Schattenbilder - Lichtgestalten: Das Kino von Fritz Lang und F.W. Murnau. Filmstudien [1. Aufl.] 9783839411032
Die Stummfilme von Fritz Lang und F.W. Murnau zählen zu den eindrucksvollsten Filmkunstwerken der 1920er Jahre. Technisc
229 67 2MB
German Pages 212 Year 2015
Inhalt
Vorwort
D – Ein Land sucht seine Toten
Die Bilder, die Massen
»…es wäre die Geschichte hier eigentlich aus…«
Zur fi lmischen Restauration des Patriarchats
Metaphysik und Romanze
Metropolis – ein Labyrinth zwischen Chaos und Ordnung
Restlichtverstärker, romantisch
Eine Außenansicht der Innerlichkeit
M und die Ordnungen des Films
Filmverzeichnis
Literatur
Autorenverzeichnis
Recommend Papers
![Schattenbilder - Lichtgestalten: Das Kino von Fritz Lang und F.W. Murnau. Filmstudien [1. Aufl.]
9783839411032](https://ebin.pub/img/200x200/schattenbilder-lichtgestalten-das-kino-von-fritz-lang-und-fw-murnau-filmstudien-1-aufl-9783839411032.jpg)
- Author / Uploaded
- Maik Bozza (editor)
- Michael Herrmann (editor)
File loading please wait...
Citation preview
Maik Bozza, Michael Herrmann (Hg.) Schattenbilder – Lichtgestalten
2009-08-10 14-08-21 --- Projekt: transcript.titeleien / Dokument: FAX ID 02be217806788630|(S.
1
) T00_01 schmutztitel - 1103.p 217806788638
2009-08-10 14-08-21 --- Projekt: transcript.titeleien / Dokument: FAX ID 02be217806788630|(S.
2
) T00_02 seite 2 - 1103.p 217806788646
Maik Bozza, Michael Herrmann (Hg.) Schattenbilder – Lichtgestalten. Das Kino von Fritz Lang und F.W. Murnau. Filmstudien
2009-08-10 14-08-21 --- Projekt: transcript.titeleien / Dokument: FAX ID 02be217806788630|(S.
3
) T00_03 titel - 1103.p 217806788654
Gedruckt mit Hilfe der Geschwister Boehringer Ingelheim Stiftung für Geisteswissenschaften in Ingelheim am Rhein.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2009 transcript Verlag, Bielefeld Die Verwertung der Texte und Bilder ist ohne Zustimmung des Verlages urheberrechtswidrig und strafbar. Das gilt auch für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Verarbeitung mit elektronischen Systemen. Umschlaggestaltung: Kordula Röckenhaus, Bielefeld Umschlagabbildung: Faust, Deutschland 1926 (Regie: F.W. Murnau); mit freundl. Genehmigung der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung. Satz: Alexander Masch, Bielefeld Druck: Majuskel Medienproduktion GmbH, Wetzlar ISBN 978-3-8376-1103-8 Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier mit chlorfrei gebleichtem Zellstoff. Besuchen Sie uns im Internet: http://www.transcript-verlag.de Bitte fordern Sie unser Gesamtverzeichnis und andere Broschüren an unter: [email protected]
2009-08-10 14-08-21 --- Projekt: transcript.titeleien / Dokument: FAX ID 02be217806788630|(S.
4
) T00_04 impressum - 1103.p 217806788662
Inhalt
Vorwort 7 D – Ein Land sucht seine Toten Manfred Koch 11 Die Bilder, die Massen Rainer Schelkle 25 »…es wäre die Geschichte hier eigentlich aus…« Alfred Stumm 45 Zur fi lmischen Restauration des Patriarchats Stefan Kleie 65 Metaphysik und Romanze Maik Bozza 85 Metropolis – ein Labyrinth zwischen Chaos und Ordnung Sascha Keilholz 101 Restlichtverstärker, romantisch Michael Herrmann 123
Eine Außenansicht der Innerlichkeit Wolfgang Kasprzik 153 M und die Ordnungen des Films Philipp A. Ostrowicz 173 Filmverzeichnis 191 Literatur 193 Autorenverzeichnis 205
Vor wor t
Die ersten ›Stars‹, die als solche bezeichnet wurden, waren, sieht man von einzelnen Bühnenhelden ab, Ikonen der Leinwand. Ein Pendant zu dieser Bezeichnung wurde später auch im Hinblick auf die großen Filmemacher gebraucht: So spricht man bis heute, insofern den Schöpfern massenwirksamer Spielfi lme gehuldigt wird, von ›Starregisseuren‹. Was die Schöpfer von kanonisierten Filmklassikern angeht, hat sich daneben jedoch auch die (vielleicht etwas antiquierte) Bezeichnung ›Meisterregisseure‹ gehalten. Sucht man nun für die 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts im deutschsprachigen Raum nach Kandidaten für diesen Titel, so stechen aus einer überschaubaren Gruppe (zu der etwa Robert Wiene, Ernst Lubitsch, Erich von Stroheim, Georg Wilhelm Pabst und Walter Ruttmann zu zählen wären) zwei Vertreter deutlich hervor: Fritz Lang und Friedrich Wilhelm Murnau. »I’m still big; it’s the pictures that got small!«, ruft die Stummfi lmdiva Norma Desmond (gespielt von Gloria Swanson) in Billy Wilders Sunset Boulevard aus, verbittert und renitent, eine fast schon groteske Gestalt aus einer anderen Zeit, ein ›Dinosaurier‹ des Films. Im Hinblick auf die Blütezeit des Stummfi lms gewinnen diese Worte allerdings einen besonderen Reiz: Wie sahen denn die ›großen Filme‹ aus? Die Frage nach der spezifischen Ästhetik des Stummfi lms läßt sich nicht allein mit dem Hinweis auf die starke gestische und mimische Ausdruckskraft der Darsteller beantworten. Herausgefordert von der technischen Beschränkung konzentrierten sich die Regisseure der stummen Bilder ganz auf die Kraft des Visuellen und formten dabei eine Bildsprache aus, die Ausdruck abseits lautsprachlicher Repräsentationsformen in fi lmische Strukturen übersetzt. Die ›Defizite‹ des Stummfi lms bargen zudem die kreative Chance, nicht unbedingt realistisch im Sinne des mimetischen Anspruchs dokumentieren zu müssen, wie es in der Welt zugeht. Die imaginative Kraft zeigt sich dabei nicht nur auf der Ebene der ästhetischen Mittel und der Reflektion der eigenen fi lmischen Möglichkeiten, sondern auch inhaltlich-narrativ: Das Zelluloid wurde zum materialen Träger jener Erzählstoffe, aus denen sonst die Träume sind. Die großen Studios wurden zu den ›Traumfabriken‹ des Zwanzigsten Jahrhunderts. Fritz Lang (1890 in Wien geboren) und Friedrich Wilhelm Murnau (eigentlich Friedrich Wilhelm Plumpe, geboren 1888 in Bielefeld), entstammen beide bürgerlichen Familien und fühlen sich früh hingezogen zur Kunst. 7
Schat tenbilder – Lichtgestalten
Lang beginnt ein Architekturstudium, wechselt zur Malerei und tritt nebenher auf Kabarettbühnen auf. Murnau ist fasziniert vom Theater, studiert Philologie und Kunstgeschichte, wird Schauspieler bei Max Reinhardt, hat Kontakte zu Malern um den ›Blauen Reiter‹ und, über seinen Freund Hans Ehrenbaum-Degele, zu Else Lasker-Schüler. Für Lang wird die Beziehung und spätere Ehe mit der Schriftstellerin Thea von Harbou bestimmend. Als Regisseure beginnen beide direkt nach ihrem Einsatz im Ersten Weltkrieg unter den politischen und wirtschaftlichen Bedingungen der Weimarer Republik. Sie feiern ihr Regiedebüt jeweils im Jahr 1919: Murnau mit Der Knabe in Blau, Lang mit Halbblut (beide Filme sind heute verschollen). Ihre Karrieren entwickeln sich in einer Blütezeit des Stummfi lms; zu bedeutenden Regisseuren werden sie, als Filme bereits Produkte für den Export sind – Metropolis und Faust werden gezielt für den Weltmarkt produziert. Und noch etwas verbindet die beiden Filmemacher: sie ziehen sich nicht auf die »Neue Sachlichkeit« zurück, sondern reizen die genuinen Möglichkeiten des Stummfi lms zur Erweiterung des erzählerischen Spektrums aus, soweit die Bilder dies nur zulassen. Was die Revolutionierung fi lmischer Techniken anbetriff t, lassen sich ihre Werke kaum überschätzen: die Kamera wird unter ihrer Ägide erwachsen, gewinnt zunehmend an Dynamik und Selbständigkeit. Weitere Revolutionen, die stilbildend waren und an denen sich die nachfolgenden Generationen bis heute orientieren, betreffen die unterschiedlichsten Aspekte der Gestaltung mittels Lichtregie, Montage und Mise en scène. Ab den späten 50er Jahren avancieren ihre Filme zu Klassikern, die auch die weitere Entwicklung des Kinos mitprägen. Murnau und Lang werden zu maßgeblichen Orientierungsgrößen für Regisseure der Nouvelle Vague in Frankreich, wie etwa für Jean-Luc Godard, zu Inspirationsquellen für Filmemacher des New Hollywood, beispielsweise für Francis Ford Coppola. Dies setzt sich bis heute fort: Zitate und Anspielungen in Filmen von Lucas und Scott – um nur zwei Namen zu nennen – zeigen die anhaltende Faszination, die von den beiden ausgeht. Innovativ waren Lang und Murnau schließlich auch hinsichtlich der Prägung zahlreicher Genres wie Abenteuer-, Science-Fiction- oder Kriminalfi lm. Auch die Filmromanze bzw. das Melodram erfuhr durch sie wichtige Impulse. »Es gibt für den menschlichen Geist kein Niemals, höchstens ein Noch nicht« – so lautet das Motto zu Beginn von Langs Frau im Mond (1929). Später wird die NASA den visionären ›Erfi nder‹ des Countdowns (eine Pioniertat Langs in der Tradition der ›phantastischen Kunst‹) zum »Father of the Rocket Science« küren. Allerdings sind weder Lang noch Murnau Apologeten eines naiven Fortschrittsglaubens: beide haben sich in ihren Filmen intensiv mit der Frage nach der Vereinbarkeit von Tradition und Moderne auseinandergesetzt. Und beiden eignet – wenn auch in unterschiedlicher Ausprägung – ein deutliches Faible für mythische Stoffe. Schattenbilder – Lichtgestalten: Das Panorama des vorliegenden Bandes umfaßt insgesamt neun Filme. Liebhaber einiger hierbei nicht berücksichtigter Werke, etwa von Murnaus Nosferatu oder Langs Mehrteiler Dr. Mabu8
Vor wor t
se, der Spieler werden womöglich enttäuscht sein. Die Auswahl erfolgte nach persönlichen Interessen der Beiträger. Vorgestellt werden aber in jedem Fall Filme aus dem Zeitraum, in welchem die Regisseure parallel arbeiten – das heißt von den frühen Zwanzigern bis zu Murnaus frühem Tod 1931. Das Todesjahr Murnaus bietet sich dabei als symbolisches Grenzjahr für die Gattung ›Stummfi lm‹ an. Es ist die Zeit, da das Genre mit dem Aufkommen der technischen Möglichkeit des Tonfi lms schnell an ökonomischer und massenmedialer Bedeutung verliert – und bald weitgehend von den Kino-Leinwänden verschwindet. Während Murnau 1931 auch seinen letzten Film Tabu als stummen Film konzipiert, ist bei Lang der Übergang zum Tonfilm deutlich sichtbar. Bis 1960 bleibt er als Regisseur tätig, bevor er 1963 in Godards Le Mépris noch einmal zwischen zwei Kameras tritt, um den Filmemacher Fritz Lang zu spielen. Als er 1976 stirbt, hat er Murnau um 45 Jahre überlebt. Sein gesamtes Œuvre umfaßt schließlich mehr Ton- als Stummfi lme. Nach den Großproduktionen Metropolis und Frau im Mond inszenierte Lang in M (1931) deutlich die Wende: Hier kommt nun der Ton zum Einsatz, steht aber (im Unterschied zur späteren Entwicklung) noch im Kontrast zum Bild, ist noch nicht ausschließlich Pendant zum Gezeigten. Im Zuge der Verabschiedung einer reinen Stummfi lmästhetik wird dieser Film zum Schlußakkord einer ganzen Gattung. Mit dem parallel zu Tabu erschienenen M als Schwellenfi lm am Ende und Der müde Tod von 1921 zu Beginn, umspannt der Band zehn Jahre Filmgeschichte. Gemeinsam ist den Beiträgen ein textwissenschaftlich grundierter Umgang mit den Filmen. Im Unterschied zu häufig gewählten produktionshistorischen oder filmkritischen Zugängen stellen die vorliegenden Beiträge hermeneutisch interessierte Lektüren vor, denen es besonders um das geht, was in den Filmen (eben auch abseits von Handlungen) erzählt wird, wie dies im einzelnen geschieht und im Rahmen welcher ästhetischen und kulturellen Kontexte. Dabei werden sowohl gesellschaftspolitische als auch fi lm-, kultur- und literaturhistorische Bezüge verhandelt. Langs und Murnaus Filme sind Teil der klassischen Moderne, als solche werden sie gelesen. Bei aller diesbezüglichen Vielfalt bieten die Texte gemeinsam einen Beitrag zur filmwissenschaftlichen Diskussion um den sogenannten expressionistischen Stil und seine bild- und filmästhetischen Auswirkungen. Und nicht zuletzt wollen unsere Lektüren auch Anregung sein zur weiteren Beschäftigung eines breiteren Publikums mit dem Stummfi lm.
***
Herzlich danken wollen wir Freundinnen und Freunden, Kolleginnen und Kollegen und Studentinnen und Studenten. Ohne Anna Baumann, Jutta Böske, Stephan Hager, Sebastian Klöß, Jens Möller und Eduard Voll hätte das Stummfi lmprojekt nicht gelingen können. Ebenso verpfl ichtet sind wir Heinz J. Drügh und Volker Mergenthaler, von denen wir die Veranstaltungs9
Schat tenbilder – Lichtgestalten
reihe zum Film am Deutschen Seminar der Uni Tübingen 2005 übernahmen. Carmen Prokopiak von der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung danken wir für die überaus freundliche Erfüllung unserer Bildwünsche. Und zuletzt gilt unser Dank der Geschwister Boehringer Ingelheim Stiftung für Geisteswissenschaften für die großzügige fi nanzielle Unterstützung.
Maik Bozza und Michael Herrmann Stuttgart und Tübingen, im Mai 2008
Nach Wahl der Autoren erscheinen die Texte jeweils in alter oder reformierter Rechtschreibung. 10
D – Ein Land sucht seine Toten Fr itz Langs Nationalmärchen Der müde Tod Manfred Koch
I. Die Personifizierung des Todes ist ein epochen- und kulturübergreifendes Mittel zur Bewältigung des Schreckens, der von dieser unbegreiflichsten Tatsache unseres Lebens ausgeht. Sie gehört zu jener elementaren Arbeit des Mythos, die die Gewalt des Numinosen durch Differenzierung, Gestaltgebung und Narrativierung zu bannen versucht.1 Die (ebenfalls universelle) Metapher der ›Todesreise‹ führt von der Bildlogik her fast zwangsläufig zur Vorstellung eines Reiseführers, der den prekären Übergang zwischen den Welten erleichtert, indem er den Sterbenden abholt und ihm auf seinem letzten Weg vorangeht. Dieser Begleiter kann je nach kulturellem Kontext Tieroder Menschengestalt haben, er kann aber auch als Dämon, Engel oder Gerippe auftreten. Am attraktivsten innerhalb dieses Spektrums ist fraglos die Vermenschlichung. Sie macht den Tod zum zugänglichen Gesprächspartner, dessen Macht sich imaginativ überwinden läßt. Aus dieser Grundkonstellation ergeben sich verschiedene Erzählmuster, die in der Volkskultur zahlreiche Märchen, Sagen oder auch Schwänke hervorgebracht haben. Man kann den Tod in Menschengestalt besoffen machen (wie in dem Komödienklassiker Der Brandner Kaspar und das ewige Leben), man kann ihn erweichen, bestechen, einsperren oder auch, ganz sachlich, in Vertragsverhandlungen verwickeln. Unsterblichkeit erlangt der Mensch durch diese Manöver zwar nie, im allgemeinen reicht es aber immerhin für einige Jahre Aufschub. Fritz Langs Spielfi lm basiert auf diesem ubiquitären Modell des Todesmoratoriums; motivisch greift er zurück auf das populäre Grimm-Märchen vom Gevatter Tod. Hier bieten sich einem armen Mann erst der liebe Gott, dann der Teufel als »Gevattersmänner« für sein jüngstes, dreizehntes Kind 1. Vgl. Hans Blumenberg: Arbeit am Mythos, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1979, Erster Teil. Zum Verhältnis von »Arbeit des Mythos« und »Arbeit am Mythos« vgl. v.a. ebd., S. 294f.
11
Manfred Koch
an. Der verbitterte Vater weist beide ab und entscheidet sich für den Tod, den er als großen gerechten Gleichmacher anerkennt. Dank eines Wunderkrauts, das sein Pate ihm schenkt, wird aus dem Kind ein berühmter Arzt. Er heilt Kranke in den schrecklichsten Agonien, darf aber nicht eingreifen, wenn er den Tod zu ihren Füßen erblickt (ähnlich wie in Langs Film geht es in diesem Märchen also um einen Todesaufschub, den der Held nicht für sich, sondern für andere erwirkt). Mit einem simplen Trick – er dreht die Bettstatt der Patienten um, so daß der Tod am Kopfende steht – überlistet der Arzt zweimal seinen mächtigen Paten. Zur Strafe wird er in eine unterirdische Höhle geführt, in der »tausend und tausend Lichter in unübersehbaren Reihen« brennen: »die Lebenslichter der Menschen«, wie der Tod erklärt.2 Der Arzt erblickt das seinige, das kurz vor dem Erlöschen ist. Durch eine fingierte Ungeschicklichkeit erstickt es der Tod im nächsten Moment. Die Kerzenhalle mit den Lebenslichtern – eine großartige Raumidee – ist das einzige Motiv, das Lang einem bestimmten Märchen entnimmt. Ansonsten geht es ihm in seinem »deutschen Volkslied in sechs Versen« (so hieß Der müde Tod3 ursprünglich im Untertitel) eher um die Schaff ung von Märchen-Atmosphäre durch den Einsatz vertrauter Genreelemente (die wiederkehrende Dreizahl, der Gasthof zum Einhorn, die Wunderwurzel, die Mitternachsstunde). Was allerdings nicht zu der damit herauf beschworenen Welt ursprünglicher deutscher ›Volkspoesie‹ paßt, sind die Binnengeschichten. Zwar spielt die eine in Bagdad, was 1001-Nacht-Assoziationen herbeiführen mag, eine andere in einem nicht weniger märchenhaften China. Die Unwirklichkeit in diesen Einlagen ist aber von gänzlich anderer Art. Der Gegensatz zwischen deutscher Märchenwelt im Rahmen und exotischer Welt in den Binnengeschichten ist entscheidend für das Verständnis von Langs phantasmagorischem Lichtspiel. Als Film, der ein »deutsches Volkslied« sein will, reiht sich Der müde Tod ein in die Folge volkstümlicher, originär ›deutscher‹ Stoffe und Gehalte, die vor allem auch Thea von Harbou, die Drehbuchautorin (und damals schon Fast-Ehefrau von Fritz Lang), über das neue, wirkungsmächtige Medium verbreiten wollte. Deutsche Märchenreminiszenzen, deutsche Volkslieder und ein typisch deutsches, ›faustisches‹ Szenario prägen die Rahmenhandlung derart stark, daß letztlich sogar der Tod, obwohl er als exterritorialer Fremdling eingeführt wird, irgendwie deutsch wirkt (der blonde Hüne mutet an wie eine Mischung aus germanischer Gottheit und Stefan George). Obwohl Ort und Zeit der Handlung am Anfang ausdrücklich im Unbestimmten gelassen werden, dürfte jeder Zuschauer das verwunschene Städtchen sofort als deutsche Provinz – eine Art vorweggenommenes Kaisersaschern – identifizieren. Der Inhalt und die Grundstruktur des Films lassen sich anhand des – üb2. Kinder- und Hausmärchen gesammelt durch die Brüder Grimm. Vollständige Ausgabe auf der Grundlage der dritten Aufl age (1837), hg.v. Heinz Rölleke, Frankfurt a.M.: Deutscher Klassiker Verlag 1985, S. 200. 3. Der müde Tod, Deutschland 1921, Regie: Fritz Lang, DVD: Image Entertainment, USA 2000.
12
D – Ein Land sucht seine Toten
rigens ja auch an Faust erinnernden – Motivs des Vertrags, des Wettkampfs mit der Vernichtungsmacht, relativ leicht zusammenfassen: (1.) Die Rahmengeschichte: Ein Brautpaar kommt in ein mittelalterliches Städtchen, glücklich und selbstvergessen, schon unterwegs steigt jedoch ein unheimlicher Passagier in die Kutsche: der Tod. Als die Braut im Gasthaus einen Blick in die Küche wirft, verschwindet der Tod mit ihrem Geliebten. In einer Rückblende erfährt man, daß der geheimnisvolle Fremde vor langer Zeit der Gemeinde das Gelände neben dem Friedhof abgekauft und mit einer gewaltigen Mauer ohne jeden Durchlaß umgeben hat. Das verzweifelte Mädchen findet in einer traumhaften Entrückung dennoch den Zugang in dieses jenseitige Reich und triff t mit dem überraschend konzilianten Tod die erste Vereinbarung: ihr Liebster wird ihr zurückgegeben, wenn sie drei bereits dem Tod verfallene Leben in letzter Minute rettet (bzw. genauer: eines von diesen dreien – von der epischen Logik her ist aber klar, daß alle drei durchgespielt werden müssen). Für diese drei Leben stehen im gewaltigen Kerzendom des Todesreichs drei flackernde Kerzenstümpfe. Das sind (2.) die drei Binnenepisoden, die im Orient, im Venedig der Renaissance und in China spielen. Dreimal verliert das Mädchen, das sich traumhaft in die junge Heldin dieser Geschichten verwandelt hat, den Kampf um die Rettung des Geliebten. Es folgt – wieder in der Rahmenhandlung – der zweite Vertrag, auf den der müde Tod sich einläßt: sie soll das Leben eines beliebigen anderen für dasjenige ihres Bräutigams beibringen. Wieder scheitert das Mädchen dreimal beim Versuch, zuerst einen alten, dann einen bettelarmen und zuletzt mehrere hinfällige Menschen zur freiwilligen Preisgabe ihrer trostlosen Existenzen zu überreden. Zuletzt aber erhält sie in einer Feuersbrunst die Chance, dem Tod ein kleines hilfloses Kind als Auslösepfand für ihren Mann zu übergeben. In dieser Extremsituation entschließt sie sich, den Säugling am Leben zu lassen und selbst den Gang in den Tod anzutreten. Das Schlußbild zeigt das vom Tod, genauer: in seiner Umarmung wiedervereinigte Paar beim Aufstieg in höhere Gefi lde.
II. Langs Film scheut sich nicht, dem Zuschauer explizite Deutungshinweise zu geben. Den offenkundigsten kann man gemäß dem klassischen Schema des Dreischritts zusammenfassen. In ihrem Auf begehren gegen das grausame Schicksal spricht das verzweifelte Mädchen anfangs das biblische Wort: »Liebe ist stark wie der Tod« (0:23:30; Das Hohe Lied, 8,6). Dieser Glaubenssatz wird – jedenfalls in der Implikation, die Liebe vermöge den Tod zu überwinden – in jedem der gezeigten Fälle brutal negiert. Der Schluß aber offeriert eine Art romantischer Synthese: Zwar ist Liebe nicht stärker als der Tod, wohl aber ist Liebe am stärksten als Tod, im Tod. Der Tod ist nicht das Ende der Liebe, sondern ihre eigentliche Erfüllung, erst in der Umarmung des Todes vollzieht sich die wahre Vereinigung des Paares. Für diese Art von Todeserotik läßt sich bekanntlich eine ehrwürdige deutsche Traditionslinie aufweisen. Was von Harbou und Lang für ihren pro13
Manfred Koch
grammatisch deutschen Film mobilisieren, sind also nicht nur bestimmte Motive aus Märchen und Sagen, sondern im Affekthaushalt der Nation tief verankerte kulturelle Deutungsmuster. Oder, um es prägnanter zu sagen: Erlösungsmuster. Es ist evident, daß der Tod in Langs Film sich zwar, wie es die offizielle Lesart gebietet, als Diener Gottes ausgibt (0:28:30ff.). Im Grunde aber ist er die wahre Sakralmacht, die eigentliche Instanz des Heils. Die zahlreichen Aufstiegsbewegungen in diesem Film führen nicht hinauf in ein himmlisches Reich, sie sind, gerade auch als Transzendenz, Über-Stieg ins Licht, allesamt Erhebungen innerhalb der Immanenz des Todesreichs. Es gibt nur diese zwei Reiche, die Dimension des Oberen ist in Langs Film wie abgeschnitten. Nichts zeigt das deutlicher als jene unermeßliche Mauer, die ja nicht nur in die Breite, sondern auch nach oben hin keinen Abschluß, keinen Rand hat. Die Mauer öffnet sich nicht in der Vertikalen hin auf eine Dimension, zu der die Toten begnadigt werden. Die Mauer umschließt alles Jenseitige schlechthin, wer hier die Treppe hinaufgeht, auf den wartet der Allmächtige: der Tod. Auf diese Weise schaff t es der Film, alle christlichen Symbole mühelos zu Insignien seiner Religion, einer Religion des Todes, umzufunktionieren. Die Kreuze, die eben keine Kruzifi xe mit dem Leib des Heilands sind, künden von der Macht des Todes. Der Tod usurpiert folgerichtig auch die ChristusIkonographie. Gleich zu Beginn des Films wird er dreimal mit Kreuz(en) im Hintergrund gezeigt (0:01:40; 0:02:52; 0:03:46), zuletzt in einer körperlichen Verschmelzung: als er in die Kutsche einsteigt, scheint das Kreuz aus seinem Kopf zu wachsen. Am Ende segnet er die Liebenden, spricht Christi Worte vom Gewinn des wahren Lebens durch Preisgabe des irdischen (»Wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird’s finden«; Matth. 10,39) und führt sie, selbst zur Kreuzgestalt geworden, endgültig heim (1:36:35). Im Verlauf des Films nimmt er deutlich die Züge einer verständnisvollen, ja zärtlichen Vatergestalt an. Unheimlich ist dieser Tod nur ›draußen‹, vor der Mauer. In seinem Reich berührt er gleich beim Empfang das Mädchen auf der Treppe mit sensiblen Gesten, wiegt das ihm anheimgefallene Kind behutsam und offenbar tief bewegt im Arm 4 und lächelt gar milde angesichts der bräutlichen Entschlossenheit, ihn, den Ewigen, herauszufordern (0:29:45; das zweite Mal lächelt er, als er die Liebenden wieder zusammenführen darf; 1:34:14). Diese Verwandlung kulminiert folgerichtig in dem Bekenntnis, daß er selbst gern von seiner Aufgabe erlöst wäre – eine Äußerung, die nicht als Widerstand gegen die Sinnlosigkeit des Sterbens, sondern als Bekundung von Trauer über die unvermeidliche Zufügung von Schmerz zu verstehen ist. Er liebt die Menschen, sie tun ihm leid, und vermutlich wäre ihm wohler, wenn sie sich williger ergäben. Das ›Volkslied‹, das hier anklingt, ohne daß man es in der Musik des Films zu hören bekäme, ist Claudius’/Schuberts Der Tod und das 4. »Mit unendlicher Sorgfalt hebt der Tod des Licht einer Kerze empor, um sanft die Seele eines Kindes vom Körper zu trennen.«, Siegfried Kracauer: Von Caligari zu Hitler. Eine psychologische Geschichte des deutschen Films, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1984, S. 99.
14
D – Ein Land sucht seine Toten
Mädchen, die suggestivste Gestaltung der Todesverlockung in der deutschen Kulturgeschichte: »Bin Freund, und komme nicht zu strafen/[…]/sollst sanft in meinen Armen schlafen.« Mit höchster Raffi nesse macht Langs Film den affektiven Prozeß spürbar, in dem der Tod seinen Schrecken verliert und immer intensiver das Potential der süßen Erlösung ausstrahlt. Ebenso – es geht noch immer um die Vereinnahmung des Christlichen – ist der Kerzendom ein Sakralraum des Todes, eine Kontrafaktur des im Volkslied beschworenen Sternenhimmels, an dem der Herr seine Schäflein zählt (0:02:10). Hier ist der Tod der Herr der Lebenslichter; er hütet und zählt sie, daß »ihm ja nicht eines fehlet«. Auch der Kerzendom ist ein Todesreich ohne sichtbare Begrenzung. Man erkennt die Innenarchitektur einer Kathedrale, deren Elemente aber in der Luft zu schweben scheinen: ein Raum ohne Wände, ohne Decke, ohne Ein- und Ausgang. Wenn schließlich das Mädchen, eingefaßt in den gotischen Spitzbogen, seine Entrückung ins Jenseits erfährt, so ist die Adaption christlicher Ikonographie bis hin zur Mariensymbolik unübersehbar.
III. Die Frage stellt sich natürlich, vor welchem zeitgeschichtlichen Hintergrund diese Sakralisierung und Erotisierung des Todes in einem Film zu sehen ist, der ja auf ein Massenpublikum zugeschnitten war. Kracauer hat auf die zeitliche Nähe zu Spenglers Der Untergang des Abendlandes hingewiesen.5 Das ist plausibel, was den allgemeinen Mechanismus angeht, den man in diesen Jahren hinter der Produktion neuer deutscher Mythologie vermuten kann: die Erfahrung der verheerenden Niederlage im Weltkrieg wird verarbeitet in kollektiven Phantasmen des süßen, in sich selbst sinnvollen Todes (von Harbou/Lang) oder des allumfassenden Sterbens ganzer Kulturkreise (Spengler). Doch bleiben wir zunächst bei handgreiflichen Befunden zum historischen Hintergrund des Films. Allein der Titel ist von höchster zeitgeschichtlicher Aussagekraft: Daß der Tod müde ist, hat 1921, drei Jahre nach Kriegsende, eine ganz unmittelbare, fürchterliche Evidenz.6 Man muß sich den Rezeptionshorizont, in den Langs Film hineinwirkte, so konkret wie möglich zu vergegenwärtigen suchen. Was, so muß man sich fragen, ging vor allem in den Zuschauerinnen vor, den Soldatenmüttern und jungen Witwen (oder verwitweten Bräuten), wenn sie eineinhalb Stunden lang immer wieder die liebende Frau vorgeführt be5. Vgl. ebd., S. 96. 6. Im Zweiten Weltkrieg verfaßt der jüdische Schönberg-Schüler Viktor Ullmann
im Konzentrationslager nach einem Libretto des ebenfalls inhaftierten Maler-Dichters Petr Kien die Oper Der Kaiser von Atlantis oder der Tod dankt ab. In diesem Stück verkündet der sagenhafte Kaiser den »Krieg aller gegen alle«, worauf der überlastete Tod in den Ausstand tritt. Die Menschen hören auf zu sterben, wissen aber nicht mehr, wohin mit ihrem Leben. Der Tod erklärt sich schließlich bereit, die Arbeit wiederaufzunehmen, wenn er mit dem Kaiser den Neuanfang machen darf.
15
Manfred Koch
kamen, die alleine zurückbleibt? Auf sie, von denen viele sicherlich mit dem Gedanken gespielt haben, dem geliebten Mann freiwillig nachzufolgen, muß der Film eine faszinierende, im Einzelfall wohl auch kathartische Wirkung gehabt haben. Weiter: wie haben vor diesem Hintergrund des massenhaften Sterbens vielversprechender Jünglinge die Szenen gewirkt, in denen das Mädchen den alten Mann, den gebrechlichen Bettler und die Siechen anfleht, ihr verwelktes Leben für das seine hinzugeben? Die frühen 20er Jahre waren durch eine Eugenik-Diskussion geprägt, deren schauerliches Vokabular – »sinnlose Existenzen«, »minderwertiges Leben« – ohne die tiefe Verbitterung über das Verschwinden einer halben Generation gesunder junger Männer und die daraus gespeisten Phantasmen eines Überhandnehmens der Krüppel, Debilen, Behinderten und Kriminellen nicht zu verstehen ist. Wohlgemerkt: die meisten Mediziner, die in diesem Diskurs Euthanasie- oder Sterilisierungsmaßnahmen befürworteten, waren keineswegs frühe Nazis oder auch nur Deutschnationale! Es war die Mehrheit der etablierten Mediziner und Juristen, die Programme zur Wiederherstellung eines »gesunden Volkskörpers« mit größter Selbstverständlichkeit diskutierten.7 Vergegenwärtigt man sich diesen Kontext, erhält das ›deutsche‹ Programm des Lang/Harbou-Films allerdings gespenstische Konturen. Es ist ja nicht so, daß alles nur auf eine mehr oder minder libidinöse Ergebung in den Tod hinausliefe. Die liebende Frau entscheidet sich am Ende für den Abschied vom Leben. Sie tut dies aber zugunsten eines neuen Lebens, zugunsten einer anderen jungen Frau, die gerade Mutter geworden ist. Die Versöhnung mit dem Tod des jungen Mannes, die gleichsam ein filmisches Ritual der Versöhnung mit dem hunderttausendfachen Tod junger deutscher Männer im Krieg ist, geht also einher mit der Beschwörung einer neuen, Hoffnung schenkenden Jugend. Im Rückblick überkommt einen bei Betrachtung der Szene, in der die Mutter das gerettete Kind an die Brust drückt (1:33:33), allerdings eine Gänsehaut: Nimmt man das Produktionsjahr des Films 1921 sozusagen wörtlich und rechnet weiter, dann wird dieser Neugeborene im Jahr 1939 genau 18 Jahre alt sein. Von hier aus fällt auch ein Licht auf die Differenz zwischen Rahmen- und Binnenhandlung. Nur in der Rahmenhandlung ist der Tod ja ein natürliches, ›höheres‹ Geschick und transzendente Verlockung. Die Liebhaber in den Binnenepisoden hingegen sind alle Opfer von Heimtücke, Eifersucht und Mordgier. Diese Geschichten aber spielen eben in fremden Kulturen, die zudem von Stufe zu Stufe häßlichere (oder auch lächerlichere) Züge annehmen. Am 7. Verfasser des 1920 erschienenen Buchs Die Freigabe der Vernichtung unwerten Lebens waren der Strafrechtler Karl Binding, lange Jahre Rektor der Universität Leipzig, und der Arzt Alfred Hoche, Leiter der Freiburger Nervenklinik (vgl. den Nachdruck Berlin: BWV 2006). Der Tübinger Psychiatriepapst Robert Gaupp, politisch der liberalen Deutschen Demokratischen Partei nahestehend, bescheinigte dem Buch in einer Rezension, es enthalte »tiefgründige und beachtenswerte Gedanken« (Deutsche Strafrechtszeitung 7, 1920).
16
D – Ein Land sucht seine Toten
Ende steht der Kaiser von China, ein wahrlich groteskes Monster, das zwei Liebende auseinanderbringt, die sich zu Beginn küssen wie aufgezogene Tanzautomaten (1:00:50). Alle drei Binnengeschichten kreisen um grausame Herrschergestalten, gegen die weder die gewitzten noch die gefühlvollen Untertanen eine Chance haben. Im deutschen Rahmen hingegen gibt es keine Obrigkeit (die städtischen Honoratioren zu Beginn sind Schießbudenfiguren). In diesem Land herrscht nur ein Meister: der Tod. Gleichsam inkognito, als Gärtner und Bogenschütze, ist er in den Binnengeschichten vertreten und leistet Handlangerdienste für die Autokraten. Im Zusammenspiel von Rahmen und Einlagen wird aber klar, daß ihm auf lange Sicht auch die Schreckensmänner verfallen sind. Das tröstet über die perfiden Tötungen der Liebhaber in den drei Geschichten hinweg und stärkt das Gerechtigkeitsempfinden. Der deutsche Tod stellt eine höhere Sinnebene dar, die Wertmaßstäbe bietet gegen die verruchte Herrschaftspraxis der welschen und orientalischen Ränkeschmiede. Das ist eine aparte Variante des deutschen Anspruchs auf ›Kultur‹, ›Tiefe‹ und ›Innerlichkeit‹. Mit der Sphäre der Machtausübung hat das Geschehen in diesem Land nichts zu tun – es geht um Schicksal, es geht um die letzten Dinge, es geht um den Sinn des Opfers. Der meisterliche deutsche Tod, so früh und grausam für die Betroffenen er eintritt, ist auf diese Weise doch ein höheres Walten, das mit der ganzen suggestiven Bildlichkeit des Stundenglases und des die letzten Stündlein ausrufenden Nachtwächters herauf beschworen wird. Draußen, in den fremden Lebenswelten, versuchen die Menschen mit allen möglichen rationalen Planungen, mit Listen und zuletzt sogar mit Zaubertricks, dem Tod, in den das gesellschaftliche Böse sie treibt, zu entgehen. Vergebens. Hier, in der deutschen Provinz, erscheint er mitten im Alltag, bei einer Wirtin wundermild, und entführt den Geliebten. Auch das Mädchen, das in der Verzweiflung die Giftflasche leeren will, begreift am Ende, wie süß der Lethetrank des Liebestodes mundet.
IV. Der müde Tod ist, wenn diese Interpretation zutriff t, ein zwar unaufdringlicher, aber wohl gerade deshalb extrem wirkungsvoller deutschnationaler Film. Die Frage ist freilich, ob die technische Machart eine solche vom Drehbuch vorgegebene Programmatik nur verstärkt oder sie eventuell unterläuft, dementiert. Ich muß gestehen, hier keine befriedigende Antwort gefunden zu haben, und führe deshalb einfach zwei gegensätzliche Lesarten vor. Die erste liegt auf der Linie des bisher Entwickelten, ich nenne sie (a) die ›nationale‹. Die zweite wäre der Versuch, das visuelle Geschehen vom Inhalt abzulösen, den Eigensinn der cineastischen Mittel geltend zu machen. Diese Lesart nenne ich (b) die ›ästhetische‹. Zunächst eine allgemeine Vorbemerkung: Der Film ist, was die Verfugung der Motive, die Technik der Vorausdeutungen und Wiederaufnahmen angeht, exzellent gemacht. Zwei Beispiele: Das pathetische Motiv der Kerze, des Lebenslichts, wird eingeführt in einem durch und durch satirischen Kon17
Manfred Koch
text. Der Notar im Wirtshaus ärgert sich über die Wachstropfen, die von – wie könnte es anders sein – drei Kerzen über seinem Haupt herabfallen (0:05:30). Er versucht es mit Ausblasen, was ihm nicht gelingt – als wüßten auch diese Wirtshauskerzen um ihre symbolische Bedeutung und fügten sich nur höherer Gewalt. Kurz darauf (0:06:07) flackern dann fünf Kerzen über den fünf Honoratioren, als diese das Erscheinen des Fremden diskutieren. Mitten im Leben, erfährt der Zuschauer auf sanft ironische Art, sind auch diese geldgierigen Hedonisten schon vom Tod umfangen – sie sind nur unfähig, es sich einzugestehen, obwohl doch der Fremde auch etwas merkwürdig »Vertrautes« an sich hat. Eine eigene Untersuchung verdienten die Tiere in Langs Film: von den unheildräuenden Eulen und Raben über die schamverhüllte Gans in der Kutsche bis hin zu den signifikanten Katzen im (phallischen) Wirtshaus zum Einhorn. Daß die Braut in der Szene, die das Verschwinden des Bräutigams offenbart, geradezu in Katzen eingekleidet erscheint, ist ein deutlicher Hinweis auf ihr sexuelles Verlangen. Die Symbolik verstärkt aber nicht einfach nur die Tragik der Entzweiung eines Paars, das buchstäblich auf dem Liebeshöhepunkt auseinandergerissen wird. Im Blick auf die Vereinigung, mit der der Film endet, handelt es sich umgekehrt auch um eine Erotisierung des Todes. Die symbolische Überdeterminierung ist einer der Gründe dafür, daß alle Requisiten und architektonischen Anlagen des Films von vornherein auch als Zeichen begegnen. Der Film tendiert zu einer gewissen Flächenhaftigkeit, die Leinwand wird zur zweidimensionalen Folie, auf der Chiff ren verschiedenster Art erscheinen. Auch hier ist die mysteriöse Wand das Paradebeispiel: sie ist eine Riesentafel, die ›natürlichen‹ Maserungen der Steine wirken wie aufgetragene Zeichen, die aus der gewöhnlichen Alltagswelt wegführen, sie erinnern an Hieroglyphen, Keilschrift, magische Figuren. Der Gang durch die Wand, der dem Mädchen schließlich gelingt, wird so auch suggeriert als handgreifliche Erschließung von geheimnisvollen archaischen Zeichen. Die Transzendenz des Mädchens, also ihr Verschwinden in der Wand, wird mit zwei symbolischen Feldern verbunden: Verlust des Bewußtseins und ein Sich-Hineinbegeben in hermetisch-alchemistische Vollzüge (der Apotheker als eine Art Hermes Trismegistos). Das korreliert zeitgeschichtlich wieder mit einer heftigen Okkultismus-Welle im Deutschland der frühen 20er Jahre, die sich bekanntlich auch in der Literatur niedergeschlagen hat (Thomas Manns Prosatext Okkulte Erlebnisse stammt aus dem Jahr 1923). Für eine Nation, die so viele Tote zu beklagen hatte, war Spiritismus fraglos ein attraktives Bewältigungsangebot. Der Geisterzug, den das Mädchen an der Mauer sieht (0:18:55), hat deshalb auch etwas von einer Séance, die für kurze Momente noch einmal Kontakt mit den lieben Abgeschiedenen vermittelt. Nur ein beinamputierter Invalide und zwei Soldaten (noch dazu in historischen Uniformen, nicht im berühmten Feldgrau des Ersten Weltkriegs) sind unter den Vorübergehenden; im Zusammenspiel mit den anderen Indikatoren genügte das offenbar, um die damaligen Zuschauer die Herkunft dieser Gespenster ahnen zu lassen. Nimmt die Wirklichkeit im Film tendenziell Schriftcharakter an, so neigen 18
D – Ein Land sucht seine Toten
die Schriftzeichen der Titel wiederum zur Auflösung ins Bild. Die Typen sind, je nach Kultur, in der Rahmenhandlung gotisch, in den Binnenerzählungen eben venezianisch, chinesisch und arabisch stilisiert. An einem bestimmten Punkt, das zeigt besonders schön die Bagdad-Geschichte, tritt fast ein Gleichgewicht ein: die Wandteppiche und Vorhänge, hinter denen das Versteckspiel des verfolgten Ungläubigen mit seinen Häschern stattfindet, sind fast nicht mehr von den Tafeln zu unterscheiden, die ihre Reden wiedergeben. Damit komme ich (a) zur ›nationalen‹ Lesart. Ein zweites auff älliges Gestaltungsmittel, das der gerade erläuterten Tendenz zur Flächenhaftigkeit zu widersprechen scheint, sind die permanenten Öff nungen und Schließungen, mit denen der Film konfrontiert. In Mauern und Vorhängen, in Fahrzeugen und Kleidern tun sich plötzlich Portale, Lücken, Spalten auf, die eine Passage zwischen Vordergrunds- und Hintergrundswelt in Gang bringen. Das betriff t die deutschen wie die ›ausländischen‹ Szenarien. Aber auch hier dient der Parallelismus eher dazu, den Kontrast zu verstärken. Die Hinterwelt, die sich in den Binnengeschichten zeigt, ist eine hinterhältige Welt. Hinter dem Vorhang lauern die Spione und Mörder, was sich öffnet, sind nicht die Übergänge in die Transzendenz, sondern Fallen. Auch das läßt sich exemplarisch an einer kleinen Szene demonstrieren. In der Venedig-Geschichte wird der Liebesbote der schönen Signorina von zwei gedungenen Mördern auf einer Treppe niedergestochen. Auch diese Treppe ist offenbar eine Kontrafaktur der Treppe im Reich des Todes. Dort stieg das Mädchen hinauf zum erlösenden Tod, hier flieht das Opfer abwärts und erleidet einen schmählichen Tod. Um die Treppe deutlich als Falle auszuzeichnen, wird sie im Film nur im Mittelausschnitt gezeigt, die linke und die rechte Seite sind kaschiert. Das Bild der Spalte im Vorhang, das in den Binnengeschichten mehrfach auftaucht, wird durch ein ostentativ künstliches Verfahren auf die große Dimension der Freitreppe übertragen. Als Gegenbild zur heiligen Treppe im Todesreich zeigt diese profane Treppe an, daß wir uns in einer Welt der Fallen, der Ranküne und des Mordens befinden. Welche Bedeutung die Architektur in allen Lang-Filmen hat, braucht hier nicht eigens erörtert zu werden. Eine genaue Analyse des müden Tods müßte Sequenz für Sequenz den Einsatz folgender Elemente nachzeichnen: Treppen, Brücken, Säulen, Wände sowie die Vielzahl von Tor-, Fenster- und Gewölbebögen. Treppen sind Hauptakteure in Langs Film, über die beiden erwähnten hinaus begegnen noch zahlreiche andere: verwinkelte und gradlinige, heruntergekommene und prächtige Holz- und Steintreppen. Die Treppen in den Binnengeschichten strukturieren Räume, in denen sich vor allem Fluchten abspielen. Mal handelt es sich, wie bei der venezianischen Treppe, um die Flucht eines Einzelnen vor wenigen Schergen, häufig aber auch um regelrechte Massenverfolgungsjagden. Das lenkt den Blick auf eine weitere wichtige Differenz zwischen Rahmen und Einlagen. Im Rahmen gibt es nur eine einzige Massenszene: die tragische Notgemeinschaft der von einer Feuersbrunst bedrohten Stadtbewohner. Die deutsche ›Masse‹ ist ein solidarischer Volkskörper, zusammengeschmiedet durch das gemeinsame Sich-zurWehr-Setzen gegen das Unheil, das unverschuldet über ihn hereingebrochen 19
Manfred Koch
ist. Der Mutter in diesem Volkskörper – nicht in erster Linie der einzelnen Frau – wird das gerettete Kind zurückerstattet. In den Binnengeschichten dagegen treten wiederholt Menschenmengen auf, die durch den Willen zum Exzeß erhitzt sind und unkontrollierbar toben. Für die heitere – wenn auch sexuell anrüchige – Ekstase stehen die Teilnehmer des Venezianischen Karnevals, für die brutale die fanatischen Muslime, die dem verkleideten Franken ans Leben wollen. Diese Massen werden von Lang in auff älliger Weise in den Filmraum hineinkomponiert. Sie strömen über Treppen, durch Korridore und Säulenhallen, die ihrerseits verwirrend vielgestaltig sind. Auff ällig ist z.B. die Szene, in der der Franke durch eine Art Kellergewölbe mit zahlreichen Pfeilern flüchtet (0:34:20). Erst sieht man ihn allein, kurz Orientierung suchend (als wolle er einen Slalomlauf beginnen), dann kommen seine Verfolger und füllen das Bild, machen durch ihre rasende Bewegung aber gleichsam auch die Pfeiler mobil. Es ist nicht übertrieben, angesichts dieses und anderer Bilder in Langs Film von einem ›Ornament der Masse‹ zu sprechen: Akteure und Hintergrund verschmelzen zu einer arabesken Bewegungsfigur. Die Beobachtung, daß der Film zur Zweidimensionalität tendiert, muß hier präzisiert werden. Es sind in erster Linie die Binnengeschichten, in denen Figuren – begünstigt natürlich auch durch die abenteuerlichen Kostüme – permanent Teil eines flächigen Ornaments zu werden scheinen. Die Wandvorhänge, Teppiche und Fensterreihen des Orients bilden ein Kontinuum mit den Gestalten des Kalifen, der Prinzessin und ihrer Diener und Dienerinnen. Kommen wir noch einmal zurück zum Phänomen der Masse. Es mutet im Rückblick seltsam an, daß ein deutscher Film 1921 als Denunziation des ›Fremden‹ Lebenswelten präsentiert, in denen bösartige Führer mit Hilfe einer fanatisierten Masse die Liebe zwischen Menschen zerstören. Gerade der Massenrausch, der Schwindel der Besessenen (man denke an die drehenden Derwische; 0:31:10), scheint Lang ja besonders fasziniert zu haben. Dieses Dämonische, das dem Fremden attestiert wird, verbietet es auch, den Film als harmlose Umsetzung kultureller Stereotypen zu verstehen, bei der Arabien eben ›arabesk‹, China in der Art einer ›Chinoiserie‹ dargestellt wird. Was Lang tatsächlich betreibt, ist die Entgegensetzung von deutscher Tiefe und fremder Oberfläche/Oberflächlichkeit, deutscher würdiger Langsamkeit und fremder (moderner) Gehetztheit. Der Mittelteil des Films ist sehr viel schneller als der Rahmen. Die Beobachtung, daß in den fremden Welten sich dauernd Öffnungen auf verborgene Räume ergeben, widerspricht diesem Befund einer Inszenierung von Oberfläche keineswegs. Es geht eben um Hinterhalte (also die schreckliche Zweideutigkeit dessen, was sich in diesen Kulturen dem arglosen Blick darbietet), und nicht um eine fundierende Hinterwelt. Exemplarisch zeigt das der unterschiedliche Einsatz der Spitzbogenarchitektur. Im deutschen Bereich taucht er auf in der transparenten Architektur des Kerzendoms und – zentral – als Einlaßpforte ins Reich des Todes. Dieser eine, sinneröffnende Bogen ist ersichtlich das Kontrastbild zu den vielen schnörkeligen Bögen vor allem der Orientszenen. Dem entspricht die Vervielfachung der Personen und die wirre Vielgestaltigkeit ihrer Laufwege in den fremdländischen Episoden. Hier der gerade deutsche Weg zur Transzendenz, dort das 20
D – Ein Land sucht seine Toten
Wuchern der Linien und Bezüge in einer bedrohlichen, undurchschaubaren Wirklichkeit. Auch die deutsche Treppe ist in ihrer monumentalen Verweisungskraft das Gegenstück zu den bisweilen an M.C. Escher erinnernden Treppenarchitekturen der Fremde. Mentalitätsgeschichtlich wäre der Film vor allem aufschlußreich durch die Projektion des totalitären Staats nach außen. Er würde einmal mehr belegen, wie in Deutschland die Grundlagen für jenen Diktator, der sich wie kein anderer auf die Lenkung pogromsüchtiger Massen verstand, gerade durch die Berufung auf die ›tiefen‹ Werte der Liebe und der opferbereiten Treue gelegt wurden – in Absetzung von den bloßen Herrschaftsmechanismen des Auslands. Die geheime Sehnsucht nach der süßen Umarmung des Todes, die aus der überkomplexen, sinnentleerten Welt der Moderne erlösen sollte, hat Hitler viele Anhänger in die Arme getrieben. Fritz Lang hat, wenn diese Lesart plausibel ist, wenige Jahre vor den Nibelungen ein heimliches Nationalepos gedreht, das womöglich subtiler, hintergründiger kollektive Stimmungslagen rezipiert und auf sie wieder zurückgewirkt hat, als ein programmatischer Bewältigungsfilm es vermocht hätte. Wobei ich den Ausdruck Nationalepos gleich wieder zurücknehme: Denn es geht eben nicht um deutsches Heldentum, um Kampf und Größe, sondern um die stille, sanfte Ergebung in einen Tod, der nur durch diskrete, umwegige Konnotationen als Nationaltod zu erkennen ist. Vier Jahre lang hat dieser Tod Schwerstarbeit auf den Schlachtfeldern geleistet, von der Propagandamaschine als »Tod fürs Vaterland« zu einer Art Kriegsgott übersteigert. Nun, nach der deutschen Niederlage, ist er müde und nimmt die Attitüde des sorgenden Vaters an, der seinen untergegangenen Söhnen eine liebevolle Heimstatt bereitet hat. Lang gelingt eine Mythisierung des deutschen Sterbens in der Gegenrichtung des Heroischen: naiv-idealisch (wie man mit Hölderlin sagen könnte), also nicht als Heldensage, sondern als Märchen und Lied. Es ist aufschlußreich, daß sich bei Thomas Mann in derselben Zeit eine ähnliche Umbesetzung der Register des Deutschnationalen – vom Heroischen zum Innerlichen – findet. Die Schlußszene des Zauberberg, der zum Großteil in den Jahren 1920-1924 geschrieben wurde, zeigt Hans Castorp auf einem Schlachtfeld des Ersten Weltkriegs, »mit ackerschweren Füßen« seinem (wahrscheinlichen) Ende entgegentaumelnd. Erstaunlicherweise singt der todgeweihte Soldat, aber nicht – wie von der Heeresleitung wohl erwünscht – das ›Deutschlandlied‹ oder Die Wacht am Rhein, sondern Schuberts LindenbaumLied.8 Was Langs Film suggeriert – die Ergebung in den Kriegstod dank musikalischer Todeserotik – wird in Manns Roman als Grundzug deutscher Mentalität reflektiert. Wenn der Zauberberg in seinem berühmten Schneekapitel die Absage an die süchtige »Sympathie mit dem Tode« formuliert, könnte man fast den Eindruck gewinnen, dies sei auch als Warnung vor dem sympathischen deutschen Tod zu verstehen, den Fritz Lang vorgestellt hatte. 8. Thomas Mann: Der Zauberberg, Frankfurt a.M.: S. Fischer 1981, S. 870f. Vgl. hierzu Hans Rudolf Vaget: Seelenzauber. Thomas Mann und die Musik, Frankfurt a.M.: S. Fischer 2006, S. 52ff.
21
Manfred Koch
Man kann aber – und damit komme ich (b) zur zweiten, ›ästhetischen‹ Lesart – alles auch ganz anders sehen. Sind nicht, so könnte man fragen, die eben angestellten Überlegungen ihrerseits zu ›deutsch‹, zu biedersinnigernst allein auf eine ›Botschaft‹ des Films gerichtet? Der müde Tod ist ja auch ein Stück Unterhaltungskino, gezielt auf ein breites, vergnügungsbereites (und nicht nur trauerndes) Publikum. Für die komischen oder auch sensationellen Effekte waren fraglos die Binnenepisoden zuständig. In ihnen bot sich dem Regisseur auch die Chance, die technischen Möglichkeiten des neuen Mediums vorzuführen. Die These zu dieser Lesart würde ganz einfach lauten: the medium is the message. Die artistische Ornamentik des Films spielt sich gleichsam in den Vordergrund und läßt die Inhalte, die das Drehbuch vorgibt, fast bedeutungslos werden. Gerade in den Binnenepisoden entfaltet der Film ein unglaubliches Sinnenspektakel aus Personenkonfigurationen, exotischen Mustern und architektonischen Formen. Der Gegensatz von Rahmen und Einlagen wäre unter diesem Aspekt eine Präsentation der konträren Möglichkeiten phantastischen Erzählens im Film: in der Rahmengeschichte das Kino der langen Einstellungen (das die Figuren mitunter fast zu Standbildern erstarren läßt), der Beschwörung traditioneller Symbole; in den Binnenepisoden das Kino der schnellen Schnitte, der wechselnden Perspektiven, der technischen Tricks und Experimente, das sich im Sog der visuellen Effekte verliert, bis die Inhaltsebene abhanden zu kommen scheint. Kulturwissenschaftler sind derzeit darauf trainiert, allenthalben ›Selbstreflexivität‹ zu entdecken und die jeweiligen Artefakte auf diese einzige Bedeutung zurechtzustutzen. Bei aller Skepsis gegenüber dieser Mode kann man kaum der Versuchung widerstehen, den Zauberer der China-Geschichte als Portrait des Regisseurs im Reich der unbegrenzten cineastischen Möglichkeiten zu verstehen. Das Geschehen kippt unablässig um ins Surreale. Statt einer Handlung werden Verwandlungstechniken, statt einer faßlichen Szenerie Möglichkeiten der Raumaufteilung und Raumerfüllung im Film vorgeführt. Mal dominieren abstrakte geometrische Muster (z.B. die drei Kreise, die der Kaiser durchquert; 1:25:35), mal heben sich die Figuren nur silhouettenhaft, als schwarze Striche, gegen einen leeren Himmel ab (wie bei der Verfolgungsjagd). Dann wieder wird die Leinwand förmlich zugedeckt von einem Dschungel ineinander verschlungener Linien, die sich kaum noch realen Gegenständen zuordnen lassen. Der Kaktus, in den die Gehilfin ihren Meister verwandelt, steht als veritable moderne Skulptur im Raum, eine Ausführung Giacomettis nach einem Entwurf von Arcimboldo. Als Höhepunkt seiner Zauberkunst produziert A Hi eine wunderschöne Spielzeugarmee, nicht von Zinnsoldaten, sondern von wirklichen, lebendigen Figuren, die er in sein magisches Viereck (den Teppich) bannt (1:07:20) und nach seinem Gusto sich bewegen läßt. Die China-Episode ist Langs Präsentation des Kinos als Spielwiese für den Regisseur – im ganzen Spektrum vom Unterhaltungsangebot bis hin zur experimentellen Kunst. Sie bietet Burleskes, komische Slapstickszenen, aber auch grandiose Einstellungen, die nicht 22
D – Ein Land sucht seine Toten
zufällig die Bildsprache der zeitgenössischen Malerei und Skulptur zitieren. Jede kulturelle Stereotype wird zum Sprungbrett für einen neuen visuellen Einfall, eine Trickaufnahme, einen überraschenden Beleuchtungseffekt. Auch das Publikum im Film ist begeistert und sichtlich traurig, als der magische Kasten vor dem Kaiserpalast wieder zugesperrt wird. Bedenklich bleibt nur, daß der Herrscher sich zwar ebenfalls freut und das Schauspiel genießt, der Zauber ihm aber nichts anhaben kann, sondern seine Macht sogar steigert. Es ist den Tyrannen dieser Welt immer wieder gelungen, die magischen weißen Pferde der Kunst für ihre Zwecke zu satteln.
23
Die Bilder, die Massen Zu Fr itz Langs Die Nibelungen Rainer Schelkle
Langs Mythen Fritz Lang hat gelogen. Er floh nicht Hals über Kopf, kurz nach dem Reichstagsbrand und ohne auch nur Geld von der Bank abheben zu können, vor den Nationalsozialisten und ihrem Propagandaminister Joseph Goebbels aus Berlin, nachdem dieser ihm die Leitung der Reichsfilmkammer und damit des gesamten deutschen Kinos angeboten hatte. Langs Pass beweist, dass er, entgegen der von ihm verbreiteten Version, Berlin erst im Juni 1933 endgültig verließ. Er wird nachgedacht, abgewägt, auch verhandelt haben in diesen Monaten.1 Die sich aufdrängende und berechtigte Frage ist, was das mit Langs etwa ein Jahrzehnt zuvor entstandener Verfilmung des Nibelungenlieds zu tun hat. Die Antwort: mehreres. Zunächst, dass der Nibelungen-Zweiteiler2 eine wichtige Voraussetzung dafür war, dass Lang Goebbels’ Angebot überhaupt bekam; es war vor allem dieser Film, der ihn und seine Partei hoffen ließ, Lang würde ihnen eines Tages das nationalsozialistische Äquivalent zu Eisensteins Potemkin liefern. Angeblich war der erste Teil, Siegfried, sogar Hitlers Lieblingsfi lm. All dies hielt die nationalsozialistischen Filmkontrolleure aber nicht da1. Eine sehr präzise Schilderung der Vorgänge um Fritz Lang in den ersten Monaten des Jahrs 1933 findet sich in Patrick McGilligan: Fritz Lang. The Nature of the Beast, London: Faber and Faber 1997, S. 169-185. Vgl. auch Klaus Theweleits schöne Endnote zu Langs Pass und Godards Le Mépris. Klaus Theweleit: Buch der Könige 2y. Recording angels‹ mysteries. Basel, Frankfurt a.M.: Stroemfeld/Roter Stern 1994, S. 727f. Zwei Beispiele für Langs Version finden sich in: Fritz Lang: Interviews, hg.v. Barry Keith Grant, Jackson: University of Mississippi Press 2003, S. 25 und S. 78f. 2. Die Nibelungen. Teil 1: Siegfried. Teil 2: Kriemhilds Rache, Deutschland 1924, Regie: Fritz Lang, DVD: Divisa Home Video, Spanien 2003 (=Edición Especial Coleccionista).
25
Rainer Schelkle
von ab, die Nibelungen bei ihrer Wiederauff ührung um mehr als die Hälfte zu kürzen. Der komplette zweite Teil, Kriemhilds Rache, blieb im Archivregal und auch 966 Meter von Siegfried fielen unter den Schneidetisch des Zensors.3 Die Nibelungen passten als Ganzes also nicht in die nationalsozialistische Propaganda. Patrick McGilligan schießt übers Ziel hinaus, wenn er schreibt: »Lang was spared the worst of Nazi vilification suffered by Jewish and non-Jewish artists who chose to leave Germany. There seems to have been genuine regret in his case, as if the Nazi leaders also blamed themselves for fatally misreading the man who had directed their immortal Die Nibelungen. While most of Lang’s films were banned outright, others – like Siegfried, reissued in 1933 – merely had to be touched up by the Nazis.«4
Die zwiespältige Haltung der Nationalsozialisten, die weite Teile der von Fritz Lang und seiner Drehbuchautorin Thea von Harbou »dem deutschen Volke« gewidmeten Nibelungen als ungeeignet für das Publikum des Dritten Reichs einstuften, aber denselben Film gleichzeitig als ideales Modell eines kommenden, alles überragenden nationalsozialistischen Kinos begriffen, führt direkt zur Fragestellung dieses Aufsatzes. Wie (proto-)faschistisch sind die Nibelungen, sowohl in den Aussagen des Films als auch in seinen Bildern? Woran erkennt man überhaupt ein faschistisches Bild? Wo positioniert sich der Film im Verhältnis zu den Ästhetiken und Ideologien seiner Zeit? Die Bilder und Texte des Films sollen auf den historischen Moment ihrer Entstehung bezogen und vor diesem Hintergrund auf ihre politischen und ästhetischen Funktionen und Werte hin befragt werden. »Lieber Straßenkehrer sein als Richter«5, sagt Gilles Deleuze, und dieser weisen Grundregel folgend möchte ich gleich klarstellen, dass es nicht das Ziel ist, mit diesem Aufsatz zu einem Schuld- oder Freispruch zu kommen und den Nibelungen einen Stempel mit dem Prädikat »faschistisch« oder »nichtfaschistisch« aufzudrücken. Ähnliches gilt für die Person Fritz Lang und ihre Selbstmythologisierungsversuche bzw. Lügen. Lang ist ein Vierteljahr später aus Berlin weggegangen als er behauptet hat; weder macht ihn die Tatsache, dass er wegging, zu einem Helden, noch macht es ihn automatisch zu einem Nazi, dass ihn Goebbels’ Angebot in Versuchung geführt hat.6 Es sollte mehr 3. Vgl. Victoria M. Stiles: »Fritz Lang’s Definitive Siegfried and its Versions«, in: Literature/Film Quarterly 13/4 (1985), S. 258-274, hier S. 258. 4. P. McGilligan: Fritz Lang, S. 184. 5. Im Original: »Plutôt être balayeur que juge.«, Gilles Deleuze/Claire Parnet: Dialogues, Paris: Flammarion 1977, S. 15. Vgl. René Schérers Kommentar zu diesem Satz in: René Schérer: »Gilles Deleuze: l’écriture et la vie«, in: Yannick Beaubatie (Hg.), Tombeau de Gilles Deleuze, Tulle: Mille Sources 2000, S. 75-90, hier S. 88f. 6. Ein anderer möglicher Grund, den Patrick McGilligan für Langs Abreise aus Berlin nennt, soll nicht verschwiegen werden: verletzter männlicher Stolz darüber, dass seine frisch geschiedene Ex-Frau und -Drehbuchautorin Thea von Harbou mit Ayi Tendulkar anbändelte. Vgl. P. McGilligan: Fritz Lang, S. 181f.
26
Die Bilder, die Massen
Genres für die Beschreibung des Verhaltens von Künstlern in unterdrückerischen Regimen geben als nur die Hagiographie und die Denunziation. Erst wenn wir damit aufhören, Künstler gemäß eines binären Schemas zu bewerten, das nur Helden und Schurken kennt, werden wir in der Lage sein, die Verquickungen und die Verstrickungen von Künstlern und Kunstwerken mit der Politik ihrer Zeit zu begreifen.
Woran erkennt man ein faschistisches Bild? ([…] Aber ich riß mich doch lieber am Riem’; und seufzte ein bißchen; wie diese ›Natzjonnahle Poesie‹ selbst den besten Menschen verrohen kann: sogar=ich war ja 1 Moment anfällich gewordn. Also aufpassn.) Arno Schmidt: Kaff auch Mare Crisium7
Die wahrscheinlich einflussreichsten Sätze über Siegfried hat Siegfried Kracauer formuliert, in seinem zwischen 1941 und 1947 im New Yorker Exil geschriebenen Buch Von Caligari zu Hitler – dem Versuch, mit Hilfe einer Analyse ihrer Filme herauszufinden, wie die Deutschen zu Nazis wurden. »Ganz bestimmte menschliche Ornamente des Films bezeichnen […] die Allmacht der Diktatur. Diese Ornamente setzen sich aus Lehnsleuten und oder Sklaven zusammen. Gunthers Männer stützen den Landungssteg, auf dem Brunhild ans Ufer geht; bis zu den Hüften im Wasser stehen sie, wie lebendige Säulen von mathematischer Berechnung. Besonders ins Auge springt das Bild der angeketteten Zwerge, die der Riesenurne, die Alberichs Schätze enthält, als dekorativer Sockel dienen. Verflucht von ihrem Herrn, verwandeln die versklavten Kreaturen sich in steinerne Figuren. So triumphiert das Ornamentale über das Menschliche auf der ganzen Linie. Absolute Autorität behauptet sich dadurch, daß sie die ihr unterworfenen Menschen zu gefälligen Mustern anordnet. Dies ist der Fall beim Nazi-Regime, das seine starken ornamentalen Neigungen durch Massenaufgebote zum Ausdruck brachte. Wann immer Hitler sich an das Volk wandte, glitt sein Blick weniger über Hunderttausende von Hörern hinweg als über ein Riesenornament, das aus hunderttausend Einzelteilen bestand. Am Triumph des Willens, dem offiziellen Nazifilm des Nürnberger Parteitags von 1934, läßt sich nachweisen, daß die Architekten der Veranstaltung zur Anordnung ihrer Massenornamente Anregung schöpften aus den Nibelungen.«8
Dazu ist zunächst zu sagen, dass Kracauer Recht hat: in den Bildern vom burgundischen Hof ist das Individuum dem Ornament ebenso auf der ganzen Li-
7. Arno Schmidt: »Kaff auch Mare Crisium«, in: ders., Werke, Studienausgabe, Bd. I/3, hg.v. der Arno Schmidt Stiftung (Red. Wolfgang Schlüter), Zürich: Haffmans 1987, S. 7-278, hier S. 85. 8. Siegfried Kracauer: Von Caligari zu Hitler. Eine psychologische Geschichte des deutschen Films, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1979, S. 103.
27
Rainer Schelkle
nie untergeordnet wie die angeketteten Zwerge in Alberichs Schatzkammer. Aber ist das bereits ein faschistischer Zug dieser Bilder? Eine Klarstellung scheint an dieser Stelle angebracht: in der Kritiker- und Forscherrede über die Nibelungen wird nie explizit gesagt, es handle sich um einen faschistischen Film – vielmehr wird von Affi nitäten, Korrespondenzen, Vorwegnahmen gesprochen. Da aber die Nähe zum Faschismus ein Grundthema fast jeder Auseinandersetzung mit Langs Film ist, scheint es angebracht, die Frage klar und offen zu stellen, woran faschistische Bilder zu erkennen – und ob in den Nibelungen welche zu finden sind. Um diese Frage zu beantworten, bietet es sich an, die von Kracauer gelegte Spur weiter zu verfolgen und die Parallelen zwischen den Nibelungen und dem Triumph des Willens, Leni Riefenstahls Parteitagsfi lm, der als wahrscheinlich berühmtestes Beispiel des nationalsozialistischen Propagandakinos ein guter Ansatzpunkt zur Beantwortung dieser Frage ist, genauer unter die Lupe zu nehmen.9 In beiden Filmen ist eine Lust an der Anordnung von Menschenkörpern zu Reihen, Blöcken, Ornamenten nicht zu übersehen. In beiden Filmen zeigt sich diese Lust daran, dass die Körperornamente eine bei weitem größere Rolle spielen, als ihnen in der jeweils zu erzählenden Geschichte eigentlich zukommen würde. Lust an menschlichen Mustern in den Nibelungen: die mit Hilfe eines für damalige Verhältnisse sehr aufwendigen Trickverfahrens versteinernden Zwergensklaven;10 die aufgereihten, bis zum Hals im Wasser stehenden Soldaten, die den Landungssteg halten bzw. bilden;11 die beim ersten Einzug des burgundischen Hofs im Vordergrund stehenden, säulenhaften und identisch gemusterten Soldaten12 – sie alle haben keine außerhalb ihrer Ornamentik liegende ästhetische oder dramaturgische Funktion. Das gilt weitgehend auch für all die geometrischen Konfigurationen, zu denen sich die Protagonisten im Verlauf der Auseinandersetzungen am Wormser Hof formieren. Riefenstahl und die NSDAP führten dieses Prinzip einer sich in sich selbst erschöpfenden Ornamentik in Triumph des Willens zu einem kaum zu überbietenden Höhepunkt. So wurde der Nürnberger Parteitag nicht etwa veranstaltet, um dort – wie auf Parteitagen üblich – über Politik und Personal der NSDAP zu diskutieren; seine Funktion bestand in der ornamentalen Inszenierung der deutschen Massen; und diese Massen wurden inszeniert, damit sie von Leni Riefenstahl abgefi lmt werden konnten. In den Worten Siegfried Kracauers: »[A]us dem wirklichen Leben der Menschen wurde eine gefälschte Realität aufgebaut, die für die genuine ausgegeben wurde; aber diese Travestie der Realität diente, statt das eigentliche Ziel 9. Auch, weil der für sein Caligari-Buch viel gescholtene Siegfried Kraucauer mehr und besseres verdient hat, als seine These mit dem Gemeinplatz wegzuwischen, dass »Macht- und Anbetungsrituale seit alters her zum Gesellschaftskanon gehören.«, Fred Gehler/Ullrich Kasten: Fritz Lang. Die Stimme von Metropolis. Berlin (Ost): Henschelverlag 1990, S. 101. 10. Vgl. Siegfried, 0:34:27-0:34:48. 11. Vgl. ebd., 1:08:15-1:09:13. 12. Vgl. ebd., 0:09:15-0:10:20.
28
Die Bilder, die Massen
zu sein, bloß als Ausstattung für einen Film, der dann den Charakter eines authentischen Dokumentarfi lms annehmen sollte.«13 Andererseits darf man bei allen Parallelen nicht die Differenzen zwischen Langs und Riefenstahls Massenornamenten übersehen, und auch die binäre Art, wie Kracauer Inszenierung und Realität, Falsches und Echtes gegeneinander ausspielt, wird zu überdenken sein. Zunächst: die Nazimassen sind mit Blicken und Körpern völlig auf den Führer ausgerichtet, und sowohl die Blicke als auch die Körperhaltung machen die starke affektive Beziehung und Bindung deutlich, die zwischen ihnen besteht – der Propagandafi lm unterstreicht dies unter anderem mit einer Aneinanderreihung von strahlenden, blonden Jungengesichtern. Diese eben nicht nur räumliche, sondern auch affektive Ausrichtung der Menschenornamente auf jemanden oder etwas, der oder das über ihnen steht, seien es Götter oder menschliche Führer, fehlt in den Nibelungen.14 Auch und gerade die Herrschenden selbst formieren sich bei Lang zu Ornamenten. Das beste Beispiel ist die Szene, als es kurz nach der Ankunft Siegfrieds in Worms zum Konflikt kommt: die Kamera fi lmt die Beteiligten von schräg oben, in einer weiten Totalen, und zeigt sie so als die Schachfiguren, die sie sind.15 Das einzige Prinzip, das über diesen Ornamenten steht und für das sie geformt werden, ist der Blick der Kamera selbst. Darüber hinaus sind die Naziblöcke in Triumph des Willens dynamisch: in ihren »Sieg Heil«-Rufen und Aufmärschen sind die vorangegangenen und folgenden Gewaltausbrüche sichtbar angelegt und enthalten. Die Ornamentik der Nibelungen ist dagegen eine statische, was sich nicht nur am Beispiel der versteinernden Zwerge zeigen lässt; so spricht Lang selbst davon, dass er den burgundischen Hof als »die Welt einer schon überfeinerten Kultur, in der jede Geste, jedes Gewand, jeder Gruß von einer fast müden […] Einfachheit war«16, zeigen wollte. 13. S. Kracauer: Von Caligari zu Hitler, S. 354. Eine detaillierte Analyse dieser Zusammenhänge von inszenierter Authentizität einerseits und Propagandawirkung andererseits findet sich in Martin Loiperdinger: Rituale der Mobilmachung. Der Parteitagsfilm »Triumph des Willens« von Leni Riefenstahl, Opladen: Leske & Budrich 1987. 14. Die von Kracauer erwähnten Soldaten, die den durchaus ornamentalen Landungssteg für Brunhild bilden, haben keinerlei affektive Beziehung zu den über sie Herrschenden; es ist nur eins von vielen Bildern des Films, die es alles andere als erstrebenswert erscheinen lassen, sich einzureihen in das Ornament. Gerade diese Lust ist aber Grundzug faschistischer Körper- und Affektpolitik. 15. Vgl. Siegfried, 0:42:28-0:42:43. 16. Fritz Lang: »Worauf es beim Nibelungen-Film ankam«, in: F. Gehler/U. Kasten, Fritz Lang, S. 170-174, hier S. 171. Vgl. auch die Beobachtungen Frieda Grafes: »Die Ornamentalisierung ist eine Herausforderung ans Kino. Wie weit es möglich ist, bei einer Kunst, die an Ablauf, Zeitablauf gebunden ist, alle Dynamik vergessen zu machen, bis das Kino zu Stein erstarrt. Und bis dann das Chaos, das Ungeformte in Etzels Gestalt einbrechen kann. Bis dahin sind die fl ächigen, zeitlosen Bilder wie ein gigantischer Comic Strip, angesichts dessen man sich fragt, wo denn die ganze
29
Rainer Schelkle
Wahrscheinlich sind aber Ausrichtung und Dynamik der Nazimassen nur zwei Aspekte eines viel grundlegenderen Unterschieds das Im-OrnamentSein der Einzelnen betreffend. Salopp gesprochen: die Nazis in Triumph des Willens wollen Teil des Ornaments sein, die Zwerge, Soldaten und auch die Adligen in den Nibelungen dagegen haben keine Wahl. Was den Menschenornamenten in Langs Film völlig abgeht, ist die affektive Textur, die für Riefenstahl so entscheidend ist – und die sie bezeichnenderweise durch Großaufnahmen erreicht, die die Totalen der riesigen Menschenblöcke komplementieren. Die bereits erwähnten aneinander gereihten jungen, lachenden, strahlenden, blonden, den Blick fest auf den außerhalb des Bilds stehenden Führer gerichteten Jungengesichter dokumentieren die Lust des Einzelnen, Teil der Reihe, Teil des Blocks zu sein; der Komplementarität Nahaufnahme/ Totale entspricht die Komplementarität Gesicht/Menschenblock. Beide illustrieren perfekt Klaus Theweleits These, dass Faschismus beschrieben werden muss als eine Organisation von Körpern und Affekten, bei der der Einzelne das Gefühl der eigenen körperlichen Unversehrtheit und Ganzheit nur erreichen kann als Teil einer Marschformation, eines Heers, eines Blocks, einer »Sieg« und »Heil« garantierenden Ganzheit. Die Realität dieser Lust zu verkennen, sie als Resultat einer gewieften Manipulation abzutun, die durch die Aufklärung der Massen zu durchbrechen sei, war der große Irrtum Siegfried Kracauers und großer Teile der Weimarer Linken.17 Das heißt, ein faschistisches Bild lässt sich nicht einfach als eines definieren, in dem Menschen zu Ornamenten an- bzw. ihnen untergeordnet sind. Entscheidend ist vielmehr, was ich weiter oben die affektive Textur dieser Bilder genannt habe: die Art, wie das Ornament mit Lüsten und Gefühlen aufgeladen und besetzt wird; die Art, wie die Bilder gemäß einer bestimmten Affektökonomie aufeinander bezogen werden; schließlich die Art, wie die Bilder mit den Affekten ihrer Betrachter (zu) interagieren (versuchen).18 So wird der Blick frei dafür, dass es gerade die Großaufnahmen sind, die Triumph des Willens zu einem faschistischen Film machen, insofern erst in ihnen das ganze Ausmaß des Versprechens von Ganzheit, Lebendigkeit und Lust sichtbar wird, das der Nationalsozialismus mit seinen ornamentalen Menschen-
action des Epos geblieben ist, die Intrigen und Gegenintrigen. […] Der Film zeigt eine wirklich genuine Kinoversion des alten Stoffes, einen Aspekt, den vor ihm keine Kunst zeigen konnte. Wie Menschen an ihrer Umwelt, an ihren Lebensformen zugrunde gehen. Sie werden erdrückt von ihren reichen Gewändern, ihren Panzern, ihren Burgen, ihren Domen. Der Dekor verschlingt sie. Der Dekor wird ihr Grab.«, Frieda Grafe: Licht aus Berlin. Lang, Lubitsch, Murnau und weiteres zum Kino der Weimarer Republik, Berlin: Brinkmann & Bose 2003, S. 49f. 17. Vgl. Klaus Theweleit: Männerphantasien 1. Frauen, Fluten, Körper, Geschichte, München: Piper 2000, S. 401-456. 18. Zum Begriff der Textur vgl. Eve Kosofsky Sedgwick: Touching Feeling. Affect, Pedagogy, Performativity, 2. Aufl., Durham, London: Duke University Press 2004.
30
Die Bilder, die Massen
blöcken für Millionen Deutsche darstellte.19 Wie anders in den Nibelungen. Das für Kracauer so wichtige Bild der angeketteten, versteinernden Zwerge ist das exakte Gegenteil der Riefenstahlbilder. Triumph des Willens zeigt, wie sehr das Ornament für Faschisten eine Quelle der Lebendigkeit darstellt; in den Nibelungen ist das Menschenornament dagegen deutlich ausgestellt als Lebendigkeitsverlust bis hin zum Tod.20 Ein ähnlicher Kontrast ergibt sich, wenn man die Ökonomie der Blicke in beiden Filmen vergleicht. Im Triumph des Willens entspricht der Reihung von nach oben gerichteten Jungenblicken eine andere Reihung – die der (wie von Kracauer beschrieben) auf die Menschenreihen herunterblickenden Parteitagsredner, die einerseits durch kurze Einblendung der Namen individualisiert werden, andererseits eine ebenso geschlossene Reihe bilden wie die unten Stehenden. Das Entscheidende ist, dass die Blicke der Führer und ihrer Gefolgsleute kein Außen haben. Sie bilden ein perfekt geschlossenes Relais, die Kamera macht sich so weit als möglich vergessen, um die suture nicht zu gefährden, die alle Risse in der Nazigemeinschaft und den Körpergefühlen der einzelnen Nazis näht.21 Eine Außenperspektive auf diese Ganzheit, auf diesen Blick darf es nicht geben, sonst würde sie sofort in Frage gestellt. Faschisten ertragen es nicht, »wenn [auch] nur ein Einziger neben den Blöcken marschiert«22, der sie bei ihrem Tun beobachten könnte. Solche geschlossenen, Ganzheit produzierenden Relais von Blicken finden sich nicht in den Nibelungen. Ganz im Gegenteil: der Film betont die Differenz zwischen Innen- und Außenperspektive; die Problematisierung von Sehen 19. Es soll nicht verschwiegen werden, dass auch Siegfried Kracauer die Bedeutung der Großaufnahmen in Riefenstahls Film aufgefallen ist; leider kommt er bei der Beschreibung ihrer Wirkung und Funktion wiederum nicht über den Binarismus Realität/Manipulation hinaus: »Die Kameras tasten unablässig Gesichter, Uniformen, Waffen und wieder Gesichter ab, und jede dieser Großaufnahmen liefert einen Beweis für die Gründlichkeit, mit der die Metamorphose der Realität erreicht wurde. […] Diese Großaufnahmen, die nicht nur für Triumph des Willens typisch sind, scheinen die Funktion zu haben, Objekte und Geschehen aus ihrer eigenen Umgebung in einen fremden, unbekannten Raum hinauszunehmen. Die Dimensionen dieses Raums bleiben jedoch völlig undefiniert. Es ist nicht ohne symbolische Bedeutung, dass Hitlers Gesicht oft vor Wolken erscheint.«, S. Kracauer: Von Caligari zu Hitler, S. 354f. Vgl. auch Godards Ausführungen zur Geschichte und Affektpolitik der Großaufnahme in Jean-Luc Godard: Einführung in eine wahre Geschichte des Kinos, München, Wien: Carl Hanser 1981, S. 287f. 20. In der Szene, in der wir den burgundischen Hof zum ersten Mal erblicken, stehen im Bildvordergrund Soldaten (mit sich wiederholenden Mustern auf ihren Uniformen) aufgereiht und erlauben uns nur einen teilweisen Blick auf die Hauptfiguren des Dramas – hier verschwinden die Menschen fast hinter dem Ornament, anstatt sich lustvoll zu ihm zu verschmelzen. 21. Zur suture und ihren ideologischen Implikationen vgl. Kaja Silverman: The Subject of Semiotics, New York, Oxford: Oxford University Press 1983, S. 194-236. 22. K. Theweleit: Männerphantasien 1, S. 449.
31
Rainer Schelkle
und Nicht-Sehen, von Sehen und Gesehenwerden durchzieht besonders Siegfried in fast jeder Szene. Beispielsweise, wenn Siegfried und Kriemhild sich zum ersten Mal gegenüberstehen. Ihre Blicke treffen sich, Siegfried senkt sein Schwert und die gegenseitige Liebe und bevorstehende Vereinigung wird fi lmisch durch streng symmetrische Bildkomposition und frontale Schussund Gegenschusseinstellungen ihrer beider Blicke unterstrichen. Doch die perfekte Gegenseitigkeit wird unterbrochen, eine Einstellung, die Hagen als aufmerksamen Beobachter der Szene zeigt, wird von Lang dazwischen geschoben. Hagen sieht, was andere nicht sehen. Hagen sieht, dass andere nicht sehen.23 Das macht ihn zur mächtigsten Figur im Geschehen des ersten Teils. Kriemhilds Rache zeigt dann die Wendung: die neue Titelfigur, die im ersten Teil als passiv, ornamental und immer weiß gekleidet eingeführt wurde – wie gemacht zum Gesehenwerden –, wird zur wichtigsten Sehenden. Es ist der Blick der schwarz gekleideten Kriemhild, der nun das Geschehen kontrolliert und für die Zuschauer perspektiviert.24 Blicke in den Nibelungen sind nie einfach und unproblematisch. Sehen und Gesehenwerden sind immer Ausdruck eines komplexen und umkämpften Gefüges von Macht und Kontrolle. Eine solche Problematisierung des Sehens hat Thomas Elsaesser als grundlegenden Gegensatz des Weimarer Kinos zum Kino des Dritten Reichs beschrieben: »If one analyzes films of the Weimar period in comparison to Nazi films, what is striking is the very instability, the excess and the self-conscious foregrounding of specular relations […] in the textual systems and the narratives. By contrast, after 1933 – partly owing to the coming of sound, but not decisively (as can be seen by three such typical ›Weimar‹ sound films as Die Dreigroschenoper, M, Der Blaue Engel) – all traces of this particular specularity in the mise-en-scène are eliminated, and the films appear readable in terms of classical narrative […].«25
Diese Ausführungen zur Anordnung von Massen und Blicken in Siegfried lassen sich in Kriemhilds Rache weiter verfolgen. Oft wird in der Auseinandersetzung mit dem Nibelungenfi lm nicht genug zwischen dem Gesamtwerk und seinen Teilen differenziert; exemplarisch hierfür ist Patrick McGilligans Lang-Biographie, in der einerseits die Liebe der Nationalsozialisten zu den Nibelungen hervorgehoben wird, McGilligan aber andererseits schreibt, dass 23. Vgl. Siegfried, 0:46:22-0:47:55. 24. Nicht nur Kriemhild, auch Siegfried ist im ersten Teil meist weiß gekleidet.
Beide sind leere Flächen, die gesehen werden, ohne selbst zu sehen. Kriemhilds schwarze Kleidung im zweiten Teil lässt sie dagegen oft mit den dunklen Hintergründen verschmelzen, so dass nur noch ihr weißes Gesicht und ihre Augen, die die Rache nie aus dem Blick verlieren, aus dem Bild herausstechen. Vgl. Kriemhilds Rache, 0:24:50-0:25:10 und 0:36:45-0:36:49. 25. Thomas Elsaesser: »Film History and Visual Pleasure: Weimar Cinema«, in: Patricia Mellencamp/Philip Rosen (Hg.), Cinema Histories, Cinema Practices, Westport, CT: Greenwood Publishing 1984, S. 47-87, hier S. 72.
32
Die Bilder, die Massen
unter den Nazis nur Siegfried gezeigt wurde (was ein Verbot von Kriemhilds Rache zwar impliziert, das aber seinem Argument schaden würde und darum verschwiegen wird). Woran liegt es, dass Kriemhilds Rache so oft unterschlagen wurde und wird, wenn es um die Nibelungen geht? Ein Grund wurde mit dem ungezähmten Blick der im ersten Teil so dekorativen Kriemhild bereits genannt; ein anderer sind Etzels Hunnenhorden und Steppen, die die wohlgeordnete, ornamentale Welt Burgunds ersetzen und zerstören. Hier haben wir es mit einer völlig anderen Sorte von Masse zu tun, und um die Differenz zum burgundischen Ornament zu fassen bietet sich ein Begriffspaar an, das von Gilles Deleuze und Félix Guattari in ihrem Zweiteiler über Kapitalismus und Schizophrenie entwickelt wurde: molar und molekular. Molar sind Massen, die gleichmäßig strukturiert sind, eine Ganzheit bilden, klar defi nierte Ränder aufweisen, sich auf ein Zentrum hin ausrichten und aus sich gleichenden, austauschbaren Einheiten bestehen; molar sind die Körperanordnungen am burgundischen Hof ebenso wie die Massenornamente in Triumph des Willens. Molekulare Massen dagegen lassen sich am besten mit Begriffen wie Gewimmel, Getümmel, Gewühl oder Gewusel beschreiben; sie haben weder Zentrum noch Grenze noch ein übergeordnetes Organisationsprinzip; und die einzelnen Elemente interagieren nicht als Einheiten, als Individuen (ungeteilte Ganzheiten) miteinander, sondern partiell, temporär, unvorhersehbar.26 Die Hunnen in den Nibelungen sind eine solche molekulare Masse, denn auch wenn Etzel ihr (mehr oder weniger) anerkannter Herrscher ist, hat er weder den Willen noch die Disziplinarmacht, die Körper seiner Untergebenen zu organisieren und auf sich auszurichten. Das Schöne an den Nibelungen ist dabei, dass der Film als Gesamtwerk diese sehr unterschiedlichen Formen von Masse nicht wertet. Anders als Alberich, der von Lang im ersten Teil gängigen antisemitischen Klischees entsprechend als jüdisch-amerikanischer Untermensch inszeniert wird, werden die Hunnen und wird vor allem das Fehlen einer molaren Organisation ihrer Körper in den Nibelungen neben die ornamentalen Burgunden gestellt, ohne dass der Film und seine Bilder eine Wertung vornehmen. Mehr noch: Lang betont in einem Text von 1924, wie sehr gerade die Auflösung der Masse zu einer molekularen Unordnung für ihn Reiz und Ziel der Arbeit am zweiten Teil der Nibelungen war. »Aber es hat mir kaum etwas so am Herzen gelegen, wie die Aufgabe, aus meinen Komparsen […] Menschendarsteller zu machen und sie, mich und das Publikum von dem Anblick einer Menschenherde zu befreien, die auf Kommando einen oder beide Arme hebt […]. [I]ch [hatte] die Freude, unter meiner Komparserie, die eine aufgelöste Masse geworden war, zuletzt ebenso viele Individualitäten zu haben, als da Menschen vor mir standen. […] Und nur durch diese Auflösung der Masse zu
26. Vgl. Gilles Deleuze/Félix Guattari: Anti-Ödipus. Kapitalismus und Schizophrenie 1, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1974, S. 360-365.
33
Rainer Schelkle
Einzelwesen bekommen wir das, was wir im Film am nötigsten brauchen: beseelte Lebendigkeit.«27
In einem anderen Text schrieb Lang, dass es ihm darauf ankam, jede der vier Welten des Films (Worms, die Welt des Walds und der Höhlen, Isenland, die Welt der Hunnen) »in sich selbst zu einem Gipfel zu führen«28; das ist ihm gelungen: jeder Welt der Nibelungen scheint bei Lang ein bestimmtes Element, ein bestimmter Aggregatzustand, sogar eine bestimmte Geschwindigkeit und Art der Fortbewegung zu entsprechen. Ein solches Programm ist bemerkenswert horizontal, wie Heinz-B. Heller ganz richtig bemerkt hat; er schreibt, dass »diese ›vier Welten‹ von Lang nicht in ein Verhältnis des sozial-hierarchischen Oben und Unten, sondern in das eines konkurrierenden Nebeneinander gesetzt werden« – dass Heller als Ausnahme neben Alberich auch die Hunnen nennt, in denen er das »Stereotyp […] des asiatischen ›Untermenschen‹«29 verkörpert sieht, scheint allerdings fragwürdig. Schließlich sind Etzel und seine Hunnen in Langs Film bei aller Primitivität auch die Verkörperung zweier Ideale der europäischen Romantik, nämlich Natur- bzw. Erdverbundenheit einerseits und Kindlichkeit andererseits;30 und nicht wenige Zuschauer werden der drückend lastenden Ornamentik der Burgunden die »beseelte Lebendigkeit« der Wilden vorgezogen haben bzw. vorziehen.
27. Fritz Lang: »Aufgelöste Massen«, in: F. Gehler/U. Kasten, Fritz Lang, S. 174176, hier S. 175f. Vielleicht müsste man eher von einer Tendenz zum Molekularen sprechen, da Lang ja immer noch von einzelnen Individualitäten ausgeht. Die Bilder der Hunnenmassen, z.B. wenn sie über die Hügel geritten kommen oder die Burg stürmen, stehen in ihrer ungeordneten Dynamik allerdings in einem solchen Kontrast zur steinernen Statik des Wormser Adels, dass der Begriff der molekularen Masse hier dennoch haltbar scheint. 28. F. Lang: Worauf es beim Nibelungenfilm ankam, S. 171. 29. Heinz-B. Heller: »›Man stellt Denkmäler nicht auf den fl achen Asphalt‹. Fritz Langs Nibelungen-Film«, in: Joachim Heinzle/Anneliese Waldschmidt (Hg.), Die Nibelungen. Ein deutscher Wahn, ein deutscher Alptraum. Studien und Dokumente zur Rezeption des Nibelungenstoffs im 19. und 20. Jahrhundert, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1991, S. 351-369, hier S. 358. 30. Wie aus einem Bild Böcklins scheinen zum Beispiel die um das Bäumchen tanzenden Hunnenkinder entsprungen. Vgl. Kriemhilds Rache, 0:54:53-0:55:44.
34
Die Bilder, die Massen
Ein deutscher Wald Ich glaube, es ist kein Zufall, daß die Lehren des Bolschewismus dort in unserem deutschen Vaterlande am stärksten und raschesten Eingang gefunden haben, wo der deutsche Wald entweder ganz fehlt […] oder zu einer Holzfabrik geworden ist. […] Je tiefer der Mensch in das Wesen dieser wunderbaren Pfl anzengemeinschaft, die wir Wald nennen, eindringt, je stärker er die Eindrücke der Waldnatur auf sich wirken läßt, desto stärker wird ihm bewußt, daß nur die Stetigkeit, das Festhalten an allem dem, was an Werten uns umgibt, dauerndes und gesundes Leben erzeugen kann und so mag auch der Wald unbewußt den Kern deutscher Weltanschauung, die deutsche Treue, in unserem Volke entwickelt und herausgebildet haben. Eduard Zentgraf: Wald und Volk 31
Das 20. war das Jahrhundert der Massen, das Jahrhundert ihres für viele angsteinflößenden Wachsens, das Jahrhundert ihrer Beherrschung, Zähmung, Manipulation – ihrer Vernichtung. Aber auch das Jahrhundert, das so laut wie kein anderes nach ihrer Befreiung rief. Das Buch, das die Frage nach Beherrschung und Befreiung der Massen am radikalsten stellt und beantwortet, ist Elias Canettis Masse und Macht. Im vorliegenden Zusammenhang ist dieser Text deshalb so wichtig, weil er wie kaum ein anderer die psychischaffektive Dimension des In-der-Masse-Seins zu beschreiben in der Lage ist. Besonders interessant sind dabei die Strukturen und Gefühle spezifisch deutscher Massen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die Canetti beschreibt – allem voran das, was die Deutschen im Wald empfanden (und empfinden?). »Das Massensymbol der Deutschen war das Heer. Aber das Heer war mehr als das Heer: es war der marschierende Wald. In keinem modernen Lande der Welt ist das Waldgefühl so lebendig geblieben wie in Deutschland. Das Rigide und Parallele der aufrechtstehenden Bäume, ihre Dichte und ihre Zahl erfüllt das Herz des Deutschen mit tiefer und geheimnisvoller Freude. […] Ihre Sauberkeit und Abgegrenztheit gegeneinander, die Betonung der Vertikalen, unterscheidet diesen Wald von dem tropischen, wo Schlinggewächse in jeder Richtung durcheinanderwachsen. […] Heer und Wald waren für den Deutschen, ohne daß er sich darüber im klaren war, auf jede Weise zusammengeflossen. Was anderen am Heere kahl und öde erscheinen mochte, hatte für den Deutschen das Leben und Leuchten des Waldes. Er fürchtete sich da nicht; er fühlte sich beschützt, einer von diesen allen.«32 31. Eduard Zentgraf: Wald und Volk, Langensalza: Hermann Beyer & Söhne 1923, S. 11f. 32. Elias Canetti: Masse und Macht, Frankfurt a.M.: Fischer 1982, S. 190. Daher auch die große Bedeutung, die die Nationalsozialisten dem Wald beimaßen: »Nazi propaganda […] frequently used the forest […] to extol the National Socialist ideal of community and malign the democratic emphasis on the individual. […] [F]or-
35
Rainer Schelkle
Mit anderen Worten: der deutsche Wald und die Gefühle, die er hervorruft, sind – in der oben eingeführten Begrifflichkeit – molar und müssen streng unterschieden werden von einer ungeordneten, wuchernden, molekularen Natur. Diesen Wald und die mit ihm verbundenen deutschen Sehnsüchte hat vielleicht niemand besser und beeindruckender ins Bild gesetzt als Fritz Lang in den Nibelungen. Das liegt vor allem daran, dass Lang und der für die Bauten des Films verantwortliche Otto Hunte gar nicht erst versucht haben, einen solchen Wald zu finden; sie haben ihn selbst gebaut – aus Beton.33 Folgt man Canetti, so wird klar, dass das Rigide, Parallele, Vertikale, sauber Abgegrenzte des (Beton-)Walds, durch den Siegfried bei Lang reitet, genau dem Körperbild und Körpergefühl entspricht, nach dem sich viele Deutsche Mitte der 20er Jahre sehnten – schließlich vermissten sie seit dem Verbot des Heers durch den Versailler Vertrag schmerzlich die Institution, die sonst ihre Körper in diesem Sinne geformt und organisiert hatte.34 Der andere Aspekt, den deutsche Waldliebhaber in den 20er und 30er Jahren immer wieder hervorheben, ist die Dauerhaftigkeit, die »Ewigkeit« des Waldes. Ewiger Wald hieß ein Propagandafi lm, der 1936 in die Kinos kam, mehrere Bücher unter dem gleichen oder ähnlichen Titeln erschienen in diesen Jahrzehnten.35 Auch das passt gut zu Langs Nibelungenwald: das deutsche Waldgefühl nicht als Liebe zur Natur, sondern als Sehnsucht nach betonhafter Härte und Ewigkeit. Im Übrigen sähe der Wald in Deutschland, hätte man ihn wild wachsen lassen, sehr anders aus als der häufig so monotone, in Reih und Glied stehenesters were drafted into Weltanschauliche Schulungslager (ideology camps) to receive ›ideological and physical training‹. The fact that foresters shared this ›honor‹ with relatively few other professions such as teachers and university lecturers indicates how important the National Socialists thought foresters were as public role models in the rural districts.«, Michael Imort: »Eternal Forest – Eternal Volk. The Rhetoric and Reality of National Socialist Forest Policy«, in: Franz-Josef Brüggemaier/Mark Cioc/ Thomas Zeller (Hg.): How Green Were the Nazis? Nature, Environment, and Nation in the Third Reich, Athens: Ohio University Press 2005, S. 43-72, hier S. 53f. 33. Vgl. Siegfried, 0:16:16-0:16:42 und 0:17:35-0:18:16. Vgl. dazu auch Lotte Eisner: Fritz Lang, London: Secker & Warburg 1976, S. 74. 34. Vgl. Canettis Kapitel zum »Deutschland von Versailles« in E. Canetti: Masse und Macht, S. 197-202. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch Susan Power Brattons öko-feministische Perspektive: sie sieht Siegfried primär als phallische, die Natur penetrierende und ausbeutende Figur. Vgl. auch Susan Power Bratton: »From Iron Age Myth to Idealized National Landscape. Human-Nature Relationships and Environmental Racism in Fritz Lang’s Die Nibelungen«, in: Worldviews. Environment, Culture, Religion 4/1 (2000), S. 195-212, bes. S. 200-205. Demgegenüber weist Victoria Stiles zu Recht darauf hin, dass Siegfried nicht zufällig beim friedlichen Trinken an einer Quelle getötet wird, wie zuvor der Drache. Vgl. Victoria M. Stiles: »The Siegfried Legend and the Silent Screen: Fritz Lang’s Interpretation of a Hero Saga«, in: Literature/Film Quarterly 8/4 (1980), S. 232-236. 35. Vgl. M. Imort: Eternal Forest, S. 55.
36
Die Bilder, die Massen
de. Über Jahrhunderte war auf dem Gebiet des heutigen Deutschland Mischwald vorherrschend, mit viel Unterholz, mehr molekulare Unordnung als molares Heer von gleichen Bäumen. Besonders vom 19. Jahrhundert an, im Zuge der Expansion von Kapitalismus und Militarismus, wurden (z.B. im Schwarzwald) Monokulturen von Fichten und Kiefern gepflanzt, schnell wachsende und verwertbare Baumarten.36 Die strenge Ordnung des deutschen Walds basiert also auf der Zurichtung des vormaligen Wuchern des Walds auf kapitalistische Verwertbarkeit.
Der unsichtbare Jude als Beherrscher des Mediums Werktreue stand für Thea von Harbou beim Schreiben der Nibelungen ebenso wenig auf der Agenda wie für Fritz Lang beim Dreh; sie soll hier auch ganz sicher nicht eingeklagt werden. Und doch gibt es einen Punkt, an dem die Distanz zwischen Film und Nibelungenlied nicht nur groß ist, sondern auch symptomatisch und beklagenswert. Es geht um Alberich – und darum, was Harbou, Lang und Maskenbildner Otto Genath in Siegfried aus ihm gemacht haben. Dazu zuerst ein Blick auf Alberich und seine Art zu kämpfen im Nibelungenlied: »Dazu die reichen Könige, die schlug er [Siegfried; R. S.] beide tot. Durch Alberich kam er darauf in große Not: seine Herrn wollt schleunig rächen seine Hand. bevor die große Stärke er an Sigfrid erkannt. Da konnt ihn nicht bestehen der kräftige Zwerg. Wie die wilden Löwen liefen sie an den Berg, wo er die Tarnkappe Alberich abgewann. Da ward der Herr des Hortes Sigfrid, der vielkühne Mann.«37
Alberich ist Siegfried hier ein gleichwertiger Gegner, der gar nicht daran denkt, sich mit seiner Tarnkappe einen unfairen Vorteil zu verschaffen und der Siegfried angreift, nachdem dieser seine Herren getötet hat. Im Film greift Alberich grundlos an, aus dem Hinterhalt, unsichtbar, der nichts Böses ahnende oder tuende Siegfried wird plötzlich gepackt und gewürgt. Als Siegfried ihn dennoch besiegt, winselt und bettelt der Zwerg um
36. Vgl. Hansjörg Küster: Geschichte des Waldes. Von der Urzeit bis zur Gegenwart, München: C.H. Beck 1998, S. 207-209; Karl Hasel/Ekkehard Schwartz: Forstgeschichte. Ein Grundriss für Studium und Praxis, 2. Aufl., Remagen: Dr. Kessel, 2002, S. 292-300. 37. Das Nibelungenlied, übers., eingel. u. hg.v. Felix Genzmer, Stuttgart: Reclam 1975, S. 27.
37
Rainer Schelkle
sein Leben, verspricht verborgene Schätze – und lauert doch nur auf seine nächste Chance.38 Im Film ist Alberich Jude, die antisemitische Karikatur eines Juden, und wurde von den Zeitgenossen auch so verstanden.39 Nun ist, wie so oft, der Zeitpunkt entscheidend: Anfang 1924, bei der Premiere der Nibelungen, steckten den Deutschen noch die Inflation und die Wirtschaftskrise in den Knochen. »Im April 1923 benötigte man nicht Millionen oder Milliarden, sondern Billionen Mark, um ein Brot zu kaufen oder einen Brief zu frankieren. Die Bauern weigerten sich, ihre Erzeugnisse abzugeben, die Industrieproduktion erreichte einen beispiellosen Tiefstand, es gab Lebensmittelunruhen, die Arbeiterschaft war dem Verhungern nahe, Millionen Angehörige des Bürgertums verloren ihre sämtlichen Ersparnisse, während gleichzeitig Spekulanten Reichtümer erwarben.«40
Und in der antisemitischen Imagination vieler Deutscher waren diese Spekulanten allesamt Juden. Doch die Inflation war mehr als die Entwertung der Mark und die Bedrohung durch Hunger und Armut. Sie war eine Entwertung der Deutschen selbst, in ihren eigenen Köpfen und Körpern, wie Canetti ausführt: »Man kann die Infl ation als einen Hexensabbat der Entwertung bezeichnen, in dem Menschen und Geldeinheit auf das sonderbarste ineinanderfließen. […] Der einzelne fühlt sich entwertet, weil die Einheit, auf die er sich verließ, die er sich selber gleichachtete, ins Abgleiten geraten ist. Die Masse fühlt sich entwertet, weil die Million entwertet ist. […] Alle Massen, die sich in Infl ationszeiten bilden – und sie bilden sich gerade dann sehr häufig –, stehen unter dem Druck der entwerteten Million. So wenig man allein gilt, so wenig gilt man dann auch zusammen. Wenn die Millionen in die Höhe klettern, wird ein ganzes Volk, das aus Millionen besteht, zu nichts. […] Keine plötzliche Entwertung der Person wird je vergessen, sie ist zu schmerzlich. Man trägt sie ein Leben lang mit sich herum, es sei denn, man kann sie auf einen anderen werfen. Aber auch die Masse als solche vergißt ihre Entwertung nicht. Die natürliche Tendenz ist dann, etwas zu finden, das noch weniger gilt als man selbst, das man so verachten kann, wie man selbst verachtet wurde.«41
38. Vgl. Siegfried, 0:26:35-0:28:03. 39. Lotte Eisners Verteidigung von Langs Alberich ist keine. Sie schreibt: »Sieg-
fried Kracauer alleged that Lang’s Alberich has markedly Jewish features, and he reads into this a deliberate gesture of anti-semitism. In reality, Lang and his makeup artist Otto Genath were simply influenced by the Russo-Jewish Habimah ensemble that was currently visiting Berlin.«, L. Eisner: Fritz Lang, S. 79. Das Problem ist aber nicht allein Alberichs Aussehen, sondern sein Handeln als erkennbar aus zeitgenössischen Klischees vom Juden zusammengesetzte Figur. 40. Peter Gay: Die Republik der Außenseiter. Geist und Kultur in der Weimarer Zeit 1918-1933, Frankfurt a.M.: Fischer 1987, S. 204. 41. E. Canetti: Masse und Macht, S. 205f.
38
Die Bilder, die Massen
»Das Wesen des Films – ich möchte dies immer wieder feststellen – ist nur dann überzeugend und eindringlich, wenn es sich mit dem Wesen der Zeit deckt, aus der dieser geboren wurde«42, schrieb Lang nach Fertigstellung der Nibelungen. Ein heimtückischer, unsichtbar agierender, von hinten angreifender, 43 heimlich Schätze hortender und dazu jüdischer Alberich als fi lmisches Objekt der Verachtung deckte sich nur allzu sehr mit dem deutschen »Wesen« der Jahre nach 1924. Alberich im Film ist nicht nur Jude, sondern auch Amerikaner, mit dem Kopfschmuck der Freiheitsstatue. Nun gingen und gehen Antisemitismus und Antiamerikanismus »spätestens seit dem frühen 19. Jahrhundert Hand in Hand«, 44 doch die Verbindung Jude/Amerikaner hat in den Nibelungen darüber hinaus einen spezifischen Grund – einen kinospezifischen, denn Alberich erweist sich als Meister auch des Sichtbarmachens, als Beherrscher des Lichts, der beeindruckende Bilder auf Wände projiziert, mit einem Wort: als Kinomann. Doch er repräsentiert eine Sorte Kino, gegen die sich Lang mit den Nibelungen wendet, das Kino Amerikas, genauer: das Kino des 1924 erst am Anfang seiner Blütezeit stehenden und weitgehend von eingewanderten Juden betriebenen Hollywood. 45 »Es kann meines Erachtens nicht die Aufgabe des deutschen Films sein, mit der äußeren Monumentalität des amerikanischen Kostümfi lms in Konkurrenz zu treten« 46, und dementsprechend ist das einzige Bild, das Alberich hinbekommt, eines von Gold & Juwelen, ein Bild von »äußerer Monumentalität«. Lang dagegen empfiehlt sich als Schöpfer 42. Fritz Lang: »Kitsch – Sensation – Kultur und Film«, in: Edgar Beyfuss/Axel Kossowsky (Hg.), Das Kulturfilmbuch, Berlin: Carl P. Chryselius 1924, S. 28-31, hier S. 29. 43. Das Bild vom ehrlichen deutschen Kämpfer, der von hinten angegriffen wird, ist auch sehr kompatibel mit 1924 virulenten Dolchstoßlegenden und -affekten. 44. Andrei S. Markovits: Amerika, dich haßt sich’s besser. Antiamerikanismus und Antisemitismus in Europa, Hamburg: Konkret Texte 2004, S. 174. 45. »Jesse Lasky, Carl Laemmle, Adolph Zukor, William Fox, Samuel Goldwyn, Marcus Loew, Louis B. Mayer, Irving Thalberg, Harry, Al, Jack, and Sam Warner, Harry Cohn, Joe and Nick Schenk, David O. Selznick – of the major powers in the Big Eight Hollywood studios that dominated the industry from the 1920s through the 1940s, only Cecil B. DeMille and Darryl Zanuck were not immigrant Jews.«, Michael Rogin: Blackface, White Noise. Jewish Immigrants in the Hollywood Melting Pot, Berkeley, Los Angeles: University of California Press 1996, S. 78. »Hollywood wurde erfunden von Juden, die Europa ausschloss, oder ausspuckte.«, Klaus Theweleit: absolute(ly) Sigmund Freud Songbook, Freiburg i.Br.: orange press 2006, S. 203. Zu den vergessenen Ostküstenanfängen dieser Kinomänner vgl. Dennis B. Klein: »The Movies: Notes on the Ethnic Origins of an American Obsession«, in: Paul Buhle (Hg.), Jews and American Popular Culture, Vol. 1: Movies, Radio, and Television, Westport: Praeger 2007, S. 1-11. 46. F. Lang: Worauf es ankam, S. 172. Eine ausführliche Analyse Alberichs als Repräsentant eines jüdischen Kinos findet sich in David J. Levin: Richard Wagner, Fritz Lang and the Nibelungen. The Dramaturgy of Disavowal, Princeton, NJ: Princeton University Press 1998, S. 123-136.
39
Rainer Schelkle
eines Kinos, das auf solche Effekte verzichten kann und das »im Gegensatz zum nivellierend-internationalen unübertragbar national ist.« 47 Doch ein anderer Aspekt dieser Szene darf nicht unterschlagen werden. Der Denunziation des inhaltsleeren Hollywoodkinos Alberichs gegenüber steht nämlich eine beißende Kritik an der lächerlichen Inkompetenz des deutschen Helden Siegfried im Umgang mit Bildern – nach Alberichs Vorführung tastet er ungläubig die Höhlen(lein)wand ab. 48 Lang zitiert hier ein metafilmisches Minigenre aus der Frühzeit des Kinos, die sogenannten »Uncle Josh«-Filme, in denen ein Einfaltspinsel vom Land »im Kino auf die Leinwand kletterte und entweder das Bild greifen, hinter das Bild schauen oder sich zur schönen Dame ins Schlafzimmer gesellen wollte.«49 ›Die Deutschen müssen aufhören, mit offenen Mündern Bilder aus Amerika anzustarren‹, sollte das heißen. Sie sollten – so die Intention – in den Nibelungen den Film, in Lang den Filmer eines überlegenen deutschen Kinos erkennen und anerkennen.50 Der NS-Reichsfi lmkammer waren solche Szenen, als sie 1933 daran ging, sich ihre eigene Version von Siegfried zurecht zu schneiden, mehr als suspekt, und so sind unter den bereits erwähnten knapp tausend Metern Film, die herausgeschnitten unter den Tisch fielen, besonders die, die Siegfried als Naivling im Umgang mit Erzählungen und Bildern ausweisen, und die, in denen seine fehlende Impulskontrolle und seine primitiven Ursprünge betont werden.51 An einer solchen Darstellung des Siegfried scheint aber vornehmlich die metafi lmische Reflexivität gestört zu haben, die die Naivität Siegfrieds im Umgang mit Bildern und anderen Repräsentationen sichtbar macht. Nicht allein, dass der Deutsche Siegfried unfähig ist im Umgang mit Bildern ist das Problem, sondern dass Lang ein Bild macht von dieser Unfähigkeit. 47. F. Lang: Worauf es ankam, S. 172. Was dieses deutsche Kino ausmacht bleibt sehr vage in Langs Text; es scheint einerseits die Schicksalhaftigkeit des Geschehens zu sein und andererseits eine gewisse ästhetische Effizienz, die z.B. zu Massenszenen nur greift wenn unbedingt notwendig (vgl. ebd.). Interessant ist auch, wie sehr Langs Rhetorik den heutigen Beschwörungen eines vermeintlich überlegenen europäischen Kinos gleicht, in Kontrast zum vermeintlich seelenlosen amerikanischen Film. 48. Vgl. Siegfried, 0:31:44-0:32:39. 49. Thomas Elsaesser: Filmgeschichte und frühes Kino. Archäologie eines Medienwandels, München: edition text + kritik 2002, S. 72. 50. David J. Levin betont zu Recht, dass Siegfrieds Fehler nach dem Tod Alberichs vor allem darin besteht, dessen Leuchtkugel und damit die Bildproduktion nicht an sich zu nehmen und stattdessen mit seinem neuen Schwert zu posieren (Gesehenwerden statt Sehen). Levins abschließende Frage nach dem Verbleib der Leuchtkugel ist mit Langs zeitgenössischen Texten im Ohr nicht schwer zu beantworten: Lang selbst hat sie und mit ihr die Macht, bessere Bilder zu produzieren. Vgl. D. Levin: Richard Wagner, Fritz Lang and the Nibelungen, S. 101-123 u. 128-140. 51. Eine detaillierte Darstellung der verschiedenen Siegfried-Fassungen findet sich in: V. Stiles: Fritz Lang’s Definitive Siegfried. Einen guten Überblick über die Geschichte der Filmzensur in Nazideutschland liefert Klaus-Jürgen Maiwald: Filmzensur im NS-Staat, Dortmund: Nowotny 1983.
40
Die Bilder, die Massen
Schlussakkord : Bilder und Wor te, Kunst und Industr ie, Wald und Meer, Nibelungen und Odyssee, Heimat und Exil, Lang und Godard Der TONFILM öffnet seine Pforten dem Theater, das den Platz besetzt und mit Stacheldraht umgibt. Robert Bresson: Noten zum Kinematographen52
Wer etwas herausfinden will über das Verhältnis der Nationalsozialisten zu Bildern, über die Art, wie Faschisten mit Bildern umgehen, der wird im Fall Lang vor allem fündig bei der Untersuchung der Differenzen zwischen Siegfried und der von der Reichsfi lmkammer 1933 in die Kinos gebrachten Neufassung Siegfrieds Tod. Bereits der Titel ist hier Programm: Siegfrieds Tod ist Siegfrieds Tod als derjenige eines spannenden, widersprüchlichen, offenen Films. Dem faschistischen Eindeutigkeitswillen fielen alles Unheldische, Schwache, Missverständliche an Siegfried zum Opfer. Nicht das Werden, sondern das Sein interessiert die faschistische Repräsentation, deshalb beginnt der Film in Worms, mit Volker, der Siegfrieds (gesäuberte) Heldengeschichte vorträgt, und nicht mit Siegfried selbst. Wo Lang zeigt, wie Siegfried zum Helden wird, sorgt der vorgezogene rahmende Sänger in Siegfrieds Tod dafür, dass Siegfried von Anfang an ein Held ist, dessen Taten besungen werden.53 Doch die Zensoren taten noch mehr: sie legten aus dem Off gesprochene Verse aus dem Nibelungenlied über Langs Bilder; Ausdruck eines faschistischen Unbehagens an der Mehrdeutigkeit, Flüchtigkeit und Offenheit von Langs Filmbildern, die durch die Rückbindung an die literarische Quelle unter Kontrolle gebracht werden sollten.54 Folgt man Jean-Luc Godard, so war dies auch Ausdruck eines viel weiter gehenden Willens zur Unterwerfung der sprachlosen Bilder des »stummen«55 Kinos unter die Wörter: »Es ereignet sich genau 1930, als Hitler in Deutschland anfängt, und Roosevelt in Amerika. Als Geschichtsschreiber des Kinos sage ich, daß es einen ›new deal‹ zwischen dem Bild und dem Ton gibt. […] [D]er Text, das Drehbuch ergreift wieder die Macht, in dem Moment, wo Stalin Stalin wird, Hitler Hitler. Das Drehbuch, die Texte, die Programme, die Drehbücher, und die Lager.«56
In Le Mépris, Godards Film über das Kino und seine Produktionsweisen und 52. Robert Bresson: Noten zum Kinematographen, München, Wien: Carl Hanser 1980, S. 8. 53. Vgl. V. Stiles: Fritz Lang’s Definitive Siegfried, S. 262. 54. Geschnitten wurde auch Kriemhilds Falkentraum, den Experimentalfilmer Walter Ruttmann für Lang gedreht hatte. Vgl. Siegfried, 0:40:31-0:41:35. 55. »Der Tonfilm hat die Stille erfunden.« R. Bresson: Noten zum Kinematographen, S. 28. 56. Zit.n. Klaus Theweleit: Buch der Könige 2x. Orpheus am Machtpol, Basel, Frankfurt a.M.: Stroemfeld/Roter Stern 1994, S. 110.
41
Rainer Schelkle
-bedingungen, spielt Fritz Lang sich selbst als einen Regisseur, der von einem amerikanischen Produzenten mit der Verfi lmung der Odyssee beauftragt wurde. Godard feiert in diesem Film Lang als einen Hersteller von Bildern, die sich nicht zurückführen und reduzieren lassen auf Worte in Drehbüchern. In einer Szene in Le Mépris wird der von Jack Palance gespielte Filmproduzent Jeremy Prokosch wütend und wirft Lang vor, die von ihm gedrehte Sequenz stehe nicht im Drehbuch; mit einem verschmitzten Lächeln beweist Lang ihm das Gegenteil. Lang machte aus Worten Bilder, die sich diesen Worten entzogen, sich von ihnen befreiten und ein eigenes Leben entwickelten.57 Doch Kinobilder mit eigenem Leben zu machen, war und ist keine einfache Aufgabe, und Lang ist als Repräsentant des Kinos in Le Mépris so geeignet, weil er wie kaum ein anderer die Spannung zwischen den Systemen »Film als massenproduzierende Industrie« und »Film als Mittel künstlerischen Ausdrucks« verkörpert. Eine Spannung, die Lang eben nicht zum zweiten Pol hin aufzulösen versuchte, weshalb sich »so ein rundes Cinephilen-Fetischverhältnis mit einem gehörigen Schuß Trauer über Kinovergangenheit« bei seinen Filmen »nicht ohne weiteres«58 einstellt. Auch die Nibelungen sind zuallererst Kino für die Massen. Das heißt bei Lang aber auch: nicht Politik, nicht Ideologie; die sind zwar wichtig, verhalten sich aber sekundär zu den Bildern selbst, und von Langs zeitgenössischen Aussagen über den Film sind die über sein Kino als »Esperanto«59 seiner Praxis bei weitem näher als die, in denen er die Nibelungen als spezifisch deutsche Verfi lmung eines »Nationalheiligtums« anpreist.60 Lang ist in Godards Le Mépris jenseits der Verachtung, nicht etwa des57. »Der Film ist für mich Eurydike. Eurydike sagt zu Orpheus: ›Wende dich nicht um.‹ Und Orpheus wendet sich um. Orpheus ist die Literatur, die Eurydike dem Tod weiht. Und sein restliches Leben macht er Kohle mit dem Buch über den Tod Eurydikes, das er veröffentlicht. […] Für mich sind die Bilder das Leben und das Geschriebene der Tod. Es muß beides geben: ich bin nicht gegen den Tod. Aber ich bin nicht für den Tod des Lebens in diesem Ausmaß, vor allem nicht in der Zeitspanne, in der das Leben gelebt werden sollte.«, Jean-Luc Godard: »Zum Tode von Alfred Hitchcock. Interview in Libération vom 2.5.1980«, in: Filmkritik, Juni 1980, S. 280-284, hier S. 283. 58. F. Grafe: Licht aus Berlin, S. 21. 59. F. Lang: »Kitsch – Sensation – Kultur«, S. 29. Sabine Hake sieht in der eklektizistischen, alles über einen stilistischen Kamm scherenden Ästhetik der Nibelungen eine Nähe zum Faschismus: »In these configurations the film betrays its correspondences with a fascist aesthetics that precisely thrives on reconciling the irreconcilable: the choreography of the masses and the celebration of individual heroism, the cult of racial purity and the fascination with the Other, the aesthetic of ossification and the spectacle of destruction.«, Sabine Hake: »Architectural Hi/stories: Fritz Lang and The Nibelungs«, in: Wide Angle 12/3 (1990), S. 38-57, hier S. 55. Aber macht nicht gerade der Eklektizismus, die Esperantohaftigkeit von Langs Kino die synthetische Gemachtheit seiner Bilder augenfällig und damit der Reflexion zugänglich? 60. F. Lang: Worauf es ankam, S. 170.
42
Die Bilder, die Massen
halb, weil er sich heldenhaft gegen den Filmproduzenten und sein System auflehnen würde, sondern weil er versucht, diesem System so gut es eben geht Bilder abzuringen.61 Objekt der Verachtung ist in Godards Film vielmehr Paul Javal (Michel Piccoli), ein Mann des Theaters, der Wörter und der Texte, der weinerlich die Position des autonomen Künstlerindividuums für sich beansprucht und dem Kino schließlich den Rücken kehrt. Aber Le Mépris ist auch eine Entgegnung. Godard entwirft freundschaftlich-kritische Gegen-Bilder zu Langs Kino, z.B. zu den Nibelungen. So verfi lmt Lang bei Godard die Odyssee: die germanische Sage von Heimat, von Standhaftigkeit und Treue bis zum Tod, wird ersetzt durch den mediterranen Mythos vom gerissenen drifter, vom Herumirrer und -treiber Odysseus. Ein Mythos, der selbst keine richtige Heimat hat, was daran deutlich wird, dass wie bei Joyce in Le Mépris die lateinischen Namen der Helden und Götter verwendet werden. Le Mépris, ein Film in vier Sprachen, feiert die Heimatlosigkeit Odysseus’ – und der Odyssee; diejenige Fritz Langs, des Wieners, der in Deutschland, Frankreich und den USA Filme gedreht hat und damit in fast ebenso vielen Sprachen, wie in Godards Film zu hören sind; schließlich die des Kinos selbst, zwischen Hollywood, Cinecittà, Berlin und Paris, zwischen Massenkunst und auteurisme. In der letzten Einstellung von Le Mépris blicken die Kamera und mit ihr (der Darsteller des) Odysseus(-Darstellers) aufs Meer, obwohl gesagt wird, nun erblicke er Ithaka. Ein schöner Schluss: Exil statt Heimat, Odyssee statt Nibelungenstreit, Mittelmeer statt deutscher Wald.62
61. Als sie die erste Fassung von Le Mépris sahen, beschwerten sich die Produzenten Ponti und Levine bei Godard, weil Brigitte Bardot, der Star des Films, nicht nackt zu sehen war. Nach heftigen Auseinandersetzungen (es ist z.B. überliefert, dass Godard eine Gruppe von Schlägern auf Ponti ansetzte) gab Godard nach und drehte die wunderbare Eröffnungsszene, die das Kunststück vollbringt, Bardots nackten Körper in unpornographischer Schönheit zu zeigen und gleichzeitig eine Reflexion zu sein über die alltäglich-pornographischen Mechanismen im Umgang mit Frauenkörpern: Fragmentierung, Inventarisierung und Evaluierung (»Liebst du meine Brüste?« usw.). »The re-shoots demonstrate clearly the difficulty of any aesthetic which would simply oppose creativity and money, for there can be little doubt that Contempt would be a much less beautiful and moving film without the long opening scene of Bardot naked on a bed.«, Colin MacCabe: Godard. A Portrait of the Artist at Seventy, New York: Farrar, Straus and Giroux 2004, S. 154. 62. Lang hat selbst nur einen Film gemacht, in dem er aufs Meer schaut, Clash by Night von 1952; in einem Text von 1930 bekannte Lang, dass er vom Meer fasziniert sei, sich aber auch vor ihm fürchte. Vgl. F. Grafe: Licht aus Berlin, S. 59f.
43
»…es wäre die Geschichte hier eigentlich aus…« Identitätsverlust und soziale Desintegration in Murnaus Der letzte Mann Alfred Stumm
I. Der Anfang »Heute bist Du der Erste, geachtet von allen, ein Minister, ein General, vielleicht sogar ein Fürst – Weisst Du, was Du morgen bist?« Dieses Motto von Murnaus Der letzte Mann 1 verweist abstrakt auf einen Aspekt sozialer Dynamik, konkreter wird darin die ständige Gefahr des gesellschaftlichen Abstiegs thematisiert. Dynamik und Abwärtsbewegung sind dann auch die prägenden Elemente der berühmten Anfangssequenz; zum ersten Mal in der Filmgeschichte wurde hier wirkmächtig die ›entfesselte Kamera‹ eingesetzt. Die Bewegung der Kamera im Fahrstuhl nimmt dabei das Schicksal des namenlosen Protagonisten bis zum ›ersten Schluß‹ vorweg. Dessen Abstieg vom Hotelportier zum Toilettenwärter führt, wie in der Forschung verschiedentlich erwähnt, zu einer Identitätskrise, ja zur Auflösung seines Ich2 und überdies 1. Grundlage der vorliegenden Interpretation ist die 2001/2002 erstellte Rekonstruktion des Films: Der letzte Mann, Deutschland 1924, Regie: Friedrich Wilhelm Murnau, DVD: Universum Film, BRD 2002 (=Transit Classics). 2. Vgl. Frieda Grafe: »Der Mann Murnau. Eine kommentierte Biografie«, in: Friedrich Wilhelm Murnau (= Reihe Film 43, hg.v. Peter W. Jansen u. Wolfram Schütte in Zusammenarbeit mit der Stiftung Deutsche Kinemathek), München, Wien: Carl Hanser 1990, S. 7-60, hier S. 37: »Die Degradierung des ›letzten Manns‹ ist […] einer dieser Stürze, bei der Autorität und Selbstgefühl verlorengehen und alle Sicherheit. Das Bild, das Ideal-Ich, das der alte Portier hatte, bricht auseinander.« Siehe auch Helmut Weihsmann: »Virtuelle Räume. Die Formensprache der Neuen Sachlichkeit bei Friedrich Wilhelm Murnau«, in: Klaus Kreimeier (Hg.), Die Metaphysik des Dekors. Raum, Architektur und Licht im klassischen deutschen Stummfilm, Marburg, Berlin: Schüren 1994, S. 22-48, hier S. 29: »Aus dem Schicksal eines wil-
45
Alfred Stumm
zu sozialer Desintegration. Neben dem für Der letzte Mann wesentlichen Verhältnis »von sich zu sich«3 wird hier also auch dasjenige ›zu anderen‹ untersucht. Welche bildlichen Mittel der Film findet, die genannten Prozesse darzustellen, wurde bisher weitgehend vernachlässigt und soll daher näher erörtert werden. Hinsichtlich seines Selbstverhältnisses ist zunächst die jähe Veränderung der Körperhaltung des ›letzten Manns‹ augenfällig, als er seinen Nachfolger – während des Durchschreitens der Drehtür – erblickt. Schreitet er zuvor mit stolzgeschwellter Brust und auf dem Rücken verschränkten Armen einher, hat sein Körper mit einem Mal all seine Spannung verloren. Mit Blick auf die für den Film insgesamt charakteristische strukturelle Opposition von oben und unten inklusive ihrer jeweiligen metaphorischen Implikationen wirkt sich diese Veränderung in Relation zu seinem Nachfolger negativ aus – er erscheint tatsächlich unterlegen. Der physische Niedergang verstärkt sich zudem rasant, was sowohl den bisher wirksamen selbstdisziplinierenden Aspekt der Anstellung als auch das mit ihrem Verlust verbundene Schockmoment illustriert. Schließlich schleppt sich der anscheinend vom Alter gebeugte Protagonist nur noch mühevoll voran. Doch schon unmittelbar nach jener ersten Konfrontation mit dem Nachfolger ist er nicht mehr Herr seiner selbst, so daß einer der Pagen den aufgrund des Schocks in Passivität Verfallenen geradezu durch die Drehtür des Hotels manövrieren muß. Bereits in den ersten Szenen ist die enge Beziehung zwischen Identität und Uniform des Portiers erkennbar. Entsprechend wird ihm die Livree »wie eine zweite Haut mühsam abgeschält« 4. Des äußeren Zeichens seiner Stellung auf diese Weise entkleidet, schaut er unverwandt an sich herab, als kenne er sich so selbst nicht, als sei er sich fremd. Der Zuschauer gewinnt den Eindruck, daß sich der Protagonist bar seiner Uniform nurmehr geringschätzig betrachten kann. In diesem Zusammenhang heißt es bei Hughes: »[T]he porter in Der letzte Mann [invests] his own identity in his uniform«5. Wenn helminisch geprägten Menschen, der seine stolze Uniform ausziehen muß und zum Toilettenwärter des Luxushotels degradiert wird, machen Murnau, Mayer und Freund eine psychologische Farce von der Zerstörung einer Persönlichkeit.« Zur gendertheoretischen Tragweite dieses Sachverhalts siehe Janet Bergstrom: »Sexuality at a Loss. The Films of F.W. Murnau«, in: Poetics Today 6/1-2 (1985), S. 185-203, sowie Stephan Schindler: »What makes a man a man. The construction of masculinity in F.W. Murnau’s The Last Laugh«, in: Screen 37/1 (1996), S. 30-40. 3. Eric Rohmer: »Was denkt Eric Rohmer zu Murnau. Gespräch mit Frieda Grafe und Enno Patalas«, in: P.W. Jansen/W. Schütte (Hg.), Friedrich Wilhelm Murnau, S. 71-106, hier S. 95. 4. Thomas Koebner: »Der romantische Preuße«, in: Hans Helmut Prinzler (Hg.), Friedrich Wilhelm Murnau. Ein Melancholiker des Films, Berlin: Bertz 2003, S. 9-52, hier S. 35. 5. Jon Hughes: »›Zivil ist allemal schädlich‹. Clothing in German-Language Culture of the 1920s«, in: Neophilologus 88 (2004), S. 429-445, hier S. 444. Vgl. T. Koebner: Der romantische Preuße, S. 34: »In gewisser Hinsicht ist Der letzte Mann
46
Identitätsverlust und soziale Desintegration in Murnaus Der letzte Mann
der Autor allerdings zuvor feststellt: »His loss of status is symbolized above all by the loss of the uniform he had been required to wear«6, ist insofern Vorsicht geboten, als das Verb »symbolized« von seiten des Films eine objektive semantische Affi rmierung des mit diesem Mantel verbundenen hohen Status zu unterstellen scheint. Doch der Wert der Portiersuniform ist hier primär ein subjektiver. Die skizzenhafte Handlungsführung sowie die Typenhaftigkeit der namenlosen Figuren verleiht den Geschehnissen allerdings eine über den Einzelfall hinausweisende Relevanz.
II. Der Autor itätsdiskurs Gleichwohl sind Zweifel angebracht, wenn Der letzte Mann einseitig als »eine scharfsichtige Entlarvung deutscher Untertanen-Mentalität«7 gedeutet wird. Warum nämlich folgt der Film dann dem Leidensweg seines Protagonisten derart ausführlich und schenkt ihm, wie gebrochen dies auch geschehen mag, ein Happy End? Immerhin kommt im einzigen, eine Zäsur bildenden Zwischentitel das durchaus ernstgemeinte Mitleid des Autorerzählers mit seiner Hauptfigur zum Ausdruck. Den Film von dieser Seite her zu vereinnahmen, ist folglich ebenso problematisch wie Siegfried Kracauers Vorwurf, in Der letzte Mann breche sich präfaschistisches Gedankengut Bahn: »Alle Mieter, besonders die weiblichen, erstarren in Ehrfurcht vor seiner Uniform, die durch ihr schieres Vorhandensein einen mystischen Glanz auf ihr bescheidenes Leben zu werfen scheint. Sie verehren die Uniform als Symbol allerhöchster Macht und sind noch stolz darauf. So befördert der Film, wenngleich ironisch, das autoritäre Credo, nach dem der magische Glanz der Autorität die Gesellschaft vorm Zerfall bewahrt. […] Da der Film davon ausgeht, daß einzig und allein die Autorität die zerfallenen gesellschaftlichen Bereiche zu einem Ganzen füge, muß der Fortfall der Uniform, die für Autorität einstand, Anarchie nach sich ziehen.«8
Der dem Portier entgegengebrachte Respekt wird nicht derart eindimensional präsentiert. Die »Ironie« ist somit nicht als belanglos für die vermeintlich eigentliche Aussage des Films zu begreifen. Vielmehr ist entweder diesem selbst aufgrund der Figurenzeichnung bzw. -darstellung eine ironische Didie Tragödie eines alten Mannes, dem man mit dem Prunkmantel die Identität und Würde raubt«. 6. J. Hughes: Zivil ist allemal schädlich, S. 438. 7. T. Koebner: Der romantische Preuße, S. 34. Vorsichtiger, aber in der Sache ähnlich formuliert Schindler aus gendertheoretischer Sicht: »[T]he film eventually dismantles the old man’s identification with his uniform as a false form of male autonomy, as an anachronistic belief in the traditional hierarchy.«, S. Schindler: What makes a man a man, S. 31. 8. Siegfried Kracauer: Von Caligari zu Hitler. Eine psychologische Geschichte des deutschen Films, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1984, S. 109.
47
Alfred Stumm
stanzierung von den Respektsbekundungen, oder aber fiktionsintern den Figuren ein bewußt augenzwinkernd spielerischer Umgang damit zu attestieren. Ferner wird deutlich, daß die Uniform dem Portier im Hinblick auf den gesamtgesellschaftlichen Rahmen keine wirkliche Autorität verleiht; außerhalb des Wohnquartiers schenkt ihm auf dem Weg zum Hotel niemand Beachtung.9 Statt dessen weist ihn seine gesamte Erscheinung inklusive der Uniform als Anachronismus aus.10 Die höchsten ›Machthaber‹ des Films und damit der modernen Gesellschaft, der Hotelmanager, vor allem aber die reichen Gäste des Hotels, tragen keine Uniform im eigentlichen Sinn, auch wenn ihre Kleidung sie als Inhaber ihres hohen sozialen Status ausweist. Zudem bricht mit dem »Fortfall der Uniform« im Arbeiterviertel keineswegs »Anarchie« aus, sondern die sozialen Gesetzmäßigkeiten setzen sich unter veränderten Bedingungen, aber gemäß denselben Prämissen fort. Auch ist nicht klar, ob und inwieweit der Verlust der Position oder dessen Verheimlichung bzw. die Hochstapelei ausschlaggebend für das Gespött der Leute und die soziale Desintegration des Portiers sind. Wäre das immer schon vorgängige Ziel der Argumentation Kracauers nicht der anhand einer Analyse des Films als kulturellem Produkt geführte Nachweis einer tiefenpsychologischen Disposition zum Autoritarismus »in Deutschland von 1918 bis 1933« 11, könnte der Interpret genausogut zu dem Schluß gelangen, Der letzte Mann stelle das revolutionär gesinnte Volk dar, das sich am Sturz der Autorität erfreue. Dies triff t indes ebensowenig zu; denn es handelt sich nicht um den Sturz einer tatsächlichen gesellschaftlichen Autorität. Vielmehr wird hier eine Form der Schadenfreude vorgeführt, die letztlich nicht über sich selbst hinausweist und bloß die bestehenden Paradigmen zementiert. Begründet ist diese Schadenfreude durch den Sturz des nur insofern relational Höherstehenden, als er dem Schein nach an der Welt der Privilegierten partizipierte und daraus eine entsprechende Selbstinszenierung ableitete. Faktisch war er jedoch immer einer der ihren: ein Unterprivilegierter. Dennoch hat die Verbreitung der skandalösen Neuigkeit über den Portier das gehässige Lachen einiger Frauen in seinem Wohnquartier zur Folge. Deren Gesichter erscheinen in der Closeup-Überblendung fratzenartig; die diffamierende Absicht hinter dieser formalen Gestaltung ist offenkundig (1:06:33). Betrachtet man weiter die Faktur des Films, so wird auf den Verlust der Anstellung und damit der Uniform des Protagonisten szenisch mindestens zweimal vorausgedeutet. Zu Beginn trägt er ein Regencape, das seinen Por9. Vgl. Fritz Göttler: »Der letzte Mann. 1924«, in: Friedrich Wilhelm Murnau (= Reihe Film 43), S. 161-172, hier S. 168: »Führwahr, wenn er dahermarschiert in seiner Uniform, verkörpert er nie und nimmer die Autorität seiner Gesellschaft. Wie ein Maskottchen tritt er in den Hinterhof, wie ein ausgewachsenes Riesenbaby«. 10. T. Koebner: Der romantische Preuße, S. 34: »Schon der Wert, den er auf die Uniform legt, mit ihren Litzen, Verzierungen, Knöpfen, kennzeichnet ihn als Relikt einer vergangenen Epoche, der Wilhelminischen Vorkriegsära«. Vgl. F. Göttler: Der letzte Mann, S. 168. 11. S. Kracauer: Von Caligari zu Hitler, S. 7.
48
Identitätsverlust und soziale Desintegration in Murnaus Der letzte Mann
tiersmantel überdeckt. Noch ist er Portier, aber das darauf hindeutende Zeichen, die entsprechende Uniform, ist nicht sichtbar. Schindler bringt dies mit einem bereits zu diesem Zeitpunkt bestehenden Mangel an Autorität in Verbindung, der sich darin äußere, daß auf sein Pfeifen hin niemand herbeieilt, um ihm zu helfen: »The single indicator of this lack of respect for his authority is the invisibility of his uniform, which is covered by a shapeless raincoat.« 12 Als er dann den Koffer selbst auf seine Schultern lädt, blickt die Kamera vom Wagen auf den unter der Last Gebeugten herab.13 Eine weitere Prolepse zeigt seine Nichte auf den Balkon der Wohnung, während sie den Portiersmantel bürstet. Somit wird die nachfolgende Ablösung der Uniform von ihrem Träger bereits an dieser Stelle semiotisch vorweggenommen. Überdies konnotiert die gründliche Pflege des Mantels dessen Wert: Einerseits ist er gemäß den Insignien gesellschaftlicher Autoritäten der Vergangenheit gestaltet, hat aber als Berufskleidung eines Hotelangestellten bloß eine ornamentale Funktion. Andererseits – aber damit ist kein reflektiertes Handlungsmotiv auf Ebene des Figurenbewußtseins gemeint – gebührt dem Mantel diese Pflege auch als Fundament der herrschaftlichen Selbstinszenierung des Portiers und Garant des ihm im unmittelbaren sozialen Umfeld entgegengebrachten Respekts. Insofern tut sich hier ein Mißverhältnis zwischen der eigentlichen Bedeutung des Mantels und dem Selbstverständnis seines Trägers auf, der ihn anscheinend von seinem Ursprungskontext her fehldeutet, was den Verlust für ihn umso schwerwiegender macht.
III. Die Inszenierung des Identitätsverlusts Insgesamt bleibt es jedoch nicht bei der bisher beschriebenen Inszenierung einer Selbstentfremdung oder Identitätskrise; es wird hingegen auf der Bildebene mehrfach die Auslöschung der Identität des Portiers angedeutet. So schon im Anschluß an den gescheiterten Versuch, das Fortbestehen seiner Manneskraft durch Hochheben eines herumstehenden Koffers unter Beweis zu stellen. Der im Sturz offenkundige Zusammenbruch hat ein derangiertes Äußeres zur Folge, das im Kontrast zur vorherigen, minuziösen Haar- und Bartpflege des ›letzten Manns‹ in seiner Signifikanz deutlich wird. Als dann eine Hotelangestellte dem nunmehr ehemaligen Portier einen weißen Kittel als Signum seiner zukünftigen Tätigkeit auf den Arm legt und Handtücher darauf stapelt, zeigt die Kamera das Profi l seines Gesichts, Ausweis der Identität schlechthin, vollständig verdeckt von diesen neuen Arbeitsutensilien (0:29:08). Die Eliminierung seiner Identität und die neue dienstliche Aufgabe des Protagonisten werden hier unmittelbar miteinander assoziiert. 12. S. Schindler: What makes a man a man, S. 33. 13. Vgl. Lotte H. Eisner: Murnau, überarbeitete, erweiterte u. autorisierte Neu-
ausg., hg.v. Hilmar Hoffmann u. Walter Schobert, Frankfurt a.M.: Kommunales Kino Frankfurt 1979, S. 240. Die Autorin führt hier die für Der letzte Mann wichtige Bedeutung des Wechsels von Frosch- und Vogelperspektive der Kameraeinstellung aus.
49
Alfred Stumm
Darauf hin steigt der neue Toilettenwärter die Treppen zu seinem Arbeitsplatz hinab. Während des Abstiegs verstellt der Türrahmen nahezu gänzlich den Blick auf ihn. Schließlich verschwindet er in der Dunkelheit. Die hinter ihm zuschlagende Tür vermittelt dabei im Unterschied zur Drehtür des Hotels, die auf ständigen Wandel bzw. Dynamik hindeutet, den Eindruck von Endgültigkeit. Insgesamt findet sich in dieser Szene der Prozeß fortschreitender (auch räumlicher) Desintegration des zuvor von heraneilenden Gästen umringten Portiers illustriert – eine Entwicklung, die sich bereits im Büro des Hotelmanagers bei der Übergabe des Degradierungsschreibens andeutete.
Die Separierung des Bildkaders durch den Rahmen der gläsernen Tür wird zur Übergabe des Schreibens vom Hotelmanager kurzfristig überbrückt, um den Portier dann aber, nach einem anerkennenden Klaps auf die Schulter, mit dem Brief und dessen Folgen allein zurückzulassen. Isolation ist die Folge (0:19:27 u. 0:20:14). Allein der Zuschauer, zunächst durch die räumliche Tiefengliederung ebenfalls vom Protagonisten distanziert,14 wird dann mit14. Ursula v. Keitz: »Der Blick ins Imaginäre. Über ›Erzählen‹ und ›Sehen‹ bei Murnau«, in: K. Kreimeier (Hg.), Die Metaphysik des Dekors, S. 80-99, hier S. 81:
50
Identitätsverlust und soziale Desintegration in Murnaus Der letzte Mann
tels einer Trickfahrt der Kamera nah an ihn herangeführt. Derart in unserer Empathie gelenkt, lesen wir das Schreiben mit ihm.15 In deutlicher Korrespondenz zur beschriebenen Aushändigung der neuen Arbeitsutensilien ist die Szene der endgültigen Rückgabe der Portiersuniform an den Nachtwächter des Hotels gestaltet. Dessen Umhängelampe nämlich strahlt dem Erniedrigten im Moment der Übergabe frontal so ins Gesicht, daß dessen Konturen einer weißen Fläche weichen (1:10:20).
Dies ist in technikhistorischer Hinsicht besonders auff ällig; denn: »Operateur Freund verwendete verfeinerte Linsen, um die Züge des Individuums im Close up sprechender herauszuholen.« 16 Der Verlust der früheren Anstellung und der zugehörigen Livree als deren Symbol wird demgemäß mehrfach bildlich mit der Auslöschung der Identität des Portiers gleichgesetzt! Die hier verwendete, metonymische Bezeichnung ›der Portier‹ ist somit nicht nur Folge des im Film nicht angegebenen Namens, sondern auch insofern berechtigt, als der ›letzte Mann‹ ohne seine bisherige berufliche und entsprechende private Rolle (er erscheint auch zur Hochzeit seiner Nichte in Portiersuniform) offensichtlich nicht zu leben vermag. Da er nicht fähig ist,
»Dominantes Zeichen im Vordergrund ist das Skelett der Glas-Doppeltür, die das Bild sowohl in der Fläche als auch in der Raumtiefe gliedert.« 15. Vgl. James N. Bade: »Murnau’s The Last Laugh and Hitchcock’s Subjective Camera«, in: Quarterly Review of Film and Video 23 (2006), S. 257-266, hier S. 258: »It was Murnau’s ›creative, interpretative use‹ of the mobile camera enabling it to be used subjectively which constituted the revolution«. Und schließlich wird dort ausgeführt: »In The Last Laugh, the subjective shot encourages audience identification and empathy with the porter as he tries to adapt to his new lowly place in society.«, ebd., S. 265. 16. H. Weihsmann: Virtuelle Räume, S. 26.
51
Alfred Stumm
den bisherigen Selbstentwurf durch einen anderen zu ersetzen, ist er als Person gleichsam inexistent. Entsprechend der Selbstbestimmung der privaten über die berufliche Identität findet sich in der Traumsequenz eine bildliche Überblendung beider Lebensräume. In deren Verlauf ist im Bildvordergrund das dominante Motiv der gläsernen Drehtür und durch diese hindurch der Hinterhof des Wohnquartiers zu erkennen, an dessen Wand sich wiederum der Fahrstuhl der Hotellobby bewegt; im Hof sieht man eine Ansammlung von Hotelgästen (0:40:53).
Entscheidend ist nun, daß sich die Selbstbestätigung bzw. der Wunsch nach Anerkennung, die sich in diesem Traum manifestieren, ausschließlich auf die berufliche Tätigkeit beziehen. Diese Wunschtraum-Sequenz wird bereits durch eine Darstellung der Ich-Dissoziation eingeleitet, die ebenfalls auf das Motiv des Gesichts zurückgreift. Bezeichnenderweise folgt diese Szene im Anschluß an die Selbstkarikierung des Portiers im betrunkenen Zustand. Auch hier nutzt der Film die Überblendungstechnik: Im Übergang zum bewußtseinsinternen Narrativ des Traums spaltet die Drehtür, durch die der Protagonist zu Beginn dieses Traumnarrativs in Portiersmontur herausschreitet, das Gesicht des Träumenden auf bewußtseinsexterner Ebene (0:39:52), vgl. Abb. nächste Seite. Die Drehtür auf der Traumebene ist dabei im Vergleich zu ihrem realen Pendant erheblich überlängt, was die Größe der Institution im Kontrast zu ihren Angestellten veranschaulicht. Dem jedoch steht die in der Traumsequenz beschworene Macht und Kraft des Individuums entgegen. Der Portier nämlich stemmt – einem Herkules gleich – einhändig einen Koffer in die Höhe, den zuvor sechs Männer kaum zu bewegen vermochten, und läßt
52
Identitätsverlust und soziale Desintegration in Murnaus Der letzte Mann
diesen mühelos herumwirbeln. Das trägt ihm im bewußtseinsinternen Narrativ den Applaus der Hotelgäste ein: die erträumte Anerkennung.17 Mit Selbstkarikierung und Anerkennungswunsch wird der Protagonist in kurzer Folge als schwankend zwischen sarkastischer Verhöhnung einerseits und – das zeigt das Wunschszenario einer idealen Erfüllung seiner dienstlichen Pflichten – Überhöhung der Portiersanstellung andererseits präsentiert. Außerdem bedeutet der die Traumsequenz prägende, simultane Glaube an die alles überragende Größe der Institution sowie an die Wichtigkeit der eigenen Person einen inneren Widerspruch. Überdies ist die nach dem Erwachen fortdauernde Betrunkenheit nicht allein psychologisch zu erklären, sondern der Protagonist fungiert hier zudem als von seinem vormaligen Ich abweichendes Zeichen: Gemessen am eigenen Rollenentwurf ist er auch äußerlich nur noch eine Schwundstufe seiner Selbst. Die beschriebene Dissoziation wird ferner mittels zweier klassischer Topoi des Subjektdiskurses veranschaulicht: Spiegelbild und Schatten. Hinsichtlich des ersteren fällt auf, daß der Protagonist nach seiner Degradierung, bei der neuen Arbeit als Toilettenwärter, verschiedentlich in längeren Einstellungen neben seinem Spiegelbild im Kader erscheint. Vorher hingegen wird er zwar ebenfalls vor dem Spiegel stehend, so z.B. in Rückenansicht bei der ausgiebigen Haarpflege, gezeigt, sein Spiegelbild jedoch ist aufgrund des Einstellungswinkels nicht zu sehen (0:51:41 und 0:13:56). Facettenreicher im Hinblick auf die Dissoziation des Ich ist das Verhältnis des Protagonisten zu seinem Schatten gestaltet. Während er vor der Degradierung in nahezu völliger Kongruenz zu diesem die Treppe der Mietskaserne hinaufsteigt (0:10:00), scheint sich sein Schatten nach der Degradierung von ihm abzulösen – ein bildlicher Hinweis auf die Spaltung, den Zerfall des Ich. Zu beobachten ist dies zum ersten Mal, als er zum Büro des Direktors 17. Der hier offenkundige Wunsch ist, gemessen an seiner immer schon untergeordneten Stellung, in seinem positiven Gehalt gänzlich übersteigert.
53
Alfred Stumm
schleicht, um den Portiersmantel zu entwenden, und setzt sich dann fort, als er sich die Treppen im Mietshaus hochschleppt, wo zunächst nur sein Schatten an der Wand (0:34:32) und wenig später erst er selbst im Bildkader erscheint. Konterkariert wird dieses Moment hier aber durch die, allerdings mühevolle, Bewegung nach oben.
Eine erneute szenische Umsetzung erfährt dieses Motiv, nachdem er bei seiner Tätigkeit als Toilettenwärter entdeckt worden ist und nach Hause zurückkehrt. Dies fällt ihm, da er Schlimmes erwartet, sichtlich schwer. Demgemäß zeichnet sich anfangs lediglich sein Schatten auf der Mauer des Hofdurchgangs ab, und der Protagonist scheint diesem bloß zu folgen (1:05:17).
Augenscheinlich innerlich hin- und hergerissen, weiß er nicht, was er tun soll, und verharrt. Daraufhin ist anhand des Schattens zu beobachten, wie er sich aufrichtet und notdürftig Haltung annimmt. Entsprechend mechanisch fällt dann auch sein Gruß aus, als ihm, während er den Hof betritt, jemand entgegenkommt. Gleich darauf muß er sich abstützen; die kurze Zeit in seiner vormals beständig eigenommenen Körperhaltung hat ihn bereits überfordert. Schließlich, nach der gerichtsszenenartigen Konfrontation mit seinen 54
Identitätsverlust und soziale Desintegration in Murnaus Der letzte Mann
Verwandten, verläßt er deren Wohnung und sein Schatten verhält sich wieder nahezu kongruent zur Silhouette seines Körpers. Doch indiziert diese neuerliche Kongruenz zusammen mit der Tatsache, daß er sich – nunmehr beim Abstieg – anscheinend voller Scham von der Kamera weg und der Wand zudreht,18 seine endgültige Selbstaufgabe. Es gibt in ihm keinen Widerstreit positiver und negativer emotionaler Erwartungshaltungen mehr; er hat alle Hoffnung fahren lassen. Insofern ist die bereits geschilderte, wenig später erfolgende Rückgabe des Portiermantels ein Akt der Resignation. Vor allem die beschriebene zweite Szene im Treppenhaus legt einen Vergleich mit Nosferatu nahe. Die berühmte Sequenz nämlich, in der sich Orlok zu Ellen hochschleicht, zeigt nur seinen an der Wand sich bewegenden Schatten, der zwar auf den Vampir verweist, dessen Körper aber bildlich ersetzt. Hieran wird die Differenz zum Portier in Der letzte Mann deutlich, denn Orlok, das illustriert die bildliche Substitution, ist ganz mit seinem Schatten identisch – er ist dieser Schatten. Anders als im Falle des hinter seinem Schatten hergehenden Portiers handelt es sich bei dem Vampir folglich nicht um die Darstellung der Dissoziation, der verlorenen Einheit des Ich, sondern um ein Ganz-bei-sich-selbst-Sein, das in der Inszenierung des Verhältnisses von Schatten und Figur zum Ausdruck kommt. Der Graf weiß genau, was er will, und er handelt diesem Willen gemäß.19 Ohne damit eine gegenteilige Aussage über Nosferatu zu implizieren, läßt sich der Subjektdiskurs im Letzten Mann folglich trotz des antiquiert erscheinenden Protagonisten als charakteristisches Produkt der Klassischen Moderne fassen. Man vergegenwärtige sich in diesem Zusammenhang nur Freuds These, »daß das Ich nicht der Herr sei in seinem eigenen Haus« oder Ernst Machs Ausspruch: »Das Ich ist unrettbar«.20 In diesem Sinn greift es auch zu kurz, die »Trickeinstellung, in der das Hotelgebäude auf die Figur hinzustürzen droht«, als bloße Illustration des »Schuldbewußtsein[s] des ›letzten Mannes‹«21 infolge des soeben begangenen Manteldiebstahls zu interpretieren. Vielmehr fi ndet hier eine fundamentale Erschütterung des Verhältnisses des Protagonisten zur Welt ihren Ausdruck. Daß dies in der objektiven Situation begründet liegt, veranschaulicht der kräftige Gegenwind, der ihm in dieser Szene die Haare zerzaust.22 Aber sub18. Eine Steigerung dieser Verhaltensweise des Protagonisten läßt sich nach der endgültigen Übergabe des Mantels an den Nachwächter beobachten. 19. Inwiefern Graf Orlok dabei selbst ein Getriebener bzw. Besessener ist, braucht an dieser Stelle nicht erläutert zu werden. 20. Sigmund Freud: »Eine Schwierigkeit der Psychoanalyse«, in: ders., Gesammelte Werke. Chronologisch geordnet, hg.v. Anna Freud u.a., Bd. 12: Werke aus den Jahren 1917-1920, 3. Aufl., Frankfurt a.M.: S. Fischer 1966, S. 3-11, hier S. 11. Ernst Mach: Die Analyse der Empfindungen und das Verhältnis des Physischen zum Psychischen. Mit einem Vorwort zum Neudruck v. Gereon Wolters, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1987 (Nachdruck der 9. Aufl ., Jena 1922), S. 20. 21. U. v. Keitz: Der Blick ins Imaginäre, S. 82. 22. Vgl. Der letzte Mann, 0:34:04. Zum Motiv des Windes im Werk Murnaus vgl.
55
Alfred Stumm
jektseitig betrachtet, bietet er dem Wind mit dieser Haartracht – Indiz seines unzeitgemäßen Selbstentwurfs – auch besonders viel ›Angriffsfläche‹.
IV. Der letzte Mann – ein Drama der Moderne? Mithin ist zu betonen, daß Der letzte Mann, wenngleich der Film beim Rezipienten durchaus Mitleid mit seiner Hauptfigur evoziert, kein Pamphlet gegen etwaige soziale Ungerechtigkeiten darstellt. Zwar werden soziale Kontraste aufgezeigt, z.B. wenn der ehemalige Portier im Toilettenraum sitzend eine Suppe ißt und in Parallelmontage die Hotelgäste beim reichhaltigen Mahl inklusive Austern gezeigt werden. Insgesamt jedoch scheint die Position des Films hinsichtlich der präsentierten sozialen Problematik durchaus ambivalent. So läßt sich die Drehtür des Hotels in Umkehrung einer auf Die Finanzen des Großherzogs bezogenen Beobachtung von Grafe/Patalas als eine Verräumlichung der Zeit auffassen.23 Sie verweist darauf, daß es sich bei dem Schicksal des alternden Portiers gleichsam um den Lauf der Dinge handelt, der früher oder später auch seinen Nachfolger erfassen wird. Objektiviert wird dieser Lauf der Dinge also im ›Zeit-Raum‹ der Drehtür, in der sich demgemäß die Ablösung des Hotelportiers durch seinen Nachfolger vollzieht. Ferner bedeutet die kontrastierende Montage des kraftvoll agierenden Nachfolgers unmittelbar nach dem erwähnten Sturz im Büro des Hotelmanagers geradezu die filmische Affirmierung von dessen Argumentation.24 Ähnliches gilt auch für die Szene, in welcher der Zuschauer mit dem gealterten Hotelangestellten auf jenes Schreiben blickt, das diesen über seine Degradierung informiert. Das Verschwimmen der Schrift ist hier nicht nur als dem Augenblick geschuldete Schockwirkung zu begreifen, sondern zudem Ausdruck des fortgeschrittenen Alters des Protagonisten. Darauf verweist auch das vorangehende, umständliche Aufsetzen der Brille, das ihn signifi kanterweise schon zum Ablegen der Mütze, eines Teils seiner Uniform, veranlaßt. Entsprechend ist die auf dem Schreiben erscheinende, ellipsoide Einspielung der Verabschiedung des greisen Angestellten, der zugunsten des bisherigen T. Koebner: Der romantische Preuße, S. 39: »Überhaupt der Wind: Murnau braucht ihn […], um Angst erzeugende Bewegung in seine Räume hineinzubannen [Bezugspunkt sind hier die frühen Filme sowie Faust; A.S.], ebenso als Gleichnis für den Aufruhr der Gefühle«. Erinnert sei hier an die Sturmszene in Sunrise oder auch daran, daß schon in Schloß Vogelöd ungelöste zwischenmenschliche Verwicklungen ihre (metaphorische) Objektivierung durch das ständige Stürmen des Windes erfahren. Erst als die Konflikte durch Aufklärung und Tod beigelegt sind, kommt auch die in den rhythmisierenden Außeneinstellungen eingefangene Natur zur Ruhe. 23. Vgl. E. Rohmer: Was denkt Eric Rohmer zu Murnau, S. 82, wo von einer Verzeitlichung des Raumes in Filmen Murnaus die Rede ist. 24. Vgl. S. Schindler: What makes a man a man, S. 34: »The old man’s lack of controlled male vigour is reinforced by a rough cut that shows the new, agile porter lifting serveral suitcases at the same time.«
56
Identitätsverlust und soziale Desintegration in Murnaus Der letzte Mann
Portiers einem Versorgungsheim überwiesen wird, als eine der schonungslosesten Szenen des Films anzusehen. Denn wenn diese Einspielung auch als subjektive Imagination verstanden werden kann, illustriert sie lediglich den schriftlich beschriebenen ›realen‹ Vorgang. Somit ist der weitere Lebensweg des Protagonisten schon vorgezeichnet! Irritierend ist im Hinblick auf diese Interpretation allerdings folgende Szene: Am Ende seines Niedergangs angekommen, schleppt sich der ›letzte Mann‹ auf einen Hocker im Toilettenraum, seiner neuen Arbeitsstätte. Ihm folgt der Nachtwächter, der zuvor bereits seine Solidarität unter Beweis gestellt hat, indem er ohne Auf hebens die gestohlene Livree zurück in das Büro des Hotelmanagers hängte. Als der Wächter nun seine Lampe vor den Spiegeln abstellt, versieht deren Lichtkegel den Erniedrigten mit einer Gloriole (1:12:26).
Was ist die Funktion dieses Bildes? Zwar ist dem Portier nicht die Schuld an seinem Schicksal zuzusprechen, aber die Täuschung seiner Familie wie auch sein übriges Verhalten lassen ihn nicht in der ethischen Vollkommenheit eines Heiligen erscheinen. Und wenn dieses Bild einen Hinweis auf seinen Märtyrerstatus darstellte, wofür hätte er sich dann eingesetzt? Schließlich ist die qualitative wie quantitative Reichweite seiner Auflehnung gegen den ihm oktroyierten weiteren beruflichen Weg äußerst gering. Auch fällt er zumindest bis zum ›ersten Schluß‹ nicht durch besonderes zwischenmenschliches Engagement auf. Statt dessen bekommt er an dieser Stelle vom Nachtwächter in einer rührenden Szene, die an das Handeln des heiligen Martin erinnert, dessen Mantel umgehängt. Hierin kommt das höchste Maß an Mitmenschlichkeit im gesamten Film zum Ausdruck. Entscheidend ist indes der Schauplatz dieser von Gloriole und Mantelgabe geprägten Sequenz: der Toilettenraum. Insofern darf der auf der Wand sich abzeichnende Nimbus semantisch nicht allzu sehr auf seinen Ursprungskontext, die Heiligendarstellung, eingeengt werden. Vielmehr verleiht er dem Protagonisten als Kontrapunkt auf 57
Alfred Stumm
ästhetisch-bildlicher Ebene einen Rest von Würde und leistet so eine Vermittlung mit dem ›zweiten Schluß‹. Insgesamt bündeln sich hier die beiden zentralen erörterten Aspekte: Identitätsverlust und Desintegration. Zum einen nämlich bewirkt der Lichtkegel erneut die bereits beschriebene Auslöschung der Gesichtszüge. Zum anderen wird der Anteilnahme des Wächters mittels Montage die stille Reglosigkeit im Wohnquartier des ›letzten Manns‹ entgegengesetzt. Diese Reglosigkeit veranschaulicht die unumstößliche Endgültigkeit seiner sozialen Ausstoßung und erklärt sein Leid. Von seinem bisherigen Umfeld hat er nichts Positives mehr zu erwarten. Die Bitte des vormaligen Portiers um Verzeihung und Integration wurde in der erwähnten familieninternen Gerichtsszene abschlägig beschieden. Ein Widerruf dessen bleibt aus. Das kündigt sich allerdings schon in der Inszenierung des Raums während des ›Gnadengesuchs‹ an (1:09:18).
So scheint der Bittsteller infolge der Kameraeinstellung der Kleinste der Gruppe zu sein, was seine Unterlegenheit illustriert. Seine Nichte – offensichtlich auf die Nachsicht ihres Ehemanns hoffend – ist nicht nur emotional, sondern auch ihrer ›Größe‹ nach die ihm nächste Person. Als erkennbares Zeichen ihrer Anteilnahme und augenscheinlich Teil des Gestaltungswillens der mise en scène krümmt sie sich ein wenig zusammen und bewirkt eine ansatzweise räumliche Vermittlung. Aber eine Überwindung der Kluft findet nicht statt. Zu fest ist die Position der ihr übergeordneten Familienmitglieder, v.a. ihres Ehemanns, des pater familias. Damit jedoch ist das soziale Schicksal des ›letzten Manns‹ besiegelt. Die Frage aber, ob das geschilderte Drama der Natur des Menschen schlechthin oder der Verfaßtheit der modernen Welt geschuldet ist, wird vom Film nicht in diesem ethisch-pejorativen Sinn aufgeworfen. Natürlich ist menschliches Dasein nur in einem spezifischen historischen Kontext möglich und denkbar. Der Kontext des dargestellten Geschehens ist die Moderne. 58
Identitätsverlust und soziale Desintegration in Murnaus Der letzte Mann
Hinweise darauf sind Insignien modernen Lebens wie die Großstadt und der Bahnhof. Von daher bezeichnet der beschriebene ›Zeit-Raum‹ der Drehtür auch keine von aller Historie losgelöste, auf gleichsam naturhafte Prozesse verweisende Metapher, sondern ist als Teil des großstädtischen Hotels im historischen Zusammenhang der Moderne verortet. Der letzte Mann aber tritt dieser Moderne nicht einseitig vorwurfsvoll entgegen. Vielmehr wird sie lediglich mit ihren Gesetzmäßigkeiten in ihrer Wirkung auf einen bestimmten Typus von Subjekt vorgeführt; und dabei wird sogar nahegelegt, daß das Defizit auch eines dieses Subjekts ist, das nicht zur Konstituierung eines zeitgemäßen Selbstbildes in der Lage ist. Hinsichtlich des Niedergangs seines Protagonisten zeigt der Film indes zwei letztlich wohl komplementär zu denkende Alternativen auf. Die eine betriff t das Subjekt und würde eine dauerhafte Distanzierung vom vormaligen Selbstentwurf verlangen, wie sie in der Karikatur des eigenen Rollen-Ich im betrunkenen Zustand zum Ausdruck gelangt.25 Allerdings bleibt dieser Moment des Ausbruchs hier exzeptionell und somit folgenlos. Die andere, durch die Zweisamkeit im Happy End nobilitierte Alternative ist auf der Ebene unmittelbarer Zwischenmenschlichkeit angesiedelt und wird vom Nachtwächter in seiner liebevollen Solidarität verkörpert. Aber im Rahmen der durch den ›ersten Schluß‹ abgesteckten Bedingungen kann auch dieses Verhalten aufgrund seines Ausnahmecharakters sowie der fehlenden Möglichkeiten des niederen Angestellten keine grundsätzliche Wendung zum Besseren bewirken.
V. Der ›zweite Schluß‹ Der ›zweite Schluß‹ des Films hat immer schon geteilte Reaktionen hervorgerufen. Dabei sind im wesentlichen zwei Lager auszumachen, deren prominenteste Vertreter Siegfried Kracauer bzw. Eric Rohmer auf der einen und Lotte Eisner auf der anderen Seite sind. Kracauer ist der Ansicht, im »spöttelnden Stil dieser Schlußsequenz« des Films drücke sich »die Skepsis des Autors gegen ein Happy End und die Kategorien Glück und Pech« aus; so folgert er: »Kraft seines zweiten Schlusses unterstreicht der Film die Bedeutung des ersten«26. Für Eisner hingegen ist »die Banalität des trivialen happy ends, jenes angefügten kommerziellen Märchens«, eine dem Film unwürdige Anbiederung an den Publikumsgeschmack.27 Das wird von Rohmer wiederum ausdrücklich verneint: 25. Von hieraus gewinnt auch die Tatsache ihre Bedeutung, daß der zu diesem Zeitpunkt schon degradierte Portier in dieser Szene seine Uniform nicht trägt. 26. S. Kraucauer: Von Caligari zu Hitler, S. 110. 27. L.H. Eisner: Murnau, S. 247. Vgl. Joseph Roths ambivalente Position in seiner Rezension vom 8.1.1925 in der Frankfurter Zeitung, in: H.H. Prinzler (Hg.), Friedrich Wilhelm Murnau, S. 165-167, hier S. 166f. Roth spricht zwar letztlich abwertend vom »ironischen Konzessionsschluss« (ebd., S. 167), ist aber von der später entwickelten
59
Alfred Stumm
»Der schlechte Ausgang von Geschichten kann genauso zum Klischee, zum Stereotyp werden wie das Happyend im Hollywoodfilm. Im Letzten Mann erwartet man den schlechten Ausgang, aber der gute Ausgang ist der subtilere. […] Er ist so schön, so außergewöhnlich, ein unglücklicher Ausgang wäre entschieden banaler gewesen.«28
Dem ist insofern zuzustimmen, als das Happy End tatsächlich der gesamten vom Film bis dahin generierten Erwartungshaltung, die bereits wesentlich durch das Motto bedingt ist, entgegensteht. Das wird ostentativ hervorgehoben durch den Zeitungsartikel, der den fi ktionsinternen Leser wie den Rezipienten über die jüngst zurückliegende glückhafte Wendung informiert. Beschwört das Motto die Gefahr des plötzlichen gesellschaftlichen Abstiegs, bedeutet dieser Text nun eine Umkehrung dessen: »Demnach scheint sich jene biblische Verheißung, daß die Letzten die Ersten sein sollen, diesmal schon auf Erden zu erfüllen, denn der Glückliche ist…«29 Hier bricht der Satz ab und es folgt seine fi lmische Vervollständigung, die der Zuschauer freilich schon vorausahnt. Die 30-sekündige, ungeschnittene Rückwärtsfahrt der Kamera vorbei an den speisenden und lachenden Gästen stellt dabei den strukturellen Gegenpart zur Anfangssequenz dar, in der sich die Kamera vorwärts in den Raum hinein bzw. aus ihm heraus bewegt. Damit wird auf die inhaltliche Verkehrung des vor der Zäsur Geschehenen verwiesen: Der Glückliche und somit Ziel der Kamerafahrt ist der vormals degradierte Portier. Die neuerliche schriftliche Eröffnung ist in die fiktionale Ebene verlegt, was eine narrative Distanzierung der Autorinstanz von dieser positiven Schlußsequenz darstellt. Relativiert wird diese zudem durch das im Motto ausgedrückte soziale Gefahrenmoment, das dem Happy End des Films einen zumindest untergründig labilen Charakter verleiht; zumal das Motto eben nicht fi ktionsintern, sondern allein durch die Autorinstanz begründet ist. Markiert wird die Zäsur zwischen beiden Schlüssen durch den neben dem Motto einzigen nicht an eine Figurenperspektive gebundenen Texteinschub des gesamten Films: »Hier an der Stätte seiner Schmach, würde der Alte den Rest seines Lebens elend verkümmern und es wäre die Geschichte hier eigentlich aus. Aber es nimmt sich des von Allen Verlassenen – der Autor an, indem er ihm ein Nachspiel schenkt, worin es ungefähr so zugeht, wie es im Leben – leider – nicht zuzugehen pflegt.« (1:14:381:15:08) Position Kracauers nicht weit entfernt, wenn er schreibt: »Der Autor macht sich lustig über die Mode des Films mit freudigem Ende.« 28. E. Rohmer: Was denkt Eric Rohmer zu Murnau, S. 95. 29. Indem der Film sich hier der Zeitung, eines massenhaften Informationsmediums seiner Zeit, bedient, verweist er auf die Virulenz sozialkitschiger Narrative in der Moderne, die er sich – auch mittels der offenkundigen Kontingenz des Glücks – in reflektierter, nicht aber desavouierender Form mit dem ›zweiten Schluß‹ selbst zu Nutze macht.
60
Identitätsverlust und soziale Desintegration in Murnaus Der letzte Mann
Diese nun explizite Einmischung der Autorinstanz betont die Abkehr vom aristotelischen Prinzip mimetischer Wahrscheinlichkeit und irritiert die rezeptionsseitige Identifi kation mit der fi lmischen Fiktion.30 Szenisch setzt die »märchenhafte Posse«31 mit einer Folge lachender Gesichter ein. Das Lachen wird somit zum Vorzeichen dieses Schlusses, das als Hinweis auf dessen komödienhaften Zuschnitt dient. Dementsprechend ist zu konstatieren: »Das positive Ende – ob es Murnau aufgezwungen wurde oder nicht, steht hier nicht zur Debatte – wurde jedenfalls von ihm bewußt ironisch übertrieben.«32 Die übrigen Hotelgäste fungieren dabei als fi ktionsinterne Zuschauer der Szene, die rezeptionslenkend wirken. Der ›zweite Schluß‹ ist also zum Lachen; gleichwohl werden hier die beiden erläuterten alternativen Handlungskonzepte wieder aufgegriffen und sind insofern ernstzunehmen. Solche tiefergehenden Vermittlungen beider Schlüsse blieben bisher häufig unbeachtet. In sozialer Hinsicht jedenfalls erhält zunächst der Nachtwächter die Belohnung für seinen solidarischen Beistand, indem er nun am Reichtum des ehemaligen Portiers partizipieren darf. Der Nachfolger auf dem Posten des Toilettenwärters erfährt vom neureichen ›letzten Mann‹ in einer überzeichneten und daher durchaus auch komischen Szene menschliche sowie finanzielle Zuwendung und Anerkennung. Die Erinnerung an die eigene altersbedingte und damit persönlich unverschuldete Degradierung motiviert diese Empathie des nunmehr Arrivierten mit dem in der Hierarchie der Berufe niederen Angestellten. Mit Blick auf das Motto impliziert offensichtlich die Erkenntnis der Unwägbarkeit der sozialen Verhältnisse einen Appell zur Solidarität. So erhalten auch die übrigen Hotelangestellten reichlich Trinkgeld. Hinsichtlich der eigenen Person erlaubt der neue Status dem Protagonisten wesentliche Komponenten seiner ›herrschaftlichen‹ Selbstinszenierung als Portier zu bewahren. Die abermalige Veränderung der äußeren Parameter erfordert keinen wirklich neuen Selbstentwurf, sie begünstigt vielmehr eine Legitimierung und Stärkung bereits vorhandener Charakterzüge. Er gehört jetzt – wenngleich er als Emporkömmling angesehen wird –33 tatsächlich zu den Privilegierten und die Respektsbekundungen der Mitwelt beschränken sich nicht mehr auf das soziale Umfeld des Wohnquartiers. Selbstbild und Rea30. Siehe hierzu F. Grafe: Der Mann Murnau, S. 18: »Ein Illusionsbruch kann dem Film nicht schaden, ihn kümmert nicht die erste Sorge des konventionellen Erzählens, die Wahrscheinlichkeit und Glaubwürdigkeit der Geschichte.« 31. T. Koebner: Der romantische Preuße, S. 28. 32. H. Weihsmann: Virtuelle Räume, S. 32. Zum Moment möglichen Zwangs bei der Entscheidung für das positive Ende vgl. Kai Wessel: »Technische Innovation und soziales Drama«, in: H.H. Prinzler (Hg.): Friedrich Wilhelm Murnau, S. 169-171, hier S. 170: »So düster und hoffnungslos durfte der Film nicht enden, fanden die Geschäftsleute der Ufa.« Vgl. auch S. Schindler: What makes a man a man, S. 31. 33. Bezeichnend ist in diesem Zusammenhang die abschätzige Miene des Hotelmanagers, der sich dann aber doch entscheidet, den zuvor Degradierten zu begrüßen.
61
Alfred Stumm
lität entsprechen einander in einem höheren Maße als zuvor. An die Stelle der familiären Bezugspersonen sind Substitute getreten; er ist wieder integriert.
VI. Mediale Selbstreflexiv ität Wie die meisten Filme Murnaus beinhaltet Der letzte Mann eine Ebene der Reflexion des eigenen Mediums.34 So trägt das Durchschreiten bzw. die Einblendung der Drehtür des Hotels wesentlich zur Strukturierung des Films bei. Und diese bisher als ›Zeit-Raum‹ gedeutete Tür dient, ohne daß dies auf eine Durchbrechung der filmischen Illusion abzielt, auch als selbstreferentielle Metapher der eigenen Medialität. Einer liegenden Filmspule ähnelnd, gibt sie durch ihre Glasscheiben den Blick auf gerahmte Bilder ( frame) frei. Daher soll hier abschließend erneut jene zentrale Szene betrachtet werden, in der sich filmisch die Ablösung des alten Portiers durch seinen Nachfolger vollzieht (0:18:08).
Geschieht das im Durchschreiten der Drehtür, wird bildlich vorgeführt, daß immer auch der Film selbst Agens der Handlung ist. Letzteres scheint eine Platitüde zu sein, da sich dies auf medialer Ebene von jeder beliebigen Szene in jedem Film behaupten ließe. Das Besondere hieran jedoch ist, daß Der letzte Mann diese seine eigene Verantwortlichkeit im Bild der Drehtür/Filmspule selbst reflektiert. Zudem begreift sich der Film, indem er die Drehtür eines großstädtischen Hotels gleichsam als Selbstbildnis verwendet, als Teil und Produkt eben der Moderne, in der alten Menschen wie dem Portier berufl iche Degradierung und sozialer Ausschluß drohen – mithin in seiner eigenen historischen Bedingtheit. Diese ›Komplizenschaft‹ kommt entsprechend zum Ausdruck, wenn der Hotelmanager in der Drehtür stehend und durch die34. Vgl. F. Grafe: Der Mann Murnau, S. 45f.
62
Identitätsverlust und soziale Desintegration in Murnaus Der letzte Mann
se blickend den erschöpften Portier bei seiner unerlaubten Pause beobachtet (0:05:41) – die Szene, die den weiteren, negativen Handlungsverlauf initiiert.
Von hier aus fällt noch einmal ein Licht auf den ›zweiten‹, positiven Schluß, ist dieser doch lediglich durch den Eingriff der den Film verantwortenden Autorinstanz motiviert. Die krasse Abwendung vom ›ersten Teil‹ rückt somit auch deren inhomogene Position in den Blick, die vorrangig nicht der Erzähllogik, sondern der eigenen Willkür verpflichtet ist. Bleibt festzuhalten, daß gemäß der beschriebenen ›Komplizenschaft‹ eine ausschließlich diffamierende Sichtweise der Moderne im fi lmischen Medium widersinnig ist und von Murnaus Film auch nicht vertreten wird. Das heißt indes nicht, daß in Filmen grundsätzlich keine Kritik an einzelnen Qualitäten des modernen Lebens geübt werden kann. Tatsächlich verlässt Der letzte Mann in seinen kommentierenden wie implizit appellierenden Momenten die Position eines bloßen Beobachters. In erster Linie aber spürt der Film den qualifizierenden psychologischen, sozialen wie medialen Charakteristika seiner Zeit nach; er zeugt vom Bewußtsein der Moderne.
63
Zur filmischen Restauration des Patr iarchats Ev idenz und Ver führung in Fr iedr ich Wilhelm Murnaus Tartüff Stefan Kleie
Die Jahre 1926/27 brachten gleich zwei Klassikerverfi lmungen Friedrich Wilhelm Murnaus in die europäischen und amerikanischen Kinos. Doch während das nationale Prestigeprojekt Faust. Eine deutsche Volkssage eine kosmische Deutung des Stoffes samt Erzengeln mit Flügeln vorlegte, begnügte sich der Tartüff 1 (1925, Drehbuch Carl Mayer) mit einer auf Kammerspielformat reduzierten Fassung, die gerade in der Abkehr vom Kostümfi lm eines Ernst Lubitsch ihren künstlerischen Anspruch bekundete. In beiden Filmen ragt Emil Jannings unter den Darstellern als Meister des Gebärdenspiels heraus. Schon in einer Rezension zu Reinhold Schünzels Alles für Geld (1923) mit Jannings in der Hauptrolle, bemerkt dazu Béla Balázs: »Der eigentliche Inhalt dieses Films sind die Großaufnahmen von Jannings’ Gesicht. […] Da zeigten sich die ungeheuren polyphonen Möglichkeiten der Physiognomie, wo ein Gesichtsausdruck die verschiedensten und scheinbar widersprechendsten Dinge ausdrücken kann. Es gibt kein Wort, auch keinen Satz, der gleichzeitig und in organischer Einheit so vielerlei sagen kann wie eine einzige Miene.«2
1. Tartüff, Deutschland 1926, Regie: Friedrich Wilhelm Murnau, DVD: restaurierte Fassung mit Original-Musik, Universum Film, BRD 2005 (= Deluxe Edition, Transit Classics). 2. Béla Balázs: Rez. »Alles für Geld«, in: Der Tag vom 14. November 1923, wiederabgedruckt in: ders., Schriften zum Film I, hg.v. Helmut H. Diederichs, Wolfgang Gersch u. Magda Nagy, Berlin (Ost): Henschelverlag u. München, Wien: Carl Hanser 1982, S. 244. Allgemein zur Physiognomik vgl. Claudia Schmölders: Das Vorurteil im Leibe. Einführung in die Physiognomik, Berlin: Akademie 1997.
65
Stefan Kleie
Der Einbruch der Kamera in den f iktiven Raum des Theaters Die verstärkte Aufmerksamkeit auf das Phänomen der Gebärde verbindet Bestrebungen der sprachskeptischen Theaterreformbewegung um 1900 mit den Möglichkeiten des neuen Mediums. Hier sind es natürlich die von Balázs angeführten »Großaufnahmen«, die einen viel engeren Kontakt mit der Physiognomie des Schauspielers erlauben und damit – im Gegensatz zum Theater – für eine Loslösung des medialen Körperbilds vom Körper sorgen. Die logische Konsequenz aus der Überschreitung der Rampe als sichtbarer Grenze zwischen Fiktion und Realität »ist jedoch, daß das Kameraauge mit diesem Schritt in einen fiktiven Raum vorgedrungen ist und sich mithin alle daraus folgenden Konsequenzen als Folge einer Form des ›Spiel im Spiel‹ oder allgemeiner: der ›Fiktion in der Fiktion‹ beschreiben lassen.«3 Murnaus Tartüff erscheint mir als besonders geeignet, die Doppelungsstruktur von Binnen- und Rahmenhandlung als historische Medienreflexion im Grenzbereich von Theater und Kino anzusiedeln. 4 In meinem Aufsatz möchte ich daher die verschiedenen Formen der Medienkonkurrenz zwischen Schrift, Theater und Film in den Vordergrund meiner Überlegungen rücken. Jörn Hetebrügge und Nils Meyer fassen dieses Verhältnis als eines der »Verschleifung von Saal und Leinwand«, mithin als eine schon bei Max Reinhardt angelegte Tendenz zur Überwindung der Trennung von Bühnenund Zuschauerraum.5 Demnach »übertrug [Murnau, Anm. d. Verf.] die Reinhardtschen Ideen konsequent aufs Kino und entwickelte sie fort.«6 Sieht man Reinhardts Ästhetik des Festes lediglich als eine Form der seit Wagners Ge3. Ulrike Haß: »Elemente einer Theorie der Begegnung: Theater, Film«, in: Gabriele Brandstetter/Helga Finter/Markus Weßendorf (Hg.), Grenzgänge. Das Theater und die anderen Künste, Tübingen: Narr 1998, S. 55-76, hier S. 61. 4. Die Doppelungsstruktur erscheint auch innerhalb der Teilerzählungen als zweifacher Anlauf der Gegenintrige. So betritt der Enkel zweimal das Haus seines Großvaters, zweimal setzt Elmire zur Verführung Tartüffs an. 5. Vgl. Leonhard M. Fiedler: Max Reinhardt und Molière, Salzburg: Müller 1972. Für die Verwirklichung von Reinhardts Vorstellung vom Regietheater erwiesen sich besonders die comédie-ballets und kleineren Komödien als geeignet, da sie dem Bedürfnis nach einer Verbindung von szenischer Aktion, Bühnendekoration, Musik und Sprache am weitesten entgegen kommen. Auch Hugo von Hofmannsthal griff in enger Zusammenarbeit mit Reinhardt und Harry Graf Kessler bei der Konzeption seiner Opern Rosenkavalier und Ariadne auf Naxos auf comédie-ballets Molières zurück, so etwa auf den Monsieur de Pourceugnac für den Rosenkavalier und auf Le Bourgeois gentilhomme für die Ariadne. 6. Jörn Hetebrügge/Nils Meyer: »›Sehet, damit ihr geheilt werdet!‹. Murnau und sein Verhältnis zum Theater im Spiegel des Tartüff«, in: Murnau (Friedrich Wilhelm) in Murnau (Oberbayern). Der Stummfilm-Regisseur der 1920er Jahre, hg.v. Schloßmuseum des Marktes Murnau, bearb.v. Brigitte Salmen, Murnau: Schloßmuseum Murnau 2003, S. 97-105, hier S. 99.
66
Zur f ilmischen Restauration des Patr iarchats
samtkunstwerk und dann wieder in der Avantgarde angestrebten Verbindung von Kunst und Leben, erweist sich in dieser medienteleologischen Perspektive der Übertragung und Fortentwicklung Murnaus Filmästhetik als die Einlösung dieser Utopie. Im Gegensatz zu dieser Kontinuitätsthese möchte ich die Selbstreflexivität von Murnaus Tartüff betonen, die die Unterschiede zwischen Kino und Theater deutlich macht. Hetebrügges und Meyers Ansatz – so sehr er auch die technischen Unterschiede zwischen Kino und Theater hinsichtlich der medienspezifischen Umsetzung der Dispositive der Sichtbarkeit betont – verkennt die Bedeutung einer unterschiedlichen Realisierung dramatischer Handlungsmodelle in Film und Theater. Intrige und Verführung als die wichtigsten textlich-theatralen Handlungsformen der Komödie des 17. und 18. Jahrhunderts stehen für die Verschiebung bzw. Unterwanderung eines prätendierten Sinns, die mit dem Anspruch des Films auf unmittelbare Evidenz kollidiert.7 Als Supplemente für die im Stummfi lm fehlende Mündlichkeit treten Gebärde und Schrift – in Form von Zwischentiteln und direkten Schriftzeugnissen wie Briefen und juristischen Dokumenten – in ein Spannungsverhältnis, das das komische Potential des Stummfi lms eigentlich erst recht begründet. Die Notwendigkeit einer Intrige zur Überführung des Heuchlers verlangt ein komplexeres Ineinander von Schrift, Bewegung und Gebärde als es die Annahme einer einfachen Übertragung des Verbalen ins Visuelle suggeriert.8
7. Dieser mit der Physiognomik einhergehende Anspruch auf Evidenz bildet geradezu das Gegenstück zur Verdoppelung der Fiktion im ›Spiel im Spiel‹ und verweist auf ein grundsätzliches Problem jeder Filmästhetik. Dazu bemerkt Ulrike Haß: »Im Gesicht wird die Unerreichbarkeit des anderen erfahren, die Unmöglichkeit, die Stelle des anderen einzunehmen, an seiner Stelle eine Erfahrung zu machen. Es ist die Stelle, an der der Abgrund zwischen den Begegnenden offenbar wird, der fiktive Charakter der Begegnung, die als fiktive sich gründet.«, U. Haß: Elemente einer Theorie der Begegnung, S. 62. In einer weiteren mediengeschichtlichen Perspektive konkurriert der Anspruch des Films auf Evidenz mit dem der Photographie, die ihrerseits um 1900 u.a. im »Schauspiel der Hysterie« einen solchen Anspruch erhob. Während in Charcots Salpetrière das technische Medium im Verbund mit der psychiatrischen Wissenschaft für die Theatralisierung einer Diagnose sorgte und damit die Hysterie jenseits der Grenzen eines spezifischen Diskurses als kulturelles Epochenphänomen etablierte, führt die Wiederaufnahme der Physiognomik im Unterhaltungsmedium Film zu einer generelleren Aufstellung eines Dispositivs der Sichtbarkeit, das weniger an spezifische Einzeldiskurse gebunden bleibt. 8. Vgl. J. Hetebrügge/N. Meyer: Murnau und sein Verhältnis zum Theater, S. 101.
67
Stefan Kleie
Spiel und Fest. Das Theater Max Reinhardts als Vorbild Die für die theoretische Positionierung des Films wichtige Abgrenzung vom Theater kann um 1925/26 – gegen Ende der Stummfilmära – als abgeschlossen gelten. Schon in der Auseinandersetzung der 1910er Jahre hatten sich ausgehend von einer Konkurrenzanalyse bald die medialen Unterschiede herauskristallisiert. In seinem Aufsatz Schaulust und Kunst sieht Julius Hart jedoch im Bildertheater des Kinos die Möglichkeit einer Reinigung des Theaters von bloßen Effekten, mithin also eine Chance für die Renaissance des Sprechtheaters, gegeben. Dabei werden Komödienelemente der vorliterarischen Stegreiftradition wie sie auch für Molièrekomödien typisch sind, mit medialen Besonderheiten des Films enggeführt: »Diese Komödien, die sich auf Situationskomik aufbauen, Requisitenwitzen, auf Maskeradenscherz, Verkleidung und Verwechslungen, des Wortes und sprachlicher Darstellung auch entbehren können, spielen sich zuletzt im Film viel leichter, rascher und lustiger ab, und hier haben wir in dem neuen Ausdrucksmittel des Kinematographen auch ein besseres gefunden.«9
In den 1920er Jahren überwog dann eher die selbstbewusste Positionierung des Kinos, dessen Affi nität zum Traum und zum kollektiven Unbewussten entweder expressionistisch überhöht oder neusachlich gedämpft werden konnte.10 Vor diesem Hintergrund hat der Rückgriff auf einen Komödienklassiker wie Molières Le Tartuff e einen resümierenden Charakter. Gleichzeitig mit dem Rückblick auf die Stummfi lmära zitiert der Film eine Aufführungstradition, die natürlich eng mit dem Namen Max Reinhardts verbunden ist und sich als Gegensatz zu der von Hart angestrebten Renaissance des Sprechtheaters verstehen lässt. Legendär geworden ist etwa die Auff ührung des Tartüff am Deutschen Theater (1906) unter Max Reinhardt mit Frank Wedekind in der Titelrolle und Tilla Durieux als Elmire, die Molière im Repertoire des Deutschen Theaters auf eine Stufe mit Shakespeare und Goethe rückte. Auch biographisch kann die Prägung durch Max Reinhardts Regietheater für Murnau und Jannings – beide spielten vor bzw. während des Ersten Weltkriegs am Deutschen Theater in Berlin – nicht überschätzt
9. Julius Hart: »Schaulust und Kunst« [zuerst in: Die Woche 15 (1913)], in: Jörg Schweinitz (Hg.), Prolog vor dem Film. Nachdenken über ein neues Medium 19091914, Leipzig: Reclam 1992, S. 253-259, hier S. 258. 10. Zu den Kinodebatten vgl. Thorsten Lorenz: Wissen ist Medium. Die Philosophie des Kinos, München: Fink 1988. Lorenz unterscheidet zwei Debatten über das neue Medium, für die der Epocheneinschnitt des Ersten Weltkriegs von entscheidender Bedeutung ist. Ging es vor dem Ersten Weltkrieg noch v.a. um eine psychiatrische und juristische Inventarisierung der Folgen des Kinos, setzte die eigentlich ästhetische Auseinandersetzung erst nach dem Ersten Weltkrieg ein.
68
Zur f ilmischen Restauration des Patr iarchats
werden.11 Die direkte Anregung für das Drehbuch von Carl Mayer ging ebenfalls auf eine Tartüff -Inszenierung Reinhardts am Deutschen Theater zurück.12 Die Berliner Urauff ührung von Murnaus Film in den »festfrohen Räumen« 13 des Gloria-Palasts der Ufa eignete sich somit hervorragend, die Kontinuität der am Fest orientierten Theaterästhetik Max Reinhardts im Kino unter Beweis zu stellen.14 Der Kintopp schien endlich auf Augenhöhe mit dem klassischen Theater zu sein. Doch eine desaströse Ausgabenpolitik bei ihren Prestigeprojekten Faust und Metropolis, der neue Tonfi lm und die beginnende ökonomische Übermacht Hollywoods stürzten die Ufa bald in eine fi nanzielle Krise. Murnaus Weggang in die USA und die endgültige Übernahme durch die Scherl-Gruppe Hugenbergs (1927) besiegelten dann auch bald den Abschied der Ufa vom ›visionären Kino‹.
Über Wahrheit und Lüge. Heuchelei und mediale Inszenierung Die Unterschiede zur Komödie im Drehbuch Carl Mayers ergeben sich neben einer Beschränkung des Personals aus einer radikalen Vereinfachung des verwirrenden Spiels von Intrige und Gegenintrige in Molières Stück.15 Ange11. Vgl. J. Hetebrügge/N. Meyer: Murnau und sein Verhältnis zum Theater, S. 98. 12. »Angeregt durch eine Tartüff-Inszenierung an Max Reinhardts ›Deutschem
Theater‹ in Berlin (mit Eugen Klöpfer in der Titelrolle), hatte Carl Meyer bereits 1922 das Stück für den Film bearbeitet.«, Booklet zur DVD, o.P. 13. Die Premiere am 25.01.1926 fiel nämlich mit der Einweihung dieses neuesten Repräsentationskinos der Ufa zusammen. Zur Premierenkritik etwa Berliner Lokal-Anzeiger, ein Blatt der Scherl-Gruppe vom 25.01.1926, zit.n. DVD-Booklet: »Gestern Abend sammelte sich in den festfrohen Räumen des neuesten Kinos an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche ein Kreis geladener Gäste. In milder Helle schimmerte das Gold der Verzierung, glänzte der Vorhänge Damast, funkelten die Hänger von Kristall. Und Blumen blühten üppig. Die Kultur dieser Umwelt schuf alltagsentrückte Stimmung.« Die geschäftlichen und personellen Verflechtung der Ufa mit dem Medienimperium der Scherl-Gruppe führte in deren Zeitungen – wie etwa hier im Berliner Lokalanzeiger – meistens zu Elogen, die lediglich die äußeren Umstände der Premiere beschrieben. 14. Die Ausrichtung an der großen Oper war durch die Aufführung der Ali BabaOuvertüre von Luigi Cherubini unter der Leitung des ›Generalmusikdirektors‹ Ignatz Waghalter und das neobarocke Ambiente überdeutlich. Damit beansprucht die Ufa, mit den ebenfalls am Barock orientierten elitären Salzburger Festspielen zu konkurrieren. Vgl. Klaus Kreimeier: Die Ufa-Story. Geschichte eines Filmkonzerns, München, Wien: Carl Hanser 1992, S. 143f. 15. Zur Intrige in Molières Le Tartuffe vgl. Peter v. Matt: Die Intrige. Theorie und Praxis der Hinterlist, München, Wien: Carl Hanser 2006, S. 129: »Vorerst geschieht alles wie nach einem Handbuch für Komödienschreiber: Die Wahrheit tritt ans Licht, der Schuft wird entlarvt, dem Wolf wird der Schafspelz vom Leib gezogen – und
69
Stefan Kleie
siedelt in einem aus der Romantik vertrauten zeitlos-provinziellen Philistermilieu 16, erscheint die Rahmenhandlung als Bindeglied zwischen dem Standpunkt des Kinogängers in der großstädtischen Moderne und einer ins späte 18. Jahrhundert versetzten Komödienhandlung. Jenseits dieser Verdopplung der Handlung wird jedoch schon zu Beginn eine weitere Rahmung auff ällig: In drei aufeinander folgenden Zwischentiteln erscheint ein anonymer, geradezu emblematischer Kommentar, der – vor jedem bewegten Bild, jeder szenischen Aktion – bestrebt ist, die Rezeption von vornherein zu lenken. Er tut dies durch ebenso allgemeine wie identifi katorische Appelle. Die Nähe zu religiösen Ermahnungen liegt auf der Hand: »Vielfach ist die Zahl der Heuchler auf Erden/Vielfach die Maske, unter denen sie uns begegnen – !/Oft sitzen sie neben uns und wir wissen es nicht!« 17 (0:00:43) Das Lichtspiel als ›moral play‹ oder als ›moralische Anstalt‹? Tatsächlich ist in der allegorischen Verallgemeinerung dieses »Play of all times an all realms«, wie es in der restaurierten amerikanischen Fassung heißt, die Nähe zum Topos des barocken Welttheaters nicht zu übersehen.18 Doch lässt sich der Mahnung des Films keine klar erkennbare religiöse oder metaphysische Weltdeutung mehr zuschreiben. Gewarnt wird vor der »Maske«, doch der Warner im ›Off‹ bleibt selbst maskiert. Wer definiert das Kollektiv und wer die Heuchler? Eine wichtige Frage, denn immerhin sitzen die anonymen Zuschauer in einem abgedunkelten Raum, in dem selbst für den größten Physiognomiker nicht ausgemacht ist, wer zu den Heuchlern, den Maskenträgern, gehört. Hetebrügges und Meyers Deutung bleibt unkritisch, wenn sie in dieser ideologischen Lenkung lediglich ein Experiment sieht, »den Zuschauer trotzdem in die Filmhandlung einzubeziehen.«19 Tatsächlich gestaltet sich das Kinoerlebnis schon zu Beginn nicht als ein Gemeinschaft stiftendes Fest, sondern als ein von Denunziation und Misstrauen geprägtes Tribunal. Die Brüchigkeit moralischer Normen und Setzungen wird so durch mediale Inszenierungen lediglich kaschiert; ein Thema, das schon bei der Urdann bewirkt diese Wahrheit gar nichts. […] So perfekt ist die Intrige des Schurken, daß die perfekte Anagnorisis der Gegenintrige ins Leere läuft. Ein unglaublicher Moment ist das. Er wirft uns aus aller Sicherheit gegenüber den Konventionen und Gebräuchen der Literatur.« 16. Carl Mayer spricht in einem Skript von der »Jetztzeit«, »mit einem Zug ins Kleinstädtische, altmodisch Zurückgebliebene«. Zit.n. Lotte H. Eisner: Murnau, überarbeitete, erweiterte u. autorisierte Neuausg., hg.v. Hilmar Hoffmann u. Walter Schobert, Frankfurt a.M.: Kommunales Kino Frankfurt 1979, S. 109. 17. Die Zeitangaben folgen der oben genannten DVD. 18. Zum Vergleich der Beginn von Hofmannsthals Jedermann: »Spielansager tritt vor und sagt das Spiel an […] Der Hergang ist recht schön und klar,/der Stoff ist kostbar von dem Spiel,/Dahinter aber liegt noch viel/Das müsst ihr zu Gemüte führen/ Und aus dem Inhalt die Lehr ausspüren.«, Hugo von Hofmannsthal: Jedermann, in: ders., Gesammelte Werke in zehn Einzelbänden, Dramen III. 1893-1927, hg.v. Bernd Schoeller, Frankfurt a.M.: S. Fischer 1979, S. 11. 19. J. Hetebrügge/N. Meyer, Murnau und sein Verhältnis zum Theater, S. 100.
70
Zur f ilmischen Restauration des Patr iarchats
auff ührung von Molières Le Tartuffe (1664) für Verwirrung sorgte. Die scharfsinnige Skepsis der französischen Moralisten begründete sich auf einer prinzipiellen Ununterscheidbarkeit von Wahrheit und Lüge, Tugend und Laster. Das Motto von La Rochefoucaulds Réfl exions ou sentences et maximes morales (1678), »Nos vertus ne sont le plus souvent que des vices déguisés«20 als Universalisierung der Heuchelei, kehrt das Verhältnis von Tugend und Laster gesellschaftskritisch um, und »überführt den Gegensatz von Echtheit und Schein des Wahren, von Tugend und Laster, von Gut und Böse, in die paradoxe Beziehung einer ›coincidentia oppositorum‹, die ihre bislang nie angefochtene ontologische Geschiedenheit in Frage stellt.«21 Diese dann von Nietzsche und der Moderne aufgenommene Skepsis gegenüber der Sprache gilt es jedoch auch auf das neue Bildmedium Film anzuwenden. Dessen Anspruch, mittels der vermeintlichen Evidenz (»Denn sehet«) der Gebärde die in der Sprachverwendung unmögliche Unterscheidung von aufrichtigem und unaufrichtigem Gebrauch zu restituieren,22 muss daher mit Vorsicht begegnet werden.23 Insofern benennt Siegfried Kracauer zwar das Problem, wendet es jedoch zu einseitig im Sinne einer sozialkritisch-realistischen Lesart, die die Paradoxie einer Darstellung der Heuchelei außer Acht lässt: »Dieser Tartuffe, statt den Zuschauern die Heuchelei einzureiben, war selbst tartüffisch, da er einem Publikum schmeichelte, das die wesentlichen Dinge lieber unberührt ließ.«24
20. François de La Rochefoucauld: »Réflections ou Sentences et Maximes morales (1678)«, in: ders., Œuvres Complètes, (=Bibliothèque de la Pléiade 24), hg.v. Louis Martin-Chauffier, Paris: Gallimard 1973, S. 385-471, hier S. 385. 21. Hans Robert Jauß: »Der Tartuffe-Skandal im Lichte von Mimesis und Simulation«, in: Andreas Kablitz/Gerhard Neumann (Hg.), Mimesis und Simulation, Freiburg i.Br.: Rombach 1998, S. 121-144, hier S. 122. Jauß bringt den Skandal um die Uraufführung von Molières Tartuffe (1664) mit einer Krise der Ähnlichkeitsbeziehungen im 17. Jahrhundert in Verbindung. 22. Dies berührt z.B. auch noch die eng mit der Intentionalität verbundene Aufrichtigkeitsbedingung der Sprechakttheorie, die es ihr unmöglich macht, den Status fiktionaler Rede zu begründen. 23. Der Anspruch des Films lässt sich im Rückgang auf die Physiognomik als Umkehrung einer rationalistischen Skepsis verstehen: »Doch gegen den Augenschein der simulierten Devotion erweist sich die Vernunft als ohnmächtig, ›parce que les hommes jugent plus par les yeux que par la raison‹, wie die Lettre kommentiert (L 549).«, H.R. Jauß: Der Tartuffe-Skandal, S. 129. 24. Siegfried Kracauer: Von Caligari zu Hitler. Eine psychologische Geschichte des deutschen Films (=ders.: Schriften, Bd. 2, hg.v. Karsten Witte), Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1979, S. 157.
71
Stefan Kleie
Der patr iarchalische Blick : Die Rahmenhandlung In der kurzen Abfolge von Bedientenklingel und intimem Blick in die unaufgeräumte Bedientenkammer wird die Haushälterin (Rosa Valetti) gleich zu Beginn eingeführt, wie es der patriarchalischen Ordnung des greisen Rats (Hermann Picha) entspricht. Das Schockmoment der schrillen Klingel- und Glockentöne durchbricht immer wieder die Ausführung der Intrige und gemahnt damit leitmotivisch an die durch sie repräsentierte Ordnung. Dass diese Ordnung allerdings bedroht ist, geht aus den unachtsam umgestossenen Schuhen des Rats hervor, die Kamera zeigt sie aus einer ungewöhnlichen Froschperspektive. Die bildliche Umsetzung dieser Hierarchie, die die Haushälterin in die Fluchtlinien dieser fetischisierten abgetretenen Altherrenstiefel zwingt, wirkt für 1925 reichlich reaktionär (0:01:17).
Doch wäre es verfehlt, die Grundtendenz des Films in expressionistischer Vatermördermanier einseitig als »gegen diese zäh verharrende alte Zeit, gegen das fest im Wilhelminismus verankerte Bürgertum, das vom Großvater repräsentiert wird«25 gerichtet, anzunehmen. Viel eher scheint es um das Erbe eben dieses wilhelminischen Bürgertums zu gehen, wobei der Film die Möglichkeit einer nichtlegitimen Verschiebung der Macht zu Gunsten der Unterschichten aus Proletariern und Kleinbürgern in Gestalt der Haushälterin als Heuchelei, Verrat und Verbrechen denunziert. Die Aufstellung der Schuhe ›in Reih’ und Glied‹ wird daher auch die erste Amtshandlung des eingedrungenen Enkels (André Mattoni), des unbekümmerten Gegenspielers der pflichtvergessenen Haushälterin, sein. Kamera und Erzählung fügen sich also einem Dispositiv, das sich ganz klar an den Vorgaben der Verdächtigungsrhetorik hält. Der fi lmische Blick kann nur deshalb zur Entlarvung der Intrige (Giftmischerei der Haushälterin) bzw. zur 25. J. Hetebrügge/N. Meyer: Murnau und sein Verhältnis zum Theater, S. 104.
72
Zur f ilmischen Restauration des Patr iarchats
Komplizenschaft mit der Gegenintrige führen, da er sich über die Trennung ›öffentlich/privat‹ hinwegsetzt. Durch die enge Verbindung von Schaulust und entlarvender Blickführung der Kamera wird der Zuschauer zugleich vom Enkel als »Zeuge« (Zwischentitel, 0:09:48) der Anklage in einem juristischen Verfahren instrumentalisiert. Wie in den meisten Filmen Murnaus wird in beiden Teilerzählungen der Verlust von Ordnung zum eigentlichen Thema. Im Gegensatz etwa zum Letzten Mann ist jedoch in der Rahmenhandlung des Tartüff der Verfall in Gestalt des greisen Rats schon bis zur senilen Demenz fortgeschritten; der Rat eignet sich also weder als tragische noch als Mitleid erweckende Figur. Indem er als Karikatur erscheint, kann er diese Ordnung auch nicht mehr glaubhaft verkörpern – die Erhaltung der Ordnung wird dadurch zum Selbstzweck. Lediglich mit Brille am Schreibtisch sitzend, gewinnt der störrische Greis einen Rest seiner Würde zurück (0:03:25). Die einzige ihm verbliebene Stütze seiner Macht über Haushälterin und Enkel liegt in der auf der Schrift basierten juristischen Sphäre, die soziale Beziehungen über das Erbrecht regelt. Das Testament wird somit wie in Molières Komödie zum Ausweis einer reibungslos funktionierenden rechtstaatlich-bürokratischen Ordnung, deren Autorität durch die Täuschungsabsichten des Heuchlers bedroht ist. Andererseits macht das skrupellose Kalkül des Enkels beim Beharren auf seinem Erbe deutlich, dass die zum Erhalt der Ordnung eingesetzten Mittel sich nur unwesentlich von den Mitteln der heuchlerischen Intrige unterscheiden. Die Unterstellung einer besonderen biologischen Nähe zwischen Großvater und Enkel wird in der Anspielung auf das Gleichnis vom verlorenen Sohn einfach vorausgesetzt, durch das Auftreten des Enkels jedoch nur wenig gestützt. Sein überragendes Selbstbewusstsein wird schon durch das Eindringen in das Haus seines Großvaters dokumentiert. Dabei wird der Sehschlitz, durch den der Kontrollblick von innen ja eigentlich unliebsame Gäste ausspähen sollte, von ihm einfach interventionistisch zur Türöff nung umfunktioniert, ganz als wäre er der eigentliche Herr im Hause (0:06:54). Nach diesem Kunststück zieht dieser echte Strahlemann beim Eintritt in das Haus des Großvaters zu allem Überfluss den Hut und wendet sich zeremoniell rechts und links an ein imaginäres Gegenüber, das unschwer als das zur Komplizenschaft angehaltene Kinopublikum erkannt werden kann. Sein Einsatz von Maske und filmischer Inszenierung erweist sich gegenüber der Heuchelei der Haushälterin als überlegen. Gegenüber der glatten Souveränität des Enkels, dessen Lachen schon zur Maske erstarrt ist, bevor es hinter Bart, Perücke und Brille verschwindet, ist das von Runzeln, Sommersprossen und Falten entstellte Gesicht der Haushälterin physiognomisch im Nachteil. Das Gesicht des Enkels erscheint dagegen stets in einer undifferenzierten Helligkeit, während die ungeschminkte Haushälterin in ein verdächtiges Hell-Dunkel gehüllt ist. Zunächst Enterbungsgrund und verbunden mit den gängigen Klischees der Sittenlosigkeit, wird der Schauspielerberuf, gerade indem er in der moralisch zweifelhaften Gestalt der Täuschung auftritt, zur Grundlage des Triumphes über die Widersacherin. Sein gewandtes Auf73
Stefan Kleie
treten im Trenchcoat der Neuen Sachlichkeit kontrastiert mit einer zwischen Nachlässigkeit und Gewalt changierenden Amateurintrige der Haushälterin, die an den Naturalismus des 19. Jahrhunderts erinnert. Als besonders deutliche Gewaltdrohung erscheint mir die angedeutete Opferszene, in der die Haushälterin das Rasiermesser an einem Riemen wetzt, der sich diagonal durch den Bildraum zieht (0:06:46). Im linken unteren Teil sitzt der ahnungslos ›eingeseifte‹ Rat, der inmitten des Seifenschaums eine Regressionsphantasie bebildert. Mit gefalteten Händen, das Damoklesschwert über sich, wartet er Schicksal ergeben, bis ihn ein sehr abrupter Bildschnitt zum Enkel aus dieser unangenehmen Lage erlöst.
Der Enkel lässt sich jedoch vom ersten Rückschlag, der Enterbung und Verstoßung bringt, nicht entmutigen. In der Verbindung der lieblos weggeworfenen Schuhe mit einem einzigen verächtlichen Blick der Haushälterin erkennt der durch die Schauspielerei erfahrene Physiognomiker sofort Symptome einer allgemeinen Lage und entwirft auf der Stelle einen Plan. Die Gegenintrige greift nun mit dem Wanderkino zurück auf die Entstehungszeit des Kinos als Jahrmarktbelustigung, die historisch etwa von 1895 bis 1910 anzusetzen ist, also in einer Zeit, in der noch nicht von einem künstlerischen Anspruch des Kinos die Rede sein konnte, da dies die technischen Möglichkeiten noch nicht erlaubten. Doch zitiert der Kindertross, der sich an den Zirkuswagen des Kinoimpresarios heftet, ganz beiläufig die Verführungsgewalt des neuen Mediums. Wieder ist es die Klingel, die als Requisit der Verführung – ganz ähnlich wie die Flöte des Rattenfängers von Hameln – nunmehr die reale Macht der in Auflösung befindlichen patriarchalischen Ordnung durch die imaginäre Macht des Kinos substituiert. Mit dem Zirkus- und Jahrmarktsmilieu sind sofort Assoziationen mit dem Wunderbaren, der Magie und dem Sensationellen aufgerufen, die den Begriff des Mediums mit einer Nähe zu okkulten Praktiken aufladen. Indem sich die Filmvorführung im Stile eines Zaubertricks dieser Assoziationen bedient, gelingt ihr der 74
Zur f ilmischen Restauration des Patr iarchats
Übergang von der ›realistischen‹ Rahmenhandlung zur stilisierten Welt der Tartüff-Handlung. Angesiedelt inmitten eines langen Bücherregals in der Bibliothek des greisen Rats, führt die Filmvorführung die magische Reanimation eines verschriftlichten kulturellen Raumes26 vor (0:12:39). Folglich ist es auch der senile Rat – als Schreiber und Inhaber einer stattlichen Bibliothek Vertreter der Schriftkultur – der sich als erbittertster Gegner des Kinos auff ührt (Zwischentitel: »Ein Kino! Ein Kino! Das ist ja ein Unsinn«). Die Haushälterin, die zunächst noch abfällig (»Wir brauchen kein Kino«) einen typischen Kleinbürgerstandpunkt gegenüber allem Neuen vertritt, erweist sich hinsichtlich der Verführungskraft des Kinos und seines exotischen Impresarios als weitaus anfälliger. Ja, sie verliert sogar die Intrige aus den Augen und klatscht zu Beginn der Vorführung enthusiastisch in die Hände. Der narzisstische Blick in den Spiegel (0:12:04) – immerhin ganze 14 Sekunden – verdrängt den kalten, kontrollierenden Blick, der zur Planung einer Intrige unabdingbar ist. Auch die Bildführung trägt diesem Umstand Rechnung. Nach der Fensterszene – eine klassische Verführungssituation samt Maskerade – verlagert sich das Geschehen auf drei Räume, was mehrere Passagen und Schnitte notwendig macht. Im Gegeneinander bewirken Intrige und Gegenintrige, Pfl icht und Neigung der Haushälterin eine Beschleunigung der Bildsequenzen und wirken damit Spannung erzeugend. Trotz ihrer vermeintlich simplen Abfolge und des Rekurses auf Versatzstücke der Unterhaltungsliteratur (die böse Haushälterin) ist damit die Rahmenhandlung keineswegs als »recht naive[], schwerfällige Pedanterie«27 abzutun, wie dies Lotte H. Eisner tut. Weit mehr als im Hauptteil werden hier historische und mediale Aspekte des Kinos berührt, die in dieser Offenheit bis dato wohl kaum Gegenstand eines Kinofi lms geworden sein dürften.
Ornament und Ver führung. Die Kunst der Stilisierung Ganz anders verhält sich dies in der Haupthandlung. Während in der ›realistischen‹ Rahmenhandlung die Illusion erst in Gestalt des Kinos und der Schauspielerei Einzug hält, die Intrige der Haushälterin von Anfang an entlarvt wird, scheint es sich hier schon immer um ein Spiel mit der Illusion – »wie durch Gaze verschwimmend aufgenommen«28 – zu handeln. Stilisiertes Bühnenbild und künstliche Accessoires (Leuchter, Laternen, kulissenhafte Park26. Die Formulierung einer magischen »Reanimation des Gedächtnisraumes« übernehme ich aus dem Aufsatztitel von Peter Matussek: »Intertextueller Totentanz. Die Reanimation des Gedächtnisraumes in Hofmannsthals Drama Der Tor und der Tod«, in: Hofmannsthal Jahrbuch 7 (1999), S. 199-231. 27. Lotte H. Eisner: Die dämonische Leinwand, hg.v. Hilmar Hoffmann u. Walter Schobert, Frankfurt a.M.: Fischer 1980, S. 251. 28. L.H. Eisner: Murnau, S. 109.
75
Stefan Kleie
anlage) zitieren das Theater und verstoßen damit eigentlich gegen den vom Kino geforderten Realismus. Der Verzicht auf die bereits im Letzten Mann erfolgreich erprobte frei bewegliche Kamera kann nicht nur als eine »Parodie auf die – räumliche – Beschränktheit der Guckkastenbühne«29, sondern auch als nostalgische Reminiszenz an das symmetrische Ideal des Klassizismus aufgefasst werden. Die für die Haupthandlung des Tartüff typische distanzierte Beobachterperspektive ergibt sich ja gerade aus dem Kontrast zwischen den stilisierten Tableaus der Totalen und den physiognomischen Großaufnahmen. Für eine psychologische Einfühlung in eine der Figuren ist in dieser Spielanordnung kein Platz. Auch Béla Balázs macht im Übergang vom »Stilfi lm« zum künstlerisch bedeutenderen »Filmstil« Abstriche vom geforderten Realismus: »Denn wenn der Film wirklich einen eigenen Stil hat, so kommt es gar nicht mehr darauf an, ob dieser der Zeit, die er darstellt, historisch getreu entspricht. Im Gegenteil! Eigentlich ist jeder wirklich erlebte Stil modern, in dem Sinn nämlich, daß er gewissermaßen unsere Beziehung zu dem dargestellten Stil enthält. Nicht auf die authentische Formen, sondern auf den Geist, – ich möchte sagen: auf die Physiognomie des Stils – kommt es an, die sich im Laufe der Geschichte ändert, weil sie jeder Generation anders erscheint.«30
Antimimetische Konzepte waren schon Bestandteil der Bühnenreform um 1900. So schreibt Hugo von Hofmannsthal bereits 1903 in Die Bühne als Traumbild unter dem Eindruck der Bühne Max Reinhardts: »Denn die Welt ist nur Wirklichkeit, ihr Abglanz aber ist unendliche Möglichkeit […]. Wer die Bühne aufbauen will, muß durchs Auge gelebt und gelitten haben. Tausendmal muß er sich geschworen haben, daß das Sichtbare allein existiert, und tausendmal muß er schaudernd sich gefragt haben, ob denn das Sichtbare nicht, vor allen Dingen, nicht existiert.«31
Die »unendliche[n] Möglichkeit[en]«, die sich in der Abweichung von einem realistischen Bühnenbild ergeben, werden schon in der Eingansszene als Wunschräume markiert. Wohl kein Raum inszeniert in der Kunstgeschichte deutlicher ein solches Versprechen als das Boudoir des Rokoko. Elmire (Lil Dagover) ist nur in einer Seitenansicht im Spiegel zu sehen (0:16:13). Halbprofi le und Rückenansichten, die die Mode stark betonen, bilden dann auch ein Markenzeichen Elmires. Ihr Kopf bleibt im Eingangsbild außerhalb der Spiegelfläche, dafür wird ihr Dekolleté in der Seitenansicht stark betont. Der 29. J. Hetebrügge/N. Meyer: Murnau und sein Verhältnis zum Theater, S. 102. 30. Béla Balázs: »Stilfilm, Filmstil und Stil überhaupt«, in: ders., Schriften zum
Film I, S. 341-345, hier S. 343. 31. Hugo von Hofmannsthal: »Die Bühne als Traumbild«, in: ders., Gesammelte Werke in zehn Einzelbänden, Reden und Aufsätze I, hg.v. Bernd Schoeller, Frankfurt a.M.: S. Fischer 1979, S. 490-493, hier S. 492f.
76
Zur f ilmischen Restauration des Patr iarchats
Bildmittelpunkt fällt knapp über den Spiegel und damit auf die sich korallenförmig windenden Kerzenständer, die somit als phantastisch wuchernde Gliedmaßen als Erweiterungen des Brustbildes der Elmire im Spiegel erscheinen. Damit zitiert das Bild die manieristische Tradition der Metamorphosendarstellungen, von denen die bekannteste die der Daphne sein dürfte.32
Die Künstlichkeit der Elmire zeigt sich später auch im »Perlmutt eines wollüstig gebeugten Frauennackens«33. Lil Dagover überzeugt besonders dann, wenn sie die Verführerin spielt, wogegen ihre eigentliche Rolle als treue Gattin Orgons leicht zur sentimentalen Schablone und damit zur Karikatur des ›bürgerlichen Trauerspiels‹ erstarrt.34 Als Gegenspielerin Tartüffs profitiert sie als Figur im bewussten Einsatz ihrer Reize indirekt von dessen Lüsternheit. Heuchelei und Verführung arbeiten nach dem gleichen Prinzip einer Krise der Repräsentation, die es unmöglich macht, zwischen aufrichtigem Handeln und Verstellung zu unterscheiden. Doch im Gegensatz zur Heuchelei, die als prätendierte Heiligkeit immer auf diese binäre Dichotomie angewiesen bleibt, operiert die Verführung, der es ja nicht um wahr oder falsch, sondern immer nur um ihr eigenes Gelingen geht, performativ. In ihrer unmittelbaren Bildwirkung erscheint Elmires Verführung – in der Erzählstruktur 32. Hier abgebildet: »Daphne als Trinkgefäß« v. Abraham Jamnitzer (Nürnberg, Ende 16. Jahrhundert; Silber, größtenteils vergoldet, Koralle; Höhe: 68 cm; Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Grünes Gewölbe, Inv. Nr. IV 260. Foto: Jürgen Karpinski. Abgedruckt mit freundl. Genehmigung der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. 33. L.H. Eisner, Die dämonische Leinwand, S. 272. 34. Vgl. auch die Ähnlichkeit mit Lessings Minna von Barnhelm schon bei L.H. Eisner: Murnau, S. 249.
77
Stefan Kleie
ausgewiesen als notwendiges Element ihrer Gegenintrige – ambivalent. Die durch die Gegenintrige gewonnene sexuelle Emanzipation Elmires entwickelt nämlich eine Eigendynamik, die für die Institution der Ehe womöglich nicht minder gefährlich ist, als die Gefährdung von außerhalb. Wie später noch auszuführen sein wird, gelingt es erst im letzten Moment, diese zentrifugalen Tendenzen der Gegenintrige einzuholen.
Die verbannte Venus. Heuchelei und Tr iebschicksal In kurzer Abfolge folgen auf den Raum der Intimität die zum Empfang des Hausherrn festlich geschmückte Treppe (in der Diagonale durch den Kranz verlängert; 0:16:34) und die Außenansicht des Schlosses zentralperspektivisch in der Totalen (0:16:39).35 In der Zentralperspektive erteilt Orgon auch seinen Dienern Pierre, Jean und Jacques vom Seitenbalkon des Treppenhauses seine gegen den Luxus gerichteten Anweisungen. Die Zentralperspektive als ökonomischste Form der Blickführung korrespondiert, indem sie auf Rationalisierung setzt, mit dem ökonomischen Verhalten in der Haushaltsführung. Dass sich die Beherrschung des Treppenhauses durch den zentralperspektivischen Blick des Hausherrn aber als Illusion erweist, macht die darauf folgende Einstellung deutlich, die die gleiche Szene (0:19:35) von oben beleuchtet.
35. Die Ähnlichkeit des Schlosses mit Sanssouci macht noch einmal den adaptiven Umgang des Films mit dem Stil einer Epoche deutlich. Während Hofmannsthals Ariadne die Rahmenhandlung aus Molières Le Bourgeois gentilhomme nach Wien verlagert (2. Fassung, 1916), gemahnt Murnaus Tartüff damit tatsächlich an eine preußische Minna von Barnhelm.
78
Zur f ilmischen Restauration des Patr iarchats
Aus dem Bildzentrum verdrängt und gefährlich weit über das Geländer gelehnt, droht Orgon von der geschwungenen Architektur des Treppenhauses wie von einem Strudel verschluckt zu werden. Das Treppenhaus erweckt niemals den Eindruck solider Architektur und verfehlt somit die räumliche Dimension. Dies macht es zur perfekten Bühne: Wenige, statische Kameraeinstellungen lassen die verschiedenen Auftritte der Protagonisten wie revueartige Nummern erscheinen, von denen der Auftritt Tartüffs natürlich die aller anderen übertriff t. Andererseits weckt diese Form der Inszenierung natürlich auch die Lust, hinter die Türen zu schauen; Lotte H. Eisner schreibt: »Die Treppe scheint voller Intrigen.«36 Doch zunächst entfaltet die Ankunft Tartüffs rege Betriebsamkeit. Die Verbannung der Venus – einer Kopie der badenden Venus – wird dann schon fast zum mythischen Frevel Orgons. Die Geilheit Tartüffs, der in das Gemach der Venus einzieht, und die verführerische Erotik Elmires werden die Widergänger der aus dem Haus verbannten Sexualität sein. Doch zunächst verkündet ein Kammerdiener auf die Sekunde genau die Ankunft des neuen Herrn (Zwischentitel: »Vor dem Hause steht ein seltsamer Geselle«). Es dauert noch eine erhebliche Zeit von der Ankündigung bis zum Auftritt des Titelhelden. Denn nicht so sehr in seiner Erscheinung – die ist eher grotesk –, sondern in seiner Wirkung auf die von ihm Abhängigen soll sich seine dämonische Qualität zeigen. Es handelt sich v.a. um die zunehmende Isolierung Orgons als Ehemann und Hausherr, also wiederum um die Gefährdung der patriarchalischen Ordnung, für die die Institution der Ehe ebenso steht wie das Erbrecht. Offenbar ist die Abhängigkeit Orgons von Tartüff schon so weit fortgeschritten, dass das zur Schrift erstarrte Gebot, dass die Unterordnung festschreibt, genügt.37 Im Stummfi lm Tartüff kann es demnach nicht um die Genese dieser Beziehung – das heißt im Hinblick auf Tartüff: um das »Faszinosum seines Charakters, den Ursprung der Macht, die er über andere auszuüben vermag«38 – gehen, sondern um die Erschütterung dieser angemaßten Macht, die Intrige und Gegenintrige miteinander verschränkt. Auch in der Tartüff-Handlung erscheint also, ähnlich wie in der Rahmenhandlung, Schrift als Grundlage der Intrige. Sowohl die betrügerische Haushälterin als auch Tartüff stützen sich auf die Schrift, um ihre Intrige ins Werk zu setzen. Es sind juristische und religiös-moralische Verbindlichkeiten, die in Schriftform (Testament, religiöse Erbauungsbücher, Geldwechsel) dokumentiert werden. Ihre Schriftzentriertheit, der Glaube an die Unverrückbarkeit des geschriebenen Wortes auch als Ergebnis einer Manipulation, macht beide Intriganten anfällig gegenüber den Verlockungen der auf das Visuelle abzielenden Gegenintrige. So wie sich die Haushälterin vom Wanderkino und seinem Handküsse verteilenden Impresario verführen lässt, so verfällt Tartüff der durch einen fingierten Brief Elmires eingeleiteten Gegenintrige. In 36. L.H. Eisner: Murnau, S. 249. 37. Exemplarisch vorgeführt im Gebot, das auf »Über die Nichtigkeit alles Irdi-
schen« folgt. 38. H.R. Jauß: Der Tartuffe-Skandal, S. 128.
79
Stefan Kleie
Elmires Gegenintrige funktioniert das Zusammenspiel von Schrift und Körper als das einer direkten Fortsetzung, während in Tartüffs Intrige die Schrift immer in einem antagonistischen Verhältnis zum Körper steht. Der Nachteil der Schrift wird besonders anhand von Tartüffs zunehmend defensivem Umgang mit seinem Erbauungsbüchlein deutlich: Die Pose des Heiligen wird so zur distanzierenden Flucht vor der verführerischen Leiblichkeit Elmires (0:37:37). Am Ende erweist sich die Herrschaft der Schrift über den Körper als Sträflingstätowierung Tartüffs. Die Evidenz des fi lmischen Blicks (›in flagranti‹) wird durch die Einschreibung der staatlichen Gewalt in den Körper des Delinquenten zusätzlich unterstrichen (0:59:17). Der eigentliche Auftritt Tartüffs markiert schon den Höhe- und Endpunkt seiner Intrige. Als stilistisches Mittel wird sein gravitätisch schreitender Gang zum Massstab für einen verlangsamten Rhythmus des Films, was durch Giuseppe Becces Choralbearbeitungen des »Vom Himmel hoch, da komm ich her« auch musikalisch unterstützt wird. An der mimetischen Übernahme des Bewegungsrhythmus wird die Abhängigkeit Orgons, der sich wie ein Schatten an Tartüff anschmiegt, besonders auff ällig (v.a. im »Morgengebet«, 0:28:00, und im »Bittgebet« für Elmire, 0:50:19). Fortan erscheint er jedoch zusehends in der Rolle des hemmungslosen Genießers und erotisch Enthemmten und damit eher in der Rolle Falstaffs als in der eines gerissenen Tartüff. Die Evidenzrhetorik des fi lmischen Blicks verlagert sich von einem Indizienprozess in Betrugsfragen zur Schilderung einer Sexualpathologie.39 Die Tendenz zur Verharmlosung seiner intellektuellen Fähigkeiten zu Gunsten einer Betonung der Triebhaftigkeit legt wieder eine physiognomische Lesart nahe. Zunächst geht die Gemessenheit seiner Bewegung mit der statuarischen Steif heit seiner Erscheinung einher. Die Belebung dieser Gelehrtenkarikatur erfolgt wie in Condillacs Traité des sensations quasi experimentell durch die Aktivierung verschiedener Sinne. Essen und Trinken (Mund, Kauen), der Anblick eines Ringes (Augen, Habsucht) bilden isolierte sinnliche Erregungsmomente in Jannings’ ansonsten weiterhin statischer Physiognomie. Das groteske Augenrollen angesichts der Verführungskunst Elmires bestimmt dann über weite Strecken die Handlung. Zu völlig ungehemmter pantomimischer Bewegung gelangt Tartüff jedoch erst vor der zweiten Verführungsszene. Ungeahnt behände durchstreift er als gespenstischer Schatten das ganze Treppenhaus, um in das Schlafzimmer Elmires zu gelangen. Eine völlig enthemmte Mimik korrespondiert mit einem eher grobmotorischen Tatsinn, der sich des Wunschobjekts – Elmires wogenden Dekolletés – bemächtigt. Es fällt auf, dass sich Tartüff mit fast übertriebenem Misstrauen im Hause Orgons bewegt. In der gespenstischen, 39. Diese Entscheidung wird notwendig, wenn man bedenkt, dass der klassische faux dévot »ein Mensch ohne eigenen Charakter ist« (ebd., S. 133), seine Darstellung also immer auf eine Mischung von Mimesis und Simulation angewiesen ist. Viel besser eignet sich daher im weitgehend auf das Gestaltungsmittel der Gebärde beschränkten Stummfilm die Darstellung der hinter der Maske des Heiligen verborgenen und langsam hervorbrechende sexuellen Begierde.
80
Zur f ilmischen Restauration des Patr iarchats
nur vom Kerzenlicht erhellten Treppenhausszene hängt er seinen Mantel an einen mit einem geweihförmigen Kerzenleuchter (0:23:26) versehenen Garderobenhaken und markiert sich damit – noch dazu in Gegenwart Dorines (Lucie Höfl ich) – selbst als ein zur Jagd frei gegebenes, ›gehörntes‹ Großwild. Die Ähnlichkeit mit Elmires verführerischem Dekolletébild verkehrt die Geschlechtertypologie, die hier in der Zuordnung von männlichem Jäger und weiblichem Wild besteht. Weitere Einstellungen wie etwa die der abgeschnittenen Füße Tartüffs in der Hängematte, von der man nur die massiven Taue sieht (0:32:32), lassen nichts Gutes für ihn ahnen und erinnern gleichzeitig an seine kriminelle Vergangenheit, für die er vermutlich als Galeerensklave büßte. Wie in der Rahmenhandlung werden die vom Körper losgelösten Partialobjekte zu Vorboten einer dem Träger drohenden Gefahr.
Doppelte Zeugenschaf t. Filmischer Blick und Agonie des Pr ivaten In zwei parallelen Verführungsszenen verliert nun Tartüff allmählich die Kontrolle über den beanspruchten Habitus. Die durch den Brief Elmires eingeleitete Verabredung zum Tee folgt noch ganz den Konventionen eines Theaters, das Elmire sowohl für Tartüff als auch für den unbelehrbaren Orgon inszeniert. Durch die Nuancierung der Übergänge in der mimisch-gestischen Aktion liegt hier der unbestrittene schauspielerische Höhepunkt im Zusammenspiel von Lil Dagover und Emil Jannings. Eine Großaufnahme von Jannings’ Gesicht, die die Überraschung nach Elmires Eröffnung eines Geständnisses ausdrückt, macht dies schlagartig deutlich (0:45:43). Die durch einen der wenigen Kameraschwenks eingeleitete einladende Bewegung Elmires veranlasst Tartüff dazu, sein Erbauungsbüchlein einzustecken und sich dem theatralen Spiel der Verführung auszuliefern (0:44:25). Doch Tartüff bleibt misstrauisch, ein sicherer Instinkt für die Gefahr liegt im Wettstreit mit seiner erwachenden sexuellen Begierde. Zudem fehlen ihm auch sämtliche Mittel einer galanten Konversation, so dass er sich wie ein Pennäler verlegen mit den Händen über die Hosenbeine streift. Immerhin kann die Kamera hier auch einmal die Position Tartüffs einnehmen, dem sich die verführerische Elmire mit zurückgezogenem Kopf in ungewöhnlicher Position darbietet (0:48:25). In der anschließenden Einstellung zeigt sich eine ungewöhnliche Dreiecksfigur, die sich aus dem stehenden Tartüff, der diagonal hingestreckten Elmire und der Teekanne mit dem anamorphotisch verzerrten Antlitz Orgons, einer Spiegelung des neugierigen Lauschers hinter dem Vorhang, zusammensetzt (vgl. Abb. auf der Folgeseite). Im Vergleich mit der Gegenintrige der Rahmenhandlung, in der die Projektionsleinwand des Kinos in die (Bücher-)Wand eingelassen war, erweist sich die leibliche Präsenz Orgons hinter dem Vorhang als medialer Störfaktor, denn nur der Filmzuschauer kann »unsichtbar Zeuge« (Zwischentitel) sein.
81
Stefan Kleie
Doch zuvor wechselt Tartüff noch einmal in die Rolle des Don Juan. Die extrem stilisierte Straßenszene im Zeichen der übergroßen Laterne – ein optischer Höhepunkt des Films – erinnert an die vielen flüchtigen Begegnungen im Halbdunkel in Molières Drama bzw. Mozarts Oper, in der sich der Titelheld ja auch der Leidenschaft Donna Elviras zu erwehren hat; opernhaft auch Elmires Gefühlsausbruch und angedeutete Ohnmacht, die ornamentale Körperfiguren mit extremer Leidenschaft verbindet und damit den strengen Rhythmus des Schreitens endgültig durchbricht (0:52:24).
Ganz anders als die erste gestaltet sich die zweite Verführungsszene, die zugleich zur Enttarnungsszene wird. Der Verrohung Tartüffs, der sich an keine Konvention mehr gebunden glaubt, entspricht der Blick durchs Schlüsselloch, der als entmaterialisierter Blick in Analogie zum filmischen Blick nicht mehr an die leibhaftige Präsenz im Raum gebunden ist. Tartüffs plötzliches Vertrauen in die Sicherheit des Privaten (»Wer im Geheimen sündigt, sün82
Zur f ilmischen Restauration des Patr iarchats
digt nicht«) wird konterkariert durch die Missachtung der Privatsphäre im Blick der Kamera bzw. im Blick des von der Zofe Dorine angestifteten Orgon. Die Verdächtigung des Privaten arbeitet damit gleichzeitig an einer Legitimierung der Ausdehnung der Sichtbarkeit. Als Telepathie (»Sehet, damit Ihr geheilt werdet«) stellt sich der Film in die Reihe magischer Heilungspraktiken. In der Übertragung des kriminalistischen Wahrheitsanspruchs auf das Kino einerseits und im Anknüpfen an die an keine stabilen Zeichenrelationen mehr gebundene theatrale Verführung Elmires andererseits, entsteht jedoch auf der Bildebene der Tartüff-Handlung eine Spielbewegung, die die angestrebte Eindeutigkeit unterläuft. Erst durch die Stillstellung ihres Körpers, die hier zugleich zur Bloßstellung des Body of evidence vor dem ›kalten‹ Blick der kriminalistisch eingesetzten Kamera wird, kann die behauptete Evidenz der Sichtbarkeit aufrechterhalten werden. In der durch einen scharfen Schnitt hervorgerufenen Kontrastierung von Delinquent und Lockvogel wird diese Instrumentalisierung durch die Kamera deutlich (Übergang 0:56:38). Im Umkippen von der erotischen Verführung zur Androhung sexueller Gewalt löst sich der Blick der Kamera von der engen Anbindung an Elmires Gegenintrige und lässt diese damit als bloße Spielfigur mit weiblichen Körperbildern erscheinen. Der Preis für die Wiederherstellung der patriarchalischen Ordnung, die Orgon ja mehr schlecht als recht an Tartüff exekutiert, wird daher auch die in der Gegenintrige gewonnene Handlungsautonomie Elmires sein. Insofern erweist sich die Tartüfferie des fi lmischen Verfahrens weniger, wie Kracauer angenommen hatte, in der Publikumsschmeichelei, sondern viel eher in der Lenkung der Wahrnehmung im Sinne der mit dem Entlarvungsgestus verbundenen Evidenzprätention des Kinos. Der Blick durch das Schlüsselloch als »fi lmisches Emblem« 40 beendet und übertriff t das ambivalente theatrale Spiel der Intrige und führt in Verbindung mit der manipulativ eingesetzten Schriftlichkeit der Zwischentitel zur Restauration des eigentlich schon obsolet gewordenen Patriarchats. Die ›realistische‹ Rahmenhandlung liefert den Abschluss der Verhörsituation und die Beweisaufnahme im Tribunal gegen die Haushälterin, zu dem sich die Filmvorführung bald entwickelt hat. Zugerichtet wie für die Aufnahme ins Verbrecheralbum sitzt die Haushälterin in der Ecke zusammengekauert und wird tatsächlich vom Enkel-Impresario durch das plötzlich entfachte Licht wie durch kriminalistische Verhörmethoden geblendet (1:00:43, vgl. Abb. am Ende). Ihre momentane Verstörtheit, die durch die effektvolle Demaskierung des Enkels noch verstärkt wird, erlaubt die Sicherstellung des wichtigsten Beweismittels, des Giftfläschchens, was selbst den senilen Rat überzeugen muss. Nicht etwa die glückliche Zusammenführung des Enkels mit seinem Großvater, sondern die Entehrung der Haushälterin, die in der Verstossung und dem Verlachen durch die Kinder (1:02:04) liegt, bildet den logischen Ausgang eines Films, dessen Rahmenhandlung auf Verdächtigung und Entlarvung setzt. Die durch die mediale Inszenierung manipulierten Kinder offenbaren 40. J. Hetebrügge/N. Meyer: Murnau und sein Verhältnis zum Theater, S. 100.
83
Stefan Kleie
statt einer vermeintlichen Unschuld eine aggressive Gewalttätigkeit, die in eine tumultuarische Prangerszene mündet. Auch die Unschuld des Kinobesuchs wird erheblich getrübt durch einen suggestiven Appell zur Denunziation, der die spätere Funktion des Kinos als Propagandainstrument des totalitären Staates schon vorwegzunehmen scheint: »Und deshalb Du – weißt Du denn – – wer neben Dir sitzt???« (1:02:32) Abschließend ließe sich formulieren, dass im Zusammenspiel von Rahmen- und Haupthandlung die aus dem Theater Max Reinhardts übernommene Ästhetik des Festes dem filmischen Anspruch auf Zeugenschaft und Evidenz geopfert wird.
84
Metaphysik und Romanze Murnaus Faust Maik Bozza Für Klaus-Peter Philippi – und den Biber
Murnaus Faust ist ein Abschiedsfi lm. Als er am 26. August 1926 uraufgeführt wird, hat der Regisseur bereits die Dreharbeiten für Sunrise in den Staaten begonnen, zur offiziellen Premiere im Ufa-Palast Zoo am 14. Oktober 1926 schickt er Kabelgrüße aus Hollywood. Sein Mephisto, Emil Jannings, telegraphiert Glückwünsche von einer Reise mit dem Hochseedampfer Albert Ballin.1 Zuvor, am 14.08.1926 schon, geriet Murnaus Entwurf seiner amerikanischen Hoffnungen im Film-Kurier auch zum Resümee: »Ich liebe mein deutsches Vaterland über alles in der Welt, doch hier fühle ich die wunderbare Jugend und Frische eines Landes. Durch mein Werk hoffe ich, jener Jugend zu gefallen und das Herz Amerikas zu erreichen. Das ist mein Ehrgeiz. Wenn ich mir den Vergleich erlauben darf, so komme ich mir als Europäer, der nach Amerika kommt, wie ein Autofahrer vor, der vom ersten zum dritten ›gear‹ (Gang) umschalten muß. Ich versuche das zu tun, und will mein Bestes tun, um ein Werk zu schaffen, das all der Güte wert ist, mit der [s]ie mich jetzt überschütten.«2
Vor diesem Auf bruch versammelt der letzte im geliebten Vaterland gedrehte Film eine geschlossene, dichte Welt der deutschen Volkssage.3 Faust inszeniert 1. Vgl. Fred Gehler/Ullrich Kasten: Friedrich Wilhelm Murnau, Berlin (Ost): Henschelverlag 1990, S. 117 u. David Gaertner/Sascha Keilholz: »Filmografie, Bibliographie«, in: Hans Helmut Prinzler (Hg.), Friedrich Wilhelm Murnau. Ein Melancholiker des Films, Berlin: Bertz 2003, S. 267-296, zu Faust S. 279f., hier S. 280. 2. Murnau in Film-Kurier v. 14.08.1926, zit.n.: F. Gehler/U. Kasten: Friedrich Wilhelm Murnau, S. 116f. 3. Im folgenden benutzt wird die DVD-Edition der restaurierten ›Inlandsfassung‹ des Films: Faust. Eine deutsche Volkssage, Deutschland 1926, Regie: Friedrich
85
Maik Bozza
das europäische Amalgam, speist seine Vision des düsteren Mittelalters aus Bildern und Geschichten der christlichen Metaphysik und Ikonographie, aus Bildsprachen der europäischen Malerei, mit Motiven und Erzählkonzepten aus der Faust-Dichtung. »Aus der Historia von D. Johann Fausten (1587) stammten beispielsweise die […] Flüge auf dem Zaubermantel; aus Christopher Marlowes The Tragicall History of the Life and Death of Doctor Faustus (um 1590) wurden die auch noch im Puppenspiel verwendeten widerstreitenden Stimmen eines guten und eines bösen Engels übernommen; der Besuch in Parma entsprach dem obligatorischen Mittelteil des Puppenspiels; das Motiv des Helfen-Wollens ging wohl auf Friedrich Maximilian Klingers Roman Fausts Leben, Taten und Höllenfahrt (1791) zurück; die Erneuerung des Paktes mitten in Fausts Euphorie hatte bereits Friedrich ›Maler‹ Müller 1776 zum Wendepunkt der Faust-Handlung gemacht; Fausts Aufenthalt auf einem Berggipfel war sowohl von Christian Dietrich Grabbe (Don Juan und Faust, 1829) als auch von Nikolaus Lenau (Faust. Ein Gedicht, 1836) verwendet worden.«4
Was dabei häufig als Fehler und Makel des Films herausgestellt wird, das Werk trage »die Maske einer konservativen Ästhetik, die aus dem imaginären Museum der christlich-abendländischen-deutschen Motiv- und Ideengeschichte schöpft«5, kann man auch als Teil eines bewußten wie hintersinnigen Maskenspiels lesen. Dies werde ich zunächst detaillierter herleiten und im zweiten Teil dann am Film ausführen.
I. Murnau schaff t eine fi lmgewordene Idee, einen fi ktionalen Entwurf der Alten Welt deutscher Kultur in einem versammelnden Nachruf. Einen Film in Fraktur – in Zeiten der diese Welt zunehmend auflösenden Moderne. Ohne sich ganz außerhalb dieser Welt zu verorten, ist er dabei offenbar empfindlich für den von Nietzsche beschworenen Bruch des Weltbilds nach dem Tod Gottes. Denn der Faustfi lm beschwört zwar ein Gefüge unter transzendentalem Obdach – aber er weist auch hin auf die Zwiespältigkeit der Deutungsgewalt, die die ›Himmelsmacht‹ dabei hat. Murnau erzählt einerseits eine LiebesgeWilhelm Murnau, DVD: Eureka Entertainment, UK 2006 (= Masters of Cinema Series 24; Two Disc-Edition). Sie weicht, gerade am Ende ungeahnt deutlich von der bisher häufig benutzten Fassung ab, die in der angegebenen Edition als ›Exportfassung‹ beigegeben wird. Auf Zeitangaben wird im folgenden verzichtet, auch aus den Zwischentiteln ohne Nachweis zitiert. 4. Günther Mahal: »Murnau, Hauptmann, Kyser. Zum Film ›Faust. Eine deutsche Volkssage‹«, in: ders., Faust. Untersuchungen zu einem zeitlosen Thema. Neuried: ars una 1998, S. 568-577, hier Anm. 14 zu S. 569 auf S. 574f. 5. Thomas Koebner: »Der romantische Preuße«, in: H.H. Prinzler (Hg.): Friedrich Wilhelm Murnau, S. 9-52, hier S. 39.
86
Metaphysik und Romanze
schichte (die aus heutigen Augen Kitsch ist) und andererseits die Geschichte einer christlich-metaphysischen Welt, die sich dieser Liebe bemächtigt. So ist die gezeigte Welt auch immanente Reminiszenz, wenn die Macht der metaphysischen Gewalt mit ihrer Erhöhung Gretchens und Fausts und dem Schlußwort Liebe letztendlich durch ein Rezeptionsangebot ausgehöhlt wird: eben Erhöhung und Schlußwort zu verstehen als nachträglich vereinnahmendes, der Liebe zwischen Faust und Gretchen äußerliches Diktum! Es soll gezeigt werden, wie Murnau aus der traditionellen Interaktion und dem Antagonismus zweier ›Welten‹ über die in Faust jeweils mit ihnen identifizierten kinematographischen ›Prinzipien‹ für den denkenden Blick eine hermeneutische Brunnentiefe erzeugt, die nach bildungsbürgerlichen Kriterien eigentlich kaum woanders als im absoluten deutschen Charakter Faust und dessen Schöpfung durch Goethe gefunden werden dürfte. Diesen Anspruch nämlich formuliert die zeitgenössische deutsche Kritik, ohne dabei das ästhetische Vermögen der Kunst der bewegten Bilder ernstzunehmen. Beinahe durchweg charakterisiert sie den Film als unsymphatisch, befremdlich und dumm und mißt ihn unabdingbar an Goethe: »Fausts Schicksal ward durch Goethe zum geistigen Schicksal erhoben, nicht wiederzugeben im Film«, urteilt Kurt Pinthus;6 in der Literarischen Welt schreibt Willy Haas: »[Murnau] wollte unbewußt das Universalistische des Goethe-Faust, die ungeheure stilistische Vielfalt durch eine Summierung filmhafter Intentionen widerspiegeln; ohne daß die Summe, die unendlich große Summe eines Goetheschen Geistesuniversums, die jene stilistische Universalität erst erfordert und rechtfertigt, da war, da sein konnte.«7
Die Grundlage dieser dem Film so wenig gerecht werdenden zeitgenössischen Urteile, so erklärt es Fritz Göttler,8 sei die Oberflächenphobie des schriftfixierten, sich ins Klassiker-Dogma flüchtenden Intellektualismus:
6. Kurt Pinthus in Das Tage-Buch Nr. 43 v. 23.10.1926, zit.n.: Ilona Brennicke/ Joe Hembus: »Faust. Eine deutsche Volkssage«, in: dies., Klassiker des Deutschen Stummfilms 1910-1930, München: Goldmann 1983, Sp. 130a-133b, hier Sp. 133a. 7. Willy Haas in Die Literarische Welt Nr. 44 v. 29.10.1926, zit.n.: Jacques Aumont: »›Mehr Licht!‹ Zu Murnaus ›Faust‹ (1926)«, in: Franz-Josef Albersmeier/Volker Roloff (Hg.), Literaturverfilmungen, Frankfurt a.M. 1989, S. 59-79, hier S. 62. (Eine Zusammenfassung der zeitgenössischen Kritiken zu diesem Punkt bei G. Mahal: Murnau, Hauptmann, Kyser, S. 569.) Dies Urteil wirkt lange nach. Selbst im Band zur MurnauRetrospektive der Berlinale 2003 findet sich in einem Text Thomas Koebners (Der romantische Preuße, S. 37) eine späte Abschattung: »im Œuvre Murnaus bestand durch diese Wahl [des Faust-Stoffes] ein Zwang zur Meisterschaft. Das Projekt konnte nicht gelingen.« 8. Nicht ohne den Faust selbst mit den Worten »kein Gesamtkunstwerk, gewiß« zu kommentieren (Fritz Göttler: »Kommentierte Filmografie«, in: Friedrich Wilhelm Murnau (= Reihe Film 43, hg.v. Peter W. Jansen u. Wolfram Schütte in Zusammen-
87
Maik Bozza
»Der Blick hindurch, der Blick dahinter, der sich nicht fangen und verführen läßt von den Oberfl ächen: das ist die alte Vorstellung der Intellektuellen, wenn sie an ihre Arbeit denken und dem Kino mißtrauen, das ihnen dabei in die Quere kommt. Daß man die Perspektive wechseln kann von einer Einstellung auf die andere, in einer Einstellung gar, das ist eine Erfahrung, die für manchen zu suspekt und revolutionär ist, eine Erfahrung, die Murnau, gerade im Faust, in jeder seiner Einstellungen reflektiert.«9
Falsch ist dieser Ansatz sicher nicht. Aber das Aufrufen des vermeintlichen Dualismus von intellektuellem und cineastischem Blick birgt eine Gefahr, die sich gut an der Tradition der Faust-Betrachtung Eric Rohmers und anderer enfants de la cinémathèque zeigen läßt. Rohmer widmet sich – und es ist eine große Leistung, von der auch dieser Text profitiert – mit hoher Präzision der Beschreibung der bildlichen und raumorganisatorischen Mittel und Verfahrensweisen, er erfaßt Murnau in der »absoluten Beherrschung aller Details, die zum bildlichen Ausdruck beitragen, und einer Erfindungskraft, die ständig neue Formen schaff t und zusammenfügt«. Dabei aber bleibt er stehen. So verhält Rohmer sich, von entgegengesetzter Seite kommend, ähnlich ausschließend wie die Goethe-Apologeten, wenn er darauf besteht, daß in Murnaus Faust »die bildliche Ausdruckskraft eindeutig den Vorrang vor der Handlung« habe,10 und damit die Gewichtung der Aufmerksamkeit wiederum einseitig vom inhaltlich-narrativen zum bildlich-technischen verschiebt.11 arbeit mit der Stiftung Deutsche Kinemathek), München, Wien: Carl Hanser 1990, S. 107-208, zu Faust S. 179-189, hier S. 182). 9. F. Göttler: Kommentierte Filmografie, S. 182f. 10. Die beiden französischen Bücher Rohmers aus dem Jahr 1977 sind versammelt in Eric Rohmer: Murnaus Faustfilm. Analyse und szenisches Protokoll, München, Wien: Carl Hanser 1980. Beide Zitate ebd., S. 9. Vergleichbar gelten im MurnauSonderheft der Filmfaust 1979 als Innovationen von »Murnau, Mayer und Freund« ausschließlich filmische Techniken, nicht ästhethische Kunst mit einem vielschichtigen Spiel zwischen histoire und discours: »Aus ihrem Schaffen kann man nicht nur, sondern muß man Kriterien für die gegenwärtige und zukünftige Filmarbeit übernehmen – in Kritik und Produktion. Es sind dies die ›Tiefenschärfe im Film‹, die ›bewegliche Kamera‹ und die ›inszenierte Einstellung‹. Kann man ohne ihre zukünftige Anwendung in Kritik und Produktion, noch ernst genommen werden? Die Krise des deutschen Films ist eben auch eine seiner Geschichtslosigkeit in Filmregie und Filmkritik! Wenn die Geschichte nicht dazu da ist, daß man von ihr lernt – warum dann Geschichte machen? Wer meint, ungestraft über die getane Arbeit anderer auf Dauer einfach hinweggehen zu können, irrt. Er zahlt mit seinem Charakter, seiner Glaubwürdigkeit und endet in der Geschichtslosigkeit.«, Bion Steinborn: »F.W. Murnau – der deutsche Virtuose der kinematographischen Mittel oder Die drei Bedingungen für Filmregie und Filmkritik«, in: Filmfaust 2 (1979), Heft 12, S. 2-21, hier S. 18f. 11. Vgl. etwa: »Rohmers Murnau-Rezeption ist die Lektüre der reinen Form unter Ausblendung des Dramas.«, Klaus Kreimeier: »Das Drama und die Formen. Versuch über einen Melancholiker«, in: Friedrich Wilhelm Murnau 1888-1988. Ka-
88
Metaphysik und Romanze
(Die scharfe Diskussion in der Nouvelle Vague um das Verhältnis von literarischen Vorlagen und unabhängiger Innovation des Films, läßt sich schon zuvor in François Truffauts Streitschrift Une certaine tendance du cinéma français 12 verfolgen.) – Einer Zusammenführung von formalen, technischen Charakteristika mit inhaltlichen, erzählten, narrativen Gehalten, zeit-, medien- oder fi ktionshistorischen Momenten gar, geht auch Rohmer leider aus dem Weg. Faust, so möchte ich dagegensetzen, zeigt, in Interaktion mit dem inhaltlichen Antagonismus zwischen Gretchenhandlung und Weltspiel, einen Umbruch innerhalb derjenigen kinematographischen Konzeption von Bildlichkeit, die in cineastischen Texten häufig als ›expressionistisch‹ bezeichnet wird. Terminologisch ist dies gefährlich, weil der auf den Film angewendete Begriff schnell mit dem kunst- und literaturhistorisch etablierten verschwimmt. ›Expressionistisch‹ meint in cineastischem Bezug, daß solche Filme durch Doppelbelichtungen etwa oder andere Tricktechnik zustandegekommene Bilder zeigen (Rohmer sagt »Erscheinungen« 13), die als natürlicher Seheindruck für Menschen in der realen Welt nicht vorkommen und demgemäß, im Film gesehen, erst als Ausdruck von etwas verstanden werden müssen. Dies ist es, was Rohmer 1948, schon von der Warte des zukünftigen Bildproduzenten her argumentierend und so häufig mißverstanden, formuliert hat: »[D]er Begriff Expressionismus […] bezeichnet […] die Bemühung um eine Übertreibung im Ausdruck, die dazu bestimmt ist, nicht quantitativ dessen unmittelbare Kraft zu steigern, sondern ihn mit einer anderen Bedeutung auszustatten, gestützt sozusagen auf die immanente Bedeutung, die er in der Wirklichkeit besitzt, ohne daß sie Gefahr liefe, in ihr aufzugehen.«14
Faust arbeitet nun nicht nur sehr stark mit der ›expressionistischen‹ Doppelbelichtung und ähnlichen tricktechnischen Bildverfahren, er vollzieht auch eine Wende innerhalb dieses fi lmischen Expressionismus: Von den tricktechtalog zur Bielefelder Ausstellung 1988, Red.: Klaus Kreimeier, Bielefeld: BVA 1988, S. 88-97, hier S. 90a. Zur Kritik an Rohmers Konzeption vgl. auch Rainer Gansera: »Der Faustfilm und die Franzosen. Bemerkungen zu Eric Rohmers Buch über Murnaus Faust«, in: Friedrich Wilhelm Murnau 1888-1988, S. 77-87, hier S. 80b: »Zweifellos gibt es das [von Rohmer beschriebene, M.B.] Faszinosum [der Form, M.B.], aber die Ästhetik, die Wirklichkeit des künstlerischen Gebildes, beginnt im Darüberhinaus. Als Faszinosum ist das ästhetische Ereignis kein ästhetisches, sondern ein Naturereignis.« 12. Erschienen in Cahiers du cinéma Nr. 31, Januar 1954, S. 12-29; vgl. François Truffaut: »Eine gewisse Tendenz im französischen Film«, in: ders., Die Lust am Sehen, Frankfurt a.M.: Verlag der Autoren 1999, S. 295-313. 13. E. Rohmer: Murnaus Faustfilm, S. 67. 14. Maurice Schérer (d.i. E. Rohmer): »Le cinéma, art de L’espace«, in: La Revue du Cinéma Nr. 14, Juni 1948, hier zit.n.: »Was denkt Eric Rohmer zu Murnau. Gespräch mit Frieda Grafe und Enno Patalas«, in: Friedrich Wilhelm Murnau (= Reihe Film 43), S. 70-106, hier Anm. 3 zu S. 77 auf S. 103.
89
Maik Bozza
nischen Bildern, die vom (sich natürlich der Fiktionalität bewußten) Zuschauerblick verstanden werden sollen als Abbild einer phantastischen, übernatürlichen Welt, hin zum Bild, in dem tricktechnisch erzeugte, nicht als natürlich rezipierbare Elemente immer als Ausdruck einer menschlichen emotionalen Bewegung oder Vorstellung, als Traum, Imagination oder Vision etc. verstanden werden sollen.15 Dies ist ein Umschlag von Phantastik zu Emotionalität, von Metaphysik zu Romanze. Die Romanze ist Fausts und Gretchens Liebe;16 sie ist tendenziell in gleichmäßig ausgeleuchteten Szenen gefilmt, die gewissermaßen einen ›weichgezeichneten‹, insofern idealisiert-geschönten fi lmischen Realismus vorprägen – mit ihr verbunden sind tricktechnisch erzeugte Bilder, die vom Rezipienten als psychologisch motiviert zu verstehen sind. Die metaphysisch stratifizierte, phantastische Welt ist die von Engel und Mephisto; sie ist überwiegend in starker Modulation von Hell und Dunkel gefi lmt, die überreich eingesetzten Trickbilder sollen hier verstanden werden als Abbild der Phantastik der dargestellten, erzählten, gezeigten Welt! Diese Entgegensetzung der Bildkonzepte im Faust ist auch Rückblick Murnaus auf das eigene Werk und Vorschau auf seine künftige Entwicklung: Auf der einen Seite steht der Murnau des Nosferatu. Schon Rohmer führt beide Filme unter dem Prinzip der Ausnutzung der Tricktechnik, besonders der Doppelbelichtung, zusammen: »Im Faust, in dem es (mehr noch als im Nosferatu) um Zauber geht, erfährt dieser Prozeß [der Bildmontage, M.B.] seine äußerste Zuspitzung. Kein natürliches Gesetz kontrolliert hier das Auftauchen einer Form, eines Gegenstandes, eines neuen Wesens im Innern des Films. Herrschendes Gesetz sind die ›Erscheinungen‹, Produkt des ersten Tricks der Filmgeschichte.«17
15. Es verlockt, die an Balázs Sichtbarkeitskonzeption angelehnte Beschreibung von Jacques Aumont, im Faust werde der »Film endlich zum Träger von Begriffen und inneren Erfahrungen« (J. Aumont: ›Mehr Licht!‹, S. 76), assoziativ in Zusammenhang zu bringen mit einer der beiden kinematographischen Ebenen im Faust. Dazu aber bleibt Aumont zu vage. 16. Der Begriff ›Romanze‹ soll dabei nicht darüber hinwegdeuten, daß es innerhalb der Liebesgeschichte auch problematische Züge gibt, etwa die symbolischen Bilder von Fausts aggressivem Öffnen des von Gretchen von innen zugehaltenen Fensters zu Beginn ihrer gemeinsamen Liebesnacht. 17. E. Rohmer: Murnaus Faustfilm, S. 67. In seinem kurzen Kapitel »Szenengliederung und Montage« (ebd., S. 66-72), dem das hier zitierte entstammt, scheidet er auch zwischen »eigentlichen Erscheinungen, den ›übernatürlichen‹, durch Tricks bewerkstelligten« und »Visionen […], als einfache, von Mephisto hervorgerufene Halluzinationen […], oder […] durch Gewissensbiss bewirkte Phantasien und Wahnvorstellungen« (ebd., S. 70). Insofern legt Rohmer in der technischen Beobachtung das zugrunde, was auch meiner Analyse zentral ist, er führt es aber nicht zusammen mit der Erzählung des Films, mit den erzählten Welten der Transzendenz von Engel und Teufel und der privaten Liebe von Faust und Gretchen.
90
Metaphysik und Romanze
Auf der anderen Seite bewegt sich Murnaus Kino mit Filmen wie Sunrise hin zu einem zunehmenden fi lmischen Realismus, in dem das tricktechnische Bild nur noch psychologisch-emotional gerechtfertigt ist, oder mit Tabu zu einem fingierten Dokumentarismus, in dem solche Bildtechnik dann zunehmend unbenutzt bleibt.18 Auch vor diesem Hintergrund ist Murnaus Hinweis auf einen historischen und biographischen Wechsel cineastischer Moden spannend: »Ich folgte dem Angebot nach Hollywood, weil ich glaubte, daß man immer noch etwas lernen kann und mir Amerika neue Wege bot, meine künstlerischen Pläne zu verwirklichen. Wie ich das meine, zeigt am besten mein Film ›Sonnenaufgang‹.«19
II. Mit einem ganz anderen ›Sonnenaufgang‹ hatte Faust geendet. Faust und Gretchen werden, in einem hellen pulsierenden Lichtkranz langsam schwebend, in den Himmel geholt. Wie das? Im Nachspiel im Himmel erklärt der weiße Engel dem trotzig protestierenden Mephisto: Durch das wirkende Wort Liebe! »Das Wort, das jubelnd durch die Schöpfung schallt, das Wort, das jeden Schmerz und Kummer stillt, das Wort, das alle Menschenschuld versühnt« ist dann der pulsierende Kern in der strahlengekränzten, sonnengleichen Ideologie-Monstranz gegen Ende des Faust-Films. So eindrücklich und vereindeutigend scheint dies zu wirken, daß Helma Sander-Brahms 2003 im Band zur Murnau-Retrospektive der Berlinale zusammenfaßt: »Diesen Faust mit dem wallenden Bart und den tiefen Falten kann Gretchen, das den jugendlichen Faust liebte, zunächst nicht erkennen – und erkennt ihn dann doch, weil ihre Liebe sie alles verstehen und verzeihen läßt. Und damit reißt sie Faust zu sich aus den Armen der Verdammnis, und der weiße Engel triumphiert über das Dunkel, und Fausts Pakt mit dem Bösen ist zerrissen. Die Liebe ist die siegreiche
18. Wobei damit keine harsche Trennung im Werk behauptet werden soll, denn diese beiden Motivationen von bildlichem Ausdruck kennen sowohl Zwischenstufen und Uneindeutigkeiten als sie auch jeweils werkhistorisch vor und nach Faust vorkommen. So ist die ›realistische‹ Bildlichkeit mit psychologisch-emotiver Begründetheit gerade etwa im Letzten Mann vorherrschend. 19. F.W. Murnau in: Filmkünstler. Wir über uns selbst, hg.v. Dr. Hermann Treuner, Sibyllen-Verlag: Berlin 1928, zit.n.: F. Gehler/U. Kasten: Friedrich Wilhelm Murnau, S. 117. Vgl. auch Murnaus Hinweis: »Ich glaube, daß Filme der Zukunft lieber Personen zeigen werden als Leinwand-Helden, Humanität anstelle populärer Film-Stars.«, F.W. Murnau: »Filme der Zukunft« (1928 als »Films of the Future«), in: Filmfaust 2 (1979), Heft 12, S. 24-30, hier S. 26 (auch in: F. Gehler/U. Kasten, Friedrich Wilhelm Murnau, S. 144-150, hier S. 145f.).
91
Maik Bozza
Kraft, die die Energie des Lebens weiterträgt, den Tod überwindet und die Gegensätze auflöst.«20
Murnaus Film allerdings endet, freilich ist dies auch Konvention, lakonisch mit »Ende«! Nicht mit dem im Bild blinkenden »Liebe« oder etwa einem ›Amen‹. Denn: Vor dem himmlischen Eingreifen erzählt der Film eine Liebesgeschichte zu ihrem eigenen Ende. Im Moment größter Not springt der nun wieder alte Faust zu Gretchen auf den Scheiterhaufen: sie sieht ihn an, erkennt ihn einen Moment lang nicht. Dann wird der greise Faust in ihrem Blick zu ihrem jungen Buhlen – so muß man die Verwandlung wohl deuten und den Doppelbelichtungstrick der Filmbilder als Ausdruck der Liebe im Blick Gretchens verstehen.
Dann sehen sie einander tief in die Augen, Gretchen neigt ihren Kopf, sie küssen sich. In diesem Blick, diesen Gesten und Handlungen sind Faust und Gretchen emotional wieder vereint, wie sie es vormals in ihrem Liebesidyll in Marthes Garten waren. Umringt und geeint vom Ringelreihen der Blumenkinder, hatten sie einander auch dort tief in die Augen gesehen und geküßt. In dieser Rückkehr zum vormaligen Glück überspringen Faust und Gretchen all die mephistophelischen Intrigen und Verhinderungsstrategien, die ihnen zuvor widerfahren waren. Dreimal zuvor hatte Grete Mephistos Griff um Faust bereits gelockert: Nach der sexuellen Erregung der Parma-Episode verfällt Faust der Melancholie und findet kein Sehnsuchtsziel außer der Rückkehr zur »Heimat«, aus deren Enge und Bedrohung er sich, nach dem gescheiterten Versuch die Pest zu bekämpfen, von Mephisto hatte retten lassen. Widerwillig, aber vertraglich gezwungen, kehrt Mephisto mit ihm zurück. In seiner alten Heimat begegnet Faust, direkt am Kirchenportal, Gretchen – sehr zum Mißfallen des sich direkt von ihr bedroht fühlenden Mephisto (wie man Jannings Spiel deutlich ablesen kann). Sofort entbrennt Faust für sie und zwingt Mephisto, ihm bei der Werbung um sie behilflich zu sein.21 Aus dieser ersten entwickelt sich dann auch die zweite Subversion gegen Mephistos Einfluß: Vom Schmuck 20. Helma Sander-Brahms: »›So deutsch, so schön‹«, in: H.H. Prinzler (Hg.): Friedrich Wilhelm Murnau, S. 185-188, hier S. 188. 21. Zu diesem Zeitpunkt hat Mephisto die Chance, die Gretchen für seine Belange sein könnte, noch nicht erkannt. Dies beginnt erst mit dem Geschenk, das er Faust für Gretchen bereitstellt.
92
Metaphysik und Romanze
entzückt, den sie von Faust bekommen hat, läuft Gretchen zu Marthe. In ihrem Garten begegnet sie schließlich Faust zum ersten Mal gelassen. Hier findet der Film, sowohl inhaltlich für Faust und Gretchen als auch diskursiv kinematographisch, zu seiner zentralen Szene: zum Liebesidyll Gretchens und Fausts. Räumlich und zeitlich beinahe abgeschlossen, ist dieser Liebesgarten, in dem blühender Frühling herrscht und Blumenkinder Reigen tanzen, der topische locus amoenus. Das eigene, beruhigte Reich des privaten Glücks reflektiert sich auch in der merklich zurückgenommenen Modulation des Lichts im Vergleich zum vielzitierten Hell-Dunkel-Spiel in den metaphysisch-phantastischen Teilen des Films. Die Kamera konzentriert sich in weichgezeichneten Bildern und nahen, großen Aufnahmen auf die Gesichter, die Küsse, die Blicke von Faust und Gretchen.22 Gretchen sitzt links auf einer Bank, Faust kniet rechts davor, umfaßt ihre Hände, steckt ihr einen Ring an, verspricht ihr seine immerwährende Liebe,23 sie küssen einander innig.
Aus diesem Glück speist sich der Film im folgenden zweimal: In seiner Audrücklichkeit besonders deutlich ist der Bezug zu diesem Idyll, als Gretchen im Kerker sitzt. Sie wartet auf ihre Hinrichtung, bindet aus dem Stroh in der Zelle einen Blumenkranz, wie sie das mit den Kindern im Garten getan hatte, als sie Faust dort traf. Dann imaginiert sie sich in diesen Garten Marthes, der Film zeigt wieder ein emotional zu rezipierendes Trickbild, indem er Gretchen im Kerker und Gretchen im Garten ineinander ›blendet‹.24 22. Vgl. E. Rohmer: Murnaus Faustfilm, S. 204-207 (Szenen 428-450). 23. Zentral ist hier der intime Rahmen des Liebesversprechens. Ein Bezug auf
eine himmlische Macht besteht nicht, es ist keine ›Ehe‹ vor Gott, sondern Liebesversprechen für- und voreinander. Im Kontext der späteren Himmelfahrt ist es wichtig, dies zu vermerken. 24. Tatsächlich ist das filmische Verfahren wohl eine Kombination aus Überblendung und Doppelbelichtung. Vgl. E. Rohmer: Murnaus Faustfilm, S. 230f. (Sze-
93
Maik Bozza
Dort lächelt Gretchen dann, »neigt den Kopf leicht nach hinten, während Faust aus dem Hintergrund rechts herantritt, mit geöffneten Armen auf sie zugeht und sie umarmt, als sie sich zu ihm umdreht. Sie küssen sich lange.«25 Der zweite, diesmal nicht bildliche, sondern eher über die Wiederholung der Handlung vermittelte Bezug zum Glück des Gartenreichs besteht in der bereits erwähnten Szene, in der Gretchen den alten als ihren jungen Faust wiedererkennt. Die Konstellation wiederholt sich, Gretchen steht wieder links im Bild, Faust kniet rechts, dann küssen sie einander wieder wie zuvor.
Filmbildlich ist Fausts Verjüngung im Blick Gretchens der letzte Schritt in einer Reihe von Szenen, in denen ›expressionistische‹ Trickaufnahmen emonen 570-572): »Jetzt blendet über die ganze Fläche der Einstellung in Doppelbelichtung eine Ansicht von Frau Marthes Garten auf und läßt den Dekor des Gefängnisses verschwinden; Gretchens Gestalt jedoch bleibt, um sie herum beginnt [die Handlung]«. 25. Ebd., S. 231 (Szene 571).
94
Metaphysik und Romanze
tional bzw. als psychologisch gerechtfertigt zu verstehen sind – und die damit dem mit Mephisto und der Metaphysik verbundenen Bildkonzept entgegen-, bzw. in Konkurrenz zu ihm stehen. Vorausgegangen ist eine Doppelbelichtungsszene, die eine Seelenbewegung, eine innere Kommunikation zwischen den Liebenden vermittelt: Als Grete, indem die Stadtwachen sie dafür gefangennehmen, bewußt wird, daß ihr Kind gestorben ist, befähigt sie dies Elend und Grauen zu einem inneren Ruf nach Hilfe: Ein Schrei, der Bild wird! Die der »extremen Großaufnahme ihrer aufgerissenen Augen und ihres schreienden Mundes«26 folgende Doppelbelichtung macht die vielleicht eindrucksvollste Bewegung des frühen Kinos aus: das über die Landschaft zu Faust dringende, schreiende Gesicht Gretchens, das Faust aus der zweiten Melancholie reißt und ihn motiviert, ihr gegen alle Widerstände Mephistos beizustehen. Hier steht der phantastischen (Bild-)Macht Mephistos eine emotionale (Bild-)Macht entgegen! Wie sehr Mephisto zuvor inszenatorische Gewalt hatte, belegt etwa das Finale der Parma-Episode: In einem schwarzen Raum entzündet Mephisto das Licht eines Hängeleuchters und setzt ihn dann in Bewegung.27 So beleuchtet er den Ort der Handlung und inszeniert in der pendelnden Lichtbewegung das Verrinnen der Probezeit des Pakts zwischen ihm und Faust. Mit dieser Probezeit droht Faust seine künstliche Jugend gerade in dem Moment abzulaufen, in dem er sich mit der Gräfi n von Parma aufs Lager des dunklen Reichs zurückziehen will. Mephisto zeigt Faust die leere Sanduhr und das Bild seines zurückzuerwartenden greisen Ich. In diesem von Mephisto geschickt gewählten Moment schlägt Faust, überwältigt vom Verlangen, endgültig in den Pakt ein. Ein weiteres Mal folgen Bilder der Inszenierungsgewalt Mephistos und vermitteln dabei auch dessen diebische Freude über das Erreichte: Über dem samtenen schwarzen Himmel des Betts, in dem Faust und die Gräfi n sich küssen, dominiert der schwarze Engel, verwehrt der Kamera mit dem Samt des Baldachins keusch den Blick auf den sich dort abspielenden Geschlechtsakt, indem er den Stoff wie einen Vorhang schließt und die Enden mit seinen Händen in unverhohlener Freude an sich zieht. Abseits dieser eigenen Inszenierungen ist Mephisto mit dem phantastischen, übernatürlichen Filmbild identifiziert. Besser: mit einem Bild, das nicht uneigentlich verstanden sein will, sondern als Abbild der phantastischen, metaphysisch wunderträchtigen Welt. Gleich zu Beginn wird das deutlich, wenn Mephisto, nach Faustens Teufelsbeschwörung am Kreuzweg, als Lichtkugel vom Himmel fällt und zum schelmisch von unten nach Faust äu-
26. Ebd., S. 228 (Szene 559); zur Beschreibung des gesamten folgenden Bildablaufs vgl. ebd., S. 228f. (Szenen 559-561). Auf eine oder mehrere Abbildungen wird hier verzichtet, weil Einzelbilder die Bewegung, auch in einer Folge gezeigt, kaum wiederzugeben vermögen. 27. Zur genauen Beschreibung der Szene vgl. ebd., S. 178 (Szene 272).
95
Maik Bozza
genden Wesen »in Gestalt eines grauwen Münchs«28 wird.29 Später zeigen die Bilder von Mephisto, wie er seine eigene Gestalt variieren kann: Seine dem greisen Faust als Mönchlein angemessene Erscheinung läßt eine zweite Form seines Selbst, diejenige des dem jungen Faust adäquaten, galanten schwarzen Junkers, auftauchen.
Einen Moment lang stehen die beiden Mephistogestalten nebeneinander, dann befiehlt der Junker den Mönch fort, der verschwindet, die Überblendung endet. Von vergleichbarer Bildlichkeit ist die Verwandlung Fausts, für die sich Mephisto durchs Pusten ins Feuer selbst raumfüllend aufpumpt. Auch die Szene, in der Mephisto als übergroße Fluchgestalt den Pesthauch über der Stadt niedergehen läßt, oder diejenige, in der der Teufel dem gegen den Furor der Massen anbetenden Mönch als beherrschende, in seine Spielzeugwelt hinabschauende Riesengestalt erscheint, könnten herangezogen werden, um 28. Hier inszeniert der Film deutlich, dies als Quervermerk zur eingangs gemachten Bemerkung zu den literarischen Quellen, die Historia von Johann D. Fausten, die als Motivation des Teufelsanrufs allerdings nicht Hilfswille, sondern »Fürwitz/ Freyheit vnd Leichtfertigkeit«, curiositas also angibt: »an einem vierigen Wegschied machte er mit einen Stab etliche Circkel herumb […]/Beschwure also den Teuffel in der Nacht […]/dann bald ein grosser Büchsenschuß/darauff ein Helle erschiene […] | Es ließ sich sehen/als wann ob dem Circkel ein Greiff oder Drach schwebet/ vnd fl atterte/wann dann D. Faustus seine Beschwerung brachte/da kirrete das Thier jämmerlich/bald darauf fiel drey oder vier klaffter hoch ein feuwriger Stern herab/ verwandelte sich zu einer feuwrigen Kugel […]. Bald darauff endert sich der Teuffel vnd Geist in Gestalt eines grauwen Münchs/kam mit Fausto zusprach/fragte/was er begerte.«, Historia von D. Johann Fausten. Text des Druckes von 1587. Kritische Ausgabe. Mit den Zusatztexten der Wolfenbüttler Handschrift und der zeitgenössischen Drucke, hg.v. Stephan Füssel u. Hans Joachim Kreutzer, ergänzte u. bibliograph. aktualisierte Ausg., Stuttgart: Reclam 2006, S. 15-17. 29. Dieser Mönch ist dann mit einer gespenstischen Ungebundenheit an Raum und Zeit und Befähigung zur Allanwesenheit ausgestattet. Dieser Eindruck wird allerdings nicht durch Trickbilder erzeugt, sondern durch die Unbewegtheit Mephistos innerhalb der Szenen. Im Gegensatz dazu bewegt sich Faust hastig, sowohl innerhalb der Szenerien als auch von Ort zu Ort.
96
Metaphysik und Romanze
das kinematographische Prinzip zu beschreiben, das mit Mephisto identifiziert wird. Hier geht es nicht um Vorstellungen von Handelnden, um Träume, Visionen, Gedanken, die bildlich dem Rezipienten vermittelt werden, sondern um den bildlichen Eindruck einer Welt, in der diese übernatürlichen Vorgänge stattfinden, eine Welt mit Engel und Teufel eben. Schließlich aber muß Mephisto gegen Gretchens Macht der Liebe antreten. Als Faust ihn, Gretchens Ruf folgend, zwingt, ihn zum Scheiterhaufen zu bringen, bleibt ihm nur ein letztes Machtmittel: Er nimmt seine Zaubereien zurück und Faust damit die Jugend – die Grundlage für die Liebe Gretchens, so anscheinend seine Vorstellung. Er irrt. Die Liebe zwischen Faust und Gretchen findet ihren Weg, die Bilder zeigen, wie sie einander erkennen und das Elend ihrer brennenden Körper in diesem Blick zur Romanze ihrer brennenden Liebe wird. Der Film der Liebesgeschichte ist hier zu Ende. Es folgt übergangslos die Erhöhung Fausts und Gretchens, die die Romanze heimholt, in die metaphysische Welt übernatürlicher Bilder. Diese Instrumentalisierung hatte sich in einer Bedeutungsschicht des Films angedeutet – in Bildern allerdings, die alle auch abseits der Aufladung mit christlichem Sinn innerhalb der erzählten Welt Sinn ergaben. Gretchen war im Film in seiner Amalgamierung bildlicher Konzepte der christlich-katholischen Symbolik beständig der Gottesmutter Maria beigeordnet worden. In der mittelalterlichen erzählten Welt steht Gretchen häufig neben, unter, bei Marien-Figuren, sowohl in der Kirche als auch in ihrem Zimmer. Und auch die Inszenierung der Bilder selbst läßt sich aus dieser Perspektive rezipieren, insofern diese sich häufig an Mariendarstellungen der alten und jüngeren Meister der bildenden Kunst anlehnen.30 Diese Annäherung bzw. Identifi kation zwischen Gretchen und Maria wird christologisch noch zugespitzt ausgeprägt. Begegnen Faust und Gretchen sich erstmals zu Ostern, damit in der Hoffnung auf Erlösung, wird Fausts und Gretchens Kind schließlich sogar doppelt mit dem Kind in der Krippe, mit Jesus identifiziert: zunächst vermittels einer zwischengeschnittenen weihnachtlichen Krippenspiel-Szene, die die Geburt des Gretchen-Kinds bildlich vertritt: »Im Vordergrund die Krippe. Die Muttergottes schräg von vorn, weiß gekleidet, hält in ihren Armen das Jesuskind, von Licht umstrahlt. Im Mittelgrund, von vorn gesehen, singt ein Kinderchor. Titel: Und hat ein Kindlein bracht im tiefsten Winter. Die Kinder singen. Abblende.«31 Später dann imaginiert Gretchen (der Film zeigt es wieder mit einer ihre Vision verbildlichenden Überblendung), daß sie, ausgelaugt von der nutzlosen Suche nach Hilfe und im Schnee hockend an »eine Mater Dolorosa«32 erinnernd, ihr Kind 30. Vgl. dazu im Ansatz Eva M.J. Schmid: »Magie der Zeichen. Murnau und die bildende Kunst«, in: Klaus Kreimeier (Hg.), Die Metaphysik des Dekors. Raum, Architektur und Licht im klassischen deutschen Stummfilm, Marburg, Berlin: Schüren 1994, S. 49-79, etwa: »Gretchen gleicht im Typ den Madonnen des Präraffaeliten Dante Gabriel Rossetti, nicht nur der Frau in ›Ecce ancilla domini‹«, ebd., S. 60f. 31. E. Rohmer: Murnaus Faustfilm, S. 224 (Szene 542). 32. Ebd., S. 227 (Szene 550). Kursivierung von mir, M.B.
97
Maik Bozza
in eine Krippe bettet. Als Maria bekommt, als Maria verliert sie ihr Kind: Der Tod des Kindes wird so, über den Bezug zum Leid der Gottesmutter, mit dem Tod Jesu assoziiert. Kurzum: Aus dem Blick der immanenten christlich-metaphysischen Kräfte und Bildschichten dieser im Faust gezeigten, ikonisch mittelalterlich kodierten Welt ist die finale Erlösung des Paares durch das wirkende Wort, »das jubelnd durch die Schöpfung schallt, das Wort, das jeden Schmerz und Kummer stillt, das Wort, das alle Menschenschuld versühnt« hochgradig schlüssig! Denn: »Daran ist erschienen die Liebe Gottes gegen vns/Das Gott seinen eingeborenen son gesand hat in die Welt/das wir durch jn leben sollen. Darinne stehet die Liebe/Nicht das wir Gott geliebet haben/sondern das er vns geliebet hat/vnd gesand seinen Son zur versönung fur vnser sünde«,
heißt es im ersten Brief des Johannes im Neuen Testament.33 Während für die beiden, Gretchen und Faust, die Liebe zueinander genug ist, sie sich im wechselseitigen Blick erkennen – auf dem Scheiterhaufen der mittelalterlichen Gerichtsbarkeit freilich und so im Tod –, bemächtigt sich die transzendentale Macht der Liebe des Paares, und zwar im neutestamentlichen Verständnis der Liebe als Gottesliebe. Aus dieser transzendenten Perspektive war schon der Tod ihres Kinds als Opfer Jesu lesbar. Nun beendet der Himmel seinen Wettstreit mit Mephisto um die Menschenseele Fausts (und damit die Erde) mit der Auffahrt des Paares im pulsierenden Lichtbogen.
33. 1. Joh. 4,9. Hier zitiert nach: D.Martin Luther: Die gantze Heilige Schrifft Deudsch. Wittenberg 1545. Letzte zu Luthers Lebzeiten erschienene Ausgabe, hg.v. Hans Volz unter Mitarbeit v. Heinz Blanke, München 1972, Bd. 2, S. 2428.
98
Metaphysik und Romanze
»Kannst Du in Faust das Göttliche zerstören: dein sei die Erde«, so lautete die Wettbedingung des Engels. Dieser metaphysischen Ideologie nach ist die Liebe von Faust und Gretchen der rechte Gebrauch der »Freiheit des Menschen: zu wählen zwischen Gut und Böse« und damit Grund für die Erhöhung und so den Sieg über Mephisto. Wie übernatürlich dieser Sieg ist, zeigen auch die Filmbilder. Häufig hat die Kritik gerade das Ende in seiner seltsamen und befremdlichen Künstlichkeit in den Blick genommen und, so etwa Aumont, die »äußere Abgeschlossenheit, die sich zudem noch fatalerweise auf ein ›Schlußwort‹ […] stützt, das sehr an ein ›Happy-End‹ denken läßt«, vermerkt. Die ›Künstlichkeit‹ läßt sich nutzbar machen, sie unterläuft dem Film nicht und sie ist nicht ›faules‹ Zugeständnis an die »kulturellen Anforderungen«34 des Faust-Sujets, sondern bildlich hintersinniger Kommentar. Die (vergleichsweise unbeholfen wirkende) tricktechnische Auffahrt in den Himmel35 wird von den umstehenden Schaulustigen der öffentlichen Verbrennung als real wahrgenommen. Angesichts dieses Wunders der Lichtwerdung fallen sie nämlich auf die Knie. Damit wird die Himmelfahrt doppelt mit derselben phantastischen Filmbildlichkeit identifiziert, die Mephisto zugeordnet war, und der das Bildkonzept einer psychologisch-emotionalen Bewegtheit der Liebe des Faust-Paars diametral entgegenstand. Faust und Gretchen haben sich in ihrem Blick ›erlöst‹. Die abschließende Erlösung im Wunder ist der Liebe, die sie einander schenken, nicht nur nachgeordnet, sondern auch äußerlich – es ist eine Erlösung für und in der Metaphysik des stark modulierten HellDunkel.36 Nicht Gretchen und Faust brauchen das transzendentale Obdach, das Obdach braucht sie zum Gewinn des metaphysischen Wettstreits. Murnaus Faust aber, es sei wiederholt, ist ein Abschiedsfi lm.
34. Beide J. Aumont: ›Mehr Licht!‹, S. 64. 35. Rohmers Untersuchung und Beschreibung liegt noch die am Ende sehr ver-
stümmelte Exportfassung oder eine fehlerhafte Kopie des Faust zugrunde, in der eine wirkliche, bildliche Auffahrt des Paars nicht zu sehen ist. Vgl. seine Beschreibung: »Plötzlich, wie durch einen Zauber, scheint die Flamme [des Scheiterhaufens, M.B.] sich in eine riesige Kugel zu sammeln, die konzentrische Ringe und dünne Strahlen aussendet, die das ganze Bild ausfüllen.«, E. Rohmer: Murnaus Faustfilm, S. 236 (Szene 612). 36. Filmhistorisch freilich obsiegen Faust und Gretchen gegen die Erlösung im Wunder: Der filmische Realismus wird zunächst die metaphysischen, dann allerdings auch die emotionalen ›Erscheinungen‹ von den Filmrollen verbannen, das Spiel, Gesichter und Handlungen werden ganz für sich sprechen.
99
Metropolis – ein Labyr inth zwischen Chaos und Ordnung Sascha Keilholz
Immer wieder Metropolis.1 Zunächst ein Gegenstand für die noch junge Filmkritik,2 die Filmsoziologen, dann zunehmend für die Filmhistoriker. Fritz Langs 1927 uraufgeführten Stummfi lm gegenwärtig wieder zu sehen, bedeutet auch, die vielen Nachfolger, die sich im Zitat, Pastiche etc. auf das Original beziehen, mitzudenken. So funktioniert Metropolis heute unter anderem als spiegelverkehrte Abbildung unserer eigenen Kinosozialisation.3 Kaum ein Film ist in der Forschung derart ausgewertet wie Metropolis. Über den Klassiker zu schreiben, zieht zwangsläufig die Rekonstruktion einer ganzen Wissenschaftsgeschichte nach sich. Allein Siegfried Kracauers ideologiekritischer Ansatz in seinem Opus Magnum Von Caligari zu Hitler4 kann als Ausgangspunkt einer solchen Ausrichtung dienen. Neben der sich daran anschließenden Diskussion weisen sich viele Analysen des Films als Genre-Untersuchungen aus. Gemeinsam mit Frau im Mond (1929), Langs übernächstem Projekt, fungiert Metropolis als Inventar des Science-FictionKosmos.5 Darüber hinaus gilt Metropolis vor allem für drei Forschungsfelder als 1. Metropolis, Deutschland 1927, Regie: Fritz Lang, DVD: neu restaurierte Fassung mit Originalmusik, Universum Film, BRD 2003 (= Deluxe Edition, Transit Classics). 2. Als Überblick sei der Berlinale-Begleitband empfohlen: Rolf Aurich/Wolfgang Jacobsen/Cornelius Schnauber (Hg.): Fritz Lang. Leben und Werk. Bilder und Dokumente. 1890-1976, Berlin: Jovis 2001. 3. Diesem Umstand trage ich in den Anmerkungen und zwei Exkursen Rechnung. 4. Siegfried Kracauer: Von Caligari zu Hitler. Eine psychologische Geschichte des deutschen Films, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1984. 5. Vgl. Guntram Geser: Fritz Lang – Metropolis und Die Frau im Mond: Zukunftsfilm und Zukunftstechnik in der Stabilisierungszeit der Weimarer Republik, Meitingen: Corian 1996.
101
Sascha Keilhol z
Standardgegenstand: Kaum eine wissenschaftliche Publikation über Topographie, Architektur und Großstadt im Film, die es sich leisten würde, auf Langs Klassiker zu verzichten. In meiner Auseinandersetzung möchte ich sowohl die Genre- als auch die historisch-soziologische Lektüre vernachlässigen und letzteren Komplex fokussieren. Dabei begreife ich meinen Gegenstand als Autorenfi lm im besten Sinne. Zunächst möchte ich also das Naheliegende tun und Metropolis als Stadtfi lm betrachten. Mein Blick gilt den formalästhetischen Strukturen wie sie Klaus Kreimeier in seinem Aufsatz Strukturen im Chaos. Wie Fritz Lang Ordnung in den Dschungel bringt 6 untersucht hat: »›M‹ ist weder ein dokumentarischer, noch ein psychologischer Film, sondern zuallererst eine hochartifizielle Konstruktion. Ein abstraktes Gebilde, das von Ordnung und Ordnungen handelt, und das selbst von Ordnungsmustern – bis in die Einzelheiten, Bildkadrierungen und Kameraperspektiven hinein – durchdrungen ist.«7 Ganz ähnlich verhält es sich bei Metropolis. Kracauer zählt Langs Werk zu den Tyrannenfi lmen. Ein Typus, der für ihn immer auch die Frage nach dem Dokumentarischen aufwirft, in doppelter Hinsicht, wie bezüglich Dr. Mabuse, der Spieler – Ein Bild der Zeit (1922) klar wird: »Er ist keineswegs ein Dokumentarfi lm, sondern ein Dokument seiner Zeit.«8 Auch Kracauer untersucht die ästhetische Struktur, wenn er auf den »Ornamentalcharakter«9 des langschen Œuvres eingeht: »In Nibelungen hatte sein dekorativer Stil eine vielfältige Bedeutung; in Metropolis erscheint das Dekorative nicht nur als Selbstzweck, sondern unterläuft sogar gewisse, mittels der Handlung getroffene Aussagen. […] In seinem unbedingten Willen zur Ornamentalisierung scheut Lang nicht davor zurück, dekorative Muster aus jenen Massen zu bilden, die verzweifelt der Überflutung der Unterstadt zu entfliehen suchen.«10
Im Gegensatz zu Kracauers Idee, diesen zweiten Teil von Metropolis als Fortführung der Anfangsbilder zu begreifen, möchte ich ihn vielmehr als deren Spiegelung und Umschreibung deuten. Anschlussfähig sind meine Thesen an Hermann Kappelhoffs Untersuchung von James Camerons Titanic, der Langs Auf bau übernimmt und über6. Klaus Kreimeier: »Strukturen im Chaos. Wie Fritz Lang Ordnung in den Dschungel bringt«, in: Irmbert Schenk (Hg.), Dschungel Großstadt. Kino und Modernisierung, Marburg: Schüren 1999, S. 57-67. Der gesamte Band kreist bezeichnender Weise um Lang, vor allem um M – Eine Stadt sucht einen Mörder (1931) und Metropolis. 7. Ebd., S. 58. Kreimeier zeigt auf, wie sich Inhalt und Struktur bei dem Kindermörderfilm entsprechen, wie von psychischen und gesellschaftlichen Dispositionen abstrahiert wird und die Abstraktionen in der Bildsprache eine Entsprechung finden. Ähnliches lässt sich auch bei Metropolis beobachten. 8. S. Kracauer: Von Caligari zu Hitler, S. 89. Vgl. auch S. 91 und S. 100. 9. Ebd., S. 102. Auf den folgenden Seiten geht er darauf noch näher ein. 10. Ebd., S. 159.
102
Metropolis – ein Labyr inth zwischen Chaos und Ordnung
trägt: »Die Bilder des Untergangs – das steigende Wasser, die einbrechenden Bordwände, die stürzenden Gegenstände – gehorchen einer strengen Choreographie, deren rhythmische Ornamentik wie in einem Revuefi lm eng mit dem Score verknüpft ist.«11 Um diese Struktur nachzuvollziehen werde ich die Exposition und das Finale (furioso) des Films einem close reading unterziehen. Vor dem Hintergrund von Kracauers Kritik am Ornamentalcharakter langscher Bilder möchte ich Kappelhoffs und Kreimeiers Ansätze bei meiner Metropolis-Analyse fusionieren. Wie sieht die bildliche Textur der fi lmischen Großstadt in ihrer formalen Gestaltung aus und welche dramaturgischen Strukturen finden darin ihre Entsprechung? Die Dichotomie Ordnung/Chaos soll als strukturierendes Prinzip der Großstadt und des Films begriffen werden. Wie sehr der Film solchem Konzept Rechnung trägt, soll an der spezifischen Chronologie der Ereignisse gezeigt werden. Übergeordnet ist dieser Fragestellung eine Untersuchung labyrinthischer Konzepte.
Stadtraum : Langs ver tikale Kinokonstruktion Der 2001 erschienenen rekonstruierten 118-minütigen Fassung12 von Metropolis sind 55 Sekunden Texteinblendung vorangestellt. Die Titelsequenz ist statisch, ehe bei 0:01:40 Musik einsetzt. Parallel zu dieser auditiven Bewegung fährt die Einblendung der Darstellernamen nach oben. Den Abschluss der Titelsequenz markiert ein graphisches Trickverfahren, das den Film auf mehreren Ebenen kennzeichnet. Auf dem schwarzen Bilduntergrund werden verschiedene Flächen sichtbar. Lang arbeitet mit Kontrasten im Hell-Dunkel-Bereich, etabliert parallel Licht-Schatten-Motive. Auff ällig ist die harte und klare Linienführung. Lichtstrahlen, erneut in Gestalt von Linien, brechen in das Bild ein und in dessen Mitte formen sich die Buchstaben des Wortes ›Metropolis‹. Durch eine Überblendung ist das Bild einer von Gebäuden dominierten Stadt hinter den Lettern präsent. Durch Untersichten und perspektivische Verzerrungen gewinnt man den Eindruck pyramidenartiger Flächen. Das fi lmische Konzept wirkt anti-naturalistisch. 11. Hermann Kappelhoff: Matrix der Gefühle, Berlin: Vorwerk 8 2004, S. 308. Zwei Unterkapitel in Kappelhoffs Titanic-Komplex ließen sich direkt auch auf Metropolis übertragen: Dramaturgie der gespiegelten Zeitebenen (S. 311ff.) und Ornament der Bedeutsamkeit (S. 317ff.). 12. Zum historischen Überblick über die verschiedenen Fassungen seien zur Lektüre empfohlen: Enno Patalas: Metropolis in/aus Trümmern: eine Filmgeschichte, Berlin: Bertz 2001 und Thomas Elsaesser: Metropolis – Der Filmklassiker von Fritz Lang, Hamburg, Wien: Europa 2001. Aufgrund der Entdeckung dreier Filmdosen, in denen sich Negativkopien der bislang verschollen geglaubten Langfassung befanden, erhält die Geschichte von Metropolis ein neues Kapitel. Die Sichtung für diesen Aufsatz war nicht mehr möglich, dennoch werde ich an entsprechenden Stellen mit Fußnoten auf die neuen Erkenntnisse hinweisen (vgl. dazu Zeit-Magazin Leben, 9. Juli 2008).
103
Sascha Keilhol z
Wieder bilden sich aus den Licht- und Schattenspielen der Zeichnung neue Formen. Die Titelsequenz – Langs elliptisches Verfahren ist hier bereits zu erahnen – geht nahtlos über in eine Spielszene, die den Konflikt Mensch/ Maschine etabliert, wobei die Absenz des Menschen eklatant ist. Dampfmaschinen bewegen sich vertikal (0:02:27-0:02:33). Variiert wird diese Bilddynamik durch horizontale Streifen, die als dreigeteilte Fläche über das Bild hin- und herziehen. Das Gefühl von Bewegung wird durch die doppelte und in sich gegenläufige Richtungsdynamik potenziert. Eine schnell geschnittene Montagesequenz zeigt eine Vielzahl unterschiedlicher Maschinen ›at work‹, ehe immer mehr von ihnen bildlich ineinander übergehen. Die finale Überblendung (0:02:51) suggeriert Chaos und Unkontrollierbarkeit. Unterschnitten ist dieser Moment durch eine Einstellung aus Joh Fredersens Büro. Zwei Uhren, offensichtliche Ordnungssysteme, hängen an der Wand. Während das kleinere, obere Exemplar einer Einteilung in 24 Tagesstunden folgt, reguliert die imposantere, untere die zehnstündige Arbeitsschicht. Das unruhige, beinahe hüpfende Voranschreiten des Sekundenzeigers wird sich später in den Bewegungen der Arbeiter spiegeln. Das erste ›Außenbild‹ (0:03:08) zeigt einen eng kadrierten Ausschnitt der Stadt. Im Bildzentrum befi nden sich pyramidenförmig angeordnete Dampfpfeifen. Bereits die Eingangssequenz illustriert Langs Denken in Oppositionen: Die Maschinenwelt steht für Beschleunigung und Chaos. Was zunächst von jener Welt sichtbar wurde, war eine sehr reduzierte Abstraktion. Die Maschinenwelt hat hier noch keinen konkreten Raum, sie ist reine übergeordnete, metaphorische Dingwelt mit scheinbarem Eigenleben. Laut, bedrohlich und offensichtlich nicht kontrollierbar. In die vom Menschen geschaffene klare architektonische Struktur der Stadt bricht sie wie ein aggressiver Fremdkörper in Form der Dampf ausstoßenden Pfeifen ein. Trotz ihrer Gegensätzlichkeit zeichnen sich beide Welten durch exaltierte Künstlichkeit aus. Beide Welten wirken unbelebt, unbewohnt, unwirtlich und unwirklich. Schon an verschiedenen Stellen wurde darauf hingewiesen, dass sich Thea von Harbou und ihr Mann, was die Konzeption der fi ktiven Stadt Metropolis betriff t, während der Arbeit an Buch und Drehbuch sowie den Filmvorbereitungen, auch entgegen Langs eigener Legendenbildung, recht wenig am vermeintlichen Vorbild New York orientierten.13 Zwar galten die Wolkenkratzer in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts bereits als Wahrzeichen New Yorks und dienen Lang nur allzu offensichtlich als dankbares vertikales Strukturelement. Was bislang jedoch nie zur Sprache kam, auch bei Vergleichen von M – Eine Stadt sucht einen Mörder mit Joseph Loseys amerikanischem Remake aus dem Jahre 1951 nicht, sind ganz offensichtliche Differenzen: New York lebt als Ostküstenstadt von dem typischen Blick auf die Skyline vom Meer aus. Darüber hinaus ist New York, vor allem sein Zentrum Manhattan, eine der übersichtlichsten und plansten Städte der Welt. Ganz anders Metropolis: Lang nutzt keine Panoramaeinstellungen, um eine Skyline zu zeigen. Keine Übersichten, keine Aufsichten. Die Kamera ist noch völlig 13. Vgl. u.a. G. Geser: Fritz Lang, S. 42f.
104
Metropolis – ein Labyr inth zwischen Chaos und Ordnung
immobil, statisch. Immer nur in kurzen Ausschnitten werden völlig disparate Teile der Stadt abgelichtet. Ein Gesamtbild von Metropolis ergibt sich zu keiner Zeit. Die Stadt bleibt ein Abstraktum, dass sich in unserer Phantasiewelt vor allem ideologisch konnotiert zusammensetzen muss, aus unterschiedlich inhaltlich belegten und aufgeladenen Bereichen wie der Unter- und Oberwelt der Arbeiter respektive Herrscher, dem Vergnügungsviertel Yoshiwara, 14 Rotwangs romantischem Haus etc. Der Stadtraum Metropolis ist bei Lang nicht nur äußerst disparat, er folgt vor allem dezidiert und ausgestellt einer Drehbuch- und Studiologik, was den Film nicht nur auch an dieser Stelle exemplarisch für Langs Werk macht, sondern vor allem eine weitere Brücke zu M – Eine Stadt sucht einen Mörder schlägt, über den Kreimeier schreibt: »Ähnlich obsessiv hat Lang in diesem Film als Dokumentarist gearbeitet. Am wenigsten dokumentarisch ist er in jenen Sequenzen, die ausdrücklich ›Großstadt‹ signalisieren – man sieht ihnen deutlich an, daß sie im Studio gebaut wurden; die Straßenkreuzung, über die Lorre, von den Häschern des Gangstersyndikats gejagt, in ein Bürogebäude flüchtet, sieht die Kamera von oben, und man sieht nicht viel mehr als ein maßstabsgerechtes Modell aus Kulissen; der ›Dschungel Großstadt‹ ist in diesem Film – in jeder Hinsicht – nichts als angewandte Mathematik.«15
Wenn auch der für viele Filme Langs geradezu konstitutive Blick von oben auf eine räumliche Anordnung (erstmals eingesetzt in Die Spinnen. Teil 2. Das Brillantenschiff, 1920) ausgerechnet in Metropolis ausbleibt, lässt sich das fi lmische Konzept und das vertikale Strukturprinzip des Regisseurs, wie von Kreimeier an M analysiert, auch hier erkennen: »Lang beobachtet seine Stadt-Konstruktion – und was sich in ihr begibt – wie ein Architekt, der in sein nach oben offenes Modell hineinschaut: ein Kontrollblick, ein autoritärer Blick, der das Chaos zu regulieren sucht.« 16 Wo bei Lang, von den Tyrannenfi lmen über die ›Anti-Nazi-Filme‹ bis hin zu den späten Noirs in unterschiedlichsten Ausprägungen das Chaos droht, räumliche, bürgerliche, psychische und moralische Ordnungen zu zerstören, setzt er seine eigene Filmsprache immer wieder als regulierendes Element ein:17 »Bei seiner Erforschung der Möglichkeiten des Kinos hat das ›gerahmte‹ Bild, das feste Bild zunächst die entscheidendere Rolle gespielt – das, was in einem Bild simultan sich vorstellen ließ, viel mehr als die Richtung, der Übergang von einem Bild zum anderen. Lang ging das Kino an, ausgerüstet mit Erfahrungen von Architektur und Malerei.«18 Es gibt kaum einen Regisseur, der das Bild so sehr als Fläche 14. Die Yoshiwara-Sequenz – Josaphats Ausflug in die Stadt – fehlte in der bisherigen Version. 15. K. Kreimeier: Strukturen im Chaos, S. 59. 16. Ebd., S. 60. 17. Zu den Wurzeln dieser Filmsprache vgl. Lotte Eisner: Fritz Lang, New York: Da Capo 1986, S. 89. 18. Frieda Grafe: »Für Fritz Lang. Einen Platz, kein Denkmal«, in: Fritz Lang
105
Sascha Keilhol z
begreift, die es zu strukturieren gilt. Ich möchte Lang also im Anschluss an Frieda Grafe ganz als Filmarchitekt verstehen. Die Bildbauten dieses Regisseurs folgen durchgängig vertikalen Anordnungen. Kreimeier hat auch diese Feststellung doppelt codiert. So verläuft, wie er richtig erkennt, bei M – Eine Stadt sucht einen Mörder die »Kommandostruktur, von oben nach unten, vertikal« 19. Es lässt sich also sowohl inhaltlich als auch in der szenischen Gestaltung »das vertikale Gliederungsprinzip«20 erkennen. Ähnliches konstatiert Frank Arnold im selben Band für Metropolis, den er »durch vertikale Strukturen bestimmt«21 sieht. Und Thomas Koebner unterstreicht die Homogenität von Dschungel Großstadt. Kino und Modernisierung, wenn er die »vertikale Stadtkonzeption in Langs Metropolis«22 beschreibt. In der Folge werde ich darlegen, wie Langs Stadtentwurf das dramaturgische Spannungsfeld Chaos und Ordnung determiniert. Gleichzeitig verfolge ich, wie sich die Architektur der Stadt und die Architektur des Films gegenseitig durchdringen. Zum einen verstehe ich dabei unter der Architektur des Films seinen dramaturgischen Auf bau, als dessen zentrales Element die Umformung der Eingangssequenz im Finale fungiert. Zum anderen ist der Aufbau des Films von entgegengesetzten Bewegungsmustern und einer Rhythmisierung als Tempobeschleunigung gekennzeichnet. Zentrale Bedeutung schreibe ich dem Begriff des Labyrinths zu. Sowohl der Film als auch die Stadt lassen sich labyrinthisch begreifen. Das Labyrinth als Ordnungsmuster weist letztlich den Weg aus dem Chaos.
Ordnung Nach einem die Schicht ankündigenden Zwischentitel sind zum ersten Mal Menschen auf der Leinwand zu sehen. Hundertschaften von Arbeitern, so veranschaulicht die Bildfolge, betreten bzw. verlassen durch einen an U-Bahn-Stationen erinnernden Tunnel ihre Arbeitsstätte. Die Einstellungen bestechen durch ihre symmetrische Anordnung und Klarheit: Der Weg ist durch eine Mittellinie zweigeteilt, die sich auch durch den ansonsten scheinbar einför(= Reihe Film 7, hg.v. Peter W. Jansen u. Wolfram Schütte in Zusammenarbeit mit der Stiftung Deutsche Kinemathek), München, Wien: Carl Hanser 1976, S. 7-82, hier S. 34. Weiter schreibt sie dazu: »Der Immobilismus, das Statische der langschen Bildkonstruktionen enthält einen Gestus, der auf das Fotogramm verweist, das hinter jedem Bild steht.«, ebd., S. 24. Und: »Formen und deren Verhältnisse sind wichtiger als Erzählvorgänge«, ebd., S. 64. 19. K. Kreimeier: Strukturen im Chaos, S. 65. 20. Ebd., S. 62. 21. Frank Arnold: »Die Stadt im Science-Fiction-Film: Ein Streifzug«, in: Irmbert Schenk (Hg.), Dschungel Großstadt. Kino und Modernisierung, Marburg: Schüren 1999, S. 157. 22. Koebner, Thomas: »Der Schock der Moderne. Die Stadt als Anti-Idylle im Kino der Weimarer Zeit«, in: I. Schenk (Hg.): Dschungel Großstadt, S. 78.
106
Metropolis – ein Labyr inth zwischen Chaos und Ordnung
migen, mit Gitterstäben verkleideten Fahrstuhl zieht. Rechts gehen die Menschen hinein, links kommen sie heraus. Selbst die Deckenwölbungen sind symmetrisch, die Beleuchtung des Raums ebenfalls. Im Massenschritt, der nicht militärisch zackig, sondern eher träge und dennoch rhythmisch ist, bewegen sich die Arbeiter durch den Tunnel. Dabei unterscheidet sich das Tempo der beiden Gruppen auff ällig. Die im Bild links angeordneten, zur Schicht schreitenden Männer bewegen sich gleichmäßig, wohingegen die zurückkehrenden Arbeiter sich unnatürlich, wie zeitversetzt, mit einem ständigen Innehalten zwischen den Schritten fortbewegen. Als Gesamtformation erweckt die Gruppe so den Eindruck des Schwankens. Nimmt man diese Wellenbewegung der Masse ernst, die Langs so statisches Gefüge doch merklich aufbricht, deutet sich schon hier die Katastrophe an. Das beinahe zombiehafte Schleichen der anonymen Arbeiterschaft ist eben doch schon eine Bewegung, der es bislang aber noch an Dynamik fehlt. Das »Ornament der Masse«23 deutet jedoch schon die in ihr befindliche Kraft an. Im offenen Aufzug mit der Nummer 219, der durch ein nach oben fahrendes Gittergeländer begrenzt wird, fährt die männliche Arbeiterschaft gesenkten Hauptes zunehmend ins Dunkle, immer tiefer unter die Erde, wie eine von oben nach unten fahrende Texteinblendung verkündet. Dieser Textzug ist genau umgekehrt, also von unten nach oben, zu lesen.24 Der Ausstieg aus den Fahrstühlen 327, 326 und 325, die wieder völlig symmetrisch das Bildfeld ausfüllen, veranschaulicht die Masse der Leute, die in die unterirdische Stadt heimkehren. Lang etabliert mit der strengen Ordnung dieser Sequenz einen Pol, dessen Gegenpol er in der zweiten Filmhälfte erfahrbar macht. Das hier noch nach allen Regeln der Kunst symmetrisch komponierte Bild avanciert dort zum Ausdruck von Chaos. Die Veränderungen in Metropolis, die den Ausnahmezustand auslösen werden, sind ausschließlich an die Arbeiterschaft und ihre Unter-Welt gekoppelt. Von ihr gehen die Umwälzungen unmittelbar aus, auch wenn andere wie Rotwang als individuell Handelnde im Hintergrund den Rang strategischer Organisatoren einnehmen. Doch noch bevor er oder Freder und sein Mittler-Diskurs eingeführt werden, hat Lang dem Proletariat visuellen Raum zugewiesen, um eines der eigentlichen Hauptthemen des Films zu etablieren: die Mobilisierung der Masse. Dem Prozess von der trägen, gesichtslosen und regulierten Belegschaft zum unkontrollierten hysterischen Pulk entspricht eine Mobilisierung des Bildes in der zweiten Hälfte von Metropolis.
23. Eisner zieht in diesem Kontext eine Verbindung zur Neuen Sachlichkeit und spricht von »symbolic ornamentalism«. Vgl. L. Eisner: Fritz Lang, S. 86. 24. David Fincher hat sich in seinem richtungsweisenden Serial-Killer-Film Se7en (1995) auf Lang bezogen. In diesem Film, wo es auf unterschiedlichen Ebenen auch um Chaos, Kontrollverlust und die Ordnungshoheit eines Regisseurs geht (vgl. Richard Dyer: Seven, London: BFI Publishing 1999), verwendet er ebenfalls das Verfahren des ›falschen‹ Abspanns.
107
Sascha Keilhol z
Chaos Eine explosive Mischung aus dumpfer Unzufriedenheit und Intrigen hat den mechanisch ablaufenden Alltag von Metropolis aus dem geregelten Trott gebracht. Nachdem der Menschen-Roboter Hel mit dem Gesicht Marias versehen wurde, beginnen die Umstürze und das Chaos bricht sich Bahn. Auf einem Empfang Rotwangs präsentiert sich die falsche Maria halb nackt tanzend der geifernden männlichen Aristokratenmasse (1:13:18-1:16:36) und Freder gelangt zur Erkenntnis: »Der Tod ist über der Stadt« (1:16:56). Spielerisch gelingt es der Femme fatale, die Grenzen zwischen Ober- und Unter-Welt zu durchdringen; schon bald verführt sie auch die Arbeiterschaft (1:21:33). Lang drückt die resultierende Raserei in Vexierbildern aus. Nachdem Freder erkannt hat: »Du bist nicht Maria – !!!« (1:24:32), entsteht ein Tumult, der im blutigen Handgemenge endet, das Gregory sein Leben kostet. Er opfert sich für den Heilsbringer Freder (1:25:10-1:25:40). Wenig später wird der eingangs etablierte zentrale Platz der Arbeiterstadt von den Menschenmassen überflutet. Sie drängen sich in unkoordinierter Aktivität und eilen auf Initiative der falschen Maria in Richtung Fabrik (1:27:081:27:48). Die aufgeregten Horden stürmen in die Fahrstühle, nun alle Ordnung ›über den Haufen werfend‹ (1:27:50-1:28:31). Im Aufzug 125 sieht man exemplarisch, wie sich die Menschen drängen und beinahe herausstürzen. Auch Frauen sind nun im Rahmen der Revolte zu erkennen – eine weitere Zersetzung der Ordnungsstruktur. Die Menschen agieren wild, strecken ihre Hände und Arme durch die Gitterstäbe des nach oben fahrenden Aufzugs. Schließlich erreichen sie den tunnelartigen gewölbten Gang, mittlerweile mit diversen Werkzeugen bewaffnet. Die in den Anfangsbildern festgehaltene Statik ist in unkontrollierte Dynamik umgeschlagen (1:28:40-1:28:44). Der Menschenroboter erreicht als erster das Gittertor. Während er und sein Gefolge sich daran machen, es einzureißen, nimmt auch die Kraft der Menschenmenge in den Fahrstühlen immer destruktivere Züge an; die Geländer wackeln bedrohlich, Einzelne hängen sich an die bereits fahrenden Aufzüge (1:28:59-1:29:09). Als die ersten Stäbe des Gittertores zu den Maschinenhallen nachgeben, nimmt die Revolution endgültig eine ungehemmt chaotische Form an. Die Massen ›entern‹ die Maschinenhalle (1:29:50). Die Zerstörung der Herzmaschine (1:32:36-1:33:59) bildet den Höhepunkt des Aufstands und ist gleichzeitig endgültiger Auslöser der Katastrophe. Noch während die Menschen wie im Rausch vor der Maschine toben – ihre Gestik fi ndet hier ihre Klimax – brodelt das Wasser in den Kanälen. Die Fahrstühle, Symbole für den geordneten, kontrollierten Arbeitsablauf, explodieren und stürzen ein (1:34:00-1:34:23). Der Riss im Gefüge wird von Lang inszenatorisch versinnbildlicht, als Wasser durch eine Betonritze des Bodens dringt. Die Fontäne schießt in die Höhe, auch anhand solcher Bilder wird die eingeleitete Aufwärtsbewegung sichtbar. Ebenso begeben sich nun Freder und Josaphat nach oben, sie klettern aufwärts (1:34:45-1:34:55). Wasser ist die größtmögliche Bedrohung für eine Unterwelt – das Tunnelsystem als Labyrinth wird so unfreiwillig wie unweigerlich zur Kanalisa108
Metropolis – ein Labyr inth zwischen Chaos und Ordnung
tion umfunktioniert. Drastisch formuliert evoziert Lang Bilder ›ersaufender Ratten‹. Gleichzeitig impliziert auch das Wasser die Abgeschlossenheit des Systems Metropolis. In der Tradition des Science-Fiction-Romans wird der utopische Topos der Inselstadt bemüht und ins Negative gewendet. Schon vormals waren alleingelassene Kinder im Bild, nun sieht man ein kleines Mädchen und bald auch andere Kinder vor den Wassermassen aus einem Wohnhaus flüchten (1:35:00-1:35:08). Sie folgen, kreuz und quer durchs Bild laufend, Marias Signal und versammeln sich auf einem kleinen Podest. Als das Wasser durch die Gemäuer des Wohnblocks bricht, ist das Schicksal der Unterstadt besiegelt (1:36:00, 1:36:18). Fredersen lässt des Nachts noch einmal den Blick über seine Stadt schweifen (1:37:00). Als das elektrische Licht ausfällt, hat die Katastrophe auch die Oberstadt erreicht. Der Einbruch von Dunkelheit in die Zivilisation markiert den Orientierungs- bzw. Ordnungsverlust (1:37:19). Freder und Josaphat kämpfen sich, beispielhaft für Langs labyrinthische Welten, durch die Kanalisation (1:37:50) und es gelingt Josaphat in einer weiteren Aufwärtsbewegung – wieder über Treppen – Kinder zu retten (1:39:171:39:49). Am Ende der Befreiungsaktion eilt er Freder und Maria zur Hilfe. Wo Josaphats systematisch-besonnenes Handeln und der Zusammenschluss mit Freder und Maria zu einem erfolgreich engagierten Triumvirat – eine Konstellation, die am Ende des Films aufgegriffen wird – den Kindern das Leben rettet, ist die Lage andernorts noch verheerend: Im Maschinenraum tanzen die Menschen inmitten züngelnder Flammen Ringelreihen, rundherum liegt alles in Schutt (1:41:30-1:42:30). Erst als der besonnene Grot fragt: »Wo sind Eure Kinder?« (1:42:49), eine Formulierung, die unweigerlich das Ende von M – Eine Stadt sucht einen Mörder ins Gedächtnis ruft, gibt es einen Moment des Innehaltens. Doch die Aggression findet nur ein neues Ziel – der tobende Mob hetzt nun Maria.25 Beim Tumult vor dem Klub der Söhne (ab 1:45:50) wird Langs gegenüber dem Anfang veränderte Inszenierungsstrategie deutlich. Die von Grot angeführte Menge rennt bewaff net die Stufen zum Club empor, durch Reihen parkender Autos hindurch. Die Kamera ist fi xiert, doch die Menge läuft auf sie zu und an ihr vorbei, im linken Bildvordergrund Grot, dessen Gesicht sich fast zur Fratze verzerrt. Alles im Bild ist dicht gedrängt, Köpfe und Gliedmaßen der Aufständischen, einzelne zu Waffen umfunktionierte Werkzeuge wie Hammer und Schaufeln sind zu erkennen (1:45:59-1:46:02). Schon in dieser kurzen Einstellung wird eine Aufwärtsbewegung festgehalten. Dieser Eindruck wird in der nächsten Einstellung noch verstärkt, die aus der Aufsicht gefi lmt ist. Langs Bildkomposition veranschaulicht Unordnung und Bewegung: Der Mob stürmt zwei nun nicht mehr symmetrisch im Kader angeordnete Treppen hinauf an versetzt stehenden Autos vorbei. Kreuz und quer rennen die Aufgewiegelten über beide Treppenhälften und zwischen ihnen hindurch. 25. Wo es hier darum geht, die Masse als Gefahr zu begreifen, gilt es in M – Eine Stadt sucht einen Mörder und While the City sleeps (1956) die Bedrohung in Gestalt eines Einzelnen aus der Masse heraus zu filtern, wofür Lang diverse filmische Verfahren entwickelt.
109
Sascha Keilhol z
Im nächsten Bild, auf dem Plateau angekommen, rennen sie wieder direkt auf die Kamera zu, manche einen Sims heraufkletternd, ihre Gerätschaften wild schwenkend, zwei werfen sogar wie von Sinnen ihre Hämmer nach vorne (1:46:06-1:46:15). Die entladene Energie äußert sich in einem finalen destruktiven Akt. Der falschen Maria ist am Domplatz ein Scheiterhaufen errichtet worden. Lang setzt die Hexenverbrennung als inszenatorischen Höhepunkt, Raserei und Chaos kennzeichnen die Aufnahmen: Maria auf einem Berg von Autowracks, Müll und Sperrholz an einen Pfahl gefesselt, der gesamte Bildkader ist voll mit Komparsen, die sich um die Erhöhung herum tummeln und zu einer undefinierbaren Masse verschmelzen (1:48:10). Wenig später zeigt eine weitere Einstellung das Chaos auf den Straßen, wo kollidierte Autos, dicht aneinander gedrängt, verlassen herumstehen (1:48:40).
Eine neue Ordnung – die Rolle des Tyrannen Sowohl Fredersen als auch Rotwang verkörpern Aspekte des größenwahnsinnigen Tyrannen, wie er archetypisch Langs frühe Filme dominiert. Charakteristisch für Metropolis ist das Verhältnis, in welches Lang und von Harbou ihre Protagonisten zu diesem Figurentyp setzen. Obwohl beide ursprünglich als zwei Pole intendiert waren, werden sie aus der Perspektive Freders bis zum Höhepunkt des Chaos zu zwei Seiten einer Medaille. Sowohl der Industrielle als auch der Erfinder pflegten eine intime Beziehung zu Freders Mutter. Beide haben auf je unterschiedliche Weise den Verlust ihrer Geliebten nicht verwunden und hängen diesem Sehnsuchtsbild noch immer nach. So verschmelzen Fredersen und Rotwang im Laufe des Films zunehmend zu einer gemeinsamen Vater-Imago Freders. Dessen Wahrnehmung der Rolle seines leiblichen Vaters wird vom Regisseur über Raum-Metaphern gestaltet. Ein pyramidenförmig angeordneter Schriftzug (0:05:37) verweist auf das vertikale, durch Oppositionen bestimmte System von Metropolis. Er verkündet den »Klub der Söhne«, welcher sich in der nächsten Einstellung dem Zuschauer als Sportstätte präsentiert. Wo Beengung das unterirdische Leben charakterisierte, verweist die Ausschnitthaftigkeit des Bildes hier auf die monumentale Größe der Anlagen. Als die Kamera das erste Mal an die Söhne heranrückt, zeigt sie vier von ihnen in einer Halbnahen, vor undefinierbarem Hintergrund, wie im unbegrenzten Raum. Hinter dem Vordersten sind die anderen drei mit zunehmender Distanz nur schemenhaft erkennbar. Langs Prinzip ist deutlich: er weicht von seinen starren Bildern ab, es gibt keine Begrenzungslinien, keine Rahmung. Hier ist alles offen, frei, riesig und in dieser Monumentalität kaum überschaubar. Die soziale Implikation ist nicht minder deutlich: das Proletariat schuftet, die herrschende Klasse vergnügt sich beim Sport.26 Ihr herausstechender Protagonist: Freder. Die Kamera weiß ihn an26. Hier lässt sich eine deutliche Verbindung zu Thorstein Veblens Theory of the Leisure Class (Die Theorie der feinen Leute, 1899) knüpfen.
110
Metropolis – ein Labyr inth zwischen Chaos und Ordnung
fangs immer im Bildvordergrund und -mittelpunkt. Als Schnellster im Ziel ist er von vornherein exponiert. Den denkbar größten Kontrast zu seiner ersten Station, dem Ort, der ihm vertraut ist und ihn definiert, stellen die Fabrikhallen dar, in denen sich Freder wenig später wieder findet. Hier ist er weder aktiv noch erfolgreich. Erstmals sieht der Zuschauer ihn an einem Ort, der nicht sportiv konnotiert ist. Leisure trifft work. Kleinere Treppen verdeutlichen die Größe und die Höhenanordnungen des Objekts, gleichzeitig seine Unübersichtlichkeit. Freder, dessen Handlungen im Zuge seiner ›Reise‹ immer zielgerichteter werden, mangelt es zu diesem Zeitpunkt der Narration augenscheinlich noch an Orientierung. Blickfang und Zentrum ist eine riesige, nach oben laufende, zweigeteilte Treppe. Sie ist der Zugang zur Herzmaschine. Als ein Arbeiter aus Erschöpfung zusammenbricht, steigt die Temperaturkurve eines Thermometers, Dämpfe treten aus, Menschen stürzen herab. Die Empore der Treppe verwandelt sich – vermittelt über Freders Perspektive – in eine Fratze. »Moloch!« schreit Freder (0:14:00). Im Schnittwechsel sind er und die Totale des Moloch-Objektes zu sehen. Menschen werden an Leinen wie Sklaven nach oben gezogen, Freder hebt schützend die Hände.27 Halbnackte, kahl rasierte Arbeiter werden mit Peitschen nach oben und durch das Maul getrieben, ehe sie ins Ungewisse stürzen. Hinter dem Nebeldickicht werden Zahnräder erkennbar, zwischen denen die Sklaven offensichtlich zermahlen werden. Dann folgen Massen dunkel gekleideter Arbeiter, die demselben Schicksal entgegengehen. Als diese Vision Freders endet, sieht er, wie Männer auf Bahren davongetragen werden. Im Schockausdruck seines Gesichts lässt sich die unvermittelte Härte des neuen Eindrucks ablesen. Freder wird mit dem anderen, dunklen Teil der Welt konfrontiert, für die ganz dezidiert sein Vater steht. Lang inszeniert hier einen Moment des Augen-Öffnens, ganz offensichtlich bricht etwas bislang nicht Wahrgenommenes, womöglich Verdrängtes in Freders Welt ein. Eine schützende Handbewegung illustriert, wie sehr ihn das ›Gesehene‹ überwältigt. Freders Konfrontation mit den Machenschaften seines Vaters ist gekennzeichnet als Eindringen in eine neue, fremde, düstere Welt. Dieses Eindringen in einen unbekannten Raum lässt sich als markantes Strukturmerkmal der langschen Inszenierungsstrategie herausdestillieren. Metropolis ist sowohl als physische wie auch als Erkenntnisreise Freders gestaltet, in deren Verlauf er ins Zentrum der väterlichen Welt eindringen muss. Mit einer solchen Koppelung des Tyrannen-Modells an räumliche Bewegungsstrukturen hat Fritz Lang entscheidend die James-Bond-Romane Ian Flemings und deren spätere Verfi lmungen beeinflusst.28 In der klassischen Bond-Film-Phase mit Sean Connery geht es immer auch um die Aufrechterhaltung einer gewissen strukturellen Ordnung, die kolonialistische, royalistische und aristokratische 27. Zur Bedeutung der Gestik im Schauspiel bei Lang, insbesondere des Einsatzes der Hände, vgl. G. Geser: Fritz Lang, S. 111ff. 28. Für Die Frau im Mond (1929) erfand Lang den Countdown – Schlüsselelement vieler Bond-Adaptionen. Weitere ›Paten‹ sind Dr. Mabuse und – schon der Name deutet darauf hin – Spione (1928).
111
Sascha Keilhol z
Interessen vertritt.29 Bonds Feinde der ursprünglichen Serie gehören einer Organisation an, deren erklärtes Ziel die Herbeiführung von Chaos ist. In diesem Element sehe ich die wichtige Verbindung zwischen den Tyrannenfiguren, wie sie auch Metropolis prägen: Neben monetären Interessen verfolgen die Größenwahnsinnigen immer das Ziel, die Welt ins Chaos zu stürzen. In Fredersen und Rotwang führt Lang das Oppositionspaar ›Ordnung/Chaos‹ zur Tyrannenfigur zusammen. Während Fredersen vor allem für die übermächtige und fehlgeleitete, aber der Vernunft verpflichtete Vaterfigur steht, mit der sich auch die Waise Bond symbolisch in all ihren Abenteuern konfrontiert sieht, agiert Rotwang bewusst destruktiv. In dessen labyrinthischer Zentrale, die gleichzeitig als Gefängnis für des Protagonisten ›love interest‹ fungiert – vielfach variiertes Erzählmoment der Agentenreihe – findet sich auch Freder wieder. Sein Opponent will einen dauerhaft chaotischen Zustand herbeiführen. Lang hat damit einen Typus geschaffen, der bis heute aktuell ist.30 Bereits in den unterschiedlichen Mabuse-Verfi lmungen bis hin zu Langs letztem Werk, das noch eine kleine Schar an Folgeproduktionen nach sich zog, wird der Terrorismusdiskurs schon auf der Dialogebene explizit. In Die 1000 Augen des Dr. Mabuse (1960) – auch hier dringt der Held schließlich ins Zentrum, die Schaltzentrale des Tyrannen ein – wird dessen Nachahmer Professor Jordan der Hang zum Chaos attestiert. In Rotwang vereinigen sich der skrupellose Herrscher mit Allmachtsanspruch und der Terrorist. Freder muss ihn – seinem Nachfolger im Geiste, Bond, gleich – in der finalen Konfrontation persönlich besiegen. Erst als der Tyrann ein symbolträchtiges Ende findet, kehrt endgültig wieder Ruhe ein: Rotwangs Sturz vom Dach des Doms in die Tiefe (1:54:01) beendet beinahe schlagartig alle Tumulte und restituiert das Gemeinwohl. Der starrsinnige Tyrann endet im freien Fall, der einsichtige tritt geläutert im Schlussbild in 29. Vgl. Oliver Lubrich: »Dracula – James Bond: Zur Kontinuität und Variation mythischer Phantasie in der Moderne«, in: KulturPoetik 3/1 (2003), S. 81-95, hier S. 84ff. 30. Auch in The Dark Knight, dem weltweit an den Kinokassen erfolgreichsten Film von 2008, ist es das erklärte Ziel des Terroristen, die Welt ins Chaos zu stürzen. Vgl. Thorsten Funke: »The Dark Knight«, auf: www.critic.de/filme/detail/film/thedark-knight-1253.html, 04.08.2008. Immer wieder nehmen die Menschen in Langs filmischem Universum ihre öffentlichen Feinde als Terroristen wahr. Die Litfaßsäule, Insignium der modernen Großstadt, trägt ein ums andere Mal den Schriftzug: »10.000 Mark Belohnung« – sei sie für Haghi ausgerufen oder für Hans Beckert. Gerade in Deutschland nimmt man Fahndungsplakate bis heute als Indiz des Terrorismus wahr – kein Litfaßsäulen-Konterfei ist ikonografisch so besetzt, wie das Ulrike Meinhofs. Auch in der Bernd-Eichinger-Produktion Der Baader-Meinhof-Komplex (2008), der neuesten medialen Annäherung an die RAF, darf das Plakat nicht fehlen. Das gesamte Marketing des Films setzte, vor allem in Trailern, auf die Präsentation der Schauspieler als Fahndungsfoto-Klone. Vgl. Sascha Keilholz: »Der BaaderMeinhof-Komplex«, auf: www.critic.de/filme/detail/film/der-baader-meinhof-komplex-1400.html, 22.09.2008.
112
Metropolis – ein Labyr inth zwischen Chaos und Ordnung
Erscheinung. Die Restauration der Ordnung feiert Lang mit der Wiederkehr des symmetrischen Bildauf baus, der die Dompforte im Mittelpunkt weiß. Arbeiter formen ein Dreieck, an dessen Spitze Grot genau die Bild- und Dommitte ansteuert. Die Masse bewegt sich wieder langsam, rhythmisch, geordnet, im Gleichschritt (1:55:04-1:55:30). Nachdem das Finale unterschiedliche Dreier-Konstellationen arrangiert hat, steht am Ende die Dreieinigkeit: Freder, Fredersen, Grot. Der Schlusstitel benennt ihre Positionen explizit: »Mittler zwischen Hirn und Händen muß das Herz sein!« Hierin deutet sich somit nicht bloß eine Restitution, sondern eine wirkliche qualitative Veränderung der Ordnung an. Kracauer allerdings sieht in diesem restaurativen Element, in der Überwindung des proletarischen Aufstands, das Gefährliche, Opportune an Metropolis. Frieda Grafe fasst die gesellschaftspolitische Dimension neutraler und sinnvoller, indem sie Langs deutsche Filme als »Chiff ren einer Krise«31 wahrnimmt. In Metropolis weist Freder ganz symbolhaft den Weg aus der Krise. Seine persönliche Odyssee durch die Großstadt inszeniert Lang dabei als Reise durch ein Labyrinth.
Labyr inth I »Labyrinthe sind dazu da, daß man sich in ihnen verliert – vorübergehend oder auf Dauer. […] Die Angst des Labyrinthgängers, nicht ankommen zu können, gehört zu jenen Erfahrungen, die sich anscheinend nicht aus der Welt schaffen lassen«, so Manfred Schmeling in der Eingangspassage seines einflussreichen Werks über den labyrinthischen Diskurs.32 Seine Untersuchung konzentriert sich auf literarische Texte, die als labyrinthisch zu charakterisieren sind, beispielsweise von Hoff mann, Kafka, Joyce und Borges. Zwar ließe sich dieser Ansatz problemlos auf Filme anwenden. Doch wäre es schlicht falsch, Langs Metropolis in Schmelings Sinne als labyrinthisch zu verstehen. Zwar ist er ein durchaus komplexes, multiple Deutungen zulassendes Werk – man führe sich nur Gunnings Probleme mit dem Komplexitätsgrad einzelner Szenen und dem Ende vor Augen33 –, dennoch bietet er, beispielsweise mit dem Mittlerdiskurs und der ›Problemlösung‹ am Schluss im Gegensatz zu den genannten Kollegen ›Auswege‹. Weniger droht sich der Zuschauer in dem Film zu verlieren als vielmehr der Protagonist im Setting. Wenn Schmeling von Zolas Germinal schreibt: »[A]ls Labyrinth präsentiert sich aber vor allem der Raum, das heißt, der Schauplatz, an dem die Geschichte sich abspielt«34, lässt sich allerdings eine Brücke zu Metropolis schlagen. Primär über Freders 31. F. Grafe: Für Fritz Lang, S. 37. 32. Manfred Schmeling: Der labyrinthische Diskurs. Vom Mythos zum Erzählmo-
dell, Frankfurt a.M.: Athenäum 1987, S. 13. 33. Vgl. Tom Gunning: The Films of Fritz Lang. Allegories of Vision and Modernity, London: BFI Publishing 2000, S. 68ff. 34. M. Schmeling: Der labyrinthische Diskurs, S. 73.
113
Sascha Keilhol z
Irrweg durch die Stadt seiner Väter – was bei Lang nicht nur übertragen, sondern konkret zu verstehen ist – erschließt sich dem Betrachter das Labyrinth. Dem Architekten Lang geht es um den Ort Metropolis. Er gestaltet den Lebens- und Erfahrungsraum als Labyrinth. »Im Wort ›Labyrinth‹ ist strukturell und konzeptuell auf einen Begriff gebracht, was die Welt an chaogenen, aber auch an ordnenden Elementen beinhaltet«,35 schreibt Schmeling weiter. Genau so gilt es Langs Konzept zu verstehen: als Darstellung eines Kampfes zwischen Chaos und Ordnung, der an einem konkret als Labyrinth in Szene gesetzten Raum stattfindet. Während Schmeling das Labyrinth aus seiner literaturwissenschaftlichen Perspektive »als Gegenstand oder Medium kultureller Kommunikation«36 fasst, nähert sich Hermann Kern dem Phänomen als einem kunst- und kulturwissenschaftlichen.37 Alle drei von ihm für das Labyrinth ausgemachten Bedeutungsebenen: Metapher, Irrgarten und Labyrinth im eigentlichen Sinne, sind bei Metropolis zu finden. Kern konzentriert sich vor allem auf letztere, widmet sich dem Labyrinth als baulichem Konstrukt und als System, so wie ich es auch bei Lang verstehe. Entsprechend werde ich diesen Ansatz im letzten Kapitel als wichtigen Bezugspunkt nutzen.
Exkurs : Film Noir und Tunnelsysteme Die Wichtigkeit labyrinthischer Vorstellungen Langs lässt sich durch eine Einordnung von Metropolis in Langs Œuvre festhalten. Der Regisseur selbst sah M – Eine Stadt sucht einen Mörder als Zäsur in seinem Schaffen und formulierte das wie folgt: »Nach den großen Fresken der Nibelungen, von Metropolis und Frau im Mond interessierte ich mich mehr für menschliche Wesen, für die Beweggründe ihrer Handlungen.«38 Generell ist leicht nachzuvollziehen, was der alternde Regisseur hier in der Retrospektive charakterisiert, nämlich seine Wendung weg von der Kolportage hin zu einer genaueren Psychologisierung der Figuren. Plakativ gesprochen: Die Person tritt in den Vordergrund, die Architektur tritt in den Hintergrund. Doch Metropolis zeigt sich im Einzelnen durchaus als Vorstufe zu dieser Interessenverschiebung Langs. Wenn von seiner komplexen Bildsprache und seinen diversen Strukturierungs- bzw. Ordnungsmethoden die Rede ist, erscheint es sinnvoll, auf die im Kontrast dazu häufig simplen Drehbücher zu verweisen. Mir geht es dabei nicht um eine Aufspaltung der Arbeit in Lang und von Harbou. Viel ist über das Verhältnis der beiden, sowohl die Arbeitsprozesse als auch das Private betreffend, spekuliert worden.39 Auf einen Nen35. Ebd., S. 15f. 36. Ebd. 37. Vgl. Hermann Kern: Labyrinthe. Erscheinungen und Deutungsformen. 5000
Jahre Gegenwart eines Urbilds, München: Prestel 1999. 38. Fritz Lang zit.n. P.W. Jansen/W. Schütte (Hg.): Fritz Lang, S. 100. 39. Spekulativ ist vor allem Patrick McGilligan: Fitz Lang. The Nature of the
114
Metropolis – ein Labyr inth zwischen Chaos und Ordnung
ner gebracht würde ich mich Grafes Ansicht anschließen: »Metropolis ist kein Beweis dafür, daß die Harbou in den deutschen Filmen Langs böser Geist war.« 40 Völlig unabhängig von seiner zwischenzeitlichen Ehefrau ist Lang ein Experte der Kolportage. Sie ermöglicht ihm eine Konzentration auf bestimmte Effekte, bei Metropolis etwa den Effekt des Umschwungs, des Moments, in dem die Ordnung vom Chaos überrollt wird. In Metropolis geht es dezidiert um den Verlust von Kontrolle – und hier ist Lang dem späteren Film Noir bereits sehr nah. 41 Der Regisseur lässt sich trotz einzelner Übereinstimmungen weder in die Riege der Expressionisten einreihen noch als Vertreter der Neuen Sachlichkeit kategorisieren. Von großer Relevanz ist darüber hinaus Langs Spiel mit Licht und Schatten, weil es ein weiteres Mal des Regisseurs Denken in Dichotomien verdeutlicht – ein Denken, das auch den Film Noir kennzeichnet. In den USA etablierte sich Lang als einer der beständigsten Vertreter dieser Stilrichtung. 42 Eingangs habe ich mir Kreimeiers Blick auf M – Eine Stadt sucht einen Mörder zu eigen gemacht, und an dieser Stelle erscheint es mir wichtig, die beiden Großstadtfi lme unter der Prämisse des Noir noch einmal nebeneinander zu stellen. In meiner Annäherung an Metropolis habe ich den Klassiker in Bezug auf Determinanten, die sich durch Langs gesamtes Œuvre ziehen, untersucht: Das Oppositionspaar ›Ordnung/Chaos‹, die vertikale Inszenierung und nun der städtische Raum als Labyrinth. Diese Kontexte hat Lang später vor allem in M – Eine Stadt sucht einen Mörder, den ich als Brückenfi lm zwischen seiner deutschen und seiner amerikanischen Phase verstehe, 43 Beast, London: Faber and Faber 1997. Sehr ernsthaft und akribisch nehmen sich besonders des Schaffens Thea von Harbous an: Karin Bruns: Kinomythen 1920-1945. Die Filmentwürfe der Thea von Harbou, Stuttgart, Weimar: Metzler 1995; Reinhold Keiner: Thea von Harbou und der deutsche Film bis 1933, Hildesheim: Olms 1984. 40. F. Grafe: Für Fritz Lang, S. 23. 41. Bei Metropolis geht es um einen strukturellen Kontrollverlust, der sich an einzelnen Figuren und Konstellationen ablesen lässt: Der eigentlich gutmütige Tyrann Fredersen verliert die Kontrolle über ›sein‹ System Metropolis, genauso wie über seinen Sohn. Rotwang gerät außer Kontrolle, genauso die Arbeiterschaft. Der Film Noir thematisiert in seiner Genderdimension fast durchgängig den Kontrollverlust von Männern gegenüber Frauen. 42. Dabei ist M – Eine Stadt sucht einen Mörder bereits stilistisch ein Fundus des Film Noir, ähnlich wie Orson Welles‹ Citizen Kane (1941). Bei Anton Kaes heißt es zu diesem Zusammenhang: »M’s shadow falls over a large number of film noirs«, Anton Kaes: M, London: BFI Publishing 1999, S. 78. Und er verweist auf Eddie Muller, der meint: »M deserves to be recognized among the genre’s earliest progenitors.«, ebd., S. 111. Paul Duncan führt M – Eine Stadt sucht einen Mörder in seiner Liste gar als Pre-Noir. Vgl. Paul Duncan: Film Noir. Films of Trust and Betrayal, Herts: Pocket Essentials 2000, S. 42. 43. Rein historisch-chronologisch gedacht wäre das natürlich Liliom, 1936 in Frankreich gedreht.
115
Sascha Keilhol z
und den späteren Noirs in den Vordergrund gerückt. 44 Die Verknüpfung von Großstadt, wie Lang sie futuristisch in Metropolis und zeitgemäß in M – Eine Stadt sucht einen Mörder in Szene setzte, und Polizeiarbeit – geschehen bei Letzterem und vielen seiner Noirs – ist die deutlichste Ausprägung des Kampfes einer Ordnungsinstanz gegen das Chaos. Lang versinnbildlicht diesen Grundkonflikt in seinem späten Noir-Meisterwerk While the City sleeps (1956). Hier nimmt er zwei zusammenhängende Komponenten des Noir-Universums wieder auf: psychoanalytische Modelle und sexuelle Konnotationen. Der Serienkiller mit Mutterkomplex flüchtet im Finale furioso vor Polizei und Journalisten in die städtische Unterwelt. Die Jagd führt ihn von der Unterwasserkanalisation in die U-Bahn-Schächte, wo er, rauminszenatorisch logisch, sein Ende findet. Knapp 30 Jahre zuvor schuf Lang in Metropolis erstmals ein Tunnelsystem. Bereits hier kommt den unterirdischen Räumen eine gewichtige Rolle zu. Auff ällig ist in diesem Kontext Langs Inszenierung des eingangs skizzierten Raums als Reminiszenz an eine U-Bahn-Station. Während die Fahrstühle nichts anderes als vertikale Schächte sind, erinnern die angedeuteten langen Gänge ganz konkret an U-Bahn-Schächte. Diese Raumkonstruktionen sind bei Lang wiederkehrend symbolisch aufgeladen, sie sind häufig Schauplatz dramaturgischer Knotenpunkte. Das gilt sowohl für durch Tunnel fahrende Züge als auch für durch Tunnel laufende Menschen. Derlei Szenarien repräsentieren Langs Faible für Tunnel und Unterirdisches. Schon in Metropolis arbeitet Lang das Verhältnis von Statik und Bewegung in diesem Kontext aus. Überirdisch bewegen sich die Flugzeuge, Autos und Schwebebahnen, in der Arbeiterwelt existieren indes keine äquivalenten Mobilitätskonzepte. Der Schritt der Arbeiter ist langsam, in ihrer Formierung als Gruppe sind sie aber bereits voller potentieller Energie. Das fi lmspezifische Prinzip der Bewegung ist bei Lang nicht nur hier verknüpft mit dem spezifischen Ort ›Tunnel‹. Zu beobachten ist das bei einer der von Lang geliebten – und wieder Kino als Reinform beschwörenden – Verfolgungsjagden in Spione (1928). 45 Auch in dem Anti-Nazi-Film Man Hunt (1941) leitet Lang eine entscheidende Verfolgungsjagd durch den Tunnel. In Human Desire (1954), seinem zweiten Remake eines Jean-Renoir-Werks, 46 ist die Zug- und Tunnel-Symbolik in der 44. M – Eine Stadt sucht einen Mörder ist nicht zuletzt ein Vorläufer der semidokumentarischen Polizeifilme, die, noch im Gewand des Noir, das Genre begründeten. Martin Rubin weist auf den Wortstamm ›polis‹ hin, der aus dem Griechischen stammt, und Stadt bedeutet. Vgl. Martin Rubin: »The Police Thriller«, in: ders., Thrillers, Cambridge: Cambridge University Press 1999, S. 252. 45. Der zwischenzeitliche Höhepunkt dieser Sequenz findet im Zugtunnel statt. Es sind immer solche Momente, wo die Kamera dann, wenn auch nicht entfesselt wie bei Murnau, so aber doch mobiler wird als bei den ausschnitthaften, gerahmten Standbildern der titelgebenden Metropole in seinem Zukunfts-Film-Klassiker. 46. In diesem Kontext zur vertiefenden Lektüre empfohlen sei Tricia Welsch: »Sound Strategies: Fritz Lang’s Rearticulation of Jean Renoir«, in: Cinema Journal 39/3 (2000), S. 51-65.
116
Metropolis – ein Labyr inth zwischen Chaos und Ordnung
Eingangssequenz auf die Spitze getrieben, mit psychoanalytischen und entsprechend sexuellen Konnotationen aufgeladen. Schmeling bezeichnet das Labyrinth als einen immer auch sexuell konnotierten Raum. 47 Wichtig ist in diesem Kontext das Motiv des Tunnels als Teil einer labyrinthischen Raumvorstellung. Freders Einsicht und Hineinwachsen in die Rolle des Mittlers ist zugleich als Mannwerdung inszeniert. Seine erste Begegnung mit Maria, der Beginn des romantischen Plotelements, variiert das im Tunnel etablierte Labyrinthmotiv in Gestalt des Lustgartens. Insgesamt entspricht Metropolis in seiner Unüberschaubarkeit einem Labyrinth. 48
Labyr inth II Freders nächste ›Station‹ nach seiner Einführung sind die Ewigen Gärten. Was die Kamera uns davon als repräsentativen Ausschnitt vorstellt, ist ein pavillonartiges Gebäude, dessen organisch wirkende Pfeiler sich wie baumähnliche Gewächse nach oben zum Dach schlängeln. Naturwesenhaft wirken auch die bevorzugt mit freiem Nacken auftretenden Frauen. Das neckische Hasch-mich-Spiel übertriff t den Sport in dieser gedanklichen Konstruktion noch in seiner ›Nutzlosigkeit‹. Der Lustgarten macht seinem Namen alle Ehre – seinen Höhepunkt findet das lustige Treiben in einem sich anbahnenden Kuss. Doch als sich ein riesiges Tor öffnet (0:08:38), nimmt der Film die nicht allzu überraschende Wendung. Maria steht in der Mitte einer Gruppe von Kindern. Die Einstellung ist ganz langsche Komposition: Pflanzen am linken unteren Bildrand im Vordergrund, leicht versetzt dahinter am rechten unteren Bildrand, Blumengestrüpp. Minimal rechts von der Bildmitte versetzt schreitet eine Gans einen durch Steinplatten vorgezeichneten Weg entlang, gefolgt von einer kleineren Ente. Im Bildhintergrund, genau zwischen beiden und eben inmitten der Kindergruppe – Maria. Die Wand des scheinbar irrational riesigen, jede Kathedrale überragenden Gebäudes ist von zwei Säulen gesäumt, durch Treppenstufen, die zur Plateauebene führen, umgrenzt. An beschriebener Sequenz lässt sich trefflich beobachten, wie Metropolis als Raum beschaffen ist. Weder architektonisch noch geographisch fügen sich die Sportstätten und die Ewigen Gärten zu einem kohärenten Gesamtbild. Vor allem die Übergänge vom einen zum anderen Ort werden nicht in Szene gesetzt. Jeder Ort steht für sich alleine in seinem symbolischen Wert. Vereinend ist die Überdimensionalität. Zunächst erstaunt, dass sich die Gärten unter einer Kuppel befinden. Bei näherer Betrachtung liegt dies jedoch in der Logik von Metropolis begründet: es gibt kein Außen. Jeder Ort ist ab47. M. Schmeling: Der labyrinthische Diskurs, S. 87ff. 48. Das Doppelgängerinnenmotiv, charakteristisch für den späteren Film Noir
(vgl. Barbara Steinbauer-Grötsch: Die lange Nacht der Schatten. Film Noir und Filmexil, Berlin: Bertz 2000), treibt die Handlung über weite Strecken des Mittelteils von Metropolis voran.
117
Sascha Keilhol z
solut, und das Ganze ist die Metropole. Es scheint, als sei Metropolis nicht eine Stadt, sondern die Stadt, in sich geschlossen und hermetisch abgeriegelt. Im gesamten Film gibt es keinen Verweis auf ein Außen. Metropolis ist die absolute Stadt, ein abgeschlossenes System, dessen sorgsam konstruierte und dennoch völlig unschlüssige Struktur Lang zu Beginn des Films offen legt. 49 So gleicht Metropolis als System dem Labyrinth. Dessen »geometrische Form […] ergibt nur dann Sinn, wenn man sie als architektonischen Grundriss, also von oben betrachtet.«50 Dass uns Lang genau diese Perspektive vorenthält, hat die Orientierungslosigkeit des Zuschauers zur Folge. Dessen Blick ist zudem über weite Strecken an den Freders gekoppelt. Freder ist sofort von Marias Anblick ergriffen, er fasst sich ans Herz (0:10:36). Später tritt er durch dasselbe Tor ab, durch welches Maria im wahrsten Sinne des Wortes erschienen ist. Nach dieser Begegnung wird er ihr folgen wie einem Ariadnefaden, und seine Suche durch Metropolis zeigt dem Zuschauer versatzstückartig immer neue Facetten der Stadt. Der Industriellensohn verlässt das Gebäude durch einen türlosen, wieder mit Treppen versehenen Ausgang, vor dem ein Wagen auf ihn wartet. In der Front sitzt ein Fahrer mit Mütze, vermutlich ein Chauffeur. Innerhalb der elliptischen Narration ist nicht nachvollziehbar, wo der Fahrer herkommt. Freders Reise führt ihn »Zum neuen Turm Babel« (0:16:00). Die Fahrt zum Büro des Vaters visualisiert Lang auf raumlogisch bemerkenswerte Weise: In der ersten Einstellung kann man den Wagen erahnen. Vermutlich handelt es sich um das einzelne, ja bizarr einsame Auto, das sich über eine verkantete Brückenstraße zunächst durch eine Häuserschlucht bewegt, ehe es aus dem Bild fährt, um dann weiter unten links seinen Weg fortzusetzen (0:16:08-0:16:22). Aus vier auf der Autobahn fi xierten Scheinwerfern schnellen Lichtkegel in die Höhe, wie um dem sie passierenden Automobil die Sicht zu erleichtern (0:16:18).51 Im Anschluss ist das Auto nicht mehr zu sehen,52 was in dem hier 49. Man könnte von Metropolis als von einer eigenen Welt und gleichzeitig von einem Welterklärungsmodell sprechen. 50. H. Kern: Labyrinthe, S. 13. 51. Spike Lees graphische Titelsequenz zu 25th Hour (2002), in der dem Tower of Remembrance eine signifikante Rolle zukommt, scheint sich an diesem Bild zu orientieren. 52. Das Gegenkonzept zu dieser Autofahrt in jeder Hinsicht ist in The Shining (1980) zu finden. Ganz anders als Langs starrer frontaler Aufblick, der die vertikalen Strukturen betont, funktioniert Kubricks aus dem Helikopter gefilmte Aufsicht. In beiden Fällen verfolgt die Kamera das Auto der Protagonisten und setzt gleichzeitig die Beziehung zur Umwelt in Szene. Bei Kubrick bleibt allerdings immer der Wagen im Fokus, egal wie weit er sich von der Kamera, oder sie sich von ihm, entfernt. Bei Lang ist er irgendwann nicht mehr im Bild, das Stadtbild rückt in den Vordergrund. Obwohl Kubrick genau den Weg aus dem Zentrum in die Peripherie nachzeichnet, eint beide filmischen Werke wieder die Nähe zum Labyrinth. Als solches sind sowohl das Overlook Hotel, das sogar über einen Irrgarten verfügt, dem im Finale eine entscheidende Rolle zukommt, als auch die Stadt Metropolis inszeniert.
118
Metropolis – ein Labyr inth zwischen Chaos und Ordnung
schon sich anbahnenden Verkehrschaos begründet liegt. Busse, Bahnen, Züge, Autos, Flugzeuge bewegen sich kreuz und quer, ohne erkennbare Ordnung, durch die Megacity. Dafür werden weiterhin Stadtbilder von betonter Ausschnitthaftigkeit offeriert.53 Schon an dieser Stelle wirkt Metropolis wie ein dysfunktionales Hybrid. Die erste Weite (0:16:22) zeigt keine Begrenzungen. Wenig später (0:16:36) ermöglicht ein Blick von oben auf Straßen eine neue Perspektive. Das vermutete Zentrum der Stadt, der neue Turm von Babel, ist im Hintergrund zu erahnen. Das legt die Montage nahe, denn nach einem Umschnitt befindet sich Freder im Innern des Büros seines Vaters. Der Raum wirkt wie eine riesige Halle mit Blick auf die Stadt. In einer an der Wand montierten Maschine laufen Zahlen von oben nach unten durch. In dieser Sequenz, die am längsten innerhalb dieses Großstadtfilms das Zentrum zeigt, wird ein weiteres Mal die Dualität von Chaos und Ordnung inszeniert. Freders Fahrt abwärts ergibt raumlogisch keinen Sinn, will er doch von der Fabrik zum Vater in den Turm von Babel, also von unten nach oben. Seine Bewegungen sind hier schon abstrakt, innerhalb eines labyrinthischen Systems, zu verstehen, dessen Logik sich dem Zuschauer aufgrund des limitierten Einblicks nicht erschließen kann. Freders Weg ist als Linienführung von einem Punkt zum anderen zu sehen: »Jedes Labyrinth besteht aus Linien, die als Grundriß zu lesen sind; sie bilden eine hochkomplizierte abstrakte Bewegungsfigur, deren Nachvollzug erhebliches Vorstellungsvermögen erfordert.«54 Kerns Formprinzip des Labyrinths, die Linien als Bewegungsfigur, entspricht einem konstitutiven Moment der Kinoapparatur. Letztlich lässt sich so auch Langs ornamentaler Stil fassen. Hier ist es die Arbeiterschaft, die sich als lineares Konzept zur Bewegungsfigur fügt.55 »Die einzige Sackgasse eines Labyrinths liegt […] im Zentrum. Dort muß der Besucher seine Gehrichtung ändern; er erreicht die Außenwelt nur, wenn er sich wendet und den Eingangsweg zum Ausgangsweg macht.«56 So beschreibt Kern das »Prinzip Umweg«, später konkretisiert er: »Der Besucher wird auf einem mühevollen aber kreuzungsfreien Weg zwangsläufig ins Zentrum geleitet.«57 Das Begreifen des Eingangswegs als Ausgangsweg lässt sich übertragen in der von Lang vorgenommenen dramaturgischen und narratologischen wechselseitigen Spiegelung der Alltags- und Katastrophensequenzen wieder finden. In der ersten Viertelstunde der Handlung lernt der Zuschauer 53. Man denke nur an Ridley Scotts Blade Runner (1982), für den immer wieder Metropolis als Genre-Referenzfilm genannt wird (vgl. I. Schenk: Dschungel Großstadt) und der im Allgemeinen als einer der wichtigen Vertreter der Neo-Noir-Bewegung verstanden wird. Dort bestimmen die typischen Aufsichten und Übersichten, nicht nur aus dem Helikopter gefilmt, sondern diesen gleich als Handlungsraum nutzend, die Atmosphäre schon zu Beginn des Films. 54. H. Kern: Labyrinthe, S. 14. 55. Schon durch die bereits beschriebene Titelsequenz rückt Lang die Linienführung ostentativ als strukturierendes Prinzip des Films ins Bewusstsein. 56. H. Kern: Labyrinthe, S. 13. 57. Ebd., S. 14.
119
Sascha Keilhol z
mit Ausnahme von Rotwangs Haus, das ohnehin eine Ausnahmestellung im Metropolis-Universum einnimmt und als eigenständiges Labyrinth funktioniert, alle relevanten Handlungsorte kennen. Von nun an bewegen sich die Protagonisten durch die Verzweigungen des Systems. Allen voran Freder, der hier zielgerichtet unterwegs ist. Er muss ins Zentrum vordringen und wieder in die Unterwelt zurückkehren, um endlich an sein Ziel zu gelangen – raus aus dem alten Metropolis hin zu einer neu strukturierten Welt. Während Rotwang für Fredersen einen »Plan der zweitausendjährigen Katakomben tief unter den Tief bahnen [von dessen] Metropolis« dechiff riert, steigen die Arbeiter treppab zu ihrem geheimem Treffen, an eben jenen Ort, was in der Mise en scène durch eine Überblendung veranschaulicht wird (0:41:44). Gemeinsam mit seinem Rivalen geht auch Rotwang diverse Treppen und durch eine Klapptür seines märchenhaften Hauses hinab, ehe sich den beiden der Blick auf Maria vor einem mit Kerzen umrankten und beleuchteten Altar bietet. Rotwang lauert ihr wenig später auf. Ihre aussichtslose Flucht vor ihm ist dezidiert als Lauf durch ein unterirdisches Labyrinth inszeniert (0:55:20-0:58:22). Vorbei an Totenschädeln offensichtlich Verirrter flüchtet sie, immer wieder geblendet, vor dem kreisförmigen Lichtkegel, den Rotwangs Lampe wirft, dabei ständig an Wände stoßend. Das Licht fängt sie förmlich ein. Zuletzt klopft Maria an hölzerne Türen, nicht ahnend, dass sie bereits in Rotwangs Anwesen und in dessen Gewalt ist. Marias Gefängnis, Rotwangs Haus nämlich, entpuppt sich als Labyrinth. Freder dringt, durch Marias Hilfeschreie angelockt, ein, die Tür schließt sich automatisch hinter ihm (1:04:23). Es gelingt dem Suchenden nicht, das System des Anwesens zu begreifen, er wird selbst zum Gefangenen des Labyrinths im Labyrinth. Es bleibt eine Zwischenstation auf Freders Weg durch die Verzweigungen des Labyrinths. Er musste ins Zentrum vordringen und wieder in die Unterwelt zurückkehren, um schließlich an sein Ziel zu gelangen – raus aus dem alten Metropolis hin zu einer neu strukturierten Welt.
Fazit Lotte Eisner spricht von Metropolis als »Lang’s vision of skyscrapers, an exaggerated dream of the New York skyline […]. Again it is the encounter of Expressionism and Surrealism.«58 Auch wenn Lang offensichtlich den Einflüssen seiner Zeit ausgesetzt ist, habe ich dieser recht einfachen und mittlerweile falsifizierten Deutung von Metropolis als New-York-Variation mit diesem Aufsatz das komplexe Bild einer heterogenen, künstlich strukturierten, labyrinthischen und ständig vom Chaos bedrohten Stadt entgegenstellen wollen. Die Sequenz, in der Freder seinen Vater in dessen Büro im obersten Stockwerk des neuen Turms zu Babel aufsucht, illustriert am nachdrücklichsten Langs Vision dieser Stadt: Während Freders Ansprache an seinen Vater geht beider Blick hinaus aus dem riesigen Fenster, das, wie schon die Ewigen 58. L. Eisner: Fritz Lang, S. 86.
120
Metropolis – ein Labyr inth zwischen Chaos und Ordnung
Gärten, durch seine gitterhafte Struktur die Abgeschlossenheit des Systems verdeutlicht und so als Pars pro toto für ein Gefängnis steht. Dieser Blick vom obersten Punkt der Stadt lässt auch hier kein Ende, keine Begrenzung erkennen. Metropolis erstreckt sich scheinbar ins Unendliche und ist auch aus der gewählten Perspektive nicht wirklich überschaubar. Die Bauten sind eine Mixtur unterschiedlichster Stile. Der Stadt fehlt architektonisch jegliche Identität. Eine Montage von Auf blicken und Unterperspektiven, die gleichzeitig verkantet sind, verstärkt den Eindruck des Heterogenen und Disparaten. Im Finale der Montage blickt die Kamera auf den neuen Turm von Babel, um den herum nun plötzlich kreisförmig angeordnete Gebäude zu sehen sind. Kurz darauf, im Moment der ausbrechenden Katastrophe wird die Stadt zur Todesfalle, das Labyrinth zum Gefängnis – verzweigt, nicht zu überblicken. Es scheint kein Entrinnen möglich.
121
Restlichtverstärker, romantisch Bedrohte Humanität in F.W. Murnaus Sunrise 1 Michael Herrmann
Im Schatten des Vampirs Sunrise2 (1927) bildet zwischen Nosferatu (1922) und Tabu (1931) das Mittelglied einer Trilogie von Beziehungsdramen. In allen drei Filmen ergibt sich der zentrale Konflikt aus einer Dreierkonstellation, wobei jeweils eine Paarbeziehung massiv von einem bzw. einer Dritten gestört wird. In Sunrise wird zu Beginn eine Ehe in der Krise präsentiert; eine verführerische Frau der Stadt3 , auf den ersten Blick als Vamp4 erkennbar, hat den Mann seiner Ehefrau entfremdet; 1. Ich danke der Heidelberger Akademie der Wissenschaften für ihre freundliche Förderung dieser Studie. Für wichtige Hinweise und Diskussionen danke ich Frank Bezner, Maik Bozza, Volker Mergenthaler und Jens Möller. 2. Sunrise. A Song of Two Humans, USA 1927, Regie: Friedrich Wilhelm Murnau, DVD: Eureka Entertainment, UK 2005 (= Masters of Cinema 1). 3. Murnau ist ein detailverliebter Regisseur. Nun fällt auf, dass die weibliche Antagonistin der Ehefrau im Cast zwar noch als »Woman from the City« (Hervorhebung M.H.) bezeichnet wurde, im vierten Zwischentitel, unmittelbar vor ihrem ersten Auftritt, jedoch als »Woman of the City« (Hervorhebung M.H.) bezeichnet wird. Damit wird die Figur zwiespältig: Einerseits wird eine ›Frau aus der Stadt‹ angekündigt, andererseits eine ›Frau der Stadt‹. Letztere kommt nicht etwa aus jener Stadt, in der später der Mann und die Ehefrau wieder zueinander finden, sondern repräsentiert im Sinne einer mythischen Personenallegorie jene imaginäre Stadt, die sie im Sumpf für den Mann entwirft: die ›Frau der Stadt‹ verkörpert die Auflösung von Ordnung, die Entgrenzung, das Dionysische. 4. Nimmt man diese Bezeichnung wörtlich, so bezeichnet sie eine phantastische Gestalt, eine legitime Nachfolgerin des Grafen Orlok, der hier nicht nur sein Geschlecht, sondern auch die Essenz gewechselt hat, von der er lebt: Es ist nicht mehr das Blut, hinter dem der Vampir her ist, sondern das Geld; er hat sich mittlerweile – quasi im Sinne eines Evolutionsprozesses, den er zwischen Nosferatu (1922) und Sunrise (1927) durchlaufen hat – seiner Umgebung angepasst.
123
Michael Herrmann
vom Vamp zum Mord an seiner Ehefrau getrieben, besinnt er sich jedoch im letzten Augenblick eines Besseren; im Zuge eines Tagesausflugs in die nahe gelegene Stadt versöhnt sich das Paar; ein Unwetter reißt es erneut auseinander, schließlich jedoch kommt es zur glücklichen Wiedervereinigung im gemeinsamen Heim; der aus dem Feld geschlagene Vamp verlässt das Dorf. Zunächst scheint es also, als käme das Paar in Sunrise in den Genuss des Privilegs, vom tragischen Scheitern der Beziehung verschont zu bleiben. Mehr noch: obwohl es kurz vor Schluss noch danach aussieht, als sollte die Frau der Stadt, die Anstifterin zum Mord, ihrerseits von der Hand des Mannes ermordet werden, darf schließlich sogar sie infolge der glücklichen Errettung der Frau ungehindert ihres Weges ziehen. Obwohl im Verlaufe der Handlung keine der drei genannten Figuren unangefochten bleibt, jede ihre ganz individuelle Krise zu durchleben hat, kommt also am Ende niemand zu Tode. Gibt es plausible Gründe für dieses auf den ersten Blick seltsam harmlose, unrealistisch wirkende Ende? Murnau und Carl Mayer, der Verfasser des Drehbuchs zu Sunrise, weichen in diesem Punkt eindeutig von der literarischen Vorlage des Films ab: In Hermann Sudermanns naturalistischer Novelle Die Reise nach Tilsit5 ertrinkt am Ende der männliche Protagonist, wobei der (reichlich bigotte) Erzähler nahe legt, dies als göttliche Strafe zu interpretieren. Einen ersten Hinweis darauf, dass Sunrise deutlich komplexer strukturiert ist, liefert die Betrachtung einer der drei genannten Hauptfiguren, der Frau der Stadt. Es ist nämlich – insbesondere vor dem Hintergrund von Nosferatu – fraglich, ob es sich bei ihr überhaupt um eine gewöhnliche Sterbliche handelt. Gibt sie sich zunächst als eine verführerische Femme fatale zu erkennen, so ist damit eine ambivalente Figur bezeichnet, die sich sowohl als phantastische als auch als realistische Figur deuten lässt. Unter den Vorzeichen eines aufgeklärten Menschenbildes ist sie zwar keine Hexe mehr, deren ›Magie‹ ist jedoch unter diesen Auspizien in ›Attraktivität‹, in ›sexuelle Anziehungskraft‹ übersetzbar. Die moderne Frau der Stadt tritt das Erbe der Hexe an, wobei ihre metaphorische Bezeichnung als ›Vamp‹ durchaus noch dämonisierende Züge hat. Es zeugt von der subtilen Inszenierung dieser Ambivalenz, dass die Figur im Film nicht zu Tode kommt: die Ambivalenz würde dann zu Lasten der mythischen Deutung der Figur des Vamps aufgelöst, seine Sterblichkeit bewiese, dass die Bezeichnung eben keine allegorische wäre, sondern dass man hier lediglich von einem vagen Vergleich der kapitalistisch orientierten Frau der Stadt mit einem Blutsauger zu sprechen hätte. Dies entspräche einem Sieg der realistischen Weltdeutung. Würde sich der Vamp hingegen trotz aller Bemühungen nicht umbringen lassen und somit als unsterblich erweisen, hätte man es ebenfalls nicht mit einer allegorischen Figur zu tun, die Bezeichnung 5. Hermann Sudermann: »Die Reise nach Tilsit«, in: ders., Die Reise nach Tilsit/ Jolanthes Hochzeit, hg.v. Heinz-Peter Niewerth, Berlin: Nicolai 1989, S. 5-46. Die Reise nach Tilsit erschien erstmals 1917 im Rahmen einer Sammlung von Erzählungen Sudermanns mit dem Titel Litauische Geschichten.
124
Restlichtverstärker, romantisch
des Vamps als Frau der Stadt wäre in diesem Fall verharmlosend. Die Auflösung der Ambivalenz zugunsten dieser Seite entspräche einem Sieg der mythischen Weltdeutung. Dadurch, dass der Mann seinen Mordversuch nicht zu Ende führt, bleibt die Deutung in der Schwebe, keine der beiden möglichen Positionen erhält auf Kosten der anderen die Deutungshoheit. Was bleibt, ist die Irreduzibilität der doppelten Bedeutung, die beunruhigende innere Dynamik der Allegorie. Der Vamp bleibt zumindest potentiell ein Vampir, so lange ihm nicht der Pflock der Eindeutigkeit – der klaren Unterscheidung von Mythos und Realität – ins Herz gestoßen wird. Die Figur balanciert auf der Grenze zwischen zwei Welten. Sunrise präsentiert sich als eine filmische Erkundungsfahrt, die nicht zuletzt Aufschluss darüber geben soll, was es heißt, solche Grenzen zu überschreiten.
Unter wegs in Raum und Zeit Wie Lucy Fischer in ihrer Studie zu Sunrise überzeugend nachweist, ist dieser Film, was seinen strukturellen Aufbau betriff t, geprägt durch eine erstaunliche Vielzahl von Leitdifferenzen.6 Die Benennung der entsprechenden Gegensatzpaare liefert Fischer eine Ausgangsbasis für die Integration der verschiedensten früheren Lektüren des Films. Im einleitenden Kapitel »›Sunrise‹: Border Crossings« formuliert sie ihre Leitthese: »Rather than embrace fi xed divisions, Sunrise is a text marked by fluid boundaries – junctions that trace the subtle connection between entities rather than their clear demarcation. It is this complex mode of ›border crossing‹ […] that makes the fi lm so poignant, resonant, fascinating and modern.«7 Dass es das Phänomen des Übergangs ist, dem Murnaus besonderes Interesse gilt, ist absolut zutreffend. Was beispielsweise die Montage anbetrifft, bevorzugt er überwiegend weiche Schnitte. Entsprechend häufig werden Blenden eingesetzt, um einzelne Szenen so bruchlos wie möglich ineinander übergehen zu lassen. Gleitende Übergänge zwischen Dorf und Stadt (im Boot, in der Straßenbahn) werden inszeniert, zwischen Tag und Nacht (in den verschiedenen Graustufen der Dämmerung), zwischen Liebe und Hass, »bitter« und »sweet«; allmähliche Veränderungen im Verlauf der psychischen Entwicklung einzelner Figuren, Ähnlichkeiten zwischen Figuren, Übergänge im Wechsel ihrer jeweiligen Beziehungen. Sunrise zeigt lediglich einen relativ kleinen Ausschnitt aus dem Leben seiner Protagonisten. Der Handlungsraum lässt sich grob in drei Sphären unterteilen, die jeweils in sich noch einmal differenziert sind: (1.) das Dorf, innerhalb dessen zu Beginn und zum Ende des Films das Geschehen stattfindet, sowie (2.) die Stadt, die im umfangreicheren Mittelteil als Ort des Geschehens firmiert und (3.) der See, der die Sphäre des Übergangs zwischen den beiden vorigen markiert. Die Straßenbahn, die das entsprechende Seeufer mit der 6. Vgl. Lucy Fischer: Sunrise. A Song of Two Humans, London: BFI Publishing 1998, S. 5. 7. Ebd., S. 8.
125
Michael Herrmann
Stadt verbindet, kann als verlängerter Arm der urbanen Sphäre verstanden werden, da es sich hierbei um ein genuin modernes Transportmittel handelt; dieses ist also nicht in derselben Weise ein neutrales Gebiet zwischen Stadt und Land wie der See, der gleichsam ein ›Niemandsland‹, genauer: einen liquiden und mithin von vornherein instabilen Zwischenraum vorstellt. Gerade die Zwischenräume sind es, in denen die Kamera ihre Selbständigkeit gegenüber den Protagonisten ausspielt. Murnau kaschiert die Zwischenräume nicht, im Gegenteil: er stellt sie geradezu aus. Gerade im Übergang zwischen den vermeintlich entscheidenden Aktionen der Darsteller gibt uns die Kamera in Sunrise reichlich viel zu sehen. Der Blick in die Tiefe zeugt Bilder, die ihre ganz eigene Dramatik aus dem Umstand beziehen, dass sie sich in ihrer Flüchtigkeit zu erkennen geben. Sie geben dem Betrachter zu viel auf einmal zu sehen, als dass er damit so ohne weiteres zu Rande käme. Es sind Bilder des Übergangs, flüchtige Bilder fließenden Lebens. Für solche bewegt-bewegenden Bilder interessiert sich Murnau – und bettet sie ein in eine fi lmische Erzählung, die ihnen adäquat ist.8 »Sunrise« ist das erste, was der Betrachter sieht. Der Sonnenaufgang wird zu Beginn nur symbolisch angezeigt. Wenn er dann tatsächlich innerhalb der histoire des Films stattfindet, läutet er gleichzeitig das Ende des filmischen discours ein. Was hier bei Sonnenaufgang anfängt, wird nicht mehr weitererzählt. Worum es Murnau geht, fängt jedoch nicht erst mit dem Anfang der Projektion an und endet auch nicht mit deren Schluss. Der Film besetzt lediglich einen Zwischenraum, ist Text im Kontext des Alltags, das vorgestellte Wechselspiel von Licht und Dunkel transzendiert die Grenzen des Films. Dies gilt speziell auch für die Kadrierung. Die zeitlichen Grenzen des Films und die räumlichen Grenzen des Bildes auf der Leinwand sind fließend bzw. offen – jederzeit kann etwas von außen eindringen bzw. nach außen über die Grenzen des Films hinaustreten.9 Zusätzliche Erweiterungsmöglichkeiten schaff t sich Murnau, indem er die Kamera ›entfesselt‹, d.h. so weit wie möglich flexibilisiert, und die Mise en scène häufig so gestaltet, dass mittels ausgefeilter Bildkomposition und Lichtregie so viel wie möglich von der Tiefe des Raumes eingefangen werden kann. 8. Diese Beobachtung korrespondiert mit der Feststellung André Bazins, »daß es mitten im Herzen des Stummfilms eine Filmkunst gibt, die genau das Gegenteil dessen ist, was man als das ›Kino par excellence‹ betrachtet; eine Sprache, deren semantische und syntaktische Einheit keineswegs die Einstellung ist; eine Kunst, in der das Bild vor allem zählt, weil es die Realität enthüllt, nicht weil es ihr etwas hinzufügt«, André Bazin: Was ist Film?, hg.v. Robert Fischer, Berlin: Alexander 2004, S. 94. 9. Damit wird Peter Dittmar widersprochen, der behauptet: »Das Bild ist bei Murnau genau durchkomponiert und weist nicht über seinen Rahmen hinaus«, Peter Dittmar: F. W. Murnau. Eine Darstellung seiner Regie und seiner Stilmerkmale durch die Rekonstruktion der verlorenen und unvollständig überlieferten Filme, Diss., Berlin 1962, S. 148. Vgl. hierzu auch Jo Leslie Collier: From Wagner to Murnau. The Transposition of Romanticism from Stage to Screen, Ann Arbor, London: UMI Research Press 1988, S. 136.
126
Restlichtverstärker, romantisch
Langsam und bedächtig wird die Handlung entfaltet, die Konfliktsituationen werden sorgfältig aufgebaut und entwickelt. Der Handlungszeitraum, der hier in eineinhalb Stunden präsentiert wird, umfasst weniger als zwei Tage. Dabei wird fast ausschließlich linear erzählt. Zwar werden wiederholt verschiedene Erzählstränge parallel geführt, daneben kommt der Film aber mit einer einzigen Rückblende aus. Die Schlichtheit der Zeitstruktur ist Programm und entspricht der vermeintlichen Schlichtheit des Plots. Doch es geht ums Detail. So einfach Sunrise von der Makrostruktur der Erzählung her zunächst erscheint, so komplex sind häufig einzelne Bilder und Sequenzen gestaltet. In symbolischer Hinsicht ist der Film extrem aufgeladen, subtile kunst- und kulturgeschichtliche Zitate werden präsentiert, komplexe Rituale werden mit minutiöser Sorgfalt in Szene gesetzt. Letztlich ist es dann aber die gleitende ›musikalische‹ Bewegung als ganze, das Gespür für die Variation des Tempos und des Lichts, sind es die fließenden Übergänge zwischen dramatischen und besinnlichen Momenten der Handlung, die den spezifischen Rhythmus des Films prägen. Wenn dieser »Song of Two Humans« auf den ersten Blick als ein Lied daherkommt, so verbirgt sich dahinter die Fortführung einer poetischen Tradition: Murnau entpuppt sich als ein Nachfahre der Romantik.
Der Einstieg ins Märchen Sowohl hinsichtlich dessen, was erzählt wird, als auch hinsichtlich der Art und Weise, wie erzählt wird, lässt sich eine deutliche Verwandtschaft zwischen Sunrise und der literarischen Erzählform des Märchens feststellen, deren Blütezeit die Romantik war. Auf den ersten Blick mag dieser Befund überraschen, handelt es sich doch erstens bei der literarische Vorlage zum Drehbuch des Films, Hermann Sudermanns Die Reise nach Tilsit, um eine naturalistische Novelle, und scheint es dem Film doch zweitens an einem notwendigen Bestandteil des Märchens im engeren Sinne zu mangeln: am Wunderbaren in konkreter Gestalt von Wesen, die mit magischen Kräften ausgestattet sind und sich damit als Verkörperungen übernatürlicher Mächte bzw. universaler Prinzipien – seien es gute oder böse – zu erkennen geben. Der erste Einwand ist vergleichsweise leicht zu entkräften: Murnau und sein Drehbuchautor Carl Mayer haben sich mit Sunrise relativ weit von der literarischen Vorlage entfernt. Die klare topographische Situierung wird aufgehoben, sowohl das Dorf als auch die Stadt bleiben im Film namenlos, der Film verweigert diesbezüglich konkrete Referenzen.10 Sudermanns Novelle ist ein Stück ostdeutscher Heimatliteratur, Murnaus Film hat demgegenüber einen universalen Anspruch. Zahlreiche Versatzstücke einerseits traditionaler Dorfund andererseits moderner Stadtkultur werden gezeigt, wobei die Dorfauf10. Die gesamte Szenerie wurde künstlich geschaffen, Murnau ließ sich von seinem Architekten Rochus Gliese ein Dorf und eine Stadt nach seinen Wünschen bauen. Während das Dorf am Lake Arrowhead aus dem Boden gestampft wurde, entstand die Stadt auf dem Gelände der Fox Studios in Hollywood.
127
Michael Herrmann
nahmen Musterbeispiele grandioser Plein-Air-Photographie vorstellen – und dennoch ist Sunrise zu keinem Zeitpunkt ein naturalistischer Film. Der zweite Einwand wiegt schwerer. Wie eingangs beschrieben, ist die Frau der Stadt eine zweideutige Figur. Für den Zuschauer ist es allerdings nicht zwingend notwendig, sie als eine allegorische aufzufassen: der Film wird in logischer Hinsicht nicht etwa unverständlich, wenn man es nicht tut. Sunrise lässt sich auch lesen, ohne dass man dabei auf die Anwesenheit übernatürlicher Kräfte rekurriert.11 Allerdings muss unter dieser Voraussetzung relativ häufig der glückliche Zufall bzw. ein von vornherein festgelegtes freundliches Fatum bemüht werden, um den positiven Verlauf und insbesondere den glimpflichen Ausgang der Geschichte zu erklären, was im Sinne realistischen Erzählens nicht sonderlich befriedigend erscheint. Bei Sunrise handelt es sich um die filmische Darstellung einer (arche-) typischen Beziehungskrise und deren Bewältigung, die sowohl in philosophischer als auch in psychologischer Hinsicht eine subtile Erforschung der conditio humana vorstellt, und zwar in Form eines Märchens. Märchentypisch ist zunächst die Überschaubarkeit des Umfangs an handelnden Personen. Diese erscheinen im Märchen meist stark typisiert, nicht selten haben die Figuren hier keine Eigennamen. Selbiges gilt auch für Sunrise: Der Mann (»The Man«) ist als solcher ein Stellvertreter für viele Männer, die Ehefrau (»The Wife«) ist ihm gegenüber schon etwas deutlicher spezifiziert, so auch die Frau (aus) der Stadt (»The Woman from the City«). Alle weiteren gelisteten Personen sind entweder durch ihren Beruf (»The Maid«, »The Photographer«, »The Barber«, »The Manicure Girl«) oder durch eine hervorstechende Eigenschaft (»The Obtrusive Gentleman«, »The Obliging Gentleman«) näher charakterisiert. Weitere Personen finden im Cast zunächst überhaupt keine Erwähnung. Daraus ergibt sich die Frage: Wer genau sind hier die »Two Humans«? Zunächst einmal scheint dadurch, dass seine Charakterisierung hier eindeutig den höchsten Unbestimmtheitsgrad hat, der Mann (»Man«) auf eine der beiden Positionen abonniert; dann aber wird es schon zweideutig: Zunächst würden wir ihm, auch von der Reihenfolge des Erscheinens her, die Ehefrau (»Wife«) zugesellen; allerdings tritt sie hier nominell nicht als Frau (»Woman«) in Erscheinung, die Frau (aus) der Stadt hingegen sehr wohl. Diesen Zwiespalt wird der Film in den kommenden eineinhalb Stunden austragen, mit allen Konsequenzen, die das für die Definition von Humanität, für die Definition des Menschen (»Man«) hat. So überschaubar die Personenkonstellation bleibt, so vage werden zu Beginn die Figuren charakterisiert. Selbiges gilt für den Ort der Handlung. Ein Dorf am See, eine Stadt, dazwischen Wald und Wiese, nicht mehr ganz unberührte Natur, durch die eine Straßenbahn fährt. Letztere sowie die Stadt 11. Nicht zuletzt aus diesem Umstand resultiert der wiederholte Vorwurf eines Missverhältnisses zwischen histoire und discours. Die vermeintlich simple, eindimensionale, ja zuweilen kitschige Geschichte würde der aufwändigen ästhetischen Gestaltung des Films nicht gerecht, so liest man immer wieder. Diese Auffassung teile ich nicht.
128
Restlichtverstärker, romantisch
und deren Bewohner erlauben es uns, die erzählte Zeit des Märchens vom vorgeführten Stand der kulturellen Entwicklung, der Mode, der Architektur, der Interieurs, der Transportmittel und der anderen technischen Errungenschaften her – zumindest partiell 12 – auf die 20er Jahre des 20. Jahrhunderts zu datieren, also ungefähr auf die Entstehungszeit des Films. Schließlich geht auch die erzählstrukturelle Rahmung des Films weitgehend konform mit derjenigen eines Märchens: Das Ende der Erzählung sieht – zumindest an der Oberfläche – glücklich aus: das Liebespaar wird wieder zusammengeführt, die störende Antagonistin wird bestraft und muss kurz vor Schluss die Szene verlassen, mit der Sonne scheint eine entsprechend goldene Zukunft auf. Im Märchenstil gehalten sind auch die ersten beiden Zwischentitel des Films, die nach dem Cast die erste Szene eröffnen: (1.) »This song of the Man and his Wife is of no place and every place; you might hear it anywhere, at any time.« (2.) »For where ever the sun rises and sets – in the city’s turmoil or under the open sky on the farm – life is much the same; sometimes bitter, sometimes sweet.« Mit dem ersten Zwischentitel wird die zuvor erzeugte Unsicherheit, auf wen genau sich dieser »Song of Two Humans« denn nun eigentlich bezieht, scheinbar zugunsten der Ehefrau aufgelöst. Mit beiden wird die universelle Gültigkeit der Geschichte behauptet, unabhängig von historischen oder topographischen Bedingungen. Der erste Insert des Films, der nach Art eines Werbeplakats gestaltet ist, und der in Sunrise noch vor den ersten bewegten photographischen Bildern gezeigt wird, stimmt den Betrachter ein: »Summertime… vacation time« lautet der eingängige Slogan, der ihm vom ersten Bild des Films, auf das er mittlerweile bereits zweieinhalb Minuten gewartet hat, ins Auge springt. »Der Zuschauer ist ein Passagier, er hat den Film wie eine Passage gebucht. […] Die Städter kommen aufs Land, das sie lockt, das unbekannte, das völlig andere Leben […]. Das Land, das ist die unbekannte fremde Region, die dunkle Landschaft der Seele. Ein Labyrinth, ein Zwischenreich, zwischen Ufer und See, Acker und Wasser.«13
Bevor wir dieses Land jedoch sehen dürfen, konfrontiert uns der Film mit moderner Werbeästhetik, wie sie der alltäglichen Wahrnehmung des urlaubshungrigen Stadtflüchtigen entspricht. Eine gezeichnete Bahnhofszene wird überblendet mit einem zum Verwechseln ähnlichen photographischen Bild, das sich zu bewegen beginnt: der dargestellte Zug verlässt den Bahnhof. Mit 12. Das Dorf wird demgegenüber als kulturell und wirtschaftlich different vorgeführt. Es bezeichnet einen traditionsverhafteten, ja archaischen Raum. Was der Film vorführt, ist – auch im Hinblick auf die innerhalb eines Raumes handelnden Figuren – das Problem der Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. 13. Fritz Göttler: »Sunrise – A Song of Two Humans«, in: Friedrich Wilhelm Murnau (= Reihe Film 43, hg.v. Peter W. Jansen u. Wolfram Schütte in Zusammenarbeit mit der Stiftung Deutsche Kinemathek), München, Wien: Carl Hanser 1990, S. 189-197, hier S. 192f.
129
Michael Herrmann
der ersten Überblendung des Films zeigt uns Murnau gleichzeitig seine Instrumente: Das zunächst gezeichnete Bild gewinnt im Übergang zur Photographie enorm an Tiefe. Es folgt eine hochdynamische Sequenz von Bewegungsaufnahmen, bei der verschiedene Transportmittel in Aktion gezeigt werden. Diese werden von einer im Vordergrund eingeblendeten Strandszene mit ›Badenixe‹ zusammengehalten, die den rechten unteren Bildwinkel beherrscht und damit eine Zusammenschau verschiedener Urlaubsmotive zu einer Art fi lmischer Postkarte vorstellt. Durch das nahtlose Ineinanderblenden von gezeichneten und photographierten Gegenständen wird der Betrachter weg von den künstlichen Bildern hinübergeleitet zur realistischen Plein-Air-Photographie. Der Zuschauer wird gezielt gestresst. Er ist aufgerufen, zunächst einen überaus hektischen Auf bruch zum Urlaubsort mit eigenen Augen nachzuvollziehen, bevor – nach einer ersten Schwarzblende – im starken Kontrast dazu ein ganz anderes Bild entsteht. Ruhig, entspannt gleiten wir mit einem Ausflugsdampfer dem kleinen Hafen eines pittoresken Dorfes entgegen, der nach den Aufregungen der ersten 50 bebilderten Sekunden nicht zuletzt auch für das soeben intensiv in Anspruch genommene Auge eine echte Erholung bedeutet: Mit der Ankunft des Schiffes am Ufer des Dorfes kommt auch der Zuschauer im Urlaub an. »Ist der seltsam konventionelle Auftakt des Films, die Ankunft des Dampfers mit den Sommergästen, auf das Konto von Hollywood zu setzen? Von Murnaus Freude an Bewegung, an Rhythmus und Licht ist hier wenig zu spüren. Enttäuscht merkt man hier einen drittklassigen Ufastil, dem Murnau sonst nie verfallen ist.« 14 Lotte Eisner interessiert sich hier offensichtlich zu wenig für den Zusammenhang, in dem dieser »konventionelle Auftakt« steht. Die Ankunft im Dorf steht bewusst im Kontrast zum tatsächlichen »Auftakt« des Films, den sie an dieser Stelle schlichtweg ignoriert. Murnau spielt schon hier, zu Beginn von Sunrise, virtuos auf der Klaviatur der Affekte des Publikums. Nach einer kurzen, nervenaufreibenden Eingangssequenz setzt er bei der Ankunft des Dampfers dezidiert auf ruhige Bewegungen, eine unspektakuläre Hafenansicht und gewohnte ästhetische Muster, mit einem Wort: auf Entspannung. Die knappe Minute zwischen der ersten und der zweiten Schwarzblende wird vom Zuschauer seinem eigenen Zeiterleben nach im Vergleich zur hektischen Eingangssequenz als deutlich länger wahrgenommen, obwohl sie objektiv ungefähr gleich lang dauert. Wenn sich Murnau mit der dritten Sequenz endlich der Frau der Stadt zuwendet, hat er bis dahin den Zuschauer hinsichtlich der Zeitwahrnehmung bereits durch ein Wechselbad der Extreme geschickt. Bevor der zentrale Konfl ikt entwickelt wird und der Film allmählich zu seinem wellenartigen Erzählrhythmus findet, hat der Zuschauer unwillkürlich eine ›Aufwärmphase‹ durchlaufen und dabei ein Wahrnehmungstraining absolviert, das seine Sinne für die Erzählung der eigentlichen Geschichte geschärft hat, wie sie nach 14. Lotte H. Eisner: Murnau, überarb., erw. u. autorisierte Neuausgabe, hg.v. Hilmar Hoffmann u. Walter Schobert, Frankfurt a.M.: Kommunales Kino Frankfurt 1979, S. 290.
130
Restlichtverstärker, romantisch
der zweiten Schwarzblende mit dem dritten Zwischentitel ihren Ausgang nimmt: »Among the vacationists was a Woman of the City. Several weeks had passed since her coming and still she lingered.« Warum? Wir sind gespannt. Die Kamera führt uns ins Dorf.
Macht der Ver führung Welche Vorstellungen haben wir vom Leben auf dem Land? Welche vom urbanen Leben? In Sunrise werden wechselseitig beide Mythen reflektiert, der Mythos ›Dorf‹ und der Mythos ›Stadt‹, und zwar jeweils aus der Perspektive der Bewohner des anderen Lebensraumes.15 Dadurch wird jeder der beiden Räume verfremdet, ohne dabei entweder als völlig bekannt oder als völlig fremd dargestellt zu werden. Es ist der Reiz des jeweils Anderen, das Abenteuer der Entdeckung des gegenüber eingefahrenen Sehgewohnheiten jeweils verändert wahrgenommenen Raumes. Dabei erscheint weder das Dorf im Blick der Stadtbewohner noch die Stadt im Blick der Dorf bewohner als dämonisierter Raum.16 Die Dämonie bleibt dem ambivalenten Zwischenreich des Sumpfes, dem Niemandsland zwischen Erde und Wasser vorbehalten. Die Problematisierung der Verbindung zwischen Dorf und Stadt wird mit der Problematisierung der ehelichen Verbindung zwischen Mann und Frau gekoppelt. Die Projektion eines imaginären Wunsch-Ortes, wie sie der Vamp für den Mann inszeniert, ist als Film im Film mitzuerleben, wenn der Sumpf zum Kino wird. Damit wird der Vamp als Regisseur des Films im Film zu einer Figur, in der sich nicht zuletzt auch die Macht des Illusionisten Murnau spiegelt. Qua Analogie mit dem Mann als passivem Zuschauer eines Films, welcher zwar seinem Wunsch nach ekstatischem Leben entspricht, welcher aber andererseits nur deshalb inszeniert wird, um ihn von seinem bisherigen Leben zu entfremden, um ihn leichter ausbeuten zu können, ist der Zuschauer aufgerufen, die Gefahren des fi lmischen Illusionismus zu reflektieren. Er wird, wie der Mann, dazu verführt, eine Scheinwelt für bare Münze zu nehmen, 15. Der Mythos ›Stadt‹, für den der Vamp stellvertretend steht, ist älter als jene konkrete Stadt der erzählten Welt, die uns im weiteren Verlauf präsentiert wird: Es ist die imaginäre Stadt, die für den Mann vom Dorf das schlechthin Andere markiert, eine Stadt, die den Ausbruch aus der gelebten Enge erlaubt und dem machtvollen Wunsch nach ausgelebter Sexualität entspricht. Als realer Raum, innerhalb dessen die Frau der Stadt ihre Macht uneingeschränkt entfalten kann, erweist sich folgerichtig auch nicht die Stadt, sondern der Sumpf, ein Ort roher (Trieb-)Natur. 16. Damit wird Colin McArthur widersprochen, der die Unterscheidung zwischen gutem Dorf und böser Stadt zur Schlüsseldifferenz erklärt: »The country/city opposition, with the former as Arcadia and the latter as Sodom, furnishes the key structural opposition in Sunrise (1927)«, Colin McArthur: »Chinese Boxes and Russian Dolls. Tracking the elusive cinematic city«, in: David B. Clarke (Hg.), The Cinematic City, London, New York: Routledge 1997, S. 19-45, hier S. 21.
131
Michael Herrmann
nur weil sie seinem Begehren so viel besser zu entsprechen scheint, als die reale Welt es jemals könnte. Der Beziehungskonflikt wird entfaltet: Ein verheirateter Mann, Landwirt und Dorfbewohner, steht zwischen zwei extrem verschiedenen Frauen. Die Beziehung zu seiner biederen, blonden Ehefrau steckt in einer tiefen Krise, ist massiv gestört seit dem Auftauchen einer schicken, schwarzhaarigen Touristin. Aus dieser Situation ergibt sich kein geschlossenes Beziehungsdreieck: Die beiden Frauen treffen während des gesamten Films nicht ein einziges Mal aufeinander, sie sind also niemals gemeinsam im Bild. Für beide sind jeweils eigene Sphären, eigene Handlungsräume reserviert, zwischen denen der Mann hin- und herpendelt. Die Frau der Stadt beherrscht den Sumpf, während die Ehefrau das Monopol auf die häusliche Sphäre hat; letztere bietet daneben noch Raum für den Ehemann, die Magd und das Kind des jungen Ehepaars, erstere bleibt allein dem intimen Zusammentreffen zwischen der Frau der Stadt und dem Mann vorbehalten. Beide Räume bieten Platz für Heimlichkeiten: der Sumpf für die vor der Dorföffentlichkeit versteckten außerehelichen Treffen, also für die gemeinsame ehebrecherische Heimlichkeit von Mann und Frau der Stadt, das Haus hingegen – und das markiert den Ort als denjenigen der krisenhaften Beziehung – das Haus eignet sich für Heimlichkeiten des Mannes gegenüber seiner Ehefrau, wenn er über das Fenster des Esszimmers Kontakt nach außen aufnimmt, während die Ehefrau in der Küche beschäftigt ist. Das Haus bietet innerhalb fester Außenmauern nur wenige Entfaltungsund Ausweichmöglichkeiten, der Sumpf ist demgegenüber nach allen Seiten offen. Die unkultivierte Wildheit der Natur und die latente Gefahr, die vom unsicheren Boden des Sumpfes ausgeht, lassen diesen als idealen Raum für (erotisch aufgeladene) Abenteuer und bewusst gesuchten (ekstatischen) Orientierungsverlust erscheinen, er korrespondiert perfekt mit dem Begehren des Mannes nach passiver Hingabe an den weiblichen Eros, nach ungezügelter Leidenschaft, nach Suspension von Kontrolle und Ordnung. Der genaue Ort der heimlichen Zusammenkunft im Sumpf ist von der Frau der Stadt für ihre Zwecke perfekt gewählt. Während der Mann die Selbstkontrolle zunehmend aufgibt, kontrolliert sie zunehmend die gesamte Situation, ihre Aktionen sind kalkuliert, das Risiko des Scheiterns der Verführung wird minimiert. Hinzu kommt ihr perfektes Timing: Die Nacht gehört dem Vamp, hier kann er seine Qualitäten voll ausspielen, im opaken Licht des Mondes wird sein Opfer durch nichts von seiner erotischen Selbstinszenierung abgelenkt. Die Imaginationskraft des Mannes wird von der natürlichen Umgebung begünstigt. Er unterliegt der nahezu hypnotischen Kraft jener Bilder, welche die Frau der Stadt entwirft, sei es das Bild ihrer selbst, das sie noch unmittelbar vor dem Zusammentreffen mit Schminke korrigiert, sei es der (Trick-) Film im Film, den sie über dem Wasser in den nächtlichen Himmel projiziert. Indem sie dem Mann äußerst lebendig jenen Ort rauschhaften Erlebens vor Augen führt, verdoppelt sich die Frau der Stadt. Der Mann findet sich simultan auf zwei Ebenen ihren Verführungskünsten ausgesetzt: im Hier und Jetzt des Sumpfes, wo sie leibhaftig anwesend ist, und in den imaginären Bildern, die sich vor den Horizont schieben. Dabei wird ihm nicht zuletzt auch eine Zu132
Restlichtverstärker, romantisch
kunft suggeriert, die gigantische sexuelle Potenz verheißt.17 Sich verdoppelnd, besetzt der Vamp also neben dem Sumpf in Gestalt der Stadt des Rausches den Raum des Imaginären, der die Auflösung der starren Ordnung, der begrenzten Perspektive, der Unterscheidung von Phantasie und Realität verspricht. Wo Ich ist soll Rausch, soll Ekstase werden. Dieser Lawine von sowohl physischen als auch psychischen Manipulationen ist der Mann vor dem Hintergrund seines von ihm als blutleer erfahrenen Ehelebens nicht gewachsen. Die Mise en abyme ist ein probates Mittel der Selbstreflexion. Tritt man bei der Betrachtung dieser Passage noch einen weiteren Schritt zurück, so wird erkennbar, dass selbstverständlich auch Sunrise verführen will. Wir werden als Betrachter dazu veranlasst, die hier vorgeführte intradiegetische Imagination für die extradiegetische zu nehmen und angesichts des Films im Film letzterem einen Realitätsgrad zuzubilligen, den er eigentlich nicht für sich in Anspruch nehmen kann. Wir sehen den Film, den der Vamp vorführt, als Film und werden dabei gleichzeitig dazu verführt, den ausgesprochen fiktionalen Charakter der Rahmenerzählung zu vergessen, genauer: über ihn hinwegzusehen. Der Vamp ist in der Lage, bewegte Bilder zu erschaffen, die sein Opfer fesseln, die es gefangen nehmen. Insofern wir uns aber als Betrachter von Sunrise nicht gefangen nehmen lassen, insofern wir also der Verführung für einen Moment widerstehen, dürfen wir uns die skeptische Frage erlauben, ob denn der Projektor – der insofern als ein Agent, d.h. als ein ausführendes Organ des Regisseurs angesehen werden kann, als er nach dessen Maßgabe bewegte, uns bewegende Bilder produziert (und auf Wunsch immer wieder reproduziert) – ob also dieser Projektor sich nicht zum Kinopublikum verhält wie der Vampir zu seinem Opfer. Allerdings erhält der Kinozuschauer mit der Verdopplung der Beobachtersituation prinzipiell die Möglichkeit, seine eigene Position zu reflektieren und zu relativieren. Der Zuschauer nimmt an dieser Stelle eine den Figuren der erzählten Welt überlegene Beobachterposition zweiter Ordnung ein. Dem Mann im Sumpf hingegen bleibt die Option verwehrt, Distanz zu den imaginierten Bildern zu gewinnen, ihm fehlt diese zweite Dimension der Beobachtung. Er ›sieht‹ nur einen ›Film‹, der zudem in viel stärkerem Maße sein eigener ist, als es Sunrise für sein Publikum je sein könnte. Die Vision der Stadt über dem Wasser ist als seine subjektive Innenschau aufzufassen, motiviert allerdings durch die subtilen Einflüsterungen des Vamps. Der Film im Film weist in eine imaginäre Zukunft, der Vamp entwirft die Stadt als chaotische Stätte exzessiven Rausches. Genau das Gegenteil ist der Fall, wenn später der Mann noch einmal, diesmal allerdings auf die Initiative der Ehefrau hin, in die Rolle des Zuschauers versetzt wird. Der Weg des Paares durch die Stadt führt in die Kirche, wo es mitten in eine Hochzeitszeremonie hineingerät. Für das Paar weist dieses Spiel im Spiel – das zwar 17. Der nach Art einer Leuchtreklame von Licht durchpulste ›Maibaum‹, der das Zentrum des weitläufigen Platzes markiert, und der auf der wilden Fahrt durch die imaginäre Stadt den ersten und einzigen stabilen Orientierungspunkt vorstellt, ist eindeutig phallisch konnotiert.
133
Michael Herrmann
für den Kinozuschauer ebenso ein fiktionales Schauspiel ist, wie die vorige Inszenierung der Chimäre Stadt, innerhalb der erzählten Welt jedoch pure Realität – nicht in die Zukunft, sondern in die Vergangenheit: Es erinnert an deren eigene Hochzeit. Dabei erhält insbesondere der Mann die Gelegenheit, sein Ehegelöbnis angesichts der Trauungszeremonie noch einmal zu erneuern, nachdem er zuvor so eklatant gegen das ursprüngliche verstoßen hat. Keiner der beiden produziert diese Bilder, weder durch Suggestion (wie zuvor der Vamp) noch durch entsprechende Projektion. Allerdings projiziert sich der Mann diesmal in die Rolle des realen Bräutigams hinein. Er geht mit der Zeremonie mit, antwortet auf die Fragen des Pfarrers. Während er seinen kathartischen affektiven Zusammenbruch durchlebt, bettet er seinen Kopf in den Schoß der Ehefrau; diese reagiert mit Gesten der Fürsorge und der Verzeihung. All dies lässt nicht eben darauf schließen, dass der Mann zu diesem Zeitpunkt bereits wieder wie ein Erwachsener agiert. Hier erlebt er zunächst einmal seine Wiedergeburt als Mensch – als Kind Gottes. Am Ende der Zeremonie tritt das Paar durch den Hauptausgang ins Freie, wo eine kleine Gruppe von Hochzeitsgästen eigentlich Spalier für die anderen Frischverheirateten steht. Symbolisch wird hiermit der Akt der segnenden Verbindung zweier Menschen zu einem Ehepaar und dessen Entlassung in die Welt an den beiden noch einmal vollzogen, der Zuschauer sieht ihn allerdings erstmalig. Was bis zu diesem Zeitpunkt geschah, präsentiert sich von daher nicht als Eheleben, sondern vielmehr als dessen Vorgeschichte. Aus der notwendigen Wiedergeburt des Mannes erklärt sich auch die seltsame Position der Kirchenszene innerhalb der Reihe verschiedener Stationen, die das Paar in der Stadt durchläuft. Aus dramaturgischen Gründen würde man im Rahmen eines Melodrams üblicherweise erwarten, dass eine solche Kirchenszene entweder zu Beginn oder, noch wahrscheinlicher, am Ende präsentiert wird, im letzteren Falle entsprechend aufwändig inszeniert. Nicht so in Sunrise: Selbst innerhalb der Stadt steht die Kirchenstation erst an dritter Stelle, nach dem Besuch des Kaffeehauses und dem Kauf des Blumenstraußes, dabei vor dem Friseurladen, dem Photoatelier und dem ausgedehnten Besuch des Vergnügungsparks. Das erscheint vom ganz spezifischen Handlungsverlauf des Filmes her durchaus sinnvoll, haben so doch die Protagonisten und mit ihnen die Zuschauer nach der wilden Flucht, der Fahrt mit der Straßenbahn und der Ankunft in der Stadt zunächst noch etwas Zeit, sich in der neuen Umgebung zu akklimatisieren und ihre Wahrnehmung an das neue Umfeld anzupassen.
Film über Film Als eine Schlüsselszene, welche Murnau die Gelegenheit zur Medienreflexion gibt, entpuppt sich der Besuch des Ehepaars im Photoatelier. Der Photograph korrigiert zunächst nur sporadisch die Selbstinszenierung des Paares vor der Hintergrund einer Phototapete, die auf künstliche Art und Weise die freie Natur ins Studio holt. Keine urbane Szene ist es, die das Paar zum Hintergrund 134
Restlichtverstärker, romantisch
gewählt hat, sondern eine idyllische, die relativ nahtlos an die zuvor in der Retrospektive der Magd gezeigte »Kindheit« des Paares anknüpft. Im deutlichen Missverhältnis zur zwanglosen, ungekünstelten Naivität, die einem solchen Hintergrund entspräche, nimmt insbesondere der Mann eine fast schon militärische, zumindest aber im Kontext der Dokumentation des Ehestandes eine übertrieben patriarchale Haltung ein. Diese kann er jedoch angesichts der neuerlichen Verliebtheit und der damit verbundenen scherzhaften Tändeleien mit seiner Frau nicht durchhalten. Während der Photograph mit dem Aufnahmeapparat beschäftigt scheint, verliert das Paar seine Contenance. So gelingt es dem Photographen schließlich, neben seiner eigentlichen Auftragsarbeit auch noch ein völlig ungekünsteltes Photo zu schießen: Ein Kuss wird auf Platte gebannt, ohne dass das Paar dies zunächst bemerkt. Murnau thematisiert hier die Unterscheidung von ›natürlichem‹ und ›künstlichem‹ Bild, von unwillkürlichem Spaß und gestelltem Ernst, von Dokumentation gelebten Lebens einerseits und bewusst inszeniertem Schauspiel andererseits. Dabei ist ersteres mit Affekt, mit ›echter‹ Leidenschaft und mit der Dynamik des Gefühlsaustauschs verbunden, der sich im Kuss manifestiert; letzteres, also das Schauspiel, wird demgegenüber mit Statik und – schlimmer noch – mit unfreiwilliger Komik konnotiert. Gibt das Paar seiner unwillkürlichen Albernheit nach, so kann daraus ein glaubwürdiges gefühlsintensives Bild entstehen; versuchen die beiden hingegen, sich mutwillig als besonders würdevolles Ehepaar zu inszenieren, so geben sie dabei ein albernes Bild ab. Ein analoger Chiasmus findet sich bei der genaueren Betrachtung des Aufnahmeapparats: Dem abzulichtenden Gegenstand korrespondiert auf dem Kameraschirm sein Bild, wobei das Bild im Verhältnis zum Gegenstand auf dem Kopf steht. Im unmittelbaren Anschluss an die beiden Aufnahmen – von denen das Paar die eine gar nicht mitbekommen hat – wird ein verwegenes Spiel um Köpfe und Kopflosigkeit inszeniert, während der Photograph im Hinterzimmer die Platten entwickelt. Infolge der heiteren Tändeleien des Paares fällt eine Venusstatuette zu Boden die zuvor weder Mann noch Ehefrau genauer in Augenschein genommen haben. So haben beide auch nicht bemerkt, dass die Statuette – die der Zuschauer schon vorher im Bildhintergrund sehen konnte – von vornherein fragmentiert war: Kopf und Arme fehlten bereits zuvor. An der Oberfläche handelt es sich zunächst einmal um einen weiteren Hinweis auf die Herkunft des Paares: Als einfache Leute vom Lande sind die beiden bisher vermutlich höchst selten mit vergleichbaren Kunstwerken in Kontakt gekommen, sodass sie die Statuette primär als einen defizienten Gegenstand wahrnehmen. Sie identifizieren das Fragment nicht als eine besondere Erscheinungsform von Kunst, die zwar auf den ersten Blick nach Komplettierung verlangt, auf den zweiten Blick jedoch gerade deshalb als künstlerisches Ausdrucksmittel sui generis interessant wird. In der Romantik wurde das Fragment sowohl in der Philosophie als auch in der Erzählkunst zu einer eigenen Gattung erhoben, die nach romantischem Selbstverständnis als angemessene Ausdrucksform eines genuin modernen Lebensgefühls und damit auch als äußerst geeignet zur Artikulation modernen 135
Michael Herrmann
Denkens und Erzählens propagiert wurde.18 Wenn nun das Paar beim Aufheben der heruntergefallenen Venusstatuette erschrickt, weil es den Kopf der Statuette vermisst, so ist das an der Oberfläche zunächst einmal ein kleiner Scherz auf Kosten der unwissenden Dörfler. Aber der Scherz ist noch längst nicht alles, was hier inszeniert wird. Als das Paar die Statuette ergänzt, indem es ihr einen zum Vogelkopf stilisierten Gummiball aufsetzt, erschaff t es damit ein seltsames Fabelwesen, genauer: einen teilweise menschlichen, teilweise tierischen Zwitter. Sein Körper, dem allerdings die Arme fehlen, ist menschlich, sein Kopf, der Sitz des Geistes, ist tierisch. Liegt es nicht auf der Hand, bei dieser ›gefallenen Venus‹ auch an die Frau der Stadt, bei diesem phantastisch anmutenden Zwitter an den Vamp zu denken? Insbesondere, wen man diese Figur als mythische Personenallegorie begreift? Dazu passt, dass sich die Filmerzählung direkt im Anschluss an die Atelier-Episode für kurze Zeit wieder dem Vamp zuwendet, der im Dorf die Rückkehr des Mannes erwartet. Und noch auf etwas anderes wird mit dem Statuetten-Zwischenspiel hingewiesen: Die Austauschbarkeit des Kopfes bei der Komplettierung der Venus weist auf die Austauschbarkeit der Figuren bei der Besetzung der Rolle der Venus hin. Ist es zu Beginn des Films noch die Frau der Stadt, welche die Rolle einer dämonischen Venus spielt, so wird es am Ende des Films die Ehefrau sein, welche die heilige Venus gibt. Zwei Facetten der Göttin werden auf zwei Figuren verteilt, wobei jedoch zu jedem bestimmten Zeitpunkt jeweils nur eine den Mann beherrscht, während die andere entmachtet außen vor bleibt. Darüber hinaus ist die Atelierszene mit einer anderen Szene des Films verknüpft. Ein künstlicher Hintergrund, wie er hier mittels der Phototapete erzeugt wird, ist dem Zuschauer zuvor schon einmal begegnet, und zwar in jener Szene, in der das Paar während des Ganges über die Straße auf einmal in einer paradiesisch anmutenden Parallelwelt unterwegs zu sein scheint.19 Die urbane Umgebung tritt hier für kurze Zeit hinter eine gemeinsam imaginierte Traumwelt zurück, von Harfenklängen begleitet schreitet das Paar durch einen zauberhaften Garten, in dem niemand die absolut harmonische Zweisamkeit stört. Der Zuschauer erinnert sich jedoch an eine frühere Szene, in welcher der Mann die kopflos flüchtende Ehefrau gerade noch rechtzeitig 18. »Viele Werke der Alten sind Fragmente geworden. Viele Werke der Neuern sind es gleich bei der Entstehung«, Friedrich Schlegel: »Athenäums-Fragmente«, in: ders., Kritische Ausgabe, Bd. 2: Charakteristiken und Kritiken I (1796-1801), hg.v. Hans Eichner, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1967, S. 165-255, hier S. 169. 19. Dieser dritte Film im Film, der Bilder aus der Perspektive von Figuren der erzählten Welt zeigt, unterscheidet sich in zweifacher Hinsicht wesentlich von den beiden vorangegangenen, der Erinnerung der alten Dörfl erin an die gute alte Zeit und der Phantasmagorie der Stadt, die der Vamp im Sumpf entwirft. Hier handelt es sich, was das ›Drehbuch‹ anbetrifft, um eine Koproduktion von Liebenden, wobei die Autoren selbst auch die Protagonisten sind. Künstlich sind diese Bilder nur für uns, nicht für das Paar, das für wenige glückliche Sekunden tatsächlich in ihnen lebt.
136
Restlichtverstärker, romantisch
vor den anrollenden Fahrzeugen in Schutz nehmen konnte. Das Glück der Entrückung ins Paradies ist nur ein Glück auf Zeit – welches innerhalb eines potentiell lebensbedrohlichen realen Kontexts wie der Überquerung einer belebten Fahrbahn zur Hauptverkehrszeit lebensbedrohliche Züge annehmen kann. In diesem Moment haben die beiden jedoch wirklich Glück. Allerdings verursacht der Übergang in paradiesische Binnengefi lde, der Transport ins Imaginäre, im Rahmen der erzählten Welt einen veritablen Verkehrsstau. Die entsprechende Vertreibung des Paares aus dem Paradies folgt auf dem Fuße, wobei es hier nicht ein zürnender Gott ist, der die Verbannung ausspricht, sondern ein unrasierter, hupender, dabei allerdings nicht minder erboster Autofahrer, der die beiden mit einem ruppigen »Get out of there!« von der Straßenkreuzung verjagt. Der Traum des Paares, an dem der Zuschauer Anteil nehmen durfte, ist ausgeträumt. Er bleibt jedoch im Gedächtnis, um später im Photoatelier, dem Raum zumeist gestellter, künstlich erzeugter (Wunsch-)Bilder, wieder abgerufen zu werden. Im Anschluss an die Szene im Photoatelier erfolgt – eingerahmt von zwei Schwarzblenden – ein Zwischenschnitt hinüber ins Dorf, wo die Frau der Stadt bei der Zeitungslektüre zu sehen ist. Das dargestellte Medium ist ein anderes, die Medienreflexion geht allerdings weiter. Der Vamp studiert intensiv den Anzeigenteil der Zeitung, wobei der Zuschauer in Form eines Inserts Einblick in das Gelesene erhält. Eine der Anzeigen erregt seine besondere Aufmerksamkeit: »FARMERS! if you want to sell your home and move to the city… We Pay Cash./United Real Estate Company/Natl. Bank Bldg.« Diese Anzeige passt hervorragend zum laufenden Ausbeutungsprojekt des Vamps, in dessen Verlauf er zunächst bestrebt ist, den Mann dazu zu bewegen, seinen Hof zu Geld zu machen, um sich dieses dann in einem zweiten Schritt aneignen zu können. Das zuvor von ihm im Sumpf entworfene und zu diesem Zeitpunkt noch erfolgreich auf den Mann projizierte vage Glücksversprechen, verbunden mit dem imaginierten Leben in einer imaginären Stadt, gewinnt hier auf einmal eine sehr konkrete, durchaus realistische Perspektive. Der Name der entsprechenden Institution, »The Real Estate Company« (Hervorhebung M.H.), ist in dieser Hinsicht sprechend. Und auch das Gebäude, in dem diese Firma ansässig ist, konnte der Zuschauer zuvor bereits mit eigenen Augen sehen, da es sich an prominenter Stelle im Zentrum ausgerechnet jener Stadt befindet, in der – parallel zur Zeitungslektüre des Vamps innerhalb der Ferienwohnung im Dorf – das Ehepaar sich aktuell befindet. Im Zuge seiner Zeitungslektüre führt der Vamp nun eine zweite bedeutsame Handlung aus: Nicht nur, dass er sein Interesse auf eine ganz spezielle Anzeige fokussiert, er markiert diese noch zusätzlich dadurch, das er sie mit einem Stift umrandet. Hierdurch wird einerseits ein präziser Zugriff auf die Anzeige, wie er gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen könnte, erleichtert; andererseits wird diese aber auch durch die optische Hervorhebung von ihrem unmittelbaren Kontext abgeschnitten, die anderen Anzeigen werden zu einem diff usen Hintergrund reduziert. Die Übertragung dieser Aktion auf das Medium Film fällt nicht schwer, denn die Analogie des Vorgangs zu dem der Kadrierung ist augenfällig; es ist nichts anderes als eine Rahmung des 137
Michael Herrmann
Fokussierten, was der Vamp hier mit Hilfe des Stifts an Stelle der Auswahl einer bestimmten Kameraeinstellung unternimmt. Die Präsentation der Anzeige als einer unter anderen weist auf dasjenige hin, was sich außerhalb des jeweils aktuell präsentierten Ausschnitts abspielt, ohne unmittelbar beobachtet werden zu können. Insofern wird der Zuschauer zur Suche nach möglichen Kontexten für die präsentierten Bilder aufgerufen und zu entsprechenden Verknüpfungsleistungen animiert. Der dazu erforderliche Wechsel zwischen verschiedenen Ebenen der Erzählung ist etwas, dass auch in literarischen Texten der Romantik wieder und wieder inszeniert wird. Wenn es darum geht, ein Gesamtkunstwerk im romantischen Sinne zu schaffen, hat ein solches Unterfangen – so unrealistisch und hypertroph es von vornherein erscheinen mag – überhaupt nur dann die geringste Aussicht auf Erfolg, wenn die Beteiligten an diesem Projekt ihre Wahrnehmung flexibilisieren, geistig beweglich bleiben, und zwar dauerhaft. Die adäquate Darstellung dessen, was es bedeutet, ein Mensch zu sein, wird zum unendlichen Projekt. Die dazu notwendige fortgesetzte Selbstreflexion wird potenziell dadurch erleichtert, dass die Kunst ein entsprechendes Spiegelkabinett zur Verfügung stellt. Es kommt dann jedoch wesentlich auf die geeignete Anordnung der Spiegel an, wenn daraus nicht ein unübersichtliches Chaos entstehen soll. Die Erweiterung der filmästhetischen Möglichkeiten mit Hilfe kamera- und montagetechnischer Innovationen ist für Murnau nicht etwa Selbstzweck,20 sondern sie steht im Dienst einer Überzeugung, einer bestimmten Haltung: der humanistischen Gesinnung eines Filmkünstlers, dessen Anliegen es ist, die Überlebenschancen dieses Humanismus unter den veränderten 20. Murnau selbst gab dazu die folgende Auskunft: »Für mich bedeutet die Kamera das Auge einer Person, durch deren Geist man Ereignisse auf der Leinwand erwartet. […] Ich glaube, die Filme der Zukunft werden mehr und mehr diese Kamera-Engel benutzen […]. Sie helfen, Denken abzulichten«, Friedrich Wilhelm Murnau: »Filme der Zukunft« (i. O.: »Films of the Future«, McCall’s Magazine, New York, September 1928), in: filmfaust 12, Februar 1979, zit.n.: Fred Gehler/Ullrich Kasten: Friedrich Wilhelm Murnau, Berlin (Ost): Henschelverlag 1990, S. 144-150, hier S. 148. Im eklatanten Widerspruch dazu Fritz Göttler: »Keine menschliche Perspektive steckt mehr hinter dieser Kamera«, F. Göttler: Sunrise – A Song of Two Humans, S. 191. Ebenso Rodney Farnsworth: »Human characters, in Sunrise, are secondary to the true protagonist – the camera. […] Plots and characters seem pretenses for movement and light; boats, dance halls, trolley cars, and other city traffic – not intrigue and love – are the true forces of motion in Sunrise«, Rodney Farnsworth: »Sunrise«, in: Nicolet V. Elert/Aruna Vasudevan (Hg.), International Dictionary of Films and Filmmakers, Bd. 1: Films, 3. Aufl ., Detroit u.a.: St. James Press 1997, S. 976-978, hier S. 977. Ansätze zu einer differenzierteren Analyse der Erzählperspektive liefert Ursula v. Keitz: »Der Blick ins Imaginäre. Über ›Erzählen‹ und ›Sehen‹ bei Murnau«, in: Klaus Kreimeier (Hg.), Die Metaphysik des Dekors. Raum, Architektur und Licht im klassischen deutschen Stummfilm, Marburg, Berlin: Schüren 1994, S. 80-99, hier insbes. S. 80-83.
138
Restlichtverstärker, romantisch
Bedingungen der entwickelten Moderne zu problematisieren, ohne dabei in pure Sentimentalität abzugleiten. Der drohende Verlust einer Kultur, an deren Weiterführung Murnau offensichtlich liegt, ist seinen Filmen deutlich abzulesen, insofern die utopischen Restbestände als gefährdete vorgestellt werden; gleichermaßen fragwürdige wie fragile Gebilde sind es und eben keine stabilen Pfeiler, auf denen die moderne Kultur aufruht. Dennoch werden sie gerade deshalb nicht etwa preisgegeben, sondern in ihrem prekären Status als gleichermaßen unterstützenswerte und unterstützungsbedürftige vorgeführt. Mögen die 20er Jahre auch im Zeichen technischen Fortschritts und aufstrebender Urbanität stehen, das Dorf als der Ort einer (ohnehin bereits gebrochenen) traditionellen Gegenkultur ist angesichts dieser Entwicklung gerade nicht verzichtbar. Nicht die Großstadt, das im Sinne modernen Fortschritts unzeitgemäße Dorf wird als der Ort vorgestellt, von dem ein wiedergeborener Humanismus neuerlich ausstrahlen könnte. Dass aber der Sonnenaufgang als solcher noch nicht die dauerhafte Rettung des Humanismus impliziert, Sunrise – im Gegensatz beispielsweise zu zahlreichen expressionistischen Verkündigungsdramen – keine ungebrochen messianische Perspektive mehr eignet, kennzeichnet diesen Film als ein Kunstwerk auf der Höhe seiner Zeit.
Kommentar zur philosophischen Ästhetik Bei aller Modernität geht es Murnau jedoch auch ganz allgemein um die fi lmische Präsentation lebendiger Charaktere, mehr noch: um die Auslotung dessen, was menschliches Leben überhaupt auszeichnet. Alle seine Filme zeugen letztlich – in unterschiedlichen Gradationen – vom ausgeprägten anthropologischen Interesse des Regisseurs. Im September 1928 erscheint ein Artikel in McCall’s Magazine, in dem er zum Thema Filme der Zukunft die folgende Auskunft gibt: »Zu oft haben Filme die Welt banalisiert, anstatt neue Höhen und Tiefen im Leben aufzuzeigen. […]Ich glaube, daß Filme der Zukunft lieber Personen zeigen werden als Leinwand-Helden, Humanität anstelle populärer Film-Stars. In ›Sunrise‹ (›Sonnenaufgang‹) gingen einige der Kritiker streng mit mir ins Gericht, weil ich Janet Gaynor erlaubte, die häßliche zweifarbige Perücke zu tragen. Sie beklagten sich darüber, dass diese ihre Schönheit verdecke und sie häßlich mache. Sie errieten nicht, daß dies genau das war, was ich zu erreichen versuchte! Ich wollte Janet vorführen, nicht Janet Gaynor, die Leinwand-Schönheit, sondern ein armes dummes kleines Mädchen vom Land. Ich mußte ihre körperliche Schönheit abdrängen, um die Schönheit ihres Herzens herauszustellen.«21
Auf lebendige »Personen« und deren »Herzensbildung«22 kommt es Murnau an, »Humanität« soll als solche zur Darstellung gebracht werden. Ergänzende 21. F.W. Murnau: Filme der Zukunft, S. 145f. 22. Ebd., S. 146.
139
Michael Herrmann
Hinweise liefert ein weiterer, früherer Artikel im ersten Heft des Jahrgangs 1924 der Filmwoche, in dem es Murnau hauptsächlich um »den frei im Raum zu bewegenden Aufnahmeapparat«23 geht: »Mit diesem Werkzeug ausgerüstet, werden sich neue Möglichkeiten erst erfüllen lassen, deren stärkste eine [sic!] der Architekturfilm ist./Die fließende Architektur durchbluteter Körper im bewegten Raum, das Spiel der auf- und absteigenden, sich durchdringenden und wieder lösenden Linien, der Zusammenprall der Flächen, Erregung und Ruhe. Aufbau und Einsturz, Werden und Vergehen eines bisher erst erahnten Lebens, die Symphonie von Körpermelodie und Raumrhythmus, das Spiel der reinen, lebendig durchfluteten, strömenden Bewegung.«24
Der Ausdruck ›Architekturfilm‹ kann als Bezeichnung leicht missverstanden werden. Einem solchen geht es in erster Linie nicht etwa um Set-Bauten, um die Hervorhebung der mehr oder minder grandiosen Kulissen. Hier geht es vielmehr um »die fließende Architektur durchbluteter Körper« [Hervorhebungen M.H.], um die lebendige Bewegung der Körper der Darsteller im Raum, um die Musikalität dieser Bewegung, um eine spezifische »Körpermelodie« und einen bestimmten »Raumrhythmus«, die sich in ihrem Zusammenspiel zu einer fi lmischen »Symphonie« verdichten. Die aus heutiger Sicht ungewöhnliche Verwendung des Begriffs ›Architektur‹ hat ihre eigene Geschichte. Murnaus Überlegungen könnten sich diesbezüglich auf einen sehr prominenten Prätext berufen: Von der »architektonische[n] Schönheit der menschlichen Bildung«25 spricht bereits Friedrich Schiller in seiner ästhetischen Programmschrift Über Anmut und Würde, wobei mit »Bildung« in diesem Zusammenhang zunächst nichts anderes als der Körperbau des Menschen bezeichnet wird. Diese spezifische Form der Schönheit beruht einzig und allein auf diesem naturgegebenen Körperbau, ist mithin eine »architektonische«. Bezeichnenderweise exemplifi ziert Schiller diese Schönheit ausgerechnet an Venus, wie sie dem Schaum des Meeres entsteigt, und damit an einer Figur, die als Archetypus der verführungsmächtigen Form von Weiblichkeit im zentralen Beziehungskonflikt von Sunrise eine entscheidende Rolle spielt: »Venus, ohne ihren Gürtel und ohne die Grazien, repräsentiert uns das Ideal der Schönheit, so wie letztere aus den Händen der bloßen Natur kommen kann und, ohne die Einwirkung eines empfindenden Geistes, durch die plastischen Kräfte erzeugt wird. […]/Es sei mir erlaubt, diese von der bloßen Natur, nach dem Gesetz 23. Friedrich Wilhelm Murnau: »… der frei im Raum zu bewegende Aufnahmeapparat«, in: Die Filmwoche 1 (1924), zit.n.: F. Gehler/U. Kasten: Friedrich Wilhelm Murnau, S. 141. 24. Ebd. 25. Friedrich Schiller: »Über Anmut und Würde«, in: ders., Kallias oder über die Schönheit/Über Anmut und Würde, hg.v. Klaus L. Berghahn, Stuttgart: Reclam 1991, S. 67-136, hier S. 75.
140
Restlichtverstärker, romantisch
der Notwendigkeit gebildete Schönheit, zum Unterschied von der, welche sich nach Freiheitsbedingungen richtet, die Schönheit des Baues (architektonische Schönheit) zu benennen. […]/Diese Venus steigt schon ganz vollendet aus dem Schaume des Meers empor: vollendet, denn sie ist ein beschlossenes, streng abgewogenes Werk der Notwendigkeit und als solches keiner Varietät, keiner Erweiterung fähig. […]/ Die architektonische Schönheit der menschlichen Bildung muß von der technischen Vollkommenheit derselben wohl unterschieden werden. Unter der letztern hat man das System der Zwecke selbst zu verstehen, so wie sie sich untereinander zu einem obersten Endzweck vereinigen; unter der erstern hingegen bloß eine Eigenschaft der Darstellung dieser Zwecke, so wie sie sich dem anschauenden Vermögen in der Erscheinung offenbaren. Wenn man also von der Schönheit spricht, so wird weder der materielle Wert dieser Zwecke noch die formale Kunstmäßigkeit ihrer Verbindung dabei in Betrachtung gezogen. Das anschauende Vermögen hält sich einzig nur an die Art des Erscheinens, ohne auf die logische Beschaffenheit seines Objekts die geringste Rücksicht zu nehmen.«26
Auf den Status einer solchen schaumgeborenen Venus kann die Frau der Stadt freilich keinen Anspruch erheben. Ihre Anziehungskraft beruht auf Täuschung, Styling und Schminke werden selbst im Sumpf noch als notwendige Mittel der Verführung präsentiert. Der Vamp repräsentiert die heidnische, materialistisch-kapitalistische, sexuell-triebhafte, dämonische Venus in Opposition zur christlichen, idealistischen, sexuell enthaltsamen, heiligen Mariengestalt, welche – ebenfalls in mythischer Überhöhung des Weiblichen – als fruchtbare, mütterlich-nährende Kehrseite der aggressiven Bedrohung der göttlichen Ordnung eine Leitbildfunktion für die Aufrechterhaltung christlicher Moral gewinnt. Verkörpert erstere das Lustprinzip, so versinnbildlicht letztere als fürsorgliche Mutter Christi das Prinzip der Caritas, in der sich gleichzeitig die Liebe zu Gott manifestiert. Schönheit ist nach Kants Definition, an der Schiller sich hier orientiert, »Form der Zweckmäßigkeit eines Gegenstandes, sofern sie, ohne Vorstellung eines Zwecks, an ihm wahrgenommen wird.«27 Welches Bildmedium wäre geeigneter zur künstlerischen Darstellung lebendiger Körper, »so wie sie sich dem anschauenden Vermögen in der Erscheinung offenbaren«, als der Film? Insbesondere dann, wenn es darum geht, zu zeigen, wie sich die Schönheit in Gestalt der Anmut in der Bewegung manifestiert – oder eben nicht. »Wenn […] die Anmut eine Eigenschaft ist, die wir von willkürlichen Bewegungen fordern, und wenn auf der andern Seite von der Anmut selbst doch alles Willkürliche verbannt sein muß, so werden wir sie in demjenigen, was bei absichtlichen Bewegungen unabsichtlich, zugleich aber einer moralischen Ursache im Gemüt entsprechend ist, aufzusuchen haben./Dadurch wird übrigens bloß die Gattung von Bewegungen bezeichnet, unter welcher man die Grazie zu suchen hat; aber eine 26. Ebd., S. 74f. 27. Immanuel Kant: Kritik der Urteilskraft, Werkausgabe, Bd. X, hg.v. Wilhelm
Weischedel, Frankfurt a.M: Suhrkamp 1974, S. 155.
141
Michael Herrmann
Bewegung kann alle diese Eigenschaften haben, ohne deswegen anmutig zu sein. Sie ist dadurch bloß sprechend (mimisch).«28
Hier nun erweist sich der Film als ein Medium par excellence. Die »fließende Architektur durchbluteter Körper« (Hervorhebungen M.H.) zum Ausdruck zu bringen und damit die Lebendigkeit der Kunst zu betonen, muss für den bildenden Künstler ein erhebliches Darstellungsproblem darstellen.29 Wenn es darum geht, Architektur nicht primär mit Statik sondern eben mit Dynamik in Verbindung zu bringen, mehr noch: die Dialektik von Statik und Dynamik sinnfällig zu inszenieren, dann schlägt die Stunde des Films. Die Anmut der Bewegung ist es, die dem Mann zu Beginn des Films eindeutig fehlt. Ganz im Banne des Vamps bewegt er sich träge, wie unter Drogen, erscheint streckenweise wie gelähmt vom dämonischen Zauber. Mit Ausnahme einiger reichlich hektischer, triebhafter Bewegungsanfälle – der wilden Umarmung des Vamps im Sumpf – und des späteren mechanischen, automatenhaften Ruderns anlässlich des Bootsausflugs mit der Ehefrau bleibt diese Trägheit das vorherrschende Merkmal seiner Person, oder vielmehr Unperson: seine Körpersprache hat monströse Züge, ist also extrem ›sprechend‹. Sie lässt damit entsprechende Rückschlüsse auf »eine[] moralische[] Ursache im Gemüt« zu: Unter dem Einfluss des Vamps ward der Mensch zum Tier.30 Seiner natürlichen Bestimmung wird der Mann zu Beginn also durchaus nicht gerecht. Es mangelt ihm nicht nur an Anmut, sondern vor allem auch an Würde.31 »Sind Anmut und Würde, jene noch durch architektonische Schönheit, diese durch Kraft unterstützt, in derselben Person vereinigt, so ist der Ausdruck der Menschheit in ihr vollendet, und sie steht da, gerechtfertigt in der Geisterwelt und freigesprochen in der Erscheinung.«32 Damit wäre das Ziel bestimmt, das der Mann auf dem Weg der Entwicklung ins Auge zu fassen hätte, der Gipfel der Humanität. Und nicht allein er, auch die Ehefrau weist in dieser Hinsicht zu Beginn des Films noch Defizite auf: Sie versteckt ihre 28. F. Schiller: Über Anmut und Würde, S. 92. 29. So Aby Warburg: »Im 15. Jahrhundert verlangt ›die Antike‹ von den Künstlern
nicht unbedingt das Zurücktreten der durch eigene Beobachtung selbst errungenen Ausdrucksformen […] sondern lenkt nur die Aufmerksamkeit auf das schwierigste Problem für die bildende Kunst, auf das Festhalten der Bilder des bewegten Lebens«, Aby Warburg: »Sandro Botticellis ›Geburt der Venus‹ und ›Frühling‹ (1893)«, in: ders., Gesammelte Schriften. Studienausgabe. Erste Abteilung, Bd. 1.1: Die Erneuerung der heidnischen Antike. Kulturwissenschaftliche Beiträge zur Geschichte der europäischen Renaissance, Reprint der von Gertrud Bing edierten Ausgabe von 1932, neu hg.v. Horst Bredekamp u. Michael Diers, Berlin: Akademie 1998, S. 1-59, hier S. 54. »Die auffallende […] Bestrebung, die transitorischen Bewegungen in Haar und Gewand festzuhalten« (ebd., S. 10), die Warburg Botticelli attestiert, lässt sich als ein Versuch der Bewältigung dieses Problems verstehen. 30. Vgl. F. Schiller: Über Anmut und Würde, S. 94. 31. Vgl. ebd., S. 119. 32. Ebd., S. 126f.
142
Restlichtverstärker, romantisch
›architektonische Schönheit‹ hinter ihrer Schürze, zusätzlich wird diese extrem gemindert durch die strenge Frisur und den helmartigen Hut, den sie – zumindest außerhalb geschlossener Räume, teilweise jedoch sogar innerhalb derselben – während des gesamten Ausflugs in die Stadt tragen wird. Schließlich gebricht es ihr zumindest im Dorf deutlich an Durchsetzungskraft, sie nimmt nicht etwa den Kampf mit dem Vamp auf, sondern fügt sich anfänglich nahezu willenlos in ihr Schicksal. Obwohl in ihrer Würde von Seiten des Mannes eindeutig angegriffen, setzt sie sich nicht zur Wehr. Weder Achtung noch Liebe bringt der Mann seiner Ehefrau anfänglich entgegen.33 In mehreren Schritten wird er in der Stadt zunächst die erstere, dann allmählich auch die letztere zurückgewinnen. Die Frau der Stadt ist für beide Gefühle prinzipiell keine geeignete Adressatin, in der Beziehung mit ihr regiert die Begierde. »Von der Achtung kann man sagen, sie beugt sich vor ihrem Gegenstande; von der Liebe, sie neigt sich zu dem ihrigen; von der Begierde, sie stürzt auf den ihrigen. Bei der Achtung ist das Objekt die Vernunft und das Subjekt die sinnliche Natur. Bei der Liebe ist das Objekt sinnlich, und das Subjekt die moralische Natur. Bei der Begierde sind Objekt und Subjekt sinnlich./Die Liebe allein ist also eine freie Empfindung, denn ihre reine Quelle strömt hervor aus dem Sitz der Freiheit, aus unsrer göttlichen Natur.«34
Liebe zeigt sich in der Zuneigung zum Geliebten, Begierde im Sich-Stürzen auf das Begehrte. Beide schließen einander aus. Die zentralen Handlungsanweisungen für die Schauspieler in Sunrise decken sich offensichtlich mit der eben zitierten Textpassage. Während Mann und Vamp im Sumpf buchstäblich wild übereinander herfallen, beugt sich der Mann am Schluss liebevoll über seine Ehefrau, bevor sie sich küssen. Und in Übereinstimmung mit Schiller wird dieser Kuss eben nicht als ein erotisches Seherlebnis inszeniert: »Wahre Schönheit, wahre Anmut soll niemals Begierde erregen.«35
Boy meets girl, boy loses girl – boy meets girl again? Der Entwicklungsgang des Paares lässt sich nun folgendermaßen rekonstruieren: Anfänglich befinden sich die Eheleute – infolge des störenden Einflusses der Frau der Stadt auf den Mann – nicht mehr auf einer gemeinsamen Ebene. Die Ehefrau präsentiert sich als schwacher Mensch, der Mann als Tier. Weshalb konnten sie nicht gemeinsam den Vamp abwehren? Möglicherweise deshalb – so lässt sich die Analepse lesen, die als Erinnerungssequenz aus der rückblickenden Erzählung der Magd resultiert – weil beide zum Zeit33. Vgl. ebd., S. 128. 34. Ebd., S. 129. 35. Ebd., S. 131.
143
Michael Herrmann
punkt, zu dem der Vamp im Dorf auftauchte, noch nicht erwachsen geworden waren. Bis zum Erscheinen der personifizierten Sünde hatten sie sich noch im naiven Stadium der Unschuld befunden: »They used to be like children, carefree… always happy and laughing…« Diese ›Goldene Zeit‹ ist vorbei. Nach dem Einbruch des Vamps in die naive Ordnung der Beziehung bedarf diese der Rekonstruktion unter veränderten Bedingungen. Es ist die Zeit nach dem Verlust der Unschuld. Das heißt nun nicht etwa, dass die Zeit des Spielens ein für allemal vorbei ist, im Gegenteil: die Stadt ist ein ideales Spielfeld, auf dem sich Mann und Ehefrau wieder vorsichtig, in mehreren Etappen, einander annähern können. Allerdings wissen sie nun, dass sie Spielpartner sind. Die entscheidende Voraussetzung dafür ist, dass sie auf einer gemeinsamen Ebene miteinander interagieren und kommunizieren können. Zu diesem Zweck muss der Mann zuvor auf die menschliche Ebene gehoben werden. Dies geschieht in der Kirche, zu der hin ihn die Ehefrau dirigiert, wo er angesichts der Hochzeit eines anderen Paares seine Läuterung erfährt. Im Anschluss an seinen ebenso heftigen wie kathartischen Gefühlsausbruch durchläuft er eine erste Phase der Reinigung, innerhalb derer er neuerlich auf seine Gattenpflichten eingeschworen wird. Die Beziehung ist nunmehr gekennzeichnet von gegenseitiger Achtung. Bevor diese innere Reinigung und die Erneuerung des Eheversprechens mit Hilfe einer Photographie dokumentiert werden kann, bedarf es zunächst der Wiederherstellung eines entsprechenden äußeren Erscheinungsbildes. Auf die rituelle Reinigung der Seele des Mannes folgt die nicht weniger rituelle Reinigung des Körpers im Friseursalon. Im Gegensatz zum geheiligten Refugium der Kirche ist dies jedoch ein deutlich gefährlicherer Raum, in dem beide schon zu diesem frühen Zeitpunkt der ehelichen ›Rekonvaleszenz‹ erneut mit Anfechtungen zu kämpfen haben. Diese werden allerdings souverän abgewehrt, und zwar in der Hauptsache vom Mann, der nun seiner Beschützerrolle im Auftrag der Kirche wieder gerecht wird. Im Atelier des Photographen wird die Einheit des Ehepaars auf Platte gebannt. Das Paar beschäftigt sich wieder ausführlich miteinander und entdeckt dabei zunehmend die Stadt als einen gemeinsamen Spielplatz. Der gemeinsame Weg führt konsequenterweise in den gigantischen Vergnügungspark, eine kolossale Stadt in der Stadt, eine Welt der Zerstreuungen und der Illusionen, die allein zu Spielzwecken erschaffen wurde.36 Die Wiederaufnahme der partnerschaftlichen Beziehung kulminiert dort im gemeinsamen Tanz. Einer der Stadtbewohner, der sie offenbar als Dorf bewohner identifiziert hat, hat bei der Tanzkapelle einen Ländler (»peasant dance«) bestellt. Erneut ist es die Ehefrau, die – gegen den anfänglichen Widerstand des Mannes – den gemeinsamen Tanz vor versammeltem Publikum durchsetzt. Haben die beiden in der Kirche ihre Würde wieder gefunden, so erhalten sie nun auch noch die Gelegenheit, sich wechselseitig ihrer Anmut 36. Eine solche Betrachtung basiert freilich auf der einseitigen Perspektive des Kunden. Das Gewinnstreben der Betreiber – auf das im Verlauf der Handlung mehrfach deutlich hingewiesen wird – ist dabei nicht zu vergessen. Dieses Interesse teilen sie mit der Frau der Stadt.
144
Restlichtverstärker, romantisch
und damit ihrer sinnlichen Anziehungskraft, ihres Wohlwollens und ihrer Liebe zu versichern, und zwar öffentlich. Wenn das Paar nach Verlassen des Vergnügungsparks seine Heimreise antritt und dann schließlich – diesmal auch im übertragenen Sinne – in einem Boot sitzt, wäre dies eigentlich eine geeignete Schlusseinstellung für ein Happy End. Allerdings ist bis zu diesem Zeitpunkt ein wichtiger Handlungsfaden noch nicht zu Ende gesponnen: Um auch die Wiederherstellung der Ordnung im Dorf zu garantieren, bedarf es noch der Entfernung des Vamps von diesem Ort. Die letzte und wichtigste Bewährungsprobe für den Mann steht also noch aus, die neuerliche und diesmal hoffentlich siegreiche Selbstbehauptung als Mensch und liebender Ehemann gegenüber den dämonischen Verführungskünsten der Frau der Stadt. Die Stadt hat sich – ganz im Gegensatz etwa zu den Ressentiments antimodernistischer Traditionalisten, die gerne die Verklärung der dörflichen Kultur auf Kosten der urbanen betreiben – als ein insgesamt freundlicher Urlaubsort erwiesen, als ein vielfältiger Erlebnispark, ungefährlich für Leib und Leben. Ganz anders sieht die Situation jedoch auf dem Wasser aus: Schon auf dem Hinweg hat sich das liquide Element als trügerisches Medium des Übergangs gezeigt. Weder das Land noch die Stadt, sondern das Wasser, das sie voneinander trennt, die Sphäre des Übergangs zwischen den Regionen der traditionellen und der modernen Kultur ist es, welche die entscheidenden Risiken birgt. Bei aller menschlichen Kultur gibt es doch immer noch eine Sphäre ursprünglicher Natur, die sich zumindest potentiell der Beherrschung durch den Menschen entzieht, die seinem Willen nicht gehorcht, sondern sich ganz plötzlich als wild und chaotisch, ja lebensgefährlich erweisen kann. Das Wasser kann Entzweite – wie auf der Hinreise – nötigen, im gemeinsamen Boot zu bleiben, oder es kann bei Entfesselung der Elemente – wie jetzt auf der Rückreise – das Boot kentern lassen und ein Paar gewaltsam trennen. Diese neuerliche Trennung erhöht den Druck auf den Mann, wenn es darum geht, bei der folgenden Konfrontation mit der Frau der Stadt seine eben zurückgewonnene Menschlichkeit einerseits dadurch zu bewahren, dass er sie standhaft gegen eine neuerliche Verführung verteidigt, andererseits dadurch, dass er nicht etwa aus so niedrigen Beweggründen wie Rache an ihr zum Mörder wird. An der letzteren Herausforderung droht er zu scheitern. Nur die wunderbare Errettung der Ehefrau sorgt dafür, dass der erneute Rückfall ins Animalische nicht von langer Dauer ist, und dass der geschlagene Vamp körperlich relativ unbeschadet – wenn auch offensichtlich missgelaunt – per Kutsche das Feld räumen kann. Der Mann kehrt zurück ins Haus, wo die Gerettete den Schlaf der Gerechten schläft. Er wacht an ihrem Bett. Sie schlägt die Augen auf. Sie lächelt. Er küsst sie. Hinter dem Dorf geht die Sonne auf. »Finis«. Ein märchenhaft schönes Ende, dass Murnau von zahlreichen Kritikern als Zugeständnis an Hollywood angekreidet wurde.37 Aber handelt 37. Lotte Eisner bemerkt zur Adaption von Sudermanns Novelle: »Mayer und Murnau haben diese ziemlich banale Geschichte umgedichtet […]. Hollywood zuliebe haben sie ein happy end gesucht«, L.H. Eisner: Murnau, S. 270. Lothar Schwab
145
Michael Herrmann
es sich hier tatsächlich um ein ungetrübtes Happy End? Ist es denn tatsächlich noch die Ehefrau, die der Mann am Ende in die Arme schließt?
Fadenscheiniges Happy End Die Synchronisierung unterschiedlicher Persönlichkeitsentwicklungen der Ehepartner innerhalb der gemeinsamen Beziehung ist eines zentralen Probleme, die der Film verhandelt. Es ist genau dieses Problem, vor dessen Hintergrund das vermeintliche Happy End des Films plötzlich fragwürdig erscheint. Warum? Den Ausgangspunkt zur Beantwortung dieser Frage liefert ein letztes Zitat aus Über Anmut und Würde: »Die beruhigende Grazie grenzt näher [als die belebende, der Reiz] an die Würde, da sie sich durch Mäßigung unruhiger Bewegungen äußert. Zu ihr wendet sich der angespannte Mensch, und der wilde Sturm des Gemüts löst sich auf an ihrem friedeatmenden Busen. Diese kann Anmut genannt werden. […]Auch die Würde hat ihre verschiedenen Abstufungen […]./Der höchste Grad der Anmut ist das Bezaubernde; der höchste Grad der Würde die Majestät. Bei dem Bezaubernden verlieren wir uns gleichsam selbst und fließen hinüber in den Gegenstand. […] Die Majestät hingegen hält uns ein Gesetz vor, das uns nötigt, in uns selbst zu schauen. […]/Majestät hat nur das Heilige. Kann ein Mensch uns dieses repräsentieren, so hat er Majestät; und wenn auch unsre Kniee nicht nachfolgen, so wird doch unser Geist vor ihm niederfallen.«38
Der »wilde Sturm des Gemüts«, unter dem der »angespannte Mensch« zu leiden hatte, »löst sich auf« am »friedeatmenden Busen« der »beruhigende[n] Grazie«: Schillers Text liest sich wie ein Drehbuch zur letzten noch von den Protagonisten bevölkerten Einstellung in Sunrise, die das wiedervereinigte Ehepaar zeigt.39 Janet Gaynor, die zuvor während der gesamten Zeit eine schließt sich an, wenn auch er hinter dem glücklichen Ausgang eine »Konzession an Hollywoods Happy-End-Zwang« vermutet. Lothar Schwab: »Sunrise – A Song of Two Humans«, in: Michael Töteberg (Hg.), Metzler Film Lexikon, 2., aktualisierte u. erweiterte Aufl ., Stuttgart: Metzler 2005, S. 612-613, hier S. 613. Vgl. auch Tom Tykwer: »Sometimes Bitter, Sometimes Sweet«, in: Hans Helmut Prinzler (Hg.), Friedrich Wilhelm Murnau. Ein Melancholiker des Films, Berlin: Bertz 2003, S. 201. Deutlich plausibler Jo Leslie Collier: »In Murnau’s works, the process of growth is often presented in the appropriate terms of the progression from childhood to adulthood. […] Maturation must occur. Where it does (Sunrise), a ›happy‹ ending is possible; where it does not (Nosferatu), there is no happy ending«, J.L. Collier: From Wagner to Murnau, S. 107. 38. F. Schiller: Über Anmut und Würde, S. 132f. 39. Dies geschieht unmittelbar bevor die Kamera die ersten Strahlen der hinter dem Dorf aufgehende Sonne einfängt, welche dann zum Schluss – in Form einer Trickaufnahme – die Apotheose leinwandfüllend überstrahlt. Das letzte Wort hat
146
Restlichtverstärker, romantisch
scheußliche Perücke tragen musste, darf sich endlich mit offenem blondem Haar präsentieren. Der extreme Kontrast ihres jetzigen äußeren Erscheinungsbildes zum bisherigen begünstigt eine Annäherung an das »Bezaubernde« und damit den »höchste[n] Grad der Anmut«. Dabei muss allerdings allein die Ansicht des Kopfes und insbesondere der Haartracht pars pro toto für ihre gesamte Erscheinung genommen werden; größtenteils verhüllt, erholt sich die Frau im Bett von den Strapazen, die sie bis zu ihrer Errettung durchstehen musste. Die letzte Großeinstellung, bei der fast nur die Köpfe des sich schließlich küssenden Paares zu sehen sind, bildet den Abschluss einer Sequenz, die – in Vorausdeutung auf den Sonnenaufgang – das Erwachen der Frau nach der soeben überstandenen Beinahe-Katastrophe zeigt. Eingeleitet wird sie mit einer Halbtotalen, die einen Ausschnitt des Schlafzimmers zeigt. So, wie sich die Figur der Frau hier am Ende des Films präsentiert, lässt sie sich keinesfalls mehr auf die Rolle der Ehefrau reduzieren. Sie liegt mit dem Kind im Bett, während der Mann auf einem Stuhl neben dem Bett geduldig darauf wartet, dass sie erwache. Dieses Erwachen wird wiederum in einer Großeinstellung gezeigt, Kopf und Schultern der Frau füllen das Bild nahezu aus. Dabei wendet die Frau den Blick zunächst gen Himmel, bevor sie sich dem Mann zuwendet. Dieser erste Blick ist ein verklärter, der sein ikonographisches Pendant in zahlreichen Marien-Darstellungen der christlichen Kunst findet. Passend hierzu ist ihr Kopf bedeckt, eine Decke bildet gleichsam einen Schleier, der ihr Gesicht umrahmt. Ihr blondes Haar fällt in Wellen und wirkt wie drapiert, im deutlichen Gegensatz zur oben beschriebenen letzten Großeinstellung, wo es unverschleiert und geglättet erscheint. Die Frau ist hier deutlich mehr als bloß Ehefrau, sie wird als Madonna inszeniert. 40 Was in der letzen Großeinstellung mutwillig geglättet wird, ist nicht nur ihr Haar. Es wird damit auch eine entscheidende Analogie überspielt, die das Happy End als solches fragwürdig werden lässt: die vorangegangene Anspielung auf die heilige Familie. Nicht etwa das Ehepaar liegt gemeinsam im Bett, sondern Mutter und Kind, wie auch Jesus und Maria gemeinsam den eigentlichen Kern der heiligen Familie bilden. Joseph spielt die undankbare Rolle einer Randfigur innerhalb der Familie, da er ja nicht der leibliche Vater
allerdings der noch einmal die abendländische Tradition beschwörende Schriftzug »Finis«, der wellenartig vom unteren Bildrand vor der schwarzen Tiefe aufsteigt, um sich schließlich wie ein Nebel in nichts aufzulösen. Der Zuschauer sieht sich also zunächst schon wieder mit der Dunkelheit konfrontiert, bevor der Kinosaal erleuchtet wird, um ihn in den Alltag zu entlassen. 40. In ikonographischer Hinsicht erscheint Colliers Rekonstruktion fragwürdig, wenn sie behauptet: »Her being lost and found again is also the symbolic death of the madonna image, the woman as Ideal, and the birth of the woman as woman. At the end of the film, the wife’s long hair – traditional sign of femininity and hence female sexuality – is no longer confined in the tight little bun, but is free and full, spilling over the pillow of the bed«, J.L. Collier: From Wagner to Murnau, S. 126.
147
Michael Herrmann
Jesu ist. Diese Dreierkonstellation wird von Murnau reinszeniert, wenn er den Mann auf einem Stuhl neben dem Bett platziert. Im Rückblick auf die vergangenen Szenen im gemeinsamen Schlafzimmer der Eheleute – ein Schlafzimmer, das durch getrennte und zusätzlich noch in Längsrichtung gegeneinander verschobene Betten der Ehekrise Ausdruck verlieh – identifiziert der Zuschauer jenes am Ende gezeigte Bett von dessen Position her als das Bett der Ehefrau. Nach wie vor – und das ist bezeichnend – findet der Mann am Ende seinen Platz eben nicht in diesem Bett. Vielmehr beansprucht das Kind diesen Platz. Die zweite Dreierkonstellation neben derjenigen von Ehefrau, Mann und Frau der Stadt, die der Kleinfamilie, kommt nunmehr voll zur Geltung. Innerhalb dieser zweiten Konstellation, die auf den ersten Blick harmonisch erscheint, auf den zweiten jedoch ihr ganz eigenes Konfliktpotential in sich birgt, verschieben sich die Positionen: Der Mann rückt aus dem Zentrum (aus der Position zwischen zwei Frauen) an die Peripherie, die Frau besetzt nunmehr die zentrale Position (eingebettet zwischen Mann und Kind). Gemeinsam ist beiden, dass sie nicht als geschlossene Beziehungsdreiecke präsentiert werden. War zuvor die männliche Position im Zentrum eine der trennenden Unterscheidung zweier Sphären, so ist nun die weibliche Position im Zentrum die verbindende, die entscheidende, die Position der Macht. Wenn kurz darauf das Kind in der letzten Einstellung nicht mehr zu sehen sein wird, beruht dies letztlich nur auf der Gnade des Ausschnitts. Der Mann kann die Frau noch so innig küssen: zumindest potentiell besteht hier eine Konkurrenzsituation, im Konfliktfall konkurrieren Mann und Kind um die Gunst der Frau. Nimmt man dabei den Vergleich mit der heiligen Familie ernst, so dürften in einem solchen Fall die Chancen des Mannes verschwindend gering sein. Aber auch die Frau hat einen Preis für ihre Macht zu zahlen: Im Gegensatz zur dämonischen Venus wird sie als wiedergeborene und damit quasi wieder jungfräuliche Madonna desexualisiert. Das Heilige verdrängt das Geschlechtliche. Entsprechend wird die Frau in den letzten Einstellungen extrem verhüllt gezeigt. Ihr Körper wird unter der Bettdecke versteckt, nur ihr Kopf bleibt sichtbar. Der Körper der Frau wird also bildkompositorisch auf den Sitz des Geistes reduziert. Nur die Seele zählt. Und die spiegelt sich bekanntlich im Antlitz des Menschen wider, genauer: in seinen Augen. Die Verschiebung des Machtgefüges ergibt sich aus der Metamorphose der Ehefrau zur Heiligen, wie sie mit der wunderbaren Errettung, oder besser: mit der märchenhaften Wiedergeburt aus den Fluten des Sees einhergeht. Wie zunächst in der Kirche der Mann eine Metamorphose vom Tier zum Menschen durchmacht, folgt später im Anschluss an das Unwetter die Verwandlung der Ehefrau in eine Heilige. Sie verkörpert am Ende eine Macht, die Anmut und Würde in sich vereinigt. Der »höchste Grad« an Würde gibt sich in Gestalt der Frau als »Majestät« zu erkennen und »hält uns ein Gesetz vor, das uns nötigt, in uns selbst zu schauen«. Vor diesem Gesetz beugt der Mann das Knie, als er vor deren Bett niedersinkt wie vor einem Altar. Entsprechend steht oder liegt auch der Schatten des (Fenster-)Kreuzes jedes Mal über diesem Bett, wenn die Kamera es einfängt. 148
Restlichtverstärker, romantisch
Dies bedeutet freilich, dass das anfängliche Ungleichgewicht zwischen Mann und Ehefrau am Ende auf einer höheren Stufe wiederhergestellt wird. Von daher erscheint es fraglich, ob sich tatsächlich der gesamte Film als ein »Song of Two Humans« lesen lässt, oder ob dieser Titel nicht vielmehr nur auf den kurzen gemeinsamen Ausflug des Paares in die Stadt zutriff t. 41 Von einem Happy End kann eigentlich nur die Rede sein, insofern es dem Mann – stellvertretend für den Zuschauer – gelingt, der Nötigung zur Selbstbescheidung als Mensch gegenüber der Heiligen mit entsprechender Demut nachzukommen und diese als ein Glück aufzufassen. Für jene spielerische Leichtigkeit, die das Paar innerhalb des Vergnügungsparks an den Tag legte, bleibt hier – bei nüchterner Betrachtung der häuslichen Umstände – nicht mehr allzu viel Raum. Die Situation entschärft sich sofort wieder, wenn in der anschließenden Großaufnahme des innigen Kusses den soeben etablierte Kontext wieder gnädig verschleiert wird. Aufgrund des merkwürdigen Unterschieds zwischen den beiden letzten Einstellungen, insbesondere was die Darstellung der Frau anbetriff t, ließe sich dabei von einer Bifurkation sprechen, von einer Durchbrechung der Linearität des Erzählens im letzten Moment. Nach dieser Lesart würden am Ende des Films, im Übergang von einer Großeinstellung zur anderen, zwei alternative Enden der Geschichte vorgestellt. Das eigentümliche Spannungsverhältnis zwischen beiden ließe sich beschreiben als ein ›Schweben zwischen Gegensätzen‹ – als romantische Ironie. 42 An ironischen Brechungen in dieser spezifisch romantischen Bedeutung von ›Ironie‹ herrscht in Sunrise kein Mangel. Nicht nur im Rückblick auf die 41. Dass diese spielerische Leichtigkeit in der Stadt ihren eigentlichen Ort hat, hängt mit der urlaubsgemäßen Außeralltäglichkeit der Situation, d.h. auch wesentlich mit der Abwesenheit eines störenden Dritten zusammen. Sämtliche Figuren, die sich als mögliche Kandidaten für eine solche störende Instanz zu erkennen geben, werden dort prompt – und dabei quasi arbeitsteilig – entweder vom Mann oder von der Ehefrau abgewehrt. 42. »Das Kunstmärchen bedient sich häufig des Stilmittels der Ironie. Das hängt mit dem wichtigsten Unterschied [zum so genannten Volksmärchen] zusammen, der die Modernität des Kunstmärchens begründet: Geschildert wird nicht ein geschlossenes Weltbild, sondern eine fragmentarisch erfahrbare, problematische Welt, in der sich ein Subjekt bewegen muss, das sich auch seiner selbst, vor allem der eigenen Wahrnehmung, nicht sicher sein kann«, Stefan Neuhaus: Märchen. Tübingen, Basel: A. Francke 2005, S. 8. »Ergebnis eines Märchens mit Happy-End ist eine radikale Statusverbesserung, in extremer Form durch Heirat mit dem Angehörigen eines Königshauses oder durch das Erlangen großen Reichtums«, ebd., S. 372. Die Statusverbesserung, die der Mann erreicht hat, sein Aufstieg vom Tier zum Menschen, wird jedoch zumindest nach einer der beiden angebotenen Lesarten durch den späteren der Ehefrau zur Heiligen konterkariert. Der Mann hätte demnach als ›Bodyguard‹ dienende Funktion. Mithin hätte er lediglich eine Herrin, die Frau der Stadt, durch ihre Antagonistin ersetzt, in Relation zum beherrschenden weiblichen Gegenüber also nichts gewonnen.
149
Michael Herrmann
idyllischeren Zeiten der jungen Ehe erweist sich der »Song of Two Humans« von zentralen Motiven her als Reprise eines sehr alten Lieds, insofern man die Bibel als ein solches bezeichnen darf. Dass der Film von der Vertreibung eines Paares aus dem Paradies erzählt, hat sich im Verlauf der vorliegenden Lektüre mehrfach gezeigt. Der Vamp, die personifizierte Sünde, übernimmt dabei die Rolle der verführerischen Schlange und damit des ersten störenden Dritten überhaupt in der Geschichte der Menschheit. Mann und Ehefrau, Adam und Eva, haben bis zum erscheinen der Schlange in ihrem ländlich-idyllischen Refugium gelebt wie die Kinder und dabei im Unterschied zum biblischen Prätext bereits einen Nachkommen gezeugt. Es bleibt allerdings unklar, wie die beiden zu diesem Kinde gekommen sind, da ja die Entdeckung der Sexualität, der rauschhaft-ekstatischen, triebhaften Seite der menschlichen Natur, erst mit dem Auftritt des Vamps innerhalb dieser arkadischen Welt stattfindet. Ein zweiter Unterschied betriff t die Verführung zur Sünde: Nicht die Ehefrau als das Pendant Evas ist es, die den Mann zum Genuss der verbotenen Frucht verführt, sondern die Frau der Stadt und damit die Schlange selbst. Aber ist es tatsächlich allein der Vamp, der seine Verführungskünste am Mann erprobt? Noch einmal wird in diesem Zusammenhang die Szene im Photoatelier interessant. Unmittelbar vor dem Spiel mit der Venus-Statuette, während der Photograph bereits zum Entwickeln der Platten ins Hinterzimmer verschwunden ist, versucht die Ehefrau ihrerseits, den Mann zum Genuss einer Frucht zu verführen, wenn es auch in diesem Fall kein Apfel ist, sondern eine Traube. Das macht nun allerdings die Sache nicht besser, sondern hiermit werden lediglich zwei verschiedene Stränge abendländischer Kultur miteinander verwoben, zwei Bildarchive gleichzeitig verwendet, indem an beide Mythologien gleichzeitig angeknüpft wird: an die christliche und an die heidnisch-antike. Die Traube kann als Metonymie für den Wein, jener als Metonymie für den Rausch gelesen werden. Dionysos ist also mit im Spiel, wenn die Ehefrau dem Mann die Traube schmackhaft machen möchte. Letzterer wehrt sich in dieser Szene standhaft dagegen, nascht zu diesem Zeitpunkt nicht von der Frucht. Das gebrannte Kind scheut das Feuer. Dennoch wird hier bereits auf den Schluss des Films vorausgedeutet, insofern die dortige Verknüpfung von Maria und Venus in Gestalt der wiedergeborenen Heiligen hier bereits angelegt zu sein scheint, auch wenn es sich hier noch deutlich um deren ›sündige‹ Vorstufe, die Verknüpfung von Eva und Venus handelt. Die Verknüpfung von Maria und Venus als eine gelingende vorzustellen, ist ein Desiderat der Romantik. Autoren wie Ludwig Tieck, Clemens Brentano und Joseph von Eichendorff haben dieses Thema erzählend verarbeitet, wobei am Ende allerdings nie eine gelingende Synthese dieser beiden Frauenrollen formuliert wird. Das hat auch Folgen bezüglich des triadischen romantischen Geschichtsmodells, demzufolge das eigene Zeitalter, das als ein Zeitalter der Moderne verstanden wird, nur ein Intervall zwischen einem vergangenen ›Goldenen Zeitalter‹ der Menschheit und dessen zukünftiger Restituierung vorstellt. 43 Von einem paradiesischen Zustand in den anderen, von Arkadien 43. »Die Frühromantiker entwickelten den Begriff des Goldenen Zeitalters, ei-
150
Restlichtverstärker, romantisch
nach Elysium führt gemäß dieser Utopie der Weg der Menschheitsgeschichte. 44 Während die Frau am Ende von Sunrise als ein Wesen inszeniert wird, das diesen Zustand nach ihrer letzten Metamorphose möglicherweise erreicht hat, gilt das für den Mann durchaus nicht. Er ist ja schließlich erst seit kurzer Zeit überhaupt wieder Mensch. Die außergewöhnliche Bedeutung jener Wiedergeburt der Frau als Heiliger zeigt sich in der gleichzeitigen Entfesselung der Naturgewalten: Der See, im wahrsten Sinne des Bildes der Inbegriff der Transgression, wird für das Paar im Unwetter zu einem locus horribilis. Wenn auch die Frau später ›gerettet‹ wird und zu ihrem Mann und ihrem Kind zurückkehrt, so ist sie doch nicht mehr dieselbe wie zuvor. Mag das Kind in seiner Unschuld vielleicht noch mit einigem Recht einen Platz in ihrem Bett – mit anderen Worten: im Paradies – beanspruchen, so gilt das nicht auch schon für den Mann. Letzterer hat noch einen langen Bildungsweg vor sich. Das Stadium des völlig erwachsenen Mannes hat er noch längst nicht erreicht, wie sich im Zuge der ›Rettung‹ der Frau herausstellt. Ohne die entscheidende Mithilfe eines älteren Fischers, also eines Angehörigen der Elterngeneration des Paares, der auch die Magd und die überwiegende Mehrzahl der gezeigten Dorf bewohner zuzurechen sind, wäre diese vermutlich nicht von Erfolg gekrönt gewesen. »… I couldn’t give up hope. I know the tides… I went around the Point…« Der alte Fischer benennt selbst die drei Eigenschaften, die ihn, im Gegensatz zum Mann, sowohl als einen erwachsenen Menschen als auch als einen gestandenen Fachmann in seinem Beruf ausweisen: Er gibt (1.) die Hoffnung nicht auf; er kennt (2.) die Strömungen, und zwar – so lässt sich ergänzen – nicht nur die des Wassers, sondern auch die des Lebens, aufgrund seines Alters und des dementsprechend umfangreicheren Erfahrungsschatzes; und er geht (3.) auch einmal über jenen Punkt hinaus, den die anderen als Grenze ihrer Welt zu akzeptieren gewohnt sind, ist also in der Lage, die Konventionen des Alltags zu transzendieren. Dass die Amme, die sich noch an die ›Goldnen Zeiten‹ erinnert, diesem Fischer sehr gewogen sein muss und ihm entsprechend heftig um den Bart geht, liegt dabei genauso auf der Hand wie auch, dass das weiterhin anwesende ältere Volk diesem Treiben schließlich Einhalt gebietet,
ner mythischen Vorzeit, in der die Natur eins war, eine säkularisierte Vorstellung vom Paradies. […] Dem folgte das – andauernde – Zeitalter der Spaltung, die Natur differenzierte sich aus in Mineralien, Metalle, Pfl anzen, Tiere und Menschen. Der Mensch bildet die Krone der Schöpfung, denn ihm ist die Fähigkeit zu denken gegeben. Diese Fähigkeit ermöglicht es ihm, die Wiederkehr des Goldenen Zeitalters zu antizipieren. Das bedeutet nicht eine Restauration früherer Verhältnisse, vielmehr gilt es eine höhere Stufe zu erreichen, die Intuition und Reflexion einschließt«, S. Neuhaus: Märchen, S. 6. 44. Über die mögliche Dauer des Intervalls bestehen allerdings unterschiedliche Auffassungen. Skeptischere Romantiker gehen bestenfalls von einer ›unendlichen Annäherung‹ an paradiesische Zustände aus.
151
Michael Herrmann
bevor es etwa ins Unsittliche abgleiten könnte, indem selbst bei diesem alten Fischer die noch wesentlich älteren animalischen Triebe sich regen. Was an der Oberfläche einfach eine lustige Zwischenepisode ist, mit der das Dorf – und mit ihm der Zuschauer – die ›Rettung‹ der Frau feiert, erweist sich bei näherer Betrachtung als ein Spiegel der modernen Entwicklung. Das Dorf als Refugium der Tradition erscheint zumindest tendenziell als überalterter Raum, der vom Aussterben bedroht ist. Die Stadt, Sphäre urbaner Modernität, streckt in Gestalt der Straßenbahn ihre Fühler nach dem umliegenden Land aus. Dennoch brauchen die Stadtbewohner das Land, wie das noch verhältnismäßig junge Paar vom Lande die Stadt braucht: als Naherholungsgebiet. Wenn es darum geht, Distanz zum Alltag zu gewinnen, wenn es darauf ankommt, die eigene Identität aus einer anderen Perspektive zu betrachten – und es gibt Krisensituationen, in denen dies unerlässlich ist – so wird ein relativ schnell erreichbares anderes Ufer nicht trotz, sondern gerade wegen seiner vermeintlich unzeitgemäßen Eigenart zum idealen Refugium. Das Happy End des Filmes ist aufgesetzt. Darin zeigt sich allerdings nicht etwa eine dramaturgische Schwäche, sondern vielmehr die Konsequenz, mit der hier ein romantisches Märchen inszeniert wird. Als ein solches betrachtet, ist es absolut stringent, wenn in Sunrise die vorgestellten Konflikte nicht etwa dauerhaft gelöst werden. Der Film hat dezidiert ein offenes Ende. Die Zeit, in der sich die labile Ordnung neuerlich wird bewähren müssen, steht noch aus. Der Vamp, der die störende Instanz verkörpert, verlässt zwar dieses eine Dorf; das chaotische, verschlingende Prinzip, das die hemmungslose Ausbeutung der lebendigen Kreatur, den rücksichtslosen Verbrauch ihrer vitalen Ressourcen – metaphorisch gesprochen: des Blutes – wird damit jedoch nicht ein für allemal beseitigt. Gleichzeitig wird ein Übergang zwischen den Ebenen von histoire und discours erkennbar: Die weibliche Protagonistin präsentiert sich am Ende als eine von Hut und Perücke befreite Frau. Die Beseitigung dieser beiden bereits innerhalb der histoire als Maskierung bzw. Verschachtelung inszenierten Verkleidungen – die Ankunft der ›befreiten‹ Frau (mit offenem Haar) im Abschied von der Rolle der Ehefrau (mit Perücke) außerhalb von geschlossenen Räumen (noch zusätzlich mit Hut) – mag sich zunächst als Befreiung von überkommenen zivilisatorischen Zwängen lesen lassen. Sie findet jedoch zunächst nur innerhalb des Hauses, innerhalb der umfriedeten Privatsphäre statt. Weiterhin handelt es sich um eine fragwürdige ›Befreiung‹ zur Heiligen, zur Mariengestalt, zum Gegenstand sakraler Kunst, mit einem Wort: zur Ikone der Weiblichkeit. Mit selbstbestimmtem Handeln hat eine solche ›Freiheit‹ nichts zu tun. Es ist nur eine ›Befreiung‹ zur Frau im Film, zur (Zeichen-)Trägerin von allergrößter Bedeutung, wobei der Film in Gestalt seines aufgesetzten Happy Ends den Hut von Janet Gaynor in genau dem Moment übernimmt, in dem sie ihn loswird. Das Spiel mit der Maskierung hat die Ebene gewechselt, es ist aber nicht aus der Welt.
152
Eine Außenansicht der Innerlichkeit Murnaus Film Tabu Wolfgang Kasprzik
I. Die Probleme der Produktionsgeschichte von Murnaus letztem Film überschatten dessen Rezeptionsgeschichte bis heute. Die Spannungen zwischen dem als ›Spielfi lmregisseur‹ gekennzeichneten Murnau und dem ›Dokumentarfi lmer‹ Flaherty, die im Laufe der Dreharbeiten zum Bruch zwischen den beiden führten, zogen die Aufmerksamkeit der Interpreten auf sich – und lenkten sie ab von der erzählten Geschichte, die meist für so schlicht gehalten wird, daß sie einer genaueren Analyse nicht bedarf. Nun ist die Frage, wie – und von wo aus – hier der Blick auf die koloniale Gesellschaft einiger Südseeinseln konstruiert wird, in der Tat zentral für das Verständnis dieses Films. Sie darf aber nicht reduziert werden auf die Alternative ›bloßes exotisches Dekor einer Spielfi lmhandlung‹ oder ›ethnographische Skizze, die sich des Fiktionalen zur Vermittlung bedient‹. Beide Sichtweisen haben gemein, daß sie die Frage, was dieser Film eigentlich ›dokumentiert‹, nicht an die zentrale Institution im Zentrum seiner Fiktion richten: das Tabu. Dabei war gerade diese religiöse Institution von großer Bedeutung für das Bild sogenannten ›primitiven‹ Denkens in Europa. Der vorliegende Beitrag versucht, Tabu1 von der Analyse des Tabus her aufzuschließen, von dem der Film erzählt. Dabei ergibt sich auch eine Neubewertung des Anteils, den Murnau und Flaherty an Tabu haben.
II. Murnau lernte 1929 Robert J. Flaherty kennen, der vor allem mit Nanook of the North (dt. Nanuk der Eskimo) von 1922 berühmt und zu einem der Väter des 1. Tabu, USA 1931, Regie: Friedrich Wilhelm Murnau, DVD: Divisa Home Video, Spanien 2006 (= Edición Especial Coleccionista).
153
Wolfgang Kasprzik
Dokumentarfi lms geworden war. Die beiden entschlossen sich, gemeinsam in der Südsee zu arbeiten. »Wir wollten einen Film drehen, fern von Hollywood, mit Menschen einer anderen Welt, einer anderen Rasse.« Murnau knüpfte bei dieser Hinwendung zu Stoffen jenseits der europäischen Zivilisation an den älteren Plan einer Eifersuchtsgeschichte an, die er ursprünglich in Alaska spielen lassen wollte. Er charakterisierte diesen Stoff so: »Was mich an einem Filmthema immer am meisten anzieht, ist die absolute Einfachheit der Handlung. So betrachtet, ist diese Geschichte, die in drei Worten erzählt werden kann, fast das ideale Filmsujet.« Zu diesem Sujet sollte aber als Nebenthema hinzutreten: »was wird aus einer glücklichen, primitiven Rasse, wenn sie mit der Zivilisation in Berührung kommt.«2 Flaherty hatte schon 1926 einen Südseefi lm namens Moana gedreht, der sich mit der traditionellen polynesischen Kultur befaßte.3 Seine anfänglichen brieflichen Berichte von dem gemeinsamen Projekt mit Murnau lesen sich so: »Unsere Idee, was die Herstellung des Films betriff t, ist, hinzugehen ohne eine vorgegebene Geschichte irgendwelcher Art, sondern ein Jahr dort zu leben und während dieser Zeit unseren Film zu entwerfen und zu realisieren.« 4 Man ahnt schon, daß die beiden durchaus etwas Verschiedenes im Blick hatten. Jahrelange Feldstudien und die Verfilmung einer Liebesgeschichte, die in drei Worten erzählt werden kann, sind eben nicht dasselbe. Die Geschichte des Verhältnisses von Murnau und Flaherty ist umfänglich erforscht und in der Literatur diskutiert worden.5 Während der Dreharbeiten in der Südsee haben sich die beiden auseinandergelebt. Murnau zog die Regiearbeit mehr und mehr an sich, Floyd Crosby nahm Flahertys Stelle hinter der Kamera ein, und dieser war zum Schluß fast nur noch als Kopierassistent tätig. Schließlich verkaufte er Murnau seine Anteile an der Produktionsgesellschaft, die die beiden 1929 gegründet hatten, und zog sich ganz aus dem Projekt zurück. Dennoch ist sein Anteil an Tabu nicht gering, liegt aber auf einem anderen Gebiet, als man zunächst vermutet. Daß hier ein prominenter Spielfilmregisseur und ein prominenter Dokumentarfi lmer zusammengearbeitet haben und nicht miteinander ausgekommen sind, hat von Anfang an die Frage nach dem dokumentarischen Charakter des Films und die Frage, welche Position Tabu einnimmt bezüglich unseres Verhältnisses zu den »glücklichen, primitiven Rasse[n]« und ihrer 2. Friedrich Wilhelm Murnau: Südseebilder. Texte, Fotos und der Film Tabu, ausgew., bearb. und kommentiert von Enno Patalas, hg. von der Friedrich-WilhelmMurnau-Stiftung, Berlin: Bertz + Fischer 2005, S. 20. 3. Auf Moana wurde übrigens der Begriff ›documentary‹ erstmals angewendet. Vgl. Forsyth Hardy: »Introduction«, in: ders. (Hg.), Grierson on Documentary, gekürzte Ausg., London: Faber & Faber 1979, S. 11-17, hier S. 11. 4. F.W. Murnau: Südseebilder, S. 21. 5. Für eine gründliche Darstellung, die vor allem mit dem Mythos ›Murnau als einsamer Autorenfilmer gegen eine monolithische amerikanische Filmindustrie‹ aufräumt und die den Anteil Flahertys an Tabu neu bewertet, vgl. Mark J. Langer: »Tabu. The Making of a Film«, in: Cinema Journal 24/3 (1985), S. 43-64.
154
Eine Außenansicht der Innerlichkeit
Korrumpierung durch die Zivilisation, das Murnau ja ausdrücklich als Thema benennt, ins Zentrum der Rezeption gerückt.6 Zu Recht, nur muß man die Frage, was an diesem Film dokumentarisch genannt zu werden verdient, allgemeiner fassen und sich auch Gedanken darüber machen, auf welcher Basis und in welchem Sinne man hier die Darstellung von Realität einklagt. Schließlich hat die Funktionalisierung von Bildern aus der Südsee eine lange und komplexe Geschichte. Zunächst kann man wohl annehmen, daß viele Einblicke in das Alltagsleben – etwa die Art zu Fischen, die Art, wie die verschiedenen Kanus gefahren werden, die Technik des Tauchens nach Perlenmuscheln – ›dokumentarisch‹ sind. Hier sieht man den Blick Flahertys, dessen Thema immer wieder das Verhältnis von Menschen in Randzonen der Zivilisation zur Natur war.7 Auch der traditionelle Tanz zur Weihe der Jungfrau könnte von Murnau und Flaherty so vorgefunden und auf der Basis genauer Beobachtung dokumentiert worden sein. (Ob dieser Tanz diese Funktion hatte, ist allerdings zu bezweifeln.) Und Einblicke in die soziale Lage der Perlentaucher, die vor allem von chinesischen Händlern in Schuldabhängigkeit getrieben wurden, gewann Murnau selbst während der Hinreise.8 Schon durch diese realistischen Momente unterscheidet sich Tabu von den meisten Südseefi lmen, die in Hollywood damals und in den folgenden Jahren in immer größerer Zahl produziert wurden.9 Man könnte sich also auf die Formel ›Südseeliebesgeschichte mit dokumentarischen Elementen‹ verständigen. Und genau das haben die Interpreten von Anfang an getan, wobei auch die Murnau und seinem letzten Film Wohlgesonnenen dieser Geschichte wenig Komplexität zutrauten. So schrieb Lotte Eisner anläßlich der deutschen Urauff ührung 1931: »Es ist eine alte Geschichte, wie sie immer wieder neu bleibt, die Flaherty und Murnau erzählen. Von
6. Als prominentes Beispiel sei genannt: Siegfried Kracauer: Rez. »Zweimal Wildnis« [Tabu im Vergleich mit einem Film von Heinrich Hauser, FZ vom 6.10.1931], in: ders., Werke, hg.v. Inka Mülder-Bach, Bd. 6/2: Kleine Schriften zum Film 19281931, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 2004, S. 544-546. 7. Für eine kritische ethnographische Analyse der ethnographischen Dokumentarfilmer, die ausführlich auf Flaherty eingeht, vgl. Eliot Weinberger: »The Camera People«, in: Transition 55 (1992), S. 24-54. 8. Vgl. F.W. Murnau: Südseebilder, S. 65. 9. Filme wie Tabu hatten übrigens für das Publikum damals auch noch die Funktion, es überhaupt mit visuellen Eindrücken ferner Länder und Völker zu versorgen, was wir uns in Zeiten des Massenferntourismus und des Fernsehens erst vergegenwärtigen müssen. Man sieht das daran, daß noch 1940 Einstellung aus Tabu mit Aufnahmen eines Fischzuges, die Murnau neben der Arbeit an Tabu gedreht hatte und weiterem Material zu einem ›Kulturfilm‹ namens Treibjagd in der Südsee für das Beiprogramm kompiliert wurden. Vgl. Enno Patalas: »Tabu: Takes und Outtakes«, in: Hans Helmut Prinzler (Hg.), Friedrich Wilhelm Murnau. Ein Melancholiker des Films, Berlin: Bertz 2003, S. 231-234.
155
Wolfgang Kasprzik
Liebe, Verzichtensollen, von dem bösen Bann des Tabu und vom Liebestod.«10 Kritischer das Urteil von Frieda Grafe: »Später in Tabu hat Murnau die Proportionen verkehrt, da gibt es viel Natur und ein wenig ziemlich fadenscheinige Fiktion. Flaherty konnte sie nur als Konzession an Hollywood verstehen und hätte allein über die gehäuften, um keine Wahrscheinlichkeit bemühten Schreibtitel stutzig werden müssen. Nicht hinsehen, tabu.« 11 Es scheint als ob, durch die Bilder überwältigt, kaum jemand das Bedürfnis verspürte, sich mit der Liebesgeschichte in Tabu zu befassen. Auch selbsttrivialisierende Äußerungen Murnaus mögen dazu beigetragen haben, wie etwa: »Ein Tabu ist nichts anderes, als was das Wort Tabu bedeutet: ein Verbot, das aber keineswegs von Menschen, sondern von irgendeiner göttlichen Macht ausgesprochen wurde. Um diese Idee hatte ich zusammen mit Robert Flaherty eine möglichst einfache, gefühlvolle Liebesgeschichte geschlungen.« 12 Zwei Eigenschaften werden der Geschichte dabei Mal ums Mal zugesprochen: sie sei (a) einfach und (b) zeitlos. Doch diese Liebesgeschichte besteht keineswegs aus einem zeitlosen Romeo-und-Julia-Plot, der mit ethnographischem Kolorit angereichert wird. Von »absoluter Einfachheit der Handlung«, wie Murnau sie verspricht, kann keine Rede sein, und das liegt nicht zuletzt daran, daß in ihrem Zentrum eine spezifische Institution der Religion der Südseevölker steht, die seit dem 19. Jahrhundert für die europäische Rezeption ›primitiver‹ Religionen von größter Bedeutung war: das Tabu. Die Frage, auf welche Realität sich der Film eigentlich bezieht, muß daher nicht nur in Bezug auf das Bild der Südseegesellschaft gestellt werden, das er gewissermaßen nebenher zeichnet, sondern vor allem in Bezug auf den Kern der Liebesgeschichte selbst. Und insofern kann man überhaupt nicht unterscheiden zwischen der Liebesgeschichte einerseits und dem Kontext, in den sie der Film versetzt, andererseits. Nicht nur an diesen Kontext, sondern vor allem an die Liebesgeschichte zwischen Reri und Matahi muß man die Frage richten, wie hier mit dem Bild außereuropäischer Kulturen umgegangen wird.
10. Lotte H. Eisner: Murnau, überarbeitete, erweiterte u. autorisierte Neuausg., hg.v. Hilmar Hoffmann u. Walter Schobert, Frankfurt a.M.: Kommunales Kino Frankfurt 1979, S. 330. 11. Frieda Grafe: »Der Mann Murnau: Eine kommentierte Biographie«, in: Friedrich Wilhelm Murnau (= Reihe Film 43, hg.v. Peter W. Jansen u. Wolfram Schütte in Zusammenarbeit mit der Stiftung Deutsche Kinemathek), München, Wien: Carl Hanser 1990, S. 7-60, hier S. 43. 12. Friedrich Wilhelm Murnau: »Der Stern des Südens« (1931), in: Fred Gehler/ Ullrich Kasten, Friedrich Wilhelm Murnau, Berlin (Ost): Henschelverlag 1990, S. 170173, hier S. 170f.
156
Eine Außenansicht der Innerlichkeit
III. Wie kommt diese Idee, die die Handlungsstruktur des Films generiert, die Idee einer den Göttern geweihten Jungfrau und des Tabus, das auf ihr lastet, in Murnaus Film? ›Tabu‹ ist ein weitverbreitetes Konzept der polynesischen Religion. Seitdem der Begriff 1784 durch die Reiseberichte James Cooks nach Europa importiert wurde, hat er eine prominente Stellung in der Hermeneutik fremden Denkens.13 Die gedankliche Herausforderung bestand im Verstehen des für die ethnologische Reflexion paradoxen Doppelcharakters des Tabubegriffs, hat doch das Tabuisierte, wenn man nach Analogien in europäischer Religiosität sucht, scheinbar einander widersprechende Eigenschaften, da es einerseits Merkmale des Heiligen, andererseits Merkmale des Unreinen, das nicht berührt werden darf, aufweist. Die Geschichte der Theoriebildungen stellt sich als eine Abfolge verschiedener entparadoxierender ›Erklärungen‹ des Tabu dar, durch welche Erklärungen immer auch diejenigen, die Tabus befolgen, ohne über solche Erklärungen zu verfügen, als die Anderen, als die ›anders Denkenden‹ gekennzeichnet werden.14 Das Wort ›Tabu‹15 blieb aber nicht auf die ethnologische Theoriebildung beschränkt, sondern wurde als eines der wenigen Worte der polynesischen Religion Teil unserer Alltagssprache, wo es auf zwiespältige Weise unverständliches Verhalten bezeichnet. ›Tabu‹ kann nur im Zusammenhang mit ›Mana‹ verstanden werden, dessen Negativität es gewissermaßen darstellt. ›Mana‹ kann im weitesten Sinn als ›heilig‹ im Sinn von ›Heil gewährend‹ übersetzt werden. Der Gegenbegriff ist ›Noa‹, ›das Profane‹. Auf Tahiti wird ›Mana‹ eher in Verbindung mit der Herrscherfamilie gebraucht. Es eignet Göttern und Geistwesen und allem, was in Verbindung zu ihnen steht. »Diese Heiligkeit war aus nicht näher zu bestimmenden Gründen gefährlich für alle diejenigen, die wenig oder weniger von dieser Kraft besaßen, weshalb Objekte und Personen mit mana für sie tapu waren, was mit ›abgegrenzt‹, ›für den Gebrauch im heiligen Ritual bestimmt‹ oder ›vom normalen Gebrauch ausgenommen‹ übersetzt werden kann.«
Sowohl Mana wie Noa übertragen sich. »Das Heilige konnte durch Berührung mit Profanem ›verdorben‹ werden, schützte sich aber durch seine Gefährlichkeit, durch tapu.« 16 Gemäß diesem Konzept wäre eine geweihte Jungfrau zweifellos für alle 13. Vgl. Hans-Jürgen Greschat: Art. »Mana und Tabu«, in: Theologische Realenzyklopädie, hg.v. Gerhard Müller u.a., Bd. 22, Berlin: de Gruyter 1992, S. 13-16. 14. Für einen ganz kurzen Einblick in die Theoriegeschichte vgl. Jens Kreinath: Art. »Tabu«, in: Religion in Geschichte und Gegenwart, hg.v. Hans Dieter Betz u.a., 4. Aufl ., Bd. 8, Tübingen: Mohr Siebeck 2005, Sp. 3f. 15. Es gibt auch die Transkription »Tapu«. 16. Beide Zitate: Ingrid Heermann: Mythos Tahiti. Südsee – Traum und Realität, mit Beiträgen von Matthias Mersch und Hilke Thode-Arora, Berlin: Dietrich Reimer
157
Wolfgang Kasprzik
anderen tabu. Aber welche Funktion hat diese Jungfrau? Welchem Tabu unterliegt Reri? In dem ersten Entwurf eines Plots unter dem Titel Turia 17, mit dem Murnau und Flaherty in die Südsee auf brachen, spielte das Thema Tabu noch überhaupt keine Rolle. Es geht, verflochten mit einer Liebesgeschichte, um einen Perlentaucher, der, um eine Schuld zurückzuzahlen, an einer gefährlichen Stelle nach Perlen taucht und dabei umkommt, also um Motive, die im zweiten Teil von Tabu verarbeitet wurden. Das Motiv der Heiligkeit der Dorfjungfrau und des Tabus, das über ihr waltet, wurde von Flaherty eingebracht, der davon auf Samoa hörte, wo er den Film Moana gedreht hatte. Im Drehbuch heißt die heilige Jungfrau dann auch Taupou.18 Eine Taupou ist jedoch etwas ganz anderes, als was uns in Tabu vorgeführt wird. Es handelt sich um eine Art Ehrenjungfer, die der Häuptlingsfamilie zugeordnet ist, nicht um eine Tempeljungfrau. Auf Bora Bora, der Insel, auf der der erste Teil von Tabu angesiedelt ist, scheint es eine entsprechende Institution gar nicht zu geben. 1928 befaßte sich Flaherty mit dem nicht vollendeten Projekt eines Films mit dem Arbeitstitel Acoma, der unter Indianern spielen sollte, in dessen Plot sich Basisstrukturen von Tabu finden. Ein tapferer Jäger namens Lone Wolf (Matahi) verliebt sich in das gefangene Mädchen Wild Deere (Reri), das einem feindlichen Stamm angehört (verbotene Liebe, hier: Romeo-und-JuliaStruktur) und dazu ausersehen ist, den Göttern geopfert zu werden (Taupou zu werden), damit der dringend benötigte Regen fällt. Er erjagt in einer kühnen Aktion als Ersatz für dieses Opfer das Fell eines besonderen Bären (wie Matahi nach der Perle als Äquivalent taucht) und opfert das eigene Leben, um das seiner Geliebten zu retten (wie sich Reri opfert, sich selbst der Rache der Götter ausliefert, um Matahi zu retten, also mit umgekehrter Zuordnung von männlicher und weiblicher Rolle).19 Das überraschende Resultat ist also, daß der Kern der Fiktion des Films – bestehend aus der Geschichte einer verbotenen Liebe, wobei jeweils eine ›primitive‹ religiöse Institution, einmal das Menschenopfer, das andere Mal das Tabu, im Zentrum der Handlung steht, und der Aufopferung eines der Liebenden für den anderen – vom ›Dokumentaristen‹ des so gegensätzlichen Regisseurpaares stammt; wobei er von diesem keineswegs in jahrelanger ethnographischer Beobachtung vor Ort gefunden, sondern als formaler Multifunktionsplot mitgebracht wurde, der von Samoa nach Tahiti verlagert werden konnte, nachdem er auch schon bei den Indianern Amerikas gute Dienste geleistet hatte.20 Um so wichtiger ist es, zu fragen, wie dieser Plot in Tabu eingesetzt wird, 1987, S. 57f. Für eine allgemeinere Darstellung vgl. H.-J. Greschat: Art. »Mana und Tabu«. 17. Friedrich W. Murnau/Robert W. Flaherty: Turia. Eine Originalgeschichte, in: F. Gehler/U. Kasten: Friedrich Wilhelm Murnau, S. 154-170. 18. F.W. Murnau: Südseebilder, S. 139. 19. Zusammenfassung nach M.J. Langer: Tabu, S. 47 und S. 54. 20. Und insofern ist der Vorspann korrekt, der vermeldet: »Erzählt von F.W.
158
Eine Außenansicht der Innerlichkeit
nicht um dann vorwurfsvoll festzustellen: ›der Film tut nur so, als ob er einen Konflikt thematisiert, der die Gesellschaft bestimmter Südseeinseln charakterisiert, der Film tut nur dokumentarisch‹, sondern um das Verfahren zu kennzeichnen, mit dem hier das fi lmische Bild einer gesellschaftlichen Institution – welcher eigentlich? – generiert wird. Es läßt sich zeigen, daß Murnau die Idee des Tabus gerade in ihrer Abstraktheit von Flaherty übernimmt und durch eine Reihe genialer Erfindungen daraus einen echten Murnau-Film entstehen läßt. Genial ist zunächst, daß uns dieses Verfahren im Film selbst vorgeführt wird, und zwar im Fall des Tabus über den reichsten Perlengründen, die von einem Hai bewacht werden. Der französische Polizist bringt dort auf dem Wasser ein Schild mit dem Wort »Tabu« an, nachdem der Hai einen Taucher getötet hatte. Er kommentiert dies in seinem Tagebuch:21 ›Es handelt sich also nicht um Aberglauben, da ist tatsächlich ein Hai‹. Womit er implizit voraussetzt: ›Wäre da kein Hai, so handelte es sich um Aberglauben.‹ Er verwendet das Wort ›Tabu‹ also ganz anders als die Bewohner der Insel. Wer an Mana und Tabu glaubt, würde nicht sagen, daß das Wort ›Tabu‹ nur ein Label für die Gefährlichkeit des Hais ist, vielmehr wäre die Stelle für ihn ursprünglich gefährlich, und der Hai exekutierte nur diese Macht. Das über den Wassern schwebende Schild »Tabu« ist also eine moderne Rekonstruktion dieses Konzepts. Nicht anders verfährt übrigens auch eine der berühmtesten Theorien über das Tabu. In Totem und Tabu von 1912/13 versucht Sigmund Freud moderne Zwangsneurosen und den Glauben der Südseeeinwohner an das Tabu nach ein und demselben Schema zu erklären: Der aktuelle psychische Zwang ist ein Oberflächenphänomen, hinter dem sich in der Tiefe der Vorgeschichte reale Zwänge verbergen, nämlich die von einem Urvater verhängten (vor allem: sexuellen) Restriktionen. »Wir konstruieren die Geschichte des Tabu aber folgendermaßen nach dem Vorbild der Zwangsverbote. Die Tabu seien uralte Verbote, einer Generation von primitiven Menschen dereinst von außen aufgedrängt, das heißt also doch wohl von der früheren Generation ihr gewalttätig eingeschärft. Diese Verbote haben Tätigkeiten betroffen, zu denen eine starke Neigung bestand.«22
Wie mit dem Schild »Tabu« auf dem Meer wird mit dieser Theorie signalisiert: es gibt tatsächlich eine Gefahr, die in der Tiefe lauert, aber gefährlich ist es dort nicht aus den Gründen, die diejenigen benennen, die das Wort Tabu ursprünglich gebrauchen (religiöse Mächte), sondern aus Gründen, die wir Murnau/R.J. Flaherty« und: »Regie F.W. Murnau«, F.W. Murnau: Südseebilder, S. 114. 21. F.W. Murnau: Südseebilder, S. 186f. 22. Sigmund Freud: »Totem und Tabu«, in: ders., Studienausgabe, hg.v. Alexander Mitscherlich u.a., Bd. IX: Fragen der Gesellschaft/Ursprünge der Religion, Frankfurt a.M.: S. Fischer 1974, S. 287-444, hier S. 323.
159
Wolfgang Kasprzik
moderne (bzw. gesunde) Menschen als Bedrohung rekonstruieren, wobei wir uns an dem orientieren, was uns selbst als begehrenswert und bedrohlich erscheint. Die fortdauernde Verwendung religiöser Redeweisen ist damit als Verschiebung charakterisiert. Nach demselben Schema erzeugt auch Murnau aus dem von Flaherty eingebrachten Teilplot ›Tabu über einer den Göttern geweihten Jungfrau zerstört Liebesbeziehung‹ ein Bild nicht – oder jedenfalls nicht nur – der Lage der Südseebewohner, sondern der mentalen Verfaßtheit seiner europäischen Gegenwart. Unter dem Label ›Tabu‹ geht es um eine Deutung der Zwänge der zivilisierten Welt durch deren Projektion in eine Vorgeschichte, die als Abfolge von »Paradise« und »Paradise Lost«, so die Titel der beiden Teile des Films, konstruiert wird. Mit der Verlagerung des Paradieses in die Südsee knüpft er an eine Tradition an, die mindestens bis zur utopischen Literatur der frühen Neuzeit zurückreicht, als das Paradies aus Vorzeit und Jenseits, wo der christliche Glaube es ansiedelte, in die räumliche Ferne der nun entdeckten neuen Länder verlegt wurde. Um es immakulat zu erhalten, war es passend, es in der Fiktion auf eine ferne Insel zu verlegen.23 Die Grundfrage aller Darstellungen verlorener Paradiese ist: Wo lokalisiert man die Ursache des Verlustes? Steckt der Wurm, die Schlange, schon im Paradies, so erscheint das Paradies als in sich gespalten und insofern weniger paradiesisch, weniger geeignet für die Projektion einer Idylle. Kommt die Gefahr nur von außen, so läßt sich die Geschichte des Verlustes auch nur als Geschichte eines äußeren Kampfes darstellen, mit der Folge, daß das Bild der eigentlichen Idylle an Spannungslosigkeit leidet. Die Liebe von Matahi und Reri scheitert unter dem Druck des Tabus. Das Tabu vertreibt sie aus dem Paradies. Ist diese Institution ein Teil des Südseeparadieses selbst? Murnau scheint diese immanente Variante verfolgt zu haben: »Ich hatte den Plan gefasst, über das ›Tabu‹ – über das Problem, dass die Menschen sich selbst Tragödien schaffen müssen, wenn das Schicksal ihnen großmütig gesinnt ist – einen Film herzustellen.«24 Demnach ginge es ihm um eine selbstgeschaffene, und zwar von Menschen unter paradiesischen Lebensumständen selbstgeschaffene Tragödie. Doch in der Realisierung bedient er sich einer raffinierten Spaltung. Um seine Paradiesesinsel immakulat zu erhalten, läßt Murnau das Tabu wie von außen kommen. Obwohl Hitu, der Abgesandte des großen Häuptlings Fanuma, die Gewässer dieser Region im zweiten Teil des Films mit einem Boot auch ganz allein zu befahren vermag, bedient er sich in kultischer Mission (!) des Linienschiffs der französischen Kolonialmacht (das übrigens Moana heißt, so wie Flahertys erster Südseefi lm). Auf diesem Schiff, also quasi auf französischem Hoheitsgebiet – und nicht, wie man erwarten sollte, auf der Insel selbst, an einem heiligen Ort – wird den Bewohnern der Insel die religiöse Absicht Fanumas über die heilige Jungfrau eröff net. Und sie wird ihnen durch das Verlesen eines schriftlichen Dokumentes eröffnet, was keineswegs 23. Speziell für Tahiti vgl. I. Heermann: Mythos Tahiti, S. 11-13. 24. F.W. Murnau: Südseebilder, S. 56.
160
Eine Außenansicht der Innerlichkeit
nur ein Trick ist, um geschickt Text im Stummfilm unterzubringen. Die zentrale Bedeutung, die Schrift im zweiten Teil des Films hat, vor allem die Beschriftung des Tabus über den gefährlichen Perlengründen mit einem Schild, macht deutlich, daß das Tabu hier der Schriftkultur zugerechnet wird. Der französische Kapitän spielt eine wichtige Rolle bei der Proklamation von Erwählung und Tabu. Er dirigiert den Häuptling der Insel zu Hitu (nicht umgekehrt!), schaut später nach, ob Reri endlich zu ihrer Weihe bereit ist – womit er die Funktion des Polizisten vorwegnimmt, der im zweiten Teil den Haftbefehl überbringt –, und er schreitet schließlich an der Seite von Hitu zum Weihefest und ist dabei wohl auch zugegen. Diesem überraschenden In-Szene-Setzen des europäischen Kapitäns korrespondiert umgekehrt eine Depotenzierung des Häuptlings von Bora Bora: Dieser Häuptling tritt überhaupt nur in Funktionen auf, in denen er selbst Befehlsempfänger ist. Murnau und Flaherty lassen, wenn wir noch einmal auf die mögliche ethnographische Perspektive ihres Films blicken, die innere soziale Struktur der Inselgesellschaft völlig außer Acht,25 nicht (nur) aus Desinteresse, sondern weil eine interne Hierarchie/Herrschaft in der Konstruktion eines Paradieses keinen Platz hat. Besondere Betrachtung verdient die Ankunft des Schiffes. Die Szenenfolge von der ersten Entdeckung des Schiffes am Horizont, über die ausführlichst dargestellte Fahrt sämtlicher Kanus auf das Schiff zu, bis zum Entern des Schiffes, wobei zahlreiche Jünglinge in die Takelage klettern, ist eine der längsten zusammenhängenden Einheiten des Films. Ikonographisch ist ihre Grundstruktur – tropische Bucht, darin ein europäisches Schiff mit hohen Masten, dem sich leichtbekleidete Eingeborene in Kanus nähern, die im Gegensatz zu dem hoch aufragenden Schiff mit dem Meer verbunden bleiben und nicht durch Größe, sondern durch Anzahl beeindrucken – traditionell mit der Ankunft und Anwesenheit von Kolonisatoren verbunden. So oder so ähnlich sieht es auf hunderten von Bildern aus, wenn europäische Mächte in den ›neuen‹ Ländern eintreffen und ihre neuen Götter einführen, oder wenn sie sich wieder einmal zeigen, um ihre Macht zu manifestieren.26 Auch das Umschlagen einer anfänglichen freundlich-freudigen Erwartung der ›Eingeborenen‹ in lähmendes Erschrecken über die Konsequenzen des neuen Gesetzes wird vor allem von den ersten Kontakten in den amerikanischen Kolonien berichtet. Nur die Absicht, dieses Umschlagen möglichst 25. Historisch waren die Gesellschaftsinseln durchaus eine Klassengesellschaft, bestehend aus Adel, Gemeinen und Sklaven. Das ungebundene Leben, das uns von den Jünglingen und Mädchen am Anfang gezeigt wird, paßt am ehesten auf die Gruppe der Arioi, von der es hier auf die Gesamtgesellschaft übertragen wird. Vgl. I. Heermann: Mythos Tahiti, S. 59-65 und S. 110-114. 26. Das Urbild all dieser Bilder ist das von Columbus Ankunft in Hispaniola (noch ohne Kanus). Als Beispiel für eine kriegerische Variante vgl. den Stich »Die Eingeborenen von Otaheite greifen das Schiff von Capitain Wallis an« (1773), abgedruckt bei I. Heermann: Mythos Tahiti, S. 16, weitere Beispiele dort auf S. 21 und S. 26.
161
Wolfgang Kasprzik
effektiv zu inszenieren, erklärt die Dynamik, die der Film hier auf bietet. Das florale Jugendstilsetting der Szenen am Wasserfall wird unterbrochen vom Bild des expressionistischen Propheten, des ›Rufers‹. Die kreisend spielerischen Bewegungsformen des Anfangs werden verdrängt durch das gerichtete Streben aller Bewohner der Insel auf das Schiff hin – nur Matahi bewegt sich auch dabei schon in der Gegenrichtung. Wenn Matahi zuvor, dem Ruf folgend, vom erhöhten Standpunkt im Wipfel einer Palme sieht, was für die am Boden Stehenden noch hinter dem Horizont verborgen ist, ein kleines weißes Segel am Horizont des sonst leeren Meeres, so sieht er die Tag-Variante des letzten Bildes des Filmes, in dem das Schiff Hitus nicht ankommt, sondern im Nacht-Reich verschwindet. Positive und negative Eschatologie sind nur in der Tönung unterscheidbar. Dieses Paradies jedenfalls wartete auf etwas, das kommt, und was da kommt, kommt von außen. Es soll damit nicht behauptet werden, der Film erzähle uns, die Institution des Tabus werde als etwas Neues und Fremdes den Bewohnern von Bora Bora aufgezwungen; zu bemerken ist vielmehr, der Film erzähle die Geschichte auf der Bildebene so, daß wir überhaupt nicht darüber nachdenken, daß das Tabu als religiöse Institution natürlich in der Gesellschaft der Paradiesesinsel selbst verankert sein müßte. Eine religiöse Kommunikation, die der Sache nach eine Kommunikation unter den Südseebewohnern ist, wird dargestellt wie eine äußere Kolonisierung.27
IV. »Paradise Lost« heißt dann der zweite Teil. Aber welches Paradies ist denn verlorengegangen? Daß wir eine Kultur als paradiesisch empfinden, in der Oberhäuptlinge einer fernen Zentralinsel mürrisch dreinblickende Greise losschicken können, um junge Mädchen aus den Armen der sie liebenden Jünglinge zu reißen, um sie für den Dienst in ihrem Tempel zu verpfl ichten, dieses Gefühl will der Film ja gerade nicht vermitteln. Der Zwischentitel kennzeichnet die Perleninsel durch zwei Eigenschaften als verlorenes Paradies: sie ist der Ort, wo (a) »der weisse Mann herrscht« und (b) »die alten Götter vergessen sind« – doch das sind eben die alten Götter, vor deren Bann Reri und Matahi auf die Insel des weißen Mannes geflohen sind. Durch die so aufgebaute dreistellige Struktur hat Murnau die Möglichkeit einer doppelten Klammerung. Einmal kann er das reine Südseeparadies zeigen, das in zwei Stufen kolonisiert ist, durch die restriktive Herrschaft, die das Tabu aufrichtet und durch die Herrschaft des weißen Mannes; zum anderen kann er die Südseewelt, zu der dann auch das Tabu gehört, der modernen Kolonialherrschaft gegenüberstellen. Worin besteht nun der Bruch des Tabus im Sinne des Flaherty/Murn27. Vgl. noch einmal die oben zitierte Auffassung Freuds, die »Tabu seien uralte Verbote«, die den Menschen »von außen aufgedrängt« (Hervorh. W.K.) wurden. S. Freud: Totem und Tabu, S. 323.
162
Eine Außenansicht der Innerlichkeit
auschen Tabukonstruktes? Keinesfalls wird hier Sexualität als tabuisiert betrachtet. Während die christlichen heiligen Jungfrauen, jedenfalls in der verbreitetsten Funktionalisierung, eine Reinheit symbolisieren, die eigentlich alle Menschen auszeichnen sollte, wird Reri durch ihre Erwählung ganz speziell ›tabuisiert‹, wohingegen der allgemeine natürlich-freie Umgang der Geschlechter dessen Bild die anfänglichen Szenen am Wasserfall evozieren, dadurch nicht aufgehoben wird.28 So ist denn auch der Tanz, mit dem die den Göttern geweihte Jungfrau initiiert wird, derart voller erotischer Energie, daß der Unterschied zu einer heiligen Jungfrau im abendländischen Sinne offenkundig ist. Mit dieser Projektion der Vision einer freien Sexualität auf tropische Inseln steht Murnau in einer langen Tradition der Produktion von Südseemythen.29 Tabuisiert ist nicht Sexualität, sondern das individuelle Begehren, und das wird eigentlich erst durch das Tabu geweckt, da folgt Murnau ganz dem Apostel Paulus: »Denn ich wüßte nichts von der Begierde, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte: ›Du sollst nicht begehren!‹« (Römer 7,7) Die Liebe von Matahi und Reri vor der Proklamation des Tabus wird nämlich wie etwas Naturhaftes dargestellt und ihr Begehren als eines, das von sich nichts weiß. Hier herrscht eine florale jugendstilhafte Bildsprache vor. Reri taucht für uns zum ersten Mal wie eine Blüte im Zentrum einer großen Pflanze auf, so wie Faust Gretchen im Garten der Frau Schwerdtlein von Blumen (und Kindern) umgeben sieht. Unter dem Verdikt des Tabus wird das Begehren als der damit etablierten Ordnung entgegenstehend bewußt. Reri flüchtet sich in den Schoß ihrer Mutter.30 Daß ihr Vater bei dem Geschehen bis hin zu ihrem Abschied nur in stummer Trauer verharrt und genau wie der Häuptling der Insel jeder Funktion beraubt ist, zeigt, daß Hitu jetzt die patriarchale Vaterrolle übernommen hat. Auch Matahi versinkt zunächst in Lethargie, entschließt sich dann aber zur Opposition. Die erste Stufe seines Tabubruchs besteht in der Verweigerung des Kranzes für Hitu. Der Kranz ist leitmotivisch vorbereitet: schon bei der kleinen Eifersuchtsszene zwischen Reri und einem anderen Mädchen am Wasserfall – deren Funktion es ist, zu zeigen, wie harmlos Besitzansprüche im paradiesischen Zustand sind, auch wenn sie zu kleinen Tätlichkeiten führen – geht es darum, wessen Kranz Matahi sich aufgesetzt hat. Bei der Verkündung des Tabus auf dem 28. Diesen wichtigen Unterschied übersieht Jo Leslie Collier, die Reri als romantische Madonna deutet. Vgl. Jo Leslie Collier: From Wagner to Murnau. The Transposition of Romanticism from Stage to Screen, Ann Arbor, London: UMI Research Press 1988, S. 110 und S. 129. 29. Vgl. dazu allgemein I. Heermann: Mythos Tahiti, S. 85-87 und, speziell auf das Sexualverhalten der Arioi bezogen, S. 114. Man denke auch an Gauguins geradezu besessene Suche nach einer freien Sexualität auf Tahiti. Vgl. Paul Gauguin: Noa Noa, München: Rogner & Bernhard 1969. 30. Thomas Koebner weist darauf hin, daß der Schmerz der Mutter hier den rituellen Rahmen sprengt. Vgl. Thomas Koebner: »Der romantische Preuße«, in: H.H. Prinzler (Hg.), Friedrich Wilhelm Murnau, S. 9-52, hier S. 50.
163
Wolfgang Kasprzik
Schiff wird der Kranz, den Matahi Reri aus der Takelage überwirft, brüsk zu Boden geworfen. Und spiegelbildlich wirft nun Matahi den Hitu gebührenden Kranz zu Boden, nachdem er unmittelbar zuvor Reri bekränzt hat. Der Tanz stellt dann das Zentrum des Tabubruchs dar. Noch einmal sei betont: dieser Tanz zur Weihe der neuen Taupou wäre auch ohne den Tabubruch voller erotischer Symbolik gewesen. Nicht darin besteht das Sakrileg, sondern in der Individualisierung. Aus einem Ritus, in dem das ganze Dorf die Tempeljungfrau weiht, machen Matahi, der sich in den Kreis der Tanzenden hineindrängt, und Reri, die ihm respondiert, einen Akt ihrer Liebe als Individuen, die jeden Anspruch der gesellschaftlichen Ordnung negiert. Beiden Akten – der Verweigerung des Kranzes und der Usurpation des Tanzes – geht jeweils eine Phase voraus, in der Matahi bewegungslos, wie gelähmt in seiner Hütte verweilt. Das Sakrileg ist kein natürlicher Reflex der Natur gegen die Restriktion des Verbotes, es entspringt der Innerlichkeit der Trauer! Matahi raubt schließlich Reri und die beiden fliehen auf eine Insel, die die durch Europäer kolonisierte Welt repräsentiert. Fasziniert von diesem Liebespaar, hat kaum ein Interpret registriert, daß die beiden hier nicht nur äußerlich von dem alten Zwang des Tabus und den neuen Zwängen der kolonialen Ökonomie bedrängt werden, sondern daß sich der Charakter ihrer Beziehung grundsätzlich wandelt. Was das Tabu provoziert und der Tabubruch realisiert hat: das Heraustreten aus naturhaften und traditionellen Bindungen, erscheint jetzt in fast karikierender Gestalt verwirklicht. Während Reri und Matahi auf der paradiesischen Insel als Mitglieder der Gruppe ihrer Generationsgenossen eingeführt werden, leben sie auf der Perleninsel eine bürgerliche Privatexistenz. Sie bewohnen ein Häuschen, das im Gegensatz zu den Hütten im Paradies über eine Tür verfügt, die man verriegeln kann, was freilich für den Vertreter des Gesetzes kein Hindernis darstellt. Der Mann geht außer Haus einer regelmäßigen Arbeit nach, die Frau hütet das Heim, bewahrt sparsam das gemeinsame Geld und übt in ihrer freien Zeit für die Höhepunkte des gemeinsamen Lebens Lieder auf der Gitarre ein.31 Aus der paradiesischen Individualität wird also in der Zivilisation die Privatheit. In der öffentlichen Sphäre auf der Perleninsel korrespondiert der Individualisierung eine gegenläufige Entindividualisierung durch die Tauschökonomie. Auch auf Bora Bora wurden Gaben überreicht, sie wurden aber nicht gleich mit einer äquivalenten Gegengabe verrechnet. Man vergleiche etwa die rituelle Überreichung des Getränkes an Hitu mit dem Ausschank des Champagners auf der Perleninsel, wo im Hintergrund die Kosten mitgerechnet werden. Überhaupt sind die beiden Feste sehr genau parallel konstruiert. Das Fest auf Bora Bora ist ein Fest zu Ehren Reris, bei dem Reri und Matahi den Tanz der ganzen Gruppe in den Akt ihrer individuellen Liebe verwandeln, bis Hitu diesem Tabubruch ein Ende bereitet. Bis dahin fi ndet ihr Tanz allerdings begeisterte Resonanz. Das ganze Dorf feiert mit ihnen, wodurch Hitus In31. Thomas Koebner notiert zu Recht »Murnau[s] Ausrutscher ins Volkskundlich-Revuehafte«. T. Koebner: Der romantische Preuße, S. 50.
164
Eine Außenansicht der Innerlichkeit
tervention noch einmal als von außen kommend gekennzeichnet ist. Auch daran sieht man, wie konstruiert das Tabu hier ist. Wäre das Tabu über der erwählten Jungfrau tatsächlich eine Institution dieser Inselgesellschaft, so müßte doch auch jemandem außer Hitu aufgefallen sein, daß Matahi hier genau das Tabuisierte tut, indem er einen begehrlichen Blick auf die heilige Jungfrau wirft. Statt dessen schauen sich die Tänzer nach Hitus ›Halt‹ wie ertappte Schulbuben um. Im noch tabufreien Paradies sind Individualität und Gemeinschaft jedenfalls festlich vereint. Das Fest auf der Perleninsel wird zu Ehren Matahis gefeiert. An die Stelle der Choreographie, die das ganze Dorf einbezieht, ist der moderne Paartanz getreten – großartig die Bilder der teils beschuhten, teils unbeschuhten Füße. Der als Versuch einer Wiederholung ihres initialen Tanzes im Paradies angelegte Tanz von Matahi und Reri hat in diesem Kontext den Charakter einer arrangierten Inszenierung. Während im Paradies das ganze Dorf sich fröhlich auf das Fest vorbereitete, muß hier jemand gefunden werden, der auf einem Blechkanister den Takt schlagen kann. Vor allem aber wird am Schluß dieses Festes die Rechnung präsentiert. Die Verknüpfung zwischen der Transformation der Paarbeziehung und der Ökonomie wurde in der zeitgenössischen Theorielandschaft übrigens an verschiedenen Stellen durch Projektion in die Südsee bearbeitet. Neben dem schon erwähnten Totem und Tabu von S. Freud (1912/13) sei hingewiesen auf Bronislaw Malinowski, der in Die Argonauten des westlichen Pazifiks 1922 ein Tauschsystem beschrieb, bei dem die Reziprozität durch extreme Verzögerung unsichtbar wird, bevor er 1929 Das Geschlechtsleben der Wilden in Nordwest-Melanesien im Rahmen des Gesamtsystems von Tauschverhältnissen, von Geben und Nehmen, darstellte.32 Daran knüpfte unter anderem Wilhelm Reich 1931 in Der Einbruch der Sexualmoral33 an, der die Rückschau auf die »sexuelle Ökonomie« der Südseevölker zur Selbstverständigung im zeitgenössischen antikapitalistischen Klassenkampf nutzen wollte. Wie sieht das ökonomische Schicksal von Matahi und Reri im einzelnen aus? Matahi, von dem wir zunächst erfahren, daß er die Institution des Geldes nicht versteht, beherrscht kurz darauf eine besonders subtile Form des Äquivalententauschs, die Beamtenbestechung. Er bietet dem Polizisten eine wertvolle Perle für die Niederschlagung des Haftbefehls. An dieser Stelle taucht zum ersten Mal eine Schachtel als Behältnis des zu tauschenden Gutes auf. Könnte man hier noch denken, daß es sich um irgendeine Art von Geldbörse handelt, so wird die Schachtel, in der Matahi das Geld für die Schiffskarten zur Agentur trägt und die er leer zurückbringt, so auff ällig ins Bild gesetzt, daß dahinter Methode stecken muß. Durch die Schachtel wird das der Intention nach ja sehr transparente Agieren mit zu tauschenden Gütern als etwas 32. Vgl. Bronislaw Malinowski: Schriften in vier Bänden, Bde. 1 u. 2, hg.v. Fritz Kramer, Frankfurt a.M.: Syndikat 1979. 33. Wilhelm Reich: Der Einbruch der Sexualmoral. Zur Geschichte der sexuellen Ökonomie, Berlin, Leipzig, Wien: Verlag für Sexualpolitik 1931. Spätere Aufl agen trugen den Titel Der Einbruch der sexuellen Zwangsmoral.
165
Wolfgang Kasprzik
Intransparentes dargestellt. Ist die Schachtel geschlossen, so sieht man nicht, wie groß das eigene Vermögen gerade ist. Wenn dann die Schachtel, in der Reri die gekauften Tickets vermutet, leer ist, was Matahi vor ihr zu verbergen sucht, so ist das ein Zeichen dafür, daß das Guthaben, das Reri in Gestalt des von ihr gesparten Geldes in die Schachtel geschüttet hatte, aufgrund der Überschuldung eigentlich gar nicht existent war. Später schreibt Reri ihren Abschiedsbrief auf die auseinandergefaltete Schachtel.34 Diese letzte Zusammenführung von Tausch und Schrift ist konsequent. Reri erkennt, daß ein im Sinne der Logik des Tabus schuld(en)freies Leben nicht durch den Einsatz eines Äquivalentes wie Geld gekauft werden kann, also nicht mit etwas, bei dem von der Individualität des Gegebenen abstrahiert wird. Diese Schachtel ist daher jetzt funktionslos und stellt nur noch den assoziativen Anschluß her zu einer archaischeren Form der Gabe, zum Opfer. Um Matahis Leben zu retten, muß Reri sich selbst hingeben. Die Geste, mit der Hitu dann den Laderaum des Bootes schließt, entspricht dem Verschließen der Schachtel (es ist ein Zusammenschieben). Der Unverständlichkeit der Geldwirtschaft entspricht die Intransparenz der göttlichen Sphäre. Über den Zustand dieser Opfergabe verfügen jetzt nur noch Hitu und die Götter, denen er Reri übergeben wird. Dem Blick Matahis ist dieser Bereich damit entzogen. Der Gegensatz zwischen dem Tausch abstrakter Äquivalente und der unvertretbar individuellen Hingabe an das Heilige wird übrigens schon am Ende des ersten Teils thematisiert, als die Bewohner von Bora Bora Hitu ein anderes Mädchen als Ersatz für die geraubte Reri anbieten. Schon allein auf die Idee zu kommen, man könne die heilige Jungfrau durch ein gewiß ebenso schönes Mädchen ersetzen (eben durch ein Äquivalent), liegt absolut jenseits der religiösen Logik von Erwählung und Heiligkeit. Entweder soll hier noch einmal gezeigt werden, wie äußerlich das Tabu dem Denken der Bewohner des Paradieses ist – so äußerlich, daß sie erst von dem Fremden Hitu darüber belehrt werden müssen, daß man das Tabu nicht mit einem solchen Tauschakt umgehen kann –, oder dieser Versuch wäre als eine schon durch Tabubruch und Raub verursachte Korrumpierung des Denkens der Bewohner von Bora Bora zu werten. Reri jedenfalls entschließt sich am Ende zur persönlichen und unvertretbaren Hingabe als Opfer, um Matahis Leben zu retten. Es handelt sich dabei um die Hingabe in den Tod und nicht nur um die nachgeholte Einwilligung in die Überführung zum Dienst als heilige Jungfrau und den Verzicht auf die Liebe zu Matahi, wie eine oberflächliche Lesart zunächst vermuten lassen könnte. Der Kapitän hatte es schon in seinem Logbuch vorhergesagt: »Wenn sie nicht zurückgebracht wird, bedeutet das Tabu den Tod. Sie wird gehetzt und geopfert werden.«35 Hitu holt Reri ab, um dem Zwang des Tabus – das auch ihn selbst unter ein Todesverdikt stellt – Genüge zu tun, nicht um Reri 34. Man erkennt das allerdings fast nur, wenn man das Drehbuch gelesen hat. Vgl. F.W. Murnau: Südseebilder, S. 207f. 35. F.W. Murnau: Südseebilder, S. 166.
166
Eine Außenansicht der Innerlichkeit
zu guter Letzt doch noch als Tempeldienerin zu installieren. Vor allem aber sprechen die Bilder eine klare Sprache. Er tritt mit seinem kleinen Boot als Charon auf, und die Schritte Reris in den Rumpf des Bootes sind Schritte in einen Sarkophag.36 Um die Bedeutung dieses Opfers zu verstehen, müssen wir uns noch mit der Art der Präsenz Hitus im zweiten Teil des Films und mit dem Dreieck Reri – Matahi – Hitu beschäftigen. Hitus Ankunft und Anwesenheit im zweiten Teil ist von der im ersten völlig verschieden. Zwar triff t er wieder mit dem Schiff Moana ein, zwar hat er zur Exekution seines Anspruchs auf Reri wieder einen Komplizen auf Seiten der Kolonialmacht – im ersten Teil den Kapitän, im zweiten Teil den Polizisten mit dem Haftbefehl –, doch bleibt er selbst zunächst unsichtbar. Er bleibt überhaupt unsichtbar für alle – außer Reri. Wenn Matahi zur Tür schaut, in der Reri soeben noch Hitu erblickte, so sieht er nichts. Die Beziehung von Reri und Hitu findet hauptsächlich nachts statt und ähnelt vielfach der nachtwandlerischen Kommunikation von Ellen und Orlok in Nosferatu. Nachts fallen die entscheidenden Entschlüsse Matahis und Reris, aber nachts sind sie nie zugleich wach – oder versuchen jedenfalls vor einander zu verbergen, daß sie wach sind. So ist auch Hutter in der Nacht abwesend als Ellen den Entschluß faßt, sich dem Vampir hinzugeben. Und schon das Einlaufen des Schiffes auf der Perleninsel, das den zweiten Tanz Matahis und Reris unterbricht, ist deutlich der Ankunft Orloks in Wisborg nachempfunden. Die Frau kommuniziert nachts mit den dämonischen Mächten, der Mann hat auch Träume, aber die betreffen das erfolgreiche Handeln in der Tagwelt der Tauschwirtschaft. Matahi träumt davon, in einer nächtlichen Aktion eine große Perle als Gegenwert ihrer Schulden zu erbeuten. Daß auch er in der Nachtwelt enden wird, zeigt eine kleine Verschiebung auf der Bildebene: er findet eine Perle, aber das ist nicht die, von der er geträumt hat. Er träumte von der weißen Riesenperle, er findet aber eine kleine schwarze Perle. Die ist zwar genauso wertvoll, könnte also im Tausch die Schulden tilgen, aber für einen solchen Handel ist jetzt nicht mehr die Zeit. Mit Hitu als dem Repräsentanten einer Kolonisation von außen würde ein Held wie Matahi den Kampf aufnehmen und gewinnen, wie er es getan hat, als er ihm den Kranz verweigerte, als er Reri raubte und als er den Kolonialpolizisten bestach. Mit einem realen Hitu als dem Repräsentanten des Tabus würde er fertig, wie er mit dem realen Hai als dem Repräsentanten des zweiten Tabus fertigwurde. Matahis Untergang kann nicht einfach so gelesen werden, daß eine weitere Konfrontation desselben Typs ansteht, für deren Bestehen nun eben seine Kräfte nicht mehr ausreichen. Zu einem Kampf kommt es überhaupt nicht mehr. Hitus Schnitt durch das Seil, mit dem sich Matahi an Bord zu ziehen versucht, unterbricht die Verbindung zwischen der Sphäre Matahis und der der alten Götter, in die er Reri nun führen 36. Vgl. dazu die bekannten Illustrationen einer ganz anderen Geschichte durch Edward Coley Burne-Jones (Holzschnitt, Mitte der 1860er Jahre) und John Roddam Spencer Stanhope (Gemälde, 1883), nämlich die Bilder von Charon und Psyche.
167
Wolfgang Kasprzik
wird. Deshalb kann man auch angesichts der Schlußszene des Films die oben gemachte Behauptung aufrecht erhalten, daß im zweiten Teil niemand außer Reri Hitu sieht. Matahi wird mit Hitu erst dann konfrontiert, als er Reri in die Nachtwelt folgen will, doch Hitu schneidet die Verbindung ab. Und während wir mehrfach den ungerührten Blick Hitus auf den ihn verfolgenden Matahi sehen, sehen wir nie, daß Matahi den Kopf aus dem Wasser hebt und Hitu anschaut. Man könnte Tabu fast als Kommentar zu Nosferatu lesen. Das Auftauchen des Dämonischen als Nachtseite der zivilisierten Welt, das große Thema der expressionistischen Stummfi lme, wird hier, in einem der letzten Stummfi lme überhaupt, durch die Vorschaltung einer Vorgeschichte im Paradies als innere Wiederkehr, als Internalisierung des Gesetzes gedeutet. Dort »wo der weiße Mann herrscht und die alten Götter vergessen sind«, wie der Zwischentitel die Welt charakterisiert, in die Reri und Matahi vor dem Tabu geflüchtet sind, kehren die alten Götter als innerer Zwang zurück! In dieser Perspektive gewinnt das Bild Reris die Dimension der Innerlichkeit. Oben wurde betont, daß sie durch die Proklamation des Tabus nicht zur Madonnenfigur wird – und schon gar nicht zur romantischen. Dem Tabu in seiner elementaren Form fehlt das dafür nötige Potential einer Differenzierung von Innerem und Äußerem. Erst nachdem Hitu zu Reris innerem nächtlichen Besucher geworden ist, erst nachdem sie den Ruf des Gesetzes verinnerlicht hat, bekommt ihre Liebe Züge einer madonnenhaften Hingabe. Vor allem im Vergleich zu der sinnlich-körperlichen Intensität ihres Tanzes auf der Paradiesesinsel wirkt die Beziehung von Matahi und Reri im zweiten Teil deutlich entsexualisiert.37 Nur in ihrem Versuch, den Tanz unter den Bedingungen der Zivilisation zu wiederholen, blitzt noch etwas von dieser erotischen Energie auf. Ansonsten sehen wir nur noch beschützend-tröstende Berührungen der Liebenden. Dabei wird das Bild Reris nicht nur ins madonnenhafte gewendet, sie nimmt, wie manche Frauengestalten des deutschen Stummfi lms,38 zugleich christologische Züge an. In kreuzförmiger Körperhaltung stellt sie sich vor den schlafenden Matahi, um ihn vor Hitus Speer zu schützen, und vollzieht aus dieser Haltung heraus die Geste, mit der sie Hitu zu verstehen gibt, daß sie bereit ist, sich zu opfern, um Matahis Leben zu retten. Doch was die Wirkung des stellvertretenden Opfers betriff t, so ist Tabu das deutlich negativere Gegenstück zu Murnaus früheren Filmen. Während Ellens Hingabe an den Vampir die Stadt von der Pest befreit, Faust und Gretchen im gemeinsamen Tod Erlösung finden, ist der Tod von Reri und Matahi
37. Was für Murnaus Paare nicht ungewöhnlich ist. So läßt uns wenig daran zweifeln, daß in Nosferatu die Ehefrau Ellen für die doch eigentlich reinen Jungfrauen zugedachte Funktion geeignet ist, sich dem Vampir als Opfer hinzugeben. Und neben der zur Madonna mit Kind stilisierten Frau im Schlußbild von Sunrise steht der Mann in der Position des Josef. 38. Man denke an das Bild Marias vor den Kreuzen in Langs Metropolis.
168
Eine Außenansicht der Innerlichkeit
gar kein gemeinsamer mehr39 und führt zu keiner Erlösung. Zwar sterben beide füreinander, aber sie wissen nicht nur nicht von ihrem Sterben, sie haben ihr Füreinander-Sterben jeder für sich und ohne Kommunikation miteinander auf sich genommen.
V. Bei der Beantwortung der am Anfang gestellten Fragen nach der Realität, von der Tabu handelt, und danach, ob der Film in irgendeiner der vorgeschlagenen Bedeutungen als dokumentarisch bezeichnet werden kann, müssen diese Positionierung im Werk Murnaus und die Art, wie dieses Werk auf Stimmungsumschwünge der zeitgenössischen Gesellschaft reagiert, in Betracht gezogen werden. Dann ließe sich auf der Basis der vorstehenden Analysen folgende Antwort formulieren: Was das zentrale Thema betriff t, handelt es sich definitiv nicht um eine Dokumentation von Problemkonstellationen der polynesischen Gesellschaft um 1930. Das Tabu ist ein Konstrukt, das Murnau auf der Basis einer Idee von Flaherty verfertigt, die dieser selbst schon in verschiedenen Ethnien angesiedelt hatte, wobei Murnau – wahrscheinlich ohne davon zu wissen – Themenkreise berührt, die auch in der zeitgenössischen Psychoanalyse unterschiedlicher Schulrichtungen und in der Ethnologie diskutiert wurden. Das Konzept ›Tabu‹ wird als ein Label für etwas von den westlichen Sprechern in der Tiefe ihrer Zivilisation Vermutetes verwendet, so wie der Kolonialpolizist das Schild »Tabu« verwendet, um vor dem Hai in der Tiefe zu warnen. Das Tabu wird in Tabu von Anfang an nicht so verstanden, wie in der polynesischen Religion, wo es eine objektive Kraft bedeutet. Das Tabu über Reri wird wie ein Verbot eingeführt und zwar in Schriftform. Ein schriftlich proklamiertes Verbot wirkt aber nicht als subjekt-unabhängige Kraft, da es zunächst einmal des interpretierenden Lesers bedarf und außerdem von dem Willen abhängt, es zu befolgen, der unter Umständen durch äußere Sanktionen erzwungen werden muß. Das Tabu ähnelt hier also viel mehr dem Gesetz im europäischen Verständnis. In zweiten Teil wirkt das Tabu dann sehr wohl selbst zwanghaft, aber dieser Zwang ist nicht naturhaft, sondern resultiert aus der Verinnerlichung des Verbotes, aus einem kulturellen Prozeß. Tabu könnte als ein Dokumentarfi lm über das Unbehagen an der eigenen Kultur bezeichnet werden. Weil das, was das Paradies – von dem der erste Teil scheinbar handelt – von außen bedroht, im zweiten Teil mit dem identifiziert wird, was als innere Dämonie in die Zivilisation einbricht, wird in der 39. Verleitet durch ihren an sich sehr anregenden Versuch, Matahi und Reri mit Tristan und Isolde von Wagner zu vergleichen, deutet Jo Leslie Collier das Ende von Matahi und Reri als gemeinsamen Liebestod, da sie nun im Wasser vereint seien. Vgl. J.L. Collier: From Wagner to Murnau, S. 129f. Schon das stimmt aber nicht. Reri befindet sich im Rumpf des Bootes, der, die Schachtel aufgreifend, Unzugänglichkeit symbolisiert. Und mit diesem Boot überführt Hitu sie in ein fernes Land.
169
Wolfgang Kasprzik
Rückschau das Bild des Paradieses als Produkt des melancholischen Rückblicks aus der Zivilisation verständlich. Murnau zeigt seinen Zeitgenossen ein Paradies vor aller Spaltung und zugleich zeigt er ihnen, welcher Spaltung sich dieser Blick auf das Paradies verdankt. Dazu sei noch einmal an die Möglichkeit der doppelten Klammerung erinnert: Wirklich paradiesisch wäre nur eine Welt, die auch frei ist von den Zwängen der alten Gesetze und Tabus. Aktuell fühlt man sich aber gerade vom Verlust der alten Bindungen bedroht und empfindet die Moderne als Vertreibung aus dem Paradies. Dies entspricht einer weit verbreiteten Stimmungslage der Weimarer Zeit. Die neue Gesellschaftsordnung, wesentlich durch die gesteigerte Ausdifferenzierung der Geldwirtschaft gekennzeichnet, wurde selbst wieder in religiösen Kategorien gedeutet und als dämonisch erlebt, das eigene Unbehagen als Gefühl der Verschuldung gegenüber den alten Gottheiten verinnerlicht und die Frage aufgeworfen, ob Opfer an der Zeit seien. Diese Konstellation generiert, quasi als Blick in den Rückspiegel, verschiedenste Zurück-zur-Natur-Bewegungen und das Bild eines Paradieses vor den Schmerzen der Modernisierung, eines Paradieses freilich, das nicht davor gefeit ist, durch expressionistische Rufer, die schon mehr zu sehen beanspruchen als der Rest der Menschheit, in eschatologische Erregung versetzt zu werden. Sieht man Murnaus Film als ganzen, ohne die Bilder des Anfangs zu isolieren, so zeigt sich, daß die Bedingungen, unter denen es zu diesem in sich gebrochenen Sehnsuchtsblick auf ferne Paradiese kommt, derart präzis offengelegt sind, daß von einer Verklärung der Südseewirklichkeit bei ihm sehr viel weniger die Rede sein kann, als bei vielen sich dokumentarisch gebenden ›Kulturfi lmen‹. Dieser Film ist eine Projektion, aber keine naive Projektion. Murnau ist sich des Konstruktcharakters des Tabus in Tabu bewußt. Und er macht ihn bewußt. Durch die Parallelführung einer äußeren und einer inneren Gegenwart des Verbotes im ersten und im zweiten Teil des Films gelingt es ihm, eine Form für das Bild von etwas Unsichtbarem zu finden: der Film zeigt den Prozeß der Internalisierung, der Verwandlung einer äußeren Kolonisierung in eine innere, bei der der Gesetzgeber in der Tagwelt unsichtbar bleiben kann. Von daher wäre Eric Rohmers Kennzeichnung des Murnauschen Stils als »transzendental«, wobei er sich besonders auf Tabu bezieht, eine weitere Bedeutungskomponente abzugewinnen. Rohmer meinte damit eine »kinematographische Reflexion«, durch die fi lmische Bilder ohne den Umweg eines anekdotischen Rückbezugs auf ihre Herstellung gleichzeitig offenlegen, »was Kino ist« und »was die Welt ist«. 40 Assenka Oksilof hat, ohne sich auf Rohmer explizit zu beziehen, diesen Gedanken weitergeführt und spezifischer auf das Thema von Tabu bezogen. 41 Murnau habe in Gestalt die40. Eric Rohmer: »Was denkt Eric Rohmer zu Murnau. Gespräch mit Frieda Grafe und Enno Patalas«, in: Friedrich Wilhelm Murnau (= Reihe Film 43, hg.v. Peter W. Jansen u. Wolfram Schütte in Zusammenarbeit mit der Stiftung Deutsche Kinemathek), München, Wien: Carl Hanser 1990, S. 71-106, hier S. 91f. 41. »Rather, the ›primitive‹ as a constructed cultural referent in Tabu, I would argue, functions as a signifier pointing to another imagined referent, that of the
170
Eine Außenansicht der Innerlichkeit
ses Films, der bewußt als Stummfi lm realisiert sei, den »mutual glance«, das ursprüngliche Sich-Begegnen der Blicke, das die vormoderne Kultur kennzeichne, als Modus des Films – und insofern als Modus gerade eines für die moderne Massenkultur charakteristischen Mediums – zurückzugewinnen versucht. 42 Die vorstehende Analyse von Tabu versuchte, noch einen Schritt weiter zu gehen. Nicht nur das Bild im visuellen Sinne, nicht nur die Blicke im Film und die Blicke des Zuschauers im Kino auf den Film, werden hier reflexiv konstruiert. Auch auf der inhaltlichen Ebene wird mit der Geschichte der Verinnerlichung des Gesetzes die Bedingtheit eines Rückblicks auf das Paradies und den Verlust des Paradieses gezeigt und offengelegt.
history and act of filmmaking itself.«, Assenka Oksiloff: Picturing the Primitive. Visual Culture, Ethnography, and Early German Cinema, New York: Palgrave 2001, S. 166. 42. Vgl. ebd., S. 176f.
171
M und die Ordnungen des Films Philipp A. Ostrowicz
1. Der Film als Medium In dem Interview »Le Dinosaure et le Bébé« von 1967 fragt Jean-Luc Godard Fritz Lang, welcher seiner Filme »bleiben« wird. Beide sind sich einig: M1. Es folgt keine weitere Nachfrage von Godard.2 Doch was macht die besondere Bedeutung von M aus? Fritz Lang selbst spricht mit Bezug auf M von einem »documentaire«3, an anderer Stelle weist er darauf hin, daß selbst die von der Kritik oft als »romantisch« bezeichneten Szenen, beispielsweise in der Bettlerbörse, der Wirklichkeit nachempfunden seien, wenngleich sie natürlich durchaus auch als von Brechts Dreigroschenoper inspiriert gelten können. 4 Lang betont dabei, ihn interessiere vor allem die Frage der Beweggründe des Menschen für sein Tun, »what makes him tick«5. Es scheint bemerkenswert, daß Lang vor allem den Realitätsbezug seines Films bei seinen Äußerungen zu M ins Zentrum stellt. Anton Kaes rekonstruiert in seiner Studie zu M den zeithistorischen Hintergrund der Entstehung des Films und seine historischen Bezüge.6 Er geht dabei vor allem auch auf die Verbindung zwischen einer im Entstehen be1. M. Eine Stadt sucht einen Mörder, Deutschland 1931, Regie: Fritz Lang, DVD: restaurierte Fassung, Universum Film, BRD 2002 (= Ufa Klassiker Edition). 2. Das Interview »Le Dinosaure et Le Bébé« von 1967 ist aus der Reihe Cinéastes de notre temps, die seit 1964 von Janin Bazin und André S. Labarthe produziert wurde. Die Diskussion ist in der Compilation Godard Encore enthalten (= Jean-Luc Godard Collection, Vol. 1, DVD: Optimum, UK 2007). Das gesamte Interview ist mit Szenen aus M unterlegt. 3. Vgl. J.-L. Godard: Le Dinosaure, 0:19:40-0:19:50 und auch Gero Gandert: Fritz Lang über M, in: Fritz Lang: M. Protokoll. Mit einem Interview des Regisseurs von Gero Gandert (= Cinemathek 3), Hamburg: Marion von Schröder 1963, S. 123128, hier S. 125. 4. Vgl. ebd. 5. Ebd., S. 123. 6. Vgl. Anton Kaes: M, London: BFI Publishing 1999, S. 26ff.
173
Philipp A. Ostrowicz
griffenen Massenpresse und verschiedenen Serienmorden ein, die zur Zeit der Entstehung des Films Deutschland erschütterten. Noch heute bekannt ist der Hannoveraner Serienmörder Haarmann, auf den sich auch der Abzählreim am Anfang des Films bezieht. Daneben steht Peter Kürten, genannt der »Vampir von Düsseldorf«, der insgesamt zwischen Winter 1929 und Frühjahr 1930 neun Morde verübte und im Mai 1930 verhaftet und verurteilt wurde, Pate für Langs Film.7 Kürten wurde durch das Fallbeil hingerichtet. Lang selbst wies darauf hin, daß er diese Ereignisse als »aufmerksamer Zeitungsleser« verfolgte. In Breslau ereignete sich zeitgleich eine Verbrechensserie an Kindern, die nie aufgeklärt wurde.8 Diese Verbrechen und die anhängigen Prozesse wurden von einer breiten Öffentlichkeit in ganz Deutschland verfolgt. Besonders im Fall Kürten berichtete die Presse in Berlin derart reißerisch über die Morde, daß das Publikum den Eindruck gewinnen konnte, daß die Morde vor der eigenen Haustür geschahen.9 Ein Berliner Kommissar, der als Vorbild für Lohmann gelten kann, hatte damals die Ermittlungen in Düsseldorf übernommen. Kürten sagte aus, er habe die Morde begangen, da er in der Zeitung über den britischen Massenmörder Jack the Ripper gelesen und ähnlich berühmt habe werden wollen.10 In der Zeit der polizeilichen Ermittlungen gingen über 200 Selbstanzeigen und Briefe bei der Polizei und der Presse von Menschen ein, die sich selbst der Morde bezichtigten und so durch die Presse bekannt werden wollten. Auch Kürten hatte einen Brief an die Polizei geschrieben, der aber ignoriert wurde. Wie Beckert in Langs Film sandte Kürten den Brief dann an eine Tageszeitung, Kopien wurden in allen großen deutschen Zeitungen veröffentlicht.11 Langs Film hatte ursprünglich eine Szene enthalten, in der Kommissar Lohmann mit einem Bürger aus Dresden telephoniert, der erklärt, er sei der Mörder, was aber deutlich nicht der Wahrheit entsprechen konnte. Diese Szene fehlt heute oder wurde von Lang selbst in der endgültigen Version entfernt.12 In Deutschland entstand eine Art Serienmord-Hysterie. Die Presse beeinflußte in einem hohen Maße die Faszination vom Verbrechen und vom Mord. Die Suche nach Kürten war eines der ersten großen Medienspektakel in Deutschland. Und auch die Mörder selbst wiederum wurden durch die Presse inspiriert und bezogen sich auf sie. Langs Film handelt auch von diesen Medienspektakeln. Der gellende Ruf »Extraaaa-Ausgaaaabe!« kündigt einen neuen Mord an, dieses Mal an der kleinen Elsie. Anschläge auf Litfaßsäulen (die Mitte des 19. Jahrhunderts in Berlin als Werbemittel erfunden wurden) loben eine Belohnung von 10.000 7. Vgl G. Gandert: Fritz Lang, S. 124. 8. Ebd. 9. Vgl. zum Kürten-Komplex: Elisabeth Lenk/Katharina Kaever (Hg.): Peter Kür-
ten, genannt der Vampir von Düsseldorf, Frankfurt a.M.: Eichborn 1997. In diesem Band sind zahlreiche Dokumente zum Fall Kürten abgedruckt. 10. Vgl. die Vernehmungsprotokolle bei E. Lenk/K. Kaever: Peter Kürten. 11. Ein Brief an die Freiheit (Düsseldorf) ist abgedruckt bei E. Lenk/K Kaever: Peter Kürten, S. 35. 12. Diese Szene wird wiedergegeben bei A. Kaes: M, S. 81f.
174
M und die Ordnungen des Films
Mark für die Ergreifung des Mörders aus. Auch die Mutter von Elsie ist Rezipientin der Massenmedien. Während sie auf ihre Tochter Elsie wartet, die sich auf dem Schulweg anscheinend verspätet hat, klingelt es an der Tür. ›Das muß endlich Elsie sein.‹ Als Frau Beckmann öffnet, ist es Herr Gehrke, der ihr die neueste Folge einer Krimiserie mit den – im Kontrast zum angepriesenen literarischen Thrill – sehr gelangweilten Worten übergibt: »Die neue Fortsetzung, Frau Beckmann. Spannend, aufregend, sensationell«. Frau Beckmann zahlt und nimmt das Heft entgegen. Der Mord, der in der – fi lmischen – Realität stattfindet, ist in der Fiktion der Kriminalfortsetzungsgeschichte bereits vollzogen und thematisiert. Langs Film exemplifiziert so selbst eine Grundregel des Fortsetzungsromans. Am Beginn einer Geschichte steht ein Mord, um mehrere Fortsetzungen zu ermöglichen, muß die Aufklärung des Mordes immer wieder spannend verzögert werden; so auch in M. Auch Elsies Mörder schreibt zunächst an die Polizei, um sich selbst des Mordes zu bezichtigen. Da dieser Brief geheim gehalten wird, wendet er sich direkt an die Presse, der Brief wird prompt veröffentlicht. Er schließt mit den Worten: »Ich bin noch nicht am Ende«. Bereits zu Beginn des Films, in der Exposition, wird deutlich, wie sehr sich M auf mediale Phänomene und damit auch auf sich selbst bezieht. Elsies Mutter hat hierbei eine Doppelrolle inne. Zum einen ist sie selbst eine Rezipientin der Medien, zum anderen ist sie deren Gegenstand in Langs Film. Dabei geht Lang weit über das, was er selbst »documentaire« nennt, hinaus. Die herausragende Bedeutung von Langs Film liegt nicht in einer realistisch erzählten Kriminalgeschichte, sondern vielmehr in der Exemplifizierung fi lmischer Mittel und der Etablierung von fi lmischen Ordnungssystemen auf diskursiver Ebene. Die folgende Analyse will daher die unterschiedlichen Ordnungsstrukturen, mit denen der Film arbeitet, in den Blick nehmen, um so die Funktionsweise von M als Film – auch jenseits des erzählten Kriminalfalls – zu verdeutlichen.
2. Ordnung von Ton und Bild : Der blinde ›Seher‹ Fast emblematisch für die filmische Umsetzung von M kann der Bettler gelten, der den Mörder Beckert überführt. Er ist blind und erkennt den Mörder nur an der Melodie, die dieser pfeift, wenn er ein neues Opfer verfolgt. Die gepfi ffene Melodie aus Griegs Peer Gynt Suite (»In der Halle des Bergkönigs«)13 fungiert als musikalisches Leitmotiv, das verschiedene Funktionen hat. Zunächst kündigt das Motiv jeweils einen neuen Mord bzw. den Ausbruch ›des Triebes‹ bei Beckert an. Griegs Textvorlage ist Henrik Ibsens dramatisches Gedicht Peer Gynt und über diesen Verweis verzweigen sich auch die Verweisungen durch das Motiv. Der Verweis auf das Drama von Henrik Ibsen funktioniert hierbei in doppelter Hinsicht: Peer Gynt kann als Verfolgter seines unsteten Charakters und seines Hanges zur Lüge begriffen werden. Er 13. Lang selbst soll die Melodie gepfiffen haben. Vgl. Patrick McGilligan: Fritz Lang. The Nature of the Beast, New York: St. Martin’s Press 1997, S. 155f.
175
Philipp A. Ostrowicz
befindet sich selbst in stetiger Bewegung. Im zweiten Akt befindet er sich im Palast des Dovregreis, des Königs der Trolle, dessen Tochter er heiraten möchte. Der Dovregreis macht seine Zustimmung zur Heirat davon abhängig, daß sich Peer in einen Troll verwandeln läßt. Peer ist entsetzt und vergleicht die Trolle mit Tieren. Ihm soll zur Verwandlung das rechte Auge ausgestochen und das linke zu einem Schlitz verengt werden, »und niemals mehr siehst du was ungenau«.14 Peer wehrt sich gegen die Verwandlung, die unumkehrbar ist und flieht vor den Trollen. Er ist Opfer seines eignen überzogenen Anspruches, die Tochter des Königs der Trolle zu heiraten und wird so zum von den Trollen Verfolgten. Lang greift dieses Thema auf und zeichnet die Figur Bekkert in seiner Funktion als Mörder ähnlich doppelt: Zum einen ist er Verfolger immer neuer Opfer, zum anderen wird er zum Opfer seines Triebes sowie von Polizei und Unterwelt. Das Tribunal in der alten Schnapsfabrik wirkt wie eine andere Welt im Gegensatz zu den klaren Linien der gezeigten Großstadt und kann als Analogon zur Halle des Bergkönigs gesehen werden. Beckert soll sich dem Tribunal und ihrem Vorsitzendem, dem Schränker, unterwerfen, er kann sich im Gegensatz zu Peer aber nicht mehr aus eigener Kraft befreien. Beckert greift in seiner Verteidigungsrede das Thema der Verfolgung auf: »Immer… immer muß ich durch Straßen gehen… Und immer spür’ ich, es ist einer hinter mir her…: Das bin ich selber! Und verfolgt mich… lautlos… aber ich hör es doch… Ja! Manchmal ist mir,… als ob ich selber… hinter mir herliefe!« Er ist in seiner eigenen Doppelstruktur gefangen, wird selbst zu seinem eigenen Verfolger.15 Gleichzeitig werden auch die von ihm getöteten Kinder zu Verfolgern: »Und mit mir rennen die Gespenster von Mütter… von Kindern… Die geh’n nie mehr weg… Die sind immer da!« Auch hier findet sich eine ähnliche Doppelstruktur von Verfolgung und Verfolgtwerden. Die gepfi ffene Melodie steht prototypisch für die Funktion des Tones bei Lang. Die Linearität der Handlung wird durch den Ton aufgebrochen und die Bedeutungsebenen erweitert. Beckert wird durch einen Blinden ›erkannt‹. Dieser kann nur durch seine auditive Sensibilisierung den Mörder überführen. Der Ton in M ist damit unabdingbar, er wird als für die Ergreifung des Mörders zwingend notwendig präsentiert. M ist Langs erster Tonfi lm.16 Er setzte sich eingehend mit den neuen Möglichkeiten des Tons auseinander,17 bereits mit diesem Film setzt er Standards, auf die später immer wieder zurückgegriffen und verwiesen wird. In ihrem 1928 erschienenen Manifest zum Tonfilm weisen Sergej M. Eisenstein, Wsewolod I. Pudowkin und Grigorij W. Alexandrow darauf hin, daß die Erfindung des Tons für den Film eine »zweischneidige 14. Vgl. Henrik Ibsen: Peer Gynt. Ein dramatisches Gedicht, mit einem Nachwort v. Ruprecht Volz, Stuttgart: Reclam 2008, S. 42. 15. Gerald Bär weist darüber hinaus auch auf die Doppelstruktur von bravem Bürger und Mörder hin, die sich in Beckert ausdrückt. Vgl. Gerald Bär: Das Motiv des Doppelgängers als Spaltungsphantasie in der Literatur und im deutschen Stummfilm, Amsterdam, New York: Rodopi 2005, S. 597-600. 16. Vgl. G. Gandert: Fritz Lang, S. 125. 17. Vgl. ebd., S. 126.
176
M und die Ordnungen des Films
Erfindung« sei.18 Ton müsse sich zwingend kontrapunktisch zum visuellen Montage-Stück verhalten, wenn er nicht nur überflüssig und ohne tiefere Bedeutung das Bild überlagern wolle. Ton wird also zu einem vollkommen eigenständigen Element, das sowohl aus sich wie aus dem Gegensatz zum Bild Bedeutung generiert. Eisenstein, Pudowkin und Alexandrow warnen vor einer »naturalistischen« Verwendung des Tons, die nur der Erzeugung einer banalen Illusion von Wirklichkeit dient.19 Daß ein Blinder – also jemand, der nicht in der Lage ist, Bilder wahrzunehmen – den Mörder überführt, kann als fi ktionsironisch gewertet werden, ist aber gleichzeitig auch Betonung der Wichtigkeit des Tones, der auch hier das Bild auf einer eigenen Ebene ergänzt. Die Ton-Wahrnehmung wird schließlich für die Welt in eine visuelle übertragen, als ein anderer Bettler Beckert ein großes M aus Kreide auf die Schulter drückt, um ihn so auch für die anderen ›Sehenden‹ zu markieren. Fritz Lang setzt die Vorgaben des Manifests zum Tonfilm in M insofern um, als der Ton als eigenständiges kompositorisches Element fungiert. Der Film beginnt ohne Titelmusik – schwarze Leinwand, ein Uhrschlag, dann setzt eine Kinderstimme ein: »Warte, warte nur ein Weilchen, bald kommt der schwarze Mann zu dir, mit dem kleinen Hackebeilchen macht er Schabefleisch aus dir«20, erst dann wird aufgeblendet. Wir sehen Kinder aus erhöhter Kameraperspektive, die im Kreis einen Abzählreim aufsagen. Wie eine Uhr, um deren Mittelpunkt sich der Zeiger bewegt, dreht sich das Kind in der Mitte und zeigt nacheinander auf jedes einzelne Kind. Die Kamera schwenkt nach oben auf einen Balkon, von wo aus Einspruch gegen das Kinderspiel von einer der Mütter ertönt, dann sehen wir den leeren Balkon, der Abzählreim wird weiterhin aufgesagt. Bild und Text sind nicht miteinander verbunden. Der Abzählreim fungiert als eine Art Warnung aus dem Off. Das Spiel der Kinder deutet auf den Mord an Elsie voraus, der leere Balkon visualisiert des Fehlen von Überwachung und den damit verbundenen Schutz, was auch Elsie zum Verhängnis wird. Wenig später ruft Elsies Mutter verzweifelt nach ihrer Tochter, die nach der Schule nicht nach Hause kommt. Während der gellende Schrei »Elsie« ertönt, sehen die Zuschauer nur das leere Treppenhaus von oben, dann das leere Dachgeschoß, Elsies leeren Platz am Mittagstisch. Schnitt. In vollkommener Stille rollt ein verlorener Ball auf eine Wiese, 18. Sergej M. Eisenstein, Wsewolod I. Pudowkin u. Grigorij W. Alexandrow: »Manifest zum Tonfilm«, in: Franz-Josef Albersmeier (Hg.), Texte zur Theorie des Films, Stuttgart: Reclam 1990, S. 42-45, hier: S. 43. 19. Genau diese naturalistische Verwendung des Tons hat sich im Film der Gegenwart durchgesetzt. 20. Dieser Abzählreim war nach dem Schlager von Walter Kollo (»Warte, warte nur ein Weilchen, bald kommt auch das Glück zu Dir«) entstanden. Bezugspunkt war der Fall Haarmann in Hannover. Vgl. hierzu Thomas Kailer: »Werwölfe, Triebtäter, minderwertige Psychopathen. Bedingungen von Wissenspopularisierung: Der Fall Haarmann«, in: Carsten Kretschmann (Hg.), Wissenspopularisierung: Konzepte der Wissensverbreitung im Wandel, Berlin: Akademie 2003, S. 323-360, hier S. 337f.
177
Philipp A. Ostrowicz
ein Luftballon in Menschform bleibt zwischen Telegraphendrähten hängen. Abblende. Es ertönt eine aggressive Stimme: »Extra-Ausgabe«. Immer wieder und schneller wird dies wiederholt. Erst bei der vierten Wiederholung wird aufgeblendet, eine Straßenszenerie erscheint, Zeitungsverkäufer bieten ihre »Extra-Ausgaben« an. Der Zuschauer weiß allerdings schon, was geschehen ist. Der Ton eröffnet durch seinen Kontrast zum Bekannten eine zweite Erzählebene als Erweiterung der Inszenierung und lädt die Bilder mit zusätzlicher Bedeutung auf. Der Abzählreim der Kinder deutet auf das grausame Verbrechen voraus – nur sein Rhythmus bestimmt, wer als nächstes draußen ist. Beckerts Opfer werden von ihm nicht nach rationalen Kriterien ausgewählt, die Morde sind nicht Folge einer kausalen Handlung, sondern an den Ausbruch und Anspruch des Triebes gekoppelt. Beckert schlägt auf der Straße zu, wie im Abzählreim triff t es ein Individuum, das sich in der Gruppe der möglichen Mordopfer, nämlich der Kinder, befunden hat. Ton funktioniert bei Lang dabei auch als strukturierendes Element, das Ordnung ermöglicht. Das Voice-over hat die Funktion, die sehr schnelle Szenenabfolge in größere inhaltliche Abschnitte zu gliedern. Das Telephongespräch zwischen Minister und Polizeipräsident bildet eine Art Rahmenhandlung, in welche die Aufzählung der Ermittlungstechniken der Polizei – graphologische Analyse, Fingerabdrücke, Rasterfahndung – als kurze Einzelszenen eingebettet sind. Diese Szenen sind nur durch den Ton – das Telephongespräch – zusammengehalten. Ebenso fungiert innerhalb dieser kurzen Szenen der Ton wieder als Verbindungsglied, so z.B. wenn die graphologische Analyse durch die Darstellung des Mörders, der sich im Spiegel betrachtet, unterbrochen wird, der Ton aber weiterläuft. Während der Graphologe bei der Schrift von »Ausdruck einer Schauspielerei« spricht, zieht der Mörder vor dem Spiegel verschiedene Fratzen. Allein der Ton verbindet die beiden Szenen miteinander und nicht die Kausalität der Handlung. Wiederum ist nicht die chronologisch verlaufende Handlung zentral, sondern vielmehr stehen die Mittel des Films im Zentrum. Fast hämisch kommentiert hier die Bildebene den Ton. Ähnlich verknüpft sind auch die Parallelszenen zwischen der Polizei und den Ring-Vereinen, in denen die Verfolgung des Mörders diskutiert wird. Die Dialoge greifen hier ineinander, Lang montiert die Szenen als Match-Cut und verstärkt dies durch eine Überlappung im Ton. Es scheint, als führten die Polizeiangehörigen direkt mit den Verbrechern einen Dialog über die Möglichkeiten zur Ergreifung des Mörders. Gleichzeitig arbeitet der Film in vielen Passagen noch stark, sogar potenziert mit den Mitteln des Stummfi lms. Lang verzichtet völlig auf Umgebungsgeräusche oder untermalende Musik. Dies erscheint in der Szene vor der Durchsuchung durch die Polizei artifiziell. Das Vorfahren der Lastwagen, das Absteigen der Polizisten geschieht vollkommen ohne Ton, erst dann ertönt ein schriller Pfi ff, der die Durchsuchung einleitet, und der Schreckensruf einer Frau: »Die Bullen!«. Erst beim Eintreten der Polizei in die Kellerkneipe werden auch wieder Umgebungsgeräusche hörbar. Auch in anderen Fällen wird der Ton extrem ›perspektiviert‹ oder 178
M und die Ordnungen des Films
›fokussiert‹21, d.h. der Zuschauer nimmt den Ton des Filmes mit den Ohren seiner Protagonisten wahr: Als Beckert durch die Stadt streift – in Parallelmontage werden die Durchsuchungsszenen in seiner Wohnung gezeigt – hört man zunächst das Straßengeräusch. Als Beckert vor einem Laden mit Messern in der Auslage stehen bleibt, wird er aus dem Geschäft heraus in den Blick genommen, d.h. durch die Glasscheibe, alle Geräusche verstummen. Beckert betrachtet die Messer und entdeckt in einem Spiegel ein kleines Mädchen. Seine ganze Aufmerksamkeit wird vom Mädchen absorbiert, er folgt ihm und beginnt, das Peer-Gynt-Motiv zu pfeifen. Straßengeräusche hören wir nur kurz, ganz vereinzelt, sie dringen nicht an sein Ohr und so hört der Zuschauer auch die Geräuschkulisse nicht mehr, er sieht mit Beckerts Augen und hört mit Beckerts Ohren, ist eingeschworen auf dessen triebgesteuerte Wahrnehmung. Durch die gezielte Fokussierung und seine Aufmerksamkeit für das Mädchen werden die Geräusche ausgeblendet. Auch an dieser Stelle wird das Thema der Doppelgestalt von Verfolgtem und Verfolger wieder aufgenommen. Wieder verweist das Peer-Gynt-Motiv darauf, daß Beckert einerseits zwar das Mädchen verfolgt, andererseits aber auch Verfolgter seines Triebes ist, was zusätzlich visuell umgesetzt wird. Während Beckert die Messer im Schaufenster betrachtet, weisen diese – rhombisch angeordnet – in der Spiegelung im Schaufenster zunächst auf das Mädchen als mögliches Mordopfer und von Beckert Verfolgte und dann, nachdem er das Mädchen entdeckt hat, eben auch auf den Verfolger Beckert, der seinem Trieb erliegt. Er folgt dem Mädchen, das schließlich auf seine Mutter triff t. Die Situation wird aufgelöst, Beckert kann sich ihr nicht weiter nähern. Aufgekratzt pfeift er weiter und nimmt in einem Straßencafé hinter einem bewachsenen Rankengitter Platz. Keine Straßengeräusche sind zu hören. Beckert ist enttäuscht, gleichzeitig erregt, er bestellt Cognac und pfeift. »Ich fand zum Beispiel, daß ich, wenn ich allein in einem Straßencafé sitze, natürlich das Geräusch der Straße höre, daß aber im Augenblick, wo ich mich mit einem Gesprächspartner in ein interessantes Gespräch vertiefe oder eine Zeitung lese, die mein Interesse völlig in Anspruch nimmt, mein Gehirn, oder wenn Sie wollen, meine Gehörorgane dieses Geräusch nicht mehr registrieren. Ergo: Die Berechtigung, eine solche Konversation filmisch darzustellen, ohne besagtes Straßengeräusch dem Dialog zu unterlegen.«22
Dies schreibt Lang zu seinem Tonkonzept, das in M nicht nur bezüglich Bekkert konsequent umgesetzt ist. So hört ein Bettler, während er eine Berliner Weiße trinkt, eine Drehorgel, die von jemandem miserabel gespielt wird, und hält sich vor Schreck die Ohren zu. Die Drehorgel verstummt. Nach einem Augenblick nimmt der Bettler die Hände von den Ohren und die Musik, dieses Mal melodischer, erklingt wieder. Der Zuschauer müßte, obwohl sich der Bett21. Diese Übertragung visueller Begriffe in den Bereich des Hörens scheint hier angebracht, da Mittel der Kameraführung auf den Ton übertragen werden. 22. Vgl. G. Gandert: Fritz Lang, S. 126.
179
Philipp A. Ostrowicz
ler zwischenzeitlich die Ohren zuhält, die Musik weiterhin hören. Da er aber auch hier mit den Ohren der Figur hört, verstummt eben auch die Musik.23
3. Macht volle Ordnungssysteme – Systeme der Ordnung? Die Polizei und die Ring-Vereine In M werden zwei Gruppen gegenübergestellt und miteinander verschmolzen, die eigentlich Antipoden sind. Lang setzt der Arbeit der Polizei das Vorgehen der sogenannten »Ring-Vereine«24 entgegen. Die Polizei als staatliches Organ zur Herstellung der Sicherheit und Ordnung scheint nicht in der Lage zu sein, diese Aufgabe zu erfüllen. Kurz bevor Elsie entführt wird, ist es ein Polizist, der sie über die Straße geleitet. An diesem Punkt kann Elsie zwar vor dem Straßenverkehr geschützt werden, nicht aber vor ihrem Mörder. Die Methoden der Polizei sind gekennzeichnet durch ihr klassisches kriminalistisches Vorgehen, aber auch durch neue Methoden wie Graphologie und Fingerabdruckanalyse.25 Informationen werden – gerade von Kommissar Lohmann – über das Telephon weitergegeben. Lang bezieht sich damit explizit auf den technischen Fortschritt des 20. Jahrhunderts. Der Titel des Films M kann auch als Chiffre für ›Moderne‹ gelesen werden. In der Polizeistation befinden sich auf dem Schrank noch drei Petroleum-Leuchten, die inzwischen technisch überholt sind und durch moderne Lampen, die mit elektrischem Strom betrieben werden, ersetzt wurden, das 19. Jh. ist also materiell noch anwesend. Elsies Mutter ist Wäscherin. Sie wäscht auf einem Waschbrett in einem Holztrog, in ihrer Küche hängt eine mechanische Kuckucksuhr, das Essen wird auf einem Kohleherd gekocht. Die Medien allerdings schlagen eine Brücke aus ihrem materialen Leben, das noch im 19. Jh. verwurzelt scheint, in die Moderne des 20. Jahrhunderts. Gleichzeitig verweist Lang auch auf die Brüchigkeit der sogenannten Moderne. Die Polizei arbeitet nach systematischen – aber eben auch bürokratischen und damit langwierigen – Methoden. Sie versucht, den Mörder anhand von Indizien bei verübten Verbrechen zu finden.26 Dabei geht sie auch anhand von schriftlichen Aufzeichnungen und mit klassischen Ermittlungsmethoden vor. Auch die Anwesenheit von Uhren 23. An dieser Stelle kann man darüber streiten, wie gelungen dies ist; auch Lang selbst stellt dies infrage. Vgl. ebd., S. 126f. 24. Die sog. Ring-Vereine waren Organisationen von Verbrechern in der Weimarer Republik, zu den alle Arten von Krimiellen gehörten außer den Mördern und den Sexualstraftätern. Es gab ca. 50-60 solcher Vereine, die von der Polizei kaum bekämpft wurden und teilweise soziale oder mäzenatische Funktionen übernahmen. Vgl. zu diesem Komplex Peter Feraru: Muskel-Adolf & Co. Die »Ring-Vereine« und das organisierte Verbrechen in Berlin, Berlin: Argon 1995, bes. Kap. »Eine Stadt sucht ihren Mörder«, S. 157-164. 25. Vgl. hierzu die bereits oben beschriebenen Szenen während des Telephonats zwischen Polizeipräsident und Minister. 26. Lang besuchte während seiner Recherchen, so Thea von Harbous Sekretärin
180
M und die Ordnungen des Films
ist dabei bedeutsam. Zeit fungiert als logisches und strukturierendes Element einer chronologischen Handlung. Auch in seiner Dinghaftigkeit kann das Uhrwerk als Sinnbild einer nach Rationalität funktionierenden Gesellschaft gelesen werden. Die Polizei und die ›Maschine‹ Großstadt funktionieren nach einem klaren System. Der Mörder Hans Beckert allerdings läßt sich nicht ergreifen, er ist eine Art ›Fehler im System‹, die technischen Fortschritte des 20. Jh. sind also nur bedingt erfolgreich. Während der Besprechung der Polizei wird darauf aufmerksam gemacht, daß die Schwierigkeit eines solchen Verbrechens darin bestünde, daß das Opfer und der Täter nur durch den Zufall verbunden sind, ein Impuls des Mörders kann hierbei einen neuen Mord auslösen. Trotz allen technischen Fortschritts und aller modernen Methoden und der rationalen intelligenten Art Lohmanns ist die Polizei nicht in der Lage, den Mörder dingfest zu machen. Da die Polizei mit ihren Ermittlungsmethoden die ›normalen‹ Verbrecher bei Ihrer ›Arbeit‹ stört – die sich ständig wiederholenden Razzien machen ihnen das Leben schwer – entscheiden sich die Ring-Vereine dazu, den Mörder selbst zu finden, um sich selbst dem Zugriff der Polizei zu entziehen. Die Gegenfigur zu Kommissar Lohmann ist der »Schränker«27, der von Gustav Gründgens dargestellt wird. Er steht den Ring-Vereinen vor. Diese setzen bei ihrem Entschluß, den Mörder zu finden, nicht auf rationale Ermittlungsmethoden, sondern auf Überwachung. Der Zufall, der die Verbrechen Beckerts auslöst, spielt hierbei die entscheidende Rolle. Durch ein dichtes Netz von »Spitzeln« soll ein lückenloses System der Überwachung geschaffen werden, das dem Mörder freie Bewegung und freies Handeln unmöglich macht. Nicht die gezielte Auswertung von Fakten und Beweisen oder Indizien – wie die Polizei sie durchführt –, sondern die Vervielfachung von Beobachtung, bei der etwas Entscheidendes entdeckt werden kann, soll die Ring-Vereine zu ihrem Ziel führen. Der »Zufall« soll damit unmöglich gemacht werden. Dieses System der Überwachung geht über die Ermittlungsarbeit der Polizei, die zwar durch den technischen Fortschritt geprägt ist, weit hinaus. Die Polizei wäre allein personell nicht in der Lage, ein solch dichtes Netz von Überwachung zu schaffen. Die Gegenüberstellung der unterschiedlichen Methoden der Polizei und der Ring-Vereine wird anhand einer Landkarte visualisiert. Zweimal verwendet Lang die gleiche Karte. Während die Karte der Polizei mit einem Zirkel symmetrisch in Kreise eingeteilt wird, ist es bei den Kriminellen die behandschuhte Hand des Schränkers, die er auf die Karte legt, als wolle er den Verbrecher greifen. Die kriminalistischen Methoden der Polizei finden ihr Sinnbild im Zirkel als Ausdruck von Mathematik, Berechnung und System. Diese Methoden sind aber wirkungslos. Im Gegensatz dazu steht die behandschuhte Hand des Schränkers, die nach dem Verbrecher greift, als Zeichen von Gewalt- und Hilde Guttman, u.a. auch die Berliner Polizeidirektion am Alexanderplatz (»Alex«) und Scotland Yard in London. Vgl. dazu P. McGilligan: Fritz Lang, S. 150. 27. Als ›Schränker‹ bezeichnete man einen Verbrecher, der vor allem darauf spezialisiert ist, Panzerschränke zu knacken.
181
Philipp A. Ostrowicz
Machtausübung. Das Überwachungssystem der Ring-Vereine erweist sich schließlich als das effizientere, Beckert wird durch einen blinden Bettler an der gepfi ffenen Melodie des Peer Gynt-Motivs erkannt.
Die beiden Gruppen, Polizei und Ring-Vereine, werden durch die Darstellung ihrer Methoden einander gegenübergestellt. Die durch diese Methoden ausgebildeten Systeme bilden eigene Ordnungen aus. Dabei ist festzustellen, daß die Ring-Vereine in der Lage sind, eine noch effizientere und systematisierte Ordnung herzustellen als die Polizei. Die Bettler erhalten eine Nummer, ihnen werden bestimmte Abschnitte der Stadt zugeteilt, diese Zuordnungen werden in ein Buch eingetragen. Es liegt nahe, diese Vorgehensweise – nach Kracauer – als Sinnbild für das Vorgehen der Nazis in Deutschland zu sehen.28 Der Schränker in seinem langen Ledermantel und mit seinen Handschuhen fungiert dabei als eine Art Proto-Goebbels. Auch die Sprache des Schränkers erinnert an die Sprache der Nationalsozialisten. Über den Mörder sagt er: »Diese Bestie […] muß ausgerottet werden, vertilgt.« Obwohl es sich um ein Individuum handelt, spricht der Schränker davon, den Mörder »auszurotten«. Dies ist jedoch nur mit einer großen Menge an Individuen bzw. Tieren möglich, mit einer gesamten Population. Auch die physiognomischen Ähnlichkeiten mit Joseph Goebbels, der 1927 als Gauleiter der NSDAP für Berlin-Brandenburg nach Berlin kam und 1930 zum Propagandachef der NSDAP ernannt wurde, sind evident. Die Ring-Vereine sind in der Lage, gezielt zu handeln, sich gegen die Polizei durchzusetzen und den Mörder zu stellen. Dies kann insgesamt als Sinnbild für die Gewalt und den Terror der SA und des späteren Hitler-Regimes gelesen werden. Joseph Goebbels hatte sich Langs Film am 21. Mai 1931 angesehen. »Abends mit Magda Film M von Fritz Lang gesehen. Fabelhaft! Gegen die Humanitätsduselei. Für Todesstrafe! Gut gemacht. Lang wird unser Regisseur. Er ist schöpferisch.«29 Goebbels versteht 28. Vgl. Siegfried Kracauer: Von Caligari zu Hitler. Eine psychologische Geschichte des deutschen Films, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1979, bes. S. 225-233. 29. Joseph Goebbels: Eintrag vom 21.5.1931, in: ders., Die Tagebücher, hg.v. Elke Fröhlich, Teil I, Bd. 2/I, München: K.G. Saur 2005, S. 410f.
182
M und die Ordnungen des Films
den Film als Plädoyer für die Todesstrafe. Er soll Lang später sogar angeboten haben, für die Nazis zu arbeiten.30 Goebbels’ Begeisterung für den Film mag auch in der Darstellung des Schränkers begründet gewesen sein, der das neue System von Überwachung und Todesstrafe machtvoll propagiert. Nicht, daß Lang dieses System bewußt bejahen würde oder es kritisch in Frage stellt; dieses System wird im Film lediglich abgebildet. Wenn Kracauer davon spricht, die Filme der Weimarer Republik spiegelten gleichsam die Entwicklung Deutschlands zum Nationalsozialismus, dann kann man in Variation dieser These über M sagen, daß dieser Film ein System darstellt, das durch Überwachung und Gewalt lebt und auch so erfolgreich ist. Dabei wird allerdings durchaus die Ambivalenz der ›romantischen‹ Verbrecherwelt mit ihrer humorvollen Abbildung auf der einen – und der Gewalt, die vom Schränker ausgeht, auf der anderen Seite thematisiert. Gleichzeitig mit der Gegenüberstellung beider Gruppen hinsichtlich ihrer unterschiedlichen Methoden kann man von einer sich abzeichnenden Verschmelzung sprechen. Besonders die Sequenz, in der die Beratungen der Polizei der Versammlung der Führer der Ring-Vereine gegenübergestellt werden, ist dabei von Bedeutung. Beide Gruppen treffen sich, um zu besprechen, wie gegen den Mörder vorgegangen werden kann. Beide Versammlungen sind organisiert und werden vom ranghöchsten Teilnehmer geleitet. Zwar finden beide Veranstaltungen an verschiedenen Orten statt, doch durch die Montage kurzer Dialogszenen, scheint es sich um einen Dialog zwischen beiden Gruppen zu handeln; es ist in manchen Szenen nur noch mühsam feststellbar, ob gerade Polizei oder Ring-Vereine gezeigt werden. So werden z.B. Sätze, die der Schränker beginnt, qua Schnitt vom Polizeipräsidenten beendet. Auf der Bildebene wird dies mit der Übereinstimmung der Gesten beim Sprechen von Schränker und Polizeipräsident unterstrichen. Die Bilder fließen in einem Match-cut, zusätzlich auch durch den Zigarren- und Zigarettenrauch, der die Szenerie verunklart, immer mehr ineinander. Obwohl die Ausgangssituation klar ist (die ›Sitzung‹ der Ring-Vereine wird vergleichsweise ausführlich eingeleitet, ebenso das Eintreffen des Vorsitzenden, des Schränkers), verschwimmen die Gegensätze zwischen beiden Seiten: Es entsteht eine bildliche, tonale, damit auch inhaltliche Unschärfe, die eine klare Abgrenzung zwischen beiden Bereichen unmöglich macht. Die Verwischung der Gegensätze, die Auflösung der Konturen durch die Unschärfe, die Auslöschung der objektiven Begrenzungen läßt auch die beiden Gruppen ineinander fließen. Nicht mehr der klar konturierte (auch moralisch bestimmbare) Gegensatz ist hier entscheidend – auf der einen Seite die Staatsmacht, die Ordnung und Recht zur Durchsetzung verhelfen soll, auf der anderen Seite die Verbrecherwelt, die versucht, Recht und Ordnung zu brechen –, sondern die Vereinigung beider Gruppen steht im Vordergrund. Beide haben ein Ziel: Beckert zu fassen. Damit soll die jeweilige Ordnung wiederhergestellt werden. Damit haben sich die Paradigmen des Gegensatzes zwischen Polizei, d.h. staatlicher 30. Vgl. zu diesem Komplex Werner Gösta: »Fritz Lang and Goebbels: Myth and Facts«, in: Film Quarterly 43/3 (1990), S. 24-27.
183
Philipp A. Ostrowicz
Ordnungsmacht, und der Verbrecherwelt verschoben. Das Verbrechen und damit auch die Verbrecher sind zum Teil der Ordnung der Gesellschaft geworden. Wo das Verbrechen einst als Regelverletzung und als Verstoß gegen die Ordnung verstanden wurde, ist es jetzt Teil dieser Ordnung. Der Hinweis Langs, daß die Szenen der Verbrecherwelt, so z.B. die der Stullenbörse, von Brechts Dreigroschenoper beeinflußt sind, verweist auf den Theater-Charakter, den diese Szenen vermitteln. Der Gegensatz zwischen den klaren Linien der Großstadt – die sich besonders in der Architektur des Bürohauses, in dem sich Beckert vor seinen Verfolgern versteckt, ausdrücken – und den organischen, ›unordentlichen‹ Strukturen in der Kellerkneipe oder der Stullenbörse intendiert einen Gegensatz zwischen einer ›ordentlichen Oberwelt‹ und einer ›unordentlichen Unterwelt‹, die zwar der Vorstellung des Zuschauers entsprechen mag, durch die Darstellung des Ordnungssystems der RingVereine aber bewußt konterkariert wird. Die Welt der Verbrecher ist strukturiert, organisiert, alles ›Unordentliche‹ ist nur noch Kulisse. Zwar findet das Tribunal gegen Beckert am Ende in der Alten Schnapsfabrik statt, die Räumlichkeiten erscheinen dunkel, unklar, organisch, aber inhaltlich folgt das Tribunal den Regeln der ›Oberwelt‹, die Verbrecher folgen den gleichen Regeln, der gleichen Systematik. Die Räumlichkeiten deuten – man denke an den Verweis auf die »Halle des Bergkönigs« in Ibsens Drama – wieder auf ihre eigene Kulissenhaftigkeit hin. Wo die Welt der Verbrecher früher selbst gegen die Gesellschaftsordnung stand, ist sie jetzt Teil dieser und wendet sich gegen Beckert, der jetzt im Gegensatz zur Gesellschaft (die eben aus ›Ober-‹ und ›Unterwelt‹ besteht31) steht. Das eigentliche Ziel, einen Kindermörder zu fassen, um so mögliche Opfer vor dessen Zugriff zu schützen, tritt sowohl bei Polizei wie bei den Ring-Vereinen vollkommen in der Hintergrund. Der Polizei geht es vor allem um die Wiederherstellung der Ruhe in der Bevölkerung, um die Beendigung einer Massenhysterie, um das eigene Renommee und die eigene Arbeitsbelastung. Den Ring-Vereinen geht es primär darum, die Ordnung insoweit wiederherzustellen, daß die Polizei den dauernden Zugriff auf ihre Sphäre wieder beendet. Der Kindermörder verdirbt den Verbrechern das Geschäft und blamiert die Polizei. Aus unterschiedlichen Motiven wird ein Ziel verfolgt, daß nicht mehr an die Wiederherstellung einer ethischen orientierten Ordnung gebunden ist, sondern lediglich von praktischen Interessen gelenkt ist. Am Ende des Filmes kann die Polizei den Tod Beckerts durch die Lynchjustiz der Ring-Vereine nur knapp verhindern. Daß Beckert gefaßt und von der Polizei festgenommen wird, kann dennoch als ›Zusammenarbeit‹ gewertet werden. Es ist kein Zufall, daß sich der Schränker in der Uniform eines Schutzpolizisten Zugang zum Bürohaus verschaff t. Zwar kann die Polizei durch ihre Ermittlungen Beckert ebenso überführen, sie kann ihn aber nicht ausfindig machen. Die Ring-Vereine haben einen kleinen 31. Vgl. hierzu auch Feraru, der sehr ausführlich beschreibt, wie die Ring-Vereine in der deutschen Gesellschaft, besonders in der Großstadt Berlin, integriert waren und daß Lang für M vermutlich auf ein ähnliches Vorgehen der Ring-Vereine in der Realität zurückgegriffen hatte. P. Feraru: Muskel-Adolf, S. 157-164.
184
M und die Ordnungen des Films
zeitlichen Vorsprung. Nur durch eine Unachtsamkeit ihrerseits – sie lassen den Einbrecher Hans am Tatort zurück, wo er von der Polizei gefaßt wird – kann die Polizei des Mörders auch habhaft werden. Obwohl die Methoden der Polizei faktisch eine Aufklärung herbeiführen, können nur die Ring-Vereine die Ergreifung vollziehen. Die Methode der Ring-Vereine ist die effizientere, die ›Rettung‹ Beckerts ist damit keine Rücknahme dieses Potentials der Überwachung. Sind die Ring-Vereine erst in der Lage, ihre Methode fehlerfrei durchzuführen, so ist der Umsetzung ihrer eigenen Macht keine Grenze mehr gesetzt. Die letzte Szene des Filmes problematisiert diesen Zustand der Verwerfung einer überzeitlichen Ethik. Frau Beckmann wendet sich hier als trauernde Witwe an den Zuschauer: »Das macht unsere Kinder ooch nich wider lebendig! Man muß halt besser uffpassen uff die Kleenen…«.
4. Ordnungen der Schr if t Der Filmtitel M hat an sich keine semantische Bedeutung und drückt nichts aus. Er kann als vollkommen arbiträres Zeichen gelesen werden, das mit einer Vielzahl von Bedeutungen aufgeladen werden kann. Dieser Titel ermöglicht es dem Zuschauer nicht, den Inhalt des Filmes aus einem bereits vorgegebenen Rahmen heraus zu interpretieren.32 Das zu Beginn verwendete »M« – das in der Version von 2003 der Innenfläche einer stilisierten Hand eingeschrieben ist – verweist in seiner arbiträren Zeichenhaftigkeit auf Zeichensysteme im allgemeinen und auf das der Schrift im speziellen. M kann als »textuelles Rätsel«33 gelten. Gleichzeitig verweist der Buchstabe auf die Ordnung des Alphabets als ordnendem Archiv und der Schrift als Ordnungssystem. Thierry Kuntzel geht in seiner Abhandlung zu Fritz Langs Film auf die Bedeutung des Titels ein: »Pourquoi M? La lettre appartient, comme initiale, à un double réseau textuel constitué en diachronie dans l’œuvre de Lang, par les M(abuse) et en synchronie, dans le fi lm, […] le mot M(örder).«34 Mit dieser Feststellung verweist Kuntzel auf den Ordnungscharakter des Buchstaben ›M‹. Der Titel ordnet den Film im Werk von Lang ein und gleichzeitig auf der Ebene der Handlung den Protagonisten einer bestimmten juristisch festgelegten Personengruppe zu. Der Titel verweist – in dieser Lesart – somit in zweierlei Hinsicht »aus sich selbst heraus«: einmal, in dem er den Werkcharakter des Filmes betont, zum anderen, indem er sowohl die Handlung thematisiert, den Film aber auch »gesellschaftlich« verortet. Kuntzel weist weiterhin auch auf das barocke Menschenalphabet von Flötner hin, in dem der Buchstabe 32. Vielleicht ist aus diesem Grund auch der Zusatz bzw. Untertitel Eine Stadt sucht einen Mörder entstanden. 33. Vgl. hierzu Daniel Wild: The Writing on the Screen: Images of Text in the German Cinema From 1920 to 1949, Diss., University of Pittsburgh: 2006 (auch Mikrofiche: Ann Arbor: ProQuest 2007), S. 153. 34. Thierry Kuntzel: »Le travail du film«, in: Commuications 19 (1972), S. 2339, hier: S. 16.
185
Philipp A. Ostrowicz
›M‹ die geöffneten Beine eines Menschen symbolisiert und damit auf die im Film visuell nicht vorhandenen Szenen des sexuellen Mißbrauchs verweist. Das ›M‹ kann somit auch als Vorwegnahme der Assoziationen und Gedanken des Zuschauers gelesen werden. Der Titel bietet allerdings keinen ›Schlüssel‹ zum Film, sondern stellt vielmehr die Grundfrage nach Sinn überhaupt und danach, inwieweit Schrift mit der Bedeutung, mit dem Sinn in M verbunden ist. Der Zuschauer wird explizit als ›Leser‹ gefordert, der das textuelle Material des Filmes entschlüsseln muß.35 Das erste Mal, daß der Mörder in Erscheinung tritt, wird er nur als körperloser Schatten vor einem Anschlag auf einer Litfaßsäule gezeigt. Während die Schriftzeichen die Verbrechen beschreiben und mittels Text, d.h. mittels Schrift auf einem Plakat, um Hinweise auf den Verbleib von zwei Kindern erbeten werden (deren Adresse angegeben ist), ist der Mörder selbst nur als Schattenriß über dem geschriebenen Wort erkennbar, er ist noch nicht gefaßt, die seinem Schatten unterlegte Schrift ordnet ihn aber schon eindeutig den Verbrechen zu.
Schriftzeichen machen Informationen verfügbar und ordnen diese. Gleichzeitig mit der Zuordnung durch das Wort ›Mörder‹ wird Beckert auf der visuellen Ebene dem »schwarzen Mann« aus dem Kinderreim in der ersten Sequenz des Films zugeordnet. Der Zuschauer nimmt den Schatten und das Plakat aus Elsies Perspektive wahr, gleichzeitig ist der Zuschauer aber – im Gegensatz zu Elsie, die die Litfaßsäule nur für ihr Ballspiel verwendet – in der Lage, sowohl die Schriftzeichen zu decodieren und ihre Bedeutung zu 35. Vgl. D. Wild: The Writing, S. 155 und Anton Kaes: »Das Unsichtbare im Film. Zu Fritz Langs M«, in: John McCarthy (Hg.), The Many Faces of German: Transformation in the Study of German History and Culture. A Festschrift for Frank Trommler. New York, Oxford: Berghahn Books 2004, S. 75-85.
186
M und die Ordnungen des Films
verstehen als auch den Schatten dem Inhalt der Schrift zuzuordnen. Bild und Text konvergieren, im Bild vollzieht und exemplifiziert sich gleichzeitig der Prozeß der Entzifferung von Text und die Entstehung von Bedeutung. Das Wort ›Mörder‹ nimmt quasi während der Lektüre bildliche Form an. Die Funktion von Schrift als Prinzip der Ordnung in Langs Film wird auch in den beiden scheinbar gegensätzlichen Ebenen von Ring-Vereinen und Polizei exemplifiziert. Schrift spielt in beiden Welten eine wichtige Rolle. In der »Stullenbörse« werden auf einer Tafel an der Wand die verschiedenen Namen und Preise der Butterbrote vermerkt. Auch bei der Einteilung der Bettler zur Überwachung wird strikt nach schriftlichem Ordnungsprinzip vorgegangen und nicht nach einem chaotischen System des Zufalls. Es werden deren Namen festgehalten, bei Doppelung von Namen werden diese durch eine Zahl ergänzt. So heißt einer der Bettler z.B. Müller XVI. Jeder Bettler erhält zudem eine Nummer, ihm wird ein Bezirk, der ausdrücklich benannt und abgegrenzt ist, zugeordnet. Diese Daten werden in einer Tabelle in einem Buch vermerkt. Der blinde Bettler, der Beckert schließlich überführt, ist mit einem Umhängeschild durch den Schriftzug »blind« bezeichnet. Bei der Razzia der Polizei müssen sich alle Anwesenden ausweisen; wer dies nicht kann, wird zur Identitätsüberprüfung in die Polizeidirektion gebracht. Nur durch die Schrift wird das Individuum bezeichnet und damit erst als solches etabliert. Friedrich Kittler hat in seinem Aufsatz »Die Stadt ist ein Medium« davon gesprochen, daß die Orte und Individuen einer Stadt eine »Adresse« erhalten. »Von der Staatspost über das Selbstwahltelephon bis zum Autokennzeichen arbeiten Medien daran, die Leute durch ihre Adresse zu ersetzen.«36 Eine Stadt funktioniert dabei nach Kittler insofern als ein Medium, als sie – analog z.B. zu Büchern – Speicher- und zugleich Übertragungsmedium für Informationen ist. Langs Film kann als Visualisierung dieser Feststellung angesehen werden. Die Ermittlungen der Polizei, die Beckert schließlich auch überführt, haben erst Erfolg, als Lohmann psychiatrische Akten konsultiert, die alle Entlassungen der letzten fünf Jahre verzeichnen. Anhand dieser Akten werden zunächst die aktuellen Adressen aller dort Verzeichneten zusammengestellt und diese dann überprüft. Daß der Zuschauer auch als Leser explizit gefordert wird, wird deutlich, als Lohmann die Protokolle der Besprechungen und Anordnungen Korrektur liest. Das Typoskript wird in Großaufnahme ohne zusätzlichen Ton oder eine Stimme, die den Text vorliest, gezeigt. Man sieht eine Füllerspitze, die den Text zum einen korrigiert, zum anderen die entscheidenden Stellen markiert. Der aktive Akt des Lesens, der hier gefordert wird, macht den Zuschauer zum aktiven Teilnehmer an der Aufklärung der Morde. Zu Beginn des Films nimmt der Zuschauer – wie oben beschrieben – das Plakat, das zur Aufklärung zweier Morde aufruft, mit den Augen von Elsie wahr. Später sieht und liest der Zuschauer aus der Perspektive einer Menschenmenge ein Plakat, das eine Belohnung bei Ergreifung des Mörders 36. Friedrich A. Kittler: »Die Stadt ist ein Medium«, in: Gotthard Fuchs/Bernhard Moltmann/Walter Prigge (Hg.), Mythos Metropole, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1995, S. 228-244, hier S. 238.
187
Philipp A. Ostrowicz
auslobt. Der Zuschauer nimmt die Postion eines namenlosen Beobachters, eines Unbeteiligten ein. Er wird Teil der Masse. Kurz vorher schaut der Zuschauer dem Mörder über die Schulter, wie er handschriftlich einen Brief an die Presse verfaßt und dabei das Motiv aus Peer Gynt pfeift.
Auch aus der Perspektive des Mörders sieht der Zuschauer also manchmal, beispielsweise als Beckert den Bekennerbrief schreibt. Das Papier wird an der linken und rechten Seite von je einer Hand festgehalten, die dem Zuschauer zu gehören scheinen. Später wiederum wird der Brief als Faksimile in der Zeitung abgedruckt, wieder sieht man die Titelseite der Zeitung aus der Zuschauerperspektive, die Presse ist der Katalysator der Informationen für die Masse. Es folgt die Schriftanalyse und die Analyse von Fingerabdrücken durch die Polizei. Es wird ein Fingerabdruck gezeigt, der vergrößert und mit Zahlen bezeichnet auf eine Leinwand projiziert wird. Dieser Fingerabdruck eines Menschen wird durch die Vergrößerung selbst zu einer Art Schriftzeichen, das entziffert werden muß. Die Aufklärung der Morde soll durch einen Akt des Lesens und Decodierens stattfinden. So dient der Name der Zigarettenmarke Ariston37 als Auslöser der Überführung von Beckert. Lohmann erinnert sich an einen der Morde: In der Nähe des Fundortes der Leiche wurden mehrere Zigarettenstummel der Marke Ariston gefunden. Er zeichnet den Schriftzug ›Ariston‹ mit seinen Fingern in die Luft, um seiner Erinnerung auf die Sprünge zu helfen. Bei der Überprüfung von Beckerts Zimmer wurde eine Schachtel eben dieser Zigarettenmarke gefunden. Lohmann und ein weiterer Ermittler kehren dorthin zurück und entdecken ein weiteres belastendes Indiz. Auf der Fensterbank finden sich Spuren des Briefes, in dem 37. Die Marke Ariston war eine zeitgenössische Zigarettenmarke, gleichzeitig ist Ariston auch der Name des Vaters von Platon.
188
M und die Ordnungen des Films
sich der Mörder selbst bezichtigt hat. Der Stift hat durch das Papier den Text des Briefes ins Holz der Fensterbank eingeritzt. Der Schreibakt hinterläßt materielle Spuren. Mit einer Lupe können diese Spuren sichtbar gemacht werden. Diese Indizien sind für Lohmann ausschlaggebend, er ist nun von der Schuld Beckerts überzeugt.
5. Der Fehler im System : M als Widerpar t der Ordnungen? Es wird deutlich, wie sehr Ordnungssysteme – sowohl auf Ebene der histoire mit der Polizei und den Ring-Vereinen, wie auch auf der Ebene des discours mit Schrift, Bild und Ton – Langs Film bestimmen. Der von den Beteiligten gewünschten Wiederherstellung der Ordnung steht der Mörder Hans Beckert entgegen. Er kann diese Ordnungen weder erkennen noch für sich herstellen. Die gestörte bzw. nicht vorhandene Verbindung zur übergreifenden Gesellschaftsordnung wird deutlich. Beckert wird gezeigt, wie er sich in den Straßen der Großstadt38 herumtreibt, er hat ein Zimmer zur Untermiete, ist unverheiratet, außer seiner Vermieterin gibt es keine Menschen, die in einer Beziehung zu ihm stehen. In einer Szene steht Beckert vor einem Obststand und ißt hastig einen Apfel, über ihm hängen Ananas und Bananen, im Straßencafé sitzt er hinter Rankpflanzen. Beckert wirkt hier wie ein gehetztes Tier, das auf ein neues Opfer wartet. Diese Szenen nehmen die Perspektive Beckerts auf, das Irrationale, das Zusammenhanglose. Er kann die klare Gliederung, die klaren Linien, die Ordnungen der Gesellschaft, der Großstadt, der Schriftlichkeit, die hier vorgeführt werden, nicht erkennen, sondern treibt sich unruhig und ziellos in der Stadt herum. Sein Trieb macht ihm die Einordnung unmöglich und verwehrt ihm den Zutritt. Gleichzeitig fungiert er als Spiegel einer Großstadt, einer Moderne, deren Subjekte durch eine »Rezeption der Zerstreuung«39 gekennzeichnet sind. Dissoziation, d.h. Zersplitterung bestimmt seine Perspektive und seinen Alltag. Nur in den Phasen, wo sein Trieb zu töten ausbricht und sein Verhalten bestimmt, scheint Beckert zur Fokussierung in der Lage. Allerdings geschieht dies nicht im Sinne einer Fokussierung auf Einordnung und Verstehen, sondern wiederum einer Fokussierung 38. Vgl. zum Themenkomplex ›M und Großstadt‹ Edward Dimendberg: »From Berlin to Bunker Hill: Urban Space, Late Modernity, and Film Noir in Fritz Lang’s and Joseph Losey’s M«, in: Wide Angle 19/4 (1997), S. 62-93 sowie Klaus Kreimeier: »Strukturen im Chaos. Wie Fritz Lang Ordnung in den Dschungel bringt«, in: Irmbert Schenk (Hg.): Dschungel Großstadt. Kino und Modernisierung, Marburg: Schüren 1999, S. 57-67. 39. Benjamin führt dies im Kunstwerk-Aufsatz aus. Vgl. Walter Benjamin: »Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit«, in: ders., Gesammelte Schriften, unter Mitwirkung v. Theodor W. Adorno u. Gershom Scholem hg.v. Rolf Tiedemann u. Hermann Schweppenhäuser, Bd. I/2, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1991, S. 431-508, hier S. 505.
189
Philipp A. Ostrowicz
auf den triebgesteuerten Mord, der die Zerstörung des Zusammenhanges zwischen Subjekt Beckert und gesellschaftlicher Ordnung nur bestätigt und vertieft. 40 Beckert richtet in den triebgesteuerten Momenten seine gesamte Aufmerksamkeit auf das Opfer. Alles andere erscheint ausgeblendet. 41 Auch hier ist die Verbindung zur gesellschaftlichen Ordnung und zur räumlichen Umgebung aufgehoben. Nur durch seine psychopathologische Disposition ist er in der Lage, diese Aufmerksamkeit, die der eines Tieres bei der Jagd ähnelt, in den von seinem Trieb bestimmten Momenten aufzubringen. Beckert steht als individuelles Subjekt gegen alle anderen, die in Gruppen agieren und sich organisieren, die im System der Großstadt verortet werden und sich dessen Ordnung unterwerfen müssen. Beckert fällt vollkommen aus dieser Ordnung heraus. Dies wird auch durch sein Versteck auf dem Dachboden des Bürohauses verdeutlicht. Es ist eine Abstellkammer, in der der Mörder wie eine Puppe zwischen den unklaren Linien des Gerümpels wirkt. Seine Umgebung spiegelt nun auch materiell seine Situation. Die Rumpelkammer in ihrer organischen Form fällt aus der klaren, verschriftlichten Ordnung der Großstadt heraus Beckerts Funktion als ›Fehler im System‹ wird hier besonders deutlich. Nicht in seiner Funktion als Kindermörder ist Beckert bedeutsam, auch die Unfähigkeit, sich den verschiedenen Ordnungen zuzuordnen, ist eher von geringer Wichtigkeit. Beckert kann als ein sich grundsätzlich jeder Ordnung verweigerndes Subjekt begriffen werden. So kann man den Kindermörder auch als Fehler im Medium selbst begreifen. Sein Handeln hält sich nicht an Linearität oder Kausalität, unterwirft sich nicht der schriftlichen Ordnung und durchbricht so auch die übliche Ordnung des Films.
40. Der Ton unterstützt dies. 41. Diese Aufmerksamkeit – die Jonathan Crary als typisches Merkmal der
modernen Sehwahrnehmung ausmacht – wird hier vor allem in der Lautwahrnehmung ausgedrückt. Vgl. Jonathan Crary: Aufmerksamkeit, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 2002.
190
Filmverzeichnis
Der letzte Mann, Deutschland 1924, Regie: Friedrich Wilhelm Murnau, DVD: Universum Film, BRD 2002 (= Transit Classics). Der müde Tod, Deutschland 1921, Regie: Fritz Lang, DVD: Image Entertainment, USA 2000. Die Nibelungen. Teil 1: Siegfried. Teil 2: Kriemhilds Rache, Deutschland 1924, Regie: Fritz Lang, DVD: Divisa Home Video, Spanien 2003 (= Edición Especial Coleccionista). Faust. Eine deutsche Volkssage, Deutschland 1926, Regie: Friedrich Wilhelm Murnau, DVD: Eureka Entertainment, UK 2006 (= Masters of Cinema Series 24; Two Disc-Edition). M. Eine Stadt sucht einen Mörder, Deutschland 1931, Regie: Fritz Lang, DVD: restaurierte Fassung, Universum Film, BRD 2002 (= Ufa Klassiker Edition). Metropolis, Deutschland 1927, Regie: Fritz Lang, DVD: neu restaurierte Fassung mit Originalmusik, Universum Film, BRD 2003 (= Deluxe Edition, Transit Classics). Sunrise. A Song of Two Humans, USA 1927, Regie: Friedrich Wilhelm Murnau, DVD: Eureka Entertainment, UK 2005 (= Masters of Cinema Series 1). Tabu, USA 1931, Regie: Friedrich Wilhelm Murnau, DVD: Divisa Home Video, Spanien 2006 (= Edición Especial Coleccionista). Tartüff, Deutschland 1926, Regie: Friedrich Wilhelm Murnau, DVD: restaurierte Fassung mit Originalmusik, Universum Film, BRD 2005 (= Deluxe Edition, Transit Classics).
191
Literatur
Aumont, Jacques: »›Mehr Licht!‹ Zu Murnaus ›Faust‹ (1926)«, in: Franz-Josef Albersmeier/Volker Roloff (Hg.), Literaturverfilmungen, hg. v., Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1989, S. 59-79. Aurich, Wolf/Jacobsen, Wolfgang/Schnauber, Cornelius: Fritz Lang. Leben und Werk. Bilder und Dokumente. 1890-1976, Berlin: Jovis 2001. Bade, James N.: »Murnau’s The Last Laugh and Hitchcock’s Subjective Camera«, in: Quarterly Review of Film and Video 23 (2006), S. 257-266. Balázs, Béla: »Stilfi lm, Filmstil und Stil überhaupt«, in: ders., Schriften zum Film I, hg. v. Helmut H. Diederichs, Wolfgang Gersch u. Magda Nagy, Berlin (Ost): Henschelverlag u. München, Wien: Carl Hanser 1982, S. 341345. Balázs, Béla: Rez. »Alles für Geld«, in: ders., Schriften zum Film I, hg. v. Helmut H. Diederichs, Wolfgang Gersch u. Magda Nagy, Berlin (Ost): Henschelverlag u. München, Wien: Carl Hanser 1982, S. 244. Bär, Gerald: Das Motiv des Doppelgängers als Spaltungsphantasie in der Literatur und im deutschen Stummfi lm, Amsterdam, New York: Rodopi 2005. Bazin, André: Was ist Film?, hg. v. Robert Fischer, Berlin: Alexander 2004. Benjamin, Walter: »Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit«, in: ders., Gesammelte Schriften. Unter Mitwirkung v. Th.W. Adorno u. G. Scholem hg. v. Rolf Tiedemann u. Hermann Schweppenhäuser. Bd. I/2, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1991, S. 431-508. Bergstrom, Janet: »Sexuality at a Loss. The Films of F.W. Murnau«, in: Poetics Today 6/1-2 (1985), S. 185-203. Binding, Karl/Hoche, Alfred: Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens. Ihr Maß und ihre Form. Leipzig: Meiner 1920; Neudruck: Berlin: BWV 2006. Blumenberg, Hans: Arbeit am Mythos, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1979. Bratton, Susan Power: »From Iron Age Myth to Idealized National Landscape. Human-Nature Relationships and Environmental Racism in Fritz Lang’s Die Nibelungen«, in: Worldviews. Environment, Culture, Religion 4/1 (2000), S. 195-212.
193
Schat tenbilder – Lichtgestalten
Brennicke, Ilona/Hembus, Joe: »Faust. Eine deutsche Volkssage«, in: dies., Klassiker des Deutschen Stummfi lms 1910-1930, München: Goldmann 1983, Sp. 130a-133b. Bresson, Robert: Noten zum Kinematographen, München, Wien: Carl Hanser 1980. Bruns, Karin: Kinomythen 1920-1945. Die Filmentwürfe der Thea von Harbou, Stuttgart, Weimar: Metzler 1995. Bukatman, Scott: Blade Runner, London: BFI Publishing 1997. Canetti, Elias: Masse und Macht, Frankfurt a.M.: Fischer 1982. Collier, Jo Leslie: From Wagner to Murnau. The Transposition of Romanticism from Stage to Screen, Ann Arbor, London: UMI Research Press 1988. Crary, Jonathan: Aufmerksamkeit, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 2002. Das Nibelungenlied, übers., eingeleitet u. hg. v. Felix Genzmer, Stuttgart: Reclam 1975. Deleuze, Gilles/Guattari, Félix: Anti-Ödipus. Kapitalismus und Schizophrenie 1, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1974. Deleuze, Gilles/Parnet, Claire: Dialogues, Paris: Flammarion 1977. Dimendberg, Edward: »From Berlin to Bunker Hill: Urban Space, Late Modernity, and Film Noir in Fritz Lang’s and Joseph Losey’s M«, in: Wide Angle 19/4 (1997), S. 62-93. Dittmar, Peter: F.W. Murnau. Eine Darstellung seiner Regie und seiner Stilmerkmale durch die Rekonstruktion der verlorenen und unvollständig überlieferten Filme, Diss., Berlin 1962. Duncan, Paul: Film Noir. Films of Trust and Betrayal, Herts: Pocket Essentials 2000. Eisenstein, Sergej M./Pudowkin, Wsewolod I./Alexandrow, Grigorij W.: »Manifest zum Tonfi lm«, in: Franz-Josef Albersmeier (Hg.), Texte zur Theorie des Films, Stuttgart: Reclam 1990, S. 42-45. Eisner, Lotte H.: Die dämonische Leinwand, hg. v. Hilmar Hoffmann u. Walter Schobert, Frankfurt a.M.: Fischer 1980. Eisner, Lotte H.: Fritz Lang, London: Secker & Warburg 1976 (Nachdruck: New York: Da Capo Press 1986). Eisner, Lotte H.: Murnau, überarbeitete, erweiterte u. autorisierte Neuausg., hg. v. Hilmar Hoffmann u. Walter Schobert, Frankfurt a.M.: Kommunales Kino Frankfurt 1979. Elsaesser, Thomas: »Film History and Visual Pleasure: Weimar Cinema«, in: Patricia Mellencamp/Philip Rosen (Hg.), Cinema Histories – Cinema Practices, Westport, CT: Greenwood Publishing 1984, S. 47-87. Elsaesser, Thomas: Filmgeschichte und frühes Kino. Archäologie eines Medienwandels, München: edition text + kritik 2002. Elsaesser, Thomas: Metropolis. Der Filmklassiker von Fritz Lang, Hamburg, Wien: Europa 2001. Farnsworth, Rodney: »Sunrise«, in: Nicolet V. Elert/Aruna Vasudevan (Hg.), International Dictionary of Films and Filmmakers, Bd. 1: Films, 3. Aufl., Detroit u.a.: St. James Press 1997, S. 976-978.
194
Literatur
Feraru, Peter: Muskel-Adolf & Co. Die Ring-Vereine und das organisierte Verbrechen, Berlin: Argon 1995. Fiedler, Leonhard M.: Max Reinhardt und Molière, Salzburg: Otto Müller 1972. Fischer, Lucy: Sunrise. A Song of Two Humans, London: BFI Publishing 1998. Freud, Sigmund: »Eine Schwierigkeit der Psychoanalyse«, in: ders., Gesammelte Werke. Chronologisch geordnet, hg. v. Anna Freud u.a., Bd. 12: Werke aus den Jahren 1917-1920, 3. Aufl., Frankfurt a.M.: S. Fischer 1966, S. 3-11. Freud, Sigmund: »Totem und Tabu«, in: ders., Studienausgabe, hg. v. Alexander Mitscherlich u.a., Bd. IX: Fragen der Gesellschaft/Ursprünge der Religion, Frankfurt a.M.: S. Fischer 1974, S. 287-444. Friedrich Wilhelm Murnau (= Reihe Film 43, hg. v. Peter W. Jansen u. Wolfram Schütte in Zusammenarbeit mit der Stiftung Deutsche Kinemathek), München, Wien: Carl Hanser 1990. Friedrich Wilhelm Murnau 1888-1988. Katalog zur Bielefelder Ausstellung 1988, Red.: Klaus Kreimeier, Bielefeld: BVA 1988. Fritz Lang (= Reihe Film 7, hg. v. Peter W. Jansen u. Wolfram Schütte in Zusammenarbeit mit der Stiftung Deutsche Kinemathek), München, Wien: Carl Hanser 1976; 2., ergänzte Aufl. München, Wien: Carl Hanser 1987. Funke, Thorsten: »The Dark Knight«, auf: www.critic.de/fi lme/detail/fi lm/ the-dark-knight-1253.html, 04.08.2008. Gaertner, David/Keilholz, Sascha: »Filmografie, Bibliografie«, in: Hans Helmut Prinzler (Hg.), Friedrich Wilhelm Murnau. Ein Melancholiker des Films, Berlin: Bertz 2003, S. 267-296. Gansera, Rainer: »Der Faustfilm und die Franzosen. Bemerkungen zu Eric Rohmers Buch über Murnaus Faust«, in: Friedrich Wilhelm Murnau 1888-1988. Katalog zur Bielefelder Ausstellung 1988, Red.: Klaus Kreimeier, Bielefeld: BVA 1988, S. 77-87. Gauguin, Paul: Noa Noa, München: Rogner & Bernhard 1969. Gay, Peter: Die Republik der Außenseiter. Geist und Kultur in der Weimarer Zeit 1918-1933, Frankfurt a.M.: Fischer 1987. Gehler, Fred/Kasten, Ullrich: Fritz Lang. Die Stimme von Metropolis, Berlin (Ost): Henschelverlag 1990. Gehler, Fred/Kasten, Ullrich: Friedrich Wilhelm Murnau, Berlin (Ost): Henschelverlag 1990. Geser, Guntram: Fritz Lang – Metropolis und Die Frau im Mond. Zukunftsfi lm und Zukunftstechnik in der Stabilisierungszeit der Weimarer Republik, Meitingen: Corian 1996. Godard, Jean-Luc: »Scénario du Mépris«, in: ders., Godard par Godard. Les années Karina, Paris: Flammarion 1985, S. 73-85. Godard, Jean-Luc: »Zum Tode von Alfred Hitchcock. Interview in Libération vom 2.5.1980«, in: Filmkritik, Juni 1980, S. 280-284. Godard, Jean-Luc: Einführung in eine wahre Geschichte des Kinos, München, Wien: Carl Hanser 1981. 195
Schat tenbilder – Lichtgestalten
Goebbels, Joseph: Die Tagebücher, hg. v. Elke Fröhlich, Teil I, Bd. 2/I, München: K.G. Saur 2005. Göttler, Fritz: »Der letzte Mann. 1924«, in: Friedrich Wilhelm Murnau (= Reihe Film 43, hg. v. Peter W. Jansen u. Wolfram Schütte in Zusammenarbeit mit der Stiftung Deutsche Kinemathek), München, Wien: Carl Hanser 1990, S. 161-172. Göttler, Fritz: »Kommentierte Filmografie«, in: Friedrich Wilhelm Murnau (= Reihe Film 43, hg. v. Peter W. Jansen u. Wolfram Schütte in Zusammenarbeit mit der Stiftung Deutsche Kinemathek), München, Wien: Carl Hanser 1990, S. 107-208. Grafe, Frieda: »Der Mann Murnau. Eine kommentierte Biografie«, in: Friedrich Wilhelm Murnau (= Reihe Film 43, hg. v. Peter W. Jansen u. Wolfram Schütte in Zusammenarbeit mit der Stiftung Deutsche Kinemathek), München, Wien: Carl Hanser 1990, S. 7-60. Grafe, Frieda: »Für Fritz Lang. Einen Platz, kein Denkmal«, in: Fritz Lang (= Reihe Film 7, hg. v. Peter W. Jansen u. Wolfram Schütte in Zusammenarbeit mit der Stiftung Deutsche Kinemathek), München, Wien: Carl Hanser 1976, S. 7-82. Grafe, Frieda: Licht aus Berlin. Lang, Lubitsch, Murnau und weiteres zum Kino der Weimarer Republik, Berlin: Brinkmann & Bose 2003. Greschat, Hans-Jürgen: Art. »Mana und Tabu«, in: Theologische Realenzyklopädie, hg. v. Gerhard Müller u.a., Bd. 22, Berlin: de Gruyter 1992, S. 1316. Gunning, Tom: Metropolis: Oedipal Nightmares, Allegorical Riddles, in: ders., The Films of Fritz Lang. Allegories of Vision and Modernity, London: BFI Publishing 2000, S. 68-76. Hake, Sabine: »Architectural Hi/stories: Fritz Lang and The Nibelungs«, in: Wide Angle 12/3 (1990), S. 38-57. Hardy, Forsyth: »Introduction«, in: ders. (Hg.), Grierson on Documentary, gekürzte Ausg., London: Faber & Faber 1979, S. 11-17. Hart, Julius: »Schaulust und Kino« (1913), in: Jörg Schweinitz (Hg.), Prolog vor dem Film. Nachdenken über ein neues Medium 1909-1914, Leipzig: Reclam 1992, S. 253-259. Hasel, Karl/Schwartz, Ekkehard: Forstgeschichte. Ein Grundriss für Studium und Praxis, 2. Aufl., Remagen: Dr. Kessel, 2002. Haß, Ulrike: »Elemente einer Theorie der Begegnung: Theater, Film«, in: Gabriele Brandstetter/Helga Finter/Markus Weßendorf (Hg.), Grenzgänge. Das Theater und die anderen Künste, Tübingen: Narr 1998, S. 55-76. Heermann, Ingrid: Mythos Tahiti. Südsee – Traum und Realität, mit Beiträgen von Matthias Mersch und Hilke Thode-Arora, Berlin: Dietrich Reimer 1987. Heller, Heinz-B.: »›Man stellt Denkmäler nicht auf den flachen Asphalt‹. Fritz Langs Nibelungen-Film«, in: Joachim Heinzle/Anneliese Waldschmidt (Hg.), Die Nibelungen. Ein deutscher Wahn, ein deutscher Alptraum. Studien und Dokumente zur Rezeption des Nibelungenstoffs im 19. und 20. Jahrhundert, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1991, S. 351-369. 196
Literatur
Hetebrügge, Jörn/Meyer, Nils: »›Sehet, damit ihr geheilt werdet!‹. Murnau und sein Verhältnis zum Theater im Spiegel des Tartüff«, in: Murnau (Friedrich Wilhelm) in Murnau (Oberbayern). Der Stummfilm-Regisseur der 1920er Jahre, hg. v. Schloßmuseum des Marktes Murnau, bearb. v. Brigitte Salmen, Murnau: Schloßmuseum Murnau 2003, S. 97-105. Historia von D. Johann Fausten. Text des Druckes von 1587. Kritische Ausgabe. Mit den Zusatztexten der Wolfenbüttler Handschrift und der zeitgenössischen Drucke, hg. v. Stephan Füssel u. Hans Joachim Kreutzer, ergänzte u. bibliograph. aktualisierte Ausg., Stuttgart: Reclam 2006, S. 15-17. Hofmannsthal, Hugo v.: »Die Bühne als Traumbild«, in: ders., Gesammelte Werke in zehn Einzelbänden, Reden und Aufsätze I, hg. v. Bernd Schoeller, Frankfurt a.M.: S. Fischer 1979, S. 490-493. Hofmannsthal, Hugo v.: »Jedermann«, in: ders., Gesammelte Werke in zehn Einzelbänden, Dramen III. 1893-1927, hg. v. Bernd Schoeller, Frankfurt a.M.: S. Fischer 1979, S. 9-72. Hughes, Jon: »›Zivil ist allemal schädlich‹. Clothing in German-Language Culture of the 1920s«, in: Neophilologus 88 (2004), S. 429-445. Ibsen, Henrik: Peer Gynt. Ein dramatisches Gedicht. Stuttgart: Reclam 2008. Imort, Michael: »Eternal Forest – Eternal Volk. The Rhetoric and Reality of National Socialist Forest Policy«, in: Franz-Josef Brüggemaier/Mark Cioc/ Thomas Zeller (Hg.), How Green Were the Nazis? Nature, Environment, and Nation in the Third Reich, Athens: Ohio University Press 2005, S. 4372. Jahnke, Eckart: »Fritz Langs M«, in: Filmwissenschaftliche Mitteilungen 6 (1965), S. 169-180. Jauß, Hans Robert: »Der Tartuffe-Skandal im Lichte von Mimesis und Simulation«, in: Andreas Kablitz/Gerhard Neumann (Hg.), Mimesis und Simulation, Freiburg i.Br.: Rombach 1998, S. 121-144. Joyce, James: Ulysses, The Gabler Edition, New York: Vintage 1986. Kaes, Anton: »Das Unsichtbare im Film. Zu Fritz Langs M«, in: John McCarthy (Hg.), The Many Faces of German. Transformation in the Study of German History and Culture. A Festschrift for Frank Trommler, New York, Oxford: Berghahn Books 2004, S. 75-85. Kaes, Anton: M, London: BFI Publishing 1999. Kant, Immanuel: Kritik der Urteilskraft, Werkausgabe, Bd. X, hg. v. Wilhelm Weischedel, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1974. Kappelhoff, Hermann: Matrix der Gefühle, Berlin: Vorwerk 8 2004. Keilholz, Sascha: »Der Baader-Meinhof-Komplex«, auf: www.critic.de/fi lme/ detail/fi lm/der-baader-meinhof-komplex-1400.html, 22.09.2008. Keiner, Reinhold: Thea von Harbou und der deutsche Film bis 1933, Hildesheim: Olms 1984. Keitz, Ursula v.: »Der Blick ins Imaginäre. Über ›Erzählen‹ und ›Sehen‹ bei Murnau«, in: Klaus Kreimeier (Hg.), Die Metaphysik des Dekors. Raum, Architektur und Licht im klassischen deutschen Stummfi lm, Marburg: Schüren 1994, S. 80-99. 197
Schat tenbilder – Lichtgestalten
Kern, Hermann: Labyrinthe. Erscheinungsformen und Deutungen. 5000 Jahre Gegenwart eines Urbilds, München: Prestel 1999. Kinder- und Hausmärchen. Gesammelt durch die Brüder Grimm, vollständige Ausgabe auf der Grundlage der dritten Auflage (1837), hg. v. Heinz Rölleke, Frankfurt: Deutscher Klassiker Verlag 1985. Kittler, Friedrich A.: »Die Stadt ist ein Medium«, in: Gotthard Fuchs/Bernhard Moltmann/Walter Prigge (Hg.), Mythos Metropole, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1995, S. 228-244. Klein, Dennis B.: »The Movies: Notes on the Ethnic Origins of an American Obsession«, in: Paul Buhle (Hg.), Jews and American Popular Culture, Bd. 1: Movies, Radio, and Television, Westport: Praeger 2007, S. 1-11. Koebner, Thomas: »Der romantische Preuße«, in: Hans Helmut Prinzler (Hg.), Friedrich Wilhelm Murnau. Ein Melancholiker des Films, Berlin: Bertz 2003, S. 9-52. Kracauer, Siegfried: Rez. »Zweimal Wildnis« [Tabu], in: ders., Werke, hg. v. Inka Mülder-Bach, Bd. 6/2: Kleine Schriften zum Film 1928-1931, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 2004, S. 544-546. Kracauer, Siegfried: Von Caligari zu Hitler. Eine psychologische Geschichte des deutschen Films (= ders., Schriften, Bd. 2, hg. v. Karsten Witte), Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1979; Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1984. Kreimeier, Klaus (Hg.): Die Metaphysik des Dekors. Raum, Architektur und Licht im klassischen deutschen Stummfi lm, Marburg, Berlin: Schüren 1994. Kreimeier, Klaus: »Das Drama und die Formen. Versuch über einen Melancholiker«, in: Friedrich Wilhelm Murnau 1888-1988. Katalog zur Bielefelder Ausstellung 1988, Red.: Klaus Kreimeier, Bielefeld: BVA 1988, S. 8897. Kreimeier, Klaus: »Strukturen im Chaos. Wie Fritz Lang Ordnung in den Dschungel bringt«, in: Irmbert Schenk (Hg.), Dschungel Großstadt. Kino und Modernisierung, Marburg: Schüren 1999, S. 57-67. Kreimeier, Klaus: Die Ufa-Story. Geschichte eines Filmkonzerns, München, Wien: Carl Hanser 1992. Kreinath, Jens: Art. »Tabu«, in: Religion in Geschichte und Gegenwart, hg. v. Hans Dieter Betz u.a., 4. Aufl., Bd. 8, Tübingen: Mohr Siebeck 2005, Sp. 3f. Kuntzel, Thierry: »Le travail du fi lm«, in: Commuications 19 (1972), S. 23-39. Küster, Hansjörg: Geschichte des Waldes. Von der Urzeit bis zur Gegenwart, München: C.H. Beck 1998. La Rochefoucauld, François de: »Réflections ou Sentences et Maximes morales (1678)«, in: ders., Œuvres Complètes (= Bibliothèque de la Pléiade 24), hg. v. Louis Martin-Chauffier, Paris: Gallimard 1973, S. 385-471. Lang, Fritz: »Aufgelöste Massen«, in: Fred Gehler/Ullrich Kasten, Fritz Lang. Die Stimme von Metropolis, Berlin (Ost): Henschelverlag 1990, S. 174176.
198
Literatur
Lang, Fritz: »Kitsch – Sensation – Kultur und Film«, in: Edgar Beyfuss/Axel Kossowsky (Hg.), Das Kulturfi lmbuch, Berlin: Carl P. Chryselius 1924, S. 28-31. Lang, Fritz: »Worauf es beim Nibelungen-Film ankam«, in: Fred Gehler/Ullrich Kasten, Fritz Lang. Die Stimme von Metropolis, Berlin (Ost): Henschelverlag 1990, S. 170-174. Lang, Fritz: Interviews, hg. v. Barry Keith Grant, Jackson: University of Mississippi Press 2003. Lang, Fritz: M. Protokoll. Mit einem Interview des Regisseurs v. Gero Gandert (= Cinemathek 3), Hamburg: Marion von Schröder 1963. Langer, Mark J.: »Tabu. The Making of a Film«, in: Cinema Journal 24/3 (1985), S. 43-64. Lenk, Elisabeth/Kaever, Katharina (Hg.): Peter Kürten, genannt der Vampir von Düsseldorf, Frankfurt a.M.: Eichborn 1997. Levin, David J.: Richard Wagner, Fritz Lang and the Nibelungen. The Dramaturgy of Disavowal, Princeton, NJ: Princeton University Press 1998. Loiperdinger, Martin: Rituale der Mobilmachung. Der Parteitagsfi lm ›Triumph des Willens‹ von Leni Riefenstahl, Opladen: Leske & Budrich 1987. Lorenz, Thorsten: Wissen ist Medium. Die Philosophie des Kinos, München: Fink 1988. Lubrich, Oliver: »Dracula – James Bond. Zur Kontinuität und Variation mythischer Phantasie in der Moderne«, in: KulturPoetik 3/1 (2003), S. 81-95. Luther, D.Martin: Die gantze Heilige Schriff t Deusch. Wittenberg 1545. Letzte zu Luthers Lebzeiten erschienene Ausgabe, hg. v. Hans Volz unter Mitarbeit v. Heinz Blanke, München: Rogner & Bernhard 1972, Bd. 2, S. 2428. MacCabe, Colin: Godard. A Portrait of the Artist at Seventy, New York: Farrar, Straus and Giroux 2004. Mach, Ernst: Die Analyse der Empfindungen und das Verhältnis des Physischen zum Psychischen, mit einem Vorwort zum Neudruck v. Gereon Wolters, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1987. Mahal, Günther: »Murnau, Hauptmann, Kyser. Zum Film ›Faust. Eine deutsche Volkssage‹«, in: ders., Faust. Untersuchungen zu einem zeitlosen Thema. Neuried: ars una 1998, S. 568-577. Maiwald, Klaus-Jürgen: Filmzensur im NS-Staat, Dortmund: Nowotny 1983. Malinowski, Bronislaw: Schriften in vier Bänden, Bde. 1 u. 2, hg. v. Fritz Kramer, Frankfurt a.M.: Syndikat 1979. Mann, Thomas: Der Zauberberg, Frankfurt a.M.: S. Fischer 1981. Markovits, Andrei S.: Amerika, dich haßt sich’s besser. Antiamerikanismus und Antisemitismus in Europa, Hamburg: Konkret Texte 2004. Matt, Peter von: Die Intrige. Theorie und Praxis der Hinterlist, München, Wien: Carl Hanser 2006. Matussek, Peter: »Intertextueller Totentanz. Die Reanimation des Gedächtnisraumes in Hofmannsthals Drama Der Tor und der Tod«, in: Hofmannsthal Jahrbuch 7 (1999), S. 199-231.
199
Schat tenbilder – Lichtgestalten
McArthur, Colin: »Chinese Boxes and Russian Dolls. Tracking the elusive cinematic city«, in: David B. Clarke (Hg.), The Cinematic City, London, New York: Routledge 1997, S. 19-45. McGilligan, Patrick: Fritz Lang. The Nature of the Beast, London: Faber and Faber u. New York: St. Martin’s Press 1997. Murnau (Friedrich Wilhelm) in Murnau (Oberbayern). Der Stummfi lm-Regisseur der 1920er Jahre, hg. v. Schloßmuseum des Marktes Murnau, bearb. v. Brigitte Salmen, Murnau: Schloßmuseum Murnau 2003. Murnau, Friedrich W./Flaherty, Robert W.: »Turia. Eine Originalgeschichte«, in: Fred Gehler/Ullrich Kasten, Friedrich Wilhelm Murnau, Berlin (Ost): Henschelverlag 1990, S. 154-170. Murnau, Friedrich W.: »…der frei im Raum zu bewegende Aufnahmeapparat« (1924), in: Fred Gehler/Ullrich Kasten: Friedrich Wilhelm Murnau, Berlin (Ost): Henschelverlag 1990, S. 141. Murnau, Friedrich W.: »Der Stern des Südens« (1931), in: Fred Gehler/Ullrich Kasten, Friedrich Wilhelm Murnau, Berlin (Ost): Henschelverlag 1990, S. 170-173. Murnau, Friedrich W.: »Filme der Zukunft« (1928 als ›Films of the Future‹), in: Filmfaust 2 (1979), H. 12, S. 24-30; auch in: Fred Gehler/Ulrich Kasten: Friedrich Wilhelm Murnau, Berlin: Henschelverlag 1990, S. 144-150. Murnau, Friedrich W.: Südseebilder. Texte, Fotos und der Film Tabu, ausgew., bearb. und kommentiert v. Enno Patalas, hg. v. der Friedrich-WilhelmMurnau-Stiftung, Berlin: Bertz + Fischer 2005. Neuhaus, Stefan: Märchen, Tübingen, Basel: A. Francke 2005. Oksiloff, Assenka: Picturing the Primitive. Visual Culture, Ethnography, and Early German Cinema, New York: Palgrave 2001. Patalas, Enno: »Tabu: Takes und Outtakes«, in: Hans Helmut Prinzler (Hg.), Friedrich Wilhelm Murnau. Ein Melancholiker des Films, Berlin: Bertz 2003, S. 231-234. Patalas, Enno: Metropolis in/aus Trümmern. Eine Filmgeschichte, Berlin: Bertz 2001. Pfäfflin, Friedemann: »Kinderliebe, Pädophilie und pädosexuelle Straftaten. M – eine Stadt sucht einen Mörder«, in: Stephan Doering/Heidi Möller (Hg.), Frankenstein und Belle de Jour. 30 Filmcharaktere und ihre psychischen Störungen, Heidelberg: Springer Medizin 2008, S. 355-363. Prinzler, Hans Helmut (Hg.): Friedrich Wilhelm Murnau. Ein Melancholiker des Films, Berlin: Bertz 2003. Reich, Wilhelm: Der Einbruch der Sexualmoral. Zur Geschichte der sexuellen Ökonomie, Berlin, Leipzig, Wien: Verlag für Sexualpolitik 1931. Rogin, Michael: Blackface, White Noise. Jewish Immigrants in the Hollywood Melting Pot, Berkeley, L.A.: University of California Press 1996. Rohmer, Eric: »Was denkt Eric Rohmer zu Murnau. Gespräch mit Frieda Grafe und Enno Patalas«, in: Friedrich Wilhelm Murnau (= Reihe Film 43, hg. v. Peter W. Jansen u. Wolfram Schütte in Zusammenarbeit mit der Stiftung Deutsche Kinemathek), München, Wien: Carl Hanser 1990, S. 71-106. 200
Literatur
Rohmer, Eric: Murnaus Faustfilm. Analyse und szenisches Protokoll, München, Wien: Carl Hanser 1980. Roth, Joseph: Rez. »Der letzte Mann« (Frankfurter Zeitung v. 8.1.1925), in: Hans Helmut Prinzler (Hg.), Friedrich Wilhelm Murnau. Ein Melancholiker des Films, Berlin: Bertz 2003, S. 165-167. Rubin, Martin: »The Police Thriller«, in: ders., Thrillers, Cambridge: Cambridge University Press 1999, S. 242-258. Sander-Brahms, Helma: »›So deutsch, so schön‹«, in: Hans Helmut Prinzler (Hg.), Friedrich Wilhelm Murnau. Ein Melancholiker des Films, Berlin: Bertz 2003, S. 185-188. Schenk, Irmbert: Dschungel Großstadt. Kino und Modernisierung, Marburg: Schüren 1999. Schérer, René: »Gilles Deleuze: l’écriture et la vie«, in: Yannick Beaubatie (Hg.), Tombeau de Gilles Deleuze, Tulle: Mille Sources 2000, S. 75-90. Schiller, Friedrich: »Über Anmut und Würde«, in: ders., Kallias oder über die Schönheit/Über Anmut und Würde, hg. v. Klaus L. Berghahn, Stuttgart: Reclam 1991, S. 67-136. Schindler, Stephan: »What makes a man a man. The construction of masculinity in F.W. Murnau’s The Last Laugh«, in: Screen 37/1 (1996), S. 30-40. Schlegel, Friedrich: »Athenäums-Fragmente«, in: ders., Kritische Ausgabe, Bd. 2: Charakteristiken und Kritiken I (1796-1801), hg. v. Hans Eichner, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1967, S. 165-255. Schmeling, Manfred: Der labyrinthische Diskurs. Vom Mythos zum Erzählmodell, Frankfurt a.M.: Athenäum 1987. Schmid, Eva M.J.: »Magie der Zeichen. Murnau und die bildende Kunst«, in: Klaus Kreimeier (Hg.), Die Metaphysik des Dekors. Raum, Architektur und Licht im klassischen deutschen Stummfi lm, Marburg, Berlin: Schüren 1994, S. 49-79. Schmidt, Arno: »Kaff auch Mare Crisium«, in: ders., Werke, Studienausgabe, Bd. I/3, hg. v. der Arno Schmidt Stiftung, Red.: Wolfgang Schlüter, Zürich: Haffmans 1987, S. 7-278. Schmölders, Claudia: Das Vorurteil im Leibe. Einführung in die Physiognomik, Berlin: Akademie 1997. Schwab, Lothar: »Sunrise – A Song of Two Humans«, in: Michael Töteberg (Hg.), Metzler Film Lexikon, 2., aktualisierte u. erweiterte Aufl., Stuttgart: Metzler 2005, S. 612-613. Schweinitz, Jörg (Hg.): Prolog vor dem Film. Nachdenken über ein neues Medium 1909-1914, Leipzig: Reclam 1992. Sedgwick, Eve Kosofsky: Touching Feeling. Affect, Pedagogy, Performativity, 2. Aufl., Durham, London: Duke University Press 2004. Silverman, Kaja: The Subject of Semiotics, New York, Oxford: Oxford University Press 1983. Steinbauer-Grötsch, Barbara: Die lange Nacht der Schatten. Film noir und Filmexil, Berlin: Bertz 2000.
201
Schat tenbilder – Lichtgestalten
Steinborn, Bion: »F.W. Murnau – der deutsche Virtuose der kinematographischen Mittel oder Die drei Bedingungen für Filmregie und Filmkritik«, in: Filmfaust 2 (1979), H. 12, S. 2-21. Stiles, Victoria M.: »Fritz Lang’s Definitive Siegfried and its Versions«, in: Literature/Film Quarterly 13/4 (1985), S. 258-274. Stiles, Victoria M.: »The Siegfried Legend and the Silent Screen. Fritz Lang’s Interpretation of a Hero Saga«, in: Literature/Film Quarterly 8/4 (1980), S. 232-236. Sudermann, Hermann: »Die Reise nach Tilsit«, in: ders., Die Reise nach Tilsit/Jolanthes Hochzeit, hg. v. Heinz-Peter Niewerth, Berlin: Nicolai 1989, S. 5-46. Theweleit, Klaus: absolute(ly) Sigmund Freud Songbook, Freiburg i.Br.: orange press 2006. Theweleit, Klaus: Buch der Könige 2x. Orpheus am Machtpol, Basel, Frankfurt a.M.: Stroemfeld/Roter Stern 1994. Theweleit, Klaus: Buch der Könige 2y. Recording angels‹ mysteries. Basel, Frankfurt a.M.: Stroemfeld/Roter Stern 1994. Theweleit, Klaus: Männerphantasien 1 & 2, München, Zürich: Piper 2000. Töteberg, Michael: Fritz Lang, Reinbek: Rowohlt 1985. Trenz, Hans-Jörg: »Das Kino als symbolische Form von Weltgesellschaft«, in: Berliner Journal für Soziologie 15/3 (2005), S. 401-417. Truffaut, François: »Eine gewisse Tendenz im französischen Film«, in: ders., Die Lust am Sehen, Frankfurt a.M.: Verlag der Autoren 1999, S. 295-313. Tykwer, Tom: »Sometimes Bitter, Sometimes Sweet«, in: Hans Helmut Prinzler (Hg.), Friedrich Wilhelm Murnau. Ein Melancholiker des Films, Berlin: Bertz 2003, S. 199-202. Vaget, Hans Rudolf: Seelenzauber. Thomas Mann und die Musik, Frankfurt a.M.: S. Fischer 2006. Warburg, Aby: »Sandro Botticellis ›Geburt der Venus‹ und ›Frühling‹ (1893)«, in: ders., Gesammelte Schriften. Studienausgabe. Erste Abteilung, Bd. 1.1: Die Erneuerung der heidnischen Antike. Kulturwissenschaftliche Beiträge zur Geschichte der europäischen Renaissance, Reprint der von Gertrud Bing edierten Ausgabe von 1932, neu hg. v. Horst Bredekamp u. Michael Diers, Berlin: Akademie 1998, S. 1-59. Weihsmann, Helmut: »Virtuelle Räume. Die Formensprache der Neuen Sachlichkeit bei Friedrich Wilhelm Murnau«, in: Klaus Kreimeier (Hg.), Die Metaphysik des Dekors. Raum, Architektur und Licht im klassischen deutschen Stummfi lm, Marburg, Berlin: Schüren 1994, S. 22-48. Weinberger, Eliot: »The Camera People«, in: Transition 55 (1992), S. 24-54. Welsch, Tricia: »Sound Strategies. Fritz Lang’s Rearticulation of Jean Renoir«, in: Cinema Journal 39/3 (2000), S. 51-65. Werner, Gösta: »Fritz Lang and Goebbels. Myth and Facts«, in: Film Quarterly 43/3 (1990), S. 24-27. Wessel, Kai: »Technische Innovation und soziales Drama«, in: Hans Helmut Prinzler (Hg.), Friedrich Wilhelm Murnau. Ein Melancholiker des Films, Berlin: Bertz 2003, S. 169-171. 202
Literatur
Wild, Daniel: The Writing on the Screen. Images of Text in the German Cinema from 1920 to 1949, Diss., University of Pittsburgh 2006 (auch Mikrofiche: Ann Arbor: ProQuest, 2007). Zentgraf, Eduard: Wald und Volk, Langensalza: Hermann Beyer & Söhne 1923.
203
Abbildungsnachweise
Die Bilder aus Der letzte Mann, Tartüff und Faust werden abgedruckt mit freundlicher Genehmigung der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung, Wiesbaden. Die Bilder aus M werden wiedergegeben mit freundlicher Genehmigung der Praesens-Film AG, Zürich. Die Photographie der »Daphne als Trinkgefäß« von Abraham Jamnitzer (Nürnberg, Ende 16. Jahrhundert; Silber, größtenteils vergoldet, Koralle; Höhe: 68 cm; Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Grünes Gewölbe, Inv. Nr. IV 260) wurde aufgenommen von Jürgen Karpinski und wird abgedruckt mit freundlicher Genehmigung der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden.
205
Autorenverzeichnis
Maik Bozza, geb. 1978, studierte Neuere deutsche Literatur, Philosophie und Rhetorik in Tübingen. 2005-2007 war er Wiss. Angestellter am Dt. Seminar der Uni Tübingen und Mitarbeiter bei der Tübinger Poetik-Dozentur, seit 2007 ist er Wiss. Angestellter am Stefan George-Archiv in der WLB, Stuttgart. Er schreibt an einer Dissertation zu Alfred Döblin und arbeitet zum Schelmenroman im 17. Jahrhundert. Zuletzt erschienen die Aufsätze Das Martyrium der Ehrlichen Frau und die Geburt des Schelms (Daphnis 36, 2007) und Bilder aus der ›Gaukel-Tasche‹ (Oxford German Studies 37, 2008). Michael Herrmann, geb. 1966, studierte Neuere deutsche Literatur, Philosophie und Soziologie in Tübingen. 2000-2002 Wiss. Angestellter am Dt. Seminar der Uni Tübingen, 2006-2008 Mitarbeit am Projekt Konstruktion von Vergangenheit als Raum des Politischen der Heidelberger Akademie der Wissenschaften (WIN-Kolleg), seit 2002 Lehraufträge am Dt. Seminar der Uni Tübingen sowie 2003-2008 am dortigen Leibniz Kolleg. Er arbeitet an einer Dissertation zum Spätwerk Paul Celans und ist Mitglied der Tübinger Autoren- und Künstlergruppe Holzmarkt. Zuletzt erschien: Die Ferien des Dr. Tulp. Gesammelte Bruchstücke (2006). Wolfgang Kasprzik, geb. 1953, Studium der Philosophie, Evangelischen Theologie und Germanistik. Nach Vikariat und Assistententätigkeit am Institut für Hermeneutik in Tübingen längere Zeit Lektor des Theologischen Verlags Zürich, z.Zt. freiberuflich tätig, hauptsächlich für die Udo Keller Stiftung – Forum Humanum und das Forum Scientiarum in Tübingen. Aufsätze zu Schleiermacher und zur Kunst der Gegenwart. Sascha Keilholz, geb. 1978, Studium der Filmwissenschaft und AVL in Berlin. Seit 2007 ist er Wiss. Mitarbeiter am Lehrstuhl für Medienwissenschaften in Regensburg und promoviert zum Amerikanischen Polizeifi lm. Er ist Mitinitiator der Filmreihen Debut im Berliner Babylon und Spotlights im Regensburger Andreasstadel, Mitbegründer und Mitglied der Chefredaktion von critic.de, freier Autor und Lektor u.a. für den NDR. Forschungsschwerpunkte: American Independent Cinema, New Hollywood, Amerikanisches Genrekino. Neben zahlreichen Rezensionen erschien zuletzt 207
Schat tenbilder – Lichtgestalten
Zerfallstudien – Verlusterfahrungen im Nordamerikanischen Independent Kino 1991-2002 (2009). Stefan Kleie, geb. 1980, Studium der Neueren deutschen Literatur, der Alten Geschichte und Musikwissenschaft in Dresden und Tübingen (1999-2006). Seit 2007 ist er Doktorand innerhalb des Pro*Docs »Intermediale Ästhetik« in Basel (Modul »Ritual und Spiel«) mit einem Thema zu den Opernlibretti Hofmannsthals. Manfred Koch, geb. 1955, studierte Philosophie, Germanistik und Geschichte in Tübingen. 1987 Promotion, 1988-1991 DAAD-Lektor an der Uni Thessaloniki, Griechenland, 1992-1998 Wiss. Assistent am Germanistischen Seminar der Uni Gießen, 2001 Habilitation, 2001-2003 Lehrstuhlvertretung am Dt. Seminar d. Uni Tübingen, 2004-2007 Mitorganisator der Tübinger Poetikdozentur, seit 2009 Dozent an der Uni Basel. Seit 1996 freier Mitarbeiter im Feuilleton der Neuen Zürcher Zeitung. Zahlreiche Erscheinungen zur dt. Literatur, zuletzt Hölderlins württembergisches Manifest (2006); mehrere literarische Anthologien (zus. mit Angelika Overath). 2009 erscheint der Essay Brot und Spiele. Versuch über die Religion des Sports. Philipp A. Ostrowicz, geb. 1975, studierte Neuere deutsche Literatur, Deutsche Linguistik, Neuere Geschichte und Rhetorik in Braunschweig, Florenz und Tübingen. Er war von 2004-2009 Wiss. Angestellter am Dt. Seminar d. Uni Tübingen und leitet seit 2007 die Jury des Würth-Literaturpreises. Seit 2009 ist er Projekt-Manager an der Syddansk Universitet (Odense, Dänemark). Er promoviert über »Die Ästhetik der Unschärfe in der Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts«. Zuletzt erschien 2005 Die Poetik des Möglichen zu Marcel Beyers Flughunde. Rainer Schelkle, geb. 1978, studierte in Tübingen Neuere englische Literatur, Romanistik und Empirische Kulturwissenschaft. Ab 2009 ist er Wiss. Angestellter am Engl. Seminar der Uni Tübingen. Der Titel seines Promotionsprojekts lautet »Realities and realisms of postmodernity: readings of A. L. Kennedy, David Foster Wallace and David Chase’s The Sopranos«. Titel der letzten (bisher unveröffentlichten) Arbeit: »Blake in Amerika, Amerika in Blake. Jim Jarmuschs Dead Man, William Blake und die Indianer Nordamerikas«. Alfred Stumm, geb. 1977, studierte Neuere deutsche Literatur, Philosophie und Kunstgeschichte in Tübingen und Paris. 2007 war er Teaching Assistant an der Brown University in Providence, seit 2008 mit Unterbrechungen Wiss. Angestellter am Dt. Seminar der Uni Tübingen. Ab 2009 ist er Mitglied der Graduiertenschule des Exzellenzclusters »Languages of Emotion« an der FU Berlin mit dem Promotionsprojekt »Wütende Texte. Zu einer literarischen Präsentationsform des Furors«, darüber hinaus geht er Forschungsinteressen zu Goethes Lyrik und Uwe Johnson nach. 208
ZfK – Zeitschrift für Kulturwissenschaften
Karin Harrasser, Helmut Lethen, Elisabeth Timm (Hg.)
Sehnsucht nach Evidenz Zeitschrift für Kulturwissenschaften, Heft 1/2009 Mai 2009, 128 Seiten, kart., 8,50 €, ISBN 978-3-8376-1039-0 ISSN 9783-9331
ZFK – Zeitschrift für Kulturwissenschaften Der Befund zu aktuellen Konzepten kulturwissenschaftlicher Analyse und Synthese ist ambivalent: Neben innovativen und qualitativ hochwertigen Ansätzen besonders jüngerer Forscher und Forscherinnen steht eine Masse oberflächlicher Antragsprosa und zeitgeistiger Wissensproduktion – zugleich ist das Werk einer ganzen Generation interdisziplinärer Pioniere noch wenig erschlossen. In dieser Situation soll die Zeitschrift für Kulturwissenschaften eine Plattform für Diskussion und Kontroverse über Kultur und die Kulturwissenschaften bieten. Die Gegenwart braucht mehr denn je reflektierte Kultur, historisch situiertes und sozial verantwortetes Wissen. Aus den Einzelwissenschaften heraus kann so mit klugen interdisziplinären Forschungsansätzen fruchtbar über die Rolle von Geschichte und Gedächtnis, von Erneuerung und Verstetigung, von Selbststeuerung und ökonomischer Umwälzung im Bereich der Kulturproduktion und der naturwissenschaftlichen Produktion von Wissen diskutiert werden. Die Zeitschrift für Kulturwissenschaften lässt gerade auch jüngere Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen zu Wort kommen, die aktuelle fächerübergreifende Ansätze entwickeln.
Lust auf mehr? Die Zeitschrift für Kulturwissenschaften erscheint zweimal jährlich in Themenheften. Bisher liegen die Ausgaben Fremde Dinge (1/2007), Filmwissenschaft als Kulturwissenschaft (2/2007), Kreativität. Eine Rückrufaktion (1/2008), Räume (2/2008) und Sehnsucht nach Evidenz (1/2009) vor. Die Zeitschrift für Kulturwissenschaften kann auch im Abonnement für den Preis von 8,50 € je Ausgabe bezogen werden. Bestellung per E-Mail unter: [email protected] www.transcript-verlag.de
Film Catrin Corell Der Holocaust als Herausforderung für den Film Formen des filmischen Umgangs mit der Shoah seit 1945. Eine Wirkungstypologie Juni 2009, 520 Seiten, kart., zahlr. Abb., 39,80 €, ISBN 978-3-89942-719-6
Daniel Devoucoux Mode im Film Zur Kulturanthropologie zweier Medien 2007, 350 Seiten, kart., zahlr. Abb., 34,80 €, ISBN 978-3-89942-813-1
Dagmar Hoffmann (Hg.) Körperästhetiken Filmische Inszenierungen von Körperlichkeit Oktober 2009, ca. 286 Seiten, kart., zahlr. Abb., ca. 28,80 €, ISBN 978-3-8376-1213-4
Leseproben, weitere Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie unter www.transcript-verlag.de
2009-08-05 15-45-34 --- Projekt: transcript.anzeigen / Dokument: FAX ID 02f2217380612390|(S.
1-
4) ANZ1103.p - Seite 1 217380612414
Film Gesche Joost Bild-Sprache Die audio-visuelle Rhetorik des Films 2008, 264 Seiten, kart., zahlr. Abb., 25,80 €, ISBN 978-3-89942-923-7
Hedwig Wagner Die Prostituierte im Film Zum Verhältnis von Gender und Medium 2007, 324 Seiten, kart., 29,80 €, ISBN 978-3-89942-563-5
Waltraud »Wara« Wende, Lars Koch (Hg.) Krisenkino Filmanalyse als Kulturanalyse: Zur Konstruktion von Normalität und Abweichung im Spielfilm Oktober 2009, ca. 400 Seiten, kart., zahlr. Abb., ca. 29,80 €, ISBN 978-3-8376-1135-9
Leseproben, weitere Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie unter www.transcript-verlag.de
2009-08-05 15-45-35 --- Projekt: transcript.anzeigen / Dokument: FAX ID 02f2217380612390|(S.
1-
4) ANZ1103.p - Seite 2 217380612422
Film Doris Agotai Architekturen in Zelluloid Der filmische Blick auf den Raum 2007, 184 Seiten, kart., zahlr. Abb., 24,80 €, ISBN 978-3-89942-623-6
Joanna Barck Hin zum Film – Zurück zu den Bildern Tableaux Vivants: »Lebende Bilder« in Filmen von Antamoro, Korda, Visconti und Pasolini 2008, 340 Seiten, kart., zahlr. Abb., 32,80 €, ISBN 978-3-89942-817-9
Ulrich Meurer, Maria Oikonomou (Hg.) Fremdbilder Auswanderung und Exil im internationalen Kino April 2009, 250 Seiten, kart., zahlr. Abb., 27,80 €, ISBN 978-3-8376-1122-9
Katrin Oltmann Remake | Premake Hollywoods romantische Komödien und ihre Gender-Diskurse, 1930-1960 2008, 356 Seiten, kart., 29,80 €, ISBN 978-3-89942-700-4
Nathalie Bredella Architekturen des Zuschauens Imaginäre und reale Räume im Film
Sebastian Richter Digitaler Realismus Zwischen Computeranimation und Live-Action. Die neue Bildästhetik in Spielfilmen
September 2009, 186 Seiten, kart., zahlr. Abb., 25,80 €, ISBN 978-3-8376-1243-1
2008, 230 Seiten, kart., zahlr. z.T. farb. Abb., 25,80 €, ISBN 978-3-89942-943-5
Tina Hedwig Kaiser Aufnahmen der Durchquerung Das Transitorische im Film
Nadja Sennewald Alien Gender Die Inszenierung von Geschlecht in Science-Fiction-Serien
2008, 230 Seiten, kart., zahlr. Abb., 27,80 €, ISBN 978-3-89942-931-2
2007, 314 Seiten, kart., zahlr. Abb., 29,80 €, ISBN 978-3-89942-805-6
Klaus Kohlmann Der computeranimierte Spielfilm Forschungen zur Inszenierung und Klassifizierung des 3-D-Computer-Trickfilms
Catherine Shelton Unheimliche Inskriptionen Eine Studie zu Körperbildern im postklassischen Horrorfilm
2007, 300 Seiten, kart., 29,80 €, ISBN 978-3-89942-635-9
2008, 384 Seiten, kart., 34,80 €, ISBN 978-3-89942-833-9
Leseproben, weitere Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie unter www.transcript-verlag.de
2009-08-05 15-45-35 --- Projekt: transcript.anzeigen / Dokument: FAX ID 02f2217380612390|(S.
1-
4) ANZ1103.p - Seite 3 217380612430
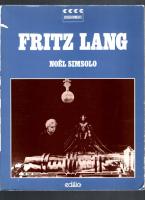



![Übersetzung und Film: Das Kino als Translationsmedium [1. Aufl.]
9783839420812](https://ebin.pub/img/200x200/bersetzung-und-film-das-kino-als-translationsmedium-1-aufl-9783839420812.jpg)
![V/Erkennungsdienste, das Kino und die Perspektive der Migration [1. Aufl.]
9783839425756](https://ebin.pub/img/200x200/v-erkennungsdienste-das-kino-und-die-perspektive-der-migration-1-aufl-9783839425756.jpg)
![Fremdbilder: Auswanderung und Exil im internationalen Kino [1. Aufl.]
9783839411223](https://ebin.pub/img/200x200/fremdbilder-auswanderung-und-exil-im-internationalen-kino-1-aufl-9783839411223.jpg)

![Kino der Lüge [1. Aufl.]
9783839401804](https://ebin.pub/img/200x200/kino-der-lge-1-aufl-9783839401804.jpg)
![Durchkreuzte Helden: Das »Nibelungenlied« und Fritz Langs Film »Die Nibelungen« im Licht der Intersektionalitätsforschung [1. Aufl.]
9783839426470](https://ebin.pub/img/200x200/durchkreuzte-helden-das-nibelungenlied-und-fritz-langs-film-die-nibelungen-im-licht-der-intersektionalittsforschung-1-aufl-9783839426470.jpg)