Wesen und Funktion der Sterberede im elisabethanischen Drama 9783111326122, 9783110982961
226 84 17MB
German Pages 182 [184] Year 1964
Meinen Eltern
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
I. Einleitung
II. Das Verhältnis Des Elisabethaners Zum Tode
III. Charakterisierung Repräsentativer Sterbereden Im Elisabethanischen Drama: Längsschnitt
IV. Untersuchung Der Sterbereden: Querschnitt
V. Zusammenfassung Und Ausblick
Anhang:Tabellen I-III
Literaturverzeichnis
Recommend Papers

- Author / Uploaded
- Rudolf Böhm
File loading please wait...
Citation preview
Britannica et Americana (Britannica, neue Folge)
Herausgegeben von den Englischen Seminaren der Universitäten Hamburg und Marburg / Lahn (Prof. Dr. Ludwig Borinski, Prof. Dr. Walther Fischer f, Prof. Dr. Rudolf Haas und Prof. Dr. Horst Oppel)
Band 13
Wesen und Funktion der Sterberede elisabethanischen Drama von
Rudolf Böhm
1964 Cram, de Gruyter £ Co., Hamburg
A n g e n o m m e n als Dissertation von der Philosophischen Fakultät der Universität Marburg und gedruckt mit freundlicher Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft
© Copyright 1964 by Cram, de Gruyter & Co., Hamburg Alle Rechte einschließlich der Übersetzungsrechte u n d der Rechte auf Herstellung von Photokopien u n d Mikrofilmen vorbehalten. Printed in Germany. Gesamtherstellung: Gustav Peters, Lüneburg
MEINEN
ELTERN
Inhaltsverzeichnis
Verzeichnis der Abkürzungen
9
I. Einleitung
11
II. Das Verhältnis des Elisabethaners zum T o d e
.
.
.
.
17
1. Zeitgeschichtliche Anlässe und Zeugnisse
17
2. Innere Einstellung und Haltung
32
3. Sterbereden
38
III. Charakterisierung repräsentativer S t e r b e r e d e n im elisabethanisdien Drama: Längsschnitt
42
1. Gismond of Salerne
42
2. Cambises
45
3. Locrine
49
4. The Troublesome
Reign of King John .
.
.
.
.
.
.
56
5. The Spanish Tragedy
61
6. Tamburlaine the Great
65
7. Doctor
74
Faustus
8. The Jew of Malta
76
9. King Edward II
79
10. The Battle of Alcazar
83
11. Orlando Furioso
86
12. Titus Andronicus
88
13. The First Part of King Henry VI
91
14. The Second Part of King Henry VI
95
15. The Third Part of King Henry VI
99
16. The Tragedy of King Richard III
104
17. The Life and Death of King John
108
18. Romeo
and Juliet
Ill
19. The Tragedy of King Richard II
115
20. The First Part of King Henry IV
118
21. The Second Part of King Henry IV
119
22. The Life of King Henry V
121
IV. U n t e r s u c h u n g der S t e r b e r e d e n : Querschnitt
.
.
.
.
124
1. Äußere Merkmale
124
2. Wiederkehrende Elemente
127
3. Beziehung zur Figur
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
137
4. Beziehung zur Todesart
.
.
.
.
.
.
.
.
.
142
5. Stil und Sprache V. Z u s a m m e n f a s s u n g u n d Ausblick
144 149
A n h a n g : T a b e l l e n I—III
162
Literaturverzeichnis
172
Abkürzungsverzeichnis Anglia Archiv CHEL CritQ DVJs E&S EIC ELH ES HLQ JEGP JHI MLR MP NS PMLA PQ SJ SP SQ 2AA
Anglia: Zeitschrift für englische Philologie Archiv für das Studium der Neueren Sprachen The Cambridge History of English Literature The Critical Quarterly Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte Essays and Studies by Members of the English Association Essays in Criticism A Journal of English Literary History English Studies The Huntington Library Quarterly Journal of English and Germanic Philology Journal of the History of Ideas The Modern Language Review Modern Philology Die Neueren Sprachen Publications of the Modern Language Association of America Philological Quarterly Shakespeare Jahrbuch Studies in Philology Shakespeare Quarterly Zeitschrift für Anglistik und Amerikanistik
A&Cl Alph. Arden Ath. Tr. A&V Battle B.D'A Bond. Br.H. By. Tr. Camb. Ch. Cromw. D &B Dido Dud>. EI E II E III F Fam.Vict. Gism. Gorb. A HIV
Antony and Cleopatra Alphonsus King of Arragon Arden of Feversham The Atheist's Tragedy; or, The Honest Man's Revenge Appius and Virginia The Battle of Alcazar Bussy D'Ambois Bonduca The Broken Heart The Tragedy of Charles Duke of Byron Cambises The Changeling Thomas Lord Cromwell David and Bethsabe Dido Queen of Carthage The Duchess of Malfi King Edward I. King Edward II. King Edward III. Doctor Faustus The Famous Victories of King Henry V. Gismond of Salerne Gorboduc The First Part of King Henry IV.
B HIV HV AH VI BHVI
The Second Part of King Henry IV. The Life of King Henry V. The First Part of King Henry VI. The Second Part of King Henry VI. CHVI The Third Part of King Henry VI. H VIII The Famous History of the Life of King Henry HAML. Hamlet, Prince of Denmark HOT. Horestes Julius Caesar JC Jew The Jew of Malta Joe. Jocasta Joban Kynge Johan John The Life and Death of King John L.Dom. Lust's Dominion; or, the Lascivious Queen Lear King Lear Locr. Locrine Look.Gl. A Looking Glass for London and England L.Sacr. Love's Sacrifice Macb. Macbeth Mass. The Massacre at Paris Misf. The Misfortunes of Arthur More Sir Thomas More M.Tr. The Maid's Tragedy N.Sp.S. The Noble Spanish Soldier Orl. Orlando Furioso Oth. Othello, the Moor of Venice PW Perkin Warbeck RII The Tragedy of King Ridiard II. R III The Tragedy of King Ridiard III. Rev.B.D'A. The Revenge of Bussy D'Ambois Rev.Tr. The Revenger's Tragedy R&J Romeo and Juliet Sej. Sejanus Sel. The Tragical Reign of Selimus S&P Soliman and Perseda Sp.Tr. The Spanish Tragedy Straw Life and Death of Jack Straw TA Titus Andronicus Tamb. Tamburlaine the Great Tancr. Tancred and Gismunda Timon Timon of Athens 'TisP. 'Tis Pity She's a Whore Tr&Cr Troilus and Cressida Tr.R. The Troublesome Reign of King John Wars The Wars of Cyrus W.B.W. Woman Beware Woman Wh.D. The White Devil; or, Vittoria Corombona Woodst. Woodstock Wounds The Wounds of Civil War Wyatt Sir Thomas Wyatt
VIII.
I. Einleitung Form und Bedeutung der dramatischen Rede im elisabethanischen Drama haben gerade in den letzten Jahren zunehmende Beachtung gefunden. Besonders umfassend und auch methodisch richtungweisend ist das Buch von W. Clemen 1 ), das uns durch die Untersuchung der Rede einen Zugang zur Entwicklungsgeschichte des vorshakespearesdien Dramas eröffnet. Clemen geht darin über eine Stilanalyse hinaus, um auch die zum Ausdruck gebrachten Inhalte betrachten und die Herausbildung einer Vielzahl verschiedener Redetypen feststellen zu können. Wesentlich spezieller, beinahe katalogartig, ist Sister M. Josephs umfangreiches Werk aufgebaut, in dem die Verbindung zu den antiken rhetorischen Formen hergestellt wird 2 ). Die Bedeutung der Rhetorik als einer Lehre der Sprachgebung, die Fragen ihres Einflusses auf die Dichtung und der große Reichtum rhetorischer Stilfiguren auch im Werke Shakespeares werden gewürdigt in Aufsätzen von K . L. Klein 3 ) oder K . Muir 4 ). M. B. Kennedy versucht, Shakespeares Reden in die drei aus der antiken Rhetorik überlieferten Arten der Beredsamkeit — Gerichtsrede, beratende Rede und Lob- oder Preisrede — einzuordnen 5 ). Andere Arbeiten leisten einen Beitrag zur Erforschung der dramatischen Rede, indem sie etwa die in ihr enthaltenen Handlungselemente und gestischen Ausdrucksmittel 6 ) oder die bildhaften Darstellungsmöglichkeiten untersuchen 7 ). Alle diese speziellen oder die dramatische Rede nur nebenbei betreffenden Studien, zu denen auch Untersuchungen über die Darstellungsweise in Vers oder Prosa 8 ) oder die Verwendung von Wortspielen 9 )
') Die Tragödie vor Shakespeare: Ihre Entwicklung im Spiegel der dramatischen Rede, Schriftenreihe der Dt. Sh.-Gesellsdiafl, N. F. Bd. V (Heidelberg, 1955). 2) Shakespeare's Use of the Arts of the Language (New York, 1947). *) "Rhetorik und Diditungslehre in der elisabethanischen Zeit", Festschrift z. 7.5. Geburtstag v. Th. Spira, hrsg. v. H . Viebrock und W . Erzgräber (Heidelberg, 1961), S. 1 6 4 - 1 8 3 . 4 ) "Shakespeare and Rhetoric", SJ, X C (1954), 4 9 — 6 8 . 5) The Oration in Shakespeare (Chapel Hill, 1942). 6 ) A. Gerstner-Hirzel, "Stagecraft and Poetry", SJ, X C I (1955), 196—211; Ders., The Economy of Action and Words in Shakespeare's Plays, The Cooper Monographs on English and American Language and Literature (Bern, 1957). ' ) W . Clemen, The Development of Shakespeare's Imagery (London, 1951, repr. 1 9 5 3 ) ; C. Spurgeon, Shakespeare's Imagery and what it tells us (Cambridge, 1935, repr. 1958). 8 ) T. Eichhorn, "Prosa und Vers im vorshakespearesdien D r a m a " , SJ, L X X X I V / L X X X V I (1950), 1 4 0 - 1 9 8 ; M. Crane, Shakespeare's Prose (Chicago, 1 9 5 2 ) ; E . Tschopp, Zur Verteilung von Vers und Prosa in Shakespeares Dramen, Schweizer Anglistische Arbeiten, Bd. X L I (Bern, 1956). 9 ) M. M. Mahood, Shakespeare's Wordplay (London, 1957).
11
gerechnet werden können, machen ersichtlich, welche Bedeutung der Rede als zentralem Ausdrudesinstrument zukommt: sie ist "zunächst das alleinige Mittel für die Darstellung der Charaktere, ihrer Gemütszustände und Handlungsimpulse, aber audi für die Verdeutlichung des dramatischen Gehaltes, ja selbst für die Darlegung des Handlungsverlaufes" 10 ). "Was nun diesen Handlungsverlauf angeht, so zeigt es sich, daß bestimmte, häufig wiederkehrende Situationen 11 ) die Entwicklung von Konventionen für entsprechende Redetypen begünstigt haben, so daß geradezu von situationsgebundenen Reden gesprochen werden kann. Solche Grundtypen scheinen in ihrer Formenvielfalt über die drei Genera der antiken Rhetorik hinauszugehen 12 ). Der kurze Katalog solcher Reden, den Clemen zusammengestellt hat 1 3 ), mag als Illustration dienen. Exponierende und damit meist statische Reden sind Situationsüberschau, Bericht-, Planungs- und Entschließungsrede. Im eigentlichen Sinne 'dramatisch' ist die Umstimmungsrede, die durch einen Willenskampf ausgelöst wird 14 ), und ihre Varianten Beschwichtigungs-, Anspornungs- und Ermahnungsrede, Werbungs- und Bittrede sowie die Beratungsrede. Weitere Redetypen sind Lobund Preisrede, Triumph-, Begrüßungs- und Herausforderungsrede, Gerichts-, Anklage-, Verteidigungs- und Schlußrede. Den zahlenmäßig stärksten Anteil bilden die 'Affektreden', zu denen die Klage-, Fluch-, Rache- und Sterberede gehören. Diese situationsgebundenen Reden kommen selbstverständlich nicht in jedem Drama in gleicher Häufigkeit vor, und es gibt sicher kein Einzelwerk, das sie alle enthielte. Ein Blick auf Shakespeares Richard III. mag jedoch den hohen Entwicklungsstand um 1593 bezeugen: das Schlagwortregister zu W. Clemens Interpretationsband 15 ) führt zu dem Stichwort 'typische Reden' Beispiele an für Abschiedsrede, Anspornungsrede, Beratungsrede, Fluchrede, Klagerede, Reuerede, Staatsrede, Sterberede, Umstimmungsrede und Verstellungsrede. Der Gegenstand der vorliegenden Untersuchung ist die Sterberede als Einzelform unter den situationsgebundenen Reden. Die Tatsache, daß Sterbereden — ebenso wie alle anderen Redetypen — häufig auch Elemente anderer Redeformen enthalten, also nicht immer rein und unvermischt auftreten, erklärt es, daß in Clemens Werk unter dem Oberbegriff der Klagerede auch Sterbereden mitbehandelt werden konnten 16 ). Es wäre jedoch irrig, daraus schließen zu wollen, daß vor dem Tode gehaltene Reden stets Klagereden und folglich eine Sonderform dieses Redetypus seien und daß die Benennung 'Sterbe'-Rede ledig-
10 ) n)
,2) 13)
14)
15) 16)
12
Clemen, Tragödie vor Shakespeare, S. 10. Vgl. F. Hoffmann, Die typischen Situationen im elisabethanischen Drama (Diss. München, 1954). Hierzu vgl. E. R. Curtius, Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter (Bern, München, 3. Aufl. 1961), S. 77/78; Clemen, Tragödie vor Shakespeare, S. 44—46. Tragödie vor Shakespeare, S. 46—49. Dazu vgl. L. L. Schücking, Shakespeare und der Tragödienstil seiner Zeit, Sammlung Dalp, Bd. XLV (Bern, 1947) und Horst Oppel, "Zur Problematik des Willenskampfes bei Shakespeare", SJ, L X X X I X (1953), 72-105. Kommentar zu Shakespeares Richard III.: Interpretation eines Dramas (Göttingen, 1957). Tragödie vor Shakespeare, Kap. X I I .
lieh die Rede-Situation bezeichne. Im Verlaufe der Untersuchung wird verschiedentlich auf Elemente anderer Redeformen hinzuweisen sein: insbesondere solche der Fluch-, Umstimmungs-, Belehrungs- oder Beriditrede. Im ganzen betrachtet ist die Sterberede jedoch ein selbständiger Redetypus, der aus verschiedenen Gründen zu einer eingehenderen Beschäftigung reizt. So wird das Augenmerk den in Ubersteigerung und Schrumpfung der reinen Rhetorik begründeten Grenzen der Sterberede zu gelten haben. Daraus ergeben sich Fragen wie die folgenden: Ist nicht diese Redeform wegen des besonderen Charakters einer Grenzsituation im menschlichen Leben der Gefahr einer Ubersteigerung rhetorischer Darstellungsweisen weniger ausgesetzt als etwa die Lob- und Preisrede? Soweit jedoch rhetorische Elemente völlig in den Hintergrund treten, bleibt zu erörtern, ob dann nicht auch die Form der Rede aufgehoben wird. Andere Probleme ergeben sich aus dem weltanschaulichen Gehalt der Sterberede: darf man in ihr einen Niederschlag elisabethanischer Glaubenslehre sehen bis hin zur Theodizee? Auch die Verbindung zur elisabethanischen phllosophy of history17), wie sie etwa in Gaunts Sterberede zum Ausdruck kommt (vgl. Richard IL, II, i, 1 ff.), erfordert besondere Aufmerksamkeit: wie ist die kritische Spannung zur dramatischen Szene nutzbar gemacht worden? Diese lebt aus konkreten Anlässen und persönlichen Entscheidungen der jeweiligen Dramenfigur, duldet aber meist nichts Allgemeines. Weil Shakespeares 'klassizistische Gegenspieler'18) dies nicht erkennen, wirken sie so bühnenfremd. Im Ausspielen der Szene besteht dagegen die große Wirkungskraft des elisabethanischen populär play, von der auch die Sterberede zeugt. Diese ist ein Musterbeispiel dafür, wie tradierte Elemente ein langes und beständiges Leben führen, aber doch ganz allmählich verändert und umgeschmolzen werden. Bevor sich die Untersuchung im folgenden mit Bemerkungen zur Auswahl der Dramen und zu Ziel und Aufbau der Arbeit dem eigentlichen Thema zuwendet, bedarf es noch einiger Erläuterungen zum Begriff der Sterberede. Unter 'Sterberede' werden hier die letzten Worte verstanden, die im Bewußtsein des unmittelbar bevorstehenden eigenen Todes gesprochen werden. Voraussetzung ist also in jedem Fall das Wissen um den bevorstehenden Tod 19 ). Dabei ist es gleichgültig, ob dieser auf der Bühne oder off stage erfolgt. Gleichgültig ist " ) Der Ausdruck stammt von I. Ribner, The English History Play in the Age of Shakespeare (Princeton, 1957), S. 5 u. ö. 18 ) W. F. Schirmer, "Shakespeares klassizistische Gegenspieler", Anglia, L X X V I (1958), 90—115. 18 ) Es versteht sich, daß dies Wissen für den Betreffenden nur den Charakter einer hohen Wahrscheinlichkeit haben kann. Als Sterbereden werden hier jedoch nur solche Äußerungen behandelt, die nach der Absicht des Dramatikers letzte Worte sind — nicht dagegen solche, die der Ausdruck subjektiver, durch den weiteren Verlauf nidit bestätigter Vermutungen und Todesahnungen einer Figur sind. Beispiele hierfür finden sich etwa in Wounds of Civil War (A Select Collection of Old English Plays, Originally Published by Robert Dodsley in the Year 1744. Fourth Edition ... by W. Carew Hazlitt, Bd. VII [London, 1874] — künftig als Dodsley-Hazlitt zitiert), S. 136—139 (Marius) und 161—164 (Cornelia und Fulvia) oder Sir Thomas More (Shakespeare Apocrypha, hrsg. v. C. F. T. Brooke [Oxford, 1908]), III, i, 77—135 (Doli).
13
ferner die Länge der Rede: auch kurze und in Dialog eingegliederte Äußerungen werden als Sterberede erwähnt. Es wird also auf die von Clemen versuchte Abhebung der Rede vom Dialog 20 ) bewußt verzichtet und eine Einbuße an Eindeutigkeit in Kauf genommen, um den vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten der Sterberede und den reichen Ausdrucksvarianten angesichts des Todes gerecht werden zu können. Eine solche Definition darf nur als ordnender Leitfaden verstanden werden, nicht als einengendes Schema; dann können gelegentlich auftauchende Grenzfragen, die dem Buchstaben nach unberücksichtigt bleiben müßten, dem Sinne nach einbezogen werden 21 ). Sonderfälle, die nicht mehr als Sterberede bezeichnet werden, aber in unserem Zusammenhang aufschlußreiche Beobachtungen ermöglichen, werden als solche erwähnt und in den Tabellen in Klammern angeführt. Der Untersuchungszeitraum deckt sich zeitlich etwa mit der Regierung Elisabeths I.. Für die Verwendung des Begriffes 'elisabethanisches Drama' ist jedoch weniger die Vorstellung einer durch historische Daten begrenzten Zeitspanne maßgeblich als vielmehr der Eindruck einer zusammenhängenden Entwicklungslinie, die durch bestimmte, als 'elisabethanisch' bezeichnete gemeinsame Merkmale charakterisiert wird. Unsere Untersuchung setzt ein um das Jahr 1560; sie verfolgt die Entwicklung des ernsten Dramas seit dem allgemein als erste englische Tragödie bezeichneten Gorboduc. Als Vorstufe werden die Sterbereden in Kynge Johan als Wegbereiter einer tragischen Spielart der Historie einbezogen, um aus der Tradition der Moralitäten weitergereichte Vorstellungen erkennen zu können. Der Endpunkt des hier behandelten Zeitraums wird durch Shakespeares Henry V. bezeichnet (etwa 1600). Der Zeitpunkt eines solchen Einschnittes ist anfechtbar, wenn aus einer großen Entwicklungslinie — hier der des Dramas — ein Teilbereich in den Mittelpunkt der Betrachtung gerückt wird. Er läßt sich jedoch um 1600 verhältnismäßig sinnvoll und ungezwungen motivieren. Henry V. ist Shakespeares letzte Historie (Henry VIII. ist ein Nachklang). Damit ist wenigstens für diese bestimmte Dramenart ein Abschnitt gegeben. Gleichzeitig bedeutet dieser Zeitpunkt das Ende der Schaffensperiode des jungen Shakespeare: es kündigt sich ein Umbruch an, der die Phase der großen Tragödien einleitet. Die Grundhaltung ist nicht mehr als proper Elizabethan zu bezeichnen, sondern trägt die Kennzeichen eines zum Jacobean drama hinführenden Übergangsstils 22 ). Die damit ver-
20
) Clemen versteht unter 'Rede' jedes Redestüdc, "das sich durch seine Länge und Gliederung, durch sein Thema oder seine Bedeutung aus dem Dialog merklich heraushebt." (Tragödie vor Shakespeare, S. 9) 21 ) Oft ist es schwierig, den genauen Beginn einer Sterberede zu fixieren: nicht immer ist der tödliche Ausgang einer Verwundung oder einer unbemerkt zugezogenen Vergiftung sofort bewußt; Selbstmorde werden oft Szenen vorher angekündigt, ohne daß man dann schon von einer Sterberede sprechen möchte. Auch aus der häufigen Vermischung mit anderen Redetypen resultiert die Notwendigkeit eines behutsamen Vorgehens. 22 ) Zur Vorstellung von drei Entwicklungsphasen (statt der Zweiteilung Elizabethan — Jacobean) vgl. U. Ellis-Fermor, The Jacobean Drama: An Interpretation (London, 3. Aufl. 1953), S. 1 und Anm.
14
bundenen Veränderungen betreffen auch das Verhältnis zum Tod und seine Darstellung im Drama: der Tod kommt nicht mehr plötzlich, sondern das ganze Leben ist ein Leben auf das Ende hin 23 ). Damit wird sich in vielen Fällen für die Sterberede eine grundsätzliche Grenze ergeben. So kann beispielsweise der ganze letzte Akt des Hamlet als Sterberede angesehen werden: Hamlets Lebensrückblick zeigt bereits seine Ausrichtung auf den Tod an: seine Auseinandersetzung mit dem Lebensende nimmt nicht mehr den Weg rhetorischer Selbstaussage, sondern wird zu inner action, die aus dem äußeren Verhalten zu erschließen ist. Trotzdem reißt hier die Konvention der Sterberede nicht völlig ab, und übernommene Klischeevorstellungen für Gehalt, Aufbau und Darbietungsweise lassen sich noch sehr viel später nachweisen. Ein Ausblick auf die Verwendung der Sterberede nach 1600 und ihre Weiterentwicklung ist daher eine Notwendigkeit, der in Kapitel V in knapper Form Rechnung getragen wird. In engem Zusammenhang mit der Abgrenzung des Untersuchungszeitraums steht die Frage der Dramenauswahl. Daß es sich angesichts der großen Anzahl der überlieferten Werke nur um eine Auswahl handeln kann, bedarf keiner Begründung. Es kann allein angestrebt werden, einen verläßlichen Querschnitt zu bieten, d. h. Beispiele von Repräsentationswert heranzuziehen, um der durch Dramengattung, Quelleneinfluß, Stilrichtung und individueller Wirkungsabsicht bedingten Formenvielfalt Genüge zu tun. Auch Produkte von künstlerisch minderem Wert sind einbezogen worden, weil sich der Typus eines Strukturelements häufig gerade dort am reinsten nachweisen läßt 24 ). Im einzelnen enthält die der Untersuchung zugrunde liegende Auswahl Tragödien, Historien und verschiedene Mischtypen; Stoffe aus eigener und fremder, früher und gegenwärtiger Geschichte, aus Bibel und klassischem Altertum. Die Stilarten reichen von der Nachahmung streng klassizistischer Vorbilder bis zu betont volkstümlicher Ausprägung. Die Auswahl enthält ferner anonyme Dramen, Einzelwerke namentlich überlieferter Autoren und das gesamte ernste Dramenwerk anderer bekannter Dramatiker (Kyd, Marlowe, Shakespeare). Die vorliegende Arbeit zielt darauf ab, die Sterberede in aller bezeugten Formenvielfalt darzustellen. Dabei ist als Arbeitshypothese vorausgesetzt, daß die Sterberede tatsächlich ein eigenständiges Strukturelement ist — also in einer unverwechselbaren Form auftritt, die trotz aller äußerlichen Abweichungen die bestimmenden Wesensmerkmale erkennen läßt. Zur Darstellung der Sterberede gehören inhaltliche und sprachliche Analysen, die — in genügender Anzahl und über einen hinreichenden Zeitabschnitt durchgeführt — sowohl die Ausprägung und Weitervermittlung bestimmter typischer Kennzeichen erkennen lassen, als auch die Möglichkeiten einer Variation des Grundtypus demonstrieren. Es wird also möglich sein, Einblick in den individuellen Gestaltungswillen des jeweiligen Dramatikers zu nehmen. In den Fällen, in denen mehrere Werke
2S
M
) U. Ellis-Fermor grenzt diese "preoccupation with death" deutlich ab gegen die elisabethanisdie Lebenshaltung. (Ebd., S. 2)
) Vgl. Clemen, Tragödie vor Shakespeare, S. 16.
15
desselben Autors untersucht werden (Kyd, Marlowe, Peele, Greene und vor allem Shakespeare), können bestimmte persönliche Entwicklungstendenzen erfahrbar werden. Dies Ziel eines möglichst umfassenden Überblicks über den Formenreichtum der Sterberede wird auf zwei methodisch verschiedenen Wegen verfolgt. Nach vorbereitenden Abschnitten über den zeitgeschichtlichen Hintergrund, insbesondere die Beziehung zum Phänomen 'Tod' und die innere Einstellung der Elisabethaner dazu (Kap. I I ) , behandelt das erste Kapitel des Hauptteils (Kap. I I I ) sämtliche Sterbeäußerungen in einer kleineren Anzahl ausgewählter Dramen, die einen repräsentativen Längsschnitt durch den gesamten Untersuchungszeitraum darstellen. Die Untersuchung jedes dieser Dramen wird eingeleitet durch eine zahlenmäßige Zusammenstellung, die den Anteil der Sterbenden an der Gesamtpersonenzahl, die Zahl der auf offener Bühne Sterbenden und die Zahl der gehaltenen Sterbereden enthält 2 5 ). Es folgen Kurzanalysen aller vorkommenden Sterbeäußerungen mit Angaben über Beginn und Länge in Zeilen 2 6 ). In einem ersten Teil wird dann der Gehalt kurz dargestellt und interpretiert, während sich eine zweite Hälfte mit Fragen von mehr technischer Natur beschäftigt: mit der Beziehung der Rede zu Figur und Todesart, mit der Eingliederung in Handlungszusammenhang und aktuelle Situation, mit Aufbau und Darbietungsweise, mit der Funktion für den Handlungsablauf, für die Charakterisierung des betreffenden Sterbenden oder anderer Figuren oder für die Unterrichtung des Publikums. Beachtung finden hier auch Sprache, Stil, Metrik, Redehaltung und mimische oder gestische Begleiterscheinungen, die den Worten Umstehender entnommen werden können. Die Behandlung jedes Dramas wird abgeschlossen durch eine kurze Zusammenfassung gemeinsamer Merkmale. Das zweite Kapitel des Hauptteils (Kap. I V ) verwendet als Ergänzung der Darstellung eine andere Methode. In Form eines Querschnitts wird die Gesamtheit aller herangezogenen Sterbereden unter ganz bestimmten Gesichtspunkten betrachtet. Dieser Teil der Arbeit enthält Darstellung und Interpretation äußerer Merkmale wie Häufigkeit, Länge und Darbietungsweise, eine Zusammenstellung wiederkehrender Bauelemente, ferner Untersuchungen der Beziehung der Sterbereden zur jeweiligen Figur und zur besonderen Todesart und schließt mit Bemerkungen über Stil und Sprache. Alle in diesen beiden Kapiteln gemachten Beobachtungen werden in Kapitel V zusammengefaßt und durch einen Ausblick auf die Weiterentwicklung nach 1600 vervollständigt 2 7 ).
) Diese Angaben sind im Anhang in Tab. I zusammengestellt. ) Diese Daten sind in Tab. II enthalten. 2 7 ) Zahlenangaben über die hierfür neu herangezogenen Dramen sind in Tab. III zusammengestellt. 25
2a
16
n . Das Verhältnis des Elisabethaners z u m T o d e 1. Zeitgeschichtliche Anlässe und Zeugnisse Der Elisabethaner hatte den Tod fast ständig vor Augen; die Tatsache der menschlichen Vergänglichkeit war ihm eindringlich bewußt. Seuchen, Hungersnöte, Kriege, politische und religiöse Verfolgungen und öffentliche Hinrichtungen einer grausamen Justiz waren dafür ebenso verantwortlich wie Hinweise und Ermahnungen in Kirche, Literatur und Kunst. Die Pest spielt in der N o t der Zeit eine besonders große Rolle. " S i e hat ungeheure Opfer gefordert. Ganze Dörfer und kleinere Städte verschwinden, weil die Bevölkerung ausgestorben ist" 1 ). Zwar werden meist bestimmte Jahre angegeben, die seit dem ersten Ausbrechen des 'Schwarzen Todes' in den Jahren 1348/49 als Pestjahre bekannt sind 2 ), man muß sich aber vor Augen halten, daß dies nur die schlimmsten Jahre sind: " I n Shakespeare's day the plague was an annual visitor to London" 3 ). Durch seine Bevölkerungsdichte ist London besonders anfällig. Ein eindrucksvolles Bild der großen Pestwelle, die in den Jahren 1592 und 1593 durch die Lande geht, finden wir etwa in G. B. Harrisons erstem Elizabethan Journal*). D a seit 1592 erstmals eine wöchentliche Zählung und Registrierung der Todesfälle für London und Vororte durchgeführt wird 5 ), kann Harrison einen genauen Überblick geben. So verzeichnet er unter dem 17. Juli 1593: " I n London this last week 149 persons are dead of the plague" (S. 254). In der folgenden Woche sind es bereits 454 — von insgesamt 666 Todesfällen (S. 254). Am 5. Juli lesen wir: " T h e plague is worse than ever this last
*) P. Meißner, England im Zeitalter von Humanismus, Renaissance und Reformation, hrsg. v. H . Kauter (Heidelberg, 1952), S. 405. 2 ) So etwa die Jahre 1362 und 1369 nach W. F. Schirmer, John Lydgate: Ein Kulturbild aus dem Ii. Jahrhundert, Buchreihe der Anglia, Bd. I (Tübingen, 1952), S. 3 ; 1563 nach F. P. Wilson, The Plague in Shakespeare's London (Oxford, 1927), S. 15 und Ph. Aronstein, Das englische Renaissancedrama (Leipzig, Berlin, 1929), S. 7 5 ; 1570 nach F. P. Wilson, Plague, S. 15; 1592—94 nach Aronstein, Das englische Renaissancedrama, S. 75. 3 ) J . Dover Wilson, Hrsg., Life in Shakespeare's England: A Book of Elizabethan Prose, The Cambridge Anthologies (Cambridge, 2. Aufl. 1913), S. 135. Audi R . J . Mitdiell und M. D. R . Leys betonen die Häufigkeit der Seudien in A History of London Life (London, N e w York, Toronto, 1958), S. 101. *) An Elizabethan Journal: Being a Record of those Things Most Talked of During the Years 1591—1594 (London, 1928). Zum folgenden vgl. audi die z. T . leicht abweichenden "Plague Records" in E . K. Chambers' The Elizabethan Stage (Oxford, 1923), IV, 3 4 5 - 3 5 1 . «) Vgl. G. B. Harrison, Journal, S. 182.
17
week and whole households have died. O f 1603 deaths, 1130 are from the plague" (S. 256). Am 14. August durften keine genauen Zahlen mehr veröffentlicht werden — vermutlich, um die begreifliche Unruhe der Bevölkerung nicht zu vergrößern. Gerüdite sprechen von 1700 bis 1800 pro Woche (S. 257). Einen Monat später schreibt Harrison: "There is still no sign of an end to the mortality from the plague. About a thousand deaths of the plague weekly are now being reported in the City, and outside some five hundred" (S. 260). Am 28. September sind es noch 1100 bis 1200 (S. 261), und erst am 9.November kann mit 420 Toten von einem merklichen Rückgang gesprochen werden (S. 264). Für das ganze Jahr 1593 ergibt sich die erschreckende Zahl von 10 675 Opfern der Pest (S. 268) 8 ). Die ganze Furchtbarkeit dieser Zahlen wird erst deutlich, wenn man sich vergegenwärtigt, daß die Einwohnerzahl Londons zu der Zeit kaum mehr als 150 000 betragen haben dürfte 7 ). Eine Eindämmung der Seuchengefahr erwies sich als schwierig: die hygienischen Verhältnisse waren mangelhaft, ärztliche Hilfeleistungen teuer und auch kaum ausreichend 8 ), die Vorstellungen über die Ursachen der Pest zum Teil recht abenteuerlich. Allgemein war man überzeugt, die Pest sei eine "Geißel Gottes zur Bestrafung der Sünder" 9 ). Erschwert wurden die Schutzmaßnahmen gegen eine Ausbreitung der Seuche schließlich noch durch die Kirche, die mit zahlreichen Predigten den Gedanken in das Volk trug, "daß niemand vor seiner Stunde sterben würde, daß also nicht nur alle hygienischen Vorkehrungen wirkungslos seien, sondern gleichsam einen Eingriff in die göttliche Schöpfungsordnung darstellten" 1 0 ). Aber die durch die Pest bedingte eindringliche Konfrontierung mit dem Phänomen des Todes reicht weiter, als es bloße Zahlen andeuten können. Auch wer im 16. Jahrhundert nicht durch Todesfälle in der engeren Umgebung un-
) Im Jahre zuvor waren es von März bis Dezember sogar 11 503 (vgl. ebd., S. 183). ) P. H . Ditdifield, The England of Shakespeare (London, 1917), S. 86, nimmt für 1559 etwa 120 000 Einwohner an; G. M. Trevelyan, English Social History: A Survey of Six Centuries: Chaucer to Queen Victoria (London, 1948), S. 143 für dasselbe Jahr etwa 100 000 und für 1603 etwa 200 000. 8 ) Trevelyan, English Social History, schreibt S. 1 2 0 : "Only the rich had medical attendance of any value, and even their children died off at a rate that would appal modern parents, but was then taken as a matter of course." Vgl. auch H . Craig, An Interpretation of Shakespeare (New Y o r k , 1948, repr. 1949), S. 15: "Elizabethan medicine was murderous." *) Meißner, England, S. 406. Auch F. P. Wilson, Plague, S. 3, sieht in der Uberzeugung: " T h e plague was God's instrument for the punishment of sin" den wichtigsten E r klärungsversuch, und L. B. Wright, Middle-Class Culture in Elizabethan England (Ithaca, N e w Y o r k , 1958), S. 229, schreibt: " T h e judgments of God upon blasphemers, profane swearers, Sabbath breakers, and unbelievers were known to every citizen. The havoc of the plague, which laid waste London with inexorable regularity, which multiplied graves in Paul's Churchyard until a minister at Paul's Cross complained of the stench, which made every heart chill at the sight of a cross-marked door and its 'God H a v e Mercy Upon Us' — all this was only the condign punishment sent upon a city which had forgotten God." Ähnlich audi G. B. Harrison, Journal, S. 253. 1 0 ) Meißner, England, S. 407. 6 7
18
mittelbar mit der Seuche in Berührung kam, konnte sich dem Eindruck ihrer Schrecklichkeit nicht entziehen: "For the Londoner of the sixteenth and seventeenth centuries, the plague meant a vision of frightened citizens fleeing from a stricken city; of carts, loaded with the dead, creaking to loathsome burials" 11 ). Jeder Schritt in London mußte an Häusern vorbeiführen, die durdi außen angebrachte Kennzeichen darauf aufmerksam machten, daß in ihnen die Pest wütete 12 ). Außerdem wird die zwischen 1549 und 1592 geltende Vorschrift, zu jedem Begräbnis sei mindestens eine Glocke dreiviertel Stunden lang zu läuten 18 ), die Gedanken unwiderstehlich in dieselbe Richtung gedrängt haben, denn "there were 114 churches in the 26 wards: London was a city of many towers and spires and of many bells" 14 ). Schließlich wurden auch alle Theateraufführungen und sonstigen öffentlichen Belustigungen des Londoners wie bearbaiting, bowling und Sportveranstaltungen als Herde der Ansteckung verboten, wenn die Zahl der Toten pro Woche 30 überstieg. So meldet W. Harrison 1572: "Plaies are banished for a time out of London, lest the resort vnto them should ingender a plague, or rather disperse it, being already begönne" 15 ). In dem Pestjahr 1593 wird das Rose Theatre schon ab 2. Februar geschlossen16) und kann erst am 26. Dezember wieder eröffnet werden 17 ). Auch Dover Wilson bestätigt: "When there were over 30 deaths a week the theatres were closed", und er setzt hinzu: "There were very few summers in which this did not happen" 18 ). Es darf als sicher gelten, daß Häufigkeit und Schrecken der Pestepidemien in besonderem Maße dazu beigetragen haben, dem Elisabethaner den Gedanken an den Tod und seine Unausweichlichkeit nahezubringen 19 ). ") 11! ) 13 ) »)
15
)
") ») 18 ) 19
)
Wright, Middle-Class Culture, S. 446. Vgl. G. B. Harrison, Journal, S. 251; Wright, Middle-Class Culture, S. 229. Vgl. F. P. Wilson, Plague, Note B, S. 177. F. P. Wilson, Plague, S. 177. N . Drake, Shakspeare And His Times: . . . (Paris, 1838), S. 113, berichtet von der zu Ende des 12. Jahrhunderts üblichen Sitte, im Augenblick des Sterbens Glocken zu läuten, und er setzt hinzu: "This custom of ringing a bell for a soul just departing, which is now relinquished . . . , we have reason to believe was still observed in Shakespeare's time." Audi Jeremy Taylor, The Whole Works of the Right Rev. J. Taylor. . ., hrsg. v. R. Heber (London, 1828), VI, 456, erwähnt nodi die sog. "passing-bell". Harrison's Description of England in Shakspere's Youth .. ., hrsg. v. F. J. Furnivall, Published for the N e w Shakspere Society, Series VI, 1 (London, 1877), S. liv. G. B. Harrison, Journal, S. 193. Ebd., S. 268. J. D Wilson, Life in Shakespeare's England, S. 135. Aronstein, Das englische Renaissancedrama, S. 75, ergänzt dazu, daß seit 1605 die kritische Grenze bei 40 Todesfällen lag. Die Betonung der Seudiengefahr für das elisabethanisdie England darf jedoch nicht den Eindruck erwecken, als sei die Pest eine Heimsuchung lediglich Englands gewesen. F. P. Wilson (Plague, S. 85) berichtet beispielsweise von schweren Epidemien in Lissabon 1599, in Spanien 1601 und den Niederlanden 1602. Immerhin ist es aber interessant, daß Gracian in El Criticon, hrsg. v. M. Romera-Navarro (London, 1938), I, 332 unter allen zitierten Städten London als Beiwort für Pestilenzen anführt: "Pues y o veo . . . una Babilonia de confusiones, una Lutecia de inmundicidas, una Roma de mutaciones, un Palermo de volcanos, una Constantinopla de nieblas, un Londres de pestilencias y un Argel de cautiverios." (Hervorhebung vom Verf.)
19
Die Pest war eine der größten Geißeln jener Zeit, aber dodi bei weitem nicht die einzige. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts setzte eine gewaltige Hungersnot ein, die ganz England ergriff und viele Todesopfer forderte 2 0 ). Ferner muß man sich vor Augen halten, daß besonders das späte 16. J a h r hundert eine Zeit ausgedehnter kriegerischer Auseinandersetzungen war, die zumindest in den betroffenen Familien die Vorstellung des Todes und der Vergänglichkeit dieses Lebens weckten und wachhielten 2 1 ). D a diese Kriege sich aber meist auf dem Festland oder zur See abspielten, haben sie die Bevölkerung vielleicht nicht so stark mit dem Phänomen des Todes und seiner Allgegenwart konfrontiert, als es die religiösen und politischen Verfolgungen im eigenen Lande taten. " E i n Mensch von selbständigem Wahrheitsdrang mußte damals täglidi zu flüchten oder zu sterben bereit sein" 2 2 ). U n d da zu jener Zeit Differenzen zur religiösen Einstellung der Krone wie Staatsverbrechen bestraft wurden 2 3 ), haben die Chroniken dauernd Gelegenheit, von Märtyrern und ihrem T o d zu berichten. Die religiöse N o t betrifft fast die ganze Tudor-Zeit. Die Regierungsjahre Heinrichs V I I I . sahen viele Hinrichtungen wegen Verweigerung des Suprematseides 24 ), darunter auch Kardinal Fisher und Sir Thomas More. Nach den Aufständen der J a h r e 1536/37, die der Verteidigung des alten Systems galten 2 5 ), erhielten die Henker besonders reichlich Arbeit: etwa 2 5 0 wurden gehängt, gevierteilt oder enthauptet 2 6 ). Trotzdem waren das noch weniger, als unter Maria in zweieinhalb Jahren für den anderen Glauben starben. Ihre 300 Todesopfer, darunter Bisdiof Ridley, Hugh Latimer und Thomas Cranmer, fallen besonders im Vergleich mit den relativ ruhigen sieben Jahren unter Edward V I . stark ins Auge. Auch unter Elisabeth ging die Verfolgung — nun wieder der romanists — weiter: von 1570 bis 1603 wird mit einer Zahl um 180 gerechnet 27 ).
20 )
21 )
22 )
23 )
24 )
25 )
2«) 27 )
20
Vgl. Meißner, England, S. 401/402. Daß dieselben Kriege auch für das Erstarken des nationalen Selbstgefühls einen durchaus förderlichen Einfluß hatten, braucht in diesem Zusammenhang nicht zu interessieren. Die Kriege geben audi einen Hintergrund ab, vor dem das Drama der Zeit gesehen werden muß: "The background of Elizabethan drama from Marlowe's 'Tamburlaine' (c. 1587) to 'Hamlet' (published in 1603) was a great war", sagt G. B. Harrison, "The National Background", A Companion to Shakespeare Studies, hrsg. v. H. Granville-Barker und G. B. Harrison (Cambridge, 1934), S. 168 und weiter: "Englishmen were thus very familiar with war." W. Dilthey, Weltanschauung und Analyse des Menschen seit Renaissance und Reformation, Gesammelte Sdiriften, Bd. II (Leipzig, Berlin, 1914), S. 95. Audi dies gilt nicht nur für England; auf dem Festland waren die Religionskriege zum Teil noch wesentlich blutiger (so in Spanien, Frankreich und den Niederlanden). Vgl. etwa R. Bayne, "Religion", Shakespeare's England: An Account of the Life and Manners of his Age (Oxford, 1917), I, 50 oder J. I. Bryan, The Philosophy of English Literature (Tokyo, 1930), S. 133. Vgl. H. Schöffler, Die Anfänge des Puritanismus: Versuch einer Deutung der englischen Reformation, Kölner Anglistische Arbeiten, Bd. X I V (Leipzig, 1932), S. 86/87. Vgl. Schöffler, Die Anfänge des Puritanismus, S. 88 ff. Vgl. ebd., S. 92. Vgl. Bayne, "Religion", S. 50.
Im 16. Jahrhundert forderten auch Hexenverfolgungen noch ihre Opfer 2 8 ); von 1563 bis 1603 werden 200 Prozesse gezählt 2 9 ). Ähnlich wie bei dem Vorgehen gegen Andersgläubige handelte es sich weniger um eine religiöse als vielmehr um eine politische Aktion, die dem Schutz der Sicherheit von Staat und Dynastie dienen sollte und die für Hochverrat vorgesehenen Strafen anwandte. Diese Strafen berühren uns heute als grausam, aber damals riefen sie keinen Protest des Volkes hervor, und sie können tatsächlich nicht einmal für so ungewöhnlich gehalten werden, wenn man die derzeit üblidie Rechtsprechung und Strafvollziehung in Betracht zieht. Trotz aller durch den zeitlichen Abstand des modernen Betrachters gebotenen Zurückhaltung in einer Bewertung der damaligen Justiz muß zweierlei festgehalten werden: bemerkenswerte Härte auf der einen und oft kaum verhüllte Korruption auf der anderen Seite. Es kommt uns hier in erster Linie darauf an, die hohe Zahl der Todesurteile als weiteren Hinweis dafür herauszustellen, daß der Tod damals buchstäblich überall und zwangsläufig in jedermanns Bewußtsein war. Daher brauchen wir uns der Frage nach der Rechtfertigung der vielen Bluturteile und der Unzulänglichkeiten der Justiz nicht näher zuzuwenden; einige wenige Beispiele mögen die Situation illustrieren. Ein Londoner Bischof bat Kardinal Wolsey, sich für eine Einstellung der Strafverfolgung seines Kanzlers zu verwenden, "because London juries are so prejudiced that they would find Abel guilty of the murder of Cain" 3 0 ). Einer anderen Quelle verdanken wir Zahlenangaben über die Bestechlichkeit der Geschworenen: " N o t guilty for 20 crowns" 3 1 ), d. h. Freispruch für eine Krone pro Geschworenen 32 ). Die Unzulänglichkeiten der Rechtsprechung führten dazu, daß der einzelne Londoner sich sein Recht mit eigener Hand zu verschaffen suchte 33 ). Hier mag audi kurz auf die Vorliebe der Elisabethaner für das Duell hingewiesen werden: " T h e stream of popular opinion upholding the duel was so strong that even persons who believed thoroughly in its unlawfulness were forced to conform to the practice or else to withdraw entirely from social inter-
) Meißner, England, S. 500, schreibt: "Der Hexenwahn ist im sechzehnten Jahrhundert keineswegs abgeebbt. Sowohl auf katholisdier als auch auf protestantischer Seite wurde die grausame Verfolgung nicht nur fortgesetzt, sondern in gewissen Abständen sogar noch gesteigert." Über Hexenglauben und -prozesse zuletzt: K. M. Briggs, Pale Hecate's Team (London, 1962), bes. Kap. II. 2») Vgl. Meißner, England, S. 500. 3 0 ) H . B. Wheatley, "London and the Life of the Town", Shakespeare's England, II, 170. 3 t ) J. O. W . Haweis, Sketches of the Reformation and Elizabethan Age Taken from the Contemporary Pulpit (London, 1844), S. 139. Auch W. Harrison übt Kritik an der Geldgier der Riditer in seiner Description, S. 204—207. 3 2 ) "The price of perjury . . . seems to have been low enough to enable a comparatively poor man to buy his life." (Haweis, Sketches, S. 139) M ) Vgl. H . T. Stephenson, The Elizabethan People (New York, 1910), S. 10/11: " E v e r y man wore commonly a sword by his side in public. When justice failed the individual did not scruple to take the law into his own hands." Es folgen einige Beispiele, die zeigen " h o w quick every one was to shed blood upon small provocation". 28
21
course lest they should be considered base cowards" 84 ). Die starke Verbreitung des Duellierens wurde manchem Londoner zum Verhängnis: "Dead men, with holes in their breasts, were often found by the watdiman, with their pale faces resting on the door-steps of merchants' houses or, propped up and still bleeding, hid away in church p o r c h e s . . . Many a battle was less dangerous than one night spent at a tavern, when the wine had flowed somewhat faster than usual, and the dice, the representative of castles and mansions had tumbled about too often" 35 ). Eine noch größere Rolle für die Allgegenwart des Todes im täglichen Leben spielt jedoch die hohe Zahl der öffentlichen Hinrichtungen, die sich einmal aus der Verhängung der Todesstrafe schon für geringfügige Vergehen, zum anderen, wohl bedeutenderen Teil, aus der religiösen und politischen Situation erklärt. Die Höhe des Strafmaßes stand oft in keinem sinnvollen Verhältnis zum Vergehen: "The punishments that followed upon conviction were . . . harsh to the border of ferocity" 36 ). So wurden Todesstrafen verhängt für kleinere Delikte bis hinab zum Diebstahl etwa eines "sheet worth 8 shillings" 37 ). Daß dies Verfahren nicht nur uns heute als grausam erscheint, beweist der Kommentar eines Franzosen, der 1558 England bereiste: "En Angleterre y a vne fort cruelle iustice, car pour vn rien feront mourir vn homme" 88 ). Die Todesart für alle Vergehen, die nicht als Staatsverbrechen angesehen wurden, war Erhängen 39 ). Hierüber sind aufschlußreiche Zahlenangaben überliefert. Thomas Platter berichtet von seiner Englandreise im Jahre 1599: "Es vergehet selten ein Rechtstag viermal im Jahr, daß man nicht zu London von 20 biß in 30 personen, mann vnndt weib, mitt einander aufknipfet" 4 0 ). Den Jahresdurchschnitt für London notiert Paul Hentzner 1598 in seinem Reisetagebuch mit mehr als 30041). Das ist eine angesichts der Bevölkerungszahl Londons 42 )
34
) F. T. Bowers, Elizabethan Revenge Tragedy 1587—1642 (Gloucester, Mass., 1940, repr. 1959), S. 33. Ähnliche Feststellungen bei Stephenson, Elizabethan People, S. 217: "Duelling, in Elizabethan times, was very common. In fact, 'points of honour' were matters of daily settlement. The least provocation was sufficient for a fight." Vgl. auch Ditchfield, The England of Shakespeare, S. 29; L. Einstein, Tudor Ideals (London, 1921), S. 121; G. W. Thornbury, Shakspere's England: Or, Sketches of Our Social History in the Reign of Elizabeth (London, 1856), I, 181. 35 ) Thornbury, Shakspere's England, I, 182. 3 ') E. P. Cheyney, A History of England: From the Defeat of the Armada to the Death of Elizabeth (London, 1914), II, 333. ") Ebd., S. 334. Audi Mitchell und Leys bestätigen: "theft was punishable by death." (History of London Life, S. 97) S8 ) Description des Royavlmes d'Angleterre et d'Escosse. Composé par Maistre Estienne Perlin (Paris, 1558), S. 25. 3 ») Vgl. Harrison's Description, S. 221. 40 ) Thomas Platters des Jüngeren Englandfahrt im Jahre 1599, hrsg. v. H. Hedit (Halle, 1929), S. 47. 41 ) Vgl. A Journey into England, hrsg. v. Horace Walpole (London, 1757), S. 88. 42 ) S. oben S. 18 und Anm. 7. 22
sehr hohe Zahl 43 ). Selbstverständlich beschränkte sich die Vorliebe für diese Todesart nicht auf London. In einer Analyse der Vollstreckungsurteile eines Jahres in der Grafschaft D e v o n betont Cheyney die Häufigkeit der Hinrichtungen durch den Strang: "In Devonshire in the midwinter sessions of 1598 out of sixty-five culprits w h o were tried eighteen were hung; in the spring sessions out of forty-five twelve were hung, at midsummer out of thirty-five eight were hung, thirteen flogged, seven acquitted, and seven on account of their claim of benefit of clergy branded and released. Although only one was hung at the autumn sessions, with the thirty-five w h o suffered the same year by order of the assize courts, seventy-four men and women altogether were put to death in one county in this one year. In Middlesex although no actual statistics during Elisabeth's reign are available the number was enormous" 44 ). Für ganz England werden verschiedene Angaben gemacht: W. Harrison meint: "there is not one yeare commonlie, wherein three hundred or foure hundred of them are not deuoured and eaten vp by the gallowes in one place and another" 45 ); für das ausgehende 16. Jahrhundert werden mehr als 800 (bei einer Gesamtbevölkerung von etwa 5 Millionen) angegeben 46 ), für die Regierungsjahre Heinrichs VIII. wird gar von 72 000, also etwa 1900 jährlich, gesprochen 47 ). Diese Zahlen beziehen sich nur auf die durch Erhängen geahndeten Vergehen: Staatsverbrecher, die mit "hanging, drawing, and quartering" 48 ) oder im Falle von Angehörigen der Aristokratie mit Enthaupten bestraft werden 49 ), sind darin nicht enthalten 80 ). " ) Th. Finkenstaedt, "Galgenliteratur: Zur Auffassung des Todes im England des 16. und 17. Jahrhunderts", DVJs, X X X I V (1960), 531, hält die Zahl noch für hoch, obgleich er sie irrtümlich für den Jahresdurchschnitt ganz Englands ansieht. ") A History of England, II, 333. 4t ) Description, S. 231. 4 «) A. Underhill, "Law", Shakespeare's England, I, 398. 47 ) Vgl. Harrison's Description, S. 231: "It appeareth by Cardane . . . in the geniture of king Edward the sixt, how Henrie the eight, executing his lawes verie seuerelie against such idle persons, I meane, great theeues, pettie theeues and roges, did hang vp threescore and twelue thousand of them in his time." 48 ) Underhill, "Law", S. 398. 4B ) Vgl. Harrison's Description, S. 222: "The greatest and most greeuous punishment vsed in England, for such as offend against the state, is drawing from the prison to the place of execution vpon an hardle or sled, where they are hanged till they be hälfe dead, and then taken downe, and quartered [aliue;] after that, their members and bowels are cut from their bodies, and throwne into a fire prouided neere hand . . . Sometimes, if the trespasse be not the more heinous, they are suffered to hang till they be quite dead. And when soeuer anie of the nobilitie are conuicted of high treason . . . this maner of their death is conuerted into the losse of their heads onelie." 50 ) W. Harrison spricht ausdrücklich nur von "theeues and roges" (vgl. Anm.47),Hentzner unterscheidet bewußt zwischen Aufhängen und "beheading" (Journey, S. 88); auch die übrigen Quellen reden nur von Hängen. Wir möchten daher nicht mit Finkenstaedt ("Galgenliteratur", S. 531) die genannten hohen Zahlen zum überwiegenden Teil mit Hinrichtungen von Staatsverbrechern und Ketzern erklären. Es sei auch dahingestellt, ob deren Anteil an den jährlichen Todesopfern so hoch ist wie Finkenstaedt ihn annimmt: Aus der Zahl der Berichte in den Chroniken läßt es sich nicht sicher erschließen, da die hohe öffentliche Stellung sowie das größeres Aufsehen erregende Verfahren der Hinrichtung sie zu geeigneteren und auffälligeren Objekten der Berichterstattung machten. 23
Ihnen muß nun unsere Aufmerksamkeit gelten, denn das Verfahren ihrer Hinrichtung sowie die großen Zusdiauermengen, die das Schauspiel anzog, machen sie besonders interessant für eine Darstellung der Verbreitung des Todesgedankens im Elisabethanischen England. Bei diesen Verurteilten handelt es sich durchweg um kirchlich oder politisch exponierte Persönlichkeiten. In den meisten Fällen war es nicht einmal nötig, tatsächlich einen Landesverrat begangen zu haben: schien jemand für den Staat zu gefährlich zu sein, so war es ein leichtes, Vorwände für ein Vorgehen gegen ihn zu finden und so nach außen den Anschein des Rechts zu wahren 51 ). Den Anteil der durch dies Verfahren Betroffenen wird man nicht zu niedrig einschätzen dürfen: "Those who suffered for treason because they had lost the royal favor and were regarded as a potential menace to the state were almost as numerous as those who were executed as a consequence of outright rebellion" 62 ). Insgesamt ist die Zahl der Hinrichtungen hoher Persönlichkeiten wohl recht beträchtlich. Perlin hat aus seiner Englandreise den Eindruck gewonnen: "en ce pays lä vous ne trouverez pas guéres de grands seigneurs desquelz leurs parens n'ayent eu la teste tranchée" 53 ). Wichtiger als Zahlen sind jedoch das Verfahren der Hinrichtung und die Wirkung, die davon auf die Bevölkerung — und nicht nur die unmittelbaren Zuschauer — ausging. Die großen Zuschauermengen gehören wohl zu den auffälligsten Kennzeichen der Hinrichtungen im 16. Jahrhundert. Einige Quellen mögen zur Illustration dienen. Im Jahre 1553 verzeichnet Machyn in seinem Tagebuch: "The X X I of August was, by VIII of the cloke in the mornyng, on the Towre hylle a-boythe X Ml. men and women for to have [seen] the execussyon of the duke of Northumberland" 54 ). Die Verbrennung des Bischofs Hooker 1555 erlebte eine "multitude of people, which were assembled, being by estimación to the nomber of 7000 (For it was Market daye, & many also came to se his behauiour towards death)" 55 ). Im gleichen Jahr erlitten die Bischöfe Latimer und Ridley den Feuertod: "A multitude of Oxford scholars and gentlemen stood by and witnessed the scene, for the most part, with pious and complacent countenances" 56 ). 1556 strömten 20 000 Menschen zusammen, um die Verbrennung von 13 Ketzern in Stratford-a-Bow mitzuerleben 57 ). 1587 läßt Whetstone bei der Beschreibung 51
) Vgl. L. B. Smith, "English Treason Trials and Confessions in the Sixteenth Century", JHI, X V (1954), 473. Einstein, Tudor Ideals, hebt den Widerspruch zwischen formaler Gesetzestreue und tatsächlichem "disregard of justice" (Smith, "Treason Trials", S. 476) stark hervor: "To those who seek to understand the spirit of that time, few things are more confusing than the seeming respect given to legal form with the gross breaches of justice. The most amazing contradictions stand out side by side" (S. 64), und was er von Heinrich VII. sagt, gilt in gleichem Maße für jeden Tudor-Herrscher: "The law in his hands became an instrument of policy more than of justice" (S. 65). 52 ) Smith, "Treason Trials", S. 475. 53 ) Description, S. 28. M ) The Diary of Henry Machyn..., hrsg. v. J. G. Nichols, Camden Society, N o . 42 (London, 1848), S. 42. 55 ) John Foxe, Actes and Monuments of these latter and perillous dayes ... (London, 1563), S. 1060 b. 56 ) Th. H. Lewin, Life And Death . . . (London, 1910), S. 47. " ) Vgl. Machyn, Diary, S. 108: "and ther wher a X X M. pepull."
24
einer großen Hinrichtung einen seiner fiktiven Sprecher sagen: "I cannot number the thousands", und "the whole multitude, without any signe of lamentation, greedylye behelde the spectacle from the first to the last" 58 ). Im gleichen Jahr wird Mary Stuart hingerichtet, und wir erfahren, daß "about three hundred knights and gentlemen of the county had been admitted to witness the execution" 59 ). 1591 hören wir über eine Exekution: "The crowd was so vast that it was long time before the officers could bring him to the gibbet which had been set up by the Cross in Cheapside" 80 ). Aus dem Jahre 1604 ist ein besonders interessantes Beispiel bekannt 61 ). Die Angehörigen einer schottischen Adligen hatten versucht, den Hinrichtungstermin auf 3 Uhr nachts zu legen, um Zuschauer auszuschließen — sie fanden damit jedoch weder bei dem Chronisten und der Bevölkerung noch auch bei der Verurteilten selbst Verständnis: "A very unbecoming zeal was displayed by her relations, to have her executed as privately as possible, and at such a time as would be unknown to the populace" — "albeit she was far otherwise minded, herself; for she purposed not to have gone furth till between 5 and 6 in the morning" 82 ). Zu dieser Zeit hätte sie allerdings die Öffentlichkeit zum Zeugen gehabt 63 ). Hier erhebt sich natürlich die Frage, was die Engländer jener Zeit bewogen hat, in Scharen Hinrichtungen zu besuchen. Zu einem Teil mag wohl Sensationslust mitgesprochen haben (die von Foxe und Whetstone angeführten Beispiele — vgl. Anm. 55 und 58 — könnten den Gedanken nahelegen); diese Annahme reicht als Erklärung jedoch nicht aus, wie am Beispiel der Hinrichtung eines Jesuiten im Jahre 1594 deutlich wird: "When he was taken from prison towards the place of execution, more than three hundred ladies and women of good position, all with black hoods, set out to follow him, and being asked where they were going, they answered, 'To accompany that gentleman, that servant of God, to his death, as the Maries did Christ' " 64 ). Wir zögern aber, mit Finkenstaedt von den Hinrichtungen als 'Erbauung' zu sprechen85), vor allem deshalb, weil wir bereits in den Hinrichtungen des 16. Jahrhunderts ein stärkeres Element der Abschreckung zu sehen
58
) The Censure of a loyall Subiect: . . . (London, 1587) in Illustrations of Early English Popular Literature, hrsg. v. J. P. Collier (London, 1863), I, 12/13. ) Lewin, Life And Death, S. 59. 60 ) G. B. Harrison, journal, S. 45. Weitere Hinweise auf die Anwesenheit von Zuschauern bei Hinrichtungen etwa in Cobbet's Complete Collection of State Trials..., Bd. I: 1 1 6 3 - 1 6 0 0 (London, 1809), S. 763 und 1033; R. Grafton, A Chronicle at large and meere History of the affayres of Englande and Kinges of the same .. . (London, 1569), S. 1319; The Works of Sir Walter Ralegh ...To which is prefix'd, A new Account of his Life by Tho. Birch (London, 1751), I, lxxxiii. M ) Den Hinweis verdanke ich Finkenstaedt, "Galgenliteratur", S. 533. • 2 ) R. Pitcairn, Hrsg., Criminal Trials in Scotland, from A. D. MCCCCLXXXVIII to A. D. MDCXX1V ... (Edinburg, 1833), II, 447. BS ) N . Breton, Fantastickes, 1626, sagt zu "Five of the Clock": "the streets are full of people"; "the scholars are up and going to school" (J. D. Wilson, Life in Shakespeare's England, S. 276). M ) G. B. Harrison, Journal, S. 309. 65 ) Finkenstaedt, "Galgenliteratur", S. 533.
59
25
meinen als er 8 6 ). In dem von Finkenstaedt zitierten Ausspruch der jungen Schottin: " T h e more publick death be, the more profitable it shall be to m a n y " 6 7 ) , scheint ein solches Element bereits mitzuschwingen; es wird aber auch ganz deutlich ausgesprochen in Augenzeugenberichten: die Adligen " o n t faict mourir a Londres, pour donner terreur au peuple" 6 8 ) und in auf dem Schafott gehaltenen Sterbereden: " I pray God that this my death may be an example to all men" 6 9 ). Auch bei Whetstone finden w i r : " b y his ouerthrowe al men are w a r n e d " und " L e t the ende of this traitor be a warning example" 7 0 ). V o r allem ist bei einer Ablehnung des Gedankens der Abschreckung nicht zu verstehen, warum Körperteile der Hingerichteten wochenlang öffentlich aufgespießt wurden; dies Verfahren wird in Prozeßakten ausdrücklich als "example to all Traitors and R e b e l s " bezeichnet 71 ). Das Verfahren der Hinrichtung war geeignet, sowohl auf die Zuschauer als aber audi auf die gesamte Bevölkerung nachhaltigen Eindruck zu machen. W ä h rend die Leichen Erhängter im allgemeinen sofort bestattet wurden 7 2 ), war es üblich, Staatsverbrecher nodi lebend vom Galgen zu nehmen und zu vierteilen oder (und) zu enthaupten. Als "exceeding f a u o u r " konnte die Königin den Verurteilten gestatten, am Galgen zu sterben, ehe sie heruntergeholt und verstümmelt wurden 7 3 ). Alle diese grausamen Vorgänge verfolgten die Zuschauer mit Aufmerksamkeit. Dabei war es üblich, daß der Scharfrichter — nach Kiechels Beobachtung ein Metzger 7 4 ) — den K o p f hochhielt, um ihn der Menge zu zeigen 7 5 ), die sich dabei nicht selten in einen Rausch hineinsteigerte: "his [ = J o h n Feiton, hingerichtet 1 5 7 0 ] head was smitten off, and held up, that the people might see it: whereat the people gave a shout, wishing that all Traitors
66 )
•7) 98 ) ••) 70)
71 )
72 )
73 ) ,4)
75 )
26
Vgl. ebd.: "die möglichen abschreckenden Wirkungen der Hinrichtungen auf potentielle Verbrecher —, daran dachte die Zeit noch nicht." Pitcairn, Hrsg., Criminal Trials, II, 447. Perlin, Description, S. 25. Cobbett, State Trials, S. 764. Censure, S. 23 und 51. Weitere Beispiele: Grafton, Chronicle, S. 1340; A Chronicle of England During the Reigns of the Tudors, From A. D. 1485 to 1559. By Charles Wriothesley, hrsg. v. W. D. Hamilton, Camden Society, N.S. X I (London, 1875), I, 40. Cobbett, State Trials, S. 1086. Gelegentlich, besonders bei Hingerichteten ohne Freunde oder Verwandte, blieben die Leichen einige Tage lang hängen; so in folgendem, von Machyn berichteten Fall: "The xxix day of Aprell [ = 1555] was cutte downe of the galows a man that was hangyd the xxvi day of Aprell." {Diary, S. 86) Vgl. Whetstone, Censure, S. 42. Ähnlich auch Cobbett, State Trials, S. 1161/62 oder A Complete Collection of State-Trials ... (London, 2. Aufl. 1730), 1,135 b. "Aus Samuel Kiechel's Reisen, vom Jahr 1585 bis 1589", Archiv für Geographie, Historie, Staats- und Kriegskunst, X I , 64, Montag, den 29. May 1820 (Wien, 1820), S. 267: "Zum Henken haben die Engländer keinen besonderen Nachrichter; sie nehmen zu diesem Geschäfte einen Metzger, und welchen sie dazu auffordern, der muß es verrichten." Vgl. Lewin, Life And Death, S. 60: "The executioner, when he raised the head as usual to show it to the c r o w d , . . . "
were so served" 76 ). Die Stimmung des Volkes, das oft am Vollstreckungstage noch das Verfahren der Hinrichtung in milderndem oder verschärfendem Sinne beeinflussen konnte, war weitgehend abhängig vom Verhalten des Verurteilten. Im folgenden Fall hatte dieser durch Benehmen und Reden die Menge gegen sich aufgebracht: "the people, unwilling in their fury that any mercy should be shown him, cried out that he should be cut down at once . . . As soon as he was taken down, almost in a trice, his heart was cut out and shown openly to the people" 77 ). Dies war jedoch wohl ein Sonderfall; meist wurden lediglich die abgeschlagenen Köpfe der Hingerichteten erhoben und gezeigt. Danach wurden sie sowie die Körperteile der Gevierteilten an verschiedenen Orten der Stadt aufgespießt. Damit beginnt ihre Wirkung sich auf diejenigen auszudehnen, die nicht selbst Augenzeuge der Hinrichtung waren. Einen anschaulichen Bericht über die auf der (damals einzigen) Londoner Brücke aufgespießten Köpfe verdanken wir Platter: "Auf dem einen thurn [#'c], fast mitten auf der brücken, steckten über die dreyßig todten Köpf zu öbrist auf hohen Stangen, vornemmer Herren, die vor diesem vmb angestifften aufruhr vnndt anderer vrsachen willen gericht vnndt geköpft worden" 78 ). Ähnliche Darstellungen finden wir auch an vielen anderen Stellen überliefert 79 ). Wenn auch die Köpfe an vielen anderen Orten in London gezeigt wurden — so auf den Stadttoren, auch "vpon the toppe of the gallowes" 80 ) —, war London Bridge doch der bevorzugte Platz. Die Köpfe wurden dort sehr lange belassen; sogar der Abbruch des Brückentores war kein Hindernis: "The towre on the drawe bridge vpon london bridge is taken downe in Aprill [d. J. 1576], being in great decaie; . . . & wereas the heddes of soche as were executed for treason were wont to be placed vpon this towre, they were now remoued, & fixed ouer the gate which leadeth from Southwarke into the citie by that bridge" 81 ). Wenn Platz für nachfolgende Köpfe fehlte, wurden alte in die Themse geworfen 82 ). Unter den weiteren Beispielen mögen noch die Schicksale Wyatts herausgegriffen werden, dessen Körper in vier Teile geteilt wurde und "set vp in diuers places about the City, & his hed was set vpon the Galowes at H a y hill besides Hide parke" 83 ), und die der 1570 verurteilten Thomas und Christopher Norton,
™) Cobbett, State Trials, S. 1088. Weitere Belege für die Sitte des Kopf-Zeigens etwa ebd., S. 764 und 1035; Ralegh, Works, I, Ixxxv. 77 ) G. B. Harrison, Journal, S. 46. 78 ) Enzland fahrt, S. 18/19. 7> ) Vgl. Hentzner, Journey, S. 5; W. B. Rye, England as Seen by Foreigners in the Days of Elizabeth and James the First... (London, 1865), S. 9; A compleat Collection of the Lives, Speeches, Private Passages, Letters and Prayers of Those Persons lately Executed.. . (London, 1661), S. 84 und 158; Wriothesley, Chronicle, I, 24, 28, 29 u. ö.; Madiyn, Diary, S. 41, 55, 63 u. Ö. 80 ) Whetstone, Censure, S. 14. 81 ) Harrison's Description, S. lvi. e2 ) So war der Kopf Thomas Mores "placed upon London-Bridge, where having continued for some Months, and being about to be thrown into the Thames to make room for o t h e r s . . . " (A Complete Collection of State Trials, I, 63 b). 8i ) Grafton, Chronicle, S. 1342. 27
deren Hinrichtung zum Abschluß noch einmal den Normalfall verkörpern kann: sie wurden erhängt, dann gevierteilt, dann "their heads [were] set on LondonBridge, and their quarters set upon sundry gates of the city of London, for an example to all Traitors and Rebeis, for committing High-Treason against God and their prince" 8 4 ). Die Köpfe erinnerten jeden Passanten an den Tod. Es wird zwar vereinzelt daran gezweifelt, daß sie der Mitwelt noch auffielen: "man hätte auch Zeit gehabt, sich daran zu gewöhnen" 8 5 ), wir glauben jedoch, dies nicht so einfach abtun zu können. Dem Fremden, In- wie Ausländer, mußte der "Brückenschmuck" unbedingt auffallen; aber auch der häufiger vorbeikommende Londoner war sich seiner Anwesenheit bewußt. So berichtet Platter: "Vnndt pflegen sich ihre nachkömbling deßen zu rühmen, zeigen einem ihrer Voreltern Köpf selber auf gemelter brücken" 8 6 ). D a ß die über der Brücke aufgespießten Köpfe im Bewußtsein der Zeit fest zu London gehörten, ja eine der Sehenswürdigkeiten bildeten, geht eindrucksvoll aus der Tatsache hervor, daß sie sogar auf alten Stadtkarten zu sehen sind — für den heutigen Betrachter ein zweifellos ungewöhnlicher Anblick 8 7 ). Hatte sich der Elisabethaner in den beschriebenen Fällen dem Tod in seiner ganz konkreten Gestalt gegenübergesehen, so waren damit noch nicht die Gelegenheiten erschöpft, die ihm die Vorstellung von der Vergänglichkeit des irdischen Lebens eindringlich ins Bewußtsein riefen. Es gilt hier vor allem, die Ermahnungen und Hinweise in Literatur und Kunst zu veranschlagen. Schriften, die sich in irgendeiner Weise mit dem Problem des Todes und Sterbens beschäftigen, waren außerordentlich zahlreich und vielgestaltig. Zum Teil hatten sie ganz konkrete Ereignisse zum Anlaß wie etwa die Pest 8 8 ); die Darstellungen sind oft abstoßend realistisch und darauf angelegt, eine morbide Lust am Grauen zu befriedigen 89 ). Zum Teil entspringen sie auch dem Bemühen der Kirche, den Sterbenden Trost zu spenden und den Lebenden die rechte Ein-
) Cobbett, State Trials, S. 1086. ) E. Mareks, Königin Elisabeth von England und ihre Zeit, Monographien zur Weltgeschichte, hrsg. v. E. Heydt, Bd. II (Bielefeld, Leipzig, 1897), S. 94. 8«) England fahrt, S. 19. 8 7 ) Vgl. A. Van den Wyngaerde, View of London (London, cir. A. D. 1550); deutlicher ist die um 1600 entstandene Karte von C. J . Vissdier: Londinum florentissma [sie] Britanniae Urbs . . . — die dort eingezeichneten 18 Köpfe lassen sogar Gesichtszüge erkennen. Vgl. ferner J. Speed, Theatrum Imperii Magni Britanniae . . . (Amsterdam, 1616), S. 1 v. und J . D. Wilsons Wiedergabe der "Southwark Gate of London Bridge" aus Visschers Map of London (1616) in der Pelican Book-Ausgabe seines Life in Shakespeare's England (1944, repr. 1959), vor S. 193. Auch im Drama derZeit sind deutliche Hinweise zu finden: " A n d on London Brydge like ye bestowe hys head" {Kynge ]ohan, Z. 2549, in Specimens of the Pre-Shaksperean Drama, hrsg. v. J . M. Manly [Boston, London, 1 8 9 7 ] , Bd. I). Vgl. ferner C Henry VI. (The Complete Works of William Shakespeare, hrsg. v. W . J . Craig [London, New York, Toronto, 1943, repr. 1954]), I, iv, 1 7 9 / 1 8 0 ; II, i, 6 5 - 6 7 ; II, ii, 2 ; II, vi, 52/53 und 8 5 / 8 6 ; Richard III., II, ii, 70. 8 8 ) Vgl. Wright, Middle-Class Culture, S. 294, Anm. 135: "Plague literature was extremely popular." Ähnlich auch S. 448. 8 ») Vgl. ebd., S. 446.
84
85
28
Stellung z u m T o d zu vermitteln. Solche Schriften nahmen z w a r auch oft ein konkretes Ereignis z u m Anlaß, transzendierten es aber u n d entwickelten religiöse, moralische oder ethische Lehren. Es w a r aber keineswegs nur die Kirdie, die hier wirksam w a r : " I t was a churdi-going and sermon-reading age, one in which reflections u p o n the ultimate issues of life and death were encouraged not merely by preadiers and moralists but b y p o p u l a r pamphleteers a n d balladwriters" 9 0 ). Zahlenmäßig w a r der Anteil der kirchlichen Publikationen jedoch der größte 9 1 ). Wesentlicher noch als die Z a h l ist die Tatsache, d a ß die Predigten, Gebetbücher, f r o m m e n Spridiwortsammlungen, moralisierenden Allegorien und Ratgeber f ü r alle Situationen des christlichen Lebens auch wirklich und sogar begierig gelesen w u r d e n , u n d z w a r von Mitgliedern aller kirchlichen Gemeinschaften 9 2 ). Eine E r k l ä r u n g h i e r f ü r ist in dem Glauben an die Wirksamkeit guter Lehren zu suchen; speziell w a r der Elisabethaner überzeugt, d a ß die Craft of Dying lehr- und lernbar sei und d a ß " t h e r e is a certen w a y w h e r b y a m a n m a y die well" 9 3 ). So sah " t h e end of the sixteenth century . . . a great multiplication of devotional books, m a n y of which concerned themselves w i t h the problems of h o w to die well" 9 4 ). Ein Titel wie: A salve for a sicke man: Or, A treatise containing the nature, differences, and kindes of death; as also the right maner of dying well mag als Beispiel f ü r sich sprechen 95 ). Die Betonung der Bedeutung dieser religiösen Schriften k a n n nicht leicht übertrieben werden, wenn man sich als Beispiel vor Augen hält, d a ß " f o r every Elizabethan w h o saw or read one of Shakespeare's plays, a h u n d r e d bought a n d read Perkins' sermons" 9 6 ). D a es uns hier in erster Linie darauf a n k o m m t zu zeigen, wie auch religiöse Schriften dazu beitrugen, den G e d a n k e n an den T o d alltäglich zu machen, braudien wir auf den C h a r a k t e r der erwähnten Anleitungen z u m rechten Sterben nicht näher einzugehen: sie betonen durchweg die Unausweichlichkeit des Todes 9 7 ) u n d seine Universalität 9 8 ). Hieraus und aus der Ungewißheit der letzten Stunde w i r d die
00
) F. P. Wilson, Elizabethan and Jacobean (Oxford, 1945), S. 8. ") E. Klotz, "A Subject Analysis of English Imprints for Every Tenth Year from 1480 to 1640", HLQ, I (1937/38), 417, hat in ihrer Analyse festgestellt, daß von den insgesamt 3530 Publikationen 1562 Titel unter die Rubrik "Philosophie und Religion" fallen; der Anteil der philosophischen Schriften sei jedoch verschwindend gering: "eight in 1640 being the greatest number for any year checked" — man wird also mit etwa 40 °/o kirchlichen Zeugnissen rechnen dürfen. 9! ) Vgl. Wright, Middle-Class Culture, S. 294; Ders., "The Significance of Religious Writings in the English Renaissance", JHI, I (1940), 66. M ) W. Perkins, A salve for a sicke man: . . . (London, 1595), S. 105. M ) Wright, Middle-Class Culture, S. 248/249. °5) W. Perkins. Natürlich ist diese Themenstellung nicht neu: Wright, Middle-Class Culture, S. 249, Anm. 34, weist auf Darstellungen der Ars moriendi im Mittelalter hin. 96 ) Wright, "Religious Writings", S. 59. ") Vgl. Prayers and Other Pieces of Thomas Becon, hrsg. v. J. Ayre, Parker Society, No. XVII (Cambridge, 1844), S. 147: "We are mortal: we therefore must needs die." ,8 ) Vgl. The Remains of Edmund Grindal..., hrsg. v. W. Nicholson, Parker Society, No. VIII (Cambridge, 1843), S. 10: "Daily experience sheweth that all are subject to death." Ähnlich audi Becon, Prayers, S. 147; The Sermons of Edwin Sandys.. ., hrsg. v. J. Ayre, Parker Society, No. II (Cambridge, 1841), S. 168/169.
29
Notwendigkeit abgeleitet, sich auf seinen Tod vorzubereiten: "There be two causes that ought . . . to move us to prepare for death. The one is the necessity of death: the other is the uncertainty thereof" 9 *). Die Notwendigkeit einer Vorbereitung auf den Tod legt die Frage nahe, ob dann nicht ein langsamer einem plötzlichen Tod vorzuziehen sei. Hooker setzt sich ausführlich damit auseinander; nach sorgfältigem Abwägen der Gründe, die dafür 100 ) und dagegen sprechen101), kommt er zu der Überzeugung: "to be preserved "from sudden death', is a blessing of God" 1 0 2 ). Hookers Meinung darf als Ausdruck der herrschenden Ansicht der Christen der Zeit gelten. Diese werden in fast allen einschlägigen Schriften auf die Freuden des "everlasting life" hingewiesen103), woraus gefolgert wird, der Christ dürfe am allerwenigsten den Tod scheuen: "it is rather most fervently to be desired, seeing by that we pass hence unto eternal joys" 104 ). Es versteht sich von selbst, daß nicht alle Elisabethaner mit dieser Haltung identifiziert werden können; schon die noch weitverbreitete stoische Todeskonzeption bot andere Begründungen. Hier berühren wir jedoch die Einstellung des Elisabethaners zum Tod, deren Besprechung einem gesonderten Abschnitt vorbehalten bleibt. Zunächst haben wir uns noch die Tatsache vor Augen zu führen, daß auch die Kunst durch konkrete oder symbolische Darstellungen den Todesgedanken in den Alltag einbezog. "The art of the period literally teems with pictures of death" 105 ). Aus welchen Quellen diese uns heute abnormal erscheinende "preoccupation with death" 108 ) gespeist wurde, interessiert uns hier weniger; wir stellen lediglich als Tatsache fest, daß Memento mori-Motive auf allen Gebieten der reinen und angewandten Kunst anzutreffen sind (— auch diese Erscheinung ein europäisches Phänomen). Einen Höhepunkt bilden ohne Zweifel die Darstellungen des Dance of Death als Versinnbildlichung der universellen Macht des Todes. Sie waren ein besonders beliebtes Thema vom ausgehenden Mittelalter bis ins 17. Jahrhundert hin-
89 )
10°)
101 ) 102 )
10J)
104 )
105 ) 1M )
30
Grindal, Remains, S. 6. The Works of Mr. Richard Hooker in Eight Books of the Laws of Ecclesiastical Polity..., hrsg. v. I. Walton (London, 1821), II, 138: "slow and deliberate death, . . . , that the soul may have time to call itself a just account of all things past." "Suddenness, because it shorteneth their grief, should in reason be most acceptable" (Ebd.). Ebd. Vgl. The Catechism of Thomas Becon with other pieces written by him in the reign of King Edward the Sixth, hrsg. v. J. Ayre, Parker Society, No. X I I I (Cambridge, 1844), S. 4 9 - 5 1 . Ebd., S. 575. Ähnlich audi Becon, Prayers, S. 120 und 148; The Examinations and Writings of John Philpot..., hrsg. v. R. Eden, Parker Society, No. V (Cambridge, 1842), S. 219; The Works of Nicholas Ridley .. ., hrsg. v. H. Christmas, Parker Society, No. I (Cambridge, 1841), S. 77. Th. Spencer, Death and Elizabethan Tragedy: A Study of Convention and Opinion in the Elizabethan Drama (Cambridge, Mass., 1936), S. 49. F. P. Wilson, Elizabethan and Jacobean, S. 105.
ein 107 ); sie ergänzen wirkungsvoll die entsprechenden literarischen Variationen dieses Themas. Einen starken Anteil an der Verwendung von Memento moriMotiven hatte die Kirche, die sie zu belehrenden und ermahnenden Zwecken benutzte und an Grabmälern und Monumenten, in Klöstern und Kirchen anbrachte. Es handelt sich vielfach um Abwandlungen des Totentanzmotivs oder auch um Darstellungen von Leichen, die den Betrachter an das eigene Schicksal erinnern sollen. Dazu gehören dann Inschriften wie etwa: "As I am, so must you be; / Therefore prepare to follow me" 1 0 8 ). Man sieht, die Thematik ist die gleiche, wie wir sie in der christlichen Predigtliteratur feststellen konnten. Oft begegnen auch Darstellungen von Schädeln, mit oder ohne gekreuzten Knochen, mit Inschriften wie Respice finem oder Memento mori109), die den Gedanken an den Tod wachhalten sollen oder ihn in abgewandelten Motiven — z. B. Schädel über Szepter und Hacke 110 ) — als den großen leveller darstellen. Natürlich kommen Memento mori-Motive nicht nur in der kirchlichen Sphäre vor. Wir finden sie auf Münzen, Schmuckstücken111) und Gebrauchsgegenständen aller Art, auf Holzschnitten, Gemälden und Drucken, als Außen- oder Innendekoration von Bauwerken, in Büchern religiösen wie weltlichen Inhalts, auch als Illustration zu Ereignissen der Zeit 112 ); — die Aufzählung ließe sich fortsetzen, denn " 'Memento mori' devices occurred everywhere" 113 ). Auf eine Beschreibung von Einzelheiten kann angesichts der sehr umfänglichen und materialreichen Zusammenstellung Webers verzichtet werden 114 ). Am Rande mag noch vermerkt
) Vgl. F. P. Weber, Aspects of Death and Correlated Aspects of Life in Art, Epigram, and Poetry: Contributions towards an Anthology and an Iconography of the Subject (London, 4. Aufl. 1922) mit Beispielen S. 75 ff. u. ö. und bibliographischen Angaben S. 85/86. Vgl. ferner Spencer, Death, S. 49—51 und B. Whites Einleitung zu The Dance of Death, hrsg. v. F. Warren (London, 1931). Leonard P. Kurtz, The Dance of Death and the Macabre Spirit in European Literature (New York, 1934), behandelt vor allem die französische Literatur und Kunst, geht aber auch auf analoge Erscheinungen in anderen Ländern ein und verfolgt die Entwicklung bis zur Gegenwart. Vgl. bes. Kap. V I I I : " T h e Dance of Death in England" (S. 139—146) und die Bibliographie S. 282—301. 1 0 8 ) Abgedruckt bei Weber, Aspects of Death, S. I l l , als Beispiel eines "very common English epitaph during the sixteenth and seventeenth centuries". 10 ») Vgl. ebd., S. 139/140. 1 1 0 ) Vgl. The Heroicall Devises of M. Claudius Paradin . . . (London, 1591), S. 373. m ) Interessant sind Fingerringe mit einem Totenschädel; sie galten als Kennzeichen für Kurtisanen (vgl. H . Th. Stephenson, The Elizabethan People [New York, 1 9 1 0 ] , S. 98/99), wurden aber auch von den Puritanern gern getragen. Auch Luther soll einen solchen Ring getragen haben (vgl. Weber, Aspects of Death, S. 750). 1 1 2 ) Ein instruktives Beispiel ist die bei G. B. Harrison, Journal, neben S. 84 abgebildete Execution of Edmund Jennings, die insgesamt fünf verschiedene Darstellungen von Hinrichtungen, aufgespießten Köpfen und zerstückelten Leidien enthält und zwei größere Zuschauergruppen aufweist. , 1 3 ) Weber, Aspects of Death, S. 135. So auch W. Farnham, The Medieval Heritage of Elizabethan Tragedy (Oxford, 1936, repr. 1956), S. 42. ,14) Aspects of Death. Einen Vergleich mit Darstellungen in der modernen Kunst führt C. Gottlieb durch: "Modern A r t and Death", The Meaning of Death, hrsg. v. H . Feifei (New York, Toronto, London, 1959), S. 1 5 7 - 1 8 8 . 107
31
werden, d a ß die Gestalt des Todes (zusammen mit anderen Masken) bei Banketten auch zur U n t e r h a l t u n g diente. So h a t Machyn im J a n u a r 1556/57 in seinem Tagebudi v o n einem Festessen berichtet: " a n d ther cam a grett cumpene of m y lord tresorer('s) men w i t h portesans, a n d a grett mene of musysyonars a n d dyssegyssyd, and w i t h trumpets a n d drumes, a n d w i t h ys consellers a n d dyver odur offesers, and ther was a dullvyll shuting of f y r e , and w o n was lyke D e t h w i t h a dart in hand" 1 1 5 ). Alle a n g e f ü h r t e n Beispiele — die Heimsuchungen durch Seuchen, H u n g e r s nöte und Kriege, die religiösen u n d politischen Verfolgungen sowie die D a r stellungen in Schrift u n d Bild — hatten den Zweck, die zwangsläufige V e r t r a u t heit des Elisabethaners mit dem T o d zu demonstrieren. Es hätten weitere Beziehungen zum T o d hergestellt werden u n d auch auf die allgemein niedrigere Lebenserwartung u n d hohe Sterblichkeit hingewiesen werden können, es hätten sich mehr Beispiele und Belege zitieren lassen. Für unsere Absicht w ä r e damit nichts gewonnen worden. Das Ergebnis w ä r e auch bei einer Ausweitung dasselbe u n d könnte nur die Erkenntnis bekräftigen, d a ß der Elisabethaner in seinem täglichen Leben eine ungewöhnlich enge Beziehung z u m T o d in seinen verschiedenen Erscheinungsformen gehabt hat. Diese Erkenntnis m u ß bei der Betracht u n g des elisabethanischen D r a m a s im Auge behalten werden. D e r H i n t e r g r u n d w ä r e aber noch nicht genügend abgesteckt, w e n n wir nicht auch nach der inneren Einstellung z u m Todesproblem fragen, wie sie an der H a l t u n g Sterbender u n d den K o m m e n t a r e n der Zeitgenossen ersichtlich ist. 2. Innere Einstellung
und
Haltung
Nach übereinstimmenden Berichten zeitgenössischer Beobachter aus dem I n u n d Ausland ist den E n g l ä n d e r n eine bemerkenswerte Furchtlosigkeit vor dem T o d e eigen. Sie erweist sich in allen Bevölkerungsschichten und v o m M ä r t y r e r oder Landesverräter aus der Hocharistokratie bis z u m gemeingefährlichen Gewohnheitsverbrecher u n d S t r a ß e n r ä u b e r ; es ist sogar weitgehend gleichgültig, ob der Verurteilte schuldig ist oder nicht. Das mögen zunächst einige Beispiele u n d K o m m e n t a r e illustrieren; anschließend werden wir nach der z u g r u n d e liegenden H a l t u n g fragen. Z u r Hinrichtung des D u k e of Somerset 1551 ist in den P r o z e ß a k t e n vermerkt, er sei " n o t h i n g at all abashed . . ., neither w i t h the sight of the ax, neither yet of the h a n g m a n , or of present death" 1 1 6 ); er legte den Kopf auf den Block "shewing no manner or token of trouble or fear, neither did his countenance (hange" 1 1 7 ). Dies ist dieselbe H a l t u n g , wie sie v o n jenem namenlosen englischen Soldaten berichtet w i r d , der im spanisch-niederländischen Krieg in holländische Gefangenschaft geriet; v o n den insgesamt 24 Gefangenen sollten 8 zum E r h ä n -
115
) Diary, S. 125. »•) Cobbett, State Trials, S. 523. " ' ) Ebd., S. 526. 32
gen ausgelost werden: "There was besides in that danger, a certaine Englishman, a common souldier, who with a carelesse countenance, expressing noe feare of death at all, came boldly to the helmet, and drew his lot; chance fauoured him; it was a safe lot. Being free himselfe from danger, hee came to the Spaniard, who was yet timorous, and trembled to put his hand into the fatall helmet; and receiuing from him ten crownes, hee entreated the Iudges (oh horrid audacity!) that dismissing the Spaniard, they would suffer him againe to try his fortune. The Iudges consented to the mad mans request, who valewed his life at soe low a rate; and he againe drew a safe lot" 1 1 8 ). Besonderes Gewicht erhält eine Anerkennung, wenn sie widerwillig gegeben wird wie in dem Bericht über Cranmers Feuertod 1556, den dieser bewegungslos und stumm erduldete: " i f it had been taken either for the glory of God, the wealth of his country, or the testimony of truth, . . ., I could worthily have commended the example, and matched it with the fame of any father of antient time: But seeing that not the death, but the cause and quarrel thereof, commendeth the sufferer, I cannot but much dispraise his obstinate stubbornness and sturdiness in dying, and specially in so evil a cause" 119 ). Frauen bestiegen das Sdiafott mit der gleichen Kaltblütigkeit wie die Männer. Mary Stuart ist ein Beispiel: "her countenance carelesse, imparting thereby rather mirth then mournfull dieare, and so she willingly stepped up to the scaffold which was prepared for her in the H a l l " ; dort erwartete sie den tödlichen Streich "without any token or fear of death" 1 2 0 ). Ähnliches wird von Anne Boleyn, Katherine Howard und Lady Jane Grey berichtet 121 ). Fast alle bekannten Einzelbeispiele gewaltsamer Todesfälle zeigen äußerlich das gleiche Bild, so daß Sir Thomas Smith 1565 zusammenfassen kann: " T h e nature of English men is to neglect death . . . In no place shal you see malefactors go more constantly, more assuredly, and with lesse lamentation to their death than in England" 1 2 2 ). Auch Ausländer, die sicher keinen Grund für eine unkritische Stellungnahme hatten, äußerten sich ähnlich: " I t is worth consideration that the English care little or nothing for death" 1 2 3 ), und Van Meteren beschreibt 1575 die Engländer als "bold, courageous, ardent, and cruel in war, fiery in attack, and having little fear of death" 1 2 4 ). Kriterien für die beschriebene Einschätzung der Einstellung zum Tod waren entweder die auf dem Schafott gehaltenen Sterbereden (die als unmittelbar für unser Thema relevant gesonderte Beachtung verdienen) oder Haltung, Aussehen
118) 118 )
12°)
1J1 ) 122)
123 )
124 )
The Mirrour of Mind.es, or, Barclays Icon animorum, Englished by T. M. (London, 1631), S. 114/115. Cobbett, State Trials, S. 861. E. K. Kendall, Hrsg., Source-Book of English History (New York, 1900), S. 175. Vgl. Einstein, Tudor Ideals, S. 263. De República Anglorum: The maner of Gouernement or policie of the Realme of England, compiled by the Honorable man Thomas Smyth ... (London, 1583), S. 85. Vgl. audi Harrison's Description, S. 221 : "our condemned persons doo go so cheerefullie to their deths." Girolamo Cardano, zitiert bei Rye, England as Seen by Foreigners, S. xlix. Zitiert ebd., S. 70. 33
und Stimme des Verurteilten. Dabei lag die Uberzeugung zugrunde, daß psychische Vorgänge sich direkt an äußerlichen Ausdrucksmerkmalen ablesen lassen125). Es wurde also darauf geachtet, ob etwa Knie oder Hände der Delinquenten zitterten, ob ihr Gesicht bleich war und ob die Stimme schwankte. Da die Verurteilten wußten, daß man sie daraufhin beobachten und ihre Furchtlosigkeit vor dem Tod entsprechend einschätzen würde, bemühten sie sich, diese Merkmale entweder zu vermeiden — und sei es auch mit Hilfe von Alkohol 128 ) — oder doch unverfänglich etwa durch Krankheit zu erklären 127 ). Die zum Schafott geführten Elisabethaner wollten also ganz bewußt einen furchtlosen Eindruck machen. Erstaunlich ist die Tatsache, daß selbst Unschuldige, die der Staatssicherheit geopfert wurden, nicht nur fast nie Einspruch gegen ihr Todesurteil erhoben, sondern es sogar ausdrücklich als gerecht erklärten, sich ihm genau wie der gemeine Verbrecher unterwarfen und ohne Groll, ja mit guten Wünschen für ihren Herrscher, aus dem Leben schieden. In seiner sehr anregenden Studie: "English Treason Trials" hat L. B. Smith versucht, dies Phänomen zu erklären. Drei Gruppen von Gründen sind seiner Meinung nach verantwortlich für die Anerkennung offensichtlicher Rechtsbrüche: "physical pressure brought directly to bear upon the victims, Tudor ideas concerning a subject's duty towards his sovereign and his society; and finally the importance of certain religious and fatalistic ideals of the age" (S. 483). Endgültige Sicherheit ist nicht zu gewinnen, wie Smith auch selbst anmerkt (S. 498); immerhin sind die gebotenen Erklärungsversuche als Motive durchaus denkbar. Dies Problem hat uns an eine wesentliche Frage herangeführt: die Frage nämlich, welche innere Haltung der äußerlich zur Schau getragenen Todesverachtung zugrunde liegt. Von den relativ wenigen Fällen abgesehen, die laut Chroniken und Prozeßakten unmittelbar Todesangst erkennen ließen 128 ),
126
) R. L. Anderson, Elizabethan Psychology and Shakespeare's Plays, University of Iowa Humanistic Studies, III, 4 (Iowa, 1927), S. 89, spricht von der "certainty with which an emotional state reveals itself through observable signs". Vgl. auch H . Craig, "Shakespeare's Depiction of Passions", PQ, IV (1925), 299: "Flushing and paling, trembling, sighing, sobbing, smiles and laughter, postures of body, head and features, and every outward bodily sign were the immediate manifestations of an inward and ascertainable psychological state". 12 ') So hat sich etwa John Carew vorbereitet "by drinking three pints of Sack to bear his spirits" (A compleat Collection, S. 24). ,27 ) Audi W. Ralegh hat auf eine solche Erklärung Wert gelegt: "And if I shew any Weakness, I beseech you to attribute it to my Malady, for this is the Hour I look for it" (Works, I, xc). Vgl. auch Finkenstaedt, "Galgenliteratur", S. 542/543 und W. Farnham, "Tragic Prodigality of Life", EIC, 2nd Series, University of California Publications in English, IV (Berkeley, California, 1934), S. 193. Als Beleg aus einem Shakespeare-Drama ist B Henry VI., IV, vii, 97/98 anzuführen: "Why dost thou quiver, man?" — "The palsy, and not fear, provokes me." 128 ) Einstein, Tudor Ideals, S. 264, vermutet, daß Angst vor dem Tod eine größere Rolle gespielt hat, als aus den Berichten über Hinrichtungen hervorgeht. Dazu vgl. The Works of Hugh Latimer, hrsg. v. G. E. Corrie für die Parker Society (Cambridge, 1844), I, 220: "This face of death and hell is so terrible, that such as have been wicked men had rather be hanged than abide it."
34
scheint diese Furchtlosigkeit tatsächlich ein charakteristisches Merkmal der Elisabethaner gewesen zu sein. Die Frage nach der Todeskonzeption jener Zeit ist jedoch schwierig: " I t is almost needless to point out that the aspect of, or mental attitude towards, death must vary much with the age, sex, temporary or permanent occupation (or want of occupation), past experiences, future prospects, education, moral and religious surroundings, personal principles and religious beliefs, aspirations, ambition, personal, hereditary or racial temperament, and the temporary state of health and enjoyment in life. It must, to some extent, vary from time to time according to the condition of the mind and body and the changing moods of the individual. Moreover, supposed proximity is likely often to modify as well as to intensify the aspect in which the idea of death presents itself" 1 2 9 ). Auch eine Rubrizierung nach verschiedenen Geistesströmungen bedeutet für uns kaum eine Hilfe, weil die verschiedenen Philosophien zu zahlreich und zu eng miteinander verwoben sind: " T h e European of the sixteenth century found himself confronted at one and the same time with an orthodox Platonism, a religion according to Plotinus, an atheism founded on Proclus, a purged Aristotle, a heretical Averroes and Alexander, a providencedenying Epicureanism, and a Stoicism that took the back door to Christian ethics. Accepting the major premise that all the fruit of antiquity was palatable, he tried not only to reconcile these systems to each other but to marry them to Moses and Christ. The result was a philosophic nightmare, a philosophic tragedy" 1 3 0 ). Für die Zwecke unseres kurzen Uberblicks muß es genügen, einige Ansatzpunkte aufzuzeigen 131 ). Trotz der scheinbaren Gleichförmigkeit im Verhalten der Elisabethaner zum Tod müssen wir uns bewußt sein, daß die Einstellung ganz verschieden sein kann: es gibt nicht nur eine Todeskonzeption, die für das 16. Jahrhundert allein
) Weber, Aspects of Death, S. 159. Vgl. auch S. 508. °) Don Cameron Allen, " T h e Degeneration of Man and Renaissance Pessimism", SP, X X X V (1938), 2 0 6 / 2 0 7 . Vgl. auch M. Doran, Endeavors of Art: A study of form in Elizabethan drama (Madison, 1954), S. 4 1 5 : "There is no Elizabethan state of mind; there are many Elizabethan states of mind." Ähnlich auch Th. Spencer, Shakespeare and the Nature of Man (New York, 2. Aufl. 1949), S. 1 und C. S. Lewis, English Literature in the Sixteenth Century Excluding Drama, The Oxford History of English Literature, III (Oxford, 1954), S. 63. 1 8 1 ) Ausführlicher wird die Einstellung zum Tod behandelt bei Farnham, Medieval Heritage, S. 421—432; Ders., "Tragic Prodigality"; J . Huizinga, Herbst des Mittelalters: Studien über Lebens- und Geistesformen des 14. und Ii. Jahrhunderts in Frankreich und in den Niederlanden (München, 1928), bes. Kap. X I : "Das Bild des Todes"; P. Meißner, "Mittelalterliches Lebensgefühl in der englischen Renaissance", DVJs, X V (1937), 433—472; Spencer, Death, bes. S. 3 5 - 6 5 ; C. B. Watson, Shakespeare and the Renaissance Concept of Honor (Princeton, 1960), S. 115—117 u. ö.; Weber, Aspects of Death, bes. Kap. I I : "The various possible aspects of death and mental attitudes towards the idea of death." Audi für den englischen Kulturkreis grundlegend: W . Rehm, Der Todesgedanke in der deutschen Dichtung vom Mittelalter bis zur Romantik, DVJs, Buchreihe, X I V (Halle, 1928), Kap. V I : " D a s 16. Jahrhundert." Vgl. audi die Ausführungen über die Einstellung zum Problem der Zeit bei Meißner, England, S. 259—269. 12e
13
35
kennzeichnend wäre. Da kann zunächst die christliche Auffassung vom Tod als Zugang zu dem eigentlichen Leben dem Sterben seine Schrecken nehmen 132 ). Ihr verdanken viele der mit so eindrucksvoller Gelassenheit Sterbenden ihre Haltung. So wird die Todesverachtung Raleghs ausdrücklich als "Effect of Christian Courage" bezeichnet133), und Latimer predigt: "If we believe in Jesu Christ, we shall overcome death" 134 ). Diese Haltung erklärt auch die überlegene Heiterkeit, mit der viele Verurteilte von Morus bis Ralegh aus dem Leben geschieden sind 135 ). Stärker mittelalterlich ist die gänzliche Verachtung alles Irdischen, die den Tod als Befreiung der Seele aus dem Gefängnis des Leibes herbeisehnt: "I feel in myself, O merciful Saviour, how grievous a prison this my body is unto my soul, which continually wisheth to be loosened out of this vile carcase, and to come unto thee" 136 ). Der Verbrecher jedoch, der auf dem Schafott den Todesstreich erwartete, begrüßte den Tod nicht als Erlösung von einem unerträglichen Dasein, ebensowenig wie der Soldat die Gelegenheiten zum Sterben suchte137). Diese Elisabethaner, die zahlenmäßig wohl den größten Anteil stellen, nehmen ihren Tod als unvermeidliches Ende eines in vollen Zügen genossenen Lebens hin; als "gallant gamblers with life" sind sie "ready to pay without murmur when they lose, prodigal in their expenditure of life and scorning to flatter life in servile fashion to get from it a few more days or years . . . It is the full acceptance of death coming out of the full acceptance of life" 138 ). Auf das offensichtlich 'blinde' Wüten der Pestepidemien ist die vielfach vertretene Ansicht zurückzuführen, die Seuchen seien ein Instrument Gottes und alle vorbeugenden oder heilenden Maßnahmen daher nutzlos: "So, by a twist of rationalization, the popular terror of death gave rise to the complete disregard of death" 139 ). Bei öffentlichen Hinrichtungen spielte der Gedanke an den Eindruck eine Rolle, den die Zuschauer erhalten und bewahren würden. Dieser Gesichtspunkt führt uns zu einer für die Zeit sehr kennzeichnenden Haltung: dem Renaissancemenschen war, anders als dem Engländer des Mittelalters, der Gedanke unerträglich, nach dem Tod vergessen zu sein. Sofern er nicht im christlichen Sinn an Unsterblichkeit glaubte, war die Hoffnung auf ein Weiterleben im Gedäditnis der Nachwelt eine Möglichkeit, den Tod zu
1S2
) ) ) 136 )
133 134
is«) 137
) ) 139 ) 138
36
Vgl. Becon, Catechism, S. 49—51. Ralegh, Works, I, lxxxiii. Works, I, 224. Vgl. Watson, Honor, S. 116/117 und Finkenstaedt, "Galgenliteratur", S. 545. Farnham, "Tragic Prodigality", S. 196, meint, diese Haltung sei "not by any means typical of heroic deaths in Elizabethan tragedy. These are usually serious to the last degree". Becon, Prayers, S. 83. Vgl. audi Spencer, Death, der S. 47/48 die Beziehung dieser Doktrin zum Calvinismus herstellt. Vgl. Farnham, "Tragic Prodigality", S. 193. Ebd., S. 193/194. P. H. Kodier, Science and Religion in Elizabethan England (San Marino, California, 1953), S. 273. Ähnliches meint auch Einstein, Tudor Ideals, S. 263, wenn er schreibt: "There was a fatalism in the spirit of the time, and a moral preparation for death which came from the continuous neighbourhood of danger."
überwinden. Daher die Betonung des Ruhmes und die Bedeutung seiner zuverlässigen Verbreitung in Wort, Schrift oder bildlichen Darstellungen und der Gedanke eines Fortlebens in den Nachkommen 1 4 0 ). Die Überzeugung, daß die Erinnerung an rühmliche Taten fortleben wird, milderte auch die allgemeine Furcht vor plötzlichen Todesfällen 1 4 1 ), wie sie in jener Zeit der Seuchen, mangelnden Medizinkenntnis, Kriege und Hungersnöte erwartet werden mußten. Am schlimmsten war ein rascher Tod für Christen: sie brauchten eine Vorbereitungszeit, um ihre Sünden zu bereuen und den Tod nicht als Bestrafung fürchten zu müssen. Beispiele sind der Duke of Somerset, der bei seiner Hinrichtung 1551 Gott für seinen langsamen Tod dankte 1 4 2 ), oder Lady Jane, die in ihrer Sterberede 1553 sagte: " I thanke God of his goodnesse that he hath geuen mee a tyme and respite to repent" 1 4 3 ). Schließlich ist besonders bei Hinrichtungen noch zu veranschlagen, daß die Haltung dem Tod gegenüber als Rechtfertigung des Lebens und Beweis für Glauben oder Entsühnung interpretiert wurde 1 4 4 ); deshalb auch die bereits erwähnte Sorge der Elisabethaner, einen gefaßten und sicheren, ja unbekümmerten Eindruck zu erwecken 145 ). Zum Abschluß mag ein Blick auf die Einstellung der Elisabethaner zum Problem des Selbstmordes den Uberblick über die Todeskonzeptionen abrunden 1 4 8 ). Während das Christentum den Freitod grundsätzlich und uneingeschränkt ablehnte 1 4 7 ), wurde er mit zunehmendem Einfluß der Antike in Literatur und Leben häufiger: Montaigne spricht von einer "indication of the willingness of Renaissance moralists to view suicide as an honourable act" 1 4 8 ). Man bewunderte zunächst die Haltung der Alten: "Beholde the noble resolution of the auncient Captaines, a number feared not death, & almost euery one
140
) Vgl. Spencer, Death, S. 135: "But the blankness of being forgotten was of all thoughts the most tormenting"; ferner Watson, Honor, S. 6 9 if., 3 7 0 ; M. Deutschbein, Die kosmischen Mächte bei Shakespeare (Dortmund, 1947), S. 22/23, 3 0 / 3 1 ; Weber, Aspects of Death, S. 1 2 3 ; Bacons "Essay of Death", The Philosophical Works of Francis Bacon, hrsg. v. J . M. Robertson (London, 1905), S. 737.
) ) 14S ) 144) 145)
Vgl. Spencer, Death, S. 2 3 : " F e a r of sudden death was a commonplace." Vgl. Cobbett, State Trials, S. 526. Grafton, Chronicle, S. 1337. Vgl. Finkenstaedt, "Galgenliteratur", S. 534. Auch in Mores Utopia, hrsg. v. J. H . Lupton (Oxford, 1895), S. 276/277, finden wir die Ansicht, daß ein angstvoller und widerwilliger Tod ein sehr übles Anzeichen sei, "as though the sowie, beinge in dyspayre and vexed in conscience, through some preuy and secret forefeilyng of the punnishment now at hande, were aferde to depart". Bacon, "Essay of Death", S. 737, bezeichnet die Angst vor dem Tod als "weak". u > ) Ausführungen hierzu bei F. Eisinger, Das Problem des Selbstmordes in der Literatur der englischen Renaissance (Diss. Freiburg, 1 9 2 6 ) ; Watson, Honor, S. 117—123; Spencer, Death, S. 158. 1 4 7 ) Vgl. Watson, Honor, S. 117: "The Christian taboo against suicide encompassed all sects and creeds." 1 4 8 ) Zitiert bei Watson, Honor, S. 120. Auch Eisinger, Selbstmord und W . E. H . Lecky, History of European Morals From Augustus to Charlemagne (London, 1869), II, 58/59, weisen auf die veränderte Einstellung und zunehmende Häufigkeit der Selbstmorde hin. I4
2 ) Vgl. Levin, The Overreacher, S. 44: "Magniloquence does duty for magnificence. Hence the hero is a consummate rhetorician and, conversely, weakness is represented as speechlessness."
73
sind aber auch rein dialogisch durchgeführte Sterbeszenen selten (Olympia, Governor). So entsteht — im Vergleich etwa zur Spanish Tragedy — ein äußerlich ausgeglicheneres Bild 8 3 ). Mit Ausnahme der Sterbereden der beiden Hauptpersonen, Zenocrate und Tamburlaine, sind die des zweiten Teils merklich kürzer und aufgelockerter als die des ersten. Die inhaltliche und auch stilistische Ausrichtung auf Wesen und Ausdrucksweise Tamburlaines gibt dem Drama zwar eine einheitliche Tonlage, mindert aber die individuelle Ausgestaltung der Sterbereden nach Todesart und Person des Sterbenden. Die Verknüpfung mit der Handlung ist im allgemeinen wenig befriedigend und geht selten über den Rahmen einer Episode hinaus. Die Sterbereden sind mit wenigen Ausnahmen Affektreden und von Eigengewicht; ein Zurücktreten hinter die Handlung ist nur in wenigen Ansätzen spürbar (Olympia, Governor); Gefühle werden noch beschrieben, nicht dargestellt. Die Hauptbedeutung des Tamburlaine innerhalb einer Untersuchung der Sterbereden ist also in der sprachlichen Gestaltung zu suchen94). Der Blankvers ist außerordentlich klangvoll und rhythmisch durchgegliedert, zeichnet sich meist durch reiche Metaphorik aus und eine leidenschaftliche, in kühnen Bildern sich übersteigernde Ausdrucksweise; gelegentlich besitzt er lyrische Qualität und vermittelt zartere Gefühlstöne. Wenn auch viele Sterbereden noch unpersönlich bis zur Austauschbarkeit sind, deutet sich bereits eine individuellere Sprachgestaltung an und lassen sich Ansätze zu charaktertypischen Äußerungen aufweisen (Zabina, Zenocrate, Olympia, Governor, Tamburlaine) 95 ). Auf rhetorische patterns wird weitgehend verzichtet; an ihre Stelle tritt die phantastisch ausgeweitete Vision Marlowes und der Glanz seines Vokabulars, häufig eindrucksvoll unterstützt durch Bühnenbild und Personengruppierung. 7. Doctor
Faustus
Marlowes Faustus verlangt besondere Beachtung. Der einzige Sterbende dieses Werkes ist die Hauptgestalt selbst. Ihre Sterberede beherrscht im Grunde das ganze Drama seit Abschluß des Teufelspaktes (528—542). Von dem Augenblick an kennt Faustus den genauen Zeitpunkt seines Todes; und daß er ihn nicht vergißt, beweist der immer wiederkehrende Gedanke an sein Ende 9 6 ). Wir be-
) Vgl. Clemen, Tragödie vor Shakespeare, S. 103. ) Einen Überblick über die von Marlowe benutzten Möglichkeiten einer Belebung und Variation des Blankverses gibt Bakeless, Tragicall History, II, in Kap. X V : "The Mighty Line", bes. S. 183 ff. Vgl. audi D. Peet, "The Rhetoric of 'Tamburlaine'", ELH, X X V I (1959), 137-155; C. F. T. Brooke, "Marlowe's Versification and Style", SP, X I X (1922), 186-205. 5 • ) Audi P. H. Kodier, Christopher Marlowe: A Study of his Thought, Learning, and Character (Chapel Hill, 1946), S. 304, nennt Zabina, Zenocrate und Olympia als hoffnungsvolle Ausnahmen einer allgemein undifferenzierten Sprachgebung: sie seien "described with a certain power of insight". »•) Vgl. Z. 1106-09, 1142-44, 1285/86, 1360, 1371 ff.
,s
M
74
trachten hier nur Fausts letzten, 1419 beginnenden (59 Zeilen langen) Monolog — "one of the summits of the Elizabethan drama and even of the drama of all ages" 97 ); er unterscheidet sich stark von den bisher im vorshakespeareschen Drama üblichen Sterbereden. Grundhaltung dieser Rede ist Fausts Verzweiflung, daß ihm jetzt, eine Stunde vor Ablauf des Vertrages, keine Zeit zur Reue mehr bleibt. Er mödite bereuen, möchte den Pakt ungeschehen machen, um seine Seele vor der ewigen Verdammnis zu retten — und weiß doch genau, daß es zu spät ist und daß seine Sünde zu groß ist, als daß sie ihm vergeben werden könnte. Diese Überlegungen werden nicht in Form einer wohlgeplanten Deklamation vorgetragen, sondern sie entstehen sichtbar erst im Augenblick des Sprechens; sie sind hochdramatischer Ausdruck eines qualvollen Seelenkampfes. Redeaufbau und Sprache sind mit dem Inhalt eine Einheit eingegangen, wie sie enger kaum gedacht werden könnte. Im folgenden sollen einige für die Ausprägung des Redetypus belangvolle Merkmale hervorgehoben werden. Der elfte Glockenschlag bringt Faustus sein unmittelbar bevorstehendes schreckliches Ende nachdrücklich zum Bewußtsein (1419—21); eine Apostrophe an die Sphären und die Sonne drückt seine Verzweiflung über die unaufhaltsam verrinnende Zeit aus (1422—30)98). Das Bewußtsein der Verdammung ruft in Faustus die Vision von Christi Blut am Himmel hervor und verstärkt gleichzeitig seine Verzweiflung: für ihn ist nicht einmal "hälfe a drop" (1433) vergossen worden. Schwer empfindet er den "heauy wrath of God" (1431—39). Er kann nicht entfliehen: weder nimmt ihn die Erde auf, noch reißen ihn die Sterne empor und retten seine Seele (1440—49). Der Glockenschlag der halben Stunde verstärkt Faustus' Entsetzen. Er will 1000, ja 100 000 Jahre in der Hölle leben, aber dann doch gerettet werden: "O, no end is limited to damned soules" (1458). Aber Gott antwortet nicht (1452—60). Auch der pythagoreische Seelenwanderungsglaube gibt keinen Trost (1461—66). So flucht er den Eltern, sich selbst, Lucifer. Als es 12 Uhr schlägt, sucht er wieder verzweifelt nach Möglichkeiten, Lucifer doch noch zu entgehen: "now body turne to ayre" (1470) und " O soule, be changde into little water drops, / And fal into the Ocean, nere be found" (1472/73). Noch beim Erscheinen der Teufel sucht er Aufschub (1475) und Rettung: "Ile burne my bookes" (1477); umsonst: wortlos und rasch wird er von der Bühne geführt. — Die Beziehung dieser Sterberede auf die Todesart ist enger, als uns bisher begegnet ist: die ganze Rede ist auf die bevorstehende Erfüllung des Teufelspaktes ausgerichtet und zieht ihre Dramatik aus dem vergeblichen Bemühen Fausts, seine Seele doch noch zu retten. Auf die Ver-
" ) Poirier, Marlowe, S. 142. Ähnlich lobend äußert sich Bakeless, Tragicall History, I, 275 und II, 182; Ders., Christopher Marlowe (London, 1938), S. 135. Interpretationen der Sterbeszene Fausts bei J. A. Symonds, Shakspere's Predecessors in the English Drama (London, 1884), S. 645—648; P. Simpson, "Marlowe's 'Tragical History of Doctor Faustus'" in seinen Studies in Elizabethan Drama (Oxford, 1955), S. 102—104; Hoffmann, Die typischen Situationen, S. 54—56. 9e ) Die Verwendung dieser üblichen Anrufe ist hier nicht gedankenlos übernommenes Klischee, sondern aus Charakter und Situation hinreichend motiviert. Vgl. Clemen, Tragödie vor Shakespeare, S. 132 und 221.
75
knüpfung mit aer Gesamthandlung und der Person i'austs ist bereits hingewiesen worden. Es sind zwar konventionelle Elemente verwendet w o r d e n " ) , aber in ganz konkreter Funktion und motiviert durch die Verzweiflung über die verrinnende Zeit, die eigene Ohnmacht und die Gewißheit ewiger Verdammnis. Neuartig und bewundernswert ist vor allem die sprachliche Gestaltung 1 0 0 ), die uns den auslösenden Seelenkonflikt als 'Vorgang' miterleben läßt. Die Sätze entstehen erst während des Sprechens; die S y n t a x ist den Gedankensprüngen angepaßt. S o stehen Kurzsätze nebeneinander, in denen oft die zweite Aussage das Gegenteil der ersten enthält, weil deren Undurchführbarkeit oder Unrichtigkeit erkannt wird 1 0 1 ). Die hohe Intensität des Erlebens wird unterstrichen durch Kurzverse, Ausrufe und durch Wortwiederholungen (vgl. Z . 1424, 1432, 1438, 1440, 1470, 1474), die den Blankvers auflockern und ein dynamisches Element einführen' 0 2 ). Die Einbeziehung der Zeit und der dauernde Bezug auf ihre U n aufhalts&mkeit trägt ebenfalls bei zu der Empfindung des Bewegten und Lebendigen 1 0 3 ); eine Diskrepanz zwischen der realen Zeitspanne von einer Stunde und ihrer Komprimierung in 59 Zeilen wird nicht empfunden 1 0 4 ). K u r z zusammengefaßt sind die wichtigsten Merkmale dieser Sterberede also Dramatisierung und Konkretisierung von Seelenvorgängen, ihre unmittelbare, spontane sprachliche Wiedergabe sowie eine neuartige, sinnvoll motivierte Verwendung konventioneller Topoi.
8. The Jew of
Malta
I m Jew of Malta sterben 11 der insgesamt 30 Personen; 5 davon auf der Bühne. 3 Figuren wird vor dem T o d die Gelegenheit zu letzten Worten gegeben; eine lange Rede ist dabei nicht vertreten. Abigails Sterberede, die erste des Dramas ( 1 4 6 4 ; 2 + 5 + 4 + 4 + 3 + 2 + 4
) Selbstapostrophe 1419, 1468; Anrede des Körpers und der Seele 1470, 1472; Anrufung der Elemente 1422, 1424, 1442, 1443; Anrufung Gottes 1452, 1474. '»») Vgl. Poirier, Marlowe, S. 145: " . . . it [the verse] reaches a freedom and power that will not be found anywhere else in the works of Marlowe." 101 ) Vgl. 1431: " O lie leape vp to my God: who pulles me downe?"; 1442: "Earth gape. O no, it wil not harbour me"; 1467/68: "Curst be the parents that ingendred me: / No Faustus, curse thy selfe, curse Lucifer." I»5) Vgl. T. S. Eliot, Selected Essays (London, 3. Aufl. 1951, repr. 1961), S. 122: Marlowe "broke up the line, to gain in intensity, in the last soliloquy". l o s ) Vgl. Clemen, Tragödie vor Shakespeare, S. 221: " . . . es wird nicht mehr ein Gefühl smotiv aus der weiterlaufenden Handlung herausgegriffen und als 'Haltepunkt' als 'statische Szene' lyrisch-rhetorisch gestaltet, sondern auch innerhalb der Rede vollzieht sich nun Handlung, 'innere Handlung', die von der Rede als etwas Gleichzeitiges (und nidit nachträglich Überschautes) abgebildet wird." W. W. Greg spricht von "intense spiritual drama" in "The Damnation of Faustus", MLR, X L I (1946), 105, Anm. 1. 1M ) Vgl. Clemen, Tragödie vor Shakespeare, S. 132; Levin, The Overreacher, S. 151; Bakeless, Marlowe, S. 135. M
76
Zeilen), ist in Dialogform gehalten; kein Einzelabschnitt ist länger als 5 Zeilen (bei insgesamt 24 gesprochenen Zeilen). Abigail betritt die Bühne, als Friar Barnardino gerade von der Vergiftung der Nonnen berichtet hat und nun bei ihrem Anblick sein Erstaunen darüber äußert, daß sie als einzige am Leben geblieben sei. Das ist das Stichwort für Abigail, die ohne Umschweife erwidert: "And I shall dye too, for I feele death comming." Dann beichtet sie dem Friar und enthüllt ihm ihres Vaters Rolle beim Tode Mathias' und Lodowicks. Sie will damit nicht ihren Vater verderben, sondern sucht Frieden für ihre Seele: "To worke my peace, this I confesse to thee" (1487). Deshalb bittet sie Barnardino: "Reueale it not, for then my father dyes" (1488). Als letzte Bitte richtet sie an den Friar den Wunsch, er möge ihren Vater bekehren und bezeugen, daß sie als Christin gestorben sei. — Diese Sterberede scheint sich durch eine Entgrenzung zum Dialog hin auszuzeichnen. Es handelt sich aber nur um eine äußerliche Aufgliederung: die kurzen Einwürfe des Mönches (1472: "What then?"; 1477: "Yes, what of them?"; 1482: "So, say how was their end?"; 1486: "Oh monstrous villany") nehmen keinen Einfluß auf Abigails Rede, die im Grunde zusammenhängend vorgetragen wird. Marlowes Kunstgriff ruft aber doch den Eindruck der Vielgliedrigkeit hervor und ist (besonders im Vergleich zu den längeren Reden des Tamburlaine) als echter Fortschritt in der Dramentechnik zu werten. Die Wirkung des Giftes wird nicht betont; Marlowe verzichtet hier auf ausführlichere Beschreibungen des körperlichen Zustands: lediglich zwei Halbzeilen nehmen direkten Bezug auf den bevorstehenden Tod (1464, 1494). Als überzeugende Charakterrede können wir Abigails Worte nicht bezeichnen, wenngleich Ansätze zu einer Individualisierung und zu einer Verknüpfung mit bereits dargestellten Eigenschaften vorhanden sind. Die wohlüberlegte Ausführlichkeit der Selbstdarstellung könnte an die unbeholfene Verdeutlichungstechnik früherer Sterbereden erinnern, ist hier aber motiviert durch die Situation der Beichte vor dem nicht unterrichteten Friar. Die Enthüllungen Abigails werden schon im folgenden Auftritt dramatisch wirksam, als der Mönch entgegen dem 1489—92 gegebenen Versprechen sein Wissen gegen Barabas ausspielen will und dabei selbst zugrunde geht. Die Sprache dieser Sterberede ist einfach und schlicht, ohne rhetorische Kunstgriffe, überschwengliche Wendungen oder phantasievolle Bilder und ist fast ausschließlich auf konkrete Ereignisse bezogen — nur in 1473/74 wird auf nicht näher bezeichnete "sins" hingewiesen. Der Blankvers ist nicht mechanisch nach dem Metrum, sondern rhythmisch und dem Gehalt entsprechend gegliedert; daher ergeben sich Pausen innerhalb einer Zeile, gelegentliche weibliche Versausgänge, eine unvollendete Zeile. Die Rede ist nicht affektiv emphatisch, sondern ruhig und überlegt; einziger HandlungsVorgang ist die Übergabe eines Briefes an den Friar. Uber die Sterbeszene des Friar Barnardino kann kurz hinweggegangen werden. Die beiden Zeilen "What, doe you meane to strangle me?" (1653) und "What, will you haue my life?" (1657) unterstreichen die unbedeutende, nicht individualisierte Rolle des Mönches. Wenn auch die erste Äußerung noch gerechtfertigt werden könnte als unreflektierter Ausruf der Überraschung nach plötzlichem Herausreißen aus dem Schlaf, so beweist der einfallslose Parallelismus 77
des zweiten Satzes, daß hier nicht einmal die dramatische Qualität des vergleichbaren Ausrufs Horatios in Kyds Spanish Tragedy erreicht worden ist. Ergiebiger ist die Sterberede des Jew (2348; 1 + 2 + 1 + 13 Zeilen). Barabas ist das Opfer seines eigenen Anschlages geworden und in den für Calymath vorbereiteten Kessel gestürzt. Voll Sdimerz und Todesangst ruft er die Umstehenden allgemein und namentlich um Hilfe an: "Helpe, helpe me, Christians, helpe" (2348); " O h helpe me, Selim, helpe me, Christians. / Gouernour, why stand you all so pittilesse?" (2353/54). Als er aber die Vergeblichkeit seines Flehens erkennen muß (2359: " Y o u will not helpe me then?"), gewinnt er seine frühere Energie zurück und beschließt, mit "resolution" zu sterben. Es folgt ein Sdiurkenmonolog, in dem Barabas triumphierend seine Schandtaten verkündet ( 2 3 6 5 - 7 0 ) : Know, Gouernor, 'twas I that slew thy sonne; I fram'd the challenge that did make them meet: Know, Calymath, I aym'd thy ouerthrow, And had I but escap'd this stratagem, I would haue brought confusion on you all, Damn'd Christians, dogges, and Turkish Infidels. Der Bezug auf die "intolerable pangs", die Barabas in dem glühendheißen Kessel erleidet, ist wieder nur sehr kurz in zwei Zeilen hergestellt (2371/72). Die letzten Worte sind ein Sdirei der Qual und Wut: " D y e life, flye soule, tongue curse thy fill and dye" (2373) 1 0 5 ). Diese Sterberede ist ohne Zweifel außerordentlich bühnenwirksam. Durch die eindringlichen Wiederholungen des "help" (siebenmal in den ersten fünf Zeilen) entsteht die Wirkung eines einzigen Hilferufes, der gleichwohl in Verbindung mit den Einwürfen Fernezes einen Übergang zu der Trotzhaltung des Bühnenschurken anbahnt, so daß die beiden Redehaltungen nicht unvermittelt nebeneinanderstehen. Parallelkonstruktionen beherrschen auch die letzte, zusammenhängende Rede. Selbstapostrophen mit den Sonderformen der Anrede von Körperteilen und Todeswunschformeln unterstreichen die Beziehung zu älteren Konventionen. Die Verknüpfung der Sterberede mit dem Gang der Handlung ist dramaturgisch recht gesdiickt vollzogen. Der Schurkenmonolog 2365—70 entspricht dem Charakter des Barabas der späteren Akte 1 0 6 ) wie auch der Konvention des Typus des stage villain, von dem die elisabethanisdien Zuschauer Eröffnungen dieser Art erwarteten 107 ). Die Sprache ist relativ regelmäßiger Blankvers. Namentliche Anrede der Umstehenden verstärkt den konkreten Bezug auf die Situation. ) Eliot, Selected Essays, S. 123: " . . . the last words of Barabas complete this prodigious caricature." (Eliot versteht diese Szene als "farce of the old English humour, the terribly serious, even savage comic humour . . . ") 10°) Der Bruch in der Entwicklung des reichen Kaufmanns und liebenden Vaters zu einem "human monster" wird besonders von Poirier deutlich hervorgehoben {Marlowe, S. 158/159). Vgl. auch Clemen, Tragödie vor Shakespeare, S. 138; B. Spivack, Shakespeare and the Allegory of Evil: The History of a Metaphor in Relation to His Major Villains (New York, 1958), S. 348-353. 107 ) Poiriers Kritik, der Jew sei hier "absurd and ridiculous", geht daher am Wesen dieser typischen Rolle vorbei (Marlowe, S. 159). 105
78
Die Sterbereden im Jew of Malta setzen die Entwicklung zu Kürze, Dialogisierung und Konkretisierung fort. Die konventionelle Verdeutlichungstendenz ist noch vorhanden, bedient sich aber bereits in zunehmendem Maße rein schauspielerischer Mittel. Die charaktertypische Sprachgestaltung ist unbefriedigend; neben Doctor Faustus ist in dieser Hinsicht nur in Edward II. eine echte Weiterentwicklung zu spüren. Die inhaltlichen Bezüge sind konkret und vordergründig, der Stil schmucklos und prosahaft. 9. King Edward
II.
Als letztes Werk Marlowes soll hier noch Edward II. besprochen werden. Von den 43 Personen sterben 10, davon nur 2 auf der Bühne. Diese niedrige Zahl ist besonders auffällig im Vergleich mit Tamburlaine und The Massacre at Paris, wo sich fast alle Todesfälle vor den Augen der Zuschauer ereignen. Die Zahl der Sterbereden ist mit 9 sehr hoch, jedodi sind sie, der bereits angedeuteten Entwicklung folgend, kurz und teilweise rein dialogisdi. Gaveston (1289; 4 + 1 Zeile) sieht seinem Tod zwar schon seit 1192 entgegen, ist aber erst mit dem Hereinstürmen Warwicks und seiner Soldaten in unmittelbarer Lebensgefahr. Sein erster Gedanke gilt der schmachvollen Situation, waffenlos und gefesselt seinen Mördern ausgesetzt zu sein. Eine Klage, daß dieser Tag sein letzter sei, ist nur kurz in lVs Zeilen angedeutet, dann bittet Gaveston: "Speede to the king" (1292). Das ist eine für den Günstling und Schützling des Königs verständliche, halb automatische Reaktion. Erst nach Warwicks eindeutigen Worten und Anstalten erfaßt Gaveston die ganze Hoffnungslosigkeit seiner Lage: "Treacherous earle, shall I not see the king?" (1302). Danach wird er zur Exekution abgeführt, ehe weitere Äußerungen Gavestons Haltung vor dem Tode deutlich machen können. So bleibt der Interpretation hier ein weiterer Spielraum als in den meisten bisher behandelten Sterbereden 108 ). Gavestons Tod ist der Abschluß einer Entwicklung, die mit dem Beginn des Dramas einsetzt und sich ständig zugespitzt hat. Er hat unmittelbare dramatische Auswirkung in der Rache, die der König an Gavestons Mördern nimmt. Die Sprache dieser Sterberede ist direkt und konkret; die in Zeile 1289 gegebene Beschreibung — "Weaponles must I fall and die in bands" — dient nicht der Überverdeutlichung, sondern gibt Einbilde in Gavestons Charakter und ersetzt eine längere Pathosrede. Der Blankvers ist prosahaft aufgelockert: der Sinnakzent deckt sich nicht immer mit dem .metrischen Akzent; die Verszeile ist syntaktisch aufgegliedert. Eine Kurzzeile bildet den nachdrücklichen Abschluß des ersten Redeabschnitts. Die Sterbereden Warwicks (1557: "Farewell vaine worlde") und Lancasters (1558: "Sweete Mortimer farewell") können rasch übergangen werden, da sie 108
) U. Ellis-Fermor, Christopher Marlowe (London, 1927), sieht in Gavestons letzten Worten eine "simple expression of grief" (S. 121) und stellt eine Charakterentwicklung von dem geschickten Diplomaten zu einem echten, treuen Freund Edwards fest. (Ebd., S. 120)
79
keine neuen Gesichtspunkte aufweisen und im Drama keine spezifische Funktion erfüllen. Beide Halbzeilen zusammen ergeben einen vollständigen, metrisch völlig regelmäßigen Blankvers, der durch die zyklische Anwendung des Wortes "farewell" — eines der ältesten Klischees für solche Situationen — die Bedeutungslosigkeit der beiden Äußerungen unterstreicht. Eider Spencer war bisher erst einmal sprechend aufgetreten (1338 ff.); Kern seiner Rede war dort das Gelöbnis "to defend king Edwards royall right" (1344). Ausdruck seiner Rechtschaffenheit sind auch die letzten Worte vor dem Tode (1859/60): sein Stolz lehnt sich dagegen auf, als "rebell" bezeichnet zu werden, da er doch für den König kämpft. An den eigenen Tod denkt er nicht; er muß nur seiner Empörung Luft machen und auf die eigene gerechte Sache hinweisen. Ausführlichere Beachtung verlangt auch diese Sterberede nicht. Die Sterberede des jüngeren Spencer (1967; 5 Zeilen) ist eine Klage über die Trennung von Edward. Beherrschendes Wort in diesen Zeilen ist "gone", das insgesamt fünfmal an syntaktisch oder metrisch bedeutsamer Stelle gebraucht wird (anfangs in rhetorische Fragen gekleidet, dann als verzweifelte und resignierte Feststellung) und das noch unterstützt wird durch entsprechende Wendungen wie "Parted from hence" oder "neuer to make returne". Fast genau die Mitte dieser Sterberede bildet eine aus früheren Werken Marlowes bekannte kosmische Vernichtungsformel in der typischen Form der Apostrophe: "Rent sphere of heauen, and fier forsake thy orbe, / Earth melt to ayre" (1969/70). Diese Formel ist hier nicht mehr Baustein einer konventionellen Pathosrede, sondern stark komprimierter emotionaler Höhepunkt eines in dramatischer Sprache gehaltenen Ausdrucks individuell-menschlichen Abschiedsschmerzes109). Der jüngere Spencer erweist sich mit seiner Sterberede als echter Freund des Königs; von der berechnenden, nur auf den eigenen Vorteil bedachten Haltung, mit der er sich 724 ff. eingeführt hatte, ist nichts mehr geblieben. Daher wird auch dem Gedanken an den eigenen Tod kein Ausdruck gegeben. Das bemerkt und bemängelt Baidock in seiner unmittelbar folgenden Sterberede (1972; 8 Zeilen). Im Gegensatz zu Younger Spencer richtet er seine Worte an einen konkreten Gesprächspartner — Spencer —, den er dreimal namentlich anredet. Sein Anliegen kleidet er in die Aufforderung (1974—76): Make for a new life man, throw vp thy eyes, And hart and hand to heauens immortall throne, Pay natures debt with cheerfull countenance.
Zum Schluß faßt er seine Lehren noch einmal nachdrücklich in einem couplet zusammen: "To die sweet Spencer, therefore Hue wee all, / Spencer, all liue to die, and rise to fall" (1978/79). Daß Baidock eine solche überpersönlichchorische, predigtartige Rede halten würde, war dramatisch nicht vorbereitet und folglich nicht zu erwarten; wahrscheinlich äußert sich hier Marlowe selbst deutlicher als an anderen Stellen 110 ). Es ist bemerkenswert, daß diese Sterberede, 10>
) Vgl. auch Clemen, Tragödie vor Shakespeare, S. 224. lio) w Wielandt, Mensch und Kosmos bei Christopher Marlowe (Diss. Marburg, 1940), S. 56, hebt hier die Übernahme der "Vergänglichkeitströstung der stoischen Philosophie" hervor.
80
die unmittelbar auf die des jüngeren Spencer folgt, keine Variation dazu darstellt, sondern ganz andersartig ist. Audi die bilderreiche Sprache111) trägt zu diesem Eindruck bei. Die Rede ist statisch und entspricht damit der leidenschaftslosen, didaktischen Haltung Baidocks. Einen Kommentar zu dem angekündigten Todesurteil bringt er so wenig wie Younger Spencer. Kents Sterberede (2422; 1 + 1 + 1 + 4 Zeilen) ist ein weiterer Beleg für den "decline of the soliloquy" 112 ); sie ist in ein bewegtes Gespräch eingegliedert, dessen dramatischem Tempo sie sich angleicht. Erste Reaktion auf das Todesurteil durch Younger Mortimer ist Trotz: "base traitor I defie thee." In dem folgenden Willenskampf zwischen Edward III., Isabella und Younger Mortimer setzt letzterer sich erwartungsgemäß durch, was Kents Frage provoziert: "Art thou king, must I die at thy commaund?" (2435). Dieser Einwand hilft Kent jedoch so wenig wie sein Appell an die Soldaten (2438—40): Either my brother or his sonne is king, And none of both them thirst for Edmunds bloud, And therefore soldiers whether will you hale me?
Als Charakterausdruck ist diese Sterberede unbefriedigend. Die Tragik, die in dem Zwiespalt zwischen Bruderliebe, Königstreue und "the realmes behoofe" (1071) liegt, hat Marlowe nicht entwickelt, so daß Kent den Eindruck eines schwankenden Rohrs macht. In seiner Todesstunde will er mit Rechtsgrundsätzen argumentieren, deren Gültigkeit er selbst hat untergraben helfen. Daraus resultiert bei ihm nach der kurzen Empörung über Younger Mortimer ein Gefühl der Unsicherheit. Die wesentlichste Funktion dieser Rede ist die indirekte Charakterisierung Mortimers. King Edwards Sterberede (2556; 2 + 1 Zeile) ist keine Rede im herkömmlichen Sinne mehr: auf eine Auseinandersetzung mit den Mördern wird völlig verzichtet. Es bleibt lediglich die Betonung der Schwäche (2556: "I am too weake und feeble to resist"), die Anrufung Gottes (2557: "Assist me sweete God, and receiue my soule") und ein Ruf der Todesangst (2559: " O spare nie, or dispatche me in a trice") 113 ). Trotz der Beschränkung und starken Komprimierung rufen diese Worte beim Leser einen tiefen Eindruck hervor, der allerdings durch die dem Mord vorausgehende Szene wirkungsvoll vorbereitet wurde 114 ). Die körperliche Zerrüttung wie auch die Hinwendung zu Gott sind
ln
) Vgl. "our soules are fleeted hence", "the sun-shine of our life", "heauens immortall throne", "Pay natures debt". m ) Bradbrook, themes and Conventions, S. 161. 113 ) Clemen, Kommentar, S. 130, hebt hervor, wie diese Beschränkung "psychologisch noch echter und unmittelbarer wirken kann als die an geistigem und gedanklichem Gehalt wohl reidiere Shakespeare-Szene" (gemeint ist Clarence' Ermordung I, iv). U4 ) Dieser Szene wird von manchen Kritikern ein höherer künstlerischer Rang eingeräumt als dem entsprechenden Auftritt in Shakespeares Richard II. Vgl. F. S. Boas, Shakspere and his Predecessors (London, 1896, repr. 1930), S. 57; A. W. Verity, The Influence of Christopher Marlowe on Shakespeare's Earlier Style (Cambridge, 1886), S. 82; W. Creizenach, Geschichte des neueren Dramas, V: Das englische Drama im Zeitalter Shakespeares, 2 (Halle, 1916), S. 47; Brooke, Tudor Drama, S. 326.
81
deutlich beschrieben und dargestellt worden, so daß die letzten Worte Edwards überzeugend motiviert sind. Die Rederichtung ist in jedem Satz verschieden: Zeile 2556 ist nicht an ein bestimmtes Gegenüber gerichtet, sondern als Selbstgespräch aufzufassen. Das Element der Verdeutlichung für das Publikum klingt eben nodi an, ist aber auf ein Minimum reduziert. Zeile 2557 enthält eine Anrufung Gottes, während Zeile 2559 eine direkte Anrede des Mörders darstellt. Der Stil ist schlicht, einfach und ruhig; Marlowe beweist erneut seine Tendenz "towards calmness, skill, knowledge of humanity, and the restraint, which he so badly needed . . ," 115 ). Younger Mortimers Sterberede (2627; 8 Zeilen) macht nadi Form und Inhalt einen konventionellen Eindruck. Der Verurteilte redet Fortuna an und stellt fest, daß er den höchsten Punkt ihres Rades erreicht habe und daher notwendig stürzen müsse. Diese Überlegung 118 ) resultiert in stoischer117) Hinnahme seines Schicksals: "And seeing there was no place to mount vp higher, / Why should I greeue at my declining fall?" (2630/31). Danach wendet er sich der Königin zu ("Farewell faire Queene") 118 ) und bittet sie, nidit um ihn zu trauern, der die Welt verachte und wie ein Reisender unbekannte Länder erforschen wolle 119 ). Diese Sterberede nimmt auf die Todesart keinen Bezug, sie illustriert jedoch allgemein Mortimers Einstellung zum Tod. Der Person und Funktion Mortimers sind die Worte durchaus angemessen: er war im ganzen Drama der aktive Politiker machiavellistischer Prägung, sah sich als Beherrscher des Schicksals (2197: "Who now makes Fortunes wheele turne as he please") und fühlte sich noch 2579—82 unangreifbar und gefürchtet als "Ioues huge tree". Das Eingeständnis, doch dem Rad der Fortuna unterworfen zu sein, enthält ein Element dramatischer Ironie, macht aus Mortimer ein Beispiel für die Unbeständigkeit des Schicksals im Sinne der De C»i-Tradition und bewirkt gleichzeitig eine enge Verknüpfung mit dem Handlungsgang. Mortimers Charakter hat eine unterschiedliche Beurteilung erfahren: einige Autoren bemängeln bzw. konstatieren eine "degeneration of character" 120 ), durdi die ein stolzer Lord zu
115
) " . . . and never quite achieved" fährt Bakeless sehr zurückhaltend fort (Tragicall History, II, 182). Vgl. dagegen Ph. Henderson, Christopher Marlowe (London, N e w York, Toronto, 1952), der von "severe discipline", "restraint" und "the almost cold clarity and precision of the verse" spricht (S. 126). lle ) Vgl. Levin, The Overreacher, S. 123: "Where Barabas died cursing, Mortimer's last lines are profoundly meditative." U7 ) Vgl. Wielandt, Mensch und Kosmos bei Marlowe, S. 56/57; I. Ribner, "Marlowe's 'Edward II' and the Tudor History Play", ELH, X X I I (1955), 247. ««) CI. Leech, "Marlowe's 'Edward II': Power and Suffering", CritQ, I (1959), 195, sieht in Mortimers Annahme seines Schicksals eine "rather empty rhetoric" und meint angesichts seines intimen Verhältnisses zur Königin: "Certainly it would be difficult to find two other lovers in Elizabethan drama who parted with words so chill." 119 ) Die Parallele zu Hamlet, III, i, 79/80 ist offensichtlich. Vgl. J. E. Hankins, Shakespeare's Derived Imagery (Lawrence, 1953), S. 135; Bakeless, Tragicall History, II, 209; Levin, The Overreacher, S. 123; Henderson, Marlowe, S. 125. I2 °) W. D. Briggs, Hrsg., Marlowe's Edward II (London, 1914), Introduction, S. cvii.
82
einem "medianical stage villain" werde 121 ). Andere glauben, daß Mortimer jetzt endlich ein persönliches Gesidit — und sei es auch als Madiiavellist — bekomme 122 ) oder heben den "schwungvollen Abgang ganz im Stil der Marlowischen Ubermenschen" hervor 123 ). Uns genügt hier die Feststellung, daß Mortimers Sterberede trotz der typischen Elemente seiner Person unverwechselbar entspricht und daher gerechtfertigt ist. Die Sprache ist reich an Bildern und Metaphern 124 ). Während der erste Teil der Rede als Aufklärung für das Publikum verstanden werden kann, ist der zweite Teil konkret an die Königin gerichtet. Es entsteht jedoch kein Gespräch, sondern die Form der selbständigen Rede bleibt erhalten. Auch in Edward II. sind die Sterbereden kurz, meist in Dialogform und konkret auf die Handlung bezogen. Während sie in Tamburlaine noch häufig den Geschehnisablauf hemmten, führen sie ihn hier vorwärts. Auch der Bezug zum Gesprächspartner ist enger geworden: rein monologische Deklamationen kommen nicht mehr vor; Ansätze dazu werden abrupt abgebrochen (vgl. in Mortimers Sterbereden den Bruch zwischen Zeile 2631 und 2632). Die Tonlage der Sterberede ist nicht einheitlich: persönliche, seelisch vertiefte Gefühlsäußerungen stehen neben farblos konventionellen Formeln. Überkommene Topoi werden nicht gedankenlos verwendet, sondern verraten eine bestimmte Wirkungsabsicht und stehen im Dienste einer stärkeren Individualisierung der Charaktere. Die Sprache ist meist konkret, schmucklos und prosahaft und unterstützt die Entwicklungstendenz vom Rede- zum Handlungsdrama 125 ). 10. The Battle of Alcazar Peeles Verwendung der Sterberede mutet im Vergleich zu Marlowe und Kyd wie ein Rückschritt an 129 ). Ein Blick auf The Battle of Alcazarm) macht deutlich, wie dieser Autor wohl eine Sprachbegabung besaß, aber nicht verstanden hat, die Rede zu dramatisieren und in das Handlungsgesdiehen einzubeziehen. The Battle of Alcazar weist 33 Personen auf, von denen 5 den Tod finden, 3 davon auf der Bühne. Es werden 2 Sterbereden gehalten, die beide stark an
lö
) Ellis-Fermor, Marlowe, S. 120 und 141. ) Vgl. F. P. Wilson, Marlowe and the Early Shakespeare, The Clark Lectures, Trinity College, Cambridge, 1951 (Oxford, 1953), S. 95/96. 123 ) Creizenach, Das englische Drama im Zeitalter Shakespeares, 1, 520; ähnlich audi Boas, Marlowe, S. 191. 124 ) Vgl. das Rad der Fortuna; ferner "my declining fall", "traueller [that]/ Goes to discouer countries yet vnknowne". 125 ) Vgl. Poirier, Marlowe, S. 190: "the style is subordinated to the action more than anywhere else." 129 ) Vgl. Clemen, Tragödie vor Shakespeare, S. 146. 127 ) Zitate und Zeilenzählung der Werke Peeles nach A. H. Bullens Ausgabe The Works of George Peele (London, 1888). 122
83
die Redetechnik der frühen elisabethanischen Tragödie erinnern und eine eingehendere Beschäftigung kaum verdienen. Abdelmelec (V, i, 20; 11 Zeilen) hat gerade ungünstige Nachricht vom Stand der Schlacht gegen Muly Mahamet und den portugiesischen König erhalten. In Form einer konventionellen Selbstapostrophe und rhetorisdien Frage ruft er aus: "Ah, Abdelmelec, dost thou live to hear / This bitter process of this first attempt?" In den beiden folgenden Zeilen ruft er seine Lords zu erhöhter Anstrengung auf und will auch selbst in den Kampf eingreifen, als er plötzlich einen Sdiwächeanfall erleidet (24—27): . . . O, the goal is lost, The goal is lost! — Thou King of Portugal. Thrice-happy diance it is for thee and thine That heavens abates my strength and calls me hence. —
Es folgt dann ein kurzer Hinweis auf körperliche Begleiterscheinungen des herannahenden Todes: "My sight doth fail" (28); die Sterberede schließt, wiederum durchaus klischeehaft, mit einem Abschied von der Welt: "Farewell, vain world! for I have play'd my part" (30). — Der Tod Abdelmelecs kommt für den Leser des Dramas so unerwartet wie offenbar audi für Abdelmelec selbst. Fast in einem Atemzug rafft er sich zum Gegenschlag auf (24: "My horse, Zareo!") und gibt alles verloren (24: "O, the goal is lost"), weil er sein Ende nahen fühlt. Das erfährt der Leser aber erst drei Zeilen später: "heavens . . . calls me hence." Dieser plötzliche Tod ist dramatisch nicht motiviert, die Reaktion des Abdelmelec unnatürlich distanziert und unpersönlich: so könnte ein innerlich unbeteiligter Zuschauer das Geschehen beschreiben. Die Rede ist auf die aktuelle Situation bezogen und in der Ausdrucksweise konkret. Die recht undramatische Sprache wird aufgelockert durch zahlreiche Apostrophen (Abdelmelec selbst, "lords", Zareo, King of Portugal, "vain world"), ohne doch eine deutlichere Tendenz zur Aufgabe des isolierten Monologs zu zeigen. Häufiges Enjambement lockert den meist regelmäßigen Blankvers zu natürlichem Redefluß. Rhetorische Mittel sind sparsam verwendet worden; auffällig sind lediglich Wiederholungen als Mittel der Intensivierung. Stukeleys Sterberede (V, i, 132; 49 Zeilen) ist vor allem erwähnenswert wegen des ungewöhnlidi langen Lebensrückblicks, der den Anlaß der Rede vorübergehend vergessen läßt. Stukeley beginnt mit der üblichen Feststellung seines bevorstehenden Todes, worauf unvermittelt der Aufruf folgt: "Hark, friends; and with the story of my life / Let me beguile the torment of my death" (134/135). Dieser Lebensbericht ist 37 Zeilen lang und überspannt die Zeit seit seiner Geburt. Die eingeschobene Mahnung: "Short be my tale, because my life is short" (158) bleibt ohne Wirkung; Peele hat wohl die Notwendigkeit gespürt, an den Anlaß dieser Rede zu erinnern. Der Schluß des Berichtes ist überdeutlich markiert: "Stukeley, the story of thy life is told" (173). Die eigentliche 'Sterbe'-Rede wird klischeehaft konventionell eingeleitet: "Here breathe thy last, and bid thy friends farewell" (174). Die letzten Zeilen enthalten die Mitteilung, daß auch der portugiesische König gefallen ist. Wie so oft in konventionellen Sterbereden tritt der Tod auch hier nicht eher ein, als 84
die Rede nach I n h a l t u n d Form einen deutlichen Abschluß gefunden h a t : " H e r e endeth Fortune ['s] rule a n d bitter rage; / H e r e ends T o m Stukeley's earthly pilgrimage" (179/180). — Diese Rede ist ein extremes Beispiel f ü r Peeles Neigung zur Isolierung der monologisierenden Rede, wie sie im rein klassizistischen D r a m a k a u m ausgeprägter zu erwarten ist; sie ist ein klarer H a l t e p u n k t im Geschehnisablauf. W e n n auch ein Lebensrückblick in Sterbereden nicht gerade selten ist 128 ), so ist die Länge doch ungewöhnlich u n d weder durch die Situation (der R e d e n d e ist schwer v e r w u n d e t ) noch die Person Stukeleys gerechtfertigt 1 2 9 ). D e r Bericht w i r d als Digression e m p f u n d e n u n d t r ä g t z u m Verständnis des D r a m a s so wenig bei wie zur Individualisierung des Sprechenden. Lediglich der letzte Teil der Rede weist eine lose V e r k n ü p f u n g mit dem H a n d l u n g s g a n g auf. Die beiläufig e r w ä h n t e Nachricht v o m T o d e Sebastians ist aber nnr f ü r den Zuschauer bedeutsam, denn Stukeley ist allein auf der Bühne 1 3 0 ). Wenig später w i r d die Leiche des Königs gebracht, ohne d a ß die in der Mitteilung des Todes angelegte Möglichkeit dramatisch wirksamer V e r k n ü p f u n g genutzt w o r d e n wäre. D e r Stil der Sterberede ist recht flüssig, der Blankversrhythmus jedoch relativ starr. Mythologische Anspielungen beschränken sich auf die E r w ä h n u n g von Phcebus u n d Mars; das verbreitete Bild von " F o r t u n e ' s wheel" w i r d beiläufig e r w ä h n t (Z. 139). Rhetorische Figuren sind sparsam verwendet worden und dienen mit Ausnahme der zyklischen Wortwiederholung, die den Einschub Zeile 158 auch f o r m a l hervorhebt, der M a r k i e r u n g u n d A u f h ö h u n g des Schlusses (Endreime, Anapher). Peele zeigt sich in seiner V e r w e n d u n g der Sterbereden recht unoriginell u n d überkommenen K o n v e n t i o n e n verpflichtet 1 8 1 ). Von einer Einbeziehung in die dramatische Komposition k a n n ebensowenig die Rede sein wie v o n einer T e n denz zu Auflockerung oder gar A u f g a b e des weitschweifigen Monologs; A b schweifungen wie der Lebensrückblick Stukeleys 1 3 2 ) unterstreichen die Selbständigkeit der Sterberede als Einzelelement ohne dramatisch wirksame Verk n ü p f u n g mit dem H a n d l u n g s g a n g . D e r Blankvers ist oft eintönig regelmäßig; ganz selten finden sich 6-hebige Zeilen. D e r Stil w i r k t jedoch recht elegant und flüssig d a n k einer natürlichen, ungekünstelten W o r t w a h l u n d auflockerndem E n j a m b e m e n t ; er dient aber noch nicht der Charakterisierung der Personen. Die Ausdrucksweise ist klar u n d konkret. Bilder u n d metaphorische W e n d u n g e n sind nicht zahlreich; sie werden häufiger in den Sterbereden von Edward I.
128
) Vgl. unten S. 132. ) Vgl. Hoff mann, Die typischen Situationen, S. 60: "Die psychologisch unmöglich lange Sterberede des allein auf dem Schlachtfeld liegenden schwer verwundeten Stukeley . . . ist überhaupt nur dann verständlich, wenn man sich die Bedeutung des patterns für mittelmäßige elisabethanisdie Dramatiker bewußt macht." 130 ) Die Anreden "friends" (V, i, 134) und "lordings" (136) sind an das Publikum gerichtet. lsl ) Vgl. Hoffmann, Die typischen Situationen, S. 59/60. 132 ) Auch Queen Elinor ( £ I, xxv, 95—110) gibt in ihrer Sterberede einen Lebensbericht; sie hat jedoch einen Gesprächspartner, durch dessen Verhalten ihre Beichte eine dramatische Funktion erhält. lw
85
(besonders der von Joan of Acon). Rhetorischer Schmuck ist selten und beschränkt sich auf Figuren der Wortwiederholung oder Reimpaare zur Hervorhebung der Redeschlüsse oder Intensivierung pathetischer Äußerungen. 11. Orlando
Furioso
Greene133) macht keinen starken Gebrauch von Sterbereden134), die überdies so wenig originell sind, daß sich eine eingehendere Behandlung kaum lohnt. Lediglich die Sterberede in Orlando Furioso soll etwas näher betrachtet werden, da sie durch ihre Länge mehr Aufschluß über Greenes Verwendungsweise bietet und da sie überdies beispielhaft alle Form- und Sprachelemente auch der übrigen (wesentlich kürzeren) Sterbereden Greenes enthält 135 ). Von den 31 in Orlando Furioso auftretenden Personen sterben 3, davon 2 auf offener Bühne. Die einzige Sterberede wird von Sacrepant gehalten (1 + 3 + 1 + 9 + 20 Zeilen) und beginnt Zeile 1239, nachdem er im Zweikampf mit dem verhüllten Orlando eine tödliche Wunde empfangen hat. Die üblicherweise die Sterberede eröffnende Feststellung, daß die Wunde tödlich sei 136 ), enthält hier außerdem Hinweise auf Sacrepants Stolz und Überheblichkeit: "Oh Villaine! thou hast slaine a prince." Orlandos Antwort verrät Sacrepant, daß sein Gegner kein "base born moore" sein kann; daher will er den Namen erfragen. Orlando entdeckt sich jedoch noch nicht, sondern fragt seinerseits nach Sacrepants Namen. Parallel zur ersten Zeile seiner Sterbereden ergänzt dieser nun: "Then know that thou hast slaine Prince Sacrepant" (1250). Auf Orlandos Frage nach Schuld oder Unschuld Angelicas folgt völlig unmotiviert nicht nur ein volles Geständnis Sacrepants, sondern auch ein durch parallelen Zeilenbau hervorgehobenes Bekenntnis tiefer Reue: "O, thats the sting that pricks my conscience! / Oh, thats the hell my thoughts abhorre to thinke!" (1255/56). Danach erst kommt Sacrepant auf die Frage zurück, deren frühere Beantwortung das Schuldbekenntnis wohl verhindert hätte: "Now teil me, what shall I call thy name?" (1263). Als er erfährt, daß Orlando sein Richter gewesen ist, bricht Sacrepant in eine 20 Zeilen lange, auffällig in Marlowes Stil gehaltene Fluchrede aus137). In einer eröffnenden rhetorischen Frage empfindet Sacrepant Sieg und Gericht durch Orlando als ein besonders hartes Schicksal. Eine weitere, durch Steigerung stilistisch hervorgehobene Feststellung des bevorstehenden Endes ist verknüpft mit der in alter Selbstsicherheit vorgebrachten Behauptung,
) Zeilenzählung und Zitate nach J . Ch. Collins' Ausgabe The Plays and Poems of Robert Greene (Oxford, 1905). 134) Alph.: 0 (bei 4 Sterbenden), Look.GL: 2 (bei 4 Sterbenden), James IV.: 0 (0), Orl.:
133
_ ¡er nicht enthaltenes Element ist lediglich die in Paphlagons Sterberede (Look. Gl., 878—881) klischeehaft beschriebene Wirkung des Giftes. ) Bei Greene vgl. Look.GL, 7 4 6 : " O h I am slaine" und 8 7 8 : " O h , I am dead." 1 3 7 ) Nach H . Conrad, "Robert Greene als Dramatiker", S], X X I X / X X X (1894), 230, "ein Muster edit Marlowe'schen Bombastes".
1S5
138
86
)
ihm sei ein hohes Alter bestimmt gewesen: "This daie, this houre, this minute ends the daies / Of him that liude worthie olde Nestors age" (1279/80). Es folgt eine formelhafte A n r u f u n g der Elemente, die zu kosmischen Vernichtungsformeln gesteigert wird (1281-87) 1 3 8 ): Phoebus, put on thy sable suted wreath, Ciadde all thy spheres in darke and mourning wcedes: Parcht be the earth, to drinke vp euery spring: Let corne and trees be blasted from aboue; Heauen turne to brasse, and earth to wedge of steel; The worlde to cinders. Mars, come thundering downe, And neuer sheath thy swift reuenging swoorde,
Sacrepants letzte Worte fassen die einzelnen Verwünschungen in eine einzige übersteigernde Vernichtungsformel zusammen: "Heauen, earth, men, beasts, and euerie liuingthing, / Consume and end w i t h C o u n t i e S a c r e p a n t ! " (1290/91) 139 ).— Diese Sterberede ist aus mehreren Gründen unbefriedigend gestaltet. Sie wird weder sprachlich noch formal der Situation des Sterbens gerecht. Greene ist es auch nicht gelungen, ein einheitliches Charakterbild von Sacrepant zu entwerfen, das in der Sterbestunde wiederzuerkennen wäre. Ganz im Gegenteil ist diese Rede zusammengesetzt aus verschiedenen widersprüchlichen und nicht motivierten Elementen: einer auf die gegebene Situation überhaupt nicht bezogenen, durch Worte (nicht etwa den Zweikampf) angeregten Frage nach Stand und Namen, einem wegen fehlender dramatischer Vorbereitung überraschenden und unglaubwürdigen Schuld- und Reuebekenntnis und einer auch f ü r einen erwiesenen Bühnenschurken (vgl. 238 ff., 494 ff.) undiarakteristischen Verwünschungsrede 140 ). Die Verknüpfung mit Handlungsgang und augenblicklicher Situation ist oberflächlich und nur in Sacrepants Geständnis konkret und detailliert. Die Fluchrede verwendet mythologische Anspielungen, die zum allgemeinen Vorrat elisabethanischer Pathosgesten gehören. Die Rede beginnt dialogisch; auch der 9-zeilige Abschnitt ist dramatisch geschickt als Aufklärung f ü r den Gesprächspartner gedacht und nicht als Überverdeutlichung f ü r das seit Anbeginn (503 ff.) informierte Publikum. Der 20-zeilige Schlußteil ist jedoch eine stark an Tamburlaine orientierte, selbständige, weder an ein Gegenüber auf der Bühne noch die Zuschauer gerichtete Pathosrede, die zugleich ein statisches Element darstellt. Mit Sacrepants Schuldbekenntnis und Orlandos Enthüllung sind die letzten möglichen Spannungsmomente der Situation geschwunden, so
138
) Clemen, Kommentar, S. 90, vermutet darin eine bewußte Parodie des marloweschen Obermaßes des Tamburlaine; ebenso U. Ellis-Fermor, "Marlowe and Greene: A N o t e on Their Relations as Dramatic Artists", Studies in Honor of T. W. Baldwin, hrsg. v. D o n Cameron Allen (Urbana, 1958), S. 143. Vgl. audi Clemen, Tragödie vor Shakespeare, S. 161 und 162. Hoffmann, Die typischen Situationen, S. 59, betont, daß die Ausdrucksweise, die in Tamburlaine die Maßlosigkeit des Titanen zeige, dem hinterhältigen Intriganten Sacrepant nicht angemessen sei. 13a ) Clemen, Tragödie vor Shakespeare, S. 162, vermutet in der Aneinanderreihung der Leitworte in Zeile 1290 eine Nachahmung von Kyds Spanish Tragedy, III, ii, 22. »») Vgl. audi Hoffmann, Die typischen Situationen, S. 59.
87
daß Sacrepants Schlußworten nicht mehr inhaltlich, sondern nur noch rhetorisch ein Wert als purple patch zukommt. Die Blankverse dieser Rede haben stellenweise die starre Regelmäßigkeit aufgegeben zugunsten eines natürlichen Sprachrhythmus. Es finden sich einige Verse mit 4 oder 6 Hebungen; gelegentlich betonter Versanfang. Einen charakteristischen eigenen Stil hat Greene in dieser Sterberede nicht entwickelt 141 ). Als äußere Mittel der Hervorhebung und Intensivierung dienen außer den erwähnten metrischen Unregelmäßigkeiten vor allem parallele Satzkonstruktionen (besonders 1255/56), rhetorische Frage, hyperbolische Diktion, Häufung von Apostrophen; inhaltlich zeichnet sich besonders die abschließende Verwünschungsrede durch übersteigerte Gedankenfiguren aus. 12. Titus
Andronicus
Am Anfang unserer Untersuchung der Sterbereden im Werke Shakespeares142) steht eine Betrachtung ihrer Verwendung in Titus Andronicus1*3). Dieses Werk, das sich (zusammen mit Kyds Spanish Tragedy) jahrzehntelang beim elisabethanischen Publikum einer außerordentlichen Beliebtheit erfreute 144 ), ist für uns besonders interessant, weil es durch sein frühes Entstehungsdatum und seine Nähe zur zeitgenössischen Tradition erlaubt, "den jungen Shakespeare ganz unmittelbar bei der Arbeit zu sehen" 145 ). Dem Charakter des Stückes (tragedy of blood) entspricht die ungewöhnlich hohe Zahl der Sterbenden: das Verhältnis von 14 Todesfällen (9 auf der Bühne) zu den insgesamt 29 Dramatis Personae stellt das Drama in eine Reihe mit Arden of Feversham, Locrine, The Misfortunes of Arthur, Selimus und Soliman and Perseda. Dagegen ist die Anzahl der gehaltenen Sterbereden mit 3 (die nur berichteten Schreie der Nurse werden als Sonderfall besprochen) gering, und auch ihre Länge verrät eine bemerkenswerte Zurückhaltung: nur Aaron hält eine zusammenhängende, 7 Zeilen lange Rede. Mutius wird ganz überraschend von seinem erregten Vater erstochen; seine letzten Worte sind ein Hilferuf an den Bruder: "Help, Lucius, help!" (I, i, 291). Die Kürze des Ausrufs trägt der Situation Rechnung: der plötzlich eintretende Tod läßt keine Zeit für längere Ausführungen; der Gewinn an Lebensnähe ist
) Vgl. Clemen, Tragödie vor Shakespeare, S. 160 und 162. ) Zitiert wird nach der Oxford-Ausgabe Craigs. 1 4 S ) Auf die Problematik von Verfasserschaft und Datierung kann hier nicht eingegangen werden. Dazu vgl. zuletzt H . Oppel, Titus Andronicus: Studien zur dramengeschichtlichen Stellung von Shakespeares früher Tragödie (Heidelberg, 1961), Kap. I. 1 4 4 ) Vgl. J . D . Wilson, Hrsg., Titus Andronicus (Cambridge, 1948), S. ix. Vgl. auch Ben Jonsons Ausspruch aus dem Jahre 1 6 1 4 : " H e e that will sweare, 'Ieronimo', or 'Andronicus' are the best playes, yet, shall passe vnexcepted at, heere, as a man whose Judgement shewes it is constant, and hath stood still, these fiue and twentie, or thirtie yeeres", Bartholomew Fair, Induction (Ben Jonson, hrsg. v. Herford & Simpson, V I [Oxford, 1938], 16). 1 4 5 ) Oppel, Titus Andronicus, S. 15. 141 142
88
evident. Ein Vergleich mit dem " O pitie vs" der Virgins in Tamburlaine (I, 1900) verdeutlicht den Fortschritt in der dramatischen Handhabung: Mutius' Hilferuf klingt echt und der Situation angemessener. Die einzeln hervorgestoßenen Wörter beschleunigen das dramatische Tempo; sie haben durch Anrufen und Eingreifen des Bruders eine unmittelbare dramatische Funktion. Die Frage nach dem charaktertypischen Ausdruck wird hier gegenstandslos, da ein in Todesnot ausgestoßener Hilferuf wie dieser eine allgemein-menschliche Reaktion darstellt, die somit auch für Mutius glaubhaft ist. Die Wiederholung des "help" ist wohl nicht als rhetorische Satzfigur anzusehen: nach traditioneller Zeilenanordnung ergänzen Mutius' Worte die von Titus gesprochene Halbzeile zu einem vollständigen Blankvers; damit bleibt trotz realistischer Darstellung das sprachliche Gleichgewicht gewahrt. Aber auch wer eine selbständige Zeile für die drei Worte ansetzen möchte146), kann nur Shakespeares lebensnahe Kunst bewundern, die das Bewußtsein des Sterbenden einengt auf den einen Gedanken, vom Bruder Hilfe zu erbitten. Der Clown erfüllt mit seinen letzten Worten (IV, iv, 45; 1 + 2 Zeilen) eine Funktion, die von ihm als Kontrastfigur erwartet wird: er schafft comic relief. Da ihm IV, iii, 111/112 von Titus eingeschärft worden war, daß er nach Ubergabe der Tauben seine Belohnung erwarten dürfe, ist seine Aufmerksamkeit nun so ausschließlich und intensiv auf den erhofften Gewinn gerichtet, daß er sein Todesurteil überhaupt nicht zur Kenntnis nimmt, sondern in höchst ungewöhnlicher Formulierung an seinen Lohn erinnert: " H o w much money must I have?" Vollends der folgende pun, in dem er, ungerührt durch die erneute, deutliche Todesdrohung, die schöne Höhe hervorhebt, die sein Hals beim Hängen erreichen wird, war des Beifalls der Gründlinge sicher. Dies Verhalten ist durchaus typisch und verrät keine individuelle Einstellung zum Tod. Der Clown ist eine reine Nebenfigur; erst IV, iii, 76 tritt er erstmals auf. Seine Funktion besteht wohl weniger in der Ausführung des für die Handlungsführung ohnehin kaum nutzbar gemachten Auftrags von Titus als in einer Entspannung der im Zuschauer angestauten Emotionen. Dieser typischen Verwendungsweise entspricht die Sprache: eine für die konventionelle Figur des Clowns charakteristische, nachlässiger Alltagssprache angeglichene Prosa. Auch Aaron ist eine traditionelle Figur; seine Sterberede (V, iii, 184; 7 Zeilen) weist ihn unverwechselbar als Bühnenschurken aus und läßt deutlich traditionelle Elemente anklingen. Insbesondere ist die Verwandtschaft mit Marlowes stage villains auffällig 147 ). Aaron benimmt sich ganz wie das Publikum von ihm erwartete; er kündigt eine Fluchrede an: "O! why should wrath be mute, and
"') So J. C. Maxwell, Hrsg., Titus Andronicus (London, 1953), S. 17, Anm. zu I, i, 290/291. ) Vgl. J. D . Wilson, Hrsg., Titus Andronicus, S. lxii: "Aaron is certainly an imitation of Marlowe's Machiavellian villains." Bakeless, Tragicall History, II, 260: "Aaron is a typical, self-revealed Marlowe villain, a kind of link between Barabas and the later and subtler Shakespearean scoundrels, like Iago."
147
89
fury dumb?" 1 4 8 ). Es folgt die ebenfalls übliche Beteuerung, daß er nicht nur nichts zu bereuen gedenke, sondern gern noch zehntausend weitere U n t a t e n begehen würde 1 4 9 ). Den Schluß bildet ein erneuter, geschickt ins Positive umgewandelter Gebrauch des Wortes " r e p e n t " , nun auf eine gute T a t bezogen, die er vielleicht versehentlich begangen haben könnte. Diese Rede entspricht völlig dem Bild, das wir von Aaron gewonnen haben; die Haltung der Sterberede ist bereits vorweggenommen in dem Greuelkatalog V , i, 124. Erstaunlicherweise empfinden wir trotzdem beinahe eine Regung der Sympathie für Aaron und jedenfalls eine Anteilnahme an seinem Schicksal, die über bloße Kenntnisnahme typischen Benehmens einer stock figure hinausgeht. Das erklärt sich durch die Ansätze zu einer Individualisierung, die Aaron als stolzem und liebevollem Vater zuteil geworden sind und durch die er zu "Shakespeare's masterstroke in 'Titus' " wird 1 5 0 ). Die Sprache ist dem Inhalt angemessen. Rhetorische Frage und hyperbolische Ausdrucksweise sowie der regelmäßige, meist am Zeilenende unterbrochene Blankvers entsprechen der Tradition der Fluchrede, die auch hier nicht an einen Gesprächspartner gerichtet ist, sondern als monologischer Affektausbruch ihre Bindung an den Typus bekundet. Als Sonderfall verdienen die Todesschreie der Nurse Erwähnung, von denen uns ihr Mörder Aaron durch direkte Nachahmung berichtet: " 'Weke, weke!' / So cries a pig prepared to the spit" ( I V , ii, 1 4 7 / 1 4 8 ) 1 5 1 ) . Diese Darstellung der Todesschreie ist eine Meisterleistung des jungen Shakespeare; K y d hat in der Spanish Tragedy die gleiche dramatische Situation sprachlich nicht bewältigen können: erst I V , iv, 1 0 8 / 1 0 9 erfahren wir beiläufig, daß H o r a t i o bei seinem Tode Schreie ausgestoßen hat. Die mit naturalistischer Eindringlichkeit wiedergegebenen Todesschreie der so plötzlich und unerwartet gemordeten Nurse bewirken eine ungewöhnliche Intensität des dramatischen Geschehens; gleichzeitig geben sie Aaron durch den ihn charakterisierenden Zynismus den Schein einer beinahe sublimen Bosheit 1 5 2 ). Eine darüber hinausgehende dramatische Funktion kommt der Stelle nicht zu. Sie ist jedoch höchst bemerkenswert durch die außergewöhnliche Lebensnähe der sprachlichen Äußerung, deren Wirkung durch die metrische Anordnung unterstützt wird: " W e k e , w e k e ! " ist eine selbständige Zeile und damit eine Unterbrechung der sonst verwendeten Blankverse; durch eine angemessene Pause konnte der Schauspieler den Eindruck noch steigern 1 5 8 ). ) Es ist bemerkenswert, daß Shakespeare schon in Richard III. die unnatürlich anmutende Beredsamkeit vor dem Tode in Frage stellt: "Why should calamity be füll of words?" (IV, iv, 126). Vgl. auch The Misfortunes of Arthur (Early English Classical Tragedies, hrsg. v. Cunliffe), IV, ii, 14: "Small griefes can speake: the great astonisht stand" und The Massacre at Paris, 1084: "I cannot speak for greefe." i4») Vgl. aU ch die Sterbereden Wat Tylers und Balls in Jack Straw (Dodsley-Hazlitt, V [London, 1874], S. 411) sowie die des Jew of Malta (2368/69). 160 ) J. D. Wilson, Hrsg., Titus Andronicus, S. lxiv. 151 ) Durch die in direkter Rede wörtlich wiedergegebenen Todesäußerungen unterscheidet sich diese Stelle von anderen nur berichteten Sterbereden. (Vgl. unten S. 126/127 ) 1SI ) Vgl. J. D. Wilson, Hrsg., Titus Andronicus, S. lxiii. 163) teilen nicht die Meinung P. Simpsons, "Shakespeare's Versification: A Study of Development", in seinen Studies in Elizabethan Drama, S. 71/72, es läge hier die Verstümmelung eines Alexandriners durch die Herausgeber vor.
148
90
Bereits das erste hier besprochene Drama Shakespeares läßt die reiche Formenvielfalt erahnen, die seine Sterbereden auszeichnet. In Titus Andronicus ist die Zahl dieser Reden gering; im Grunde verdienen nur Aarons Worte eine solche Bezeichnung. Es ist sidier kein Zufall, daß gerade er die konventionellste Figur des Dramas ist. Die übrigen Sterbereden verraten stärker Shakespeares individuellen Gestaltungswillen; das sprechendste Beispiel ist die Darstellung der Todesschreie der Nurse 154 ). Alle Sterbeäußerungen sind der jeweiligen Situation angemessen. Eine Modifikation hinsichtlich der betreffenden Figur ist nidit festzustellen. Trotzdem sind nicht alle Sterbereden untereinander austauschbar: die typischen Rollen Clown und Bühnenschurke sind entsprechend deutlich gegeneinander abgegrenzt. Bemerkenswert ist die Kürze und Lebensnähe der Sterbeäußerungen. Mit Ausnahme der konventionellen Rede Aarons kommen nur kurze Ausrufe oder Sätze vor; hohle Rhetorik, pompöse Deklamation, unverbundener Zeilenstil, Häufung isolierter Bilder — durchweg Kennzeichen, die dem Drama im ganzen nadigesagt werden können — lassen sich an den Sterbereden nicht nachweisen; hier erlegt Shakespeare sich eine bemerkenswerte Zurückhaltung auf 155 ).
13. The First Part of King Henry
VI.
Der dreiteilige Henry VI. ist derselben frühen Schaffensperiode Shakespeares zuzurechnen wie Titus Andronicus. Wegen der Vielfalt der Erscheinungsformen und der engen Verknüpfung der Dramen erscheint es angebracht, die Sterbereden aller drei Einzeldramen im Überblick zu registrieren. Im Interesse einer Raffung des umfangreichen Materials können jedoch nur die für unsere Fragestellung aufschlußreichsten Reden nähere Beachtung finden. Von den 59 Personen in A Henry V/. 166 ) sterben 7 (6 auf der Bühne), davon nur eine wortlos. Die beiden ersten Sterbeäußerungen können rasdi übergangen werden. Der jähe Tod gestattet Salisbury und Gargrave nur noch, Gottes Gnade anzurufen; dies geschieht in einer durch aufdringlichen Parallelismus gekünstelt anmutenden Weise (I, iv, 70/71): Salisb.: O Lord! have mercy on us, wretched sinners. Gargr.: O Lord! have mercy on me, woeful man.
Da beide Figuren erst seit I, iv, 23 auf der Bühne sind, konnte noch keine Charakterzeichnung erfolgen. Möglicherweise ist jedoch der Gebrauch von us
154
) Hoffmann, Die typischen Situationen, S. 64, sieht die Sterbeszenen noch ganz konventionell behandelt, "ohne daß an irgendeiner Stelle die Eigenart Shakespeares durchschimmert". 15B ) Vgl. auch Oppel, Titus Andronicus, S. 49. 15e ) Die Problematik der Entstehungsfolge bleibt hier unberücksichtigt. Einen Einblick vermitteln R. Frickers Bemerkungen zu J. D. Wilsons Ausgabe von Henry VI. in ES, X X X V I I (1956), 20/21.
91
im Gegensatz zu me als unterscheidendes Merkmal beabsichtigt. Bemerkenswert ist die folgende von Talbot gegebene Beschreibung, die indirekt (also nicht, wie bisher oft der Fall, durch den Sterbenden selbst) Aufschluß über die Art der Verwundung, über Gestik und Mimik des sterbenden Salisbury gibt und auf sein Todesröcheln hinweist, das zugleich einen letzten Kommentar zu konkreten Bühnenvorgängen darstellt. Mortimers Sterberede füllt in mehreren Abschnitten eine ganze Szene (II, v, 1; 17 + 12 + 1 + 6 + 4 + 32 + 4 + 6 + 6 Zeilen). Der Aufbau der Redeteile ist durchdacht und auf die Handlung abgestimmt: 1—16 enthält eine eingehende Beschreibung des körperlichen Zustands; Zeile 17 leitet über zum Grund des Kommens: ". . . teil me, keeper, will my nephew come?" Der Abschnitt 21—32 verzögert das Geschehen; er bereitet Richard Plantagenets Erscheinen vor und gibt erste Hinweise auf den Gegenstand des folgenden Gesprächs. Der Gruß Mortimers (34, 37—42) läßt auf seine völlige Erblindung schließen: das konventionelle "These eyes . . . / Wax dim" (8/9) erweist hier ohne Regieanweisungen oder Erklärungen lebendige dramatische Kraft. In einem weiteren retardierenden, aber zugleich unseren Einblick in die Hintergründe des Geschehens ausweitenden Einsdiub antwortet Mortimer, der Grund für den Tod von Richards Vater sei derselbe gewesen, der auch ihn ins Unglück gestürzt habe (55—58). Erst auf eine erneute Frage entwickelt Mortimer ausführlich (61—92) ihrer beider Genealogie und begründet den Thronanspruch der Mortimers, dessen Verfechtung Richards Vater das Leben gekostet hatte. In den folgenden Abschnitten seiner Sterberede wünscht Mortimer dem Herzog als seinem Erben besseren Erfolg (94—97), ermahnt ihn angesichts der Stärke des Hauses Lancaster zu Vorsicht (101—106) und schließt seine Rede mit der Bitte, nicht zu trauern und für seine Bestattung zu sorgen; die konventionelle Abschiedsformel ist verbunden mit guten Wünschen. — Die Länge dieser Sterbeszene ist auffällig; sie ist nicht durch den Charakter Mortimers motiviert, dessen zugleich erster und letzter Auftritt sie ist, auch wohl kaum durch die Todesart, wenngleich das langsame Auslöschen eines alten Menschen sie rechtfertigen könnte, sondern in erster Linie durch den mitgeteilten Gehalt, dessen dramatische Auswirkungen die Rosenkriege im 2. und 3. Teil der Trilogie mitbestimmen werden. Die darauf bezogenen Redeteile lassen die Redesituation weithin vergessen, so daß Shakespeare durch gelegentliche Hinweise auf den Tod, Mortimers "fading breath" und "fainting words" daran erinnern muß. Dies Verfahren ist undramatisch; der spätere Shakespeare weiß das Stocken der Rede ohne ausdrückliche und durch die Sprechweise selbst nicht gestützte Hinweise unmittelbar einsichtig zu machen. Als weitere Schwäche muß die Häufung der mit like oder as eingeleiteten Vergleiche gelten, die besonders im ersten Teil der Rede (3—12) mehr der Amplifikation als einer Intensivierung dienen. Sie sind ein Kennzeichen des Stils des jungen Shakespeare. Bemerkenswert ist jedodi, daß die sachlicheren Berichte und objektiven Darstellungen 21—32 und 61—92 keine poetische Ausweitung erfahren haben, der Stil also nicht mechanisch angewendet, sondern dem jeweiligen Gehalt angepaßt worden ist. Die Gesamtrede ist zwar in einzelne Abschnitte unterteilt, jedoch haben die Gesprächspartner (zuerst 92
2 Gaolers, d a n n Richard Plantagenet) hier keine E i g e n f u n k t i o n ; sie liefern nur das Stichwort f ü r den Fortgang der Rede, deren inhaltliche Bezüge k o n k r e t sind u n d organisch aus der Gesprächssituation erwachsen. I m ganzen überwiegt freilich der Eindruck einer noch unoriginellen, an überlieferten K o n v e n t i o n e n ausgerichteten Gestaltungsweise. D a f ü r spricht auch die Ü b e r n a h m e von Klischees wie Beschreibung des körperlichen Zustandes, Personifizierung des Todes, Absdiiedsformel. Die Sprache ist ungleichmäßig; die A n f o r d e r u n g e n der M e t r i k sind oft nur mit spürbarer Mühe e r f ü l l t ; das w i r d deutlich an syntaktischen Eigenheiten, an der N o t w e n d i g k e i t , einerseits viele End-ed silbisch zu lesen, andererseits mehrsilbige W ö r t e r zu kontrahieren u n d geht bis zu völligem Verzicht auf Skandierbarkeit des Blankverses; vgl. Zeile 82/83: " L o n g a f t e r this, when H e n r y the F i f t h / Succeeding his f a t h e r Bolingbroke, did reign / . . ." Als Einzelbeispiel w i r k e n diese Verse ungeschickt. Ein Bemühen um freiere u n d lockerere Sprache ist jedoch spürbar a n den häufigen betonten Zeilenanfängen u n d an der zunehmenden V e r w e n d u n g v o n E n j a m b e m e n t . Auch die Sterberede des D u k e of B e d f o r d ( I I I , ii, 110; 5 Zeilen) ist im G r u n d e nur der Abschluß einer Sterbeszene, die bereits Zeile 41 beginnt. W i r werden bei Shakespeare noch häufiger der Situation begegnen, d a ß der T o d wesentlidi f r ü h e r angedeutet w i r d , als m a n sinnvoll von 'Sterberede' sprechen k a n n . D e r sterbende B e d f o r d h a t sich auf den Schauplatz des K a m p f e s um Rouen tragen lassen, um dessen Ausgang mitzuerleben. Nach dem Sieg der Engländer n i m m t er ruhig Abschied v o n dieser W e l t : " N o w , quiet soul, d e p a r t when H e a v e n please, / For I h a v e seen our enemies' o v e r t h r o w . " D i e Flucht der Franzosen ist A n l a ß zu der philosophischen Bemerkung: " W h a t is the trust or strength of foolish m a n ? " (112). Dieser von der konkreten Einzelbeobachtung ins Allgemeingültige abstrahierende Einschub ist ein u n v e r k e n n b a r Shakespearesches C h a r a k teristikum. Nach seinem T o d w i r d B e d f o r d wieder von der Bühne getragen, wodurch die innere Geschlossenheit der Szene auch einen äußeren R a h m e n erhält. Die U m s t ä n d e des Todes entsprechen der seit Beginn des D r a m a s gegebenen Charakterzeichnung des Regenten Frankreichs; die Sterberede selbst hebt sich durch ihre R u h e ab von dem bewegten H i n t e r g r u n d der Szene. Die A p o s t r o p h e an die Seele ist kein Klischee, sondern h a t als Stimmungsträger eine eigene Funktion, die ihre Überzeugungskraft aus dem Z u s a m m e n w i r k e n gerade dieser Situation mit der Disposition gerade dieses C h a r a k t e r s zu eben diesem Zeitp u n k t gewinnt. D i e Sprache ist natürlich, ruhig, ohne unnötige schmückende Ausweitung; sie t r ä g t die durch Szenenstruktur u n d Gedankengehalt evozierte A t m o s p h ä r e und r u n d e t den Eindruck der Sterberede zu wohltuender Geschlossenheit. M i t Talbots Sterberede (IV, vii, 1; 16 + 15 Zeilen) betritt Shakespeare den Bereich echter, w e n n auch noch lauter u n d wortreicher Tragik. Die Feststellung des bevorstehenden eigenen Todes ist durch geschickte V e r k n ü p f u n g mit dem Schicksal des Sohnes auch hier indirekt: " W h e r e is m y other life? — mine o w n is gone; — / O ! where's young Talbot? where is valiant J o h n ? " D a m i t ist der Tenor der ganzen Rede gegeben, deren I n h a l t v o n liebevollem Stolz auf den tapferen Sohn bestimmt wird. D e r gleichzeitig gegebene Einblick in den H e r 93
gang der Schlacht ist kein Bericht um seiner selbst willen, sondern ergibt sich zwanglos. Die Sterberede entspricht den Vorstellungen, die das Publikum von dem berühmten Talbot hatte. Sie spiegelt den unbeugsamen Stolz, der ihn auf den personifiziert dargestellten Tod verächtlich herabblicken läßt 167 ) und schließt doch, in dem Verhältnis zum Sohn begründet, weichere Züge mit ein. Wir beschränken uns im folgenden darauf, auffällige und unterscheidende Merkmale dieser glanzvollen Sterberede aufzuzeigen. Der Wortreichtum stände der Totenklage eines überlebenden Talbot um seinen Sohn besser an als den letzten Worten des Sterbenden. Wahrscheinlich hat Shakespeare hier dem Umstand Rechnung getragen, daß Talbot für das englische Publikum eher die Bedeutung eines Symbols als eines individuellen Charakters hatte; Lebenstreue mußte also wohl den Anforderungen des Typus geopfert werden. Die beiden durch das Hereintragen der Leiche John Talbots unterbrochenen Redeteile tragen szenischen Charakter. Mimik und Gestik werden in Talbots Worten angedeutet; auf eine indirekte Regieanweisung hin legt man ihm den Sohn in die Arme. Die Verwendung der zahlreichen Bilder verrät deutlich eine Tendenz vom losen Vergleich zur integrierten Metapher (vgl. Z. 14, 16, 18, 21, 32); mit like ist nur noch ein Vergleich angefügt (7). Auffällig ist die durchgehende Gestaltung in Reimpaaren aus meist regelmäßigen Pentametern, wodurch ein hymnischer Eindruck hervorgerufen wird. Der durch den Berichtstil ruhigere Redeteil 3—16 ist aufgelockert durch gelegentliche betonte Versanfänge. Verdoppelungen, die beinahe tautologischen Charakter haben (8, 11), wirken ungeschickt. Der zweite Redeabschnitt ist lebendiger durch eine weniger am Zeilenende orientierte Syntax, äußerlich kenntlich an vermehrter Interpunktion im Satzinnern. Auch Joans Sterberede (V, iv, 86; 6 Zeilen) muß vor dem Hintergrund der ganzen Szene gesehen werden. Seit Zeile 36 beziehen sich die Worte der Pucelle auf das angekündigte Todesurteil, dem sie sich durch Hinweise auf königliche Abkunft, göttlichen Auftrag und schließlich Schwangerschaft (um gesetzlich vorgesehenen Aufschub der Strafvollstreckung zu erwirken) zu entziehen sucht. Nachdem sich alle Versuche als vergeblich erwiesen haben, hält Joan die Fluchrede, die von ihr als sorceress, d. h. Verkörperung einer Schurkenrolle, erwartet wurde. Danach wird sie zur Exekution abgeführt. Diese Rede ist durchaus konventionell und entspricht Shakespeares Interpretation der Jungfrau von Orleans als niederträchtiger Zauberin. Die Flüche sind nicht mehr Marlowes übersteigerte Ausbrüche, sondern merklich maßvoller und vergleichsweise nüchtern und sachlich. Das Versmaß ist beinahe schematisch regelmäßiger Blankvers, die Sprache unoriginell und farblos und ohne rhetorischen Schwung und Schmuck, wodurch die Verwünschungen an Wirkung verlieren. Zusammenfassend ist die Tendenz zur Sterbe-Szene festzuhalten, wie sie
,57
94
) M. Lüthl, Shakespeares Dramen (Berlin, 1957), S. 364, sieht darin eine "doppelte Ironie": " i m Tod . . . ereignet sich nicht die Vernichtung, sondern die höchste Verwirklichung des Helden, der Mensch vermag den Schalksnarren Tod ('antick death'), der sich über uns lustig machen will, seinerseits zu narren."
besonders deutlich beim Tode Mortimers, Bedfords, Joans, aber auch Talbots, zu Tage tritt. Verliert so die Sterberede an Selbständigkeit, so ist sie andererseits enger in den dramatischen Zusammenhang einbezogen. Der Sprachstil ist sehr uneinheitlich und zum Teil künstlich und konventionell. Der auffallende Bilderreichtum beschränkt sich oft auf durch like oder as lose angeknüpfte Vergleiche, zeigt aber auch bereits eine Neigung zu metaphorischer Verdichtung. H o h e dramatische Kunst wird besonders durch die Einbeziehung von Gebärden, dramatische Relevanz übernommener Klischees und Verwendung indirekter Regieanweisungen markiert. 14. The Second Part of King Henry
VI.
B Henry VI., möglicherweise zuerst entstandenes 158 ), dramentechnisch sicherlich bestes Werk der Trilogie, weist 67 Figuren auf, von denen 17 sterben (9 auf offener Bühne). 5 Sterbende halten Sterbereden. Schon der kurze Ausruf Horners: " H o l d , Peter, hold! I confess, I confess treason" (II, iii, 97/98) illustriert Shakespeares Kunst, ein komplexes Gefüge dramatischer Beziehungen sichtbar zu machen. Die Wortwiederholungen erinnern gleichzeitig an die Technik des Intensivierens, an die mühsame Satzbildung Sterbender, wie auch an das Stottern Betrunkener. Der Aussagegehalt läßt die lange Tradition der Gottesurteile anklingen; f ü r die besondere Situation innerhalb des Dramas bedeutet Horners Geständnis eine Enthüllung der Absichten Yorks. Der Sieg Peters gewinnt an Gewicht durch seine Klage I, iii, 219—222, er könne nicht fechten. Die an der kurzen Sterbeäußerung des persönlich unbedeutenden, im Grunde nur als Werkzeug benutzten H o r n e r bereits angedeuteten Möglichkeiten sind in der folgenden Sterberede, der des Kardinals, zu einem dramatischen H ö h e p u n k t ausgestaltet worden. Beauforts Sterberede (III, iii, 2; 3 + 11 Zeilen) ist unmittelbarer Ausdruck eines gequälten Gewissens; sie bricht aus Tiefenbereichen, die Shakespeare uns bisher noch in keiner Sterberede zugänglich gemacht hat und ist in der Intensität des Ausdrucks wohl nur Fausts letztem Monolog vergleichbar 159 ). Die inhaltliche Analyse kann hier abgekürzt werden, da wir in H . Oppels Aufsatz "Der Tod Beauforts" 1 6 0 ) eine eingehende Interpretation der Szene besitzen. Der sterbende Kardinal hält den ihn anredenden König f ü r den Tod und versucht, selbst diesen zu bestechen (2—4). Warwick bedeutet ihm: "it is thy sov'reign speaks to thee" (7); Beaufort reagiert jedoch kaum darauf; er nimmt nicht teil am Leben der sein Bett Umstehenden. Das schuldige Gewissen engt sein Bewußtsein ein auf Gericht, Geständnis wider Willen und visionäre Schau des ermorde-
158
) Vgl. die Einleitungen zu J. D. Wilsons Ausgabe von A, B Henry VI. ) Diese Parallelität hat Fleay zu der Annahme einer Verfasserschaft Marlowes geführt; vgl. H . C. Hart, Hrsg., The Second Part of King Henry the Sixth (London, 1908), S. xxi. 160 ) Festschrift zum 75. Geburtstag von Theodor Spira, S. 113—124. I69
95
ten Gloster, dessen Name jedoch nicht fällt (8—16). Die peinigende Vision seines Opfers ist von grausiger Eindringlichkeit: "Comb down his hair; look! look! it stands upright" (15). Beauforts letzte Worte sind eine Bitte um Getränk und das bereits gekaufte Gift, dessen er jedoch nicht mehr bedarf. Wie im Falle Salisburys (A H VI, I, iv) erweist sich auch hier eine direkte Regieanweisung "He dies" als überflüssig: die Agonie des Todeskampfes wird in den Worten Warwicks widergespiegelt (24). Die Verwendung von Gebärden findet eine besonders eindrucksvolle Variante in der Verweigerung des kleinen, Gottes Gnade anrufenden Handzeichens (29). — Auffälligstes Merkmal dieser Sterberede ist die Dichte und Eindringlichkeit der Atmosphäre 161 ). Sie wird geschaffen durch die Gedrängtheit der Sprache, die nichts Überflüssiges enthält; durch die konsequente motivliche Einheit, die nur Vorstellungen von Tod, Schmerz, Gericht, Gewissensqual, Gift enthält; durch die Verwendung von Andeutungen und Vorspiegelungen statt konkreter Aussagen oder greifbarer Tatsachen; durch den völligen Einklang mit dem Charakter des Sterbenden und den besonderen Umständen des Todes. Diese Sterberede ist monologischer Ausbruch eines gequälten, aber verstockten Menschen; die Bewußtseinseinengung ist so stark, daß echtes Gespräch mit den Umstehenden nicht zustande kommt. Der König, Warwick und Salisbury sind nicht nur räumlich Außenstehende: sie vermögen nicht, die Wand aus physischer und psychischer Qual um Beaufort zu durchdringen. Die Szene erreicht eine bemerkenswerte künstlerische Einheit; ihr Eindruck auf den Leser ist in der Tat "overpowering" 162 ). Die Verwendung der Sprache ist eindringlich, der Blankvers entsprechend dem Ausdrucksgehalt bewegt und dramatisch; betonte Zeilenanfänge und weibliche Versausgänge tragen zur Auflockerung der sonst regelmäßigen Zeilen bei. Das einzige Bild, ein durch like angeschlossener Vergleich (16), dient der Aufhöhung und Kommentierung der Vision Glosters in Vers 15. Suffolks Sterberede (IV, i, 117; 1 + 1 0 + 7 Zeilen) ist ein weiteres Beispiel für das Zurücktreten der selbständigen Rede: wieder haben wir eine ausgesprochene Sterbe-Szewe vor uns. Der hier für die letzten Äußerungen angesetzte Beginn mit Zeile 117 ist daher nicht unangreifbar. Die Szene ist organisch mit dem Tod des Kardinals verbunden 163 ), bedeutet aber in vielem ein Kontrastbild. Vor allem sind die inneren Vorgänge hier nach außen verlegt, was sich am deutlichsten an den direkten und vergleichsweise oberflächlichen Dialogen zeigt. Rein technisch entspricht dies Verfahren der veränderten Situation, in der die Vergeltung von außen an den Übeltäter herangetragen wird 164 ). Suffolks Erschrecken (33, 117) über den Namen seines Richters verknüpft die Szene mit der I, iv, 36 gegebenen Prophezeiung, er werde durch "water", d. h. hier: "Walter", umkommen. Trotz der festen Überzeugung, daß sein Tod unausweichlich ist,
) ) lra) 1M) lel
162
96
Vgl. Oppel, "Der Tod Beauforts", S. 116/117. Drake, Shakspeare And His Times, S. 486. Vgl. Oppel, "Der Tod Beauforts", S. 121 und 123. Zu den Theorien über die beiden Wege der divine retribution vgl. die grundlegende Arbeit von Campbell: "Theories of Revenge."
behält Suffolk seinen Hochmut; er läßt sich nicht dazu herab, um sein Leben zu bitten (121—130). Besonders deutlichen Ausdruck findet sein unbeugsamer Stolz in den letzten Worten, die eine Beispielsammlung zu der Feststellung: "Great men oft die by vile bezonians" (134) geben und in der er sidi aufgrund seines Todes durch Piratenhand in eine Reihe mit Cicero, Caesar und Pompejus stellt. Dieser Haltung liegt die Konvention zugrunde, es sei schimpflich, durch einen im Range wesentlich Tieferstehenden getötet zu werden: " T o die by peasants, what a grief is this" 1 8 5 ). Die Sterberede entspricht dem von Suffolk gezeichneten Charakterbild. Die Redewechsel machen trotz der häufigen Hinweise auf "death", "block", "execute", " d i e " usw. einen kalten, tieferes Mitgefühl nicht weckenden Eindruck 1 6 6 ). Die konventionellere Behandlung dieser Sterberede beeinträchtigt die Würdigung Suffolks als eines individualisierten Charakters. Die sprachliche Gestaltung bekräftigt den Eindruck des Konventionellen und ist besonders nach der Todesszene Beauforts unbefriedigend. Das lateinische Zitat (117) ist unmotiviert und überflüssig. Das Holprige und Unrhythmische des Blankverses geht meist auf Kosten der betonten Zeilenanfänge, deren hohe Anzahl möglicherweise für bewußten Gebrauch als Stilmittel spricht, dessen Verwendung aber noch wenig glücklich erscheint. Die wesentliche Bedeutung dieser Sterberede ist also im szenischen Aufbau zu sehen und in der Bedeutung für den Handlungsgang, für den die Todesszenen Beauforts und Suffolks Höhepunkte bedeuten. Auch Lord Says Sterberede ( I V , vii, 103; 8 + 4 Zeilen) folgt der schon vielfach beobachteten Tendenz, lediglich Abschluß einer ganzen Sterbeszene zu sein. Der erste Teil der Rede, konkret und direkt an den Ankläger gerichtet, enthält eine vierfache Variation der Frage: "Teil me wherein I have offended most?", gipfelt in der eine indirekte Anklage enthaltenden Feststellung: "These hands are free from guiltless bloodshedding" (108) und schließt mit der als Kurzzeile besonders eindringlichen Bitte: " O ! let me live" (110). Cades und der Umstehenden Wiederholung des Todesurteils bewegt Say im letzten Teil seiner Sterberede zu einer Anrede seiner "countrymen", die er in Gottes Namen um Mitleid und Schonung bittet (121—124); darauf wird er zur Exekution abgeführt. Says Schicksal ist schon bei seinem ersten Auftreten vorausgedeutet: "Lord Say, Jack Cade hath sworn to have thy head" ( I V , iv, 19). Die wenigen Hinweise auf seinen Charakter ( I V , iv, 46—48; 59/60) bestätigen die der Sterberede zugrunde liegende Überzeugung von der eigenen Unschuld; ausgeprägtes Rechtsgefühl verlangt eine Begründung des Todesurteils. Die wiederholte Bitte um Schonung ist nicht als unwürdig dargestellt; sie gibt eine wirkungsvolle Folie für die Grausamkeit der Aufständischen ab. Die Kennzeichen des Monologischen sind zurückgetreten zugunsten direkt bezogener Wechselrede. Der Stil ist schlicht und durch
"») Mass., 1021. Vgl. auch Spencer, Death, S. 136—138. 1 M ) So empfindet auch B. Kiehl, Wiederkehrende Begebenheiten und Verhältnisse in Shakespeares Dramen: Ein Beitrag zur Shakespeare-Psychologie (Diss. Berlin, 1904), S. 31, wenn er schreibt: " e r [Suffolk] stirbt würdig, doch macht ihm der Tod so wenig aus, daß audi wir nicht gerührt werden."
97
die in Frageform gekleidete indirekte Rechtfertigung eindrucksvoll. Der Gebrauch flüssiger, nach Wortwahl und Syntax hochentwickelter Blankverse hebt Say aus den Prosa sprechenden Rebellen heraus und erfüllt somit eine besondere Funktion 1 6 7 ). Für den Handlungsgang hat Says Sterberede nur episodische Bedeutung. Cade beginnt seine Sterberede (IV, x, 6 3 ; 7 + 5 Zeilen) mit der konventionellen Feststellung: " O , I am slain!". Sein Stolz gebietet es, die Niederlage mit seiner durch fünftägiges Hungern bedingten Schwäche zu erklären (64, 7 9 / 8 0 ) . Den folgenden Fluch auf Garten und Bewohner beschließt Cade mit der für viele Sterbereden typischen Nennung des eigenen Namens, die hier aber eine dramatische Funktion erhalten hat durch die Wirkung auf Iden (70—75). Cades Stolz findet erneut deutlichen Ausdruck in den letzten Zeilen seiner Sterberede (76-80): Iden farewell; and be proud of thy victory. Teil Kent from me, she hath lost her best man, and exhort all the world to be cowards; for I, that never feared any, am vanquished by famine, not by valour. Cades Sterberede macht Gebrauch von zahlreichen konventionellen Elementen (Todesfeststellung, Fluch, Namensnennung, Abschiedsformel), die zum Teil jedoch dramatisch geschickt eingesetzt wurden. Sie ist der Situation (Todeswunde) nicht angemessen, paßt aber gut zur Gestalt Cades, wozu rein äußerlich der Prosastil wesentlich beiträgt. Die durchweg betonte Grundhaltung des Stolzes, der die hyperbolische Ausdrucksweise in Zeile 65 und 7 8 / 7 9 entspricht, verleiht der Sterberede eine gewisse Würde, die den konventionellen Fluchreden meist nicht eigentümlich ist 1 6 8 ). Ein kurzer Überblick über B Henry VI. zeigt, daß die Neigung zur Sterbeszene weiter verstärkt, die Sterberede selbst enger mit dem Handlungsgang verbunden wurde. Auch die Individualisierung der Charaktere ist verstärkt worden, wie die letzten Worte Cades 1 6 9 ) und besonders Beauforts verdeutlichen. Dessen Sterberede illustriert in für diese Frühstufe erstaunlicher Intensität die Verlegung auf innere Vorgänge und auf das Überwiegen seelischer über körperliche Qualen; außerdem ist sie ein weiteres Beispiel für die Verwendung gestischer Mittel. Der Stil ist deutlich unterschieden nach dem jeweiligen Sterbenden; er ist stets knapp und eindringlich und variiert von dramatischem (Horner, Beaufort), sachlich-nüchternem (Suffolk) und schlichtem (Say) Blankvers, der sich durch häufige Verwendung betonter Versanfänge auszeichnet, zur niederen, aber nicht vulgären Prosa (Cade).
l n ) Vgl. auch Crane, Shakespeare's Prose, S. 6 und 133. i«8) Ygi Lüthi, Shakespeares Dramen, S. 358. 1 M ) Vgl. L. C. Knights, Some Shakespearean Themes (London, 1959), S. 30: "Cade is a 'character', whereas Iden, say, is a type figure."
98
15. The Third Part of King Henry
VI.
Von den 52 Figuren des dritten Teils der Trilogie sterben 11; davon 6 auf der Bühne. Ebenfalls 6 halten eine Sterberede. Die letzten Worte eines 7. Sterbenden werden, ähnlich wie die der Nurse in Titus Andronicus, in direkter Rede berichtet (Montague: V, ii, 42 und 47). Sie besitzen jedoch nicht die dramatische Kraft der früheren Szene; die konventionelle Abschiedsformel farewell sowie ebenso berichtetes Stöhnen des Todwunden rechtfertigen keine ausführlichere Behandlung als Sonderfall; es genüge hier der Hinweis auf erneuten Gebrauch des technischen Kunstgriffes, Sterbereden nicht nur dem Inhalt nach, sondern wörtlich wiedergeben zu lassen. Rutlands Sterberede (I, iii, 12; 9 + 2 + 2 + 1 + 7 + 1 Zeile) ist die eines Kindes170) und als solche zu bewerten. Die Todesandrohung Cliffords beantwortet er mit einem rhetorisdi ausgeschmückten Gleichnis seiner Lage (12—15) und einem durch Cliffords grausamen Blick hervorgerufenen Todes wünsch: "Ah! gentle Clifford, kill me with thy sword, / And not with such a cruel threatening look" (16/17) 171 ), dem flehentliche Bitten um Schonung folgen. Diese Bitten erinnern fern an das argumentative Verfahren der frühen Tragödie; die angeführten Gründe — ein Kind ist kein angemessener Gegner (18—20, 23/24), es gibt keinen hinreichenden Grund für den Mord (38, 44/45), Gott kann die Untat an Cliffords eigenem Sohn rächen (40—42) — sind jedoch keine Debatte um des Argumentierens willen, sondern Rettungsversuche eines geängstigten Menschen — wenn auch nicht gerade eines Kindes. Clifford läßt sich aber nicht rühren und ersticht Rutland, der mit einem Ovidzitat auf den Lippen stirbt. — Diese Sterberede wirkt durch den Verzidit auf Altklugheit oder Heroismus mancher elisabethanischer Kindergestalten relativ echt und kindlich; die sprachliche Gestaltung ist dagegen unnötig konventionell. Das Gleichnis zu Beginn der Rede verrät ebenso wie die den Verstand mehr als das Gefühl ansprechenden Umstimmungsversuche und das lateinische Zitat einen selbst für Erwachsene unnatürlichen Abstand zum eigenen Schicksal. Ansätze zu kindlichem und menschlich-bewegendem Ausdruck wie in Zeile 35/36 oder 38 ("I never did thee harm: why wilt thou slay me?") machen jedoch die positive Beurteilung verständlich, die Clemen für Rutlands Sterberede findet172). Bemerkenswert ist der direkte, rasche, Zeile 39 durch eine split line verzahnte Dialog, sowie die Verwendung von Mimik und Gestik (11, 34, 36). Die dramatische Funktion der Szene ist gering: Cliffords Tod wird nicht in ursächlichen Zusammenhang damit gebracht; Rutlands Andeutungen der Rache an Cliffords Sohn werden nicht ausgewertet.
170
) Hall gibt sein Alter mit etwa 12 Jahren an; vgl. Hart und J. D. Wilson (Hrsg., C H VI), Anm. zu I, iii, 47 bzw. vor I, iii. ) Eine Variation bietet Shakespeare V, vi, 26, wenn Henry bittet: "Ah! kill me with thy weapon, not with words." Das Motiv des tötenden Blicks erinnert an Marlowes Darstellung in Tamb. I, 1057/58. Vgl. ferner A H IV, I iii, 143: "And on my face he turn'd an eye of death." 172 ) Kommentar, S. 145. 171
99
Auch die Sterberede Yorks (I, iv, 111; 39 + 1 7 + 2 Zeilen) besteht aus längeren Reden, die sein Todesurteil kommentieren, und einer letzten kurzen Äußerung nach den tödlichen Wunden. Der lange erste Redeabschnitt ist zunächst ausschließlich an Queen Margaret gerichtet, deren haßerfüllte Beschimpfungen (70—108) Mitgefühl für Y o r k geweckt haben. Seine Antwort fällt nicht in die gleiche Tonlage, sondern bleibt trotz aller Anklage sachlich und würdig (111—136) und selbst im Fluch noch maßvoll (164). Nach der durch den ihm angetanen Schimpf provozierten Entgegnung tritt ohne spürbaren Übergang der trauernde Vater in den Vordergrund, der seinen ermordeten Sohn beweint und mit seinen Tränen Rache über Clifford und die Königin ruft (137—149). Nach einer kurzen Zwischenbemerkung Northumberlands, in der dieser sich von der Rede stark beeindruckt zeigt, klagt der gebrochene Vater die unmenschliche Königin an, die ihm ein mit dem Blut Rutlands getränktes Tuch gereicht hatte, um damit seine Tränen zu trocknen. Yorks Klage über die Untat Margarets, des "tiger's heart wrapp'd in a woman's hide" (137), ist bewegend; seine Überzeugung (161—163): Upon my soul, the hearers will shed tears; Yea, even my foes will shed fast-falling tears, And say, 'Alas! it was a piteous deed!'
erfährt in Northumberlands Reaktion (169—171) unmittelbare Bestätigung. Y o r k fleht nicht um sein Leben; er ergeht sich auch nicht in Trotz- und Fluchtiraden: sein Leid ist zu groß, als daß er noch Freude am Leben oder an heroischen Taten haben könnte 1 7 3 ). Daher bittet er Clifford um seinen T o d mit dem Wunsch: " M y soul to heaven, my blood upon your heads!" (168). Clifford und die Königin erstechen danach kaltblütig York, der mit seinen letzten Worten die Gnade Gottes anruft: " O p e n thy gate of mercy, gracious God! / M y soul flies through these wounds to seek out thee" (177/178). Diese Sterberede ist bewegender Ausdruck menschlichen Leids; sie ist sowohl der Person wie auch der Situation angemessen und gut mit dem Handlungsgang verknüpft. Die Ausweitung zur Szene und die Länge der Rede erlauben vielfältige Anspielungen und Bezüge, die aber dem Gesamteindruck der aktuellen Vorgänge untergeordnet sind: das Gegenbild der Königin vermittelt indirekte Information über Shakespeares Bild nicht nur von dieser, sondern auch allgemein von der Frau ( 1 1 3 - 1 1 5 , 1 2 8 - 1 3 3 , 141); Yorks letztes Wort (178) knüpft an medizinische Vorstellungen der Zeit an, ohne sich darüber ablenkend und ausweitend zu verbreiten; man kann die Szene als ein Beispiel für die Einstellung lesen, die Rache müsse Gott überlassen bleiben (vgl. 148, 168); die ausdrückliche Verzögerung des Mordes wegen der zu erwartenden Sterberede (110) ist ein nachdrücklicher Hinweis auf das Bestehen einer solchen Tradition. Als Äußerung von ausgeprägtem Redecharakter verdient die Sprachgebung besondere Beachtung. Das Ausmaß des verwendeten konventionellen rhetorischen Schmucks ist größer, als
173
) Es ist bemerkenswert, daß auch hier (wie bei Beaufort) seelisches Leid stärker empfunden wird als die I, iv, 23 betonte körperliche Schwäche.
100
oberflächliches Lesen vermuten läßt — ein Hinweis auf funktionale Unterordnung statt selbständiger Wirkungsabsicht. Zahlreiche Tiermetaphern unterstützen Charakterisierung und Atmosphäre (111, 112, 137, 155)174), auch lockerer eingefügte Vergleiche sind noch vertreten (114, 116, 135, 136). Parallelismen und symmetrische Konstruktionen (128—133, 143/144), Worthäufungen (140, 141), Epipher (161/162), Ellipse (142,168), Hyperbel (155), alliterierende Wortgruppen (162, 167), Spruchweisheiten (127, 145/146), Antithese und Kontrast (111, 128—136) sind eine Auswahl der Elemente, die Shakespeare bewußt angewendet hat, um die inhaltliche Wirkung zu unterstreichen und Gefühlstöne anzuschlagen, die anders kaum zu erreichen wären. Vergegenwärtigt man sich noch den mit der Handhabung des blutigen Tuches, der Papierkrone, des Mordüberfalls verbundenen Anteil an Gestik und Mimik, so entsteht der Eindruck einer Rede, in der ausgesprochene Freude an den sprachlichen Ausdrucksmitteln dem Ausdruck echt menschlicher Gefühlsregungen dient, so daß die Rede mit Recht als "one of the most moving speeches in the play" bezeichnet werden kann 175 ). Clifford ist für seine Sterberede (II, vi, 1; 30 Zeilen) ein eigener Auftritt vorbehalten. Todwund betritt er die leere Bühne. Seine in ein sprechendes Bild gekleidete Feststellung des bevorstehenden Todes lenkt den Gedanken ganz natürlich auf den König: "Here bums my candle out; ay, here it dies, / Which, while it lasted, gave King Henry light" (1/2) und weiter auf die Konsequenzen seines Todes für das Land: er befürditet den Sturz des Königs (3/4), eine Stärkung der Plantagenets (5—10) und macht Henry, illustriert durch einen Vergleich mit dem Sonnenwagen (11—13) den Vorwurf, nicht wie ein guter König York rechtzeitig unterdrückt zu haben (14—22). Der Übergang zum eigenen Schicksal ergibt sich organisch aus dem Vorhergehenden: "Bootless are plaints, and cureless are my wounds" (23). Wie den Zustand des Reiches analysiert er auch nüchtern die eigene Lage: die Unmöglichkeit der Flucht, die Unbarmherzigkeit der Feinde, die Tödlichkeit seiner Wunde (24—28). Mit einer letzten großen Geste ruft er seine Feinde an, für das eigene Leben nichts bereuend und nichts beklagend: "I stabb'd your fathers* bosoms, split my breast" (30). Er verliert das Bewußtsein und stirbt wenig später unter Stöhnen, das die Aufmerksamkeit der inzwischen aufgetretenen York-Partei auf ihn lenkt. Aufschlußreich für die "architecture of the single scene"176) ist Shakespeares dramatisch äußerst wirkungsvoller Kunstgriff, Cliffords Feinde noch Leben in ihm vermuten zu lassen und den Toten in einer Szene von makabrer Ironie zu schmähen und zu verhöhnen (58—79). — Die für einen Sterbenden auffällige Länge und strukturelle
17i
) Weitere Beispiele in den Sterbereden Cliffords (II, vi, 8, 9, 17) und Warwicks (V, ii, 12, 13). Zur Tiersymbolik in Henry VI. vgl. Lüthi, Shakespeares Dramen, S. 356. A. Yoder, Animal Analogy in Shakespeare's Character Portrayal ( N e w York, 1947), gibt S. 65 eine tabellarische Übersicht über die Verwendung in Shakespeares Werken. ««) Leech, "Marlowe's 'Edward II'", S. 186. 17 ') H. T. Price, Construction in Shakespeare, The University of Michigan Contributions in Modern Philology, X V I I (1951), 21.
101
Durchgliederung der Rede knüpft an überkommene Vorbilder an, ist dabei aber dem Charakterbild Cliffords überzeugend angepaßt (Sorge um den Staat, Fehlen weicherer Gefühlstöne, tapferer, achtunggebietender Tod). Bemerkenswert ist die überaus sorgfältig gestaltete Sprache, deren Reichtum an Bildern, Metaphern und Vergleichen für eine Sterberede ungewöhnlich ist (1/2, 5, 6, 8 - 1 0 , 1 1 - 1 3 , 17, 21/22). Apostrophen (3, 11, 14, 29), syntaktische Parallelismen (9/10, 21/22), konventionelle mythologische Anspielung (11—13), rhetorische Fragen, meist in Form von Spruchweisheiten (9, 10, 21, 22), Vergleich (14/15), Abschluß durch Reimpaar (29/30) illustrieren Shakespeares bewußte Sprachgebung. Die Freude am Wort und rhetorischen Schmuck ist ein Kennzeichen seiner frühen Sterbereden; sie tritt später zurück, bzw. äußert sich zu passenderen Gelegenheiten. Auch Warwicks Sterberede (V, ii, 5; 24 + 7 + 2 Zeilen) ist sehr wortreich und besonders in ihrem auf der leeren Bühne gesprochenen längeren ersten Teil künstlich und konventionell. Die einführende Frage nach dem Sieger des vorausgegangenen Kampfes beantwortet er sich selbst durch Hinweise auf seine tödlichen Wunden (5—10), deren Folgen er mit klischeehaften Vergleichen und Bildern kommentiert (11—26). Ein nachdrücklich durch Endreim hervorgehobenes gemeinplätzliches Fazit schließt diese Rede ab: " W h y , what is pomp, rule, reign, but earth and dust? / And, live we how we can, yet die we must" (27/28). Der Auftritt Oxfords und Somersets beendet die undramatische Monologsituation. In durchaus realistischer Weise illustriert Warwicks Anrede an den nicht anwesenden Bruder Montague das Nachlassen seines Augenlichtes. Die Sprache ist hier natürlicher, schlichter, menschlich-echter (33—39). Man unterrichtet ihn nun vom Tode Montagues, dessen letzte Worte dem Bruder gegolten hatten, worauf Warwick kurz seiner gedenkt und dann in traditioneller Weise von den Lords Abschied nimmt, nachdem er ihnen geraten hat, sich durch Flucht zu retten (48/49). Die sprachlichen Charakteristika dieser Rede: rhetorische Fragen (7, 21, 22, 27), Metaphern, Bilder und Vergleiche ( 1 1 - 1 5 , 17, 20), Endreim (27/28) sind dieselben wie bei den Sterbereden Yorks und Cliffords. Der Hervorhebung wert sind jedoch die Verwechslung Somersets mit Montague als Auswirkung der an sich klischeehaften Feststellung: "These eyes, that now are dimm'd with death's black veil" (16) sowie die durch den Zusammenhang motivierte Beschreibung seines Zustandes (36—3 8) 1 7 7 ): Thou lov'st me not; for, brother, if thou didst, Thy tears would wash this cold congealed blood That glues my lips and will not let me speak.
Dieser Verzicht auf einen medizinischen Exkurs um seiner selbst willen erweist ebenso wie der erwähnte realistische Einschlag Shakespeares zunehmende Kunst der szenischen Gestaltung, während die Sprachgebung der Sterbemonologe wegen ihrer künstlichen und verspielten Gesprächigkeit noch weithin unbefriedigend erscheint.
177
) Allein diese beiden Züge sprechen m. E. stark gegen Brookes Ansicht, Warwicks Sterbereden seien typisch Marloweisdi (Tudor Drama, S. 320/321).
102
Somersets letzte Worte (V, v, 6) sind so wenig individuell wie seine Rolle als unbedeutende Nebenfigur nur erwarten läßt. Seine Unterwerfung unter das Todesurteil ist ein Echo der Worte Oxfords; der Gedanke an den Tod berührt ihn offenbar nicht: als Soldat ist er gewöhnt, sich geduldig der wechselnden Fortuna zu beugen. Bemerkenswerter ist die Tatsache, daß auch Henry nur eine kurze Sterbeäußerung erhält (V, vi, 59; 2 Zeilen). Sie greift seine Prophezeiung V, vi, 37 ff. wieder auf und ist zugleich unmittelbare Entgegnung auf Glosters Behauptung, er sei für diesen Mord bestimmt gewesen: "Ay, and for much slaughter after this. / O, God forgive my sins, and pardon thee!" Mit dieser christlichen Haltung wächst der greise, durch Leid gereifte König aus der Sphäre menschlicher Leidenschaften heraus. — Die Worte bezeichnen den dramatischen Abschluß einer Szene, die seit Beginn durch die Todesahnungen Henrys gekennzeichnet war. Dessen Charakterisierung Glosters und die Prophezeiung des von ihm ausgehenden Unheils ist über den Rahmen dieses Dramas hinaus von Wirkung: sie erfüllt sich in Richard III. Mit der kurzen, schlichten und bewegenden Sterbeäußerung trägt Shakespeare dem Charakter des Königs Redinung. Wenn er in seinen späteren Werken auch durchweg laute Töne und geschwätzige Umständlichkeit im Angesicht des Todes vermeidet, so hat ihn hier wohl die christlichduldende und verzeihende Haltung Henrys die Unangemessenheit einer Fluchund Trotzrede oder würdelosen Betteins um das Leben empfinden lassen. Die Rede steht in wirkungsvollem Kontrast zu den Worten und Taten Glosters, der in perversem Triumph dem leblosen Körper weitere Stiche beibringt (67), womit er sich eindringlicher charakterisiert als in seinem folgenden schauerlichen Monolog. Die Sterbereden des 3. Teils von Henry VI. sind im Mittel länger als die der beiden ersten Teile, jedoch sind auch sie meist ins Szenische hinein aufgelockert. Die charaktertypische Unterscheidung ist nicht weiter entwickelt worden; Ansätze zur Individualisierung verraten vor allem Rutland, York und der König. Weitergehende dramatische Funktionen sind den Sterbereden nidit gegeben worden: entsprechend der losen Struktur des Dramas leben sie vorwiegend aus der einzelnen Szene heraus. Die sprachliche Gestaltung ist oft unbefriedigend konventionell. Wortreiditum und reichlich verwendeter rhetorischer Schmuck überwuchern an vielen Stellen menschlidi-echte Töne. Die zahlreichen, überdeutlich markierten Vergleiche und Bilder (darunter besonders viele Tiermetaphern) dienen noch fast durchweg mehr der Amplifizierung und Variation 178 ) als einer durch Verschmelzung gewonnenen weiteren Dimension der Ausdrucksmöglichkeiten. Hervorzuheben sind außer der exuberanten, für Sterbereden zu klangvollen Sprachgebung die sehr geschickte szenische Anordnung und die dramatische Wirksamkeit, die durch realistische Züge, eingefügte gestisdie und mimische Elemente, Reaktionen und Kommentare Umstehender und originelle Kunstgriffe wie die durch schwache Sehkraft bedingte Personenverwechslung
178
) Vgl. Clemen, Shakespeare's Imagery, S. 40—46. 103
(Warwick) oder das Anreden (Clifford) oder Mißhandeln (Henry) der bereits Gestorbenen erreicht wird. 16. The Tragedy of King Richard
III.
In Richard III. sterben 14 der insgesamt 55 Figuren; eine davon auf offener Bühne. Es werden 6 Sterbereden gehalten, die sämtlich in Gespräch oder Dialog eingebettet sind. Die erste, eindrucksvollste und vielschichtigste Sterbeszene ist die des Clarence (I, iv, 184; 3 + 1 + 1 2 + 6 + 9 + 1 + 6 + 2 + 5 + 1 + 3 + 6 + 1 + 10 Zeilen). Das verstörte Stammeln der beiden Mörder auf die direkte Frage nach ihrem Auftrag (179—183) macht trotz des eben erst erzählten schrecklichen und Todesahnungen weckenden Traumes (I, iv, 2—74) Clarence' Hoffnung verständlich, durch Überredung sein Leben noch retten zu können. Durch diese Hoffnung wird die Ausführlichkeit der folgenden Argumentation psychologisch glaubwürdig. Der erste Umstimmungsversuch stützt sich auf die fehlende rechtskräftige Verurteilung (186, 190—210). Die Mörder berufen sich auf einen Auftrag des Königs, den Clarence durch Hinweise auf Gott und dessen Strafe für Gesetzesbrecher zu entkräften sucht (204—209). Das Gegenargument, er selbst habe sich in den Rosenkriegen mit Schuld beladen, eröffnet der Szene eine weitere Dimension und macht zugleich mit sparsamsten Mitteln den historischen Hintergrund gegenwärtig. Clarence münzt sein Eingeständnis sogleich in ein Argument um: da er für den König schuldig geworden sei, könne dieser ihn nicht verurteilen: "For in that sin he is as deep as I " (223) und warnt erneut die Mörder (224 —228) 179 ): If God will be avenged for the deed, O! know you yet, he doth it publicly: Take not the quarrel from his powerful arm; He needs no indirect or lawless course To cut off those that have offended him.
Die Illusion, in der Clarence befangen ist, wird noch deutlicher in seiner folgenden Berufung auf die Liebe und Hilfe seiner Brüder (232, 235—240, 242/243, 244—248, 250, 254—256). Schließlich beschwört Clarence die Mörder erneut, an Gott und ihr Seelenheil zu denken (260—265, 266: "Relent and save your souls") und appelliert an ihr Mitleid (268—277) — umsonst: ungerührt und kaltblütig ersticht ihn First Murderer. Clarence' Sterbereden verraten eine dramatisch sehr wirksame Szenenführung. Bis zum Schluß bleibt die Möglichkeit einer Rettung angelegt; besonders die Gewissensregungen des Second Murderer (266: "What shall we do?") sind ein effektvolles Spannungsmittel. Uber diese
17«) "No better exposition of the whole theory [of revenge] exists . . . than that in 'Richard III', where Clarence argues with his murderers": I, iv, 204—209, 224—228, 262/263 (Campbell, "Theories of Revenge", S. 290).
104
äußerliche Anteilnahme hinaus wird das Interesse der Zuschauer durch den gewonnenen Einblick in Clarence' Psyche fixiert. Die Fehleinschätzung seiner Lage, die Hoffnung auf die Kraft seiner Beredsamkeit (vgl. I, iii, 348: "Clarence is well-spoken"), vor allem aber seine blinde Verkennung Richards (dessen Verstellungskunst dadurch indirekt charakterisiert wird) rufen eine eindringliche Empfindung der Ironie hervor. Die Szene ist durch zahlreiche Anspielungen nicht nur mit dem Handlungsverlauf der vorausgehenden Szenen verknüpft, sondern ruft auch die vor Beginn des Dramas liegende Vergangenheit ins Gedächtnis (211—217). Die Bezüge sind konkret und persönlich; chorisch-neutrale Digressionen kommen nicht vor. Das Gespräch ist kein verdeckter Monolog, sondern in Argument und Gegenargument aufgelöster Dialog 180 ), der auch äußerlich durch syntaktische und wörtliche Parallelismen (186/187, 208—210, 232/233) und Verzahnung durch Halbzeilen (243, 266) eng verbunden ist. Die Sprache ist eindringlich; rhetorischer Schmuck ist sehr sparsam und nicht als Selbstzweck verwendet worden: Wort- und Satzparallelen (184/185, 221), Häufung von Fragen (190—195), etymologisierende Stammwiederholung (276/ 277) dienen der Intensivierung. Bilderhäufungen oder locker angeführte Vergleiche fehlen ebenso wie aufdringliche Variationen und Amplifikationen. Der Blankvers ist abwechslungsreich (Enjambement, weibliche Versausgänge, 6hebige Zeilen, ein 3-hebiger Kurzvers), die Sprache flüssig und nach Anliegen und Stimmung variiert (Interjektionen, Fragen, Anrede, Klage, sachliche Darstellung, beschwörende Bitten) 181 ). Die Sterbereden Rivers' (III, iii, 1; 3 + 6 + 6 + 2 Zeilen), Greys (III, iii, 4; 2 + 3 Zeilen) und Vaughans (III, iii, 6) können gemeinsam betrachtet werden, da sie kaum individuell unterschieden sind182), sondern als Aufteilung eines Monologes auf drei Sprecher wirken. Die Situation — der Weg der Verurteilten zur Richtstätte — bestimmt die Motive: Unrechtmäßigkeit der Todesurteile (1—3, 13, 22), Verwünschung der Richter (4/5), Prophezeiung (6), Apostrophe des Schlosses Pomfret und Rückschau (8—13), Hinweis auf den Fluch Margarets, der sich nun an ihnen erfüllt (14—18), Gebet (18-22), Abschied (24/25). Trotz der Bedeutungslosigkeit der Figuren und der scheinbaren Episodenhaftigkeit dieser kurzen Szene sind die Sterbereden bemerkenswert sorgfältig mit dem Handlungsgang verknüpft. Zahlreiche Anspielungen auf die Hinrichtung in der vorhergehenden Szene (ab Z. 50) haben das Publikum vorbereitet. Der Bezug auf Margarets Fluch (I, iii, 196—214) erweist dessen dramatische Wirksamkeit und läßt ein ähnliches Schicksal auch für die anderen darin Genannten
180
) Der Stil der Mörder ist dabei dem Niveau Clarence' angeglichen, was V. Whitaker, Shakespeare's Use of Learning: An Inquiry into the Growth of his Mind and Art (San Marino, California, 1953), S. 63, als "outrageous defiance of decorum" bezeichnet. Vgl. audi Clemen, Kommentar, S. 117/118, 126 Anm. 2. lel ) Eine eingehende und vielseitige Interpretation der Szene bietet Clemen, Kommentar, S. 9 9 - 1 3 2 . 182 ) Die Längen der Sterbereden (17:5:1 Zeile) entsprechen jedoch etwa dem Anteil und Gewicht der früheren Auftritte der Sprecher (30:8:0 Zeilen).
105
erahnen 1 8 3 ). Indem Rivers f ü r seine Schwester und die beiden Prinzen betet (20/21), sind auch diese wieder gegenwärtig und in die Unheilsahnungen einbezogen. So greift die Szene Ereignisse früherer Akte auf und richtet zugleich den Blick auf zukünftige Schicksale. Audi diese Sterbereden verwenden kaum rhetorische Mittel. Auffällig sind lediglich der Hervorhebung dienende Parallelismen und Wiederholungen (3, 8, 17/18) und ein Reimpaar (2/3). Die Tendenz vom selbständigen Bild und Gleichnis zur unauffällig eingegliederten Metapher ist audi hier angedeutet 184 ). Hastings' Sterberede (III, iv, 79; 14 + 6 + 5 Zeilen) trägt trotz der Einwürfe Ratcliffs und Lovels monologischen Charakter, jedoch ist den drei Redeabschnitten je ein eigenes Thema vorbehalten. Das unerwartete Todesurteil öffnet Hastings plötzlich die Augen; rückblickend versteht er die Ahnungen und Vorbedeutungen aus den vorhergehenden Szenen in ihrem Bezug auf sein Schicksal, und er erkennt, daß Margarets Fluch sich nun an ihm verwirklicht (79—92). Im zweiten Teil seiner Sterberede beklagt Hastings in überpersönlich-chorischer Weise das ewig unsichere Dasein des Menschen (96—100). Den Abschluß bilden Prophezeiungen des Unheils f ü r England und des Todes f ü r seine Richter (102—106). — Auch diese Sterberede zeichnet sich durch überaus enge Verknüpfung mit dem Handlungszusammenhang aus 185 ); rüdewirkend wirft sie verdeutlichend und Handlungsfäden wieder aufgreifend neues Licht auf Anspielungen und Vorgänge früherer Szenen. Besonders eindrucksvoll ist der Gebrauch tragischer Ironie in der Charakterzeichnung Hastings', der sich bis zuletzt aufgrund einer grotesken Verkennung von Richards Charakter in trügerischer Sicherheit wähnt (vgl. I I I , ii, 21, 97—103; iv, 14, 52/53) und von seinem Schicksal völlig überrascht wird: erst das Todesurteil öffnet ihm die Augen 186 ). Die Eindringlichkeit dieser Szene rührt aus der Diskrepanz zwischen den Informationen und Einsichten der Zuschauer und der Ahnungslosigkeit Hastings'. Die dramatische Funktion von Margarets Fluch reicht über diese Sterberede hinaus: es ist mit weiteren Beweisen seiner Wirksamkeit zu rechnen. Hinzu kommt die Prophezeiung Hastings', die durch das abschließende Reimpaar noch zusätzliches Gewicht erhält. Die Sprache ist auch hier schlicht u n d konkret; lediglich der chorische Mittelteil illustriert die verallgemeinernde Lehre durch ein konkret verdeutlichendes Bild. Die Nennung des eigenen Namens erinnert
183
) Die ausgesprochen dramatische Funktion der Erwähnung des Fluches, an den sich auch Hastings (III, iv, 91/92) und Buckingham (V, i, 25—27) in ihren Sterbereden erinnern, spricht m. E. gegen die Interpretation, die A. W. Pollard in seiner Einleitung zu P. Alexander, Shakespeare's Henry VI and Richard III (Cambridge, 1929), S. 25, vorlegt: "I am sure . . . that the excessive length (3619 lines) of 'Richard III' must be partly explained by recognizing as interpolations the impossible appearances and speeches of the dethroned Queen Margaret and the subsequent references to her prophecies, . . . " ,84 ) Eine eingehendere Würdigung dieser Szene gibt Clemen, Kommentar, S. 188—192. 185) Vgl Clemens Analyse dieser Szene, ebd., S. 192—199. 1M ) Spivack, Shakespeare and the Allegory of Evil, S. 398, bezeichnet Hastings als "gull"; " . . . he flatters himself to death, paying with his head for his simplicity."
106
an eine von Shakespeare sonst selten aufgegriffene Konvention. Die Tonlage der Klage wird — noch etwas starr und unpersönlich — durch den häufigen Gebrauch der Interjektion ' O ' gestützt. Buckinghams Sterberede (V, i, 1; 1 + 8 + 18 Zeilen) ist ähnlich der Hastings' kein echter Dialog, sondern unterbrochener Monolog 1 8 7 ). Nach einem erfolglosen Versuch, noch einmal mit Richard zu sprechen (1), ruft Buckingham die toten Opfer des Königs an (3—9), wodurch in aller Kürze deren ähnliche Schicksale und Situationen wieder gegenwärtig werden. Der längere letzte Teil der Sterberede ist stärker strukturiert. In vierfacher, parallel gestalteter Variation betont Buckingham die Bedeutung des All Souls' D a y als seines Todestages (10, 12—19). Ganz im Sinne konventioneller Verdeutlichungsabsicht umschreibt er sein Schicksal in unpersönlich-lehrhaftem Stil; wieder wird dabei der Bezug zu Margarets Fluch hergestellt (20—27). Am Sdiluß der Rede steht ein Reimpaar, das überdies durch das formelhafte Fazit auch inhaltlich hervorgehoben w i r d : "Wrong hath but wrong, and blame the due of blame" (29). — Diese Rede ist unpersönlicher als die anderen Sterbereden in Richard III.-, sie wirkt eher als chorischer Kommentar denn als natürliche Auseinandersetzung eines fühlenden Menschen mit dem bevorstehenden Tod. Das wiederholte "Thus . . ." (23, 25) macht aus dem eigenen Schicksal ein belehrendes Exempel f ü r die Zuschauer. Die sachlich abschließende Aufforderung: "Come, lead me, officers, to the block" (28), mit der Buckingham (ähnlich Hastings in seiner Sterberede) zum Handlungsgang zurückführt, ist als Ausdruck individueller Todeseinstellung unbefriedigend distanziert und unergiebig. Hervorhebenswert ist wiederum die sorgfältige Verknüpfung mit der Gesamthandlung; eine metrische Besonderheit ist das häufige Vorkommen klingender Versausgänge. Im Vergleich zu Henry VI. — aber auch zu anderen Reden in Richard III. — fällt besonders die schmucklose, nüchterne und knappe Sprache der Sterbereden auf 188 ). Sie sind -durchweg in kürzere Redeabschnitte aufgeteilt, wenn auch meist noch nicht echter, auf den Gesprächspartner bezogener Dialog entsteht. Ansätze zu Charakterreden beschränken sich auf die letzten Worte Clarence'; Hastings und Buckingham haben gelegentlich chorisch-kommentierende Funktion. Besonders bemerkenswert ist die enge Verknüpfung der Sterbereden mit dem Handlungsgang, sowie ihre dramatische Funktion als Schlüssel f ü r Einsichten in Bedeutung und Auswirkung zurückliegender Szenen. Als wirkungsvolles Strukturelement verdient Shakespeares Gebrauch der tragischen Ironie Erwähnung, die aus der Diskrepanz zwischen dem Überblick des Zuschauers und der blinden Ahnungslosigkeit der Opfer Richards entsteht, die erst im Augenblick des Todes zu einer klaren Einschätzung ihrer selbst, ihrer Lage und ihrer Gegner gelangen (Clarence, Hastings).
187
) Eine Interpretation bringt Clemen, Kommentar, S. 276—278. 188) Ygj a u c h Clemen, Shakespeare's Imagery, S. 47.
107
17. The Life and Death of King
John
In King John treten 30 Figuren auf, von denen insgesamt 6 (2 davon auf der Bühne) den Tod finden. Die 3 Sterbereden gewinnen an Interesse durch die engen Parallelen zu The Troublesome Reign of King John-, es erscheint daher angebracht, sich anbietende Vergleichsmöglidikeiten wahrzunehmen. Arthurs Sterberede (IV, iii, 9; 2 Zeilen) fängt in einem Satz die gesamte Vorgeschichte seines Verhältnisses zu King John ein: " O me! my uncle's spirit is in these stones." Damit sind dem Publikum sofort die Anschläge Johns auf das Leben des jungen Herzogs wieder gegenwärtig, und es kann die Zeile als indirekten Hinweis auf Arthurs Lebensende verstehen. Der zweite Satz trägt einen gebetartigen Charakter: "Heaven take my soul, and England keep my bones!" 189 ). Der Unterschied dieser Sterberede zu der Darstellung in The Troublesome Reign of King John macht ein wertendes Vergleichen kaum möglich. Während in dem anonymen Stück neben konventionellen (vgl. die Selbstbeschreibung II, i, 19 und 24/25) und umständlichen Stellen Zeilen großer Eindruckskraft (vgl. II, i, 12—18) stehen, liegt Shakespeares Beschränkung auf nur zwei Zeilen ein anderer Ausdruckswille zugrunde. Die Ansicht, Shakespeare habe die "dichterischen Schönheiten der Sterberede Arthurs zugunsten eines schnelleren Handlungstempos geopfert" 190 ), wird daher der Szene nicht völlig gerecht. Außer der zweifellos erreichten Beschleunigung wäre besonders die durch äußerste Verdichtung gewonnene Intensität hervorzuheben, die in wenigen Worten ein ganzes Netz dramatischer Bezüge knüpft, das Vordergründige unausgesprochen läßt und gleichzeitig durch Implikation die Phantasie des Zuschauers anregt. In Shakespeares King John erscheint Arthur erwachsener als in The Troublesome Reign of King John; ausgesprochen kindliche Züge fehlen seiner Sterberede (im Unterschied zu anderen Stellen des Dramas). Die Form des Reimpaares ist ein konventionelles Stilmittel der Hervorhebung; der Versrhythmus ist unruhiger als in den vorausgehenden Zeilen. Meluns Sterberede (V, iv, 7; 1 + 1 1 + 2 7 Zeilen) ist zwar kürzer und direkter als die Parallele in The Troublesome Reign of King John, ist aber ähnlich der für Henry VI. festgestellten Charakteristika sprachlich noch recht verspielt und umständlich. Melun läßt sich zu den englischen Lords führen (V, iv, 7); Salisbury hebt (wohl für das Publikum) ausdrücklich die Tödlichkeit der Wunde hervor (9). Die folgenden zwei Reden kreisen um ein einziges Thema, das ständig variiert, erläutert und erweitert wird: die Mitteilung nämlich, daß der französische König die Dienste der englischen Lords mit dem Tode belohnen werde. Diese Eröffnung hat ein größeres dramatisches Gewicht als die entsprechende Rede in The Troublesome Reign of King John, weil die Absicht der Franzosen bei Shakespeare nicht auf der Bühne gefaßt, das Publikum also nicht
) J. D. Wilson (Cambridge, 1936) und E. A. Honigmann (London, 1954) weisen in ihren Ausgaben auf die Ähnlichkeit zu derzeit üblichen Testamentseröffnungen hin (Anm. zu IV, iii, 10). 1
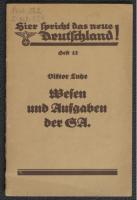


![Leistungserschwerung und Zweckvereitelung im Schuldverhältnis: Zur Funktion und Gestalt der Lehre von der Geschäftsgrundlage im BGB und im System des Reformentwurfs der Schuldrechtskommission [1 ed.]
9783428505203, 9783428105205](https://ebin.pub/img/200x200/leistungserschwerung-und-zweckvereitelung-im-schuldverhltnis-zur-funktion-und-gestalt-der-lehre-von-der-geschftsgrundlage-im-bgb-und-im-system-des-reformentwurfs-der-schuldrechtskommission-1nbsped-9783428505203-9783428105205.jpg)


![Unmöglichkeit und Pflichtverletzung: Die Funktion der Unmöglichkeitstatbestände im BGB und der Reformversuch der Schuldrechtskommission [1 ed.]
9783428505821, 9783428105823](https://ebin.pub/img/200x200/unmglichkeit-und-pflichtverletzung-die-funktion-der-unmglichkeitstatbestnde-im-bgb-und-der-reformversuch-der-schuldrechtskommission-1nbsped-9783428505821-9783428105823.jpg)
![Wesen und Recht der Sekte im religiösen Leben Deutschlands [Reprint 2019 ed.]
9783111680576, 9783111294339](https://ebin.pub/img/200x200/wesen-und-recht-der-sekte-im-religisen-leben-deutschlands-reprint-2019nbsped-9783111680576-9783111294339.jpg)

