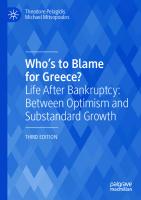Sprachlicher Substandard I [Reprint 2010 ed.] 9783110935882, 9783484220362
232 121 19MB
German Pages 236 [240] Year 1986
Inhalt
Vorwort
Ulrich Ammon - Explikation der Begriffe 'Standardvarietät' und 'Standardsprache' auf normtheoretischer Grundlage
Jörn Albrecht - „Substandard" und „Subnorm". Die nicht-exemplarischen Ausprägungen der „Historischen Sprache" aus varietätenlinguistischer Sicht
Günter Holtus - Standard und Substandard als grammatikalisches Problem
Edgar Radtke - Substandard als ästhetische Wertung in der Sprachgeschichte
Christian Schmitt - Der französische Substandard
Werner H. Veith - Substandard unter dialektologischem Aspekt. Forschungen zur deutschen Sprachstatistik und Sprachkartographie
Wolf gang Viereck - Zur Erforschung des Substandard English
Recommend Papers
![Sprachlicher Substandard I [Reprint 2010 ed.]
9783110935882, 9783484220362](https://ebin.pub/img/200x200/sprachlicher-substandard-i-reprint-2010nbsped-9783110935882-9783484220362.jpg)
- Author / Uploaded
- Günter Holtus (editor)
- Edgar Radtke (editor)
File loading please wait...
Citation preview
Konzepte der Sprach- und Literaturwissenschaft
Herausgegeben von Klaus Baumgärtner
36
Sprachlicher Substandard
Herausgegeben von Günter Holtus und Edgar Radtke
Max Niemeyer Verlag Tübingen 1986
\M!&Ö[
\Jy\7
CIP-Kurztitelaufnahme der Deutschen Bibliothek Sprachlicher Substandard I hrsg. von Günter Holtus u. Edgar Radtke. - Tübingen : Niemeyer, 1986. (Konzepte der Sprach- und Literaturwissenschaft ; 36) NE: Holtus, Günter [Hrsg.]; GT ISBN 3-484-22036-8
ISSN 0344-6735
© Max Niemeyer Verlag Tübingen 1986 Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, dieses Buch oder Teile daraus photomechanisch zu vervielfältigen. Printed in Germany. Satz: Bernhard Walter, Tübingen. Druck: Allgäuer Zeitungsverlag GmbH, Kempten.
Inhalt
Vorwort Ulrich Ammon Explikation der Begriffe 'Standardvarietät' und 'Standardsprache' auf normtheoretischer Grundlage
VII
1
Jörn Albrecht „Substandard" und „Subnorm". Die nicht-exemplarischen Ausprägungen der „Historischen Sprache" aus varietätenlinguistischer Sicht
65
Günter Holtus Standard und Substandard als grammatikalisches Problem
89
Edgar Radtke Substandard als ästhetische Wertung in der Sprachgeschichte
105
Christian Schmitt Der französische Substandard
125
Werner H. Veith Substandard unter dialektologischem Aspekt. Forschungen zur deutschen Sprachstatistik und Sprachkartographie. . . 187 Wolf gang Viereck Zur Erforschung des Substandard English
219
Vorwort
Die Problematik der Substandardfestsetzung ist im wesentlichen im Bereich der einzelsprachlich orientierten Philologien und von Fall zu Fall aufgearbeitet worden. Eine allgemein gültige Substandardbeschreibung ist nicht vollzogen worden. Angesichts dieser Situation ist eine Vielfalt von Substandardauffassungen festzustellen, deren Angemessenheit von Fachvertretern der Nachbardisziplinen nur selten diskutiert wird. Die vorliegende Zusammenstellung versucht, aus dem breiten Spektrum dieser Ansätze Verfahren der Substandardbeschreibung herauszuarbeiten, die der Diskussion um grundsätzliche Auffassungen im interdisziplinären Bereich zugute kommen. Die Beiträge reichen von Definitionsentwürfen der formalen Logik, varietätenlinguistischen Grundlagen bis hin zu neuen Methodologien in der Sprachgeographie. Den Herausgebern geht es dabei weniger darum, die Substandardsituation in den einzelnen Sprachen aufzuzeigen, als vielmehr die grundsätzliche Bedeutung der theoretischen Vorhaben und der methodischen Ansätze geltend zu machen. Dies kann letztendlich nicht ohne sprachliche Beispiele erfolgen, so daß selbstverständlich einzelne Sprachen als Beschreibungsgrundlage und Beispielmaterial dienen. Allerdings liegt der Schwerpunkt weniger auf den spezifischen Verhältnissen in den Einzelsprachen als auf der allgemeinen Verfahrenstechnik. Die eigentlichen einzelsprachlichen Anwendungsprobleme bei der Substandardbeschreibung sollen in einem Folgeband thematisiert werden. Die Herausgeber danken Dr. Thomas Krefeld und Dr. Wolfgang Schweickard (Mainz) für die Mitarbeit bei der Drucküberwachung.
Explikation der Begriffe 'Standardvarietät' und 'Standardsprache' auf normtheoretischer Grundlage* Ulrich Ammon (Duisburg)
"Throughout this work, I was puzzled by the use of the term 'standard language'. It was never clear to me what this was or where it was to be found" (Joan Rubin 1979, 49). "I cannot respond to the notion of standardization any more elaborately than some previously good articles (Garvin and Mathiot, for one), and I must admit that I considered it an 'emic' concept full of empirical and defining detail" (Dennis R. Preston, persönl. Brief). 1. Methodische Vorüberlegungen 2.1 'Sprache', 'Varietät', 'Register', 'Repertoire' 2.2 Verschiedene Argumentbereiche (Individuenbereiche) von standardsprachlich (Sx/S(X)) und Hinweise zur Terminologie 3. Potentielle Definitionsmerkmale des Begriffs 'standardsprachlich (Sx)' 3.1 'Überregional (ÜBR)' 3.2 'Oberschichtlich (OBS)' 3.3 'Invariant (INV)' 3.4 Ausgebaut (AUG)' 3.5 'Geschrieben (SCH)' 3.6 'Kodifiziert (KOD)' 4. Lösungshinweise auf normtheoretischer Grundlage 4.1 Einige normtheoretische Begriffe 4.2 Komponenten eines Explikats von 'kodifiziert (KOD)' 4.3 Vorschlag eines Explikats von 'standardsprachlich (S)' 4.4 Zu den Begriffen 'Standardvarietät' und 'Standardsprache' 4.5 Hinweise zur Fruchtbarkeit unseres Explikats
1. M e t h o d i s c h e V o r ü b e r l e g u n g e n Bei einem T h e m a dieser A r t besteht immer die Gefahr, d a ß m a n Termini (sprachliche A u s d r ü c k e ) , Begriffe (gedankliche Gebilde) und objektive G e g e n s t ä n d e (hier: Varietäten und Sprachen) verwechselt. In manchen Z u s a m m e n h ä n g e n ist dies unproblematisch, in anderen jedoch verursacht es Verwirrung. So kann man z. B . ein und denselben Begriff 'Standardvarietät' *
Für sachdienliche Hinweise und Gespräche danke ich sehr herzlich meinen Kollegen Vilém Fried, Christine Nawrod und Hans Leuer, für nochmalige Durchsicht des Manuskriptes danke ich Hildegard Krane und Kerstin Wendt.
2
Ulrich Ammon
mit verschiedenen synonymen Termini bezeichnen wie Standardsprache, Literatursprache oder Hochsprache und ihn anwenden auf verschiedene Gegenstände wie z. B. die deutsche Standardvarietät in der BRD, die französische Standardvarietät in Quebec usw. Wir wollen die Unterschiede im folgenden durch die eben gewählte Notation ausdrücken: „' '" markieren Begriffe, Kursivierung Termini; Gegenstände erhalten keine Markierung. Wir machen diese Unterscheidung allerdings nur bezüglich der hier zur Diskussion stehenden Termini, Begriffe und Gegenstände, jedoch nur, wo uns Verwechslungen möglich erscheinen, z. B. auch nicht in Formeln (autonyme Notation). Im Rahmen dieses Aufsatzes geht es uns in erster Linie um Begriffe und erst in zweiter Linie um Termini. Ein Begriff ist nach gängiger Auffassung gegeben durch seine Intension und seine Extension. (Es soll natürlich nicht behauptet werden, dies sei die einzige Auffassung. Der Nominalismus lehnt nicht nur den Begriff der Intension, sondern auch schon die obige Dreiteilung: Terminus, Begriff, Gegenstand, ab; er erkennt nur sprachliche Ausdrücke (Termini) und die durch sie bezeichneten Gegenstände an.) Die Intension eines Begriffs ist die Menge derjenigen Merkmale (Eigenschaften und Beziehungen), die allen Gegenständen zukommen, die unter den Begriff fallen; man spricht kürzer von den Merkmalen des Begriffs. Die Extension ist die Menge der unter den Begriff fallenden Gegenstände. Die Intension eines Begriffs läßt sich folgendermaßen darstellen. Seien Mi, M2, . . . , M m die Merkmale (bzw. eigentlich nur die Bezeichnungen der Merkmale) des Begriffs B, so ist seine Intension: I (B) = {lMi, M 2 , . . ., M m }. Die Extension eines Begriffs wird dargestellt durch die Angabe der unter den Begriff fallenden Gegenstände (streng genommen natürlich wieder nur die Bezeichnungen (Namen) der Gegenstände). Seien Xi, x 2 , . . . , xn die (Namen der) unter den Begriff fallenden Gegenstände, so ist seine Extension: E (B) = {xi, x2, .. ., x n }. Häufig ist eine vollständige Auflistung ausgeschlossen, insbesondere auch in den hier zur Diskussion stehenden Fällen. Dann kann man immerhin noch relative Angaben zur Extension machen, indem man mengentheoretische Beziehungen zur Extension anderer Begriffe aufzeigt, z.B. E(Bi) c E(B 2 ) usw. Da es klar ist, daß solche Angaben extensional sind, schreibt man kürzer: Bi c B 2 usw. Eine Kombination intensionaler und extensionaler Angaben ist möglich in prädikatenlogischer Notation oder auch in der sogenannten Prädikatnotation von Mengen. Dabei kombiniert man die (intensionalen) Merkmale des Begriffs mit propositionslogischen (aussage-/satzlogischen) Konnektoren und mit prädikatenlogischen Quantoren, die extensional definiert sind. Damit kann man zugleich die Stelligkeit des Begriffs oder seiner Merkmale angeben, z.B. in prädikatenlogischer Notation: Bx = Mix A Vy M2xy, in mengentheoretischer Notation: B = {x|Mi A Vy M 2 xy}.
'Standardvarietät' und 'Standardsprache'
3
Die Intensionen von Begriffen determinieren ihre Extensionen in dem Sinn, daß Begriffe mit gleicher Intension stets auch die gleiche Extension haben, was umgekehrt nicht immer zutrifft. Daher hat die intensionale Begriffsanalyse Vorrang vor der extensionalen. Die intensionalen Merkmale eines Begriffs können unterschieden werden in notwendige und hinreichende. Notwendige Merkmale muß ein Gegenstand aufweisen, um unter den Begriff zu fallen; sie gewährleisten jedoch nicht, daß er darunter fällt. Hinreichende Merkmale gewährleisten dies, sie sind aber nicht unbedingt notwendig; ein Gegenstand kann also auch dann unter einen Begriff fallen, wenn er ein (nur) hinreichendes Merkmal nicht aufweist. Für notwendige Merkmale (M N ) bzw. hinreichende Merkmale (M H ) gelten - per definitionem dieser Merkmale - die folgenden Allpropositionen: Vx(Bx ->• MNx) (alle Gegenstände, die B sind, sind M N ) bzw. VX(MHX -> Bx) (alle Gegenstände, die M H sind, sind B). D.h.: auf jeden Gegenstand, auf den B zutrifft, trifft auch ein notwendiges Merkmal für B zu, bzw. auf jeden Gegenstand, auf den ein hinreichendes Merkmal für B zutrifft, trifft auch B zu. Die notwendigen und hinreichenden Merkmale spielen nun für unsere Begriffsanalyse die folgende Rolle. Wir prüfen die in der Fachliteratur vorgeschlagenen Merkmale des uns interessierenden Begriffs auf ihren notwendigen und/oder hinreichenden Charakter, indem wir Gegenbelege beizubringen versuchen. Typisch für Definitionen oder Begriffserläuterungen in der Fachliteratur sind Formulierungen, die sich deuten lassen als die Proposition (Aussage): 'M ist Merkmal von B \ Dabei wird M zumeist n i c h t hinsichtlich seines notwendigen oder hinreichenden Charakters spezifiziert. In solchen Fällen prüfen wir beide Möglichkeiten. Hinsichtlich des n o t w e n d i g e n Charakters des Merkmals fragen wir, ob es Fälle gibt, auf die nach gängigem Sprachgebrauch (dieser Begriff wird noch näher erläutert) zwar B zutrifft, aber nicht M. Finden sich solche Fälle, so ist offenkundig die folgende Existenzproposition wahr: Hx (Bx A ~ M X ) ('Es gibt Gegenstände, die B sind, aber nicht M'). Diese Proposition läßt sich äquivalent umformen in ~ V x ~ (Bx A ~ M X ) und ~ V x ~ ~ (~Bx v Mx) und ~ V x (~Bx v Mx) und schließlich ~Vx (Bx -> MX) ('Nicht alle Gegenstände, die B sind, sind M'). Diese Proposition ist nun kontradiktorisch zur ex definitione geltenden Proposition für notwendige Merkmale: Vx (Bx -> Mx). M läßt sich daher nicht als notwendiges Merkmal von B aufrecht erhalten. Um die Kontradiktion zu beseitigen, können wir zweierlei Maßnahmen ergreifen, von denen jede für sich zur Beseitigung der Kontradiktion hinreicht. (1) Wir können beschließen, daß unsere Beispiele keine Fälle von B sind. Wir können also B umdefinieren. Ein solcher Beschluß ist dann problematisch, wenn er eine starke Abweichung vom gängigen Sprachgebrauch beinhaltet.
4
Ulrich Ammon
(2) Wir können beschließen, daß M kein notwendiges Merkmal von B ist. Dieser Beschluß wird uns zumeist leichter fallen, und zwar a) dann, wenn dieser Charakter des Merkmals in unserer fachwissenschaftlichen Textquelle ohnehin nicht ausdrücklich behauptet wurde, b) weil selbst im Falle dieser Behauptung nur ein Definitionsvorschlag eines Wissenschaftlers zur Disposition steht und nicht der gängige Sprachgebrauch. Hinsichtlich des h i n r e i c h e n d e n Charakters des Merkmals fragen wir, ob es Fälle gibt, auf die nach gängigem Sprachgebrauch zwar M zutrifft, aber nicht B. Wenn sich solche Fälle finden, so ist die folgende Existenzproposition wahr: Hx (Mx A —BX) ('Es gibt Gegenstände, auf die M zutrifft, aber nicht B'). Sie läßt sich analog umformen wie zuvor in ~Vx(Mx ->• Bx). ('Nicht alle Gegenstände, auf die M zutrifft, sind B'). Diese Proposition ist kontradiktorisch zur ex definitione geltenden Proposition für hinreichende Merkmale: Vx (Mx -»* Bx). Zur Beseitigung dieser Kontradiktion stehen wieder 2 analoge Maßnahmen wie zuvor zur Verfügung: (1') Wir können beschließen, daß unsere Beispiele keine Fälle von M sind; wir können also M umdefinieren. (2') Wir können beschließen, daß M kein hinreichendes Merkmal von B ist. Diese Möglichkeit wird aus den analogen Gründen wie in (2) zumeist vorzuziehen sein. Finden wir Kontradiktionen der geschilderten Art, so sind wir gezwungen, B oder M oder die Beziehung zwischen beiden Begriffen abzuändern - wenn wir keine Kontradiktion in die mit diesen Begriffen aufzubauenden Theorien einschleppen wollen. Finden wir jedoch keine Kontradiktion, so ist eine entsprechende Abänderung deshalb nicht ausgeschlossen. Eine Abänderung mag aus anderen Gründen ratsam sein, z. B. um bestimmte Forschungsperspektiven zu eröffnen. Die Methode des Aufzeigens von Kontradiktionen hilft uns in vielen Fällen; wir können uns jedoch nicht auf sie beschränken. Diese Methode basiert offenkundig auf dem g ä n g i g e n S p r a c h g e b r a u c h , bzw. genauer: auf unserer Kenntnis dieses Sprachgebrauchs. Hierin steckt ein Problem, das wir im vorliegenden Zusammenhang nicht zufriedenstellend lösen können. Im Grunde bedürfte es zur Ermittlung des gängigen Sprachgebrauchs sorgfältiger empirischer Untersuchungen, zu denen wir uns im Moment aber nicht in der Lage sehen. Wir sind daher angewiesen auf unsere intuitive Kenntnis des gängigen Sprachgebrauchs, die wir allerdings durch Beispiele zu stützen suchen. Unsere Behauptungen über den gängigen Sprachgebrauch haben also den Charakter weitgehend ungeprüfter empirischer Hypothesen; und unsere darauf gestützte Argumentation und Analyse gilt nur unter dem Vorbehalt, daß diese Hypothesen wahr sind. Immerhin liegt diese Voraussetzung unserer Argumentation zutage und kann grundsätzlich überprüft werden.
'Standardvarietät' und 'Standardsprache'
5
Wir wollen nun noch gewisse der in den bisherigen Hinweisen schon enthaltenen methodischen Prinzipien etwas expliziter machen. Die bisherigen Ausführungen beinhalten die Auffassung, daß Begriffe eine konventionelle Komponente haben. Wir haben z.B. von der Möglichkeit gesprochen, ein Merkmal als notwendig oder hinreichend festzulegen. Der konventionelle Charakter von Termini dürfte ziemlich trivial sein. Bei Begriffen ist eine solche Auffassung problematischer. Sie erscheint uns jedoch berechtigt. Damit soll allerdings eine objektive Komponente keinesfalls in Abrede gestellt werden: die Eigenschaften und Beziehungen der unter den Begriff fallenden Gegenstände sind Gegebenheiten, die nicht per Beschluß verändert werden können, und diese Gegebenheiten werden, zumindest teilweise, widergespiegelt in der Intension des Begriffs. Auf der anderen Seite ist es aber durchaus auch möglich, per Beschluß einzelne Merkmale aus der Intension eines Begriffs auszuschließen bzw. sie aufzunehmen sowie Gegenstände in seine Extension einzubeziehen oder nicht. Diese Merkmale haben nämlich begrifflichen (ideellen) Charakter. Es ist also möglich, einen Begriff unterschiedlich f e s t z u l e g e n . Beispielsweise könnte man den Begriff 'Standardvarietät' per Beschluß so festlegen, daß seine Intension als notwendiges Merkmal enthält: 'es liegt ein Aussprachewörterbuch für diese Varietät vor'. Solche Beschlüsse sollten natürlich jeweils begründet werden, und zwar gewöhnlich im Bezug auf Theorien. In der Analyse und Diskussion von Begriffen lassen sich nun zwei Fragestellungen deutlich auseinanderhalten: 1. Wie ist der Begriff zu einer bestimmten Zeit festgelegt, was ist seine Intension? 2. Wie könnte er für die Zukunft neu festgelegt werden? Bei einer Antwort auf die erste Frage handelt es sich offenkundig um die Behauptung einer Tatsache, nämlich der Beschaffenheit eines Begriffs zu einer bestimmten Zeit. Diese Behauptung kann wahr oder falsch sein. Eine Antwort auf die zweite Frage ist dagegen ein Vorschlag, der nicht wahr oder falsch, wohl aber mehr oder weniger brauchbar sein kann, z. B. zur Klassifizierung von Gegenständen für bestimmte Zwecke oder zur Konstruktion von Theorien. Man sollte vorsichtiger nur von der v o r h e r r s c h e n d e n Beschaffenheit eines Begriffs (zu einer bestimmten Zeit) sprechen, denn eine durchgängige Einheitlichkeit ist kaum je zu erwarten. Die meisten Begriffe variieren auch zu ein und derselben Zeit (zu einem Zeitpunkt oder innerhalb einer kurzen Zeitspanne) intersubjektiv und sogar - von Kontext zu Kontext - intrasubjektiv. Diese vorherrschende Beschaffenheit des Begriffs ist nun Teil des oben angeführten gängigen Sprachgebrauchs. Ein anderer Teil ist die vorherrschende Bezeichnung des Begriffs (Terminologie). Vorherrschend kann dabei wieder sehr Unterschiedliches bedeuten. Hier meinen wir damit den
6
Ulrich Ammon
vermuteten häufigsten Gebrauch in einschlägigen fachwissenschaftlichen Texten. Auf eine weitere Präzisierung verzichten wir, da wir uns ohnehin zu einer entsprechenden empirischen Untersuchung nicht in der Lage sehen. Wenn auch die beiden Fragestellungen: Feststellung und Festsetzung eines Begriffs, deutlich unterschieden werden können, so sollten sie doch nicht völlig unabhängig voneinander verfolgt werden. Zumindest sollten bei der zweiten Fragestellung und den dabei zu treffenden Entscheidungen die Ergebnisse der ersten Fragestellung nicht gänzlich aus den Augen entschwinden, und zwar u. a. deshalb, weil die neuen Begriffe das in den alten Begriffen gespeicherte Wissen möglichst vollständig aufnehmen sollten. Gewöhnlich besteht weniger die Gefahr eines völligen Bruchs, da ein Wissenschaftler kaum umhin kann, an den vorfindlichen Begriffen anzuknüpfen. Eher bleibt die Beziehung zwischen den vorgefundenen und den vorgeschlagenen Begriffen unklar, weil die beiden Fragestellungen nicht auseinander gehalten werden. Als einen Spezialfall der Verbindung beider Fragestellungen ohne allzu große Gefahr ihrer Konfusion kann man Rudolf Carnaps Methode der „Begriffsexplikation" ansehen (Carnap 1959, 12-18). Bei der Begriffsexplikation wird terminologisch sorgfältig unterschieden zwischen dem vorfindlichen Begriff, dem „Explikandum", und dem neuen Begriff, dem „Explikat". Gewöhnlich ist das Explikandum ein Alltagsbegriff oder so inkonsistent wie ein Alltagsbegriff, während das Explikat ein wissenschaftlicher Begriff ist, der sich u. a. durch größere Konsistenz und/oder größere Präzision auszeichnet. Bei der Begriffsexplikation darf die Intension durchaus verändert werden; es soll jedoch eine gewisse Übereinstimmung zwischen Explikandum und Explikat bestehen bleiben: „Das Explikat muß dem Explikandum so weit ä h n l i c h sein, daß in den meisten Fällen, in denen bisher das Explikandum benutzt wurde, statt dessen das Explikat verwendet werden kann" (Carnap 1959, 15). Damit könnte gemeint sein, daß beim Schnitt der Extension des Explikandums (EEd = Extension des Explikandums) und der Extension des Explikats (EEt = Extension des Explikats) die Schnittmenge größer bleiben soll als die jeweiligen Restmengen |EEd n EEt| > |EEd - (EEd n EEt) | und p E d n EEtj > |EEt - (EEd n EEt)|. Eine strenge Anwendung dieses denkbaren Kriteriums dürfte allerdings oft wegen zu ungenauer Kenntnis der Extension ausgeschlossen sein. Um den teilweise konventionellen Charakter eines Explikats anzuzeigen, ist die Darstellung in Form einer Definition angebracht. Das Definiendum (links vom Definitionszeichen: D EF) ist dann eine globale und das Definiens (rechts vom Definitionszeichen) eine differenzierte Bezeichnung der Intension des Explikats. Dabei darf nicht etwa das Definiendum als das Explikandum und das Definiens als das Explikat mißverstanden werden.
'Standardvarietät' und 'Standardsprache'
7
Vielmehr steht das Explikandum am Anfang und das Explikat am Ende des Explikationsprozesses. Die gesamte abschließende Angabe in Definitionsform ist das Explikat. Diese Angabe sollte so beschaffen sein, daß der links vom Definitionszeichen stehende Ausdruck in a l l e n Kontexten ersetzbar ist durch den rechts davon stehenden Ausdruck, ohne daß sich der Wahrheitswert der jeweiligen Proposition ändert. Aus den Definientia wird ersichtlich, welche Teile präzise sind und welche unter Umständen nicht. Vollkommen präzise sind die formallogischen (propositions- und prädikatenlogischen) und mengentheoretischen Teile. Die betreffenden Zeichen sind in der formalen Logik und der Mengentheorie exakt definiert. Nicht ohne weiteres präzise sind dagegen die verbleibenden deskriptiven (im Gegensatz zu den logischen) Ausdrücke und Begriffe. Sie bedürfen unter Umständen weiterer Explikation und/oder der empirischen Schärfung, z. B. durch Operationalisierung. Für deskriptive Ausdrücke und Begriffe, also solche, die sich auf empirische Gegenstände beziehen, ist jedoch grundsätzlich nicht derselbe Grad von Präzision zu erreichen wie für die logischen Ausdrücke. Dennoch ist ein solchermaßen in einem Definiens analysiertes Explikat auch eine gewisse Präzisierung des Explikandums. Es wird nämlich durch die verschiedenen Bestandteile des Definiens in ein Begriffssystem eingefügt, durch das der Unbestimmtheitsbereich eingeschränkt wird. Insbesondere aber vertieft ein gelungenes Explikat unsere Kenntnis der betreffenden Gegenstände, z.B. aufgrund seiner „Fruchtbarkeit" (Carnap 1959,15). Wir kommen hierauf gleich noch einmal zurück. An dieser Stelle erscheint uns zunächst eine weitere Unterscheidung wichtig, nämlich die zwischen den per definitionem festgelegten Merkmalen und den später evtl. gefundenen weiteren (allgemeinen oder mehr oder weniger häufigen) Eigenschaften oder Beziehungen der unter den Begriff fallenden Gegenstände. Nur erstere haben eine konventionelle Komponente und verdanken ihr Dasein letztlich unserer Festlegung der Wissenschaftssprache. Letztere hingegen sind Tatsachenbefunde. Wenn es sich um allgemeine Eigenschaften oder Beziehungen handelt, so haben sie den - seit Karl R. Popper (1973, 3-13, 39^1) geläufigen - nicht verifizierbaren, unaufhebbar hypothetischen Charakter (empirische Allpropositionen). Empirisch bestätigte generelle Eigenschaften und Beziehungen der unter den Begriff fallenden Gegenstände dürfen jedoch in die Intension des Begriffs aufgenommen werden. Es sollte freilich klar sein, daß dies allein aufgrund empirischer Befunde, niemals nur aufgrund einer Festlegung zulässig ist. Das „Auffüllen" der Intension eines Begriffs ist eine empirische Forschungsaufgabe n a c h der Festlegung der definitorischen Merkmale. Die beiden Arten von Merkmalen, nämlich d e f i n i t o r i s c h e und e m p i r i s c h e , sollten weiterhin auseinander gehalten werden. Aussagen, die einem unter den Begriff fallenden Gegenstand ein definitorisches Merkmal zuschreiben, sind logisch
8
Ulrich Ammon
(per definitionem) wahr, nämlich kraft unserer Festlegung der Wissenschaftssprache; Aussagen, die einem solchen Gegenstand ein empirisches Merkmal zuschreiben, sind dagegen allenfalls empirisch bestätigt. Die Extension eines Begriffs ändert sich durch hinzukommende empirische Merkmale nicht. Sie ist durch die definitorischen Merkmale schon festgelegt. Diese vorgängige Festlegung ist sogar die Voraussetzung dafür, daß empirische Merkmale überhaupt ermittelt werden können. Beispielsweise ist die Aussage, daß die betreffenden Merkmale allen unter den Begriff fallenden Gegenständen zukommen, ja nur dann ohne Zirkel möglich, wenn die Extension des Begriffs zuvor feststeht. Dies schließt nicht aus, daß man den Begriff später einmal modifiziert und anders festlegt. An diese Möglichkeit scheint auch gedacht zu sein bei der „Methode der paradigmatischen Beispielmenge", die Wittgenstein aufgrund seiner Schwierigkeiten mit dem Begriff 'Spiel' vorgeschlagen hat (Stegmüller 1970-1973, Teil E, Kap. IX, Abschn.4). Dabei wird ausdrücklich nur von einer Teilmenge der Extension des betreffenden Begriffs ausgegangen, und zwar von einer Menge typischer Fälle, die unter allen Umständen unter den Begriff fallen sollen. In unserem Fall wäre dies eine aufzulistende Menge von Varietäten oder Sprachen, die wir auf jeden Fall zu den Standardvarietäten bzw. Standardsprachen zählen wollen. Aus dieser Menge werden aufgrund der Eigenschaften, die allen Elementen zukommen, die definierenden Merkmale des Begriffs abstrahiert. Nachdem diese Forschungsphase zu einem zufriedenstellenden Abschluß gebracht ist, kann wieder geprüft werden, ob sich die ursprünglich eng gefaßte Extension des Begriffs erweitern läßt, d. h. ob es nicht Gegenstände außerhalb der paradigmatischen Beispielmenge gibt, die unter die konstruierte Intension des Begriffs fallen. Fallen nun unverhofft auch ganz unwillkommene Gegenstände unter den Begriff, so kann man die Intension wiederum modifizieren. Nach der definitorischen Festlegung des Begriffs sind folgende Erweiterungen unserer empirischen Erkenntnisse möglich: 1. kann, wie schon erwähnt, die Intension durch bestätigte empirische Generalisierungen aufgefüllt werden; 2. kann die Extension des Begriffs erforscht werden. Die Extension ist zwar durch die festgelegte Intension determiniert, aber deshalb noch keineswegs im einzelnen b e k a n n t . Es kann z. B. von Interesse sein, die Kardinalzahl der Extension zu einem bestimmten Zeitpunkt zu kennen oder wenigstens abschätzen zu können oder sogar- im Falle einer verhältnismäßig kleinen Kardinalzahl - über eine möglichst vollständige Listennotation der Extension zu verfügen. Letzeres ist z. B. beim Begriff 'Standardvarietät' keineswegs abwegig. (Vgl. die tentative Liste aller derzeitigen Sprachen in Grimes 1984.) Solche genaueren Kenntnisse von der Extension eines Begriffs erfordern u. U. aufwendige empirische Untersuchungen. Insbesondere kann es sich dabei auch erweisen, daß die intensionalen Merkmale für sichere Ent-
'Standardvarietät' und 'Standardsprache'
9
Scheidungen im Einzelfall zu vage sind und der Schärfung bedürfen. Hierbei wird man unter Umständen auch zu Operationalisierungen greifen müssen, d.h. zur Angabe von Feststellungsverfahren durch Tests usw. Probleme dieser Art wollen wir im weiteren nicht behandeln. Wir bleiben auf der Ebene „theoretischer Begriffe" im Sinne von Carnap, für die charakteristisch ist, daß sie noch der empirischen Schärfung bedürfen (von „theoretischen Begriffen" im modernen Sinn von J. D. Sneed kann leider bei uns nicht ernsthaft die Rede sein (vgl. Stegmüller, 19701973, v. a. Teil D, Kap. VIII, Abschn. 3)). Theoretische Explikate sollen zwar „in exakter Weise gegeben werden", womit aber nicht empirische Schärfe gemeint ist, sondern „daß das Explikat in ein wohlfundiertes System wissenschaftlicher Begriffe eingebaut wird" (Carnap 1959, 15). In unserem Fall handelt es sich dabei um Begriffe der Normtheorie. Des weiteren soll das „Explikat (...) fruchtbar sein, d. h. die Formulierung möglichst vieler genereller Aussagen gestatten" (Carnap 1959, 15). Auch hierzu wollen wir in unserem Fall einige Hinweise geben. Das von Carnap weiter genannte, aber in der Wichtigkeit nachgeordnete Gütekriterium eines Explikats, nämlich die „Einfachheit", spielt in unseren Überlegungen keine Rolle. Noch ein letztes Methodenproblem sei kurz angesprochen. Die Explikation eines Begriffs schreitet nicht selten voran in der Reihenfolge der drei „Begriffsformen", die Carl G. Hempel (1952) unterschieden hat: von klassifikatorischen zu komparativen (topologischen) und von dort zu quantitativen (metrischen) Begriffen (vgl. auch Stegmüller 1970-1973, Teil A,Kap. I). Durch einen klassifikatorischen Begriff werden Gegenstände verschiedenen, zumeist zwei Klassen zugeordnet. Dies geschieht z.B. durch den Begriff 'x ist eine Standardvarietät', der die Varietäten folgenden beiden Klassen zuordnet: der Klasse der Standardvarietäten und der Klasse der Non-Standardvarietäten. Wenn der Begriff unscharf ist, wie im vorliegenden Fall, d.h. über die Zuordnung in Einzelfällen Zweifel bestehen, so kann man auch noch eine dritte Klasse bilden, die alle Gegenstände umfaßt, über deren Zuordnung Zweifel bestehen. Bei der Präzisierung des Begriffs geht es dann darum, diese dritte Klasse allmählich zu verkleinern. Durch einen komparativen Begriff werden Gegenstände durchgehend in eine Rangordnung gebracht. Dies geschieht dadurch, daß für jedes Gegenstandspaar eine von zwei Beziehungen festgelegt wird: Niedriger-Rangigkeit (Vorgängerrelation) oder Gleichrangigkeit (Koinzidenzrelation). Solche Relationen sind auch in unserem Zusammenhang kein ganz sinnloses Gedankenspiel: 'x ist weniger standardisiert als y' oder 'x ist gleich standardisiert wie y' dürften gar nicht so selten auf Varietäten angewandte Begriffe sein, wenngleich sie zweifellos reichlich unklar sind. Die meisten Linguisten dürften jedoch intuitiv z. B. der Proposition zustimmen, d. h. sie als sinnvoll
10
Ulrich Ammon
und als wahr bewerten: 'Die deutsche Sprache zur Zeit Luthers war weniger standardisiert als die heutige deutsche Sprache. Komparative Begriffe sind feinere gedankliche Analyseinstrumente als klassifikatorische Begriffe. Einerseits führen sie gewöhnlich zu einer differenzierteren Klassifikation der Gegenstände. Die Gegenstände, die in Koinzidenzrelation stehen, bilden jeweils Klassen, denn die Koinzidenzrelation ist eine Äquivalenzrelation (symmetrisch, transitiv und reflexiv). Andererseits bringen komparative Begriffe alle Klassen in eine lineare Ordnung, vermittels der Vorgängerrelation. Eine noch feinere Analyse gestatten quantitative Begriffe. Es handelt sich dabei um reelle Funktionen, die den Gegenständen (als Argumenten der Funktion) reelle Zahlen (als Funktionswerte) zuordnen. Die reellen Zahlen repräsentieren Maßeinheiten, die der Unmißverständlichkeit wegen meistens zusätzlich angegeben werden, z.B.: Gegenstand a h> 10,2 cm; Gegenstand b h-> 3,72° usw. Quantitative Begriffe ermöglichen vor allem eine umfassende mathematische Handhabung. Mit ihrer Hilfe lassen sich unsere differenzierten Kenntnisse der reellen Zahlen auf die jeweiligen Gegenstände, die Funktionsargumente, anwenden. Hinsichtlich der uns interessierenden Begriffe ist zwar unseres Wissens eine Quantifizierung bislang ungeklärt; sie ist jedoch nicht undenkbar. Dies zeigt sich z. B. daran, daß es nicht gänzlich abwegig erscheint, vom Ausmaß der Standardisierung einer Varietät zu sprechen. Andeutungen von Quantifizierungen liegen in der Literatur z.T. vor (Garvin/Mathiot 1960; Ferguson 1962, 24f.). Es ist denkbar, daß die bislang ziemlich nebelhaften Vorstellungen darüber eines Tages so präzisiert werden, daß einzelnen Varietäten als Funktionsargumenten auf wohlbegründete Weise reelle Zahlen als Funktionswerte zugeordnet werden können, die das Ausmaß ihrer Standardisierung repräsentieren. Selbstverständlich können bei allen drei Begriffsformen wieder Intension und Extension unterschieden werden. Für klassifikatorische Begriffe haben wir den Unterschied schon erläutert. Bei komparativen Begriffen besteht die Intension aus der Koinzidenzrelation und der Vorgängerrelation und die Extension aus der Vereinigungsmenge der Menge aller in Koinzidenzrelation (K) stehenden geordneten Gegenstandspaare und der Menge aller in Vorgängerrelation (V) stehenden geordneten Gegenstandspaare: E(P) = {|Kuv} u {[Vxy}. Im Falle eines komparativen Begriffs von 'Standardvarietät' würden die Variabein u, v, x, y über Varietäten als ihre Konstanten laufen. Bei metrischen Begriffen besteht die Intension aus der reellen Funktion und die Extension aus der Menge aller geordneten Paare, deren Erstglied durch einen der fraglichen Gegenstände (des Argumentbereichs) gebildet wird und deren Zweitglied von der reellen Zahl, die durch die Funktion zugeordnet wird: E(P) = {|u H> v}. Im Falle eines metrischen Begriffs von 'Standardvarietät'
'Standardvarietät' und 'Standardsprache'
11
würde die Variable u über Varietäten und die Variable v über reelle Zahlen als ihre jeweiligen Konstanten laufen. Die Redeweise von einem klassifikatorischen Begriff von 'Standardvarietät', einem komparativen Begriff von 'Standardvarietät' usw. ist im Grunde irreführend. Ebenso die gängige Rede von verschiedenen Begriffsformen. In Wirklichkeit handelt es sich nämlich um gänzlich verschiedene Begriffe. Soweit wir sehen, besteht zwischen diesen Begriffen nicht einmal ein strenger, d. h. logischer Zusammenhang; sondern beim Übergang kommen sowohl empirische Erkenntnisse als auch Festlegungen ins Spiel. Dasselbe gilt generell für den Übergang von einem Explikandum zu einem Explikat, wovon das Fortschreiten in der Richtung der Hempelschen „Begriffsformen" nur ein Spezialfall ist. Wenn man sich dessen bewußt ist, schadet die gängige, etwas laxe Redeweise kaum. Sie ist vor allem bisweilen recht bequem. Wir bedienen uns daher auch einer solchen unpräzisen Redeweise. Ähnlich sprechen wir gelegentlich aus Bequemlichkeitsgründen von einem Begriff und verwenden auch die zu Anfang eingeführte Notation für einen Begriff („' ' " ) , wenn in Wirklichkeit ganze Begriffsklassen gemeint sind, die z.B. klassifikatorische, komparative und metrische „Begriffsformen" oder auch ein einstelliges und ein mehrstelliges Prädikat umfassen. 2.1 'Sprache', 'Varietät', 'Register', 'Repertoire' Für unseren Explikationsversuch des Begriffs 'standardsprachlich' ist es zweckmäßig, die in der Überschrift genannten vier Begriffe zu unterscheiden. Unter einer 'Sprache' verstehen wir eine Menge von Varietäten; dies ist eine gängige Bedeutung des außerordentlich polysemen Ausdrucks Sprache (vgl. z. B. Ferguson/Gumperz 1960, 5). Die Begriffe 'Sprache' und 'Varietät' liegen also auf unterschiedlichen Abstraktionsniveaus, denen die MengenElement-Beziehung entspricht. Dieser Unterschied ist zunächst gemeint, wenn man 'Varietät' und 'Sprache' in Opposition bringt. Sodann wird gewöhnlich angenommen, daß grundsätzlich alle Varietäten zu Sprachen gruppiert, d. h. einer bestimmten Sprache zugeordnet werden könnten, auch gemischte Varietäten (Kreols), die unter Umständen neue Sprachen bilden. Allerdings liegt z. Zt. keine Methode für eine effektive eindeutige Zuordnung vor. Im Falle vollzogener Zuordnung spricht man expliziter von der Varietät a in der Sprache A, z. B. der Varietät Ruhrdeutsch in der Sprache Deutsch (oder in der deutschen Sprache). Diese Beziehung zwischen 'Varietät' und 'Sprache' erlaubt auch, daß es Sprachen mit nur einer Varietät gibt (Einermenge); sei A die Sprache und a ihre Varietät, so gilt in solchen Fällen: A = {a}. In allen uns bekannten Fällen liegen jedoch mehrere Varietäten vor, wie z. B. im Fall der deutschen Sprache: ihre Varietäten sind das Ruhrdeutsch, der schwäbische Dialekt, die sogenannte Hochsprache (oder
12
Ulrich Artimon
Standardsprache) in der BRD, die Hochsprache (oder Standardsprache) in Österreich usw. ; die deutsche Sprache selber ist die Menge all dieser Varietäten. Die Relevanz dieser begrifflichen Unterscheidung für unsere Fragestellung ist leicht einzusehen: die Behauptung 'Die sogenannte deutsche Hochsprache in der BRD ist eine Standardsprache' ist intuitiv verhältnismäßig klar. Dies ist jedoch sicher nicht ohne weiteres der Fall bei der Behauptung 'die deutsche Sprache (im Sinne der Menge aller deutschen Varietäten) ist eine Standardsprache'. Zunächst einmal bezieht sich der uns interessierende Begriff also auf Varietäten, nicht auf ganze Sprachen. Wir sprechen daher im weiteren von Standardvarietät. Eine gewisse Berechtigung hat der Terminus Standardsprache in der Anwendung auf eine Teilmenge der Varietäten in einer Sprache. In diesem Sinne spricht man z. B. von der deutschen Standardsprache und meint damit gewöhnlich die Standardvarietäten der BRD, DDR, Österreichs und der Schweiz zusammengenommen. Gelegentlich nennt man wohl eine ganze Sprache auch dann eine Standardsprache, wenn eine der Varietäten standardisiert, also eine Standardvarietät ist (vgl. 4.4). Außerdem gibt es den Begriff des 'Standardisierungsgrades einer ganzen Sprache', womit grob gesprochen das Gewicht oder die Rolle der standardisierten gegenüber den nichtstandardisierten Varietäten gemeint ist (vgl. z. B. Ferguson 1962, 24f.). Im Zusammenhang mit der Unterscheidung von 'Varietät' und 'Sprache' stellt sich die Frage, wie Varietäten zu einer Sprache klassifiziert werden, was also die klassenbildende Beziehung ist. Bei dieser Fragestellung ist vorausgesetzt, daß Varietäten als solche identifiziert oder wenigstens identifizierbar sind, was - wie sich im weiteren zeigen wird - leider nicht gewährleistet ist. Bisher wird bei der Zusammenfassung von Varietäten zu Sprachen auch innerhalb der Linguistik uneinheitlich verfahren. Dies liegt vor allem daran, daß das spezifisch linguistische Kriterium aufgrund seiner großen Komplexität nur unzureichend präzisiert ist. Es handelt sich um das Kriterium, das von Heinz Kloss (z. B. 1978, 63-79) als linguistischer „Abstand" bezeichnet wird. Danach sollen diejenigen Varietäten, die Abstand voneinander haben, d. h. einander linguistisch nicht ähnlich sind, verschiedenen Sprachen, diejenigen, die keinen Abstand haben, d. h. einander linguistisch ähnlich sind, ein und derselben Sprache zugeordnet werden. Die klassenbildende, hier: sprachenbildende Relation ist also die linguistische Ähnlichkeit zwischen Varietäten. Man kann sie analog sehen zur anschaulicheren Farbähnlichkeit (oder Gleichfarbigkeit), aufgrund der die einander farblich ähnlichen Gegenstände zu den einzelnen Farben rot, gelb usw. geordnet werden. Bekanntlich gibt es bei den Farben interkulturelle Divergenzen. Sie sind analog bei Sprachen zu vermuten, die interkulturellen Divergenzen in der Farbenklassifikation können jedoch erst festgestellt werden auf der
'Standardvarietät' und 'Standardsprache'
13
Grundlage einer objektiven physikalischen Farbklassifikation. Analog ist es bei den Sprachen. Eine objektive linguistische Klassifikation könnte u. a. dazu dienen, interkulturelle Divergenzen in der Klassifikation von Varietäten zu Sprachen aufzudecken. Die Durchführung einer solchen linguistischen Klassifikation bereitet allerdings Schwierigkeiten. Eine davon ist die, daß es aufgrund des linguistischen Forschungsstandes in absehbarer Zeit kaum möglich sein dürfte, ein allgemein brauchbares linguistisches Distanzmaß zu entwickeln. Dementsprechende Bemühungen, durch die sich unter anderem Morris Swadesh mit seiner Lexikostatistik (Swadesh 1954; 1955; Gudschinsky 1956) und neuerdings William Mackey (1976, 283-307) verdient gemacht haben, sind bislang zu keinem wissenschaftlich zufriedenstellenden Ergebnis gelangt. Allerdings wird insbesondere mit der Lexikostatistik seit Jahrzehnten praktisch gearbeitet (Beispiele: Bromley 1967; Dyen 1965; Phillips 1979, Kapitel 2), wobei man sich der Verkürzungen dieser Methode bewußt ist. Eine indirekte Methode der linguistischen Distanzmessung sind Verstehbarkeitstests. Der Grad der gegenseitigen Verstehbarkeit wird dabei als Indikator für die linguistische Distanz genommen. Daß dies kein eindeutiger ïndikator ist, liegt auf der Hand: Vorkenntnisse der anderen Varietät sowie ablehnende oder zustimmende Attitüden, entweder gegenüber der anderen Varietät bzw. ihren Sprechern oder gegenüber dem Testverfahren, können die Ergebnisse verzerren (Chambers/Trudgill 1980, 4). Jedoch wird auch mit solchen Verstehbarkeitstests seit längerem für bestimmte Zwecke praktisch gearbeitet, insbesondere im Zusammenhang mit Verschriftungsund Alphabetisierungsbemühungen des Summer Institute of Linguistics (Casad 1974). Letztendlich müßten geeignete linguistische Distanzmaße und Verstehbarkeitsmaße aneinander validiert werden, d.h. im Idealfall mit dem positiven Koeffizient 1 korrelieren. Eine Annäherung an dieses Ideal wird jedoch noch geraume Zeit auf sich warten lassen. Es dürfte - unabhängig von den Meßverfahren selber - nur annähernd erreichbar sein mit unvoreingenommenen Informanten bei den Verstehbarkeitstests, welche die andere Varietät nicht schon kennen und ihr und den Testkomponenten gegenüber eine neutrale Attitüde haben (neutralisierte Verstehbarkeit). Distanzmaße und Verstehbarkeitsmaße sind Quantifizierungen, bei denen Paaren von Varietäten als Funktionsargumenten reelle Maßzahlen als Funktionswerte zugeordnet werden. Will man auf ihrer Grundlage wieder klassifizieren, was man ja bei der Einteilung in Sprachen tut, so muß man einen Abstand auf den betreffenden Skalen festlegen. Man erhält dann Sprachen a) nach linguistischen, b) nach Verstehbarkeitskriterien (vgl. Ammon 1983, 40-49).
14
Ulrich Ammon
Schon die Verstehbarkeit, zumindest die nicht neutralisierte Verstehbarkeit, ist ein kulturell geprägtes, gewissermaßen sekundäres Kriterium für die Klassifikation von Varietäten zu Sprachen. Daneben gibt es noch massiver kulturell und politisch motivierte Kriterien (vgl. dazu auch Goebl 1984). Sie spielen vor allem in alltäglichen, nichtwissenschaftlichen Einteilungen eine große Rolle. Heinz Kloss hat diesen Kriterien mit seinem Begriff „Ausbausprache" Rechnung zu tragen versucht (Kloss 1978, 23-60. Vgl. Abschnitt 3.4). Damit ist grob gesprochen gemeint, daß eine einzelne Varietät vor allem aufgrund ihrer Verwendung, z.B. im Schrifttum, oder aufgrund eines hohen Sozialprestiges oder aufgrund von Standardisierung selber zu einer „Sprache" wird. Genauer wird sie zum Kristallisationspunkt einer eigenen „Sprache", nämlich einer abgesonderten Varietätenklasse, in der sie, wie man sagt, „autonom" ist, wogegen die zugeordneten übrigen Varietäten „heteronom" sind (Chambers/Trudgill 1980, 10-14). Von solchen politisch motivierten „Sprach"-bildungen, die häufig mit staatlichen Zusammenschlüssen oder Grenzen koinzidieren, werden linguistische Sprachen überlagert. So wurden z. B. die linguistisch einander ähnlichen niederfränkischen Dialekte durch die deutsch-niederländische Grenze in zwei verschiedene „Sprachen" zerlegt und die einander weniger ähnlichen ober-, mittel- und niederdeutschen Dialekte zu ein- und derselben „Sprache" zusammengefaßt. Offenkundig sind bei den linguistischen und den kulturell-politischen Klassifikationen unterschiedliche Kriterien im Spiel. Es hat wenig Sinn, die verschiedenen Begriffe von Sprache zu einem einzigen Begriff zu konglomerieren, wie dies z. B. Ferguson und Gumperz (1960, 5) tun. Der Versuch ist verlockend, 'Varietät' nicht nur von 'Sprache' zu unterscheiden, sondern auch positiv zu definieren. Wir befürchten jedoch, daß man dabei nicht viel weiter kommen wird als z. B. beim Versuch der Definition eines „native speaker". Jede Gesamtheit von kohärenten verbalen Fähigkeiten eines Sprechers (native speaker im weitesten Sinn. Vgl. Coulmas 1981) ist eine Varietät. Die innere Kohärenz oder Systematik ist ein wichtiger Gesichtspunkt, um eine Varietät nicht mit dem 'Repertoire eines Sprechers (= Idiolekt)' zu verwechseln. Das Repertoire eines Sprechers kann nämlich ohne weiteres mehrere verschiedene Varietäten umfassen, sogar Varietäten aus verschiedenen Sprachen (multilingualer Sprecher). Auch Ferguson und Gumperz (1960, 3) betonen die innere Kohärenz oder „Homogenität" von Varietäten: „A variety is any body of human speech patterns which is sufficiently homogeneous to be analyzed by available techniques of synchronic description ( . . . ) " . Diese Homogenität wird aber nicht ohne weiteres durch die linguistische Deskription hergestellt, sondern nur insofern diese das vom native speaker aufgebaute kohärente System adäquat rekonstruiert. Varietäten sind aufgrund ihres Gebrauchs als Kommunikationsmittel gewöhnlich nicht individuell, sondern gruppenspezifisch. Allerdings diver-
'Standardvarietät' und 'Standardsprache'
15
gieren in den meisten Gruppen die Repertoires der einzelnen Mitglieder, da diese in unterschiedliche kommunikative Netzwerke eingespannt sind. Desgleichen sind vermutlich auch die Varietäten von Gruppen zumeist nur näherungsweise homogen. Ober welche Abstraktionsschritte man die Varietät einer Gruppe adäquat (re)konstruiert, scheint ein bislang methodisch ungelöstes Problem zu sein (vgl. z. B. Heger 1976). Ein weiterer für uns wichtiger Begriff ist der des 'Registers (= Stilebene)'. Ein Register umfaßt die in einer bestimmten Situation (Situationsklasse) gebräuchlichen Sprachzeichen mit ihren Bedeutungen. Varietäten können mehrere Register umfassen. Sie enthalten dann - zumeist zum kleineren Teil - situationsspezifische (= stilistisch markierte) und - zum größeren Teil - situationsneutrale (= stilistisch unmarkierte) Bestandteile. Es gibt jedoch auch Sprecher, denen verschiedene Varietäten als unterschiedliche Register dienen, sogar Varietäten aus verschiedenen Sprachen (multilinguale Sprecher). Wir vermuten, daß es angemessen ist, auch den Unterschied zwischen 'geschriebener' und 'gesprochener Sprache' als Registerunterschied aufzufassen - im Gegensatz beispielsweise zu Otto Ludwig (1983a, 35f.), der darin verschiedene Varietäten sieht. Es gibt unserer Auffassung nach Varietäten mit und ohne geschriebene bzw. gesprochene Register (Klassen von Registern). Ein anderer, gar nicht so seltener Fall ist der, daß verschiedene Varietäten als diese Register dienen, z.B. der schwäbische Dialekt als gesprochenes und die sogenannte deutsche Hochsprache der BRD als geschriebenes Register. Zur Unterscheidung von einem bloßen 'Arsenal von Sprachzeichen', z.B. einem Fachwortschatz, ist gelegentlich postuliert worden, daß eine Varietät ein vollständiges System ist, das alleine zureicht zur Kommunikation in allen Alltagssituationen (vgl. dazu auch Uliendorf 1977) oder aber mindestens zur Kommunikation in einer (nicht ritualisierten) Kommunikationssituation, also mindestens ein Register umfaßt. Ferguson und Gumperz (1960, 3) tragen diesem Gesichtspunkt in ihrer Definition Rechnung: "A variety (...) has a sufficiently large repertory of elements and their arrangements or processes with broad enough semantic scope to function in all normal contexts of communication". Eine 'vollständige Varietät' bedarf sicher einer derartigen Spezifizierung. Warum aber sollte es nicht auch defizitäre Varietäten geben? Jedoch scheint uns für sie zumindest die Festlegung angemessen, daß es sich nicht nur um lexikalische Besonderheiten handeln darf, sondern daß auch Besonderheiten in den geschlosseneren grammatischen Teilsystemen der Phonemik/Graphemik, Morphemik oder Syntax vorliegen müssen. Die hier angedeuteten Begriffe bleiben offenkundig reichlich unklar; dennoch sind wir in unseren weiteren Ausführungen auf sie angewiesen. Sie lassen sich nicht ersetzen durch präzisere, aber ganz andersartige Begriffe,
16
Ulrich Ammon
z.B. „Varietäten", wie sie zur Beschreibung sprachlicher Variation in der Soziolinguistik entwickelt wurden (Klein 1974; Klein/Dittmar 1979). Solche „Varietäten" sind allenfalls Ausschnitte aus Registern, aber sicher nicht diejenigen Gegenstände, von denen wir prädizieren 'x ist eine Standardvarietät'. 2.2 Verschiedene Argumentbereiche (Individuenbereiche) von standardsprachlich (Sx/S (X)) und Hinweise zur Terminologie Standardisiert sein können die verschiedenartigsten Gegenstände, nicht nur sprachliche Zeichen. Synonym mit standardisiert wird auch normiert gebraucht. Mit dem Ausdruck standardsprachlich bezieht man sich dagegen nur auf sprachliche Zeichen und deren Bedeutungen. Ist es klar, daß man über sprachliche Zeichen spricht, so kann man unter Umständen auch standardisiert sagen, was jedoch nicht immer synonym mit standardsprachlich ist. Weiterhin kann man den Ausdruck standardsprachlich (oder standardisiert) aber auch entweder nur auf einzelne Sprachzeichen und ihre Bedeutungen (Elemente oder Bestandteile von Varietäten) oder auf ganze Systeme von Sprachzeichen (Varietäten) oder sogar auf Klassen solcher Systeme (Sprachen) anwenden. Hierbei handelt es sich um verschiedene Begriffe beim gleichen Ausdruck. Die Differenzierung zwischen diesen Begriffen kann unter Umständen wichtig sein, z. B. wenn man der Frage nachgeht, ob Varietäten auch nur teilweise standardsprachlich sein können. Es erscheint plausibel, diese Frage nicht a limine zu verneinen. Vielleicht kann man Varietäten sogar danach ordnen, welche Teile standardsprachlich sind (vgl. Abschnitt 4.4). Dann aber muß man differenzieren zwischen der 'Standardsprachlichkeit eines einzelnen Sprachzeichens oder Varietätselements (Sx)' und der 'Standardsprachlichkeit einer ganzen Varietät (S(X))\ Wir tun dies im weiteren, indem wir im Zweifelsfall die beigefügte abgekürzte Notation verwenden. Der Begriff 'Standardsprachlichkeit einer ganzen Sprache' spielt für uns im weitern kaum eine Rolle. Die genannte begriffliche Differenzierung hat für uns auch einen heuristischen Zweck. Ganze Varietäten kann man nicht vorzeigen. Auch verbale Hinweise bleiben aufgrund der Vagheit des Begriffs unvermeidlich undeutlich. Dies ist anders bei einzelnen Sprachzeichen. Wir können sie im folgenden leicht und unmißverständlich als Beispiele zitieren. Mit der spezifisch linguistischen Frage, wie einzelne Sprachzeichen identifiziert bzw. die Elemente einer Varietät und die zwischen ihnen bestehenden Beziehungen festzustellen sind, befassen wir uns hier nicht. Es ist fast trivial, daß sie uns nicht unmittelbar gegeben sind, sondern nur über linguistische Beschreibungstheorien. Diese sollten wiederum mit übergeordneten Sprachtheorien vereinbar sein (Bartsch/Vennemann 1982, 5), um nicht nur Beschreibungs-, sondern auch Erklärungsadäquatheit zu erreichen. Ziel
'Standardvarietät' und 'Standardsprache'
17
solcher Bemühungen ist es, die Sprachzeichen und ihre Beziehungen nicht in einem beliebigen System zu konstruieren, sondern so, wie sie den Sprechern selber gegeben sind. Da in dieser Hinsicht keiner der bisherigen Sprachbeschreibungstheorien der Vorzug gebührt und diese Frage zudem in unseren Überlegungen einen untergeordneten Stellenwert hat, wählen wir unsere Beispiele von Varietätselementen der Einfachheit halber im Einklang mit dem taxonomischen Strukturalismus. Beispiele solcher Varietätselemente sind ein bestimmtes Vorkommnis (Inzidenz) eines bestimmten Phonems in einem bestimmten Wort (z. B. y in [fynf]), ein bestimmtes (gebundenes) Morphem an bestimmter Stelle eines bestimmten Wortes (z.B. -en in golden), ein bestimmtes Lexem (z. B. Knopf), eine bestimmte lexikalisierte Lexemderivation oder -komposition (z.B. reinlegen), eine bestimmte idiomatische Wortgruppe (z. B. Grüß Gott), eine unmittelbare Konstituente eines Satzes (z.B. hat das können machen im schwäbischen Satz Er hat das können machen), aber auch die Bedeutung eines derartigen Ausdrucks (z.B. die Bedeutung 'Knopf oder Knoten' des schwäbischen Lexems Knopf). Auch terminologische Fragen erörtern wir im weiteren nicht, wenn auch unsere eigene Terminologie in verschiedener Hinsicht sehr unbefriedigend bleibt. Vor konsequenten Änderungvorschlägen in der Terminologie bedarf es u. E. noch weiterer begrifflicher Klärung. Die in der Fachliteratur gebräuchliche Terminologie ist vielfältig (vgl. z. B. Ising/Kleinfeld/Schnerrer 1984, 10-37). Annähernd synonym mit unserem Ausdruck Standardvarietät werden gebraucht: Standard, Standardsprache, Schriftsprache, Einheitssprache, Hochsprache, Gemeinsprache, Kultursprache, Literatursprache, Ausbausprache, Nationalsprache und Landessprache. Für alle diese Ausdrücke finden sich in bestimmten Kontexten auch andere Bedeutungen. In Abschnitt 3 wird sich zeigen, daß diese Ausdrücke in der Tat zum Teil auf andere Bedeutungen festgelegt werden können.
3. Potentielle Definitionsmerkmale des Begriffs 'standardsprachlich (Sx)' 3.1 'Überregional (ÜBR)' Dieses potentielle Merkmal findet sich z.B. in Theodor Lewandowskis Linguistischem Wörterbuch unter dem Lemma „Standardsprache". „Standardsprache" wird erläutert als „überregionale Verkehrssprache einer Sprachgemeinschaft, die Umgangssprache(n) und Dialekte überlagert" (Lewandowski 1975, 688). Ähnlich findet sich 'überregional' als Merkmal von
18
Ulrich Ammon
'Standardvarietät' z.B. bei Janet Byron (1976, 1) oder John J. Gumperz und C M . Nairn (1960, 96). Wenn noch weitere Merkmale angeführt sind, z.B. bei Lewandowski: „durch Normen des korrekten mündlichen und schriftlichen Gebrauchs festgelegt", so spielt dies für uns im Moment keine Rolle. Damit könnte zwar angedeutet sein, daß das Merkmal 'überregional' nicht als hinreichend betrachtet wird; ein entsprechender ausdrücklicher Hinweis fehlt jedoch. Daher prüfen wir lieber - hier wie in ähnlich gelagerten anderen Fällen - unabhängig von irgendwelchen Vermutungen über die diesbezügliche Auffassung des Autors - , welche Konsequenzen die Festlegung als notwendiges bzw. als hinreichendes Merkmal hätte. Generell geht es uns nicht um die ausgewogene Darstellung irgendwelcher Positionen, sondern um die Prüfung von in Betracht kommenden Definitionsmerkmalen. Das potentielle Merkmal 'überregional' ist bei Lewandowski auf ganze Varietäten bezogen. Es läßt sich aber analog auf Varietätselemente anwenden. Dementsprechend verfahren wir auch später, d.h. wir wenden Merkmale, die für ganze Varietäten gegeben werden, auf Varietätselemente an, wo dies angemessen erscheint. Wir wollen zunächst explizieren, wie wir 'überregional' verstehen, wobei wir hoffen, daß wir mit dem gängigen Sprachgebrauch übereinstimmen. Im Rahmen des gängigen Sprachgebrauchs sind durchaus verschiedene Versionen denkbar. Wir wollen eine schwache und eine starke unterscheiden. Zunächst die schwache Version: (1) Eine Varietät (oder ein Varietätselement) ist genau dann überregional, wenn ihr Gebiet (Gebrauchsgebiet) echte Obermenge des Gebietes von mindestens einer anderen Varietät ist. Die starke Version: (2) Eine Varietät (oder ein Varietätselement) ist genau dann überregional, wenn ihr Gebiet (unechte) Obermenge der Gebiete aller anderen Varietäten derselben Sprache innerhalb des betreffenden Staatsgebietes ist. Die beiden Versionen bedürfen einiger erläuternder Hinweise. Die Elemente der als Menge aufgefaßten Gebiete sind die Gebietspunkte, was sicher unproblematisch ist. Die Version (1) ist schwach, weil das Gebiet der fraglichen Varietät (oder eines ihrer Elemente) echte Obermenge des Gebiets von nur mindestens einer anderen Varietät zu sein braucht. Wichtig ist allerdings, daß es echte Obermenge ist; dies entspricht der Bedeutung des Affixes über-. Die Version (2) ist stark, weil die Gebiete aller anderen Varietäten enthalten sein müssen, allerdings nicht als echte Teilmenge. Das Gebiet der fraglichen Varietät und die Gebiete der anderen Varietäten dürfen also auch identisch sein. Außerdem werden die Gebiete auf das jeweilige Staatsgebiet begrenzt. Andernfalls würde das Merkmal überstark, d.h. von so gut wie keiner Varietät mehr erfüllt. Dies ist leicht einzusehen,
'Standardvarietät' und 'Standardsprache'
19
wenn man an die von Heinz Kloss (1978, 60-63) sogenannten „dachlosen Außenmundarten" denkt. Seien a, b, . . . , n alle Varietäten der betreffenden Sprache innerhalb des betreffenden Staatsgebietes, dann läßt sich der Unterschied zwischen (1) und (2) etwas formaler folgendermaßen darstellen: (1) ÜBRia DEF (Gebiet von a z> Gebiet von b) v (Gebiet von a =) Gebiet von c) v . . . v (Gebiet von a => Gebiet von n) (2) UBR 2 a DEF (Gebiet von a z> (Gebiet von b u Gebiet von c u .. . u Gebiet von n) Das bei genauerer Betrachtung recht diffizile Problem, wie einer Varietät oder auch nur einem Varietätselement ein Gebiet zugeordnet wird, können wir hier nicht erörtern, sondern müssen dazu auf die Areallinguistik verweisen. Auch die nicht weniger heikle Frage, ob Varietäten in Teilen überregional sein können und in anderen Teilen nicht (analog unserer Vermutung hinsichtlich der Standardsprachlichkeit), glauben wir hier übergehen zu dürfen; wir haben dieser Möglichkeit auch in unseren Explikaten von 'überregional' nicht Rechnung getragen. Wir stellen nun die Frage, ob dieses in zweierlei Weise explizierte Merkmal notwendig oder hinreichend ist für den Begriff 'standardsprachlich (Sx)'. Dabei können wir entsprechend unserer zwei Explikate differenziert vorgehen und unser Prüfverfahren verschärfen. Wir fragen nämlich nach der Notwendigkeit unserers schwächeren Explikats (ÜBRi) und nach dem hinreichenden Charakter unseres stärkeren Explikats (ÜBR 2 ). Die umgekehrte Fragestellung erübrigt sich: wenn nicht einmal unser schwächeres Explikat notwendig ist, dann erst recht kein stärkeres; und wenn nicht einmal unser stärkeres Explikat hinreichend ist, dann wiederum erst recht kein schwächeres. Im Falle der Notwendigkeit unseres schwächeren Explikates müßte die folgende Allproposition wahr sein: 'Alle standardsprachlichen Varietätselemente sind überregional im Sinne von (1) (Vx (Sx -> ÜBRix))'. Diese Allproposition läßt sich falsifizieren durch die Verifikation folgender Existenzpropositionen (vgl. Abschnitt 1): 'Es gibt standardsprachliche Varietätselemente, die nicht überregional im Sinne von (1) sind (Hx (Sx A ~ ÜBRix))'. Eine gut gesicherte Verifikation dieses Existenzsatzes ist uns zur Zeit nicht ohne weiteres möglich. Wir machen jedoch einen zweifachen Versuch. Wir betrachten zunächst Varietäten, die unzweifelhaft als standardsprachlich gelten und die zugleich ein verhältnismäßig kleines Gebiet aufweisen. Bei ihnen besteht vermutlich am ehesten die Aussicht, daß sie wenigstens annähernd die gesuchte Eigenschaft der Nicht-Überregionalität haben. Ein Beispiel ist das Isländische. Dieses wird einerseits - wie wir meinen unzweifelhaft als Standardvarietät eingestuft. Andererseits wird auf „das Fehlen mundartlicher Verschiedenheiten" hingewiesen, „dank welchem die Hochsprache zugleich d e r Regiolekt Islands ist ( . . . ) " (Kloss 1978, 213 -
20
Ulrich Ammon
Sperrung im Original). Mißlicherweise fehlen regionale Dialekte jedoch nicht gänzlich (vgl. Groenke 1966; Pétursson 1978, 66-73). Dieser Fall legt jedoch eine Überlegung nahe, die durchaus zulässig ist. Wir haben schon in Abschnitt 1 auf folgendes hingewiesen: Die Falsifikation der Allproposition widerlegt zwar zwingend die Notwendigkeit des zur Diskussion stehenden Merkmals. Das Scheitern der Falsifikation hindert uns jedoch nicht an weiteren Überlegungen, welche die Notwendigkeit des Merkmals ebenfalls untergraben können. Fälle wie das Isländische provozieren die Frage: würden wir einer solchen Varietät bzw. ihren Elementen die Standardsprachlichkeit absprechen, wenn tatsächlich keinerlei regionale Differenzierung vorhanden wäre, wenn sie also nicht einmal im Sinne von (1) überregional wäre? Wir können diese Frage auch weiter treiben: Es wäre immerhin denkbar, daß selbst in größeren Gebieten wie in der BRD die Dialekte gänzlich außer Gebrauch kämen („aussterben" würden). Würde damit die bundesrepublikanische Standardvarietät ihren standardsprachlichen Status einbüßen? Uns scheint, daß wir diese Frage einigermaßen zuverlässig verneinen dürfen. Zumindest können wir soviel festhalten: diese Varietät hätte auch dann noch wesentlich andere Eigenschaften als z.B. Dialekte oder Umgangssprachen. Ob man diese Eigenschaften mit dem Ausdruck standardsprachlich bezeichnet, ist letztendlich eine Frage der terminologischen Konvention. Wie wir in Abschnitt 4.3 zu zeigen versuchen, erscheint uns der Ausdruck standardsprachlich jedoch durchaus treffend. Die Existenz nicht überregionaler und dennoch standardsprachlicher Varietätselemente soll noch an einem andersartigen Beispiel demonstriert werden, nämlich anhand der deutschen Handwerkernamen (vgl. Besch 1972). Am 23. Nov. 1966 verabschiedete der Bundestag die Handwerksordnung vom Jahre 1965, in der anstelle vormaliger regionaler Varianten jeweils eine einzige Handwerksbezeichnung für den geschäftlichen und amtlichen Verkehr in der ganzen Bundesrepublik verbindlich gemacht wurde, z.B. Fleischer für vormaliges Fleischer, Metzger, Schlachter oder Töpfer für vormaliges Töpfer, Hafner, Hafner. Die ausgewählte Bezeichnung wurde damit jeweils überregional gemacht, und zwar sogar im Sinne unserer stärkeren Version (2). Ihre Standardsprachlichkeit ist unbestritten. Wie aber steht es um die Standardsprachlichkeit der verschiedenen Varianten vor diesem Bundestagsbeschluß? Sie waren regional verteilt und vermutlich teilweise nicht einmal im Sinne unserer schwächeren Version (1) überregional. In einigen Fällen wurde außerdem auch noch 1966 für Bayern eine Ausnahmeregelung erwirkt. So ist dort im amtlichen und geschäftlichen Verkehr z.B. Pflasterer neben Straßenbauer oder Spengler neben Klempner weiterhin zugelassen (Besch 1972, 995f.). Diese Varianten sind vermutlich nicht einmal im Sinne von (1) überregional. Es scheint uns jedoch durchaus im
'Standardvarietät' und 'Standardsprache'
21
Einklang mit dem gängigen Sprachgebrauch zu stehen, wenn man sie gleichwohl als standardsprachlich betrachtet. Man bedenke, daß sie im Schriftverkehr der Behörden und in der nichtdialektalen Literatur verwendet sowie in der Schule akzeptiert werden. Nebenbei bemerkt, sind diese Handwerkernamen ein Indiz dafür, daß die deutsche Standardsprache - 'Sprache' hier im Sinne einer Menge von Varietäten - nicht nur staatenspezifisch, sondern nach wie vor in Resten auch noch innerhalb der BRD „polyzentrisch" ist (Clyne 1984, Kap. 1-3). Dies entspricht der föderalistischen politischen Struktur der BRD. Wir meinen, daß unsere Beispiele ausreichend falsifizieren, daß 'überregional', auch im schwachen Sinn von (1), ein notwendiges Merkmal von 'standardsprachlich' ist. Wir fragen nun, ob 'überregional' ein hinreichendes Merkmal für 'standardsprachlich' ist, und zwar 'überregional' im stärkeren Sinn von (2). In diesem Fall müßte folgende Allproposition wahr sein: 'Alle überregionalen Varietätselemente sind standardsprachlich (Vx (ÜBR 2 x ->• Sx))'. Diese Allproposition läßt sich falsifizieren, indem folgende Existenzproposition verifiziert wird: 'Es gibt überregionale Varietätselemente, die nicht standardsprachlich sind (3x (ÜBR 2 x A ~ Sx))'. Diese Existenzproposition ist verifizierbar durch solche Varietätselemente, die in der deutschen Sprachwissenschaft herkömmlich als umgangssprachlich bezeichnet werden: „Umgangssprache" ist „eine Sprachform, die nicht mehr Mundart [= Dialekt! U.A.] ist" (Bellmann 1957, 168). Diese Kennzeichnung von Günter Bellmann stellt die 'Umgangssprache' deutlich außerhalb der 'Standardvarietät'. Umgangssprache ist jedoch ein polysemer Ausdruck, der auch ein bestimmtes Register innerhalb der Standardvarietät bezeichnet; dabei entspricht Umgangssprache dem englischen colloquial. Der Bedeutung einer nicht standardsprachlichen Varietät entspricht eher das englische vernacular. In diesem letzteren Sinn meinen wir Umgangssprache hier. Allerdings handelt es sich in vielen Sprachgebieten dabei nicht um eine einzige Varietät; im Zusammenhang mit der „Umgangssprache" zeigt sich vielleicht am dramatischsten die Schwierigkeit der Abgrenzung einzelner Varietäten (vgl. z.B. Radtke 1973). Weitgehender Konsens besteht jedoch in einer Hinsicht, die uns hier vor allem interessiert, nämlich daß es ausgesprochen überregionale umgangssprachliche Varietätselemente gibt: „Die 'großlandschaftliche' Umgangssprache umfaßt ein größeres Territorium und meidet möglichst kleinräumige Formen" (Kleine Enzyklopädie: Deutsche Sprache 1983, 431). Beispiele, die einerseits unser stärkeres Explikat von 'überregional' im Sinne von (2) erfüllen und andererseits nach gängigem Sprachgebrauch zweifellos nicht standardsprachlich sind, finden sich vor allem in der Jugendsprache, die durch die Massenmedien zum Teil mindestens im ganzen Gebiet der BRD verbreitet ist. Hierher gehören Wörter
22
Ulrich Ammon
wie Macker 'Mann (abfällige Bewertung)' oder idiomatische Wortgruppen wir null Bock haben 'keine Lust haben' (Müller-Thurau 1983). Aber auch ältere Formen wie die Genetivumschreibung durch Dativ + Possessivpronomen: dem Vater sein Hut, sind sowohl überregional im Sinne von (2) als auch nicht standardsprachlich. Beate Henn (im Druck) konnte nachweisen, daß viele bislang für ausgesprochen dialektal gehaltene Formen in Wirklichkeit nahezu im ganzen deutschen Sprachgebiet gebräuchlich sind. Man könnte in anderen Sprachgebieten auf Pidgins und Kreols hinweisen, die als lingua franca dienen und ebenfalls sowohl überregional im Sinne von (2) als auch nicht standardsprachlich sind, z.B. das frühere Suaheli in Ostafrika oder Neo-Melanesisch und Hiri Motu auf Neuguinea (Wurm 1977) zu einer Zeit, als sie zweifellos noch nicht standardsprachlich waren. Durch diese Beispiele wird unser Existenzsatz verifiziert, und der hinreichende Charakter von 'überregional' für 'standardsprachlich' falsifiziert. Man kann das Ergebnis dieser Analyse dahingehend zusammenfassen, daß 'standardsprachlich' und 'überregional' (im schwächeren oder stärkeren Sinn) logisch voneinander unabhängige Eigenschaften von Varietätselementen sind. Sie können natürlich kontingent (empirisch) koinzidieren und tun dies auch in vielen Fällen. Wie es scheint, überschneiden sich die Extensionen von 'überregional' (in beiden Versionen) und 'standardsprachlich' derart, daß weder die Schnittmenge noch eine der Restmengen leer ist, also S n ÜBR ± 0, S - ÜBR ± 0 und ÜBR - S -h 0. Dies trifft wenigstens auf das Gebiet der BRD zu, vermutlich aber auch auf viele andere Sprachgebiete. 'Überregionalität' läßt sich in verschiedene Arten differenzieren. Wir haben uns aus guten Gründen beschränkt auf verschiedene Versionen innerhalb des Gebiets einer Sprache und sogar eines Staates. Insofern eine überregionale Varietät die überdachten Varietäten gebietsmäßig eint, kann man von Einheitsvarietät sprechen; in derselben Bedeutung einigermaßen gängig ist schon der Ausdruck Einheitssprache. Bei der Überdachung von Varietäten verschiedener Sprachen wird zumeist von einer lingua franca gesprochen. 3.2 'Oberschichtlich (OBS)' Siegfried Jäger gibt im Lexikon der Germanistischen Linguistik (1973, 272) folgende Begriffserläuterung: „Als Standardsprache wird die Sprache bezeichnet, die im Sprachverkehr der oberen und mittleren Schichten verwendet wird". Anstelle der oberen und mittleren Schichten werden in der Literatur auch die „gebildeten Schichten" genannt oder die „Elite". Im Bezug auf die Bildungsschichten definiert z.B. Godfrey C. Aniche (1982,74) die englische Standardsprache von Nigeria folgendermaßen: "The Nigerian College Student whose brand of English is the focus of this paper, must have
'Standardvarietät' und 'Standardsprache'
23
had at least eleven years of formal exposure to the language by the time he graduates from high school; it would be proper, therefore, to regard his performance in the language as 'educated usage', or his model as the Nigerian 'standard'". Eine Variante dieses Merkmals, die wir nicht gesondert diskutieren wollen, besagt, daß standardsprachlich diejenigen Sprachformen sind, die hohes Prestige haben. Ein Beispiel findet sich bei Henry und Renée Kahane (1979, 187), die vom Terminus "prestige language" unvermerkt hinübergleiten zum Terminus "standard". Wir nennen das hiermit identifizierte potentielle Definitionsmerkmal vereinfachend oberschichtlich. Es spielt für unsere Überlegungen nur eine untergeordnete Rolle, daß dieses Merkmal in der Literatur gewöhnlich nicht klar oder scharf festgelegt ist. So gibt es zum einen zweifellos recht unterschiedliche Festlegungsmöglichkeiten der sozialen Schichtung, erstens was die Kriterien der Schichtung und ihre Gewichtung betrifft (Einkommenshöhe, Bildungsniveau usw.), zweitens was die Anzahl der Schichten betrifft (dichotomische, trichotomische usw. Schichtung) und drittens was die Abgrenzung zwischen den einzelnen Schichten betrifft. Zum anderen ist es ungeklärt bzw. besteht zumindest kein Konsens, wie ein Varietätselement (oder eine Varietät) einer sozialen Schicht zugeordnet werden soll, was es also bedeuten soll, daß es schichtenspezifisch ist. Bei ganzen Varietäten hängt diese Unklarheit damit zusammen, daß der Begriff 'Varietät' nicht geklärt ist. Aber auch für klar abgegrenzte einzelne Varietätselemente gibt es unterschiedliche Zuordnungsmöglichkeiten zur sozialen Schichtung. So kann man ein klar abgegrenztes Varietätselement einer ebenfalls klar abgegrenzten Sozialschicht beispielsweise auf folgende Arten unterschiedlich zuordnen, d.h. seine Schichtenspezifik festlegen: - Das Varietätselement wird in der betreffenden Schicht häufiger verwendet als in jeder anderen Schicht (statistische Zuordnung), was wieder unterschiedlich festgelegt werden kann, z.B.: - absolut häufiger, d.h. mehr als 50% aller Verwendungen ereignen sich in dieser Schicht, - relativ häufiger. Das kann z.B. heißen, daß die einzelnen Mitglieder dieser Schicht das Wort durchschnittlich häufiger verwenden als die einzelnen Mitglieder irgendeiner anderen Schicht. Die Verwendung braucht deshalb nicht absolut häufiger zu sein, wenn die betreffende Schicht z.B. weniger Mitglieder hat als andere Schichten oder diese sich weniger äußern. - Das betreffende Varietätselement gilt als eher angemessen für ein Mitglied dieser Schicht als für ein Mitglied einer anderen Schicht (Zuordnung aufgrund einer Wertung). Diese Zuordnung braucht nicht unbedingt zu koinzidieren mit häufigerer Verwendung. Auch hier gibt es wieder unterschiedliche Festlegungsmöglichkeiten im einzelnen.
24
Ulrich Ammon
Nebenbei sei darauf hingewisen, daß die hier angesprochene Differenzierung analog auch schon hinsichtlich der Region (Gebiet) eines Varietätselementes (oder einer Varietät) möglich gewesen wäre. Denn ein Varietätselement wird zumeist ebenfalls nicht ausschließlich in „seiner" Region verwendet - man denke nur an Reisen, Migration und Massenkommunikation; auch hier gibt es unterschiedliche Festlegungsmöglichkeiten. Entsprechende Differenzierungen werden allerdings seitens der Areallinguistik, vor allem der Dialektgeographie, weniger nahe gelegt als seitens der mit Schichtenunterschieden befaßten Soziolinguistik. Wir haben die Frage der Gebietszuordnung in Abschnitt 3.1 pauschal der Areallinguistik zugewiesen und sie deshalb nicht erörtert, weil sie uns für unsere Begriffsanalyse nicht entscheidend erschien. Wir verfahren hier analog: Das Problem fällt in den Aufgabenbereich der mit sprachlichen Schichtenunterschieden befaßten Soziolinguistik. Wir behelfen uns wiederum mit der Betrachtung zweier extremer Versionen. Die schwache Version: (1) eine Varietät oder ein Varietätselement wird bei einer dichotomen Schichtung in der oberen Schicht relativ häufiger gebraucht (OBSi). Die starke Version: (2) eine Varietät oder ein Varietätselement wird bei einer mehr als dichotomen Schichtung in der obersten Schicht exklusiv gebraucht (OBS2). Wir meinen, daß die verbleibenden Vagheiten unsere Argumentation nicht entscheidend beeinträchtigen. Wie sich im weiteren zeigen wird, hätte z.B. eine genauere Festlegung der Schichten in (2) keinen Sinn, da uns keine entsprechenden Daten zur Verfügung stehen. Wir fragen nun wieder, ob wenigstens unsere schwache Version (1) ein notwendiges Merkmal von 'standardsprachlich' ist. In diesem Fall müßte die folgende Allproposition wahr sein: Alle standardsprachlichen Varietätselemente sind oberschichtlich (Vx (Sx -> OBSi x))'. Falsifizierbar ist diese Allproposition durch Verifikation der folgenden Existenzproposition: 'Es gibt standardsprachliche Varietätselemente, die nicht oberschichtlich sind (Hx(Sx A ~ O B S ! X ) ) \
Eine eindeutige Verifikation unserer Existenzproposition und damit Falsifikation unserer Allproposition ist uns mangels geeigneter Daten nicht möglich. Wir können jedoch Hinweise geben, die eine Widerlegung der Notwendigkeit des potentiellen Merkmals 'oberschichtlich (OBSi)' wahrscheinlich erscheinen lassen. Bei Standardisierungen (bzw. allgemein als solche geltenden Vorgängen) von Varietäten in der jüngeren Vergangenheit finden sich Fälle, die zumindest teilweise nicht an den in den höheren Sozialschichten gebräuchlichen Varietäten orientiert sind. Vielmehr gehen die Bemühungen sogar gerade darauf aus, die „Sprache des Volkes" zu standardisieren, gelegentlich sogar in ausdrücklicher Absetzung von den Varietäten der
'Standardvarietät' und 'Standardsprache'
25
oberen Schichten, die als dem „Volk" fremd bewertet werden. Ein Beispiel ist die Einführung des Landsmâl in Norwegen, das unter sozialistischem Einfluß, nicht zuletzt der Arbeiterpartei selber, durch „volkssprachliche" Elemente bereichert wurde, die sogar ihr Schöpfer Ivar Aasen als zu „plebejisch" abgelehnt hatte (Haugen 1972, 136). Warum sollten solche Sprachformen nach ihrer vollzogenen Standardisierung nicht für einige Zeit weiterhin überwiegend in den unteren Sozialschichten verwendet werden? Auch bei Standardisierungen von Nationalitäten- und Minoritätenvarietäten in sozialistischen Ländern wie der UdSSR (Lewis 1972, 167-170) dürften solche Beispiele zu finden sein. Offenkundig bedürfte der Nachweis genauer empirischer Untersuchungen an Ort und Stelle. Wir nehmen jedoch aufgrund solcher Fälle an, daß sich unser Existenzsatz durchaus empirisch verifizieren läßt. Der Zusammenhang unserer Beispiele mit sozialistischen Bestrebungen legt außerdem die etwas spekulative Ausweitung unserer Überlegungen nahe. Angenommen, in Zukunft entständen tatsächlich einmal kommunistische Gesellschaften ohne Schichtenunterschiede. Würden wir solchen Gesellschaften prinzipiell die Möglichkeit absprechen, über eine Standardvarietät zu verfügen? Dies wäre die logische Konsequenz bei Notwendigkeit des potentiellen Merkmals 'oberschichtlich' (in welcher Version auch immer) für 'standardsprachlich', wie der folgende Schluß zeigt: (1) Vx (Sx -> OBRi x) (2) ~ OBRi a (3) Vx Sx -> Vx OBRi x (4) Sa -> OBRi a (5) ~ Sa
lt. Definition eines notwendigen Merkmals lt. Voraussetzung: a ist nicht oberschichtlich (mangels vorhandener Schichten) aus (1) aufgrund einer Tautologie (Carnap 1968, 59) aus (3) durch Spezialisierung aus (2) und (4) aufgrund Modus tollens
Einen Ausweg aus dieser Konsequenz böte nur ein konditionaler Zusatz: 'Wenn Schichtenunterschiede bestehen, dann ist 'oberschichtlich' notwendiges Merkmal von 'standardsprachlich". Eine solche bedingte Definition zöge jedoch diverse Schwierigkeiten nach sich. Stattdessen halten wir sowohl die Aussichten empirischer Widerlegung als auch die darüber hinausgehenden Überlegungen für beweiskräftig genug, um 'oberschichtlich' auch im schwächeren Sinn von (1) nicht als notwendiges Merkmal von 'standardsprachlich' festzulegen. Ist 'oberschichtlich' im stärkeren Sinne von (2) hinreichendes Merkmal für standardsprachlich? In diesem Fall müßte folgende Allproposition wahr sein: 'Alle oberschichtlichen Varietätselemente sind standardsprachlich (Vx (OBS2 x -> Sx))'. Widerlegen läßt sich diese Allproposition durch die Verifikation der Existenzproposition 'Es gibt oberschichtliche Varietätselemente,
26
Ulrich Ammon
die nicht standardsprachlich sind (Hx (OBS2 x A ~ Sx))'. Im Fall der Verifikation der Existenzproposition ist das Merkmal 'oberschichtlich' im Sinne von (2) nicht hinreichend. Wiederum ist uns eine eindeutige Verifikation der Existenzproposition nicht möglich. Sie ist grundsätzlich schwierig, da die Exklusivität der Verwendung kaum nachweisbar ist - wenn auch eine Verifikation nicht grundsätzlich ausgeschlossen ist: impliziert ist in der Exklusivität nämlich nur eine raum-zeitlich begrenzte Allproposition ('alle Verwendungen im Raum-Zeitgebiet r • t ereignen sich in der Oberschicht'), nicht eine unbegrenzte Allproposition (vgl. zu dem Problem Popper 1973, 39-41). Dennoch sind wir anstelle zweifelsfreier empirischer Belege auf Plausibilitätserwägungen angewiesen. Wir halten exklusive Oberschichtverwendung für naheliegend bei einem Sprachverhalten, das man mit dem Begriff 'Slang' (oder auch 'Jargon') zu erfassen versucht. Eine der möglichen Festlegungen dieses Begriffs ist die eines für eine soziale Gruppe oder Schicht exklusiven Registers, das verhältnismäßig raschem Wandel unterliegt. Und zwar nötigt der laufende Verlust der angestrebten Exklusivität zu diesem Wandel. 'Slang' ist zudem entweder per Definition gänzlich, oder zumindest empirisch zu erheblichen Teilen, nicht standardsprachlich, nämlich „lässig gebrauchte (...) Umgangssprache" (Bußmann 1983, 465) "outside of conventional or standard usage" {Webster's New World Dictionary of the American Language, Cleveland/New York, The World Publishing Company, 1964, 1369). Solcher zumindest großenteils nicht standardsprachlicher Slang ist insbesondere in sich abkapselnden Oberschichten zu vermuten, wie sie z.B. Thorstein Veblen (1899) als "leisure class" für die USA um die Jahrhundertwende beschrieben hat. Das Bedürfnis nach symbolischer Absetzung, auch durch die Sprache, von den unteren Sozialschichten mag dort besonders stark ausgeprägt sein, wo die Schichtenexklusivität nicht durch die Sozialordnung, z.B. eine ständische Ordnung, gesichert ist. Ein in groben Zügen ähnliches Verhalten zeigt z.B. schon der heimkehrende Meier Helmbrecht in einer Zeit sich lockernder ständischer Ordnung, als er mit niederfränkischen Brocken um sich wirft, um seine Weitläufigkeit und Zugehörigkeit zur Ritterschaft zu demonstrieren. Schon in spätmittelalterlicher Zeit ist also slangartige exklusive Oberschichtverwendung bestimmter Varietätselemente anzunehmen. Andere Beispiele mehr oder weniger exklusiver Oberschichtverwendung finden sich in der historischen deutschen Studentensprache (Henne/Objartel 1982/1983; 1984). Ein uns näherliegendes Beispiel liefert Hugo Steger in seinem Aufsatz „Gruppensprache". Die in seiner Seminargruppe offenbar exklusiv verwendeten idiomatischen Wendungen: einen Roman beforschen, einen Forsch nehmen 'forschen' usw. (Steger 1964, 131) sind sicher nach gängigem Sprachgebrauch nicht standardsprachlich. Zwar mag man die Zugehörigkeit von wissenschaftlichen Mitarbeitern und Studenten zur Oberschicht anzweifeln.
'Standardvarietät' und 'Standardsprache'
27
Aber warum sollten derartige verbale Besonderheiten nicht gleichermaßen vorkommen in Gruppen, die eindeutiger der Oberschicht zuzurechnen sind? Sicher würde niemand die betreffenden Varietätselemente allein aufgrund ihrer exklusiven Oberschichtverwendung als standardsprachlich einstufen. Dieser Hinweis dürfte zumindest die Vermutung rechtfertigen, daß sich der hinreichende Charakter von 'oberschichtlich' empirisch widerlegen läßt. Wir sind in unseren Überlegungen allerdings wieder über empirische Hinweise hinausgegangen. Auch diese weitergehenden Überlegungen stützen die Auffassung, daß 'oberschichtlich', in welcher Version auch immer, weder hinreichendes noch notwendiges definitorisches Merkmal von 'standardsprachlich' ist. Mit dieser Feststellung ist die häufige empirische Koinzidenz beider Eigenschaften ohne weiteres vereinbar. Daß es sich dabei um eine empirische und nicht um eine definitorische Beziehung handelt, liegt auch nahe angesichts der Diskussion um die schichtenspezifische Verteilung von Standardvarietät und nicht standardsprachlichen Varietäten (vor allem Dialekten), die im letzten Jahrzehnt in der BRD stattgefunden hat (vgl. z.B. Ammon 1973a, Mattheier 1980, 82-90). Die extensionale Beziehung von 'oberschichtlich (in verschiedenen Versionen)' und 'standardsprachlich' dürfte analog der sein von 'überregional' und 'standardsprachlich', nämlich: S n OBS * 0, S - OBS * 0 und OBS - S -h 0. 3.3 'Invariant (INV)' Dieses potentielle Merkmal wird weniger durch vorliegende Definitionsvorschläge in der einschlägigen Literatur als durch die alltagssprachliche Bedeutung von standardisieren '(. ..) vereinheitlichen, normen (. . .)' {Großes Duden-Wörterbuch 1981, 2476) nahegelegt oder durch das verbreitete Verständnis von Standardisierung in anderen Bereichen, z.B. die Standardisierung von technischen Geräten oder von wissenschaftlicher Terminologie. Standardisierung beinhaltet dort zumeist die Reduktion von Variation (z.B Wüster 1970, passim und besonders 94-97). Bei zugegeben oberflächlicher Betrachtung vieler Studien zur „Standardisierung" von Varietäten oder Sprachen entsteht ebenfalls der Eindruck, daß es dabei in erster Linie oder zumindest unter anderem um die Reduktion von Variation geht (z.B. Deprez/Geerts 1977). Hiermit stehen auch gängige Begriffe aus der Theorie der Planung von Standardvarietäten grob im Einklang, für die u. a. "uniformity" oder "commonality" angestrebt werden sollen (Ray 1963, 12, 54), sowie Vorschläge, das Ausmaß der erreichten „Standardisierung" am Grad der Variation zu messen (Ferguson 1962, 24f.). Nun sind mit diesen globalen Hinweisen z. T. recht unterschiedliche Phänomene angesprochen. Einmal ist wiederum zu unterscheiden zwischen dem Bezug auf eine Varietät und dem Bezug auf eine ganze Sprache als
28
Ulrich Ammon
Klasse von Varietäten. Letztere hat z.B. Ferguson im Auge, vermutlich auch Ray. Wir haben uns mit den bisher erörterten potentiellen Merkmalen nur auf Eigenschaften von Varietäten bezogen, nämlich ihre Überregionalität (Überdachung anderer Varietäten) und ihre Oberschichtlichkeit (Verteilung auf die oberen Sozialschichten). Wenn wir auch weiterhin am Bezug auf Varietäten bzw. Varietätselementen festhalten und uns zumindest im Abschnitt 3 darauf beschränken, was angebracht erscheint, so bleiben, soweit wir sehen, drei Arten von Variation zu erörtern: (1) die kontextuelle Variation, (2) die registerspezifische (= stilistische) Variation, (3) die freie Variation. Alle drei Arten von Variation liegen i n n e r h a l b von Varietäten, bzw. wir erörtern sie nur, insoweit dies der Fall ist. Von der Variation in der Zeit (diachrone Dimension) sehen wir ab, da sie uns für die Definition von 'standardsprachlich' nicht in Betracht zu kommen scheint. Man denke z.B. nur daran, daß junge, in hohem Maße „künstlich" gestaltete Varietäten ebensogut standardsprachlich sein können wie ältere, die sich lange Zeit kaum verändert haben. Wir fragen nun, ob 'invariant' notwendiges oder hinreichendes Merkmal von 'standardsprachlich' ist. Unter 'ein Varietätselement x ist invariant in einer Varietät X (INVx in X)' verstehen wir, daß 'es kein Element y in der Varietät X gibt, das variiert mit dem Element x der Varietät X'. Wenn man VARyx als Abkürzung benützt für das Varietätselement v variiert mit dem Varietätselement x, so kann man die Definition folgendermaßen etwas formaler anschreiben: INVx in X DÏF ~Hy (y e X A VARyx A X eX). INVx und VARyx können nun nach Bedarf spezifiziert werden als 'kontextueir, 'registerspezifisch' oder 'frei'. Wenn 'invariant' notwendiges Merkmal ist von 'standardsprachlich', so muß die folgende Allproposition wahr sein: Alle standardsprachlichen Varietätselemente sind invariant (Vx (Sx -> INVx))'. Diese Allproposition kann empirisch widerlegt werden durch Verifikation folgender Existenzproposition: 'Es gibt standardsprachliche Varietätselemente, die nicht invariant sind (3x (Sx A - I N V X ) ) ' .
Betrachten wir nacheinander die verschiedenen Arten von Varianz. Es gibt ohne Zweifel kontextuelle Varianten, die standardsprachlich sind. Im Deutschen sind es phonetische Varianten wie [t] - [d], [g] - [k] in [lu:t] '(er, sie, es) lud' - [luidn], 'luden', [truik] 'trug' - [truign] 'trugen'. In Standardvarietäten anderer Sprachen mit stärker phonetischer Orthographie, z.B. im Niederländischen, wird zudem entsprechend kontextuell orthographisch variiert, z.B. 'Dieb' - 'Diebe'. 'Kontextuell invariant' ist somit sicher kein notwendiges Merkmal von 'standardsprachlich'.
'Standardvarietät' und 'Standardsprache'
29
Hinsichtlich der 'registerspezifischen Invarianz' können wir den Gedanken an ein notwendiges Merkmal ohne Umstände begraben. Angeregt durch die Prager Schule wurde in zahlreichen Publikationen darauf hingewiesen, daß eine reiche registerspezifische Variation ein wichtiges Gütekriterium für eine Standardvarietät ist (z.B. Havranek 1964b; 1971, 28-30; Ising 1982, 18-24). Des weiteren finden sich in jedem größeren Wörterbuch der deutschen und vieler anderer Standardvarietäten zahlreiche stilistische Varianten. Auch das 'Fehlen freier Varianten' erscheint uns als notwendiges Merkmal von 'standardsprachlich' unhaltbar. Ein strenger Beweis, daß es sich im Einzelfall tatsächlich um freie Variation handelt, dürfte zwar schwierig sein, da irgendwelche „stilistische Funktionen" kaum zuverlässig ausgeschlossen werden können. Es gibt jedoch Beispiele, wo solche „Funktionen" zumindest sehr fraglich sind, im deutschen etwa orthographische Varianten wie [Foto] - [Photo] oder [Frisör] - [Friseur] oder auch Varianten des Substantivgenus, z.B. der Liter - das Liter. An der Standardsprachlichkeit dieser Varianten besteht kein Zweifel. Wir können auch hier unsere Fragestellung wieder spekulativ ein wenig zuspitzen: würden wir diesen Varianten die Standardsprachlichkeit absprechen, wenn eine sorgfältige empirische Untersuchung ergäbe, daß es sich tatsächlich um freie Variation handelt? Uns scheint, daß diese Frage zuverlässig verneint werden darf. Den Gedanken eines hinreichenden Merkmals brauchen wir wohl nicht ernsthaft zu prüfen. Niemand wird ein Element z.B. eines Dialekts allein aufgrund von Invarianz, sei es kontextuelle, registerspezifische oder freie, als standardsprachlich deklarieren. Wir kommen also wiederum zu dem Befund, daß 'invariant', in welcher Spezifikation auch immer, für den Begriff 'standardsprachlich' weder notwendig noch hinreichend ist. Beide Begriffe sind vielmehr definitorisch voneinander gänzlich unabhängig. Dies schließt allerdings empirische Zusammenhänge nicht aus, z.B. die folgenden: - die registerspezifische Variation in einer Varietät nimmt infolge der Standardisierung zu; - die freie Variation in einer Varietät nimmt infolge der Standardisierung ab. Es erscheint plausibel, daß Hypothesen dieser Art, die man in der einschlägigen Literatur des öfteren liest, nicht per definitionem, sondern allenfalls empirisch wahr sind. Sie sind grundsätzlich falsifizierbar. 3.4 'Ausgebaut (AUG)' Dieses potentielle Merkmal findet sich bei Heinz Kloss, wenngleich eher implizit als explizit. Kloss setzt zunächst einmal „Standardsprache" synonym mit „Kultursprache", „Hochsprache" und auch „Schriftsprache": „Ob-
30
Ulrich Ammon
wohl ich die Bezeichnung ,Kultursprache' im Titel, wo sie soviel wie ,Hochkultursprache' bedeutet, beibehalten habe, habe ich sie im neuen Text nur vereinzelt verwendet und gebrauche in der Regel dafür die Bezeichnung ,Hochsprache', die ich als im wesentlichen gleichbedeutend mit Standardsprache' betrachte ( . . . ) " (Kloss 1978, 12). Sodann gebraucht er „(moderne) Kultursprache" synonym mit „Ausbausprache", wenn er z.B. von einem ehemaligen Dialekt schreibt, „der voll zur modernen Kultursprache ausgebaut worden, also eine Ausbausprache geworden ist ( . . . ) " (Kloss 1978, 81). Für Kloss gilt also: Standardsprache = (moderne) Kultursprache = Ausbausprache mit dem Merkmal '(voll) ausgebaut'. Ähnlich sind Terminologie und Begrifflichkeit in Anlehnung an Kloss bei Harald Haarmann (z.B. Haarmann 1979, 336, 358). Die Kloss'schen Termini beziehen sich kaum auf ganze Sprachen, denn er wendet sie gewöhnlich nur auf Varietäten oder allenfalls Teilklassen von Sprachen an, z.B. auf Schwyzertütsch, Pennsilfaanisch oder Elsässer Ditsch, aber nicht auf die deutsche Sprache insgesamt (Kloss 1978, 105-139). Wir können also davon ausgehen, daß seiner Auffassung nach '(voll) ausgebaut' ein Merkmal von 'standardsprachlich' in dem von uns gemeinten Sinn ist, also von Standardvarietäten bzw. ihren Elementen. Bei genauerer Betrachtung erweist sich das potentielle Merkmal 'ausgebaut' als recht komplex. Es umfaßt sowohl „Stilmittel" als auch „Anwendungsbereiche" (Kloss 1978, 37). Allerdings werden von Kloss nur die Anwendungsbereiche differenziert erläutert; hinsichtlich der Stilmittel begnügt er sich mit ziemlich globalen Hinweisen (z.B. Kloss 1978, 37f.). Da er zudem Stilmittel und Anwendungsbereiche für „interdependent" hält (Kloss 1978, 37), so erscheint es legitim, das Merkmal 'ausgebaut' hier auf die Anwendungsbereiche einzuschränken. Die Anwendungsbereiche werden von Kloss durch eine zweifache Gliederung geordnet. Zum einen unterscheidet er vier Komponenten der „kulturellen Kraft" einer Varietät: ihre Verwendung (I) in „Schlüsseltexten" (z.B. Bibel), (II) in „Dichtung und Erzählung", (III) in mündlichen „Zusprachetexten" (z.B. auf der Kanzel, im Rundfunk), (IV) im „Sachschrifttum". (Kloss 1978, 39; Kloss/McConnell 1978, 54-56). Diesen Komponenten mißt Kloss in aufsteigender Ordnung zunehmendes Gewicht bei, das er - unter Hinweis auf den provisorischen Charakter dieser Quantifizierung - in „Punktzahlen" ausdrückt. Ist (I) erfüllt, so erteilt er 100 Punkte, für (II) zusätzlich 200, für (III) zusätzlich 300 und für (IV) zusätzlich 400 (Z = 1000 Punkte). Das größte Gewicht im Ausbau einer Varietät hat für ihn also die Verwendung im Sachschrifttum. Erst durch sie wird eine Varietät zu einer Ausbausprache. Die 'Verwendung im Sachschrifttum' wird von Kloss in einer zweiten Gliederung weiter differenziert zum Zweck der Unterscheidung verschiedener Ausbaustufen. Kloss spricht zwar von „Phasen" des Ausbaus und weist
'Standardvarietät' und 'Standardsprache'
31
die Bezeichnung „Stufen" ausdrücklich zurück. Es handelt sich jedoch um nichts anderes als Stufen oder Ränge, womit Kloss' Hinweis, daß sich im historischen Prozeß „ihre normal geltende Reihenfolge umkehren" kann (Kloss 1978, 46), ohne weiteres vereinbar ist. Bei diesen Ausbaustufen unterscheidet Kloss einerseits drei „Anwendungsbereiche" (offenbar in einem engeren Sinn als zu Anfang) und andererseits drei „Entfaltungsstufen", die er jeweils in eine Rangfolge bringt. Anwendungsbereiche : 1. gruppeninterne Themen (volkskundlich, die heimische Flora betreffend), 2. die sonstigen „kulturkundlichen Fächer" (Geisteswissenschaften, Rechtswissenschaften usw.), 3. „Naturwissenschaften und Technologie". Entfaltungsstufen : a) „Jedermannsprosa (Volksschulstufe)", b) „Gehobene" Prosa („Bildungsstufe der Oberschule") oder „Zweckprosa", c) „Hochschul- oder Forscherprosa" (Kloss 1978, 47). Die niedrigste Ausbaustufe ergibt sich durch die Kombination der jeweils ersten Stufe der Anwendungsbereiche (im letzteren, engeren Sinn) und der Entfaltungsstufen, die höchste Ausbaustufe durch die Kombination der jeweils dritten Stufe. Dementsprechend können wir nun wieder eine schwache und eine starke Version von 'ausgebaut' unterscheiden, die allerdings - was Kloss verschiedentlich eingesteht - jeweils nicht gerade scharf abgegrenzt sind. Die schwache Version ist: (1) 'die Verwendung für gruppeninterne Themen in „Jedermannsprosa (Volksschulstufe)" (AUGi)'. Die starke Version ist: (2) Die 'Verwendung für Naturwissenschaften und Technologie in Hochschul- und Forscherprosa (AUG 2 )'. AUGi kommt in Betracht als notwendiges, AUG 2 als hinreichendes Merkmal von 'standardsprachlich'. In beiden Versionen könnte man 'Verwendung' wieder unterschiedlich spezifizieren, ähnlich wie wir das bei 'oberschichtlich' (Abschnitt 3.2.) gemacht haben, z.B. als 'ausschließliche' oder nur als 'statistisch überwiegende Verwendung'. Wir hätten dann mindestens 2 x 2 = 4 Versionen zu prüfen. Aus Platzgründen verzichten wir hier jedoch auf diese zusätzliche Differenzierung und begnügen uns mit der vagen Festlegung als 'gängige Verwendung', wozu z.B. keine Verwendungen gehören, die Zitate sind oder die sowohl vom Sprecher/Schreiber selber als auch von allen Adressaten als Lapsus bewertet werden. Wäre unsere schwächere Version (1) notwendiges Merkmal von 'stan-
32
Ulrich Ammon
dardsprachlich', so müßte die folgende Allproposition wahr sein: 'Alle standardsprachlichen Varietäten bzw. ihre Elemente werden verwendet für gruppeninterne Themen in „Jedermannsprosa (Volksschulstufe)" (Vx (Sx -> AUGi x))\ Diese Allproposition läßt sich falsifizieren durch Verifikation der Existenzproposition: 'Es gibt standardsprachliche Varietäten oder Varietätselemente, die nicht für gruppeninterne Themen in „Jedermannsprosa (Volksschulstufe)" verwendet werden (Hx (Sx A —AUGi x))\ Ein nach irgendwelchen Maßstäben strenger empirischer Beweis ist aus analogen Gründen wie früher sehr schwierig, wenn nicht unmöglich: Es lassen sich kaum alle entsprechenden Verwendungen überblicken. Die Argumentation wird weiter erschwert durch eine Unklarheit hinsichtlich des Argumentbereichs von 'ausgebaut' (in beiden Versionen). Läßt sich 'ausgebaut' wie die bisherigen potentiellen Merkmale tatsächlich auch von einzelnen Varietätselementen prädizieren? Wenn man den Ausdruck in seiner wörtlichen Bedeutung nimmt, so ist dies wohl kaum sinnvoll. Nimmt man ihn jedoch in der Bedeutung unserer beiden Versionen (1) und (2), die der Begriffserläuterung von Kloss entsprechen, so erscheint dies durchaus möglich. Nach den vorausgegangenen Hinweisen hat ausgebaut dann ganz grob die Bedeutung: 'in der Sachprosa gängig'. Dies kann man offenkundig von einzelnen Varietätselementen prädizieren. Wenn man diese Bedeutungsfestlegung akzeptiert, so läßt sich die zur Diskussion stehende Frage auch so formulieren: Gibt es Varietätselemente, die einerseits standardsprachlich und andererseits nur in der „Kunstprosa", nicht in der Sachprosa gängig sind? 'Kunstprosa' ist nämlich für Kloss das Negat von 'Sachprosa' im Argumentbereich der Prosa (Kloss 1978, 41). Es dürfte nicht schwerfallen, die in dieser Frage enthaltene spezifizierte Existenzproposition zu verifizieren. Hierzu braucht man nur auf ausgesprochen „poetische" Ausdrücke zu verweisen. Im Deutschen sind dies z.B. Wörter wie säuseln, Herzliebchen usw. oder syntaktische Besonderheiten wie nachgestellte unflektierte Adjektive: Röslein rot, Bächlein klar u.a. Niemand wird daran zweifeln, daß solche Ausdrücke standardsprachlich sind. Sie gehören zum poetischen Register der Standardvarietät. Diese Beispiele verifizieren unsere Existenzproposition. Sie belegen, daß Varietätselemente standardsprachlich sein können, ohne in der Sachprosa verwendet zu werden. Demnach ist 'ausgebaut', im schwächeren Sinn von (1), kein notwendiges Merkmal von 'standardsprachlich'. In diesem Zusammenhang sei auch daraufhingewiesen, daß die Standardisierung von Varietäten herkömmlich wohl eher auf die Kunstprosa bezogen war als auf die Sachprosa, was übrigens von Kloss durchaus eingeräumt wird (Kloss 1978, 77). Man vergleiche dazu z. B. die Abhandlung von Eric A. Blackall (1966) oder den von Paul L. Garvin (1964b) herausgegebenen
'Standardvarietät' und 'Standardsprache'
33
Band über die Prager Theorie der Schriftsprache - darin insbesondere die Arbeiten von Jan Mukafovsky - oder auch nur die Belege in älteren Dudenauflagen, z.B. noch in der Duden-Grammatik von 1959, wo etwa unter „Gattungszahlwörter" (§ 543) nur Textauszüge aus der Kunstprosa angeführt werden, nämlich von Schiller, Wieland, Leip, Spoerl, Zillich, Hauptmann und Carossa, dagegen kein einziger Beleg aus der Sachprosa. Fragen wir nun, ob 'ausgebaut' im Sinne von (2) hinreichendes Merkmal von 'standardsprachlich' ist. Dann müßte die folgende Allproposition wahr sein: 'Alle Varietäten bzw. ihre Elemente, die für Naturwissenschaften und Technologie in Hochschul- und Forscherprosa verwendet werden, sind standardsprachlich (Vx AUG2 x -> Sx))'. Sie läßt sich falsifizieren durch Verifikation der Existenzproposition: 'Es gibt Varietäten bzw. Varietätselemente, die für Naturwissenschaften und Technologie in Hochschul- und Forscherprosa verwendet werden und die nicht standardsprachlich sind (Hx (AUG 2 x A -SX))'.
Würden wir uns auf die Gegenwart beschränken, so dürfte uns die Verifikation unserer Existenzproposition sehr schwer fallen. An einer hochgradigen Konvergenz zwischen S und AUG 2 besteht zumindest für die neueste Zeit wohl kein Zweifel. Anders sieht es dagegen aus, wenn wir uns um einige Jahrhunderte in die Vergangenheit zurück begeben, nämlich in die Zeit der allmählichen Ablösung des Latein als europäischer „Bildungssprache" durch Varietäten des Italienischen, Französischen, Englischen, Deutschen usw. Zwar wird der erst von Kloss gebührend gewürdigten Bedeutsamkeit der Sachprosa (vgl. z.B. Joseph 1980b) in der deutschen Sprachgeschichtsschreibung bis zur jüngsten Zeit nur unzureichend Rechnung getragen. Dennoch läßt sich den traditionellen Sprachgeschichten schon entnehmen, daß spätestens in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts naturwissenschaftliche Schriften auf Hochschulniveau in deutscher Sprache veröffentlicht wurden. Beispiele sind die Arbeiten von Paracelsus (Eggers 1969, 180; Eis 1965) oder auch von Adam Riese (Rechnung auf Linihen, 1518; Rechnung nach der Lenge auff der Linihen und Feder, 1550). Niemand wird die darin verwendeten Varietätselemente für standardsprachlich halten. Nun handelt es sich hier um Grenzfälle, insbesondere was das Hochschulniveau betrifft. Aber offenbar sind die nationalen Varietäten vor allem über Naturwissenschaft und Technologie, die zunächst verachteten „Realdisziplinen", in die Hochschulen eingedrungen (Pörksen 1983, 232). Unzweifelhaft wird unsere stärkere Merkmalversion von 'ausgebaut' erfüllt von den Arbeiten Galileis, der im zweiten Jahrzehnt des 17. Jahrhunderts zum Italienischen überging (Pörksen 1983, 244), ohne daß man die von ihm verwendeten Varietätselemente durchgängig als standardsprachlich einstufen könnte. Diese Beispiele verifizieren unsere Existenzproposition und
34
Ulrich Ammon
belegen, daß 'ausgebaut' auch in der stärkeren Version kein hinreichendes Merkmal von 'standardsprachlich' ist. Wir kommen also wiederum zu dem Ergebnis, daß 'ausgebaut' und 'standardsprachlich' nicht definitorisch miteinander verquickt werden sollten. 'Ausgebaut' beinhaltet die textsortenspezifische (= situationsspezifische) Verwendung einer Varietät sowie die dafür spezifischen Register. Dieses Verständnis entspricht jedenfalls dem erwähnten Hinweis von Kloss auf die „Interdependenz" von „Anwendungsbereichen" (im weiteren Sinn) und „Stilmitteln" (Kloss 1978, 37). Wir sind der Auffassung, daß weder Anwendungsbereiche noch Registerspezifika geeignete Definitionsmerkmale von 'standardsprachlich' abgeben. Wiederum ist die Extension von 'ausgebaut (= in der Sachprosa gängig)' und 'standardsprachlich' interfèrent (AUG n S =£ 0, AUG - S # 0, S - A U G * 0), vermutlich mit einer verhältnismäßig großen Schnittmenge. 3.5 'Geschrieben (SCH)' Dieses potentielle Definitionsmerkmal von 'standardsprachlich' wird nahegelegt durch den teilweise synonymen Gebrauch von Schriftsprache und Standardsprache. Der synonyme Gebrauch wurde gefördert durch die Rezeption der Prager Theorie der „Schriftsprache", in der tschechisch spisovny jazyk teils als Schriftsprache, teils als Standardsprache übersetzt wurde (vgl. z.B. Ising 1982). Die insbesondere im angelsächsischen Sprachgebiet übliche Übersetzung in standard language (z.B. Garvin 1964 a,b) hat dann sogar auf den tschechischen und slowakischen Sprachgebrauch zurückgewirkt, wo inzwischen auch standardni jazyk (tschech., Jedlicka 1978, 58) bzw. standardny jazyk (slowak., Ising 1982, 12) gängig ist. Uns interessiert hier allerdings nicht die strikt synonyme Verwendung, denn 'schriftsprachlich' und 'standardsprachlich' sind in diesem Fall merkmalsidentisch. Bei einem potentiellen Definitionsmerkmal setzen wir einen begrifflichen Unterschied voraus und wählen daher auch die Bezeichnung geschrieben. Ein begrifflicher Unterschied wird auch gemacht in der allerdings eher marginalen Kontroverse in der Soziolinguistik, ob es nicht-geschriebene Standardvarietäten gibt. Diese Möglichkeit wird z.B. bezweifelt von Einar Haugen (1968, 268): "Although it has been asserted that standardization can take place without writing (Stewart 1962, p.24), the evidence for this is slender". Von Paul L. Garvin scheint diese Möglichkeit sogar definitorisch ausgeschlossen zu werden: "written language by d e f i n i t i o n has a place on the standard scale" (Garvin 1974, 74. Hervorhebung im Original). Man beachte allerdings den terminologischen Unterschied: writing bzw. written language, womit sich unter Umständen ein begrifflicher Unterschied verbindet, der in den beiden genannten Kontexten jedoch nicht recht klar wird. Als Verfech-
'Standardvarietät' und 'Standardsprache'
35
ter der von Haugen angezweifelten Auffassung wird zumeist William Stewart genannt (vgl. Haugen oben; auch Joseph 1980a, 113, Anmerkung 86). Dieser nimmt eine auf den ersten Blick widersprüchliche Position ein. Er behauptet einerseits, die Standardisierung einer Varietät sei unabhängig vom „Schreiben" ("writing"), denn es gebe nicht-geschriebene Standardvarietäten: "In a strict sense, standardization is independent of writing, since there have apparently been cases of unwritten languages which have nevertheless been standardized on the basis of traditionally recited and preserved oral models" (Stewart 1962, 24). Dieselbe Auffassung vertritt übrigens auch Heinz Kloss (Kloss/McConnell 1978, 51), auf den sich Stewart sogar zum Teil beruft (auf Kloss 1952, Kap.l). Andererseits nimmt Stewart "writing" dennoch ausdrücklich als definierendes Merkmal von 'Standardisierung' auf: "However, in view of the fact that writing is so frequently a characteristic of present-day standard languages, it will be generally included in the definition of standardization here, but only in the sense of 'an established writing system, together with an appropriate set of orthographical conventions, which has become part of the language's codified grammar'" (Stewart 1962, 24). Spätestens Stewarts Spezifizierung im letzten Zitat verrät, daß hier verschiedene Begriffe im Spiel sind, was durch ein und denselben Terminus, nämlich "writing", eskamotiert wird. Im ersten Fall handelt es sich einfach um 'schriftlichen Gebrauch (Schreibung)', im zweiten Fall um 'kodifizierte Verschriftung'. In beiden Fällen müssen natürlich Schriftzeichen (ideographische oder alphabetische) benützt werden. Der Unterschied besteht jedoch darin, daß nur im zweiten Fall eine in Regeln formulierte verbindliche Orthographie vorliegt - wie Stewart sagt - als Teil der Kodifikation ("codified grammar") der betreffenden Varietät. Da wir uns mit dem Merkmal 'kodifiziert' in den Abschnitten 3.6 und 4.2 ausführlich befassen, beschränken wir uns hier auf den ersten Begriff. In diesem Sinne wollen wir geschrieben verstehen. Wir verzichten hier wiederum auf die denkbare Differenzierung in verschiedene Versionen, da sie uns für unsere Argumentation nicht erheblich erscheint. Es genügt die folgende, in verschiedener Hinsicht vage Definition von 'ein Varietätselement x ist geschrieben': SCHx DEF es gibt mindestens 1 geschriebenen Text, in dem x vorkommt A die Tatsache, daß x dort vorkommt, wird weder vom Schreiber noch von allen Adressaten als Lapsus bewertet (gängiges Vorkommnis) A X wird nicht nur zitiert. Wenn 'geschrieben' notwendiges Merkmal von 'standardsprachlich' ist, so muß die folgende Allproposition wahr sein: Alle standardsprachlichen Varietätselemente sind geschrieben (Vx (Sx -> SCHx)'. Diese Allproposition ist falsifizierbar durch Verifikation der Existenzproposition: 'Es gibt standardsprachliche Varietätselemente, die nicht geschrieben sind (Hx (Sx A ~ SCHx)'.
36
Ulrich Ammon
Beim Verifikationsversuch denkt man vielleicht zunächst an die in der soziolinguistischen Literatur immer wieder genannten Fälle von „Standardisierungen" mittels des Rundfunks, z.B. des Somali über Radio Hargeisa (Andrzejewski 1971). Aber erstens ist in diesen Fällen zumeist nicht gesichert, ob nebenher nicht auch geschrieben wurde, und zweitens handelt es sich, genauer betrachtet, gar nicht um Standardisierung in unserem Verständnis, sondern entweder um die Gebietsausdehnung einer Varietät (vgl. Abschnitt 3.1) oder um ihre Modernisierung durch Schaffung bestimmter Fach Vokabularien. Es gibt jedoch zahlreiche viel näher liegende Beispiele, die nicht geschrieben werden und dennoch unzweifelhaft standardsprachlich sind, nämlich sämtliche standardsprachliche Lautgestalten, die gesamte Orthophonie (= Orthoepie). Sie wird zwar im Falle einer Alphabetschrift in der Orthographie in grober Annäherung abgebildet, weshalb man auch vom „phonologischen Prinzip" spricht, das in der Orthographie wirksam ist. Niemand wird aber behaupten wollen, daß die orthophonischen Elemente selber geschrieben werden. Es gibt eine heikle Ausnahme: die Aussprachewörterbücher. In ihnen sind die orthophonischen Lautgestalten in phonetischer Schrift eindeutig abgebildet. Man kann auch sagen: dort sind die orthophonischen Regeln für die einzelnen Wörter formuliert. Die Beschreibung oder Konstruktion in Regeln darf man aber nicht mit der schriftlichen Verwendung selber gleichsetzen. Sie steht dazu in einem ähnlichen Verhältnis wie das Zitat eines Zeichens zu seinem Gebrauch, also wie Metasprache zu Objektsprache. Ob es sich tatsächlich um Metasprache handelt, ist allerdings fraglich. Daß das Beschreiben in Regeln nicht schon das Schreiben einer Varietät ist, läßt sich auch anders plausibel machen: wäre dies der Fall, so wäre jede linguistische Beschreibung zugleich die Schreibung der betreffenden Varietät. Diese offenkundig absurde Konsequenz wird niemand verfechten wollen. Wir sehen also, daß es in den orthographischen Lautgestalten durchaus standardsprachliche, aber nicht geschriebene Varietätselemente gibt. Durch sie wird unsere Existenzproposition verifiziert. Demnach ist 'geschrieben' in dem von uns erläuterten Sinn auch kein notwendiges Merkmal von 'standardsprachlich'. Dies entspricht übrigens der bekannten Tatsache, daß es sowohl eine „schriftliche Form" als auch eine „mündliche Form" von Standardvarietäten geben kann (Ludwig 1983b, 14f.). Fragen wir nun, ob 'geschrieben' vielleicht hinreichend ist für 'standardsprachlich'. Daß dies nicht der Fall ist, läßt sich leicht zeigen. Es müßte dann nämlich die Allproposition wahr sein: Alle geschriebenen Varietätselemente sind standardsprachlich (Vx (SCHx -> Sx))'. Die dazu kontradiktorische Existenzproposition: 'Es gibt geschriebene Varietätselemente, die nicht standardsprachlich sind (Hx (SCHx A —SX))', ist leicht verifizierbar. Man braucht dazu nur auf die Fülle von Dialektliteratur zu verweisen, durch
'Standardvarietät' und 'Standardsprache'
37
welche die betreffenden Dialekte bzw. deren Elemente noch lange nicht standardsprachlich werden. Demnach sind 'geschrieben' und 'standardsprachlich' zwei definitorisch auseinanderzuhaltende Eigenschaften. Selbstverständlich mag das eine das andere fördern, d. h. zum Teil bewirken. Dies ist jedoch eine kausale und mithin kontingente Beziehung. 3.6 'Kodifiziert (KOD)' Nach verbreiteter Auffassung ist 'kodifiziert' ein besonders geeignetes definierendes Merkmal von 'standardsprachlich'. John E. Joseph hält es für ein notwendiges Merkmal, wenn man seine Formulierung genau nimmt: "No dialect [= Varietät! U. A.] may be considered 'standardized' until it has been codified" (Joseph 1980a, 94. Ähnlich Stewart 1968, 534). Wir verstehen diese Äußerung als die Behauptung der Allproposition: Alle standardsprachlichen Varietäten (allerdings nicht unbedingt alle Varietätselemente!) sind kodifiziert'. Für Jedlicka ist die Kodifiziertheit offenbar sogar hinreichend: „Und gerade die K o d i f i k a t i o n ist nur auf die Schriftsprache [= Standardvarietät? U.A.] beschränkt" (Jedlicka 1978, 62. Hervorhebung im Original. Zur Synonymität von Schriftsprache und Standardvarietät s. ebd. 3, 59f.). Jedlicka hält die Kodifikation jedoch offenbar nicht für notwendig, zumindest nicht für jedes standardsprachliche Varietätselement, denn er zählt auch die „Konversationssprache" zur Standardvarietät, obwohl sie teilweise nicht kodifiziert ist (Jedlicka 1978, 44f.). Neben solchen Auffassungen, die den definierenden Charakter von 'kodifiziert' für 'standardsprachlich' hervorheben, gibt es auch andere. Insbesondere wird die Notwendigkeit des Merkmals in Abrede gestellt - ohne daß es wie bei Jedlicka als hinreichend betrachtet wird. Implizit geschieht dies schon in den Fällen, wo eines oder mehrere der in den Abschnitten 3.1 bis 3.5 besprochenen Merkmale für hinreichend gehalten wird. Ein weiteres Beispiel findet sich bei Pete van de Craen und Hugo Baetens Beardsmore. Sie nehmen für Belgien eine Triglossie an, für die sie neben den Dialekten und dem "Algemeen Nederlands" die Existenz eines "General Southern Dutch" behaupten, das sie folgendermaßen charakterisieren: "This third code serves as an acceptable standard in Flemish Belgium but is not a codified norm ( . . . ) " (van de Craen/Baetens Beardsmore 1984, 2). Allerdings liegt hier ein sehr weiter Begriff von 'standardsprachlich' zugrunde, dies geht daraus hervor, daß van de Craen und Baetens Beardsmore auch das Schwyzertütsch darunter subsumieren; es wird ausdrücklich als weiteres Beispiel eines derartigen "standard" angeführt (ebd., 2). Das Schwyzertütsch gilt jedoch im gängigen Sprachgebrauch als Dialekt (im Sinne einer regionalen Non-Standardvarietät), wenngleich als eine besondere Art von Dialekt,
38
Ulrich Ammon
z.B. als „Ausbaumundart" (Kloss 1978, 58) oder „Nationaldialekt" (Zimmer 1977; Gegenposition: Haas 1978). Nicht hinreichend für 'standardsprachlich' ist 'kodifiziert' offenbar nach Auffassung Renate Bartschs. Jedenfalls verstehen wir so den folgenden Abschnitt, nach dem auch Dialekte kodifiziert sein können, die Bartsch hier deutlich von Standardvarietäten absetzt: "Even the linguists that provide a codification by writing down grammar and a lexicon of a dialect, work under the assumption of descriptive science, that they only write down factual language use and that their formulations are not codifications ( . . . ) " (Bartsch im Druck, 22f.). Nach Auffassung von Bartsch handelt es sich im Gegensatz zur Einschätzung seitens jener Linguisten offenbar tatsächlich um Kodifikationen. Spätestens hier stellt sich die Frage, wie das potentielle Definitionsmerkmal 'kodifiziert' zu verstehen ist. Eigentümlicherweise haben wir nirgendwo eine einigermaßen ausführliche und präzise Explikation gefunden. Sogar in einschlägigen Nachschlagewerken wird der Begriff ganz lapidar erläutert, z.B. als „das Festhalten und die Festlegung der Norm der Schriftsprache (in normativen Grammatiken, Wörterbüchern u . a . ) " (Slovnfk spisovného jazyka ceského 1960, Lemma kodifikace. Übs. Vilém Fried), oder es wird nur auf die Gütekriterien oder Mängel von Kodifikation hingewiesen: Flexibilität bzw. Starrheit (z.B. Vachek/Dubsky 1956, 21). Wie stark jedoch die mit diesem Ausdruck verbundenen Begriffe divergieren können, sei an zwei Beispielen illustriert. Renate Bartsch versteht darunter, was uns nicht ohne weiteres mit obigem Zitat vereinbar erscheint, "an official formulation of a norm concept that is realized as a praxis" (Bartsch 1982, 64; ähnlich Bartsch im Druck, 17). Man achte auf den Zusatz "offiziell", der allerdings nicht näher erläutert wird. Demgegenüber faßt Einar Haugen den Begriff viel weiter. Er differenziert zwischen „formeller" und „informeller Kodifikation"; unter ersterer versteht er vermutlich Ähnliches wie Bartsch. „Informelle Kodifikation" umfaßt aber offenbar die bloße Existenz von Normen ganz ohne ihre Beschreibung: "Informal codification is the rule in any language community ( . . . ) . One can have a high degree of agreement in usage without any formal statement of rules" (Haugen 1966, 20). Unklar scheint auch zu sein, ob eine Kodifikation per definitionem präskriptiv ist, also z. B. „wie eine Vorschrift für die erforderliche normale Verwendung der Schriftsprache als verbindlich empfunden und akzeptiert wird" (Jedlicka 1978, 66), oder ob sie auch deskriptiv (= nicht präskriptiv) sein kann. Im letzteren Sinn versteht offenbar Hadumod Bußmann (1983, 353) den Begriff, wenn sie auch eine „rein beschreibend kodifizierende Grammatikform der (...) deskriptiven Linguistik" für möglich hält. Das potentielle Merkmal 'kodifiziert' scheint uns dringlicher als die zuvor erörterten Merkmalskandidaten explikationsbedürftig. Wir wollen
'Standardvarietät' und 'Standardsprache'
39
nun zunächst einige normtheoretische Begriffe einführen, die uns für einen solchen Explikationsversuch dienlich erscheinen.
4. Lösungshinweise auf normtheoretischer Grundlage 4.1 Einige normtheoretische Begriffe Es ist nun an der Zeit, den Begriff 'Norm' einzuführen. Die Argumente der uns interessierenden Prädikate, die Varietätselemente, sind sprachliche Normen. Für Normen generell ist u. a. charakteristisch, daß sie von Subjekten gelernt werden und daß ihre Einhaltung durch Korrektheitsurteile kontrolliert wird. Genau dies ist bei Varietätselementen offenkundig der Fall, und zwar unabhängig davon, ob sie standardsprachlich sind oder nicht. Von Normen sind, wie Renate Bartsch (1982) verdeutlicht hat, Regeln zu unterscheiden. Dabei ist allerdings zu beachten, daß Norm und Regel polyseme Ausdrücke sind, die oft auch synonym gebraucht werden. Beispielsweise sind die sogenannten sozialen Regeln Normen; desgleichen die „Regeln eines Spiels" im Sinne von Wittgenstein, als deren Sonderfall oft die „Regeln einer Sprache" genannt werden (von Wright 1963, 6f.); diese „Regeln einer Sprache", die beispielsweise in Heringer 1974 behandelt werden, sind im Sinne der Unterscheidung von Bartsch Normen und eben keine Regeln. Bartsch versucht, die Beziehung zwischen den Begriffen 'Norm' und 'Regel' u. a. folgendermaßen zu fassen: Es gibt solche Regeln, mit denen nur Linguisten befaßt sind, z.B. gewisse Transformationsregeln der generativen Transformationsgrammatik. Dies seien keine Normen. Und es gibt außerdem solche Regeln, die auch für die Sprecher selber beim Erlernen und Gebrauch einer Varietät eine Rolle spielen. Diese Regeln seien zugleich Normen. Über die erweiterte Standardversion der generativen Transformationsgrammatik schreibt Bartsch z. B. "not all of its rules belong to or are structurally equivalent to the set of norms themselves" (Bartsch 1982, 69). Es scheint uns aber bedenkenswert, ob man linguistische Regeln, von denen Bartsch handelt, nicht generell als Normbeschreibungen oder Normkonstruktionen (nicht Normformulierungen! von Wright 1963, 93f.) von den sprachlichen Normen selber unterscheiden sollte, und zwar im Sinne der Unterscheidung von Meta- und Objektebene. Wenn wir beim Beispiel einer generativen Grammatik bleiben, so sind zwar die erzeugten Endketten isomorph mit sprachlichen Normen. Sind sie aber die Normen selber? Sind es nicht vielmehr nur deren Beschreibungen oder Abbildungen? Die Normen selber sind Erwartungen der Sprecher und Hörer (Gloy 1980, 363f.) und haben u. E. einen anderen ontologischen Status als linguistische Beschrei-
40
Ulrich Ammon
bungen/Konstruktionen. Es dürfte klar sein, daß Varietätselemente oder Varietäten auf der Ebene der Normen und nicht der Normbeschreibungen (Regeln) liegen. Genauer müßte man sagen: Es sind Normen (Norminhalte) für die S p r e c h e r / S c h r e i b e r . Denn auch Normbeschreibungen (Regeln) können Normen sein, aber nicht für die Sprecher/Schreiber, sondern für die Linguisten. Und für die Normbeschreibungen kann es wiederum Regeln geben, nämlich methodologische Regeln (Metaebene). Hiermit wird auch deutlich, daß Normen stets relativ auf bestimmte Subjekte sind. Vielleicht genügt es schon, diese Relativität zu beachten, um einen klaren Unterschied zwischen Normen und Regeln zu entwickeln, speziell zwischen sprachlichen Normen und linguistischen Regeln. Sowohl für ein besseres Verständnis von Normen als auch für die Explikation von 'kodifiziert' und 'standardsprachlich' erscheint uns vor allem die Normtheorie von Georg H. von Wright (1963) brauchbar. Wir wollen daher einige in unseren Augen wichtige Begriffe daraus skizzieren. Von Wright unterscheidet verschiedenartige Normen im weiten Sinn, von denen er dann die Präskriptionen (= Normen im engeren Sinn) herausgreift und einer genaueren Analyse unterzieht. Sie sind auch für uns besonders interessant. Außer den Präskriptionen nennt und charakterisiert er Regeln im Sinne der „Regeln eines Spiels" ("rules"), Bräuche ("customs"), Direktiven oder technische Normen ("directives or technical norms"), moralische Normen ("moral norms") und ideale Regeln ("ideal rules") (von Wright 1963, 1-16). Für Präskriptionen sind nach von Wright (1963, 70—79) die folgenden Komponenten konstitutiv: (1) der „Normcharakter" ("character of a norm"). Dies ist das Gebotensein (O (...)) oder Erlaubtsein (P (...)) oder auch Nichtgebotensein ( ~ 0 (...)) oder Nichterlaubtsein (= Verbotensein) (~P (...)) des Inhalts der Präskription. „O" steht für "obligation", „P" für "permission". (Deutsch findet man oft „E" anstelle von „P", z. B. bei Kutschera 1973). (2) Der „Norminhalt" ("content of a norm"). Dabei handelt es sich um dasjenige, dem ein bestimmter Normcharakter zukommt, das also geboten, erlaubt usw. ist. Der 'Norminhalt' ist ein etwas schwieriger Begriff, der für uns deshalb bedeutsam ist, weil er die Varietätselemente enthält. Er ist jedoch nicht ohne weiteres mit ihnen identisch. Betrachtet man die Normcharaktere als deontische Operatoren, so sind die Norminhalte deren Argumente, also das, was in (1) an die Stelle der Punkte zu treten hat. Es ist fraglich, ob dies einfach Varietätselemente sein können, denn der Gedanke, ein Varietätselement a sei verboten, geboten usw., ist nicht ohne weiteres klar. Geboten oder verboten sein können nach von Wright nur menschliche Akte (= Handlungen) oder Aktivitäten, also z. B. das - mündliche oder schriftliche - Äußern (Sprechen/Schreiben) des Elements a oder auch die Unterlassung der Äußerung des Elements a. Allerdings ist das mündliche (oder
'Standardvarietät' und 'Standardsprache'
41
schriftliche) Äußern von a keine konkrete, sondern eine „generische Handlung" (von Wright, 23, 72). Sie bedarf zu ihrer Konkretisierung mindestens folgender Ergänzungen: der Angabe des handelnden Subjekts sowie der situativen (raumzeitlichen) Einbettung (vgl. auch Kutschera 1973, 14-16). Diese beiden Komponenten kommen in (5) als „Subjekt der Präskription" und (6) als „Okkasion der Präskription" noch zur Sprache. (3) Die „Anwendungsbedingung der Norm" ("condition of application of the norm"). Dies ist (sind) die Bedingung(en), die erfüllt sein muß (müssen), damit der generische Akt von (2) überhaupt ausgeführt werden kann. Neben solchen trivialen Bedingungen, wie daß der Akt nicht schon ausgeführt ist, scheint uns hierher der Kontext (oder Kotext), speziell der Satzrahmen, zu gehören, in den das fragliche Varietätselement paßt. (1) bis (3) bilden den „Normkern" ("norm-kernel"), den von Wright formalisiert. Die weiteren Komponenten behandelt er nur informell; sie sind jedoch für uns auch bedeutsam. (4) Die „Autorität der Präskription" ("authority of the prescription"). Hier ist - anders als beim Normkern - der spezifische Bezug auf Präskriptionen angebracht, da bei anderen Arten von Normen nicht ohne weiteres bestimmte Autoritäten auszumachen sind. Die Autorität der Präskription ist die Person oder Institution, die sie in Kraft setzt und/oder aufrecht erhält, und zwar durch Androhung von „Sanktionen" für den Fall des Zuwiderhandelns. Man könnte geneigt sein, die Sanktionen als zusätzliche Komponente von Präskriptionen zu betrachten, was von Wright aber ablehnt (1963, 70). Es ist in unserem Zusammenhang wichtig, daß die Autorität der Präskription hierarchisch strukturiert sein kann. Für die Autorität, welche die Präskription ausgibt, mag seinerseits eine Präskription seitens einer übergeordneten Autorität bestehen, die ihr erlaubt oder gebietet usw., die betreffende Präskription auszugeben (von Wright 1963, Kap. X). Beispielsweise gebieten oder verbieten Lehrer den Gebrauch gewisser Varietätselemente in bestimmten Kontexten nicht einfach aus freien Stücken, sondern weil ihnen das wiederum von den Schulbehörden geboten ist; es ist ihnen z.B. nicht erlaubt, im Kontext eines Diktats die Schreibweise zu erlauben, sondern es ist ihnen geboten, zu gebieten. (5) Das „Subjekt der Präskription" ("subject of a prescription"). Dies ist (sind) die Person (Personen), der (denen) vorgeschrieben ist, im Sinne der Präskription zu handeln. Im Falle des unter (4) genannten Beispiels sind auf höherer Stufe der Hierarchie die Lehrer und auf niedrigerer Stufe der Hierarchie die Schüler die Subjekte der jeweiligen Präskription. (6) Die „Okkasion der Präskription" ("occasion for which the prescription is made"). Dies ist (sind) die Situation(en) (Raum-Zeit-Gebiete), durch deren Angabe die generische Handlung zu einer konkreten Handlung wird. Es ist nicht die Situation, in der die Präskription ausgegeben wird,
42
Ulrich Ammon
sondern diejenige Situation, in der die gebotene oder erlaubte usw. Handlung auszuführen oder zu unterlassen ist. Präskriptionen können hinsichtlich der Okkasion „partikular" sein, wenn es sich um bestimmte Einzelsituationen handelt; sie können aber auch hinsichtlich der Okkasion „generell" sein, wenn sie nämlich stets existieren - sofern die Anwendungsbedingungen für sie erfüllt sind. Beispielsweise besteht die unter (4) erwähnte Präskription für Lehrer und Schüler generell unter den betreffenden Anwendungsbedingungen, nämlich im schulischen Diktat, wenn das Wort nämlich diktiert wird. Die Norm selber bzw. die Präskription als Spezialfall einer Norm, die durch die genannten Komponenten charakterisiert wird, ist zu unterscheiden von der „Normformulierung" ("norm-formulation") oder „Normpromulgation" ("promulgation of the norm"). Beide Ausdrücke sind bei von Wright weitgehend synonym (von Wright 1963, 93, 95). Manche Normen, insbesondere Bräuche, existieren auch unformuliert und werden dann imitativ gelernt und befolgt (von Wright 1963, 9, 95). Präskriptionen werden dagegen notwendigerweise promulgiert: "When the norm is a prescription, the promulgation of the norm, /. e. the making of its character, content, and conditions of application (...) known to the norm-subjects is an essential link in (or part of) the process through which this norm originates or comes into existence (being)" (von Wright 1963, 94). Von der „Existenz" ("existence") der Norm (von Wright 1963, Kap. VII), ihrem In-Kraft-Sein, ist ihre „Gültigkeit" ("validity") zu unterscheiden (von Wright 1963, 194-202). {Geltung wird im Deutschen ambig gebraucht für 'Existenz' oder 'Gültigkeit' und ist daher mit Vorsicht zu handhaben). Für ihre Gültigkeit ist ihre Existenz notwendiges Merkmal. Darüber hinaus ist für die Gültigkeit aber noch notwendig, daß eine übergeordnete Norm existiert, die der Autorität die Ausgabe der fraglichen Präskription erlaubt oder gebietet. Gültigkeit hat eine Präskription also stets nur relativ zu einer anderen, übergeordneten Norm. Man kann davon wiederum die „Legitimität einer Norm" unterscheiden, die sie erhält durch eine Begründung im Bezug auf akzeptierte Werte (bei Bartsch 1982, 64, annähernd in diesem Sinn "justification". Vgl. auch Gloy 1975, Kap. 4). Selbstverständlich stehen Normen noch in vielen anderen Beziehungen (Gloy 1975, 34-37); die angeführten sind jedoch die wichtigsten für unsere Zwecke. 4.2 Komponenten eines Explikats von 'kodifiziert (KOD)' In der Explikation von 'kodifiziert' stecken vielleicht die größten Schwierigkeiten für eine Explikation von 'standardsprachlich'. Wir haben sie hier nicht zufriedenstellend gelöst, hoffen jedoch, daß unsere Hinweise einer
'Standardvarietät' und 'Standardsprache'
43
künftigen stringenteren Lösung die Richtung weisen. Bei der Explikation von 'kodifiziert' sollten mindestens die folgenden drei Aspekte berücksichtigt werden: (I) der außerlinguistische juristische Begriff 'Kodifikation' (s. z.B. Erler/Kaufmann 1978, 907-921); (II) der gängige Sprachgebrauch in der Linguistik; (III) die Brauchbarkeit des Explikats als definierendes Merkmal von 'standardsprachlich'. Wir wollen den Bereich des uns hier interessierenden Begriffs zunächst durch einige elementare Abgrenzungen spezifizieren. Offenkundig wäre es wenig sinnvoll, den bloßen Tatbestand sprachlicher Normen schon als Kodifikation zu betrachten. Weiterhin sind auch sprachliche Normen mit Prestige, die höher bewertet werden als andere Sprachnormen, per se noch nicht kodifiziert. Es erscheint uns zweckmäßig, all das, was Einar Haugen (1966, 20. Vgl. Abschnitt 3.6) als „informell kodifiziert" bezeichnet, überhaupt nicht unter dem Begriff 'kodifiziert' zu subsumieren. Auch die bloße Fixierung von Normen in Schrift oder auf Tonträgern ist noch keine Kodifikation, sonst wäre jede Niederschrift eines Textes schon eine Kodifikation. Selbst Texte, die als Vorbild dienen, an denen sich also andere orientieren, oder auch Sammlungen solcher Texte (Chrestomathien) sind allenfalls ein Grenzfall, den wir nicht einbeziehen wollen. Notwendiges Merkmal von 'kodifiziert' scheint uns vielmehr zu sein: die Darstellung der Sprachnormen, genauer: der Sprachnorminhalte, in Regeln. Es scheint uns also ratsam, den Begriff einzuengen auf Haugens „formelle Kodifikation". Damit gelten auch Sprachnorminhalte, die in mehr oder weniger imitierenden Schreibertraditionen weitergereicht werden (Beispiele: altägyptische Schreibtradition, spätmittelalterliche Kanzleien), noch nicht als kodifiziert. Die 'Darstellung in Regeln' ist ein notwendiges Merkmal von 'kodifiziert', gewissermaßen sein linguistisches. Es ist jedoch nicht hinreichend. Hinzukommen muß ein zweites, grob gesprochen, soziologisches: die 'Präskription der durch die Regeln definierten Varietätselemente', die begrifflich noch zu spezifizieren ist. Die bloße Deskription existierender sprachlicher Normen betrachten wir noch nicht als Kodifikation. Sonst wäre jede linguistische Deskription gleich eine Kodifikation. Auch juristisch gilt die bloße Deskription existierenden Rechts noch nicht als Kodifikation, solange sie nicht selber als „Rechtsquelle" dient. Es wäre auch wenig sinnvoll, für jede linguistische Deskription den bedeutungsträchtiger scheinenden Ausdruck Kodifikation zu verwenden; um Verwirrung zu vermeiden, sollte man sich diesen Ausdruck dann besser ersparen. Bei einer Deskription ist die Wahrheitsfrage sinnvoll. Die Deskription ist dann wahr, wenn die beschriebenen Sprachnorminhalte existieren, andernfalls falsch. Bei einer Kodifikation ist die Wahrheitsfrage dagegen nicht
44
Ulrich Ammon
ohne weiteres sinnvoll. Eine Kodifikation kann auch Regeln enthalten, durch die bislang nicht existente Sprachnorminhalte erst eingeführt werden. Man denke nur an Plansprachen wie z.B. das Esperanto, die sehr wohl kodifiziert sein können, ohne daß zum Zeitpunkt ihrer Einführung die durch die Regeln definierten Varietätselemente schon als Sprachnorminhalte existierten. Diesem Tatbestand wird in manchen Erläuterungen des Begriffs 'kodifiziert' Rechnung getragen durch Hervorhebung der bewußten Gestaltung oder Auswahl der Regeln, z. B. bei B. A. Serébrennikow (1973, 469): „Die Kodifizierungen der Normen, d.h. ihre bewußte Auswahl und Fixierung ( . . . ) " . Uns scheint jedoch, daß die Intentionen und Bestrebungen der Verfasser der Regeln nicht entscheidend sind, d.h. weder ein notwendiges noch ein hinreichendes Merkmal für 'kodifiziert' abgeben. Man könnte jedoch für maßgeblich halten, wer die Regeln verfaßt und in wessen Auftrag. So schreiben Paul Garvin und Madeleine Mathiot (1960, 784): "The construction of the norm is entrusted to a condifying [sic!] agency (. . . ) " . Daß es sich hierbei um ein notwendiges Merkmal handelt, liegt vor allem nahe in Anbetracht der Sprachakademien. Die bekanntesten sind diejenigen der italienischen Stadtstaaten (Otto 1972,8), von denen die Accademia della Crusca in Florenz wiederum die berühmteste ist (seit 1582), die Académie Française (seit 1634), die Real Academia Espanola (seit 1713. Milan 1983, besonders 124f.) und ihre südamerikanischen Ableger (Guitarte/Quintero 1968). Neben der Abfassung der Regeln in Sprachakademien gibt es jedoch solche Fälle, wo dies offenbar ganz ohne höheren Auftrag geschehen ist. Besonders auffällige Beispiele sind Samuel Johnson in England und Noah Webster in den USA, die in rein privater Initiative gearbeitet haben (Heath 1976; Heath/Mandabach 1983). Dasselbe gilt hinsichtlich des Serbokroatischen für Vuk Karadzic oder hinsichtlich des Tschechischen für Josef Dobrovsky (Auty, 1970; Jedlicka 1978, 21, 70, 88). Selbst die Abfassung der Dudenbände - mit Ausnahme des Rechtschreibwörterbuchs — ist ein rein privates Unterfangen, ohne jeglichen höheren (staatlichen) Auftrag (vgl. Äugst 1982). Uns erscheint es durchaus angemessen, auch in solchen Fällen von Kodifikation zu sprechen (Auty 1961,365; Jedlicka 1978, passim). Dieser Sprachgebrauch scheint uns auch noch vereinbar mit dem juristischen, wo zunächst rein privat abgefaßte Rechtssammlungen unter gewissen Umständen zu den Kodifikationen im weiteren Sinn gezählt werden dürfen. Beispiele sind vielleicht die mittelalterlichen Rechtsbücher wie der Sachsenspiegel (Autor: Eike von Repgow) oder der Schwabenspiegel (Autor unbekannt). Eine entsprechende begriffliche Festlegung ist jedenfalls, wie die angelsächsischen Beispiele zeigen, geboten, wenn 'kodifiziert' als notwendiges Merkmal von 'standardsprachlich' in Betracht kommen soll. Eine andere Frage ist es, ob die Abfassung der Regeln in staatlichem Auftrag' ein hinreichendes Merkmal für 'kodifiziert' ist. Wenn man von dem
'Standardvarietät' und 'Standardsprache'
45
Extremfall absieht, daß die Abfassung mißlingt, worauf jedoch der Auftrag erneuert werden könnte, so erscheint uns diese Auffassung vertretbar. Allerdings ist dieses Merkmal nur dann hinreichend, wenn man davon ausgeht, daß solchermaßen verfaßte Regeln nach der Abfassung stets als „Rechtsquelle" dienen. Entscheidend ist also auch dann nicht, in wessen Auftrag und von wem die Regeln verfaßt sind, sondern wie sie später gehandhabt werden. Dieser Frage wollen wir uns nun zuwenden. Man könnte zunächst daran denken, daß es darauf ankommt, ob sich irgendwelche Personen in ihrem Sprechen oder Schreiben an den vorliegenden Regeln orientieren. Dies wäre jedoch unzureichend. Insbesondere freiwillige Orientierungen an einem Regelwerk machen dieses noch nicht zu einem Kodex. Auf einer Tagung des Verbandes deutscher Schriftsteller im Saarland (17.-19.2.1984 in Saarbrücken) wurde ich persönlich Zeuge, wie Dialektschriftsteller den Verfassern des Saarbrücker Wörterbuchs (Saarbrükken, Saarbrücker Druckerei und Verlag, 1984), Edith Braun und Max Mangold, dankend bestätigten, daß ihnen mit diesem Wörterbuch ein wichtiges Hilfsmittel an die Hand gegeben sei; dort könnten sie nachschlagen, wie es korrekt saarbrückisch heißt. Im gängigen Sprachgebrauch gelten solche Wörterbücher oder Grammatiken deshalb jedoch noch nicht als Kodifikationen. Wird ein Regelwerk in dem Moment zu einem Kodex, in dem ein Gebot besteht, sich daran im Sprechen oder Schreiben zu orientieren? Auch dies ist noch unzureichend. Beispielsweise mag ein Verleger oder Buchherausgeber seinen Autoren oder Beiträgern gebieten, für ein Buch mit Dialektdichtung sich an einer vorliegenden Dialektgrammatik zu orientieren — bei Strafe der Nichtannahme des Beitrags. Aufgrund eines solchen Gebotes wird man die betreffende Dialektgrammatik jedoch noch nicht als Kodex einstufen. Ein anderer Fall liegt schon vor, wenn ein solches Gebot in einem Verlag satzungsmäßig verankert wird, z. B. für alle in diesem Verlag erscheinende Literatur im betreffenden Dialekt. Während das Gebot zuvor bezüglich der Okkasion partikular war, wird es nun generell (vgl. Abschnitt 4.2). Dies ist ein notwendiges Merkmal von Recht im Unterschied zu einmaligen Geboten (Hart 1961, 20-25). Ein ähnlicher Fall ist der eines Dialektpflegevereins, der seinen Mitgliedern per Satzung gebietet, sich an einer vorliegenden Grammatik zu orientieren. Auch für die barocken Sprachgesellschaften sind ähnliche Verhältnisse vorstellbar, nämlich das generelle Gebot der Orientierung an einem vorliegenden Regelwerk. Dabei ist es nicht so wichtig, ob dieses Gebot geschriebenes „Gesetz" ist, z. B. Bestandteil einer Satzung, oder ungeschriebenes Gewohnheitsrecht. Vielleicht wäre es vertretbar, den Begriff Kodifikation so festzulegen, daß sich derartige Fälle noch darunter subsumieren lassen. Dies wäre auch vereinbar mit einem Definitionsvorschlag von Garvin und Mathiot (1960, 784): "There are two things
46
Ulrich Ammon
involved in codification: (1) the construction of a codified norm, contained in formal grammars and dictionaries; (2) the enforcement of the norm by control over speech and writing habits (...)"• Ein Problem ist allerdings, daß ein derart weitgefaßter Begriff von 'Kodex' sich kaum sinnvoll unterscheiden läßt vom allgemeineren Begriff 'präskriptives linguistisches Regelwerk (präskriptive Grammatik)'. Der Terminus Kodex wäre dann überflüssig. Demgegenüber erscheint es sinnvoller, den Begriff 'Kodex' auf eine bestimmte Art eines präskriptiven linguistischen Regelwerks festzulegen. Ein Artmerkmal (notwendiges Merkmal) läßt sich gewinnen aus dem verschiedentlich genannten offiziellen Status eines Kodex (z.B. Bartsch 1982, 64). Dies wäre auch analog zum juristischen Begriff des 'Kodex'. Nach dem bisher Ausgeführten kann der offizielle Status jedoch nicht die Abfassung der Regeln betreffen, sondern nur die Autorität der Präskription. Deren offizieller Charakter kann wiederum letztlich nichts anderes bedeuten, als daß diese Autorität der Staat ist. Präskriptionsautorität kann der Staat aber nur sein in denjenigen Institutionen, über deren sprachliches Handeln er Macht hat, also in der staatlichen Verwaltung, den Gerichten, dem Militärwesen, den staatlichen Schulen — aber auch in den Privatschulen, sofern sie an staatliche Lehrpläne gebunden sind. Ein linguistischer Kodex wäre demnach ein Regelwerk, an dem sich Gebote sprachlichen Handelns in staatlich kontrollierten Institutionen orientieren. Diese Gebote existieren selbstverständlich nur für bestimmte Präskriptionssubjekte und Okkasionen in den betreffenden Institutionen; für diese existieren sie jedoch generell, also nicht für bestimmte Individuen, sondern für Rollenträger, und nicht für individuelle Situationen, sondern Situationstypen. Sie haben diese generelle Existenz hinsichtlich der Okkasionen, weil sie als eine Art Recht existieren, sei es in ungeschriebener gewohnheitsrechtlicher oder in geschriebener Form (Verordnung, Erlaß o. ä.). Präskriptionsautorität dieses Rechts ist der Staat; er ist jedoch nicht unmittelbare Präskriptionsautorität der betreffenden Gebote selber. Unmittelbare Präskriptionsautoritäten sind Vorgesetzte in den betreffenden Institutionen. Ihnen ist es aufgrund der Rechtslage geboten, d.h. sie sind dazu verpflichtet, ihren Untergebenen in deren dienstlichen Rollen (Funktionen) das Schreiben oder auch Sprechen nach den betreffenden Regeln zu gebieten. Dies ist ihnen nicht etwa nur erlaubt, denn sie dürfen keineswegs beliebige Regeln zugrunde legen. Beispiele solcher Präskriptionsautoritäten sind Vorgesetzte in Behörden bezüglich Schreibkräften als Präskriptionssubjekten oder Lehrer bezüglich Schülern - auch Lehre ist zumeist präskriptiv Vielleicht ist es angemessen, diese komplexe präskriptive Beziehung folgendermaßen zu charakterisieren: Die in dem linguistischen Regelwerk enthaltenen Regeln definieren bestimmte Varietätselemente; bezüglich dieser Varietätselemente sind Gebote offiziell gültig; diese Gebote, deren Inhalt
'Standardvarietät' und 'Standardsprache'
47
(Präskriptionsinhalt) aus den betreffenden Varietätselementen besteht, sind hinsichtlich der Okkasion generell (nicht partikular). Uns scheint es angemessen, bei einem derartigen präskriptiven Status eines linguistischen Regelwerks von einem linguistischen Kodex zu sprechen. Es empfiehlt sich, einige naheliegende Mißverständnisse auszuräumen. Der Kodex braucht den unmittelbaren Präskriptionsautoritäten (Verwaltungsvorgesetzte, Lehrer usw.) nicht unbedingt bekannt zu sein. Ihre Gebote müssen nur im Einklang damit sein, so daß sie sich im Konfliktfall als gültig erweisen. Entsprechendes gilt für die Präskriptionssubjekte, deren sprachliches Handeln nur im Einklang damit zu stehen braucht. Dies ist analog zum Recht, das den Rechtssubjekten auch nicht im einzelnen bekannt zu sein braucht, solange sie nur danach handeln. Was zum Kodex gehört, braucht nicht explizit und präzise abgegrenzt zu sein. Zumeist ist es bei bestimmten Regelwerken eindeutig, daß sie zum Kodex gehören; bei anderen Regelwerken muß dies im Konfliktfall jeweils ausgehandelt werden. Auch dies ist analog zum existierenden Recht. Es ist auch nicht notwendig, daß der Kodex in sich widerspruchsfrei oder einheitlich ist. Man vergleiche z. B. den Siebs (1969) und das Duden: Aussprachewörterbuch (1962; 1974). Beide gehören zum linguistischen Kodex der BRD, divergieren jedoch sowohl hinsichtlich der aufgenommenen Lemmata als auch der Regeln für die einzelnen Lemmata. Man mag bezweifeln, daß speziell bei der Aussprache überhaupt Gebote in staatlichen Institutionen vorliegen, also der Staat letztlich Präskriptionsautorität ist. Man müßte diesen Einwand in der Tat genau prüfen in Schauspielschulen, Theatern, Massenmedien oder in der Schule. Man beachte, daß die Gebote keinesfalls streng zu sein brauchen; es gibt auch sehr milde Gebote. Der Lehrer, der z. B. im Gedichtvortrag eine entsprechende Aussprache durch behutsames Lob „fördert", gebietet auch, wenngleich in sehr milder Form. Ist es ihm beispielsweise erlaubt, eine ganz andere, x-beliebige Aussprache zu fördern als die durch den Siebs oder das Duden: Aussprachewörterbuch definierte? Wenn wir diese Frage verneinen, was den Tatsachen entsprechen dürfte, bestätigen wir damit schon die Existenz eines entsprechenden Gebotes in einer staatlichen Institution. Es ist auch durchaus möglich, daß ein zum Kodex gehörendes Regelwerk nur teilweise gültig ist. Angeregt durch die Prager Schule ist oft auf veraltete oder überspannte Bestandteile von Kodizes hingewiesen worden, auf teilweise „schlechte" oder „falsche" Kodifizierungen (z.B. Havrânek 1964a, 414; Dokulil 1971; Serébrennikow 1973, 479; Jäger 1973, 273f.). Auch hier ist die Abgrenzung im Konfliktfall jeweils auszuhandeln. Wenn der Staat Präskriptionsautorität eines Kodex ist, so ist jeder Kodex gültig für einen bestimmten Staat. Dies schließt freilich zwischenstaatliche Übereinkünfte, ausdrückliche oder stillschweigende, nicht aus. Ein Beispiel
48
Ulrich Ammon
ist die Übereinkunft hinsichtlich der Rechtschreibung zwischen den verschiedenen deutschsprachigen Staaten. Die übrigen Kodexteile, vor allem die Regelwerke für Aussprache und Wortschatz, divergieren „polyzentrisch" zwischen den deutschsprachigen Staaten. Es dürfte schließlich deutlich geworden sein, daß die Verfasser der Regeln nicht die eigentlichen Präskriptionsautoritäten sind. Zu welchen Sanktionsdrohungen wären sie auch in der Lage? Daher sind Appelle an sie, nur zu beraten und keine Vorschriften zu machen (z. B. Dokulil 1971, 100; Tauli 1968, 157), falsch adressiert. Wozu beispielsweise die Dudenredaktion unter dem Eindruck solcher Appelle nur rät oder was sie gar nur „beschreibt" (vgl. „Einleitung" und „Vorwort der Herausgeber" in den Dudengrammatiken 1973 bzw. 1984), das wird an ganz anderen Orten zu Geboten. Allerdings haben regelverfassende Institutionen wie die Dudenredaktion zumindest Einfluß auf den Inhalt dieser Gebote. Nach diesen Hinweisen, die hoffentlich gewisse Mißverständnisse verhindern, bedarf unsere Explikation nurmehr weniger Ergänzungen. Im Rechtswesen ist eine Kodifikation „die ein ganzes Rechtsgebiet umfassende, daher möglichst vollständige, gedanklich und technisch einheitliche Regelung, die in einem Gesetzbuch (codex) enthalten ist" (Erler/Kaufmann 1978, 907). Es dürfte zweckmäßig sein, auch den Begriff 'linguistischer Kodex' entsprechend festzulegen. Die Regeln für ein sprachliches Detail sind noch kein Kodex, erst die für einen ganzen grammatischen Rang (Plan/ Ebene). Der gängige Begriff 'grammatischer Rang' (Lyons 1971, 210f.) ist hier etwas zu erweitern. So sind Schreibung und Aussprache auseinanderzuhalten, die gewöhnlich nicht als verschiedene Ränge gelten. Im einzelnen lassen sich dann grob die folgenden grammatischen Ränge unterscheiden - wobei sicher je nach Grammatiktheorie unterschiedliche Einteilungen möglich sind: die Schreibweise (Graphie), welche die Schriftzeichen und ihre Anordnung (Rechtschreibung) umfaßt, die Aussprache einschließlich der suprasegmentalen Merkmale (Phonie), die Grammatik im engeren Sinn (Morphologie und Syntax) und der Wortschatz einschließlich Idiomatik. Zumeist werden Registerspezifika noch gesondert behandelt. Im einzelnen liegen gewöhnlich die folgenden Regelwerke vor: Rechtschreibwörterbuch, Aussprachewörterbuch, Grammatik, Bedeutungswörterbuch und Stilistik. Diese Teilkodizes bilden zusammengenommen den Gesamtkodex. Keines dieser Regelwerke ist auf einen der grammatischen Ränge beschränkt, sondern erstreckt sich partiell auch auf andere Ränge. So sind z. B. im Bedeutungswörterbuch auch ein Großteil der Graphie und ein Teil der Morphologie definiert oder im Rechtschreibwörterbuch ein Teil des Lexikons, zumindest dessen Ausdrucksgestalten, sowie ein Teil der Morphologie. Je nachdem, welche Regelwerke vorliegen, kann man sagen, die betreffende Varietät ist graphisch, phonisch, grammatisch, lexikalisch oder auch stilistisch de-
'Standardvarietät' und 'Standardsprache'
49
finiert. Liegen die ersten vier genannten Regelwerke vor, so ist sie auf allen Rängen definiert. Man kann schließlich unterscheiden zwischen explizit definierten, d.h. einzeln angegebenen, und nur implizit definierten Varietätselementen. Letztere sind aus den Regeln deduzierbar im Unterschied zu nichtdefinierten Elementen. Beispielsweise sind bei Angabe der verbalen Flexionsparadigmen in der Grammatik und der einzelnen Verben im Lexikon die Flexionsformen derjenigen Verben implizit definiert, die bestimmten Paradigmen explizit zugeordnet sind; die Flexionsformen der übrigen Verben sind dagegen nicht definiert. Wir verzichten auf die Darstellung unseres Explikats in Form einer Explizitdefinition, da die formale Konsistenz noch zu wünschen übrig läßt. Ein 'linguistischer Kodex' hat die folgenden notwendigen Merkmale, deren logische Konjunktion hinreichend ist: (1) Linguistisch: Es liegt ein linguistisches Regelwerk RWvor, und zwar für mindestens einen grammatischen Rang ('Regelwerk für den betreffenden grammatischen Rang') oder für mehrere oder alle vier Ränge ('Regelwerk für alle grammatischen Ränge'). Die Regeln definieren eine Menge DF von Varietätselementen. (2) Soziologisch: bezüglich der durch die Regeln in RW definierten Varietätselemente sind Gebote offiziell gültig. Dies braucht jedoch nicht bezüglich der gesamten Menge DF, sondern nur bezüglich einer Teilmenge offGG Œ DF der Fall zu sein (offGG = Menge derjenigen Varietätselemente aus DF, bezüglich der Gebote offiziell gültig sind); es mag eine Restmenge DF - offGG (z.B. veraltete Varietätselemente) geben, bezüglich der dies nicht zutrifft. Sei a G offGG und 0 der Gebotsoperator, so haben die Gebote grob die Struktur 0(0(a)) - oder vermutlich genauer: 0 (0 (Schreiben a)) oder 0(0 (Sprechen a)), da erst jetzt der Inhalt der inneren Klammer einen generischen Akt repräsentiert. Die durch den Inhalt der äußeren Klammer repräsentierten Gebote sind gültig, insofern sie selber geboten sind (daher die Einbettung in einen zweiten Gebotsoperator). Die Gebote bestehen hinsichtlich der Okkasion generell (nicht partikular). Die mittelbare Autorität der Gebote und die unmittelbare Autorität der Gebotsgebote ist der Staat. Jedes Varietätselement aus der Menge DF ist kodifiziert (KOD), sofern das Regelwerk RW das Merkmal (2) erfüllt. Überhaupt nicht zur Sprache gebracht haben wir die Frage der Legitimation des Kodex, zu der Verfasser oder Kommentatoren oft sehr differenzierte Überlegungen anstellen. Diese Frage ist zwar aus verschiedenen Gründen hochinteressant, gehört aber nicht unmittelbar zur Definition von 'Kodex' bzw. von 'kodifiziert'. Die Legitimität eines Kodex ist abhängig von den damit verfolgten Zwecken, z. B. Festigung der staatlichen Einheit, Sta-
50
Ulrich Ammon
bilisierung einer bestimmten historischen Entwicklungsstufe einer Varietät, Sicherung des Zugang zu bestimmter Literatur, Vereinfachung oder sonstige Förderung des Erlernens der betreffenden Varietät usw. Ein Regelwerk wird gewöhnlich nur dann zum Kodex, wenn es den vorherrschenden politischen Zielen in der betreffenden Gesellschaft, d. h. insbesondere den Zielen der jeweils herrschenden Klasse, dienlich erscheint. 4.3 Vorschlag eines Explikats von 'standardsprachlich (S)' Ist 'kodifiziert' im hier festgelegten Sinn ein notwendiges oder hinreichendes Merkmal von 'standardsprachlich'? Bei Notwendigkeit müßte folgende Allproposition wahr sein: 'Alle standardsprachlichen Varietätselemente sind kodifiziert (Vx (Sx -> KODx))'. Eine vorschnelle Bestätigung verbietet sich, denn in der Fachliteratur finden sich Äußerungen, die damit nicht ohne weiteres verträglich sind. William Stewart unterscheidet zwischen „Standardisierung mit Kodifikation" und „Standardisierung ohne Kodifikation". Im ersten Fall spricht er von „formeller Standardisierung", im zweiten Fall von „informeller Standardisierung" (Stewart 1968, 534, Anmerkung 5). Letztere beruht auf "uncodified but socially preferred norms of usage". Aufgrund dieser Erläuterung könnte man geneigt sein, die „informelle Standardisierung" leichter Hand als außerhalb des Begriffs 'standardsprachlich' liegend zurückzuweisen, da ihre Einbeziehung, wie es scheint, zu ähnlichen Schwierigkeiten führt wie das potentielle Merkmal 'oberschichtlich' (Abschnitt 3.3). Mehr zu denken geben Einwände, die vor allem aus der Prager Schule stammen. Dort wird unterschieden zwischen „tatsächlichem Zustand der Schriftsprache (= Standardvarietät! U. A.)" und „dem in den Handbüchern kodifizierten Sprachzustand" (Jedlicka 1978, 55). Ferner wird die „Norm der Schriftsprache", ihre „Sprachnorm selbst", der „Kodifikation der Sprachnorm (der Schriftsprache! U . A . ) " gegenübergestellt (Havrânek 1964a, 414). Außerdem wird auf die Möglichkeit der „Divergenz zwischen der schriftsprachlichen Norm und ihrer Kodifikation" (Dokulil 1971, 100) hingewiesen und auf „Widersprüche zwischen dem heutigen schriftsprachlichen Usus und der Kodifikation" (Jedlicka 1978, 81. Ähnlich Deme 1972, 259). Bei aller Divergenz in der Terminologie (tatsächlicher Zustand, Norm, Usus), auf die wir hier nicht eingehen können, laufen diese Hinweise allesamt auf die Behauptung der Existenzproposition hinaus, die durch unsere obige Allproposition falsifiziert wäre: 'Es gibt standardsprachliche Varietätselemente, die nicht kodifiziert sind (Hx (Sx A — K O D X ) ) ' . Alois Jedlicka (1978, 81f.) nennt Beispiele dafür aus dem Tschechischen, Lazio Deme (1972, 259) aus dem Ungarischen. Es gibt allerdings auch die andere Auffassung, daß Varietätselemente erst durch die Aufnahme in den linguistischen Kodex standardsprachlich
'Standardvarietät' und 'Standardsprache'
51
werden. Die Ausführungen Günter Drosdowskis verstehen wir beispielsweise in diesem Sinn. Drosdowski unterscheidet zwischen „geltendem Sprachgebrauch" auf der einen Seite und der „Norm (= Standardvarietät! U. A.)" auf der anderen Seite. Der „geltende Sprachgebrauch" wird erst durch die Aufnahme in den linguistischen Kodex standardsprachlich (= „Norm"). „Ständig werden von der Dudenredaktion mithilfe der Sprachkartei Untersuchungen durchgeführt, wird der geltende Sprachgebrauch ermittelt und danach die Norm neu bestimmt (...). Die Dudenredaktion ist heute die einzige Stelle, die regulierend in das Sprachgeschehen eingreift und entscheidet, was richtig oder falsch ist. Im Abglanz der normierten Rechtschreibung haben im Laufe der Zeit auch alle anderen normativen Festlegungen der Dudenredaktion autoritative Geltung erhalten. Mit ihren Sprachnormen trägt die Dudenredaktion heute ganz entscheidend dazu bei, die Standard- oder Hochsprache zu formen und zu stabilisieren, dies um so mehr, als Sprachakademien und Sprachgesellschaften immer mehr an Bedeutung verloren haben (. ..). Bei konkurrierenden Formen oder Konstruktionen, etwa das Auto meines Freundes/das Auto von meinem Freund!meinem Freund sein Auto, bestimmt die Dudenredaktion zunächst einmal den Typ des Sprachgebrauchs, den Bereich der Sprachverwendung. Die Bezeichnungselemente und Verwendungsweisen der Standardsprache sollen normalsprachlich sein, also nicht der Umgangssprache oder der gehobenen Sprachschicht angehören (das Auto meines Freundes ist neutral, meinem Freund sein Auto gehört dagegen der saloppen Umgangssprache an). Sie untersucht dann die Gebräuchlichkeit, stellt die Übereinstimmung im Sprachgebrauch fest und ordnet die sprachlichen Mittel der Standardsprache zu, für die sich ein statistisches Übergewicht ermitteln läßt" (Drosdowski 1980, llf.). Drosdowski behauptet nicht, daß die Dudenredaktion allein entscheidet, was standardsprachlich ist, sondern verweist in diesem Zusammenhang auf weitere, allerdings vergleichsweise unbedeutende Instanzen. Man kann dies folgendermaßen verstehen: einerseits konstituieren die Dudenbände nicht den gesamten Kodex der BRD (was mit unseren Ausführungen in Abschnitt 4.2 gut zu vereinbaren wäre), daneben gibt es weitere Kodexbestandteile (die allerdings kaum genau abgrenzbar sind); andererseits sind aber nur diejenigen Varietätselemente standardsprachlich, die durch den Kodex definiert sind. Die von uns vermutete Auffassung Drosdowskis läßt sich vereinbaren mit der Prager Auffassung, wenn man verschiedene standardsprachliche Schichten unterscheidet: (1) Die innere standardsprachliche Schicht (Si). Sie umfaßt diejenigen Elemente, welche die beiden folgenden Merkmale erfüllen: (a) sie sind kodifiziert (KOD); (b) im Bezug auf sie sind Gebote offiziell gültig (offGG) (vgl. Abschnitt 4.2 (2)). Es ergibt sich also die folgende Definition: Si x D I F KODx A offGGx
52
Ulrich Ammon
Si ist Teilmenge der kodifizierten Varietätselemente: Si ç KOD. Sofern der Kodex „ungültige" Elemente enthält, ist Si echte Teilmenge von KOD: Si c KOD. (2) Die äußere standardsprachliche Schicht (S2). Sie umfaßt diejenigen Elemente, welche die folgenden beiden Merkmale erfüllen: (a) Sie sind nicht kodifiziert (~KOD); (b) Im Bezug auf sie sind Gebote offiziell gültig (offGG). Es ergibt sich also die folgende Definition: S2x DBF ~ KODx A offGGx S2 und Si sind offenkundig disjunkt: Si n S2 = 0. Die Vereinigungsmenge von Si und S2 bildet die Gesamtmenge der standardsprachlichen Varietätselemente (S): S DËF Si u S2. Si und S2 sind damit noch nicht empirisch präzisiert, ebensowenig S. Unsere Explikation hat nur, wie wir hoffen, eine gewisse theoretische Klärung gebracht (vgl. zu theoretischen und empirischen Begriffen Stegmüller 1973, II, D, 45-63). Es dürfte jedoch deutlich geworden sein, daß die empirische Schärfung keine ganz einfache Aufgabe ist und daß gängige Patentlösungen, wie im Deutschen z.B. eine Festlegung einfach anhand der Dudenbände (Notlösung bei Ammon 1985, Henn im Druck), unzureichend sind. 4.4 Zu den Begriffen 'Standardvarietäf und 'Standardsprache' Die Termini Standardvarietät und Standardsprache werden zumeist synonym verwendet. Sie lassen sich jedoch begrifflich sinnvoll differenzieren, wenn man an die Unterscheidung zwischen 'Varietät' und 'Sprache' anknüpft (vgl.Abschnitt 2.1). 'Standardvarietäf wird dann prädiziert von Varietäten, 'Standardsprache' von ganzen Sprachen (= Klassen von Varietäten). Beide Begriffe sind wiederum verschieden von 'standardsprachlich' (in dem in Abschnitt 4.3 explizierten Sinn), das von Elementen von Varietäten prädiziert wird. Eine andere Frage ist die, wie 'Standardvarietäf oder 'Standardsprache' genauer festgelegt werden sollten. Uns erscheint es zweckmäßig, dafür von den verschiedenen „Begriffsformen" auszugehen, die wir am Ende von Abschnitt 1 erwähnt haben. Es erscheint plausibel, daß man Varietäten nach ihrem Anteil von Si-Elementen und S 2 -Elementen ordnen kann; je höher der Anteil von Si-Elementen, desto höher ihr Rang der Standardisierung. Allerdings stehen einer Durchführung dieses Programms bislang die folgenden Hindernisse im Wege, deren Beseitigung nicht einfach sein dürfte. Erstens müßten Varietäten theoretisch gut begründet und hinreichend scharf abgegrenzt werden können. Zweitens müßten Varietätselemente
53
'Standardvarietät' und 'Standardsprache'
theoretisch gut begründet und zuverlässig identifiziert werden können; d.h. es müßte Konsens hinsichtlich einer geeigneten Sprachbeschreibungstheorie bestehen. Drittens müßten die Begriffe Six und S2x empirisch geschärft sein, d. h. es müßten empirisch hinreichend präzise Kriterien vorliegen, wann ein Varietätselement Si, wann S2 und wann weder Si noch S2 ist. Es ist nicht abzusehen, wann diese Hindernisse beseitigt, d.h. die Voraussetzungen für eine strenge Topologisierung oder gar Metrisierung von 'Standardvarietät' geschaffen sein werden. Inzwischen sind jedoch provisorische Lösungen möglich. So kann man den Standardisierungsrang einer Varietät grob nach den vorliegenden Kodexteilen festlegen - wobei allerdings jeweils zu prüfen ist, ob es sich tatsächlich um Kodexteile und nicht einfach um linguistische Deskriptionen handelt. Dafür kommen in Betracht: Kodexteile für die Schreibung, die Lautung, die Grammatik (Morphologie und Syntax), das Lexikon und eventuell für Registerspezifika (Stilistik). Fehlt ein Kodex für die Lautung, so ist allenfalls die geschriebene Sprache standardisiert, z.B. Deutsch vor 1898 (Erscheinen von Siebs). Denkbar wären die folgenden, sehr groben Standardisierungsränge: 1 = einer der genannten Kodexteile liegt vor, 2 = zwei der Kodexteile liegen vor, . . ., 4 (oder eventuell 5) = alle Kodexteile liegen vor. Zusätzlich sind grobe Schätzungen der Vollständigkeit der Kodexteile möglich. Beispielsweise mag die Schreibweise nur in Form allgemeiner Regeln, nicht in Wörterbuchform kodifiziert sein, oder es mögen größere Bereiche der Grammatik fehlen. Hiernach kann man die einzelnen Ränge unter Umständen weiter differenzieren. Auf der Grundlage solch grober Rangbildungen kann man dann einen klassifikatorischen Begriff von 'Standardvarietät' festlegen oder zweckmäßiger vielleicht zwei klassifikatorische Begriffe, z. B.: (1) minimal standardisierte Varietät annähernd vollständig vor;
D|F
mindestens ein Kodexteil liegt
(2) vollständig standardisierte Varietät D EF alle 4 (bzw. 5) Kodexteile liegen annähernd vollständig vor. Eine 'Standardsprache' könnte man minimal einigermaßen praktikabel so festlegen, daß mindestens eine ihrer Varietäten im Sinne von (2) voll standardisiert ist. Abgesehen von dieser rudimentären Festlegung sind zahlreiche weitere Differenzierungen möglich, u.a. nach: - der Anzahl m der standardisierten Varietäten in der betreffenden Sprache (die betreffende Standardsprache ist dann m-zentrisch); - der Anzahl der nicht standardisierten Varietäten im Gebiet jeder standardisierten Varietät der betreffenden Sprache; - der linguistischen Distanz zwischen Standardvarietät und nicht standardisierten Varietäten (größte Distanz, gewichtete Distanz);
54
Ulrich Ammon
- dem Verhältnis zwischen (a), (b) und (c), das sind Personen und Situationen, für die: (a) Gebote im Sinne von Abschnitt 4.2 (2) offiziell gültig sind, (b) die Standardvarietät zur Kommunikation dient ohne die Gültigkeit solcher Gebote, (c) Nonstandardvarietäten zur Kommunikation dienen. (a) und (b) bilden in Renate Bartschs (im Druck, 2) Begriffen die „Existenzdomäne" ("Domain of existence") der Standardvarietät. In modernen Gesellschaften ist die Existenzdomäne der Standardvarietät auf die gesamte Population des betreffenden Staates ausgedehnt. Es gibt sogar für jedes Individuum einen Situationstyp im Sinne von (a), und zwar aufgrund der allgemeinen Schulpflicht. 4.5 Hinweise zur Fruchtbarkeit unseres Explikats Ein Begriffsexplikat ist explanativ fruchtbar, wenn es sich eignet zur Formulierung von Gesetzmäßigkeiten, die ihrerseits Erklärungen, Prognosen und Retrodiktionen ermöglichen. Es ist heuristisch fruchtbar, wenn es das Auffinden neuer Hypothesen erleichtert. Wir können hier zu beiden Arten der Fruchtbarkeit unseres Explikats von 'standardsprachlich' nur einige sehr grobe Hinweise geben. Zunächst einige Beispiele für die explanative Fruchtbarkeit. Die Vertreter der Prager Schule haben in zahlreichen Veröffentlichungen die besondere „Stabilität", den verlangsamten Wandel einer „Schriftsprache" (= Standardvarietät) hervorgehoben (z. B. Havrânek 1964a, 415; 1971, 26; Jedlicka 1978, 37f., 66f.). Wenn wir diese Tendenz zur Stabilität als empirisches Faktum nehmen, so erscheint es von unserem Explikat aus erklärlich. (Von einer formal einwandfreien Erklärung im Sinne von Hempel/Oppenheim sind wir allerdings aus verschiedenen Gründen weit entfernt (vgl. dazu Stegmüller 1974). I. J. Gelb weist darauf hin, daß schon das Schreiben einer Varietät ihren Wandel dramatisch verlangsamt (Gelb 1952, 223f.), dabei wirkt eine Alphabetschrift nachhaltiger stabilisierend auch auf die gesprochene Sprache als eine ideographische oder logographische Schrift, weil sie die Lautgestalt der Morpheme ziemlich genau abbildet. Die stabilisierende Wirkung tritt deshalb ein, weil sich erstens spätere Schreiber an früheren und zweitens die Sprecher an den Schreibern orientieren, d. h. diese imitieren. Diese Orientierung geschieht vor der Standardisierung gewissermaßen freiwillig, wenngleich verschiedene Vorteile (Bequemlichkeit, wirtschaftliche Vorteile, bessere Verständlichkeit) damit verbunden sein mögen. Außerdem ist die Orientierung mühsam, weil die vorliegenden Texte nicht zum Nachschlagen gemacht sind. Beides ändert sich mit der Standardisierung. Aus der Freiwilligkeit wird ein Zwang (Gebotscharakter), der in bestimm-
'Standardvarietät' und 'Standardsprache'
55
ten Situationen permanent wirkt (die Gebote sind hinsichtlich ihrer Okkasionen generell). Außerdem erleichtert der Kodex, der gewöhnlich für ratsuchende Benutzer gestaltet ist (alphabetisches Wörterverzeichnis, Paragrapheneinteilung, Querverweise usw.), die Orientierung in Zweifelsfällen. Nach R. Subbaya haben Standardvarietäten zumeist ein größeres phonemisches Inventar als nicht standardisierte Varietäten, und zwar durch die Aufnahme von Fremdwörtern, die nicht assimiliert werden (nach Bartsch im Druck, 9). Dies erklärt sich zwar einerseits aus der vorherrschenden Verteilung von Standardvarietäten auf die höheren Sozialschichten und deren intensiveren internationalen Kontakten - auf diese soziale Verteilung kommen wir gleich noch zu sprechen. Zum anderen ist die Inventarerweiterung aber auch erklärbar als eine Auswirkung der Kodifikation. Diese wirkt nicht nur stabilisierend, sondern auch akkumulierend. Bei Neuauflagen des Kodex wird leichter etwas hinzugefügt, und zwar aus der Menge S2 (vgl. Abschnitt 4.3), als weggelassen. Man vergleiche nur beispielsweise Konrad Dudens Orthographisches Wörterbuch von 1880 mit dem Duden: Rechtschreibwörterbuch von 1973. Die Inventarerweiterung findet nicht nur in der Phonemik, sondern auf allen grammatischen Rängen statt (Garvin/ Mathiot 1960, 785). Auch zur Erklärung der typischen sozialen Verteilung von Standardvarietäten und Nichtstandardvarietäten trägt unser Explikat bei. In vielen Untersuchungen hat sich gezeigt, daß Standardvarietäten zumeist mehr auf die oberen Sozialschichten und Nichtstandardvarietäten mehr auf die unteren Sozialschichten verteilt sind (Ammon 1973b). Die Erklärung dafür ist komplex. Die oberen Schichten haben einerseits die Macht, ihre eigenen Sprachnormen zur Standardvarietät zu machen. Sie genießen andererseits — per definitionem von 'Oberschicht' — die längere Schulbildung. In der Schule wird aber so gut wie immer die Standardvarietät gelehrt (als Lehrgegenstand des Primärsprachunterrichts). Das Merkmal 'oberschichtlich' ist daher ein einigermaßen zuverlässiger empirischer Indikator für eine Standardvarietät, nicht jedoch ein Definitionsmerkmal (vgl. Abschnitt 3.3). Auch die Tatsache, daß in der Schule so gut wie immer die Standardvarietät gelehrt wird, ist teilweise aus unserem Explikat von 'standardsprachlich' erklärbar. Die Planung der Lehre wird erleichtert und überhaupt erst systematisch möglich, wenn ein Regelwerk vorliegt. Ist eine Varietät nur Unterrichtsmedium und nicht Lehrgegenstand, so ist ein Regelwerk weniger dringlich. Liegt für eine Varietät ein Regelwerk vor und ist sie außerdem Lehrgegenstand einer staatlichen oder einer an staatliche Lehrpläne gebundenen Schule, so ist sie damit nach unserem Explikat auch kodifiziert und überdies - mindestens minimal - standardisiert.
56
Ulrich Ammon
Besonders eng ist der empirische Zusammenhang zwischen Standardisiertheit und Überregionalität einer Varietät. Daher auch der häufige Vorschlag, 'standardsprachlich' durch 'überregional' zu definieren. Die Erklärung dieses empirischen Zusammenhangs ist wiederum komplex. Die Sicherung der überregionalen Kommunikation ist ein mit der Standardisierung besonders häufig verfolgter Zweck. Überregionale Varietäten, die standardisiert sind, verfallen leichter, haben weniger Stabilität (Beispiel: die mittelhochdeutsche Dichtersprache). Die Stabilisierung überregionaler Varietäten liegt vor allem im unmittelbaren Interesse der oberen sozialen Schichten, die in vielen Gesellschaften die überregionale Kommunikation führen. Außerdem eignen sich überregionale Varietäten eher zur Sicherung der gesamtstaatlichen Kommunikation sowie als Nationalsymbole. Sie werden daher auch aus nationalistischen Motiven standardisiert. Noch drei Beispiele für die heuristische Fruchtbarkeit unseres Explikats. Unsere definierenden Merkmale lassen erwarten, daß Standardvarietäten die Tendenz haben, ihre Existenzdomäne auf Kosten von Nichtstandardvarietäten auszuweiten. Sie sind zwar nur für bestimmte Personen (Rollenträger) in bestimmten Situationen geboten; die Gebote sind jedoch weder streng isoliert noch präzise abgegrenzt. Sie bewirken daher auf Dauer die Ausweitung der Existenzdomäne der Standardvarietät. (Hinzu kommt natürlich, daß aufgrund politisch-ökonomischer Veränderung mehr derartige Situationen entstehen können, z. B. durch die Erweiterung der Schulpflicht.) Eine zweite Hypothese, die durch unser Explikat von 'standardsprachlich' nahegelegt wird, ist die, daß die Kodifizierung und die Entstehung einer Standardvarietät eine Repertoireerweiterung der Präskriptionssubjekte bewirken. Das bestehende Gebot zwingt sie, die Standardvarietät soweit zu lernen — unter Umständen zusätzlich zu ihren primären (muttersprachlichen) Varietäten —, daß sie den Sanktionen für das Zuwiderhandeln entrinnen. Drittens ist zu vermuten, daß die Sprecher/Schreiber von Standardvarietäten ein höheres Korrektheitsbewußtsein haben, d.h. auf den Norminhalt (die verwendeten Varietätselemente) stärker achten als Sprecher/Schreiber nichtstandardsprachlicher Varietäten. Dieses höhere Korrektheitsbewußtsein dürfte sich sowohl auf das eigene Sprechen/Schreiben richten (Monitorierung) als auch auf dasjenige anderer Personen. Verursacht ist dieses Bewußtsein durch die bestehenden Gebote bzw. die diesen Geboten Nachdruck verleihenden Sanktionsdrohungen seitens der Präskriptionsautoritäten. In all diesen skizzierten Beispielen handelt es sich um komplizierte Faktorengeflechte, aus denen hier nur unvollständige Ausschnitte angedeutet wurden. Die angedeuteten Erklärungsansätze und Hypothesen, die sich speziell aus unserem Explikat ergeben, sind keinesfalls ein Ersatz, sondern
'Standardvarietät' und 'Standardsprache'
57
nur eine Ergänzung von soziolinguistischen Erklärungsansätzen auf politisch-ökonomischer G r u n d l a g e .
Im Text e r w ä h n t e Literatur Ammon, Ulrich, Dialekt, soziale Ungleichheit und Schule, Weinheim/Basel, Beltz, 1973a (urspr. 1972). Ammon, Ulrich, Dialekt und Einheitssprache in ihrer sozialen Verflechtung, Weinheim/Basel, Beltz, 1973b. Ammon, Ulrich, Vorbereitung einer Explizit-Definition von 'Dialekt' und benachbarten Begriffen mit Mitteln der formalen Logik, in: Mattheier, Klaus J. (ed.), Aspekte der Dialekttheorie, Tübingen, Niemeyer, 1983, 27—68. Ammon, Ulrich, Möglichkeiten der Messung von Dialektalität, in: Besch, Werner/ Mattheier, Klaus J. (edd.), Ortssprachenforschung, Berlin, Erich Schmidt, 1985, 259-282. Andrzejewski, B.W., The Role of Broadcasting in the Adaption of the Somali Language to Modern Needs, in: Whiteley,W H. (ed.), Language Use and Social Change, London, Oxford University Press, 1971, 262-273. Aniche, Godfrey C., Standard Nigerian English and the educated user, in: Indian Journal of Applied Linguistics 8(1), 1982, 71-81. Augst, Gerhard, Soll die Schule Sprachnormen als fest, wandelbar oder veränderbar lehren?, in: Schulen für einen guten Sprachgebrauch, bearb. von Mogge, Britta / Radtke, Ingulf, Stuttgart, Klett-Cotta, 1982, 126-143. Auty, Robert, Spracherneuerung und Sprachschöpfung im Donauraum, 1780—1850, in: Österreichische Osthefte 3, 1961, 363-371. Auty, Robert, Changing Views on the Role of Dobrovsky in the Czech National Revival, in: Brock, P. / Shilling, H. G. (edd.), The Czech Renaissance of the Nineteenth Century, Toronto/Buffalo, 1970, 12-24. Bartsch, Renate, The Concepts 'Rule' and 'Norm' in Linguistics, in: Lingua 58, 1982, 51-81. Bartsch, Renate, Norms of Language in Language Planning and Language Development, im Druck (erscheint in Lingua). Bartsch, Renate / Vennemann, Theo, Grundzüge der Sprachtheorie: eine linguistische Einführung, Tübingen, Niemeyer, 1982. Bellmann, Günter, Mundart — Schriftsprache — Umgangssprache, in: Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 79, 1957, 168—181. Besch, Werner, Sprachnorm-Kompetenz des Bundestages? Das Beispiel der Handwerkernamen, in: Studien zur Volkskultur, Sprache und Landesgeschichte: Festschrift für Matthias Zender, 2 Bde., Bonn, Ludwig Röhrscheid, 1972, 993-1015. Blackall, Eric A., Die Entwicklung des Deutschen zur Literatursprache 1700—1775, Stuttgart, Metzler, 1966 (engl. 1959). Bromley, M., The Linguistic Relationship of Grand Valley Dani: A Lexico-statistical Classification, in: Oceania 37(4), 1967, 286-308. Bußmann, Hadumod, Lexikon der Sprachwissenschaft, Stuttgart, Kröner, 1983. Byron, Janet, Selection among Alternates in Language Standardization: The Case of Albanian, The Hague/Paris, Mouton, 1976. Carnap, Rudolf, Induktive Logik und Wahrscheinlichkeit, bearb. von Stegmüller, Wolfgang, Wien, Springer, 1959.
58
Ulrich Ammon
Carnap, Rudolf, Symbolische Logik, Wien/New York, Springer, 31968 (urspr. 1954). Casad, Eugene H., Dialect Intelligibility Testing (Publicaton No. 38), Norman/Oklahoma, Summer Institute of Linguistics, 1974. Chambers, J. K. / Trudgill, Peter, Dialectology, Cambridge, Cambridge University Press, 1980. Clyne, Michael G., Language and society in the German-speaking countries, Cambridge, Cambrigde University Press, 1984. Coulmas, Florian (ed.), A Festschrift for Native Speakers, The Hague, Mouton, 1981. van de Craen, Pete/Baetens Beardsmore, Hugo, Language Standardisation in Progress (unveröff. Ms.), 1984. Deme, Laszlö, Standard Hungarian, in: Benkl, L. / Imre, S. (edd.), The Hungarian Language, The Hague/Paris, Mouton, 1972, 255-298. Deprez, Kas / Geerts, Guido, Lexical and Pronominal Standardization: The Evolution of Standard Netherlandic in West Flanders (Belgium) (Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik, Beiheft 22), Wiesbaden, Steiner, 1977. Dokulil, Milos, Zur Frage der Norm der Schriftsprache und ihrer Kodifizierung, in: Benes, Eduard/Vachek, Josef (edd.), Stilistik und Soziolinguistik, Berlin/München, List, 1971 (tschech. 1952), 94-101. Drosdowski, Günther, Der Duden — Geschichte und Aufgabe eines ungewöhnlichen Buches, Mannheim/Wien/Zürich, Bibliographisches Institut, 1980. Duden, Konrad, Vollständiges orthographisches Wörterbuch der deutschen Sprache, Leipzig, Bibliographisches Institut, 1880. Duden: Aussprachewörterbuch, bearb. von Max Mangold, Mannheim /Wien/Zürich, Bibliographisches Institut, 1962, 21974. Duden: Grammatik der deutschen Gegenwartssprache, neu bearb., Mannheim/Wien/ Zürich, Bibliographisches Institut, 1959, 21966, 31973, 41984. Duden: Das große Wörterbuch der deutschen Sprache, 6 Bde., Mannheim/Wien/ Zürich, Bibliographisches Institut, 1976-1981. Duden: Rechtschreibung der deutschen Sprache und der Fremdwörter, Mannheim/ Wien/Zürich, Bibliographisches Institut, 161967, 171973. Dyen, Isidore, A lexicostatistical classification of the Austronesian languages, Baltimore, Waverly, 1965. Eggers, Hans, Deutsche Sprachgeschichte III: Das Frühneuhochdeutsche, Reinbek bei Hamburg, Rowohlt, 1969. Eis, Gerhard, Zum deutschen Wortschatz des Paracelsus, in: Vor und nach Paracelsus: Untersuchungen über Hohenheims Traditionsverbundenheit und Nachrichten über seine Anhänger (= Medizin in Geschichte und Kultur 8), Stuttgart, 1965, 322-327. Erler, Adalbert / Kaufmann, Ekkehard (edd.), Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, vol. II, Berlin/Bielefeld/München, Erich Schmidt, 1978. Ferguson, Charles A., The Language Factor in National Development, in: Anthropological Linguistics 4 (1), 1962, 23-27. Ferguson, Charles A. / Gumperz, John J., Linguistics Diversity in South Asia: Studies in regional, social and functional variation, in: International Journal of American Linguistics 26 (3), 1960, 1-118. Garvin, Paul L., The Standard Language Problem — Concepts and Methods, in: Language in Culture and Society: A Reader in Linguistics and Anthropology, New York, 1964a, 521-526. Garvin, Paul L. (ed.), A Prague School Reader on Esthetics, Literary Structure, and Style, Washington D. C , Georgetown University Press, 1964b. Garvin, Paul L., Some Comments on Language Planning, in: Fishman, Joshua A.
'Standardvarietät' und 'Standardsprache'
59
(ed.), Advances in Language Planning, The Hague/Paris, Mouton, 1974, 69-78. Garvin, Paul L. / Mathiot, Madeleine, The Urbanization of the Guarani Language A Problem in Language and Culture, in: Wallace, Anthony F. C. (ed.), Men and Cultures, Philadelphia,University of Pennsylvania Press, 1960, 783—790. Gelb, I. J., A Study of Writing, London, Routledge and Kegan Paul, 1952. Gloy, Klaus, Sprachnormen I: Linguistische und soziologische Analysen, StuttgartBad Cannstatt, Fromann-Holzboog, 1975. Gloy, Klaus, Sprachnorm, in: Althaus, Hans P. / Henne, Helmut /Wiegand, Herbert E. (edd.), Lexikon der Germanistischen Linguistik, Tübingen, Niemeyer, 21980, 363-368. Goebl, Hans, Sprachklassifikationen im Spannungsfeld zwischen Politik und Wissenschaft, in: Messner, Dieter (ed.), Das Romanische in den Ostalpen, Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1984, 207—244. Grimes, Barbara F. (ed.), Languages of the World: Ethnologue, Dallas/Texas, Wycliffe Bible Translators, 101984. Groenke, Ulrich, On Standard, Substandard, and Slang in Icelandic, in: Scandinavian Studies 38, 1966, 217-230. Gudschinsky, Sarah C , TheABC's of Lexicostatistics (Glottochronology), in: Word 12 (2), 1956, 175-210. Guitarte, Guillermo L. / Quintero, Rafael, Linguistic Correctures and the Role of the Academics, The Hague/Paris, Mouton, 1968. Gumperz, John J. / Nairn, C M . , Formal and Informal Standards in the Hindi Regional Language Area, in: Ferguson, Charles A. / Gumperz, John J. (edd.), Linguistic Diversity in South Asia (= International Journal of American Linguistics 26, No. 3), 1960,92-118. Haarmann, Harald, Elemente einer Soziologie der kleinen Sprachen Europas. Vol. 2: Studien zur Multilingualismusforschung und Ausbaukomparatistik, Hamburg, Buske, 1979. Haas, Walter, Wider den Nationaldialekt, in: Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik 45(1), 1978,62-67. Hart, H. L. A., The Concept of Law, Oxford, Clarendon, 1961. Haugen, Einar, Language Conflict and Language Planning: The Case of Modern Norwegian, Cambridge/Mass., Harvard University Press, 1966. Haugen, Einar, The Scandinavian Languages as Cultural Artifacts, in: Fishman, Joshua A. / Ferguson, Charles A. / Das Gupta, Jyotirindra (edd.), Language Problems of Developing Nations, New York usw., Wiley, 1968, 267-284. Haugen, Einar, Language Planning in Modern Norway, in: The Ecology of Language: Essays by Einar Haugen, ed. by A.S. Dil, Stanford/Ca., Stanford University Press, 1972 (urspr. 1961), 133-147. Havranek, Bohuslav, Zum Problem der Norm in der heutigen Sprachwissenschaft und Sprachkultur, in: Vachek, Josef (ed.), A Prague School Reader in Linguistics, Bloomington/London, Indiana University Press, 1964a (urspr. 1936), 412-420. Havranek, Bohuslav, The Functional Differentiation of the Standard Language, in: Garvin, Paul L. (ed.), ^4 Prague School Reader on Esthetics, Literary Structure, and Style, Washington, Georgetown University Press, 1964b (tschech. 1932), 3-16. Havrânek, Bohuslav, Die Theorie der Schriftsprache, in: Benes, Eduard /Vachek Josef (edd.), Stilistik und Soziolinguistik, Berlin/München, Paul List, 1971 (urspr. 1969),19-37. Heath, Shirley B., A National Language Academy? Debate in the New Nation, in: International Journal of the Sociology of Language 11,1976, 9 - 4 3 . Heath, Shirley B. / Mandabach, Frederick, Language Status Decisions and the Law in
60
Ulrich Ammon
the United States, in: Cobarrubias, Juan / Fishman, Joshua A. (edd.), Progress in Language Planning: International Perspectives, Berlin/New York/Amsterdam, Mouton, 1983,87-105. Heger, Klaus, 'Sprache' und 'Dialekt' als linguistisches und soziolinguistisches Problem, in: Göschel, Joachim / Nail, Norbert / van der Eist, Gaston (edd.), Zur Theorie des Dialekts (Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik, Beiheft, Neue Folge 16), Wiesbaden, Steiner, 1976 (urspr. 1969), 215-235. Hempel, Carl G., Fundamentals of Concept Formation in Empirical Science, Chicago, University of Chicago Press, 1952. Henn, Beate, Nonstandardmuster als syntaktische Varianten und das Problem ihrer Arealität, Habil.-Schrift Universität Duisburg, im Druck. Henne, Helmut / Objartel, Georg, German Student Jargon in the Eighteenth and Nineteenth Centuries, Berlin/New York, de Gruyter, 1982/1983. Henne, Helmut / Objartel, Georg (edd.), Bibliothek zur historischen deutschen Studenten- und Schülersprache, 6 Vol., Berlin/New York, de Gruyter, 1984. Heringer, Hans J. (ed.), Seminar: Der Regelbegriff in der praktischen Semantik, Frankfurt/Main, Suhrkamp, 1974. Ising, Erika, Theorie der Literatursprache in der CSSR, in: Direktor des Zentralinstituts für Sprachwissenschaft der Akademie der Wissenschaften der DDR (ed.), Sprachwissenschaftliche Informationen, Vol. 4, Berlin/DDR, Zentralstelle für sprachwissenschaftliche Information und Dokumentation, 1982, 5—72. Ising, Erika / Kleinfeld, Annemarie / Schnerrer, Rosemarie, Forschungen zu einer Theorie der Literatursprache und der Sprachkultur in der DDR (= Sprachwissenschaftliche Informationen 7), Berlin/DDR, Zentralstelle für sprachwissenschaftliche Information und Dokumentation, 1984. Jäger, Siegfried, Standardsprache, in: Althaus, Hans P. / Henne, Helmut / Wiegand Herbert E. (edd.), Lexikon der Germanistischen Linguistik, Tübingen, Niemeyer, 1973,271-275. Jedlicka, Alois, Die Schriftsprache in der heutigen Kommunikation, Leipzig, Verlag Enzyklopädie, 1978 (tschech. 1974). Joseph, John E., The Standard Language: Theory, Dogma, and Sociocultural Reality (PH. D. The University of Michigan 1981), Ann Arbor/Mi., University Microfilms International, 1980a. Joseph, John E., Rez. von „Heinz Kloss: ,Die Entwicklung neuer germanischer Kultursprachen seit 1800. ' 2. erweiterte Ausgabe. Düsseldorf: Pädagogischer Verlag Schwann, 1978. 463pp.", in: Language Problems and Language Planning 4, 1980b, 160-162. Kahane, Henry / Kahane, Renée, Decline and survival of Western prestige languages, in: Language 55, 1979, 183-198. Klein, Wolfgang, Variation in der Sprache: ein Verfahren zu ihrer Beschreibung, Kronberg/Ts., Skriptor, 1974. Klein, Wolfgang / Dittmar, Norbert, Developing Grammars: The Acquisition of German Syntax by Foreign Workers, Berlin/Heidelberg/New York, Springer, 1979. Kleine Enzyklopädie Deutsche Sprache, ed. Fleischer, Wolfgang et al., Leipzig, Bibliographisches Institut, 1983. Kloss, Heinz, Die Entwicklung neuer germanischer Kultursprachen seit 1800, Düsseldorf, Schwann, 21978 (urspr. 1952). Kloss, Heinz / McConnell, Grant D. (edd.), The Written Languages of the World: A Survey of the Degree and Modes of Use, Vol. 1: The Americans, Québec, Les Presses de l'Université Laval, 1978.
'Standardvarietät' und 'Standardsprache'
61
Kutschera, Franz von, Einführung in die Logik der Normen, Werte und Entscheidungen, Freiburg/München, Alber, 1973. Lewandowski, Theodor, Linguistisches Wörterbuch, 3 Bd., Heidelberg, Quelle & Meyer, 1973-1975. Lewis, Glyn E., Multilingualism in the Soviet Union, The Hague/Paris, Mouton, 1972. Ludwig, Otto, Writing Systems and Written Language, in: Coulmas, Florian / Ehlich, Conrad (edd.), Writing in Focus, Berlin/New York/Amsterdam, Mouton, 1983a, 31-43. Ludwig, Otto, Einige Vorschläge zur Begrifflichkeit und Terminologie von Untersuchungen im Bereich der Schriftlichkeit, in: Günther, Klaus B. / Günther, Hartmut (edd.), Schrift, Schreiben, Schriftlichkeit, Tübingen, Niemeyer, 1983b, 1-15. Lyons, John, Einführung in die moderne Linguistik, München, Beck, 1971 (engl. 1968). Mackey, William F., Bilinguisme et Contact des Langues, Paris, Klincksieck, 1976. Mattheier, Klaus J., Pragmatik und Soziologie der Dialekte, Heidelberg, Quelle & Meyer, 1980. Milan, William G., Contemporary Models of Standardized New World Spanish: Origin, Development, and Use, in: Cobarrubias, Juan / Fishman, Joshua A. (edd.), Progress in Language Planning: International Perspectives, Berlin/New York/Amsterdam, Mouton, 1983, 121-144. Müller-Thurau, Claus P., Laß uns mal 'ne Schnecke angraben: Sprache und Sprüche der Jugendszene, Düsseldorf/Wien, Econ, 61983. Mukafovsky, Jan, Standard Language and Poetic language, in: Garvin, Paul L. (ed.), A Prague School Reader on Esthetics, Literary Structure, and Style, Washington, D. C , Georgetown University Press, 1964 (tschech. 1932), 17-30. Otto, Karl F., Die Sprachgesellschaften des 17. Jahrhunderts, Stuttgart, Metzler, 1972. Pétursson, Magnus, Isländisch, Hamburg, Buske, 1978. Phillips, Kathleen, The Initial Standardization of the Yambeta Language, Diss. University of Yaounde (Kamerun), 1979. Pörksen, Uwe, Der Übergang vom Gelehrtenlatein zur deutschen Wissenschaftssprache. Zur frühen deutschen Fachliteratur und Fachsprache in den naturwissenschaftlichen und mathematischen Fächern (ca. 1500—1800), in: Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik 13 (51/52), 1983, 227-258. Popper, Karl R., Logik der Forschung, Tübingen, Mohr, 1973 (urspr. 1934). Radtke, Ingulf, Die Umgangssprache: Ein weiterhin ungeklärtes Problem der Sprachwissenschaft, in: Muttersprache 83, 1973, 161 — 171. Ray, Punya, Language Standardization, The Hague, Mouton, 1963. Rubin, Joan, Rez. von , Janet Gyron: 'Selection among Alternates in Language Standardization: The Case of Albanian'. The Hague, Paris: Mouton, 1976.", in: Language Problems and Language Planning 3, 1979, 48-50. Serébrennikow, B. A. (ed.), Allgemeine Sprachwissenschaft, Vol. I, München/Salzburg, Fink 1973 (russ. 1970). Siebs: Deutsche Aussprache, ed. de Boor, Helmut / Moser, Hugo /Winkler, Christian, Berlin, de Gruyter, 191969. Slovnik spisovného jazyka ceského (Wörterbuch der tschechischen Schriftsprache), Vol. I, ed. vom Institut für tschechische Sprache der tschechischen Akademie der Wissenschaften, Prag, unter Leitung von Havrânek, Bohuslav, 4 Vol., Prag, Academia Praha, 1960ff. Steger, Hugo, Gruppensprachen, in: Zeitschrift für Mundartforschung 31, 1964, 125-138. Stegmüller, Wolfgang, Probleme und Resultate der Wissenschaftstheorie und Analyti-
62
Ulrich Ammon
sehen Philosophie, Vol. II: Theorie und Erfahrung, Berlin/Heidelberg/New York, Springer, 1970-1973. Stegmüller, Wolfgang, Probleme und Resultate der Wissenschaftstheorie und Analytischen Philosophie, Vol. I: Wissenschaftliche Erklärung und Begründung, Berlin/ Heidelberg/New York, Springer, 1974 (urspr. 1969). Stewart, William A., An Outline of linguistic typology for describing multilingualism, in: Rice, F. A. (ed.), Study of the Role of second languages in Asia, Africa and Latin America, Washington, 1962, 15-25. Stewart, William A., A sociolinguistic typology for describing national multilingualism, in: Fishman, Joshua A. (ed.), Readings in the Sociology of Language, Den Haag/Paris, Mouton, 1968, 530-545. Swadesh, Morris, Perspectives and problems of Amerindian comparative linguistics, in: Word 10, 1954, 306-332. Swadesh, Morris, Towards greater accuracy in lexicostatistic dating, in: International Journal of American Linguistics 21, 1955, 121 — 137. Tauli, Valter, Introduction to a Theory of Language Planning, Uppsala, Almqvist & Wiksell, 1968. Ullendorf, Edward, Is Biblical Hebrew a Language?, Wiesbaden, Harrassowitz, 1977. Vachek, Josef / Dubsky, Josef, Dictionnaire de Linguistique de l'Ecole de Prague, Utrecht/Anvers, Éditions Spectrum, 1956. Veblen, Thorstein, The Theory of the Leisure Class, New York, Macmillan, 1899. von Wright, Georg H., Norm and Action: A Logical Enquiry, London, Routledge & Kegan Paul, 1963. Wüster, Eugen, Internationale Sprachnormung in der Technik, Bonn, Bouvier, 31970 (urspr. 1931). Wurm, Stephan A., Pidgins, Creoles, Lingue Franche and National Development, in: Valdman, Albert (ed.), Pidgin and Creole Linguistics, Bloomington/London, Indiana University Press, 1977, 333-357. Zimmer, Rudolf, Dialekt — Nationaldialekt — Standardsprache, in: Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik 44 (2), 1977, 145-157.
' Standardvarietät' und 'Standardsprache' Liste verwendeter Zeichen {} c ç 3 3 n u 0 | | \-> < > X > ~ A v -> H V 0 E
Mengenangabe echte Teilmenge von Teilmenge von echte Obermenge von Obermenge von Schnittmenge von Vereinigungsmenge von Restmenge von (ohne die nachfolgende Menge) leere Menge Kardinalzahl der Menge eindeutige Abbildung einer Menge auf eine andere (Funktion) Angabe geordneter n-Tupel Summe zahlenmäßig größer logische Negation logische Konjunktion logische Alternative (Disjunktion) logisches Konditional (materiale Implikation) Existenzquantor Allquantor Gebotsoperator Erlaubnisoperator
63
„Substandard" und „Subnorm". Die nicht-exemplarischen Ausprägungen der „Historischen Sprache" aus varietätenlinguistischer Sicht Jörn Albrecht (Mainz-Germersheim)
0. 0.1 0.2 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 2. 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 3. 3.1 3.2 3.3 3.3.1
Einführung Vorläufige Definitionen Inhaltsübersicht Die sprachliche Variation und ihre Beschreibung Die Variation des Sprechens im allgemeinen Variation innerhalb der Einzelsprache Variable, Varianten, Varietäten Varietätengrammatiken Vorzüge und Schwächen der Varietätengrammatiken Besondere Schwierigkeiten mit lexikalischen Variablen Jede Einzelsprache hat ,ihren' Substandard Sprachnormierung und Geschichte Das Problem der sprachlichen Norm Das Problem der sprachlichen Korrektheit Die unterschiedlichen „Architekturen" der Einzelsprachen Die Herausbildung der Norm im Französischen, Italienischen und Deutschen Unterschiedliche Beurteilung der Variation im Raum Unterschiede des Verhältnisses von dialects und styles „Geschrieben" vs. „gesprochen" Gibt es universelle Charakteristika der Substandardvarietäten? Das Problem der 'Vereinfachung' Größere Regelmäßigkeit (Typologische) 'Fortschrittlichkeit' Tendieren die Substandardvarietäten unserer europäischen Sprachen in besonderer Weise zum ,analytischen' Ausdruck? 3.4 Kleine Typologie der Substandardvokabeln 3.4.1 Pseudoreflexiva im Substandard 4. Ausblick 0. Einführung 0.1 Die Termini Substandard und Subnorm werden in der soziolinguistischen Literatur weitgehend synonym gebraucht. Wenn hier eine Differenzierung vorgeschlagen werden soll, so geschieht dies nur um der begrifflichen Klarheit willen, nicht aus dem Ehrgeiz heraus, unpräzise gebrauchte Fachtermini strenger zu normieren. Ich werde im letzten Abschnitt dieses Aufsatzes aus Gründen, die gleich darzulegen sein werden, auf die Einhaltung der eingangs eingeführten terminologischen Regelung verzichten.
66
Jörn Albrecht
Der Terminus Substandard wurde vermutlich von Bloomfield wenn nicht geprägt, so doch einer breiten Öffentlichkeit als (schwach normierter) Fachterminus bekanntgemacht (vgl. Bloomfield 121973, 52); er ist im Kontext einer im strengen Sinne 'deskriptiven' (d. h. nicht-präskriptiven) Linguistik entstanden und bezieht sich somit auf das 'Normale', auf die Ist-Norm. Der Terminus Subnorm, der vor allem im romanischen Bereich gebraucht wird (vgl. z.B. Müller 1975, 184), gehört zum begrifflichen Instrumentarium von Sprachwissenschaftlern, die keine Normaskese üben, ja oft ganz bewußt nicht üben wollen; er bezieht sich somit auf das 'Anzustrebende', auf die Soll-Norm (vgl. 2.1). Durch die beiden Begriffe wird also ein bestimmter Bereich von Erscheinungsformen einer Einzelsprache aufgrund unterschiedlicher Kriterien ausgesondert. Da nun aber die Sprachnormierung keine creatio ex nihilo ist, sondern immer nur eine Art von Auswahlprozeß aus dem Vorrat des bereits Bestehenden darstellt, und da sie außerdem, wenn sie erfolgreich ist, auf das Bestehende zurückwirkt, führt die Anwendung der beiden unterschiedlichen Aussonderungskriterien in der Praxis zu sehr ähnlichen Ergebnissen. Bei der Vorführung konkreten sprachlichen Materials kann daher der Unterschied zwischen Substandard und Subnorm vernachlässigt werden. Wenn man - wie ich es hier tun werde — die Soll-Norm einer historischen Einzelsprache als in „diaphasischer" Hinsicht (vgl. 1.2) nicht homogen ansieht; m . a . W , wenn man der Tatsache Rechnung trägt, daß viele Sprachnormierer für geringere' Ausdrucksbedürfnisse ,niedrigere' Ausdrucksmittel expressis verbis zugelassen haben (vgl. 1.1), dann könnte man den Terminus Subnorm für einen besonderen Gegenstandsbereich reservieren, nämlich für den ,unteren' Bereich der Soll-Norm, zu dem u.a. ein großer Teil der sog. „gesprochenen Sprache" gehört1. Dieser mögliche spezifische Gebrauch des Terminus Subnorm ist jedoch meines Wissens in der soziolinguistischen Literatur nicht üblich. 0.2 Im vorliegenden Band erscheint — dem Rahmenthema entsprechend - nur der erste Abschnitt dieses auf drei größere Teile angelegten Aufsatzes; die beiden folgenden Abschnitte, die sich im wesentlichen auf drei Einzelsprachen, nämlich Französisch, Italienisch und Deutsch, beziehen werden, folgen in einem weiteren, von denselben Herausgebern betreuten Band, der den Problemen des sprachlichen Substandards in den Einzelsprachen gewidmet sein wird. Aus Gründen der Übersichtlichkeit (ich werde in 1
Mit dieser Ansicht widerspreche ich ausdrücklich einer heute weit verbreiteten Meinung, die erstmals von Ludwig Soll (1974, 28-36) vertreten wurde und derzufolge innerhalb beider Modalitäten der Sprache, der geschriebenen und der gesprochenen, mit einer diaphasischen Variation sui generis zu rechnen sei (vgl. 1.3 und 2.3.4).
„Substandard" und „Subnorm"
61
diesem Abschnitt gelegentlich auf die folgenden verweisen) soll bereits an dieser Stelle der Inhalt des gesamten Aufsatzes skizziert werden: Zunächst wird das Phänomen der sprachlichen Variation vorgeführt und seine Behandlung bei verschiedenen Autoren diskutiert werden. Im Mittelpunkt der Betrachtung steht das ,statische' Modell der „Architektur der Historischen Sprache" von Leiv Flydal und Eugenio Coseriu, das sich besser als die modernen Varietätengrammatiken dazu eignet, Unterschiede im Gefüge der Varietäten verschiedener Einzelsprachen anschaulich hervortreten zu lassen. Ferner wird etwas ausführlicher auf das Verhältnis von Varianten und Variablen sowie auf die „Dimensionen der Variabilität" einzugehen sein. Der zweite Abschnitt ist speziell dem Bereich des „Substandard" bzw. der „Subnorm" gewidmet. Es geht zunächst um die Sprachnormproblematik im allgemeinen und um das Problem der sprachlichen „Korrektheit" (bzw., negativ gesehen, des ,Sprachfehlers'), und es wird schließlich zu zeigen sein, daß die Stellung der Norm im Gesamtgefüge der Varietäten einer Einzelsprache historisch bedingt und somit von Sprache zu Sprache verschieden ist. Konkret zeigt sich das u.a. in der unterschiedlichen gesamtgesellschaftlichen Beurteilung der räumlichen („diatopischen") Variation und im jeweils spezifischen Verhältnis zwischen sozialer („diastratischer") und situationeller („diaphasischer", „qualitativer") Variation. Im dritten Abschnitt soll der Frage nachgegangen werden, ob es ,rein sprachliche' Charakteristika von Substandardvarietäten gibt, die wenigstens einigen Einzelsprachen gemeinsam sind. Gemeint sind Erscheinungen, die sich ohne Rekurs auf außersprachliche Parameter beschreiben lassen. Es wird zu prüfen sein, ob sich Begriffe wie „größere Regelmäßigkeit" („Übergeneralisierung von Regeln", nicht selten vorschnell als „Vereinfachung" bezeichnet), „typologische Progressivität" (d.h. schnellere und konsequentere Fortsetzung eines typologischen Wandels, der sich in der Geschichte der Gesamtsprache abzeichnet) zur globalen Charakterisierung von Substandardvarietäten eignen. Schließlich soll anhand einer kleinen, provisorischen „Typologie von Substandardvokabeln" der Unterschied zwischen sprachlichen' und ,nicht-sprachlichen' Eigentümlichkeiten der Substandardvarietäten aufgezeigt werden 2 .
2
Dabei stütze ich mich — wie in vielen anderen Punkten dieses Aufsatzes — auf meine unveröffentlichte Habilitationsschrift aus dem Jahre 1977: „Standard" und „Substandard" im Lexikon des Französischen und Italienischen. Zum Problem der sozio-stilistischen Indizierung („Registermarkierung") in französischen und italienischen Wörterbüchern.
68
Jörn Albrecht
1. Die sprachliche Variation und ihre Beschreibung Das Wort Sprache wird im Deutschen gewöhnlich im Plural oder mit einem Quantor bzw. mit einschränkenden Bestimmungen (französisch, italienisch usw.) verwendet; es bezeichnet dann die Verwirklichung des Sprechens (einer allgemein menschlichen Fähigkeit) „nach einer historisch bestimmten und bedingten Technik" (Coseriu 1966b, 111). Von der „Sprache" schlechthin wird weit seltener gesprochen; man überläßt dergleichen „Abstraktionen" nicht ungern den Sprachwissenschaftlern und den Philosophen. Nun kann es sich bei der Verwendung des Wortes Sprache im Singular ohne zusätzliche Bestimmungen um - zumindest - zwei verschiedene Arten von „Abstraktion" handeln: Es kann entweder davon abgesehen werden, w e l c h e historisch bedingte und bestimmte Technik des Sprechens konkret gemeint ist, oder es kann der Schluß vom unmittelbar beobachtbaren Sprechen auf die ihm zugrundeliegende Technik des Sprechens selbst gemeint sein. Ich will hier die erste Art der Abstraktion „Generalisierung", die zweite - mangels eines besseren Ausdrucks — „Hypostasierung" nennen. 1.1 Lange Zeit interessierten sich die Sprachwissenschaftler hauptsächlich für den Aspekt des Problems, der mit der „generalisierenden" bzw. „partikularisierenden" Verwendung des Wortes Sprache zusammenhängt. Der Linguist hatte sich zu fragen, wie groß denn die Gesamtheit der bei verschiedenen sozialen Gruppen wahrnehmbaren Unterschiede des Sprechens sein mußte, wenn man mit einiger Berechtigung nicht von ,Abarten' e i n e r Sprache, sondern von v e r s c h i e d e n e n S p r a c h e n sprechen wollte. Bei dieser Fragestellung stand die räumliche Differenzierung sprachlicher Erscheinungen zunächst im Vordergrund, und zwar meist in Form taxonomischer Hierarchisierungsprobleme vom Typ „selbständige ,Sprache' oder ,Dialekt einer Sprache'?" 3 . Weit seltener werden andere Kriterien als das der räumlichen Differenzierung bei dem Versuch berücksichtigt, verschiedene „Techniken des Sprechens" voneinander abzugrenzen. Als ein Versuch in dieser Richtung darf der üblicherweise mit elocutionis genera überschriebene Komplex der antiken Rhetorik gelten. Es geht hier um stilistische' Unterschiede in einem wohldefinierten Sinn: Es werden jeweils Klassen von zur Verfügung stehenden Ausdrucksmitteln (praktisch handelt es sich fast ausschließlich um lexikalische Einheiten) mit Typen von zu behandelnden Themen korreliert. 3
Noch im Jahre 1969 sah Klaus Heger, ausgehend von der „nicht gerade neue(n) Erkenntnis, daß der Grad der Wohldefiniertheit der Termini 'Sprache' und 'Dialekt' in krassem Mißverhältnis zu ihrem vielfältigen Gebrauch in der Sprachwissenschaft steht", sich veranlaßt, die betreffende Unterscheidung endlich „auf zuverlässige Kriterien zu stützen" (vgl. Heger 1969, 46 bzw. 48).
„Substandard" und „Subnorm"
69
So ist z.B. ein bestimmtes Thema für das genus humile geeignet und somit im stilus humilis zu behandeln; andere Themen haben eine Affinität zum genus medium oder zum genus sublime und erfordern daher eine Behandlung im stilus mediocris bzw. gravis*. Dabei ist jeweils eine Auswahl aus dem Gesamtvorrat der zur Verfügung stehenden sprachlichen Mittel zu treffen. Sicherlich hätten die antiken Rhetoriker diese verschiedenen „Stile" nicht als unterschiedliche 'Sprachen' im modernen Verständnis des Wortes interpretiert; das taten sie jedoch auch mit der räumlichen, an unterschiedliche Kulturkreise gebundenen Differenzierungen des Sprechens nicht mit der Selbstverständlichkeit, mit der wir es heute tun. Die „Hypostasierung" der verschiedenen Arten des Sprechens zu verschiedenen „Sprachen", derzufolge man nicht lateinisch redet, sondern Latein spricht bzw. k a n n , ist in der Antike erst ansatzweise erkennbar (vgl. Coseriu 1966b, 112). Die „Hypostasierung" oder „Reifizierung" des Sprechens in einer bestimmten Art und Weise zu einer „Sprache" ist im natürlichen' Sprachgebrauch der modernen europäischen Nationen vorgebildet; die wesentlichen definitorischen Bestandteile der langue fand Ferdinand de Saussure in seiner Muttersprache vor. Ein weiteres Abgrenzungskriterium, das in einem Teil der modernen Soziolinguistik eine überragende — wenn auch weitgehend ungeklärte Rolle spielt, ist das der Zugehörigkeit von Sprechergruppen zu einer bestimmten sozialen Schicht5. Eine besonders radikale Ansicht zu diesem Punkt vertrat Friedrich Schleiermacher. Er ging so weit zu behaupten, daß „nicht nur die Mundarten verschiedener Stämme eines Volkes und die verschiedenen Entwicklungen derselben Sprache oder Mundart in verschiedenen Jahrhunderten schon in einem engeren Sinn verschiedene Sprachen sind, und nicht selten einer vollständigen Dolmetschung untereinander bedürfen", sondern daß darüber hinaus „selbst Zeitgenossen, nicht durch die Mundart getrennte, nur aus verschiedenen Volksklassen, welche durch den Umgang wenig verbunden und in ihrer Bildung weit auseinandergehen", sich oft nur „durch eine ähnliche Vermittlung" (d.h. „Dolmetschung") verstehen können (Schleiermacher 1813/1973, 38). Seit mehr als hundert Jahren - vermutlich schon viel länger - haben sich Sprachwissenschaftler bemüht, taxonomische Systeme zu entwerfen mit 4
5
Vgl. Lausberg 1963,156f. Dante hat sich sichtlich bemüht, den Vorschriften der antiken Schulrhetorik im Bereich der elocutionis genera gerecht zu werden. So wählt er z. B. verschiedene Signifikanten zum Ausdruck des Signifikats „alt" in Abhängigkeit von der jeweiligen Stillage: «Un vecchio, bianco per antico pelo» (Inf. III, 83 = genus humile); «vidi presso di me un veglio solo» (Purgat. I, 31 = genus medium); «credea veder Beatrice, e vidi un sene» (Parad. XXXI, 59 = genus sublime). Bei sene handelt es sich vermutlich um eine spontane Entlehnung aus dem Lateinischen. Auf die Unterscheidung von „Klasse" und „Schicht" bzw. auf die marxistische Kritik am Schichtenmodell der „bürgerlichen" Soziologie kann hier nicht eingegangen werden. Vgl. hierzu Hager/Haberland/Paris 1973, 210ff.
70
Jörn Albrecht
dem Ziel, den gesamten Bereich der sprachlichen Variation begrifflich zu gliedern. Beispiele für dergleichen Bemühungen findet man u.a. bei Hermann Paul (81968, 33 und 404), Joseph Vendryes (1923/68, 259-271), Leonard Bloomfield (121973, 52) und in neuerer Zeit bei Dieter Wunderlich (1974, 138f.). Alle Versuche, das Problem in den Griff zu bekommen, haben sich mit einem scheinbar in sich selbst widersprüchlichen Befund auseinanderzusetzen: Einerseits finden sich keine zwei Sprecher, die genau gleich sprechen, und selbst eine Person zeigt kaum je über längere Zeit hinweg ein völlig homogenes sprachliches Verhalten; andererseits scheint dennoch zwischen einer erstaunlich großen Zahl von Sprechern gegenseitiges Verstehen gewährleistet zu sein, obwohl doch das Zustandekommen einer im engeren Sinne sprachlichen Kommunikation nur damit zu erklären ist, daß die dabei beteiligten Partner über den gleichen Zeichenvorrat verfügen. Zwei einander entgegengesetzte, extreme Positionen sind denkbar, mit deren Hilfe versucht werden könnte, die Aporie zu überwinden: a) Es gibt ebensoviele „Sprachen" wie Sprecher, genauer gesagt, wie Sprechakte 6 ; jedoch ist dennoch innerhalb verhältnismäßig großer Gruppen Verständigung möglich, da jedes Individuum „mehrsprachig" ist7; b) es gibt überhaupt nur eine „Sprache", und alle Unterschiede beim Sprechen resultieren nicht daraus, daß in verschiedenen Sprachen gesprochen wird, sondern daraus, daß ein und dieselbe Sprache auf ganz verschiedene Art und Weise v e r w e n d e t werden kann 8 . 6
7
8
Von manchen Autoren wird angenommen, der gesamte Vorrat an Zeichen und Regeln eines einzelnen Sprechers, der sog. Idiolekt, repräsentiere die homogenste Ausprägung einer Sprache. Diese Annahme ist aus zwei Gründen unsinnig: 1. Wenn man annimmt, daß die intersubjektive Dimension für das Wesen der „Sprache" in jeder ihrer noch so partikulären Ausprägung konstitutiv ist (und das tun zumindest diejenigen, die in Sprachen „Kommunikationssysteme" sehen), dann kann es sich beim „Idiolekt" per definitionem nicht um eine Sprachausprägung, eine „Varietät" handeln. 2. Viele Sprecher verfügen in einem durchaus handfesten (hier nicht erst zu diskutierendem) Sinn über die unterschiedlichsten Varietäten einer Sprache (oder über verschiedene Einzelsprachen) und 'switchen' nicht selten von einer zur anderen. Wir gelangen also nicht durch induktive Generalisierung zum gesuchten Aussonderungskriterium, sondern wir müssen über dieses Kriterium schon vor der „Klassifikation des Materials" verfügen (vgl. u.a. Coseriu 3 1978, 63f., und Wunderlich 1974,139). Die folgende Äußerung eines bekannten Sprachwissenschaftlers kommt der Position a) immerhin schon ziemlich nahe: „Wir sprechen mehrere Sprachen, Teilsprachen, schon in unserer Muttersprache . . . Wir wechseln immer wieder von der einen zur anderen Sprache, je nachdem, mit wem wir sprechen, vor wem wir sprechen. . . . wer Ohren hat, zu hören, wer Augen hat, zu sehen, weiß aus alltäglicher Erfahrung, daß eine Sprache eigentlich ein Konglomerat von Sprachen ist" (Wandruszka 1971,127). Nicht wenige Autoren haben in völliger Verkennung der Problematik, die Saussures langue — parole — Dichotomie aufwirft, alle Phänomene der Variation, die innerhalb einer Einzelsprache auftreten, zu „Performanzerscheinungen" erklärt - das gilt vor allem für die codes von Basil Bernstein. Im Vorgriff auf eine erst noch
„Substandard'' und „Subnorm"
71
Diese beiden Positionen wurden bewußt in dieser extremen Form vorgeführt, um gleich deutlich werden zu lassen, wohin die simple Reduzierung unserer Fragestellung auf eine einzige begriffliche Unterscheidung führen muß. Keiner der soeben genannten Autoren vertritt eine dieser beiden extremen Positionen, aber alle operieren mit ,Begriffspyramiden' die auf einer kombinierten Anwendung der beiden w o. erörterten Abstraktionsarten, der „Generalisierung" und der „Hypostasierung", beruhen. Sie gehen also ähnlich vor wie Saussure, der glaubte, mit seiner langue-parole-Dichotomie gleich „zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen zu können": En séparant la langue de la parole, on sépare du même coup: 1° ce qui est social de ce qui est individuel; 2° ce qui est accessoire et plus ou moins accidentel. (CLG, 30) Es dürfte allgemein bekannt sein, wie groß die Schwierigkeiten sind, die Saussure mit dieser (apokryphen?) Formulierung seinen Exegeten bereitet hat. Genausowenig wie man das Sprachsystem von der Sprachverwendung auf der einen und eine individuelle Technik des Sprechens von einer kollektiven auf der anderen Seite mittels einer einzigen begrifflichen Operation unterscheiden kann, lassen sich unsere beiden Abstraktionsschritte kombiniert bzw. in hierarchisch geordneter Reihenfolge vornehmen. Es handelt sich nämlich um zwei Operationen, die auf demselben logischen Niveau stehen und deshalb nicht hierarchisch, sondern nur in Form von „Kreuzklassifikation" auf den Gegenstandsbereich angewendet werden können. Genau dieser Methode hat sich vor dreißig Jahren E. Coseriu bedient - mit dem Unterschied, daß er, teilweise in Anlehnung an Aristoteles, nicht zwei binäre, sondern zwei ternäre Unterscheidungen auf seinen Untersuchungsgegenstand anwendet. Ausgehend von der von vielen Autoren in immer neuen Varianten formulierten Erkenntnis, daß 'Sprache' sich nur im Sprechen konkret manifestiert, nimmt er sich vor, die viel bemühte Aussage Wilhelm von Humboldts, daß Sprache èvéQyeia, nicht EQyov sei, wirklich ernst zu nehmen und unter „Sprache" eine Art von Tätigkeit zu verstehen. Eine Tätigkeit im allgemeinen kann man nach Aristoteles unter drei verschiedenen Gesichtspunkten betrachten: a) als solche, xax' èvéQyeiav; b) als Tätigkeit inpotentia, xaxà ôuvauiv; c) als eine in ihren Ergebnissen oder Erzeugnissen verwirklichte Tätigkeit, xax'ëQYovDa das Sprechen im besonderen eine universelle Tätigkeit ist, die von einzelnen Individuen geleistet wird, die ihrerseits Glieder historischer Gemeinschaften sind, muß man speziell die Tätigkeit des Sprechens auch unter diesen drei weiteren Gesichtspunkten betrachten. Schematisch läßt sich das folgendermaßen darstellen: einzuführende Terminologie sei an dieser Stelle gleich bemerkt, daß man in den Unterschieden zwischen den verschiedenen „Varietäten" einer Sprache keine Erscheinung der 'Sprachverwendung', sondern durchaus Unterschiede der 'Sprachsysteme' zu sehen hat.
72
Jörn Albrecht
P^s.
Betrach- xax' èvéoyeiav tungs^ \ w e i s e als Tätigkeit Ebene \ ^
xatà ôiivauiv
xax' ëoyov
als tun können
als Ergebnis
universell
Sprechen im allgemeinen
sprechen können
die Gesamtheit des 'Gesprochenen' (bzw. Geschriebenen)
historisch
die konkrete Sprache
eine Sprache können (languei)
die abstrakte Sprache. Sie wird, insofern sie anderen als Muster dient,
^v
' individuell
f das tatsächliche Sprechendes einzelnen
sich mittels einer oder mehrerer Sprachen ausdrücken können
zu
I
der „Text"
(vgl. Coseriu, 31978, 44f., und 1981, 273) So viel zur Variation des Sprechens im allgemeinen. Möchte man sich auf die Variation in e i n e r S p r a c h e konzentrieren, so hat man das, was im obenstehenden Schema als „historische Ebene" erscheint, einer näheren Prüfung zu unterziehen. Die besonderen Schwierigkeiten entstehen dadurch, daß man unter 'Sprache ' gewöhnlich eine Einzelsprache oder, wenn man so will, eine Nationalsprache versteht, also ein mehr oder weniger 'künstlich' geschaffenes Konglomerat, eine Art von Kompromißlösung zwischen (genetisch meist eng verwandten) „Techniken des Sprechens" 9 . So sind die primären Dialekte in der Regel älter als die dazugehörige 'Sprache', und was man gemeinhin als „dialektale Abweichung" bezeichnet (d.h. als Variation im Raum im engeren varietätenlinguistischen Sinn), ist Ergebnis eines Überlagerungsprozesses, bei dem die alten Dialekte als Substrate der Hochsprache auftreten: (regional gefärbte) Umgangssprache (Moser 1960, 219), français régional (Chaurand 1972, 13), italiano regionale (Cortelazzo 1976, 18f.) usw. Vergleichbares gilt auch für die anderen „Dimensionen der Variation", auf die in 1.3 einzugehen sein wird. 9
Aus diesem Grunde sahen viele Sprachwissenschaftler des 19. Jh. in den Literatursprachen keine geeigneten Objekte für die 'wissenschaftliche' Sprachbetrachtung: „An dem mangel ausnahmslos durchgreifender lautgesetze bemerkt man recht klar, dass unsere Schriftsprache keine im munde des Volkes lebendige mundart, keine ungestörte Weiterentwicklung der älteren sprachform ist. Unsere volksmundarten pflegen sich als sprachlich höher stehende, regelfestere Organismen der wissenschaftlichen betrachtung darzustellen, als die Schriftsprache" (Schleicher 1860,170).
„Substandard" und „Subnorm"
73
Mit meiner Exkursion in das Gebiet der Variation des Sprechens im allgemeinen wollte ich zeigen, daß es willkürlich und falsch ist anzunehmen, die Variation in e i n e r S p r a c h e - sofern es sich nicht um „freie" oder „kombinatorische Variation" im strukturalistischen Sinn handelt, die in diesem Zusammenhang nicht interessiert - sei ein Problem der S p r a c h v e r w e n d u n g , gehöre in den Bereich der „Performanz" 10 . Bei den verschiedenen Ausprägungen einer Sprache handelt es sich genau wie bei den Einzelsprachen selbst durchaus um verschiedene 'Sprachsysteme', die sich allerdings noch weit weniger als jene einfach dadurch abgrenzen lassen, daß man sie mit Sprechergruppen „korreliert". Wenn man schon nicht sicher sein kann, daß alles, was Franzosen sagen, als „Französisch" anzusehen ist, so darf man im Falle von regional oder sozial begrenzten Gruppen eines Volkes noch weniger darauf vertrauen, daß man nur den beobachtbaren Sprachgebrauch dieser Gruppen zu generalisieren brauche, um einen (in varietätenlinguistischer Hinsicht relevanten) Dialekt oder Soziolekt zu erhalten. Es müssen vielmehr 'systeminterne' Kriterien mit herangezogen werden, Kriterien, die aus der systematischen Betrachtung der aufzufindenden „Technik des Sprechens" selbst abzuleiten sind, und man hat dabei notgedrungen — zirkulär, d.h. nach dem trial and error-Verfahren vorzugehen. Wie dies geschehen könnte, soll der folgende Abschnitt zeigen, der einem früheren Modell der sprachlichen Variation gewidmet ist, das im Umkreis des 'aufgeklärten Strukturalismus' entstanden ist. 1.2 In der 'Vulgataversion' des Cours de linguistique générale (CLG), auf die ich mich hier ausschließlich beziehe, weil sie für die Geschichte der Sprachwissenschaft sehr viel wichtiger ist als die später aufgefundenen Notizen des 'wahren' Saussure, wird — kurz nachdem die Termini synchronisch und diachronisch eingeführt worden sind — versichert, ein Sprecher habe keine Kenntnis von vergangenen Stadien seiner Sprache (CLG, 117); die Rede (parole) funktioniere ausschließlich auf der Grundlage eines „Sprachzustandes" (état de langue; CLG, 127). An dieser Behauptung hat der norwegische Linguist Leiv Flydal (1951, 255f.) Anstoß genommen. Bis zu einem gewissen Grade habe jeder Sprecher Kenntnis nicht nur von älteren Stadien, sondern auch von unterschiedlichen regionalen Ausprägungen seiner Sprache. Flydal hält den Terminus Sprachzustand für unglücklich gewählt, weil man geneigt ist, ihn ausschließlich auf die zeitliche Dimension zu beziehen, während Saussure selbst ihn ausdrücklich auch auf eine Ausprägung mit räumlich begrenzter Geltung angewendet wissen wollte (CLG, 143). Flydal geht nun noch einen Schritt weiter und bezieht eine weitere Dimen10
Selbstverständlich ist der Gebrauch, den jeder einzelne von den Varietäten macht, die er beherrscht, ein Problem der Sprach Verwendung.
74
Jörn Albrecht
sion der Variation in seine Überlegungen mit ein: die soziale Schichtung innerhalb einer historischen Sprachgemeinschaft. Er ersetzt den seiner Ansicht nach zur Bezeichnung des gesamten Sachverhalts ungeeigneten Saussureschen Terminus durch den (ebenfalls nicht besonders glücklichen) Ausdruck structure de langue und nennt das ganze, aus mehreren 'Strukturen' oder doch wenigstens 'Teilstrukturen' zusammengesetzte Gebäude "architecture d'ensemble de la langue" oder schlicht "architecture de langue". Strukturunterschiede, die zwischen verschiedenen Ausprägungen der Nationalsprache innerhalb ihres geographischen Geltungsbereichs bestehen, nennt er diatopisch; diejenigen, die durch die Zugehörigkeit der Sprecher zu verschiedenen sozialen Schichten bedingt sind, diastratisch. Eine 'Sprachstruktur\ die keine geographisch bedingten Unterschiede aufweist, die somit in topischer Hinsicht als homogen anzusehen ist, heißt syntopisch; synstratisch nennt er entsprechend die in stratischer Hinsicht homogene Struktur. Die Rede {parole) ist nicht, wie Saussure angenommen zu haben scheint (vgl. w. o.), ausschließliche und konsequente Realisierung einer dieser „Strukturen", sondern sie bedient sich zur Erzielung gewisser 'stilistischer' Effekte der Ausdrucksmittel verschiedener Strukturen (Flydal 1951, 248). Da nach traditioneller Auffassung auch die Wahl von Einheiten, die innerhalb derselben 'Struktur' funktionieren, zur „Stilistik" gerechnet wird (z.B. die Entscheidung darüber, ob man einen zu beschreibenden Gegenstand Haus oder Gebäude nennt oder ob man eine Handlung aktivisch oder passivisch schildert), schlägt Flydal vor, den bewußten Einsatz von Elementen aus verschiedenen 'Sprachstrukturen' zur Erzeugung bestimmter 'stilistischer' Effekte „interstrukturelle stilistische Wahl" {opération stylistique interstructurale im Unterschied zur „intrastrukturellen stilistischen Wahl", der opération stylistique intrastructuralé) zu nennen (vgl. Flydal 1951, 253). Flydal war es darum gegangen, das Verhältnis von 'Sprachzustand' und 'Stil' darzustellen, wobei unter letzterem die individuelle Ausschöpfung der Ressourcen einer Einzelsprache durch 'Mischung von Zuständen', durch den bewußten Einsatz von „Extrastrukturalismen" zu verstehen ist (vgl. Zimmer 1981, 131ff.). Coseriu hat diese Überlegungen aufgegriffen, in verschiedenen Punkten modifiziert und ergänzt und zu einem begrifflichen Instrumentarium weiterentwickelt, mit dessen Hilfe aus der Vielfalt des Sprechens das ideale Beschreibungsobjekt der strukturellen Sprachwissenschaft isoliert werden soll: die funktionelle Sprache (langue fonctionelle), die der historischen Sprache, d.h. der Nationalsprache in ihren verschiedensten Ausprägungen, gegenübersteht (vgl. Coseriu 1966, 51). Coserius wichtigste Ergänzung gegenüber Flydal stellt die Heranziehung eines weiteren Kriteriums dar, mittels dessen ein von Flydal nicht ausdrücklich berücksichtigter Typ von Unterschieden innerhalb einer historischen Sprache erfaßt werden kann: die Unterschiede in der Modalität des Ausdrucks, die ihrerseits von
„Substandard" und „Subnorm"
75
der „Situation" im weitesten Sinne (vgl. w.u.) bedingt sind. Unterschiede dieser Art nennt Coseriu (analog zum Gesamtplan der von Flydal vorgeschlagenen Terminologie) diaphasisch. Eine synphasische (in phasischer Hinsicht einheitliche) Technik des Sprechens heißt bei Coseriu Sprachstil, die syntopischen Techniken werden, je nach Kommunikationsradius mit bereits eingebürgerten Termini wie Dialekt oder Regionalsprache benannt, die synstratischen Techniken heißen Sprachniveaus oder Sprachebenen. Eine „funktionelle Sprache" läßt sich nicht, wie von einigen Interpreten behauptet worden ist11, disjunkt, sondern nur als Konjunktion dieser drei Begriffe darstellen, d.h. sie muß in topischer, stratischer und phasischer Hinsicht einheitlich sein. Noch einige Bemerkungen zum Terminus diaphasisch, der in der neueren Literatur nicht immer in angemessener Weise rezipiert worden ist. Die diaphasischen Unterschiede bei Coseriu werden durch eine Reihe von Faktoren bedingt, die in der Soziolinguistik meist als selbständige, von keinem übergeordneten Begriff abhängige Differenzierungskriterien erscheinen: Geschlecht, Alter des Sprechers, Rollenbeziehung zwischen Sprecher und Adressaten, Sprechsituation und anderes mehr. Coseriu ordnet alle diese Faktoren einem einheitlichen Begriff unter, der Relation, die zwischen dem Sprecher und den am Sprechereignis beteiligten Faktoren besteht; er nennt sie Angemessenheit. Ein Sprachstil kann als „angemessene" Technik des Sprechens in dreierlei Hinsicht aufgefaßt werden: a) in bezug auf den Sprecher bzw. auf das Verhältnis von Sprecher und Angesprochenem; b) in bezug auf den Gegenstand des Sprechens; c) in bezug auf die Situation, in der das Sprechereignis stattfindet. Der „Sprachstil" unterscheidet sich also in der Weise vom „Dialekt" und von der „Sprachstufe", in der in der englischsprachigen Literatur zwischen styles und dialects unterschieden wird (vgl. Lieb 1970, 54): Zuordnungskriterium für die letzteren ist die Zugehörigkeit des Sprechers zu einer Gruppe, während der Sprachstil bzw. die styles von allen am Sprechereignis beteiligten Umständen determiniert werden. Der „Sprachstil" ist also kein Indiz für die Gruppenzugehörigkeit eines Sprechers, sondern eine Funktion der am Sprechereignis beteiligten Faktoren; der Sprecher paßt seinen Stil diesen Faktoren an, oder er wählt - in besonderen Fällen — gerade den diesen Umständen 'unangemessenen' Stil, um bestimmte Wirkungen beim Adressaten zu erzeugen. Müßte man angesichts dieser Tatsache nicht den Autoren recht geben, die die „diaphasischen" Unterschiede auf Erscheinungen der S p r a c h v e r w e n d u n g zurückführen möchten, die nur im Rahmen einer linguistique de la parole bzw. einer Theorie der Performanz untersucht werden können? So lehnt z.B. Karel Hausenblas, ein Vertreter der Prager Schule, den Terminus Sprachstil 11
So äußert sich z.B. Berruto 1974, 68, in dieser Hinsicht mißverständlich: "... ognuna di tali varietà sarebbe una 'lingua funzionale' ...".
76
Jörn Albrecht
mit der Begründung ab, daß er den Eindruck erwecke, „als ob es sich direkt um Stilvarianten der Sprache, um Systemgebilde handelte" (Hausenblas 1962/1971, 39). „Systembedingt" könne nur das sein - so lassen sich viele ähnliche Ansichten verschiedener Autoren resümieren - , was außerhalb der Wahlmöglichkeit des Sprechers steht, was den Sprecher in seinem Sprachverhalten determiniert. Gegen diese Ansicht ließen sich verschiedene Einwände vorbringen; wollte man ihn wirklich ganz ernst nehmen, so stünde man vor der Schwierigkeit zu erklären, wie intentioneil erworbene und praktizierte Mehrsprachigkeit eines Sprechers überhaupt möglich ist. Flydal hatte die Schwierigkeiten auf diesem Gebiet vorhergesehen, als er vorschlug, zwischen „interstrukturellen" und „intrastrukturellen" Optionen zu unterscheiden. Ich möchte versuchen, den Unterschied anhand eines Beispiels zu erklären, wobei ich - wie es in solchen Fällen nun einmal unumgänglich ist - stark idealisiere. Nehmen wir einmal an, die beiden folgenden Sätze seien Ausdruck ein und derselben Mitteilungsabsicht: (1) Katrin behauptete, sie wisse nicht, wozu man einen Theodoliten braucht (1') Die Katrin hat behauptet, daß sie nicht weiß, zu was man einen Theodoliten braucht. Es wäre durchaus denkbar, daß ein (gebildeter) Süddeutscher Satz (1') mündlich äußern, Satz (1) dagegen schreiben würde - worin ich, im Gegensatz zu anderen Autoren, eine besondere Form der diaphasischen Variation sehe (vgl. w.o. Anm. 1 und w.u. 1.3., 2.3.4.). Nun unterscheiden sich die beiden Sätze in zwei Punkten durch Elemente, die auch in anderer Weise konfrontiert werden können: (2) Katrin hört nicht zu (3) Das Mädchen hört nicht zu (4) Katrin saß am Fenster und schrieb einen Brief (5) Diesen Brief hat Katrin geschrieben. Norddeutsche Sprecher haben in diesen Fällen keine 'stilistische' Wahlmöglichkeit, die 'Grammatik' ihrer Varietät des Deutschen schreibt ihnen vor, welche Elemente sie jeweils zu gebrauchen haben: den Artikel nur bei Appellativa, nicht bei Eigennamen, das 'umschriebene' Perfekt nur bei Ereignissen mit unmittelbarem Bezug zur Gegenwart. Ein süddeutscher Sprecher könnte dagegen sehr wohl eine 'stilistische' Wahl treffen, und in „informellen" Situationen Sätze bilden wie: (2') Die Katrin hört nicht zu (4') Die Katrin ist am Fenster gesessen und hat einen Brief geschrieben12. Schematisch läßt sich das folgendermaßen darstellen: 12
Weder Norddeutsche noch Süddeutsche bilden dagegen - normalerweise - Sätze vom Typ: (5') Diesen Brief schrieb Katrin. Bei dem bekannten Schillerschen Satz: „Schriebst du diesen Brief?" {Kabale und Liebe, V, 2) handelt es sich um einen typischen „Hyperkorrektismus".
„Substandard" und „Subnorm" 'norddeutsch' +sekundär 'formell' 'süddeutsch' + sekundär 'informell'
Eigennamen (—) Artikel
11 Appellativa (4-) Artikel
U (+) Artikel generalisiert
ohne Bezug zur Gegenwart Präteritum
mit Bezug zur Gegenwart Perfekt
U Perfekt generalisiert
Die vertikalen Pfeile symbolisieren die „interstrukturellen" (also nicht 'sprachverwendungsbedingten' stilistischen Unterschiede Flydals; in Coserius Terminologie heißen sie Verschiedenheiten (diversités). Die durch horizontale Pfeile symbolisierten Unterschiede entsprechen einfach der Grammatik, in der sie auftreten; Coseriu nennt sie in guter strukturalistischer Tradition Oppositionen (Coseriu 1966a, §5.3.) Das Verhältnis von wozu in (1) und zu was in (1') ist schwerer zu interpretieren. Die erste Form gilt als „korrekt", die zweite als „umgangssprachlich" (Duden 9, s.v. Pronominaladverb, 5.); sie ist vor allem im Süden Deutschlands sehr gebräuchlich. Auf den ersten Blick scheint das gleiche Verhältnis vorzuliegen wie im obenstehenden Schema. Eine kleine Umfrage ergab jedoch, daß einige Sprecher - genau wie der Verfasser — die beiden Formen wenigstens okkasionell mit einem systematischen Unterschied gebrauchen: „Zu was brauchst du die Gabel?", aber „Wozu lebt man eigentlich" (ungefähr nach dem Muster „Damit habe ich nicht gerechnet" vs. „Mit ihr habe ich nicht gerechnet"). Viele Fälle von Sprachwandel entstehen dadurch, daß die Sprecher eine „Verschiedenheit", die sie in der „Architektur" ihrer Sprache vorfinden, zu einer „Opposition" innerhalb einer „funktionellen Sprache" machen. Werden diese 'Vorschläge' von der gesamten Sprachgemeinschaft - und nicht zuletzt von den Sprachnormierern — angenommen, so verfügt die 'kanonische Form' der historischen Sprache im Laufe der Zeit über differenziertere Ausdrucksmöglichkeiten als die natürlichen Varietäten.
Die Weigerung vieler Autoren, „Sprachstile" als 'Subsysteme der Sprache' (und nicht vielmehr als Eigentümlichkeiten der „Sprachverwendung") anzusehen, wird verständlich, wenn man sich vor Augen hält, daß ein „Sprachstil" sehr wenig enthält, was nicht gleichzeitig auch auf einer „Sprachstufe" oder innerhalb eines Dialekts anzutreffen wäre oder wenigstens früher einmal dort anzutreffen war. Zwischen den drei Dimensionen der Variation besteht nämlich ein inklusives Verhältnis: Diatopische Ausprägungen einer Sprache können auch als diastratische und/oder diaphasische fungieren, aber nicht umgekehrt. Ein Dialekt kann gleichzeitig das übliche Verständigungsmittel einer sozialen Schicht sein; eine „Sprachstufe" kann als „Sprachstil" verwendet werden. In vielen Sprachgemeinschaften geschieht dies in der Form, daß die Sprachstufe einer niederen sozialen Schicht als „familiäre" Sprache einer höheren Schicht fungieren kann (vgl. 2.3.3.). Diese 'Überschneidung' der diastratischen und der diaphasischen Dimension (vgl. Schlieben-Lange 1973, 76) hat William Labov für die Stadt New York besonders klar dargestellt (Labov 1966). Aus zweierlei Gründen bin ich auf das 'statische', 'spät-strukturalistische' Modell der „Architektur der historischen Sprache" verhältnismäßig
78
Jörn Albrecht
ausführlich eingegangen: zum einen, weil die Termini diatopisch, diastratisch und diaphasisch heute zwar zum terminologischen Gemeingut der Sprachwissenschaft gehören, aber häufig nicht genau im Sinne derer gebraucht werden, die sie geprägt haben. Zum anderen, weil das terminologische Instrumentarium der Varietätenlinguistik einerseits zu abstrakt ist, um der historischen Einmaligkeit, der 'Individualität' einer Einzelsprache gerecht zu werden (vgl. 2.3), andererseits wiederum so konkret, daß hinter dem eindrucksvollen technischen Apparat, der entwickelt wurde, um variables Sprach verhalten zu s i m u l i e r e n , der Gegenstand nicht mehr recht zu erkennen ist, für den sich der Linguist eigentlich zu interessieren hat: der systematische Aspekt der Variation, die 'kontrastive Grammatik' der verschiedenen Ausprägungen einer Sprache. Bevor ich mich dem Status zuwende, der dem „Substandard" in der „Architektur" verschiedener Sprachgemeinschaften zukommt, möchte ich zunächst auf einige Fragen eingehen, die verschiedene neuere Beiträge zur Varietätenlinguistik aufwerfen. 1.3 Im deskriptiven Instrumentarium der Sprachwissenschaft hat sich die Wortfamilie von lat. v a r i u s eine starke Position erobert. Der klassische Strukturalismus operierte im wesentlichen nur mit freien und kombinatorischen Varianten; die Standardversion der generativen Grammatik hatte aufgrund ihrer methodischen Homogenitätsannahme das Problem der Variation in der Sprache kaum thematisiert. Seit dem Ende der sechziger Jahre werden jedoch die Wortbildungsmöglichkeiten unserer europäischen Wissenschaftssprachen hinsichtlich der Grundlage v a r i u s voll ausgeschöpft: Allenthalben ist von Variation, Variabilität, Variablen und Varianten die Rede, die betreffenden Termini werden jedoch nicht selten in irreführender Weise gebraucht. Ich halte es daher für angebracht, einige Hinweise darauf zu geben, wie diese Termini hier verwendet werden sollen. Zunächst ein Beispiel aus der Alltagssprache: Haarfarbe13 schwarz braun rötlich blond
Variable (Merkmal) Varianten (Merkmalausprägungen, Werte der Variablen)
Eine Variable, so wie ich den Terminus im Bereich der empirischen Wissenschaften verstehen möchte, ist eine virtuelle veränderliche Größe. Unmittelbar beobachtbar sind immer nur die konkreten Werte oder Zustände, die 13
Ich gebe hier nur Beispiele für nicht-numerische Variable, weil sie in der Soziolinguistik eine besonders wichtige Rolle spielen. Was den Umgang mit Variablen in den Sozialwissenschaften betrifft, vgl. u.a. McCollough/Atta 41970, 91ff.; zum Problem der „Messung" nicht-numerischer Variablen Cicourel 1974 und Nikitopoulos 1973, 66ff.
79
„Substandard" und „Subnorm"
eine solche Größe annehmen kann. Der Schluß von den Werten einer Variablen auf die Variable selbst kann als eine Art von Abstraktionsprozeß aufgefaßt werden. Häufig ist - wie im hier angeführten Beispiel — das Ergebnis dieses Prozesses in unserer Alltagssprache schon 'fertig vorgegeben' (z.B. in Form eines gemeinschaftlichen nomen qualitatis oder actionis), so daß wir uns des Prozesses selbst gar nicht mehr bewußt werden. Bei der Übertragung dieses simplen Modells auf sprachliche Befunde kommt es jedoch nicht selten zu Fehlinterpretationen: Möglichkeiten des Modusgebrauchs in einer gegebenen Konstruktion
Variable
c'est dommage
c'est dommage
Varianten
qu'il pleuve
qu'il pleut
In solchen Fällen, die zum eigentlichen Gegenstandsbereich der Varietätenlinguistik gehören, läßt sich für die jeweilige Variable oft nur unter Schwierigkeiten ein angemessener sprachlicher Ausdruck finden. In vielen linguistischen Arbeiten werden die entsprechenden Begriffe fehlerhaft verwendet 14 : Im soeben angeführten Beispiel wird c'est dommage qu'il pleut gern als „Variante" von c'est dommage qu'il pleuve ausgegeben, in Wirklichkeit haben jedoch beide Konstruktionen den Status von Varianten. (Um Mißverständnissen vorzubeugen: Bei der Wahlmöglichkeit zwischen beiden Konstruktionen handelt es sich um eine Verschiedenheit in der Terminologie Coserius, nicht um eine Opposition, wie sie z.B. zwischen „je cherche une jeune fille qui sait l'italien" und „je cherche une jeune fille qui sache l'italien" besteht). Überträgt man dieses simple (aber nichtsdestoweniger zu Fehlinterpretationen Anlaß gebende) Modell der Variation aus dem Bereich einzelner sprachlicher Erscheinungen in jenen ganzer sprachlicher Systeme, so erhält man folgendes Schema: „Historische Sprache" (Einzelsprache)
Variable
FSi FSk FSi (= funktionelle Sprachen, Sprachausprägungen)
Varietäten (= Gefüge zusammengehöriger Varianten)
Eine Varietät ist also ein Gefüge aus 'zusammengehörigen' Varianten variabler Elemente und Regeln der Gesamtsprache. Die Frage nach den Kriterien, die über die 'Zusammengehörigkeit' entscheiden, wird uns gleich noch beschäftigen. 14
Auch die Arbeiten von Labov und De Camp (vgl. 1.4) sind nicht frei von solchen Fehlern.
80
Jörn Albrecht Zunächst sei jedoch darauf hingewiesen, daß die soeben gegebene Definition der „Varietät" unterschiedliche Interpretationen zuläßt. Interpretiert man sie im Sinne Coserius als „funktionelle Sprache", so ist sie in linguistischer Hinsicht homogen, d. h. sie enthält keine variablen Elemente mehr; den außersprachlichen Parametern kommt dabei lediglich eine 'identifizierende' Funktion zu. Interpretiert man sie hingegen als Ergebnis einer Zuordnung (Korrelation) von sprachlichen Erscheinungen und gesellschaftlichen bzw. 'pragmatischen' Parametern, so kann sie weiterhin variable Elemente enthalten, wenn auch weit weniger als die Gesamtsprache.
In der Varietätenlinguistik wird also eine Gesamtsprache als variable Größe verstanden, die man im Prinzip genau so behandeln kann wie irgend eine Variable in einer anderen wissenschaftlichen Disziplin. Nun gibt es variable Größen, die in mehrfacher Hinsicht unterschiedliche (und daher auch untereinander kombinierbare) Werte annehmen können, so daß es zu gewissen Zwecken angezeigt scheint, den Gesamtkomplex der Variation in verschiedene Komponenten aufzuspalten, die ich Dimensionen der Variation nennen möchte. Zunächst wiederum ein Beispiel aus dem Alltag: Haarbeschaffenheit
'heterogene' Variable
_*^^\/ / \ X^X^ Varianten, die verschiedenen schwarz fettig kraus blond glatt trocken Dimensionen der Variation angehören Der Gesamtbereich der Variation ist in einem solchen Fall in genau so viele 'Dimensionen' aufgespalten, wie es untereinander kombinierbare Klassen von Varianten gibt, in unserem Fall also mindestens in die Komponenten Farbe, Struktur, Fettigkeitsgrad. Schon in der Antike hat man die Einzelsprache - mehr oder weniger intuitiv - als eine solche 'heterogene' Variable aufgefaßt, und später haben Sprachwissenschaftler immer wieder von neuem versucht, die verschiedenen 'Dimensionen' der sprachlichen Variation zu bestimmen. Der umfassendste mir bekannte Vorschlag, der in dieser Hinsicht speziell zum Französischen gemacht worden ist, stammt aus dem außerordentlich verdienstvollen (und erfolgreichen) Buch von Bodo Müller über Das Französische der Gegenwart (Müller 1975). Nachdem er den Leser darauf aufmerksam gemacht hat, daß es „,das Französische' stricto sensu in der Sprachwirklichkeit gar nicht gibt" und daß die kodifizierte Norm nur eine „Sub- oder Teilsprache" des Französischen unter anderen Sub- oder Teilsprachen ist, nennt er „sieben Aspekte", die s. E. geeignet sind, „spezifische Sprachregister, -ebenen, Codes oder Subsprachen" auszugrenzen: 1. den chronologischen Aspekt; 2. den formalen Aspekt (betrifft geschrieben und gesprochen); 3. den quantitativen Aspekt; 4. den diatopischen Aspekt; 5. den diastratischen Aspekt; 6. den qualitativen Aspekt (entspricht diaphasisch bei Coseriu) und 7. den normativen Aspekt (vgl. Müller 1975, 34f.).
81
„Substandard"' und „Subnorm" Ich kann mich diesem Vorschlag, den drei 'klassischen' Dimensionen der Variation, nämlich Raum, soziale Schichtung und 'Situation', vier weitere hinzuzufügen, nicht anschließen. Aus Platzmangel kann ich die Gründe für meine diesbezügliche Weigerung nur in sehr knapper, schematischer Form vortragen: Der chronologische Aspekt ist der Untersuchung der Sprachvariation vorgeordnet. Mittels des Kriteriums „Zeit" wird zunächst einmal festgelegt, innerhalb welchen Stadiums einer Sprache die Variation überhaupt untersucht werden soll. Dabei muß allerdings eingeräumt werden, daß viele variable Elemente, die primär den drei klassischen Dimensionen der Variation zuzuordnen sind, letztlich auf die diachronische Variation zurückgeführt werden können: Es gibt natürlich 'archaischere' und 'progressivere' räumliche und soziale Ausprägungen einer Sprache, und archaische Elemente werden - vor allem in der Literatur - nicht selten zur Erzielung bestimmter 'stilistischer' Effekte (und somit innerhalb der diaphasischen Dimension) eingesetzt. Was den formalen Aspekt betrifft, so kann ich hier zunächst nur im Vorgriff auf einen späteren Abschnitt die Behauptung aufstellen, daß der gesamte Komplex „geschrieben vs. gesprochen" in drei Komponenten aufgespalten werden muß, von denen nur eine etwas mit der sprachlichen Variation zu tun hat, und bei dieser Komponente handelt es sich um einen Spezialfall der qualitativen (diaphasischen) Variation (s. 2.3.4). Der quantitative Aspekt stellt ein nebengeordnetes Kriterium dar, das allenfalls numerische Proportionen zwischen verschiedenen Varietäten einer Sprache tangiert, für die Ausgrenzung von Varietäten jedoch nicht in Betracht kommt. Ähnliches gilt für den normativen Aspekt; die Sprachnormierung besteht im wesentlichen in einer Auswahl aus dem Inventar von Elementen der 'natürlichen' Varietäten der Gesamtsprache und in deren 'Kanonisierung'; der normative Aspekt ist somit der eigentlichen Problematik der Variation nachgeordnet (s. 2.1). Schematisch läßt sich das Verhältnis der drei 'klassischen' Dimensionen der Variation zu den vier von B. Müller hinzugefügten „Aspekten" folgendermaßen darstellen: . Diachronie Chronologie (vorgeordnet)\
Synchronie {diatopisch (diastratisch (qualitativ))}15 •—.—' (diaphasisch)
i
15
quantitativ (nebengeordnet)
normativ formal (nachgeordnet) (nachgeordnet) | Die Klammerung symbolisiert das Inklusionsverhältnis zwischen den drei Dimensionen, auf das in 1.2 bereits hingewiesen wurde: Jede topische Variable kann auch als stratische und/oder phasische auftreten, jede stratische als phasische aber nicht umgekehrt.
82
Jörn Albrecht
Wenn die sieben „Aspekte" Bodo Müllers auch keine gleichberechtigten „Dimensionen" der Sprachvariation darstellen, so sind sie doch alle für die praktische, soziolinguistische und 'pragmatische' Beschreibung einer Sprache von Bedeutung. Das gilt besonders für den Wortschatz: Alle „sieben Aspekte" findet man in der Lexikographie in Form von Kriterien wieder, die für die „diasystematische Indizierung" maßgeblich sind (vgl. Hausmann 1977, 112ff.). 1.4. Jede noch so knappe Darstellung der sprachlichen Variation und ihrer Behandlung in der Linguistik wäre unvollständig, wenn sie keinen Hinweis auf die verschiedenen Typen von Varietätengrammatiken enthielte. Ich muß mich hier mit Andeutungen zufriedengeben, werde jedoch die Gelegenheit benutzen, um auf einige spezifische Probleme hinzuweisen, die soziolinguistische Variable dem Sprachwissenschaftler stellen. Auf die reichhaltige Literatur zur beschreibungstechnischen Bewältigung der Variation braucht hier nur am Rand eingegangen zu werden (vgl. u. a. Klein 1974; Wildgen 1977; Sankoff 1981). Alle Varietätengrammatiken im engeren Sinne beruhen auf dem Bestreben, die spezifischen Regeln für die einzelnen Varietäten der historischen Sprache 'unter einem gemeinsamen (abstrakteren) Dach' zu vereinen: „Historische Sprache" Varietäti Varietätk ...
Varietätengrammatik Regelspezifizierungen für Vi
Regelspezifizierungen fürV k ...
Man kann drei Typen von Varietätengrammatiken unterscheiden, die bis zu einem gewissen Grade untereinander kombinierbar sind: a) Das „Diasystem", wie es z.B. von Weinreich (1954) entworfen wurde. Es handelt sich dabei grosso modo um eine Beschreibung der Gesamtsprache nach dem bekannten distributionalistischen Muster, bei der die für alle Varietäten gültigen Elemente und Regeln notationstechnisch gegenüber jenen besonders hervorgehoben werden, die jeweils nur in einer bestimmten Varietät erscheinen. (Diese Methode eignet sich nur zur Darstellung relativ einfacher Beziehungen zwischen verschiedenen Varietäten, etwa von der Art, wie sie w. u. für das Varietätenpaar Standarddeutsch Schwäbisch diskutiert werden; s. 1.4.2). b) Eine Grammatik mit Variablenregeln, für die sich vor allem W Labov (1970) eine Zeitlang eingesetzt hat. Es handelt sich im Prinzip um eine 'normale' generative Grammatik, die neben den dem allgemeinen Rahmen vorbehaltenen kategorischen Regeln auch sog. „semikategorische" Variablenregeln enthält. Bei diesem letzteren Regeltyp wird jeder Expandierung („Ersetzung" im Sinne der GTG) eine veränderliche Größe zugewiesen, die
„Substandard" und „Subnorm"
83
die Anwendungswahrscheinlichkeit der Regel in Abhängigkeit von außersprachlichen Faktoren ausdrückt (z.B. die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von /nixts/ oder /niks/ in Äußerungen, wenn sowohl die soziale Schicht des Sprechers als auch die Sprechsituation bekannt ist). Es ist hier nicht der Ort, die technischen Einzelheiten dieses Verfahrens zu diskutieren; es sei lediglich auf zwei besonders problematische Punkte hingewiesen: Einerseits wird in einer Grammatik, die Regeln mit - so muß man zumindest annehmen — statistisch interpretierbarer Anwendungswahrscheinlichkeit enthält, die der Saussureschen Dichotomie langue vs. parole nachgebildete Unterscheidung zwischen Kompetenz und Performanz 'verwischt' (Wunderlich 1971, 319; Dittmar 1973, 174f. ) ; andererseits wird gerade bei Labov - trotz aller gegenteiliger Beteuerungen - der 'Standard' in unannehmbarer Weise privilegiert, weil nämlich die für ihn charakteristischen Elemente nicht wie 'gewöhnliche' Merkmalausprägungen, sondern als eine Art von 'idealer Norm' behandelt werden 16 . c) Grammatiken auf der Grundlage sog. „Implikationsskalen" (die unter dem Namen scalogramm erstmals 1944 von dem Soziologen L. Guttmann beschrieben worden sind). Diese „Implikationsskala", die vor allem von D. De Camp gegen die Grammatik mit Variablenregeln in die Diskussion eingebracht wurde, repräsentiert ein Ordnungsprinzip, das - so De Camp - das Verhältnis zwischen soziolinguistischen Merkmalen und Varietäten einer Sprache regieren muß, denn sonst könnte ein Sprecher die Vielfalt der zur Verfügung stehenden Elemente und Regeln mnemotechnisch überhaupt nicht beherrschen. Bei der Implikationsanalyse werden Merkmale und Varietäten in eine Beziehung gesetzt: In einer Matrix sind die Varietäten von oben nach unten nach der Anzahl der in ihnen erscheinenden Merkmale, die Merkmale wiederum von links nach rechts nach dem Grade ihrer Verbreitung über die verschiedenen Varietäten hinweg geordnet. Aus dieser Anordnung ergibt sich zweierlei: Zum einen sind die verschiedenen Merkmale nicht frei kombinierbar, zum anderen ergeben sich eine Reihe von Implikationsbeziehungen. Nicht nur aus beschreibungstechnischen, sondern vor allem aus Gründen der empirischen Adäquatheit läßt sich das mögliche Funktionieren einer solchen Implikationsskala am besten anhand eines winzigen Ausschnitts einer Sprache darstellen: 16
So untersucht Labov in seiner berühmt gewordenen Studie zur sozialen Schichtung des Englischen in der Stadt New York die verschiedenen Realisierungen von /th/ in Abhängigkeit von der Schichtzugehörigkeit der Sprecher und der Sprechsituation. Dabei werden jeder beobachteten Realisierung von /th/ als [0] - die 'korrekte' Aussprache - null Punkte, als Affrikate [t9] ein Punkt, als Verschlußlaut [t] zwei Punkte zugeteilt. Bezugspunkt der 'Messung' ist also nicht eine 'abstrakte' Variable (vgl. w.o.). sondern eine als exemplarisch angesehene Variante (vgl. Labov 1966).
84
Jörn Albrecht G e g e b e n seien die folgenden Variablen mit jeweils zwei Varianten: Bezeichnungsmöglichkeiten für „apis" Imme
Bezeichnungsmöglichkeiten für „industrius, impiger"
Biene
emsig
fleißig
Durch A n o r d n u n g in einer Implikationsskala ließe sich (aufgrund intuitiver A n n a h m e n ) z . B . die folgende Verteilung d e r M e r k m a l e auf verschiedene Varietäten des D e u t s c h e n v o r n e h m e n (zur Verdeutlichung wird links die Matrix in ihrer allgemeinen Form aufgeführt): Mi
M2
+ + -
+ — —
Mi Vi V2 V3
emsige emsige fleißige
M2 Imme Biene Biene
„poetisch" „gehoben" „neutral"
Durch diese A n o r d n u n g wird die Kombination fleißige Imme ausgeschlossen (was einigermaßen mit intuitiven A n n a h m e n über die verschiedenen „Register" des D e u t s c h e n zu vereinbaren ist). A u ß e r d e m werden 'Implikationsschlüsse' d e r folgenden A r t nahegelegt: „Wenn emsig in V 2 auftritt, dann m u ß es auch in V i auftreten" (Schluß 'nach oben') u n d „wenn in Vi Imme erscheint, dann m u ß dort auch emsig erscheinen" (Schluß 'nach links': über j e d e m + u n d links von j e d e m + steht notwendigerweise ebenfalls ein + ) . M a n erkennt auf d e n ersten Blick, d a ß auch bei diesem Verfahren die jeweils 'höherrangige' Merkmalsausprägung privilegiert wird, weil sie als „Vorhandensein" des M e r k m a l s , die 'niederrangige' dagegen als „ A b w e s e n h e i t " des M e r k m a l s aufgefaßt wird (vgl. u . a . D e C a m p 1971; D i t t m a r 1973, 185ff.; Sankoff 1981, 79ff.). 1.4.1 In der jüngsten Vergangenheit ist die Diskussion um formale Varietätengrammatiken mit geringerer Intensität geführt worden. Dafür lassen sich verschiedene Erklärungen geben: das allgemein abnehmende Interesse an formalen Sprachbeschreibungsmethoden, eine gewisse Resignation vor der außerordentlichen Vielfalt und Vieldeutigkeit der zu berücksichtigenden Erscheinungen und nicht zuletzt die Erkenntnis, daß sich - vielleicht mit Ausnahme des vergleichsweise anspruchslosen 'Diasystems' — die bisher entwickelten Modelle keineswegs für alle „historischen Sprachen" gleich gut eignen. Zur vergleichenden Charakterisierung der „Architektur" verschiedener „historischer Sprachen" sind sie — wie bereits erwähnt (1.2) - überhaupt nicht geeignet. 1.4.2 Eine besondere Schwierigkeit, die in der varietätenlinguistischen Literatur nicht genügend berücksichtigt wird, ergibt sich aus der Tatsache,
85
„Substandard" und „Subnorm"
daß im lexikalischen Bereich häufig nicht Wörter im Sinne vollständiger sprachlicher Zeichen, sondern bestimmte Bedeutungen von Wörtern varietätenspezifisch auftreten. So kann z.B. das frz. Verb flanquer (das als Wort des 'Standards' „flankieren" bedeutet) im Substandard mit Bedeutungen auftreten, die im Standard den Verben jeter, donner und envoyer vorbehalten sind17. Schematisch lassen sich die Verhältnisse folgendermaßen darstellen: jeter
donner
envoyer
flanquer
'Standard'
(Wertj)
'Substandard'
(Wert2)
Es handelt sich dabei, wie bereits gesagt, um eine grobe Schematisierung; genauere Untersuchungen würden vermutlich ergeben, daß die Verhältnisse noch weit komplizierter sind. Jedoch folgt bereits aus unserer vereinfachten Darstellung, daß die Bedeutung des Wortes flanquer, intensional gesprochen, in jedem Fall 'allgemeiner' ist als die eines seiner möglichen 'Standardäquivalente'. Möchte man nun die Verhältnisse im Standard und im Substandard als zwei Werte einer Variablen auffassen, so bieten sich zwei verschiedene Arten des Vorgehens an: Entweder geht man von der 'allgemeinen' Bedeutung der Substandardform aus und betrachtet die drei korrespondierenden Standardformen insgesamt als einen der beiden Werte (s. das obenstehende Schema), oder man 'projiziert' die Standardbedeutungen auf die Substandardbedeutung (wie es in den meisten Wörterbüchern geschieht) und erhält dann drei homophone Verben mit drei unterschiedlichen Bedeutungen: jeter
donner
envoyer
'Standard'
(Wertj)
flanquer!
flanquer2
flanquer3
'Substandard'
(Wert2)
Im Deutschen treten Schwierigkeiten ähnlicher Art auf, wobei die Variation im Raum stärker in Erscheinung tritt. Aus dem Munde von Norddeutschen kann man hören, die Schwaben 'verwechselten' die Wörter Fuß und Bein miteinander. Wie in einigen ähnlichen Fällen (z.B. bei den stimmlosen und stimmhaften Verschlußlauten) liegt dem Vorwurf der Verwechslung selbst eine 'Verwechslung' zugrunde, nämlich die von „Verwechslung" und „NichtUnterscheidung". Wiederum schematisch: 17
Vgl. hierzu die folgenden Belege: "C'est les ravissants de l'état-major que je vais flanquer dans la cave de la mairie" (Sartre, La mort dans l'âme, Paris, collection folio, 1972, 209). "Les colchiques, qui flanquent la diarrhée aux vaches" (H. Bazin, Vipère au poing, Paris, Livre de Poche, 1972, 307). "... vous saviez ce que vous vouliez quand vous me flanquiez vos gnons dans la geule" (S. Groussard, Taxi de nuit, Paris, Livre de Poche, 1974,127).
86
Jörn Albrecht Variable: Möglichkeiten der Gliederung des Wortschatzes in einem bestimmten Bereich der Bezeichnung
| Fuß
| Bein |
(Variante^ gehört zur Varietät „deutsche Standardsprache")
Fuß (Variante2, gehört zur Varietät „südwestdeutsche Umgangssprache")
Ähnliches gilt für rennen/springen; riechen/schmecken; halten/heben und weitere Fälle; das jeweils an zweiter Stelle genannte Wort gilt im Schwäbischen für den gesamten in der Standardsprache auf zwei Lexeme aufgeteilten Bereich. Es gibt noch komplexere Beziehungen zwischen den regionalen Varietäten und der kanonischen Form des Deutschen. Den Sprachatlanten (König 1978, 210) kann man entnehmen, daß im dt. Sprachgebiet für „equus" unter einigen anderen vor allem drei Wörter gebraucht werden: Pferd in großen Teilen des Nordens und des Zentrums, Gaul in Teilen des Zentrums und des Südwestens, Roß im äußersten Süden und im gesamten Südosten. In der Standardsprache hat sich - und dies ist im Deutschen vergleichsweise häufiger als in vielen anderen europäischen Sprachen geschehen — aus diesem konkurrierenden Nebeneinander ein differenziertes Miteinander entwickelt: Roß Pferd Gaul
„literarisch" „neutral" „familiär + pejorativ"
Verwendet ein gebildeter Stuttgarter das Wort Gaul, so kann man nicht sicher sein, ob er unbewußt („fehlerhaft"; vgl. 2.2) einen „Extrastrukturalismus" (vgl. w. o.) aus der ihm vertrauten Varietät des Deutschen in den Standard hat einfließen lassen oder ob er das Wort gemäß den Regeln des Standards mit „funktionalistischer"18 Ausdrucksabsicht eingesetzt hat. 1.4.3 Die Stellung der Norm im Gesamtgefüge der Architektur einer historischen Sprache ergibt sich aus der Sprachgeschichte, und die Geschichte der Einzelsprachen ist - selbst in einer kulturell verhältnismäßig homogenen Region wie Europa - bekanntlich von Fall zu Fall sehr unterschiedlich verlaufen. Die wenigen a l l g e m e i n g ü l t i g e n Aussagen, die sich zum sprachlichen Standard und Substandard machen lassen, müssen 18
Der von der „Leipziger Schule" geprägte Begriff der „Funktionalstilistik" entspricht bis zu einem gewissen Grad der „diaphasischen Variation", so wie sie hier verstanden wird. Jedoch wird auch hier nicht zwischen „interstruktureller" und „intrastruktureller" Wahl im Sinne Flydals unterschieden; die gesamte „Funktionalstilistik" scheint als eine Angelegenheit der 'Sprachverwendung' aufgefaßt zu werden (vgl. Michel 1969, 275, und Spillner 1974, 57).
„Substandard" und „Subnorm"
87
also notwendigerweise so allgemein gehalten werden, daß sie nichtssagend wirken. Scheinbar universelle (und allgemein akzeptierte) Begriffe wie „Sprache" und „Dialekt" erweisen sich bei näherem Hinsehen als empirische Generalisierungen von Teilbereichen, was dazu führen muß, daß jede neue Definition dieser Termini alsbald mit Fakten konfrontiert wird, auf die sie nicht zu passen scheint (vgl. u.a. Heger 1969; Ammon 1978; Vahle 1978).
Literaturverzeichnis Albrecht, Jörn, „Standard" und „Substandard" im Lexikon des Französischen und Italienischen. Zum Problem der sozio-stilistischen Indizierung („Registermarkierung") in französischen und italienischen Wörterbüchern, unveröffentlichte Habilitationsschrift, Tübingen, 1977. Ammon, Ulrich, Begriffsbestimmung und soziale Verteilung des Dialekts, in: Ammon, Ulrich/Knoop, Ulrich/Radtke, Ingulf (edd.), Grundlagen einer dialektorientierten Sprachdidaktik, Weinheim/Basel, Beltz, 1978, 49-71. Berruto, Gaetano, La sociolinguistica, Bologna, Zanichelli, 1974. Bloomfield, Leonard, Language, London, Allen & Unwin, 121973 (11933). Chaurand, Jacques, Introduction à la dialectologie française, Paris/Bruxelles/Montréal, Bordas, 1972. Cicourel, Aaron V , Methode und Messung in der Soziologie (Method and Measurement in Sociology), Frankfurt/M., Suhrkamp, 1974. Cortelazzo, Manlio, Avviamento critico alio studio della dialettologia italiana, vol. I, Problemi e metodi, Pisa, Pacini, 1968. Coseriu, Eugenio, Sincronia, diacronia e historia. El problema delcambio lingüistico, Madrid, Gredos, 31978 01958). Id. ( = 1966a), Structure lexicale et enseignement du vocabulaire, in: Actes du premier colloque international de linguistique appliquée (Nancy 26.—31. 10.1964), Nancy, 1966, 175-217 (= Annales de l'Est, Mémoire no 31). Id. (= 1966b), Der Mensch und seine Sprache, jetzt in: Id., Sprache. Strukturen und Funktionen. XII Aufsätze, Tübingen, Narr, 21971 (11966). Id., Lecciones de lingüistica general (Lezioni di linguistica generale), Madrid, Gredos, 1981. De Camp, David, Implicational scales and sociolinguistic linearity, Linguistics 75 (1971), 30-43. Dittmar, Norbert, Soziolinguistik. Exemplarische und kritische Darstellung ihrer Theorie, Empirie und Anwendung. Mit kommentierter Bibliographie, Frankfurt/ M., Fischer/Athenäum, 1973. Der Grosse Duden in zehn Bänden, Band 9, Zweifelsfälle der deutschen Sprache, Mannheim/Wien/Zürich, Dudenverlag, 1972. Hager, Frithjof/Haberland, Hartmut/Paris, Rainer, Soziologie + Linguistik, Stuttgart, Metzler, 1973. Hausenblas, Karel, Stile der sprachlichen Äußerung und die Sprachschichtung, in: Kochan, Detlef C. (ed.), Stilistik und Soziolinguistik. Beiträge der Prager Schule zur strukturellen Sprachbetrachtung und Spracherziehung, Berlin, List, 1971. Hausmann, Franz Josef, Einführung in die Benutzung der neufranzösischen Wörterbücher, Tübingen, Niemeyer, 1977.
88
Jörn Albrecht
Heger, Klaus, „Sprache" und „Dialekt" als linguistisches und soziolinguistisches Problem, Folia Linguistica 3 (1969), 46-67. Klein, Wolfgang, Variation in der Sprache. Ein Verfahren zu ihrer Beschreibung, Kronberg Ts., Scriptor, 1974. König, Werner, dtv-Atlas zur deutschen Sprache. Tafeln und Texte, München, Deutscher Taschenbuch Verlag, 1978. Labov, William, The social stratification of English in New York City, Washington D.C., Center for Applied Linguistics, 1966. Id., The study of language in its social context, Studium generale 29 (1970), 30-87. Lieb, Hans-Heinrich. Sprachstadium und Sprachsystem, Stuttgart etc., Kohlhammer, 1970. McCollough, Celeste/Atta, Loche van, Statistik programmiert (Statistical concepts a Programm for self-instruction), Weinheim/Basel, Beltz, 1970. Michel, G., Stilnormen grammatischer Mittel, Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universität 18 (1969), 275-278. Moser, Hugo, „Umgangssprache". Überlegungen zu ihren Formen und ihrer Stellung im Sprachganzen, Zeitschrift für Mundartforschung (1960), 215—232. Müller, Bodo, Das Französische der Gegenwart. Varietäten Strukturen Tendenzen, Heidelberg, Winter, 1975. Nikitopoulos, Pantelis, Statistik für Linguisten. Eine methodische Darstellung, I. Teil, Tübingen, Narr, 1973. Paul, Hermann, Prinzipien der Sprachgeschichte, Tübingen, Niemeyer, 81968 (HSSO). Sankoff, David (ed.), Linguistic Variation. Models and Methods, New York/San Francisco/London, Academic Press, 1978. Saussure, Ferdinand de, Cours de linguistique générale, Paris, Payot, 31971 (11916). Schleicher, August, Die deutsche Sprache, Stuttgart, Cotta, 1860. Schleiermacher, Friedrich, Heber die verschiedenenen Methoden des Uebersezens, jetzt in: Störig, Hans Joachim (ed.), Das Problem des Übersetzens, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 31973, 38-70 (^SD). Schlieben-Lange, Brigitte, Soziolinguistik. Eine Einführung, Stuttgart etc., Kohlhammer, 1973. Soll, Ludwig, Gesprochenes und geschriebenes Französisch, Berlin, Schmidt, 1974, 2 1980. Spillner, Bernd, Linguistik und Literaturwissenschaft. Stilforschung, Rhetorik, Textlinguistik, Stuttgart etc., Kohlhammer, 1974. Vahle, Fritz, Semantisch-pragmatische Varianz: Hessisch (unter besonderer Berücksichtigung des Dialekts von Salzböden) — Einheitsdeutsch, in: Ammon, Ulrich/ Knoop, Ulrich/Radtke, Ingulf (edd.), Grundlagen einer dialektorientierten Sprachdidaktik, Weinheim/Basel, Beltz, 1978, 229-251. Vendryes, Joseph, Le langage. Introduction linguistique à l'histoire, Paris, Albin Michel, 1968 (11923). Wandruszka, Mario, Interlinguistik. Umrisse einer neuen Sprachwissenschaft, München, Piper, 1971. Weinreich, Uriel, Is a structural dialectology possible?, Word 10 (1954), 388—400. Wildgen, Wolfgang, Différentielle Linguistik. Entwurf eines Modells zur Beschreibung und Messung semantischer und pragmatischer Variation, Tübingen, Niemeyer, 1977. Wunderlich, Dieter, Zum Status der Soziolinguistik, in: Klein, Wolfgang/Wunderlich, Dieter (edd.), Aspekte der Soziolinguistik, Frankfurt/M., Athenäum, 1971, 297-321. Id., Grundlagen der Linguistik, Reinbek, Rowohlt, 1974. Zimmer, Rudolf, Probleme der Übersetzung formbetonter Sprache, Tübingen, Niemeyer, 1981 (= Beiheft 181 zur ZrP).
Standard und Substandard als grammatikalisches Problem Günter Holtus (Mainz)
Stellt das Verhältnis von Standard und Substandard überhaupt ein genuin grammatikalisches Problem dar? Betrachtet man die lange Tradition der Grammatikographie einzelner Sprachen, so hat es vielfach den Anschein, als beantworte sich die Frage nach der Berücksichtigung substandardsprachlicher Phänomene in einschlägigen Grammatiken von selbst: Die sprachlichen Phänomene des vom Standard — was immer auch im einzelnen mit diesem Terminus in den Grammatiken gemeint sein mag — abweichenden Substandards werden bevorzugt (wenn überhaupt) in Form von mehr oder weniger umfangreichen Ergänzungsabschnitten, Exkursen, Anmerkungen, Postillen etc. an die Beschreibung der standardsprachlichen 'Grammatik' des jeweiligen Teilbereichs angehängt. Dadurch wird der täuschende Eindruck erweckt, als würde der Gebrauch des Terminus 'Grammatik' im Sinne eines funktionierenden sprachlichen Systems und seiner Deskription nur im Bereich des Standards seine Berechtigung haben. Daß dem nicht so ist, zeigen ansatzweise bereits ältere Untersuchungen etwa zu einer Grammaire des fautes (Frei 1929), in eindrucksvollerer Form die in den letzten Jahrzehnten intensiv unternommenen Aktivitäten zur Erstellung einer Grammatik gesprochener Sprache, insbesondere des Italienischen und des Französischen. Natürlich kann sich hier sofort der berechtigte Einwand erheben, daß die Dichotomie gesprochene vs. geschriebene Sprache auf einer anderen Ebene anzusiedeln ist als die des Verhältnisses von Standard und Substandard: Schließlich läßt sich sowohl in der geschriebenen Sprache als auch in der gesprochenen Sprache von einem Standard sprechen und von davon abweichenden sprachlichen Substandards — es sind lediglich verschiedene Standards, die je nach Normfestsetzung, nach soziolinguistischer Einschätzung und nach je sprachspezifischer Tradition unterschiedlich ausgeprägt sind. Dennoch zeigt sich generell, zumindest in der Tradition der romanischen Grammatikographie, die Tendenz, im wesentlichen von der Konstruktion eines standardsprachlichen Systems geschriebener Sprache und seiner grammatischen Beschreibung auszugehen, was mit bedingt ist durch die grundsätzliche Unterscheidung von langue und parole, derzufolge die
90
Günter Holtus
Grammatik sich zunächst mit dem Funktionieren des Systems einer Sprache auf der abstrakten Ebene der langue befaßt, aber auch auf didaktische Überlegungen zurückzuführen ist, die darauf hinauslaufen, zunächst einmal die Beschreibung des grammatischen Systems einer Sprache und seines Funktionierens auf einen anerkannten Standard zu beschränken — wobei sich sofort die bekannte Frage nach der Begründung der Anerkennung (von wem anerkannt? zu welchem Zweck? etc.) stellt. Ein gewisses Maß an Klärung dieser Problematik liefert die in der neueren Sprachwissenschaft erfolgte Trennung von System, Norm und Rede. Läßt sich daraus aber die Konsequenz ableiten, daß die grammatische Beschreibung letzten Endes drei Ebenen zu berücksichtigen hätte, die des abstrakten sprachlichen Systems {langue), die der sprachgeschichtlich und soziolinguistisch bestimmbaren Norm einer Sprache und die der Realisierung des sprachlichen Systems in einzelnen, konkreten Sprechakten (parole)! An einem konkreten Beispiel demonstriert: Läßt sich die Beschreibung der Funktion des accord beim Partizip Perfekt im Französischen, seine Auswirkungen auf das Funktionieren des sprachlichen Systems, trennen von der Beschreibung des tatsächlichen Gebrauchs des accord, seines Auftretens in einem bestimmten Zeitabschnitt, in bestimmten Regionen, Sprachschichten und Situationskontexten und von der Frage, wie die möglichen Divergenzen zwischen sprachsystematischer Funktion und realisiertem Sprachgebrauch mit den Angaben einer historisch und soziolinguistisch entwickelten Norm in Einklang gebracht werden können? Letzten Endes ergibt sich hier eine Vielzahl von offenen Punkten, deren Klärung grundsätzlich abhängig ist von einer exakten und allgemein akzeptierten Definition der Begriffe Standard, Substandard und Grammatik (vgl. dazu auch die Diskussion in Verf. 1984b, 315ff.). In diesem Kontext stellt sich auch die Frage, welche praktischen Auswirkungen die Versuche einer Abgrenzung der Termini Standard und Substandard in der Grammatikographie einer Sprache bisher mit sich gebracht haben (vgl. in diesem Zusammenhang die Bemerkungen von Kleineidam 1985, 3ff., zu den Möglichkeiten einer „kodespezifischen Grammatik"). Die folgenden Ausführungen möchten mit dazu beitragen, das Verhältnis von Standard und Substandard am Beispiel der französischen Grammatikographie zu erläutern und die verschiedenen Tendenzen und Schlußfolgerungen, die sich aus dem gewählten Beispiel für eine allgemeinere Standortbestimmung ergeben, in ihren wesentlichen Zügen herauszuarbeiten und ansatzweise mit der Situation der Grammatikographie anderer Sprachen zu vergleichen (vgl. dazu Verf. 1978 und 1984a). Die Auswahl der Beispiele beschränkt sich auf die für die Grammatik des Gegenwartsfranzösischen relevanten Publikationen aus den letzten Jahrzehnten und geht nur in Ausnahmefällen auf diachronische Perspektiven in
Standard und Substandard als grammatikalisches Problem
91
der Tradition der Grammatikographie ein. Ein besonderer Schwerpunkt wird — nicht nur aus didaktischen und anwendungsorientierten Gründen auf die für die Grammatikographie im deutschsprachigen Raum jüngsten Veröffentlichungen der Grammatik des heutigen Französisch von Klein/ Kleineidam (1983) und der Textgrammatik der französischen Sprache von Weinrich (1982) gelegt. Für die französischsprachigen Grammatiken steht die monumentale Zusammenstellung von Grevisse (1980), Le Bon Usage, im Mittelpunkt, während auf die weiteren Grammatiken von Chevalier (1964), Mauger (1968), Togeby (1982-) und Wagner/Pinchon (1973) nur kürzer Bezug genommen werden soll. Methodisch wird so verfahren, daß das in der Konzeption der Grammatik beschriebene Verhältnis von Standard und Substandard mit einem oder mehreren Abschnitten der grammatikalischen Beschreibung eines Teilbereichs verglichen werden soll. Im Rahmen dieser Untersuchung können die spezifischen Eigenarten der Grammatiken im Hinblick auf Zielpublikum, linguistische und methodische Grundlage, Orientierung an bestimmten sprachwissenschaftlichen Modellen nicht näher berücksichtigt werden. Den untersuchten Grammatiken ist gemeinsam, daß sie alle auf ein fortgeschrittenes Lernstadium des Französischen ausgerichtet sind und eine ausführliche Deskription der Grundstrukturen des französischen Sprachsystems anstreben, d. h. sich nicht zu sehr auf die Vermittlung elementarer Kenntnisse beschränken oder sich als „didaktische Grammatiken" im engeren Sinne verstehen (vgl. dazu die ausführliche Diskussion bei Zimmermann 1979 und bei Königs 1983, 25-31). Klein/Kleineidam (1983, 3) geben in der Einleitung folgende Bestimmung des ihrer grammatischen Beschreibung zugrunde gelegten sprachlichen Standards des Französischen: Gegenstand dieser Grammatik ist die Darstellung der Morphologie und Syntax des gegenwärtigen Französisch innerhalb eines Sprachbereichs, den man mit dem Begriff „Standardsprache" umschreiben kann. Als maßgeblich für die Darstellung der „Norm" dieses Sprachbereichs gilt nicht mehr allein der traditionelle bon usage, der gute Sprachgebrauch klassischer und moderner Autoren. Zentrale Bedeutung kommt vielmehr der geschriebenen und gesprochenen Form der Alltagssprache zu, so wie sie heute im Großraum Paris geprägt, von den Medien verbreitet und von der Mehrheit der Sprecher in einer Vielzahl von Situationen gebraucht wird. Der funktionalen Gliederung des gewählten Sprachbereichs versucht die Grammatik gerecht zu werden, indem sie die für das Französische typischen Unterschiede zwischen gesprochener und geschriebener Sprache durchgehend berücksichtigt und Abgrenzungen von Sprachregistern systematisch vornimmt. Im Kapitel über „Bejahung - Verneinung — Einschränkung" (S. 200-207, §§ 290-301) konkretisiert sich diese Festlegung mehrmals insofern, als konsequent zwischen geschriebener und gesprochener Sprache mit ihren jewei-
92
Günter Holtus
ligen Regeln der Verwendung unterschieden wird und zusätzlich für den Bereich der gesprochenen Sprache die private von der öffentlichen Sprechsituation getrennt wird. Ferner erwähnt die Grammatik Besonderheiten literarischer Sprache, gehobener Sprache und regionaler Verwendung (§291 Anm., §292 Anm., §293 Anm., §295, §296, §297, §298 Anm., §299, § 301). Als Prinzip zeigt sich somit die Tendenz, vornehmlich die Unterscheidung gesprochen vs. geschrieben zu berücksichtigen und darüber hinaus für den Bereich oberhalb des Standards Termini wie „gehobene Sprache" und „Literatursprache" zu verwenden, während eigentliche substandardsprachliche Angaben nicht weiter ausgeführt werden — sieht man einmal von der Beschreibung „gesprochene Sprache in privater Sprechsituation" ab (vgl. die zustimmende Besprechung von Barrera-Vidal 1984, 207: „ . . . die Erfahrung zeigt, daß so etwas wie ein merkmalloses 'français standard' tatsächlich existiert"). Die Ausführungen zum Thema „Die Übereinstimmung des Participe passé mit seinem Bezugselement" (S. 257-259, §§377-379) ergeben ein mit den bisherigen Aussagen vergleichbares Bild: So wird z. B. gesagt, daß in der gesprochenen Sprache die Angleichung auch dann häufig „vernachlässigt" wird, wenn eine hörbare weibliche Form existiert (§378), und daß in besonderen Fällen (ib. Anm.) von der beschriebenen Norm abweichende Verwendungsweisen „zulässig" sind. Auch in den anderen Kapiteln hält sich die Grammatik relativ konsequent an ihr Grundprinzip der Unterscheidung von gesprochenem und geschriebenem Französisch (vgl. S. 17f.) und an ihre Orientierung an der „sogenannten Standardsprache {la langue standard)1', die trotz der großen Anzahl regionaler und lokaler Unterschiede des Französischen als eine für die meisten Sprecher verbindliche und von ihnen anerkannte Norm herausgestellt wird: Die Standardsprache wird im Großraum Paris geprägt. Sie wird durch Schule und Massenmedien verbreitet und von der Mehrzahl der Franzosen benutzt. Die Standardsprache ist ihrerseits ein vielschichtiges System, das passende Ausdrucksmöglichkeiten für eine Vielzahl von Sprechsituationen anbietet (Klein/ Kleineidam 1983, 19). Die Verfasser weisen zwar darauf hin, daß die Sprechsituation durch verschiedene Faktoren bestimmt wird, z.B. das Medium (gesprochen — geschrieben), den Öffentlichkeitsgrad (privat — öffentlich), das Thema (alltäglich — besonderer Anlaß), Eigenschaften der Kommunikationspartner (Alter, Geschlecht, soziale Stellung, Bildung, Wissen, etc.), die Beziehung zwischen den Kommunikationspartnern (bekannt - unbekannt, vertraulich - förmlich - distanziert, etc.), und daß die Wahl eines Registers (z.B. förmlich-distanziert, neutral oder vertraut—familiär), das nicht zu einer
Standard und Substandard als grammatikalisches Problem gegebenen Situation paßt, als Normverstoß empfunden wird; jedoch soll in der vorliegenden Grammatik die „neutrale Standardsprache" dargestellt werden: Das sind diejenigen grammatischen Strukturen, die der Sprachbenutzer in einer Vielzahl von Situationen mündlich und schriftlich verwenden kann, ohne einen Normverstoß zu begehen. Dabei werden die Strukturen, die für die geschriebene Sprache oder für die gesprochene Sprache typisch sind, jeweils gekennzeichnet (ib.)Als Abweichungen von der neutralen Standardsprache werden zwei Stilebenen unterschieden: im Bereich des Gesprochenen die „familiäre gesprochene Sprache", im Bereich des Geschriebenen die „gehobene geschriebene Sprache", zu der auch die literarische Sprache gerechnet wird. Mit Recht wird betont, daß diese Unterscheidungen als grobe Registermarkierung angesehen werden können. Als Ergebnis dieses ersten Überblicks läßt sich festhalten, daß Klein/ Kleineidam zwar nur einen beschränkten Bereich des Substandards in ihre Grammatik aufnehmen, diesen Ausschnitt - der familiären gesprochenen Sprache - jedoch relativ konsequent und systematisch in der Beschreibung der grammatischen Strukturen berücksichtigen. Es wird deutlich, daß die grundsätzliche Problematik des sprachlichen Substandards und die damit verbundenen grammatischen Phänomene des Französischen den Verfassern vertraut sind und sie versucht haben, die wesentlichen Merkmale in die Darstellung zu integrieren, soweit dies im Rahmen der vorliegenden (Schulund) Universitätsgrammatik möglich gewesen ist. Die Grammatik von Maurice Grevisse, Le Bon Usage, Grammaire française avec des remarques sur la langue française d'aujourd'hui ( n 1980), stellt zweifellos die bedeutendste grammatikalische Zusammenfassung und Beschreibung des Funktionierens des gegenwärtigen sprachlichen Gesamtsystems des Französischen dar. In der Einleitung (25-29) erfährt der Leser allerdings wenig zur Frage des sprachlichen* Standards und der Berücksichtigung substandardsprachlicher Phänomene; zwar wird auf die Unterscheidung langage parlé und langage écrit in sehr allgemeiner Form Bezug genommen (25), jedoch bleibt der Rahmen sehr traditionell: "la phrase est un assemblage logiquement et grammaticalement organisé en vue d'exprimer un sens complet: elle est la véritable unité linguistique" (S. 25, §2). Zur Frage der Norm wird lediglich die folgende Aussage gemacht: La grammaire descriptive expose l'usage linguistique d'un groupement humain à une époque donnée. Elle se borne ordinairement à constater et à enregistrer le "bon usage", c'est-à-dire l'usage constant des personnes qui ont souci de bien parler et de bien écrire. C'est alors la grammaire normative ou, selon la définition habituelle, "l'art de parler et d'écrire correctement" (S. 28, §5).
93
94
Günter Holtus
Trotz dieser nur spärlichen allgemeinen Aussagen zur Frage der Norm und des Substandards zeigt sich jedoch, daß im Abschnitt über die "Adverbes de négation" (S. 1065-1094, §§2174-2233) zahlreiche Markierungen zu Abweichungen von einem als Standard anerkannten bon usage zu verzeichnen sind, die auch im kommentierenden Teil der Grammatik als solche tituliert werden. Dabei werden neben diachronischen (Archaismus) und diatopischen Varietäten (Regionalismus, Dialektalismus) sowohl die grundsätzlichen Unterscheidungen von langue parlée und langue écrite als auch verschiedene Niveaumarkierungen (familier, populaire einerseits, littéraire, soigné andererseits) verwendet. So werden z. B. für die Negation die folgenden Klassifizierungen vorgenommen: "usage familier" (que in der Bedeutung 'seulement, exclusivement', §2187), "inusité dans la langue parlée", "dans la langue écrite, il est archaïque" (mie, § 2188), "dans certains patois" (ib. Anm. 74), "surtout dans la langue poétique" (ni vor dem letzten Element einer Reihung von verneinten Elementen, §2193), "dans la langue parlée et même dans le style littéraire" (bouger nur mit ne, § 2196), "surtout en poésie et dans la langue familière" (Ellipse von ne in Interrogativsätzen, §2202), "langue populaire" (geläufiger Ausfall von ne, ib. Anm. 78), "la langue parlée (...) se débarrasse de plus en plus de cette particule parasite [le ne explétif]" (§ 2203), il[point] est surtout littéraire et semble même avoir disparu du français parlé, sauf dans la langue paysanne" (§2222), "surtout dans le style familier" (pas, point anstelle von non, non pas, §2224), "très couramment dans la langue familière ou populaire" (pas für n'est-ce pas, §2225), "dans l'usage familier" (pas vrai, ib.), "consacré aujourd'hui par le bon usage" (ne ... pas que, ne . . . point que, §2226), "dans la langue littéraire", "une certaine teinte archaïque" (ne vor, pas nach dem Infinitiv, §2228), "tend à passer de la langue populaire dans la langue littéraire", "reste suspecte d'incorrection" (pour ne pas que, §2231), "langue populaire" (pourpas que, ib.). Insgesamt fällt auf, daß nicht nur relativ viele Markierungen im Zusammenhang mit Abweichungen vom Standard, der hier als bon usage bezeichnet wird, auftreten, sondern daß in einigen Fällen auch substandardsprachliche Markierungen („familiär") sich verbinden mit der Klassifikation als „poetischer" oder auch „literatursprachlicher" Gebrauch, der in diesem Kontext somit als „Ausdruck dichterischer Freiheit", als „individualstilistischer" Gebrauch oder als allgemeines „stilistisches" Merkmal zu interpretieren ist. Die grammatischen Regeln zum Thema accord beim Partizip Perfekt betreffen in erster Linie den code graphique; im code phonique treten hörbare Veränderungen überhaupt nur bei den auslautenden Phonen [z] und [t] auf. Aus der Fülle der Einzelprobleme seien die wichtigsten Angaben zur Thematik Substandard und Standard, gegenseitiges Verhältnis, Abweichun-
Standard und Substandard als grammatikalisches Problem
95
gen etc. in der Grammatik von Grevisse, Abschnitt accord des Partizips Perfekt, zusammengestellt: "dans la langue moderne (...) parfois encore chez les poètes" (accord nach direktem Objekt zwischen Hilfsverb und Partizip, (§ 1910 Anm. 247), "règle (...) artificielle" (accord des mit avoir konjugierten Partizips Perfekt, § 1910, vgl. die Zitate von Cohen undThérive, "tradition universitaire", "divorce secret entre la langue écrite et la langue vivante", "pseudo-règle grammaticale", "morte dans l'usage", "désuétude", ib. Anm. 248), "règle (...) pas sûre" (ci-inclus, ci-joint ohne accord bei Stellung vor dem Bezugswort, § 1914 Anm. 250), "l'usage ne tient aucun compte de ces distinguos de logiciens" (Sonderfälle des accord bei vorausgehendem direktem Objekt, § 1921), "l'accord du participe dépend de l'intention de celui qui parle ou qui écrit, ou bien du sens" (accord bei zwei vorausgehenden, mit ou oder ni verbundenen Elementen, § 1926), "Pour certains grammairiens, le participe passé suivi d'un infinitif ne devrait jamais s'accorder, parce que le vrai complément d'objet direct est l'infinitif avec ses accessoires. — Il n'empêche que, dans l'usage, on observe généralement les règles suivantes . . . " (§ 1929), "Dans l'usage, il règne en ceci une grande confusion" (accord bei laissé + Infinitiv, § 1931), "L'usage des bons auteurs se plie à ces exigences du sens; il sait d'ailleurs faire, à l'occasion, entre l'accord et l'invariabilité de ces participes, une certaine distinction ( . . . ) . Mais, d'une façon générale, à moins que le sens n'impose absolument l'invariabilité, les auteurs considèrent qu'il est indifférent de rapporter au participe ou à l'infinitif le pronom complément et optent, sans raison impérieuse, tantôt pour l'accord, tantôt pour l'invariabilité" (§ 1933), "Selon la plupart des grammairiens, on laisse invariable le participe passé précédé de l'adverbe pronominal en; on justifie cette invariabilité en disant que en est un neutre partitif signifiant 'de cela, une partie de cela' et qu'il est, non pas objet direct du participe, mais complément déterminatif du nom partie (ou quantité) sousentendu (...)• N. B. — Cette règle est fort précaire. En réalité, l'usage est très indécis et l'accord a souvent lieu, en étant senti, non comme un neutre, mais comme un complément d'objet partitif dont le genre et le nombre sont ceux du nom représenté" (§§1935—1936), "Le cas du participe passé précédé de en et d'un adverbe de quantité est controversé. Les uns veulent que ce participe soit toujours invariable; d'autres admettent l'accord par syllepse quand l'adverbe de quantité précède en ( . . . ) . Le Dictionnaire de l'Académie garde le silence sur ce cas épineux. Pratiquement, le mieux est de laisser ce participe invariable dans tous les cas" (§ 1937 Anm. 259), "Ici encore la règle est très précaire, et il n'est pas rare de rencontrer ce participe accordé avec le nom représenté par en" (§ 1938), "On observe, dans l'usage populaire, et parfois même chez d'excellents auteurs, une tendance instinctive à faire accorder, dans tous les cas, le participe des verbes pronominaux avec le sujet" (§1941 Anm. 261), "L'usage ordinaire laisse plu, déplu, complu
96
Günter Holtus
invariables. Certains auteurs, traitant se plaire, se déplaire, se complaire comme les autres verbes pronominaux avec pronom censément préfixé, font plu, déplu, complu variables" (§ 1943). Das Überraschende an der ausführlichen Darstellung der Regeln zum accord des Partizips Perfekt im Französischen in der Grammatik von Grevisse ist, daß eine klare Zuordnung von Tendenzen zum Standard und zum Substandard in einer ganzen Reihe von Fällen überhaupt nicht möglich erscheint, daß sich infolge der Artifizialität der Regeln für die heutige Sprache diesbezüglich eine Trennung von Standard und Substandard nicht mehr durchführen läßt. Somit wird an diesem Beispiel die Problematik der Abgrenzung von Standard und Substandard besonders deutlich: Die größtenteils historisch gewachsenen, teilweise künstlichen Regeln zum accord des Partizips Perfekt sind für das Funktionieren des Sprachsystems wenig von Belang, allein die präskriptive Norm erhält in diversen Fällen einen Regelapparat aufrecht, der für den Sprachgebrauch nicht mehr unabdingbar erscheint. Als Ergänzung zu den beiden eher traditionell ausgerichteten Grammatiken von Klein/Kleineidam und von Grevisse sei nun noch auf die methodisch andersartige Textgrammatik der französischen Sprache von Harald Weinrich (1982) näher eingegangen. In dem Abschnitt „Grundlagen der Grammatik" nimmt der Verfasser zu den Abgrenzungen von Standard und Substandard und allgemein zu den methodischen Voraussetzungen seines Werkes, bei dem es sich „um eine erste voll ausgearbeitete Grammatik handelt, die konsequent textlinguistisch und kommunikations-anthropologisch verfaßt ist" (23), wie folgt Stellung: Die Grammatik soll 'deskriptiv', nicht 'normativ' (gemeint ist: 'normativ' im Sinne von 'präskriptiv') sein, ihr Thema „ist das, was in der Sprache ist oder sein kann, und nicht, was in ihr sein soll" (25); die Beschreibungen beziehen sich auf die französische Sprache der Gegenwart, wobei es nicht das Ziel ist, die vielen regionalen, sozialen und zweckspezifischen Varianten, aus der die französische Sprache — wie jede Kultursprache — besteht, abzubilden, vielmehr orientiert sich die Grammatik an einem „relativ disziplinierten Sprachgebrauch, wie er bei gebildeten Franzosen im Gespräch mit ausländischen Gesprächspartnern üblich ist" (26). Im Rahmen der linguistischen Grundlagen nimmt Weinrich ferner Stellung zu den Varietäten und dem Thema Sprechkode und Schriftkode: Der Sprechkode gilt nicht nur für die tatsächlich gesprochene Sprache, sondern auch für gewisse schriftliche Sprachäußerungen, die dem mündlichen Sprachgebrauch nahestehen oder ihn bewußt nachahmen (zum Beispiel: alltägliche Briefe, Tagebuchaufzeichnungen . . . ) . Desgleichen gilt der Schriftkode nicht nur für tatsächlich geschriebene Sprachäußerungen, sondern auch für solche Formen des mündlichen Sprachgebrauchs, die sich an einer schriftlichen Vorlage orientieren oder aus stilistischen Gründen den Normen des Schriftkodes folgen (zum Beispiel: Vorträge, Rundfunknachrichten . . . ) . Die unterschiedliche Teilhabe am
Standard und Substandard als grammatikalisches Problem Kode der Sprache und seinen Varietäten schränkt die Möglichkeiten der Kommunikation in einer Sprachgemeinschaft ein. Andererseits gleichen alle Gespräche, die erfolgreich geführt werden, bestehende Unterschiede in der Beherrschung des Kode in gewissen Grenzen wieder aus (28). Vergleicht man nun die (begrüßenswerten) programmatischen Aussagen der Einleitung mit der Darstellung eines grammatischen Teilbereichs, dem der Negation, so bleibt zunächst anzuerkennen, daß die Einbettung dieser Thematik innerhalb einer „Syntax des Gesprächs" als methodisch konsequent und gelungen bezeichnet werden kann (679-805, vgl. zum Gesprächskontakt 680-700, zur Assertion 700-734, davon Affirmation 701-705, Negation 705-734, Frage und Antwort 734-784, zitierte Meinungen 784-805). Zum Verhältnis von Standard und Substandard lassen sich die folgenden Aussagen im Abschnitt über die Negation zusammentragen: „gelegentlich" wird die Variante non pas zu pas verkürzt (709), „In der mündlichen Umgangssprache wird das Vorsignal ne oft weggelassen. Man sagt also vielfach, sofern man sich eine gewisse Lässigkeit im Reden erlauben kann ( . . . ) . Man schreibt jedoch in der Regel, sofern nicht mündliche Rede im Schriftbild imitiert werden soll ( . . . ) " (710, vgl. 713), das Negationsmorphem steht „in der Regel" mit seinen beiden Elementen vor dem nicht-finiten Verb (712), eine „veraltete Nebenform" ist ne . . . point 'nicht', „Sie ist um eine Nuance nachdrücklicher, wird jedoch nur regional und insgesamt sehr selten gebraucht. Man findet sie hauptsächlich in älteren Texten", während als verstärkende Varianten ne . .. nullement, ne . . . aucunement, ne . . . absolument pas auftreten können (713; ne .. . pas du tout etc. wird nicht erwähnt, vgl. jedoch ne . . . rien du tout, 111), die „Umgangssprache" verzichtet manchmal „auf diesen Negativ-Junktor" {ne ... ni... ni) und verwendet et... ne . .. pas . . . non plus (723), die „mündliche Umgangssprache läßt das Vorsignal ne nicht selten weg" (725), in der „gesprochenen Umgangssprache wird das Vorsignal ne ebenso wie bei den anderen gebundenen NegationsMorphemen nicht selten weggelassen" (726). Die methodisch ohne Zweifel gelungene und ausgereifte Darstellung der Negation läßt im Hinblick auf die Markierung und die Klassifikation von standardsprachlichen und substandardsprachlichen Erscheinungen einige Wünsche offen. Die Terminologie der Zuordnung schwankt, bisweilen treten auch sich widersprechende Charakterisierungen auf. Dem muß allerdings entgegengehalten werden, daß infolge der textlinguistischen Ausrichtung der Grammatik und der in der Einleitung geäußerten theoretischen und linguistischen Grundlagen in diesem Werk den Varietäten prinzipiell weniger Gewicht beigemessen werden soll. Außerdem ist zu berücksichtigen, daß die Orientierung der Grammatik am Textbegriff von vornherein eine soziolinguistische Klassifikation als weniger dringlich erscheinen läßt als die genauere Beschreibung der Funktion etwa der Negationsträger in
97
98
Günter Holtus
einem Text, ihre Stellung im Dialog und ihre Auswirkungen auf den weiteren Gesprächs- und Handlungsablauf. Die Verbindung textlinguistischer Vorgehensweisen mit der varietätenlinguistischen Situierung grammatischer Phänomene bleibt ein für die Zukunft einzulösendes Desiderat. Dem grammatischen Thema des accord beim Partizip Perfekt wird in der Textgrammatik kein eigenes Kapitel gewidmet, doch werden einzelne Fälle des accord im größeren Zusammenhang von Kongruenz von Genus und Numerus mit dem Bezugselement (34—72) gelegentlich mit angesprochen. Die Auswertung weiterer Grammatiken der französischen Sprache bringt keine grundsätzlich neuen, von den bisherigen Analysen abweichenden Erkenntnisse zum Thema Standard und Substandard als grammatikalischem Problem, so daß hier eine auswahlhafte Darstellung genügt, um den repräsentativen Charakter der bisherigen Untersuchungsergebnisse zu untermauern. Zunächst erscheint auffällig, daß die Beziehungen zwischen Standard und Substandard insgesamt recht differenziert in der einleitenden Konzeption der Grammatiken erläutert werden. Die Grammaire Larousse du français contemporain von Chevalier et al. (1964) ergänzt die Beschreibung des Gegenwartsfranzösischen mit Beispielen aus dem klassischen Französischen des 17. (und 18.) Jahrhunderts und präzisiert: "la notion de 'bon usage', dotée par les grammairiens du XVII e siècle d'un statut précis, est aujourd'hui impossible à saisir. Nous avons donc rappelé soigneusement les prescriptions de la grammaire normative, mais, dans le même temps, nous avons cherché, aussi précisément que possible, à fixer les divers usages (langue écrite et langue parlée, usage familier et usage recherché, etc.)" (5), wobei als Quellen Grammatiker und chroniqueurs, literarische Werke und Textkorpora gesprochener Sprache ("les dépouillements du Français élémentaire et nos propres enregistrements", ib.) herangezogen werden: "Cette analyse attentive des divers niveaux de langue nous a conduits à accorder une plus grande place à des faits parfois un peu négligés" (ib.). Relativ ausführlich beschreibt Mauger (71968), auch aus didaktischen Überlegungen (vgl. S. III), die Beziehungen zwischen gesprochener und geschriebener Sprache und den "quatre tranches, allant de la langue la moins populaire à la plus populaire" (S. V): 1. Un français écrit, essentiellement littéraire (...). 2. Une langue courante, qui se placerait entre le français écrit littéraire et le français parlé familier: celle qu'emploie le Parisien de moyenne culture dans une conversation avec un interlocuteur qu'il ne connaît pas intimement, avec un de ses supérieurs ou un de ses chefs (...). 3. Un français parlé familier (...). Il suppose des rapports plus étroits avec l'interlocuteur (...). La langue courante s'alimente constamment à cette source (...). 4. Un quatrième niveau concerne le français parlé populaire (.. .). Ce sera la langue pratiquée en général par les ouvriers entre eux.
99
Standard und Substandard als grammatikalisches Problem Enfin nous ne citons que pour mémoire le français parlé vulgaire (...) auquel appartiennent les expressions basses ou grossières (S. Vf.). Das Verhältnis dieser vier Ebenen wird im Schaubild so dargestellt: français écrit (littéraire)
langue courante (écrite et parlée)
_ français parlé familier
_ français parlé populaire
Presse et radio — Récit des romans (S. VI). Daraus ergeben sich folgende Ratschläge für den Benutzer der Grammatik: - Pour l'écrit: La rédaction d'un texte d'une certaine tenue (rapport, conférence, essai) demanderait qu'on s'en tienne à la substance embrassée par le français écrit littéraire (...) et la langue courante. S'il s'agit de rédiger un dialogue (roman ou théâtre), une lettre à un ami, les tours de la langue courante et du français parlé familier devraient convenir. - Pour la conversation: Dans la conversation quotidienne, la langue courante permettra de concilier le naturel et la bonne tenue. Mais les expressions du français parlé familier, et même populaire, ne seront pas toujours déplacées. Tout dépendra des circonstances, de la culture de l'interlocuteur et du ton qu'il confère à l'entretien. Dans tous les cas, il faudra éviter les expressions du français parlé vulgaire et celles qui seront indiquées comme archaïques ou affectées (S. VI). Wagner/Pinchon (21973) gehen in der Einleitung nur sehr knapp auf den Begriff des français commun ein: "Non sans de bons motifs, les grammairiens modernes entendent sous le nom de 'français commun' la langue qui sous-tend les énoncés informatifs c'est-à-dire tous ceux qu'un français réalise en tant que 'je' et au nom de son 'je' d'une manière spontanée, sans prendre le temps d'organiser son discours" (6). Es überrascht, daß die ausführliche Grammatik vonTogeby, in der Überarbeitung seitens seiner Schüler (1982-), an keiner Stelle der Einleitung (9-17) zum Thema des sprachlichen Standards Stellung bezieht (dafür jedoch einen willkommenen systematischen Überblick über die Teilbereiche der Syntax und der Morphosyntax bietet). Die Markierung der vom Standard abweichenden Varietäten erfolgt gemäß den zitierten allgemeinen Zielsetzungen in den jeweiligen Einleitungen - in der Grammatik von Mauger (71968) relativ ausführlich (vgl. etwa S. 373-378 zur Negation). Einen noch breiteren Raum nimmt die Darstellung der Negation in der Grammatik von Togeby ein (S. 222-303, §§1781-1885); dabei wird auch das in der Einleitung zu vermerkende Fehlen an Aussagen zum Standard und zu substandardsprachlichen Merkmalen mehr als ausgeglichen, wie sich bereits an der das Kapitel der Negation eröffnenden Feststellung zum Ausfall des ne als Kennzeichen der langue familière ersehen läßt: "Dans la langue familière, on n'utilise pas de ne. On se contente des autres négations. Du point de vue de ce niveau de langue, le ne est donc un élément superflu,
100
Günter Holtus
ou redondant, appartenant à la langue littéraire. Cependant, quand on veut décrire les deux niveaux de langue, il paraît plus simple de considérer l'usage de la langue familière comme une réduction de la langue littéraire que de recenser les cas où celle-ci ajouterait ne" (222). In den folgenden Ausführungen, die hier nicht mehr in extenso zitiert werden sollen, wird kontinuierlich auf Abweichungen vom Standard, einerseits in Richtung langue littéraire, andererseits in Richtung langue familière und langue populaire, verwiesen (weitere Kennzeichungen: langue écrite und langue parlée, langue courante, régionalismes, style très littéraire, jargon militaire, variante archaïque, littéraire ou régionale, langue courante de la conversation, usage littéraire, pour ne pas dire archaïque, etc.). Letzten Endes bleibt für den Benutzer der Grammatik von Togeby lediglich zu bedauern, daß die vorbildliche Gesamtdarstellung des Kapitels der Negation mit ihren zahlreichen Beobachtungen zu Abweichungen vom Standard nicht innerhalb eines klar umrissenen Markierungsgefüges vollzogen wird, das es dem Leser ermöglichen würde, klarere Abgrenzungen gerade im Bereich des Substandards vorzunehmen. Es wird jedoch deutlich, daß die Niveauzuordnungen weitaus konsequenter und häufiger erfolgen als etwa in den entsprechenden Abschnitten der Grammatiken von Chevalier (S. 427-431, §§ 622-630) und Wagner/Pinchon (S. 394-412, §§469-488). In Ergänzung zu dem Überblick anhand repräsentativer Grammatiken des Gegenwartsfranzösischen sei noch kurz auf zwei Handbücher eingegangen, die für die Zuordnung grammatischer Phänomene zum Standard und zum Substandard in der Tradition der französischen Grammatikographie eine erhebliche Rolle spielen, und zwar die grammatischen Wörterbücher zu den difficultés de la langue française von Thomas (1971) und den difficultés du français moderne von Hanse (1983). Thomas nimmt in der Einleitung klar Stellung zu der Position seines Handbuchs, das Fehler, „Barbarismen" etc. insbesondere auf der Vergleichsgrundlage und gemäß dem Maßstab des Dictionnaire de VAcadémie française und des Sprachgebrauchs der "écrivains tant classiques que contemporains" (S. XI) als solche herauszustellen beabsichtigt: Nous avons évité autant que possible de donner des exemples littéraires infirmant une règle reconnue: cette méthode ne contribuant qu'à semer l'indécision et le doute dans l'esprit du lecteur, qui ne sait plus quel parti prendre. D'aucuns nous reprocheront peut-être, de ce fait, d'avoir été trop strict en une matière qui est en continuelle évolution, mais il ne nous est pas interdit de penser que d'autres nous trouveront trop libéral dans le choix de nos exemples. Faudrat-il en déduire que nous avons réussi à nous tenir dans un juste milieu? C'est là notre but: maintenir la pureté de la langue des "honnêtes gens", tout en tenant compte de son évolution. Ferner weist Thomas auf die sozialen Auswirkungen fehlerhaften, substandardsprachlichen Gebrauchs hin: "Il n'est pas inutile de rappeler qu'il suffit
Standard und Substandard als grammatikalisches Problem
101
souvent d'un seul mot employé à contresens, d'une construction fautive ou d'une prononciation barbare pour marquer définitivement l'auteur de l'une de ces inconséquences" (ib.). Aus dieser Haltung resultiert auch die eindeutige Ablehnung der in der Entwicklung der französischen Grammatik des 20. Jahrhunderts umstrittenen Toleranzerlasse von 1901 (bzw. 1976, der bei Thomas nicht berücksichtigt werden konnte): "Pour terminer cette courte introduction, rappelons que le décret du 26 février 1901, derrière lequel s'abritent les partisans d'une langue plus libérale, n'est qu'un édit de tolérance aux examens et concours, et qu'il ne doit, en aucun cas, couvrir des incorrections qu'une personne cultivée ne saurait commettre" (ib.). Michel de Toro unterstreicht im Vorwort der Ausgabe von 1971 noch einmal die Intentionen von Thomas, indem er auf den zeitgenössischen "engouement encore plus général" in Fragen der "casuistique du langage" verweist: "On se pique de bien parler, même lorsqu'on parle mal ( . . . ) . Le développement de l'instruction primaire a eu pour résultat d'accroître le nombre de personnes soucieuses de bien parler. Il a donné lieu à une abondante littérature du 'bon usage'" (S. VI). Differenzierter erscheint dagegen die Einstellung zu Fragen des Standards und des Substandards, die Hanse in seinem Wörterbuch von 1983 äußert. Er möchte einerseits dem Benutzer des Handbuchs in Zweifelsfällen klare und eindeutige Lösungsvorschläge bieten, muß jedoch anerkennen, daß der Sprachgebrauch dies nicht immer zuläßt: "l'usage est souvent plus variable ou plus instable que ne le prétendent la grammaire scolaire traditionnelle ou les puristes" (8). Sein Bestreben ist: " . . . réformer certains jugements non fondés et (. ..) définir nettement le bon usage. Celui-ci peut s'établir scientifiquement si on tient compte non seulement des bons linguistes et des meilleurs dictionnaires, mais dans chaque cas du nombre et de la qualité des gens cultivés et des écrivains qui peuvent offrir leur caution dans la mesure où l'on perçoit, et c'est facile, l'importance qu'ils accordent, les uns et les autres, à la correction du langage en général" (ib.). Daraus ergeben sich für ihn die folgenden Erfordernisse: une information scrupuleuse, une réflexion qui me laisse à distance des laxistes comme des puristes, de l'archaïsme comme du laisser-aller ou du laisser-faire. À maintes reprises, je note que tel usage est vieilli ou rare ou littéraire, que tel autre appartient à un français régional ou au registre familier ou populaire. Je prends soin d'ailleurs, très souvent, de nuancer ces dernières épithètes. Chacun comprendra que le français familier, celui de la conversation, surtout entre intimes, n'est pas fautif parce qu'il est détendu, mais qu'il se distingue du français soigné, surveillé, imposé souvent par les circonstances dans le langage écrit ou même parfois dans le langage oral. Quant au français populaire, il a aussi ses degrés, mais il faut savoir que dans l'ensemble il se caractérise par la spontanéité, par l'invention et la liberté, par l'absence de tout souci de norme ou de distinction, sans aller d'ailleurs pour cela jusqu'à la vulgarité (8f.).
102
Günter Holtus
Als Grundprinzip hält Hanse fest, daß die zu beschreibende Sprache die des français vivant, "celui de la vie courante" (9), sein soll. In bezug auf die offiziellen Toleranzerlasse des französischen Unterrichtsministeriums setzt er die Tradition von Thomas fort, indem er den "Arrêté ministériel français du 28 décembre 1976, relatif à des 'tolérances grammaticales ou orthographiques'" ablehnt: "C'est qu'il ne peut être pris en considération par celui qui a le souci d'écrire et de parler correctement. Simple mesure scolaire, il est rempli d'erreurs de fait et de jugement. Je les ai dénoncées avec d'autant plus de vigueur que je suis un partisan déclaré de certaines réformes dans l'enseignement et la pratique de la langue" (10; vgl. zur Interpretation der Erlasse auch Verf. 1979). Als Ergebnis der Untersuchung der Grammatiken und grammatischen Wörterbücher läßt sich festhalten, daß zwar in einzelnen grammatischen Bereichen — wie hier anhand der Negation und ausschnitthaft des accord des Partizips Perfekt exemplifiziert - die Zuordnungen zum standardsprachlichen Gebrauch und zu den substandardsprachlichen Abweichungen bis auf einige Sonderfälle des komplexen Bereichs des accord im wesentlichen vorgenommen werden, daß jedoch eine systematische Kennzeichnung unterbleibt und ein allgemein anerkannter Maßstab angesichts der Dynamik der Entwicklung des Französischen im 20. Jahrhundert nicht mehr zu erkennen ist. Obwohl die dieser Analyse zugrunde gelegten Grammatiken und grammatischen Wörterbücher insgesamt als repräsentativ und maßgeblich für Grammatikdarstellungen des Gegenwartsfranzösischen angesehen werden können und - mit Ausnahme der Textgrammatik von Weinrich keinen grundlegend verschiedenartigen methodischen Verfahrensweisen oder besonderen, eigenständigen Beschreibungsmodellen verpflichtet sind, divergieren die Aussagen zum Teil derart erheblich, daß in Einzelfällen sogar widersprüchliche Angaben auftreten. Die Gründe für die unterschiedlichen Klassifizierungen liegen zum einen in der Sache selbst, der Eigenart der Entwicklungsgeschichte der französischen Sprache im 20. Jahrhundert, zum anderen in der unterschiedlichen Beurteilung der Relevanz von Maßnahmen in den Bereichen der Normfestsetzung und der Einschätzung sprachpflegerischer und -puristischer Tendenzen, d. h. generell in der Divergenz der Einstellung gegenüber Fragen der Soziolinguistik, der Sprachpolitik und der Sprachdidaktik. Die Untersuchung hat ferner offenbart, daß gerade die Verfasser von Grammatiken (neben den Lexikographen) diejenigen sind, die eigentlich für die inhaltliche Ausfüllung des mit dem Terminus 'Substandard' belegten Bereichs zuständig wären. Die Zuweisung von Varietäten zu einem jeweils zu definierenden Standard und die Abweichungen von diesem Standard oberhalb einer festzulegenden Norm und unterhalb dieser Norm (Substandard) vollziehen sich in keinem Teilbereich der Sprachwissenschaft so selbst-
Standard und Substandard als grammatikalisches Problem
103
verständlich wie gerade in der Grammatikographie und in der Lexikographie. Von daher erscheint es umso erstaunlicher, daß es zwar immer wieder Ansätze zu einer Diskussion der Normfestsetzungen in Grammatiken und Wörterbüchern gegeben hat, ein kohärentes und systematisches Gliederungsprinzip jedoch (bisher) nicht vorliegt. Dieser Umstand läßt sich, wie bereits angedeutet, zum einen darauf zurückführen, daß die sprachlichen Bereiche selbst, in denen divergierende Varianten eines bestimmten Phänomens auftreten (man denke über die hier analysierten Themen hinaus an so unterschiedliche Teilbereiche wie die der Numerusmarkierung von Nominalsyntagmen, die Darstellung der temps surcomposés oder die Besonderheiten der Segmentierung), in sich derart differenziert sind und dauernden historischen Veränderungen unterliegen, daß ein einheitliches Regelsystem und ein daraus ableitbarer Markierungsraster gar nicht (mehr) erstellt werden können. Zum anderen zeigt sich gerade auf dem Gebiet der romanischen Sprachen, daß infolge der Bedeutung und der Resonanz sprachnormierender und sprachpolitischer Maßnahmen in der jeweiligen Sprachgemeinschaft, angefangen von sprachpflegerischen Initiativen in den Medien {chroniques de langage etc.) bis hin zu den gesetzgeberischen Maßnahmen (Spracherlasse, Sprachgesetzgebung und Terminologiekommissionen) die Diskussion über eine generelle Standortbestimmung des sprachlichen Standards und der substandardsprachlichen Varietäten bereits über eine lang andauernde Tradition verfügt, in der sich restriktive und liberale Tendenzen in der Frage der Normfestsetzung teils einander ablösen, teils einander ergänzen. Die Bestimmung eines sprachlichen Substandards steht im Rahmen dieser Tradition in einem engen Zusammenhang mit der jeweiligen Standortbestimmung der Sprachbenutzer und der Sprachbetrachter, sie ist somit weniger systemlinguistisch bedingt, als vielmehr dem historischen Wandel der Normfestlegung und der Spracheinschätzung unterworfen.
Literatur Barrera-Vidal, Albert, Rez. zu Klein/Kleineidam 1983, Praxis des neusprachlichen Unterrichts 31 (1984), 207-208. Chevalier, Jean-Claude et al., Grammaire Larousse du français contemporain, Paris, Larousse, 1964. Frei, Henri, La Grammaire des fautes, Paris, Geuthner, 1929. Grevisse, Maurice, Le Bon Usage. Grammaire française avec des remarques sur la langue française d'aujourd'hui, Stuttgart/Paris/Gembloux, Klett/Duculot, n 1980. Hanse, Joseph, Nouveau dictionnaire des difficultés du français moderne, Paris/Gembloux, Duculot, 1983. Holtus, Günter, Code parlé und code écrit und ihre Berücksichtigung in französischen (Schul-)Grammatiken, Neusprachliche Mitteilungen 31 (1978), 100-111.
104
Günter Holtus
Holtus, Günter, 75 Jahre französische Sprachnormierung und französische Grammatik: zu den Spracherlassen von 1901 und 1976, Französisch heute 10 (1979), 191-202,239-248. Holtus, Günter, Norm und Varietät im Italienischunterricht, in: Mair, Walter N./Meter, Helmut (edd.), Italienisch in Schule und Hochschule. Probleme, Inhalte, Vermittlungsweisen, Tübingen, Narr, 1984, 27-44 (= 1984a). Holtus, Günter, L'emploi des formes surcomposées dans les variétés linguistiques du français et l'attitude des grammairiens, Französisch heute 15 (1984), 312-329 (= 1984b). Klein, Hans-Wilhelm/Kleineidam, Hartmut, Grammatik des heutigen Französisch, Stuttgart, Klett, 1983. Kleineidam, Hartmut, Französische Grammatik im Wandel. Zur Konzeption der Grammatik in Lehrwerken des Französischen für die Erwachsenenbildung, Zielsprache Französisch 17 (1985), 1-11. Königs, Frank G., Normenaspekte im Fremdsprachenunterricht. Ein konzeptorientierter Beitrag zur Erforschung des Fremdsprachenunterrichts, Tübingen, Narr, 1983. Mauger, Gaston, Grammaire pratique du français d'aujourd'hui - langue parlée, langue écrite, Paris, Hachette, 71968. Müller, Bodo, Das Französische der Gegenwart. Varietäten, Strukturen, Tendenzen, Heidelberg, Winter, 1975. Radtke, Edgar, Die Rolle des Argot in der Diastratik des Französischen, Romanische Forschungen 94 (1982), 151-166. Radtke, Edgar, Das gesprochene Italienisch in der Normdiskussion des Fremdsprachenunterrichts, in: Mair, Walter N./Meter, Helmut (edd.), Italienisch in Schule und Hochschule. Probleme, Inhalte, Vermittlungsweisen, Tübingen, Narr, 1984, 153-164. Rattunde, Eckhard (ed.), Sprachnorm(en) im Fremdsprachenunterricht, Frankfurt am Main/Berlin/München, Diesterweg, 1979. Schmitt, Christian, Sprachplanung und Sprachlenkung im Französischen der Gegenwart, in Rattunde 1979, 7-44. Seelbach, Dieter, Linguistik und französischer Grammatikunterricht. Eine Einführungfür Lehrende und Studierende, Tübingen, Narr, 1983. Thomas, Adolphe V , Dictionnaire des difficultés de la langue française, Paris, Larousse, 1971. Stammerjohann, Harro, Französisch für Lehrer. Linguistische Daten für Studium und Unterricht, München, Hueber, 1983. Togeby, Knud, Grammaire française. Publié par Magnus Berg, Ghani Merad et Ebbe Spang-Hanssen, Copenhague, Akademisk Forlag, 1982—. Wagner, Robert-Léon/Pinchon, Jacqueline, Grammaire du français classique et moderne, Paris, Hachette, 2[1973]. Weinrich, Harald, Textgrammatik der französischen Sprache, Stuttgart, Klett, 1982. Zimmermann, Günther, Was ist eine „Didaktische Grammatik"?, in: Kleine, Winfried (ed.), Perspektiven des Fremdsprachenunterrichts in der Bundesrepublik Deutschland, Frankfurt am Main/Berlin/München, Diesterweg, 1979, 96—112.
Substandard als ästhetische Wertung in der Sprachgeschichte Edgar Radtke (Mainz)
1. A. Pedro amigo de- que se haze la puta vieia? P. De la puta moça. M. No, sino por hauerlo sido gran tiempo, y parido vn hideputa. A. Pietro amico caro di che si fà la putana vecchia? P. Dalla giouane. M. Questo no, ma per esserla stata gran tëpo prima, ed hauer partorito vn figliuol di bagascia. A. Mein guter Freundt Peter, woraus macht man ein alte Hur. P. Aus einer Iungen. M. Nein, sondern dieweil sie lang zuuor eine gewest ist, vnd einen Hurnsohn getragen hatt. A. Pierre mon amy, dequoy se fait la vieille putain? P. De la ieune. M. Non, mais pour l'auoir esté longtemps auparauant, & auoir porté vn fils de ribaude. (Oudin 1665, 182-185) A. Pedro alli viene vn caminante, echale vna pulla. P. Olà hermano, por donde van? Caminante. A d o ? P. En casa de la puta que os pariö. A. Buena a fee, otra al companero que quoda atras. P. A. Serïor, es suyo el mulo? P. Aquel que beseys. Cam. Qual mulo? en el culo [sic] A. Pietro, ecco là vn passagiero, digli un motto. P. Oh la fratello, di doue si va? Passag. In che luogo? P. A casa délia puttana, che ti ha fatto. A. Buono a fè, vn altro al compagno, che gli vien dietro. P. Oh signore è suo il mulo? Pas. Che mulo. P. Quello, che voi lo bacciate nel culo. A. Peter, sehe da kompt ein wandersman gebet ihm ein Stich der nicht blute. P. Herr Bruder, welchen weg mus man gehen? Wandersman. wohin? P. In der Hure Haus die dich geboren hatt. A. Der ist in der warheit gut, noch einen vor den, der hinder ihm geht.
106
Edgar Radtke
P. Ho mein Herr, ist der Maulesel ewer? wan. welcher Maulesel? P. Dem ihr den Ars küssen werdet. A. Pierre, voicy venir vn passant, donnez-luy son lardon. P. Haula frère, par où va-t'on? Passant. Où? P. A la maison de la putain, qui vous a mis au monde. A. Bon par ma foy, encore vn à celuy qui est derrière. P. Hau Monsieur, ce mulet est-il a vous? Pa. Quel mulet? P. Celuy que vous baiserez au derrière.
(Oudin 1665, 186-187)
Sicherlich kann man sich im 17. Jahrhundert keinen angeseheneren Fremdsprachenlehrer vorstellen als Antoine Oudin, „secretaire, interprète dv Roy treschrestien" 1 , dennoch ist der heutige Leser erst einmal irritiert: Diese Texte sollen für jüngere Adelige, die vor ihrer ersten Bildungsreise standen, und für das gehobene Bürgertum bestimmt gewesen sein? Darf ein offizieller, königlicher Dolmetscher auf solch niedere Sprachebenen und düpierende Situationen zurückgreifen, um die Alltagssprache zu vermitteln? Ist das noch die Sprache der französischen Klassik, das vorbildliche Französisch? Unter dem Gesichtspunkt der Fremdsprachenvermittlung lassen sich die beiden Auszüge, die durchaus Parallelen bei anderen Dialogbüchern aufweisen, nicht mehr als Elemente der normalen Alltagskommunikation rechtfertigen, eher wird man den Höfling Oudin aus heutiger Sicht als engagierten Verbreiter von Vulgarismen, von Substandardformen nach der Lektüre dieser Textproben einschätzen wollen. Hat sich die ästhetische Wertung geändert? Zunächst einmal ist vorauszuschicken, daß die Vermittlung fremdsprachlichen Substandards in der Sprachgeschichte keineswegs so neu oder gar schockierend ist. Vielmehr hat sich diese Tradition bis heute gehalten und ist vielleicht aktueller denn je: Ein angesehener deutscher Taschenbuchverlag vertreibt unter der Reihe „Anders reisen" Textanthologien zum Substandard mit Worterklärungen des Typs engl, wally „Blödmann", berk „Vollidiot" (O'Sullivan/Rösler 1985, 113), frz. faire chier „anmachen", un engin à la con „Scheißmaschine" (Jue/Zimmermann 1984, 71). Bereits leicht veraltet sind solche besonders umgangssprachlich ausgerichteten Sprachmittler von Selvani 1965 oder Perales/Gossen 1962. Das Italienischlehrbuch der Pasolini-Sprachschule ([1982], 73) vermittelt bereits im fünften Kapitel vaffanculo. Insofern haben wir uns heute noch nicht allzu weit von der Auffas1
So im Titelblatt zur zitierten Ausgabe. Zur Biographie und zur umfangreichen Lehrbuchproduktion wie auch zu Grammatiken und Wörterbüchern von Antoine Oudin vgl. Winkler 1912, 18-24.
Substandard als ästhetische Wertung in der Sprachgeschichte
107
sung des Lernstoffes bei Oudin entfernt. Oudin selbst hat zu seiner Zeit keinen Anstoß erregt, das Werk ist von der Zensur genehmigt worden. Warum stößt man sich eventuell heute an den Dialogen? Die fingierten Gesprächssituationen geben Scherze wieder; der erste bezieht sich auf die Prostitution, der zweite dient dazu, Fremde zu nasführen. Sexuelle Konnotationen sind in den Gesprächsbüchern recht häufig2 und dürften den Benutzer nicht weiter gestört haben, sonst wären die nachfolgenden Ausgaben oder auch Übernahmen in andere Werke ausgeblieben. Das Necken wird insofern als peinlich empfunden, als die sozialen Hierarchien im 17. Jahrhundert dies nur bei Niedriggestellten zuließen: Die Anrede holhola war für sozial Niedriggestellte vorgesehen zum Zweck der Kontaktaufnahme anstelle einer eingehenden Begrüßung {Dieu vous doint le bon iour + Befindensformeln). Oudins Beispiele entsprechen durchaus dem Normempfinden seiner Zeit, das sich nicht erhalten hat. 2. Welche Folgerungen lassen sich aus dieser Episode ziehen? Norm und Subnorm etwa im Französischen des 17. Jahrhunderts werden an dem Kanon der „großen" Werke herausragender Autoritäten gemessen: Das, was die Académie française notiert, gehört zur Norm, das Nichtauf genommene bzw. das explizit Getadelte fällt in die Subnorm (wobei zu fragen ist, inwieweit sie dann überhaupt bekannt sein kann); Vaugelas' Trennung in dites und ne dites pas führt wenigstens Subnormkonstruktionen auf. Anhand einer solchen Trennung kann Wolf 1984 daraus Regionalismen des Pariser Raumes bestimmen, die nicht zur langue commune gehören. Die Dokumentation der Subnorm sollte sich allerdings nicht ausschließlich an den normgebundenen Schriften orientieren. Vielmehr müssen dazu Textsorten bemüht werden, die den Bereich zwischen Norm - Alltagssprache - Subnorm gründlich erfassen und nicht ausschließlich im Dienst der Normerhebung stehen. Für die deutsche Gegenwartssprache bemüht Schwitalla 1976 vier Bezugsbereiche, die auch ihre analoge sprachliche Manifestation erfahren: Alltag, Wissenschaft, Literatur, Religion sind Gebrauchstexte, wissenschaftliche, literarische, religiöse Texte zugeordnet 3 . Nun hat die Sprachgeschichte Alltagskommunikation besonders vernachlässigt und eigentlich die Sprachgeschichte primär von literarischen Texten aus konzipiert. Dies trifft für das Französische des 17. Jahrhunderts im besonderen Maße zu: Die Alltagssprachlichkeit spielt eine marginale Rolle, Gebrauchs2
3
Tancke 1984, 41, nimmt allerdings an: „Der Wortschatz wird, ähnlich wie in den heutigen Lehrwerken auch, eher einer gehobeneren Sprachschicht zuzurechnen sein". Dem vermag ich nicht zuzustimmen, denn gerade Vulgarismen, Verbalinjurien und Maledicta erfreuen sich in jener Zeit in den Texten offensichtlich großer Beliebtheit. Zur Diskussion dieser Einteilung vgl. Steger 1984, 188, der insbesondere institutionelle Texte gesondert gewürdigt wissen will.
108
Edgar Radtke
texte sind in aller Regel nicht für die Beschreibung sprachgeschichtlicher Epochen bemüht worden, sieht man einmal von den Anfängen einer Sprache in den einschlägigen Handbüchern ab. Daraus folgt, daß die sprachgeschichtliche Kenntnis von Subnormen entsprechend rudimentär ausfallen muß. Tauscht man die angesehenen, präskriptiven Grammatiken mit den entsprechenden Gebrauchstexten aus, ändert sich die Dokumentationsbasis. Nicht die sprachpflegerischen Instanzen wie die Académie française geben den Ausschlag, sondern die Gebrauchsliteratur von überwiegend unbekannten Autoren, die die Alltagskommunikation bewußt verarbeiten und auch für die Nachwelt in gewisser Weise transparent machen. Die ästhetische Wertung des „kleinen Mannes" bzw. des einfachen Grammatikschreibers spiegelt eine Kommunikationssituation nicht authentischer wider als die großen Sprachpfleger, aber bestimmte Bereiche, wie der des Scherzens, fallen nicht in das Normierungsprogramm derselben. 3. Die Gebrauchsliteratur im (Fremd-)Sprachenerwerb enthält zahlreiche Ansatzpunkte zur Dokumentation des Substandards. Im folgenden seien aus einer größeren Sammlung von älteren Gebrauchsgrammatiken einige Erörterungen herausgegriffen, die die Bedeutung der Textsorte für eine sprachgeschichtliche Substandardbeschreibung aufzeigen können. Der Topos von der „guten" italienischen Aussprache hat eine sehr lange Tradition, eine von Giovanni Veneroni oder richtiger Jean Vigneron übernommene Fassung des Maître Italien, schätzungsweise um 1780 gedruckt, führt dazu aus (Veneroni 1780, 233): On se trompe fort de croire que c'est à Florence où l'on parle & prononce le mieux l'Italien: au contraire, c'est un des lieux où la prononciation est la plus rude & la plus méchante. La Cour y parle bien, & les Académiciens; mais tout le reste a un méchant accent, & l'on ne prononce que du gosier & du nez. Ce que les Auteurs Florentins, tant modernes qu'anciens, on [sic] écrit est du beau stile; & c'est à ce propos que le Proverbe Italien dit au sujet de leur prononciation: Lingua Toscana in bocca Romana. Il est certain que les lieux où l'on parle le mieux, c'est à Rome & à Sienne. C'est pourquoi on dit: Per intender parlar ben Italiano, Bisogna ch'un Toscan parti Romano. Etwas befremdlich an diesen Ausführungen ist die schroffe Ablehnung des florentinischen Aussprachemodells aufgrund des negativen Signums des vernacolo fiorentino, des populären Stadtdialekts. Diese Sichtweise hat sich im Grunde bis heute gehalten, ein Blick in das Vorwort der florentinischen Wortsammlung von Raddi (1977, 9) genügt zur Illustration: Il pretesto principale (...) è stata un'occasionale chiacchieratina accademica, pacata ma non per questo meno provocatoria, sostenuta con certi amici di altra regione, che contestavano a noi Toscani e, in particular modo, a noi Fiorentini, il
Substandard als ästhetische Wertung in der Sprachgeschichte
109
diritto di autodefinirci - me lo ero fatto, invero con poca umiltà, scappar di bocca pochi attimi prima - maestri di lingua. Die soziale Ä c h t u n g des Florentinischen zugunsten des senese und des römischen A k z e n t s aufgrund einer niederen Dialektvarietät n e b e n d e m gepflegten Florentinisch hat sich erst im Laufe des 18. J a h r h u n d e r t s in den Sprachlehrwerken niedergeschlagen, Veneroni (1780, 26) e r m a h n t im eigentlichen Aussprachetraktat nochmals eindeutig: Remarquez, que toute autre prononciation de la lettre s est condamnée à Rome, & à Sienne, qui sont les deux villes où l'on parle le mieux Italien, & c'est de là que l'on dit, Lingua Toscana in bocca Romana. Die Faustregel lingua toscana in bocca romana reicht indessen schon weit in das 17. J a h r h u n d e r t zurück, bereits L o n c h a m p s (1664, 6) empfiehlt sie den L e r n e n d e n ("impararai il puro Toscano distinto dal R o m a n o , cosa cercata da molti, ma non trouata, e giungerai a quella desiderata p r o u a di pronunciar la lingua Fiorentina in bocca R o m a n a " ) . D a s Florentinische scheint also bei den Sprachlehrern erst im Laufe der Zeit allmählich im Prestige zu sinken. Auch die G e b r a u c h s g r a m m a t i k von Francesco Soave (1799, 195-6) identifiziert Toskanisch mit senese: La Pronunzia è si diversa nelle diverse Provincie dell'Italia, che troppo difficil cosa sarebbe, e pressochè impossibile l'assegnarne regole certe e precise. Quella che è più tenuta in maggior pregio si è la pronunzia de' Romani, e de' Toscani, singolarmente de' Sanesi, ma questa medesima non puö apprendersi che coll'uso. Die Empfindung, d a ß das senese die beste Sprachvarietät darstelle, ist nicht nur im Sprachunterricht b e h e i m a t e t , sondern kursiert auch als vox populi. Diese ästhetische Einschätzung beruht aber keinesfalls auf einer fehlenden Dialektalität im senese selbst, wie es sehr einprägsam die Aufnahme einer Seneser Sprecherin von Giannelli (1976, 112) enthüllt: Dialetto senese corrente: G. T. di anni 31 - Siena. [prefempio mi akkçrgo . . . no si diée he ssiena é lia madré lingua de . . . de . . . dell ifîaUano, inveée non é vvero huesto, non é vvero n kuanto . . . noi ci si hokkola um po su kkuesto . . . su kkuesto fatto. non é vvero çperké, noi si parla sempre indistintamenthe un zzQliûo linguaggo, vale a ddire, io ora stç pparlando hon lei, mi pçsso sforzare di (parlare bene pero nnom mi riesse di parlare meVVo di huello 'e . . . ke nnon parlo]. Traduzione: Per esempio, mi accorgo . . . noi diciamo che Siena è "la madrelingua" de . . . dell'italiano, invece non è vero questo, non è vero in quanto . . . noi ci coccoliamo un po' su questo . . . su questo fatto. Non è vero perché, noi parliamo sempre, indistintamente, un medesimo linguaggio, vale a dire, io ora sto parlando con lei, mi posso sforzare di parlare bene, perö non mi riesce di parlare meglio di quello che . . . che non parlo. Im 19. J a h r h u n d e r t ist schließlich ein nachdrücklicher Verweis auf die römische Aussprache als Standardmodell zu verzeichnen, so bei Filippi 1829, 2:
110
Edgar Radtke
„Die Römer aber, deren Aussprache überhaupt in Italien von gebildeten Personen desToskanischen vorgezogen wird ( . . . ) " . Insgesamt erfährt die italienische Standardaussprache in den Lehrwerken eine Regionalitätsbestimmung, die variieren kann und vom Normempfinden des Verfassers abhängt. Die Trennung Standard - Substandard orientiert sich dabei weniger an institutionell festgelegten Maßstäben, vielmehr wird sie von der ästhetischen, arbiträren Wertung der betreffenden Autoren vollzogen. Zur Verdeutlichung sei die intervokalische Aussprache des s im Italienischen aufgegriffen. Beginnen wir wiederum mit der späten Fassung von Veneroni (1780, 26): Sa, dans ces mots, cosa, chose, & rosa, rongée, doit être prononcé comme on prononce la première syllabe de salut. C'est-à-dire fort. Il en est de même dans tous les Adjectifs terminés en oso, comme glorioso, glorieux; vittorioso, victorieux &c. tant au singulier, qu'au pluriel, & tant au féminin, qu'au masculin. Dans les Adjectifs terminés en ese, & dans les mots en uso, il faut prononcer la lettre s, comme on la prononce en François dans les mots, oser, exposer, composer. Exemple: palese, confuso &c. Excepté fuso, fuseau, où il faut prononcer la lettre s comme dans le mot salut. Dans le mot cosi ainsi, si se prononce de même, c'est-à-dire fort, comme s'il y avoit deux s, en appuyant sur la dernière. Les Napolitains disent cousi, mais il faut éviter de prononcer de cette manière. Der Fall von cosi wird durch die Jahrhunderte gerne in die Ausspracheerörterungen aufgenommen. Besonderes Interesse verdient die Substandardzuweisung von cosi [ku'si], dessen méridionale Aussprache des stimmlosen s heute nicht mehr getadelt wird. Soave (1799, 209) zeigt sich in derselben Periode toleranter und beschränkt sich auf die Beschreibung der regionalen Verteilung: La S si pronunzia, come abbiam detto, con un sibilo ora più dolce, ed ora più forte. Qui la diversità fra la varie parti dell'Italia è grandissima. I Toscani, i Romani, i Napoletani usano più comunemente la seconda, i Piemontesi, i Genovesi, i Lombardi, i Veneziani assai più la prima. Casa per esempio da quelli si pronunzia con s forte, da questi con s dolce. Soave verzichtet auf die Feststellung einer Normwidrigkeit, gegenüber Veneroni bleibt die Regionalität von der substandardsprachlichen Qualität frei, was sich bis heute im wesentlichen gehalten hat (Lepschy 1978, Francescato 1977). In der Aussprachedebatte um den Standard wird cosi bereits gerne zu Beginn des 17. Jahrhunderts angeführt, wie Guédan (1602, 32) und Ledoux (1604, 15) belegen: S simple se prononce entre les voielles comme z François, exemple cosa, rosa, excepte, en cosi que quelque vns veulët prononcer comme cossi avec deux ss ce que ie n'apreuue. (Guédan 1602, 32)
Substandard als ästhetische Wertung in der Sprachgeschichte
111
In medio autem inter duas vocales, eneruato sono accedit ad Zain, vt: rosa, desio. Excipe, cosi, altresi, conciosia, quae priore sibilo enunciantur, accedente ad geminum ss. (Ledoux 1604, 15) Auffälligerweise wird bei Guédan ausdrücklich darauf Bezug genommen, daß die ästhetische Wertung vom Verfasser selbst vorgenommen wird, die Einführung der 1. Person in der Kommentierung ist ungewöhnlich. Der Verfasser beruft sich als Autorität auf sich selbst. Meistens werden solche Entscheidungen als von höherer Stelle sanktioniert ausgegeben, der Autor tritt in der Regel zurück. Standardzuschreibungen werden eher stillschweigend als von einem generell akzeptierten sprachlichen Gebrauch legitimiert betrachtet. Guédan gibt die Subjektivität seiner Präferenz ohne weiteres zu - er setzt Norm und Subnorm explizit aufgrund seiner persönlichen, nicht unbedingt repräsentativen oder autorisierten Meinung fest. Die Norm orientiert sich in diesem Fall nicht an den Gegebenheiten des Sprachgebrauchs, sondern an dem ästhetischen Empfinden des Schreibers. Diese am persönlichen Geschmack gebundene Wahl hängt oftmals von den vorausgehenden Italienaufenthalten der Verfasser ab, die in den Vorworten auch auf die Vorliebe für bestimmte Regionen Bezug nehmen. So gesteht Lonchamps (1664, 6) die Mitarbeit eines Florentiners ein ("Onde con il consiglio, aiuto, ed assistenza del Sign. Angelo da Firenze si è dato alla luce le due Grammatiche (. . .)") und muß sich daraufhin im bereits vorgelegten Zitat bemühen, den Wert des puro Toscano herauszustellen und gleichzeitig der wohl auch von den potentiellen Benutzerkreis gewünschten Ausrichtung Lingua Fiorentina in bocca Romana wenigstens im Vorwort zu genügen. Der ausdrückliche Bezug zu normgebenden, anerkannten Institutionen in den bescheidenen Sprachlehrbüchern zeigt sich gehäuft erst im 18. Jahrhundert, so nennt Veneroni 1780 die Crusca in der Titelei, frühere Werke verzichten auf eine Beachtung höherer Instanzen, sie werden offensichtlich für glaubwürdig befunden. Gerade die italienische Aussprache scheint viel Spielraum zu lassen, Standard und Substandard nach individuellen Wertungen der Sprachmeister auszurichten. 4. Welche Motivation ästhetischen Wertungen bei der Monierung von Substandardformen zugrunde liegen kann, möge das Beispiel aus Ledoux (1604, 76) in seiner Schola Italica illustrieren: In perfectis verö ad conferentiam passiuorum, simplicibus verbis auxiliaribus infectis gaudent, vt, io sono andato, non autem io sono stato andato; io ho voluto & non io ho hauüto voluto. Io ho hauüto voluto wird als Substandardform getadelt. Allerdings finden sich in den übrigen Sprachlehrbüchern des 17.und 18. Jahrhunderts keine Parallelen. Die Zurückweisung des italienischen passé surcomposé ist bei
112
Edgar Radtke
Ledoux ein Einzelfall. Zwar ist die Bildung aus altitalienischen Texten im Norden durchaus bekannt, und die dialektale Vitalität ist im Italienischen beobachtet worden (Cornu 1953). Die Verwendung ist auf norditalienische Dialekte eingeschränkt: "Il 'passé surcomposé' (...) sembra presentarsi soltanto in alcuni dialetti settentrionali" (Rohlfs 1969, §673). Demnach nimmt das passé surcomposé im Italienischen - wenn überhaupt - eine marginale Rolle ein. Es ist schriftsprachlich nicht weiter belegbar. Was veranlaßte aber Ledoux, diese Substandardform aufzunehmen, wenn ihr nur eine äußerst geringe Bedeutung zukommt? Aufgrund seiner Biographie kann man davon ausgehen, daß Ledoux seinen Italienaufenthalt überwiegend in Florenz, Siena, Rom, Pisa und Ligurien verbracht hat (Emery 1947, 9; Justi 1899) - Städte und Gegenden, denen das passé surcomposé fremd ist. Die Nennung des passé surcomposé ist dabei jedoch nicht durch das Italienische motiviert, sondern erklärt sich aus der Herkunft von Ledoux: Catherin Ledoux wurde 1540 in Cruseilles geboren und verbrachte in Savoyen Kindheit und Jugend. Er studierte in Annecy (Emery 1947, 9). Diese biographische Notiz mag durchaus für die Aufnahme von io non ho auuto voluto ausschlaggebend sein, da das frankoprovenzalische Gebiet noch heute eine ausgiebige Verwendung des passé surcomposé aufweist (Holtus 1984, 318). Das passé surcomposé ist in Frankreich primär diatopisch markiert, so daß für Ledoux der Gebrauch aufgrund seiner Herkunft geläufig gewesen sein dürfte und auch beim Verfassen von fremdsprachigen Lehrwerken anklingt, zwar in eindeutiger Kenntlichmachung als Substandard, aber doch im Bewußtsein der Geläufigkeit dieser Bildung aus seiner eigenen, persönlichen Anschauung. Private Erfahrungen oder Vorgaben sind also geeignet, die Wertung einer Form als Substandard zu beeinflussen, obwohl die fragliche Bildung von offiziellen Norminstitutionen wegen ihrer generellen Belanglosigkeit nicht getadelt wird. Die ästhetische Beurteilung ist frei von Vorgaben der Norminstitutionen und unterliegt keinen sprachwissenschaftlich voraussagbaren Kriterien. 5. Die Aussprachebeschreibungen und Ledoux' Ablehnung des italienischen passé surcomposé sind ästhetisch indiziert, aber nicht begründet worden. Es handelt sich um Festsetzungen, deren Motivation dem Lerner vorenthalten wird. Ästhetische Wertungen werden prinzipiell als Fakten dargestellt, die keiner weiteren Diskussion bedürfen. Nun ist aber die ästhetische Präferenz nicht immer so eindeutig, da auch sie einem Wandel unterworfen sein kann. Mit Erläuterungen wird offenbar äußerst zurückhaltend umgegangen, ästhetische Substandardbewertungen leiden an einem kontinuierlichen Motivationsdefizit. Wo solche weitergehenden Ausführungen dennoch vermittelt werden, stellen sie in den seltensten Fällen den Leser zufrieden.
Substandard als ästhetische Wertung in der Sprachgeschichte
113
Wie blaß solche Begründungen immer noch ausfallen, entnehme man der Grammatik von Doergang (1604, 162), der aus einer grammatisch zu interpretierenden, in unserem Falle leider antisemitischen Textpassage4 den adäquaten Gebrauch der Vergangenheitstempora ableitet: Exempla de singulis. Comme le diable & les Iuifs vserent de la saincte escripture pour oppugner & mettre à mort Iesus Christ: ainsy les hérétiques oppugnerent anciennement, & ont oppugné tousjours, & oppugnent encores aujourd'huy VEspouse de Iesus Christ, L'Eglise de Dieu, pour la mettre à bas par la saincte escripture forcée & tirée à leur volonté corrumpue & perverse fantasie, Vincent. Lyrienensis (...). Hic vbi vides vserent, & oppugnerent potest etiam poni primum imperfectum vsoyent, oppugnoyent. Sed, ont oppugné, praeteritum germanicum ponitur cum aduerbio tousjours id est semper, omnem temporis praeteriti differentiam vsque ad praesens temporis punctum complectens, cum quo non potest poni primum imperfectum. Potest tarnen subinde poni praeteritum germanicum loco praeteriti latini, vt vbi hic ponitur vserent, & oppugnerent, potest etiam poni, ont vsé, & ont oppugné, sed non ita eleganter, nam elegantius in his & simbilibus primo quà secundo praeterito vtimur. Die noch heute genauso heikle Frage der adäquaten Tempusverwendung im Französischen wird hier ebenfalls als subjektives, ästhetisches Problem aufgefaßt, wobei wiederum die persönlich markierte Meinung des Verfassers den Ausschlag gibt (vtimur). Als Begründung wird das Kriterium der Eleganz angeführt, also nichts anderes als ein Plädoyer für den persönlichen Geschmack in sprachlichen Fragen. Die Tempora werden als gleichwertig und von ihrer Funktion her austauschbar gesehen, obgleich Doergang zuvor die prinzipielle Unterschiedlichkeit der prceteriti latini und prœteriti germanici behandelt. Die Austauschbarkeit der Tempora im gewählten Beispiel veranlaßt ihn nicht zu einer Ausweitung der grammatischen Regeln, sondern wird durch eine Geschmackspräferenz indiziert. Die Eleganz als Entscheidungskriterium für Standard oder NichtStandard wird des öfteren bemüht, so auch auf der Grundlage des deutsch-französischen Sprachvergleichs bei Doergang (1604, 161): Et vbi Germani vtuntur primo imperfecto, ibi Galli saepius,& elegantius vtuntur praeterito latino (...). Die Eleganz wird dabei zu einer Entscheidungshilfe bei Gebrauchsnormen, die mehrere Varianten zulassen. Anstelle einer präskriptiven Festlegung wird der Gebrauch durch Empfehlungen geregelt. Die ästhetische Stellungnahme wird noch durch eine quantitative Bilanz im Gebrauch ergänzt, nämlich durch die statistische Norm (sœpius). Das passé simple ist also nicht nur 4
Das Beispiel wird ungeachtet seines diskriminierenden Charakters nur zum Verständnis der grammatikalischen Komponente bemüht. Antisemitische Beispiele sind im Unterrichtsmaterial leider nicht selten anzutreffen.
114
Edgar Radtke
geschmackvoller, sondern auch häufiger. Sœpius & elegantius vtuntur wird zu einer Formel, die ein Höchstmaß an Idiomatizität gewährleistet im Sinne eines „besonders französischen Französisch". Die ästhetische Wertung ist gleichzusetzen mit einem Genuinitätsanspruch. Unausgesprochen klingt an, daß das passé composé in diesen Fällen „deutsch" wirkt. Die ästhetische Empfehlung trägt dazu bei, den Eigencharakter des Französischen in der Grammatik gegenüber dem Deutschen herauszustellen und als Bewertungsmaßstab zu akzeptieren. Ein solcher Anflug, den Substandard aus dem Sprachvergleich abzuleiten, ist bei Doergang (1604, 151) auch noch an anderer Stelle anzutreffen: VValones Germanos aliquädo imitantur & dicunt, le suis esté, le sois esté, l'estois esté, le fusse esté, le serois esté, le fus esté, le seray esté. Sed hos tu caue si verè Gallus esse velis. Mit ähnlichem Wortlaut wird diese Argumentation nochmals aufgegriffen (Doergang 1604, 164): VValones & Lotharingi aliquando germanos, vt pote ijs vicini imitantur & dicüt le suis esté, tu es esté, il est esté, nous sommes esté, vous estes estes, ils sont esté. Sed hos tu fuge si pure gallicè velis loqui. Im Gegensatz zu dem vorausgegangenen Beispiel wird die Verwendung des Hilfsverbs estre eindeutig getadelt. Dabei werden zunächst Sachinformationen vorangestellt, um die ästhetische Wertung zu begründen: für den Fremdsprachenlerner ist der Typ je suis été ein Germanismus, die Bildung findet diatopisch nur beschränkte Verbreitung, d.h. sie wird als unfranzösisch empfunden 5 . Die ästhetische Wertung richtet sich wie bei den Vergangenheitstempora - allerdings diesmal explizit - nach dem pure gallicè, dem reinen Französisch, also nach dem Gebrauch des verè Gallus, des wahren Franzosen. Hier wird ein abstraktes Normideal konzipiert, das inhaltlich nicht gefüllt ist, sich aber auf die Genuinität des Französischen bezieht. Die Nicht-Akzeptabilität des Substandard wird gegenüber dem Beispiel des Tempusgebrauchs unmißverständlich ausgesprochen, der je suis été-Typ wird als für das Französische nicht repräsentativ eingestuft. Den getadelten Formen fehlt es am Authentizitätsgrad für das Französische. Offensichtlich gelingt es in diesem Fall, auch ohne ausgeprägte Norminstanzen Standard und Substandard voneinander zu trennen. Ästhetisch motivierte Substandardwertungen konkurrieren nicht mit präskriptiven Festsetzungen; auch nach der Schaffung von anerkannten Norminstanzen wie der Académie française oder Vaugelas' Remarques bleiben die subjektiven Zuweisungen erhalten und weichen keineswegs zurück. Anweisungen offizieller Norminstan5
Zur Rolle der diatopischen Varietäten und der Dialekte in Frankreich bezüglich der Grammatikschreibung des 16. und 17. Jahrhunderts vgl. die Untersuchung von Schmitt 1977.
Substandard als ästhetische Wertung in der Sprachgeschichte
115
zen gehen mit ästhetischen Wertungen parallel einher. Dabei verfahren die präskriptiven Instanzen letzten Endes nicht anders als Doergang oder andere weitgehend unbekannte Sprachmeister: Die Festlegung des usage ist auch bei Vaugelas eine persönliche Entscheidung der Geschmacksbildung. Blochwitz (1968, 108) spricht vom „arbiträren Charakter des Sprachgebrauchs" im Zusammenhang mit Vaugelas' Ablehnung des anstößigen poitrine de veau. „Der usage basiert auf dem Element der Willkürlichkeit, er gleicht der Mode und ist unberechenbar wie die Fortuna" (Blochwitz 1968, 108). Der einzige Unterschied liegt in der Prestigequalität, in dem Autoritätszuspruch, den die ästhetische Wertung des Standards und Substandards erfährt. Die Trennung von Standard und Substandard wird dann in Einzelfällen verbindlich vollzogen, wenn die Prestigeträchtigkeit gewährleistet ist. So gelangen die englischen Sprachmeister des Französischen im 16. Jahrhundert, die den Aussprachestandard erstellen (Schmitt 1979, 3), nicht über persönliche Beobachtungen hinaus, da ihr Ansehen und ihre Tragweite als potentielle Normgeber zu gering sind. Normfestsetzung bedarf der Autorisierung durch den französischen Hof oder ähnliche prestigefördernde Instanzen. Die Substandardmarkierung kann nur dann an Anerkennung gewinnen, wenn der soziale Status der Urheber geeignet ist, über einzelne Regionen hinaus bekannt zu werden. 6. Kehren wir noch einmal zu unserem Ausgangspunkt, dem substandardsprachlich gefärbten, vulgären Dialog zurück. Der sexuell bezogene, pejorativ konnotierte Wortschatz wird seit jeher als Sustandardbestandteil empfunden, allerdings ist er nicht immer lexikographisch tabuisiert gewesen, etwa wenn Dornseiff 1933 für sein sachgruppenbezogenes Wörterbuch einen Ergänzungsband für den Gelehrtengebrauch erstellt, der Sexualia und Vulgärsprachlichem vorbehalten ist. Wie sich in diesem Bereich ästhetische Einschätzungen mit einer wissenschaftlichen Zielsetzung auch in der Sprachgeschichte manifestieren, läßt sich anhand der Lexikographie mit mehr oder weniger stark vorstrukturierten Wörterbuchartikeln ablesen. Zwei italienisch-deutsche Wörterbücher gegen Ende des 18. Jahrhunderts (Romani 2 1786, Jagemann 1799) illustrieren die Berücksichtigung subjektiv nuancierter Stellungnahmen besonders deutlich am Substandardlemma cazzo: Càzzo s. m. das männliche Glied, ohne die Hoden. Càzzo, interj. Ey potztausend (Besser und ehrbarer ist, capo, capita, caspita, cancaro, Castro, etc.). (Romani 21786) Cazzo (in der niederen Sprache) das männliche Glied - ein Scheltwort, du dummer Kerl! Nichts, ein Pfiffeding, ein Dreck. Cazzo! ein Ausruf der Ungeduld, des Zors [sie], der Verwunderung. Auch wird es ohne Bedeutung aus böser Gewohnheit gesagt. (Jagemann 1799)
116
Edgar Radtke
Zunächst einmal ist zu begrüßen, daß beide Wörterbücher überhaupt ein häufiges Substandardlexem notieren, da selbst noch Wörterbücher der italienischen Gegenwartssprache wie De Felice/Duro 1975 das Wort ignorieren. Eine persönliche Wertung klingt bei Romani in der ersten Grunddefinition nicht an, allerdings schleicht sich diese dann bei der Beschreibung der Interjektionsverwendung ein, „ehrbarer" ist demnach der Rückgriff auf Euphemismen, also ist cazzo implizit doch anrüchig, ohne daß man dies der Grunddefinition entnehmen könnte. Die Wertung ist also lexikographisch nur am Rande im Zusammenhang mit einer Zweitbedeutung eingeführt worden, der Vorschlag von Ersatzmöglichkeiten legt die gesonderte Wertigkeit nahe. Sie hätte lexikographisch durchaus eindeutiger gefaßt werden dürfen. Umfänglicher ist der Artikel bei Jagemann 1799 aufgebaut. Die Substandardmarkierung liegt explizit vor („in der niederen Sprache") und bezieht sich unmißverständlich auch auf die Grundbedeutung. Anstelle der Substitutionsmöglichkeiten werden getreu der eigentlichen Aufgabe eines zweisprachigen Wörterbuches Übersetzungsbeispiele geboten. Darüber hinaus fließt eine knappe Schilderung möglicher Verwendungssituationen ein. In der Wörterbucharbeit ungewöhnlich, aber für den Benutzer bestimmt hilfreich ist die Schlußbemerkung „Auch wird es ohne Bedeutung aus böser Gewohnheit gesagt". Zwar hat cazzo stets eine Bedeutung, aber damit wird auf besonders expressives Sprechverhalten hingewiesen. Jagemann läßt präskriptive Parameter außer acht und orientiert sich am Gebrauchsrahmen. Die Zusatzbemerkung stellt klar, daß das Lexem „der niederen Sprache" nicht niedrigen sozialen Schichten vorbehalten ist, sondern von weiten Kreisen der Bevölkerung benutzt wird. Selbst die heutige Lexikographie hat dafür noch keine eindeutige Markierungsindizierung gefunden, der Zusatz familiär deckt diesen Gebrauch vulgärsprachlicher Lexeme auch in der Verwendung von oberen Gesellschaftsschichten nicht genau ab. Hier steht eine Markierung der Situationsgebundenheit, ein gesonderter pragmatischer Indikator, grundsätzlich aus. Zwar würde das Zurückgreifen auf „aus böser Gewohnheit" dem heutigen Lexikographen nicht mehr zugestanden, aber die Floskel ist zur Bedeutungserfassung durchaus dienlich. Die vorgenommene ästhetische Wertung deckt den Stellenwert des Substandardlexems in der Alltagskommunikation auf. Den beiden Wörterbüchern ist zu entnehmen, daß das als heikel empfundene Lexem in sprachhistorischer Sicht 1786 wie 1986 dieselbe Problematik aufweist und daß sich die Verwendungsbedingungen nicht sichtlich gewandelt haben. Zweisprachige Gebrauchswörterbücher sind also demnach ein geeignetes Instrument, die ästhetischen Einstellungen zu besonderen Substandardlexemen sprachgeschichtlich zurückzuverfolgen. Diese Nutzbarmachung der diachronen Lexikographie ist keineswegs auf sexuelle Substandardbereiche zu beschränken. Auch der Verlust der stan-
Substandard als ästhetische Wertung in der Sprachgeschichte
117
dardsprachlichen Verwendung läßt sich am Wörterbuchvergleich demonstrieren, so im Bereich der diatopischen Markierung. Hierbei scheut sich De Felice/Duro 1975 einmal nicht, das Substandardlexem cerasa "ciliegia" als regionale Variante (allerdings unter dem Lemma ceraso) aufzuführen. Das Wort selbst entstammt den süditalienischen Dialekten (De Mauro 41974, 182, 398). Erstaunlich ist lediglich die Tatsache, daß der dialektale Status erst seit der Einigung notiert wird. Davor erschienene Sprachlehrwerke und Wörterbücher verwenden cerasa als standardsprachliches Lexem ohne jegliche regionale Markierung, cilegia fehlt in älteren Werken. Stattdessen findet sich cireggia, so in Veneroni (1780, 378), ciregia "cerise" neben cerase "cerises" (Veneroni 1780, 376), in Romani 21786 cirègia „Kirsche" neben cerasa „s. cireggia" (Romani 21786). Cerasa als in ganz Süditalien verbreitetes Dialektwort (AIS VII, K. 1282, Freund 1933, 93, Zaccheo/Pasquali 1976, 173, Rohlfs 1977, 158 u.v. a.m.) ist gleichermaßen im romanesco beheimatet (Chiappini 31967, 76) und von dort aus überregional verbreitet worden neben toskanischem ciregia bzw. cilegia (AIS VII, K. 1282). Erst im 19. Jahrhundert gleitet cerasa aufgrund der fehlenden Toskanität in den Substandard ab. Um solche Entwicklungen nachzuvollziehen, bietet dieser Rückgriff auf sprachlich ausgerichtete Gebrauchsliteratur einen getreuen Reflex von Vorgängen, die sich in der questione della lingua auf einer abstrakten Diskussionsebene abspielen, wobei die Umsetzung in die Praxis nur am Rande an wenigen Einzelfällen vollzogen wird. Die Festschreibung der literarischen Norm tangiert nicht immer von vornherein die Durchsetzung von Konkurrenzformen aus verschiedenen Sprachvarietäten, die vestärkt die Alltagskommunikation umfassen. Die Geschichte nichtliterarischer Sprachvarietäten ist jedoch kaum anhand des präskriptiven Kanons der Normgebungsschriften ausreichend nachzuzeichnen; eine Verlagerung in der Frage der Textsortenselektion dürfte für das Sprachverhalten des „kleinen Mannes" in der Sprachgeschichte neue Anhaltspunkte bergen 6 , die die sprachhistorische Dimension des Substandards erhellt. 6
Vgl. dazu ähnliche Ansätze in der Germanististk wie etwa bei Besch 1979, 324: „Es ergab sich, daß angestammte Sprache eine soziale Minderung erfahren konnte bis hin zur Verächtlichmachung. Das Infragestellen von Sprache trifft den Menschen am Lebensnerv. Insofern war der Siegeszug der Schriftsprache immer zugleich auch ein Stück Problem-Weg für eine Reihe von Menschen, sei es in bestimmten Landschaften, sei es in bestimmten Sozialgruppen. Diese Problemseite ist noch wenig beschrieben. Sie gehört aber zweifellos auch zur historischen Wahrheit. Sie betraf vornehmlich den namenlosen Bürger, den sogenannten ^leinen Mann'. Sprachgeschichte aus seiner Sicht sieht anders aus als eine Sprachgeschichte der sich verfeinernden Schriftlichkeit und der hohen Kultur. Die bisherigen Bemühungen konzentrieren sich eher - und das sicher zu Recht - auf das letztere Gebiet. Das gibt uns Raum und Legitimation für erste Schritte in das wenig behandelte Gebiet, weg von den Potentaten, Höfen, Hohen Schulen, Literaturzirkeln hin zu den vielen nicht Herausgehobenen".
118
Edgar Radtke
7. Bislang ist in den obigen Ausführungen der Terminus Substandard ohne nähere Erläuterung verwendet worden. Die diesbezügliche Diskussion ist z. T. recht heterogen und sogar widersprüchlich geführt worden. Das herangezogene Beispielmaterial zeigt Eigenschaften des Substandards auf, die für die Konzeption in einem sprachgeschichtlichen Rahmen relevant sind: - Substandard umfaßt einen „mittleren Bereich" (Bellmann 1983, 124), der als eigenständige Beschreibung in der Sprachwissenschaft zumeist ausgespart geblieben ist. Das System des Standards bzw. des Dialekts ist leichter zu strukturieren als eine Varietät, die Elemente der beiden Ebenen aufnimmt. Diese Stellung des Substandards bedingt eine Tendenz zur Variabilität, die Konstanz scheint schwächer ausgebildet zu sein. - Dieser vorrangig sprechsprachliche Bereich ist aufgrund seiner vernachlässigten Beschreibung sprachgeschichtlich in metasprachlichen Texten immer nur am Rande einbezogen worden. Dies deckt sich aber nicht mit der Bedeutung der Substandardvarietäten in der tatsächlichen Alltagskommunikation. Substandarduntersuchungen waren in früheren Jahrhunderten für die Autoren wenig ergiebig und dienten nur zur besseren Sanktionierung des Standards. - Da der Substandard nicht wie der Standard offiziell dokumentiert wurde, ist die diesbezügliche Zuweisung in großem Ausmaß von ästhetischen Wertungen bedingt. Er ist Ausdruck der Geschmacksbildung und variiert in der Sprachgeschichte. Diese Geschmacksbildungen sind individuell an entsprechenden Textsorten nachvollziehbar, die für die Betrachtung nichtliterarischer Varietäten in der Sprachgeschichte ausschlaggebend sein können. Sie verstehen sich als Korrektiv für die traditionelle Sprachgeschichtsschreibung, das der Rolle des Substandards einer Sprache mehr Bedeutung beimißt, da der Abbau der Dialekte im europäischen Sprachraum in früheren Jahrhunderten nicht so weit fortgeschritten sei, wie gemeinhin angenommen. Zumindest gilt dies vermutlich für bestimmte Gesellschaftsschichten. Die Quellen des sprachlichen Selbstempfindens sind dazu aber systematisch auszuwerten.
Substandard als ästhetische Wertung in der Sprachgeschichte
Benutzte Literatur 1. Primärquellen: Sprachlehrwerke, Grammatiken, Dialogbücher und Wörterbücher Doergang 1604 INSTITVTIONES IN LINGVAM GALLICAM, ADMODVM FACILES, QVALES ante hac nunquam visae. QVIBVS OMNES EIVS LINguae difficultates ad viuum quam luculentissimè resecantur & dissoluuntur, ad ö ve diligens ac generosus proprio earn Marte ex his addiscere poßit. GERMANOS IN PRIMIS, QVI eius linguae flagrant desiderio, explebunt gaudio, & reliquis nationibus multum poterunt adferre fructus. AVTHORE HENRICO DOERGANGIO Apud Vbios Colon. Agrippin. Linguarum Gallicae, Italicae, & Hispanicae Professore. COLONIAE, Imprimebat Ioannes Christophori, Sumptibus ipsiusmet Authoris, Anno M.DC.IIII. Cum gratia & priuilegio S. Caesareae Maiestatis. Filippi 1829 O . A . Filippi Italienische Sprachlehre oder practische und theoretische Anweisung zum gründlichen Unterrichte in der italienischen Sprache. Zwölfte von neuem sorgfältig durchgesehene und verbesserte Original-Auflage. Wien: J . G Heubner 1829. Guédan 1602 INSTITVTION DE LA LANGVE FLORENTINE ET TOSCANE. Pour apprendre promptement, & facilement, la langue Italienne. Tant pour la lecture, prononciation & escriture d'icelle: que pour l'intelligence, composition, & traduction des liures Italiens en François,
119
120 & des François en Italien. DEDIEE A LATRESCHRESTIENNE ROYNE DE FRANCE, ET DE NAVARRE, Marie de Medicis. Par FRANCOYS GVEDAN Niuernois iadis aulmosnier ordinaire de Madame Chrestienne de Lorraine Gran-Duchesse de Toscane. A PARIS. Chez IEAN GESSELIN, rue Sainct Iacques à l'image SainCt Martin, & au Palais, en la gallerie des prisonniers. 1602 Auec Priuilege du Roy. Jagemann 1799 Cristiano Giuseppe Jagemann Vocabolario Italiano-Tedesco e Tedesco-Italiano disposto con ordine etimologico Parte prima ove le voci italiane si convertono in tedesco Lipsia: C. G. Vogel 1799 (Zweite Auflage 1816) Ledoux 1604 CATHARINI DULCIS SCHOLA ITALICA, INQVA PRAECEPTA BENE LOquendi facili methodo proponuntur; ET EXERCITATIONUM Lib. VI. illustrantur; CUM DICTIONARIIITALICOLATINI appendice. FRANCOFORTI IMpensIs ConraDI nebenll. Lonchamps 1664 LA NOVISSIMA GRAMMATICA Delle trè Lingue ITALIAN A, FRANZESE, E SPAGNVOLA. Cioè, la Franzese, e l'Italiana DI GIO: ALLESSANDRO LONCHAMPS & la Spagnuola
Edgar Radtke
Substandard als ästhetische Wertung in der Sprachgeschichte DI LORENZO FRANCIOSINO. Opera profitteuole à chi desidera imparare fondatamente, e con breuità à leggere, comporre, intendere, e parlare in quelle. Con l'aggiunta dell'Interprete Sinottico, del Sig. Angelo da Firenze Maestro veterano di Lingue, e belle Lettere in Roma. Con alcuni Dialoghi in fine, che contengono moti acuti, e manière di dire per chi desidera far viaggio. Et di nuouo corretta dal Sig. D. Giouanni Le Page. VENETIA, M.DC.LXIV. Per Nicolö Pezzina. Con Licenza de'Superiori, e Priuilegio. Oudin 1665 DIALOGVES FORT RECREATIFS COMPOSEZ EN ESPAGNOL, et nouuellement mis en Italien, Alleman, & François, AVEC DES OBSERVATIONS pour l'accord & la propriété des quatre Langues. PAR ANTOINE OVDIN, SECRETAIRE INTERPRETE DV ROY TRES-CHRESTIEN. IN VENETIA M.DC.LXV Presso Paolo Baglioni. Con Licenza de'Superiori, Et Priuilegio. Romani 1786 Nouvo Dizzionario Italiano-Tedesco eTedesco-Italiano, secondo l'ortografia dell'Accademia délia Crusca Oder Vollständiges Italiänisch-Deutsches und Deutsch-Italiänisches Wörter-Buch, nach der Orthographie der Florentinischen Akademie und nach Anleitung ihres Wörterbuchs wie auch anderer bewährter Hilfsmittel entworfen von Don d e m e n t e Romani, mit sonderbarem Fleiße ausgearbeitet und zu allgemeinem Gebrauche eingerichtet von Wolfgang Jäger. Zweyte, durchgehends vermehrte Auflage Nürnberg: Gabriel Nikolaus Raspe seel. Witwe, 1786.
121
122
Edgar Radtke
Soave 1799 GRAMMATICA RAGIONATA DELLA LINGUA ITALIANA DEL P.D. FRANCESCO SOAVE C.R.S, Adattata all'uso, e all'intelligenza comune. IN NAPOLI MDCCXCIX. Con licenza de' Superiori. Verieroni 1780 LE MAITRE ITALIEN, OU LA GRAMMAIRE DEVENERONI Augmentée de plusieurs Régies très-nécessaires, & corrigée selon l'orthographe moderne & la plus pure de l'Académie délia CRUSCA: AVEC UN DICTIONNAIRE POUR LES DEUX LANGUES. A VIENNE, Chez Jean Paul Krauss.
2. Sekundärliteratur AIS = Jaberg, K./Jud, J., Sprach- und Sachatlas Italiens und der Südschweiz, Zofingen 1928-40. Bellmann, G. (1983), Probleme des Substandards im Deutschen, in: (hg.) Mattheier, K. J., Aspekte der Dialekttheorie, Tübingen: Niemeyer, 103-130. Besch, W. (1979), Schriftsprachen und Landschaftssprachen im Deutschen. Zur Geschichte ihres Verhältnisses vom 16.—19. Jahrhundert, RVJB 43, 323-343. Blochwitz, W. (1968), Vaugelas' Leistung für die französische Sprache, BRPh 7, 101— 130. Chiappini, F. (31967), Vocabolario romanesco, a cura di B. Migliorini con aggiunte e postule di U. Rolandi, Roma: Chiappini. Cornu, M. (1953), Les formes surcomposées en français, Bern: Francke. De Felice, E./Duro, A. (1975), Dizionario délia lingua e délia civiltà italiana contemporanea, Palermo: Palumbo. De Mauro, T. (1963/41974), Storia linguistica delVItalia unita, Bari: Laterza. Dornseiff, F. (1933/71970), Der deutsche Wortschatz nach Sachgruppen, Berlin: de Gruyter. Emery, L. (1947), Catherin Ledoux maestro d'italiano, LN 7, 8-12. Francescato, G. (1977), Qualepronuncia insegnare agli stranieri?, in: AAVV, Italiano d'oggi. Lingua nazionale e varietà regionali, Triest: Lint, 119-133.
Substandard als ästhetische Wertung in der Sprachgeschichte
123
Freund, I. (1933), Beiträge zur Mundart von Ischia, Leipzig: Noske, phil.diss. Giannelli, L. (1976), Toscana, Pisa: Pacini. Holtus, G. (1984), L'emploi des formes surcomposées dans les variétés linguistiques du français et l'attitude des grammairiens, fh 15, 312-329. Jue, I./Zimmermann, N. (1984), Sprachbuch Frankreich, Reinbek: Rowohlt. Justi, F. (1899), Leben des Professors Catharinus Dulcis von ihm selbst beschrieben, Marburg: Elwert'sche Verlagsbuchhandlung. Lepschy, G. (1978), L'insegnamento della pronuncia italiana, in: id., Saggi di linguistica italiana, Bologna: II Mulino, 101-109. O'Sullivan, E./Rosier, D. (1985), Sprachbuch Großbritannien Irland, Reinbek: Rowohlt. Pasolini-Sprachschule [1982], Parole. Corso d'italiano per principianti, [Frankfurt]: Pasolini-Sprachschule, s. d. Perales, J./Gossen, R. (1962/21982), Spanisch wie es nicht im Wörterbuch steht, Frankfurt: Scheffier, Taschenbuchausgabe: Bergisch-Gladbach: Bastei Lübbe. Raddi, R. (1977), A Firenze si parla cosi. Frasario moderno del vernacolo fiorentino, Firenze: SP 44. Rohlfs, G. (1969), Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti, Torino: Einaudi, 3 voll., trad, dal tedesco. Rohlfs, G. (1977), Nuovo dizionario dialettale della Calabria, Ravenna: Longo. Schmitt, Ch. (1977), La grammaire française des XVle et XVHe siècles et les langues régionales, in: (hg.) Taverdet, G./Straka, G., Les français régionaux, Paris: Klincksieck, 215-225. Schmitt, Ch. (1979), La grammaire de Giles du Wes, étude lexicale, RLiR 43, 1^5. Schwitalla, J. (1976), Was sind ,Gebrauchstexte'?, ds, H. 1, 20-40. Selvani, G. (1965/1982), Italienisch wie es nicht im Wörterbuch steht, Frankfurt: Scheffier, Taschenbuchausgabe: Bergisch-Gladbach: Bastei Lübbe. Steger, H. (1984), Sprachgeschichte als Geschichte der Textsorten/Texttypen und ihrer kommunikativen Bezugsbereiche, in: (hg.) Besch. W./Reichmann, O./Sonderegger, S., Sprachgeschichte. Ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Sprache und ihrer Erforschung, I, Berlin/New York: de Gruyter, 186-204. Tancke, G. (1984), Die italienischen Wörterbücher von den Anfängen bis zum Erscheinen des „Vocabolario degli Accademici della Crusca" (1612). Bestandsaufnahme und Analyse, Tübingen: Niemeyer. Winkler, E. (1912): La doctrine grammaticale française d'après Maupas et Oudin, Halle»: Niemeyer. Wolf, L. (1984), Le français de Paris dans les Remarques de Vaugelas, in: Langues et Cultures. Mélanges offerts à Willy Bal, CILL 10, 1-3, 357-366. Zaccheo, L./Pasquali, F. (1976), // dialetto di Sezze, Sezze: Centro Studi Archéologie.
Der französische Substandard Christian Schmitt (Heidelberg)
1. Vorbemerkungen Sprachliches Handeln heißt grundsätzlich soziales Handeln; im sozialen Kontext wird durch das Medium Sprache Bewußtseinsbildung, Handlungsanweisung und Wirklichkeitsdarstellung geleistet. Dabei besteht zumindest rudimentär eine Affinität von Sozialstruktur und Sprachstruktur, die sich historisch durch die Interdependenz von Benutzergruppen und Sprachstrukturen bzw. sprachlichen Varietäten erklären läßt. Sprachsoziologie stellt im Grunde einen Pleonasmus dar; der unglücklich gewählte Terminus kann eigentlich alles oder nichts heißen, wird aber primär im Zusammenhang mit einer Betrachtungsweise der Sprache verwendet, die (1) die sozialen Entstehungsbedingungen, (2) die Korrelation linguistisch-systematischer und außersprachlich-gesellschaftlicher Phänomene, (3) die sozialen Funktionen sprachlicher Regeln und (4) die Verwendungsmodalitäten beim sozialen Handeln zum Hauptgegenstand gewählt hat. Als fait social muß Sprache stets in Verbindung mit den Regeln sozialen Handelns gesehen werden. Daraus ergibt sich, daß sprachliche Normen im Grunde soziale Normen darstellen (sollen); sprachliche Normen beziehen sich mithin auf sozial akzeptiertes beziehungsweise akzeptables Handeln. Wie soziale Normen Bewertungen von Verhalten oder Konventionen beim Verhalten von Gruppen zum Gegenstand haben, hängt die sprachliche Norm direkt zusammen mit der Einschätzung und Bewertung der aktualisierten sprachlichen Varietäten. Sprachnormen müßten daher im Grunde soziale Bewertungsmuster zugrunde liegen, die auch dem Umstand Rechnung zu tragen haben, daß die Adäquatheit sozialen Handelns mit keiner absoluten Regel erfaßt werden kann, sondern situationsabhängig bleibt. So kann eine abweisende Handbewegung unter Bekannten in einer familiären Situation eine akzeptable Form der Mißbilligung darstellen, im Sport hingegen kann dieselbe Handlungsweise mit Sanktionen belegt werden; ein/e certifie ist gemeinsprachlich durchaus akzeptabel, in einem Arbeitszeugnis hingegen würde man je soussigné (...) certifie erwarten. Damit wird klar, daß vom sprachwissenschaftlichen Standpunkt aus keiner ne-varietur-Norm das
126
Christian Schmitt
Wort geredet werden darf, Norm ist kein bon usage, von dem andere Register abweichen, ist auch kein dites ... ne dites pas oder buen lenguaje, Norm figuriert als eine soziologische Variable, als ein Definiendum, nie ein Definitum. Die Bezugsebene des Substandards, die Norm, kann zweierlei darstellen und bedeuten und wird auch in doppelter Bedeutung verwendet. Coseriu[ hat dies klar gesehen, daraus aber nicht die Konsequenz gezogen, wenn er die Norm als zwischen dem sistema (Gesamtheit der funktionalen Beziehungen im abstrakten System Sprache) und der habla (individueller Akt, Sprachhandlung) befindliche abstrakte Ebene ("realization normal del sistema", p. 86) definiert und damit die Bedeutungskomponenten normal und normativ zusammenfaßt, obwohl er ihre Differenzierung für notwendig erachtet: "AI comprobar la norma a la que nos referimos, se comprueba cômo se dice y no indica cômo se debe decir [...]: El hecho de que las dos normas puedan coincidir no nos interesa aquï; cabe, sin embargo, senalar que muchas veces no coinciden, dado que la 'norma normal' se adelanta a la 'norma correcta', es siempre anterior a su propia codification" (p. 90). Doch beziehen sich Definitionen des Subcodes in der Tat auf beide Aspekte der Norm, denn teils versteht man darunter Abweichungen vom Üblichen, dem Brauch, der Durchschnittsnorm, wie dies z. B. im viel zitierten Handbuch von Müller2 der Fall ist, teils vom 'Gesollten', dem, was Soziologen wie Spittler3 durch Sanktionen abgesicherte Verhaltensforderungen, psychologisch und juristisch ausgerichtete Verhaltensforscher wie Luhmann „kontrafaktisch stabilisierte Verhaltenserwartungen" 4 nennen. Die Definitionen hängen dabei jeweils von Variablen ab, da sowohl die Verhaltensforderungen wie die Erwartungen keine Konstanten darstellen; (soziale) Subcodes zeichnen sich damit ebenso durch Dynamik aus wie Normen, die „Stabilität eines Normensystems wird daher in neuen Situationen und bei veränderten Machtverhältnissen immer wieder in Frage gestellt" 5 , das Sprachbewußtsein erfährt selbstverständlich seine Ausprägung durch die jeweiligen sozialen Gegebenheiten. Dabei ist aber das Verhältnis der Subcodes zur Norm nicht vorgegeben, da die Norm weder die qualitative noch die quantitative Mitte ausmacht; Alvars 6 Vorstellungen von der Sprachnorm als einem sprachlichen Korrelat 1 2 3 4 5 6
E. Coseriu, Sistema, norma y habla, in: E. C , Teoria del lenguaje y lingüistica general, Madrid 1962, 11-113. B. Müller, Das Französische der Gegenwart. Varietäten, Strukturen, Tendenzen, Heidelberg 1975, p.216ff. G. Spittler, Norm und Sanktion: Untersuchungen zum Sanktionsmechanismus, Freiburg 1967, p. 12ff. N. Luhmann, Rechtssoziologie, Opladen 21983, p.43. Spittler, op.cit., p. 87. M. Alvar, La lengua como libertad y otros estudios, Madrid 1982.
Der französische Substandard
127
zur Demokratie als Herrschaft der Mehrheit, des Volks, über die partikulären Gruppen und Interessen mag zwar manchem als der Stein der Weisen vorkommen, doch hinkt dieser Vergleich, wie sich leicht zeigen läßt: "Negar la correcciön como principio es aspirar a la anarquîa; y con la pretension de salvar lo que, por discrepante, no es total ni absoluto, se intenta destruir lo que se hizo estable. [. . .] Para mi, norma general es correcciön d e m o c r a t i c a m e n t e [wir sperren] conseguida y aceptada: normas particulares, cada una de las que existen minoritariamente y que son realizaciones del sistema reducidas a grupos limitados" (p. 55). Wie, muß man fragen, wird hier die demokratische Basis bestimmt? Umfaßt sie die politische Einheit Spanien unter Einschluß der von Ninyoles7 als idiomas en la Espana periférica bezeichneten Sprachräume mit eigenen (spanischen) Varietäten und Statuten, oder gehört dazu ,natürlich' auch der lateinamerikanische Sprachgebrauch, wie z. B. Montes Giraldo 8 betont, der mit dem Hinweis auf die Notwendigkeit der supranationalen Kommunikation selbst eine Art präskriptiver Norm verteidigt: "No deseo que se créa que rechazo toda norma prescriptiva. Ella es necesaria para mantener un dialecto literario general como vinculo superior de comunicaciön interdialectal. Solo que ya no puede aceptarse la norma impuesta desde un centro cuando se trata de una lengua multinacional, sino que ella debe elaborarse colectivamente" (p. 253). Bei dieser Ausgangslage bleibt es schwierig zu erkennen, worauf das Sprachbewußtsein aufbauen soll, und vor allem, von welchen gesellschaftlichen Konventionen die Normen bestimmt werden sollen. Gleiches gilt auch für die normas objetivas bei Lara, der zugibt: "la influencia de la sociedad sobre la formaciön de normas me parece, en consecuencia, mas definitiva que la creaciön relativamente natural a partir de la relaciön lengua - objeto - metalengua" (p. 103), und der trotz der gerade für das Spanische gegebenen besonderen soziologischen Ausgangslage Norm wie folgt definiert: "Entiendo por norma un modelo, una regia o un conjunto de reglas con cierto grado de obligatoriedad, impuesto por la comunidad lingüistica sobre los hablantes de una lengua, que actüa sobre las modalidades de actualizaciön de su sistema lingüistico, seleccionando de entre la ilimitada variedad de posibles realizaciones en el uso, aquellas que considéra aceptables" (p. 110)9. 7
8 9
R. Ninyoles, Cuatro idiomas para un estado, (El castellano y los conflictos lingüisticos en la Espana periférica), Madrid 1977f. J. J. Montes Giraldo, Lengua, dialecto y norma, in: Thesaurus 35 (1980) 237-257. L. F. Lara, El concepto de norma en lingüistica, Mexiko 1976; diese Definition verdankt wesentliche Aspekte den Arbeiten von K. Heger (Sprache und Dialekt als linguistisches und soziolinguistisches Problem, in: Folia Lingüistica 3, 1969, 46-67; Belegbarkeit, Akzeptabilität und Häufigkeit. Zur Aufgabenstellung der Sprachwissenschaft, in: Bibliotheca Phonetica 9, 1970, 23—33) und P. v. Polenz (Sprachnorm, Sprachnormung, Sprachnormenkritik, in: Linguistische Berichte 17,1972,76—84).
128
Christian Schmitt
Ähnliche Probleme ergeben sich auch für das Englische, wo morphosyntaktische und syntaktische Phänomene heute zwar überwiegend unter dem Aspekt der Vorkommensmöglichkeit betrachtet werden, die Sprachgebrauchsangaben im einsprachigen Wörterbuch aber immer noch überwiegend Sollwerte darstellen. Zwar gilt hier die nicht unvernünftige Dichotomie des ersten einsprachigen Wörterbuches von Cawdrey10, der das "learned English" und den "Court talk" vom "rude English" und dem "Country speech" schied, heute ebensowenig wie die Zweiteilung Cockerams11, der entsprechend seiner Premonition from the Author to the Reader die choisest words von den vulgar words, den mocke-words und den fustian words sogar alphabetisch trennte, doch kann man wirklich von einem Fortschritt sprechen, wenn im Longman Dictionary of Contemporary English12 der Substandard lexikalisch wie syntaktisch definiert wird: "Words or phrases marked nonstandard are perhaps widely used, but are considered by teachers and examiners to be incorrect" (p. XXV)? Die englischen Sprachwissenschaftler tun sich hier mit der Definition des widely used oder der Mittelschicht der Gebrauchsnorm ebenso schwer wie z. B. die spanischen mit der Bewertung von el uso, comun(mente) oder se usa (usamos) und die französischen mit dem usage, dem français commun, français zéro oder der Durchschnittsnorm, die sich soziologisch kaum bestimmen lassen. Die Gramâtica der Real Academia 13 sieht in der gente culta de Castilla (pp. 5 und 473) die soziale Referenzeinheit zu ihrer Norm und nicht schlechthin im uso del pueblo castellano, wobei die Grammatik stets um eine Affinität zum Sprachgebrauch de nuestros clâsicos, der Sprache des siglo de oro, die nach ihrer Auffassung ihre Vollendung in der Sprache Cervantes' gefunden hat, systematisch bemüht war, wie dies Rabanales festgestellt14 hat: 10
11 12 13
14
R. Cawdrey, A Table alphabeticall of hard usual English words (1604), Nachdruck, Gainesville 1966, schreibt im Vorwort {To the Reader) : "Therefore, either wee must make a difference of English, & say, some is learned English, & othersome is rude English, or the one is Court talke, the other is Country-speech, or els we must of necessitie banish all affected Rhétorique, and use altogether one manner of language". H. Cockeram, The English Dictionarie: or an interpreter of hard English words, 1623, Nachdruck Menston 1968. Longman Dictionary of Contemporary English, ed. by Paul Procter (e.a.), London 1978. Real Academia Espanola, Gramâtica de la lengua espahola, nueva edition reformada de 1931 y apendice con las nuevas normas de prosodia y ortografia declaradas de aplicaciön preceptiva desde 1° de enero de 1959, Madrid 1959 (u. ö.). A. Rabanales, La gramâtica de la Academia y el estado actual de los estudios gramaticales, in: Boletin de filologia, Universidad de Chile, Publicaciones del Instituto de Filologia, section del Instituto de Investigaciones histörico-culturales de la Facultad de Filologia y Educaciön 17 (1965) 261-280.
Der französische Substandard
129
"De este modo, la lengua literaria del periodo clâsico gana todos los sufragios de los senores académicos como la lengua que hay que imitar por su calidad de modelo y, por lo tanto, como la lengua de cuyo estudio hay que inferir la doctrina gramatical. Asi, pues, la Academia vuelve nostâlgicamente los ojos a su siglo de Oro, como los alejandrinos del siglo III a. C. vuelven los suyos a Homero y al Siglo de Pericles" (p. 265). Der Bezugspunkt der sozialen Subcodes ist damit im Spanischen ebensowenig eine wie auch immer zusammengesetzte Mitte, sondern ein weitgehend historisch ausgerichtetes Ideal, das mit der anonymen Sprechergruppe der Durchschnittssprecher (el buen uso, se halla usado, hay costumbre; comunmente, ordinariamente, por lo ordinario, etc.) ein nicht greifbares Kollektiv als Bezugspunkt vorgibt15. Hier gleicht im Spanischen der normative Diskurs dem seit Vaugelas16 in der französischen Literatur wohl bekannten, auf der (offiziell verschleierten) Ideologie des jeweiligen Autors basierenden, angeblich objektiven oder deskriptiven Normkonzept 17 , das aber, wie Berrendonner 18 überzeugend dargelegt hat, immer nur vorgegeben war und nie der Forderung Martinets 19 , eine "étude est dite scientifique lorsqu'elle se fonde sur l'observation des faits et s'abstient de proposer un choix parmi ces faits, au nom de certains principes esthétiques ou moraux" (p. 6), entsprochen hat. Stets spielten und spielen weiterhin bei Normdefinitionen historische oder sonstige Aspekte eine Rolle, wie dies z. B. Müller20 oder zahlreiche Beiträge des von E. Bédard und J. Maurais zusammengestellten Normenbandes 21 unterstreichen. Norm, die Bezugseinheit des Subcode, ist und 15
16 17
18 19 20 21
Vgl. auch R. Sarmiento. La gramâtica de la Academia: historia de una metodologia, in: Boletin de la Real Academia Espanola 58 (1978) 435—466; ders., Filosofia de la Gramâtica de la Real Academia Espanola, in: Anuario de Letras 17 (1979) 59-96; ders., La doctrina gramatical de la Real Academia Espanola, in: Anuario de Letras 19 (1981) 47-74. Claude Favre de Vaugelas, Remarques sur la langue françoise, facsimile de l'édition originale, introduction, bibliographie, index par Jeanne Streicher, Genf 1970. D. François, La notion de norme en linguistique. Attitude descriptive. Attitude prescriptive, in: J. Martinet (Hg.), De la théorie linguistique à l'enseignement de la langue, Paris 1974, hat zu Recht auf die Verbindung von Linguistik mit Deskriptivismus abgehoben: "Ce qui caractérise le descriptivisme: [...] L'observation n'est pas une fin en soi, une limitation; elle n'est qu'une étape qui doit déboucher sur l'analyse des matériaux et l'explication des faits [...]; enfin, l'observation linguistique doit éviter de recourir à des a priori externes, qu'il s'agisse de jugements de valeur logicistes, esthétiques [...], de qualifications sociales, ou encore de perspectives appliquistes prématurément abordées [. . .]" (p. 194). A. Berrendonner, Léternel grammairien: étude du discours normatif, Bern/Frankfurt 1982. A. Martinet, Eléments de linguistique générale, Paris 1970. B. Müller, Das Französische der Gegenwart. Varietäten, Strukturen, Tendenzen, Heidelberg 1975, p.216ff. La norme linguistique, Québec 1983.
130
Christian Schmitt
war nie die Durchschnittssprache, die demokratische Größe, die Alvar fordert, sondern ist stets — zumindest im Französischen und den übrigen romanischen Sprachen — ein über dem Durchschnitt liegendes Diasystem, das sich synchronisch allein nicht bestimmen läßt. Deutlich läßt sich diese These am Akademiewörterbuch 22 zeigen, das trotz anderslautender Absichtserklärungen der Verfasser sich immer wieder als ideologisches Werk einer Kaste erweist. Wenn man in der Erstauflage von 1694 s. v. aristocratie die Definition "gouvernement politique où le pouvoir souverain est [...] exercé par un certain nombre de personnes considérables" liest, liegt diese Ausführung ebenso im Rahmen des Erwartbaren wie die Bemerkungen zu démocratie, wo sich der Satz findet: "[...] La démocratie est sujette à de grands inconvéniens". Überraschen muß hingegen, daß in der Ausgabe des an VII de la République (1798) der von der Revolution aufgehobenen Gesellschaft aristocratie dieselbe Definition kennt wie 1694 und s.v. démocratie der erste Satz weiterhin lautet: "La Démocratie est sujette à de grands inconvéniens", populace mit "le bas peuple" definiert wird und populaire (façon de parler populaire) einen negativen Wert besitzt23. Wenn populaire selbst im Robert 24 als Notation, welche "qualifie un mot ou un sens courant dans la langue parlée des milieux populaires (souvent argot ancien répandu), qui ne s'emploierait pas dans un milieu social élevé" (p. XXVIII) definiert wird, so zeigt diese Einschätzung, wie schwer sich heute noch immer Autoren tun, die sonst frei von jedem Verdacht sind, zur Gruppe der Puristen zu gehören. Die Notation populaire gehört damit nicht deshalb nicht zum Standard, weil der Robert die häufige, durchschnittliche Form ablehnt, sondern weil der Robert sich an einen Kanon für die Sprachbewertung hält bzw. diesem verpflichtet zu sein glaubt, der auf dem heute sicher vor allem im sprachlichen Bereich problematischen Antagonismus milieu populaire versus milieu élevé basiert. Roberts (der Name figuriert hier nur beispielhaft) Definition bleibt deshalb unbefriedigend, weil er versucht, die bestehenden Traditionen fortzuführen oder — anders ausgedrückt - mit populaire einen absoluten Wert zu verbinden sucht und nicht erkennt, wie sehr dieser Begriff von seiner Historizität bestimmt ist und seine Interpretation vom Faktor Zeit abhängt.
22
23
24
Le Grand Dictionnaire de l'Académie Françoise, dédié au Roy, Paris 1694; ich benutze hier den auf einem holländischen Raubdruck basierenden Nachdruck ("seconde édition, 1695") von Genf, 1968. Dictionnaire de l'Académie françoise, Paris 51798, s. v. peuple (adjectif) findet sich der aufschlußreiche Satz: "Les autres Princes avoient l'air peuple auprès de lui, c'est-à-dire, vulgaire". Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, par Paul Robert, rédaction dirigée par A. Rey et J. Rey-Debove, Paris 1981 (nouvelle édition).
Der französische Substandard
131
2. Historische A s p e k t e Die Wendung s'exprimer populairement wird von GLarLF 25 als zu début du XVIe siècle entstandene Sprachbewertung bezeichnet. Dies mag stimmen, beginnt doch die intensive Beschäftigung mit der Volkssprache in Frankreich im 16. Jahrhundert und damit auch die Erarbeitung bzw. Übernahme von Epitheta für die Bezeichnung des Standards wie des NichtStandards. Natürlich ist es problematisch, vom Erstbeleg ausgehend die Geschichte der Termini des Substandards nachzeichnen zu wollen, da die Anfänge der Normdiskussion in der französischen Renaissancegrammatik im Grunde eine Neuaufnahme bereits längst bekannter Positionen der antiken Grammatik darstellen, wobei Norm und Substandard - wie noch heute - unter zwei Aspekten definiert werden: (1) dem sprachimmanente Strukturen und kommunikative Aspekte betonenden, synchronischen und (2) dem asystematischen, sprachexternen Aspekt, der die Klassifizierung von Substandard und Standard von der Affinität zu einem historischen Ideal aus vornimmt und damit als etymologisch ausgerichteter Standpunkt apostrophiert werden darf. Dieser Gesichtspunkt spielte vor allem in den ersten grammatischen Darstellungen der französischen Volkssprache eine zentrale Rolle, so z.B. bei Dubois 26 , der in seinem Vorwort deshalb dem Pikardischen einen hohen Stellenwert einräumt, weil es sich weniger weit vom Latein entfernt habe als das Französische, und der somit die Affinität zur lateinischen Muttersprache als Kriterium für Standard und Substandard heranzieht: " P i c , pro Picardi saepe reperies, quöd horum sermonis cum Gallico atque adeö Graeco & Latino, si Erasmo & veritati credimus, maxima est affinitas: uter integrior, aliorum sit iudicium", weshalb er auf keinen Fall eine Unterordnung seines heimatlichen Idioms unter das Franzische hinnähme; von Bovelles27 gar, der wie die meisten Grammatiker seiner Zeit den Wandel von l-v-l -> l-z-l (und die hyperkorrekte Entwicklung l-z-l -> Ar-/) tadelt, werden Pariser Formen den pikardischen wegen fehlender Übereinstimmung mit der Wurzel untergeordnet: "Oseille, id est acetosa herba, & pendet ab ea. Ibi A in O &, C in S cadit. Parrhisii corruptius loquentes, dicunt oreille; ut qui perpetuo inter literas S & R vitio laborant" (p.71); eine differentia zum Franzischen muß also nicht unbedingt aus dem Pikardischen eine weniger wertvolle Varietät 25
26
27
L. Guilbert, R. Lagane, G. Niobey (e. a.), Grand Larousse de la langue française en sept volumes, Bd. V, Paris 1976, p. 4466a. Iacobi Sylvii Ambiani in linguam gallicam Isagoge, unà cum eiusdem Grammatica Latino-Gallica, ex Hebraeis, Graecis, et Latinis authoribus, Paris 1531. Carolus Bovillus, Liber de differentia vulgarium linguarum et Gallici sermonis varietate, Paris 1533; vgl. auch Vf., Bovelles, linguiste, in: Charles de Bovelles en son cinquième centenaire 1479—1979, Paris 1982, p. 247-263.
132
Christian Schmitt
des Französischen machen: "Parrhisij cumprimis apud seipsos laborant vitio literarum R & S, aliam pro alia in medijs syllabis eloquentes" (p. 89f.). Der Gesichtspunkt der Systemadäquatheit kommt hingegen besonders in den seit Meigrets 28 eindeutig am usage orientierter Grammatik erschienenen Werken zum Tragen und repräsentiert im Grunde zwei Traditionen, die hier zusammenwirken: - die von Varro 29 in der lateinischen Grammatik propagierte Lehre von der Anomalie und der Analogie sowie die hier von Cicero 30 und Varro31 begründete wsws-Lehre, auf die sich z.B. P. Ramus 32 und Stephanus 33 beziehen; - und die aus der Rezeption dieser Thesen entstandene Lehre vom uso (vivo) als Kriterium für die Sprachnorm in den romanischen Sprachen 34 , die in Frankreich vor allem über die verschiedenen Traktate Nebrijas bekannt wurde 35 und hier zur Diskussion um den (bon) usage36 und die ideale geographische Varietät geführt hat. 28 29 30 31
32 33 34
35 36
L. Meigret, Le Tretté de la grammçre françoçze, Paris 1550. M. Terenti Varronis de lingua Latina libri, éd. L. Spengel und A. Spengel, Berlin 1885, IX. Cicero, Orator ad Marcum Brutum, éd. K. W. Piderit, Leipzig 1865, 48, 159f.: "usum loquendi populo concessi, scientiam mihi reservavi". M. Terenti Varronis de lingua Latina libri, ed. L. Spengel und A. Spengel, Berlin 1885, IX, 5f.; zur Normdiskussion vgl. auch E. Siebenborn, Die Lehre von der Sprachrichtigkeit und ihren Kriterien: Studien zur antiken normativen Grammatik, Amsterdam 1976. P. de la Ramée, Grammaire, Paris 1572, p. 30. H. Estienne, Conformité du langage français avec le grec, ed. L. Feugère, Paris 1853,p.56ff. Für Italien vgl. C. Trabalza, Storia délia grammatica italiana, Mailand 1908, Nachdruck Bologna 1963, p. llff.; für Spanien - schon die erste Grammatik von Sylvius zitiert Nebrissensis (= Nebrija) mehrere Male — vgl. die umfangreiche Untersuchung von W. Bahner, Beitrag zum Sprachbewußtsein in der spanischen Literatur des 16. und 17. Jahrhunderts, Berlin 1956, und D. Briesemeister, Das Sprachbewußtsein in Spanien bis zum Erscheinen der Grammatik Nebrijas (1492), in: Iberoromania 1/2 (1969/70) 35-55. Anders F. J. Hausmann, Louis Meigret humaniste et linguiste, Tübingen 1980, p. 131ff. Vgl. A. François, Histoire de la langue française cultivée des origines à nos jours, Bd. I, Genf 1959, p. 133ff.; H. Lausberg, Zur Stellung Malherbes in der Geschichte der französischen Schriftsprache, in: Romanische Forschungen 62 (1950) 172—200; Z. Marzys, La formation de la norme du français cultivé, in: Kwartalnik Neofilologiczny 21 (1974) 315—332; F. Brunot, La langue du Palais et la formation du "bel usage", in: Romanische Forschungen 23 (1909) 667-690; R. A. Budagow, La normalisation de la langue littéraire en France aux XVle et XVIle siècles, in: Beiträge zur romanischen Philologie 1 (1961) 143-158; K.-A. Ott, La notion du "bon usage" dans les remarques de Vaugelas, in: Cahiers de l'association internationale des études françaises 14 (1962) 79—94; H. Weinrich, Die clarté der französischen Sprache und die Klarheit der Franzosen, in: Zeitschrift für
Der französische Substandard
133
Mit Meigrets Treue beginnt sich das Kriterium des usus durchzusetzen, wobei wie schon bei Horaz (Ep. ad Pis., 70-72) usus mit Norm grosso modo gleichgesetzt wird: "Multa renascentur quae iam cecidere, cadentque Quae nunc sunt in honore vocabula, si volet usus Quem penes arbitrium est et ius et norma loquendi".
Dies heißt zwar nicht, daß damit Abschied von historischen Argumenten genommen worden wäre, aber die historische Perspektive spielte fortan eine Rolle, wie sie diese etwa auch bei Quintilian (I, 6, 1) einnimmt: "Rationem praestat praecipue analogia, nonnumquam et etymologia". Mit zunehmender Präzisierung und Einengung des usus bildete sich immer deutlicher der Substandard heraus; je enger der (korrekte) usus mit je einer geopraphischen 37 und einer sozialen Varietät identifiziert wurde, desto breiter und vielfältiger mußte sich der (unkorrekte) malus usus, der Substandard, präsentieren. Auch hierfür gibt es eine Parallele in der lateinischen Sprachgeschichte: Bereits Cicero (Brut. 74, 258) und Varro (IX, 1, 5f.) haben der Gebrauchsnorm (bona consuetudo) einen schlechten Sprachgebrauch (pravissima consuetudinis régula, mala consuetudo) entgegengestellt, an einer anderen Stelle spricht Cicero gar von der Kategorie des subrusticum (Orator 48, 161); diese Teilung des usus findet sich wieder bei Henricus Stephanus, der in seinen Hypomneses (1582) aus dem usus einen nichtakzeptablen Bereich ausgliedert, der den Geruch der plebis faex38 trage, wie er anhand der zahlreichen Synonyme für avare ausführt, die er nicht behandle "pour sentir trop leur populace" 39 . Ob er damit aber tatsächlich nur Formen und Regeln meint, die auf eine Bevölkerungsschicht beschränkt sind, muß offen bleiben, da offensichtlich auch Formen mit affektivem Wert
37
38
39
romanische Philologie 11 (1961) 528-544; ders., Vaugelas und die Lehre vom guten Sprachgebrauch, in: Zeitschrift für romanische Philologie 76 (1960) 1—33; L. Wolf, La normalisation du langage en France. De Malherbe à Grevisse, in: E. Bédard, J. Maurais (Hgg.), La norme linguistique, Québec 1983, 105 — 137; ders., Historische Aspekte zum Begriff des guten Sprachgebrauchs im Französischen, in: Wissenschaft zwischen Forschung und Ausbildung, Schriften der philosophischen Fachbereiche der Universität Augsburg 1 (1975) 141-152; A. Sauvageot, Français d'hier ou français de demain?, Paris 1978, p. 31ff. ; J.-P. Caput, La langue française, histoire d'une institution, Bd. I, Paris 1972, p. 216ff. ; u. a. m. Vgl. Vf., La grammaire française des XVle et XVIle siècles et les langues régionales, in: Travaux de linguistique et de littérature 15 (1977) 215—225. H. Estienne, Hypomneses de Gallica lingua, peregrinis earn discentibus necessariae: quaedam vero ipsis Gallis multum profuturae, Paris 1582, p. 2: "Minime autem is quem pronuntiationis habere magistrum volent, aliquis sit e faece plebis, sed qui saltern aut non omnino sit illiteratus, aut certe cum iis qui non illiterate ideöque satis pure loquuntur versatus"; vgl. auch ibid., p. 48ff. H. Estienne, De la précellence du langage françois, nouvelle édition revue et annotée par Louis Humbert, Paris s. d., p. 251.
134
Christian Schmitt
und Hervorhebungen darunter fallen, wie dies von Stephanus anhand der Konkurrenzformen für tout fin neuf „brandneu" expliziert wird: "ac, ne hac quidem adiectione contenta [seil, tout fin neuf] faex vulgi (Parisiis praesertim) dicit etiam, tout fin clinquant neuf'40, und an anderen Stellen deutlich wird, daß es ihm nicht um die Verdammung der mots vils, roturiers geht: "Mais quelle pitié sera-ce si nous voulions bannir autant de mots que nous trouverons estre en usage entre le populaire, et principalement quand il n'y en a point d'autres, ou pour le moins de si propres? Il est certain que c'est le vray moyen de faire nostre langue belitre et coquin: car quand il aura perdu le sien, ne sera-il pas force qu'il coquine l'autruy? Or, quant à moy, pour conclusion, je di, puisque l'usage de nos mots est si mal asseuré qu'on le peult dire (par manière de parler) estre fondé sur la glace d'une nuict, à l'endroict de ceux qui le veulent aujourdhuy gouverner, que c'est une grande folie de s'y arrester; et qu'au lieu de rejecter ce qui est de l'ancien francois, quand il aura passé par la bouche du commun peuple, nous devons dire ce que disoit Ciceron parlant de l'orthographe latine: Usum loquendi populo concessi, scientiam mihi reservavi"41.
Diese Stellungnahme des Stephanus zeigt deutlich, daß man sich — unter genauer Beachtung der klassischen mittelalterlichen Grammatik - in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts um eine Präzisierung des Standards und des NichtStandards oder Substandards bemühte; nachdem das Kriterium der Affinität zum Latein sich als für die französische Volkssprache nicht praktikabel erwiesen hatte, begannen die folgenden vier sprachinternen Parameter die Definitionsversuche zu bestimmen: a) die geographische Mitte Die Analysen der grammatisch orientierten Diskussion um den diatopischen Standard und Substandard reichen noch weit in die erste Hälfte des 16. Jahrhunderts zurück 42 und haben literarische Vorläufer, auf die immer wieder verwiesen wird; bekannt sind dabei die zahlreichen Aussagen über die Sonderstellung des Franzischen (von Conon de Béthune, ed. A. Wallensköld, Helsingfors 1891, p.223, über Guernes de Pont-SainteMaxence, ed. C. Hippeau, Genf 1969, p.205, bis hin zu François Villon, ed. A. Mary, Paris 1962, p.94f.) 43 ; weniger rezipiert hingegen wurden G. 40 41
42
43
H. Estienne, Hypomneses (vgl. nota 38), Paris 1582, p. 211. H. Estienne, Conformité du langage français avec le grec, nouvelle édition accompagnée de notes et précédée d'un essai sur la vie et les ouvrages de cet auteur, par L. Feugère, Paris 1853, p. 56ff. ; Stephanus verweist hier auf die oben zitierte Stelle bei Cicero, Orator 48, 160. Vgl. Vf., La grammaire française des XVle et XVIle siècles et les langues régionales, in: Travaux de linguistique et de littérature 15 (1977) 215—225. Vgl. dazu M. Pfister, Die sprachliche Bedeutung von Paris und der Ile-de-France vor dem 13. Jahrhundert, in: Vox Romanica 32 (1973) 217—253; G. Hilty, Les origines de la langue française. Un principe méthodologique et son application aux Serments de Strasbourg, ibid., p. 254—271; F. Rauhut, Warum wurde Paris die Hauptstadt Frankreichs?, in: Festschrift H. Rheinfelder, München 1963, p. 2 6 7 -
Der französische Substandard
135
Tory44 oder gar Fabri, der einen m. E. wesentlichen Aspekt in die Diskussion einführte, die partielle Gültigkeit der Regeln des (geographischen) Substandards; so lehnt Fabri z. B. die pikardischen Diphthonge ab, "qui non seullement sentent de sa prolation et manière de parler aux picars: mais de tous pays/et veult par ce donner a entendre que les motz et termes qui ne sont point entenduz oultre les faulxbourgs des villes ou es villages parciaulx ne sont a escripre en livre authentique pour leur barbare son ou signification ou accent" 45 . Die Mehrzahl der Zeugnisse - mit Ausnahme der latinisierenden Humanisten - bestätigen dabei ein Urteil , das die englischen Grammatiker der französischen Sprache schon etwa 150 Jahre früher gefällt haben, denn "all the best textbooks of the end of the fourteenth and fifteenth centuries endeavour with few exceptions to import a knowlegde of the French of Paris, 'doux françois de Paris' or 'la droite langage de Paris', as it was called, in contrast with the French of Stratford-atte-Bowe and other parts of England" 46 ; dabei kommt dem Franzischen bzw. der zwischen Paris und Orléans gesprochenen Varietät das höchste Prestige zu, denn "ridentur Picardi & Lotharingi quod dicant blanc pain, rouge vin"47. Wie in der Antike Athen, so bildet Paris zu Ende des 16. Jahrhunderts unangefochten das Zentrum: "Sed quaenam tandem ea est Galliae pars quae hoc nomine commendari queat? Ea profectö quae propriè Francia nominatur. Verum ut Francia prae aliis Galliae partibus, iisque potissimum quae in eius sunt confiniis, hanc laudem meretur: ita Franciae urbes quae Lutetiae circumvicinae sunt, alias aliis digniores esse non inficior: sie tarnen ut hae quoque ab illa superentur. Sermonis enim verè Gallici (sicut & ipsius Galliae) metropolin esse Lutetiam dico" 48 .
44
45
46
47
48
288; M . Delbouille, La notion de "bon usage" en ancien français. Apropos de la genèse de la langue française, in: Cahiers de l'association internationale des études françaises 14 (1962) 9-24; ders., Comment naquit la langue française, in: Phonétique et linguistique romanes, Festschrift G. Straka, Lyon-Straßburg 1970, Bd. I, p. 187-199; C.Th. Gossen, Die Einheit der französischen Schriftsprache im 15. und 16. Jahrhundert, in: Zeitschrift für romanische Philologie 73 (1957) 427—459; vgl. auch F. Brunot, Histoire de la langue française des origines à nos jours, Bd. I, De l'époque latine à la Renaissance, Paris 1966, p. 329f.; A. François, Histoire de la langue française cultivée des origines à nos jours, Bd. I, Genf 1959, p. 93f., und J. P. Caput, La langue française: histoire d'une institution, Bd. I, Paris 1972, p. 46-48. Vgl. W. Settekorn, u Mettre & ordonner la langue francoise par certaine reigle . . . " Überlegungen zur Genese sprachnormativen Diskurses in Frankreich, in: Festschrift R. Rohr, Heidelberg 1980, p. 494-513. P. Fabri, Le grant et vray art de pleine rethorique, stille, proffitable et nécessaire a toutes gens qui désirent a bien elegantement parler et escripre, Paris 21532, p. LV K. Lambley, The Teaching and Cultivation of French Language in England during Tudor and Stuart Times, with an Introductory Chapter of the Preceding Period, Manchester-London 1920, p. 17. J. Pillot, Gallicae linguae institutio, Latino sermone conscripta, per Ioannem Pillotum Barrensem, Paris 1550, p. 13 v°. H. Estienne, Hypomneses de Gallica lingua, Paris 1582, p. IL
136
Christian Schmitt
Diese Festlegung hatte zur Folge, daß regionaler Wortschatz wie regionale Formen, Wortbildung und Syntax fortan zum Substandard gezählt wurden. Die französischen Lexikographen beginnen jetzt mit einer systematischen Markierung des diatopischen Substandards 49 , die im 17. Jahrhundert geradezu in eine Jagd auf die Regionalismen ausarten sollte, denn nichts fürchtete z. B. Vaugelas so sehr wie die contagion des Provinces, denn die Vermeidung des Provinzialismus habe z. B. allein den Ruhm Amyots begründet: "Quelle obligation ne luy a point nostre langue, n'y ayant jamais eu personne qui en ayt mieux sceu le génie et le caractère que luy, ny qui ayt usé de mots, ny de phrases si naturellement Francoises, sans aucun meslange de façons de parler de Provinces, qui corrompent tous les jours la pureté du vray langage François"50. Die puristische Auffassung von der korrekten diatopischen Varietät bestimmt die Lexikographie seit dem 17. Jahrhundert 51 und hat im grammatischen Bereich dazu geführt, daß Phänomene der Regiolekte (die Puristen sprechen \on patois) völlig ausgegliedert wurden 52 . b) das Problem der sozialen Norm Zwei Hauptaspekte haben die Humanisten im Zusammenhang mit der schichtenspezifisch kodifizierten Sprachnorm herausgearbeitet: (1) diastratische Sprachverwendung als Folge literarischer Konvention und (2) diastratische Registerbenutzung als Ergebnis der Zugehörigkeit zu sozialen Schichten. Dabei dominierte der erste Aspekt in den Schriften zu Beginn des 16. Jahrhunderts, während sich in den Grammatiken und Traktaten des ausgehenden 16. Jahrhunderts das Interesse mehr auf diejenigen Bereiche verlagerte, die auch heute noch den Gegenstand der Soziolinguistik bilden53. 49
50 51
52
53
Vgl. G. Roques, Les régionalismes dans Nicot 1606, in: La lexicographie française du XVle au XVIle siècle, Actes du Colloque International de Lexicographie dans la Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, publiés par Manfred Höfler, Wolfenbüttel 1982, p. 81-101. Remarques sur la langue françoise, par Vaugelas, nouv. éd. par A. Chassang, Paris s.d.,p.36f. B. von Gemmingen-Obstfelder, La réception du bon usage dans la lexicographie du 17e siècle, in: La lexicographie française du XVle au XVIIIe siècle, Actes du Colloque International de Lexicographie dans la Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, Wolfenbüttel 1982, p. 121-136; vgl. auch J. Rey-Debove, Le métalangage dans les dictionnaires du XVIIe siècle (Richelet, Furetière, Académie), ibid., p. 137-147. Vgl. z. B. P. Guiraud, Patois et dialectes français, Paris 1968; bezeichnenderweise enthält dieser Que sais-je-Band ein Kapitel les mots dialectaux, während die Morphologie und die Syntax im Grunde fehlen. Vgl. z.B. N. Dittmar, Soziolinguistik. Exemplarische und kritische Darstellung ihrer Theorie, Empirie und Anwendung, Frankfurt 1973; B. Schlieben-Lange, Soziolinguistik. Eine Einführung, Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz 1973; oder A. Rucktäschel, Sprache und Gesellschaft, München 1972.
Der französische Substandard
137
In Anlehnung an die mittelalterliche, aus der Tradition der Vergilkommentare erwachsene Drei-Stil-Lehre 54 entwickelte bereits Fabri ein Modell für die französische (Literatur-)Sprache; dabei geht er davon aus, "tout ainsi qu'il est de graves/moyennes/et basses substances seullement est il de haulx termes/de moyens et de petis" 55 , und er definiert den hohen Stil analog den Vergil-Kommentatoren vom Gegenstand und der gewählten Gattung aus; nicht das Lexem, nicht sein Gebrauch, nicht seine eventuelle Gebrauchseinschränkung werden diskutiert, sondern die Stellung der Sache in einer absoluten Werteordnung, die dann auf das Sprachliche übertragen wird. Es verwundert daher nicht, daß dieser Rhetorikprofessor das höchste Register inhaltlich bestimmt: "Les haultes et graves substances sont quant on parle de théologie [des sept ars liberaulx] du regime des princes et la chose publicque"; analog dazu wird die Mitte definiert, denn "les moyennes et familiaires substances sont quant on traicte des choses mécaniques, de yconomique et gouvernement de sa maison, de rentes, de marchandise et de tout proffit singulier et honneste". Der Rest wäre dementsprechend zum Substandard zu zählen: "Les basses et humiliées substances/et quant Ion parle de basses et petites matières/combien quilz soient utilles/honnestes/necessaires/toutesfois lexercitation en est un peu deiectee/comme de famille de maison/de petis enfans/de fleurettes/de bergers/vachers" 56 . Wie deutlich Fabri hier in der Tradition der Interpretation und Kommentierung von Vergils Bukolika und Georgika steht, zeigt besonders sein auf das Französische bezogenes Beispiel des Gebrauchs der Subnorm: "Les bas et humiliez termes sont ceulx qui sont appropriez a deduyre basse substance. Exemple. Comme iay faict porter de lestable de metz mes brebis trois charrestees de fiens/et ay faict rapporter trois panniers. Et se peuvent eslever iusques aux moyennes substances comme en parlant de yconomique ou de autres choses" 57 .
Von dieser von außen an die französische Sprache herangetragenen 'diastratischen' Subnorm sollte in der Folge nur noch am Rande die Rede sein, denn dieses Klassifikationsprinzip lebt im Prinzip nur noch in der Einheit der mots bas insofern fort, als dieser Terminus sich meist auf Lexeme bezieht, die tabuisierte Gegenstände bezeichnen. Ansonsten wird immer mehr das schichtenspezifische Sprechen zum Gegenstand der Sprachbeschreibung, wobei man die These vertreten darf, daß die Existenz sozialer 54
55 56 57
E. R. Curtius, Die Lehre von den drei Stilen im Altertum und Mittelalter, in: Romanische Forschungen 64 (1952) 57-70; vgl. auch F. Quadlbauer, Die antike Theorie der genera dicendi im lateinischen Mittelalter, Wien 1962, p. 150—158, und E. R. Curtius, Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter, Bern 21950, p. 80f. P. Fabri, Rethorique, Paris 21532, p. XIII. Alle Zitate, ibid.,p. XIII. P. Fabri, ibid., p.XUU.
138
Christian Schmitt
Subregister früher in ausländischen Grammatiken der französischen Sprache als in in Frankreich verfaßten Werken thematisiert wurde. Die erste mir bekannte Stelle, die ausführlich diastratische Divergenzen benennt, findet sich bei Palsgrave, der diastratische Probleme klar erkannt hat: "Here foloweth wherin the voulgar people [= Gegensatz zu lerned men in Fraunce], marchaunte men and suche as write hystories dyffer from the maner of nombring here afore rehersed" 58 . Eine frühe Angabe zur Subnorm findet sich auch bei Tory, doch wird nicht eindeutig klar, ob man sich unter den hier an den Pranger gestellten iargonneurs Sprecher vorzustellen hat, deren Sprache durch die Ausübung einer handwerklichen Tätigkeit affiziert ist, oder einfach Argotsprecher 59 . Abgesehen von immer wieder kolportierten Vorurteilen gegen die angeblich schlechte Sprache der Frauen 60 konzentriert sich die Diskussion um den sozialen Standard und Substandard in der Renaissance auf die Opposition cour und parlement. Dabei ist es schwierig, die zahlreichen Zeugnisse zu systematisieren, da vielfach die Entscheidung für oder gegen die Hof spräche oder für bzw. gegen die Parlamentariersprache auch ein politisches oder gar in erster Linie ein politisches Credo darstellt. Bis etwa 1560 entscheidet sich eine stattliche Anzahl für die Sprache des Hofes; Louis Meigret61 und sein Gegenspieler J. Peletier du Mans 62 sind sich hierin erstaunlicherweise einig; selbst R. Estienne stimmt dieser Einschätzung noch rückhaltlos zu, wenn er in seiner 1557 erschienenen Grammatik berichtet, er habe "faict un recueil principalement de ce que nous avons veu accorder a ce que nous avions le temps passé apprins des plus sçavans en nostre langue, qui avoyent tout le temps de leur vie hanté es cours de France, tant du Roy que de son Parlement à Paris, aussi sa Chancellerie et Chambre des comptes: esquels lieux le langage s'escrit et se prononce en plus grande pureté qu'en tous autres"63, und damit einen Kompromiß zwischen den beiden Autoritäten, dem Hof und dem Parlament, anstrebt. 58 59 60 61 62 63
J. Palsgrave, Lesclarcissement de la langue française, ed. F. Génin, Paris 1852, p. 367ff. G. Tory, Champfleury,introduction par J. W. Jolliffe, Paris-La Haye 1970, p. V Zur Sprache der Frauen vgl. z.B. G. Tory, Champ fleury, p. XXXIII; J. Pillot, Gallicae linguae institutio, p. 5; H. Estienne, Hypomneses, p. 136, u. a. m. Defenses de Louis Meigret touchant son orthographie Françoçze contre les censures ç colonies de Glaomalis de Vezelet e de ses adherans, Paris 1550, p. 20. J. Peletier du Mans, Apologie a Lovis Meigrét Lionnees, in: J. P. d. M., Dialogue de l'Ortografe, éd. Porter, Genf 1964, p. 23. R. Estienne, Traité de grammaire françoise, 1557, Neudruck Genf 1972, p. 3 (Vorwort); ähnlich schon G. Tory (zur Schriftsprache): "Il est certain que le stile de Parlement et le langage de court sont très bons" (Champsfleury,p. Vv°).
Der französische Substandard
139
Selbst der popularisierende Abel Mathieu, der sich als amy de la multitude bezeichnet 64 , übernimmt diese Einschätzung, wenn auch vorsichtiger und differenzierter65. Ein Umschwung macht sich hier mit der Regentschaft Catherine de Médias bemerkbar. Hatte z . B . Pasquier noch festgestellt, "nous n'escrivons plus qu'en un langage, qui est celuy de la Cour du Roy" 66 , so stellt er schon wenig später in einem Brief an Monsieur de Querfinien fest, "qu'il n'y a lieu où nostre langue soit plus corrompue" 67 ; die meisten Calvinisten68 schließen sich dieser Beurteilung an 69 . Während man von einer Entscheidung bei dieser delikaten Frage wohl nicht sprechen kann, steht eindeutig fest, daß die Sprache des gemeinen Volkes bereits vom 16. Jahrhundert an in den Substandard verwiesen wurde, wie dies H. Estienne eindeutig bezeugt: "Or je presuppose, quand je parle ou de nostre langage parisien, ou de ceux que j'appelle les dialectes, qu'on entende qu'il faut premièrement oster toutes les corruptions et depravations que luy a fait le menu peuple . . ."70. Diesem parler du menu peuple, dem historischen Vorläufer des français populaire, galt im 17. Jh. dann ein besonderes Interesse, als Vaugelas die Sprache der unteren Klassen aus dem usage commun ausgliederte und sie zum mauvais usage schlug; Marzys sieht hier sicher richtig, wenn er unterstreicht, Vaugelas "est en accord avec les porte-parole du milieu aristocratique français - Balzac, Chapelain et même Malherbe - chez qui le mépris du peuple, de ses goûts et partant de sa langue est constant" 71 . Von der im 16. und 17. Jahrhundert erworbenen negativen Konnotation konnte sich das Kompositum français populaire nie mehr erholen, selbst moderne Definitionen bleiben mehr oder weniger der hier beschriebenen Diskussion verpflichtet. c) die Bewertung der Xenismen Auch die Diskussion um die Bewertung der Xenismen wurde im Zeitalter des Humanismus und der Renaissance für das Französische im Grunde zu 64 65 66 67 68
69 70 71
A. Mathieu, Second devis de la langue française (1560), Nachdruck Genf, 1972, p. 8. A. Mathieu, Devis de la langue française (1559), Nachdruck Genf, 1972, p. 22. E. Pasquier, Les recherches de la France (1621), Paris 1665, p. 660; vgl. auch G. Zeller, Les institutions de la France au XVIe siècle, Paris 1948, p. 71-110. E. Pasquier, Lettre 4, A Monsieur Querfinien, p. 230. So z. B. Th. Beza, De Francicae linguae recta pronuntiatione, Genevae 1584, p. 9f; aber auch P. Ronsard, Abrégé de l'art poétique françois, in: Ronsard, Oeuvres complètes, éd. Cohen, Bd. II, Paris 31965, p. 998. Vgl. auch F. Brunot, La langue du Palais et la formation du "bel usage", in: Romanische Forschungen 23 (1909) 667-690. H. Estienne, Précellence, éd. Humbert, p. 293. Claude Favre de Vaugelas, La préface des "Remarques sur la langue françoise", éditée avec introduction et notes par Z. Marzys, Neuchâtel-Genève 1984, p. 22.
140
Christian Schmitt
einem definitiven Abschluß gebracht, denn für die puristisch motivierte Ablehnung der Entlehnungen wurden hier die Grundlagen gelegt72. Es ist kein Zufall, daß sich ein Etiemble 73 im 20. Jahrhundert auf Henricus Stephanus beruft; auch wenn ersterer fast ausschließlich das Englische, letzterer hingegen den vermeintlich übergroßen Einfluß des Italienischen aufs Korn nimmt 74 , so bleiben beider Grundhaltungen doch so weitgehend identisch, daß man Estiennes dialogues du nouveau langage françois Italianize ohne Einschränkung das parlez-vous franglais? des 16. Jahrhunderts nennen darf. Neben dem Italienischen75 kam im 16. Jahrhundert in erster Linie das Latein (zusammen mit dem Griechischen) 76 als Spendersprache in Frage 77 . Abgesehen von den theoretischen Schriften der Pléiade, in denen eine Ausbeutung dieses potentiellen Fundus für die französische Sprache empfohlen wird78, wenden sich fast alle Sprachtraktate zumindest gegen die Aufnahme „unnötiger" Latinismen. Bereits P. Fabri warnte vor den "escumans termes latins" 79 ; satirisch wird die Frage der Latinismen bei G. Tory behandelt, wo sich die folgenden Sätze finden: "Quant Escumeurs de Latin disent Despumon la verbocination latiale, & transfreton la Sequane au dilucule & crépuscule, puis deambulon par les Quadrivies & Piatees de Lutece, & comme verisimiles amorabundes captivon la benevolence de l'omnigene & omniforme sexe feminin, me semble quilz ne se mocquent seulement de leurs semblables, mais de leur mesme Personne"80. 72
73 74
75
76
77 78 79 80
Vgl. Vf., La planification linguistique en français contemporain: bilan et perspectives, in: Le français en contact avec: la langue arabe, les langues négro-africaines, la science et la technique, les cultures régionales, Sassenage 1977, p. 89-110. R. Etiemble, Parles-vous franglais?, édition revue et augmentée d'un chapitre, Paris 21973, p. 363-365 (11964). H. Estienne, Deux dialogues du nouveau langage françois, italianizé, et autrement desguizé principalement entre les courtisans de ce temps: De plusieurs nouveautéz, qui ont accompagné ceste nouveauté de langage: De quelques courtisanismes modernes, et de quelques singularitez courtisanesques, 2 Bde, Paris 1885. Vgl. T. E. Hope, Lexical Borrowing in the Romance Languages. A critical study of Italianisms in French and Gallicisms in Italian from 1100 to 1900, 2 Bde, Oxford 1971; B.Wind, Les mots italiens introduits en français au XVIe siècle, Deventer 1928. Vgl. G. Gougenheim, La relatinisation du vocabulaire français, in: Annales de l'Université de Paris 29,1 (1959) 5—18; P. Guiraud, Le moyen français, Paris 31972, p. 52ff. Vgl. auch P. Rickard, La langue française au seizième siècle, Cambridge 1968, p. 18ff. Vgl. dazu auch H. Chamard, Histoire de la Pléiade, Bd. IV, Paris 1963, p. 63ff. Rethorique, Paris 21532, passim. G. Tory, Champ fleury, A IL
Der französische Substandard
141
Diese wurden dann von Rabelais im sog. „Schülerdialog"81 übernommen, der eine der bekanntesten Persiflagen auf das "fratin" (français x latin) darstellt. Derlei makkaronisches Französisch wurde mit den Lexemen écumer, despumer, excorier, écorcher etc. bedacht. Hinsichtlich des Latinismus und Gräzismus im Französischen hat Lebègue sicher richtig gesehen, wenn er die grundsätzliche Einstellung vom sprachlichen Verhalten der Übersetzer herleitet, die seit ca. 1570 eine puristische Attitüde zeigen: "Brunot place au XVIIe siècle l'épuration du vocabulaire français. Je crois que le reflux a commencé plus tôt, selon les milieux littéraires, vers 1570-1580" 82 . Die Ablehnung des Cultismus fällt damit zeitlich zusammen mit dem Höhepunkt der Auseinandersetzung mit der italienischen Kultur 83 . In der Folgezeit wechselten zwar die Einflüsse fremder Sprachen auf das Französische, doch blieben die Lexikographen insofern konstant in ihrer Bewertung des Xenismus und dem 16. Jahrhundert verpflichtet, als sie weiter die Entlehnungen markierten und sich in der Regel xenophob zeigten. d) zur Beurteilung des historischen Wandels Zwei Kriterien des Sprachwandels kannten die frühen Grammatiken der französischen Volkssprache: (1) Evolution "par vice de nature, ou par accident" oder (2) Veränderung durch "changement de seigneureries, ou d'habitation" 84 ; dabei entspricht (2) der durch Nebrija propagierten 85 , berühmten These 86 , "que siempre la lengua fue companera del imperio" 87 , (1) der bereits von Quintilian (IX, 3, 1) klar formulierten Einsicht, daß "verborum vero figurae et mutatae sunt semper et utcumque valuit consuetudo mutan81
82
83
84
85
86
87
Vgl. dazu W. Berschin, Rabelais' „Schülerdialog", in: Acta conventus neo-Latini Lovaniensis, Louvain-München 1973, p. 95—99; R. Lebègue, L'escolier limousin, in: Revue des cours et conférences 40 (1938/9), Teil I, 304-306. R. Lebègue, La langue des traducteurs français au XVle siècle, in: Festgabe E. Gamillscheg, Tübingen 1952, p. 29; vgl. auch ders., Flux et reflux du vocabulaire français au XVle siècle, in: French and Provençal Lexicography. Essays presented to honor A. H. Schutz, Columbus 1964, p. 219-226. Vgl. H. Estienne, Deux dialogues (1578); Précellence (1579), Hypomnese (1582). Mehrere antiitalienische Bemerkungen enthält schon die Apologie pour Hérodote (1566), nouvelle éd. par R. Ristelhuber, Paris 1879, p. 135ff. C. Fauchet, Recueil de l'origine de la langue et poésie françoise, ryme et romans; plus les noms et sommaire des oeuvres de CXXVII poètes François, vivans avant l'an MCCC, Paris 1581 (Nachdruck Genf, 1972), p. 8. Antonio de Nebrija, Gramâtica castellana, 1492, texto establecido sobre la éd. "princeps" por P. Galindo Romeo y L. Ortiz Munos, Madrid 1946, p. 5. Zur Rezeption dieser These in Frankreich vgl. Vf., Die französische Sprachpolitik der Gegenwart, in: R. Kloepfer (ed.), Bildung und Ausbildung in der Romania, Bd. II: Sprachwissenschaft und Landeskunde, München 1979, p. 470-490. Vgl. auch A. Asensio, La lengua companera del imperio: historia de una idea de Nebrija en Espana y Portugal, in: Revista de Filologia Espanola 43 (1960) 399-413.
142
Christian Schmitt
tur", die von Bovillus in Frankreich in seinem Buch De differentia vulgarium linguarum et Gallicisermortis varietate (1533) auf das Französische angewandt und aktualisiert wurde, in dem dieser unterstreicht, in Volkssprachen sei "enim nullus rationis tenio, nulla ibi fixa et certa mentis aurigatio: sed eo navigandum, ibi figenda anchora, quo tempus, quo locus, & quo incerta hominum labia vocant ingénia. Adde quod quotidie humanorum labiorum vitia secant, variant, adulterant incompta vulgi idiomata: adeo ut permodica loci distantia protinus invertat cuiuslibet popularis linguae stilum, et versuram faciat in labiis imperitorum hominum"88. Bovillus ist hier in vielem ausführlicher als Quintilian und auch wesentlich präziser als Dante, der den Unterschied zwischen der genormten Gelehrtensprache Latein und dem volgare in folgenden Worten beschrieben hat: "Lo latino è perpetuo e non corruttibile, e lo volgare è non stabile e corruttibile"89. Früh schon wurde diese allen Volkssprachen immanente Eigenschaft als Vitium gegeißelt; so bemerkt bereits Fabri in seiner Rhetorik, es gebe "une autre manière de barbare appellee vice de innovation commis ignorans" 90 . Wenn es auch übertrieben wäre, den Humanisten eine generelle Ablehnung des Neuwortes unterstellen zu wollen, so läßt sich doch sicher als generelle Tendenz für das 16. Jahrhundert die Formel aufstellen, daß man bei Neologismen die skeptische Einstellung Quintilians teilte 91 und lediglich dann großzügiger verfuhr, wenn es sich um Reprisen handelte oder um Wörter und Neubildungen, die - ein Paradoxon - das Prestige des Alters aufwiesen: "Novorum optima erunt maxime vetera" 92 . Besonders negativ beurteilt wurden Neologismen in dem von den Druckern stark rezipierten Handbuch von Tory, wo sich eine Rangliste für Sprach verderber findet: Dort stehen die Forgeurs des motz direkt vor den Escumeurs de Latin, den Plaisanteurs und den Jargonneurs: "Je treuue en oultre quil y a une aultre manière dhomes qui corrompt encores pirement nostre langue. Ce sont Innovateurs & Forgeurs de motz nouveaulx" 93 . Konzessionen wurden im 16. Jahrhundert nur für die unverzichtbare "liaison nécessaire entre le travail et la langue du travail" gemacht, wie dies L. Clément treffend formuliert hat 94 . 88 89 90 91 92 93 94
Paris 1533, p. 3. // convivio I, 5, 7; vgl. auch K.-O. Apel, Die Idee der Sprache in der Tradition des Humanismus von Dante bis Vico, Bonn 21975, p. 114. P. Fabri, Rethorique, Paris 21532, p.LI. Quintilian VIII, 6, 31f. ibid., I, 6, 41. G. Tory, Champfleury,A II. L. Clément, Henri Estienne et son œuvre française, Paris 1898 (Neudruck, Genf 1967), p. 399-404.
Der französische Substandard
143
Wenn Ronsard im Zusammenhang mit der Wiederaufnahme von veraltendem und veraltetem Material davon spricht, daß eine "meure et prudente election" 95 angebracht sei, so sahen seine Schüler und Zeitgenossen in diesem Rat keine Aufforderung, Reprisen zu begünstigen, sondern eher eine Warnung vor übermäßigem Gebrauch von Archaismen. Es fehlt sicher nicht an Apologien für den Archaismus - analog zur bereits für den Regionalismus vertretenen These, es sei besser, auf genuines, eigenes Material zurückzugreifen - , und Pasquier gibt sicher die grundsätzliche Einstellung wieder, wenn er schreibt (Les recherches de la France, Paris 1621, ed. 1665, p. 661): "J'ay remarqué plusieurs belles paroles anciennes, dont les aucunes sont du tout perdues par la nonchalance, & les autres changées en pires par l'ignorance des nostres. Nos ancestres usèrent de Barat, Guille, & Lozange, pour Tromperie, & Barater, Guiller, & Lozanger, pour tromper: Dictions qui nous estoient naturelles, au lieu desquelles nous en avons adopté des Latines, Dol, Fraude, circonvention: Vray qu'encore le commun peuple use du mot de Barat".
Das sind nostalgische Bemerkungen, mehr nicht; die Tendenz, veraltendes oder veraltetes Material zu markieren und dem Substandard zuzurechnen, beginnt im 16. Jahrhundert, und noch heute gelten die von den Humanisten erarbeiteten Prinzipien.
3. Die französische Klassik und der Substandard Den wichtigsten sprachtheoretischen Text der französischen Klassik stellen ohne Einschränkung die Remarques sur la Langue Françoise, utiles à tous ceux qui veulent bien parler et bien escrire Claude Favre de Vaugelas' dar; die Préface der Remarques bildet dabei die theoretische Grundlage, in der Vaugelas das im Grunde noch heute gültige Konzept des bon usage96 darlegt 97 . Vaugelas' Konzept stützt sich dabei auf drei Grundpfeiler, die allesamt so95 96
97
ArtPoétique\\\,4%. Vgl. dazu A. Adam, Pour le troisième centenaire des "Remarques" de Vaugelas, in: Mercure de France 300 (1947) 246-261; W. Blochwitz, Vaugelas' Leistung für die französische Sprache, in: Beiträge zur romanischen Philologie! (1968) 101-130; M. Cohen, Vaugelas et le français de classe, in: Grammaire et style, Paris 1954, p. 57—64; Z. Marzys, Claude Favre de Vaugelas: La Préface des ''Remarques sur la langue françoise", Neuenburg-Genf 1984, p. 7 - 3 7 ; Q. I. M. Mok, Vaugelas et la ''désambiguïsation de la parole, in: Lingua 21 (1968) 303-311; K. A. Ott, Die Sprachhaltung des 17. Jahrhunderts in den "Remarques sur la langue françoise" von Cl. F de Vaugelas, Diss, phil., Heidelberg 1947; H. Weinrich, Vaugelas und die Lehre vom guten Sprachgebrauch, in: Zeitschrift für romanische Philologie 76 (1960) 1—33. Wichtig ist immer noch M. Magendie, La politesse mondaine et les théories de l'honnêteté en France au XVIle siècle, de 1600 à 1660, Paris 1925. Wir stützen uns dabei auf die Ausgabe von Chassang, Paris s. d. (wohl 1880).
144
Christian Schmitt
ziologisch definiert sind: (1) den (bon) usage, d.h. "la façon de parler de la plus saine partie de la Cour, conformément à la façon d'escrire de la plus saine partie des Autheurs du temps", einer "élite des voix" (p. 12f.) von la Cour, d. h. Personen "qui participent à (la) politesse (du Prince)" (p. 13) und les écrivains, d.h. zeitgenössischen Autoren, die dazu beitragen, daß ihre Leser "acquièrent une pureté de langage et de stile, qu'on n'apprend que dans les bons Autheurs" (p. 14), (2) die gens savants en la langue, worunter man sicher Gebildete zu verstehen hat, deren Sprache durch die Kenntnis der klassischen Sprachen nicht verbildet war, und (3) das Prinzip der analogie, das insofern soziologisch definiert bleibt, als für Vaugelas diese Analogie "n'est autre chose en matière de langues, qu'un Usage general et estably que l'on veut appliquer en cas pareil à certains mots, ou à certaines phrases, ou à certaines constructions, qui n'ont point encore leur Usage déclaré, et par ce moyen on juge quel doit estre ou quel est l'Usage particulier, par la raison et par l'exemple de l'Usage general" (p. 21f.). Die diesem bon usage untergeordneten Kategorien des Substandards sind allesamt bekannt aus der Diskussion des 16. Jahrhunderts: - die mauvais mots ("pour faire mespriser une personne dans une Compagnie, pour descrier un Prédicateur, un Avocat, un Escrivain", p. 29) hat bereits der Autor des Rosenromans proskribiert: après garde que tu ne dies ces orz moz ne ces ribaudies . .. je ne tiens pas a cortois orne qui orde chose et laide nome (VV2099-2113)98. Zu diesen mauvais mots sind sicher auch die nirgends im Werk genauer definierten mots bas zu rechnen, die nicht auf die untersten Volksschichten beschränkt zu sein scheinen; offenbar versteht er darunter - wie auch Estienne bei der Definition der mots vils et roturiers (vgl. nota 40) - Wortschatz, der sozialen Konventionen und Tabus widerspricht und deshalb nicht vom honnête homme gebraucht werden darf. Es sind Namen für Dinge, die obszön oder unschicklich sind, von ihrem Gebrauch ist wie von der Verwendung eines mauvais mot abzuraten, denn "un mauvais mot, parce qu'il est aisé à remarquer, est capable de faire plus de tort qu'un mauvais raisonnement, dont peu de gens s'aperçoivent, quoy qu'il n'y ait nulle comparaison de l'un à l'autre" (p. 29f.); - das français populaire, das er mit dem bekannten Satz "selon nous le peuple n'est le maistre que du mauvais Usage, et le bon Usage est le maistre de nostre langue" (p. 28) apodiktisch als inakzeptabel verwirft, wobei 98
Vgl. dazu A. François, Histoire de la langue française cultivée, Bd. I, Genf 1959, p. 30. Wie auch P. Guiraud, Les gros mots, Paris 1975, angedeutet hat, bildet der dialektische Gegensatz vilainlcourtois die Basis für diese Kategorie.
Der französische Substandard
-
-
-
-
145
er im Kapitel VIII der Préface die These aufstellt, "que le peuple n'est point le maistre de la langue"; das français provincial oder dialectal, das für ihn ebenso uninteressant bleibt wie das français populaire, denn seine Remarques "ne sont pas faites contre les fautes grossières, qui se commettent dans les Provinces, ou dans la lie du peuple de Paris; elles sont presque toutes choisies et telles, que je puis dire sans vanité, puis que ce n'est pas moy qui prononce ces Arrests, mais qui les rapporte seulement, qu'il n'y a personne à la Cour, ny aucun bon Escrivain, qui n'y puisse apprendre quelque chose, et que comme j'ay dit, qu'il n'y en avoit point qui ne fist quelque faute, il n'y en a point aussi qui n'y trouve à profiter" (p. 46.); die néologismes und archaïsmes: In ihnen sieht Vaugelas — wie die Humanisten - normale Phänomene lebender Sprachen: "J'avoue, que c'est la destinée de toutes les langues vivantes, d'estre sujettes au changement ( . . . ) " (p. 36); und wenn er auch sein rigoristisches "il n'est donc pas vray qu'il soit permis de faire des mots, si ce n'est qu'on veuille dire, que ce que les Sages ne doivent jamais faire, soit permis" (p.40f.) einschränkt und relativiert, so bleibt doch die Zuordnung zum Substandard unbestritten, denn selbst ein vom Herrscher neu gebildetes Wort hat wegen fehlender Verständlichkeit "aussi peu de mise et de service en son commencement, que si le dernier homme de ses Estats l'avoit fait" (p. 40); le burlesque, le comique und le français familier, worunter Vaugelas wohl den diasituativ inadäquaten Gebrauch der Sprache versteht: "Il ne faut pas croire, comme font plusieurs, que dans la conversation, et dans les Compagnies il soit permis de dire en raillant un mauvais mot, et qui ne soit pas du bon usage" (p. 26). Die explizit genannten Beispiele boutezvous là für mettez-vous là und ne demarez point für ne bougez de votre place ("c'estoit mal parler", p. 26) zeigen, daß darunter wohl auch familiäres Französisch in einer normalen Kommunikation zu verstehen ist: "Que s'ils repartent qu'il ne faut pas dans la conversation ordinaire parler en langage soustenu, je l'avoue, cela seroit encore en quelque façon plus insupportable, et souvent ridicule; mais il y a bien de la différence entre un langage soustenu, et un langage composé de mots et de phrases du bon Usage, qui comme nous avons dit, peut estre bas et familier, et du bon Usage tout ensemble; Et pour escrire, j'en diray de mesme, que quand j'escrirois à mon fermier, ou à mon valet, je ne voudrois pas me servir d'aucun mot qui ne fust du bon usage, et sans doute si je le faisois, je ferois une faute en ce genre" (p. 27); die Berufssprachen: Da der (adlige) honnête homme sich über das gemeine Volk erhebt, werden die Fachsprachen und Technolekte automatisch zu Bestandteilen des Substandards, so z.B. die Sprache der Seeleute, wie Vaugelas anhand eines Beispiels ausführt:
146
Christian Schmitt
"si je parle d'un navire, ou d'une galère, j'useray bien de tous ces mots, rames, avirons, voiles, proüe, pouppe, tillac encore et plusieurs autres semblables que estants fort en usage sont entendus d'un chacun, mais aussitots que je parleray de trinquet, de carène et autres dont le nombre est infini, parce que ces mots n'estant pas si usitez ne s'entendent que de ceux du mestier, je ne parleray plus comme il faut, non pas mesmes quand je ferois une description d'un combat naval, ou il semble que l'on ne sçauroit passer d'employer tous ces termes là, qui ne sont gueres entendus que de gents de marine. Car M. Coef[feteau] a bien fait voir en divers endroits de sa traduction de Florus et de son Histoire Romaine ou il y a de si belles descriptions de batailles navales, que nostre langue nous fournit assez de termes conus et excellents pour exprimer ces choses là avec toutes les graces et tous les ornements que l'on sçauroit désirer"99. Es lohnt sich für Vaugelas nicht, diese Problematik weiter zu behandeln; es finden sich im theoretischen Teil nur noch Bemerkungen zur Sprache der Juristen: obwohl er diesen zubilligt, die "termes de l'art sont tousjours fort bons et bien receus dans l'estenduë de leur jurisdiction, ou d'autres ne vaudraient rien" (p. 35), kommt er zum Schluß, "on peut dire sans blesser une profession si nécessaire dans le monde, que beaucoup de gens usent de certains termes, qui sentent le stile de Notaire, et qui dans les actes publics sont très-bons, mais qui ne valent rien ailleurs" (p. 35). Damit ergibt sich auch bei Vaugelas — trotz der prononciert vorgetragenen Dichotomie bon usage versus mauvais usage — eine Dreiteilung der sprachlichen Register, wobei zum Standard sowohl der langage soustenu als auch die conversation ordinaire gehören, während dem Substandard alle übrigen Niveaus und Register zuzurechnen wären, wie dies anhand des nachfolgenden Schaubildes verdeutlicht werden soll: |
Standard (oral und skriptural)
langage soustenu conversation ordinaire
Substandard I (oral und skriptural)
1
-o^-o=r "g | 1.1
°
a
H
8 e* ^ | . g-1
S ^ £ J
%% | |
ri
!§•
s
i
3
|
i
Dieses typologische Grundmuster ist auch zur Grundlage des Akademiewörterbuches von 1694 geworden, das Vaugelas' Ansatz lediglich verfeinerte und präzisierte, ja sie bestimmt noch heute die sprachliche Registerdefinition der Franzosen, die einen usage cultivé (soigné, choisi, soutenu, tenu) und einen usage courant (commun, usuel) der Norm zuschlagen und zum Substandard das français familier, das français populaire und das français 99
Zitiert nach La préface des "Remarques sur la langue françoise"', éd. Z. Marzys, Neuchâtel/Genève 1984, p. 63.
Der französische Substandard
147
vulgaire (auch français argotique) rechnen 100 , wobei selbstverständlich jedes dieser Register pragmatische Verwendungsregeln kennt. Dasselbe Grundmuster findet sich wieder im Akademiewörterbuch, dessen Notationen ich auf der Basis des Nachdrucks eines 1695 in Holland entstandenen Raubdruckes der Erstauflage von 1694 systematisch ausgewertet habe. In dieser mit der Erstauflage identischen Ausgabe 101 stehen ein zweigeteilter Standard und ein noch weiter als in Vaugelas' Remarques aufgegliederter Substandard in Opposition zueinander. Wie bei Vaugelas steht an oberster Stelle der selten explizit genannte style soutenu ("n'a guère d'usage que dans le style soustenu", "il est plus en usage dans le style soustenu"), dem auch die Sprache der Poeten nahesteht, sofern sie nicht gleichgesetzt wird ("poétiquement et dans le style soustenu", "n'a guère d'usage que dans le style soustenu ou poétique", "les poètes disent", "poétiquement", "figur. et poët.", "en poésie", "poët."); doch bildet die literarische Sprache nicht prinzipiell und nicht immer eine Art Übernorm, wie dies Markierungen vom Typ "par exaggeration et poétiquement", "stile pastoral", "veillit en prose" oder "veillit et ne s'emploie guère qu'en vers" und "en poésie pastorale" zeigen. Da das Akademiewörterbuch den normalen Sprachgebrauch des honnête homme darstellt, bilden die nicht markierten Einheiten zusammen mit dem als dem style soutenu bzw. poétique zugehörig markierten Wortschatz den Standard, dem ein erstaunlich differenzierter Substandard entgegensteht. Gemäß der bereits im 16. Jahrhundert vertretenen und dann noch einmal von Malherbe dezidiert in Erinnerung gebrachten These, daß der Gebrauchsnorm, dem usage, höchste Aufmerksamkeit zu widmen sei, wird alles markiert, was (a) nicht zum usus gehört bzw. (b) im aktuellen usage an Bedeutung verliert und damit gerade veraltet bzw. bereits veraltet ist. Nur auf den usage beziehen sich dabei Notationen wie "quelques-uns (disent)", das kodespezifische "que dans la conversation" und die fein abgestimmten Gebrauchsspezifizierungen "il a peu d'usage", "il est de peu d'usage", "il est peu en usage", "il n'est presque plus d'usage", "il n'est plus guère en usage" und "il n'est plus guère usité"; dabei wird nichts über die Gründe gesagt, die die Akademiemitglieder veranlaßt haben, das Lexem nicht zum Standard zu rechnen. Für die Zugehörigkeit zum Substandard können durchaus verschiedene oder sogar das Zusammenwirken unterschiedlicher Gründe angeführt werden, wie dies ergänzende Bemerkungen deutlich machen: Ein wichtiger Faktor ist dabei die Zeit, denn ein Wort "commence à vieillir", "vieillit", "vieillit fort", ist "de nul usage (sinon dans le burlesque)", "vieux îoo Ygi ß Müller, Das Französische der Gegenwart. Varietäten, Strukturen, Tendenzen, Heidelberg 1975, p. 183f. 101 Vgl. nota 22; wir behalten die uneinheitliche Orthographie bei.
148
Christian Schmitt
et de peu d'usage"; es kann aber auch nur ein Bedeutungsstrang veralten ("en ce sens il est vieux"), nur noch literarisch ("n'est guère en usage que parmi les gens de lettres"; "au siècle passé"; "en stile de vieux Roman"; "termes des anciennes Ordonnances") oder sozial ("il est vieux et bas") eingeschränkt sein bzw. nur noch in bestimmten Situationen verwendet werden ("il vieillit et ne se dit gueres plus qu'en raillerie"; "ce mot est fort vieux et ne se dit jamais qu'en raillerie"; "ne se dit que par une espèce d'ironie"; "ne se dit plus dans le style sérieux"); in einem Fall ist sogar davon die Rede, daß "ce mot n'est plus en usage parce que ce metier est aboly" (s. v. atournaressé). Interessant bleibt dabei, daß die Notation vieux kein Antonym kennt, denn in der Erstauflage der Akademie wird kein einziges Lexem als Neologismus bezeichnet. Entgegen der ursprünglichen Absicht konnte die Akademie nicht umhin, einen umfangreichen, dem Standard nicht entsprechenden Wortschatz wenn auch unter Hinzufügung einer Notation - in ihr Wörterbuch aufzunehmen 102 , denn der Wortschatz des honnête homme hätte zur Beschreibung der Realia nie ausgereicht. Da die Akademie nirgendwo die zahlreichen qualifizierenden Epitheta systematisch definiert hat, bleibt im nachhinein natürlich in zahlreichen Fällen eine Identifizierung der Notationen des Substandards schwierig; doch läßt sich ohne Probleme hier ein Bereich ausmachen, den man heute gemeinhin als le français populaire™ bezeichnet. Auf dieses sozial definierte Register rekurrieren die Adjektive commun, populaire, ordinaire, bas, vulgaire und ihre jeweiligen Wortfamilien; dabei habe ich die folgenden Notationen vorgefunden: communément, plus communément; populaire, populairement, façon de parler pop., en cette phrase populaire, populaire mais fort usité, le peuple appelle, parmi le peuple, façon de parler de quelques femmes du bas peuple, le peuple par corruption, ne se dit que parmy le peuple, il n'est que dans la bouche du peuple, n'est en usage que parmi le menu peuple, on dit parmi le peuple bassement; ordinairement, plus ordinairement, dans le discours ordinaire; parler bas, bas(sement), il est un peu bas, il est bas et ne se dit plus, il est tresbas, ce mot est bien bas; le vulgaire appelle, vulgairement. Die Schwierigkeit, le français populaire zu definieren, die noch heute fortbesteht 104 , zeigt sich in den zahlreichen Verbindungen dieser Adjektive mit anderen Notationen: 102
Vgl. auch I. Popelar, Das Akademiewörterbuch von 1694 — das Wörterbuch des Honnête Homme?, Tübingen 1976, p. 8ff. 103 Ygi p Guiraud, Le français populaire, Paris 31973 (Que sais-je, 1972). 104 Vgl. C. Désirât, T. Horde, La langue française au 20e siècle, Paris 1976, p. 39ff.
Der französische Substandard
149
populaire et bas, bas et populaire, proverb, et populairement, proverb. et bassement, proverbial et bas, figurément et bassement, bas et injurieux, façon de parler basse et burlesque, familier et bas, bassement et par raillerie, populaire et vieux, bas et vieux, il est bas et vieillit. Diese Zusammensetzungen können sicher zumindest teilweise als Indiz für die zahlreichen Verwendungsmöglichkeiten, also als pragmatische Regeln des Subkodes interpretiert werden. Eine untergeordnete Rolle spielen für die Akademie die Provinzialismen. Da regionaler Wortschatz grundsätzlich abgelehnt wurde, bleiben diatopische Notationen selten. So fällt z. B. das normannische haro ("n'est en usage qu'en Normandie") - wohl wegen seiner Zugehörigkeit zur Rechtssprache aufgenommen {clameur de haro "terme de justice, usité en Normandie") - völlig aus der Reihe; je einmal findet sich der Vermerk "dans les Provinces", "n'est en usage qu'en quelques Provinces", und als diatopische Notation darf man auch das einmal belegte "dans les justices inférieures" werten; der Sprachgebrauch der Hauptstadt "à Paris (petites maisons)" wird ein einziges Mal markiert. Einen breiteren Raum nehmen diasituative Anmerkungen ein; dabei dominiert familier mit großem Abstand vor den weniger klaren comique, burlesque und par raillerie o.a.: familier, stile familier, discours familier, conversation familière, stile très familier, familier et bas, conversation fort familière ou style comique; manière de raillerie, ne se dit (plus) qu'en raillerie, terme de raillerie, par raillerie et en burlesque; terme de derision, et un peu libre. Schwierig bleibt das einmal ausgewiesene "se dit abusivement et par exagération" zu bewerten, mit dem das Akademiewörterbuch die profane Verwendung von adorable beurteilt; doch scheint es, daß hier wohl gegen ein religiöses Tabu verstoßen wird, da historisch eine Ableitung von lt. adorare "anbeten" vorliegt. Obwohl Thomas Corneille 105 mit Billigung der Akademie den Wortschatz des Handwerks und der Künste separat dargestellt hat, nehmen die fachlich-funktionell motivierten Auszeichnungen mit großem Abstand den breitesten Raum ein. Dabei wird unterschiedslos der Wortschatz akademischer Berufe wie traditioneller handwerklicher Tätigkeiten markiert, denn der honnête homme zeichnete sich bekanntlich dadurch aus, daß ihm körperliche wie geistige Arbeit weitgehend fremd waren; berufsbezogenen Fachwortschatz konnte er mithin nicht kennen. Im Akademiewörterbuch werden Verfahren der Notation angewandt, ohne daß eine Begründung für das Vor105
Th. Corneille, Le grand dictionnaire des arts et des sciences, Paris 1694, Nachdruck Genf 1968.
150
Christian Schmitt
gehen ersichtlich wäre: D i e Auszeichnung erfolgt (a) nach d e m G e b r a u c h von Berufstätigen, (b) nach Berufs- und Fachgebieten und (c) nach berufstypischen Texten. Z u r ersten G r u p p e gehören dabei die folgenden 17 Notationen: les anatomistes divers artisans se servent parmi les astronomes les avocats parmi les banquiers et gens d'affaires ne se dit que par les Bateliers parmi les Chasseurs les Chirurgiens disent parmi les fauconniers
les Libraires ne se dit gueres que par les marchands les médecins disent les Rhetoriciens parmi les Rotisseurs et les Cuisiniers terme de physique et de Sage-femme les servantes appellent parmi les Théologiens
Weitaus wichtiger ist die zweite G r u p p e , zu der die folgenden 76 Notationen gehören: en matière d'affaire terme d'agriculture terme d'anatomie terme d'architecture terme d'architecture militaire terme d'arithmétique terme d'armoirie en armoiries dans les arts arts mechaniques terme d'astrologie terme d'astronomie terme de Banquier terme de bastimens terme de blason terme de broderie terme de chancellerie terme de charpenterie terme de charroy terme de chasse terme de chirurgie terme de chymie terme de commerce terme de commerce et de marine en matière criminelle en termens (sic) de devotion dogmatique terme de droit terme de droit canon terme des eaux et forests terme d'Escole terme d'escrime terme de fauconnerie
terme de feu d'artifice terme de finance terme de fortification terme de géométrie terme de géographie terme de grammaire terme de gruerie terme de guerre terme d'imprimerie terme de jeu terme de jeu de Cartes terme de jeu des échecs terme de jurisprudence en justice terme de libraire terme de logique terme de maçonnerie terme de manege terme de marchandise terme de marine terme de mathématique terme de mechanique terme de menuiserie terme de musique en musique terme de négoce stile de notaire terme de palais terme de paume terme de peinture en peinture en peinture et en sculpture terme de philosophie
151
Der französische Substandard
terme de philosophie et de théologie dans la physique terme de physique ou de Sage-femme le style de pragmatique terme de pratique
terme de procedure terme de Rhétorique en termes de sculpture terme de vénerie
Die dritte Gruppe bleibt etwas disparat; hier werden Hinweise auf Texte und Textsorten zusammengestellt, wobei der religiöse und der administrative Bereich eine besondere Rolle spielen: (terme) de l'Ecriture ecclés. religion, en matière de religion terme de formule
lettres de Chancellerie dans l'université chanson(s)
Dieses Notationssystem wurde über Jahrhunderte beibehalten und teilweise noch ausgebaut und verfeinert; es gilt grosso modo für das maßgebliche Wörterbuch des 19. Jahrhunderts von Littré 106 , wo das Fachvokabular noch gewissermaßen zum Substandard zählt, den Robert 107 wie das Konkurrenzwörterbuch des Larousse-Verlages108. Wenn auch der GRob und der GLarLF im Fachwortschatz selbst keinen Substandard mehr erblicken - die berechtigte Gegenfrage müßte dann lauten: Über welches Lexem verfügt der Standard? - so erklärt sich doch die exzessive Auszeichnung des Fachvokabulars aus der über Jahrhunderte geübten lexikographischen Praxis, findet damit eher eine Legitimation in der Tradition als in generell akzeptierten sprachwissenschaftlichen Erkenntnissen, zumal heute feststeht, daß die Grenze zwischen Fachsprache und Gemeinsprache nicht zu ziehen ist — man denke nur an das Prinzip der Terminologisierung — und eher eine breite Grauzone darstellt109. 106 107
108
109
E. Littré, Dictionnaire de la langue française, Paris 1873-74 (mit Supplément, 1878). P. Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, 6 Bde, Paris 1951-64 (mit Supplément, Paris 1970) [= GRob]. L. Guilbert, R. Lagane, G. Niobey (e. a.), Grand Larousse de la langue française en six (sept) volumes, Paris 1971-1978 [= GLarLF]. Vgl. dazu z. B. L. Drozd, W. Seibicke, Deutsche Fach- und Wissenschaftssprache. Bestandsaufnahme, Theorie, Geschichte, Wiesbaden 1973, p. 166; L. IhleSchmidt, Studien zur französischen Wirtschaftsfachsprache, Frankfurt/Bern 1983, p. 21, betont zu Recht, es gebe ständig einen regen Austausch zwischen Gemeinsprache und Fachsprache, und zwar sowohl auf lexikalischem als auch auf syntaktischem, morphologischem und stilistischem Gebiet; vgl. auch A. Phal, Le vocabulaire scientifique général en allemand et en français, in: Etudes de linguistique appliquée 2 (1971) 88f.; W. Klute (Hg.), Fachsprache und Gemeinsprache: Texte zum Problem der Kommunikation in der arbeitsteiligen Welt, Frankfurt 1975; H. R. Fluck, Fachsprachen, München 21980; R. Kocourek, La langue française de la technique et de la science, Wiesbaden 1982.
152
Christian Schmitt
4. Z u m heutigen Substandard Alle Handbücher zum Gegenwartsfranzösischen zeigen eindrucksvoll, wie schwierig die Definition der niveaux de langage heute geworden ist110. Die Puristen111 beklagen in diesem Zusammenhang das angebliche Fehlen einer Richtschnur, eines allgemein anerkannten Maßes, in neuerer Zeit, übersehen dabei aber, wie hier gezeigt wurde, daß es (a) eine solche ne-varieturNorm zu keiner Zeit gegeben hat und auch nicht geben kann, da der Wandel eine immanente Eigenschaft lebender Sprachen darstellt112, und (b) ein français zéro eine Abstraktion bleiben muß 113 , ohne jeden Bezug auf den Rahmen, in dem Sprache aktualisiert wird. Bekanntlich können auch Regeln, die eine hohe Frequenz besitzen, durchaus markiert sein, während der Gebrauch generell akzeptierter Regeln gegen pragmatische Gesetzmäßigkeiten verstoßen kann114 und damit ebenfalls zur Entneutralisierung von Sprache (= parole) führt. Ein Satz wie si j'aurais su, j'aurais pas venu ist ohne jeden Zweifel agrammatisch insofern, als das Konditional in ^/-Sätzen nicht stehen darf und venir mit être verbunden wird; er wirkt aber in Form und Funktion wiederholter Rede korrekt und ist durchaus normkonform in gesprochener Sprache, wenn zwei Bedingungen erfüllt werden: (a) der Rezipient muß dasselbe Vorwissen haben wie der Sender und den Satz als ein Zitat aus dem allgemein bekannten, in Frankreich heute noch goutierten Film La guerre des boutons identifizieren, damit (b) die Mitteilung auch uneingeschränkt als - ironisches bzw. nur eine gewisse (teilweise vorgege110
Vgl. dazu B. Müller, Das Französische der Gegenwart. Varietäten, Strukturen, Tendenzen, Heidelberg 1975, p. 183ff.; C. Désirât, T. Horde, La langue française au 20e siècle, Paris 1976, p. 37ff. 111 P. Dupré, Encyclopédie du bon français dans l'usage contemporain, 3 Bde, Paris 1972. ii2 Vgi yf ? Variété et développement linguistiques. Sur les tendances évolutives en français moderne et en espagnol, in: Revue de linguistique romane 48 (1984) 397-437. 113 Vgl. M. Cohen, Matériaux pour une sociologie du langage, Paris 1971; A. Sauvageot, Français d'hier ou français de demain?, Paris 1978; wichtig in diesem Zusammenhang bleibt auch Unité et diversité du français contemporain, Sonderheft von Le français dans le monde (Paris 1965). 114 E. Bautier-Castaing, La notion de pratiques langagières: un outil heuristique pour une linguistique des dialectes sociaux, in: Langage et société 15 (1981) 3—35; M. Jonas, Une planche de salut pour le français: le français quotidien et les niveaux de langue, in: The French Review 51 (1977) 180—187; D. Noel, "Parler comme du monde" ou "parler comme tout le monde": rapport à la langue et appartenance de classe, in: Langage et société 12 (1980) 3—31; J. J. Walling, The language of the majority: a contribution to the analysis of popular French, in: Modern Languages 61 (1980) 16-21; S. F. Noreiko, The language of the majority again: the academic study of popular French, in: Modern Languages 62 (1981) 138-143; J. J. Thomas, Littérature populaire, langue populaire, in: Poétique 10 (1979) 10—23.
Der französische Substandard
153
bene) Hilflosigkeit ausdrückendes - Bedauern über die Anwesenheit oder das Kommen verstanden wird, das in situativ vergleichbarem Kontext wie im Film sprachlich gefaßt wird. In diesem Fall wäre die Norm des allgemein anerkannten usus sogar aufgehoben. Schon dieses Beispiel zeigt, wie problematisch eine linguistisch begründete Unterscheidung qualitativer Register bleibt; der Betrachter gibt in diesem Falle vor, daß eine objektiv reale Abstufung der Register bestehe und die sprachliche Wirklichkeit sich in definierbare Parameter einteilen lasse, zu denen sich soziale Sprechergruppen konform verhalten. Dabei könnte in diesem Zusammenhang auf Bauche verwiesen werden, der bereits vor einem halben Jahrhundert bemerkte, "que le conditionnel, qui tend à disparaître en LP [= langage populaire] en tant que conditionnel, y est employé souvent à la place de l'imparfait de l'indicatif. Ex. Si qu'on irait voir ça? 'si on allait voir ça?' Si qu'on viendrait nous dire?, 'si on venait nous dire?'" 115 . Wer ein solches von der Norm nicht akzeptiertes Conditionnel e i n e m Register zuordnet, sieht in der Sprache ein nach Schichten und Sedimenten geordnetes, immobiles Gebilde. Damit wird eine wie auch immer begründete Registerordnung zum Prokrustesbett, vergleichbar der traditionellen Grammatik; des weiteren hat bei einer solchen statischen Darstellung der Beschreibende bewußt die pragmatische Perspektive ausgeblendet, indem er nur eine von mehreren und sicher die wichtigste Verwendungsregel zum generellen Bezugspunkt wählte und sich letztendlich um eine konsistent angesetzte différentielle Funktionsanalyse von sprachlichen Regeln drückt. Vielleicht hat gerade dieser Umstand dazu beigetragen, daß die traditionelle Syntax und die Morphosyntax 116 bei der Definition der Subregister, etwa bei Müller und Désirat/Hordé 117 , nicht die entscheidende Rolle spielen118 und daß transphrastische Analysen des Substandards eigentlich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vorliegen. Denn gerade die zahlreichen bisher vorgenommenen linguistischen Analysen haben immer wieder vor Augen geführt, daß die soziologische Klassifikation von sprachlichen 115
116
117
118
H. Bauche, Le langage populaire. Grammaire, syntaxe et dictionnaire du français tel qu'on le parle dans le peuple avec tous les termes d'argot usuel, Paris 41946, p. 108. Vgl. S. Belasco, Derived and modified nouns in French Slang, in: Lingua 48 (1979)
177-192.
B. Müller, Das Französische der Gegenwart, p. 194ff. ; C. Désirât, T. Horde, La langue française au 20e siècle, p. 39ff. Vgl. M.-A. Auvigne, M. Monte, Recherches sur la syntaxe en milieu social sousprolétaire, in: Langage et société 19 (1982) 23-63; K. Lambrecht, Topic French style: remarks about a basic sentence type of modern non-standard French, in: Proceedings of the annual meeting of the Berkeley Linguistics Society 6 (1980)
337-360.
154
Christian Schmitt
Regeln deshalb so problematisch bleibt, weil die Untersuchung der Varietät und Variation der Sprache in bezug auf die soziale Struktur der Sprachgemeinschaft nicht unabhängig von den K o m m u n i k a t i o n s b e d i n g u n g e n (formale Aspekte, Raum, Zeit, Situation, Gesprächspartner, Intention, Konzeption, u. a. m.) vorgenommen werden darf119, während von soziologischen Positionen ausgehende Studien, wie z. B. Robachs Untersuchung zum Orléans-Korpus 120 , mangels linguistischer Differenzierung121 insgesamt recht unbefriedigende Ergebnisse erbracht haben 122 , da sie nur beweisen können, ob ihre soziologischen Prämissen sich in den Texten widerspiegeln oder nicht, und nicht, von der Sprache ausgehend, zu soziolinguistischen Kategorien gelangen. Ziel einer umfassenden Darstellung (die hier nicht geleistet werden kann) müßte daher sein, Sprechen-in-Situation bzw. Sprache-in-Situation oder funktionelle Sprache als homogenes System zu analysieren und die Vielfalt der Regeln zu erfassen, die in der Rede realisiert werden. Dabei wären markierte Regeln wie markierter Wortschatz und ihr Zusammenwirken auf der Isotopieebene des Textes systematisch und umfassend zu beschreiben, wollte man z.B. die Epitheta familier, populaire oder langue spécialisée definieren; français populaire wäre dann als sozial markiertes, primär orales Register der informellen Kommunikation, im wesentlichen ohne situative Festlegung, français familier als sozial unmarkiertes, primär orales Register der vertraulichen, wie teilweise der informellen Kommunikation mit situativer Festlegung, langue spécialisée als sozial markiertes, weitgehend kodeunabhängiges Register der informellen Kommunikation mit situativer und thematischer Festlegung zu beschreiben. Die Zuordnung dieser drei Termini zum Substandard läßt sich dabei linguistisch natürlich nicht begründen, sie bleibt ein historisches Residuum, während die Eingliederung etwa der diatopischen Einschränkungen unterliegenden regiolektalen Sprachregeln wie des Regionalwortschatzes und des alternden bzw. ver119
120
121
Ch. Bachmann, Le social pèse lourd sur le discours: un cas d'inégalité interactionnelle, in: Applied Linguistics 3 (1980) 217—223; D. Baggioni, Aspects sociolinguistiques de la néologie lexicale: le vocabulaire 'à connotations scientifiques' et le fétichisme des mots', in: Linguistische Arbeitsberichte 17 (1977) 33—40; J. Boutet, Matériaux pour une sémantique sociale, in: Modèles linguistiques 4 (1982) 7 - 3 7 ; dies., Quelques courants dans l'approche sociale du langage, in: Langage et société 12 (1980) 33-70. I. B. Robach, Etude socio-linguistique de la segmentation syntaxique du français parlé, Lund 1974. L. A. Mullineaux, M. H. A. Blanc, The problems of classifying the population sample in the socio-linguistic survey of Orléans (1969) in terms of socio-economic, social and educational categories, in: ITL. Review of Applied Linguistics 55 (1982)
3-37.
122 Ygi ( j a z u auch unsere Besprechung, in: Zeitschrift für französische Sprache und Literatur 86 (1976) 280-282.
Der französische Substandard
155
alteten Sprachgebrauchs wegen der begrenzten Gebrauchsmöglichkeiten, tatsächlich gegebener Konnotationen und der limitierten Rezeptionsebene schon eher gerechtfertigt scheint. Das français vulgaire123 und das français argotique124, die ebenfalls vom Nullregister abweichen bzw. nicht zu diesem zu rechnen sind, hätten in einer linguistischen Beschreibung des Subcodes eigentlich keinen Platz, da sie keine sprachlichen Register darstellen und sich so gut wie ausschließlich auf Vokabular und Idiomatik beziehen. Ihre Erfassung und Beschreibung gehört im Grunde eher als zur eigentlichen Sprachwissenschaft zur Ethnolinguistik, wenn man unter dieser Disziplin die Untersuchung und Darstellung der sprachlichen Varietäten und der Variation der Sprache in bezug auf die Zivilisation und Kultur versteht. Denn die Ethnolinguistik untersucht in ihrer traditionellen Ausrichtung sprachliches Material, das von den Dingen her motiviert bzw. konnotiert ist. Hier werden unter anthropologischsprachwissenschaftlichen Aspekten Vorstellungen wie Vorurteile, Konzeptionen, Tabus, Glauben, Ideologien u. a. m. untersucht; der Faktor Zeit bzw. Epoche spielt dabei eine entscheidende Rolle, wie dies leicht die Kenner mittelalterlicher Fabliaux, Farcen oder Mysterienspiele ermessen können, die in diesen Werken einer anderen Einschätzung etwa der Verwendungsregeln für die Namen der Körperteile begegnen. In diesen Sektor scheinen mir auch mehr oder weniger deutlich die konnotierten Anglizismen zu gehören (nicht jedoch die historische Markierung anglicisme), da, wie z. B. Höfler überzeugend nachgewiesen hat, die Notation angl. (zumindest im Robert) keine objektive, beschreibende Markierung (etwa vergleichbar de Voll, oder de Vesp.lde Vit.) darstellt, sondern als Konnotation auszulegen und damit als puristischer Hinweis aufzufassen ist125. Anglicisme bezeichnet hier in erster Linie nicht die Herkunft aus dem Englischen, sondern betont die Zugehörigkeit des Lexems zum angloamerikanischen Kulturbereich, seine Bedeutung ist grosso modo mit derjenigen von italianisme im 16. Jahrhundert, namentlich bei Estienne, zu vergleichen.
123
124
125
P. Guiraud, Le gros mots, Paris 31983; T. Horde, Les mots exclus, in: Le français aujourd'hui 58 (1982) 5-10. Die von F. Caradec {Dictionnaire du français argotique et populaire, Paris 1977) vorgenommene Vermengung bleibt recht problematisch; überzeugender scheint die Einteilung von J. Cellard und A. Rey {Dictionnaire du français non conventionnel, Paris 1980), die eine von der Akzeptabilität ausgehende Dichotomie vornehmen; vgl. auch: T. Horde, Les mots exclus, in: Le français aujourd'hui 58 (1982) 5-10 und E. Radtke, Die Rolle des Argot in der Diastratik des Französischen, in: Romanische Forschungen 94 (1982) 151 — 166. M. Höfler, Zur Verwendung von 'anglicisme' als Indiz puristischer Haltung im 'Petit Robert', in: Zeitschrift für französische Sprache und Literatur 86 (1976) 334-338.
156
Christian Schmitt
Unter dem Terminus 'Substandard' werden damit heute recht disparate Aspekte der sprachlichen Variation subsumiert. Aus linguistischer Sicht ist es angebracht, dem français commun fünf klar umrissene Register unterzuordnen, wobei, wie Holtus und Radtke betonen, bei dieser Sicht „für die vermeintliche Umgangssprache eine Grauzone bestehen geblieben ist" 126 ; diese Varietäten des Substandards kann man Registern zuordnen, die jeweils von ihren Funktionen und den Textarten her definierbar sind: - dem sozial markierten français populaire; - dem regiolektal markierten français régional (bzw. teilweise noch dem français dialectal) ; - dem situativ markierten français familier; - dem aus dem usage wegen chronologischer Argumente ausgegliederten français vieux oder vieilli; - den in fachlich begrenzten Kommunikationsbereichen 127 verwendeten 126
127
G. Holtus, E. Radtke, Der Begriff 'Umgangssprache' in der Romania und sein Stellenwert für die Iberoromanistik, in: Umgangssprache in der Iberoromania, Festschrift für Heinz Kröll, Tübingen 1984, p. 6. Die Markierung der Fachsprachen in PRob 1 und PRob 2 erfolgt weniger konsequent als die der Gemeinsprache; vor allem die beiden der Norm zuzurechnenden Bereiche bleiben unscharf abgesteckt. Wenn es noch einfach ist, der obersten Ebene die Fachsprachen m i n é r a l o g i e (z. B. lépidolithe "mica blanc ou rose violacé qui constitue le principal minerai de lithium"), c h i r u r g i e (z. B. laparotomie "ouverture chirurgicale de la paroi abdominale"), g é o l o g i e (z. B. lapidifier "entraîner la lapidification de"), l i n g u i s t i q u e (z.B. ladin "l'un des groupes de langues romanes, parlé en Suisse, en Autriche occidentale et en Italie septentrionale"), m é d e c i n e (z. B: lipome "tumeur constituée par une prolifération du tissu adipeux"), etc., oder wohl auch i m p r i m e r i e (z.B. lingot "garniture") zuzurechnen, so wird diese Einteilung bei der Markierung t e c h n i q u e sehr problematisch (z. B. laboratoire "partie d'un fourneau à réverbère où l'on met la matière à fondre", liaison "alliage . . . pour former la soudure", lien "pièce .. . reliant deux parties d'un assemblage"; neben lithopanie "dessin sur une matière rendue translucide par des inégalités d'épaisseurs", lupuline "alcaloïde extrait du lupulin", etc.). Noch schwieriger einzuschätzen ist die Markierung s p o r t ( s ) (z.B. leader "concurrent qui est en tête", léger /poids léger/, licence "autorisation . . . " und licencié, longueur /saut en longueur/, etc.) oder der t e r m e s de b l a s o n , die in Ac 1694 eine zentrale Rolle spielen (z. B. lambel, lambrequin, lampassé, langue, léopard, léopardé, lis/lys, listel, losange, losange). Zum obersten Bereich der Fachsprachen gehören auch die zahlreichen Doppelungen vomTyp lignerolle ( t e c h . /mar.) "petit filin en fil de caret", locuteur ( d i d a c t i q u e / l i n g u i s t i q u e ) "personne qui emploie effectivement le langage, qui parle", laure ( h i s t o i r e / a r t s ) "monastère en Orient", wie auch libérer ( c h i m . / p h y s . ) "dégager; réaction chimique qui libère un gaz", etc.; auch hier ist die Grenze zur Werkstattsprache unklar (vgl. etwa lobe, z o o l . / c h a s s e "chacune des deux parties arrondies de la nageoire caudale d'un poisson" oder Herne, t e c h n i q u e / c h a r p e n t e r i e "pièce de charpente horizontale qui relie des poteaux", u. a. m.). Der oberste Bereich der Fachsprachen kennt prozentual den größten Zuwachs, auch sind die Markierungen (z.B. leucocythe b i o l . -> m é d . ; lymphocyte
Der französische Substandard
157
Berufsjargons 1 2 8 , deren Abgrenzung zu d e r wohl d e m Standard 1 2 9 zugehörigen Werkstatt- und Verkäufersprache 1 3 0 unklar bleibt 131 .
128
129
b i o l . -> med., etc.) und die Präzisierungen (PRob 1 -> PRob 2 lactase c h i m . -> b i o c h i m . ; lipase b i o l . -> b i o c h i m . ) hier am zahlreichsten. Die unterste Stufe der Fachsprachen wird im PRob so gut wie nicht berücksichtigt; hierher gehören wohl die mit fachsprachlicher Markierung und Konnotation versehenen Lexeme bzw. Bedeutungen (bei Teilmarkierung), wie Fachsprache X + a n g l i c i s m e (linkage "liaison existant entre les gènes d'un chromosome", leasing "système de financement du matériel industriel par location, vente à bail"; Unter "duvet de fibres courtes"; loup "malfaçon dans un ouvrage de construction, de couture" und leadership "fonction, position de leader"), die wohl im Vorgriff auf zu erwartende Spracherlasse markiert werden. Sonst werden fachsprachliche Einheiten sehr selten mit Konnotationen ausgezeichnet: - viermal fand sich im Buchstaben L- der Typ Fachsprache X + vieux: lourer ( m u s i q u e / vieux) "marquer nettement (la première note de chaque temps)" logistique ( d i d a c t i q u e / v i e u x ) "partie d'arithmétique, de l'algèbre qui concerne les quatre opérations" lâcher ( m é d e c i n e / v i e u x ) /"de petits pruneaux pour lâcher le ventre"/ lichen ( m é d e c i n e / v i e u x , PRob 2 ) "dermatose . . . " - nur einmal kommt die Verbindung populaire + Fachsprache X vor: lanterne ( p o p u l a i r e / c y c l i s m e ) "le dernier du peloton, du classement" - und ebenfalls nur einmal argot + Fachsprache: lâcher ( a r g o t / s p o r t s ) "distancer dans une course". Die Berufsjargons, die R. Beauvais in seiner bekannten Satire "Le français kiskose" (Paris 1975) auf die Schippe genommen hat, gehören zu den am schlechtesten repräsentierten Bereichen im PRob wie in den übrigen gemeinsprachlichen Wörterbüchern des Neufranzösischen überhaupt, obwohl sie in der Arbeitswelt eine zentrale Stelle einnehmen. Die mittlere Schicht (Standard der Werkstatt- und Verkäufersprache), die der lexikalischen Norm zuzurechnen ist, bietet bei der Beschreibung naturgemäß die größten Schwierigkeiten. Diesem Bereich müssen sicher einige Lexeme oder Bedeutungen zugerechnet werden, die mit Fachsprache X + courant markiert sind, wie z. B.: luminescent ( p h y s i q u e et c o u r a n t ) "où se produit le phénomène de la luminiscence" levier ( t e c h n i q u e et c o u r a n t ) "organe de commande, utilisant le principe du levier" larguer ( m a r . et c o u r a n t ) "lâcher ou détacher (un cordage)" loupe ( m é d e c i n e et c o u r a n t , PRob 2 ) "kyste sébacé . . . " losange ( g é o m é t r i e et c o u r a n t ) "parallélogramme"; oder auch Doppelmarkierungen, wie z. B. liaisonner ( t e c h n i q u e / m a ç o n n e r i e ) "remplir (des joints) avec du mortier" livrée ( z o o l . / c h a s s e ) "pelage ou plumage d'un animal ( . . . ) " limite ( s p o r t / b o x e ) /"gagner avant la limite"/, etc. Besonders schwierig bleibt die Zuordnung heute weitgehend bekannter Fachgebiete. Bei lober ( f o o t b a l l ) "lober le gardien de but", lé ( c o u t u r e ) "largeur d'une étoffe entre ses deux lisières", leurre ( p ê c h e ) "amorce factice munie d'un hameçon", libouret ( p ê c h e ) "ligne à plusieurs hameçons employée pour
158
Christian Schmitt
Dabei gilt für alle Subregister, daß in der Erwartungshaltung der Rezipienten ein engerer Zusammenhang zwischen Skriptualität und Normativität bzw. Akzeptabilität als zwischen Oralität und Normativität besteht; diesem Umstand wird entsprechend bei der Textgestaltung Rechnung getragen132. Wegen der gegebenen Abhängigkeit von sprach- und kulturhistorischen Aspekten lassen sich auch diese in der heutigen französischen Sprache koexistierenden Register am besten in einem dreistufigen, hierarchisch geordneten Schaubild darstellen (s. gegenüberliegende Seite). Dabei bleibt zu betonen, daß es ebenso wenig rein familiäre und rein auf einem populären Register basierende Texte gibt wie etwa vulgärlateinische Texte und daß der Situierungseffekt der Register pragmatisch gesehen symptom- und appellfunktional auch pervertiert werden kann. Die Register genügen sich nicht, stellen also keine vollständigen Kommunikationssysteme dar; sie treten stets in Mischform auf, wobei die dominierende Isotopieebene das Hauptkriterium für die Textklassifikation darstellt. Müller, Guiraud und Désirat/Hordé betonen in diesem Zusammenhang zu Recht die Komplexität der mit den jeweiligen Registern des Substandards verbundenen Phänomene und unterstreichen mit gutem Grund, daß es unmöglich ist, etwa der Nofmsprache vergleichbare homogene Strukturen und Teilsysteme auszuarbeiten 133 ; schließlich reicht heute etwa für das geographische Zentrum der Ile-de-France die Spannbreite für das français populaire von der "langue du peuple de Paris, dans sa vie quotidienne" 134 oder gar der parpêcher", u. a. m., entscheidet sich der PRob zwar für eine fachsprachliche Markierung, doch überzeugt eine einheitliche Markierung so disparater Einzelfälle nicht. 130 H. Ischreyt, Studien zum Verhältnis von Sprache und Technik, Düsseldorf 1965, p.65ff. und 206ff.; ferner H.-R. Fluck, Fachsprachen, München 21980, p. 17ff. und W. v. Hahn, Fachsprachen, in: P. Althaus, H. Henne, E. Wiegand (Hgg.), Lexikon der germanistischen Linguistik, Tübingen 21980, p. 391. 131 H. Ischreyt, Studien zum Verhältnis von Sprache und Technik, Düsseldorf 1965, p. 41, betont zu Recht die Zusammengehörigkeit der verschiedenen, von den Sprachwissenschaftlern oft getrennt betrachteten Stufen: „Ingenieur, Laborant, Facharbeiter, kurz das Arbeitsteam bedient sich eines Ausschnitts aus der Fachsprache je nach besonderen Kenntnissen und den jeweiligen Bedürfnissen". 132 Vgl. auch R. Martin (Hg.), La notion de recevabilité en linguistique, Strasbourg 1978; S. Greenbaum, Acceptability in Language, The Hague 1977; W. Haas, Introduction on the normative character of language, in: Standard languages: spoken and written, ed. W. Haas, Manchester 1982, p. 1—36; L. F. Lara, El concepto de norma en lingüistica, Mexico 1976. 133 B. Müller, Das Französische der Gegenwart, p. 195ff.; C. Désirât, T. Horde, La langue française du 20e siècle, p.41ff.; P. Guiraud, Le français populaire, betont zu Recht: "Evidemment il n'y a pas un français populaire, mais d'infinies nuances" (p. 9). 134 P. Guiraud, Le français populaire, p. 9.
159
Der französische Substandard
^
\
>
o
«
c
=5 vS
c
-Sä
&•-
.2 Ü
c -g
^
G-a
6 2
£P "o
-S td" g 5
^ ^ « •§
§ J3 o y •2 £
c !c « y .2 r&
o '§ 3 "~! pq ^ N 2
français vulgaire français argotique aus
§ 3 ^ 7? S 3
"2 'a 5 £ "§
(kultur)historischen Gründen dem Substandard zugeordnetes Material und Sprachregeln
c
>-
„familiär" -> „gesprochen" wäre also im wesentlichen bereits durchlaufen. Wenn nous neben on im ungezwungenen Sprechen dennoch noch vorkommt, so kann man darin, falls es sich nicht um Einfluß des code écrit handelt, ein im Grunde konservatives Element sehen"142. Wenn Soll hier die grundsätzlich gegebene Schwierigkeit bei der Bewertung von Markierungen betont, so kann man ihm uneingeschränkt beipflichten; eine Kritik scheint aber dennoch angebracht: Soll versucht meistens, Phänomene des heutigen Französisch an der gesprochenen Sprache festzumachen, den code parlé m a t e r i e l l zu definieren, und tut dabei des Guten bisweilen zuviel, denn von der Entwicklungslinie populär -^familiär -> gesprochen kann nur bedingt die Rede sein. Die Regel on "nous" - die hier zur Exemplifizierung herangezogen wird - kann eine Regel der gesprochenen Sprache darstellen, nebenbei aber durchaus noch pragmatisch als Regel des français populaire fortbestehen. In diesem Fall drückt sie, wie François143 richtig gesehen hat, eine Ironie oder Herablassung, aber - je nach Text und Situation - auch eine Zuneigung aus. Es geht nicht an, wegen der Häufigkeit von on "nous" im code oral diese Gebrauchsregeln des français populaire und des français familier zu negieren und nur von der These auszugehen, heute sei „dieses on grammatikalisiert und damit in dem genannten stilistischen Sinn wertfrei"144. 142 143 144
L. Soll, Gesprochenes und geschriebenes Französisch, Berlin 21980, p. 137. D. François, Français parlé. Analyse des unités phoniques et significatives d'un corpus recueilli dans la région parisienne, Paris 1974, p. 399. L. Soll, Gesprochenes und geschriebenes Französisch, Berlin 21980, p. 135.
162
Christian Schmitt
Ein ähnliches Mißverständnis besteht auch in der Grammatik von Haas/ Tanc145, wo die Begriffe 'Alltagssprache', 'Umgangssprache' und 'gehobene Sprache' anhand der nachfolgenden Beispiele expliziert werden sollen: Alltagssprache
Umgangssprache
gehobene Sprache
(Ne) t'en fais pas! Il faut que je me sauve. Il a la cote.
Ne te fais pas de souci. Il faut que je parte. Il est apprécié par ses supérieurs. Je vous remercie infiniment •
Ne vous inquiétez pas. Je vais devoir me retirer. II jouit de l'estime de ses supérieurs. Veuillez croire à l'expression de ma reconnaissance.
Merci beaucoup.
Eine Kommentierung dieser Beispiele erübrigt sich weitgehend 146 . Jeder, der die französische Umgangssprache nur einigermaßen beherrscht, wird sofort erkennen, daß hier zum einen code oral und code écrit vermengt wurden {veuillez croire à l'expression de ma reconnaissance ist schriftsprachlich, merci beaucoup bleibt ohne Konnotation und kann in allen drei Bereichen verwendet werden), daß Expressivität allein in der Alltagssprache akzeptiert und daß die Umgangssprache (z. B. mit voller Negation ne t'en fais pas) über die durchschnittliche Sprechsprache gestellt wird. Ähnliche Probleme hat auch Roland 147 mit der Wiedergabe der conversation quotidienne, die lexikalisch recht gut, morphosyntaktisch und syntaktisch hingegen kaum gelungen ist, oder Hausmann 148 , der dem genre poissard zuzurechnende Bordellgespräche für die Geschichte der gesprochenen Sprache nutzbar machen möchte: Der Text des Caylus vermittelt jede Menge vulgären und obszönen Wortschatzes, doch darf man ausschließen, daß je in einem Etablissement so kommuniziert wurde. Caylus' Texte sind ebenso weit von der Realität der gesprochenen Sprache dieser Sprechergruppe entfernt wie etwa der petit Nicolas149 vom français familier; in diesen fiktiven Texten finden sich primär die disparaten Einheiten der porträtierten Register, aber eine Grammatik auf der Grundlage dieser Texte ließe sich für keinen Bereich des Subkodes schreiben. Alle Texte sind mehr oder weniger durchsetzt von Regeln, die verschiedenen Kommunikationsformen und Registern gleichzeitig angehören; die 145 146 147 148
149
J. Haas, D. Tanc, Französische Grammatik, Frankfurt/Berlin/München 1979, p. 1. Vgl. Vf., Zur Diskussion um die französische Schulgrammatik, in: Feuillets 5 (1983) 38-54. P. Roland, Skidiz, lexique du français familier à l'usage des étrangers qui veulent comprendre "ce qu'ils disent", Paris 1977. F. J. Hausmann, Zur Rekonstruktion des um 1730 gesprochenen Französisch, in: H. Stimm (Hg.), Zur Geschichte des gesprochenen Französisch und zur Sprachlenkung im Gegenwartsfranzösischen, Beiheft 6 der Zeitschrift für französische Sprache und Literatur, Wiesbaden 1980, p. 33-46. Z. B. Sempé, Le petit Nicolas et les copains, Paris 1963, mit vielen Elementen des français familier (wie des français populaire).
Der französische Substandard
163
Festlegung morphosyntaktischer und syntaktischer Formen auf Register ist dabei besonders schwierig, da solche Phänomene — mehr noch als der Wortschatz, dessen grundsätzliche Orientierung fester zu sein scheint - stets als in Abhängigkeit von Situation und Text stehend interpretiert werden müssen. Im Text entscheidet sich, ob eine Form konnotiert wirkt oder nicht; dabei sind gerade im syntaktischen Bereich die Markierungen problematisch, da man heute grundsätzlich von der Annahme ausgehen muß, daß nicht die Kommunikationsform selbst markiert ist, sondern daß sich die Markierung primär aus der Distribution und der Frequenz von Formen herleiten läßt. Es kann nicht Ziel einer Gesamtdarstellung sein, alle Phänomene der dem Substandard zugehörigen Register aufzulisten. Auch wäre es m . E . wenig sinnvoll, hier zusammenzustellen - wie etwa Bauche, Frei, Guiraud u. a. m. — welche syntaktischen Phänomene in welchen dem Substandard zuzurechnenden Texten vorkommen; da die Erstellung der Frequenzliste ohnehin den Einsatz moderner Datenverarbeitung voraussetzen würde, könnte eine solche Arbeit von einer Person schwerlich zum Abschluß gebracht werden. Wir begnügen uns daher, hinsichtlich der Phonetik 150 , der Morphosyntax 151 und der Syntax152 neben den Spezialuntersuchungen auf die Handbücher von Müller und Désirat/Hordé zu verweisen, die umfassend informieren, gleichzeitig aber auch die Schwierigkeit einer Zuordnung dokumentieren, wenn etwa Müller après ça, elle m'a engueulée gleichermaßen dem français populaire, français familier und dem français vulgaire 150
151
152
H. Bäckvall, Deux voyelles nasales face à la norme, in: Moderna Spràk 70 (1976), 227—238; I. Fönagy, Variation et normes prosodiques, in: Folia linguistica 16 (1982) 17-39; D. Hoppe, Aussprache und sozialer Status: eine empirische Untersuchung zur französischen Gegenwartssprache, Kronberg 1976; A . M . Houdebine, Français régional ou français standard? A propos du système des voyelles orales en français contemporain, in: Phonologie et société, éd. H. Walter, Paris 1977, p. 35—63; V. Lucci, Etude phonétique du français contemporain à travers la variation situationnelle, Grenoble 1983; O. Mettas, La prononciation parisienne: aspects phoniques d'un sociolecte parisien, Paris 1979; H. Walter, Systèmes phonologiques et facteurs sociaux, in: Cahiers du Centre interdisciplinaire des Sciences du Langage 3 (1981/2) 51 —59; A. Dauses, Etudes sur l'e instable dans le français familier, Tübingen 1973. Siehe dazu auch G. Holtus, Morphosyntaktische Tendenzen des gesprochenen Französisch der Gegenwart, in: Zielsprache Französisch 13 (1981) 105-113; K. Hunnius, "Mais des idées, ça, on en a, nous, en France": Bilanz und Perspektiven der Diskussion über das Personalpronomen "on" im gesprochenen Französisch, in: Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen 133 (1981) 76—89; M. Léon, Culture, didactique et discours oral, in: Le français dans le monde 45 (1979) 4 6 - 5 3 . Vgl. dazu Etudes de textes de français parlé: syntaxe et variations, éd. par le Groupe Aixois de recherches en syntaxe, in: B. Gardin, J.-B. Marcellesi (Hgg.), Sociolinguistique I, approches, théories, pratiques, Paris 1980, p. 305—314.
164
Christian Schmitt
zuordnet 153 oder zeigt, wie die Grenzen zwischen den qualitativen Registern heute mehr und mehr verwischen und die Wörterbuchautoren ihre liebe Not mit der Zuordnung zu den Subregistern haben 154 . Trotz der Warnung Stefenellis: „Angesichts der fließenden diastratischen Grenzen, die sich gerade aus den Annäherungen und permanenten diachronischen Veränderungen ergeben, stößt die Registerzuweisung auf große Schwierigkeiten und hat bislang noch kaum zu empirisch fundierten Analysen des heutigen Wortschatzes geführt"155, und des Hinweises, daß wegen des Fehlens empirisch fundierter Grundlagen und einheitlich definierter Registertermini die diastratisch-diaphasische Markierung in modernen Lexika einem Lotteriespiel zu gleichen scheint („ein Vergleich von 70 Lexemen in sechs verschiedenen Wörterbüchern ergab lediglich bei 8 Formen eine einheitliche Markierung" 156 ), wollen wir versuchen, die Subregister lexikalisch zu definieren, allerdings nur auf der Basis e i n e s Wörterbuchs, um die Bewertungsgrundlage eines Zentralwerkes zu erarbeiten. Da wir überzeugt sind, daß der Substandard am besten noch - trotz der gemachten Einschränkungen - im Wörterbuch faßbar ist, haben wir das heute generell anerkannte Standardwerk zur französischen Lexikographie, den PRob 157 ausgewertet, um auf deduktivem Wege die markierten Register zu erfassen und zu definieren. Dazu haben wir den Buchstaben L- der ersten und zweiten Auflage systematisch exzerpiert und sowohl alle Notationen wie den Wandel der Notationen umfassend registriert, um auf diese Weise die dem PRob zugrundeliegende Einschätzung zu analysieren und gleichzeitig feststellen zu können, ob sich bei der Einschätzung des Subkodes Veränderungen ergeben haben. 4.1 français régional/dialectal Es fällt auf, daß regionaler Wortschatz im Robert eine untergeordnete Rolle spielt, der Robert damit eine hier bereits beschriebene Tradition fortsetzt, obwohl gerade in den letzten Jahren durch die Erfolge frankokanadischer 158 oder afrofranzösischer159 Literatur der frankophone Leser zunehmend mit Regionalwortschatz konfrontiert wird. 153
B. Müller, Das Französische der Gegenwart, p. 185. Ibid., p. 188f. ; vgl. auch B. Müller, Soziale Varietäten und heutiges Französisch, in: Imago Linguae, Festschrift F. Paepcke, München 1977, p. 411-424. 155 A. Stefenelli, Geschichte des französischen Kernwortschatzes, Berlin 1981, p. 239. 156 A. Stefenelli. ibid.,p.240. 157 PRob2, Ausgabe von 1981. 158 Ygi dazu G. Bouthillier, J. Meynaud, Le choc des langues au Québec (1760-1970), Québec 1972, p. 39ff. 159 Vgl. Vf., Die französische Sprache in Afrika, in: Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen 136 (1984) 80-112. 154
Der französische Substandard
165
Als regional wurden in beiden Auflagen markiert: Hard "variété de peuplier" locher "secouer un arbre pour en faire tomber les fruits" louée "assemblée où se louent les ouvriers agricoles". Daneben gibt es einige Lexeme, bei denen in beiden Auflagen eine zweite Markierung hinzutritt, so etwa laisse "espace que la mer laisse découvert à chaque marée" (Géographie ou régional), Artikel + Personenname (la Jeanne, le Pierre, familier ou régional), lambrusque "vigne sauvage", loque "(Belgique, Nord) morceau d'étoffe usé" (beide vieux ou régional). Der allgemeinen Tendenz der heutigen Wörterbücher entsprechend wird eine bescheidene Anzahl von Belgizismen, wie lancer "(Belgique, Nord) élancer, en parlant de douleur" légumier "(Belgique) marchand de légumes" lichette "(Belgique) attache de ruban" ligne "(Belgique) ligne de cheveux: la raie" loque "(Belgique) peau à la surface du lait bouilli", und Kanadismen, wie ligne "moderne (Canada): mesure de longueur" livre "(au Canada): unité de masse valant 16 onces" lot "(au Canada) histoire: terrain de canton concédé à un particulier pour le défrichement et la culture", neu aufgenommen. Bei diesen Provinzialismen handelt es sich stets um mots régionaux und nicht um mots d'origine régionale160, die in der Regel ortsgebundene Dinge und Sachverhalte bezeichnen. Der geringe Zuwachs von Regionalismen zeigt, daß trotz der besonderen Aktualität der frankophonen Sprachpolitik die "mots employés dans une ou quelques régions" (PRob 2 , s. v. régional) immer noch große Hürden bei der Aufnahme zu überwinden haben. 4.2 français populaire Unter français populaire versteht der PRob 2 "un mot ou un sens courant dans la langue parlée des milieux populaires, qui ne s'emploierait pas dans un milieu social élevé" (p. XXVIII). Der untersuchte Auschnitt bietet 23 mit pop. markierte oder teilmarkierte Lemmata; der Robert nimmt dabei offensichtlich B. Quemadas Warnung ernst, daß "toute enquête sérieuse 160
Zu dieser Unterscheidung vgl. K. Baidinger, Contributions à une histoire des provincialismes dans la langue française, in: Revue de linguistique romane 21 (1957) 62—92; ders., L'importance du vocabulaire dialectal dans un thésaurus de la langue française, in: Lexicologie et lexicographie françaises et romanes, Paris 1961,
p. 149-176.
166
Christian Schmitt
révèle la non-cohérence socio-linguistique actuelle par rapport aux critères habituels allégués. C'est ainsi que les anciennes dénominations de langue bourgeoise ou populaire ont perdu toute signification précise, car elles ne s'appliquent plus à aucune réalité" 161 und die langue populaire nicht auf die "couches sociales, formées en gros par les Français qui n'ont pas fait d'études secondaires" 162 begrenzt werden darf. Aber die mit pop. markierten Lemmata bzw. Bedeutungen bleiben immer noch recht disparat, denn es ist z.B. schwierig, Gemeinsamkeiten in der Auszeichnung von lavette "langue", der Abkürzung loco für locomotive oder légitime "femme légitime" zu erkennen; im einzelnen werden im Buchstaben L- markiert: lâcher "les lâcher: (les sous)"163 lampe (s'en mettre plein la lampe) "manger et boire abondamment" lardon "petit enfant" lavette "langue" lèche {faire la) "action de flatter servilement" lèche-vitrines "faire du lèche-carreaux" légitime "femme légitime" lessiver "éliminer d'une compétition" lever "entraîner (qn.) avec soi" licher "boire" limace "chemise" linge (il y a du beau linge) "(...) des femmes bien habillées" lion, lionne (il a bouffé du lion) "fait preuve d'une énergie inhabituelle" liquette "chemise" liquide "du vin" litron "litre de vin" loco "locomotive" long (avoir les côtes en long) "être très paresseux ou très fatigué" loufiat "garçon de café" loufoque "fou" (suffigierte Verlanbildung) lourde "porte" lune "gros visage joufflu". Es läßt sich anhand dieser Liste leicht nachweisen, daß eine soziologische Konzeption fehlt und die Autoren sich grosso modo auf ihr Sprachgefühl verlassen; so darf etwa das auch bei Caradec (neben louf "fou") aufgeführte 164 , mit Hilfe des Verlan (/fu/ -> /uf/ -> /7uf/) und der parasitären Suffigierung (-oque ist gemeinsprachlich nicht produktiv 165 ) gebildete loufoque 161
B. Quemada, L'évolution du français, in: M. Blancpain, A. Reboullet (edd.), Une langue: le français aujourd'hui dans le monde, Paris 1976, p. 40. 162 C. Stourdzé, Les niveaux de langue, in: Guide pédagogique pour le professeur de français langue étrangère, sous la direction d'A. Reboullet, Paris 1971, p. 39. 163 wj r übernehmen nicht die volle Definition des PRob2, sondern reduzieren jeweils den Text auf das Wesentliche. 164 F. Caradec, Dictionnaire du français argotique et populaire, Paris 1977, p. 148. 165 Daher nicht aufgenommen bei J. Thiele, Wortbildung der französischen Gegenwartssprache, Leipzig 1981, p. 168ff.
Der französische Substandard
167
sicher nicht als populär beschrieben werden, da seiner Bildung Wortbildungsregeln des Argot zugrundeliegen und von einem allgemeinen Gebrauch dieses Adjektivs nicht die Rede sein kann; auch bei loufiat oder lardon fehlt der Gebrauch in breiten Schichten des Volkes, beide erfüllen damit nicht die erste Definitionskomponente des Robert ("courant dans la langue parlée des milieux populaires"). Die Problematik der Bewertung wird besonders im Zusammenhang mit dem Kompositionstyp pop. + X deutlich: Wie kann z. B. ein Lexem pop. et vieilli sein {lavement: personne importune "en voilà un vieux lavement")? Oder wie rechtfertigt sich bei lanterne: la lanterne rouge "le dernier du classement" die Einschränkung auf den Radsport (pop.: cyclisme)? Auch die Kombination pop. ou plaisanterie (loyal: à la loyale) ist schwer einzuschätzen. Die mangelnde soziologische Einbettung dieses Terminus darf sicher auch mit der erstaunlich geringen Anzahl von Neuaufnahmen (im Buchstaben L nur lolo "sein" und lourder "mettre à la porte") und dem Umstand in Verbindung gebracht werden, daß im untersuchten Korpus eine Veränderung bei den im PRob 1 mit pop. markierten Lexemen nicht festzustellen war. 4.3 français familier Numerisch gesehen bildet die Gruppe der mit jam. markierten Einheiten das umfangreichste Korpus; nach Auffassung des Robert handelt es sich dabei um Wortschatz des "usage parlé et même écrit de la langue quotidienne: conversation, etc.; mais ne s'emploierait pas dans les circonstances solennelles" (PRob 1 XXVI), also diasituativ markierte Lexeme, bei denen die Markiertheit in der Regel vom Kontext abhängt. Die Markierung fam. ist damit keine mit dem jeweiligen Lexem grundsätzlich verbundene Bewertung, sondern ein Phänomen des Textes, wobei sich die Textgebundenheit der Notation im recht umfangreichen Kontext des Wörterbuchs widerspiegelt, wie dies anhand des Beispiels frz. là verdeutlicht werden soll: Natürlich ist là unmarkiert und kann auf jeder Ebene der Sprache gebraucht werden; markiert werden hingegen die feste Fügung être un peu là "tenir beaucoup de place, être important" ("Mais je j'suis là . . . J'suis même un peu là, comme on dit", Barbusse) und die Verwendung von là in der Bedeutung von "à l'intérieur de ce lieu" (Beispiel: "Debout là-dedans"), während die Verwendung als Proform ("pour reprendre un terme que l'on vient d'exprimer") generell als fam. markiert wird: "Avez-vous de l'amour pour elle, là, ce qu'on appelle de l'amour?" (Marivaux). Die Markierung bezieht sich damit grundsätzlich auf Verwendungsweisen von Lexemen, auf das Auftreten von lexikalischen Solidaritäten; grundsätzlich mit fam. markierte Lexeme wie lâchage "action de quitter brusquement", lâcheur "personne
168
Christian Schmitt
qui abandonne facilement", limoger "relever de son commandement, frapper d'une mesure de disgrâce" oder louchon "personne qui louche" bleiben insgesamt selten. Wie unter der Notation pop. werden auch unter der Notation fam. recht heterogene Fälle subsumiert wie Abkürzungen, expressive Wortbildungen, hypochoristischer Wortschatz, Redewendungen, übertragener und uneigentlicher Gebrauch, ja sogar Fremdwörter: labo "laboratoire" laborieux (c'est laborieux) "c'est long" lac (tomber dans le lac) "échouer" lâcher "donner; quitter brusquement" laid(e) (Hou qu'il est laid! Hou le laid!) laisser "accepter qqch. d'agréable" + (y laisser sa peau) lait (si on lui pressait le nez il en sortirait du lait) laïus "discours" laïusser "faire des laïus" laïusseur, -euse "bavard(e) intarissable" lambin "personne qui agit habituellement avec lenteur et mollesse" lambiner "agir avec lenteur" lampée "grande gorgée de liquide avalée d'un trait" lancer "engager dans un sujet de conversation" lanternier "patron de maison close" lapin, -ine "homme qui a beaucoup de tempérament; femme très féconde" lapinisme "fécondité excessive" larbin "domestique" lard "graisse de l'homme" lardoire "arme pointue" large (en long et en large; prendre le large) largeur (dans les grandes largeurs) larme (larmes du crocodile) lascar "homme brave" lassitude (J'ai des lassitudes dans les jambes) lavage (lavage de tête) lavette "homme mou" le, la , les (préférez-vous-les [les cartes postales] en noir ou en couleur?) lécher (s'en lécher les babines, etc.) lester "charger, munir" lettre (passe comme une lettre à la porte) "être facilement admis" lézard (faire le lézard) "se chauffer paresseusement au soleil" lézarder "paresser au soleil" libre (être libre comme l'air; — Taxi! vous êtes libre?) lichette "petite tranche" limité "avoir des moyens limités" limiter (limiter les dégâts) "les restreindre" limogeage "action le limoger, son résultat" limoger "relever de son commandement, frapper d'une mesure de disgrâce" liquider "en finir avec" lire (lire en diagonale) locomotive (c'est une vraie locomotive) "puissant, infatigable" log. "logarithme"
Der französische Substandard
169
logique "normal, explicable" loin (ne pas voir plus loin que son nez / le bout de son nez, etc.) loir (être paresseux comme un loir; dormir comme un loir) long, -ue (c'est long à venir; être long à s'habiller) longtemps (est-ce qu'il partira dans longtemps) longuet, -ette "qui est peu long" louchon "personne qui louche" loulou, -outte "terme d'affection" loup "terme d'affection" loupé "manqué, raté" louper "ne pas réussir; laisser échapper" loupiot, -otte "enfant" loupiote "petite lampe" lourd (il fait lourd, silence lourd, etc.) lumière (ce n'est pas une lumière) "il n'est pas très intelligent" luminaire "cour, appareil d'éclairage" lunette (mettez vos lunettes) "regardez mieux" lunetté(e) "porteur de lunettes" lurette (il y a belle lurette) "il y a bien longtemps" luxe (c'est du luxe) "cela entraîne une dépense déraisonnable" lyre (toute la lyre) "toutes choses ou personnes du même genre".
Angesichts dieser Beispiele dürfte es sich als müßig erweisen, darüber zu streiten, ob das français familier der Norm nähersteht als das français populaire; die Beispiele zeigen deutlich, daß es sich hier um ein Register mit anderer Funktion handelt: das Register der nicht von Konventionen bestimmten Unterhaltung, des zwanglosen Gesprächs in zahlreichen Situationen, ein Register, das nur dann eingesetzt werden kann, wenn sich die Gesprächspartner nahestehen oder seit längerem kennen. DELS français familier steht also nicht über, sondern neben dem français populaire, es wird nicht als Signum sociale, sondern spontan gleichsam als Register gebraucht, das die Qualität der Beziehung von Sender und Empfänger ausdrückt bzw. kommentiert, und es läßt sich durch eine gewisse Permissivität z. B. in der aktualisierten Bedeutung der Lexeme, durch einen Grad der Affektivität und eine besondere Bildhaftigkeit charakterisieren. Seine Vernetzung mit anderen Registern zeigt sich an den zahlreichen Doppelungen wie z. B. 'moderne et familier' (lavasse "boisson, sauce, soupe trop étendue d'eau"), 'familier (régional) '(le, la, /es: la Jeanne, le Pierre), 'familier par euphémisme' (lettre: les cinq lettres, v. merde) oder 'familier et péjoratif (loustic "homme, type"). Auffallend bleibt, daß die Verbindung 'familier et populaire' oder 'populaire et familier', die im Akademiewörterbuch von 1694 besonders häufig ist, im untersuchten Korpus nicht nachgewiesen werden kann. Der Zuwachs bei diesem Register ist recht bedeutend: Die zweite Auflage des PRob unterscheidet sich von der ersten durch die Neuaufnahme von drei mit fam. markierten Lemmata, hinzu kommen noch zwei mit fam. markierte Redewendungen:
170
Christian Schmitt I PRob1
I PRob2
lard
0 Bed.
largeur lopette loubar(d)
0Bed. 0 0
loupage
0
(se demander si c'est du lard ou du cochon) "quelle est la nature du problème" "se débarrasser de qc. ou de qn." "petite lope" (terme d'injure)166 "jeune homme vivant dans la banlieue affectant un comportement asocial" "le fait de louper"
I Lexem
Insgesamt läßt sich damit feststellen, daß dieses recht produktive Register sowohl neuen Wortschatz wie spezifische, aus der situationsgebundenen Verwendung leicht erklärbare Bedeutungen im Wörterbuch kennt, daß aber die spezifischen Bedeutungen bei weitem überwiegen. 4.4 Chronologische Bestimmung des Substandards Evolution kennzeichnet alle lebenden Sprachen; dabei kann man unter diesem Begriff die verschiedensten diachronischen Prozesse subsumieren, wie z. B. - die Bildung von Neugut (Neologismen); - die Entstehung von veraltetem / veraltendem Material (Archaismen; daneben Historismen); - die qualitative Veränderung des Gebrauchs (Registertransposition, semantischer Wandel); - die quantitative Veränderung des Gebrauchs (Frequenz- und Disponibilitätswandel). Da sich die dictionnaires de langue die Beschreibung des usage zur besonderen Aufgabe gemacht haben, muß ein Wörterbuch wie der PRob sein besonderes Augenmerk auf die diachronische Markierung der Wörter 167 legen168. Dem Zeitablauf entsprechend unterscheidet Robert dabei (a) nach rückwärts gerichtete, (b) auf die Gegenwart bezogene und (c) nach vorwärts orientierte zeitliche Markierungen, wobei vor allem die Markierung cour(ant) "insister sur le fait qu'un sens, un emploi est connu et employé de tous, quand le mot est d'apparence savante ou quand les autres sens sont techniques, savants, etc." ebenso problematisch bleibt wie seine Steigerung (plus courant "plus courant que d'autres sens eux-mêmes cou166
Dabei wird merkwürdigerweise dem in der Definition auftretenden lope kein Lemma reserviert. 167 Vgl. dazu U. Ricken (e. a.), Französische Lexikologie. Eine Einführung, Leipzig 1983, p. 77ff. ; F. J. Hausmann, Einführung in die Benutzung der neufranzösischen Wörterbücher, Tübingen 1977, p. 112ff. 168 Ygi auch P Gilbert, Différenciations lexicales, in: Le français dans le monde 69 (1969)41-47.
Der französische Substandard
171
rants; ou relativement plus courant que les autres sens, sans être très courant dans l'absolu") 169 . Diese Kategorie bleibt im Gegensatz zu den néologismes und den archaïsmes recht unscharf umrissen, die Kriterien sind nicht oder nur teilweise auszumachen. a) alterndes und veraltetes Material In der nach rückwärts orientierten Sicht des Wortschatzes unterscheidet der Robert zwischen vieux, vieilli und ancien, anciennement; dabei definiert er wie folgt: vieilli: "mot, sens ou expression encore compréhensible de nos jours, mais qui ne s'emploie plus naturellement dans la langue parlée courante"; vieux: "mot, sens ou emploi de l'ancienne langue, incompréhensible ou peu compréhensible de nos jours et jamais employé, sauf par effet de style: archaïsme" 170 ; vieux und vieilli unterscheiden sich damit hinsichtlich der Verständlichkeit und des Gebrauchs, während die Qualifikation ancien(nement): "présente un mot ou un sens courant qui désigne une chose du passé disparue" 171 eindeutig chronologisch fixiert bleibt, ähnlich wie die Notation hist. ant. ("terme didactique d'histoire antique") 172 , die den lexikalischen Historismus markiert "als Bezeichnung für Denotate, die der Geschichte angehören und auf die auch heute ihre damaligen Benennungen angewandt werden" 173 . Die Zahl der im Korpus mit vieilli und vieux markierten oder teilmarkierten Lexeme erweist sich als ausgesprochen hoch; in beiden untersuchten Auflagen werden je 31 Lexeme mit vieilli und 113 mit vieux ausgezeichnet. Dieser Umstand erklärt sich zweifellos aus der Zielsetzung des Robert, der primär kulturellen Ansprüchen gerecht werden soll. Mit vieilli werden die nachfolgenden Lemmata markiert oder teilmarkiert: lampion "godet contenant une matière combustible et une mèche" langueur "état d'un malade dont les forces diminuent lentement" languir "perdre lentement ses forces" languissant "qui languit" larcin "objet volé" larron "voleur" lave-mains "petit bassin où l'on lave les mains" lésineur "avare" 169 170 171 172 173
PRob 2 , p. XXV. PRob 2 , p. XXIX. PRob 2 , p. XXIV PRob 2 , p. XXVI. G. Haßler, Ungebräuchlichwerden von Wörtern, in: U. Ricken (e.a.), Französische Lexikologie. Eine Einführung, Leipzig 1983, p. 78.
172
Christian Schmitt
lessiver "nettoyer du linge à l'aide de lessive" lettre (au pluriel) "la culture littéraire" levant "les régions qui sont au levant" lever "prendre (une partie) sur un tout" liaison "action de se lier; fait d'être lié avec qn." Hard "très petite somme d'argent" Harder "lésiner" libéral "qui donne facilement, largement" libéralisme "attitude, doctrine de libéraux" libertinage "licence de l'esprit en matière de foi, de discipline, de morale religieuse" libretto "libretto d'un opéra" licence "liberté excessive" lieu (plur. à valeur de singulier) "endroit unique considéré ou non dans ses parties") limer "parfaire par un travail méticuleux" limousine "type d'automobile" lisière "bandes ou cordons attachés au vêtement d'un enfant pour le soutenir quand il commence à marcher" louangeur, -euse "personne qui a l'habitude, la manie de louanges" louer "engager à son service pour un temps déterminé" loup-garou "personne d'humeur insociable" lumière "connaissance" lumignon "bout de la mèche" lune "satellite d'une planète" luron "gaillard décidé et énergique". Was hier mit dem Epitheton vieilli markiert wurde, erweist sich als heterogenes, inkonsequent und uneinheitlich analysiertes lexikalisches Material; da dient z.B. das angeblich veraltete licence zur Definition von libertinage, wird ein Verb, das einen heute kaum noch praktizierten Waschvorgang bezeichnet (lessiver), oder ein Substantiv, das als Denotat für eine heute weitgehend unbekannte Sache verwendet wird (lisière), neben ein v. a. im code écrit noch recht häufig belegbares, eher literarisches Lexem (lettres)™ gestellt, angeblich veraltetes libretto findet sich gar in der tautologischen Definition, etc.; es wäre leicht, weitere Inkonsequenzen bei der Verwendung von vieilli nachzuweisen, das auch in den Doppelungen populaire et vieilli (lavement "personne importune"), vieilli ou littéraire (lésine "épargne 174
Der Trésor de la langue française, dictionnaire de la langue du XIXe et du XXe siècle, Bd. 10, 1118f., markiert lettres "ensemble de connaissances" mit vieux. Die Bedeutung "connaissances, études littéraires" bleibt ohne Konnotation. Im Frequenzwörterbuch zum TLF (CNRS, Dictionnaire des fréquences. Vocabulaire littéraire des XIX et XXe siècles, Bd. I, table alphabétique, Paris 1971, p. 1219), das auf grammatische und semantische Aspekte keine Rücksicht nimmt, findet sich kein Hinweis, der eine solche Annahme stützen würde; es bleibt auch zu bedenken, daß gemäß Bd. III dieses Wörterbuchs (table des variations de fréquence, p. 230f.) von einer generellen Abnahme der Frequenz nicht die Rede sein kann.
Der französische Substandard
173
sordide"; licencieux, -ieuse "qui m a n q u e de p u d e u r " ; logis "endroit où on loge") und vieilli ou droit (livrer " m e t t r e qch. en la possession") auftritt und in der zweiten Auflage nur eine einzige Z u n a h m e (lésinerie "acte de lésine") kennt. Auch der G e b r a u c h von vieux bleibt in vielen Einzelfällen diskutabel, da nicht klar wird, für wen bzw. welche Sprecherguppe das jeweilige L e m m a (bzw. die teilmarkierten Eintragungen, die jeweilige B e d e u t u n g ) unverständlich sein soll; wir zitieren die unter d e m Buchstaben L- aufgeführten mots vieux: là "là-bas: au-dessous" labadens "camarade de collège" labourage "le travail de la terre" laboureur "cultivateur" lâcher "décocher, lancer par une brusque détente" lacs (Là les vierges folles "Le prendront dans leurs lacs aux premières paroles") ladre "lépreux" ladrerie "lèpre" lai(e) "laïque" laideron (pour danser avec un laideron comme moi) laisser (faites votre devoir, et laissez faire aux dieux) laiteux "qui a rapport au lait" lanice "qui provient de la laine" lamenter "pousser son cri" lampas (humecter le lampas) "boire" lampiste "fabriquant de lampes" lampisterie "commerce de lampes à réservoir" lance-bombes "mortier" langoureux "affaibli par maladie" lanterne (conter des lanternes: des balivernes) lanterner "faire attendre qn." lapider "maltraiter, critiquer durement" lapin, lapine (monter, voyager en lapin) laptot "piroguier, matelot" (Senegal, Afrika) larcin "plagiat" lardon "trait piquant, raillerie" largesse "action de donner largement" larigot "sorte de flûte rustique" larron "brigand" (le bon, le mauvais larron)
las! "hélas!" lassant "fatigant" lasser "fatiguer" latiniser "affecter de parler latin" latitude "largeur" latte "ancien sabre de cavalerie" lavasse "pluie subite" lavement "action de laver" layette "tiroir où l'on rangeait des papiers" le, la, les ("pour les plus importants et plus nobles emplois!") lécheur "personne qui aime beaucoup la bonne chère" léger "qui change trop aisément de sentiments" légèreté "faute commise par étourderie" légion "régiment ( . . . ) " législation "droit de faire les lois" légitimer "reconnaître pour légitime" légume "graines qui se forment dans des gousses" légumier "jardin, potager" lequel, laquelle, lesquels, lesquelles (v. qui; "Ne vois-tu pas le sang, lequel dégoutte à force") lestement "d'une manière élégante" leurre "artifice (.. .)" levée "action de lever" lévite "longue redingote" lexique "dictionnaire" lez, les "à côté de" liaison "assemblage" liant "souple, flexible" libéral (Arts libéraux: peinture, sculpture) libraire "artisan et marchand qui imprimait, vendait des livres" licence "droit, liberté; autorisation d'enseigner"
174
Christian Schmitt licencier "faire quitter un lieu à qn." licencieux "qui abuse de la liberté" licol ou licou "licol" lien "corde, chaîne qui enserre un captif lier (lier partie) fesse "joie" lieu "place dans une hiérarchie sociale" lieutenance "charge, office de Heutenant" lignage "ensemble de parents issus d'une couche commune" lignard "soldat de l'infanterie de ligne" ligne "ligne de compte: article d'un compte" limon "citron" limonade "boisson rafraîchissante" limousin "maçon" linguistique "étude comparative et historique des langues" lion, lionne "homme en vue, célèbre" lippée "bouchée; bon repas" liquéfaction "fusion" lisière "étoffe utilisée pour tresser des chaussons" litigieux "qui aime les litiges" littérateur "humaniste" littérature "ensemble des connaissances; culture générale" livrée "la domesticité" livret "petit livre" local "lieu considéré dans ses caractères particuliers (.. .)" localité "particularité ou circonstance locale (. . .)" locomobile "qui peut se mouvoir pour changer de place"
locuste "sauterelle verte" locution "manière de s'exprimer, de parler" loge "abri de branchage; gîte d'un animal" loi "domination imposée par la conquête, la victoire" loisible "qui est permis" loisir "état dans lequel il est permis à qn. de faire qc." lopin "petit morceau" lorette "jeune femme élégante et facile" lorgner "loucher" lors (seul: v. alors) lotion "action de se faire couler un liquide sur le corps pour le laver" louage "action de donner ou de prendre en location; loyer" louche "qui est atteint de strabisme" loup "lésion (rappelant la morsure d'un loup)" louveterie "chasse aux loups" louvetier "officier de la maison du roi" loyer "prix du louage de services (...)" lucide "clair, lumineux" lucre "gain, profit" luisant "qui luit, émet de la lumière" lunatique "soumis aux influences de la lune et, de ce fait, atteint de folie périodique" lune "mois lunaire" lustrine "sorte de droguet de soie" lutiner "taquiner de façon espiègle" lyrisme "style élevé et hardi de l'auteur inspiré".
Eine solche Klassifizierung setzt einen Sprachbenutzer voraus, der wenig Kultur besitzt, denn er hat z . B . von Labiche (labadens) und La Fontaine {laboureur) nichts gehört, kennt die französische Sozialgeschichte nicht (z.B. législation "droit de faire les lois" oder levée "action de lever") und besitzt nicht einmal die natürliche Fähigkeit, durchsichtige Wortbildungen175 korrekt zu beurteilen (z. B. labourage — labourer, laiteux — lait, légumier — légume, lampiste — lampe, etc.). Das Epitheton vieux wird im PRob 175
H.-M. Gauger, Durchsichtige Wörter. Zur Theorie der Wortbildung, Heidelberg 1971.
Der französische Substandard
175
viel zu rigoristisch angewandt; Rey und Robert sind hier zweifellos Opfer der frz. Tradition, doch kommen m. E. noch andere Aspekte hinzu, die sich in den zahlreichen Doppelungen widerspiegeln: - die Verbindung vieux ou littéraire zeigt deutlich, daß die Autoren sich verpflichtet sehen, den Kanon der 'guten' Literatur zu beachten und Lexeme oder Bedeutungen wie ladre "avare (l'argent fait . . . du plus généreux, un ladre)" ladrerie "avarice sordide" lamentable "qui inspire la pitié" languir "souffrir (...)" libertin(e) "qui ne suit pas les lois de la religion" livrer (livrer des assauts, des combats) longer "prendre, suivre" aufzunehmen; - die Notation vieux ou régional weist auf das Dilemma hin, daß zahlreiche Wörter in der Frankophonie oder einem weiten Teil derselben gebraucht werden, in Paris aber ersetzt sind bzw. wegen der hier ausschließlich vorherrschenden Industriegesellschaft sachlich nicht bekannt sein können, wie lambrusque "vigne sauvage" loque "reste d'étoffe"; - ähnliches gilt auch für die Kombination vieux + Sach- oder Fachbereich: médecine/vieux: lâcher (de petits pruneaux pour lâcher le ventre) automobile/vieux: landaulet "petit coupé semi-décapotable" imprimerie/vieux: lettrine "petite lettre entre parenthèses" droit/vieux: libelle "notification" litispendance "état d'un procès en instance" vieux/science: lithologie "pétrographie" vieux ou droit: loyal(e) "conforme à la loi" architecture/vieux: loge "galerie, tribune" didactique/vieux: logistique "partie de l'arithmétique" musique/vieux: lourer "marquer nettement", - und auf die pragmatische Komponente des Epithetons vieux weisen vieux ou ironie: langoureux, -euse "qui manifeste une langueur réelle ou feinte, particulièrement en amour" vieux ou plaisanterie: larcin (doux larcin) "faveur, baiser dérobé à une femme", während die Kombination courant vieux: lavabo "table de toilette" widersprüchlich scheint. Die Unterschiede zwischen beiden Auflagen erweisen sich bei vieux als wenig ergiebig: Bei den teilmarkierten langage "discours", lecture "instruc-
176
Christian Schmitt
tion qui résulte de la lecture" sind die markierten Bedeutungen nicht mehr eingetragen, bei liqueur "plasma" erfolgte lediglich eine wissenschaftliche Präzisierung, bei lithique "acide urique" und longimétrie erscheinen neu die Eintragungen vieux chim. bzw. vieux; alle übrigen Markierungen betreffen ausschließlich die medizinische Fachsprache (PRob 2 médecine vieux): larvé(e) "forme du paludisme" liehen "nom générique de dermatoses" lupus "maladie cutanée" lymphatisme "augmentation de volume des tissus lymphoïdes". Auch die Markierung ancien!anciennement erweist sich als sprachwissenschaftlich kaum legitimiert, schwierig und sachlich oft unhaltbar, wie dies die 19 Beispiele unseres Korpus dokumentieren: laïcisme "doctrine tendant à réserver aux laïques une certaine part dans le gouvernement de l'Eglise" lambrequin "bande d'étoffe autour d'un cimier, au bas d'une cuirasse" lampadaire "support notical pour une ou plusieurs lampes" lancier "cavalier armé de la lance" landau "voiture à quatre roues (...)" landaulet "petit landau" lansquenet "jeu de cartes" lanterne "fanal spécialement destiné à l'éclairage de la voie publique" lanternier "allumeur des lanternes publiques" laquais "valet portant la livrée" lice "palissade" lieu (lieux communs) lieue "mesure de distance" litière "sorte de lit ambulant" livre (livre d'or) "registre des noms de familles nobles" livre "unité de poids" livrée (la livrée d'une dame) "rubans, pièces d'étoffe à ses couleurs"; "vêtements aux couleurs des armes d'un roi" loch "planche immergée (...)" loustic "amuseur attitré d'une compagnie", zu denen noch a n c i e n n e m e n t / m u s i q u e : loure "musette de grande taille" und eine recht beachtliche Anzahl von historischen Rechtstermini ( d r o i t a n c i e n bzw. a n c i e n d r o i t ) kommen: lacération "action de lacérer un écrit" lacérer "déchirer un écrit" lais (= forme ancienne de legs) légitime (la légitime) "institution à protéger les héritiers (...)" lieutenant (lieutenant général du royaume) Wf (lit de justice). b) Markierungen, die sich auf den gegenwärtigen Zeitpunkt beziehen Es ist erstaunlich, daß der Robert — im Gegensatz etwa zum Akademie Wörterbuch — auch Angaben zur Gegenwart in der Diachronie macht. Eine Reihe von Eintragungen oder Bedeutungen ist mit moderne, courant oder
Der französische Substandard
177
rare markiert; dabei gehört moderne "insister sur le fait qu'un sens, un emploi est d'usage actuel" (p. XXVII) - im Gegensatz zu zusätzlich markierten Verwendungen des Epithetons - ebensowenig zum Substandard wie courant, dessen Abgrenzung zu moderne recht vage bleibt, während bei rare ("mot qui, dans son usage particulier (il peut être didactique, technique, etc.), n'est employé qu'exceptionnellement") das Verhältnis zur Norm und damit auch zum Substandard wenig explizit und damit unklar bleibt. In dem analysierten Korpus taucht 23mal die Markierung rare (dazu einmal r a r e et l i t t é r a i r e : luisance "caractère de ce qui luit", und r a r e et vieux: lez, les ou lès "lès") auf: labile "qui est sujet à faillir, à changer" laidement "avec bassesse, malhonnêteté" lainage "toison des moutons" lampant "propre à alimenter une lampe à flamme" laqueux "qui a l'aspect de la laque" lèchement "action de lécher" législature "le corps législatif d'un pays" lénifier "calmer, apaiser" levrette "qui a la taille svelte du lévrier" levretter "mettre bas (du lièvre)" liage "action de lier, son résultat"
libéralité "libéralisme, tolérance" licencieux (licencieusement) licitement "d'une manière licite" limitable "susceptible d'être limité" lingerie "fabrication ou commerce du linge" liquidable "qui peut ou doit être liquidé" longotte "tissu de coton épais" lophophore "les plumes de cet oiseau" louer "se vanter" lourdeur "caractère de ce qui pèse lourd" luncher "faire un lunch" luxure "action luxurieuse".
Es scheint schwierig, eine allgemeine Grundstruktur hinter dieser Notation zu entdecken, die sich unterschiedslos auf die Frequenz, grammatische Regeln und die subjektive Einschätzung stilistischer Probleme zu beziehen scheint und eine gewisse Konzeptionslosigkeit verrät, die sich auch in der Bewertung der Personalpronomina le} la, les in Verbindung mit gewissen Verben als g a 11 i c i s m e s (z. B. je ne Ventends pas de cette oreille. Le disputer à qn. Je vous le donne en mille. L'emporter sur qn. Se le tenir pour dit. L'échapper belle. Il la trouva mauvaise) widerspiegelt176. Klare Vorstellungen hingegen über das Verhältnis zum Standard verbindet der PRob mit den recht seltenen Markierungen abusivement, improprement) und langage enfantin (dazu nur loh und laid in der stehenden Redewendungen c'est laid de + Verb): abusivement bezieht sich auf einen "emploi criticable, parfois faux sens ou solécisme" (PRob 2 , XXIV), wie 176
Gallicisme definiert der PRob2, p. 845b, als "construction ou emploi propre à la langue française" bzw. "construction française introduite abusivement dans une autre langue"; über das Verhältnis zur Norm wird im ersten Teil der Definition nichts gesagt.
178
Christian Schmitt
z.B. bei lagon "lagune centrale d'un atoll" oder lot "lopin de terre" (nur PRob 2 ), während impropre{ment) schlichtweg einen "emploi criticable" (PRob 2 , XXVI) markiert, wie er bei lettre "le phonème représenté par le caractère alphabétique" vorliege. c) nach vorwärts orientierte chronologische Markierung Weitgehend der Tradition der französischen Lexikographie verpflichtet bleibt der Robert bei der Definition neuer und neuester Signifikanten und Signifikate, obwohl er die weit verbreitete Unterscheidung von néologie als akzeptablem und néologisme als weniger empfehlenswertem Neuwort zu Recht aufgegeben hat177; im tableau des signes conventionnels et abréviations definiert Robert den Terminus néol. als "mot nouveau, relevé ou entendu peu de temps avant la parution du dictionnaire: entre 1950 et 1965", nennt also nur das chronologische Argument, ohne überhaupt das Kriterium der Akzeptabilität anzusprechen, dem z.B. Guilbert einen hohen Stellenwert einräumt, wenn er betont, diese "se définit par la combinaison d'un certain nombre de variables qui tiennent à la fois aux règles morphosyntaxiques de production du terme construit, à la structure sémantique générale sousjacente à la langue et à une certaine norme sociale qui régit le lexique de la langue" 178 . Die Grenzen zwischen moderne und néologisme bleiben dabei recht unscharf, wie dies ein Beispiel verdeutlichen soll: littérature "tout usage esthétique du langage, même non écrit; littérature orale" gilt in dieser Bedeutung als néologisme, verdeutlicht wird der Gebrauch am nicht datierten Beispiel von littérature orale; lecteur, lectrice "assistant étranger adjoint à un professeur de langues vivantes dans un établissement d'enseignement", das seit 1836 belegt ist und wohl auf dt. Lektor zurückgeht, gilt hingegen als mod. Die Bewertungsmaßstäbe sind dabei ebensowenig erkennbar wie das Verhältnis von mod. und néol. zum Standard, doch scheint das recht sparsam verwendete néol., das sich auch bei laverie automatique "blanchisserie moderne, équipée de machines à laver" und lignage "nombre de lignes imprimées qui entrent dans la composition d'un texte" findet, hierarchisch dem recht häufig auftretenden mod. nachgeordnet 179 ; unter mod. finden sich generell akzeptierte Lexeme und Bedeutungen wie landau "voiture d'enfants à caisse suspendue", légion "corps de gendarmerie", licence "grade de l'enseignement supérieur", linguistique "science qui a pour objet 'la langue envisagée en elle-même et pour elle-même' (Saussure)", u. a. m. Insgesamt gilt damit, daß im Robert bei der diachronischen Markierung des Wortschatzes eine erstaunliche Unsicherheit herrscht und eine wenig 177 178 179
Vgl. dazu L. Guilbert, La créativité lexicale, Paris 1975, p. 44ff. L. Guilbert, ibid.,p.45. Das numerische Verhältnis beträgt 3 néol. zu 80 mod. für den Buchstaben L-.
Der französische Substandard
179
konsequente Auszeichnung nachgewiesen werden kann. Die für das Französische weit vorangetriebene Datenforschung wurde nicht gewinnbringend in die Diskussion eingebracht, ein Gleichgewicht in der Beurteilung des alten und des neueren Vokabulars gibt es nicht, das persönliche Urteil der primär im Bereich des Neuwortschatzes unsicheren Autoren bleibt letztlich für die Beurteilung der Lexeme das entscheidende Kriterium. 4.5 Substandard in bezug auf Kultur und Zivilisation Vor etwa hundert Jahren noch konnte Littré den Argotwortschatz als "langage particulier aux vagabonds, aux mendiants, aux voleurs, et intelligible pour eux seuls" und "phraséologie particulière, plus ou moins technique, plus ou moins riche, plus ou moins pittoresque, dont se servent entre eux les gens exerçant le même art et la même profession"180 wegen der fehlenden generellen Verständlichkeit und der beruflichen Bindung ebenso wie die sogenannten patois ausschließen; diese Kriterien gelten heute nicht mehr, da inzwischen der Argot längst sich von der Sondersprache derer, die am Rande der Gesellschaft leben, zur Sprache derer, die der bürgerlichen Gesellschaft kritisch gegenüberstehen und ihre Werte despektierlich behandeln, weiterentwickelt hat und zu einem Signum sociale und einem Mittel der Identifikation und der Abschirmung für alle Berufsstände geworden ist. Obwohl den Argot wegen seiner großen Innovationskraft und des steten Bedürfnisses, mit Bildhaftigkeit und Hyperbolisierung ausgestattete Neologismen zu formen, eine gewisse Instabilität auszeichnet, darf man davon ausgehen, daß bei der Mehrzahl der Franzosen ein großer Teil der sich auf wenige Sachgebiete konzentrierenden Argotwörter bekannt ist. In diesem Sinne scheint es auch berechtigt, daß François Caradec ein Dictionnaire français argotique et populaire verfaßt und dabei die Gemeinsamkeiten zwischen dem français populaire und dem argot herausstreicht und so dem Umstand Rechnung trägt, daß zahlreiche Argotwörter regelmäßig in die Gemeinsprache und sogar in das français standard aufgestiegen sind181 und weiter den Weg nach oben finden, wobei die Literatur 182 und die Medien zur Generalisierung einen wesentlichen Beitrag leisteten. Wenn aber im PRob 2 (p. XXIV) noch immer zu lesen ist, arg. bezeichne ein "mot d'argot, emploi argotique limité à un milieu particulier, surtout professionnel {arg. scol.: argot scolaire) inconnu du grand public", so werden hier historische Argu180 181 182
E. Littré, Dictionnaire de la langue française Bd. I, Paris 1873, p. 192a. Paris 1977; diese Verbindung sieht auch der PRob2, p. XXIV, wenn er bemerkt: "pour les mots d'argot passés dans le langage courant, voir pop." G. Holtus, Untersuchungen zu Stil und Konzeption von Célines 'Voyage au bout de la nuit', Bern/Frankfurt 1972, p. 103ff.; vgl. auch B. Steegmüller, Das von der Schriftsprache abweichende Vokabular in Célines 'Mort à crédit'', Frankfurt 1981.
180
Christian Schmitt
mente und Kriterien zitiert, die für die Gegenwart keine Aussagekraft mehr besitzen. Um bei Roberts Beispielen zu bleiben: Wer möchte behaupten, daß der Schülerargot, den Knopp zusammengestellt hat 183 , "inconnu du grand public" sei oder Queneaus vielfach dem Argot entnommenes néofrançais184? Hier darf man Guiraud ohne Einschränkung zustimmen, wenn er zum Gebrauch des argot feststellt, er sei heute "une simple manifestation de l'esprit de corps et de caste — une façon particulière de parler par laquelle un groupe s'affirme et s'identifie"185, und gleichzeitig hervorhebt, der Argot bleibe "une branche de la langue populaire 186 und sei deshalb heute weiten Kreisen geläufig. Ja es drängt sich der Vergleich mit den gros mots auf, deren Fehlen im français fondamental G. Gougenheim in einem Straßburger Seminar in unvergeßlicher Manier mit dem Satz "moi, je ne les emploie jamais" kommentierte. Auch hier hat Guiraud einen offensichtlichen Widerspruch zwischen lexikographischer Absenz und prinzipieller Geläufigkeit der meisten, wenn nicht fast aller Vulgarismen festgestellt: "Quels sont la forme et la fonction des gros mots? leur emploi? leur origine? leur place dans le système linguistique? Quels sont les mécanismes langagiers, sociaux, psychologiques qui font de merde, de con ou de foutre les mots les plus usités de la langue française et qui devraient figurer aux tout premiers rangs des dictionnaires si ces derniers attestaient l'usage réel?" 187 .
Diese hier kritisierte, merkwürdige Einschätzung der gros mots und des argot stellt ohne jeden Zweifel ein Fortwirken traditioneller bürgerlicher Normvorstellungen und der v. a. im 17. Jahrhundert ausgearbeiteten Regeln der sprachlichen bienséance dar. Überwachungsmechanismen stellen dabei gleichermaßen die Familie wie die staatlichen und privaten Erziehungseinrichtungen dar, die auch vor allem den exzessiven Gebrauch von Fremdwörtern aus Gründen der angeblich fehlenden Verständlichkeit tadeln und dabei natürlich in erster Linie den angloamerikanischen meinen 188 , der eine eigene, primär von der Jugend geschätzte Kultur ins Land zu bringen droht 189 , die offenbar auf sprachlichem Sektor zu schlimmeren Folgen führen kann 190 als die Errichtung eines französischen Disneyland östlich von 183
K. Knopp, Französischer Schülerargot, Frankfurt/Bern/Las Vegas, 1979. J. Langenbacher, Das 'néo-français': Sprachkonzeption und kritische Auseinandersetzung Raymond Queneaus mit dem Französischen der Gegenwart, Frankfurt/ Bern 1981, p. 198ff. 185 R Guiraud, L'argot, Paris 61973, p. 6. 186 P. Guiraud, ibid.,p. 7. 187 P. Guiraud, Les gros mots, Paris 1975, p. 5f. 188 Ygi yf^ Sprachplanung und Sprachlenkung im Französischen der Gegenwart, in: E. Rattunde (Hg.), Sprachnorm(en) im Sprachunterricht, Frankfurt 1979, p. 7—44. 189 Vgl. R. Etiemble, Parlez-vous franglais?, Paris 21973, p.223ff. 190 Dementsprechend negativ ist auch die Einschätzung des Anglizismus beiW. Blochwitz, W. Runkewitz, Neologismen der französischen Gegenwartssprache unter besonderer Berücksichtigung des politischen Wortschatzes, Berlin 1971, p. 268ff. 184
Der französische Substandard
181
Paris. Die Anglizismen191 und Argotwörter 192 sowie der sonstige Tabuwortschatz, die alle ihre eigenen Wörterbücher besitzen 193 , werden aus denselben Gründen dem Substandard zugewiesen: Ihr Gebrauch entspricht nicht den außersprachlichen Normen und Konventionen der heutigen Gesellschaft, linguistische Kriterien und Argumente gegen den Gebrauch dieser Wörter fehlen. a) Der Argotwortschatz Im untersuchten Korpus nahmen sich mit arg. markierte Wörter recht bescheiden aus; in beiden Auflagen verzeichnet waren nur: lerche (pas lerche) "pas beaucoup" loyal(e) (à la loyale) Arg. "s'il avait accepté de se battre à la loyale" (Genet); hinzu kommen noch zwei Einheiten aus Fachargots: argot sport: lâcher "distancer (un concurrent) dans une course" argot militaire: lampe "lampe à souder: mitraillette"; die geringe Zahl der aufgenommenen Argotwörter oder argotischen Verwendungen des Gemeinwortschatzes ist sicher als Indiz für puristische Sprachhaltung zu werten. b) Der Vulgärwortschatz Noch vorsichtiger ist der PRob bei der Aufnahme vulgären Wortschatzes; in beiden Ausgaben war jeweils nur ein Beleg für den Gebrauch dieser Markierung zu finden: lèche-cul "homme qui flagorne servilement; elles sont lèche-cul"; dabei hätte es an Material nicht gefehlt194. c) Anglizismen Auch die Anglizismen wurden nur in bescheidenem Maße aufgenommen. In beiden Auflagen findet sich mit gleicher Markierung und gleicher Bedeutung: links "terrain de golf"; 191
J. Rey-Debove, G. Gagnon, Dictionnaire des anglicismes. Les mots anglais et américains en français, Paris 1980, und M. Höfler, Dictionnaire des anglicismes, Paris 1982. 192 F. J. Hausmann, Einführung in die Benutzung der neufranzösischen Wörterbücher, Tübingen 1977, p. 125ff. 193 Vgl. z.B. P. Guiraud, Dictionnaire historique, stylistique, rhétorique, étymologique de la littérature erotique, Paris 1978. 194 Y g | z g p Caradec, Dictionnaire du français argotique et populaire, Paris 1977, p. 143—149, und J. Cellard, A. Rey, Dictionnaire du français non conventionnel, Paris 1980, p. 462-491.
182
Christian Schmitt
mit Doppelmarkierung versehen sind anglicisme/politique: leadership "fonction, position de leader" anglicisme/technique: Unter "duvet de fibres". Bei label "marque apposée sur un produit ( . . . ) " , liner "paquebot de grande ligne ( . . . ) " und lobby "groupe de pression" sind die deflatorischen Teile leicht verändert, in der Regel erweitert und präzisiert, die Neuaufnahmen halten sich in Grenzen: lambswool "laine très légère provenant de jeunes agneaux" leasing "système de financement du matériel industriel par location" (anglicisme, commerce) lemon-grass "nom de plusieurs plantes graminées (...)" liberty "étoffe légère (...)" lifting "opération de chirurgie esthétique" linkage "liaison existant entre les gènes d'un chromosome" listing (Anglicisme) v listage ("action de lister") loader "engin des travaux publics (...)"• Dabei zeigen die Zusätze, daß der Anglizismus aus kulturpolitischen Überlegungen unter Hinweis auf die Ministerialerlasse und das Sprachgesetz von 1975 zu vermeiden ist: lifting: équivalent proposé "déridage, lissage" loader, recommandation officielle "chargeuse" listing: bleibt ohne Definition; PRob2 verweist direkt auf frz. listage. Es zeigt sich damit, daß der Robert einen Bereich des Substandards kennt, der nur unzulänglich mit sprachwissenschaftlichen Kriterien beschrieben werden kann und in kein soziolinguistisches Koordinatensystem paßt; dieser Bereich stellt "un langage de la valeur culturelle et sociale" 195 dar und bildet "les formes sémiques élémentaires d'un système de conceptualisation et d'expression de la valeur. Système dont la grossièreté n'est qu'une partie et qui n'est lui-même qu'une partie d'une structure plus vaste, constituée par T'image du corps' qui donne leur forme et leur nom à tous nos concepts" 196 .
5. Ergebnisse und Folgerungen Unsere diachronisch wie synchronisch orientierte Darstellung des französischen Substandards hat gezeigt, daß im Grunde genommen die Diskussion seit dem 16. Jahrhundert von den humanistischen Umdeutungen der bereits mittelalterlichen Drei-Stile-Lehre bestimmt ist und daß soziologische oder soziolinguistisch begründete Raster für die Sprachbewertung weitgehend 195 196
P. Guiraud, Les gros mots, Paris 1975, p. 21. P. Guiraud, ibid.,p. 123.
Der französische Substandard
183
noch heute fehlen. Nicht nur die Termini (wie z. B. populaire, familier oder vulgaire, bas, etc.) sind uralt und durch die gerade in Frankreich besonders ausgeprägte lexikographische Tradition197 bestimmt, auch die Inhalte dieser Epitheta bleiben wenig aktualitätsbezogen, beziehen sich eigentlich immer auf gestrige Zustände, obwohl sie die Gegenwart beschreiben sollen198. Aus diesem Grund erschien es uns notwendig, vor allem die Anfänge der Diskussion um den Substandard umfassend herauszuarbeiten, da nur so ein Verständnis für die diskutable, recht fragwürdige Praxis selbst in den heutigen lexikalischen Standardwerken geschaffen werden kann 199 . Ähnliches gilt natürlich auch für die Grammatik, wo, wie Berrendonner in seiner ideologiekritischen Studie gezeigt hat 200 , die inhaltliche Okkupation der qualifizierenden Epitheta in der Regel durch den Puristen erfolgt ist. Im Grunde genommen sind alle den Substandard betreffenden diasystematischen Markierungen nur eingeschränkt brauchbar: Ganz deutlich wurde diese terminologische Insuffizienz im Zusammenhang mit dem Epitheton populaire, das in einer demokratischen Gesellschaft eher die Durchschnittssprache bezeichnen sollte, aber heute noch — von wenigen Ausnahmen abgesehen 201 - eine Varietät des Substandards darstellt wie zur Zeit des Anden Régime-, aber auch die anderen diasystematischen Markierungen sollten neu überdacht werden; so z. B. die diatopischen, die zu sehr von der Ideologie vom Primat der Sprache der Ile-de-France bestimmt sind, die diachronischen Notationen, die eigentlich nicht von kulturhistorischen wie kulturpolitischen Vorstellungen der Bourgeoisie bestimmt sein dürften, sondern rigoros den tatsächlichen usage actuel bzw. contemporain zum Bezug haben müßten, und die diasituativen Markierungen, die besser die Bedingungen beschreiben sollten, in denen ein Wort gebraucht oder eine Regel aktualisiert werden kann bzw. verwendet werden soll. Allein im Bereich der langues de spécialité(s) hat sich insofern ein Wandel vollzogen, als Fachsprachen heute neutral wirken und nicht länger 197
198
199
200
201
Vgl. K. Baidinger, Autour du 'Französisches Etymologisches Wörterbuch' (FEW). Considérations critiques sur les dictionnaires français (Aalma 1380 — Larousse 1949), in: Revista Portuguesa de Filologia 4 (1951) 342-373. Vgl. B. Quemada, Les Dictionnaires du français moderne (1539—1863), Paris 1968. So sieht auch A. Stefenelli, m. E. völlig zu Recht, in dem Fortwirken der spezifischen Vorgeschichte ein besonderes Kriterium für die Sonderstellung des Französischen (Geschichte des französischen Kernwortschatzes, Berlin 1981, p. 207ff.). A. Berrendonner, L'éternel grammairien: étude du discours normatif, Bern/Frankfurt 1982. So z. B. der Dictionnaire du français vivant von M. Davau, M. Cohen und M. Lallemand, Paris/Bruxelles/Montréal 1972 , in dem entsprechend der Auffassung M. Cohens die üblicherweise mit populaire markierten Wörter mit argot familier markiert werden, da sie in der Regel eher dem ungezwungenen Umgangston der Bourgeoisie angehören.
184
Christian Schmitt
normativ konnotiert sind. Die diatechnische Markierung des Fachwortschatzes hat ausschließlich informativen und definitorischen Charakter und ist damit für das Französische der Gegenwart weitgehend aus der vertikalen Sprachmarkierung herausgenommen. Wie Stefenelli überzeugend ausführt, hat dieser Umschwung in der Aufklärung begonnen: „die geistesgeschichtliche Entwicklung des 18. Jahrhunderts, als 'siècle des lumières', bringt auch eine teilweise Modifizierung der sprachtheoretischen Haltung speziell gegenüber dem Wortschatz. Die starke Erweiterung der Interessen, Kenntnisse und Fortschritte führt einerseits, seit dem ausgehenden 17. Jahrhundert, zur Wiedereinbeziehung des fachsprachlichen Vokabulars in den Wortschatz der gehobenen Gemeinsprache und der Prosaliteratur, andrerseits, in der 2. Hälfte des Jahrhunderts, zu einer eigentlichen lexikalischen Neuerungsbewegung. Um die Jahrhundertmitte hatten sich die Kenntnis und die Verwendung vieler fachsprachlicher 'termes des arts et des sciences' in der Gemeinsprache der Gebildeten schon so ausgeweitet, daß selbst das an sich konservativ-puristische Akademiewörterbuch dieser Entwicklung in der 4. Auflage von 1762 Rechnung tragen mußte und eine Vielzahl von bis dahin ausgeschlossenen Fachausdrücken aufnahm"202. Wir konnten daher bei der Betrachtung des PRob 2 auf derartige Markierungen, die bei einer Vielzahl der Einträge eindeutig dominieren, verzichten, denn die beiden Hauptbereiche des fachsprachlichen Wortschatzes - wissenschaftliche Termini und Fachtermini aus Handwerk, Gewerbe, Industrie, Sport u. a. m. — werden einander komplementär 203 und nicht hierarchisch zugeordnet 204 . Doch deutet sich hier bereits eine neue Tendenz zur Hierarchisierung insofern an, als der gewöhnungsorientierte Gebrauch der Fachsprachen bzw. fachsprachlicher Einheiten - Puristen sprechen in diesem Zusammenhang meist vom jargon205 (bzw. jargon des sciences) — zunehmend als Substandard der Fachsprachen interpretiert wird; dieser Bereich der Fachsprachen wird besonders klar bei Müller dargestellt: „Innerhalb einer Fachsprache können Subregister, Niveauabstufungen, Differenzierungen bestehen. Wie regionale Varianz bei großen und geschichtsträchtigen Fachsprachen in Erscheinung tritt [Weinbauterminologie im Elsaß/Weinbauterminologie im Bordelais], so machen sich Unterschiede bemerk202 203
204
205
A. Stefenelli, Geschichte des französischen Kernwortschatzes, Berlin 1981, p. 214. M. Girard, S. Vallée, Langage et identité professionnelle, in: Langage et société 12 (1980) 31f. Vgl. auch die Darstellungen bei G. Matoré, La méthode en lexicologie, domaine français, Paris 1953, p. 84; P. Rivenc, Lexique et langue parlée, in: Le français dans le monde 8 (1968) 32a; K. Baldinger, Die Gestaltung des wissenschaftlichen Wörterbuchs, in: Romanistisches Jahrbuch 5 (1952) 90; B. Müller, Das Französische der Gegenwart, Heidelberg 1975, p. 172. Vgl. R. Etiemble, Le jargon des sciences, Paris 1966; M. Bruguière, Pitié pour Babel. Un essai sur les langues, Paris 1978; J. Merlino, Les Jargonautes. Le bruit des mots, Paris 1978; R. Beauvais, "Le français kiskose", Paris 1975; R. Beauvais, L'hexagonal tel qu'on le parle, Paris 1970; vgl. auch R. Lassus, Les perles du spiqueur, suivi de Big Léon, Luxembourg 1982.
Der französische Substandard
185
bar zwischen Personen, die zwar dem Fach nach eine geschlossene Gruppe bilden, dem Grad der Spezialisierung und der Art ihrer Tätigkeit nach jedoch divergieren, Unterschiede auch zwischen schriftlichem und mündlichem Gebrauch. Die Kommunikation verlangt an einer bestimmten Stelle jeweils ein bestimmtes Maß von fachsprachlicher Ausführlichkeit, Korrektheit, Allgemeingültigkeit eines Terminus"206. Solche aus der Vulgarisierung der Fachsprachen erklärbaren Lexeme können, müssen jedoch nicht degradative Konnotation in der Gemeinsprache besitzen. Insgesamt läßt sich feststellen, daß die sprachwissenschaftlichen Beschreibungsmethoden noch zu wenig bei der Bestimmung des Subkodes, namentlich in der Lexikographie, beachtet werden und daß die Text-, Ausdrucks- und Kommunikationsformen nicht genügend auseinandergehalten werden. Was nützt es, daß zwar Frequenzuntersuchungen zum heutigen Französisch vorliegen 207 , Analysen der Umgangssprache mit klar definierter Begrifflichkeit existieren208 und alle linguistischen Grammatiken auf die Unzulänglichkeit der bisherigen, meist irgendwie puristisch gefärbten Beschreibung des Substandards hingewiesen haben, wenn diese Anregungen nicht aufgegriffen und konsequent in der Lexikographie wie in der Grammatik appliziert werden? André Martinet hat in einem anderen Zusammenhang auf die fatalen Auswirkungen des unkoordinierten Wirkens von grammairiens und linguistes bei der grammatischen Beschreibung des Neufranzösischen hingewiesen209. Ein solches bezugloses Nebeneinander gibt es m . E . auch heute noch zwischen dem deskriptiven Sprachwissenschaftler und dem Lexikographen, der - zumindest in der französischen Tradition, aber auch sonst in der Romania - zu sehr als Bewahrer auftritt und damit letztendlich puristischen Traditionen verpflichtet bleibt. Eine Besserung der Situation kann m. E. hier nur dann erreicht werden, wenn aus dem Neben- und Gegeneinander ein koordiniertes, fein abgestimmtes Miteinander wird. Nur so wird sich vermeiden lassen, daß gerade der Substandard das ideale Aktionsfeld für Sprachliebhaber und Puristen bleibt210. 206 207 208
209
210
B. Müller, Das Französische der Gegenwart. Varietäten, Strukturen, Tendenzen, Heidelberg 1975, p. 172. CNRS, Dictionnaire des fréquences. Vocabulaire littéraire des XIXe et XXe siècles Paris 1971. Vgl. dazu H. Kleineidam, Systematische Grammatik vs. kommunikative Grammatik, in: R. Kloepfer (Hg.), Bildung und Ausbildung in der Romania, Bd. II, München 1979, p. 292-305. Les grammairiens tuent la langue, in: Arts, 3 juin 1963; der Artikel erschien unter dem neuen Titel Les puristes contre la langue, in: A. M., Le français sans fard, Paris 1969, p. 25—32; offensichtlich war eine Aussöhnung zwischen grammairien und linguiste möglich. Vgl. dazu z. B. M. Rat, Grammairiens et amateurs de beau langage, Paris 1963.
Substandard unter dialektologischem Aspekt. Forschungen zur deutschen Sprachstatistik und Sprachkartographie Werner H. Veith (Mainz)
1. Standard - Nonstandard — Substandard 1.1 Standard 1.2 Nonstandard 1.3 Substandard 2. Substandard sprachstatistisch 2.1 Praktische Ansätze 2.2 Sprachstatistik im Anschluß an den KDSA 2.3 Ergebnisse 3. Substandard sprachkartographisch 3.1 Diskordanztypen 3.2 Kartographie der Diskordanztypen 3.3 Ergebnisse Literaturhinweise 1. Standard — Nonstandard - Substandard 1.1 Standard Das Adjektiv standard ist in der englischen, nicht aber in der deutschen Sprache belegt (vgl. Duden. Deutsches Universalwörterbuch 1983, 1201, u. Wahrig 1979, Sp. 3497f.). Das American College Dictionary (Barnhart/Stein 1963, 1177) kennt neben dem Substantiv das Adjektiv, welches wie folgt definiert wird: "— adj. 17. a serving as a basis of weight, measure, value, comparison, or judgment. 18. of recognized excellence or established authority: a standard author. 19. (of a variety of a given language, or of usage in the language) characterized by preferred pronunciations, expressions, grammatical constructions, etc., the use of which is considered essential to social or other prestige, failure to conform to them tending to bring the speaker into disfavor . ..". Unabhängig von dem sprachwissenschaftlichen Aspekt wird das entsprechende Substantiv definiert u. a. als "anything taken by general consent as a basis of comparison; an approved model" (American College Dictionary: Barnhart/Stein 1963, 1177). Mit der Bedeutung 'Normalmaß, Richtschnur; herkömmliche Normalausführung (z. B. einer Ware)' hat das englische Substantiv wohl schon im 19. Jh. in die deutsche Kaufmannssprache Eingang gefunden (s. Duden. Etymologie 1963, 669), während der sprach wissen-
188
Werner H. Veith
schaftliche Terminus erst mit der Rezeption der amerikanischen Linguistik Ende der sechziger und Anfang der siebziger Jahre aus dem Amerikanischen ins Deutsche übernommen wurde (vgl. Glinz 21980, 609f.). Im Englischen bestehen verschiedene Standardvarietäten, die sich z.T. im Wortschatz, im wesentlichen aber in der Aussprache unterscheiden (vgl. Oomen 1982, 17, u. die ausführliche Liste bei Wächtler 1977, 51). Auch die deutsche Sprache kennt mehrere regionale Standardvarietäten, z. B. in der Schweiz, in Österreich und seit dem Zweiten Weltkrieg in der Bundesrepublik Deutschland und in der DDR (vgl. Jäger 21980, 376; Hellmann 21980, insbes. 522ff.). Glinz (21980,610) versteht unter der deutschen Standardsprache der Gegenwart „die heute gehörte und gelesene, gesprochene und geschriebene deutsche Sprache, soweit sie als allgemein gebraucht, als nicht-mundartlich und als nicht-schichtenspezifisch betrachet wird". In diesem Sinne sollte sich der Terminus „Standard" sowohl auf die schriftliche als auch auf die mündliche Kommunikationsform der Sprache erstrecken. Welche Sprachvarietäten als Standardvarietäten gelten können, hängt synchron betrachtet - ab: a) von dem Prestige, das diese Varietäten gegenüber anderen Varietäten bei den Sprechern eines Varietätenraums (zu diesem Terminus vgl. Klein 1974 u. 1976) genießen bzw. genießen sollen, b) von dem Varietätenraum, über den sich diese so ausgezeichneten Varietäten erstrecken (z. B. dem Varietätenraum, der dem Standard American English, dem Deutschen, dem Schweizerdeutschen oder dem Hindi zugrunde liegt bzw. zugrunde liegen soll), c) von der Verbindlichkeit dieser Varietäten in der Sprachverwendung, d. h. von der gesellschaftlichen Sanktionierung, die in dem entsprechenden Varietätenraum mit der Verwendung bzw. Nicht-Verwendung der ausgezeichneten Varietäten verbunden ist; Standardvarietäten sind absolut verbindlich, „weitgehend normiert und kodifiziert" (vgl. Stammerjohann 1975, 461); d) von der pragmatischen Funktion, welche eine Varietät zu erfüllen hat, und der damit verbundenen Infrastruktur einer jeden Varietät; nach Havranek ist die Literatursprache [als Varietät der schriftlichen Kommunikation] funktional geschichtet (s. bes. Havrânek 1976, 151ff.); ebenso fallen Funktionalstile (vgl Riesel 21963 u. Seiffert 1977) innerhalb des geschriebenen und gesprochenen Standards in diesen Bereich, wenn sie als „Realisationsweisen des Sprachsystems" und nicht als „Untersysteme der Sprache" aufgefaßt werden (vgl. Nabrings 1981, 190). 1.2 Nonstandard Der normative Bezugsrahmen (vgl. Stammerjohann 1975, 461) für die Orientierung der Kommunizierenden ist auch maßgebend für die Definition
Substandard unter dialektologischem Aspekt
189
des Nonstandard. Ex negativo handelt es sich bei dem Nonstandard um Varietäten - ohne das Prestige der Standardvarietäten, - ohne einen größeren Geltungsraum, - ohne allgemeine Verbindlichkeit. Somit können alle Äußerungen, die nicht den Regeln der Standardsprache folgen, unter den Begriff des Nonstandard subsumiert werden, d. h. auch solche Äußerungen, die zwar standardsprachlich intendiert, aber durch Regelverstöße gekennzeichnet, d. h. fehlerhaft, sind. Berücksichtigt man also das Unsystematische in der "Parole", so läßt sich jedes abweichende Sprachverhalten unter dem Begriff des Nonstandard fassen, d. h. auch Regelverstöße gegen die Normen jener Varietäten, welche nicht als Standardvarietäten ausgezeichnet sind (vgl. Veith 1968). Wenn Fishman von Nonstandard (in deutscher Übersetzung: Nicht-Standard, s. Fishman 1975, 34) spricht, so meint er die Sprache bzw. die sprachliche Varietät als System. Entsprechend sind die Darlegungen von Glinz (21980, 610f.) zu verstehen, wenn dort das „Verhältnis der Standard-Formen zu den Nichtstandard-Formen" erörtert wird. Zwar wird der schichtenspezifische Sprachgebrauch von Glinz kurz angesprochen, aber die wesentlichen Varietäten des „NichtStandard" sind in seinen Augen die Dialekte und Regionalsprachen, und er konstatiert, „daß das Prestige der Dialekte und Regionalsprachen gewachsen und die Häufigkeit ihrer Benutzung auch zu Zwecken, für die früher die Standardsprache allein benutzt wurde, gestiegen ist, vor allem in Süddeutschland, Österreich und der Schweiz". Der Nonstandard wird somit begrifflich auf bestimmte Varietäten eingeengt, die aus der Perspektive der Standardvarietät und der damit verbundenen Wertung auch als Varietäten des Substandard betrachtet werden können. 1.3 Substandard In der traditionellen amerikanischen Linguistik steht bei dem Begriff des Substandards der wertende Aspekt im Vordergund, so daß die für den Normalverbraucher gedachte Definition lautet: "... 3. Linguistics, characteristic of a normal, uncultivated variety of a language which has a standard variety, hence tending to reflect prejudicially on the user" (American College Dictionary: Barnhart/Stein 1963, 1207). Die in dieser Definition angesprochene Voreingenommenheit wird von U. Oomen am Beispiel der gesellschaftlichen Funktion von Aussprachenormen erörtert (Oomen 1982, 17f.). Sind entsprechende Regelverstöße gegen die Aussprachenorm nicht situationsabhängig oder idiolektal bedingt, so stellt sich die Frage nach den kausalen Zusammenhängen unter dem Aspekt,
190
Werner H. Veith
welches zugrundeliegende (Sub-)System der Sprache für die Fehler verantwortlich ist. Aus diesen und ähnlichen Gründen ist z.B. für das Deutsche ein Fehleratlas auf dialektaler Grundlage geplant (s. Löffler 1982). Bei Wächtler (1977, 38, 83 et passim) werden für das Englische neben dem Slang ein ethnischer und ein regionaler Substandard (d. h. Dialekte) unterschieden, aber die Situation ist wesentlich komplizierter, wie das Buch von U. Oomen (1982) zeigt. Entsprechendes gilt für das Deutsche, z.B. diskutiert und mit einer tabellarischen Übersicht verbunden bei I. Radtke (1973; Tabelle S. 167). Den Begriff des Substandards hat aus germanistischer Sicht jüngst G. Bellmann diskutiert und nur auf die mündliche Kommunikation bezogen (Bellmann 1983). So ist Substandard der Oberbegriff „für den sprechsprachlichen Gesamtbereich unterhalb des Standards"; Spezifikationen sind z.B. „Einzelsubstandard", „Gesamtsubstandard", „landschaftliche Substandards", „Neuer Substandard" (Bellmann 1983, 124). Der Gesamtsubstandard der deutschen Gegenwartssprache ist die „Menge der landschaftlichen Substandards", aber der Terminus Substandard bezeichnet „sowohl - als Einzelsubstandard — jedes vertikale Teilkontinuum in dem angegebenen Sinne als auch horizontal Gruppen dieser Teilkontinua, soweit sie — als landschaftliche Substandards - auf einer gemeinsamen dialektalen Grundlage eine sprachlandschaftliche Ausprägung entweder bewahrt oder angenommen haben" (Bellmann 1983, 124). Der in dieser Definition enthaltene Bezug zu den Dialekten ist für die von U. Oomen angesprochene Orthophonie und i.w. S. auch für die Orthographie von Wichtigkeit, da die Dialekte schwerpunktmäßig im Bereich der Phonologie differenziert sind. Sie besitzen somit auf dieser Ebene eine Steuerungsfunktion in bezug auf die Systematik der Varietäten des Substandards allgemein, aber auch bezüglich der Verstöße gegen die orthophonischen und orthographischen Regeln der Standardvarietäten im besonderen (vgl. Veith 1983). Somit kann das linguistische Phänomen des Substandards nur dann ausreichend beschrieben werden, wenn der dialektologische Aspekt gebührend berücksichtigt wird.
2 Substandard sprachstatistisch 2.1 Praktische Ansätze Die sprachstatistische Untersuchung des breiten, vertikalen Spektrums zwischen Standard und Dialekt (im Sinne von Bellmanns „Einzelsubstandard") ist zwar ein wichtiges Forschungsdesiderat, kann aber nur punktuell und nicht synoptisch für ein ganzes Sprachgebiet geleistet werden. Untersuchun-
Substandard unter dialektologischem Aspekt
191
gen des Soziologen U. Oevermann (1972) oder der Dialektologen U. Ammon (1973) bzw. D. Stellmacher (1977) enthalten sprachstatistische Analysen für das jeweilige Bearbeitungsgebiet, da anhand von Variablen z.B. das Dialektniveau gemessen werden soll (vgl. Ammon 1973, 80ff., u. Stellmacher 1977, 128ff.). Dazu kommentiert Mattheier (1980, 198): „So bleibt am Ende des Abschnitts über die Messung von Dialektalität nur festzustellen, daß bisher noch keine eindeutig brauchbaren Meßmethoden entwickelt worden sind. Allenfalls bei Untersuchungen, die sich auf einen Ortspunkt beziehen, über den in ausreichendem Maße Informationen über sprachliche Zwischenformen und die dialektale Basis vorhanden sind, läßt sich die von Ammon entwikkelte Methode wohl verwenden". Diese von Mattheier, aber auch bereits von Ammon und Stellmacher als Voraussetzung angesehene dialektale Basis ist durch den Kleinen Deutschen Sprachatlas (KDSA) wenigstens für den linguistischen Teilbereich der Phonologie gegeben. Außerdem wird das deutsche Sprachgebiet nicht nur punktuell, sondern in seiner gesamten Ausdehnung in Zentraleuropa vor 1933 erfaßt. Dies hat den Vorteil, daß sich der Frage nach dem Substandard auch unter nunmehr sprachhistorischen Gesichtspunkten nachgehen ließe, aber zugleich den Nachteil, daß die nach 1933 erfolgten Sprachveränderungen nicht mit erfaßt werden. Außerdem ist die Arbeit mit mehreren Variablen, wie sie von Ammon und Stellmacher vorgenommen worden ist, nicht möglich, dafür aber eine flächendeckende, statistische Kontrastierung von Dialekt und Standardsprache. Die Daten des KDS A erlauben vermutlich dialektometrische Studien, wie sie im Anschluß an J. Séguy u. a. von H. Goebl für das Italo-, Räto- und Galloromanische vorgelegt worden sind (vgl. Goebl 1982 u. 1984). Sie wären einerseits um so leichter zu leisten, als die Daten des KDS A bereits computativ erfaßt sind (vgl. Kleiner Deutscher Sprachatlas 1984, Einleitung, XlXff., u. Veith 1984, 304ff.); andererseits besteht die Schwierigkeit der im Vergleich zu dem AIS und dem ALF, die Goebl als Datengrundlage dienten, ungleich größeren Belegdichte mit 5.892 Belegorten im KDSA. Sprachstatistische Fragen sind im Rahmen von Untersuchungen deutscher Dialekte bisher wenig berücksichtigt worden. In der Einzelarbeit von H. Kleine (1983) besteht das sprachstatistische Interesse in erster Linie wie auch bei Goebl — im Zusammenhang mit Fragen der Dialektgliederung. Unter den Sprachatlanten wäre der Historische Südwestdeutsche Sprachatlas zu nennen, denn er enthält Karten, welche die Belegzahl pro Ortspunkt erkennen lassen, so daß entsprechende Belegsymbole sowohl einen qualitativen als auch einen quantitativen Aspekt besitzen (vgl. Kleiber/Kunze/Löffler 1979). Für den projektierten Südwestdeutschen Sprachatlas ist eine Segmentstatistik vorgesehen, welche Vorkommenstypen, die „Gesamtsumme der in allen Gruppen vorkommenden Einzelsegmente",
192
Werner H. Veith
sowie die entsprechende absolute und relative Häufigkeit erkennen läßt (s. Kelle/Platzek 1983, 127 u. 141ff.; vgl. auch Kelle 1983). 2.2 Sprachstatistik im Anschluß an den KDSA Die verlochten Morphe sind zusammengefaßt worden, indem für die häufigste Form der Buchstabe A, für die zweithäufigste der Buchstabe B, für die dritthäufigste der Buchstabe C usw. automatisch vergeben worden ist. Neben der Belegtypkennzeichnung wird für diese morphologischen Zwischendaten 1.) die absolute, 2.) die relative und 3.) die kumulative Häufigkeit angegeben. Das standardsprachliche Wort auf erscheint beispielsweise - verkürzt um die Belegtyp-Nr., die hier ausgespart wird - folgendermaßen in dem Zwischenprotokoll: H ä u f i g k e i t Symbol Morph absolut relativ kumulativ A u p 1109 x 18,83% 18,81% B u f 887 x 15,06% 33,89% C au f 715 x 12,14% 46,03% D u ff 628 x 10,66% 56,69% E a f 514 x 8,73% 65,42% F o p 513 x 8,54% 73,96% Go f 310 x 5,26% 79,22% H u pp 278 x 4,72% 83,94% I o ff 259 x 4,40% 88,34% J o b 241 x 4,09% 92,43% Wie aus der kumulativen Angabe hervorgeht, bilden diese zehn Belegtypen bereits 92,43 % der tatsächlichen Belege (theoretische Belegzahl reduziert um fehlende Belege); in absoluten Zahlen sind das 5.454 Belege. Möchte man sich auf die Konsonanten allein beziehen, so wirft der Rechner auch dafür die entsprechenden Werte aus. Demnach ist das Phonem /p/ (aus p, pp, b) in diesen zehn Belegtypen 2.141 mal (36,18%), das Phonem lil (aus /, ff) aber 3.313 mal (56,25 %) belegt. Sämtliche Informationen, die in den Rechner eingegeben worden sind, können zum Gegenstand von Sortierungen gemacht werden. Sinnvoll wären Sortierungen, die beispielsweise an folgenden Fragen orientiert sind: (1) Welche Formen des dialektalen Substandards entsprechen mit welcher Häufigkeit einer standardsprachlichen Form? (2) Was sind die häufigsten Formen des dialektalen Substandards für eine bestimmte standardsprachliche Form? (3) Welche relative (in %) und absolute Häufigkeit haben Formen, die bezüglich des dialektalen Substandards und des Standards konkordant sind?
193
Substandard unter dialektologischem Aspekt
(4) Welche relative (in % ) und absolute Häufigkeit haben Formen, die bezüglich des dialektalen Substandards und des Standards diskordant sind? (5) Wie hoch ist die durchschnittliche Konkordanz zwischen den Formen des dialektalen Substandards und des Standards, und welche Formen sind betroffen? (6) Wie hoch ist die durchschnittliche Diskordanz zwischen den Formen des dialektalen Substandards und des Standards, und welche Formen sind betroffen? (7) Welche Konkordanz- bzw. Diskordanztypen lassen sich aus den Durchschnittswerten ableiten? Die nachfolgenden Tabellen 1 bis 3 beziehen sich auf die Frage (1), die Tabellen 4 und 5 auf Frage (2), und die Tabellen 6 bis 17 bilden eine exhaustive Aufarbeitung der KDSA-Daten, stets bezogen auf den Bereich des Konsonantismus. Die Übersichten, welche sich aufgrund von Frage (4) ergeben haben, sind hier aus Platzgründen nicht im einzelnen wiedergegeben worden, jedoch haben sie bei der kartographischen Darstellung in Abschnitt 3 Berücksichtigung gefunden; überdies können die Tabellen 1 bis 3, auf denen allerdings die relative Häufigkeit nicht angegeben ist, als Beispiele dienen. Die Tabellen 18 bzw. 19 beantworten die Fragen (5) bzw. (6). Die an Tab. 18 anschließende Typenbildung ist hier nicht abgedruckt, dafür aber die sich auf Tab. 19 beziehende Typisierung, die somit eine Antwort auf Frage (7) gibt und gleichzeitig die statistische Grundlage der kartographischen Darstellung (Abschnitt 3.2) bildet. Tab. 1: Formen des Substandards f. standardsprl. -ch (lt. KDSA Bd. 1.2) standardsprl. Dialektform
Häufigkeit
in
Karte
-ch
747 2544 2521 1846 1279 1671 1562 2234 263 48 53 23 15 27 13 2057 1863 1880 4
auch kochloeffel sich ich gleich dich sich ich dich auch kochloeffel sich ich gleich dich auch kochloeffel gleich sich
184 183 176 175 174 173 176 175 173 184 183 176 175 174 173 184 183 174 176
-ch
-ck -g
-k -seh
194
Werner H. Veith standardsprl. Dialektform
Häufigkeit
in
Karte
-ch
6 14 25 27 6 2394 848 1265 1752 2217 3808
ich dich sich ich gleich auch kochloeffel sich ich gleich dich
175 173 176 175 174 184 183 176 175 174 173
-seh -tch -/
Tab. 2: F o r m e n des Substandards f. standardsprl. s e h . . . (lt. K D S A B d . 1.2) standardsprl. Dialektform
Häufigkeit
in
Karte
seh-
17 4970 6 8 19 17 27 4904 4921 754 869 26 17 20 3554 853 31 37 14 4973 4967 873 894 24 30 36 520 10 8 15 19 4723 4382 7 838 602 3 53 43
schoene schoene schoene schoene schlafen schlechte schlafen schlechte schlafen schlechte schlafen schlechte schlafen schmolzen schmolzen schmolzen schmolzen schneien schnee schneien schnee schneien schnee schneien schnee schwarz Schwester schwarz Schwester Schwester schwarz Schwester schwarz Schwester schwarz Schwester Schwester schwarz Schwester
160 160 160 160 161 162 161 162 161 162 161 162 161 163 163 163 163 165 164 165 164 165 164 165 164 166 167 166 167 167 166 167 166 167 166 167 167 166 167
schl-
ksehsgshssehschlslzl-
schm-
sehn-
sehschmsmzmsehsehnsnzn-
schw-
ssehschbschwshbswzzw-
195
Substandard unter dialektologischem Aspekt Tab. 3: Formen des Substandards f. standardsprl. -n (lt. K D S A Bd. 1.2) standardsprl. Dialektform
Frequenz
Beleg
Karte
-n
15 7 4019 4221 2738 2311 2068 3529 115 52 37 5 4 8 24 1886 1560 3176 3423 2775 1831 104
von sein wein von sein mein kein an wein sein mein kein an mein von wein von sein mein kein an kein
221 220 222 221 220 219 218 217 222 220 219 218 217 219 221 222 221 220 219 218 217 218
-m -n
-n
-ngt -r -/
-/+s
Tab.4: Häufigste F o r m e n d. Substandards f. standardsprl. lil ( K D S A Bd. 1.2) Häufigkeit
Form
standardsprl. in
Karte
5303 3774 3656 3601 3529 3441 3439 3391 3378 2935 2729 2187 2177 2135 2127 2071 2047 1986 1769 1602 700 506
-ft -ff-ff-f-f-ff-f-f -rf(/d_) -rf -f-p-p-p-p-rp -p -p-p-w-b-r(/d_)
-ft -ff-ff-f-f-ff-f-f -rf(/_d) -rf -f-f-f-ff-f-rf -f -ff-ff-f-f-rf(/d_)
131 123 125 126 128 124 129 130 133 132 127 126 128 125 129 132 130 123 124 127 127 133
luft äffe pfeffer kaufen schlafen loeffel seife auf duerft dorf ofen kaufen schlafen pfeffer seife dorf auf äffe loeffel ofen ofen duerft
196
Werner H. Veith
Tab. 5: F o r m e n d. Substandards f. -ch . . . nach Häufigkeit ( K D S A Bd. 1.2) Häufigkeit
Dialektform
standardsprl. in
4452 3808 3533 2746 2544 2521 2394 2250 2241 2234 2217 2057 1880 1863 1846 1752 1671 1562 1361 1279 1265 848 747 263 58 53 48 42 33 27 27 25 23 22 18 16
-ch-/ -ch-ch-ch -ch -/ -k-k-ck -/ -k -k -k -ch -/ -ch -ck -k-ch -/ -/ -ch -ck -g-g -g -g-g-tch -g -tch -g -tch-/-chch-
-ch-ch -ch-ch-ch -ch -ch -ch-ch-ch -ch -ch -ch -ch -ch -ch -ch -ch -ch-ch -ch -ch -ch -ch -ch-ch -ch -ch-ch-ch -ch -ch -ch -ch-ch-ch-
Karte
wochen dich gebrochen machen kochloeffel sich auch machen gebrochen ich gleich auch gleich kochloeffel ich ich dich sich wochen gleich sich kochloeffel auch dich wochen kochloeffel auch gebrochen machen ich gleich sich sich wochen machen wochen
182 173 180 181 183 176 184 181 180 175 174 184 174 183 175 175 173 176 182 174 176 183 184 173 182 183 184 180 181 175 174 176 176 182 181 182
Tab. 6: Bilabiale Plosive - Substandard = Standard (n. KDSA Bd. 1.1) Prozent Frequenz Dialektf.
Standardf.
Beleg
Karte
99 99 99 99 99 99 99 99
bbbbbbbbl-
bald bauen baeumchen bei beissen besser boesen blaetter
1 2 4 5 6 8 9 11
5278 5805 5775 5772 5773 5789 4794 5734
bbbbbbbbl-
197
Substandard unter dialektologischem Aspekt Tab. 6: Bilabiale Plosive - Substandard = Standard (n. KDSA Bd. 1.1) Prozent Frequenz Dialektf. 99 99 99 99 99 99 99 98 98 89 Average: 98
5839 5706 5597 5872 5740 5847 5865 5844 5781 5237
blbrbrbrbrbrbrbblb-
Prozent Frequenz Dialektf. 47 47 44 44 44 43 41 36 31 8 Average: 39
2276 2415 2550 2576 2539 2293 2387 2048 1631 447
-b-b-b-b -rb-b-b-b-b-lb-
Prozent Frequenz Dialektf. 42 39 34 Average: 38
2477 2125 2029
pfpf-pf-
Standardf.
Beleg
Karte
blbrbrbrbrbrbrbblb-
bleib bracht (ge-) brannt(ge-) braune brochen(ge-) brot bruder berge blieben bauern
12 14 15 16 17 18 19 7 13 3
Standardf.
Beleg
Karte
-b-b-b-b -rb-b-b-b-b-lb-
abend oben ueber bleib storben(ge-) treiben blieben liebes glaube selbst
23 27 29 31 33 28 24 26 25 32
Standardf.
Beleg
Karte
pfpf-pf-
pfeffer pfund aepfelchen
21 22 34
Tab. 7: Alveo-dentale Plosive (Antaxe) - Substandard = Standard (n. K D S A Bd. 1.1) Prozent Frequenz Dialektf. 99 74 72 Average: 82
5802 4204 4239
drd=r dr=
Prozent Frequenz Dialektf. 50 49 43 41 39 39 Average: 44
2875 2623 2531 2194 2203 2273
trtrtttt-
Standardf.
Beleg
Karte
drd=r dr=
drei duerft dreschen
41 36 42
Standardf.
Beleg
Karte
trtrtttt-
trinken treiben tische tochter tot tut
44 43 37 38 39 40
198
Werner H. Veith
Tab. 8: Alveo-dentale Plosive (In- u. Abtaxe) - Substandard = Standard (n. K D S A ) Prozent Frequenz Dialektf. 74 72 65 51 33 13 Average: 51
4373 4198 3695 2942 1943 695
-d-d-Id-nd-nd-rd-
Prozent Frequenz Dialektf. 35 Average: 35
1878
-Id
Prozent Frequenz Dialektf. 82 70 53 48 42 40 38 36 33 27 19 Average: 44
4810 4005 3085 2865 2504 2371 2199 2128 1936 1523 1115
-nt-tt-t-t-t+-rt-tt-tt-It-nt-It-
Prozent Frequenz Dialektf. 88 Average: 88
5163
-rt
Standardf.
Beleg
Karte
-d-d-Id-nd-nd-rd-
bruder muede felde andern funden(ge-) werden
50 51 60 72 73 66
Standardf.
Beleg
Karte
-Id
bald
61
Standardf.
Beleg
Karte
-nt-tt-tt-t-t-rt-tt-tt-It-nt-It-
winter mutter mutter zeiten roten garten blaetter wetter kalte unten alte
78 54 55 57 56 67 52 53 63 77 62
Standardf.
Beleg
Karte
-rt
wort
69
T a b . 9: A f f r i k a t e . . . z . . . ( / t s / ) - S u b s t a n d a r d = S t a n d a r d ( n . K D S A B d . 1.1) Prozent Frequenz Dialektf. 66 66 61 61 61 61 59 51 48 44 Average: 58
3896 3902 3625 3598 3257 3616 3475 3039 2161 2355
zwzwzz-tz-rzz-lz -lz-rz
Standardf.
Beleg
Karte
zwzwzz-tz-rzz-lz -lz-rz
zwei zwoelf zaehlt(er-) zeiten sitzen herzen zum salz schmolzen(ge-) schwarz
48 49 45 46 59 70 47 65 64 71
199
Substandard unter dialektologischem Aspekt
Tab. 10: V e l a r e r P l o s i v ( L e n i s ) - S u b s t a n d a r d = Standard (n. K D S A B d . 1.1) Prozent Frequenz Dialektf. 96 95 95 95 94 94 93 92 82 Average: 93
5369 5502 5333 5462 5443 5064 5481 4967 4281
grgggrgglgggl-
Prozent Frequenz Dialektf. 83 74 70 44 Average: 68
4044 4351 4046 2472
-g-g-g-g
Prozent Frequenz Dialektf. 76 Average: 76
4484
-rg-
Standardf.
Beleg
Karte
grgggrgglgggl-
groesser garten gehen gross gut gleich gaense gestern glaube
98 81 82 97 84 96 80 83 95
Standardf.
Beleg
Karte
-g-g-g-g
äugen fliegen liegen genug
99 100 101 103
Standardf.
Beleg
Karte
-rg-
berge
104
T a b . 11: Velarer Plosiv (Fortis) - Substandard = S t a n d a r d ( n . K D S A B d . 1.1) Prozent Frequenz Dialektf. 98 98 97 96 96 96 96 96 96 Average: 97
5786 4851 5153 5610 5647 5548 5622 5419 5656
kkkkkkkkk-
Prozent Frequenz Dialektf. 90 Average: 90
3184
-nk-
Prozent Frequenz Dialektf. 60 51 48 Average: 53
3440 2954 2735
-chs -chs-chs-
Standardf.
Beleg
Karte
kkkkkkkkk-
kannt(ge-) kein kochloeffel kalte kaufen kind kohlen kommen (ge-) kuehe
87 89 91 86 88 90 92 93 97
Standardf.
Beleg
Karte
-nk-
trinken
109
Standardf.
Beleg
Karte
-chs -chs-chs-
sechs ochsen wachsen
107 105 106
200
Werner H. Veith
Tab. 12: L a b i o d e n t a l e r Frikativ - Substandard = Standard (n. Bd. 1.2) Prozent Häufigkeit 97 96 96 89 Average: 94
5765 5699 5671 5199
Prozent Häufigkeit 61 60 58 58 49 Average: 57
3601 3529 3391 3439 2729
Prozent Häufigkeit 64 64 62 Average: 63
3441 3774 3653
Prozent Häufigkeit 90 Average: 90
5303
Prozent Häufigkeit 60 50 Average: 55
3378 2935
KDSA
Form
standardsprl. in
Karte
wwww-
wwww-
116 119 118 117
Form
standardsprl. in
Karte
-f-f-f -f-f-
-f-f-f -f-f-
126 128 130 129 127
was wo wie(viel) wem
kaufen schlafen auf seife ofen
Form
standardsprl. in
Karte
-ff-ff-ff-
-ff-ff-ff-
124 123 125
Form
standardsprl. in
Karte
-ft
-ft
131
Form
standardsprl. in
-rf(/d_) -rf(/d_) -rf -rf
loeffel äffe pfeffer
luft
duerft dorf
Karte 133 132
Tab. 13: Alveo-dentaler Frikativ - Substandard = Sd (. K D S A Bd. 1.2) Prozent Häufigkeit 96 94 86 86 85 85 81 8 6 Average: 70
5652 5482 5112 5039 4966 4984 4315 465 380
Form
standardsprl. in
Karte
-s-s -st-ss-st-st -rst -rst
(germ.*s)-s(germ.*s)-s (germ.*s)-st(germ.*s)-s(germ.*s)s(germ.*s)-st(germ.*s)-st (germ.*s)-rst (germ.*s)-rst
138 152 155 153 137 154 156 157 158
haeuser eis Schwester ist sollen gestern fest durst wurst
201
Substandard unter dialektologischem Aspekt Prozent Häufigkeit 61 59 59 57 57 55 54 54 46 Average: 56
3759 3445 3527 3353 3277 3107 3274 3115 2719
Prozent Häufigkeit 60 55 54 Average: 56
3346 3254 3179
Form
standardsprl. in
Karte
-ss-ss -ss-ss-ss-ss-ss-ss -ss-
-ss-ss -ss-ss-ss-ss-ss-ss -ss-
139 146 140 145 143 142 141 144 147
Form
standardsprl. in
Karte
-s -s -s
-s -s -s
148 150 149
besser muss wasser isst weisse groesser beissen gross muesst
aus was das
T a b . 14: Palato-alveolarer Frikativ - Substandard = Standard (n. K D S A Bd. 1.2) Prozent Häufigkeit 89 86 84 84 84 82 80 80 Average: 84
4970 4904 4973 4967 4921 4382 4723 3554
Prozent Häufigkeit 94 93 74 Average: 87
5475 5493 4356
Form
standardsprl. in
Karte
sehschlsehnsehnschlschwschwschm-
sehschlsehnsehnschlschwschwschm-
160 162 165 164 161 166 167 163
Form
standardsprl. in
-seh -seh -seh -seh -sch(/dr_) -sch(/dr_)
schoene schlechte schneien schnee schlafen schwarz Schwester schmolzen
tisch fleisch dreschen
Karte 171 172 170
T a b . 15: Palataler bzw. velarer Frikativ - Substandard = Standard (n. K D S A Bd. 1) Prozent Häufigkeit 90 87 83 Average: 87
5197 4967 4461
Form
standardsprl. in
Karte
-ch-cht-cht-
(germ.*h)-ch- gebracht (germ.*h)-cht-schlechte (germ.*h)-cht-tochter
189 177 190
202
Werner H. Veith Prozent Häufigkeit 48 45 31 28 24 14 Average: 32
2544 2521 1846 1671 1279 747
Prozent Häufigkeit 29 Average: 29
1763
Form
standardsprl. in
Karte
-ch -ch -ch -ch -ch -ch
-ch -ch -ch -ch -ch -ch
183 176 175 173 174 184
Form
standardsprl. in
Karte
-Ich
-Ich
178
kochloeffel sich ich dich gleich auch
milch
T a b . 16: Liquide - Substandard = Standard (n. K D S A B d . 1. 2) Prozent Häufigkeit 91 87 86 84 83 81 81 81 73 64 49 48 Average: 76
5329 4899 5005 4969 4725 4738 4503 4268 4016 3754 2913 2591
Prozent Häufigkeit 88 79 79 76 73 61 Average: 76
5102 4622 4714 4249 4295 3580
Form
standardsprl. in
Karte
-11-11-1-If -11-1-11 -11-1 -11-1-Is
-11-11-1-If -11-1-11 -11-1 -11-1-Is
192 193 199 203 195 198 197 196 201 194 200 204
Form
standardsprl. in
Karte
-r-r-r-r -r-r-
-r-r-r-r -r-r(e es)
206 210 205 208 209 207
alle fallen gestohlen zwoelf bestellt kohlen will wollte viel sollen erzaehlt als
ohren vor fahren fuer hoert waere es
T a b . 17: Nasale - Substandard = Standard (n. K D S A Bd. 1.1 u. 1. 2) Prozent Frequenz Dialektf. 95 58 Average: 77
5352 3592
-mm-m
Standardf.
Beleg
Karte
-mm-m
kommen wem
211 212
203
Substandard unter dialektologischem Aspekt Prozent Frequenz Dialektf. Standardf. 96 89 79 73 73 68 67 66 65 64 46 42 40 40 Average: 65
5466 5150 4696 4221 4254 3670 4019 3529 3765 3788 2738 2068 2360 2311
-n-n-n-n -nn -ns -n -n -ns-ns-n -n -nf -n
-n-n-n-n -nn -ns -n -n -ns-ns-n -n -nf -n
Prozent Frequenz Dialektf. Standardf. 92 91 31 Average: 71
5311 5019 1819
-nd -nd -nd
-nd -nd -nd
Prozent Frequenz Dialektf. Standardf. 89 Average: 89
4600
-ng-
-ng-
Beleg
Karte
nug(ge-) deiner braune von mann uns wein an unserm gaense sein kein fuenf mein
213 215 214 221 216 227 222 217 226 225 * 220 218 224 219
Beleg
Karte
kind pfund und
74 75 76
Beleg
Karte
faengt
229
T a b . 18: Substandard = Standard (Durchschnitt in % ) % Konkordanz Formen
Phonet. Klassifikation
Tab.
98 97 94 93 90 90 89 88 87 87 84 82 77 76 76 76 71 70 68
Bilabiale Plosive Velarer Plosiv (Fortis) Labio-dentaler Frikativ Velarer Plosiv (Lenis) Velarer Plosiv (Fortis) Labio-dentaler Frikativ Nasale Alveo-dentale Plosive Palato-alveolarer Frikativ Palataler/velarer Frikativ Palato-alveolarer Frikativ Alveo-dentale Plosive Nasale Liquide Velarer Plosiv (Lenis) Liquide Nasale Alveo-dentaler Frikativ Velarer Plosiv (Lenis)
6 11 12 10 11 12 17 8 14 15 14 7 17 16 10 16 17 13 10
b. . . kwg... -nk-ft -ng-rt -seh... -eh. . . seh... d.. . -m. . . -r. . . -rg-1. . . -nd .. .s.. . -g...
204
Werner H. Veith % Konkordanz Formen
Phonet. Klassifikation
Tab.
65 63 58 57 56 56 55 53 51 44 44 39 38
Nasale Labio-dentaler Frikativ Affrikate .. .z.. .(/ts/) Labio-dentaler Frikativ Alveo-dentaler Frikativ Alveo-dentaler Frikativ Labio-dentaler Frikativ Velarer Plosiv (Fortis) Alveo-dentale Plosive Alveo-dentale Plosive Alveo-dentale Plosive Bilabiale Plosive Bilabiale Plosive (Affrikate) Alveo-dentale Plosive Palataler/velarer Frikativ Palataler/velarer Frikativ
17 12 9 12 13 13 12 11 8 7 8 6
35 32 29 Average: 68
-n.. . -ff.. . z . . . -f(-) -s -ss(-) -rf... -chs(-) -.. .dt... .. .t-. ..b...pf-ld -ch -Ich
6 8 15 15
Tab. 19: Substandard 4- Standard (Durchschnitt in %) % Diskordanz Formen
Phonet. Klassifikation
Tab.
71 68 65 62
-Ich -ch -ld . . .pf-
15 15 8
61 56 56 49 47 45 44 43 42 37 35 32 30 29 24 24 24 23 18 16 13
-.. .bt.. . .. .t-.. .d-chs(-) -rf... -s(s(-)) -f(-) .. . z . . . -ff-n... -g... ...s... -nd -1. .. -r. .. -rg-m... d... sch... -sch...
Palataler/velarer Frikativ Palataler/velarer Frikativ Alveo-dentale Plosive Bilabiale Plosive (Affrikate) Bilabiale Plosive Alveo-dentale Plosive Alveo-dentale Plosive Alveo-dentale Plosive Velarer Plosiv (Fortis) Labio-dentaler Frikativ Alveo-dentaler Frikativ Labio-dentaler Frikativ Affrikate .. .z.. .(/ts/) Labio-dentaler Frikativ Nasale Velarer Plosiv (Lenis) Alveo-dentaler Frikativ Nasale Liquide Liquide Velarer Plosiv (Lenis) Nasale Alveo-dentale Plosive Palato-alveolarer Frikativ Palato-alveolarer Frikativ
6 6 7 8 8 11 12 13 12 9 12 17 10 13 17 16 16 10 17 7 14 14
205
Substandard unter dialektologischem Aspekt % Diskordanz Formen 13 12 11 10 10 7 6 3 2 Average: 32
-eh... -rt -ng-nk-ft g. . . wkb...
Phonet. Klassifikation
Tab.
Palataler/velarer Frikativ Alveo-dentale Plosive Nasale Velarer Plosiv (Fortis) Labio-dentaler Frikativ Velarer Plosiv (Lenis) Labio-dentaler Frikativ Velarer Plosiv (Fortis) Bilabiale Plosive
15 8 17 11 12 10 12 11 6
2.3 Ergebnisse Tab. 1 gibt die in dem KDSA-Teilband 1.2 belegten Dialektformen für standardsprachlich -ch wieder; die Häufigkeitsangabe ist an das jeweils verkartete Paradigma gebunden. Das Zeichen -/ (bzw. -/-) ist auf dieser und weiteren Tabellen als Null (Zero) zu lesen, es steht also für -0 (bzw. -0-). Der Tabelle 1 entsprechend sind die Tabellen 2 und 3 aufgebaut, welche ebenfalls die Formen des dialektalen Substandards zu einer vorgegebenen standardsprachlichen Form nennen. Aus Tab. 4 ist zu entnehmen, welche die häufigsten Formen des dialektalen Substandards für nichtanlautendes III sind, wobei dem Rechner als Bedingung angegeben worden ist, daß eine Form häufiger als 500 mal belegt sein muß; auch hier richtet sich die Häufigkeitsangabe nach dem Paradigma. Würde man die Dialektformen, die f, p, w, b und Ausfall (Null) enthalten, aufaddieren, so erhielte man die folgende Repräsentation von nichtanlautendem standardsprachlichem /{/ in dem dialektalen Substandard: f(f[t],ff,f,[r]f) 39.176 x
p(p,[r]p) 16.499 x
w(w) 1.602 x
b(b) 700 x
Ausfall 506 x
Entsprechendes gilt für die Tab. 5, welche im KDSA-Band 1.2 für standardsprachlich -ch auftretende Formen, nach Häufigkeit je Paradigma sortiert, enthält. Die Tabellen 6 bis 17 beziehen sich auf beide Teilbände (KDSA Bd. 1.1 und 1.2) und somit auf den gesamten Konsonantismus. Sie sind thematisch primär nach der Art des Konsonanten und sekundär nach der Artikulationsstelle geordnet, d. h., es werden folgende Großgruppen unterschieden: Plosive (Tab. 6 bis 11), Frikative (Tab. 12 bis 15), Sonanten (Tab. 16 und 17). Die Feingliederung in der Darstellung der Plosive und Frikative wird von der Artikulationsstelle bestimmt, und bei den Sonanten werden Liquide und Nasale unterschieden. Die Artikulationsstellen sind: bilabial (Tab. 6), labio-dental (Tab. 12), alveo-dental (Tab. 7, 8, 9, 13), palato-alveolar (Tab. 14), palatal/velar (Tab. 15), velar (Tab. 10, 11). Aspekte einer noch weiter
206
Werner H. Veith
gehenden Feingliederung sind der Verkettungsprozeß (Taxe) - ob Antaxe (Anlautverkettung), In- bzw. Abtaxe (In- bzw. Auslautverkettung) vorliegt (nach Tabellen: 7, 8; aber auch intern, z. B. Tab. 10, 11) - und der LenisFortis-Kontrast (Tab. 10, 11) sowie der Spezialfall der Affrikate (alsTabelle: 9, als Unterposten: auf Tab. 6). Diese Konkordanzlisten sind auf Tabelle 18 zusammengefaßt. Aus ihr ist zu entnehmen, daß die größte Konkordanz zwischen dialektalem Substandard und Standard in der Antaxe (der Anlautverkettung) des bilabialen Plosivs b besteht (98% Konkordanz), und die geringste (29% Konkordanz) bei demTagma -Ich. Als durchschnittliche Konkordanz werden 68% errechnet. Verallgemeinert bedeutet dies, daß der Konsonantismus der deutschen Standardsprache zu zwei Dritteln mit dem Konsonantismus des dialektalen Substandards übereinstimmt und umgekehrt daß im Bereich des Konsonantismus ein Drittel des deutschen dialektalen Substandards von dem Konsonantismus der Standardsprache abweicht. Dieses Ergebnis ist erstens unter historiolinguistischen Gesichtspunkten von einiger Wichtigkeit, da nun ein statistischer Maßstab zu dem Verhältnis von Substandard und Standard vorliegt. Offenbar ist die historiolinguistische Auszeichnung und Ausgrenzung der jetzigen (mündlichen) Standardvarietät im Vergleich zu anderen Varietäten des Deutschen nicht ohne Rückendeckung durch eine Vielzahl von Varietäten erfolgt. Die Schriftsprache basiert - trotz der bekannten Diskordanzen zwischen Schreibung und Lautung - auf der Hochsprache (als mündlicher Standardvarietät), so daß die Verallgemeinerung auf das Verhältnis von Substandard und Standard insgesamt bezogen werden kann und nicht auf die mündliche Kommunikation beschränkt ist. Das Ergebnis ist zweitens unter sprachtypologischen Gesichtspunkten wichtig, denn die Abgrenzung des Deutschen gegenüber anderen, insbesondere benachbarten Sprachen, muß sich auf den Standard und den Substandard gleichermaßen erstrecken. Dazu bemerkt Goossens (1976, 260): Alle diese sprachlichen Systeme, die wir „deutsch" nennen, weisen bestimmte Übereinstimmungen und Gegensätze auf. Für die Summe der identischen und kontrastierenden Elemente einer Reihe von verwandten Sprachsystemen verwendet die Sprachwissenschaft den Ausdruck Diasystem. Der Begriff „Deutsch" muß demnach als ein Diasystem verstanden werden. Der Begriff Diasystem ist übrigens mit U. Weinreichs bedeutendem Aufsatz in die Linguistik eingeführt worden (Weinreich 1954). Die Tabellen zeigen, daß die Systeme des Diasystems „Deutsch" formal und statistisch aufeinander bezogen sind. Sie zeigen ferner, wie die interne, formale und statistische Differenzierung des Diasystems im Bereich des Konsonantismus beschaffen ist. Der Vorteil der hier erzielten Ergebnisse besteht u.a. darin, daß der Begriff des Diasystems „Deutsch" für einen Teilbereich inhaltlich präzisiert
Substandard unter dialektologischem Aspekt
207
werden kann. Bei der Abgrenzung dieses Diasystems gegenüber anderen Diasystemen - z.B. dem niederländischen oder dänischen - könnte dies von Relevanz sein. Das Ergebnis ist drittens unter didaktischen Gesichtspunkten von Interesse. Es zeigt sich, daß der dialektale Substandard nichts vom Standard völlig Verschiedenes ist, sondern daß, statistisch gesehen, ein Konkordanzund ein Diskordanzspektrum besteht. Die Statistik ergibt folgendes Bild: Das Konkordanzspektrum (Tab. 18) und das Diskordanzspektrum (Tab. 19) beträgt jeweils 70%-Grade (wegen der Komplementarität stimmen die Zahlen 70:70 überein). Das Spektrum der Konkordanz zwischen dialektalem Substandard und Standard rangiert zwischen 98 und 29 (69 + 1 = 70) und das der Diskordanz zwischen 71 und 2 (69 + 1 = 70)%: Spektralanalyse dialektaler Substandard - Standard (Konsonantismus) Konkordanzspektrum: 70% Diskordanzspektrum: 70% maximale minimale maximale minimale Konkordanz Diskordanz 98% 29% 71% 2% Der Übergang vom dialektalen Substandard zum Standard ist also kein radikaler, sondern ein allmählicher. Ähnliches, wenngleich nicht so differenziert, hat übrigens für das Verhältnis der standardfernen zur Standardvarietät in einer Stadtsprache (Frankfurt am Main) festgestellt werden können (s. Veith 1983, 87f.). Der nicht-dialektale Substandard, d. h. die Varietäten oberhalb des Dialekts und unterhalb des Standards (wenn ein Modell mit vertikaler Komponente erlaubt ist), wird sich, wenn keine Einflüsse von außerhalb der beteiligten Systeme des Dialekts und des Standards vorliegen, zwischen den Extremen dieser Systeme bewegen — dazu vergleiche man auch die Forschungen zur deutschen Umgangssprache, zuletzt zusammengefaßt und neu konzipiert durch Munske (1983). Bei schulischen Übungen, deren Ziel die Kompensation von Fehlern ist, welche durch die Diskordanz von Standard und Substandard verursacht worden sind, ist die Kenntnis des Diskordanzpotentials einer Region didaktisch hilfreich. Solche Informationen sollen beispielsweise auch die Sprachhefte „Dialekt/Hochsprache — kontrastiv" liefern (s. Besch/Löffler/Reich 1976ff.). Die hier vorgelegten Zahlen sind dafür kein Ersatz, aber eine Ergänzung, die auf das gesamte Sprachgebiet und nicht wie bei Besch/Löffler/Reich auf einzelne Regionen der Bundesrepublik bezogen ist; Tab. 19 belegt, welche Formen Diskordanzen aufweisen, wo also Hauptschwierigkeiten für Orthophonie und Orthographie zu erwarten sind. Die folgenden Karten geben darüber hinaus eine regionale Orientierung.
208
Werner H. Veith
3. Substandard sprachkartographisch 3.1 Diskordanztypen Tab. 19 ist das Negativ von Tab. 18 und somit auch die negative Zusammenfassung der Tabellen 6 bis 17, d. h., im Vergleich zu Tab. 18 werden hier die Bereiche der Diskordanzen im einzelnen angegeben. Jeder Bereich faßt 1 bis n Karten zusammen, so daß bereits eine Typisierung vorliegt. Die Frage nach der regionalen Relevanz eventueller, verallgemeinerbarer Typen könnte sich an den Vorschlägen zur Gliederung der deutschen Dialekte orientieren (zuletzt Wiesinger 1983), da mit solchen Versuchen der Aspekt regionaler Besonderheiten besonders berücksichtigt wird. Unter sprachstatistischen Aspekten bietet sich aber auch die numerische Differenzierung an, so daß Kon- bzw. Diskordanztypen von abgestufter Ähnlichkeit bzw. Unähnlichkeit zwischen dialektalem Substandard einerseits und Standard andererseits entstehen. Die Wiedergabe von Konkordanztypen wird hier ausgespart, weil Gebiete mit Diskordanzen verkartet werden sollen, woraus sich indirekt auch die Konkordanzen ergeben, da beide Parameter komplementär sind. Tabelle 20 enthält die auf Tab. 19 basierenden Diskordanztypen zum deutschen Konsonantismus. Die Differenzierung erfolgt auf einer 10-ProzentBasis, woraus sich eine Aufteilung der 35 Items von Tabelle 19 auf sechs Typen mit mindestens vier und höchstens sieben Items pro Typ ergibt. Tab. 20: Diskordanztypen (Substandard) in % der diskordanten Belege Typl bis 9% b... 02 k03 w06 g... 07 -nk10
Typ II 10-19% -ft 10 -ng11 -rt 12 -ch... 13 -seh... 13 seh... 16 d... 18
Typ III 20-29% -m... 23 -r... 24 -rg24 -1... 25 -nd 29
Typ IV 30-39% ...s... 30 -g... 32 -n...- 35 -ff37
TypV 40-49% ...z... 42 -f(-) 43 -s(s(-)) 44 -rf... 45 -chs... 47 -...d- 49
Typ VI über 49% a) ...t... 56 -...b- 61 ...pf- 62 -ld 65 b) -ch 68 -Ich 71
Durchschnitt
Durchschnitt
Durchschnitt
Durchschnitt
Durchschnitt
Durchschnitt
disk.=6%
disk. = 13%
disk. =25%
disk.=34%
disk. =45%
disk.=64%
Substandard unter dialektologischem Aspekt
209
3.2 Kartographie der Diskordanztypen Die numerisch gefundenen Typen geben zwar Aufschluß über das Maß der Diskordanz für bestimmte Phoneme bzw. Phonemverbindungen, aber in welchen Regionen des Sprachgebiets sie auftreten, verrät nur die Sprachkarte. Daher sind die im KDSA erfaßten diskordanten Erscheinungen pro Typ auf ein Kärtchen übertragen worden, so daß die Diskordanzen lokalisierbar werden. Ein Hauptproblem ist dabei die Erfassung der Diskordanzdichte, da in manchen Regionen nur für ein oder zwei Items eines Typs Diskordanzen auftreten, in anderen Regionen dagegen für alle oder auch für kein einziges Item. Die auf Auszählungen beruhenden Gebietsgrenzen der Kärtchen sind identisch mit Diskordanz-Isoquantoren; dies sind Linien, die Punkte mit einer gleichen Zahl von Diskordanzen verbinden (zu dem Begriff der Isoquantoren in der Linguistik s. Veith 1979, 267). Auf der Karte für Typ I (Diskordanzen bis zu 10%) sind nur zwei Abstufungen unterschieden worden, auf den Karten für die Typen II bis V dagegen drei: Die Diskordanzen sind hier zahlenmäßig hoch bzw. mittel bzw. niedrig, d. h., daß für mindestens ein Item (niedrig) und für maximal alle theoretisch möglichen Items - aber abzüglich der tatsächlich nicht belegten Diskordanzen (hoch) die entsprechende kartographische Kennzeichnung erfolgt; „mittel" ist ein Zwischenwert. Lediglich bei den Diskordanzen über 50% hat wegen der großen Diskordanzdichte noch der Extremwert „sehr hoch" hinzugefügt werden müssen (Kärtchen für die Typen Via und VIb). 3.3 Ergebnisse Bei der Frage nach dem Wesen des Substandards ist untersucht worden, wie sich der dialektale Substandard und der Standard statistisch zueinander verhalten. Hinter den von der Statistik offenbarten Zahlen verbirgt sich inhaltlich die dialektale Basis des Standard als einer ausgezeichneten Varietät innerhalb des gegebenen Varietätenraumes. Die Lokalisierung der Konkordanzen ermöglicht die Beantwortung der Frage: - Welche areal fixierten Varietäten des Substandards bilden die Basis der Standardsprache? Die Lokalisierung der Diskordanzen hingegen ermöglicht auch die Beantwortung der Frage: - Welche areal fixierten Varietäten des Substandards bilden die Basis der Standardsprache nicht? Die Diskordanzen mittlerer Zahl werden auf der Kartenskizze zu Typ I im hochalemannischen Raum hauptsächlich durch die Verschiebung k- > ch- sowie b... > p. . . und -nk- > -nch- hervorgerufen, im Moselgebiet durch w- > b- sowie g... > j . . . Bei der Kartenskizze zu Typ II sind das Hochalemannische und das Westniederdeutsche auffallend diskordant: Im
210
Werner H. Veith
Hochalemannischen treffen d.. . > t..., der Ausfall von auslautendem ch, von ng (in fängt) u.a. aufeinander, im Westniederdeutschen sind es u.a. Regeln wie seh > s, ft > cht sowie die r-Metathese in dreschen und dürft. Auf der Kartenskizze zu Typ III sind der Ausfall von mm in (ge)kommen und die Besonderheit des Pronomens wem von Bedeutung, daneben Ausfall des Dentals nach n (und > un); entscheidend ist aber die Vokalisierung von / und r. Die Spirantisierung des velaren Plosivs (g > / ) , der Übergang von germ. *s zu seh (fest > fescht u.a.), der Ausfall am Wortende (Ma < Mann) bzw. vor Frikativ (fünf, Gänse) sowie die unterbliebene Verschiebung von p zu ff (Pfeffer) sind charakteristisch für die Skizze zu Typ IV. Auch bei dem Kärtchen zu Typ V ist die unterbliebene Lautverschiebung im Norden des Sprachgebiets entscheidend (sitfen statt sitzen, ut statt aus, Warer statt Wasser, slapen statt schla/en; daneben treten die Besonderheiten des Rhotazismus (müde > mir) und des Dental-Ausfalls nach Sonanten (andern > annern) sowie der Ausfall des velaren Konsonanten vor s (sechs > sess) in Erscheinung. Wegen der großen Diskordanzintensität sind für den Typ VI zwei Kartenskizzen angefertigt worden: Für Via mit vielen Besonderheiten im Bereich der Plosive (t > d, r, /, ;', g, Ausfall u. a.; b > w, Ausfall u. a.; pf > / ? , / ; Ausfall von d in bald); für VIb wegen der unterbliebenen Lautverschiebung im Norden (ich > ik) und des Spirantenausfalls im Süden (ich > i) sowie der /-Vokalisierung (vie/ > \ü u. a.) vor allem im bairisch-österreichischen Raum. Über Näheres informieren die Karten des Kleinen Deutschen Sprachatlas. Die letzte Kartenskizze liefert eine schematisierte Synopse über die Diskordanzintensität der Konsonanten insgesamt. Bei einer dreistufigen Differenzierung erweist sich die Diskordanzintensität als sehr hoch bis hoch im Westniederdeutschen, Pommerschen, Niederpreußischen sowie im Bairisch-Österreichischen und Hochalemannischen. Sie bewegt sich in mittlerer Größenordnung im Westmitteldeutschen, Niederalemannischen, z.T. Ostfränkischen und Südbairischen. Verhältnismäßig niedrig ist die Diskordanzintensität im gesamten Ostmitteldeutschen und Hochpreußischen, was umgekehrt heißt, daß hier - im Vergleich zu anderen Regionen des Sprachraums - für den Konsonantismus die größte Nähe zur Standardsprache besteht.
Ulli] mittel
ILLLLÜ
niedrig
Die Diskordanzen si nd zahlenmäßig
Sä hoch
LLLLD
mittel
QÏÏ3
Die Diskordanzen sind zahlenmäßig niedrig
d. Konsonanten v. Standard u. Dialekt sind diskordant
Typ II: 10-19%
d. Konsonanten v. Standard u. Dialekt sind diskordant
Typ I: bis 9%
Substandard unter dialektologischem Aspekt 211
M hoch M
mittel
EO niedrig
Die Diskordanzen sind zahlenmäßig 'S
hoch
^
m1ttel
ED
niedrig
Die Diskordanzen sind zahlenmäßig
d. Konsonanten v. Standard u. Dialekt sind diskordant
Typ IV: 30-39%
d. Konsonanten v. Standard u. Dialekt sind diskordant
Typ III: 20-29% 212 Werner //. Veith
ED
niedrig
ED mittel
H sehr hochfflhoch
mittel
M hoch
M
Die Diskordanzen sind zahlenmäßig
Die Diskordanzen sind zahlenmäßig
EU niedrig
d. Konsonanten v. Standard u. Dialekt sind diskordant
Typ Via: über 4 9 %
d. Konsonanten v. Standard u. Dialekt sind diskordant
T y p V : 40-49%
Substandard unter dialektologischem Aspekt 213
•
• sehr hochfflhoch
Ol
mittel
Die Diskordanzen sind zahlenmäßig ED niedrig
•
i
M hoch
d. Konsonanten v. Standard u. Dialekt sind diskordant
Typ Vlb: über 49%
DUl mittel
•
niedrig
Diskordanzintensität der Konsonanten (Schema)
214 Werner H. Veith
Substandard unter dialektologischem Aspekt
215
Literaturhinweise Ammon, Ulrich, Dialekt und Einheitssprache in ihrer sozialen Verflechtung. Eine empirische Untersuchung zu einem vernachlässigten Aspekt von Sprache und sozialer Ungleichheit, Weinheim/Basel, Beltz, 1973 (Pragmalinguistik. Bd. 3). Barnhart, C. L./Stein, Jess (edd.), [The] American College Dictionary, New York, Random/Syracuse, Singer, 1963. Bellmann, Günter, Probleme des Substandards im Deutschen, in: Mattheier, Klaus J. (ed.), Aspekte der Dialekttheorie, Tübingen, Niemeyer, 1983 (Reihe Germanistische Linguistik. Bd. 46) 105-130. Besch, Werner/Löffler, Heinrich/Reich, HansH. (edd.), Dialekt! Hochsprache-kontrastiv. Sprachhefte für den Deutschunterricht, Heft Iff., Düsseldorf, Schwann, 1976ff. Duden. Deutsches Universalwörterbuch, hg. u. bearb. v. Wiss. Rat u. d. Dudenredaktion unter Leitung v. Günther Drosdowski, Mannheim/Wien/Zürich, Duden Verlag, 1983. Duden. Etymologie. Herkunftswörterbuch der deutschen Sprache, bearb. v. Drosdowski, Günther/Grebe, Paul [u.a.], Mannheim /Wien/Zürich, Duden Verlag, 1963 (Duden. Bd. 7). Fishman, Joshua A., Soziologie der spräche. München, Hueber, 1975 (hueber hochschulreihe. Bd. 30). Glinz, Hans, Deutsche Standardsprache der Gegenwart, in: Althaus, Hans Peter/ Henne, Helmut/Wiegand, Herbert Ernst (edd.), Lexikon der Germanistischen Linguistik, Tübingen, Niemeyer, 21980, 609-619. Goebl, Hans, Dialektometrie. Prinzipien und Methoden des Einsatzes der Numerischen Taxonomie im Bereich der Dialektgeographie, Wien, Verl. d. Österr. Akad. d. Wiss., 1982. Goebl, Hans, Dialektometrische Studien. Anhand italoromanischer, rätoromanischer und galloromanischer Sprachmaterialien aus AIS und ALF unter Mitarb. v. Selberherr, Siegfried/Rase, Wolf-Dieter/Pudlatz, Hilmar, 3 Bde., Tübingen, Niemeyer, 1984 (Beih. z. Zeitschr. f. rom. Phil. 191-193). Goossens, Jan, Was ist Deutsch - und wie verhält es sich zum Niederländischen? (1971), in: Göschel, Joachim/Nail, Norbert/Van der Eist, Gaston (edd.), Zur Theorie des Dialekts. Aufsätze aus 100 Jahren Forschung. Mit biographischen Anmerkungen zu den Autoren, Wiesbaden, Steiner, 1976 (ZDL Beihefte N. F. 16). Havranek, Bohuslav, Die funktionale Schichtung der Literatursprache, in: Scharnhorst, Jürgen/Ising, Erika (edd.), Grundlagen der Sprachkultur. Beiträge der Prager Linguistik zur Sprachtheorie und Sprachpflege, Tl. 1, Berlin (DDR), Akademie-Verlag, 1976, 150-161. Hellmann, Manfred W , Deutsche Sprache in der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik, in: Althaus, Hans Peter/Henne, Helmut/ Wiegand, Herbert Ernst (edd.), Lexikon der Germanistischen Linguistik, Tübingen, Niemeyer, 21980, 519-527. Jäger, Siegfried, Standardsprache, in: Althaus, Hans Peter/Henne, Helmut/Wiegand, Herbert Ernst (edd.), Lexikon der Germanistischen Linguistik, Tübingen, Niemeyer, 21980, 375-379. Kelle, Bernhard, Bericht zum Stand der maschinellen Datenverarbeitung im Projekt „Südwestdeutscher Sprachatlas" (SSA), in: Forschungsbericht „Südwestdeutscher Sprachatlas", Marburg, Elwert, 1983 (Studien z. Dialektologie in Südwestdeutschland. Bd. 1), 35-68.
216
Werner H. Veith
Kelle, Bernhard/Platzek, Eberhard, Der Einsatz der EDV bei der Analyse von mundartlichen Lautsystemen, in: Forschungsbericht „Südwestdeutscher Sprachatlas'1, Marburg, Elwert, 1983 (Studien z. Dialektologie in Südwestdeutschland. Bd. 1), 111-155. Kleiber, Wolfgang/Kunze, Konrad/Löffler, Heinrich, Historischer Südwestdeutscher Sprachatlas. Aufgrund von Urbaren des 13. bis 14. Jahrhunderts, Bde. 1-2, Bern/ München, Francke, 1979. Klein, Wolfgang, Variation, Norm und Abweichung in der Sprache, in: Lotzmann, Geert (ed.), Sprach- und Sprechnormen - Verhalten und Abweichung, Heidelberg, Groos, 1974, 7-21. Klein, Wolfgang, Sprachliche Variation, in: Studium Linguistik 1 (1976), 29-46. Kleine, Heinrich, Die phonologischen Systeme nordelsässischer Ortsdialekte, Diss. Mainz, 1983 [in Vorher, als Beih. z. Zeitschr. f. Dialektologie u. Linguistik, Wiesbaden/Stuttgart, Steiner]. Kleiner Deutscher Sprachatlas [KDSA], Bd. 1: Konsonantismus, Tl. 1: Plosive, dialektologisch bearb. v. Veith, Werner H., computativ bearb. v. Putschke, Wolfgang u. Mitarb. v. Hummel, Lutz, Tübingen, Niemeyer, 1984 [Tl. 2: Frikative, Sonanten, Zusatzkonsonanten 1986, in Vorb.]. Löffler, Heinrich, Interferenz-Areale Dialekt/Standardsprache: Projekt eines deutschen Fehleratlasses, in: Besch, Werner/Knoop, Ulrich/Putschke, Wolfgang/Wiegand, Herbert Ernst (edd.), Dialektologie. Ein Handbuch zur deutschen und allgemeinen Dialektforschung, Berlin/New York, de Gruyter, Erster Halbband, 1982, 528-538. Mattheier, Klaus J., Pragmatik und Soziologie der Dialekte. Einführung in die kommunikative Dialektologie des Deutschen, Heidelberg, Quelle & Meyer, 1980 (UTBBd.994). Munske, Horst Haider, Umgangssprache als Sprachenkontakterscheinung, in: Besch, Werner/Knoop, Ulrich/Putschke, Wolfgang/Wiegand, Herbert Ernst (edd.), Dialektologie. Ein Handbuch zur deutschen und allgemeinen Dialektforschung, Berlin/New York, de Gruyter, Zweiter Halbband 1983, 1002-1018. Nabrings, Kirsten, Sprachliche Varietäten, Tübingen, Narr, 1981 (Tübinger Beiträge z. Linguistik. Bd. 147). Oevermann, Ulrich, Sprache und soziale Herkunft. Ein Beitrag zur Analyse schichtenspezifischer Sozialisationsprozesse und ihrer Bedeutung für den Schulerfolg, Frankfurt/M., Suhrkamp, 21972 [!1970] (edition suhrkamp. Bd. 519). Oomen, Ursula, Die englische Sprache in den USA: Variation und Struktur, Teil I, Tübingen, Niemeyer, 1982. Radtke, Ingulf, Die Umgangssprache. Ein weiterhin ungeklärtes Problem der Sprachwissenschaft, in: Muttersprache 83 (1973), 161-171. Riesel, Elise, Stilistik der deutschen Sprache, Moskau, Verl. f. fremdsprach. Lit., 2 1963. Seiffert, Helmut, Stil heute. Eine Einführung in die Stilistik, München, Beck, 1977 (Beck'sche Schwarze Reihe. Bd. 159). Stammerjohann, Harro (ed.), Handbuch der Linguistik. Allgemeine und angewandte Sprachwissenschaft, München, Nymphenburger/Darmstadt, Wiss. Buchgesellschaft, 1975. Stellmacher, Dieter, Studien zur gesprochenen Sprache in Niedersachsen. Eine soziolinguistische Untersuchung. Marburg, Elwert, 1977 (Deutsche Dialektgeographie. Bd. 82). Veith, Werner H., Zum Problem der umgangssprachlichen Unsystematik, in: Muttersprache 78 (1968), 370-376.
Substandard unter dialektologischem Aspekt
217
Veith, Werner H., Isoquantoren: Ein methodisches Hilfsmittel zur historiolinguistischen Rekonstruktion des Sprachenkontakts, in: Rauch, Irmengard/Carr, Gerald F. (edd.), Linguistic Method. Essays in Honor of Herbert Penzl ,The Hague/Paris/ New York, Mouton, 1979, 265-284. Veith, Werner H., Die Sprachvariation in der Stadt. Am Beispiel von Frankfurt am Main, in: Muttersprache 93 (1983), 82-90. Veith, Werner H., Kleiner deutscher Sprachatlas (KDSA). Dialektologische Konzeption und Kartenfolge des Gesamtwerks, in: Zeitschrift f. Dialektologie u. Linguistik 51 (1984), 295-331. Wächtler, Kurt, Geographie und Stratifikation der englischen Sprache, Düsseldorf, Bagel/Bern u. München, Francke, 1977 (Studienreihe Englisch. Bd. 16). Wahrig, Gerhard, Deutsches Wörterbuch. Mit einem „Lexikon der Sprachlehre", voll. überarb. Neuaufl., Gütersloh, Bertelsmann, 1979. Weinreich, Uriel, Is a structural dialectology possible? in: Word 10 (1954), 388^00. Wiesinger, Peter, Die Einteilung der deutschen Dialekte, in: Besch, Wemer/Knoop, Ulrich/Putschke, Wolfgang/Wiegand, Herbert Ernst (edd.), Dialektologie. Ein Handbuch zur deutschen und allgemeinen Dialektforschung, Berlin/New York, de Gruyter, Zweiter Halbband,1983, 807-900.
Zur Erforschung des Substandard English Wolfgang Viereck (Bamberg)
Die englische Sprache gibt es allenfalls in schlechten Lehrbüchern des Englischen, nicht indes in wissenschaftlicher Hinsicht. Dies gilt für das englische Mutterland und erst recht für die weltweit gesprochenen und geschriebenen Varietäten des Englischen. Allen diesen Varietäten gemeinsam ist jedoch ein gemeinsamer Kern 1 im Hinblick auf die phonologische Struktur, die Grammatik und die Lexik, der eine Grundvoraussetzung dafür bildet, daß das Englische zur Weltsprache aufsteigen konnte. Zwar gibt es Tendenzen zur Divergenz vor allem in bestimmten Regionen der Welt, in denen Englisch als Zweitsprache gesprochen wird, sie haben jedoch keineswegs zu neuen, vom Englischen unabhängigen Sprachen geführt, was Brackebusch 1868 aufgrund der weiten Verbreitung des englischen Sprachgebietes befürchtete. Die in seiner Dissertation selbstgestellte Frage "Is English destined to become the universal language of the world?" ließ Brackebusch folgerichtig offen. Die Kräfte der Konvergenz insbesondere im Bereich des geschriebenen Englisch haben sich als stärker erwiesen als die der Divergenz. Mit anderen Worten, der allen Varietäten gemeinsame Kern des Englischen hat sich erweitert. Wir können mit Quirk / Greenbaum / Leech / Svartvik (1972, 13) die synchronischen Varietäten des Englischen, weltweit gesehen, nach folgenden sechs Faktoren unterscheiden, die ihren Gebrauch bestimmen: nach der Region, aus der der Sprecher stammt, nach dessen Bildung und sozialer Position, nach der Gesprächssituation, nach dem verwendeten Medium, d.h. gesprochene gegenüber geschriebener Sprache, nach der Haltung gegenüber dem Hörer oder Leser, dem Gesprächsgegenstand oder dem Zweck der Kommunikation und schließlich nach Art und Grad der Interferenz mit anderen Sprachen. Der letztgenannte Bereich hebt sich zwar deutlich von den anderen ab, ist aber wesentlich für die Gebiete in der Welt, in denen Englisch als Zweit- oder als Fremdsprache gesprochen wird. Diese nicht-mutterprachlichen Varietäten wurden erst in den letzten Jahren als Forschungsgegenstand erkannt. Innerhalb der erwähnten Bereiche lassen sich wiederum zahlreiche Varietäten unterscheiden.
1
Der Begriff common core wurde von Charles Hockett geprägt.
220
Wolfgang Viereck
Wie in anderen Bereichen der Linguistik, so muß auch hier als beklagenswertes Faktum die Tatsache konstatiert werden, daß der Gebrauch der gleichen Termini nicht unbedingt mit dem gleichen Bedeutungsinhalt gleichzusetzen ist, den die einzelnen Forscher ihnen beimessen. Anhand der folgenden Tabelle soll versucht werden, das bisher von der Forschung Vorgebrachte ausschnitthaft zu ordnen.
Educated English
nicht-lokalisierte Varietäten des Englischen Soziolekte - Class Dialects
Die englische Sprache umfaßt bezogen auf Aussprache, Grammatik, Wortschatz und Orthographie:
bezogen auf die Aussprache:
Standard English supranational)
Received Standard (English), Received Pronunciation Z.B.Oxford Accent
Modified Standard English
bezogen auf Ausspräche und Wortschätz:
Colloquial, informal, familiar English
Nonstandard English (Uneducated English) Substandard English, Vulgar English, Popular English
Local, Regional, Accent Provincial Dialect, Regiolekt « « < lokalisierte Varietäten des Englischen
Die Pfeile zwischen den jeweiligen Bereichen, die nicht als absolut zu verstehen sind, sollen fließende Übergänge andeuten, und zwar in beiden Richtungen. Das gilt nicht nur zwischen Standard English und Modified Standard English, sondern auch zwischen Modified Standard English und Substandard English bzw. Local/Regional Dialect, vor allem aber zwischen den beiden letztgenannten Bereichen. Unsere tabellarische Darstellung folgt außerlinguistischen Überlegungen. Rein linguistisch betrachtet, müßte das Nonstandard English (im Sinne von Local bzw. Regional Dialect) dem Standard English nebengeordnet und nicht untergeordnet sein, da es sich bei ersterem ebenfalls um ein völlig ausgeprägtes und eigenständiges System handelt, dessen Erforschung zum Verständnis des Phänomens Sprache zumindest ebenso wichtig, wenn nicht gar wichtiger ist, als die der langsam, durch außerlinguistische Faktoren begünstigt, aus einem regionalen Dialekt entstandenen und im Laufe der Entwicklung in ein Regelkorsett eingezwängten Hochsprache. Wertungen von Sprechern des Standard English, die im Nonstandard English etwas Negatives,
Zur Erforschung des Substandard English
221
gar eine korrupte Form gegenüber dem Standard English sehen, sind andererseits auch heute noch ein Faktum von erheblicher sozialer Tragweite und können nicht ignoriert werden. (Zu diesbezüglichen, auf den regionalen Dialekt bezogenen Aussagen vgl. Viereck 1966, 44f.). Innerhalb der bildungsmäßigen und sozialen Differenzierung des Englischen steht somit faktisch ein supranationales Standard English (dem regionsbedingt mehrere national standards zuzuordnen sind) am oberen Ende der sozialen Skala - mit der Received Pronunciation (RP) als Aussprachenorm, die nach Aussage von Hughes /Trudgill 1979,3 indes nur mehr von etwa 3 % der Bevölkerung gesprochen wird. Wesentlich ist, daß selbst die RP nicht monolithisch ist. A. C. Gimson (1980,91) unterscheidet innerhalb der RP drei generationsbedingte Typen, das conservative RP, das general RP und das advanced RP. Am unteren Ende unserer Skala ist das Nonstandard English anzusiedeln , ein Terminus, der gelegentlich als übergeordneter Begriff für Local bzw. Regional Dialect und Substandard English gebraucht wird. Während das Oxford English Dictionary (1933) dialect 1577 erstbelegt, verzeichnet es weder substandard noch non-standard. Im zweiten Supplementband dieses Wörterbuches (1976) wird non-standard bis 1924 zurückgeführt (und dessen weitere Verwendung übrigens auch mit einem Beispiel aus einem unserer Beiträge belegt). Ob substandard in unserem Jahrhundert früher gebildet wurde, wie dies Lehnert 1981,5 angibt, wird erst der Eintrag im bislang noch nicht erschienenen 4. und letzten Supplementband des Oxford English Dictionary zeigen. Die früheren Ausdrücke für die euphemistische Bezeichnung Substandard English stammen aus dem 16. Jahrhundert (barbarous English) und dem 17. Jahrhundert (vulgar English, popular English und uncultivated English). Unsere Tabelle macht im Bereich des Nonstandard English enge Verzahnungen deutlich. Das große Webster's Third New International Dictionary of the English Language (31961, 1971) zeigt diese ebenfalls, wenngleich in nicht ganz deckungsgleicher Weise. Es definiert die hier wesentlichen Begriffe dialect, nonstandard und substandard folgendermaßen: Dialect ist "a local or regional variety of a language chiefly oral and orally transmitted and differing distinctively in vocabulary, grammar, and pronunciation from other local or regional varieties and from the standard language" (s. v. ' 2 dialect', l a ) . Nonstandard heißt "of language: not conforming in pronunciation, grammatical construction, idiom, or choice of word to the usage generally characteristic of educated native speakers of the language" (s. v. 'nonstandard', 2), und substandard bedeutet "conforming to a pattern of linguistic usage existing within a speech community but not that of the prestige group in that community in choice of word (as set, for sit), form of word (as brung, for brought), pronunciation (as twicet, for twice), grammatical construction (as the boys is growing fast), or idiom (as all to once, for all at once)" (s. v. ' Substandard', b.).
222
Wolfgang Viereck
Somit definiert Webster nonstandard und substandard — im Gegensatz zu dialect — deckungsgleich eindimensional sozial. Als Zeuge für die im Vergleich auch zu unserer Tabelle dritte Möglichkeit, daß nonstandard auch mit dialect gleichgesetzt werden kann, mag Blake 1981 dienen. Nicht nur die Zuordnung von nonstandard (zu substandard und/oder dialect) bereitet Schwierigkeiten, dies gilt auch für eine Trennung von Substandard English und Dialectal English. Wie nicht zuletzt die Definitionen des Webster zeigen, besteht ein wichtiger Unterschied in der Eindimensionalität des Substandard English gegenüber der Zweidimensionalität des Dialectal English. Daß lokaler bzw. regionaler Dialekt auch sozial stratifiziert sein kann, hatte bereits Joseph Wright erkannt, der 1905 bemerkte: " . . . even the pronunciation of natives differs considerably in the same district according to their social rank, for the working classes have their social scales, just as the upper classes" (S. VI). Aus alledem resultiert einmal die wichtige Erkenntnis, daß Dialectal English sehr wohl auch die Norm sein kann, d. h. richtig vom Standpunkt des Dialekts 2 , Substandard English hingegen nie, da es immer im Zusammenhang mit dem Standard English und mit den sozial stigmatisierten Abweichungen von dieser Norm zu sehen ist. Zum anderen ergibt sich aus obigem, daß das Dialectal English ein selbständiges linguistisches System darstellt — im Gegensatz zum Substandard English, wo es sich jeweils nur um einzelne Abweichungen vom Standard English handelt, die von Sprechern des Standard English als negativ und falsch eingestuft werden. Es wurde bereits darauf hingewiesen, daß die Standard EnglishSprecher, die bekanntlich situationsbedingt mehrere sprachliche Register ziehen können, die gleiche Einschätzung auch den Dialekten in England entgegenbringen. Für sie stehen Sprecher des Substandard English und des Dialectal English auf sozial gleich niederer Stufe. Da, wie M. Lehnert 1981,22 treffend bemerkt, beide Bereiche "weitgehend den gleichen Bedingungen, Tendenzen und Triebkräften" unterliegen, wird verständlich, daß "die englischen Mundarten viele sprachliche Erscheinungen mit dem Substandard English gemein [haben], die sie gleicherweise vom Standard English abheben" (loc.cit.). So gesehen, erscheinen die erwähnten Unterschiede zwischen Substandard English und Dialectal English sekundär. Lehnert 1981 versucht zu trennen, was sein Lehrer Horn noch gleichsetzte. Bei Horn lesen wir: „Heute besteht eine tiefe Kluft zwischen der Hochsprache und der Londoner Stadtmundart, der Vulgärsprache. Zwar wird die Vulgärsprache immer von neuem von der Hochsprache beeinflußt, aber ein Einfluß der Vulgärsprache auf die Hochsprache ist heute nicht mehr da" (1944,6). In Parenthese sei hier vermerkt, daß der letzte Teil 2
Blake 1981,20 bemerkt treffend, daß bei Werken, die durchgängig im Dialekt geschrieben sind, "the dialect is thus the standard". Leider wird dieser Bereich in Blakes Untersuchung völlig ausgeklammert.
Zur Erforschung des Substandard English
223
dieser Aussage selbst dann unrichtig ist, wenn man - wie Horn — Local Dialect mit Vulgar English gleichsetzt. Kürzlich hat sich Lehnerts Schüler Arnold mit der Substandard EnglishProblematik befaßt. Er führt aus: "The sociolect Substandard] E[nglish] and the regional dialects .. . are not mutually exclusive and it is difficult to distinguish exactly between both varieties in all cases . . . In principle, however, we consider to be dialectal what is limited to smaller parts of the linguistic territory while we regard as SubE what is supraregional, i. e. phenomena spread over the whole or almost the whole area" (1982,8). Arnolds Abgrenzungskriterium ist sehr vage. Als Beispiele für Substandard English führt er folgende an: das demonstrative Adjektiv them (in them days für Standard English in those days), doppelte Adjektivsteigerungen vom Typ worser, Gebrauch des unbestimmten Artikels a z.B. in a apple anstatt Standard English an apple, Verallgemeinerung der Past Tense-Form was für alle Personen, z.B. in we was all quiet a while anstatt Standard English we were, den Gebrauch von as als Relativpronomen (z. B. in aching in a place as never hurt anstatt Standard English that) sowie die Aussprache von -ing als /-in/ anstatt Standard English /-irj/. Wenn Arnold behauptet: "In contrast to the regional dialects British SubE has been investigated only very little so far . . . " (loc.cit.) und neben Lehnerts Akademieschrift von 1981 nur noch das Kapitel "Die Vulgärsprache" bei Storm 21896 anführt, so ist dies ausgesprochen irreführend. Die von Arnold aufgeführten Beispiele sind allesamt als regionalsprachliche Merkmale in zahlreichen Arbeiten genannt worden, z. B. in Wrights English Dialect Dictionary (1898-1905). Die Beispiele entsprechen zwar Arnolds Kriterium, was er indes erst feststellen konnte, nachdem er Wrights Wörterbuch und ähnliche Werke, die die regionale Verbreitung der Merkmale liefern, konsultiert hatte. Die Merkmale, die am weitesten verbreitet sind, werden dann zu Phänomenen des Substandard English umfunktioniert. Es kann somit nicht wunder nehmen, daß dieselben, der Literatur entnommenen Merkmale bei Lehnert 1981 als Substandard English, bei Blake 1981 hingegen als dialektale Merkmale behandelt werden. Noch überraschender wird Arnolds magerer Forschungsbericht zum Substandard English angesichts der Tatsache, daß er die Merkmale, die im Rahmen der Untersuchungen zur sozialen Stratifikation des Englischen in (großen) amerikanischen und englischen Städten z. B. von Labov 1966 und Trudgill 1974 als für die unteren Schichten kennzeichnend festgestellt wurden, zum Substandard English zählt. So gesehen, ist das Substandard English auf den britischen Inseln und in den USA unter zusätzlicher Berücksichtigung des bereits erwähnten regionalsprachlichen Aspekts nämlich schon erfreulich intensiv untersucht worden. Nur hat sich für die von Labov und seinen Nachfolgern praktizierte Art von Untersuchung die Bezeichnung
224
Wolfgang Viereck
social dialectology im anglo-amerikanischen Raum durchgesetzt, und wir sehen keinen Anlaß, von diesem Ausdruck abzuweichen. Es hat wenig Sinn, terminologisch gegen den Strom zu schwimmen, zumal dann, wenn keine Kriterien angegeben werden können, die einzelne Bereiche zweifelsfrei gegeneinander abgrenzen. Hinzu kommt eine behutsame Änderung der Einstellung sprachlichen Formen gegenüber. Normen beginnen, etwas aufzuweichen, und gegenüber Formen, die der oberen Norm nicht entsprechen, macht sich eine gewisse Toleranz bemerkbar. Dies ist zweifelsohne ein langer Prozeß. Diese gesellschaftsbedingte Änderung zeigt sich nicht zuletzt auch in der Verwendung neutralerer Termini. Die Bezeichnungen Vulgar English bzw. Vulgärenglisch sind heute, wenn sie sich nicht auf den Tabu-Bereich beziehen, zum einen unzeitgemäß, zum andern gilt das, was später zum Substandard English und Nonstandard English gesagt wird. Die letzte wichtige sprachwissenschaftliche Arbeit - sie gehört zugleich zu den frühen soziolinguistischen Untersuchungen in den USA, deren Wert nicht hoch genug eingeschätzt werden kann —, die die Bezeichnung "vulgar" English noch verwendet - bezeichnenderweise mit Anführungszeichen - ist Fries 1940. Er führt aus: "'Vulgar' as here applied to English must not be taken to mean 'offensive to good taste'; it stands simply for a type of English that is as nearly 'illiterate' as writing may become and still fulfill the function of communication" (1940,29, Fn.8). Zu den formalen Kriterien, die Fries in den untersuchten Briefen für diese Kategorie vorfand, äußert er sich folgendermaßen: "These were matters of spelling, capitalization, and punctuation which clearly demonstrated that the writer was not accustomed to writing at all, that he was semi-illiterate. For this purpose mere accidental misspellings were not considered, but the habitual misspelling of eight or ten simple words was regarded as significant when joined with the evidence from capitalization (lower case letters for the pronoun / and the initial letters of the names of towns and persons), and with the evidence from punctuation (no sentence end punctuation of any kind in a letter of more than two hundred words). Such, for example, was the situation in a letter from 8005. The word know was spelled 'no' all six times it was used; 'rote for wrote, three times; lrong' for wrong, twice; 'crecf for correct] 'pradé for parade; chu' for who; 'anoff for enough; 'parencê for parents; 'nervicé for nervous" (1940,30). Dieser Bereich verdient ohne Zweifel weitere Beachtung. Er hängt eng mit den Bereichen des Lexikons zusammen, wo zum einen Personen ihre mangelhafte Bildung durch falschen Gebrauch sog. „Tintenfaßwörter" (inkhornisms) oder durch Entstellungen von aus dem Griechischen und Lateinischen stammenden hard words zum Ausdruck bringen. Da Mrs. Malaprop in Sheridans The Rivals (1775) zu denen gehörte, die solche langen Wörter gewöhnlich falsch anwendete (z. B. in "as headstrong as an allegory on the
225
Zur Erforschung des Substandard English
banks of the Nile"), wird dieses Faktum als malapropism bezeichnet. Für Entstellungen von hard words gibt es genügend Beispiele in der Literatur, die noch einer systematischen Erforschung harren. Ein Bereich innerhalb des Lexikons verdient indes besondere Aufmerksamkeit, den Arnold 1982,8 - im Gegensatz zu Lehnert 1981 - überraschenderweise völlig ausklammert, nämlich der des Slang, für den es keine genaue Entsprechung im Deutschen und im Französischen gibt. Webster definiert diesen Terminus folgendermaßen: " 1 : language peculiar to a particular group: as a: the special and often secret vocabulary used by a class (as thieves, beggars) and usually felt to be vulgar or inferior . . . b: the jargon used by or associated with a particular trade, profession, or field of activity; 2: a non-standard vocabulary composed of words and senses characterized primarily by connotations of extreme informality and usually a currency not limited to a particular region and composed typically of coinages or arbitrarily changed words, clipped or shortened forms, extravagant, forced, or facetious figures of speech, or verbal novelties usually experiencing quick popularity and relatively rapid decline into disuse" (s. v. ' 3 slang'). Diese Definitionen machen deutlich, daß der Slang aus mehrfachen Gründen untersuchenswert ist: z.B. aus rein linguistischen im Hinblick auf Wortbildungstypen, die in diesem Bereich besonders produktiv sind (auf diesem Gebiet verdanken wir Soudek 1967 wichtige Einsichten), im Hinblick auf Neologismen allgemein, im Hinblick auf semantische Eigentümlichkeiten oder aus diachron-sozialen Gründen. Viele ursprüngliche Slang-Wörter sind (meist langsam) bis hin zum Standard English aufgestiegen. Rot 1973,13f., versucht, diesen Aufstieg folgendermaßen schematisch darzustellen, wobei ein Slang-Ausdruck einen Ausdruck des Standard English ersetzen kann: The first stage: A1 is the standard usage, A2 is slang: S Y S T E M
STRUCTÜRE
STANDARD
WRITTEN
A1
SPOKEN A2
SLANG
The second stage: A1 is the standard usage, A2 penetrates into the structure of the language (uncodified variations): S Y S T E M
STRUCTÜRE
STANDARD
WRITTEN SPOKEN
SLANG
A1 A2
226
Wolfgang Viereck
The third stage: A1 is the standard usage, A2 penetrates into the spoken standard: S Y S T E M
STRUCTÜRE
STANDARD
WRITTEN SPOKEN
A1 A2
SLANG
The fourth stage: A1 and A2 are co-functional standards: S Y S T E M
STRUCTÜRE
STANDARD
WRITTEN
A1 A2
SPOKEN SLANG
The fifth stage: A1 is restricted to the sphere of the written standard (archaism), A2 becomes the sole standard: S Y S T E M
STRUCTÜRE
STANDARD
WRITTEN
A1
A2
SPOKEN SLANG
Es wäre nun wichtig, die Nützlichkeit dieser theoretischen Schematisierung anhand von Beispielen praktisch zu belegen. Im Gegensatz zu der Auffassung Arnolds 1982,5 ergibt sich aus dem bislang Dargelegten folgerichtig, daß eine Zusammenfassung der unteren sozialsprachlichen und regionalsprachlichen Komponenten unter der neutraleren Bezeichnung Nonstandard English am sinnvollsten ist. Abgesehen von der bei lb gegebenen Definition von Slang, die aus unserem Rahmen fällt, können alle diskutierten Bereiche und deren sprachliche Merkmale unter diesem Etikett unschwer subsumiert werden. Wie schon erwähnt, wird Nonstandard English bereits gelegentlich in diesem Sinne gebraucht. Diese Verwendungsweise wird sich weiter durchsetzen. Sie macht den Begriff Substandard English überflüssig, geht hingegen nicht zu Lasten des Begriffs Dialect, dessen Beibehaltung weiter oben linguistisch begründet wurde. Einige Aspekte, denen sich die Forschung näher widmen sollte, wurden bereits genannt. Dazu gehört auch eine ständige Beobachtung der stets im Wandel begriffenen Sprache. Einmal ist beim Nonstandard English ein fortwährender Nivellierungsprozeß zu beobachten, zum anderen gibt es beim
Zur Erforschung des Substandard English
227
Statuswandel von Wörtern auch regionale Gesichtspunkte zu beachten. Letzteres zeigte sich nirgends deutlicher als bei der kontroversen Debatte über ain't im Anschluß an das Erscheinen der 3. Auflage des großen Webster (1961). Einerseits gibt es einen deutlichen Statusunterschied bei diesem Wort zwischen dem britischen und dem amerikanischen Englisch, andererseits gehört ain't (als Kontraktion von am not, are not, is not) auch zum Standard des Englischen der amerikanischen Südstaaten. Die Untersuchung des Nonstandard English hat neben bedeutsamen praktischen Implikationen für den Unterricht in der Schule auch solche für die Theorie. Hier ist die bedauerliche Tatsache zu konstatieren, daß die Einsichten der theoretischen Linguistik fast ausschließlich auf einer Beschreibung des Standard English beruhen; das Nonstandard English bleibt weitgehend ausgeklammert. Aussagen wie die folgende sind noch viel zu selten: "I have chosen a construction from non-standard spoken English, not only because of its own intrinsic interest in relation to the general topic of my article but also in an attempt to redress the descriptive linguistic balance, as it were, because of the overconcentration on middle class written standard language as the basis of theorizing about grammatical matters" (Lodge 1979,169). Daß die Einbeziehung des Nonstandard English für die linguistische Theorie ebenso wichtig ist wie die des Standard English, soll abschließend an einigen Beispielen gezeigt werden. Chomsky / Halle (1968) präsentieren einen komplizierten Regelapparat, der die phonologischen Prozesse „des Englischen" darstellen soll. Im Vorwort ihres Buches heißt es: "It seems to us that the rules we propose carry over, w i t h o u t m a j o r m o d i f i c a t i o n , to m a n y o t h e r d i a l e c t s of E n g l i s h , though it goes without saying that we have not undertaken the vast and intricate study of dialectal variation. For reasons that we will discuss in detail, it s e e m s to us very likely that the underlying lexical (or phonological) representations must be common to all English dialects, with r a r e e x c e p t i o n s , and that much of the basic framework of rules must be common as well. Of course, this is an empirical question, which must be left to future research" (S.X, unsere Hervorhebung). Ganz abgesehen davon, daß die postulierten Regeln noch nicht einmal zum Generieren des gesamten Wortschatzes des Standard English ausreichen, wie wir an anderer Stelle (Viereck 1973) gezeigt haben, haben die im Zitat anzutreffenden vagen Vermutungen bis heute keinerlei Substantiierung erfahren. Sie dienten indes als Ausgangspunkt für jahrelange zum Teil erregte Debatten über eine panlektale oder polylektale Grammatik des Englischen. Auch Labovs theoretische Einsichten über die Universalität gewisser Formen und Funktionen dürften bei genügender Berücksichtigung des Nonstandard English Änderungen erfahren. So bemerktTrudgill 1983,19 bei der
228
Wolfgang Viereck
Diskussion der in den schottischen West Highlands auftretenden Form Where's my book? — Ah, here it's zu recht: "It causes great difficulties . . . for Labov's (1969) thesis on copula deletion and reduction in English". E d w a r d s / Trudgill / Weltens 1984,31 führen aus: " O u r own survey, for instance, included literature which challenges Labov's (1972) assertion that negative attraction . . . is a general and compelling rule of English which is equally binding on all dialects" 3 . All dies ist ein weites Feld. Theorien werden häufig vorschnell aufgestellt. Sie müssen sich indes an D a t e n b e w ä h r e n , die die gesamte Sprachwirklichkeit umfassen.
Bibliographie Arnold, Roland, On the social variability of English: Problems of investigating substandard English, in: Arnold, Roland/Neubert, Albrecht (edd.), Englisch heute: Vorträge der sprachwissenschaftlichen Arbeitstagung anläßlich des 100. Jahrestags der Anglistik in Greifswald am 4. und 5. Mai 1981, Linguistische Studien, Reihe A - Arbeitsberichte 100 (1982), 2 - 2 2 . Blake, Norman F., Non-standard Language in English Literature, London, André Deutsch, 1981. Brackebusch, W., Is English destined to become the Universal Language of the World?, Diss. Göttingen, 1868. Chomsky, Noam/Halle, Morris, The Sound Pattern of English, New York/Evanston/ London, Harper & Row, 1968. Edwards, V. K./Trudgill, R/Weltens, B., The Grammar of English Dialect: A Survey of Research, London, Economic and Social Science Research Council, 1984. Fries, Charles C , American English Grammar. The Grammatical Structure of Presentday American English with especial Reference to Social Differences or Class Dialects, New York, Appleton-Century-Crofts, 1940. Gimson, A . C . , An Introduction to the Pronunciation of English, London, Edward Arnold, 31980. Harris, John, The underlying non-identity of English dialects: a look at the HibernoEnglish verb phrase, Belfast Working Papers in Language and Linguistics 6 (1982), 1-36. Horn, Wilhelm, Mundart und Hochsprache in England, Archiv für das Studium der Neueren Sprachen 99 (1944), 2 - 1 0 . Hughes, Arthur/Trudgill, Peter, English Accents and Dialects. An Introduction to Social and Regional Varieties of British English, London, Edward Arnold, 1979. Labov, William, The Social Stratification of English in New York City, Washington, Center for Applied Linguistics, 1966. 3
"In standard English — as in many other varieties of English — there is a rule that transforms indeterminate any- + negative verb into no- + positive verb, e. g. Anyone won't go -> No-one will go . . . Apparently this rule does not apply to Irish English, as Harris (1982) shows, e. g. Anyone wasn't any good at it at air (Edwards/Trudgill/Weltens 1984, 18).
Zur Erforschung des Substandard English
229
Labov, William, Contraction, deletion, and inherent variability of the English copula, Language 45 (1969), 715-762. Labov, William, Where do grammars stop?, in: Shuy, Roger W (ed.), Sociolinguistics: Current Trends and Prospects, 23rd Annual Round Table, Washington, D . C . , Georgetown University Press 1972 [1973], 43-88. Lehnert, Martin, Substandard English, Berlin, Akademie-Verlag, 1981. Lodge, K., A three-dimensional analysis of non-standard English, Journal of Pragmatics 3 (1979), 169-195. The Oxford English Dictionary, being a corrected re-issue with an Introduction, Supplement, and Bibliography of A New English Dictionary on Historical Principles, edd. Murray, James A. H./Bradley, Henry/Craigie, W A./Onions, C.T., Oxford, Clarendon Press, 1933. Quirk, Randolph/Greenbaum, Sidney/Leech, Geoffrey/Svartvik, Jan,/4 Grammar of Contemporary English, London, Longman, 1972. Rot, Alexander, Problems of Modern British and American Slang, Budapest, 1973. Soudek, Lev, Structure of Substandard Words in British and American English, Bratislava, 1967. Storm, J., Englische Philologie, I, 2, Leipzig, 21896. A Supplement to the Oxford English Dictionary, ed. Burchfield, R. W , Vol. II: H-N, Oxford, Clarendon Press, 1976. Trudgill, Peter, The Social Differentiation of English in Norwich, Cambridge, Cambridge University Press, 1974. Trudgill, Peter, On Dialect: Social and Geographical Perspectives, Oxford, Basil Blackwell, 1983. Viereck, Wolfgang, Phonematische Analyse des Dialekts von Gateshead-upon-Tynel Co. Durham, Hamburg, Cram, de Gruyter, 1966. Viereck, Wolfgang, Funktionale und generative Phonologie, Hamburger Phonetische Beiträge 9 (1973), 145-163. Webster's Third New International Dictionary of the English Language, ed. Gove, Philip Babcock, Springfield, Mass., G. & C. Merriam Comp., 31961, 1971. Wright, Joseph, The English Dialect Dictionary, 6 Bde., Oxford/London etc., Henry Frowde, 1898-1905. Wright, Joseph, The English Dialect Grammar, Oxford/London etc., Henry Frowde, 1905.

![Sprachlicher Substandard II: Standard und Substandard in der Sprachgeschichte und in der Grammatik [Reprint 2017 ed.]
9783110935820, 9783484220447](https://ebin.pub/img/200x200/sprachlicher-substandard-ii-standard-und-substandard-in-der-sprachgeschichte-und-in-der-grammatik-reprint-2017nbsped-9783110935820-9783484220447.jpg)
![Psychologische Effekte sprachlicher Strukturkomponenten [Reprint 2021 ed.]
9783112535585, 9783112535578](https://ebin.pub/img/200x200/psychologische-effekte-sprachlicher-strukturkomponenten-reprint-2021nbsped-9783112535585-9783112535578.jpg)
![Psychologische Effekte sprachlicher Strukturkomponenten [Reprint 2021 ed.]
9783112473948, 9783112473931](https://ebin.pub/img/200x200/psychologische-effekte-sprachlicher-strukturkomponenten-reprint-2021nbsped-9783112473948-9783112473931.jpg)
![Psycholinguistische Einheiten und die Erzeugung sprachlicher Äusserungen [Reprint 2021 ed.]
9783112581148, 9783112581131](https://ebin.pub/img/200x200/psycholinguistische-einheiten-und-die-erzeugung-sprachlicher-usserungen-reprint-2021nbsped-9783112581148-9783112581131.jpg)


![Verletzende Worte: Die Grammatik sprachlicher Missachtung [1. Aufl.]
9783839405659](https://ebin.pub/img/200x200/verletzende-worte-die-grammatik-sprachlicher-missachtung-1-aufl-9783839405659.jpg)
![Countering the Problem of Falsified and Substandard Drugs [1 ed.]
9780309269407, 9780309269391](https://ebin.pub/img/200x200/countering-the-problem-of-falsified-and-substandard-drugs-1nbsped-9780309269407-9780309269391.jpg)