Romantheorie in der Aufklärung: Thesen und Texte zum Roman des 18. Jahrhunderts in Frankreich [Reprint 2021 ed.] 9783112481325, 9783112481318
198 75 81MB
German Pages 342 [348] Year 1985
Recommend Papers
![Romantheorie in der Aufklärung: Thesen und Texte zum Roman des 18. Jahrhunderts in Frankreich [Reprint 2021 ed.]
9783112481325, 9783112481318](https://ebin.pub/img/200x200/romantheorie-in-der-aufklrung-thesen-und-texte-zum-roman-des-18-jahrhunderts-in-frankreich-reprint-2021nbsped-9783112481325-9783112481318.jpg)
- Author / Uploaded
- Rolf Geißler
File loading please wait...
Citation preview
Rolf Geißler
Romantheorie in der Aufklärung
Literatur und Gesellschaft Herausgegeben von der Akademie der Wissenschaften der DDR Zentralinstitut für Literaturgeschichte
Rolf Geißler Romantheorie in der Aufklärung Thesen und Texte %um Roman des 18. Jahrhunderts in Frankreich
Akademie-Verlag • Berlin 1984
Erschienen im Akademie-Verlag, DDR - 1086 Berlin, Leipziger Straße 3 - 4 © Akademie-Verlag Berlin 1984 Lizenznummer: 202 • 100/181/83 Printed in the German Democratic Republic Gesamtherstellung: IV/2/14 VEB Druckerei „Gottfried Wilhelm Leibniz", 4450 Gräfenhainichen • 6158 Lektor: Otto Matthies LSV 8051 Bestellnummer: 754 184 0 (2150/83) 01400
Inhalt
7
Vorbemerkung des 18. Jahrhunderts in Frankreich
15
Stationen auf dem Wege zur Legitimation des Romans . . . 1. Versuch einer historischen Fundierung: Pierre-Daniel Huet (1670) 2. Neues Wirklichkeitsverhältnis und „Proskription" der Romane (1737) 3. Zwischenbilanz der Debatten : Abbé Irailh (1761) . . 4. Die Geschichte des Genres in neuer Sicht: Jean-François Marmontel (1787)
15
Thesen zur Romantheorie
Der Roman als Medium der Wirklichkeitserkenntnis . . . 1. Die Erkundung der menschlichen Psyche: „science de l'homme" 2. Die Erschließung neuer Wirklichkeitsbereiche der Gesellschaft: „tableau des mœurs" Wirkungsstrategie der Aufklärung und Darstellungsformen im Roman 1. Der Roman als einträgliches Handelsobjekt . . . . 2. Wirklichkeitsveränderung als programmatische Funktionssetzung 3. Illusion, Identifikation, Emotion als Rezeptionsbedingungen . 4. Wirklichkeit und Idealmodell Der Roman im Kontext der literarischen Gattungen . . . . 1. Roman und Geschichtsschreibung 2. Roman und Epos 3. Roman und Theater
15 21 29 32 40 41 53 68 68 73 77 86 94 96 102 108 5
Texte zur Romantheorie Simon-Augustin
des 18. Jahrhunderts in Frankreich
.
Irailh
Die Romane (1761) Jean-Jacques
121
121
Rousseau
Vorwort zu „Julie" oder Gespräch über die Romane (1761)
132
Denis Diderot Lobrede auf Richardson (1762)
158
Nicolas-Thomas Barthe Die Romane (1769)
175
Louis-Sébastien Mercier Romane (1784)
192
Pierre-Ambroise-François Choderlos de Laclos Über den Roman „Cäcilia" (1784)
196
Jean-François
Marmontel
Versuch über die Romane aus moralischer Sicht (1787) . . .
200
Donatien-Alphonse-François de Sade Betrachtungen über den Roman (1801)
240
Anne-Louise-Germaine de Staël Versuch über die Dichtungen (1795)
260
Anmerkungen
zu den Thesen
284
Anmerkungen
zu den Texten
307
Personenregister
334
Vorbemerkung
Kein literarisches Genre hat im Zeitalter der Aufklärung in Frankreich einen solchen quantitativen und qualitativen Aufschwung genommen und eine für damalige Verhältnisse so weite Verbreitung gefunden wie der Roman. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts noch als regellos und unmoralisch geschmäht und von der offiziellen Poetologie ignoriert, wurde der Roman bereits gegen Ende desselben Jahrhunderts von namhaften Vertretern der Literatur in Frankreich wie auch in Deutschland als das zeitgemäße literarische Genre anerkannt, welches sich in mancherlei Hinsicht den traditionellen Gattungen des Epos, der Tragödie und der Komödie als überlegen erweise. Der Roman hatte damit jenen Rang erworben, den er in den europäischen Literaturen bis heute behaupten und festigen konnte. Den deutschsprachigen Lesern unserer Gegenwart sind allerdings aus der Vielzahl französischer Romane der Aufklärung meist nur noch wenige Glanzleistungen bekannt, die sich mit Namen wie Le Sage, Montesquieu, Prévost, Voltaire, Choderlos de Laclos und besonders Diderot verbinden. Doch nicht um eine Darstellung der Geschichte des französischen Aufklärungsromans, die durch zahlreiche, vor allem auch vergessene Werke zu dokumentieren wäre, geht es in unserem Band. Im Blickpunkt stehen hier vielmehr die leidenschaftlichen und kontroversen Diskussionen, die den Aufstieg des umstrittenen Genres im 18. Jahrhundert begleiteten und in denen engagierte Romanautoren ihre Intentionen und Vorstellungen oder interessierte Leser ihre Meinungen und Leseeindrücke, ihre Zustimmung und ihre Kritik artikulierten und begründeten. Diese Debatten sind ein wichtiger Zugang zum Verständnis der Romanentwicklung in jener Zeit und darüber hinaus von Literaturprozessen überhaupt. Sie geben u. a. Aufschlüsse über die darstellerisch-ästhetischen Probleme, die die Verfasser von Romanen bewegten und deren Lösung sie anstrebten. Sie zeigen, gegen welche 7
Widerstände sich das neue Genre durchzusetzen hatte, bis es literarisches Bürgerrecht erlangte. Vor allem aber vermitteln sie auch Erkenntnisse über die soziale und bewußtseinsbildende Funktion der Romane, für die die formulierten Wirkungsabsichten der Autoren und die lebhaften Reaktionen der Leser gleichermaßen Indizien liefern. Während in der Forschung der letzten zwei Jahrzehnte Untersuchungen zum französischen Roman wie auch kritische Textausgaben in wachsender Zahl zu verzeichnen waren, fanden jedoch die Bemühungen um die theoretische Fundierung des Genres, um die Bestimmung seiner Bedeutung und Funktion im Zeitalter der Aufklärung bisher weniger Beachtung.1* So fehlt bislang auch noch eine umfassende Dokumentation zur Romantheorie des 18. Jahrhunderts in Frankreich, wie sie z.B. für den englischen und den deutschen Roman erarbeitet wurde.2* Bibliographisch erfaßt und erstmals ausgewertet wurde zwar ein großer Teil der einschlägigen französischen Texte bereits 1925 von Daniel Mornet. In seiner mit positivistischer Akribie verfaßten Überblicksdarstellung der Romandiskussionen beschränkte er sich jedoch darauf, Hauptprobleme zu skizzieren. Die neuen Akzente in den moralischen, sozialen und gesellschaftlichen Fragestellungen sowie ihr produktives Verhältnis zum bürgerlichen Emanzipationsprozeß und zur Aufklärung als dessen ideologischem Ausdruck bleiben außerhalb seiner Betrachtungen. Unter diesem Blickwinkel wurden z. B. die Romankonzepte der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts als uninteressant abgetan.3 Auch Georges May grenzte seine fundamentale Untersuchung zum Verhältnis von französischer Romanentwicklung und Kritik im 18. Jahrhundert (Le Dilemme du roman au 18e siècle, 1963) auf den Zeitraum von 1715 bis 1761 ein. Er verfolgte vor allem die Bemühungen der Romanautoren in der ersten Jahrhunderthälfte, gegen die Widerstände einer ästhetisch und moralisch motivierten Kritik in ihren Werken eine „realistischere" Gestaltung der Wirklichkeit durch Überwindung geltender literarischer Konventionen durchzusetzen. Das „Dilemma" des Romans jener Zeit sah er darin, daß dieser - insofern er einen „realistischen" Zugriff auf die Wirklichkeit wagte - als unmoralisch denunziert wurde oder aber, wenn er die moralischen Postulate zu erfüllen gewillt war, sich des Anspruchs auf „Wahrscheinlichkeit" begab. Davon ausgehend stellte May die These auf, daß gegen Ende des 18. Jahrhunderts „die Übereinstimmung der Kritiker, der Autoren und des Publikums" in der Wertschätzung des didaktischen und moralischen Romans das Genre in eine Sackgasse lenkte und 8
scheitern ließ.4 Er bewegte sich damit in den bereits 1928 von F. C. Green vorgegebenen Bahnen der Interpretation, derzufolge die Entwicklungslinie des französischen Romans von den frühen „Realisten" Le Sage, Marivaux und Prévost über die Romantiker zu Balzac verlief, wobei der spätaufklärerische Roman als Abweichung davon außer Betracht blieb.5 Diese Auffassung stützte sich auf ein der späteren Entwicklung entnommenes Realismusmodell, wobei von den realen gesellschaftlichen, ideologischen und literarischen Prozessen im 18. Jahrhundert und den Funktionen des Romans in diesem historischen Kontext abstrahiert wurde. Der Wandel von Gegenständen, Problemstellungen und Darstellungsmethoden des Romans wie auch die Debatten um diese Fragen sind in ihrer Bedeutung aber nur zu erfassen, wenn sie im gesellschaftlichen Kontext ihrer Zeit betrachtet werden. Mit Blick auf den französischen Roman des 19. und 20. Jahrhunderts hat Manfred Naumann als Anliegen formuliert, „die jeweils neuen literarischen Lösungen zu verdeutlichen, die der Roman für die Probleme fand, die sich ihm im Fortgang der Geschichte stellten", statt die Literatur „an einem aus Balzac destillierten Realismusmödell zu messen"6. Nicht anders ist auch an den Roman des 18. Jahrhunderts heranzugehen, dessen Entwicklung maßgeblich durch die sozialen Prozesse in der Endphase des Übergangs vom Feudalismus zum Kapitalismus, durch die bürgerlichen Emanzipationsbestrebungen und die fortschreitende Freisetzung des Individuums aus ständischen Bindungen geprägt war. Schon 1964 hatte Werner Krauss in seiner Studie Zur französischen Romantheorie des 18. Jahrhunderts, die etwa gleichzeitig mit der Arbeit von Georges May entstand, entschieden die Anwendung jedweder Realismusnormen für die Beurteilung des Aufklärungsromans als inadäquat abgelehnt. Dabei wies er vor allem auf drei Faktoren hin, die für die Gattungsentwicklung wie auch die Romantheorie jenes Zeitraums wesentliche Bedeutung hatten: die sich verändernde Wirklichkeit als Gegenstand des Romans, die Aufklärungsideologie als Theoriebildung über die Gesellschaft und die Funktion der Literatur in den ideologischen Auseinandersetzungen der Zeit. So zeigte er am Beispiel des hohen Anteils von Feenmärchen an der Erzählliteratur der Aufklärung, daß die Abkehr von r e a l i s t i s c h e n Darstellungsformen zu jener Zeit vor allem eine verstärkte Hinwendung zur Wirklichkeit markierte, eben weil bei der herrschenden Zensur aktuelle Gesellschaftskritik am ehesten „in der Verschleierung
9
einer exotischen Handlung oder eines orientalischen Dialogs"7 ihr Publikum erreichte. Unter den neueren Darstellungen zur Entwicklung des französischen Romans nimmt Henri Coulets Standardwerk Le roman jusqu'à la Révolution (1967) einen ersten Platz ein. In den Kapiteln über den Roman des 18. Jahrhunderts arbeitete er insbesondere dessen Relevanz im bürgerlichen Emanzipationsprozeß heraus, wobei er alle abstrakt-ästhetischen Wertungen zurückwies. Treffend charakterisiert er wesentliche soziale Momente und Funktionen des Aufklärungsromans, wenn er schreibt: „Erstmals nimmt das Bürgertum seine Literatur in Besitz; es erkennt sich in Werken wieder, in denen es nicht lächerlich gemacht wird; es sieht, daß seine Tugenden gerühmt und seine Hoffnungen genährt werden, daß seine Lebensweise gepriesen wird und seine Probleme für diejenigen stehen, die im allgemeinen die menschliche Existenz mit sich bringt."8 Zugleich hat Henri Coulet in einem Anhang zu seiner Darstellung der Gattungsgeschichte eine Auswahl von theoretischen und kritischen Texten zum Roman publiziert, die im Rahmen des Gesamtwerkes für den Zeitraum des 18. Jahrhunderts allerdings nur knapp ausfallen konnte. Er vermochte damit u. a. die traditionelle These zu entkräften, daß die Romantheorie der Spätaufklärung keinerlei zukunftsorientierende Bedeutung für die Gattungsentwicklung gehabt hätte. Demgegenüber konnte er überzeugende Belege dafür beibringen, daß die von Balzac bis Zola geltende Romankonzeption bereits Ende des 18. Jahrhunderts Gestalt angenommen hatte.9 Die umstrittene Frage der Bedeutung und Wertung der Romandebatten in der Aufklärung wurde damit um neue interessante Aspekte bereichert. Um dem deutschsprachigen Leser Gelegenheit zu geben, sich aus eigener Anschauung ein Bild von den Diskussionen um den Roman im Frankreich des 18. Jahrhunderts zu machen, die ja auch im zeitgenössischen Deutschland Resonanzen hervorgerufen hatten, wird in unserem Band erstmals eine Reihe einschlägiger Texte in Übersetzung vorgelegt. Die Mehrzahl davon war bisher in deutscher Sprache gar nicht oder nur schwer zugänglich. Im Unterschied zu vorhandenen französischsprachigen Anthologien, die sich auf stark gekürzte Fassungen und Textausschnitte beschränken, wird hier eine weitestgehend vollständige Wiedergabe der Texte angestrebt, die nur in Ausnahmefällen unerheblich gekürzt wurden. Der Leser wird damit nicht von vornherein auf bestimmte Probleme orientiert, sondern er erhält die Möglichkeit, am authentischen Material die Anschauungen der hier 10
aufgenommenen Autoren zum Romanproblem in allen ihren Aspekten zu studieren. Um die Auswahl repräsentativ zu gestalten, wurden Texte ganz unterschiedlicher Art und Gewichtung von namhaften wie auch weitgehend unbekannten Autoren aufgenommen. Neben umfänglichen Abhandlungen (Marmontel, Marquis de Sade, Madame de Staël) stehen kurze essayistische Exkurse (Mercier, Choderlos de Laclos), fiktive Dialoge (Rousseau, Barthe), ein literaturkritisches Resümee (Irailh) und der Nachruf auf einen Schriftsteller (Diderot). Wie sich die Aufklärer zur Darstellung ihrer Philosophie noch der ganzen Vielfalt literarischer Ausdrucksformen bedienten, so hat auch die Literaturkritik und -theorie im 18. Jahrhundert von diesem Recht Gebrauch gemacht und sich noch keinen formalen Darstellungsgesetzen gefügt. Nicht zuletzt daraus resultierten die Lebendigkeit, Anschaulichkeit und Allgemeinverständlichkeit der Erörterungen, deren Lektüre auch heute noch nicht nur Erkenntnisgewinn verspricht, sondern durchaus auch literarisches Vergnügen zu bereiten vermag. Die hier vorgelegten Texte entstammen der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts und sind nach Rousseaus epochemachendem Roman Julie ou La Nouvelle Héloïse (1761) erschienen. Angesichts der eingangs skizzierten Forschungslage schien eine solche schwerpunktmäßige Orientierung auf diesen Zeitraum nicht nur gerechtfertigt, sondern geradezu dringlich. Denn in den bisher vernachlässigten Jahrzehnten von ca. 1760 bis 1800 entstanden einerseits die bedeutendsten Romane des 18. Jahrhunderts, andererseits meldeten sich hier auch die führenden Vertreter der Aufklärung mit gewichtigen Beiträgen in den Romandebatten zu Wort. Was eben dadurch an neuen Erkenntnissen über Potenzen und Wirkungen des umstrittenen Genres, über seine Rolle und Funktion im gesellschaftlichen und ideologischen Prozeß eingebracht wurde, ist bei weitem noch nicht hinreichend geklärt. Im Gegenteil bestehen darüber - wie wir andeuteten - sehr kontroverse Auffassungen. In der einleitenden Betrachtung dieses Bandes wird versucht, auf der Grundlage nicht nur der hier abgedruckten Texte, sondern auch vieler anderer Quellenmaterialien, die aus Raumgründen nicht in den Textteil aufgenommen werden konnten, wesentliche Probleme der französischen Romandiskussionen in der Spätaufklärung näher zu beleuchten. Dabei ist es unumgänglich, zunächst kurz auch auf die Hauptpositionen in den Romandebatten des ausgehenden 17. und frühen 18. Jahrhunderts einzugehen, insofern sie als Ausgangs- und Bezugs11
punkte in den späteren Diskussionen relevant bleiben. Der Information des Lesers darüber dient vor allem auch unser erster Text aus der Feder des Abbé Irailh, der aus zeitgenössischer Sicht einen guten Überblick über die Problemlage vermittelt. Ihren spezifischen Charakter erhielten die Literaturdebatten im 18. Jahrhundert dadurch, daß im Verständnis der Aufklärung die Literatur keinen Selbstzweck darstellte, sondern stets als Mittel zum Zweck, als Medium der Kommunikation und der Erkenntnis angesehen wurde. Darum stand in den Romandiskussionen des 18. Jahrhunderts auch die Funktionsproblematik im Mittelpunkt des Interesses. Die den Roman betreffenden anthropologischen, moralischen wie ästhetischen Probleme wurden in der Aufklärung nie als abstrakte Prinzipienfragen behandelt, sondern stets unter dem Aspekt des Verhältnisses von Literatur und Gesellschaft diskutiert. Literatur wurde als gesellschaftliches Phänomen begriffen, das auf den Gang der sozialen Entwicklung nicht unerheblich einzuwirken vermag. Fragen des Inhalts und der Form wurden somit stets mit Blick auf das potentielle Publikum, auf ihre mögliche Wirkung behandelt. Es braucht nicht betont zu werden, wieviel näher unserem heutigen Literaturverständnis solche Auffassungen sind als etwa die im 19. Jahrhundert entwickelten Theorien der Literaturautonomie, die nicht nur eine strikte Grenzziehung zwischen einer eng verstandenen Literatur und allen anderen Ideologiebereichen (z. B. Moral, Philosophie, Wissenschaften) vornahmen, sondern auch in ihren entscheidenden Ausprägungen den Anspruch auf gesellschaftliches Wirken von Literaturaufgaben und deren soziale Funktion rundweg leugneten. Diese in Analogie zum ökonomischen Prozeß der Arbeitsteilung sich vollziehende Spezialisierung und Autonomisierung der Ideologiebereiche hatten in der Literaturwissenschaft ihre Entsprechung in der Durchsetzung der literaturimmanenten Betrachtungsweise, die keinen Zugang mehr zu einer Literatur zu vermitteln vermochte, die wie die Aufklärungsliteratur noch im weitesten Sinne Medium a l l e r geistigen Bestrebungen ihrer Zeit war und in der Philosophie, Wissenschaften und Kunst noch eine glückliche Synthese eingehen konnten. Die Herausbildung eines neuen Funktionsverständnisses des Romans im Kontext des bürgerlichen. Emanzipationsprozesses im 18. Jahrhundert besaß mithin grundlegende Bedeutung für alle romantheoretischen Überlegungen in der französischen Aufklärung. Dieser Aspekt wird daher in der einleitenden Betrachtung im Zentrum stehen. In diesem Zusammenhang wird vor allem drei Fragen nachgegangen : 12
wie der Roman im Verständnis der Aufklärung als Medium der Wirklichkeitserkenntnis und als Instrument der Bewußtseinsbildung tungierte bzw. fungieren sollte, inwiefern die Wirkungsstrategie der Aufklärung auf die Darstellungsprinzipien im Roman einwirkte und wie sich das Verhältnis des Romans zu den traditionellen Gattungen veränderte. Es wird zu zeigen sein, daß entgegen den herkömmlichen Einschätzungen in der Aufklärung Einsichten über Wesen und Möglichkeiten des Romans, über Erkenntnisfunktion und Wirkungsweise, über die ästhetische Aneignung der Welt und moralisch-politische Bewußtseinsbildung gewonnen wurden, die für die weitere Gattungsentwicklung durchaus relevant blieben und heute noch bedenkenswert sind.
Thesen zur Romantheorie des 18. Jahrhunderts in Frankreich Stationen auf dem Wege %ur Legitimation des Romans
1. Versuch einer historischen Fundierung: Pierre-Daniel Huet (1670) Das 17. Jahrhundert gilt in der Literaturgeschichte als die klassische Zeit der französischen Dichtung. Unter der Schirmherrschaft der absolutistischen Staatsmacht, die mit Ludwig XIV. in der zweiten Jahrhunderthälfte auf ihren Höhepunkt gelangte und auf glänzende Repräsentation bedacht war, erfuhr die Literatur ebenso wie die Wissenschaften großzügige Förderung. Die in dieser Zeit entstandenen Tragödien Corneilles und Racines und die Komödien Molieres markieren einen Gipfelpunkt der französischen Literaturentwicklung überhaupt. Zugleich erlangte die von Boileau ausgearbeitete klassische Literaturtheorie und Poetologie, die dem Neoaristotelismus verpflichtet war, nahezu unumschränkte Geltung. Gestützt auf die Autorität der Meisterwerke, die nach ihren Regeln verfaßt waren, beherrschte diese „doctrine classique" auch noch im 18. Jahrhundert weitestgehend das poetologische Denken. Die traditionellen Dichtungsgattungen waren damit auf lange Sicht einem strengen Regelkanon unterworfen, der nur einen geringen Spielraum für die Anpassung an neue Gegenstände und Problemstellungen ließ. Doch bereits auf dem Höhepunkt der „Klassik" in der Ära des „Sonnenkönigs" bildeten diese in den Poetiken fixierten Gattungen nur einen Teil des literarischen Lebens aus. Theorie und Praxis standen hier in einem offensichtlichen Widerspruch. Denn nicht die hochgeschätzten und durch die Tradition legitimierten Genres wie Epos und Tragödie machten das Gros der Produktion an fiktiver Literatur aus, sondern die offiziell ignorierten Prosagenres Roman und Novelle, die sich größter Beliebtheit und weiter Verbreitung erfreuten. Unberührt von einengenden Regeln vollzogen sie eine Entwicklung, die offenbar im vollsten Einvernehmen mit dem Geschmack jenes Publikums stand, das sich auf der anderen Seite an den Meisterwerken der 15
„hohen" Dichtung delektierte. Bezeichnend dafür ist, daß bereits Mitte der sechziger Jahre des 17. Jahrhunderts ein Gelehrter wie der nachmalige Bischof von Avranche, Pierre-Daniel Huet, daranging, in einem Traité de l'origine des romans (Abhandlung über den Ursprung der Romane), der zuerst 1670 als Vorrede zu Zayde, einem Roman von Madame La Fayette und Jean-Regnauld de Segrais, erschien, eine erste historisch-psychologische Grundlegung und Funktionsbestimmung des Romans zu versuchen. Eine Bemerkung in seinen Mémoires zeigt ihn uns als empfindsamen Verehrer einer Romankunst, die uns heute nur noch ein Gähnen abnötigen würde. Es ging dabei um den Hirtenroman Astrée (1607-1627) von Honoré d'Urfé, den er seinen Schwestern mit größter persönlicher Anteilnahme vorlas. „Diese Lektüre wühlte uns dermaßen auf", schrieb er, „daß wir im Gefühlsüberschwang Tränen vergossen und der Worte nicht mächtig waren." 10 Dies könnte auch hundert Jahre später geschrieben sein, allerdings dann in bezug auf den ganz anders gearteten Roman der Aufklarung. Wie sich hier in der Rezeptionsweise eine erstaunliche Analogie kundtut, obgleich eine ungeheure, nicht nur zeitliche Kluft die Spätaufklärung vom „Siècle de Louis XIV" trennte, so scheinen auch von Huet fixierte Gattungsspezifika die Zeitläufe überdauert und allen gesellschaftlichen und literarischen Wandlungen zum Trotz die Romantheorien auch des späten 18. Jahrhunderts noch gespeist zu haben. Um dieses Phänomen zu verstehen, ist es erforderlich, zunächst Huets Auffassung und ihre Voraussetzungen knapp zu skizzieren. Huet ging aus von einer Romanliteratur, die seit Beginn des 17. Jahrhunderts mit unterschiedlicher Akzentuierung der sentimentalen und heroischen Aspekte sich ein Publikum erobert hatte, das sich aus den gebildeten Schichten der Gesellschaft, von der Aristokratie bis hin zum gehobenen Bürgertum, rekrutierte. Der bis dahin noch im Schwange befindliche Ritterroman in der Amadis-Tradition mit seinen märchenhaften Helden und unverbindlich-wundersamen Abenteuern wurde bereits Anfang des Jahrhunderts durch den Hirtenroman verdrängt, der in Anknüpfung an die bukolische Traditionslinie mit Honoré d'Urfés Astrée einen Markstein der Romanentwicklung überhaupt setzen sollte. In deutlicher Abkehr von den spanischen Vorbildern wurde hier in pastoraler Einkleidung eine fiktive Welt gestaltet, der die realen Widersprüche der französischen Gesellschaft jener Zeit deutlich ihr Gepräge gaben. Die soziale und machtpolitische Polarisierung zwischen absolutistischem Königtum und ländlichem Feudaladel gegen Ende der Ära 16
Heinrichs IV. und darüber hinaus fand ihre literarische Entsprechung in der bukolischen Welt der Hirten und Nymphen, deren realgeschichtlicher Bezug durch die Ausführung als Schlüsselroman noch unterstrichen wurde. Doch nicht allein dieses neue Wirklichkeitsverhältnis machte den Erfolg des Romans aus, sondern vor allem auch, daß darin eine von jahrzehntelangen Religionskriegen zerrüttete Gesellschaft in idealer Weise ein Lebensgefühl artikuliert fand, das ihren Hoffnungen und Sehnsüchten nach einer besseren Welt entsprach. In dem die bukolische Welt beherrschenden Ideal von Reinheit und Unschuld manifestierte sich die Umkehrung einer erdrückenden Lebenserfahrung: Es beinhaltete Verachtung von Machtanspruch und Reichtum, Rückkehr zu Ursprünglichkeit und Einfachheit, Wiederherstellung moralischer Verhaltensweisen und echter Gefühlsbindungen. 11 Diese unheroische Lebenshaltung konnte allerdings auf Dauer einen Stand nicht befriedigen, der sich seiner Natur nach zu Kriegsdienst und öffentlich-politischem Wirken berufen fühlte. Diesem Wunschempfinden suchte der heroisch-galante Roman zu entsprechen, der in den Jahren 1640-1660 seine Blüte erlebte. In Heldenwahl und Struktur dem antiken Epos verpflichtet, aber in Prosa ausgeführt, verlieh er der Gesinnung jener aristokratischen Schichten Ausdruck, die unter dem Widerspruch von historischem Geltungsbewußtsein und politischer Machtlosigkeit unter dem absolutistischen Regime litten und für die die Literatur einen Freiraum für die Kompensation unerfüllbarer Wünsche darbot. In den unendlichen Zyklenromanen der Gomberville und La Calprenede verband sich bei den Protagonisten im antiken Gewand wie Polexandre, Cassandre oder Cleopätre die künstliche Heldenpose mit der von ausgeklügelter Liebeskasuistik geprägten Galanterie der höfischen Gesellschaft. Der Gesetzgeber des französischen Klassizismus, Boileau, hat darum mit Recht den Vorwurf erhoben, die Autoren hätten „aus den bedeutendsten Helden der Geschichte . . . sehr frivole Hirten" gemacht und „manchmal sogar Bürgerliche, die noch frivoler waren als jene Hirten" 12 . Wenn Boileau von seinem pauschalen Urteil die nach gleichem Muster verfaßten Romane der Mademoiselle de Scudery wie Le Grand Cyrus und Clelie nicht ausnahm, so unterschlug er dabei gewichtige Unterschiede, die für die kritische Haltung Huets von grundlegender Bedeutung waren. Zwar gilt im ganzen, daß diese Literatur - wie Antoine Adam formulierte - „dem Ideal einer Gesellschaft Ausdruck verleiht, in der die heroischen Taten und Liebesabenteuer einiger sehr hochgestellter und mächtiger Persönlichkeiten allein An2
Geißler, Romantheorie
17
spruch auf Interesse haben"13, doch wurden gerade in den letztgenannten Romanen mit der programmatischen Berufung auf den griechischen Romanautor Heliodor und auf d'Urfe als verbindliche Vorbilder neue Akzente gesetzt, die die sentimentalen Aspekte gegenüber den von falschem Schein geprägten heroischen in den Vordergrund stellten. Bereits damit kündigte sich eine Wende an, die bei Madame de La Fayette mit dem klassischen Roman La Princesse de Cleves (1678) ihren vollendetsten Ausdruck finden sollte und die bereits in Zayde, einer Liebesgeschichte in maurisch-orientalischem Gewand, vorbereitet war. Eben damit im Zusammenhang aber hatte ja Huet seine Romankonzeption entwickelt und auch veröffentlicht. Es ist also „die nunmehr vollzogene Trennung von Roman und Epos" 14 , von der die Romantheorie Huets ausgeht. Nach seiner prägnanten Formel, die über ein Jahrhundert lang als verbindliche Definition akzeptiert wurde, sind Romane „erfundene Geschichten von Liebesabenteuern, die mit Kunstfertigkeit in Prosa zum Vergnügen und zur Belehrung der Leser verfaßt wurden"15. Hervorzuheben ist Huets strikte Orientierung an einer gesellschaftlich-literarischen Praxis, die sich keineswegs den Postulaten der Verfechter einer elitären klassischen Literaturtheorie fügte. Besonders deutlich kommt dies in seiner Prosaapologie zum Ausdruck, die er nicht nur historisch, sondern auch empirisch durch den aktuellen „usage" seiner Zeit motivierte. Die provokante Bedeutung dieser These, die erst im 18. Jahrhundert allgemein akzeptiert wird und zur Neubewertung der Prosa führen sollte, liegt auf der Hand, wenn man sich vergegenwärtigt, daß um dieselbe Zeit „die Franzosen den Gipfel ihrer Verskunst in Racines vollendet getönter Dichtersprache" erreichten und „durch Boileau . . . die Vorzugsstellung, ja exklusive Geltung der Poesie für die gesamte Literatur bekräftigt" wurde.16 Indem Huet unter Berufung auf eine Maxime von Aristoteles, die er bei Plato vorgebildet und bei Horaz, Plutarch und Quintilian bekräftigt fand, behauptete, daß der Dichter mehr zum Dichter werde durch die von ihm erfundenen Fiktionen als durch seine Verse, gab er einer Argumentation neue Impulse, die im 18. Jahrhundert bis hin zu Diderot in allen Auseinandersetzungen um diese Probleme bemüht werden sollte. Huet folgerte daraus, daß die Romanautoren zu den Dichtern gehören.17 Einhundert Jahre später wird Mercier erklären, daß sich keiner als Dichter bezeichnen könne, der nicht wenigstens auch einen Roman geschrieben habe.18 Nicht minder folgenreich für den Roman war Huets moralisches Konzept. Dem klassizistischen Leitsatz, daß „plaire et instruire" (ge18
fallen und belehren) die wesentlichen Zielsetzungen der Poesie in bezug auf den Leser sein müßten, gab er eine eigene Deutung, die den Roman in Frankreich für lange Zeit gewissermaßen an einem Gängelband festmachte. Die „instruction de l'esprit" und die „correction des mœurs" als gesellschaftlich-operative Zielsetzungen des Romans sollten, so Huet, durch die Strukturierung der Werke im Sinne gleichnishafter Exempel realisiert werden. So konnte faktisch der christliche Glaubensgrundsatz von der im Jenseits zu erwartenden göttlichen Gerechtigkeit bereits auf irdischem Boden seine Bestätigung finden. Damit kam man zu jener Zeit den Erwartungen einer im gesellschaftlichen Mittelfeld angesiedelten Leserschicht entgegen. Die Formel Huets von der belohnten Tugend und dem bestraften Laster im Roman („la vertu couronnée et le vice puni") wird jedenfalls nicht nur eine programmatische Forderung in der Aufklärung bleiben, sondern unterschwellig noch den Populärroman des 19. Jahrhunderts prägen.19 In diesem Zusammenhang ist aber zu beachten, daß die Bedeutung von „vertu" und „vice" sich im Laufe der Geschichte nicht unbeträchtlich wandelte. Waren die älteren Romane darauf bedacht, die Tugendideale des herrschenden Adels wie Mut, Tapferkeit und Treue gegenüber dem Souverän zu verherrlichen, wurden etwa in der Princesse de Clèves (1678) in Frontstellung gegen die aristokratische Lebenspraxis eheliche Treue über den Tod hinaus und Liebesverzicht als Ausdruck höchster Tugend dargestellt, so ging es seit dem 18. Jahrhundert im Roman zunehmend um die Einhaltung bürgerlicher Lebensnormen wie Gehorsam der Kinder gegenüber ihren Eltern, Aufopferung für die Familie, Rechtschaffenheit und Tatkraft, die als tugendhaft gepriesen wurden. Den Schwerpunkt der Abhandlung Huets bildet - wie schon der Titel sagt - die Beantwortung der Frage nach dem Ursprung des zeitgenössischen Romans. Als Parteigänger der Anciens, die die Legitimation der Kunst und Literatur ihrer Zeit auf antike Vorbilder gründeten, ermittelte er eine lange Ahnenreihe von romanhaften Werken, die er bis zu den frühesten schriftlichen Äußerungen bei den orientalischen Völkern der vorgriechischen Zeit zurückverfolgte. Die Romankunst ist nach seiner Vorstellung kein Produkt der geschichtlichen Entwicklung; ihren Ursprung sieht er vielmehr rein anthropologisch „in einem überzeitlich-konstanten Bedürfnis des Menschen nach Fiktionen"20, die lediglich nach den Zeitbedingungen, unter denen die Menschen leben, verschiedene historische Ausprägungen erfahren, sich also beispielsweise in Form der antiken Liebesromane, der mittel19
alterlichen Ritterromane, der Hirtenromane etc. vergegenständlichen. Prägnant formulierte er: „ . . . ich sage, daß man ihren Ursprung in der geistigen Natur des schöpferischen Menschen suchen muß, der das Neue und die Fiktionen liebt, der begierig ist zu lernen und anderen mitzuteilen, was er erfunden und was er gelernt hat, und daß diese Neigung allen Menschen zu allen Zeiten und an allen Orten eigen ist . . . Die im Prinzip allen Menschen eigene schöpferische Phantasie als Voraussetzung für das Schreiben von Romanen schien Huet jedoch bei den orientalischen Völkern (Ägyptern, Arabern, Persern, Indern, Syrern) stärker ausgeprägt als bei den abendländischen, eine Auffassung, die Anfang des 18. Jahrhunderts mit dem Riesenerfolg der arabischen Märchen aus 1001 Nacht (1704-1717; übersetzt von Antoine Galland) und der persischen Märchen von 1001 Tag (1710 bis 1712; übersetzt von Petis de La Croix) in Frankreich eine Bekräftigung erfahren sollte. Jene Völker hätten daher beispielgebend gewirkt und müßten als Erfinder der Romane angesehen werden. Indem Huet die Romandichtung als eine dem Menschen eigene natürliche Ausdrucksform darstellte, trat er entschieden der von geistlicher Seite vorgebrachten Kritik entgegen, die im Roman nur eine willentlich vorgenommene Überbewertung irdischer Dinge, eine Ablenkung von den Glaubenswahrheiten und eine Entwertung christlicher Moralgebote sah. Mit der Bindung der Fiktion an die menschliche Natur hat Huet demgegenüber dem Roman einen Freiraum zwischen historischer Faktizität und Glaubenswahrheiten eingeräumt. Daraus erwuchs diesem Genre ein Betätigungsfeld, das es zu einem vorzüglichen Instrument moralischer und gesellschaftlicher Bildung machte und zugleich seine Einordnung in das Gefüge der legitimierten Gattungen ermöglichen sollte. Der ursprünglichen Form- und Gesetzlosigkeit romanhafter Darstellungen hat Huet zufolge der Regelkanon des griechischen Epos ein Ende gesetzt. Er bestritt also nicht die Verwandtschaft zwischen beiden epischen Kunstformen. Die sie trennenden Unterschiede wären eher gradueller Natur, lägen in einer Akzentverschiebung bei der Behandlung der Gegenstände, die in ihrer Tendenz vom Epos zum Roman die Wendung vom Erhabenen zum Einfachen, vom Wunderbaren zum Wahrscheinlichen, vom Allegorischen zum Gegenständlichen, von der militärisch-politischen Staatsaktion zum privaten Liebeskonflikt beinhalten.22 Die damit betonte Kontinuität zwischen Epos und modernem Roman verdeckt jedoch nicht, daß mit dieser 20
Charakteristik des neuen Genres zugleich die strikte Trennung vollzogen wurde. Die Gegenstandsbereiche sind in unüberbrückbarer Weise geschieden. Indem Huet jedoch statt der Festschreibung eines neuen Regelkanons für den Roman sich in wesentlichen Punkten auf eine Tendenzbestimmung beschränkte, hielt er den Blick offen für weitere mögliche Entwicklungen. Daher ist es auch zu erklären, daß seine Theorie noch unter ganz anderen literarisch-gesellschaftlichen Konstellationen ausgesprochen und unausgesprochen ein ständiger Bezugspunkt für die Romantheoretiker der Aufklärung bleiben konnte. Zunächst einmal sollte jedoch mit dem bisher praktizierten „großen" Roman auch diese Romantheorie in die Krise geraten. 2. Neues Wirklichkeitsverbältnis und der Romane (1737)
„Proskription"
Die heroisch-galanten Romane hatten eine Vorstellungswelt poetisch vergegenständlicht, die mit der Erfahrung des politischen Zusammenbruchs der Fronde Mitte des 17. Jahrhunderts, des letzten Aufbegehrens des Feudaladels im Bündnis mit Teilen des wohlhabenden Bürgertums gegen die absolutistische Königsmacht, in ihren Grundfesten erschüttert worden war. Die hehren Ideale von Macht und Heldentum, denen die Aristokratie anhing, erwiesen sich angesichts dessen als recht fragwürdig. Der allmähliche Bewußtseinswandel in der tonangebenden französischen Gesellschaft, den in gewisser Hinsicht bereits die noch in traditionellem Gewand abgefaßten Romane der Scudéry erkennen ließen und der sich in der Literaturtheorie Huets besonders in der Trennung von Epos und Roman manifestierte, sollte jedoch überhaupt das Ende des „großen" Romans als Ausdruck einer als falsch erkannten Weltsicht einleiten. Um glaubhaft zu erscheinen, mußte sich nunmehr auch die fiktive Wirklichkeitsdarstellung in Formen kleiden, die bisher der Wiedergabe historischen Geschehens oder authentischen Erlebens gedient hatten. Es waren dies vor allem „histoires", „mémoires", „lettres" und „nouvelles". Von den Lettres portugaises (1668), den fiktiven Briefen einer portugiesischen Nonne an ihren Geliebten, über Madame de La Fayettes Meisterwerk ha Princesse de Cleves (1678), die Pseudomemoiren abenteuerlustiger Helden aus der Feder von Courtilz de Sandras bis hin zu den als „Mémoires" oder „Lettres" deklarierten Romanen des 18. Jahrhunderts werden fast ausschließlich diese Aushängeschilder benutzt. 21
Zu dieser Entwicklung, die ihren wesentlichen Anstoß offensichtlich durch die Konsolidierung absolutistischer Machtverhältnisse erhielt, hat jedoch entscheidend ein weiterer Faktor der Gesellschaftsentwicklung beigetragen: die Ausweitung der bürgerlich-kapitalistischen Produktionsverhältnisse und das ökonomische Erstarken der davon profitierenden Bevölkerungsschichten. Aus der Desillusionierung der Aristokratie einerseits und der Praxisorientierung des mit Handel und materieller Produktion verbundenen Bürgertums andererseits erwuchs das Interesse für eine Literatur, die nicht mehr nur hehre Ideale des Heldentums und der Liebe verherrlichte, sondern sich stärker der realen Lebenssphäre annäherte. Freilich blieben über lange Zeit noch Edelleute die Helden, wie es der sozialen Gewichtung in der unverändert feudalständischen Gesellschaft entsprach, doch der treffend mit „encanaillement du héros" 23 * umschriebene Prozeß, der auf die Verbürgerlichung des Romanhelden hinzielte, war damit eingeleitet und erwies sich auch in der französischen Romanentwicklung als unumkehrbar. Wenn zumeist noch in höheren Ständen angesiedelt, bekleideten die Romanhelden immerhin keine soziale Ausnahmestellung mehr auf der Feldherren- und Herrscherébene, die ihnen Heldentaten und Staatsaktionen abverlangte; vielmehr näherten sie sich in Denken, Fühlen und Handeln bereits weitgehend dem Durchschnittsbürger an. „Die Helden der alten Romane haben nichts Natürliches; alles an ihren Charakteren ist übertrieben . . . " , urteilte 1702 Morvan de Bellegarde. „ . . . die Helden der modernen Romane sind besser charakterisiert; man stattet sie mit Leidenschaften, Tugenden und Lastern aus, wie sie den Menschen eigen sind ; daher erkennt sich jedermann in diesen Schilderungen wieder." 24 Weit über die alte Forderung nach Wahrscheinlichkeit hinausgehend, wird hier bereits auf die mögliche Identifikation des Lesers mit den Romanfiguren hingewiesen. Dieser Vorgang wird schon bald die Rezeptionsweise des Romans vorrangig bestimmen. Konnten vorher die Romanhelden wie auch die Helden des Epos und der Tragödie auf Grund ihrer gesellschaftlichen Ausnahmestellung als Könige und Heerführer dem Publikum allenfalls Bewunderung abnötigen, so sollen sie jetzt die Anteilnahme des gebildeten Durchschnittslesers erregen, der in ihnen seinesgleichen zu sehen vermag. Die ästhetische Distanz zwischen Leser und poetischer Welt ist damit aufgehoben, und für den Roman wird ein neues Verhältnis zwischen Literatur und Publikum konstituiert. Diese „Demokratisierung" eines Teils der literarischen Produktion in jener Zeit eröffnet ihr ganz neue Funktions-
22
aspekte, die im Verlauf des 18. Jahrhunderts bewußt erkannt und programmatisch in die Romantheorie aufgenommen werden sollten. Daß diese grundlegenden Wandlungen des Romans an der Schwelle zum 18. Jahrhundert nicht ideengeschichtlich als Gegenreaktion auf herrschende Traditionen zu erklären sind, sondern Ausdruck struktureller Veränderungen in der Gesellschaft waren, ist u. a. aus den Begründungen der Apologeten des neuen Kurzronians abzulesen. Sein Erfolg wie auch die Abkehr vom „großen" Roman wurde einhellig darauf zurückgeführt, daß er besser den Bedürfnissen des Publikums entspreche. Hatte noch Morvan de Bellegarde gemeint, die „petites histoires" wären „der heftigen und ungestümen Gemütsart der Franzosen, die natürlich keinen Geschmack an den langatmigen Werken finden können, angemessener"25, so erhält bei Lenglet Du Fresnoy diese psychologische Motivation einen deutlich sozialen Hintergrund, wenn er darauf verweist, daß anderweitige Beschäftigungen die ungeteilte Aufmerksamkeit der Leser für eine weitschweifige Lektüre nicht mehr erlauben: „Die Abenteuer der großen Romane . . . waren so auseinandergerissen und so miteinander verwickelt, daß die Aufmerksamkeit zu sehr geteilt wurde: man mußte davon viel mehr aufbringen, als junge Menschen oder mit anderen Dingen beschäftigte Leute gewöhnlich haben . . .'doch nicht zustande. Ohne seine Anmerkungen schickte er daher Goethes Übersetzung am 20. Januar 1796 an Cotta, der sie im 2. Horcw-Stück 1796 publizierte. Der in unserem Band abgedruckte Text Versuch über die Dichtungen in der Übersetzung Goethes wurde entnommen: Goethe: Berliner Ausgabe. Bd. 22. Kunsttheoretische Schriften und Übersetzungen, Berlin-Weimar: Aufbau-Verlag 1978, S. 7-32. Keine seiner Fähigkeiten ist dem Menschen werter als die Einbildungskraft. Das menschliche Leben scheint so wenig auf Glück berechnet, daß man nur mit Hülfe einiger Schöpfungen und gewisser Bilder, nur durch glückliche Wahl unserer Erinnerungen die verteil261
ten Freuden der Erde sammeln und nicht durch die Kraft der Philosophie, sondern durch die weit mächtigere Wirkung der Zerstreuungen gegen die Leiden zu kämpfen vermag, die uns das Schicksal auflegt. Man hat viel von den Gefahren der Einbildungskraft gesprochen, und es wäre unnütz aufzusuchen, was eine unfähige Mittelmäßigkeit oder eine strenge Vernunft hierüber wiederholt haben. Die Menschen werden nicht aufgeben, sich interessieren zu lassen, und diejenigen, die das Talent besitzen, uns zu rühren, werden noch weniger Verzicht tun, es mit Glück auszuüben. Die kleine Anzahl notwendiger und gewisser Wahrheiten wird niemals Geist und Herz völlig befriedigen; wer sie entdeckt, hat ohne Zweifel den höchsten Ruhm, aber auch nützlich für das menschliche Geschlecht haben die Verfasser solcher Werke gearbeitet, die uns rühren oder angenehm betrügen. Will man die Leidenschaften des Menschen mit metaphysischer Genauigkeit behandeln, so tut man seiner Natur Gewalt. Auf dieser Erde gibt es nur Anfänge; keine Grenze ist bezeichnet, die Tugend steht fest, aber das Glück schwebt im Weiten; und wenn es eine Untersuchung nicht aushält, wird es durch sie vernichtet, wie glänzende Nebelbilder, aus leichten Dünsten emporsteigend, für den verschwinden, der durch sie hindurchgeht. Demohngeachtet aber ist das Vergnügen, das die Dichtungen hervorbringen, nicht ihr einziger Vorteil; sie unterhalten, wenn sie zu den Augen sprechen, aber sie haben einen großen Einfluß auf das Moralische, wenn sie das Herz bewegen, und dies Talent ist vielleicht das mächtigste, um aufzuklären oder Richtungen zu geben. In dem Menschen gibt es nur zwei deutlich zu unterscheidende Kräfte, die Vernunft und die Einbildungskraft; alle die andern, selbst die Empfindung, sind nur abhängig oder zusammengesetzt. Das Reich der Dichtungen ist deswegen wie das Reich der Einbildungskraft sehr ausgebreitet; auch die Leidenschaften, anstatt ihr im Wege zu stehen, sind ihr willkommen. Die Philosophie muß die unsichtbare Gewalt sein, die ihren Wirkungen die Richtung gibt, aber wenn sie sich zu bald zeigte, würde sie den Zauber zerstören. Ich werde deswegen, indem ich von Dichtungen spreche, sowohl ihren Gegenstand als ihren Reiz betrachten; denn in dieser Art Werken kann die Anmut ohne Nutzen bestehn, niemals aber der Nutzen ohne Anmut. Die Dichtungen sind berufen, uns zu verführen, und je fester man sich dabei einen moralischen oder philosophischen Zweck vorsetzte, desto mehr müßte man sie mit gefälligem Reiz ausstatten, um seinen Zweck zu erreichen, ehe ihn jemand gewahr wer-
262
den könnte. In den mythologischen Dichtungen werde ich nur auf das Talent des Dichters sehen, da ihr religiöses Verhältnis nicht zu meiner Betrachtung gehört; ich werde von den Werken der Alten nach dem Eindrucke reden, den sie zu unsern Tagen machen, und ich werde nur von ihrem Talent, nicht von ihren Lehrsätzen mich unterhalten. Die Dichtungen können in drei Klassen geteilt werden. 1) Die wunderbaren und allegorischen Dichtungen. 2) Die historischen. 3) Die Dichtungen, wo alles zugleich erfunden und nachgeahmt ist, in denen nichts wahr, aber alles wahrscheinlich ist. Wollte man hierüber ausführlich schreiben, so würde man ein weitläufiges Werk hervorbringen, das die meisten dichterischen Arbeiten begriffe; fast alles würde darin zur Sprache kommen, denn e i n Gedanke kann nur vollkommen durch die Verbindung aller übrigen entwickelt werden. Aber meine Absicht ist, nur zugunsten der Romane zu schreiben, und ich werde zu zeigen suchen, daß ein Roman, der mit Feinheit, Beredsamkeit, Tiefe und Moralität das Leben darstellt, wie es ist, die nützlichste von allen Dichtungen sei, und ich habe aus diesem Versuch alles, was dahin nicht zielen möchte, entfernt. I Die wunderbare Dichtung verursacht ein Vergnügen, das sich sehr bald erschöpft. Die Menschen müssen erst Kinder werden, um diese unnatürlichen Schilderungen zu lieben, um sich durch unwahre Darstellungen zu Schrecken und Neugierde reizen zu lassen. Die Philosophen müssen erst wieder Volk werden, um nützliche Gedanken unter dem Schleier der Allegorie zu lieben. Die Mythologie der Alten enthält manchmal nur einfache Fabeln, wie sie die Leichtgläubigkeit, die Zeit und die Priester in allen abgöttischen Religionen fortgepflanzt haben, aber man kann sie auch öfter als eine Folge von Allegorien betrachten; man sieht personifizierte Leidenschaften, Talente oder Tugenden. Ohne Zweifel gehört zu der Wahl dieser Dichtungen ein gewisses Glück, eine Gewalt der Einbildungskraft, die den Erfindern einen wahren Ruhm versichert. Sie haben eine Sprache geschaffen, dem Stile eine Gestalt gegeben und, um die poetischen Ideen in ihrer Würde zu erhalten, sie von der gemeinen Sprache gesondert. Werke, die zu diesen einmal angenommenen Fiktionen noch andere hinzutun wollten, würden gar keinen weitern Nutzen haben.
263
Wunderbare Dichtungen erkälten immer die Empfindungen, denen man sie beigesellt. Wenn man nur Bilder verlangt, die gefallen sollen, so ist es erlaubt, auf tausend Arten zu blenden. Man hat gesagt: die Augen seien immer Kinder, und es gilt noch viel mehr von der Einbildungskraft; sie verlangt nur, unterhalten zu sein, ihr Zweck ist in ihrem Mittel, sie dient, das Leben zu betrügen, die Zeit zu rauben, sie kann dem Tag die Träume der Nacht geben; ihre leichte Tätigkeit ist statt der Ruhe, indem sie zugleich alles, was rührt, und alles, was beschäftigt, entfernt. Aber wenn man sich des Vergnügens dieser Einbildungskraft zu einem moralischen Zwecke mit Konsequenz bedienen will, so muß man sowohl mehr Folge als mehr Einheit in den Plan legen. Jene Verbindung der Helden und der Götter, der Leidenschaften und der Gesetze des Schicksals schadet selbst den Gedichten Homers und Vergils; kaum verzeiht man dem Erfinder eine Gattung, deren Erfindung ihm so viel Ehre macht. Wenn Dido den Aeneas liebt, weil sie unter den Zügen des Ascanius den Amor an ihren Busen gedrückt: hat 244 , so bedauert man das Talent, das die Geburt dieser Leidenschaft durch das Gemälde der Bewegungen des Herzens viel besser gezeigt hätte. Wenn die Götter den Zorn, den Schmerz und den Sieg Achills befehlen 245 , so kann man weder Jupitern noch den Helden bewundern; der eine ist ein abstraktes Wesen, der andere ein Mensch, durch das Schicksal unterjocht; die Allmacht des Charakters wird durch das Wunderbare verdeckt, das ihn umgibt. Auch kommt bei dieser Art des Wunderbaren bald etwas Gewisses, bald etwas Unerwartetes vor; wir können deshalb nicht nach unsern eigenen Empfindungen fürchten oder hoffen und sehn uns auf diese Weise des schönsten Vergnügens beraubet. Wenn Priam den Leichnam Hektors von Achill zurückzuverlangen geht 246 , so sollten mich die Gefahren, in die seine väterliche Liebe ihn stürzte, in Furcht setzen; ich sollte zittern, wenn ich ihn in das Zelt des schrecklichen Achills eintreten sehe, und sollte, in Ungewißheit bei allen Worten dieses unglücklichen Vaters, durch seine Beredsamkeit sowohl den Eindruck der Gefühle, die sie darlegt, als die Ahnung der Begebenheiten, die sie entscheiden wird, empfinden. Aber ich weiß schon, daß Merkur den Priam durch das Lager der Griechen führt, daß Thetis, auf Befehl des Jupiters, ihrem Sohn die Rückgabe des Leichnams befohlen hat, ich bin über Priams Unternehmen nicht mehr verzweifelt, mein Geist ist nicht mehr aufmerksam, und ohne den Namen des göttlichen Homers würde ich eine Rede nicht lesen, die erst auf die Situation folgt, anstatt sie herbeizuführen. 264
Wenn ich sagte, daß auch etwas Unerwartetes im Wunderbaren sei, das die ganz entgegengesetzte Wirkung der erst getadelten Gewißheit hervorbringt und uns das Vergnügen raubt, was wir hoffen und wünschen vorauszusehen, meinte ich die Fälle, wenn die Götter die bestverknüpften Maßregeln reißen, ihren Günstlingen einen unwiderstehlichen Schutz gegen die größten Mächte verleihen und alles Verhältnis der Begebenheiten, wie sie dem Menschen angemessen sind, aufheben. Ich gestehe wohl, die Götter nehmen hier nur den Platz des Schicksals ein, sie sind der personifizierte Zufall; aber bei Dichtungen ist es besser, seinen Einfluß zu entfernen. Alles, was erfunden ist, soll wahrscheinlich sein, alles, was uns in Erstaunen setzt, muß durch Verkettung moralischer Ursachen erklärt werden können; in solchen Werken entdeckt man alsdann ein philosophisches Resultat, und das Talent, das sie hervorbringt, übernimmt eine größere Arbeit; denn eingebildete oder wirkliche Situationen, aus denen man sich durch einen Machtstreich des Schicksals zieht, können keine Bewunderung erregen. Ich wünschte, daß, indem man zum Menschen spricht, man auch die großen Wirkungen durch den Charakter des Menschen hervorbrächte. Hier ist die unerschöpfliche Quelle, aus der das Talent tiefe und schreckliche Schilderungen schöpfen kann, ja selbst Dante hat seine höllischen Bilder 247 nicht so weit getrieben, als die blutigen Verbrechen unserer Tage 248 sich einander übertroffen haben. Sind nicht in den epischen Gedichten, die wir wegen des Wunderbaren ihrer Fiktionen schätzen, eben die Stellen die erhabensten, deren Schönheiten ganz unabhängig vom Wunderbaren sind? Was man in Miltons Satan 249 bewundert, ist der Mensch, was von Achill übrigbleibt, ist sein Charakter, was man bei der Leidenschaft Reinalds zu Armiden 250 vergessen möchte, ist die Zauberei, die sich zu den Reizen gesellt, die ihn entzündet haben. Was in der Aeneis wirkt, sind die Empfindungen, die zu aller Zeit allen Herzen angehören, und unsere tragischen Dichter, die aus alten Schriftstellern Gegenstände wählten, haben sie fast ganz von den wunderbaren Maschinen 251 abgesondert, die man meist an der Seite der großen Schönheiten, wodurch die Werke des Altertums sich auszeichnen, wirksam findet. Die Ritterromane lassen noch mehr die Unbequemlichkeit des Wunderbaren fühlen; bei ihnen schadet es nicht allein dem Interesse der Begebenheiten, sondern es mischt sich auch in die Entwickelung 265
der Charaktere und Empfindungen. Die Helden sind riesenmäßig, die Leidenschaften überschreiten die Wahrheit, und eine eingebildete moralische Natur hat noch weit mehr Unbequemlichkeiten als die Wunder der Mythologie und der Feerei. Das Falsche ist inniger mit dem Wahren verbunden, und die Einbildungskraft selbst wirkt weniger; denn es ist hier die Rede nicht, zu erfinden, sondern zu übertreiben, was da ist, und eben, was in der Wirklichkeit sehr schön ist, in einer Art von Karikatur darzustellen, wodurch sowohl Tapferkeit als Tugend lächerlich werden könnten, wenn Geschichtsschreiber und Moralisten die Wahrheit nicht wiederherstellten. Doch muß man die menschlichen Dinge nicht nach ausschließlichen Grundsätzen richten; ich weiß daher das schöpferische Genie zu ehren, das jene poetischen Dichtungen hervorgebracht hat, auf denen der Geist so lange ruht und die zu so viel glücklichen und glänzenden Vergleichungen gedient haben; aber man kann wünschen, daß künftige Talente einen andern Weg einschlagen, und ich möchte jene lebhaften Seelen, denen Gespenster so oft als wahre Bilder erscheinen können, auf die einzige Nachahmung des Wahren einschränken oder vielmehr zu ihr erheben. Bei den , Werken, wo die Heiterkeit herrscht, könnte man ungern die lieblichen Dichtungen vermissen, von denen Ariost 252 einen so schönen Gebrauch gemacht hat, und wirklich ist auch in dem glücklichen Zufall, der die Anmut des Scherzes hervorbringt, keine Regel und kein Gegenstand. Der Eindruck kann nicht analysiert werden, das Nachdenken kann sich nichts davon zueignen. In dem Wahren findet man so wenig Ursache zur Fröhlichkeit, daß gewiß in den Werken, die ihr gewidmet sind, das Wunderbare manchmal nötig ist. Empfindung und Nachdenken erschöpfen sich nie, aber der Scherz ist ein Glück des Ausdrucks oder des Gewahrwerdens, dessen Rückkehr man nicht berechnen kann. Jede Idee, die Lachen erregt, könnte die letzte sein, die man jemals entdeckte, es ist kein Weg, der zu dieser Gattung führte; es gibt keine Quelle, aus der man mit Gewißheit schöpfen könnte. Man weiß, sie existiert, weil sie sich immer erneuert, aber man kennt weder die Ursache noch die Mittel. Der Ton des Scherzes bedarf mehr Begeisterung als der erhöhte Enthusiasmus selbst. Diese Heiterkeit in dichterischen Werken, die nicht aus einem Gefühl von Glück entsteht, diese Heiterkeit, von der der Leser weit mehr Genuß als der Schriftsteller hat, ist ein Talent, zu dem man auf einmal gelangt, das sich ohne Abstufung verliert, dem man wohl eine Richtung geben, an dessen Stelle man aber keine
266
Fähigkeit des größten Geistes setzen kann. Wenn also das Wunderbare oft zu den Werken, die immer heiter sind, paßt, so mag wohl die Ursache sein, weil sie niemals die Natur vollkommen malen; niemals kann eine Leidenschaft, ein Schicksal, eine Wahrheit munter sein; nur aus einigen flüchtigen Schattierungen solcher ernsthafter Ideen können lächerliche Kontraste hervorspringen. Es gibt eine Gattung, weit über diejenigen erhaben, von der ich eben sprach, die zwar auch scherzhafte Situationen hervorbringt, ich meine die Werke des komischen Talents; aber eben der Vorzug, daß seine ganze Stärke auf natürlichen Charakteren und Leidenschaften beruht, würde ganz verändert und geschwächt werden, wenn man dabei das Wunderbare brauchen wollte. Mischte sich in den Charakter des Gil Blas253, des Tartuffe, des Menschenfeindes254 irgend etwas Wunderbares, so würde unser Geist durch diese Werke weniger getroffen, weniger verführt werden. Die Nachahmung des Wahren bringt immer größere Wirkungen hervor als übernatürliche Mittel. Ohne Zweifel erlaubt uns die hohe Metaphysik anzunehmen, daß es über unsere Fassungskraft Gedanken, Gegenstände, Wahrheiten und Wesen gibt, die über alle unsere Begriffe reichen; aber da wir von diesen abstrakten Regionen nicht den mindesten Begriff haben, so können wir, selbst mit unserm Wunderbaren, ihnen nicht näher kommen ; das Wunderbare bleibt vielmehr u n t e r der Wirklichkeit, die wir kennen; übrigens begreifen wir nichts, als was mit der Natur des Menschen und der Dinge übereinstimmt. Alles also, was wir unsere Schöpfungen nennen, ist nichts als eine unzusammenhängende Versammlung von Ideen, die wir aus eben der Natur ziehen, von der wir uns zu entfernen suchen. In dem Wahren ist der göttliche Stempel. Man gibt zu, das Genie erfinde, und doch nur, indem es entdeckt, vereinigt, darstellt das, was ist, verdient es den Ehrennamen eines Schöpfers. Es gibt noch eine andere Art von Dichtungen, deren Wirkung mir noch geringer scheint als die des Wunderbaren, es sind die A l l e g o r i e n . Mir scheint, daß sie den Gedanken schwächen, wie das Wunderbare das Gemälde der Leidenschaften entstellt Unter der Form der Fabel haben die Allegorien manchmal dienen können, nützliche Wahrheiten allgemein zu machen; aber selbst dieser Ursprung ist ein Beweis, daß wenn man dem Gedanken diese Form gibt, man ihn herabzusenken glaubt, um ihn den Menschen überhaupt begreiflich zu machen. Wer Bilder braucht, um sich einen Begriff zu verschaffen, zeigt eine Schwäche des Geistes an; denn selbst einem Ge-
267
danken, den man auf diese Weise klarmachen könnte, würde es doch bis auf einen gewissen Grad an Abstraktion und Feinheit mangeln. Die Abstraktion ist weit über alle Bilder, sie hat eine geometrische Genauigkeit, und man kann sie nicht anders als mit ihren bestimmten Zeichen ausdrücken. Die vollkommene Feinheit des Geistes kann durch keine Allegorie festgehalten werden; die Schattierungen der Darstellungen sind niemals so zart als metaphysische Ideen, und was man körperlich darstellen kann, wird niemals das Geistreich-Feinste des Gedankens sein. Aber außer dem, daß die Allegorie dem Gedanken, welchen sie ausdrücken will, schadet, sind die Werke dieser Gattung fast ohne irgendeine Art von Armut. Der Zweck ist doppelt; man will eine moralische Wahrheit anschaulich machen und durch ihr Bild, durch die Fabel, einnehmen; immer mißglückt eins durch das Bedürfnis, das andere zu erreichen. Der abstrakte Begriff ist unbestimmt dargestellt, und das Gemälde hat keine dramatische Wirkung; es ist eine Fiktion in der Fiktion, an deren Begebenheiten wir keinen Anteil nehmen können, weil sie nur da sind, um philosophische Resultate vorzustellen, die man weit mühsamer begreift, als wenn sie rein metaphysisch ausgedruckt wären; man muß in Allegorien das Abstrakte von dem, was dem Bilde zugehört, sondern, die Begriffe unter dem Namen der Personen, die sie vorstellen, entdekken und das Rätsel zu erraten suchen, ehe man den Gedanken begreift. Wenn man erklären will, was dem sonst so angenehmen Gedichte Telemach255 Einförmigkeit gibt, so wird man finden, daß es die Figur des Mentors ist, die, zugleich wunderbar und allegorisch, auf doppelte Weise beschwerlich ist. Als wunderbar benimmt sie uns alle Unruhe über Telemachs Schicksal, denn man ist gewiß, daß die Götter ihn aus allen Gefahren siegreich herausführen werden; als allegorisch zerstört sie die ganze Wirkung der Leidenschaften, die aus dem innern Streite derselben entspringt. Die zwei Gewalten, welche die Moralisten in dem Herzen des Menschen unterscheiden, sind in F e n e l o n s Gedicht als zwei Personen aufgestellt. Mentors Charakter ist ohne Leidenschaft und Telemach ohne Herrschaft über sich selbst; der Mensch steht zwischen beiden, und nun weiß man nicht, an welchem Gegenstand man teilnehmen soll. Jene auffallenden Allegorien, wo, wie in Theleme und Macare256, der Wille reist, um das Glück zu finden, diese verlängerten Allegorien, in denen, wie in Spensers Fairy Queen21'1, jeder Gesang eine Tugend als Ritter im Streite gegen ein Laster vorstellt, können uns eigentlich nicht anziehen, von welcher Art auch das Talent sei, das
268,
sie verziert. Ermüdet von dem romanhaften Teil der Allegorie, gelangt man zum Ende, und man hat nicht mehr Kraft, den philosophischen Sinn zu fassen. Die Fabeln, in denen man die Tiere reden läßt, dienten im Anfang zu einer Art Gleichnis, in welcher das Volk leichter den Sinn begriff; nachher hat man daraus eine eigene Gattung der Dichtkunst gemacht, in welcher viele Schriftsteller sich geübt haben. Es gab einen Mann, der sich einzig in dieser Laufbahn zeigte, dessen Naturell so vollkommen war, daß es weder zweimal entstehn noch einmal nachgeahmt werden konnte. Ein Mann, der die Tiere reden läßt, als wenn sie eine Art von denkenden Wesen wären, in einer Welt, in der weder Vorurteile noch Anmaßungen herrschen. Eben L a F o n t a i n e n s 258 Talent entfernt von seinen Schriften die Idee der Allegorie, indem er den Charakter der Tierarten personifizieret und ihn nach seinen eigenen Verhältnissen ausmalt; das Komische seiner Fabeln kommt nicht aus Anspielungen, sondern es entspringt aus dem wahrhaften Bilde der Sitten der Tiere, die er auf den Schauplatz bringt. Notwendig war dieser Erfolg begrenzt, und alle andern Fabeln, die man in verschiedenen Sprachen versucht hat, teilen, indem sie zur Allegorie zurückkehren, auch ihre Unbequemlichkeit. Die Werke voll Anspielungen sind auch eine Art Dichtung, deren Verdienst nur die Zeitgenossen recht lebhaft empfinden; die Nachwelt beurteilt diese Schriften, ohne auf das Verdienst der Wirkung zu sehen, die sie zu ihrer Zeit haben konnten, und ohne die Schwierigkeiten in Anschlag zu bringen, die ihre Verfasser zu überwinden hatten. Sobald das Talent in einem gewissen Bezüge arbeitet, verliert es seinen Glanz mit den Umständen, die es in Bewegung setzten. Hudibras2o9 zum Beispiel ist vielleicht eins von denen, worin man an meisten Witz findet; aber weil man immer in dem, was der Verfasser gesagt hat, aufsuchen muß, was er sagen wollte, weil Noten ohne Zahl nötig sind, um seine Scherze zu verstehen, und weil man, ehe man lachen oder teilnehmen kann, sich vorläufig unterrichten muß, so kann der Wert dieses Gedichts nicht mehr allgemein empfunden werden. Ein philosophisches Werk kann fordern, daß man nachforsche, um es zu verstehen, aber eine Dichtung, von welcher Art sie sei, bringt keine entschiedene Wirkung hervor, als wenn sie in sich selbst alles enthält, wodurch sie allen Lesern, in allen Momenten, einen vollkommenen Eindruck geben kann. Je mehr eine Handlung zu den gegenwärtigen Umständen paßt, desto nützlicher ist sie, deswegen ist ihr Ruhm unsterblich; die Werke des Schrift269
stellers aber gewinnen nur, insofern sie sich von den gegenwärtigen Begebenheiten losmachen, um sich zur unveränderlichen Natur der Dinge zu erheben, und alles, was die Schriftsteller für den Augenblick tun, ist, wie Massillon260 sich ausdrückt, verlorne Zeit für die Ewigkeit. Einzelne Gleichnisse, die auch gewissermaßen Allegorien sind, zerstreuen die Aufmerksamkeit weniger, und der Gedanke, der vor ihnen meist vorausgeht, wird nur durch sie aufs neue entwickelt; aber selten ist ein Gefühl oder ein Gedanke in seiner ganzen Stärke, wenn man sie durch ein Bild ausdrücken kann; das „Sterben soll er!" des alten Horaz 261 hätte kein Bild vertragen. Wenn man das Kapitel des Montesquieu liest, wo er, um den Despotismus zu schildern, ihn mit den Wilden der Louisiane vergleicht262, so wünschte man an der Stelle dieses Bildes einen Gedanken des Tacitus263 oder des Verfassers selbst zu lesen. Freilich würde es zu streng sein, allen diesen Putz zu verbannen, dessen der menschliche Geist so notwendig hat, um von neuen Begriffen auszuruhen oder den bekannten Mannigfaltigkeit zu geben. Die Bilder, die Schilderungen bringen den Zauber der Poesie hervor und beleben alles, was ihr ähnlich ist; aber was aus dem Nachdenken entspringt, erlangt eine größere Gewalt, eine weit mehr konzentrierte Kraft, wenn der Ausdruck des Gedankens seine Stärke nur aus ihm selbst nimmt. Auch unter den Allegorien, wie unter den wunderbaren Dichtungen, finden wir Werke, die philosophische Ideen scherzhaft vortragen wollen; so ist das Märchen von der Tonne, Gulliver264, Mikrotnegas265 usw. Ich könnte von dieser Gattung wiederholen, was ich von der andern gesagt habe: wenn man Lachen erregt, so ist der Zweck erfüllt; aber doch gibt es einen höhern Zweck in dieser Art von Schriften; man will einen philosophischen Gegenstand anschaulich machen, und es geschieht nur unvollkommen. Wenn die Allegorie an sich selbst unterhaltend ist, so merken die Menschen mehr auf die Fabel als auf das Resultat, und Gulliver hat mehr als Märchen gereizt, als seine Resultate unterrichtet und moralisch gebessert haben. Die Allegorie wandelt immer zwischen zwei Klippen. Ist ihr Zweck zu deutlich ausgesprochen, so wird er lästig; ist er verborgen, so vergißt man ihn; versucht man die Aufmerksamkeit zu teilen, so kommt man in Gefahr, gar keine zu erregen.
270
II In dem zweiten Teil versprach ich von historischen Dichtungen zu reden, von Erfindungen nämlich, die auf wahre Begebenheiten gegründet sind. Die Gegenstände der Tragödien sind meist aus der Geschichte genommen; doch wenn man so viele Empfindungen in einen Raum von vierundzwanzig Stunden 266 und fünf Akten einschließen soll, oder wenn man seinen Helden in der Höhe der epischen Poesie erhalten will, so zeigt uns kein Mensch, keine Geschichte ein vollkommenes Muster. Hier ist Dichtung nötig, aber sie nähert sich nicht dem Wunderbaren. Es ist keine andere Natur; hier ist eine Wahl aus der, die vor uns liegt. Wir dürfen alsdann der poetischen Sprache nur das, was ihr eigen ist, nachgeben, so ist unser Herz der beste Richter der schönsten Situationen und der epischen oder dramatischen Charaktere; sie sind von der Geschichte entlehnt, nicht aber entstellt; sie sind von dem, was sie Sterbliches hatten, abgesondert und so gewissermaßen vergöttert; nichts ist außer der Natur in dieser Dichtungsart; natürliche Verhältnisse, natürlicher Gang; und wenn ein Mensch, der zum Ruhme geboren ist, ein Meisterstück wie die Henriade, den Gengiskart, Mithridat oder Tancred^1 anhört, wird er bewundern, ohne zu staunen, er wird genießen, ohne an den Verfasser zu denken und ohne hier die Schöpfung eines talentreichen Künstlers zu vermuten. Aber es gibt eine andere Art von historischen Dichtungen, die ich völlig verbannt wünschte; es sind Romane, auf die Geschichte gepfropft, wie die Anekdoten des Hofs Philipp Augusts268 und andere. Man könnte diese Romane artig finden, wenn man die bekannten Namen veränderte, aber jetzt stellen sich diese Erzählungen zwischen uns und die Geschichte, um uns Details zu zeigen, deren Erfindung, indem sie den gewöhnlichen Lauf des Lebens nachahmt, sich dergestalt mit dem Wahren verwirrt, daß man sie davon nicht wieder abscheiden kann. Diese Gattung zerstört die Moralität der Geschichte, indem sie die Handlungen mit einer Menge Beweggründe, die niemals existiert haben, überladen muß, und reicht nicht an den Wert des Romans, weil sie, genötigt, sich an ein wahres Gewebe zu halten, den Plan nicht mit Freiheit und mit der Folge ausbilden kann, wie es bei einem Werk von reiner Erfindung nötig ist. Das Interesse, das ein schon berühmter Name für den Roman erregen soll, gehört zu den Vor271
teilen der Anspielungen, und ich habe schon zu zeigen versucht, daß eine Dichtung, die Erinnerungen statt Entwickelungen zu Hülfe nimmt, niemals in sich selbst vollkommen sei. Auch ist es übrigens gefährlich, die Wahrheit so zu entstellen; man malt in solchen Romanen nur die Verwickelungen der Liebe. Die übrigen Begebenheiten der Epoche, die man wählt, sind alle schon durch den Geschichtsschreiber dargestellt, nun will man sie durch den Einfluß der Liebe erklären, um den Gegenstand seines Romans zu vergrößern; und so stellt man ein ganz falsches Bild des menschlichen Lebens auf. Man schwächt durch diese Dichtung die Wirkungen, welche die Geschichte hervorbringen sollte, von der man den ersten Gedanken geborgt hat, wie ein übles Gemälde dem Eindruck des Originals schaden kann, woran es durch einige Züge unvollkommen erinnert. III Die dritte und letzte Abteilung dieses Versuchs soll von dem Vorzuge solcher Dichtungen handeln, in denen alles zugleich erfunden und nachgeahmt ist. Die Trauerspiele, deren Inhalt ganz erfunden ist, werden aber nicht in dieser Abteilung begriffen sein, sie malen eine erhöhtere Natur, einen hohen Stand und eine besondere Lage. Die Wahrscheinlichkeit dieser Stücke hängt von sehr seltenen Begebenheiten ab, aus denen nur wenig Menschen sich etwas zueignen können. Zwar nehmen die Dramen, die Komödien auf dem Theater denselben Rang ein, den die Romane unter den andern Dichtungsarten haben, auch hier erscheint das Privatleben und natürliche Umstände; aber die theatralischen Bedürfnisse hindern solche Entwickelungen, durch welche man das Beispiel zunächst auf sich beziehen kann. Man hat zwar dem Drama erlaubt, seine Personen anderswoher als aus der Klasse der Könige und Helden zu wählen, aber man kann nur starke Verhältnisse malen, weil man nicht die Zeit hat, die Schattierungen abzustufen. Das Leben ist nicht so eingeschränkt, nicht in Kontrasten, nicht theatralisch, wie ein Stück erfunden sein muß. Die dramatische Kunst hat andere Wirkungen, andere Mittel, andere Vorteile, von denen man besonders reden müßte; aber nur der neue Roman ist imstande, auf unsere Bildung durch das Gemälde unserer gewohnten Empfindungen nützlich zu wirken. Man hat eine besondere Klasse für die philosophischen Romane errichten wollen und hat nicht bedacht, daß alle philosophisch sein sollen. Alle sollen, aus der innern Natur des Menschen geschöpft, 272
wieder zu seinem Innern sprechen, und hierzu gelangt man weniger, wenn man alle Teile der Erzählungen auf einen Hauptbegriff richtet, denn man kann alsdann weder wahr noch wahrscheinlich in der Verbindung der Begebenheiten sein; jedes Kapitel ist eine Art von Allegorie, deren Begebenheiten nichts als das Bild des Grundsatzes darstellen, der nun folgen soll. Die Romane Candide, Zadig und Memnorp1®, die übrigens so allerliebst sind, würden viel tiefer auf uns wirken, wenn sie erstlich nicht wunderbar wären, wenn sie ein Beispiel und kein Gleichnis darstellten, und dann, wenn die Geschichte nicht gewaltsam auf e i n e n Zweck hindeutete. Diesen Romanen geht es wie den Lehrmeistern, denen die Kinder nicht glauben, weil alles, was begegnet, zu der Lektion passen soll, die sie ihnen einschärfen wollen; da doch die Kinder schon ohngefähr merken, daß in dem wahren Gang der Begebenheiten weniger Regelmäßigkeit ist. Aber in den Romanen R i c h a r d s o n s und F i e l d i n g s , die sich an der Seite des Lebens halten, um die Abstufungen, die Entwikkelungen, die Inkonsequenzen der Geschichte des menschlichen Herzens darzustellen und doch dabei die beständige Rückkehr der Resultate aller Erfahrungen zur Moralität der Handlungen und zum Vorteil der Tugend zu zeigen, sind die Begebenheiten erfunden, aber die Empfindungen dergestalt aus der Natur, daß der Leser oft glaubt, man rede mit ihm und habe nur die kleine Rücksicht genommen, den Namen der Person zu verändern. Die Kunst, Romane zu schreiben, steht nicht in dem Rufe, den sie verdient, denn eine Menge ungeschickter Verfasser haben mit ihren elenden Arbeiten eine Gattung erdrückt, in der die Vollkommenheit das größte Talent erfordert und in welcher jedermann mittelmäßig sein kann. Diese unzählbare Menge geschmackloser Romane hat fast die Leidenschaft selbst, welche sie schildern, abgenutzt, und man fürchtet sich, in seiner eigenen Geschichte das mindeste Verhältnis zu Situationen zu finden, welche sie beschreiben. Nur die Autorität großer Meister konnte diese Gattung wieder emporheben, ohngeachtet so viele Schrifsteller sie heruntergebracht hatten. Wie sehr zu bedauern ist es, daß man solche Werke erniedrigt, indem man die häßlichen Gemälde des Lasters hineinmischte und, anstatt sich des Vorteils der Dichtung zu bedienen, um alles, was in der Natur belehren und als Muster dienen könnte, um den Menschen zu sammeln, geglaubt hat, daß man die gehässigen Gemälde der verdorbenen Sitten nicht ohne gute Wirkung darstellen könne, eben als wenn ein Herz, das sie abstößt, so rein bliebe als das Herz, das sie niemals kannte. 18
Geißlcr, Ronunthcotie
273
Dagegen ist ein Roman, wie man sich davon einen Begriff machen kann, wie wir auch einige Muster haben, eine der schönsten Produktionen des menschlichen Geistes. Sie wirkt mit stiller Gewalt auf die Gesinnungen der Privatpersonen, aus denen nach und nach die öffentlichen Sitten sich bilden. Demohngeachtet ist aus gewissen Ursachen die Achtung für das Talent, das nötig ist, um solche Werke hervorzubringen, nicht allgemein genug, da sie sich gewöhnlich der Liebe widmen, der gewaltsamsten, allgemeinsten und wahrsten aller Leidenschaften, diese aber ihren Einfluß nur über die Jugend ausübt und in den übrigen Epochen des Lebens nicht mehr zur Teilnahme aufruft. Aber sind nicht alle tiefe und zärtliche Empfindungen von der Natur der Liebe? Wer ist zum Enthusiasmus der Freundschaft fähig? wer zur Ergebung im Unglück? wer zur Verehrung seiner Eltern? wer zur Leidenschaft für seine Kinder? als ein Herz, das die Liebe gekannt oder verziehen hat. Man kann Ehrfurcht für seine Pflichten haben, aber niemals sie mit frohem Hingeben erfüllen, wenn man nicht mit allen Kräften der Seele geliebt hat, wenn man nicht e i n m a l aufgehört hat zu sein, um ganz in einem andern zu leben. Das Schicksal der Weiber, das Glück der Männer, die nicht berufen sind, Reiche zu regieren, hängt oft für das übrige Leben von dem Einfluß ab, den sie in der Jugend der Liebe auf ihre Herzen erlaubt haben; aber in einem gewissen Alter vergessen sie jene Eindrücke ganz und gar, sie nehmen einen andern Charakter an, beschäftigen sich mit andern Gegenständen und überlassen sich andern Leidenschaften. Diese neuen Bedürfnisse müßte man auch zum Inhalt der Romane wählen, dann, scheint mir, würde sich eine neue Laufbahn denjenigen eröffnen, die das Talent besitzen, zu schildern und durch die innerste Kenntnis aller Bewegungen des menschlichen Herzens uns anzulocken. Der Ehrgeiz, der Stolz, die Habsucht, die Eitelkeit könnten Gegenstände zu Romanen werden, deren Vorfälle neuer und deren Begebenheiten ebenso mannigfaltig sein würden als diejenigen, die aus der Liebe entspringen. Wollte man sagen, daß die Schilderung jener Leidenschaften schon in der Geschichte aufgestellt wird und daß man sie eigentlich da aufsuchen müsse, so läßt sich antworten: daß die Geschichte niemals zu dem Privatleben der Menschen reicht, nicht bis zu den Empfindungen und Charaktern, woraus keine öffentliche Begebenheiten entsprungen sind. Auch wirkt die Geschichte nicht auf uns durch ein moralisches und unterhaltenes Interesse, das Wahre ist öfters unvollständig in seinen Wirkungen. Übrigens würde man durch Entwickelungen, die allein 274
tiefe Eindrücke hinterlassen, den schnellen und notwendigen Gang der Erzählung aufhalten und einem historischen Werk eine Art von dramatischer Form geben, da es doch ein ganz anderes Verdienst haben soll. Endlich ist die Moral der Geschichte niemals vollkommen ausgesprochen, entweder weil man nicht beständig und mit Gewißheit die innern Empfindungen darstellen kann, wodurch die Bösen in der Mitte ihres Glücks gestraft werden und tugendhafte Seelen sich bei allem Unglück belohnt fühlen, oder weil das Schicksal des Menschen überhaupt in diesem Leben nicht zu seinem Ende gelangt. Die praktische Moral, die auf die Vorteile der Tugend gegründet ist, wird durch das Lesen der Geschichte nicht immer gestärkt. Zwar versuchen die großen Geschichtsschreiber, und besonders Tacitus 270 , die Moralität aller Begebenheiten, die sie erzählen, zu zeigen; man beneidet den sterbenden Germanicus und verabscheut Tiberen auf seiner Höhe 271 , aber doch können Geschichtsschreiber nur diejenigen Empfindungen malen, v.on welchen die Handlungen zeugen, und das, was sich bei der Geschichte am lebhaftesten eindruckt, ist mehr das Übergewicht des Talents, der Glanz des Ruhms und der Vorteil der Macht als eine stille Sittenlehre, die zart und sanft das Glück der einzelnen Menschen, in ihren nächsten Verhältnissen, hervorbringt. Ich will dadurch keineswegs der Geschichte zu nahe treten und ihr die Erfindungen ausschließlich vorziehen, denn diese müssen ja selbst aus der Erfahrung geschöpft werden. Die feinen Schattierungen, die uns der Roman vorlegt, fließen aus philosophischen Resultaten her, aus jenen Grundideen, die uns das große Bild der öffentlichen Begebenheiten gleichfalls darstellt. Aber die Moralität der Geschichte kann nur in ihrer großen Masse beruhen. Nur durch die Rückkehr einer gewissen Anzahl von Veränderungen lehrt uns die Geschichte wichtige Resultate, die jedoch nicht einzelne Menschen, wohl aber ganze Nationen sich zueignen können. Ein Volk kann von den Regeln, welche die Geschichte aufstellt, Gebrauch machen, weil sie unveränderlich sind und man sie auf allgemeine und große Verhältnisse immer anwenden kann, aber man sieht in der Geschichte nicht die Ursachen der vielfachen Ausnahmen, und eben diese Ausnahmen können jeden einzelnen Menschen verführen; denn wenn die Geschichte uns bedeutende Umstände bewahrt, so bleiben doch dazwischen ungeheure Lücken, in welchen vieles Unglück, viele Fehler Raum haben, woraus doch die meisten Schicksale der Privatpersonen bestehen. Dagegen können die Romane mit so viel Gewalt und so ausführlich Charakter und Empfindungen 18*
275
malen, daß keine Lektüre einen so tiefen H a ß gegen das Lastet und eine so reine Liebe für die Tugend hervorbringen könnte. Die Moralität der Romane hängt mehr von der Entwicklung innerer Bewegungen der Seele als von den Begebenheiten ab, die man erzählt; nicht aus dem willkürlichen Umstand, den der Verfasser erfindet, um das Laster zu strafen, zieht man die nützliche Lehre; aber die Wahrheit der Gemälde, die Steigerung oder Verkettung der Fehler, der Enthusiasmus bei Aufopferungen, die Teilnahme am Elend läßt unauslöschliche Züge zurück. Alles ist in solchen Romanen so wahrscheinlich, daß man sich leicht überredet, alles könne so begegnen; es ist nicht die Geschichte des Vergangenen, aber man könnte oft sagen, es sei die Geschichte der Zukunft. Man hat behauptet, daß Romane eine falsche Idee vom Menschen geben; das ist von schlechten Romanen wahr, wie von Gemälden, welche die Natur übel nachahmen ; aber nichts gibt eine so tiefe Kenntnis des menschlichen Herzens als diese Gemälde aller Umstände des, gemeinen Lebens und der Eindrücke, die sie hervorbringen; nichts übt so sehr das Nachdenken, das in dem Einzelnen sehr viel mehr zu entdecken findet als in allgemeinen Ideen. Die Schriften, welche uns die Denkwürdigkeiten einzelner Menschen überliefern und die wir unter dem allgemeinen Namen der M e m o i r e n begreifen, würden auch diesen Endzweck erreichen, wenn sie nicht auch, wie die Geschichte, nur berühmte Männer und öffentliche Angelegenheiten allein beträfen. Und wären auch die meisten Menschen geistreich und aufrichtig genug, um eine getreue und charakteristische Rechenschaft von dem zu geben, was sie im Lauf ihres Lebens erfahren haben, so könnten doch diese aufrichtigen Erzählungen nicht alle Vorteile des Romans in sich vereinigen, denn man würde in ihnen eine Art dramatischen Effekts vermissen, der die Wahrheit nicht entstellen darf, aber der sie, indem er sie zusammendrängt, auffallender macht; so wie die Kunst des Malers die Gegenstände nicht verändert, sondern sie nur fühlbarer darstellt. Die Natur läßt uns oft die Gegenstände ohne Abstufung sehen, sie zeigt Kontraste nicht auffallend, und indem man sie knechtisch nachahmte, würde man sie niemals darstellen; die genaueste Erzählung enthält zwar eine gewisse Wahrheit der Nachahmung; vom Bilde verlangt man aber eine Harmonie, die ihm eigen sei, und eine wahre Geschichte, merkwürdig durch ihre Schattierungen, durch Empfindungen und Charaktere, bedarf dennoch zu ihrer Darstellung eines Talents, das auch fähig wäre, eine Dichtung hervorzubringen. 276
Wenn uns nur nicht auch das Genie, das wir bewundern müssen, weil es uns in die Tiefen des menschlichen Herzens blicken läßt, manchmal durch so viele Details beschwerlich fiele, mit welchen die berühmtesten Romane gleichsam erdrückt sind. Der Autor glaubt, daß ein Gemälde dadurch an Wahrscheinlichkeit gewinne, und sieht nicht, daß alles, was das Interesse schwächt, die einzige Wahrheit der Fiktion zerstört, den Eindruck nämlich, den sie hervorbringt. Wenn man auf dem Theater alles, was in dem Zimmer vorgeht, vorstellen wollte, so würde man die theatralische Illusion völlig zerstören. So haben die Romane auch ihre dramatischen Bedingungen, und es gibt in der Erfindung nichts Notwendiges, als was die Wirkung des Erfundenen vergrößern kann. Wenn ein Blick, eine Bewegung; ein unbemerkter Umstand dienen kann, einen Charakter zu malen; eine Empfindung zu entwickeln, so hat man, je einfacher das Mittel ist, desto mehr Verdienst, es ergriffen zu haben; aber die genaue einzelne Darstellung einer gewöhnlichen Begebenheit vermindert die Wahrscheinlichkeit, anstatt sie zu vermehren. Wenn man zur positiven Idee des Wahren durch Details, die nur ihm gehören, zurückgeführt wird, so tritt man aus der Illusion heraus, und man ist bald ermüdet, weder den Unterricht der Geschichte noch das Interesse des Romans zu finden. In der Gabe zu bewegen liegt die große Gewalt der Dichtungen; man kann fast alle moralische Wahrheiten fühlbar machen, wenn man sie in Handlung setzt. Die Tugend hat einen solchen Einfluß auf das Glück oder Unglück des Menschen, daß man die meisten Lagen des Lebens von ihr abhängig machen kann. Es gibt strenge Philosophen, die alle Rührung verdammen, die verlangen, daß die Sittenlehre ihre Gewalt allein durch den Ausspruch ihrer Pflichten ausübe, aber nichts paßt weniger zu der Natur des Menschen überhaupt als eine solche Meinung; man muß die Tugend beleben, wenn sie mit Vorteil gegen die Leidenschaften streiten soll, nur ein erhöhtes Gefühl findet Freude bei der Aufopferung. Man muß das Unglück auszieren, wenn es allen Gaukeleien verderblicher Verführungen vorgezogen werden soll. J a ! die rührenden Dichtungen sind es, welche die Seele in großmütigen Leidenschaften üben und ihr darin eine Gewohnheit geben. Ohne es zu wissen, geht sie ein Bündnis mit sich selbst ein, und sie würde sich schämen, zurückzutreten, wenn ihr eine solche Lage persönlich werden könnte. Aber je mehr die Gabe zu rühren eine wirkliche Gewalt hat, desto nötiger ist es, ihren Einfluß auf Leidenschaften eines jeden Alters,
277
auf Pflichten einer jeden Lage auszudehnen; die Liebe ist meist der Gegenstand der Romane, und Charaktere, auf die sie nicht wirkt, sind nur wie Beiwerke angebracht. Wenn man einem andern Plan folgte, würde man eine Menge neuer Gegenstände entdecken. Tom Jones272 hat von allen Werken dieser Art die allgemeinste Moral, die Liebe erscheint darin nur als ein Mittel, damit das philosophische Resultat desto lebhafter hervortrete. Zu zeigen, wie ungewiß das Urteil sich auf den äußern Schein gründe, zu zeigen, welches Übergewicht die natürlichen Eigenschaften über jene Reputationen haben, denen nur die Rücksicht äußerer Verhältnisse zugute kommt, dieses hatte der Verfasser des Tom Jones vor Augen, und es ist einer der nützlichsten und mit Recht berühmtesten Romane. Neuerlich ist einer erschienen, dem man zwar hie und da Längen und Nachlässigkeiten vorwerfen kann, aber der genau die Idee der unerschöpflichen Gattung gibt, von der ich gesprochen habe, es ist Caleb Williams von Godwin 273 . Die Liebe hat wenig Einfluß in diese Dichtung, nur eine grenzenlose Leidenschaft für äußeres Ansehn in dem Helden des Romans und in Caleb eine verzehrende Neugierde, ob auch Falkland die Achtung verdiene, die er erworben hat, bringt das Interesse der Erzählung hervor, und indem man von dieser romanhaften Darstellung hingerissen wird, wird man dabei zum tiefsten Nachdenken aufgefordert. Einige unter Marmontels Moralischen Erzählungen, einige Kapitel der Empfindsamen Reise, einige abgesonderte Anekdoten aus dem Zuschauer274 und andern moralischen Schriften, einige Stücke aus der deutschen Literatur, welche sich täglich mehr erhebt, zeigen uns eine kleine Anzahl glücklicher Dichtungen, die uns die Verhältnisse anderer Leidenschaften als der Liebe darstellen. Aber ein neuer Richardson hat sich noch nicht gewidmet, die übrigen Leidenschaften der Menschen in einem Roman zu schildern, ihren Fortschritt, ihre Folgen ganz zu entwickeln; das Glück eines solchen Werks könnte nur aus der Wahrheit der Charaktere, aus der Stärke der Kontraste, der Energie der Situationen entstehen und nicht aus jener Empfindung, die so leicht zu malen ist, die uns so bald einnimmt, die den Weibern gefiele durch das, woran sie erinnert, wenn sie auch nicht durch Größe oder Neuheit der Bilder anzöge. Was für Schönheiten ließen sich nicht in einem ehrgeizigen Lovelace275 entdecken? Auf welche Entwickelungen würde man geraten, wenn man alle Leidenschaften zu ergründen und bis in ihre einzelnen Wirkungen zu kennen bemüht wäre, wie bisher die Liebe in den Romanen behandelt worden ist.. 278
Man sage nicht, daß moralische Schriften zur Kenntnis unserer Pflichten vollkommen hinreichen; sie können nicht die Schattierungen einer zarten Seele verfolgen, sie können nicht zeigen, was alles in einer Leidenschaft liegt. Man kann aus guten Romanen eine reinere, höhere Moral herauszuziehen als aus einem didaktischen Werk über Tugend; eine solche Schrift, indem sie trockner ist, muß zugleich nachsichtiger sein, und die Grundsätze, welche man im allgemeinen muß anwenden können, werden niemals den Heroismus der Zartheit erreichen, von dem man wohl ein Beispiel aufstellen, daraus aber mit Vernunft und Billigkeit niemals eine Pflicht machen kann. Welcher Moralist hätte sagen dürfen: Wenn deine Familie dich zwingen will, einen abscheulichen Menschen zu heiraten, und du dich durch diese Verfolgung verleiten lässe&t, einem Mann, der dir gefällt, nur einige Zeichen der reinsten Neigung zu geben, so wirst du dir Schande und Tod zuziehen! und doch ist das der Plan von Ciarissen, das ist's, was man mit Bewunderung liest, ohne sich gegen den Verfasser aufzulehnen, der uns rührt und gewinnt. Welcher Moralist hätte zu behaupten gewagt, daß es besser sei, sich der tiefsten Verzweifelung zu überlassen, der Verzweifelung, die den Verstand angreift und das Leben bedroht, als den tugendhaftesten Mann zu heiraten, dessen Religion von der eurigen verschieden ist, und doch rührt uns Clementinen^276 Liebe, indem sie gegen Gewissensskrupel kämpft, wenn wir auch ihre abergläubischen Meinungen nicht billigen. Der Gedanke der Pflicht, die über Leidenschaft siegt, ist ein Anblick, der auch selbst diejenigen erweicht und rührt, deren Grundsätze nicht im mindesten streng sind und die mit Verachtung ein solches Resultat verworfen hätten, wenn es sich vor der Schilderung als Grundsatz hätte aufdringen wollen, da es als Folge und Wirkung ganz natürlich aus ihr herfließt. So finden sich in Romanen einer weniger erhabenen Art die zartesten Grundsätze über das Betragen der Frauen; in den Meisterstücken, die unter dem Namen der Prinzessin von Cleve, des Grafen Comminge, Ceciliens bekannt sind, in den- Romanen der Madame Riccoboni, in Carolinen, deren Reiz so allgemein empfunden wird, in der rührenden Episode von Callisten, in Camillens Briefenworin die Fehler einer Frau und das Unglück, das sie nach sich ziehen, ein sittlicheres, ein strengeres Bild sind als selbst der Anblick der Tugend, und wieviel französische, englische und deutsche Werke könnte ich anführen, um diese Meinung zu bestätigen. Ich wiederhole: die Romane haben das Recht, die strengste Tugend darzustellen, ohne daß wir uns dagegen 279
auflehnen. Sie haben unser Gefühl gewonnen, und das allein spricht für die Nachsicht, und indessen moralische Schriften und ihre strengen Grundsätze durch das Mitleid gegen das Unglück oder durch den Anteil an der Leidenschaft bestritten werden, besitzen die Romane die Kunst, selbst diese Regungen auf ihre Seite zu ziehen und sie zu ihrem Endzweck zu gebrauchen. Was man gegen die Romane, in welchen die Liebe behandelt wird, immer mit vielem Rechte sagen kann, ist, daß diese Leidenschaft darin so gemalt ist, daß sie dadurch erzeugt werden kann, und daß es Augenblicke des Lebens gibt, in welchen diese Gefahr größer ist als alle Vorteile, die man davon erwarten könnte; aber diese Gefahr würde niemals entstehn, wenn man andere Leidenschaften der Menschen zum Gegenstand wählte. Indem man die ersten flüchtigsten Symptome einer gefährlichen Leidenschaft charakteristisch zeichnete, könnte man sich und andere davor zu bewahren suchen; der Ehrgeiz, der Stolz, die Habsucht erzeugen sich oft ohne Wissen derer, die sich ihnen nach und nach ergeben, nur die Liebe wächst durch die D a r stellung ihrer eignen Gefühle, aber das beste Mittel, die übrigen Leidenschaften zu bestreiten, ist, sie zu entdecken und aufzustellen. Wenn ihre Züge, ihre Triebfedern, ihre Mittel und ihre Wirkungen so an den T a g gebracht, so durch die Romane popularisiert würden, wie es mit der Geschichte der Liebe gegangen ist, so würde man in der Gesellschaft über alle Verhandlungen des Lebens die Regeln weit sicherer und die Grundsätze zarter finden. Aber wenn auch bloß philosophische Schriften, wie es Romane tun, alle möglichen Schattierungen unserer Handlungen voraussehen und aufstellen könnten, so würde die dramatische Moral doch noch immer den großen Vorteil haben, daß sie uns zur Indignation bewegen, unsere Seele erheben und eine sanfte Melancholie über sie ausbreiten und durch diese verschiedenen Wirkungen romanhafter Situationen die Erfahrung gleichsam supplieren kann. Dieser Eindruck ist demjenigen ähnlich, den wir erhalten hätten, wenn wir Zeugen bei den Fällen selbst gewesen wären, aber indem er immer auf e i n e n Zweck gerichtet ist, wird der Gedanke nicht zerstreuet, wie es durch die unzusammenhängenden Gegenstände, die uns umgeben, geschieht; und laßt uns noch eins bedenken, es gibt Menschen, über welche die Pflicht keine Gewalt hat und die man vielleicht noch vom Laster abhalten könnte, wenn man ihnen zeigte, es sei möglich, sie zu rühren. Zwar würden Charaktere, die nur durch Beihülfe der Rührung menschlich sein könnten, die, wenn ich mich so ausdrücken darf, des
280
physischen Vergnügens der Seele bedürfen, um gut und edel zu sein, unsere Achtung wenig verdienen, aber wenn die Wirkung rührender Fiktionen allgemein und populär würde, dürfte man vielleicht hoffen, in einer Nation solche Wesen nicht mehr zu finden, deren Charakter eine unbegreifliche moralische Aufgabe bleibt. Der Stufengang vom Bekannten zum Unbekannten ist lange unterbrochen, ehe man begreifen kann, was vor Empfindungen die Henker Frankreichs 278 geleitet haben. Keine Beweglichkeit des Geistes, keine Erinnerung eines einzigen mitleidigen Eindrucks muß sich in ihrer Seele bei keiner Gelegenheit, durch keine Schrift entwickelt haben, daß es ihnen möglich ward, so anhaltend, so unnatürlich grausam zu sein und dem menschlichen Geschlecht, zum erstenmal, eine vollkommene grenzenlose Idee des Verbrechens zu geben. Es gibt Werke, wie den Brief Abelards von Popen, Werther, die Portugiesischen Briefe; es gibt ein Werk in der Welt: Die neue Heloisederen größtes Verdienst in der Beredsamkeit der Leidenschaften besteht, und obgleich der Gegenstand oft moralisch ist, so gewinnen wir doch eigentlich nur dadurch den Begriff von der Allmacht des Herzens. Man kann diese Art Romane in keine Klasse stellen. Es gibt in einem Jahrhundert e i n e Seele, e i n Genie, das dahin zu reichen vermag, es kann keine Gattung werden, man kann dabei keinen Endzweck sehen; aber wollte man wohl diese Wunder der Sprache verbieten, diese tiefgeholten mächtigen Ausdrücke, die allen Bewegungen passionierter Charaktere genugtun? Leser, die ein solches Talent mit Enthusiasmus aufnehmen, sind nur in einer kleinen Anzahl, und solche Werke tun ihren Bewunderern immer wohl. Laßt brennenden und gefühlvollen Seelen diesen Genuß, sie können ihre Sprache nicht verständlich machen; die Gefühle, von denen sie bewegt werden, begreift man kaum, und man verdammt sie immer. Sie würden sich auf der Welt ganz allein glauben, sie würden bald ihre Natur, die sie von allen Menschen trennt, verwünschen, wenn leidenschaftliche und melancholische Werke ihnen nicht eine Stimme in der Wüste des Lebens hören ließen und in ihre Einsamkeit einige Strahlen des Glücks brächten, das ihnen in der Mitte der Welt entflieht. In diesen Freuden der Abgeschiedenheit finden sie Erholung von den vergeblichen Anstrengungen betrogner Hoffnung, und wenn die Welt sich fern von dem unglücklichen Wesen bewegt, so bleibt eine beredte und zärtliche Schrift bei ihm, wie ein treuer Freund, der ihn genau kennt. Ja das Buch verdient unsern Dank, das nur einen einzigen Tag den Schmerz zerstreut; es dient gewöhnlich den 281
besten Menschen, denn zwar gibt es Schmerzen, die aus Fehlern des Charakters entspringen, aber wie viele kommen nicht aus einer Superiorität des Geistes oder aus einer Fühlbarkeit des Herzens, und man würde das Leben viel besser ertragen, wenn man einige Eigenschaften weniger hätte. Eh ich es noch kenne, hab' ich Achtung für das Herz, das leidet, und gebe solchen Dichtungen Beifall, wenn sie auch nur Linderung seiner Schmerzen zum Zweck hätten. In diesem Leben, wodurch man besser hindurchgeht, je weniger man es fühlt, sollte man nur den Menschen von sich und andern abzuziehen suchen, die Wirkung der Leidenschaften aufhalten und an ihre Stelle einen unabhängigen Genuß setzen. Wer es vermöchte, könnte für den größten Wohltäter des menschlichen Geschlechts gehalten werden, wenn der Einfluß seines Talents nicht auch verschwände.
Anmerkungen
Abkür%ungsver%eicbnis Coulet, Roman
- Henri Coulet: Le roman jusqu' à la Ré-
Diderot, Eloge
- Denis Diderot: Eloge de Richardson.
volution. 2 Bde. Paris 1968. In:
Œuvres esthétiques. Ed. crit. p. Paul Vernière. Paris 1968. Encyclopédie
- Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. [Hg. : Di-
Grimm,
Correspondance
derot/d'Alembert.] 35 Bde. Paris
1751-80.
- Friedrich Melchior Grimm/Denis
Diderot:
Correspondance littéraire, philosophique et critique. E d . Maurice Tourneux. Bd. 1 - 1 6 . Paris 1 8 7 7 - 1 8 8 2 . Deutsch: Melchior Grimm: Paris zündet die Lichter an.
Literarische
Korrespondenz. Hg. v. Kurt Schnelle. Leipzig 1977. Huet, Origine
- Pierre-Daniel Huet: Lettre-traité sur l'origine des romans . . . E d . crit. par Fabienne Gégou. Paris 1971.
Irailh,
Querelles
- Simon-Augustin Irailh: Querelles littéraires. Bd. 2. Paris
Jauß, Nachahmungsprinzip
1761.
- Hans Robert Jauß: Nachahmungsprinzip und Wirklichkeitsbegriff in der Theorie des Romans von Diderot bis Stendhal. I n : Nachahmung und Illusion. München
Krauss, Romantheorie
1964.
- Werner Krauss: Zur französischen
Roman-
theorie des 18. Jahrhunderts. I n :
Krauss:
Essays zur französischen Literatur. Berlin Weimar 1968, S. 8 0 - 1 0 1 . L'année littéraire
- L'année littéraire, ou suite des lettres sur quelques écrits de ce temps. Amsterdam Paris 1782.
Marmontel, Essai
- Jean-Français Marmontel: Essai sur les romans, considérés du côté moral. I n : Œuv-
283
May, Dilemme
-
Mercier, Bonnet de nuit
-
MEW
-
Rousseau, Nouvelle Héloïse
-
Sade, Idée
-
Staël, Essai sur les fictions
-
res de Marmontel. Bd. 3/2. Paris 1819. S. 558-596. Georges May: Le dilemme du roman au XVIII e siècle. New Haven - Paris 1963. Louis-Sébastien Mercier: Mon bonnet de nuit. Bd. 2, Neuchâtel - Versailles 1784. Karl Marx/Friedrich Engels: Werke. Bd. 1 bis 39 (u. 2 Erg.-Bde„ 2 Verz.-Bde.). Hg. v. Institut fiir Marxismus/Leninismus beim ZK der SED. Berlin 1956-1971. Jean-Jacques Rousseau: Julie ou La Nouvelle Héloïse. Hg. v. René Pomeau. Paris. Garnier Frères 1960. Donatien-Alphonse-François de Sade: Idée sur lès romans. In: de Sade: Les crimes de l'amour. Bd. 1. Paris 1955. Anne-Louise-Germaine de Staël: Essai sur les fictions. In: Œuvres complètes, publiées par son fils. Bd. 2. Paris 1820.
Anmerkungen
den Thesen
1 Umfassende Studien wie: May, Dilemme und Krauss, Romantheorie blieben Einzelerscheinungen. Auf dem 1968 vom C.E.R.M. veranstalteten Kolloquium über „Roman et lumières au XVIII e siècle" (publ. Paris 1970) wurde zwar auf wichtige Fragen hingewiesen und sogar der Problemkreis recht umfassend in einem „Document préparatoire" von R. Desné und anderen abgesteckt, doch blieb die Realisierung bis heute unbefriedigend. Vgl. ferner: Vivienne Mylne: The 18 th Century French Novel. Techniques of Illusion. Manchester 1965; Nachahmung und Illusion. Kolloquium Gießen, Juni 1963. Hg. v. H. R. Jauß. München 1964; Französische Aufklärung. Bürgerliche Emanzipation, Literatur und Bewußtseinsbildung. Kapitel XI: Erzählliteratur und revolutionäres Bewußtsein in der Aufklärung (R. Geißler/ M. Starke). Leipzig 1974; Jean Fabre: Idées sur le roman de Madame de La Fayette au marquis de Sade. Paris 1980; Rolf Geißler: Der Roman als Medium der Aufklärung. In: Sozialgeschichte der Aufklärung in Frankreich. Hg. v. H. U. Gumbrecht, R. Reichardt, Th. Schleich. Teil II: Medien, Wirkungen. München - Wien 1981, S. 89-110. 2 Einschlägige französische Texte finden sich in : Henri Coulet : Le roman jusqù' à la Révolution. Bd. 2: Anthologie. Paris 1968; ferner in der Studienausgabe: Texte zur französischen Romantheorie des 18. Jahrhunderts. Hg. v. Horst Wagner. Tübingen 1974, die allerdings nur kurze Auszüge enthält und viele Druckfehler aufweist.
284
May, Dilemme
-
Mercier, Bonnet de nuit
-
MEW
-
Rousseau, Nouvelle Héloïse
-
Sade, Idée
-
Staël, Essai sur les fictions
-
res de Marmontel. Bd. 3/2. Paris 1819. S. 558-596. Georges May: Le dilemme du roman au XVIII e siècle. New Haven - Paris 1963. Louis-Sébastien Mercier: Mon bonnet de nuit. Bd. 2, Neuchâtel - Versailles 1784. Karl Marx/Friedrich Engels: Werke. Bd. 1 bis 39 (u. 2 Erg.-Bde„ 2 Verz.-Bde.). Hg. v. Institut fiir Marxismus/Leninismus beim ZK der SED. Berlin 1956-1971. Jean-Jacques Rousseau: Julie ou La Nouvelle Héloïse. Hg. v. René Pomeau. Paris. Garnier Frères 1960. Donatien-Alphonse-François de Sade: Idée sur lès romans. In: de Sade: Les crimes de l'amour. Bd. 1. Paris 1955. Anne-Louise-Germaine de Staël: Essai sur les fictions. In: Œuvres complètes, publiées par son fils. Bd. 2. Paris 1820.
Anmerkungen
den Thesen
1 Umfassende Studien wie: May, Dilemme und Krauss, Romantheorie blieben Einzelerscheinungen. Auf dem 1968 vom C.E.R.M. veranstalteten Kolloquium über „Roman et lumières au XVIII e siècle" (publ. Paris 1970) wurde zwar auf wichtige Fragen hingewiesen und sogar der Problemkreis recht umfassend in einem „Document préparatoire" von R. Desné und anderen abgesteckt, doch blieb die Realisierung bis heute unbefriedigend. Vgl. ferner: Vivienne Mylne: The 18 th Century French Novel. Techniques of Illusion. Manchester 1965; Nachahmung und Illusion. Kolloquium Gießen, Juni 1963. Hg. v. H. R. Jauß. München 1964; Französische Aufklärung. Bürgerliche Emanzipation, Literatur und Bewußtseinsbildung. Kapitel XI: Erzählliteratur und revolutionäres Bewußtsein in der Aufklärung (R. Geißler/ M. Starke). Leipzig 1974; Jean Fabre: Idées sur le roman de Madame de La Fayette au marquis de Sade. Paris 1980; Rolf Geißler: Der Roman als Medium der Aufklärung. In: Sozialgeschichte der Aufklärung in Frankreich. Hg. v. H. U. Gumbrecht, R. Reichardt, Th. Schleich. Teil II: Medien, Wirkungen. München - Wien 1981, S. 89-110. 2 Einschlägige französische Texte finden sich in : Henri Coulet : Le roman jusqù' à la Révolution. Bd. 2: Anthologie. Paris 1968; ferner in der Studienausgabe: Texte zur französischen Romantheorie des 18. Jahrhunderts. Hg. v. Horst Wagner. Tübingen 1974, die allerdings nur kurze Auszüge enthält und viele Druckfehler aufweist.
284
3 4 5
6 7 8
9
10 11 12
13
14
Zur deutschen und englischen Romantheorie vgl. vor allem die Textsammlungen: Theorie und Technik des Romans im 17. und 18. Jh. 2 Bde. Hg. v. D. Kimpel und C. Wiedemann. Tübingen 1970; Romantheorie. Dokumentation ihrer Geschichte in Deutschland 1620-1880. Hg. v. E. Lämmert und anderen. Köln - Berlin 1971 ; Texte zur Romantheorie I (1626 bis 1731). Mit Anmerkungen, Nachwort u. Bibliographie von E. Weber. München 1974; English Theories of the Novel. Bd. 2. Ed. by W. F. Greiner. Tübingen 1970. Vgl. Jean-Jacques Rousseau: La Nouvelle Héloise. Nouvelle éd. publ. p. D. Mornet. Bd. 1. Paris 1925, S. 287. May, Dilemme, S. 253. Vgl. Frederick Charles Green: The Eighteenth Century French Critic and the Contemporary Novel. In: Modem Language Review, XIII, 1928, S. 186 f. Manfred Naumann: Prosa in Frankreich. Studien zum Roman im 19. und 20. Jahrhundert. Berlin 1978, S. 9 (Literatur und Gesellschaft). Krauss, Romantheorie, S. 88. Coulet, Roman, Bd. 1, S. 319: „Pour la première fois la bourgeoisie va posséder sa littérature, se reconnaître dans des œuvres qui ne la ridiculiseront pas, voir ses vertus exaltées, ses aspirations encouragées, son genre de vie magnifié par l'art, ses problèmes devenus représentatifs des problèmes que pose en général la condition humaine." Vgl. ebenda, Bd. 2, S. 159. - Vgl. auch: Angus Martin, Vivienne Mylne, Richard L. Frautschi: Bibliographie romanesque française, 1751-1800. London - Paris 1977, S. XIII: „On est frappé par la caresse des études, d'un caractère général, traitant des problèmes thématiques et techniques que pose le genre romanesque après 1751. . . La stagnation que certains semblent constater dans l'évolution du genre est pourtant peut-être plus apparente que réelle. Ne trouvera-t-on pas dans les romans et contes écrits sous l'empire de la sensibilité et du moralisme une originalité qui leur est propre, lorsqu'on connaîtra mieux la quasi-totalité de cette littérature?" Huet, Origine, S. 25: „Cette lecture nous touche si fort que l'émotion faisait couler nos larmes, et nous ôtait la parole." Vgl. Antoine Adam: Histoire de la littérature française au XVII e siècle. Bd. 1. Paris 1962, S. 120-133. Nicolas Boileau-Despréaux : Discours sur le dialogue intitulé „Les héros de roman" (1710). In: Œuvres. Bd. 4, La Haye 1729, S. 5 ces auteurs . . . des héros les plus considérables de l'histoire firent des bergers très frivoles, et quelquefois même des bourgeois plus frivoles que ces bergers." Antoine Adam: Histoire de la littérature française au XVII e siècle. Bd. 2. Paris 1962, S. 135: exprime l'idéal d'une société où le seul objet digne d'intérêt, c'est la vie amoureuse et héroïque de quelques très hauts et puissants personnages." Werner Krauss: Zur Bedeutungsgeschichte von „romanesque" im 17. Jahr-
285
15 16 17 18 19 20
21
22
hundert. In: Krauss: Gesammelte Aufsätze zur Literatur und Sprachwissenschaft. Frankfurt a. M. 1949, S. 415. Huet, Origine, S. 46 f : „. . . des histoires feintes d'aventures amoureuses, écrites en prose avec art, pour le plaisir et l'instruction des lecteurs." Werner Krauss: Grutidprobleme der Literaturwissenschaft. Reinbek bei Hamburg 1968, S. 44. Vgl. Huet, Origine, S. 47. Vgl. Mercier, Bonnet de nuit, S. 330. Vgl. Hans-Jörg Neuschäfer: Populärromane im 19. Jahrhundert von Dumas bis Zola. München 1976. Fritz Wahrenburg: Funktionswandel des Romans und ästhetische Norm. Die Entwicklung seiner Theorie in Deutschland bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts. Stuttgart 1976, S. 144. - Vgl. hierzu auch: Wilhelm Voßkamp: Romantheorie in Deutschland, von Martin Opitz bis Friedrich von Blanckenburg. Stuttgart 1973, S. 72ff. Huet, Origine, S. 51: „. . . je dis qu'il faut chercher leur première origine ( = des romans) dans la nature de l'esprit de l'homme inventif, amateur des nouveautés et des fictions, désireux d'apprendre et de communiquer ce qu'il a inventé et ce qu'il a appris, et que cette inclination est commune à tous les hommes de tous les temps et à tous les lieux . . . " Die Textstelle lautet wörtlich: „Pétrone dit que les poèmes doivent s'expliquer par de grands détours, par le ministère des dieux, par des expressions libres et hardies de sorte qu'on les prenne plutôt pour des oracles qui partent d'un esprit plein de fureur que pour une narration exacte et fidèle. Les romans sont plus simples, moins élevés et moins figurés dans l'invention et dans l'expression; les poèmes ont plus du merveilleux quoique toujours vraisemblables; les romans ont plus du vraisemblable quoiqu'ils aient quelquefois du merveilleux-, les poèmes sont plus réglés et plus châtiés dans l'ordonnance et reçoivent moins de matière, d'événements et d'épisodes; les romans en reçoivent davantage parce qu'étant moins élevés et moins figurés, ils ne tendent pas tant l'esprit et le laissent en état de se charger d'un plus grand nombre de différentes idées; enfin les poèmes ont pour sujet une action militaire ou politique et ne traitent l'amour que par occasion; les romans au contraire ont l'amour pour sujet principal et ne traitent la politique et la guerre que par incident." Ebenda, S. 47 f.
23 May, Dilemme, S. 182 ff. In den Observations sur la littérature moderne von 1749 heißt es dazu: „Nous sommes plus fastueux [que les Anglais], nous autres Français dans les titres que nous donnons aux livres de cette espèce; on ne voit guère en France de romans roturiers; ils sont presque tous de la première condition; il en est peu qui ne soient décorés du nom d'une terre érigée en duché, en marquisat ou en comté par exemple: les Mémoires du duc de. . . ., Les aventures de la comtesse de . . ." Zit. nach: F. Ch. Green: La peinture des mœurs de la bonne société dans le roman français de 1715 à 1761. Paris 1924, S. 5.
286
24 Morvan de Bellegarde: Lettres curieuses de littérature et de morale, 1702. Zit. nach: Texte, S. 5: „. . . les héros des anciens romans n'ont rien de naturel ; tout est outré dans leurs caractères . . . ; . . . les héros des romans modernes sont mieux caractérisés; on leur donne des passions, des vertus, des vices, qui se sentent de l'humanité; ainsi tout le monde se retrouve dans ces peintures." 25 Ebenda, S. 4 : „. . . plus convenables à l'humeur brusque et impétueuse des Français qui ne doivent pas naturellement avoir du goût pour les ouvrages de longue haleine . . ." 26 Nicolas Lenglet Du Fresnoy: De l'usage des romans, où l'on fait voir leur utilité et leurs différents caractères avec une bibliothèque des romans, accompagnée de remarques critiques. Bd. 1. Amsterdam - Paris 1734, S. 201. „Les aventures des grands romans . . . étaient si coupées et sie embarrassées les unes avec les autres que l'attention se partageait trop: il en fallait becaucoup plus que n'en ont ordinairement de jeunes personnes ou des gens occupés d'ailleurs . . ." 27 Voltaire: Œuvres complètes. Ed. Moland. Bd. 8. Paris 1877, S. 362: „On cherche de vrai en tout; on préfère l'histoire au roman; les Cyrus, les Clélie, et les Astrée, ne sont aujourd'hui lus de personne." 28 Ebenda, S. 361. 29 Montesquieu: Quelques réflexions sur les Lettres Persanes. In: Œuvres complètes, publiées sous la direction d'A. Masson, Bd. 1. Paris 1950. S. 3. 30 Mémoires de Trévoux, juillet 1736, S. 1453. Auszüge aus: Père Porée: De libris qui vulgo dicuntur Romanses, oratio habita die 25. Februarii anno D. 1736 [. . .] C'est-à-dire Discours sur les romans. Paris 1736. 31 Alain René Le Sage: Histoire de Gil Blas de Santillane. In: Œuvres, précédées d'une introduction de C.-A. Sainte-Beuve. Paris 1876, S. 15: „. . . je ne me suis proposé que de représenter la vie telle qu'elle est . . ."; „j'ai cru devoir les [dérèglements des comédiennes de Madrid] adoucir, pour les conformer à nos manières." - Deutsch: Le Sage: Die Geschichte des Gil Blas von Santillana. Aus d. Franz. übertragen von Konrad Thorer. Leipzig 1958, S. 5. 32 Pierre-François Guyot Desfontaines: Observations sur les écrits modernes (1735-1743). Zit. nach: Texte zur französischen Romantheorie des 18. Jh. Hg. v. Horst Wagner. Tübingen 1974, S. 24: „. . . nos romanciers . . . laissent là les grandes aventures, les idées héroïques, les intrigues délicatement nouées, la peinture des passions nobles, leurs ressorts et leurs effets, . . . ils s'attachent aux mœurs bourgeoises, et prennent leurs héros partout. Ils les tirent même quelquefois de la lie du peuple, sans craindre de s'encanailler. Ils vous peignent sans façon les mœurs, et vous rapportent tout au long les élégants entretiens d'un cocher de fiacre, d'une lingère, d'une fille de boutique . . . " 33 Mémoires de Trévoux, juillet 1736, S. 1453.
287
34 Vgl. Silas Paul Jones: A List of French Prose Fiction from 1700 to 1750. New York 1939. 35 Mémoires de Trévoux, juillet 1736, S. 1453. 36 Ebenda, S. 1456: „Par leur contagion ils gâtent tous les genres de littérature, auxquels ils ont quelque rapport. Par leur fécondité ils étouffent le goût des bonnes lettres, et même des genres auxquels ils ne se rapportent point." 37 Ebenda, S. 1460: „. . . des peuples feintes dans des climats réels, des mœurs feintes dans des nations véritables . . ." 38 Ebenda, S. 1470f: „. . . qu'on pourrait justement nommer Dictionnaire historique et romanesque, critique et antiebrétienne." 39 Ebenda, S. 1471: „les lettres d'un prétendu Asiatique qui voyage en Europe, et balance à sa manière le génie et les mœurs des nations sans en excepter les religions mêmes . . ." 40 Irailh, Querelles, S. 341 : „à la veille d'une révolution funeste dans la littérature et dans les mœurs." - Deutsch: S. 125 dieser Ausgabe. 41 Zit. nach: May, Dilemme, S. 77: „Que les lois transpercent, que les flammes détruisent, et fassent disparaître si faire se peut d e tout le territoire toutes les œuvres empoisonnées des auteurs de romans." 42 Ebenda, Kapitel I I I : La proscription des romans, S. 75 ff. Vgl. ferner Hans Mattauch: Sur la proscription des romans 1737-1738. I n : Revue d'histoire littéraire de la France (1968), 3/4 S. 610-617. 43 Antoine Adam: Le mouvement philosophique dans la première moitié du XVIIIe siècle. Paris 1967, S. 10. 44 Hans Mattauch: Sur la proscription des romans 1737-1738. I n : Revue d'histoire littéraire de la France (1968) 3/4 S. 614: quoique la manufacture d e l'imprimerie, et le négoce de la librairie en souffre, rien n'est plus raisonnable que la proscription des romans, surtout des mauvais." 45 Irailh, Querelles, S. 338: „un genre pernicieux de sa nature"; „Peut-il s'alliex avec le bon sens, les bonnes mœurs, le bon goût et le progrès des lettres?" - Deutsch: S. 123 dieser Ausgabe. 46 Ebenda, S. 342: „les magistrats chargés du soin de la police". - Deutsch: S. 125 dieser Ausgabe. 47 Ebenda, S. 343. - Deutsch: S. 126 dieser Ausgabe. 48 Ebenda, S. 348: „de montrer la vertu récompensée et le vice puni." Deutsch: S. 128 dieser Ausgabe. 49 Krauss, Romantheorie, S. 88. 50 Irailh, Querelles, S. 351 : „II semble que chez une nation libre, dans un gouvernement qui ne défend ni de penser ni d'écrire ce qu'on veut, la licence des mœurs devrait être extrême dans les livres. C'est pourtant le contraire à Londres. Quelque libre qu'y sort la presse, il en sort beaucoup moins que parmi nous de romans licencieux." - Deutsch: S. 130 dieser Ausgabe. 51 Vgl. dazu: Manfred Naumann/Dieter Kliche: Literaturrezeption in der Geschichte. In: Gesellschaft, Literatur, Lesen. Berlin - Weimar 1975,
288
52 53 54 55 56
S. 197 f.: „Die Kriterien der Wertung werden aus der neuen gesellschaftlichen Funktion abgeleitet, die die Literatur als Faktor der 'Aufklärung' übertragen bekommen hatte." Irailh, Querelles, S. 334: „l'ouvrage de la fiction et de l'amour." - Deutsch: S. 121 dieser Ausgabe. Mémoires de Trévoux, juillet 1736, S. 1453 : „œuvre galante de pure fiction, dont la fin n'est autre que l'amour profane." Encyclopédie, Bd. 14, S. 341 „récit fictif de diverses aventures merveilleuses ou vraisemblables de la vie humaine." Antoine Sabatier de Castres: Dictionnaire de littérature . . ., Bd. 3. Paris 1777, S. 408. Nicolas-Edme Rétif de la Bretonne: Les Françaises, ou XXXIV exemples choisis dans les mœurs actuelles, propres à diriger les filles, les femmes, les épouses et les mères. Bd. 3. Paris 1786, S. 265 f.: „C'est un ouvrage d'imagination, en partie fondé sur la réalité, ne sortant jamais de la classe des possibles, dans lequel on se propose de tracer l'histoire des sentiments et de la conduite d'un héros ou d'une héroïne, d'une manière d'instruire doublement le lecteur, par ses vertus, par ses succès, par ses malheurs: C'est un ouvrage où l'auteur met une morale vivante d'autant plus instructive, qu'elle joint l'exemple au précepte."
57 Mercier, Bonnet de nuit, S. 328: „Les romans regardés comme frivoles par quelques personnes graves, mais qui ont la vue courte, sont la plus fidèle histoire des mœrs et des usages d'une nation." - Deutsch: S. 193 dieser Ausgabe. 58 Vgl. zur weiteren ideologischen Situierung Merciers: lendemains (1978), 3/11, darin besonders: Karlheinrich Biermann: Mercier: Der Literat, das Volk und die öffentliche Meinung. Das Selbstverständnis des Schriftstellers in der Spätaufklärung und die Propagierung neuer Gattungen, S. 11-23. 59 Encyclopédie, Bd. 14, S. 341. 60 L'année littéraire, S. 155. 61 Marmontel, Essai, S. 559. - Deutsch: S. 202 dieser Ausgabe. 62 Ebenda, S. 560: j'oserais croire que la fiction poétique ne fut que la fiction romanesque employée avec choix, maniée avec art, réduite à des exemples qui pouvaient servir de leçons, surtout ennoblie, embellie par le coloris des images et par tous les charmes d'un style pittoresque et harmonieux." - Deutsch: S. 204 dieser Ausgabe. 63 Ebenda, S. 559: „roman perfectionné"; „poésie déréglée et dégénérée." Deutsch: S. 203 dieser Ausgabe. 64 Wilhelm Voßkamp: Romantheorie in Deutschland, von Martin Opitz bis Friedrich von Blanckenburg. Stuttgart 1973, S. 91. 65 Marmontel, Essai, S. 563: „l'héroïsme religieusement consacré à la protection de la faiblesse et de l'innocence, de la beauté et de l'amour". - Deutsch : S. 208 dieser Ausgabe. 66 Ebenda, S. 565. 19
Geißler. Ronuntheorie
289
67 Ebenda, S. 566: „le droit naturel de la défense et de la vengeance personnelle a cédé ses fonctions à l'autorité répressive. Les lois ont pris la place des chevaliers errants, qui tenaient la place des lois." - Deutsch: S. 211 dieser Ausgabe. - Vgl. dazu: Hans-Jörg Neuschäfer: Populärromane im 19. Jahrhundert von Dumas bis Zola. München 1976, S. 33, wo die von Marmontel gemachten Beobachtungen über das Ende der Ritterromane aus neuester Kenntnis in ihrem Kern bestätigt werden. Dort wird in anderem Zusammenhang darauf hingewiesen, daß die „unvorstellbare Popularität" des später von Cervantes parodierten spanischen Ritterromans „in dem Augenblick unwiederbringlich dahin war, als die publikumssoziologische Relevanz seiner Handlung durch tiefgreifende soziale Veränderungen (vor allem durch den Funktionsverlust des Rittertums) im wahrsten Sinne des Wortes hinfällig geworden war". 68 L'année littéraire, S. 155 : „. . . ouvrages qui ne pouvaient avoir d'autre effet que d'élever l'âme et d'inspirer des sentiments heroïques." 69 Vgl. ebenda, S. 156: la même simplicité de mœurs, la même force de corps, la même adresse dans les exercices et les jeux militaires, le même respect pour le serment, la même armure et la même valeur." 70 Marmontel, Essai, S. 564: „. . . en soulevant contre la tyrannie, des hommes engagés par un serment inviolable à ne jamais laisser l'innocence opprimée ni le crime impuni." - Deutsch: S. 208 dieser Ausgabe. 71 L'année littéraire, S. 157: „La grande et belle poésie vit de préjugés, de mensonges et de fables, et non pas de réflexions et de sentences." 72 Werner Krauss: Zur französischen Novellistik des 18. Jahrhunderts. In: Krauss: Essays zur französischen Literatur. Berlin - Weimar 1968, S. 66. 73 Marmontel, Essai, S. 565: „. . . moins insensé à l'égard des mœurs que le merveilleux mythologique." - Deutsch: S. 210 dieser Ausgabe. 74 L'année littéraire, S. 157. „. . . les mœurs [de ces siècles] étaient plus vraies, plus énergiques, et par conséquent beaucoup plus poétiques que les nôtres." 75 Claude-Adrien Helvétius: De l'esprit (I). In: Œuvres complètes. Bd. 2. Deux-Ponts 1784, S. 199, Anmerkung I: „Ce n'est pas que ces anciens romans ne soient encore agréables à quelques philosophes, qui les regardent comme la vraie histoire des mœurs d'un peuple considérée dans un certain siècle et une certaine forme de gouvernement." - Deutsch: Helvétius: Vom Geist. Berlin - Weimar 1973, S. 245, Anmerkung 92. 76 Vgl. dazu: Französische Aufklärung. Bürgerliche Emanzipation, Literatur und Bewußtseinsbildung. Leipzig 1974, S. 501 ff. 77 Nicolas Bricaire de La Dixmerie: Les deux âges du goût et de génie français sous Louis XIV et sous Louis XV. Amsterdam 1770, S. 262 f.: „II . . . saisit toutes les nuances du sentiment et des passions. Il rend palpables des traits qui, sans lui, resteraient imperceptibles." 78 Zit. nach: Réal Quellet: La théorie du roman épistolaire en France au
290
XVIII e siècle. In: Studies on Voltaire and the 18th Century. Bd. 89 (1972), S. 1210: „petites choses qui font connoistre le cœur." 79 Zit. nach Coulet, Roman, Bd. 2, S. 94: . . je vous avoue que je suis beaucoup plus touché de voir régner dans un roman une certaine science du cœur, telle qu'elle est, par exemple dans la Princesse de Clèves." - Vgl. dazu Hans Mattauch: Die literarische Kritik der frühen französischen Zeitschriften (1665-1748). München 1968, S. 133. Der Verf. hat aus Zeitschriftenrezensionen ermittelt, daß sich diese Forderungen nach der „délicatesse des sentiments", der finesse de sentiments et d'expression qui fait la beauté des romans" oder - wie es Pavillon formulierte - der „science du cœur" auf Modelle wie die Princesse de Cléves stützten. Zugleich betonte er, daß offensichtlich „nur eine kleinere, enger mit der Salonwelt verbundene Zahl von Kritikern" diese Auffassung vertrat, wobei von Fontenelle ein beträchtlicher Einfluß ausging. Darin besteht ein wesentlicher Unterschied zum 18. Jahrhundert. 80 Vgl. zur Funktion der Psychologie in der höfischen Gesellschaft: Fritz Wahrenburg: Funktionswandel des Romans und ästhetische Norm. Die Entwicklung seiner Theorie in Deutschland bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts. Stuttgart 1976, S. 207 f. Der Verfasser hat - ausgehend von der These von Norbert Elias (Die hofische Gesellschaft. Untersuchungen zur Soziologie des Königtums und der höfischen Aristokratie mit einer Einleitung: Soziologie und Geschichtswissenschaft. Neuwied - Berlin 1969), daß die „Kunst der Menschenbeobachtung" durch die Bedingungen des „höfischen Konkurrenzkampfes" gefördert wurde - zeitgenössische Belege aus Deutschland (Thomasius, Neumeister) angeführt, in denen die Absicht offen deklariert wurde, „die analytische und punktuell vergegenwärtigende Sicht des Gesamtcharakters eines Menschen zum Herrschaftsmittel auszubauen". Ob und inwieweit ein solches Funktionsverständnis der Psychologie auch in Frankreich eine Rolle bei der Herausbildung des psychologischen Romans des 17. Jahrhunderts gespielt haben mag, wäre noch näher zu prüfen. Der Roman des 18. Jahrhunderts hingegen hatte andere gesellschaftliche Grundlagen und Aufgaben. 81 MEW, Bd. 13, S. 616; vgl. dazu: Französische Aufklärung. Bürgerliche Emanzipation, Literatur und Bewußtseinsbildung. Leipzig 1974, S. 484 ff; Erwin Pracht: Probleme der Entstehung des Romans. In: Zeitschrift für Anglistik und Amerikanistik (1958) 6, S. 283 ff. 82 Vgl. Michèle Duchet: Anthropologie et Histoire au siècle des lumières. Buffon, Voltaire, Rousseau, Helvétius, Diderot. Paris 1971, S. 230. 83 Werner Krauss: Zur Anthropologie des 18. Jahrhunderts. Die Frühgeschichte der Menschheit im Blickpunkt der Aufklärung. Hg. von Hans Kortum und Christa Gohrisch. Berlin 1978, S. 12. 84 Journal encyclopédique, 1 e r mars 1761, S. 66: „un tableau bien singulier du cœur humain." 85 Bibliothèque universelle des romans. Bd. 1, oct. 1780, S. 9: „ . . . l a 19»
291
science de l'homme est une nécessité plus forte que celle des faits et . . . elle doit la précéder." 86 Vgl. Jauß, Nachahmungsprinzip, S. 162. 87 Diderot, Eloge, S. 32: „C'est lui qui porte le flambeau au fond da la caverne; c'est lui qui apprend à discerner les motifs subtils et déshonnêtes qui se cachent et se dérobent sous d'autres motifs' qui sont honnêtes . * ." Ebenda: „S'il est au fond du personnage qu'il introduit un sentiment secret, écoutez bien, et vous entendrez un ton dissonant qui le décéléra." - Deutsch : S. 161 dieser Ausgabe. 88 Denis Diderot: Entretiens sur le Fils naturel. In: Diderot: Œuvres esthétiques. Paris 1968, S. 104: „Heureusement une actrice, d'un jugement borné, d'une pénétration commune, mais d'une grande sensibilité, saisit sans peine une situation d'âme, et trouve, sans y penser, l'accent qui convient à plusieurs sentiments différents qui se fondent ensemble, et qui constituent cette situation que toute la sagacité du philosophe n'analyserait pas." Deutsch: Diderot, Ästhetische Schriften. Bd. 1. Berlin - Weimar 1967, S. 184. 89 Diderot, Eloge, S. 31 : „. . . les passions qu'il peint sont telles que je les éprouve en moi ; ce sont les mêmes objets qui les émeuvent . . ., les traverses et les afflictions de ses personnages sont de la nature de celles qui me menacent sans cesse . . . " - Deutsch: S. 160 dieser Ausgabe. 90 Mistelet: De la sensibilité par rapport aux drames, aux romans et à l'éducation. Amsterdam (Paris) 1777, S. 35: „avec art et avec intérêt tout ce qui peut avoir rapport à la connaissance intérieure de l'individu"; „d'appliquer ces connaissances à tous les individus". - „La lecture du Roman doit donc précéder celle de l'Histoire." 91 Mercier, Bonnet de nuit, S. 328: „parce qu'il est fondé sur la profonde sensibilité de l'homme." 92 Friedrich von Blanckenburg: Versuch über den Roman. Faksimiledruck der Originalausgabe von 1774. Mit einem Nachwort von Eberhard Lämmert. Stuttgart 1965, S. 285. 93 Ebenda, S. 432. 94 Staël, Essai sur les fictions, S. 186. - Deutsch: S. 267 dieser Ausgabe. 95 Romance de Mesmon: De lat lecture des romans. Fragment d'un Manuscrit sur la Sensibilité. Paris 1776, S. 8. 96 Ebenda, S. 4: [il] rentre dans son propre cœur où il trouve le contentement dans la délicatesse de ses sentiments, et la perfection de ses connaissances." 97 Ebenda, S. 5 : „. . . tout le porte à une sorte d'attendrissement sur luimême, plaisir inconnu à tout le reste des hommes." 98 Ebenda, S. 6: „. . . l'homme sensible trouve des entraves à sa sociabilité; il est blessé de ce qu'il voit . . ." 99 Ebenda, S. 8 : „La multitude d a situations qui se trouvent dans les romans, supplée au défaut de nos propres expériences . . ."
292
100 E b e n d a , S. 2 6 : „. . . je n e ctois pas qu'il y ait d'homme sensible, qui, en se r e c h e r c h a n t lui-même, ne trouvât successivement dans son propre cœur tous les articles d'un iode . . ." 101 E b e n d a , S. 27. 102 Krauss, Romantheorie, S. 88. 103 Sade, Idée, S. 2 6 : que l'étude profonde du cœur de l'homme, véritable dédale de la nature, peut seule inspirer le romancier . . ." Deutsch: S. 251 dieser Ausgabe. 104 Ebenda, S. 27. 105 Kritische Friedrich-Schlegel-Ausgabe. Abt. 1, Bd. 2 : Charakteristiken und Kritiken I ( 1 7 9 6 - 1 8 0 1 ) . Hg. u. eingel. v. H . Eichner. München - P a d e r born - Wien 1967, S. 185. 106 M E W , Bd. 21, S. 287. 107 D i d e r o t , Eloge, S. 3 0 : „Cet auteur ne fait point couler le sang le long des lambris; il ne vous transporte point dans des contrées éloignées; i] ne vous expose point à être dévoré p a r des sauvages; il ne se renferme point dans des lieux clandestins de débauche; il n e se perd jamais dans les régions de la féerie." - Deutsch: S. 160 dieser Ausgabe. 108 E b e n d a . 109 Grimm, Correspondance, Bd. 2, S. 2 6 7 : „Les Anglais ont une espèce d e roman domestique qui est tout à fait inconnue aux Français." - Deutsch: S. 56. 110 E b e n d a , S. 267 f . : „II paraît d ' a b o r d étonnant que les Français, qui ont beaucoup d e bons romans dans leur langue, n'en aient point qui peignent leurs mœurs domestiques; . . . ce n'est pas faute d e peintre, c'est f a u t e d'originaux." „Quand on peint nos petits-maîtres et nos petites, maîtresses, on a à peu près épuisé la matière, et mis tout le national qu'il est possible d e mettre dans un roman français." - Deutsch: S. 56. 111 E b e n d a , S. 2 6 8 : „Tout le monde a à peu près les mêmes propos, parle le même jargon ; tout le monde se ressemble, c'est-à-dire que nous ne ressemblons proprement à rien: voilà pourquoi nous n'aurons jamais d e roman« domestiques." - Deutsch: S. 57. 112 Vgl. d a z u : Günther Klotz: Optimismus und Wirklichkeit im englischen Roman. I n : Literatur im Epochenumbruch. Funktionen europäischer Literaturen im 18. und beginnenden 19. Jahrhundert. H g . von Günther Klotz, Winfried Schröder, Peter Weber. Berlin - Weimar 1977, S. 137 f f . 113 Arnold Hauser: Sozialgeschichte der Kunst und Literatur. Bd. 2. M ü n chen 1953, S. 10. . 114 Grimm, Correspondance, Bd. 2, S. 2 6 8 : „Ajoutez que tous les états sont confondus dans la société; que le seigneur, le magistrat, le financier, l'homme d e lettres, l'artiste, sont traités d e la même manière; qu'il ne reste donc proprement d'état dans un pays comme celui-ci que l'état d'homme d u monde . . ." .- Deutsch: S. 57. 115 E b e n d a , S. 2 6 8 : „Les Anglais, au contraire, ont conservé avec leur li-
293
116 117
118 119
120 121
122
123
124 125 126
127 128 129 130 131 132 133 134
294
berté le privilège d'être, chacun en particulier, tel que la nature l'a formé, de ne point cacher sas opinions ni les préjugés et les manières de la profession qu'il exerce . . . " - Deutsch : S. 57. Jürgen Habermas: Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchung zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft. Neuwied - Berlin 19683 S. 56. Rousseau, Nouvelle Héloïse, S. 740: „On apprend à aimer l'humanité. Dans les grandes sociétés on n'apprend qu'à haïr les hommes." - Deutsch: S. 137 dieser Ausgabe. Vgl.: Hans-Jörg Neuschäfer: Populärromane im 19. Jahrhundert von Dumas bis Zola. München 1976, S. 32 ff. Rousseau, Nouvelle Héloïse, S. 739: „Pas une mauvaise action, pas un méchant homme qui fasse craindre pour les bons; des événements si naturels, si simples, qu'ils le sont trop; rien d'inopiné, point de coup de théâtre . . . Est-ce la peine de tenir registre de ce que chacun peut voir tous les jours dans sa maison ou dans celle de son voisin?" - Deutsch: S. 136 dieser Ausgabe. Diderot, Eloge,, S. 34. - Deutsch: S. 163 dieser Ausgabe. Ebenda, S. 35: „Vous vous trompez; c'est ce qui se passe tous les jours sous vos yeux, et que vous ne voyez jamais." - Deutsch : S. 163 dieser Ausgabe. Ebenda: „Vous avez vu cent fois le coucher du soleil et le lever des étoiles; vous avez entendu la campagne retentir du chant éclatant des oiseaux; mais qui de vous a senti que c'était le bruit du jour qui rendait le silence de la nuit plus touchant?" - Deutsch: S. 164 dieser Ausgabe. Ebenda: „. . . les éclats des passions ont souvent frappé vos oreilles; mais vous êtes bien loin de connaître tout ce qu'il y a de secret dans leurs accents et dans leurs expressions." - Deutsch: S. 164 dieser Ausgabe. Zur Rolle des „Details" bei Diderot vgl. Jauß, Nachahmungsprinzip, S. 159 ff. Vgl. die Hinweise bei: Stephan Kohl: Realismus: Theorie und Geschichte. München 1977, S. 76. Diderot, Eloge, S. 30: „ . . . on prend . . . un rôle dans les ouvrages, on se mêle à la conversation, on approuve, on blâme, on admire, on s'irrite, on s'indigne." - Deutsch: S. 159 dieser Ausgabe. Ebenda, S. 32. - Deutsch : S. 161 dieser Ausgabe. Ebenda, S. 38. - Deutsch: S. 166 dieser Ausgabe. Ebenda, S. 32. - Deutsch: S. 161 dieser Ausgabe. Nicolas-Edme Rétif de La Bretonne: Les contemporaines mêlées. Ed. par J. Assézat. Paris [o. J.], S. 144. Ebenda, S. 144: „. . . je n'ai plus voulu écrire que la vérité. J'ai été l'historien de personnages, dont je n'ai menti que le nom . . . " Ebenda, S. 145. Staël, Essai sur les fictions, S. 204. - Deutsch: S. 276 dieser Ausgabe. Denis Diderot: De la poésie dramatique. In: Œuvres esthétiques. Paris
1968, S. 214: „Un ouvrage sera romanesque, si le merveilleux nait de la simultanéité des événements ; si l'on y voit les dieux ou les hommes trop méchants, ou trop bons ; si les choses et les caractères y diffèrent trop de ce que l'expérience ou l'histoire nous les montre; et surtout si l'enchaînement des événements y est trop extraordinaire et trop compliqué." - Deutsch in: Diderot: Ästhetische Schriften. Bd. 1. Berlin - Weimar 1967, S. 268. 135 Voltaire: Œuvres complètes, éd. Moland. Bd. 40. Paris 1880, S. 349 (Brief vom 12. April 1760): „. . . cette lecture m'allumait le sang. Il est cruel . . . de lire neuf volumes entiers dans lesquells on ne trouve rien du tout . . . Quand tous ces gens-là seraient mes amis, je ne pourrais m'intéresser à eux." 136 Jean-François La Harpe: Lycée, ou Cours de littérature ancienne et moderne. Bd. 16. Paris 1827, S. 275 f.: „Que me fait à moi cette foule d'agents subalternes . . . ? " „Ce sont des fripons gagés, des femmes perdues: ne voilà-t-il pas des objets bien intéressants pour m'en occuper si longtemps?" 137 Sade, Idée, S. 29: „. . . un style bas et rampant, des aventures dégoûtantes, toujours puisées dans la plus mauvaise compagnie; nul autre mérite enfin, que celui d'une prolixité . . . dont les seuls marchands de poivres le remercieront." - Deutsch: S. 165 f. dieser Ausgabe. 138 Ebenda, S. 34. - Deutsch: S. 169 dieser Ausgabe - Zur Problematik der Romantheorie de Sades vgl.: Jean Fabre, Préface zu: De Sade: Les crimes de l'amour. Paris 1964, S. XVI ff. Wenn Fabre einerseits in de Sades Idée sur les romans mit einigem Recht „à la fois un couronnement et un terminus" sah, so wurde er andererseits mit seiner abwertenden Einschätzung den romantheoretischen Reflexionen im 18. Jahrhundert kaum gerecht, etwa wenn er Marmontel, der zu den meistgeschätzten Aufklärern und Prosaautoren seiner Zeit zählte, als Theoretiker wie als Erzähler jede Bedeutung absprach und seinen Essai sur les romans considérés du côté moral, „dont le titre accuse déjà la banalité et le vide" (S. XIX) lieber der Vergessenheit überantwortet hätte. Daß Fabre als einer der besten Kenner der Literatur der Aufklärung zu einem solchen negativen Urtèil gelangte, lag daran, daß er hier eine literaturimmanente Betrachtungsweise praktizierte, die alle außerliterarischen Bezüge und Funktionen - als der schönen Literatur abträglich - strikt ausschloß: „Que rien ne soit plus fastidieux ni plus vain que de raisonner de littérature en fonction d'exigences ou de notions extra-littéraires, le XVIII e siècle, en ses bavardages sur le roman, en donne le plus affligeant témoignage." (S. XVII) 139 Ebenda, S. 32: la main de la fortune, en exaltant le caractère de celui qu'elle écrase, le met à la juste distance où il faut qu'il soit pour étudier les hommes . . . " - Deutsch : S. 255 dieser Ausgabe. 140 Vgl. dazu: Romantheorie. Dokumentation ihrer Geschichte in Deutschland 1620-1880. Hg. v. Eberhard Lämmert u. Hartmut Eggert u. a. Köln - Berlin 1971.
295
141 Johann Carl Dähnert: Critische Nachrichten. Bd. 2, 11. Stück. Greifswaid 1751, S. 82. - Vgl. Romantheorie. Dokumentation ihrer Geschichte in Deutschland 1620-1880. Hg. v. Eberhard Lämmert u. Hartmut Eggert u. a. Köln - Berlin 1971, S. 105. 142 Vgl. ebenda, S. 121. 143 Ebenda, S. 120. 144 Vgl. Christoph Georg Lichtenberg: Romane. In: C. G. Lichtenberg: Aphorismen. Nach d. Handschrift hg. v. Albert Leitzmann. 3. Heft: 1775 bis 1779, Berlin 1906, S. 36 ff. 145 Christian Garve: Betrachtung einiger Verschiedenheit in den Werken der ältesten und neuern Schriftsteller, insbesondre der Dichter. In: Neue Bibliothek der schönen Wissenschaften und der freyen Künste. Bd. 10. 1. Stück, 1770, S 10 f. 146 Friedrich von Blanckenburg : Versuch über den Roman. Faksimiledruck der Originalausgabe von 1774. Mit einem Nachwort von Eberhard Lämmert. Stuttgart 1965, S. XV. 147 Ebenda, S. 18. 148 Johann Gottfried Herder: Briefe zur Beförderung der Humanität. 8. Sammlung. 99. In: Sämtliche Werke. Hg. v. Bernhard Suphan. Bd. 18. Berlin 1883, S. 109 f. 149 Ebenda, S. 110. 150 Ebenda. 151 Vgl. Diderot, Eloge, $.40, - Deutsch: S. 167 dieser Ausgabe. 152 Friedrich Schlegel: Gespräch über die Poesie. Brief über den Roman. In: Kritische Friedrich-Schlegel-Ausgabe. Abt. 1. Bd. 2: Charakteristiken und Kritiken I (1796-1801). Hg. u. eingel. v. H. Eichner. München - Paderborn - Wien 1967, S. 33a. 153 Friedrich Schlegel: [Rezension in:] Die Hören. II. Stück. In: Ebenda, S. 9. 154 Friedrich von Blanckenburg: Versuch über den Roman. Faksimiledruck der Originalausgabe von 1774. Mit einem Nachwort von Eberhard Lämmert. Stuttgart 1965, S. XIII. 155 Friedrich Schlegel: Gespräch über die Poesie. Brief über dem Roman. In: Kritische Friedrich-Schlegel-Ausgabe. Abt. 1. Bd. 2: Charakteristiken und Kritiken I (1796-1801). Hg. u. eingel. v. H. Eichner. München - Paderborn - Wien 1967, S. 330. 156 Friedrich Schlegel: Geschichte der alten und neuern Literatur. In: Ebenda. Abt. I, Bd. 6, S. 331. 157 Friedrich Schlegel: Gespräch über die Poesie. Brief über den Roman. In: Ebenda, Abt. 1, Bd. 2, S. 330 f. 158 Friedrich Schlegel: Geschichte der europäischen Literatur. In: Ebenda, Abt. 2, Bd. 11 : Wissenschaft der europäischen Literatur. Hg. v. E. Behler. 1958, S. 160. 159 Vgl. dazu: Albert Monod: De Pascal à Chateaubriand. Les défenseurs français du christianisme de 1670 à 1802. Paris 1916.
296
160 Hans Robert Jauß: Theorie der Gattungen und Literatur des Mittelalters. In: Grundriß der romanischen Literaturen des Mittelalters. Bd. 1. Heidelberg 1972, S. 129; vgl. auch: Gesellschaft, Literatur, Lesen. Berlin Weimar 1975, S. 46. 161 Nicolas-Thomas Barthe: Les romans. In: La jolie femme, ou La femme du jour. Amsterdam 1769, S. 46-91. 162 Ebenda, S. 89: „Ces livres qui circulent dans toutes les mains repoussent la barbarie . . . " - Deutsch: S. 191 dieser Ausgabe. 163 Ebenda, S. 86: „Vu du côté du commerce, les romans sont un objet de plusieurs millions: l'argent, par ce moyen circule." - Deutsch: S. 189 dieser Ausgabe. 164 VgL Richard L. Frautschi: A list of French Prose Ficton. 1751-1800: a progress report. In: Mitchel: Computers in the Humanities. Edinburgh 1974, S. 149 ff. ; Angus Martin, Vivienne Mylne, Richard L. Frautschi: Bibliographie romanesque française, 1751-1800. London - Paris 1977; Richard L. Frautschi: Styles du roman et styles de censure dans la seconde moitié du dix-huitième siècle français. In: Studies on Voltaire and the 18«h Century. Bd. 88 (1972), S. 516. 165 Nicolas-Thomas Barthe: Les romans. In: La jolie femme ou La femme du jour. Amsterdam 1769, S. 86. - Deutsch: S. 190 dieser Ausgabe. 166 Ebenda, S. 87. - Deutsch: S. 190 dieser Ausgabe. - Zum Problem der „Marktgesetzlichkeit" bei literarischen Erzeugnissen vgl. besonders: Werner Krauss: Über den Anteil der Buchgeschichte an der literarischen Entfaltung der Aufklärung. In: Krauss: Studien zur deutschen und französischen Aufklärung. Berlin 1963, S. 108 ff.; Winfried Schröder: Gesellschaftliche Gegebenheiten in der sich auflösenden Ständegesellschaft und ihre Konsequenzen für die Aufklärungsideologie. In: Französische Aufklärung. Bürgerliche Emanzipation, Literatur und Bewußtseinsbildung. Leipzig 1974, S. 65 ff. ; Manfred Naumann und Dieter Kliche: Bedürfnisbefriedigung über Marktbeziehungen: In: Gesellschaft, Literatur, Lesen. Berlin - Weimar 1975, S. 208 ff. 167 Ebenda. - Vgl. dazu: Artikel „Tabac, ferme du" (Verf.: Jaucourt). In: Encyclopédie, Bd. 15, S. 790. 168 Bibliothèque universelle des romans, juillet 1781, S. 64 f.: „. . . que les liaisons mercantiles de tels qui n'ont jamais su distinguer une idée d'un quolibet, décident depuis longtemps du sort des ouvrages littéraires." 169 Grimm, Correspondance, S. 314: „Nous sommes accablés de brochures, de.petits écrits; dès qu'un objet intéresse le public, on en voit paraître par centaines, on les voit disparaître avec la même rapidité." - Deutsch: S. 271. 170 Roger Poirier: La bibliothèque universelle des romans. Rédacteurs, Textes, . Public. Genève 1976, S. 6 f.: „ . . . compte parmi les plus importantes entreprises de librairie du XVIII e siècle en France." 171 Ebenda, S. 109. 172 Jean-François Marmontel: Œuvres posthumes. Mémoires. Bd. 1. Paris an
297
XIII-1804, S. 330: „Vingt ans d'étude et de méditation dans le silence et la retraite, ont amassé, mûri et fécondé ses connaissances [de Rousseau] . . ." „Ma seule excuse était mon infortune et le' besoin de travailler incessamment et à la hâte pour me procurer de quoi vivre." - Zur „Veränderung der gesellschaftlichen Stellung und Funktion des Schriftstellers" in der Aufklärung vgl. Winfried Schröder in: Französische Aufklärung. Bürgerliche Emanzipation, Literatur und Bewußtseinsbildung. Leipzig 1974, S. 86 ff. 173 Sade, Idée, S. 34: „ . . . personne ne te contraint au métier que tu fais; mais si tu l'entreprends, fais-le bien. Ne l'adopte pas surtout comme un secours à ton existence; ton travail se ressentirait de tes besoins, tu lui transmettrais ta faiblesse; il aurait la pâleur de la faim; d'autres métiers se présentent à toi; fais des souliers, et n'écris point des livres." Deutsch: S. 256 dieser Ausgabe. 174 Vgl. dazu Jochen Schulte-Sasse: Die Kritik an der Trivialliteratur seit der Aufklärung. Studien zur Geschichte des modernen Kitschbegriffs. München 1971; Wolfgang Schemme: Trivialliteratur und literarische Wertung. Einführung in die Methoden und Ergebnisse der Forschung aus didaktischer Sicht, Stuttgart 1975; Hans-Jörg Neuschäfer: Populärromane im 19. Jahrhundert von Dumas bis Zola. München 1976. 175 Aristoteles: Poetik. Leipzig 1972, S. 51. 176 Vgl. dazu besonders: Hans Robert Jauß: Literaturgeschichte als Provokation. Frankfurt 1970; Gesellschaft, Literatur, Lesen. Berlin - Weimar 1975. 177 Vgl. dazu: Gesellschaft, Literatur, Lesen. Berlin - Weimar 1975, S. 52 ff. 178 Vgl. Marmöntel, Essai, S. 559. 179 Vgl. Rousseau, Nouvelle Héloïse, S. 749: quand on Veut être utile, il faut se faire lire en province." - Deutsch: S. 148 dieser Ausgabe. 180 Ebenda: „Iis [les romans] changent leur retraite en un désert affreux; et, pour quelques heures de distraction qu'ils leur donnent, ils leur préparent des mois de malaise et de vains regrets." 181 Encyclopédie, Bd. 14, S. 342. 182 François Béliard: Zélaskim, histoire américaine, ou les Aventures de la marquise de P***, avec un Discours pour la défense des romans. Paris 1765, S. xvj : „ . . . d'adoucir leurs mœurs, de se former les sentiments, de s'instruire des usages, de la politesse . . ." 183 Nicolas-Thomas Barthe: Les romans. In: La jolie femme, ou La femme du jour. Amsterdam 1769, S. 74. - Deutsch: S. 185 dieser Ausgabe. 184 Ebenda, S. 90. - Deutsch: S. 191 dieser Ausgabe. 185 Rousseau, Nouvelle Héloïse, S. 743: „Pour rendre utile ce qu'on veut dire, il faut d'abord se faire écouter de ceux qui doivent en faire usage. J'ai changé de moyen, mais non pas d'objet." - Deutsch: S. 142 dieser Ausgabe. 186 Marmontel, Essai, S. 558.
298
187 Diderot, Eloge, S. 29: „Tout ce que Montaigne, Charron, La Rochefoucauld et Nicole ont mis en maximes, Richardson l'a mis en action." Deutsch: S. 159 dieser Ausgabe. 188 Ebenda, S. 31-33. - Deutsch: S. 160-162 dieser Ausgabe. 189 Mercier, Bonnet de nuit, S. 331: „II est encore une sorte de roman bien cher au philosophe; c'est celui qui offre en idée le plan de félicité publique et nationale . . . " - Deutsch: S. 195 dieser Ausgabe. 190 Ebenda, S. 332: „. . . en pensant que lui ou ses enfants pourront recueillir le fruit de ces tableaux touchants et philosophiques." - Deutsch: S. 195 dieser Ausgabe. 191 Grimm, Correspondance, Bd. 3, S. 83: „Dans de pareils sujets, il ne s'agit pas d'arracher aux spectateurs quelques marques d'admiration pour le poète, il faut exciter en eux ce mouvement tumultueux, ce trouble violent et terrible que produisent en nous les dangers de quelqu'un qui nous intéresse vivement, il faut savoir nous déchirer le cœur . . . " - Deutsch: S. 116. 192 Jean-François Marmontel: Œuvres posthumes. Mémoires. Bd. 1. Paris 1804, S. 134 f.: „Si je jouais l'Ami de la Maison comme vous l'entendez et comme je le sens, aucune mère ne voudrait plus me laisser auprès de sa fille." 193 Ebenda: „. . . on ne craint pas dans le monde que nous soyons des Tartufes." 194 Elie de Beaumont: Lettres du marquis de Roselle. Bd. 2. Londres-Paris 1767, S. 33: „. . . la grandeur des sujets, et la dignité de la poésie, leur fait regarder les héros de la tragédie comme des êtres d'une autre espèce." - „Elles [les jeunes personnes] se disent à chaque page, c'est moi me voilà. Bientôt elles diront du premier jeune homme qu'elles verront, c'est lui, c'est Lindor, c'est Léandre." 195 Vgl. dazu Fritz Nies: Gattungspolitik und Publikumsstruktur. Zur Geschichte der Sévignébriefe. München 1972. 196 Vgl. Jürgen Habermas : Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchung zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft. Neuwied - Berlin 19683,S. 61. 197 Rousseau, Nouvelle Héloïse, S. 740: „Quel style épistolaire! qu'il est guindé! que d'exclamations 1 que d'apprêts! quelle emphase pour ne dire que des choses communes! quels grands mots pour de petits raisonnements!" - Deutsch: S. 137 dieser Ausgabe. 198 Ebenda. 199 Jauß, Nachahmungsprinzip, S. 160. 200 Diderot, Eloge, S. 30. - Deutsch: S. 160 dieser Ausgabe. 201 Ebenda, S. 35 : „Sachez que c'est à cette multitude de petites choses que tient l'illusion . . ." 202 Ebenda: ce sont toutes ces vérités de détail qui préparent l'âme aux impressions fortes des grands événements." 203 Jauß, Nachahmungsprinzip, S. 161 f.
299
204 Denis Diderot: Les deux amis de Bourbonne: In: Diderot: Œuvres romanesques. Hg. v. Henri Bénac. Paris 1962, S. 791: il [le conteur] est assis au coin de votre âtre; il a pour objet la vérité rigoureuse; il veut être cru; il veut intéresser, toucher, entraîner, émouvoir, faire frissonner la peau et couler les larmes . . . " - D e u t s c h : Diderot: Das erzählerische Werk. Hg. v. Martin Fontius. Bd. 4 : Rameaus Neffe. Berlin 1979, S. 122. 205 Ebenda: „II parsèmera son récit de petites circonstances si liées à la chose, de traits si simples, si naturels, et toutefois si difficiles à imaginer, que vous serez forcé de vous dire en vous-même: Ma foi, cela est vrai : on n'invente pas ces choses-là." - Deutsch : Ebenda, S. 123. 206 Diderot, Eloge, S. 31 : „ . . . les passions qu'il peint sont telles que je les éprouve en moi; ce sont les mêmes objets qui les émeuvent, elles ont l'énergie que je leur connais . . . " - Deutsch : S. 160 dieser Ausgabe. 207 Ebenda, S. 32: „II [Richardson] n'a point démontré cette vérité; mais il l'a fait sentir: à chaque ligne il fait préférer le sort de la vertu opprimée au sort du vice triomphant." - Deutsch: S. 161 dieser Ausgabe. 208 Claude-Prosper Jolyot de Crébillon: Lettres de la duchesse de xxx au duc de***. Teil 1. Paris 1769, S. ij: „. . . le vrai a toujours plus de droits que ce que nous savons n'en être que l'imitation . . ." 209 Ebenda, S. iij: „. . . mille petites circonstances qu'amène le hasard, que l'esprit dédaigne comme trop futiles, ou qu'il n'imagine pas, et qui toutes concourent à donner le ton du vrai . . ." 210 Irailh, Querelles, S. 351: „La narration . . . en devient plus naturelle, plus vive, plus intéressante, et le lecteur plus curieux, plus attentif, plus ému . . . l'illusion produit tout son effet." - Deutsch: S. 130 dieser Ausgabe. 211 Zit. nach Coulet, Roman, Bd. 2, S. 156: „. . . en attendrissant le cœur, ils produisent le même effet que la chaleur sur une boule de cire, qui par elle devient capable de recevoir la forme qu'on veut lui donner." 212 François-Thomas-Marie de Baculard d'Arnaud: Nouvelles historiques. Bd. 1. Paris 1774, S. xj: je dois trop à ce public sensible et estimable, le seul qui m'intéresse . . ." je ne veux qu'attendrir, et pouvoir être utile en attendrissant." 213 Vgl. dazu: André Monglond: Le préromantisme français. 2 Bde. Grenoble 1930; Pierre Trahard: Les maîtres de la sensibilité française au XVIII e siècle (1715-1789), 4 Bde. Paris 1931-1933; André Grenet/Glaude Jodry: La littérature du sentiment au XVIII e siècle. 2 Bde. Paris 1971; Gerhard Sauder: Empfindsamkeit. Stuttgart 1974. 214 Marmontel, Essai, S 573: „Depuis le peuple jusqu'au petit nombre des esprits cultivés, chacun demande à être ému." - Deutsch : S. 220 dieser Ausgabe. 215 Ebenda, S. 574. „. . . l'art de feindre, pour émouvoir, est une espèce de
300
chimie qui a ses remèdes et ses poisons." - Deutsch: S. 221 dieser Ausgabe. 216 Louis-Sébastien Mercier: Discours sur la lecture. In: Mercier: Eloges et discours philosophiques. Amsterdam 1776, S. 262 où l'auteur crée des fictions sinistres, où l'on vous conduit dans de sombres cavernes, où il vous présente un infortuné luttant contre le désespoir, où il fait ruisseler le sang sous vos yeux . . . " 217 Ebenda, S. 263: „ Q u e votre pitié ne soit point stérile: ne pleurez point, un livre à la main, dans un réduit solitaire; sortez, et soyez récompensé des larmes que vous verserez; allez essuyer celles que répand le pauvre sous un toit obscur; . . . c'est là que vous goûterez vivement ce plaisir délicieux de secourir l'humanité souffrante . . ." 218 Sade, Idée, S. 28. „. . . voilà ce qui s'appelle écrire le roman . . ." Deutsch : S. 252 dieser Ausgabe. 219 Vgl. Paul Lafargue: Vom Ursprung der Ideen. Ausgewählte Schriften. Hg. v. Katharina Scheinfuß. Dresden 1970, S. 147. 220 Sade, Idée, S. 30: „. . . il n'y avait point d'individu qui n'eût plus éprouvé d'infortune en quatre ou cinq ans, que n'en pouvait peindre en un siècle le plus fameux romancier de la littérature . . . " - Deutsch : S. 253 f. dieser Ausgabe. 221 Paul Lafargue: Vom Ursprung der Ideen. Ausgewählte Schriften. Hg. v. Katharina Scheinfuß. Dresden 1970, S. 149. 222 Sade, Idée, S. 2 6 : l'ouvrage nous ayant excessivement émus . . . doit indubitablement produire l'intérêt qui seul assure des lauriers." Deutsch : S. 252 dieser Ausgabe. 223 Vgl. ebenda, S. 35. - Deutsch: S. 256 dieser Ausgabe. 224 Ebenda: „. . . que tes épisodes naissent toujours du fond du sujet et qu'ils y rentrent." - Deutsch: S. 257 dieser Ausgabe. 225 Ebenda: „. . . il faut que tes descriptions locales soient réelles, ou il faut que tu restes au coin de ton feu . . . " - Deutsch: S. 257 dieser Ausgabe. 226 Rousseau, Nouvelle Héloïse, S. 749 : „J'aime à me figurer deux époux lisant ce recueil ensemble, y puisant un nouveau courage pour supporter leurs travaux communs, et peut-être de nouvelles vues pour les rendre utiles. Comment pourraient-ils y contempler le tableau d'un ménage heureux, sans vouloir imiter un si doux modèle? Comment s'attendrir sur le charme de l'union conjugale . . . sans que la leur se resserre et s'affermisse?" - Deutsch: S. 148 f. dieser Ausgabe. 227 Ebenda, S. 752: „Sublimes auteurs, rabaissez un peu vos modèles,, si vous voulez qu'on cherche à les imiter" - Deutsch: S. 152 dieser Ausgabe. 228 Encyclopédie, Bd. 14, S. 342. 229 Ebenda. 230 Antoine Sabatier de Castres : Dictionnaire de littérature . . . , Bd. 3. Paris 1777, S. 413. 231 Mercier, Bonnet de nuit, S. 265: „Un poème, un drame, un roman qui
301
232 233
234 235 236 237 238 239 240 241
242
243 244
245
246 247 248 249 250 251
302
peint vivement la vertu, modèle le lecteur, sans qu'il s'en apperçoive, sur les personnages vertueux qui agissent; ils intéressent, et l'auteur a persuadé la morale sans en parler." Ebenda. Marmontel, Essai, S. 575: „Mais quand les larmes auront coulé de tous les yeux, que restera-t-il dans les âmes? La triste conviction qu'il est dans la nature une foule de maux dont il ne peut se garantir . . . " - Deutsch: S. 223 dieser Ausgabe. Ebenda, S. 576 : „. . . la théorie du pathétique dans les romans comme sur la scène." - Deutsch : S. 223 dieser Ausgabe. Ebenda: intéressante dans son principe, excusable dans ses erreurs, mais funeste dans son délire et criminelle dans ses excès . . ." Ebenda, S. 577: „. . . ce genre de pathétique est très peu moral." Deutsch: S. 225 dieser Ausgabe. Ebenda, S. 578. - Deutsch: S. 225 dieser Ausgabe. Ebenda, S. 577: la persévérance d'une scélératesse exclut toute bonté morale." - Deutsch: S. 224 dieser Ausgabe. Krauss, Romantheorie, S. 88. Marmontel, Essai, S. 583: „. . . dans nos fictions, ce n'est pas assez d'imiter, il faut épurer la nature . . . " - Deutsch: S. 228 dieser Ausgabe. Vgl. dazu: Jean Fabre: Préface zu: Les crimes de l'amour. In: Œuvres complètes du Marquis de Sade. Edition définitive. Bd. 10. Paris 1964, S. XIX. Marmontel, Essai, S. 595: soit l'histoire ou la fable, le fruit qu'elle présente à la réflexion n'est pas d'aimer ou de haïr, de fuir ou d'imiter, de souhaiter ou de craindre ce qui a été, mais ce qui peut être. Il ne s'agit pas du passé, mais de l'avenir." - Deutsch: S. 238 dieser Ausgabe. Staël, Essai sur les fictions, S. 182. - Deutsch: S. 265 dieser Ausgabe. Ebenda, S. 204: „Tout est si vraisemblable dans de tels romans, qu'on se persuade aisément que tout peut arriver ainsi; ce n'est pas l'histoire du passé, mais on dirait souvent que c'est celle de l'avenir." - Deutsch: S. 276 dieser Ausgabe. Sade, Idée, S. 26: l'homme, non pas seulement ce qu'il est, ou ce qu'il se montre . . ., mais tel qu'il peut être, tel que doivent le rendre les modifications du vice, et toutes les secousses des passions." - Deutsch: S. 251 dieser Ausgabe. Ebenda, S. 27: un des modes de ce cœur étonnant." - Deutsch: S. 252 dieser Ausgabe. Ebenda, S. 37. - Deutsch: S. 258 dieser Ausgabe. Ebenda. Krauss, Romantheorie, S. 99. Ebenda. Auch Marmontel verwertete seine Erkenntnisse über den Roman nicht in seiner Poetik.
252 Wilhelm Voßkamp: Romantheorie in Deutschland, von Martin Opitz bis Friedrich von Blankenburg. Stuttgart 1973, S. 170. 253 Ebenda, S. 145. 254 Jauß, Nachahmungsprinzip, S. 157 ff. 255 Walter F. Greiner: Studien zur Entstehung der englischen Romantheorie an der Wende zum 18. Jahrhundert. Tübingen 1969, S. 56. 256 Vgl. ebenda, S. 51. 257 Ebenda, S. 56. 258 Aristoteles: Poetik. Leipzig 1972, S. 37. 259 Reinhart Koselleck: Geschichte, Historie. In: Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland. Hg. v. Otto Brunner, Werner Conze, Reinhart Koselleck. Bd. 2. Stuttgart 1975 (Nachdruck 1979), S. 659. 260 Ebenda. 261 Vgl. Werner Krauss: Cartaud de La Villate. Ein Beitrag zur Entstehung des geschichtlichen Weltbildes in der französischen Aufklärung. Teil 1. Berlin 1960, S. 40. 262 Vgl. Coulet, Roman, Bd. 2, S. 123 f. 263 Encyclopédie, Bd. 8, 1765, S. 223: „Toute certitude qui n'est pas démonstration mathématique, n'est qu'une extrême probabilité. Il n'y a pas d'autre certitude historique." - Deutsch nach: Artikel aus der von Diderot und d'Alembert herausgegebenen Enzyklopädie. Hg. v. Manfred Naumann. Übersetzt v. Theodor Lücke. Leipzig 1972, S. 671. 264 Reinhart Koselleck: Geschichte, Historie. In: Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland. Hg. v. Otto Brunner, Werner Conze, Reinhart Koselleck. Bd. 2. Stuttgart 1975 (Nachdruck 1979), S. 662. 265 Grimm, Correspondance, Bd. 4, S. 429: „Le but de tous les beaux-arts est d'imiter la nature . . . Le mensonge de l'art tantôt s'étudie à approcher de la nature le plus qu'il est possible, et son triomphe serait complet s'il pouvait à vous faire confondre l'imitation et le modèle . . . " - Deutsch: S. 181 f. 266 Vgl. Diderot, Eloge, S. 30 f., S. 38 f. 267 Grimm, Correspondance, Bd. 5, S. 202: „L'art est à la nature comme une belle statue à un bel homme." - Deutsch: S. 209. 268 Denis Diderot: De la poésie dramatique. In: Œuvres esthétiques. Paris 1968, S. 217: le but de la poésie est plus général que celui de l'histoire." - Deutsch: Diderot: Ästhetische Schriften. Bd. 1. BerlinWeimar 1967, S. 270. 269 Diderot, Eloge, S. 39 f.: „L'histoire peint quelques individus; tu peins l'espèce humaine: l'histoire attribue à quelques individus ce qu'ils n'ont ni diu ni fait; tout ce que tu attribues à l'hommej, il l'a dit et fait: l'histoire n'embrasse qu'une portion de la durée, qu'un point de la surface du globe; tu a embrassé tous les lieux et tous les temps. Le cœur humain,
303
qui a été, est et sera toujours le même, est le modèle d'après lequel tu copies." -
Deutsch: S; 167 dieser Ausgabe.
270 Ebenda:
j'oserai dire que l'histoire la plus vraie est pleine de men-
songes, et que ton roman est plein de vérités." 271 Claude-Joseph Dorât: Idées sur les romans. I n : Les sacrifices de l'amour, ou Lettres de la Vicomtesse de Senanges et du Chevalier de Versenay. Bd. 1. Amsterdam -
Paris 1771, S. 1 3 : „Le roman, quand il est bien
fait, est pris dans le système actuel de la société où l'on vit; il est . . . l'histoire usuelle, l'histoire utile, celle du moment." 272 Mercier, Bonnet de nuit, S. 328 f. 273 Pierre-Ambroise-François Choderlos de Laclos: Œuvres complètes. Paris 1951 (Bibliothèque de la Pléiade), S. 5 0 0 :
elle dit des mœurs pub-
liques, et se tait sur les mœurs privées." - Deutsch: S. 197 dieser Ausgabe. 2 7 4 Ebenda: „. . . les lumières qu'elle répand . . .
ne nous montrent jamais
les peuples que dans leurs relations avec ceux qui les commandent." 275 Sade, Idée, S. 3 1 : „. . . ils servent à vous peindre tels que vous êtes, orgueilleux individus qui voulez vous soustraire au pinceau, parce que vous en redoutez les e f f e t s . . . " - Deutsch: S. 2 5 4 dieser Ausgabe. 276 M E W , Bd. 36, S. 75. 277 Juri Tynjanow: Der Affe und die Glocke. Berlin 1975, S. 106. 278 Nicolas Lenglet Du Fresnoy: D e l'usage des romans. Bd. 1. Amsterdam [Paris] 1734, S. 1 8 8 : „.
. . un roman est un poème héroïque en prose."
279 Ebenda, S. 2 0 3 : „On peut donc les laisser jouir du nom de roman, puisque ce sont comme des parties qui en paraissent détachées, et qui participent
à
l'agrément
et
à l'instruction qu'on tiraitauparavant de ces
grands poèmes." 280 Voltaire: Essai sur la poésie épique. I n : Œuvres complètes. E d . Moland. Bd. 8. Paris 1877, S. 361 : „On confond toutes les idées, on transpose les limites des arts, quand on donne le nom de poème à la prose." 281 Vgl. den Auszug in: Coulet, Roman, Bd. 2, S. 124 f. 282 François Béliard: Zélaskim, histoire américaine, ou les Aventures de la Marquise de P * * * , avec un Discours pour la défense des romans. Paris 1765, S. X X X : „Nous sommes dans un siècle de philosophie, où les noms et les préjugés ne doivent plus imposer sur ces sortes de choses." 283 Ebenda, S. X X X I : „. . . il faut que le nœud s'en fasse et s'en défasse par des incidents naturels, sans dieux et sans machines." 2 8 4 L'anné littéraire, S. 43. 285 Hans Hinterhäuser: Nachwort zu Pierre Daniel Huet: Traité de l'origine des romans. Faksimiledrucke nach der Erstausgabe von 1670 und
der
Happelschen Übersetzung von 1682. Stuttgart 1966, S. 26. 286 Friedrich von Blanckenburg: Versuch über den Roman. Faksimiledruck der Originalausgabe von 1774. Mit einem Nachwort von Eberhard Lämmert. Stuttgart 1965, S. X I I I .
3 04
287 Ebenda, S. XV f. 288 Zit. nach Coulet, Roman, Bd. 2, S. 116: ils [nos romanciers] s'attachent aux mœurs bourgeoises, et prennent leurs héros partout. Ils les tirent même quelquefois de la lie du peuple . . ." 289 Grimm, Correspondance, Bd. 2, S. 268: „. . . les grandes passions tiennent immédiatement à l'humanité et ont partout les mêmes ressorts." Deutsch • S. 56f. 290 Vgl. Denis Diderot. D e la poésie dramatique. In: Œuvres esthétiques. Paris 1968, S. 215. - Deutsch: Diderot: Ästhetische Schriften. Bd. 1. Berlin - Weimar 1967, S. 268. 291 Aristoteles: Poetik. Leipzig 1972, S. 23. 292 Denis Diderot. Entretiens sur le Fils naturel. In: Œuvres esthétiques. Paris 1968, S. 81. - Deutsch- Diderot: Ästhetische Schriften. Bd. 1. Berlin - Weimar 1967, S. 166. 293 Denis Diderot: D e la poésie dramatique. In Œuvres esthétiques. Paris 1968, S. 215. - Deutsch: Ebenda, S. 269. 294 Ebenda. 295 Vgl. dazu: Martin Fontius. Zur Ästhetik des bürgerlichen Dramas. In: Französische Aufklärung. Bürgerliche Emanzipation, Literatur und Bewußtseinsbildung. Leipzig 1974, S. 452 ff. 296 Denis Diderot: D e la poésie dramatique. In: Œuvres esthétiques. Paris 1968, S. 271 : „C'est la peinture des mouvements qui charme, surtout dans les romans domestiques. Voyez avec quelle complaisance l'auteur de Pamêla, de GrancLisson et de Clarisse s'y arrête! Voyez quelle force, quel sens, et quel pathétique elle donne à son discours! Je vois le personnage; soit qu'il parle, soit qu'il se taise, je le vois; et son action m'affecte plus que ses paroles." - Deutsch: Diderot: Ästhetische Schriften. Bd. 1. Berlin - Weimar 1967, S. 319. Diese Stelle scheint ein ziemlich sicheres Indiz dafür, daß Diderot die Romane Richarddramatique, sons bei der Ausarbeitung seiner Abhandlung De la poésie die im November 1758 erschien, wirklich gelesen hatte. Jacques Chouillet zieht diesen Beleg bei seiner Datierung der Erstlektüre dieser Werke durch Diderot zwischen 1757 und 1760 offenbar nicht heran. Wichtig ist aber sein Nachweis, daß es sich dabei nur um die französischen Übersetzungen gehandelt haben kann und Diderot erst gegen Ende 1760 Bekanntschaft mit dem englischen Original der Clarissa schloß. (Vgl. J. Chouillet: La formation des idées esthétiques de Diderot. Paris 1973, S. 508 f.). 297 Ebenda, S. 277 : „ . . . c'est que le roman suit le geste et la pantomime dans tous leurs détails; que l'auteur s'attache principalement à peindre et les mouvements et les impressions: au lieu que le poète dramatique n'en jette qu'un mot en passant." - Deutsch: Ebenda, S. 324. 298 Ebenda, S. 278: „La pantomime serait établie sur nos théâtres, qu'un poète qui ne fait pas représenter ses pièces, sera froid et quelquefois inintelligible, s'il n'écrit pas le jeu." - Deutsch: Ebenda, S. 325. 20
Geißler, Ronruntheonc
305
299 Vgl. François Béliard: Zélaskim, histoire américaine, ou les Aventures de la Marquise de P * * * , avec un Discours pour la défense des romans. Paris 1765, S. xij. 300 Elie de Beaumont: Lettres du marquis de Roselle. Bd. 2. Londres Paris 1767, S. 33. 301 Mistelet: De la sensibilité par rapport aux drames, aux romans et à l'éducation. Amsterdam (Paris) 1777, S. 20. 302 Charles-Jacques-Louis-Auguste Rochette de La Morlière: Le fatalisme ou Collection d'anecdotes . . . Teil 1. Londres - Paris 1769, S. xvif: „La Comédie n'est autre chose que la circonstance vraie ou fausse de la vie d'un grand personnage, d'un homme qualifié, d'un bourgeois ou d'un paysan . . ." 303 304 305 306
Ebenda, S. xivf. Ebenda, S. xv. Ebenda, S. xxii. Barthélémy Imbert: Les égarements de l'amour, ou Lettres de Fanéli et de Milfort. Bd. 1. Amsterdam - Paris 1776, S. v : „La peinture des mœurs, des caractères et des passions, appartient également à l'Auteur dramatique, et au Romancier. Le cœur humain est la mine, que l'un et l'autre doit fouiller."
307 L'année littéraire, S. 147: „Le véritable Roman paraît avoir un rapport bien marqué avec la poésie dramatique." 308 Ebenda, S. 150. 309 Ebenda, S. 151. 310 Jean-François de La Harpe: Lycée, ou Cours de littérature ancienne et moderne. Bd. 14. Paris 1827, S. 243: „Un bon roman doit offrir un ensemble régulier et marcher à un but, comme le drame; comme le drame, il manque son effet si l'intérêt est porté sur un trop grand nombre de personnages, si la mémoire est fatiguée, et l'attention distraite par une trop grande multitude d'aventures." 311 Ebenda, S. 252. 312 Ebenda, Bd. 16. Paris 1827, S. 277. 313 Pierre-Ambroise-François Choderlos de Laclos: Œuvres complètes. Paris 1951 (Bibliothèque de la Pléiade), S. 500. - Deutsch: S. 198 dieser Ausgabe. 314 Ebenda. - Deutsch: S. 198 dieser Ausgabe. 315 Ebenda. 316 Ebenda: „II suit de là que le caractère le plus heureusement mis au théâtre, laisse encore au romancier une vaste carrière à parcourir." 317 Ebenda, S. 501. 318 Ebenda. 319 Staël, Essai sur les fictions, S. 196. - Deutsch: S. 272 dieser Ausgabe. 320 Ebenda. S. 197. - Deutsch: S. 272 dieser Ausgabe. 321 Ebenda.
306
322 Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Ästhetik. Bd. 2. Berlin - Weimar 1965, S. 452. 323 Staël, Essai sur les fictions, S. 197. - Deutsch: S. 272 dieser Ausgabe. 324 Marmontel, Essai, S. 558: „Le plus digne objet de la littérature, le seul même qui l'ennoblisse et qui l'honore, c'est son utilité morale . . . " Deutsch: S. 201 dieser Ausgabe. 325 Hermann Hof er: Louis-Sébastien Mercier und kein Ende. In: lendemains. Zeitschrift für Frankreichforschung und Französischstudium (1978) 11, S. 4. 326 Claude-Joseph Dorât: Idée sur les romans. In: Les sacrifices de l'amour . . . Amsterdam - Paris 1771, S. 12: „Le roman, tel qu'il doit être conçu, est une des plus belles productions de l'esprit humain, parce qu'il en est une des plus utiles . . ." 327 Staël, Essai sur les fictions, S. 200: „. . .un roman tel qu'on peut le concevoir, tel que nous en avons quelques modèles, est une des plus belles productions de l'esprit humain, une des plus influantes sur la morale des individus, qui doit ensuite former les mœurs publiques." - Deutsch: S. 274 dieser Ausgabe. 328 Vgl. Vorbemerkung zu diesem Band, S. 8 f. 329 Manfred Naumann: Prosa in Frankreich. Studien zum Roman im 19. und 20. Jahrhundert. Berlin 1978, S. 14 (Literatur und Gesellschaft). 330 MEW, Bd. 20, S. 240. 331 Vgl. Manfred Naumann: Prosa in Frankreich. Studien zum Roman im 19. und 20. Jahrhundert. Berlin 1978, S. 14 ff. (Literatur und Gesellschaft).
Anmerkungen
den Texten
1 Das ist die These Pierre-Daniel Huets (1630-1721) in seinem Traité de l'origine des romans (1670), den Irailh für die folgenden romangeschichtlichen Angaben teils als Quelle benutzte. 2 Es muß heißen „Cléarque" (Klearchos), der nach Huet „Liebesbücher verfaßt hatte". Er stammte aus Kilikien (Provinz in Kleinasien), lebte im 4. Jh. v. u. Z. und wird von Athenaios (3. Jh. u. Z.) in seinem Werk Deipnosopbistai (Gastmahl der Wissenschaftler) erwähnt. (Vgl. Fabienne Gégou: Lettre-traité de P.-D. Huet sur l'origine des romans . . . , Paris 1971, S. 50 und 72). 3 Verfasser des griechischen Romans Histoire de Leucippe et de Clitophon ist Achilleus Tatios aus Alexandria (6. Jh. u. ZO. - Die wunderbaren Abenteuer des Liebespaares Rhodanes und Sinonis beschrieb der griechische Schriftsteller Jamblichos (2. Jh. u. Z.). - Der griechische Hirtenroman Dapbnis und Cloe wurde von Longos (3. Jh. u. Z.) verfaßt. - Jacques Amyot (1513-1593), Bischof von Auxerre, wurde besonders durch seine glänzenden 20*
307
322 Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Ästhetik. Bd. 2. Berlin - Weimar 1965, S. 452. 323 Staël, Essai sur les fictions, S. 197. - Deutsch: S. 272 dieser Ausgabe. 324 Marmontel, Essai, S. 558: „Le plus digne objet de la littérature, le seul même qui l'ennoblisse et qui l'honore, c'est son utilité morale . . . " Deutsch: S. 201 dieser Ausgabe. 325 Hermann Hof er: Louis-Sébastien Mercier und kein Ende. In: lendemains. Zeitschrift für Frankreichforschung und Französischstudium (1978) 11, S. 4. 326 Claude-Joseph Dorât: Idée sur les romans. In: Les sacrifices de l'amour . . . Amsterdam - Paris 1771, S. 12: „Le roman, tel qu'il doit être conçu, est une des plus belles productions de l'esprit humain, parce qu'il en est une des plus utiles . . ." 327 Staël, Essai sur les fictions, S. 200: „. . .un roman tel qu'on peut le concevoir, tel que nous en avons quelques modèles, est une des plus belles productions de l'esprit humain, une des plus influantes sur la morale des individus, qui doit ensuite former les mœurs publiques." - Deutsch: S. 274 dieser Ausgabe. 328 Vgl. Vorbemerkung zu diesem Band, S. 8 f. 329 Manfred Naumann: Prosa in Frankreich. Studien zum Roman im 19. und 20. Jahrhundert. Berlin 1978, S. 14 (Literatur und Gesellschaft). 330 MEW, Bd. 20, S. 240. 331 Vgl. Manfred Naumann: Prosa in Frankreich. Studien zum Roman im 19. und 20. Jahrhundert. Berlin 1978, S. 14 ff. (Literatur und Gesellschaft).
Anmerkungen
den Texten
1 Das ist die These Pierre-Daniel Huets (1630-1721) in seinem Traité de l'origine des romans (1670), den Irailh für die folgenden romangeschichtlichen Angaben teils als Quelle benutzte. 2 Es muß heißen „Cléarque" (Klearchos), der nach Huet „Liebesbücher verfaßt hatte". Er stammte aus Kilikien (Provinz in Kleinasien), lebte im 4. Jh. v. u. Z. und wird von Athenaios (3. Jh. u. Z.) in seinem Werk Deipnosopbistai (Gastmahl der Wissenschaftler) erwähnt. (Vgl. Fabienne Gégou: Lettre-traité de P.-D. Huet sur l'origine des romans . . . , Paris 1971, S. 50 und 72). 3 Verfasser des griechischen Romans Histoire de Leucippe et de Clitophon ist Achilleus Tatios aus Alexandria (6. Jh. u. ZO. - Die wunderbaren Abenteuer des Liebespaares Rhodanes und Sinonis beschrieb der griechische Schriftsteller Jamblichos (2. Jh. u. Z.). - Der griechische Hirtenroman Dapbnis und Cloe wurde von Longos (3. Jh. u. Z.) verfaßt. - Jacques Amyot (1513-1593), Bischof von Auxerre, wurde besonders durch seine glänzenden 20*
307
Übersetzungen der Werke des griechischen Schriftstellers Plutarch (46-120 u. Z.) ins Französische berühmt. - Heliodors Roman, der die Liebesabenteuer des Theagenes und der Charikleia schildert, trug den Titel Aitbiopica und stammt aus dem 3. Jh. u. Z. 4 Françdis de Salignac de La Mothe Fénelon (1651-1715), Erzbischof von Cambrai, verfaßte für seinen Zögling, den Herzog von Bourgogne, den Erziehungsroman Les aventures de Télémaque (1699), in dem er am absolutistischen Herrschaftssystem Ludwigs XIV. heftige Kritik übte. Er fiel daraufhin beim König in Ungnade und wurde vom Hofe verwiesen. 5 Der Erzbischof Turpin von Reims (753-800) nahm selbst an der Rolandsschlacht teil. Die ihm zugeschriebene Histoire Caroli Magni et Rotholandi, die sogenannte Pseudo-Turpinische Chronik, entstand jedoch erst Mitte des 12. Jhs. 6 Abbé Claude Fleury (1640-1723) war Prinzenerzieher am Hofe Ludwigs XIV. und Verfasser einer zwanzigbändigen Kirchengeschichte. 7 In dieser Reimchronik von Benoît de Sainte-More (12. Jh.) wird in 42 000 Achtsilbern die Geschichte der normannischen Herzöge von den Anfängen bis zum Jahre 1135 dargestellt. 8 Antoine Rivet de La Grange (1683-1749), gelehrter Benediktinermönch, ist der Verfasser einer Histoire littéraire de la France (1733-1750 in 9 Bänden; Geschichte der Wissenschaften und der Literatur in Frankreich), die nach seinem Tode von seinen Nachfolgern bis ins 19. Jh. fortgesetzt wurde. 9 Mit seinem berühmten parodistischen Roman Don Quijote (1605/15) hat Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616) nicht nur die Ritterromane mit ihren wundersamen Abenteuern ad absurdum geführt, sondern zugleich eine neue, von humanistischen Ideen getragene Weltsicht gestaltet. 10 Der Schäferroman L'Astrée (1607-1627) von dem französischen Schriftsteller Honoré d'Urfé (1568-1625) bezeichnet einen Markstein in der Roman entwicklung. 11 Ibrahim ou l'illustre Bassa (1641 in 4 Bänden; Ibrahim oder Der erlauchte Bassa), Artamène ou Le grand Cyrus (1649/53 in 10 Bänden; Artamenes oder Der große Kyros) und Clélie, histoire romaine (1654/61 in 10 Bänden; Clélie, eine römische Geschichte) sind heroisch-galante Romane von Madeleine de Scudéry, an denen auch ihr Bruder Georges mitgewirkt haben soll. 12 In Wirklichkeit ist der von Jean Regnauld de Segrais (1624-1701) und Marie Pioche de La Vergne de La Fayette (1634-1693) gemeinsam verfaßte Roman Zayde, histoire espagnole (1669/71 ; Zayde, eine spanische Geschichte) in literarisch-ästhetischer Hinsicht nicht vergleichbar mit Madame de La Fayettes Meisterwerk La Princesse de Cleves (1678), das einen ersten Höhepunkt des psychologischen Romans markiert. 13 Verfasser heroisch-galanter Romane: Marin Le Roy de Gomberville (1600 bis 1674) ; Polexandre (1629-1637, 8. Bde) ; Gautier de Coste de La Calprenède (1610-1663); Cassandre (1642-1645, 10 Bde.); Clêopâtre (1647,
308
12 Bde.); Faramond ou L'Histoire de France (unvoll., 1661, 12 Bde.); Desmarets de Saint-Sorlin (1595-1676); Ariane (1632, 10 Bde.). 14 Nicolas Boileau-Despréaux (1636-1711), der führende Theoretiker det französischen Klassik, verfaßte 1666 eine Satire auf den Roman mit dem Titel he dialo que des héros de roman (Der Dialog der Romanhelden), veröffentlicht erst 1688. 15 Pierre-Daniel Huet nahm eine differenziertere Haltung gegenüber dem Roman ein, als hier zum Ausdruck kommt. 16 Jean Regnauld de Segrais (1624-1701) verfaßte u. a. einen Roman Bérénice (1648) und historische Novellen Nouvelles françaises (1656). E r trat dafür ein, statt der antiken Heroen Franzosen als Romanhelden zu nehmen. 17 Madame de Villedieu (1640-1683) hat zunächst Romane im Stil der Gomberville und Scudéry verfaßt, dann aber besonders mit ihrer Novellensammlung Annales galantes das Genre der galanten Kurzgeschichte begründet. 18 Marguerite de Lussan (1682-1758) verfaßte vor allem historische Romane. 19 Pierre Carlet de Chamblain Marivaux (1688-1763) hat in seinen beiden großen Romanen La vie de Marianne (1728-1741 ; Das Leben Mariannes) Bauer) durch und Le paysan parvenu (1135/36-, Der emporgekommene seine subtilen psychologischen Analysen und realistischen Sittenschilderungen neue Wirklichkeitsbereiche literarisch erschlossen. Auf Kritik stieß besonders, daß er Romanfiguren aus niederen Ständen auftreten ließ und entgegen den klassischen Normen die Sprache durch Neologien und stilistische Raffinessen, die sogenannte „marivaudage", in ihrem Ausdrucksvermögen zu bereichern suchte. 20 Claude-Prosper Jolyot de Crébillon (1707-1777) analysierte und schilderte in seinen Romanen und Erzählungen, die man auf Grund ihres schlüpfrigerotischen Charakters als „contes licencieux" bezeichnet hat, die korrupte Welt der parasitären Aristokratie seiner Zeit und ihres inhaltlosen D a seins in den Salons. E r bediente sich dabei teils der orientalischen Märchenform wie in L'ècumoire ou Tanzai et Néardané (1734; Der Schaumlöffel oder Tanzai und Néardané) und Le sopba (1740), teils aber auch der wirklichkeitsnahen Brief- oder Dialogform wie in Les égarements du cœur et de l'esprit (1736; Die Verirrungen des Herzens und des Verstandes) oder Le hasard au coin du feu (1763; Der Zufall in der Kaminecke). Trotz der gegen ihn erhobenen Beschuldigungen, damit die öffentliche Moral zu gefährden, ließ ihm Madame de Pompadour das Amt eines königlichen Bücherzensors übertragen. 21 Die Histoire de Gii Blas de Santillane (1715-1735; Geschichte des Gii Blas von Santillana) ist das Hauptwerk Alain-René Le Sages (1668-1747), in dem er in Anlehnung an das Modell des spanischen Schelmenromans ein umfassendes Sittenbild der französischen Gesellschaft am Anfang des 18. Jhs. gestaltete.
309
22 Argents (1621), ein Sittenspiegel aus jener Zeit, ist das Hauptwerk des englischen Dichters und Satirikers John Barclay (1475-1552). 23 Romane und Erzählungen Voltaires. 24 Antoine Hamilton (1646-1720), Verfasser des historisch-biographischen Romans Mémoires de la vie du Comte de Grammont (1713). 25 Scarron (1610-1660) parodierte mit seinem Roman comique (1651-1657), in dem er die Abenteuer einer fahrenden Komödiantentruppe schilderte, die heroisch-galanten Romane seiner Zeit mit ihren erhabenen Helden und großartigen Taten. 26 Autor der Lettres juives, ou Correspondance philosophique, historique et critique (1736; Jüdische Briefe oder philosophische, historische und kritische Korrespondenz) war der französische Aufklärer Jean-Baptiste de Boyer d'Argens. 27 Vgl. Anmerkung (Texte) 20. 28 Romane von Antoine-François Prévost (1697-1763). 29 Roman von Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), erschienen 1762. 30 César Chesneaii Du Marsais (1676-1756) gehörte zu den philosophischen Wegbereitern des Atheismus in der Frühaufklärung. Der ebenfalls für seine freigeistige Gesinnung bekannte Gerichtspräsident Desmaisons (1666-1715) stellte ihn als Hauslehrer für seinen Sohn ein. 31 Nicolas Lenglet Du Fresnoys Schrifi De l'usage des romans, où l'on fait voir leur utilité et leurs différents caractères (1734-, Vom Gebrauch der Romane, wo ihr Nutzen und ihr unterschiedlicher Charakter gezeigt wird) ist der Versuch einer Romanapologie in Anknüpfung an Huet. - Charles de Fieux de Mouhy wandte sich in einer Préfacé ou Essai pour servir de Réponse à un ouvrage intitulé Entretiens sur les romans, par M. l'Abbé Jfaquin] (Vorwort oder Essay als Antwort auf ein Werk mit dem Titel Unterhaltungen über die Romane vom Abbé Jaquin), enthalten in dem Roman Le financier (1755), gegen die Verurteilung des Romans als Genre. 32 In diesem 1735 in Amsterdam erschienenen Buch stellt Lenglet Du Fresnoy ganz auf der Argumentationslinie der Frühaufklärung die geschichtliche Wahrheit über den Erkenntniswert der Romandichtung. 33 Die satirischen Romane The Tale of a Tub (1704; Das Märchen von der Tonne) und Travels into Several Remote Nations of the World, by Lemuel Gulliver (1726; Gullivers Reisen) wurden von Jonathan Swift (1667-1745) verfaßt. 34 Roman von Henry Fielding (1707-1754). 35 Samuel Richardson (1689-1761) galt im 18. Jh. in Frankreich als bedeutendster englischer Romanautor. Bei seinem Tode 1761 widmete ihm Diderot mit seiner Eloge de Richardson einen begeisterten Nachruf. 36 Der Begriff der „belle nature" (schöne Natur) als eigentlicher Gegenstand der Dichtung hatte in der klassischen Poetik zentrale Bedeutung. Mit ihm wird eine idealisierende und moralisierende Wirklichkeitsdarstellung legi-
310
37 38 39
40
41
42
43 44
timiert, die ira Verlauf der Entwicklung unterschiedlichen Zielsetzungen dienen sollte. Vielleicht zwei, vielleicht auch niemand, (lat.) Schändlich und jämmerlich, (lat.) „Siehe den siebenten Kupferstich" (Anmerkung Rousseaus). Er hat die Unterschrift: „Das Vertrauen der schönen Seelen." Der Kupferstich zeigt, wie Saint-Preux nach einer langen Reise von den Wolmars auf ihrem Landgut empfangen wird. Obwohl der Gatte Julies, Monsieur de Wolmar, wußte, daß Saint-Preux ihr ehemaliger Liebhaber war, hat er selbst ihn im vollen Vertrauen in beider Tugend in sein Haus eingeladen. „So reichen wir auch wohl dem kranken Knaben / Des Bechers Rand mit süßem Naß besprengt ¡/Getäuscht empfängt er, ohne Widerstreben./Den herben Saft und, durch die Täuschung, Leben." Torquato Tasso: Befreites Jerusalem, I, 3; nach der Übersetzung von Gries). Durch den Vergleich von Rousseaus Romanhelden Saint-Preux, seiner Geliebten Julie und ihrer Freundin Ciaire mit Gestalten aus Honoré d'Urfés Schäferroman Astrée (1607-1619), von Saint-Preux' Freund und Gönner Milord Edouard Bomston mit Don Quijote soll ihre Realitätsferne unterstrichen werden. Rousseau wendet sich hier erneut gegen den Vorwurf seitens der Aufklärer um Diderot, daß er durch seinen Rückzug aus der Gesellschaft ihre Sache verraten hätte. Vgl. den Brief Diderots an Rousseau vom 10. März 1757. Hinweis auf Figuren und Begebenheiten in den Schäferromanen, namentlich in d'Urfés Astrée. Die Stelle lautet: „Ich meinerseits habe keinen andern Maßstab zur Beurteilung meiner Lektüre, als daß ich die Stimmung prüfe, in welche sie mein Gemüt versetzt, und ich kann mir kaum vorstellen, wie ein Buch nur irgend gut sein könnte, das seinen Leser nicht zum Guten erweckt." (Rousseau: Julie ou La Nouvelle Héloïse. Teil 2, Brief 18. Paris: Garnier Frères 1960, S. 239; zit. nach: Julie oder Die neue Heloise. Bd. 1. Berlin 1922, S. 366.)
45 „Dies betrifft nur die modernen englischen Romane". (Anmerkung Rousseaus). 46 „Man vergleiche den Brief an M. d'Alembert über die Schauspiele. 1. ed., S. 81." (Anmerkung Rousseaus). Rousseaus Lettre à d'Alembert sur les Spectacles (1758) ist Ausdruck seines Zerwürfnisses mit den Enzyklopädisten. Er unterzog darin das französische Theater, gegen dessen Verbot in Genf d'Alembert in seinem Enzyklopädie-Artikel Genève aufgetreten war, einer radikalen Kritik. 47 Vgl. Rousseau: Julie ou La Nouvelle Héloïse, Teil I, Briefe 14 und 54. Paris: Garnier Frères 1960. 48 Die bereits 1733 verfaßte Komödie Rousseaus wurde 1752 aufgeführt. 49. Rousseaus Oper he Devin du village (Der Dorfwahrsager) entstand 1752.
311
50 51 52 53
Aus der Vorrede zum Narcisse und der erwähnten Lettre à d'Alembert. Vgl. Anmerkung (Texte) 39. Vitam impendere vero (sein Leben der Wahrheit hingeben). Vgl. Rousseau: Julie ou La Nouvelle Héloïse, Teil II, Brief 3. Paris: Garnier Frères 1960: Milord Edouard macht Julie den Vorschlag, mit ihrem Geliebten nach England zu fliehen und Zuflucht auf einem Schloß seiner Vorfahren zu suchen, das er ihr zum Geschenk machen will.
54 Vgl. ebenda, Teil III, Briefe 21 und 22: die berühmte Diskussion um das Selbstmordproblem. 55 Michel Eyquem de Montaigne (1533-1592) wurde durch seine Essais berühmt. Seine humanistisch-skeptische Gesinnung blieb auch in der Aufklärung ein Leitbild. - Pierre Charron (1541-1603) erwies sich in seinem Hauptwerk De la sagesse (1601; Von der Weisheit) als Schüler Montaignes. - François de la Rochefoucauld (1613-1680) vertrat in seinen Réflexions ou Sentences et Maximes morales (1665 ; Betrachtungen oder moralische Sentenzen und Maximen) die pessimistische These, daß das Handeln der Menschen durch rein egoistische Motive bestimmt werde. - Pierre Nicole zählte zu den führenden Vertretern der katholischen Kirchenreformbewegung des Jansenismus von Port-Royal und ist u. a. mit Essais de Morale (1671) literarisch hervorgetreten. 56 Kapitän Tomlinson ist Komplice von Lovelace, der die Heldin in Richardsons Roman Clarissa, or tbe History of a Young Lady (1747/48; Clarissa oder die Geschichte einer jungen Damé) verführt und ins Unglück stürzt. 57 Höchstwahrscheinlich meint er damit seinen Aufenthalt in Grandval beim Baron d'Holbach im Oktober 1760. 58 Weitere Romane Richardsons: Pamela, ou Virtue Rewarded (1740; Pamela oder Die belohnte Tugend), The History of Sir Charles Grandison (1754/ 59; Die Gechicbte des Sir Charles Grandison). 59 Der Abbé Prévost übersetzte Pamela 1742, Clarissa 1751 und Grandison 1755, jedoch mit vielen Auslassungen und in rigoroser Anpassung an den französischen Geschmack. Vor allem ging dadurch der Ausdrucksreichtum der englischen Originale verloren. Im folgenden ist von Stellen die Rede, die in der Ubersetzung fehlten. Der Abbé Prévost hat die Kritik Diderots beherzigt und 1762 ein Supplément aux lettres anglaises de Miss Clarisse Harlowe mit Diderots Eloge als Vorwort veröffentlicht. 60 Anspielung auf die Meinungsverschiedenheiten über Clarissa zwischen Sophie Volland, ihrer Mutter und ihrer Schwester, Madame Legendre, bei ihrem Aufenthalt auf dem Schloß Isle im September 1761. 61 Richardson starb am 4. Juli 1761 in London. 62 David Hume (1711-1776), berühmter englischer Philosoph und Historiker, schloß sich den französischen Aufklärern an, als er 1763-1766 als Gesandtschaftssekretär in Paris weilte, und lud Rousseau nach England ein, mit dem es darauf aber zum Zerwürfnis kam. 63 Es handelt sich um Madame Legendre, die von Diderot „Uranie" ge-
312
64
65
66 67 68
nannt wurde. Sie brach unter dem Eindruck der Lektüre der Clarissa ihren heimlichen Briefwechsel mit einem Kollegen ihres Mannes, dem Ingenieur Vialet, ab. Diderot wußte von dieser Affäre. Dieser Brief ist vermutlich authentisch und stammt von Madame d'Epinay (vgl. Diderot: Œuvres esthétiques. Ed. Vernière. Paris 1968, S. 42, Fußnote 2). Dies geschah, wie Diderot in einem Brief an Sophie vom 17. September 1761 berichtet, bei Damilaville. Doch nicht dieser, sondern er selbst führte sich so enthusiastisch auf. Lovelace wird hier durch den Gedanken beunruhigt, daß seine Geliebte fliehen könnte. Hauptgestalten aus dem Schäferroman Astrée (1607-1619) von Honoré d'Urfé. Gestalten aus den heroisch-galanten Romanen der Mademoiselle de Scudéry. Daß der Meister der klassischen französischen Tragödie des 17. Jh., Jean Racine, daraus wesentliche Impulse empfangen hätte, ist abwegig.
69 Racine gedachte zunächst tatsächlich, eine Tragödie Tbéagène et Cbariclée zu schreiben, die von Heliodors Roman inspiriert war. Vgl. Anmerkung (Texte) 3. 70 Saint-Evremond (1616-1703) vertrat wie Fontenelle in der Querelle des anciens et des modernes (Streit der Altertumsfreunde und der Modernen) den Standpunkt der letzteren: er lehnte die Vorbildgeltung der Antike für die Literatur ab. „Wenn Homer heute lebte, würde er bewundernswerte Dichtungen schaffen, die dem Jahrhundert angepaßt wären, in dem er schreibt", heißt es in seiner Schrift Sur les poèmes des anciens (1685; Über die Diebtungen der Alten). 71 Vgl. Anm. (Texte) 3. 72 Die sogenannten Contes de fées (Feenmärchen, meist in orientalischem Gewand) wurden im 18. Jh. in Frankreich zu einer literarischen Modeerscheinung ersten Ranges. Der große Erfolg vor allem der Ubersetzung der arabischen Märchen aus 1001 Nacht (1704-1717 von Antoine Galland) hatte dazu den Anstoß gegeben. Hinzu kam aber, daß sich die Contes de fées als vorzügliche literarische Waffen in den gesellschaftlichen und ideologischen Auseinandersetzungen der Aufklärung einsetzen ließen. Denn „in der Verschleierung einer exotischen Handlung oder eines orientalischen Apologs" (Werner Krauss) hatte die Kritik an der herrschenden Gesellschaft größere Chancen, der Verfolgung durch die Zensurbehörden zu entgehen und in die Öffentlichkeit zu gelangen. Berühmteste Beispiele für die Umfunktionierung dieses Genres im Sinne der Aufklärung sind Voltaires Contes philosophiques und Diderots Les Bijoux indiscrets (1748; Die geschwätzigen Kleinode). Daneben gab es freilich eine Vielzahl sogenannter Contes tartares, chinois, mongols etc., die mit meist pikant-erotischen Schilderungen lediglich Unterhaltungsansprüche zu befriedigen suchten. 73 Verfasser ist Antoine-François Prévost d'Exilés (1697-1763).
313
74 Der Roman Histoire du chevalier des Grieux et de Manon Lescaut (1731) vom Abbé Prévost ist die tragische Geschichte einer großen Liebe, die durch gesellschaftliche Konventionen und ökonomische Zwänge unter den feudalabsolutistischen Verhältnissen zugrunde gerichtet wird. 75 Vgl. Anm. (Texte) 19. 76 Claude-Prosper Jolyot de Crébillon, vgl. Anm. (Texte) 20. 77 Le sultan Misapouf et la princesse de Grisemine (1760) ist ein Feenroman von Claude-Henri de Fusée de Voisenon. 78 Dieser bekannteste Feenroman Crébillons knüpft an die Geschichten von 1001 Nacht an. Es geht darum, daß nach Allahs Willen die Seele eines Sterbenden bei ihrer Wanderung einmal in eine recht ungewöhnliche Hülle ein Sofa - schlüpfen mußte. Was sie da erlebte, bis sich - als Bedingung für ihre Erlösung - erstmals auf diesem Sofa ein Menschenpaar in wahrer Liebe begegnet, macht den eigentlichen Inhalt des Romans aus. 79 Isaac Newton (1634-1727), englischer Physiker, Mathematiker und Astronom, hat mit seiner Gravitationslehre wichtige Grundlagen f ü r die Herausbildung eines wissenschaftlichen Weltbildes geschaffen. Besonders den Bemühungen von Maupertuis und Voltaire ist es zu danken, daß seine Ideen Allgemeingut der französischen Aufklärung wurden, die daraus für ihre naturwissenschaftliche und antitheologische Orientierung wichtige Impulse bezog. 80 Vgl. den Text: Denis Diderot, Eloge de Richardson. 81 Voltaire schrieb an die Marquise D u Deffand (Brief vom 12. April 1760): diese Lektüre [der Clarissa] brachte mein Blut in Wallung. Es ist schrecklich . . ., neun ganze Bände zu lesen, an denen man überhaupt nichts findet . . . Auch wenn alle jene Leute meine Verwandten und meine Freunde wären, könnte ich mich nicht für die interessieren." 82 Oliver Cromwell (1599-1658), Staatsmann und Führer der bürgerlichen Revolution in England, der 1649 die Hinrichtung König Karls I. durchsetzte. Bei den Anhängern des Königshauses in Frankreich galt er darum als die Verkörperung des Bösen. 83 Es handelt sich bei Clarissa um einen Briefroman mit vielen verschiedenen Absendern und Empfängern von Briefen. 84 Bei Grandison ist der Moralismus Richardsons auf die Spitze getrieben. Diese Figur verkörpert das Idealbild puritanisch-bürgerlicher Tugend und trägt kaum noch wirklichkeitsnahe Charakterzüge. 85 Henry Fielding (1707-1754), englischer Dramatiker und Romancier, verfaßte u. a. die Romane Joseph Andrews (1742), Tom Jones, tbe History of a Foundling (1749) und Amelia (1752). Anders als bei Richardson ging ed bei ihm nicht um die Offenlegung von Gedanken und Gefühlen der Romanfiguren in Briefen durch die Methode der Introspektion und Selbstanalyse, sondern um breitangelegte Charakter- und Sittenschilderungen im Rahmen dramatischer Handlungsabläufe. Fielding gilt daher als bedeutender Vorläufer einer realistischen Romankunst im Sinne der großen Gesellschaftsromane des 19. Jhs.
314
86 Jean-Baptiste Molière (1622-1737), der größte französische Lustspieldichter, hatte vollendete Sitten- und Charakterkomödien geschaffen, so daß im 18. Jh. die Meinung verbreitet war, diese Gattung sei erschöpft, da alle nur möglichen Charaktere von Molière bereits in exemplarischer Weise dargestellt worden wären. 87 Jean-Baptiste Joseph Pater (1695-1736) und Jean-Baptiste Siméon Chardin (1699-1779), französische Maler. Während Pater in der Art Watteaus vor allem galante Feste und ländliche Vergnügungen malte, gestaltete Chardin mit seinen Genrebildern Szenen aus dem bürgerlichen Alltag. 88 Vgl. dazu den Text: Jean-Jacques Rousseau: Julie oder die neue Heloïse. Zweite Vorrede. 89 J.-J. Rousseau: Julie ou La Nouvelle Héloïse. Ed. Renée Pomeau. Paris 1960. Préface, S. 4. 90 Raffael, eigtl. Raffaello Santi (1483-1520), bedeutendster italienischer Maler der Hochrenaissance, dessen Bildwerke sich durch vollendete Harmonie zwischen Inhalt, Form und Farben auszeichnen. Innigkeit, Erhabenheit und lebendige Ausdruckskraft kennzeichnen seine Altar- und Madonnenbilder, darunter als berühmtestes die „Sixtinische Madonna" in der Nationalgalerie Dresden. - Francesco Albani (1578-1660), italienischer Maler, schuf neben zahlreichen weniger bedeutenden Altarbildern vor allem idyllische Darstellungen nach antiken Mythen, die ihm den Beinamen eines „Anakreon der Malerei" eintrugen. 91 Gemeint ist Alain-René Le Sage (1668-1747), vgl. Anm. 21 (Texte). Sein Roman he diable boiteux (1707; Der hinkende Teufel), der in seiner Fabel einem spanischen Modell folgt, bietet eine satirisch-kritische Sicht auf die französische Gesellschaft des 18. Jhs. Vermittels seiner teuflischen Kräfte vermag Asmodeus, die Dächer von den Häusern zu heben und Einblick in die intimsten Geschehnisse der Stadt zu gewähren, die er ausführlich kommentiert. 92 Miguel de Cervantes' Don Quijote (1605-1616) wurde zunächst vor allem als meisterhafte Parodie auf die Ritterromane geschätzt, ehe im Verlauf einer langen Rezeptionsgeschichte immer neue Aspekte seiner weit darüber hinausgehenden literarisch-ästhetischen wie ideologischen Bedeutung erschlossen wurden. Im Spanien des 17. Jhs. fand das Buch je nach dem Standort der Betrachter eine ganz unterschiedliche Aufnahme. Die rasche Popularität, die der Roman erlangte, kontrastiert scharf mit der unnachsichtigen Kritik seitens der Vertreter der Intelligenz. Als Dichtung galt ihnen nur die in Versen verfaßte Rede. Lope de Vega etwa betrachtete das Geschichten- und Novellenerzählen als eine Sache, die lediglich „Handarbeiter und Ignoranten" ansprechen konnte. (Vgl. Werner Krauss: Miguel de Cervantes. Leben und Werk. Neuwied - Berlin-West 1966.) 93 Gemeint ist das unvollendete italienische Epos Orlando innamorato (1486; Der verliebte Roland) von Matteo Maria Boiardo (1434-1494), das von der Liebe Rolands zur schönen Angelika berichtet und mit der Darstel-
315
lung der höfischen und verliebten Artusritter deto Geschmack der vornehmen Gesellschaft angepaßt war. Vgl. auch Anm. (Texte) 111. 94 Romane von Charles Pinot Duclos, der als Sekretär auf Lebenszeit der Académie française (seit 1755) die Bestrebungen der Aufklärungspartei dort unterstützte. Als Moralist trat er mit gesellschaftskritischen Werken hervor. Die Mémoires du comte de*** (1741) schildern, wie der Laufbahn eines Verführers ein Ende gesetzt wird. - Acajou et Zirpbile (1744) gehört in die Reihe der Feenerzählungen mit libertinistischem und satirischem Einschlag. 95 Romane und Erzählungen Voltaires. 96 Die geistreichen und witzigen Dialoge des griechischen Schriftstellers Lukian (um 120-180), in denen er die Gebrechen seiner Zeit aufs Korn nahm, dienten den Aufklärern als literarische Modelle. Seine Göttergespräche, Hetärengespräcbe und Totengespräche sind Weltliteratur. 97 Vgl. dazu den Enzyklopädie-Artikel Ferme du tabac (Tabaksteuer), wo über die Vorteile für Staat und Wirtschaft bei richtiger Handhabung dieser steuerlichen Maßnahme gehandelt wird. 98 Juvenal (Decimus Iunius Iuvenalis), ca. 6 0 - 1 2 0 u. Z., römischer Satirendichter, geißelte in seinen 5 Bände umfassenden 16 Satiren mit unnachsichtiger Schärfe besonders die Laster der vornehmen Gesellschaft Roms unter den Kaisern Trajan und Hadrian. Seine Werke galten in der Aufklärung als ein Modell satirischer Dichtung. 99 Mercier hat hier die traditionelle Historiographie der absolutistischen Ara im Auge, die sich auf Dynastengeschichte und die Berichterstattung über fürstliche Kabinettsintrigen sowie über militärische und diplomatische Ereignisse beschränkte. Diese Geschichtsbetrachtung wurde in der französischen Aufklärung überwunden und an Stelle der Geschichte der Könige die Geschichte der Nationen und ihrer ökonomischen, künstlerischen und literarischen Aktivitäten in den Blickpunkt gerückt. Das Hauptverdienst hierbei fällt Voltaire zu, der mit seinen historiographischen Hauptwerken Le siècle de Louis XIV und Essai sur les mœurs et l' esprit des nations (1756) zum Begründer der Kulturgeschichtsschreibung wurde. 100 Mercier spielt hier auf die im 18. Jh. zahlreich erscheinenden Utopien „voyages imaginaires" („Phantastische Reisebeschreibungen") an, die in lehnung an Morus' Utopia glückliche Staatswesen auf fernen Inseln schreiben. Mit seinem Roman L'an 2440 (1771) hat Mercier selber solche Utopie verfaßt und erstmals die Idealgesellschaft als Ergebnis historischen Entwicklung in der Zukunft dargestellt.
und Anbeeine der
101 Kritik an der klassischen Regelpoetik, die in den traditionellen Dichtungsgattungen auch im 18. Jh. noch uneingeschränkt Geltung hatte. 102 Den letzten mißglückten Versuch zur Schaffung eines großen französischen Nationalepos hatte Voltaire mit seiner Henriade (1728) unternommen. 103 Vgl. Anm. (Texte) 86. - Tartuffe ist der Held der gleichnamigen Komödie
316
Molières. Mit ihm hat Molière den Typ eines Heuchlers geschaffen, der religiösen Eifer vortäuscht, um seine egoistischen Interessen
wahrzuneh-
men. 104 Vgl. Anm. (Texte) 19. - Climal ist eine Gestalt aus Marivaux' Roman La vie de Marianne (1728-1742); unter dem Deckmantel christlicher Nächstenliebe sucht er das Vertrauen der schutzbedürftigen Marianne zu gewinnen, um sie dann zu verführen. 105 Horaz (Quintus Horatius Flaccus), 6 5 - 8 v. u. Z., römischer Dichter, machte sich besonders durch seine Oden einen Namen. Sein dichterisches Wirken stellte er in den Dienst der Politik des Augustus (vgl. insbesondere die sogenannten Römeroden). Er verfaßte u. a. Satiren und Episteln, darunter im zweiten Epistelbuch drei Literaturbriefe, die als Ars poetica die kunsttheoretischen Auffassungen insbesondere auch der französischen Klassik beeinflußten. 106 „Nur was recht und geziemt, danach forsch ich und will darin aufgehn" (Horaz, Epist. I, 1, 11; zit. nach: Q. Horatius Flaccus: Satiren und Briefe. Lateinisch und deutsch. Eingel. u. übers, von Rudolf Helm. Zürich Stuttgart 1962, S. 206 f . ) . 107 „Was auch die Herrscher begehn, die Achäer erhalten die Schläge" (Horaz, Epist. I, 2, 14; zit. nach: Ebenda, S. 219.). 108 Sophokles (um 496-406 v. u. Z.), griechischer Tragödiendichter, zählt zu den Klassikern des Theaters. Von seinen zahlreichen Dramen sind uns sieben vollständig erhalten, die sämtlich Themen aus der griechischen Mythologie gestalten, darunter Antigone, König Ödipus, Elektra und Philoktet. 109 Lukrez (Titus Carus Lucretius), ca. 9 7 - 5 5 v. u. Z., römischer Dichter und Philosoph, hat in seinem Lehrgedicht De rerum natura (Von der Natur der Dinge) die Atomlehre Demokrits und Epikurs verarbeitet und damit als Wegbereiter eines materialistischen Weltbildes gewirkt. Diese auch in ästhetischer Hinsicht anspruchsvolle Dichtung zählte zu den wichtigsten Quellen des französischen Materialismus des 18. Jhs. 110 „. . . damit sie täuschen den unvorsichtigen Sinn . . . des Kindes" (Titus Lucretius Carus, D e rerum natura, I, 939 und IV, 14; zit. nach. Lukrez: Von der Natur der Dinge. Nach der Übers, von K. L. v. Knebel hg. v. Otto Güthling. Leipzig 1947). 111 Ludovico Ariosto (1474-1533), italienischer Dichter. Sein Hauptwerk, das Epos L'Orlando furioso (1516; 1532 um 6 Gesänge erweitert; Der rasende Roland), das als freie Fortsetzung des Orlando innamorato von Boiardo (vgl. Anm. (Texte) 93) die Liebe Rolands zur schönen Angelika und seinen daraus entspringenden Wahnsinn schildert, bezeichnet den Höhepunkt der ritterlichen Poesie Italiens und ist eine der bedeutendsten Dichtungen der Renaissance. - Das italienische Nationalepos aber schuf Torquato Tasso (1544-1595) mit seinem Hauptwerk La Gerusalemme liberata (1581 ; Das befreite Jerusalem), das von der Befreiung Jerusalems aus heidnischer Herrschaft durch das Kreuzfahrerheer berichtet.
317
112 Homer (8. Jh. v. u. Z.), der den Beginn der griechischen Literatur bezeichnet, hatte mit seinen großen, meisterhaften Epen Utas, der Schilderung des Kampfes um Troja, und Odyssee, wo von den Irrfahrten des Odysseus bei seiner Heimkehr aus dem Trojanischen Krieg gehandelt wird, für die Gattung des Epos bleibende Maßstäbe gesetzt. 113 Gestalten aus der griechischen Mythologie: Kadmos ist der sagenhafte Gründer der Stadt Theben und Erfinder der griechischen Buchstabenschrift; Herkules (griech. Herakles), Sohn des Zeus, den dieser in der Gestalt des Amphitryon mit Alkmene zeugte, war eine mit übermenschlicher Kraft ausgestattete Heldengestalt; Jason leitete den Zug der Argonauten nach Kolchis, der das goldene Vlies nach Griechenland zurückbringen sollte; Minos, Sohn des Zeus und der Europa, König von Kreta, galt als milder und gerechter Gesetzgeber, der nach seinem Tode Richter in der Unterwelt wurde; Atriden - die Söhne des Atreus, Agamemnon und Menelaos. 114 Gestalten der mittelalterlichen Heldendichtung, der höfischen Romane und Ritterromane. 115 Ovid (Publius Ovidius Naso), 43 v. u. Z. - 18 u. Z., römischer Dichter, erzählt in seinem Hauptwerk, den in Hexametern verfaßten Metamorphosen, 250 Verwandlungssagen. 116 Ionier - griechischer Volksstamm; Milet - ionische Handelsstadt in Unteritalien. 117 Pierre-Daniel Huet in seinem Traité de l'origine des romans (1670). Vgl. auch Anm. (Texte) 1. 118 Vgl. Anm. (Texte) 96. 119 Apuleius (um 125-180), römischer Schriftsteller, verfaßte einen Roman Metamorphosen oder Der goldene Esel, in dem ein neugieriger Jüngling in einen Esel verwandelt und nach zahlreichen Abenteuern durch göttliches Eingreifen erlöst wird. 120 Antoninus Pius (86-161) und Marcus Aurelius Antoninus (161-180) römische Kaiser. 121 Honorius (395-423) - Kaiser des Weströmischen Reiches. 122 Beide Romane stammen aus dem 3. Jh. u. Z. Der berühmte antike Schäferroman Daphnis und Chloe hat auf die bukolische Dichtung des 17. Jhs. einen starken Einfluß ausgeübt. - Vgl. auch Anm. (Texte) 3. 123 Titus Petronius Arbiter (gest. 66 u. Z.) war Neros „Schiedsrichter in ästhetischen Fragen". Sein Roman Satiricon ist nur in Fragmenten erhalten. Er handelt von den frivolen und erotischen Abenteuern eines Freigelassenen, der sich als Vagabund durchs Leben schlägt, und enthält treffende Sittenschilderungen aus der Zeit Neros (römischer Kaiser 54-68 u. Z.) 124 Eurípides (480-406 v. u. Z.) - neben Sophokles der bedeutendste Tragödiendichter der griechischen Antike. - Kratinos (gest. um 423 v. u. Z.), griechischer Komödiendichter und Rivale des Aristophanes. - Menander (Menandros), um 342-292 v. u. Z., lebte in Athen und war der bedeu-
318
tendste Vertreter der neueren griechischen Komödie, der sich im Gegensatz zur politisch-satirischen Komödie des Aristophanes auf den privaten Bereich zurückzog und die Charaktergestaltung in den Mittelpunkt stellte. 125 Unter Kaiser Augustus (63 v. u. Z. - 14 u. Z.), dem Adoptivsohn und Erben Cäsars, hatte das Römische Reich einen Höhepunkt seiner Macht und eine Blütezeit seiner Kultur erlebt. 126 Der Frankenkönig Karl der Große (frz. Charlemagne), Lebenszeit 742 bis 814, hatte sich im Jahre 800 vom Papst zum römischen Kaiser krönen lassen. Unter seiner Regierung erreichte das Frankenreich durch die Eroberung zahlreicher Gebiete in Mittel- und Südeuropa eine gewaltige Ausdehnung. Ökonomische Entwicklung, politische Machtentfaltung und Befriedung im Innern bildeten die Grundlage für eine erste Blütezeit von Kultur und Wissenschaft in der mittelalterlichen Feudalgesellschaft. 127 Theseus, Nationalheld der attischen Sage und König von Athen, gilt als der Gründer des attischen Staatswesens mit Athen als Hauptstadt und der dort installierten Demokratie. 128 Cacus, nach der römischen Mythologie ein feuerspeiender Riese und Sohn des Vulkan, der dem Herkules Rinder stahl und von diesem erschlagen wurde. - Prokrustes, in der griechischen Sage ein Räuber, der die Überfallenen auf ein Bett zwang und sie nach dessen Länge streckte bzw. überhängende Teile abhackte. Er wurde von Theseus erschlagen. - Amadis, Held gleichnamiger Ritterromane und Muster ritterlicher Tugend. - Vgl. auch Anm. (Texte) 113. 129 Kyros der Ältere, gest. 523, Gründer des Perserreiches und einer der größten Eroberer der Weltgeschichte. In Xenophons Erziehungsroman Cyropaedta wird er als Muster eines humanen und tugendhaften Herrschers dargestellt. - Scipio (Publius Cornelius Scipio Africanus), 2 3 5 - 1 8 3 v. u. Z., genoß in Rom große Popularität und führte erfolgreiche Kriege gegen die Karthager. 130 In den Ritterromanen die Ritter der Tafelrunde des König Artus. 131 Pierre du Terrail, Chevalier de Bayard, mit dem Beinamen „Ritter ohne Furcht und Tadel", begleitete König Franz I. auf seinen Italienfeldzügen und kam dort 1524 um. Der französische König wurde geschlagen und geriet in Gefangenschaft. 132 Miltiades besiegte als Heerführer der Athener 490 v. u. Z. die Perser bei Marathon. - Themistokles, athenischer Staatsmann, schlug 480 v. u. Z. die überlegene persische Flotte bei Salamis. - Epameinondas, thebanischer Feldherr und Staatsmann, errang 371 v. u. Z. einen entscheidenden Sieg über Sparta. 133 Sagenhafte griechische Helden im Trojanischen Krieg, die in Homers llias besungen werden. 134 M. Manlius Capitolinus soll 392 v. u. Z. das Capitol in Rom vor dem Ansturm der Gallier errettet haben. - Cn. Marcius Coriolanus, erfolgreicher römischer Feldherr, eroberte 493 v. u. Z. die Volskerstadt Corioli, wurde
319
aber dann von den Plebejern aus Rom vertrieben und führte daraufhin ein Volksheer gegen Rom. - M. Claudius Marcellus besiegte 222 v. u. Z. den gallischen Stamm der Insubrer. - Hannibal, karthagischer Heerführer, zog im Jahre 218 v. u. Z. mit 90 000 Mann Fußvolk, 12 000 Reitern und 37 Elefanten durch Gallien, überschritt bei Verlust der Hälfte seines Heeres die Alpen und eroberte Oberitalien. - Pyrrhus, König von Epirus, bekannt besonders durch seine äußerst verlustreichen Siege über die Römer bei Herakleia (280 v. u. Z.) und Ausculum (279 v. u. Z.) ; „Pyrrhussieg" ist seitdem sprichwörtlich. - Lucius Cornelius Sulla, römischer Feldherr und Staatsmann (138-78 v. u. Z.), führte zahlreiche Kriege und erlangte diktatorische Vollmachten in Rom, mit denen er die Restaurierung des Senats und die Entmachtung der Volkstribunen durchsetzte. Er selbst legte sich den Beinamen Felix (der Glückliche) zu, weil er nie eine Schlacht verloren hatte. 135 Zar Peter I. von Rußland (1672-1725) und König Karl XII. von Schweden (1682-1718) bekämpften sich im sogenannten Nordischen Krieg, in dessen Ergebnis Rußland den Zugang zur Ostsee erwarb. 136 Henri de La Tour d'Auvergne, Vicomte de Turenne (1611-1775), Marschall von Frankreich und einer der bedeutendsten Heerführer des 17. Jhs. 137 Graf Moritz von Sachsen (1696-1750), Sohn Augusts des Starken, trat 1720 in französische Dienste und wurde 1744 Marschall von Frankreich. An zahlreichen Kämpfen beteiligt, galt er als der beste französische Feldherr seiner Zeit. 138 Chares, athenischer Feldherr, wurde 338 v. u. Z. bei Chaeronea von Philipp von Mazedonien besiegt. 139 Französische Heerführer des 17. Jhs. 140 Vgl. Anm. (Texte) 11 und 13. 141 Publius Vergilius Maro (70-19 v. u. Z.) schuf mit seiner Aeneis in Anlehnung an Homer das römische Nationalepos. Darin wird von den Geschicken des Aeneas berichtet, der nach seiner Flucht aus dem brennenden Troja und nach langer Irrfahrt nach Latium gelangte und dort die römische Herrschaft begründete. Indirekt wird mit dieser Darstellung der sagenhaften Geschichte zugleich die Größe Roms unter Augustus gerühmt. 142 Es handelt sich um die wenig geglückten Epen Alaric ou Rome vaincue (1654; Alaricb oder Das besiegte Rom) von Georges de Scudéry, das erste christliche Epos Clovis ou La France chrétienne (1657; Chlodwig oder Das christliche Frankreich) von Desmarets de Saint- Sorlin und LaPucelle d'Orléans (1656/57; Die Jungfrau von Orleans) von Jean Chapelain. 143 Die Preziösen waren Damen der vornehmen Gesellschaft, die um die Mitte des 17. Jhs. in den Pariser Salons einen besonderen Lebensstil, eine besondere Geisteshaltung, Liebesauffassung und Sprache kultivierten. Im Zentrum dieser Bestrebungen stand die berühmte Romanautorin Mademoiselle de Scudéry. Ihr Bemühen war u. a. darauf gerichtet, durch die
320
Propagierung einer im platonischen Sinne geläuterten Liebe die Beziehungen zwischen den Geschlechtern auf eine neue Grundlage zu stellen und damit die herkömmliche, durch Sitte und Gesetz verfügte gesellschaftliche Unterordnung der Frau zu überwinden. So wird in ihrem Roman Le grand Cyrus (1649/53) die nur außerhalb ehelicher Bindung mögliche „amitié galante, délicate et tendre" als einzige Garantie bleibender gegenseitiger Zuneigung der obligatorischen Konvenienzehe entgegengestellt. Ihren Widerspruch zu den geltenden Normen brachten die Preziösen besonders auch in sprachlicher Hinsicht zum Ausdruck, indem sie im Bestreben, die Sprache von Archaismen, Provinzialismen, aber auch fachsprachlichen Wendungen zu reinigen, einen gekünstelten, mit Metaphern überladenen Stil praktizierten. Daß sie damit bei aller Übertreibung letztlich doch einen Beitrag zur Entwicklung der klassischen französischen Literatursprache leisteten, wurde oft übersehen. 144 Molière hàt in seiner Komödie Les précieuses ridicules (1659; Die lächerlichen Preziösen), seinen ersten großen Theatererfolg in Paris, die Auswüchse und Verstiegenheiten der Preziosität mit beißendem Spott bedacht. 145 Vgl. Anm. (Texte) 92. 146 Dieser zur Weltliteratur zählende Roman, La Princesse de Cleves, von Madame de La Fayette erschien 1678. Er stellt nicht nur einen künstlerischen Höhepunkt dar, sondern bezeichnet zugleich einen Wendepunkt der Romanentwicklung: Durch ihn erfährt die klassische Einfachheit der Handlung und die Meisterschaft der psychologischen Gestaltung ihre exemplarische Ausprägung. 147 Unter „Régence" (1715-1723) wird die Zeit der Regentschaft des Herzogs Philipp von Orléans verstanden. Nach dem Tode Ludwigs XIV. hatte er an Stelle des noch minderjährigen Ludwigs XV. die Leitung des Staates übernommen, entsprechend seinen aufklärerischen freigeistigen Neigungen die Verfolgung der Jansenisten und Hugenotten eingestellt, eine weitgehende Einschränkung der Bücherzensur veranlaßt und durch die Abschaffung der königlichen Intendanten als Willensvollstrecker des Herrschers das absolutistische Unterdrückungssystem gelockert. 148 Zur Beseitigung der hohen Staatsverschuldung hatte der Regent den Schotten John Law berufen, der 1716 eine private Notenbank gründete. 1720 wurde er zum Finanzminister ernannt. Law glaubte, das Problem durch die Einführung von Papiergeld und den Verkauf von Aktien zur Finanzierung neugegründeter Handelsgesellschaften in den Kolonien lösen zu können. Von dort sollten die Reichtümer ins Mutterland zurückfließen. Die Aussicht auf leichten Gewinn verführte Leute aller Schichten zu bis dahin einmaligen Aktienspekulationen, so daß deren Kurs den zwanzigfachen Nennwert erreichte. Als Zweifel an dem in großer Menge in Umlauf gesetzten Papiergeld entstanden und ein Ansturm auf die Banken zum Umtausch in Gold einsetzte, brach Laws „System" zusammen. 21
Geißler, Roman theo ri e
321
149 Figur des Verführers in Crébillons Roman Les égarements du cœur et de l'esprit. 150 François Rabelais (1494-1553), einer der bedeutendsten französischen Schriftsteller, brachte in seinem berühmten Roman von den Riesen Gargantua und Pantagruel (1532 ff.) in genialer Wci«e die sich in der Frührenaissance herausbildende neue, diesseitsgerichtete Lebensauffassung zum Ausdruck, indem er zugleich das mittelalterliche Welt- und Menschenbild einer sarkastischen Kritik unterzog. Bei ihm paart sich eine tiefgründige humanistische Gelehrsamkeit mit einer unbändigen Phantasie, einem unerschöpflichen Humor und der Fähigkeit, durch den von grotesken und komischen Situationen strotzenden Gang einer Abenteuerhandlung die Gebrechen einer in wirklichkeitsfremden Denkschemen erstarrten Welt aufzudecken. Dabei bediente er sich in adäquater Weise einer Sprache, die mit einer Fülle neuer Wortschöpfungen und Konstruktionen alle Regeln mißachtete, alle Tabus niederriß und damit zu einem Instrument entwickelt wurde, das die neue Welterkenntnis unumwunden zum Ausdruck zu bringen vermochte. 151 Vgl. Anm. (Texte) 96. 152 Jean de La Bruyère (1645-1696), französischer Moralist und Philosoph, war Erzieher im Hause des großen Condé. In seinem berühmten Buch Les caractères (1688; Die Charaktere) vermittelt er an Hand von Charakterbeschreibungen von Zeitgenossen aus seiner Umgebung ein kritisch-satirisches Bild der vornehmen Gesellschaft in der Ära Ludwigs XIV. 153 Antoine Hamilton, Engländer von Geburt, lebte im Exil in Frankreich und verfaßte neben pseudoorientalischen Contes den biographischen Roman Mémoires de la vie du comte de Grammont (1713), der mit seinem geistreich-ironischen Stil und der Genauigkeit und Detailtreue, mit der Gestalten und Situationen charakterisiert werden, bereits die Erzähikunst des späteren 18. Jhs. ankündigt. 154 Vgl. Anm. (Texte) 98. 155 Vgl. Anm. (Texte) 21 und 91. 156 Jean-Jacques Rousseaus (1712-1778) pessimistische Zivilisationskritik, derzufolge die Entstehung des Privateigentums und die Fortschritte der Wissenschaften und Künste Ursache des Verfalls der Sitten wären, stieß bei der Mehrzahl der Aufklärer, die den wissenschaftlichen und kulturellen Fortschritt bejahten, auf heftige Ablehnung. Rousseau reflektierte dabei den Standpunkt der zunehmend von der kapitalistischen Entwicklung benachteiligten kleinbürgerlichen Schichten. Sein Erziehungsroman Emile (1762) als Programm einer natürlichen Erziehung übte eine nachhaltige Wirkung auf die pädagogischen Diskussionen aus. 157 Biaise Pascal (1623-1662) war einer der führenden Köpfe des Jansenismus in Frankreich, einer katholischen Kirchenreformbewegung, die durch Rückbesinnung auf das frühe Christentum und vor allem den moralischen Rigorismus der Lehre des Kirchenvaters Augustinus (354-430) das religio-
322
se Leben erneuern wollte. Ein Hauptwerk sind seine Lettres à un provincial (1656; Briefe an einen Provinzler). In 18 Briefen hat er darin in voller Entfaltung seines nuancenreichen Stils, der alle Ausdrucksmöglichkeiten von der gelehrten Darlegung bis zur beißend ironischen Argumentation ausschöpfte, die Moral der Jesuiten einer vernichtenden Kritik unterzogen. 158 Vgl. Anm. (Texte) 19. - Gérard Dow, eigentlich Gerrit Dou (oder Douw) (1613-1675), ist ein niederländischer Maler, Schüler Rembrandts. Seine Malweise, die der seines Lehrers verpflichtet ist, zeichnet sich durch detailgetreue Wirklichkeitsdarstellung unter geschickter Anwendung von Beleuchtungseffekten aus. 159 Gestalt aus Voltaires Roman Candide (1759), Kap. XXV, ein reicher venezianischer Senator. Pococurante bedeutet: „der sich kaum Sorgen macht". 160 Vgl. Anm. (Texte) 74. 161 Vgl. Jean-François Marmontel: Poétique française. Bd. 2. Paris 1763, Kap. XII r De la Tragédie. 162 „Erbärmliche Tugend, nutzlose und verhängnisvolle EigenschaftI" 163 Gemeint ist Prévosts Roman Manon Lescaut. Vgl. Anm. (Texte) 74. 164 In dem Roman Le philosophe anglais, ou Histoire de Monsieur Cléveland, fils naturel de Cromwel (1732; Der englische Philosoph oder Geschichte von Monsieur Cleveland, dem natürlichen Sohn Cromwells). 165 Diese Passage befindet sich im Vorwort des Romans. (Siehe J.-J. Rousseau: Julie ou La Nouvelle Héloïse. Ed. René Pomeau. Paris 1960, S. 4.) 166 Hier folgen weitere Ausführungen, die die moralische Schädlichkeit von Rousseaus Roman nachweisen sollen. 167 Vgl. den Text: Denis Diderot: Elóge de Richardson (1762). 168 Vgl. Anm. (Texte) 59. 169 Es folgt hier eine Betrachtung zu Richardsons Roman Grandison, die aber nichts Neues bringt, ferner eine kurze Bemerkung über die Vorteile des Briefromans. 170 Marmontel zitiert hier aus seinem im Mercure de France (August 1758) veröffentlichten Artikel über Richardsons Roman, auf den er in einer Fußnote hinweist. Er betont, daß sich seine Meinung dazu seitdem nicht geändert hätte. 171 172 173 174
Madame Riccoboni (1714-1792). Vgl. Anm. (Texte) 4. Vgl. Anm. (Texte) 129. Herodot (Herodotos), 484-425 v. u. Z., ist der älteste griechische Geschichtsschreiber, dessen Werk zusammenhängend erhalten ist. Er gilt als „Vater der Geschichtsschreibung" auch insofern, als er sich bemüht hatte, das Sagenhafte vom Realgeschichtlichen zu scheiden. Seine Darstellung enthält dennoch viel Phantastisch-Märchenhaftes und ist durch novellenartige Episoden aufgelockert.
175 Kyros, dessen Jugend in sagenhaftes Dunkel gehüllt ist, besiegte 550 v. u. Z. 21*
323
Astyages von Medien. - Tomyris war Königin der Massageten (im Nordosten Irans). Im Kampf gegen diesen Volksstamm fiel Kyros 529 v. u. Z. 176 Charles Castel de Saint-Pierre (1658-1743) hatte u. a. einen Friedensplan entworfen, der die Gründung einer europäischen Republik mit einer gesamteuropäischen Regierung vorsah. Seine heftige Kritik am Absolutismus Ludwigs XIV. führte 1718 zu seinem Ausschluß aus der Académie. française. 177 Agesilaos, König von Sparta (401-361 v. u. Z.) ; Xenophon begleitete ihn 396 v. u. Z. auf einem Feldzug in Kleinasien und kämpfte 394 auf seiten Spartas gegen seine Heimatstadt Athen (Schlacht von Koroneia). 178 Kambyses - Vater des Kyros; Kyaxares - modischer Herrscher um 625 v. u. Z. ; Tigranes - König von Armenien, ca. 95-55 v. u. Z. 179 Xenophon war Schüler des Sokrates (469-399 v. u. Z.). 180 Der römische Geschichtsschreiber Publius Cornelius Tacitus (um 55-120 u. Z.) hat in seinen berühmten Geschichtswerken Germania und Atmalen aus seinen republikanischen Neigungen und seiner Ablehnung der Kaiserherrschaft kein Hehl gemacht. - Der italienische Staatsmann und Historiker Niccolò Machiavelli (1469-1527) vertrat in seiner Schrift II Principe (1532; Der Fürst) die Auffassung, daß der Herrscher zur Erreichung seiner Ziele - gemeint war damit konkret die Herstellung der staatlichen Einheit Italiens gegen die Sonderinteressen der Feudalgewalten - ohne Rücksicht auf Moral und Religion sich jeglicher Mittel zu bedienen habe; Die Abhandlung wurde daher lange Zeit als „klassisches" Handbuch skiupelloser Machtpolitik mißverstanden. 181 Aristides (um 530-467 v. u. Z.), mit dem Beinamen „der Gerechte", war Führer der konservativen Agrarpartei in Athen und wurde auf Betreiben der die Interessen der Geschäftsleute vertretenden demokratischen Partei unter Themistokles verbannt, später aber rehabilitiert. - Miltiades (6. Jh. v. u. Z.), athenischer Feldherr und Sieger bei Marathon über die Perser, wurde schließlich für ein fehlgeschlagenes militätisches Unternehmen bestraft. - Sulla: vgl. Anm. (Texte) 134. - Antigone, nach der griechischen Sage Tochter des ödipus, begleitete ihren geblendeten Vater in die Verbannung und wurde lebendig begraben, weil sie gegen das Verbot ihren Bruder, der als Verräter galt, begraben hatte. - Sokrates (469-399 v. u. Z.), griechischer Philosoph, wurde unter der Anklage, die Jugend zu verleiten und nicht an die Götter zu glauben, zum Tode verurteilt. - Phokion (403-318 v. u. Z.), ein erfolgreicher athenischer Feldherr, erlitt unter Beschuldigung des Hochverrats das gleiche Schicksal. - Lucius Sergius Catilina (108-62 v. u. Z.) versuchte durch eine Verschwörung die Herrschaft über Rom zu erlangen. Diese wurde von Cicero aufgedeckt; Catilina entfloh jedoch und fiel bei Pistoria an der Spitze seines Heeres. Marcus Iunius Brutus (85-42 v. u. Z.) ermordete Julius Cäsar, der sich unter Ausschaltung des Senats von Rom zum Diktator auf Lebenszeit
324
182
183 184 185
186
gemacht hatte, und beging nach der verlorenen Schlacht bei Philippi Selbstmord. - Cromwell: vgl. Anm. (Texte) 82. - Heinrich XV. (1553-1610), König von Frankreich, beendete durch die Proklamierung religiöser Toleranz (Edikt von Nantes, 1598) die Hugenottenkriege und machte sich um die Einheit Frankreichs verdient. Er wurde von einem katholischen Fanatiker ermordet. - Ludwig XI. (1423-1483) bekämpfte durch gewaltsames Vorgehen gegen seine Vasallen die Feudalgewalten, stärkte die Königsmacht und förderte die Wirtschaftsentwicklung durch Begünstigung des Bürgertums. - Ludwig XII. (1462-1515) galt als milder und gerechtet Herrscher, erlitt aber mit seiner Italienpolitik ein Fiasko. - Franz I. (1494-1547) war in seiner Außenpolitik wenig erfolgreich, konnte jedoch durch weitere Stärkung der Königsmacht die innere Stabilität Frankreicht festigen und förderte die Entwicklung von Wirtschaft und Kunst. Protesilaos wurde der Sage nach als erster Grieche auf trojanischem Boden getötet. - Idomeneus ist Homers llias zufolge der Anführer der Kreter vor Troja. - Lucius Aelius Seianus war ein Günstling des römischen Kaisers Tiberius (42 v. u. Z. - 37 u. Z.), hatte dessen Sohn vergiften lassen und wurde hingerichtet. - François Michel Le Tellier, Marquis de Louvois (1641-1691), war als Kriegsminister Ludwigs XIV. von Frankreich mitverantwortlich für dessen Kriegspolitik. Lykurgos (9. Jh. v. u. Z.) galt als der legendäre Gesetzgeber Spartas. Diodoros Siculus aus Sizilien war der Verfasser einer Weltgeschichte in 40 Büchern. Er lebte um die Zeitenwende. Sesostris - ägyptischer König, der bei Herodot erwähnt wird; Semiramis sagenhafte Königin von Assyrien; Pygmalion - König von Kypros und Bildhauer, der sich der Sage nach in eine von ihm selbst geschaffene Mädchenstatue verliebte. Sinngemäß: „Der Mensch kann sich für die Wahrheit nicht erwärmen, er ist Feuer und Flamme für die Lüge." - La Fontaine (1621-1659), ein Zeitgenosse Molières und Racines, zählt mit seiner Fabeldichtung zu den großen Poeten der französischen Klassik.
187 Anmerkung de Sades: „Herkules ist eine Gattungsbezeichung, die aus zwei keltischen Wörtern besteht: H e r - C o o l e , was wörtlich .Herr Anführer' bedeutet. H e r k u l e s wurde der Führer einer Armee genannt, daher gab es unendlich viele H e r k u l e s s e ; die Sage schrieb dann einem einzigen die wunderbaren Taten mehrerer zu." (Vgl. die Histoire des Celtes von Peloutier.) 188 Vgl. Anm. (Texte) 1. 189 Esra (griech. Esdras), jüdischer Priester, führte nach der Zerstörung des babylonischen Reiches durch Kyros (6. Jh. v. u. Z.) die Juden nach Palästina zurück. Beschrieben wird dieses Ereignis in der Bibel (Altes Testament/Das Buch Esra). 190 Vgl. Anm. (Texte) 3.
325
191 Aristides von Milet verfaßte die Milesiaka (Geschichten aus Milet), eine Sammlung erotischer Novellen in sieben Büchern, um 100 v. u. Z. 192 Vgl. Anm. (Texte) 119. 193 Antonios Diogenes (1. Jh. u. Z.) ist Autor des Reiseromans Wunder jenseits von Thüle oder Die Liebe von Dimas und Dercyllis, den der französische Schriftsteller Lesueur 1745 unter dem Titel Dinias et Dercillide in einer adaptierten Fassung herausbrachte. 194 Vgl. Anm. (Texte) 3. 195 Vgl. Anm. (Texte) 129. 196 Vgl. Anm. (Texte) 3. 197 Verfasser dieses griechischen Romans ist der Byzantiner Eumathios Makrembolites (12. Jh.). Das Buch wurde 1559 ins Französische übersetzt und hat d'Urfé bei der Abfassung der Astrée vorgelegen. 198 Vgl. Anm. (Texte) 123. 199 Marcus Terentius Varro (116-27 v. u. Z.), römischer Gelehrter und Schriftsteller, verspottete in den Menippeiscben Satiren Sittenverderbnis und Aberglauben seiner Zeit. 200 Barden hießen die Dichter und Heldensänger bei den Völkern keltischer Abstammung (Gallier, Bretonen, Irländer, Schotten). - Der griechische Satiriker Lukian (120-180 u. Z.) - vgl. auch Anm. (Texte) 96 - kam auf seinen Reisen an die Atlantikküste Galliens mit ihnen in Berührung. 201 Vgl. Anm. (Texte) 5. 202 Der bretonische Sagenstoff um den König Artus und seine Tafeirunde wurde in den mittelalterlichen Romanen in vielfältiger Weise verarbeitet. Chrétien de Troyes (um 1130-1190) hat in Lancelot ou Le conte de la charrette (Lancelot oder Der Karrenritter) und Perceval ou Le conte du Craal (Parceval oder die Graissage) den Artusstoff mit Elementen der provenzalischen Minnelyrik verschmolzen und damit den französischen höfischen Roman geschaffen. 203 Troubadours waren höfische Dichter und Sänger im Mittelalter in Südfrankreich, die an den Fürstenhöfen ihre in provenzalischer Sprache abgefaßten Dichtungen vortrugen, vergleichbar den Minnesängern in Deutschland. 204 Im Gegensatz zu den höfischen Dichtungen der Troubadours waren die Fabliaux schwankhaft-realistische Verserzählungen, die ihre Stoffe zumeist aus der mündlichen Völksüberlieferung schöpften. 205 Der französische König Hugo Capet, der erste in der Reihe des Herrschergeschlechts der Kapetinger, regierte von 987 bis 996. 206 Der französische Literaturkritiker Jean François de La Harpe (1739-1803) äußerte sich zu dieser Frage in seinen Literaturvorlesungen Lycée, ou Cours de littérature ancienne et moderne (Paris 1827, Bd. 5, S. 27 ff.). 207 Sade irrt, wenn er die hier genannten berühmten italienischen Dichter auf das Vorbild der Troubadours festzulegen versucht. Ebensowenig sind Boccaccios großartige Renaissancenovellen, die er im Decamerone (1348/ 53) zusammengefaßt hat, durch die Fabliaux zu erklären.
326
208 Vgl. Anm. (Texte) 10. 209 Vgl. Anm. (Texte) 11, 13, 143. 210 Vgl. dazu Anm. (Texte) 92 und 70. - Saint-Evremond (1616-1703), der mit seiner freigeistig-skeptizistischen Gesinnung, seinem Eintreten für religiöse Toleranz und seiner Fortschrittsüberzeugung zu den unmittelbaren Vorläufern der Aufklärung zählt, war zugleich einer der scharfsinnigsten Literaturkritiker seiner Zeit. 211 Vgl. Anm. (Texte) 13. 212 Vgl. Anm. (Texte) 146. 213 La Rochefoucauld (1613-1680) z e i c h n e sich durch feine psychologische Beobachtungsgabe und tiefdringende Menschenkenntnis aus, die ihren Niederschlag in seinen Réflexions ou sentences et maximes morales (1699; Betrachtungen oder moralische Sentenzen und Maximen) fanden. (Vgl. auch Anm. (Texte) 55.) Mit Madame de La Fayette war er eng befreundet, hatte aber nach ihren eigenen Angaben ebensowenig wie der Dichter Segrais (1625-1701) nennenswerten Anteil an der Abfassung ihres Romans La Princesse de Cleves. (Vgl. auch Anm. (Texte) 16.) 214 Vgl. Anm. (Texte) 4. 215 Jeanne-Marie Bouvier de la Motte-Guyon (1648-1717) suchte mit schwärmerischem Einsatz in Frankreich den Quietismus zu verbreiten, eine aus Spanien stammende religiöse Lehre, die die direkte Kommunikation mit Gott durch mystische Versenkung propagierte. Einfluß erlangte sie u. a. auf Madame de Maintenon, die Frau Ludwigs XTV., ebenso auf Fénelon. In dem folgenden Quietismusstreit, der durch die heftigen Gegenreaktionen der offiziellen Kirche mit ihrem Sprecher Bossuet ausgelöst wurde, verfocht Fénelon ihre Sache. Als der Papst dessen Schrift Explications des Maximes des Saints (1697; Erläuterungen zu den Maximen der Heiligen) als häretisch verurteilte, mußte et sich schließlich unterwerfen. Madame de Guyon wurde ins Kloster geschickt. 216 Vgl. Anm. (Texte) 25. 217 Scarron lernte die Schauspielertruppe, deren Abenteuer er in seinem Roman beschrieb, in Le Mans kennen. 218 Madeleine-Angélique de Gomez (1684-1770) war die Tochter des Schauspielers Paul Poisson (gest. 1690). Sie zählt zu den bedeutendsten Verfassern von Novellen in der ersten Hälfte des 18. Jh.: Les journées amusantes (1723 ff., in 8 Bänden) sind in der Art der Novellensammlung L'Heptaméron von Marguerite de Navarre (1558/59) verfaßt. Hauptwerk sind die Cent Nouvelles nouvelles (1735, in 8 Bänden). 219 Madame de Lussan: vgl. Anm. (Texte) 18. - Claudine-Alexandririe Guérin de Tencin (1682-1749) verfaßte Romane mit meist unglücklichem Ausgang. In ihrer psychologischen Analyse verfuhr sie ähnlich wie Marivaux und Prévost. Zu ihren bekanntesten Romanen zählen die Mémoires du comte de Comminge (1735). - Françoise d'Issembourg d'Happoncourt de Graffigny wurde durch ihren Roman Lettrés d'une Péruvienne (1747;
m
Briefe einer Peruanerin) berühmt. Die nach Europa entführte Romanheldin Zilia beschreibt darin - ähnlich den Persern in Montesquieus Lettrés persanes - ihre Eindrücke vom Leben und von den Sitten in Frankreich, die dadurch in einer satirisch-kritischen Perspektive gezeigt werden. - AnneLouise Dumesnil-Molin, Madame Elie de Beaumont, ist Verfasserin des Briefromans Lettres du Marquis de Roselle (1764), der viele verwandte Züge mit Rousseaus Nouvelle Héloise aufweist. — Marie-Jeanne Laboras de Mézières Riccoboni (1714-1792) zählt zu den bedeutendsten Romanschriftstellerinnen des 18. Jhs. Ihre Romane in Briefform hat sie nach englischem Vorbild abgefaßt. Einer ihrer bekanntesten ist Lettres de Mylady Juliette Catesby à Lady Henriette Campley, son amie (1759; Briefe von Juliette Catesby an ihre Freundin Henriette Campley). Vernunft und Gefühl im richtigen Gleichgewicht zu halten gilt ihr als ideale Verhaltensnorm, auf die sie mit ihren Romanen orientieren möchte. 220 Ninon de Lendos (1620-1705), die sich durch Geist und Schönheit auszeichnete und ein ungebundenes Leben führte, zog bedeutende Zeitgenossen wie Scarron, Molière, La Rochefoucauld u. a. in ihren Salon. Marion Delorme (1613-1650), berühmte Kurtisane, die mit dem 1742 hingerichteten Günstling Ludwigs XIII. und Verschwörer gegen Richelieu, Cinq-Mars, liiert war. - Der Marquis Henri de Sévigné (1624-1651) war der Mann der berühmten Briefautorin Madame de Sévigné (1626-1696). Durch sein ausschweifendes Leben und durch seine Liaison mit Ninon de Lenclos hatte er von sich reden gemacht. - Charles-Auguste de La Fare (1644-1712) und Guillaume Amfrye de Chaulieu (1639-1729) huldigten einer epikureischen Lebensauffassung und verfaßten anakreontische Gedichte, die im 18. Jh. in einer gemeinsamen Ausgabe erschienen. - SaintEvremond: vgl. Anm. (Texte) 210. 221 Die griechische Insel Kythera war Hauptstätte des der Liebesgöttin Aphrodite gewidmeten Kults. 222 Vgl. Anm. (Texte) 20. 223 Vgl. Anm. (Texte) 19. 224 Voltaire, mit bürgerlichem Namen François-Marie Arouet (1694-1778), behandelte in seinen als „Contes philosophiques" bezeichneten Romanen und Erzählungen mit Witz und Ironie aktuelle philosophische und politische Fragen, die er durch den Gang der Handlung in seinem Sinne zu entscheiden wußte. Gerade dieses vom Autor selbst wenig geschätzte Genre macht - wie de Sade richtig voraussah - heute vor allem Voltaires literarischen Ruhm aus. 225 Gott des Spotts und der Tadelsucht in der griechischen Mythologie. 226 Marmontels Erziehungsroman Bélisaire (1766) stand in der Tradition von Fénelons Télémaque (Vgl. Anm. (Texte) 4). Er wurde besonders wegen des hier erwähnten 15. Kapitels, in dem er den religiösen Fanatismus anprangerte und für religiöse Toleranz eintrat, von der Sorbonne verurteilt. 227 Vgl. Anm. (Texte) 35, 85.
328
228 Vgl. Anm. (Texte) 59. •229 La Harpe kritisiert in seinen Literaturvorlesungen Lycée, ou Cours de littérature ancienne et moderne (Band 16. Paris 1827, S. 272 ff) Weitschweifigkeit und Vielzahl der Details in Richardsons Romanen. 230 Vgl. Anm. (Texte) 74. 231 Anmerkung de Sades: „Wie viele Tränen vergießt man bei der Lektüre dieses köstlichen Werkes! Wie vortrefflich ist die Natur darin geschildert, wie gut wird die Spannung aufrechterhalten, wie nimmt sie stufenweise zu ! Wie viele bewältigte Schwierigkeiten! Wie viele Philosophen waren notwendig, um zu erreichen, daß man einem gefallenen Mädchen so viel Interesse abgewinnt! Wäre es übertrieben, wenn man zu behaupten wagte, daß dieses Werk als unser bester Roman bezeichnet werden könnte? Hierin erkannte Rousseau, daß eine Heldin trotz Unklugheit und Unbesonnenheit uns noch zu rühren vermochte, und vielleicht hätten wir ohne Manon Lescaut niemals Julie erhalten." 232 Claude-Joseph Dorat (1734-1780) versuchte sich als Dichter in fast allen Gattungen und hinterließ ein umfangreiches Werk, das allerdings kaum Originelles aufweist. Er gehörte zu den Apologeten des Romans, den er selbst nach dem Vorbild der Engländer und Rousseaus u. a. mit Les sacrifices de l'amour ou Lettres de la Vicomtesse de Sénanges et du Chevalier de Versenay (1771 ; Die Opfer der Liebe oder Briefe der Vicomtesse de Senanges und des Chevalier de Versenay) zu praktizieren suchte. Nach dem Zerwürfnis mit Voltaire entfremdete er sich immer mehr von den „Philosophes". 233 De Sade hat hier Mariveaux' preziöse Ausdrucksweise, den sogenannten „marivardage", im Auge. Vgl. Anm. (Texte) 19. 234 Vgl. Anm. (Texte) 20. 235 Gemeint ist Stanislas-Jean de Bouffiers (1738-1815), der mit seiner pikant-erotischen Erzählung La Reine de Golconde (1761) im 18. Jahrhundert großen Erfolg hatte. Sie handelt vom abenteuerlichen Schicksal des Bauernmädchens Aline, das eines unverschuldeten Fehltritts wegen das Elternhaus verlassen mußte und über etliche Stationen käuflicher und auch erzwungener Liebe in verschiedenen Regionen der Welt zur Königin eines Staates in Indien aufstieg. Eingedenk ihrer einfachen Herkunft wurde sie eine humane Herrscherin, für die auch auf dem Höhepunkt ihrer Macht die ländliche Idylle ihrer Jugend Gegenstand ihrer Sehnsucht und Bedingung individueller Glückserfüllung blieb. Bouffiers, ein den Aufklärungsideen aufgeschlossener französischer Offizier und Diplomat, Mitglied mehrerer Akademien, schloß sich 1789 der Revolution an, emigrierte 1791 nach Preußen und wurde schließlich ein eifriger Parteigänger Napoleons, nachdem dieser ihm 1800 die Rückkehr nach Frankreich ermöglicht hatte. - Mit „Held und Retter Frankreichs" ist Napoleon gemeint. „Glücklicher als Ovid" ist Bouffiers insofern, als er nicht wie jener römische Dichter auf Lebenszeit verbannt blieb. Trotz der hier deutlichen
329
Huldigung an die Adresse Napoleons wurde de Sade bald darauf - 1801 verhaftet und verbrachte den Rest seines Lebens im Gefängnis bzw. im Irrenhaus. 236 Franjois-Thomas-Marie de Baculard d'Arnaud (1718-1805), der auf Voltaires Empfehlung einige Zeit am Hofe Friedrichs II. in Potsdam weilte, behandelte in seinen Dramen und Novellen vor allem schaudererregende und blutrünstige Stoffe. Er gilt daher als Begründer des „genre sombre", der „dunklen Gattung", der er zu großem Erfolg verhalf. 237 Gemeint ist Nicolas-Edme Rétif de La Bretonne (1734-1806), der wohl fruchtbarste Schriftsteller der französischen Literatur überhaupt. Sein Werk, in der Mehrzahl Romane und Erzählungen, beläuft sich auf fast zweihundert Bände, die er als gelernter Buchdrucker teilweise ohne vorheriges Manuskript gesetzt haben soll. In Romanen wie Le paysan pervertí ou les dangers de la ville (1776; Der verdorbene Bauer oder Die Gefabren der Stadt) oder La paysanne pervertie (1776; Die verdorbene Bäuerin) geißelte er im Sinne Rousseaus die in den Städten herrschende Sittenverderbnis in den gräßlichsten Farben und gestaltete die einfache ländliche Idylle als einzige Alternative. Der ungeschminkten Wirklichkeitsgestaltung bis hinein in das Milieu der Deklassierten und Verbrecher verdankt er den ihm von Grimm erteilten Beinamen eines „Rousseau der Gosse". 238 Ann Radcliffe (1764-1823) zählt neben Horace Walpole (1717-1797) zu den Hauptautoren des englischen Schauerromans, der in Frankreich in zahlreichen Übersetzungen Verbreitung fand. - Der berühmte Schauerroman Ambrosio, or the Monk (1795; Ambrosio oder Der Möncb) stammt von dem Engländer Mathew Gregory Lewis (1775-1818) und wurde 1797 ins Französische übersetzt. 239 Die römischen Kaiser Antoninus Pius (86-161), Marcus Aurelius Antoninus (121-180) und Titus Flavius Vespasianus (9-79) galten als weise und gerechte Herrscher. 240 Der byzantinische Kaiser Andronikos I. (1163-1185) und sein Nachfolger gleichen Namens herrschte mit Grausamkeit und Verschlagenheit. - Der römische Kaiser Nero (54-68) ist besonders durch seine grausamen Christenverfolgungen unrühmlich bekannt. 241 Die Auslassung betrifft Bemerkungen de Sades zu den Quellen für seine Novellen, denen diese Abhandlung als Einleitung Vorangestellt wurde. 242 De Sades Roman Aline et Valcour erschien 1795. 243 De Sade meint hier seinen Roman Justine ou les malbeurs de la vertu (1791; Justine oder die Unglücksfälle der Tugend), den verfaßt zu haben er bestritt. Überhaupt hat er sich als Autor nur zu zwei Romanen bekannt, nämlich Aline et Valcour (1795) und Les crimes de l'amour (1800; Die Verbrechen der Liebe). 244 Szene aus Vergils Aeneis (erstes Buih, Vers 712-719). 245 Bezug auf Homers ¡lias.
330
246 Szene aus Horners llias (24. Gesang). 247 Dante Alighieri (1265-1321) schilderte in seiner meisterhaften Dichtung Divina commedia (1472; Göttliche Komödie), wie der Mensch durch die Hölle (inferno) und über den Läuterungsberg (purgatorio) zur göttlichen Seligkeit (paradiso) gelangt. 248 Madame de Stael meint damit die blutigen Ereignisse besonders unter der sogenannten „Schreckensherrschaft" (1793-1794) in der Französischen Revolution, als die Jakobiner unter dem Druck der militärischen Bedrohung von außen und der inneren Reaktion zu Terrormaßnahmen greifen mußten, um die Revolution zu retten. 249 John Milton (1608-1674), der mit Paradise Lost (1667; Das verlorene Paradies) das bedeutendste englische Epos schuf, symbolisiert dort im Kampf der himmlischen und satanischen Heere die Auseinandersetzung des puritanischen Bürgertums mit dem Despotismus. 250 Gestalten aus Torquato Tassos Epos La Gerusalemme liberata (1581; Das befreite Jerusalem). 251 Wörtliche Übersetzung des französischen Wortes „machine", mit dem hier das mythologische Beiwerk, die Ränke der Götter als schicksalsbestimmende Faktoren im Leben der Menschen, gemeint ist. 252 Vgl. Anm. (Texte) 111. 253 Vgl. Anm. (Texte) 21. 254 Hauptgestalten in Molieres Komödien Le Tartuffe (1664) und Le Misantbrope (1666). Vgl. auch Anm. (Texte) 103. 255 Vgl. Anm. (Texte) 4. 256 Voltaires Verserzählung Tbettme et Macare erschien 1762, 257 Das allegorische Epos The Faerie Queene (1590/96; Die Feenkönigin) ist das Hauptwerk des englischen Renaissancedichters Edmund Spenser (um 1552-1599). 258 Der französische Fabeldichter Jean de La Fontaine (1621-1695) war Zeitgenosse Molieres, Racines und Boileaüs. 259 Das komische Heldenepos Hudibras (1663) von dem Engländer Samuel Butler (1612-1680) richtete seinen Spott gegen die Puritaner. 260 Jean-Baptiste Massillon (1663-1742), berühmt als wortgewaltiger Kanzelredner, war seit 1704 Hofprediger Ludwigs XIV. Voltaire zitierte ihn als Beispiel für eindrucksvolle Beredsamkeit. 261 Zitat aus Pierre Corneilles Tragödie Horace (1640; Die Horatier), 3. Akt, 6. Szene. 262 In L'Esprit des lois (1748; Geist der Gesetze), 5. Buch, Kapitel 13. 263 Vgl. Anm. (Texte) 180. 264 Vgl. Anm. (Texte) 33. 265 Voltaires philosophische Erzählung Micromegas (1752). 266 Hinweis auf die Regel von der Einheit der Zeit, die neben den Einheiten des Ortes und der Handlung für das klassische Theater als verbindlich galt.
331
267 Das Versepos La Henriade (1728) und die Tragödie L'Orphelin de' la Chine (1755 ; Die Waise Dort China), in der Dschingis-Chan („Gengiskan") eine Rolle spielt, sowie die Tragödie Tancrède (1760) stammen von Voltaire, die Tragödie Mitbridate (1673) von Jean Racine. 268 Marguerite de Lussan verfaßte die Anecdotes de la cour de Philippe-Auguste (6 Bände, 1733-1738). 269 Diese „contes philosophiques" Voltaires erschienen 1759, 1747 und 1749. 270 Vgl. Anm. (Texte) 180. 271 Tacitus berichtet in seinen Annalen (2. Buch, Kap. 72) vom Tod des populären Feldherrn Gaius Julius Caesar Germanicus (15 v. u. Z. - 19 u. Z.)> der angeblich im Auftrag des Kaisers Tiberius (42 v. u. Z. - 37 u. Z.) ermordet wurde. 272 Vgl. Anm. (Texte) 85. 273 In dem Roman Caleb Williams, or Things as Tbey Are (1794 ; Caleb Williams oder Wie die Dinge sind) griff der englische Schriftsteller William Godwin (1756-1836), der ein begeisterter Anhänger der Ideen der Aufklärung und der Französischen Revolution war, das aktuelle politische Thema der Verfolgung eines Unschuldigen durch die Gesetzesvertreter auf. 274 Marmontels Contes moraux (1761; Moralische Erzählungen) hatten nicht nur einen großen Publikumserfolg zu verzeichnen, sondern blieben Vorbild für die Kurzerzählung bis zum Ende des Jahrhunderts. - Weiter werden hier genannt: A Sentimental ]ourney Tbrougb France and ltaly by Mr. Lörick (1768; Eine empfindsame Reise durch Frankreich und Italien von Mr. Yorick) von Lawrence Sterne (1713-1768) und die englische moralische Wochenschrift The Spectator (1711/12; Der Zuschauer), die von Addison und Steele herausgegeben wurde. 275 Lovelace ist der Verführer Clarissas in Richardsons gleichnamigem Roman. 276 Clementine ist die weibliche Hauptgestalt aus Richardsons Roman Sir Charles Grandison (1754). Sie glaubt sich verpflichtet, wegen ihrer katholischen Religion auf den Geliebten verzichten zu müssen. 277 La Princesse de Cleves, Roman von Madame de La Fayette. Vgl. Anm. (Texte) 146. - Mémoires du Comte de Comminge, Roman von Madame de Tencin. Vgl. Anm. (Texte) 219. - Cécilie et Calliste, ou Lettres écrites de Lausanne (1786; Cécilie und Calliste oder Briefe aus Lausanne), Roman der Schriftstellerin Isabelle-Agnès-Elisabeth de Saint-Hyacinthe de Charrière (1740-1805). - Caroline et Julie (1780) und Camille, ou Lettres de deux filles (1785; Camille oder Briefe von zwei Töchtern) sind Romane der Madame Riccoboni. Vgl. dazu Anm. (Texte) 219. 278 Madame de Staël meint damit die Jakobiner in der Französischen Revolution. Wie den überlebenden Aufklärern und der Mehrzahl der anderen fortschrittlich gesinnten Zeitgenossen aus dem Bürgertum blieb ihr die Einsicht in die historische Bedeutung der Jakobinerdiktatur versagt. 279 Gemeint sind damit die großen Liebesgeschichten in der Literatur: Epistle from Eloisa to Abelard (1716; Brief Heloisens an Abälard) von Alexan-
332
der Pope (1688-1744); Die Leiden des jungen Wertbers (1774) von Johann Wolfgang Goethe; Lettres portugaises (1669) von dem französischen Schriftsteller und Diplomaten Gabriel-Joseph de Lavergne, Comte de Guilleragues (1628-1685), die lange Zeit als authentische Briefe einer portugiesischen Nonne an ihren Geliebten, einen französischen Offizier, galten; Julie ou La Nouvelle Helotse (1761) von Jean-Jacques Rousseau.
Wir danken dem Aufbau-Verlag, Berlin - Weimar, für die Genehmigung zum Abdruck folgender Texte: Diderot, Lobrede auf Richardson. Übersetzt von Friedrich Bassenge und Theodor Lücke. Aus: Diderot, Ästhetische Schriften. Bd. 1. Berlin - Weimar 1967. Madame de Stael, Versuch über die Dichtungen. Übersetzt von J. W. Goethe. Aus: Goethe, Berliner Ausgabe, Bd. 22. Kunsttheoretische Schriften und Übersetzungen. Berlin - Weimar 1978.
Rousseaus „Vorwort zu Julie' oder Gespräch über die Romane" wurde der deutschen Ausgabe von Rousseaus Roman „Julie oder Die neue Heloise", übersetzt von H. Denhardt, Bd. 1, Leipzig o. J. (RUB Nr. 1359-1364), entnommen. Für die Abdruckgenehmigung danken wir dem Reclam-Verlag.
Personenregister
Achilleus Tatios 307 Adam, Antoine 17 Addison, Joseph 332 Agesilaos II. König v. Sparta 233 324 Aguesseau, Henri-François d' 29 Alban!, Francesco 187 315 Alembert, Jean Le Rond d' 132 200 303 311 Alexander der Große 245 Amyot, Jacques 122 307 Andronikos I. 258 330 Antoninus Pius 206 258 318 330 Antonios Diogenes 245 326 Apuleius 205 245 318 Argens, Jean-Baptiste de Boyer d' 30 310 Marx-Antoine-René de Argenson, Voyer d', Marquis de Paulmy 71 Ariosto, Ludovico 35 37 67 203 210 266 317 Aristides v. Milet 236 245 324 326 Aristophanes 318 319 Aristoteles 18 33 73 85 96 99 109 122 251 Arnaud, François-Thomas-Marie de Baculard d' 83 253 330 Astarbus 238 Astyages v. Medien 232 324 Athenaios 307 August der Starke 212 320 Augustinus Aurelius 322 Augustus (Gajus Julius Cäsar Octavianus) 207 317 319 Aumont, Herzog v. 200
334
Balzac, Honoré de 9 10 94 102 Barclay, John 126 310 Barthe, Nicolas-Thomas 11 68-69 70 75 175 Bassenge, Friedrich 158 Bastide, Jean-François de 71 Bayard, Piere du Terrail de 211 319 Bayle, Pierre 28 97 Béliard, François 74 104-105 Benoît de Sainte-More 308 Blanckenburg, Friedrich v. 46-48 63 64 65 66 95 106-107 Boccaccio, Giovanni 246 247 326 Boiardo, Matteo Maria, Graf v. Scandiano 315 317 Boileau-Despréaux, Nicolas 15 17 18 29 124 126 309 331 Bossuet, Jacques-Bénigne 327 Bouffiers, Stanislas-Jean de 253 329 Bourgogne, Herzog v. 308 Bricaire de La Dixmerie, Nicolas 41 Brutus Marcus Junius 236 324 Buffon, Georges-Louis Leclerc de 43 249 Burney, Fanny (eigtl. Frances) 115 196 Butler, Samuel 269 331 Caillot, Joseph 78 Cäsar Gajus Julius 234 324 Catilina Lucius Sergius 236 324 Cervantes Saavedra, Miguel de 67 70-71 123 143 215 247 290 308 315
Chapelain, Jean 320 Chares 213 320 Chardin, Jean-Baptiste-Siméon 185 315 Charrière, Isabelle-Agnès-Elisabeth de 332 Charron, Pierre 76 159 299 312 Chasles, Robert 41 Chateaubriand, François-René Vicomte de 85 Chaulieu, Guillaume Amfrye de 249 328 Chauvelin, Germain-Louis de 28 Choderlos de Laclos, Pierre-AmbroiseFrançois 7 11 24 94 101 115 116 196 Chouillet, Jacques 305 Chrétien de Troyes 326 Cicero Marcus Tullius 125 324 Cinq-Mars 328 Condé, Louis II de Bourbon, prince de 322 Congreve, William 95 Coriolanus Marcius 212 319 Corneille, Pierre 15 105 179 331 Cotta v. Cottendorf, Johann Friedrich Freiherr 261 Coulet, Henri 10 Courths-Mahler, Hedwig 57 Courtilz de Sandras, Gatien de 21 Crébillon, Claude-Prosper Jolyot de 27 30 54 82 94 105 126 250 253 259 309 314 322 Cromwell, Oliver 184 236 314 325
Dähnert, Johann Cari 63 Dante, Alighieri 246 265 331 Delorme, Marion 249 328 Demokritos v. Abdera 317 Demosthenes 125 Denhardt, H. 134 Desfontaines, Pierre-François Guyot 26 108 Desmaison s 128 310
Desmarets de Saint-Sorlin, Jean 124 247 309 320 Desné, Roland 284 Diderot, Denis 7 11 18 34 43 44 bis 45 50 54 56 57-59 60 61 62 65 67 71 76-77 79-80 81-82 84 86 91 95 96 98-99 109 110-111 113 114-115 118 132 158 192 200 252 294 303 305 310 311 312 313 Diodor 238 325 Dorât, Caude-Joseph 100 117 118 253 259 329 Dow, Gérard 220 323 Duclos, Charles Pinot 316 Du Deffand, Marie de Vichy-Chamrond 61 314 Du Fresny, Charles Rivière 175 Du Marsaii, César Chesneau 30 128 310 Du Plaisir 41 Elias, Norbert 291 Elie de Beaumont, Anne-Louise Dumesnil-Molin 78 111 249 328 Engels, Friedrich 53 102 Epameinondas 211 319 Epikuros 128 317 Épinay, Louise-Florence-Pétronille Tardieu d'Esclavelles d* 132 313 Euripides 162 206 318 Fabre, Jean 295 Féneion, François de Salignac de la Mothe 24 33 47 71 97 102 103 122 248 268 308 327 328 Feuerbach, Ludwig 53 Fielding, Henry 40 47 51 54 65 66 75 185 228 251 273 278 310 314 Fleury, Claude 122 308 Fontenelle, Bernard Le Bovier de 41 291 313 Franz I. 211 236 319 325 Fréron, Elie-Cathérine 37 105 113 Friedrich II. 330 Furetière, Antoine 26 71
335
Galland, Antoine 20 313 Garve, Christian 63 64 65 Geliert, Christian Fürchtegott 63 Germanicus, Gajus Julius Cäsar 332 Godwin, William 278 332 Goethe, Johann Wolfgang 48 66 108 192 261 333 Gomberville, Marin Le Roy de 17 71 124 247 308 309 Gomez, Madeleine-Angélique de 249 327 Graffigny, Françoise d'Issembourg d'Happoncourt de 249 327 Granet, François 29 Green, Frederick Charles 9 Greiner, Walter F. 95 Grimm, Friedrich Melchior 5 4 - 5 5 56 70 77-78 98 108 330 Guilleragues, Gabriel-Joseph de Lavergne de 24 333 Gyon, Jeanne-Marie Bouvier de La Motte 248 327 Habermas, Jürgen 56 Hadrian Publius Aelius 316 Hamilton, Antoine 126 219 310 322 Hannibal 212 320 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich 53 117 Heine, Maurice 242 Heinrich IV. 17 123 236 325 Heliodor 18 70 122 206 245 308 313 Helvétius, Claude-Adrien 40 43 Herder, Johann Gottfried 64 65 108 Herodot 65 232 238 247 323 325 Hiller, Johann Adam 121 Hobbes, Thomas 51 Hofer, Hermann 118 Holbach, Paul Thiry d' 132 312 Homer 35 36 37 65 103 162 173 202 203 204 205 206 214 264 313 318 319 320 325 330 331 Honorius 206 318 Horaz 18 202 220 270 317
336
Huet, Pierre-Daniel 1 5 - 2 1 23 29 31 32 35 36 95 96 98 102^103 105 bis 106 124 126 205 206 244 307 309 310 318 Hugo Capet 246 326 Humboldt, Wilhelm v. 261 Hume, David 312 Imbert, Barthélémy 113 Irailh, Simon-Augustin 11 12 28 29 bis 32 33 82 121 Jamblichos 245 307 Jaquin, Abbé 98 104 310 Jaucourt, Louis de 33 35 74 Jauß, Hans Robert 68 80 95 96 Juvenal, Decimus Junius 194 219 316 Kambyses II. 234 324 Karl der Große 122 203 207 210 212 246 319 Karl I. ¿14 Karl XII. 212 320 Katharina II. 71 Klearchos 122 307 Kratinos 206 318 Krauss, Werner 9 31 38 51 93 313 Kyaxares 234 324 Kyros der Ältere 208 232 234 238 319 323 324 325 La Bruyère, Jean de 218 322 La Calprenède, Gauthier de Coste de 17 71 124 213 214 215 247 308 La Fare, Charles Auguste de 249 328 Lafargue, Paul 85 La Fayette, Marie-Madeleine Pioche de la Vergne de 16 18 21 45 123 216 242 248 308 321 327 332 La Fontaine, Jean de 66 128 239 269 325 331 La Harpe, Jean-François de 61 114 bis 115 175 246 252 326 329
La
Morlière, Charles-Jacques-LouisAuguste Rochette de 112 La Rochefoucauld, François, prince de Marcillac, duc de 76 159 248 299 312 327 328 Laufer, Roger 241 Law, John 321 Legendre, Marie-Charlotte 312 Lenclos, Anne de (genannt Ninon) 249 328
116 126 183 198 219 242 250 251 253 309 317 327 329 Marmontel, Jean-François 11 24 32 bis 40 47 72 73 75 78 83 89 bis 92 118 200-201 250 278 290 295 302 323 328 332 ¿Marx, Karl 42
Lenglet Du Fresnoy, Nicolas 23 30 103 128-129 310 Le Sage, Alain-René 7 9 25 27 41 71 219 248 309 315 Lessing, Gotthold Ephraim 63 Lesueur 245 Lewis, Mathew Gregory 85 330 Lichtenberg, Georg Christoph 63 Locke, John 27 Longos 70 206 245 307 Louvois, Michel Le Tellier, marquis de 238 325 Lücke, Theodor 158 Ludwig XL 236 325 Ludwig XII. 236 325 Ludwig XIII. 328 Ludwig X1Y. 15 238 308 321 322 325 327 331 Ludwig XV. 321 Ludwig XVI. 260 Lukian 65 97 124 189 205 219 246 316 326 Lukrez 76 202 317 Lussan, Marguerite de 126 249 309 327 332 Lykurg 238 325
Massillon, Jean-Baptiste 270 331 Mattauch, Hans 291 Maupertuis, Pierre-Louis Moreau de 314 May, Georges 8 9 28 Menander 206 318 Marcus Aurelius Antoninus 206 318 330 Mercier, Louis-Sébastien 11 18 34 bis 35 46 60 7 6 - 7 7 8 3 - 8 4 88 100 101 111 118 192-193 289 316 Miltiades 211 236 319 324 Milton, John 249 331 Mistelet 45 111 Molière (eigtl. Jean-Baptiste Poquelin) 15 26 114 116 185 187 198 215 219 315 317 321 325 328 331 Montaigne, Michel Eyquem de 76 159 299 312 Montesquieu, Charles-Louis de Secondât, Baron de la Brède et de 7 24 27 28 270 328 Moritz v. Sachsen 212 320 Mornet, Daniel 8 134 Morus, Thomas 316 Morvan de Bellegarde, Jean-Baptiste 22 23 Mouhy, Charles de Fieux de 30 31 128-129 310
Machiavelli, Niccolò 236 324 Maintenon, Françoise d'Aubigné de 327 Manlius Capitolinus 212 319 Marcellus 212 320 Marguerite de Navarre 327 Marivaux, Pierre Carlet de Chamblain de 9 26 27 30 31 41 104
Napoleon I. Bonaparte 192 241 260 329 330 Naumann, Manfred 9 119 Necker, Jacques 260 Nero 206 258 318 330' Neumeister, Erdmann 291 Newton, Isaac 27 184 314 Nicole, Pierre 76 159 299 312
22
Geißler, Romantheorie
337
Ovid
204 253 318 329
Pascal, Biaise 219 322 Pater, Jean-Baptiste Joseph 185 315 Paulmy (siehe Argenson, d') Pavillon, Etienne 291 Peter I. 212 320 Pétis de la Croix, François 20 Petrarca, Francesco 246 Petronius Arbiter 206 246 318 Philipp II. v. Mazedonien 320 Philipp v. Orléans 122 320 Phokion 236 324 Piaton 18 44 65 128 185 Plautus Titus Maccius 26 Plutarch 18 185 308 Poirier, Roger 71 Poisson, Paul 249 327 Pompadour, Marquise de 309 Pope, Alexander 281 333 Porée, le P. Charles 26 2 7 - 2 8 29 33 125 126 Prévost d'Exilés, Antoine-François 7 9 27 30 31 41 51 54 62 84 89 90 97 104 108 158 220 225 228 242 252 253 310 312 313 314 323 327 Pjrrhus 212 320 Quintilian
18
Rabelais, François 218 322 Racine, Jean 15 18 105 178 179 313 325 331 332 Radcliffe, Ann 85 253-254 330 Raffael 187 315 Raynal, Guillaume-Thomas-François 121 Regnard, Jean-François 26 Rembrandt 323 Rétif de La Bretonne, Nicolas-Edme 34 5 9 - 6 0 6 1 - 6 2 83 253 256 330 Rey, Marc Michel 70 133 Riccoboni, Marie-Jeanne Laboras de Mézières 249 279 323 328 332 Richardson, Samuel 40 44 45 47 51
338
53 54 5 7 - 5 9 61 62 65 67 76 81 99 104 111 113 114 115 129 158 159-174 184 185 186 196 201 226 230 251 252 273 278 299 300 305 310 312 314 323 329 332 Richelieu, Armand-Jean du Plessis, Herzog v. 328 Rivet de la Grange, Antoine 122 308 Romance de Mesmon, Germain Hyacinthe de 4 9 - 5 0 51 Rousseau, Jean-Jacques 11 24 30 34 43 4 5 - 4 6 48 4 9 - 5 0 51 54 56-57 60 72 74 75 79 84 86 88 89 91 100 108 118 132-134 153 192 196 201 219 228 242 250 298 310 311 312 322 323 329 333 Sabatier de Castres, Antoine 33 88 Donatien-Alphonse-François, Sade, Marquis de 11 51 5 2 - 5 3 61 62 63 72 84 85 86 9 2 - 9 4 101 240 bis 242 295 325 326 329 330 Saint-Évremond, Charles de Marguetel de Saint-Denys de 179 248 249 313 327 328 Saint-Pierre, Charles-Irénée Castel de 233 324 Scarron, Paul 71 127 248 249 310 327 328 Schiller, Friedrich 261 Schlegel, August Wilhelm 260 Schlegel, Friedrich 53 6 5 - 6 7 108 Scipio 208 319 Scudéry, Georges de 247 308 320 Scudéry, Madeleine de 17 21 71 124 126 213 214 215 247 308 309 313 320 Segrais, Jean-Regnauld de 16 123 126 248 308 309 327 Seianus, Lucius Aelius 238 325 Sévigné, Henride 328 Sévigné, Marie de Rabutin-Chantal, Marquise de 79 249 328 Shaftesbury, Anthony Ashley Cooper, Third Earl of 80
Shakespeare, William Sokrates
67
234 236 324
Sophokles
162 202 206
Spenser, Edmund Stael-Holstein,
11 4 8 60 62 66
Urfé, Honoré d'
16 18 71 123 215
247 248 308 311 313 Varro, Marcus Terentius
Stendhal (eigtl. Henri Beyle)
94 119
Vergil (P. Vergilius Maro)
315 214 264
320 330
65 67 332
Sulla, Lucius Cornelius
212 236 320
324
Villedieu, Marie-Catherine Desjardins, Madame de
Swift, Jonathan
246 326
Vega Carpio, Félix de Lope
332
Sterne, Lawrence
102
92
1 1 6 - 1 1 7 118 2 6 0 - 2 6 1 331 Steele, Richard
122 2 4 6 308
Tynjanov, J . N. 317
268 331
Anne-Louise-Germaine
Necker de
Turpin v. Reims
126 309
Voisenon, Claude-Henri de Fusée de
310
314 238
Volland, Sophie (eigtl. Louise-Henri-
35 37 203 204 210
Voltaire (eigtl. François-Marie Arouet)
Tacitus, Publius Cornelius
236
ette)
2 7 0 275 324 332 Tasso, Torquato
7 23 24 34 43 61 71 7 7 - 7 8 9 8 99
246 317 331 Tencin, Claudine-Alexandrine de
Terentius Afer Publius Terrasson, Jean Theseus
Vofikamp, Wilhelm
95 96 289 303
211 319 324 Wahrenburg, Fritz Walpole, Horace
291
Tiberius, Claudius Nero
238 325 332
291 330
Watteau, Jean-Antoine
315
Wieland, Christoph Martin
234 324
Titus Flavius Vespasianus Trajan
328 330 331 332
26
207
Tigranes
1 0 3 - 1 0 4 105 121 179 189 192 200 201 220 2 5 0 310 313 314 316 323
24
Thomasius, Christian
Tomyris
Guerin
27 249 327 332
Themistokles
312 313
47 106
258 330
232 324 316
Xenophon
71 2 3 2 - 2 3 3 234 238 245
319 324
Turenne, Henri de La Tour d'Auvergne de
212 320
Zola, Emile
10
339
Berichtigung S. 333 muß ergänzt werden durch: Die Texte von Irailh, Barthe, Mercier, Choderlos de Laclos, Marmontel und de Sade wurden aus dem Französischen übersetzt von Renate Petermann. Auf folgenden Seiten ist richtig Zu lesen: S.
12, 16./17. Zeile v. u. :
Literatur aufgaben
S.
15, 5./6. Zeile v . u . :
bildeten das Gros der Produktion an fiktiver Literatur, sondern . . .
10. Zeile v. u.:
machten diese . . . Gattungen nur einen Teil des literarischen Lebens aus.
S. 30, 12. Zeile v . o . :
Lenglet Du Fresnoy
S. 98, 10. Zeile v . o . :
ideologiekritischen
21./22. Zeile v. o. : S. 113, 3. Zeile v . o . :
dem ersteren
Es gibt keine andere historische Gewißheit,
S. 150, 2. Zeile v. u.:
Strafpredigten
S. 210, 6. Zeile v . o . :
weniger unsinnig
S. 240, 15. Zeile v. o.:
geleugnet
S. 242, 11./12. Zeile v. o. :
bis zu einer Lettre sur les romans
S. 250, 9. Zeile v. o.:
Le Sopba cœur
S. 252, 13. Zeile v. o.:
das der Rcman . . .
S. 289, Anm. 57:
mœurs
S. 290, Anm. 75:
peuple considéré
S. 291, Anm. 80:
höfische Gesellschaft
S. 304, Anm. 279:
qu'on tirait auparavant
S. 308, Anm. 5:
Historia
S. 321, Anm. 144:
seinem . . . Theatererfolg
S. 329, Anm. 233:
marivaudage
S. 334:
Argenson, Marc-Antoine-René de . . .
S. 338:
Sévigné, Henri de
![Texte zur französischen Romantheorie des 19. Jahrhunderts [Reprint 2012 ed.]
9783110924435, 9783484530287](https://ebin.pub/img/200x200/texte-zur-franzsischen-romantheorie-des-19-jahrhunderts-reprint-2012nbsped-9783110924435-9783484530287.jpg)
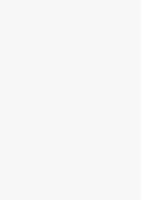


![Gedankenexperimente: Wissenschaft und Roman im Frankreich des 19. Jahrhunderts [Reprint 2017 ed.]
9783110910285, 9783484550322](https://ebin.pub/img/200x200/gedankenexperimente-wissenschaft-und-roman-im-frankreich-des-19-jahrhunderts-reprint-2017nbsped-9783110910285-9783484550322.jpg)

![Repertorium der Sangsprüche und Meisterlieder des 12. bis 18. Jahrhunderts. Band 16 Register zum Katalog der Texte: Namen, Quellen, Bibelstellen, Datumsangaben [Reprint 2010 ed.]
9783110943986, 9783484105164](https://ebin.pub/img/200x200/repertorium-der-sangsprche-und-meisterlieder-des-12-bis-18-jahrhunderts-band-16-register-zum-katalog-der-texte-namen-quellen-bibelstellen-datumsangaben-reprint-2010nbsped-9783110943986-9783484105164.jpg)
![Repertorium der Sangsprüche und Meisterlieder des 12. bis 18. Jahrhunderts. Band 15 Register zum Katalog der Texte: Stichwörter [Reprint 2010 ed.]
9783110943993, 9783484105157](https://ebin.pub/img/200x200/repertorium-der-sangsprche-und-meisterlieder-des-12-bis-18-jahrhunderts-band-15-register-zum-katalog-der-texte-stichwrter-reprint-2010nbsped-9783110943993-9783484105157.jpg)
![Repertorium der Sangsprüche und Meisterlieder des 12. bis 18. Jahrhunderts. Band 14 Register zum Katalog der Texte: Initien [Reprint 2010 ed.]
9783110944006, 9783484105140](https://ebin.pub/img/200x200/repertorium-der-sangsprche-und-meisterlieder-des-12-bis-18-jahrhunderts-band-14-register-zum-katalog-der-texte-initien-reprint-2010nbsped-9783110944006-9783484105140.jpg)
![Der empfindsame Roman in Frankreich, Teil 1: Die Anfänge bis zum Beginne des XVIII. Jahrhunderts [[Mehr nicht ersch.]. Reprint 2019 ed.]
9783111433431, 9783111067872](https://ebin.pub/img/200x200/der-empfindsame-roman-in-frankreich-teil-1-die-anfnge-bis-zum-beginne-des-xviii-jahrhunderts-mehr-nicht-ersch-reprint-2019nbsped-9783111433431-9783111067872.jpg)