Pikarische Erzählverfahren: Zum Roman des 17. und 18. Jahrhunderts 9783110516180, 9783110514711
For the first time, this volume systematically addresses the persistence of picaresque themes as a contoured genre exten
207 85 5MB
German Pages 335 [336] Year 2016
Inhalt
Vorwort
Zur Zitierweise. Abkürzungen
Pikarische Erzählverfahren. Einleitung
Narrative Arbeit am Mythos vom göttlichen Schelm. Quevedos Buscón
Topische Radikalisierung und allegorische Kontrolle des Pikaresken in den frühen deutschsprachigen Adaptationen
Moralische Topologie und Chronotopos. Zu einem Strukturproblem pikarischen Erzählens
Der Goldene Esel des Apuleius und Wolfgang Caspar Printz’ Gueldner Hund. Vorbild und Spielform des Pikaroromans
Alonso de Salas Barbadillos La Hija de Celestina (1612), Paul Scarrons Les Hypocrites (1657) und die Verbreitung pikaresker Bücher über transnationale Formen der Intertextualität
Religionsfreiheit und die Pikareske. Ein Versuch über Niclas Ulenharts History von Isaac Winckelfelder und Jobst von der Schneid
Pikarische Kinder des Glücks. Erzählte Zufälle bei Johann Beer und in einer moralisierenden Fortunatus-Redaktion
Orte des Eigenen, Orte des Anderen. Zur Poetik des Handelns in Johann Beers pikarischen Romanen
‚Frommer Betrug‘ am Leser?. Unterhaltung und Klugheitslehre in Christian Weises Politischem Näscher (1678)
Der homo variegattus und die Diversität der Erfahrung. Johann Georg Schielens Deß Frantzösischen Kriegs- Simplicissimi Hoch-verwunderlicher Lebens-Lauff (1682/83)
Medizinisches Wissen und die Funktion pikaresken Erzählens in Johann Christoph Ettners Medicinischen Maul-Affen-Romanen (1694–1720)
Pikareske Destabilisierungen kolonialer Machtstrukturen. Der Lazarillo de ciegos caminantes (1775) und die Genese des lateinamerikanischen Romans
Register der Eigennamen und Werktitel
Recommend Papers

- Author / Uploaded
- Jan Mohr (editor)
- Carolin Struwe (editor)
- Michael Waltenberger (editor)
File loading please wait...
Citation preview
Pikarische Erzählverfahren
Frühe Neuzeit
Studien und Dokumente zur deutschen Literatur und Kultur im europäischen Kontext Herausgegeben von Achim Aurnhammer, Wilhelm Kühlmann, Jan-Dirk Müller, Martin Mulsow und Friedrich Vollhardt
Band 206
Pikarische Erzählverfahren Zum Roman des 17. und 18. Jahrhunderts Herausgegeben von Jan Mohr, Carolin Struwe und Michael Waltenberger
ISBN 978-3-11-051471-1 e-ISBN (PDF) 978-3-11-051618-0 e-ISBN (EPUB) 978-3-11-051472-8 ISSN 0934-5531 Library of Congress Cataloging-in-Publication Data A CIP catalog record for this book has been applied for at the Library of Congress. Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar. © 2016 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston Druck und Bindung: CPI books GmbH, Leck ♾ Gedruckt auf säurefreiem Papier Printed in Germany www.degruyter.com
Inhalt Jan Mohr / Carolin Struwe / Michael Waltenberger Pikarische Erzählverfahren Einleitung 3 Rainer Warning Narrative Arbeit am Mythos vom göttlichen Schelm Quevedos Buscón 35 Thomas Althaus Topische Radikalisierung und allegorische Kontrolle des Pikaresken in den frühen deutschsprachigen Adaptionen 67 Christian Kirchmeier Moralische Topologie und Chronotopos Zu einem Strukturproblem pikarischen Erzählens
95
Rosmarie Zeller e Der Goldene Esel des Apuleius und Wolfgang Caspar Printz’ Guldener Hund Vorbild und Spielform des Pikaroromans 111 Frank Estelmann Alonso de Salas Barbadillos La Hija de Celestina (1612), Paul Scarrons Les Hypocrites (1657) und die Verbreitung pikaresker Bücher über transnationale Formen der Intertextualität 131 Jan K. Hon Religionsfreiheit und die Pikareske Ein Versuch über Niclas Ulenharts History von Isaac Winckelfelder und Jobst von der Schneid 159 Sebastian Speth Pikarische Kinder des Glücks Erzählte Zufälle bei Johann Beer und in einer moralisierenden Fortunatus-Redaktion 179
VI
Inhalt
Simon Zeisberg Orte des Eigenen, Orte des Anderen Zur Poetik des Handelns in Johann Beers pikarischen Romanen
205
Jörg Krämer ‚Frommer Betrug‘ am Leser? Unterhaltung und Klugheitslehre in Christian Weises Politischem Näscher (1678) 225 Carolin Struwe Der homo variegattus und die Diversität der Erfahrung Johann Georg Schielens Deß Frantzösischen Kriegs-Simplicissimi Hochverwunderlicher Lebens-Lauff (1682/83) 245 Claus-Michael Ort Medizinisches Wissen und die Funktion pikaresken Erzählens in Johann Christoph Ettners Medicinischen Maul-Affen-Romanen (1694–1720) 275 Christian Wehr Pikareske Destabilisierungen kolonialer Machtstrukturen Der Lazarillo de ciegos caminantes (1775) und die Genese des lateinamerikanischen Romans 311
Register der Eigennamen und Werktitel
325
Vorwort Die in diesem Band versammelten Studien gehen zurück auf Vorträge, die auf einer Tagung vom 19. bis 21. September 2012 am Forschungskolleg Humanwissenschaften, Bad Homburg, gehalten wurden. An erster Stelle möchten wir den Beiträgern Dank abstatten für ihre Bereitschaft, sich auf die Probleminteressen der Veranstalter einzulassen, und nicht zuletzt für ihre Geduld mit den Herausgebern. Zu danken haben wir außerdem dem Münchner SFB 573 Pluralisierung und Autorität in der Frühen Neuzeit, der Vereinigung von Freunden und Förderern der Goethe-Universität Frankfurt am Main und der Fritz Thyssen Stiftung für die Finanzierung der Tagung sowie all jenen, die an ihrer Organisation und Durchführung beteiligt waren, besonders Sabine Sänger und dem Team des Bad Homburger Forschungskollegs, außerdem den Herausgebern der Frühen Neuzeit für die Aufnahme des Bandes in ihre Reihe, Anna-Dorit Lachmann für ihre Arbeit am Register sowie Jacob Klingner vom De-Gruyter-Verlag für die Betreuung der Drucklegung. Frankfurt am Main und München im Sommer 2016
Zur Zitierweise Zitate aus alten Drucken werden nicht normalisiert. Aufgelöst wurden lediglich Nasalstriche, Geminationsstriche und Abbreviaturen. Schaft-s ist als Rund-s wiedergegeben; die zwei Formen des /r/ in der Frakturschrift werden nicht unterschieden. Virgeln sind einheitlich mit folgendem Spatium, jedoch ohne Spatium davor gesetzt. Der Wechsel in die Antiqua wird durch Kapitälchen wiedergegeben. Zeilen- und Versumbruch wird durch vertikalen Strich markiert.
Abkürzungen ADB
Allgemeine Deutsche Biographie. Hg. durch die Historische Commission bei der Königlichen Akademie der Wissenschaft. 55 Bde. Leipzig 1875–1912
DVjs
Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte
DWb
Jacob und Wilhelm Grimm: Deutsches Wörterbuch. 16 Bde. [wechselnde Bearbeiter]. Leipzig 1854–1960. Quellenverzeichnis. Stuttgart 1971. Nachdruck in 32 Bänden [zitiert] und Quellenverzeichnis [Bd. 33]. München 1984
GRLMA
Grundriß der romanischen Literaturen des Mittelalters
GRM
Germanisch-Romanische Monatsschrift
IASL
Internationales Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur
Killy
Killy Literaturlexikon. Autoren und Werke des deutschsprachigen Kulturraums. Begr. von Walter Killy. 12 Bde. 2., vollst. überarb. Aufl. Hg. von Wilhelm Kühlmann. 13 Bde. Berlin, New York 2008 ff.
LiLi
Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik
RLW
Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft. Neubearb. des Reallexikons der deutschen Literaturgeschichte. Bd. 1, hg. von Klaus Weimar u. a.; Bd. 2, hg. von Harald Fricke u. a.; Bd. 3, hg. von Jan-Dirk Müller u. a. Berlin, New York 1997–2003
TRE
Theologische Realenzyklopädie. Hg. von Gerhard Krause und Gerhard Müller. 39 Bde. Berlin, New York 1976–2007
WdF
Wege der Forschung
ZfdA
Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur
ZfdPh
Zeitschrift für deutsche Philologie
Jan Mohr / Carolin Struwe / Michael Waltenberger
Pikarische Erzählverfahren Einleitung
1 Pikaroroman, pikarische Texte, pikarisches Erzählen Die Geschichte des Pikaroromans ließ sich als Erfolgsgeschichte des neuzeitlichen Romans überhaupt rekonstruieren. Nicht nur erhielt aus dieser Perspektive in den spanischen Gründungstexten erstmals ein sozial marginalisiertes Subjekt eine eigene Stimme, sondern es eröffnete sich in ihnen auch ein Erzählraum, der prominent die Auseinandersetzung eines neuzeitlichen Subjekts mit einer restriktiven Gesellschaft entfaltet. So konnte man im europäischen Schelmenroman nicht nur den Bildungsroman, sondern auch typische Formen des Gesellschaftsromans in ihren Kernen präludiert sehen. Nicht zuletzt weil es sich verhältnismäßig abstrakt resümieren ließ, konnte einem von der Forschung schon früh benannten Set von thematischen, motivischen und erzählstrukturellen Charakteristika1 der gattungskonstituierenden spanischen Texte eine erstaunliche Persistenz nachgewiesen werden. Insbesondere drei Momente der spanischen Gründungstexte ließen sich in unterschiedlicher diskursiv-struktureller Durchformung in narrativen Formen verschiedener kultureller Kontexte und verschiedenster Epochen wiederfinden: die Anlage als Autonarration mit dem Potenzial zur Relativierung der erzählten Zusammenhänge wie auch der Geltungszuweisungen durch das erzählende Ich; sodann eine Nähe zur Satire im distanziert beobachtenden und entlarvenden Blick auf soziale Schichten, Segmente oder Funktionszusammenhänge; und schließlich die Tendenz zur episodischen Reihung, die auf panoramatische Abgeschlossenheit oder enzyklopädische Vollständigkeit zielen kann. Bei einem derart perspektivierenden, weiten Vorverständnis könnte man den Pikaroroman als transhistorische Textgruppe nach Maßgabe einer Familienähnlichkeit im Sinne Wittgensteins so zu rekonstruieren versuchen, dass jeder Text mindestens eine Eigenschaft mit mindestens einem weiteren Text teilt. Und eine solche Darstellung mag Auf-
1 Vgl. insbesondere Claudio Guillén: Zur Frage der Begriffsbestimmung des Pikaresken [1962]. In: Pikarische Welt. Schriften zum europäischen Schelmenroman. Hg. von Helmut Heidenreich. Darmstadt 1969 (WdF 163), S. 375–396.
4
Jan Mohr/Carolin Struwe/Michael Waltenberger
schluss bieten über Affiliationen und Affinitäten pikarischer Motiviken auch über weite historische Kontrastgründe und nationalliterarische Traditionsbildungen hinweg, bis ins 21. Jahrhundert und in die Literaturlandschaften aller fünf Kontinente.2 Dass sich dabei je auch spezifisch gelagerte Beobachtungsinteressen und analytische Voreinstellungen bemerkbar machen, deutet sich freilich in der seit etwa zwei Jahrzehnten noch verstärkten Forschungstätigkeit und erhöhten Publikationsdichte ebenfalls an. Dem Blick des rigorosen Gattungspuristen könnte sich die Geschichte des Pikaroromans denn auch weniger imponierend darstellen. In seiner Perspektive ließe sich auch sagen: Kaum hat die Geschichte des Pikaroromans angehoben, beginnt sie sich auch schon wieder aufzulösen und erfährt die Gattung im wenig fixierten und rasch sich binnendifferenzierenden Spektrum erzählerischer Groß- und Kleinformen im 17. und 18. Jahrhundert Interferenzen und Vermischungen mit anderen Erzähltraditionen. Einem solchen engeren Verständnis folgend, müsste man konzedieren, dass die ‚klassischen‘ Pikaroromane beinahe an einer Hand abzuzählen seien. Verbindet sich eine solche Sicht gar noch mit einem nicht formalisierten, sondern wertenden Begriff von Epigonalität,3 ist es um die Gattung beinahe ganz geschehen; sie wäre dann als ‚gescheiterter Anfang‘ zu beschreiben.4 Einen solchen Standpunkt könnte man zumal mit Blick auf die Textreihe der deutschsprachigen Pikaroromane einnehmen. Die ersten nicht auf romanischen Prätexten basierenden Schelmenromane, Hieronymus Dürers Lauf der Welt und Spiel des Glücks (1668) und Grimmelshausens Simplicissimus Teutsch (1669), verarbeiten schon Muster und Episoden aus höfischem Roman, Schäferroman, aus Utopien und Robinsonaden, und sie integrieren einzelne Episoden aus konkreten Vorlagen, Grimmelshausen bekanntlich auch aus Sorels Francion, der seinerseits Elemente der spanischen Pikaroromane und des sich konstituierenden Roman comique kombiniert. In den folgenden zwei Jahrzehnten wird das Profil des Pikaroromans noch unschärfer; in der deutschen Literaturlandschaft geht es
2 Vgl. aus den letzten Jahren prominent Christoph Ehland/Robert Fajen (Hg.): Das Paradigma des Pikaresken. The Paradigm of the Picaresque. Heidelberg 2007 (GRM-Beiheft 30); Niels Werber/Maren Lickhardt (Hg.): Transformationen des Pikarischen. Stuttgart, Weimar 2014 (LiLi 175. Sonderbd.). Die Nachweise der jüngeren Forschung zum Pikaro- bzw. zum Schelmenroman beschränken wir an dieser Stelle bewusst auf wenige markante Eckpunkte. 3 Vgl. Wolfgang Harms: Epigone. In: RLW 1, S. 457–459. 4 So rekonstruiert Francisco Rico (La novela picaresca y el punto de vista. Korrigierte und erw. Aufl. Barcelona 2000) die Geschichte pikaresker Texte derart, dass auf eine die maßgeblichen narrativen Strukturmomente konstituierende erste Phase eine lange Verfallsgeschichte gefolgt sei. Vgl. auch Fernando Lázaro Carreter: „Lazarillo de Tormes“ en la picaresca. Barcelona 1983, bes. S. 198–201.
Pikarische Erzählverfahren
5
auf in den Politischen Romanen Christian Weises und Johannes Riemers, in den Erzähltexten Johann Beers und, wie auch im Niederländischen, in den Aventurier-Romanen und Robinsonaden. Im Gattungssystem des französischen âge classique werden die Übertragungen der spanischen Texte der Kategorie des Roman comique zugeordnet und konzeptuell dessen mittlerer Stillage und einer stärker betonten Unterhaltungsfunktion angepasst. In der englischen Literaturlandschaft nehmen sie motivischformale Momente der Roguery-Tradition auf und speisen ihrerseits erzählstrukturelle Charakteristika in diese ein. Im deutschen Sprachraum werden bis weit ins 18. Jahrhundert hinein Drucke auf dem Titelblatt an den Erfolg von Grimmelshausens Simplicissimus anzuschließen versuchen. Der Eigenname ist in ihnen teilweise bereits zum Appellativum geworden und geeignet, bei einer prospektiven Leserschaft Erwartungen auf bestimmte narrative Register zu wecken; so bindet er ganz heterogene Schriften zusammen, die sich nur locker in Motivik, Thematik und zum Teil auch in der Erzählhaltung berühren. Der Anschluss an Grimmelshausen und an die pikarische Traditionsbildung ist in erster Linie ein auf die Pragmatik des Buchmarktes zielender. Nur bei vordergründiger Betrachtung bewahrt in Deutschland eine nicht abreißende Textreihe eine stabilere generische Kontinuität. Dass mit dem Pícaro eine Gestalt die Bühne der Weltliteratur betreten habe, die den Roman umstands- und vor allem lückenlos in die Moderne führe, kann man also ebenso gut für unwahrscheinlich halten – und dies übrigens schon, wenn man der älteren Forschung abnimmt, dass bereits früh eine „Verbürgerlichung des Pikaro“5 eingesetzt habe. Es liegt demnach die Sichtweise nicht allzu fern, dass die Wirkung und das Weiterleben des Pikarischen nach einer verhältnismäßig kurzen Phase der Sichtbarkeit zu einem guten Teil auch subkutan erfolgt sein könnte, neben anderen kulturellen und narrativen Mustern oder diese überlagernd. Von daher könnte es aufschlussreich sein, eine Gattung ‚Pikaroroman‘ nicht als transhistorisch konsistente strukturell-diskursive Formation zu konzeptualisieren, sondern stattdessen einzelne Momente ihres Profils diachron in den Persistenzen und Verschiebungen ihrer narrativen Integration und semantischen Funktionalisierung zu verfolgen. Das könnte den Blick schärfen für Überlagerungen und Interferenzen mit Motiven und Erzählstrukturen anderer Traditi-
5 Die Formel geht zurück auf Arnold Hirsch: Bürgertum und Barock im deutschen Roman. Zur Entstehungsgeschichte des bürgerlichen Weltbildes. Frankfurt am Main 1934; zu ihrer Diskussion etwa Hans Gerd Rötzer: Die ‚Verbürgerlichung des Pikaro‘ – nur ein Mythos? In: Daphnis 32 (2003), S. 721–728.
6
Jan Mohr/Carolin Struwe/Michael Waltenberger
onslinien. Die Produktivität pikarischen Erzählens würde so vielleicht konziser beschreibbar als durch die umstandslose Ausweitung ‚des‘ Pikaresken zu einem transhistorischen Kulturparadigma oder durch den gattungshistoriografischen Versuch seiner Auffächerung in Mischklassen.6 Auf einen solchen Ansatz zielen wir mit der Frage nach pikarischen Erzählverfahren. So ließe sich – ein willkürlich herausgegriffenes Beispiel – die Präsentation weltkluger Verhaltensoptionen im Politischen Roman neu einschätzen, indem man sie auf die Handlungs- und Selbstbehauptungsschemata pikarischer Texte bezöge. Gegenüber dem typischen agonalen Schwankschema von List und Gegenlist, das schon die spanischen Pikaroromane über weite Passagen paradigmatisch entfalten, setzt der Politische Roman je schon ein breiteres Spektrum von Handlungsoptionen voraus; zugleich stellen für die beobachtende Rolle der Protagonisten während ihrer ‚soziomoralischen Recherche‘7 agonale Handlungsschemata im Hintergrund eine wichtige Kontrastfolie dar. Und fragen ließe sich im Anschluss, wie die bereits in den Pikaroromanen profilierten Kompetenzen der Fremdbeobachtung und -deutung bewertet werden und wie sie im Einzelnen modelliert sind. Ersetzungen und funktionale Umbesetzungen pikarischen Listhandelns lassen sich indes schon bei der Rezeption der spanischen Romane selbst beobachten. Das narrative Profil etwa, in dem Quevedos Buscón seine europaweite Wirkung entfaltete, ist jenes der pseudonymen französischen Übersetzung, die mit einem veränderten Schluss zugleich andere Prinzipien der Selbstbehauptung valorisiert: statt okkasionellem Listhandeln strategischer Weitblick, statt Mangel oder aber dem kontingenten Umschlag zwischen Mangel und Verausgabung eine Ökonomie der Wertakkumulation, aber auch des Verhaltens und des Affekthaushalts, eine Regie der Blicklenkung, erfolgreiches selffashioning in Räumen reziproker Sichtbarkeit.
6 Zum Begriff der Mischformen Jürgen Mayer: Mischformen barocker Erzählkunst. Zwischen pikareskem und höfisch-historischem Roman. München 1970; Jörg-Jochen Müller: Studien zu den Willenhag-Romanen Johann Beers. Marburg 1965 (Marburger Beiträge zur Germanistik 9); Richard Alewyn: Johann Beer. Studien zum Roman des 17. Jahrhunderts. Leipzig 1932 (Palaestra 181), S. 153–155. Wie wenig auch der an historische Selbstpositionierungen sich anlehnende Begriff der ‚Simpliziaden‘ analytisch trennscharf werden kann, zeigt schlaglichtartig schon der Umstand, dass einer solchen hypostasierten Textgruppe einmal vier, an anderer Stelle wieder 33 Texte zugeordnet werden; vgl. zusammenfassend Stefan Trappen: Grimmelshausen und die menippeische Satire. Eine Studie zu den historischen Voraussetzungen der Prosasatire im Barock. Tübingen 1994 (Studien zur deutschen Literatur 132), S. 65–76. 7 Vgl. Andrea Wicke: Die Politischen Romane, eine populäre Gattung des 17. Jahrhunderts. ‚Was die Politica ist/ das wollen itzt auch die Kinder wissen‘. Diss. Frankfurt am Main 2012, S. 457–493.
Pikarische Erzählverfahren
7
Eine Rekonstruktion derartiger Interferenzen hätte freilich weder einseitig auf Brüche und Diskontinuitäten noch auf die Persistenz einzelner textproduktiver Momente abzuheben. Soll die diachrone Perspektive auf Elemente pikarischen Erzählens nicht zu einer konzeptuell eher unterkomplexen Motivgeschichte geraten, sind Kontinuitäten auf unterschiedlich abstrakten narratologischen Niveaus in geduldiger Beschreibung auf ihre narrative wie auch funktionale Integration zu überprüfen. Dabei wäre ebenso auf Einbindungen wie mögliche Geltungskonkurrenzen oder ein unabgestimmtes Nebeneinander zu achten – und übrigens auch darauf, was jeweils diskursiv gesagt und was in der narrativen Entfaltung gezeigt werden kann. Bei einer solchen Aufmerksamkeitseinstellung geriete jedenfalls weniger die Pikareske als historische Gattungsformation in den Blick, sondern eine von ihr abstrahierbare Kategorie ‚pikarisches Erzählen‘, die an der Formierung verschiedener historischer Textgruppen Teil hätte und sich in je unterschiedlicher Weise in ihnen verdichtete. Eine solche Kategorie ließe sich als Schreibweise in dem Sinne, wie ihn Klaus Hempfer vorgeschlagen hat, konzeptualisieren. Der heuristische Vorteil einer Unterscheidung zwischen Gattungen als historisch je wandelbaren Textgruppen einerseits und Schreibweisen im Sinne von „relativ oder absolut konstante[n] Tiefenstrukturen“ anderseits8 läge darin, dass die Beschreibung pikarischer Charakteristika nicht mehr von einer mal strikteren, mal großzügigeren Konturierung historischer Textgruppen oder von deren transhistorischer Ausweitung abhinge. Denn bei aller Vorläufigkeit der Begriffsbildung9 lässt sich sagen, dass die beobachtbare transhistorische und transgenerische Kontinuität einer Schreibweise nicht schon deren Universalität unterstellt und einen literarhistorischen grand récit impliziert. Eine Verfolgung pikarischer Erzählmuster auch in nahestehenden Textgruppen des narrativen Spektrums ist weiterhin an einen textlinguistischen Ansatz anschließbar, der Textsorten als Figuren der Kompatibilität zwischen einzelnen, auf unterschiedlichen Ebenen angesiedelten Textkomponenten konzeptu-
8 Grundlegend Klaus W. Hempfer: Gattungstheorie. Information und Synthese. München 1973, bes. S. 26–29 und 141–150, Zitat S. 141. 9 Eine nähere Bestimmung der Kategorie ‚Schreibweise‘ ist, soweit wir sehen, Desiderat. Hempfer scheint sich vorläufig auf die Evidenz seiner Beispiele zu verlassen („das Narrative, das Dramatische, das Satirische usw.“ [Anm. 8, S. 27]. An anderer Stelle stellt er etwa noch das „Groteske[ ]“ und das „Tragische[ ]“ zu den Beispielen: Klaus W. Hempfer: Generische Allgemeinheitsgrade. In: Handbuch Gattungstheorie. Hg. von Rüdiger Zymner. Stuttgart, Weimar 2010, S. 15–19, hier S. 17; vgl. auch Klaus W. Hempfer: Schreibweise2. In: RLW 3, S. 391– 393). Das Pikarische als eine Schreibweise wäre im Sinne Hempfers wohl auf einer ähnlichen Abstraktionsebene wie das Satirische oder das Groteske anzusetzen.
8
Jan Mohr/Carolin Struwe/Michael Waltenberger
alisiert.10 Eine solche Perspektivierung nicht von einer hypostasierten Gattung, sondern von einzelnen, systematisch beschreibbaren motivisch-strukturellen Termen her erlaubte es dann auch, den historischen Wandel von Textsorten – oder literarischen Gattungen – nachzuzeichnen, indem thematische Verschiebungen oder funktionale Umbesetzungen textimmanent als Neu-Konstellationen einzelner Textkomponenten analysierbar werden. Während nun Schreibweisen auf dem gegenwärtigen Diskussionsstand wohl am ehesten als transhistorische Sprech- oder Aussagehaltungen aufzufassen wären („das Narrative, das Dramatische, das Satirische usw.“,11 das „Komische“, das „Groteske“12) und auch in einem Verständnis von Gattungen als Kompatibilitätsfiguren eine Rekonstruktion der Regeln für deren Verknüpfung eher auf den Werkcharakter abzielt, verbände sich mit dem Programm einer textuellen Verfahrensanalyse eine Konzentration auf die Prozessualität des poietischen Akts. Die Frage nach Erzählverfahren richtete sich näherhin auf die narrative Entfaltung etwa von motivischen Rekurrenzen, plot-Strukturen und Sujetfügung. An ihnen ließen sich erzählerische Strategien beschreiben, indem etwa neben dem propositionalen Gehalt und semantischen Referenzialisierungen gerade auch die sprachliche Formierung, die Kombinatorik und das Arrangement der einzelnen motivisch-strukturellen Terme in den Fokus der Analyse rückten. Auf diese Weise könnte im Übrigen auch die Spezifik eines in den Texten verhandelten, konstitutiv prozessual gefassten Erfahrungswissens präziser zu beschreiben sein; wir kommen darauf zurück. Gerade für ein solches Erkenntnisinteresse scheint es freilich ungünstig, eine Opposition zwischen tragender semantischer Struktur und einer ‚amimetischen‘ Textur vorauszusetzen, wie in einigen jüngeren Modellentwürfen für eine Verfahrensanalyse geschehen.13 Die Unterscheidung der
10 Vgl. Wolf-Dieter Stempel: Gibt es Textsorten? In: Textsorten. Differenzierungskriterien aus linguistischer Sicht. Hg. von Elisabeth Gülich und Wolfgang Raible. Frankfurt am Main 1972, S. 175–179, bes. S. 178. 11 Hempfer (Anm. 8), S. 27. 12 Ebd., S. 163. 13 Vgl. Moritz Baßler: Deutsche Erzählprosa 1850–1950. Eine Geschichte literarischer Verfahren. Berlin 2015, S. 11–30; ders.: Prolegomena zu einer Verfahrensgeschichte deutscher Erzählprosa 1850–1950. In: Literaturgeschichte. Theorien – Modelle – Praktiken. Hg. von Matthias Buschmeier, Walter Erhart und Kai Kauffmann. Berlin, Boston 2014 (Studien und Texte zur Sozialgeschichte der Literatur 138), S. 231–245; ders.: Die Entdeckung der Textur. Unverständlichkeit in der Kurzprosa der emphatischen Moderne 1910–1916. Tübingen 1994 (Studien zur deutschen Literatur 134), bes. S. 12–16. Das Problem diskutiert Robert Matthias Erdbeer: Der Text als Verfahren. Zur Funktion des textuellen Paradigmas im kulturgeschichtlichen Diskurs. In: Zeitschrift für Ästhetik und Allgemeine Kunstwissenschaft 46 (2001), S. 77–105, bes. S. 87–91 und 82, Anm. 33.
Pikarische Erzählverfahren
9
strukturalen Textlinguistik zwischen einer syntagmatischen Textebene, auf der die Verknüpfung der einzelnen Terme geleistet wird, und einer paradigmatischen Ebene, auf der ihre Selektion aus einem sprachlichen „Thesaurus“14 erfolgt, setzt ja schon voraus, dass interne Relationierbarkeiten (‚Textur‘) sich erst in der syntagmatischen Entwicklung entfalten können und dass die Referenzialität von Bedeutung tragenden Strukturen und sekundäre Bedeutung stiftenden textinternen Responsionen allenfalls graduell differenziert werden kann: ‚Struktur‘ ist in diesem Verständnis das Integral von Textsyntagma und -paradigma.15 So verstanden, erlaubt der Strukturbegriff allerdings flexible Analyseeinstellungen und verpflichtet methodisch nicht von vornherein zu einem Strukturalismus strikter Observanz. Das Verhältnis von syntagmatischer und paradigmatischer Textebene lässt sich auf unterschiedlichen Abstraktionsebenen beschreiben,16 und Ergebnisse von poietischen Verfahren lassen sich am Text ebenso auf struktureller wie auf diskursiver Ebene beobachten. Zum Reservoir wird auf dieser Ebene das verfügbare kulturelle Wissen. Welche diskursiven und praxeologischen Kontexte aber in welcher Weise sich mit pikarischen Erzählmustern verknüpfen, diese Frage erwies sich für die in den Beiträgen dieses Bandes eingenommenen Frageperspektiven als integrierende Problemstellung. Indem die einzelnen Beiträge in der Mehrheit die Übernahme und textproduktive Adaptation pikarischer Erzählmuster in benachbarte historische Textgruppen im späten 17. und im 18. Jahrhundert nachzeichnen, verfolgt der hier vorliegende Band einen Ansatz weiter, den die Herausgeber im Rahmen des Münchner SFB 573 Pluralisierung und Autorität in der Frühen Neuzeit erprobt haben.17 Dabei haben wir den historischen Blick geweitet und den analytischen
14 Baßler: Entdeckung der Textur (Anm. 13), S. 15; zustimmend Erdbeer (Anm. 13), S. 88 f. 15 Vgl. etwa Roman Jakobson: Linguistik und Poetik [1960]. In: Ders.: Poetik – Ausgewählte Aufsätze 1921–1971. Hg. von Elmar Hohenstein und Tarcisius Schelbert. Frankfurt am Main 31993, S. 83–121 und mit Bezug auf eine textuelle Verfahrensanalyse die konzise Problemrekonstruktion bei Erdbeer (Anm. 13), S. 82, Anm. 33. – Baßler (vgl. die in Anm. 13 genannten Arbeiten) nimmt also bei seinem Bezug auf Jakobson eine Umbesetzung von ‚Struktur‘ vor, indem er ihr erstens die syntagmatische Textebene zuweist und sie zweitens auf die Generierung, den Transport und die Sicherung von referenziellem Sinn reduziert; die paradigmatische Ebene beschränkt er umgekehrt auf a-mimetische Sinnbezüge, die implizit mit Unverständlichkeit assoziiert werden. 16 Für eine systematisierende Zusammenschau der heterogenen neueren Begriffsverwendung von ‚Paradigma‘ vgl. Giorgio Agamben: Was ist ein Paradigma? In: Ders.: Signatura rerum. Zur Methode. Aus dem Italienischen von Anton Schütz. Frankfurt am Main 2009, S. 11–39. Vgl. auch Erdbeer (Anm. 13), bes. S. 84–104. 17 Vgl. Jan Mohr/Michael Waltenberger (Hg.): Das Syntagma des Pikaresken. Heidelberg 2014 (GRM-Beiheft 58); vgl. daneben u. a. Jan Mohr: Kalkül und Kontingenz. Narrative Strukturen in Hieronymus Dürers ‚Lauf der Welt Und Spiel des Glücks‘. In: Mitteilungen des
10
Jan Mohr/Carolin Struwe/Michael Waltenberger
Fokus verschoben von der Rekonstruktion historischer Voraussetzungen für pikarisches Erzählen und eines synchronen Feldes von Narrativierungsoptionen hin zu Fragen einer nachhaltigen Produktivität, aber auch Überformung und funktionalen Umbesetzung einzelner pikarischer Erzählmomente. Für die Textbeobachtungen aber weiterhin leitend sind bestimmte analytische Voreinstellungen, die das Verhältnis von Erzählsyntagma und paradigmatisch entfalteten Sinnbezügen betreffen,18 und ein Verzicht auf Thesenbildungen, die die Textbeobachtungen auf makrohistorische Prozesse bezögen (Säkularisierung, Rationalisierung, Kapitalisierung, ‚Verbürgerlichung‘). Stattdessen wurde dort und wird hier in historisch tiefenscharfen Studien Offenheiten und Potenzialitäten von frühneuzeitlichen Erzählkonstellationen nachgespürt. Die Diskontinuität des diskursiv-strukturellen Profils pikarischen Erzählens wird einerseits auf diejenige einer diachronen Entfaltung der Gattung ‚Pikaroroman‘ und anderseits auf die textproduktiven Bedingungen im wenig regulierten Feld frühneuzeitlicher Prosa bezogen.
2 Der Pikaroroman als spezifische Formung von kulturellem Wissen Für die Konturierung eines Profils pikaresker Erzählverfahren im späten 17. und frühen 18. Jahrhundert wählen wir eine Beobachtungseinstellung, die auf den Pikaroroman als spezifische Formung von kulturellem Wissen fokussiert. Damit schließt der Band an kulturwissenschaftliche Konzepte an, die literarische Texte als historisch „je neu zu bestimmende Sonderform […] kulturellen Wissens“ perspektivieren.19 Wir fassen kulturelles Wissen in diesem Zusammenhang als
Sonderforschungsbereichs 573 ‚Pluralisierung und Autorität in der Frühen Neuzeit‘ 2 (2009), S. 16–25; Michael Waltenberger: Eskalation. Zur ‚Eigenlogik‘ episodischer Erzählformen am Beispiel der ‚Lazarillo‘-Fortsetzungen. In: Erzähllogiken in der Literatur des Mittelalters und der Frühen Neuzeit. Hg. von Florian Kragl und Christian Schneider. Heidelberg 2013 (Studien zur historischen Poetik 13), S. 285–301; Carolin Struwe: Episteme des Pikaresken. Modellierungen von Wissen im frühen deutschen Pikaroroman. Berlin, Boston 2016 (Frühe Neuzeit 199). 18 Vgl. Jan Mohr/Michael Waltenberger: Einleitung. In: Dies. (Anm. 17), S. 9–35, bes. S. 10, 30–32. 19 Lutz Danneberg u. a.: Vorwort der Herausgeber. In: Scientia Poetica 8 (2004), S. VII–IX, hier S. VII. Mit diesem Stichwort ist eine anhaltende, engagiert, mitunter auch polemisch betriebene Forschungsdebatte aufgerufen, in der die Beschreibung der Relation von Wissen und Literatur mit unterschiedlichen, zum Teil konträren Ansätzen versucht worden ist. Eine ausführliche Diskussion streben wir an dieser Stelle nicht an. Zu der Vielzahl von Ansätzen vgl. Nicolas Pethes: Literatur- und Wissenschaftsgeschichte. Ein Forschungsbericht. In: IASL 28 (2003), S. 181–231.
Pikarische Erzählverfahren
11
„Gesamtheit kollektiv geteilter und symbolisch vermittelter Annahmen über die Wirklichkeit, d. h. über gesellschaftlich prävalente Themen, Werte, Normen, Selbst- und Fremdbilder“20 auf, und wir gehen davon aus, dass es nicht nur in verbalisierter, sondern auch in impliziter Form beobachtet werden kann.21 Dementsprechend unterstellen wir, dass Bestände eines kulturellen Wissens nicht nur in Strukturen des Erzählten, sondern auch des Erzählens gespeichert, verarbeitet, reproduziert, aber ebenso produziert werden. Insofern verbinden wir kulturelles Wissen nicht mit der Vorstellung eines statischen, propositional-systematisch geordneten Wissenssystems,22 sondern zielen auf die Beschreibung einer pluralen, von Spannungen und Konkurrenzen geprägten epistemischen Formation, die als prozessual und grundsätzlich erweiterbar zu denken und deshalb in der jeweiligen historischen Situierung und in der Spezifik seiner Formiertheit zu analysieren wäre. Zu ihr stehen literarische Texte in einer dynamischen Beziehung; sie bilden Wissen nicht lediglich ab, sondern haben an dessen „Konstruktion, Modifikation und Dissemination teil“23. Diese Form einer Produktion von Wissen vollzieht sich durch Momente der Selektion und Konfiguration in der Integration verschiedenartiger, auch heterogener Wissenselemente in den Text: Dabei können diese durch Zusammenstellung mit anderen, möglicherweise auch konkurrierenden Wissensinhalten neu perspektiviert oder relativiert, narrativiert und verzeitlicht und über ihre jeweilige Bindung an Äußerungsinstanzen mit unterschiedlicher Geltung vermittelt werden. So bringt der Text in seinen erzähltechnischen Formungen auch neue, vorgängig nicht oder nicht in dieser Form versprachlichte Wissenskonfigurationen hervor.24 Narration erscheint in dieser Perspektive als
20 Birgit Neumann/Ansgar Nünning: Kulturelles Wissen und Intertextualität: Grundbegriffe und Forschungsansätze zur Kontextualisierung von Literatur. In: Kulturelles Wissen und Intertextualität. Theoriekonzeptionen und Fallstudien zur Kontextualisierung von Literatur. Hg. von Marion Gymnich, Birgit Neumann und Ansgar Nünning. Trier 2006 (ELK 22), S. 3–28, hier S. 6. 21 Vgl. ebd.; zur Unterscheidung von explizitem und implizitem kulturellem Wissen vgl. Birgit Neumann: Kulturelles Wissen und Literatur. In: Gymnich/Neumann/Nünning (Anm. 20), S. 29– 51, hier S. 44 f. 22 Vgl. grundlegend zu diesem Konzept die Definition von kulturellem Wissen bei Michael Titzmann: Strukturale Textanalyse. Theorie und Praxis der Interpretation. München 1977, besonders S. 263–320. Ähnlich auch ders.: Kulturelles Wissen – Diskurs – Denksystem. Zu einigen Grundbegriffen der Literaturgeschichtsschreibung. In: Zeitschrift für französische Sprache und Literatur 99 (1999), S. 47–61, bes. S. 48. 23 Neumann/Nünning (Anm. 20), S. 6. 24 Vgl. ebd., S. 17.
12
Jan Mohr/Carolin Struwe/Michael Waltenberger
ein Ort, an dem auf spezifisch poietische Weise Wissen geformt bzw. im Erzählprozess allererst konstituiert werden kann.
Erfahrung als diskursiver Eigenwert Im pikaresken Erzählen vollzieht sich die Formung von kulturellem Wissen unter den erzählstrukturellen Bedingungen seriell-episodischer Reihung und der bekannten, charakteristischen Perspektivierung. In der retrospektiv erzählten Lebensgeschichte gewinnt die pseudoenzyklopädische Erfassung, das erfaren der Welt durch das erzählte Ich – entweder als Beobachter oder Akteur – zentrale Bedeutung. Unter diesen Bedingungen erscheint Wissen als ein in die Prozessualität und Zeitlichkeit des Erzählens eingelassenes. In den pikarischen Erzählmustern setzt sich damit eine Aufwertung von erfarung fort, die bereits in den historiae und näherhin im Prosaroman des 16. Jahrhunderts zu beobachten war. Schon dort wird erfarung verhandelt und konturiert als ein „Sich-auf-den-Weg-machen, um etwas zu erkunden, kennenzulernen und selbst zu sehen, wie etwas ist, sowie als das, was man dabei erfährt, als Gegensatz des Theoretischen und bloß Gedachten, des geschichtlich Überlieferten und auf Autorität Angenommenen“25. Schon etymologisch ist der Begriff des erfarens „mit Betonungen der Augen- und Sinneswahrnehmung, der Augenzeugenschaft und des Dabei(-gewesen-)seins, mit Bewegungen im Raum, Situationen der Nähe und Formen praktischen Wissens“ verbunden.26 Wie Jan-Dirk Müller pointiert formuliert, „[suggeriert] [d]ie Rede von ‚täglicher‘ erfarung […] weniger die Wiederholbarkeit einmal gewonnener Erkenntnis als deren dauernde Erweiterung durch neu Hinzukommendes“27. Prononciert wird mit erfarung demnach ein im Prinzip unabschließbarer Prozess des Erwerbs und der Formierung von Wissen angesprochen, das stets erweiterbar und korrigierbar bleibt28 und sich gegen eine Abstrahierung und die Ableitung generalisierbarer Regeln oder Regularitäten sperrt. Stattdessen rückt die gradu-
25 Hans Bayer: Sprache als praktisches Bewußtsein. Philosophisch-wissenschaftliche Terminologie und Sprachhandlung bzw. konkrete fachliche Praxis. In: ZfdPh 93 (1974), S. 321– 342, hier S. 321. Siehe auch die Nachweise zum Verbum ‚erfahren‘. In: DWb 3, Sp. 788 f.; zur Etymologie auch Achim Hahn: Erfahrung und Begriff. Zur Konzeption einer soziologischen Erfahrungswissenschaft als Beispielhermeneutik. Frankfurt am Main 1994, S. 94–98. 26 Christian Kiening: ‚Erfahrung‘ und ‚Vermessung‘ der Welt in der frühen Neuzeit. In: Text – Bild – Karte. Kartographien der Vormoderne. Hg. von Christian Kiening und Jürg Glauser. Freiburg im Breisgau 2007 (Litterae 105), S. 221–251, hier S. 225. 27 Jan-Dirk Müller: ‚Erfarung‘ zwischen Heilssorge, Selbsterkenntnis und Entdeckung des Kosmos. In: Daphnis 15 (1986), S. 307–342, hier S. 333. 28 Vgl. ebd., S. 317.
Pikarische Erzählverfahren
13
elle Reichweite und situative Gebundenheit der verhandelten Erfahrungen in den Mittelpunkt. Die im Pikaroroman beschriebene Wanderung des Protagonisten durch die Welt inszeniert ähnlich wie der Prosaroman einen Modus von Erfahrungshaftigkeit, in der intradiegetisch Handlungswissen, Weltwissen und Weltkenntnisse erworben werden können, in der also der Erwerb von Wissen an die Bewegung im Raum gekoppelt ist. Erfahrung wird allerdings durch pikarische Erzählverfahren in zweierlei Hinsicht radikalisiert: zum einen im Hinblick auf ihre Bindung an einen homodiegetischen Erzähler, zum anderen durch die prinzipielle Fortsetzbarkeit der pikarischen pseudoautobiografischen Erzählung. Mit der Etablierung des autobiografischen Erzählmusters „wird der Kontingenzgrad der Episodenreihe insofern erhöht, als die Lebensgeschichte eines von sich selbst erzählenden Ichs prinzipiell nie eine abgeschlossene sein kann“29. Indem Erfahrung an eine autobiografische Erzählsituation gebunden ist, führt die (prinzipiell) unabschließbare Anhäufung von Erfahrungen verschiedenster Art anders als im heterodiegetisch erzählten Prosaroman nicht nur zu widersprüchlichen Wertungen und uneindeutigen Zuordnungen durch die Erzählinstanz. Betont werden so nicht nur die Partikularität, Gradualität und situative Gebundenheit des erworbenen Wissens, sondern es kommt auch zu einer deutlich brisanteren Spannung zwischen der prinzipiellen Offenheit des pikarischen Lebenslaufs und der angestrebten Geschlossenheit etwa in Form eines negativen Exempels. Die späteren pikarischen Texte geben die Unabschließbarkeit jeder IchErzählung immer stärker zu bedenken. Wo der frühe pikarische Roman nach dem Alemán’schen Erzählmodell ebenso wie etwa der Simplicissimus Teutsch die syntagmatische Schließung des paradigmatisch organisierten Erzählens zumindest noch über die (in Aussicht gestellte) Bekehrung am Schluss zu bewerkstelligen suchte, rücken das moraltheologische telos der Bekehrung und in Verbindung damit eine mögliche Funktionalisierung des Textes als confessio in den Hintergrund. So machen die späteren Texte verstärkt von der Möglichkeit des Weitererzählens Gebrauch, die bereits im Spanischen mit den Lazarillo-Fortsetzungen und im deutschen Sprachraum spätestens mit dem Simplicianischen Zyklus als Strukturangebot greifbar ist: Mit der Fortsetzung bestätigt sich die Offenheit des Erzählsyntagmas; ihm werden paradigmatisch neue Episoden und neue Möglichkeiten der erfarung von Welt angefügt, um es dann einem – nun als grundsätzlich vorläufig und reversibel markierten – Handlungsende zuzuführen. Die damit ausgestellte prinzipielle Unabschließbarkeit der pikarischen Bewegungen kann durch die explizite Ankündigung einer Fortsetzung der Lebensgeschichte oder in
29 Waltenberger (Anm. 17), S. 287.
14
Jan Mohr/Carolin Struwe/Michael Waltenberger
der Verweigerung eines textuellen Endes zusätzlich radikale Offenheit ausstellen.30 Es entstehen Spannungsverhältnisse zwischen normativen Sinnvorgaben und Zersetzungstendenzen durch Partikularisierung.
Einbindung von Wissenselementen, Verhandlung von Geltungsansprüchen Das für pikarisches Erzählen charakteristische seriell-episodische Erzählen und die aggregative Bauart lassen Einschübe jeglicher Art leicht zu. Das zeigt bereits ein Blick auf die Oberfläche der Texte, die mit Einschüben kleinerer und größerer autonomer Textteile überwiegend einen hybriden Charakter aufweisen. Mit Blick auf die Anfänge des pikarischen Genres in Deutschland allerdings erscheint die deutliche Tendenz, das pikarische Erzählmodell für die Vermittlung eines nicht narrativ geformten Wissens zu öffnen, weder als Bruch noch als Neuerfindung, sondern als fortgeführte freiere und radikalere Funktionalisierung eines in pikarischen Erzählverfahren angelegten Potenzials.31 Bei solchen Prozessen der Einbindung von Wissenselementen in Erzählzusammenhänge muss selbstverständlich vor allem deren Veränderung durch Neukontextualisierung in den Blick kommen: Wir gehen von einer „fiktionsinterne[n] Kontextualität des Wissens“ und damit von der Annahme aus, dass Wissen „unlösbar an seinen narrativen Kontext gebunden [wird], mit allen Konsequenzen für Status, Glaubwürdigkeit und Funktionen dieses Wissens“32. Marginalisiertes Wissen kann in den Mittelpunkt der Narration rücken und poietisch bearbeitet werden, anderseits können Wissensbestände durch die Verzeitlichung in der Narration auch ihren Universalitätsanspruch einbüßen. Strukturell zeigen sich solche De-Autorisierungsstrategien auch in Steigerungen von Komplexität, strukturell bedingten Veruneindeutigungen und damit einhergehenden Distanzierungen.
30 Beispiele für diese Problematik im spanischen Roman gibt Hanno Ehrlicher: Zwischen Karneval und Konversion. Pilger und Pícaros in der spanischen Literatur der Frühen Neuzeit. München 2010, S. 231–237. 31 Vgl. zu dieser charakteristischen Tendenz in frühen deutschen pikarischen Texten Struwe (Anm. 17). 32 Frieder von Ammon: Plurale Perspektivierungen des Wissens. Zu Formen und Funktionen von Paratexten in enzyklopädischer Literatur und literarischer Enzyklopädistik. In: Enzyklopädistik 1550–1650. Typen und Transformationen von Wissensspeichern und Medialisierungen des Wissens. Hg. von Martin Schierbaum. Münster 2009 (Pluralisierung & Autorität 18), S. 457–481, hier S. 471.
Pikarische Erzählverfahren
15
Nur selten werden heterogene Wissenselemente wie in Grimmelshausens Simplicissimus Teutsch fast nahtlos narrativ in die Ich-Erzählung integriert. Sonst ist mehrheitlich ein „Einbruch an unverarbeiteter Stofflichkeit“33 zu konstatieren, durch welchen das Syntagma der Lebensgeschichte in den Hintergrund rücken und in seinem narrativen Zusammenhang gelockert, beinahe gar aufgelöst werden kann. Die Unabgestimmtheit von Geltungsansprüchen der Wissenselemente, vor allem aber das Fehlen autoritativer Instanzen und die Verweigerung einer auktorialen Deutung führen zu einer Erosion narrativer Kohärenz. Bei Joseph von Eichendorffs auf den hohen Roman der Barockzeit gemünztem Wort von den „tollgewordene[n] Real-Encyclopädien“34 lässt sich dementsprechend auch an pikarische Romane denken. Und dies möglicherweise mit noch größerer Berechtigung: Wo das Register von Lohensteins Arminius-Roman in sich selbst wiederum mehrfach gegliedert ist, wird in der anonymen deutschen Iustina Dietzin statt des Registers eine unterschiedslose Zusammenstellung von Einträgen mit ganz unterschiedlichem erkenntnistheoretischem Status präsentiert. Nivelliert werden so Kategorien erfolgreichen Weltverhaltens, historische Exempelfiguren und Szenen der erzählten Handlung, die allenfalls in der weiteren Geschehensabfolge Bedeutung aufbauen können. Distinktionen zwischen hohen und niederen Stoffen, zwischen Christlichem und Paganem, zwischen Wissenswertem und Nichtigem zerfallen so. Dass diese Partikularisierung und Unabgestimmtheit des Wissens in den Texten des späten 17. und frühen 18. Jahrhunderts an Virulenz gewinnt, korrespondiert mit dem veränderten Stellenwert der conversio. Als legitimatorischer Fluchtpunkt rückt sie in der Entwicklung der pikarischen Gattung in immer weitere Ferne. Erzählstrukturell kann sie zwar teilweise als telos erhalten bleiben und als Widerlager gegen die weltverhafteten Erfahrungen gesetzt werden. Dass sich in ihr allerdings zugleich ein Normenhorizont mit stabilen Axiologien repräsentiere, lässt sich bei näherer Betrachtung nicht bestätigen. Vielmehr zeigt sich, dass die conversio keinen diskursiven Stellenwert mehr in einem Normensystem behaupten kann und auf die Ebene eines Motivs absinkt; sie wird unverbindlich, ja folgenlos, und kann dementsprechend ubiquitär aufgerufen werden. Der in den frühen Pikaroromanen formulierte Geltungsanspruch für einen der Narration übergeordneten moraltheologischen Normenhorizont tritt in den späteren Texten zurück oder wird durch andere Geltungsansprüche ersetzt, die sich nun
33 Urs Herzog: Der deutsche Roman des 17. Jahrhunderts. Stuttgart 1976 (Sprache und Literatur 98), S. 74. 34 Joseph von Eichendorff: Geschichte der poetischen Literatur Deutschlands [1857]. In: Ders.: Sämtliche Werke. Historisch-kritische Ausgabe begründet von Wilhelm Kosch und August Sauer. Hg. von Hermann Kunisch und Helmut Koopmann. Bd. 9. Regensburg 1970, S. 111.
16
Jan Mohr/Carolin Struwe/Michael Waltenberger
sowohl auf das Erfahrungswissen wie auf partikulare Wissensbereiche beziehen können; religiöse Sinnstiftungen werden hierbei nicht selten lediglich in parodistischen Bezugnahmen präsent gehalten (etwa in den Texten Johann Beers). Auch an anderen traditionell mit hoher Autorität ausgestatteten diskursiven Feldern lassen sich Tendenzen zu einem Abbau von Autorität feststellen. Neben der Religion wird in Schielens Frantzösischem Kriegs-Simplicissimus auch die Geschichte als magistra vitae in ihrer Anwendbarkeit auf Fragen des Weltgeschehens geprüft und letztlich ihre Nutzlosigkeit ausgestellt. Sinnstiftende Deutungsangebote werden distanziert. Stattdessen werden in die pikarische Lebensgeschichte Wissenselemente inseriert und integriert, die im Status ihrer Fiktionalität erheblich differieren: Ausgedehnte Reisebeschreibungen, politische Informationen und Dokumente, aktuelle Zeitungen und Avisen werden ebenso in das Makrosyntagma eingebunden wie medizinisches und ökonomisches Wissen eingespeist. In dieser inhaltlich-thematischen Hybridisierung verwischen sich auch die Konturen von Textsorten und literarischen Gattungen. Die dabei auftretenden kontrastiven Konstellationen können (vorläufig) entschieden, aber auch sistiert oder als Alternativen etabliert und verworfen werden. Mit dieser Hybridisierung und Entgrenzung einhergehend, sind dementsprechend Umbesetzungen und Umwertungen verschiedener verhandelter Wissensfelder zu beobachten. Einige Texte stellen solche Aporien aus, sodass dies auch als symptomatischer Ausdruck einer ‚epistemischen Krise‘ gedeutet werden könnte. Wo das Erfahrungswissen des Pícaro nicht mehr entwertet und damit zusammenhängend die Kontingenz nicht mehr auf allgemeingültige kausale Relationen (von Sünde und Strafe) verkürzt bzw. nachträglich als Providenz umgedeutet werden kann, richtet sich der Fokus verstärkt auf verschiedene Wissensformen und die Auseinandersetzung mit ihnen: So verschiebt sich sapientiales Wissen, das den Pícaro etwa im albertinischen Gusmann zu einem frommen Einsiedler machen soll, hin zu einem prudentialen Wissen, das nicht so sehr Letztbegründungszusammenhängen verpflichtet ist, als vielmehr verschiedene Verhaltensoptionen für erfolgreiches Weltverhalten präsent hält. Dabei können Konkurrenzen zwischen Handlungsoptionen ebenso ausgestellt werden wie deren fehlende Hierarchisierbarkeit. Der Fokus wird damit von einem Wissen mit der höchsten Relevanz, auf das andere Wissensbestände stets schon zugeordnet und von dem aus sie in ihrer Geltung beurteilt werden können, auf Handlung als Auswahl aus verfügbaren Verhaltensoptionen verschoben, die damit diskursiven Eigenwert erhält. In dem Maße, in dem die Texte nicht mehr einem enzyklopädischen Anspruch unterstehen, können einzelne Wissensdiskurse und kann damit partikulares Wissen in den Vordergrund rücken: Eine Emanzipation aus selbstverständlich voraussetzbaren Normenbezügen eröffnet neue erzählerische Potenziale, schafft
Pikarische Erzählverfahren
17
aber auch neue Begründungs- und Plausibilisierungsnotwendigkeiten, wie die einzelnen Beiträge dieses Bandes zeigen.
3 Zu den Beiträgen Eine erste Gruppe von Beiträgen verbindet die konkrete Textanalyse mit sehr grundsätzlichen Erwägungen zu Prinzipien pikarischer Erzähl- und Vertextungsverfahren, indem sie einzelne Textkomponenten systematisch beschreiben und zugleich nach ihren generisch bedingten Formierungen und historischen Funktionalisierungen fragen. Die Beiträge setzen bei der Figur des Schelmen (Rainer Warning), bei Prinzipien der Textproduktion und Sinnstiftung (Thomas Althaus) und bei gattungsgenerischen Strukturproblemen (Christian Kirchmeier) an. Anders als die Mehrheit der gattungshistoriografischen Versuche geht Rainer Warning nicht vom ‚doppelten Anfang‘35 des Pikaroromans – dem Lazarillo de Tormes und dem Guzmán de Alfarache –, sondern von Quevedos Buscón aus. In diesem 1626 zuerst gedruckten, aber wohl schon gegen 1605 handschriftlich kursierenden Roman ist der erzählende Pícaro nicht nach dem Schema des reuigen Sünders angelegt, und damit fällt die für Pikaroromane sonst typische Kommentarebene aus, in der das Handeln des Pícaro ex post als ein weltverfallenes beurteilt werden kann. Deswegen sei, so Warning, die Pikareske nicht als Spielart der Satire zu beschreiben, die Referenzialität und stabile normative Bezugshorizonte zur Voraussetzung hat. Eine Textkomponente, die der Pikareske nicht satirische Subversion, sondern die Beunruhigung und Zumutung eines tendenziell referenzlosen Spiels mit Masken ermögliche, bestimmt Warning im Mythos vom Schelm als einer im formalen Sinne göttlichen Figur. Als Ausgangspunkt dient ihm der Anfang des 20. Jahrhunderts verschriftete und vom Ethnologen Paul Radin eingehend diskutierte Erzählzyklus vom mythischen Indianerhäuptling Wakdjunkaga,36 einer hybriden Trickster-Figur, die sich außerhalb aller Soziali-
35 Vgl. Guillén (Anm. 1), S. 377. 36 Der Bezug zu der von C. G. Jung, Karl Kerenyi und Paul Radin publizierten Erzählung der Winnebago-Indianer ist in der germanistischen Pikaroforschung gelegentlich hergestellt, allerdings lediglich für den Nachweis motivischer Parallelen an der Textoberfläche genutzt worden. Johannes Roskothen: Hermetische Pikareske. Beiträge zu einer Poetik des Schelmenromans. Frankfurt am Main u. a. 1992 (Europäische Hochschulschriften I 1358), bes. S. 79–89 interpretiert den Schelmen als Idealtyp der im griechischen Gott Hermes versammelten Eigenschaften und Handlungsfunktionen; Claudia Erhart-Wandschneider: Das Gelächter des Schelmen. Spielfunktion als Wirklichkeitskonzeption der literarischen Schelmenfigur. Untersuchungen
18
Jan Mohr/Carolin Struwe/Michael Waltenberger
tät und jeglicher Moralvorstellungen bewegt. In der episodischen Reihung der kurzen Handlungssequenzen lasse das unvermittelte Umschlagen zwischen listigem und tölpelhaftem Verhalten die Rekonstruktion einer wertbesetzten Opposition nicht zu. Es bilde vielmehr ein Dual aus, „das aller Normativität voraus liegt“ (S. 42) und beim Rezipienten ein Lachen provoziere, das sich gegen den Übertölpelten und den erfolgreichen Betrüger gleichermaßen richte. Nach dieser Logik funktioniere aber auch der Buscón mit seiner „Entmächtigung wie beibehaltene[n] Exzeptionalität“ (S. 45) des Protagonisten. Ideologische Wertsetzungen würden im Roman kaum einmal greifbar, und auch im Verhalten von Pablos und seinem Umfeld werde die Opposition von Tugend und Laster neutralisiert. Die Basisopposition im epistemischen Haushalt des spanischen siglo de oro: engaño – desengaño werde derart aufgelöst, die aus ihr abgeleiteten Oppositionen würden „entmarkiert und damit dekonstruiert zum pikaresken Dual“ (S. 50). Das Lachen mit dem und über den Schelm als körperliche Reaktion auf Situationen, die nicht in oppositiven Wertsetzungen zu konzeptualisieren seien, lasse sich insofern als supplementär verstehen und weise auf ein Unabgegoltenes hin; es indiziere, dass die Schelmenfigur strukturhomolog dem Mythos und das Handeln des Pícaro nicht auf wertbesetzte Normoppositionen abzubilden sei. In die gleiche Richtung tendieren aber auch die hypertrophen Sprachspiele Quevedos, die zu Opazität und Referenzlosigkeit tendieren. Pikarische Virtuosität äußere sich demnach im Buscón nicht in Anpassungsfähigkeit, sondern in einem Spiel mit den Institutionen selbst, und Quevedo gehe in dieser Konzeption so weit, den Pícaro als mythische Figur anzulegen. Die Einsamkeit des Pícaro resultiere demnach nicht, wie in der Forschung vielfach vorausgesetzt, aus einer dezentrierten barocken Subjektivität, sondern aus einem narrativen Kern des Mythos, der in der göttlichen Asozialität des Schelmen begründet liege. Während Warning gerade den irritierenden Ausfall einer Kommentarebene im Buscón zum Ausgangspunkt für seine Interpretation macht, setzt Thomas Althaus für die frühen deutschsprachigen Adaptationen der Pikaroromane umgekehrt am Verhältnis von seriell aggregierten Schwankhandlungen und allegorisch deutender Kommentierung an. Die Verkoppelung von Handlungsepisoden zum Syntagma einer erzählten Biografie orientiert sich an Mustern schwankhaften Erzählens und kompilatorischer Erzähltechniken aus einem poetologisch wenig regulierten Feld sich selbst als ‚niedrig‘ ausweisender Erzählprosa. Das Strukturprinzip der fortsetzenden Reihung legt per se schon einen Anspruch
zum modernen Schelmenroman. Frankfurt am Main u. a. 1995 (Europäische Hochschulschriften I 1510), S. 61 f. sucht über den Wakdjunkaga-Mythos eine Nähe der Pikareske zu volkstümlichen mündlichen Erzähltraditionen zu plausibilisieren.
Pikarische Erzählverfahren
19
auf Überbietung des Variierten nahe, und das Prinzip der Textgenese nach den Regeln der zeitgenössischen fontes-Lehre tendiert zu einer topischen Radikalisierung, in der jeder Bezug zu Normhorizonten und Wertmaßstäben abzureißen droht. Dem versucht die Technik einer moraldidaktischen Kommentierung und allegorischen Einhegung zu begegnen, indem sie die Vielfalt des Erzählten im Paradigma der Moraltheologie einzuordnen und zu bewerten sucht. In besonderer Deutlichkeit ist dieser Anspruch in der Übertragung des spanischen Guzmán de Alfarache durch den gegenreformatorischen Hofratssekretär Aegidius Albertinus zu beobachten. Allerdings kann Althaus zeigen, dass auch hier Topik und Allegorie nicht bruchlos aufeinander zu beziehen sind. So kann es zu einem eigentümlichen Typus von Erbauungsliteratur kommen, deren diskursive Unabgestimmtheiten bis zu blasphemischer Transgression des Normhorizonts gesteigert sein können. Ein solcher Typus liegt bereits in Albertinus’ Übertragung vor, noch weitreichender aber in Niclas Ulenharts Cervantes-Adaptation Isaac Winckelfelder und Jobst von der Schneid. In der nach dem topischen Verfahren befremdlicher Vergleiche konstituierten Herrschaft des Zuckerbastel ist nicht einfach die Gegenwelt eines mundus inversus geschaffen, sondern – wie man im Anschluss an Rainer Warnings Argumentation pointieren könnte – eine Heterotopie, insofern sie die herrschenden Vorstellungen sozialer Ordnung repräsentiert, dabei aber ihre eigenen Logiken etabliert. Auch die Ich-Rede der Iustina Dietzin beruht auf dem textgenerischen Prinzip überzogener Vergleiche, die virtuos für eine Legitimation ihrer Herkunft und ihres Werdegangs eingesetzt werden. Doch eine vollständige Kontrolle des allegorisierenden Moraldiskurses gelingt auch ihr nicht. Hier wie auch in Ulenharts Isaac Winckelfelder und Jobst von der Schneid werden die Sinnstiftungsebenen narrativer Entfaltung und allegorisierender Explikation einander angeglichen; die eine konkurriert mit der anderen, und so ist der Effekt dieser intradiegetisch wuchernden Kommentierung durchaus vergleichbar mit dem von Warning beschriebenen Ausfall der Kommentarebene in Quevedos Buscón: Den sicheren Boden eines normativen Bezugssystems enthalten beide Texte ihren Rezipienten vor. Christian Kirchmeier versteht diesen Befund als Problemreferenz, die einen strukturellen Kern pikarischen Erzählens ausmache. Dieses partizipiere einerseits an der Moralsatire, insofern es eine Topologie moralischer Normen entwerfe, und frage anderseits, wie das Individuum einen Ort in der Gesellschaft finden könnte. Kirchmeier geht heuristisch von unterschiedlichen Typen der Koppelung von „normativer Konformität bzw. Devianz und sozialer Inklusion bzw. Exklusion“ (S. 98) aus und überprüft seine Thesen an Grimmelshausens Simplicissimus Teutsch und dem anonymen Simplicissimus Redivivus (1743). Der Sozialisierungsprozess von Grimmelshausens Simplex beginnt paradoxerweise in einem sozialen Exklusionsraum, wenn der Knabe vom Einsiedler
20
Jan Mohr/Carolin Struwe/Michael Waltenberger
moraltheologisch unterwiesen wird. In Hanau setzt Simplex dann die übernommenen Normvorstellungen als Grundlage sozialer Koexistenz voraus und schließt sich so selbst aus dem mundus inversus der Kriegsgesellschaft aus. Erst in der Rolle eines Hofnarren kann seine Inklusion gelingen, weil seine (nunmehr: Narren-)Weisheiten keine Verhaltensentscheidungen mehr begründen müssen. Das Problem, wie normenbasiertes Leben und soziale Inklusion miteinander vereinbar seien, ist damit freilich nur auf Spannung gestellt. Mit der danach beginnenden, eigentlich pikarischen Karriere hört die Kritik an der Gesellschaft auf und sperrt sich der Text gegen eine Reduktion auf eindeutige Wertungen, wie sie die Moralsatire anbieten kann. An deren Stelle tritt eine nicht mehr axiologisch wertende, groteske Komik; sie gibt zu bedenken, dass Normen eine Gesellschaft nicht mehr fundieren können, weil sie keine universale Gültigkeit mehr haben. Auf das Problem, dass normenbasiertes Leben und soziale Integration einander ausschließen, reagiert der Text mit der „Liminalitätsfigur“ (S. 105) des Pícaro, die die Dichotomie von Inklusion und Exklusion unterläuft. In Anlehnung an Rainer Warning spricht Kirchmeier von dualen Strukturen, die der Roman in seinen pikarischen Passagen prozessiere. Der Simplicissimus Redivivus (1743) nimmt demgegenüber schon insofern eine wertende Position ein, als er Teil der habsburgischen Kriegspropaganda ist. Der pikarische Chronotopos reduziert sich hier auf die Binarität zweier Kriegsparteien und damit auf eine basale, wertbesetzte Opposition. Simplicissimus wechselt zwar von einer Partei zur anderen; auf beiden Seiten ist er aber gesellschaftlich inkludiert, und der Seitenwechsel bestätigt lediglich eine klare Axiologie. Für das Problem, wie Normativität und Gesellschaftsordnung miteinander zu vereinbaren seien, eröffnet der gegenüber Grimmelshausens Simplicissimus veränderte Kontext moderner Staatenbildung einen neuen Lösungsvorschlag, indem die moralische Topologie ganz in der oppositionellen Struktur des Chronotopos aufgeht. Normen haben zwar keine universale Geltung mehr, aber aus deren beschränkter – nationaler – Reichweite lassen sich dennoch stabile Inklusions- und Exklusionsordnungen ableiten. Damit gibt der Text die Möglichkeit zu bedenken, dass eine Gesellschaftsordnung nicht mehr über universale Normen, sondern eine segmentierte Normativität zu fundieren sein könnte. Drei weitere Beiträge reflektieren Voraussetzungen für die Entstehung und Verbreitung von pikarischen Texten über nationalsprachliche Grenzen hinweg; in ihnen verschiebt sich die Frage nach textkonzeptuellen Prinzipien pikarischer Erzählverfahren auf diejenige nach Möglichkeitsbedingungen produktiver Rezeption in intertextuellen Zusammenhängen. Rosmarie Zeller beleuchtet intertextuelle Bezugnahmen im von der Fore schung bisher wenig beachteten Guldnen Hund von Wolfgang Caspar Printz. Seinen wichtigsten Prätext stellt Apuleius’ Goldener Esel dar: Aus dem spätan-
Pikarische Erzählverfahren
21
tiken Roman übernimmt Printz nicht nur Motive und Handlungssequenzen, sondern auch deren Bindung an einen (tierischen) Ich-Erzähler und die episodisch reihende Erzählstruktur. Den Stoff zu seinem Text, in dem ein Edelmann in einen Hund verwandelt wird, fand Printz zwar in Grundzügen in mehreren zeitgleich erschienenen Flugschriften vor, doch verbindet er mit der Erzählinstanz des Hundes zugleich eine quellenkritische Perspektive: Der Protagonist behauptet nämlich, die Historie als Einziger wahrheitsgemäß erzählen zu können. In einem „Spiel mit Berichtigungs- und Beglaubigungsverfahren“ (S. 116), wie es sich bereits im Simplicianischen Zyklus beobachten lässt, diskreditiert er den Wahrheitsgehalt der faktualen Textsorten, etwa indem er diesen Berichten Unwahrscheinlichkeit nachweist. Gleichzeitig überführt er das in den Quellen vorgefundene Syntagma des Exempels über einen Gotteslästerer, der mit der Verwandlung seine gerechte Strafe erhalten hat, in das seriell-episodische Erzählschema des niederen Romans. Dem Hund als integrierendem Erzählsubjekt kommt dabei vor allem die pikareske Rolle des Beobachters zu, allerdings ohne dass damit eine exemplarische Deutung des Stoffes, wie sie in einigen Quellen der Geschichte vorzufinden war, verbunden wäre: Zwar reflektiert der Protagonist stellenweise sein Handeln und bewertet es im Paradigma von Tugendlohn und Sündenstrafe. Das telos des Romans besteht aber gerade nicht in seiner Bekehrung, die es erlaubte, die Erzählung auf ein moraltheologisches Deutungsmuster zu beziehen, sondern allein in seiner Rückverwandlung in einen Menschen. Frank Estelmann beobachtet die Genese des Pikaresken an der Adaptation von spanischen Texten in Frankreich und ihrer Verortung im Gattungssystem des âge classique. Mit Blick auf die Novelle La Hija de Celestina (1612) und ihre Übertragung durch Paul Scarron (1657) zeichnet Estelmann eine hochgradig reflektiert-produktive Adaptation der spanischen Erzählmuster nach. Die dazu gewählte, einerseits formale, anderseits komparatistische Analyseeinstellung erweist sich in zweierlei Hinsicht als aufschlussreich. Estelmann zeigt, dass La Hija de Celestina als frühes Zeugnis der spanischen Pikareske bereits „mit anderen Erzähltraditionen kontaminiert“ (S. 138) und als bewusste Variation pikarischer Erzählmuster arrangiert ist. Diese Hybridität spiegelt sich vor allem in der Doppelstruktur des Textes wider, in der mit zwei voneinander getrennten parallelen Handlungen zugleich zwei Erzählweisen – die höfisch-novellistisch geprägte Liebesgeschichte des Don Sancho und die pikaresk geprägte pseudoautobiografische Erzählung der Pícara Elena – als „narrative Konkurrenzmodelle“ (S. 144) einander gegenüberstehen. Aufgrund der intradiegetischen Einkapselung von Elenas Lebensgeschichte wird diese Konkurrenz jedoch nicht ausgespielt, sondern zunächst über die gesamte Handlung hinweg sistiert, bevor sie mit der Hinrichtung Elenas am Ende der Erzählung entschieden wird. Diese moralisch geprägte Entscheidung musste jedoch nicht als letztgültige verstanden
22
Jan Mohr/Carolin Struwe/Michael Waltenberger
werden, wie Estelmann an Scarrons Adaptation Les Hypocrites zeigt: Unter Berufung auf das neue klassizistische Stilideal der simplicité und die in erster Linie unterhaltende Funktion des Roman comique übersetzt Scarron zwar große Teile der Handlung wortgetreu, richtet den Fokus aber ganz auf die Liebeshandlung. Zudem kommt die Pícara bei ihm nicht nur ungeschoren davon, sondern gelangt auch zu Reichtum. Entgegen dieser vermeintlichen Schließung des Erzählsyntagmas in einem Aufstiegssujet werden jedoch weitere Abenteuer in einer Fortsetzung angekündigt; der pikareske Erzählstrang wird so gegenüber dem höfischen aufgewertet. Scarrons Adaptation erweist sich damit als „Medium metafiktionaler Reflexivität“ (S. 158), in dem der bereits hybride Ausgangstext zunächst dem Roman comique assimiliert, mit der veränderten Schlusslösung aber wiederum „in die pikareske Gattungsgeschichte eingeschrieben“ (ebd.) wird. Eine noch wesentlich weiter gehende kulturelle Assimilation vollzieht Niclas Ulenhart in der Übertragung von Cervantes’ Rinconete y Cortadillo. In seiner History von Isaac Winckelfelder und Jobst von der Schneid (1617) ist die Handlung der spanischen Novelle ins Milieu der Prager Unterwelt überführt. Jan Hon analysiert deren herausragendes Charakteristikum, eine irritierend spannungslose Koexistenz verschiedener Konfessionen. Dass diese gegenseitige Tolerierung kaum einsinnig als Satire gegen eine bestimmte Konfession oder Glaubensgemeinschaft aufzufassen ist, macht Hon in einer kritischen Aufarbeitung der bisherigen Forschung deutlich. Gegenüber deren sozialhistorischen Ansätzen führt der Fokus auf die narrativen Strukturen zu einer differenzierteren Einschätzung: In der Kombination charakteristisch pikarischer Erzählinstanzen wird jede konfessionelle Positionierung des Textes dekonstruiert. Die Installation einer extradiegetischen Erzählhaltung fördert zudem die Erzeugung dialogischer Vielfalt und die Konfrontation widersprüchlicher Positionen. Nicht nur werden in den autobiografischen Berichten der Protagonisten sowohl Calvinismus als auch Wiedertäufertum negativ perspektiviert: In einer Potenzierung typisch pikaresker Erzählhaltungen wird so die „‚Unzuverlässigkeit‘ der vermittelnden Pícaro-Figur und ihrer Perspektive […] sozusagen narrativ objektiviert“ (S. 170 f.), indem „die Beobachtung selbst […] zum Gegenstand der erzählerischen Betrachtung“ wird (S. 170). Die in der zeitgenössischen Debatte virulenten Themen Konfessionalität und Religionsfreiheit werden so als sinnentleerte diskursive Formation inszeniert. Als Deutungshorizont, der das heillose Treiben der Prager Gaunerzunft einzuordnen und zu bewerten erlaubte, fällt der (moral-)theologische Diskurs damit gerade aus, wie es in anderer Perspektive auch Thomas Althaus in seinem Beitrag entwickelt. Mit einem derart offenen Sinnangebot des Textes setzt Ulenhart freilich eine Leserdisposition voraus, die auf einen aktiven Beitrag bei der Sinnkonstitution verpflichtet werden kann. Ansätze zu entsprechenden poetologischen Reflexionen in der deutschsprachigen Literaturlandschaft weist Hon im frühneu-
Pikarische Erzählverfahren
23
zeitlichen Prosaroman nach: In den dortigen Paratexten sieht er poetologische Prinzipien vorgebildet, die in der History mit der Einbindung in die Handlung dann freilich eine ungleich radikalere Umsetzung erfahren. An erzählstrukturellen und diskursiven Affinitäten zwischen pikarischem Erzählen und frühneuzeitlichem Prosaroman setzt auch Sebastian Speth an, der Texte von Johann Beer mit dem Erstdruck (1509) und einer späten, moralisierenden Redaktion (1850) des Fortunatus konfrontiert. Dabei konzentriert sich Speth auf das textintern entfaltete Kontingenz-Paradigma, bei dem er zwischen dem „zufälligen Herumirren eines Pícaro auf der Horizontalen der erzählten Welt“ und dem „vertikalen Mechanismus von Fortunas Glücksrad“ (S. 181) unterscheidet. In Beers Jucundus Jucundissimus ist eine räumliche Universalisierung der Kontingenz zu beobachten, die sich nun auch auf das abgelegene Heimatdorf, den Hof und sogar sakrale Räume erstreckt. Zugleich enthalten diese Räume symbolische Bezüge auf die Glücksikonografie: So verweist das Mühlrad, über das Jucundus reflektiert, auf die rota fortunae, die den umherziehenden Helden in eine Logik der Vertikalen einbindet – und damit seine Erfolgsgeschichte bereits vorzeichnet. Außerdem wird Jucundus’ Aufstieg von den pikaresken Lebensläufen einiger Nebenfiguren flankiert, in denen vor allem das unheilvolle Wirken der fortuna mala präsentiert wird. Die Aufstiegsgeschichte des Protagonisten wird so von einer pikarisch besetzten Horizontalen der erzählten Welt abgehoben, und als Negativexempel legitimieren diese Geschichten einen moraldidaktischen Anspruch des Textes: Beer ermöglicht „Einblicke in die Wandelbarkeit des Weltlaufs“ (S. 200), präsentiert diesen aber nicht als regellos, sondern vor einem Deutungshorizont von Tugendlohn und Sündenstrafe. Eine vergleichbare Bindung an moraltheologische Normen wird in der späten Fortunatus-Redaktion noch forciert. Die vom Erstdruck her vorgegebene Privilegierung von Weisheit gegenüber Reichtum wird dort in der Handlung selbst entfaltet und zusätzlich kommentiert, pikareske Nebenhandlungen werden gekürzt, und das regelmäßige Auf und Ab des Fortuna-Rades wird gegenüber der Horizontalen eines pikarisch akzentuierten Chronotopos privilegiert. Irritierend konterkariert wird diese Glättung im Dienste der Moraldidaxe allerdings, wenn die Andrean-Episode nicht den Kontrast zu Fortunatus’ Weltverhalten bildet, sondern einen alternativen Lebenslauf präsentiert. Auch in Texten Johann Beers erscheint Kontingenz auf eine spezifische Weise gedrosselt. Simon Zeisberg analysiert die von Beer narrativ konturierten Bedingungen der Möglichkeit sozialen Aufstiegs; der Text legt dabei nahe, dass man den Wechselfällen der Fortuna mit zweckrationalem Kalkül begegnen kann. Zu dessen Inbegriff wird vor allem die Position als Hofmeister und Verwalter, von der aus die Pícaros auf ihre Lebensgeschichte zurückblicken. Zeisberg beschreibt ihr Vorgehen mit Michel de Certeau als taktisches Handeln, das parasitär in den Ort
24
Jan Mohr/Carolin Struwe/Michael Waltenberger
des Anderen einzudringen versucht – auf diese Kategorie lassen sich pikarische Erzählsujets typischerweise beziehen –, und zugleich als strategisches Handeln, das einen Ort des Eigenen als Operationsbasis schon voraussetzt. An kulturhistorischer Prägnanz gewinnt die neue Sujetfügung durch den Einbezug verwaltungsökonomischer Kontexte: Der adlige Haushalt wird zeitgenössisch in einem Spannungsfeld zwischen der „Notwendigkeit der funktionalen Optimierung“ und der „Gefahr seiner Unterwanderung durch parasitäre Subjekte“ (S. 212) gesehen. Während aber die Hausväterliteratur dieses „Verwaltungsparadox“ (S. 213) lediglich beschreibt und vor betrügerischen Verwaltern warnt, wird es bei Beer dynamisiert, indem die Figuren immer wieder zwischen taktischem und strategischem Handeln wechseln, bis sie schließlich als reiche Mitglieder der Gesellschaft „am ‚Ort des Eigenen‘“ (S. 209) angelangen. Der damit verbundenen vorzeitigen Schließung des Syntagmas begegnet der Text, indem Binnenerzählungen von besitzlosen pikaresken Figuren inseriert und diegetisch motiviert werden. Ein struktureller Abschluss des Syntagmas wird so aufgeschoben, und auch eine epistemische Schließung durch die Bindung an moralisch-religiöse Normbezüge spielt, wenn überhaupt, nur noch eine untergeordnete Rolle: Während Beer im Corylo noch auf die Bekehrung in Form des Rückzugs ins Kloster setzt, wird eine vergleichbare religiöse Schließung im Jucundus Jucundissimus durch den rücksichtslosen und das Raster der Ständeordnung sprengenden Aufstiegsplan des Protagonisten radikal distanziert. Die Frage nach einer normativen Fundierung sozialer Inklusion, wie sie Christian Kirchmeier in seinem Beitrag als zentrales Strukturproblem pikaresker Narration identifiziert, tritt bei Beer merklich in den Hintergrund. Mit der moralisch indifferenten Konzentration auf den Aufstieg erschließen sich Beers Romane stattdessen neue Wissensfelder, etwa ökonomisches Verwaltungswissen und dessen zielgerichteten Einsatz sowie die Durchsetzung kameralistischer Rationalisierungskonzepte. Mit dem Beitrag von Jörg Krämer erweitert sich der Skopus des Bandes um die Gattung des Politischen Romans, der in der bisherigen Forschung aufgrund seiner vermeintlich rein moraldidaktischen Funktion vor allem als Gegenentwurf zur Pikareske gelesen wurde. Demgegenüber beschreibt Krämer Christian Weises Politischen Näscher (1678) als eine erzählerische Mischform, in der nicht nur die Narrenrevue als Darstellungsmittel Anwendung findet, sondern auch narrative Charakteristika der Pikareske wie auch der Novellistik und der Schwanktradition aufgegriffen werden. Der – von einem extradiegetischen Erzähler vermittelte – Lebenslauf des Protagonisten dient in erster Linie dazu, eine wahre Fülle von intradiegetischen Erzählungen in ein Syntagma zu integrieren. In additiver Reihung werden so Betrüger-Episoden versammelt, die vor allem „Topoi der Novellen- und Komödientradition“ (S. 237) zum Inhalt haben und die Haupthandlung zu überwuchern drohen. Eine Lehre oder Erkenntnis lässt sich aus ihnen trotz immer
Pikarische Erzählverfahren
25
wieder eingefügter autoritativer Urteile nicht ableiten. Auch didaktische Zugänge werden distanziert, wenn in Binnenerzählungen anstatt einer Belehrung zur Weltklugheit – die der Politische Roman generisch in Aussicht stellt – Überschüsse unterhaltsamen Erzählens bzw. „pragmatisch-spontane […] Reaktionen auf die kontingenten Probleme des Alltags“ (S. 241) zu beobachten sind. Die Kohärenz dieser hybriden Form wird „durch fast gewaltsame auktoriale Eingriffe“ (S. 239) gesichert, prominent durch die Anfügung eines moraldidaktischen Traktats am Romanende, dem ungleich mehr Geltung als der Haupthandlung und allen Binnennarrationen zugeschrieben wird. Dass umgekehrt der Roman selbst kaum die theoretischen Postulate der Gattung verwirklicht, wird prägnant auch vor dem Hintergrund der im Kurtzen Bericht vom Politischen Näscher (1680) entwickelten Poetik deutlich, die für den Politischen Roman die Funktion von satirischer Kritik und Belehrung zu weltklugem Verhalten festschreibt – der fiktionale Text selbst tendiert demgegenüber eher zu narrativer Verselbstständigung. Die letzten drei Beiträge des Bandes zeichnen Wandlungen und Grenzen pikarischen Erzählens und seine Funktionalisierbarkeit an der Schwelle vom Barock zur Frühaufklärung nach. Carolin Struwe widmet sich einem Text, der in besonders radikaler Weise die Disparität des Wiss- und Sagbaren zur Diskussion stellt. Hatte Thomas Althaus schon für die frühen Adaptationen der spanischen Pikarotexte gezeigt, wie eine allegorische Kommentierung des pikarischen Treibens nicht gelingt, so wird im Frantzösischen Kriegs-Simplicissimus (1682/83) eine Bewertung aus moraltheologischer Perspektive bereits als formal ungenügend abgewiesen. Eine geistlich perspektivierte Kommentierung des betrügerischen Kaufmannslebens wird mit dem Argument zurückgenommen, dass aus der Partikularität des Erlebten noch keine generalisierbaren Folgerungen abzuleiten seien. Damit ist das konstitutive diskursiv-erzählstrukturelle Gefüge des Pikaroromans, in dem die Spannung von Welterfahrung und Weltabkehr verhandelt wird, ausgehebelt. Denn der Anspruch theologischer Textauslegung auf universelle Gültigkeit wird unterlaufen: Erfahrungswissen ist von irreduzibler Diversität, bleibt stets erweiterbar, damit potenziell aber auch immer korrekturbedürftig. Im Text zeigt sich dies in einer wahren Flut von durchaus widersprüchlichen Informationen über die Wechselfälle des Krieges, die die Handlung und das autobiografische Schema beinahe vollständig überwuchern. In der Kombination verschiedenster inserierter Textsorten wird eine Diversität der Erfahrung radikalisiert, die dem Potenzial der pikaresken Tradition zu paradigmatischer Schließung und moralischer Sinngebung zuwiderläuft. Im Gegenzug werden allerdings die Geltungsansprüche traditioneller Autoritätsinstanzen negiert. Weder kann das historische Buchwissen in seiner Exemplarizität die Komplexität und Veränderlichkeit der politischen Landkarte
26
Jan Mohr/Carolin Struwe/Michael Waltenberger
erklären noch kann das Feld des Religiösen als diskursive Ressource für eine moralische Deutung genutzt werden: Es wird bereits auf innerdiegetischer Ebene Gegenstand der Aushandlung von Geltungs- und Welterschließungsansprüchen. Erfahrungsweltliche Ordnungsüberschreitungen kann das religiöse Wissen nicht einmal erfassen. Doch auch theologische Streitfragen werden nicht geklärt, einander widersprechende Lehrsätze kommen unabgestimmt nebeneinander zu stehen und relativieren sich gegenseitig. Die Disparatheit partikularer Wissensbestände und Informationen kann schließlich auch im Deutungsparadigma innerweltlicher Lebensklugheit nicht mehr zu einer Einheit integriert werden. Ebenso wie den gemachten Erfahrungen eine paradigmatische Integration wird dem pikarischen Lebenslauf eine syntagmatische Schließung verweigert; in der outrierten Zukunftsoffenheit der pikarischen Vita schöpft der Text das „Potenzial paradigmatischer Anschlussfähigkeit und narrativer Fortsetzbarkeit gänzlich aus“ (S. 273); entsprechend findet er keinen Abschluss, sondern bricht unvermittelt ab. An der Bewältigung der Fülle des Wissbaren und ihrer Integration in Ordnung verheißende Sinnbildungsstrukturen arbeitet sich auch der sechsteilige Romanzyklus des Arztes und Pharmazeuten Johann Christoph Ettner ab, den ClausMichael Ort analysiert. Die ab 1694 publizierten Reiseromane um die fiktive Figur Eckarth lassen sich sowohl in einem fachhistorischen als auch in einem epistemologischen Spannungsfeld verorten. Thematisch wiederholen sie die um 1700 zu beobachtende berufsständische Konkurrenzlage zwischen dem akademisch gebildeten medicus politicus und dem medicus empiricus, repräsentiert durch volksmedizinisch ausgebildete Kleriker und Laien. Als „narrative Medien der Wissenspopularisierung“ (S. 278) partizipieren die Romane sodann an zwei Wissensordnungen: In den typologisch älteren, analogisierenden Ordnungsmodellen werden die medizinischen Erkenntnisse und Praxen nicht nur auf naturwissenschaftliche, sondern auch auf moralische und theologische Geltungsansprüche bezogen. Dem gegenüber steht ein Typus von Wissen, das empirische Beobachtungen in offene Sammlungen von Ereignistypen einspeist, statt sich auf universell geltende Sinnmuster und Normenhorizonte zu beziehen. Im Rahmen eines derart erweiterbaren und prinzipiell unabschließbaren Wissensfonds besteht der Nutzen medizinischer Erkenntnis nicht in Moralisierung, sondern in wissensdidaktischer Verwendbarkeit. Damit beschreibt Ort für das popularisierend-narrative Schrifttum der Frühen Neuzeit jene epistemische Konstellation, die etwa auch Thomas Althaus und Carolin Struwe zum systematischen Ausgangspunkt ihrer Argumentationen machen. Der kaiserliche Rat Ettner nun nimmt in seinen medizinischen Romanen einen in doppelter Hinsicht vermittelnden Standpunkt ein. Einerseits grenzt sich der Protagonist Eckarth von allen Trägern einer populären Volksmedizin strikt
Pikarische Erzählverfahren
27
ab, obgleich er in seine ausufernden Belehrungen auch paracelsisches, im konservativen Sinne also verdächtiges Gedankengut aufnimmt; anderseits bezieht er seine medizinischen Diagnosen auf moralische Verfehlungen seiner Gegenüber. Dabei versucht er aber nicht mehr, Wissen systematisch in von übergeordneten Sinnhorizonten angebotene Deutungsmuster einzupassen, sondern beschränkt sich auf seine enzyklopädische Erfassung und innerweltliche Einordnung bzw. Beurteilung. Die sechs Romane betten medizinkundliche Belehrung in den Rahmen einer mehrjährigen tour d’horizon durch ganz Europa, die einer kleinen Gesellschaft unter Eckarths Leitung Gelegenheit bietet, verschiedene Typen medizinisch-moralischen Fehlverhaltens nach dem Muster von Christian Weises Ertz-Narren zu katalogisieren, öffentlich zu entlarven und zu sanktionieren. Diese Anlage der Romane generiert freilich mehrere Probleme. Zum einen leidet die Glaubwürdigkeit Eckarths darunter, dass er sich zur Entlarvung der Quacksalber und zur Aufklärung von deren Publikum der gleichen betrügerischen Methoden bedienen muss wie jene. Darüber hinaus wird die Frage provoziert, auf welche Weise innerhalb der Romanfiktion ein akademisch-medizinisches Wissen in seiner Heterogenität und unter den Bedingungen vielfältigen Betrugs und drohender Entlarvung überhaupt noch validierbar sein kann. Erzählstrukturell stellt das Prinzip akkumulierender Wissenspräsentation den Verfasser dabei vor die Herausforderung, seine Romane überzeugend abzuschließen – das zeigt sich schon an der Erweiterung zum Zyklus. Ettner bearbeitet dieses Problem in ähnlicher Weise, wie sie Thomas Althaus für die frühen Adaptationen der spanischen Pikaroromane analysiert hat. Was aus den von Ettner versammelten heterogenen Wissensbeständen Geltung haben soll, wird nicht nur über die Integrationsfigur Eckarths, sondern auch durch paratextuelle Ausgliederung zu sichern gesucht; doch wird dies unterlaufen, wenn die Romanfiguren selbst zu metaleptischen Lesern jener paratexuell ausgegliederten Lehrsätze werden oder wenn Ettner selbst als Figur in seinen Romanen auftritt. Nicht nur in derartigen Fiktionalisierungen nähert sich Ettner den Erzähltechniken von Grimmelshausens Schriften an, sondern auch in einem Zug zu poetologischer Selbstreflexivität, die eine moralisierende Schließung des Erzählens allenfalls im Modus potenzierender Selbstbeobachtung zulässt. Die Beiträge von Struwe und Ort zeigen, wie in der deutschsprachigen Traditionsbildung pikareske Erzählmuster einer narrativen Entfaltung von Kontingenz zuarbeiten, die als Symptom für epistemische Verunsicherungen in den Jahrzehnten um 1700 gelesen werden kann. Der von Christian Wehr analysierte hispanoamerikanische Reisebericht Lazarillo de ciegos caminantes (‚Lazarillo der reisenden Blinden‘) hingegen stützt sich in seiner aufklärerischen Tendenz auf das satirische Potenzial des pikarischen Genres:
28
Jan Mohr/Carolin Struwe/Michael Waltenberger
Vermutlich seiner subversiven Tendenzen wegen wird dieser Text unter Pseudonym gedruckt. Der Name des vorgeblichen Verfassers ist in zweifacher Hinsicht ein sprechender: Sein Beiname Concolorcorvo (‚rabenschwarz‘) weist ihn als Angehörigen der indigenen Bevölkerungsgruppen aus, ein weiterer Namensbestandteil weckt Assoziationen an den Verfasser einer Geschichte der Conquista. Nach heutigem Kenntnisstand verbirgt sich dahinter Alonso Carrió de la Vandera, ein ranghoher Beamter der spanischen Krone. Der Text protokolliert eine Inspektionsreise, die der Verwalter des Postwesens in den Kolonien zusammen mit seinem Sekretär Concolorcorvo quer durch den südamerikanischen Kontinent unternimmt. In der genauen Bezeichnung der Reiserouten und -stationen, der exakten Vermessung des Terrains und einer Fülle von Informationen ist der Bericht von der nominalistischen Episteme des 18. Jahrhunderts geprägt. Daneben greift er jedoch auch inhaltliche und erzählstrukturelle Momente der pikaresken Tradition auf. Zu einer Subversion des offiziösen Reiseprotokolls tragen insbesondere die Vervielfältigung der Erzählperspektiven und eine gezielte Verunklärung der Urheberschaft des Textes bei. Der Text wird ausgegeben als mehrfaches Palimpsest, das die Erinnerungen des spanischen Beamten zur Grundlage und seine vorliegende Gestalt in mehreren erweiternden, kürzenden und zensierenden Redaktionsschritten erhalten habe. Er inszeniert so ein Ringen um die historiografische Diskurshoheit, bei dem herrschende Geltungshierarchien dekonstruiert werden. Zudem werden in den dialogischen Partien des Textes die Redeanteile des hegemonialen Diskurses der königlichen Verwaltung durch den Beamten und die subversiven Einwürfe der kolonisierten indigenen, in der Figur des humanistisch gebildeten Sekretärs aber ihrerseits schon hybriden Kultur zunehmend ununterscheidbar: „Der Lazarillo de ciegos caminantes inszeniert über pikareske Gattungskomponenten Erosionen kolonialer Machtdiskurse“ (S. 322). In literarhistorischer Perspektive werden an ihm zugleich die Möglichkeitsbedingungen einer eigenständigen hispanoamerikanischen Literatur sichtbar – umso eindrücklicher, als auch der gemeinhin als Initialtext an deren Beginn gesetzte Periquillo Sarniento Fernández de Lizardis (1816) seiner narrativen Anlage und seinem Sujet nach pikarischen Erzählmustern folgt.
4 Zum strukturell-diskursiven Profil pikarischen Erzählens um 1700 Mit Blick auf die in diesem Band vorgelegten Analysen lässt sich ein strukturelldiskursives Profil pikarischen Erzählens gegen Ende des 17. Jahrhunderts in ersten Umrissen nachzeichnen. Erzählstrukturelle Brisanz bezieht es aus der Konstella-
Pikarische Erzählverfahren
29
tion von seriell-episodischer Reihung, einer inkonsistenten Ich-Instanziierung und der Spannung von Syntagma und Paradigma, in der es immer noch dem Alemán’schen Gattungsmodell folgt, anderseits aber mit der zunehmend reflexiven Rezeption im französischen und deutschen Sprachraum bereits einige Veränderungen durchgemacht hat. Wollte man eine Entwicklung von den Anfängen pikarischer Texte hin zum Ende des 17. Jahrhunderts konturieren, könnte man bei der Integration verschiedener Formen von Wissen ansetzen, die mit Relativierung, Nivellierung, mit Autorisierungskonkurrenzen und Autoritätseinbußen einhergehen kann, außerdem bei der Auflösung von normativen Ordnungen (Kirchmeier) in einer dualen, ateleologischen Episodizität (Warning) sowie bei der Interferenz und Vermischung mit anderen Gattungen und Erzählmodellen. Diese strukturell-diskursiven Charakteristika ließen sich freilich bereits in den spanischen Anfängen (La Hija de Celestina) und im Ansatz auch im deutschen Sprachraum bereits früher, etwa in Dürers Lauf der Welt, erkennen; doch treten sie nun verstärkt in den Vordergrund und bringen semantische Umbesetzungen und neue Funktionalisierungen mit sich. Greifbar werden diese diskursiven und semantischen Veränderungen nicht zuletzt im Verzicht auf die Propagierung einer konfessionellen Schlagrichtung und auf die Bekehrung als Endpunkt der Erzählhandlung. Solche moraltheologischen Funktionalisierungen rücken in den Hintergrund (Iustina Dietzin, Frantzösischer Kriegs-Simplicissimus) oder werden ganz aufgegeben (Buscón, Beer’sche Romane, Politischer Roman), mitunter sogar als sinnentleerte Formationen präsentiert (Isaac Winckelfelder und Jobst von der Schneid). Wo der frühe pikarische Roman eine Spannung zwischen Welterfahrung und religiöser Bekehrungsgeschichte entwirft und aus ihr produktionsästhetisches Potenzial entwickelt, stellen die pikaresken Texte am Ende des 17. Jahrhunderts aus, dass das Feld religiöser Theorie und Praxis nicht mehr für eine nachhaltige Sinnstiftung verfügbar gemacht werden kann. In dem Maße, in dem moraltheologische Diskurse ihre Autorität einbüßen und nicht mehr als diskursive Ressource für eine Deutung in Anspruch genommen werden, verlieren sie ihre zentripetale Funktion zur Einhegung disparaten Erfahrungswissens und werden zugleich innerdiegetisch zum Gegenstand der Aushandlung von Geltungsansprüchen. Greifbar wird diese Verschiebung des Skopus der Texte auch in neuen Schlusslösungen, die einen erfolgreichen sozialen Aufstieg oder aber lediglich ein telos in der Immanenz (Gldner Hund) zeigen. Wo umgekehrt eine Schließung des Handlungsbogens gerade verweigert wird – etwa in der Ankündigung immer weiterer Erfahrungen über die Gegenwart des Lesers hinaus –, begründet sich diese Unabschließbarkeit nicht mehr aus der Spannung zwischen Welt- und Transzendenzbezug, sondern aus der schieren Masse eines Erfahrungswissens, das verarbeitet sein will (Frantzösischer Kriegs-Simplicissimus, Ettners medizinische Romane).
30
Jan Mohr/Carolin Struwe/Michael Waltenberger
Wenn mit der Ablösung aus normativen Sinnbezügen ein diskursiver Eigenwert von Erfahrung beobachtet werden kann, dann ist damit freilich wohl kaum schon die Präfiguration der Aufklärung oder die Konstitution des modernen Subjekts zu assoziieren. Der Erfahrungsbegriff der Frühen Neuzeit ist, dies zeigt sich nicht nur in pikarischen Texten, in Kategorien wissenschaftlicher Empirie noch nicht hinreichend beschrieben. Auch angesichts der hier vorgelegten Studien ist er plausibler als Symptom einer historischen Wahrnehmung des Unabschließbaren, Veränderlichen, Skalierbaren und Situativen zu beschreiben. Wissen erscheint als partikular und damit als etwas, das immer wieder in Relation und Konkurrenz zu anderen Wissenselementen zu betrachten und dessen Geltung immer wieder neu auszuhandeln ist. Sichtbar werden so auch hinter Autoritäten Prozesse von Autorisierung, die sie als bedrohte, vorläufige und immer wieder neu zu generierende entlarven (Iustina Dietzin, Politischer Näscher, Frantzösischer Kriegs-Simplicissimus, Medizinische Maul-Affen). Neben einer moraltheologischen Einhegung von Kontingenz oder aber ihrer radikalen Ausstellung werden auch kontingenzdrosselnde Erzählmodelle genutzt, die eine soziale Entwicklung bis hin zur Inklusion des Pícaro in die Gesellschaft vorstellbar machen, dabei aber auf das moralisch indifferente zweckrationale Kalkül des Protagonisten setzen (Jucundus Jucundissimus). Mit einer Radikalisierung von Erfahrung geht also nicht automatisch die Entwicklung hin zu einem konsistenten Ich als Träger dieser Erfahrung einher. Der Einbruch von Wissen in den Text geht eher zulasten eines konsistenten Ich-Entwurfs und verbindet sich mit einem Spiel mit verschiedenen Perspektiven (Wechsel von Er-Erzähler und Ich-Erzähler in der Hija de Celestina, im Isaac Winckelfelder und Jobst von der Schneid) und einem unabgestimmten Nebeneinander von (Ich-)Instanzen im Text (Iustina Dietzin, Frantzösischer Kriegs-Simplicissimus). Dass der Pikaroroman im Zuge dieser semantischen Umbesetzungen und erzählstrukturellen Entgrenzungen gegen Ende des 17. und zu Beginn des 18. Jahrhunderts weder einfach verschwindet noch in einer ‚Verbürgerlichung‘ aufgeht, zeigt sich in Interferenzen mit anderen narrativen Modellen, mit nicht-narrativen Elementen, ja sogar in einer medialen Hybridisierung (Frantzösischer Kriegs-Simplicissimus). Nicht selten werden pikareske Teilsyntagmen einer Makroerzählung bei- oder untergeordnet: Diese können agonal-konkurrierend (etwa im Französischen Kriegs-Simplicissimus, in den Medizinischen Maul-Affen, im Spanischen bereits in der Hija de Celestina), perspektivierend und dabei relativierend (in den Texten Weises, Beers und im Fortunatus) oder einfach unabgestimmt nebeneinander präsentiert werden (Iustina Dietzin). Prägnant tritt dies in der Übernahme pikarischer Verfahren im Politischen Roman zutage, der gerade nicht, wie die bisherige Forschung angenommen hat, als Gegenentwurf zum Pikaresken zu werten ist. Dass pikarische Erzählverfahren als für den Politischen Roman funk-
Pikarische Erzählverfahren
31
tionalisierbar erscheinen konnten, lässt sich mit der gesteigerten Bedeutung der Beobachtung von Welt begründen, die sich sowohl in der Pikareske als auch im Politischen Roman verstärkt mit Erfahrung und Experientz verbindet. Mit der hier vorgeschlagenen veränderten Beobachtungseinstellung, die nicht auf ein generisches Tableau, sondern auf Textkomponenten und die narrativen Verfahren ihrer Integration fokussiert, lassen sich dann zwei komplementäre Tendenzen bestimmen: Während der Protagonist der Haupthandlung charakteristischerweise vor allem als Beobachter auftritt und aus unmittelbaren Interaktionszusammenhängen herausgelöst ist, werden typisch pikarische Figuren und Handlungskonstellationen vor allem in den Binnenerzählungen präsentiert. Die schon im Lazarillo angelegte doppelte Funktion des Pícaro als Involvierter und Beobachtender erscheint im Politischen Roman in eine Haupthandlung und mehrere ihr funktional zugeordnete Binnenhandlungen aufgespalten. Was strukturell einer axiologischen Vereindeutigung zuarbeiten könnte, scheint in seinen Geltungsansprüchen freilich in einer Weise auf das Diesseits beschränkt, die Anlass zu Irritation geben könnte. Im Politischen Roman steht nicht mehr der sündhafte Mensch im Mittelpunkt, sondern die Torheit, die als ein Mangel an Klugheit und politischem Geschick bewertet wird. Nicht mehr Weltabkehr ist der Fluchtpunkt, sondern das Handeln in der Welt soll verbessert werden. Das Angebot einer geschlossenen moralischen Deutung wird bei Christian Weise, dem immer wieder eine religiöse Motivation nachgesagt wurde, dadurch konterkariert, dass in den Texten selbst die praktische Erfahrung ohne moralisierende Kommentare präsentiert wird. Ähnlich wie im französischen Bereich scheinen sich pikarische Erzählmuster in der sich ausdifferenzierenden Narrativik besonders in Genres einer ‚mittleren‘ Stillage wiederzufinden. Dagegen scheinen hoher Roman und pikarische Erzählmuster eher zu divergieren, trotz Affinitäten an der Textoberfläche: Beiden ist die Integration einer wahren Flut an Wissen gemeinsam, in der Iustina Dietzin, dem Frantzösischen Kriegs-Simplicissimus und Ettners medizinischen Romanen ebenso wie im Arminius oder der Asiatischen Banise. Die Abgrenzung gegenüber dem hohen Roman, dem Heliodor’schen Erzählmodell, bestünde nicht nur in der Auswahl von niederen Stoffen und ebenso wenig in einer ‚realistischeren‘ Darstellung (wie man sie Grimmelshausen nicht selten nachgesagt hat), sondern eher in der Formung und Präsentation bzw. Produktion von Wissen sowie in ihrer Bindung an eine pikarische Figur. Wo der höfisch-historische Roman im Schlusstableau ein durch Providenz oder Fatum erklärtes Ordnungsgefüge darbietet, in das sich auch das entfaltete Wissen fügen soll, präsentiert das pikarische Erzählen Unabgestimmtheit und Nicht-Hierarchisierbarkeit von Wissenselementen, die sich keinem übergeordneten Sinnzentrum fügen, und verzeichnet Hohes neben Niederem, Marginales neben Zentralem und Profanes neben Religiösem
32
Jan Mohr/Carolin Struwe/Michael Waltenberger
ohne klare axiologische Zuordnungen. Im hohen Roman erscheinen Wissensbestände charakteristischerweise als statisch, und tendenziell bruchlos fügen sich ihre Konturen in eine Episteme der Repräsentation. Demgegenüber ist es gerade die Dynamik (und δύναμις) eines auf erfarung gegründeten und partikularisierten Wissens, die in pikarischem Erzählen in den Blick gerät. Diese Betonung des Partikularen schlägt sich dabei auch in der Konzentration auf einzelne Wissensfelder nieder. In der Ausdifferenzierung von Wissensbereichen werden Differenzen und markierte Oppositionen letztlich unterminiert. Eine systematische oder übergeordnete Einordnung über die Kasuistik hilfreicher Einzelbeobachtungen hinaus wird aber nicht beansprucht – die Geltung des Wissens hat nurmehr eine begrenzte Reichweite. Wo es im hohen Roman also um die demonstrative Bewältigung im Sinne der Erkenntnis einer ordnenden und damit sinngebenden göttlichen Instanz geht, wird gerade in pikarischen Erzählverfahren ausgestellt, wie aufgrund fehlender oder konkurrierender Instanzen die Chancen auf Bewältigung schwinden. Gerade im Hinblick auf die damit markierte epistemische Krise gegen Ende des 17. Jahrhunderts lassen sich in der Entwicklung des pikarischen Erzählens an der Schwelle zur Frühaufklärung sodann zwei gegenläufige Tendenzen festmachen, in denen das generische Spektrum und sein Potenzial noch einmal in Gänze vermessen wird: Einerseits wird im Frantzösischen Kriegs-Simplicissimus und den Medizinischen Maulaffen das pikarische Erzählmodell bis an seine Grenzen ausgereizt, indem es inkohärentes Erfahrungswissen – die „ungeschönte Differenz des Heterogenen“ (Ort, S. 290) –, das unabschließbare Erzählen und damit das nicht zu Bewältigende ausstellt und radikalisiert. Die paratextuelle Sicherung von Geltung wird dabei unterlaufen, in den Vordergrund rückt hingegen die Narration in ihrer Prozessualität. Auf der anderen Seite lassen sich im kolonialen Lazarillo de ciegos caminantes bereits aufklärerische Tendenzen festmachen, die, so ließe sich perspektivieren, die satirische Schlagrichtung pikarischer Erzählmuster für eine „utopische Gegenkonstruktion[ ]“ (Wehr, S. 324) zu kolonialen Machtdiskursen nutzen. Dass mit der Etablierung einer axiologischen Dichotomie aber nicht unbedingt ein normativ sinnstiftender Horizont einhergehen muss, dass also die pikareske Erzählanlage in der Aufklärung über Moralisierung, philosophische Begriffsschärfung und Rationalisierung in ihrer Progressivität vollends entschärft worden wäre, ist damit nicht gesagt: Wenn im Simplicissimus Redivivus das pikarische Erzählmuster nochmals regelrecht wiederbelebt wird – in Form der ‚Rematerialisierung‘ von Simplicissimus’ pikarischem Geist –, kann die Erfahrung einer pluralen Welt tatsächlich strukturell in die Binarität von nationalistisch angespitzten Parteien aufgelöst und damit als epistemisches Problem entschärft werden. Eine Rückkehr zur Moralsatire stellt dies freilich nicht dar;
Pikarische Erzählverfahren
33
stattdessen gibt der Text in seinen letzten Abschnitten zu bedenken, dass es nicht nur keine übergeordneten Normen mehr geben kann (was die Adaptationen des spanischen Erzählmusters ja zunächst als Aporie ausstellen), dass aber stattdessen eine Ausdifferenzierung in eine segmentierte Normativität vorstellbar ist, auf deren Grundlage sich sodann auch eine Gesellschaftsordnung generieren könne. Nimmt man ernst, dass der Ich-Erzähler im Simplicissimus Redivivus auf seinen letzten Seiten ein Kochbuch der verhassten Franzosen präsentiert, könnte man auch sagen: Jeder nach seinem Gusto – die in den pikarischen Texten immer wieder ausgestellte normative Pluralisierung wäre damit in einer segmentierten Pluralität (vorläufig) zur Ruhe gekommen.
Rainer Warning
Narrative Arbeit am Mythos vom göttlichen Schelm Quevedos Buscón
1 Der Schelm als duale Figur Mein Titel ist ein Doppelzitat: Hans Blumenbergs Arbeit am Mythos1 und der indianische Mythenzyklus Der göttliche Schelm, 1954 herausgegeben von dem Psychoanalytiker Carl Gustav Jung, dem Mythenforscher Karl Kerényi und dem Ethnologen Paul Radin.2 Blumenberg selbst hat diesen Schelmenmythos nicht zu einem seiner eigenen Themen gemacht. Es handelt sich um einen Zyklus der Winnibagos, vom Westufer des Michigan, der Sioux-Sprachfamilie angehörend. Er besteht aus episodischen Kurzerzählungen, niedergeschrieben von einem Winnibago-Indianer Sam Blowsnake und zunächst mündlich tradiert. Sein Protagonist ist ein Winnibago-Häuptling Wakdjunkaga, der wegen diverser Tabubrüche vertrieben wurde, ein bewegtes Wanderleben führte und am Ende gottähnlich verabschiedet wird. Die Abenteuersequenz ist aber nicht schon teleologisch auf dieses Ende angelegt. Ihr Reiz liegt in der Varianz der einzelnen Episoden mit ihrem brüsken Umschlag von Erfolg und Misserfolg. Wakdjunkaga ist ein Grenzgänger zwischen Animalität und Menschlichkeit. Animalisch sind sein Hunger und eine priapische Sexualität. Er hat einen extrem langen Penis, den er aufgerollt in einem Kasten mit sich herumträgt und den er bald zu seinem Nutzen, bald zu seinem Schaden aktiviert. Er kann ihn ausrollen und über größere Distanzen hinweg ans Ziel kommen lassen. Zieht er ihn wieder ein, läuft er Gefahr der Beschädigung, wobei aber die verloren gehenden Teile ihrerseits wieder fruchtbar werden
1 Hans Blumenberg: Arbeit am Mythos. 4. Aufl. Frankfurt am Main 1986. 2 Paul Radin, Karl Kerényi und Carl Gustav Jung: Der göttliche Schelm. Ein indianischer Mythen-Zyklus. Zürich 1954. Auf diese Untersuchung stieß ich im Rahmen meiner Beschäftigung mit Thomas Mann, dem sie in der Endphase seiner Arbeit am Felix Krull, also gleich in ihrem Erscheinungsjahr 1954 zur Kenntnis kam. Ich komme am Ende darauf zurück. Der Pikaroforschung scheint sie, soweit ich sehe, entgangen zu sein, mit Ausnahme der ertragreichen Studie von Alexander Honold: Travestie und Transgression. Pikaro und verkehrte Welt bei Grimmelshausen. In: Das Paradigma des Pikaresken. The Paradigm of the Picaresque. Hg. von Christoph Ehland und Robert Fajen. Heidelberg 2007 (GRM-Beiheft 30), S. 201–223, hier S. 212 ff.
36
Rainer Warning
können. Die Figur ist also ambivalent schon in ihrer Körperlichkeit, vor allem aber in ihrer Geistigkeit. Wakdjunkaga ist ein Schelm, gleichermaßen geprägt von List und Tölpelhaftigkeit. Er ist ein duales Wesen, dessen Zweiheiten sich nicht polar aufeinander beziehen lassen, nicht dialektisierbar sind. Er ist Schöpfer wie Zerstörer, Räuber wie Spender, Betrogener wie Betrüger. Er handelt impulsiv, kennt keinerlei Normen, lebt außerhalb jedweder Sozialität und Moralität. Radin charakterisiert ihn fazitartig wie folgt: Wir müssen zum Schluß wohl fragen, was der Inhalt und was der Sinn von diesem ursprünglichen Zyklus ist? Nach meiner Ansicht kann darüber kein Zweifel herrschen. Er vereinigt in sich die vagen Erinnerungen einer archaischen und uranfänglichen Vergangenheit, wo es noch keine klaren Unterscheidungen zwischen Göttlichem und dem Nicht-Göttlichen gab. Für diese Periode ist der Schelm das Symbol. Sein Hunger, seine Sexualität, seine Wanderlust gehören weder den Göttern noch den Menschen an. Sie gehören stofflich und geistig zu einem anderen Reich, und deshalb wissen weder die Götter, noch die Menschen etwas mit ihnen anzufangen. Das Symbol, das der Schelm verkörpert, ist kein statisches. Es enthält die Verheißung der Differenzierung, das Verheißen von Gott und Mensch. Aus diesem Grunde befaßt sich jede Generation mit einer Neuinterpretierung des Schelms. Keine Generation versteht ihn ganz, doch kommt auch keine ohne ihn aus. Jede Generation hat ihn in alle ihre Theologien und Kosmogonien aufzunehmen, ungeachtet der Einsicht, daß er nirgends in sie hineinpaßt, denn er vertritt nicht nur die unentwickelte und ferne Vergangenheit, sondern ebenso die unentwickelte Gegenwart, die jedem Individuum innewohnt. Darin liegt seine allgemeine und dauernde Anziehungskraft. Und so wurde er und blieb er alles für Alle: Gott, Tier, menschliches Wesen, Held, Possenreißer, er, der vor Gut und Böse da war, Verneiner, Bejaher, Vernichter und Schöpfer. Kurzum, der göttliche Schelm. Lachen wir über ihn, so grinst er uns an. Was ihm geschieht, geschieht auch uns.3
Dieses Lachen gehört zu seiner Dualität. Er lacht über seine eigenen Erfolge wie Misserfolge. Entsprechend dual ungerichtet ist das Lachen der Zuhörer. Es gilt dem Betrogenen wie dem Betrüger. Daher schließt Radin sehr treffend mit der Bemerkung, er grinse uns an, wenn wir lachen. Unser Lachen hinterlässt, so könnte man in Fortführung Radins sagen, etwas Unabgegoltenes. Das hängt auch mit der Episodizität des Erzählten zusammen. Lachen ist bekanntlich, wie alle Komik, episodisch.4 Insofern ist es epistemisch ‚offen‘ wie das Episodische des Erzählten. Die Episoden liegen jenseits aller Systematik bzw. Systematisierbarkeit. Sie lassen sich nicht zu größeren Einheiten sujethaften Charakters ordnen, höchstens zu kleineren, thematisch verwandten Sequenzen. Der Zyklus
3 Der göttliche Schelm (Anm. 2), S. 153. 4 Vgl. Rainer Warning: Elemente einer Pragmasemiotik der Komödie. In: Das Komische. Hg. von dems. und Wolfgang Preisendanz. München 1976 (Poetik und Hermeneutik 7), S. 279–333.
Narrative Arbeit am Mythos vom göttlichen Schelm
37
insgesamt ist ateleologisch, die Rede von der „Göttlichkeit“ eine, wie Radin sagt, „nachträgliche Konstruktion“.5 Dieser Zyklus also wurde 1912 von Radin ediert und kommentiert, er erschien 1954 zunächst in deutscher Übersetzung, 1959 in englischer. Mit den Übersetzungen begann eine breite Rezeption im Rahmen ethnologisch-mythologischer Trickster-Forschung. Schon Radin selbst sprach in der englischen Version vom Schelm als einem Trickster. Er hielt seinen Fund für dessen früheste und archaischste Erscheinung, für das erste Dokument eines weltweit verbreiteten Mythos, bis heute in Figuren wie dem Clown fortlebend. Für Radin, Kerényi und Jung war diese historische Perspektive entscheidend, für Radin der Übertritt von Natur in Kultur, für Kerényi ein Beitrag zur Mythenforschung, für Jung eher ein Regressionsphänomen, die Wiederkehr von Verdrängtem. Was nicht hinreichend zur Geltung kam, ist die Wiederholungsstruktur dieser Wiederkehr selbst, also die Serialität der schelmischen Maskerade. Hier erweist sich die nur gut zehn Jahre später erschienene Arbeit von Gilles Deleuze über Différence et répétition als Kompensation des Desiderats.6 Deleuze bewegt sich in einem mit den Namen Freud, Nietzsche und Kierkegaard bezeichneten Dreieck und löst sich dabei von allen Ursprungs- und Teleologieprämissen, bei Freud also von der Bedeutung der Urszene. Er unterscheidet zwei Arten der Wiederholung, die von ihm sogenannte „répétition nue“, die ‚nackte‘ Wiederholung, und die „répétition vêtue“, die ‚bekleidete‘. Erstere ist identitär, die Wiederholung eines Begriffs, eines Konzepts, eine teleologische Wiederholung desselben. Ihr Bereich ist der der Vernunft. Letztere ist nicht begrifflich, sondern bildhaft-szenisch, nicht identitär, sondern differenziell, wobei mit Differenz die Varianz der Wiederholungen gemeint ist.7 Ihr Bereich ist der des Imaginären, die Imagination ist für Deleuze die eigentliche vis repetitiva.8 Die Bindung an die freudsche Metapsychologie und damit an die Urszene ist abgekoppelt, Ausgangspunkt ist eine ebenso ursprungslose wie ateleologische Begierde, die sich manifestiert in einer offenen Serie von Masken. Hinter der Maske verbirgt sich keine Substanz, sondern immer nur wieder eine weitere Maske: Tatsächlich ist die Wiederholung das, was sich verkleidet, indem es sich konstituiert, und sich nur insofern konstituiert, als es sich verkleidet. Sie liegt nicht unter den Masken,
5 Der göttliche Schelm (Anm. 2), S. 148. 6 Gilles Deleuze: Différence et répétition. Paris 1968. Ich zitiere nach der ausgezeichneten und fast seitenidentischen Übersetzung ins Deutsche von Joseph Vogl (Gilles Deleuze: Differenz und Wiederholung. Aus dem Französischen von Joseph Vogl. 2., korrigierte Aufl. München 1997). 7 Ebd., S. 34 ff. passim. 8 Ebd., S. 106.
38
Rainer Warning
sondern bildet sich von einer Maske zur anderen, wie von einem ausgezeichneten Punkt zu einem anderen, von einem privilegierten Augenblick zu einem anderen, mit und in den Varianten. Die Masken verdecken nichts, nur andere Masken. Es gibt keinen ersten Term, der wiederholt würde […].9
Das fügt sich nahtlos mit Radins Formel vom Schelm als einem „archaischen Speculum imaginationis“,10 der priapischen Sexualität des Schelms mit dem Gegenpol eines immer implizierten Todestriebs.
2 Die Trickster-Welt Seit den 1960er-Jahren ist der Begriff des Tricksters auch in Arbeiten zum pikaresken Roman eingegangen. Bislang hat das allerdings eher zu einer bloß quantitativen Komplexitätssteigerung der ohnehin kaum noch überschaubaren Forschungsliteratur geführt. Ich will daher versuchen, zunächst mit einigen elementaren Differenzierungen die Pikareske des spanischen Spätbarocks als ein epochal wie räumlich begrenztes Korpus zu umreißen, das es verbietet, Früheres und vor allem Späteres unter dem Stichwort ‚pikaresk‘ bruchlos an dieses Korpus anzuschließen und damit Kontinuitäten zu suggerieren, wo das Insistieren auf Diskontinuität geboten wäre. Das erste Differenzierungsgebot betrifft Mündlichkeit und Schriftlichkeit. Wo immer man mit Radin den pikaresken Roman auf ein mythisches Substrat bezieht, setzt man oft vorschnell horizontale wie vertikale Kontinuität voraus, verleitet von Radins Auskunft, die Figur des Schelms finde sich in allen möglichen Kulturen, sie sei nur in Nordamerika besonders gut dokumentiert, und es habe sie schon immer gegeben, von der Antike bis ins Mittelalter, hier vor allem im Karneval. So ähnlich ist man ja häufig im Falle Rabelais’ verfahren. Vernachlässigt werden dann schriftliche Traditionen, sei es aus der Antike (Petronius, Apuleius), sei es aus dem Mittelalter, sodass schriftliche Vorgaben aus klassischer Tradition oft heillos vermischt werden oder gar untergehen neben einer angeblich karnevalesken ‚Volkskultur‘.11
9 Ebd., S. 34. 10 Der göttliche Schelm (Anm. 2), S. 9. 11 Freilich gibt es auch Ausnahmen, die sich um einen differenzierten Begriff des Karnevalesken bemühen, gerade auch in Bezug auf Quevedo. Als Beispiel verweise ich auf die dem Buscón gewidmeten Teile der bei mir entstandenen Dissertation von Bernhard Teuber: Sprache – Körper – Traum. Zur karnevalesken Tradition in der romanischen Literatur aus früher Neuzeit. Tübingen
Narrative Arbeit am Mythos vom göttlichen Schelm
39
Ebenso wichtig ist, dass man beim Trickster nicht einfach davon absehen kann, ob man sich in christlichen oder außerchristlichen Kontexten befindet. Die christliche Weltordnung hat auch die der Trickster-Welt wesentliche Unordnung zu disziplinieren gesucht, indem sie die Figur mit dem ohnehin schon ‚dummen‘ Teufel und also ihre Amoralität mit Teufelswerk, ja die Figur selbst mit dem Antichrist identifiziert hat. Das freilich konnte im Spanien des Barock nicht einfach vorausgesetzt und mitgemacht werden. Man fragt sich also, wieso gerade dort und zu jener Zeit ein Roman entstand und zur Blüte gelangte, der sich als IchRoman gleich auf seiner pragmatischen Basis, also bei der Erzählsituation, mit dieser Spannung konfrontiert sehen musste. Das kam der mit dem Namen Américo Castro verbundenen converso-These zugute,12 die einen engen Zusammenhang des pikaresken Romans mit den conversos herzustellen suchte, also den christlich getauften Mauren und vor allem den Juden, die man verdächtigte, ihrem alten Glauben weiterhin anzuhängen, wenn ihn nicht gar heimlich noch zu praktizieren. Für das messianische, also auf den Allmachtsgott noch offene Judentum selbst musste der Trickster nicht der Teufel sein; aber nicht alle betreffenden Autoren waren conversos, und Quevedo schon gar nicht, womit allerdings noch nichts gesagt ist über eine oft vorschnell postulierte satirische Aggressivität Quevedos seinem Geschöpf, dem Buscón gegenüber. In diesen Kontext gehört auch der Streit um die Rolle Augustins. In den Confessiones geht es bekanntlich zentral um eine Konversion, die Bekehrung des sündhaft ins Irdische verstrickten Ichs in ein Ich, das reuig auf sein früheres Leben zurückblickt. Für diese Doppelung des Ichs in ein weltverstricktes erlebendes und ein dieses aus der Rückschau kommentierendes, erzählendes Ich hat man den pikaresken Roman als die erste neuzeitliche Manifestation ansehen wollen, enden doch der Lazarillo de Tormes und Mateo Alemáns Guzmán de Alfarache mit der finalen Einkehr des Protagonisten, mit einem wie ernst auch immer gemeinten Reuebekenntnis. Aber es gibt auch Ausnahmen von diesem Schema innerer Ein- und Umkehr, und eine der bedeutendsten ist wiederum Quevedos Buscón. Diese Ausgestaltung der Erzählsituation aber hat Konsequenzen für die Inhaltsebene, also für die Art und Weise, in der sich die schon fast topisch als
1989 (Mimesis 4). Ich mache diesen Aspekt hier nicht thematisch, weil meine Fragestellung in eine andere Richtung weist. 12 Américo Castro: Perspectiva de la novela picaresca. [1935] In: Ders.: Hacia Cervantes. 3. considerablemente renovada ed. Madrid 1967, S. 118–142; ders.: De la edad conflictiva I: El drama de la honra en España y en su Literatura. Madrid 1961. Kritisch zu dieser These jetzt Susanne Zepp: Ironie, Inquisition und Konversion. Parodien von Inklusionsdispositiven im ‚Lazarillo de Tormes‘. In: Romanistisches Jahrbuch 56 (2005), S. 368–392.
40
Rainer Warning
satirisch qualifizierte Geschichte darbietet (wenn denn überhaupt die Pikareske mit diesem Begriff angemessen in den Blick gerät).
3 Zur Erzählsituation der Pikareske Man tut gut daran, sich generell dem Satirischen als poetologischer Kategorie nicht vorschnell zu nähern. Ich selbst jedenfalls will eine gewisse Animosität nicht verschweigen. Sie gründet darin, dass sich beim Satirischen die Weite des Begriffsgebrauchs einer Unschärfe deskriptiver Kategorien zu verdanken scheint. Wo immer man versucht hat, bei der satirischen Aggression eine spezifische Sprachlichkeit als eine über sprachliche Verfahren spezifizierte Vermittlungsebene abzuheben von der Ebene des Vermittelten, also dem Objekt der Kritik, der Aggression, ist man nicht weit gekommen, besonders dann nicht, wenn man weiter gefragt hat nach dem Verhältnis des Satirischen zum Komischen. Die Vermittlungsebene bleibt weithin abhängig vom Vermittelten, der Nachweis satirischer Aggression braucht zu seiner Plausibilisierung immer schon den Rekurs auf eine Referenz. Die Referenz saugt die Vermittlungsebene aus, satirische Tendenz ist eine Tendenz zur Mimesis auf Kosten des Ästhetischen. Statt mit dem Gegenstand sollte man daher besser mit der Pragmatik beginnen, also mit den spezifischen Verfahren seiner literarischen Inszenierung. Und die betreffen gleich das Verhältnis von Autor und Erzähler. Denn dieser Erzähler, also das erzählende Ich, ist selbst bereits ein inszeniertes, inszeniert von einem dahinterstehenden Autor, und die Doppelung von erlebendem und erzählendem Ich sagt noch nichts aus über die Art und Weise, in der sich der Autor zu den Kommentaren des erzählenden Ichs verhält, wie weit er sich mit ihnen identifiziert, sie ironisiert oder insgeheim gar negiert. Was wissen wir von diesen Autoren? Von dem des Lazarillo so gut wie nichts, von dem des Guzmán, also von Mateo Alemán, dass er wahrscheinlich, aber über Vorfahren, zu den conversos zählt, und von dem des Buscón, also von Quevedo, dass er der altkastilischen Oberschicht angehörte, die im Namen der honra und der pureza del sangre, der Reinheit des Bluts, eine streng katholische, altchristliche Identität zu wahren bestrebt war, was freilich noch nichts besagt über eine angeblich mit dem Buscón verfolgte Verteidigung der Ständegesellschaft gegen deren Bedrohung durch soziale Aufsteiger.13 Aber damit ist das eigentliche Problem nicht gelöst, wie denn dann das Verhältnis zwischen Erzähler und erzähl-
13 Das betont zu Recht María José Tobar Quintanar: El decoro cómico del ‚Buscón‘: parodía de la ‚Atalaya‘ de Mateo Alemán. In: La Perinola 16 (2012), S. 259–279, hier S. 274. Die Referenz auf diese mir ebenso wichtige wie sympathische Studie verdanke ich Matei Chihaia.
Narrative Arbeit am Mythos vom göttlichen Schelm
41
ter Figur zu fassen ist. Zwar kann sich der Erzähler personalidentisch auf sein früheres Ich zurückbeziehen, dessen Geschichte er kommentierend begleitet, wie das in den meisten Ich-Romanen der Fall ist. Er kann sich aber auch mit seiner eigenen Meinung verbergen bis zu dem Punkt, da der Leser mit der Perspektive des erlebenden und zugleich erzählenden Ichs allein gelassen ist, und von eben dieser Möglichkeit macht Quevedo einen ebenso konsequenten wie raffinierten Gebrauch. Denn mit dem Ausfall einer Kommentarebene verschwindet der Autor Quevedo hinter seiner Erzählung, der Leser wird mit einem erlebenden Ich allein gelassen, was es erzählt, ist eine Fiktion, hinter der sich der Autor verbirgt wie hinter einer Maske, um die Metapher von Deleuze aufzunehmen. So modelliert Quevedo schon mit der Erzählsituation eine Distanz, mit der er das erzählende Ich wie seine erzählte Welt in eine Alterität versetzt, in eine Heterotopie,14 die er mit den Listen eines Schelms füllen kann. Damit erklärt sich, dass auch dort, wo man zur converso-Hypothese nicht Position bezieht, diese Erzählerfigur selbst als ein Trickster in einer Welt voller Trickster erscheint. Theoretisch könnte man damit den Autor Quevedo selbst als Trickster innerhalb einer Welt von Trickstern und damit als einen geheimen Sympathisanten seines Buscón ansehen. Das führt zu Fragen, die bis zum heutigen Tag offen, aber nicht unwichtig sind für jede grundsätzliche Näherung dem Thematischen gegenüber und also auch und gerade der Frage des Satirischen.
4 Zur Struktur der pikaresken Episode Nirgends lässt sich die Pikareske so problemlos an den von Radin beschriebenen Schelmenmythos anschließen wie bei der dualen Struktur der Episoden. Wie die Autoren ihre Erzähler in deren marginaler Existenz wesentlich als gespaltene Figuren und nicht schon als autonome Subjekte inszenieren, so sind auch die paradigmatisch prozessierten Episoden grenzwertig, d. h. scheinbar auf dem Wege zu einer teleologischen Syntagmatik, die sie aber nicht erreichen. Wenn Radin also von einer „Verheißung der Differenzierung“ von Gott und Mensch spricht,15 so impliziert dies, dass das Erzählte noch weithin im Zeichen der Entdifferenzierung steht. Gewiss lassen sich die Episoden linguistisch als elementare Syntagmen mit Anfang, Mitte und Ende fassen, nicht aber als Einheiten eines übergreifenden Syntagmas, also eines teleologisch auf das Ende hin gespannten Sujets. Der Reduktion eines episodischen Dreischritts auf ein Dual, eine
14 Auf diesen Begriff komme ich unten ausführlich zurück. 15 Der göttliche Schelm (Anm. 2), S. 153. Zum Zusammenhang siehe das Zitat oben.
42
Rainer Warning
Dyade, ein Kipp-Phänomen entspricht eine wesentlich paradigmatisch prozessierte Makrostruktur. Paradigmatik kennt Steigerung, Sequenzbildung, zyklische Rückbezüge vom Ende an den Anfang, nicht aber übergreifende Strukturen sujethaften Charakters, wie sie insbesondere Jurij M. Lotman beschrieben hat,16 also keine binäre Raumsemantik, keine im Prinzip unüberschreitbare Grenze, keine gleichwohl statthabende und damit ereignishafte Transgression. Kurz: Der Pícaro ist kein Held im Sinne Lotmans. Und die gereihten Episoden bleiben Zweiheiten, Dyaden, sind nicht schon logische, also systembezogene Oppositionen. Das ist mir Anlass, einen Aufsatz aufzugreifen, in dem Roland Barthes bereits 1971 eine Arbeitshypothese im Blick auf die Proust-Forschung formuliert hat.17 Er beobachtet dort ein ständiges Umschlagen, einen „renversement“ von Figuren, Objekten, Situationen, Sprachen aus einem Zustand in einen ganz anderen. Eine hässlich, alt und sich vernachlässigend wirkende Frau erweist sich als hochrangige Adlige, ein von den Frauen verehrter Adelsspross als homosexuell, als „inverti“, wie sich nahezu die ganze Gesellschaft der Recherche am Ende als eine homosexuelle erweist. Aber diese sexuelle Inversion will Barthes nur als das auffälligste und in seinem Überraschungseffekt markanteste Beispiel für ein allgemeines Phänomen verstehen, nämlich als einen „dessin, qui conjoint dans un même objet deux états absolument antipathiques et renverse radicalement une apparence en son contraire“.18 Ich möchte nun die duale Episodizitat der Pikaresken gleichsetzen mit diesem „dessin“ als einem grenzwertig elementaren Narrativ, als eine Inversion, das Umschlagen eines Zustands in einen ganz anderen, also als ein Dual, das aller Normativität voraus liegt, die allemal oppositive Differenzierung mit entsprechender Markierung eines der beiden Terme voraussetzt. In Radins Winnibago-Mythos geht es in der 24. Episode darum, dass Wakdjunkaga sich entleeren muss, wie üblich ausgiebig, es will kein Ende nehmen, er kommt immer wieder auf seinem eignen Kot zu sitzen. Schließlich sucht er Rettung auf einem Baum, doch vergeblich: Sogar dort oben auf dem Ast, auf dem er saß, mußte er sich entleeren. Er probierte verschiedene Stellungen aus. Doch da der Ast sehr glatt war, fiel er hinunter und mitten in den Kot. Hinunter ging’s und hinein in den Dung. Ja, er versank vollkommen darin, und nur unter größter Anstrengung gelang es ihm, wieder herauszukommen. Seine Bärenfelljacke war voller Unrat, und als er herauskam, schleppte er sie hinter sich her. Das Bündel, das er
16 Vgl. Rainer Warning: Erzählen im Paradigma. Kontingenzbewältigung und Kontingenzexposition. In: Romanistisches Jahrbuch 52 (2001), S. 176–209, zu Jurij M. Lotman: Die Struktur literarischer Texte. Übers. von Rolf-Dietrich Keil. München 1972. 17 Roland Barthes: Une idée de recherche [1971]. Jetzt in: Roland Barthes u. a.: Recherche de Proust. Paris 1980, S. 34–39. 18 Ebd., S. 34.
Narrative Arbeit am Mythos vom göttlichen Schelm
43
auf dem Rücken trug, war mit Dung bedeckt, ebenso der Kasten, der seinen Penis enthielt. Diesen Kasten leerte er aus und lud ihn sich dann wieder auf den Rücken.19
Keiner der Pícaro-Autoren kannte den Winnibago-Mythos. Aber bei allen findet sich eine Episode, die an diesen Sturz erinnert. Quevedo bringt sie gleich im zweiten Kapitel. Zur Fastenzeit hat das Ritual des Hahnenkönigs, des „Rey de gallos“ statt. In der Schule wird Pablos ausgelost für den Ritt zum Marktplatz. Dortselbst kommt es zu einem Getümmel mit den Marktfrauen, der Klepper scheut, wirft Pablos ab, und der landet im Kot: „cayó conmigo en una – hablando con perdón – privada“ (S. 96); er „fiel mit mir (mit Verlaub zu sagen) in eine Dreckpfütze“ (S. 23).20 Das ist eine dual strukturierte Episode, vornormativ, allenfalls als karnevaleskes Ritual vorgegeben. Wie steht es dann aber um die pikareske Komik, um das Lachen, wenn es nicht, zumindest nicht primär und basal, ein satirisches Verlachen ist?
5 Pikareske Komik Das Lachen ist im pikaresken Roman allgegenwärtig, und zwar gerade auch in der Weise, das der Pícaro selbst lacht über das Gelingen seiner Listen und Streiche ebenso wie über ihr Misslingen. Gleich im ersten Kapitel des Lazarillo de Tormes entwendet Lázaro dem Blinden eine Wurst, der Blinde spürt ihr nach, dringt mit seiner Nase so tief in den Rachen Lázaros, dass der sich übergeben muss. Beim gemeinsamen Traubenverzehr beginnt der Blinde unvermittelt und ohne Kommentar, statt einer zwei zu nehmen, Lázaro sagt nichts, nimmt seinerseits drei und wird vom Blinden zur Rede gestellt. Woher wusste der das? Aus Lázaros Schweigen bei seiner eigenen Erhöhung auf zwei hat er geschlossen, dass der Diener ihn zu überbieten suchen und also drei nehmen würde. Das sind Beispiele für die duale Strukturierung der Listen des Tricksters. Sie münden in beiderseitiges Lachen, in das sie die umstehenden Zuschauer bzw. den Leser einbeziehen. Mit der Komiktheorie Henri Bergsons ist das nicht zu beschreiben. Dessen Basisdefinition ist bekanntlich das Komische als „du mécanique plaqué sur du vivant“, Lachen als „brimade sociale“,
19 Der göttliche Schelm (Anm. 2), S. 48 f. 20 Francisco de Quevedo: La vida del Buscón llamado Don Pablos. Hg. von Domingo Ynduráin. Madrid 81987 (Letras Hispánicas 124). Ich zitiere mit Seitenangabe im laufenden Text. Für ein deutschsprachiges Lesepublikum gebe ich, ebenfalls im laufenden Text, die Übersetzung von Herbert Koch nach der Ausgabe von Horst Baader: Spanische Schelmenromane, 2 Bde., München 1964, Bd. 2, S. 7–154.
44
Rainer Warning
als soziale Rache am nicht Angepassten, an sozialer „raideur“, „inadaptation“.21 Das setzt aber nicht Duale voraus, sondern Oppositionen, eben die Opposition von Mechanischem und Lebendigem, wobei dieses Lebendige normativ fundiert und priorisiert ist in Bergsons Vitalismus. Alles, was dem „élan vital“ zuwiderläuft, denunziert sich selbst oder muss satirisch denunziert werden als mechanisch. Seit jeher ist Bergsons Theorie wegen dieser ihrer ideologischen Bindung kritisiert worden. Man braucht nur die allbekannte Definition des Witzes als Auflösung einer gespannten Erwartung in nichts dagegenzuhalten. Das ist keine Opposition, sondern eben ein Dual, das lachend beantwortet wird. Helmuth Plessner ist dem gerechter geworden. In seiner bekannten Untersuchung über Lachen und Weinen beschreibt er das Lachen als Grenzreaktion auf Grenzsituationen, Mehrdeutigkeiten, Gegensinnigkeiten. Wir lachen über Dinge, mit denen wir intellektuell nicht fertig werden, die wir logisch nicht bewältigen, nicht in logische Strukturen wie Oppositionen bringen können. In solchen Fällen übernimmt der Körper die Antwort.22 Lachen ist nach Plessner wesentlich eine körperliche Reaktion, eine Antwort des Körpers auf epistemisch nicht beherrschbare Situationen und eben darin eine Grenzreaktion auf Grenzsituationen. Plessner bleibt zurückhaltend mit Beispielen, erst recht bei der Frage nach Strukturen dieser Grenzsituation. Daher darf man bei ihm auch nicht suchen nach dem Konzept des Duals. Ich möchte diesen Konnex versuchen: Mit dualen Situationen, Objekten, die wir logisch-oppositiv nicht beherrschen können, sind spezifisch pikareske Anlässe des Lachens gegeben. Lachend wird der Pícaro mit seinen Schelmenstreichen auch noch in ihrem Misslingen fertig, und dieses Lachen gibt er an seine Leser weiter. Freilich ist die von Plessner so beschriebene „Antwort“ des Lachens eine supplementäre, vom Körper übernommene. Das Lachen erledigt nicht den Anlass, sondern sucht mit ihm fertig zu werden. Plessner sieht darin allein eine positive Leistung, die sich der ‚exzentrischen Position‘ des Menschen verdanke: Der außer Verhältnis zu ihm geratene Körper übernimmt für ihn die Antwort, nicht mehr als Instrument von Handlung, Sprache, Geste, Gebärde, sondern als Körper. Im Verlust der Herrschaft über ihn, im Verzicht auf ein Verhältnis zu ihm bezeugt der Mensch noch sein souveränes Verständnis des Unverstehbaren, noch seine Macht in der Ohnmacht, noch seine Freiheit und Größe im Zwang. Er weiß auch da noch eine Antwort zu finden, wo es nichts mehr zu antworten gibt.23
21 Henri Bergson: Le rire. Essai sur la signification du comique. [1924] Paris 1969, bes. S. 29 und 103. 22 Helmuth Plessner: Lachen und Weinen. Eine Untersuchung nach den Grenzen menschlichen Verhaltens [1941]. 3. Aufl. Bern, München 1961 (Sammlung Dalp 54), S. 50 ff. 23 Ebd., S. 89.
Narrative Arbeit am Mythos vom göttlichen Schelm
45
Mir scheint schon diese Formulierung selbst etwas zu verraten, nämlich ein der körperlichen Reaktion allemal inhärent bleibendes intellektuell Unabgegoltenes. Und die Pikareske scheint mir nun genau mit dieser Ambivalenz zu spielen, wofür die oben zitierte Bemerkung Radins über den göttlichen Schelm höchst aufschlussreich scheint: „Lachen wir über ihn, so grinst er uns an.“ Unser Lachen findet seinerseits eine Antwort in diesem Grinsen des Schelms. Es spielt an der Grenze und spielt mit der Grenze zwischen dem Epistemischen und dem Imaginären. Der Schelmenmythos, so Radin, ist ein „archaisches Speculum imaginationis“, in dem der Kampf des Menschen mit sich selbst und mit der Welt widergespiegelt wird, eine Welt, wohin er ohne sein Wollen und ohne seine Zustimmung versetzt wurde. Damit aber sind wir unversehens auch schon bei Hans Blumenbergs Basisdefinition des Mythos, wenn er sagt: Mythen antworten nicht auf Fragen, sie machen unbefragbar. Die Geschichten, von denen hier zu reden ist, wurden eben nicht erzählt, um Fragen zu beantworten, sondern um Unbehagen und Ungenügen zu vertreiben, aus denen allererst Fragen sich formieren können. Der Mythos braucht keine Fragen zu beantworten; er erfindet, bevor die Frage akut wird und damit sie nicht akut wird.24
So erklärt sich, dass die narrative Arbeit an diesem Schelmenmythos zum Indikator für epistemische Krisen werden kann, Zeiten, in denen ein Bewusstsein für Alterität, für ein Anderes des vermeintlich Gewussten akut wird, so akut wie in der frühen Neuzeit, der Geburtszeit der Gattung des pikaresken Romans. Dann gewinnen Trickster an Attraktivität, Erzähler, die dem Leser Duale zuspielen, Duale, die man als epistemische Grenzgänger bezeichnen könnte: Indem sie sich präsentieren in entmarkierten Oppositionen, setzen sie Gewusstes außer Kraft, halten aber im Unabgegoltenen ihres Lachens ein Reflexionsmoment wach. In diesem Kontext aber gilt es speziell auch die Listen des Pícaro zu sehen. Hans Blumenberg hat anlässlich der Göttermetamorphose einmal gesprochen vom „mythologische[n] Gepräge“ der List. Die Olympier müssen zum Erreichen ihres Ziels gegebenenfalls „Umwegigkeit“25 in Kauf nehmen und damit gleichsam unter ihr Niveau gehen, was aber ihre Göttlichkeit kaum affiziert. So besehen, indizieren ihre Listen Entmächtigung bei beibehaltener Exzeptionalität, und mir scheint, dass eben dies auch für die Listen des göttlichen Schelms gilt. In ihnen begegnen sich beide: Entmächtigung wie beibehaltene Exzeptionalität. Darin
24 Blumenberg: Arbeit am Mythos (Anm. 1), S. 142, 203 f., 219. 25 Hans Blumenberg: Wirklichkeitsbegriff und Wirkungspotential des Mythos. In: Terror und Spiel. Probleme der Mythenrezeption. Hg. von Manfred Fuhrmann. München 1971 (Poetik und Hermeneutik 4), S. 11–66, hier S. 30.
46
Rainer Warning
gründet das wesentliche Alleinsein des Schelms. Er gehört noch nicht in die Welt sozialer Formationen, er hat keine ständigen Freunde und kennt sich zwar aus in sexueller Vereinigung, die aber nichts zu tun hat mit der Aussicht auf dauerhafte Intersubjektivität. Es gibt keinen verheirateten Schelm, der noch Schelm geblieben wäre.26 Ebenso wenig erreicht er, wie wir bereits bei Radin lasen, die Differenzierung von Gott und Mensch. In eben dieser Unentschiedenheit gründet das von ihm hervorgerufene Lachen. Er bleibt bei allem Lachen, das er provoziert, ja gerade in diesem Lachen ein sich entmächtigendes wie exzeptionelles Wesen. Darum wird er nie verlacht. Seine Exzeptionalität ist vorgesellschaftlich, sein Raum ist der Grenzbereich zwischen sozial-normativer Differenzierung und einer mythischen Alterität, in der er sozial nicht belangbar ist und also auch nicht mit einem Sozialität allemal voraussetzenden Verlachen. Wenn aber seine Listen eben diesem Grenzbereich entstammen, passen sie auch nicht einseitig in den sozialen Raum. Daher kann der Schelm auch nicht als Ausgangspunkt historisch variabler Subjektentwürfe dienen. Wer hierfür den Pícaro in Anspruch nimmt, verrät damit immer auch eine Ambivalenz von narrativer Lust an der List und epistemischer Bedeutsamkeit. Der Umgang mit dieser Ambivalenz deckt das Spektrum der Pikareske des 17. Jahrhunderts ab, aber auch das ihrer Rezeptionsgeschichte. Diese Ambivalenz soll gleichsam programmatisch die folgenden Überlegungen leiten.
6 Der Buscón als exemplarische Einlösung des Schelmenmythos Kein Autor der frühen Neuzeit hatte ein solches Bewusstsein dieser Zeit wie Quevedo. Er hat den Zerfall des altkastilischen Sozialgefüges und die Krise der spätbarocken Episteme universaler Analogie durchschaut und unterschiedlich darauf reagiert, am irritierendsten wohl mit dem Buscón.27 Unter pragmatischem,
26 Die Ehe des Lázaro sichert als Einwilligung in den ménage à trois mit einer Konkubine des Erzpriesters sein Amt eines öffentlichen Ausrufers, gehört also ins Paradigma seiner Listen. Narratologisch besehen ist dieser ménage à trois ein raffiniert verstecktes Spiel mit der Schwierigkeit, dass sich serielles Erzählen nur um den Preis eines sozusagen ‚faulen Kompromisses‘ an ein Ende bringen lässt. 27 Mit dieser Krise beziehe ich mich auf eine namentlich von Michel Foucault: Les mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines. Paris 1966, hier Kap. II, ausgelöste Diskussion über den Zerfall der barocken Episteme universaler Analogie, die besonders intensiv und kontrovers in der deutschen Hispanistik geführt wurde und wird. Ich kann hier nur die für meinen Kontext wichtigen Aspekte aufrufen und verweise im Übrigen auf Joachim Küpper und
Narrative Arbeit am Mythos vom göttlichen Schelm
47
also die Erzählsituation betreffendem Aspekt besteht eine Besonderheit dieses Romans in der bereits erörterten Distanz zwischen Autor und Erzähler. André Stoll spricht geradezu von einem „Zynismus [, mit dem] dieser Autor sich an der Ohnmacht des in einem circulus vitiosus gefangenen Pícaro erfreut; er erweist sich als erbitterter Feind seines eigenen literarischen Geschöpfs“.28 Das aber ist bereits eine Interpretation der Distanz, die exemplarisch zeigt, wie schnell man zu kurz greifen kann, wenn man wie selbstverständlich für die Satirethese optiert. Schon die Rede vom Satirischen überhaupt ist bei der Pikareske alles andere als selbstverständlich. Bekannte Basisdefinitionen der Satire wie „ästhetisch sozialisierte Aggression“29 oder „funktionalisierte (mediatisierte) Ästhetik zum Ausdruck einer auf Wirkliches negativ und implizierend zielenden Tendenz“30 rechnen mit einem Richtungssinn und damit einer Referenzierbarkeit der Objekte des Lachens, die der Pikareske abgehen. Am ehesten lässt sich noch mit der weiten Bestimmung des Satirischen als „transparente[r] Entstellung“31 arbeiten, weil sie das Satirische auf das Komische öffnet und damit Raum lässt für eine komische Positivierung von Negativität, die dem Umschlagen des pikaresken Duals Rechnung trägt oder aber selbst diese Struktur wiederum außer Kraft setzt, womit das Lachen zum eigentlichen Problem des Ganzen wird. Bei Quevedos Buscón geht es, wie wir sehen werden, zentral um diese Problematik. Gleich zu Beginn haben wir Beispiele für Dualität. Der Pícaro wird einerseits ostentativ negativ, andererseits aber mit einer den Leser eher gewinnenden Paradoxie von erlittenen Qualen und der Leichtigkeit ihrer Verarbeitung insze-
Friedrich Wolfzettel (Hg.): Diskurse des Barock. Dezentrierte oder rezentrierte Welt? München 2000 (Romanistisches Kolloquium 9). 28 André Stoll: Scarron als Übersetzer Quevedos. Studien zur Rezeption des pikaresken Romans ‚El Buscón‘ in Frankreich (‚L’Aventurier [sic!] Buscon‘, 1633). Diss. masch. Universität zu Köln, S. 254. Hans Gerd Rötzer hat sich im Nachwort zu dem von ihm herausgegebenen ReclamBändchen nachdrücklich mit dieser Sichtweise identifiziert: „Der Buscón dagegen ist eine ‚Abrechnung‘ des tatsächlichen Autors mit seiner erfundenen Figur. Buscón hat keine Chance, sich zu rechtfertigen; er ist nicht nur dem Gelächter der Leser, sondern auch dem zynischen Spott seines Erfinders ausgesetzt. Diese Aufhebung der Rechtfertigungsperspektive hat System; sie zeigt, dass Quevedo sehr wohl den Sinn der pikaresken Ich-Perspektive begriff, nur führte er sie aufgrund seiner gegenläufigen Erzählsituation ad absurdum“ (Der europäische Schelmenroman. Stuttgart 2009, S. 119). Ich zitiere so ausführlich, weil diese Sichtweise als Negativfolie für meine eigene Interpretation lesbar ist. 29 Jürgen Brummack: Zu Begriff und Theorie der Satire. In: DVjs 45 (1971), Sonderheft: Forschungsreferate, S. 275–377, hier S. 282. 30 Klaus W. Hempfer: Tendenz und Ästhetik. Studien zur französischen Verssatire des 18. Jahrhunderts. München 1972 (Romanica Monacensia 5), S. 34. 31 Wolfgang Preisendanz: Zur Korrelation zwischen Satirischem und Komischem. In: Warning/ Preisendanz (Anm. 4), S. 411–413, hier S. 413.
48
Rainer Warning
niert. Sein Vater ist Henker, seine Mutter vermutlich jüdischer Herkunft, sie gilt im Dorf als Hexe und Kupplerin, die Inquisition hat sie bereits im Visier. Pablos, der Buscón selbst, steht zudem noch im Ruf unehelicher Geburt, sein Onkel ist Scharfrichter. All das ist eine Charakterisierung, die man, wollte man sie soziologisch betrachten, als Beispiel pikaresker Marginalität nehmen könnte, würde sie diese Verortung nicht gleichzeitig derart überziehen, outrieren, dass die Fiktion in Konkurrenz tritt zu den Realreferenzen und also aus beidem, der ideologischen Negativierung des converso-Milieus wie seiner sprachlichen Positivierung dieser Entstellung, ihren ästhetischen Reiz gewinnt. Aber wo und wie wird im Text überhaupt eine ideologische Negativierung des converso-Milieus greifbar? Nirgends, wird man sagen müssen. Sie wird nicht greifbar aus einer Erzählsituation heraus, in der sich eine Ich-Origo im Sinne Karl Bühlers raumzeitlich und damit normativ-referenziell rekonstruieren ließe, ist doch der Buscón überall und nirgends zugleich. Und sie wird nicht greifbar in einer Autorposition, die sich hinter einer solchen sozialgeschichtlichen Besetzung zu erkennen gäbe, im Gegenteil: Eben diese Autorposition verbirgt sich hinter der Maske, die die Erzählung ist. Was dieser Zirkel umschreibt, ist eine Alterität, ein Ausfall der hic et nunc-Deixis, eine Heterotopik, die auch das Erzählte nur, wie wir bereits vermuten können, als Heterotopie lesbar macht. Was sich damit abzeichnet, ist der Irrweg, der überall dort beschritten wird, wo man die pikareske Erzählsituation zum Ausgangspunkt einer Gattungsgeschichte nehmen zu können glaubt, die sich als Beitrag zur Geschichte moderner Subjektkonstitution versteht. Am Anfang steht nicht Sozialkritik. Am Anfang haben wir die Maske und nur die Maske. Pablos ist geboren in Segovia. Wenn sein Vater Henker ist und sein Onkel Scharfrichter, seine Mutter als Hexe und Kupplerin und er selbst als Bankert gelten, dann ist damit von Anfang an das fiktionale Dual im Spiel, das Wechselspiel von Aggression und in parodistischer Outrierung sich ausstellender Fiktion. Pablos sucht seinem Herkunftsmilieu zu entkommen. Nicht aber einem blinden Bettler verdingt er sich, sondern er tritt in die Dienste des Sohns des scheinbar altadligen Don Diego Coronel de Zúñiga, mit dem ihn bald ein Verhältnis verbindet, das freundschaftliche Verbundenheit suggeriert. Dieser Pícaro also ist, zumindest zunächst, nicht allein, er hat schon zur Schulzeit in Segovia einen Freund. Damit wäre, nimmt man Don Diegos Vater für einen Repräsentanten der alten Standeshierarchie, die vielzitierte typisch pikareske ‚Perspektive von unten‘ ersetzt durch eine Fusion von unten und oben, eine Infizierung der Ränder vom Zentrum her. Aber wie steht es um dieses Zentrum, wie um diese Ränder? Don Diego kann seinem Freund zwar nicht die eingangs bereits zitierte Blamage beim Fastenbrauch des „Rey de gallos“ ersparen, zu dem er in der Schule ausgelost wurde. Aber die bleibt noch rituell abgefedert und wird nicht etwa ausgeschrieben zu
Narrative Arbeit am Mythos vom göttlichen Schelm
49
einer Ständesatire auf defiziente Schulmeisterei. Das scheint sich zu ändern mit der Aufnahme des Studiums in Alcalá, wo die beiden Freunde untergebracht sind im Internat des vermutlich altjüdischen Licenciado Cabra, der mit seinem Geiz die Insassen zu ärmlichen Hungerleidenden schikaniert. Er bringt nichts auf den Teller: „Cenaron y cenamos todos, y no cenó ninguno“ (S. 108); „Man aß, alle aßen wir, und es aß keiner“ (S. 29). Das duale Wortspiel „cenamos todos“ – „cenó ninguno“ lässt den Hunger nicht vergessen, immerhin aber füllt es gleichsam substitutiv die leeren Teller. Die agudeza kann sich ausweiten zu grotesker Bildlichkeit. Die Hungerleidenden sind so heruntergekommen, dass sie im Hause von Don Diegos Vater kaum noch als Menschen erkennbar sind. Die Augen sind so eingefallen, dass es eines „esplorador[ ]“ (S. 114), eines Spähers bedurft hätte, der sie mit einem Federschwanz reinigte wie ein bis zur Unkenntlichkeit verstaubtes altes Gemälde. Der Arzt verordnet strengste Bettruhe über neun Tage: „Mandaron los doctores que por nueve días, no hablase nadie recio en nuestro aposento porque, como estaban güecos los estómagos, sonaba en ellos el eco de cualquiera palabra“ (S. 115); „Die Doktoren befahlen, niemand solle innerhalb von neun Tagen in unserm Zimmer laut sprechen; denn da unsere Mägen so hohl waren, tönte in ihnen das Echo eines jeden Wortes wider“ (S. 33). In den hohlen Mägen kehren die leeren Teller wieder, der medizinische Beistand erlaubt gleichsam nebenher einen Hieb nicht nur auf die Ärzte, sondern mit der Verordnung neuntägigen Schweigegebots auch auf die christliche Novene, was sich aber fast verliert hinter der Ursache des Ganzen, also dem Geiz Cabras. Eine Fülle satirischer und bis zu tendenziell selbstreferenziellem Wortspiel vorgetriebener Referenzen substituiert gleichsam die Leere des Hungerinternats. Aber hier stellt sich wiederum die Frage, wie sich dieses selbstreferenzielle Wortspiel mit satirischer Referenz verträgt. Und so geht es denn auch gleich weiter mit einer Variante der Cabra-Episode im Studium an der Universität von Alcalá. Unüberbietbar erscheinen hier die Schikanen dem Neuling gegenüber. Vor den rituellen Spucksalven flüchtet Pablos unter der Beteuerung, er sei kein Ecce Homo (S. 128; 41), ins Haus des Morisken, bei dem er sich mit Don Diego einquartiert hat. Diese Beteuerung ist nur ein Beispiel all jener häretischen biblischen Referenzen, die die Altkastilier Mauren, Juden wie conversos zuschrieben, aber wenn man diese als von Quevedo mitgemeint annimmt wie schon bei Cabra, so doch gewiss nicht als Aggressionsobjekt aus dem Geiste der Inquisition, wie wir sogleich sehen werden. Zwar werden die Spucksalven noch überboten von den nächtlichen Schikanen, die Pablos’ Bett in ein Kotlager verwandeln, aber wenn all das wiederum zu seinem Entschluss führt, sich diesem Milieu anzupassen und darin eine „nueva vida“ (S. 132), ein „neues Leben“ (S. 45), zu beginnen, so ist das vermutlich ein ironischer Hieb auf
50
Rainer Warning
den moralisierenden Mateo Alemán,32 der mit Guzmáns Reue gewartet hatte bis zu jener Schinderei auf den Galeeren, wo der Geplagte eine geplante Meuterei verrät und sich damit eine Begnadigung von höchster Stelle verdient. Und so darf es denn auch im Buscón nicht überraschen, wenn bei Pablos das ‚Neue Leben‘ nach der ‚Novene‘ eher den Fortgang der Reihe zu Schlimmerem und damit immer wieder Komischem bringen wird. Das folgende Kapitel wird denn auch eröffnet mit einem dieser Konversion angemessenen Sprichwort; „‚Haz como vieres‘, dice el refrán, y dice bien. De puro considerar en él, vine a resolverme de ser bellaco con los bellacos, y más, si pudiese, que todos“ (S. 133), „‚Mach’s, wie Du’s siehst‘, heißt ein Sprichwort, und es hat recht damit! Als ich über das Sprichwort nachdachte, kam ich zu dem Entschluß, mit den Schurken ein Schurke zu sein und, wenn möglich, ein größerer noch als alle zusammen“ (S. 45). So beginnt er im Hause Don Diegos dessen Haushälterin zu schikanieren bis hin zur Erpressung mit der Suggestion, ihr den Hühnern geltendes „¡Pió, pió!“ sei ein der Inquisition anzuzeigender sündhafter Gebrauch von Papstnamen (S. 138; 49), was die Haushälterin, eine heuchlerische conversa, zu Gefälligkeiten jeder Art bereit macht.33 Diese Strategie scheint einen vorläufigen Höhepunkt zu finden in ihrer Ratifizierung durch Don Diego selbst: „Era de notar ver a mi amo tan quieto y religioso, y a mí tan travieso, que el uno exageraba al otro o la virtud o el vicio“ (S. 134); „Es verdient Beachtung, meinen Herren so ruhig und fromm, mich jedoch so verschmitzt zu sehen, und so hob sich durch Tugend das Laster wieder auf oder umgekehrt“ (S. 46). Diese wechselseitige Neutralisierung von Tugend und Laster hebt knapp und bündig die Opposition selbst auf, diese wird entmarkiert und damit dekonstruiert zum pikaresken Dual.
32 Siehe dazu wiederum Tobar Quintanar, die im Rahmen der von ihr für Quevedo postulierten Ablehnung literarischen Moralisierens zugunsten entfesselter Komik geradezu von einer Parodie auf den Guzmán spricht. Sie hält es für unplausibel, Quevedo habe aus der Perspektive der überkommenen ständischen Ordnung den Buscón verspotten wollen, ja sie sieht schon in der Möglichkeit sozialen Aufstiegs eine moderne Rückprojektion (Tobar Quintanar [Anm. 13], S. 259– 279, bes. S. 274 f.). 33 Das spricht für Quevedos fast schon provokantes Spiel mit der Inquisition. Vgl. dazu Enrique Gacto Fernández: Sobre la censura literaria en el s. XVII: Cervantes, Quevedo y la Inquisición. In: Revista de la Inquisición 1 (1991), S. 11–61. Diese Referenz verdanke ich ebenfalls Matei Chihaia.
Narrative Arbeit am Mythos vom göttlichen Schelm
51
7 Pablos’ Konversion Im siebenten Kapitel erhält Pablos einen Brief von seinem Onkel, dem Scharfrichter, der ihm mitteilt, dass er seinen Vater gehenkt habe, mit welchem Heldenmut der die Prozedur über sich habe ergehen lassen, dass er anschließend gevierteilt und zu Pasteten verarbeitet wurde, an denen die Bäcker gut verdient hätten, dass seine Mutter jede Nacht mit einem Bock Sodomie betrieben habe und zusammen mit vierhundert anderen Frauen am Dreifaltigkeitstag hingerichtet würde und dass schließlich er, der Oheim, ein von den Eltern hinterlassenes kleines Vermögen verwalte, das Pablos bald abholen möge. Zugleich hat Don Diego einen Brief von seinem Vater erhalten, in dem dieser ihm befiehlt, sich von Pablos zu trennen, was er auch tun will, aber nicht ohne Pablos zuvor bei einem anderen, ihm befreundeten „caballero“ in Dienst gegeben zu haben. Darauf aber legt Pablos keinen Wert, die Aussicht auf ein kleines Vermögen ist ihm wichtiger: „Señor, ya soy otro, y otros mis pensamientos; más alto pico, y más autoridad me importa tener. Porque, si hasta ahora tenía como cada cual mi piedra en el rollo, ahora tengo mi padre.“ Declaréle cómo había muerto tan honradamente como el más estirado, cómo le trincharon y le hicieron moneda, cómo me había escrito mi señor tío, el verdugo, desto y de la prisioncilla de mamá, que a él, como a quien sabía quién yo soy, me puede descubrir sin vergüenza. (S. 149 f.) „Mein Herr! Ich bin ein anderer geworden, und auch meine Gedanken haben sich geändert; ich strebe höher hinauf, und es paßt besser zu mir, einen höheren Rang einzunehmen. Bisher strebte ich wie jeder andre in die Höhe, mein Vater aber strebte noch höher!“ Ich erzählte ihm, wie ehrenvoll er gestorben sei als ein Mensch, der nach dem Allerhöchsten strebte, wie sie ihn gevierteilt und dann zu Gelde gemacht hätten, wie mein Oheim, der Scharfrichter, mir das geschrieben habe, und dazu auch alles über die Festnahme meiner lieben Mutter. Denn da er wußte, wer ich war, konnte ich es ihm ohne Rückhalt anvertrauen. (S. 57)
Mit dieser Trennung vom Freund nun ist der Buscón allein, wie der Schelmenmythos es will. Was auffällt, ist die Absenz jedweder moralischen Empörung über das Erbgut der Eltern, Pablos’ Stolz auf das ‚ehrenvolle‘ Verhalten des Vaters auf der Leiter zum Galgen, dann die wiederum unkommentiert hingenommene Mitteilung der der Mutter angelasteten Untaten und ihres bevorstehenden Endes, und schließlich, als Fazit, Pablos’ Entschlossenheit zu seinem Streben nach Höherem, ja dem Allerhöchsten. Was auf die Trennung von Don Diego folgt, löst denn auch ein, was sie erwartbar macht. Bevor wir aber nach Madrid kommen, sei noch eine kleine Episode des Weges nach Cercedilla erwähnt, wo er das Geld abholen will. Beim Eingang eines Passes trifft er einen Eremiten, der den Rosenkranz betet, „el ermitaño rezando el rosario en una carga de leña hecha bolas, de manera que, a cada avemaría, sonaba un
52
Rainer Warning
cabe“ (S. 175 f.); „Der Eremit betete den Rosenkranz an seinem Meter Holz und ließ die Kugeln derart fallen, daß sie schon bei jedem Ave-Maria wie Billardbälle knallten“ (S. 73). In Cercedilla angekommen, macht wiederum eben dieser Eremit den Vorschlag, in einem Wirtshaus zusammen mit einem Soldaten Ave Marias zu spielen, aber auf eine Art und Weise, die Pablos kommentiert mit einem: „No dejaba santo que no llamaba; nuestras cartas eran como el Mesías, que nunca venían y las agurdábamos siempre“ (S. 177); „Er rief sämtliche Heiligen zu Hilfe, und unsere Karten waren wie der Messias; sie kamen nie, und wir erwarteten sie ständig“ (S. 74). All das sind Duale, Umschläge, Inversionen im Sinne von Barthes, transparente Entstellungen im Sinne von Preisendanz, die das Entstellte noch deutlich erkennen lassen, zugleich aber zeigen, wie sich pikareske agudeza vor das Objekt schiebt und dabei nicht davor zurückscheut, seine Künstlichkeit mit häretischer Perversion oszillieren zu lassen. Diese Episoden zeigen im Kleinformat, was sich später mit der Nonnenepisode in Ratlosigkeit steigert und erklären mag, weshalb Quevedo seine Autorschaft des Buscón verleugnete, um sich der Inquisition zu entziehen. Auf dem Weg von Cercedilla zurück nach Madrid begegnet er einem Don Toribio Rodríguez Vallejo Gómez de Ampuero, der das Vermögen seines Vaters durch eine Bürgschaft verloren haben will. Als er auf Pablos’ Nachfrage seinem Namen gar noch ein „Jordán“ hinzufügt, also Don Toribio Rodríguez Vallejo Gómez de Ampuero y Jordán, sieht Pablos sich in seiner Skepsis bestätigt: Mit „don“ beginnt, was mit „dan“ endet, „como son de badajo“ (S. 194); „was wie Glocken klang“ (S. 86). Dieses Glockenspiel „don“-„dan“ verweist gleichsam proleptisch auf eine Hochstapelei, wie sie in Madrid gang und gäbe ist, und in der Tat ist es auch eben dieser Don Toribio, der Pablos in dieses Madrid initiiert: Lo primero ha de saber que en la corte hay siempre el más necio y el más sabio, más rico y más pobre, y los extremos de todas las cosas; que disimula los malos y esconde los buenos, y que en ella hay unos géneros de gentes como yo, que no se les conoce raíz ni mueble, ni otra cepa de la que decienden los tales. Entre nosotros nos diferenciamos con diferentes nombres; unos nos llamamos caballeros hebenes, otros, güeros, chanflones, chirles, traspillados y caninos. Es nuestra abogada la industria; pasamos las más veces los estómagos de vacío, que es gran trabajo traer la comida en manos ajenas. Somos susto de los banquetes, polilla de los bodegones y convidados por fuerza. Sustentámonos así del aire, y andamos contentos. Somos gente que comemos un puerro, y representamos un capon. (S. 195 f.) An allererster Stelle müßt Ihr wissen, daß in Madrid die Dümmsten und die Klügsten, die Reichsten und die Ärmsten, also die größten Gegensätze zu Hause sind, daß sich hier die Bösen verbergen und die Guten verstecken und daß es immer wieder gewisse Leute, wie zum Beispiel mich, gibt, deren bewegliche und unbewegliche Habe ebenso unbekannt ist wie ihr Herkommen. Wir selbst unterscheiden uns durch allerlei Namen; so nennen wir einige gehaltlose, andre unfruchtbare, schale, ausgemergelte oder hungrige Ritter. Unsere
Narrative Arbeit am Mythos vom göttlichen Schelm
53
Schutzheilige ist die erfinderische Rührigkeit. Meistens haben wir leere Mägen; denn es fällt einem schwer, fremden Händen das Essen zu entlocken. Wir sind der Schrecken der Bankette, die Motten der Speisehäuser, das Geschwür der Schenken und immer ungebetne Gäste. So leben wir fast von der Luft und sind doch zufrieden. Wir können eine Zwiebel essen und uns dabei einbilden, einen Kapaun zu verzehren. (S. 87)
Was diese Initiation sprachlich konstruiert, ist eine Serie von Oppositionen, die durchgängig entmarkiert und damit zu Dualen werden, zu Dualen, die ineinanderkippen und eine Serie von Kipp-Phänomenen bilden. Im Kipp-Phänomen aber hat wiederum die Komiktheorie ein Strukturmoment freigelegt,34 das satirischer Komik die Basis entzieht. Mit seriellen Dualen wird ein satirisches Objekt nicht mehr eindeutig referenzierbar und dem Hörer bzw. Leser jene Einsinnigkeit entzogen, die ein satirisches Verlachen möglich macht. Es liegt also das genaue Gegenteil zu Bergsons Konzept vor, der das Komische, wie zitiert, schlicht als „du mécanique plaqué sur du vivant“ bestimmt, als Mechanisierung vitalistisch grundierter gesellschaftlicher Interaktion, als „brimade sociale“, als „soziale Rache“. Aber auch mit Plessner scheint man hier nicht einfach durchzukommen, sofern man das oben diskutierte Unabgegoltene der körperlichen Reaktion des Lachens mitbedenkt. Wenn also mit Don Toribios Initiation die Welt Madrids gleichsam proleptisch charakterisiert wird, so steht zu erwarten, dass sie in ihrer Undurchsichtigkeit zum idealen Lebensraum eines Pícaro wird, zugleich aber den Leser das Unabgegoltene seines Lachens spüren lässt. Damit ist der Rahmen abgesteckt, innerhalb dessen der Buscón seine „vida nueva“ und der Leser nach lachender Beantwortbarkeit suchen müssen.
8 Pablos’ Listen und Streiche Dass es dem Buscón an „industria“ nicht mangeln wird, steht zu erwarten, zumal er ja noch mit einem kleinen Vermögen ausgestattet ist und also vorderhand weitaus selbstbewusster und beweglicher agieren kann als ein Lázaro oder ein Guzmán. Er grüßt unbekannte „caballeros“ und kann damit umherstehenden Zuschauern einen Lakaien vorspielen, ja er kann sich, Geld hat er ja, ein Pferd mieten und nunmehr selbst als „caballero“ stur hinter einem unbekannten Lakaien herreiten, als sei er sein Herr (S. 253; 131). Er kann sich unter adligem Pseudonym in ein Gasthaus einmieten und, um die Skepsis seiner Mitbewohner zu zerstreuen, angebliche Freunde einladen, bei den Terminen aber verschwin-
34 Vgl. Wolfgang Iser: Das Komische: ein Kipp-Phänomen. In: Warning/Preisendanz (Anm. 4), S. 398–402.
54
Rainer Warning
den, sodass sein Haus leer und er selbst unerkannt bleibt – „enviar a mi casa amigos a buscarme cuando no estaba en ella“ (S. 234; 115). Wenn etwas misslingt, hat Pablos es schnell korrigiert, bis auf die Panne beim Heiratsbetrug. Die Auserwählte ist eine Doña Ana, bei der eine Mitgift von sechstausend Dukaten winkt, aber dieses Spiel verliert er, weil er nicht ahnt, dass es sich um eine Cousine Don Diegos handelt. Und diesem ehemaligen Freund entgeht keiner der zahlreichen Tricks des Buscón, weil er selbst im Madrider Milieu sich auskennt und Pablos brutal zusammenschlagen lässt. Als rächende Nemesis hat man Don Diego deswegen interpretiert,35 in Verkennung dieser Welt, in der das Faszinosum des Geldes längst alle Nemesis in die Absenz geschickt hat. Interessanter erschiene da die Frage, wie eindeutig es überhaupt um die ständische Integrität der Familie des Don Diego bestellt ist. Immerhin hatte der Vater ja zunächst der Freundschaft seines Sohnes mit Pablos zugestimmt, dann die beiden getrennt, und jetzt ist der Sohn nicht nur am Geld der Doña Ana interessiert, sondern darüber hinaus auch selbst in verdächtiger Weise milieukundig. Das ist so lesbar, als verberge sich hinter dem auffliegenden Heiratsschwindel nicht allein die Gegenläufigkeit eines scheinbaren Aufstiegs und eines realen Abstiegs, sondern eben das, was ich als die Infizierung des Zentrums von den Rändern angesprochen, aber nicht eigens zu meiner Fragestellung gemacht habe. Und immerhin hat ja auch Peter N. Dunn die Diegos mit guten Gründen als besonders raffinierte und skrupellose conversos identifizieren zu können geglaubt.36 Die sozialkritisch und/oder subjektgenetisch orientierte Pícaro-Forschung hat das herunterzuspielen gesucht. Mir hingegen ist Dunns Argument sympathisch, weil ich die Trennung der beiden anfänglichen Freunde im Sinne einer Arbeit Quevedos am Mythos vom göttlichen Schelmen lese und also als Ausbeutung einer sozialgeschichtlich vorgegebenen Struktur für das konstitutive Alleinsein des Schelms.
35 So Hans Gerd Rötzer: Francisco de Quevedo, Historia de la vida del Buscón […]. In: Der Spanische Roman vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Hg. von Volker Roloff und Harald WentzlaffEggebert. Düsseldorf 1986, S. 109–125, hier S. 119. 36 Peter Dunn zählt unter Bezugnahme auf familiengeschichtliche Untersuchungen von Luis F. Peñalosa und Carroll Johnson die Coronels von Segovia zu den conversos und die fiktiven Diegos also zu denjenigen, die sich nach ihrer Konversion nicht scheuten, gegen andere conversos Partei zu ergreifen, sofern ihnen dies nützlich schien (Peter N. Dunn: Spanish Picaresque Fiction. A New Literary History. Ithaca, NY, London 1993, S. 157 f.).
Narrative Arbeit am Mythos vom göttlichen Schelm
55
9 Das Madrider Gefängnis Und so bleibt er doch bei allen kleinen Erfolgen einem Milieu verpflichtet, das sich aus „caballeros de rapiña“, aus ‚Raubritter[n]‘ (S. 222; 106) zusammensetzt, und hier trifft jeder Gauner auf einen ihm wieder überlegenen, hier ist die Polizei schnell zur Stelle, und so landet auch der Buscón im Gefängnis. Dieses Madrider Gefängnis aber ist nicht etwa eine Institution des Rechts, sondern ein Ort, an dem alle Normativität untergegangen ist in einem sozialen wie moralischen Chaos, das alles überbietet, was Don Toribio in Aussicht stellte. Seine Initiationsrede hatte schon gezeigt, wie sich alle Oppositionen zu keinerlei sozialem oder moralischem System mehr fügen wollten. Das Gefängnis modelliert Quevedo denn auch zum Kataklysmus, es ist ein „calabozo“, ein Kerker-Loch (S. 223; 107). In ihm herrscht ein Hunger, der alle Einfälle eines Cabra bei Weitem übertrifft, eine Kälte, die die Gefangenen in der Dunkelheit der Nächte Wärme suchend zu Haufen zusammen kriechen lässt, bis die Läuse oder unerträglicher Kotgestank sie wieder auseinandertreiben, eine Bestechlichkeit der Wärter, sofern dazu überhaupt noch finanzielle Restmöglichkeiten existieren, ein in permanente Schlägerei ausartender Kampf aller gegen alle, ein Ort quasi animalischer Regression. Zur Galeere verurteilte Sträflinge sehnen sich schon nach ihrer Erlösung auf eben diesen Galeeren. Wenn Pablos diese Hölle überlebt, so vor allem deswegen, weil er in größter Not immer wieder zu ein paar Talern greifen kann, die ihm ermöglichen, das Schlimmste zu überleben und sich schließlich auch seine Freilassung zu erkaufen. Was er aber Quevedo damit ermöglicht, ist eine Reduktion des Chaos auf jenes Maß, das Pablos eine beobachtende Distanz sichert, die wiederum Voraussetzung ist für eine Versprachlichung im Sinne transparenter Entstellung. Aber selbst diese weit gefasste, Satirisches mit Komischem vermittelnde Formel ist dem Leser keine Hilfe mehr, wenn es zu Szenen kommt wie der folgenden. Gleich zu Beginn der Gefängnisepisode liest man unter dem Stichwort Bekleidung, die Gefangenen seien bereits verlumpt in die Hände der Häscher geraten, und wie dann noch weiter verfahren wird, liest sich so: A cuál, por asirle de alguna parte segura, por estar todo tan manido le agarraba el corchete de las puras carnes, y aun no hallaba de qué asir, según los tenía roídos la hambre. Otros iban dejando a los corchetes en las manos los pedazos de ropillas y gregüescos; al quitar la soga en que venían ensartados, se salían pegados los andrajos. (S. 224 f.) Den einen packte der Häscher, um etwas Festes in der Hand zu haben, weil ja alles so mürbe war, am nackten Fleisch, und auch da fand er nichts, woran er ihn hätte halten können, so wenig Fleisch hatte der Hunger an seinen Knochen gelassen; ein anderer ließ dem Häscher die Fetzen seiner Kleider und Hosen in den Händen zurück. Als man ihnen den Strick abnahm, an dem man sie aufgefädelt hatte, blieben die Lumpen daran kleben. (S. 107)
56
Rainer Warning
Bei solchen Bildern fragt man sich, ob hier überhaupt noch von metaphorischer Hyperbolik gesprochen werden kann. Iser beschließt seinen Durchgang durch Varianten des Kipp-Spiels mit der Frage, was geschehe, wenn „das Lachen als die Verarbeitungschance des Komischen seinerseits zum Kippen gebracht“ werde. Dann beginne „[u]nser Lachen […] zu erstarren“ und das geschehe „im Theater Becketts“.37 Nun ist Becketts Welt zwar nicht die die Welt Quevedos, aber das Prinzip einer fiktionalen Totalverfremdung ins Negative bei gleichzeitiger Komisierung macht auch bei ihm das Lachen zur Frage. Und Entsprechendes hat auch Preisendanz im Blick, wenn er generell im Blick auf die Satiretheorie sagt: Solange nicht nach den konkreten Bedingungen der Möglichkeit impliziter Gegenbilder gefragt wird, solange bleibt solche Gegenbildlichkeit ein bloßes dummy element der SatireTheorie. Und darum sehe ich einstweilen keine Nötigung, den Mephisto zum Humoristen zu erklären, obwohl er, als „der Schelm“ und als „der Geist, der stets […] verneint“, doch wohl kaum ein Ideal, eine Utopie, ein positives Gegenbild in petto haben dürfte – es sei denn, man nimmt sein „drum besser wär’s, daß nichts entstünde“ als Utopie und das „EwigLeere“, das er allem Geschaffenen vorzöge, als Ideal.38
Ich zitiere dies nur vorläufig als einen Weg zur Lösung jener exzessiven Inhumanität im Madrider „calabozo“ wie auch im Vorgriff auf die Nonnenepisode in Toledo. Hier wie dort verdichten sich die Wortspiele zu einer Opazität, die vom Leser kaum noch aufgelöst werden kann. Der Sprachwitz des Erzählers gerät auf die eine oder andere Weise an seine Grenzen.
10 Das Toledaner Nonnenkloster Noch sind wir in Madrid, und hier muss der wieder frei gekommene Buscón dort neu anfangen, wo ein Lázaro gleich zu Beginn seinen Weg suchte, beim Betteln. Aber er wäre nicht der Buscón, wenn er es nicht selbst hier in kürzester Zeit und dank überschüssiger Beherrschung biblischer Demutsformeln zu neuerlichem Erfolg brächte. Nachdem aber Don Diego den Heiratsschwindel entdeckt und ihm ein unsanftes Ende bereitet hat, geht es wieder bergab. Der Boden in Madrid ist für ihn zu heiß geworden. Am Ende steht Kinderdiebstahl, der Pablos zwar noch Finderlohn einbringt, aber auf dieser schmalen Basis will er doch nicht mehr in Madrid weitermachen, sondern in Toledo. Hier freilich geht es bald wieder so weit bergauf, dass er sich noch aufschwingen kann zum „galán de monjas“, zum Non-
37 Iser (Anm. 34), S. 402. 38 Preisendanz (Anm. 31), S. 415 f.
Narrative Arbeit am Mythos vom göttlichen Schelm
57
nenliebhaber (S. 265; 139). Das nimmt ein scheinbar abwesender Quevedo zum Anlass, den Buscón die gesamte Szenerie sine ira et studio beschreiben zu lassen: die Klosterkirche mit dem Ineinander von Vesper und geistlichem Spiel: unten, im Kirchenschiff, die Ausschau haltende geile männliche Kundschaft, oben, auf der Galerie, die nicht weniger geilen Nonnen. An den Trenngittern aus Holz oder Glas kommt es zu perversen Spielchen beider Geilheiten durch die Lücken hindurch bis hin zu Küssen an den Fenstern, Küsse wie die an einer verglasten Reliquie, „como güeso de santo“; „um ein Mädchen wie einen Heiligenknochen durch ein Gitter oder Glasfenster anzustarren“ (S. 281; 148). Das Kloster ist kaum von einem Bordell zu unterscheiden. Die prekäre Trennung durch die Gitterwände scheint ein Symbol für die im ganzen Roman hindurch inszenierte Fusion von Marginalität und Zentrum, für das Chaos dieser Welt, womit das Kloster zu einer Toledaner Variante des Madrider Gefängnisses wird. Aber dann erhebt sich doch Kritik, zwar nur draußen in einer anonymen Stimme auf der Gasse, als Replik auf jenen Buscón, der der nicht Erreichbaren zugeflüstert hatte „como sacerdote que dice las palabras de la consagración“ (S. 281), „wie ein Priester, der die Wandlung vollzieht“ (S. 148 f.) und dabei seinen Kopf so sehr an die Gitter gedrückt hatte, dass Spuren sichtbar blieben. „‚¡Maldito seas, bellaco monjil!‘, y otras cosas peores“, „‚Sei verflucht, du Nonnenjäger!‘, und noch Schlimmeres“ (S. 281; 149), hallt es ihm draußen auf der Gasse entgegen. Aber das bleibt zunächst ohne Wirkung, bis zu dem Tag des Evangelisten Johannes, an dem das perverse Spiel mit dem Ritus Formen annimmt,39 die dem Buscón offenbaren „lo que son las monjas“, „was Nonnen eigentlich sind“ (S. 281; 149). Immerhin hat Quevedo anders als beim Madrider Gefängnis der moralischen Norm eine wenn auch schwache Stimme gegeben und damit das Ende vorbereitet. Noch einmal will Pablos in Sevilla sein Glück versuchen, aber die Stationen folgen dicht aufeinander und bereiten damit die letzte Aufgipfelung vor, wenn er sich als „rabí de los otros rufianes“, als „Rabbi aller Gauner“ (S. 292; 154) und mit der Prostituierten, der Grajal, absetzen will in die Neue Welt. Freiwillig also ist diese Absicht nicht, will er sich doch den Konsequenzen seiner Verwicklung in einen Polizistenmord entziehen, und obendrein ist er selbst sich schon darüber im Klaren, dass auch drüben alles immer nur noch schlimmer kommen kann.
39 Es geht um Streitigkeiten zwischen den Verehrerinnen des Evangelisten Johannes und Johannes des Täufers.
58
Rainer Warning
11 Pikareske Virtuosität Im Madrid der Sueños haben wir eine Opposition von engaño und desengaño, die eine satirische Lesung für sich in Anspruch nehmen kann. So haben wir in El mundo por de dentro einen allegorisierten desengaño, der das Ich in einer Traumvision durch die Calle mayor de la Hipocresía führt und mit seinen Kommentaren alle ihnen Begegnenden ‚von innen‘ zeigt, also als Inkarnationen der Heuchelei.40 Im Buscón ist dieser desengaño abwesend. Erwähnt wird er, wenn ich genau genug gelesen habe, nur ein einziges Mal bei jenem Schreiberling, dessen Lebensunterhalt in einer unermüdlichen Produktion frommer Sprüche besteht, mit denen er eine ihn umgebende Bettlerschar versorgt. Und eben diese Zulieferung frommer Heuchelei ist mottohaft überschrieben als „Premática del desengaño contra los poetas güeros, chirles y hebenes“ („Verordnung zur Belehrung der leeren, schalen und wässrigen Poeten“ [S. 167; 67]). Im Madrid des Buscón sind wir in eine fiktionale Welt versetzt, in der der desengaño, wiewohl Konstituens dieser amoralischen Welt, nur noch als ironisches Zitat erscheint. Und Entsprechendes gilt für die Klosterepisode in Toledo. Was sich dort abspielt, steigert das Madrider Gefängnis noch darin, dass dort ‚nur‘ eine offizielle Institutionalisierung irdischer Rechtssprechung invertiert wurde, hier hingegen der offizielle Ort nicht nur irdischer Präsenz des Rechts, sondern auch des es gründenden Heiligen selbst. So hinterlässt der Buscón als dominierenden Eindruck den Ausfall jedweder Normativität, was „das Werkchen“, so Leo Spitzer in einer ihm gewidmeten brillanten Studie, in seiner amoralischen Frechheit und Tigergrazie noch unheimlicher [macht]: es ist ein Stück prall gespannten Lebens voll Weltsucht vor uns hingestellt – eine Entspannung in Weltflucht ist derartig komplementär, notwendig, geboten, daß wir Leser, um sie betrogen, nach dem Sinn jener Gestaltung tappen – und hilflos, unorientiert bleiben bis auf den heutigen Tag […].41
In meine Terminologie übertragen: Die epochal dominante, den Barock charakterisierende Opposition von engaño und desengaño verliert ihre Markierung, zerfällt, wie wir bereits sahen, in eine Pluralität von Dualen. Forciert wird damit auch das, was ich anlässlich Plessners als die anhaltende Fragwürdigkeit des Lachens bezeichnet habe, als das Unabgegoltene des komischen Gegensinns.
40 Francisco de Quevedo: Sueños y Discursos. Hg. von Francisco Abad. 2. Aufl. Madrid 1983, S. 129–152. 41 Leo Spitzer: Zur Kunst Quevedos in seinem Buscón. In: Ders.: Romanische Stil- und Literaturstudien. Bd. II. Marburg 1931 (Kölner Romanistische Arbeiten 2), S. 49–125, hier S. 53 (die Hervorhebungen dort durch Sperrdruck).
Narrative Arbeit am Mythos vom göttlichen Schelm
59
Wo also bleibt die Perspektive des Autors Quevedo auf diesen Wandel, die dem epistemischen wie dem sozialen Orientierungsverlust seiner Zeit Rechnung trüge? Hierfür aufschlussreich wird ein Begriff, der Spitzers Studie wie ein roter Faden durchzieht: die Formel vom pikaresken Virtuosentum, vom Buscón als einem Virtuosen, und zwar in seinen Listen und Gaunereien wie in der Verarbeitung ihrer Rückschläge. Spitzer spricht von einem „Charakter in seiner Selbstentfaltung, in der Entwicklung zur heiter-amoralischen Selbstbehauptung in der Welt“, ja geradezu einem „Selfmademan“.42 Die Wahl dieses Begriffs erscheint aus heutiger Perspektive als wenig glücklich, lässt er doch jenes ‚self-fashioning‘ des New Historicism assoziieren, das sozialhistorisch orientierte Studien zur Pikareske zu einem ihrer terminologischen Fixpunkte für die Annahme einer generischen Kontinuität von der Pikareske hin zum modernen Ich-Roman, wenn nicht gar noch bis zum Bildungsroman des 19. Jahrhunderts, genommen haben. Im Buscón ist schelmische Virtuosität, wie wir sahen, nicht virtuose Anpassung an vorgegebene Institutionen, sondern ein Spiel mit diesen Institutionen bis hin zu den kirchlichen. Das hat Quevedo gesehen bis hin zu der Konsequenz, seinen Pícaro als eine mythische Figur zu modellieren, und das bereits von Radin angesprochene Alleinsein dieser Figur wäre dann das, was Blumenberg als die „narrativen Kerne“ eines Mythos bezeichnet. Die Stabilität dieser Kerne verweist, weiter mit Blumenberg, auf die „geringe[ ] Vielfalt derjenigen menschlichen Sachverhalte, Bedürfnisse und Situationen, die sich in mythischen Konfigurationen abbilden oder diese zumindest formal ähnlich erscheinen lassen“.43 Dieser Kern hat also nichts mit einer heute so oft bemühten dezentrierten Subjektivität des Barock zu tun, sondern er verweist auf jene „Göttlichkeit“, mit der Radin die Figur des Schelms ausgestattet sieht und die auf ihr historisch je anders kontextualisiertes Potenzial lachenden Umgangs mit einer Welt verweist, die „den Menschen nicht durchsichtig ist und nicht einmal sie selbst sich dies sind“.44 Von allen Pícaros ist eine so verstandene „Göttlichkeit“ mit Quevedos Buscón noch am ehesten eingelöst. Daher meine Insistenz auf der Ateleologie der Episoden. Teleologisch ist allein das Erklimmen einer Karriereleiter, und zwar so, dass sich diese Leiter unter den Listen des Pícaro in nichts auflöst. Alle ‚Entwicklung‘ ist an diese Kautel pikaresken Trickstertums gebunden. Sie beherrscht die Gattung bis in die Aufklärung hinein, ja bis zu Thomas Manns Felix Krull, der bekanntlich zunächst als eine Parodie auf den Bildungsroman konzipiert war, worauf ich abschließend noch zurückkommen werde. In der Pikareske ist eine
42 Ebd., S. 92 (Hervorhebung im Original durch Sperrdruck) und 93. 43 Blumenberg: Arbeit am Mythos (Anm. 1), S. 303. 44 Ebd.
60
Rainer Warning
Subjektstelle vakant und mit dieser Vakanz jegliche Form von Intersubjektivität absent. Das Alleinsein des Schelms ermöglicht seine Aufwertung zum mythischen Kristallisationspunkt einer Rätselhaftigkeit, die sich gerade auch im widergöttlichen Spiel mit den Restbeständen institutionalisierter Sakralität zeigt. „Man kann sich“, so Spitzer anlässlich der Nonnenepisode, „solche an sich unnötige[n] Anspielungen auf die heiligsten Gestalten und Institutionen der christlichen Lehre nur aus einem Nichtloskommen von solchen Vorstellungen erklären, die, weil dem Herzen (und dem Auge!) so nahe, auch in anstößigem Zusammenhang sich auf die Zunge drängen. Weltsucht und Weltflucht rücken wieder einmal einander bedenklich nahe, so daß sie ineinander überzugehen scheinen […].“45 Das ist eine psychologische Erklärung, die einer anderen nachgeordnet werden sollte. Wenn man von der Opposition engaño versus desengaño als der barocken Basisopposition ausgeht, wird ja im Buscón der desengaño nicht ersatzlos fallen gelassen, sondern supplementär substituiert von einem Pícaro, den Quevedo sein Trickstertum im Text auf allen Ebenen einlösen lässt: auf der Ebene der dualen „burlas“ wie ihrer sprachlichen Inszenierung im dual strukturierten Witz, in der agudeza. Hier bietet Spitzers Abhandlung eine der reichhaltigsten Beispielsammlungen, die von späteren selten überboten wird. Was ich aus dem Text zitierte, zählt nur zu den besonders markanten und instruktivsten Fällen. Immer geht es um Antithesen auf Lexem- wie auf Satzebene, die umschlagen, die kippen im Sinne von Barthes’ „renversement“, der „inversion“: „Cenaron y cenamos todas, y cenó ninguno“, „don“–„dan“, „haciéndole lacayo sin serlo“ (S. 253), „enviar a mi casa amigos a buscarme cuando no estaba“. All das kann freilich nicht verdecken, dass der Weg weder ein teleologischer Aufstieg noch Abstieg ist, sondern eine ateleologische Reihung mit offenem Ende, eine potenziell unendliche Maskerade also. Wir haben im Buscón die exemplarische Inszenierung eines Schelms, der unser Lachen, so Radins treffliche Charakterisierung, mit einem Grinsen beantwortet und damit auf das Unabgegoltene dieser unserer Antwort im Sinne Plessners verweist. Was die „Göttlichkeit“ des Schelms substituiert, ist die vom christlichen Schöpfergott erwartete „garantierte Realität“, um die es im Übergang vom Barock zur Neuzeit schlecht bestellt war.46
45 Spitzer (Anm. 41), S. 87. 46 Mit dieser „garantierte[n] Realität“ beziehe ich mich auf die bekannte Arbeit von Hans Blumenberg: Wirklichkeitsbegriff und Möglichkeit des Romans. In: Nachahmung und Illusion. Hg. von Hans Robert Jauß. München 1964 (Poetik und Hermeneutik 1), S. 9–27. Blumenberg lokalisiert diese „garantierte Realität“ in seiner Sequenz historischer Wirklichkeitsbegriffe als den, „der für das Mittelalter und die als sein Resultat ansetzende Neuzeit fundierend ist“ (S. 11).
Narrative Arbeit am Mythos vom göttlichen Schelm
61
12 Pikareske Heterotopik Es bietet sich an, von hierher noch einmal auf die Welt des Pícaro zurückzukommen, und sogleich auf deren Zentren in Madrid und in Toledo. Man könnte auch sagen, dass das Madrider Gefängnis und die Toledaner Kirche modelliert sind als Heterotopien. Damit wäre man das Satireproblem los, besteht doch die Heterotopie nach Foucault wesentlich darin, dass sie aus einer gegebenen sozialgeschichtlichen Formation ‚andere Räume‘, heteroi topoi ausgrenzt, um diese Formation zu kontestieren und zu invertieren in „contre-emplacements“, „Gegenplatzierungen“. Foucault unterscheidet zwischen „hétérotopies de déviation“, also Orten desillusionierender Provokation einer diese Normalität reklamierenden Normalität wie psychiatrische Anstalten, Hospize, Gefängnisse, Jahrmärkte, Feriendörfer, Motels oder Bordelle, und „hétérotopies de compensation“ wie öffentliche Parks, zoologische Gärten, Theater oder Museen.47 Allemal geht es um Hervorbringungen oder Asyle eines utopischen oder dystopischen Imaginären, was erklärt, dass die von Foucault als soziologische Kategorien eines urbanistischen Diskurses entwickelten Heterotopien oft auch in der Literatur anzutreffen sind, ja dass Foucault immer schon auch solche Fiktionalisierungen mit im Blick hatte. Ich habe das des Näheren ausgeführt in meiner Arbeit über literarische Heterotopien, denen die Absage an jedweden mimetischen Anspruch wesentlich ist.48 Literarische Heterotopien sind Heraussetzungen eines Imaginären, und sie verdanken sich auch in ihrer Sprachlichkeit der Absage an jedwede diskursive Ordnung, sind in diesem Sinne konterdiskursiv. Geht man nun davon aus, dass pikareske Räume als ‚andere Räume‘ immer Homotopien sprengen, um sich ihrerseits zu einem übergreifenden heterotopen ‚Anderen‘ zu fügen, so wäre die Welt des Pícaro ein eindringliches Exempel für diese übergreifende Inversion. Pablos’ Weg von Segovia über Alcalá, Madrid, Toledo und Sevilla mit dem utopischen Ziel der Neuen Welt ist lesbar als Stationen einer solchen Reihe von Heterotopien, und dieser Offenheit der Reihe entspricht die potenzielle Unendlichkeit und letztlich auch Unreferenzierbarkeit konzeptistischen Wortspiels, das mit den räumlichen Inversionen einhergeht. So schreibt Quevedo mit seinem Buscón die pikareske Welt aus zu einer literarischen Heterotopie, die alle Bestimmungen des von Radin beschriebenen Mythos vom göttlichen Schelm in sich versammelt – einschließlich seines Grinsens angesichts der Antwortversuche derer, die ihm mit einem Verlachen vergeblich gerecht zu werden suchen. Ich zitierte eingangs die
47 Michel Foucault: Des espaces autres. In: Ders.: Dits et écrits. 1954–1988. Bd. IV: 1980–1988. Paris 1994, S. 752–762. 48 Rainer Warning: Heterotopien als Räume ästhetischer Erfahrung. München 2009.
62
Rainer Warning
These Blumenbergs, derzufolge der Mythos keine Fragen beantwortet, sondern dass er erfindet, bevor die Frage akut wird und damit sie nicht akut wird. Damit käme man zu dem Ergebnis, dass Quevedos Buscón die vielleicht am konsequentesten erarbeitete Maske des Pícaro ist, einschließlich dem Grinsen über diejenigen, die, wie insbesondere Literaturwissenschaftler, nicht müde werden, hinter diese Maske zu schauen.
13 Zur Rezeptionsgeschichte Mir scheint der Wert der Analysen Spitzers nicht allein in ihrer faszinierenden Ausbeute an sprachlichen Verfahrensweisen Quevedos zu liegen, sondern auch und vor allem darin, dass er mit ihnen zeigt, weshalb wir als Leser des Buscón mit einer Frage entlassen werden. Für die Rezeptionsgeschichte der spanischen Pikareske wichtiger geworden sind demgegenüber Texte, die, anders als Quevedo, mit der Doppelung von erlebendem und erzählendem Ich arbeiten. Das wären also der Lazarillo de Tormes und der Guzmán de Alfarache von Mateo Alemán. Lázaro bringt es am Ende immerhin noch zum öffentlichen Ausrufer in Toledo und zur Heirat einer Konkubine des Erzpriesters. Und Guzmán endet zwar auf einer Galeere, aber er verrät eine von seinen Leidensgenossen geplante Meuterei und wird dafür mit königlicher Urkunde freigelassen. Die Reue kommt zwar spät, aber das Schema christlicher conversio ist erfüllt, und so schließt denn auch das dritte und letzte Buch mit einer Laus Deo. So endet in beiden Texten die Reihung der Gaunereien in einem Einkehrschema, das freilich hier wie dort nicht frei von Ironie ist und die ganze Geschichte vom Ende her noch einmal unter das Zeichen einer amoralischen Fiktion bringt. Von dieser Duplizität ist zunächst auch die Gattungsgeschichte des pikaresken Romans geprägt, mindestens bis ins 18. Jahrhundert. Das brachte die Forschung auf eine Zweigleisigkeit, der Verwirrungen eingeschrieben waren. Man konnte die Listenreihung dominant setzen und damit selbst noch das Einkehrschema eines verbürgerlichten Pícaro unter diese Perspektive bringen, wenn man die Einheirat in eine reiche Kaufmannsfamilie als sein letztes Meisterstück interpretierte, sodass man wenigstens hier eine deutliche Zäsur zum Bildungsroman zu gewinnen glaubte. Man konnte aber auch schon die Anfänge im Spätbarock als dezentrierte Subjektivität interpretieren, womit man die Grundlage dafür schuf, die Gattungsgeschichte als eine Illustration neuzeitlicher Subjektgenese zu konzipieren, angefangen vom self-fashioning des New Historicism bis hin zu den ‚techniques de soi‘ des späten Foucault. In diesem Wirrwarr einer Übertheoretisierung bietet ein historisch-theoretischer Ansatz mit Radins Göttlichem Schelm zumindest den Vorteil einer Reihe
Narrative Arbeit am Mythos vom göttlichen Schelm
63
von Strukturmerkmalen, die das Pikareske selbst als Fokus wahren. Das ist zunächst und allem voran jene Grundierung im Imaginären, die für das Exzeptionelle eines ‚göttlichen‘ Schelms, also für seine Wurzeln im Mythos unabdingbare Voraussetzung ist. Entsprechendes gilt für die Folgebestimmungen wie das Dual, das Alleinsein des Schelms und sein ‚Grinsen‘, mit dem er auf jene reagiert, die über ihn lachen zu können glauben, aber nicht genau wissen, warum. Und das ist schließlich das Heterotopiekonzept, womit sich Radins Vorgaben bis in den Poststrukturalismus erhellend weiterführen lassen, weiter zumindest als der Begriff des Pikaresken selbst. Das Spanische ‚pícaro‘ stammt vermutlich aus dem Argot und meint soviel wie ungelernter Diener. In dieser Bedeutung taucht es in den frühen Romanen auf, zusammen mit ‚picardía‘. In der Widmung „Al lector“ kündigt Quevedo an, was dieser Leser finden werde: „todo genero de Picardia (de que pienso que los mas gustan) sutilezas, engaños, inuenciones, y modos, nacidos del ocio para viuir a la droga“ – „Bubenstreiche aller Art – deren größter Teil dir gefallen dürfte – Spitzfindigkeiten, Erfindungen und Tricks, von der Muße ausgebrütet“ (S. 78; 15). Der Romantitel indes ist hier wie generell ‚vida‘ oder ‚historia‘. Novela picaresca ist eine Erfindung der Gattungsgeschichtler, im Deutschen alternativ zu ‚Schelmenroman‘. Begriffsgeschichtlich wie gattungsgeschichtlich ist damit alles subsumierbar, was in etwa mit dem ‚Pikaresken‘ assoziiert und unter diesem Titel untergebracht werden kann. Aber weiter reicht das Klärungspotenzial des Begriffs und seiner Geschichte nicht. Schon La Geneste lässt seine französische Übersetzung L’Avanturier Buscón aus dem Jahre 1633 nicht offen enden wie das Original, sondern mit der Einheirat in die Familie eines Großkaufmanns. Damit scheint das Alleinsein des Schelmen preisgegeben, aber mit der Einheirat wird doch auch Wohlstand suggeriert, sodass diesem Preis die pikareske List offenbar nicht zum Opfer gefallen ist. Will man von einer Gattungsgeschichte des Pikaresken sprechen, muss man mit solchen Ambiguitäten, mit Inkonsistenzen und Diskontinuitäten rechnen, denen sich nur mit einem entsprechend weiten Gattungsbegriff beikommen lässt. Ich möchte daher mit Wolf-Dieter Stempel Gattungen fassen als „historisch-normhafte Kompatibilitätsfiguren von Textkomponenten“,49 deren systematische Beschreibung bei „Einzelkomponenten“ einzusetzen hat, „von denen kaum eine als spezifisch, d. h. als unverwechselbar und ausschließlich auf eine Gattung beschränkt angesehen werden kann“.50 Der Schelmenmythos wäre dann eine solche historisch-normative Kompatibilitätsfigur, nicht aber so etwas wie eine ‚Tiefenstruktur‘ des Pikaresken und der pikaresken Schreibweise, von der man regelhaft und das heißt innerhalb eines homogenen Erzeugungsmodells an die ‚Oberfläche‘ historischer Konkretionen gelangen könnte. Ich habe am Beispiel Quevedos zu
49 Wolf-Dieter Stempel: Gibt es Textsorten? In: Textsorten. Differenzierungskriterien aus linguistischer Sicht. Hg. von Elisabeth Gülich und Wolfgang Raible. Frankfurt am Main 1972 (Athenäum-Skripten Linguistik 5), S. 175–179, hier S. 178. 50 Ebd., S. 176.
64
Rainer Warning
zeigen versucht, wie reichhaltig an systematischem Potenzial der Mythos ist, was nicht ausschließt, dass die spätere Rezeptionsgeschichte anders gewichtet und manches wohl auch verschenkt. Quevedos Buscón ist gleichwohl kein Einzelfall geblieben. In der raffiniertsouveränen Inszenierung des systematischen Potenzials hat er zumindest einen Nachfolger gefunden, und das ist Thomas Mann, den ich bereits eingangs erwähnte (Anm. 2) und auf den ich hier abschließend zurückkomme. Die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull haben mit Unterbrechungen Manns Arbeit von den 1920er- bis in die 50er-Jahre begleitet. Man kann sie lesen als einen Metatext zu dem in diesem Zeitraum entstehenden Gesamtwerk Thomas Manns, was ich andernorts näherhin verfolgt habe.51 Der Krull war zunächst angelegt als eine Parodie auf den Bildungsroman, ließ aber mit dem „Kostümkopf“52 als einem göttlichen Glückskind eine besondere Nähe zu Karl Kerényi erkennen, dem Thomas Mann als Mytheninteressierter seit Langem nahestand. Und als dann 1954 Der göttliche Schelm erschien, war Mann einer seiner ersten Leser, entdeckte er doch hier eine „merkwürdige Koinzidenz“, wie es in einem Brief an Max Rychner vom 17. Oktober 1954 heißt. Kerény weise in seiner mythologisierenden Einleitung […] auf die Entwicklung bis zu Rabelais, Spanien, Simplicissimus, Eulenspiegel, Reineke Fuchs – und Felix Krull geradezu hin. Man weiß nicht, was man tut, erfährt es aber gern, besonders wenn man soviel Wert darauf legt, wie ich, sich in einer festen, möglichst weit zurückreichenden Tradition stehend zu wissen.53
Diese Bemerkung scheint mir von größtem Wert, macht sie doch den Krull lesbar als den sehr viel späteren Höhepunkt einer Gattungsgeschichte, die exemplarisch mit dem Buscón beginnt. Wir haben die offene Reihung der Abenteuer, die Faszination an der von Episode zu Episode wechselnden Maskerade, das permanente Umschlagen der Handlung je nach Einschätzung für das Gelingen der List, das ‚göttliche‘ Alleinsein des Schelms in all diesen Episoden, die bald mehr vom Lebens-, bald mehr vom Todestrieb beherrscht sind, und wir haben schließlich bei Thomas Mann auch jene ‚anderen Räumen‘ des Imaginären und damit jene literarische Heterotopie, als welche ich bereits den Buscón gelesen habe. Auch im Felix Krull schließen sich die dargestellten Heterotopien zum Gesamttext als
51 Vgl. Rainer Warning: Ästhetisches Grenzgängertum. Marcel Proust und Thomas Mann. München 2012 (Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, PhilosophischHistorische Klasse, Jahrgang 2012, H. 1). 52 Thomas Mann: Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull. Der Memoiren erster Teil (Thomas Mann: Gesammelte Werke in zwölf Bänden, Bd. 7, S. 263–661), S. 284. 53 Zitiert nach Thomas Mann: Tagebücher 1953–1955. Hg. von Inge Jens. Frankfurt am Main 1995, S. 686.
Narrative Arbeit am Mythos vom göttlichen Schelm
65
einer literarischen Heterotopie zusammen: Felix in der Wiesbadener Operette bei Müller-Rosé, in der faszinierenden Bewegtheit der Pariser Hotelwelt, bei den allzeit vom „Genickbruch“54 bedrohten Trapezkünstlern im Zirkus Stoudebecker, schließlich und vor allem bei Familie Kuckuck in Lissabon. Sie wohnt hoch droben über der Stadt, der kauzige Professor, seine Gattin Maria Pia da Cruz und ihre Tochter Zouzou. Lissabon steht mit Portugal metonymisch für die Iberische Halbinsel, die ihrerseits Ägypten assoziieren lässt, besonders deutlich bei der Corrida. Thomas Mann bringt hier mit Maria Pias Busenwogen und dem tödlich getroffenen Stier sein mythisch-mythologisches Ägypten-Phantasma zu einer Engführung, von der Felix und mit ihm der Leser nicht recht wissen, ob das zum Lachen ist, und wenn ja, weshalb.
54 Mann: Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull (Anm. 52), S. 455.
Thomas Althaus
Topische Radikalisierung und allegorische Kontrolle des Pikaresken in den frühen deutschsprachigen Adaptationen Das Pikareske fügt sich nicht den Modellierungen, in denen die literarische Prosa seit dem 18. Jahrhundert vor allem in genrespezifischer Hinsicht (als Roman und Novelle) mehr und mehr Struktur gewinnt. Es bleibt widerständig und geht bestenfalls als Unruhefaktor darin auf. Von jenen Modellierungen schreibt sich aber die entwickelte Erzähltheorie und Narratologie her, wenn sie ihre Analyseinstrumente an das Syntagma des Pikaresken hält. Damit impliziert sie Textordnungen, die ihrer Terminologie entsprechen, denen sich das hier Gemeinte aber nur sehr bedingt fügt. So rückt es in den Schein verwilderten und gebrochenen Erzählens. Für diese Sicht spricht ja auch einiges. Sie ist durch die Beschreibungsmöglichkeiten besagter Theorien gedeckt, außerdem sehr wohl auch durch die analytische Konzentration berechtigt, die der Einsatz solcher Möglichkeiten erzeugen kann. Aber die Faktoren gerade für das Exzessive und Fragmentierte des Pikaresken in der frühneuzeitlichen Schreibkultur sind damit noch nicht eruiert. Im Folgenden wird versucht, hierfür die topische Darstellung und die allegorische Interpretation in Anspruch zu nehmen, das eine als historisch verfügbares Muster rhetorischer Textgenese und das andere als Auslegungsanstrengung theologischer Provenienz. Letztere droht freilich an der Heillosigkeit des Pikarischen zu versagen. Doch sie begegnet ihm immer noch mit der Zuversicht, es möchte vieles daran auch im höheren geistlichen Sinne, bei entsprechender Transposition, wahr sein, obwohl es sich vorderhand ausschließlich und massiv der Immanenz pflichtig zeigt. Je provokativer die Texte sind, desto mehr bleiben sie historisch auf Deutbarkeit in christlichen Belangen angewiesen, jedenfalls solange das thomistische Vertrauen in die analogia entis an der pikarischen Welterkundung nicht völlig versagt.
1 Exempla non docent Der Allegoriebedarf des Pikaresken Mit ‚Topos‘ und ‚Allegorie‘ werden hier kennzeichnende Modi des pikarischen Erzählens an Leitbegriffen aus dem geschichtlichen Horizont der Texte identifiziert. Dabei geht es aber nicht so sehr um einen theoretisch an Frühneuzeitli-
68
Thomas Althaus
chem geschulten Blick, weshalb auch auf eine gelehrte Herleitung jener Begriffe aus der humanistischen Rhetorik verzichtet wird.1 Vielmehr soll dem wichtigen Umstand Rechnung getragen werden, dass das textorganisierende Bewusstsein pikarischen Erzählens nicht erst Objekt einer so angeleiteten Wahrnehmung ist, sondern über topische Darstellung und allegorische Auslegung als Modi der Textund Sinnproduktion schon seinerseits verfügt. Als sich das pikarische Erzählen in Adaptationen berühmter spanischer Vorbilder und nach italienischen Zwischenstufen in der deutschsprachigen Prosa Bahn bricht, verlieren allerdings Topik und Allegorese bereits ihre definitorische Kontur und ihre systemischen Kontexte.2 Daraus werden nun unterschiedliche Zugriffsweisen narrativer Praxis. Im ohnehin wenig regulierten Feld der Prosa und zumal im schier unregulierbar wirkenden Raum des episch Pikaresken funktioniert allegorische Auslegung
1 Zu den wissensgeschichtlichen Zusammenhängen der Topik vgl. Wilhelm Schmidt-Biggemann: Topica universalis. Eine Modellgeschichte humanistischer und barocker Wissenschaft. Hamburg 1983 (Paradeigmata 1); Barbara Mahlmann-Bauer: Jesuitische ‚ars rhetorica‘ im Zeitalter der Glaubenskämpfe. Frankfurt am Main u. a. 1986 (Mikrokosmos 18) sowie Peter von Moos: Geschichte als Topik. Das rhetorische Exemplum von der Antike zur Neuzeit und die ‚historiae‘ im ‚Policraticus‘ Johanns von Salisbury. Hildesheim u. a. 1988 (Ordo 2). Die literaturgeschichtliche Entwicklung hieraus hervor skizziert in guter Zusammenfassung Manfred Beetz: Rhetorische Logik. Prämissen der deutschen Lyrik im Übergang vom 17. zum 18. Jahrhundert. Tübingen 1980 (Studien zur deutschen Literatur 62). In der barocken Textkultur gelten Epigramme und Apophthegmen als isolierte und konzentrierte Einheiten gedanklicher Operation nach den Verschieberegeln der Topik. Als Beispiel für umfänglichere Zusammenhänge von topisch organisierter Darstellung und literarischer Erkenntnis vgl. Thomas Althaus: Topik und Komödie. Andreas Gryphius’ ‚Horribilicribrifax Teutsch‘. In: Kollision und Devianz. Diskursivierungen von Moral in der Frühen Neuzeit. Hg. von Yvonne Al-Taie, Bernd Auerochs und Annegreth Horatschek. Oldenburg 2015 (Diskursivierung von Wissen in der Frühen Neuzeit 3), S. 165–188. 2 Das zeigt in besonderem Maße natürlich die ‚barocke Allegorie‘ als differenzbewusste Semiose in zunehmender Ferne von den Traditionen der Bibelauslegung (vgl. dazu etwa Peter-André Alt: Begriffsbilder. Studien zur literarischen Allegorie zwischen Opitz und Schiller. Tübingen 1995 [Studien zur deutschen Literatur 131], S. 162–164; Heinz J. Drügh: Anders-Rede. Zur Struktur und historischen Systematik des Allegorischen. Freiburg i.Br. 2000 [Litterae 77], S. 409). Den historischen Status religiöser, aber dafür auch bereits denkbar vielbezüglicher Auslegungskunst aus den Traditionen der Allegorese markieren die voluminösen Deutungsanleitungen des Aegidius Albertinus, auf die in den folgenden Anmerkungen wiederholt referiert wird (vgl. dazu auch Thomas Althaus: Hirnschleiferei. Die Umdeutungskunst des Aegidius Albertinus in der Perspektive auf Grimmelshausen. In: Simpliciana 35 [2013], S. 161–186). Im hier aufzurufenden Kontext pikarischen Erzählens ist der religiöse Bezugsrahmen noch deutlich wirksam. Zugleich gelten jedoch die Referenzen auf die Hl. Schrift auch schon einem ostentativen Zelebrieren von Interpretationsmacht auf der Suche nach anderen Lesarten des Pikaresken. Dabei geht es überdies bereits um deutlich ungemäße Forcierungen, die das Bemühen um mehr Sinn ironisch unterlaufen.
Topische Radikalisierung und allegorische Kontrolle des Pikaresken
69
als legitimatorische semantische Operation. Im Schutz dessen spielt topische Darstellung umso mehr aber ihre Möglichkeiten als Gruppierungstechnik und Kombinatorik aus. Vermittels kaleidoskopartig erzeugter Variation verfügbarer Textelemente werden hier befremdliche Zusammenhänge statuiert und umgekehrt vertraute Bezüge mit Kontrast durchzogen. Statt um Folgerichtigkeit geht es dabei um die Ausschöpfung des Variationspotenzials, um Blickumstellung und ungewohnte Sichtweisen als Ertrag alternativen Denkens – solange dies alles nicht gegen jenen höheren (allegorischen) Sinn des Ganzen revoltiert. Letzteres wird freilich schnell zum Problem. Es ist sehr die Frage, ob und inwieweit die Irritationskräfte des topisch-variativen Verfahrens noch allegorisch zu zügeln sind. Dass nicht einfach nur Abwandlungen anstehen, sondern starke Effekte der Variation, die ordnungsbezogener Einschätzung zuwider sind, ergibt sich für das pikarische Erzählen wesentlich bereits aus den Mechanismen seines Erfolgs. Die Verbreitung, die dieses Erzählen auf dem Weg topischer Ausgestaltung erfährt, wird von dem Impetus fortwährender Akzentuierung und Umakzentuierung getragen. Die literaturgeschichtliche Entwicklung ist hier als solche zunächst durchaus im Sinne einer einfach versatzstückartigen Fortschreibung zu verstehen. Aber schlicht schon aus der Eigendynamik, mit der hier Reproduktion gleichwohl Aufmerksamkeit erheischt, laufen Fortsetzung, Reihung, Variation in der Geschichte pikarischen Erzählens auf Überbietung hinaus. Nicht unwesentlich resultiert überhaupt erst aus solchen Sensationierungen möglichst markanter Musterabweichung das mitunter krass Skandalöse in seiner labilen Textur als literarische Landstörzerei – und auf das alles wird im narrativen Prozess selbst mit dem Rechtfertigungswillen textbegleitender Auslegung reagiert. Diese Dialektik schlägt deshalb in besonderer Weise auf die ‚neue Tradition‘ des pikarischen Erzählens im deutschsprachigen Raum durch, weil mögliche Rückführungen dieses Pikaresken, etwa auf die converso-Problematik der spanischen Anfänge oder die Tradition der menippeischen Satire,3 nur partiell gültig und von Evidenz sind. Zu viel erfassen sie nicht mit, weshalb sie als unterschiedlich
3 Vgl. für den sozialgeschichtlichen Anschluss (ausgehend von Américo Castro: La realidad histórica de España. 2. Aufl. Mexiko 1962) die Arbeiten von Hans Gerd Rötzer, hier vor allem Picaro – Landstörtzer – Simplicius. Studien zum niederen Roman in Spanien und Deutschland. Darmstadt 1972 (Impulse der Forschung 4), S. 63–74; zuletzt: Geschlossene oder offene Erzählstruktur? Cervantes und die Pikareske. In: Das Syntagma des Pikaresken. Hg. von Jan Mohr und Michael Waltenberger. Heidelberg 2014 (GRM-Beiheft 58), S. 156–184, hier S. 162–170. Für den genregeschichtlichen Anschluss vgl. Theodor Verweyen: Der polyphone Roman und Grimmelshausens ‚Simplicissimus‘. In: Simpliciana 12 (1990), S. 95–228, hier S. 217; Stefan Trappen: Grimmelshausen und die menippeische Satire. Eine Studie zu den historischen Voraussetzungen der Prosasatire im Barock. Tübingen 1994 (Studien zur deutschen Literatur 132), S. 233 f.
70
Thomas Althaus
dimensionierte Erklärungszusammenhänge sogar verdecken können, wie sehr es hier an vorgegebenem Sinn oder vorgegebenen Sichtweisen fehlt. An der allegorischen Perspektivierung der Gegenstände und Modi pikarischen Erzählens entscheidet sich dann womöglich grundsätzlich die Sinnfähigkeit dieses Erzählens, das sich jedenfalls nicht im Horizont historischer Wertgefüge, vielmehr in einem weiten Problemspektrum entfaltet, dabei von keinem Genremodell gerahmt wird und sich keiner oder jedenfalls keiner deutlich konturierten Genreintention verschreibt. Ursächlich für diese schwierige Situation dürfte im Bereich textstruktureller Beobachtung sein, dass die pikarische Prosa bei der Übertragung ins Deutsche mit den eigenen frühneuzeitlichen Traditionen kleiner Prosa in deren recht porösem Textfeld vermengt oder analogisiert wird. Das hat narrative Prozesse zur Folge, die sich erst in langer Entwicklung auch als epische Extension bezeichnen lassen. Vorderhand verdanken sie sich der tradierten kompilatorischen Erzähltechnik, wie das die Augsburger Parallelausgabe des deutschen Lazarillo und des deutschen Rinconete von 1617 unter dem Titel Zwo kurtzweilige/ lustige/ vnd lcherliche Historien4 im genauen Anschluss an die entsprechenden Sammlungen des 16. Jahrhunderts zeigt.5 Die früheste handschriftliche Übersetzung, der Breslauer Lazaril von 1614, übersetzt den spanischen Text dazu noch in die Konstellation der Schwankprosa hinein, mit dem dafür leitenden Vokabular der „Possen“ und „Stücklin“.6 Entsprechende Situationen interner Rezeption solcher Geschichten zur „Kurtzweile“ werden hierbei aufmerksamer als in der Vorlage betont: „Aber es wußte der Blinde dieselben meine Stücklin so artig fürzubrin-
4 Die folgende Analyse der Rinconete-Übertragung (Kap. 3) folgt dem separaten Nachdruck: Niclas Ulenhart: Historia von Isaac Winckelfelder vnd Jobst von der Schneid 1617. Nach Cervantes’ „Rinconete y Cortadillo“. Kommentiert und mit einem Nachwort von Gerhart Hoffmeister. München 1983 (Literatur-Kabinett 1). Nachweise der Zitate mit der Sigle »IW«. Ein Digitalisat des Drucks von 1617 ist über die Bayerische Staatsbibliothek München online verfügbar. 5 In der Kontroverse um strukturelle Analogien zwischen dem episodisch organisierten pikarischen Erzählen und den kompilatorischen Erzählsammlungen deutschsprachiger Prosa vor allem des 16. Jahrhunderts setzt sich im Grunde die Debatte um den Schwankroman und seine fragliche Konsistenz fort. Jenseits der strittigen Fragen nach einer konzeptionellen Entsprechung scheint indes evident zu sein, dass die frühe Wahrnehmung der Pikareske im deutschsprachigen Raum – wie der Ulenhart-Titel zeigt – mit der eigenen und mächtigen Tradition kleiner Prosa foliert wird. Vgl. dazu Johannes Klaus Kipf: Episodizität und narrative Makrostruktur. Überlegungen zur Struktur der ältesten deutschen Schelmenromane und einiger Schwankromane. In: Mohr/Waltenberger (Anm. 3), S. 71–101, hier S. 100. 6 Leben und Wandel Lazaril von Tormes Und Beschreibung, was derselbe für Unglück und Widerwärtigkeit ausgestanden hat. Verdeutscht 1614. Hg. von Manfred Sestendrup. Nachwort von Gisela Noehles. Stuttgart 1983, S. 27.
Topische Radikalisierung und allegorische Kontrolle des Pikaresken
71
gen und so anmutig zuerzählen“; „[d]a fingen sie dann aufs neue an zu erzählen, und […] lachten der visierlichen Possen“.7 Ein solches Erzählen ist aus dem Repertoire der Überlieferung produktiv, in forciert situativen Entfaltungen und mit der schon angedeuteten Tendenz solcher „Stücklin“, sich durch Eklatantes unter ihresgleichen bemerkbar zu machen. Das Konzept des Pícaro bzw. das, was in der einsetzenden deutschen Tradition inskünftig damit gemeint ist, hat dann im Wesentlichen mit Lizenzen in der textlichen Ausführung als kombinatorischer Abfolge von Historien zu tun. Diese Lizenzen haben ihren thematischen Ausweis in Inkonsequenzen des Verhaltens, im unsteuerbaren Auf und Ab pikarischer Biografien, in der merklichen Disproportion zwischen situationsklugem Verhalten und einer weiter tragenden Organisation des eigenen Lebens, damit in Erfahrungen ohne prospektives Moment, aus denen die Landstörzer selten klug werden. Die Problematik eines solchen Geschehens eröffnet wiederum die Möglichkeit unverbundener narrativer Ergänzung und Weiterführung und hält auch die bald stärker durchstrukturierten Texte grundsätzlich affin zur Textgenese durch Kompilation. Das topisch orientierte Erzählen muss sich nicht auf eine weitreichende Darstellungsperspektive verstehen, sondern auf die stellenbezogene Ausspielung seiner Möglichkeiten. Hierin und nicht in Bezug auf narrative Zusammenhänge und kohärentes Erzählen entwickelt es Konsequenz. Das alles verlangt nach höherer Bedeutung. Die Biografien der pikarischen Figuren sind Abfolgen ‚kurzweiliger, lustiger und lächerlicher Historien‘, denen nun durch das autodiegetische Erzählen einer einzigen Lebensgeschichte mehr Zusammenhalt eignet als den Historien im Sammelschrifttum der Wegkürzer, Zeit- und Melancholievertreiber. Letztere sind nicht nur durch den Wechsel des Plots, sondern – mehr oder weniger ausdrücklich – durch eine ihnen jeweils beigegebene epimythische Schließung voneinander abgesetzt. Davon ist das pikarische Erzählen weitgehend frei. Auf der anderen Seite ist dann aber unklar, welcher Belehrung dieses Erzählen noch dienen kann. Eine dem geltende Orientierung ist nur schwierig an das entstandene ‚Ganze‘ zu delegieren. Schließlich handelt es sich ja nicht unwesentlich gerade deshalb um Lebensgeschichten von Landstörzern, weil es hier zwar den roten Faden einer durchgehenden Narration, aber dennoch keinen kontinuierlichen Bedeutungsaufbau gibt. Solche Lebensgeschichten mit ihren kasuistischen Lösungen und Verkehrungen von Fall zu Fall bei gleichzeitig doch typisierten Momenten dieses Wechselgeschehens haben den
7 Ebd., S. 27 und 49. Vgl. Lazarillo de Tormes. Klein Lazarus vom Tormes. Spanisch/Deutsch. Übersetzt, kommentiert und mit einem Nachwort versehen von Hartmut Köhler. Stuttgart 2010, S. 40/41 und 76/77.
72
Thomas Althaus
Charakter einer offenen Problementfaltung. Übergreifende Sinnstiftung kann dem Verfahren der Textaggregation aus Historien und der reihenden Zuspitzung also kaum überlassen werden. Wenn überhaupt lehrt es von Beispiel zu Beispiel hier dies und dort jenes. Daraus ergibt sich ein von Kontrasten und Umschlägen nicht nur geprägtes, sondern definiertes Fortkommen eigentlich nach nirgendwohin. Deshalb gehört zur vagen strukturellen Bindung immer wieder auch die fehlende teleologische Ausrichtung der erzählten Handlung. Für einen Pícaro und eine Pícara ist jeder Tag anders, aber in der Summe erleben sie doch alle ein und dasselbe, und dies auf eine in sich ausweglose Weise, folglich auch ohne eine aus den eigenen Bedingungen zureichende Bearbeitung ihres Geschicks. Von daher bieten die pikarische Erzählung und der Pikaroroman ein nachgerade prädestiniertes Textgeschehen für einen allegorischen Zugriff, der sich eben nicht in den Gang der Geschichte hinein erstreckt, sondern sich von ihr abhebt. Arbeitet das pikarische Erzählen durch die Koppelung topischer ‚Stellen‘ in den deutschsprachigen Fortschreibungen nahezu systematisch eine Sinnlücke aus, so wird eine übergeordnete exegetische Bemühung um die unheiligen Texte dadurch noch dringender, dass die versatzstückhafte Fügung im Durchspielen ihrer Möglichkeiten, wie im Folgenden zunächst zu sehen ist, Ungeheuerliches, Unsägliches produziert. Hier wird die allegorische Interpretation zur letzten Möglichkeit, dass auf anderer Sinnebene und notfalls durch willkürliche Verschiebung noch erreicht werden kann, was die buchstäbliche Bedeutung auf keinen Fall hergibt. Die Bedingungen dafür scheinen denn auch insofern günstig zu sein, als mit der allegorischen Auslegung im pikarischen Text kein kontinuierlicher Reflexionsaufbau und kein tragendes Darstellungskonzept konkurriert. Die Textsituationen sind aber komplizierter. Das zeigt sich bereits an der aus den Bedingungen des Pikaresken selbst resultierenden Handlungskompetenz. Das Sinnbedürfnis wird möglicherweise allein schon durch die Definition des Herumtreibens als Überlebensleistung gestillt. Es handelt sich bei diesen Tagedieben, Taugenichtsen und Streunern um solche, die, „ob ihnen schon das Glück zu wider gewesen und sie verfolget, gleichwohl mit Gewalt hindurch gedrungen, und auf diesem wilden ungestümen Weltmeer mit dem Ruder“ sich „artig […] wissen zugebaren“.8 Mit diesem Hinweis schließt die Vorrede des Breslauer Lazaril.
8 Leben und Wandel Lazaril von Tormes (Anm. 6), Vorrede, S. 9.
Topische Radikalisierung und allegorische Kontrolle des Pikaresken
73
2 Erbauliche Blasphemien Der Landstörtzer Gusmann von Alfarche oder Picaro genannt des Aegidius Albertinus Der Landstörzer Gusman gerät auf seinen Irrwegen auch einmal unter die Komödianten. Caput LIV des ersten Teils „erzehlt etliche artliche bossen“, die er dabei „gerissen“,9 zum Beispiel den folgenden, als es in einem „Comedispil“ (LG 454) um den Sinn des Lebens geht, den jetzt für den Pícaro schon nicht einmal mehr das liebe Geld ausmacht. Letzteres ist für den unverschämten ‚Fatzmann‘, als den er sich inszeniert, bereits nicht mehr der Mühe wert. Ich sagte/ daß nur die Narren jhren lust mit dem Gelt vnnd wenig nutz daruon haben/ sich auch bißweilen etliche von deß Gelts wegen hencken: Wann du aber zuwissen begerest/ was der aller best lust vnnd lieblichkeit auff Erden seye/ so will ich dirs sagen: nemblich wann einer zur zeit der hochtringenden vnnd ein zeitlang verhaltener noth die Hosen auffnestelt: das priuat erwischet/ vnnd den Bauch außlret/ dann durch dises mittel wirstu nicht allein der sorg in die Hosen zuhofiren befreyt/ sonder es wirdt auch die Natur am meisten erquickt. Wofern aber du es nicht wilst glauben/ so versuche es/ verhalte den Stulgang ein zeitlang/ hupffe/ lauffe vnd wehre dich mit Hnd vnd Fssen/ vnd halte vest biß zur eussersten noth/ so wirstu letztlichen ein vberauß grosse linderung vnnd lieblichheit empfinden. (LG 455 f.)
Die Verrichtung der Notdurft als summum bonum, als Glück der Entleerung markiert den äußersten Punkt der Nichtigkeit des Erzählten. Das hält bei der radikalen Immanenz und Bedürfnisbezogenheit des Pikaresken gleichwohl jeder experimentellen Prüfung stand. Die Zumutung resultiert aus einer erzählerischen Verschachtelung. Dies ist eine von vielen Historien des Landstörzerlebens, in der es jetzt mit den „Comedien“ intern noch einmal um eine „repræsentirung viler alten vnnd newen Geschichten vnd Historien“ (LG 453) geht. Wie diese Komödianten nicht „gute Historien agiren“, sondern „lcherliche bossen vnd Gauckelspil verrichten/ bossirliche schnacken reissen/ vnd vom einen ort zum andern vmbziehen“ (LG 454), wird innerhalb des Romans mit einer mise en abyme die produktions- und rezeptionsästhetische Dimension der Schwankprosa nachgebildet, die dieser erste deutsche Pikaroroman als topisches Reservoir zur variativen und amplifikatorischen Fortschreibung der spanischen Texte auswertet. Für diese copia rerum et verborum bildet die Landstörzerei das ideale thematische Konzept der Versammlung. Darüber hinaus demonstriert der Erzählvorgang
9 Aegidius Albertinus: Der Landstörtzer Gusmann von Alfarche oder Picaro genannt. (Nachdruck der Ausgabe München 1615). Mit einem Nachwort von Jürgen Mayer. Hildesheim, New York 1975, S. 452. Weitere Zitate mit der Sigle „LG“.
74
Thomas Althaus
bei Albertinus, mit welcher Überbietungslogik hierbei die topische Angliederung vom Argen ins Ärgste führt. Das Komödienspiel um jenes vermeintlich höchste Gut setzt früher an, indem nacheinander der Beischlaf, dann das Saufen, dann eben das liebe Geld als Sinnangebote des pikarischen Lebens in Vorschlag gebracht werden (LG 454 f.). Dem Pointierungsbestreben der Reihung ist aber erst Genüge getan, als das Glück der Entleerung alle anderen prekären Sinnangebote an Problematik übertrumpft. In der topischen Radikalisierung reißt jeder Bezug zu frühneuzeitlichen Wertsystemen ab. Sie selbst ist aber nur ein Verschärfungsmechanismus, der sich aus der Akkumulation der loci topici gerade dann ergibt, wenn der Nivellierungstendenz solcher Reihung mit aufmerksamkeitssteigernder Setzung begegnet wird. Der Gottesmann Albertinus kann es auf keinen Fall bei solcher Wahrheit belassen. Er durchzieht den Herkunftstext Alemáns in der Adaptation mit ausufernder geistlicher Unterweisung. Das beginnt damit, Alemáns Roman als ein Promptuarium Exemplorum voll abschreckender Beispiele für die homiletische Bemühung auszubeuten.10 Es endet dies aber in der Selbstanforderung, dass sich der geistliche Sinn auch direkt am problematischen Gegenstand bewähren können muss und die schimpfliche Immanenz durch allegorische Interpretation schon ihrerseits auf die Transzendenz verweisen soll. Die Bezugnahme auf den unbotmäßigen Roman Alemáns ist entschieden von diesem Durchsetzungswillen getragen, der vollständig im zweiten Teil zum Austrag kommt, mit der detaillierten und systematischen Transformation des Landstörzer- in das Pilgerleben. Die Requisiten eines Umhertreibens ohne Hab und Gut werden Insignien: „der Mantel der Lieb/ der Huet der Gedult/ der Grtel deß Gebetts vnnd Betrachtung/ der Sack deß fewrigen vnnd lebendigen Glaubens/ der Stab der Hoffnung/ die Schuch der guten verlangen/ das Hndtlein deß guten Eyfers“ (LG 703) vervoll-
10 Vgl. etwa Andreas Hondorff: Promptuarium Exemplorum. Historien vnd Exempelbuch Aus heiliger Schrifft/ vnd vielen bewerten Scribenten gezogen/ vnd mit fleis zum Spiegel der warhafftigen Busse auff die Zehen Gebot Gottes außgetheilet […]. Bitterfeld 1580, Vorrede, Bl. ijv: „Denn also mssen die Menschen erstlich Gottes Gebot vnd befehl gelehret werden/ aus seinem Gttlichen Gesetze/ was sie thun vnd lassen sollen/ darnach aus dem Exempel/ das ist/ Geschichten vnd beyspielen/ das sie dieselben anschawen/ vnd sich dardurch bessern mgen/ Wie denn solches der beste vnd sicherste weg ist/ klug zu werden/ vnd schaden zuuermeiden/ da man aus ander Leut Exempel lernet frsichtiger werden.“ Die Maßgabe, dass „in der Kirchen Gottes/ allezeit das Gttliche Gesetz/ vnd Exempel vnd Historien behalten vnd getrieben sollen werden“ (ebd., Bl. ijr), prägt der frühen deutschen Rezeption der novela picaresca das Verwertungsverhältnis auf, das die Promptuarien zu den Exempel- und Historiensammlungen des 16. Jahrhunderts haben. Über dieses Wahrnehmungsmuster wird das pikareske Erzählen zunächst als produktive Fortsetzung eigener Traditionen (kleiner Prosa) registriert und integriert.
Topische Radikalisierung und allegorische Kontrolle des Pikaresken
75
ständigen das Zeichensystem, das den Landstörzer von nun an auf dem rechten „Weg der pœnitentz“ (LG 503) nicht mehr auslassen soll. Mit der Einbringung allegorischer Interpretation in den Erzählprozess droht freilich deren Kontrolle über das Ganze verloren zu gehen. Das betrifft selbst diese breit ausgeführte und als Schlussallegorie angelegte Umsetzung, die den „Ander[n] Theil“ des Romans, 220 von 723 Seiten einnimmt. Sie läuft ihrerseits noch in die Ankündigung eines dritten Teils aus, der die Reise nach Jerusalem als das gute Ende erfüllten Sinns wieder in den pikarischen Geschehensverlauf integriert, dabei aber zugleich episodisiert. Der dritte Teil stellt in Aussicht, „wie es nemblich mir auff der Reiß gen Jerusalem ergangen/ was ich daselbst fr buß gethan/ folgents vom Türcken gefangen/ gen Constantinopel gefhrt/ aber wider ledig worden: Nach solchem die Jndianische Lnder besucht“ (LG 723). Dies macht das irdische Jerusalem zur Etappe auf einer Reise, die nach überall hin führen kann, nur nicht und in keiner Weise des Überstiegs gen Jerusalem caelestis. Damit ist das Signal dafür gegeben, dass die Allegorese nicht die Historien des Landstörzerlebens rahmt, sondern von diesen überbordet wird. Dem gibt der Roman über jene Ankündigung eines dritten Teils hinaus keinen weiteren erzählerischen Vollzug.11 Er bricht die narratio fragmentarisch ab, bevor eine Fortführung die allegorische Sinngebung fragmentieren kann. Im Übergang vom ersten zum zweiten Teil des Romans ist schon einmal die Situation einer Endsetzung gegeben. Sie weist das pikarische Leben in allegoriefähiger Weise und dennoch vergeblich über seine irdischen Belange hinaus. Gusman wird zum Tode verurteilt. Das ist die gerechte Strafe für einen „Picaro oder Schwaracken“ (LG 54), „Bernhuter/ Bettler/ vnnd Lodterbuben“ (LG 118), „Landstoͤrtzer oder Maußkopff“ (LG 412), „nichtig[n] Schelm“ (LG 446) und was der Titel mehr sind für einen, der aber bis dahin weder die Sündhaftigkeit seines Lebens einsieht noch in seiner Kurzsichtigkeit überhaupt versteht oder ernst nimmt, dass es ihm als Malefiz-Person jetzt wirklich an den Kragen gehen soll. Lange bevor es dazu kommt, 250 Seiten früher, erfährt diese fehlende Einsicht eine vorbereitende allegorische Auslegung, die Gusman zum Repräsentanten menschlicher Diesseitsbefangenheit macht und damit seiner nicht nur moralischen, sondern auch kognitiven Reduktion entsprechend Sinn gibt: Vnser Leben ist ein jmmerwehrender Todt/ zu demselben eylen wir/ alsbaldt wir anfahen zu leben: Zu gleicher weiß auch wie man sagt/ daß der Dieb gehenckt wirdt/ wann er auffm weg ist/ oder auff der Laiter stehet/ vnangesehen er den Strick noch nit vmb den Halß hat/ dann die hinfhrung/ das auffsteigen auff die Laiter vnd das binden gehrt alles zum
11 Vgl. dazu Matthias Bauer: Das Sagbare umschreiben: am Beispiel des ‚Guzmán‘. In: Mohr/ Waltenberger (Anm. 3), S. 257–280, hier S. 270 f.
76
Thomas Althaus hencken/ also vnd ebner gestallt wird das Leben ein Todt genennt allweil es zum Todt verordnet wirdt. Wie auch der jenig Dieb nrrisch wre/ welcher/ wann er zum Galgen geführt wird/ vnd es fr einen Pomp vnd Pracht hielte/ daß er auff einem Wagen gefhrt wirdt/ zwey Priester bey jhm sitzen hat/ vnnd ein grosse schaar Volcks zu Roß vnd zu Fuß hinden vnd vor jhm gehen hette/ Also seind die jenigen Christen lauter Narren/ welche nicht gedencken/ daß alles was vns allhie geschicht/ Jnstrumenta deß Todts seind/ dann die Kleyder seind gleichsamb symbola vnd zeichen des Todts/ banden vnd fußeysen der Dieben: Die Speiß fhret vns zum Todt wie ein Wagen […]. (LG 204 f.)
Diese Allegorie findet wiederholt Aufnahme im Roman (vgl. LG 508 u. 685). Dazwischen kommt es zu jener thematischen Konkretion einer Hinrichtung des pikarischen Helden keineswegs in effigie, sondern durchaus in persona. Diese Textpassage geht nicht auf die spanische Vorlage zurück. Das bekannte Muster dazu wird von den Fazetien-Sammlungen deutscher Tradition bezogen und geht in ihnen wiederum auf die Exekutionsberichte der Malefiz- und Nequambücher zurück. Die Strafbücher dokumentieren das reuige Verhalten der Delinquenten auf der Richtstätte als wichtigen rechtlichen Teil der peinlichen Prozesse und der Hinrichtungsrituale, wenn ein armer Sünder idealerweise mit einer Galgenpredigt zur Ermahnung des Publikums von seinem schlimmen Leben absteht. Die Fazetien entwickeln aus diesem locus communis durch variierende Materialausschöpfung immer wieder neue Geschichten von Galgenvögeln, die völlig unfähig zur Konzentration auf die Transzendenz bis zuletzt dem Diesseits verhaftet sind, ja sogar noch in dem Augenblick, in dem die Schlinge den Hals schnürt, ihr Leben lieber mit einem letzten Scherz aushauchen als mit dem Bekenntnis ihrer Schuld. Es ist hchlichen zubeklagen/ ja mit heissen Thrnen zu beweynen/ daß solche Leuthe/ die da wegen jrer begangenen Vbelthat andern zum abschew vnd Exempel zum Tod vervrtheilet worden/ so gar ruchloß bißweilen absterben/ vnnd weder auff jhre Seelsorger […] weder vff jr ewiges Heyl vnd Wolfarth achtung geben.12
Dem sind in der topischen Musterabwandlung immer wieder neue Pointen abzuringen: solche von allerletzter Kurzweil der Malefiz-Personen oder solche von ihrer völligen Unfähigkeit, über den nächsten Augenblick hinaus zu denken, in dem sie das Zeitliche segnen werden. In der Ausführung des Musters bei Albertinus ‚leistet‘ Gusman als Delinquent das eine durch das andere. Man führt ihn
12 Michael Caspar Lundorf: Wißbadisch Wisenbrnlein: Das ist/ Hundert schne kurtzweilige/ zum theil new/ zum theil aber auß etlichen Lateinischen vnd Teutschen Scribenten zusammen gelesene vnd verdeutschte Historien. Allen/ bevorab aber zum Wißbad reysenden/ Mann vnd Weibspersonen/ ohne verruckung Zucht vnd Ehr/ gantz kurtzweilig/ lustig vnd lieblich/ zu lesen vnd zuhren […]. Frankfurt 1610, S. 108 f. (HIST. XLV. Von einem andern henckmessigen vervrtheilten Dieb/ wie derselbe den Nachrichter besch[ie]den).
Topische Radikalisierung und allegorische Kontrolle des Pikaresken
77
hinauß zu der Gerichtstatt/ vnnd auf die Laiter/ vnnd als man mir den strick vmb den halß legen wolte/ verwiderte ich mich dessen/ vnnd sagte zum Hencker/ er solls bleiben lassen/ dann ich knne je nichts enges vmb den Halß leiden/ vnnd were es nicht gewohnt: Dessen lachte jederman vberlaut: Jm wehrenden Gelchter sahe ich einen auff der Post eylendts daher reitten/ der winckte mit dem Hut/ vnnd schrye/ daß man mit der execution jnnhalten solle (LG 501).
Durch „allergndigste intercession“ (ebd.) kommt es zu einer halslösenden Wendung und bleibt Gusman vor „der woluerdienten Strangstraf“ bewahrt (LG 502). Den dafür notwendigen Aufschub schafft aber genau das problematische Verhalten, an dem die moralisatio die Jenseitsvergessenheit des irdischen Lebens exemplifiziert. Die topische Variation des Musters im Pikaroroman bedingt hier den besonderen Fall, dass zwar der letzte Atemzug für eine unwillkürliche Pointe verbraucht wird und dass sich Gusman damit um sein Seelenheil zu betrügen droht, dass er aber andererseits dadurch Zeit genug fürs Überleben im Hier und Jetzt herausschindet. In der pikarischen Textentwicklung durch abzuwandelnde loci topici kann es zu Variationen kommen, die in das Paradox einer zeitweise blasphemischen Erbauungsliteratur bar jeder Norm abdriften oder, weil die Musterabwandlung das hergibt, eine übergeordnete Perspektive durch völlige Horizontverengung unterlaufen. So gehen denn topische Darstellung und allegorische Interpretation keinesfalls spannungsfrei ineinander auf, und eben dieser Problemlage wegen eröffnet der Landstörtzer Gusmann des Albertinus die Tradition pikarischen Erzählens nach spanischen Vorbildern 1615 mit einem überregulierten Text.
3 Das Skandalon der pikarischen Ordnung Niclas Ulenharts History von Isaac Winckelfelder/ vnnd Jobst von der Schneid Cervantes’ Rinconete y Cortadillo (1613) stattet die Sevillaner Unterwelt mit eigenem Rechtswesen, Rechnungswesen und eigener, diebischer Religiosität aus, die auch Messen lesen lässt und ihren Kirchenzehnten entrichtet. Diese Unterwelt bildet als Zerrbild eines funktionierenden Gemeinwesens den mundus perversus der Satire. Die Landstörzer sehen sich darin um den problematischen Sinn ihres pikarischen Lebens, ihre Freiheit und Vogelfreiheit gebracht: Ich hab vermeint/ […] das Stelen sey ein freye Kunst/ die ein jeder/ ders kan/ ohne meniglichs jrr- vnd hinderung treiben/ auch daruon weder Stewr/ Auffschlag/ noch Vngeld bezahlen/ oder da man je etwas dauon bezahlen mst/ man einem auff Borgschafft respectiue,
78
Thomas Althaus
deß ruckens/ oder der Gurgl/ so lang zuwarte/ biß er alles miteinander auff einmal bezahlt. (IW 246)
Ulenharts Adaptation und Amplifikation, die History von Isaac Winckelfelder/ vnnd Jobst von der Schneid (1617) verändert diese Perspektive zunächst nicht. Sie extendiert die Geschichte der beiden fahrenden Gesellen und ihres Verbleibs in der Prager Diebeszunft des Zuckerbastel eigentlich nur nach dem Verfahren des unschicklichen Vergleichs, das als inventive Kombinationsmöglichkeit für ein versiertes Schreiben im Umgang mit den loci topici zur Verfügung steht. Solche Kombinationsmöglichkeiten werden in der frühneuzeitlichen Rhetorik systematisiert. Große Lehrgebäude – schon seit Rudolf Agricolas De inventione dialectica libri tres (1539) über Petrus Fonsecas Institutiones dialecticae (1611) bis Jacob Masens Ars Nova Argutiarum (1649) – verwandeln die thematisch orientierte Topik mehr und mehr in eine methodisch orientierte,13 wobei sich jenes Verfahren des unschicklichen Vergleichs unterschiedlich klassifizieren lässt, als „Fons alienatorum, wann man von einer […] Sache etwas bejahet/ das ihr entgegen zu seyn scheinet“, oder als „Fons Comparatorum“, für den Fall, dass „ungleiche/ Dinge unter sich artig verglichen werden“,14 in diesem Fall eben die Gesetzlosigkeit spiegelbildlich mit dem Gesetz.15 Indem nun Ulenharts History nach diesem Prinzip die Unterwelt der Prager Altstadt bis ins kleinste Detail durchdekliniert und durchorganisiert, verändert sich die Perspektive nun allerdings doch: Im Zunftwesen der „Maußkpff“ (IW 244), mit eigener Kanzlei und Justiz, geschieht jede Hantierung „Cum facultate & licentia Superiorum“ (IW 245), und das Rotwelsch ist als Geheimsprache nicht mehr nur dafür da, um dies alles zu verdecken. Seine „termini artis“ (IW 250)
13 Diese Entbindung schafft – wissenschaftsgeschichtlich und mit erheblichen Auswirkungen auf das literarische Schreiben – einer „fast schon aktivisch sich gerierenden Kollektions- und Dispositionsfähigkeit“ freien Raum (Schmidt-Biggemann [Anm. 1], S. 15). Ihr bieten die loci „Möglichkeiten zur Prädikation in jedweder Weise“, ohne dass dem, was herauskombiniert wird, „logische und metaphysische Sperren festgesetzt“ wären (ebd.). Die topische Radikalisierung hat hierin ihre wesentliche verfahrenstechnische Voraussetzung. 14 In der Übersetzung von Magnus Daniel Omeis: Grndliche Anleitung zur Teutschen accuraten Reim= und Dicht=Kunst/ durch richtige Lehr-Art/ deutliche Reguln und reine Exempel vorgestellet […]. 2. Aufl. Nürnberg 1712, S. 185 f. 15 Da stellen sich dann interessante Fragen, wie Harsdörffer sie später für derartige Quellen der Fontes-Lehre formuliert: „Was hat die Kunst fr Gemeinschaft mit der Unschicklichkeit/ und die Ordnung mit der Verwirrung und Unordnung?“ (Georg Philipp Harsdörffer: Ars Apophthegmatica. Das ist: Kunstquellen Denckwürdiger Lehrsprüche und Ergötzlicher Hofreden. 2 Bde. [Nachdruck der Ausgabe Nürnberg 1655–1656]. Hg. und eingel. von Georg Braungart. Frankfurt am Main 1990 [Texte der frühen Neuzeit 2], Bd. 2, Vorrede, S. 21 [Die VI. Kunstquelle […] Deß Unschicklichen und Ubermssigen]).
Topische Radikalisierung und allegorische Kontrolle des Pikaresken
79
helfen auch, um die „habilitet vnd dexteritet“ (IW 277 f.) jedes einzelnen Mitglieds dieser Gesellschaft pro und contra zu diskutieren. So entsteht ein Kodex, der Normen definiert, Vergehen gegen die Verbrecherehre sanktioniert und Recht schafft. Mit der Ausführlichkeit Ulenharts, die den Cervantes-Text verdoppelt, definiert das Unwesen die Verhältnisse über sich. Was sonst einmal Ordnung gewesen sein mochte, gilt nur noch in diesem Bezug. Das betrifft nach außen hin etwa auch den „Procurator/ der vns bißweilen vor Gericht ein beystandt thut“ (IW 273), „nicht weniger die Ober- vnd Vnderrichter/ bey denen es stehet/ auß dem Verbrechen kein Verbrechen/ vnnd auß keinem Verbrechen ein Verbrechen zu machen“ (IW 274 f.). Die schlechte Ordnung hat schließlich ihr Gutes darin, dass es neben ihr gar keine andere mehr gibt. Diese Regelungskompetenz und Einstülpung des Rechts in das Unrecht rückt innerhalb des Gefüges alle Orientierungshandlungen, alles systemische Verhalten unter einen falschen Nenner, und sie macht die übrige Welt außerhalb des Gefüges zum rechtsfreien Raum. Vom Konzept der Satire her muss das zunächst nicht weiter irritieren. Es entspricht dem Totalisierungsdrang der Entrüstung über eine verkehrte Welt, die eben im Ganzen anders zu sein hätte. Nur sind gerade die pikarischen Figuren jetzt ja für die Ordnung zuständig. Sehr ungleiche Dinge, Verbrechen und ‚gute Policey‘, werden hier zur Entsprechung gebracht, nach einer Methode, die über Differenz zum Vergleich kommt. Aus der Usurpation von Ordnung durch das Verbrechen erwächst nun überhaupt Ordnung als regulatorisches Konstrukt. Damit greift die topische Modellierung des pikarischen Erzählens in radikaler Weise auf Ordovorstellungen aus. Das unterstützt in seinen komischen Effekten wiederum die satirische Perspektivierung. Mit der variativen Häufung lassen solche Effekte aber auch nach. Im selben Maße validiert der topische Textausbau dann das Verbrechersyndikat als funktionierendes Gemeinwesen.16 Die legislatorischen Bestimmungen, die ausgefeilte Logistik und übertriebene Bürokratie, in registerartiger Ausführung fast schon als Selbstzweck erkennbar, sorgen dafür, dass die
16 Die Kritik an der History als Verunstaltung des spanischen Originals im „Kanzleistil“ (Alberto Martino: Die Rezeption des ‚Rinconete y Cortadillo‘ und der anderen pikaresken Novellen von Cervantes im deutschsprachigen Raum [1617–1754]. In: Daphnis 34 [2005], S. 23–135, hier S. 67 f.) bleibt an den Intentionen des Rinconete orientiert. Die sicherlich ungefüge und langatmige Übersetzung, mit ihrer aufs Systemische zielenden Amplifikation, schafft jedoch auf eigene Weise innerhalb des Pikaresken ein Gegengewicht zur „Verwirrung der ethischen Ordnungen“ und „Auflösung der tragenden Ordnungen“ (Werner Beck: Die Anfänge des deutschen Schelmenromans. Studien zur frühbarocken Erzählung. Zürich 1957 [Züricher Beiträge zur vergleichenden Literaturgeschichte 8], S. 131 f.), die als solche der Ulenhart-Text eben auch ungleich stärker betont.
80
Thomas Althaus
Libertinage des bezugslosen Lebens mit dem regelhaften, gesetzmäßigen Verhalten in beides erfassender Ironie korreliert. Das berührt auch die Frage nach einer allegorischen Sinnebene, auf der dies alles vielleicht doch noch anders zurechtzurücken wäre. Deren geistlicher Gehalt wird ebenso bereits für das problemangepasste asozial-soziale System bemüht. Die Vorrede warnt, „daß auch an etlichen Orten/ etliche geistliche sachen einkommen/ dern sich dergleichen heilose Leut/ offt nur zum Deckmantel/ offt aber eben auß eingebung deß bsen Geists/ vnnd zwar zu dem end vndernemmen vnd gebrauchen/ damit er sie desto besser feßlen/ vnd in sein stricken lang behalten mg“ (IW 4r f.). Religiöse Besinnung hat dadurch jedoch auf merkwürdige Weise durchaus statt, trotz einzelner satirischer Brechungen, welche die eindeutige Funktion haben, Bigotterie zu markieren („Etliche […] ligen auß andacht bey keinem ledigen menschen/ die Maria heist am Sonnabend“ [IW 254 f.]). Einen Schneider, nunmehr Beutelabschneider in der wohlorganisierten Bande des Zuckerbastel, führt die Ausübung seiner Kunst in manche Messe, wo er sich im Stil der lutherischen Invokationspredigten darüber belehrt finden kann, dass der rechte Glaube das falsche Tun aufwiegt („wie wir kinder des zorns seind“, haben wir auch „vil absolution jm Euangelio und seind reichlich und mit vielen absolution uberscht“.17 Mehr noch: Ob der Schneider die Predigt nun zwar „nicht zuhrens/ sondern anderer vrsachen halben besucht“, bekommt er doch so viel mit, „daß ein jeder sein Thun vnnd Lassen knne Gott dem Allmchtigen zu ehren/ vnnd dem Nchsten zum besten richten/ beuorab auf die weiß/ wie es jetzt der Zuckerbastel bey der Bruderschafft in eine feine richtige Ordnung gebracht“ (IW 251) hat. Die Betschwester Maruschka ist „am andchtigsten“ nach verrichteter Arbeit, „Diebstal/ Kuplerey“ (IW 385). Abbitte leisten und Beichte tun gehören hier genauso wie das Laster zum festen Programm der Lebensgestaltung. Es kommt jedoch nicht mehr dazu, dass solche pikarischen Figuren, wie etwa im Gusmann vorgeführt wurde, „von jhrem sndigen Leben abstehen/ vnd alßdann erst auff die deuotion vnd Bußwerck in der Kirchen/ sich legen vnd begeben“ (IW 386), in später Einsicht, aber immerhin doch für die Ewigkeit. Die Verhältnisse haben sich auch hierin umgekehrt. Das Leben als Verbrecher bleibt ihre letzte Wahrheit, die nun unterwegs manches Glaubensbekenntnis einschließt, bei dem der „Rosenkrantz“ (IW 254, 385) durchgeschnurrt wird.
17 Martin Luther: Acht Sermon […] geprediget zu Wittemberg in der Fasten […]. In: D. Martin Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe. Hg. von Paul Pietsch. Bd. 10/3. Weimar 1905 (Weimarer Ausgabe). „Erste Predigt“ (9. März 1522), S. 1–13, hier S. 2; „das letzte stck dieser Predigten“ (16. März 1522), S. 58–64, hier S. 63.
Topische Radikalisierung und allegorische Kontrolle des Pikaresken
81
Zwischenein geht man auch wohl einmal beichten und beten, sofern durch solche herzkräftigende Stärkung der Raubberuf keinen Abbruch leidet. Das topische Durchspielen von Möglichkeiten der Gegensatzaufhebung, aus der Kunstquelle befremdlicher Vergleiche geschöpft, bedingt die Integration des regulären in das pikarische Verhalten im Sinne einer umfassenden Persiflage. Die Idee einer Aufhebung des Schlechten ins Rechte wird durch die erzählerische Demonstration umgekehrter Vereinnahmung gleich mitkarikiert. Damit ist alles, was nach historischem Verständnis zur höheren Ordnung und zum höheren Zweck einer allegorischen Interpretation (ordo in finem) taugt, bereits für die Problementfaltung in Anspruch genommen. Das Distanzverhältnis ist aufgehoben, das es zur Konstruktion eines Auslegungsziels braucht, durch das die halt- und ortlose Existenz der Herumtreiber bewahrheitet werden kann. Das pikarische Gebaren vernutzt von sich aus die Referenz auf einen höheren Belang, der es in ein Sinngefüge (als sensus spiritualis dieses bewegten Lebens) überführen und übersteigen könnte. Das ist der schlechte Tausch, der mit der scheinbaren Vervollständigung des Defizitären eingegangen wird, wenn jetzt die Verwahrlosung rituelles Handeln kopiert und damit tatsächlich auf eine Intentionalisierung dieses Handelns hinwirkt. Denn der Zuckerbastel trifft sehr wohl religiöse und zugleich ganz praktische Vorkehrungen gegen irdisches Verlorensein. Er zelebriert den Zutritt zu seiner „Bruderschafft“ (IW 375) als „nouitiat[ ]“ (IW 376), damit die mafiöse Struktur funktioniert, und die allwöchentliche Beuteverteilung unter den Mitbrüdern in einer sonntäglichen Liturgie, damit hier alles mit rechten Dingen zugeht; und er „gibt jhnen den Segen“ (IW 383), der Verantwortung fürs Ganze einschließt, die er selbst wiederum durch den klugen Ratschlag einlöst, man solle sich „zu keiner stehten vnd gewissen Herberg verobligiern“, auf dass einem die Häscher nicht über den Hals kommen (ebd.). Das suffragium, als Almosen zu Fürbitten, verballhornt er zum ‚naufragium‘: Es wird schiffbrüchig gelebt, „per viam naufragii“ (IW 273), auf welche makkaronische Wendung der Ulenhart- und auch der Cervantes-Text wiederholt eingehen. Das betrifft an besagter Stelle die neue Kirchensteuer auf erwirtschaftete Beute, die unter den Mitgliedern dieses Ordens für den Fall erhoben wird, dass man sich auf dem ungestümen Weltmeer mit dem Ruder doch so artig nicht zu gebaren weiß. Die breite Ausführung ungemäßer Bezüge entwickelt hier eine eigene, in Qualifikation umschlagende Tendenz, das Skandalon der pikarischen Ordnung durch umsichtige Darstellung zu mildern. Das wird so natürlich nicht durch die topische Radikalisierung als solche erreicht, der durch kein iudicium und kein aptum verlässlich Grenzen gesetzt sind, wohl jedoch durch den insistenten variativen Vollzug, der es nicht bei einmaliger Zuspitzung bleiben lässt. Die Fülle der Akzentuierungen, mit ihr der Textausbau dieser Pikareske in der deutschsprachigen Rezeption, bedingt Aspektwechsel und diese wiederum bedingen eine dif-
82
Thomas Althaus
ferenzielle Exposition des problematischen Gegenstandes keineswegs nur unter dem Gesichtspunkt des Lächerlichen oder des Frevels. So wird dem Zuckerbastel mit seinem „terminum, per viam naufragii“ neben dem „vnuerstandt der Lateinischen Sprachen“ (IW 384 f.) doch gleichzeitig ein genauer Blick für die Welt als Gefährdungslage attestiert, von der die pikarischen Figuren eine so ungelehrte wie unverstellte Kenntnis haben. Freilich entgleiten auch solche zweiten Aspekte, die das Karikierte und Persiflierte an Erfahrung rückkoppeln, nicht der satirischen Beobachtung. Das Ganze unterliegt weiterhin einer Wahrnehmung als Problem, womit denn auch ein Gegenteil des Gesagten als Norm impliziert bleibt. Doch ist nicht mehr sicher, nach welchem Maßstab dieses Ganze „nit nur grauitèr, sonder auch jocosè“ (IW 3r) zu nehmen und ins Richtige umzudeuten ist.18 Einerseits zielt das topische Vergleichen in überzogener Weise auf eine umfassende Ordnung des Verbrecherlebens, worin auch geistliche Hinwendung nur zu Symbiosen mit der Sünde führt. Wie jedoch andererseits die variative Ausschöpfung mit großer Ausführlichkeit und viel Sinn fürs Detail „Sachen […] gegeneinander hlt/ ihre Gleichheit und Ungleichheit betrachtet“ und sie dadurch „vollstndiger an das Liecht setzet“,19 bedingt der darum betriebene Aufwand Beobachtungszuwachs und detaillierte Einschätzung.20 Daraus folgt das Paradox einer satirischen Affirmation, die für die kritisierten Gegenstände auch einzunehmen weiß. Die topische Erweiterung des Problemfeldes lässt merkwürdige Ioco-Seria des Pikaresken entstehen, die den Erfolg dieser Prosa eminent befördern. Sie schaf-
18 Vgl. Stefanie Stockhorst: Reformpoetik. Kodifizierte Genustheorie des Barock und alternative Normenbildung in poetologischen Paratexten. Tübingen 2008 (Frühe Neuzeit 128), S. 326 f., zur Vorredenpoetik Ulenharts, der Horaz und sich selbst mit den Rechtfertigungsgründen normorientierter Satire als „Moralphilosophen apostrophiert“ und dem eigenen Text ein „zutiefst moraldidaktische[s] Wesen“ bescheinigt. 19 Georg Philipp Harsdörffer: Poetischer Trichter (Nachdruck der Ausgabe Nürnberg 1648–1653). Darmstadt 1969. Dritter Theil, S. 57. 20 Hieraus folgt möglicherweise auch eine Erklärung dafür, dass diese novela picaresca in der dritten Person erzählt wird. Das absorbiert zumindest tendenziell die Problematik unzuverlässigen Erzählens, als selbsteigene Perspektivierung des pikarischen Lebens durch den schriftstellernden Pícaro. Rötzer hält die untypische Fokalisierung fest, zusammen mit der „satirischen Umkehr der Verhältnisse zwischen pikareskem Milieu und staatlicher Öffentlichkeit“ (Rötzer, Geschlossene oder offene Erzählstruktur? [Anm. 3], S. 174). Sobald es dabei aber nicht allein um satirische Totalisierung geht, sondern gleichzeitig um einen ausdifferenzierten Ordnungsentwurf in der Pikareske, kann der eingeschränkte Blick des pikarischen Erzählers hierin auch zugweise und mit einer Funktionsverlagerung auf die Figurenrede aufgehoben werden. Solcher Figurenrede (des Isaak Winckelfelder, Jobst von der Schneid oder anderer Mitglieder der Diebsgesellschaft) wird ständig das Wort erteilt, und sie informiert dann über das Funktionieren dieses merkwürdigen Gemeinwesens.
Topische Radikalisierung und allegorische Kontrolle des Pikaresken
83
fen offene Darstellungssituationen, deren eindimensionale Bewertung zu einer unterkomplexen Auseinandersetzung mit dem pikarischen Erzählen führt. Der Reihungscharakter der Darstellung lässt aus vielen Historien diese eine History entstehen. Ihr obliegt durch die satirische Brechung hindurch eine fallweise oder je nach Aspekt andere Beurteilung des pikarischen Verhaltens, insgesamt eine solche, die bei aller Vermahnung das Leben der „Mauskpfe“ im Wechsel seiner Situationen als anstellig und weltfähig zu erkennen gibt. Hingegen wird nun moralisch integres Verhalten überall dort satireverdächtig, wo es dahingehend anders ist, dass es in seinen Vorbehalten, seinen Attitüden und Erfahrungsdefiziten erstarrt.
4 Die Pícara Justina Dietzin als Allegorikerin Den eigentlichen Geschehenseinstieg der Landstörtzerin Iustina Dietzin Picara genandt bildet – nach drei umständlichen Eingängen in den Roman – die Genealogie der Heldin, die zugleich eine Genealogie ihrer Laster ist: „Von den vnterschiedlichen Inclinat[i]onibus oder neygungen jhrer Voreltern/ empfngt Iustina viel vnd mancherley qualiteten“.21 Sie entstammt einer Familie der „Bossenreisser“, „Schwetzer vnnd Fabelkrmer“ (ID 89 f.), von denen es wenig mehr zu erben gibt als ein schnelles und gefräßiges Mundwerk. Weil sie ihre Zunge nicht zu zügeln wussten und den Hals nicht voll bekommen konnten, geht ihnen der gerechte Tod je und je direkt an die Gurgel. Einem bleibt am Galgen die Luft weg (vgl. ID 93), einem anderen, einem Musikanten, wird die Pfeife in den Rachen gerammt (vgl. ID 104). Die Mutter Justinas erstickt an ihrer Gier; bei einem Kaminraub kann sie eine letzte Wurst nur noch halb herunterwürgen. Derart provoziert das Durchspielen solcher Todesarten, als Sterben an „mangel deß Athems“ (ID 153), auch hier üble oder auch absurde Überschreitungen, nur dass der Effekt schon recht zu Beginn eintritt und dafür nicht erst ein letztes Extrem in der Reihenbildung abgewartet werden muss. Das gilt nicht nur für exzessive Momente der Narration, sondern auch für Pointierungen, die sich aus der kombinatorischen Versetzung der Argumentationselemente ergeben können. Entsprechend gedreht und gewendet, kommt dabei für die fiktive Schreiberin dieses Romans heraus, dass es noch lange nichts gegen ihre Befähigung als Fabelkrä-
21 Andrea Perez [i.e. Francisco López de Ubeda]: Die Landstörtzerin Iustina Dietzin Picara genandt. 2 Teile in einem Band (Nachdruck der Ausgabe Frankfurt am Main 1626–1627). Hildesheim, New York 1975, S. 78. Weitere Zitate mit der Sigle ID. Wenige Zitate aus dem II. Theil mit der erweiterten Sigle ID II.
84
Thomas Althaus
merin besagt, wenn sie auch ein solches Ende nehmen sollte. Das ist dann sogar erst der rechte Vergleichspunkt für ihre garrulitas auf über 1000 Seiten, bei der es ihr „ehr an Athem mangeln wird/ als an Erzehlung einer oder d’ander Fabel“ (ID 98). Mit solch einer Umkehrung gleich zu Beginn der Variationskette ist ein Argumentationsweg herauszuklügeln, auf dem die Redseligkeit dem Erstickungstod doch noch Paroli bietet. Der verquere Gedanke gewöhnt an den Stolz Justinas und daran, dass ihre unendliche Schwatzhaftigkeit im Resultat dieses Buches sie selbst als maulfertige Landstörzerin überlebt. Der locus communis, aus dem die Variationsreihe erzeugt ist, lautet: „Wie der Mensch lebt/ also stirbt er auch“ (ID 139). In den Exempeln zu dieser Formel genauer Korrelation aus der ‚Kunstquelle des Vergleichs‘ macht allerdings das Haarsträubende der Fälle den ausgleichenden Sinn zunichte. Statt zu idealtypischer Aufhebung des Lasters mit seinen eigenen Mitteln und zu poetischer Gerechtigkeit driftet die Häufung der Beispiele in den Graduationsmodus der topischen Radikalisierung. Mit der Überbietung einer Historie durch die andere sprengt der narrative Prozess die Grenzen moralisationsfähiger Darstellung, was dann bei Einlösung jenes Enthymems nur noch pro forma in eine Legitimation zu integrieren ist. Freilich wird auch da der ‚Lehrsatz‘ bestätigt, dies aber auf eine so ungehörige Weise, dass das Erzählen als schlüpfrige Art der Lastererkundung den vorgeblichen Zweck einer diesbezüglichen Ermahnung nachrangig macht. Justinas Urgroßvater väterlicherseits, ein „Theriackskrmer“ und Marktschreier, bedient sein Publikum trefflich mit „Comedien vnd gauckel Possen/ die er bey seiner Bank vbete“ (ID 91 f.). Das rächt sich in seiner letzten bösen Stunde. Wie dieser fabulierende Pícaro, Fatz- und Galgenvogel andere für seine Zwecke betört hat (vor allem das Weibsvolk), so verfällt er dann seiner eigenen Imagination und wird zu weiterem Ausgleich das Objekt der Kurzweil anderer. Darin gipfelt nun allerdings ein durch und durch gotteslästerliches Geschehen, das die Symmetrie ruiniert: Im Delirium bildet der Alte „jhme auß Vnvernunfft ein/ als wer er ein Ochs oder Farr“, ein Stier, den seine Umgebung im Spital aufs Blut reizt, bis ihm „das steinerne Crucifix“ im Weg ist und zur Affektableitung herhalten muss; wie er es auf die Hörner nehmen will, rennt er sich den Kopf daran ein, so „daß er darbey also bald niederf[i]el vnnd starb“ (ID 92). Das heilige Kreuz wird zum roten Tuch und zur Angriffsfläche für eine extreme Negation kopfgesteuerten Verhaltens durch das Tier im Menschen. Die darauf folgende zweite, kaum weniger arge Blasphemie besorgt der hinzukommende satirische Beobachter. Ironisch praktiziert er die alte solonische Weisheit, dass den Toten nur Gutes nachzureden sei, und erklärt jenes Anrennen gegen das Kreuz aus Trunksucht, Irrsinn, Religionshass und Selbstzerstörungsdrang, wie der Mann so daliegt, für das Ende eines guten Christen: „O gesegnet bistu/ mein Sohn/ daß du zu den Fssen dieses Crucifixes so selig verschieden“ (ID 93).
Topische Radikalisierung und allegorische Kontrolle des Pikaresken
85
Potenziell sind von jeder Position der Reihung neue und andere Variationen abzuzweigen, die das pikarische Erzählen unter verändertem Aspekt topisch radikalisieren. Der Vater Justinas wird als betrügerischer Gastwirt und Händler mit dem falschen Gewicht erschlagen, mit dem er seine Kunden betrogen hat. Als man bei seinem Begräbnis die Totenwache ausfallen lässt, um unverzüglich am reich gedeckten Tisch des Mörders über den Verlust hinwegzukommen, hat der ebenfalls hungrige Hund am Toten einen eigenen Leichenschmaus. Er „ließ nichts von dem gantzen Crper vbrig/ als allein den Kopff“ (ID 145). Damit dies unbemerkt bleibt, bezieht man preisgünstig aus „der nechsten Garkchen stinckend Fleisch“ (ebd.) und versucht damit eine Restitutio ad integrum des zerstückelten Leichnams. Dieser Zuführung von übelriechendem Schlachtabfall entspricht in wohlorganisiertem Kontrast eine Nachepisode zum Schlaraffenlandtod der Mutter, der „noch ein stück von der letzt verschluckten Wurst zum halß herauß“ schaut (ID 152). Die Leichenträger behandeln dies als eine Art Serviervorschlag. Es ist ein Geben und Nehmen: Als sie wegen „deß anmthigen Geruchs“ der Wurst den Sarg öffnen, befinden sie das schöne Stück noch für gut und essen daran fort; „denn solche Leut sind nicht so eckel vnnd subtiel/ sondern haben jmmerzu einen guten Appetit“ (ID 157). Der Hunger treibt es hinein. Bei entsprechender Vorbehaltlosigkeit gegen das tierische Bedürfnis kann der Mensch auch das, was der Hund kann. Durch die Umstellproben topischen Vorgehens werden Problematiken methodisch in ihrem Für und Wider erwogen und unter wechselnden Aspekten beobachtet. Der Anreicherung von Historien zum Roman fehlt dann zwar narrative Kohärenz, dafür eignet ihr aber ein durchaus analytisches Moment, das erkennen lässt, wie „zweyerley Sachen […] auf einander folgen und aus einander entstehen“, „einander gleichen“ oder „einander zu wider sind“.22 In dieser satirischen Nutzung des Argumentationsverfahrens durch das pikarische Erzählen verhält sich freilich der Reflexionsgewinn umgekehrt proportional zur hierbei anzuzeigenden Reduktion. Das summiert sich auf niedrigstem Niveau, mit der Fressgier als leitendem Kriterium, dem das Vieh ohne große Umstände genügt. Doch auch das menschliche Personal eines solchen Landstörzer-Romans bedient sich an Leichen. Es ist anstellig genug, um von einem Toten noch etwas zwischen die Zähne zu bekommen, und steht sich bei solcher Gelegenheit nicht selbst mit Feingefühl im Weg. Die topische Variation wird zu einer Erzeugung des Ärgsten aus dem Argen, wie das schon für den Gusmann des Albertinus festzustellen war. Darauf wird
22 Harsdörffer: Ars Apophthegmatica (Anm. 15), Bd. 2, Vorrede, S. 17 (Die IV. Kunstquelle […] Der Abtheilung und Unterscheidung).
86
Thomas Althaus
mit aufstufender „Lehr vnd Erinnerung“ reagiert, im ersten Teil des Romans durchgängig bis zum siebten Kapitel des zweiten Buches und damit für insgesamt 13 Kapitel unter genauer Beibehaltung des Deutungsschemas traditioneller Exempelliteratur mit ihren den Erzählprozess schließenden Merksätzen.23 In den 46 weiteren Kapiteln des Romans werden derartige Epimythien nurmehr sporadisch eingesetzt. Solche ‚Lückenbildung‘ signalisiert denn auch einen lediglich streckenweise kontrollierten Umgang mit dem pikarischen Geschehen. Oft erfahren die Historien dann stattdessen durch zusätzliche Historien Kommentierung, wenn sich das Gelichter gegenseitig „ein schne Vermahnung“ (ID II 156) erteilt, dies jeweils freilich nicht mit der Absicht auf Belehrung, sondern zur fortgeführten Unterhaltung durch Exempel von gleich bedenklicher Art. Doch auch dort bereits, wo lehrhafte Auslegung noch verlässlich die Kapitel schließt, werden die Schwierigkeiten einer normgerechten Kommentierung des pikarischen Geschehens deutlich. In seinem völligen Unmaß versperrt es sich der Adhortation. Pragmatische Stellungnahmen bleiben Teil des Problems und selbst versuchsweise ethische Erwägungen machen sich noch viel zu sehr mit der schlimmen Sache gemein. Eine legitime Befassung mit dem erzählten Geschehen auf gleicher Sinnebene ist kaum möglich, was eine davon abhebende andere Lesart nahezu erzwingt. Es obliegt also wieder der allegorischen Interpretation, dem noch eine Perspektive abzuringen. Über die Möglichkeiten dazu verfügt Justina allerdings bereits selbst. Als Abkömmling einer Sippe von Fabelkrämern ist sie dazu ausreichend rhetorisch geschult. Bevor sie das Wort zur „Lehr vnd Erinnerung“ einer heterodiegetischen Instanz überlassen muss, verklärt sie die viehische Begierde ihres Geschlechts mit allen ihren Stufen der Selbsterniedrigung in eine demütige und bewusste Katabasis, die zu den Ursprüngen des Seins zurückführe: Alle Ding kehren vnnd wenden sich endlich widerumb zu jhrem Vrsprung von welchem sie erstlich kommen/ als die Erde zu jrem Centro, welches jhr anfang ist: das Wasser zum Meer/ als zu seiner Mutter: […] Die zeytige oder volle Ahern oder Garben biegen sich zur Erden/ auß deren sie entworffen: […] Vnnd also verhlt es sich mit vns Menschen: nach dem spruch der H. Schrifft: O Mensch gedenck/ daz du Staub vnd Aschen bist. (ID 164)
Familienschicksale, die man besser für sich behielte (wäre man nicht selbst so geschwätzig wie die Ahnen), nehmen sich jetzt als fortgesetztes Bemühen um erste und letzte Fragen der Existenz aus. Bei solcher Auslegung haben die Vorfah-
23 Das verliert allerdings auch hier bereits seine Proportion und wird eher zum Anhängsel, wenn etwa das 6. Kap. jenes zweiten Buches auf annähernd 60 Seiten sich narrativ in Wollust, Diebereien und Saufereien ergeht, zwischenein mit Einlassungen dazu, wie die heidnischen Götter das gehalten haben, und dann die abschließende Lehre in lediglich drei Sätzen kursorisch auf die „trewhertzigen Vermahnungen frommer vnd getrewer Seelsorger“ (ID 294) Bezug nimmt.
Topische Radikalisierung und allegorische Kontrolle des Pikaresken
87
ren eigentlich doch in aller Bescheidenheit dem Laster gefrönt, unter herkunftsbewusstem Verzicht auf die hybride Selbstüberschätzung des Menschen, wenn er sich für ein höheres Wesen hält. Die indiskreten Mitteilungen Justinas haben ihren eigenen Anteil an dieser Besinnungsleistung. Je mehr freilich die Pícara als problematische narrative Instanz am reflexiv gebrochenen Charakter des pikarischen Erzählens partizipiert, umso weniger kann sie sich selbst durch die predigthafte Diktion noch glaubwürdig sein. Wo sie diese Diktion lediglich persifliert, stellt sie gleichwohl jedoch ihre intellektuelle Befähigung zu geistlicher Auslegungskunst und zu einer solchen Umdeutung unter Beweis. Ein Albertinus kann das auch nicht besser.24 Die Pícara geht theologisch versiert mit den Todesarten der Vorfahren und dem Niedergang ihres Geschlechts um, der nach allem Erwarten in ihrem eigenen kulminieren wird. Wie das prospektiv also auch sie betrifft, eignet sich Justina im Vorfeld bereits die Interpretationsmacht über das klägliche Ende einer Landstörzerin an, die wie ihre Vorfahren bis in den Tod hinein dem Laster treu bleiben wird. Mit großem Deutungsaufwand, unter Beiziehung von Metempsychose (ID 163) sowie Kreisund Zirkelvorstellungen aller Art avisiert sie den eigenen moralischen, seelischen und körperlichen Verfall als Rückkehr zu den Wurzeln. Es ist eine Frage der Perspektive, an der sie hier aber selbst mitschreibt, ob ein derartiger Verfall sie tatsächlich das Seelenheil kosten muss. In jedem Fall ringt diese pikarische Predigerin ihrem Leben biblische Wahrheit ab und macht es dergestalt zu einem Geschehen voller bedeutender Zeichen. Für sie selbst läuft das auf eine forderungsfreie Identifikation mit dem Schlimmsten hinaus, die sie als ethische und religiöse Leistung und als Vollendung schönfärbt. Hierdurch subvertiert sie den geistlichen Diskurs, in dem sie dafür noch zur Rede zu stellen wäre. Danach schließt die eigentliche „Lehr vnd Erinnerung“ als weitere, davon abgesetzte moralisatio das erste Buch des Romans. Diese Belehrung muss nun auf dem von der Pícara bereits beanspruchten Feld der Auslegung und mit der selbsteigenen allegorischen Interpretation ihres Lebens konkurrieren. Jn diesem hat das leichtfertige Weib nicht vbel geredt/ da sie gesagt/ es komme alles widerumb zu seinem Anfang: Dannenhero sie denn mit allen andern jhres gleichen sehr weit
24 Vgl. Aegidius Albertinus: NOSCE TE IPSUM. Oder/ Kenn dich selbst. Auß Geistlichen Hieroglyphicis, weltlichen Symbolis, oder Zeichen/ Gleichnussen/ Gemlden/ vnd verborgnen Rtherischen Sprchen/ anfangs Durch LAURENTIVM ZAMORIENSEM […] in Hispanischer Sprach beschriben/ Vnd an jetzo Durch ÆGIDIVM ALBERTINVM […] verteutscht. München 1607, fol. 27v: „die Christliche Kirch vnsere getrewe Mutter […] thut einen lauten Rueff vnnd spricht: Memento homo, quod cinis es & in cinerem reuerteris, als wolte sie sagen: O Mensch/ erkenne dich selbst/ vnnd gedenck/ daß du nur ein Erd/ Staub vnnd Aschen bist/ vnnd widerumb in Staub vnnd Aschen verkehrt sollest werden.“ Ebenso fol. 4v, 12v, 14v, 40v und 50r.
88
Thomas Althaus
jrren/ daß sie sich nicht erinnern/ daß/ dieweil vnser anfang nichts/ dann Staub vnd Aschen gewesen/ wir vnsers Endts ja nimmermehr vergessen/ sondern solche Gutthat erkennen/ dem Schpffer darfr dancken/ daß er vns zu seinem Ebenbildt erschaffen/ zu welchem wir endlich/ als zu vnserm allgemeinen Anfang vnd Vrsprung alles Gutten werden gelangen. (ID 166)
Die nachgereichte Gegenauslegung reagiert auf das Erklärungsmodell der Pícara und sucht darin einzubrechen, doch bleibt sie hierdurch ohne eigene sorgfältige Herleitung und muss sich deshalb schlicht darauf verlassen können, dass die Lehre von der Gottesebenbildlichkeit des Menschen mit den daraus abzuleitenden Geboten schon noch stärker überzeugen dürfte als die hocheigene Moralisation der Pícara. Letztlich heißt das aber nur, gegen das Memento in Gen 3,19 („[…] Bis das du wider zu Erden werdest/ da von du genomen bist/ Denn du bist Erden/ vnd solt zu Erden werden“) die similitudo spiritualis nach Gen 1,26 ins Feld zu führen („VND Gott sprach/ Lasst vns Menschen machen/ ein Bild/ das vns gleich sey“).25 Das eine Bibelzitat steht gegen das andere, im Vertrauen darauf, dass das schon werterhaltend funktionieren wird. Daran ändert sich auch nichts durch den Umstand, dass die interne Fokalisierung der Pikareske durch die „Lehr vnd Erinnerung“ von einer Nullfokalisierung überboten wird. Dadurch entsteht eine Wahrnehmungshierarchie, für die sich hier immer wieder ein extradiegetischer Erzähler von der problematischen Erzählinstanz des pikarischen Subjekts abspalten muss. Mit solchen Nachsätzen der Erklärung verrät er, dass es ihn überhaupt gibt: „Aber was rede ich als ein Mann? Ach ich hatte vergessen/ daß ich ein Weibßbild were vnnd mich Iustinam genennet.“ (ID 47) Da ist also noch jemand, der sich unabhängig zu Wort melden kann. Dann ist es aber umso mehr ein Problem, dass ihm eigentlich gar nichts anderes übrig bleibt, als die Argumentationsstrategie der Pícara zu übernehmen. Wie sie kommt auch er mit einer Bibelstelle daher. So steht es bestenfalls pari, wenn man nämlich vernachlässigt, dass ‚ihm‘ wirklich nichts Besseres einfällt, als ‚sie‘ hierin zu kopieren. Gleich zu Beginn des Romans reißt die Pícara mit Paratexten von ihr selbst (I.–III. „Eingang“, ID 3–50) die Interpretationsmacht über ihre Geschichte an sich und beweist sich dabei, in ostentativer Vorführung ihrer diesbezüglichen Fähig-
25 Das sind maßgebliche Sätze der allegorisierenden Erbauungsliteratur des 17. Jahrhunderts, an deren schwierigem Abgleich sich Albertinus um diese Zeit abarbeitet: „Alle Thier erschuef Gott auß der Erde, aber er nennte sie nit nach der Erd, wie den Menschen, dann der Name Adam bedeut die Erd: Ob wol auch Gott den Menschen nach seinem Ebenbildt erschaffen hatte, nit desto weniger nennte er jhne ein Erd, keiner andern Vrsachen halben, als damit er von der ignorantia sui nit gestürtzt wurde“ (Aegidius Albertinus: Lucifers Königreich und Seelengejaidt [1616]. Hg. von Rochus Freiherrn von Liliencron. Berlin, Stuttgart [1884] [Deutsche Nationallitteratur 26], S. 28).
Topische Radikalisierung und allegorische Kontrolle des Pikaresken
89
keiten, als gewiefte Allegorikerin: Die Gegenstände im Nahumfeld des Schreibens, die „Ganßfeder“ (ID 4), ein „hrlein“ daran (ID 22), das Wasserzeichen im Papier (vgl. ID 37) geben auf vielfältige Weise Veranlassung zur sinnbildlichen Auslegung ihres Lebens.26 Über die allegorische Rede wird hier allerdings nie vollständig verfügt. „Justina sihet eine Schlang auff dem Papier/ als deß papierers Zeichen“ (ID 37) und kann sich damit selbst als Schlange entdeckt sehen, wie es denn spät im Roman, in einer brieflichen Mitteilung über sie und alle „vermaledeyten/ vnbillichen verkehrten vnnd boßhafftigen Landtstrtzerin[nen]“ heißt: „Die Natur hat niemals gifftigere Thier erschaffen/ als jhr seydt“ (ID II 404). Justina bringt es jedoch zuwege, dass für sie „auch in der Schlangen etwas glcklichs verborgen ligen“ kann (ID 41). Sie beruft sich auf „das Symbolum oder Zeichen der Weißheit“ (ID 43), „Aesculapii Symbolum“ (ID 44), „Mercurii Zeichen“ (ID 45) und weicht dergestalt, freilich auch erkennbar, vor der naheliegenden in fernere Bedeutungen aus. Damit kommt ein kompliziertes Spiel in Gang, bei dem der Semiotikerin die Semiose ständig zu entgleiten droht. Die Zeichen sind sehr wohl noch wahrheitsfähiger, als die Pícara dies für ihre literarische Selbstbespiegelung brauchen kann. Auch wenn sie glaubt, alles aus allem machen zu können, zeigt sie sich dennoch als diejenige, die sie eben ist. Von gelingender Usurpation der allegorischen Rede durch die problematische Figur kann unter dem Aspekt genehmer Sinnbildung deshalb nur bedingt die Rede sein. Was Justina als Figur dann allerdings ausmacht, sind ganz wesentlich inventive und ingeniöse Fähigkeiten,27 die bei der schmeichelnden Selbstauslegung eines so lasterhaften Lebens, wie diese Landstörzerin es geführt hat, freilich auf härteste Proben gestellt werden. Die drei Eingänge des Romans zeigen, wie sehr es ihr auf die Demonstration ihrer rhetorischen Versatilität ankommt. Dafür riskiert sie mit der amplifikatorischen Ausdeutung des Schlangensymbols auch ihren Leumund, auf dem allerdings ohnehin nicht sonderlich zu bestehen ist. Die Pícara Justina legt sich mit unverhohlenem Stolz die Welt und ihr eigenes Leben allegorisch zurecht, wie sie will, und partizipiert in der fiktionalen Situation
26 Vgl. dazu die Beiträge von Carolin Struwe (Die widerspenstige Feder. Überlegungen zu den drei Erzähleingängen in der ‚Iustina Dietzin Picara genandt‘) und Christa Haeseli (Die Picara Iustina als unzuverlässige Erzählerin? Zur Problematik einer narratologischen Kategorie) in: Mohr/Waltenberger (Anm. 3), S. 281–300 und 301–314. 27 Diese Fähigkeiten bezeichnen im Hirnschleiffer von Albertinus (1618) nun überhaupt den Intellekt des Allegorikers. Denn die interpretatio christiana von Schrift und Welt ist nur noch bei gehöriger Flexibilität des Auslegungsverhaltens durchzuhalten: „Sonsten wird das wort […] noch anders außgelegt“, „Endtlich speculiren etliche das Wort […] noch anderst auß […]“ (Aegidius Albertinus: Hirnschleiffer. Kritische Ausgabe. Hg. von Lawrence S. Larsen. Stuttgart 1977 [Bibliothek des Literarischen Vereins in Stuttgart 299], S. 46 und 48).
90
Thomas Althaus
des Romans als schreibende Landstörzerin zugleich an den Wertungsstrategien der Epoche. Sie koppelt ihre Auslegungen an die Funktion topischer Darstellung, dient damit gleichzeitig den Belangen einer so entfalteten Prosa und versucht, deren Sinn zu steuern. Damit setzt sie ihr pikarisches Leben in ihrem Erzählen und das pikarische Erzählen auf der Deutungsebene fort, mit überreichem Ertrag für die copia rerum, die den fülligen Roman konstituiert. Dieses Verfahren ließ schon den italienischen Text Barezzo Barezzis gegenüber dem spanischen Original um einiges anschwellen und treibt den deutschen Text gegenüber dem italienischen in beiden Teilen des Romans noch einmal aus,28 und zwar nicht nur in die Länge, sondern deutlich auch über die Grenzen verantwortbarer Narration. Das amplifikatorische Verfahren mit seinen exzessiven Weiterungen wird seinerseits noch wieder um Justinas findige Auslegungen ergänzt, mit welcher Rechtfertigungspolitik sie vor allem aber das Bedeutungsgehabe wertsüchtigen Verhaltens an den Niederungen ihrer fiktionalen Biografie denunziert. In all dem kommt das neue pikarische Erzählen auf riskante Weise durch Sinnzersetzung zu literarischer Produktivität. Das Auslegungsvermögen der Pícara als Allegorikerin tangiert nicht erst die Deutung der Historien. Phasenweise greift es auch bereits in deren erzählerische Konstruktion ein. Die Historie vom Urgroßvater väterlicherseits, der sich im delirium tremens für einen Stier gehalten und den Kopf am Kreuz eingerannt hat, wird durch einen Zusatz zu einem tatsächlich so noch aufgewerteten Ende, das ihn nämlich dem Literalsinn nach wohl als Malefiz-Person auf der Richtstätte ereilt haben dürfte. Ein kurzer Stimmenwechsel des Erzählens genügt, um den Leser diesbezüglich zu verunsichern: „Von diesem seinem Abschied finden sich noch jtzund etliche Verleumbder/ die da vorgeben/ er sey am Galgen erstickt/ ohne zweiffel/ dieweil das Creutz von den Alten ein Galgen ist genennet worden“ (ID 93). Damit wäre man deutlich wieder bei einem Tod ‚aus Mangel des Atems‘. Für diese verdeckte Selbstanzeige einer allegorischen Konstruktion verweist Justina
28 Bei solcher Entgrenzung wird gleichzeitig aber die Lebensgeschichte der Landstörzerin als Plot im Verhältnis zur spanischen Vorlage nur noch fragmentarisch vollzogen (vgl. Volker Meid: Von der ‚Pícara Justina‘ zu Grimmelshausens ‚Courasche‘. In: Simpliciana 24 [2002], S. 15–26, hier S. 17 f.). Dies wird durchaus zutreffend als ungeschickte Ausdehnung erklärt, mit Blick auf umständliche Transformationen des Conceptismo zumal in der deutschsprachigen Prosa des frühen 17. Jahrhunderts (so z. B. Karl A. Zaenker: Grimmelshausen und die ‚Pícara Justina‘. In: Daphnis 27 [1998], S. 631–653, hier S. 633). Nur erfahren dadurch die variativen und exzessiven Fortschreibungen noch keine eigene Funktionszuschreibung, und ebenso bedarf die Umsetzung von argutia-Leistungen konzettistischer Prägung in den Beziehungsreichtum allegorischer Interpretation noch eigener Beobachtung. Zur italienischen Übertragung siehe auch ausführlich Thomas Bodenmüller: Literaturtransfer in der Frühen Neuzeit. Francisco López de Úbedas ‚La Pícara Justina‘ und ihre italienische und englische Bearbeitung von Barezzo Barezzi und Captain John Stevens. Tübingen 2001 (Communicatio 25).
Topische Radikalisierung und allegorische Kontrolle des Pikaresken
91
auf andere, die hier das ganz normale Ende eines Galgenvogels erzählerisch ungemäß aufbereitet finden. Sofern die Geschichte tatsächlich der Fantasie einer Allegorikerin entsprungen ist, erübrigt sich die Vorstellung von einer geistlichen Lesart des pikarischen Geschehens als Korrektiv. So wie Justina dieses Geschehen auszulegen weiß, ist an allegorische Kontrolle des Sinns nicht mehr zu denken. Was bei Albertinus im Ganzen doch als allegorische Zähmung des Pikaresken funktioniert, schafft in der Úbeda-Adaptation der topischen Radikalisierung dieses Pikaresken erst recht freie Bahn. Die hehre Ebene der allegorischen Interpretation wird für den fiktiven Entwurf einer vollständigen Bestialisierung des Menschen und einer wütigen Lästerung des Kreuzes in Anspruch genommen, und zwar als letzte Wahrheit, die einem solchen Geschöpf Gottes noch bleibt, wenn es auf sein Ende sieht, in weitestem Abstand zur christlichen Vorstellung der Lebensbeichte, ja mit grässlicher Lust an einer letzten Todsünde, bei der man sich den Kopf einstoßen kann, damit das alles aufhört.
5 Zwischenorientierungen Allegorisches im Pikaresken Die Situation pikarischen Erzählens ist bereits in den frühen deutschsprachigen Adaptionen komplex. Darauf war hier für zwei Pikaroromane (den Landstörtzer Gusmann des Albertinus und die Iustina Dietzin genandt Picara) mit bloß ausschnittartiger Wahrnehmung und für alle behandelten Texte mit einer bewusst schematisch und funktional angelegten Argumentation zu reagieren. Diese Argumentation konzentrierte sich auf eine leitende Schreibweise und eine bestimmende Erklärungsweise des Pikaresken, die es zu isolieren und miteinander zu konfrontieren galt: das topische Verfahren in seiner Tendenz zur Radikalisierung und die allegorische Auslegung als Sinnbemühung um ein Erzählen, das sich mit zahllosen Beispielen für den Sieg des Lasters über die Tugend auf der Ebene des sensus litteralis gegen eine normgerechte Perspektivierung sträubt. Statt mit avancierten erzähltheoretischen und narratologischen Analysekonzepten wurde die Textur des Pikaresken hier im Rekurs auf die historische Begrifflichkeit bzw. auf Darstellungsmodi untersucht, die den ästhetischen Diskurs über die ungebundene Rede im frühen 17. Jahrhundert prägen. Es ist dies ein Diskurs, den die frühneuzeitliche Rhetorik zunehmend aufgibt und die frühneuzeitliche Poetik noch kaum beginnt. In dieser poetologisch offenen Situation ist das textorganisierende Bewusstsein pikarischen Erzählens stark auf verfügbare Traditionen der Wissensproduktion und der Sinnkonstitution angewiesen, die in ihrer Vielschichtigkeit mit den Termini ‚Topos‘ und ‚Allegorie‘ eher schlagwortartig
92
Thomas Althaus
bezeichnet sind. Topische und allegorische Darstellungsmodi werden hier unter sehr veränderten Bedingungen aktiviert, nämlich bei weitreichendem Verlust von Ordnungssystemen für ihre Entfaltung – und durch ein Schreiben, das wie kaum ein anderes zu Beginn des 17. Jahrhunderts diesen Verlust literaturgeschichtlich dokumentiert. Dabei war zunächst auf die spezifische Dialektik zu achten, in die hier topische und allegorische Darstellung miteinander geraten. Die Radikalisierungseffekte der topischen Kombination provozieren den Verfügungsdrang allegorischer Kontrolle (Abschnitt 1 und 2). Das hängt ursächlich mit der Prosa der Exempel- und Historiensammlungen des 16. Jahrhunderts zusammen, auf welche Textkultur das Pikareske in der deutschen Tradition geblendet wird. Wie aus dem alten kompilatorischen Verfahren nun durchgängig, wenn auch weiterhin episodisch Erzähltes erwächst, geraten Narration und Explikation mit sukzessivem Verlust der Hierarchie ineinander. Dies bedingt parallel eine parodistische Inanspruchnahme von ordo-Vorstellungen gerade für die Gesetzlosigkeit des Pikaresken (Abschnitt 3) und eine Persiflage der forcierten Auslegungskunst, die Laster als Tugenden zu verhandeln weiß und so den Abstand des Sinnlosen zum Sinnvollen ironisch souverän verkürzt (Abschnitt 4). Das geschieht auf Kosten der Sicherungsebene exegetischer Konstruktion, auf der sich aus der sehr irdischen Problematik pikarischer Texte und überhaupt aus dem Weltgeschehen immer noch so etwas wie ein Schöpferwille und ein Heilsplan destillieren lässt, solange jedenfalls noch die dafür notwendigen Abhebungseffekte durch irgendeine „Lehr vnd Erinnerung“ zu erzielen sind. Aber die pikarische Prosa greift darauf aus, macht sich selbst in dieser Hinsicht klug und verfügt ostentativ über die Deutungsstrategien ethisch-religiöser Sublimation, von denen dann keine solche Absetzung mehr zu erwarten ist. Anders als das topisch radikalisierte Schreiben macht die Einziehung von Allegorese in den Prozess pikarischen Erzählens einen zunächst wenig spektakulären Eindruck. Aber sie revolutioniert die Verhältnisse im Text. Es entsteht eine neue, narrativ-reflexive Darstellungssituation, für die deutschsprachige Entwicklung der Erzählprosa vor dem aufgerufenen Hintergrund der Exempelliteratur nahezu in einem literaturgeschichtlichen Sprung: Zwischen narrativem Beispiel und deutender Lehre gibt es kein Verhältnis der Differenz mehr. Sie sind nun ineinander verschoben und konkurrieren auf einer Ebene. Die Lehre muss sich innerhalb eines auf Fallbeispiele ausgelegten Erzählens bewähren, auch wenn sie sich abseits des Pikaresken ansonsten noch unbefragt als doctrina christiana behaupten kann. Sie wird Teil des Textgeschehens. Darüber gewinnt sie durchaus auch eigene narrative Qualität. Nur ist sie nun eben in einen Erzählprozess integriert, in dem höherer Sinn – wie übrigens jeder andere Sinn auch – nur noch situativ gültige Klärung schafft. Eine Richtungsvorgabe ergibt das nicht mehr. Ein Pícaro und eine Pícara müssen zusehen, dass sie halbwegs unbeschädigt von einer
Topische Radikalisierung und allegorische Kontrolle des Pikaresken
93
aporetischen Situation in die andere kommen. Das ist ihr ‚großes Ziel‘. Für die Schwierigkeiten dessen bürgt wiederum die topische Darstellung mit ihrer Steigerungsdynamik, deren Problemzuwachs ein möglicher höherer Sinn im Gefüge des Pikaresken kaum noch oder jedenfalls nicht durchgängig beikommen kann. Innerhalb eines Textgeschehens, das für ein ordnendes Bewusstsein zunehmend schwierig zu kalkulieren ist, verlegt sich die Allegorisierung des pikarischen Lebens auf andere Deutungsmodelle. Es sind primär solche, in denen der erschlossene Sinn dann auch der Unwägbarkeit des Dargestellten genügt. Dies mag nun jene viel bemühte Allegorie von der schwierigen Schifffahrt im Sturm des Lebens betreffen, mit der die Vorrede des Breslauer Lazaril aufwartet, um daran die Überlebensleistung der pikarischen Figuren zu ermessen (die sich – wie das eingangs zu zitieren war – „auf diesem wilden ungestümen Weltmeer mit dem Ruder so artig […] wissen zugebaren“). Oder es betrifft die BaldandersEpisode in Grimmelshausens Continuatio des abentheurlichen SIMPLICISSIMI. Wie alle allegorischen Passagen in Grimmelshausens Romanen (so der Traum vom Ständebaum, die Fahrt zum Mummelsee oder die Schermesser-Episode) bleibt aber auch die Baldanders-Episode ein Einschub und als dieser eingeengt auf eine Auslegung in spezifischer Sicht. Bei einem ganz und gar unverlässlichen Geschehen fehlt es auch der Rede von organisierter Kontingenz: dass immer alles „bald so und bald anders“ ist („bald reich bald arm/ bald hoch bald nider/ bald lustig bald traurig/ bald böß bald gut“),29 an Tragweite und Gewähr. Allerdings eignet solchen allegorischen Passagen in der pikarischen Prosa selbst dann noch eine höhere Verbindlichkeit, wenn sie als unsicher gewordene Interpretation des Geschehens innerhalb des Geschehens Widerlegung erfahren. Wichtig sind sie trotzdem: als Deutungsansätze und -versuche oder auch als Sinnsetzungen für das pikarische Erzählen in Teilen, nicht jedoch für den großen Unzusammenhang, dem nichts mehr ohne beträchtliche Forcierung zu einer homogenen Perspektive verhilft. Damit wäre dann – als neue Wahrheit des Ganzen – die Lückenhaftigkeit einer jeden Weltauslegung konzediert. Hierfür spricht nun jedenfalls einiges. Unter dieser Voraussetzung sind die Lebensgeschichten pikarischer Figuren am Ende vielleicht gar nicht mehr sonderlich erklärungsbedürftig und auf anderes hin auszulegen. Der Figurentypus ist selbst zur Allegorie geworden. Er steht für das unverortete, bezugslose und ungewisse Leben des (früh-)neuzeitlichen Subjekts.
29 Hans Jacob Christoffel von Grimmelshausen: Der Abentheurliche Simplicissimus Teutsch und Continuatio des abentheurlichen Simplicissimi. Hg. von Rolf Tarot. 2., durchgesehene und erweiterte Aufl. Tübingen 1984 (Grimmelshausen. Gesammelte Werke in Einzelausgaben), S. 506.
Christian Kirchmeier
Moralische Topologie und Chronotopos Zu einem Strukturproblem pikarischen Erzählens
1 Von der Moralsatire zum Kochbuch Wenn man die historisch-genealogische Fragestellung dieses Beitrags in zwei Bilder fassen wollte, könnte man sie folgendermaßen zuspitzen: Wie kommt man vom ersten Tier zum zweiten?
Abb. 1: Grimmelshausen: Simplicissimus Teutsch
Abb. 2: La Varenne:
(Monpelgart 1669 [recte: Nürnberg 1668]),1
‚Le Grand Ecuyer-Tranchant‘ (1721)2
Titelkupfer (Ausschnitt)1
1 Der Simplicissimus Teutsch wird zitiert nach der Ausgabe Hans Jacob Christoffel von Grimmelshausen: Werke I,1. Hg. von Dieter Breuer. Frankfurt am Main 1989 (Bibliothek deutscher Klassiker 44; Bibliothek der Frühen Neuzeit 4/1); im Folgenden nachgewiesen mit der Sigle „ST“ und der Seitenzahl. 2 François Pierre de La Varenne: Le vray cuisinier françois […]. La Haye 1721, S. 333.
96
Christian Kirchmeier
Mit Rupfen und Entschuppen ist es hier offenbar nicht getan. Denn bekanntlich zeigt die erste Abbildung, das berühmte Titelkupfer von Grimmelshausens Simplicissimus Teutsch, nicht einfach irgendein Tier, sondern ein Monstrum, das aus menschlichen und tierischen Teilen zusammengesetzt ist und so einen Bruch der natürlichen biologischen Ordnung darstellt, was letztlich auch eine moralische Monstrosität anzeigt. Die Darstellung verweist somit auf einen Verstoß von ästhetischen und moralischen Normen, und der Satyrkopf bereitet den Leser darauf vor, dass er sich auf eine Moralsatire einstellen muss. Die zweite Abbildung stammt aus einem Kochbuch, das die Gattung des Kochbuchs im modernen Sinne erst begründet hat. Le cuisinier françois von François Pierre de La Varenne3 hat fast im Alleingang die französische haute cuisine hervorgebracht, indem es auf stark reduzierte Soßen setzte und sich von den arabischen Einflüssen der spätmittelalterlichen Hochküche löste. Ihm verdanken wir beispielsweise das Ragout. Und genau dieses Buch, das heute noch verlegt wird, hat einen überraschenden Auftritt in einer simplicianischen Schrift des 18. Jahrhunderts, und zwar in der 1743 anonym erschienenen Erzählung Simplicissimvs Redivivvs. Der Autor lässt Grimmelshausens Simplicius als Kriegsberichterstatter wiederauferstehen – und als französischen Koch enden, der seinen Lesern zum Abschluss den Vrai cuisinier françois (eine ergänzte Neuauflage von La Varennes Werk) empfiehlt. Zwischen den beiden Abbildungen vollzieht sich also ein halsbrecherischer diskursiver Brückenschlag, den es im Folgenden zu erklären gilt: Warum endet ein Text, den sein Titelkupfer als Moralsatire ausweist, als Kochbuch? Die Antwort, die dieser Beitrag geben möchte, geht von der Vermutung aus, dass dieser Wandel in einer Problemreferenz begründet liegt, die den strukturellen Kern von Grimmelshausens Simplicissimus Teutsch ausmacht, nämlich der Verbindung von zwei verschiedenen architextuellen Konzepten: auf der einen Seite das Konzept einer Moralsatire, in der es immer um die Diskursivierung moralischer Normen geht, und auf der anderen Seite das Konzept eines pikari-
3 François Pierre de La Varenne: Le cuisinier françois […]. Paris 1651. Der Text erreichte in den folgenden 75 Jahren 30 Auflagen und wurde schnell ins Deutsche, Englische und Italienische übersetzt. Die Ausgaben wurden verschiedentlich ergänzt und mit Abbildungen versehen, während die Erstauflage noch ohne Abbildungen auf den Markt kam. Zum Cuisinier françois und zu seiner Wirkung vgl. Brian Cowan: Neue Welten, neue Geschmäcker. Speisemoden ab der Renaissance. In: Essen. Eine Kulturgeschichte des Geschmacks. Aus dem Englischen von Barbara Häusler u. a. Hg. von Paul Freedman. Darmstadt 2007, S. 197–231, hier S. 224–229, sowie das ausführliche Vorwort in der Ausgabe [La Varenne]: Le cuisinier françois. Hg. von Jean-Louis Flandrin, Philip und Mary Hyman. Paris 1983 (Bibliothèque bleue), S. 11–107. Die Erstauflage des Werkes wurde mit einem kurzen Vorwort erneut herausgegeben: La Varenne: Le cuisinier françois. D’après l’édition de 1651. Hg. von Mary und Philip Hyman. Paris 2001.
Moralische Topologie und Chronotopos
97
schen Erzählverfahrens, in dem es immer (zumindest auch) um die Verortung des Einzelnen in der Gesellschaft geht und damit um Fragen sozialer Inklusion und Exklusion. Auf der einen Seite geht es also um Normativität, um die Frage nach richtigem und falschem Verhalten, auf der anderen um die Ordnung der Gesellschaft, d. h. um die Frage, welchen sozialen Ort das Individuum aufgrund seines Verhaltens einnimmt. Noch einmal anders formuliert: Es geht um das Verhältnis zwischen der moralischen Topologie der Gesellschaft und dem Chronotopos, den die Individuen durchlaufen.4 Damit ist ein thematischer Bereich angesprochen, zu dem die Soziologie seit ihrer Entstehung aus der Moralwissenschaft eine zentrale These aufgestellt hat. Die These besagt, dass ein ursprünglicher Zusammenhang zwischen normkonformem bzw. normdeviantem Verhalten sowie gesellschaftlicher Inklusion bzw. Exklusion besteht und dass sich dieser Zusammenhang mit zunehmender sozialer Differenzierung aufgelöst hat. Émile Durkheim beispielsweise erklärt diesen historischen Wandel in De la division du travail social (1893) mit der Umstellung von mechanischer auf organische Solidarität. Die mechanische Solidarität ist Durkheim zufolge durch geteilte Normen gestiftet.5 Wer gegen die Normen verstößt, aus denen sich die Gesellschaft bildet, wird aus der Gesellschaft ausgeschlossen – d. h. vertrieben, eingesperrt oder getötet. Dieser Exklusionsmechanismus ermögliche es vormodernen Gesellschaften gewissermaßen, sich auf der Grundlage von Normen zu schließen. Durkheim zufolge verfügen diese frühen Gesellschaften über ein ‚Kollektivbewusstsein‘, das ihnen eine einheitliche moralische Topologie garantiert. Mit fortschreitender Arbeitsteilung sei dieses Kollektivbewusstsein fragmentiert worden. In einer pluralisierten Welt sind die Individuen dann gezwungen, ihre Solidarität selbst zu bestimmen. Daraus entsteht, wie Durkheim folgert, eine Form der organischen Solidarität,6 in der sich die Moralvorstellungen des Einzelnen nicht mehr mit den Normerwartungen der Gesellschaft decken müssen. In arbeitsteiligen Gesellschaften ist es nicht mehr möglich, Individuen aufgrund von Normverstößen zu exkludieren, schon weil ein solcher Normverstoß innerhalb einer sozialen Gruppe durchaus funktional für die Gesamtgesellschaft sein kann.7
4 Zu dem Begriff vgl. Michail M. Bachtin: Chronotopos. Aus dem Russischen von Michael Dewey. Frankfurt am Main 2008. 5 Émile Durkheim: Über soziale Arbeitsteilung. Studie über die Organisation höherer Gesellschaften. Frankfurt am Main 1992, S. 118–161. 6 Ebd., S. 162–184. 7 Für Durkheims Argumentation ist der soziale Umgang mit Normverletzungen zentral. Empirisch versucht er, anhand der Rechtsgeschichte zu belegen, dass das Strafrecht im Zuge der Umstellung auf organische Solidarität gegenüber dem Zivilrecht an Bedeutung verliert
98
Christian Kirchmeier
Für einen Historiker ist es sicherlich unbefriedigend, einen markanten Diskontinuitätsbruch in der Entwicklung des Verhältnisses von Normativität und Exklusion zu postulieren, wie ihn Durkheims makrohistorische Perspektive nahelegt. Es wäre abwegig anzunehmen, dass sich der Zeitpunkt des Umbruchs von mechanischer zu organischer Solidarität genau bestimmen lässt. Vielmehr lassen sich beide Formen zu allen Zeiten finden. Allerdings kommt dem Medium der Literatur bei Fragen nach einem sozialgeschichtlichen Wandel eine Sonderstellung zu, weil Literatur die Gesellschaft mit ihren eigenen Mitteln beobachtet und dabei soziale Komplexität nach Maßgabe ihrer eigenen medialen Bedingungen reduziert. Literarische Verarbeitungen sind deswegen darauf angewiesen, Differenzen typologisch zu verdichten, wie ja auch jeder Interpret typologische Differenzen verwenden muss, wenn er historische Entwicklungen und Diskontinuitäten beschreiben will. Wie weit nun die typologische Heuristik von normativer Konformität bzw. Devianz und sozialer Inklusion bzw. Exklusion trägt, soll die folgende Interpretation des Simplicissimus Teutsch8 und des Simplicissimvs Redivivvs testen.
2 Simplicissimus Teutsch Als Grimmelshausens Protagonist gleich zu Beginn des Romans vom Hof seines Knans vertrieben wird und zum Einsiedler kommt, erhält er von diesem seinen ersten Namen, ‚Simplex‘ (ST 38). Doch eigentlich ist ‚Simplex‘ schon mehr als ein Name, es ist die Kennzeichnung des Einfältigen, der keine Unterscheidungen treffen kann. Der Knabe lebt wie im „Paradis“ (ST 20), heißt es im Text. Bevor er gewissermaßen vom Baum der Erkenntnis gegessen hat, existiert er in einem amoralischen (was nicht schon bedeutet: in einem unmoralischen) Zustand: Er kennt „weder GOtt noch Menschen/ weder Himmel noch Hll/ weder Engel noch Teuffel/ und wuste weder Gutes noch Bses zu unterscheiden“ (ebd.). Die Einfalt des Protagonisten ist zuallererst insipientia, also ein „Mangel an Einsicht und Weisheit“,9 und zwar als moralische Einfältigkeit, als Mangel an normativem
und damit der Ausgleich zwischen konkurrierenden Normvorstellungen wichtiger wird als die Bestrafung von Verstößen gegen gesamtgesellschaftlich gültige Normen. 8 Bei der Interpretation des Simplicissimus Teutsch greife ich auf Vorarbeiten zurück (Christian Kirchmeier: Moral und Literatur. Eine historische Typologie. München 2013, S. 208–228). 9 Dietz-Rüdiger Moser: Narrenliteratur. In: Historisches Wörterbuch der Rhetorik. Hg. von Gerd Ueding. Bd. 6. Darmstadt 2003, Sp. 106–115, hier Sp. 108.
Moralische Topologie und Chronotopos
99
Wissen. Im Gegensatz zur stultitia als pathologischer, körperlich begründeter Narrheit lässt sich dieser intellektuelle Mangel beheben. Seine Kenntnisse über die moralische Topologie der Gesellschaft, die ihn aus dem Zustand der insipientia herausführen, erwirbt Simplex vom Einsiedel, und das heißt: in sozialer Exklusion. Der Text verbirgt seinen Protagonisten also im Chronotopos eines geschützten Raumes, in dem normgeleitete Kommunikationen risikolos geäußert werden können, weil sie keine Entscheidungen generieren. Denn sobald in der Gesellschaft normativ kommuniziert wird, ist es nie völlig kontrollierbar, wie ein anderer auf einen Befehl der Form ‚Du sollst x nicht tun!‘ reagiert. Sollte der andere nämlich ein anderes normatives Wertesystem zugrunde legen, kann er den normbezogenen Befehl in eine Machtfrage verwandeln: ‚Und was, wenn ich’s doch tue?‘ Solange sich diese Frage nur in der asymmetrischen Machtkonstellation der Erziehung stellt, wie zwischen dem Einsiedel und Simplicius, ist sie von vornherein entschieden. Spätestens außerhalb der Pädagogik droht hingegen schnell die Gefahr, dass sie gewaltsam gelöst wird. Der nächste chronotopische Abschnitt im Roman ergibt sich dann ganz folgerichtig: Nachdem Simplicius moralisch geschult wurde, wird er als Page des Gouverneurs in die Hanauer Gesellschaft in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges entlassen. Unter den Soldaten erlebt er Normverstöße, die er sich beim Einsiedel nicht hätte vorstellen können. So begegnet er beispielsweise einem Ehebrecher, der seine Tat nicht nur verteidigt (er habe nämlich die Ehe nicht gebrochen, sondern nur gebogen; ST 87), sondern sich ihrer sogar noch rühmt. Als ihm Simplicius darauf den moralischen Vorwurf macht, dass er sich mit seinen „gottlosen Worten mehr versndige[ ]/ als mit dem Ehebruch selbsten“ (ST 88), droht ihm der Offizier Prügel an. Und so ähnlich geht es ihm von nun an ständig. Überall wird er für einen Narren gehalten, weil er die moraltheologischen Normvorstellungen als Grundlage der sozialen Ordnung in Anspruch nehmen will. Im mundus inversus ist das Verhältnis von Narrentum und Weisheit verdreht: Als Narr vertritt Simplicius jetzt paradoxerweise nicht mehr die insipientia, sondern die sapientia. Und diese Umkehrung wird im mundus inversus zu einem Prinzip sozialer Ordnung, weil Normverstöße nicht mehr zu sozialer Exklusion führen, sondern im Gegenteil erst zur Inklusion in die verkehrte Welt. Das ist weit mehr als ein bloß literarisches Problem. Seine pragmatische Prägnanz, ja seine soziale Dramatik erhält diese Perversion von Normativität und Inklusion durch Grimmelshausens realistische Poetik. Bei ihm ist der mundus inversus kein bloßes Gedankenexperiment. Seine Fiktion einer normativ verkehrten Gegenwelt wurde längst von der Kriegsrealität eingeholt.10
10 Walter Ernst Schäfer hat untersucht, wie die Kriegsrealität von Grimmelshausen und Moscherosch als verkehrte Welt inszeniert und wie dadurch eben nicht Moralität (wie in der
100
Christian Kirchmeier
Nun ließe sich diese soziale Dramatik durch das Argument entschärfen, dass die Darstellung des mundus inversus ein Prinzip der Moralsatire ist und die Funktion des Textes gerade darin liegt, Normverstöße darzustellen und dadurch Normvorstellungen zu stabilisieren.11 Martin Opitz hat in diesem Sinne die vornehmliche Aufgabe der Satire darin gesehen, das Laster zu verbannen und zur Tugend anzumahnen, weswegen die Satire „mit allerley stachligen vnd spitzfindigen reden/ wie mit scharffen pfeilen/ vmb sich scheußt“.12 Der Text würde in dieser Gattungstradition also letztlich doch die Inklusionsleistung von normkonformem Verhalten betonen. Dennoch spricht wenigstens ein Strukturmerkmal gegen seine Einordnung in die Tradition der Moralsatire: Im Narrenschiff beispielsweise ist es ja tatsächlich so, dass der Verstoß gegen die sozialen Normen als Narrheit gekennzeichnet wird und es damit um die Frage geht, wie die Narren aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden können. Bei Grimmelshausen heißt der Narr aber Simplicius, und er ist es, der die christlichen Normen verteidigt.13 Der Pfarrer bestätigt ihm sogar, dass in der gegenwärtigen Welt noch die Aposteln als Narren gelten würden, sollten sie wiedergeboren werden (ST 96). In einer solchen Welt aber kann es keine Einheit von christlichen Normen und sozialer Ordnung mehr geben. Gibt es dann innerhalb einer solchen verkehrten Gesellschaft überhaupt noch einen sozialen Ort für die moralisch guten Menschen? Das ist die Frage, die das zweite Buch zu klären versucht. Angesichts von Simplicius’ weltfremdem normativem Rigorismus fällt dem Gouverneur nichts anderes ein, als ihn entweder verprügeln zu lassen oder zum Teufel zu jagen (ST 126) und damit den sozialen Fremdkörper aus der Stadt zu verbannen. Eine Alternative findet sich erst, als Simplicius in einem gewaltsamen Initiationsritus die Transformation in einen Hofnarren vollzieht.14 In der Rolle des Hofnarren kann er nämlich die moraltheo-
Satire), sondern Providenz problematisch wird (Walter Ernst Schäfer: Der Dreißigjährige Krieg aus der Sicht Moscheroschs und Grimmelshausens. In: Morgen-Glantz 9 [1999], S. 13–30). 11 Vgl. dazu etwa Werner Welzig: Ordo und verkehrte Welt bei Grimmelshausen. In: ZfdPh 78 (1959), S. 424–430, und 79 (1960), S. 133–141. 12 Martin Opitz: Buch von der Deutschen Poeterey (1624). Studienausgabe. […] Hg. von Herbert Jaumann. Stuttgart 2008, S. 30. 13 Hans-Joachim Mähl hat in einem wichtigen Aufsatz gezeigt, wie die Transformation des Narren in einen Pícaro dazu führt, dass die Gattung der Moralsatire ihr normatives Fundament verliert (Hans-Joachim Mähl: Narr und Picaro. Zum Wandel der Narrenmotivik im Roman des 17. Jahrhunderts. In: Studien zur deutschen Literatur. Festschrift für Adolf Beck zum siebzigsten Geburtstag. Hg. von Ulrich Fülleborn und Johannes Krogoll. Heidelberg 1979 [Probleme der Dichtung 16], S. 18–40). 14 Vgl. dazu Peter Triefenbach: Der Lebenslauf des Simplicius Simplicissimus. Figur – Initiation – Satire. Stuttgart 1979, S. 96–116.
Moralische Topologie und Chronotopos
101
logischen Normen weiter verteidigen.15 Weil es sich dabei nur um Narrenwahrheiten handelt, sind sie aus dem politischen Entscheidungsprozess gelöst. Das ermöglicht Simplicius eine ambivalente Haltung zur Gesellschaft, wie der Gouverneur selbst erkennt: „Jch halte ihn vor einen Narrn/ weil er jedem die Warheit so ungescheut sagt/ hingegen seynd seine Discursen so beschaffen/ daß solche keinem Narrn zustehen“ (ST 162). Eine wirkliche Lösung des Problems von Normativität und Exklusion ist das natürlich nicht, da es alleine die soziale Rolle des Hofnarren ist, die eine normbasierte Existenz innerhalb der Gesellschaft zulässt. Seine Verteidigung der moraltheologischen Normen bleibt für die politische Ordnung der Gesellschaft folgenlos. Nachdem der Text das Problem um Normativität und Exklusion so weit entwickelt hat, beginnt nun erst der eigentlich pikarische Erzählstrang. Die moralische Distanz, die Simplicius bisher eingehalten hat, gibt er auf seinem Weg durch den Chronotopos des Romans allmählich auf. Er bestiehlt einen Pfarrhof, prostituiert sich in Paris und verbindet sich mit dem Erzverbrecher Olivier.16 Zudem hört Simplicius damit auf, die Welt zu kritisieren – sowohl als handelndes Ich als auch als reflektierender Erzähler.17 Diese Entwicklung spricht dafür, dass man den Roman mit Beginn des pikarischen Erzählverfahrens nicht mehr angemessen in die Tradition der Moralsatire einreihen kann. In der Grimmelshausen-Forschung waren es vor allem allegorische Deutungen, die diese Perspektive dennoch beibehalten wollten.18 Diese Ansätze verorten den Roman im moraltheologischen Diskurs seiner Zeit
15 Insofern erfüllt er die typisch frühneuzeitliche Funktion des Hofnarren als „Korrektiv der herrscherlichen Souveränität“ (Albrecht Koschorke: Narr, Narrenfreiheit. In: Des Kaisers neue Kleider. Über das Imaginäre politischer Herrschaft. Texte – Bilder – Lektüren. Hg. von Thomas Frank u. a. Frankfurt am Main 2002, S. 244–253, hier S. 252). 16 Wie Hania Siebenpfeiffer argumentiert, vertritt Olivier insofern ein Konzept des radikal Bösen, als seine Taten malefacta sind, also durch eine willentliche Entscheidung für das Böse entstehen (Hania Siebenpfeiffer: „… im übrigen aber nur eine Bestia!“ Zur Figur des Bösen im ‚Simplicissimus Teutsch‘. In: Simpliciana 34 [2012], S. 177–196, hier S. 186–189). 17 Die Spannung zwischen den moralischen Verfehlungen des ‚erzählten Ichs‘ und dem geläuterten ‚erzählenden Ich‘ – Simplicius auf der Kreuzinsel – waren zu Beginn des Romans die erzählstrukturelle Bedingung der Möglichkeit für die moraldidaktischen Reflexionen; vgl. Lothar Schmidt: Das Ich im „Simplicissimus“. In: Wirkendes Wort 10 (1960), S. 215–220. 18 Zumeist bemühen sich diese Ansätze um den Nachweis, dass der Roman eine Allegorie auf die zeitgenössischen moraltheologischen Lasterkataloge darstelle (vgl. etwa Walter Ernst Schäfer: Laster und Lastersystem bei Grimmelshausen. In: GRM 12 [1962], S. 233–243, sowie Peter Heßelmann: Gaukelpredigt. Simplicianische Poetologie und Didaxe. Zu allegorischen und emblematischen Strukturen in Grimmelshausens Zehn-Bücher-Zyklus. Frankfurt am Main u. a. 1988 [Europäische Hochschulschriften I 1056], S. 168–197). Gelegentlich wird dieser theologische Moraldiskurs mit einem philosophischen als Deutungskontext ergänzt (Walter Ernst Schäfer: Moral und Satire. In: Ders.: Moral und Satire. Konturen oberrheinischer Literatur
102
Christian Kirchmeier
und versuchen so zu zeigen, dass die moralischen Normen immer noch bekräftigt werden, auch wenn keine expliziten moralischen Bewertungen mehr vorkommen. Dabei können sie sich beispielsweise auf das Vorwort der Continuatio berufen, wonach die pikarische Erzählung nur den Zucker über der bitteren Pille bilde, aber letztlich die moralische Lehre nie wirklich aus dem Blick geraten sei.19 Diese allegorischen Deutungen im Geiste der Moralsatire lassen wichtige Fragen unbeantwortet.20 Warum etwa verzichtet der Text darauf, wenigstens poetische Gerechtigkeit walten zu lassen,21 wenn schon zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges keine heilsgeschichtliche Gerechtigkeit in der Welt mehr vorausgesetzt werden kann? Es gibt eben keine Belohnung des Tugendhaften, wie sich am deutlichsten am langsamen Siechtum der moralisch vorbildlichen Figur Hertzbruder erkennen lässt. In der Welt des Romans gibt es nur Verlierer, egal wie tugendhaft sie sich verhalten.22 Zweitens können die allegorischen Interpretationen nicht recht erklären, warum der Text es nötig haben soll, ein Normensystem derart vor-
des 17. Jahrhunderts. Tübingen 1992, S. 50–134, hier vor allem S. 105–116). Ulrike Zeuch: Wie wird Simplicissimus zum „schlime[n] Gesell“? Grimmelshausens Antwort auf die zeitgenössische Ethik. In: IASL 28 (2003), H. 2, S. 133–151, geht sogar so weit, den Roman als einen Beitrag zur ethischen Debatte im Umfeld des Neostoizismus zu lesen. 19 Vgl. dazu etwa Hans G. Rötzer: Picaro – Landtstörtzer – Simplicius. Studien zum niederen Roman in Spanien und Deutschland. Darmstadt 1972 (Impulse der Forschung 4), S. 137–141. 20 Deswegen lehnt auch Matthias Bauer diejenigen Versuche ab, die den Roman durch eine allegorische Lesart gegen die Komplexität des Textes auf eine Deutung reduzieren wollen (Matthias Bauer: Der Schelmenroman. Stuttgart, Weimar 1994 [sm 282], S. 96–109), und auch Dieter Breuer sieht im Kommentar zu seiner Simplicissimus-Ausgabe die Besonderheit des Romans gerade darin, dass er sich nicht auf die moraltheologischen Lasterkataloge reduzieren lässt (ST 714–720). 21 Jean Schillinger: Simplicissimi erotische Abenteuer in Paris. In: Simpliciana 31 (2009), S. 161– 181, hat etwa – bei aller Nähe zu moraltheologischen Interpretationen – für die Paris-Episode darauf hingewiesen, dass es sich bei Simplicius’ Erkrankung eben nur scheinbar um die Syphilis handelt und der Protagonist damit letztlich doch der direkten Strafe für seine Ausschweifungen entgeht. Für einen Überblick zum Konzept der poetischen Gerechtigkeit vgl. Hartmut Reinhardt: Poetische Gerechtigkeit. In: RLW 3, S. 106–108. 22 Walter Ernst Schäfer erkennt geradezu ein Gattungsmerkmal darin, dass die poetische Gerechtigkeit im niederen Roman problematisch wird (Walter Ernst Schäfer: Tugendlohn und Sündenstrafe in Roman und Simpliciade. In: ZfdPh 85 [1966], S. 481–500). Die Apologeten einer poetischen Gerechtigkeit im Simplicissimus müssen dann schon auf ein Konzept zurückgreifen, in dem „die Strafe bereits in der Sünde selber enthalten ist“ (Ulrich Stadler: Das Diesseits als Hölle: Sünde und Strafe in Grimmelshausens „Simplicianischen Schriften“. In: Europäische Tradition und deutscher Literaturbarock. Internationale Beiträge zum Problem von Überlieferung und Umgestaltung. Hg. von Gerhart Hoffmeister. Bern, München 1973, S. 351–369, hier S. 357). Da aber mit der Kausalität letztlich der Faktor Zeit selbst aus dem Konzept getilgt wäre, könnte die poetische Gerechtigkeit auch nicht mehr als Substitut für eine heilsgeschichtliche Gerechtigkeit fungieren.
Moralische Topologie und Chronotopos
103
aussetzungsvoll zu chiffrieren, nur um dahinter christliche Normvorstellungen zu verbergen, die ihrem Inhalt nach doch im Kontext des kulturellen Wissens der Zeit völlig unstrittig waren.23 Und drittens müssen die allegorischen Lesarten verneinen, dass es im Roman eine Lust am Erzählen gibt, die sich nicht auf moralsatirische Eindeutigkeiten reduzieren lässt.24 In der Tradition der allegorischen Deutungen wäre eigentlich eine andere Frage entscheidend: Warum findet der Roman die Möglichkeit einer nach normativen Maßstäben intakten Welt nur in den fantastischen, utopischen Gesellschaftsentwürfen etwa der Jupiter- und Mummelsee-Episode? Volker Meid hat hier auf einen impliziten Widerspruch aufmerksam gemacht: Einerseits wird darauf verwiesen, daß die irdischen Verhältnisse grundlegend verändert werden müssen, andererseits zeigt sich, daß die ideale Ordnung, die den Gottesfürchtigen ein Leben in Ruhe und Frieden garantieren würde, nicht verwirklicht werden kann, weil sie auf Voraussetzungen beruht, die in der geschichtlichen Welt nicht herzustellen sind.25
Dieser Widerspruch ist aber für die Verbindung von Moralsatire und pikarischem Erzählverfahren ganz zentral. Es geht demnach im Simplicissimus gar nicht darum, ein universal gültiges Normensystem nach Maßgabe der Moralphilosophie zu verteidigen, sondern um die viel grundlegendere Frage, ob überhaupt noch ein Normensystem denkbar ist, das die Grundlage einer Sozialordnung bilden kann. Diese Frage stellt sich vor allem, wenn man die groteske Komik des Romans mit bedenkt.26 Der Roman lebt ja von seiner grotesken Motivik, von der Darstel-
23 Diese Frage stellt sich vor allem, wenn man die Motive betrachtet, mit denen Grimmelshausen die verkehrte Welt gestaltet. Diese Motive hat Petra Kabus in ihrer Interpretation, die den Text konsequent als Satire zu deuten versucht, herausgearbeitet (Petra Kabus: Verkehrte Welt. Zur schriftstellerischen und denkerischen Methode Grimmelshausens im ‚Abentheurlichen Simplicissimus Teutsch‘. Frankfurt am Main u. a. 1993 [Europäische Hochschulschriften I 1416], S. 38–68). 24 Diesen Einwand hat – lange vor den poststrukturalistischen Apologien einer ‚Lust am Text‘ – bereits Paul B. Wessels vorgebracht: Dort, „wo das Komische um seiner selbst willen Geltung besitzt und nicht mehr dazu dient, die Heilsordnung und menschliche Verfehlung darzustellen, verläßt Grimmelshausen endgültig die Ebene der Satire“ (Paul B. Wessels: Göttlicher ordo und menschliche inordinatio in Grimmelshausens ‚Simplicissimus Teutsch‘. In: Festschrift Josef Quint. Anläßlich seines 65. Geburtstages überreicht. Hg. von Hugo Moser, Rudolf Schützeichel und Karl Stackmann. Bonn 1964, S. 263–275, hier S. 275). 25 Volker Meid: Grimmelshausen. Epoche – Werk – Wirkung. München 1984, S. 115. 26 Dieses Argument geht auf Michail Bachtin zurück, der zwischen den literarischen Operationsweisen einer exkludierenden Negation (wie in der Satire) und einer Umkehrung oder – wie man kontrastierend sagen könnte – partizipierenden Negation (wie in der Groteske) unterscheidet (Michail Bachtin: Rabelais und seine Welt. Volkskultur als Gegenkultur. Hg. und mit einem
104
Christian Kirchmeier
lung des fressenden und ausscheidenden Körpers, seiner Sexualität und Gewalt.27 In dem Maße, in dem diese grotesken Elemente zunehmen, verschwindet die satirische Komik. Mit Hans Robert Jauß gesprochen, tritt dann an die Stelle des Lachens über die Normverstöße der satirisch gezeichneten Figuren das Lachen mit dem grotesken Helden28 – beispielsweise wenn Simplicius durch den Kamin ins Pfarrhaus eindringt, um den Speck zu stehlen, und seiner Gefangennahme nur entgeht, weil er sich als der Leibhaftige selbst ausgibt, oder wenn er bei einer Affäre vom Vater der Frau in flagranti erwischt wird, noch im Bett vor dem eilig herbeigeholten Pfarrer die Ehe schließen muss und sich schließlich mit einem „Schertz“ (ST 330) auf Kosten seines neuen Schwiegervaters verabschiedet. Diese veränderte Komik hat weitreichende Konsequenzen für die Konzeption eines Normensystems. Während die Satire ein Normensystem ex negativo voraussetzt, benötigt die Welt der Groteske ein solches positives System überhaupt nicht. Zwar gibt es lebenspraktische Handlungsmaximen, die den Handlungen der Figuren zugrunde liegen, aber diese Maximen widersprechen einander und werden vom Text weder legitimiert noch durch einfache Negation abgelehnt.29 Mit Rainer Warning ließen sie sich als ‚duale‘ Strukturen auffassen, die noch nicht normativ aufgeladen, also noch nicht ‚oppositionell‘ formatiert sind.30 Weil Normensysteme definitionsgemäß ihre universale Geltung voraussetzen, wird durch einen
Vorwort versehen von Renate Lachmann. Frankfurt am Main 1995, S. 49–110). Zum Problem einer Unterscheidung dieser Negationstypen und ihrem historischen Ort an der Schwelle von Spätmittelalter und Renaissance vgl. Hans Ulrich Gumbrecht: Literarische Gegenwelten, Karnevalskultur und die Epochenschwelle vom Spätmittelalter zur Renaissance. In: Literatur in der Gesellschaft des Spätmittelalters. Hg. von Hans Ulrich Gumbrecht. Heidelberg 1980 (Begleitreihe zum GRLMA 1), S. 95–144. 27 Die grotesken Elemente des Romans untersucht Detlef Kremer: Körper und Gewalt im frühneuzeitlichen Roman – ‚Lazarillo de Tormes‘, Rabelais’ ‚Gargantua‘ und Grimmelshausens ‚Simplicissimus Teutsch‘. In: Simpliciana 27 (2005), S. 65–75, hier S. 69–73. Kremer weist auch auf die beiden zentralen Unterschiede zur Gattungstradition hin: An die Stelle des Nahrungsüberschusses tritt der Nahrungsmangel, und die hyperbolische Gewaltdarstellung enthält mit dem Bezug auf den Dreißigjährigen Krieg eine realistische Referenz. 28 Hans Robert Jauß: Über den Grund des Vergnügens am komischen Helden. In: Das Komische. Hg. von Wolfgang Preisendanz und Rainer Warning. München 1976 (Poetik und Hermeneutik 7), S. 103–132, hier S. 103–109 mit Bezug auf Bachtin. 29 Natalie Zeemon Davis hat im Anschluss an Bachtin betont, dass der Karneval nicht nur bestehende Ordnungen ablehnt, sondern auch alternative Ordnungen entwirft (Die Narrenherrschaft. In: Dies.: Humanismus, Narrenherrschaft und die Riten der Gewalt. Gesellschaft und Kultur im frühneuzeitlichen Frankreich. Frankfurt am Main 1987, S. 106–135). Dabei aber, so müsste man ergänzen, wird im Medium der literarischen Darstellung eben gerade die Kontingenz von Normensystemen ausgestellt. 30 Vgl. den Beitrag von Rainer Warning in diesem Band.
Moralische Topologie und Chronotopos
105
Normenpluralismus (der Begriff selbst ist ein Oxymoron) das Konzept von Normativität selbst unglaubwürdig. Und schon deswegen kann Normativität nicht mehr über Inklusion in die und Exklusion aus der Gesellschaft entscheiden. Genau das ist aber die Problemreferenz, auf die der Text mit der Darstellung Simplicius’ als pikarischer Figur reagiert. Sobald Simplicius seine Rolle als Hofnarr aufgegeben hat, wird er zu einem „‚halben Außenseiter‘“,31 der einmal Teil der Gesellschaft ist, ein andermal sich von ihr distanziert, der teils in die Gesellschaft inkludiert ist und teils aus ihr exkludiert. Als Liminalitätsfigur ist der Pícaro die Lösung des Problems, auf das der Roman in seiner Verbindung von Moralsatire und Groteske zugesteuert hat: dass nämlich ein normbasiertes Leben nur in sozialer Exklusion möglich ist (etwa als Einsiedler), zugleich aber danach gesucht wird, wie das Individuum innerhalb der Gesellschaft existieren kann – und soll. Diesen Widerspruch löst Simplicius als Pícaro, indem er die Inklusions-/Exklusionsdichotomie als Voraussetzung seiner individuellen Existenz unterläuft. Er ist eine soziale Randfigur, weil er nur so den Verlust einer verbindlichen Normativität kompensieren kann, oder mit Durkheim gesprochen: weil er sich nur so von der mechanischen Solidarität an das im Kollektivbewusstsein verankerte Normensystem lösen kann. Besonders überzeugend ist diese Lösung freilich nicht, weil sie die Frage nicht beantwortet, wie denn eine soziale Ordnung ohne Bezug auf ein Normensystem gestaltet werden soll. Und so recht scheint sich der Roman dann auf diese Lösung auch nicht zu verlassen. Das fünfte Buch endet mit einer Weltabsage, Simplicius wird wieder Einsiedler – wenn auch zunächst nur bis zum Beginn der Continuatio. Das makrohistorische Problem der Auflösung einer normbasierten Sozialstruktur bleibt als strukturelle Aporie bestehen, in der der Text gefangen bleibt.32 Um diese Aporie noch einmal zu pointieren: Als Moralsatire hält der Text
31 Das ist das zentrale Konzept von Claudio Guillén: Zur Frage der Begriffsbestimmung des Pikaresken. In: Pikarische Welt. Schriften zum europäischen Schelmenroman. Hg. von Helmut Heidenreich. Darmstadt 1969 (WdF 163), S. 375–396, hier S. 384. 32 Es wäre zu überlegen, ob die Identifizierung dieses Strukturproblems nicht zu einer Revision der Verbürgerlichungsthese von Arnold Hirsch führen müsste. Hirsch hatte argumentiert, dass die Weltflucht als Telos des pikarischen Lebenswandels die Ideologie eines asketischen Ethos bekräftige, während erst der calvinistische Pícaro als Kaufmann in der Welt ankomme. Damit sei die Gattung im ausgehenden 17. Jahrhundert zu einer bürgerlichen Ideologie umgeschwenkt (Arnold Hirsch: Bürgertum und Barock im deutschen Roman. Ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte des bürgerlichen Weltbildes. 2. Aufl. besorgt von Herbert Singer. Köln, Graz 1957 [Literatur und Leben N. F. 1]; vgl. zur Auseinandersetzung mit Hirsch auch Christian Kirchmeier: Regeln der Abweichung. Funktionen von Kriminalität in deutschen pikaresken Texten des 17. Jahrhunderts. In: LiLi 45 [2015], Nr. 179, S. 134–164). Schon früh wurde an dieser These kritisiert, dass Hirschs Bürgertumsbegriff zu vage sei (so etwa Walter Benjamin in seiner
106
Christian Kirchmeier
an den moraltheologischen Normen fest, als Groteske zeigt er, dass diese Normen nicht mehr in der Lage sind, eine Gesellschaft zu fundieren, und mit den Mitteln einer pikarischen Erzählung versucht er, an einem Individuum eine Lösung durchzuspielen, die aber das zugrunde liegende soziale Problem unberührt lässt.
3 Simplicissimus redivivus Diese Thematik von Grimmelshausens Simplicissimus Teutsch lässt sich nicht vom Dreißigjährigen Krieg lösen, von der Erfahrung von Hunger und Pest und von der Entvölkerung ganzer Landstriche. Es war vor allem dieser Krieg, der den Verlust des traditionellen christlichen Normensystems und der daran gebundenen Sozialordnung augenfällig machte. Der Simplicissimvs Redivivvs33 steht in einem völlig anderen historischen Kontext. 1743, inmitten des Österreichischen Erbfolgekrieges erschienen,34 zählt er zu den spätesten simplicianischen Schriften. Die Handlung der etwa 100 Druckseiten umfassenden Erzählung spielt in den ersten beiden Kriegsjahren, also von 1740 bis 1742. Sicherlich ist dieser Kabinettskrieg trotz der Beteiligung aller europäischer Staaten in seinem Ausmaß nicht mit dem Dreißigjährigen Krieg zu vergleichen, und dieser Unterschied lässt sich in der Erzählung auch nicht übersehen. Den aufkommenden habsburgisch-preußischen Dualismus hat der anonyme österreichische Autor noch nicht registriert, er spielt jedenfalls im Text keine Rolle. Dafür steht die Handlung voll und ganz im Zeichen der traditionellen Feindschaft zwischen Österreich und Frankreich sowie im historischen Kontext der modernen Staatenbildung, ein Prozess, der die Zeit seit dem Dreißigjährigen Krieg bis zur Französischen Revolution prägt. Dieser
Rezension [Walter Benjamin: Gesammelte Schriften. Bd. 3. Hg. von Hella Tiedemann-Bartels. Frankfurt am Main 1991, S. 428–430]) und dass bereits das Barock auf einer bürgerlichen Ideologie beruhe (Wilfried Barner: Barockrhetorik. Untersuchungen zu ihren geschichtlichen Grundlagen. Tübingen 1970, hier S. 215–220). Vor dem Hintergrund der hier vorgestellten Deutung wäre die Weltflucht nicht als Askese zu begreifen, sondern Ausdruck der Krise eines ethischen Lebensentwurfs in einer Gesellschaft, die sich in ihrer Selbstbeschreibung nicht mehr auf Moral begründen kann. 33 Anon.: SIMPLICISSIMVS REDIVIVVS. Das ist: Der in Franckreich wieder belebte und curieus becrperte alte SIMPLICIUS […]. o. O. [1743] (im Folgenden zitiert als SR mit Seitenzahl; diese Ausgabe ist als Mikrofilm in der Harold Jantz Collection of German Baroque Literature, Nr. 2859, Rolle 565, verfügbar). Vgl. dazu Peter Heßelmann: Simplicissimus redivivus. Eine kommentierte Dokumentation der Rezeptionsgeschichte Grimmelshausens im 17. und 18. Jahrhundert (1667– 1800). Frankfurt am Main 1992 (Das Abendland N. F. 20), S. 203–205. 34 Zum historischen Kontext vgl. Reed Browning: The War of the Austrian Succession. New York 1993.
Moralische Topologie und Chronotopos
107
veränderte historische Kontext führt auch zu einer neuen Lösung im Verhältnis von moralischer Topologie und Chronotopos des Helden, wie sie die Erzählung vorschlägt. Um diese Lösung zu beschreiben, muss zunächst die Handlung des wenig bekannten Textes knapp zusammengefasst werden: Da Simplicius im Jahr 1740 natürlich schon lange tot ist, muss er erst zum Leben erweckt werden. Das erledigt zu Beginn der Erzählung ein „grosser Philosophischer Adeptus“ (SR 4) in Paris, der aus Langeweile Grimmelshausens simplicianische Schriften gelesen hat und nun den Protagonisten persönlich treffen will. Er lässt den Geist Simplicius’ in den Körper eines verstorbenen Dieners fahren. Eine Zeitlang lebt Simplicius nun in Paris, bis er sich als Soldat für das französische Heer anwerben lässt, um nach dem Tod des Habsburgers Karl VI. gegen Österreich zu ziehen. Simplicius ist Augenzeuge, als das französische und das bayerische Heer in Prag einziehen und als sich Kurfürst Karl Albrecht von Bayern zum König von Böhmen krönen lässt. Der Erzähler fungiert über einen Großteil der Handlung nur als Kriegsberichterstatter. Der Roman greift also auf eine journalistische Schreibweise zurück, die sich auch in anderen simplicianischen Schriften nach Grimmelshausen finden lässt, besonders ausgeprägt etwa in Johann Georg Schielens Frantzösischem Kriegs-Simplicissimus (1682/83).35 Doch während Schielens Bericht durch eine zurückhaltende Kommentierung des Erzählers dem Leser ermöglichen soll, sich sein eigenes Urteil zu bilden,36 macht der wiederbelebte Simplicius keinen Hehl aus seiner Abscheu gegen Frankreich und die französischen Soldaten.37 Er beginnt mit einer Kritik an den „Franzsische[n] Hof=Intriguen“ (SR 14) und erzählt, wie der französische König vorgibt, die Thronfolgeregelung nach der
35 [Johann Georg Schielen]: Deß Frantzösischen Kriegs=Simplicissimi hoch=verwunderlicher Lebens=Lauff […]. 2 Bde. Freiburg 1682/83. Zur Autorschaft Schielens und zu dessen Umgang mit seinen historischen Quellen vgl. Manfred Koschlig: Der „Frantzösische Kriegs-Simplicissimus“ oder: Die „Schreiberey“ des Ulmer Bibliotheksadjunkten Johann Georg Schielen (1633–1684). In: Jahrbuch der deutschen Schillergesellschaft 18 (1974), S. 148–220; zur journalistischen Schreibweise vgl. Peter Heßelmann: Schelmenroman und Journalismus – Johann Georg Schielens ‚Deß Frantzösischen Kriegs-Simplicissimi Hoch-verwunderlicher Lebens-Lauff‘ (1682/83) im mediengeschichtlichen Kontext des 17. Jahrhunderts. In: Das Ungarnbild in der deutschen Literatur der frühen Neuzeit. ‚Der Ungarische oder Dacianische Simplicissimus‘ im Kontext barocker Reiseerzählungen und Simpliziaden. Hg. von Dieter Breuer und Gábor Tüskés. Bern u. a. 2005 (Beihefte zu Simpliciana 1), S. 161–181. 36 Vgl. dazu Koschlig (Anm. 35), S. 162, sowie den Beitrag von Carolin Struwe in diesem Band. 37 Auch für antifranzösische Propagandaschriften gibt es simplicianische Vorlagen. So weist Peter Heßelmann (Simplicissimus redivivus [Anm. 33], S. 203) auf den Straßburgischen StaatsSimplicius von 1684 hin, in dem die französische Annexion Straßburgs (1681) kritisiert wird (vgl. ebd., S. 171–173).
108
Christian Kirchmeier
Pragmatischen Sanktion zu respektieren, insgeheim aber gegen Maria Theresia agiert und den bayerischen Kurfürsten militärisch unterstützt. Besonders ausführlich stellt Simplicius die „innerliche Herzens=Boßheit“ (SR 27) der französischen Soldaten bloß, die dem Volk eine falsche Frömmigkeit vortäuschen, nur um es danach umso skrupelloser auszubeuten, die verheiratete Frauen verführen und sogar eine Kirche anzünden. War es bei Grimmelshausen also noch Simplicius selbst, der mit den moralischen Normen gebrochen hat, sind es nun ausschließlich die Franzosen. In Prag erlebt Simplicius den Niedergang der Stadt unter der französisch-bayerischen Besatzung. Die Verpflegung ist so schlecht, dass die Einwohner damit beginnen, ihre fast verhungerten Pferde massenweise zu schlachten, sodass sich auf dem Platz vor der Reitschule ein zweiter Boden aus getrocknetem Pferdeblut bildet. Unter diesen Lebensumständen erkrankt Simplicius. Er muss in ein Spital, dessen katastrophale Zustände er besonders drastisch schildert: Auf der Erde war nichts von denen Brettern zu sehen, denn da war alles 4.–5. Finger hoch Urin, Koth, Blut, ausgedruckte Materie, gespienes, und dergleichen, und vor jedem Bethe sahe man grosse Hauffen Koth und Blut, denn bey dem Aderlassen wird das Blut nur so auf die Erde gelassen, ohne daß man es in eine Schssel, oder in einen Topf auffanget. (SR 52)
Mit diesen Schilderungen greift der Text zwar groteske Motive auf, aber das Moment einer grotesken Komik fehlt. Immer wieder betont Simplicius seinen Ekel vor den Zuständen und seinen Hass gegenüber der französischen „Lebens=Art“ (SR 70), ja er wünscht sich sogar, von seinem „geborgten Crper Abschied“ zu nehmen (SR 60). Und so ergreift er schließlich die erstbeste Möglichkeit, um zu desertieren und aus der Stadt zu fliehen. Entscheidend ist, dass er nun gerade keinen pikarischen Lebenswandel einschlägt, sondern sofort die Seiten wechselt und sich der ungarischen Armee anschließt. Die Komplexität des pikarischen Chronotopos reduziert sich damit auf die Binarität der kriegsführenden Parteien. Wo Grimmelshausen, um noch einmal mit Warning zu sprechen, unaufhaltsam Duale prozessiert, löst dieser Text alle Duale in einer großen, normativ aufgeladenen Opposition zwischen Franzosen und Ungarn auf. Unter den Ungarn erscheint dann auch alles unter im Vergleich zum französischen Heer umgekehrten Vorzeichen: O was war da fr schnes Volk! die schne gesunde regulirte Infanterie, die schne Hussaren, die Compagnien und fast unzehlbare Vlker der Insurgenten, die verschiedene Ungarische Vlker, Lickaner, Panduren, die Siebenbrgischen, und wie sie nur alle immer heissen mgen, einem jeden, und allen sahe man Herzhafftigkeit, Muth, und Tapferkeit aus den Augen an, ja ich muß bekennen, daß ich es denen Franzosen fast nicht bel deuten kan, wenn sie bey dem Anblick solcher heroischen Leute davon lauffen, und die Flucht nehmen. […]
Moralische Topologie und Chronotopos
109
In diesem Lager gieng es sehr gut und herrlich zu, es war alles lustig, redlich, und aufrichtig/ die Ehre und der Respect der hohen Generalitt und aller Herren Officiere wurde ganz anderst als bey denen Franzosen in acht genommen […]. (SR 73 f.)
Der Erzähler verschweigt geflissentlich den Frieden von Berlin zwischen Österreich und Preußen, der am 28. Juli 1742 den ersten Schlesischen Krieg beendet und die Rückeroberung Prags überhaupt erst ermöglicht hat. Stattdessen berichtet er nur knapp, dass die „Vlker der Knigin [Maria Theresia] ihren frhlichen Einzug hatten“ (SR 75). Noch leidet Simplicius an der erneut ausgebrochenen Gelbsucht, die es ihm verwehrt, an der Eroberung Prags teilzunehmen, ihm aber die Zeit gibt, seine Lebenserzählung seit der Wiedergeburt zu verfassen. Die Isolation im moralischen Exklusionsraum der Kreuzinsel, auf der Simplicius bei Grimmelshausen seine Biografie aufschreibt, wird also durch das Krankenbett im Lager der ‚guten‘ kriegsführenden Partei ersetzt. Kaum ist Prag von den Franzosen befreit, verbessert sich auch der Gesundheitszustand des Protagonisten: „Weil nun wieder alles frhlicher aussahe und bessere Zeiten waren, indem an denen besten Victualien kein Mangel war, so erholte ich mich bey guter Verpflegung auch bald wieder und wurde vllig gesund“ (ebd.). Damit endet die Handlung. Der Handlungsverlauf macht deutlich, dass der Simplicissimvs Redivivvs Teil einer habsburgischen Kriegspropaganda ist. Doch es gibt noch grundlegendere Unterschiede zum Simplicissimus Teutsch: Während sich Simplicius bei Grimmelshausen immer an der Grenze zwischen sozialer Inklusion und Exklusion bewegt, ist er in der anonym verfassten Erzählung eindeutig inkludiert, zunächst in das französische, dann in das ungarische Heer. Die Transgression des Protagonisten von dem einen in den anderen Inklusionsraum hat die Funktion, die jeweiligen Normensysteme unterschiedlich zu bewerten: Auf der einen Seite brandmarkt der Text die Normen der französischen Lebensführung als durchweg negativ und führt vor, wie durch sie eine Stadt zugrunde gerichtet wird. Das ungarische Heer wird als Gegenbild aufgewertet; es steht für einen normativen Idealzustand und heilt durch seine bloße Anwesenheit die Stadt und den Protagonisten von den Folgen der französischen Besatzung. Die moralische Topologie geht in dieser Erzählung völlig in der oppositionellen Struktur des Chronotopos auf. Mit dieser Idealisierung zählt der Simplicissimvs Redivivvs zu einem Texttypus, der sich wahrscheinlich zu allen Zeiten finden lässt und der normative Differenzen in die axiologische Differenz zwischen ‚wir‘ und ‚die anderen‘ überführt.38 Vor dem
38 Vgl. in Auseinandersetzung mit Reinhart Koselleck Peter Strohschneider: Fremde in der Vormoderne. Über Negierbarkeitsverluste und Unbekanntheitsgewinne. In: Alterität als Leitkonzept für historisches Interpretieren. Hg. von Anja Becker und Jan Mohr. Berlin 2012 (Deutsche Literatur. Studien und Quellen 8), S. 387–416.
110
Christian Kirchmeier
historischen Kontext der modernen Staatenbildung im 18. Jahrhundert scheint hier dennoch eine historische Entwicklung erkennbar zu sein: Der Simplicissimvs Redivivvs macht den Vorschlag, das Problem des Normenpluralismus, wie es etwa bei Grimmelshausen zu beobachten war, über nationale Differenzen zu lösen, und zwar lange vor dem nationalistischen 19. Jahrhundert. Es geht ihm gewissermaßen darum, um noch einmal Durkheims Begrifflichkeit aufzugreifen, die mechanische Solidarität durch eine nationale Solidarität zu ersetzen. Der Text gesteht also durchaus ein, dass Normen keine universale Geltung mehr beanspruchen können, aber er versucht zu zeigen, dass diese Unterschiede sich in Inklusions- und Exklusionsordnungen auflösen lassen, die nationenspezifisch sind. Und er nimmt Teil an einer Art moraldidaktischem Krieg um die Deutungshoheit darüber, welches nationale Normensystem der Gesellschaft schadet und welches sie – bis auf die Ebene der hygienischen Zustände – heilt. Pointiert formuliert, lässt sich im Simplicissimvs Redivivvs also das Projekt erkennen, die Gesellschaftsordnung nicht mehr über universale moralische Normen zu begründen, sondern Normativität im Konzept der Nation aufgehen zu lassen; eine Lösung, die dann in den folgenden zwei Jahrhunderten immer wieder auf den verschiedensten Feldern, etwa der Politik, der Ästhetik und der Wirtschaft, diskutiert wurde. Es beginnt eine Zeit, in der die Moralsatire nicht mehr die gesellschaftsstabilisierende Funktion hat, die auf dem Titelkupfer von Grimmelshausens Simplicissimus noch konnotiert war, eine Zeit, in der die Frage nach dem richtigen Leben in eine Frage nach der richtigen Nation umgewandelt wurde. Bleibt der Verweis auf das französische Kochbuch. Die Handlung des Simplicissimvs Redivivvs endet, wie erwähnt, mit der Rückeroberung Prags. Die Erzählung fügt aber auf den letzten 20 Seiten – immerhin ein Fünftel des Umfangs – einen „kleinen Bericht“ darüber an, „wie es bey denen Franzosen in der Kche zu zugehen pfleget“ (SR 76). Zwar kritisiert Simplicius auch hier die französische Art, sich ohne Rücksicht auf den Rang und ohne Dankgebet an den Tisch zu setzen, doch hinter der ausführlichen Beschreibung der Kochrezepte wird eben auch sichtbar, dass er zumindest der französischen Küche einen Vorbildcharakter zugesteht. Wenigstens kulinarisch reserviert der Text somit einen Bereich kultureller Alterität, der die Differenzen zwischen Österreich und Frankreich nicht mit normativen Oppositionen auflädt. Und so ist es dann auch der weiterführende Literaturhinweis ausgerechnet auf ein französisches Buch, nämlich La Varennes Kochbuch, mit dem Simplicius seinen Exkurs beendet: Wer nun Lust hat noch mehr Franzsische Speisen zu lernen, der beliebe nur das Buch: le vray Cuisinier zu lesen/ es ist in der Haupt=Stadt des Herzogthums Brabant zu Brssel 1712. gedruckt; wer also Franzsisch verstehet, kan auch aus diesem Buche recht Franzsisch fressen lernen. (SR 93 f.)
Rosmarie Zeller
Der Goldene Esel des Apuleius und Wolfgang e Caspar Printz’ Guldner Hund Vorbild und Spielform des Pikaroromans Das Titelblatt des 1675 anonym erschienenen Romans Gldner Hund, welcher mit überzeugenden Argumenten Wolfgang Caspar Printz zugeschrieben wird, enthält eine Reihe von Signalen, die das Werk in den Gattungskontext des Pikaroromans einordnen.1 Zunächst einmal weist der Autor auf dem Titelblatt selbst auf diese Verwandtschaft hin, wenn er bemerkt, das Buch sei „[s]o nützlich und lustig zu lesen als deß Apuleji gldner Esel/ oder Samuel GreifenSohns Simplicius Simplicissimus“.2 Dieser Hinweis ist der erste in einer Reihe von Nachahmungen und Variationen des Simplicissimus.3 Die Formulierung „[s]o nützlich und lustig zu lesen“ selbst kann als weiteres Signal interpretiert werden, heißt es doch auf dem Titelblatt des Simplicissimus: „Uͤberauß lustig/ und mnniglich nutzlich zu lesen“;4 und auf dem Titelblatt der Courasche wird dies wieder aufgenommen: „Eben so lustig, annemlich und nutzlich zu betrachten als Simplicissimus
1 Zitiert wird nach der Ausgabe Wolfgang Caspar Printz: Ausgewählte Werke. Hg. von Helmut K. Krausse. Bd. 2. Berlin, New York 1979. (Ausgaben deutscher Literatur des XV. bis XVIII. Jahrhunderts 84). Vgl. zur Verfasserfrage Bd. 3. Berlin, New York 1993 (Ausgaben deutscher Literatur des XV. bis XVIII. Jahrhunderts 144), S. 212. Zitate hier und im Folgenden nach dieser Ausgabe, nachgewiesen durch Seitenzahl im Haupttext. 2 Der vollständige Titel lautet: Gldner Hund/ oder Ausfhrliche Erzehlung/ wie es dem so genannten Cavalier aus Bhmen/ welcher nicht/ (wie etliche mit Unwahrheit vorgegeben/) wegen greulicher Gotteslsterung/ sondern durch Zauberey/ in einen Hund verwandelt worden/ bißhero ergangen/ Und wie er wieder seine vorige menschliche Gestalt berkommen: (So nützlich und lustig zu lesen als deß Apuleji gldner Esel/ oder Samuel GreifenSohns Simplicius Simplicissimus;) Erstlich in Polnischer Sprache beschrieben/ anitzo aber/ denen Böhmischen Lands=Leuten zu Ehren verteutscht von COSMOS PIERIO BOHEMO. Gedruckt zu Wrzeckowitz, im Jahr 1675. 3 Siehe dazu Peter Hesselmann: ‚Simplicissimus Redivivus‘. Eine kommentierte Dokumentation der Rezeptionsgeschichte Grimmelshausens im 17. und 18. Jahrhundert (1667–1800). Frankfurt am Main 1992 (Das Abendland N. F. 20), S. 41. 4 Hans Jacob Christoffel von Grimmelshausen: Der abentheuerliche Simplicissimus Teutsch. In: Ders.: Werke. Hg. von Dieter Breuer. Bd. I, 1. Frankfurt am Main 1989 (Bibliothek deutscher Klassiker 44; Bibliothek der Frühen Neuzeit 4/1), S. 11.
112
Rosmarie Zeller
selbst.“5 Weitere Signale sind, dass das Werk einem anonymen Autor zugeschrieben wird, der es in polnischer Sprache geschrieben habe; der Übersetzer nennt sich Cosmus Pierius Bohemus. Es gibt einen fiktiven Erscheinungsort Wrzeckowitz, was so viel bedeutet wie: Cosmopolis.6 Dies wiederum erinnert an den Erscheinungsort von Grimmelshausens Courasche „Utopia“7. Als weiteren Hinweis auf das Gattungsmuster könnte man auch deuten, dass der zweite Teil des Romans, der 1676 erschien, nicht als Fortsetzung, sondern als Ergänzung des ersten Teils deklariert wird, so wie die Courasche eine Ergänzung des Simplicissimus ist.
1 Der Goldene Esel als antiker Prototyp des niederen Romans Der Gldne Hund wird in der Forschungsliteratur zum Pikaroroman und zu Apuleius’ Goldenem Esel erwähnt,8 ist aber nie einer genaueren Untersuchung unterzogen worden, auch wenn die Forschung in der Zusammenstellung von Simplicissimus und Goldenem Esel bereits einen Beleg für die Herkunft des Pikaroromans aus der menippeischen Satire gesehen hat.9 In Analogie zu Apuleius’ Goldenem Esel, wo ein junger Mann in einen Esel verwandelt wird, wird in Printz’ Roman ein Mann in einen Hund verwandelt. In beiden Texten behalten die Tiere alle menschlichen Eigenschaften außer der menschlichen Gestalt bei, eine Voraussetzung für die gesellschaftskritische Rolle, die Esel und Hund hier spielen. Sowohl der Hund wie der Esel kommen zu immer neuen Herren, bis sie endlich in einen Menschen zurückverwandelt werden. Der zweite Teil von Printz’ Roman erzählt den angeblich aus Eile zu kurz
5 Hans Jacob Christoffel von Grimmelshausen: Courasche. In: Ders.: Werke. Hg. von Dieter Breuer. Bd. I, 2. Frankfurt am Main 1992 (Bibliothek deutscher Klassiker 73; Bibliothek der Frühen Neuzeit 4/2), S. 9–151, hier S. 11. 6 Vgl. Alois Eder: Erstlich in polnischer Sprache beschrieben … Wolfgang Caspar Printz’ ‚Güldner Hund‘ und Polen. In: Acta Universitatis Wratislaviensis, Nr. 431 (Germanica Wratislaviensia 34), 1978, S. 213–239, hier S. 223. 7 Grimmelshausen: Courasche (Anm. 5), S. 11. 8 Vgl. Birgit Plank: Johann Sieders Übersetzung des „Goldenen Esels“ und die frühe deutschsprachige „Metamorphosen“-Rezeption. Ein Beitrag zur Wirkungsgeschichte von Apuleius’ Roman. Tübingen 2004 (Frühe Neuzeit 92), S. 216–218; Hesselmann (Anm. 3). 9 Vgl. Stefan Trappen: Grimmelshausen und die menippeische Satire. Eine Studie zu den Voraussetzungen der Prosasatire im Barock. Tübingen 1994 (Studien zur deutschen Literatur 132), S. 234 f. und 312.
e
Der Goldene Esel des Apuleius und Wolfgang Caspar Printz’ Guldner Hund
113
geratenen Schluss ausführlicher. Zudem werden zwei Traktate, einer über das Geld, der andere über Musik, eingefügt. Apuleius’ Goldener Esel, der einzige antike Roman, der vollständig erhalten ist, ist im literarischen Bewusstsein des 16. und 17. Jahrhunderts sehr präsent, obwohl es nur wenige volkssprachliche Übersetzungen und Drucke gibt.10 Sein Verfasser gilt als platonischer Philosoph, und seine Präsenz mag auch damit zusammenhängen, dass Augustinus im Gottesstaat das Buch erwähnt.11 Am berühmtesten ist die in den Roman eingelegte Erzählung Amor und Psyche, die auch oft separat veröffentlicht wurde, auf die hier aber nicht weiter eingegangen werden soll.12 Im Zusammenhang mit dem pikarischen Erzählen interessiert vielmehr die Rolle, die der Goldene Esel in der Gattungstheorie des Romans in Frankreich im 17. Jahrhundert spielt, wo zum ersten Mal auch der niedere Roman theoretisch erfasst wurde. Jean Chapelain, der den Guzmán des Mateo Alemán ins Französische übersetzte, hat schon zu Beginn des 17. Jahrhunderts einen Versuch gemacht, den bis dahin im System der Gattungen nicht vorkommenden Roman in Analogie zum System der dramatischen Gattungen zu definieren und ihn in einen hohen, heroisch-historischen, und einen niederen, komischen, einzuteilen.13 Letzterer bedient sich des sermo humilis und stellt wie die Komödie die Begebenheiten des privaten Lebens, die Laster und die Miss- und Übelstände der Welt dar.14 Chapelain hat diese Gattung des komischen Romans auf Apuleius und Lukian zurückgeführt und sie damit
10 Siehe dazu: Julia Haig Gaisser: The Fortunes of Apuleius and the ‚Golden Ass‘. A Study in Transmission and Reception. Princeton, Oxford 2008 (Martin Classical Lectures). Die erste deutsche Übersetzung stammt von Johann Sieder: Ain schn lieblich auch kurtzweylig gedichte Lucii Apuleii von ainem gulden Esel. […]. Augsburg (Alexander Weissenhorn) 1538. Ich zitiere die Ausgabe von Frankfurt (Zacharias Palthenius) 1605: Sehr liebliches/ kurzweiliges, knstliches vnd ntzliches Gedicht Lucij Apulej […] Von seiner auß einem Menschen/ in einen Vernnfftigen Esel/ Wunderbaren/ schnellen vnnd gefhrlichen Metamorphosi/ Transmutation vnd Verwandelung […]. Bey Palthenio inn Franckfurt zu finden. Anno 1605. 11 Vgl. Plank (Anm. 8), S. 19 f.; Gaisser (Anm. 10), S. 29–36. 12 Im 17. Jahrhundert wird der Goldene Esel von Apuleius manchmal mit dem gleichnamigen griechischen Roman, der Lukian zugeschrieben wurde, der heutzutage aber als pseudolukianisch bezeichnet wird, in eins gesetzt. Zu dieser Problematik siehe Gaisser (Anm. 10), S. 153–157, zur deutschen Übersetzung durch Niklas von Wyle ebd., S. 245–248. 13 Das Werk erschien erst postum: Jean Chapelin: De la lecture des vieux romans. Hg. von Alphonse Feillet. Paris 1870. 14 Siehe dazu Jean-Marie Valentin: Grimmelshausen zwischen Albertinus und Sorel. Wege und Formen des Schelmenromans in Frankreich und Deutschland im 17. Jahrhundert. In: Simpliciana 12 (1990), S. 135–157 und Ansgar Thiele: Zwischen Exklusion und Individualisierung. Transformationen des Pikaros in der ‚histoire comique‘. In: Das Paradigma des Pikaresken. The Paradigm of the Picaresque. Hg. von Christoph Ehland und Robert Fajen. Heidelberg 2007 (GRMBeiheft 30), S. 133–146.
114
Rosmarie Zeller
genauso wie die dramatischen Gattungen als aus der Antike stammend legitimiert. Der Goldene Esel wurde in der Folge zu dem antiken Referenzwerk für den niederen Roman, den Roman comique.15 Die Darstellung von mehr oder weniger alltäglichen Begebenheiten im komischen Roman, welche scheinbar ungeschminkt und ohne rhetorischen Aufwand beschrieben werden, führte dazu, dass man diese Gattung im Gegensatz zum hohen Roman immer als besonders realistisch empfand, auch wenn Passagen „auß andern Büchern extrahirt“ sind,16 wie der Erzähler im Simplicissimus Teutsch selbst zugibt. In seiner Bibliothèque Françoise von 1667 widmet Charles Sorel den „ROMANS COMIQVES, Ou Satyriques“ ein eigenes Kapitel, in dem er immer wieder hervorhebt, dass der Roman comique näher bei der Wahrheit sei als andere Romane: „Les bons Romans Comiques & Satyriques semblent plûtost estre des images de l’Histoire que tous les autres; Les actions communes de la Vie estans leur objet, il est plus facile d’y rencontrer de la Verité.“17 Schon im Kapitel über den heroischen Roman stellt er fest: „Beaucoup de Gens se plaisent dauantage au recit naturel des auantures modernes, comme on en met dans les Histoires qu’on veut faire passer pour vrayes non pas seulement pour vraysemblables.“18 Das Erzählen von wahren Begebenheiten wird geradezu zum Gattungsmerkmal des komischen Romans. So leitet Sorel ihn von der relativ neuen Gattung der „Nouvelles“ oder „Historiettes“ her, welche wahre Begebenheiten in der Reihenfolge, wie sie sich begeben haben, erzählen. Da das Publikum aber ein Bedürfnis nach längeren Erzählungen dieser Art habe, sei der Roman comique entstanden. Als Beispiel für diese neue Romanform nennt er den Goldenen Esel: „Comme il y a des Romans Heroïques, on en veut de Comiques. L’Asne d’or d’Apulée, auroit de belles Narrations au gré des plus difficiles, si on en auoit osté l’impureté.“19 Für diese komische Untergattung des Romans verweist er ferner auf Rabelais und die Spanier: „Les Espagnols sont les premiers qui ont fait des Romans vray-semblable & diuertissans.“20 Er nennt als Beispiele Don Quichotte und die ganze Reihe der
15 Auf die Wichtigkeit des Goldenen Esels als Muster für den Pikaroroman hat Margot Kruse bereits 1959 hingewiesen. Margot Kruse: Die parodistischen Elemente im ‚Lazarillo de Tormes‘. In: Romanistisches Jahrbuch 10 (1959), S. 292–304, besonders S. 300–304. Vgl. auch Trappen (Anm. 9), S. 236–238. 16 Grimmelshausen: Der abentheuerliche Simplicissimus Teutsch (Anm. 4), S. 319. 17 Charles Sorel: La Bibliothèque françoise. Seconde édition revue et augmentée. Paris 1667, Neudruck Genf 1970, S. 188. 18 Ebd., S. 187. 19 Ebd., S. 191 f. (Kap. Des Romans comiqves, ou satyriques et des Romans burlesques). Sorel führt weiter aus: „Auec toutes les Pieces agreables, il en faut de grandes & de narratiues, pour ceux qui veulent estre plus long temps entretenus“ (S. 191). 20 Ebd., S. 192.
e
Der Goldene Esel des Apuleius und Wolfgang Caspar Printz’ Guldner Hund
115
Pikaroromane, Guzman d’Alfarache, den Buscon, den Lazarillo de Tormes und auch die Pícara Justina.21 Diese Aufzählung macht den von den Theoretikern des 17. Jahrhunderts geschaffenen Zusammenhang zwischen dem Goldenen Esel, dem Pikaroroman und dem Roman comique deutlich. Der Goldene Esel als aus der Antike überlieferter Roman dient dazu, die Gattung, obwohl Sorel von ihr als ‚modernem Roman‘ spricht, doch letztlich auf die Antike zurückzuführen. Der komische Roman ist durch Wahrscheinlichkeit, durch das Unterhaltende und die lineare Erzählweise gekennzeichnet – die Romane beginnen häufig sogar mit der Geburt des Helden22 –, während der höfisch-heroische Roman dem Epos folgend medias in res beginnt und generell starke Achronien aufweist, zudem ein stark idealisiertes Personal hat, dem die unglaublichsten Dinge zustoßen. In Bezug auf das motivisch-thematische Feld von Verhängnis und Fortuna thematisiert der komische Roman die Wechselfälle der Fortuna, wie sich gerade am Goldenen Esel zeigt. Der Held reflektiert immer wieder darüber, dass ihm das Glück nicht hold sei und er sich daher nicht in einen Menschen zurückverwandeln könne.23 Generell sind die im Roman comique aneinander gereihten Episoden beliebig erweiterbar. Im Gegensatz zum höfisch-heroischen Roman, der durch die Wahl eines bekannten historischen Stoffes ebenso wie das Epos und die Tragödie von vornherein legitimiert ist, braucht der komische Roman, der beansprucht, wirklich Vorgefallenes zu erzählen, eine Beglaubigung. Diese wird durch Orts- und Zeitangaben, durch den Bezug auf historische Begebenheiten oder Nennung allgemein bekannter Personen geleistet, aber auch durch die Ich-Erzählung. Der Erzähler schildert im Allgemeinen seine eigene Geschichte, womit er zugleich den Anspruch erhebt, die Wahrheit zu erzählen. Da er sich aber in seinem Leben auch oft als Lügner erweist, kann eine komplexe Erzählsituation entstehen, in der die Glaubwürdigkeit des Erzählers untergraben wird. Die Frage nach der Glaubwürdigkeit des Erzählens und damit eine Zuordnung zu den rhetorischen Kategorien fabula und historia wird im Fall eines Romans, der vorgibt, die wahre Geschichte der Verwandlung eines Menschen in einen Hund zu erzählen, virulent. Der komische Roman, dem, wie erwähnt, Wirklichkeitsnähe nachgesagt wird, tendiert generell zur historia, wie man am Gebrauch des
21 Ebd. 22 Im Vorwort des Lazarillo de Tormes wird dies ausdrücklich thematisiert: „Weil aber der Herr begehret hat, ich wollte ihm das gantze Wesen nach der Länge beschreiben und erzählen, so hab ich für gut angesehen, nicht in der Mitten, sondern gantz von Anfang anzuheben, damit man mich rechtschaffen hieraus kennen lerne“ (Leben und Wandel Lazaril von Tormes. […] Verdeutscht 1614. Hg. von Manfred Sestendrup. Stuttgart 1979, S. 9). 23 Vgl. Formulierungen wie „Aber das neydische Glück war mir abermal zuwider/ vnnd zimmerte eine neue Widerwärtigkeit“ (Apuleius [Anm. 10], S. 293).
116
Rosmarie Zeller
Begriffs ‚historia‘ für die einzelnen Episoden zum Beispiel des Simplicius Simplicissimus nachweisen kann. Andererseits wird die Wahrheit der historia ja gerade auch wieder von einer Person wie der Courasche infrage gestellt. Sie behauptet, die wahre Geschichte des Simplicius zu erzählen und deckt dessen Irrtümer bzw. Nichtwissen auf. Ähnlich wird im Gldnen Hund behauptet, es werde in dem Roman eine Geschichte berichtigt, die dem Leser bereits bekannt sei, jedoch eben nicht in der richtigen Version. Dies kann man wiederum als Beglaubigungsstrategie sehen: Es gibt, so die Unterstellung, eine wirklich vorgefallene Historie, die der Öffentlichkeit bekannt ist. Sie wurde aber falsch erzählt und wird nun in dem vorliegenden Text berichtigt.24 Um dieses Spiel mit Berichtigungs- und Beglaubigungsverfahren, welches auch ein Element pikarischen Erzählens ist, zu verstehen, muss kurz auf die bereits gut aufgearbeitete Stoffgeschichte eingegangen werden,25 wobei ich mich auf jene Aspekte konzentrieren werde, die für Printz’ Roman relevant sind.
2 Der in einen Hund verwandelte Edelmann Quellen und mögliche Vorlagen Printz’ Roman geht angeblich auf eine wahre Begebenheit zurück, welche auch in anderen Medien wie Flugblättern, Magiebüchern und Kalendern überliefert ist. So taucht 1633 in einer Flugschrift, die im ersten Teil dem Tod Gustav Adolfs in der Schlacht von Lützen gewidmet ist, die Geschichte von einem Edelmann aus Böhmen auf, welcher sehr hartherzig war und einer Witwe mit fünf Kindern die letzte Kuh wegnahm und ihr sagte, ihre Kinder sollten Tierkadaver fressen. Als er nach Hause kam, erfuhr er, dass sein Vieh gestorben war, er lästerte Gott, worauf er in einen Hund verwandelt wurde und nur noch Tierkadaver fraß.26 Die Geschichte wird von verschiedenen Medien vermittelt und schafft es auch ins Theatrum Europaeum und in andere historische Darstellungen und Geschichtssammlungen, was zeigt, dass sie für wahr gehalten und den Historien zugeordnet
24 Diese Parallele zur Erzählsituation der Courasche wurde bisher nicht bemerkt. 25 Rolf Wilhelm Brednich hat diese unter primär volkskundlichen Aspekten aufgearbeitet: Der Edelmann als Hund. Eine Sensationsmeldung des 17. Jahrhunderts und ihr Weg durch die Medien der Zeit. In: Fabula 26 (1985), S. 29–57. 26 Seufftzende Klag vnd Threnen Gesang/ Ein schn trawrig Klaglied/ ber Jhre Königliche Majest. zu Schweden hochlobseligster vnd glorwrdigster Gedchtnuß […] Darbey auch Ein erschrckliche doch warhafftige Newe Zeitung/ von einem gottlosen Edelmann in Polen/ wie er zu einem Hund worden […]. Erstlich gedruckt zu Frankfurt an der Oder/ bey Mich. Fischer/ 1633 (VD 17:1:693284F).
e
Der Goldene Esel des Apuleius und Wolfgang Caspar Printz’ Guldner Hund
117
wurde.27 Die Nachricht wird denn auch in der Flugschrift als „eine erschrckliche doch wahrhafftige Newe Zeitung“ angekündigt und im ersten Satz eine „wunderlichen Historia“ genannt. Wie üblich werden zur Beglaubigung ein Ort und ein Datum (Stettin, 1. September 1633) sowie der Name des Edelmannes angegeben. Solche Wunder wurden in verschiedensten Zusammenhängen gesammelt und oft als Hinweise auf den nicht mehr allzu fernen Jüngsten Tag interpretiert. So heißt es bezeichnenderweise am Ende der Hundegeschichte, man wisse nicht, „ob er ein Hund biß an den Jngsten Tag verbleiben wird“.28 Ein im selben Jahr erschienenes Zeitungslied interpretiert die Geschichte geradezu als Hinweis auf den Jüngsten Tag: „DAs seynd die rechte Zeichen/ wol vor dem Jüngsten Tag/ O Mensch lass dich erweichen/ merck weiter was ich sag“.29 Die Geschichte soll zeigen, wie Gott die Hartherzigkeit bestraft, und soll die Menschen zur moralischen Umkehr und Barmherzigkeit vor dem Jüngsten Tag bewegen.30 Zunächst gibt es keine weiteren Belege für das Weiterleben der Episode; 1673 taucht sie massiv in den verschiedensten Medien wieder auf, allerdings mit einigen Veränderungen. Auf zwei Flugblättern ist der betroffene Edelmann ein Böhme aus vornehmer Familie,31 weshalb man seinen Namen nicht nennen wolle, die Geschichte habe sich 1672 an einem nicht näher genannten Ort abgespielt, auf einem Flugblatt wird der Name seines Schlosses und der naheliegenden Stadt nur mit N. angegeben. In den zahlreichen Zeitungen, die von dem Vorfall berichten, stammt die Nachricht aus Nürnberg, der hier ebenfalls namenlose Edel-
27 Einige Dokumente werden von Brednich (Anm. 25) im Anhang abgedruckt, S. 54–57. Der Text erschien in Bd. 3 des Theatrum Europaeum (Frankfurt 1670, S. 77). 28 Seufftzende Klag (Anm. 26), unpag. 29 Zitiert nach Brednich (Anm. 25), S. 32. Für den Zusammenhang zwischen Wundern und Hinweisen auf den Jüngsten Tag siehe Heinz Schilling: Job Fincel und die Zeichen der Endzeit. In: Volkserzählung und Reformation. Ein Handbuch zur Tradierung und Funktion von Erzählstoffen und Erzählliteratur im Protestantismus. Hg. von Wolfgang Brückner. Berlin 1974, S. 326–392. 30 Brednich (Anm. 25) deutet die Geschichte sozialkritisch, ihm folgend auch Michael Schilling: Bildpublizistik der Frühen Neuzeit. Aufgaben und Leistungen des illustrierten Flugblatts in Deutschland bis um 1700. Tübingen 1990 (Studien und Texte zur Sozialgeschichte der Literatur 29), S. 195 f. Dagegen spricht, dass alle Berichte über das Ereignis einen moralisierenden Kommentar anfügen. Auch das Theatrum Europaeum interpretiert die Verwandlung als Strafe für die Gotteslästerung. Auch noch ein Flugblatt von 1673 (siehe unten Anm. 34), das an der Geschichte zweifelt, schreibt, die Geschichte werde als „ein Straff=Zeichen für alle Gotteslästerliche und Ungerechte“ interpretiert. Erst in der Wiedergabe bei Happel in den Relationes curiosae wird das Beispiel umgedeutet als Warnung an die „Befehlhaber und Bedienten“, mit armen Leuten besser umzugehen. 31 Warhafftige und glaubwrdige Vorstellung der jenigen erschrcklichen Geschicht/ So sich unweit von Prag in dem Königreich Bheim/ jngst verwichenem 1672. Jahr mit einem vornehmen Cavallier zugetragen. O. O. [1673].
118
Rosmarie Zeller
mann selbst einmal aus N., ein andermal soll sich die Geschichte in der Nähe von München abgespielt haben.32 Im Unterschied zur Version von 1633 behält der Hund den Menschenkopf, ja selbst die Perücke bei. Seine Frau führt ihn an Orte, wo Wunder geschehen, und lässt Messen lesen in der Hoffnung, er werde zurückverwandelt. In einer Version wird er als abschreckendes Wunder herumgeführt. Der Akzent der Flugblätter liegt jetzt ganz auf der Gotteslästerung. Auffällig ist, dass keine Beglaubigungsstrategien, wie sie für Flugblätter üblich sind (Angabe von Datum, Ort, Zeuge), gebraucht werden, vielleicht weil Zeitungsnachrichten an sich als verlässlich gelten. Nur auf einem Flugblatt wird eine Quelle angegeben: „Aus Prag von einer Geistl. vornehmen Ordens=Persohn ausfhrlich berichtet.“33 Bei den Flugblättern werden die fehlenden Daten durch Bilder ersetzt, die die Funktion haben, die Glaubwürdigkeit der Geschichte zu bestätigen. Es werden der Hund, die ihn begleitende Kutsche und die Kirchen, zu denen seine Frau mit ihm gepilgert ist, gezeigt. Oft werden mehrere Episoden abgebildet. Dies ist auch nötig, denn in einem in Frankfurt am Main publizierten Flugblatt wird darauf hingewiesen, dass die Geschichte bereits 40 Jahre früher von „bewerthen Geschichtschreibern“ erzählt, ja von einem Augenzeugen bezeugt wurde. Hingegen mangelt es der Geschichte von 1672 in den Augen des Verfassers an Wahrheit, auch wenn die Geschichte „unser gantzes Teutschland erfllet“ und „auß unterschiedlichen Orten Bericht eingelauffen“ seien.34 In seiner Magiologia von 1675 schreibt der Pfarrer Bartholomäus Anhorn, der die Geschichte von 1633 ausführlich berichtet und für bezeugt und wahr hält, das „Kupfergemld von einem/ in einen Hund verwandleten Graffen“ diene nur dazu, „newgierige Leute zuffen“ und Geld mit ihnen zu machen. Niemand habe je diesen Hund mit einem
32 Brednich (Anm. 25) hat acht Zeitungen gefunden, die die Geschichte berichten. Ich habe zusätzlich noch einen Kalender von Gabriel Bardewick gefunden: Speculum Astro-Meteorologicum, Oder Spiegel der Grossen Practica/ Auf das Jahr/ der heylwehrten Geburt Jesu Christi/ M.DC.LXXIV. Die Praktik gehört zum Kalender (1673) Alter und Neuer Europaeischer Chronicken […]. Auf das Jahr […] M.DC.LXXIV. 33 Erschrecklicher Fluch=Spiegel/ oder entsetzliche Vorstellung Eines unbarmhertzigen und Gotteslsterlichen Menschens/ wie derselbe durch GOttes gerechtes Gericht in einen abscheulichen Hund verwandelt worden […]. O. O. 1673. 34 Erschckliche Wunder-Verwandlung/ Eines Menschens in einen Hund […]. Frankfurt am Main 1673.
e
Der Goldene Esel des Apuleius und Wolfgang Caspar Printz’ Guldner Hund
119
Menschengesicht gesehen.35 Anhorns Bemerkung weist indirekt darauf hin, dass 1673 die Abbildung des Hundes die Hauptrolle in der Bezeugung des Ereignisses spielte.
3 Quellenkritik des Ich-Erzählers In diesem Kontext des Wiederauflebens der Geschichte36 und der Diskussion um ihre Wahrheit muss meiner Ansicht nach auch der Roman von Printz gesehen werden, der nicht nur eine amüsante Geschichte erzählt, sondern zugleich die in der Untergattung Komischer Roman virulente Diskussion um fabula und historia weiterführt. Der Ich-Erzähler ist, wie dies auch für Apuleius’ Esel gilt, der in ein Tier verwandelte Mensch selbst, der somit weiß, wie es wirklich gewesen ist. Im Fall des Gldnen Hunds handelt es sich um den Sohn eines Bauern aus der Walachei, der im Dienst eines polnischen Adligen stand, was wiederum erklärt, warum es sich bei dem Roman (angeblich) um eine Übersetzung aus dem Polnischen handelt. Die Darstellung in den Flugblättern funktioniert als Prätext, den der Roman korrigieren will. Bereits im Titel wird der Anspruch, die Wahrheit darzustellen, deutlich: Es soll nämlich ausführlich erzählt werden, „wie es dem so genannten Cavalier aus Bhmen/ welcher nicht/ (wie etliche mit Unwahrheit vorgeben/) wegen greulicher Gotteslsterung/ sondern durch Zauberey/ in einen Hund verwandelt worden/ bißhero ergangen“. Die Diskussion um fabula und historia wird gleich im ersten Kapitel aufgenommen, in dem der Titel ankündigt, dass das „Paßquill von dem Bhmischen Cavalier“ (S. 8), das offensichtlich als bekannt vorausgesetzt wird,37 widerlegt werden soll. Im Kontext der Diskussion erwartet man, dass die Lügenhaftigkeit der Geschichte entlarvt werden soll, was durch den ersten Satz des Kapitels bestätigt wird: „Die Lgen seyn jetziger Zeit so gemein/ daß der jenige/ so nicht will betrogen werden/ fast nichts glauben darff.“
35 Bartholomäus Anhorn: Magiologia. Christliche Warnung fr dem Aberglauben vnd Zauberey […]. Basel 1674, S. 565–567, das Zitat S. 567. 36 Warum die Geschichte in den 1670er-Jahren wieder auflebte, ist schwer zu sagen. Immerhin sei darauf hingewiesen, dass es in diesen Jahren auch eine Diskussion um die ApokalypseDeutung und den Jüngsten Tag gab. Siehe zum Thema die Beiträge in Morgen-Glantz 21 (2011). 37 Schon auf der ersten Seite heißt es, „Kupferstecher und Buchdrucker“ hätten „nur ihren Nutzen darmit gesucht“ (S. 8). Ein Pater, welcher die Geschichte in seiner Predigt benutzt, sagt: „die Geschichte htte sich neulich zu getragen/ knte also weder in der Bibel/ noch in einigen Patre gefunden werden: Er htte aber die gantze Historie gedruckt/ und wr der Hund da bey in Kupfer gestochen.“ (S. 48 f.) Die Geschichte wurde tatsächlich in Predigten benutzt; vgl. Brednich (Anm. 25), S. 36.
120
Rosmarie Zeller
Klug sei derjenige, „der sehr wenig/ und nur/ was er selbst gesehen/ glubet“ (S. 8). Der Grimmelshausen-Leser kennt dieses Spiel vor allem aus der Continuatio, wo der Pilger Simplicius Gelesenes als Selbsterlebtes ausgibt, weil die Welt betrogen sein will, ein Satz, den übrigens auch Anhorn als Begründung für die Geschichte vom böhmischen Kavalier anführt.38 Bei der „Historie von dem vornehmen Cavalier aus Bhmen/ so zum Hunde worden“, hätten sich „so viel Lgen mit eingeschliechen/ daß verstndige Leute solche Geschicht billig für eine Fabel halten“ (S. 8). Das ganze erste Kapitel dient denn auch dazu, die Fakten zu berichtigen. Zunächst hebt der Erzähler die Unwahrscheinlichkeiten an der Geschichte hervor: Man gebe den Namen des Edelmannes in Rücksicht auf seine Familie nicht an, zugleich behaupte man, das Gesicht sei nicht verwandelt worden und er sei in einem durchsichtigen Käfig an heilige Orte geführt worden bzw. neben dem Wagen seiner Gemahlin hergelaufen. Es sei doch völlig unwahrscheinlich, dass ihn bei dieser Gelegenheit nicht jemand erkannt hätte bzw. dass seine Gemahlin nicht erkannt worden wäre. Und er schließt dann: „Was bemhe ich mich aber solche ungeschickte Fabul zu wiederlegen/ da ich doch selbst der jenige bin/ der in einen Hund verwandelt worden/ und also am besten weiß/ wer ich bin“ (S. 9). Er ist nämlich weder ein Edelmann noch ein Kavalier oder Graf, sondern der Sohn eines Bauern, der einige Schulbildung erhalten hat und schließlich nicht in Böhmen, sondern in Masuren Steuern eintreiben musste, und zwar nicht 1672 oder 1673, sondern 1668, wobei eine reiche Witwe ihn mittels einer Salbe in einen großen schwarzen Hund verwandelte. Dass er der Sohn eines Bauern ist, passt zum Pícaro, der ja durchwegs aus einfachen Verhältnissen stammt. Die Geschichte, wie sie die Flugblätter berichten, kommt in einer Predigt nochmals vor, wo sie vom Pater als Beispiel für die Bestrafung von Gotteslästerern angeführt wird. Ein Adliger aus Böhmen kritisiert beim nachfolgenden Mittagessen den Pater scharf, dass er eine solche Fabel von der Kanzel herab erzähle, „[d]er Erfinder dieser Fabel [sei] ein Ertzschelm“ (S. 49), es sei ihm nur darum gegangen, den böhmischen Adel zu beschimpfen. Er habe sie an dem Ort, wo die Verwandlung geschehen sein soll, verfasst, aber niemand wisse etwas davon. Das Pikante an der Episode ist, dass sie nur berichtet werden kann, weil der in einen Hund verwandelte Ich-Erzähler dem Ganzen beiwohnt. Das heißt, der böhmische Adlige behauptet, eine solche Verwandlung habe nie stattgefunden, während die Anwesenheit des in einen Hund verwandelten Polen zugleich bezeugt, dass sie eben doch stattgefunden hat, allerdings ein bisschen anders, als von „den Schandmuler[n]“ (S. 9 ) berichtet.
38 Anhorn (Anm. 35), S. 567: „weil je die Welt will betrogen werden“.
e
Der Goldene Esel des Apuleius und Wolfgang Caspar Printz’ Guldner Hund
121
Eine besonders witzige intertextuelle Beziehung wird dadurch erzeugt, dass sich der Hund fragt, ob auch sein Gesicht verwandelt wurde, und um dies festzustellen, ein ziemlich kompliziertes Kunststück vollführen muss: Ob auch daz Angesicht gantz und gar einem Hund hnlich/ kunte ich so eigentlich noch nicht wissen. Weil aber an der Wand ein grosser Spiegel hieng/ als bemhete ich mich/ in denselben mich zu bespiegeln. Ich versuchte/ mich auff die Hinterbeine zu stellen/ kunte aber damals allein auff denselben nicht stehen: Unterstunde mich derohalben auff die Banck zu springen/ weiln ich aber der Hundesprnge noch nicht gewohnet/ fiel ich fein sauber wieder zu rcke. Dessentwegen aber ließ ich nicht ab/ mich zu bemhen/ biß ich auff die Bank kam. Auff derselben stellete ich mich fr dem Spiegel/ und betrachte mit Schrecken mein Angesicht/ welches so wohl/ als andere Glieder vollkommen hndisch aussahe. Woraus der gnstige Leser abermals siehet/ wie abscheulich die Hunds-HistorienSchreiber lgen […]. (S. 11)
Der Hund kommt ja nur auf die Idee festzustellen, ob auch das Gesicht verwandelt ist, weil er die von Flugblättern erzählte Geschichte kennt, die sich diesen zufolge aber erst fünf Jahre später abspielt. Für den Verlauf des Romans ist die vollständige Verwandlung eine Voraussetzung, denn nur sie erlaubt, dass der Hund die Rolle des Pícaro übernehmen kann, wozu auch gehört, dass er später das Hundeverhalten perfekt beherrschen wird. Mit der Remotivierung der Verwandlung hat sich Printz allerdings ein Problem eingehandelt, denn nur Gott kann in seiner Allmacht Menschen in Tiere verwandeln, für einen Menschen ist dies nicht möglich. Zauberei gehört in den Bereich des Teufels, und dieser kann keine wirklichen Verwandlungen erzeugen, sondern nur Sinnestäuschungen. In der Vorrede zu seiner Übersetzung des Goldenen Esels von Lukian erwähnt Niklas von Wyle, sich auf Augustinus beziehend, das Beispiel eines Mannes, der einen giftigen Käse gegessen habe, worauf er in einen so tiefen Schlaf gefallen sei, dass man ihn nicht habe wecken können. Beim Erwachen habe er erzählt, er sei ein Pferd gewesen, das harte Arbeit verrichten musste.39 Stellt sich also die Frage, wie man die Verwandlung eines Menschen in einen Esel erklären soll. Niklas von Wyle greift zu einer Erklärung, die regelmäßig angeführt wird, wenn es um die Aufnahme von antiken Stoffen geht:40
39 Lukian: Der Glden Esel. Ein schne Histori von dem Esel Luciani […]. [Übersetzt von Niklas von Wyle] Magdeburg 1620, Vorrede, unpag. Dasselbe berichtet auch der Übersetzer des Apuleius in seiner Vorrede (Anm. 10), unpag. 40 Siehe zur Rezeption des Goldenen Esels in Deutschland Franziska Küenzlen: Kommentierung – Übersetzung – Neuschöpfung. Apuleius-Rezeption zwischen wissenschaftlichen und erzählerischen Interessen. In: Das Syntagma des Pikaresken. Hg. von Jan Mohr und Michael Waltenberger. Heidelberg 2014 (GRM-Beiheft 58), S. 131–156.
122
Rosmarie Zeller
Aber die Poeten pflegen offtmals etliche Ding verdecket/ vnter der Gestalt einer Fabel zu beschreiben/ so sie doch gleichwol darin die Warheit vermeynen. Also mag auch hie seyn/ das Lucianus gemeynet hab/ daß dieser Mensch/ von dem er schreibet/ zu einem Esel/ das ist/ Thoren vnd Narren in seiner Bulschafft worden sey.41
Der Übersetzer von Apuleius’ Goldenem Esel zitiert in der „Vorrede“ viele Beispiele von Verwandlungen, ohne allerdings dazu Stellung zu beziehen, ob diese nur Einbildungen oder wirklich vorgefallen seien. Nimmt man das alles zusammen, so könnte man in der Tatsache, dass die Verwandlung des Ich-Erzählers nicht durch Gott, sondern durch die Salbe eines bösen Weibes verursacht wird, einen Hinweis darauf erkennen, dass wir es hier mit einer Fiktion zu tun haben, dass sich das Ganze also nur in der Fantasie des Hunde-Erzählers abgespielt hat. Die Sache ist aber vielleicht nicht so einfach, denn im 17. Jahrhundert glaubte man meistens, dass Apuleius seine eigene Verwandlung in einen Esel erzähle, hielt also so etwas doch für möglich. Zu denken ist auch an eine Episode wie die Teilnahme des Simplicius am Hexensabbat in Grimmelshausens Simplicissimus. Simplicius fährt, nachdem er eine Bank in der Nähe von Fulda mit einer Salbe bestrichen hat, zum Hexensabbat in der Nähe von Magdeburg. Dies kann der Leser der Lebensgeschichte zwar als Einbildung und Traum abtun, er müsste dann aber erklären, wie Simplicius „auß dem Stifft Hirschfeld oder Fulda […] in so kurtzer Zeit ins Ertz-Stifft Magdeburg marchirt seye.“42 Die Verwandlung von Simplicius in ein Kalb hingegen fällt nicht in diese Kategorie, weil er nicht wirklich verwandelt wird, allerdings hilft ihm dort auch ein Mittel, das ihm der Pfarrer gegeben hat, die Verwandlungsprozedur unbeschädigt zu überstehen, was man in den Bereich der Naturmagie verweisen könnte. Der Hunde-Erzähler spielt offensichtlich mit diesen nicht eindeutigen Positionen in Bezug auf Zauberei und Naturmagie. Andererseits betont er seine Glaubwürdigkeit, indem er nur erzählt, was er mit eigenen Augen gesehen habe. Wenn er schläft oder hinausgejagt wird, kann er nicht erzählen, was vorgefallen ist (vgl. S. 19, 27, 50). Auf der anderen Seite unterläuft aber der Roman diese Glaubwürdigkeit wieder, indem er sich als Übersetzung ausgibt und der Übersetzer nicht etwa ein Deutscher ist, der Polnisch kann, sondern ein Böhme, der, wie er von sich selbst sagt, „der Deutschen Sprache nicht so kndig/ als er wohl wnschen mchte“ (S. 7). In der Vorrede „An den Hochgnstigen Leser“ im zweiten Teil betont dieser Böhme namens Cosmus Pierus, die Übersetzung könne Fehler enthalten, da es schwierig sei, „etwas aus einer fremden in eine andere fremde Sprache [zu] bringen“ (S. 67). Dies zeigt, dass es Printz darum ging, die Glaubwürdigkeit
41 Lukian (Anm. 39), Vorrede, unpag. 42 Grimmelshausen: Der abentheuerliche Simplicissimus Teutsch (Anm. 4), S. 181.
e
Der Goldene Esel des Apuleius und Wolfgang Caspar Printz’ Guldner Hund
123
infrage zu stellen, indem er sein Werk als Übersetzung ausgibt.43 Zudem könnte die Idee mit der Übersetzung eine weitere Anspielung auf den Goldenen Esel sein, dessen lateinische Fassung durch Apuleius ihr Vorbild in der Eselsgeschichte des Pseudo-Lukian hat.44 Dies wird noch dadurch unterstrichen, dass der Übersetzer dem Edelmann zufolge den Hinweis auf Apuleius eigenmächtig angebracht habe, den der Ich-Erzähler angeblich gar nicht kennt (vgl. S. 70). Alles dies kann man als Varianten des Spiels mit fabula und historia, mit Glaubwürdigem und Unglaubwürdigem interpretieren, das typisch zu sein scheint für den Pikaroroman, der immer vorgibt, die Realität zu erzählen, und zugleich bewusst macht, dass er eigentlich Fiktion ist. Der Pikaroroman hat eine Tendenz zu metaliterarischen Verfahren, 45 die Printz schon durch den intertextuellen Bezug auf gleich zwei Prätexte, die Flugblätter und den Goldenen Esel, recht weit treibt.
4 Der Gldne Hund und der Goldene Esel Das Tier in der Funktion des Pícaro Der Bezug des Gldnen Hunds zum Goldenen Esel wird im Roman ausführlich thematisiert, was auch deshalb nötig ist, weil der Hund ja schwarz ist und deshalb zunächst nicht verständlich ist, woher die Bezeichnung „gldner Hund“ kommt. Diese auf den ersten Blick nicht motivierte Bezeichnung macht den intertextuellen Bezug zum Goldenen Esel nur umso deutlicher. Die Benennung wird allerdings im Roman motiviert und darüber hinaus als Anlass für das Buch ausgegeben. Ein armer, alter Mann, dem der Hund begegnet und aus Erbarmen etwas schmeichelt, nennt ihn „gldner Hund“ (S. 69 f.), worauf der Hund ein Gelübde tut: „[D]aß/ wofern ich meine vorige menschliche Gestalt wieder erlangen mchte/ ich eine Historie von meinem Hundes Stande schreiben/ und dieselbe/ diesem lieben Alten zum Gedchtniß/ den gldnen Hund nennen wolte“ (S. 70). Es gibt zudem eine witzige intertextuelle Beziehung zwischen dem Goldenen Esel und dem Gldnen Hund. Als Lucius ein von Räubern entführtes Mädchen wieder ihren
43 Eder (Anm. 6) überlegt, warum Printz behauptet, der Roman sei polnisch geschrieben; er hat aber nicht gesehen, dass das Problem, das Printz interessierte, in der Tatsache der Übersetzung liegt. 44 Die Beziehung zu Lukian, der in den Poetiken des 17. Jahrhunderts als Erfinder von Lügengeschichten gilt, kann hier nicht weiter dargestellt werden, wäre aber eine Untersuchung wert. 45 Man denke etwa daran, dass Grimmelshausens Continuatio als eine Art Kommentar zu den fünf Büchern des Simplicissimus gelesen werden kann.
124
Rosmarie Zeller
Eltern zurückbringt, wird er an der darauffolgenden Hochzeit mit viel Gerste und Heu gefüttert; als er aber sieht, dass die Hunde die Abfälle des Hochzeitsmahls bekommen, verflucht er die Photis, „daß sie mich nit vielmehr zu einem Hundt gemacht“.46 Es scheint, als habe Printz diese Idee aufgegriffen und sich gefragt, was geschieht, wenn der Held in einen Hund statt in einen Esel verwandelt wird. Auch wenn Printz von der Nachricht über den in einen Hund verwandelten Edelmann angeregt wurde, stützt er sich bezüglich der Erzählstruktur und der verwendeten Motive nicht auf die Exempel der Flugblätter, sondern erzählt in Analogie zum Goldenen Esel die Erlebnisse des in einen Hund verwandelten Edelmannes, der sich allein durchs Leben schlagen muss. Dem Schema des Pikaroromans oder des Roman comique gemäß gelangt der Hund von einem Ort zum andern und von einem Abenteuer ins andere, wobei sich das wankelmütige Treiben der Fortuna im Auf und Ab des Lebensweges abzeichnet. Es geht darum, seine Grundbedürfnisse zu befriedigen, das heißt genügend Essen zu erhalten; und zwar nicht etwa Tierkadaver, wie sie der Hund der Flugblätter frisst, sondern in Analogie zum Pikaroroman menschliches Essen. Um an solches Essen zu kommen, muss sich der Hund ebenso wie der Pícaro in die Dienste fremder Herren begeben, weil er merkt, dass das Stehlen zu mühsam ist, um sich durchzubringen. Die Befriedigung menschlicher Grundbedürfnisse ist die typische Motivation für den Eintritt des Pícaro in die Welt der Großen und Mächtigen. Und wie der Pícaro manches lernen muss, um sich durchzuschlagen, so lernt der Hund sogenannte Hundekünste. Ein solches Kunststück besteht darin, dass er Wein trinkt, was ihm als Mensch Spaß macht, aber natürlich Verwunderung bei den Zuschauern hervorruft, da den Hunden das Weintrinken „von Natur zu wieder ist“ (S. 21).47 Wie es sich für den Pícaro gehört, kommt er in missliche Situationen, ja sogar in Todesgefahr, wird verleumdet, zeigt sich aber auch mutig, als er einen Mörder beißt und damit einen Seiltänzer vor dem Tod rettet. Er wird vom Seiltänzer angestellt, um seine Künste vorzuführen, wird also zu einer Art Buffo. Schließlich erfährt er durch Zufall, dass nunmehr seine Frau die Salbe besitzt, mit der er zurückverwandelt werden kann; sie hatte sie von der Hexe vor deren Tod erhalten. Da die Frau aber mittlerweile den Juncker, bei dem ihr Mann im Dienst stand, zum Liebhaber hat, hat sie kein Interesse daran, dass sich ihr erster Mann zurückverwandelt. Sie wirft deshalb die Salbe weg, die aber der Hund, der nun in ihrem Haus wohnt, erwischt. Mit einiger Mühe kann er sich mit der Salbe
46 Apuleius (Anm. 10), S. 279. In der Übersetzung von Niklas von Wyle ist es noch expliziter: „hab ich die Palestram gescholten/ daß sie mich nicht in ein Hundt/ sondern in einen Esel verendert vnd gemacht.“ (Lukian [Anm. 39], Bl. cviiv) 47 Künste zu erwerben ist ja auch eine Eigenheit von Simplicius: Er kann die Laute schlagen, er kennt gewisse naturmagische Mittel.
e
Der Goldene Esel des Apuleius und Wolfgang Caspar Printz’ Guldner Hund
125
bestreichen und verwandelt sich in einen Menschen zurück, woraufhin er bei einem Obristen als Fourier arbeitet. Die Übereinstimmungen zwischen dem Printz’schen Hund und dem Esel sind relativ groß. Da beide ihre menschlichen Eigenschaften bewahrt haben, haben sie auch menschliche Gelüste, vor allem, was das Essen betrifft. Sie streben beide nach Köstlichkeiten, die sie sich stehlen müssen, wobei dies für den Esel etwas komplizierter ist als für den Hund, schon weil er nicht so leicht in die Häuser kommt.48 Die ständige Stehlerei führt auch dazu, dass manchmal Unschuldige in Verdacht geraten. Das Erstaunen darüber, dass der Esel menschliche Speise isst, ist größer als beim Hund, von dem man als Haustier solches eher gewöhnt ist. So widmet Apuleius den größten Teil des zehnten Buchs diesem Thema. Dazu gehört auch, dass der Esel Wein trinkt, ein Kunststück, das auch mit dem Hund ausgeführt wird.49 Während im Goldenen Esel die Sexualität eine relativ große Rolle spielt, was auch zu Kritik an dem Roman geführt hat, ist dieser Aspekt bei Printz praktisch nicht vorhanden. Das einzige Mal, wo eine sexuelle Konnotation ins Spiel kommt, ist, wo der Hund der Waschmagd Geld bringen soll. Sie beginnt mit ihm zu spielen und sagt dann: „Ach Taußs/ wenn du ein Kerl werst!“ Die umstehenden Pagen bringt das zum Lachen, sodass sie den scheinbar sinnlosen Spruch immer wiederholen (vgl. S. 44). Beide Tiere werden auch häufig misshandelt. Der Esel, indem er schwere Arbeit wie für einen Esel üblich verrichten muss, zum Beispiel Mühlräder treiben oder schwere Lasten tragen, während der Hund geschlagen wird. Sowohl dem Esel wie dem Hund droht, kastriert zu werden, beide sind auch mehrfach vom Tod bedroht, der Hund soll sogar anatomisch untersucht werden. Dem Esel wie dem Hund werden gewisse Kunststücke beigebracht, die es ihnen anschließend erlauben, eine unterhaltende Rolle zu spielen. Das heißt, sie werden zu einer Art Hofnarr oder Buffo, Rollen, die ja der Pícaro auch oft spielt.50 Diese Art von Künsten spielt beim Hund eine größere
48 Apuleius (Anm. 10), S. 419. Ein Bäcker und ein Koch bringen köstliche Speisen nach Hause, von denen der Esel isst, wenn sie ins Bad gehen. 49 In einem Wirtshaus geben ihm trinkfreudige Gesellen aus Spaß einen Becher mit Wein: „Welches ich mich doch gantz nicht erschrecken ließ/ sondern zog die Lefftzen fein glmpfflich zusammen/ vnd tranck den grossen Becher/ auff einen Trunck auß“ (Apuleius [Anm. 10], S. 424). Bei Printz lautet die Stelle: „Jrge […] gab mir den Becher Wein/ den ich nahm/ und so gut/ als es mglich war/ in den Halß goß; Worber sich alle Edelleute verwunderten“ (S. 21). 50 „Welcher damit er seinem Herren desto besser gefallen mcht/ lehret er mich viel Knst/ als daß ich kont zu Tische sitzen/ springen/ vnd hfflich tantzen […]“ (Apuleius [Anm. 10], S. 425). Zur Rolle des Narren im Simplicissimus siehe Rosmarie Zeller: Gespielte Narrheit. Hofnarren im niederen Roman. In: Der Narr in der deutschen Literatur im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit. Kolloquium in Nancy (13.–14. März 2008). Hg. von Jean Schillinger. Bern u. a. 2009 (Jahrbuch für Internationale Germanistik A 96), S. 235–248.
126
Rosmarie Zeller
Rolle als beim Esel, sie liegen ihm auch näher. Er bringt sich schon am Anfang selbst Künste bei, um einen Herrn zu finden; so lernt er zum Beispiel aufrecht zu gehen, und als er zu einem Seiltänzer kommt, bringt ihm dieser weitere Künste bei und lässt ihn als Schausteller auftreten. Der Hund hat im Gegensatz zum Esel etwas von einem Künstler, man begehrt ihn seiner Geschicklichkeit und Künste wegen, ja, man gibt sogar viel Geld aus, um ihn zu besitzen. Sowohl der Esel wie auch der Hund haben ihre moralische Urteilsfähigkeit nicht verloren und decken einen Ehebruch auf.51 Printz übernimmt direkt einen Schwank aus dem Goldenen Esel. In diesem geht es darum, einen Liebhaber zu decken, der bei der verfrühten Rückkehr des Ehemannes aus Versehen seine Mütze zurückgelassen hat. Durch eine schlaue Lüge gelingt es zunächst, den Ehemann, einen Schuhmacher, zu beruhigen, doch als der Liebhaber in Anwesenheit des Hundes erneut mit der Frau sein Spiel beginnt, bellt dieser und verdirbt ihm die Freude. Im Gegensatz dazu gelingt im Goldenen Esel, wo nicht eine Mütze, sondern Sandalen im Spiel sind, die List des Liebhabers, und die Geschichte findet keine Fortsetzung. Im Unterschied zum Hund, der eine aktive Rolle in dieser Episode spielt, hat der Esel die Geschichte nicht selbst erlebt, sie wird ihm nur erzählt. Generell scheint, wie nicht anders zu erwarten, der güldne Hund moralischer als der goldene Esel, indem der Hund einerseits einschläft, wenn es allzu wild zugeht zwischen Knechten und Mägden (vgl. S. 19 und 27), und andererseits immer wieder Unrecht aufdeckt. Einmal verrät er einem Bauern, dass seine Frau Fleisch isst, den andern aber nur Haferbrei und Wassersuppe auftischt (vgl. S. 13–16). Auch weist der Hund seinen Herrn einmal darauf hin, dass die Köchin, ein andermal, dass eine Magd einen Liebhaber hat (vgl. S. 57 f. u. 98 f.). Einmal beschützt er die Frau eines Advokaten, die von einem Liebhaber angegriffen wird, ein andermal beißt er einen Räuber ins Bein und verhindert so einen Raubüberfall. Im Goldenen Esel finden sich viele Geschichten, unter anderem auch die von Amor und Psyche, die nichts mit den Erlebnissen des Esels zu tun haben, sondern von Personen, denen er begegnet, zur Unterhaltung erzählt werden. Im Unterschied dazu schreibt Printz alle Geschichten und Schwänke ähnlich wie Grimmelshausen im Simplicissimus der Hauptfigur zu, was bedeutet, dass der Hund oft nicht nur Zeuge einer Episode ist, sondern auch Handelnder und häufig auch Opfer. Wenn er ein Unrecht aufdeckt, wird er hinterher oft verleumdet oder weggejagt. Auch ist er manchen, weil er so viel Verstand hat, unheimlich, ja, sie halten ihn für den „Teufel selbst“ (S. 108). Dass der Goldene Esel der wichtigste Prätext für den Gldnen Hund ist, scheint mithin unbestreitbar.
51 Vgl. Apuleius (Anm. 10), S. 376–378. Vgl. Printz (Anm. 1), S. 119.
e
Der Goldene Esel des Apuleius und Wolfgang Caspar Printz’ Guldner Hund
127
5 Der Simplicissimus Teutsch und der Gldne Hund Zu erklären bleibt noch der Hinweis auf Grimmelshausens Simplicissimus auf dem Titelblatt. Wollte Printz einfach am Erfolg des Simplicissimus partizipieren oder gehen die Verbindungen weiter? Entgegen der in der Forschung geäußerten Meinung, es gebe keine Parallelen zwischen dem Gldnen Hund und dem Simplicissimus,52 möchte ich zum Schluss auf einige intertextuelle Beziehungen hinweisen. Der Hund kommt zuerst zu einem Junker, wo er Fress- und Saufgelagen beiwohnt, ähnlich wie Simplicius in Hanau, was ihn ebenfalls zu Reflexionen über die Menschheit veranlasst. Er wird dann verleumdet, er habe eine Gans gestohlen, worauf er fliehen muss; diese Episode erinnert an den gestohlenen Becher im Simplicissimus, den Olivier gestohlen hat, dessen Diebstahl aber dem jüngeren Hertzbruder untergeschoben wird. Eine gewisse Zeit hat der Hund ein gutes Leben auf einem Schloss, was an das Leben des Simplicius im Kloster Paradies erinnern mag, jedoch stirbt sein Herr und er kommt dann tatsächlich in ein Kloster, wo er es nicht mehr gut hat. Der Hund wird an einer Stelle für tollwütig gehalten, wobei eine Probe, von der der Hund hört, wie er sich in ihr verhalten muss, dann natürlich negativ ausfällt. Das erinnert an die Episode, als Simplicius in ein Kalb verwandelt werden soll und durch sein Wissen darum der Prozedur nicht zum Opfer fällt. Der Hund unternimmt einmal eine berühmte Wallfahrt, weil er hofft, dadurch wieder zu einem Menschen zu werden, was an die Wallfahrt des Simplicius nach Einsiedeln erinnert. Die Wallfahrt kommt allerdings auch in den Texten der Flugblätter vor. Dies alles wird bei Printz sehr kurz erzählt und nicht ausgeschmückt. Man könnte vielleicht auch den Schluss, wo der Hund „Verlangen“ trägt, „zu erfahren/ wie es meinem Weib gieng“ (S. 59), mit dem Simplicissimus in Verbindung bringen, wo ja mehrere Episoden ihre Berechtigung darin haben, dass Simplicius zu seiner Frau zurückkehren möchte, es aber dann doch nicht tut bzw. durch äußere Umstände davon abgehalten wird.53 Die Zweiteilung von Printz’ Roman, wo im zweiten Teil jene Episoden ausführlich erzählt werden, die im ersten Teil nur kurz gestreift wurden, erinnert – liest man den Text in Bezug auf den Simplicianischen Zyklus – einerseits an die Aufteilung Simplicissimus und Continuatio und anderseits an Grimmelshausens Verfahren der Sprossgeschichten. Wie Grimmelshausen aus dem Simplicissimus
52 So z. B. Hesselmann (Anm. 3), S. 41 f. 53 Die Heirat findet in Buch 1, Kap. 22 statt; erst in Buch 2, Kap. 5 kann bzw. will Simplicissimus zurückkehren, „weil ich eine Begierde hatte/ dermalen einst mein Weib auch wiederum zu sehen“ (Grimmelshausen: Der abentheurliche Simplicissimus Teutsch [Anm. 4] , S. 462).
128
Rosmarie Zeller
die Courasche und den Springinsfeld entwickelt und in den Kalendern die fehlenden Elemente, zum Beispiel die Rückkehr des Simplicius von der Kreuzinsel, nachträgt, so ergänzt Printz im zweiten Teil allerdings auf eine viel weniger raffinierte Art jene Episoden, die er am Ende des ersten Teils nur noch erwähnt hat, obwohl die Geschichte mit dem Bericht über die Zurückverwandlung des Hundes in einen Menschen eigentlich zu Ende ist. Für diese Interpretation könnte sprechen, dass Printz im zweiten Teil des Romans einen „Steltzfuss“ auftreten lässt (S. 80), einen Soldaten, der ein Bein verloren hat, ein deutlicher Hinweis auf Springinsfeld. Schon ziemlich am Anfang wird der Hund zudem mit einem Musquetier verglichen.54 Ein weiteres Element, das man auf Grimmelshausen beziehen könnte, ist, dass der Hund einerseits darüber reflektiert, was er im Umgang mit den verschiedenen Menschen gelernt hat (vgl. S. 75), und dass er andererseits dazu neigt, die schlechte Behandlung, die er immer wieder erfährt, als Strafe für Untaten zu interpretieren (vgl. S. 40) oder generelle Betrachtungen über die Moral anzustellen, während der Esel Lucius seine schlechte Behandlung allein als Wirken der Fortuna interpretiert. Gerade dieser letzte Aspekt, die moralische Reflexion des eigenen Handelns, wirft die Frage auf, ob nicht auch die Konstruktion des Pícaro bei Grimmelshausen und Printz eine ähnliche ist. Simplicius hat nichts Gaunerhaftes, er ist kein Schwindler, wie ja auch der Hund kein Schwindler ist. Sowohl Simplicius wie der Hund reflektieren ihr Verhalten und haben moralische Maßstäbe.55 Andererseits muss betont werden, dass das Ziel in Printz’ Roman nicht eine moralische Bekehrung oder Abwendung von der Welt ist, sondern allein die Rückverwandlung in die menschliche Gestalt. Diese wird allerdings gerade durch das unmoralische Verhalten der Ehefrau des Verwandelten erschwert, weil sie kein Interesse an einer Rückverwandlung hat, die schließlich nur durch eine List gelingt.
6 Der Hund als Pícaro Zuletzt soll noch die Frage gestellt werden, welchen Vorteil Printz hat, einen Hund statt eines Menschen in der Funktion des Pícaro zu verwenden. Wenn der
54 Der Hund soll Schildwache halten, dafür gibt man ihm einen Prügel und eine Tabakspfeife, worauf er die Pfeife raucht, „wie wenn ich ein rechter Musquetier gewesen were“ (S. 26). 55 In der Adaptation des Pikaroromans in Deutschland lässt sich ja seit der Übersetzung und Bearbeitung des Guzmán durch Aegidius Albertinus eine starke Moralisierung der Gattung feststellen.
e
Der Goldene Esel des Apuleius und Wolfgang Caspar Printz’ Guldner Hund
129
Pícaro als ein „halber Außenseiter“56 der Gesellschaft definiert wird, so ist der Hund ein ganzer Außenseiter, weil er nicht als Mitglied der menschlichen Gesellschaft wahrgenommen wird. In der Forschung wurde manchmal darauf hingewiesen, dass der Hund eine ähnliche Funktion hat wie das unsichtbar machende Vogelnest in Grimmelshausens Vogelnest-Roman. In der Tat weiß niemand, dass der Hund die menschliche Sprache versteht, daher erfährt der Hund Dinge, die ein Mensch nicht erfahren würde, wenn man wüsste, dass er zuhörte. Das zeigt sich vor allem im ersten Teil des Romans, wo der Hund das Verhalten der Mitmenschen entlarvt, manchmal aber auch das positive Verhalten hervorhebt. Der Hund ist als Haustier eine sehr bewegliche Figur, die überall Zugang hat, was ihn dazu prädestiniert, hinter die Kulissen zu sehen und die Welt zu entlarven. Er kommt auch in verschiedene soziale Kreise vom Bauernhof über die Schausteller bis zum Edelmann und den Geistlichen. Er lebt bei einem Advokaten, einem Arzt, einem Leutnant. Dieses für den spanischen Pikaroroman typische Schema wird im letzten Kapitel des ersten Teils besonders deutlich gemacht, indem nur noch die wechselnden Herren aufgezählt werden, ohne dass noch Details mitgeteilt würden: Nach diesem kam ich in einen Gasthoff und wurde Ziemek genennt. Der Gastwirth verkauffte mich einem Advocaten. Der Advocat schenkte mich seinem Vetter/ welcher ein Doctor Medicinæ war. Diesem wurde ich von einem Soldaten […] gestohlen. Weil mich aber dieser Herr einmal trunckner Weise bel tractirte/ lieff ich von ihm/ und kam zu einem Fuhrmanne […]. (S. 58 f.)
Es folgen dann noch zwei Handwerksburschen und Bettler, bis er schließlich den Junker wiederfindet, in dessen Auftrag er Steuern eingetrieben hatte. In dieser Aufzählung wird auch deutlich, dass seine Möglichkeiten beschränkt sind, es hängt nur selten von ihm selbst ab, wohin er kommt. Er wird verkauft, verschenkt, weggeprügelt und läuft manchmal auch von alleine weg. Dies macht das Wesen der Fortuna deutlicher als beim menschlichen Pícaro, weil man bei letzterem eher den Eindruck hat, er könne selbst etwas für sein Schicksal tun, was freilich oft auch nur in beschränktem Maße der Fall ist. Der Gldne Hund ist sicher kein Meisterwerk der Weltliteratur, er hat aber doch das Verdienst, den Versuch gemacht zu haben, den Goldenen Esel von Apuleius, der zwar in der theoretischen Literatur zum niederen Roman im 17. Jahrhundert eine wichtige Rolle spielt, jedoch meines Wissens nie nachgeahmt wurde, in die Gegenwart des späten 17. Jahrhunderts übertragen zu haben, wobei er jenen Teil
56 Claudio Guillén: Zur Frage der Begriffsbestimmung des Pikaresken. In: Pikarische Welt. Schriften zum europäischen Schelmenroman. Hg. von Helmut Heidenreich. Darmstadt 1969 (WdF 63), S. 375–396, hier S. 384.
130
Rosmarie Zeller
des Romans nachahmte, der dem Pikaresken entsprach und sowohl den Anfang wie auch die vielen Binnenerzählungen und auch den Schluss wegließ. Mit dem Goldenen Esel hat der Gldne Hund auch gemeinsam, dass der Held in Tiergestalt ein erwachsener und keineswegs naiver Mann ist, wie dies auch bei Grimmelshausen für die Besitzer des Vogelnests gilt. Man kann den Gldnen Hund sogar als eine Art aemulatio des Goldenen Esels auffassen, weil der Hund viel beweglicher ist als der Esel und daher mehr Einblicke in die Menschenwelt erlaubt. Spielen die Romane Grimmelshausens wie der Simplicissimus Teutsch und die Courasche auf das Muster der Lebensgeschichte, ja der confessio an, so gilt dies nicht für den Gldnen Hund, dem es darum geht, eine Geschichte richtigzustellen, die von den Medien falsch wiedergegeben wird. Gerade dadurch betont er aber auf der anderen Seite die Fiktionalität, indem er jene Teile der Geschichte ausschmückt, die in den Medien gar nicht vorkommen, nämlich was mit dem Hund nach seiner Verwandlung passierte; damit tendiert er dazu, die Unterhaltung über die Nützlichkeit zu stellen.
Frank Estelmann
Alonso de Salas Barbadillos La Hija de Celestina (1612), Paul Scarrons Les Hypocrites (1657) und die Verbreitung pikaresker Bücher über transnationale Formen der Intertextualität 1 Der Beitrag der Epigonen Am Anfang des siebten Kapitels von Alonso de Salas Barbadillos La Hija de Celestina (Zaragoza 1612) unterbricht der Erzähler die gerade von der Hauptfigur Elena, einer Pícara, ihrem Reisebegleiter und Liebhaber Montúfar erzählte Lebensgeschichte an einem besonders heiklen Punkt, und zwar mit den folgenden, an die Leser gerichteten Worten: Ya sé que me miráis todos a las manos para ver por qué puerta sale el que dio libertad a las bien castigadas matronas. ¿Quién duda que algún poeta de cartapacio, de estos que piensan que porque trasladaron el soneto y romance de su vecino en papel que era suyo, escrito de su letra y con pluma que les costó sus dineros, que pueden canonizar el trabajo por propio, y lo hacen, se arma contra mí, reprehendiéndome la flojedad [de] mi ingenio con mucha aspereza, pues se durmió en cosa que tanto importa?1 Ich weiß schon, daß ihr mir nun alle auf die Finger schaut, um zu erfahren, durch welche Tür derjenige gekommen ist, der den so gerecht bestraften Frauen die Freiheit wiedergab. Kein Zweifel, daß jetzt irgendein Gelegenheitspoet, einer von denen, die das Sonett oder die Romanze eines anderen eigenhändig auf ihr Papier geschrieben haben, mit einer Feder, die sie ihr Geld gekostet hat und deshalb meinen, die Arbeit als ihre eigene ausgeben zu können (was sie auch tun), daß also einer von denen jetzt gegen mich aufstehen und mir mit schroffen Worten die Trägheit meines Geistes vorwerfen wird, weil er über einer so wichtigen Sache eingeschlafen ist.2
1 Alonso Jerónimo de Salas Barbadillo: La Hija de Celestina. Hg. von Enrique García SantoTomás. Madrid 2008 (Letras Hispánicas 614), S. 137 (im Folgenden „HC“). 2 Alonso Jerónimo de Salas Barbadillo: Die Tochter der Celestina. Übers. von Egon Hartmann. Leipzig 1968, S. 63 (im Folgenden „TC“).
132
Frank Estelmann
Der ‚implizite Autor‘3 des Werks, dem ein Platz in der Reihe der pikaresken Erzähltexte spanischer Sprache des Siglo de Oro eingeräumt werden kann, insistiert in diesem Einschub auf der Autorität seiner Autorschaft gegen potenzielle Epigonen und wehrt sich gegen jene ‚Übertragungen‘, die auf die Aneignung der ihm gebührenden Urheberschaft hinauslaufen. Ihnen hält er die eigene, einen wahren Dichter charakterisierende Originalität („ingenio“) entgegen. Eine solche Passage, deren ironisch-humorvoller Erzählton gleichwohl in Betracht gezogen werden muss, ist Teil des Kampfes um Autorenrechte im 17. Jahrhundert. Sie führt darüber hinaus aber auch deshalb in das im Folgenden behandelte Thema ein, da sie auf eine verbreitete Praxis hinweist, gegen die es keinen Schutz gab: die epigonale Aneignung im transnationalen Kontext, in diesem Fall tatsächlich auch geschehen durch den bekannten französischen Romancier Paul Scarron, den Autor von Le Roman comique (1651–1657) und eine der wichtigen literarischen Stimmen des französischen Klassizismus. Scarron hat La Hija de Celestina nicht nur ins Französische übertragen, sondern dabei tatsächlich die ‚Arbeit‘ („trabajo“) Salas Barbadillos auf ‚eigenes Papier‘ („papel que era suyo“) gesetzt. Das Ergebnis hat er dann unter dem Titel Les Hypocrites in die unter seinem eigenen Namen publizierte Novellensammlung Les Nouvelles tragi-comiques (Paris 1657) aufgenommen, ohne den Autor des spanischen Ausgangstextes zu erwähnen. Zusätzliche Brisanz erhält diese Bemächtigungsgeste dadurch, dass Scarron die zitierte Passage in seiner Version der Erzählung ausgelassen hat. Damit hat er das barocke Spiel mit Referenzialität und Originalität zu übertragen versäumt, das La Hija de Celestina noch kennzeichnet, positiv gesprochen aber einen wichtigen Beleg dafür gegeben, wie frei pikareske Erzähltexte spanischer Sprache im klassizistischen Frankreich übertragen wurden und wie sehr diese Freiheit im Zusammenspiel zwischen der Wirkungs- und Rezeptionsgeschichte eines einzelnen spanischen Erzähltextes pikaresker Spielart verortet werden sollte. Die Untersuchung speziell des wirkungsgeschichtlichen Aspekts in der Interpretation von La Hija de Celestina darf als besonderes, unter Umständen auch kontroverses Anliegen des vorliegenden Beitrags aufgefasst werden. An den Anfang gestellt werden sollte vor allem die Hoffnung, der mit der entwicklungsgeschichtlichen Untersuchung des Transfers pikaresker Erzählungen in die europäischen Literaturen des 17. Jahrhunderts verbunden ist. Für eine europäische Literaturgeschichte des pikaresken Erzählens wäre es hilfreich, wenn vermieden werden könnte, die transnational verlaufende Gattungsgeschichte der pikares-
3 Vgl. dazu Edward H. Friedman: The Antiheroine’s Voice. Narrative Discourse and Transformations of the Picaresque. Columbia, Miss. 1987, S. 16.
Alonso de Salas Barbadillo, Paul Scarron und die Verbreitung pikaresker Bücher
133
ken Bücher („libros picarescos“)4 als Verfallsgeschichte eines Archetyps spanischer Provenienz zu deuten. Geschehen ist dies zum Beispiel in Francisco Ricos in abwertender Absicht erfolgten Konzeption von ‚Meistern‘ und menores bzw. ‚Epigonen‘ in der Gattungsgeschichte der pikaresken Texte.5 Tatsächlich dürfte unstrittig sein, dass das vom Lazarillo de Tormes inspirierte, jedoch tatsächlich erst von Mateo Alemán in den beiden Bänden des Guzmán de Alfarache (Madrid 1599 und Lissabon 1604) geformte pikareske Erzählmodell, auf dem Ricos Konzeption der Gattung ruht, in Spanien bereits um 1605 als etabliert gelten konnte.6 Ohne das Bewusstsein von einer bereits zu diesem literarhistorisch sehr frühen Moment bestehenden Einheit der Gattung wäre das Frontispiz der editio princeps von Francisco López de Úbedas Libro de entretenimiento de la Pícara Justina (Medina del Campo 1605) mit dem Thema der „nave de la vida picaresca“ (also des Schiffs des pikaresken Lebens)7 nicht vorstellbar gewesen. Auch die Ginésde-Pasamonte-Episode im ersten Teil (1605) des Don Quijote, in der von einer vom Lazarillo de Tormes vertretenen Gattung („género“) die Rede ist, oder die wahrscheinlich gegen 1604/05 verfasste Vida del Buscón (1626 publiziert) Francisco de Quevedos setzen ein solches, mit den genannten Erzähltexten verbundenes
4 Ich folge der u. a. von Fernando Rodríguez Mansilla vorgeschlagenen Terminologie, auf den Begriff des Romans („novela“) zu verzichten, der den fiktionalen, romanesken Charakter der Werke verabsolutiert, und stattdessen von pikaresken Büchern (libros picarescos) oder PícaroBüchern (libros de pícaros) zu sprechen. In: „Quien bien ata, bien desata“: ‚La hija de Celestina‘ de Salas Barbadillo. In: eHumanista: Journal of Iberian Studies 6 (2006), S. 114–131, hier S. 127– 129. Vgl. dazu unter den älteren Studien schon: Fernando Cabo Aseguinolaza: El concepto de género y la literatura picaresca. Santiago de Compostela 1992 (Monografías da Universidade de Santiago de Compostela 167; Publicacións en literatura 43). Das Thema diskutieren auch: Klaus Meyer-Minnemann: El género de la novela picaresca. In: La novela picaresca. Concepto genérico y evolución del género (siglos XVI y XVII). Hg. von dems. und Sabine Schlickers. Madrid 2008 (Biblioteca Áurea Hispánica 54), S. 13–40; Juan Antonio Garrido Ardila: La novela picaresca en Europa, 1554–1753. Madrid 2009, bes. S. 57–72. 5 Francisco Rico: La novela picaresca y el punto de vista. Korrigierte und erw. Aufl. Barcelona 2000. Rico lässt die Geschichte der ersten Phase der pikaresken Texte, zu denen er ausschließlich den Lazarillo de Tormes und den Guzmán de Alfarache zählt, bereits mit La Pícara Justina enden. Er rechnet La Hija de Celestina in die Geschichte des Verfalls der ursprünglichen Erzählanlagen ein. Fernando Lázaro Carreter: „Lazarillo de Tormes“ en la picaresca. Barcelona 1983, hier S. 198– 201, hat ebenfalls zwischen Epigonen und Meistern in der Gattungsentwicklung unterschieden. 6 Vgl. z. B. Thomas Bodenmüller: Literaturtransfer in der Frühen Neuzeit. Francisco López de Úbedas ‚La Pícara Justina‘ und ihre italienische und englische Bearbeitung von Barezzo Barezzi und Captain John Stevens. Tübingen 2001 (Communicatio 25), S. 30–34. 7 Vgl. dazu etwa Lucas Torres: Emblemática y literatura. El caso de ‚La Pícara Justina‘. In: Actas del XIII Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas (AIH). Hg. von Florencio Sevilla und Carlos Alvar. Madrid 2000, S. 780–789.
134
Frank Estelmann
Gattungsbewusstsein voraus.8 Lässt man aber, wie Rico, den Auftakt zur ‚Verfallsgeschichte‘ der pikaresken Bücher mit der Pícara Justina oder dem Buscón zeitlich zusammenfallen, koinzidiert der ‚Verfall‘ der pikaresken Bücher bereits mit der Kodifizierung ihres Erzählmodells. Die Gattungsentwicklung wäre dann schon zu einem frühen Zeitpunkt in der spanischen Literaturgeschichte in eine „vía muerta“9 geraten, also in eine Sackgasse. Nun kann die zeitlich nach dieser Kodifizierung einsetzende europäische Wirkungsgeschichte der pikaresken Bücher – in Frankreich, aber nicht nur dort – kaum vorurteilslos in den Blick geraten, wenn sie von Beginn an unter dem Verdikt steht, nichts Konstruktives zur Entwicklung der Gattung beigetragen zu haben. Kann als Basis des Missverständnisses recht schnell ein gattungspoetisch-normativer und nationalliterarisch verengter Blick auf die Bildung und Verbreitung des pikaresken Erzählmodells in Spanien identifiziert werden, fällt allerdings noch eine weitere problematische Auffassung ins Gewicht: ein zu modern konzipierter Originalitätsmaßstab im gattungsgeschichtlichen Aufriss, der die Bedeutung des im weitesten Sinne Epigonalen unterschätzt. Dagegen hat z. B. Judith Schlanger vorgeschlagen, das Literaturverständnis des 17. Jahrhunderts besser in alternativen Begriffen zu fassen: „L’idée moderne du chef-d’oeuvre qui accomplit et qui épuise est l’inverse de l’idée classique de la fécondité des modèles.“10 Auch wenn in dieser Periode also durchaus ein kritisches Bewusstsein für das Epigonentum herrschte, wie es ja auch das oben genannte Zitat von Salas Barbadillo belegt, müsste das Konzept des Epigonalen, um gattungshistorisch überhaupt für irrelevant gehalten werden zu können, erst einmal genau rekonstruiert werden. Dabei müsste es zum einen von sämtlichen Formen der aemulatio bereinigt werden, die als Praxis des überbietenden Nacheiferns anerkannt und valorisiert war. Zum anderen müsste es auch, folgt man Schlanger, mit einem Literaturverständnis abgeglichen werden, in dem literarische Modelle an ihrer Fruchtbarkeit gemessen wurden, was intuitiv gut dazu geeignet scheint, die beeindruckende europäische Geschichte der pikaresken Bücher vom 17. Jahrhundert bis in die Gegenwart
8 Miguel de Cervantes Saavedra: Don Quijote de la Mancha. Hg. von Francisco Rico. 2. Aufl. Barcelona 1998 (Biblioteca clásica 50/2), Bd. 1, S. 243 (Erster Teil, Kap. 22) („que mal año para Lazarillo de Tormes y para todos cuantos de aquel género“). Vgl. dazu schon Lázaro Carreter (Anm. 5), S. 203–205 und 222–228. Der Autor geht von einer „poética dada“ (einer gegebenen Poetik; S. 223) des pikaresken Erzählens im Blick von Cervantes und Quevedo aus. Auch Antonio Rey Hazas (Deslindes de la novela picaresca. Málaga 2003 [Thema 30], S. 14) schlägt vor, formale, strukturelle und semantische Aspekte dessen, was er „poética básica“ des „género picaresco“ (S. 15) nennt, bei der Erläuterung der Gattungsgeschichte zu berücksichtigen, die er als allmähliche Erarbeitung eines Erzählmodells („puro esquema narrativo“, S. 35) versteht. 9 Rico (Anm. 5), S. 139. 10 Judith Schlanger: La mémoire des œuvres. Lagrasse (Aude) 2008, S. 117.
Alonso de Salas Barbadillo, Paul Scarron und die Verbreitung pikaresker Bücher
135
zu erfassen. Allerdings setzt ein solches Verständnis der Gattungsentwicklung – wie auch der einschlägige typologische Artikel von Claudio Guillén konzedieren muss – die pragmatische Akzeptanz eines breiten Variationsspielraums dessen voraus, was als pikareskes Erzählen gelten kann.11 Schon im Falle Salas Barbadillos sind die evozierten Zusammenhänge in mehrfacher Hinsicht aufschlussreich. Denn dieser Autor publizierte das Pícarabuch um Elena, die Tochter der bekannten literarischen Kupplerfigur der Celestina aus dem Fernando de Rojas zugesprochenen Werk Tragicomedia de Calisto y Melibea (1499), auch La Celestina genannt, nicht nur in der historischen Chronologie vor den Novelas ejemplares (Madrid 1613) von Miguel de Cervantes.12 La Hija de Celestina folgte zeitlich gesehen auch bald auf die erste Phase der Kodifizierung des Pikaresken. Anders gesagt sollte gerade dieses Werk von Salas Barbadillo, dessen ausgesprochene Heterogenität oft betont wird, auf ein Rezeptions- und Wirkungsverhältnis mit den frühen pikaresken Büchern hin untersucht werden, das deren generische Kodifizierung bereits voraussetzt (2).13 Die Tatsache dann, dass Paul Scarron Mitte der 1650er-Jahre den zu diesem Zeitpunkt bereits über vier Jahrzehnte alten spanischen Erzähltext in eigener Version veröffentlichte, gibt in einem nächsten Schritt (3) zu denken, in dem, wie bereits angedeutet, die Rezeptionsmuster des Pikaresken bei Scarron als typischem Vertreter der Prosasprache des siècle classique in genaueren Augenschein genommen werden sollen. Die Analyse von Scarrons Les Hypocrites erweist sich dabei als instruktiv für das Verständnis des literarischen Transfers pikaresker Erzählungen von Spanien nach Frankreich.
11 Vgl. Claudio Guillén: Zur Frage der Begriffsbestimmung des Pikaresken. In: Pikarische Welt. Schriften zum europäischen Schelmenroman. Hg. von Helmut Heidenreich. Darmstadt 1969 (WdF 163), S. 375–396, hier S. 376. 12 Vgl. HC, Introducción, S. 21, und José Enrique López Martínez: ‚Correción de vicios‘, de Salas Barbadillo, y la primera etapa de la novela corta española. In: Lejana. Revista Crítica de Narrativa Breve 7 (2014), S. 1–16, hier S. 4. 13 Vgl. auch HC, Introducción, S. 23.
136
Frank Estelmann
2 Variationen pikaresken Erzählens La Hija de Celestina und die spanischen libros picarescos Alonso de Salas Barbadillo gehörte zu den Autoren des Siglo de Oro, die in der von Lope de Vega dominierten Adelskultur am Madrider Hof der Zeit Philipps III. von Spanien (bis 1621), also des frühen 17. Jahrhunderts, und der darauffolgenden Periode unter Philipp IV. (bis 1665) Karriere machten.14 Die 1612 veröffentlichte Hija de Celestina stellt ein Frühwerk dar, das den in den Jahren nach 1620 veröffentlichten und mehrfach übersetzten Werken, wie der Novellensammlung Don Diego de noche (Madrid 1623), oder den 75 Komödien, die der Autor neben seinen weiteren Romanen produzierte, zeitlich voranging.15 In La Hija de Celestina wird weitgehend nullfokalisiert und mit einem in pikaresker Hinsicht untypischen in medias res-Beginn die Geschichte der schönen und lügnerischen Elena erzählt, die mit ihrem Liebhaber Montúfar, den sie als ihren Bruder ausgibt, und der Zofe Méndez durch Spanien reist. Die Erzählung beginnt mit der Ankunft der Gruppe in Toledo und der Verführung des Pagen einer hochgestellten Persönlichkeit durch die sich als adlige Dame ausgebende Elena. Durch den Pagen erfährt diese, dass dessen Herr namens Don Sancho auf Geheiß seines Onkels am nächsten Tag heiraten wird. Es gelingt Elena daraufhin, diesem Onkel weiszumachen, dass sein Neffe nicht nur eigentlich ihr das Versprechen der Ehe gegeben, sondern sie und ihre Ehre unter Androhung von Gewalt bereits geschändet hat. Sie verlangt für ihr Schweigen einen hohen Geldbetrag. Der Onkel zweifelt nicht an der Wahrhaftigkeit der Erzählung, zumal er seinen unsteten Neffen zu kennen glaubt und Elena das Gesagte mit einem Don Sancho gehörenden Dolch beglaubigen kann, den sie freilich erst kurz zuvor dem Pagen entwendet hatte. Er zahlt die gewiefte Pícara aus, woraufhin diese schnell aus Toledo verschwindet. Nachfolgend wird die Parallelerzählung um Don Sancho aufgenommen, der Elena zufällig auf der Straße gesehen hatte und sogleich in Liebe zu ihr entbrannt war. Er macht sich, als der Betrug am Onkel bekannt wird, noch in der Hochzeitsnacht aus Toledo auf, die Schelmin zu suchen, ohne zu wissen, dass es sich in
14 Vgl. ebd., S. 11–16. 15 Zur Editionsgeschichte der Werke des Autors vgl. Jaime Moll: Analísis editorial de las obras de Salas Barbadillo. In: Silva. Studia philologica in honorem Isaías Lerner. Hg. von Isabel LozanoRenieblas und Juan Carlos Mercado. Madrid 2001, S. 471–477. Speziell für die Editionsgeschichte von La Hija de Celestina vgl. HC, Introducción, S. 16 und 59–61.
Alonso de Salas Barbadillo, Paul Scarron und die Verbreitung pikaresker Bücher
137
Wirklichkeit um die Angebetete handelt. Er stellt sie auch nahe eines Gasthofs auf dem Weg, lässt sie aber unbehelligt laufen, da er sie als das Objekt seiner Begierde erkennt und der ehrenwert wirkenden Unbekannten die Betrügerei nicht zutraut. Auf der weiteren Reise beschließen wiederum Elena und Méndez, den Tyrannen Montúfar loszuwerden, was dieser alsbald dadurch rächt, dass er die beiden Frauen an einen Baum am Wegesrand gefesselt zurücklässt. Als der auf einer Jagd zufällig vorbeieilende Don Sancho sie dort entdeckt, traut er seinen Augen nicht. Dennoch kehrt er kurze Zeit später zurück, um den Gefesselten die Freiheit zu schenken. Diese befinden sich allerdings nicht mehr an Ort und Stelle, denn der reuige Montúfar hat sie inzwischen selbst befreit. Don Sancho zweifelt daher an seinen eigenen Eindrücken, die er inzwischen für ein Gespinst seiner Verliebtheit („aquellas fantasías“) und eine Illusion des Teufels („ilusión del Demonio“ [HC 134]) hält. Die Reisegruppe um Elena gelangt derweil nach Sevilla, wo man es schafft, sich als devotes Geschwisterpaar auszugeben und durch zahlreiche Almosen so lange ein Leben in verstecktem Saus und Braus zu führen, bis man durch den Verrat eines Dieners entlarvt wird. Die Zofe Méndez kostet dies das Leben. Erst als Elena Montúfar in Madrid unter der Bedingung geheiratet hat, dass sie dennoch als Prostituierte arbeiten kann, und der eifersüchtige Ehemann von einem reichen Liebhaber Elenas namens Perico getötet worden ist, wendet sich auch die fortuna Elenas zum Schlechten. Sie wird von der Justiz gefasst, angeklagt, zum Tod durch Ertrinken verurteilt, enteignet und hingerichtet. Zu den Besonderheiten von La Hija de Celestina gehört es, dass ihr Erzähler in wiederholten moralischen Digressionen auf die Unmoral Elenas hinweist – die sich für ihn eben darin auch als geistige Tochter der Celestina erweist. Insbesondere im dritten Kapitel des Buchs deutet er die durch Betrug und Diebstahl bestrittene mala vida der weiblichen Hauptfigur als Konsequenz ihrer nicht zur Ruhe kommenden Mobilität und der dazu gehörigen moralischen Haltlosigkeit: El que mal vive no tiene casa ni ciudad permaneciente, porque antes de poner los pies en ella, hace por donde volver las espaldas, ganando, con uno a quien ofende, a todos por enemigos porque, como se recelan justamente de igual daño, reciben la ofensa por común; y aunque sea criatura tan desamparada del socorro del cielo que nunca tenga pesar del mal que hace, por lo menos jamás le falta el del temor, considerando cuán graves castigos le están guardados si da en las manos de la Justicia. (HC 105) Wer ein Gaunerleben führt, hat kein Heim und keinen festen Wohnsitz; denn kaum hat er den Fuß in eine Stadt gesetzt, stellt er schon etwas an und muß ihr wieder den Rücken kehren; und so macht er sich mit dem einen, den er hineinlegt, alle zu Feinden, fürchten sie doch zu Recht den gleichen Schaden und fühlen sich alle zusammen betrogen. Mag nun auch ein Mensch so von Gott verlassen sein, daß ihn das Böse, das er anrichtet, niemals reut, so wird er zumindest das Gefühl der Angst nie los, wenn er bedenkt, welch schwere Strafen ihn erwarten, falls er der Justiz in die Hände fällt. (TC 29 f.)
138
Frank Estelmann
Entsprechend registriert der Erzähler anlässlich der Hinrichtung Elenas auch die Genugtuung der guten Gesellschaft Toledos, also die „satisfacción de toda la Corte“ (HC 153; „Freude der ganzen Stadt“ [TC 80]). Er weiß nur noch zu berichten, dass Don Sancho reumütig zu seiner Ehefrau zurückgekehrt ist und seinen Lebensstil verändern möchte: „[…] don Sancho […] propuso de allí adelante de vivir honesto casado“.16 Schon in diesem knappen Resümee ist die große Freiheit gegenüber dem historisch gerade erst kodifizierten pikaresken Erzählmodell offensichtlich, das nicht einfach opportunistisch übernommen, sondern mit anderen Erzähltraditionen kontaminiert worden ist. Die Unterstellung, Salas Barbadillo habe, so wie Alonso de Castillo Solórzano, ein vorrangig kommerzielles Interesse am pikaresken Erzählen verfolgt, dessen Formen und Inhalte er verwässert habe, greift somit schnell ins Leere.17 Auch der von einigen Autoren geäußerte Zweifel daran, dass es sich bei Salas Barbadillos Text überhaupt um eine pikareske Erzählung handelt,18 scheint für ein tieferes Verständnis des Textes und dessen Poetik nicht unbedingt weiterführend zu sein. La Hija de Celestina ist vielmehr als das Ergebnis einer bewussten Variation pikaresken Erzählens ausdeutbar. So sieht es auch der Herausgeber der kritischen Ausgabe des Textes, Enrique García Santo-Tomás: El contexto vital que ve nacer la presente novela puede ser estudiado, en este sentido, desde dos perspectivas diferentes: por una parte, se trata de una pieza única en la producción de Salas, en cuanto incluye elementos picarescos matizados por la inclusión de otros ingredientes no específicos de este subgénero; por otro, sin embargo, es una más de las exploraciones formales en un legado que […] se articula precisamente a partir de lo heterogéneo y lo no repetible. (HC 44)
16 HC 153 („gelobte er [Don Sancho] sich, hinfort als ehrbarer Ehemann zu leben“ [TC 80]). 17 Vgl. die substantielle Einleitung in: Picaresca feminina de Alonso de Castillo Solórzano. ‚Teresa de Manzanares‘ y ‚La garduña de Sevilla‘. Hg. von Fernando Rodríguez Mansilla. Madrid, Frankfurt am Main 2012 (Biblioteca Áurea Hispánica 79), S. 11–174. Vgl. dagegen Richard Bjornson: The Picaresque Hero in European Fiction. Madison, Wisc. 1977, bes. S. 90– 96, der außer Acht lässt, dass Salas Barbadillo 1612 noch kein erfolgreicher Autor war, wenn er vorbringt, als „successful dramatists“ hätten dieser und Castillo Solórzano pikareske Themen aus opportunistischen Gründen verwendet (S. 90). 18 Vgl. vor allem Rodríguez Mansilla (Anm. 4), der dafür plädiert, La Hija de Celestina aus dem Korpus der pikaresken Erzähltexte auszuschließen. Ihr Autor habe die Freiheit zur Variation der pikaresken Gattung bewusst missbraucht, da es ihm eigentlich darum gegangen sei, „a subvertir o contrahacer el género picaresco y proponer otra cosa; tampoco una novella al uso, sino su propia idea de novela“ (S. 115). Es fehlt aber die textuelle Grundlage, um von einer Subversion oder Fälschung der pikaresken Gattung sprechen zu können.
Alonso de Salas Barbadillo, Paul Scarron und die Verbreitung pikaresker Bücher
139
Der Kontext, in dem der vorliegende Roman entstand, kann in dieser Hinsicht aus zwei Blickwinkeln analysiert werden: Einerseits handelt es sich um einen in der literarischen Produktion von Salas einzigartigen Text, da seine pikaresken Elemente durch den Einschub anderer, für diese Subgattung unspezifischer Elemente abgetönt wurden. Zum anderen ist er dennoch ein weiterer formaler Versuch, ein literarisches Vermächtnis ausgehend vom Heterogenen und Nichtwiederholbaren zu artikulieren. (Übers. d. Verf.)
In anderen Worten: Salas Barbadillos Erzählung setzt ein generisches Bewusstsein vom pikaresken Erzählen voraus, das nach der Maßgabe inhaltlicher und stilistischer Vielfalt auf quasi experimentelle Weise variiert, mit anderen Elementen angereichert und von seinen Grenzen her modelliert wird. Zum Fundus an Erzähltraditionen, die in La Hija de Celestina aufgriffen werden, gehört neben der pikaresken der von Rojas initiierte Celestina-Strang der spanischen Literaturgeschichte. In der Literaturgeschichte der Pícaras hatte diese familiäre Genealogie weiblicher Schurkerei bereits zuvor als wichtige Referenz gedient: namentlich in López de Úbedas La Pícara Justina.19 Salas Barbadillo aber kombiniert sein Werk direkt mit dem im gesamten 16. Jahrhundert verlegerisch erfolgreichen celestinesken Erbe. Er knüpft damit direkter als López de Úbeda an diese misogyne Literaturtradition Spaniens an.20 Allerdings griffe die Annahme, dass Salas Barbadillo umstandslos die Celestina-Tradition fortgesetzt habe, zu kurz. Denn der grundsätzlich moralistische, abwertende Ton des Erzählers gegenüber dem devianten Verhalten der weiblichen Hauptfigur passt zwar genau in das von Rojas’ Celestina eröffnete Feld. Mutter und Tochter erleiden in beiden Texten auch das gleiche Schicksal, wenn sie von der königlichen Justiz hingerichtet werden. Dennoch ist Elena trotz der ja auch paratextuell markierten Form der reprise keine Kupplerin wie ihre Mutter,
19 Vgl. Berta Bermúdez: ‚Celestina‘ como intertexto en ‚La Pícara Justina‘. In: Celestinesca 25,1–2 (2001), S. 107–132; Gregory G. LaGrone: Salas Barbadillo and the Celestina. In: Hispanic Review 9,4 (1941), S. 440–458. Aus einer Fülle neuerer Arbeiten über die Pícarabücher vgl. z. B. María Soledad Arredondo: ‚Pícaras‘. Mujeres de mal vivir en la narrativa del Siglo de Oro. In: Dicenda 11 (1993), S. 11–33; Reyes Coll-Tellechea: Contra las normas. Las pícaras españolas (1605–1632). Madrid 2005 (Biblioteca crítica de las literaturas luso-hispánicas 12); Friedman (Anm. 3); Lucas Torres: Hijas e hijastras de Justina: venturas y desventuras de una herencia literaria. In: Memoria de la palabra. Actas del VI congreso de la Asociación Internacional Siglo de Oro. Hg. von MaríaLuisa Lobato und Francisco Domínguez Matito. Madrid 2004, S. 1763–1771; sowie: Anne J. Cruz: Discourses of Poverty. Social Reform and the Picaresque Novel in Early Modern Spain. Toronto, Buffalo, London 1999 (University of Toronto Romance Series). 20 Vgl. dazu Francisco José Herrera: La honra en La Celestina y sus continuaciones. In: Lemir: Revista de Literatura Española Medieval y del Renacimiento 3 (1999); ders.: La materia celestinesca. Un hipertexto literario. Valencia 1999; sowie: Joseph T. Snow: Hacia una historia de la recepción de ‚Celestina‘: 1499–1822. In: Celestinesca 21 (1997), S. 115–173.
140
Frank Estelmann
sondern eben eine Pícara, deren Handwerk die Lüge ist, deren schöne dunkle Augen ‚mörderisch‘ sind und deren gepflegtes Äußeres ihr beim Betrügen hilft.21 Entsprechend ist der Text von typisch pikaresken Themen geprägt, wie der horizontalen und vertikalen Mobilität der Protagonistin, die eben nicht an einem Ort verweilt, sondern von Stadt zu Stadt zieht und den sozialen Aufstieg neben der materiellen Bereicherung als Ziel ihres Handelns vor Augen hat. Zudem wird zwar auch Elena in Sevilla ‚vom Text‘ prostituiert,22 doch verkauft sie jenen Körper, den ihre Mutter einstmals gleich dreimal als jungfräulich feilbot, inzwischen aus eigenem Antrieb: Obligóse Montúfar, cuando se dio por esposo de Elena, a llevar con mucha paciencia y cordura […] que ella recibiese visitas; pero con un ítem: que habían de redundar todas en la gloria y alabanza de los cofres, trayendo utilidad y provecho a la bolsa […]. (HC 148) Als sich Elena mit Montúfar vermählte, hatte dieser versprochen, sich […] geduldig und vernünftig aufzuführen […], daß sie Besuch empfangen konnte, jedoch unter der Bedingung, daß dieser ihren Truhen zu Nutz und Frommen gereichte und dem Geldbeutel Vorteil und Gewinn brächte (TC 75).
Diese Form der Prostitution als Instrument zweckrationalen Handelns, das Elena im Allgemeinen perfektioniert hat, ist dem tradierten Kupplermotiv der celestinesken Tradition im Grunde fremd, für die pikaresken Bücher hingegen ebenso typisch wie die Rolle des gehörnten Ehemannes, die Montúfar, darin literarischer Nachkomme Lazarillos, dabei zufällt. Es ist auch signifikant, wenn Salas Barbadillo in den späteren Ausgaben des Textes – den er wiederholt in verschiedenem Umfeld publizierte – den Titel zu La ingeniosa Elena veränderte.23 Er kehrte damit eine für den Text ohnehin auch in formaler Hinsicht charakteristische Abweichung von den celestinesken Normen noch deutlicher heraus. Des Weiteren ist bereits des Öfteren bemerkt worden, dass in La Hija de Celestina das pikareske Erzählen gattungsgeschichtlich mit der novella italienischen Stils vermischt wurde, also mit einer Gattung, die in den 1610er-Jahren, und zwar spätestens mit den Novellensammlungen von Cervantes und Lope de Vega, einen der literarischen Trends am spanischen Hof setzte.24 Die gesamte Erzählung um
21 Vgl. HC 84 f. 22 Vgl. Enriqueta Zafra: Prostituidas por el texto. Discurso prostibulario en la picaresca femenina. West Lafayette, Ind. 2009 (Purdue Studies in Romance Literatures 46). 23 Vgl. dazu HC, Introducción, S. 59 f. Diese (amplifizierte) Version der Erzählung erschien erstmals 1614, sei hier aber nur erwähnt. 24 Die Bedeutung Madrids als Raum hedonistischer Selbstverwirklichung für den jungen Autor Salas Barbadillo ist im Übrigen bereits erforscht worden. Vgl. Enrique García Santo-Tomás: Espacio urbano y creación literaria en el Madrid de Felipe IV. Madrid 2004 (Biblioteca Áurea
Alonso de Salas Barbadillo, Paul Scarron und die Verbreitung pikaresker Bücher
141
Don Sancho entspricht, so argumentiert insbesondere Antonio Rey Hazas, dem italienischen Vorbild höfisch-novellistischen Erzählens.25 Tatsächlich evident ist angesichts der Kommunikationssituation des Autors, der „señores míos“ (HC 86) als textinternen Adressaten und der am Ende der Erzählung herrschenden joie de la cort, dass der soziale Adressat des Textes und sein impliziter Leser höfische sind. Inwieweit diese Beobachtung allerdings überhaupt Rückschlüsse auf die Konstruktion des pikaresken Erzählens zu ziehen erlaubt, ist weniger eindeutig. Rey Hazas geht gleichwohl davon aus, dass La Hija de Celestina stilistisch am „límite máximo permitido entre la picaresca y la ‚novella‘ a la italiana – o su heredera española, llamada desde Amezúa novela cortesana“26 („an der äußersten Grenze zwischen dem pikaresken Roman und der ‚novella‘ italienischen Stils – oder deren spanischer Spielart, die man seit Amezúa höfische Novelle nennt“ [Übers. d. Verf.]) zu verorten sei. Naheliegend ist in der Tat die ideologische Privilegierung des Höfischen vor dem Pikaresken. Fernando Rodríguez Mansilla hat daran erinnert, dass das Werk nicht mit der Hinrichtung Elenas ende, sondern vom Erzähler ideologisch geschlossen werde mit dem Hinweis darauf, dass Don Sancho aus der Erfahrung mit Elena lerne.27 Entsprechend bleibt Don Sancho als getäuschter Liebender, der Einsicht in sein Fehlverhalten und Reue gezeigt hat, als die einzige Figur des Textes vor dessen implizitem Leser moralisch bestehen – und über das Ende der Erzählung hinaus am Leben. Wenn Elena dagegen als pikaresker pharmakós einer ihr letztlich feindselig gegenüberstehenden Gesellschaft zugrunde geht und zuvor nicht einmal die Möglichkeit bekam, ihren ‚Fall‘ analog zu Lázaro, Guzmán oder Justina selbst darzulegen, hat dies wohl dem misogynen Zeitgeist
Hispánica 33); ders.: Modernidad bajo sospecha. Salas Barbadillo y la cultura material del siglo XVII. Madrid 2008. 25 Antonio Rey Hazas: Novela picaresca y novela cortesana: ‚La Hija de la Celestina‘, de Salas Barbadillo. In: Edad de oro 2 (1983), S. 137–156; erneut publiziert in leicht erweiterter Form unter dem Titel: Estudio de ‚La Hija de la Celestina‘. In: Alonso Jerónimo de Salas Barbadillo und Alonso de Castillo Solórzano: Picaresca feminina. ‚La Hija de la Celestina‘ – ‚La Niña de los embustes, Teresa de Manzanares‘. Hg. von Antonio Rey Hazas. Barcelona 1986 (Clásicos Plaza & Janés 42), S. 39–67. 26 Rey Hazas: Novela picaresca (Anm. 25), S. 149. Rey Hazas diskutiert dies in der Folge der Aussage ausführlich. Auch für Lázaro Carreter (Anm. 5) stellt La Hija de Celestina einen Grenzfall („caso límite“; S. 200) des pikaresken Erzählens dar. 27 Vgl. dazu Rodríguez Mansilla (Anm. 4), S. 119–124, der seinerseits verweist auf: Jannine Montauban: El ajuar de la vida picaresca: reproducción, genealogía y sexualidad en la novela picaresca española. Madrid 2003 (Biblioteca filológica hispana 33).
142
Frank Estelmann
entsprochen.28 Auch Friedman hat in seiner Interpretation des Textes ja auf das auktoriale Voice-over hingewiesen, durch das Elena gar nicht recht zu Wort kommt: „[…] the implied author negates the value of her voice. She is not a woman speaking for herself but an extension of the narrator.“29 Tatsächlich behalten am Ende sowohl die männliche Herrschaft als auch das höfische Gesellschaftsmodell die Oberhand.30 Deren Sprecher, der Erzähler des Textes, wird denn auch in einen anonymen Toledaner Poeten gespiegelt, der das den Text abschließende Schmäh-Sonett auf Elena mit den Worten einleitet: „[…] con que mi pluma dará el ultimo paso y se cerrarán las puertas de esta historia“ (HC 153 f.; „womit meine Feder den letzten Schritt tut und sich die Tore dieser Geschichte schließen“ [TC 80]). Dennoch impliziert ein solches Ende nicht unbedingt das Scheitern des pikaresken Erzählmodells. Um dieses interpretatorische Problem erhellen zu können, muss die Doppelstruktur von La Hija de Celestina berücksichtigt werden. Das Werk besteht aus zwei komplett getrennt voneinander verlaufenden Erzählungen. Die eine ist die um Elena und trägt stark pikareske Züge. Die andere ist die um Don Sancho und ist als Erzählung von einer illusionären Liebe stark höfisch und novellistisch geprägt. Kurioserweise nun werden beide Erzählebenen im Text nicht miteinander vermengt, sondern parallel zueinander montiert. Elena weiß nicht, dass Don Sancho sie durch halb Spanien verfolgt und der Neffe des von ihr übers Ohr gehauenen Onkels ist. Diesem wiederum ist zu keinem Zeitpunkt bewusst, dass die von ihm Angebetete, die ihm immerhin drei Mal über den Weg läuft, mit der von ihm im Auftrag des Onkels gesuchten Pícara identisch ist; er hält sie für eine ehrbare Person seines Standes. Der im Text realisierte Kunstgriff besteht also darin, dass die realen und imaginären Welten der beiden Protagonisten im Grundsatz unabhängig voneinander bleiben. Nun hat Rey Hazas, der auf dieser Beobachtung insistiert, aus ihr die Notwendigkeit einer auktorialen Rahmung des Gesamttextes abgeleitet, da es Salas Barbadillo nur mit deren Hilfe habe gelingen können, die beiden getrennten Erzählungen um Elena und Don Sancho zu bündeln.31 In der Konsequenz ist damit konzediert, dass La Hija de Celestina ein weitgehend nichtperspektivischer Text ist, was für die frühen pikaresken Bücher als ausgesprochen untypisch gelten muss. Im Lazarillo de Tormes und Guzmán de Alfarache werden die Handlungsele-
28 Vgl. zur fehlenden Autorschaft der weiblichen Pícaras neben den in Anm. 19 genannten Werken auch HC, Introducción, S. 51–57 (mit weiteren Literaturhinweisen). Den Begriff pharmakós zur Kennzeichnung der Pícara-Figur hat Cruz (Anm. 19) vorgeschlagen. 29 Friedman (Anm. 3), S. 94–100, hier S. 99. 30 Vgl. dazu Rey Hazas: Novela picaresca (Anm. 25), S. 146 f. 31 Vgl. ebd., bes. S. 143–145 und 149–152.
Alonso de Salas Barbadillo, Paul Scarron und die Verbreitung pikaresker Bücher
143
mente bekanntlich aus der „Perspektive des Pikaro als Erzählheld“32 geschildert. Die daraus resultierende Perspektivität der Erzählung, die schon im Lazarillo mit der letztlich offenbleibenden Frage nach dem Redeanlass verbunden ist, sorgt für die Unzuverlässigkeit der Erzählung, die nötige Komplementärlektüre des Lesers33 und insofern auch für die Offenheit von Deutungsmöglichkeiten sowie die ambigue Unabgeschlossenheit des von diesen Werken definierten pikaresken Erzählmodells. Dies ist in La Hija de Celestina, dessen ideologische Schließung offensichtlich ist, sicherlich global nicht mehr der Fall. Dennoch würde es zu kurz greifen, einfach nur das Fehlen pikaresker Perspektivität zu behaupten. Denn sobald Elena eines Abends ihrem Begleiter Montúfar die Geschichte ihrer niederen Herkunft sowie bedrückenden Kindheit und Jugend erzählt (Kap. 3), wechselt der Fokus dann doch in den pseudoautobiografischen Modus und die Perspektive der Pícara, und zwar mit den typischen, die Zuverlässigkeit des Erzählten problematisierenden Implikationen: – Muchas veces, amigo el más agradable a mis ojos y por esta razón entre tantos elegido de mi gusto, me has mandado y yo he deseado obedecerte, que te cuente mi nacimiento y principios, y siempre nos han salido al camino estorbos que no han dado lugar. Ahora nos sobra tiempo, y el que nos corre, tan triste, que necesita mucho de que le busquemos entretenimiento; […]. (HC 106) Du mein Freund, der du mir von allen am besten gefällst, weshalb ich dich unter so vielen auserwählt, schon oft hast du mich gebeten – und ich war willens, deinem Wunsche zu entsprechen –, dir über meine Herkunft und Geburt zu berichten; doch stets ist etwas dazwischengekommen. Jetzt haben wir reichlich Zeit, und da wir in nicht eben gehobener Stimmung sind, könnten wir ein wenig Aufmunterung und Ablenkung wohl gebrauchen. (TC 31)
In dem auf diese Aussage folgenden Teil des Werks, den Elena zum Zweck des alivio de caminos selbst erzählt, ist sie als autodiegetische auch eine typisch pikareske Erzählerin, ganz abgesehen davon, dass ihre niedere und unehrenhafte Herkunft – ihr Vater ist ein einfacher Galicier und Säufer, ihre Mutter arabischen Ursprungs und eine Konvertitin – und ihre frühe Vertrautheit mit dem Verbrechen typische Züge einer pikaresken Biografie erkennen lassen. Dahingehend ähnelt dieser Teil des Werks Mateo Alemáns Guzmán de Alfarache. Letztlich ist die Vermutung, in La Hija de Celestina vollziehe sich eine Distanzierung vom pikaresken Erzählmodell, wohl zu weitgehend. Es gibt nämlich auch Gründe, die dagegen sprechen. Elena als Erzählerin im dritten Kapitel des Werks zieht souverän das pikareske Register, wenn sie von ihrem Vater berichtet:
32 Guillén (Anm. 11), S. 385. 33 Vgl. ebd. sowie Matthias Bauer: Im Fuchsbau der Geschichten. Anatomie des Schelmenromans. Stuttgart, Weimar 1993, S. 26–33.
144
Frank Estelmann
„Ya te dije que mi patria es Madrid. Mi padre se llamó Alonso Rodríguez, gallego en la sangre y en el oficio lacayo, hombre muy agradecido al ingenio de Noé por la invención del sarmiento.“ (HC 106; „Wie ich dir schon sagte, bin ich in Madrid geboren. Mein Vater hieß Alonso Rodríguez und hatte galicisches Blut in den Adern; von Beruf war er Lakai; dem genialen Noah war er für die Entdeckung der Rebe zu großem Dank verpflichtet“ [TC 31]) Solche Aussagen sind in Inhalt und Form typisch pikaresk. Sie halten die perspektivische Doppeldeutigkeit der Erzählung, ähnlich wie in La Pícara Justina, präsent – hier sprachspielerisch durch die gelehrte Anspielung auf den Alkoholismus des Vaters, den die Tochter nicht direkt ausspricht – und setzen sie (auch) in ein Verhältnis der Kontinuität zum pikaresken Erzählen. Folgt man dieser Lektüreachse, wird deutlich, dass die pikareske Welt durch ‚Einkapselung‘ von der höfischen Welt ebenso unabhängig bleibt wie umgekehrt diese von ihr. Die dazu gehörigen Erzählweisen sind als narrative Konkurrenzmodelle zueinander angeordnet und bleiben denn auch als solche bestehen. Die Einkapselung der pikaresken Erzählung in ein singuläres Kapitel von La Hija de Celestina ist mit der Erzählanlage der frühen pikaresken Bücher sicherlich nicht vereinbar. Allerdings muss der Grund dafür gar kein ideologisch-höfischer sein. Dafür ähnelt das Werk auch noch in anderer Weise zu sehr dem Guzmán de Alfarache. Schon die Figuren Elenas und Guzmanillos, also die Figur, auf dessen Schurkereien im Guzmán de Alfarache zurückgeblickt wird, teilen mehr als ihre niedere und als unehrenhaft geltende Abstammung und ihr schelmisches Treiben. Beide sind auch, wie Rodríguez Mansilla beobachtet hat,34 auf durchaus analoge Weise Gegenstand der Erzählerkontrolle. Wie gesehen, stilisiert der Erzähler von La Hija de Celestina das abwechslungsreiche Leben der Protagonistin zu einem Beispiel für eine schlechte Lebensführung. Allerdings verfolgte auch der Erzähler Guzmán gegenüber dem Schelm, der er selbst einmal war (und vielleicht noch immer ist), eben diese doppelte Erzählstrategie der moralistischen Objektivierung und unterhaltsamen Ausstellung des pikaresken Daseins. Die bloße Beobachtung, dass die Geschichte Elenas bei Salas Barbadillo Gegenstand einer Erzählerkontrolle ist, die sie moralisch abwertet, unterscheidet dessen Text also nicht von Mateo Alemáns Werk. Vielmehr ist die Warnung vor den „flaquezas de nuestra naturaleza miserable“ (HC 117; den „Schwächen unserer erbärmlichen Natur“ [TC 40]), die in der Pícara Elena verkörpert sind und ihr beim Aufbau einer ehrenhaften sozialen Existenz im Wege stehen, inhaltlich deutlich an den Guzmán angelehnt. Auch in La Hija de Celestina ist, anders gesagt, der Alemánsche Verbund aus „consejo“, der moralischen Botschaft an eine höfische Leser-
34 Vgl. Rodríguez Mansilla (Anm. 4), hier S. 116–118.
Alonso de Salas Barbadillo, Paul Scarron und die Verbreitung pikaresker Bücher
145
schaft, und „conseja“, dem pikaresken Fallbeispiel, an dem diese Botschaft formuliert worden ist, realisiert.35 Freilich bleiben die beträchtlichen formalen und ideologischen Unterschiede zwischen beiden Texten bestehen. Im Guzmán blickt der Erzähler selbst auf seine Verfehlungen zurück, bezieht sich nicht vorrangig auf eine soziale, sondern spirituelle Norm und hofft mit seiner Lebensbeichte auf sein Seelenheil, buhlt also gerade nicht um die Solidarität des Publikums bei der Verurteilung der Hauptfigur.36 La Hija de Celestina mag also in diesen Hinsichten von pikaresken Merkmalen gelöst worden sein, ist aber dennoch – um ein Zwischenfazit zu ziehen – ein wichtiger Text für die Entwicklung der pikaresken Gattung. Als ein letztlich illegitimer, d. h. nicht vorrangig nach Treuegeboten konzipierter ‚Nachwuchs‘ der kodifizierten pikaresken Bücher Lazarillo de Tormes und Guzmán de Alfarache lässt Salas Barbadillos Werk eine frühe Art der nichtpuristischen Tradierung der Gattung erkennen – einer Tradierung, die durch Momente von Vermischung und Einkapselung charakterisiert ist. Es unterstreicht die Möglichkeit, die Gattungsgeschichte der pikaresken Bücher auf der Grundlage einer den Autoren eingeräumten Freiheit zur originellen Variation des pikaresken Erzählens zu verfassen. Die Tradierung des pikaresken Erzählens wurde schon früh, und schon in Spanien selbst, mitunter von entfernten Verwandten geleistet, die, um mit Thomas Bodenmüller zu sprechen, „antiautomatisierte[ ] Produkt[e] eines hochreflektiert-eigenständigen Umgangs mit der Gattung“37 lieferten und damit letztlich deren Fruchtbarkeit bewiesen.
3 Paul Scarrons Les Hypocrites und die transnationale Intertextualität Klaus Meyer-Minnemann hat in der Referenz auf die einschlägige Studie von Fernando Cabo Aseguinolaza drei Richtungen angesprochen, denen die Forschungen im Bereich der pikaresken Bücher folgen.38 Waren die älteren Studien noch an erster Stelle an den sozialgeschichtlichen Referenzen der Gattung interessiert, ein Ansatz, der spätestens seit Ricos narratologischer Studie in der Tat erheblich an Überzeugungskraft verloren hat, hält Meyer-Minnemann vor allem die zweite, also die formale, Orientierung für produktiv: Sie „resulta capaz de fundamentar
35 Vgl. dazu das Vorwort („Al discreto lector“) in: Mateo Alemán: Guzmán de Alfarache. Hg. von José María Micó. 2 Bde., 3. Aufl. Madrid 1994 (Letras Hispánicas 86; 87), hier Bd. 1, S. 111. 36 Vgl. Rodríguez Mansilla (Anm. 4), S. 117–120. 37 Bodenmüller (Anm. 6), S. 35, mit Bezug auf López de Úbedas La Pícara Justina. 38 Meyer-Minnemann (Anm. 4), S. 13–19, mit Bezug auf Cabo Aseguinolaza (Anm. 4).
146
Frank Estelmann
una relación de coherencia genérica entre una serie de textos narrativos que ya en el momento de su concepción y difusión históricas empezaron a considerarse unidos por rasgos de semejanza“.39 Die Analyse von La Hija de Celestina hat diese Annahme bestätigen können. Nun zeigt jedoch die neuerliche Bearbeitung des Stoffes durch Paul Scarron recht gut, dass auch die dritte, die komparatistische Orientierung sehr aufmerksam beachtet werden sollte, auch deshalb, da sie für Genese und Struktur der formalen Gattungsmerkmale relevant gewesen ist. Im Folgenden soll daher Juan Antonio Garrido Ardilas Konzept der „intertextualidad transnacional“ die Analyse von Scarrons Les Hypocrites leiten und dabei helfen, die formale und komparatistische Orientierung in einem gemeinsamen Modell der Gattungsentwicklung zusammenzubringen.40 Dieses Modell sollte idealerweise sowohl Nachahmungen als auch Übersetzungen von einzelnen Texten gemeinsam untersuchen – und ebenfalls sensibel für deren Mischformen sein.41 Die transnationale Verbreitung der pikaresken Bücher spanischer Provenienz qua intertextueller Serialität war bislang nur selten Gegenstand der Forschung.42 Dabei war z. B. für die erste Mode des Pikaresken in Frankreich zweifellos nicht nur jene von Alexandre Cioranescu untersuchte Spanienbegeisterung43
39 Ebd., S. 18 f. („ist in der Lage, ein Verhältnis der Gattungskohärenz innerhalb einer Serie von Erzähltexten zu stiften, deren über Ähnlichkeiten vermittelte Einheit man bereits im Moment ihrer historischen Entstehung und Verbreitung festzustellen begann“ [Übers. d. Verf.]). 40 Garrido Ardila (Anm. 4), S. 21. Diese Studie ist eine der wenigen neueren monografisch angelegten Versuche, die europäische Wirkungsgeschichte der „picaresque fictions“ (S. 23) zu untersuchen; die Ausführungen darin sind deutlich auf die englische Literatur fokussiert. Es liegen daneben schon seit längerem Systematisierungsversuche pikaresker Traditionsbildung vor, wie z. B. Alexander Blackburn: The Myth of the Picaro. Continuity and Transformation of the Picaresque Novel, 1554–1954. Chapel Hill 1979. Sie können jedoch im Rahmen einer Intertextualitätstheorie nicht fruchtbar gemacht werden, worauf es mir im Sinne der Modellierung einer Gattungsgeschichte der pikaresken Bücher als Geschichte konkreter literarischer Transfers und Verhältnisse aber gerade ankommt. 41 Ich folge weitgehend dem übersetzungswissenschaftlichen Ansatz von Michael Schreiber, der die Übersetzung, aufbauend auf Genettes Studie Palimpsestes. La littérature au second degré, als eine spezifische Form der Intertextualität konzipiert. Vgl. dazu genauer Michael Schreiber: Übersetzung und Bearbeitung. Zur Differenzierung und Abgrenzung des Übersetzungsbegriffs. Tübingen 1993 (Tübinger Beiträge zur Linguistik 389), hier bes. S. 12–43 und 125. Den Zusammenhang von Übersetzung und Intertextualität diskutiert haben auch Werner von Koppenfels: Intertextualität und Sprachwechsel. Die literarische Übersetzung. In: Intertextualität. Formen, Funktionen, anglistische Fallstudien. Hg. von Ulrich Broich und Manfred Pfister. Tübingen 1985 (Konzepte der Sprach- und Literaturwissenschaft 35), S. 137–158 und Horst Turk: Intertextualität als Fall der Übersetzung. In: Poetica 19 (1987), S. 261–277. 42 Vgl. vor allem Bodenmüller (Anm. 6). 43 Vgl. Alexandre Cioranescu: Le masque et le visage. Du baroque espagnol au classicisme français. Genf 1983 (Histoire des idées et critique littéraire 210).
Alonso de Salas Barbadillo, Paul Scarron und die Verbreitung pikaresker Bücher
147
verantwortlich, durch die das Spanische nach 1600 zur höfischen Modesprache wurde und die pikaresken Bücher schnell auch auf der ‚Leseliste‘44 des französischen Publikums standen. Im Zeitraum etwa zwischen 1600 und 1630 sorgten eben auch Sofortübertragungen von Texten wie dem Guzmán de Alfarache oder den Fortsetzungen des Lazarillo de Tormes – neben Verlegern wie Billaine, die diese Übersetzungen vertrieben – dafür, dass die pikaresken Bücher spanischen Ursprungs schnell auch Einzug in den „Kernbestand“ der übersetzten Texte in Frankreich hielten.45 Insofern ist die erste Phase der Verbreitung der pikaresken Bücher im Hexagon auch in mehrerer Hinsicht aufschlussreich. So zeigt z. B. die Praxis der zweisprachig französisch-spanischen Textausgaben, die vor allem den Lazarillo de Tormes betraf, dass man Ausgangs- und Zieltexte in der literarhistorischen Retrospektive nicht ungebührlich strikt voneinander trennen sollte.46 Die Prominenz der pikaresken Bücher in Frankreich – in spanischer Sprache oder in französischer Übersetzung – in dieser frühen Periode widerlegt währenddessen die Annahme, dass es erst die einschlägigen Romane bekannter Autoren wie Sorel (in der Histoire comique de Francion, 1623/33), Tristan L’Hermite (im Page disgracié, 1643) oder Scarron (im Roman comique, 1651/57) waren, die pikareske Erzählverfahren in Frankreich popularisierten. Eine Literaturgeschichte des pikaresken Erzählens in Frankreich also, die sowohl den spanischen pikaresken Büchern selbst als auch deren Übersetzungen den ihnen gebührenden Stellenwert verwehrte, würde von Beginn an zu kurz greifen. Dank übersetzungsgeschichtlicher Arbeiten sind die beschriebenen Sachverhalte freilich schon lange bekannt. Bereits Rolf Greifelt untersuchte vor der Periode des auch kulturpolitisch gefestigten französischen Klassizismus eine durch Übersetzungen charakterisierte „Öffnungszeit“, „in der von außen her, von einem anderen Lande der Anstoß kommt, dessen Produktion unbedenklich aufgenommen wird, um dann aber in einem langsamen Assimilationsprozeß den Fremdcharakter zu verlieren und einer französischen Neuschöpfung zu
44 Vgl. Jörn Albrecht: Literarische Übersetzung. Geschichte – Theorie – Kulturelle Wirkung. Darmstadt 2009, S. 226. 45 Vgl. ebd., S. 206–214. Zur Übersetzungsgeschichte vgl. neben der bereits genannten Studie Cioranescus (Anm. 43) auch Hendrik van Gorp: The European Picaresque Novel in the 17th and 18th Centuries. In: The Manipulation of Literature. Studies in Literary Translation. Hg. von Theo Hermans. London 1985, S. 136–148, sowie Rolf Greifelt: Die Übersetzungen des spanischen Schelmenromans in Frankreich im 17. Jahrhundert. In: Romanische Forschungen 50 (1936), S. 51–84. 46 Vgl. José Manuel Losada Goya: Bibliographie critique de la littérature espagnole en France au XVIIe siècle. Présence et influence. Genf 1999 (Travaux du Grand Siècle 9), bes. S. 62 f. und 392– 395; Fritz Nies: Schnittpunkt Frankreich. Ein Jahrtausend Übersetzen. Tübingen 2009 (Transfer 20), bes. S. 40.
148
Frank Estelmann
weichen“47. Folgt man seinen Gedanken in aktuelleren Begriffen, waren die pikaresken Werke spanischer Provenienz qua einbürgernder Übersetzungen im literarischen Polysystem Frankreichs in den ersten Dekaden des 17. Jahrhunderts ein nicht-kanonisierter, peripher bleibender Faktor in der literarischen Entwicklung. Dieser Faktor wirkte so lange dynamisch auf das Zentrum des französischen Literatursystems ein, bis er zur Mitte des 17. Jahrhunderts hin allmählich ‚assimiliert‘ wurde, etwa durch die Neumodellierung einer Erzählgattung wie des Roman comique.48 Etwas Ähnliches hatte schon Charles Sorel, also einer der Protagonisten der Entwicklung, in der Bibliothèque françoise (1664) erklärt.49 Er führt aus, wie offenbar insbesondere die freien Übersetzungen spanischer Ausgangstexte, also etwa Jean Chapelains Le Gueux, ou la Vie de Guzman d’Alfarache (1619) oder Genestes L’avanturier Buscon, histoire facétieuse (1633),50 das Feld für die Gattung des komischen Romans in Frankreich bereitet haben. Gewöhnlich unter der Bezeichnung der belles infidèles versammelt, gebührt aus Sicht Sorels jenen Übersetzern Lob, die sich im französischen Klassizismus als Koautoren verstanden und die spanischen Pikaroromane mit weitgehend unphilologischen Formen der Übersetzung ‚französiert‘ haben: „Ie nomme des Liures qui sont Espagnols d’origine, mais qui ayant esté faits François par la Traduction, peuuent tenir leur rang en ce lieu.“51 Nun wäre es unangebracht, diesen noch über Sorel hinaus dynamisch verlaufenden Prozess mit einem verlorengegangenen Einfluss der spanischen pikares-
47 Greifelt (Anm. 45), S. 53 f. Vgl. auch van Gorp (Anm. 45), S. 136–139. 48 Das Konzept des literarischen Polysystems geht zurück auf Itamar Even-Zohar: Papers in Historical Poetics. Tel Aviv 1978 (Papers on Poetics and Semiotics 8), bes. S. 11–26. Even-Zohar entwickelt darin auch ein Modell für literarischen Kontakt (S. 44–52). 49 Vgl. Charles Sorel: La Bibliothèque françoise. 2. Aufl. Paris 1667, Kap. 9: „Des romans comiqves, ou Satyriques, & des Romans Burlesques“ (S. 188–200). 50 Vgl. Klaus Meyer-Minnemann: La primera traducción francesa de ‚La vida del Buscón‘. In: Ders./Schlickers (Anm. 4), S. 443–457; Jan Mohr: ‚Buscón‘ französisch. Zum semantischstrukturellen Profil der Adaptation durch La Geneste (1633). In: Das Syntagma des Pikaresken. Hg. von Jan Mohr und Michael Waltenberger. Heidelberg 2014 (GRM-Beiheft 58), S. 209–239. 51 Sorel (Anm. 57), S. 193. Zum Selbstbild der Übersetzer vgl. Theo Hermans: Images of Translation. Metaphor and Imagery in the Renaissance Discourse on Translation. In: Hermans (Anm. 45), S. 103–135; sowie ders.: Renaissance Translation between Literalism and Imitation. In: Geschichte, System, literarische Übersetzung. Hg. von Harald Kittel. Berlin 1992 (Göttinger Beiträge zur internationalen Übersetzungsforschung 5), S. 95–116. Hinsichtlich der einbürgernden Übersetzungsverfahren im französischen Klassizismus einschlägig ist Roger Zuber: Les ‚belles infidèles‘ et la formation du goût classique. Paris 1995 (Bibliothèque de „L’Évolution de l’Humanité“ 14). In meinem Kontext hilfreich erscheint zudem José Luis Colomer: Translation and Imitation: Amplificatio as a Means of Adapting the Spanish Picaresque Novel. In: Revue de littérature comparée 63 (1989), S. 369–376. Vgl. die distanzierte Konzeptualisierung Schreibers
Alonso de Salas Barbadillo, Paul Scarron und die Verbreitung pikaresker Bücher
149
ken Bücher auf die Blütezeit des siècle classique in Frankreich zu verwechseln. Die ‚Klassiker‘ der Gattung, wie insbesondere der Lazarillo de Tormes und der Guzmán de Alfarache, wurden bis ins 18. Jahrhundert hinein immer weiter neu aufgelegt, z. T. auch neu übersetzt.52 Richtig ist allerdings, dass sich ab den 1620er-Jahren die Rezeptionsbedingungen der libros de pícaros zu verändern begannen. Zwar waren auch die meisten der in Spanien erst nach etwa 1620 veröffentlichten pikaresken Bücher weiterhin auch in französischer Version erhältlich, doch geschah dies inzwischen mit einer Verzögerung um einige Jahre. Ein Beispiel dafür gibt neben Castillo Solórzanos La garduña de Sevilla (1642; La fouyne de Seville, 1661) schon die bereits erwähnte Übersetzung des Buscón Quevedos, der erst knapp ein Jahrzehnt nach der spanischen Erstveröffentlichung auch auf Französisch erhältlich war (1633). Den Extremfall stellen die Pícarabücher dar, und zwar speziell die Erzählungen aus der Frühphase der spanischen Gattungsgeschichte. Sie erschienen grundsätzlich erst mit großer Verspätung in französischer Übersetzung. López de Úbedas La Pícara Justina lag erst nach 30 Jahren auf Französisch vor (La Narquoise Justine, 1635). Salas Barbadillos La Hija de Celestina übertrug Scarron sogar erst gut 40 Jahre nach der Publikation des spanischen Referenzwerks ins Französische. Es ist aber sogar angesichts dieser Verlangsamung der Frequenz des literarischen Transfers klar, dass die libros picarescos in Form von Übersetzungen oder Bearbeitungen auch über 1620–1630 hinaus einen Platz im französischen Literatursystem beanspruchten. Scarrons Novellensammlung Les Nouvelles tragi-comiques (1657) – die 20-mal bis 1718 neu aufgelegt wurde53 – zeigt den komplementären Charakter der spanischen Literatur zur einheimischen Literaturproduktion recht gut an. Man könnte sie zwar als einheimische literarische Spielform bezeichnen, sie besteht allerdings in Gänze aus übersetzungsnahen, französischen Versionen einzelner spanischer Ausgangstexte, denen sie intertextuell sehr eng verbunden bleibt. Scarron hat für eine solche Form transnationaler Intertextualität im Einzelnen, neben La Hija de Celestina, drei Novellen aus María de Zayas’ Novelas amorosas y ejemplares (1637) übertragen und für „Plus d’effet que de paroles“ wohl vorrangig eine Komödie Tirso de Molinas adaptiert. Nun enthält bereits Scarrons Hauptwerk Le Roman comique, dessen erster Teil 1651 und dessen zweiter Teil 1657 erschien, eine Reihe eingeschobener Bin-
(Anm. 41), der die belles infidèles der normativen Einbürgerung zuordnet (z. B. S. 282–284) und sie daher nicht mehr als ein Übersetzungsverfahren versteht. 52 Vgl. Greifelt (Anm. 45). 53 So Guichemerre in der Einleitung zu seiner Ausgabe von Paul Scarron: Les nouvelles tragicomiques. Hg. von Roger Guichemerre. Paris 1986 (Société des Textes Français Modernes 182), S. 7–18, hier S. 14 f.
150
Frank Estelmann
nenerzählungen, die übersetzungsnahe Bearbeitungen verschiedener Novellen u. a. von María de Zayas und Castillo Solórzano sind. Scarron hat sie, ohne Nennung der Quellen, in französischer Version mit der Erzählung von einer fahrenden Theatertruppe gerahmt, zu der sie in einem Verhältnis des Echos stehen.54 Dagegen können die in Les Nouvelles tragi-comiques gebündelten französischen Versionen spanischer novelas cortas aufgrund des losen Charakters des Werks ohne weiteres als weitgehend autonome Erzähltexte aufgefasst werden. Entsprechend schwierig ist aber auch die Rekonstruktion der Gründe, die Scarron dazu bewogen haben, gerade die angesprochenen Werke zu übertragen und in einem Band zu versammeln. Wie Guiomar Hautcœur gezeigt hat,55 kommt es wohl vor allem darauf an, sein allgemeines Interesse an der spanischen Novellengattung zu betonen, und zwar vor dem Hintergrund des vraisemblance-Gebots, das Texte wie La Hija de Celestina als Alternativen zu den umfangreichen und idealisierenden französischen Romanformen der Zeit erscheinen ließ. Die Textauswahl motiviert haben dürften aber auch inhaltliche Gesichtspunkte, insbesondere die Liebesthematik sämtlicher in den Nouvelles tragi-comiques versammelten Erzählungen. Gerade der Mischcharakter von Salas Barbadillos Erzähltext, in den Romaneskes ebenso wie Novellistisches, eine Pícara-Erzählung ebenso wie eine höfische Liebesgeschichte eingeflossen ist, macht Scarrons Interesse an dieser Erzählung also nachvollziehbar. Angesichts dessen kann es kaum ein Zufall sein, dass einer der wenigen Texte der spanischen Literaturgeschichte, der die genannte Heterogenität teilt, nämlich María de Zayas’ El castigo de la miseria,
54 Vgl. z. B. Rosa Maria Calvet Lora: ‚Le Roman comique‘ o la reversibilidad de una traducción. In: La traducción: metodología, historia, literatura: ámbito hispanofrancés. Hg. von Francisco Lafarga Maduell, Albert Ribas und Mercedes Tricás Preckler. Barcelona 1995, S. 231–239; Horst Weich: Paul Scarron, ‚Le Roman comique‘ (1651/1657), und Antoine Furetière, ‚Le Roman bourgeois‘ (1666). In: 17. Jahrhundert – Roman, Fabel, Maxime, Brief. Hg. von Renate Baader. Tübingen 1999, S. 67–111; Stéphane Lojkine und Pierre Ronzeaud (Hg.): Fictions de la rencontre. ‚Le roman comique‘ de Scarron. Aix-en-Provence 2011; Sabine Schlickers: Paul Scarron, ‚Le roman comique‘ (1651/1657). In: Meyer-Minnemann/Schlickers (Anm. 4), S. 523–543; Ansgar Thiele: Zwischen Exklusion und Individualisierung. Transformation des Pikaros in der ‚histoire comique‘. In: Das Paradigma des Pikaresken. The Paradigm of the Picaresque. Hg. von Christoph Ehland und Robert Fajen. Heidelberg 2007 (GRM-Beiheft 30), S. 133–146, sowie Gabrielle Verdier: Scarron traducteur, ou l’occasion fait le larron. In: Papers on French Seventeenth Century Literature 10 (1978), H. 1, S. 79–96. 55 Guiomar Hautcœur: Les ‚Nouvelles tragi-comiques‘ de Scarron et la critique du roman. In: La traduction en France à l’âge classique. Hg. von Michel Ballard und Lieven d’Hulst. Villeneuve d’Ascq 1996, S. 243–258, hier bes. S. 247–252; vgl. daneben auch die Scarron gewidmeten Teile in Guiomar Hautcœur Pérez-Espejo: Parentés franco-espagnoles au XVIIe siècle. Poétique de la nouvelle de Cervantès à Challe. Paris 2005 (Bibliothèque de littérature générale et comparée 54).
Alonso de Salas Barbadillo, Paul Scarron und die Verbreitung pikaresker Bücher
151
von Scarron ebenfalls für Les Nouvelles tragi-comiques ausgewählt und unter dem Titel Le chastiment de l’avarice übertragen worden ist. Ganz offenbar stellt Scarrons Novellenband jenen Teil seines Gesamtwerks dar, in dem sich das Interesse des Autors am pikaresken Erzählen spanischer Provenienz in aller Deutlichkeit niedergeschlagen hat, auch wenn es ihm darin sicherlich nicht ausschließlich um das pikareske Erzählen ging – das teilt er allerdings sowohl mit Salas Barbadillo als auch mit María de Zayas. Wie schon Salas Barbadillo privilegierte er in Les Hypocrites vielmehr die Ansteckung der pikaresken mit alternativen, hier vorrangig komischen Erzählweisen. Die Klärung des ‚warum‘ dieses Vorgehens muss allerdings zurückstehen hinter der Analyse des ‚wie‘, denn es ist eine Antwort auf die nun bereits des Öfteren evozierte Frage nach der Freiheit vonnöten, die sich Scarron im intertextuellen Bezug auf La Hija de Celestina nahm. Zunächst ist es schon wichtig festzuhalten, dass Les Hypocrites im kritischen Vergleich zu La Hija de Celestina übersetzungsnah, wenn nicht sogar, zumindest in Teilen, übersetzenden Charakters ist. Zu den in dieser Hinsicht signifikanten Passagen zählt die in Sevilla spielende Szene, in der Helene (also Elena) und ihre Begleiter von einem ihnen bekannten Gauner als in Saus und Braus lebende falsche Devote entlarvt werden. Montufar, dessen Namen Scarron ohne Akzent notiert und damit wie die Namen der anderen Figuren leicht französisiert hat, verhindert die Lynchjustiz der aufgebrachten Öffentlichkeit, indem er sich dem Ankläger zu Füßen wirft und ihn mit der folgenden heuchlerischen Selbstanklage konfrontiert: Je suis le méchant, disoit-il à ceux qui le voulurent entendre, je suis le pecheur, je suis celuy qui n’ay jamais rien fait d’agreable aux yeux de Dieu. Pensez-vous, continuoit-il, parce que vous me voyez vestu en homme de bien, que je n’aye pas esté toute ma vie un larron le scandale des autres et la perdition de moy-mesme? Vous estes trompez, mes freres; faites-moy le but de vos injures et de vos pierres, et tirez sur moy vos espées.56 Yo soy el malo, yo el pecador, yo el que jamás hizo obra de que se pagasen los ojos de Dios. ¿Pensáis, aunque me veis así, que no he sido toda mi vida un ladrón vil, con mal ejemplo de la república y grave daño de mi alma? Pues estáis engañados; contra mí vienen bien las saetas, desnudad para mí las espadas y tiradme a mí las piedras […]. (HC 141)
56 Paul Scarron: Les Hypocrites. In: Les nouvelles tragi-comiques (Anm. 53), S. 111–170, hier S. 158 f.; zu HC 141 vgl. TC 68: „Ich bin der Übeltäter, der Sünder, derjenige, der nie etwas getan, was den Augen Gottes ein Wohlgefallen war! Weil ihr mich jetzt so seht, glaubt ihr, ich könne nicht mein Leben lang, zum bösen Beispiel für die Allgemeinheit und zum schweren Schaden für meine Seele, ein verruchter Halunke gewesen sein? Nun wohl, ihr irrt euch, ich bin das richtige Ziel für die Pfeile; zieht eure Degen gegen mich und steinigt mich!“
152
Frank Estelmann
Diese Szene, die durch Tartuffe in Molières gleichnamiger Komödie (III,6) bekannt geworden ist, ist typisch für die Schelmereien, die von den Protagonisten verübt werden. Der inszenierte „acte d’humilité“57 Montufars dient bloß dazu, die materielle Bereicherung durch die Almosen der (gut-)gläubigen Sevillaner zu kaschieren, um die es in Wirklichkeit geht. Die in der französischen Version angemessen übertragene Rhetorik der Heuchelei zeigt deutlich die beachtliche spanische Sprachkompetenz Scarrons und ist ein Beleg dafür, dass jene Form transnationaler Intertextualität, die Scarron selbst „Version“58 nannte, in der Tat auch auf Übersetzungsverfahren beruht. Man sollte Scarrons literarische Kompetenz also nicht gegen seine Übersetzerkompetenz ausspielen wollen. Passagen wie die zitierte, die sich im Vergleich der französischen und spanischen Version als Ergebnis translatorischen Handelns erweisen, verbieten es, in Les Hypocrites eine freie Nachahmung zu sehen, die mit dem spanischen Ausgangstext nur in einem losen Verhältnis der Inspiration stünde. Den Blick auf eine weitergehende Beobachtung lenkt ein anderes Beispiel. Es handelt sich um die Passage anfangs der ‚Jagd‘ auf die Pícara, in der Dom Sanche seine Diener zurechtweist, weil sie die Kutsche der angebeteten Frau, also Helene, auf der Suche nach der am Onkel zur Betrügerin Gewordenen durchsucht haben: „Coquins, s’écrioit-il, ne vous-ay je pas dit que vous prissiez bien garde à ne vous méprendre pas […].“59 – „Pícaros, hombres viles! ¿No os dije antes de llegar a este coche que mirásedes bien si era lo que buscaba?“ (HC 120) Es ist gut erkennbar, dass Scarron den stark konnotierten spanischen Begriff „pícaros“ nicht verfremdend übersetzt, denn er setzt dafür das Wort „coquins“ ein. Allerdings findet sich das französische picaro, auch wenn Oudins Wörterbuch das Wort schon kennt, in einem pikaresken Text meines Wissens erst bei Lesage.60 Wäre Scarron der Übersetzungspraxis seiner Zeit gefolgt, hätte er – so wie Chapelain in seiner Übersetzung des Guzmán de Alfarache – das spanische „pícaros“ mit gueux (Bettler)
57 Ebd., S. 159. 58 A qui lira [Vorwort zu „La Précaution inutile“], In: Scarron (Anm. 53), S. 31–33, hier S. 32. 59 Scarron: Les Hypocrites (Anm. 56), S. 137; zu HC 120 vgl. TC 43 f.: „Spitzbuben, elendes Pack, habe ich euch nicht, bevor ihr diese Kutsche anhieltet, gesagt, ihr sollt genau hinsehen, ob es auch die gesuchte sei?“ 60 Im Gil Blas de Santillane Alain-René Lesages wird das französische Wort picaro zweimal benutzt. Einmal verwendet es der Duc de Lerme gegenüber Gil Blas („vous avez été tant soit peu picaro“), einmal charakterisiert Gil Blas damit den jungen Scipion („Dans son enfance, Scipion a été un vrai picaro“). Vgl. Le Sage: Gil Blas de Santillane. Hg. von Étiemble, Paris 1996, S. 622 (Buch 8, Kapitel 2) und 861 (Buch 10, Kapitel 12). Zwar tauchte picaro schon im Trésor des deux langues espagnolle et française von César Oudin in der Bedeutung von ‚Bettler‘ auf – wohl das erste Indiz einer tatsächlich im Hintergrund wirkenden Entlehnung aus dem Spanischen. Dies blieb aber offensichtlich für die Übersetzungspraxis im 17. Jahrhundert folgenlos.
Alonso de Salas Barbadillo, Paul Scarron und die Verbreitung pikaresker Bücher
153
übersetzen müssen. Diese Übersetzung wäre aber unglücklich gewesen, weil sie keine Entsprechung im Figurenrepertoire von La Hija de Celestina gehabt hätte. Scarron musste also eine Alternative dazu finden, die er aus dem galantkomischen Register gewählt hat. Diese Wahl an sich ist mit dem Vorrang, der der Wirkungsgleichheit zwischen Ausgangs- und Zieltext vor einer im engeren Sinne philologischen Übersetzungsoption gegeben wurde, aber unter Umständen noch vereinbar. Sie verweist bereits darauf, dass Scarron seine Version von Salas Barbadillos Erzählung entschieden in der für die belles infidèles charakteristischen „Unbestimmtheitszone“61 zwischen Bearbeitung und Übersetzung situierte. Allerdings sollte hier der Streit beachtet werden, in den Scarron von Antoine Le Métel, auch d’Ouville genannt, verwickelt wurde, der kurz zuvor eine Übersetzung der Novelas ejemplares y amorosas von María de Zayas publiziert hatte (Les nouvelles exemplaires et amoureux, Paris 1655). Dabei handelt es sich um den Novellenband, aus dem Scarron sich, wie angesprochen, in den Nouvelles tragi-comiques bediente. Zieht man Scarrons Erwiderung zu Rate, hatte d’Ouville, ein bekannter Übersetzer aus dem Spanischen, Scarrons den Ausgangstext von María de Zayas plagiierende und aus seiner Sicht unangemessene Version kritisiert. Scarron erwiderte in einer späteren Edition des Werks mit einer Gegenrede, in der er sich nicht nur maliziös auf seine überlegenen Spanischkompetenzen berief – der Kontrahent sei „peu sincere en François et fort ignorant en Espagnol“ –,62 sondern auch auf seine María de Zayas gegenüber überlegenen stilistischen Kompetenzen. Scarron spricht ausgesprochen abschätzig von der Autorin, „cette Espagnole, qui écrit tout d’un style extravagant et rien de bon sens“; ihre Novelle sei „déplorablement écrite en Espagnol“.63 Seine eigene Version der Geschichte habe dagegen den Vorteil der „nouveauté“ und zudem auch noch Erfolg beim Publikum („heureux succés“).64 Nun war es durchaus gängig, den spanischen Erzählern eine größere Originalität in der inventio einzuräumen; dies hatte schon der Cervantes-Übersetzer Vital d’Audiguier so gesehen: „[L]es Espagnols ont quelque chose par dessus nous en l’invention d’une histoire.“65 Gepaart war dieses kulturelle Stereotyp, das im Übrigen das Interesse französischer Autoren der Zeit an spanischen Stoffen zu illustrieren vermag, im Allgemeinen aber, so auch bei Scarron, mit dem an die Spanier gerichteten Vorwurf, in Fragen der dispositio und vor allem der elocutio überaus nachlässig zu sein.
61 Albrecht (Anm. 44), S. 142. 62 Scarron: A qui lira (Anm. 58), S. 32. 63 Ebd., S. 33 und 32. 64 Ebd., S. 33. 65 Vital d’Audiguier: Préface zur Übersetzung der Novelas ejemplares von Cervantes (1615). Zitiert nach Hautcœur (Anm. 55), S. 248.
154
Frank Estelmann
Lenkt man den Blick von da aus zurück auf Les Hypocrites, wird schnell deutlich, warum Scarron zwar an der Geschichte, wie Salas Barbadillo sie erzählte, (weitgehend) festhielt, aber z. B. die Kapitelstruktur der Vorlage auflöste, einige der Dialoge zwischen den Figuren in eine extradiegetisch vermittelte Szene transponierte oder eine Reihe weiterer Passagen von La Hija de Celestina kürzte, raffte, ausließ, resümierte und explikativ konkretisierte.66 Es handelte sich aus seiner Sicht um Verschönerungen von dispositio und elocutio des Ausgangstextes. Dies zeigt auch jene Szene, in der Méndez Elena dazu rät, sich endlich vom Tyrannen Montúfar zu trennen: Mais vous donner toute entiere, comme vous faites, à un filou aussi meschant que lasche, qui a mis toute son ambition à excroquer des femmes, qui ne les gagne que par des menaces et ne les garde que par des Tyrannies, c’est, ce me semble, dépenser son bien à se rendre miserable de la derniere misere et travailler à sa ruine. […] pero con un pícaro – hombre de ruines entrañas y de bajo ánimo, cuyo corazón es tan vil que se ha contentado y satisfecho, para pasar su vida, de este bajo entretenimiento en que se ocupa, estafando mujeres, comiendo de sus amenazas y viviendo de sus insolencias – locura es, necedad sin disculpa, gastar con él la hacienda y el tiempo.67
In dieser Passage wird erneut die verfremdende Übersetzung des spanischen „pícaro“ vermieden und stattdessen „filou“ verwendet. Allerdings korrespondiert Scarrons Version der Passage nicht mit der Stilhöhe des Ausgangstextes: Sie ist komisch und nicht komisch-moralisierend, semantisch dementsprechend auf das Liebesregister reduziert und durch den evidenten Rekurs auf das klassizistische Stilideal der simplicité zwar möglicherweise ‚verschönert‘, zunächst aber schlicht vereinfacht; der Ausdruck „hombre de ruines entrañas y de bajo ánimo“ im Zitat ist beispielsweise französisiert worden.68 Krasser schlägt zu Buche, wenn Scarron an anderer Stelle „galanterie“69 für die bedrohliche Geil-
66 Einzelheiten zu diesen Bearbeitungsverfahren Scarrons gibt Guichemerre (Anm. 53), S. 102– 105. 67 Scarron: Les Hypocrites (Anm. 56), S. 142; zu HC 125 vgl. TC 49: „Aber mit einem Spitzbuben, einem Mann von schäbigem Charakter und niedrigem Sinn, dessen Denkungsart so armselig ist, daß er in dieser gemeinen Beschäftigung, mit der er seinen Lebensunterhalt verdient, Genüge und Zufriedenheit findet, Frauen ausnützt, sich von Drohungen nährt und von seinen Unverschämtheiten lebt: Torheit ist es, eine unentschuldbare Dummheit, ihm Vermögen und Zeit zu opfern.“ 68 Weitere Beispiele und Erörterungen gibt Hautcœur (Anm. 55), S. 247, die zu dem Schluss kommt: „La traduction des Nouvelles Tragi-Comiques dévoile une volonté de francisation qui parfois confine à l’hispanophobie et se trouve à l’origine de transformations lexicales et stylistiques.“ 69 Scarron: Les Hypocrites (Anm. 56), S. 114.
Alonso de Salas Barbadillo, Paul Scarron und die Verbreitung pikaresker Bücher
155
heit Don Sanchos einsetzt, die in La Hija de Celestina moralistisch als „flaquezas de la carne“ (HC 90; als „Freuden [eigtl. „Schwächen“] des Fleisches“ [TC 15]) bezeichnet wird. Dort wird klar, dass Scarron das pikareske Leben nicht mehr durchgängig als Beispiel für eine schlechte Lebensführung zeigt. Die in die Rahmenhandlung eingekapselte pikareske Erzählung Elenas – bei Salas Barbadillo als die Geschichte von „mi nacimiento y principios“ (HC 106; „meine Herkunft und Geburt“ [TC 31]) bezeichnet – wird in Les Hypocrites vielmehr als Abenteuergeschichte („des avantures“)70 eingeführt. Zwar spricht schon der spanische Ausgangstext mitunter von „aventuras“71, um die Schelmereien Elenas zu kennzeichnen. Scarron aber führt die existenzielle Bedrohlichkeit der mala vida, die in La Hija de Celestina wie im Guzmán de Alfarache in explizit moral-didaktischer Absicht präsentiert wird, eben als unterhaltsam-komische (Liebes-)Komödie weiter, wie auch das Ende der Erzählung zeigt, von dem noch die Rede sein wird. Generell ist Scarrons Tendenz nicht zu übersehen, die moralistischen Passagen des Ausgangstextes zu variieren, und zwar zumindest zum Teil auch auf so radikale Weise, dass das intertextuelle Verhältnis beider Texte zueinander loser und variantenreicher erscheint als es wahrscheinlich – und die Kontroverse mit d’Ouville mag als ein weiterer Anhaltspunkt dafür dienen – das Übersetzungsverfahren der belles infidèles autorisiert hätte. Allerdings verbleiben auch in diesem Bereich von Scarron übersetzte Versatzstücke aus La Hija de Celestina klar identifizierbar.72 Dennoch: Wenn auch der Ort der Handlung in Spanien verblieb, die Namen der Protagonisten nur geringfügig verändert wurden und in Les Hypocrites zweifellos wichtige Treuegebote realisiert wurden, wurde doch die literarische und kulturelle Alterität des Ausgangstextes, angefangen vom längeren Lob Toledos, das in La Hija de Celestina am Anfang steht, über einige Details (wie spanische Straßennamen) bis hin zum pikaresken Vokabular der Vorlage entweder bewusst ausgelassen oder eben normativ eingebürgert. Auch die anfangs erwähnte Auslassung der Klage über das Epigonentum kann in diesen Kontext gestellt werden.
70 Ebd., S. 125. 71 Vgl. z. B. HC 97. 72 Vgl. vor allem folgende Passage: „Homme miserable à qui le Ciel a donné les deux choses du monde qui peuvent plus faire ta félicité: du bien en abandonce et une femme aimable, […]. N’as-tu pas en ta maison une moitié de toy-mesme, une femme dont l’esprit divertit le tien, dont le corps se donne tout entier à ton plaisir […].“; Scarron: Les Hypocrites (Anm. 56), S. 133 f.; zum Vergleich HC 116 f.: „Hombre miserable, que pierdes la ocasión de ser el más dichoso de la tierra; tú, a quien dio el Cielo las dos mayores comodidades, las dos más grandes ventajas que puede tirar el gusto humano, como son larga hacienda y mujer propia que te iguala en la calidad, hermosa en las partes del cuerpo, descreta en las del alma […].“
156
Frank Estelmann
Sie ist bei Salas Barbadillo Bestandteil einer längeren Sequenz, in der der Erzähler den Leser beruhigt, er werde ihm die weitere Geschichte nicht länger vorenthalten, und die Scarron radikal auf den folgenden technischen Einschub verkürzt: L’on dira peut-estre que je laisse icy trop long-temps le Lecteur en suspens, qui sans doute a impatience de sçavoir par quel enchantement Helene et Mendez avoient disparu à l’amoureux Dom Sanche. Qu’on ne s’en scandalise pas davantage! je m’en vay vous le dire.73
Angesichts solcher Passagen kann Les Hypocrites letztlich nicht anders als zuvorderst zielkulturell erklärt werden. Der in La Hija de Celestina produzierte Textsinn wird zwar in der von Sigrid Kupsch-Losereit74 dargestellten Weise im translatorischen Handeln „ver-rückt“ bzw. „neu produziert“, aber eben über wichtige Treuegebote hinaus. Der digressive, metaphorische Stil der Vorlage wird gerafft und vereinfacht. Insofern ist Scarrons Novelle ein gutes Beispiel für die „paradoxical relation“ zwischen Übersetzung und Nachahmung, die Theo Hermans im französischen Klassizismus konstatiert hat.75 Denn eigentlich deutet Scarrons Version der Erzählung darauf hin, dass „im Zeitalter der belles infidèles“ der „Unterschied zwischen Schriftsteller und Übersetzer verwischt“76 war. Verwischt war damit in diesem besonderen Fall aber auch, dass die Aneignung von Salas Barbadillos pikareskem Buch (auch) eine Enteignung war – und dies von der Enteignung Salas Barbadillos in der Frage der Autorschaft bis hin zu den genannten Verschönerungen. Les Hypocrites kann also aus leicht nachvollziehbaren Gründen nicht als vollendetes Beispiel für eine gelungene Form literarischer Kulturvermittlung im Medium der Übersetzung bezeichnet werden. Der Text ist Ausdruck eines tiefen Funktionswandels der pikaresken Bücher auf dem Weg zu ihrer Verbreitung in den europäischen Literaturen. In Frankreich kann dieser Wandel auf den Einfluss des Roman comique zurückgeführt werden. Das vergnügliche und ausdrücklich auch erbauliche Erzählen eines Mateo Alemán oder selbst noch Salas Barbadillos ist gerade deshalb um seine didaktischen, moralistischen Komponenten gebracht worden, weil Scarron poetologisch dem Modell dieser Romangattung folgte – die vorrangig der Unterhaltung von la cour et la ville diente. Insofern ist das Ende, das Scarron Les Hypocrites gab, dann doch überaus erstaunlich, und zwar gar nicht unbedingt deshalb, weil er sich darin die größte
73 Scarron: Les Hypocrites (Anm. 56), S. 154. 74 Sigrid Kupsch-Losereit: Ver-rückte Kulturen: Zur Vermittlung von kultureller Differenz beim Übersetzen. In: Quo vadis Translatologie? Ein halbes Jahrhundert universitäre Ausbildung von Dolmetschern und Übersetzern in Leipzig. Rückschau, Zwischenbilanz und Perspektive aus der Außensicht. Hg. von Gerd Wotjak. Berlin 2007, S. 205–220, bes. S. 214–216. 75 Hermans: Images (Anm. 51), S. 103. 76 Albrecht (Anm. 44), S. 271.
Alonso de Salas Barbadillo, Paul Scarron und die Verbreitung pikaresker Bücher
157
Untreue im Verhältnis zu La Hija de Celestina erlaubte. Wie gesehen, wird Elena am Ende von Salas Barbadillos Erzählung hingerichtet, wobei sie dem Erzähler zufolge ihren gerechten Lohn für ihr sündiges und unmoralisches Leben erhält. In Les Hypocrites dagegen trifft Helene am Ende auf der Flucht vor den Justizbeamten zufällig auf Dom Sanche, der soeben von seiner Frau verlassen worden ist und sich auf dem Weg nach Amerika befindet, wo er im Auftrag der spanischen Krone eine neue Kolonie gründen soll. Beide beschließen, die Reise gemeinsam zu unternehmen, wobei dies ausdrücklich als glückliches Unterfangen gekennzeichnet ist: Dom Sanche et Helene allerent heureusement aux Indes, où il leur est arrivé des aventures qui ne peuvent tenir dans un si petit volume, et que je promets au public sous le tiltre de La Parfaite Courtisanne ou de la Laïs moderne pour peu qu’il témoigne avoir envie de les apprendre.77
Les Hypocrites endet also mit dem real freilich nicht eingelösten Versprechen, die Abenteuer der beiden Protagonisten in Amerika in einem weiteren Band zu publizieren. Nun ist klar, dass Scarron damit die moralistischen Implikationen von La Hija de Celestina komplett verkehrt – anstatt für ihren pikaresken Lebenswandel bestraft zu werden, kommt Helene ungeschoren davon und wird auch noch mit der Ehe mit einem Edelmann und mit zu erwartendem Reichtum belohnt. Dom Sanche wiederum ist offenbar beglückt darüber, nicht mehr durch die Ehe zur moralischen Besserung verurteilt worden zu sein. Er weiß allerdings weiterhin keineswegs, dass er einer Betrügerin aufsitzt, denn Helene hält mithilfe hunderter Lügen („cent menteries“78) an ihrer falschen Identität als respektable Dame fest. Auch in erzählerischer Hinsicht ist die mésalliance zwischen einer unmoralischen Pícara und einem verdorbenen honnête homme also glücklich verlaufen: Nur ist es der pikareske Erzählstrang, der nun gegenüber dem höfischen Erzählstrang das bessere Ende für sich hat. Diese Verkehrung mag eine konventionelle Note haben, denn das Tragisch-Komische, das Les Nouvelles tragi-comiques im Titel tragen, erforderte per Gattungsnorm ein versöhnliches Ende der Novelle. Auch hat Scarron auf diese Weise sicherlich der „polémique anti-romanesque“ seiner Zeit Ausdruck verliehen; das burleske Ende der Erzählung ist nicht mehr heroisch ausdeutbar und daher strikt entidealisierend.79 Schließlich ist auch eine
77 Scarron: Les Hypocrites (Anm. 56), S. 170. 78 Ebd., S. 169. 79 Hautcœur (Anm. 55), S. 252.
158
Frank Estelmann
Pointe gegen das spanische Kolonialreich darin erkennbar, dass dessen Kolonialbeamte offenbar aus recht dubiosen Kreisen rekrutiert werden. Dennoch sind all dies nur Hilfsargumente, betrachtet man das Ende von Les Hypocrites aus der gattungsgeschichtlichen pikaresken Perspektive. Scarron inszenierte, mit einem durchaus pikaresken Augenzwinkern, nämlich einen Schluss der Erzählung, der für die spanischen Pikaroromane typisch ist – man denke nur an das Ende von Quevedos Buscón, nämlich: die abschließende Reise der Protagonisten in die amerikanischen Kolonien, die mit der Ankündigung einer Fortsetzung der Erzählung verbunden ist. Als intertextuelle Replik auf den Ausgangstext zwingt ein solches offenes Ende Salas Barbadillos Erzählung von der Tochter der Celestina wieder zurück in die sedimentierte pikareske Erzähltradition. Ein bereits in der spanischen Version heterogener Text, der in der Übertragung ins Französische noch weiter aus dem pikaresken Deutungsmuster gelöst worden war, wird wieder in die pikareske Gattungsgeschichte eingeschrieben. Dabei lässt die burleske Umkehr ein hohes Maß an poetologischem Bewusstsein für die pikareske Gattung erkennen. Sie zeigt gleichermaßen, wie sehr diese Gattung im literarischen Transfer nach Frankreich nicht allein zu einem Medium ungetrübter literarischer Unterhaltsamkeit geworden ist, sondern auch zu einem Medium metafiktionaler Reflexivität. In Bezug auf Frankreich wäre es also falsch anzunehmen, dass der Roman comique, als möglicherweise einheimische Spielform pikaresken Erzählens, das dominante oder gar einzige Medium darstellte, in dem man sich im französischen Klassizismus mit dem pikaresken Erzählmodell auseinandersetzte und es literarisch rezipierte oder auch fortschrieb. Tatsächlich kann die Assimilierung des pikaresken Erzählmodells im Zentrum des klassizistischen Literatursystems Frankreichs nicht angemessen rekonstruiert werden, ohne in ihr, in Form einer Wirkungsgeschichte einzelner spanischer libros picarescos wie La Hija de Celestina, das Resultat literarischer Transfers zu erkennen. Les Hypocrites ist ein ausgesprochen gutes Beispiel für die Verschränkung rezeptions- und wirkungsgeschichtlicher Faktoren in den die europäische Geschichte der pikaresken Bücher mitbestimmenden Formen transnationaler Intertextualität. Die beiden untersuchten Texte sind entfernte Verwandte – selbst wenn Salas Barbadillo sich eine Aneignung wie die seines Nachahmers und Übersetzers Scarron so ausdrücklich wie vergeblich verbeten hatte.
Jan K. Hon
Religionsfreiheit und die Pikareske Ein Versuch über Niclas Ulenharts History von Isaac Winckelfelder und Jobst von der Schneid An der Schwelle der deutschsprachigen Aneignung der aus Spanien kommenden Pikareske steht ein Text, dessen Zugehörigkeit zu ebendieser Tradition kontrovers diskutiert wird.1 Es handelt sich um eine zwar relativ treue, aber wesentlich erweiterte Übertragung von Cervantes’ Novelle Rinconete y Cortadillo aus den Novelas ejemplares (1613), die insbesondere dadurch auffällt, dass sie nicht nur sprachlich, sondern auch kulturell und geografisch ‚eingedeutscht‘ ist: Die ganze Handlung findet nämlich nicht wie bei Cervantes in Sevilla, sondern im rudolfinischen Prag statt. Herausgebracht wurde die History von Isaac Winckelfelder vnd Jobst von der Schneid2 1617 in Augsburg zusammen mit der ersten gedruckten deutschen Übersetzung des Lazarillo („castigado“) bei Andreas Aperger im Auftrag des Verlegers Nikolaus Henricus d. J. Als ihr Autor wird ein Niclas Ulenhart genannt, über den nichts Näheres bekannt ist,3 was zu der wohl berechtigten Vermutung führte, dass es sich um ein Pseudonym handelt.4 Die Forschung
1 Vgl. zur Gattungsbestimmung von Cervantes’ Rinconete y Cortadillo in jüngerer Zeit Hans Gerd Rötzer: Der europäische Schelmenroman. Stuttgart 2009, hier S. 61–63, sowie erweitert ders.: Geschlossene oder offene Erzählstruktur? Cervantes und die Pikareske. In: Das Syntagma des Pikaresken. Hg. von Jan Mohr und Michael Waltenberger. Heidelberg 2014 (GRM-Beiheft 58), S. 157–184, hier bes. S. 174–176; zum Bezug von Ulenharts Bearbeitung zur Tradition des Schelmenromans vgl. zuletzt Alberto Martino: Die Rezeption des ‚Rinconete y Cortadillo‘ und der anderen pikaresken Novellen von Cervantes im deutschsprachigen Raum (1617–1754). In: Daphnis 34 (2005), S. 23–135, hier S. 68–80; kritisch zu den Abgrenzungen von der pikaresken Tradition Volker Roloff: Spanische Schelme in Böhmen. In: „Böhmische Dörfer“. Streifzüge durch eine seltene Gegend auf der Suche nach den Herren Karl Riha, Agno Stowitsch und Hans Wald. Hg. von Peter Gendolla und Carsten Zelle. Gießen 1995, S. 135–150. 2 Zitiert nach dem Faksimile Niclas Ulenhart: Historia von Isaac Winckelfelder vnd Jobst von der Schneid 1617. Nach Cervantes’ „Rinconete y Cortadillo“. Kommentiert und mit einem Nachwort von Gerhart Hoffmeister. München 1983. Zitate hier und im Folgenden nach dieser Ausgabe, nachgewiesen durch Seitenzahl in Klammern nach der Textstelle. 3 Vgl. demnächst zusammenfassend Carolin Struwe: Ulenhart, Niclas. In: Frühe Neuzeit in Deutschland 1520–1620. Literaturwissenschaftliches Lexikon. Bd. 6. Hg. von Wilhelm Kühlmann u. a. [voraussichtlich Berlin, Boston 2016]. Ich danke Carolin Struwe für die Möglichkeit, ihren Artikel noch vor dessen Publikation einzusehen. 4 So Hoffmeister in Ulenhart (Anm. 2), S. 267.
160
Jan K. Hon
bemühte sich nichtsdestotrotz immer wieder, die Identität des Verfassers näher zu bestimmen, und zwar aufgrund der Art und Weise, wie das Prager Milieu in der Erzählung dargestellt wird. Als besonders hartnäckig erwies sich dabei die These, dass es sich um einen mit Prag gut vertrauten Katholiken gehandelt haben wird.5 Da für diese konfessionelle Zuordnung jedoch jegliche historische Evidenz fehlt, sagt diese These nicht sonderlich viel über den Text selbst aus. Zusammen mit ihren kritischen Überprüfungen und Ergänzungen6 ist sie vielmehr symptomatisch dafür, wie ein erheblicher Teil der spärlichen Forschung den Text implizit interpretierte: nämlich als eine verschlüsselte Stellungnahme im konfessionellen Streit in Böhmen vor dem Ausbruch des Dreißigjährigen Kriegs – und das obwohl Richard Alewyn bereits 1929 konstatierte, dass „[i]rgend eine Stellungnahme im Religionsgemisch […] jedenfalls nicht zu erkennen“ sei.7 Ich möchte im Folgenden hingegen zeigen, dass die Suche nach einer bestimmten historischen Position im konfessionellen Streit des frühen 17. Jahrhunderts dem Text nicht gerecht werden kann, weil sie die Besonderheiten des Erzählverfahrens, mit dessen Hilfe die Novelle das Thema der Konfessionalität präsentiert, aus dem Blick verliert. Es wird mir also um die Frage gehen, welche Möglichkeiten der Partizipation am aktuellen politischen Diskurs dieses pikareske – oder zumindest von der Pikareske beeinflusste – Erzählverfahren öffnet, und um einige damit verbundene poetologische Implikationen.
1 Der historische Konfessionalitätsstreit und Ulenharts Novelle Die History erzählt, wie sich die zwei Titelschelme – da heißen sie noch „Isac Winckler“ (S. 33) und „Jobstel Schneider“ (S. 49) – zufällig vor Prag in einer Herberge kennenlernen. Aus ihrem Gespräch ergibt sich bald, dass sie beide nach einigen schlechten Erfahrungen in ihrer Vergangenheit kriminelle Laufbahnen eingeschlagen haben. Sie schließen sogleich Freundschaft und begeben sich
5 Vgl. Julius Schwering: Litterarische Beziehungen zwischen Spanien und Deutschland. Eine Streitschrift gegen Dr. Arturo Farinelli, Professor an der Universität Innsbruck. Münster 1902, S. 55 f.; Hubert Rausse: Zur Geschichte des Spanischen Schelmenromans in Deutschland. Münster 1908 (Münstersche Beiträge zur neueren Literaturgeschichte 8), S. 70. 6 Etwa Armin Reiner Schulze-van Loon: Niclas Ulenharts „Historia“. Beiträge zur deutschen Rezeption der Novela picaresca und zur Frühgeschichte des barocken Prosastils. Hamburg 1955 [Diss. masch.], S. 110, oder Martino (Anm. 1), S. 29–31 sowie S. 95–103. 7 Richard Alewyn: Die ersten deutschen Übersetzer des „Don Quixote“ und des „Lazarillo de Tormes“. In: ZfdPh 54 (1929), S. 203–216, hier S. 214.
Religionsfreiheit und die Pikareske
161
gemeinsam in die Stadt, in der sie bald von der lokalen Mafia entdeckt und aufgenommen werden – und so auch zu ihren Zunftnamen aus dem Buchtitel kommen (vgl. S. 114). Ab dem Moment lässt die Novelle einzelne Gesichter des lokalen kriminellen Untergrunds vor ihren Augen defilieren: das Haupt der Mafia – den sogenannten Zuckerbastel (im Original hieß er Monipodio) –, Dirnen und ihre Liebhaber, die Protektoren der Kriminellen aus der ‚zivilen‘ Bevölkerung sowie schließlich auch die Auftraggeber der kriminellen Taten, die von den Mitgliedern der Bruderschaft ausgeführt werden. Den Abschied der zwei Schelme von der Mafia, der am Ende der Novelle in Aussicht gestellt wird, nutzt insbesondere Ulenhart zu einem mahnenden Appell an die Leser gegen eine solch verruchte Lebensweise. Nun ist aber bemerkenswert, dass diese kriminelle Gruppierung just ein Ideal verkörpert, welches in der historischen Zeit, in die die Handlung gesetzt wird – nämlich am Anfang des 17. Jahrhunderts8 – in Böhmen ein durchaus brisantes Thema war und zur Zeit der Entstehung des Textes vielleicht noch virulenter wurde: Die kriminelle Zunft ist konfessionell absolut tolerant. Das Thema der Religionsfreiheit und des konfessionellen Nebeneinanders ist auch eine der wichtigsten Aktualisierungen Ulenharts gegenüber der spanischen Vorlage. Während sich nämlich Cervantes’ Novelle an der gut katholischen Scheinheiligkeit der Diebe und Prostituierten von Sevilla ergötzt, konzentriert Ulenhart den religiösen Inhalt der Novelle auf das Thema der Koexistenz unterschiedlicher Konfessionen in Böhmen vor dem Dreißigjährigen Krieg. So werden z. B. bei Cervantes die zwei Schelme unter anderem über die folgenden Regeln und Abläufe in der Bruderschaft informiert: „Übrigens tun wir noch mehr: wir beten wöchentlich unsre Rosenkränze, viele von uns stehlen am Freitag nicht und geben sich am Sonnabend mit keinem Weib ab, das Maria heißt.“9 Und Ulenhart erweitert die entsprechende Stelle so: Ausser dessen/ so jetzt erzehlt/ befindt sich auch vnder den Reglen der Bruderschafft/ eine/ fr die so Catholisch/ daß sie in der Wochen einmal den Rosenkrantz/ den siben tagen nach außgetheilt/ betten sollen. So finden sich etliche vnder jhnen/ die machen jhnen ein
8 Martino gibt einige Hinweise dafür, dass die Handlung wohl in das Jahr 1603 gesetzt werden kann – vgl. Martino (Anm. 1), S. 49 f. 9 Die deutsche Übersetzung zitiert (als „Novellen“) nach Miguel de Cervantes: Die Novellen. Vollständige deutsche Ausgabe der ‚Novelas Ejemplares‘ unter Benutzung älterer Übertragungen besorgt von Konrad Thorer. Wiesbaden 1956. Dieses Zitat auf S. 173. „Tenemos más, que rezamos nuestro rosario repartido en toda la semana, y muchos de nosotros no hurtamos el día del viernes, ni tenemos conversación con mujer que se llame María el día del sábado.“ Der spanische Text zitiert (als „Novelas“) nach Miguel de Cervantes: Novelas ejemplares. Hg. von Jorge García López. Madrid 2013. Dieses Zitat auf S. 180.
162
Jan K. Hon
Gwissen/ am Freytag zu stelen/ Etliche andere ligen auß andacht bey keinem ledigen menschen/ die Maria heist am Sonnabend/ welches gleichwol die andere Bursch nicht sonders achtet/ sonder steht einem jeden frey/ sein Andacht auff ein oder den andern Weg/ er sey gleich Catholisch/ Picardisch/ Hussitisch/ oder Euangelisch/ vnd wie jn Gott ermahnet/ zu erweisen. (S. 96 f.)
Diese Einbettung der konfessionellen Vielfalt in Ulenharts Erzählung ist in der Forschung sehr unterschiedlich gedeutet worden. Wie bereits erwähnt, sah insbesondere die älteste Forschung in Ulenharts Novelle eine katholische Satire auf den Protestantismus.10 Schulze-van Loon erkannte in der Darstellung der Multikonfessionalität offenbar nicht viel mehr als ein erzählerisches Mittel, das dem des „kongenialen Wechsel[s] des Szenariums“11 dienen sollte. Implizit wurde die Problematik der Konfessionalität somit als ein Aspekt des (nationalen) Stils aufgefasst.12 In einem anderen Ansatz wird die Auffassung vertreten, dass in der Prager Bruderschaft eine Utopie der Religionsfreiheit inszeniert wird. In reinster Form formulierte Guillaume van Gemert diese These,13 sie geht jedoch auf ältere Interpretationen zurück, denen immerhin bewusst war, dass die Utopie bei Ulenhart nicht unproblematisch ist. Nicht nur weil sie – so Alberto Martinos Einwand – zu einer Zeit formuliert worden sei, als die rudolfinische „politische, religiöse und spirituelle Konstellation in Böhmen“ bereits vorbei war,14 sondern auch in Hinblick auf die Darstellung selbst: Das Vehikel dieser Utopie ist nämlich eine scheinheilige und verruchte Gaunergesellschaft, welche jede Utopie notwendigerweise infrage stellt. Der Ausweg, den etwa Werner Beck aus diesem Paradox zu finden glaubte, indem er Ulenharts Darstellung eine „humoristische Utopie“ nannte,15 überzeugt jedoch nicht: Die verbrecherische Natur der Schel-
10 „Er [Ulenhart] war Katholik, dafür sprechen einige ironische Bemerkungen gegen die reformatorische Lehre“, Schwering (Anm. 5). S. 55. 11 Schulze-van Loon (Anm. 6), S. 117. 12 Das sieht man bei Schulze-van Loon insbesondere dann deutlich, wenn er Ulenharts zusätzliche konfessionelle oder nationale Zuschreibungen im Hinblick auf die Protagonisten der deutschen Bearbeitung unter dem stilistischen Vorgang der „Vermehrung“ von „argumenta“ verbucht (vgl. ebd. 191 ff.). 13 Guillaume van Gemert: Ulenhart, Niclas. In: Killy 11, S. 665 f., hier S. 666: „Indem [Ulenhart] in der Prager Schelmenzunft des Zuckerbastel die unterschiedl[ichen] Konfessionen in voller Religionsfreiheit zusammenleben lässt, funktioniert er die Vorlage in eine Utopie der religiösen Toleranz um.“ 14 Vgl. Martino (Anm. 1), S. 95. 15 Werner Beck: Die Anfänge des deutschen Schelmenromans. Studien zur frühbarocken Erzählung, Zürich 1957, S. 110–173, hierzu insb. 135–137. Becks Begriff „humoristische Utopie“ folgt auch Uta Maley: Niclas Ulenharts ‚Historie von Isaac Winckelfelder und Jobst von der Schneid‘ (1617) und Cervantes’ novela ejemplar ‚Rinconete y Cortadillo‘ (1613). Zentrum oder Peripherie?
Religionsfreiheit und die Pikareske
163
menzunft soll laut Beck schon bei Cervantes dadurch entkräftet worden sein, dass die Mitglieder keine „Kapitalverbrechen“ begehen und die ganze kriminelle Agenda „mehr oder minder harmloser Schabernack“ sei.16 So könne „der Leser den Schelmen […] seine Sympathie nicht versagen“17 – und für Ulenhart löse sich das Paradox darin, dass er der „überkonfessionellen Gemeinschaft“, zu der er Cervantes’ „humanistische[ ] Utopie“18 erhob, „lächelnd und mit skeptischem Achselzucken“ gegenüberstehe,19 wobei das Lächeln die Utopie nicht infrage stelle, sondern im Gegenteil die „schützende[ ] Hülle des Humors“ für „Ideen von beträchtlicher Gewagtheit“ verkörpere.20 Dass solche Deutungskonstruktionen zerbrechlich sind, hat zuletzt Alberto Martino gezeigt21 und bot zugleich alternative Möglichkeiten einer Interpretation an, die er für historisch fundiert hielt – ohne sich allerdings auf eine von ihnen festlegen zu wollen. So könnte es laut ihm in Ulenharts Bearbeitung um eine Verhöhnung der Irenisten gegangen sein, gerade weil hier die religiöse Toleranz mit dem kriminellen Milieu gleichgesetzt wird; alternativ könnte es sich aber um eine Satire auf den „machiavellistischen Gebrauch […] von der religiösen Toleranz“22 gehandelt haben – und schließlich auch um eine Parodie der mährischen Wiedertäufergemeinden.23 Doch ähnlich wie die Utopie-These lassen sich diese Gegenvorschläge anzweifeln – oder wiederum ergänzen. Warum z. B. eine Verhöhnung der Irenisten? Dass eine Gruppe von Verbrechern der konfessionellen Zuordnung ihrer Mitglieder gleichgültig gegenübersteht, muss noch nicht bedeuten, dass die Irenisten des 17. Jahrhunderts hier am Pranger stehen, zumal die Zunftmitglieder kein Interesse an interkonfessioneller Verständigung zeigen. Vielmehr ist ihnen das Glaubensbekenntnis der Mitstreiter von Herzen egal. Auch die These, dass es sich bei dem Text um eine Satire auf die mährischen Wiedertäufer handeln könnte, weckt Zweifel. Zwar weist Martino auf einige Praktiken der Zunft hin, die auch für die mährischen Wiedertäufer bezeugt sind, vor allem die Formen des gemeinschaft-
In: Centros y periferias en España y Austria: perspectivas lingüísticas y traductológicas. Hg. von Carlos Buján López und María José Domínguez Vázquez. Frankfurt am Main u. a. 2009 (Studien zur romanischen Sprachwissenschaft und interkulturellen Kommunikation 55), S. 111–122, hier S. 118 f. – jedoch ohne Bezug auf die Darstellung der Konfessionalität. 16 Beck (Anm. 15), S. 124 f. 17 Ebd., S. 120. 18 Ebd., S. 122 19 Ebd., S. 137. 20 Ebd., S. 136. 21 Vgl. Martino (Anm. 1). 22 Ebd., S. 96. 23 Zu den möglichen historischen Anspielungen vgl. ebd., S. 91–103.
164
Jan K. Hon
lichen Lebens. Doch warum sollte dies ausgerechnet auf die Wiedertäufer abzielen? Die Grundzüge des gemeinschaftlichen Lebens wurden von Cervantes übernommen, und dem wird man wohl keine Wiedertäuferkritik zuschreiben können. Außerdem ist einer der Schelme von einer mährischen Wiedertäufergemeinde verstoßen worden, wie man am Anfang der Erzählung erfährt. Wieso sollte also Kritik an den Wiedertäufern mittels einer vagen Ähnlichkeit mit der Prager Gaunergruppe geübt werden, wenn die Wiedertäufer in der Vorgeschichte – und auch während der Vorstellung der zwei Schelme bei Zuckerbastel (vgl. S. 116) – explizit thematisiert werden? Etwas plausibler erscheint die These, dass hier die machiavellistische Instrumentalisierung der Religionsfreiheit angeprangert wird.24 Aber es ließen sich auch andere potenzielle Referenzen in Betracht ziehen als die oberösterreichischen Bauernaufstände des 16. und 17. Jahrhunderts, auf die sich Martino bezieht. Man könnte hier z. B. an den Aufstand unter der Führung Stefan Bocskais in den Jahren 1604–1606 denken, der mit dem Frieden von Wien endete, in dem den ungarischen Ständen Religionsfreiheit zugesichert wurde.25 In dieser Schlussepisode des sogenannten Langen Türkenkriegs verband sich der Fürst von Siebenbürgen, der zuvor die Politik der Habsburger unterstützt hatte und in seiner Jugend sogar am Hof der Habsburger tätig gewesen war,26 mit einigen Vertretern der ungarischen reformierten wie katholischen Stände und den Heiducken in einem von den Osmanen unterstützten Kampf gegen Rudolf II. Die Gewährung von Religionsfreiheit war eine der notwendigen Maßnahmen des strengen Kalvinisten Bocskai, um die national wie konfessionell heterogene Gruppe in seinem Zug gegen die Monarchie zusammenzuhalten.27 Wie Zuckerbas-
24 Martino (Anm. 1), S. 96 f. 25 Vgl. in jüngerer Zeit etwa András Péter Szabó: Inhalt und Bedeutung der Widerstandslehre im Bocskai-Aufstand. In: Calvin und Reformiertentum in Ungarn und Siebenbürgen. Helvetisches Bekenntnis, Ethnie und Politik vom 16. Jahrhundert bis 1918. Hg. von Márta Fata und Anton Schindling. Münster 2010 (Reformationsgeschichtliche Studien und Texte 155), S. 317–340 oder Géza Pálffy: Bündnispartner und Konkurrenten der Krone: die ungarischen Stände, Stefan Bocskai und Erzherzog Matthias 1604–1608. In: Ein Bruderzwist im Hause Habsburg (1608–1611). Hg. von Václav Bůžek. Budweis 2010 (Opera historica 14), S. 363–396. 26 Vgl. Pálffy (Anm. 25), S. 375. Näheres zu Bocskais Biografie vgl. in Andrea Molnár: Fürst Stefan Bocskay als Staatsmann und Persönlichkeit im Spiegel seiner Briefe 1598–1606. München 1983 (Studia Hungarica 23), S. 33–38. 27 Meinolf Arens weist darüber hinaus darauf hin, dass dabei „die calvinistische Rechtfertigungslehre […] eine zentrale Rolle“ spielte; und „[d]amit verknüpft war die Verteidigung der ständischen Libertas“ (Meinolf Arens: Habsburg und Siebenbürgen 1600–1605. Gewaltsame Eingliederungsversuche eines ostmitteleuropäischen Fürstentums in einen frühabsolutistischen Reichsverband. Köln u. a. 2001 [Studia Transylvanica 27], S. 227), was man ja im Zusammenhang
Religionsfreiheit und die Pikareske
165
tel verkehrte Bocskai also in den höchsten politischen Etagen der Monarchie, was ihn gleichzeitig nicht daran hinderte, sich gegen dieselbe Monarchie in Verbindung mit deren niedrigeren Schichten zu wenden. Konfessionelle Toleranz war dabei, wie in der Prager Schelmenzunft, nicht unbedingt das primäre Anliegen des Anführers, sondern genau genommen ein Nebenprodukt seiner Politik. Aber auch im berühmten Bruderzwist zwischen Rudolf und Matthias, der im Grunde eine Folge von Bocskais Aufstand war,28 ließe sich eine Parallele zu Ulenharts Prager Schelmenbruderschaft sehen. Auch Matthias versammelte 1608 eine recht heterogene Gruppe aus ungarischen, nieder- wie oberösterreichischen und mährischen Ständen, mit der er sich dem Herrscher stellen wollte. Der Preis, den er dafür bezahlen musste, war nichts anderes als das Versprechen von Religionsfreiheit an seine Verbündeten. Auch wenn sich diese beiden folgenreichen historischen Ereignisse selbstverständlich nicht eins zu eins auf Ulenharts Darstellung der Prager kriminellen Unterwelt übertragen lassen, haben sie mit dieser immerhin gemeinsam, dass sich in ihnen Religionsfreiheit nicht als utopisches humanistisches Ideal zeigt, sondern eher als pragmatisches Resultat einer Vereinigung, die in den Augen des Establishments notwendigerweise als subversiv, ja kriminell angesehen werden muss.29 Für die Interpretation von Ulenharts Erzählung ließe sich somit der Schluss ziehen, dass Religionsfreiheit erfahrungsgemäß Hand in Hand mit Bedrohung der sozialen Ordnung geht, obwohl sie mit dieser aufs Engste verwoben ist. Man könnte die Geschichte aber noch mehr bemühen und etwa meinen, dass das kleine Prosawerk sozial-kritisch ausgerichtet war. Historiker bezeugen nämlich, dass auch nachdem der Kaiserhof 1612 nach Wien zurückkehrte und Prag nicht mehr Ort hochrangiger internationaler Zusammenkünfte war, viele Religionsflüchtlinge dennoch weiterhin aus ganz Europa nach Böhmen strömten, insbesondere nachdem sich die Rekatholisierungsmaßnahmen in den Habsburgischen Erbterritorien verschärften.30 Isaac Winckelfelder ist jedenfalls
mit der ironischen Verwendung des Freiheitsbegriffs in Ulenharts Novelle sehen könnte (vgl. dazu unten), wenn man darin eine Anspielung auf Bocskais Aufstand erkennen wollte. Zur Widerstandslehre im Bocskai-Aufstand vgl. Szabó (Anm. 25). 28 Zu den historischen Zusammenhängen beider Aufstände vgl. Pálffy (Anm. 25). Vgl. auch die umfassende Darstellung bei Joachim Bahlcke: Regionalismus und Staatsintegration im Widerstreit. Die Länder der böhmischen Krone im ersten Jahrhundert der Habsburgerherrschaft (1526–1619). München 1994 (Schriften des Bundesinstituts für Ostdeutsche Kultur und Geschichte 3), S. 309–400. 29 An den religiösen Idealen der Beteiligten am Bocskai-Aufstand hatten schon die Zeitgenossen ihre Zweifel – vgl. Szabó (Anm. 25), S. 327. 30 Vgl. Petr Vorel: Velké dějiny zemí koruny české. Bd. 7. Prag, Litomyšl 2005, S. 520 f.
166
Jan K. Hon
ein solcher Fall: Als Sohn eines kalvinistischen Predigers aus der Kurpfalz, der zunächst aus Waldmünchen und später auch aus der Steiermark floh, kann er erst in Böhmen ein Land finden, in dem ihn sein konfessioneller Ursprung nicht stigmatisiert. Die soziale Kritik würde darin bestehen, dass sich in den instabilen europäischen Verhältnissen des beginnenden 17. Jahrhunderts der Weg zur Religionsfreiheit gleichzeitig als ein Weg in die kriminelle Unterwelt darstellt. Andererseits könnte in Ulenharts Darstellung auch eine Anspielung auf die aktuellen politischen Verhältnisse der letzten Jahre vor dem Ausbruch des Dreißigjährigen Kriegs gesehen werden. Gerade die Jahre 1615–1617, in denen die Entstehung der 1617 zuerst gedruckten Erzählung anzusetzen ist, sind durch einen Zerfall der protestantischen ständischen Opposition in Böhmen gekennzeichnet,31 der in aller Deutlichkeit zeigt, dass religiöse Freiheit nur dann gedeiht, wenn sich ihre Anhänger auch ‚realpolitisch‘ einigen können, wenn sie also auch ein praktisches Programm haben, das über die eigentliche Frage der Konfession hinausgeht. Dass hier ein solches Programm als organisiertes Verbrechen dargestellt wird, würde ferner für eine überkonfessionelle Haltung des Autors sprechen, nach der die bloße Zugehörigkeit zu einem Glaubensbekenntnis oder selbst konfessionelle Toleranz noch niemanden zu einem besseren Menschen macht. Und eine letzte Möglichkeit: Kurz vor der Drucklegung der Novelle erscheinen die anonymen Gründungsschriften der sogenannten Rosenkreuzer, die Johann Valentin Andreae zugeschrieben werden.32 Die drei Schriften, Fama Fraternitatis, Confessio Fraternitatis und Chymische Hochzeit, verbreiteten sich schnell in Europa und fanden umgehend einen großen Nachhall,33 und das auch in Böhmen. Insbesondere die ersten zwei Schriften, die 1614 und 1615 in Kassel gedruckt wurden und die Existenz einer bis dato verborgenen „löblichen Bruderschafft“ bzw. eines „hochlblichen Ordens“ des „hochgeehrten Rosen Creutzes“34 verkündeten, könnten vielleicht an die „lobliche[ ] Zunfft vnd Bruder-
31 Vgl. ebd., S. 499–538. 32 Vgl. Wilhelm Kühlmann: Andreae, Johann Valentin. In: Killy 1, S. 152–155. 33 Vgl. den Überblick in Wilhelm Kühlmann: Rosenkreuzer. In: TRE 29, S. 407–413, sowie umfassend in Wilhelm Kühlmann: Sozietät als Tagtraum – Rosenkreuzerbewegung und zweite Reformation. In: Europäische Sozietätsbewegung und demokratische Tradition. Die europäischen Akademien der Frühen Neuzeit zwischen Frührenaissance und Spätaufklärung. Bd. 2. Hg. von Klaus Garber und Heinz Wismann unter Mitwirkung von Winfried Siebers. Tübingen 1996 (Frühe Neuzeit 27), S. 1124–1151. 34 Solche Ausdrücke vgl. auf dem Titelblatt und in der Überschrift des Eingangskapitels zur Confessio Fraternitatis in einigen frühen Drucken – vgl. Johann Valentin Andreae: Rosenkreuzerschriften. Bearbeitet, übersetzt, kommentiert und eingeleitet von Roland Edighoffer. Cannstatt 2010 (Gesammelte Schriften 3), hier S. 188 und 193 bzw. den kritischen Apparat auf S. 233.
Religionsfreiheit und die Pikareske
167
schafft“ (S. 114) des mysteriösen Zuckerbastel erinnern. Hat Ulenhart mit seiner Umwandlung der Gaunerzunft auch in diese Richtung gezielt? Einige seiner Einschübe könnten dafür sprechen – so etwa wenn die zwei Schelme auf das erste Treffen mit Zuckerbastel warten und Isaac währenddessen in einen Nebenraum hineinschaut, in dem er u. a. – ein Zusatz Ulenharts – „ein alten runden Tisch“ sieht, „daran vil Buchstaben/ Namen/ Zeichen vnnd Zirckel eingeschnitten/ oder eingekratzt gewesen“ (S. 103 f.), also ein Requisit, das dem Sitz der geheimen Bruderschaft einen parodistischen, pseudomystischen Anstrich gibt.
2 Empirie und Erzählverfahren All die hier entworfenen historischen Interpretationsangebote sollen jedoch nicht als Versuche einer endgültigen Deutung der Prager Gaunerbruderschaft verstanden werden. Sie zeigen lediglich, dass sich in die Novelle – so wie sie konstruiert ist – eben alles Mögliche aus dem zeitgenössischen konfessionellen Diskurs hineinprojizieren lässt, und das vermutlich schon aus der Sicht der damaligen Rezipienten. Im Unterschied zu Alberto Martino denke ich aber nicht, dass „[n]ur die Kenntnis der Biographie von Niclas Ulenhart – oder wenigstens die Kenntnis von anderen Werken von ihm – […] das Problem lösen“35 könnte. Wenn Martino sagt, dass man zunächst die Ereignisse des frühen 17. Jahrhunderts in Böhmen gründlich studieren müsste,36 um den richtigen Deutungsschlüssel für die Novelle zu finden, so ignoriert er die Besonderheiten des Mediums, in welches der konfessionelle Diskurs hier einfließt. Ulenharts Erzählung ist nämlich nicht nur ein historisches Dokument, sondern eben auch und vor allem eine fiktionale und dazu noch satirische37 Erzählung. Und bei ihrer Interpretation stellt sich daher – insbesondere der Literaturwissenschaft – nicht nur die Frage, welche historisch adäquaten Stellungnahmen in ihr verschlüsselt sein könnten, sondern was sie aus diesen Stellungnahmen als Medium sui generis macht. Und gerade das führt zu der zentralen Frage dieses Bandes, nämlich der nach den Dispositionen des pikarischen Erzählverfahrens.
35 Martino (Anm. 1), S. 102. 36 „Eine präzise und detaillierte Rekonstruktion – Jahr für Jahr – des sozialen Ambientes, der kulturellen und religiösen Atmosphäre sowie der intellektuellen Gruppierungen der Stadt Prag, im Zeitraum von 1611 bis 1616, könnte vielleicht nützliche Angaben liefern, um beurteilen zu können, welche der von uns aufgestellten Hypothesen die wahrscheinlichste sei.“ (Ebd.) 37 Zu diesem Aspekt vgl. insbesondere Roloff (Anm. 1).
168
Jan K. Hon
Die oben genannten Deutungen haben im Grunde nur eins gemeinsam: Sie sind sich darin einig, dass die Novelle das Problem der Koexistenz von mehreren Konfessionen (und Nationen) thematisiert. Aber wie wird diese Koexistenz erzählt und was hat das mit der pikaresken Tradition zu tun? Über die Zugehörigkeit der Novelle und ihrer Vorlage zu dieser wurde viel diskutiert.38 Zwar lässt sich die Verwandtschaft kaum abstreiten – schon die beiden schelmenhaften Hauptfiguren weisen auf diese Tradition deutlich hin und auch die Zeitgenossen waren sich dieser Verwandtschaft bewusst, wie die gemeinsame Ausgabe mit der Lazarillo-Übersetzung zeigt. Zugleich sind jedoch auch mehrfach die Unterschiede benannt worden: Die Novelle verzichtet auf den Ich-Erzähler, sie ist als Ganzes keine selbstrechtfertigende Beichte und schon gar nicht eine episodisch aufgebaute, rückblickende (Auto-)Biografie. Dies sind allerdings keine bloß formalen, oberflächlichen Aspekte des Erzählverfahrens.39 Gerade für die Art der Darstellung von Konfessionalität haben sie entscheidende Folgen, wie gleich am Anfang der Novelle deutlich wird, als sich die beiden Hauptprotagonisten einander vorstellen. Ulenhart bringt bereits hier die Problematik der religiösen Identität ins Spiel, indem er über Cervantes’ Vorlage hinaus den beiden Hauptfiguren jeweils einen unterschiedlichen konfessionellen Hintergrund zuschreibt. Der ältere der Schelme, Isaac, erzählt über seine Kindheit als Sohn eines calvinistischen Predigers und dass er selbst später Seelsorger in der Steiermark geworden sei, nachdem ein dortiger Adliger „bey seinen Gtern das Bapstthumb außgemustert“ habe (S. 34 f.). Gegen das Gesetz habe er erst verstoßen, als die Gegenreformation dort zuschlug: Als mir aber bald darauff ein wanck gemacht worden/ von den Visitatorn, so inn kurtzem daselbst hin/ da man mich zu einem Wortsdiener auffgestellt/ anlangen solten/ hab ich mich zeitlich auß dem Staub gemacht/ Vnd weil man mir sovil zeit nicht gelassen/ daß ich mit meinem Herrn deß Dienstgelds/ wie auch mit meinen Glaubigern/ etlicher außstnd halber/ abrechnen mgen. Als hab ich vermeinet/ man wurd mirs nicht vnrecht geben knnen/ da ichs inn disem fall dem Volck Jsrael gleich thet/ damaln als es auß Egypten gezogen/ Hab disem nach den Kelch/ so in der Kirchen noch vbrig/ neben etlichem wenigem Gelt/ so ich hin vnd wider entlehnet/ zusammen gepackt/ vnd darmit nacher Welß vnd Lintz/ allda andern Diensten in dem Lndel ob der Enß nachzutrachten/ genommen. (S. 35 f.)
38 Vgl. hierzu die Literaturhinweise in Anm. 1. 39 Vgl. Rötzer, Geschlossene oder offene Erzählstruktur? (Anm. 1), S. 178: „Aber dieser Unterschied ist für die argumentative Komposition der pikaresken Archetypen elementar wichtig; denn er ergibt sich notwendig aus dem Erzählziel einer rechtfertigenden Antwort (der ‚caso‘ im Lazarillo) oder einer nachträglichen Bestätigung (die ambivalente Generalbeichte im Guzmán).“
Religionsfreiheit und die Pikareske
169
Auch Jobst berichtet, dass seine kriminelle Laufbahn Ergebnis der konfessionellen Verhältnisse in seiner Jugend sei. Er sei unter den mährischen Wiedertäufern aufgewachsen, doch: Als mir aber die Clausur vnnd das eingesperrte Leben/ nicht recht wllen eingehen/ insonderheit daß ich mich deß gebrauchs der vnder den Widertauffern ist/ daß alles gemein seyn sol/ angefangen zu mißbrauchen/ bin ich von dem obern der Widertauffer auß der Gemeinschaft der Heyligen (dann also nennen sie sich) hinauß in die schnde Welt gestossen/ vnd verwisen worden: Alda ich mein erlehrnet Handwerck der Schneiderey/ in ein anders […] Schneiden verndert […]. (S. 44)
– Gemeint ist die Verwandlung seiner Schneiderkunst ins Ab- und Aufschneiden von Taschen unaufmerksamer Passanten. Dieses erste Gespräch der zwei Hauptfiguren lehnt sich zwar stark an die vorgeprägten Muster des pikaresken Erzählens an, indem hier zum einen die fragwürdige Herkunft sowie die aktuelle kriminelle Laufbahn der Figuren zutage tritt und dies zum anderen in der Form einer autobiografischen Erzählung geschieht.40 Gleichzeitig wird jedoch diese geradezu prototypische pikareske Erzählstruktur in einen breiteren Rahmen gestellt, da es sich um zwei parallele Autobiografien handelt, die – wie Rötzer bereits in Bezug auf die Vorlage von Cervantes beobachtet hat – „in ein Wechselgespräch eingebunden [sind], so daß durch die Gegenrede jeweils eine Aussage relativiert oder zurechtgesetzt werden kann. Und dazwischen meldet sich immer wieder ein alles überblickender Koordinator zu Wort“, nämlich der Erzähler.41 Indem Ulenhart nun das Thema der Konfessionalität gerade in diesem relativierenden Gespräch zum ersten Mal verhandelt, schafft er von vornherein die Bedingung der Möglichkeit, es zum zentralen Anliegen der Erzählung zu machen, sich aber gleichzeitig nicht auf die eine oder andere Seite festlegen zu müssen. Bereits hier wird also mit pedantischer Ausgewogenheit sichergestellt, dass keine der Konfessionen gut davon kommt: Die Wiedertäufer werden als erdrückende Sekte vorgestellt, in der es sich nicht aushalten lässt; die Reformierten als wankelmütige Individualisten, die sich bei der ersten Schwierigkeit davon machen und dabei noch die eigene Kirche ausrauben, sodass die darauffolgende Verfolgung weniger mit dem Glaubensbekenntnis als vielmehr mit einem echten Verbrechen des Verfolgten zu tun hat; die Katholiken schließlich werden als Usurpatoren geschildert, die die anderen nur ins Unglück stürzen. Und das Glaubensbekenntnis wird als ein Artikel im Inventar persönlicher Güter dargestellt, der nach Belieben ausgetauscht werden kann. Eben diese ‚unparteiische‘ Stra-
40 Vgl. etwa Beck (Anm. 15), S. 127. 41 Rötzer, Geschlossene oder offene Erzählform? (Anm. 1), S. 175.
170
Jan K. Hon
tegie nutzt der Text auch in seinem weiteren Verlauf, wenn er das konfessionelle Miteinander innerhalb der Bruderschaft schildert. Hierzu trägt sicherlich in entscheidendem Maße die „offene Erzählstruktur“ bei, durch die sich bereits Cervantes’ Vorlage von der pikaresken Tradition absetzte, wie es etwa Hans Gerd Rötzer gezeigt hat.42 Laut Rötzer kann die offene Erzählstruktur insbesondere als Folge des bereits erwähnten Verzichts auf den autobiografischen Ich-Erzähler gesehen werden. Dessen Ersetzung durch den extradiegetischen Er-Erzähler bringt nämlich eine „Perspektivenvielfalt“43 ins Spiel, die es wiederum ermöglicht, „die Komplexität der Wirklichkeitserfahrung und das Urteil über die sozialen Erscheinungen möglichst umfassend in ihrer dialogischen Vielfalt einzufangen und aufzubrechen wie auch in ihrer Widersprüchlichkeit zu beschreiben“.44 Doch dies soll nicht bedeuten, dass das cervantesische Erzählverfahren mit der Pikareske endgültig bricht. Vielmehr handelt es sich um eine kunstvolle Erweiterung der pikaresken Perspektive, um ihre Einbettung in komplexere Erzählzusammenhänge. Für Ulenharts beobachtende, distanzierte Darstellung der Konfessionalität ist das Pikareske gerade im Rahmen dieser erzähltechnischen Erweiterung von großer Bedeutung. Denn es stimmt zwar, dass sowohl bei Cervantes als auch bei Ulenhart die beiden Protagonisten mithilfe der ‚objektiven‘ Erzählinstanz der dritten Person von außen her betrachtet werden. Gleichzeitig wird die Novelle jedoch so erzählt, dass die Perspektive der beiden Schelme zentral bleibt: Erzählt wird nämlich fast ausschließlich das, was die beiden erleben, und dem Leser wird somit die Unterwelt der Stadt zwangsweise als Reflex eben dieser individuellen Erfahrung unterbreitet. Somit wird die Perspektive der Pikareske nicht aufgehoben, sondern auf eine andere Ebene übertragen: Hier erzählt nicht ein Pícaro, was er beobachtet – es ist vielmehr diese Beobachtung selbst, die zum Gegenstand der erzählerischen Betrachtung wird.45 Erzählökonomisch gesehen ist dies eine Win-win-Situation, denn dem Erzähltext steht somit nicht nur die Perspektive der Pícaro-Figur zur Verfügung, die einen besonderen Zugang zum erzählten Geschehen gewährt, sondern gleichzeitig auch die Möglichkeit eines kritischen Blicks auf eben diese Betrachtungsweise. Die ‚Unzuverlässigkeit‘ der vermittelnden Pícaro-Figur und
42 Vgl. die beiden zitierten Arbeiten von Rötzer (Anm 1). 43 Rötzer, Geschlossene oder offene Erzählform? (Anm. 1), S. 178. 44 Ebd., S. 179. 45 Vgl. ebd., S. 173: „Für Cervantes ist der Pícaro ein Erzählgegenstand, ein Objekt, und nicht das autonome, sich selbst verantwortliche Subjekt, das über sich selbst berichtet.“
Religionsfreiheit und die Pikareske
171
ihrer Perspektive wird sozusagen narrativ objektiviert.46 Und es lässt sich auch tatsächlich beobachten, dass im Sinne eben dieser Objektivierung die ‚Unzuverlässigkeit‘ des Pícaro und seiner Betrachtungsweise ein wichtiges, geradezu programmatisch verfolgtes Thema von Ulenharts Erzählung ist und dies wiederum für die oben behauptete distanzierte Haltung gegenüber dem Konfessionalitätsdiskurs eine entscheidende Rolle spielt. Gut lässt sich das anhand der einzelnen Schritte des Lernprozesses zeigen, den Jobst von der Schneid und Isaac Winckelfelder in Prag und insbesondere in Zuckerbastels Bruderschaft durchlaufen. Jeder dieser Schritte wird nämlich als eine Infragestellung des bisherigen Erfahrungs- und Erwartungshorizonts inszeniert, meist als Folge von Verdrehung, Umdeutung oder Verdunklung gängiger Begriffe, die zeigt, dass jede begriffliche Aneignung der Welt potenziell ‚unzuverlässig‘ und das heißt: trügerisch sein kann. Ein besonders eindrucksvolles Beispiel bietet die erste Begegnung Isaacs und Jobsts mit einem Spitzel aus Zuckerbastels Bruderschaft. Wenn dieser „bmische[ ] Schwirack“ (S. 85) einmal die zwei Schelme bei einem ihrer Diebstähle ertappt, wendet er sich an sie mit der tschechisch („boͤmisch“) formulierten Frage:47 „Neg sauly panij taky toho rzemestla[?]“ („ob denn die Herrn auch von dem Handwerk seien?“). Da der Spitzel jedoch „boͤmisch“ spricht, verstehen die beiden die Frage nicht und meinen, dass der Unbekannte auf „Welsch“ mit ihnen rede. Doch dieser versetzt: „Jch red nicht welsch […] sonder frag allein/ ob vnd wo die Herren Bmisch gelehrnet?“ Das ist eine absurde Antwort, haben doch die beiden gerade erst gezeigt, dass sie „Boͤmisch“ eben nicht verstehen. Aber genau darin liegt der Witz: Mit „Böhmisch gelernt haben“ wird nämlich offensichtlich etwas anderes gemeint, nämlich „stehlen“, was der „Bheimb“ – sprich: Tscheche und Dieb zugleich –, den beiden wiederum nicht explizit, sondern mittels eines weiteren verschleiernden Slangausdrucks erklärt: „Mein frag/ so ich euch vorgehalten/ ob vnd wo jhr Bmisch gelernt/ geht dahin/ ob die Herren nit auch Maußkpff seyen?“ Intrikat ist diese Kette von zugleich semasiologisch wie onomasiologisch fundierten Sinnübertragungen vor allem deshalb, weil hier nicht eine Bedeutung mit einer anderen ersetzt wird, sondern alle infrage kommenden Bedeutungen beinahe unkontrolliert ineinander überfließen: „Böhmisch gelernt haben“ bedeutet gleichzeitig sowohl „Tschechisch sprechen“ als auch „stehlen“, was man aber wiederum auch „Mauskopf sein“ nennen kann – und so ergibt sich, dass die beiden neu entdeck-
46 Zum Problem der Pikarofigur als unzuverlässigem Erzähler vgl. Christa M. Haeseli: Die Picara Iustina als unzuverlässige Erzählerin? Zur Problematik einer narratologischen Kategorie. In: Mohr/Waltenberger (Anm. 1), S. 301–314. 47 Die folgenden Zitate Ulenhart (Anm. 2), S. 85 f.
172
Jan K. Hon
ten „Mausköpfe“ trotz ihrer ursprünglichen Überzeugung, „Böhmisch“ nicht zu verstehen, feststellen müssen, dass sie selbst eigentlich doch längst „Böhmisch gelernt“ haben. In ebensolchem permanenten Zustand des ‚Bedeutungsrutsches‘ setzt sich das Gespräch (und die Erzählung als Ganzes) auch fort: Vom Stehlen wird als „Handwerck“ gesprochen, von der Bruderschaft als „Zunfft“, von ihrem Haupt Zuckerbastl als „Verwalter vnd Praefect[us]“ usw.48 Das hat freilich zur Folge, dass die Bruderschaft um so mehr als ein Spiegel der ganzen gesellschaftlichen Ordnung hervortritt.49 Doch noch interessanter ist das Prinzip, nach dem dies geschieht – es basiert darauf, dass Worte ihrer ursprünglichen Bedeutung beraubt werden, oder anders gesagt: dass an der ‚Unzuverlässigkeit‘ der Sprache als solcher laboriert wird. Jobst und Isaac sind dabei Mitläufer, die dieses Prinzip nicht – etwa durch „subversive Affirmation“50 – in der Weise eines Pícaro bloßstellen, sondern aktiv mitgestalten, indem sie sich von ihm einnehmen lassen. Das Urteil darüber liegt daher auch nicht auf der Textebene, sondern obliegt dem beobachtenden Leser selbst, der „gewissermaßen an [der] Seite [der Schelme] auf der Schwelle zur organisierten Kriminalität steht“51 – und in letzter Konsequenz auch die Zuverlässigkeit seiner eigenen Betrachtungsweise zu hinterfragen hat.52 Erst von hier aus lässt sich die Einstellung der Erzählung zum Thema der Religionsfreiheit einschätzen. Wie gezeigt wurde, ist das Thema in eine diskursive Konstruktion eingebettet, die sich durch permanenten systematisch betriebenen Sinnverlust kennzeichnet. So liegt auch der Verdacht auf der Hand, dass hier gerade die Konfessionalität und religiöse Praxis als eine sinnentleerte diskursive Formation inszeniert wird, die jeglicher Glaubwürdigkeit entbehrt. In aller Deutlichkeit zeigt dies der Umgang mit dem Schlüsselbegriff des Konfes-
48 Zu Ulenharts Übertragung der Szene aus dem Spanischen vgl. Araceli Marín Presno: Zur Rezeption der Novelle ‚Rinconete y Cortadillo‘ von Miguel de Cervantes im deutschsprachigen Raum. Frankfurt am Main u. a. 2005 (Publikationen des Fachbereichs Angewandte Sprach- und Kulturwissenschaft der Johannes Gutenberg-Universität Mainz in Germersheim. Abhandlungen und Sammelbände 43), S. 85–87. 49 Vgl. etwa Beck (Anm. 15), S. 125 und 137. 50 Vgl. Rötzer, Der europäische Schelmenroman (Anm. 1), S. 32–53. 51 Matthias Bauer: Der Schelmenroman. Stuttgart, Weimar 1994, S. 84. 52 Ein erzähltechnisches Detail scheint mir in diesem Zusammenhang besonders geschickt eingesetzt zu sein. Wie gesagt, wird die Geschichte fast ausschließlich aus der Perspektive der zwei Schelme erzählt. Es gibt dazu, soweit ich sehe, nur eine Ausnahme, nämlich am Anfang der Erzählung, wo der Ärger eines „Teutschen“ geschildert wird, der sich von den zwei im Kartenspiel austricksen ließ (vgl. Ulenhart [Anm. 2], S. 53–55). Es macht den Eindruck, als wolle die Erzählung den Leser am Anfang einmal (aber eben nur dieses eine Mal) vorwarnen, dass man sich von den zwei Schelmen all zu leicht an der Nase herumführen lässt, wenn man nicht aufpasst und den eigenen Verstand vergisst.
Religionsfreiheit und die Pikareske
173
sionalitätsdiskurses, nämlich dem der Freiheit. Ulenhart setzt ihn im Gegensatz zu seiner Vorlage überall dort ein, wo die zwei Schelme einen nächsten Schritt in ihrer kriminellen Karriere machen: Wenn Isaac seinem Mitstreiter am Anfang der History über seine betrügerischen Kartentricks erzählt, sagt er: Jn summa/ ich befind mich bey diser meiner newen profession/ in einer vlligen vnd solchen Freyheit/ dergleichen sich kein anderer/ hoher oder niderstands/ wie hoch er darnach tracht/ vnnd vmb erhaltung einer solchen freyheit/ die General=Staden in Niderland/ sich vil guts vnnd Bluts kosten lassen/ rhmen kan. (S. 40)53
Wenn die zwei sich in der Stadt zunächst als Lastträger betätigen, wird ihnen der Beruf vorgestellt als „ein feines richtigs/ priuilegiertes/ freyes Thun oder Handwerck/ vnd keinem sonderbaren Superiori, oder andern nachgesetzten Obrigkeit/ als was ins gemein die lobliche Iustici ist/ vnderworffen“ (S. 63).54 Wenn Isaac die Karriere eines adeligen Dieners ablehnt, wird es folgendermaßen erzählt: Der Winckler aber/ war der Freyheit schon gewohnt/ besinnet sich nicht lang/ sagt disem seinem Promotori Danck/ vmb das anerbieten/ erklrt sich beynebens/ weil diß der erste tag/ den er in dieser Profession zugebracht/ wll es sich nicht wol schicken/ ehe vnd zuvor er versuche/ was darbey fr nutz oder schaden/ gwinn/ oder verlust […]. (S. 72)55
Und wenn die beiden Schelme endlich in die Gaunerzunft aufgenommen werden, heißt es: […] die andern all/ so zugegen waren/ vnd dem examini zugehrt hatten/ baten noch darzu den Zuckerbastel/ daß er dise zwen gute ehrliche Gesellen aller priuilegien vnd Freiheiten / dern sich die andere Zunfftgenossen/ zuerfrewen/ fhig machen/ insonderheit mit einem guten Ampt/ zu maln sie dessen alles wol wrdig/ bedencken vnnd versehen solt. Zuckerbastel/ damit er der Bruderschafft hierinn satisfaction gebe/ verwilligt alßbald in das/ was jhme die gantze Bursch einhellig zugemutet/ befilcht/ daß man dise 2. in die Oberbruderschafft einschreiben/ vnnd aller deren Freiheiten/ so den Oberbrdern vergunnt/
53 Die Stelle hat keine Entsprechung bei Cervantes. Hervorh. d. Verf. 54 Hervorh. d. Verf. – Bei Cervantes ist der Beruf hingegen nur „descansado“ also „mühelos“ (Novelas, S. 171 bzw. Novellen, S. 166). 55 Hervorh. d. Verf. – Bei Cervantes hingegen nur: „a lo cual respondió Rincón que, por ser aquel día el primero que le [el oficio] usaba, no le quería dejar tan presto, hasta ver, a lo menos, lo que tenía de malo y bueno […]“ (Novelas, S. 173) bzw: „Ecke erwiderte, da dies der erste Tag sei, an dem er sich in ihr [der Beschäftigung als Lastträger] versuche, eile es ihm nicht so sehr damit, sie wieder aufzugeben“ (Novellen, S. 167).
174
Jan K. Hon
theilhafft machen soll/ mit vermelden/ daß sie solches billich fr ein Gnad erkennen/ vnnd jhnen die Gedancken machen sollen/ daß solches nicht einem jeden vergunnt […]. (S. 167)56
In keinem dieser Fälle ist bei Cervantes von Freiheit die Rede. Bei Ulenhart handelt es sich hingegen freilich um einen ironischen, im oben genannten Sinne eben verkehrten und entleerten Freiheitsbegriff, denn die zwei Schelme nutzen die Freiheit zu nichts anderem als dazu, sich in Prag als Diebe und später als Mitglieder der lokalen Mafia durchzuschlagen. Und ähnlich verhält es sich mit der religiösen Freiheit innerhalb des Gaunervereins: Wenn der Text erzählt, wie die katholischen Mitglieder der Zunft für das Wohl der Gauner Messen feiern und Kerzen anzünden lassen – übrigens wie auch schon bei Cervantes –, während die anderen Mitglieder ungestört ihren Ritus ausüben, nimmt er weder Partei für eine der involvierten Konfessionen noch arbeitet er an einer Utopie der Religionsfreiheit, sondern schafft es, einen Zustand der konfessionellen Gleichgültigkeit zu inszenieren, der allenfalls als eine subversive Reflexion des überreizten realhistorischen konfessionellen, ständischen Streits vor dem Dreißigjährigen Krieg wahrgenommen werden kann. Das deuten übrigens auch die anderen Einschübe Ulenharts an, etwa wenn ein Vergleich zwischen der Freiheit der Schelme und den niederländischen Generalstaaten gezogen wird oder wenn in einem Atemzug mit Freiheit auch von „priuilegien“ oder einem „guten Ampt“ gesprochen wird.57 Meine These ist folglich, dass die Novelle im Hinblick auf das Problem der Konfessionalität weder katholische noch irenistische Positionen vertritt, weder mährische Wiedertäufer noch Katholiken verhöhnt, sondern eine Bühne schafft, auf der die Spannungen einer konfessionell gespaltenen Gesellschaft aus ‚epischer Distanz‘ inszeniert werden können. Sie entwirft keine Utopie der konfessionellen Toleranz, sondern inszeniert eine Gesellschaft, in der die konfessionelle, aber auch etwa die nationale Zugehörigkeit zwar entscheidende politische und soziale Signifikanz besitzen, letztendlich jedoch kein persönlich-ethisches Gewicht haben. Es ist eine distanzierte Haltung, die vermutlich eben in keinem anderen Medium als in einer fiktionalen Erzählung zum Ausdruck gebracht
56 Hervorh. d. Verf. – Cervantes hingegen: „[…] todos los presentes […] pidieron a Monipodio que desde luego les concediese y permitiese gozar de las inmunidades de su cofradía, porque su presencia agradable y su buena plática lo merecía todo. Él respondió que, por dalles contento a todos, desde aquel punto se las concedía, y, advirtiéndoles que las estimasen en mucho […]“ (Novelas, S. 189) bzw.: „[…] sämtliche Anwesende[ ] […] baten Hintermtor [Monipodio], die beiden sogleich an den Vorrechten der Brüderschaft teilnehmen zu lassen, da ihr einnehmendes Wesen und ihre wackere Sprache es vollauf verdienten. Er erwiderte, er genehmige, um allen gefällig zu sein, ihr Gesuch auf der Stelle, und er ermahnte die Burschen, diese Gunst als etwas ganz Besonderes zu betrachten […]“ (Novellen, S. 180). 57 Vgl. die Zitate oben.
Religionsfreiheit und die Pikareske
175
werden könnte.58 Die cervantesische Weiterführung pikaresker Erzählverfahren stellte dabei Ulenhart eindrucksvolle Mittel zur Verfügung. Und ich möchte sogar noch weiter gehen und behaupten, dass die Unmöglichkeit, den Autor zu identifizieren, möglicherweise Teil dieser Strategie ist. Im Böhmen des Jahres 1617 sind die konfessionellen und nationalen Spannungen so groß und so brisant, dass man sich zu ihnen schlichtweg nicht äußern kann, ohne parteiisch zu sein oder einer Partei zugeordnet zu werden. In dieser Lage des konfessionellen Diskurses schafft wohl nur eine fiktionale Erzählung – ein „inszenierter Diskurs“ eben,59 der mit keinem empirischen Autor direkt gleichzusetzen ist – die Möglichkeit, solch eine distanzierte Position einzunehmen, die nicht etwa eine Stellungnahme in diesem Diskurs, sondern vielmehr zu ihm darstellt. Das bedeutet folglich, dass es hier eher als um einzelne Konfessionen oder einen utopischen Entwurf um etwas viel Grundsätzlicheres geht – nämlich um die Frage: Was wird eigentlich wirklich gemeint, wenn man von Freiheit, von Religion, von Konfession spricht? In dieser Hinsicht ist es symptomatisch, dass Ulenhart in seinem Epilog nicht nur vor der verruchten Lebensweise der zwei Schelme und der Gaunerzunft warnt, sondern gleichzeitig die Schuld daran auch der „Obrigkeit“ und ihrer „nachlssigkeit“ sowie den allgemeinen Zuständen zuschreibt, die sich durch „confusion[ ] der so vilen vnderschidlichen Gerichten“ und „grosse[ ] mennig Volck vnnd concurs[ ] so viler frembder Nationen“ kennzeichnen (S. 229). Concurs und confusion: Vielleicht benennen gerade diese zwei unauffälligen Begriffe aus Ulenharts Epilog sein eigentliches sozialkritisches Anliegen, das wohl kaum anders als aus jener cervantesischen Distanz aufgezeichnet werden kann, wenn man sich selbst nicht darin verlieren will.
58 Vgl. im Hinblick auf die Darstellung von Kriminalität Christian Kirchmeier: Regeln der Abweichung. Funktionen von Kriminalität in deutschen pikaresken Texten des 17. Jahrhunderts. In: LiLi 179 (2015), S. 134–164, hier S. 147: „Der Text verwendet Kriminalität nicht, um ein moralisches Exempel zu statuieren, sondern als ein Medium, das einen ästhetischen Laborraum erzeugt, in dem verschiedene Gesellschaftsmodelle durchgespielt werden.“ 59 Vgl. Rainer Warning: Der inszenierte Diskurs. Bemerkungen zur pragmatischen Relation der Fiktion. In: Funktionen des Fiktiven. Hg. von Dieter Henrich und Wolfgang Iser. München 1983 (Poetik und Hermeneutik 10), S. 183–206.
176
Jan K. Hon
3 Nachtrag Deutsche Prosaromane als poetologische Vorläufer? Die radikal distanzierte – im Sinne Thomas Manns: „ironische“60 – Haltung eines Erzähltextes gegenüber den brisanten Fragen des aktuellen politischen Diskurses, die die offene Erzählstruktur zustande bringt, ist nicht nur eine Angelegenheit der Erzählstruktur selbst, nicht nur Folge eines konkreten Erzählverfahrens, sondern setzt auch eine bestimmte Leserhaltung voraus. Sie funktioniert nämlich nur dann, wenn sich der Erzähltext darauf verlassen kann, dass sein Leser keinen endgültigen Sinn von ihm verlangt und sich stattdessen darauf einzulassen bereit ist, dass er selbst als Subjekt der literarischen Kommunikation sich an der Sinnstiftung aktiv zu beteiligen hat – und dass der ‚Sinn‘ unter Umständen sogar offenbleiben muss. Eine solche Leserhaltung ist jedoch nicht selbstverständlich, sondern Bestandteil einer – auch historisch verortbaren – Konvention und direkte Folge dessen, was Warning in Bezug auf fiktionale Texte als „pragmatische[ ] Präsupposition“ und „Kontrakt zwischen Autor und Leser“ beschrieben hat.61 Die Art und Weise, wie Cervantes mit seiner Kunst der „offenen Erzählstruktur“ an die Tradition der Pikareske anknüpft, zielt ja gerade auf das Potenzial dieser Konvention ab,62 und so lässt sich denn auch zu Recht sagen, dass Ulenhart für seinen distanzierten Kommentar zur aktuellen politischen Lage nur eine vorgegebene poetische Form ausnutzt und sie mit einem neuen Inhalt füllt. Doch die Übertragung einer solchen poetischen Form in einen anderen Kulturraum setzt voraus, dass auch dort die Konvention ihre Geltung wiederfindet. Und in dieser Hinsicht, so möchte ich behaupten, knüpft Ulenharts Bearbeitung nicht primär an die recht junge Tradition des deutschen Schelmenromans an, die sie eigentlich erst überhaupt zu formen hilft, sondern an die poetologischen Prinzipien, die bereits der deutsche Prosaroman des 15. und 16. Jahrhunderts vorbereitete. In den Vorreden dieser Texte kann man nämlich feststellen, dass der verstendige Leser und
60 Thomas Mann: Die Kunst des Romans. In: Thomas Mann: Gesammelte Werke in 13 Bänden. Bd. X. Reden und Aufsätze 2. 2. Aufl. Frankfurt am Main 1974, S. 348–362, hier S. 353. 61 Warning (Anm. 59), S. 194. 62 Das bedeutet allerdings nicht, dass sie nicht schon in der autobiografischen Pikareske angelegt ist – vgl. dazu etwa Bauers Überlegungen zum „elliptischen Diskurs“ in Matthias Bauer: Im Fuchsbau der Geschichten. Anatomie des Schelmenromans. Stuttgart, Weimar 1993, S. 26–34. Sie gestaltet sich hier aber schon aufgrund der pragmatischen Grundvoraussetzungen notwendigerweise anders, als es bei Cervantes’ extradiegetischen Erzählern der Fall sein kann – vgl. dazu die zitierten Arbeiten Rötzers (Anm. 1).
Religionsfreiheit und die Pikareske
177
seine Urteilskraft eine der Konstanten der sich dort abzeichnenden rudimentären Romanpoetik darstellen. So bringt etwa der Verfasser des Diogenes-Schwankromans aus dem Jahr 1550 die Hoffnung zum Ausdruck: „vß allem sinen lbenn/ wirdt ein verstendiger das gt/ wie obstdt/ nemmen vnd behalten/ dz bß aber/ glych als ob er es weder she noch hre/ frgan“63 – und der Übersetzer des Kaiser Octavianus Wilhelm Salzmann zeigt sich in ähnlicher Weise zuversichtlich: „von keinem verstendigen wirt es nit veracht/ Dan ie mer einer dorin lesen ist/ ie lieplicher ihm die matery sein würt“.64 Es ließen sich weitere Beispiele nennen,65 darunter mindestens eins, welches das Leser-iudicium als eine wesentliche Disposition der Romanpoetik zu einem ähnlichen Zweck wie Ulenhart einsetzt, nämlich zur Distanzierung von den im Romantext vertretenen konfessionellen Positionen. In der Vorrede zu Veit Warbecks Übertragung der Magelone, die der protestantische Humanist Georg Spalatin verfasste, werden die Leser darauf aufmerksam gemacht, dass der Text zwar einige katholische Bräuche („meß/ walfarten/ ablaß/ anrffung der lieben heyligen“) beinhalte, derjenige jedoch, der „z zimlichem verstand gotes wort komen“ sei, sich davon wohl nicht werde verleiten lassen, sondern „allein vnd einig in gots lautern gnad vnnd barmhertzigkeit vnd im glaubenn an Jesum Christ“ Seligkeit suchen werde.66 Natürlich sind dies Beispiele, die mit der narrativen Brillanz und diskursiven Komplexität von Cervantes und Ulenhart mitnichten mithalten können. Aber sie zeigen doch, dass die poetologischen Prinzipien, die Ulenharts einzigartigen Kommentar zur aktuellen politischen und sozialen Lage in Böhmen des frühen 17. Jahrhunderts überhaupt ermöglichten, nicht erst mit der Pikareske in die deutschsprachige Literatur ‚importiert‘ wurden, sondern in der ‚niederen‘ Literatur schon seit längerem in Vorbereitung gewesen waren. Und wenn die Germanis-
63 Diogenes. Ein Lustig vnnd Kurtzwylige History von aller Leer vnnd Lben Diogenis Cynici des Heydnischen Philosophi. In: Niklaus Largier: Diogenes der Kyniker. Exempel, Erzählung, Geschichte in Mittelalter und Früher Neuzeit. Tübingen 1997 (Frühe Neuzeit 36), S. 101–165, hier 104 (Hervorh. d. Verf.). 64 Florent et Lyon. Wilhelm Salzmann: Kaiser Octavianus. Hg. von Xenja von Ertzdorff und Ulrich Seelbach. Amsterdam, Atlanta (Ga.) 1993 (Internationale Forschungen zur Allgemeinen und Vergleichenden Literaturwissenschaft 4), S. 6 (Hervorh. d. Verf.). 65 Ausführlicher dazu vgl. in Jan K. Hon: ‚Aemulatio‘ im Kommunikationsraum des frühneuzeitlichen Prosaromans. In: Aemulatio. Kulturen des Wettstreits in Text und Bild (1450–1620). Hg. von Jan-Dirk Müller u. a. Berlin, Boston 2011 (Pluralisierung & Autorität 27), S. 393–416 und ders.: Übersetzung und Poetik. Der deutsche Prosaroman im Spiegel tschechischer Übersetzungen der Frühen Neuzeit. Heidelberg 2016 (Studien zur historischen Poetik 21). 66 Romane des 15. und 16. Jahrhunderts. Nach den Erstdrucken mit sämtlichen Holzschnitten. Hg. von Jan-Dirk Müller. Frankfurt am Main 1990 (Bibliothek deutscher Klassiker 54; Bibliothek der Frühen Neuzeit 1), S. 590.
178
Jan K. Hon
tik vom frühneuzeitlichen Prosaroman als der „Zielform eines Prozesses“ spricht, „der sich um 1500 zunehmend durchsetzt“,67 so hat sie wohl gerade in Ulenharts Text ein Beispiel dafür, auf welches Ziel hin sich dieser Prozess zubewegte.
67 Manuel Braun: Historie und Historien. In: Hansers Sozialgeschichte der deutschen Literatur vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Bd. 1. Die Literatur im Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit. Hg. von Werner Röcke und Marina Münkler. München 2004, S. 317–361, hier S. 317.
Sebastian Speth
Pikarische Kinder des Glücks Erzählte Zufälle bei Johann Beer und in einer moralisierenden Fortunatus-Redaktion Jucundus und Fortunatus sind Kinder des Glücks.1 Ihren Namen ist der Weg zum Glück eingeschrieben. So begegnet Fortunatus, ‚der Glückliche‘, ‚der vom Glück Erhobene‘, der zuvor von einem Unglück ins nächste stürzt und bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich ‚Infortunatus‘ heißen müsste,2 im Wald Fortuna selbst. Der von ihr verliehene Geldsäckel enthebt ihn – unter festgesetzten Bedingungen und bei vorsichtigem Gebrauch – aller materiellen Sorgen. Während Fortunatus das Glück sucht und findet, wird Jucundus von ihm gefunden. Er trifft in seinem abgeschiedenen Heimatdorf auf eine Edeldame, die ihn mit Ausbildung, Anstellung und Ehefrau versieht. Ausschlaggebend ist dabei seine Wirkung auf die Dame, der er „aus der Massen wolgefiel“ (JJ 121).3 In beiden Fällen handelt es sich um Initiationsszenen, in denen die Protagonisten „paradigmatisch ins Glück gesetzt“ werden.4
1 Beers Romane werden zitiert nach der Ausgabe Johann Beer: Sämtliche Werke. Hg. von HansGert Roloff und Ferdinand van Ingen. Bern u. a. 1981–2005. Ich verwende dafür die Siglen „CO“ (Corylo, Bd. 3), „JJ“ (Jucundus Jucundissimus, Bd. 4), „NSp“ (Narrenspital, Bd. 5), „SWK“ (Simplicianischer Welt-Kucker, Bd. 1) und „VÖ“ (Verliebter Österreicher, Bd. 10). Der Fortunatus (F 1509) wird zitiert nach der Sammeledition: Romane des 15. und 16. Jahrhunderts. Nach den Erstdrucken mit sämtlichen Holzschnitten. Hg. von Jan-Dirk Müller. Frankfurt am Main 1990 (Bibliothek deutscher Klassiker 54; Bibliothek der Frühen Neuzeit 1), S. 383–585. 2 Vgl. John Walter Van Cleve: ‚Infortunatus‘. Nochmals zur architektonischen Struktur des Fortunatus (1509). In: Neuphilologische Mitteilungen 99 (1998), H. 2, S. 105–112, hier vor allem S. 107. 3 Zum Namen des Jucundus vgl. auch Johann Lachinger: ‚Glückswechsel‘ als zentrales barockes Gestaltungselement am Beispiel von Johann Beers Romanen ‚Jucundus Jucundissimus‘ und ‚Teutsche Winter-Nächte‘. In: Jahrbuch der Österreichischen Goethe-Gesellschaft 104/105 (2004), S. 79–90, hier S. 83. 4 So Florian Kragl: Fortes fortuna adiuvat? Zum Glücksbegriff im ‚Fortunatus‘. In: Mythos – Sage – Erzählung. Gedenkschrift für Alfred Ebenbauer. Hg. von Johannes Keller und Florian Kragl. Göttingen 2009, S. 223–240, hier S. 226, mit Bezug auf den Fortunatus. – Analog zu meinen Begriffen der ‚pikarischen Horizontalen‘ und des ‚vertikalen Glücksmechanismus‘ ließe sich auch von untereinander relationierbaren Ereignisfolgen sprechen, die innerhalb des Syntagmas eines geregelten Auf und Ab ein Paradigma ausbilden; vgl. zu dieser alternativen Terminologie Jan Mohr und Michael Waltenberger: Einleitung. In: Das Syntagma des Pikaresken. Hg. von Jan Mohr und Michael Waltenberger. Heidelberg 2014 (GRM Beiheft 58), S. 9–35, hier S. 9 f. und
180
Sebastian Speth
Sowohl der anonyme Fortunatus als auch zahlreiche von Johann Beers Romanen5 reflektieren dabei die Unbeständigkeit des von ihnen erzählten Glücks. Fortunatus und Andolosia beklagen vielfach ihr Unglück (F 1509, 436, 446, 453, 459 f., 504, 527, 534 f. u. ö.). Corylo und der Simplicianische Welt-Kucker setzen „mit Reflexionen zum Fortuna-Geschehen“ ein,6 wobei Beer spielerisch mit der zeitgenössischen Zufallstopik umgeht. Er verbündet sich mit dem Leser gegen das Glück, das lediglich vortäusche, „ein beständiges Verbündnis mit uns Menschen“ einzugehen, um all jene, die ihr Vertrauen in Fortuna setzen, letztlich zu betrügen (SWK 15). Indem er „unser Menschliches Leben“ mit einem „Ball“ vergleicht, der „in die Höhe geworffen wird“ (ebd.), verbindet Beer das FortunaAttribut Kugel und die Bildlogik eines unvorhersehbaren Umherrollens mit dem Auf und Ab der rota fortunae. Diese Kombination der Ikonografie aber weist – wie weiter unten zu zeigen ist – auf Beers Fortuna-Konzept hin. Er kanalisiert dabei die horizontal entfaltete Willkür des Zufalls und überführt sie in einen vertikal geregelten Gang. Obwohl Beer an der frühneuzeitlichen Romankritik partizipiert und das eigene Schaffen in Opposition zu jenen Werken setzt, die heute als ‚Prosaromane‘ bezeichnet werden, bietet sich eine vergleichende Untersuchung seiner ‚pikarischen‘ Romane mit der Fortunatus-Überlieferung dennoch an. Schließlich schöpft Beer aus Motiven und Strukturen dieser von ihm nur scheinbar zurückgewiesenen Werke.7 Auch wenn die mit dem Anspruch auf Faktenwahrheit auftretenden Texte für viele Figuren Beers als ‚Märlein‘ oder ‚Narrenpossen‘ gelten, mit denen die Jugend ihre Zeit vergeude (vgl. CO 20 und 150 f. sowie SWK 117 und
18 f. Zum Paradigma der ‚Pikareske‘ im Spannungsfeld von ‚Karnevaleske‘ und ‚Cervanteske‘ zuletzt Maren Lickhardt: Zu Transformationen des Pikarischen. In: LiLi 44 (2014), H. 175: Transformationen des Pikarischen, S. 6–23, hier S. 10–17. 5 Ich beschränke mich auf Beers ‚pikarische Romane‘; vgl. die Einteilungsversuche von Alewyn, Hardin und Krämer bei Jörg Krämer: Johann Beers Romane. Poetologie, immanente Poetik und Rezeption ‚niederer‘ Texte im späten 17. Jahrhundert. Frankfurt am Main u. a. 1991 (Mikrokosmos 28), hier S. 95–98. 6 Andreas Solbach: Johann Beer. Rhetorisches Erzählen zwischen Satire und Utopie. Tübingen 2003 (Frühe Neuzeit 82), hier S. 111. 7 Vgl. Krämer (Anm. 5), S. 149 und 196 f., Solbach (Anm. 6), S. 119, und Rosmarie Zeller: Beers ‚Rittergeschichten‘, der ‚Amadis‘ und die Volksbücher. Zur Unterhaltungsliteratur des 17. Jahrhunderts. In: Johann Beer. Schriftsteller, Komponist und Hofbeamter. 1655–1700. Beiträge zum Internationalen Beer-Symposion in Weißenfels. Oktober 2000. Hg. von Ferdinand van Ingen und Hans-Gert Roloff. Bern u. a. 2003, S. 377–399, hier S. 385–387, sowie die Zusammenstellung von Primärstellen bei Richard Alewyn: Johann Beer. Studien zum Roman des 17. Jahrhunderts [1932]. Hg. von Klaus Garber und Michael Schroeter. 2., verbesserte Aufl. Heidelberg 2012 (Beihefte zum Euphorion 64), hier S. 243–247.
Pikarische Kinder des Glücks
181
343), werden sie dennoch als Identifikationsfolie aufgerufen, mit der man sich vom verkommenen Status quo der eigenen Gegenwart abheben kann. So pariert der faule Lorentz im Narrenspital das Ansinnen zweier Adliger, die einen Mönch zu seiner katechetischen Unterweisung bestellen, mit den Worten: [W]as geht euch davon ab/ daß ich mir den Buckel kratzen und Historien erzehlen lasse/ O wäret ihr solche Kerl wie Fortunatus, Andolonia [sic!] und Ampedo gewesen/ ich glaub/ es solle besser umb eure Sachen stehen/ ich will ein Hundsfut seyn/ wann einer unter euch all sein Lebtag ein Wünschhütlein bekommen wird. […] Meinet ihr dann daß Peter mit den silbern Schlüsseln sey ein solcher Mauerscheisser/ wie ihr gewesen? oder die schöne Magelona habe dem Vieh ausgemistet/ wie eure Weiber thun/ O nein bey Element nicht/ das war ein rechtschaffener Kerl/ und ein solcher Ritter will ich noch werden […]. (NSp 166 f.)
Aus Lorentz’ Figurenperspektive werden Fortunatus, Peter und Andolosia zu Vorbildern und damit zu pikarischen Helden avant la lettre.8 Am Corylo lässt sich indes die spiegelnde Verflechtung der intertextuell aufgerufenen Prosaromane mit der erzählten Handlung leicht demonstrieren. Die Geschichten von Kaiser Octavian, Melusine und der Schönen Magelone sind hier nicht nur Alltagsgespräch des Dritten Standes (vgl. CO 73). Auch ein verwundet heimgekehrter Graf lässt sich zur Kur in seinem Bett mit dergleichen „Schnacken und Begebenheiten“ unterhalten (CO 29). Der Ich-Erzähler deutet dabei kritische Distanz zum Erzählten an, da der eigentliche Gegenstand von des Grafen Erheiterung der andächtige Vortrag dieser Historien gewesen sei. Doch ist diese kritische Haltung dadurch gebrochen, dass Corylo selbst unter dem gräflichen Bett wach liegt, während der Koch eben jene Episode der Melusine erzählt, in der Gyß „drey Tag und Nacht“ auf der Sperberburg „gewachet hette“ (CO 30). Und beide – Gyß wie Corylo – kommen letztlich um ihren Liebeslohn. Die Untersuchung setzt bei der paratextuellen Etablierung und Einhegung des Zufalls an und bespricht eine moralisierende Modifikation der ‚Fortuna des Fortunatus‘ in einer Redaktion des 19. Jahrhunderts (1.). Sie konzentriert sich dann auf Zufallsräume wie Jucundus’ Heimatdorf (2.) und schließt mit der Frage nach der Funktion von Binnenerzählungen und der Andrean-Episode (3.). Um Zufälle im Jucundus Jucundissimus und Fortunatus näher zu analysieren, wird im Folgenden zwischen dem zufälligen Herumirren eines Pícaro auf der Horizontalen der erzählten Welt und dem vertikalen Mechanismus von Fortunas Glücksrad unterschieden. Beer, der Fortunatus-Autor und ein Redaktor des 19. Jahrhunderts
8 Anna Mühlherr: ‚Melusine‘ und ‚Fortunatus‘. Verrätselter und verweigerter Sinn. Tübingen 1993 (Fortuna vitrea 10), hier S. 93 f. und 120, weist auf „Affinitäten“ des Fortunatus „zur Gattung des pikarischen Romans“ hin (die Zitate S. 120).
182
Sebastian Speth
verschränken diese Bewegungsweisen, um Zufälle hervorzubringen und in letzter Konsequenz einzuhegen.
1 Horizontale Einführung und vertikale Einhegung des Zufalls Mit einem Exkurs zur Fortuna des Fortunatus im 19. Jahrhundert Stellen die Titelblätter späterer Fortunatus-Redaktionen Fortuna als Spenderin irdischer Glückgüter dar, die ungeregelt durch die Welt eilt, so verbindet dagegen die Titelformulierung des Jucundus Jucundissimus diese horizontale mit einer vertikalen Bewegung und differenziert zwischen den Begriffen ‚Glück‘ und ‚Zufall‘. Ich zitiere sie daher zunächst in fast voller Länge: JUCUNDI JUCUNDISSIMI Wunderliche Lebens-Beschreibung/ Das ist: Eine kurzweilige Histori Eines/ von dem Glck/ wunderlich erhabenen Menschens/ welcher erzehlet/ wie und auf was Weis er in der Welt/ unter lauter abentheurlich= und seltsamen Begebenheiten herum gewallet/ bis er endlich zur Ruhe gekommen/ Jn welcher Unterschidliche Begebenheiten durch die Hechel gezogen/ und sonsten allerley merk-wrdige Zuflle der vorwitzigen Welt offenharet [sic!] und entworfen werden. […].
Mit „Histori“ ist ein Schlüsselbegriff der Prosaroman-Tradition zitiert,9 umgekehrt wird die Gattungsbezeichnung „Lebens-Beschreibung“ auch in der späten Fortunatus-Überlieferung verwendet. Doch vor allem fällt auf, dass in Bezug auf das ‚Glück‘ des Jucundus erstens nur auf die Aufstiegs-, nicht aber auf eine Abstiegsbewegung verwiesen wird („von dem Glck […] erhaben[ ]“). Zweitens ist damit implizit auf die Bewegungsart des Glücksrades verwiesen, das in der Bildlogik von ‚regnabo/ regno/ regnavi/ sum sine regno‘ im Gegensatz zur Kugel- oder Füllhorn-Tradition ein vom Glück beeinflusstes Oben und Unten kennt. Die zweite vom Titel angesprochene Bewegungsrichtung verläuft dagegen horizontal: Der vom Glück erhobene Mensch erzähle, „wie und auf was Weis er in der Welt […] herum gewallet“ sei. Das verweist auf das Landstörzertum eines Pícaro, das eine beliebige Anzahl an Episoden umfasst, „bis er endlich zur Ruhe gekommen“ ist. Der Welt, in der Jucundus seinen scheinbar ziellosen Lebensweg geht („herum gewallet“), ist der Begriff des ‚Zufalls‘ zugeordnet. Denn, so
9 Vgl. Joachim Knape: ‚Historie‘ in Mittelalter und früher Neuzeit. Begriffs- und gattungsgeschichtliche Untersuchungen im interdisziplinären Kontext. Baden-Baden 1984 (Saecula spiritalia 10), hier S. 238–253, 326–331 und 389–400.
Pikarische Kinder des Glücks
183
der Titel weiter, in der Histori werden „allerley merk-wrdige Zuflle […] entworfen“. Während der erste Teil des Titels ankündigt, was Alewyn als Ende des „Abenteurertum[s] des Pikaro“ bezeichnet,10 nämlich dass „der glückliche Ausgang im Verlauf des Romans niemals wirklich in Frage“ stehe,11 eröffnet der zweite Teil dennoch Raum für die Erzählung von Zufällen. Außerdem ist hier die Ausstellung des Fiktionscharakters zu vermerken. So werden die genannten Zufälle nicht nur ‚offenbart‘, sondern auch „entworfen“. Damit einhergehend wird die Erzählinstanz ausdifferenziert: Eine höher stehende Instanz, die ich hier den arranger der Erzählung nennen möchte,12 führt einen „von dem Glck/ wunderlich erhabenen Menschen[ ]“ als Erzähler der Zufälle seines eigenen Lebens ein. Die Erhebung durch das Glück ist damit einerseits von auktorialer Position verbürgt und weder der eingeschränkten Subjektivität des erzählenden noch derjenigen des erzählten Ichs unterworfen; sie kann daher andererseits nicht durch die aus der Ich-Perspektive entfalteten Zufälle relativiert werden. Es ist daher Jörg Krämer zuzustimmen, dem zufolge „Zufall und Chaos […] auf der Lebenslauf-Ebene ausgiebig ihr Spiel treiben [können], weil die grundlegende Setzung der Erzählsituation“ – mit dem finalen Glück des Protagonisten – „alles wieder ins rechte Lot bringt“.13 Der horizontal entfaltete Zufall wird also vertikal eingehegt. So wird sich zeigen, dass sowohl bei Beer als auch – zumindest teilweise – in der moralisierenden Fortunatus-Redaktion poetische Gerechtigkeit geübt wird und der Mechanismus von Schuld und Strafe, Tugend und Lohn in Kraft bleibt. Die ‚Fortuna des Fortunatus‘ ist gut erforscht. Im Wesentlichen wurde die gleichnamige Analyse Jan-Dirk Müllers bestätigt, der anhand des Erstdruckes von 1509 zeigt, dass der Fortunatus nur aus der Ferne betrachtet einer (eineinhalbfachen) Umdrehung des Glücksrades folge.14 Da sich Fortunatus dem Glück
10 Alewyn (Anm. 7), S. 222. 11 Manfred Kremer: Vom Pikaro zum Landadligen: Johann Beers ‚Jucundus Jucundissimus‘. In: Der deutsche Schelmenroman im europäischen Kontext: Rezeption, Interpretation, Bibliographie. Hg. von Gerhart Hoffmeister. Amsterdam 1987 (Chloe 5), S. 113–126, hier S. 119. 12 Vgl. zu diesem Begriff David Hayman: Ulysses. The Mechanics of Meaning. A New Edition, Revised and Expanded. Madison, Wis. 1982, S. 122 f. – Zu berücksichtigen wäre dabei aber auch die für den Pikaroroman prägende Differenz von erzählendem und erzähltem Ich. – Zu Beers Spiel mit seiner anonymisierten Verfasserschaft vgl. Corylos Mutmaßung über seine Herkunft (CO 101): „das ein Beer mein Vater seyn solte/ konte auch nicht müglich seyn“. 13 Krämer (Anm. 5), S. 219. 14 Vgl. Jan-Dirk Müller: Die Fortuna des Fortunatus. Zur Auflösung mittelalterlicher Sinndeutung des Sinnlosen. In: Fortuna. Hg. von Walter Haug und Burkhart Wachinger. Tübingen 1995 (Fortuna vitrea 15), S. 216–238, hier S. 218–220. – Fortunatus’ Vater Theodorus ist ein reiches Erbe hinterlassen, das er vertut, weswegen er seinem Sohn für das weitere Leben weder raten noch
184
Sebastian Speth
ausliefert, werde Andolosia „zum Spielball des Glücks“.15 Mit Clemens Lugowski verweist Müller auf eine ‚Motivation von hinten‘, die aber durch eine ‚Motivation von vorne‘, „eine induktive […] Kausalität“ „durchkreuzt“ werde, „die den generellen Verlauf eine Strecke weit ablenken kann und ihn für einige Nebenhandlungen sogar ganz umbiegt“.16 Insgesamt entstehe so ein „Eindruck von Regellosigkeit“, und durch „[d]ie vielen kleinen Glückswechsel“ sei „keine totale Sinndeutung“ möglich.17 Die traditionellen Ordnungsentwürfe, wie heilsgeschichtliche Providenz oder stabile Ständeordnungen mit verbindlichen (höfischen) Werten, sind zwar noch präsent, doch offenbare die Narration den Verlust ihrer Verbindlichkeit.18 Ein Wert wie ‚Courtoisie‘ kann in dieser Welt sogar „zum Verlust des Glücks“ führen,19 während der Listenreiche – unabhängig von seiner moralischen Disposition – besser fahren kann.20 Auch wenn Florian Kragl die Geltung „absolute[r] Kontingenz des Glücks im ‚Fortunatus‘“ relativiert, da im Mittelteil des Romans das Glück „berechenbar“ sei und am Ende eine „starre Gut-Böse-Dichotomie installiert“ werde von „Guten wie Andolosia“ einerseits und dem „Böse[n] in Gestalt der beiden Grafen“ andererseits,21 droht die fortuna mala doch über weite Strecken mit dem Absturz des Geschlechts vom Rad der Fortuna; darüber hinaus bleibt der Untergang der Söhne unverdient.22
helfen kann. Fortunatus setzt sich bewusst und explizit dem Glück aus, findet es personifiziert in der Jungfrau und steigt mit Bedacht zu höchstem Ansehen, während seine Söhne für die falsche Wahl des Vaters bezahlen müssen. 15 Müller (Anm. 14), S. 234; Vgl. dazu auch Ralf-Henning Steinmetz: Welterfahrung und Fiktionalität im ‚Fortunatus‘. In: ZfdA 133 (2004), S. 210–225, hier S. 219, der hier nachdrücklich auf die „Willkürlichkeit des Glücks“ hinweist. 16 Müller (Anm. 14), hier S. 222. Analog lässt sich im Sinne der vorliegenden Argumentation von einer horizontalen und einer vertikalen Bewegung sprechen, die einander durchkreuzen. 17 Ebd., S. 221. 18 Vgl. ebd., S. 227–229. Vgl. dazu auch Udo Friedrich: Providenz – Kontingenz – Erfahrung. Der ‚Fortunatus‘ im Spannungsfeld von Episteme und Schicksal in der Frühen Neuzeit. In: Erzählen und Episteme. Literatur im 16. Jahrhundert. Hg. von Beate Kellner, Jan-Dirk Müller und Peter Strohschneider. Berlin, New York 2011 (Frühe Neuzeit 136), S. 125–156, hier S. 138–143. 19 Kragl (Anm. 4), S. 234. 20 Vgl. ebd., S. 234. – Ebd., S. 238, spricht Kragl von den „Anti-Tugenden des ‚Fortunatus‘“. 21 Ebd., S. 226, Anm. 11, sowie S. 240 und 235. 22 Sinnfällig wird diese Tatsache in der Beschaffenheit des Säckels, die bereits zentrale Konflikte der Handlung vorbereitet. Die Übertragbarkeit auf Dritte ermöglicht die schnellen Glückswechsel der Andolosia-Agrippina-Handlung. Die Beschränkung der Wirkungsdauer auf zwei Generationen legt deren erbenloses Ableben nahe und zeigt damit bereits die Unbeständigkeit dieses irdischen Glücks an. Analog dazu impliziert Fortunatus’ Verbot, Säckel und Wunschhütlein zu trennen, und die Warnung, niemandem von ihrer Macht zu berichten,
Pikarische Kinder des Glücks
185
Eine tiefgreifende Überarbeitung erfährt der Fortunatus-Roman im 19. Jahrhundert. Das hier zugrunde gelegte Exemplar wird von der Universitätsbibliothek München inzwischen auf um 1850 datiert.23 Die Redaktion kürzt stark – so entfallen u. a. Andolosias Frankreich-Abenteuer und die Episode bei St. Patricius’ Fegefeuer. Außerdem sind zahlreiche Szenen umgestaltet,24 emotionalisiert und kommentiert, wobei auch die Glücksthematik variiert wird. Anstelle von Zwischentiteln sind allen Kapiteln gereimte Motti vorangestellt. Sie preisen „Zufriedenheit“ als höchstes irdisches Glück (F 1850, 10), mahnen an, dass Reichtum keine Klugheit generiere (vgl. ebd., S. 13), oder warnen davor, dass Sünde ewige Strafe zur Folge habe.25
deren erzähllogische Übertretung. Dies führt jedoch erst in jenem Moment zum Absturz, als sich Andolosia in seine Rolle als Werbungshelfer für den zypriotischen Prinzen fügt und auf eigene Ambitionen verzichtet. Sein Scheitern ist damit unverdient, „das Glück“ ist nach Kragl „wieder kontingent“ (ebd., S. 235). 23 Eine beraus lustige Lebensbeschreibung von Fortunatus Wnschhtlein, mit dem Seckel, der nie vom Gelde leer geworden ist. Frankfurt, Leipzig o. J. (Signatur W 8 P. germ. 13653, Nachweise hier mit der Sigle F 1850). Die Druckorte sind mit hoher Wahrscheinlichkeit fingiert bzw. geben lediglich die Messeorte an, an denen der Druck vertrieben wurde. Vgl. zu einem ähnlichen Fall (L3-Druck des Herzog Ernst-Volksbuchs) John Lewis Flood: The Survival of German ‚Volksbücher‘: Three Studies in Bibliography. Bd. 1. Diss. masch. London, S. 313 f. Zuvor war die Redaktion auf um 1787 datiert; Recherchen der UB-Mitarbeiter zum Grund für diese eigentümlich präzise Datierung blieben ergebnislos. Aufgrund überlieferungsgeschichtlicher Vergleiche ist die nunmehr korrigierte, spätere Ansetzung plausibel, jedoch scheint mir der Stil insbesondere der gereimten Motti eher ins 18. Jahrhundert zu verweisen. Vgl. zu dieser Redaktion demnächst ausführlicher meine Dissertation ‚Dimensionen narrativer Sinnstiftung‘. 24 Das gilt beispielsweise für Fortunatus’ Begabung der armen Jungfrau in Konstantinopel. Zunächst ist die Perspektive verändert, da Fortunatus noch vor der Begegnung mit der Braut auf den Bräutigam trifft, der sich gerade mit seinem Vater streitet, weil er nicht die schöne Geliebte, sondern eine missgestaltete Reiche heiraten solle (vgl. F 1850, 22). Die Aussicht auf die finanzielle Ausstattung der liebenden Elmire macht Fortunatus dabei „zum erstenmale glcklich“ über den Umstand, „daß er reich war“ (ebd.). Für Joachim Theisen ist die Szene Beleg, dass Fortunatus „darum bemüht“ sei, sich „das frei gewährte Geschenk Fortunas […] im Nachhinein zu verdienen“; Joachim Theisen: Fortuna als narratives Problem. In: Fortuna. Hg. von Walter Haug und Burkhart Wachinger. Tübingen 1995 (Fortuna vitrea 15), S. 143–191, hier S. 175 f. In der späten Redaktion ist die jährliche Ausstattung einer bedürftigen Jungfrau jedoch Bedingung für die Aushändigung des Glückssäckels (vgl. S. 13), und der Fokus verschiebt sich auf das Innenleben des Protagonisten und sein ambivalentes Verhältnis zum erhaltenen Glücksgut. 25 So F 1850, 24: „Ruhe und Glückseligkeit | Folgt der edlen That; | Doch der Snd’ ist Straf bereit, | Eh man sie begangen hat“; ebd., S. 51: „Krnkt dich nur die Strafe? Snder! | O, dann leide Hllen=Pein! | Dein Vergehen soll dich reu’n, | Nicht der Lohn fr deine That, | Die nicht mehr verdienet hat“.
186
Sebastian Speth
Auf Titelbildern wird die Darstellung des thronenden Fortunatus schon früh durch die Szene seiner Begegnung mit der Jungfrau des Glücks ersetzt.26 Im 17. und 18. Jahrhundert findet sich an dieser Stelle die klassische Darstellung einer Fortuna. Sie wird, wie noch in der 1850er-Redaktion, mit ihren traditionellen Attributen vorgestellt: Unter einem geblähten Segel balanciert sie auf einer geflügelten Kugel (Abb. 1).27 Durch den wehenden Haarschopf ist ihre Ikonografie zudem mit derjenigen der Occasio verschmolzen. Im Gegensatz zur Rad-Metaphorik der Glücksdarstellung steht ihr Rollen in horizontaler Richtung für die Unberechenbarkeit und Weltbezogenheit des von ihr verliehenen Glücks.28 Dieses wird durch ein Säckel und ein Hütlein symbolisiert, welche Fortuna in den Händen hält und die nach der Titelformulierung die eigentlichen Helden seien: Lebensbeschreibung von Fortunatus Wnschhtlein, mit dem Seckel.
Abb. 1: Eine überaus lustige Lebensbeschreibung von Fortunatus [...]. Frankfurt am Main, Leipzig [um 1850], Titelblatt (Universitätsbibliothek München: W 8 P. germ. 13653) 26 So schon in der ‚Frankfurter Überlieferungsgruppe‘ mit Hermann Gülfferichs Druck von 1549, aber auch noch bei Michael und Johann Friderich Endter 1677. Vgl. dazu Jozef Valckx: Das Volksbuch des Fortunatus. In: Fabula 16 (1975), H. 1, S. 91–112, hier S. 100 f. 27 Vgl. dazu Ehrengard Meyer-Landrut: Fortuna. Die Göttin des Glücks im Wandel der Zeiten. München, Berlin 1997, hier S. 37–134 und 152–157. 28 Diese Bewegung korrespondiert mit der Darstellung einer Weltkugel auf dem Frontispiz zum ersten Teil von Beers Simplicianischem Welt-Kucker, die unter der Beobachtung eines bocksbeinigen Satyrn, des ‚Welt-Kuckers‘, ein Landschaftspanorama durchquert.
Pikarische Kinder des Glücks
187
Bei diesen textspezifischen Attributen ist jedoch zu beachten, dass eine solche Darstellung quer zum Haupttext des Romans steht. Nach diesem gehört das Wunschhütlein nicht zu den von Fortuna verliehenen Glücksgütern. Vielmehr wird es „unter dem Siegel der Verschwiegenheit“ unter den Sultanen vererbt und dem gegenwärtigen Herrscher Ägyptens von Fortunatus durch List abgerungen (F 1850, 35 f.; Zitat S. 35). Indem das Titelbild beide Glücksgüter der Verfügungsgewalt Fortunas unterstellt, etabliert dieser Paratext ein eigenständiges Sinnangebot. Die Vergleichgültigung der Quellen irdischen Glücks stärkt dabei die Opposition von weltwärts und aufs Jenseits gerichteten Handlungsmaximen. Der Held gerät demgegenüber aus dem Blick. Im Erstdruck verdichtet das Nachwort die Romanhandlung auf den moralischen Imperativ „erkyeß Weißhait für reichtumb“ (F 1509, 580). Das schlimme Ende mit dem Tod der Söhne wird hier als notwendige Folge aus Fortunatus’ falscher Wahl dargestellt. Dadurch tritt auch im Fortunatus neben das im Hinblick auf den erreichten Erzählzeitpunkt unverdiente Scheitern der Söhne ein vertikaler Mechanismus von Schuld und Strafe, der das Geschlecht bereits in zweiter (bzw., die Elternvorgeschichte mitgezählt, dritter) Generation aus der gesellschaftlichen Höhe ins Verderben führen muss. Dieses Nachwort fällt zwar bereits in der zweiten Ausgabe von 1518 weg. Die hier untersuchte Redaktion des 19. Jahrhunderts ergänzt den Roman jedoch wieder um eine in Handlung aufgelöste moralisatio. Anders als in der ursprünglichen Form ist es hier Agrippina, die aus Rache die Grafen Theodor und Lymosius anstiftet, Andolosius zu beseitigen (vgl. F 1850, 60 f.). Nach dessen Tod zieht sie gemeinsam mit dem zypriotischen Kronprinzen in Fortunatus’ Palast und sucht mitternachts nach den Reichtümern der Helden (vgl. wie für das Folgende S. 64). Der „Geitz“ treibt sie dabei „an die schmutzigsten Orte“. Zuletzt fällt sie „in eine halb verfallene Zisterne“ und wird – „bey lebendigem Leibe – von den Schlangen aufgefressen“. Der Erzähler deutet das Geschehen mit Bezugnahme auf einen „Priester“ aus, dem zufolge das Beispiel lehre, „[d]ie Snde zu meiden, weil ihr unausbleiblich zeitliche und ewige Strafen folgen“ (im Druck gesperrt). Der vertikale Mechanismus von Schuld und Strafe, wie er Beers Jucundus eingeschrieben ist und wie ihn das Nachwort des Fortunatus-Erstdrucks der Handlung hinzufügt, wird in dieser Redaktion Teil des Geschehens selbst. Diese narrativierte Ausdeutung korrespondiert indes mit zahlreichen ergänzten Kommentaren durch die Erzähler-Instanz und die gesetzten Motti.29 Mit Hilfe der Paratexte und exponierter Teile des Haupttextes organisieren die Romane Zufälle also zweifach und hegen sie letztlich ein: Die Unregelmäßig-
29 So wird schon zuvor der Geiz als „der Vater aller Snden“ eingeführt (F 1850, 34, Motto).
188
Sebastian Speth
keiten in der Horizontalen werden jeweils mit einer den gesamten Handlungsbogen bestimmenden Bewegung des Auf- beziehungsweise Auf- und Abstiegs kombiniert. Dass trotz „[u]nterschiedliche[r] Begebenheiten“ und „allerley […] Zuflle[ ] (JJ, Titel) die Romane ihr jeweiliges Ziel erreichen, liegt an dem basalen Phänomen, dass Erzählungen „Lebensläufe mit freier Hand um- und zurechtbiegen“ können. Die „Ganzheit“ einer Lebensgeschichte besteht darin, „einen Schlusspunkt zu setzen und die Handlung dabei mit einem betonten Ende zu versehen“.30 Die Hochzeit mit der Tochter der Edelfrau zeigt Jucundus so auf der Höhe des Glücks, und im Fortunatus von 1850 wird nach dem Tod aller Protagonisten mit Agrippinas Tod final poetische Gerechtigkeit erzielt. Werden Unbeteiligte wie Fortunatus’ Mutter Gratiana von der Bewegung erfasst, kommentiert der Erzähler, dass sie das erlittene „Schicksal“ „nicht verdient“ hätten (F 1850, 5). Darüber hinaus wird die von Kragl für den Erstdruck konstatierte „Gut-BöseDichotomie“31 dergestalt aufgelöst, dass verschiedene Instanzen des Romans Kritik an Andolosius’ Selbstgerechtigkeit üben. Stilisiert er sich wie im Erstdruck zum Erlöser der Sünderin Agrippina (vgl. F 1509, 551–556 u. 561, sowie F 1850, 55 f. u. 58), so glaubt er hier auch dann noch, unschuldig am eigenen Unglück zu sein, als er für den zypriotischen Prinzen um Agrippina wirbt (vgl. F 1850, 57 f.). Außerdem warnt der Erzähler schon vorher, als Andolosius die falsche Königstochter als „Quelle all [s]eines Unglckes“ gilt, davor, die Schuld bei Anderen anstatt bei sich selbst zu suchen (ebd., S. 49). Und auch der Einsiedler erkennt, dass Andolosius „nicht Willens“ sei, „zur Weisheit zurck zu kehren“ (ebd., S. 50). Die Modifikation der zentralen Begegnung von Fortunatus mit der Jungfrau des Glücks in der späten Redaktion betrifft weniger die äußere Handlung als die diskursive Ebene im Umgang mit den Verheißungen irdischen Glückes. „Fortuna, die Gttin des Glcks“, ist von einem „hellen Schein“ umgeben (F 1850, 12), als sie ihre Macht erläutert und Fortunatus vor die Wahl eines Glücksgutes stellt. Während der Held in der editio princeps von ihr unter Zeitdruck gesetzt wird, „wann die stund des glücks zu gebn […] gar nach verschynen“ sei (F 1509, 430), solle sich Fortunatus nun nicht lange „besinne[n]“, da „die Stunde [s]eines Glcks […] bereits begonnen“ habe (F 1850, 12). Der Aufstieg wird dadurch zur
30 Alle drei Zitate: Harald Haferland: Kontingenz und Finalität. In: Kein Zufall. Konzeptionen von Kontingenz in der mittelalterlichen Literatur. Hg. von Cornelia Herberichs und Susanne Reichlin. Göttingen 2010 (Historische Semantik 13), S. 337–363, hier S. 357. – Die auktoriale Macht eines solchen Zurechterzählens auf höherer Ebene zeigt sich im Titel des dritten Teils von Beers Simplicianischem Welt-Kucker, der ankündigt, „die angefangene und fortgesetzte Erzehlungen“ wie das „Leben“ des Protagonisten zu beschließen (SWK 209). Jedoch folgt auf die Begebenheiten und Zufälle dieses Teils erst noch der finale vierte. 31 Kragl (Anm. 4), S. 235.
Pikarische Kinder des Glücks
189
Gewissheit. Fortunatus ist hier ein echtes Glückskind. Im Erstdruck antwortet er prompt, dass er „reichtumb“ von der Glücksjungfrau begehre (F 1509, 430), und der Leser muss selbst den Wunsch nach materieller Sorglosigkeit als von der Vorgeschichte her motiviert rekonstruieren. Entgegen ihrer Kürzungstendenz fügt die moralisierende Redaktion an dieser Stelle eine Reflexion über die zu treffende Entscheidung ein: Fortunatus gedachte der Menschen, wie sie auf Erden sind, und fand; daß die Reichen gewhnlich auch fr schn und weise gehalten werden, (obwohl sie es freylich selten sind) daß die Aerzte fr ihre Gesundheit wetteifern, damit ihr kostbares, langes Leben erhalten wrde; daß sie mit ihren goldenen Fingern Herzen und Mauern durchbrechen. Kurz, im Reichthume schienen ihm alle Tugenden vereinigt. (F 1850, 12)
Mit der Summierung aller Tugenden unter den Reichtum konterkartiert Fortunatus das Exempel Salomos, das zeigt, dass Reichtum die Folge von Weisheit sei, und mit dem der Erzähler des Erstdrucks im Nachwort begründet, dass die Entscheidung falsch gewesen sei (vgl. F 1509, 580).32 Außerdem nimmt er damit die weitere Handlung des Romans vorweg, die zeigen wird, dass Reichtum mitnichten Schönheit (Andolosius’ und Agrippinas Hörner, F 1850, 49 und 51), Weisheit (Fortunatus beim Waldgrafen, ebd., S. 15 f.), Gesundheit (Kassandras und Fortunatus’ Tod, S. 38 f.)33, langes Leben (Ampedos und Andolosius’ Tod, S. 62 f.) und Stärke (Andolosius im Block, S. 61) substituieren kann. Mit der romanbegleitenden Kommentierung und der Kürzung von Nebenhandlungen stärkt der anonyme Redaktor die vertikale Komponente des Werkes. Zwar ist Fortunatus auch hier das Ziel seiner Reisen gleichgültig, und er vertraut sich völlig Leopolds Führung an (vgl. F 1850, 18), aber die „Ausweich-, Fluchtoder auch Reisebewegungen“, aufgrund derer Annette Gerok-Reiter vom Fortunatus als einem ‚Roman der Bewegung‘ spricht,34 sind weitgehend zurückgedrängt. Statt der pikarischen Horizontalen bestimmt in der späten Redaktion vor allem das Auf und Ab des Rades den Gang dieses Romans über zwei Generationen hinweg.
32 Vgl. dazu Dieter Kartschoke: Weisheit oder Reichtum? Zum Volksbuch von Fortunatus und seinen Söhnen. In: Literaturwissenschaft und Sozialwissenschaften. Bd. 5: Literatur im Feudalismus. Hg. von Dieter Richter. Stuttgart 1975, S. 213–259, hier S. 217–227. 33 Mehrfach wird kommentierend darauf verwiesen, dass „die Hand des Ewigen“ „des Menschen Schicksal“ bestimme (F 1850, 38) und dass dieses Schicksal der Tod sei (vgl. ebd., S. 48, Motto). 34 Annette Gerok-Reiter: Die Rationalität der Angst: Neuansätze im ‚Fortunatus‘. In: Reflexionen und Inszenierung von Rationalität in der mittelalterlichen Literatur. Blaubeurer Kolloquium 2006. Hg. von Wolfgang Haubrichs und Eckart Conrad Lutz. Berlin 2008 (Wolfram-Studien 20), S. 273–298, hier S. 285–288 (Zitat S. 288).
190
Sebastian Speth
2 Räumliche Universalisierung des Zufalls Im Mittelalter sind Meer und Wald die prototypischen Zufallsräume und häufig als unkultivierte Wild- und Ödnis dargestellt.35 Dem steht die ritualisierte Welt des Hofes gegenüber, in der es zwar Störungen der Ordnung gibt, in der jedoch keine aventiure im Sinne eines ‚Zufallenden‘ bestanden werden kann. Auch Fortunatus geht zum Hafen, wenn er auszieht, das Glück der Welt zu suchen, um es in Gestalt der Jungfrau im Wald zu finden.36 Beer geht noch einen Schritt weiter, wenn er den Ich-Erzähler im Corylo Erde und Meer metaphorisch engführen lässt: „Die Erde ist ein Meer/ dann gleich wie ein Schiffender aller Ungelegenheit der stürmenden Winde untergeben ist/ also leben wir auch auf Erden unter dem Joch vieler tausend Beschwernissen/ welche/ gleich wie dort die Winde/ also diese auf Erden mancherley Unglück zu erregen pflegen“ (CO 17; vgl. auch CO 96, 119 und 167 sowie SWK 83). Zu diesen traditionellen Zufallsräumen kommen in der Frühneuzeit Großstädte wie Fortunatus’ London als weitere Spielart hinzu. Ebenfalls sind Sakralräume in den vorliegenden Texten kein heilsgeschichtlicher Hort der Providenz, sondern dem Wirken Fortunas ausgesetzt. Sie sind räumlich und handlungslogisch an den Rand gedrängt und werden von anderen Diskursen dominiert.37
35 Vgl. Mireille Schnyder: Räume der Kontingenz. In: Kein Zufall. Konzeptionen von Kontingenz in der mittelalterlichen Literatur. Hg. von Cornelia Herberichs und Susanne Reichlin. Göttingen 2010 (Historische Semantik 13), S. 174–185, hier S. 174. 36 Vgl. F 1509, 391 f. und 429–431, sowie F 1850, 5 f. und 11–13. Explizit bricht der Held auf, um sein „Glck jenseits des Meeres zu finden“ (F 1850, 5) und dieses „Glck wollte ihm schon im ersten Augenblicke wohl“ (ebd.), insofern er am Hafen auf einen Grafen trifft, der ihn aufgrund des Todes zweier seiner Diener sofort in Dienst nehmen kann (vgl. ebd., S. 5 f.). – Wenig später erfährt Fortunatus im Wald widriges Geschick beim Übergriff des Waldgrafen (vgl. F 1509, 434– 436, u. F 1850, 13–16), wobei ihn in der späten Redaktion die zufällige Begegnung mit einem Fuchs aus dem Gefängnis rettet (vgl. F 1850, 16). 37 Im Fortunatus ist die „[c]hristliche Providenz […] symbolisch durch Fortuna, real aber durch das Geld ersetzt“ (Friedrich [Anm. 18], S. 149). Die religiöse Lebensoption wird nur von Nebenfiguren wie dem irischen Einsiedler vorgelebt, dessen Bekehrungsversuch Andolosia in den Wind schlägt (vgl. F 1509, 537 f., u. F 1850, 50). In der späten Redaktion täuscht Fortunatus private Andacht vor, um an drei Tagen der Woche heimlich mit dem Hütlein um die Welt zu reisen (vgl. F 1850, 37 f.). – Und auch Beers Helden finden nicht zu einem Leben in gottergebener Frömmigkeit: Jan Rebhù kehrt mehrfach aus seiner Einsiedelei in die Welt zurück und seine erfolgreiche Flucht aus dem Gefängnis führt ihn bezeichnenderweise an einer Kapelle vorbei (vgl. SWK 89). Sein temporäres Dasein als Einsiedler wird zudem von ökonomischen Details überlagert: So macht er sich mit 2.000 Dukaten in die Wildnis auf (vgl. SWK 261), hat ein Leopardenfell zur Lagerstätte und ernährt sich von Honig anstatt von bitteren Wurzeln (vgl. SWK 267). Ein Pfarrer im Jucundus legt den Sündern seiner Gemeinde Naturalien-Bußen auf, lässt
Pikarische Kinder des Glücks
191
Daneben wird nun aber gerade auch der Hof als Sphäre des schnellen Auf- und Abstiegs – und damit als Einflussbereich des Zufalls – diskursiv präsent. Der Hof der Edelfrau im Jucundus ist Anlaufstelle für Betrüger, Scharlatane und Heiratsschwindler, die nicht wie im Artusroman in einer Anderwelt zu besiegen sind, sondern vor Ort daran gehindert werden müssen, den Bestand des Hofes zu gefährden.38 Im Fortunatus zeigt sich das ganze Ausmaß der Regentschaft Fortunas an zahlreichen europäischen Höfen, wobei die späte Redaktion fast alle dieser Episoden, ausgenommen die Andolosius-Agrippina-Handlung, tilgt. Somit ist aber die ganze erzählte Welt dem Zufall unterworfen. Beer zeigt dies u. a. mit dem Frontispiz zum dritten Teil seines Simplicianischen Welt-Kuckers (Abb. 2):39 Der kartografische Aufriss einer Weltkugel mit Ländern und Kontinenten ist durchsetzt von moralia wie ‚Vergänglichkeit‘ oder ‚Unbeständigkeit‘. Auf dieser Kugel steht ein Kontrabassspieler. Die Bildkomponente scheint sich vermeintlich auf eine allegorische Lesart oder mit Beer auf einen „Satyrum“ (SWK 214) zu beschränken. Diese steht jedoch in einem Kontrast zur subscriptio („Als Rebhu von Pferd viel runter | War er warlich nicht so munter“), den es aufzulösen gilt. Ich sehe die Beischrift nicht allein als ironische Brechung, die darauf verweist, dass hier Ernstes mit Humor gesagt wird, und die in letzter Konsequenz durch das horazische ‚prodesse et delectare‘ zu beschreiben wäre. Ausgehend von der Diskrepanz der allgemeinen Begriffe und der subjektivierten Beischrift sehe ich das Frontispiz als Hinweis darauf, dass im Welt-Kucker Laster und Tugenden einerseits aus Rebhùs Perspektive40 und andererseits auserzählt als erlebte Lebensweisheit dargeboten werden. Doch kombinieren pictura und subscriptio
Bettler für Almosen arbeiten und vergibt Privilegien an Spielleute (vgl. JJ 151). Auf die Spitze treibt Beer die Ökonomisierung des Sakralen, wenn er die Einsiedelei des Protagonisten im Verliebten Österreicher beschreibt: Es mangelt hier weder an Lektüre und Korrespondenz noch an Waffen, Befestigung und Kleidung. Statt von wilden Tieren bedroht zu sein, zähmt sich der Held einen Tanzbären (vgl. VÖ 320–326). 38 Vgl. für den unsicheren Stand am Hofe auch die „Kurtze Verfassung der Hoffregeln“ (SWK 169–172). Die fünfte Regel besagt: „Blüht heute die Gunst/ so ists Morgen verschwunden“ (SWK 170). 39 Allegorisch gefasst ist diese Lehre mit der „porta inconstantiae“ (SWK 151; zur Interpretation vgl. Hans-Gert Roloff: Geordnete Unordnung – Moralisation und Erzählstrategie bei Johann Beer. In: Jahrbuch der Österreichischen Goethe-Gesellschaft 104/105 [2004], S. 47–63, hier S. 60). Jan Rebhù schlägt gegenüber Miseria die Möglichkeit, sich der Herrschaft Fortunas zu entziehen, ebenso aus (vgl. SWK 186) wie Andolosia gegenüber dem irischen Einsiedler (F 1509, 537 f.). Denn beide sind nicht bereit, auf zeitliches Gut zu verzichten. 40 So heißt es im Text: „Ich […] geige in unverstelter Person“ (SWK 214).
192
Sebastian Speth
Abb. 2: Johann Beer: Der Simplicianische Welt-Kucker [...]. Halle 1679, Frontispiz zum dritten Teil (Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz: Yu 7056–3/4: R)
Pikarische Kinder des Glücks
193
zusätzlich Versatzstücke des Glücksdiskurses. Die Teildarstellung der Weltkugel und das Herabfallen vom Pferd verweisen auf Fortunas Attribute Rad und Kugel.41 Wenn aber die ganze erzählte Welt Wirkungsbereich Fortunas ist, sind die Figuren auch am entlegensten Ort und selbst während einer an Harmlosigkeit kaum zu überbietenden Tätigkeit nicht vor dem Glück sicher. Nur „ein schlechter Fuß-Steig“ (JJ, S. 106) führt in das Heimatdorf des Jucundus, in das Fremde nur gelangen, wenn sie sich verirren (vgl. JJ 105).42 Glückssymbolik ist an diesem Ort in einer Weise verdichtet, dass man mit Walter Haug eigentlich von einem ‚Kontingenzraum offener Möglichkeiten‘ sprechen müsste.43 Doch folgt der hier entfaltete Zufall nicht der willkürlichen Bewegung der Kugel, sondern der mechanisch eingehegten Form von Fortunas Rad. Der Ich-Erzähler expliziert im Folgenden einen ‚relativen Zufall‘,44 wenn er – allerdings aus analeptischer Perspektive – mutmaßt, dass die Gänse, die er in seinem Dorf hütete, „Ursach [s]eines Glückes gewesen“ sein könnten. Schließlich, so der Erzähler weiter, müsse „auch die geringste Sache […] oftermalen zum höchsten Nutzen gereichen“ (JJ 106).45 Zunächst stellt er eine erste Kausalkette vor: Er hütete seine Gänse „an der Mühle […]/ damit sie [ihm] nicht in das Wasser […] geriehten“ (JJ 107). Dabei zeigt er erhöhtes Interesse an der Glücksthematik,
41 Rebhùs Fall ist darüber hinaus ebenfalls eine zufällige Auswahl aus denjenigen Zufällen, die der Langtitel damit ankündigt, dass ebenfalls noch „anderer wundersamen Zuflle Meldung“ geschehe. 42 Wenn nachfolgend das Zufallsgeschehen beschrieben wird, das zu Jucundus’ glücklicher Erhebung führt, so ist auch zu bedenken, dass sich die Edelfrau in seine Heimat verirrt und hier nicht etwa die gesuchte Tochter, wohl aber den zukünftigen Schwiegersohn antrifft. Aufgrund der nicht intendierten, glücklichen Folgen handelt es sich um eine Zufallsbegegnung vice versa. Damit konstruiert Beer eine Handlungsvariante zum mittelalterlichen Liebes- und Abenteuerroman, mit dessen Schema auch der Fortunatus-Autor spielt. 43 Vgl. Walter Haug: Kontingenz als Spiel und das Spiel mit der Kontingenz. Zufall, literarisch, im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit. In: Kontingenz. Hg. von Gerhart von Graevenitz und Odo Marquard. München 1998 (Poetik und Hermeneutik 17), S. 151–172, hier S. 151. – Diese verdichtete Symbolebene erscheint mir wichtiger zu sein als Parallelen zum Anfang von Grimmelshausens Simplicissimus, auf die Alewyn (Anm. 7), S. 155, hinweist (vgl. dazu auch Solbach [Anm. 6], S. 132). Dass Grimmelshausen Beers wichtigster Bezugspunkt ist, wie Alewyn (Anm. 7), S. 153– 156, ausführt, soll freilich nicht bestritten werden. 44 Ein ‚relativer Zufall‘ wird hier mit Aristoteles als Folge des raum-zeitlichen Zusammentreffens zweier oder mehrerer ‚Kausalketten‘ verstanden; vgl. Rüdiger Bubner: Die aristotelische Lehre vom Zufall. Bemerkungen in der Perspektive einer Annäherung der Philosophie an die Rhetorik. In: Kontingenz. Hg. von Gerhart von Graevenitz und Odo Marquard. München 1998 (Poetik und Hermeneutik 17), S. 3–21, hier S. 9. 45 Als Glückskind bedenkt Jucundus nicht, dass im Umkehrschluss dazu die geringste Ursache auch zum größten Schaden gereichen könnte.
194
Sebastian Speth
indem er die drohende Gefahr mit einem Einschub näher beschreibt: Er hütete die Gänse, „damit sie [ihm] nicht in das Wasser/ und also unter die Räder geriethen“ (JJ 107). Freilich sind damit die Mühlräder gemeint. Es fällt jedoch auf, dass nicht nur mit dem Wasser, sondern auch mit dem Rad traditionelle Fortuna-Symbole aufgerufen werden.46 Die Tätigkeit des Gänsehütens trifft nun raum-zeitlich mit einer zweiten Handlungskette zusammen. Die genauen kausalen Umstände ihres Eintreffens lässt der Ich-Erzähler die unbekannte Edelfrau später in einer Binnenerzählung nachtragen. Hier deutet er die Kausalkette im Anschluss an das zuvor Gesagte nur an: Er habe die Gänse gehütet, „damit sie […] nicht […] unter die Räder geriethen“, da „ritte eine Frau den hohen Berg herunter“ (JJ 107). Nur aufgrund seiner Anwesenheit an der Mühle gewahrt er die Edelfrau, die im Weiteren für ihn die Funktion der Fortuna übernehmen wird.47 Und nur aufgrund des Gänsehütens kann er die Bewegung der Frau umlenken. Ihre Kausalkette wird, wenn man so will, zu seiner eigenen. Die von Jucundus herbeigerufene Mutter will der Edelfrau helfen. Während die Adlige von der Höhe herabsteigt, klettert die Mutter die Klippen hinauf (vgl. JJ 107). Dies ist raumsemantisch durchaus als Annäherung der ständisch getrennten Figuren zu verstehen. Jedoch ist der erreichte Zustand prekär: Die „Gelegenheit des Orts“ lässt einen sofortigen Absturz drohen, das Pferd der Dame scheut bei der Ankunft der Bäuerin, und wenn sich die Edelfrau nur etwas weiter niederließe, wäre dies mit großer Gefahr für sie verbunden (vgl. JJ 107). Der Bäuerin ist also der gemeinsame Aufstieg mit der strauchelnden Adligen verwehrt. Nur Jucundus ist dazu ausersehen, seine Heimat und damit die Talsohle seines Glückes gemeinsam mit ihr zu verlassen. Bezeichnenderweise scheitert sein späterer Versuch, die Eltern zu besuchen und somit in sein Heimattal zurückzukehren (vgl. JJ 172). Allerdings erzählt der Erzähler nicht nur, dass – mit Manfred Kremer gesprochen – die Edelfrau „im wahrsten Wortsinn in diese Welt hereinfällt und die
46 Johann Lachinger spricht davon, dass bei Beer das „Bild der Rota Fortunae implizit eingesetzt und […] in der Handlungsstruktur der Romane […] in der immer wiederkehrenden Rotation des Glückswechsels gestaltet“ sei (Lachinger [Anm. 3], S. 81 f.). Der Jucundus exemplifiziere „die Allegorie des Rades der Fortuna, ohne dass die Allegorie als solche im Roman erscheint“ (ebd., S. 82). Zur Radbewegung in diesem Roman unter besonderer Berücksichtigung von Jucundus’ Heimatdorf vgl. ebd., S. 82–87. 47 Beer erhöht dabei allerdings systematisch die Wahrscheinlichkeit des folgenden Geschehens. Die Zufallsbegegnung wirkt dadurch weniger zufällig, sondern eher als Schicksal, das den armen Dorfknaben zum Romanhelden prädestiniert. So gebe es nur einen Weg ins Dorf, den Jucundus in Erwartung des Vaters ständig im Auge behalte (vgl. JJ 106), und da nur wenige Einwohner zu Hause sind, ist es wahrscheinlich, dass Jucundus als einziger das Rufen der Edelfrau wahrnimmt (vgl. JJ 107).
Pikarische Kinder des Glücks
195
glückliche Wende im Leben des Jucundus herbeiführt“,48 sondern er räsoniert auch über das widrige Geschick, die fortuna mala: Hätte sich der Sattel nicht in „einer Wacholder-Stauden“ verfangen, „wär er entweder auf die Mühl-Räder/ oder auf des Mühlers Haus-Dach gefallen“ (JJ 107). Auch wenn Beer nicht den aristotelischen Dachziegel zitiert, so ist der Gedanke an das potenziell fallende Pferd doch die hypothetische Realisierung eines negativen Zufallsgeschehens.49 Der Baum verhindert damit nicht nur das beschriebene Unglück. Auf Symbolebene hält er Mühle und Mühlrad in Takt, das Rad kann sich daher weiter drehen und wird, als Glücksrad verstanden, Jucundus zu Wohlstand und einer vorteilhaften Ehe erheben (vgl. JJ 121, 135 f. u. 186).50 Das pikarische ‚Herumwallen‘ des Helden in der Horizontalen wird, noch ehe es recht begonnen hat, in eine Logik der Vertikalen abgelenkt. Jucundus erweist sich als Glückskind.
3 Das Unglück der Anderen Ist die Erfolgsgeschichte des Jucundus untypisch für einen Pícaro, so ergänzt Beer wie auch in anderen seiner Romane mehrere „fast immer pikareske[ ] Lebensläufe[ ] von Nebenfiguren“.51 Deren Binnenerzählungen sollen den Leser nicht nur unterhalten, vielmehr machen sie Schicksale vergleichbar und entlarven Fortunas wahres Gesicht.52 In der Summe bieten sie Johann Lachinger zufolge
48 Kremer (Anm. 11), S. 119. 49 Den herabfallenden Dachziegel als Inbegriff des Zufalls zitiert Beer dagegen im Corylo (vgl. CO 138). 50 Das eigentlich Beständige ist die Umdrehung des Rades, daher kann sich nach Angabe des Ich-Erzählers auch der älteste Dorfbewohner nicht an die Erbauung der Mühle und des Rades erinnern (vgl. JJ 107). Vielleicht lässt sich durch diese von Beer angelegte Interpretationsfolie erklären, wie es dazu kommt, dass er seinen Erzählrahmen am Romanende nicht schließt und es zu einer Diskrepanz von pikarischer Gattungskonvention und Märchenschluss kommt. Wenn sich das Rad weiter dreht, muss auch das Glückskind zu Fall kommen, daher motiviert der Ich-Erzähler sein Schreiben eingangs mit den traurigen Stunden seiner Betrübnis (vgl. JJ 105), obwohl die Romanhandlung mit der glücklichen Ehe von Jucundus und der Tochter der Edelfrau schließt (vgl. JJ 186). 51 Kremer (Anm. 11), S. 119. Dem „‚Ur-Modell‘ des Lazarillo“ entspreche der „typisch pikareske[ ] Lebenslauf“ des Präzeptors im Jucundus Jucundissimus (ebd., S. 120). Auch Solbach ordnet diesen Lebensbericht als „an der Oberfläche nichts anderes als die Explikation der pikarischen Existenz und der Rolle der Fortuna“ ein (Solbach [Anm. 6], S. 138). Diese „eingelegten Zwischenerzählungen“ sind nach Krämer „meist dem Bereich der Schwankliteratur“ entnommen (Krämer [Anm. 5], S. 140). 52 Solbach (Anm. 6), S. 139, sieht „die Biographien der sekundären Erzähler [als] Proben auf das Exempel der Allgewalt der Fortuna“.
196
Sebastian Speth
„so etwas wie eine vollständige Fortuna-Lehre“.53 Aber die Lebensläufe gehen in dieser Funktion nicht auf. Digressionen haben bei Beer stets Bezug zur Haupthandlung. Zunächst betrachte ich mit den Lebensbeichten der oben erwähnten Edelfrau, ihrer Tochter und ihres untreuen Bräutigams Binnenerzählungen im Jucundus Jucundissimus, bevor ich auf die Andrean-Episode des Fortunatus eingehe. Kaum hat es sich die Edelfrau nach dem Reitunfall in Jucundus’ Elternhaus etwas behaglich gemacht, erzählt sie ihre Lebensgeschichte (vgl. JJ 108–113 und 114–119). Diese ist vor allem von ihrer Schwester geprägt, die in der Perspektive der Erzählerin drei schlechte Eigenschaften in sich vereinigt: Erstens lässt sie zerbrechliches Gut „auf der Glas-Hütte“ herstellen, was sie als Irdisch-Vergänglichem zugewandt abqualifiziert. Zweitens hat sie ein „Gift= und Gall-verbittert Gemüht“ (JJ 109), und drittens fehlt ihr der christliche Glaube, sodass sie ihren Mann54 für einen Anderen verlässt (JJ 109 f.).55
53 Lachinger (Anm. 3), S. 82. 54 Auch an diesem Schwager der Edelfrau zeigen sich die Extreme irdischen Glückswechsels und die beschränkte Einsicht des Menschen: Nachdem er verlassen ist, erhält er eine „KriegsCharge“ und gilt bald als gefallen (JJ 110), doch in Wirklichkeit wurde er „Obrist-Leutenant“ und hat damit sein Glück gemacht (JJ 111). Da er sich darüber hinaus erneut verheiratet, hat ihre Schwester aus Sicht der Edelfrau „die Gelegenheit […] ihre Scharte auszuwetzen“, verpasst (JJ 115). Allerdings hat die Schwester gar nicht den Wunsch, zu ihrem Mann zurückzukehren, sodass nur scheinbar eine Chance vertan ist. 55 Glück und Unglück, Gott und Teufel werden auch von Beers Figuren als Meta-Akteure eingesetzt, deren Eingreifen das verworrene Geschehen in der Horizontalen in eine mechanische Logik überführt: So berichtet die Edelfrau auch noch vom Schicksal ihrer Nichten und Neffen, die der Käufer des von ihr veräußerten Adelssitzes nicht vertragsgemäß versorgt, sondern davonjagt. Doch „[g]leichwie aber die Rache des Himmels kein Laster mit zugeschloßenen Augen ansiehet/ also entstunde ohngefähr ein Jahr darnach eine große und grausame Wasserfluht/ welche ihm Haus und Hof über den Hauffen gerißen“ (JJ 117). Die Untat und das Unglück entsprechen einander, sodass aus Figurenperspektive auf die Wirksamkeit eines göttlichen Gesetzes rekurriert wird. Von dem Erlös ersteht die Edelfrau einen neuen Adelssitz und eine „Wasser-Mühl“, doch wird der „Mühl-Knecht“ erschlagen und „viel Vieh“ kommt ihr zu Tode. Das Unglück, über das der Ich-Erzähler Jucundus nur reflektiert, stößt der Nebenfigur zu. Da dieses Unglück aus ihrer Perspektive jedoch keine Entsprechung in eigenem Fehlverhalten hat, sei es „der Teufel“, den sie „sein Spiel“ mit ihr treiben sieht (ebd.). Der referierende Ich-Erzähler kommentiert dies nicht. So bleibt die vertikale Mythisierung in Kraft, auch wenn sie faktisch widerlegt ist. Der vom Ich-Erzähler etablierte Mechanismus wird dadurch bestätigt. Anders als im Fortunatus, wo „[r] eligiös fundierte Deutungen des Weltlaufs“ als „objektiv falsch, gelegentlich rein ideologisch“ entlarvt werden (Müller [Anm. 14], S. 224), spielt Beer metaphysische Erklärungsversuche nicht gegeneinander aus. Zwar ist „die religiöse Wissensordnung durch andere Ordnungen“ bei Beer wie beim Anonymus „unterwandert“ (Friedrich [Anm. 18], S. 141), jedoch beeinflusst dies bei Beer die Gültigkeit des vertikalen Glücksmechanismus nicht.
Pikarische Kinder des Glücks
197
Viel fehlt nicht und sie hätte die Edelfrau um Leben und Gut gebracht (vgl. JJ 109). Doch wie beim Absturz in Jucundus’ Heimattal hat die Dame auch in dieser Episode Glück im Unglück. Denn ihr vermeintlicher Bräutigam ist niemand anderes als der Geliebte ihrer Schwester, und aus seinem Abschiedsbrief erfährt sie, dass sie nicht nur ausgeraubt worden, sondern das ganze Schloss „in dem Rauch aufgegangen“ wäre, wenn sie ihre vorgeblich reumütige Schwester „nicht so wol tractiret“ hätte (JJ 116). Auch wenn der Edelfrau als einer Nebenfigur großes Unglück zustößt, wird wie häufig bei Beer der Tugendhafte belohnt, während den Missetätern poetische Gerechtigkeit widerfährt.56 Manifestes Ergebnis der kurzen Liaison ist aber eine Tochter, mit der die Edelfrau nach dem heimlichen Weggang des Betrügers schwanger geht (vgl. JJ 116). Der gereifte Ich-Erzähler, der ja auch die Binnenerzählung seiner späteren Gönnerin wiedergibt, deutet die Erzählung am Ende des ersten Buches ähnlich wie der Humanist Georg Burkhardt Spalatin die Schöne Magelone in seinem Sendbrief als Exempelgeschichte für die Notwendigkeit des vierten Gebotes.57 Demnach schmieden „die ungehorsamen Kinder […] durch ihre Laster gleichsam ein Schwerdt/ mit denen sie die Herzen ihrer Eltern durchstoßen“ (JJ 120). Doch gefährdet dieses ‚Schwert‘ zugleich die Kinder selbst, indem ihr Glück in den Tränen der Eltern zu „ersauffe[n]“ drohe (ebd.), wie der Erzähler seine moralisierende Ausdeutung schließt. So offenbart die Tochter in einer weiteren Binnenerzählung später selbst, dass sie und ihr Liebhaber auf der gemeinsamen Flucht Schiffbruch erlitten hätten und letzterer in den auf Handlungsebene realen Wassermassen ertrunken sei. Sie legt den Unfall als Zorn des Himmels aus. Jedoch bewahrt dieses vermeintliche Unglück ihre Unschuld, weshalb sie am Ende des Romans als Jucundus’ sponsa ex machina firmieren kann (vgl. JJ 185 f.).58 Nur der zufällige Tod eines Kammerdieners ermöglicht der missratenen Tochter inkognito eine Rückkehr an den Hof der Mutter, wo sie die Stelle des Verstorbenen einnimmt (vgl. JJ 152 f.). Doch erst unmittelbar bevor die Edelfrau Jucundus als Erben einsetzt und ihn in die Welt schickt, um die Liebe zu suchen, gedenkt der Ich-Erzähler ihrer aufs Neue (vgl. JJ 181). Bei der Brautschau begegnen Jucundus und seinem Präzeptor denn auch nur ungeeignete Kandidatinnen,
56 Ebenfalls werden eine betrügerische Schatzheberin und ein allzu geiziger Edelmann bestraft (vgl. JJ 135 und 106). 57 Vgl. die Edition von Müller (Anm. 1), S. 587–677, hier S. 590–592. 58 Hier lässt sich eine weitere Parallele zwischen Jucundus Jucundissimus und Schöner Magelone ziehen. Wie hier das Ertrinken des Schildknechtes die Unschuld der Frau des Protagonisten bewahrt, so ist es bei Veit Warbeck Peters weitläufige Irrfahrt über das Meer. – Liest man den Fortunatus als Geschichte mangelhafter Erziehung, steht auch dieser Roman Spalatins MageloneDeutung nahe (vgl. Steinmetz [Anm. 15], S. 212).
198
Sebastian Speth
sodass sich der Präzeptor veranlasst sieht, seinen Schützling davor zu warnen, nicht bei der Wahl einer untugendhaften Frau „Glück und Seegen“ zu verlieren (JJ 184). Freilich entscheidet sich das Glückskind Jucundus gegen die sündige Welt und kehrt mit dem Wunsch nach einer tugendhaften Braut zum Hof zurück.59 Dort hat sich der vermeintliche Kammerdiener der Edelfrau zu erkennen gegeben, und einer Hochzeit von Tochter und Ziehsohn steht nichts mehr im Wege (vgl. JJ 185 f.). Die Stöße der fortuna mala, über die der Ich-Erzähler in Anbetracht des gefährdeten Mühlrades weiter oben räsoniert, sind den Lebensgeschichten der Edelfrau und ihrer Tochter vorbehalten. Die Binnenerzähler erfüllen damit diejenige Funktion, die im Pikaroroman üblicherweise dem Helden zukommt. Noch weit drastischer kompensiert die Erzählung eines verurteilten Schwerstkriminellen (JJ 153–158) die Harmlosigkeit, welche die Erlebnisse des Ich-Erzählers auszeichnet. Während Jucundus vertikal vom Glück nur erhoben wird und horizontal vor allem über andere von den Wirren des Lebens erfährt, verhält es sich bei dem geständigen Mörder, den Jucundus auf der Heimreise zu seinen Eltern zufällig im Gefängnis besucht, weil sich sein Begleiter für dessen Physiognomie interessiert, gerade anders herum. Der „arme[ ] Sünder“ soll „geradebrecht werden“, „weil er schon vor etlichen Jahren einen auf öfentlicher Straßen erschlagen hätte“ (JJ 153).60 Er verweist auf seine „verderbte Natur“ (ebd.), für die er nun die verdiente Strafe empfange (vgl. ebd., S. 158).61 Verhinderte eine Generalamnestie zuvor seine Bestrafung, ohne Besserung zu bewirken, so hofft der Verbrecher nun darauf, dass seine Untaten als Buch abgefasst würden, damit sie anderen zur Abschreckung dienen könnten (vgl. S. 157 f.). Damit stimmt Jucundus’ eigene Deutung dieser Binnenerzählung überein, da er am Beispiel des Verbrechers erkannt habe, „[d]aß alle Laster zu seiner Zeit müßen gestraffet werden“ (S. 158). Diese moralistische Funktion macht auch Hans-Gert Roloff für Beers Schreiben im Allgemeinen stark,62 jedoch lässt sich die erzähllogische Funktion
59 Auch Fortunatus lehnt bei der Suche nach einer geeigneten Braut bloße „Zierffchen“ als mögliche Partnerinnen ab (F 1850, 27). Auch in der späten Redaktion hat er letztlich die Wahl zwischen den drei Grafentöchtern, die hier Germania, Marsopia und Kassandra heißen (vgl. ebd., S. 28–30). Neu ist, dass der König allen die gleiche Frage, und zwar diejenige nach dem gewünschten Ehemann, stellt. Der emotionalisierenden Bearbeitungstendenz entsprechend fällt die Wahl auf Kassandra, die „denjenigen whlen [will], welcher [sie] gewhlt htte“ (ebd., S. 29), während ihre Schwestern den Reichsten beziehungsweise den Schönsten begehren. Die Tugendhaftigkeit spielt bei der Entscheidung also keine Rolle. 60 Bereits zuvor wird der Lockvogel der Bande gerädert (vgl. JJ 156). Eine Strafe, die mit dem Rad wiederum das Glücksrad – und damit die Vertikale – evoziert und die ja auch im Erstdruck des Fortunatus den Schlusspunkt der Handlung setzt. 61 So auch in Orbatos Abschiedsrede im Simplicianischen Welt-Kucker (SWK 331). 62 Vgl. Roloff (Anm. 39), vor allem S. 48–51.
Pikarische Kinder des Glücks
199
dieser Binnenerzählung nicht darauf beschränken. Denn schließlich lässt sich eine solche Lehre aus dem Geständnis jedes Sünders ziehen. Doch dieser Kapitalverbrecher ist keine austauschbare Figur. Nicht jetzt erst trifft er raum-zeitlich mit Jucundus zusammen. Schon zuvor hatte er den Weg von Jucundus’ Gönnerin, der namenlosen Edelfrau, gekreuzt, und auch Jucundus kreuzt zuvor an einem entscheidenden Wegstein seines Lebens zumindest räumlich den Weg des Verbrechers. Die zufällige Episode webt sich damit ein in das Netz des Rahmentextes und erhält durch den Wunsch des Verbrechers nach Verschriftung seiner Erzählung sogar autopoetisches Gewicht. Nach eigener Angabe hat der Mörder mit seiner Diebesbande „oft in einer Woche zwanzig Personen“ erschlagen (JJ 155), kam bislang aber immer mit dem Leben davon. Doch gerade jetzt, als der Held des Romans in ihm seinem zukünftigen Schwiegervater begegnet, besteht keine Aussicht auf irdische Rettung mehr. Außerdem ist das Verbrechen, für das er die Todesstrafe empfangen soll, eben der Mord, den er just an derjenigen Stelle verübt hat, an welcher sich Jucundus von seinem Vater verabschiedet, als er in den Dienst der Edelfrau, also der geprellten Gattin des Mörders, eintritt (vgl. S. 121). Der Aufstieg des Jucundus und der Abstieg des Mörders sind damit enggeführt.63 Obwohl der fragliche Tatort nicht an einer Mühle oder einem anderen Ort liegt, der symbolisch für ‚Glück‘ stehen kann, sondern „bey einer Creutz-Seule“ (S. 153), vollzieht sich die Engführung mechanisch; ähnlich wie Gewicht und Gegengewicht am Fortuna-Rad voneinander abhängen (regnabo – regnavi). Dass der Verbrecher für diese Tat unter den Augen des Herrn büßt, korrespondiert mit seiner Selbstbeschreibung, nach der er und die Diebesbande ein „recht [t]euflisch[es]“ Leben führten und das Vaterunser mit „Blut-Gierigkeit“ vertauscht hätten (S. 155). Der sakrale Raum bewahrt ein Stück weit seine herausgehobene Stellung, wobei der Erzähler nicht erwägt, dass Christus doch auch für diesen Sünder gestorben sein müsste. Stattdessen hält Beer am Mechanismus innerweltlicher Bestrafung der Untugend fest. Da er Jucundus jedoch vor Vollstreckung des Urteils weiterziehen lässt, bleibt das Ende der Episode letztlich offen. Darüber hinaus inszeniert Beer die Begegnung mit dem Kapitalverbrecher aber auch, um das eigene Schreiben zu rechtfertigen. Während er von der Prosaromanlektüre ein Bild als nutzlose Zeitverschwendung mit unwahren Narrenpossen entwirft, hebt er das eigene Romanschaffen differenziert von solcher Kritik
63 Anhand der Figurenkonstellation Jucundus – Edelfrau – Mörder – Tochter wird der Zufall als ‚Wegbahner‘ offenbar, der im Sinne Klaus-Detlef Müllers als eine ‚verkürzte Kausalität‘ seinen Ausgang in den aufeinander bezogenen Charakteren der Figuren hat; vgl. Klaus-Detlef Müller: Der Zufall im Roman. Anmerkungen zur erzähltheoretischen Bedeutung der Kontingenz. In: GRM 28 (1978), S. 265–290, hier S. 280.
200
Sebastian Speth
ab. Wenn er von Lastern erzähle, dann immer im Hinblick auf die Bekehrung des Lesers (vgl. SWK 295).64 Aber die Parallele der Intentionen von Binnenerzählung und Roman führt noch weiter. Denn der geständige Sünder bringt als zweites Ziel des gewünschten Biografie-Projekts vor, dass der Leser „sehen könte/ daß alle Sachen nur eine Zeit lang währen“ (JJ 157), dass also – horizontal – auch das Leben in einer Räuberbande keinen Bestand hat, sondern dem Glück unterworfen ist.65 Einblicke in die Wandelbarkeit des Weltlaufs zu geben, erweist sich als eines der Zentralanliegen von Beers Romanschaffen. Der Wandel vollzieht sich dabei aber nicht entsprechend der Logik der Kugel-Ikonografie heil- und ziellos, sondern nach der ‚gezähmten‘ Fortuna-Ikonografie des Glücksrades mit Belohnung der Tugend und Bestrafung der Sünde. Da Jucundus’ Versuch, seine Eltern zu besuchen, aufgrund von deren Tod scheitert und der Erzähler die Episode zu einem schnellen Ende führt (vgl. JJ 172), zeigt sich deren tatsächliche Funktion. Sie dient nicht dazu, die Haupthandlung voranzutreiben oder den Protagonisten pikarisch, d. h. horizontal, durch die erzählte Welt zu führen. Es geht vielmehr um die Inszenierung zufälliger Begegnungen mit Erzählern von Binnengeschichten, die aber aufgrund der Nähe zum Ich-Erzähler von größter Relevanz für die Haupthandlung sind. Ich komme nochmals zum Fortunatus zurück. Existenzielle Bedrohung für den Helden hat hier die Nebenhandlung um den „Glücksritter[ ] Andrean“, dessen „verbrecherische Laufbahn […] ihre Richtung bei jeder Chance“ ändert, „die er ergreifen zu können glaubt“.66 Der Name ‚Andrean‘ wird im Erstdruck sehr spät und als Parenthese nachgetragen. Im 17. und 18. Jahrhundert wird Andreas dagegen schon am Anfang der Episode namentlich genannt. So hat die Episode ursprünglich größeres exemplarisches Gewicht, während in der weiteren Textgeschichte die Integration einer weiteren Lebensgeschichte im Vordergrund steht.67
64 Vgl. Krämer (Anm. 5), S. 218, der darauf hinweist, dass „sich das programmatische Chaos der Lebenslaufebene, auf der der Zufall regiert und ein Kausalnexus zwischen den Episoden nur rudimentär gegeben wird oder völlig fehlt, auf der Erzählebene wieder zu einer sinnvollen Einheit“ ordne. 65 Auch „des Authoris Glück-Liebende Person“ reimt am Beginn des zweiten Teils des WeltKuckers: „[…] wir sollen lehren/| Wie sichs mit uns auch bald kan wunderlich verkehren. | Das Glück hat Strick und Tück/ es hat ein’n Weiber-Sinn/| Und kommet/ wo man offt nicht hat vermuthet hin. | Den hebt sie auff den Thron/ den andern läst sie fallen/| Und machts mit einem nicht wie mit den andern allen. | Den setzt sie in die Schul/ den andern auff den Chor/| Den einen führt sie ein/ den andern aus zum Thor“ (SWK 107). 66 Müller (Anm. 14), S. 221. 67 Auch bei der Waldgrafen-Episode wird der Name dieses Antagonisten erst ganz am Ende der Episode nachgetragen (vgl. F 1509, 436). – Friedrich (Anm. 18), S. 150, bezeichnet bereits die Andrean-Episode im Erstdruck als einen mehrerer „fragmentarische[r] Lebensläufe[ ]“.
Pikarische Kinder des Glücks
201
Was auf der Handlungsebene im Erstdruck als das Zusammentreffen zweier Kausalketten erscheint, durch das Fortunatus in Lebensgefahr gerät, ist vom arranger der Erzählung bedeutsam vorbereitet (F 1509, 408–426). Denn die Figuren sind als Antagonisten angelegt.68 Kompensiert Beer mit dem Kapitalverbrecher den Schemabruch, der in Jucundus’ dauerhaftem Glück besteht, zeigt der Fortunatus durch die Lebensgeschichte des Andrean ein gegensätzliches Verhalten von Figuren in vergleichbarer Ausgangssituation auf.69 In der späten Redaktion ist die Episode um mehrere Begleitumstände reduziert (vgl. F 1850, 8–10). Andreas fädelt es geschickt ein, alleine mit dem Edelmann zu sein, um ihn zu ermorden. Schon zuvor hat er sich bei dessen Frau beliebt gemacht, weswegen sie keine Bedenken trägt, ihm die Juwelen anzuvertrauen. Da diese hier dem Edelmann selbst und nicht wie in der ursprünglichen Fassung dem König von England gehören, werden die Edelsteine von diesem auch nicht vermisst. Die zufällige Wiederentdeckung des Kästchens entfällt. Statt wie im Erstdruck mit leeren Händen in die Länder der Heiden zu fahren, bricht der erfolgreiche Andreas alsbald nach Frankreich, in der späten Redaktion seine Heimat, auf. Diese Änderung steht in krassem Widerspruch zur moralisierenden Grundtendenz der Redaktion. Ob diese in der vorliegenden Form tatsächlich intendiert war, darf aber aufgrund der fehlerhaften Textlogik in der entscheidenden Formulierung bezweifelt werden. So trägt „[d]ie Edelfrau“, deren Gunst Andreas gewonnen hat, „ein Bedenken, ihm die Schtze zu vertrauen“ (F 1850, 9), Andreas geht aber „sogleich damit nach dem Hafen“ (S. 10, meine Hervorhebungen). Korrigierte man statt der ersten die zweite Formulierung, so entfiele die folgenreiche Variante; allerdings stellte eine Emendation der ersten Stelle den kleineren Texteingriff dar. Indes muss offenbleiben, welche der beiden Formulierungen im Sinne des Redaktors zu emendieren wäre. Unabhängig davon wird jedoch durch die Kürzungen das Eigengewicht der Nebenhandlung minimiert, und das Augenmerk verschiebt sich schneller wieder auf den Protagonisten. Fährt Fortunatus über Meer, als sich der Betrüger und Mörder bei seinem Herrn einschleicht, „traf [es] sich gerade“, dass er wieder zurückkehrt, als die königlichen Häscher Hyronimus und die Seinen gefangen nehmen (F 1850, 10). Und er hat „schon den Strick um den Hals“, als der Kapitän seine Unschuld bezeugt (ebd.).
68 Beide verlieren ihr Hab und Gut in fragwürdiger Gesellschaft, sodass nicht einmal die Huren ihnen Kredit einräumen; und als Fortunatus in den Dienst Hieronymus Robertis eintritt, weiß der Leser bereits, dass Andrean auf dem Weg zu diesem ist. – Daher ist auch Haferlands Einschätzung zu relativieren, nach der die Episode „quer zur […] Haupthandlung“ stehe (Haferland [Anm. 30], S. 362, und ähnlich S. 363). 69 Vgl. z. B. die Parallele der Ausgangssituation für Ampedo und Andolosia.
202
Sebastian Speth
Wie Fortunatus suchen auch Andrean und Andreas nach ihrem Glück. Während der Erste scheitert, hat der Zweite Erfolg. Doch beide gehen für ihr Glück über Leichen. Fortunatus zeichnet sich dagegen gleichermaßen durch ‚Leistung‘ und ‚Unterwürfigkeit‘ aus.70 Für die Rezipienten des Erstdrucks muss Andrean nach seiner Flucht in die Länder der Heiden und seiner Konversion zum Islam als endgültig Gescheiterter gelten.71 Fortunatus wird in der Episode dagegen nur vorübergehend an einen Tiefpunkt innerhalb der menschlichen Gesellschaft geführt, ehe er in der Wildnis des Waldes auch dieser noch verlustig geht, sogleich aber der Jungfrau des Glücks begegnet (vgl. F 1509, 426–431, und F 1850, 10–13). In beiden Fällen, im Erstdruck wie in der späten Redaktion, wird dem Helden, der zum Glückskind auserkoren ist, eine moralisch fragwürdige Kontrastfigur an die Seite gestellt, die ihre Ziele verfehlt und dann aus der Handlung verschwindet. Hält man für die späte Redaktion an Andreas’ erfolgreichem Raub fest, eröffnet sich allerdings eine deutungsbedürftige Parallele zur Haupthandlung, indem der Mörder Andreas sein Glück ebenso findet wie Fortunatus, der 1850 ebenfalls einen Menschen tötet. Denn anders als im Erstdruck ist es hier der Held selbst, der in Konstantinopel den diebischen Wirt ersticht (vgl. F 1850, 24). Da Fortunatus den Untergang seines Geschlechts nicht verhindern kann, erweist sich die Schluss-Moralisation auch hier als gültig, obwohl der Protagonist zeitlebens ein Kind des Glückes bleibt.
4 Pikarische Horizontale erzählter Zufälle und mechanische Vertikale moralischer Bestimmung Der Hof, sakrale Räume und selbst ein abgelegenes Bauerndorf sind bei Beer dem Zufall ausgeliefert. Der Held, Jucundus, sorgt dafür, dass die Bewegung des Fortuna-Rades intakt bleibt. Fortunatus lässt sich vom Glücksverlust des Vaters nicht erschrecken und zieht in die Welt, um sein Glück zu wählen. Beide Helden erweisen sich als Kinder des Glücks. Beer setzt seine Figuren Zufällen aus, und das meint – bedenkt man das starke Gewicht, das Liebeshändel in seinen Romanen ausmachen – potenziel-
70 Freundlicher Hinweis auf diese einander ergänzenden ‚Kardinaltugenden‘ des Prosaromanheldentums von Herfried Vögel. 71 In der 1850er Redaktion konvertiert Andreas hingegen nicht und entkommt, wie gesagt, nach Frankreich, wohin auch Fortunatus weiterzieht. Dieser begegnet Fortuna in der Picardie.
Pikarische Kinder des Glücks
203
len Versuchungen. Die Binnenerzählungen bieten zahlreiche Aktualisierungen solcher Zufälle und kompensieren die Harmlosigkeit der Haupthandlung. Schon die Titelformulierung des Jucundus Jucundissimus kündet vom vertikalen Aufstieg des Helden und hebt diesen von den Zufällen in einer pikarischen Horizontalen ab. Das Glück ist berechenbar, insofern Beer einen Mechanismus von Tugend und Glück, Schuld und Unglück etabliert, der bis ans Romanende Gültigkeit besitzt. Zumindest in der Variante des Jucundus lässt sich die Fortuna des Pícaro durch moralisches Wohlverhalten einhegen und milde stimmen. Die Sünder werden gerichtet, Jucundus und die bekehrte Tochter machen ihr Glück, und die Edelfrau hat ihr Erbe wohl geordnet. Für das Ende von Corylo und Simplicianischem WeltKucker gilt dieser Mechanismus im Übrigen nicht. Das Titelbild der Fortunatus-Redaktion von 1850 zeigt die Horizontale der erzählten Welt, in der irdische Glücksquellen vergleichgültigt sind. Nicht Fortunatus und seine Söhne, sondern Fortuna und ihre Glücksgüter sind die Helden der Titelillustration. Doch stärkt die moralisierende Tendenz dieser Redaktion die vertikale Bewegung des Glücksrades und reduziert das pikarische Element des horizontalen Herumwallens. Das Nachwort des Erstdrucks ist durch eine narrativierte moralisatio ersetzt, die im Zusammenspiel mit der Kommentierung durch Erzähler und Motti entgegen der vom Titelbild etablierten Sinndeutung einen Schuld-Strafe-Mechanismus einführt und die erzählten Zufälle damit einhegt. Erst die späte Redaktion von 1850 moralisiert die Erzählung konsequent und führt die Geschichte, mit Ausnahme der Andreas-Episode, zu poetischer Gerechtigkeit, wie sie Beer im Jucundus Jucundissimus allenthalben walten lässt.
Simon Zeisberg
Orte des Eigenen, Orte des Anderen Zur Poetik des Handelns in Johann Beers pikarischen Romanen
I Um den Zusammenhang von pikarischem Handeln und Erzählen in der Frühen Neuzeit zu erhellen, wurde in der Forschung der letzten Jahre wiederholt auf Michel de Certeaus Unterscheidung strategischer und taktischer Handlungsweisen zurückgegriffen.1 Sie findet sich erläutert in seiner Kunst des Handelns (1980) und sei hier zunächst in aller Kürze referiert. Strategisch kann laut Certeau nur dort gehandelt werden, wo das handelnde Subjekt einen Ort hat, der „als etwas ‚Eigenes‘ umschrieben werden […] und somit als Basis für die Organisation seiner Beziehungen zu einer bestimmten Außenwelt […] dienen kann“.2 Wo diese Basis fehlt, wird Handeln bei Certeau unweigerlich zu taktischem Handeln. Taktik erscheint somit prinzipiell als das Andere von Strategie: Die Taktik hat nur den Ort des Anderen. Sie dringt teilweise in ihn ein, ohne ihn vollständig erfassen zu können. Sie verfügt über keine Basis, wo sie ihre Gewinne kapitalisieren, ihre Expansionen vorbereiten und sich Unabhängigkeit gegenüber den Umständen bewahren kann. Das ‚Eigene‘ ist ein Sieg des Ortes über die Zeit. Gerade weil sie keinen Ort hat, bleibt die Taktik von der Zeit abhängig; sie ist immer darauf aus, ihren Vorteil ‚im Flug zu erfassen‘. Was sie gewinnt, bewahrt sie nicht. Sie muß andauernd mit den Ereignissen spielen, um ‚günstige Gelegenheiten‘ daraus zu machen. Der Schwache muß unaufhörlich aus den Kräften Nutzen ziehen, die ihm fremd sind.3
1 Der vorliegende Aufsatz greift Gedanken auf, die ich im Rahmen meiner 2014 an der Freien Universität Berlin verteidigten Dissertation auf literar- und ökonomiehistorisch breiterer Basis verfolgt habe. Die Beobachtungen zum Spannungsfeld von Besitz und Besitzlosigkeit bei Johann Beer finden sich teilweise gleichlautend in einem Kapitel der Dissertation, werden hier jedoch einer neuerlichen Prüfung unterzogen und mit Blick auf die Fragestellung des Bandes neu gewichtet. 2 Michel de Certeau: Kunst des Handelns. Aus dem Französischen übersetzt von Ronald Voullié. Berlin 1988 (Internationaler Merve-Diskurs 140), S. 23. Die deutsche Ausgabe trägt den Titel, den Certeau dem ersten und einzig erschienenen Band seiner L’invention du quotidien gegeben hat (L’art de faire). 3 Ebd., S. 23.
206
Simon Zeisberg
Was diese Unterscheidung für die Pikaresken-Forschung interessant macht, zeigt der Blick auf die Problemzusammenhänge, in denen sie bisher eingesetzt wurde.4 Gleich zwei Aufsätze des Sammelbandes Paradigma des Pikaresken (2007) ziehen Certeau mit Blick auf die spanische Vida de Lazarillo de Tormes (1554) zurate. Sowohl Christian Wehr als auch Robert Folger erkennen im Protagonisten, dem um seine Ehre und sein Auskommen kämpfenden Lazarillo, den Prototyp des pikarischen Taktikers – eine marginalisierte Figur, die sich in einer ihr fremden Konstellation von Macht und Autorität zu behaupten sucht.5 Dies betrifft Lazarillos Rolle als Handelnder in der erzählten Welt ebenso wie seine Rolle als Erzähler. Die anonyme Autorität, an die er seinen Diskurs adressiert – angesprochen wird sie als Vuestra Merced –, vertritt die offizielle Ordnung der Dinge (sei diese nun juridischer, bürokratischer, epistemischer oder auch religiöser Art). Ihr gegenüber verfügt Lazarillo nur über das Mittel der Rede im Modus des Als-Ob. Wehr spricht in diesem Zusammenhang mit Certeau von zwei „konträre[n] Diskurstypen“, die sich im Text niederschlagen: „Während die strategische Sprache von amtlich-juridischer Eindeutigkeit ist, so überträgt die Taktik die Uneigentlichkeit der Finte auch in die Vieldeutigkeit ihrer Rede.“6 Wenn Lazarillo von sich erzählt, hält er sich nur auf den ersten Blick an die „Handlungs- und Funktionsregeln“7 des geltenden Diskurses. Bei näherem Hinsehen erweist sich seine Rede als „vieldeutig-listiges Argument gegen die anonyme Instanz der offiziellen Ordnung“.8
4 Beim folgenden kurzen Forschungsüberblick geht es nicht um Vollständigkeit, sondern darum, die Fragestellung dieses Aufsatzes aus rezenten Ansätzen der Forschung herzuleiten. 5 Vgl. Christian Wehr: ‚La Vida de Lazarillo de Tormes‘ und die Form der Individualität im Roman. In: Das Paradigma des Pikaresken. The Paradigm of the Picaresque. Hg. von Christoph Ehland und Robert Fajen. Heidelberg 2007 (GRM-Beiheft 30), S. 25–43, hier bes. S. 38–40; Robert Folger: The Picaresque Subject Writes: ‚Lazarillo de Tormesʻ. In: Ebd., S. 45–68, hier bes. S. 46 f. und 53 f. Während Folger den Machtkomplex, dem Lazarillo ausgesetzt ist, mit der spanischen Bürokratie des 16. Jahrhunderts identifiziert, verzichtet Wehr auf eine allzu spezifische Zuweisung. Die „zentrale[ ] Autorität“ (S. 38) bzw. „überindividuelle[ ] Macht“ (S. 39), von der er spricht, erscheint nicht auf eine konkrete Institution festgelegt, sondern lässt sich als Komplex verschiedener Formen institutionalisierter Autorisierung von Wissen, Glauben und Handeln im historischen Bezugsfeld des Romans denken – ein Ansatz, der der diskursiven Vielschichtigkeit des Textes eher gerecht wird. 6 Wehr (Anm. 5), S. 39. 7 De Certeau (Anm. 2), S. 25. 8 Wehr (Anm. 5), S. 39. Wie listig dieses Argument tatsächlich ist, bleibt diskutabel. Folger (Anm. 5), S. 46, geht über Wehr noch hinaus, wenn er Lazarillo die Herstellung einer ‚eigenen‘ Subjektivität attestiert: „This tactical kernel opens up the possibility of self-fashioning that counteracts the normalizing thrust of interpellation. I will trace how this dispositive of subjection and self-fashioning resonates in ‚Lazarillo de Tormes‘, arguing that the novel describes a process in which a nomadic self gradually carves out its own ‚place‘ and asserts its subjectivity […].“
Orte des Eigenen, Orte des Anderen
207
Der Einsicht in die taktische Redeweise des Pícaro fügt Wehr eine strukturelle Perspektive hinzu, die für die folgenden Ausführungen besonders wertvoll ist. Wie er feststellt, besteht ein enger Zusammenhang zwischen der Offenheit des pikarischen Syntagmas und dem „unabschließbaren Handlungszwang“, unter dem der Pícaro als Taktiker steht.9 Vom ‚Ort des Anderen‘ aus erzählt, muss „die pikareske Vita einer Logik des endlosen Aufschubes“ folgen: „Ihre besondere Form erwächst aus einer supplementären Kette von Ereignissen und Konstellationen, von der zu sehen war, dass sie niemals ein endgültiges Ziel findet.“10 Die Beobachtung der Verknüpfung von Erzählstruktur und pikarischem Handlungsmodus eröffnet Möglichkeiten, die von der Pikaresken-Forschung systematisch erstmals im Sammelband Syntagma des Pikaresken (2014) ausgelotet worden sind.11 Wie sich dabei gezeigt hat, beschränkt sich pikarisches Erzählen keineswegs darauf, der ‚Logik des endlosen Aufschubes‘ (Wehr) zu folgen. Vielmehr lassen sich im 17. Jahrhundert Tendenzen ausmachen, die auf eine Verbreiterung der Möglichkeiten des Genres in struktureller Hinsicht schließen lassen. Dies betrifft zum einen die seit Mateo Alemáns Guzmán de Alfarache (1599/1604) zu beobachtenden Versuche, das offene Syntagma des Pikaresken durch den Einsatz christlicher conversio-Konzepte zu paradigmatisieren.12 Zum anderen, und für die folgenden Überlegungen wichtiger, lassen sich Varianten der Paradigmatisierung ausmachen, die auf eine weltliche Etablierung des Pícaro hinauslaufen. Ein europaweit einflussreiches Beispiel dafür hat Jan Mohr in erwähntem Sammelband untersucht. Seine auf Certeau zurückgreifende Lektüre des Avanturier Buscon (1633), der französischen Übersetzung des Buscón Francisco de Quevedos (1626),
Aus Sicht des Certeau’schen Ansatzes fragt sich, ob in diesem Fall dann überhaupt noch von taktischem Sprechen die Rede sein kann. Gegen beide Positionen lässt sich anführen, dass der Roman gerade zum Ende hin nicht an Ironiesignalen spart – man denke nur an die Darstellung der ménage à trois Lazarillos mit seiner Frau und dem Erzpriester. Nimmt man diese Signale ernst, so führt meines Erachtens kein Weg daran vorbei, anzuerkennen, dass das Scheitern von Lazarillos Rede – ihre Entlarvung als List durch Vuestra Merced bzw. den Leser – zum poetisch-rhetorischen Kalkül des Textes gehört. Vgl. dazu meinen Aufsatz: Ein Fall scheiternder Evidenzrede. Die ‚Vida de Lazarillo von Tormes‘ (1554). In: Die ‚Vita‘ als Vermittlerin von Wissenschaft und Werk. Form- und funktionsanalytische Untersuchungen zu frühneuzeitlichen Biographien von Gelehrten, Wissenschaftlern, Schriftstellern und Künstlern. Hg. von Karl. A. E. Enenkel und Claus Zittel. Berlin 2013 (Scientia Universalis 1), S. 105–119. 9 Vgl. Wehr (Anm. 5), S. 39. 10 Ebd., S. 40. 11 Jan Mohr/Michael Waltenberger (Hg.): Das Syntagma des Pikaresken. Heidelberg 2014 (GRMBeiheft 58). 12 Vgl. dazu u. a. Matthias Bauer: Das Sagbare umschreiben: am Beispiel des ‚Guzmán‘. In: Mohr/Waltenberger (Anm. 11), S. 257–280.
208
Simon Zeisberg
arbeitet die strukturellen und semantischen Verschiebungen heraus, die zur sozialen und ökonomischen Etablierung des Protagonisten führen.13 Anders als sein spanischer Vorgänger Pablos erzählt der französische Buscon nicht vom ‚Ort des Anderen‘ aus. Vielmehr hat er am Ende seines Parcours einen ausreichend hohen Grad an ‚Unabhängigkeit gegenüber den Umständen‘ (Certeau) erreicht, um seine durch „strategisches Listhandeln“ erlangte Position in der (adligen) spanischen Oberschicht dauerhaft zu sichern.14 Mit der Überwindung des Okkasionellen kommt die Beweglichkeit15 des Pícaro zum Erliegen. Das Syntagma der Erzählung schließt sich. Der Überblick über die Perspektiven der jüngsten, an Certeau geschulten Pikaresken-Forschung soll mir im Folgenden dazu dienen, eine Konfiguration von pikarischem Erzählen und Handeln in den Blick zu nehmen, die zum Modell des Aventurier Buscon eindeutige Parallelen aufweist. Die Rede ist von den sozialen und ökonomischen Erfolgsgeschichten pikarischer Protagonisten in den frühen Romanen Johann Beers (1655–1700). Wie im Aventurier Buscon besteht deren „makronarrative[s] Basis-Sujet“ darin, den Aufstieg ihrer Protagonisten in die „Oberschicht“ ihrer Welt zu zeigen, wobei „die Aussicht auf Adel und ökonomische Sicherstellung ineins gehen“.16 Unter welchen sozialen Voraussetzungen dieser Aufstieg stattfindet, ist in den Romanen je verschieden. Die Protagonisten des Simplicianischen Welt-Kuckers (1677–1679), des Corylo (1680) und des Jucundus Jucundissimus (1680) stammen zwar nicht aus derselben Schicht – Jan Rebhu ist Sohn eines verarmten Bürgers, Corylo eines Bauern, Jucundus eines mittellosen Ziegelbrenners –, haben jedoch den Makel der ‚niederen‘ Geburt gemeinsam. Mit Certeau könnte man sagen: Sie verfügen über keine genealogische Basis des ‚Eigenen‘, die ihr Handeln in der adligen Oberschicht, in die sie aufsteigen, unterstützen würde. Das sieht im Fall des sogenannten Willenhag-Romans (1682/83) anders aus. Dessen Protagonist Zendorio-Wolffgang17 wächst zwar als Sohn eines
13 Vgl. Jan Mohr: ‚Buscón‘ französisch. Zum semantisch-strukturellen Profil der Adaption durch La Geneste (1633). In: Mohr/Waltenberger (Anm. 11), S. 209–239. Einen wesentlichen Anteil an der Verschiebung der Position des Pícaro hat die Tatsache, dass der französische Übersetzer das Ende des Romans tiefgreifend modifiziert. Im Rückgriff auf eine Novelle José Camerinos wird bei ihm die Erzählung bis zu dem Punkt fortgesetzt, an dem Buscon seinen Aufstieg zum wohlhabenden Adligen absolviert hat und aus der neuen Rolle heraus überlegen zu agieren versteht. 14 Zu diesem Aspekt vgl. ebd., S. 223–231. 15 Beweglichkeit hier mit Lotman als die – wie auch immer notgedrungene – Fähigkeit literarischer Figuren verstanden, die Grenzen semantischer Räume zu überschreiten. Vgl. Jurij M. Lotman: Die Struktur literarischer Texte. Übersetzt von Rolf-Dietrich Keil. München 1972, S. 338 f. 16 Mohr (Anm. 13), S. 239. 17 Wie (fast) alle Figuren des Doppelromans hat auch dessen Haupt- und Erzählerfigur zwei
Orte des Eigenen, Orte des Anderen
209
Schinders auf. Wie sich noch im Laufe der Erzählung herausstellt, ist er tatsächlich jedoch adliger Abstammung. Besitzt er damit die genealogische Basis des ‚Eigenen‘, die den anderen Figuren fehlt, so liegt die Pointe des Romans darin, dass er dennoch durchgängig den Eindruck vermittelt, dass nicht die Herkunft, sondern kluges Handeln die Voraussetzungen für die Etablierung der Figur am ‚Ort des Eigenen‘ darstellt. Welcher Art aber ist dieses Handeln und wie verhält es sich zu den Strukturmerkmalen einer pikarischen Erzähltradition, in der der Übergang vom Anderen zum Eigenen immer auch poetologische Konsequenzen hat – etwa indem dort, wo pikarische Beweglichkeit zum Stillstand kommt, sujetlose Erzählräume entstehen, denen es an Welthaltigkeit im Sinne pikarischer Chronotopik mangelt?18 Die folgenden Ausführungen unternehmen den Versuch, die innere Verflechtung der Dimensionen von Handeln und Erzählen in Beers frühen Romanen aufzuzeigen und einige Vorschläge zur wissens- sowie sozialhistorischen Kontextualisierung zu unterbreiten. Dass dabei auf Fragen der Poetik besonders Acht gegeben wird, versteht sich nicht nur vor dem Hintergrund der Problemstellung vorliegenden Bandes. Vielmehr wird damit auch der Tatsache Rechnung getragen, dass Beers Texte die ihnen eingeschriebenen Spannungen zwischen dem Eigenem und dem Anderem des Handelns in bemerkenswerter Konsequenz in poetologische Reflexionszusammenhänge transponieren. Beers pikarische Romane entwerfen nicht nur ein Spektrum an Figuren, die an der Grenze bestimmter sozialer Identitäts- und Alteritätskonstruktionen des späten 17. Jahrhunderts operieren. Sie führen darüber hinaus einen Diskurs poetischer Selbstverständigung, der das Spiel mit diesen Grenzen als Funktion des Erzählens reflexiv beobachtbar macht.
II Die Forschung hat bereits mit Berns’ Studie zu den Willenhag-Romanen auf die Konzentration der Erzählungen auf „zwei nach Herkunft, Besitz und demnach Unabhängigkeit zu unterscheidende Personengruppen“ hingewiesen, die in
Namen: Die Figur, die im ersten Teil, den Teutschen Winternächten, Zendorio heißt, tritt im zweiten Teil, den Kurtzweilgen Sommer-Tägen unter dem Namen Wolffgang auf. Betrifft eine Aussage zur Figur den Gesamtkontext des Doppelromans, werde ich im Folgenden daher von Zendorio-Wolffgang sprechen. 18 Dass gerade hierin eine der großen Herausforderungen Beer’scher Romanpoetik liegt, hat Solbach in seiner ausgreifenden Untersuchung gezeigt. Vgl. Matthias Solbach: Johann Beer. Rhetorisches Erzählen zwischen Satire und Utopie. Tübingen 2003 (Frühe Neuzeit 82), S. 420– 440 et passim.
210
Simon Zeisberg
immer neuen Figurationen in den Texten auftauchen: „Da ist einmal der Kreis seßhafter, begüterter Landadliger und zum andern eine riesige Schar besitzloser, unsteter Menschen, die keine feste Wohnstatt haben und meist nur kurze Zeit auf den Gütern der Landadligen Unterschlupf und Arbeit finden.“19 Die erzählerische Reduktion auf diese zwei Gruppen könnte statisch anmuten, wären da nicht die Lebensläufe der Erzählerfiguren selbst, die – so jedenfalls im Corylo, dem Jucundus und auch in der Willenhag-Dilogie – als junge Männer aus der Gruppe der Fahrenden in die Gruppe der Landadligen aufsteigen. Wie Berns bemerkt hat, ist dieser „Wechsel von der ‚unteren‘ Schicht in die Adelsschicht“20 in den Texten, anders als zunächst zu erwarten, nicht mit einer Konfrontation unvereinbarer moralischer, ästhetischer oder sozialer Normen verbunden. Vielmehr impliziert er bei näherem Hinsehen zunächst vor allem materielle Statusunterschiede. „Wie also die Landadeligen nach Lebensstandard und Temperament von anderen sozialen Gruppen nicht wesentlich sich unterscheiden, so sind sie auch in moralischer Hinsicht kaum irgendwie ausgezeichnet.“21 Und weiter: Aus all dem bisher Gesagten läßt sich schließlich folgern, daß Beer nicht etwa deshalb die Hauptfiguren seiner Willenhag-Romane als Adelige darstellt, weil er ein Anhänger und Verfechter der Prädestinationsideologie gewesen wäre und demnach im Adel ein sittlichcharakterliches Optimum gesehen hätte, sondern allein deshalb, weil dieser Stand einen Lebensstatus hatte, der eine relative Autarkie und Autonomie gewährleistete.22
Erst auf Grundlage der Autonomie, die der adlige Besitz ihnen bietet, kommen die Figuren in die Lage, aus gesicherter Existenz heraus zu erzählen.23 Der Autonomieaspekt hängt, wie Strohschneider betont hat, mit der Poetik der Texte aufs Engste zusammen. Denn mit der „Betonung der Zeitvertreibungsfunktion“ des Erzählens, die in den Vorreden und poetologischen Digressionen der Erzählerfiguren gebetsmühlenartig wiederholt wird, erinnern die Romane daran, dass „Aristokratie […] auch von der Kategorie der Zeit her gefaßt werden kann. Adlig sind diejenigen, welche die Zeit haben, sie zu vertreiben.“24 Es ergibt sich damit
19 Jörg-Jochen Müller [d.i. Berns]: Studien zu den Willenhag-Romanen Johann Beers. Marburg 1965 (Marburger Beiträge zur Germanistik 9), S. 71. 20 Ebd., S. 76. 21 Ebd., S. 78. 22 Ebd., S. 79. 23 Ganz ähnlich, wenngleich auf Beers eigene Situation bezogen, betont auch Solbach, dass sich „Beers Sehnsucht nach der Adelsidylle […] nicht primär auf den Stand bezieht, sondern auf die materielle Sicherheit, die er allerdings nolens volens mit der Adelsexistenz assoziiert“ (Solbach [Anm. 18], S. 152). 24 Peter Strohschneider: Zeit Tod Erzählen. Ansichten der ‚Teutschen Winter=Nächte‘ Johann Beers vor der Tradition des Novellare. In: Mittelalterliche Denk- und Schreibmodelle in der
Orte des Eigenen, Orte des Anderen
211
eine generell interessante Verknüpfung von (Zeit-)Ökonomie und Poetik: Aus dem (adligen) Besitz resultiert die Bedingung der Möglichkeit des Erzählens, die Zeit, weswegen das Erlangen, der Erhalt und die Vermehrung von Besitz und Wohlstand in Beers Romanen neben dem sozialen und ökonomischen Sinnhorizont immer auch poetologische Implikationen birgt. Angesichts dieser Ausgangslage überrascht es, dass die Forschung den ökonomischen Operationen der Figuren, die dem genannten Zweck dienen bzw. ihren Aufstieg erst ermöglichen, bisher keine weitere Aufmerksamkeit gewidmet hat. Sowohl Berns als auch Solbach, die einer entsprechenden Analyse am nächsten kommen, vertreten die These, dass der Wohlstand der Figuren, der mit ihrer „Nobilitierung“25 einhergeht, märchenhafte Züge trage – was von beiden Autoren als Hinweis auf unterdrückte Aufstiegsfantasien des bürgerlichen Hofmusikers Beer verstanden wird.26 Übersehen wird dabei freilich, dass Beer seinen Figuren eben nicht nur die immer gleichen Merkmale des Attraktiven – Jugendlichkeit, Schönheit, Talent, Erfindungsreichtum – einschreibt, sondern auch eine spezifische Form der Klugheit, die sie dazu prädestiniert, in der sozialen Hierarchie aufzusteigen. Corylo etwa, Kind armer Bauern, verwaltet die häuslichen Angelegenheiten seines adligen Herren so, dass dieser ihm bald die Stelle eines „Hoffmeister[s]“ anbietet.27 Ganz ähnlich geht es seinem Standesgenossen Jucundus, der als Jüngling in die Obhut einer adligen Dame kommt, deren Hofmeister wird und schließlich, zum Alleinerben eingesetzt, seinen Aufstieg in eine adlige Existenz erlebt. Die Figuren der früheren Romane tauchen damit wiederholt an einer Stelle im höfisch-ökonomischen System auf, die von der Fachliteratur der Zeit mit besonderer Aufmerksamkeit beobachtet wird. Mit dem Verwalter und Hofmeister begegnet hier ein Typus, der mit einem frappierend breiten Spektrum an Aufgaben
deutschen Literatur der frühen Neuzeit. Hg. von Wolfgang Harms und Jean-Marie Valentin. Amsterdam, Atlanta, Ga. 1993 (Beihefte zur Chloe 16), S. 269–300, hier S. 294. 25 Diesen Begriff setzt Kremer gegen Hirschs These von der ‚Verbürgerlichung‘ des Pícaro bei Beer. Manfred Kremer: Vom Pikaro zum Landadligen: Johann Beers ‚Jucundus Jucundissimus‘. In: Der deutsche Schelmenroman im europäischen Kontext: Rezeption, Interpretation, Bibliographie. Hg. von Gerhart Hoffmeister. Amsterdam 1987 (Chloe 5), S. 113–126, hier S. 123. 26 So Müller [d. i. Berns] (Anm. 19), S. 79: „Beer hat wohl auch sein eigenes Gesellschafts- und Lebensideal in diesen Adel projiziert; und im Eifer dieser Projektion erhält seine dargestellte Gesellschaftswelt, wenn so märchenhaft leicht alle Schranken verwischt oder übersprungen werden, mitunter auch utopische Züge“; ähnlich Solbach (Anm. 18), S. 105, der von „romanhaftem Reichtum“ der Figuren spricht und diesen mit Sehnsüchten des Autors Beer erklärt. 27 Johann Beer: Sämtliche Werke. Bd. 3. Hg. von Hans-Gert Roloff und Ferdinand van Ingen. Berlin u. a. 1986, S. 166 (im Folgenden zitiert als „SW“ für ‚Sämtliche Werke‘ mit Band- und Seitenzahl).
212
Simon Zeisberg
betraut ist. In einer der Schriften, dem in Beers näherem sächsischen Lebensumfeld entstehenden Memoriale Oeconomicum Politico-Practicum (1669/erweiterte Ausgabe 1680–1683) des Johann Wilhelm Wündsch, werden die „Haußhaltischen Beambten und Hoffbedienten“ als Zielgruppe im Titel direkt angesprochen.28 Die Kolektüre dieser Schrift mit den Romanen Beers bietet sich schon deshalb an, weil das Memoriale im Keim eben jenes Aufstiegsversprechen impliziert, von dem die pikarischen Erzählungen gewissermaßen ausgehen. In der Vorrede adressiert Wündsch sein Buch an all diejenigen, „so dermal eins bey fuͤrnehmen Herren zur Verwaltung ihrer Hoͤfe und Haͤuser befoͤrdert [!] zu werden gedencken (darzu es offt manchem Studenten/ nicht nur allein Schreiberey=Bedienten/ gedeihet)“.29 Trotz dieser Einladung sieht Wündsch die Motive der standesfremden Karrieristen keineswegs durchweg positiv. Streben und Handeln der Subalternen stehen im Memoriale vielmehr von vornherein in einem Spannungsfeld, in dem die Notwendigkeit der funktionalen Optimierung des (adligen) Haushaltes und die Gefahr seiner Unterwanderung durch parasitäre Subjekte die Pole besetzen. Außer Zweifel steht für Wündsch, dass jeder adlige Herr auf professionelle Verwalter zurückzugreifen hat, die eben aus der Menge der „Studenten“ und „Schreiberey=Bedienten“ – also einer der sozial besonders beweglichen Gruppen unterhalb des Adels –, zu rekrutieren sind. Zugleich freilich verpasst die Schrift kaum eine Gelegenheit, auf die verdeckten Umtriebe der Hofmeister, Verwalter, Haushälter und Schreiber hinzuweisen.30 Hinter jedem von ihnen, so lehren es die von Wündsch eng am Kanon der alteuropäischen oeconomus infidus-Tradition angelegten „xi. Prædicamentis, Eines ungerechten Haushalters“31, kann ein „unergründete[r] Partitenmacher“32 stecken – einer also, der parasitär am ‚Ort des Anderen‘ agiert: Der Haushälter verwaltet fremden Besitz, sein Handeln soll strategisch sein im Sinne der Erhaltung und Vergrößerung des Eigenen seines adligen Herren, es kann aufgrund seiner eigenen Besitzlosigkeit und sozialen
28 Vgl. [Johann Wilhelm Wündsch:] MEMORIALE OECONOMICUM POLITICO-PRACTICUM, Das ist Kurtze doch nuͤtzliche und außfuͤhrliche Unterrichtung Eines Haushaltischen Beambten und Hoffbedienten/ Wie er sich in seinem Ambte […] verhalten/ das Ambt wol dirigiren und anordnen soll […]. Allen So obrige Dienste verwalten lassen/ ingleichen denen/ so allbereit selbige verwalten oder kuͤnfftig zu verwalten gedencken/ Mit Nutz vorgestellet von Johann Wilhelm Wuͤndschen. Leipzig/ Gedruckt im Jahr 1669. 29 Ebd., fol. iiijr–iiijv. 30 Dabei ändert sich die Perspektive innerhalb des Traktates deutlich. Die Fokalisierung auf die unterständische Beamtenklientel, die im Titel als Leser und Käufer des Traktates angesprochen wird, weicht der traditionellen Perspektive des Fürstenspiegels: Junge Adlige sollen auf die Fährnisse eines Lebens als Staats- und Hausregent vorbereitet werden. 31 Wündsch (Anm. 28), S. 80–90. 32 Ebd., S. 84.
Orte des Eigenen, Orte des Anderen
213
Marginalität jedoch jederzeit in die Grund- und Bodenlosigkeit taktischer33 Aktion umschlagen. Die Konvention, die Certeau beschreibt, erhält bei Wündsch damit historisch spezifische Konturen: Sind Besitz, „Einknffte oder Einnahme[n]“ so umfangreich, dass „ein Herr und Besitzer [sie] nicht selbst abwarten kann“, so muss er, wie Wündsch formuliert, „andere [sic!]/ als Verwaltere/ Amtmnner/ Haushalter/ Vorsteher und Schreiber gebrauchen“34, von denen allerdings zu befürchten ist, dass sie eine ‚unergründete‘ andere Agenda verfolgen: eine Agenda des sozialen Aufstiegs um jeden Preis oder, schlimmer noch, der Abzweigung und Veruntreuung von Geld und Gütern.35 Wie eng die pikarische Konzeption der frühen Figuren Beers an dieses spätfrühneuzeitliche Verwaltungsparadox anschließt, lässt sich am Corylo sehr gut zeigen. Unermüdlich lässt der Text die Figur im skizzierten Spannungsfeld von einem Pol zum anderen springen. Im adligen Haushalt des alten Edelmannes (erstes Buch) missbraucht Corylo die Gutgläubigkeit seines Herren, indem er – noch ohne Amt im Hause – alle Gelegenheiten nutzt, an fremdem Eigentum zu schmarotzen. Die Dame des Hauses und ihre Töchter machen ihm in der Hoffnung auf Liebesdienste Geldgeschenke, und nur ein Zufall – nämlich ein Jagdunfall des Herrn – verhindert, dass es zwischen Corylo und seiner Herrin zum Äußersten kommt.36 Wie nötig der alte Edelmann die Dienste eines Verwalters hat, wird im Anschluss deutlich: Von einem erfahrenen Schreiber in die Geheimnisse des Hauses eingewiesen, lernt Corylo seine Klugheit (und wachsende Affektkontrolle) zur Verbesserung der „Confusen Ordnung“37 des Hauses einzusetzen. In der Folge präsentiert der Text eine gewissermaßen gespaltene Figur. Auf der einen Seite treibt Corylo aus der Stellung des Bediensteten heraus
33 Die Engführung von parasitärem und taktischem Handeln wird durch de Certeaus Formulierung nahegelegt, „der Schwache“ müsse „unaufhörlich aus den Kräften Nutzen ziehen, die ihm fremd sind“ (De Certeau [Anm. 2], S. 23). 34 Diese Einsicht findet sich nicht in der Erstausgabe von 1669, sondern erst in der wesentlich erweiterten, vierbändigen Ausgabe des Memoriale von 1680 bis 1683. Vgl. Johann Wilhelm Wuͤndschens […] Neu vermehrt= und verbessertes MEMORIALE OECONOMICO-POLITICOPRACTICUM […]. Franckfurt und Leipzig/ Jn Verlegung Christian Kirchners [Teil 1, 1680], fol. iijr. 35 Beispiele für solche Aktionen bieten die erwähnten „XI. Prædicamentis, Eines ungerechten Haushalters“ genug. 36 Vgl. die ausgedehnte Passage in SW 3, S. 22–37. Die typisch Beer’sche Verschränkung von monetärem und erotischem Schmarotzertum, die bereits im ersten Teil des Welt-Kuckers eine entscheidende Rolle spielt, wird in dem Abschnitt einmal mehr deutlich. So fordert Corylo von der Tochter des Edelmannes für eine Gefälligkeit eintausend Taler Lohn. Sie bezahlt ihn in Küssen: „da sagte ich/ das mir dieser Kuß lieber wäre/ als tausend Thaler“ (ebd., S. 35). 37 Ebd., S. 84.
214
Simon Zeisberg
der Wunsch an, sein „junges Leben in einer solchen Sclaverey und Bachanterey gar nicht zuzubringen“38, und garantiert seine (bis zum Ende) anhaltende Beweglichkeit. Auf der anderen Seite bewährt er sich in seinen Stellungen zumeist doch so, dass ihm Anerkennung und Vertrauen entgegengebracht werden. Zum Aufbruch geneigt, offeriert ihm sein zweiter Herr eine Stelle als „Haußmeister der Vorwercke“39 – ein Angebot, das Corylo zwar ablehnt, auf das er gegen Ende des Romans jedoch noch einmal zurückkommt.40 Zwischen beiden Ereignissen liegt seine Zeit beim Pariser Kaufmann, in der er sich als eine Art ökonomisches Faktotum bewährt: Nebenst meiner Buchhalterey informirte ich auch des Kauffmans Kinder im lesen/ schreiben rechnen und tantzen/ denn es war mir gar keine Arbeit zugeringe/ dero ich mich nicht in genemhaltung meines vorigen Zustandes/ alsobalden und mit Freuden unterworffen hette; Ich sahe in dem Hauße hin und wieder/ wo ich meine Dienste leisten konte/ und unterließe nicht die geringste Gelegenheit zuzeigen/ daß ich vielmehr zuthun gesinnet seye/ als mir zuverrichten aufgetragen worden.41
Blickt man nun auf das Ende des Corylo-Romans, so präsentiert dieser eine gewissermaßen doppelte Schließung des pikarischen Syntagmas – eine Technik, die offensichtlich dem Zweck dient, die überaus weltliche Aufstiegsgeschichte der Figur durch den Rückgriff auf das seit Albertinus im deutschen Sprachraum generisch konventionalisierte pikarische conversio-Muster religiös einzuholen. Ausgerechnet in dem Moment, in dem Corylo am Ziel seiner Träume ist – eine nicht standesgemäße Heirat hat ihn zum Besitzer einiger Adelsgüter in der Normandie gemacht –, kommt die abrupte, kaum motivierte Kehrtwende in eine vita contemplativa: Eingedenk seiner niedrigen Geburt entsagt er seinem Besitz und zieht sich in ein Kloster zurück. Es gehört zu den Besonderheiten des Werkes Beers, dass der zweite Roman des Jahres 1680, der Jucundus Jucundissmus, eine in vielerlei Hinsicht parallele Aufstiegsgeschichte erzählt, dabei allerdings keine Anzeichen für religiöse
38 Ebd. 39 Ebd. 40 An dieser Stelle operiert Beers Roman mithin mit einem biografischen Syntagma, innerhalb dessen Vergangenes, Gegenwärtiges und Zukünftiges eng miteinander verschaltet sind: Auch wenn es zur Übernahme des Amtes schließlich doch nicht kommt, weil Corylo seine Pläne (wieder einmal) ändert, bleibt die Möglichkeit, als „Hoffmeister“ in Dienst zu gehen, eine seiner Handlungsoptionen (ebd., S. 166). 41 Ebd., S. 119.
Orte des Eigenen, Orte des Anderen
215
oder soziale Skrupel zeigt. Für sich genommen kann dies freilich nur bedingt verwundern. Wenngleich Dünnhaupt zuzustimmen ist, dass der Jucundus eine „Gesellschaft“ präsentiert, „in der alle Klassenunterschiede aufgehoben und durch eine kraß materielle Werteskala ersetzt sind“42, beginnt die literarische Destabilisierung tradierter „Normengerüst[e]“ bei Beer nicht erst mit diesem Text, sondern, wie die Forschung gezeigt hat, bereits mit dem Simplicianischen Welt-Kucker.43 Was den Jucundus innerhalb dieser Konstellation dennoch besonders interessant erscheinen lässt, ist das veränderte Verhalten der Hauptfigur. Im Welt-Kucker bestimmt der Zufall über das Leben Jan Rebhus, der, bevor er schließlich in die gesicherte Existenz eines Landadligen findet, immer wieder derselben Dynamik von Gunstgewinn und Verstoßung, Glück und Unglück ausgeliefert ist, ohne mit seinem Handeln etwas dagegen unternehmen zu können.44 Der CoryloRoman operiert zwar strukturell deutlicher mit dem Konzept des Aufstiegs, macht dessen Vollzug jedoch von allerlei Zufällen und Verwechslungen abhängig, auf die der Protagonist ebenfalls keinen Einfluss hat.45 Im Jucundus dagegen resultiert der Aufstieg des Bauernsohns zum Hofmeister und schließlich zum Landadligen nicht (nur) aus günstigem Geschick, sondern entspricht einem Plan, den Jucundus gegenüber dem Leser freimütig bekennt. Von einer gutherzigen alten Gräfin aufgenommen, verfolgt er das Ziel, das Schloss an sich zu bringen: [W]eil ich sonsten nichts zu suchen hatte/ kehreten wir [Jucundus und sein Begleiter] auf einen andern Weg/ wieder zurück zu unserer alten Mutter/ auf das Schloß/ alwo ich entschlossen war/ meiner Hofmeisterey abzuwarten/ und zu sehen/ wie ich endlich das Schloß gar an mich partieren möchte […]. (SW 4, S. 172)
Wohl an keiner Stelle im Werk Beers tritt der parasitäre Handlungsimpuls der Hauptfigur klarer zutage. Auch Jucundus ist, bis er zum Besitzer des Schlosses wird, ein Taktiker, der ‚aus fremden Kräften Nutzen zu ziehen‘ versucht. Gleichwohl ist sein Handeln am ‚Ort des Anderen‘ insofern anschlussfähig, als er sich zutraut, das Handeln anderer bis in eine ferne Zukunft hinein vorauszusagen und
42 So Gerhard Dünnhaupt: Bibliographisches Handbuch der Barockliteratur. Hundert Personalbibliographien deutscher Autoren des 17. Jahrhunderts. 3 Bde. Bd. 1: A–G. Stuttgart 1980 (Hirsemanns bibliographische Handbücher 2), S. 281. 43 Jörg Krämer: Johann Beers Romane. Poetologie, immanente Poetik und Rezeption ‚niederer‘ Texte im späten 17. Jahrhundert. Frankfurt am Main 1991 (Mikrokosmos 28), S. 133. 44 Dazu Barbara Bauer: Ritterabenteuer und moralische Reflexion. Zur narrativen Technik im ‚Simplicianischen Welt-Kucker‘ Johann Beers (1677/79). In: Euphorion 87 (1993), S. 225–249. 45 Hierzu gehört das Motiv der doppelten Vertauschung des Kindes: Nachdem Corylo zwischenzeitlich denkt, dass er das Kind eines Adligen sei, stellt sich am Ende heraus, dass er doch von Bauern abstammt – er wurde als Säugling zweimal vertauscht (vgl. SW 3, S. 174).
216
Simon Zeisberg
die eigene Agenda auf diese Prognose abzustimmen. Im Fall des Romans betrifft dies die unverbrüchliche Zuneigung der Gräfin für ihren Zögling – einen Affekt, den Jucundus sich bis hin zur Testamentvollstreckung zunutze zu machen versteht: Indem begiebt sichs/ daß die Edelfrau zur Bezeugung ihrer Lieb gegen mich/ mir das ganze Geld testatoriè zum Erb vermachet/ und zu Ende deßen/ heißet sie mich aufs neue ausreisen/ und eine Liebste suchen/ die mir am bästen anstehen würde. Ich kan nicht glauben/ daß ein Mensch auf Erden jemaln eine größere Vergnügung als ich dazumal empfunden/ da ich zu einem solch schätzbaren Reichthum/ und zwar ganz unverdient gelanget […]. (SW 4, S. 181)
In seiner Untersuchung des Textes hat Solbach angemerkt, dass Jucundus durch seine Rede vom „gantz unverdient[en]“ Erbe „die Bedeutung des Ungeplanten und Zufälligen als Mittel zur Verwirklichung der Lebensutopie“ herausstelle.46 Doch das ist allenfalls im Hinblick auf die Unvermeidlichkeit entsprechender Topoi in Romanen der Zeit zutreffend. Bei näherem Hinsehen erscheint Jucundus’ Handeln (und Erzählen) in einem ganz anderen Licht. Die Tatsache, dass es von vornherein den Plan gibt, das Amt als Hofmeister „abzuwarten“, bis sich die Gelegenheit ergibt, „endlich das Schloß gar an mich [zu] partieren“, deutet auf eine (auf der Ebene der erzählten Welt) verborgene Agenda der Figur hin, die, wie ich meine, mit der an dieser Stelle eigens nochmals erwähnten Hofmeister-Rolle sozial- und kulturhistorisch eng zusammenhängt. Wie viele der Figuren Beers (und Beer selbst) operiert Jucundus als Hofmeister aus dem Verwaltungszentrum des adligen Haushaltes heraus – eine Position, die zum Ende des 17. Jahrhunderts längst die Beherrschung einer sehr spezifischen Rhetorik voraussetzt.47 Konkret geht es um ein Repertoire an Formeln und Gesten, das das hofmeisterliche (Sprech-)Handeln im Spannungsfeld von individueller Aufstiegsambition und ostentativer Demut gegenüber dem Herrn/der Herrin steuerbar machen soll. Wie eine solche Rhetorik funktioniert, zeigt beispielhaft die Vorrede, die der kurfürstlich-sächsische Spitzenbeamte und Bürgersohn Johann Wilhelm Wündsch seinem Neu vermehrt= und verbesserte[n] Memoriale Oeconomico-Politico-Practicum (Teil I, 1680) vorausschickt. Er sei, so Wündsch, in sein erstes Hofamt „in dem 24. Jahre meines Alters unverdient gesetzet/ [welches ich offenbarlich vor GOtt und Menschen bekenne]“.48 Das offenherzige Eingeständnis
46 Solbach (Anm. 18), S. 151. 47 Über deren kultur- und rhetorikgeschichtliche Stellung informiert Georg Braungart: Hofberedsamkeit. Studien zur Praxis höfisch-politischer Rede im deutschen Territorialabsolutismus. Tübingen 1988 (Studien zur deutschen Literatur 96). 48 Wündsch (Anm. 34), fol. ijv (Hervorh. d. Verf.).
Orte des Eigenen, Orte des Anderen
217
der unverdienten Gnade dient dem Zweck, die eigene Person vor dem Vorwurf der Überheblichkeit zu schützen, impliziert vor allem aber die Verpflichtung, den Vorschuss an Vertrauen und Güte durch bedingungslose Leistung im Dienste des Herrn nachträglich zu rechtfertigen. Im Fall Wündschens äußert sich dies in der Bekundung, dass er sich „niemals auf der Faul= oder Luder=Banck“ habe „finden lassen/ sondern […] ohne Saumsal verrichtet/ was einem verpflichteten Diener oblieget und gebuͤhret“.49 Von hier aus lassen sich die Bemerkungen des Jucundus nun genauer beschreiben als ebenso groteske wie mutwillige Verzerrung des rhetorischen Konzepts. Die Geste des offenherzigen Eingeständnisses wird im Roman durch die Paradoxie ad absurdum geführt, dass der pikarische Hofmeister zunächst seinen privatpolitischen Plan offenbart, um dessen Erfüllung dann als „gantz unverdient[e]“ Gnade seiner Herrin zu verkaufen. Dass es hier mitnichten um eine Moderation von Begehren und Pflicht, Ambition und Demut geht, wird denn auch in der provokanten, weil höchst ambivalenten Wortwahl deutlich. Jucundus will, so heißt es, seine „Hofmeisterey ab[ ]warten/ und […] sehen/ wie ich endlich das Schloß gar an mich partieren möchte“. Im Begriff des ‚Abwartens‘ schwingen zwei Bedeutungen ineinander, die im Diskurs des pikarischen Hofmeisters gleichermaßen Geltungsanspruch erheben: Zunächst ist der Begriff seiner frühneuzeitlichen Hauptbedeutung nach zu verstehen und meint: einen Dienst oder einen Haushalt „in pflege und sorge nehmen“.50 Konnotiert ist dieser Bedeutung in Jucundus’ Rede jedoch eine zweite Bedeutungsebene, die das Deutsche Wörterbuch mit den Begriffen „prospicere, speculari, expectare“ fasst:51 Indem Jucundus das Haus wartet, sieht er es darauf ab, zum Herrn des Hauses zu werden. Ihm geht es, anders als Wündsch, nicht um partielle Positionsgewinne innerhalb des Systems der Verteilung von Ämtern und Gütern; er will an die Stelle desjenigen treten, der verteilen kann, weil er selbst besitzt. Der syntagmatische Bogen, der in der Territorialisierung der Figur am ‚Ort des Eigenen‘, dem Schloss der Gräfin, endet, schießt im Jucundus damit über das Koordinatensystem zeitgenössischer Privatpolitik (und deren Rhetorik) ebenso weit hinaus wie über das Raster der Ständeordnung, das dieser zugrunde liegt.52
49 Ebd., fol. iijv. 50 DWb 1, Sp. 147. 51 Ebd. Nicht umsonst spricht Jucundus denn auch davon, „sehen“ zu wollen, wie er das Schloss an sich bringen könnte. 52 Dafür spricht nicht zuletzt auch die ständeoffene Brautschau, die der Bauernsohn Jucundus unternimmt: „Aus diesen Worten des Studenten entschloße ich mich/ mir eine fromme und Gotts-Fürchtige zu suchen/ und weil doch ein Frauen-Bild wie das andere geschaffen wäre/ nach Art der Leibs-Glieder/ achte ichs sehr wenig/ ob ich müchte eine von Adel oder eines Bürgers
218
Simon Zeisberg
In dieser Zumutung mag eine Ursache liegen, warum Beer in den Teutschen Winternächten, dem ersten Teil der Willenhag-Dilogie, den heliodorischen Topos von der unbekannten hohen Geburt reaktiviert und der Erzählerfigur Zendorio eine stabile genealogische Basis im Landadel der erzählten Welt verschafft hat. Zwar glaubt Zendorio zunächst, Sohn eines Schinders zu sein. Bereits in der Mitte des zweiten Buches wird ihm aber von seinem Freund Isodoro offenbart, dass sein Vater „doch ein Edelmann“ ist – und zwar, wie könnte es anders sein, ein Edelmann „von solchen Mitteln/ als du selbst nicht weist“ (SW 7, S. 89). Auf diese Weise aus prekärer Lage befreit, übernimmt Zendorio seinen Erbbesitz, heiratet das adlige Fräulein Caspia und wird zum Gründungsmitglied des ‚Ordens der Vertrauten‘, jenes Zusammenschlusses landadliger Herren, deren Geselligkeitsideal zum Ausgangspunkt des Erzählens Wolffgangs in den Sommer=Tägen wird. Dass die Dilogie die Provokationen des Jucundus nicht wiederholt, heißt freilich nicht, dass sie sich für die Spannung zwischen Besitz und taktisch operierendem Parasitentum nicht interessiert. Im Gegenteil kann gesagt werden, dass die Modifikationen im narrativen Versuchsaufbau nicht zuletzt dazu dienen, eine andere, erweiterte Beobachtung der Konstellation von Erzählen und ökonomischem Besitz zu ermöglichen. Erster Anhaltspunkt hierfür ist die auffällige Koinzidenz, die sich zwischen der Niederlassung Zendorios als adliger Hausherr und seiner Peripherisierung als Erzähler ergibt. Das Phänomen als solches ist der Forschung bekannt. Solbach hat darauf hingewiesen, dass der pikarische Diskurs in den Winternächten auf erster Ebene „[m]it der einmal erreichten Sicherheit in der Nobilitierung und der Ehe“53 keinen Raum zur Entfaltung mehr findet. Das Syntagma schließt sich sozusagen frühzeitig, der gewesene Schelm Zendorio ist als Adliger im Raum fixiert: „Die weitere Handlung muß neue Elemente und Schemata präsentieren, um fortschreiten zu können.“54 Die Lösung, die die Dilogie für dieses Problem findet, zeichnet sich in den Vorgängertexten bereits ab. Wie schon Jan Rebhu, der Protagonist des Simplicianischen Welt-Kuckers, am Ende seines Lebens – er lebt als Erbe einer Dame in landadligen Verhältnissen –, „[w]ann ihme die Zeit lang war“, die „Bettel-Leute in dem Dorff“ auffordert, ihm ihren „Lebens=Lauff“ zu erzählen (SW 1, S. 352), outet sich der Willenhag-Erzähler als ausgemachter „‚Welt-Junkie‘“55, der einen kolossalen Bedarf an Erzählungen Dritter hat. Gestillt wird dieser in den gesel-
Tochter heyrathen/ ja ich entschloße mich/ auch vor einer Bäurischen nicht zu fliehen/ so ich nur versichert wär/ daß sie fleissig betete“ (SW 4, S. 184). 53 Solbach (Anm. 18), S. 367. 54 Ebd. 55 Diese aus historischer Sicht problematische, mindestens auf intuitiver Ebene aber durchaus überzeugende Lesart Zendorios als Abhängiger findet sich bei Solbach (Anm. 18), S. 431.
Orte des Eigenen, Orte des Anderen
219
ligen Runden des ‚Ordens der Vertrauten‘, in denen es zu den Pflichten eines jeden Ordensmitgliedes gehört, „seinen gantzen geführten Lebens=Lauff […] zu entwerffen“ (SW 7, S. 250).56 Vor allem aber verlangt es Zendorio nach den Erzählungen besitzloser Figuren, sodass, wie er selbst bemerkt, „kein Bettler sicher vor mein Schloß passiren können/ der mir nicht seinen gantzen Lebens=Lauff von Wort zu Wort erzehlen müssen“ (SW 7, S. 311).57 Die Allusion auf das adlige Einkommensmodell der Zölle und Steuern ist mehr als eine launige Pointe des ehedem selbst besitzlosen Erzählers. Aus poetologischer Sicht ist sie ernstzunehmen schon deshalb, weil gerade dieses Einkommensmodell im Kreis des ‚Ordens der Vertrauten‘ als besonders einträglich und der genauesten Beobachtung wert betrachtet wird.58 Als Grundherren kommt den Adligen des Ordens eine entscheidende Rolle im poetologischen Selbstverständigungsprozess des Textes zu, die es näher anzusehen lohnt. Wenn Solbach zuzustimmen ist, dass im Willenhag-Roman „das freiheitliche Lebensprinzip des Landadels“ zu einer „gelebte[n] Poetik“ wird,59 dann auf Basis der Einsicht, dass diese Poetik Beweglichkeit und Territorialisierung, das Andere und das Eigene der Ökonomie, paradox aufeinander bezieht. Insbesondere in den von Beer immer wieder reinszenierten Begegnungen von adligem Grundherrn und besitzlosem Vaganten (Bettler, Diener, Schreiber, Soldat, Student etc.) kristallisiert eine Konstellation, die sehr an das erinnert, was Michel Serres mit Blick auf den seine Geschichten erzählenden Mitesser (parasitos) als spezifische Logik parasitären Handelns beschrieben hat:
56 Strohschneider (Anm. 24), S. 288, hat überzeugend gezeigt, dass das Erzählen der Ordensmitglieder deren Identität als Adlige erst eigentlich stiftet: „Im Zweifelsfall werden die Figuren ihres Adels im Medium von Geschichten inne, und zwar: nur in diesem Medium! Weder kann man diesen Adel, wie im Epos oder im mittelalterlichen Roman, am Körper der Figuren oder in ihren Taten sehen, noch ist es so, daß einer selbst um seinen Geburtsadel wüßte und nur allein seine Umwelt davon zu überzeugen hätte. Nein: Wenn es darauf ankommt, gibt es adlige Identität in den ‚Winter=Nächten‘ [sic!] nur im Modus des […] Erzählens von adliger Abkunft.“ 57 Nahezu dieselbe Formulierung verwendet Wolffgang in den Sommer=Tägen: „[M]ir aber ware/ nach Hinwegscheidung meiner guten Freunde/ nichts angenehmers/ als die Einsamkeit/ und wo ich nur einen Bettler/ oder sonsten einen Landstreichenden Vaganten auf der Strasse/ oder vor meinem Schlößlein/ sahe/ der muste mir/ um ein gutes Tranckgeld/ seinen Lebens=Lauff erzehlen/ dadurch ich mir/ nebenst Anmerckung der besten Sachen/ zugleich meine traurige Zeit trefflich vertrieben habe“ (SW 8, S. 150). 58 Dies geht so weit, dass das Ordensmitglied Ludwig seine Freunde haarklein darüber aufklärt, dass das Wissen über den eigenen Besitz bis in die Details der „Trang=Steuren“, „Winckel=Zinsen“, „Erb=Zinsen“, „Haus= und Grund=Steuern“ „Land=Steuren“, „Kopff=Steuren“ „Extraordinar-Steuren“, „Anlagen“, „Aufschläge“, „Dätz“, „Umgeld“, „Gebühr=Fuhren“, „Bitt=Fuhren“, „Kirchen=Dienste“, „Amts=Dienste“ und „Fron=Dienste“ zu reichen habe (SW 7, S. 201). 59 Solbach (Anm. 18), S. 385.
220
Simon Zeisberg
Der Parasit erfindet eine neue Möglichkeit; weil er nicht wie alle speist, konstruiert er eine neue Logik. Er kreuzt, er diagonalisiert den Austausch. Er tauscht nicht, er wechselt die Münzart. Er versucht, Stimme gegen Substanz zu tauschen […]. Man lacht, man vertreibt ihn, macht sich über ihn lustig, man schlägt ihn, er betrügt uns, aber er erfindet etwas Neues.60
Die Diagonale zwischen Materie/Besitz und Sprache/Erzählen spielt im Doppelroman eine kaum zu überschätzende Rolle. In besonderer Deutlichkeit reflektiert der Willenhag-Erzähler sie am Ende des dritten Buches der Sommer=Täge. Sich gegen kursierende Vorwürfe rechtfertigend, dass er den „alte[n] Krach=Wedel“ (SW 8, S. 164) – einen abgedienten Soldaten, der ihn mit seinen Geschichten unterhält (und sich schließlich als sein Bruder herausstellt) – in sein Haus aufnimmt, profiliert er ein asymmetrisches Tauschverhältnis zwischen dem, der erzählt, und dem, der besitzt: Diese und dergleichen Historien erzehlte mir der alte Krach=Wedel (so hiesse sein Name) etliche nach einander/ die nicht unangenehm zu hören waren; daraus kan der Leser leichtlich urtheilen/ wie ich nicht übel gethan/ daß ich ihn in seinem hohen Alter/ zu meiner eigenen Belustigung/ aufgenommen/ und ihme die Beschreibung seiner Geschichte aufgetragen habe. […] Darum/ so brauchte ich diesen guten wer da? zu meiner Zeit Verkürtzung/ davon er weiter nichts/ als mein Bißlein Brod genossen/ und zuweilen einen alten Lappen davon getragen […]. Dennoch kame das Geschrey von mir aus/ also hielte ich überflüssige Leute/ und verzehrte mein Gütlein in sauß und brauß; wie frölich ich aber dazumal gewesen/ ist niemand besser/ als mir selbst/ bewust. Doch bin ich nicht schuldig/ jemand davon Rechenschafft zu geben; dann das Gut war mein/ und nicht einem andern/ drum lebte ich/ wie mirs/ und nicht/ wie es einem andern wol anstünde […]. (SW 8, S. 164)
Das Signalwort, um das sich die Vorwürfe der Verleumder formieren, ist das des Überflusses. Aus der Sicht der bösen Zungen, die im Pikaroroman seit dem Lazarillo die wichtige Funktion der Beobachtung von Öffentlichkeit erfüllen, ist die Präsenz „überflüssige[r] Leute“ in Wolffgangs Haushalt ein klares Zeichen für dessen moralische Zerrüttung: Wer aus bloßer Vergnügungssucht Parasiten hält, ist aus dieser Perspektive einer, der sein „Gütlein in sauß und brauß“ verzehrt, ein Verschwender, der sich mit absehbar katastrophalen Folgen für Moral und Haushalt dem Laster hingibt. Ähnlich wie schon im Jucundus, in dem das Unverdiente des Aufstiegs textimmanent keinen Anlass zu einer Moralisation gibt, lassen die SommerTäge die moralische Argumentation der Verleumder gezielt ins Leere laufen. In seiner Apologie versucht Wolffgang nicht etwa, den Vorwurf der Überflüssigkeit des Geschichtenerzählers als solchen zu entkräften: Dass die Geschich-
60 Michel Serres: Der Parasit. Übers. von Michael Bischoff. Frankfurt am Main 1987, S. 58.
Orte des Eigenen, Orte des Anderen
221
ten Krach=Wedels weder einen moralischen noch einen ökonomischen Nutzen haben, steht auch für ihn außer Frage. Aufs Korn nimmt er vielmehr die simple Parallelisierung von Lust und Laster, Überfluss und ökonomischem Verderben. Dabei spielen Poetik und Ökonomie aufs Engste zusammen. Auf der einen Seite betont Wolffgang seinen Bedarf an Geschichten, der aus der Notwendigkeit der Vertreibung ‚überflüssiger‘ Zeit resultiert: Das Erzählen des alten Krach=Wedel verhindert Langeweile und garantiert damit jenen Wohlstand der Affekte („wie mirs […] wol anstünde“), der an anderer Stelle bei Beer unter dem Begriff der „Lindigkeit“ gehandelt wird.61 Auf der anderen Seite ist Wolffgang bemüht, den Eindruck zu zerstreuen, über seiner „eigenen Belustigung“ die Gebote ökonomisch-materiellen Wohlstandes aus dem Blick zu verlieren. Zwar fühlt er sich als freier Edelmann keineswegs verpflichtet, „jemand davon Rechenschafft zu geben“. Doch tut er gegenüber dem Leser genau das, wenn er betont, durch Krach=Wedels Anwesenheit im Haus seien keine „unnöthige Kosten“ entstanden.62 Mehr als ein „Bißlein Brod“, einen alten „Lappen“ zum Anziehen und eine „Pfeiffe Toback“, die bei „dergleichen Leute“ mehr bewirke, als „eine[ ] Handvoll halben Thaler“, habe er nicht investieren müssen, um die „Lust“ täglicher Unterhaltung zu genießen.63 So ironisch die Formulierung anmuten mag – Kargheit und fehlender Repräsentationswille lassen sich mit dem Rollenbild zeitgenössischen Adels nur schwer überein bringen –, so zeitgemäß erscheint Wolffgangs Sichtweise auf das in Rede stehende Problem. Dies zeigt ein kurzer Seitenblick auf Veit Ludwig von Seckendorffs FürstenStat, dessen erweiterte Ausgabe von 1665 eine Erläuterung zum Begriff der adligen Lust enthält, die Wolffgangs Argumentation nachvollziehbar macht. Denn auch Seckendorff setzt nicht (mehr) auf eine moralische Beobachtung des seit jeher heiklen Themas, sondern gibt einer kameralistischen Perspektive den Vorzug, die um das öffentliche Akzeptanzproblem adligen Vergnügens weiß: „Man halte wol Hauß/ und schaffe Geld und Vorrath durch redliche Mittel/ so kan man manchen guten Lust und reputation haben/ wenn Stand und Land darbey ist.“64 Aus dem angefügten Konditionalsatz
61 Dazu aufschlussreich Dieter Breuer: ‚Lindigkeit‘. Zur affektpsychologischen Neubegründung satirischen Erzählens in Johann Beers Doppelroman. In: Simpliciana 13 (1991), S. 81–96. Zu Beers Poetik der Zeitverkürzung vgl. Robert Vellusig: Johann Beer und die Poetik des Zeitvertreibs. Zur Medien- und Kulturgeschichte des kurzweiligen Erzählens. In: Daphnis 37 (2008), S. 487–522. 62 SW 8, S. 164 f. 63 Ebd., S. 164. 64 Herrn Veit Ludwigs von Seckendorff/ sc. Teutscher FuͤrstenStat. Nun zum drittenmahl uͤbersehen und auffgelegt/ Auch mit einer gantz=neuen ZuGabe/ Sonderbarer und wichtiger Materien umb ein grosses Theils vermehret. […] Franckfurt am Mayn/ Jn Verlegung Thom. Matthiæ Goͤtzens, Anno M. DC. LXV. Unveränderter Nachdr. der Ausg. in zwei Bänden. Mit einem Vorwort von Ludwig Fertig. Bd. 2. Glashütten im Taunus 1976, S. 152.
222
Simon Zeisberg
erschließt sich der Rechtfertigungsdruck, der auf Wolffgang lastet: Auch wenn sein Haushalt bestens bestellt ist – und seinem Vergnügen mit den Geschichtenerzählern aus kameralistischer Sicht damit nichts im Wege steht –, muss er der Verleumdungsdynamik des öffentlichen Diskurses etwas entgegensetzen. Dass seine Rede vor allem diesem Zweck dient, zeigt die Tatsache, dass Krach=Wedels Lebensbericht in den Sommer=Tägen letzthin nur in wenigen kurzen Ausschnitten wiedergegeben wird. Nicht die Geschichte des alten Soldaten interessiert Beers Roman an dieser Stelle, sondern die Bedingungen, unter denen diese Geschichte als Medium der Zeitverkürzung fungieren kann. Die Analyse macht deutlich, dass es sich lohnt, die Verflechtung ökonomischer und poetologischer Argumente im Diskurs des Willenhag-Erzählers vor dem Hintergrund des Nutzen-Paradigmas zu betrachten, das die Weltbeobachtung der Romane Beers insgesamt bestimmt. Von den haushälterischen Reformen, die Zendorio durchführt (Winternächte, Buch V, Kap. I), über das Programm des ‚Ordens der Vertrauten‘, „eines jeden Vermögen reichlich“ zu vermehren (SW 8, S. 8), bis hin zu Wolffgangs Einrichtung einer sich selbst verwaltenden Haushaltung, in der „die Güter“ alljährlich „ein merckliches vermehret“ werden (SW 8, S. 313), erweist sich der Lebenslauf des Willenhag-Erzählers allenfalls in zweiter Linie als Vita unter dem „Primat religiöser Zielsetzung“ (wie Solbach meint).65 In erster Linie findet der Leser eine Figur vor, deren Position in der Welt durch profitorientiertes, d. h. strategisches Handeln am (ökonomischen) ‚Ort des Eigenen‘ gefestigt wird.66 Strohschneiders bereits zitierte Beobachtung, adlig seien bei Beer „diejenigen, welche die Zeit haben, sie zu vertreiben“,67 ist in diesem Sinne zu ergänzen: Der Adlige bei Beer, der Zeit zum Vertreiben haben will, ohne dabei „sein Gütlein in sauß und brauß“ (SW 8, S. 164) durchzubringen, muss auf den vom weltklugen Ordensmitglied Ludwig beschworenen „Nutz“, das „tägliche[ ] Aufnehmen“ seiner Haushaltung achten (SW 7, S. 202). Erst durch die Erzielung ökonomischer Überschüsse, die die Kästen und Scheunen der adligen
65 Solbach (Anm. 18), S. 430. Indem Solbach die Bemühungen der Figur(en), ihre Haushalte auf Profitabilität zu programmieren, konsequent marginalisiert, geschieht es, dass er die (ohne Zweifel vorhandenen) religiösen Implikationen der Lebenslauferzählungen überbewertet. So ist zwar zu beobachten, dass Wolffgang mit den Gewinnen seiner Güter zunehmend religiöse Ziele verfolgt (er stiftet eine Kirche, ein Almosen für die Armen usw.). Grundlage für diese Unternehmungen – einschließlich der scheiternden Weltabkehrversuche in beiden Romanen – ist und bleibt jedoch der Nutzen, den die Ökonomie garantiert. 66 Es ist daher Berns vehement zu widersprechen, wenn er behauptet, die Figuren der Willenhag-Dilogie wüssten sich die Zeit „nicht progressiv nutzbar zu machen“ (vgl. Müller [d.i. Berns] [Anm. 19], S. 65). Genau das tun sie, indem sie ihre Haushalte auf Profitmaximierung ausrichten. 67 Strohschneider (Anm. 24), S. 294.
Orte des Eigenen, Orte des Anderen
223
Güter füllen, entsteht der Spielraum des Überflüssigen, in dem Erzählen bei Beer möglich wird: als ein Medium, dessen Zweck („Nutzen“) gerade im Lust stiftenden Verbrauch dessen liegt, was durch den „Nutz“ klugen Haushaltens erwirtschaftet wurde.
III Mit einigem Recht hat Jan Mohr in seinem Aufsatz zur Buscón-Übersetzung La Genestes davor gewarnt, von punktuellen Beobachtungen an pikarischen Texten allzu umstandslos auf makrohistorische Veränderungsprozesse im Übergang europäischer Gesellschaften von der Frühen Neuzeit in die Moderne zu schließen.68 Dieser Warnung eingedenk, sollen die folgenden abschließenden Überlegungen zur Verortung der Texte Beers im sozial- und wissenshistorischen Kontext ihrer Zeit nicht als geschichtssichere Feststellungen, sondern als Einladungen verstanden werden, das historische Profil des Beer’schen Romanwerks weiter zu erkunden. Die Frage, die die Texte diesbezüglich in erster Linie aufwerfen, betrifft die in ihnen zu beobachtende Einebnung überlieferter Konzepte von sozialer Differenz, deren Ursachen wohl kaum allein auf dem Feld der Autorpsychologie – den geheimen Aufstiegswünschen des Hofmusikers Johann Beer – zu suchen sein dürften.69 Ergiebiger kontextualisieren lässt sich das Phänomen mit Blick auf die zunehmende Relevanz ökonomischen Verwaltungswissens an den Höfen der europäischen Spätfrühneuzeit. Eine nähere Untersuchung derjenigen strategischen Handlungsweisen der Figuren, die den Fortbestand und die Expansion ihrer adligen Haushalte sichern helfen, könnte zeigen, dass die Erosion altständischer stratifikatorischer Differenzierungsmodelle bei Beer aufs Engste verknüpft ist mit der Durchsetzung kameralistischer Rationalisierungskonzepte, deren Träger die ständisch nicht eindeutig markierte Gruppe der höfischen Verwaltungsbeamten vom Schlage eines Johann Wilhelm Wündsch oder Veit Ludwig von Seckendorff ist. Je sicherer dabei behauptet werden kann, dass in den Jahrzehnten vor 1700 die Struktur adlig-höfischer Ökonomie tiefgreifenden Transformationen
68 Vgl. Mohr (Anm. 13), S. 237–239. 69 Auf die heuristisch mindestens fragwürdige psychologisierende Tradition der BeerForschung habe ich bereits verweisen (vgl. Anm. 26). Eine erhellende Aufarbeitung der sozialen Bedingungen, unter denen Beer sein Werk in Weißenfels verfasst, liefert Roswitha Jacobsen: Johann Beer in Weißenfels: Auseinanderfall von Autorität und Diskurs. In: Simpliciana 13 (1991), S. 47–80.
224
Simon Zeisberg
unterliegt,70 desto größer erscheint die Aussagekraft der Spuren, die diese Prozesse in den Romanen Beers hinterlassen. Besonders interessant erscheint mir dabei der sich bei Beer abzeichnende Zusammenhang zwischen der kameralistischen Funktionalisierung des sozialen Systems ‚Hof‘ in der Spätfrühneuzeit und der Öffnung des entsprechenden literarischen Raumes für pikarische Figuren wie Jucundus oder Zendorio-Wolffgang, die – so scheint es – am ‚Ort des Eigenen‘ (auch) deshalb reüssieren, weil sie die veränderten „Handlungs- und Funktionsregeln“ (Certeau) des sozialen Systems beherrschen. Setzt die Anwendung dieser Regeln die Einsicht in die gegenüber Verfahren kameralistischer Rationalisierung geringere Leistungsfähigkeit moralischer Argumente voraus, so könnte darin eine bisher unbekannte Ursache für die bei Beer zu beobachtende Tendenz zur poet(-olog-)ischen Depotenzierung moralisch-religiöser Geltungen liegen. Dass damit noch nicht automatisch eine Tür in Richtung moderner Ausdifferenzierungsprozesse der Literatur geöffnet ist, liegt angesichts der in dieser Hinsicht alles andere als eindeutigen Gemengelage auf dem literarischen Feld vor 1700 auf der Hand.71 Festgehalten werden aber darf, dass Beers Romane der Handlungs- und Funktionsregeln die Möglichkeiten pikarischer Narration nutzen, um die Spannungen, die bei der Neuaushandlung spätfrühneuzeitlicher Hofkultur entstehen, literarisch zu performieren.
70 Zuverlässige Erkenntnisse in dieser Hinsicht liefert Volker Bauer: Hofökonomie. Der Diskurs über den Fürstenhof in Zeremonialwissenschaft, Hausväterliteratur und Kameralismus. Wien u. a. 1997 (Frühneuzeitstudien 1). 71 Einen guten Eindruck davon vermittelt der Sammelband von Sylvia Heudecker, Dirk Niefanger und Jörg Wesche (Hg.): Kulturelle Orientierung um 1700. Traditionen, Programme, konzeptionelle Vielfalt. Tübingen 2004 (Frühe Neuzeit 93).
Jörg Krämer
‚Frommer Betrug‘ am Leser? Unterhaltung und Klugheitslehre in Christian Weises Politischem Näscher (1678) Zu den wirkungsreichsten Topoi der Poetikgeschichte zählt die bekannte Doppelformel von Horaz: „[A]ut prodesse volunt aut delectare poetae/ aut simul et iucunda et idonea dicere vitae“.1 Auch in der neu entstehenden ‚Deutschen Poeterey‘ des 17. Jahrhunderts wird die horazsche Bestimmung im Bereich der Poetik zwischen Opitz und Rotth vielfältig diskutiert.2 Insbesondere im unter Legitimationsdruck stehenden, nicht durch antike Autoritäten abgesicherten Genre des Romans greifen die Autoren häufig paratextuell die Horaz-Formel auf; in den meisten Roman-Vorreden des späteren 17. Jahrhunderts lassen sich auf unterschiedliche Art ihre Spuren finden. Als Christian Weise in den 1670er-Jahren das neue Erzählmodell des ‚Politischen Romans‘ entwickelt, knüpft auch er an Horaz an, doch mit einem bemerkenswert eindeutigen Akzent auf der Dominanz des ‚prodesse‘ über das ‚delectare‘. In den poetologischen Passagen seiner Paratexte oder in explizit poetologischen Traktaten grenzt Weise seine Form des ‚Politischen Romans‘ von anderen Arten des unterhaltenden und satirischen Erzählens stets dadurch ab, dass er besonders die Nutzanwendung betont. 1680 schreibt er etwa: „Ich sage das Leben sol erbauet werden. Das ist/ man sol nichts schreiben/ da nicht eine Tugend dem Leser eingepflantzet/ oder zum wenigsten ein Laster mit durchdringenden Beweiß verdammet wird“.3
1 De arte poetica (Epistulae II 3), V. 333 f. (Q. Horatius Flaccus: Satiren, Briefe. Sermones, Epistulae. Lateinisch-deutsch. Übersetzt von Gerd Herrmann. Hg. von Gerhard Fink. Düsseldorf, Zürich 2000, S. 270). 2 Vgl. dazu Irmgard M. Wirtz: Zur Poetik der Unterhaltung. Ein diskursives Feld zwischen Roman und Ethik um 1680. In: ‚Delectatio‘. Unterhaltung und Vergnügen zwischen Grimmelshausen und Schnabel. Hg. von Franz M. Eybl und Irmgard M. Wirtz. Bern u. a. 2009 (Beihefte zu Simpliciana 4), S. 101–119. 3 Christian Weisens/ Kurtzer Bericht vom Politischen Nscher […]. Leipzig: Christian Weidmann 1680. Alle folgenden Zitate aus diesem Text folgen der Ausgabe: Christian Weise: Sämtliche Werke. Bd. 19: Romane III. Hg. von Hans-Gert Roloff und Gerd-Hermann Susen. Berlin, New York 2004 (Ausgaben deutscher Literatur des XV. bis XVIII. Jahrhunderts 162), S. 255–348, hier S. 303 (Hervorhebung im Original durch Sperrdruck). – Im zweiten Teil heißt es ergänzend: „[…] der Leser sol etliche kluge und wolanstndige Lebens-Regeln daraus zu mercken haben“ (S. 335; im Original alles gesperrt).
226
Jörg Krämer
Demgegenüber erscheint die Unterhaltung, das ‚delectare‘, nur als untergeordnetes Mittel zum Zweck, als eine Form des ‚frommen Betrugs‘4 am Leser – angeblich ist die Nutzanwendung mitunter so tief in die Texte eingesenkt, dass der Leser selbst unterschwellig zu seinem Besten gelenkt werden kann, während er selbst glaubt, sich zu unterhalten.5 Weise qualifiziert die unterhaltende Funktion von Romanen also indirekt ab: Romane dürfen keine Unterhaltung als Selbstzweck bieten. Die germanistische Forschung ist dieser Selbststilisierung Weises bis heute weitgehend gefolgt. Weises anonym bzw. pseudonym erschienene Romane, deren Produktion schlagartig mit seiner Ernennung zum Zittauer Rektor endete, gelten als primär didaktisch motivierte Texte. Der ‚lustige Stylus‘, die Verwendung satirischer Techniken und die Übernahme narrativer Muster des populären Erzählens bei Weise werden auch in der Forschung in der Regel als bloße Transportmittel ernsthafter Nutzanwendungen im Dienste der Weltklugheitslehre sowie zur Einübung eines „privatpolitische[n] ‚Realismus‘“6 bzw. einer sozial sedativen Position eingestuft.7 Dieses in der Germanistik des späten 19. Jahrhunderts geprägte Bild ist bis heute erstaunlich konstant geblieben und führt letztlich Weises eigene Positionierung fort. Nun ist ein moralisch-didaktischer Impetus zweifellos auf vielen Ebenen seiner Texte auszumachen (und wurde
4 „Es scheint als mste man die Tugend auch per piam fraudem, der ktzlichten und neubegierigen Welt auf eine solche Manier beybringen/ drum wnsche ich nichts mehr/ als die Welt wolle sich zu ihrem Besten allhier betriegen lassen. Sie bilde sich lauter lustige und zeitvertreibende Sachen bey diesen Narren ein: wenn sie nur unvermerckt die klugen LebensRegeln mit lesen und erwegen will.“ (Christian Weise: Vorrede zu Die Drey Ertz-Narren. In: Sämtliche Werke. Bd. 17: Romane I. Hg. von Hans-Gert Roloff und Gerd-Hermann Susen. Berlin, New York 2006 [Ausgaben deutscher Literatur des XV. bis XVIII. Jahrhunderts 164], hier S. 61) 5 Zur Vorreden-Poetik Weises vgl. Andrea Wicke: Die Politischen Romane, eine populäre Gattung des 17. Jahrhunderts. ‚Was die Politica ist/ das wollen itzt auch die Kinder wissen‘. Diss. Frankfurt am Main 2012, bes. S. 109–130. 6 Die Formulierung stammt von Ingo Stöckmann: Fallhöhen der Terminologie? Christian Weise zwischen Rhetorik und literarischer Epistemologie (Rezension über: Claus-Michael Ort: Medienwechsel und Selbstreferenz. Christian Weise und die literarische Epistemologie des späten 17. Jahrhunderts. Tübingen 2003 [Studien und Texte zur Sozialgeschichte der Literatur 93]). In: IASLonline, unter www.iaslonline.de/index.php?vorgang_id=949, Absatz [7] [Stand: 30.06.2016]. 7 Vgl. etwa die Beiträge der Weise-Symposien: Peter Behnke, Hans-Gert Roloff (Hg.): Christian Weise. Dichter – Gelehrter – Pädagoge. Beiträge zum ersten Christian-Weise-Symposium aus Anlaß des 350. Geburtstages, Zittau 1992 (Jahrbuch für Internationale Germanistik A 37). Bern u. a. 1994; Peter Hesse (Hg.): Poet und Praeceptor. Christian Weise (1642–1708) zum 300. Todestag. 2. Internationales Christian-Weise-Symposium 21.–24. Oktober 2008 in Zittau. Tagungsband. Dresden 2009.
‚Frommer Betrug‘ am Leser?
227
auch bereits in der zeitgenössischen Rezeption gesehen8). Dennoch stellt sich die Frage, ob diese Selbststilisierung denn tatsächlich eine gültige Beschreibung von Weises Erzählen bietet und wie dieser didaktische Impetus mit den satirischen Techniken und den Traditionen des populären Erzählens zusammenpasst, an die Weise sich in seinen Romanen anschließt. Die Forschung hat sehr oft die Intentionen Weises beschrieben – doch hat sie damit auch erfasst, was in seinen Texten passiert? Ich möchte im Folgenden der Frage nachgehen, ob Weises Romane tatsächlich in einer rein moralisch-didaktischen Funktion aufgehen, ob also der Bestimmtheit der Intention auch eine analoge Bestimmtheit der Texte entspricht, oder ob es nicht auch in seinen Texten Tendenzen einer Widerständigkeit des Erzählens gegen seine Funktionalisierung oder einer Verselbstständigung der Unterhaltung jenseits der intendierten Funktion gibt. Als Beispieltext habe ich den Politischen Näscher9 ausgewählt. Dieser 1678 erschienene, aber wohl zumindest in Teilen früher entstandene Roman10 hat insofern eine Sonderstellung inne, als Weise bekanntlich 1680, nun nicht mehr pseudonym, am Beispiel dieses Romans eine theoretische Schrift publizierte, den Kurtzen Bericht vom Politischen Nscher/ wie nehmlich Dergleichen Bcher sollen gelesen/ und Von andern aus gewissen Kunst-Regeln nachgemachet werden.11 U.a. enthält dieser Traktat auch die Skizze zu zwei Fortsetzungen des Näschers. Das Vorliegen dieser poetologischen Schrift ermöglicht es, das Verhältnis von Theorie und Praxis am Roman selbst zu überprüfen.
8 Beispiele bei Wicke (Anm. 5), S. 15–27. 9 Der Politische Nscher/ Auß Unterschiedenen Gedancken hervor gesucht/ und Allen Liebhabern zur Lust/ allen Interessenten zu Nutz/ nunmehro in Druck befrdert/ von R. I. O. Leipzig: Johann Fritzsche [1678]. Alle folgenden Zitate nach Weise: Sämtliche Werke. Bd. 19 (Anm. 3), S. 1–253, im Folgenden nachgewiesen mit der Seitenzahl im Haupttext. 10 Äußerungen in der Vorrede an den Leser deuten auf eine frühe Entstehung des Textes hin; auch wird bereits in den Drey klügsten Leuten (1675) ein Politischer Näscher angekündigt (vgl. Christian Weise: Sämtliche Werke. Bd. 18: Romane II. Hg. von Hans-Gert Roloff und Gerd-Hermann Susen. Berlin, New York 2005 [Ausgaben deutscher Literatur des XV. bis XVIII. Jahrhunderts 163], S. 6). Dennoch kann zumindest die Fertigstellung des Näschers nicht vor den anderen Romanen erfolgt sein, wie das Zitat aus den Drey Ertznarren im 36. Kapitel des Näschers zeigt (vgl. Bd. 19, S. 225 ff.). 11 Zum Kurtzen Bericht vgl. Friedrich Vollhardt: Selbstliebe und Geselligkeit. Untersuchungen zum Verhältnis von naturrechtlichem Denken und moraldidaktischer Literatur im 17. und 18. Jahrhundert. Tübingen 2001 (Communicatio 26), S. 116–134, und besonders Wicke (Anm. 5), S. 167–248.
228
Jörg Krämer
1 Der Kurtze Bericht als Poetik Politischer Romane Ich bleibe zunächst kurz beim poetologischen Traktat. Weise beabsichtigt mit diesem Text, die Gattung des satirischen Schrifttums grundsätzlich zu legitimieren und gegen Kritik zu verteidigen („ob es recht sey/ wenn man solche Bcher schreibet?“, S. 260), auch wenn er in der Vorrede ankündigt, er selbst werde nun keine Romane mehr schreiben.12 Zunächst grenzt er sich scharf von bestimmten Formen des populären Erzählens ab – mit den Verfassern von „rgerliche[n] und verderbliche[n] Schrifften“ wie dem „Klunckermutz“13 (S. 259) möchte der Herr Rektor nicht in einen Topf geworfen werden, auch nicht mit seinem Weißenfelser Amtsnachfolger Johann Riemer, dessen Politischer Maul-Affe gerade einen Skandal ausgelöst hatte.14 Der Traktat hat zwei verschiedene Funktionen. Er ist einerseits ein Epitext hinsichtlich des eigenen Näscher-Romans, liefert zugleich aber eine präskriptive Poetik Politischer Romane überhaupt. Entsprechend zerfällt der Text in zwei Teile: Nach der umfassenden Legitimation eines entsprechend eng abgegrenzten, sozusagen ‚sauberen‘ satirischen Schreibens, nach einer Diskussion leserpsychologischer Voraussetzungen anhand der Affektenlehre und nach einer Zusammenstellung besonders geeigneter Stoffe und Motive sowie Hinweisen zu deren sprachlicher Präsentation folgt im zweiten Teil eine detaillierte Darlegung der Regeln und „Kunstgrieffe“ (S. 309), die ein Verfasser beachten müsse. Dieser Teil bietet in seinem zentralen Abschnitt zwei konkrete Beispielschemata, mit denen Weise je eine Matrix für einen neuen Roman liefert, der dann nur noch anhand des tabellarischen Schemas ausgearbeitet werden müsste (S. 319–324). Dass diese Tabellen lateinisch abgefasst sind, zeigt Weises bewusste Abgrenzungsstrategie:15 „Und ich bitte wer sich nicht zuvor in solche Ordnung einlsset/ der bleibe nur davon/ und vermenge sich nicht mit dem Bchermachen“ (S. 319; zum Lateinischen vgl. Kap. 21, S. 324).
12 Schon Gotthardt Frühsorge: Der politische Körper. Zum Begriff des Politischen im 17. Jahrhundert und in den Romanen Christian Weises. Stuttgart 1974, S. 127 hat auf den immanenten Widerspruch bei Weise hingewiesen, „dasjenige ausdrücklich anderen zur literarischen Fortsetzung zu empfehlen, was er selbst nicht mehr fortzusetzen wünscht“. 13 Der große Klunkermuz. Im Jahr 1671 [o. O.]. 14 Dazu Wicke (Anm. 5), S. 168 ff. 15 Wenn Weise wiederholt vom Verfasser satirischer Texte Lateinkenntnisse fordert, zielt er auf die Einbindung in einen Kanon höherer Bildung als Bedingung des Schreibens populärer Romane: Auch das Verfassen unterhaltender oder satirischer Romane ist ausschließlich Sache einer qualifizierten akademischen Bildungsschicht.
‚Frommer Betrug‘ am Leser?
229
Das Vorgehen beim Verfassen eines Romans stellt Weise wie folgt dar. Er definiert zunächst ein Ziel der Satire – im einen Fall die „Auffschneiderey“ („Jactantia“), im anderen die Gefallsucht („Sordidum & ineptum placendi Studium“; S. 322). Ganz schulmäßig folgt auf die definitio dann eine divisio, darauf eine Darstellung der Heilmittel (medicina), des ethisch-moralischen consequens und möglicher Spezifika. Dieses Gerüst, dessen Herkunft aus der Rhetorik unverkennbar ist, soll unmittelbar den Bauplan eines Politischen Romans bilden, der dann nur noch in passenden Exempeln ausgearbeitet werden müsste. Weise betont damit, wie viel Vorarbeit in einem ‚ordentlich‘ geschriebenen Politischen Roman stecken muss; der literarische Kunstcharakter des Textes wird von ihm in erster Linie an dieser durchdachten Vorbereitung und Dispositions-Arbeit festgemacht. Weise hat auch bereits passende Titel für die noch zu schreibenden Texte parat: Ein „Politische[r] Qvacksalber“ (S. 318) soll sich gegen die „Auffschneiderey“ richten, gegen die Gefallsucht ein „Politische[r] Leyermann“ (S. 322).16 Für den Quacksalber bietet Weise sogar verschiedene narrative Rahmen an, in denen das Material zum Roman gestaltet werden könnte (S. 324 ff.).17 Die literarische Ausgestaltung erscheint bei Weise damit von einer gewissen Beliebigkeit geprägt; das Verfassen eines Romans wird nach dem Muster akademischer Textproduktion konzipiert: „Drum wen ich vom Politischen Quacksalber ein Buch machen solte: so frage ich/ wie schriebe ich eine Disputation von der Eigenntzigen Auffschneiderey?“ (S. 318) Andrea Wicke ist also zuzustimmen, wenn sie Weises Textbegriff im Kurtzen Bericht so charakterisiert: „Die Politischen Romane beruhen demnach auf einem curieusen Gebrauch gelehrter Regeln; sie sind gewissermaßen als anmutige Traktate zu verstehen, deren systematischer Hintergrund um ihrer Popularität willen verwischt wird.“18 Der theoretische Traktat enthält auch Vorschläge zu Fortsetzungen des Näscher-Romans. Dabei geht Weise erneut von den lehrhaften Inhalten und Verhaltensregeln aus, die hier vermittelt werden sollten: „Und eben dieses solte der Mittelpunct seyn/ darauff sich die gantze Lehre von [sic!] Politischen Nscher bezogen htte. Die Historie an sich selbst/ indem sie angenehme Affecten bey sich fhrete/ so htte sie dem Leser desto mehr Lust gegeben/ der Sache nachzudencken.“ (S. 344)
16 Hervorhebung im Original durch Sperrdruck. – Zum Begriff des ‚Politicus‘ vgl. Dietmar Till: Politicus. In: Historisches Wörterbuch der Rhetorik. Hg. von Gert Ueding. Bd. 6. Tübingen 2003, Sp. 1422–1445. 17 1700 veröffentlichte Johann Kuhnau einen Roman mit dem Titel Der Musicalische QuackSalber; dass er Weises Traktat kannte, erscheint durchaus möglich, allerdings nicht zwingend. 18 Wicke (Anm. 5), S. 230.
230
Jörg Krämer
2 Theorie und Praxis So weit also Weises Theorie – und das traditionelle Bild von Weise als Didaktiker scheint sich zu bestätigen. Versucht man jedoch, diese theoretischen Regeln auf den Näscher-Roman anzuwenden, so ergibt sich eine Reihe von Problemen. Im Kurtzen Bericht fordert Weise zunächst von einem Politischen Roman ein klar und eindeutig bestimmtes Ziel der satirischen Kritik. Schwierig ist nun schon die Frage nach dem entsprechenden Hauptziel des Näscher-Romans – was ist denn ein ‚Politischer Näscher‘ bzw. das Lasterhafte am ‚Naschen‘? Das Titelkupfer (Abb. 1) und das folgende Gedicht Uber das Kupffer-Blat bieten eine erste paratextuelle Klärung an. Das Kupfer zeigt eine Butte voller reifer Trauben, denen sich von rechts eine Hand nähert, während von links eine Hand mit dem Stock droht.
Abb. 1: Christian Weise: Der Politische Näscher […]. Leipzig 1678, Titelkupfer (Bayerische Staatsbibliothek München: Rar. 4388)
‚Frommer Betrug‘ am Leser?
231
Das Gedicht deutet das Bild und mündet in die Sentenz: Was dir nicht werden kan/ Da dencke nicht daran/ Und was dir nicht gehert/ Daß laß’ auch unverseert. (S. 4)
Im zweiten Kapitel des Romans wird das Bild aus der konkreten körperlichen Sphäre19 in größere Dimensionen übertragen: Die Nscherey mit dem Maule ist ein geringe [sic!] Thun. Ein Politischer Nscher ist/ der sich umb ein Glcke/ umb eine Lust oder sonst umb einen Vortheil bekmmert/ der ihm nicht zukmmt/ und darüber er sich offt in seiner Hoffnung betrogen findet. (S. 16; im Orig. gesperrt)
Im Kurtzen Bericht wird dann nachträglich als Ziel dieses Romans bestimmt, wie ein Mensch im gemeinen oder im Politischen Leben/ das ist in der Menschlichen Gesellschafft/ welche in der Policey angestellet wird/ sich vor berflßigen Begierden hten/ und allen daher entstehenden Schaden mglichst vermeiden solte. (S. 337)
Ein „Politischer Nscher“ wäre dann also jemand, der den ihm zukommenden Platz in der Gesellschaft überschreitet und Begierden entwickelt, die ihm nicht zustehen. Wie im Kurtzen Bericht gefordert, versucht Weise also auch im Roman durchaus, das Hauptthema frühzeitig zu definieren. Im Gegensatz zu den Beispielen im Traktat aber ist die „Nscherei“ kein traditionelles, klar festgelegtes Laster, sondern eine vage und sehr allgemein definierte Kritik an nicht standeskonformem Verhalten. Im Grunde kann jede Form sozialer oder anderer Mobilität unter diesem Begriff kritisiert werden, so allgemein ist er gehalten. Während man sich bei den Exempeln aus dem Kurtzen Bericht fragt, wie ein so klares Laster wie die „Aufschneiderey“ einen längeren Roman tragen soll, ohne dass dieser rasch langweilig würde, ergibt sich hier eher ein gegenteiliges Problem. Indem ein ‚Näscher‘ als jemand definiert wird, der etwas haben möchte, das ihm nicht zusteht, steht er von vorneherein dem Betrüger nahe. Das erlaubt Weise zwar mühelos, zahlreiche Geschichten nach dem traditionellen Schema des ‚betrogenen Betrügers‘ zu integrieren; zugleich aber entgrenzt es den Text thematisch. Und in der Tat bekommt der Roman sein vorgebliches Thema nie ganz in den
19 Vgl. Gordon J. A. Burgess: ‚Die Wahrheit mit lachendem Munde‘. Comedy and Humour in the Novels of Christian Weise. Bern u. a. 1990 (Berner Beiträge zur Barockgermanistik 8), S. 210–216.
232
Jörg Krämer
Griff: Nach den immerhin über 400 Seiten des Originaldrucks20 ist erst ein ganz geringer Teil potenzieller Näscher angesprochen worden – es fehlen, wie schon im Roman selbst vermerkt wird, die geistlichen und die höfischen Näscher sowie diejenigen an der Universität, die dann in den Fortsetzungen des Romans zum Zuge kommen müssten (vgl. die Skizze im Kurtzen Bericht, S. 338–345). Passt so schon der weitgefasste Zielansatz des Romans nicht so recht mit den Verfügungen im Kurtzen Bericht zusammen, so fügt sich der Romantext noch weit weniger unter das von Weise propagierte Schema divisio – medicina – consequens. Ein kleiner Versuch zur divisio (also einer Art Phänomenologie) der Näscher zeichnet sich erst am Ende ab, wenn beklagt wird, welche Arten von Näschern im Text noch nicht berücksichtigt sind. Die medicina geht in den meisten ExempelGeschichten im allgemeinen Schema vom betrogenen Betrüger unter, und selbst die Hauptfigur kennt bis zum Schluss keine Heilmittel gegen die Näscherei (vgl. S. 252). Schließlich ebnet der Abschluss des Romans die Lasterkritik am Naschen in gewisser Weise wieder ein, indem er es als einen allgemeinen Teil des menschlichen Lebens charakterisiert: Denn wer kan davor/ So lange der Mensch seine Begierden empfindet/ und so lange der Appetit dem Gemthe zusetzet/ so lange wird sich kein Mensch so reine befinden/ daß er nicht zum wenigsten einmahl auf dem Nscher-Theatro einen Pickelherings-Poßen gemacht htte. (S. 253)
Das Naschen erscheint also nicht als vermeidbares Laster wie die Beispiele aus der Poetik, sondern als allgemein-menschlicher Zug: Die einfachen Laster der Aufschneiderei oder der Gefallsucht kann man sich möglicherweise abgewöhnen, das Naschen offenbar nicht.
3 Erzählverfahren im Politischen Näscher Wie entfaltet Weise nun seine Kritik am Näscher-Wesen erzählerisch? Es hätte nahegelegen, das breite Phänomen revueartig zu entfalten, und in der Tat weist der Roman auch Züge einer Narrenrevue auf. Immer wieder werden Figuren vorgeführt, die sich närrisch verhalten oder auch explizit als Narren bezeichnet werden (vgl. z. B. Kap. 4, 8, 10, 14, 16, 18 und 23).21 Dabei erscheinen auch topische
20 380 paginierte Seiten sowie 12 Doppelseiten für den ‚Weg zu der wahren Glückseligkeit‘ und den Abschluss. 21 Im Kurtzen Bericht wird der Begriff des Narren weitgefasst definiert: „[…] da man das Wort Narr/ nicht in diesen engen Verstande/ sondern wie es im [sic!] Sprüchen Salomonis/ und
‚Frommer Betrug‘ am Leser?
233
Figuren aus der Tradition der Narrenrevuen (z. B. der Liebes-Narr, Kap. 14 f., oder der närrische Schulmeister mit seinem weltfremden Wissen, Kap. 16); in Johann Beers Narrenspital und Weises Drey Ertz-Narren zeigt sich diese Tradition um 1680 noch als lebendig. Zudem wird im Text am Beispiel von Weises Ertz-NarrenRoman auch über die Legitimität des Erzählens von Narren diskutiert (S. 225 ff.), das Verfahren der Narrenrevue also auch auf einer Metaebene thematisiert und reflektiert. Dennoch bildet die Narrenrevue nur ein partielles Strukturmuster dieses Romans. Zu einer konsequenten Narrenrevue fehlt dem Text die Differenzierung der Näscher. Dies hängt sicher mit der Allgemeinheit des Themas zusammen, aber wohl auch mit der Vorstellung, dass das Naschen jeden betrifft, nicht nur ausgemachte ‚Narren‘. Weise greift also im Politischen Näscher auf die Narrenrevue als narrative Tradition zurück, überblendet sie aber mit erzähltechnischen Verfahren der pikarischen Tradition, der italienischen Novellistik und der deutschen Schwanksammlungen (z. B. Pauli). Diese unterschiedlich gerichteten Erzählverfahren behindern sich aber, wie zu zeigen sein wird, in gewisser Weise gegenseitig. Während der Text aus einer Fülle einzelner kleiner Exempelgeschichten besteht, die additiv und einsträngig gereiht werden, versucht Weise auf zwei Ebenen, diesen Kleinformen Kohärenz zu verleihen: zum einen durch die narrative Integration in ein Lebenslaufmodell nach dem Vorbild des pikarischen Romans, zum anderen durch die thematische Konstanz der Näscher-Thematik.
3.1 Pikarische Elemente Am Anfang des Romans präsentiert Weise eine Figur, die einige typische Züge eines Pícaro aufweist und die zunächst die Erwartung auf einen Roman in der pikarischen Tradition wecken könnte, würden nicht schon der Titel und die Paratexte in eine andere Richtung weisen. Ein junger Mann namens Crescentio wird als Vollwaise eingeführt; sein schmales Erbe geht zu Ende, weshalb ihn sein Vormund als 16-Jährigen mittellos auf die Straße setzt, damit er nach einem eigenen Platz in der Welt sucht. Er ist, worauf schon der sprechende Name hindeutet, eine Figur, die erst wachsen muss, eine Tabula rasa. Im ersten Kapitel wird dem simplicianisch als „einfltige[r] Tropff“ (S. 15) gekennzeichneten Crescentio die Aufgabe gestellt, Welt und Gesellschaft zu verstehen und das Unterscheiden zu lernen. Verhaltensbeobachtung und das Sammeln eigener Erfahrung soll ihn
im Jesus Syrach genommen wird/ etwas weiter auslegen muß/ daß alle Menschen darunter begrieffen werden/ welche sich die blinden Affecten zu einer verderblichen und schdlichen Lust verleiten lassen“ (S. 285 f.; Hervorh. im Orig. gesperrt).
234
Jörg Krämer
(und den Leser) dazu befähigen, die Narrheiten der Näscher auch hinter wohlanständigen Fassaden zu erkennen. Damit wird das pikarische Muster gleich zu Beginn des Textes modifiziert und verengt. Crescentio dient und lernt dann im Laufe des Textes bei den verschiedenartigsten Figuren – bei Lehr- und Autoritätspersonen, die seine Entwicklung befördern, aber auch bei einigen Narren (wie Balthasar Schoß oder Strephon). Dennoch lernt er es eigentlich bis zum Schluss kaum, aus eigener Erkenntnis die Näschereien zu durchschauen. Bis zum Ende des Romans bleibt er unselbständig abhängig vom Urteil autoritativer Figuren, und was aus der zu Beginn angekündigten Schrift„Rolle“ wird, in der er die Näscher-Narren systematisch verzeichnen möchte, bleibt bezeichnenderweise unklar. Auch wenn das Programm, das am Anfang entworfen wird, zweifellos mit Weises Vorstellungen einer lebensnahen Didaktik zusammenhängt, in der eigene Erfahrung über reines Lehrbuchwissen gestellt wird,22 setzt der Verlauf des Romans dieses Programm kaum um. Der pikareske Außenseiter erwirbt sich keineswegs linear die angestrebte Weltklugheit, sondern verliert sich immer wieder in den kontingenten Vorfällen des Alltags. Die wichtigsten und vom Text mit der höchsten Autorität ausgestatteten Experten für den unwissenden Crescentio sind zu Beginn Philander (einerseits ein sprechender Name, andererseits möglicherweise ein intertextueller Verweis auf Johann Michael Moscheroschs Gesichte Philanders von Sittewalt) und später insbesondere der alte fürstliche „Informator“, der das letzte Drittel des Romans als entscheidende Norminstanz prägt. Die Entwicklung Crescentios verläuft nun trotz dieser Experten freilich keineswegs so klar gerichtet, wie es das im ersten Kapitel vorgestellte Programm vermuten lässt. Die Figur bleibt weitgehend blass und entwickelt sich im Grunde kaum.23 Im Gegensatz zum klassischen Pícaro handelt Crescentio fast nie aktiv, er verbleibt durchgängig in der Position des randständigen Beobachters oder Zuhörers; immer wieder distanziert sich der Text vom „einfltig[en]“ Crescentio (vgl. S. 57 u. 211). Zwar zeigt Crescentio mitunter überraschende Kenntnisse und Fähigkeiten (Musik, Latein, Schulwissen) und ist auch allzeit bereit, dazuzulernen. Der Informator, der ihn im 24. Kapitel einer eingehenden Prüfung unterzieht, kommt jedoch zu dem Schluss: „Mein Freund/ ihr habt viel gelernet/ und seyd doch nicht gelehrt worden.“24 Daran ändert sich
22 Vgl. die kritische Darstellung blinder Schulgelehrsamkeit in Kapitel XVI des Romans. 23 Vgl. dazu auch Burgess (Anm. 19), S. 185 ff. 24 Die Stelle lautet im Kontext: „Allein er wuste gnung definitiones und distinctiones, hingegen wie man zu einem tugendhafften Leben/ ingleichen zu einem guten Gewissen durch solche distinctiones gelangen solte/ daß war ihm so wenig bekandt/ als die Strasse von Lemberg nach Moßkau. Er disputirte de Affectibus, aber wie er seine Affecten knte im Zaum halten/ und wie er andere nachdrcklich anmahnen solte/ davon hatte er nichts gehret noch
‚Frommer Betrug‘ am Leser?
235
bis zum Ende des Romans nicht viel. Die Figur gelangt also letztlich nicht zur Erkenntnis über das Näschertum, die am Anfang als Programm aufgestellt wird. Da Crescentio keine richtige Entwicklung durchläuft und da er als randständiger Beobachter fast nie aktiv in die Geschehnisse verwickelt ist, kann er damit auch nicht in jene Position eines geläutert zurückblickenden Erzählers gelangen, die viele große Texte der Pikarotradition strukturell trägt. Entsprechend ist der Roman auch nicht in der pikarischen Ich-Perspektive als Erzählung der Figur Crescentio angelegt, sondern wird (wie sämtliche Romane Weises außer den Drey Haupt-Verderbern) von einem extradiegetischen Erzähler erzählt. Das Interesse des Lesers wird damit rasch von der Crescentio-Figur weggelenkt auf die Fülle der einzelnen, additiv gereihten Episoden. Wenn Weise also mit der Ausgangslage der Hauptfigur zunächst an Traditionen des pikarischen Erzählens anknüpft, so ist das weniger inhaltlich als funktional motiviert: Das Lebenslaufschema, die Ortlosigkeit des Protagonisten und das inhärente Motiv der Raumbewegung25 sollen dazu dienen, den Text als äußere Klammern zusammenzuhalten. Das pikarische Erzählmuster wirkt wie eine narrative Hohlform, die ihres ursprünglichen Sinns weitgehend entleert ist. Auch auf der Ebene der Handlungsentwicklung waltet im Roman keine konsequente Entwicklung, sondern pure Kontingenz. Freilich fügt sich immer alles glückhaft: Kaum verliert der Junge eine Anstellung oder einen Lehrer, so biegt per Zufall genau in diesem Moment der nächste um die Ecke. Weise gibt sich oft gar keine Mühe, das zu verbergen – im Gegenteil, er stellt diese Brüchigkeit der narrativen Konstruktion bewusst aus und ironisiert sein Erzählverfahren indirekt immer wieder. So heißt es am Ende der ersten Schulmeister-Episode etwa, dass „endlich Deus ex machina erschien/ und dem armen Crescentio eine wunder-
gelernet. Er sagte viel de Fortitudine, aber wie sich die Furcht aus dem Gemthe schlagen/ und der Mittel-Weg zwischen der thumkhnen Verwegenheit klglich finden liesse/ darinn bekandte er seine Unschuld. Derhalben fieng der offterwhnte Informator an: ‚Mein Freund/ ihr habt viel gelernet/ und seyd doch nicht gelehrt worden. Euer Kopf ist mit viel theoretischen Hndeln angefllet/ doch was ihr damit thun sollet/ das bleibt euch noch verborgen. Ach was vor schdliche Leute werden aus den besten Juristen/ aus den schnsten Historicis, aus den fertigsten Disputatoribus, wenn sie weder die Affecten bezwingen/ noch das Gewissen verwahren lernen. Und wie unverantwortlich gehen die Leute mit ihren Untergebenen umb/ welche diesen Grund der Erudition, und diesen Mittelpunct der gemeinen Wohlfahrt so gar unberhret lassen!‘“ (S. 157 f.) 25 Die Raumdarstellung in Weises Text ist überwiegend funktional angelegt, weder allegorisierend noch konkret extern korrelierbar: Sie ist soziale Kulisse. – Zum Raumverhalten der Pícaros vgl. Ansgar M. Cordie: Raum und Zeit des Vaganten. Formen der Weltaneignung im deutschen Schelmenroman des 17. Jahrhunderts. Berlin, New York 2001 (Quellen und Forschungen zur Literatur- und Kulturgeschichte N. F. 19).
236
Jörg Krämer
liche Erlsung zuschickte“ (S. 83). Ironie liegt hier zusätzlich auch darin, dass dieser Deus ex Machina, der Goldschmied Strephon, sich als der allergrößte Narr unter Crescentios Dienstherren erweisen wird. Das Ende des Romans mit dem Aufstieg Crescentios in die Welt des Hofes (als Sekretär eines Geheimrats) wirkt dann auch wie eine willkürlich zustande gekommene, beliebige Klammer, mit der der narrative Rahmen mehr notdürftig zusammengehalten wird. Den thematischen Auftrag des Beginns, die politischen Näscher zu beschreiben, kann Crescentio ohnehin nicht erfüllen: „Also ward Crescentio ein Hofmann/ und merckte/ daß er bißhero nur einen Schatten von den Politischen Nschern gesehen htte […]“ (S. 252). Und das gilt genauso für den Leser: Denn der Gesellschaftsausschnitt des Textes ist im Wesentlichen auf die altständisch-bürgerliche Sphäre beschränkt (und auch von daher enger gefasst als meist im pikarischen Erzählen). Moderne Berufe aus dem Bereich der Ökonomie (Kaufmannschaft, Versicherungswesen, Weinhandel) erscheinen nur am Rande und werden dann eher als betrügerisch gekennzeichnet. Dem formalen Muster einer Aufstiegsgeschichte von vagierender Außenseiterexistenz zum „Hofmann“ fehlt im Vergleich zum klassischen Pikaroroman die Spannung von erzählendem und erzähltem Ich und damit zugleich die Spannung von additiv gereihten Episoden und ihrer syntagmatischen Verklammerung. Crescentio selbst kommt nie zum Erzählen, stattdessen erzählt ein überlegener, extradiegetischer Erzähler, der sich aber über weite Strecken des Textes hinter sekundäre intra- und homodiegetische Erzähler zurückzieht. Ständig wird in diesem Text erzählt; die Geschichten, die Crescentio selbst miterlebt, bilden einen weitaus kleineren Teil des Romans als die vielen Binnenerzählungen in typischen Situationen: beim Essen, im Wirtshaus, in privaten Abendgesellschaften, bei Festen oder in der Reisekutsche. Diese eingelegten Binnenerzählungen weisen formal eine große Bandbreite auf. Von kurzen Anekdoten über typische Schwänke bis hin zu größeren BinnenLebensgeschichten, von Liedern aller Art (und virtuos wechselnder Gestalt) über Pasquills, Gedichte, Edikte und Briefparodien nimmt der gefräßige Roman eine Fülle verschiedenster literarischer Formen in sich auf.26 Das mag mit dem akademischen Hintergrund dieses Romantyps zu tun haben, der in einem universitären Umfeld entstand und durchaus auch Züge akademischer Übungstexte aufweist.27 Bei den größeren der eingelegten Binnen-Lebensgeschichten greift
26 In der Fortsetzung des Romans im Kurtzen Bericht skizziert Weise auch die Integration einer Komödie; vgl. S. 340. 27 Dazu Jörg Krämer: Regionalität und Literatur. Novellistisches Erzählen bei Grimmelshausen und Christian Weise. In: Positionierungen. Pragmatische Perspektiven auf Literatur und Musik der Frühneuzeit. Hg. von Dirk Niefanger und Werner Wilhelm Schnabel. Göttingen 2016 [im Druck].
‚Frommer Betrug‘ am Leser?
237
Weise teilweise wiederum auf pikarische Muster zu – hier erzählen in den Roman eingekapselte Pícaros, und hier findet sich zumindest ansatzweise jene konstitutive Spannung zwischen erzählendem und erzähltem Ich wieder. Am deutlichsten ist dies bei den drei großen Erzählungen der Kapitel 19 bis 22, als bei einer Feier anlässlich einer Taufe drei Gäste ihre „Peccata Juventutis“ (S. 97) zum Besten geben. Während die ersten beiden Binnenerzähler auch als Figuren typische Pícaro-Eigenschaften haben (sie arbeiten auch mit moralisch bedenklichen Mitteln wie Gewalttätigkeit), stellt der dritte geradezu einen Antipícaro dar: Der reiche Erbe bringt sein großes Vermögen auf der sinnlosen und vergeblichen Suche nach höfischer Nobilitierung durch. Aber nur diese Figur wiederum bereut und artikuliert Einsicht in eigene Fehler; die beiden anderen, die echten Pícaros, nutzen die Spannung der Rückblende auf ihr Leben nicht, sondern beklagen allenfalls allgemein ihre widrige Fortuna.
3.2 Kohärenz Ein erheblicher Teil dieser eingelegten Erzählungen hat nun aber mit der NäscherThematik kaum oder allenfalls am Rande zu tun. Besonders deutlich ist dies in den Kapiteln 26 bis 32, als beim Mittagessen in einem Wirtshaus in einer zufällig zusammengekommenen Gesellschaft von Liebes- und Hochzeitsgeschichten erzählt wird. Keine dieser Geschichten hängt mit der Näscher-Thematik zusammen. Dafür kehren bekannte Topoi der Novellen- und Komödientradition wieder: die Verhinderung von Hochzeiten durch geizige Vormunde, böse Hausfrauen, schlaue Verwandte etc. Selbst Crescentio erkennt die Unvereinbarkeit dieser Geschichten mit der Näscher-Thematik, wenn er feststellt, er bräuchte jetzt eine andere Schrift-„Rolle“, um das Lehrhafte dieser Geschichten zu erfassen (S. 210). Beispielhaft dafür ist etwa die Binnenerzählung von einem jungen Gutsbesitzer, der, „ein feiner Mensch von guten Qvalitten“ (S. 201), zufällig bei einem geschäftlichen Abrechnungsvorgang auf die junge Nichte seines Geschäftspartners trifft, die dessen ganzen Haushalt perfekt führt. Er verliebt sich spontan in sie,28 doch seine offizielle Brautwerbung scheitert an der faulen Frau des Vormunds, die auf die Arbeitskraft der tüchtigen Nichte nicht verzichten will. Deshalb greift der junge Mann zu einem speziellen Mittel: Er schwängert die junge Nichte ohne ihr Wissen im Schlaf und hofft, auf diese Weise die Verheiratung erzwingen
28 Die intradiegetische Erzählerin betont: „Sie war auch wol liebens werth/ weil sie von einem artigen unter satzten Leibe/ von klaren und rthlichen Gesichte/ und mitten in ihrer vielfltigen Arbeit von ziemlich weichen Hnden war. Ich muß sie in diesem Stcke beschreiben/ worauf die angehende [sic!] Liebhaber gemeiniglich ihre Augen zu richten pflegen“ (S. 201).
238
Jörg Krämer
zu können. Die junge Frau wird tatsächlich schwanger, kann sich ihre Situation nicht erklären und gerät dadurch in eine Lage, die der der Kleistschen Marquise von O. ähnelt. Nach allerhand Verwicklungen wendet sich die Geschichte zum kaum mehr erwartbaren glücklichen Ende; der Vormund und seine böse Frau werden dagegen mittels poetischer Gerechtigkeit29 bestraft (S. 206). Entscheidend scheint mir bei dieser ganzen Episode, dass das zweifelhafte Vorgehen des jungen Mannes nirgendwo im Text problematisiert wird. Es erscheint im Gegenteil als offenbar gerechtfertigtes Mittel gegen die Verweigerungshaltung des Vormunds. Der Leser kann der Episode keine moralische oder weltkluge Lehre entnehmen, denn zur Nachahmung dürfte das angewandte Vorgehen kaum gedacht sein. Im Gegenteil distanziert sich Weise sogar von kurzschlüssigen Moral-Lehren: Die junge Frau wendet sich in ihrer Not an einen geistlichen Beichtvater, der ihr jedoch keinerlei Hilfe bietet, sondern nur über die „Boßheit der jetzigen Welt/ da man die Laster noch so alber und thricht vermnteln wolte“ moralisiert (S. 202). Starre konventionelle Moralvorstellungen werden hier als falsches, situationsinadäquates Verhalten vorgeführt. In den Vordergrund rückt Weise dagegen die existenzielle Notlage der jungen Frau, und die Spannung ergibt sich aus der Frage, wie diese verwickelte Situation wohl gelöst werden kann. Durch die extreme Schwarz-Weiß-Zeichnung dieser Episode (hier die böse, faule Frau des Vormunds, dort die in jeder Hinsicht tugendsame junge Nichte) muss der Leser eine glückliche Lösung erwarten, die erzählerisch durchaus kunstvoll hinausgezögert wird. Das mehr als fragwürdige Vorgehen des Brautwerbers erscheint somit primär als Teil der novellistischen Struktur, ohne dass seine Problematik thematisiert würde. Es wäre zu überlegen, ob diese Episode nicht letztlich sogar der behaupteten Gesamtthematik des Romans komplett zuwiderläuft. Denn der junge Mann müsste eigentlich insofern unter die Kategorie der Näscher gerechnet werden, als er mit fragwürdigen Mitteln etwas erreichen will, das ihm eigentlich nicht zukommt. Doch alle derartigen Gedanken werden vom unterhaltsamen Erzählen überdeckt: An die Stelle von Didaxe oder Lehre der Weltklugheit tritt die Spannung des ‚novellare‘. Was passiert hier und in anderen eingelegten Erzählungen? Hat Weise solche Episoden bewusst eingefügt, um den Leser nicht durch die Pillen sauertöpfischen Moralisierens zu ermüden? Oder verselbstständigt sich hier ein erzählerischer Impuls, der unterschiedliche literarische Traditionen weiterführt und sich eben nicht einfach als Verzuckerung bitterer Arzneien funktionalisieren lässt? Wenn es Weise wirklich nur um die Vermittlung weltkluger Verhaltenslehren im fiktiona-
29 Vgl. Hartmut Reinhardt: Poetische Gerechtigkeit. In: RLW 3, S. 106–108.
‚Frommer Betrug‘ am Leser?
239
len Kleid gegangen wäre – warum ist er dann nicht beim Modell der Narrenrevue geblieben? Der Näscher-Roman erweist sich als erzählerische Mischform, in der sich Elemente des pikarischen Erzählmodells mit anderen Erzählmustern überlagern – mit den Schwanksammlungen, mit der italienischen Novellistik, mit den Narrenrevuen, mit dem Expertus-Ignotus-Modell, das seit Moscheroschs Philander von Sittewalt in der deutschen Literatur des 17. Jahrhunderts beliebt ist. Dies kann nicht ohne Folgen für die narrative Struktur bleiben. Die Lebenslaufgeschichte des Crescentio entwickelt nahezu keinerlei konstruktive Kraft, aber auch das thematisch gebundene Beispielschema des Traktats mit seiner deduktiven Logik funktioniert im Medium des Romans nicht. Woraus aber ergibt sich dann doch so etwas wie eine Kohärenz des Romans? Sie resultiert nicht aus seiner Struktur – der Roman weist keine finale Spannung auf und erscheint beliebig erweiterbar oder kürzbar, beinahe wie ein Produkt der Bogenzahl-Vorgabe des verlegenden Buchhändlers; die Position der meisten Binnenepisoden im Roman wirkt zudem beliebig austauschbar, da diese weitgehend ohne Relevanz für den Lebenslauf der Hauptfigur bleiben. Die Kohärenz wird stattdessen durch fast gewaltsame auktoriale Eingriffe erzeugt. Kurz vor dem Ende des Textes findet sich bekanntlich ein Einschub, ein inserierter Traktat mit dem Titel „Weg Zur wahren Glckseligkeit […] von Chr. Ph.“ (S. 233), in dem streng deduktiv in 84 Punkten die Ziele des Lebens bestimmt und daraus die notwendigen Verhaltensregeln abgeleitet werden. Derartige Einschübe anderer Textsorten sind für die Romane Weises und seiner Zeitgenossen wie Beer oder Printz insgesamt charakteristisch30 und stellen offensichtlich einen Versuch dar, die thematische Kohärenz und das richtige Verständnis31 der Werke zu sichern. Aufschlussreich ist nämlich, wie Weise diesen Traktat in die fiktionale Handlung einbindet: Angeblich handelt es sich um eine in kleiner Auflage gedruckte Lebenslehre für einen Prinzen, die der alte Informator in seinen Papieren mit sich führt. Dieser übergibt den Text Crescentio und einigen Studenten, die ihn in der Kutsche begierig lesen. Doch dann schaltet sich der extradiegetische Erzähler ein mit dem Hinweis, es sei auch für den Leser des
30 Vgl. das Gerichtsurteil am Ende der Ertz-Narren oder die Epiktet-Übersetzung in den Drey Klügsten Leuten; auch in der skizzierten Fortsetzung des Näschers sollte Crescentio seinem Schüler einen Brief mit politischen Lebensregeln hinterlassen (S. 343 f.). 31 Vgl. die Bestimmung im Kurtzen Bericht: „[…] der Leser sol etliche kluge und wolanständige Lebens-Regeln daraus zu mercken haben.“ (S. 335, im Orig. gesperrt) Dadurch sollen sich „diese[ ] unschuldigen Bcher[ ]“ von „einer Schrifft von lauter unntzen Worten“ grundsätzlich unterscheiden (S. 336 f.): „[W]er keine Special Lehren vor irrende Personen im Vorrathe hat/ der begebe sich nicht auff das lustige Bcherschreiben“ (S. 337).
240
Jörg Krämer
Romans nur gut, diesen Text zu studieren. Und dabei kommt es nun zu einer charakteristischen Überblendung der Erzählebenen, die den fiktionsinternen Verfasser des Traktätleins unvermittelt mit dem extradiegetischen Erzähler selbst zusammenfallen lässt. Anspielend auf das topische Bild von der überzuckerten Pille schreibt der Erzähler (S. 232): „Denn deßwegen habe ich den lustigen Zucker im Anfange nicht gesparet/ deß nunmehr diese Artzney des Gemthes/ und diese Cur aller Politischen Nscher desto leichter angenommen und gebrauchet wrde. Hiermit schreite ich zur Sache:“ Darauf folgt der eingelegte Traktat, der damit zum eigentlichen Fluchtpunkt des Romans – und zum Werk des Erzählers erklärt wird. (Angekündigt findet sich dies allerdings bereits in der Vorrede an den Leser, wo es heißt: „Ich habe […] zu Ende des Werckes gewiesen/ wie ich dergleich Fundamental-Cur gegen die Nscher in guter Ordnung vorzunehmen gedchte“ [S. 9].) Damit wird dem Roman eine Finalität zugeschrieben, die ihm auf der narrativen Ebene nicht zukommt. Zudem handelt es sich bei dem eingeschobenen Traktat gerade nicht um eine Kritik der Näscher, sondern um eine allgemeine Lebenslehre. Den besonderen Status dieses Texteinschubs bestätigt auch die bemerkenswerte Tatsache, dass eine Rostocker Dissertation von 1681 diesen Abschnitt aus dem Roman als Beitrag zur praktischen Philosophie (gleichwertig neben Texten von Valentin Alberti, Jacob Thomasius u. a.) behandelt.32 Der ‚Weg zu der wahren Glückseligkeit‘ geht also nicht aus dem Roman selbst hervor (Crescentio findet ihn nicht), sondern ist als auktorialer Fremdkörper in diesen eingesenkt – offenkundig um eine Deutungsperspektive des Romans zu sichern, die aus dem Erzählten selbst nicht eindeutig genug hervorgeht. Zudem ist hier der mediale Unterschied aufschlussreich: Dem schriftlichen Traktat wird im Roman eine ganz andere Gültigkeit zugesprochen als den eingelegten mündlichen Erzählungen der Binnenerzähler.
4 Fazit Was bedeutet dies nun für das Erzählverfahren und seinen Zusammenhang mit der postulierten Nutzanwendung des Romans, die Weise in der Vorrede und im Kurtzen Bericht fordert? Friedrich Vollhardt hat versucht, diese wie folgt zu bestimmen: „Sie beschränkt sich auf die Techniken der Interessenwahrneh-
32 Gottlob Friedrich Seligmann (Praes.) und Johann Christoph de Lübken (Autor): Moralia In Compendio i.e. Virtuosas Actiones Nostras Ex Amore, Velut Scaturigine, Deductas, Consensu Superiorum. Rostochii 1681. Vgl. dazu Vollhardt (Anm. 11), S. 122.
‚Frommer Betrug‘ am Leser?
241
mung und rationalen Vorsorge, über die der einzelne verfügen muß, um in der ‚Menschlichen Gesellschaft‘ – von der bereits die Vorrede ein illusionsloses Bild entwirft –‚sein Privat-Glück‘ zu ‚erhalten‘, das heißt noch grundsätzlicher: sich selbst zu erhalten.“33 Dies ist freilich eine sehr allgemeine Bestimmung, die eher für den ‚Weg zu der wahren Glückseligkeit‘ als für den Näscher-Roman als Ganzes gilt: Denn trotz ihrer Allgemeinheit trifft Vollhardts Bemerkung auf einen Teil der erzählten Episoden gerade nicht zu, da diese eher von der Lust am Schema des betrogenen Betrügers motiviert scheinen als von der Darstellung von Techniken der Selbsterhaltung. Denn häufig sind die Näscher des Textes wohlhabende oder bessergestellte Bürger, deren Fehltritte zum Lachen reizen, aber keineswegs glücks- oder gar existenzbedrohende Folgen haben. Und was Vollhardt vornehm als „Techniken der Interessenwahrnehmung und rationalen Vorsorge“ bestimmt, erscheint im Roman doch eher als pragmatisch-spontane, kaum systematisierbare Reaktionen auf die kontingenten Probleme des Alltags. Dem Leser wird ebenso wenig wie Crescentio eine stringente Lehre weltklugen Verhaltens geboten. Der Roman vom Politischen Näscher ist eben keine Lehre des ‚Wegs zu der wahren Glückseligkeit‘ im fiktionalen Kleid – und gerade deshalb mag es Weise so notwendig erschienen sein, diesen Traktat am Ende des Romans einzufügen. So ernst es ihm mit dem Bemühen gewesen sein mag, zur Weltklugheit seiner Leser beizutragen, so sehr wird dieses hehre Anliegen doch im Roman immer wieder überlagert von einem unterhaltsamen Erzählen, das zur Verselbstständigung tendiert. Nur über vergleichsweise rabiate auktoriale Eingriffe (wie die Einfügung des ‚Wegs‘) oder über paratextuelle Elemente (wie das Titelkupfer samt erklärendem Gedicht) lässt sich demgegenüber die behauptete Funktion und moralische Nutzanwendung des Textes überhaupt sichern. Auch in den einzelnen Episoden müssen häufig explizite Deutungen (durch Sicherungsinstanzen wie den Informator etc.) oder die poetische Gerechtigkeit die Deutung von Erzählungen sichern, die sonst auch anders lesbar wären.34 Letztlich dient auch der Kurtze Bericht als Epitext demselben Ziel, die ‚richtige‘ Lektüre derartiger Texte zu sichern (ältere Verfahren wie die Allegorese fehlen bei Weise dagegen völlig – sie sind um 1680 offensichtlich obsolet geworden). Weise konzipiert in all seinen Para- und Epitexten das Fiktionale als bloßes Verpackungsdesign für vorgängige Inhalte und vermeidet jede Reflexion über einen möglichen Eigenwert der Unterhaltung wie auch des Literarischen. Litera-
33 Vollhardt (Anm. 11), S. 116 f. 34 Vgl. etwa die Episode vom Priester, der durch seinen Bruder betrogen wird (S. 187 f.). Hier ergibt sich die ‚Moral‘ aus der ‚poetischen Gerechtigkeit‘, nach der es dem gewitzt-betrügerischen Bruder und der opportunistischen Frau am Ende schlecht ergeht.
242
Jörg Krämer
rische Gestaltung erscheint als bloßer Schreibstil, als Textproduktion nach dem Muster der Rhetorik.35 Weises Roman jedoch entspricht nicht den theoretischen Postulaten seines Autors: Der Text weist einen Überschuss des unterhaltenden Erzählens über seine Funktionalisierung auf, einen Überschuss, der nicht in der unterhaltsamen Verpackung einer reinen Weltklugheitslehre oder in ‚frommem Betrug‘ am Leser aufgeht.36 Genau dieser Überschuss aber dürfte es wohl gewesen sein, der den Texten ihren Erfolg verschaffte und der eine Vielfalt der Rezeption ermöglichte, die vom Autor im anonymen System des Buchmarkts nicht mehr zu steuern war.37 Weises persönliche Reaktion darauf war bekanntlich der Rückzug von der Gattung Roman und die Hinwendung zum Schuldrama, dessen Rezeption in der konkreten Aufführungssituation ihm offenbar leichter zu lenken erschien.38 Auch die von ihm wesentlich mitgeprägte Gattung des ‚Politischen Romans‘ verlor dann bereits wenige Jahre später, wie Andrea Wicke gezeigt
35 Damit ist auch eine bewusste Abwehr komplexer Fiktionsverfahren verbunden, die die angestrebte Inhaltsvermittlung offenbar stören könnten (höfisches Erzählen, Allegorie, simplicianische Saalbaderschaften usw.). Andrea Wicke hat dies als Aporie eines „zwischen den Maßstäben eines gelehrten und eines populären Literaturverständnisses schwankenden Konzepts“ zu bestimmen versucht (Wicke [Anm. 5], S. 243; vgl. auch ebd. S. 247). 36 Im Kurtzen Bericht wird sogar eine um alle Lehre verkürzte Lektüre akzeptiert: „Also mgen sich einfltige Leser an der Schale/ das ist an den eusserlichen Possen begngen/ und wer seinen Kopff zu spitzfndigen Hndeln angewehnet hat/ der mag den Kern suchen/ und weiter dencken“ (S. 312). Zum diesem ‚Überschuss‘ gehören z. B. auch die Sprachspielereien im Romantext. – Vgl. allgemein Jörg Wesche: Literarische Diversität. Abweichungen, Lizenzen und Spielräume in der deutschen Poesie und Poetik der Barockzeit. Tübingen 2004 (Studien zur deutschen Literatur 173). 37 Johann Beer dagegen scheint genau dies erkannt zu haben: „Gleichwie es aber viel Köpffe giebt/ also giebt es auch viel Sinn“ (Johann Beer: Vorbericht an den Leser zu Corylo. In: Ders.: Sämtliche Werke. Hg. von Ferdinand van Ingen und Hans-Gert Roloff. Bd. 3. Bern u. a. 1986, S. 13). 38 Es wäre von daher zu überlegen, ob die Tatsache, dass Weise nach dem Näscher überhaupt keine Romane mehr schrieb, nicht nur den Rücksichten auf die Rektorenposition geschuldet war. Möglicherweise spiegelt sich darin auch seine Erkenntnis, dass diese Widerständigkeit des unterhaltenden Erzählens gegen seine Funktionalisierung im populären Genre nicht zu vermeiden war, dass also sein Konzept einer didaktischen Literatur nicht so funktionierte, wie er es intendiert hatte. – Freilich müsste die Frage angesichts der späteren Druckausgaben der Schuldramen noch einmal separat geprüft werden; vgl. dazu Claus-Michael Ort: Medienwechsel und Selbstreferenz. Christian Weise und die literarische Epistemologie des späten 17. Jahrhunderts. Tübingen 2003 (Studien und Texte zur Sozialgeschichte der Literatur 93), bes. S. 39–89. Auch Ort arbeitet aber heraus, wie Weise in den Druckausgaben seiner Dramen den „Deutungsfreiraum des Lesers durch Strategien der Rezeptionssteuerung und Affektlenkung“ wieder zu steuern und einzuschränken versucht (S. 49).
‚Frommer Betrug‘ am Leser?
243
hat, ihre modellbildende Kraft.39 Dies indiziert einen Wandel des Verständnisses von Fiktionalität einerseits, von Unterhaltung40 andererseits im späten 17. Jahrhundert, der noch genauer zu analysieren wäre.
39 Vgl. Wicke (Anm. 5) sowie dies.: Literarische Moden um 1700. Zum historischen Wandel populärer Lesestoffe. In: Eybl/Wirtz (Anm. 2), S. 27–50, bes. S. 30 f. 40 Vgl. Eybl/Wirtz (Anm. 2), darin besonders den Beitrag von Franz M. Eybl: Einleitung: Unterhaltung zwischen Barock und Aufklärung, S. 9–24, hier bes. S. 15 ff.
Carolin Struwe
Der homo variegattus und die Diversität der Erfahrung Johann Georg Schielens Deß Frantzösischen KriegsSimplicissimi Hoch-verwunderlicher Lebens-Lauff (1682/83)
1 Ein neuer Pícaro Anfang der 1680er-Jahre hat der Simplicissimus Teutsch bereits viele Nachahmungen erfahren und die pikareske Gallionsfigur Simplicius beachtlichen Familienzuwachs erhalten: immer neue Brüder, Vetter und andere Verwandte erscheinen auf der literarischen Bühne. Die Bezeichnung ‚simplicianisch‘ ist zum beliebten, verkaufsfördernden Epitheton geworden, mit dem die Erwartung eines dem Simplicissimus ähnlichen satirisch-schwankhaften Lebenslaufs evoziert wird. Zu diesen vielfältigen Nachahmungen des Simplicissimus, die in der Forschung als Simpliziaden bezeichnet werden,1 wird auch das 1682/83 erscheinende Werk Johann Georg Schielens (1633–1684),2 Deß Frantzoͤsischen Kriegs=SIMPLICISSIMI
1 Der Terminus stammt von Hubert Rausse: Zur Geschichte der Simpliziaden. In: Zeitschrift für Bücherfreunde N. F. 4 (1913), S. 195–215, hier S. 196. Die zwischen 1670 und 1744 entstandenen Simpliziaden bieten „ein recht verwirrendes Bild von über 30 Titeln, die teilweise lediglich bibliographisch nachweisbar, aber nicht mehr zugänglich sind“ (Stefan Trappen: Grimmelshausen und die menippeische Satire. Eine Studie zu den historischen Voraussetzungen der Prosasatire im Barock. Tübingen 1994 [Studien zur deutschen Literatur 132], S. 66). Diese Verwirrung erklärt sich zum einen mit der Varianz der Texte im Hinblick auf die Gattungen, die Romane (elf Titel), Gesprächsliteratur, Exempelliteratur, Flugschriften, Einblattdrucke und Kalender umfassen, zum anderen mit den völlig unterschiedlichen Bezugnahmen auf den Simplicissimus, die von einer oberflächlichen Nennung des Namens oder des Epithetons ‚simplicianisch‘ bis hin zur Übernahme von Strukturmerkmalen des Pikaroromans gehen, die allerdings oftmals stark variiert werden (vgl. ebd., S. 68–71). Wurde vor Grimmelshausen vor allem die Bezeichnung ‚pícaro‘ auf dem Titel gebraucht, wird in der Nachfolge des Simplicissimus nur noch das Etikett ‚simplicianisch‘ als Gattungskennzeichnung verwendet (vgl. Peter Heßelmann: ‚Simplicissimus redivivus‘. Eine kommentierte Dokumentation der Rezeptionsgeschichte Grimmelshausens im 17. und 18. Jahrhundert (1667–1800). Frankfurt am Main 1992 [Das Abendland N. F. 20], S. 73). 2 Manfred Koschlig konnte anknüpfend an die Studie von Richard Alewyn über die fiktive Verlagsangabe Fillion beziehungsweise den Drucker und Herausgeber Felßecker als erster die Identität des Autors aufdecken und biografische Daten zusammenstellen; Manfred Koschlig: Der „Frantzösische Kriegs-Simplicissimus“. Oder: Die „Schreiberey“ des Ulmer Bibliotheksadjunkten
246
Carolin Struwe
Hoch=verwunderlicher Lebens=Lauff 3 gezählt, das in drei Teilen zu je zwei Büchern bei Matthäus Wagner in Ulm gedruckt wird.4 Von Hubert Rausse zu den Simpliziaden „im engsten Sinne“5 gerechnet, stellt der Text nicht nur über den Titel und die Angabe der fiktiven Offizin („Druckts und verlegts J. J. Fillion“) eine Verbindung zum Simplicissimus Teutsch her, sondern nimmt auch das pikareske Erzählmodell auf, um es zu variieren und mit neuen Textsorten zu kombinieren. So werden im Frantzösischen Kriegs-Simplicissimus nicht nur pikarische Erlebnisse erzählt, wobei auch Episoden bereits erschienener Pikaroromane und Simpliziaden Verwendung finden,6 sondern im zweiten bis fünften Buch vor allem die Kriegsereignisse des Niederländisch-Französischen Krieges verhandelt. Für diese Beschreibung werden sowohl historische Quellen, wie das Diarium Euro-
Johann Georg Schielen (1633–1684). In: Jahrbuch der Deutschen Schillergesellschaft 18 (1974), S. 148–220 und Richard Alewyn: Felssecker und Fillion. Zur Verlegerfrage bei Grimmelshausen. In: Zeitschrift für Bücherfreunde N. F. 19 (1927), S. 38–40. 3 [Johann Georg Schielen:] Deß Frantzoͤsischen Kriegs=SIMPLICISSIMI, Hoch=verwunderlicher Lebens=Lauff. Darinnen Historischer Weiß vorgebildet/ und dargestellet werden/ I. Allerley Stands=Persohnen geuͤbte Tugenden/ wie auch hingegen deroselben Laster und Untugenden. II. Unterschiedliche und tieffsinnige Staats=Discursen/ von jetziger Zeit seltzamen Welt=Haͤndlen. III. Denckwuͤrdige Erzehlungen/ und wunderliche Begebenheiten deß Frantzoͤsischen Kriegs= Wesens/ so sich in Europa, von Anno 1672. an/ begeben und zugetragen. IV. Wie auch/ unzahlbarlich viel merck= und leßwuͤrdige Krieg und Friedens/ etc. betreffende Sachen. Aufs anmuthigste/ so wol dem Lesenden nutzlich/ als dem Zuhoͤrenden lustig/ und annemlich/ beschriben. MDCLXXXII. Freyburg/ Druckts und verlegts J. J. Fillion. – [Ders.:] Deß Frantzoͤsischen Kriegs=SIMPLICISSIMI Hoch=verwunderlicher Lebens-Lauff II. Theil. Oder 3. und 4. Buch. Von allerley Religion und Stands=Persohnen/ sicherlich und ohne Aergernuß/ mit Lust und Nutzen zu lesen. MDCLXXXIII. Freyburg/ Druckts und verlegts J. J. Fillion. – [Ders.:] Deß Frantzoͤsischen Kriegs=SIMPLICISSIMI Hoch=verwunderlichen Lebens-Lauff III. Theil. Oder 5. und 6. Buch. Von allerley Religion und Stands=Persohnen/ sicherlich und ohne Aergernuß/ mit Lust und Nutzen zu lesen. MDCLXXXIII. Freyburg/ Druckts und verlegts J. J. Fillion. Im Folgenden abgekürzt mit „Frantzösischer Kriegs-Simplicissimus“. Benutzt und zitiert werden die Bücher I und II sowie III und IV aus der Bayerischen Staatsbibliothek München, die Bücher V und VI aus der digitalen Sammlung der Universitäts- und Landesbibliothek Münster. 4 Das Verlagsprogramm macht deutlich, dass sich Wagner auf Simpliziaden spezialisiert hatte. Vgl. Elmar Schmitt: Die Drucke der Wagnerschen Buchdruckerei in Ulm 1677–1804. Bd. 1. Konstanz 1984 (Veröffentlichungen der Stadtbibliothek Ulm 4), S. 17–28. 5 Rausse (Anm. 1), S. 214. Zu diesen zählen nach Rausse auch Der Dacianische Simplicissimus (1683) und Simplicissimus redivivus (1744). 6 Rötzer verweist hier auf den Simplicianischen Jan Perus (1672), eine anonyme Übersetzung des English Rogue (1665–1671) von Richard Head (Buch I) und Francis Kirkman (Buch II). Siehe hierzu und zu den Bearbeitungstendenzen der Übersetzung Hans Gerd Rötzer: ‚The English Rogue‘ in Deutschland. In: Argenis 2 (1978), S. 229–247. Markiert sind im Text darüber hinaus auch Übernahmen aus Johann Beers Der Berühmte Narren-Spital und Georg Philipp Harsdörffers Frauenzimmer Gesprächspielen.
Der homo variegattus und die Diversität der Erfahrung
247
paeum, das Theatrum Europaeum und Der Verunruhigte Holländische Löw von Johann Beer, als auch publizistische Erzeugnisse, wie Relationen, Avisen und Flugschriften sowie Abdrucke von Kriegserklärungen, Edikten, amtlichen Resolutionen, Bekanntmachungen und Staatsverträgen genutzt.7 Eingebettet werden diese Quellen und der simplicianische Lebenslauf in eine Rahmenerzählung, eine breit ausgeführte Herausgeberfiktion, in welcher der Herausgeber des Frantzösischen Kriegs-Simplicissimus in der Ich-Form von einem Besuch im Wirtshaus berichtet, in dessen Zuge er auf einen seltsamen Mann aufmerksam wird: Nechst hierbey/ und an meinem Tische/ sasse/ dem ussern Ansehen nach/ ein elender liederlicher Kerl/ der mehr einem außgerissenen und dahero Galgenmssigem Feld=Knaben/ dann einem dapffern Soldaten gleich sahe; Seine Gestalt war bitter bel anzusehen/ und sein gantze Kleidung bestunde kaum dreyer Pfenningen werth; Jch hatte um etwas einen Grausen/ bey ihme an einem Tische zu sitzen; er hatte nur halbe Finger/ und ber seine Hnde/ blickten lauter Narben/ oder Wundenmahl herfr/ sein Mund war geschlitzet/ seine Nase zerhauen/ seine Stirne/ Augen und Wangen stunden voller blauer und gelbgesprengter Masen/ die Augen rageten außm Kopff herfr/ wie einem geschlagenem Stier; sein Bart und sein Haar/ wann man alles wolte genau zehlen/ bestund in so viel Hrlein/ als etwan Stunden in einem Tag seyn. (I, 5)
Doch erst nachdem sich der Unbekannte erfolgreich mit „Centnerschwerigen Worten“ (I, 5) in einen Diskurs dreier Männer über die freie Religionsausübung eingeschaltet hat, erweckt er Erstaunen und Neugier unter den Umstehenden, die nun nach seiner Herkunft und Geschichte fragen. Der gerade noch so eloquente Soldat verschweigt jedoch zunächst seinen Namen und rekurriert stattdessen auf einen anderen bekannten Lebenslauf: „Habt ihr Herren nie nichts/ von dem Simplicio Simplicissimo, gesehen oder gelesen?“ (I, 9). Erst nachdem dessen Lebensgeschichte von einem Wirtshausbesucher fokussiert auf die darin verhandelten Kriegsereignisse kurz zusammengefasst wurde, gibt sich der Fremde als Vetter eben jenes Simplicissimus Teutsch zu erkennen. Damit wird „diejenige Deutungstradition aufgegriffen, die den ‚Simplicissimus Teutsch‘ vornehmlich als Kriegsbuch rezipierte“.8 Der Schluss des Simplicissimus, an dem die Abkehr von der Welt und der Rückzug in die Einsiedelei beschrieben werden, wird hier jedoch nicht erzählt und damit gerade das für den pikarischen Roman gattungskonstitutive telos des Romans, die exemplarische conversio des Helden, sowie der Erzählanlass, die confessio in Form der Lebensgeschichte, ausgespart. In den Mittelpunkt dieser (fiktiven) frühen Rezeption rückt damit weniger der erbauliche
7 Siehe zu den Quellen Koschlig (Anm. 2), bes. S. 158–163. 8 Vgl. Heßelmann: Simplicissimus redivivus (Anm. 1), S. 154.
248
Carolin Struwe
als der informative Nutzen des Simplicissimus, womit auch der Deutungsrahmen entworfen wird, in dem sein Nachfolger, der Frantzösische Kriegs-Simplicissimus, gelesen werden soll. Der angebliche Vetter erzeugt dabei über die angebliche gemeinsame Genealogie zunächst Nähe zum berühmten Pícaro, vollzieht jedoch gleichzeitig eine Distanzierungsbewegung zum zitierten simplicianischen Lebenslauf: Eben dieser Simplicissimus/ sprach hiewiederum der zerlumpete Luftschlucker/ ist mein allernechster Bluts=Freund/ dann er und ich sind nur geschwistrigte Kinder/ mein Vatter und sein Vatter waren natuͤrliche Gebruͤder von einerley Vatter und Mutter her. Weilen wir aber/ von Jugend auf an/ wegen Kriegs Unwesens/ von unsern Elteren verjagt und vertrieben worden/ […] ist endlich auß beeden nichts anders geworden/ als arme und uͤbel verwundte Soldaten/ er dienete im Krieg dem Kayser/ und ich dem Frantzosen; deßwegen/ unter uns ein Unterscheid zu machen/ damit man uns in der Fremde und naͤhe auß einander koͤnnen moͤcht/ so wird er/ sonderlich der Zeit/ der Teutsche= und ich der Frantzoͤsische Simplicissimus genannt. (I, 10)
Poetologisch könnte man hier ebenfalls eine reflexive Auseinandersetzung mit der Gattung des Pikaresken und deren Entwicklung erkennen: Eine Verwandtschaft der beiden pikarischen Lebensläufe ist mit ihrem Beginn und ihrer Thematik (Verlust der Eltern, Krieg, Erfahrungen in der Fremde) und ihrer von Kontingenz geprägten Erzählwelt offensichtlich, doch zeichnet der neue Simplicissimus eine abzweigende Entwicklungslinie, eine alternative Lebensgeschichte nach und etabliert damit eine auf den ersten Blick zwar ähnliche, aber doch eigenen diskursiven und narrativen Logiken folgende Verwirklichung der pikarischen Gattung. Diesen französischen Simplicissimus, welcher im Wirtshaus nur die ersten Episoden seiner Lebensgeschichte erzählt, habe der Herausgeber, wie er weiter berichtet, um die Abfassung des ganzen Lebenslaufs gebeten. Das Manuskript aus der „Simplicianische[n] Feder“ (IV, 297), das er ein Jahr später erhalten habe, mache er im Folgenden mit den von Simplicius angefügten Briefen und Erläuterungen dem Lesepublikum zugänglich, und zwar dem pikarischen Erzählmuster gemäß, welches der Protagonist in einer beigefügten Stellungnahme erläutert: seye also/ zwischen dero ernannter und unbenannter hoher Persohnen/ und meiner geringer Schrifften/ kein anderer Underschied/ als daß sie die ihrige/ in secunda und tertia persona, nehmlich/ im Du und Jhr/ im Er und Sie; Die meinige aber/ allein in prima persona, nemlich im Jch/ gesetzet und beschrieben seyen. (V, 24 f.)9
9 Die Hervorhebungen im Druck durch halbfette Type.
Der homo variegattus und die Diversitat der Erfahrung
249
Abb. 1: Johann Georg Schielen: Deß Frantzösischen Kriegs-Simplicissimi Hoch-verwunderlicher Lebens-Lauff […]. Freiburg 1682, Frontispiz (Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel: Lo 4334)
250
Carolin Struwe
Abb. 2: [Franciscus Veronettus:] Der Teutsche Frantzoß […]. O. O. 1682, Titelblatt (Bayerische Staatsbibliothek München: P.o.germ. 390)
Der homo variegattus und die Diversität der Erfahrung
251
Diesen neuen Simplicissimus zeigt auch das Frontispiz (Abb. 1): Er wird hier als eine zweigeteilte Figur in französischem (rechts) und deutschem Gewand (links) gezeigt, welche sich zentral im Bildvordergrund vor drei im Hintergrund agierenden kleineren Figurenpaaren präsentiert, die an Theatrum-Mundi-Darstellungen erinnern. Die Figurenpaare sind um die Hauptfigur herum angeordnet und entfalten möglicherweise das Themenspektrum des Textes: Gezeigt werden auf der rechten Seite ein Liebespaar, das möglicherweise eine eher derbe Erotik erwarten lässt – der Mann fasst der Frau an die Brust –, und dahinter zwei Soldaten im Kampf miteinander. In der Mitte befindet sich ein Geistlicher (die Hutform deutet auf einen Jesuiten hin), der einer von der Armhaltung her vermutlich sitzenden Bettlerfigur zustrebt und dem Sitzenden möglicherweise beistehen möchte. Dass die religiöse Figur des Predigers mittig wie der Simplicissimus steht, könnte auf ihre zentrale Bedeutung hinweisen. Aufgrund ihrer geringen Größe und der Position zwischen den Beinen der Titelfigur könnte jedoch ebenso eine negative, gar obszöne Schlagrichtung angedeutet sein; das Schwert des Simplicissimus, das die Figur überdies durchzustreichen scheint, würde diese negative Bewertung zudem verdeutlichen. Die Darstellung der Zentralfigur als zweigeteilte, die im Folgenden im Fokus stehen soll, ist bei oberflächlicher Betrachtung zunächst kein Novum und tritt bereits in anderen Kontexten auf, zum Beispiel auf dem Titelblatt des Teutsche[n] Frantzoß von 1682,10 das unter dem Pseudonym Franciscus Veronettus (ein sprechender Name: ‚in Wahrheit glänzend‘) veröffentlicht wurde (Abb. 2). Auch hier wird der Betrachter mit einer durch verschiedenartige deutsche und französische Kleidung zweigeteilten Figur konfrontiert. Doch wird während der Ausstattung des Mannes mit dem französischen Habit mit dem Aufsetzen einer Brille durch eine teuflisch anmutende Figur hinter dem Protagonisten deutlich die Scheinhaftigkeit des Französischen ausgestellt. Das Titelblatt etabliert damit für den Text bereits einen eindeutigen Normenhorizont, indem deutsch und französisch axiologisch mit Sein und Schein besetzt werden – eine häufig im Zuge des AlamodeStreits vorzufindende Setzung.11 Das Pseudonym veronettus könnte in diesem
10 Der vollständige Titel lautet [Franciscus Veronettus:] Der Teutsche Frantzoß/ Worinne Mit sinnreichen Lehren und lustigen Exempeln gruͤndlich vorgebildet wird/ der Teutschen allzubegierigen Nachahmung in denen Frantzoͤsischen Sitten/ Kleydung/ Sprache/ Reisen/ und andern Vanitæten; So dann Der Nutz und Verlust/ Welcher dem Roͤmischen Reiche Teutscher Nation hierauß erwachsen. Gedruckt im Jahr 1682. 11 „So stehen deutsche Treue, Redlichkeit, Aufrichtigkeit, Festigkeit des Gemüts, Männlichkeit und Tapferkeit französischer Untreue, Falschheit, Gleisnerei, Heuchelei, Aufschneiderei, Verstellung, Höflichkeit, Leichtfertigkeit, Frivolität und Hurerei gegenüber. Mit der einfachen deutschen Tracht kontrastiert das galante Kleid […]“ (Gonthier-Louis Fink: Vom Alamodestreit
252
Carolin Struwe
Zusammenhang poetologisch eben den Moment der Aufdeckung der französischen Gleisnerei bezeichnen, in dem die (glänzende) Wahrheit hervorgebracht wird. Demgegenüber wird auf dem Frontispiz des Frantzösischen Kriegs-Simplicissimus die Disparität der beiden Körperhälften gerade nicht Sein und Schein zugeordnet und so eine ontologische Differenz markiert, sondern ihr Status unbestimmt belassen. In einer Erläuterung des Kupfers, die Simplicissimus selbst in einem Schreiben an den Herausgeber mitliefert, wird die Figur auf dem Frontispiz denn auch nicht als veronettus, ‚in Wahrheit glänzend‘ ausgewiesen, sondern als variegattus (II, 546), als ‚bunt gemacht‘. Diese Beschreibung verweist nach Peter Heßelmann strukturell auf die Disparatheit der Figur zur Versinnbildlichung des „Konglomerat[s] verschiedener Materien“ im Hinblick auf die verwendeten literarischen und nicht-literarischen Quellen sowie rezeptionsästhetisch auf „ein auf Abwechslung zielendes Erzählverfahren“ zwischen Information und Kurzweil,12 welches auch im Text selbst erläutert wird: massen der Menschen=Koͤpffe/ viel und mannigfaltig seyen/ so/ daß der eine Beliebung trage/ an erzehlten kurtzweiligen Possen: der ander ihme gefallen lasse/ ernsthaffte und gewaltige Kriegs=Sachen zu lesen/ und der dritte suche sein Ergoͤtzlichkeit/ an Oeconomischen/ oder Haußhaltungs= betreffenden Schrifften: und so fortan. Damit also/ vermittelst verschiedener Materien/ ein Curioser Leser/ vielleicht an einem anderen Orth/ nach seinem Belieben/ finden und antreffen moͤge/ so ihme/ oder seinem Frwitz/ der eine Orth versage/ u. d. gl. (II, 545)
Daran anschließend eröffnet die Auslegung des Simplicissimus im Folgenden jedoch noch eine weitere Deutungsdimension: Der homo variegattus wird als „Wunderseltzame[r] Jedermann“ bezeichnet, worauß ein Sinnreicher Leser/ gar leicht abnehmen kan/ daß/ gleich wie dieser so genannte/ Frantzsischer Kriegs=Simplicissimus, in allerley Leibs=Gestalten und Kleidungen/ und in einer gantz verwunderlicher Postur/ dastehend sich praͤsentieret/ es werde auch die Beschreibung seines wunderlichen Lebens=Lauff/ daran nunmehr mit diesen zwey ersten Buͤchern/ der Anfang gemachet worden/ Jedermaͤnnlich/ wunderseltzam/ und in allerley Stands= und Lebens=Arthen veraͤnderlich seyn/ sonderlich in nachfolgenden
zur Frühaufklärung. Das wechselseitige deutsch-französische Spiegelbild 1648–1750. In: Recherches germaniques 21 [1991], S. 3–47, hier S. 29). 12 Peter Heßelmann: Schelmenroman und Journalismus – Johann Georg Schielens ‚Deß Frantzösischen Kriegs-Simplicissimi Hoch-verwunderlicher Lebens-Lauff‘ (1682/83) im mediengeschichtlichen Kontext des 17. Jahrhunderts. In: Das Ungarnbild in der deutschen Literatur der frühen Neuzeit. ‚Der Ungarische oder Dacianische Simplicissimus‘ im Kontext barocker Reiseerzählungen und Simpliziaden. Hg. von Dieter Breuer und Gábor Tüskés. Bern u. a. 2005 (Beihefte zu Simpliciana 1), S. 161–181, hier S. 164.
Der homo variegattus und die Diversität der Erfahrung
253
Theilen/ welche nach und nach/ und also biß auf unsere/ und dann noch folgende Zeiten/ gehen/ und sich erstrecken werden. (II, 546)13
Im Deutungsangebot des Textes wird damit eine unabschließbare Wandlung der Figur und ihres Lebenslaufs angesprochen, welche auf keinen übergeordneten Sinnhorizont mehr ausgerichtet scheint. Nicht mehr die für den pikarischen Roman gattungstypische conversio und damit die Schließung des autobiografischen Syntagmas wird angestrebt, sondern die paradigmatische Reihung immer weiterer Episoden wird angekündigt, die sich nicht nur bis hin zur aktuellen Erzählsituation des Herausgebers, sondern sogar darüber hinaus in eine ungewisse Zukunft erstrecken werde. Dieses unfeste Ich des homo variegattus, dessen Position, aus der heraus er seine Lebensgeschichte erzählt, im Text selbst durch die Herausgeberfiktion unklar bleibt, vermag damit keinen übergeordneten festen Standpunkt, von dem aus eine einheitliche Sinnstiftung möglich wäre, zu generieren, sondern stellt nur mehr die Unabgeschlossenheit und Disparität des zu Erlebenden in der Lebensgeschichte aus. Bei näherer Betrachtung des Titelkupfers fällt noch eine weitere gleichsam surreal und von ihrer Position im Raum des Bildes aufgrund ihrer die Zentralperspektive störenden Darstellung kaum zu bestimmende mittelgroße Figur links von Simplicissimus ins Auge, deren Kleidung an Figuren der Commedia dell’Arte, aber auch an Narrenfiguren erinnert. Ihre Kopfbedeckung gleicht derjenigen des Pickelhering beziehungsweise des Jean Potage und taucht in ähnlicher Form auch auf anderen Titelkupfern von Schriften politischen Inhalts mit einem satirischen oder kritischen Impetus auf, die in zeitlicher Nähe erschienen.14 Doch bleibt die Figur in ihrer Ausrichtung und Bedeutung auch mit diesem Bezugsrahmen uneindeutig, und zwar schon insofern, als der Pickelhering selbst bereits
13 Die Hervorhebungen im Druck durch größere bzw. halbfette Type. 14 Siehe hierzu das Titelblatt der 1682 veröffentlichten Flugschrift: XXIIX Deutscher Pickelhering auff dem Frantzoͤsischen Schavot Oder Ausbündiges Muster einer Teutschen Person/ Woruͤber der gelehrte Leser was zu lachen/ der des Lateins Unkuͤndige aber was zuverwundern haben wird. Betrifft Die allerneulichst heraus gekommene Verdeutschung des Buͤchleins Petri Jarrigij von den Bubenstuͤcken der Jesuiten in Franckreich. Gedruckt zu Leyden/ in diesem Jahre [ca. 1670], eine Polemik auf die deutsche Übersetzung von Pierre Jarrige: Les Jesuistes mis sur l’eschafaut. Ebenfalls ist eine solche Kopfbedeckung zu sehen auf dem Titel der Schrift: Der Politische Bratenwender/ Worinnen enthalten/ Allerhand Politische Kunstgriffe/ vermittelst welcher der Eigennutz heutiges Tages fast von iederman gesucht wird/ entworffen/ von/ Amando de Bratimero zu finden. […] Leipzig 1682. Eine ähnliche Figur findet sich auch auf einer Vignette auf dem Titelkupfer zu: Der Politische Maul=Affe mit allerhand Scheinkluger Einfalt Der Ehrsuͤchtigen Welt/ aus mancherley naͤrrischen/ iedoch wahrhafftigen/ Begebenheiten zusammen gesucht/ und vernuͤnfftigen Gemuͤthern zur Verwunderung und Belustigung vorgestellet von Clemente Ephoro Albilithano. Leipzig/ bey Johann Fritzschen. Jm Jahr/ 1679.
254
Carolin Struwe
in seiner Art zwischen weisem Narren und dem Tölpel des englischen Theaters changiert,15 wie etwa Yona Pinson herausstellt: „while embodying human folly and the entire society of sinners he, at the same time, also assumes the position of the wise outsider who points out the culpability of the ‚other‘ fools“.16 Er verweist zum einen auf rein närrische unterhaltsame Elemente, gleichzeitig ist ihm die Möglichkeit mitgegeben, kritische und satirische Elemente einzubringen, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. Zudem könnte mit seiner Hybridität und Wandelbarkeit auch die hybride Konzeption des Werks sowie die ständige Wandlung und Wandlungsfähigkeit des Protagonisten unterstrichen sein. Another source of merriment was undoubtedly the costume of this Pickelhering/Jean Potage hybrid, namely the white felt that could be transformed into whatever form was desired, the ridiculously large and anachronistic ruff, and the jacket composed of many different pieces of cloth.17
Ob und in welcher Form diese Charakteristika hier mitgedacht sind, bleibt jedoch rätselhaft, da die figurale Perspektive und damit auch ihr Deutungshorizont auf dem Frontispiz selbst unklar bleiben. So scheint die Figur zwar einerseits von ihrer Körperhaltung her auf die zentrale Figur bezogen zu sein, jedoch ohne diese in ihrer Bedeutung näher zu bezeichnen. Mit ihr ist der Hauptfigur, die sich frontal nur dem Betrachter präsentiert, eine Art Konterpart beigegeben, mit dem potenziell ein bestimmter Ordnungsbezug bezeichnet werden könnte (der sich etwa satirisch gegen die Figur oder einen Teil der Figur richtete); sie verhält sich aber offenbar zum Kriegs-Simplicissimus nur beobachtend – ohne der Disparität dieser Figur einen bestimmten Sinn zu verleihen. Im Folgenden sollen diese ersten Beobachtungen aufgenommen und auf der Ebene der Episoden weiterverfolgt werden. Dabei wird sich zeigen, dass die Erzählstruktur nicht lediglich – worauf sich die bisherige Forschung konzentriert
15 Vgl. Otto Rommel: Die Alt-Wiener Volkskomödie. Ihre Geschichte vom barocken Welt-Theater bis zum Tode Nestroys. Wien 1952, S. 174. Siehe zur Entwicklung des Typus und seiner Aufnahme aus dem Englischen Theater John Alexander: Will Kemp, Thomas Sacheville and Pickelhering. A Consanguinity and Confluence of Three Early Modern Clown Personas. In: Daphnis 36 (2007), S. 463–486. 16 Yona Pinson: The Fools’ Journey. A Myth of Obsession in Northern Renaissance Art. Turnhout 2008, S. 1. 17 Robert J. Alexander: Ridentum dicere verum (Using Laughter to Speak the Truth): Laughter and Language of the Early Modern Clown „Pickelhering“ in German Literature of the Late Seventeenth Century (1675–1700). In: Laughter in the Middle Ages and Early Modern Times. Epistemology of a Fundamental Human Behavior, its Meaning, and Consequences. Hg. von Albrecht Classen. Berlin, New York 2010 (Fundamentals of Medieval and Early Modern Culture 5), S. 735–766, hier S. 747.
Der homo variegattus und die Diversität der Erfahrung
255
hat – als Rahmen für Wissen zum Niederländisch-Französischen Krieg genutzt wird beziehungsweise der Inhalt das Paradigma von Nutzen und Unterhaltung bedient, sondern tieferliegend eine grundlegende epistemische Verunsicherung verhandelt wird: Der Text stellt die Diversität von Erfahrung aus, welche nicht mehr sinnvoll auf eine Einheit hin gebündelt werden kann. Autoritäten und deren Geltungsansprüche werden zwar in einigen Episoden angespielt, in der paradigmatischen Reihung der Episoden jedoch wenig später in ihrer Geltung negiert, sodass letztlich keine übergeordnete Sinngebung, Exemplarizität oder übergeordnete Wahrheit mehr zugelassen, sondern im Gegenteil eine Destruktion von autoritären Sinnsetzungen vorangetrieben wird.
2 Die Diversität der Erfahrung Simplex gelangt nach der Flucht aus dem von Gewalt geprägten Elternhaus, einer Pilgerreise nach Rom, der Konversion zum Katholizismus, einem Jahr im Benediktinerorden, seiner Flucht aus dem Konvent und zwei Studienjahren in Straßburg in die Dienste eines Pariser Kaufmanns.18 Damit wird eine „Akzentverschiebung in der Darstellung der pikaresken Welt“ greifbar, „das städtische Milieu der Handel- und Gewerbetreibenden rückt[ ] in den Vordergrund“.19 Um den Kaufhandel zu erlernen, wird er von seinem Herrn auf den „Jahrsmarckt“ (I, 78) geschickt, um „eigentlich zu erfahren/ wie sich die Kauffleuts=Diener und Jungen/ im Handel und Wandel erzeigen/ damit ich mich mit der Zeit/ wann es mich einest werde angehen/ auch darein zu schicken wuste“ (I, 79). Dieser Handel und Wandel umfasst jedoch – wie der Pícaro in den drei darauffolgenden Tagen erfahren muss – des Tags beim Verkauf nur „Diebs-Griffe“, „nemlich allerley Luͤste und Betrug/ Griff und boͤse Voͤrtel/ mit falschem Gewicht/ Maaß und Ehlen“ (I, 84) und des Nachts den Besuch von Gelagen, Unzucht und Glücksspiel. Nach dieser Welterfahrung folgt in der nächsten Episode sogleich eine Reflexion, die typisch für die pikareske Gattung das zuvor geschilderte Handeln als verwerfliches einordnet. Diese geistliche Perspektive wird durch den Pícaro selbst vertreten, da ihm nach eigener Aussage „noch immerzu was geistliches von meinem Klosterleben anhieng“ (I, 89). Simplex beschließt, diesen „gefhrliche[n] Sünden=Stand“ zu verlassen, um einen „sicheren/ und gwissenhaffteren Stand zuerwehlen und anzunemmen“ (I, 91), und schläft daraufhin
18 Die folgenden Episoden sind – bis auf das Traumgesicht – dem Simplicianischen Jan Perus entlehnt (Teil I, Kap VIII–IX und XIV–XVI sowie Teil II, Kap. XVII). 19 Matthias Bauer: Der Schelmenroman. Stuttgart, Weimar 1994, S. 120.
256
Carolin Struwe
ein. Kurz nach Mitternacht erscheint ihm jedoch ein „Traum=Gesicht“, in dem ein „fein/ erbarer/ und bescheidener Mann/ mit gantz ernsthafften Geberden“ (I, 91) zu ihm tritt, der überaschenderweise vom Verlassen des Kaufmannsstandes abrät, denn aus dem bisher Erfahrenen sei nichts Grundsätzliches zu schließen. Denn bestehet das meiste deines Reu=Kauffs in deme/ daß du ein so uͤppiges und verschwenderisches Leben/ so wol der Kauffleuten selbsten/ als dero Dienern und Jungen/ bey dreyer Tagen hero gesehen und erfahren hast/ wodurch du allerley ungegruͤndete Consequenzias dir selber machest/ als wann dergleichen Leben/ entlichen keinen guten Außgang gewuͤnnen wurde: und dahero du mit gutem Gewissen/ der Kauffmannschafft/ nicht dienen/ noch abwarten koͤnnest. […] du giebest dich vor einen Logicum auß/ machest aber einen gantz hinckenden Syllogismum, nemlich/ weil der und dieser Kauffmann falliere/ ergò, so seye der Kauffmannschafft Handel auf lauter Fallimenten gerichtet/ und auf nichts anders angesehen/ als auf Betruͤgerey; aber du irrest hierinnen sehr weit/ und hast das axioma l o gic um , noch nit erlernet/ welches sagt; daz man auß lauter einzeligen Stucken/ koͤnne keinen vollkommenen Schluß machen/ quia à puris particularibus (specibus) non esse argumentandum ad universale. Du bist noch nicht einmal recht in der Welt gewest/ und weist nit einmal/ wo die rechte Kauffleute/ so wol hie als anderswo/ sitzen; gehe gen Londen/ gen Antorff/ gen Wien/ gen Franckfurt am Mayn […] und dergleichen Orthen mehr; allda wirstu finden und antreffen/ viel ehrliche dapffere/ vornehme/ reiche und redliche Kauff=Leuthe/ die vermittelst ihrer allzugrosser Handelschafft/ die gantze Welt/ mit kostbaren und redlichen Waaren versehen. (I, 91–93)
Überdies stehe es Simplex nicht zu, „wegen einer oder andern Unfugen/ so du alhier oder anderstwo/ von etlichen gesehen“ (I, 93) diesen Stand zu beschimpfen; „dieweil der Kauff=Handel fuͤr sich selbsten/ eine ruͤhmliche/ nutzliche und von GOtt selbst erlaubte Profession ist“ (I, 93 f.). An dieser Stelle wird demnach behauptet, dass die von Simplicissimus gemachte Erfahrung nur aus singularia bestehe, die noch keinen Schluss auf Grundsätzliches zuließen. Weitere Erlebnisse würden die gemachten Erfahrungen infrage stellen. Die Überzeugung des Simplex von der Sündhaftigkeit des Kaufmannsstandes wird hierbei durch eine doppelte argumentative Verschiebung ausgehebelt: Zunächst wird der exemplarische Sinnstiftungsmodus als (mangelhafter) Syllogismus aufgefasst und kritisiert, womit eine argumentative Verschiebung von der Rhetorik zur Logik einhergeht. In einem zweiten Schritt wird die Bewertung nach moralischen Kriterien durch eine Bewertung nach Nützlichkeitskriterien ersetzt. So wird die darauffolgende Behauptung, der Kaufhandel sei nicht nur nützlich, sondern auch eine „von GOtt selbst erlaubte Proffesion“, in ihrer Geltung auch nicht etwa durch Bibelzitate untermauert, sondern eben mit dem Argument ökonomischer Effizienz, „als dardurch/ die gantze Welt/ mit allerhand fremden Waaren […] wol versehen wird; und ohne welche kein Reich/ kein Fuͤrstenthum/ und keine Gemeinde bestehen kan“ (I, 94); schließlich wird sie noch mit dem Verweis auf antike und
Der homo variegattus und die Diversität der Erfahrung
257
weltliche Autoritäten abgesichert.20 Damit wird zugleich behauptet, dass aus dem erlebten Einzelfall eben kein Anspruch auf Exemplarizität, wie er vom Pícaro erhoben wird, abzuleiten sei. Eben dies durchkreuzt allerdings ein grundlegendes Muster der bisherigen pikaresken Texte: denn pikareske Texte tragen eine Spannung in sich. Bereits auf der Ebene der Episoden mäandert das Erzählen zwischen den Polen Welterfahrung und Weltabkehr, etwa wenn der Pícaro verwerfliche Handlungen beobachtet und daraufhin sofort als Exempel für die Sündhaftigkeit verurteilt. Eingespannt ist diese paradigmatische Episodenreihe in ein autobiografisches Syntagma, welches ebenfalls mit der gleichen Spannung operiert: Aus der Retrospektive wird das eigene sündhafte Leben in der Form einer confessio präsentiert, um am Ende Reue zu zeigen und sich aufgrund des in der Welt Erlebten, das exemplarisch ihre Schlechtigkeit und Eitelkeit erweist, von der Welt abzuwenden – etwa in Form der Eremitage. Dies wird jedoch im vorliegenden Textabschnitt verweigert, denn die Erfahrung der Sündhaftigkeit des Kaufmannsstandes sei eben nicht als exemplarisch für die Verwerflichkeit desselben insgesamt zu werten. Damit wird dem Exemplarischen gerade keine Geltung zugesprochen, denn auch weitere Erfahrungen können weder die Gottgewolltheit der Profession erweisen noch deren grundsätzliche Verwerflichkeit belegen.21 Anstelle der Universalität der theologischen Deutung rekurriert der Traum auf die „Unabschließbarkeit und Überholbarkeit von Erkenntnissen“, da „diese stets durch neue singularia vermehrbar und korrigierbar“22 sind und damit keine Regularität etablieren, die sich in der Abstrahierung der Erfahrungen zeigen würde. Unterstützt wird diese Argumentation durch den Verweis auf verschiedene Städte und die angedeutete eigene Bewegung im Raum („gehe gen“), die potenziell immer neue Erfahrungen
20 Das „Traum=Gesicht“ ist eine Hinzufügung Schielens gegenüber seiner Vorlage. „So explizit wie hier war im Jan Perus das praktische Berufsethos noch nicht artikuliert; man mußte es aus dem Verlauf der Ereignisse ablesen“ (Hans Gerd Rötzer: Der Schelmenroman und seine Nachfolge. In: Handbuch des deutschen Romans. Hg. von Helmut Koopmann. Düsseldorf 1983, S. 131–150, hier S. 142). 21 Insofern kann die These Arnold Hirschs, der aus der Episode eine „völlige Rechtfertigung und Anerkennung des bürgerlichen Erwerbsstrebens, die über die christliche Arbeitsethik weit hinausgeht“ und aus der „Anerkennung bürgerlicher Tugenden“ eine „Verbürgerlichung“ des Pícaro ableiten will, zurückgewiesen werden (Arnold Hirsch: Bürgertum und Barock im deutschen Roman. Ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte des bürgerlichen Weltbildes. 2. Aufl. besorgt von Herbert Singer. Köln, Graz 1957 [Literatur und Leben N. F. 1], S. 12). Ebenso wenig kann aus dem Traumgesicht „ein potentielles Identifikationsmodell“ abgeleitet werden, wie Rötzer es in Anlehnung an Hirsch tut (Rötzer, The English Rogue [Anm. 6], S. 245). 22 Jan-Dirk Müller: ‚Erfarung‘ zwischen Heilssorge, Selbsterkenntnis und Entdeckung des Kosmos. In: Daphnis 15 (1986), S. 307–342, hier S. 317.
258
Carolin Struwe
hervorbringen kann. Autorisiert wird auf diese Weise ein Wissen von der irreduziblen Diversität der Erfahrung, die nur immer weiter angehäuft werden kann, ohne dass aus ihr allgemeine Schlüsse zu ziehen wären – und damit ein „Wissen um die Gestreutheit des erwartbaren und möglichen Zu-tun-Habens mit den Dingen, um die Vielgestaltigkeit, in der sich etwas zeigen kann“.23 Dieses Wissen von der Diversität der Erfahrung wird auch erzählstrukturell greifbar. Denn die Struktur des Lebenslaufs wird ab dem zweiten Buch mit Kriegsavisen und Relationen, Dokumenten und Diskursen zum Niederländisch-Französischen Krieg regelrecht überwuchert.24 Der Lebenslauf des Simplicissimus und derjenige seines Kumpanen Dutz-Bruder, den er in Paris kennenlernt, geraten kaum mehr in den Blick; nur selten werden Parallelerzählungen der Pícaros zu den beschriebenen Kriegsberichten nachgereicht. Eine primäre Erzählordnung ist nur noch in Ansätzen, das autobiografische Erzählmuster so gut wie nicht mehr erkennbar. Damit wird die bereits in den frühen pikarischen Romanen erkennbare Tendenz, die Form des Pikaroromans als „eine Folge relativ selbständiger Episoden“, „die Einschübe und Amplifikationen leicht zuläßt“,25 mit Wissensbeständen unterschiedlichster Art anzureichern, in radikaler Weise wieder aufgenommen. Die eingefügten Zeitungen und Berichte werden zudem zum überwiegenden Teil nicht mehr an die Erfahrung des Pícaro selbst gebunden, sodass Simplicissimus resümiert: Jch als ein Simpel/ haͤtte wol dieses gegenwaͤrtigen Kriegs unbegreiffliche Weitlaͤuffigkeit/ mein Lebtag mir nit einbilden knnen/ wann ich nit selber darinnen/ wie ein fahrender Schuler/ herumb gestrichen wre/ und viel wunderseltzame Begebenheiten/ theils selbst erfahren/ theils von anderen gehrt. (II, 274 f.)
23 Achim Hahn: Erfahrung und Begriff. Zur Konzeption einer soziologischen Erfahrungswissenschaft als Beispielhermeneutik. Frankfurt am Main 1994, S. 16. 24 Die Berichte beginnen mit dem Jahr 1672 und sind damit zunächst keine aktuellen Nachrichten. Wie Heßelmann jedoch hervorhebt, „hatte Schielen eine Serienproduktion geplant. Sein Frantzösischer Kriegs-Simplicissimus war als periodisch erscheinendes Werk angelegt, das in weiteren Teilen aktueller werden und die politischen Begebenheiten der jüngsten Vergangenheit in Diskursen gegenwartsnah darstellen sollte“ (Heßelmann: Schelmenroman und Journalismus [Anm. 12], S. 173). Erklärbar wird der Zugriff auf die vielfältigen Nachrichten und Dokumente und deren Verarbeitung mit der Anstellung Schielens als Bibliotheksadjunkt an der Ulmer Bibliothek. Gleichzeitig ist seine publizistische Tätigkeit zu berücksichtigen – er gab ab 1683 für kurze Zeit ein politisches Journal heraus –, deren Ansätze im Frantzösischen KriegsSimplicissimus erkennbar werden. 25 Jürgen Jacobs: Der deutsche Schelmenroman. München 1983 (Artemis Einführungen 5), S. 30 und 31.
Der homo variegattus und die Diversität der Erfahrung
259
An anderer Stelle berichtet er davon, dass ihm „ein glaubwuͤrdige Person/ die selbsten alles in Augenschein genommen/ schrifftlich“ etwas gesendet habe (II, 220), rekurriert auf Nachrichten aus der Ferne („wie meine Avisen mich berichten“; IV, 355) oder gibt den Inhalt von „fliegenden Zeitungen“ (II, 474) wieder. Die zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit changierenden Nachrichten umfassen Meldungen von „ordinari und extraordinari Reit-Botten“ (II, 220), von Augenzeugen und Reisenden und gehen mit der „Emergenz von komplementären oder auch kompetitiven Teilwirklichkeiten“26 einher: War bisher die Erfahrung des Pícaro an seine eigene Perspektive und die Möglichkeiten seiner Welterfassung gebunden, so können nicht mehr nur direkt mit der eigenen Anwesenheit Ereignisse bezeugt, sondern kann auch in räumlicher Distanz medial oder figural vermittelt potenziell alles über die Entwicklung des Krieges in Erfahrung gebracht werden. Dabei werden zwar zum einen über „[d]ie sukzessive, detaillierte Berichterstattung über politisch-militärische Vorgänge […] die Winkelzüge, die Wechselhaftigkeit und die Grenzen von Herrschaftshandeln“27 fassbar. Doch büßen „[d]ie Aktionen der Mächtigen […] dadurch allmählich die Aura höherer Lenkung“28 ein. Der Glaube an eine übergeordnete Sinnstiftung weicht damit schnell der Einsicht in die Kontingenz des menschlichen Lebens und historischer Geschehnisse. Dass die Zeitungen, die dabei eingefügt werden, meist durch zufällige Begegnungen im Wirtshaus weitergereicht werden, pointiert zudem den kontingenten Erhalt von Nachrichten. Mit dieser doppelten Kontingenz wird deutlich, dass die Berichterstattung nur kurzfristige Orientierung bietet, denn die Überflutung mit Nachrichten scheint zwar einerseits immer mehr Informationen anzuhäufen, andererseits wächst jedoch gleichzeitig die Verunsicherung, welche dieser Informationen Geltung besitzen, „dann ob wir gleich stuͤndliche Nachricht darvon haben koͤnten/ so ware doch deß Auffschneidens und Luͤgens/ so viel/ daß wir kaum wusten/ was wir glauben solten“ (II, 333 f.). Nicht selten treffen aufgrund der perspektivischen Bindung der Erzählungen durch die verschiedenen Augenzeugen gänzlich konträre Berichte aufeinander. Szenisch werden diese disparaten Erfahrungsberichte häufig in agonalen Auseinandersetzungen zweier Figuren gezeigt. Diese neue Bevorzugung des Diskurses als Form der Verhandlung von Streitfragen löst
26 Jan-Dirk Müller: Vorwort. In: Pluralisierungen. Konzepte zur Erfassung der Frühen Neuzeit. Hg. von Jan-Dirk Müller, Wulf Oesterreicher und Friedrich Vollhardt. Berlin, New York 2010 (Pluralisierung & Autorität 21), S. V–XII, hier S. VI. 27 Johannes Weber: Deutsche Presse im Zeitalter des Barock. Zur Vorgeschichte öffentlichen politischen Räsonnements. In: „Öffentlichkeit“ im 18. Jahrhundert. Hg. von Hans-Wolf Jäger. Göttingen 1997 (Das achtzehnte Jahrhundert. Supplementa 4), S. 137–149, hier S. 145. 28 Ebd.
260
Carolin Struwe
dabei die für die pikareske Gattung typische Doppelung von erzählendem und erzähltem Ich fast gänzlich ab29 und verfolgt einen neuen rezeptionsästhetischen Ansatz: „dann so einer nur allein redet/ so gibt es keinen Discurs/ sonder nur eine blosse Erzehlung/ so den Zuhoͤrenden nit so angenehm faͤllt/ als wann ihre zween reden“ (I, 169). So erzählt etwa ein Niederländer, dass er, obwohl sein Handelsschiff beim Antreffen von englischen Boten die Segel gestrichen und Verhandlungsbereitschaft signalisiert habe, sofort beschossen worden sei, damit die Engländer die transportierten Waren als Beute nehmen könnten. Nach einer zweitägigen Schlacht hätten schließlich die Niederländer gesiegt. Dieser Bericht wird jedoch von einem anderen Besucher des Wirtshauses als Lüge bezeichnet: ja/ du Bernhaͤuter/ du sagest wol das deine/ zu Ehren und Wolgefallen deiner Landsleuten der Niederlaͤnderen […]. Massen ich schon von diesem Treffen/ einen anderen Vogel singen gehoͤret; nemlich euere stoltze Landsleute sollen sich auf der See gewaͤgeret haben/ vor den Engelaͤnderen ehemalen/ die Segel und Flaggen streichen zu lassen/ und daß man sie darzu zu verschiedenen mahlen zwingen muͤssen/ und glaube fast/ es werde in der Begegung/ zu erst auch nicht viel loͤblicher vorgenommen worden seyn; deßwegen die Engelaͤnder/ so gar nicht unrecht gethan/ daß sie euch Stoͤltzlinge haben begehren andere Mores zu lehren/ und wann sie voͤllig euer waͤren Meister worden/ sie euch/ und das eurige/ als eine reiche Beute/ mit Freuden in ihre Haͤfen wurden eingebracht haben; nicht aber/ wie du hier vermeldet/ daß man nur wegen der Beute allein willen/ Feindseligkeiten habe sehen lassen. (II, 248 f.)
Darauf entgegnet der Niederländer, daß dazumahl unter whrender dieser Kriegs-Action, Printz Wilhelm von Fuͤrstenberg/ dem Churfuͤrsten von Coͤllen/ bey offentlicher Tafel/ ein grosses Glaß mit Wein zugetruncken/ mit diesen Worten: Das gilt Euer Churfl. Durchl. auf guten Erfolg/ daß der Koͤnig von Engelland/ die Hollaͤndische Smirnische Flotte jetzt wird erobert haben/ oder bald bemeisteren/ wovon wir auch unseren Antheil werden zu geniessen haben. (II, 249)30
Die agonale Auseinandersetzung verbleibt im Dissens, keine übergeordnete Textinstanz greift objektivierend oder gar orientierend ein. Der Konflikt wird letztlich auf die Ebene der bloßen Gewalt transponiert, denn ein „Chur-Coͤllnischer Bedienter“ fühlt sich durch die Worte des Niederländers beleidigt und schlägt ihm den Degen „uͤber den Kopff“ (II, 249), womit die Episode endet.
29 Vgl. Maria C. Roth: Der Schelm als Soldat: Der ‚Frantzösische Kriegs-Simplicissimus‘ und ‚Schwejk‘. In: Der deutsche Schelmenroman im europäischen Kontext: Rezeption, Interpretation, Bibliographie. Hg. von Gerhart Hoffmeister. Amsterdam 1987 (Chloe 5), S. 173–192, hier S. 179. 30 Hervorhebung im Druck durch halbfette Type.
Der homo variegattus und die Diversität der Erfahrung
261
Peter Heßelmann leitet aus der Verbindung von Journalismus und Roman im Frantzösischen Kriegs-Simplicissimus die Möglichkeit einer „weiterführende[n] politische[n] Orientierung“ ab,31 die in Verbindung mit den am Ende des 17. Jahrhunderts entstehenden politisch-räsonierenden Zeitschriften zu sehen sei. Doch lässt er außer Acht, dass sich die Darstellung im Frantzösischen Kriegs-Simplicissimus deutlich von der Art der informativen und diskursiven Vermittlung durch ein politisches Journal unterscheidet. Denn wo die politische Zeitschrift Ereignisse systematisch mithilfe von wenigen geordneten Gesprächsbeiträgen verhandelt und durch Kontextualisierungen erläutert,32 werden die in den pikaresken Roman eingebundenen Nachrichten lediglich chronologisch geordnet, wie Simplicissimus selbst angibt: „sintemahlen ich/ in Beschreibung meiner Lebens=Geschichten/ mich gar nit auf die/ zu F. discurierte Materi/ verbunden/ wie erstgemeldet/ sonder auf die Ordnung der Jahren meines Alters gesehen“ (I, 194). Auf diese Weise stehen verschiedenste Nachrichten (zu unterschiedlichen Ereignissen und Themen) unabgestimmt nebeneinander. Die in den Text eingebrachten Nachrichten und Berichte bieten keine ordnende Orientierung an, sondern wecken gerade im Gegenteil zunehmenden Bedarf an Vergleich und Abstimmung konkurrierender Ansprüche auf Wahrheit. Eine übergeordnete Sinngebung und Wahrheit ist aber weder mit Bezug auf die Nachrichten noch im Rahmen der pikarischen Lebensgeschichte zu erhalten: Vielmehr zeigt die Verbindung des unsteten, ständige Wandlungen und neue Erfahrungen präsentierenden pikaresken Lebenslaufs mit Erzeugnissen der Presse als „Medium historisch-politischen Wandels schlichthin [sic!]“, dass „sich keine Brücke finden [lässt] zu einer Sinnfiguration“, die auf „Überzeitliches und unveränderlich Allgemeingültiges“33 verwiese. Die Liaison der Textgenres radikalisiert damit die frühneuzeitliche Diversität der Erfahrung und markiert eine Offenheit, die sich als problematisch für die Geschlossenheit und (moralische) Sinngebung des pikarischen Textes und der darin entfalteten Geschehnisse erweist. Eben diese Orientierung könnte mit übergeordneten Autoritäten geleistet werden, welche im Text selbst immer wieder auftreten. Doch zeigt sich mindestens an zwei dieser Autoritäten, wie diese zwar im Text eingespielt werden, ihr Geltungsanspruch jedoch sogleich wieder durchgestrichen wird.
31 Rötzer spricht ebenfalls von einem „romanesken Journalismus“ (Rötzer, The English Rogue [Anm. 6], S. 244). 32 Vgl. Johannes Weber: Götter-Both Mercurius. Die Urgeschichte der politischen Zeitschrift in Deutschland. Bremen 1994, S. 62 f. 33 Ebd., S. 12.
262
Carolin Struwe
3 Historicus und Prediger – Einspielung und Negierung von Geltungsansprüchen 3.1 Historia magistra vitae In Diskursen, welche Simplicius mit Reisenden führt, wird häufig auf historisches Wissen verwiesen, welches zur Untermauerung des Gesagten und damit als Verweis mit Geltungsanspruch gilt. So sei etwa das bei den Franzosen zu beobachtende „Auffsuchen allerley scheinbarlichen foͤrderungen/ und falscher Vorwaͤnde der Belaͤidigung“, um „auf solchen Schein deß Rechtens/ einen Streit“ zu beginnen, mit vielfältigen Exempeln abzusichern. Es sei eine überzeitliche feste Staats-Regel der Franzosen, „wie solches auß den Buͤcheren der Frantzoͤsischen Geschicht=Schreiberen/ gnugsam erhellet“ (III, 55). Damit verweist der Text auf die Vorstellung der Geschichte als historia magistra vitae: „Indem der gesamten menschlichen Erfahrung eine bestimmte a priori gültige Ordnung zugrunde gelegt wird, vermögen die historischen Exempel eine Art von ‚Erfahrungserkenntnis‘ zu liefern, dergestalt, daß die theoretisch formulierte Lehre sich in der Historie bestätigt und der Mensch sich in ihr zu spiegeln vermag.“34 Auch Simplicissimus selbst trifft auf Historici: Auf dem Parnass, zu dem er zusammen mit einem Zigeunerjungen auf dem Pegasus reitet, trifft er auf Augustus Jacobus Thuanus (1553–1617), einen auch in der Gegenwart der Romanhandlung bereits verstorbenen französischen Historiker, der als angesehener Historicus von „hohe[r] Erudition“ betitelt wird, selbst „ein gebohrner Frantzos“ ist und „darvon unvergleichliche Bcher geschrieben/ die wrdig/ in lauter Gold einzubnden/ seyn“ (III, 41). Doch ist von diesem Historicus keine überzeitliche Einordnung und exemplarische Deutung des Erfahrenen zu erhalten. Im Gegenteil wendet sich der hochgeschätzte Thuanus selbst an den Pícaro, um zu erfahren, wie es mit Frankreich stehe. das ist verwunderlich/ und kommet mir recht seltzam fuͤr/ daß Franckreich so maͤchtig seyn soll. Jch weiß mich sonsten noch wol zu erinnern/ daß diß Koͤnigreich/ durch innerliche Zerruͤttungen/ der auß= und innlaͤndischen Kriegen/ so geringeret und verkleineret worden/ daß es offt nicht so viel Vermoͤgen gehabt/ sich wider der Außlaͤndischen Gewalt zu beschuͤtzen. (III, 34 f.)
34 Wilhelm Voßkamp: Untersuchungen zur Zeit- und Geschichtsauffassung im 17. Jahrhundert bei Gryphius und Lohenstein. Bonn 1967 (Literatur und Wirklichkeit 1), S. 38.
Der homo variegattus und die Diversität der Erfahrung
263
Warum die Franzosen so mächtig sind, setzt der Pícaro daraufhin breit auseinander; schnell wird dabei deutlich, dass weniger militärische Stärke oder taktische Belange, sondern vor allem ökonomisches und wirtschaftliches Geschick von Vorteil ist, um Macht zu erlangen: Erstlich/ weil die Frantzosen/ […] mit ihren neuen Moden/ und stets veraͤnderlicher Kleider=Tracht/ solcher Gestalt/ wissen zu bethoͤren […]. Wodurch sie viel außlaͤndische Handwercks=Leute an sich gezogen/ und viel Staͤdte dardurch volckreich gemachet haben/ welche sonsten ledig und Volckloß geblieben. Mit dieser Hand=Arbeit erfuͤllen sie alle umligende Laͤnder/ worauß sie jaͤhrlich an baarem Geld erheben/ und in ihr Land bringen/ mehr als viertzig Millionen Gulden/ Frantzoͤsischen Werths. (III, 35 f.)
Simplicissimus erläutert daran anschließend auch den Reichtum Frankreichs aufgrund des Wein-, Gewürz- und Salzhandels, der Zölle, aber auch der Praxis der Güterkonfiszierung (vgl. III, 34–40) sowie die militärischen Vorteile durch die günstige Lage und enorme Größe des Landes (vgl. III, 41–45). Bereits in dieser Episode zeigt sich die Problematik der historischen Exempel, für die die Schriften des Thuanus stehen, denn sie können situativ kaum mehr die Komplexität und den schnellen Wandel der weltpolitischen Belange erläutern. Damit zeigt sich im Text eben jene epistemische Verunsicherung, „daß sich in der Neuzeit die Differenz zwischen Erfahrung und Erwartung zunehmend vergrößert, genauer, daß sich die Neuzeit erst als eine neue Zeit begreifen läßt, seitdem sich die Erwartungen immer mehr von allen bis dahin gemachten Erfahrungen entfernt haben“.35 Gegen die prätendierte Exemplarizität der gleichbleibenden Geschichte tritt immer stärker die Partikularität der Erfahrung des Pícaro hervor. Zwar könnten hier im Auf und Ab der französischen Herrschaft implizit der Lauf der Welt und das Auf und Ab des Fortuna-Rades mitgedacht sein, doch wird es nicht explizit als sinnstiftendes Schema angeboten. Vielmehr deutet sich bereits an dieser Stelle an, dass der Rekurs auf die Autorität des Historicus und der Rückgriff auf die Geschichte kaum mehr Orientierung für die Gegenwart bieten. Was sich in der ersten Begegnung bereits als Problematik abzeichnet, wird in einer zweiten in ihrem ganzen Ausmaß deutlich. Simplicissimus trifft auf einen alten Mann namens Christusio – ein Anagramm für ‚Historicus‘ –, welcher sich als besonderer Kenner des Weltlaufs ausgibt, da er „uͤber hundert Jahr“ alt sei und die Welt „kreutzweiß und berzwerch durchgestrichen“ (V, 43) habe. Das, was er im Folgenden präsentiert, ist dann allerdings eine Zusammenschau von Veraltetem und Erfundenem aus fernen und alten Ländern, das von den „Antropophagi in Scythia“ bis zu den „Mosineti“ (VI, 44 f.) reicht. Dass es sich dabei um über-
35 Reinhart Koselleck: Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten. Frankfurt am Main 1979, S. 359.
264
Carolin Struwe
kommenes Buchwissen handelt – das gegenüber einem Erfahrungswissen und aktuellen Nachrichten abgewertet wird –, hat auf der pragmatischen Ebene der Textproduktion eine Entsprechung, denn die Passage ist in Gänze einem anderen fiktionalen Text, nämlich dem 14. Kapitel der Continuatio Grimmelshausens,36 entnommen. Nachdem der Historicus zudem die Lebensgeschichte des türkischen Nusah Bassa erzählt hat, der ihm angeblich einen wertvollen Ring geschenkt habe, löst er sich plötzlich in Luft auf, spricht währenddessen die Worte „toties, quoties, das ist/ wie offt/ so offt“ (V, 68)37 und lässt Simplicissimus ratlos zurück. Wie wenig später ein mitreisender Zigeuner erläutert, sei dieser Christusio ein Historicus, dem „billich Glauben“ zu schenken sei, da er „alle Historien/ Exempel/ und andere leß= und merckwuͤrdige Dinge/ nicht anders geschrieben/ sam er selbsten/ alles mit Augen gesehen/ und mit Ohren gehoͤret haͤtte“ (V, 119). Mit den Worten „toties, quoties“38 habe er, wie Simplicissimus dann zusammenfasst, „andeuten wollen/ daß er mir so offt zu Diensten stehen wolle/ als offt ich seiner begehren werde/ nicht zwar in menschlicher Leibs=Gestalt/ sondern vermittelst seiner in Druck verfertigten Schrifften“ (V, 119).39 Auch hier wird auf das Verständnis der historia als magistra vitae rekurriert, wonach die „Gleichartigkeit der Werte innerhalb der Gesamtzeit […] die Verfügbarkeit der historischen Wertbeispiele für die jeweilige Gegenwart und Zukunft [bedingt]“.40 Doch wird diese Möglichkeit der Analogiebildung in der Erzählung selbst problematisiert. Durch den immer wieder betonten Bezug auf das eigene Erleben stellt dieser Historicus die in seinen historiografischen Schriften vermittelte Erkenntnis nämlich auf zweifache Weise infrage: Einerseits durch seine subjektive Betrachterperspektive, andererseits dadurch, dass hier ein Buchwissen, das nicht nach den im Text etablierten Maßstäben zwischen faktual und fiktional unterscheidet, die Grundlage für Aussagen über die Vergangenheit bildet. Aus den Schriften des Historicus scheint somit nicht nur nichts für die Erfahrungs-
36 Hans Jacob Christoffel von Grimmelshausen: Simplicissimus Teutsch, zitiert nach der Ausgabe: Werke I,1. Hg. von Dieter Breuer. Frankfurt am Main 1989 (Bibliothek deutscher Klassiker 44; Bibliothek der Frühen Neuzeit 4/1), S. 628–634; dort unter der Kapitelüberschrift: „Allerhand Auffschneidereyen deß Pilgers/ die einem auch in einem hitzigen Fieber nicht seltzsamer vorkommen knnen.“ 37 Der deutsche Wortlaut in halbfetter Type. 38 Dass der Historicus mit „toties, quoties“ auf einen beliebig zu vervielfachenden Ablass rekurriert, könnte die theologische Vorstellung der geschichtlichen Gleichförmigkeit noch unterstreichen, gleichzeitig jedoch auch einen satirischen Seitenhieb auf den Ablasshandel implizieren. 39 Die Hervorhebungen im Druck durch halbfette Type. 40 Voßkamp (Anm. 34), S. 36.
Der homo variegattus und die Diversität der Erfahrung
265
wirklichkeit der Lesenden zu ziehen zu sein, sondern auch das mit den Historien behauptete Wahrheitspostulat dekonstruiert zu werden. Dass sich dies nicht nur auf eine Episode bezieht, sondern als grundlegende epistemische Problematik verhandelt wird, macht der Beginn des Frantzösischen Kriegs-Simplicissimus deutlich, der als Überschrift für das gesamte Werk gelesen werden kann: DJe unerhoͤrte Europaͤische Veraͤnderungen/ die wunderseltzame Empoͤrungen/ die jaͤmmerliche Kriegs-Trubeln/ die Gwissenlose Verraͤthereyen/ und dergleichen Verwunderungswuͤrdige Begebenheiten/ welche sich zu unseren Zeiten zugetragen/ und deren wir theils erlebet haben/ theils gegenwaͤrtig erleben muͤssen/ und theils auch derselben noch kuͤnfftig erleben sollen/ wurden gewißlich den allergroͤsten Maͤhrlein und Fablen gleich scheinen/ so fern sie nicht warhafftigen Gruͤnden und Ursachen/ wie auch mit augenscheinlichen Zeugnussen/ konnten bevoͤstiget und behauptet werden. Eben so wenig/ sag ich/ wurde die Nachwelt/ unseren Blut=Jammer= und Mord=Geschichten/ Glauben zustellen/ als wenig man den erdichteten Maͤhrlein der alten Poeten/ oder den heutigen Fabelmaͤssigen Liebes=Beschreibungen/ trauen zu misset. (I, 1)
In poetologischer Hinsicht beschreibt diese Einleitung zudem nicht nur den Inhalt, sondern geradezu die Produktionsästhetik des Textes selbst: Mit der Einbindung von faktualen Quellen in einen fiktionalen pikarischen Text ergibt sich nämlich eine „fiktionsinterne Kontextualität des Wissens“.41 Geht man davon aus, dass dieses Wissen in seiner neuen textuellen Form „unlösbar an seinen narrativen Kontext gebunden [ist], mit allen Konsequenzen für Status, Glaubwürdigkeit und Funktionen dieses Wissens“,42 so verunklart der Text mit der Einbindung von politisch-historischen Zeitungen und Dokumenten in den fiktiven pikarischen Lebenslauf und der unterschiedslosen Nebeneinanderstellung von narrativen fiktionalen Passagen und historischen Quellen deren jeweiligen Wahrheits- und Wahrscheinlichkeitsanspruch; was „Maͤhrlein“ und was historische Begebenheiten sind oder waren, kann nur im Rekurs auf Augenzeugen differenziert werden – die Geltung von eben deren Aussagen wird jedoch grundlegend infrage gestellt.43
41 Frieder von Ammon: Plurale Perspektivierungen des Wissens. Zu Formen und Funktionen von Paratexten in enzyklopädischer Literatur und literarischer Enzyklopädik. In: Enzyklopädistik 1550–1650. Typen und Transformationen von Wissensspeichern und Medialisierungen des Wissens. Hg. von Martin Schierbaum. Münster 2009 (Pluralisierung und Autorität 18), S. 457– 481, hier S. 471. 42 Ebd. 43 Dies gegen Heßelmann, der in der Einbindung der historischen Quellen eine Aufwertung des Geltungsanspruchs des fiktionalen Textes in Bezug auf Wahrheit und Wahrscheinlichkeit sieht (vgl. Heßelmann: Schelmenroman und Journalismus [Anm. 12], S. 172).
266
Carolin Struwe
3.2 Theologie und Kirche Mit der Konzentration auf weltpolitische Händel gerät die heilsgeschichtliche Orientierung im Text ins Hintertreffen; doch werden moralische und theologische Lehren im Text an einigen Stellen vermittelt durch den Pícaro und in Traum-Allegorien immer wieder eingespielt und bedienen damit die gattungskonstitutive pikarische Doppelung von Erzählung und Lehre. Demgegenüber wird die Kirche beziehungsweise die Theologie im Text fast gänzlich ausgeblendet; sie bildet nur in zwei Episoden den diskursiven Hintergrund. Das erste Mal rückt sie am Beginn der Lebensgeschichte ins Blickfeld, als Simplicius in einen neuen reformierten Orden eintritt. Diese Bekehrung zu Gott bleibt aber eine Episode, die nach einem Jahr mit der Flucht aus dem Orden (mit den gesammelten Almosen im Gepäck) endet. Hier wird zwar die Geltung des Klosterlebens und des Glaubens behauptet, der Pícaro kann die Lehren aus dieser Zeit jedoch nicht habitualisieren.44 Was ich gethan/ und alhier erzehlet hab/ das ist aͤigentlich nicht auß Verachtung GOttes/ oder deß Kloster=Lebens geschehen: dann ich habe ja gesagt/ daß ich zu keinem Moͤnch bin worden/ auß Eifer und Andacht/ oder auß Liebe und Gottesforcht/ sondern allein auß Kindischem und unbedaͤchtlichem Muthwillen […]. (I, 34 f.)
Ein zweites Mal rückt die Kirche an einer für die Sinnstiftung prekären Stelle in den Vordergrund, und zwar eben dann, als Simplicissimus mit Dutz-Bruder in Streit darüber gerät, welches der von ihnen begangenen „schreckliche[n] Stücklein“ (II, 232) das schlimmere sei.45 Simplicius erzählt, dass er ein Verhältnis mit einer Magd unterhalten habe, welche er, als sie schwanger geworden sei, mit List auf ein Schiff gelockt habe. Dieses habe er dann sofort verlassen und den „Schiffs=Patron“ mit Geld dazu gebracht abzulegen. „Jch glaube vestiglich/ der Teuffel hab mich dasselbe mal gantz geritten/ wegen dieser unbarmhertzigen
44 Diese Habitualisierung wird auch durch die prekäre konflikthafte Kriegssituation verhindert, die den Pícaro zwingt, mögliche moralische Bedenken für sich zu behalten, so etwa nachdem er ein Soldatenlied gehört hat: „ich hatte allerley Gottselige Gedancken/ so ich aber mit Worten nicht offenbahren doͤrffen/ gefasset/ und wiewol ich das meinige gern dabey vorgebracht und gesagt htte/ so hab ich doch muͤssen bey solcher Gesellschafft ein Sparmundus seyn; denn etlichen wolte dieses Gesang nicht am allerbesten gefallen/ wie sich dann daruͤber einer verlauten lassen/ er solle mit solchem Pfaffen=Lied nimmer kommen/ oder er woll ihme mit seiner Klingen den Tact darzu geben/ daß ihm das Blut ber den Kopff ablauff“ (II, 371 f.). 45 Im Gegensatz zum Hertz-Bruder des Simplicissimus Teutsch ist der Dutz-Bruder kein geistiger Vater, der gegenüber dem verwerflichen Treiben des Pícaro eine normativ positive Gegenposition etabliert. Vielmehr hat der Dutz-Bruder starken, oft negativen Einfluss in weltlichen Dingen.
Der homo variegattus und die Diversität der Erfahrung
267
und grausamen That“ (II, 203).46 Dutz-Bruder erzählt strukturell fast analog von einem Verhältnis mit der Frau seines Wirts. Beide hätten zunächst den Wirt völlig ausgenommen, dann die Gläubiger herbeigerufen und den Wirt in den Schuldturm sperren lassen, wo er „vor lauter Bekuͤmmernuß“ gestorben sei (II, 230). Wenig später habe der Dutz-Bruder die von ihm schwangere Wirtin in ein abgelegenes Dorf gebracht, und dort habe die Frau unter dem Ausruf, sie sterbe um seinetwillen, das Zeitliche gesegnet. Der Streit zwischen den beiden pikarischen Figuren bleibt ohne Ergebnis; keine übergeordnete Textinstanz greift hier normgebend oder sinnstiftend ein – vermutlich auch und gerade weil das Verhalten beider Figuren sündhaft ist und insofern keine Axiologie im Gegeneinander der Figuren etabliert werden kann. Die Unsicherheit darüber, ob seine Taten nicht doch „noch aͤrger seyn/ […] wann mans unser beeden solte auf ein Waag legen“ (II, 232), führt Simplicissimus schließlich in die Kirche. Der Text weckt mit diesem Besuch die Erwartung eines Raumes, der Geltungsansprüche des Geistlichen in sich trägt und die Basis für die Autorität geistlichen Wirkens darstellt. So könnte mit der Vermittlung von geistlichem Wissen, das in den narrativen Episoden nicht zur Disposition steht, eine Bewertung der Sündhaftigkeit geleistet werden. Doch die Predigt, von welcher Simplicissimus erzählt, bietet für die erfahrungsweltliche Transgression und ihre Bewertung zunächst keine Orientierung an, der Prediger wendet sich stattdessen einem ganz anderen, einem religiösen Normenkonflikt zu: GOtt der Allmaͤchtige habe in dem siebenden Gebott/ gantz ernstlich verbotten; daß man nit stehlen soll; Dargegen aber finde er im 2. Buch Mosis geschrieben Cap. 3 im letzten vers; daß der grundguͤtige GOtt/ den Kindern Jsrael außtruckenlich gebotten und befohlen hab; Daß sie den Egypteren/ ihre silberne Geschirre nehmen und entwenden sollen. (II, 233 f.)47
Wie der Prediger erläutert, konnte er bisher keine Auslegung hierfür ausfindig machen. Zum Trost der Zuhörer habe er deshalb beschlossen, „die lieben heiligen Mnneren/ welche an der Kirchenwand allhier vor Augen stehen“ (II, 234) zu befragen – und impliziert damit, dass diese eben nicht nur eine Repräsentationsfunktion erfüllen, sondern dass mit den Bildern eine unvermittelte Präsenz des Heiligen gegeben sei. Der Prediger wendet sich zunächst an den „angemahlten zweenhornigen Mosen“, welcher die zwei Sprüche mit „selbst eigner Hand/ aus Angebung des grossen Jehovah, auf dem Berge Sinai geschrieben“ (II, 234)48 habe. Doch das Moses-Abbild schweigt. Dass gerade der „zweenhornige[ ]“ Moses
46 Die Episode ist ebenfalls dem Simplicianischen Jan Perus entnommen (Teil II, Kap. I). 47 Im Druck mehrere Hervorhebungen durch halbfette Type. 48 Im Druck durch halbfette Type hervorgehoben.
268
Carolin Struwe
mit der Auslegung betraut wird, verschärft nur die vom Prediger zum Thema gemachte Auslegungsproblematik, verkörpert doch eben er selbst ein berühmtes Auslegungsproblem: Die Vorstellung vom gehörnten Moses beruht auf einem Übersetzungsfehler in der lateinischen Vulgata (Ex 34,29: „cornuta facies“), wo im Hebräischen eigentlich der strahlende Glanz des Gesichts gemeint war.49 Die nun potenzierte Auslegungsproblematik wird im weiteren Textverlauf jedoch nicht gelöst, der Prediger wendet sich von Moses’ Schweigen unbeirrt nacheinander den Abbildern von Aaron sowie von mehreren Aposteln und Heiligen zu; eine Antwort lassen diese jedoch ebenfalls nicht verlauten. Zuletzt hält der Prediger das Kruzifix an seine Ohren, es solle nun die unvermittelte Präsenz des Heils, der Heilsbotschaft herstellen und die Antwort verkünden. Nach einer langen Andacht springt der Prediger schließlich vor Freude auf: O liebe Zuhoͤrer/ was fuͤr Geheimnussen hab ich aus diesem Crucifix vernommen/ keine menschliche Zung/ kan und vermag ja nit/ solche mit Worten/ anderen an Tag zu geben. […] Die zween Spruͤche/ liebe Hertzen/ hat mir das Crucifix/ so umbstaͤndlich/ und außfuͤhrlich außgelegt/ daß es mit keinen Worten zu beschreiben. Allein hat es mir hingegen auch gantz ernstlich verbotten/ solch Geheimnus/ keinem gemeinen Menschen zu offenbahren: Darzu uns dann gnaͤdigst verhelffen wolle GOtt Vatter/ Sohn/ und Heiliger Geist/ Amen. Gehet nun widerumb hin im Frieden des HErrn. (II, 236)
Auf den ersten Blick vollzieht sich in der Episode natürlich ein satirischer Seitenhieb auf die katholische Religion und einen nicht studierten Prediger, doch scheint sich hier auch gerade im Hinblick auf die Position der Episode im Moment der Orientierungslosigkeit und fehlender Bewertungsmaßstäbe für die Transgression des Pícaro eine tieferliegende epistemische Problematik abzuzeichnen. Der Text spielt
49 „Die Fehldeutung des hebräischen Begriffs qärän, der sowohl ‚strahlt‘ als auch ‚Horn‘ bedeutet, im Lateinischen (statt vom ‚strahlenden Gesicht‘, facies coronata, sprach die Vulgata vom ‚gehörnten Gesicht‘, facies cornuta) hatte ikonographisch zur Folge, dass Mose – mitunter bis ins 16. Jahrhundert – als Attribut zwei Hörner erhielt“ (Christoph Wenzel: Die Bibel in der bildenden Kunst. Stuttgart 2009, S. 72). Einen Höhepunkt dieser Darstellungsweise bildet Michelangelos Moses-Figur in S. Pietro in Vincoli/Rom, die er für das Grabmal Juliusʾ II. geschaffen hatte (vgl. H. Schlosser: Moses. In: Lexikon der christlichen Ikonographie 3. Hg. von Engelbert Kirschbaum SJ. In Zusammenarbeit mit Günter Bandmann u. a. Sonderausgabe. Freiburg im Breisgau 1968, Sp. 282–297, hier Sp. 285 f.). Bereits ab dem 16. Jahrhundert und mit Martin Luthers Bibelübersetzung war die Übersetzung ‚strahlt‘ zumindest bei den Protestanten bekannt. Deutlichen Niederschlag findet diese Interpretation jedoch erst in bildnerischen Darstellungen Mitte des 17. Jahrhunderts, etwa in Philippe de Champaignes Mose mit den Tafeln des Gesetzes (um 1650, St. Petersburg, Eremitage), dessen Gesicht durch Licht illuminiert scheint, oder in Jusepe de Riberas Moses mit den zehn Geboten (1638). Zur Entstehung und Geschichte des ‚gehörnten Mose‘ siehe Ruth Mellinkoff: The Horned Moses in Medieval Art and Thought. Berkeley 1970 (California Studies in the History of Art 14).
Der homo variegattus und die Diversität der Erfahrung
269
hier nämlich ein übergeordnetes Wissen, ein Heilswissen an – das Kruzifix flüstert dem Prediger ja angeblich die Synthese der widersprechenden Normen und damit die Normkonflikt-Lösung zu. Diese Lösung wird jedoch gleichzeitig als mystisches Arkanum präsentiert, das nicht zu versprachlichen ist und nicht verkündet werden darf. Der Prediger präsentiert hier also nur mehr die gegenseitige Relativierung von religiösen Normen, im Hinblick auf eine normative Sinnstiftung verharrt er jedoch sprachlos in der Ambivalenz. Die Heilsbotschaft und ihr Bezug auf die Lebenswirklichkeit kann somit nicht mehr von den Zuhörenden erfahren werden, die Kirche wird als Ort gezeigt, an dem man nichts wissen kann. So schließt der Pícaro die Episode auch mit den Worten, er habe „nicht ein einiges Wort vernommen/ was zu meiner Lehr/ und Aufferbauung der Christenheit/ oder zu einem Trost hat ædificierlich und aufferbaulich seyn koͤnnen“ (I, 237). Dass Autoritäten keine übergeordnete Sinnstiftung mehr zugesprochen wird, tritt nicht nur an dieser Stelle, sondern gerade in den folgenden Büchern immer deutlicher zutage: Angesichts des Elends im Krieg, der sich gegenseitig ständig relativierenden Meinungen und der unabgestimmten Normkonflikte, mit welchen der Pícaro in der Welt konfrontiert wird, scheint keine Autorität mehr Orientierung bieten zu können. Simplicissimus kann dies lediglich reflexiv bearbeiten und fasst in einer resignativen Reflexion im vierten Buch zusammen: Jch wuͤnsche mir hierinnen/ entweder einen Hochgelehrten Theologum/ oder einen tieffsinnigen Statisten/ oder einen wol durchgetriebenen Politicum/ um dessen jaͤmmerlichen Zustands satsame Ursachen zuvernemmen und anzuhoͤren; aber/ so viel ich ihrer/ derzeit/ noch gehoͤret/ so hab ich keinen/ auß allen/ noch befunden/ der mit der Sprach recht Categoricè heraußgegangen/ und seine Gemuͤthes=Gedancken sinè fuco, oder ohne politischem Anstriche/ expectorieret hette: der Theologus sagte zwar sein uhraltes Axioma; dieses alles waͤre der Suͤnden Schuld […]; Der Stattist will/ sich nit zwischen Thuͤr und Angel legen/ auß Beysorg/ man moͤchte ihm sein Haͤnde verbrennen; der Politicus/ zoge/ an statt des Redens/ seine Achseln uͤber sich/ und redete mehr mit gaucklerischer Verstellung seiner Fuͤssen/ und mit fechterischen Haͤnden/ als mit der Zungen […]. (IV, 363 f.)
4 Das biografische Krisenmoment und die Destruktion übergeordneter autoritärer Sinnsetzungen Gerät die Lebensgeschichte des Pícaro in den Büchern II bis V schon fast in Vergessenheit, nimmt das letzte der sechs Bücher des Frantzösischen Kriegs-Simplicissimus noch einmal verstärkt den autobiografischen Gestus der pikaresken Gattung auf. Es führt jedoch nicht zu einer abschließenden moralisatio und Schließung
270
Carolin Struwe
des autobiografischen Syntagmas, sondern betont vielmehr die Zukunftsoffenheit des pikarischen Lebenslaufs. Simplicissimus reflektiert zunächst über die „viele[n] Kriegs=Metamorphosen“ (VI, 244) und darüber, ob er es in währendem Leben nicht doch noch zu Ruhm und Ehre bringen könnte. Darüber schläft er ein und träumt vom Fortuna-Baum. Zu oberst deß Baums/ saß eine Majestaͤtische Jungfrau/ gleichsam als in einem Thron/ sehr zierlich und praͤchtig bekleidet/ auf einer Kugel/ worauf mit grossen guldenen Buchstaben geschrieben stund: FORTUNA VOLUBILIS AER; das ist: Das Glck ist Hauch und Rauch.50 Diese hielt einen Knuͤttel in der Hand/ und schluge je underweilen darmit auf die beschwerte Aeste/ daß alle besagte Sachen/ Hauffen=weiß herab fielen. (VI, 245)
Mit den von Baum geworfenen „kostbare[n] Sachen“ ist er jedoch nicht zufrieden: Die als erstes vom Baum herabfallenden geistlichen Attribute, unter anderem ein „Bet=Brevir“, ein „Prediger= oder Chorrocke“ und „ein groß gulden Spannisch Kreutz“ (VI, 247), wirft er von sich. Erst die beim letzten Streich der Fortuna herabfallende Schreibfeder und ein Buch nimmt er schließlich widerwillig und nur auf Rat eines Patrioten, der ihm befiehlt „dieses fuͤr meinen besten Welt=Schatz/ der Zeit/ gantz sorgsamlich zu bewahren“, um nicht als Bettler sein Leben zu fristen, als „geringe[ ] Gluͤcks=Gaabe“ (VI, 248) an. Mit diesen (geistlichen und literarischen) Attributen wird auf die für den pikarischen beziehungsweise simplicianischen Roman typische textinterne Schreibsituation angespielt: Ein bereits bekehrter Pícaro verfasst retrospektiv und zum Zwecke der confessio seine Lebensgeschichte. Doch wird mit dem Fortwerfen geistlicher Attribute diese erbauliche Erzählanlage gerade distanziert. Ganz „Maulhenkolische“ (VI, 249) über seinen Traum, den Simplicissimus selbst dahingehend ausdeutet, dass er „auf keinen Thaler […] kommen und gelangen“ könne, weil er „nur zu einem Pfennig gebohren waͤre“ (VI, 249), vertraut er sich einem reisenden Wahrsager und Zigeuner an, der ihm aus der Hand liest und ihm schließlich empfiehlt, Politicus zu werden: „dann das Gluͤcke residiere nicht im Traum/ sonder an hoher Herren Hoͤfen/ welches zu bekommen/ es einem selber allerley Gelegenheits Mittel an die Hand schaffe“ (VI, 249): waͤre demnach mein Rath/ sobald ihr einmahl auß dem Kriegs=Wesen wieder kommet/ daß ihr euch in einen ehrlichen Politischen Stand/ jedoch mit stillem und eingezogenem Leben begebet/ und wann ihr selbiger Zeit euch die Politic, werdet recht zu Nutz machen koͤnnen/ so trauet und glaubet mir/ es kan euch/ ob ihr zwar zu keinen so hohen Ehren mehr steigen werdet/ als wie ihr eine muthwillig verschertzet habt/ die Zeit eures Lebens noch wohl seyn. (VI, 250)
50 Hervorhebung im Druck durch halbfette Type.
Der homo variegattus und die Diversität der Erfahrung
271
Zufällig ist nun eben ein solcher Politicus namens Topilicus anwesend und präsentiert ausführlich verschiedene Regeln, mit denen sich der Pícaro in die Welt schicken könne: Aufstieg gelinge nur mit dem richtigen Maß an Schenkungen, günstiger Heirat, Lügen und Raub im Krieg (vgl. VI, 252–265). Relativ schnell wird deutlich, dass es hier nicht um eine didaktische Anleitung für innerweltliche Lebensklugheit geht, sondern um die satirische Entlarvung des Politicus als korrupt und heuchlerisch.51 Zunächst scheint der Pícaro dessen Lehren jedoch zu affirmieren und für die Zukunft beherzigen zu wollen: „ich formirte mir hierauß ein so kraͤfftiges. NB. daß ich/ mitler Zeit/ mir weit andere Mores und Sitten/ mit den Leuthen/ und sonderlich mit den Herren Oberen/ zu reden angewehnte“ (VI, 256). Im Folgenden macht er jedoch das soeben Gesagte zum Ausgangspunkt für eine religiöse Reflexion: „GLeich wie aber nichts so arg und boͤß/ in der Welt ist/ welches ein Christliches Tugend=Gemuͤthe/ nicht zu seinem besten ziehen und wenden kan“ (VI, 265) habe er die Regeln „vermittelst/ einer Gottseeligen Betrachtung/ in einen anderen Model gegossen/ und dieselbe auf folgende weiß/ [sich] zu nutz gemacht“ (VI, 265). Der Pícaro gießt hier also die innerweltlichen politischen Regeln in eine andere, mutmaßlich übergeordnete Form und schließt aus ihnen auf die Exemplarizität der Eitelkeit der Welt. Mit diesem ‚erbaulichen Model‘ wird deutlich auf das pikareske Modell der religiösen Rahmung angespielt, in welcher das Erlebte exemplarisch für die zu fliehende Eitelkeit der Welt gedeutet wird. Warum sehnest du dich nach eytlen Welt=Ehren? Sintemahlen sie nichts anders/ als ein Teuffels=Gifft seyn […]. Gedencke demnach/ mein Simplex! hinfuͤro mit derjenigen Ehre/ allein vernuͤgt zu seyn/ welche dir GOtt in dieser Welt bescheret […]. (VI, 265 f.) [J]e mehr einer mit der Welt umgehet/ je mehr wird er von ihr betrogen/ und dargegen/ je weniger einer mit ihr zu thun hat/ desto ruhiger und vergnuͤgteres Leben kan er auch fuͤhren […]. (VI, 272)
Doch die Welterfahrung, so könnte man im Rekurs auf die Bildlichkeit sagen, bleibt auch im moraltheologischen ‚Model‘ in seiner Disparatheit weiter erkenn-
51 Der Politicus wird in den 1680er-Jahren in Flugschriften, aber auch in den Schriften Johann Beers oftmals negativ bewertet. Auch der Zedler wird unter dem Lemma „Politicus“ nur negative Attribute aufführen: So werden diejenigen Politici genannt, die „nicht nur allen Leuten nach den Maul reden“, „welche durch unrechtmßige Art ihre zeitliche Glckseligkeit zu befrdern bedacht sind“, „[a]rglistige Leute, welche ihren unredlichen und eiteln Absichten einen Schein der Vernunfftmßigkeit geben“ (Grosses vollstndiges UNIVERSAL LEXICON Aller Wissenschafften und Knste, Welche bißhero durch menschlichen Verstand und Witz erfunden und verbessert worden […]. Halle und Leipzig, Verlegts Johann Heinrich Zedler […]. Bd. 28 [1741], Sp. 1528 f., hier Sp. 1528). Mit den Politischen Romanen Christan Weises und Johann Riemers und dem darin propagierten Tugendideal des politischen Handelns tritt eine Rehabilitierung des Begriffs ein, indem moralische Integrität und gesellschaftliche Reputation konvergieren.
272
Carolin Struwe
bar und könnte jederzeit in einen anderen ‚Model‘ gegossen werden. Eine mögliche syntagmatische Schließung der Erzählung des Lebenslaufs in einem religiösen Rahmen wird hier zwar angespielt, jedoch sowohl strukturell als auch explizit negiert. Strukturell, indem sich an diese Quasi-Predigt sofort die nächste Episode anschließt, in welcher zwei Frauen darüber sprechen, wie „ein tugentlich Weib/ einen Unntzen Mann knne zu recht bringen“ (VI, 272) – ein Gespräch, welches einfach abbricht: „Diese Gespihlen/ fuͤhreten noch ein langes Gespraͤch von dieser Materi/ die ich vielleicht/ im kuͤnfftigen siebendem Buch/ wann ich absonderlich/ von der Eroberung der Stadt Mastricht weitlaͤuffig tractieren werde/ beybringen will“ (VI, 276). Und explizit zum anderen, indem ein syntagmatischer Abschluss in den letzten Sätzen des Werkes pointiert verweigert wird: Fuͤr dißmal muß ich gewisser Ursach wegen/ meine Feder einzustellen/ und an diesem VI. Buch ein Ende machen […]. Mittlerweil wolle mein Hochgeneigter Leser! in guͤnstiger Gedult stehen/ und dergleichen Materi/ mehr von mir gewrtig seyn; weilen ich sie/ mit diesem weder beschliesse/ noch ENDE. (VI, 276)52
Auf diese Weise radikalisiert der Text die Möglichkeit der seriellen Episodizität der pikaresken Texte und der autobiografischen Erzählweise. Die offene Form des pikaresken Romans ermöglicht es, immer neue und andere Episoden an das bisher Erzählte anzuschließen: Durch die autobiografische Erzählform kann erzählstrukturell nur ein offener Schluss generiert werden, denn der autodiegetische Erzähler „vermag […] sein Leben nur bis zu jenem Zeitpunkt zu schildern, zu dem er sein Werk verfaßt“53 und kann deshalb die „Differenz zwischen dem Ende einer Ich-Erzäh-
52 Die hier angedeutete Ursache bestand vermutlich im neuen publizistischen Projekt Schielens, einem politischen Journal, das monatlich erscheinen sollte: Historische/ Politische und Philosophische Krieg= Und Friedens-Gespraͤch/ Auf Das jetzt neu=eingehende 1683. Jahr. Worinnen Auch allerley leß= und merckwuͤrdige DISCURSEN, Unter dem so genannten Frantzoͤsischen Kriegs=SIMPLICISSIMO, Jn den Elisaͤischen Feldern/ Aller Monatlich deß gantzen Jahrs abgehandelt werden. Die Zeitschrift erschien von Januar bis August (die Ausgaben sind gesamt erhalten in einem Sammelband in der Universitätsbibliothek München, Sign. 8 Hist. 119). In ihr wird Simplicissimus während der Gartenarbeit von einem Sturmwind in die Elisäischen Gefilde entführt, wo er fortan als Protokollant und Sekretarius den Besprechungen von Königinnen, die für einzelne Länder stehen, und drei weisen Männern, Pholiosophus, Christusio und Topilicus (= Philosophus, Historicus und Politicus), zur politischen Lage beiwohnt. 53 Ingrid Aichinger: Probleme der Autobiographie als Sprachkunstwerk [1970]. In: Die Autobiographie. Zu Form und Geschichte einer literarischen Gattung. Hg. von Günter Niggl. Darmstadt 1989 (Wege der Forschung 565), S. 170–199, hier S. 184. Vgl. zum narratologischen Problem auch Caroline Emmelius: Das Ich und seine Geschichte(n). Paradigmatische und syntagmatische Erzählstrukturen in der Novellistik, der mittelalterlichen Ich-Erzählung und im deutschen ‚Lazaril von Tormes‘ (1614). In: Das Syntagma des Pikaresken. Hg. von Jan Mohr und Michael Waltenberger. Heidelberg 2014 (GRM-Beiheft 58), S. 37–69, bes. S. 40–42.
Der homo variegattus und die Diversität der Erfahrung
273
lung und dem Lebensende dieses Ich-Erzählers“54 nicht überbrücken. Insofern „[birgt] die vor dem Tod des Erzählers erfolgende Beendigung des Werkes immer auch die Möglichkeit des Fortsetzens in sich“.55 Der Text schöpft dieses Potenzial paradigmatischer Anschlussfähigkeit und narrativer Fortsetzbarkeit gänzlich aus. Das Spiel mit der paratextuellen Markierung des Textendes betont nochmals die Unabgeschlossenheit des Frantzösischen Kriegs-Simplicissimus und die Partialität des übergreifenden biografischen Schemas. Es unterstreicht die potenzielle Erweiterbarkeit durch weitere Erfahrungen und neue Nachrichten und stellt damit die Unabschließbarkeit der Erfahrung und damit auch die diskursiven Implikationen pikarischer Erzählverfahren in ihrer Radikalität aus. Abschließend sollen noch einmal der Beginn des Textes und die Einführung des neuen Pícaro in der Rahmenerzählung in den Blick genommen werden. Mit der Erzählung seiner Lebensgeschichte darf der „liederliche[ ] kerl“ (I, 5), der neue Simplicissimus nämlich nicht schon nach seiner beeindruckenden Rede beginnen, sondern erst, nachdem er durch gespendete Kleidungsstücke der Wirtshausbesucher „von Fuß auf gantz Nagel neu mundieret“ (I, 10) worden ist. Er wird ausgestattet mit einem „neu par Schuh/ und ein[em] neu par gut Tuͤcherne Silberfarbe Hosen“, einem „dunckelgrauen Tuͤchenen Oberrock“ (I, 10 f.) etc. und habe sich dann „von Stund an auß/ und sich mit den erzehlten Kleider Stucken/ gantz Nagel neu angezogen/ daß er als ein dapfferer und ansehnlicher Kerl/ als ein urploͤtzlich vermetamoruorisierter Mensch“, als „der Frantzoͤsische Monsieur Simplicissimus“ (I, 11) vor ihnen gestanden sei. Es scheint auf der Hand zu liegen, dass diese bunten Stoffe eben diejenige bunte Diversität der Erzählstoffe und Erzählmuster versinnbildlichen, aus denen die narratio sich formt, und dass so auf die poetologische Tradition des integumentum, die verhüllende Aussageweise weltlicher Dichtung und die in den ornamenta verhüllte Wahrheit angespielt wird. Unter der Hülle verbirgt sich, wie das Frontispiz und der Text zeigen, jedoch eben gerade keine strahlende Wahrheit, sondern ein zerschundener, zerhauener und vernarbter Pícaro, der keine Einheit mehr generieren kann und mit dessen Lebenslauf kein sinnstiftender Rahmen mehr vorgegeben wird, in welchem die Relativierungen von sozialen und religiösen Normen aufgelöst, die Unsicherheit, was Wahrheit und was Lüge sei, beseitigt, oder Schein und Sein voneinander getrennt werden könnten.
54 Alexandra Stein: Die Hybris der Endgültigkeit oder der Schluß der Ich-Erzählung und die zehn Teile von „deß Abentheuerlichen ‚Simplicissimi‘ Lebens=Beschreibung“. In: DVjs 70 (1996), S. 175–197, hier S. 179. 55 Ebd., S. 181.
Claus-Michael Ort
Medizinisches Wissen und die Funktion pikaresken Erzählens in Johann Christoph Ettners Medicinischen Maul-Affen-Romanen (1694–1720) Der Arzt, Pharmazeut und nachmalige kaiserliche Rat für die schlesische Ärzteschaft Johann Christoph Ettner – geboren 1654 in Glogau, 1708 als ‚Ettner von Eiteritz‘ in den böhmischen Ritterstand erhoben, verstorben 1724 in seiner Wirkungsstätte Breslau – publiziert neben medizinischen und pharmazeutischen Schriften ab 1694 bis zu seinem Tod einen von Medizinern und Laien viel gelesenen Reiseroman-Zyklus, dessen fingierter Autor, der „getreue Eckhart“, zugleich als homodiegetische Instanz der Wissensvermittlung fungiert.1 Unter dem an Johannes Riemers Der Politische Maul-Affe von 1680 angelehnten Titel Medicinischer Maul-Affe erreichen seine sechs Bücher einen Gesamtumfang von knapp siebentausend Seiten. Im Jahr 1694 erscheint Des getreuen Eckharts Medicinischen Maul=Affens Erster Theil/ Oder Der Entlarvte Marcktschreyer/ Jn welchen vornehmlich der Marcktschreyer und Quacksalber Boßheit und Betrgereyen/ wie dieselben zu erkennen und zu meiden; Hernach bewertheste Artzney=Mittel in allerhand Kranckheiten und Zufllen Menschlichen Leibes zu gebrauchen; Dann sonderliche Philosophische/ Politische/ Chymische/ am meisten aber Medicinische Observationes und Anmerckungen; Wie auch eine grndliche Errterung vieler zweifelhaffter Vortrge; Endlich/ welcher Gestalt man sich auff Reisen/ und sowohl in frembden als einheimischen Zusammenkunfften verhalten soll: Mit Beyfgung Sinn= und Lehr=reicher/ erschrecklicher und lustiger Begebenheiten; Vorgestellet worden.2
1 Siehe das Lemma „Ettner von Eiteritz, Johann Christoph“. In: Deutsches Literatur-Lexikon. Biographisch-Bibliographisches Handbuch. Begründet von Wilhelm Kosch. Fortgeführt von Bruno Berger. 3., völlig neu bearbeitete Aufl. Bd. 4. Bern, München 1972, Sp. 567–569; James N. Hardin: Johann Christoph Ettner. Eine beschreibende Bibliographie. Bern, Stuttgart 1988 (Bibliographien zur Deutschen Barockliteratur 3), S. 12–28. 2 Johann Christoph Ettner: […] Der Entlarvte Marcktschreyer. Franckfurt, Leipzig 1694 (im Folgenden zitiert als „EM“ mit Seitenzahl). Abweichend von variierenden Schreibweisen in den Titeleien der Romane wird ab jetzt die textintern dominierende Variante ‚Eckarth‘ beibehalten.
276
Claus-Michael Ort
Die Reise beginnt in Lucebra, Neßdra und Garpa, also in Breslau, Dresden und Prag. Sodann veröffentlicht Ettner fünf weitere Fortsetzungsromane mit gleichen Untertiteln, wobei die Chronologie ihrer Publikation nicht deren inhaltliche Chronologie abbildet: – 1697 Deß Getreuen Eckharts unwrdiger DOCTOR, Jn welchem Wie ein Medicus, der rechtschaffen handeln will/ beschaffen seyn soll; […] vorgestellet wird, zusammen mit Deß getreuen Eckarths Anhang/ Vorstellends Einen rechschaffenen und Gewissenhaften MEDICUM, Was solcher fr Qualitten und Tugenden/ so wohl ad esse, als auch absonderlich ad bene esse, an sich haben und besitzen […] solle […]; die Reise führt über Venedig, Padua und Bologna nach Rom und dauert bereits ein Jahr; – 1698 Deß Getreuen Eckardts verwegener CHIRURGUS, Jn welchem Wie ein rechtschaffener Chirurgus beschaffen seyn solle/ was er fr Tugenden an sich nehmen/ und welcherley Laster er zu fliehen; […] vorgestellet wird – Florenz, Bologna, Marseille, Paris. – Bereits 1696 – und 1697 in zweiter Auflage – erscheint Des Getreuen Eckharts entlauffener CHYMICUS: Jn welchem Vornemlich der Laboranten und Proceß=Krmer Boßheit und Betrgerey/ wie dieselben zu erkennen und zu fliehen […] vorgestellet werden – Paris, London, Rotterdam, Leiden, Amsterdam, Hamburg. – Im Jahre 1700 publiziert Ettner Deß Getreuen Eckarths Ungewissenhaffter Apotecker/ Jn welchen Wie ein rechtschaffener Apotecker beschaffen seyn/ was er vor Tugenden an sich nehmen/ und welcherley Laster er fliehen soll; […] (Neudruck 1753); die Reise befindet sich im dritten Jahr und führt von Lübeck über Kopenhagen (mit Besuch der berühmten Kunstkammer des Reichsarchivars Olaus Wormius) und Stockholm nach Riga. Die Reisenden entlarven sich in Kapitel XXVI als judenfeindlich, verweisen auf vermeintliche ‚Verfehlungen‘ der Juden (z. B. Hostienfrevel) und verhandeln mit dem „getreuen Eckarth“ die am Ende keineswegs verneinte Frage, ob „es denn nicht mglich wre, daß man diese Bestien ausrottete?“3 – 1715 erscheint schließlich noch Des Getreuen Eckarths Unvorsichtige Heb= Amme, Jn welcher Wie eine Heb=Amme oder Kinder=Mutter, die ihr Gewissen wohl in acht nehmen will, beschaffen seyn, und wie sie nebenst dem erforderlichen Medico so wohl denen Unverheuratheten, als Verheuratheten und Kindern, in ihren Kranckheiten und Zufllen getreulich beystehen und helffen soll […]. Am
3 Johann Christop Ettner: Deß Getreuen Eckarths Ungewissenhaffter Apotecker […]. Augsburg, Leipzig 1700, S. 1218–1233, hier S. 1230 f.; vgl. dazu schon Udo Benzenhöfer: Die medizinischpolitischen Lehrromane des Dichterarztes Johann Christoph Ettner (1654–1724). In: Heilkunde und Krankheitserfahrung in der frühen Neuzeit. Studien am Grenzrain von Literaturgeschichte und Medizingeschichte. Hg. von Udo Benzenhöfer und Wilhelm Kühlmann. Tübingen 1992 (Frühe Neuzeit 10), S. 283–298, hier S. 294.
Medizinisches Wissen und die Funktion pikaresken Erzählens
277
Ende des Zyklus wird deutlich weniger gereist – der Reiseweg beschränkt sich im Wesentlichen auf die Strecke von Thorn nach Posen –, dafür aber umfassend mündlich und durch Lektüre der Figuren über Geburtshilfe und Hebammenwesen informiert; der Roman popularisiert auf diese Weise die aktuellen Bemühungen um eine Verfachlichung der Hebammenausbildung. – 1720 erscheint schließlich eine um das doppelte auf 1071 Seiten angewachsene Neuausgabe des ersten Romans Entlarvter Marckt-Schreyer, ab S. 957 in Kollation mit einem Ettner zugeschriebenen, warnenden „Tractaetlein“ eines metaphorischen Predigers: Allamodische Artzney=Affen/ Das ist: Wahre und klare Obschon schlechte/ dannoch gerechte Beschreibung/ Lcherlicher Fehler/ einfltiger Thorheiten/ und schdlicher Mißbrauch in der Artzney/ wie auch vieler curiosen aus der alten Weiber Artzney=Archiv genommenen Recepten […]. Allen auffschneiderischen Landstrtzern/ verlogenen Theriacks=Krmern/ auffgeblasenen Menschen=Flickern/ unerfahrenen Darm=Waschern/ Zahnlucketen Clistir=Kchin/ Ehr= und Lehr=bedrfftigen Purgier=Knstlerinnen zu einer heilsamen Warnung An das Tage=Licht gegeben.
1 Diskursivierung medizinischen Wissens, pikarisches Narrativ und die Grenzen emblematischen Erzählens Reisende Quacksalber werden nicht nur aus philanthropischen, sondern auch aus standespolitischen und ökonomischen Gründen als ‚unvernünftige‘, abergläubische oder kriminelle Scharlatane ebenso entlarvt, wie die Rollenanmaßungen des sesshaften ‚Medikasters‘ als medicus empiricus der Unterschichten kritisiert werden. Wie im Marcktschreyer vom ‚getreuen Eckarth‘ beklagt, konkurrieren insbesondere volksmedizinisch dilettierende Pfarrer oder Scharfrichter mit den akademisch ausgebildeten, welt- und wortgewandten, hoffähigen und, wie Ettner selbst, belletristisch begabten medicis politicis. Diese sehen sich im 17. und frühen 18. Jahrhundert starker beruflicher Konkurrenz ausgesetzt und vermögen mit der sozialen Anpassung der frühneuzeitlichen ‚Heiler‘ an ihre Unterschichten-‚Patienten‘ nicht Schritt zu halten: Was den vernunftbetonten Kritikern als Gipfel der Dummheit und des Aberglaubens erschien und was sie auf der Anbieterseite gern als Betrug deklarierten, kann […] auch
278
Claus-Michael Ort
als Ähnlichkeit in den Erklärungsmustern für Gesundheit und Krankheit und als genaue Kenntnis der Lebensbedingungen der Unterschichten verstanden werden.4
Der berufsständisch geprägten Position des Doktor Ettner in der Spätphase der frühneuzeitlichen Konflikte und polemischen Kontroversen zwischen medizinischer ars und doctrina einerseits und einer medicina empirica, die ihre Erfolge aus der Sicht der academicis lediglich dem Zufall, der fortuna, verdanke und die Nähe zum Bettlermilieu nicht verleugnen könne, wird jedenfalls die vorschnelle Etikettierung als frühaufklärerischer Gegner der Alchemie kaum gerecht, wie sie Ettner seit Ende des 18. Jahrhunderts immer wieder zuteil geworden ist.5 Mehr als ein Vierteljahrhundert nach Erscheinen von James Hardins Ettner-Bibliografie haben Diskurs- und Wissensgeschichte die Quellenbasis der Literaturwissenschaft ebenso erweitert wie sich die Wissenschaftsgeschichte umgekehrt auch literarischer Quellen bedient, sodass Ettners Romane als narrative Medien der Wissenspopularisierung nicht nur für die Medizingeschichte und die GrimmelshausenWirkungsforschung – Ettners Figuren diskutieren mehrfach das in den Romanen des Simplicissimus-Zyklus thematisierte medizinische Wissen6 –, sondern auch für eine literarische Anthropologie der Frühen Neuzeit als vielversprechende Quelle
4 Barbara Elkeles: Medicus und Medikaster. Zum Konflikt zwischen akademischer und „empirischer“ Medizin im 17. und frühen 18. Jahrhundert. In: Medizinhistorisches Journal 22 (1987), H. 2/3, S. 197–211, hier S. 209; vgl. auch Barbara Elkeles: Arzt und Patient in der medizinischen Standesliteratur der Frühen Neuzeit. In: Benzenhöfer/Kühlmann (Anm. 3), S. 131– 143, sowie Michael Stolberg: Zwischen Identitätsbildung und Selbstinszenierung. Ärztliches SelfFashioning in der Frühen Neuzeit. In: Diskurse – Körper – Artefakte. Historische Praxeologie in der Frühneuzeitforschung. Hg. von Dagmar Freist. Bielefeld 2015, S. 33–55; zur „Interferenz der Wissensbereiche […] Medizin und Philologie“ im 17. Jahrhundert und zur Inkorporation philologischer Gelehrsamkeit durch die Medizin vgl. Herbert Jaumann: Iatrophilologia. ‚Medicus philologus‘ und analoge Konzepte in der frühen Neuzeit. In: Philologie und Erkenntnis. Beiträge zu Begriff und Problem frühneuzeitlicher ‚Philologie‘. Hg. von Ralph Häfner. Tübingen 2001 (Frühe Neuzeit 61), S. 151–176, hier S. 151. 5 So z. B. in Johann Friedrich Gmelin: Geschichte der Chemie seit dem Wiederaufleben der Wissenschaften bis an das Ende des achtzehenden Jahrhunderts. Zweyter Bd. bis gegen das lezte Viertheil des achtzehenden Jahrhunderts. Göttingen 1798, S. 291 f.: „Vornemlich hob die Alchemie ihr Haupt stolz empor: denn ob gleich schon (Joh. Chrph.) Ettner […] die mannigfaltige Betrgereien der Goldmacher, insbesondere der herumziehenden, ans Tageslicht [brachte]“; ebd. S. 336, über „die Sucht, mit geheimen oft durch chemische Kunstgriffe verfertigten, Arzneien zu wuchern, so laut auch einige Aerzte: als J. C. Ettner […] dawider sprachen“. 6 Vgl. Misia Sophia Doms: „Alkühmisten“ und „Decoctores“. Grimmelshausen und die Medizin seiner Zeit. Bern 2006 (Beihefte zu Simpliciana 3); Wolfgang Eckart: Medizinkritik in einigen Romanen der Barockzeit – Albertinus, Grimmelshausen, Lesage, Ettner. In: Heilberufe und Kranke im 17. und 18. Jahrhundert. Die Quellen- und Forschungssituation. Hg. von Wolfgang Eckart und Johanna Geyer-Kordesch. Münster 1982, S. 49–75.
Medizinisches Wissen und die Funktion pikaresken Erzählens
279
gelten können.7 Um die medizinhistorische und literaturgeschichtliche Position von Ettners Romanen im Medien-, Gattungs- und Themenspektrum medizinischer, chemischer und pharmazeutischer Wissensvermittlung und – wie die Untertitel andeuten – auch lebenskluger Moraldidaxe um 1700 näher zu bestimmen, bietet sich folglich ein zugleich wissens- und literaturgeschichtlicher Zugriff an, dessen komplementäre Erkenntnisinteressen wie in einer Kippfigur aufeinander verweisen.8 Im Folgenden sind lediglich exemplarische Schlaglichter auf Textstrukturen, interdiskursive Episteme und Geltungsansprüche bzw. Autorisierungsstrategien der Wissensvermittlung im Marckt-Schreyer (1694) mit Seitenblicken auf andere Romane des Zyklus möglich.9 Zu fragen ist, wie sowohl topisch abrufbares medizinisches, pharmazeutisches und chemisches Wissen als auch das in fingierter ‚Empirie‘ neu gewonnene Wissen über gesellschaftliche Missstände und ‚Pathologien‘ diskursiviert, d. h. erstens innerdiegetisch generiert und verhandelt, zweitens generisch (z. B. narrativ, dialogisch oder ‚szenisch‘) formatiert und drittens mittels theologischer, moralischer und/oder naturwissenschaftlicher (z. B. paracelsischer oder aristotelisch-galenischer) Wahrheitsansprüche legitimiert oder verworfen wird und wie sich Wissenskonstrukte auf der Basis veränderter literarischer Strategien der mise en discours transformieren – in diesem Fall vor dem Hintergrund des Pikaresken als „kulturelle[m] Paradigma der Neuzeit […]: als Inventar miteinander kombinierbarer diskursiver, narrativer, stilistischer und perspektivischer Grundmuster“10.
7 ‚Anthropologie‘ im Sinne von Claus-Michael Ort und Wolfgang Lukas: Literarische Anthropologie der ‚Goethezeit‘ als Problem- und Wissensgeschichte. In: Michael Titzmann: Anthropologie der Goethezeit. Studien zur Literatur und Wissensgeschichte. Hg. von Wolfgang Lukas und Claus-Michael Ort. Berlin, Boston 2012 (Studien und Texte zur Sozialgeschichte der Literatur 119), S. 1–28; vgl. auch Walter Erhart: Medizin – Sozialgeschichte – Literatur. In: IASL 29 (2004), H. 1, S. 118–128. Weder Michael Stolberg: Homo patiens. Krankheits- und Körpererfahrung in der Frühen Neuzeit. Köln, Weimar, Wien 2003 noch Bettina von Jagow, Florian Steger (Hg.): Literatur und Medizin. Ein Lexikon. Göttingen 2005 ist Ettner dagegen eine Erwähnung wert. 8 Zu den theoretischen Voraussetzungen siehe Claus-Michael Ort: Das Wissen der Literatur. Probleme einer Wissenssoziologie literarischer Semantik. In: Literatur und Wissen. Theoretischmethodische Zugänge. Hg. von Tilmann Köppe. Berlin, New York 2011 (linguae & litterae 4), S. 164–191. 9 Vgl. Beate Kellner, Jan-Dirk Müller und Peter Strohschneider: Erzählen und Episteme. In: Erzählen und Episteme. Literatur im 16. Jahrhundert. Hg. von Beate Kellner, Jan-Dirk Müller und Peter Strohschneider. Berlin, New York 2011 (Frühe Neuzeit 136), S. 1–19, hier S. 3–4 („Erzählen: Textstrukturen“), S. 4–7 („Episteme: [Inter]diskursive Konstellationen“) und 7 („Geltungsansprüche: Autorisierungsstrategien“). 10 Christoph Ehland und Robert Fajen: Einleitung. In: Das Paradigma des Pikaresken. The Paradigm of the Picaresque. Hg. von dens. Heidelberg 2007 (GRM-Beiheft 30), S. 11–21, hier S. 12.
280
Claus-Michael Ort
Wenn überdies „[h]ybride textuelle Vermittlungsformen signalisieren“, so Wilhelm Kühlmann anlässlich versgebundener ‚Lehrdichtung‘, dass sich in der Frühen Neuzeit Leser und Autoren mit einer offenkundigen Pluralisierung, Differenzierung und Expansion der epistemischen Diskurse sowie weitläufigen Austauschprozessen zwischen literarischen Texten und Textmodellen in divergenten Kontexten […] konfrontiert sahen,11
so gilt dies a fortiori für das Ende des 17. Jahrhunderts und lässt sich insbesondere am Romanzyklus Ettners ablesen. Dessen Strategien der Wissensgenerierung und Wissenslegitimierung situieren sich dabei zwischen zwei frühneuzeitlichen Verfahren der mise en discours,12 die sowohl für moraldidaktische Zwecke als auch für solche der Vermittlung ‚empirischen‘ Wissens instrumentalisiert werden. So koexistieren um 1700 ältere, eher emblematisch semantisierende und analogisierende Ordnungsmodelle, die die Klassifikation medizinischen Wissens auf moralische Deutungsmuster verpflichten, mit potenziell unabschließbaren, jahreszeitlich und kalendarisch verzeitlichten Sammlungen ‚empirischer‘ Beobachtungen und heterogener, aber lehrreicher Einzelfälle (einschließlich neu erschienener Fachliteratur). Die emblematische Variante wird idealtypisch von der ‚Gesundheits-Policey‘ von ‚Mensch‘ und ‚Gesellschaftskörper‘ repräsentiert, die der Tiroler Arzt und Hygieniker Hippolyt Guarinonius auf aristotelisch-galenischer Grundlage und mit antiparacelsischer und gegenreformatorischer Stoßrichtung in den Dienst einer Pathologisierung des ‚Bösen‘ und der Moralisierung des ‚Kranken‘ stellt und im Jahre 1610 – unter dem auf Jesu Rede über die Endzeit (Mt 24 f.) anspielenden – Titel Die Grewel der Verwüstung Menschlichen Geschlechts publiziert.13 Die inscriptio aus der Rede über die Endzeit (Mt 24,15: „WEnn jr nu sehen werdet den
11 Wilhelm Kühlmann: Wissen als Poesie. Zu Formen und Funktionen der frühneuzeitlichen Lehrdichtung im deutschen Kulturraum des 16. und 17. Jahrhunderts. In: Joachim Telle: Alchemie und Poesie. Deutsche Alchemikerdichtungen des 15. bis 17. Jahrhunderts. Untersuchungen und Texte. Mit Beiträgen von Didier Kahn und Wilhelm Kühlmann. Bd. 1. Berlin, Boston 2013, S. 1–84, hier S. 1. 12 Zur „mise en discours“ (Diskursivierung) siehe Michel Foucault: L’histoire de la sexualité. 1. Bd.: La Volonté de savoir. Paris 1976, S. 20, 29. 13 Hippolytus Guarinonius: Die Grewel der Verwüstung Menschlichen Geschlechts. […]. Ingolstadt 1610. Vgl. insbesondere Jürgen Bücking: Kultur und Gesellschaft in Tirol um 1600. Des Hippolytus Guarinonius’ ‚Grewel der Verwüstung Menschlichen Geschlechts‘ (1610) als kulturgeschichtliche Quelle des frühen 17. Jahrhunderts. Lübeck, Hamburg 1968 (Historische Studien 401); Elmar Locher (Hg.): Hippolytus Guarinonius im interkulturellen Kontext seiner Zeit. Acta der Tagung Neustift 1993. Bozen, Innsbruck 1995 (Essay & Poesie 2). Angesichts der eher protestantisch geprägten ‚medicinischen Policey‘ erweist sich Guarinonius als katholische
Medizinisches Wissen und die Funktion pikaresken Erzählens
281
Grewel der verwüstunge“) und ihre pictura in Guarinonius’ Titelei – der siebenköpfige Drache aus der Apokalypse des Johannes verschlingt Sieche – allegorisieren das Schicksal der Kranken zum Sinnbild einer nicht nur physisch, sondern auch sittlich ‚kranken‘ Menschheit und entlarven damit zugleich die Welt als eine von Untergang und Verdammnis bedrohte (Abb. 1). Eine potenziell unabschließbare Serie heterogener Ereignisse repräsentiert dagegen das ‚naturwissenschaftliche‘ Periodikum der Breslauischen Sammlungen, das noch zu Lebzeiten Ettners 1718 „[a]ls ein Versuch ans Licht gestellet [wird] von Einigen Breslauischen Medicis“ und bis 1734 erscheint.14 In ihnen ist hundert Jahre nach Guarinonius die endzeitliche Bestrafung moralisch ‚Verwüsteter‘ einer „ordentliche[n]“ sprachlichen „Connexion“ durchnummerierter Ereignistypen (von Seuchen und Missernten bis zu „neue[n] physikalische[n] und medicinische[n] Erfindungen“ [Titelblatt]) gewichen, deren exemplarische Repräsentativität von der kontingenten Serie dessen, was „vernderliches“ in den drei Sommermonaten des Jahres 1717 „vorgefallen“ (ebd.) ist, eingeschränkt wird. Die Vermittlung praktischen und potenziell inkohärenten Erfahrungswissens marginalisiert das moralische prodesse zugunsten wissensdidaktischer ‚Nützlichkeit‘. Um diese beiden Pole einer im weitesten Sinn noch emblematisch verfassten Episteme anagogischer Sinnstiftung einerseits und der empirischen Vielfalt innerweltlich kontingenter, aber narrativ verknüpfbarer Zu- und EinzelFälle andererseits kreisen die enzyklopädischen und chronikalischen ebenso wie
Ausnahme; vgl. Peter Hersche: Muße und Verschwendung. Europäische Gesellschaft und Kultur im Barockzeitalter. 2. Teilband. Freiburg im Breisgau, Basel, Wien 2006, S. 721. 14 Sammlung Von Natur= und Medicin- Wie auch hierzu gehrigen Kunst= und LiteraturGeschichten, So sich An. 1717. in den 3. Sommer=Monaten Jn Schlesien und andern Lndern begeben. Welcher Gestalt nemlich: 1) Die Vernderung des Gewitters von Tage zu Tage und von Zeit zu Zeit. 2) Land= und Witterungs=Seuchen, von Monat zu Monat, nach dem Einfluß Lufft und Wetters. 3) Zu= und Mißwachs von Feld= Wald= und Garten=Frchten, auch allerhand animalischem Proventu, in allerley Lndern Europens von einer Jahrs=Zeit zur andern bemerckt worden: Wie nicht weniger 4) was vor eintzelne eclatante natrliche Begebenheiten am Firmament, in der Lufft, auf und unter der Erde, im Wasser, an Menschen und Vieh: auch 5) was vor neue physikalische und medicinische Erfindungen diese Zeit ber hervorgebracht und bekannt worden: und denn 6) was in re literaria Physico-Medica vernderliches vorgefallen. Alles in ordentlicher Connexion und mit allerley Reflexions Aus vielfltiger Correspondenz, und andern Relationibus, so wie grossen Theils aus eigener Erfahrung zusammen gelesen; Und Als ein Versuch ans Licht gestellet Von Einigen Breßlauischen Medicis. Sommer=Quartal 1717. Breßlau 1718. – Ab 1730 erscheint das Perodikum unter dem Titel Miscellanea physico-medicomathematica: oder angenehme, curieuse und nützliche Nachrichten von Physical- u. Medicinischen, auch dahin gehörigen Kunst- und Literatur-Geschichten.
282
Claus-Michael Ort
Abb. 1: Hippolytus Guarinonius: Die Grewel der Verwüstung Menschlichen Geschlechts. […] Ingolstadt 1610, Titelblatt (Universitätsbibliothek Kiel: Qh 3187)
Medizinisches Wissen und die Funktion pikaresken Erzählens
283
die erzählenden – auch pikaresken – Formate der Wissensdiskursivierung des 17. Jahrhunderts und vermessen zugleich das sich eröffnende, generische Spektrum.15 So wird im Pícaro-Narrativ, das „pseudoautobiographische“ und „paraenzyklopädische“16 Erzählebenen verschränkt, der Protagonist erst nach seinem cursus durch die trügerische Welt (engaño) ‚sehend‘ (desengaño) und setzt entweder sein pikarisches Leben fort oder wird als Moral-Exempel – wie in Mateo Alemáns La vida de Guzmán de Alfarache atalaya de la vida humana (1599/ 1604) – in seiner finalen ‚Heilung‘ durch Buße und Bekehrung auf eine christliche Welt- und Selbstinterpretation verpflichtet: Die Geschichte des Guzmán ist keine offene Erzählung, die sich endlos weiterführen ließe […]. Sie ist […] syllogistisch strukturiert. Das ‚quod erat demonstrandum‘ ist Ausgangspunkt und Ende der Erzählung. Der Übergang vom engaño zum desengaño, von der Täuschung zur Ent-Täuschung [sic!], geschieht nicht auf dem Wege der Empirie; er ist dogmatischer Natur. Der ‚Träumer‘ muss ein ‚Erwachter‘ werden […].17
Der Beginn des deutschsprachigen Pikaroromans legt mit der dezidiert nachtridentinisch ausgerichteten Guzmán-Bearbeitung Der Landstörtzer Gusmann von Alfarche: Oder Picaro genannt (München 1615) durch den am Münchner Hof tätigen gegenreformatorischen Hofkanzlisten Aegidius Albertinus den Schwerpunkt zunächst ebenfalls auf die moralische Allegorese von Welterfahrung und fügt letztere in die kirchlich vorgegebenen Deutungsmuster der katholischen Moraltheologie ein: „Der deutsche ‚Gusman‘ ist […] ein dogmatischer Roman, die definitio geht dem definitum voraus“,18 Gusmans desengaño folgt dem Dreischritt
15 Zur exemplarischen Position von Georg Philipp Harsdörffers Schau-Plätzen in diesem Spektrum siehe Stefan Manns: Grenzen des Erzählens. Konzeption und Struktur des Erzählens in Georg Philipp Harsdörffers ‚Schauplätzen‘. Berlin 2013 (Deutsche Literatur. Studien und Quellen 14) und zum Grossen Schau-Platz jämmerlicher Mord-Geschichte auch Claus-Michael Ort: ‚Mord‘Geschichten und ‚Verbrecher‘-Wissen. Probleme der Verbrechensdeutung und die Generierung von Wissen in Georg Philipp Harsdörffers „Grossem Schau-Platz jämmerlicher Mord-Geschichte“ (1650–52). In: Fallgeschichte(n) als Narrativ zwischen Literatur und Wissen. Hg. von Martina King und Thomas Wegmann. Innsbruck 2016 (Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft [Germanistische Reihe 84]), S. 27–48. 16 Matthias Bauer: Der Schelmenroman. Stuttgart 1994, S. 9. 17 Hans Gerd Rötzer: Picaro – Landstörtzer – Simplicius. Studien zum niederen Roman in Spanien und Deutschland. Darmstadt 1972 (Impulse der Forschung 4), S. 86; zur „orthodoxdogmatischen Doppelsinnigkeit“ des Guzmán de Alfarache s. auch Hans Gerd Rötzer: Der europäische Schelmenroman. Stuttgart 2009, S. 37–45. 18 Rötzer: Picaro (Anm. 17), S. 119. Zu Albertinus’ Gusmann vgl. ebd. S. 94–127; Hans Gerd Rötzer: Der Schelmenroman und seine Nachfolge. In: Handbuch des deutschen Romans. Hg. von Helmut Koopmann. Düsseldorf 1983, S. 131–150, hier S. 133 f.; Bauer (Anm. 16), S. 76–80; eingehend
284
Claus-Michael Ort
der tridentinischen Rechtfertigungslehre contritio, confessio und satisfactio,19 und an „die Stelle einer auslegungsrelevanten Dissoziation von erzähltem“ und retrospektiv „erzählendem Ich tritt […] ein sinnbildliches Argumentationsschema“.20 Dieses schränkt zwar die Wissenskompilation nicht ein, steckt aber den Deutungsrahmen des – Ansgar M. Cordie weist darauf hin – u. a. aus Guarinonius’ Grewel der Verwüstung Menschlichen Geschlechts übernommenen ‚Wissens‘ ab.21 Insbesondere Grimmelshausens Simplicissimus-Romane unterziehen die bereits von Anfang an christlich geprägte Weltbeobachtung des Simplicius einer ‚empirischen‘ Überprüfung,22 die seine moralische Selbsterkenntnis befördert und in der Continuatio (1669) in eine durch die Lektüre seiner eigenen Aufzeichnungen motivierte Bekehrung des Simplicius – als „Author kein Narr: sonder ein sinnreicher Poet: insonderheit aber ein Gottseeliger Christ“23 – mündet. Der nach wie vor moralisierende, sich zugleich aber auch selbstreflexiv potenzierende Deutungsrahmen der Continuatio schließt allerdings des Simplicius irdischen Lebenswandel ebenso wenig ab wie dessen Narration. Nach seiner Rückkehr in die ‚Welt‘ wird er vielmehr einer fortgesetzten Bewährungsprobe unterworfen, die seine Selbstfindungs- und Läuterungsphase über die Continuatio hinaus ‚continuiert‘. So wandelt er sich im Seltzamen Springinsfeld (1670) vom wahrsagenden Gauckelbuch-‚Künstler‘ zum moralisierenden Ratgeber, der auf Leser seiner eigenen publizierten Geschichte trifft und nun seinerseits als Beobachter anderer Pícaro-Figuren, als Interpret der eigenen sowie als Rezipient fremder Biografien
auch Ansgar M. Cordie: Raum und Zeit des Vaganten. Formen der Weltaneignung im deutschen Schelmenroman des 17. Jahrhunderts. Berlin, New York 2001 (Quellen und Forschungen zur Literatur- und Kulturgeschichte 19 [253]), S. 55–176. 19 Vgl. Jean-Marie Valentin: Französischer „Roman comique“ und deutscher Schelmenroman. Opladen 1992 (Rheinisch-Westfälische Akademie der Wissenschaften. Vorträge G 315), S. 10; siehe auch Rötzer: Picaro (Anm. 17), S. 100. 20 Bauer (Anm. 16), S. 80. 21 Cordie (Anm. 18), S. 58 f.; vgl. auch Dieter Breuer: Hippolytus Guarinonius als Erzähler. In: Die österreichische Literatur. Ihr Profil von den Anfängen im Mittelalter bis ins 18. Jahrhundert (1050–1750), unter Mitwirkung von Fritz Peter Knapp (Mittelalter) hg. von Herbert Zeman. Teil 2. Graz 1986, S. 1117–1133. 22 Vgl. Bauer (Anm. 16), S. 79 und ebd.: „im Simplicissimus geht die Morallektion der Schelmengeschichte voraus“. 23 Hans Jacob Christoffel von Grimmelshausen: Continuatio des abentheurlichen Simplicissimi. In: Ders.: Werke I,1. Hg. von Dieter Breuer. Frankfurt am Main 2005 (Bibliothek deutscher Klassiker 44; Bibliothek der Frühen Neuzeit 4/1), S. 555–699, hier S. 683; vgl. auch ebd., S. 677: „zuletzt als ich mit hertzlicher Reu meinen gantzen gefhrten Lebens-Lauff betrachtete/ und […] mir selbsten vor Augen stellte […] daß […] der barmhertzige GOtt […] Zeit und Gelegenheit geben hat mich zu bessern/ zubekehren […] beschriebe ich alles was mir noch eingefallen/ in dieses Buch […].“
Medizinisches Wissen und die Funktion pikaresken Erzählens
285
fungiert – das Pikareske beobachtet sich im Medium des Pikaresken selbst, und umso mehr ist es geboten, weil vast niemand mehr die Warheit gern blos beschauet oder hren will/ ihr ein Kleid anzuziehen/ dardurch sie bey den Menschen angenem verbliebe/ und das jenig gutwillig gehret und angenommen wurde/ was ich hin und wider an der Menschen Sitten zu corrigiren bedacht war […].24
Narrative Temporalisierung und Vervielfältigung transformieren emblematische Schließungs- und anagogische Deutungsfiguren zu – im wörtlichen Sinn in den discours ‚eingelegten‘ – Wiederholungsfiguren25 einer mitlaufenden poetologischen Selbstreflexion, die anagogische Bedeutungsstiftung nur mehr im Modus der Selbstbeobachtung vollzieht und deren Reichweite implizit zu verhandeln in der Lage ist, ohne auf Allegorese gänzlich verzichten zu müssen. Dass gerade in den letzten Simplicissimus-Romanen die eingelagerten, explizit allegorisierenden Kommentare wieder zunehmen und an den Gusmann des Aegidius Albertinus erinnern,26 mag als Konsequenz aus der drastischen Erzählung von der Ertzbetrügerin und Landstörtzerin Courasche im Trutz Simplex (1670) interpretiert werden, die den moralisch-anagogischen ‚Kern‘ auf den ersten Blick zu verhüllen scheint, dessen ihre Deutung umso mehr bedarf,27 und verweist jedenfalls auf den Geltungsverlust der vorausliegenden emblematischen Rahmung in der Continuatio. Ettners Romanzyklus erweist sich vor diesem Hintergrund als wissens- und diskursgeschichtlicher Zwitter, der auf ein „neuartiges Welt- und Literaturverständnis“28 hindeutet, die „satirische Kritik am Medizinalwesen“ und die Popularisierung medizinischen und pharmazeutischen Fachwissens für Kollegen und gebildete Laien mit der Vermittlung „praktische[r] Lebensklugheit“ verbindet und die „transzendente Diesseitsdeutung“ auf – allerdings höchst signifikan-
24 Hans Jacob Christoffel von Grimmelshausen: Der Seltzame Springsinsfeld. In: Ders.: Werke I,2. Hg. von Dieter Breuer. Frankfurt am Main 2007 (Bibliothek deutscher Klassiker 73; Bibliothek der Frühen Neuzeit 4/2), S. 153–295, hier S. 172. 25 Vgl. Peter Heßelmann: Gaukelpredigt. Simplicianische Poetologie und Didaxe. Zu allegorischen und emblematischen Strukturen in Grimmelshausens Zehn-Bücher-Zyklus. Frankfurt am Main u. a. 1988 (Europäische Hochschulschriften I 1056), S. 364; zur „implikativen“ und „explikativen Allegorie“ im Simplicissimus-Zyklus s. ebd., resümierend S. 309–318, 364–366 und 386–391. 26 Vgl. ebd., S. 365 und 387 f.; ähnlich Rötzer, Der Schelmenroman und seine Nachfolge (Anm. 18), S. 138. 27 Vgl. Heßelmann: Gaukelpredigt (Anm. 25), S. 284; vgl. auch ebd., S. 386–391. 28 Peter Heßelmann: Simplicissimus Redivivus. Eine kommentierte Dokumentation der Rezeptionsgeschichte Grimmelshausens im 17. und 18. Jahrhundert (1667–1800). Frankfurt am Main 1992 (Das Abendland N. F. 20), S. 178 f.
286
Claus-Michael Ort
te – „Rudimente“ beschränkt. Einer „apriorischen Wahrheit wird nicht mehr getraut“,29 ‚entlarvt‘ wird innerweltlich und unermüdlich lediglich die ansonsten verhüllte ‚Wahrheit‘ der Täuschung selbst, also dass und wie falsche Ärzte, Apotheker und Hebammen ihre Adressaten betrügen. Das sukzessive abgerufene und von den Reisenden kritisch verhandelte medizinische Wissen selbst erfährt jedoch kaum mehr eine emblematisch-anagogische Absicherung, sondern wird auf einen enzyklopädischen Wissensraum projiziert, den es in der tour d’horizon einer wissenschaftlichen Cavaliersreise durch Europa zu erschließen gilt.30 Auf diesem Erzähl- und Reiseweg wird zugleich pseudoempirisches Wissen über echte und falsche Ärzte, physische und gesellschaftliche ‚Krankheiten‘ und über ‚Patienten‘ als getäuschte Rezipienten betrügerischer Performanz generiert und überprüft und über pikarische Lebenserzählungen zugleich auch Vergleichswissen vermittelt.
2 Gesellige Diätetik des Wissens statt Wissenskonkurrenz Zur Vermittlung von bereits diskursiviertem Wissen nutzt Ettner nicht nur die Erzählmuster von Reise- und Schelmenroman und die Dialogstrukturen lehrhafter ‚Gesprächsspiele‘ im Sinne Georg Philipp Harsdörffers, sondern auch fachwissenschaftliche Digressionen in Traktatform und bietet ferner ausgiebige Proben angewandter Höflichkeit, vermittelt also zugleich eine sowohl bürgerliche – tränenreich affektgesättigte – als auch ständeübergreifend ritualisierte ‚Complimentier-Kunst‘. Letztere unterbricht zwar den Fortgang der Narration ebenso regelmäßig, wie sie die Weiterreise der bildungshungrigen Reisegruppe um Eckarth verzögert, vermittelt aber Wissen über standesgemäße Kommunikation und eine gesellige conduite, die dem decorum gerecht wird: Kommunikatives und medizinisches aptum ergänzen einander, soziale Differenzen und physische Alteritäten werden gleichermaßen reguliert und geheilt. Die folgende Kostprobe aus dem Marcktschreyer betrifft eine Audienz beim Fürsten Felsensatz, um dessen Familie sich Eckarth in Zeiten des Krieges als Offizier verdient gemacht hat:
29 Alle Zitate ebd., S. 179. 30 Zur ärztlichen Apodemik siehe Wolfgang Neuber: Der Arzt und das Reisen. Zum Anleitungsverhältnis von Regimen und Apodemik in der frühneuzeitlichen Reisetheorie. In: Benzenhöfer/ Kühlmann (Anm. 3), S. 94–113.
Medizinisches Wissen und die Funktion pikaresken Erzählens
287
Und er/ Mons. Eckarth/ fuhr der Frst fort/ verschmhet nicht ein gndiges Andencken unserer Danckbarkeit von unserer Hand anzunehmen/ es ist ein weniges/ und allzuwenig vor geschehene ehemalige Gutthaten/ so unserm Hause wiederfahren. Eckarth wegerte [sic !] sich ein wenig/ nahm es aber mit einer tiefen Reverentz und folgenden Worten an: Durchlauchtigster Frst/ gndiger Herr/ die von mir geschehene vermeinte meriten sind wie vor gedacht keines Dancks/ geschweige eines so kostbahren Frstl. Geschencks werth/ jedennoch nehme von Euer Durchl. ich solches in aller Unterthnigkeit an/ wnschende capabel zu seyn/ dero HochFrstl. Wolfahrt zum besten noch angenehmere Dienste zu thun. Mons. Eckarth/ replizirte der Frst/ der Verdienst ist lngsten geschehen/ und wo wir ihm keine Ungelegenheit machen/ werden wir morgen die Artzeney selbsten kommen abzuholen. Eckarth bedanckte sich gehorsamst vor angebotene Frstl. Gnaden […]. (EM 471)31
Nach ihrem just beendeten Studium unternehmen der Jurist Gotthart und sein Mediziner-Freund Siegfried frühestens ab 166632 unter der ‚väterlichen‘ Leitung des alleinstehenden Exmediziners und Exoffiziers Eckarth – ein alter Freund ihrer ‚brüderlich‘ befreundeten Väter und Gutsbesitzer Mülard und Ehrenfried – eine jahrelange Bildungsreise, die durch Besuche von zu befragenden Ärzten, operierenden Chirurgen oder Heilbädern wie dem Egerschen Sauerbrunnen, Audienzen beim Papst und bei Fürsten einschließlich Kaiser Leopolds I. in Wien sowie durch ein Treffen mit Athanasius Kircher, aber auch von – selbstredend heilbaren – Erkrankungen und Verletzungen der Reisenden selbst unterbrochen wird: Am Schluß des Marcktschreyers „muste [die Compagnie] doch weiln die allzujhe Aenderung der Lufft bey reconvalescenten nicht allezeit dienlich/ biß nach Gottharts vollkommener Restitution ihre Reise vor dieses mahl auffschieben. ENDE“ (EM 540). Gotthart und Siegfried befinden sich auf dieser Exkursion in einer Art Dauerexamen durch den ‚Lehrer‘ Eckarth, der die Reise als Anlass für längere pharmazeutische, alchemische und anatomische Referate und Literaturhinweise versteht, deren inhaltliche Abfolge sich der unvorhersehbaren kontingenten Vielfalt der Welt verdankt. Insbesondere der Mediziner Siegfried hat jederzeit in freier Natur und in geselliger Konversation sein Wissen unter Beweis zu stellen, mündliche Gutachten abzugeben und Fragen Eckarths oder der Gastgeber zu beantworten, seien sie Mediziner oder wissbegierige Laien, und sich der Beurteilung seines Mentors zu unterwerfen. Ein beliebiges Beispiel:
31 Vgl. die „Complimentir-Comödie“, die Christian Weise als Lesedrama in sein Complimentenund Chrieen-Lehrbuch Politischer Redner eingefügt hat (Christian Weisens Politischer Redner […]. Leipzig 1679, S. 294–434). 32 Zu den Problemen der Datierung der dargestellten Welt s. Benzenhöfer (Anm. 3), S. 288, Anm. 40.
288
Claus-Michael Ort
Daß wir uns von diesem Stadt=Cavallier abwenden/ so saget mir mein Herr Sohn Siegfried/ was ist daß vor ein Kraut/ so hier vor Euch stehet? Siegfried antwortete/ Herr Vater/ es sind taube Nesseln. Ja wohl versetzte Eckarth/ sinds taube/ aber dem Lateinischen nach/ nicht todte Nesseln. […] in der hefftigsten Kranckheit da kein Mittel helffen will/ schaffet dieses [Kraut] den Leidenden Ruhe und Vergngen. […]. Genung. Was ist dieses vor ein Baum der hier uns entgegen stehet? fragte Eckarth ferner. Ein Ulmen=Baum antwortete Siegfried. (EM 289 f.)
Der Dreiergruppe schließen sich zeitweise medizinisch und chemisch fachkundige Reisegenossen an, was die Konversation anregt, den erzählbaren Erlebnisund Erinnerungsvorrat vergrößert und nicht nur den medizinischen, sondern auch den natur- und ‚volkskundlichen‘ Beobachtungshorizont erweitert. Die Reisenden folgen anatomischen, diätetischen, botanisch-pharmazeutischen und chemischen Erkenntnisinteressen, beobachten aber auch Strafverfolgung und Strafjustiz, Religionsausübung und Aberglauben im sozial-ständischen und kulturell-ethnischen Vergleich. Dabei scheinen die geselligen ‚Discurse‘ Eckarths zunächst weniger auf Wissenszuwachs denn auf Wissenssicherung, also auf eine repetitive Bestätigung und Distribution von bereits populärem oder fachintern tradiertem Wissen abzuzielen. Nicht zuletzt die mehrfach und nicht nur von Eckarth bemühten säftemedizinischen Topoi und die sich daraus ableitende Diätetik harmonischer Mittelwerte und ‚gesunder‘ Zirkulation der Körpersäfte, aber auch der medizinischen Kenntnisse selbst verraten ein galenisches Fundament des in Ettners Romanen verhandelten Wissens, auf dem allerdings auch paracelsische Positionen ihren Platz finden, sobald sie ihre ‚Läuterung‘ im kritischen Diskurs Eckarths überstanden, ihre ‚guten‘, insbesondere iatrochemischen Anteile sich also der ‚schlechten‘ theosophischen entledigt haben.33 So motiviert die gesellig-idyllische Ausgangssituation des Marcktschreyers und die rührungstränenreiche und – humoralpathologisch konsequent – zugleich trinkfreudige Lebenspraxis der Figuren noch vor Erscheinen Eckarths und vor Beginn der Reise einen morgendlichen säftemedizinischen Vortrag (EM 28–39), in dem es auch um Kaffee, Tee und Schokolade, um das Tabakrauchen und um Schminke geht und der das im Fortgang des discours ausufernde medizinische Frage-Antwort-Spiel vorbereitet. Nach dem Anhören einer reyenartig kommentierenden Glückseligkeitsarie über ‚Sorglosigkeit‘ und das ‚lasterfreie‘ weil
33 Vgl. die Empfehlungen in Johann Christoph Ettner: ROSETUM CHYMICUM/ Oder: Chymischer Rosen=Garten/ Aus welchem Der vorsichtige Kunst=Beflissene/ Voll=blhende Rosen/ Der Unvorsichtige Laborant aber/ Dornen und verfaulte Knospen/ abbrechen wird; Jn sonderliche Garten=Better abgetheilet und vorgestellet […]. Frankfurt, Leipzig 1724.
Medizinisches Wissen und die Funktion pikaresken Erzählens
289
„vergngt[e]“, „friedlich[e]“ Zusammenleben „mit Gott | und seinen Nechsten“34 und nach „allerhand erbaulichen Discursen“ wirft Mülard bey Geniesung des Aufgesetzten […] die Frage [auf]: Ob auch dergleichen Confituren/ und starckgewrtzte Pfefferkuchen/ nebendst denen gebrandten Wassern des Morgens zu gebrauchen der Leibes Constitution des Menschen solte ntzlich und profitabel seyn? Kunigundis sagte zu ihren [sic!] Eheliebsten: Mein Schatz/ ihm wird obliegen/ als ein Medicus Herrn Mlarden von dieser Frage Satisfaction zu thun. Hertzlich gerne mein Kind/ replicirte Thierhold […]. (EM 28)
Thierhold antwortet auf die Frage nach den Pfefferkuchen „mit Ja und Nein“ (EM 29), da deren Verträglichkeit vom individuellen Temperament abhänge und sie jedenfalls Phlegmatikern als schleimlösend zu empfehlen seien. Da nicht nur der wissensdurstige Mülard weitere Stichworte aus Thierholds Antwort aufgreift, münden dessen Ausführungen über „Fontanellen“ – also die neben Wunden und Entzündungsherde gelegten künstlichen ‚Ausgänge‘ für die schlechten Ausdünstungen eines kranken Körpers35 – und über die „circulatio“ der „guten humores“ wie des „dnne[n] Bse[n]“ (EM 35) nach wenigen Seiten bei „Urin“, „Mastdarm“ und Stuhlgang (EM 33) und erinnern die Gartengesellschaft an den „Eckel“, den ein „Eiterhaffte[r]“ „AaßGeruch“ verursacht, wenn „zu Sommerszeiten […] der Schweiß mit zukommt“ (EM 34). Die quasi-metonymische Verkettung von Einzelaussagen entspringt zwar Thierholds Postulat, „ein jeder Mensch/ oder wenigstens ein jeder Christ“ möge ihm „zugestehen/ daß der Schpfer […] eine jede Creatur ihren Wesen nach hchst=vollkommen erschaffen“ habe, „bevoraus aber denen Menschen“ (EM 32). Indem sie die Einzelheiten solch ‚vollkommener Schöpfung‘ jedoch zur Sprache bringt, ist die gesellige Konversation intrinsisch kaum mehr zu limitieren. „Dem/ was einen vergnget/ kan man wohl zuhren“, dankt „Liebhold […] im Namen der gantzen werthen Gesellschaft“ (EM 39), die sodann vom Gastgeber Ehrenfried „auff ein klein Frhstcke“ (EM 40) in die ‚Sommerlaube‘ im Garten gebeten wird, wo Knaben die nächste Glückseligkeits-Arie vortragen (EM 42 f.) und frivole Wasserspiele als humoralpathologische Ergießungs-Surrogate für Erschrecken und Heiterkeit sorgen („gieng aus einer Rhre […] ihr ein Wassersprung unter den Rock an den Leib“36). Gottesfurcht („Tisch=Gebet“ [EM 43]), bukolischer Lebensgenuss – Speis, Trank, Musik, Geselligkeit – und ‚vergnüglich‘ belehrende Wissensvermittlung werden also nicht nur syntagmatisch verknüpft, sondern innerdiegetisch kontrastiert, zugleich affekt-diätetisch moderiert und
34 EM 27 f., hier S. 27. 35 EM 32–36, hier S. 32, 34. 36 EM 41; vgl. auch S. 40: „etliche Kunstrhren geffnet“.
290
Claus-Michael Ort
durch den säftemedizinischen Diskurs auf engstem Raum integriert. Verbalisierte ‚gesunde‘ Ausscheidungen und real praktizierte Nahrungsaufnahme folgen unmittelbar aufeinander, letztere belohnt sogar den ‚Discurs‘ über erstere: […] so wird er erstlich einen Vomitum, hernach etliche Sthle/ nach diesen einen Schweiß mit Ausgang des Urins haben/ und so dann/ wann er sich warm hlt/ fangen die Speichel=Rhren an zu schwellen/ und gehet nachmahls das Geifern an/ welches so lange dauret/ biß die Kranckheit sich gntzlich gehoben. Wohlan/ sagte Ehrenfried/ Monsr. Thierhold hat sein Frhstck wohl verdienet […]. (EM 38 f.)37
Der humoralpathologisch grundierte, medizinische Diskurs selbst dient der Gartengesellschaft also als divertissement, das die Melancholie ebenso vertreibt, wie es die eingestreuten Arien der jungen Sänger- und Musikantentruppe tun: „Wie so in tiefen Gedancken/ Ehrenfried/ sollen wir das Liedlein auffspielen? Adieu Melancholey mit deinen Grillen/ etc.“.38 Die horazische Poetik von ‚Lust‘ und ‚Nutz‘, von der schönen und vergnüglichen Hülle und dem moraldidaktischen Kern, von der Süßigkeit und der bitteren ‚Artzeney‘, stößt damit implizit an ihre Grenzen: Keine überzuckerte Pille mit trügerisch verhülltem Kern wird gereicht, sondern Mittel und Zweck, die Schale und der ungeschönte Kern darin werden nacheinander und getrennt verabreicht. In der Vorrede Eckarths und seiner Kritik an einer „Schreib-Art“ und Lektüre, die „mehr auf das Jucundum als Utile, mehr auf die Schale als den Kern [sieht]“, kündigt sich diese Konsequenz bereits an:39 „die Tugend=Bahn so wohl durch das Wiederspiel als Gleichheit der Sachen“ zu „zeigen“, dürfe durch die Dominanz des ornatus der schönen Hülle nicht mehr behindert werden. Dass die ungeschönte Differenz des Heterogenen (‚Abwechslung‘) und dessen partielle ‚Gleichheit‘ seinerseits die ‚Abwechslung‘ von ‚Gleichheit‘ und ‚Ungleichheit‘ impliziert, deutet in derselben Konversation bereits Filinda anlässlich einer deutungsbedürftigen Rührungsträne Ehrenfrieds an („Abwechselung deiner Gedancken […] die in einem Stcke eine solche Ungleichheit und in andern
37 Vgl. auch EM 37: „es wird wohl bald Zeit zum Mittagsmahl seyn/ jedennoch werden wir allerseits mit Hertzens=Vergngen meines werthesten Freundes Herr Mlards nochmalige Frage/ und derselben Errterung begierig anhren.“ 38 EM 2. Auch die affekt-hermeneutisch kommentierende Arie (EM 11 f.) weist bereits auf die Notwendigkeit hin, ambige Affektindizien wie Tränen durch Erzählen zu vereindeutigen: „Wer weiß des Menschen Hertz/ Wann Thrnen=volle Strme fliessen/ Und sich gleich einem Meer ergiessen/ Geschichts aus Freuden oder Schmertz/ Das Hertz allein kan seine Freude nennen/ Und was es schmertzt aus seinen [sic!] Grund erkennen“ (S. 11). 39 EM )(5. Zu parallelen Verfahrensweisen von Medizin und Satire (und nicht nur der MedizinSatire), also einer Medizin, die süße und bittere Arzneianteile mischt, und einer „satirischdrastischen“ Poesie s. Jaumann (Anm. 4), S. 170.
Medizinisches Wissen und die Funktion pikaresken Erzählens
291
eine verstellte Gleichheit zusammen […] wrden vor Augen stellen“ [EM 9]). Damit charakterisiert sie beiläufig auch den ‚diätetisch‘ läuternden Umgang mit konkurrierenden, widerstreitenden – etwa paracelsischen – Wissensinhalten, deren Differenzen und Gemeinsamkeiten mit der orthodoxen Medizin im geselligen Gespräch verhandelt werden. Dass laut der Allgemeinen Deutschen Biographie Ettner „als einer der frühesten entschiedenen Gegner der Alchemie […] bekannt“ sei,40 kann somit in der Tat als revidiert gelten.41 Eckarths eher positive Einstellung zur Spagyrik untermauert dies ebenso wie seine abwägend wohlwollende Einschätzung nicht nur des Paracelsisten Johan Baptista van Helmont, des „hocherfahrnen Helmontii“,42 sondern auch des Begründers der alchemistischen Pharmazie selbst, also jenes Theophrastus Bombastus von Hohenheim (Paracelsus), den Johann Christoph Adelung 1789 im siebten Teil seiner Geschichte der menschlichen Narrheit als „Kabbalist und Charlatan“ bezeichnen wird.43 Festzuhalten ist, dass Eckarth trotz mehrfacher Kritik an paracelsischen Positionen im Marcktschreyer, aber auch im Unwürdigen Doctor oder im Ungewissenhafften Apotecker nicht nur galenisch, sondern auch iatrochemisch im Sinne von Paracelsus und van Helmont argumentiert, den Hohenheimer gegen Teufelspaktverdächtigungen in Schutz nimmt und ihn gar mit dem „Heyland/ als de[m] Ober=Artzt und Helffer aller Menschen“44 vergleicht, der sich mit ähnlichen Vorwürfen von jüdischer Seite konfrontiert gesehen habe. Eckarth nähert sich damit durchaus der Argumentation van Helmonts, der die „Krafft, Kranke zu heilen durch Worte, gewisse Gebräuche, Beschwörungen, Wasser, Brodt, Saltz und Kräuter, von Anfang in der Kirche“45 ansiedelt, ihnen Wirksamkeit nicht nur „wider die bsen Geister und Zauber=Hndel, sondern durchgehends wider alle Kranckheiten“ zuschreibt und
40 Alphons Oppenheim: Ettner von Eiteritz, Johann Christian [sic!]. In: ADB, Bd. 6. Leipzig 1877, S. 401. 41 So schon Benzenhöfer (Anm. 3), S. 290 zur positiven Bewertung von Paracelsus’ Großer Wundartzney von allen wunden […] (1536) im Verwegenen Chirurgus (1698); vgl. auch S. 294 über Ettner als „Anhänger einer Alchemia medica im Sinne eines Paracelsus, van Helmont und Sylvius dele Boe“ im Ungewissenhafften Apotecker (1700) sowie S. 292 zu ähnlichen Positionen im Entlauffenen Chymicus (1696). 42 EM 36; ähnlich ebd., S. 37. 43 „73. Kapitel. Theophrastus Paracelsus, ein Kabbalist und Charlatan“. In: Johann Christoph Adelung: Geschichte der menschlichen Narrheit, oder Lebensbeschreibungen berhmter Schwarzknstler, Goldmacher, Teufelsbanner, Zeichen= und Liniendeuter, Schwrmer, Wahrsager, und anderer philosophischer Unholden. 7. Teil. Leipzig 1789, S. 189–364, hier S. 189. 44 EM 214. 45 Johan Baptista van Helmont: Die Morgenröthe. Das ist: fünf herrliche und geheimnißvolle Receptbücher zum leiblichen Wohl der Menschheit. Sulzbach 1683, S. 62.
292
Claus-Michael Ort
sie auf Christus zurückführt: „Denn die Heilung durch Christum unsern HErrn hat sich durch die Aposteln angefangen und ist immer beybehalten worden: Ja sie ist auch noch und bleibet ohne Aufhren.“46 Und als Siegfried verzweifelt die „bse[n] Zeiten“ und die Quacksalber-Plage beklagt, die „GOtt zur Straffe“ für die von ihm selbst „zugelassene Blindheit“ (EM 212) all jener geschickt habe, die die „von GOtt und der Natur erschaffene[n] Medic[os]“ nicht als „Seelsorger“ verehren, sondern in ihrer Verblendung als „Ulcera Reipublicæ, Geschwre/ fressende Schden einer Gemeine“ (ebd.) beschimpfen, weist Eckarth diese Art der medizinischen Theodizee zurück. Er erinnert stattdessen daran, wie „vor hundert Jahren Theophrastus, in diesem Seculo Helmontius, Sylvius und andere mehr/ über dergleichen Medicastros und Verchter der Artzeney-Kunst ihre Klagen gefhret“ (EM 213). Vielmehr sei der Medizin, „als sie noch ein Kind war/ viel Gifft in ihren Brey mit eingemischt worden“ (ebd.), das es nun, so die wissensdiätetische Mission Eckarths, wie in einem chemischen Läuterungsprozess von den ‚edlen‘ Anteilen – seien sie galenisch, seien sie paracelsisch – wieder zu scheiden gelte. Insofern verwundert es nicht, wenn sich Eckarth an anderer Stelle Siegfrieds Kritik an des Theophrastus „Astralische[m] Spiritus“ anschließt (EM 378), was ihn allerdings nicht daran hindert, selbst eine ‚reale‘ Geistererscheinung zu erleben und den Stein der Weisen zu beglaubigen. Ein ähnlich widersprüchlicher Umgang widerfährt im Unwürdigen Doctor übrigens auch der Mummelsee-Episode aus Grimmelshausens Simplicissimus Teutsch: Eckarth hält zwar wie Siegfried die Geschichte für Fantasterei, letzterer glaubt aber, dass die Fiktion gleichwohl valides Wissen über magische und medizinisch wirksame Steine vermitteln könne.47 Und nicht Paracelsus selbst gilt postum als Scharlatan, sondern der Quacksalber, der sich als des „Theophrasti Paracelsi Nachfolger“ ausgibt.48
46 Ebd., S. 62. Zu Christus als Medicus der Menscheit siehe Martin Honecker: Christus medicus. In: Der kranke Mensch in Mittelalter und Renaissance. Hg. von Peter Wunderli. Düsseldorf 1986 (Studia humaniora 5), S. 27–43. 47 Johann Christoph Ettner: Deß Getreuen Eckharts unwrdiger DOCTOR […] Augsburg, Leipzig 1697, S. 10–13. Siegfried erinnert sich, „in Simplicio von einen Stein/ den er von dem erdichteten Wasser=Knige/ in Centro Terrae empfangen/ gelesen zu haben“ (ebd. S. 11). Zu Ettners Grimmelshausen-Rezeption vgl. Heßelmann: Simplicissimus Redivivus (Anm. 28), S. 178–186, zur Mummelsee-Thematik ebd. S. 180 f., sowie Peter Heßelmann: Zur Rezeptionsgeschichte Grimmelshausens im Spätbarock: Das Werk Johann Christoph Ettners. In: Simpliciana 12 (1990), S. 229–266. Doms (Anm. 6), S. 134 f. weist darauf hin, dass bereits Grimmelshausens MummelseeEpisode selbst paracelsische und säftemedizinische Positionen kombiniere. 48 EM 179. Michael Lorber: Alchemie, ‚Elias artista‘ und die Machbarkeit von Wissen in der Frühen Neuzeit. In: Natur – Religion – Medien. Transformationen frühneuzeitlichen Wissens. Hg. von Thorsten Burkard u. a. Berlin 2013 (Diskursivierung von Wissen in der frühen Neuzeit 2),
Medizinisches Wissen und die Funktion pikaresken Erzählens
293
Auch wenn der argumentative Status paracelsischer Wissenskomponenten zwischen akademischer und heterodoxer Medizin in Ettners Romanen hier nicht eingehender rekonstruiert werden kann, ist festzuhalten, dass vordergründige Wissenskonkurrenz der Wissensdiätetik einer literarischen ‚Scheidekunst‘ weicht,49 die in langwierigen Reisen und klärenden Gesprächen die gute von der schlechten Medizin, die echten von den falschen Ärzten, deren gute Anlagen von den schlechten zu trennen versucht. Darüber hinaus mag die Offenheit Eckarths gegenüber paracelsischen Positionen verkappten theologischen und christologischen Diskursresten geschuldet sein, die sich auch an anderen Textstellen als Indizien einer unvollständigen Säkularisierung und Verwissenschaftlichung erweisen. Körperliche Krankheiten werden zwar kaum mehr als Zeichen des ‚Bösen‘ und der ‚Sünde‘ verstanden, moralische Verfehlungen – etwa der Quacksalber – aber gleichwohl als ‚Krankheiten‘ des Gesellschaftskörpers konnotiert, den es durch ‚Wissen‘ zu heilen und zu erlösen gilt.50 Und der Wirkungspoetik des ‚entlarvenden‘ Schriftsteller-Arztes mag außerdem eine implizit magische Grundierung allemal entgegenkommen, die – wie van Helmont – die pathogene Macht falscher Bilder und Vorstellungen (‚Larven‘) durch die stärkere heilende Macht des Wortes einzudämmen verspricht.51 Dass gerade die Konfrontation mit dem volksmedizinischen, vielfach auf Analogiezauber beruhenden Wissensbehauptungen der Quacksalber der Absicherung und Rekapitulation des akademischen Wissens dient, kann also nicht darüber hinwegtäuschen, wie fließend auch die Grenzen dieses Wissens selbst nach wie vor sind. Des ‚getreuen Eckarths‘ Umgang mit popularisierten Elemen-
S. 87–113, unterstreicht die selbst schon ambivalente epistemologische Position der Alchemie des Paracelsus, die zum einen zur „Protogeschichte der frühneuzeitlichen Experimentalkultur“ (S. 111) beiträgt und zum anderen nach wie vor als christliches, „heilsgeschichtliches Remedium“ (S. 91, dort kursiviert) verstanden wird. 49 Vgl. Ettner: Rosetum (Anm. 33). Gmelin (Anm. 5), der Ettner einseitig den Alchemie-Gegnern zuschlägt, subsumiert dennoch im selben Kapitel das Rosetum chymicum eines „Hans Chn. von Etner“ [sic!] (S. 323) unter die „mystischen“ und „theosophischen“ Schriften der Alchemie (S. 319). 50 Vgl. Gotthardt Frühsorge: Der politische Körper. Zum Begriff des Politischen im 17. Jahrhundert und in den Romanen Christian Weises. Stuttgart 1974. 51 Vgl. van Helmont (Anm. 45), S. 3–79, bes. S. 7 zur negativen Wirkung „frembde[r] Bilder und Larven“, die der Mensch „in sich abmahlet“, und S. 35 zur „Krafft“ der Worte, die „den entstellten und tobenden Lebens=Geist wieder in Ordnung bringen knnen“. Bereits Benzenhöfer (Anm. 3), S. 298 weist auf die „kaum bedachte theologische Dimension der Romane“ hin; s. darüber hinaus Volkhard Wels: Die Tradierung alchemischen Wissens bei Michael Maier, Andreas Libavius und Oswald Croll. In: Burkard u. a. (Anm. 48), S. 63–85, der an die „Transformation“ der „alchemischen Arkansprache“ zum „Stilmittel“ einer Poesie erinnert, die wiederum als Medium einer „sinnlich vermittelten Offenbarung Gottes“ und der Natur fungiert (ebd., S. 85).
294
Claus-Michael Ort
ten paracelsischen Wissens und mit dem besserungsfähigen Teil der Kurpfuscher belegt dies ebenso wie die Paradoxie, dass das ungesichert ‚prekäre‘ Wissen52 pikarischer Wissensträger gerade im Moment seiner innerdiegetisch inszenierten Disziplinierung oder Tilgung zum Gegenstand der Erkenntnis und des Erzählens wird und rudimentärer Verschriftung unterliegt.
3 Pikareskes Erzählen als Mittel sozialer Disziplinierung Ein zurückhaltend religiös, aber nicht konfessionell eingefärbter, moralisierender Blick gilt im Marcktschreyer gerade der nicht-sesshaften und dörflichen Unterschicht und insbesondere dem eigentlichen Beobachtungs- und Therapieobjekt der Reisenden, nämlich den männlichen und weiblichen, sesshaften wie fahrenden Marktschreiern, falschen Ärzten und Quacksalbern und ihren Adressaten, die wiederum durch Eckarth von Trug und Gaunerei ‚erlöst‘ werden sollen. Die „Erklrung Des Kupfferblats“ zum Entlarvten Marcktschreyer lässt an der volkspädagogisch aufklärerischen Absicht des entlarvenden ‚getreuen Eckarth‘ keinen Zweifel: So wird der Frevler List die Krancken nicht mehr plagen. Weil ein zu helles Licht uns Eckarth auffgesteckt. Wer nun sich ffen lst den darff man nicht beklagen Denn der Marckschreyer [sic!] ist entlarvet und endeckt [sic!].53
Die Metaphorik des nachäffenden Affen, den das Titelkupfer hinter der Maske des seriösen Arztes zutage fördert, weicht von der Etymologie des ‚Maulaffen‘ ab, die laut Adelungs Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart den staunenden und betrogenen Rezipienten meint, „welcher aus dummer Verwunderung das Maul auf oder offen hat“54 und dessen Leichtgläubigkeit bei Ettner durch die Enttarnung des äffenden Imitators gerade kuriert werden soll. Dies erfolgt allerdings im
52 Im Sinne von Martin Mulsow: Prekäres Wissen. Eine andere Ideengeschichte der Frühen Neuzeit. Berlin 2012, S. 11–36. 53 EM )(2; vgl. auch den Schluss der „Vorrede | An den Leser“ ebd., ohne Paginierung [S. )(7v]: Es „ist bey dieser Zeit hchstnthig/ denen Leuten zu weisen/ was ein von GOtt erwehlter Medicus und hergegen ein Landstreicher Pvels-Doctor, der andern als ein Affe nachahmet/ und Schaden verursachet/ sey“. 54 Johann Christoph Adelung: Grammatisch-kritisches Wrterbuch der Hochdeutschen Mundart, mit bestndiger Vergleichung der brigen Mundarten, besonders aber der Oberdeutschen […]. Dritter Theil, von M–Ser. Wien 1811, Lemma „Der Maulaffe“, S. 118 f., hier S. 119.
Medizinisches Wissen und die Funktion pikaresken Erzählens
295
selben theatralen Medium, also auf demselben Schauplatz, den auch der Quacksalber für sich beansprucht (Abb. 2).55 Selber als akademische ‚Vaganten‘ unterwegs, folgen Eckarth und seine Begleiter wie Naturforscher oder botanisierende Sammler als missionarische Verkünder der Wahrheit und Inquisitoren im Dienste der öffentlichen Wohlfahrt (‚policey‘) den Spuren von Quacksalbern und freuen sich über jedes weitere Exemplar, das es als Exempel „aufzunotiren“56, zu klassifizieren und zu etikettieren, zugleich aber auch zu examinieren und zu verhören, zu erziehen, zu bekehren oder zu vertreiben, zu bestrafen, hinzurichten und sogar eigenhändig zu töten, vielleicht aber auch nur mitleidig zu tolerieren gilt – und zwar auf einer kasuistischen Schädlichkeits-Skala vom harmlosen Komödianten, Taschenspieler, Hausierer oder Bader über den besserungsfähigen, nur aus Not zum Pseudopícaro gewordenen Quacksalber und Hochstapler bis hin zur rettungslos verworfenen, an Grimmelshausens Courasche erinnernden „Ertz=Vettel“ und „Canalie“57 und zum kriminellen „Schelm […] Mordbrenner […] Galgen=Vogel […] Spitzbube[n]“ (EM 412), der wie die Amme als Kindsmörderin dem Scharfrichter anheimfällt:58 „Was! sprach der General/ hat denn der Herr Bruder gewisse Ordnungen solcher Umstreicher? […] wir [haben uns] auff dieser Reise […] vorgenommen/ die Medizinischen Maul=Affen auffzunotiren […]“ (EM 305). Das zugrunde liegende Handlungsmuster der ‚soziomoralischen Recherche‘59 ist aus Christian Weises musterbildendem Roman Die drey ärgsten Ertz-Narren (1672) und Johannes Riemers Der Politische Maul-Affe (1680) bekannt: Weises Florindo wird eine Reise in die „Welt“ empfohlen, um die abzumalenden
55 Titelkupfer der Ausgabe von 1720; vgl. Hardin (Anm. 1), S. 67. 56 EM 172; ähnlich S. 225 f., wo aus Zeitgründen darauf verzichtet wird, auch den „Juristischen Maul=Affen der Welt vorzuzeigen“ (S. 226) und zu demaskieren. 57 EM 136 f., hier S. 137; die „Ertz=Bubinne“, „Feld=Hure/ oder […] verdorbene Marquetennerin“ vermag „auch aus der Gauckeltasche spielen“ (ebd., S. 136). 58 EM 409–414; vgl. bereits Arnold Hirsch: Bürgertum und Barock im deutschen Roman. Eine Untersuchung über die Entstehung des modernen Weltbildes. Frankfurt am Main 1934, der die „Verbürgerlichung des Pikaro“ (ebd., S. 22–44) an seiner Kriminalisierung abliest (ebd., S. 27– 44, zu Pícaro-Figuren als Rechtssubjekte und Verbrecher oder ‚Dirnen‘), zu Ettners MaulaffenRomanen vgl. ebd., S. 128–130. 59 Zur ‚soziomoralischen Recherche‘ als Thema der ‚Politischen Romane‘ vgl. Andrea Wicke: Die Politischen Romane, eine populäre Gattung des 17. Jahrhunderts. ‚Was die Politica ist/ das wollen itzt auch die Kinder wissen‘. Diss. Frankfurt am Main 2012, S. 457–493; zu Ettners Romanen ebd., S. 440–444; vgl. auch Andrea Wicke: Literarische Moden um 1700. Zum historischen Wandel populärer Lesestoffe. In: ‚Delectatio‘. Unterhaltung und Vergnügen zwischen Grimmelshausen und Schnabel. Hg. von Franz M. Eybl und Irmgard M. Wirtz. Bern 2009, S. 27–50.
296
Claus-Michael Ort
Abb. 2: Johann Christoph Ettner: Des getreuen Eckarths Medicinischer Maul=Affe/ Oder der Entlarvte Marckt=Schreyer. […] Frankfurt am Main, Leipzig 1720, Titelkupfer
Medizinisches Wissen und die Funktion pikaresken Erzählens
297
drei größten Narren zu finden und „in Betrachtung vielfltiger Narren/ desto verstndiger“60 zu werden. Die Compagnie – „der Narren Inquisition mde“ – beendet ihre Reise nach der Lektüre einer gelehrten „Resolution“61 zur Frage nach dem größten Narren, und Riemers Studententruppe um Philurt und Tamiro katalogisiert und entlarvt auf ihrer selbsterzieherisch erfolgreichen tour d’horizon und „inqvisition der Politischen Maul=Affen“ die ‚Eingebildeten‘ aller Berufe und Stände.62 Fast scheint es, als habe Ettner in der „Vorrede | An den Leser“ trotz oder gerade wegen seiner eigenen Grimmelshausen-Bezüge auch noch Weises Distanzierung von pikarischen Gattungsmustern und dessen Kritik an Grimmelshausens Simplicissimus als „Saalbader“63 kopiert, wenn er wiederum Unmoral, Leserbetrug und „rgerliche Possen/ Narrentheidigungen und Zoten“64 kritisiert und auch die späteren Werke des „grundgelehrte[n] Mann[es]/ der den Politischen Maulaffen der Welt vorgezeiget“65 davon nicht ausnimmt – obwohl es gerade Riemers Die politische Colica, oder das Reissen im Leibe (1681) ist, worin der Arzt Eurilus bei der Suche nach den eigentlichen Krankheitsursachen auf deren gesellschaftliche Bedingtheit stößt und der Arzt in der Vorrede nicht nur zum ‚politicus‘, sondern dieser umgekehrt zum galenischen ‚Arzt‘ des ‚Gesellschaftskörpers‘ metaphorisiert wird: „Es ist nichts neues/ daß Welt=kluge und Politische Leute die Republiqven/ Gleichnisweiß:/ corpora nennen […].“66 Mit einer „richtige[n] Diæt“ der „Gaben und Beschwerungen“ und einem „leidliche[n] temperament der Gesetze“67 könnten die Herrschenden die „Laster“ der Untertanen, „welche dem
60 Christian Weise: Die drey rgsten Ertz-Narren […]. Leipzig 1673. In: Christian Weise: Sämtliche Werke. Hg. von Hans-Gert Roloff. Bd. 17, bearb. von Hans-Gert Roloff und Gerd-Hermann Susen. Berlin, New York 2006 (Ausgaben deutscher Literatur des XV. bis XVII. Jahrhunderts 164), S. 57– 296, hier S. 67. 61 Ebd., S. 290. 62 Johannes Riemer: Der Politische Maul-Affe. Leipzig 1680 (Nachdruck Hildesheim, New York 1979), S. 86, siehe auch S. 91: „nun berlegten Sie […] in was vor Ordnung sie dieselben [die Politischen Maul-Affen] zu Papier bringen wolten.“ 63 Weise: Ertz-Narren (Anm. 60), S. 61: „Es siehet nrrisch aus/ und wer es obenhin betrachtet/ der meint/ es sey ein neuer Simplicissimus oder sonst ein lederner Saalbader wieder auffgestanden.“ 64 EM )(5. 65 EM, ohne Paginierung [S. )(6]; Ettner schreibt den Politischen Maul-Affen irrtümlich Weise zu. 66 Johannes Riemer: Die Politische Colica/ oder das Reissen im Leibe Der Schulkrancken Menschen welche in mancherley zustnden ohne Leibes Schmertzen zu Bette liegen/ Niemanden sonst als Hohen und Gelehrten Leuten zur belustigung vorgestellet durch A. B. C. Leipzig 1681, S. 1. 67 Ebd., S. 1 f.
298
Claus-Michael Ort
Regiment schaden/ von ihnen“ abtreiben, „nicht anders als wie die bsen Feuchtigkeiten aus dem menschlichen Leibe“.68 Umgekehrt dient der ‚Quacksalber‘ als Metapher für jegliche Beutelschneider, Hochstapler und Ignoranten, so noch in Johann Kuhnaus Musicalischem Quacksalber (1700), wo die Probe der Musici zunächst vom Auftritt eines Quacksalbers unterbrochen wird und sie zu Zeugen von dessen Kampf gegen eine ‚Zahnbrecherin‘ werden,69 bevor sie die beiden zum „Gleichniß“70 generalisieren: Es giebt auch Leute/ welche den Nahmen eines Qvacksalbers verdienen/ ob sie gleich keine Salbe oder Pulver zuzurichten wissen. Wenn sie nur sonsten eine Handthierung vor sich nehmen/ dabey sie den Leuten eine blaue Dunst vor die Nase machen/ und ihnen und ihrer Betriegerey das Geld aus den Beutel ziehen/ und diese knnen Politische Qvack=Salber heissen. […]: Auff solche Weise […] kan man auch die Ignoranten in der Music […] musicalische Qvaksalber nennen.71
Die moralischen Kosten einer metaphorischen Übergeneralisierung der Körper-, Krankheits-, Arzt- und Quacksalber-Semantik führt übrigens schon Christian Weises Schulkomödie Der Politische Quacksalber (1684) vor Augen, wo zwar ein ‚wirklicher‘ falscher Arzt vor den „medicinische[n] Richter“72 Aesculapio „im Medicinischen Parnass“73 geladen wird, die ausgesandte Gutachterkommission jedoch über eine solche Fülle von Exempeln für die allgegenwärtige, nicht nur medizinische Quacksalberei berichtet, dass angesichts der politischen Krankheit des gesamten ‚Leibes‘ jegliche „Politische Artzney“74 für jedes einzelne „Glied“75 wirkungslos bleiben muss, Aesculapios Gericht also auch für den anstehenden Einzelfall keinen Urteilsspruch zu fällen in der Lage ist: Solange die „Welt […] voller Quacksalber“ sei, bleibe der Beklagte „doch mit der Straffe […] verschonet […]/ biß der Ausgang erfolget/ wie hoch man das allgemeine Laster verdammen“
68 Ebd., S. 2. 69 Johann Kuhnau: Der Musicalische Qvack=Salber/ nicht alleine denen verstndigen Liebhabern der Music/ sondern auch allen andern/ welche in dieser Kunst keine sonderbahre Wissenschafft haben. Jn einer kurtzweiligen und angenehmen Historie zur Lust und Ergetzligkeit beschrieben […]. Dresden 1700, S. 24–42. 70 Ebd., S. 525. 71 Ebd., S. 42 f. 72 Christian Weise: Der Politische Qvacksalber In einem Lustigen Spiele vorgestellet [1684; Erstdruck 1693]. In: Christian Weise: Sämtliche Werke. Hg. von John D. Lindberg. Bd. 12,1. Berlin, New York 1986 (Ausgaben deutscher Literatur des XV. bis XVII. Jahrhunderts 116), S. 1–230, hier S. 220. 73 Ebd., S. 5. 74 Ebd., S. 8. 75 Ebd., S. 221.
Medizinisches Wissen und die Funktion pikaresken Erzählens
299
solle.76 Die innerweltlich richtenden und strafenden Instanzen kapitulieren vor dem Zustand der Welt und scheinen jegliches moralisches Urteil bis zum Jüngsten Tag aufzuschieben.77 Dem vermeintlichen Moraldefizit des bloß diagnostizierenden und die Diagnose schon als satirische ‚Therapie‘ ausgebenden, selbst also ‚trügerischen‘, weil nur metaphorischen ‚Arztes‘ der Laster einer eitlen, sündhaften Welt versucht Ettner durch professionelle Ent-Metaphorisierung und Wissensvermittlung zu begegnen. Nicht um satirische Überzeichnung und metaphorische Generalisierung der Arzt- und Quacksalber-Semantik als Mittel umfassender Gesellschaftskritik geht es Ettner also, sondern um ernsthafte Sozialprognosen und ‚Therapie‘ von nicht-metaphorischen Medizinern an nicht-metaphorischen Quacksalbern. Und wenn sich Eckarth die biografischen Anamnesen der Betrüger erzählen lässt, dann versucht er, in die simplicianisch anmutenden, retrospektiven Binnenerzählungen einzugreifen und sie nach Möglichkeit abzuschließen, pikarische Lebensläufe also um die im pikaresken Erzählen vorgesehene, ex post reumütige und moralisierende Selbsterkenntnis zu ergänzen. Die finale moralische Selbstbekehrung des devianten Pícaro wird bei Ettner jedoch durch zwei Optionen ersetzt: Entweder gelingt die soziale Disziplinierung mithilfe von Eckarths prophylaktischer oder bereits strafender Intervention oder es droht die endgültige Pathologisierung, Kriminalisierung und entehrende Bestrafung der Ausgestoßenen. Die Binnen-Lebensgeschichten werden in beiden Varianten von Eckarth als Fallgeschichten zum Abschluss gebracht und ‚normalisiert‘.78 Bei negativem Ausgang greift die Strafjustiz zu und beendet die physische oder zumindest soziale Existenz der Quacksalber, im Falle eines guten Verlaufes endet die erzählenswerte, wenn nicht abenteuerliche, so doch normabweichende und literaturfähige Karriere des Quacksalbers ebenfalls. Gleich der erste ‚Maul-Affe‘ im Zigeunerhabit und mit Meerkatze erweist sich als besserungsfähiger Pícaro, nämlich als die ‚teutsche‘ Halbwaise Friedrich, die
76 Ebd., S. 45; vgl. auch S. 201 f. 77 Zu Weises Politischem Quacksalber vgl. Claus-Michael Ort: Medienwechsel und Selbstreferenz. Christian Weise und die literarische Epistemologie des späten 17. Jahrhunderts. Tübingen 2003 (Studien und Texte zur Sozialgeschichte der Literatur 93), S. 82–86 und 180– 182; zur „Krise allegorischer Bedeutungskonstitution“ in Weises Schuldramen ebd. S. 167–192, zur Durchkreuzung „hierarchisierender Rahmung“ durch Temporalisierung und Linearität ebd. S. 183; vgl. außerdem Wolfgang U. Eckart: Anmerkungen zur „Medicus Politicus“- und „Machiavellus Medicus“-Literatur des 17. und 18. Jahrhunderts. In: Benzenhöfer/Kühlmann (Anm. 3), S. 114–130. 78 Durchaus bereits im Sinne von Jürgen Link: Versuch über den Normalismus. Wie Normalität produziert wird. Opladen 1997; vgl. ebd. S. 371–373 über das Konstrukt der „Normalbiographie“ und S. 387–394 über „Geständnisliteratur“.
300
Claus-Michael Ort
bei einem Goldmacher in die Lehre geht, schwedischen Werbern entrinnt und sich reumütig der Obhut Eckarths anvertraut, welcher Friedrich in der Garnison unterbringt und das ‚Unkraut‘ vom ‚Weizen‘ trennt. Eckarths quasi-emblematische subscriptio zieht die sentenzenhafte conclusio aus diesem bald abgeschlossenen ‚Fall‘: „Sehet meine lieben Shne/ welcher gestalt lderliche Eltern ihren Kindern gleiche Laster einpflantzen/ doch findet sich bey diesem Unkraut noch ein eingemengter Weitzen. So GOtt will/ werde ich ihm morgen besser als heute geschehen/ auf den Zahn fühlen.“79 Auch in Grimmelshausens Simplicissimus Teutsch (1668) bleibt die aus der Not geborene Quacksalbertätigkeit des Simplicius (IV,8) nur eine kurze Episode, gerät er doch bereits im neunten Kapitel als „Doctor“80 in Gefangenschaft und gesteht sein früheres Soldatenleben, das er wider Willen erneut aufzunehmen gezwungen ist. Anders verhält sich der Fall des von Eckarth als Reisebegleiter engagierten Leinweber-Gesellen Andreas Lichtvogel, der sich, um Soldatenwerbern zu entgehen, bei einem akademischen, aber marktschreierisch umherziehenden Arzt als „Pickelhring“ (EM 180) verdingt hatte und in dessen Diensten sowohl solide medizinische Kenntnisse als auch Einblicke in das QuacksalberUnwesen gewinnen konnte, nun aber mit der richtigen, mit Eckarths Truppe reist. Besonders erfolgreich ist der Stoffsucher Eckarth auf seiner Jagd nach Lebenserzählungen im Falle des mimisch bereits nicht mehr ‚verlarvten‘, weil unverstellt melancholischen und zu einer pikaresk selbstreflexiven Rückblickserzählung bereiten Rusilio („betrbte Minen“, „Monsieur wie so traurig […]?“81), der – wie der Affektdiagnostiker Eckarth richtig vermutet – „den Verlauf seines Lebens auf Begehren williglich erzehlen würde“ (EM 445). Die in Teilen simplicianisch anmutende Geschichte des verstoßenen, seine leiblichen Eltern suchenden Ziehsohnes, der die Unsicherheit über den „Weg zu meinem Glck oder Unglck“ mithilfe von Weidenblättern auszulosen versucht (EM 447), der zunächst bei einem Pfarrherrn, welcher ihn zur pharmazeutischen „Artzney=Kunst“ (EM 453) verleitet, nach dessen Tod bei einem akademischen Medico unterkommt und sich auf ausgedehnten Reisen aus Not auch „Comdianten“ (EM 457) anschließt, nimmt nach acht Jahren Ehe jedoch eine negative Wendung, als er Frau und Kind mit vierhundert Reichstalern in Kolberg zurücklässt, um in Italien eine bessere Lebensgrundlage für seine Familie zu finden (EM 459). Dem inzwischen verwit-
79 EM 106; seine endgültige Besserung und Disziplinierung durch Eckarth, seinen ersten „Frderer“ nach Gott, erfolgt ebd. S. 115. 80 Hans Jacob Christoffel von Grimmelshausen: Der abentheurliche Simplicissimus Teutsch. In: Ders.: Werke I,1. Hg. von Dieter Breuer. Frankfurt am Main 2005 (Bibliothek deutscher Klassiker 44; Bibliothek der Frühen Neuzeit 4/1), S. 9–551, hier S. 381. 81 EM 444–475, hier S. 444.
Medizinisches Wissen und die Funktion pikaresken Erzählens
301
weten und unter die Räuber gefallenen Rusilio bleibt am Ende nur, die finanzielle Unterstützung des ‚göttlichen‘ Eckarth anzunehmen und den Verlust seiner Rührungstränen mit einem Glas Wein zu kompensieren (EM 461 f.). Als Rusilio Eckarths Reisegesellschaft zu einer Einladung bei Fürst Felsensatz begleitet und dessen Unterstützung aufgrund seiner medizinischen Kenntnisse und Ratschläge gewinnt, entpuppt er sich überdies als kundiger Leser der Bücher „D. Etners“82 und verweist nicht nur auf van Helmont, sondern auch auf ein „gewisses Büchlein/ der entlauffene Chymicus genant“ (EM 468). Nicht nur Eckarth, sondern auch eine rechtzeitige Lektüre der nützlichen Romane Ettners, in deren Diegese sich Rusilio selbst als ihr metaleptischer Leser befindet, bewahrt Rusilio also vor der Fortsetzung seines sich bereits abzeichnenden, pikarisch-simplicianischen Lebenslaufes. Positiv bewertet wird darüber hinaus auch eine Spielart des Quacksalbers als ‚kluger‘ Possenreißer und satirischer Künstler, der sein Rollenspiel selbst als trügerisch entlarvt und in Gesangsnummern öffentlich reflektiert: Wer will unter Menschen leben/ Muß nicht tumm und albern seyn./ […] Ich kan gut das Land durchstreichen/ An betrgen fehlt mirs nicht./ Ich weiß knstlich durch zu schleichen/ Wann das Garn auff mich gericht/ So so muß ein Land=Arzt seyn/ Der da was will sammlen ein. […] So wird unsere Kunst versteckt/ Die sonst bliebe unverdeckt. (EM 480–482)
Auch die Beschreibung seiner ‚Artzeneyen‘ wird nur törichte ‚Maul-Affen‘ zum Kauf verleiten und für ihre Dummheit zu Recht bestrafen: ich habe eine Salbe bey mir […] welche die Klugen nrrisch und die Albern rasend macht. Hernach besitze ich ein Pulver/ welches niemanden Ungelegenheit machet/ er sey denn kranck/ denen Gesunden schadet es nicht. Ferner gebe ich Pillen aus/ die denen Leuten das Geld aus dem Beutel purgieren. (EM 477)
82 EM 467; vgl. auch Ettner: Doctor (Anm. 47), S. 957, wo Rusilio den Reisenden „D. Etners Beschreibung der Pest“ mit Anhängen als Lesepensum überlässt, vgl. auch ebd., S. 953, 956–958.
302
Claus-Michael Ort
Seine Auftritte beförderten laut Eckarth die Einsicht der Zuschauer in ihre eigene Leichtgläubigkeit und Dummheit, womit „Scheerschmidt der Landstrtzer“ (EM 477) allerdings den Zielen der ‚entlarvenden‘ Reisegruppe bedenklich nahekommt. So kommentiert und interpretiert Eckarth seinerseits den Auftritt Scheerschmidts öffentlich, wendet sich an dieselbe Zuhörerschaft wie der „Plauderer“ (EM 479) und konkurriert mit ihm um die Aufmerksamkeit des Publikums: dieser Mensch redet die Warheit/ welche die Hrenden nicht hren/ noch die Sehenden und Fhlenden sehen noch fhlen können/ der Kerl ist ein Muster eines Bildes welches unter einer Figur zweyerley Gestalten Præsentiret, und niemand erkennet dieselben/ als nur ein Kluger. (EM 479)83
Zugleich wird damit auch ein implizites Problem deutlich: Wenn sich nämlich der hoch reflektierte Gaukler lustvoll selbst entlarvt, was offenkundig auch der Selbsterkenntnis seiner Rezipienten dient und sie zur Skepsis erzieht, Trug mithin als Mittel der Wahrheitsfindung fungiert, dann werden die Grenzen zwischen kriminellem und künstlerischem Handeln, zwischen legitimem divertissement und Betrug fließend, und der Unterschied zwischen reflexionsfähigen Quacksalbern und dem ‚treuen‘ Eckarth verschwimmt. Auch dieser neckt seine Freunde anfangs in der Maske eines Marktschreiers (EM 54), und sein Leben verläuft zunächst alles andere als musterhaft – vom sich duellierenden und relegierten Medizinstudenten und Soldaten zum Reisebegleiter und Arznei-Verkäufer in eigener Sache. Mülard gibt denn auch den Anstoß zum endgültigen Rollen- und Seitenwechsel Eckarths, der seine gesellig komödiantischen Fähigkeiten auf der bevorstehenden Entlarvungsreise für Lockvogel-Tricks zu nutzen versteht: „Die Comdie eines Medicinischen MaulAffens hastu lange genung gespielet/ wir mssen den Marckschreyer [sic!] und Quacksalber entlarven“ (EM 58). Die Grenzziehung zwischen dem „von GOtt erwehlten Medicus“ und dem „Landstreicher Pvels-Doctor, der andern als ein Affe nachahmet“,84 bedarf in der Tat ausdrücklicher Bestätigung und erinnert an die forcierte Selbstdistanzierung von literarischen – pikarischen – ‚Narrenpossen‘, denen aber gerade der Roman als Mittel medizinischer Wissensvermittlung einiges verdankt. Letztlich unterliegt der ‚medizinische‘ Roman nach wie vor einem Fiktions- und Unzu-
83 Simplicissimus äußert als Gaukeltaschen-Künstler: „[I]hr Herren ich bin kein Schreyer/ kein Storger/ kein Quacksalber/ kein Artzt/ sonder ein Knstler! ich kan zwar nit hexen/ aber meine Knste seynd so wunderbarlich/ daß sie von vilen vor Zauberey gehalten werden; daß aber solches nit wahr sey/ sonder alles natrlicher weis zugehe/ ist aus gegenwertigem Buche zuersehen […]“ (Grimmelshausen: Springinsfeld [Anm. 24], S. 195). Diesen Kunstvorbehalt gesteht Eckarth auch Scheerschmidt zu. 84 EM, „Vorrede | An den Leser“, ohne Paginierung [S. )(7v].
Medizinisches Wissen und die Funktion pikaresken Erzählens
303
verlässigkeitsverdacht, der ihn mit seinem Gegenstand – den Quacksalbern auf ihrer ‚Bühne‘ – verbindet.85 Trotz säkular rationalisierender Argumentation, trotz professionell verfachlichender, belehrender Rhetorik des ‚getreuen‘ Eckarth und seiner Mitstreiter haftet ihnen zumal in den ersten Romanen durchaus noch das von pikaresken Erzählformaten importierte Glaubwürdigkeitsproblem an.
4 Das Problem fiktionaler Wissensvalidierung: Vom finalen theatrum der Entlarvung zum infiniten Buch In Eckarths Vorrede zum Marcktschreyer steigert sich die Abwertung fiktionalisierender Täuscher und Rollensimulanten nachgerade zu einer Angst vor Nachahmung, Kopie und aemulatio, die sich auf die eigene Publikation ausweitet – „will auch dergleichen knfftige Nachahmung vor mein Werck nicht erkennen/ wuste auch nicht worzu es nthig“86 – und nicht nur auf ein poetologisches Legitimationsproblem verweist, sondern auch auf ein epistemisches: Die von Eckarth beschworene „eigene Erfahrung“ als Wissensquelle bewahre sein singuläres Werk zwar vor topischer imitatio – „Aus Büchern habe ich wenig oder nichts geklaubet/ sondern aus eigener Erfahrung dir zu frommen und besten geschrieben/ […]“87 –, beschert ihm aber implizit zugleich das Problem seiner Unabschließbarkeit: indem in diesen und denen andern Abtheilungen nicht allein alle und iede Kranckheiten und Zuflle/ und die auf sie gerichtete gewisse Mittel und Artzneyen/ allerhand rare Medicinische und Chimische/ wie auch Chirurgische Observationes und Anmerckungen/ und was einen Medicum und Hlffbegierigen in seiner Praxi glckseelig berhmbt und vergngen knne/ vorgewiesen; daß ich zweiffele! Es werde etwas mangeln/ daß denselben nicht einverleibet sey/ […].88
85 Zur „Kombination von Medizin und Theater“ vgl. M. A. Katritzky: Quacksalber in den Schriften Christian Weises und Johann Kuhnaus: ‚Der Politische Quacksalber‘ (1693) und ‚Der Musicalische Qvack=salber (1700). In: Poet und Praeceptor. Christian Weise (1642–1708) zum 300. Todestag. 2. Internationales Christian-Weise-Symposium 21.–24. Oktober 2008 in Zittau. Tagungsband. Hg. von Peter Hesse. Dresden 2009, S. 319–340, hier S. 320, sowie schon Katrin Kröll: „Kurier die Leut auf meine Art…“ Jahrmarktskünste und Medizin auf den Messen des 16. und 17. Jahrhunderts. In: Benzenhöfer/Kühlmann (Anm. 3), S. 155–186. 86 EM, „Vorrede | An den Leser“, ohne Pag. [S. )(6r]. 87 Ebd., [S. )(7r]. 88 Ebd., [S. )(6r]f.
304
Claus-Michael Ort
Dass immer stärker anschwellende, wissensgesättigte Reiseromane ‚Wahrheit‘ für sich reklamieren, deren Figuren sich der erzieherischen Enthüllung der Wahrheit verschreiben, sich aber bei der Enttarnung von Lug und Trug ähnlicher Täuschungsmanöver und Fiktionalisierungsstrategien bedienen wie die zu entlarvenden und zu erziehenden Gaukler und Kurpfuscher, erweist sich als kaum verhüllter Selbstwiderspruch. Der Anspruch, Fachwissen narrativ zu vermitteln, lässt sich, so ist anlässlich Ettners zu vermuten, noch nicht problemlos in erfolgreiche literarische Legitimierungs- und Geltungsansprüche ummünzen; beide durchkreuzen einander, wie der – nicht nur paratextuelle – poetologische Reflexionsaufwand schon im ersten Roman ahnen lässt. Auch Ettners Narration sieht sich mit dem gattungsspezifischen Dignitätsproblem von Romanen als Vermittler wissenschaftlichen Erfahrungswissens konfrontiert: Die literarischen Mittel der Wissensvermittlung partizipieren nicht so sehr am Glaubwürdigkeitsvorschuss der Wissenschaft, sondern drohen vielmehr letzteren zu desavouieren. Gotthard Heideggers Mythoscopia Romantica (1698) attestiert der Gattung ‚Roman‘ bekanntlich „Zunder der Affecten/ und Reitzer der Gottlosigkeit“ zu sein89 und beklagt ein „ohnendlich Meer“ von Romanen90 und die zunehmende Lesewut: Was seien Romane „vil anders/ alß in loser Sprach beschribne Comædien?“91 Und noch 1726 erblickt z. B. Johann Georg Fichtner in seiner Altdorfer juristischen Dissertation „in schertz=hafftigen Erzehlungen“ der „Schalcks=Narren; alias dicuntur Possenreisser, Schwnkmacher“ den Grund allen moralischen Übels.92 Wie kann sich also der prodesse-Kern – Wissensvermittlung und Moraldidaxe – gegen die romanhafte Schale des delectare durchsetzen, ohne dass beide wie im wissenschaftlichen Traktat zusammenfallen oder wie im Roman die Schale den Kern zu verfälschen droht?93 Ettner bedient sich zur Lösung dieses Problems selbstreferenzieller, implizit zirkulärer Beglaubigungsstrategien: So integriert er pflichtethische
89 Gotthard Heidegger: Mythoscopia Romantica oder Discours von den so benanten Romans. Faksimileausgabe nach dem Originaldruck von 1698. Hg. von Walter Ernst Schäfer. Bad Homburg, Berlin, Zürich 1969 (Ars poetica. Texte 3), S. 106; ähnlich S. 112. 90 Ebd., S. 13. 91 Ebd., S. 19. 92 Johann Georg Fichtner: Parvi fvres svspendvntvr, magni dimittvntvr, vel in crvmena pvnivntvr, sive marsvpio recondvntvr. Kleine Diebe hngt man, die großen lßt man lauffen, oder strafft man im Beutel. [Resp.:] Johann Daniel Geibel. Altdorf 1726, S. 115 f. 93 Vgl. auch Holger Dainat: ‚Relationes Curiosae‘ oder ,Merkwürdige Seltsamkeiten‘. Frühe Kriminalgeschichten aus Hamburg. In: Recht und Moral. Zur gesellschaftlichen Selbstverständigung über „Verbrechen“ vom 17. bis zum 21. Jahrhundert. Hg. von Hans-Edwin Friedrich und Claus-Michael Ort. Berlin 2015 (Schriften zur Literaturwissenschaft 39), S. 193–216, der anlässlich von Eberhard Werner Happels Relationes Curiosae (1693–1690) ein ähnliches ‚Erzählproblem‘ diagnostiziert (S. 214: „Die moralisatio verdeckt ein Erzählproblem.“).
Medizinisches Wissen und die Funktion pikaresken Erzählens
305
Digressionen in seine Romane, in denen durchnummerierte Ge- und Verbote eines ärztlichen Tugend- und Lasterkatalogs vermittelt werden, die am Ende jeweils ein gesonderter Anhang nochmals rekapituliert; auch im Unwürdigen Doctor rezipieren die Figuren selbst den angehängten Paratext, der jedoch zu paradoxer metaleptischer Selbstinklusion tendiert und die Handlung fortsetzt.94 Entgegen dem immer wieder von Eckarth behaupteten Erfahrungsgehalt wird also auch Lesererziehung betrieben, und Bücher – nicht zuletzt Ettners eigene – fungieren als innerdiegetische Zielmedien. So konfrontiert Eckarth z. B. in der stark erweiterten Ausgabe des Entlarvten Marckt-Schreyers von 1720 den mündlich befragten Balneologen des ‚Sauerbrunnens‘ in Eger mit „Monsieur Ettners Bchlein zum Sauerbrunn“,95 dessen Autor später persönlich mit den Figuren zusammentrifft und als Fachautorität verehrt wird.96 Die fingierte Tilgung und Korrektur ‚falschen‘ und die pseudoempirische Validierung und Generierung neuen ‚wahren‘ Erfahrungswissens im Selbstversuch wird innerdiegetisch somit um die lehrhafte Vermittlung und zirkuläre Bestätigung von bereits vorhandenem Fachwissen ergänzt, das Eckarth aus Ettners 1699 erstmals erschienener Gründlicher Beschreibung des Egerischen Sauer-Brunns. Oder sogenannten Schleder-Säurlings entnimmt.97 Schon in der ersten Fassung des Marcktschreyers werden Bücher eines „D. Etner“ (EM 467 u. 468) erwähnt, dessen Namensanagramme außerdem noch zwei weitere, in den nachfolgenden Romanen auftretende Figuren bezeichnen (Rente, von der Erden, Edner).98 Selbstlegitimationsprobleme und das Problem der selbstreflexiven Schließung eines potenziell infiniten, nur abzubrechenden, aber nicht mehr abschließ-
94 Zu diesen innerdiegetisch auch als ‚Pesttraktat‘ bezeichneten Anhängen s. Hardin (Anm. 1), S. 28 f., 131–133 sowie 136 f.; in Ettner: Doctor (Anm. 47) liest Siegfried das erste Kapitel von des „getreuen Eckarths Anhang“ vor (ebd., S. 1, nach S. 958), der mit eigener Titelei, einer Vorrede „An den Leser“ (S. 2) und neu einsetzender Paginierung und Kapitelzählung die Romanhandlung unterbricht und nach dem Ende der Lesung (S. 3–44) fortsetzt (bis S. 207). 95 Johann Christoph Ettner: Des getreuen Eckarths Medicinischer Maul=Affe/ Oder der Entlarvte Marckt=Schreyer. […] Jngleichen eine grndliche Beschreibung und Gebrauch des Hirschberger=Landecker= Johannis=Tplitzer=Egerischen Sauerbrunn= und Carls-Bades. […]. Franckfurt, Leipzig 1720, S. 785, auch S. 793 f.; vgl. zum ‚Säuerling‘ in Eger ebd., S. 783–842. 96 Ebd., S. 816, 844–939. 97 In der ersten Marktschreier-Ausgabe von 1694 empfiehlt dagegen der Badearzt des Carlsbades Eckarth und den seinen noch die Lektüre seines eigenen „Bchlein[s] […] Hydriatria Carolina“ (EM 521), das in der zweiten Ausgabe 1720 als Publikation „Doctor Hillingers“ aus dem Jahre 1636 identifiziert und nun von dem innerdiegetischen ‚Ettner‘ zitiert wird (Ettner: MarcktSchreyer [Anm. 95], S. 936). Es handelt sich um die 1638 unter diesem Titel erschienene Kurtze Beschreibung des Carols-Baades von Wenceslaus Hüllinger. 98 Vgl. dazu auch Benzenhöfer (Anm. 3), S. 288, 291.
306
Claus-Michael Ort
baren Erzählens, hängen also eng zusammen. Auch dass sich Ettner als Arztfigur „Monsieur Ettner“ explizit in den letzten Roman Unvorsichtige Heb-Amme hineinkopiert,99 beglaubigt die medizinische Dignität der Romanfiktion nur vordergründig und fiktionalisiert vielmehr umgekehrt die innerdiegetische Epiphanie der Autor-Figur. Diese schließt sich der Reisegruppe nur für kurze Zeit an, um ihre anagrammatischen Stellvertreter Rente und von der Erden zu treffen,100 Eckarths telegrafische „Correspondentz=Uhr“101 zu verwunderlich schneller Briefkommunikation zu nutzen und die Bewunderer nach seiner Abreise mit ihrer Lektüre des vierten Vortrages aus seinem ‚Pesttraktat‘ alleine zu lassen, nicht ohne die Drucklegung eines weiteren Werkes aus seiner Feder – des „hllischen Ekron“102 – versprochen zu haben: Weiln Monsieur Ettner uns noch im frischen Gedchtniß schwebet/ so wollen wir doch aus seiner Pest=Beschreibung den Nachtrag von der Kindermutter anhren, wann Monsieur Siegfried ihm die Zeit selbigen uns vorzulesen nehmen wolte. Hertzlich gerne/ antwortete Siegfried/ nahm das Buch und laß: Der vierdte Vortrag.“103
Die Präsenz der offenkundig entbehrlichen Autorfigur wird auf ihre schriftliche Abhandlung reduziert, deren mündlicher Vortrag sich als Übergang von Eckarths, Rentes und von der Erdens Lehrgesprächen zur bloßen Textlektüre erweist.104 Die allegorisch aufgeladene Geselligkeit am Anfang des Romanzyklus, also die Gutsbesitzer-Idylle eines glücklichen, auf freundschaftlich ausgewogenen, reziproken Sozialbeziehungen beruhenden Lebens, entlässt sukzessive ein nicht enden wollendes Syntagma, das so unabschließbar und heterogen erscheint wie die kontingente, empirische Welt und das seine narrative Kohärenz zugunsten anderer Modi der Wissensrepräsentation zur Disposition stellt, die eher an Periodica wie die erwähnten ‚Breslauischen Sammlungen‘ erinnern.
99 Johann Christoph Ettner: Des Getreuen Eckarths Unvorsichtige Heb=Amme […]. Leipzig 1715, S. 637. 100 Ebd., S. 638: „Hier habt ihr euren so offt verlangten Monsieur Ettner/ der von der Erden und Rente lieffen ihm zu/ bewillkommten sich mit ihm und kßten ihn.“ 101 Vgl. ebd., S. 640–648 (Zitat S. 642), insbesondere den abgedruckten Brief des fiktiven „J. C. Ettner“ (S. 645). 102 Ebd., S. 639; „Eckron“ auch S. 641. 103 Ebd., S. 648; der innerdiegetische gedruckte und vorgelesene „Vortrag“ folgt auf S. 648–690. 104 Simulierte Mündlichkeit weicht bei Ettner zusehends intradiegetischer Schriftlichkeit; zur „schriftlichen Überformung mündlicher Erzählmuster“ im „Barockroman“ vgl. Robert Vellusig: Verschriftlichung des Erzählens. Medienprobleme des Romans im 17. und 18. Jahrhundert. In: IASL 30 (2005), H. 1, S. 55–97, hier S. 69; vgl. auch ebd. S. 57, 65, 78–82; schon Christian Weise reflektiert mit Blick auf seine Schuldramen die wirkungspoetischen Probleme des Wechsels vom Theater zum Lesedrama; vgl. Ort: Medienwechsel (Anm. 77), S. 39–56.
Medizinisches Wissen und die Funktion pikaresken Erzählens
307
Emblematisch kontrolliertes, kohärentes Erzählen, das die Bedeutungsvielfalt und serielle Unabschließbarkeit dessen, was – je lebensgeschichtlich, strafrechtlich, medizinisch – der ‚Fall‘ ist, moralisch subsumierend aufzufangen beansprucht, stößt jedoch nicht erst um 1700 an seine Grenzen: Die z.T. verschachtelten emblematisierenden Rahmungen der Fallgeschichten in Harsdörffers Grossem Schau-Platz jämmerlicher Mord-Geschichte (1656) belegen dies ebenso wie – poetologisch potenziert – die Rahmungs-, Selbstinklusions- und Abschlussprobleme der pikarisch beginnenden, moraldidaktisch endenden Bildungsgeschichten in Grimmelshausens Simplicissimus Teutsch und im Simplicianischen Romanzyklus insgesamt. Schon früh zeichnen sich also – auch in pikaresken Erzählformaten – die Grenzen einer emblematisch verfassten, literarischen Epistemologie ab, die die zunehmend unübersehbare empirische Vielfalt der Geschehnisse auf dem ‚großen Schau-Platz‘ der Welt in Sammlungen thematisch heterogener (‚novellistischer‘) Narrationen zu repräsentieren und durch ordnungsstiftende Bedeutungszuweisung zugleich zu begrenzen beansprucht. Auch der stetig zunehmende Umfang der Reiseromane von Ettners Eckarth-Zyklus erweist sich als Funktion der unabschließbaren Sukzession lehrreicher ‚Zu-Fälle‘, die sich im discours als Serialisierung des Inkohärent-Kontingenten widerspiegelt: […] wo in einer qualitativ-disjunkten ‚Ordnung‘ die Welt als ein ‚göttliches Zeichensystem‘ gedacht werden kann, das dem Menschen im Sinne der Emblematik bedeutungstragende Nachrichten vermittelt, ist [dies] in einer quantitativ-graduellen ‚Ordnung‘ nicht mehr möglich: Die Realien der Welt sind keine ‚Zeichen‘ mehr.105
Dass Ettners wissensvermittelnde Romane an dieser epistemischen Bruchstelle situiert sind, wird insbesondere dann manifest, wenn Figuren vergeblich theologisch-endzeitlich argumentieren, um die Narration der endlosen Krankheits- und Verletzungsfälle abzuschließen, und stattdessen – in selbstreflexiver Potenzierung – auf die Schriften Ettners selbst und erneut auf die syntagmatische Unabschließbarkeit einer vollständigen Verschriftung des Weltwissens zurückverwiesen werden. Obwohl also im Verwegenen Chirurgus (1698) zunächst noch die Hoffnung auf eine zukünftige, erfahrungsgesättigte ‚Complierung‘ des (insofern auch niemals kopierbaren) ‚Etnerschen‘ Werkes besteht, kapituliert Burghart –
105 Michael Titzmann: Anmerkungen zu Anthropologie(n) in Literatur(en) des 17. Jahrhunderts. In: Simpliciana 34 (2012), S. 15–42, hier S. 28 f.; zur semiotischen Episteme der Frühen Neuzeit vgl. ähnlich auch Michael Titzmann: Konstanz und intraepochaler Wandel im deutschen Barock. In: Europäische Barock-Rezeption. In Verbindung mit Ferdinand van Ingen, Wilhelm Kühlmann und Wolfgang Weiß hg. von Klaus Garber. Teil I. Wiesbaden 1991 (Wolfenbütteler Arbeiten zur Barockforschung 20), S. 63–83.
308
Claus-Michael Ort
Eckarth reist seit dem Unwürdigen Doctor (1697) unter diesem Pseudonym – vor der Vergeblichkeit jeglicher irdischer (medizinischer) und moralisch-religiöser Erlösungshoffnungen für das lasterhafte Volk: Der von der Erden fragte Siegfriden/ ob es schon alle wre? Siegfrid antwortete: ja! Oho! versetzte er/ der gute Doctor Etner muß sich versehen/ oder […] noch nicht alles gesehen und gehret haben/ doch/ weilen er weiter nichts mehr angefhret/ wollen wir vor jetzo auch nichts mehr zulegen/ es werden uns dise Reise ber noch genugsame Medicinische/ oder vilmehr Chirurgische Maulaffen aufstossen/ daß wir Ursache finden werden das Ermangelnde zu compliren und zu vermehren. Burghart sprach/ frwar je mehr ich der Sache nachdencke/ wie doch allerhand Volck/ der Interesse halben/ den Himmel so wenig achtet/ und seine Seeligkeit in die Schantze schlgt/ je weniger kan ich mir einbilden/ daß unter der grsten Menge der Menschen das allerwenigste Theil seelig werden kan; O Du grosser GOTT/ mache einmahl ein Ende/ und laß uns deine Herrlichkeit anschauen von Ewigkeit zu Ewigkeit.106
Die erst eschatologisch zu schauende, innerweltlich noch nicht ‚entlarvte‘ ewige Herrlichkeit Gottes bleibt ebenso bloße Hoffnung wie die allegorisch im Titelkupfer und in der Titelei versprochene finale Enthüllung der Wahrheit. Deren Verkünder sind auf demselben ‚maul-äffischen‘ Schauplatz der Jahrmarktsbühne zu agieren gezwungen wie die falschen Spieler selbst, und die Erlösungswirkung der ‚entlarvten‘ Wahrheit für das vor Betrügern gerettete Publikum und für die vor weiterem sozialem Abstieg in Kriminalität und Sünde erretteten Quacksalber erstreckt sich nur auf den je kontingenten und zeitlich begrenzten Einzelfall innerhalb einer Serie aufeinanderfolgender Entlarvungsakte. Medizinisch-wissenschaftliche Fortschritts- und Besserungserwartungen erweisen sich demnach als ebenso utopisch wie die Erlösungshoffnung in Burgharts eschatologischem Notruf oder die Erwartung, „der gute Doctor Etner“107 werde sein Wissen kompilierendes Erzählen jemals abschließen können.108 Im Verwegenen Chirurgus sucht man im Anschluss an dieses Gespräch ein Wirtshaus auf, endzeitliche Sinnpos-
106 Johann Christoph Ettner: Deß Getreuen Eckardts verwegener CHIRURGUS […]. Leipzig 1698, S. 359 f. 107 Ebd., S. 359. 108 In dieser Hinsicht entspricht Ettners epistemologische Position bereits weniger der galenisch-aristotelischen Schulmedizin als einer sich schon bei Paracelsus abzeichnenden ‚offenen Epistemologie‘ die, so Lorber (Anm. 48), S. 105, nicht mehr an die „Endlichkeit und Vervollkommnung des Wissens im Rahmen christlicher Eschatologie“ glaubt und sich einer infiniten „experimentelle[n] Produktion von Wissen“ (ebd.) im Sinne von Francis Bacons nova scientia nähert, ohne jedoch die „gnostische Gleichsetzung von Wissen und Erlösung“ (ebd., S. 93, Anm. 27) vollständig aufzugeben. Zum „Zusammenwirken von alchemistischen und eschatologischen Vorstellungen“ bei Paracelsus und Anderen vgl. auch Christine Maillard: Eine Wissensform unter Heterodoxieverdacht: die spekulative Alchemie nach 1600. In: Heterodoxie
Medizinisches Wissen und die Funktion pikaresken Erzählens
309
tulate und diesseitig Bedeutungsloses, Kontingentes sind nur mehr durch ihre bloße Sukzession verbunden. Auch ihr „vergngtes ENDE“109 in der Unvorsichtigen Heb-Amme (1715) vermag die wissenskomplettierende ‚Reise‘ nicht abzuschließen. Das „Amen“ kurz vor der Rückkehr von der „so schwere[n] Reisen“110 bleibt nicht das letzte Wort, sondern wird von einem Ausblick auf die zukünftige Perfektionierung und Komplettierung des medizinischen Fachwissens und des Weltwissens sowie auf die Unabschließbarkeit des Erzählens und Lesens gefolgt: Womit ich vor diesesmahl schliesse/ und meinen anfnglich gethanen Wunsch/ daß GOtt der HErr zu allem guten Rath und Artzneyen sein gndiges Gedeyen verleihen wolle/ wiederhole. Siegfried/ Rente und Carilla sagten Amen. Rente sprach: Wo wir noch knfftighin zusammen verbleiben werden/ wird noch manches/ was vor diesesmahl wegen Krtze der Zeit nicht hat knnen errtert werden/ mssen nachgeholet/ und besser ausgefhret werden.111
Die letztgültige Entlarvung der ‚nackten Wahrheit‘ hinter dem Maulaffen-Theater der Quacksalber und Marktschreier auf dem theatrum des ‚getreuen Eckarth‘ mündet in unabschließbares Beobachten, Schreiben und Lesen und beschwört damit zugleich die Marginalisierung des theatrum als Topos für enzyklopädisch kumulierbares Wissen herauf. Ettners ‚medizinische‘ Maulaffen-Romane plausibilisieren somit einerseits, dass „[t]iefgreifende Umbrüche von Wissenssystemen […] stets verbunden mit einer gesteigerten Theatralisierung von Wissen [scheinen]“112 und dass „an den epistemologischen Bruchstellen, in den wissenschaftlichen Revolutionsphasen oder Paradigmenwechseln eine Vielfalt theaterhaften Vokabulars, maskenhaften Verhaltens, kostümierenden Denkens und spektakulärer Darstellungsformen“ zu beobachten ist, sie belegen andererseits aber auch den „Hang zum Paradoxen“ und „die Tendenz zur Selbstreflexion, zur
in der Frühen Neuzeit. Hg. von Hartmut Laufhütte und Michael Titzmann. Tübingen 2006 (Frühe Neuzeit 117), S. 267–289, hier S. 289. 109 Ettner: Heb-Amme (Anm. 99), S. 944. 110 Ebd., S. 943. 111 Ebd. 112 Jan Lazardzig: Theatermaschine und Festungsbau. Paradoxien der Wissensproduktion im 17. Jahrhundert. Berlin 2007, S. 251–252, hier S. 259; vgl. auch Hans-Joachim Jakob: Vom Umgang mit Wissen im Wissenstheater. Aspekte von Wissenskonstituierung und Wissensetablierung in der Theatrum-Literatur des 17. Jahrhunderts. In: Burkard u. a. (Anm. 48), S. 285–304, sowie Markus Friedrich: Das Buch als Theater. Überlegungen zu Signifikanz und Dimensionen der ‚Theatrum‘-Metapher als frühneuzeitlichem Buchtitel. In: Wissenssicherung, Wissensordnung und Wissensverarbeitung. Das europäische Modell der Enzyklopädien. Hg. von Theo Stammen und Wolfgang E. J. Weber. Berlin 2004 (Colloquia Augustana 18), S. 205–232.
310
Claus-Michael Ort
Spiegelung und Hinterfragung des eigenen Standpunktes“ in den „Unruhephasen einer ‚offenen Epistemologie‘“.113 Infinites Schreiben und Lesen lässt sich nicht mehr auf einen ‚erlösenden‘, anagogischen Sinnhorizont, auf das theatrum endgültiger Entlarvung der Wahrheit und seinen begrenzten ‚Schauplatz‘ verpflichten – der moralisch nützliche ‚Kern‘ vermag seine im discours entfalteten säkularen ‚Schalen‘ nicht mehr aufzufangen und deren Bedeutung nicht mehr zu fixieren. Selbstreferenzielle Schließung und metaleptische Verschränkungen sind offenkundig an die Stelle allegorisch-emblematischer Sinnzuweisung getreten.114
113 Lazardzig (Anm. 112), S. 259. 114 Insofern trifft auch für Ettners Romane zu, was Hans-Edwin Friedrich anlässlich der selbstreflexiven Autonomisierung von Kunst und fiktionaler Literatur im 18. Jahrhundert konstatiert, dass sich nämlich „das Verhältnis der fiktionalen Welt zur wirklichen innerhalb des Textes selbst noch einmal wiederholt“ (Fiktionalität im 18. Jahrhundert. Zur historischen Transformation eines literaturtheoretischen Konzepts. In: Grenzen der Literatur. Zu Begriff und Phänomen des Literarischen. Hg. von Simone Winko, Fotis Jannidis und Gerhard Lauer. Berlin, New York 2009 [revisionen 2], S. 338–373, hier S. 366). Da solche re-entries in der Frühen Neuzeit bereits vor Ettner zu beobachten sind, wäre allerdings zu fragen, ob entweder der Prozess der Autonomisierung früher einsetzt oder selbstreferenzielle Potenzierungen nicht notwendig als Indikatoren von Autonomisierung fungieren.
Christian Wehr
Pikareske Destabilisierungen kolonialer Machtstrukturen Der Lazarillo de ciegos caminantes (1775) und die Genese des lateinamerikanischen Romans
1 Eine koloniale Genealogie des lateinamerikanischen Romans? Die Anfänge des lateinamerikanischen Romans werden meist mit dem Periquillo Sarniento gleichgesetzt, einer pikaresken Satire des mexikanischen Aufklärers, Publizisten und politischen Aktivisten Fernández de Lizardi. Der Text erschien ab 1816, in der letzten Phase des Vizekönigreichs Neuspanien und inmitten der Kämpfe um die Unabhängigkeit des zukünftigen Mexiko. Dass zuvor während der gesamten kolonialen Ära, also über einen Zeitraum von dreihundert Jahren, in Lateinamerika keine narrativen Fiktionen verfasst und vertrieben wurden, hat mit dem vielbeschworenen Romanverbot zu tun, das die spanische Krone unter Karl V. in den Vizekönigreichen der Neuen Welt verhängt hatte. Der administrativen Disziplin, wirtschaftlichen Effizienz und öffentlichen Moral wurde das Verfassen und vor allem die Lektüre von erzählender Literatur als abträglich erachtet. Romane konnten nur als Schmuggelware erworben und heimlich gelesen werden.1 So hemmte der rigide Zensur- und Kontrollapparat des spanischen Mutterlandes die literarische Produktion in einem Maße, das erklärbar macht, warum die ersten narrativen Fiktionen in Hispanoamerika überhaupt erst am Vorabend
Der Beitrag ist eine leicht überarbeitete Version meines Artikels gleichen Titels in: ErzählMacht – Narrative Politiken des Imaginären. Hg. von Kurt Hahn, Matthias Hausmann und Christian Wehr. Würzburg 2013, S. 45–58. 1 Zwei Verordnungen Karls V. aus den Jahren 1532 und 1543 untersagten in den lateinamerikanischen Vizekönigtümern die Verbreitung von „Romanbüchern, die profane und fabelhafte Themen behandeln und erdachte Geschichte erzählen“ („libros de romances, que traten materias profanas o fabulosas, e historias fingidas“). Zitiert und übersetzt nach: Pedro Henríquez Ureña: Apuntaciones sobre la novela en América. In: La novela hispanoamericana. Selección, introducción y notas de Juan Loveluck. 4., durchgesehene Aufl. Santiago de Chile 1972 (Colección Letras de America 21), S. 34–45, hier S. 35.
312
Christian Wehr
der Unabhängigkeit entstanden. Diese besondere historische Situation ist auch verantwortlich für einen stark epigonalen Charakter, von dem sich die erzählende Literatur im Grunde erst ab der Mitte des 20. Jahrhunderts endgültig löst. So sind die Texte der ersten drei bis vier Jahrzehnte nach dem Erreichen der Unabhängigkeiten weniger von ästhetischem als von politischem Interesse. Im Kanon der Deutungen lassen sich drei große Tendenzen unterscheiden: Der Roman des frühen 19. Jahrhunderts gilt entweder als „mediokre Vorgeschichte des Booms, sodann als eklektische Nachschrift europäischer Prätexte“, insbesondere des französischen oder englischen Romans, und schließlich als allegorische Verklausulierung eines schon früh im 19. Jahrhundert einsetzenden nationbuilding.2 Jenseits ihrer unterschiedlichen Erkenntnisinteressen konvergieren die Interpretationen darin, dass sie die literarhistorische und die politische Zäsur synchron setzen: Die Unabhängigkeit markiert zugleich den Beginn des Romans. Dagegen möchte ich in den folgenden Überlegungen die Konstanz einer Diskurstradition in den Blick nehmen, die bereits dem kolonialen Erbe entstammt. Heuristischer Fluchtpunkt ist die These, dass die Fiktionalisierung reiseliterarischer bzw. periegetischer Schreibweisen ab dem 18. Jahrhundert wesentlich zur Herausbildung einer eigenständigen Romanproduktion in Lateinamerika beiträgt. Dabei soll es nicht um den Nachweis einer linearen oder gar teleologischen Entwicklung gehen. Ziel ist es vielmehr, in genealogischer Perspektive3 die literar- und kulturhistorischen Ermöglichungsbedingungen zu rekonstruieren, die den Übergang von der Exposition zur Narration, von faktualen zu fiktionalen Schreibweisen beförderten. Entscheidende Bedeutung kommt dabei den Erzählverfahren pikaresker Provenienz zu. Denn der Schelmenroman wahrt zum einen den Sachbezug des Reiseberichts durch die Ortlosigkeit seiner Protagonisten4 und führt damit koloniale Diskurstraditionen fort. Zugleich öffnet er die periegetische Perspektive jedoch auf eine romanesk-satirische und damit potenziell subversive Imagination. Vor diesem Hintergrund treibt die fortschreitende Assimilation pikaresker Gattungs-
2 Vgl. Kurt Hahn: Felder der Transkulturation. Zu einer Genealogie französischer Diskursimporte in der hispanoamerikanischen Narrativik des neunzehnten Jahrhunderts. Unveröffent. Manuskript zur Projektpräsentation im Fakultätskolloquium des sprach- und literaturwissenschaftlichen Fachbereiches der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt am 15. Juli 2009. 3 Vgl. Michel Foucault: Nietzsche, la généalogie, l’histoire. In: Ders.: Dits et écrits. 1954–1988. Hg. von Daniel Defert und François Ewald. Bd. 2: 1970–1975. Paris 1994, S. 136–156. 4 Vgl. Jochen Mecke: Die Atopie des Pícaro. Paradoxale Kritik und dezentrierte Subjektivität im ‚Lazarillo de Tormes‘. In: Welterfahrung – Selbsterfahrung. Konstitution und Verhandlung von Subjektivität in der spanischen Literatur der frühen Neuzeit. Hg. von Wolfgang Matzat und Bernhard Teuber. Tübingen 2000 (Iberoromania, Beiheft 16), S. 67–94.
Pikareske Destabilisierungen kolonialer Machtstrukturen
313
komponenten5 durch die koloniale Reiseliteratur einen Prozess der Literarisierung voran, der seinen Höhe- und zugleich Endpunkt mit dem Periquillo Sarniento erreicht. Diese vielschichtige Entwicklung weist neben diskurs-, medienund literarhistorischen Aspekten vor allem machthistorische Implikationen auf, die im Mittelpunkt der folgenden Überlegungen stehen. Denn vor allem im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts, das ganz von den bourbonischen Reformen geprägt ist, lässt sich eine latente Erosion kolonialer Machtstrukturen beobachten. Die satirisch-uneigentliche Schreibweise der Pikareske erlaubt es, dem besagten Prozess der latenten Destabilisierung und Subversion auch unter den Bedingungen des Romanverbots und der Zensur eine erzählerische Form zu geben. Damit ist der Zugang zu einem hochgradig hybriden, bislang nur partiell erforschten Text des spanischen Kolonialbeamten Carrió de la Vandera aus dem Jahre 1775 geschaffen, der die Tradition der Reiseberichte unmittelbar aufgreift und zugleich pikaresk überformt: Der Lazarillo de ciegos caminantes (‚Lazarillo der reisenden Blinden‘).6 Halb Reiseprotokoll, halb Schelmenroman, steht der Text an der Schnittstelle zwischen periegetischer Literatur und narrativer Fiktion. Dabei aktualisiert er auf höchst originelle Weise pikarische Erzählverfahren, um die Repräsentationsverfahren kolonialer Diskurstraditionen vielfältig zu unterminieren. Auf diese Weise situiert er sich zwischen der Exploration des Fremden und der Konstruktion des Eigenen und bereitet damit den Boden für den Periquillo Sarniento als pikaresken Gründungstext des lateinamerikanischen Romans überhaupt.
2 Zwischen Periegese und Pikareske Generische und epistemologische Ambivalenzen Der Lazarillo de ciegos caminantes erschien 1775 im literarhistorischen Niemandsland: nach der humanistischen Kolonialliteratur, von der er gleichwohl deutlich geprägt ist, noch vor dem Roman des 19. Jahrhunderts, zugleich beeinflusst von den lateinamerikanischen Rezeptionen der europäischen, insbesondere fran-
5 Ich beziehe mich damit auf das Modell von Wolf-Dieter Stempel, der Gattungen nicht als vorgängige Entitäten, sondern als historisch variable „Komplexe von Komponenten“ begreift (Wolf-Dieter Stempel: Gibt es Textsorten? In: Textsorten. Differenzierungskriterien aus linguistischer Sicht. Hg. von Elisabeth Gülich und Wolfgang Raible. Wiesbaden 1975 [AthenäumSkripten Linguistik 5], S. 175–179, hier S. 178). 6 Alonso Carrió de la Vandera: El Lazarillo de ciegos caminantes desde Buenos Ayres hasta Lima. Caracas 1985.
314
Christian Wehr
zösischen Aufklärung.7 Die Erstausgabe weist einen Calixto Bustamante Carlos Inca alias ‚Concolorcorvo‘ als Verfasser aus. Heute geht man mit großer Wahrscheinlichkeit davon aus, dass es sich um ein doppeltes Pseudonym handelt, welches der reale Autor wählte, um sich aufgrund der kritisch-subversiven Tendenzen des Textes vor der Verfolgung durch die Zensur zu schützen.8 Nach heutigem Kenntnisstand war der Verfasser ein Beamter der spanischen Krone: Alonso Carrió de la Vandera, der in der Verwaltung des Postwesens der Überseekolonien eine hohe Stellung innehatte. 1771 wurde er zum Verantwortlichen der Relaisstationen zwischen Buenos Aires und Lima, also von der Atlantik- bis zur Pazifikküste ernannt.9 Diese Route inspizierte er kurz darauf in einer Dienstreise, deren Verlauf im Lazarillo minutiös protokolliert wird. Auf dieser Ebene steht der Text deutlich in der Tradition der Reiseberichte des 18. Jahrhunderts, denen er oft auch umstandslos zugeordnet wird. In präzisen Skalierungen von Distanz und Dauer der Reiseetappen wird das Terrain akribisch vermessen und geografisch nach den binären Schemata von Identität und Differenz detailgenau klassifiziert. In dieser Perspektive sind die Raum- und Zeitmodellierungen des Textes unverkennbar von der nominalistischen Episteme des 18. Jahrhunderts geprägt.10 Der konkrete Auftrag zur Reise geht auf eine behördliche Maßnahme im Kontext der bourbonischen Reformen zurück: Unter Karl III. sollten in den Überseekolonien effizientere und unabhängigere Verwaltungsstrukturen geschaffen werden, wozu vornehmlich auch die Optimierung der Kommunikations- und Transportwege zählte.
7 Vgl. zum literarhistorischen Ort des Textes Rodolfo Antonio Borello: ‚El lazarillo de ciegos caminantes‘ dentro de la literatura hispanoamericana del siglo XVIII. In: Revista de Historia de las Ideas 10 (1990), S. 115–127, bzw. Christian Wentzlaff-Eggebert: Una obra hispanoamericana entre ilustración y costumbrismo: ‚El Lazarillo de ciegos caminantes‘ de Alonso Carrió de la Vandera. In: Entre siglos. Hg. von Ermanno Caldera und Rinaldo Froldi. Rom 1993, S. 259–267. 8 Alternative Wege der Identitätsbestimmung lotet Augusto Tamayo Vargas aus: Concolorcorvo ¿sería Fray Calixto San Joseph Tupac Inga? In: Revista Iberoamericana 24 (1959), S. 333–356. 9 Vgl. Emilio Carilla: El libro de los ‚misterios‘: ‚El Lazarillo de ciegos caminantes‘. Madrid 1976 (Biblioteca románica hispánica II 247); José Manuel Gómez-Tabanera: Sobre Alonso Carrió de la Vandera, ‚Concolorcorvo‘, autor de ‚El Lazarillo de ciegos caminantes‘. In: Boletín del instituto de estudios Asturianos 37 (1983), S. 179–220; Lucas Guerra: ‚Concolorcorvo‘ o sea el visitador español Antonio Carrió de la Vandera. Un famoso enigma histórico-bibliográfico definitivamente esclarecido. Cuzco 1944; Rubén Vargas Ugarte: ¿Quién fue el verdadero autor de ‚El Lazarillo‘? In: Pontificia Universidad Católica de Lima: Cuadernos de Estudios. Instituto de Investigaciones Históricas 3 (1948), S. 1–39. 10 Vgl. Michel Foucault: Les mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines. Paris 1966, S. 60–91. Siehe zum epistemologischen Paradigmenwechsel um 1800 auch Wolf Lepenies: Das Ende der Naturgeschichte. Wandel kultureller Selbstverständlichkeiten in den Wissenschaften des 18. und 19. Jahrhunderts. Frankfurt am Main 1978.
Pikareske Destabilisierungen kolonialer Machtstrukturen
315
Mehrfach fingiert sind vermutlich aus Zensurgründen neben den Heteronymen des Autors auch Ort und Jahr des Erscheinens: Das Frontispiz der Erstausgabe gibt das Jahr 1775 sowie die nordspanische Stadt Gijón an, während inoffizielle Versionen des Textes mit großer Wahrscheinlichkeit bereits früher in Lima zirkulierten. Diese Rahmendaten sind für die Analyse aufschlussreich, da sie bereits über die Außenpragmatik ein Spiel von Ambiguierungen inszenieren, das sich in den internen Textstrukturen auf vielfache, potenziell unabschließbare Weise reflektiert und fortsetzt. Die wichtigsten dieser Ambivalenzen gründen wiederum in pikarischen Verfahren der Sujetfügung und erzählerischen Vermittlung. Sie sind primär für die hybride Textform verantwortlich, die zwischen Reiseprotokoll und Schelmenroman oszilliert. Dessen wichtigste inhaltliche und strukturelle Komponenten sind in den Text eingegangen: Dazu zählen die Herr-Diener-Konstellation, der episodische Aufbau, die Sozialkritik sowie die Perspektive von unten, sodann der Querschnitt durch die zeitgenössische Gesellschaft, die satirische Subversion sozialer Hierarchien sowie die Gleichzeitigkeit von humanistischer Erudition und derber Schwankkomik.11 Im Lazarillo de ciegos caminantes bewirken diese Komponenten nicht nur fiktionale Brechungen des Reiseprotokolls, sondern auch satirische Subversionen spätkolonialer Machtdiskurse. Die hierfür maßgeblichen Verfahren sind vor allem: die mehrfache Verunklärung der Urheberschaft, eine damit verbundene Ambiguierung der Vermittlungsverfahren sowie die Multiplikation der narrativen Instanzen, auf einer epistemologischen Ebene sodann die beginnende Überlagerung einer aufklärerisch-nominalistischen durch eine historische Repräsentation spätkolonialer Räume und Zeiten, in der sich bereits die ‚autochthonen‘ Unabhängigkeitsdiskurse des 19. Jahrhunderts ankündigen,12 schließlich die Konkurrenz und Kopräsenz zweier konträrer Typen der Raumaneignung. Zwar dominiert eine – mit Michel de Certeau gesprochen – strategische Bewegung, die auf ein Zentrum der Macht, also hier den „lieu propre“ der Krone bezogen bleibt.13 Sie weicht jedoch zusehends einer taktischen, ungeplanten und spontanen Appropriation von Orten, welche die offizielle Ordnung immer wieder unterläuft und in den Worten des Textes zu „fantastischen“ Abweichungen vom offiziellen Parcours führt.14 In einen epistemologischen Bereich gehört auch die medien-
11 Vgl. hierzu partiell Richard A. Mazzara: Some Picaresque Elements in Concolorcorvo’s ‚El Lazarillo de ciegos caminantes‘. In: Hispania 46 (1963), S. 323–327. 12 Zum ‚Zeitalter der Geschichte‘ vgl. Foucault: Les mots et les choses (Anm. 10), S. 229–232. 13 Vgl. zur Unterscheidung einer zentrumsbezogenen ‚Strategie‘ zur ‚Taktik‘ spontaner Raumaneignung Michel de Certeau: L’invention du quotidien. I. Arts de faire. Paris 1990, vor allem S. 57–63 sowie 170–180. 14 „[…] daremos una vuelta fantastica por las pampas.“ Carrió de la Vandera (Anm. 6), S. 81.
316
Christian Wehr
geschichtlich motivierte Erfahrung der Beschleunigung, die wesentlich zum Aufbrechen der Statik aufklärerischer Tableaus beiträgt und dem unmittelbaren Anlass der Reise Rechnung trägt: der Optimierung des Postverkehrs. Wiederum zu literarischen Verfahrensweisen, die die poetische Faktur des Lazarillo prägen, sind die satirische Destabilisierung kolonialer Geschichtskonstruktionen sowie schließlich eine hintergründige Selbstreflexivität zu zählen. Auch sie konstituiert eine Literarizität, die das basale Reisenarrativ immer wieder durchbricht und den Periquillo Sarniento, also den pikaresken Gründungstext des hispanoamerikanischen Romans, antizipiert.15 Einige dieser Momente deuten sich schon im Titel des Textes an; er lautet vollständig: El Lazarillo de ciegos caminantes desde Buenos-Ayres hasta Lima segun la más puntual observación, con algunas noticias útiles a los nuevos comerciantes en mulas, y otras historias, sacado de las memorias que hizo don Alonso Carrió de la Vandera en este dilatado viaje y comisión que tuvo por la Corte para el arreglo de Correos y Estafetas, situación y ajuste de Postas desde Montevideo, por Don Calixto Bustamante Carlos Inca, alias ‚Concolorcorvo‘, que acompañó al referido comisionado en dicho viaje y escribió sus extractos. Reiseführer für Blinde, die von Buenos Aires nach Lima wandern, mit genau ausgearbeiteten Reiserouten, samt einigen nützlichen Anmerkungen für die neuen Maultierhändler und anderen Geschichten, den Aufzeichnungen [bzw. Erinnerungen] entnommen, die Don Alonso Carrió de la Vandera während dieser ausgedehnten Reise fertigte, die er im Auftrag der Krone machte, um die Post- und Relaisstellen sowie Ort und Verteilung der Kurierstationen ab Montevideo zu inspizieren. Von Don Calixto Bustamante Carlos Inca, genannt ‚Concolorcorvo‘, der den genannten Beauftragten auf besagter Reise begleitete und dessen [bzw. seine] Auszüge [bzw. Zusammenfassungen] aufschrieb (Übers. d. Verf.).
3 Mehrfache Urheberschaft Zwischen kolonialer und autochthoner Origo Der Titel kündigt nicht nur den protokollarisch-dokumentarischen Charakter des Textes an, der aufgrund seines immensen Detailreichtums eine immer noch relevante Quelle für historische und kulturgeografische Studien bietet.16 Er indiziert auch bereits fundamentale Ambivalenzen der Urheberschaft und Vermittlungsstruktur, die konträr zur Sachlichkeit der propositionalen Ebene stehen – liegen
15 Vgl. zu den Strategien narrativer Selbstreflexivität die präzisen Lektüren bei Karen Stolley: El Lazarillo de ciegos caminantes – un itinerario crítico. Hanover 1992, vor allem S. 174–177. 16 Vgl. Mariano Garreta: ‚El lazarillo de ciegos caminantes‘, una lectura histórica social. Buenos Aires 1987; Rafael Ocasio: ‚El Lazarillo de ciegos caminantes‘, una visión de la organización social en el mundo virreinal. In: Cuadernos americanos 44 (1985), S. 170–183.
Pikareske Destabilisierungen kolonialer Machtstrukturen
317
dem Text doch Erinnerungen des Beamten Carrió de la Vandera zugrunde, die vom Schreiber Bustamante el Inca aufgezeichnet wurden. Bei diesem handele es sich, wie man wenig später erfährt, um einen halb akkulturierten Sekretär zumindest teilweise indigener, aber letztlich ungeklärter Herkunft. Sein Heteronym Concolorcorvo ist die diskriminierte Form von „con color de cuervo“, also ‚rabenschwarz‘, und verweist auf die ethnischen Wurzeln des Schreibers. Wer von der karnevalesken Mésalliance zwischen dem Beamten und seinem schillernden Begleiter für die letztgültige Fassung des Textes verantwortlich ist, bleibt im Titel schon durch die doppelte Referenzialisierbarkeit des Possessivpronomens „sus“ offen, das auf die kompilierten Textbausteine verweist und syntaktisch auf beide Instanzen beziehbar ist.17 Potenziert wird diese zweifache Referenz durch die Mehrdeutigkeit der besagten „extractos“, mit denen Auszüge oder Zusammenfassungen gemeint sein können. Im ersten Falle stellte der Text eine rein zitathafte Wiedergabe von Texten des Beamten durch den indigenen Sekretär dar, im zweiten dessen eigene sprachliche Leistung. Dass es sich bei den ungleichen Koautoren um eine pikareske Herr-Diener-Konstellation handelt, wird schon unmissverständlich durch den Titel signalisiert, der als Metonymie des Buches selbst lesbar ist und im gleichen Zuge auf dessen fiktional-faktuale Ambivalenz verweist: Der Lazarillo der reisenden Blinden ist ein ‚Führer‘ im figuralen und generischen Sinne, wie der Untertitel verrät. Noch im unmittelbar darauf folgenden Prolog wird diese systematische Verunklärung der Autorschaft fortgeführt und potenziert: Dort rühmt sich nunmehr der Sekretär, den Text selbst verfasst zu haben, wenngleich mit fremder Hilfe: „me servirá de mucho mérito el haber escrito este itinerario, que aunque en Dios y en conciencia lo formé con ayuda de vecinos“ (‚Es wird mir zu großer Anerkennung gereichen, diesen Reisebericht verfasst zu haben, auch wenn ich ihn – ich schwöre! – mithilfe Anderer fertigstellte‘).18 Diese Urversion stellt wiederum die Basis für Bearbeitungen und Kürzungen durch den visitador dar, wie der Beamte auch genannt wird. Sie ist also in den Worten des Textes ein „borrador“,19 ein bloßer Entwurf, der aus den Erinnerungen des visitador besteht. Sie wurden vom Sekretär niedergeschrieben, dabei aber mit eigenen Digressionen und Änderungen versehen. Diese Fassung unterzog wiederum der Beamte einer Zensur, dessen Eingriffe dann aber ihrerseits in der Endfassung nochmals von Concolorcorvo kommentiert wurden.
17 Vgl. María Soledad Barbón: Peruanische Satire am Vorabend der Unabhängigkeit (1770 bis 1800). Genf 2001 (Kölner Romanistische Arbeiten N. F. 79), S. 99–106. 18 Carrió de la Vandera (Anm. 6), Prólogo y dedicatoria, S. XVIII. 19 Ebd.
318
Christian Wehr
Der Lazarillo ist dieser Konstruktion zufolge also ein mindestens dreifaches Palimpsest, dessen Erstfassung auch nicht annäherungsweise rekonstruierbar ist.20 Fiktionsimmament existieren insgesamt vier Textversionen und drei Überarbeitungsstufen, deren zweite von besonderer Brisanz ist: Sie enthielt umfangreiche Ausführungen des Sekretärs, und auf diese virtuelle Fassung und ihre zensierten Passagen, unter anderem zur Geschichte Hispanoamerikas, wird im Text des Öfteren rekurriert. So lässt sich in einem Zwischenfazit festhalten, dass der Text, der noch in jüngeren Studien als Reiseführer klassifiziert wurde, in den Verzweigungen seiner fiktionsimmanenten Genese hochgradig offene und supplementäre Strukturen aufweist: Die Schichten verweisen auf eine unzugängliche Urversion, spätere Fassungen weisen virtuelle Lücken bzw. durch zensorische Eingriffe entstandene Leerstellen auf, die Autorenanteile bleiben diffus.
4 Sprache, Diegese, Macht Der Kampf um die Geschichte Dieses komplexe Arrangement der Versionen birgt eine Reihe polemisch-subversiver Deutungspotenziale. Hier kommen die Gattungskomponenten der Pikareske zum Tragen, die sich vor allem auf der Vermittlungsebene manifestieren. So tritt die spezifische Herr-Diener-Konstellation nicht nur als Autorengespann mit undurchsichtig verteilten Kompetenzen in Erscheinung. Sie ist zugleich als Konkurrenzverhältnis von kolonisierender und kolonisierter Instanz aktualisiert. Zieht man darüber hinaus in Betracht, dass der visitador und sein Sekretär um die Urheberschaft eines Textes konkurrieren, der das spätkoloniale Terrain vermisst und dabei auch in enzyklopädischer Weise dessen Geschichte rekapituliert, wird deutlich, warum es Carrió de la Vandera vorzog, den Lazarillo de ciegos caminantes ohne Approbation der Zensur zu publizieren. In diesem Zusammenhang möchte ich zwei besonders intrikate Themen in den Blick nehmen: einmal den Bezug von Historiografie und Fiktion, sodann den Nexus von Sprache und Macht. Zu ersterem Aspekt findet sich im Prolog eine bereits erwähnte Auskunft des Sekretärs, die im gegebenen Zusammenhang von kapitaler Bedeutung ist: In der zweiten Textversion hatte Concolorcorvo den memorias seines Herren unter anderem 700 Seiten aus eigener Feder über die Conquista, also die Eroberung Perus durch Francisco Pizarro hinzugefügt, die in der dritten Version vom visitador gekürzt wurden. Der Beiname des Sekretärs, der
20 Vgl. Barbón (Anm. 17), S. 101–104.
Pikareske Destabilisierungen kolonialer Machtstrukturen
319
auch El Inca genannt wird, erfährt hier seine wesentlichste Motivation: Stammt doch eine der kanonischen Chroniken der Kolonialzeit, die Comentarios reales aus dem Jahre 1609, aus der Feder seines Namensvetters, des Mestizen Garcilaso de la Vega el Inca, der als Sohn eines spanischen Konquistadoren und der Nichte des Inkaherrschers geboren wurde, zwischen den Kulturen aufwuchs und in seinen Comentarios die Geschichte des indianischen Volkes sowie der Eroberung seines Reiches erzählt. Concolorcorvos Beiname und die umfangreichen Ergänzungen zu den memorias seines Herrn weisen ihn als legitimen Erben seines berühmten Namensvetters aus.21 Diese implizite, zugleich ironisch mehrfach gebrochene Nobilitierung des Sekretärs zur historiografischen Autorität wirkt im Lazarillo de ciegos caminantes auf die Beziehung zwischen Herr und Diener zurück, zumal das ehemals inserierte Werk schon quantitativ offenbar wesentlich umfangreicher war als der periegetische Rahmentext. Damit gewinnt der konstatierte Kampf um die Urheberschaft weiter an Komplexität: Er wird ergänzt durch einen tieferliegenden, ungleich gewichtigeren Agon um die historiografische Konstruktion und Tradierung der eigenen Geschichte. Dieser hier noch implizite Konflikt wird im zweiten Teil des Textes szenisch expliziert: Er setzt sich auf dialogischer Ebene fort in den langen Streitgesprächen, die das pikareske Paar um die Conquista, ihre Folgen sowie ihre unterschiedlichen historiografischen Darstellungen und Deutungen führt. Der Lazarillo de ciegos caminantes erzählt somit einen doppelten parcours, der durch Raum und Zeit des Cono Sur führt. Er vermisst das Terrain auf synchroner und diachroner Ebene. Am Schnittpunkt kristallisiert sich – schon Jahrzehnte vor den Unabhängigkeitskämpfen – in satirisch-spielerischer Form eine Frage heraus, die erst in den Historiografien des 19. Jahrhunderts vollends virulent wird: Wer zeichnet letztlich verantwortlich für die Geschichtsschreibung der Überseekolonien, und aus wessen Perspektive soll sie erfolgen? Im dialogischen Spiel des Textes, der die Autorschaft im diffusen Konkurrenzverhältnis zwischen dem kolonialen Herrn und seinem autochthonen Diener oszillieren lässt, bleibt sie vorerst unbeantwortet. Die pikareske Literatur kennt derartige Inversionen und Ambivalenzen seit ihrem Gründungstext, dem Lazarillo de Tormes. Dabei gewinnt die karnevaleske Umkehrung der Hierarchie von Schelm und Herr hier ein besonderes politisches und zeitgeschichtliches Gewicht, scheint sie doch in satirisch-impliziter Form bereits auf die Ereignisse nach der Jahrhundertwende zu verweisen.
21 Carrió de la Vandera (Anm. 6), S. 130. Vgl. zu den Garcilaso-Referenzen auch Mariselle Meléndez: The Reevaluation of the Image of the Mestizo in ‚El lazarillo de ciegos caminantes‘. In: Indiana Journal of Hispanic literatures 2 (1994), S. 171–184.
320
Christian Wehr
Derartige Destabilisierungen der Hierarchie und ihr Bezug zur Frage historiografischer Autorität kommen in einem hintergründigen syllogistischen Vergleich Concolorcorvos zum Ausdruck: „Los viajeros (aquí entro yo), respecto de los historiadores, son lo mismo que los lazarillos, en comparación de los ciegos.“22 Die Beziehung zwischen Reisenden und Historikern sei also dieselbe wie jene zwischen den Lazarillos (also den Führern im personalen und livresken Sinne) und den Blinden (Herren). Damit wird die traditionelle Hierarchie zwischen der Geschichtsschreibung und ihren Quellen verkehrt. Die ohne fremde Hilfe blinde, also unwissende Historiografie ist von den Reiseberichten abhängig und nicht umgekehrt. Auch diese Analogie impliziert eine Nobilitierung Concolorcorvos, der als indigener Chronist über beides verfügt: die testimoniale Erfahrung des Autochthonen und die Kompetenz des humanistisch gebildeten Schreibers. So kann er sich in einer mehrfach besetzten Metapher zum „peje entre dos aguas“,23 zum Fisch zwischen zwei Gewässern stilisieren: Geografisch bewegt er sich zwischen Atlantik und Pazifik, ideologisch laviert er zwischen Subversion und Affirmation europäisch-kreolischer Kultur (Concolorcorvo ist nach einer ironischen Selbstauskunft nur rein indigener Abstammung, sofern sich seine Mutter keinen Seitensprung erlaubte, wofür er aber nicht garantieren könne). Emblematische Besetzungen der mula, des Maultiers, dem ganze landeskundliche, agrar- und zuchttechnische Exkurse des Textes gewidmet sind, evozieren ähnliche Ambiguitäten. Wenn dann in den langen Metareflexionen über die Geschichtsschreibung schließlich die Fiktion als Quelle der Historiografie benannt wird, hat sich die Überzeugung vom Status der Geschichte als textuelles Konstrukt, in dem sich nicht zuletzt der Standort des Verfassers manifestiert, vollends durchgesetzt. Diese Gespräche zwischen Herr und Diener sind größtenteils in wörtlicher Rede wiedergegeben. Dabei fällt vor allem gegen Ende des zweiten Teiles die wiederholte Auslassung der Inquit-Formeln ins Auge.24 Sie ist symptomatisch für ein übergreifendes Verfahren der Verunklärung von Redeanteilen. Oftmals ist nicht mehr rekonstruierbar, ob der indigene Schreiber oder sein spanischer Herr spricht. Diese Ambivalenz manifestiert sich auch auf inhaltlicher Ebene: Concolorcorvo macht sich zunehmend die syllogistischen Argumentationsstrategien und Positionen seines Herrn zu eigen, um ihn mit wachsendem Erfolg aus der Reserve zu locken und letztlich als Sieger aus den wiederholten Rededuellen hervorzugehen. Als Effekt dieser geradezu sokratischen Strategie der Gesprächsführung entsteht eine Dialogizität im unmittelbaren Sinne Bachtins, die ja nicht nur
22 Carrió de la Vandera (Anm. 6), S. 3. 23 Ebd., Prólogo y dedicatoria, S. XI. 24 Vgl. Barbón (Anm. 17), S. 108 f.
Pikareske Destabilisierungen kolonialer Machtstrukturen
321
auf die Koexistenz und Unvereinbarkeit ideologischer Positionen zielt, sondern auf eine immanente Mehrstimmigkeit des Wortes selbst,25 dessen origo zwischen kolonisierender und kolonisierter Stimme unentscheidbar wird. Man könnte diese Durchdringung als Effekt einer Transkulturation bezeichnen. Naheliegender scheint mir jedoch ein anderer Zugang: Homi Bhabha hat derartige Ambiguitäten in postkolonialen Situationen untersucht und unter dem biologistischen Begriff der Mimikry subsumiert, also der imitatorischen Aneignung hegemonialer Diskurse durch die Partei der Kolonisierten.26 Die Mimikry steht für ein Wechselspiel von Identifikation und Abgrenzung, das von fundamentalen Ambivalenzen geprägt ist: Vorderhand scheint die Imitation ein Akt der Unterwerfung und Anerkennung. Darüber hinaus fungieren, wie Bhabha unter Rekurs auf psychogenetische Erklärungsmodelle ausführt, die hegemonialen Diskurse auch als Identifikationsangebote, die von den kolonisierten Kulturen als Medien der Spiegelung und Selbstkonstitution angenommen werden. Da stets ein nicht assimilierbarer Rest von Alterität bleibt, können diese Identifikationen jedoch niemals ganz gelingen. In den Gesprächsstrategien des indigenen Sekretärs, der sich die kolonialen Herrschafts- und Bildungsdiskurse nahezu perfekt aneignet, um dann im entscheidenden Moment dennoch die Kluft kultureller Alterität zu markieren, lassen sich derartige Ambiguitäten unmittelbar nachvollziehen. Schließlich – und vor allem diese Praxis ist signifikant für den peruanischen Lazarillo – steht die Mimikry für Verfahren einer kulturellen, genauerhin semiotischen Kriegsführung, da die Imitation auch als Irreführung, listige Täuschung und Tarnung genutzt wird.27 Dadurch wird der hegemoniale Diskurs zwischen Anpassung, Selbstkonstitution und Subversion mehrfach ambivalent.
25 Vgl. zur dissonanten Interferenz, die zwei unvereinbare ideologische Standpunkte miteinander konfrontiert, Michail Bachtin: Probleme der Poetik Dostoevskijs. Frankfurt u. a. 1985, S. 208–221 bzw. die Übersicht S. 222 f.; zur ‚immanenten‘ Dialogizität, die in einer ‚Hybridisierung‘ und ‚Zweistimmigkeit‘ des Wortes selber Gestalt annimmt, vgl. ders.: Die Ästhetik des Wortes. Hg. und eingeleitet von Rainer Grübel. Aus dem Russischen übersetzt von Rainer Grübel und Sabine Reese. Frankfurt am Main 1979, etwa S. 172, 195, 244, 246. 26 Homi K. Bhabha: Die Verortung der Kultur. Mit einem Vorwort von Elisabeth Bronfen. Deutsche Übersetzung von Michael Schiffmann und Jürgen Freudl. Tübingen 2000 (Stauffenburg Discussion 5), S. 134. 27 Vgl. ebd., S. 132.
322
Christian Wehr
Diese Einsicht bietet vor allem einen Zugang zum zweiten Teil des Lazarillo de ciegos caminantes, denn die doppelte origo des gesprochenen Wortes ist im Kontext eines Kampfes auf mehreren Ebenen lesbar, der zwischen autochthoner und kolonialer Instanz buchstäblich um das letzte Wort ausgefochten wird. Dabei steht letztlich weit mehr auf dem Spiel als das selbstreferenzielle Ringen um die Autorschaft.28 Es geht um die Frage, wer in einer geschichtlichen Phase, die zwischen Reform und Erosion des kolonialen Regimes steht, die eigene Geschichte schreibt. Ein weiterer virulenter Themenkomplex, der ähnlich verhandelt wird, ist etwa die Norm der Sprachreinheit in den Kolonien, die seit Antonio de Nebrijas erster Grammatik des Kastilischen aus dem Jahre 1492 primäres Anliegen einer kulturellen und semiotischen Eroberungspolitik der spanischen Krone war.29 Zu erinnern ist in diesem Zusammenhang auch an die bereits erwähnte Überlagerung taxonomischer Klassifikationen kolonialer Zeiten und Räume durch organische und prozessuale Konzeptionen sowie das Alternieren zweier Formen der Aneignung bereister Räume. Die ‚strategische‘, Ordnung und Transparenz stiftende Durchmessung, die auf ein Zentrum der Macht bezogen bleibt und insofern für Universalität steht, weicht zusehends einer ‚taktischen‘, ungeplanten Appropriation von Orten, die Ad-hoc-Gelegenheiten aufgreift, Unübersichtlichkeit zur Folge hat, insofern Effekte von Lokalität erzeugt und die offizielle Ordnung tendenziell unterläuft.30 Strukturell sind derartige Dynamisierungen und Ambiguierungen stets Effekte literarischer Brechungen des periegetischen Substrates. Diese textimmanenten Befunde konvergieren in einem Punkt: Der Lazarillo de ciegos caminantes inszeniert über pikareske Gattungskomponenten Erosionen kolonialer Machtdiskurse. Vor allem die Destabilisierung der Herr-Diener-Konstellation wird in diesem Sinne allegorisch lesbar als beginnender Ablösungs- und Emanzipationsprozeß. So oszilliert der Text zwischen Exposition und Fiktion, zwischen der Exploration des Fremden und Konstruktion des Eigenen und bereitet damit den Boden für den ersten lateinamerikanischen Roman, der sich nunmehr die Form einer reinen Pikareske gibt.
28 Vgl. Stolley (Anm. 15), S. 174–177. 29 Vgl. Walter D. Mignolo: Nebrija in the New World. The Question of the Letter, the Colonization of Amerindian Languages, and the Discontinuity of the Classical Tradition. In: L’Homme 122– 124 (1992), S. 185–207; in allgemeinerer Perspektive die wegweisende Studie zur kulturellen Kolonisierung Lateinamerikas von Walter D. Mignolo: The Darker Side of the Renaissance: Literacy, Territoriality, and Colonization. Ann Arbor, MI 1995. 30 Vgl. oben Anm. 13.
Pikareske Destabilisierungen kolonialer Machtstrukturen
323
5 Periquillo Sarniento Beginn des Romans – Ende der Pikareske In José Joaquín Fernández de Lizardis Periquillo Sarniento (1816) erzählt der titelgebende Held sein Leben ab der Kindheit in der Ich-Form. Er übt sich in den verschiedensten Berufen, bringt seine Erbschaft durch, lernt Armut und Reichtum kennen, frönt den unterschiedlichsten Lastern, landet zeitweise im Gefängnis, fährt zur See bis nach China und zu den Philippinen. Am Ende steht eine Bekehrung, wie sie seit Mateo Alemáns Guzmán de Alfarache (1599/1604) zum festen Repertoire der Pikareske gehört. Hier lässt sich zum einen beobachten, wie das satirische Potenzial der Pikareske im Verhältnis zum Lazarillo de ciegos caminantes weiter ausgereizt wird. Dabei gewinnt die Kritik der spätkolonialen Gesellschaft nunmehr ein spezifisch aufklärerisches Profil, das bei Carrió de la Vandera nur latent erkennbar war. So exemplifiziert Lizardi am Beispiel seines jugendlichen Protagonisten über zahlreiche Emile-Referenzen rousseauistische Erziehungsideale31 und wendet sie am Vorabend der Unabhängigkeit nunmehr scharf antikolonialistisch: Der junge Periquillo ist mit guten Anlagen versehen, die von der Dekadenz der spätkolonialen Gesellschaft jedoch korrumpiert werden und erst am Ende seines Lebens wieder die Überhand gewinnen. Sein Tod gewinnt über die biblische Allegorik des Namens schließlich eine sakrifizielle und utopische Dimension: ‚Sarmiento‘ ist der Weinstock und damit ein altes christologisches Emblem. So wie die Rebe beschnitten wird und dadurch neue Triebe hervorbringt, ermöglicht auch das Opfer Christi allegorice die Bildung neuer Triebe in Gestalt der Gläubigen und der Bildung der Kirche. Trotz und jenseits aller satirischen Schärfe zielt der Tod des Schelms auch auf diese emblematische, ein neues Mexiko beschwörende Bedeutung. Ergänzt wird die Offenheit dieser christologischen Stilisierung durch einen aufklärerischen Utopieentwurf: Auf der Insel Saucheofú, die Periquillo nach einem Schiffbruch auf der Heimreise von Manila kennenlernt, findet er die ideale Gegengesellschaft zu Neuspanien.32 Der aufklärerische Mythos des Wilden wird im Eklektizismus dieses antikolonialen Imaginären ebenso aktualisiert wie eine Zivilisationskri-
31 Vgl. Jüri Talvet: Narrative Maneuvers in the ‚Periphery‘: The Spanish and Latin American Novel during Romanticism. In: Romantic Prose Fiction. Hg. von Gerald Gillespie, Manfred Engel und Bernard Dieterle. Amsterdam, Philadelphia 2008 (A Comparative History of Literatures in European Languages 23), S. 559–579, hier S. 566. 32 José Joaquín Fernández de Lizardi: El Periquillo Sarniento. Madrid 1997 (Letras Hispánicas 421), S. 752–760.
324
Christian Wehr
tik aus externer Perspektive. Lizardi ließ sich in diesem Zusammenhang allem Anschein nach von Montesquieus Lettres persanes (1721) inspirieren. Jedenfalls ist die erste narrative Fiktion Lateinamerikas zugleich die schärfste Polemik gegen die spätkoloniale Gesellschaft und neben dem Lazarillo de ciegos caminantes der zweite Schlüsseltext zwischen Spätkolonialismus und sich anbahnender Unabhängigkeit, der die Tradition des Schelmenromans fortschreibt.33 Sie bleiben damit für lange Jahrzehnte fast die einzigen Texte in dieser Gattungstradition, denn nach der Lösung vom spanischen Mutterland schreiben die Romanentwürfe der jungen Nationen eher melodramatische als satirische Modelle fort. Das subversive Potenzial der Pikareske hat seine Funktion erfüllt, indem es koloniale Texttraditionen unterminierte und schließlich auf utopische Gegenkonstruktionen öffnete. Nach dem Periquillo Sarniento wird die literarische Imagination das politisch Erreichte weiter symbolisch ausdifferenzieren und befestigen, aber kaum noch satirisch subvertieren.
33 Ottmar Ette versteht die Verschiedenes und Gegensätzliches vereinende pikarische Figur dabei als „erzähltechnisch-konstruktive Voraussetzung der Schaffung eines pränationalen Raumes“ (Ottmar Ette: Fernández de Lizardi: ‚El Periquillo Sarniento‘. Dialogisches Schreiben im Spannungsfeld Europa-Lateinamerika. In: Romanistische Zeitschrift für Literaturgeschichte 22 [1998], S. 205–237, hier S. 226).
Register der Eigennamen und Werktitel Aufgenommen sind historische Personen aus dem Untersuchungszeitraum und biblische Figuren, soweit sie im Haupttext oder syntaktisch eingebunden im Fußnotentext erscheinen, und ihnen zugeordnete Werke, gelegentlich auch geläufige Kollektivbezeichnungen für einen Werkzusammenhang (z. B. ‚Simplicianische Schriften‘). Anonym veröffentlichte Drucke sind nach dem Titel eingeordnet. Die Schreibweise wie auch die Wahl der Namen orientiert sich an der Benutzbarkeit; z. B. ist ‚Montesquieu‘ als Lemma aufgenommen, nicht aber – sachlich korrekter – ‚Secondat, Charles-Louis de, Baron de La Brède et de Montesquieu‘. Ebenso sind die Titel älterer Drucke auf die Stichwörter und Kurztitel verkürzt worden, nach denen Benutzer erwartbarerweise suchen werden. Aaron 268 Adelung, Johann Christoph 291, 294 – Geschichte der menschlichen Narrheit 291 – Grammatisch-kritisches Wörterbuch 294 Agricola, Rudolf 78 – De inventione dialectica 78 Alberti, Valentin 240 Albertinus, Aegidius 16, 19, 68, 74, 76 f., 85, 87–89, 91, 128, 214, 283, 285 – Der Landstörtzer Gusmann von Alfarche 16, 73–77, 80, 85, 91, 283, 285 – Hirnschleiffer 89 – Lucifers Königreich und Seelengejaidt 88 – Nosce te ipsum 87 Alemán, Mateo 29, 39 f., 50, 62, 74, 113, 133, 143 f., 156, 207, 283, 323 – Guzmán de Alfarache 17, 19, 39 f., 50, 53, 62, 115, 128, 133, 142–145, 147, 149, 152, 155, 168, 207, 283, 323 Andreae, Johann Valentin 166 – Chymische Hochzeit 166 – Confessio Fraternitatis 166 – Fama Fraternitatis 166 Anhorn, Bartholomäus (d. J.) 118–120 – Magiologia 118 f. Aperger, Andreas 159 Apuleius, Lucius 20, 38, 111–113, 115, 119, 121–126, 129
– Der goldene Esel 20, 111–116, 119, 121–126, 129 f. – Amor und Psyche 113 Aristoteles 193 Augustinus, Aurelianus 113, 121 – De civitate Dei 113 Bacon, Francis 308 Barezzi, Barezzo 90 Beer, Johann 5, 16, 23 f., 29 f., 179–181, 183, 186–188, 190f., 193–203, 205, 208–217, 219, 221–224, 233, 239, 242, 246 f., 271 – Der berühmte Narrenspital 181, 233 – Corylo 24, 180f., 183, 190, 195, 203, 208, 210f., 213–215, 242 – Jucundus Jucundissimus 23 f., 30, 179, 181 f., 187 f., 190f., 193–200, 203, 208, 210, 214–218, 220 – Kurtzweilige Sommer-Täge 209, 218–222 – Der politische Bratenwender 253 – Der Simplicianische Welt-Kucker 180, 186, 188, 190f., 198, 200, 203, 208, 213, 215, 218 – Teutsche Winter-Nächte 208, 218 f., 222 – Der Verliebte Österreicher 191 – Der Verunruhigte Holländische Löw 247 – Willenhag-Dilogie 6, 208–210, 218–220, 222, 224
326
Register der Eigennamen und Werktitel
Billaine, Pierre 147 Blowsnake, Sam 35 Bocskai, Stephan 164 f. Boë, Franz de le → Sylvius, Franciscus Brant, Sebastian – Narrenschiff 100 Breslauische Sammlungen 281, 306 Camerino, José 208 Carrió de la Vandera, Alonso 28, 313–319, 323 – El Lazarillo de ciegos caminantes 27 f., 32, 313–324 Castillo Solórzano, Alonso de 138, 149 f. – La fouyne de Séville 149 – La garduña de Sevilla 138, 149 Cervantes Saavedra, Miguel de 19, 22, 77, 134 f., 140, 153, 159, 161, 163 f., 168–170, 173–177 – Don Quijote 133 – Novelas ejemplares 135, 159, 173 f. – Rinconete y Cortadillo 22, 70, 77–79, 159 Champaigne, Philippe de 268 Chapelain, Jean 113, 148, 152 – Le Gueux, ou la Vie de Guzman d’Alfarache 114, 148 Dacianischer Simplicissimus → Ungarischer oder Dacianscher Simplicissimus D’Audiguier, Vital 153 Diarium Europaeum 246 f. Diogenes. Ein Lustig vnnd Kurtzweylige History 177 Dürer, Hieronymus 4, 29 – Lauf der Welt und Spiel des Glücks 4, 29 Endter, Johann Friderich 186 Endter, Michael 186 Epiktet 239 Ettner von Eiteritz, Johann Christoph 26 f., 29, 31, 275–279, 281, 285 f., 288, 291–295, 297, 299, 301, 304–307, 309 f. – Allamodische Artzney-Affen 277
– Der entlarvte Marckt-Schreyer 275, 277, 279, 286–292, 294 f., 297, 300–303, 305 – Entlauffener Chymicus 276, 291, 301 – Gründliche Beschreibung des Egerischen Sauer-Brunns 305 – Medicinische Maul-Affen-Romane 30, 32, 275, 295, 302, 305, 309 – Rosetum chymicum 288, 293 – Ungewissenhaffter Apotecker 276 f., 291 – Unvorsichtige Heb-Amme 276, 306, 309 – Unwürdiger Doctor 276, 291 f., 301, 305, 308 – Verwegener Chirurgus 276, 291, 307–309 Felßecker, Wolff Eberhard 245 Fichtner, Johann Georg 304 – Parvi fures suspenduntur 304 Fonseca, Pedro da 78 – Institutiones dialecticae 78 Fortunatus 23, 30, 179–191, 193, 196–198, 200–203 Gmelin, Johann Friedrich 278, 293 – Geschichte der Chemie 278 Grimmelshausen, Hans Christoffel von 4 f., 15, 19 f., 27, 31, 93, 96, 98–101, 103, 106–112, 122 f., 126–130, 193, 245, 264, 278, 284 f., 292, 295, 297, 300, 302, 307 – Continuatio 93, 102, 105, 120, 123, 127, 264, 284 f. – Courasche / Trutz-Simplex 111 f., 116, 128, 130, 285 – Simplicissimus Teutsch 4 f., 13–15, 19 f., 64, 93, 95 f., 98–106, 109–112, 114, 116, 122, 126–128, 130, 193, 245–248, 266, 292, 300, 307 – Simplicianische Schriften / Simplicianischer Zyklus 13, 21, 106 f., 127, 245, 278, 307 – Der seltzame Springinsfeld 128, 284 f., 302 – Das Wunderbarliche Vogel-Nest 129 Der grosse Klunkermuz 228
Register der Eigennamen und Werktitel Guarinoni, Hippolyt 280f., 284 – Die Grewel der Verwüstung menschlichen Geschlechts 280, 284 Gülfferich, Hermann 186 Gustav II. Adolf (schwed. König) 116 Happel, Eberhard Werner 117, 304 – Relationes curiosae 117, 304 Harsdörffer, Georg Philipp 78, 82, 85, 246, 283, 286, 307 – Ars Apophthegmatica 78, 85 – Der Grosse Schau-Platz jämmerlicher Mord-Geschichte 283, 307 – Der Große Schauplatz Lust- u. Lehrreicher Geschichte 283 – Frauenzimmer Gesprächspiele 246 – Poetischer Trichter 82 Head, Richard 246 – The English Rogue 246 Heidegger, Gotthard 304 – Mythoscopia Romantica 304 Heliodor 31, 218 Helmont, Johan Baptista van 291, 293, 301 Henricus, Nikolaus, d. J. 159 Hohenheim, Theophrastus Bombastus von → Paracelsus Hondorff, Andreas – Promptuarium Exemplorum 74 Horatius Flaccus, Quintus 82, 225 Hüllinger, Wenceslaus 305 – Kurtze Beschreibung des Carols-Baades 305 Johannes (der Evangelist) 57, 281 Julius II. (Papst) 268 Karl Albrecht (Kf. von Bayern) 107 Karl III. (span. König) 314 Karl V. (Kaiser d. Hl. Röm. Reichs / span. König) 311 Karl VI. (Kaiser d. Hl. Röm. Reichs) 107 Kircher, Athanasius 287 Kirkman, Francis 246 – The English Rogue 246 Kleist, Heinrich von 238 – Marquise von O. 238
327
Kuhnau, Johann 229, 298 – Der Musicalische Quack-Salber 229, 298 La Geneste [Pseud.] 63, 148, 223 – L’avanturier Buscon 63, 148, 207 f. Die Landstörtzerin Iustina Dietzin 15, 19, 29–31, 83–91 La Varenne, François-Pierre de 95 f., 110 – Le cuisinier françois 96 – Le vrai cuisinier françois 96, 110 Lazarillo de Tormes 17, 31, 39 f., 43, 53, 62, 70–72, 93, 114 f., 133 f., 142 f., 145, 147, 149, 168, 195, 206, 220, 319 Lazarillo castigado 159 Le Métel d’Ouville, Antoine 153, 155 – Les nouvelles exemplaires et amoureux 153 Leopold I. (Kaiser d. Hl. Röm. Reichs) 287 Lesage, Alain-René 152 – Gil Blas de Santillane 152 Lizardi, José Joaquín Fernández de 28, 311, 323 f. – Periquillo Sarniento 28, 311, 313, 316, 323 f. Lohenstein, Daniel Casper von 15 – Großmüthiger Feldherr Arminius 15, 31 Lope de Vega Carpio, Félix 136, 140 Lübken, Johann Christoph de 240 Lukian → Pseudo-Lukian Lundorf, Michael Casper 76 – Wißbadisch Wisenbrünlein 76 Luther, Martin 80, 268 Maria Theresia von Österreich 108 f. Masen, Jacob 78 – Ars nova argutiarum 78 Matthias (Kaiser d. Hl. Röm. Reichs) 165 Michelangelo Buonarroti 268 Miscellanea physico-medico-mathematica → Breslauische Sammlungen Molière 152 – Tartuffe ou L’Imposteur 152 Montesquieu 324 – Lettres persanes 324
328
Register der Eigennamen und Werktitel
Moses 267 f. Moscherosch, Johann Michael 99, 100, 234, 239 – Gesichte Philanders von Sittewalt 234, 239
Rotth, Albrecht Christian 225 Rousseau, Jean-Jacques 323 – Émile 323 Rudolf II. (Kaiser d. Hl. Röm. Reichs) 159, 162, 164
La Narquoise Justine 149 Nebrija, Antonio de 322
Salas Barbadillo, Alonso Jerónimo de 131 f., 134–136, 138–142, 144 f., 149–151, 153–158 – Don Diego de noche 136 – La Hija de Celestina 21, 29 f., 131–133, 135–146, 149–151, 153–158 – La ingeniosa Elena 140 Salzmann, Wilhelm 177 – Florent et Lyon / Kaiser Octavianus 177 Scarron, Paul 21 f., 132, 135, 146 f., 149–158 – Le chastiment de l’avarice 151 – Le Roman comique 132, 147, 149 f. – Les Hypocrites 22, 132, 135, 145–158 – Les nouvelles exemplaires et amoureux 153 – Les Nouvelles Tragi-Comiques 132, 149–151, 153 f., 157 – Plus d’effet que de paroles 149 Schielen, Johann Georg 16, 107, 245, 257 f., 272 – Der Frantzösische KriegsSimplicissimus 16, 25, 29–32, 107, 245–248, 251–273 – Historische politische und philosophische Krieg- und FriedensGespräch 272 Seckendorff, Veit Ludwig von 221, 223 – Teutscher Fürsten Stat 221 Seligmann, Gottlob Friedrich 240 Simplicianischer Jan Perus 246, 255, 257, 267 Simplicissimus Redivivus 19 f., 32 f., 96, 98, 106–110, 246 Sorel, Charles 4, 114 f., 147–149 – La bibliothèque françoise 114, 148 – Histoire comique de Francion 4, 147 Spalatin, Georg Burkhardt 177, 197 Sylvius, Franciscus (Franz de le Boë) 291
Omeis, Magnus Daniel 78 – Gründliche Anleitung zur Teutschen accuraten Reim- und Dichtkunst 78 Opitz, Martin 100, 225 Oudin, César 152 – Le Trésor des deux langues 152 Paracelsus 291–293, 308 Pauli, Johannes 233 Perez, Andrea [i.e. Francisco López de Úbeda] → Die Landstörtzerin Iustina Dietzin Petronius, Titus 38 Philipp III. (span. König) 136 Philipp IV. (span. König) 136 Pizarro González, Francisco 318 Poquelin, Jean-Baptiste → Molière Printz, Wolfgang Caspar 20f., 111 f., 116, 119, 121–128, 239 – Der güldne Hund 20f., 29, 111 f., 116–130 Pseudo-Lukian 113, 121–124 Quevedo y Santibáñez Villegas, Francisco Gómez de 6, 17–19, 38–41, 43, 46 f., 49 f., 52, 54–57, 59–64, 133 f., 149, 158, 207 – Vida del Buscón 6, 17–19, 29, 38–41, 43, 46–62, 64, 115, 133 f., 149, 158, 207, 223 Rabelais, François 38, 64, 114 Ribera, Jusepe de 268 Riemer, Johannes 5, 228, 271, 275, 295, 297 – Der Politische Maul-Affe 228, 275, 295, 297 – Die Politische Colica 297 Rojas, Fernando de 135, 139 – Tragicomedia de Calisto y Melibea 135
Register der Eigennamen und Werktitel Theatrum Europaeum 116 f., 247 Theophrastus Bombast von Hohenheim → Paracelsus Thomasius, Jacob 240 Thou, Jacques Auguste de 262 f. Thuanus, Augustus Jacobus → Thou, Jacques Auguste de Thüringen von Ringoltingen – Melusine 181 Tirso de Molina 149 Tristan L’Hermite, François 147 – Le page disgracié 147 Úbeda, Francisco López de 91, 133, 139, 149 – Libro de entretenimiento de la Pícara Justina 115, 133 f., 139, 144 f., 149 – s. auch Die Landstörtzerin Iustina Dietzin Picara genandt, La Narquoise Justine Ulenhart, Niclas 19, 22, 70, 78 f., 159, 161–163, 165–178 – Isaac Winckelfelder und Jobst von der Schneid 19, 22 f., 29 f., 78–83, 159–175 Ungarischer oder Dacianscher Simplicissimus 246 Vega, Garcilaso de la (gen. El Inca) 319 – Comentarios reales de los incas 319 Veronettus, Franciscus [Pseud.] 251 – Der Teutsche Frantzoß 251
329
Wagner, Matthäus 246 Warbeck, Veit 177, 197 – Die schöne Magelone 177, 181, 197 Weise, Christian 5, 24, 27, 30f., 225–242, 271, 287, 295, 297, 298, 306 – Die drey ärgsten Ertz-Narren 27, 226 f., 233, 295, 297 – Die drey Haupt-Verderber in Teutschland 235 – Die drey klügsten Leute 227, 239 – Kurtzer Bericht vom Politischen Näscher 25, 225, 227–232 – Politischer Näscher 24, 30, 225, 227–242 – Der politische Quacksalber 229, 298 f. – Der politische Redner 287 Wormius, Olaus 276 Wündsch, Johann Wilhelm 212 f., 216 f., 223 – Memoriale Oeconomicum PoliticoPracticum 212 f., 216 f. Wyle, Niklas von 113, 121, 124 Zayas y Sotomayor, María de 149–151, 153 – El castigo de la miseria 151 f. – Novelas amorosas y ejemplares 149, 153 Ziegler und Kliphausen, Heinrich Anselm von – Die Asiatische Banise 31

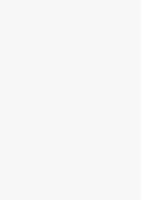



![Romantheorie in der Aufklärung: Thesen und Texte zum Roman des 18. Jahrhunderts in Frankreich [Reprint 2021 ed.]
9783112481325, 9783112481318](https://ebin.pub/img/200x200/romantheorie-in-der-aufklrung-thesen-und-texte-zum-roman-des-18-jahrhunderts-in-frankreich-reprint-2021nbsped-9783112481325-9783112481318.jpg)



