Professor Bédier und die Tagebücher deutscher Soldaten [Reprint 2018 ed.] 9783111602295, 9783111227108
176 107 2MB
German Pages 48 Year 1915
Vorwort
Text
Recommend Papers
![Professor Bédier und die Tagebücher deutscher Soldaten [Reprint 2018 ed.]
9783111602295, 9783111227108](https://ebin.pub/img/200x200/professor-bedier-und-die-tagebcher-deutscher-soldaten-reprint-2018nbsped-9783111602295-9783111227108.jpg)
- Author / Uploaded
- Karl Larsen (editor)
- Alfons Fedor [Übers.] Cohn (editor)
File loading please wait...
Citation preview
Professor Vedier und die Tagebücher deutscher Soldaten
Professor Karl Larsen
Aus dem
Dänischen
von Alfons Zedor Cohn
Berlin 1915 Druck und Verlag von Georg Reimer
All« Rechte, insbesondere das der Über, setzung in fremde Sprachen, vorbehalten.
Vorwort lyofefsor Karl Larsen dürfte der erste in allen Kulturländern gewesen sein, der die Schrift des Professors an der Sorbonne Joseph BLdier ,,Les crimes allemands d’apres des temoignages allemands“ einer textkritischen Untersuchung unterwarf, und zwar int Feuilleton der Kopenhagener Zeitung „Politiken" vom 2i. Februar 1915. Bereits dieser Artikel beklagte Bediers un wissenschaftliche Verallgemeinerung und brachte unwiderlegbare Beispiele für seine mangelhaften Kenntnisse des Deutschen, sowie für seine willkürliche Textauslegung bei. Diese Larsensche Kritik gab in Dänemark Veranlassung zu einer heftigen Pressefehde, die auf Bediers Seite vorwiegend von Kr. Nyrop, dem Professor für romanische Sprachen an der Kopenhagener Universität, unterstützt von einem jüngeren dänischen Archäologen, Dr. Fr. Poulsen von der Carlsberg-Glyptothek, geführt wurde. Professor Nyrop hatte — gleichfalls in „Politiken" — die Bediersche Schrift dem dänischen Publikum mit dem ganzen Gewicht seiner wissenschaftlichen Autorität und ohne den beschei densten Versuch einer kritischen Nachprüfung bedingungslos an empfohlen und hielt, trotz der ernst und gewissenhaft begründeten Angriffe Larsens gegen Bedier, unverrückbar und mit den stärksten Ausdrücken an der Glaubwürdigkeit seines französischen Schütz lings fest. Nachdem Larsen die Bediersche Schrift am 15. März in einem Vortrage vor der Kopenhagener „Gesellschaft für nordische Philologie" der ausführlichen kritischen Behandlung unterworfen
4
hatte, deren deutscher Wortlaut hiermit vorgelegt wird, nahm die dänische, insbesondere die Kopenhagener Presse die Polemik gegen ihn in verstärktem Maße wieder auf, oft, wie in Fällen des genannten Dr. Fr. Poulsen oder eines jüngeren Historikers Dr. I. Lindbaek (von namenlosen Zeitungsschreibern ju schweigen), mit einem ver blüffenden Mangel an Gerechtigkeitsgefühl und ohne von wissenschaft lichen Voraussetzungen Gebrauch zu mache». Die offiziellen wissenschaftlichen Kreise Dänemarks hielten sich gegenüber dieser pseudowissenschaftlichen Hetze gegen Karl Larsen mit außerordentlicher Vorsicht zurück. Eine anerkennenswerte Ausnahme bildete der Professor für Ästhetik und Literaturgeschichte an der Kopenhagener Universität I. Paludan, der anläßlich eines besonders pöbelhaften Überfalls auf Karl Larsen in der stark chauvinistischen Zeitung „Bort Land" einen ernsten Protest ein legte, der mit den für den Ton der ganzen Kontroverse sehr be zeichnenden Worten schloß: „Nach den Erfahrungen, die wir in den letzten 50 Jahren gemacht haben, wird man hier in Dänemark keine besondere Deutschenfteundlichkeit erwarten. Aber so viel Gerechtigkeits gefühl müßte doch selbst in Zeiten, da die Leidenschaften zum Sieden erhitzt sind, übriggeblieben sein, daß man die Meinung aussprecheu hören kann: die Deutschen sind doch in gewisser Weise auch Menschen, und keine Kannibalen." Auch ein bedeutender Mann der dänischen Volkshochschul bewegung, der jetzige Pastor Morten Pontoppidan, stellt sich in seiner Zeitschrift „Freies Zeugnis" auf demselben Standpunkt, indem er schreibt: „Was aus der Urteüskrast wird, wenn erst die chauvi nistischen Leidenschaften mit einem durchgehen, zeigt uns Larsen mit seiner ruhigen und beherrschten Kritik des Geistes produktes des ftanzösischen Professors Bedier. Aus Larsens sorgfältiger und völlig loyaler Untersuchung geht hervor, daß überall, wo man imstande ist Herrn Bsdier zu kontrollieren, er in einer ganz unglaublichen Weife auf den Holzweg geraten ist.... Um so mehr ist es anzuerkennen, daß es uns doch
5 nicht ganz an Schriftstellern fehlt, die als literarische Landes verteidigung unter Waffen treten und solche» Attentaten auf die gesunde Urteilskraft der Nation begegnen können." In Schweden find der Larsenschen Kritik Professor Elis Wadstein von der Gotenburger Hochschule (zuerst in „Göte borgsposten" vom 27. Februar und später im Aprllheft von „Svensk Tidskrift"), sowie der Stockholmer Rektor Professor Carl Hallendorf (in „Svenska Dagbladet" vom 11. und 17. März) gefolgt. Kopenhagen, im Aprll 1915. Der Übersetzer.
0
eiten hat wohl ein Schriftsteller sein Buch hochtrabender ein geführt, als der ftanjösische Gelehrte Joseph BLdier seine Broschüre „Les crimes allemands d’apres des temoignages
mands“.
Ich, Joseph Bedier, Professor am College de France, klingt es dem Leser entgegen, habe mir vorgenommen, eine Reihe von An klagen gegen Deutschland und die deutschen Heere zu beweisen. Oder wie er in seiner Vorrede wörtlich sagt: „Ich werde beweisen, daß die deutschen Heere nicht ganz dem Vorwurf entgehen können, mitunter das Völkerrecht verletzt zu haben. Ich werde es nach französischer Art durch einige vollwertige Aktenstücke be weisen. Durch zuverlässige, genau verglichene Texte! Ich habe mich bemüht, an ihnen mit derselben Genauigkeit und Gewissenhaftig keit Kritik zu üben, mit denen ich bisher bei den Arbeiten des Friedens den Wert einer alten Chronik oder die Echtheit einer Urkunde erörterte. Aus beruflicher Gewohnheit vielleicht und vielleicht aus dem innigen Drange nach Wahrhaftigkeit, jedenfalls aber im Interesse meiner These, richte ich diese Blätter an den ersten Besten, an jeden Beliebigen, an den Gleichgültigen, sogar an den Feind meines Vaterlandes, und ich will, daß jedweder, der diese Broschüre zufällig in seinen Mußestunden öffnet, darin nur Doku mente findet, deren Echtheit ihm ebenso in die Augen sticht, wofern
alle-
7 er Augen besitzt, wie ihre Schändlichkeit sein Herz treffen muß, wofern er ein Herz besitzt. Und ich habe andrerseits gewollt, daß diese Aktenstücke außer ihrer deutlichen Echtheit auch eine deutliche Glaubwürdigkeit be säßen. Es ist leicht anzullagen, aber schwer zu beweisen. Niemals ist es einer kriegführenden Macht schwer gefallen, haufenweise wahre oder lügenhafte Zeugnisse gegen den Feind vorzubringen; aber wenn sie auch in der feierlichste» juristischen Form durch die höchsten Behörde» gesammelt worden sind, so müssen sie unglücklicherweise lange wirkungslos verbleiben: hat nicht nach allem ein jeder, solange die Gegenpartei nicht Gelegenheit gehabt hat, sie kontradiktorisch zu diskutieren, das Recht, sie für Lügen, wenigstens für bestreitbar zu halten? Darum werde ich es vermeiden, obwohl ich sie für wahr halte, hier belgische oder französische Zeugnisse vorzubringen. Die Zeugnisse, auf die ich mich berufe, habe ich so gewählt, daß kein lebender Mensch auf der Welt, selbst nicht in Deutschland, auch nur versuchen kann, sie zurückzuweisen. Die deutschen Verbrechen werde ich durch deutsche Aktenstücke feststellen. Ich entnehme sie vorwiegend den „Kriegstagebüchern", die der Artikel 75 der Felddienstordnung des deutschen Heeres den Soldaten unterwegs zu führen empfiehlt, und die von uns als militärische Papiere den Gefangenen abgenommen worden sind. (Durch Artikel 4 der Haager Konvention von 1907 vorgesehene und gestattete Beschlagnahme.) Ihre Anzahl wächst natürlich unauf hörlich. Ich wünsche, daß die vollständige Sammlung eines Tages zur allgemeinen Erbauung in der germanischen Manuskriptabteilung der Nationalbibliothek hinterlegt werde. Unterdessen bereitet der Marquis de Dampierre, früher Schüler der Ecole des chartes, der Archivar und Paläograph, ein Buch vor und wird es bald veröffentlichen, in dem die Mehrzahl dieser Tagebücher aus dem
8
Felde eingehend beschrieben, abgeschrieben und in das rechte Licht gesetzt werden soll. Meinerseits habe ich nur etwa vierzig durch laufen. Sie genügen meiner Aufgabe." Als Professor Kr. Nyrop mit einem Artikel in der Kopenhagener Zeitung „Politiken" vom 4. Februar 1915 Bediers Schrift bei dem skandinavischen Publikum einführte, benutzte der berühmte Romanist die angeführten Worte der Vorrede, „um dem Leser einen Begriff von dem ruhigen, wissenschaftlichen Tone zu geben, worin das Buch gehalten ist". Bediers Schrift ist für den dänischen Wissenschafter wie für BöHer selbst ein durch und durch wissenschaft liches Werk. Und so einleuchtend klar, daß es in seiner vollen Wahrheit von dem ersten besten Leser, der seine 50 Centimes opfert, erfaßt werden kann! Was will nun dieses Werk beweisen? In seinen ersten Zeilen heißt es: „Ich werde beweisen, daß die deutschen Heere nicht ganz dem Vorwurf entgehen können, mitunter das Völkerrecht verletzt zu haben"; aber auf der 39. Seite des Buches heißt es, er habe bewiesen, daß „derart ein Krieg ist, dessen steche Theorie allein so größenwahnstnnige Pedanten wie Julius von Hartmann, Bernhard! und Treitschke aufstellen konnten: eine Theorie, die dem auserwählten Volke das Recht einräumen will, aus den Gesetzen und Gewohnheiten des Krieges das herauszubrechen, was Jahrhunderte Christen tum und Ritterlichkeit ihnen an Humanität mit großer Mühe eingefügt haben, eine Theorie der systematischen Roheit, die in ihrem empörenden Charakter nun zutage tritt, noch mehr aber in ihrer Torheit und Lächerlichkeit." Eine stärkere Verurteilung der deutschen Kriegsführung läßt sich wohl überhaupt kaum aussprechen, und die erste Enttäuschung, die die Bediersche Schrift dem Leser bringt, ist die, daß im
9
Gegensatz zu den großen Worten das Material, worauf diese wissenschaftliche höchste Instanz sich stützt, ganz außerordentlich gering ist. Von den ungefähr vierzig Dokumenten, die Bedier — wie er schreibt — durchgesehen hat „parcoum“, bringt das Buch unge fähr zwanzig in wenig umfangreichen Auszügen. Und von dieser geringen Anzahl hat man wiederum nur Gelegenheit — durch 14 kleine Faksimiles — den Auszug der Äußerungen von sage und schreibe elf Tagebuchverfassern zu kontrollieren. Wenn der behandelte Stoff fattisch nicht größer gewesen, und die Schlußfolgerungen, zu denen Bedier kommt, von so genereller Natur sind, wie auf der letzten Seite des Buches, dürfte es kaum zu viel gesagt sein, wenn ich — in meinen ersten öffentlichen Bemerkungen über Bediers Buch (in einem Feuilleton in „Politiken" vom 2i. Februar 1915) — ruhig feststellte, es müßte vom wissenschaft lichen Standpunkte aus zunächst als „etwas übereilt" betrachtet werden, daß der große Franzose von einem so überwältigenden Material nur eine so geringe Auswahl behandelt hätte. Schon hierin schien mir Grund genug zu liegen, wie ich mich ausdrückte, „Bediers Zeugnis mit großer Vorsicht auf zunehmen". Doch ich fand diese „Vorsicht" in noch erhöhtem Maße geboten, nachdem ich untersucht hatte, wie Bedier seine wenigen Texte be nutzte. Von vier Faksimlles des Buches entnahm ich einige an scheinend typische Beispiele für die „Unvollkommenheiten", was Lesart, Übersetzung und Zurechtmachung des Textes für das breite Publikum, an das sich die kleine Schrift wandte, betrifft. Es lag von vornherein außerhalb meiner Aufgabe, Bediers Werk zum Gegenstand einer ausführlicheren Kritik zu machen; ich
10
beschränkte mich auf Fälle, welche ich innerhalb des Rahmens der Tagespresse erschöpfend behandeln zu können glaubte, ich schrieb sowohl für die Leser einer Tageszeitung als, wie ich annahm, für Wissenschafter, die aus den angeführten Beispielen weiter folgern würden. Eine Diskussion in der Presse ließ es mir indes als zweck mäßig erscheinen, einige etwas umfassendere Betrachtungen über die Bediersche Schrift zu veröffentlichen, und besonders über die darin enthaltenen Faksimiles nach Tagebüchern deutscher Soldaten, wodurch sich die so sehr gepriesene philologische Methode des französischen Gelehrten nachprüfen läßt. Ich tue dies im wesentlichen auf Grundlage eines Vortrags, den ich auf Einladung der „Gesellschaft für nordische Philologie" in Kopenhagen am 15. März d. Js. für die Mitglieder der Gesell schaft und einige Gäste gehalten habe. Das Erste, was man von einem Manuskriptforscher verlangen kann, der einen wissenschaftlichen Namen hat und gleichzeitig seine exakte wissenschaftliche Methode selbst energisch betont, ist, daß er die von ihm behandelten Texte richtig liest, sie mit der größten Ge wissenhaftigkeit übersetzt, und nichts in diese Texte hineinlegt, was sie nicht genau enthalten. Sodann muß er, wenn — wie von Bödier — seine Texte einem breiten Publikum, dem die kritischen Voraussetzungen fehlen, vor gelegt werden sollen, dafür sorgen, daß auch nicht durch die Art ihrer „Aufmachung" dem Leser ein andrer Eindruck beigebracht werden kann, als er ihn durch Kenntnis der Originale gewinnen würde. Schließlich darf er aus seinen Texten nicht ohne hinlängliche Berechtigung allgemeine Schlußfolgerungen ziehen.— Die von BLdier in seinem Buch der Öffentlichkeit vorgelegten
wenigen Texte sind nur ein außerordentlich kurjer Auszug der Originale, und man wünscht nur allzuoft viel mehr von dem vor und hinter dem Gegebenen Stehenden zu haben, um sich einen klaren Eindruck von de» Ereignissen und den Verfassern bilden zu können. Aber selbst wenn man Bediers oft höchst abrupten Auszug für bare Münze nimmt, scheinen die Behandlung und die Bear beitung seines Stoffes für das große Publikum, ebenso wie die Schlußfolgerungen, die er daraus zieht, mir an bedenklichen Mängeln zu leiden. Das erste Kapitel von Bediers Buch stützt sich auf zwei kleine Tagebuchauszüge, welche vom Gesichtspunkt der Haager Konvention von 1907, Artikel 50, betrachtet werden, ähnlich wie spätere Kapitel in Verbindung mit andere» Artikeln der Haager Konvention gebracht werden. Es muß nun gleich festgestellt werde», daß die juristische Frage selbst, inwieweit bei den geschilderten Vorgängen eine Übertretung der Haager Konvention wirklich vorliegt oder nicht, von Bedier überhaupt nicht gestellt wird. Die Übertretungen werden als genügend erwiesen betrachtet durch den bloßen Hinweis auf eine Reihe von Artikeln in der Haager Konvention von 1907, nämlich die Artikel 1, 2, 23, 28, 47 und 50, die einfach abgedruckt werde» (was Artikel 1 betrifft, nicht einmal vollständig). Indessen hat ein dänischer Rechtsgelehrter, der in Dänemark bekannte radikale Politiker, Rechtsanwalt Oscar Johansen, der dem Völkerrecht sicher alles gibt, was ihm zukommt und der kaum militaristischer Gesinnung verdächtigt werden kann, in „Politiken" (Feuilleton vom 14.-17. November 1914) dem großen Publikum gegenüber gerade darauf hingewiesen, daß man von den erwähnten
12
Artikeln durchaus nicht sagen kann, sie hätten ein klar ausgedrücktes Recht begründet. Oscar Johansen behandelt gerade die Artikel, die die Grund pfeiler der Bedierschen Anklage bilden, nämlich die Artikel 1—2 und 50 und erinnert daran, daß Artikel 2 lautet: „Die Bevölkerung eines nicht besetzten Territoriums, welche bei Annäherung des Feindes aus eignem Antrieb zu den Waffen greift, um gegen die Jnvasionstruppen zu kämpfen, ohne Zeit gefunden zu haben, sich in Übereinstimmung mit Artikel 1 zu orga nisieren, wird als kriegführend betrachtet, falls sie die Waffen offen trägt, und falls sie die Kriegsregeln und Gebräuche befolgt." Aber er fügt hinzu (die Hervorhebungen habe ich vorgenommen): „Diese Bestimmung gibt jedoch Anlaß zu verschiedenen Zweifeln. Was wird hier unter Territorium verstanden? Wann kann man von einem Territorium sagen, daß es besetzt sei? Soll auf Grund des Wortes „Bevölkerung" der Nachdruck auf die Menge gelegt werden, so daß die Bestimmung sich nicht auf das Zudenwaffengreifen einzelner Personen bezieht? In Art. 42 heißt es, daß ein Territorium „für besetzt angesehen wird, wenn es tatsächlich der feindlichen Militärbehörde unterstellt ist". Aber auch hierüber ließe sich rechtlich wie sachlich streiten. Das Zunächstliegende ist wohl, Art. 2 dahin zu verstehen, daß er nur von einer Massenerhebung gegen einen feindlichen Einfall handelt, was auch damit übereinstimmen würde, daß die Initiative dazu von Staaten mit teilweise! Volksbewaffnung aus ging. Aber es liegen viele Fälle zwischen diesem Fall und jenem, wo ein Einwohner in Brüssel nach der Besetzung und Einrichtung der deutschen Verwaltung versuchen wollte, auf die deutschen Truppen zu schießen: Der Mann, der aus Raserei darüber, daß er seine Frau oder sein Kind getroffen und sein Haus bei dem
13
Vordringen des Feindes zerstört sieht, zu den Waffen greift. Dorfbewohner, die den Soldaten bei der Verteidigung helfe», indem sie aus den Fenstern schießen. Die Einwohner von Löwen, die nach der deutschen Darstellung die von der Verfolgung des Feindes nach der Eroberung der Stadt zurückkehrenden, nichtsahnenden Deutschen mit einem Kugelregen empfingen. Für alle solche Fälle gibt es keine Regel, wenn man nicht die Bedingungen zu einer direkten oder analogen Anwen dung des Art. 2 für gegeben hält. Und das ist um so bedauerlicher, als es ja von der größten Wichtigkeit für den Betreffenden selbst ist, ob der zivile Kombattant als Soldat, eventuell als Gefangener, oder als Mörder behandelt werden soll. Alles, woran man sich zu halten hat, sind die schönen Worte der Einleitung zur Konvention über den Landkrieg, die namentlich bei der Auslegung der Art. i und 2 zur Anwendung kommen sollen. Sie lauten folgendermaßen: „Bis eine vollstän digere, systematische Darstellung der Kriegsregeln erscheinen kann, sehen die hohen kontrahierenden Mächte es für zweckdienlich an, zu bestätigen, daß in solchen Fällen, die nicht in den von ihnen angenommenen reglementarischen Bestimmungen enthalten sind, die Bevölkerungen und die Kriegführenden unter dem Schutze und der Herrschaft der Grundsätze des Völkerrechts verbleiben, so wie diese Grundsätze aus den zwischen den zivilisierten Nationen be-stehenden Bräuchen, den Gesetzen der Menschlichkeit und aus den Forderungen der öffentlichen Meinung hervorgehen." Das ist alles sehr schön. Es ist nur der große Fehler dabei, daß es solche, von allen Seite» anerkannte Grundsätze nicht gibt. Mit Recht schließt daher Professor von Liszt in seinem Völkerrecht die Untersuchung über den Art. 2 mit den Worten: „Die Militär mächte werden daran festhalten, der Bevölkerung, die sich in den
14
von ihnen besetzten Gebieten der Kriegsmacht bewaffnet entgegen stellt, ohne den Voraussetzungen des Art. i zu entsprechen, die Eigenschaft der „Kriegführenden" nach wie vor ju versagen." Und im Art. i ist nur die Rede von Freiwilligen, die zum Heere gerechnet werden können, und von denen verlangt wird: i. daß sie „unter Befehl einer Persönlichkeit, die für ihre Untergebenen ver antwortlich ist, stehen sollen", 2. daß sie „ein festes und auf die Entfernung hin sichtbares Abzeichen haben", 3. daß sie „die Waffen offen tragen", und 4. daß sie „sich in ihren Operationen nach den Kriegsregeln und Bräuchen richten". über den Wortlaut des Art. 50 im Reglement über den Land krieg heißt es bei Oscar Johansen: „Eine Kollektivstrafe, weder eine pekuniäre, noch eine andere, kann einer Bevölkerung für individuelle Handlungen, für die sie nicht als solidarisch ver antwortlich betrachtet werden kann, nicht auferlegt werden." Gewiß kann man im Kriege nicht eine sorgfältige Untersuchung der Verantwortlichkeit des einzelnen verlangen, sondern muß sich mit einem summarischen Verfahren begnügen, wobei leicht Irrtümer unterlaufen können. Und sicher sind auch die Ausdrücke im Art. 50, wie leider allzu oft in der Haager Konvention, etwas unbestimmt. — „Betrachtet werden kann als..." überläßt zuviel dem Gut dünken des Bestrafenden. Und wodurch kann man „solidarisch verantwortlich" werden? Durch Teilnahme an einer Handlung oder schon durch Anstiftung, durch nachfolgende BeteUigung, durch Beifall oder sogar auch nur durch Passivität? Im Ausschußbericht über den Art. 50 wird la responsabilite tout au moins passive de cette collectivite verlangt. Und wenn man sich damit begnügt, reicht die Solidarität weit, ebenso wie es verständlich ist, daß der Offizier, auf dessen Leute geschossen wurde, nicht geneigt ist, gerade die engsten Grenzen für die Strafe zu ziehen.
i5
Trotzdem wird man doch kaum das Verfahren berechtigt oder mit dem Art. 50 als feste Regel übereinstimmend finden, einen Ort zu verbrennen und eine zufällige Anzahl zufälliger Bürger zur Exekution herauszugreifen, weil einzelne Bewohner auf den ein dringenden oder sogar den eingedrungenen Feind geschossen haben." Man sieht also, daß ein mit dem Völkerrecht vertrauter Rechts kundiger die Bestimmungen des Artikels äußerst unbestimmt findet. Selbst wenn Bedier weder Jurist ist, noch es zu sein vorgibt, bedarf es doch keines weiteren Nachweises, daß er im allgemeinen wissenschaftlich unverantwortlich handelt, wenn er einem kritiklosen Publikum die unklaren und höchst strittigen Worte der Haager Konvention als klare Rechtsregeln, die keiner Diskussion bedürfen, darstellt. Um so mehr, als der Hauptzweck seines Buches nach seiner eigenen Aussage ein Nachweis dieser Rechtsverletzungen ist. Und wenn man zur philologischen Betrachtung von Bediers Buch übergeht, die er selbst, unter Zustimmung und Beifall anderer Phllologen, wenigstens in Skandinavien, in den Vordergrund ge stellt hat, findet man eine Reihe Verstöße sogar gegen elementare Regeln der Textbehandlung. Die beiden erwähnten ersten kleinen Tagebuchauszüge, die mit Hilfe von Faksimiles sich einer Nachprüfung unterziehen lassen (Bedier S. 7—8, Fig. 1—2), stammen nach Bediers Mitteilungen von einem Gefreiten der deutschen Gardeinfanterie und lauten folgendermaßen: „(Die Einwohner sind geflüchtet im Dorf. Da sa es) graulich aus, das Blut giebt an alle Baute (Bärte?) und was sa man für Gesichter, gräßlich sa alles aus, es wurden sofort sämtlich Tote die Zahl 60 sofort Beerdigt fiele Alte Frauen, Väter und eine Frau welche in Entbindung stand, grauenhabt alles anzusehen, 3 Kinder hatte sich zusammegefast, und sind gestorbe. Altar und Deckern sind eingesiürtzt: Hattesn) auch Telefon Verbindung
i6
mit dem Feind. Und heut morgen den 2. 9. September da wurde sämtlich Einwohne hinansgetrieben, so sah ich auch 4 Knaben die eine Wiege Trugen auf 2 Stabe mit einem kleinen Kinde, 5—6 Monat alt. Schrecklich alles mitanjusehen. Schuß auf Schuß, Donner auf Donner — alles wird geplündert." Es folgen noch einige Worte, die in Bediers Übersetzung nicht mit hineingenommen, aber von deutscher Seite folgendermaßen gelesen worden sind: „Hüner alles ward abgeslchlachjtet", was aber etwas zweifelhaft sein dürste. Aber Bedier fügt hinzu, „au verso“ (also auf der Rückseite) stehe: „Mutter mit ihren beiden Kinder, der eine hatte eine große Wunde am Kopf und ein Auge verloren." Das Soldatenzeugnis, das dieser Text enthält, dürfte bedeuten, daß der betreffende Gefreite (der seiner Rechtschreibung und seinem Stlle nach offenbar ein sehr einfacher Mann ist) am 1. September in einem nicht näher bezeichneten, von den Einwohnern verlassenen Dorfe, wo unter anderm die Kirchengewölbe eingestürzt sind, 60 tote Zivilpersonen, darunter alte Männer, ältere und jüngere Frauen und Kinder, gesehen hat. Dies schlldert er mit starken Ausdrücken des Grausens, das er bei dem Anblick empfand. Es geht nicht unbedingt aus dem Text hervor, aber es scheint so, als ob er das Begräbnis dieser toten Menschen gesehen, ja vielleicht sogar daran teilgenommen hat, und er fügt endlich, gleich nach seiner Schilderung der teilweis zerstörte» Kirche, die für den 1. September abschließenden Be merkungen hinzu: Sie hattesnj auch Telefonverkindung mit dem Feinde. Am 2. September hat er „sämtliche Einwohner vertreiben sehen", was wohl bedeuten soll, „aus dem Ort heraus", nicht nur aus ihren Häusern, darunter Kinder, wie er schildert. Er
i7
findet es schrecklich, das mitansehen jn müssen. Wenn dieser ein fache Mann am i. September schrieb, daß die Einwohner des Dorfes geflüchtet waren, und nun am 2. erzählt, daß sämtliche Einwohner vertrieben wurden, kann man diesen anscheinend un vereinbaren Widerspruch gut verstehen, falls man ein wenig mit der Ausdrucksweise der einfachen Leute Bescheid weiß. Er wollte zunächst ausdrücken, daß die Einwohner im großen und ganzen aus dem Dorfe geflüchtet waren; wenn er einen Tag später „sämt liche" Einwohner vertrieben werden läßt, meint er damit bloß, daß sie nun auch wirklich „sämtlich" fort sind, indem die Deutschen nun auch diejenigen fortjagen, die fie noch bei Hausuntersuchungen oder dergleichen versteckt gefunden haben. Indem folgenden „Schuß auf Schuß, Donner auf Donner" liegt es nah, eine Wiedergabe seiner Eindrücke während der Zerstörung des Dorfes zu sehen, die nach Vertreibung der Einwohner stattfindet, teils durch Spren gung der größeren Gebäude und möglicherweise durch weitere StraffüMerung oder einfaches Niederschießen der Bewohner, sofern fie auf irgend eine Art bewaffneten Widerstand leisten. Danach wird „alles" geplündert fHühner und „alles" wird abgeschlachtet). Zum Schluß verzeichnet er noch auf der Rückseite den Eindruck einer Mutter mit ihren beiden Kleinen, wovon das eine eine große Wunde am Kopf und ein Auge verloren hat. Im großen und ganzen liest Bedier den deutschen Text sicher lich richtig und übersetzt etwas frei und oberflächlich, aber immerhin richtig. Dagegen beleuchtet meiner Auffassung nach schon dieses Bei spiel die wenig glückliche Art, in der Bedier seine Texte benutzt. An seine Wiedergabe des Soldatentextes sowohl vom 1. und 2. September knüpft nämlich Bedier diese Bemerkungen: „Gerechte Larsen, Prof. Bedier.
------
lg
Vergeltung („juste repression“) sagt dieser Soldat: mau hatte Telefouverbindung mit dem Feinde." Die Bemerkung des Soldaten, unmittelbar nach seiner Schilde rung der teilweise zusammengeschossenen Kirche, daß „der (oder die) auch Telefonverbindung mit dem Feinde hatte(n)", berechtigt einen nüchternen Textausleger nicht zu dem Schlüsse, eine Telefon verbindung von seiten der Einwohner mit dem Feinde sei die Ursache gewesen, daß man „repression“ gegen das Dorf übte, indem man es teilweise oder vollständig zerstörte und einen Teil seiner Einwohner füsilierte. Legt man die Betonung auf „auch", könnte die Äußerung bedeuten, daß die Einwohner außer anderen nicht erwähnten, vermeintlichen Versündigungen noch die begangen hatten, Telefonverbindung mit dem Feinde zu unterhalten. Aber es ist recht gut möglich, daß die Bemerkung von der Telefon verbindung, so wie sie — nach einem klaren und deutlichen Kolon — glei ch nach der Beobachtung von der Kirche vorgebracht wird, entweder nur bedeutet, daß die Telefonverbindung der Ein wohner mit dem Feinde von der Kirche ausging oder zugleich auch, daß die Kirche deswegen zerschossen wurde. Unter allen Umständen enthalten die angeführten Worte keinen Beweis dafür, daß die Telefonverbindung, und nur sie allein —, wie es Bedier auslegt — der entscheidende Grund für die Zerstörung gewesen ist — ganz abgesehen davon, daß die Aus sage des einfachen Soldaten, falls ihr überhaupt ein ursächlicher Zusammenhang innewohnt, unmöglich die gleiche Gewähr für den wirklichen Grund enthalten kann, wie etwa eine Aussage des am Platze Kommandierenden. Aber weit schärfer tritt die willkürliche Behandlung der Texte durch den französischen Gelehrten in dem zweiten wiedergegebenen Faksimile des Buches (S. io, Fig. 3) hervor.
19
Es sieht im Abschnitt II, in dem Bsdier die „Massaker" der Deutschen, als dem Art. 2 der Haager Konvention vermeintlich widersireitend, beleuchten will, und rührt von einem preußischen Jnfanterieleutnant Kietzmann her, der schreibt: „Der Feind hat gegen Mittag seine befestigte Stellung ver lassen, ehe unsere Truppen heran waren. Die Einwohner von Diest erzählten, daß die Stadt bereits von Militär entblößt war, ehe der erste deutsche Kanonenschuß fiel. Kurz vor Diest liegt das Dorf Schaffen. Hier hatten sich gegen 50 Zivilisten auf den Kirchturm versteckt und schossen von hier aus auf unsere Truppen mit einem Maschinengewehr. Sämt liche Zivilisten wurden erschossen. Die 149er verloren mehrere Mann, hatten zahlreiche Verwundete. Daraufhin wurde das ganze Dorf in Brand geschossen. Wegen dieser Vorfälle erhielt II/49 den Befehl die Sicherung der durchziehenden Truppen in Diest zu übernehmen. Die Straße entlang standen Posten von 10 zu 10 Schritt. Ich lag mit dem ersten Zuge in einer Brauerei, wo wir freundlich aufgenommen wurden. Uns gegenüber hatten Granaten 3 Häuser in Brand gesetzt. Der 2te Zug 11/49 hat..." Der Text gibt das lebendige Bild eines Dorfkampfes in Bel gien, wie ihn ein gebildeter Mann schildert. Die belgischen Truppen hatten eine befestigte Stellung vor der Stadt Diest und hielte» diesen Ort besetzt, räumen jedoch Stellung und Ort, bevor der erste Kanonenschuß von den vorrückenden deutschen Truppen fällt. Als die Deutschen bei ihrem Vormarsch das Dorf Schaffen kurz vor Diest erreichen, werden sie jedoch vom Feuer eines Maschinen gewehrs empfangen, das von ungefähr 50 Zivilisten, die sich auf dem Kirchturm versteckt hielten, bedient wurde, und es entwickelt sich ein Kampf: „Sämtliche Zivilisten", heißt es, „wurden erschossen. Das I. Bataillon der 49er verlor mehrere Mann und hatte zahl-
20
reiche Verwundete." Daraufhin wird das ganze Dorf in Brand gesteckt und Sicherheitsmaßnahmen gegen etwaige andere Überfälle von seiten der Zivilbevölkerung getroffen. Dann teilt der Tagebuchschreiber mit, daß er mit seinem Zuge „in einer Brauerei freundlich aufgenommen wurde", in der er Quartier erhielt. Es ist ja nun gleichgültig, ob Bedier findet, daß dieses Feuern der 50 Zivilisten auf die Deutschen vom Kirchturm rein individuelle Handlungen sind, für die die Dorfbevölkerung nicht gemeinsam verantwortlich gemacht werden kann (Artikel 50 der Haager Kon vention), oder ob er meint, daß ihr Kampf nur der Ausdruck loyaler Kriegführung von seiten einer „Bevölkerung" (Artikel 2 der Haager Konvention) ist. Unter allen Umständen dürfte es einem großen Publikum gegenüber, das nicht das deutsche Faksimile lesen kann, unverantwortlich sein, wenn Bsdier sowohl in seiner deutschen wie französischen Wiedergabe des Textes die Schllderung des Kampfes der Deutschen mit den 50 Zivilisten auf dem Kirchturm und der Verluste auf beiden Seiten, die sich daran knüpfen, gerade vor der Mitteilung von den Verlusten der Deutschen abbricht und mit denen der Zivilisten allein schließt: „Sämtliche Zivilisten wurden erschossen" — was nach dem Zusammenhange so verstanden werden kann und faktisch auch so verstanden worden ist, daß sämt liche Zivilisten im Dorfe Schaffen zur Strafe für den Überfall der 50 auf die deutschen Soldaten erschossen wurden. Ebenso unrichtig ist es, wenn er nicht zur Beleuchtung der ganzen Situation zwischen den Deutschen und der Zivilbevölkerung der Gegend die einfache Mitteilung des Textes aufnimmt, daß nach dem Jnbrandschießen des Ortes und den notwendigen Sicherheitsmaßregeln gegen weitere Überfälle die Deutschen ganz natürlich und friedlich im Quartier einer benachbarten Brauerei, gegenüber einigen durch Granatfeuer in Brand gesetzten Häusern, aufgenommen wurden.
21
In dem zweiten Text des Kapitels II, das verglichen werden kann (Fig. 4, S. 13), schildert ein sächsischer Soldat vom 1. Ba taillon des 178. Infanterieregiments: ...„abends 10 Uhr rückte 1/178 vom steilen Abhange herunter in das brennende Dorf nörd lich Dinan. Ein entsetzlich schaurig schöner Anblick. Gleich am Eingänge lagen ca. 50 erschossene Bürger, die meuchlings auf unsre Truppen gefeuert hatten. Im Laufe der Nacht wurden noch viele erschossen, sodaß wir über 200 zählen konnten. Frauen und Kinder, die Lampe in der Hand, mußten dem entsetzlichen Schauspiele zusehen. Wir aßen dann inmitten der Leichen unsern Reis, seit Morgen hatten wir nichts gegessen. Beim Durchsuchen der Häuser fanden wir viel Wein und Likör, aber keine Lebens mittel." Hier folgt ein Stenogramm, das so gedeutet worden ist: „Hanptmann H. war betrunken." (Als ein drolliges Seitenstück zu dieser stenographische» Diskretion möchte ich in Parenthese anführen, daß ich in einem dänischen Soldatenbuch von 1864 einen Fall gefunden habe, in dem ein Soldat, aus ähnlichen Motiven wie der deutsche hier, einen Bericht über die Betrunkenheit eines seiner Offiziere bei einer bestimmten Gelegenheit mit den Buch staben in umgekehrter Reihenfolge niederschreibt.) Der deutsche Text schließt: „1 Uhr nachts überschritten wir die Maaßbrücke (die eigentliche war...". Der Soldat erzählt also: Als er mit seiner Abteilung 10 Uhr abends in das Dorf einrückt, lagen am Eingänge desselben 50 Bürger, die erschossen worden waren, weil sie aus einem Hinterhalt Feuer auf die deutschen Truppen gegeben hatten, und im Laufe der Nacht wurden noch mehrere erschossen. Er selbst hat kaum an dem Er schießen teilgenommen, sonst hätte er es wohl erzählt; aber er be richtet, daß „wir" im Laufe der Nacht über 200 Leichen zählen konnten. Und dann kommt ein Satz, der von Bedier mit Recht
22
„obscur“ genannt wird, den er dafür in möglichst grelle Beleuch
tung setzt, nämlich „Franen und Kinder, die Lampe in der Hand, mußten dem entsetzlichen Schauspiele zusehen". Bedier übersetzt den Satz mit „Des femmes et des enfants, la lampe ä la main, furent contraints ä assister a l’horrible spectacie“, als ob im deutschen Texte stünde „sie wurden gezwungen,
dem entsetzlichen Schauspiele beizuwohnen" oder etwas Ähnliches. Hierzu ist zu bemerken, daß das Zeitwort „müssen" durch aus nicht die von Bädier angegebene Bedeutung des „Zwingens" haben muß. Eine der Hauptanwendungen von „müssen" ist (nach Daniel Sanders) die „Bezeichnung der Notwendigkeit (der physi schen wie der moralischen, des Nicht-anders-sein-Könnens)", z. B. in folgendem Zeitungsbericht: „...das Boot schlug um, und die beiden Kinder ertranken. Die verzweifelten Eltern mußten, ohne Hüfe leisten zu können, dem entsetzlichen Schauspiele zusehen." Ähnlich kann der betreffende Satz wiedergegeben werden mit: Frauen und Kinder mußten (d. h. sie konnten nicht anders, konnten dem nicht entgehn) dem fürchterlichen Schauspiele mit ihren Lampen in der Hand zusehen. Das „fürchterliche Schauspiel", wie der Soldat es nennt, dauert nach seiner Angabe die ganze Nacht und umfaßt eine Reihe von Hinrichtungen durch Erschießen, über deren Umfang der Soldat einen Begriff gibt, wenn er sagt, daß er und die andern Soldaten (wir) über 200 Leichen zählen konnten. Im Laufe der Nacht (die Truppen brechen auf, so daß sie um 1 Uhr die Maas brücke passieren) halten die Soldaten Rast und essen ihren Reis in dem zerstörten Orte inmitten der Leichen. Es ist dunkel, und die Lampen in den Händen der Frauen und Kinder erhalten eine natürliche Erklärung durch die Annahme, daß nach Erschießen der Männer die Frauen und Kinder überall im Ort, wo die betreffenden Exekutionen stattgefunden hatten — während die deutschen Sol-
23
baten im Orte Rast halten — im Dunkel mit ihren Lampen in den Händen umherirren, um ihre Toten aufzufinden. Bediers Er klärung erscheint sehr gesucht. Er meint, wie er sagt, daß die deut schen Exekutionskommandos Frauen und Kinder gezwungen hätten, mit den Lampen in der Hand entweder der Exekution oder dem Nachzählen der Leichen beizuwohnen (la fusiliade? ou le denombrement des cadavres?). Als ob die Deutschen, wenn sie Frauen und Kinder zum abschreckenden Beispiel zwingen wollten, der Exekution beizuwohnen, ihnen befehlen könnten, Lampen in die Hände zu nehmen oder selbst welche geben würden. Zu welchem Zwecke? Glaubt Bedier nicht, daß sie das Erschießen, auch ohne es mit Lampen zu beleuchten, genügend sehen könnten? Und glaubt er, daß die deutschen Befehlshaber eine reguläre Aufzählung der erschossenen Zivilisten vornehmen lassen, bei welchen sie Frauen und Kinder zwingen würden, mit Lampen in den Händen dabei zustehen? Ob da ein paar mehr oder weniger erschossen sind, ist den Befehlshabern sicher unendlich gleichgültig; es sind ja keine loyalen Soldaten von ihrer oder der feindlichen Seite. Was der Soldat von einer Nachzählung der Füsilierten berichtet, bedeutet nur, daß er und seine Kameraden im Laufe der Nacht über 200 Leichen, wie es heißt, „zählen konnten". Unter allen Umständen hätte ein hervorragender Wissenschafter beide Lesarten aufnehmen und fie mit seinen Argumenten für und wider darstellen müssen. Bediers m. Abschnitt ist besonders dem Auftreten der Deutschen gegenüber Frauen gewidmet. Von den vier darin behandelten Fällen find ganze drei in Faksimile wiedergegeben, das erste auf zwei Blättern, welche das erste und das letzte Blatt aus dem Tagebuch eines nicht näher mit Namen bezeichneten Mannes sein sollen.
24
Von diesen beiden Blättern (Bedier, Fig. 5—6, S. 15—16) lautet (nach dem Aufzählen verschiedener Orte, durch die der Soldat gezogen ist) das erste: „Dorf durch die elften Pioniere zerstört. 3 Frauen an den Bäumen erhängt hier die erste« Tote gesehen. Ein schauriger anblick. Dann weiter nach Neuschouetere(?) (Neufchateau?) hier eine große Schlacht, die Franzosen mit die Belgier in 4facher Übermacht zwar..." (der Rest durch Übersiemplung undeutlich gemacht), und das zweite: (in Bediers deutscher Wiedergabe: „So haben wir 8 Häuser mit den Einwohnern vernichtet. Aus einem Hause wurden allein") (nun weiter nach dem Faksimile:) „2 Männer mit ihren Frauen und ein 18 jähriges Mädgen erstochen. Das Mädel konnte mir leid tun den sie machte solch unschuldigen Blick, aber man konnte gegen die aufgeregte Menge nicht ausrichten, denn dann sind es keine Menschen sonder Tiere Wir sind jetzt auf den Wege nach Sedan." In dem ersten dieser Texte beschäftigt sich Bedier nur mit den drei toten Frauen, die an den Bäumen hängen, und zwar so, daß er sich nach den Worten des Textes, die nur die Tatsache und das Schaudern des Soldaten bei dem Anblick erwähnen, zu dem Schluß berechtigt glaubt, die Deutschen hätten sie hängen lassen, „damit sie ein Beispiel abgäben, nicht für die andern Frauen des Dorfes (die hatten es sicher schon verstanden), sondern für das Regiment und für andre Regimenter, die noch kommen würden. Es gilt, sich an den Krieg zu gewöhnen, es ist Pflicht, zu ver stehen, daß man bei guter Gelegenheit Frauen tötet". Reine Phantasie! Und daß das Beispiel Früchte getragen hat, glaubt er sich berechtigt, aus der erwähnten letzten Tagebuchseite desselben Sol daten schließen zu können. In Bediers Übersetzung des bereits
25 angeführten Textes wird man sofort bemerken, daß er das Wort „Menge" nicht durch das genau entsprechende französische „foule“ wiedergibt, sondern durch „bände“. Diese etwas freie Übersetzung zieht bereits das Wort zu der Bedierschen Auffassung hinüber, als ob der Soldat mit „Menge" sich selbst und seine Kameraden be zeichnen wollte (vgl. die bei Bödier [@. 24, Note 2] aus einem unkontrollierbaren Zitat genommene Zeile: „... die Artillerie, eine Räuberbande"). Das Wort Menge kann allerdings im älteren Deutsch und in der dichterischen Sprache etwa Körners und Schillers eine Schar von Kriegsleuten bedeuten; in moderner Umgangssprache ist es dagegen gerade der prägnante Ausdruck für Zivilbevölkerung im Gegensatz zur regulären bewaffneten Macht. 3. 95.: Die Polizei trieb die aufgeregte Menge vor sich her. Das klare Verständnis der betreffenden Stelle wird dadurch erschwert, daß Bedier sich hier wie so oft allzu kurzer und unvoll ständiger Zitate schuldig macht. Er beginnt sein Zitatenbruchstück mit: „So haben wir 8 Häuser mit den Einwohnern vernichtet —", ohne daß man erfährt, was diesem „so" vorangeht. Eine klare Ent scheidung der Frage ist so lange unmöglich, als einem nicht das vorangehende Stück des Tagebuchs vorgelegt wird. Aber es er scheint wenig wahrscheinlich, daß die deutschen Soldaten die 8 Häuser mit friedlich darin weilenden Bewohnern zerstört haben sollten; ihre Praxis scheint im allgemeinen die zu sein, daß sie, bevor sie die Häuser zerstören, die Bewohner als Arrestanten hinausjagen und sie dann teilweise standrechtlich, mehr oder weniger summarisch, behandeln. Am wahrscheinlichsten ist es, daß im vorliegende« Falle ein Kampf zwischen bewaffneten Zivilisten („der Menge") und den Soldaten stattfindet, und daß der Tagebuchschreiber in der unlogischen Sprache der einfachen Leute sagt, das junge Mädchen könnte ihm leid tun, aber „man" („wir", wie er kurz vorher schreibt)
26 konnte nichts gegen die aufgeregte Menge „ausrichten", wir mußten ohne Unterschied niedermachen, „denn dann sind es keine Menschen [mit denen man zu tun hat), sondern Tiere". Bsdiers Wiedergabe von „Menge" mit „bände“, und sein Gebrauch von „on“, das in dem einen Augenblick das „man" des Originals wiedergibt und den Soldaten bedeutet (der so wenig aufgeregt ist, daß er das Mädchen bedauert), aber im nächsten Augenblick die „aufgeregte Bande" bezeichnet, nun also ihn selbst und seine Kameraden, die „in solchen Augenblicken" keine Menschen mehr sind, sondern Tiere, scheinen, gelinde gesagt, etwas sehr willkürlich. Bedier will weitere „Zeugnisse beibringen", daß dieses Töten von Frauen und Kindern eine gewohnte Beschäftigung der deutschen Soldaten ist, durch das Faksimile folgenden Inhalts aus einem unsignierten Tagebuch (Bedier, Fig. 7, S. 17): (nach einem unver ständlichen Wort, „um 7.15 h. Abmarsch wieder zur Besetzung der Brücke. Um 10 Uhr Abmarsch nach Orchies angekommen um 4 Uhr, durchsuchen der Häuser. Sämtliche Civilpersone» werden verhaftet. Eine Frau wurde erschossen, weil Sie auf „Halt Rufen nicht hielt, sondern ausreißen wollte. Hierauf vebrennen der ganzen Ortsschaft. Um 7 h. Abmarsch von der brennenden...". Wie dieser Fall beweisen soll, daß besonders Totschlag von Frauen zur täglichen Beschäftigung der deutschen Soldaten gehört, ist mir nicht klar. Er stellt das einfache Niederschießen eines militärischen Arrestanten dar, der entfliehen will und auf den Anruf Halt! nicht siehenbleibt. Ein Niederschießen, das in ähnlichem Falle auf Grund der bestehenden militärischen Bestimmungen in den Straßen Berlins und sicher auch in denen von Paris hätte statt finden können, und zwar ebenso gut bei einem Mann wie bei einer Frau. In seiner ftanzösischen Übersetzung des Faksimiles läßt
27
Bedier sowohl den Anfang „Sämtliche Civilpersonen werden ver haftet" und nach der Schilderung der Tötung der Frau das „sondern ausreißen wollte" aus, wogegen er das folgende mitnimmt: „Hierauf Verbrennen der ganzen Ortschaft", was nun als ein ganz sinnloses Glied in der Beweisführung dafür dasteht, daß der Frauenmord zu der täglichen Arbeit der deutschen Soldaten gehört. In seiner Wiedergabe des Berichts vom Erschießen der Frau übersetzt er „erschossen" durch „passee par les armes“ (ebenso wie in der Wiedergabe des Faksimiles vorher „erstochen" durch „passis ä la balonette“ statt durch „tues ä (de) coups de ba'ionette“). Selbst wenn „passer par les armes“ und „passer ä la balonette“ sowohl für eine Hinrichtung durch Schießwaffen oder durch das Bajonett als auch für ein einfaches Niederschießen oder Niederstechen gebraucht werden kann, erscheint die Anwendung in vorliegenden Fällen wenig glücklich, weil sie, besonders in der letzten Verbindung, wo die ftanzöstsche Wiedergabe des Textes willkürlich gekürzt ist, eine nach einer bestimmten Richtung gehende Erklärung eines etwas zweifelhaften Ausdrucks gibt. Aber die letzte dieser Darstellungen von Untaten, die die Deutschen gegen Frauen verüben, und ihr Gipfelpunkt ist folgende, die von einem gemeinen Reservisten im 4. preußischen GardeArtillerie-Regiment stammt: Das Faksimile (Fig. 8, S. 18) lautet: „Aus der Stadt wurden 300 erschossen die die Salve überlebten mußten Totengräber sein das war ein Anblick der Weiber Aber es geht nicht anders. Auf dem Verfolgungsmarsch nach Wilot ging es besser die Einwohner die verziehen wollten konnten sich nach Wunsch ergeben, wo sie wollten. Aber der schoß der wurde erschossen. Als wir aus Ovele marschierten knatterten die Gewehre. Aber da gab es Feuer Weiber und Alles An der Grenze hatten sie heute ein Husar erschossen und
28 die Brücke gesprengt. Die Brücke wurde wieder hergestellt von de« mutigen Jnfantristen." Hierin wird also zunächst eine Strafvollziehung in einem belgischen Dorfe — unbekannt, aus welchem besonderen Grunde — geschildert. Die, die die Salve überlebten, mußten ihre Kameraden begraben. (Hier dürfte „mußten", im Gegensatz zu Fig. 4, richtig mit „wurden dazu gezwungen" wiedergegeben werden.) Der deutsche Soldat drückt bei dieser Gelegenheit sowohl ein gewisses Mitleid beim Anblick der Frauen, als auch seine Überzeugung aus, daß man gezwungen sei, auf diese Art vorzugehen. Auf dem späteren „Verfolgungsmarsch" nach der Stadt Wilot geht es weniger blutig zu. Man könnte mit Bedier annehmen, daß ergeben ein Lapsus für begeben wäre, und daß die folgende Stelle so, wie Bedier es tut, übersetzt werden müßte: „Die, welche fort wollten, konnten gehen, wohin sie wollten", doch es dürfte besser sei», sich an das „ergeben" des Textes zu halten, und zu übersetzen: „Die Einwohner, welche verziehen wollten, konnten sich ergeben, wenn sie wollten l), (indem wo ja auch bedeuten kann, wenn, vgl. womöglich, oder z. B. wo Du mir nicht hilfst, werde ich sterben müssen), wohingegen es gewiß schwerlich synonym mit wohin sein kann. Aber danach folgt der Teil des Zitates, der allein in der ge gebenen Verbindung Bedeutung hat: „Aber der, der schoß, wurde erschossen. Als wir aus Owele marschierten, knatterten die Gewehre. Aber da gab es Feuer Weiber und Alles." *) Ich möchte hier eine dritte Lesart in Vorschlag bringen, die mir die Gegensätze Wischen friedlichem «nd feindlichem Wesen der Bevölkerung mit ihre» verschiedenen Folgen deutlicher herausarbeitet.
Ich glaube näm
lich, daß zwischen „verziehen" und „wollten" «in „haben" ausgefallen ist, so daß man lesen darf: „...die Einwohner die verziehen jhabenj wollte», konnte» sich «ach Wunsch ergeben, wo sie wollten. «urbe erschossen."
Aber der schoß, der D. Übs.
29
Diesen interpunktionslosen Satz versieht Bedier Kolon, welches auf „les fusiis crepiterent“ folgt) punktion und übersetzt „mais lä, incendie, femmes et und er fugt in einer Fußnote hinzu: „Je respecte dans
(nach einem mit Inter le reste...“ cette phrase
l’obscurite, sans doute volontaire, du texte original.“
Die Fort
setzung, wonach „sie" heute an der Grenze einen (deutschen) Husaren erschossen und eine Brücke in die Luft gesprengt hatten, die von den mutigen Infanteristen wieder instand gesetzt wurde, über springt Bedier sowohl in seiner ftanzösischen wie in seiner deutschen Wiedergabe des Textes. Sein Finale — in dem Zitat wie in dem Abschnitt über die Frauen überhaupt — ist, mit Übersetzung und Note Jnbrandsetzen, Frauen und „der Rest"! Der Ton in der ganzen Aufzeichnung des Soldaten ist ja voll ständig ruhig und weist durchaus nicht Mangel an Mitgefühl (das war ein Anblick der Weiber), sondern sogar einen gewissen Unterton von Zuftiedenheit auf, wenn es wieder friedlicher zugehen kann (...nach WUot ging es besser die Einwohner die verziehen wollten konnten sich nach Wunsch ergebe» wo sie wollten); aber gleichzeitig hat er die feste Überzeugung: „Ordnung muß sind". (Aber es geht nicht anders — Der schoß, der wurde erschossen.) Aber bei der Erzählung vom Ausmarsch aus dem Dorfe Owele verwandelt sich in Bediers Übersetzung plötzlich der ruhig räson nierende, ungekünstelte, einfache Mann in ein wildes Tier, das sich den Mund dabei leckt, daß es da Brand, Weiber und Alles setzt, und das—stilistisch raffiniert — eine „phrase“ von einer „obscurite, sans doute volontaire" anwendet, worauf es wieder ganz ruhig in seinem gewohnten einfachen Stil ohne jede „obscurite" seine Erzählung von dem erschossenen Husar und der gesprengten Brücke fortsetzt. Schon das allein macht Bediers Übersetzung ganz unwahr-
30
scheinlich. Oer herausgerissene Satz „Aber da gab es Feuer Weiber und Alles" kann natürlich dem Wortlaute nach bedeuten: „Aber da setzte es Feuer, Weiber und Alles." Aber Übersetzen ist ja kein sklavisches Übertragen von Wörtern nach dem Lexikon. Es kommt doch darauf an, wer spricht, und in welchem Zusammenhange die Wörter gebraucht werden. Bedier begeht zunächst eine Ungenauig keit, indem er den „Verfolgungsmarsch" der Deutschen einfach mit „marche“ übersetzt, während ein rascher Marsch bei der Verfolgung feindlicher Truppen gemeint ist. Und je weiter er geht, desto schlimmer wird es. Als die Deutschen aus Owele ausmarschieren, erzählt der Soldat, „knatterten die Gewehre". Nun ist der Mann Artillerist, und man könnte annehmen, daß die Gewehre, die er knattern hörte, als er auf seinem Geschütz davonfuhr, von preußischen Infanteristen herrührten, die, mit Bezug auf sein eben erwähntes „Der schoß wurde erschossen", die Bewohner des Ortes, soweit sie auf die Deutschen geschossen hatten, erschossen. Aber die von In fanteristen an einigen Zivilisten, die auf sie geschossen hatten, voll zogene Strafe konnte nicht die mit „Aber da" eingeleitete neue Situation (bei der nicht nur von Feuer, sondern auch von „Weiber und Alles" die Rede ist) zur Folge haben. Die knatternden Gewehre beim Ausmarsch der Deutschen aus dem Dorfe müssen die der Einwohner sein. Die nämlich haben die neue Situation zur Folge: Aber da gab es Feuer — Weiber und Alles! D. h. aber da gaben wir Feuer (was die Soldaten selbstverständlich sofort taten) auf Frauen und alles. Das militärische Kommando lautet ja: Gebt Feuer! Wenn man etwas Übung darin hat, eine Sprache mit dem Ohr aufzunehmen, dann hört man in den Worten des Soldaten gleichsam den Wiederhall eines Kommandos: Gebt Feuer — Weiber und alles! Bediers „obscure“ Auslegung von „alles" hängt vollkommen in der Luft. Nachdem die Deutschen ihre Salven
3i
zur Strafe für den Überfall der Bewohner während des Aus marsches der Truppen aus dem Dorfe abgegeben haben, sind sie auf ihrem raschen Verfolgungsmarsch, wie der Soldat es schildert, weiter gegen die Grenze hin, wo sie den erschossenen Husaren sahen, und über die gesprengte, von den mutigen Infanteristen wieder hergestellte Brücke gerückt. Aber Bedier folgt ihnen nicht so weit. Er hört mit seinen „femmes“ und — „le reste“ auf, der seit La Fontaines Fabel „Les deux pigeons“ in Frankreich sprichwörtliche Bedeutung hat. Das wirkt am besten als Abschluß des Kapitels von den Ver fehlungen der Deutschen gegen Frauen. In dem folgenden Abschnitt IV will Bedier behaupten, daß „wenn eine deutsche Truppe eine Stellung stürmen will, sie oft Zivilisten, Männer, Frauen und Kinder vor sich aufstellt und sich durch diese Schilde lebenden Fleisches deckt". Lange hatte er „la portee“ dieser Berichte bezweifelt, die er darüber gehört habe; aber nun vermag er es nicht länger, nachdem er in den „Münchner Neuesten Nachrichten" vom 7. Oktober 1914 den Bericht eines bayrischen Leutnants gelesen hatte. Bedier gibt — Fig. 9, S. 20 — in Faksimile ein Stück dieses Berichtes, der ja als Wiedergabe aus einer Zeitung nicht ganz auf der Höhe der originalen Tagebuchaufzeichnungen steht. Der be treffende Leutnant erzählt hier, wie er während eines hitzigen Kampfes mit seinen Leuten in einem Hause eingeschlossen war und, um sich von einem höchst belästigenden Flankenfeuer zu befreien, einige zivile Verhaftete, die in seiner Gewalt waren, mit Stühlen auf die Straße setzte, um das Feuer zum Aufhören zu bringen, was auch gelang. Etwas Ähnliches erzählt er von einem andern Leutnant in einer entsprechenden Situation, wo das Ergebnis
32
übrigens das war, daß das belästigende Feuer zwar aufhörte, die Zivilisten aber erschossen wurden. Aus dem Bruchstück, das Bedier veröffentlicht, oder aus seinem eigenen Texte geht nun nicht hervor, ob das belästigende Flankenfeuer von einem Kampf zwischen Deutschen und regulärem französischem Militär allein herrührte, oder ob der Kampf mit Unterstützung der französischen Zivilbevölkerung stattfand, oder sogar vielleicht zwischen Deutschen und der Zivilbevölkerung allein. Was für die Beurteilung des Falles entscheidend sein dürfte. Und wenn Bedier aus diesem Einzelfall den Beweis dafür erbringen will, daß die Deutschen „oft, wenn sie eine Stellung stürmen wollen", Zivilisten ihren Abteilungen voranstelle», so ist es kaum zuviel gesagt, daß er hier eine außergewöhnlich dreiste Verallgemeinerung wagt. Vor Drucklegung dieser Seiten ist es mir indes gelungen, die betreffende Nummer der „Münchner Neuesten Nachrichten" zu beschaffen und dadurch in die interessante Lage zu kommen, auch einmal Bediers Auszug aus seinen Texten mit Hilfe des ganzen betreffenden Dokumentes vergleichen zu können. Danach teilt der Bericht mit, wie dieser Leutnant und Kom pagniechef mit seiner Kompagnie an einem Kampfe mit französischen Truppen auf der Straße nach dem Dorfe St. Marguerite teil nimmt. Als man das Dorf erreicht, „erhalten wir in der Dorfstraße Feuer, und zwar kam es nur aus den Häusern. Obwohl wir die Häuser durchsuchten, finden wir nur Zivilisten darinnen, sie werden verhaftet, die Häuser gehen in Flammen auf". Da von Zivilisten auf die Deutschen geschossen worden ist, wird vom Ober befehl angeordnet, das ganze Dorf niederzubrennen, was auch geschieht. „Endlich liegt St. Die vor uns." Dies wird als ein hübscher und fteundlicher Ort von etwa 15000 Einwohnern ge-
33 schildert: „Die Stadt erschien «ns wie das gelobte Laad, wo wir für einige Tage Erholung von den alltnschwere» Strapajen der vergangenen Wochen erhofften." Der Kompagniechef macht mit seinen Leuten bei einer Fabrik Halt und erhält den Brigadebefehl, weiter bis ans Ende des Dorfes ju rücken, das „anscheinend vom Gegner frei ist". Er marschiert los, „ju meiner Schande will ich gleich gestehn, in Marschkolonne! Aber es schien alles so ftiedlich, die Leute standen auf der Straße, Mädchen winkten «ns lächelnd zu — das Lächeln haben wir allerdings erst später verstanden. — Ein Mann in grauen Haaren springt auf mich jv: „Herr Kapitän, ich führe Sie, ich bin ein Deutscher!" „Sind noch Franzosen in der Stadt?" „O nein! Alle fort!" Wir ziehen an einer Kaserne vorbei: kein Mensch z« sehen. Da schreit einer von meinen Leuten: „Herr Oberleutnant, da drüben hab' ich ein paar rote Hosen gesehen." Ich lasse sofort halten. Das war unser Glück, denn unterdessen sind unsere Radfahrer bis auf 50 Meter an das Rathaus vorgefahren, und plötzlich sehn sie vor sich eine Barrikade. Sehn, Abspringen und Kehrtmachen war das Werk eines Augenblicks, und da rollt schon die erste Salve in unsere dichtgedrückte Marschkolonne. Die Hölle scheint sich aufgetan zu haben, die Häuser speien Feuer aus." St. Dies Einwohner haben also die deutschen Soldaten in eine Falle gelockt. Der Leutnant schildert nun weiter, wie er einen Offizier und neun Mann an Toten und Verwundeten verliert. Alle drücken sich gegen eine Mauer, da sie nicht wissen können, woher die Schüsse kommen. Da sieht er „unseren weißbärtigen französisch-deutschen Larsen, Prof. Dödter.
34
Biedermann auf das Eckhaus zustürzen. Oben drüber steht: „Cafe de l’ünivers“, schon ist er drin, ich rufe mit aller Kraft: „Alles mir nach, ins Haus!" Und nun setzen die Soldaten sich im Hause fest, schleppen die Verwundeten mit hinein und unterhalten ein energisches Feuer unter dauernden bedeutenden Verlusten. Da „erdröhnt der Boden. Eine Granate hat im Hause gerade gegenüber eingeschlagen. Und doch atmen wir erleichtert auf. Es sind die Unsern! Bravo! Wieder eine! Sie kommt schon näher an die Barrikade. Wohl fällt für uns mitunter auch was ab, aber wir kriegen Luft und...". Hier setzt Bediers Zitat erst ein (von dem braven Offiziersstellvertreter, der zurückgelangte und der Brigade von der be drängten Lage der Kompagnie Meldung machte usw.). In dem von Bedier Ausgelassenen liegt also einfach die ganze Erklärung der Situation dafür, daß der Leutnant nachher drei von den verhafteten Zivilisten, deren er sich zum Schutz gegen einen Verrat von seiten der Bevölkerung versichert hat, auf die Straße hinsetzt. — Abschnitt V will die Plünderungen behandeln, bringt aber in seinen 5 Fällen leider nichts andres als diminutive Auszüge von 3 bis 6 Zeilen ohne Beifügung eines Faksimiles. Dagegen bietet Abschnitt VI drei Faksimiles und damit wieder Gelegenheit zur kritischen Würdigung. Bedier will in diesem Abschnitt den Deutschen Gerechtigkeit widerfahren lassen, wenn er erwähnt, daß es auch Tagebuchschreiber gibt, die, „wenn sie von niedrigen Handlungen erzählen, erstaunt, entrüstet, traurig sind", allerdings mit dem bezeichnenden Zusatz, daß er nicht ihre Namen anführen will, „damit sie nicht eines Tages Gefahr laufen, zu Haus getadelt oder bestraft zu werden". Mitleid
35 mit dem Unglück oder Entrüstung über schmähliche Handlungen müssen selbstverständlich in Deutschland eine große Gefahr jur Folge haben! Übrigens ist Bediers Aufzählung von Fällen, die zugunsten von menschlichen Gefühlen der Deutschen sprechen, sehr unvoll ständig. Er führt nämlich nur „jusqu’ ä trois camets“ an, während die Reihe außer diesen 3 jedenfalls noch 5 (Fass. 1—2,4,5,6,8,17), also eine bedeutend größere Anzahl innerhalb des kleinen Materials, umfaßt. Und in Bediers Hauptfall zum Nachweis mildernder Um stände selbst für deutsche Soldaten macht er sich unter allen Um ständen, außer unrichtiger Übersetzung, grober Nachlässigkeit schuldig. Das betreffende Faksimile (Fig. 11, S. 25) eines offenbar gebildeten Soldaten lautet: „...romanischen Stil (3 Schiffe, 1 großes Mittelschiff, 2 kleinere Seitenschiffe) erbauten Kirche. Leider muß ich ein Vor kommnis mitteilen, das nicht hätte stattfinden sollen und dürfen. Aber es gibt auch in unserm Heere entmenschte Kerle, Schweine hunde denen nichts heilig ist. Ein solcher hat in die mit dem Schlüssel verschlossene Sakristei, in der das Allerheiligste stand und in welcher ein P r 0 t e st a n t aus Ehrfurcht vor demselben sich nicht schlafen legte, einen großen Kaktus gesetzt. Wie kann es solche Menschen geben? In der vorigen Nacht hat ein mehr als 3?jähriger Landwehrman», verheiratet, die noch junge Tochter seines Quartierwirtes ver gewaltigen wollen; dem Vater, der dazu kam, setzte er das Bajonett auf die Brust. Hält man so etwas für möglich? Doch der sieht der gerechten Strafe entgegen." In der Übersetzung dieses Textes, den Bedier mit „Leider muß ich..." beginnt, gibt er „die noch junge Tochter" durch „filierte“ wieder. „Die noch junge Tochter" ist ein etwas unbestimmter
36
Ausdruck, da es sich aber um de» Text eines gebildeten Mannes handelt, was sowohl Inhalt wie SÄ, Rechtschreibung und Zeichen setzung genügend verraten, wäre für einen gewissenhaften Übersetzer kein andrer Answeg gewesen, als die Worte buchstabengetreu, eventuell mit einer erläuternden Note über das Unbestimmte des Ausdrucks, wiederzugeben. Bedier wählt indes kurz entschlossen die für die Deutschen am kompromittierendste Auslegung, indem er „die noch junge Tochter" mit „filierte“ übersetzt. Ich glaube, es ist nicht notwendig, viele Worte zu verlieren, um zu erweisen, daß filierte in der gewöhnlichen Umgangssprache „kleines Mädchen" bedeutet, also ein Kind weiblichen Geschlechts vom ftühen Kindes alter an bis zur Geschlechtsreife. Man braucht nicht auf den ftanzösischen Kommissionsbericht im Journal offitiel vom 8. Januar 1915 hinzuweisen, der gerade in einer Reihe von Notzuchtsfällen ein paar kleine Mädchen von 13, 11 Jahren und darunter als filiertes bezeichnet, während junge Mädchen von 19, 21 und 23 Jahren jeunes filles heißen. In Verbindung mit dieser Übersetzung kann angeführt werden, daß Bedier in seiner sonst richtigen Wiedergabe eines andern der drei faksimilierten Manuskripte aus dieser Gruppe — Fig. 10, S. 24 —, worin ein Landwehrmann in den stärksten Ausdrücken das räuberische Auftreten gewisser Leute tadelt, die „eine Schande für unser Regiment und unser Heer sind", „Champs halb zer stört" als „Champs halb gestört" liest. Daß man statt des ersteren die in diesem Falle sogar sehr deutlichen deutschen Buchstaben verkehrt lesen und namentlich sich einbilden kann, daß „stören" denselben Sinn haben kann, wie „zerstören", deutet gerade auch nicht auf übermäßige Sicherheit im Deutschen. Doch Bedier macht in seiner Darstellung des erwähnten Not zuchtsversuches sich gleichzeitig einer Benutzung des Manuskripts
37
schuldig, die im Hinblick auf sein Publikum als unjulässig bezeichnet werden muß. Er läßt nämlich sowohl in seiner deutschen wie in seiner französischen Wiedergabe des betreffenden Textes die beiden letzten Zeilen „Hält man so etwas für möglich? Doch der sieht der gerechten Strafe entgegen" aus und schließt dramatisch mit dem Deutsche», der dem Vater das Bajonett auf die Brust setzt, ohne auch nur durch Punkte anzudeuten, daß das Original noch eine Fortsetzung hat. Man kann nicht zur Entschuldigung hierfür anführen, daß Bediers Buch ja das Original in Faksimile wiedergibt, sodaß jeder die im gedruckten Texte des Buches nicht enthaltenen Zeilen auf der Abbildung sehen kann. Denn Bediers Schrift wendet sich gerade nach seinen eigenen Worten an „all und jeden" und nicht allein an die namentlich in Frankreich und England geringe Minder zahl, die das Faksimile eines mit deutschen Buchstaben geschriebenen deutschen Textes lesen kann. Ebensowenig ist er durch die Behaup tung entschuldigt, daß er durch die Einleitung seines Kapitels VI und durch Aufnahme der Entrüstungsausdrücke des Soldaten über die Besudelung der Kirche genügend Rücksicht auf den Text nach seiner ausgesprochenen Absicht genommen hat: nämlich die Ent rüstung gewisser deutscher Soldaten über die schlechten Handlungen ihrer Kameraden zu beweisen. Denn der Inhalt des Kapitels ist keineswegs auf die Exemplifizierung von besseren Gefühlen deutscher Soldaten beschränkt, sondern malt mit allen Kräften die angeb lichen Schandtaten der deutschen Truppen weiter aus. Daß die Bemerkung des Soldaten „Doch der sieht der gerechten Strafe entgegen", eine leichtfertige und gleichgültige „Vermutung" wäre, erfordert einen Beweis, der sich im Text nicht finden läßt. Die natürliche Auslegung des ruhigen „Doch der sieht der gerechten Strafe entgegen" ist die, daß der Soldat sich auf etwas Tatsäch-
38
liches bezieht, daß sein Kamerad wirklich für seine Handlung einer Strafe von seiten der deutschen Militärbehörden, der einzigen, die überhaupt den Mann bestrafen können, entgegensieht. Hier wird nicht vermutet: „Doch der wird schon bestraft werden" oder etwas Ähnliches; weder die Äußerung an sich, noch der Zusammenhang, in dem sie vorgebracht wird, enthalten etwas Hypothetisches. Und in jedem Falle mußte Bedier als Herausgeber durch Mitaufnahme der Zeilen in seine deutsche Übersetzung es seinen Lesern überlassen haben, darüber zu urteilen, wieweit diese Worte etwas Tatsächliches berichten oder eine bloße Vermutung enthalten mögen. — Von besonderem Interesse ist in demselben Kapitel Bediers Behandlung des letzten seiner darin wiedergegebenen faksimilierten Texte. Der große Forscher führt an, daß ein Soldat vom 177. In fanterie-Regiment, nachdem er die Plünderung (le sac) von Saint Vieth (22. August) und die Plünderung von Dinant (23. August) geschildert hat, diesen Satz schreibt: „Einschlagen von Granaten in die Häuser. alle Gott!" Weiter nichts.
Abends Feldgesang: Nun danket
Der Soldat hat also »ach Bedier zunächst die Plünderung von Saint Vieth geschildert (das müssen wir ihm aufs Wort glauben), aber danach, vor der von Bsdier zitierten „phrase“, also auf dem erwähnten Faksimile (Fig. 12, S. 27), die Plünde rung von Dinant, und zwar ist das keine gewöhnliche Plünde rung gewesen, un piiiage, sondern ein „sac“ (eine „gänzliche Plünderung" «ach Sachs-Villatte, besonders in den geschichtlichen Ausdrücken sac de Troie). Die von dem Soldaten geschilderte Wirklichkeit entspricht dem von Bedier entworfenen Bilde recht wenig.
39
Der Deutsche schreibt: „Vorgehen von Regimentern. Am Tage nach der Maaß j« vorgejvgen. Hinter (unleserlich) gedeckte Stellung. Gewehrfeuer über uns! Ca. 5 Stunden hier verharrte Nachm, gegen 4 o (unleserlich) Vorgehen nach den steilen Ufern der Maaß. Hierselbst in einem Wald Sammeln des 1. Bataillons. Vor uns der Feind: starke Beschießung der Stadt Dinant, helles Brennen der Häuser. Umher irre» von Franzosen, Belgiern (Beobachtungen durch Gläser). Einschlage» von Granaten in die Häuser. — Abends Feldgesang: Nun danket alle Gott... Darnach Holen von Stroh, Einrichten..." Der Mann also, der die vollständige Plünderung von Dinant geschildert haben sollte, hat auf einem fernen Beobachtungsposten gestanden, wo er gesehen hat, wie die Stadt beschossen wurde, Flammen aus den Häusern schlugen, Granaten in die Häuser einschlugen, und wie er ausdrücklich bemerkt, mußte man ein Fernglas haben, um die Personen, Franzosen und Belgier, die umherirren, sehen zu können. Es kann überhaupt keine Rede davon sein, daß er eine Plünde rung schildert. Die Plünderung ist von Bedier hineingedichtet — was man vielleicht so vermuten kann, daß er das Wort „Feind" als „Plüd" gelesen und es als eine Abkürzung für Plünderung aufgefaßt hat, ohne sich davon anfechten zu lassen, daß es dann nicht „der", sondern „die" Plünderung heiße» müßte. Da die ganze Schilderung der Plünderung überhaupt kon struiert ist, so spielt es insofern eine geringere Rolle, daß Bediers Herauspflücken den falschen Eindruck erweckt, der Soldat habe das „lancement de grenades incendiaires dans les maisons“ persönlich gesehen oder sei sogar bei diesem Werfen von Brand bomben in die Häuser dabei gewesen; im Original aber steht „Einschlagen von Granaten in die Häuser". Also das deutliche
40
Bild von gewöhnlichen Granaten, die ans weiter Entfernung in die Häuser einschlagen! Als Beispiel wenig loyaler Wiedergabe dürfte auch angeführt werden, daß Bedier die naive Schilderung des Soldaten von dem Choralgesang am Abend, dem Strohholeu und Einrichten für die Nacht mit Auslassung der beiden letzten Glieder wiedergibt sowie ohne den Gedankenstrich des Originals und den neuen Absatz, die mit großem Nachdruck das Ereignis von dem vorhergehenden trennen. Bsdiers Behandlung dieses Textes ist überhaupt ei» vor treffliches Beispiel dafür, wie ein Text vom philologischen Gesichts punkt aus nicht behandelt werden darf. Nach der mildesten Annahme bekommt er durch falsches Lesen eines keineswegs besonders undeutlich geschriebenen Wortes („Feind") eine Plünderung (die er vielleicht aus andern Berichten kennt) sinnlos in den Text hinein, der die Beobachtung einer Beschießung aus weiter Entfernung schildert. Ferner übersetzt er Granaten (obus) durch Brandbomben (grenades incendiaires), Einschlagen mit lancement. Und er bringt Ereignisse, die — durch Gedankenstrich und neuen Absatz — voneinander in Abstand gebracht sind, in unmittelbare Verbindung. Endlich läßt er einen bezeichnenden Schluß fort, der die unmittelbare Fortsetzung dessen bildet, womit er schließt. Bediers vn. und letztes Kapitel wird zunächst mit einem sehr merkwürdigen Beispiel dafür eingeleitet, wie dieser Dokumentenforscher Manuskripte nicht nur auf die denkbar falscheste Weise lesen und wiedergeben kann, sondern wie er sogar auch Dokumente behandeln kann, die überhaupt nicht existiert haben. Dieser Abschnitt VII ist nach Bediers Absicht den angeblichen Verletzungen des Art. 23 der Haager Konvention durch die Deut-
4i
scher» gewidmet, der die Behandlung von Feinden betrifft, die sich ergeben haben. Zuerst wird — in Anführungszeichen — ein deutsches Doku ment zitiert, ein Tagesbefehl mit den Unterschriften eines Kom pagniechefs, eines Regimentchefs und eines Brigadekommandeurs, wie folgt: „Von heute ab werden keine Gefangene mehr gemacht. Sämt liche Gefangene werden niedergemacht. Verwundete ob mit Waffen oder wehrlos niedergemacht. Gefangene auch in größeren ge schloffenen Formationen werden niedergemacht. Es bleibe kein Feind lebend hinter uns. Oberleutnant und Kompagnie-Chef, Stoy; Oberst und Reginrents-Kommandeur, Neubauer; General-Major und Brigade-Kommandeur, Stenger." Bedier fügt hinzu, er wisse aus offiziellen französische» Ver nehmungen von etwa dreißig deutschen Gefangenen der betreffenden badensischen Brigade, wie alle diese Leute „bestätigen, daß dieser Tagesbefehl ihnen wirklich mitgeteilt (transmis) worden ist", und zwar am 26. August der einen Abteilung von Major Mosebach, der zweiten von Leutnant Curtius usw. Und daß allerdings die meisten gesagt haben, sie „wüßten nicht, ob der Befehl ausgeführt worden ist", aber drei beziehungsweise zwei behaupten doch gesehen zu haben, daß Verwundete im Walde von Thiaville getötet, nachdem man ihnen Pardon gegeben hatte, und daß am Wege nach Thiaville andre Verwundete umgebracht wurden, die in Gräben „gefunden" waren. Dieser mit der Unterschrift von drei namentlich bezeichneten deutschen Offizieren versehene, sorgfältig zitierte Tagesbefehl, von dem die deutschen Soldaten bestätigen sollten, daß er ihnen
42
von ihren Offizieren mitgeteilt worden war, ist von dem „ebenso genauen wie gewissenhaften" französischen Forscher — konstruiert! Er hat niemals einen solchen Tagesbefehl in der Hand gehabt. In der 4. (vielleicht schon in der 3.) Auflage seines Buches teilt Bedier in einer „Note additioneiie“ mit, daß der Tagesbefehl von ihm selbst zusammengestellt worden ist, auf Grundlage dessen, was die oben genannten etwa dreißig deutschen Gefangenen von einem Tagesbefehl erzählt haben, der „ihnen mündlich von ver schiedenen Offizieren verschiedener Truppenteile der Brigade mit geteilt worden ist, und daher kann die Form, in der wir ihn mit geteilt haben, etwas unvollständig oder geändert sein." Nach dieser Mitteilung wundert man sich nicht darüber, daß Bedier in der 1. Ausgabe ausdrücklich erklärt, daß er zu seinem Dokument nicht „General Stengers eigenhändiges Autograph" beibringen kann. „Aber", fährt Bedier fort, „es fällt mir nicht schwer, um ganz ähnliche Verbrechen zu erweisen, hier deutsche Autographen beizubringen." Und das erste deutsche Autograph, das gegen Verwundete begangene Verbrechen beweisen soll, rührt von einem mit Namen genannten Soldaten im in. Reserve-Infanterieregiment her. — Das von Bedier (Fig. 13, S. 30) mitgeteilte Bruchstück lautet: „wurde der 8ten Corporalschaft zugeteilt Straße voll franz. Leichen Pferden Amssionswagen? etc. Abends 6 Uhr Battallionsappel Nachher Einteilung der Wachen. Wurde zum Schleichpatrouillen commandiert 4mal laufen durch Wald etwas (unleserlich). Im Wald eine sehr schöne Kuh nebst Kalb angeschossen gefunden auch wieder franz. Leichen schrecklich verstümmelt Heute ist Sonntag aber kein Gottesdienst denn das ganze Dorf ist fast ganz zusammengeschossen, St. Remy." Der Schauplatz dieses Berichts ist also das Gelände bei dem
43
Dorfe St. Remy, das die Deutschen von den Franzosen erobert haben und nun besetzt halte«. Das Dorf ist von dem deutschen Artilleriefeuer fast ganz zusammengeschossen, wobei vermutlich auch das umliegende Gelände verheert worden ist. Der Soldat hat das Schlachtfeld voller französischer Leichen gesehen und sieht ferner mit einer Schleichpatrouille in einem Walde zwei angeschossene Stück Vieh, „wiederum französische Leichen schrecklich verstümmelt". Bedier benutzt von diesem Text nur die drei Zeile», die er auf Deutsch wiedergibt: „Im Wald, eine sehr schöne Kuh nebst Kalb eingeschossen (es steht „angeschossen" da) gefunden; und (es steht „auch" da) wieder stanz. Leichen schrecklich verstümmelt". Man kann nicht gerade sagen, daß dieser deutsche Text mit besonders minutiöser Sorgfalt wiedergegeben ist; eingeschossen ist positiv falsch und abattre kann nicht einschießen bedeuten, was das richtige „anschießen" auch nur bei einer etwas gezwungenen Aus legung bedeuten könnte. Aber das sind Kleinigkeiten im Vergleich zu Bediers Aus legung der „schreMch verstümmelten ftanzösischen Leichen". Er sagt selbst: „Soll man das so verstehn, daß es sich um durch loyale Waffen verstümmelte, z. B. durch Granaten zerrissene Leichen handelt? Das ist möglich; aber das wäre eine wohl wollende Auslegung, welche das folgende Schriftstück widerlegt." Das folgende Schriftstück (Fig. 14,15,16, S. 32, 33 und 35) besteht aus einem dreiteiligen Faksimile nach einer Zeitung, worin ein preußischer Unteroffizier des 154. Infanterieregiments — in einer in jedem Kriege bei allen Nationen vorkommenden groß sprecherischen Weise — von einem ungewöhnlich heißen Wald gefecht erzählt, das „mit der größten Erbitterung" geführt wird, bei dem nicht Pardon gegeben wird, aber in dem während des Kampfes sowohl Verwundete, die von den Bäumen herabgeschossen
44
worden sind, wie Unverwundete, die sich tot gestellt haben, erschossen oder mit Kolben und Bajonett niedergemacht werden, nnd von dem übrigens doch erzählt wird, daß dennoch Gefangene gemacht wurden und nirgends andre „Verstümmelungen" des Feindes erwähnt werden als die, die durch Kolbenschläge und Bajonett stöße verursacht wurden. Das hindert Bedier aber nicht, weiter zu frage«: „Wünscht man noch ein neues Dokument, um zu zeigen, in welchem Grade es im deutschen Heere üblich ist, die Verwundeten zu verstümmeln?" und als Beweis führt er das letzte Faksimile des Buches (Fig. 17—18 S. 37—38) nach einer Aufzeichnung eines mit Namen genannten deutschen Pioniers an. Der Soldat schreibt: „...Dörfer sieht. Kein Haus ist mehr ganz. Alles eßbare wird von einzelnen Soldaten requiriert. Mehrere Haufen Menschen sah man, die standrechtlich erschossen wurden. Kleine Schweinchen liefen umher und suchten ihre Mutter. Hunde lagen an der Kette und hatten nichts zu ftessen u. zu saufen u. über ihnen brannte die Häuser. Neben der gerecht Wut der Soldaten schreitet aber auch purer Vandalissmus). In ganz leeren Dörfern sdurchstrichen: stecken) setzen sie den roten Hahn ganz willkürlich auf die Häuser Mir tun die Leute (eit. Wenn sie auch unfaire Waffen gebrauchen so ver teidigen sie doch nur ihr Vaterland. Die Grausamkeiten die verübt wurden u. noch werden von seiten der Bürger werden ernst gerächt. Verstümmelungen der Verwundeten sind an Tagesordnung. 12. 8. 14. Bis jetzt habe ich mir noch nicht (unleserlich) getan,..." Eine lange Erklärung erübrigt sich. Der Soldat schildert mit dem Grauen und Mitgefühl, die auf
45
Grund des Bedierschen Materials offenbar beinah als allgemein bei den deutschen Soldaten bezeichnet werden müssen, die Zerstörungen der feindlichen Dörfer. Er erwähnt sowohl die Standgerichte und ihre Wirksamkeit und zugleich die rücksichtslose Zerstörung, die nicht ein Ausdruck „berechtigter Raserei" ist, sondern „reiner Vandalismus". Darauf fügt er eine neue Zeile hinzu: „Die Grausamkeiten, die verübt wurden und noch verübt werden von seiten der Bürger (also gegen die deutschen Soldaten), werden ernst gerächt." Und danach, ebenfalls eine neue Zelle: „Verstümmelungen der Verwundete» sind an der Tages ordnung." Wenn das nicht einfach als Verstümmelung (von seiten der „Bürger") an deutschen Verwundeten, die in ihre Hände fallen, zu verstehen ist, so verstehe ich überhaupt nicht, wie man einen ein fachen Text ungekünstelt lesen soll. Ganz abgesehen davon, daß die Deutschen sich gerade sehr oft über Verstümmelungen der Ver wundeten zu beklagen haben. Aber Bedier liest „ernst" als „wüst", trotzdem bei dieser Lesart das Wort mit einem besonders langgereckten „w" beginnen würde, das von allen andern „w" des Manuskripts verschieden wäre, und trotzdem über dem Buchstaben, der das „ü" bedeuten sollte, die Punkte fehlen, trotzdem alle andern „ü" des Manuskripts deutliche Punkte haben (z. B. „Bürger" gleich darüber und „Verstümme lungen" gleich darunter) mit Ausnahme eines ü in willkürlich, wo man doch durch eine Lupe Spuren zweier schwacher Punkte wahrnehmen kann. Ferner legt er es als einen Ausdruck der „wüsten" Rache der Deutschen aus, daß sie Verwundete verstümmeln, also die ver wundete» Bürger! Ein weiterer Kommentar erscheint überflüssig. —
46
Ich habe nun sämtliche von Bedier in Faksimile wieder gegebene Dokumente behandelt, die einzigen, über die eine Kontrolle möglich ist. Es hat sich gezeigt, daß sie in keineswegs einwandfreier Weise gelesen, oft mangelhaft übersetzt und häufig im Umfang zu beschränkt sind, um ein klares Verständnis der Texte zu ermögliche», daß sie endlich auch in wichtigen Fällen falsch aus gelegt worden sind. Ferner hat der berühmte Gelehrte es nicht für notwendig gehalten, seinen Hauptausgangspunkt, die angebliche Verletzung der Haager Konvention, der geringsten wissenschaftlichen Prüfung zu unterziehen, obgleich das Verständnis der betreffenden Artikel des Haager Abkommens, nach der Aussage Rechtskundiger, ein recht schwieriges wissenschaftliches Problem darstellt. Endlich zieht er auf Grund seines außerordentlich geringen Materials, das überdies einem höchst begrenzten Kriegsschauplatz und Kämpfen von ganz besonderem Charakter entnommen ist, unberechtigte verallgemeinernde Schlüsse auf die deutsche Krieg führung überhaupt. Daß er außerdem aus mündlichen Erklärungen ein obendrein mit Unterschriften versehenes Dokument konstruiert hat, darf schließlich auch nicht vergessen werden, ebensowenig wie, daß er das Material für das große Publikum, an das sich sein Buch wendet, an mehreren Stellen derartig hergerichtet hat, daß es weitere Mißverständnisse hervorrufen muß. Professor Bediers Vorgangsweise ist durch und durch un wissenschaftlich, und man ist berechtigt, nach der Behandlung der Texte, die sich kontrollieren lassen, und nach dem im übrigen in dieser Analyse Angeführten auf den übrigen Inhalt des Buches zu schließen.
47
Anstatt des ganzen Meisterwerks philologischer Methode, das Bedier selbst geleistet zv haben vermeint, und das andre, zum Teil berühmte Philologen ohne weitere Untersuchung ihm nachgerühmt haben, hat der französische Gelehrte in Wahrheit eine schwach begründete und durchgeführte agitatorische Arbeit zustande ge bracht, während es einem Manne der Wissenschaft — geschweige einem hervorragenden Manne der Wissenschaft — geziemt hätte, eine gründliche und erschöpfende Behandlung des ganzen ein schlägigen großen Materials, das die französische Regierung gesammelt hat, abzuwarten, ehe er eine Meinung über die Schlußfolgerungen abgab, die sich vielleicht daraus hätten ziehen lassen. Ich war der erste, der — im Feuilleton des Kopenhagener Blattes „Politiken" vom 21. Februar — betonte und durch Bei spiele beweisen zu können glaubte, daß Bediers „Zeugnis mit großer Vorsicht aufgenommen werden müsse", sowohl auf Grund gewisser Beispiele wie wegen der „etwas übereilten Verallgemeine rungen", die sich der französische Verfasser auf Grund eines sehr geringen Materials gestattete. Kurz danach erschien in der „Norddeutschen Allgemeinen Zeitung" vom 28. Februar von deutscher Seite eine umfassendere Kritik von Professor A. Hollmann, die unter Benutzung der von mir aufgeführten Fälle eine Reihe neuer vorbrachte, wovon ich in vorliegender Abhandlung mehrere ausführlicher, aber oft in andrer Art, behandelt und denen ich weitere hinzugefügt habe. Professor Hollmann gab seiner Kritik die Überschrift: „Professor Bedier — Handschriftenforscher und Verleumder" und rückte etwas von mir ab, indem er meinte, ich habe mich „sehr milde" aus gedrückt und Bedier könnte sich nicht dem Vorwurf „bewußter Fälschung" entziehen.
48
Ich glaube, Professor Hollmann hat Unrecht, sogar im Falle der Konsiruierung des unterzeichneten Tagesbefehls. Der berühmte französische Gelehrte hat sicher nicht mit Be wußtsein fälschen wollen. Aber seine Schrift bedeutet für mich ein trauriges Zeugnis dafür, daß selbst bei großen Wissenschaftlern nicht nur die Kennt nisse versagen können, sondern daß auch diese Menschenkinder in erregten Zeiten von dem Lärmen des Blutes im Hirne überwältigt werden, das ihnen die klare Besinnung benimmt, sie der methodisch erworbenen Fertigkeit beraubt und von dem voraussetzungs losen Suchen nach Wahrheit auf die wilden Wege der Leidenschaft lichkeit hinausführt. Niemand kann tiefer als ich die Schrecken, die ein Krieg mit sich bringt, beklagen, geschweige die Überschreitungen des Völker rechts und der Gesetze der allgemeinen Menschlichkeit, die ebenso zweifellos in einem Kriege vorkommen können. Aber ich empfinde mit ebenso großer Stärke das Bedürfnis, jeder Partei gerecht zu werden, gleichgültig, auf welcher Seite der kriegführenden Mächte — aus politischen oder andern Gründen — die Sympathie von vornherein liegen mag, und ich halte es für eine hohe menschliche Pflicht, auch Verirrungen eine verständnis volle Untersuchung und eine objektive Beurteilung zuteil werden zu lassen. Nichts empört mich mehr, als die hysterische Lynchjustiz, die in der erregten Massensuggestion wurzelt. Wer dazu beiträgt, die Wildheit in den Massen zu erregen oder zu steigern, hat nach meiner Auffassung eine um so schwerere Ver antwortung, je größer seine Geltung auf wissenschaftlichem »der anderen Gebieten ist.





![Die Wärme- und Kraftversorgung deutscher Städte durch Leuchtgas [Reprint 2019 ed.]
9783486730685, 9783486730678](https://ebin.pub/img/200x200/die-wrme-und-kraftversorgung-deutscher-stdte-durch-leuchtgas-reprint-2019nbsped-9783486730685-9783486730678.jpg)
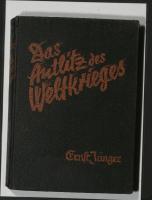
![Die Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände [2., unv. und verm. Aufl. Reprint 2018]
9783111528250, 9783111160078](https://ebin.pub/img/200x200/die-hauptstelle-deutscher-arbeitgeberverbnde-2-unv-und-verm-aufl-reprint-2018-9783111528250-9783111160078.jpg)
![Die Baumwollfrage vom Standpunkt deutscher Interessen: Betrachtungen und Vorschläge [Reprint 2021 ed.]
9783112389140, 9783112389133](https://ebin.pub/img/200x200/die-baumwollfrage-vom-standpunkt-deutscher-interessen-betrachtungen-und-vorschlge-reprint-2021nbsped-9783112389140-9783112389133.jpg)
