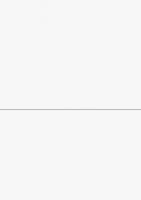Hegels Seinslogik: Interpretationen und Perspektiven 9783050047010, 9783050033471
Der Band enthält Beiträge zu allen drei Abschnitten der Lehre vom Sein in Hegels ‚Wissenschaft der Logik’ (Qualität, Qua
236 72 41MB
German Pages 333 Year 2000
Recommend Papers

- Author / Uploaded
- Andreas Arndt (editor)
- Christian Iber (editor)
File loading please wait...
Citation preview
Andreas Arndt/Christian Iber
Hegels Seinslogik
(Hg.)
HEGEL-FORSCHUNGEN Herausgegeben von Andreas Arndt, Karol Bai und
Henning Ottmann
Andreas Arndt/Christian Iber
(Hg.)
Hegels Seinslogik Interpretationen und Perspektiven
Akademie Verlag
CIP-Einheitsaufnahme
Die Deutsche Bibliothek -
Hegels Seinslogik : Interpretationen und Perspektiven / Andreas Arndt/ Christian Iber (Hg.). Berlin : Akad. Verl., 2000 -
(Hegel-Forschungen) ISBN 3-05-003347-9
© Akademie Verlag GmbH, Berlin 2000 Der Akademie Verlag ist ein Unternehmen der R.
Oldenbourg-Gruppe.
Das Papier ist alterungsbeständig nach DIN/ISO 9706.
Alle Rechte, insbesondere die der Übersetzung in andere Sprachen, vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form durch Photokopie, Mikroverfilmung oder irgendein anderes Verfahren reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen oder übersetzt werden. -
-
Druck und Bindung: Druckhaus „Thomas Müntzer" GmbH, Bad
Printed in the Federal
Republic of Germany
Langensalza
Inhalt
Andreas Arndt/Christian Iber Vorwort
9
Erster Teil
Orientierungen Christian Iber Was will Hegel eigentlich mit seiner Kleine Einführung in Hegels Logik
Wissenschaft der Logik?
Christine Weckwerth Sein unter dem Aspekt einer Forschungslogik. Zur unterschiedlichen Strukturierung des logischen und phänomenologischen Wissens bei Hegel Pirmin Stekeler-Weithofer Kritik der Erkenntnistheorie. Zur Logik von Gegenstandsbezug und Wahrheit bei
13
33
Hegel (und Wittgenstein)
59
Zweiter Teil Das Problem des Anfangs und die Logik von Sein, Nichts und Werden Milan Sobotka
Hegels Abhandlung Womit muß der Anfang der Wissenschaften gemacht werden ? und Reinholds Beyträge
80
Hans-Jürgen Gawoll Der logische Ort des Wahren. Jacobi und Hegels Wissenschaft vom Sein
90
Milan Prucha Seinsfrage und Anfang in
109
Hegels Wissenschaft der Logik
Andreas Arndt Die anfangende Reflexion.
Anmerkungen zum Anfang der Wissenschaft der Logik
126
Anton Friedrich Koch Sein Nichts Werden
140
-
-
Dritter Teil Zur Logik des Daseins Heinz Kimmerle Das Etwas und (s)ein Anderes. Wie das 'spekulative Denken' das Andere (des Anderen) zum Verschwinden bringt
158
Önay Sözer
Grenze und Schranke das Mal des Endlichen
173
-
Peter-Ulrich Philipsen Nichts als Kontexte. Dekonstruktion als schlechte Unendlichkeit?
186
Claus-Arthur Scheier Die Negation im Dasein. Zum systematischen Ort eines methodischen Terminus in Hegels Wissenschaft der Logik
202
Vierter Teil Zur Logik des Fürsichseins Günter Krack Moment und Monade. Eine systematische Untersuchung von
G.W. Leibniz und G.W.F.
zum
Verhältnis
Hegel am Beispiel des Fürsichseins
Friedrike Schick Absolutes und gleichgültiges Bestimmtsein Das Fürsichsein in -
Hegels Logik
215
235
Wolfgang Lefèvre Repulsion und Attraktion.
Der Exkurs "Die Kantische Konstruktion der Materie aus der Attraktiv- und Repulsivkraft" in Hegels Wissenschaft der Logik
252
Fünfter Teil Zur Logik der Quantität und des Maßes Renate Wahsner "Der Gedanke kann nicht richtiger bestimmt werden, als Newton ihn gegeben hat". Das mathematisch Unendliche und der Newtonsche Bewegungsbegriff im Lichte des begriffslogischen Zusammenhangs von Quantität und Qualität
271
Ulrich Ruschig Die "Knotenlinie
301
von
Maaßverhältnißen" und materialistische Dialektik
Siglen
315
Auswahlbibliographie
317
Personenregister
331
Andreas Arndt/Christian Iber
Vorwort
vorliegende Band versammelt Beiträge zu allen drei Abschnitten der Lehre vom Sein in Hegels Wissenschaft der Logik (Qualität, Quantität, Maß) und ist als Arbeitsbuch für Studenten und Dozenten konzipiert. Die Autoren haben ihre Beiträge eigens zu diesem Band verfaßt. Die Interpretationen vereinen die Bemühungen um die textnahe Erschließung des Hegelschen Gedankens mit einer Klärung seiner historischen Voraussetzungen und einer Diskussion seiner systematischen Perspektiven. Damit soll die Seinslogik nicht nur ihrer systematischen Bedeutung entsprechend stärker in das Blickfeld der Auseinandersetzung mit Hegel gerückt, sondern es sollen auch Anstöße zu weiteren Forschungen und Diskussionen gegeben werden, die sich weder im bloßen "Buchstabieren" noch in einem gängigen Vorwissen darüber, was der Kern des Hegelschen Denkens ausmache, erschöpfen. Der erste Teil Orientierungen enthält Beiträge von Christian Iber, Pirmin Stekeler-WeitDer
hofer und Christine Weckwerth, die von ganz unterschiedlichen Standorten aus die Gesamtkonzeption von Hegels Logik beleuchten und eine Situierung der Seinslogik in ihr vornehmen. Die Teile II bis V des Bandes orientieren sich am kategorialen Aufbau der Hegelschen Seinslogik. In Umkehrung der traditionellen Vorrangstellung der Quantität vor der Qualität bei Aristoteles und Kant1 beginnt die Seinslogik mit dem Abschnitt Qualität (Bestimmtheit). Die Priorität der Qualität vor der Quantität ist bei Hegel darin begründet, daß die Quantität die Abstraktion von der ihr vorausgesetzten Qualität ist.2 Hegel erörtert aber nicht nur die qualitative Bestimmtheit vor der quantitativen, sondern handelt innerhalb des Qualitätsabschnitts zuerst das Sein in seiner unbestimmten Unmittelbarkeit ab (1. Kapitel) (vgl.
HW5, 81).
Der Anfang der Hegelschen Logik und die dialektische Bewegung von reinem Sein über das Nichts zum Dasein qua bestimmtem Sein nehmen einen Sonderstatus innerhalb der Seinslogik ein, weil beides mit grundsätzlichen Problemen verbunden ist. Die Beiträge im 1 2
Vgl. Aristoteles, Kategorien. Lehre vom Satz. hg. v. E. Rolfes, Hamburg 1974, 5bllff„ 6a20ff., 10bl3ff„ 10b26ff.; vgl. Kant, KrV A, 70ff., 80ff. u. B, 96ff, 104ff. Im einem Anhang zum Abschnitt "Womit muß der Anfang der Wissenschaft gemacht werden?" gibt sich Hegel unter dem Titel "Allgemeine Einteilung des Seins" Rechenschaft über Aufbau und Kategorieneinteilung seiner Lehre vom Sein (vgl. HW 5, 79ff). Die Quantität heißt es dort ist die "negativ gewordene Qualität" bzw. "die aufgehobene, gleichgültig gewordene Qualität", setzt also die Qualität voraus (ebd., 80). -
-
Andreas Arndt/Christian Iber
Hans-Jürgen Gawoll, Andreas Arndt und Milan Prucha beschäftigen sich mit dem Problem des Anfangs der Logik und des Verhältnisses von Logik und Phänomenologie des Geistes sowohl in systematischer als auch in philosophiegeschicht-
zweiten Teil von Milan Sobotka,
licher Hinsicht. Der Aufsatz von Anton Friedrich Koch gibt eine Interpretation der anfänglichen Dialektik von Sein, Nichts und Werden. Der erste Abschnitt der Seinslogik umfaßt die Qualitätslogik im engeren Sinne, die Daseinslogik (2. Kapitel) und die Logik des Fürsichseins (3. Kapitel). Mit der Daseinslogik setzen sich im dritten Teil Zur Logik des Daseins eingehend die Beiträge von Claus-Arthur Scheier, Heinz Kimmerle, Önay Sözer und Peter-Ulrich Philipsen auseinander. Dabei werden auch die Differenzen in der Kategorienentwicklung zwischen der 1. und 2. Auflage des ersten Buches der Wissenschaft der Logik von 1812 und 1832 beleuchtet. Gerade das Kapitel über das Dasein hat Hegel für die 2. Auflage völlig umgearbeitet. Der Sammelband konzentriert sich also auf den Anfang der Logik, die Dialektik von Sein, Nichts und Werden im 1. Kapitel und die Daseinslogik im 2. Kapitel des ersten Abschnitts der Seinslogik. Dies zeigt, daß diese Teile in der Hegel-Forschung keineswegs abgegolten sind. Angesichts der Forschungslage könnte der Eindruck entstehen, daß diese Bereiche der Seinslogik so gut erforscht sind, daß es nicht lohnt, sich mit ihnen weiterhin intensiv zu beschäftigen. Nach unserer Auffassung gibt es hier nicht nur viel Neues, Unaufgehelltes zu entdecken, sondern das Verständnis dieser Teile der Seinslogik ist zugleich grundlegend für das Verständnis der Logik insgesamt. Stiefmütterlich wurde bisher in der Hegel-Forschung das 3. Kapitel des ersten Abschnitts, das Fürsichsein, behandelt. Ein wesentliches Motiv und Interesse der Herausgeber ist es, diese Forschungslücke zu schließen. Die Logik des Fürsichseins wird im vierten Teil Zur Logik des Fürsichseins in den Beiträgen von Friedrike Schick, Günter Kruck und Wolfgang Lefèvre sowohl unter systematischen als auch philosophie- und wissenschaftsgeschichtlichen Aspekten ausführlich thematisiert. Hegel folgt seinem Programm einer systematischen Kategorienentwicklung in der Seinslogik, wenn er im zweiten Abschnitt die Größe (Quantität) nach der Qualität zum Thema macht und die Kategorie des Maßes im dritten Abschnitt als Einheit von Quantität und Qualität faßt. Diese noch relativ wenig erforschten Teile der Seinslogik werden im fünften Teil Zur Logik der Quantität und des Maßes in den Aufsätzen von Renate Wahsner und Ulrich Ruschig in den zentralen Teilbereichen kritisch gewürdigt. Zwar behandeln die in diesem Band gesammelten Aufsätze die drei Abschnitte der Seinslogik nicht erschöpfend. Weder sind sie als fortlaufender Kommentar noch als Studien zu Detailproblemen der Seinslogik zu verstehen. Doch beleuchten sie aus unterschiedlicher Warte durchaus die wesentlichen Stationen im Gang der Hegelschen Seinslogik. Sie können als Beispiele für zum Teil sehr verschiedene Ansätze der Diskussion dieser Abschnitte der Seinslogik und der Hegelschen Philosophie insgesamt verstanden werden. Das Spektrum der Deutungen reicht von kritisch-hermeneutischen Interpretationen (Arndt, Iber, Kimmerle, Scheier, Schick) über einen sprach- bzw. handlungstheoretisch orientierten Beitrag (Steckeier-Weithofer), vornehmlich philosphiehistorisch ausgerichteten Aufsätzen (Gawoll, Kruck, Sobotka), wissenschaftstheoretisch bzw. wissenschaftshistorische Zugangsweisen (Lefèvre, Weckwerth, Wahsner) und existenzphilosophisch beeinflußte Ansätze (Prucha, Sözer) bis hin zur materialistischer Dialektik verpflichteten Interpretation (Ruschig) und dekonstruktivistischer Lesart
10
Vorwort
(Philipsen). Gerade die unterschiedliche Zugangsweisen dürften in der Lage sein, die Diskussion um Hegels Seinslogik lebendig zu halten und neue Perspektiven der Interpretation zu eröffnen, indem sie durch die kritische Auseinandersetzung mit der Hegelschen Seinslogik deren produktive Potentiale, aber auch und gerade deren Defizite besonders deutlich machen. Eine umfassende Auswahlbibliographie über Hegels Wissenschaft der Logik mit Schwerpunkt auf der Seinslogik beschließt den Band. Sie macht nicht nur die ungeheure Vielfalt der Publikationen über Hegels Logik deutlich, sondern auch, daß die Diskussion über die Seinslogik erst in den letzten fünfundzwanzig Jahren wirklich in Gang gekommen ist. Die Herausgeber hoffen, mit ihrem Band dem philosophischen Diskurs über Hegels Seinslogik neue Impulse geben zu können. Zu danken haben die Herausgeber besonders Peter-Ulrich Philipsen, der mit seiner Hilfe bei redaktionellen und technischen Arbeiten entscheidend des beigetragen hat.
zum
Zustandekommen dieses Ban-
11
Christian Iber
Hegel eigentlich mit seiner Wissenschaft der Logik! Kleine Einführung in Hegels Logik
Was will
Hegel läßt sich in der Wissenschaft der Logik von der methodischen Maxime leiten, die wir wieder bei Husserl und Heidegger finden, nämlich der Maxime, daß ohne vorherige programmatische Versicherungen unmittelbar an die Sache selbst zu gehen sei. Hinter dieser Haltung Hegels steckt eine Kritik an abstrakter Methodologie, die den Weg vorschreiben will, wie man sich zur Wissenschaft verhalten solle. Für Hegel ist die Methode daher nicht eine vorausgeschickte Vorschrift, sondern gemäß der Bedeutung dieses Wortes Nachweg, Nachvollzug der Sache selbst. Hegel behauptet deshalb immer wieder, daß man in Vorreden und Einleitungen allerhand versichern und behaupten könne, aber die Wahrheit sei das nicht. Das Merkwürdige ist nun, daß es kaum einen Philosophen gibt, der solche substantiellen und auch so viele Vorreden und Einleitungen geschrieben hat wie Hegel. Dementsprechend gibt es in der Wissenschaft der Logik ein ganzes Sammelsurium von Vorreden und Einleitungen. Die Konsequenz aus diesem Sachverhalt ist, daß man sich einerseits die Hegeische Logik nur im immanenten Nachvollzug der Sache selbst klarmachen kann. Andererseits aber das Ganze und einen Überblick über die Logik nur von den vorläufigen Versicherungen und Reflexionen her bekommt, die Hegel in seinen Vorreden und Einleitungen anstellt. Jedem, der sich mit Hegels Logik beschäftigt, drängen sich unweigerlich folgende Fragen auf: Was will Hegel eigentlich mit seiner Logik? Welchen Theoriestatus hat diese Logik? Was ist das für eine Wissenschaft die Wissenschaft der Logik? Die Schwierigkeit bei der Aufhellung dieser Fragen liegt in der Eigentümlichkeit der Hegelschen Philosophie, die gerade auch in der Abneigung gegen programmatische Versicherungen zum Ausdruck kommt. Bei Hegel handelt es sich um einen virtuosen Denker, der zugleich in seiner Virtuosität eine merkwürdige Naivität besitzt, weil ihm ein Mangel an Reflektiertheit über sein eigenes Tun eignet. Hegel hat eine eigentümliche Bewußtlosigkeit über sein Tun und über die Mittel, mit denen
1
er
tut,
was er
tut.1
Treffend sagt Dieter Henrich: "Hegel selbst hat nahezu nichts dazu beigetragen, die logischen Verhältnisse durchsichtig zu machen, in denen er sich mit unreflektierter Virtuosität bewegt" (Dieter Henrich, "Hegels Logik der Reflexion", in ders., Hegel im Kontext, Frankfurt a.M. 21975, 114).
Christian Iber
Um unseren Fragen auf die Spur zu kommen und sie einer Beantwortung näherzubringen, gehe ich in zwei Schritten vor. In einem ersten Schritt skizziere ich das Programm der Wissenschaft der Logik im Rekurs auf die Vorreden und Einleitungen zur Logik. Im zweiten Teil möchte ich das umrissene Programm mit einem Blick auf das methodische Gesamtkonzept und den systematischen Aufbau der Logik verdeutlichen und konkretisieren.
I Zur Erhellung unserer Fragen können wir uns an drei Anhaltspunkten orientieren, die Hegel selbst für seine Theorie der Logik gibt. Hegels Programm der Wissenschaft der Logik wird
klarer erstens in der Reflexion auf die Beziehung der Logik zur Phänomenologie des Geistes, die so etwas wie eine Einleitung oder Begründung des Gegenstandes der Logik darstellt, zweitens in der Reflexion auf die Beziehung der Logik zu den sog. realphilosophischen Wissenschaften, der Philosophie der Natur und der Philosophie des Geistes, und drittens in der Reflexion auf die Beziehung der Logik zur Tradition der Philosophie. Die überlieferte Gestalt der Philosophie besteht für Hegel in dreierlei: erstens der formalen Logik, zweitens der Metaphysik des 17./18. Jahrhunderts, die sich auseinanderlegt in die sog. generelle Metaphysik, die Ontologie, und in die spezielle Metaphysik, d. h. die rationelle Psychologie, Kosmologie und Theologie, die ihrerseits anknüpft an die Metaphysik von Piaton und Aristoteles, und drittens der Kantischen bzw. Fichteschen Transzendentalphilosophie, die für Hegel den Übergang von der Neuzeit zur Moderne darstellt. Zunächst aber gilt es zu fragen: Was ist die leitende Erkenntnisabsicht der Hegelschen Logik! Diese Frage führt uns zurück zu der noch allgemeineren Frage, was ist die Hegeische Philosophie überhaupt und im Ganzen? Die Hegeische Philosophie überhaupt und im Ganzen zielt auf eine umfassende Auffassung und Darstellung der Wirklichkeit ab. Das Wort "Auffassung" ist wie das Wort "Darstellung" ein Lieblingswort Hegels, das für ihn eine tiefe Bedeutung hat. Unter "Darstellung" versteht Hegel die entwickelte Präsentation einer Sache, die die Gedanken in Form einer Ableitung dem Inhalt gefundener Argumente entsprechend ordnet. Nicht in der Reihenfolge des historischen Auftretens, auch nicht in der Art und Weise, wie man in der Forschung auf verschiedene Momente einer Sache stößt, werden sie erörtert, sondern in ihrem systematischen Zusammenhang. Die einzelnen Bestimmungen der Sache treten als Grund füreinander auf, und jede Bestimmung nimmt die Stelle vor derjenigen anderen ein, die sie notwendig macht.2 Was heißt hier "umfassend"? In Hegels umfassender Auffassung und Darstellung der Wirklichkeit geht es um den letzten Versuch in der Geschichte der Philosophie, eine Erklärung der Wirklichkeit ohne alle Reduktionen vorzunehmen. Gemeinhin wird diese Intention wesentlich als Totalitätserkenntnis bzw. Systemdenken charakterisiert. Was aber heißt hier "Wirklichkeit"? Zunächst ist damit die historische Realität gemeint, die spezifische Gestalt der gesellschaftlichen Realität der Moderne, wie sie durch und mit der Französischen Revolution heraufgekommen ist. Sodann meint "Wirklichkeit" unsere geisti2
14
"Das leichteste ist, was Gehalt und Gediegenheit hat, zu beurteilen, schwerer, was beides vereinigt, seine Darstellung hervorzubringen" (HW 3, 13).
es zu
fassen, das schwerste,
Kleine Einführung in
Hegels Logik
Dies alles wird in der Philosophie des Geistes abgehandelt. Daneben bezeichnet Wirklichkeit aber auch die uns umgebende Natur. Diese wird zum Gegenstand einer speziellen Abteilung der philosophischen Wissenschaften, der Philosophie der Natur. Welchen Platz hat nun im System der philosophischen Wissenschaften die Logik? Gibt es einen Bereich der Wirklichkeit, dem sich speziell die Logik widmet? Um diese Frage entscheiden zu können, muß man auf eine Voraussetzung achten, die Hegel macht, und die derart grundlegend ist, daß mit ihr der Stellenwert und der Sinn der Logik steht und fällt. Diese Voraussetzung besteht darin, daß die Wirklichkeit, sei es die geistige oder natürliche Wirklichkeit, wesentlich durch Formverhältnisse strukturiert ist, die wiederum nach der Formalität unserer Denkstrukturen, den Kategorien des Denkens, aufzufassen sind. Diese von Hegel gemeinsam mit Piaton gemachte Voraussetzung ist es, die seinen gesamten Idealismus ausmacht. Hegel geht also davon aus, daß sich die strukturierenden Formverhältnisse geistiger und natürlicher Wirklichkeit in ihrer Wahrheit nur begreifen lassen nach dem Vorbild der Formalität der Ideen oder Denkbestimmungen bzw. Kategorien. In diesem Sinne ist Hegels Wissenschaft der Logik "reine Wissenschaft" (HW 5, 43) 6eopia toö kóohou Platonisch-Aristotelischen Verstände, die Schau des Universums in seinen idealen kategorialen Grundstrukturen. Die Logik ist als reine Wissenschaft die Grundlegung einer Philosophie, die als Universaltheorie angelegt ist, und zwar ist sie diese Grundlegung so, daß sie selbst schon als universale Theorie auftritt. Deshalb sagt Hegel, die Logik ist die "Wissenschaft der absoluten Form, welche in sich Totalität" (HW 6, 265) aller Formbestimmungen des Seins und Denkens ist. In diesem Sinne lobt Hegel den antiken Philosophen Anaxagoras, daß er in seiner Lehre vom voöc, von der Vernunft, den Grund zu einer Intellektualansicht des Universums gelegt hat, deren reine Gestalt die Logik ist (vgl. HW 5, 44). Es geht in Hegels Philosophie also um das Universum in seiner natürlichen und geistigen Gestalt, also um das Ganze dessen, was ist. Die Logik ist nun die reine Gestalt der Intellektualansicht des Universums, d. h. erstens ist sie diese Universalansicht des Universums selbst und zweitens ist sie diese "rein", d. h. in gewisser Abstraktion, nämlich in Abstraktion von den gegenständlichen Inhalten dieses Universums, so daß das Ganze dessen, was ist, in seiner rein begrifflichen Form ansichtig wird. Wie aber erreichen wir jenen Bereich des rein begrifflichen Denkens? Aufschluß darüber gibt uns das Verhältnis der Logik zur Phänomenologie des Geistes. Die Phänomenologie des Geistes hat für Hegel eine propädeutische Einleitungsfunktion in die Wissenschaft der Logik, die allerdings für den endlichen Geist, der wir nun einmal sind, unerläßlich ist. Sie ist somit nur in einem genetischen Sinne, nicht in einem geltungstheoretischen Sinne Voraussetzung für die Logik. Man muß daher sagen, daß die Phänomenologie des Geistes kein integrierter Teil von Hegels endgültigem System ist, was natürlich nichts an der Tatsache ändert, daß der Reichtum ihrer Einzelanalysen in keiner anderen Schrift Hegels übertroffen worden ist. Hier werden defizitäre Bewußtseinsformen widerlegt, um jene Sphäre rein begrifflichen Denkens zu erreichen, die in der Logik entfaltet wird. Voraussetzung der Logik ist also nur, daß falsche Voraussetzungen aufgehoben werden, u. a. der sog. Bewußtseinsgegensatz von Subge und
religiöse Wirklichkeit.
-
15
Christian Iber
jekt und Objekt. Diese negative Aufgabe könnte auch ein konsequenter Skeptizismus übernehmen (vgl. Enz. § 72 Anm.; HW 8, 168).3 Mit dieser Art von Voraussetzung, die die Logik in der Phänomenologie des Geistes hat, ist sehr wohl kompatibel, daß Hegel der Wissenschaft der Logik "Voraussetzungslosigkeit" (Enz. § 78 Anm.; HW 8, 168) zuspricht. Nimmt man Hegels zentrale Einsicht, daß jede Reflexion und d. h. auch realphilosophische Untersuchungen wie die der Phänomenologie des Geistes logische Kategorien unvermeidlich voraussetzt, ernst, so kommt man nicht umhin zu erkennen, daß die Phänomenologie des Geistes vielmehr umgekehrt die Logik voraussetzt. Jedenfalls könnte die Phänomenologie des Geistes nicht in gleicher Weise die Logik begründen wie diese jene, ohne einen schlechten Zirkel zu begehen. Die Wissenschaft der Logik ist daher geltungstheoretisch voraussetzungslose Wissenschaft; und dies ist sie, weil sie sich reflexiv selbst begründen kann. Hegel hat jedenfalls ein festes Vertrauen darein, daß sich das Denken im sich selbst Denken selbst prinzipiieren kann. Und genau das ist die Aufgabe der Wissenschaft der Logik. Der Gedanke der Selbstbegründung der Logik scheint also für Hegels Projekt der Wissenschaft der Logik zentral zu sein, das unter begründungstheoretischen Gesichtspunkten beansprucht, über alle bisherigen philosophischen Positionen hinaus zu
sein. Das "Logische" (HW 5, 20) ist das grundsätzlich unhintergehbare absolute, weil sich selbst begründende Prinzip des Denkens des Denkens, das allem Denken des endlichen Menschen und allem realen Sein der Natur voraus- und zugrundeliegt. Diese Grundintention von Hegels Logik finden wir in Formulierungen wie die vom Logischen als der "absolute [n] Form" (HW 5, 44) oder dem "Absolut-Wahren" (HW 5, 56) oder vom Begriff als "absoluter Grundlage" (HW 6, 264). Da die Logik nur sich selbst, die Logik, voraussetzt, kann das Unternehmen der Wissenschaft der Logik als Selbstrekonstruktion der Logik interpretiert
werden.4 Die Logik ist "Wissenschaft des reinen Denkens", die "das reine Wissen"(HW 5, 57), so wie es am Ende der Phänomenologie des Geistes als Resultat der Abfolge der Bewußtseinsgestalten hervortritt, zum Prinzip und Grundlage hat, in welchem der Bewußtseinsgegensatz von Subjekt und Objekt in eine Einheit von Begriff und Sein zusammengegangen ist und damit den Bereich des rein begrifflichen Denkens etabliert, welcher zugleich ontologische Bedeutung hat. Innerhalb dieses Bereichs vollzieht sich die Begriffsentwicklung der Logik. Was ist nun das spezielle Thema der Logik! Thema der Logik sind die "notwendigen Formen und eigenen Bestimmungen des Denkens" (HW 5, 44). Diese Formen sind in unserem natürlichen Denken und Bewußtsein immer schon auf gegenständliche Inhalte bezogen, wäh3
4
16
Daher konnte Hegel später den Vorbegriff der kleinen enzyklopädischen Logik, der auf reduzierte Weise das natürliche Bewußtsein auf den Standpunkt der Logik führt, an die Stelle der Phänomenologie des Geistes als Einleitung in die Logik setzen. Es war wesentlich die Überkomplexität der Phänomenologie des Geistes, die Hegel zu dieser reduzierten Ersetzung veranlaßte. Als reflexive Selbst- und damit Letztbegründung der Logik liest Dieter Wandschneider Hegels Wissenschaft der Logik. Vgl. Dieter Wandschneider, Gründzüge einer Theorie der Dialektik. Rekonstruktion und Revision dialektischer Kategorienentwicklung in Hegels "Wissenschaft der Logik". Stuttgart 1995, 17. Im übrigen leitet sich aus dieser Idee des Logischen als einer sich selbst begründenden, allem realen Sein vorausgehenden Struktur der Anspruch der Hegelschen Logik ab, spekulative Theologie zu sein. Jedenfalls hat Hegel durchgehend seine Wissenschaft der Logik als eine Theorie des Absoluten verstanden.
Kleine Einführung in
Hegels Logik
rend sie die Logik rein für sich betrachtet. Entsprechend ist der Inhalt der Logik nichts anderes als diese Denkformen selbst. Das natürliche Bewußtsein, sagt Hegel, ist "befangen in den Banden seiner Kategorien, in einen unendlich mannigfaltigen Stoff zersplittert" (HW 5, 27). Die Denkformen sind in der Sprache herausgesetzt und niedergelegt. Die logische Wissenschaft thematisiert die Denkbestimmungen, die überhaupt den Geist unserer Sprache instinktartig und bewußtlos durchziehen. Ihre Aufgabe ist die Enthüllung des in der Sprache Eingehüllten, die Freilegung des Bodens, auf dem wir als Sprechende immer schon stehen. Diesen Boden bezeichnet Hegel als jenes "Logische" (HW 5, 20), das er der Natur und dem Geist gegenüberstellt. Insofern ist Hegels Logik so etwas wie eine Grundlegung von Semantik, eine "reflexive[n] Vergewisserung der Sprache"5, die in die logische Tiefenstruktur der Sprache vordringt. Man darf allerdings Hegels Logik nicht auf Semantik oder Sprachtheorie einebnen. Sprachanalytisch ist ihr Geschäft nur insofern, als sie die in der Sprache enthaltenen Denkbestimmungen freilegt. Hegel betrachtet also in der Logik die Denkbestimmungen oder Denkformen rein an und für sich, d. h. nicht wie sie auf inhaltliche Substrate bezogen sind, sondern frei von den sinnlichen Substraten, den Substraten der Anschauung und Vorstellung. Um diese Substratlosigkeit deutlich zu machen, unterscheidet Hegel zwischen den Dingen und der Sache als dem Begriff der Dinge (vgl. HW 5, 29). Die Logik hat es mit der begrifflichen Sache zu tun, weil das Ensemble der Denkformen selbst der wahrhafte substantielle Inhalt aller Wirklichkeit ist. Welches Recht hat Hegel auf seiner Seite, daß er seine Logik auf der Hypothese der Identität von Form und Inhalt gründet? Die Denkformen, deren Zusammenhang die Logik untersucht, sind zwar von den Inhalten unseres gewöhnlichen Bewußtseins losgelöst als von Dingen als sinnlichen Substraten, aber nur deshalb, weil sie selbst den wahrhaften Inhalt ausmachen. Daß die Denkbestimmungen der Hegelschen Logik selber schon der wahrhafte Inhalt sind, ist eine berechtigte Aussage, sofern die Denkbestimmungen das grundsätzlich Gedachte in allem und jedem inhaltlichen Anschauen, Vorstellen oder Denken sind. Denken im erfüllten Sinne des auf Wahrheit abzielenden begreifenden Denkens ist nur, was es ist, als Denken eines Inhalts, der die Form eines unmittelbaren angeschauten oder vorgestellten Substrats verloren hat und in die Form des Gedankens aufgenommen worden ist. Die Bestimmtheit des Inhalts verdankt sich aber den Denkbestimmungen, und sie heißen Bestimmungen, weil sie dem Inhalt seine Grundbestimmtheit geben. Hegels These ist also: Die Sache selbst, der Begriff der Dinge, ist uns im Denken im Ensemble der Denkbestimmungen gegenwärtig. Dabei müssen wir einen doppelten Inhaltsbegriff unterscheiden: Außen vor der Logik bleibt der substratbestimmte Inhalt der Anschauung und Vorstellung. Davon unterschieden ist der Inhalt der Denkbestimmungen selbst. Diesen Sachverhalt möchte ich kurz zu erläutern versuchen. Hegel lobt Piaton, weil er die Natur der Denkbestimmungen erkannt hat. Piaton führt im Phaidon den Terminus "Idee" ein, indem er den Unterschied zwischen xà ïaa und fj îoottiç klarmacht, d. h. zwischen dem, was da gleich ist und der Gleichheit selber (vgl. Piaton, Phaidon 74aff.). Denke ich 'was da gleich ist', betrachte ich zwei Sachen, etwa zwei Hölzer, in der Hinsicht, daß sie gleich oder ungleich sind, so ist das, was ich eigentlich denke die Gleichheit oder Ungleich5
Micheal Theunissen, Sein und Schein. Die kritische Funktion der Hegelschen
Logik. Frankfurt a.M. 1978, 53. 17
Christian Iber
heit selber. Hegel bringt die Konsequenz der Substratlosigkeit an einer Stelle radikaler Polemik deutlich zum Ausdruck, und zwar da, wo er "das Grundmißverständnis, das üble, d. h. ungebildete Benehmen" geißelt, "bei einer Kategorie, die betrachtet wird, etwas Anderes zu denken und nicht die Kategorie selbst" (HW 5, 32). Dieses ungebildete Benehmen legt man an den Tag, nicht nur wenn man bei der Bestimmung "Dasein" etwa an die Bestimmung "Etwas" denkt, sondern auch, wenn man statt der Bestimmung an das Bestimmte, an das durch die Bestimmung Bestimmte denkt, wenn man also nicht bloß denkt "Identität", sondern dieses oder jenes Identische, nicht nur "Gegensatz", sondern alle möglichen gegensätzlichen Verhältnisse in der Welt. Und so gilt es beim Widerspruch eben diesen zu denken und nicht irgend etwas Widersprüchliches, etwa den Widerspruch zwischen Lohnarbeit und
Kapital.
Ganz allgemein gefaßt, ist es also die Aufgabe der Logik, "die logische Natur, die den Geist beseelt, in ihm treibt und wirkt, zum Bewußtsein zu bringen" (HW 5, 27). Die Logik gibt Aufschluß über das, was man denkt, wenn man denkt; oder in ihr wird gedacht, was man denkt, wenn man denkt. Die Kategorien, "die nur instinktmäßig [...] wirksam [...] und [...] verwirrend in das Bewußtsein des Geistes gebracht sind [...], zu reinigen und ihn [den Geist d. V.] damit in ihnen zur Freiheit und Wahrheit zu erheben, dies ist also das höhere logische Geschäft" (HW 5, 27). Denn "der wichtigste Punkt", so Hegel, "für die Natur des Geistes ist das Verhältnis, [...] als was er sich weiß; dieses Sichwissen ist darum, weil es wesentlich Bewußtsein ist, Grundbestimmung seiner Wirklichkeit" (ebd.). In der Logik macht sich das Denken zum Gegenstand von sich, erwirbt ein Wissen von sich selbst und von seiner unhintergehbaren Macht. Ziel und Zweck der Logik ist es also, die Macht des Denkens im Sichwissen zu sich selbst zu bringen. Es geht in der Logik um die Etablierung der Herrschaft der sich selbst begründenden Vernunft. Hier kann nun auch das Verhältnis der Logik zur Realphilosophie angesprochen werden, die ihrerseits die Wissenschaft der Grundprinzipien der empirischen Einzelwissenschaften ist. Die Hegeische Applikation der Logik auf die Realphilosophie wendet die logischen Bestimmungen nicht direkt auf die unterschiedlichen Sphären natürlicher und geistiger Wirklichkeit an. Sie findet die bereits in der Logik entfalteten Denkstrukturen nicht einfach wieder, sondern entdeckt spezifische Umstrukturierungen. Die Realphilosophie legt Formverhältnisse frei, die gegenüber den rein logischen Strukturen im selben Maße verändert sind, in welchem die Bestimmtheit der jeweils thematischen Wirklichkeit über die logisch thematisierbare Grundbestimmtheit hinausgeht. Die Anwendung wird also in dem Sinne indirekt, als sie durch eine Art Phänomenologie des Gegenstandes vermittelt ist. In der Realphilosophie sind daher die Kategorien stets mit etwas Realem, Raum-Zeitlichem, d. h. einem Substrat, das Gegenstand der Erfahrung, Anschauung und Vorstellung werden kann, verknüpft. Neben dieser indirekten Applikation kennt Hegel noch eine andere Fruchtbarmachung der Logik durch die Realphilosophie. Demnach erhält das Logische erst dadurch die Schätzung seines Werts, wenn es zum Resultat der Erfahrung der Wissenschaften geworden ist. Das Logische stellt sich als die allgemeine Wahrheit, als das Wesen allen sonstigen Inhalts des Geistes dar, nicht als eine besondere Kenntnis neben anderen Stoffen und Realitäten. Als der wahre Inhalt ist das Ensemble der Denkformen auch die Wahrheit alles sonstigen Inhalts. Daraus leitet Hegel eine selber noch logikimmanente Beziehung der Logik zur Realphilosophie ab. Es komme darauf an, das Logische mit dem Gehalte aller Wahrheit zu erfüllen (vgl.
18
Kleine Einführung in
Hegels Logik
HW 5, 55f.). Die eigentliche Bedeutung der Logik geht somit erst demjenigen auf, der sich durch die realen Wissenschaften durchgearbeitet hat. Dieses Erfüllungsverhältnis ist etwas strukturell Anderes als eine Anwendung des Logischen auf realphilosophische Verhältnisse. Dieses doppelte Verhältnis der Logik zur Realphilosophie hat Hegel im Blick, wenn er die Logik zum einen als "Vorbildner(in)", zum anderen als "innere(n) Bildner(in)" der philosophischen Wissenschaften bezeichnet (HW 6, 265). Aus der Charakterisierung des spezifischen Themas der Logik ergibt sich auch eine erste Unterscheidung zwischen dialektischer und formaler Logik. Die dialektische Logik unterscheidet sich von der formalen Logik nicht dadurch, daß sie etwa keine Formen untersucht; sie unterscheidet sich dadurch, daß sie behauptet, diese Denkformen, die für die formale Logik etwas anderes sind als der Inhalt, auf den sie appliziert werden, sind der wahrhafte Inhalt. Daraus ergibt sich, daß die dialektische Logik diese Denkformen nicht nur empirisch katalogisiert, sondern sie in ihrem Zusammenhang entwickeln will. Die formale Logik begeht nach Hegel einen Verrat am Logos, "der Vernunft dessen, was ist" (HW 5, 30), weil sie ihn als den, der alles durchzieht, vergißt. Die dialektische Logik ist so zum einen eine Alternative zur formalen Logik, zum anderen integriert sie sie in sich. Diese doppelte Stellung zur formalen Logik ergibt sich aus der Voraussetzung Hegels, daß alle bestimmten Begriffe Bestimmungen des einen Begriffs im Singular sind. Dieser Begriff im Singular ist das Hegelsche Pendant zum traditionellen Begriff des Logos, der durch alles hindurchgeht. Alle bestimmten Begriffe sind in ihrer Entwicklung als Selbstbestimmung des Begriffes zu denken. Die dialektische Logik entwickelt den genetischen Zusammenhang aller Kategorien, Denkbestimmungen und bestimmten Begriffe. Diese sind das Material, das bearbeitet wird. In dieser Entwicklung ist der erste Begriff der ärmste, der letzte der reichste. Der Fortgang als Entwicklung ist aber nicht nur Anreicherung, sondern auch Kritik, und zwar Kritik als Abbau von Schein. Diese genetische Begriffsentwicklung stellt uns vor eine doppelte Anforderung: Die erste kennen wir schon. Nur die Begriffe sollen gedacht werden, die jeweils als Gegenstand unterstellt sind. Die andere Forderung läuft dazu gegenläufig: Denn bei jeder Denkbestimmung müssen wir ihre Herkunftsgeschichte vor Augen haben, erst dann können wir sie als notwendig begreifen. Hegel legt Wert auf die Feststellung, daß die Methode der dialektischen Logik keinen präskriptiven oder normativen Charakter, sondern nur den immanenten Gang der Sache selbst zum Gegenstand hat (vgl. HW 5, 16, 49ff.). Es ist nicht eine, sondern die Methode des Denkens, deren Kern das Konzept der bestimmten Negation ist. Methodisch erfolgt die dialektische Begriffsentwicklung in einem Dreischritt: Es wird jeweils von einer zu explizierenden positiven Bestimmung ausgegangen, der per bestimmter Negation die ihr komplementär entgegengesetzte negative Bestimmung gegenübergesetzt wird. Der erste Schritt markiert "die abstrakte oder verständige" (Enz. § 79; HW 8, 168) Seite des Logischen. In einem weiteren Schritt wird der komplementäre Gegensatz der Bestimmungen in den Widerspruch überführt. Der Nachweis des Widerspruchs der Bestimmungen ist identisch mit dem Aufweis ihrer NeDiesen zweiten Schritt bezeichnet Hegel als die "dialektische oder negativ-vernünfgativität. " tige (ebd.) Seite des Logischen. Aus dem Widerspruch wird in einem dritten Schritt die Forderung der Synthesebildung hergeleitet, d. h. die Forderung, die isolierten widersprüchlichen Bestimmungen in einem neuen Synthesebegriff zu vereinigen. Dieser dritte Schritt ist die
"spekulativ- oder positiv-vernünftige" (ebd.) Seite in der Methode der logischen Begriffsent19
Christian Iber
wicklung. Die Syntheseforderung im dritten Schritt macht die Einführung einer neuen Kategorie erforderlich, die nur die bestimmte Negation der vorhergehenden Begriffskonstellation ist, also das wesentlich enthält,
woraus sie resultiert. Damit haben wir in etwa das Spezifische erfaßt, das wir meinen, wenn wir die Hegeische Logik eine dialektische Logik nennen. Dialektisch ist Hegels Logik erst als Theorie des generativen Zusammenhangs der Denkbestimmungen, der entstehen soll, indem aus den elementarsten und damit abstraktesten Bestimmungen die konkreten hervorgehen, so daß die reale Totalität als Gedankentotalität reproduziert wird. Es ist dieses Dialektikmodell, das Marx von Hegel übernommen hat, etwa im Methodenabschnitt der sog. Einleitung zur Kritik der politischen Ökonomie. Aus dem genetischen Entwicklungsgedanken der dialektischen Logik ergibt sich auch ihr Verhältnis zu Kants Transzendentalphilosophie. Die transzendentale Logik ist ja ein Kapitel der Kritik der reinen Vernunft. "Transzendental" nennt Kant seine Philosophie, weil sie die Rückwendung von den Gegenständen unserer Erkenntnis auf unsere Erkenntnis betreibt, in der die Bedingung der Möglichkeit der Gegenständlichkeit überhaupt liegt. Diese reflexive Zurückwendung auf das Denken selbst hat Kant mit der Kopernikanischen Wende verglichen. Eine entsprechende Rückwendung oder Reflexionsbewegung macht die Logik Hegels in der Rückwendung von dem je Bestimmten, was wir sprechend denken, auf die Bestimmungen, in denen wir es denken. Nach der einen Seite, nach der die transzendentale Logik Kants die apriorischen Kategorien der Gegenstände enthält und insofern nicht wie die formale Logik von allem Inhalt der Erkenntnis abstrahiert, integriert Hegel sie in seine Logik. Nach der anderen Seite, nach der die transzendentale Logik die Kategorien auf das Selbstbewußtsein als subjektivem Ich zurückführt, verabschiedet Hegel sie. Hegels Logik ist der Versuch, das, was Kant in seiner Kategorienlehre betreibt, ohne Voraussetzung eines transzendentalen Subjekts zu betreiben. Indem Kant die Kategorien auf das Subjekt des "Ich denke" bezieht, das die Denkvorgänge begleitet, bleibt er beim Bewußtseinsgegensatz stehen. So wie das Ich bei Kant aus dem Zusammenhang des kategorialen Denkens heraustritt und zum Abstraktum des leeren Ich der Apperzeption wird, so wird schließlich der Gegenstand unterschieden vom kategorialen Wissen über ihn zum unerreichbaren Ding-an-sich verflüchtigt. Kants Ding-an-sich interpretiert Hegel als Folge des in völliger Abstraktion und Unbestimmtheit belassenen Ich des Selbstbewußtseins. Hegels Kritik am Ding-an-sich ist also von seiner Kritik am transzendentalen Subjekt nicht zu trennen (vgl. HW 5, 59f). Nach Hegel genügt es nicht, die Kategorien, die man in den empirischen Urteilsformen vorfindet, zu katalogisieren und in Beziehung zu einem transzendentalen Ego zu setzen, wie Kant es tut, vielmehr gilt es, sie zu untersuchen, wie sie an und für sich selbst sind; erst dadurch offenbaren sie ihren immanenten Zusammenhang. Doch erst die Befreiung vom Bewußtseinsgegensatz erlaubt es, die Denkbestimmungen an und für sich in ihrer idealen Seinsweise zu betrachten. Dabei löst Hegels Logik die transzendentale Subjektivität in den generativen Zusammenhang der Denkbestimmungen auf, und zwar so, daß dieser selbst qua "System der Denkbestimmungen" (HW 5, 61) als Genese von Subjektivität gefaßt wird. Indem die Logik nicht stets ein denkendes Subjekt voraussetzt, springt dieses als Resultat der Entwicklung am Ende heraus. Die Logik ist also auch eine Genese der denkenden Subjektivi-
-
20
Kleine
Einführung in Hegels Logik
Hegels Logik läßt sich daher als "radikalisierende Wiederholung"6 der Kantischen Transzendentalphilosophie verstehen.7 Nachdem wir Hegels Logik erstens ins Verhältnis zur Phänomenologie des Geistes gesetzt haben, zweitens die Beziehung der Logik zur Realphilosophie betrachtet haben, schließlich drittens das Verhältnis der dialektischen Logik zur formalen Logik und viertens zur Transzendentalphilosophie Kants angeschnitten haben, müssen wir uns um das Verhältnis der Logik zur traditionellen Metaphysik kümmern. Hegel behauptet, die Wissenschaft der Logik sei die "eigentliche Metaphysik" (HW 5, 16). Hegel hat also eine durchaus affirmative Beziehung zur Metaphysik, und zwar zur ganzen metaphysischen Tradition. Wir haben schon gesehen: Metaphysik meint einmal die "metaphysica generalis", die Ontologie, zum anderen die sog. "metaphysica specialis", die sich auseinanderlegt in die drei Disziplinen rationelle Psychologie, Kosmologie und Theologie. Eine Einheit von Ontologie und Theologie war die Metaphysik aber schon bei Piaton und
tat selbst.
Aristoteles.
Hegel redet von der "vormaligen Metaphysik" (HW 5, 13) und meint damit die durch die Transzendentalphilosophie verdrängte neuzeitliche Metaphysik, die von Descartes bis Wolff herrschende Philosophie war. Vor allem in der Vorrede zur 1. Auflage der Logik hebt Hegel mit Nachdruck hervor, daß dieser vormaligen Metaphysik wieder Geltung zu verschaffen sei. Durch die Kantische Transzendentalphilosophie sei eine "völlige Umänderung" der "philosophischen Denkweise" (HW 5, 13) erfolgt, ja die traditionelle Metaphysik sei "mit Stumpf und Stil ausgerottet worden" (ebd.). Doch für Hegel ist der Untergang der Metapyhsik gleichbedeutend mit der Zerstörung der geistigen Substanz eines Volkes. Ein "gebildetes Volk ohne Metaphysik zu sehen" (HW 5, 14), sagt er, sei wie ein "mannigfaltig ausgeschmückter Tempel ohne Allerheiligstes" (ebd.). Hegel will diesen Tempel wieder aufrichten und das Allerheiligste wieder mit Leben erfüllen, und zwar deswegen, weil ihm zufolge eine als Kategorienlehre verstandene Metaphysik von jedem Bewußtsein vorausgesetzt wird.8 Demnach kann die Hegeische Logik als Aufbewahrung, ja als Erneuerung der Metaphysik angesehen werden, die dadurch hinter die Kantische Transzendentalphilosophie, die von der Metaphysik kaum mehr etwas übrig gelassen hat, zurückgreift. Worin liegt nun die positive Anknüpfung an die ältere Metaphysik? Im Gegensatz zur Kantischen Transzendentalphilosophie, nach der das Ding-an-sich das außerhalb allen Denkzusammenhangs stehende, unerkennbare Wesen der Dinge ist, ist die ältere Metaphysik durch die These definiert, daß das Denken und die Bestimmungen des Denkens nicht ein den Gegen6 7
8
Ebd., 52. Die prinzipielle Schranke der Erkenntnis im unerkennbaren Ding-an-sich hat der "konsequent durchgeführte transzendentale Idealismus" (HW 5, 41) Fichtes und Schellings überwunden, indem er die "Philosophie ihren Anfang" (ebd.) darin machen ließ, der "Vernunft aus sich selbst ihre Bestimmungen" (ebd.) zu geben. Doch der Ausgang vom Ich hat ihn nicht wirklich vom Bewußtseinsgegensatz des Subjektiven und Objektiven befreit. So kommt auch der transzendentale Idealismus Fichtes und Schellings nach Hegel nicht bis zum Bereich des Logisch-Ideellen, dem Reich der reinen sich selbst begründenden Vernunft, das dem Bereich des Geistes wie dem der Natur gleichermaßen vorhergeht. "Metaphysik heißt nichts anderes als der Umfang der allgemeinen Denkbestimmungen, gleichsam das diamantene Netz, in das wir allen Stoff bringen und dadurch erst verständlich machen. Jedes gebildete Bewußtsein hat seine Metaphysik, das instinktartige Denken, die absolute Macht in uns hat, über die wir nur Meister werden, wenn wir sie selbst zum Gegenstande unserer Erkenntnis machen" (Enz. § 246, Zusatz; HW 9, 20).
21
Christian Iber
ständen Fremdes, sondern deren Wesen sei. Metaphysik, das ist für Hegel primär die Philosophie, die davon ausgeht, daß dasjenige, was durch das Denken an den Gegenständen erkannt wird, das allein Wahrhafte oder das Ansich an ihnen ist. Die Forderung nach ihrer Erneuerung läuft demzufolge auf nichts Geringeres als auf das im Mittelpunkt des Logikprogramms stehende Postulat hinaus, den Gedanken als "die Sache an sich selbst" zu erweisen (HW 5, 43). Doch für Hegel ist erst seine Wissenschaft der Logik die "eigentliche Metapyhsik" (HW 5, 16). Das bedeutet, die ältere vormalige Metaphysik ist die uneigentliche. In dieser Distanznahme liegt auch eine Kritik Hegels an der traditionellen Metaphysik. Das Attribut "eigentlich" zeigt an, daß die von Hegel in der Logik beanspruchte Vollendung der Metaphysik nur als Aufhebung oder Transformation der Metaphysik zu denken ist, die sich nicht ohne die negativ-kritische Komponente dieses Begriffs denken läßt. Kritische Darstellung der Metaphysik ist Hegels Logik zunächst dadurch, daß sie die metaphysischen Kategorien ins Dialektisch-Logische übersetzt und diese so einer umfassenden kritischen Reflexion unterzieht.9 Hegels Programm einer kritischen Darstellung der Metaphysik wird deutlich an der Stellung der einzelnen Teile der Logik zur Metaphysik. Hegel unterscheidet die objektive Logik, zu der Seins- und Wesenslogik gehören, von der subjektiven Logik des Begriffs. Die objektive Logik tritt nun wie Hegel sagt "an die Stelle der "unmittelbar" zwar es und ist (HW 5, 61) die Ontologie, an deren vormaligen Metaphysik", Stelle die objektive Logik tritt. Die objektive Logik ersetzt also die metaphysica generalis, "die die Natur des Ens überhaupt erforschen sollte; das Ens begreift sowohl Sein als Wesen in sich" (HW 5, 61). Und zwar ersetzt die objektive Logik die Ontologie, weil ihr die Methode der Generierung der Kategorien mangelt. Die Ontologie hat nie eine wirkliche Bedeutungsanalyse der Kategorien vorgenommen, sondern diese nur empirisch katalogisiert, wobei ihr Inhalt nur auf die Vorstellung bzw. auf den Sprachgebrauch gegründet werden konnte (vgl. Enz. § 33; HW 8, 99f.). Als Ontologiekritik befaßt sich die objektive Logik aber auch kritisch mit den übrigen Disziplinen der Metaphysik, insofern diese den Denkbestimmungen ungeprüft die aus der Vorstellung genommenen Substrate Seele, Welt und Gott zugrundelegt (vgl. HW 5, 61). Sowenig die ontologische Metaphysik ihre Denkbestimmungen kritisch untersucht, so unkritisch bezieht sie diese auf der Vorstellung entnommene Substrate.10 Auf Basis der in der objektiven Logik geleisteten Metaphysikkritik als Ontologiekritik versucht Hegel in der Begriffslogik die in der traditionellen Metaphysik liegende Wahrheit zu reformulieren eine Wahrheit, die er in der vorgegebene Substrate auflösenden Prozessualität und Relationalität des sich selbst denkenden Denkens erblickt, auf die die Metaphysik nach Hegel im Grunde seit Piaton und Aristoteles abzielt. Insofern der ontologiekritische Metaphysikbezug in der Begriffslogik in den Hintergrund tritt, machen sich hier unkritische Tendenzen der Logik verstärkt bemerkbar, und zwar im ontologisierenden Grundzug der Begriffslogik, die so in Gefahr gerät, zur Restauration tradi-
-
-
9 Als "kritische Darstellung der Metaphysik" interpretiert Michael Theunissen Hegels Logik, vgl. Michael Theunissen, Sein und Schein (Anm. 5), 23ff. 10 Die traditionelle Metaphysik hat nach Hegel einen dreifachen Mangel (vgl. Enz. §§ 28-32; HW 8, 94-99): Erstens begreift sie nicht das Wesen ihrer Prädikate, zweitens täuscht sie sich über die Leistungsfähigkeit der Urteile in bezug auf die Erkenntnis ihrer Gegenstände und drittens reflektiert sie nicht auf die Rolle und das Wesen der Subjekte ihrer Urteile.
22
Kleine Einführung in
Hegels Logik
tioneller Ontotheologie zu werden. So läßt sich sagen: Hegels Programm einer Vollendung der Metaphysik ist durch und durch ambivalent. Die Logik ist als kritische Darstellung der Metaphysik zugleich Restauration der Metaphysik. Die Modernität von Hegels Logik bekundet sich jedoch darin, daß die konservativen metaphysischen Absichten auf der Basis einer radikalisierenden Überbietung der Kantischen und Fichteschen Subjektphilosophie erfolgen, was in der Begriffslogik zu einer umfassenden kritischen Verständigung des Begriffs moderner Subjektivität über sich selbst führt.
n Im zweiten Teil meiner Einführung in Hegels Logik möchte ich einen Blick auf das methodische Gesamtkonzept und den Aufbau der Logik werfen. Dadurch wird auch noch deutlicher, was kritische Darstellung der Metaphysik heißt und an welchem Punkt die Logik in eine Restauration der Metaphysik umzuschlagen droht. Vorweg läßt sich folgende These aufstellen: Die ontologiekritische Darstellung der Metaphysik in der objektiven Logik reformuliert zugleich die in der Metaphysik liegende Wahrheit als absolute Relationalität und legt so die in der philosophischen Tradition liegenden kritischen Vernunftpotentiale frei, um dann allerdings auf der Ebene der Begriffslogik wiederum in Gefahr zu geraten, in einen ontologisierenden metaphysischen Positivismus zurückzufallen. Wir haben gesehen, daß die Sache der Wissenschaft der Logik die kritische Darstellung der Denkbestimmungen ist, die durch die traditionelle Metaphysik, die Transzendentalphilosophie, die formale Logik und die Wissenschaften überliefert sind. Und zwar ist die Logik Darstellung des Systems der Denkbestimmungen. Ein System bildet diese Darstellung deshalb, weil in der Logik erstmals die Denkbestimmungen an und für sich selbst, d. h. als Bestimmungen in ihrem systematischen Zusammenhang erfaßt werden, ohne daß dabei die metaphysischen Substrate Gott, Welt, Seele oder ein transzendentales Ego als absolute Einheit oder Prinzip vorausgesetzt werden. Es handelt sich daher in gewisser Weise um eine Selbstdarstellung des Systems der Denkbestimmungen. Die Darstellung basiert wesentlich auf einer fundamentalen Kritik der Denkbestimmungen, wie sie als Prinzipien der metaphysischen Ontotheologie, der formalen Logik oder der Transzendentalphilosophie auftreten. Daraus ergibt sich die doppelte Struktur der kritischen Darstellung:11 Die kritische Darstellung erweist, daß der den Denkbestimmungen von der traditionellen Metaphysik beigelegte Prinzipiencharakter, d. h. die traditionelle Verstandesfixierung der Bestimmungen, ein wesentlicher Schein ist, während sie in Wahrheit bloß Momente eines prozessualen Beziehungszusammenhangs sind, in welchem sie sich konstituieren, sich gegenseitig aufheben und ineinander übergehen. Diese Verflüssigung der Verstandesfixierung nennt Hegel das Spe11 Auf die
Doppelstruktur der kritischen Darstellung
hat erstmals Alexander Schubert
hingewiesen,
Alexander
Schubert, Der Strukturgedanke in Hegels "Wissenschaft der Logik", Königstein/Ts 1985, 7 und 18. Alexan-
der Schuberts
an Derrida orientierte Hegelauslegung macht das Kritikmoment in Hegels Logik stark. Allerdings geht er fehl in der Annahme, daß Hegel der Denker der irreduziblen Differenz oder der unaufhebbaren Negativität sei. Zumindest in der Begriffslogik zielt Hegel auf einen Vorrang von Identität bzw. affirmativer Selbstbeziehung vor Negativität ab, ohne daß dies gleich zu einem Rückfall in Metaphysik führt.
23
Christian Iber
kulativ-Vernünftige der dialektischen Logik. Als Maßstab der Kritik der Denkbestimmungen fungiert dabei kein absolutes Ich, sondern nur der defizitäre Charakter der Bestimmungen selber. Diesen bringt Hegel auf die beiden Begriffe der "Negativität" und des "Widerspruchs", die daher von immenser Wichtigkeit für die Logik sind. Und insofern handelt es sich in der Logik um eine immanente Kritik der Denkbestimmungen. Zum einen zeigt die kritische Darstellung auf, daß die Denkbestimmungen aufgrund ihrer Negativität und Widersprüchlichkeit als solche keinen Bestand haben, sich aufheben und ineinander übergehen, um so ihren in sich bewegten, vernünftigen Zusammenhang zu konstituieren, zum anderen, wie die ihnen immanente Negativität und Widersprüchlichkeit zum Schein verschwindet, so daß sie in ihrem selbständigen Bestand als rein affirmativ erscheinen. Die kritische Darstellung kann also auf ihrer Ebene noch einmal dartun, wie es überhaupt zu dem Schein des selbständigen Bestehens der Denkbestimmungen kommt und wie es notwendigerweise dazu kommt. Die kritische Darstellung hat also eine in sich gegenläufige Reflexionsstruktur. Hegel gibt seiner Logik eine zweifache Einteilung: eine duale in objektive und subjektive Logik und eine triadische in Seins-, Wesens- und Begriffslogik, und zwar so, daß er die triadische auf die duale aufträgt. Die objektive Logik umfaßt die Seins- und Wesenslogik, die subjektive Logik ist die Logik des Begriffs, der letzte Teil der Logik. Hegel legt jedoch auf diese Unterscheidung von "objektiv" und "subjektiv" in der Logik kein besonderes Gewicht, und zwar deswegen, weil sie nicht mehr die Bedeutung des Bewußtseinsgegensatzes hat, sondern ein logikinterner Unterschied ist (vgl. HW 5, 57). Daß er sie gleichwohl macht, hat zunächst damit zu tun, daß sich die gesamte Logik in einer Theorie der Subjektivität vollendet, die aber nicht wie bei Kant und Fichte eine endliche bzw. transzendental-empirische, sondern völlig apriorische, logisch bestimmte absolute Subjektivität ist, als die Hegel die Bewegung des logischen Begriffs faßt. Die Entwicklung über die Seins-, Wesens- zur Begriffslogik beschreibt Hegel als Fortgang von der gegenständlichen Äußerlichkeit des Seins über das Innerlichwerden des Seins im Wesen bis zur reinen Innerlichkeit der Subjektivität des Begriffs. Doch mit der Kategorie der Subjektivität des Begriffs taucht auch ihr Gegenpart, die reale Objektivität, auf. Dies ist ein Indiz dafür, daß Hegels Logik unkritisch in die Subjekt-Objekt-Dialektik zurückfällt, die zu überwinden gerade ihre Absicht war. Auffällig ist jedenfalls, daß ein dritter Teil der Logik, der Subjektivität und Objektivität synthetisiert, fehlt. Denn die Idee ist als Einheit von Begriff und Objektivität Rückkehr aus der Objektivität
zur
Subjektivität.12
Wir wissen bereits: Die objektive Logik umfaßt die Seins- und Wesenslogik, die die kritische Darstellung der "Kategorien der Metaphysik und der Wissenschaften überhaupt" (Enz. § 114, Anm.; HW 8, 236) beinhaltet. Die Seinslogik ist die Sphäre der Unmittelbarkeit, weil sie die Bestimmungen gegenständlicher Denkformen, d. h. Bestimmungen an gegenständlichen Substraten erörtert. Thema sind die qualitativen, quantitativen und die Maßbe12 Vittorio Hösle hat den Vorschlag gemacht, daß ein solcher synthetischer dritter Teil eine Logik der Intersubjektivität enthalten müßte, die die Dichotomie von Subjektivität und Objektivität überwindet. Und tatsächlich müßte eine triadische Einteilung, die zugleich dialektisch wäre, der objektiven Logik von Sein und Wesen und der subjektiven Logik des Begriffs einen dritten Teil folgen lassen, in dem es zur Synthese von Objektivität und Subjektivität kommt, in dem das der Subjektivität gegenüberstehende Objekt selbst den Charakter eines Subjekts hat. Vgl. Vittorio Hösle, Hegels System. Der Idealismus der Subjektivität und das Problem der Intersubjektivität. Bd. 1, Hamburg 1988, 263ff.
24
Kleine Einführung in
Hegels Logik
von substrathaft Seiendem. Die Seinslogik hat die Funktion, diese Seinsbestimmtheiten auf ihre Bedeutung hin zu analysieren. Dabei geht es um den Nachweis, daß diese ontologischen Bestimmtheiten mehr präsupponieren, als sie in der traditionellen Metaphysik und den Wissenschaften unmittelbar bedeuten. Dieses Mehr liegt in ihrer impliziten Negativitäts- und Widerspruchsstruktur, die die dialektische Darstellung herausarbeitet. Durch diese ihre dialektische Hinterfragung wird ihre gegenständliche Unmittelbarkeit und ihre unmittelbare Selbständigkeit als Schein entlarvt und ihr Übergehen ineinander dargestellt. Auf diese Weise gelingt es Hegel, einen systematischen Zusammenhang der Kategorien der Bestimmtheit als solcher herzustellen, die sich in qualitative, quantitative und Bestimmtheit als Maß auseinanderlegt. Negationstheoretisch bewegt sich die Seinslogik zwischen erster oder einfacher Negation, als die Hegel die Bestimmtheit auslegt, und der doppelten selbstbezüglichen Negation der Negation. Die differentia speeifica zwischen qualitativer und quantitativer Bestimmtheit ist, daß die qualitative Bestimmtheit "seiend[e]" (HW 5, 118) ist. Seiend ist sie, weil sie in unmittelbarer Einheit mit dem Seienden ist, so daß sich mit ihrer Veränderung auch das Seiende selbst ändert. Die Quantität ist dagegen die "negativ gewordene Qualität" bzw. "die aufgehobene, gleichgültig gewordene Qualität" (HW 5, 80). Die Quantität setzt also die Qualität voraus. Aus dieser Überlegung rechtfertigt Hegel die Umstellung der sonst bei Aristoteles und Kant üblichen Vorordnung der Quantität vor der Qualität. Die Frage nach dem 'wieviel' setzt die Frage 'von was' schon als abgemacht voraus. Die Quantität ist eine gleichgültige Bestimmung, die verändert werden kann, ohne daß die Sache selbst ihre Identität verlöre. Das Maß ergibt sich aus der reflexiv durch sich selbst bestimmten Größe, die solchermaßen wieder ein qualitatives Moment in sich hat: "das Maß ist die einfache Beziehung des Quantums auf sich, seine eigene Bestimmtheit an sich selbst; so ist das Quantum qualitativ" (HW 5, 394). Durch das Maß einer Sache ist ein Schwellenwert definiert, bei dessen quantitativer Überschreitung ein qualitativer Sprung stattfindet, womit ihre Qualität verändert wird und sie selbst in eine qualitativ andere umschlägt. In der Dialektik der Maße versucht Hegel zu zeigen, daß die qualitativen Unterschiede der Dinge keine Selbständigkeit mehr besitzen, sondern zu verschwindenden Momenten und bloßen "Zuständen" eines ihnen gemeinsamen Substrats "herabgesetzt" (HW 5, 444) sind. Woran die dialektische Methode der Seinslogik nicht heranreicht, ist die Frage nach der Konstitution der Bestimmtheit als Bestimmtheit und damit auch diejenige nach der Notwendigkeit des Scheins der Selbständigkeit der Bestimmungen. Diese Frage erschließt sich erst aus der Perspektive der Wesenslogik, die erst eigentlich die Relationskategorien des reflektierenden Verstandes zum Gegenstand hat. Die Negativität des logischen Bestimmungsprozesses bleibt in der Seinslogik noch an das substrathafte Sein gebunden, die damit immer wieder in einfache Unmittelbarkeit und Seiendheit zusammensinkt. Letztlich geht es in der Seinslogik darum, das Verwiesensein aller Seinsbestimmtheiten auf den Vermittlungszusammenhang des Ganzen des Seins zu demonstrieren. Da dieser sich als absolute Indifferenz erweist, in der alle ontologischen Substratbestimmtheiten untergehen, kann er nicht weiter expliziert wer-
Stimmungen
25
Christian Iber
den. Aus dem Zusammenbruch des seinslogischen Bestimmungsprozesses in der absoluten Indifferenz ergibt sich die Notwendigkeit, ins Wesen Der Wesenslogik kommt in ihrem ersten Teil die Aufgabe zu, einen substratfreien Reflexionsbegriff zu entwickeln, der die absolute Negativität als solche bezeichnet. Das Wesen als Reflexion ist nur als sich auf sich beziehende Negativität. Wichtig ist, daß Hegels Begriff der Reflexion emphatisch antisubjektivistisch und antipsychologisch ist. Reflexion meint nicht den Akt des Reflektierens eines denkenden Subjekts, sondern die objektiv-logische Bewegungsstruktur der Denkbestimmungen. Das Wesen ist als Reflexion die Bewegung-von Nichts zu Nichts, reines Scheinen in sich selbst. Als absolute Negativität ist sie zugleich reine Selbstnegation. Die Bewegung der Reflexion ist die Bewegungsweise des Verhältnisses von Unmittelbarkeit und Vermittlung, der Konstitution oder Setzen der Unmittelbarkeit und ihrer Herabsetzung zum bloßen Moment der Vermittlung. Im Wesen stellt sich heraus, daß die Unmittelbarkeit, die in der Seinslogik herrschend war, lediglich Funktion der Reflexion und an sich selbst Schein ist. Als solche entfaltet sich die Reflexion in der Dialektik von setzender bzw. voraussetzender, äußerer und bestimmender Reflexion. In der bestimmenden Reflexion findet die Konstitution von Bestimmtheit überhaupt, und zwar sowohl der gesetzten wesenslogischen als auch der vorausgesetzten seinslogischen Substratbestimmtheit und damit auch von Schein statt. Aus der Perspektive der Wesenslogik wird rückläufig, und zwar unter dem Titel "äußere Reflexion" deutlich, daß die Konstitution der ganzen seinslogischen Bestimmtheit aus der Abstraktion der Reflexion von sich selbst erwächst, die in der Seinslogik aus strukturell notwendigen Gründen erfolgt. In der bestimmenden Reflexion tritt die Reflexion selbst in ein Verhältnis zu sich, tritt sich selbst als "wesentliche Unmittelbarkeit" (HW 6, 30) entgegen. Es ist die Reflexion selbst, die sich in der Reflexionsbestimmung den Charakter substratbestimmter Unmittelbarkeit gibt. Mit der bestimmenden Reflexion wird deutlich, daß die wesenslogischen Bestimmungen im Unterschied zu den Bestimmungen der Seinslogik, die an substrathaft Seiendem vorgefunden werden, solche sind, die durch die Reflexion in Beziehung auf Substrate gesetzte Bestimmungen, eben Reflexionsbestimmungen sind. Die Bestimmungen der Reflexion kommen also nicht nur an Substraten vor wie die Bestimmungen in der Seinslogik, sondern sind als Bestimmungen von Substraten gesetzt. Damit verlieren sowohl die vorausgesetzten Substrate als auch die auf sie bezogenen Bestimmungen den Schein ihrer Vorgegebenheit. Obgleich also die Logik die Denkbestimmungen frei von den der Vorstellung entnommenen sinnlichen Substraten betrachtet, wird innerhalb der Logik das dem Denken immanente Substratproblem einer kritischen Erörterung unterzogen und rekonstruiert.14
überzugehen.13
13 Eine ausführliche Übersicht über den Gang der Seinslogik bietet der Aufsatz von Christine Weckwerth in diesem Band. 14 Ein Grund für die Verständnisschwierigkeiten, mit denen uns Hegels Logik immer wieder konfrontiert, liegt darin, daß sie als Logik oder Ontologie ohne Substrate, d. h. als Semantik der Denkbestimmungen ohne referentielle Verweisung auf Designate selbst das Problem der Voraussetzung von Substraten als interne Notwendigkeit der Denkformen thematisiert. Nach Hegels Dialektikauffassung unterliegen indes sowohl die Bestimmungen als auch die Substrate an ihnen selbst der Dialektik. Im Methodenkapitel bekräftigt Hegel: "Ein solches äußerliches und fixes Subjekt der Vorstellung und des Verstandes sowie die abstrakten Bestimmungen sind, statt für letzte, sicher zugrunde Liegenbleibende angesehen werden zu können, vielmehr selbst
26
Kleine Einführung in
Hegels Logik
Logik der Reflexion ist die Bewegung der Konstitution der Denkbestimmungen als Denkbestimmungen von Substraten. In der Logik der Reflexionsbestimmungen tritt das Problem von Identität und Unterschied, des Positiven und Negativen und die Konstitution von Die
Gegensätzlichkeit in den Mittelpunkt. In eins damit werden die klassischen Grundsätze des Denkens (Satz der Identität, des Widerspruchs und des ausgeschlossenen Dritten) einer kritischen Reflexion unterworfen und in ihrer nur bedingten Gültigkeit aufgewiesen. Positives und Negatives stehen sich weder als konträr noch als kontradiktorisch Entgegegengesetzte, sondern als komplementär Entgegengesetzte gegenüber, die einen ganzen Bedeutungsbereich ausfüllen, weil sie eine vollständige Disjunktion bilden. Für Hegel gilt, Positives und Negatives verhalten sich negativ zueinander, sofern das Positive mit dem Nicht-Negativen und das Negative mit dem Nicht-Positiven identisch ist. Damit hat sich die absolute Negativität des Wesens zur spezifisch reflexionslogischen Negativität von Reflexionsbestimmungen fortentwickelt. Die Gegensätzlichkeit der selbständigen Reflexionsbestimmungen wird schließlich in den Widerspruch der selbständigen Reflexionsbestimmungen des Positiven und Negativen als solchen überführt. Die Widerspruch tritt hervor, weil die reflexionslogische Negativität der Relate als Ausschlußbeziehung zugleich ein Enthalten und Ausschließen ist. Jede Denkbestimmung, sofern es sich nämlich um endliche Bestimmungen handelt, so stellt sich heraus ist eine widersprüchliche Beziehung von Identität und Nichtidentität, besteht aus einem identischen Gegensatz von Substrat und Bestimmtheit und verkörpert mithin einen Widerspruch mit sich selbst, welcher sie in andere Denkbestimmungen überführt. Neben dem Begriff der Negativität wird daher die Kategorie des Widerspruchs, die beide zentral für Hegels Konzept der kritischen Darstellung sind, in der Wesenslogik selbst zum Thema der Logik. Der Widerspruch des an ihm selbst Positiven, des reflexionslogischen Substrats als Substrats, und des an ihm selbst Negativen, der entgegengesetzten Bestimmungen als Bestimmungen, macht offenbar, daß sie in derselben Hinsicht, in der sie sich implizieren, auch ausschließen, nämlich als selbständige, und sich daher in ihrer Selbständigkeit selbst ausschließen und an und für sich ineinander übergehen. Der Widerspruch einer jeden endlichen Bestimmung mit sich selbst begründet nach Hegel die Kritik der verselbständigten Verstandesbegriffe und somit zugleich die vernünftige Selbstbewegung des Begriffs.15 Aber die Wesenslogik begnügt sich nicht nur damit, den negativen Funktionszusammenhang der Reflexionsbestimmungen zu entwickeln. Sie muß vielmehr auf Grundlage des Übergangs von den ontologischen Bestimmungen des Seins in den negativen Funktionszusammenhang der Reflexion die ontologischen Bestimmungen auf dem Boden der Reflexion -
-
als ein Unmittelbares, eben ein solches Vorausgesetztes und Anfangendes zu betrachten, das [...] an und für sich selbst der Dialektik unterliegen muß" (HW 6, 560). 15 Zentral für Hegels Auffassung vom Widerspruchsprinzip ist dreierlei: Er akzeptiert nur die argumentationslogische Version des Widerspruchspinzips, wonach eine Kategorie oder Theorie sicher defizitär oder falsch ist, wenn sie einen unaufgelösten Widerspruch enthält. Gegenstand der Kritik ist dagegen die Verstandeskonzeption des Widerspruchsprinzips, wonach synthetische Sätze der Form "A und Nicht-A" prinzipiell falsch sind. Denkbar sind nach Hegel konsistente Verbindungen der Form "A und Nicht-A" derart, daß daraus nicht mehr die isolierten Bestimmungen "A" und "Nicht-A" hergeleitet werden können. Um einseitige, isolierte Bestimmungen ihrer Unwahrheit überführen zu können, muß Hegel drittens den ontologischen Satz des Widerspruchs ablehnen, wonach es nichts gibt, was sich widerspricht. Vgl. Christian Iber, Metaphysik absoluter Relationalität. Eine Studie zu den beiden ersten Kapiteln von Hegels Wesenslogik, Berlin/New York 1990, 448ff.
27
Christian Iber
reformulieren, d. h. sie muß darstellen, wie sich die traditionellen Substrat- und Substanzbe-
griffe als solche und doch nur rein relational konstituieren. Aus der Perspektive der im ersten Teil der Wesenslogik entwickelten Logik der Reflexionsbestimmungen werden daher im zweiten Teil der Wesenslogik die ontologischen Bestimmungen des Seins als Bestimmungen des wesentlichen Verhältnisses des Grundes, des Dings und seiner Eigenschaften, des Wesens und seiner Erscheinung und schließlich als absolutes Verhältnis der Substanzialität kritisch rekonstruiert. Letztlich fundiert Hegel die Relationalität der Substrate und ihrer Bestimmungen in der Spinozistischen absoluten Substanz, die im Übergang von der Wesens- in die Begriffslogik rein relational in einer Metaphysik absoluter Relationalität reformuliert und damit
kritisch in die Bewegung des Begriffs überführt wird.16 Unter dem Titel "absolutes Verhältnis" werden im dritten Teil der Wesenslogik die Verhältnisse der Substanzialität, Kausalität und der Wechselwirkung erörtert. Hegel stellt dar, wie der Gedanke des absoluten Verhältnisses unweigerlich die Aufhebung der Substanzialität als solcher in die diskursive Bewegung des Begriffs zur Folge hat. So ist der Begriff im Singular genau die "Vollendung der Substanz" (HW 6, 216) in dem Sinne, daß die Substanz darin nicht mehr substantial, sondern gleichsam relational und prozessual, aber gleichwohl unter Einheitsgesichtspunkten zu denken ist, nämlich aufgehoben in die begriffliche Bewegung von Allgemeinheit, Besonderheit und Einzelheit. Damit wird in der Begriffslogik die gesamte Kategorienbewegung der Logik als Kategorienbewegung gesetzt und erfaßt. Der Begriff ist die Einheit aller bestimmten Begriffe, der ontologischen substrathaften Seinsbestimmtheiten und der negativen Reflexionsbestimmtheiten des Wesens, die in die Begriffsbestimmungen der Allgemeinheit, Besonderheit und Einzelheit aufgenommen jetzt in Form von Urteilen und Schlüssen eine dem Begriff angemessene Form erlangen.17 Daher entfaltet sich die Begriffslogik in ihrem ersten Teil wesentlich als kritische Reformulierung der klassischen Urteils- und Schlußformen. Hier werden die festen Bestimmungen der Urteilsformen in der dialektischen Bewegung des spekulativen Satzes verflüssigt, so daß nicht nur das Subjekt und Prädikat, das Substrat und seine Bestimmung, ineinander übergehen, sondern auch die Sätze selbst und die Urteilsformen in andere Sätze und Urteilsformen übergehen und so ein in sich bewegtes Schlußsystem von Sätzen entsteht, welches schließlich den rationalen Sinn der Subjektivität des Begriffs ausmacht. Fassen wir zusammen: Die Seinslogik entwickelt die Kategorien, in denen das Denken die unmittelbar vorfindlichen Objekte faßt. Die Wesenslogik behandelt Kategorien der Verhältnisse oder Relationen, in denen sich diese Objekte präsentieren: das System der Reflexionsbestimmungen. Beide Teile bilden die objektive Logik, weil sie Kategorien des Objekts, also des Seienden abhandeln. Man kann die objektive Logik auch als universale Gegenstandstheorie auffassen. Die die subjektive Logik ausmachende Begriffslogik untersucht die Tätigkeit des Denkens selbst, das seine Objekte kategorial bestimmt. Untersucht werden die Urteile und Schlüsse, in denen das Denken das Wesen der Objekte ausmacht. -
-
16 Als Metaphysik absoluter Relationalität hat Vf. Hegels Wesenslogik in seiner Dissertation gedeutet. Vgl. Christian Iber, Metaphysik absoluter Relationalität (Anm. 15). 17 Nachdem Hegel in der Seins- und Wesenslogik die Kategorien des Seins und Denkens in Gegenwendung zu Kants propositionaler Auffassung der Kategorien und gemäß seinem spekulativen Standpunkt in nicht-propositionalem Sinne entwickelt hat, geht es in der Urteils- und Schlußlehre um den Versuch einer Integration der Propositionalität in die spekulativ-dialektische Logik.
28
Kleine
Einführung in Hegels Logik
Übergang von der Substanz, der letzten Bestimmung des Wesens, zum Begriff wird Hegel zugleich als Übergang von der Notwendigkeit zur Freiheit und damit als Übergang zur Subjektivität verstanden. Nachdem das denkende Subjekt in der objektiven Logik in den Zusammenhang der Denkbestimmungen aufgelöst wurde, erfährt es hier seine Restitution. Grundvoraussetzung eines Systems der subjektiven Logik ist also, daß die Substanz, wie schon die Phänomenologie des Geistes ankündigt, als Subjekt dargestellt wird (vgl. HW 3, Der
von
22f.).
Die subjektive Logik des Begriffs ist in ihrer Basis keineswegs Restauration traditioneller Ontotheologie, sondern Kritik moderner Subjektivitätsphilosophie, und zwar so, daß sie in Wahrheit deren Vollendung darstellt. Hegels Begriff der Subjektivität basiert notwendig auf einer immanenten Kritik des tradierten Subjektbegriffs. Und zwar kritisiert Hegel sowohl das Subjekt als ontologisches Substrat ("Etwas"), d. h. als ÚTTOKeípevov im klassisch-antiken Sinne, als auch das Subjekt der neuzeitlichen Reflexionsphilosophie vom Cartesianischen Ego bis hin zum transzendentalen Subjekt Kants und Fichtes. Während nach Kant und Fichte das transzendentale Subjekt den Konstitutionsgrund für Objektivität schlechthin abgibt, gehört bei Hegel das Subjekt in den Bereich des Konstituierten selber. Die in sich gegenläufige Bewegung der Reflexion, die in der Seinslogik ansetzt und in der Wesenslogik zu vollendeten Darstellung kommt, ist, weit entfernt ein absolutes Ich zu sein, die Bewegung, die in der objektiven Logik das Subjekt in den Zusammenhang der Denkbestimmungen auflöst, aber in dieser Bewegung zugleich das Subjekt konstituiert. Als Konstituiertes wird das vorausgesetzte transzendentale Subjekt als notwendiger Schein entlarvt. So wie Hegel den Reflexionsbegriff gegenüber der subjektiven Reflexionsphilosophie radikal umdeutet, so auch den Subjektbegriff. Die Wirklichkeit der Subjektivität des Begriffs ist nichts anderes als die logische Einheit des bewegten Systems der Totalität aller historisch tradierten Denkbestimmungen. Der Gedanke des Subjekts ist daher untrennbar mit dem Gedanken des Systems verknüpft. In Hegels Formulierung in der Phänomenologie des Geistes, "daß das Wahre nur als System wirklich oder daß die Substanz wesentlich Subjekt" (HW 3, 28) sei, kommt dies zum Ausdruck. Die Begriffslogik ist kritische Revision von Ursprungsphilosophie. Denn die Einheit der Subjektivität stellt sich als systematischer Zusammenhang der Denkbestimmungen her, und zwar als ursprüngliche und zugrundeliegende (vgl. HW 6, 245). Die Subjektivität des Begriffs hat eine sich selbst konstituierende Selbstbegründungsstruktur; sie ist Einheit von einfacher Selbstbezüglichkeit und Negativität und daher nicht zu verwechseln mit dem wesenslogischen Grundgedanken der sich auf sich beziehenden Negativität als solcher. Nur durch die hergestellte ursprüngliche selbstbezügliche Einheit der Subjektivität des Begriffs wird die Totalität der Denkbestimmungen eine sich selbst tragende Selbstbewegung. Die restaurativen Tendenzen der Begriffslogik, die das Programm einer kritischen Darstellung der Metaphysik in den Hintergrund treten lassen, liegen darin begründet, daß Hegel diesen Begriff der Subjektivität in traditionell-metaphysischer Weise wieder auf sich fixiert. Daß die Substanz die Subjektivität des Begriffs ist, bedeutet für Hegel zunächst umgekehrt, daß die Subjektivität des Begriffs wiederum als substantielles Sein zu begreifen ist. Daher rührt Hegels Rede, daß das substantielle Sein der Begriff sowie der Begriff das substantielle Sein sei (vgl. HW 5, 43, 57). Dies läßt sich so verstehen, daß im Begriff das Denken und das substantielle Sein der Sache eins sind. Gegen die traditionelle Entgegensetzung von Substanz und Begriff, wonach der Begriff als bloß subjektive Konzeption hinter der Fülle des substan-
29
Christian Iber
tiellen Seins der Sache zurückbleibt, hält Hegel fest, daß die Subjektivität des Begriffs in der Lage ist, die ganze, substantielle Einheit der Sache zu begreifen. Doch begnügt sich Hegel in der Begriffslogik nicht damit, daß die Subjektivität des Begriffs im Urteilen und Schließen die Objektivität des Gegenstandes erfaßt, der Begrifft soll sich darüber hinaus durch diese Tätigkeit dazu entschließen, "reales Objekt" zu werden. Der Übergang vom subjektiven Begriff zur Objektivität hat allerdings weniger mit dem ontologischen Gottesbeweis zu tun, wie Hegel behauptet, ist doch das Sein Gottes nicht mit einem realen Objekt zu verwechseln, sondern stellt mehr einen logischen Schöpfungsakt dar, in dem die reale Objektivität als eine Ausgeburt des Begriffs erscheint.18 In der Begriffslogik kommt es so zur Restitution von Regionalontologie, die als Totalitätserkenntnis reformuliert wird, so vor allem im zweiten Abschnitt der Begriffslogik, wo unter dem Titel Objektivität an sich logikfremde Gegenstände wie Mechanismus, Chemismus, Teleologie und der Begriff des Lebens abgehandelt werden. Somit entsteht in der Begriffslogik die unkritische Situation, daß auf Basis des kritischen Vermittlungszusammenhangs von Sein und Wesen in der objektiven Logik, den Hegel als absolute Negativität oder Relationalität begreift, eine affirmative Unmittelbarkeit etabliert wird, die die Subjektivität des Begriffs in die Totalität realer Objektivität umschlagen läßt. Die Begriffslogik ist solange kritisch, als sie auf die konstitutive Leistung der denkenden Subjektivität gegenüber dem Sein und seinem negativen Wesenszusammenhang reflektiert. Sie schlägt in Restauration von Metaphysik um, insofern sie die Totalität der Wirklichkeit, die sie in Wahrheit nur thetisch-objektivistisch aufgreift, sogar als praktische Zweckrealisierung und Objektivierung der reinen Innerlichkeit des subjektiven Begriffs auslegt. Der Begriff ist nicht nur denkende Subjektivität, sondern Ideologisches Prinzip der Wirklichkeit. Von da aus kommt Hegel zu seiner Konzeption der absoluten Idee als Einheit von gewußter Objektivität und sich praktisch objektivierender Subjektivität des Begriffs und damit als Einheit von Theorie und Praxis, die er selber wieder in der Form von theoretischer, nunmehr absoluter Subjektivität faßt und dieser ontotheologische Dignität zuspricht. Der Begriff als absolute Idee weiß die Objektivität als sein Anderes, als durch ihn praktisch gesetzte Voraussetzung. Der Begriff findet in der Objektivität nur sich selbst, weil die Wirklichkeit bereits vernünftig ist. Nur weil dem Begriff qua Idee diese metaphysische Dignität zukommt, kann Hegel der formellen, methodischen Selbstbesinnung der Logik, die zunächst nichts als die abstrakte Abbreviatur des Ganges des begrifflichen Erkennens darstellt, den Charakter einer notwendigen Fortsetzung und Vollendung der Logik zu-
sprechen.
Am Ende der Logik soll die spekulativ-dialektische Begriffsbewegung eine Positivität im Sinne einer absoluten Affirmation hergestellt haben, die nicht mehr in den dialektischen 18 Zu Recht bemerkt Karl Marx zu diesem Übergang: "Hegel geriet daher auf die Illusion, das Reale als Resultat des sich in sich zusammenfassenden, in sich vertiefenden, und aus sich selbst sich bewegenden Denkens zu fassen" (Karl Marx, Grundrisse der Kritik der Politischen Ökonomie, Berlin 21974, 22). Vgl. zur Kritik dieses Übergangs Friedrike Schick, Hegels Wissenschaft der Logik metaphysische Letztbegründung oder Theorie logischer Formen? Freiburg/München 1994, 243ff. Friedrike Schick sieht einen Zusammenhang zwischen der Problematik dieses Übergangs und der Hegelschen Restauration der Metaphysik in der Logik der Idee (ebd., 265ff). Hegels Logik kontaminiere zwei Intentionen, sie sei zum einen Erkenntnistheorie, Wissenschaft der Denkbestimmungen, zum anderen eine das Bestehende rechtfertigende absolute Metaphysik (ebd., 303ff.). -
30
Kleine
Einführung in Hegels Logik
Fortgang hineingerissen wird, sondern im Anderen ewig in sich ruht und in der alle Bewegung gleichsam in die ruhige Einfachheit des anfänglichen Seins zusammengezogen ist. Damit verschwindet das "Wesen der dialektischen Begriffsbewegung" in den "Schein des absoluten Subjekts"19 der göttlichen Idee, so daß der Übergang der Logik zur Natur als ein 'freies Entlassen' der logischen Idee in ihr reales Anderssein erscheint (vgl. HW 6, 573). Dieser unkritische Objektivismus, der mit der metaphysischen Ideologie einer Ontotheologie der absoluten Idee versehen wird, ist nicht nur auf die Logik beschränkt, er macht sich vor allem in den Akkommodationstendenzen von Hegels Rechts- und Staatsphilosophie bemerkbar. Hegels Logikkonzeption läßt sich gegen dessen Selbstverständnis, demzufolge die Logik die zeitenthobene Darstellung Gottes vor der Erschaffung der Natur und des endlichen Geistes ist (vgl. HW 5, 44), kritisch auf ihren Zeitbezug befragen. Mit dieser kritischen Anfrage möchte ich meine kleine Einführung in Hegels Logik beenden. Zu fragen wäre nach der der Logik immanenten Geschichtlichkeit, vornehmlich nach dem ihr immanenten Bezug zur Modernität der Moderne. Indem die Logik den spekulativ-dialektischen Zusammenhang der historisch aufgefundenen Kategorien der philosophischen Tradition entwickelt, hat sie in sich selbst einen Geschichtsbezug. Dieser liegt nicht nur darin, daß die spekulativ-dialektische Entwicklung der Kategorien immer auch eine kritische Darstellung philosophiehistorischer Positionen ist, sondern daß sie sich selbst als philosophiehistorische Position darstellt, die das Prinzip des Geistes ihrer Zeit erfaßt. Die Philosophie ist ja nach Hegels berühmtem Diktum überhaupt "ihre Zeit in Gedanken erfaßt" (vgl. HW 18, 73f.). Welche Stellung hat nun Hegels Logik zum Geist ihrer Zeit? Hegel steht mit seiner Wissenschaft der Logik als Vollender der philosophischen Tradition zugleich am Beginn der philosophischen Moderne. Wie bereits Schiller und Goethe, Fichte und Schelling und den Frühromantikern geht es Hegel um die Versöhnung der zentralen Tendenzen seines Zeitalters. Während aber Fichte und die Frühromantiker dem modernen Subjekt die Kraft zumuten, aus sich selbst heraus die neuen Synthesen und neuen Ordnungen zu stiften, wollen die Klassizisten die moderne Subjektivität im Rückgriff auf antike Formen begrenzen. Ihnen ist Schelling verpflichtet, der die Vernunft der intellektuellen Anschauung und damit ihrem antiken Modell, dem voùç, in seinem begrenzenden Verhältnis zur Siccvoia, dem diskursiven Verstand, angleicht. Davon unterscheidet sich Hegels Stellung zur Moderne und zur Tradition. Denn Hegels aus der Moderne heraustretender Rückgriff auf die antike Tradition und die Tradition der neuzeitlichen Metaphysik erfolgt zugleich so, daß er diese auch umgestaltet und in
den Dienst der Diskursivität der Moderne stellt. Wie es Hegel in der Rechtsphilosophie um die Versöhnung von antiker Sittlichkeit und moderner Freiheit geht, so in der Logik um die Versöhnung von klassischer Metaphysik bzw. von Christentum und moderner Transzendental- und Subjektivitätsphilosophie. Traditionalismus und Modernität miteinander vermittelnd wird Hegel zum ersten umfassenden kritischen Denker der philosophischen Moderne, einer Moderne, die in das Stadium ihrer Selbstreflexion eingetreten ist. Sicher sind Hegels Absichten im Verhältnis zu denen Fichtes und der Frühromantiker eher restaurativ. Während aber Fichte das Prinzip der Subjektivität schließlich zugunsten einer sie übersteigenden absoluten Einheit des reinen Seins oder 19 Alexander Schubert, Der Strukturgedanke in Hegels "Wissenschaft der Logik" (Anm. dessen Kritik an Hegels Restauration der Ontotheologie in der Begriffslogik ebd., 239ff.
11), 239. Vgl. auch
31
Christian Iber
Lebens relativiert und die Frühromantiker die Leichtigkeit moderner Subjektivität im Modus der Ironie nicht aushalten und zunehmend unter das Joch einer heteronomen tradierten metaphysischen Ordnung zurückflüchten, geschieht die von Hegel in der Logik intendierte Vollendung der traditionellen Metaphysik, ohne hinter das Prinzip der Moderne, die Subjektivität, zurückzufallen. Ja diese Vollendung der Metaphysik läßt sich ihm zufolge nur realisieren in kritischer Selbstreflexion dieses modernen Prinzips. So kommt es, daß Hegels Kritik an der modernen Subjektivitätsphilosophie in Wahrheit deren Vollendung ist.20
20 Es ist ein bleibendes Desiderat der Forschung, Hegels Theorie der Subjektivität im Kontrast zu den idealistischen und frühromantischen Theorien des Subjekts zu beleuchten und in ihren produktiven Potentialen auszuschöpfen. Einen wichtigen Beitrag dazu hat Petra Braiding geliefert, die Hegels Theorie der Subjektivität als Antwort auf die Aporien von Kants und Fichtes Theorien der Subjektivität versteht. Zudem macht sie deutlich, daß die Begriffsstruktur und nicht, wie Dieter Henrich glaubt, die Reflexionsstruktur des Wesens das Charakteristische von Hegels Subjektivitätsbegriff ausmacht, daß man also über Henrichs Interpretationsansatz hinausgehen muß, will man Struktur und Verfassung von Hegels Subjektivitätsbegriff erfassen. Vgl. Petra Braiding, Hegels Theorie der Subjektivität. Eine Analyse mit Berücksichtigung intersubjektiver Aspekte, Würzburg 1991, 152ff.
32
Christine Weckwerth
Sein unter dem Aspekt einer Forschungslogik. Zur unterschiedlichen Strukturierung des logischen und phänomenologischen Wissens bei Hegel
Zum Ausgangspunkt: Das mit der transzendentalphilosophischen Theorie neu aufgeworfene Problem einer genetischen Kategorientheorie Metaphysik, wie Hegel einmal festhält, ist der "Umfang der allgemeinen Denkbestimmungen, gleichsam das diamantene Netz, in das wir allen Stoff bringen und dadurch verständlich machen."1 Was das Sein ist, erschließt sich aus den Denkbestimmungen bzw. den Knotenpunkten ihrer Bedeutungen. Als Nachfolger Kants und Fichtes wird Hegel in dieser Frage offenbar durch den transzendentalphilosophischen Ansatz geprägt. Dieser hatte zu einem deutlichen Bruch mit der traditionellen Metaphysik und Ontologie geführt. Kant ging davon aus, daß den Objekten apriori "nichts beigelegt werden kann, als was das denkende Subjekt aus sich selbst hernimmt".2 Damit hatte er das theoretische Interesse auf die Seite des die Gegenstände strukturierenden, tätigen Subjekts gelenkt. Ein solcher Perspektivwechsel in der Philosophie führte neben anderen Problemen dazu, daß sich das Kategorienproblem der Metaphysik grundlegend neu stellte. Kant selbst beabsichtigte in seiner Kritik der reinen Vernunft, Metaphysik in den sicheren Gang einer Wissenschaft zu bringen, wie er sie beispielhaft in Mathematik und Naturwissenschaft realisiert sah. Ungeachtet seiner polemischen Bemerkungen,3 wie überhaupt einer durchgängig kritischen Auseinandersetzung mit der transzendentalen Theorie, sieht Hegel in der Kantischen 1
Vgl. Enz. § 246, Zusatz; SW 9, 44f.
2 3
KrV B, XXIII.
Vgl. beispielsweise Hegels Eingangsbemerkungen in der Vorrede zur ersten Ausgabe der Wissenschaft der Logik, wo er darauf verweist, daß "die völlige Umänderung, welche die philosophische Denkweise seit etwa fünf und zwanzig Jahren unter uns erlitten" hat als deren Auslöser er hier offenbar Kant ansieht -, der alten Metaphysik zwar die Grundlagen entzogen, selbst jedoch keine neue Metaphysik entwickelt hat. In -
Christine Weckwerth
Philosophie "die Grundlage und den Ausgangspunkt der neuern deutschen Philosophie".4 Zugleich erkennt er wie vor ihm Reinhold, Herder, Fichte, Schelling u. a. -, daß mit der Kantischen Kritik das Problem einer systematischen Kategorientheorie nicht abgegolten war. Hegel selbst hält die Lösung dieser Aufgabe nicht nur für eine innerphilosophische Aufgabe; das "Bedürfniß einer Umgestaltung der Logik"5 wie der Philosophie überhaupt erwächst für ihn vielmehr aus den Anforderungen der modernen Kultur, in der nicht mehr kirchliche Dogmen, traditionelle metaphysische Systeme, auch nicht unmittelbare, erlebnishafte Beziehun-
gen, sondern Wissenschaft
dominierenden Element kulturellen Selbstverständnisses geworden ist. Philosophie steht bei Hegel wie auch bei Kant unter der Programmatik, die Einheit der modernen Kultur spezifisch auf Wissenschaft zu begründen. zum
-
-
Die Phänomenologie als erste Antwort Hegels auf das Problem einer systematischen Kategorientheorie Hegels erste spruchreife Antwort auf die Problematik einer genetischen Kategorientheorie bildet die Phänomenologie des Geistes, nach seinem ursprünglichen Systemplan der erste Teil des Systems der Wissenschaften, dem in einem zweiten Teil Logik und Realphilosophie folgen sollten.6 In Überschreitung der Kantischen Apriorität beabsichtigt Hegel darin, die Kategorien als Resultat der geschichtlich-kulturellen Bildungsprozesse des Geistes zu entwickeln. Seine Phänomenologie ist der Versuch, den Standard der Philosophie am Ende des achtzehnten bzw. zu Beginn des neunzehnten Jahrhunderts als Ergebnis der gattungsgeschichtlichen Evolution des Bewußtseins aufzuzeigen. Ausgehend von diesem Ansatz, entwickelt er die Wissensformen darin nacheinander im Horizont der Bildungsgeschichte des individuellen, sozialisierten sowie seiner kulturellen Formierung bewußten Subjekts, und zwar aus der besonderen Perspektive der Erfahrungen des in diesen Prozeß eingeschlossenen naiven Bewußtseins. In die phänomenologische Wissensgenese fließen auf diese Weise qualitativ verschiedene Gegenstandsbildungen ein, die von Hegel als Sozialisierungs- bzw. Weltbildungskomponenten im Entstehungsprozeß der modernen Gesellschaft gefaßt werden.7 Die Phänomenologie fungiert bei Hegel einmal als Propädeutik und Einleitung in die Philosophie.8 Ihr fällt die Funktion zu, die Kategorien am Leitfaden des geschichtlichen Bildungsprozesses des Geistes zu entwickeln. Damit soll dem einzelnen Individuum zugleich eine Leiter zum philosophischen Wissen gegeben werden. "Die Aufgabe aber, das Individudiesem Zusammenhang stellt Hegel seine polemische These vom "gebildeten Volk ohne Metaphysik" auf. Vgl. GW 21, 5. Die Wesenslogik (1813) wird im folgenden zitiert nach GW 11, die Begriffslogik (1816) nach GW 12. GW 21, 46. Ebd., 36. Vgl. dazu ebd., 8f. Zu dieser Problematik vgl. die von der Verfasserin demnächst erscheinende Studie Metaphysik als Phänomenologie. Eine Studie zur Entstehung und Struktur der Hegelschen Phänomenologie des Geistes. Zu dieser Funktion vgl. die ausführliche Untersuchung von H.-F. Fulda, Das Problem einer Einleitung in Hegels Wissenschaft der Logik, Frankfurt a.M. 1965; W. Marx, Hegels Phänomenologie des Geistes. Die Bestimmung ihrer Idee in 'Vorrede und 'Einleitung', Frankfurt a.M. 21981. -
4
5 6 7 8
'
34
Sein unter dem Aspekt einer Forschungslogik
seinem ungebildeten Standpunkte aus zum Wissen zu führen, war in ihrem allgemeinen Sinn zu fassen, und das allgemeine Individuum, der Weltgeist, in seiner Bildung zu betrachten."9 In dieser Ausrichtung kommt die Phänomenologie ihrer kulturellen Funktion nach, Organ von rationalen Selbstverständigungsprozessen in der Gesellschaft zu sein. Die Phänomenologie ist nach Hegel jedoch nicht nur Einleitung in das System, sondern besitzt darüber hinaus den Status einer philosophischen Wissenschaft selbst.10 Hegel geht davon aus, daß die reinen Formmomente der Wissenschaft sich vollständig in den phänomenologischen Gestalten aussprechen. Jedem abstrakten Moment der Wissenschaft entspricht nach ihm "eine Gestalt des erscheinenden Geistes überhaupt. Wie der daseyende Geist nicht reicher ist, als sie, so ist er auch in seinem Inhalte auch nicht ärmer."11 Aus dem Entsprechungsverhältnis von logischen Formen und phänomenologischen Gestalten folgt, daß das phänomenologische Wissen in potentia bereits die Formmomente des ganzen Systems der Wissenschaft enthält. Bezeichnend hat Hegel die Phänomenologie als eine erste Wissenschaft12 charakterisiert. Die Wissenschaft der Logik, die nach Hegel die logischen Formmomente in reiner, 'unverhüllter' Weise entwickelt, gründet offenbar auf einer anderen Strukturierung als das phänomenologische Wissen. Sie setzt den geschichtlich-kulturellen Realprozeß wie das phänomenologische Wissen, eingeschlossen die Paradoxien permanent ineinander umschlagender Geistepochen, zwar voraus; die Aufgabe einer genetischen Kategorientheorie wird darin jedoch auf eine andere Weise gelöst. Um zu erhellen, nach welchen Strukturierungsprinzipien das Wissen in Hegels Logik entwickelt wird auch um damit den Unterschied zum phänomenologischen Wissen herauszustellen -, sollen im folgenden zwei wesentliche Aspekte betrachtet werden. Der erste betrifft die Herkunft der Hegelschen Logik aus der transzendentalen Logik, der zweite Aspekt behandelt Hegels Logik-Konzept unter dem Gesichtspunkt einer Systematik der Wissenschaften. Unter Zugrundelegung dieser Aspekte soll dann die Seinslogik interpretiert werden. Im letzten Abschnitt wird noch einmal zusammenfassend nach dem Verhältnis von phänomenologischem und logischem Wissens gefragt. um von
-
9 Phän., GW 9, 24. 10 Der "Weg zur Wissenschaft" ist "selbst schon Wissenschaft, und nach ihrem Inhalte hiemit Wissenschaft der Erfahrung des Bewußtseyns" (ebd., 61). 11 Ebd., 432. Vgl. dazu auch Hegels Bemerkungen in der "Vorrede" sowie im letzten Kapitel der Phänomenologie ebd., 40f. und 431 f. 12 Vgl. dazu Hegels "Selbstanzeige" der Phänomenologie, in ebd., 446.
35
Christine Weckwerth
Zur Herkunft der Hegelschen Logik aus der Problematik der transzendentalen Logik Kants. Die Umgestaltung der Logik zu einer Forschungslogik Gegenstand der Logik ist nach Hegel das objektive oder begreifende Denken,13 die "Entwicklung des Denkens in seiner Nothwendigkeit",14 das den Modus des Meinens, wie er dem naiven Bewußtsein anhängt, überwunden hat. Die Denkbestimmungen werden in seiner Logik nicht als Momente, wie sie im alltagspraktisch sprachlichen Gebrauch auftreten, sondern eigentümlich als Funktionsmomente des objektiven oder wissenschaftlichen Denkens entwickelt. "Daher wird die logische Wissenschaft, indem sie die Denkbestimmungen, die überhaupt unsern Geist instinctartig und bewußtlos durchziehen, und selbst indem sie in die Sprache hereintreten, ungegenständlich, unbeachtet bleiben, abhandelt, auch die Reconstruction derjenigen seyn, welche durch die Reflexion herausgehoben und von ihr als subjective, an dem Stoff und Gehalt äussere Formen fixirt sind."15 Hegels Logik ist spezifisch auf den Prozeß wissenschaftlicher Objektivierung gerichtet. Mit der Einführung des Inhalts in die denkende Betrachtung sind "nicht Dinge, sondern die Sache, der Begriff der Dinge, welcher Gegenstand wird."16 Dabei geht Hegel davon aus, daß in den logischen Formen sich zugleich die Formbestimmungen der Gegenstände aussprechen. Es liegt "bey dem Gebrauche der Formen des Begriffs, Unheils, Schlußes, Definition, Division u.s.f. zu Grunde, daß sie nicht bloß Formen des selbstbewußten Denkens sind, sondern auch des gegenständlichen Verstandes."17 Gadamer bemerkt in diesem Zusammenhang aufschließend: "Kategorien sind auch nicht bloße Formbestimmungen der Aussage oder des Denkens, sondern erheben den Anspruch, in der Form der Aussage die Seinsordnung zu erfassen."18 Eine solche logische Wissenschaft setzt Hegel an die Stelle der vormaligen Metaphysik und Ontologie. Vgl. GW 21, 27, 34. 14 Ebd., 18. 15 Ebd., 17f. 16 Ebd., 17. 17 Ebd., 35. Gegenüber der formalen Logik fordert Hegel ein, daß in die Logik "der Inhalt mit in die denkende Betrachtung genommen wird" (ebd., 17). 18 H.-G. Gadamer, "Die Idee der Hegelschen Logik" (1971), in ders., Gesammelte Werke, Bd. 3, Tübingen 1987, 71. Bezugnehmend auf Hegels Logik bemerkt N. Hartmann, daß Dialektik "anschmiegendes Entlangwandern an der gegliederten und vielfach verschlungenen Struktur des Gegenstandes" ist. N. Hartmann, Die Geschichte des deutschen Idealismus. 2. Teil: Hegel, Berlin und Leipzig 1929, 167. In der Rezeptionsgeschichte findet man Auffassungen, die Hegels Logik als eine Erkenntnistheorie interpretieren, dabei zugleich die Seite ihres gegenständlichen Gehalts eliminieren. Eine solche Interpretationstendenz findet man in neuerer Zeit bei F. Schick. Hegels Logik wird von ihr in eine (positive) Erkenntnistheorie oder Wissenschaft von den Denkbestimmungen, wie diese in der subjektiven Begriffslogik zur Darstellung kommt, und in eine (kritikwürdige) Metaphysik, wie sie Hegel in den anderen Logikteilen entwickelt, geschieden. Vgl. dazu F. Schick, Hegels Wissenschaft der Logik metaphysische Letztbegründung oder Theorie logischer Formen?, Freiburg/München 1994, insbes. 303ff. Mit dieser Auffassung wird man Hegels logischem Ansatz meines Erachtens nicht gerecht; liegt dieser doch gerade darin, in Anknüpfung an die Transzendentallogik die logischen Formen über ihre eigene Formbestimmtheit hinaus als Momente im (nichtformalen) wissenschaftlichen Wissensprozeß zu entwickeln (vgl. auch die folgenden Ausführungen). Inwie13
-
-
36
Sein unter dem
Aspekt einer Forschungslogik
An diesen allgemeinen Bestimmungen zeigt sich die Herkunft der Hegelschen Logik aus der Transzendentallogik. Kant war in der Kritik der reinen Vernunft davon ausgegangen, daß die (theoretischen) Gegenstände ideale Gebilde darstellen, deren Bedeutung sich spezifisch aus den logischen Synthesen des erkennenden Subjekts ergibt. In seiner Ausrichtung auf die Frage, wie Erfahrung als Wissenschaft möglich ist, ging es Kant ausschließlich um die Logik des wissenschaftlichen Erkennens, d. h. um die theoretische Strukturierung der Wirklichkeit, auf deren Grundlage die Erscheinungs welt sich als ein durchgehender Gesetzeszusammenhang darstellt. "Es ist aber klar, daß, da wir es nur mit dem Mannigfaltigen unserer Vorstellungen zu tun haben, und jenes X, was ihnen korrespondiert (der Gegenstand), weil er etwas von allen unsern Vorstellungen Unterschiedenes sein soll, für uns nichts ist, die Einheit, welche den Gegenstand notwendig macht, nichts anderes sein könne, als die formale Einheit des Bewußtseins in der Synthesis des Mannigfaltigen der Vorstellungen. Alsdann sagen wir: wir erkennen den Gegenstand, wenn wir in dem Mannigfaltigen der Anschauung synthetische Einheit bewirkt haben."19 Die Struktur der gegenständlichen Welt erweist sich nach Kant als eine Funktion der logischen Synthesen des erkennenden Subjekts. Wie "Dinge an sich selbst (ohne Rücksicht auf Vorstellungen, dadurch sie uns affizieren,) sein mögen, ist gänzlich außer unsrer Erkenntnissphäre."20 Hegel erkennt als entscheidende Leistung der transzendentalen Logik an, daß sie die logischen Funktionen des Subjekts zum Gegenstand gemacht und diese nicht mehr wie die traditionelle Ontologie als Bestimmungen der Dinge selbst aufgefaßt hat. Er hebt in dieser Hinsicht jedoch hervor, daß "dieß Untersuchen [...] selbst schon ein Erkennen" ist. "Es muß also die Thätigkeit der Denkformen und ihre Kritik im Erkennen vereinigt seyn."21 Aus Hegels Sicht geht die transzendentale Logik nicht radikal genug vor. "Jene Kritik hat also die Formen des objectiven Denkens nur vom Ding entfernt, aber sie im Subject gelassen, wie sie vorgefunden. Sie hat dabey nemlich diese Formen nicht an und für sich selbst, nach ihrem eigenthümlichen Inhalt, betrachtet, sondern sie lemmatisch aus der subjectiven Logik geradezu aufgenommen; so daß von einer Ableitung ihrer an ihnen selbst, oder auch einer Ableitung derselben als subjectiv-logischer Formen, noch weniger aber von der dialectischen Betrachtung derselben die Rede war."22 Kant nimmt nach Hegel die Kategorien nur aus den empirischen Urteilsformen, ohne sie in ihrem genetischen Zusammenhang bzw. in ihrer Einheit aufzuzeigen. Dagegen hält er, daß die Denkformen "an und für sich betrachtet werden" müssen; "sie sind der Gegenstand und die Thätigkeit des Gegenstandes selbst; sie selbst untersuchen sich, müssen an ihnen selbst sich ihre Gränze bestimmen und ihren Mangel aufzeigen. Dieß ist dann diejenige Thätigkeit des Denkens, welche demnächst als Dialektik in besondere Betrachtung gezogen werden wird".23 Indem Kant den Zusammenhang der Begriffe nicht explizit aufzeigt, die logischen Funktionen in seiner Tafel überhaupt nur auf 12 es Hegel gelingt, dieses theoretische Programm haupt teilen muß, ist eine andere Frage.
weit
19 KrV A, 105. 20 KrV B, 235. 21 Vgl. Enz. § 41, Zusatz 1; SW 8, 125 ("B. Zweite
sophie").
umzusetzen bzw.
inwieweit
Stellung des Gedankens
zu
man
diesen Ansatz über-
Objektivität,
II. Kritische Philo-
22 GW 21, 31. 23 Enz. §41, Zusatz 1;SW 8, 125.
37
Christine Weckwerth
Stammbegriffe beschränkt, bleibt seine transzendentale Logik für Hegel abstrakt und formal.24 Er erkennt in dieser Hinsicht Fichte das Verdienst zu, die Kategorien in genetischer Form abgeleitet zu haben.25 Dadurch, daß dieser die gesamte Erfahrung genetisch aus dem transzendentalen Selbstbewußtsein herleitete, konnte er sich nach Hegel von der theoretisch unbefriedigenden Lösung des Dings an sich befreien.26 Die Umgestaltung der transzendentalen Logik durch Fichte blieb in Hegels Augen jedoch beschränkt, weil dieser die Denkbestimmungen allein aus den Handlungen des reinen Ich ableitete und damit ebenfalls nur eine formale Identität zwischen dem Ich und den Dingen aufstellte. Hegels Antwort auf seine Kritik an der transzendentalen Logik ist sein im spekulativen Rahmen der Selbstbewegung der absoluten Idee entwickeltes Konzept einer genetischen Logik des wissenschaftlichen Prozesses.27 Ins Zentrum rückt bei ihm die logische Struktu-
-
riertheit des Wissens in seiner Prozessualität. Logik erhält auf diese Weise den Charakter einer Forschungslogik. Stand bei Kant das Problem im Mittelpunkt, wie auf Grundlage der apriorischen Begrifflichkeit überhaupt Erfahrung möglich sei, was er in den zentralen Paragraphen zur transzendentalen Deduktion zu lösen versuchte, verschiebt sich bei Hegel die Problematik zur Frage nach dem genetischen Zusammenhang sowie dem notwendigen Übergehen der logischen Funktionen ineinander. Hegels Logik stellt den Versuch dar, die ursprünglich-synthetische Einheit der Apperzeption, die bei Kant vorausgesetzt wird, sukzessive auseinanderzulegen. Sie ist sozusagen eine in Dialektik versetzte ideale Transzendentalität. Erst eine solche genetische Systematisierung der Kategorien begründet nach Hegel tatsächlich Objektivität und Notwendigkeit des Wissens. 24 Diesen Einwand hat Hegel bereits in seiner Differenzschrift vorgebracht. "Die Identität des Subjekts und Objekts schränkt sich auf zwölf oder vielmehr nur auf neun reine Denkthätigkeiten ein denn die Modalität giebt keine wahrhaft objektive Bestimmung, es besteht in ihr wesentlich die Nichtidentität des Subjekts und Objekts; es bleibt ausser den objektiven Bestimmungen durch die Kategorien ein ungeheures empirisches Reich der Sinnlichkeit und Wahrnehmung, eine absolute Aposteriorität, für welche keine Apriorität als nur eine subjektive Maxime der reflektirenden Urtheilskraft aufgezeigt ist; d. h. die Nichtidentität wird zum absoluten Grundsatz erhoben." G.W.F. Hegel, "Differenz des Fichte'schen und Schelling'sehen Systems der Philosophie in Beziehung auf Reinholds Beyträge zur leichtem Übersicht des Zustandes der Philosophie zu Anfang des neunzehnten Jahrhunderts", in GW 4, 6. 25 "Der Fichte'schen Philosophie bleibt das tiefe Verdienst, daran erinnert zu haben, daß die Denkbestimmungen in ihrer Nothwendigkeit aufzuzeigen, sie wesendich abzuleiten seyen" (Enz. § 42; SW 8, 128). 26 "Der consequenter durchgeführte transcendentale Idealismus hat die Nichtigkeit des von der kritischen Philosophie noch übrig gelassenen Gespensts des Dings-an-sich, dieses abstracten von allem Inhalt abgeschiedenen Schattens erkannt, und den Zweck gehabt, ihn vollends zu zerstören. Auch machte diese Philosophie den Anfang, die Vernunft aus sich selbst ihre Bestimmungen darstellen zu lassen. Aber die subjective Haltung dieses Versuchs ließ ihn nicht zur Vollendung kommen" (GW 21, 31). 27 Der genetische Ansatz von Hegels Logik ist in der neueren Rezeption in fruchtbringender Weise aus einer sprachtheoretischen Perspektive herausgestellt worden. In Untersuchung des Anfangs der Logik bestimmt beispielsweise G. Römpp das "Projekt der 'Wissenschaft der Logik' in der "Einheit von Sprachrekonstruktion und Entwicklung wahrheitsdifferenter Begriffe". G. Römpp, "Sein als Genesis von Bedeutung. Ein Versuch über die Entwicklung des Anfangs in Hegels 'Wissenschaft der Logik'", in Zeitschrift für philosophische Forschung 43 (1989), 80. Hegel beansprucht nach ihm, "mit Hilfe des bloßen Begriffs der Philosophie einen Anfang in der Philosophie machen zu können in der Rekonstruktion einer Situation, die sich als sprachanfangend verstehen läßt" (ebd., 59). Im Hinblick darauf, daß Hegel seine Logik als eine Logik der theoretischen Gegenstandsbildung entwickelt, greift die Deutung als Versuch einer allgemeinen Sprachrekonstruktion meines Erachtens jedoch zu weit. -
-
38
Sein unter dem Aspekt einer Forschungslogik
Hegel setzt seinen genetischen Ansatz um, indem er die logischen Funktionen, ausgehend elementarsten logischen Beziehungen, als aufeinander aufbauende Formmomente im Prozeß der wissenschaftlichen Wissenskonstitution entwickelt (vgl. auch den Abschnitt zur Seinslogik). Der Grundprozeß führt von unmittelbaren Daseinsaussagen (Qualität, Etwas und von
Anderes usw.) über Aussagen zur relationalen Wesensstruktur (Verhältnis von Ganzem und Teil, Kraft und Äußerung, von Äußerem und Innerem, Substanz und Akzidens, Kausalität usw.) schließlich zu einer Ebene, wo die Formbestimmungen des Aussagens selbst betrachtet werden (Begriffs-, Urteils- und Schlußsphäre). Dieser Aufstieg gipfelt bei Hegel in der Erkenntnis der Methode, wo der logische Fortgang im Ganzen in seiner allgemeinsten Struktur reflektiert wird. Dieser Aufstieg zum Methodenbegriff begründet in der Logik die Gliederung in eine Seins-, Wesens- und Begriffslogik. Dabei haben die beiden ersten Teile den für die wissenschaftliche Erkenntnis auszeichnenden Aufstieg vom Daß- zum Was-Sein zum Gegenstand,28 die Begriffslogik dagegen die logischen Formmomente in ihrer eigenen, formalen Struktur, d. h. der theoretische Prozeß wird hier auf sich selbst zurückgebogen. Es zeigt sich, daß Hegel hierbei das Grundgerüst der Kantischen Verstandesbegriffe und Grundsätze, die zwölf Stammbegriffe bzw. übergeordneten Begriffsklassen Quantität, Qualität, Relation und Modalität, die Reflexionsbegriffe und reinen Verstandesgrundsätze, übernimmt, dieses Gerüst jedoch wesentlich modifiziert und differenziert und vor allem nach oben hin aufstockt. Diese allgemeine Struktur vorausgesetzt, stellt sich im Hinblick auf den genetischen Ansatz die Frage, in welcher Weise jeweils von einer bestimmten zu einer anderen Form übergegangen wird. Bei Kant war das Problem der Übergänge in dieser Weise nicht aufgetreten. An seiner Auflösung hängt nicht zuletzt die Frage, inwieweit es Hegel gelingt, das logische Wissen tatsächlich in seiner prozessualen Verfaßtheit aufzuzeigen. Die Antwort auf diese Schwierigkeit liegt für Hegel selbst in der dialektischen Fortbewegung des Logischen. "Das, wodurch der Begriff sich selbst weiter leitet, ist das vorhin angegebene Negative, das er in sich selbst hat; diß macht das wahrhaft Dialektische aus."29 In dem dialektischen Moment erkennt er ein allgemeines Instrumentarium, die logischen Formen in genetischem Zusammenhang zu evolvieren. Blickt man auf den konkreten Entwicklungsverlauf, zeigt sich, daß von einer zu einer anderen Aussageform jeweils übergegangen wird, indem die Bedeutung der Ausgangsform jeweils in ihr Gegenteil oder Entgegengesetztes verkehrt, ihr Schema sozusagen ins Extrem geführt wird, so daß sich dieses mit der entgegengesetzten Form berührt. In Abgrenzung gegen die mathematische Erkenntnisart spricht Hegel in der Vorrede zur Phänomenologie auch von einem "Uebergange des Entgegengesetz-
28 Mit dieser Thematik nimmt Hegel eine Grundfrage der Wissenschaftstheorie seit Aristoteles in seine Logik auf. Bereits bei Aristoteles spielt die Frage nach dem Aufstieg der vom Daß- zum Was-Sein eine zentrale Rolle; vgl. z. B. dessen Analytica posteriora. In der scholastischen Philosophie kehrt diese Thematik vermittelt in der Fragestellung nach dem Verhältnis von Sein und Wesen wieder, vgl. beispielsweise Thomas von Aquins einleitende Ausführungen in seiner Erstlingsschrift De ente et de essentia: "Quia vero ex compositis simplicium cognitionem accipere debemus et ex posterioribus in priora devenire, ut a facilioribus incipientes convenientior fíat disciplina, ideo ex significatione entis ad significationem essentiae procedendum est." Thomas von Aquin, Über das Sein und das Wesen. Deutsch-lateinische Ausgabe, übersetzt und erläutert von R. Allers, Frankfurt a.M./Hamburg 1959, 13. 29 GW 21, 39. Vgl. dazu allgemein auch Hegels Ausführungen zur philosophischen Methode bzw. zur dialektischen Bewegung des Satzes im Vorwort zur Phänomenologie (GW 9, 35ff.).
39
Christine Weckwerth
in das Entgegengesetzte".30 Daß solche Übergänge überhaupt möglich sind, begründet sich für ihn daraus, daß die einzelnen, fixen Bestimmungen selbst nur Produkte der Reflexion sind, sie aus einer ungeschiedenen Anschauungseinheit erst herausgehoben und gegenübergestellt werden. Auf der philosophischen Ebene sind diese Trennungen nach ihm wieder zusammenzudenken. Aus den einzelnen Entgegensetzungen gehen jeweils neue, mittlere Bestimmungen hervor, welche die früheren Bestimmungen in sich aufnehmen. Diese werden dann erneut aufgespalten und zu einem neuen Mittelbegriff verknüpft usw. Die einzelnen Verknüpfungen ergeben schließlich eine zusammenhängende Kette, die von einfachsten Aussageformen zu immer komplexeren führt. Das Schwergewicht der Entwicklung liegt augenscheinlich auf den Mittelbegriffen, die Hegel selbst an der "bestimmten Negation" festmacht.31 Indem in den Mittelbegriffen die früheren Bestimmungen insgesamt mitgehen, kommt es sukzessive zu einer umfassenden, gerichteten Vernetzung aller logischen Elementarbegriffe. Was ein einzelner Begriff bedeutet, ergibt sich auf dieser Grundlage aus der Bedeutung bzw. dem Bedeutungszusammenhang aller anderen Begriffe. An dieser Entwicklung der Begriffe zeigt sich, daß Hegel offenbar auf Aspekte der Platonischen Dialektik zurückgreift, im besonderen in dessen späteren Dialogen. Auch Piaton hatte in seiner Ideendiskussion die Frage nach der Gemeinschaft der Ideen behandelt und war in ähnlicher Weise auf das Problem ihrer Allverknüpftheit bzw. auf das Übergehen von entgegengesetzten Bestimmungen gestoßen.32 Das dialektische Verfahren dient Hegel allgemein dazu, die logischen Formen in zusammenhängender, gerichteter Form zu entwickeln. Die Dialektik fungiert in seiner Logik in dieser Ausrichtung als Darstellungsmethode. In dieser Funktion bleibt sie grundlegend auf deren Kernprozeß, die Konstitution des objektiven Wissens, bezogen. Inwieweit auf Basis dieser Methode tatsächlich Zusammenhänge entwickelt werden, die für die Konstitution des wissenschaftlichen Objektivierungsprozeß auszeichnend sind, d. h. diese nicht nur formal gebraucht wird, läßt sich allerdings nicht auf allgemeiner Ebene, sondern nur am konkreten Entwicklungsgang einsehen. Auf Aspekte, den konkreten kategorialen Verlauf betreffend, wird im folgenden im Abschnitt zur Seinslogik eingegangen.
ten
30 GW 9, 33. 31 "Indem das Resultirende, die Negation, bestimmte Negation ist, hat sie einen Inhalt. Sie ist ein neuer Begriff, aber der höhere, reichere Begriff als der vorhergehende; denn sie ist um dessen Negation oder Entgegengesetztes reicher geworden; enthält ihn also, aber auch mehr als ihn, und ist die Einheit seiner und seines Entgegengesetzten. In diesem Wege hat sich das System der Begriffe überhaupt zu bilden, und in unaufhaltsamem, reinem, von Aussen nichts hereinnehmendem Gange, sich zu vollenden" (GW 21, 38). 32 Ausgehend von der Frage nach dem Einen und Vielen, wirft Piaton im Parmenides paradigmatisch das Problem auf, inwieweit die Gattungen und Begriffe selbst entgegengesetzte Beschaffenheiten in sich aufnehmen. Vgl. Parmenides 129a-e. Seine Antwort darauf lautet: "Das seiende Eins ist also eins und vieles, ein Ganzes und Teile, begrenzt und von unbegrenzter Menge" (145a). Oder an anderer Stelle: "Also als einerlei mit allen Anderen und auch, weil es verschieden ist, in beider Hinsicht und in jeder wäre das Eins allem Anderen sowohl ähnlich als auch unähnlich" (148c). Die Übersetzung folgt Piaton, Werke in 8 Bänden. Griechisch und deutsch, hg. von G. Eigler, Bd. 5, Darmstadt 21990, 255, 265. -
40
-
Sein unter dem
Aspekt einer Forschungslogik
Die Hegeische Logik als Versuch einer umfassenden Systematik der Wissenschaften Hegels Logik läßt sich in ihrem Kern als eine Kritik und zugleich Weiterentwicklung der Kantischen Logik auffassen. Die grundlegende Modifikation besteht darin, daß er Logik in Richtung einer Forschungslogik denkt. Dabei behält Hegel grundlegend die Kantische Option bei, Logik als eine Theorie des wissenschaftlichen Urteils zu entwerfen. Es stellt sich die Frage, inwieweit er Wissenschaft nur in ihrer allgemeinen logischen Struktur auf-
schließt oder sich darüber hinaus auch auf besondere Wissenschaften bezieht. Bei dieser Problematik wird sich zeigen, daß Hegel in seiner Logik eine Systematisierung der Wissenschaften vornimmt, und zwar anhand spezifischer Leitkategorien der Wissenschaften. Neben dem Aspekt des genetischen Ansatzes stellt dieser Gesichtspunkt meines Erachtens einen weiteren wesentlichen Schlüssel zum Verständnis der Strukturierung des logischen Wissens bei Hegel dar und soll im folgenden darum ausführlicher betrachtet werden. In dem Versuch, das Spektrum der Wissenschaften anhand der logischen Funktionen zu systematisieren, zeigt sich die Verwurzeltheit der Hegelschen Logik in der Tradition der Methodenschriften, wie sie für den an Mathematik und mathematischer Naturwissenschaft orientierten Wissenschaftsbegriff seit dem siebzehnten Jahrhundert auszeichnend gewesen ist. Diese Traditionslinie zeichnete aus, auf Basis fester Ordnungsregeln die Wissenschaften in zusammenhängender Form zu entwickeln. Dieses Ziel spricht sich exemplarisch in Leibniz' Gedanken einer Mathesis universalis aus, wie es später als ein Grundmotiv ebenfalls in Fichtes Wissenschaftslehre auf-
tritt.33 Hegel geht in seiner Logik davon aus, daß bestimmte logische Formen bzw. Operationen jeweils für bestimmte Wissenschaftstypen relevant sind, wie, um ein Beispiel zu nennen, die Zahl bzw. das Zusammenzählen für die Arithmetik auszeichnend sind.34 Indem seine Logik die logischen Funktionen in zusammenhängender Form entwickelt, treten damit auch die auf die logischen Funktionen bezogenen Wissenschaftstypen in einen spezifischen Ordnungszusammenhang. Dieser allgemeine Bezug vorausgesetzt, muß gefragt werden, in welchem konkreteren Zusammenhang die Wissenschaften in Hegels Logik systematisiert werden. Ohne auf den gesamten Entwicklungsgang der Logik einzugehen, läßt sich diese Frage meines Erachtens anhand bestimmter Gliederungsaspekte sowie eigener Hinweise Hegels beantworten. Einen solchen Hinweis findet man im Zusammenhang mit der Maßbestimmung. Hegel weist darauf hin, "daß die verschiedenen Formen, in welchen sich das Maaß realisirt, auch verschiedenen Sphären der natürlichen Realität angehören."35 Die Entwicklung des Maßes hat nach ihm speziell zu einer Fortbestimmung des Quantitativen bzw. zu einer Wissenschaft der Natur fortzugehen, welche die Sphäre des Mechanismus betrachtet.36 "Die voll33 Zu Fichte
vgl. dessen umfassende Programmatik einer Systematisierung der Wissenschaften in der (später weggelassenen) "Hypothetischen Eintheilung der Wissenschaftslehre" in seiner Schrift "Über den Begriff der Wissenschaftslehre", in ders., Werke, Gesamtausgabe der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, hg. von R. Lauth und H. Jacob, Abt. 1, Bd. 2, Stuttgart-Bad Cannstatt 1965, 150-152. 34 Vgl. GW 21, 197ff., 203f. 35 Ebd., 327f. 36 Vgl. ebd., 327.
41
Christine Weckwerth
ständige, abstráete Gültigkeit des entwickelten Maaßes d. i. der Gesetze desselben kann nur in der Sphäre des Mechanismus Statt haben, als in welchem das concrete Körperliche nur die selbst abstráete Materie ist [...] Dagegen wird solche Grössebestimmtheit des abstract Materiellen schon durch die Mehrheit und damit einen Conflict von Qualitäten, im Physikalischen, noch mehr aber im Organischen gestört [...] Noch weniger aber findet im Reich des Geistes eine eigenthümliche, freye Entwicklung des Maaßes Statt."37 Hegel bezieht den Geltungsbereich der Maßbestimmung hier speziell auf die Mechanik. Davon hebt er die Region des Physikalischen, Organischen sowie des Geistigen ab, in welchen Regionen die Maßbestimmung nach ihm "höhern Verhältnissen untergeordnet"38 wird. Einen allgemeineren Hinweis findet man in der "Allgemeinen Einteilung der Logik", und zwar in den Passagen, wo Hegel die Aufgliederung der Logik in einen subjektiven und objektiven Teil erläutert. Um diese Einteilung zu veranschaulichen, greift er auf konkrete Formen zurück, die in ihrer Konkretheit allerdings nicht Gegenstand der Logik sind. So ist der für sich seiende Begriff, der Gegenstand der subjektiven Logik, nach ihm "im denkenden Menschen, aber auch schon, freylich nicht als bewußter noch weniger als gewußter Begriff, im empfindenden Thier, und in der organischen Individualität"; dagegen ist der Begriff an sich, der Gegenstand der objektiven Logik, "nur in der unorganischen Natur".39 Das "Leben oder die organische Natur ist diese Stuffe der Natur, auf welcher der Begriff hervortritt".40 An diesen Ausführungen tritt bereits eine bestimmte Systematisierungstendenz hervor. Formbestimmungen der objektiven Logik sind nach Hegel allgemein für die Sphäre der anorganischen Natur relevant, Formbestimmungen der subjektiven Logik dagegen für die Sphäre der organischen Natur sowie der kulturellen Sphäre. Diese Sphären sind Gegenstand jeweils spezifischer Wissensregionen bzw. Wissensweisen.41 Ein solcher Schichtungsgedanke tritt am deutlichsten meines Erachtens in der subjektiven Logik, im Abschnitt zur Objektivität und Idee, hervor. Nachdem Hegel in der subjektiven Logik die für die traditionelle Logik auszeichnende Begriffs-, Urteils- und Schlußlehre dargelegt hat, geht er im Abschnitt "Objektivität" erneut zu einer objektiven Sphäre über. Die "Objektivierung des Begriffs" verläuft nacheinander über Formbestimmungen des mechanischen, chemischen und ideologischen (zweckrationalen) Prozesses, im folgenden Abschnitt "Idee" vollzieht sie sich über Formbestimmungen des organischen, theoretischen und praktischen Prozesses, bevor sie am Ende zum Begriff der Methode übergeht. Diese Formbestimmungen entsprechen offenbar Leitkategorien besonderer Wissenschaften, wie dem mechanischen Objekt und Prozeß, dem chemischen Objekt und Prozeß (Neutralität, Spannung), der Zweckbeziehung (Zweck, Mittel, ausgeführter Zweck, Produkt), dem Leben (Individuum, Lebensprozeß, Gattungsprozeß), dem Wahren (analytisches Erkennen, synthetisches Erkennen, 37 38 39 40 41
42
Ebd., 328. Ebd., 328. Ebd., 45. GW 11,20. Zu einer solchen
Zuordnung von Seinssphären zu bestimmten logischen Stufen vgl. auch Hegels von Nicolin publizierte "Unveröffentlichte Diktate aus einer Enzyklopädie-Vorlesung Hegels", in Hegel-Studien 5 (1969), 21: "Ebenso ist ferner für sich die Naturidee als Seyn die mechanische Natur, 2) als Wesen oder Sphäre der Reflexion die unorganische und 3) als Begriff die organische Natur". Die Einteilung in Sein, Wesen und Begriff bezieht Hegel dort ebenfalls auf den Geist (vgl. ebd., 21f.).
Sein
unter
dem
Aspekt einer Forschungslogik
Definition, Einteilung, Lehrsatz), dem Guten (Postulat, unendlicher Progreß), schließlich der
Methode (absolute Idee). Nach diesem Schema werden die Wissenschaften in der Aufeinanderfolge von Wissenschaften der anorganischen Natur (Mathematik, Mechanik, Chemie), der organischen Natur (Teleologie/Ökonomie, Biologie), schließlich der kulturellen Sphäre (Erkenntnistheorie, Ethik) entwickelt. Offenbar orientiert sich Hegel in groben Zügen dabei zugleich an der Entwicklung der Wissenschaften seit der Neuzeit. Eine solche Schichtung von besonderen Wissenssphären stellt gegenüber der methodischen Einteilung der Logik in eine Seins-, Wesens- und Begriffssphäre einen qualitativ neuen Gliederungsaspekt dar. Im Unterschied zu dieser dreigliedrigen Einteilung kommt diese Schichtung spezifisch in der Aufteilung der Logik in eine objektive und subjektive Logik zur Geltung.42 Ausgehend von Formbestimmungen einer objektiven Sphäre, für die solche Bestimmungen wie Dasein, Quantum, Maß, Substanz und Akzidens oder Kausalität und Wechselwirkung auszeichnend sind, geht Hegel zu Formbestimmungen zunehmender Vermitteltheit von Subjektivität und Objektivität bzw. Begriff und Realität über. Der Gegensatz zwischen Subjektivität und Objektivität wird nach ihm erst auf der letzten Stufe, im Erfassen der Methode des begreifenden Denkens, überwunden. Noch auf der vorletzten Stufe, in der Idee des Guten, sind bezeichnend "zwey Welten im Gegensatze, die eine ein Reich der Subjectivität in den reinen Räumen des durchsichtigen Gedankens, die andere ein Reich der Objectivität in dem Elemente einer äusserlich mannichfaltigen Wirklichkeit".43 Hält man sich an diese Entwicklungstendenz, läßt sich eine gewisse Nähe zu Schellings System, wie dieser es auf Grundlage des Potenzschemas entworfen hat,44 nicht übersehen. Schelling hat den Versuch unternommen, auf der Basis aufeinander aufbauender SubjektObjekt-Potenzen den Prozeß der Selbstrealisation und Selbsterkenntnis der Vernunft in einem durchgehenden kategorialen Gesamtzusammenhang darzustellen. Dieser Zusammenhang beruht nach ihm auf der "durchgängige[n] Tendenz zum Seyn oder zur Realität in Ansehung des Subjektiven".45 Auf der Basis dieses Systematisierungsprinzips entwickelt er zuerst Formbe42 Bei genauerer Betrachtung zeigt sich, daß der Aufstieg von der objektiven zur subjektiven Logik nicht linear, sondern in zwei grundlegenden Etappen erfolgt: einmal auf einer allgemeinen Ebene, als Aufstieg vom Sein zum (subjektiven) Begriff, und zum anderen auf bestimmterer Ebene, als Aufstieg von der Objektivität zur absoluten Idee. Greift man in diesem Zusammenhang auf eine Bestimmung der traditionellen Metaphysik zurück, kann man in diesen Etappen eine Unterscheidung von allgemeiner und spezieller Metaphysik erkennen. Bereits Hegels Entwurf zu Logik, Metaphysik, Naturphilosophie von 1804/05 weist eine ähnliche Struktur auf. Sieht man darauf, daß der erste Durchlauf zu der Sphäre von Begriff, Urteil und Schluß, dem Gegenstand der traditionellen Logik, führt, der zweite über eine bestimmte Abfolge von Formbestimmungen natürlicher und kultureller Prozesse dagegen zum Begriff der Methode, kann man darin zugleich einen Vorschein auf das enzyklopädische System bzw. auf die Gliederung der Philosophie in Logik, Naturund Geistphilosophie erkennen. Auf eine weitergehende Untersuchung dieser Zusammenhänge muß hier allerdings verzichtet werden. 43 GW 11,233. 44 Auf diesen theoriegeschichtlichen Zusammenhang hat u. a. bereits R. Kroner gewiesen; vgl. ders., Von Kant bis Hegel, Bd. 2, Tübingen 1924, 416. 45 F.W.J. Schelling, "Darstellung meines Systems der Philosophie" (1801), in ders., Sämmtliche Werke, hg. v. K.F.A. Schelling, Abt. 1, Bd. 4, Stuttgart und Augsburg 1859, 142. Dieses Schema greift über alle Potenzen, "und da ferner die absolute Totalität nur durch ein Reellwerden des Subjektiven in allen Potenzen, wie die relative durch ein Reellwerden in der bestimmten Potenz, construirt wird, so wird diesem Schema auch wieder die Aufeinanderfolge der Potenzen selbst sich unterwerfen müssen." (ebd.)
43
Christine Weckwerth
Stimmungen, in denen das objektive Moment überwiegt, wovon er zu Bestimmungen übergeht, in denen ein zunehmend höherer Grad an Subjektivität auftritt. Durch gegenseitiges
Einbilden von Wesen und Form entstehen dabei nacheinander im Reellen die Potenzen Materie (Schwerkraft), Licht (Magnetismus, Elektrizität, chemischer Prozeß) und Organismus, im Ideellen die Potenzen Wissen, Handeln und Kunstwerk. Die Reihe der ideellen Welt erschließt Schelling danach spezifisch über das Schema theoretischer, praktischer und ästhetisch-synthetisierender Prozeß. Dieser Aufbau läßt erkennen, daß das Schellingsche System in materialer Hinsicht Hegels Genese des Logischen vorausgreift. Ein Unterschied fällt allerdings unmittelbar ins Auge: Gegenüber Hegel, der die absolute Einheit von Subjektivem und Objektivem in den Begriff der wissenschaftlichen Methode setzt, sieht Schelling eine solche Einheit eigentümlich im Kunstwerk realisiert, einer Objektivationsform, welche nach ihm die Sphäre der logischen Begrifflichkeit wesenhaft übersteigt.46 Über die Brücke einer Systematisierung der Wissenschaften erweist sich die Hegeische Logik als eine in Form von Theoriestufen verschlüsselte Geschichte des Seins. Sie läßt sich in diesem Kontext als eine allgemeinste Formentheorie der reellen und ideellen Welt denken, und zwar der Welt, wie sie Gegenstand der Wissenschaften ist.47 In Orientierung an Leitkategorien der Wissenschaften wird Gegenständlichkeit dabei als aufeinander aufbauende Sphären des Mathematischen, Physikalischen, Chemischen, Organischen und Kulturellen erschlossen. Welche Funktion in diesem Prozeß speziell der Seinslogik zukommt, soll im folgenden Abschnitt genauer ausgemessen werden.
46 "Habe ich
dieser wechselseitigen Durchdringung aller Einheiten im Absoluten nicht aufs klarste geliegt die Ursache hievon großentheils in dem Gegenstand selbst, dessen labyrinthische und fast undurchdringliche Verwicklungen nur mit Mühe bezeichnet werden können." F.W.J. Schelling, "Fernere Darstellung aus dem System der Philosophie" (1802), in ders., Sämmttiche Werke, hg. v. K.F.A. Schelling,
schrieben,
47
von
so
Abt. 1, Bd. 4,423. Bezogen auf die Einteilung in eine
subjektive und objektive Logik hat M. Theunissen bemerkt: "Die Abfolge objektiver und subjektiver Logik spiegelt, unbeschadet der gleich noch zu artikulierenden Eigenständigkeit des 'Logischen', sehr wohl so etwas wie den 'Aufbau der realen Welt' (Nicolai Hartmann) wider." M. Theunissen, Sein und Schein. Die kritische Funktion der Hegelschen Logik, Frankfurt a.M. 21994, 47. Es greift meines Erachtens zu kurz, wenn man in dieser Ausrichtung der Hegelschen Logik einfach einen Rückfall in die traditionelle Metaphysik sieht und sie im Sinne einer Realontologie interpretiert. Das Sein wird in Hegels Logik als Gegenstand von logischen Aussagen betrachtet, d. h. als ein Träger von Bedeutungen und nicht als ein reales Ding. Gegen eine solche Interpretation, wie sie u. a. bei G. Patzig auftritt, hat sich exemplarisch HF. Fulda ausgesprochen. Patzigs grundlegender Einwand, gegen den sich Fulda in diesem Zusammenhang wendet, besteht darin, daß Hegel mit unzulänglichen Gründen sprachliche Kategorien auf die Wirklichkeit projiziere. Vgl. H.F. Fulda, "Unzulängliche Bemerkungen zur Dialektik", in Seminar: Dialektik in der Philosophie Hegels, hg. v. R.-P. Horstmann, Frankfurt a.M. 1978, insbes. 41. von
-
44
Sein unter dem
Aspekt einer Forschungslogik
Zum Entwicklungsgang der Seinslogik: Der Aufstieg von elementarsten logischen Aussageformen über die Konstitution des Gegenstandes als bestimmtes, qualitatives Sein zur Bestimmungsebene abstrakter quantitativer Formbeziehungen sowie von Maßverhältnissen Die Seinslogik ist bei Hegel die Sphäre, in der elementare Aussageformen entwickelt werden. Mit ihnen setzt der Prozeß der wissenschaftlichen Objektivierung ein bzw. verläuft in seinen ersten Etappen. Ausgehend von elementaren logischen Funktionen wird Sein darin zunächst als einzelnes, bestimmtes Dasein ausgesagt. Im Fortschreiten zu quantifizierenden Formbestimmungen (Eines und Vieles, Quantum, Zahl, Maß), wo von Bestimmtheit oder Qualität abgesehen wird, wird die Sphäre des Daseienden in ein Ordnungsgefüge relativer Größen- und Maßbestimmungen aufgelöst. In der folgenden Wesenslogik geht Hegel dann zu Aussageformen über, mit denen das Sein vermittelter ins Spannungsverhältnis von Innerem und Äußerem, von Grund und Begründetem usw. gesetzt wird, woraus schließlich der Begriff der Wirklichkeit als einer durchgängig kausal strukturierten Sphäre hervorgeht. Die Seinssphäre spannt dabei spezifisch die Ebene der Unmittelbarkeit auf "Seyn ist das Unmittelbare"48 -, die Wesenssphäre die logisch entwickeltere Sphäre von Reflexion und Vermittlung in sich. Als elementare Momente gehen die Formbestimmungen der Seinssphäre dabei in den späteren der Wesens- und auch Begriffssphäre mit. Bezogen auf den Gesamtprozeß der wissenschaftlichen Objektivierung kommt ihnen damit eine fundamentale Stellung zu. Zum Ausgang der Seinslogik: Auf die Frage, womit der Anfang in der Logik gemacht werden muß, antwortet Hegel vorausgreifend, daß dieser einfach, abstrakt, unmittelbar, unbestimmt, ohne Form und Inhalt sein muß.49 Diese Kennzeichnung der logischen Ausgangsform geht aus seinem genetischen Ansatz hervor. Um diese Problematik zu erläutern, greift Hegel in seinen einleitenden Bemerkungen auf die Struktur des Anfangs selbst zurück. "Es ist noch Nichts, und es soll etwas werden. Der Anfang ist nicht das reine Nichts, von dem etwas ausgehen soll; das Seyn ist also auch schon im Anfang enthalten. Der Anfang enthält also beydes, Seyn und Nichts; ist die Einheit von Seyn und Nichts; oder ist Nichtseyn, das zugleich Seyn, und Seyn, das zugleich Nichtseyn ist."50 Eine solche Analyse des Anfangs ergibt nach ihm den "Begriff der Einheit des Seyns und des Nichtseyns, oder in reflectirterer Form, der Einheit des Unterschieden und des Nichtunterschiedenseyns, oder der Identität und Nichtidentität."51 Diese Überlegungen vorangestellt, setzt Hegel als Ausgangsformen die Bestimmungen Sein, Nichts und Werden. Ohne auf ihre Entwicklung im einzelnen einzugehen, lassen sich hinter diesen Ausgangsbestimmungen die elementaren Aussageformen "ist" und "nicht ist" bzw. das Übergehen zwischen beiden erkennen. Diese Ausgangsformen bilden in der Hegel-
-
-
-
-
48 GW 21, 241. 49 Vgl. dazu ebd., 53ff. 50 Ebd., 60. 51 Ebd., 60.
45
Christine Weckwerth
Logik sozusagen das logische Minimum, ohne das im folgenden weder der Wissensprozeß noch die Konstitution der Gegenständlichkeit denkbar ist. Indem Sein und Nichts dabei dem Werden untergeordnet werden,52 fällt dieser Bestimmung als "Bewegung des unmittelbaren Verschwindens des einen in dem andern"53 der logische Vorrang zu. Die allgemeinste Struktur des logischen Prozesses liegt für Hegel eigentümlich im Wechsel oder Übergehen von "ist" und "nicht ist". Auf diese Problematik ist er in gewisser Hinsicht bereits in der Vorrede zur Phänomenologie, in den Passagen, wo er die elementare Struktur des gewöhnlichen und spekulativen Satzes erläutert, eingegangen. Im gewöhnlichen Satz sind nach ihm Subjekt und Prädikat aufeinander bezogen bzw. identisch gesetzt; zugleich sind sie darin aber auch unterschieden. Aus dem Spannungsverhältnis von Identität und Unterschiedenheit im Satz kommt es nach ihm im weiteren zu dessen Auflösung bzw. zur dialektischen Bewegung des Satzes, in der sich das Verhältnis von Subjekt und Prädikat umkehrt. Was Hegel hier als Elementarstruktur des philosophischen Satzes erläutert, kommt meines Erachtens in den Ausgangsformen "ist" und "ist nicht" bzw. im übergeordneten Ineinanderübergehen beider zum Ausdruck. Erst von dieser logischen Elementarebene geht Hegel zu bestimmteren Aussagen über, die sich zunächst auf das qualitative Sein richten.54 Die auf das Werden folgende Bestimmung ist das Dasein. Dasein ist bei Hegel die logische Formbestimmung für Unmittelbarkeit, unmittelbares Gegebensein schlechthin. "Aus dem Werden geht das Daseyn hervor. Das Daseyn ist das einfache Einsseyn des Seyns und sehen
-
-
Nichts. Es hat um dieser Einfachheit willen, die Form von einem Unmittelbaren."55 In der Aussage, daß etwas ist, wird zunächst das bloße Gegeben- oder Vorhandensein ausgesprochen. Alles Dasein ist wiederum qualitativ bestimmtes Dasein. Wie Hegel an spezifischen Beispielen illustriert, ist Dasein ein bestimmter Stoff, Sauerstoff, Stickstoff, oder, in der Sphäre des Geistes, ein bestimmter Charakter.56 Jede solcher Qualitäten, indem sie als eine bestimmte gefaßt wird, enthält zugleich ein ausschließendes, verneinendes Moment und weist somit auf ihr Nichtsein bzw. drückt einen Mangel, eine Beschränkung aus. Omnis determinatio est negatio, auf welchen Satz Spinozas Hegel in diesem Zusammenhang verweist. Die Bestimmung der Qualität enthält somit zwei entgegengesetzte Momente: ein seiendes, affirmatives und ein nichtseiendes, verneinendes Moment, als welche Hegel Realität und Negation bestimmt.57 Die Aussageform, die beide entgegengesetzten Momente in sich vereint, ist das Etwas. Dasein wird nunmehr bestimmter als ein Daseiendes, als Etwas, dem ein anderes Daseiendes gegenübersteht, gefaßt. Die Beziehung von Etwas und Anderes drückt gegenüber der von Sein und Nichts offenkundig eine weitergehende logische Beziehung aus. Indem 52 "Das Werden ist der erste konkrete Gedanke, und damit der erste Begriff, wohingegen Seyn und Nichts leere Abstraktionen sind" (Enz. § 88, Zusatz; SW 8, 213f.). Vgl. dazu auch H.-G. Gadamer, "Die Idee der Hegelschen Logik" (Anm. 18), 76-79. 53 GW 21, 69. 54 Im Unterschied zu Kant, der die Kategorie der Quantität voranstellte, geht Hegel in der Seinslogik spezifisch von Qualität bzw. qualitativem Sein aus. Für ihn ist Qualität das der Natur nach Erste. Aussagen zur Quantität als der "negativ gewordenen Qualität" setzen für ihn bereits vermitteitere logische Operationen voraus. "Die Qualität ist daher, als die unmittelbare Bestimmtheit die erste und mit ihr der Anfang zu machen" (GW 21, 67). Vgl. auch Enz. § 90, Zusatz; SW 8, 217. 55 GW 21, 97. 56 Vgl. Enz. § 90, Zusatz; SW 8, 217f. 57 Vgl. GW 21, 98. -
-
46
Sein unter dem Aspekt einer Forschungslogik
Etwas bestimmtes, qualitatives Dasein ausdrückt, das über die Vermittlung der in ihm ausgeschlossenen Qualitäten definiert ist (über seine Negation), stellt es nach Hegel eine einfache seiende Beziehung auf sich, ein Insichsein dar, worin er im Hinblick auf den methodischen Gang eine erste Negation der Negation erkennt.58 Etwas und Anderes werden zunächst als Formbestimmungen entwickelt, mit denen Daseiendes gleichgültig, beziehungslos zueinander gefaßt wird. ledes ist nach Hegel ein Anderes.59 Mit ihnen wird eine Bestimmungsebene aufgespannt, in welcher der Gegenstand als unmittelbare, einzelne Entität auftritt, dem andere einzelne Entitäten beziehungslos gegenüberstehen. Diese Bestimmung erweist sich nach Hegel im weiteren als Schein. "Etwas und Anderes fallen auseinander. Aber ihre Wahrheit ist ihre Beziehung".60 Das wird von ihm im weiteren aufgezeigt, indem er die Bestimmung des Etwas als Einheit der Momente Ansichsein und Sein-für-Anderes entwickelt. Etwas ist nach ihm sowohl Gleichheit, Beziehung auf sich als auch, indem das Anderssein in ihm enthalten ist, Beziehung auf sein Nichtdasein, d. h. Sein-für-Anderes. Die Bestimmung des Dings an sich, ohne Anderes gedacht, was Hegel in diesem Zusammenhang herausstellt, bildet nur eine Abstraktion, welche die Seite des Seinsfür-Anderes unzulässig ausblendet.61 Seine Logik des Daseins stellt in dieser Hinsicht eine grundlegende Kritik am traditionellen Dingbegriff bzw. an der Auffassung dar, das Seiende als gleichgültiges Nebeneinander einzelner, selbständiger Gegenstände zu begreifen. Hegel selbst faßt das Seiende dagegen bereits auf dieser Elementarebene als ein relationales Gefüge, in dem Bestimmtheit (Qualitäten) nur in Beziehung auf andere Bestimmtheiten gedacht werden kann. In der Auflösung des bestimmten Seins in ein Relationsgefüge von aufeinander bezogenen, austauschbaren Qualitäten deutet sich bereits der Weg zur quantitativen Bestim-
mungsebene an. Ausgehend vom Etwas als dem bestimmten Sein geht Hegel im weiteren zu den zentralen Bestimmungen Endlichkeit und Unendlichkeit über. Dasein ist für ihn nicht nur ein Ausdruck für Unmittelbarkeit und Bestimmtheit, sondern ebenfalls für Veränderung, Vergehen. Die Sphäre des Daseins bildet, wie er symptomatisch heraushebt, eine "Sphäre der Differenz, des Dualismus, das Feld der Endlichkeit."62 "Das Endliche verändert sich nicht nur, wie Etwas überhaupt, sondern es vergeht, und es ist nicht bloß möglich, daß es vergeht, so daß es seyn könnte, ohne zu vergehen. Sondern das Seyn der endlichen Dinge als solches ist, den Keim des Vergehens als ihr Insichseyn zu haben, die Stunde ihrer Geburt ist die Stunde ihres Todes."63 Die Bestimmung der Endlichkeit wird dabei spezifisch aus der immanenten Grenze des Etwas, die aus dessen Qualität folgt, entwickelt.64 58 Vgl. ebd., 103. 59 Vgl. ebd., 105. 60 Ebd., 107. 61 Hegel weist in diesem
Zusammenhang kritisch darauf hin, daß "die Definitionen der Metaphysik, wie ihre Voraussetzungen, Unterscheidungen und Folgerungen [...] nur Seyendes und zwar Ansichseyendes behaupten und hervorbringen" (GW 21, 110), wodurch das andere wesentliche Moment, das Sein-für-Anderes,
herausfallt. 62 GW 21, 144. 63 Ebd., 116. 64 "Durch seine Qualität ist Etwas gegen ein Anderes, ist veränderlich und endlich, nicht res, sondern an ihm schlechthin negativ bestimmt" (ebd., 96).
nur
gegen ein Ande-
47
Christine Weckwerth
Wie bei den vorangehenden Bestimmungen geht Hegel zunächst von ihrem unmittelbarem Gebrauch aus. Das "Endliche ist das Beschränkte, Vergängliche; das Endliche ist nur das Endliche, nicht das Unvergängliche; diß liegt unmittelbar in seiner Bestimmung und Ausdruck."65 Endliches erscheint danach als das Andere des Unvergänglichen, Unendlichen, wie Unendliches umgekehrt als Negation oder "Nichts des Endlichen"66 auftritt. Beide werden so jeweils als das Andere aufgefaßt. Eine solche Bestimmung bleibt nach Hegel abstrakt. Sie enthält zugleich ein dingliches Moment. "Das Endliche steht nach dieser Bestimmtheit dem Unendlichen als reales Daseyn gegenüber; so stehen sie in qualitativer Beziehung als aussereinander bleibende".67 Hegel erkennt darin eine Grundlage für die Annahme zweier heterogener Welten. Es "sind damit zwey Bestimmtheiten; es gibt zwey Welten, eine unendliche und eine endliche, und in ihrer Beziehung ist das Unendliche nur Grenze des Endlichen, und ist damit nur ein bestimmtes, selbst endliches Unendliches."68 Auf der Grundlage einer solchen dinglichen Bestimmung von Endlichkeit und Unendlichkeit läßt sich nach ihm kein wirklicher Übergang zwischen beiden bzw. nur eine äußere Vermittlung denken wie im Gedanken des ununterbrochenen Hinausschiebens der Grenze des Endlichen. Der unendliche Progreß "ist das Aeussere jener Einheit, bey welchem die Vorstellung stehen bleibt, bei jener perennirenden Wiederholung eines und desselben Abwechseins, der leeren Unruhe des Weitergehens über die Grenze hinaus zur Unendlichkeit".69 Auf die Relevanz dieser Problematik kommt er später exemplarisch am Beispiel des mathematischen Unendlichen zurück, bei dessen Bestimmung er zwischen einem (adäquaten) Verhältnis- und einem (inadäquaten) Mengenbegriff -
unterscheidet.70
Der "schlechten" Unendlichkeit, dem Ausdruck für eine verdinglichte Auffassung von Endlichem und Unendlichem, stellt Hegel den Begriff der "wahrhaften" Unendlichkeit gegenüber, mit dem beide Bestimmungen als aufeinander bezogene Momente gedacht werden. Endlichkeit ist "nur als Hinausgehen über sich; es ist also in ihr die Unendlichkeit, das Andre ihrer selbst, enthalten. Eben so ist die Unendlichkeit nur als Hinausgehen über das Endliche; sie enthält also wesentlich ihr Andres, und ist somit an ihr das Andre ihrer selbst. Das Endliche wird nicht vom Unendlichen als einer außer ihm vorhandenen Macht aufgehoben, sondern es ist seine Unendlichkeit, sich selbst aufzuheben."71 Endliches und Unendliches werden somit als Momente ein und derselben Beziehung gefaßt. Nach der Seite des Unendlichen betrachtet, drückt dieses kein dingliches Jenseits mehr aus, sondern wird als Moment im Prozeß des Daseienden bzw. das Endliche als Moment des Unendlichen, als "Prozeß des Werdens"72 gefaßt, begriffen. Die neue Bestimmung, die beide Momente vereint, ist das Fürsichsein, welches nach Hegel Rückkehr in sich, Beziehung auf sich selbst ausdrückt.
65 66 67 68 69 70 71 72
48
Ebd., 117. Ebd., 126. Ebd., 127. Ebd.
Ebd., 130. Vgl. GW 21, 244. Ebd., 133. "Die Idealität kann die Qualität der Unendlichkeit genannt werden; aber sie ist wesentlich der Proceß des Werdens" (ebd., 137). Hegel faßt das Unendliche als das Werden, "aber das nun in seinen Momenten weiter bestimmte Werden auf (ebd., 136).
Sein
unter
dem Aspekt einer Forschungslogik
In der Bestimmung der das Endliche umfassenden "wahrhaften" Unendlichkeit sieht Hegel einen entscheidenden Schritt im Prozeß der Wissenskonstitution.73 Neben den spekulativen Prämissen, die sich hierin aussprechen, setzt mit diesem Schritt wesentlich die Ablösung von der Sphäre des unmittelbaren, beschränkten Daseins ein. Der Verlauf der Seinslogik zeigt, daß im weiteren zu Formbestimmungen übergegangen wird, mit denen Sein als ein durch keine Qualität mehr beschränktes, unvergängliches ausgesagt wird. Das ist bei Hegel die Sphäre der Quantität bzw. der Zahl. Der Weg dorthin führt zunächst über die Bestimmung des Fürsichseins als der "in das einfache Seyn zusammengesunkene[n] Unendlichkeit".74 In deren Zentrum stellt Hegel die Problematik des Eins und Vielen. Das Eins, obgleich noch der Qualitätssphäre angehörend, drückt bezeichnend kein Dasein mehr aus, es ist "keine Bestimmung als Beziehung auf Anderes, keine Beschaffenheit, es ist diß, diesen Kreis von Kategorien negirt zu haben. Das Eins ist somit keines Anderswerdens fähig; es ist unveränderlich."75 In der von Rosenkranz herausgegebenen Nürnberger Propädeutik, Begriffslehre und philosophische Enzyklopädie, werden Fürsichsein, Eins und Vielheit bereits als Bestimmungen der Quantität entwickelt.76 Die zweite Grundebene der Seinslogik, zu der von der Qualitätssphäre übergegangen wird, bildet die Sphäre der Größe oder Quantität. Quantität ist nach Hegel die Bestimmtheit, "die dem Seyn gleichgültig geworden"77 ist. Das Hauptmoment dieser Sphäre setzt er in die "Gleichgültigkeit der Veränderung, so daß in ihrem Begriff selbst ihr eigenes Mehr oder Minder liegt, ihre Gleichgültigkeit gegen sich selbst."78 Was ursprünglich das Dasein konstituiert hatte, Bestimmtheit und qualitatives Sein, davon wird nunmehr gerade abstrahiert. Die zentralen Formbestimmungen der Quantitätssphäre sind Quantum und Zahl. "Das Quantum, zunächst Quantität mit einer Bestimmtheit oder Grenze überhaupt, ist in seiner vollkom-
-
-
Bestimmtheit die Zahl."79 Die Zahl wiederum wird durch Anzahl und Einheit definiert.80 Vergleichbar hatte Kant die Zahl als das Schema der Größe bestimmt, als eine Vorstellung, "die die sukzessive Addition von Einem zu Einem (gleichartigen) zusammenbe-
menen
faßt."81
Ohne auf die Entwicklung im einzelnen einzugehen, wird deutlich, daß hier eine logische Stufe betreten wird, der ein neuer Verknüpfungsmodus eigen ist. Dieser besteht in seinem Kern in der Zusammenfassung von Gleichem, von ununterscheidbaren, numerischen Eins. Unter dieser Verknüpfung wird Sein als idealer, abstrakter Gegenstand konstituiert, der sich vollständig durch Zahlenverhältnisse ausdrücken läßt.82 Es wird hier eine Bestimmungsebene 73 Vgl. GW 21, 125. 74 Ebd., 146. 75 Ebd., 152. 76 Vgl. G.W.F. Hegel, "3. Cursus.
Begriffslehre Philosophische Encyklopädie § 24-27).
77 78 79 80 81 82
und
philosophische Encyklopädie",
in SW 3, 173f.
(2. Abt.,
GW 21, 173. Ebd., 175. Ebd., 193. Vgl. ebd., 194. KrV B, 182. P. Stekeler-Weithofer hat Hegels Analyse der Quantität in der Logik als eine "analytische Philosophie mathematischer Rede" gedeutet. In Hegels Analyse der Kategorie des Quantums geht es nach ihm "wesentlich um die logische Frage nach der realen Konstitution abstrakter Gegenstände [...], und zwar speziell: der na-
49
Christine Weckwerth
aufgespannt, auf der uneingeschränkt die Leibnizsche These gilt, daß es nichts gibt, das der Zahl nicht unterworfen wäre.83 Eine solche logische Ebene zeichnet offenbar den mathematischen Wissenstypus aus. Entsprechend bezieht sich Hegel bei der Quantitätssphäre auf zeitgenössische mathematische Theorien, wie auf die Differential- und Integralrechnung, im besonderen auf die Theorie von Lagrange. Im Prozeß der wissenschaftlichen Objektivierung
kommt dem mathematischen Wissen damit ein elementarer Stellenwert zu. Die Zahl stellt in der Seinslogik ein fundamentales Ordnungsprinzip dar, auf dessen Grundlage eine Ablösung von der heterogenen Daseinssphäre erfolgt. Für Hegel selbst bilden Geometrie und Arithmetik bezeichnend das Paradigma für (endliches) analytisches und synthetisches Erkennen.84 Ungeachtet dieses Stellenwertes erkennt er dieser Sphäre allerdings nur einen eingeschränkten Geltungsbereich zu.85 Die Zahl ist nach ihm eine abstrakte Bestimmung, kein reales Prinzip. Mit dieser Beschränkung richtet er sich gegen eine Verallgemeinerung des mathematischen zum Wissen schlechthin. Auf den beschränkten Geltungsbereich des mathematischen Erkennens ist Hegel bereits in der Vorrede zur Phänomenologie eingegangen, in welchem Zusammenhang er vom "formelle[n] der mathematischen Evidenz"86 gesprochen hat. Wie er in der Logik anmerkt, ist eine Verallgemeinerung des mathematischen Wissens in der Geschichte der Philosophie paradigmatisch bei Pythagoras aufgetreten, der die Zahl in den Rang eines philosophischen Seinsprinzips gehoben hat. Auch in der zeitgenössischen Philosophie sieht er Ansätze einer solchen Verallgemeinerung, wobei er sich offenbar auf Schelling und Eschenmayer bezieht.87 Hegel selbst erkennt in der mathematischen Wissensform bezogen auf die Philosophie dagegen nur eine symbolische Erkenntnis oder eine "Vorstuffe des reinen denkenden Erfassens".88 In Symbolen (Zahlen) ist nach ihm philosophische Wahrheit "durch
türlichen, rationalen und reellen Quanten als Elemente 'unendlicher' Zahlbereiche." P. Stekeler-Weithofer, "Hegels Philosophie der Mathematik", in Vernunftkritik nach Hegel. Analytisch-kritische Interpretation zur Dialektik, hg. v. Ch. Demmerling und F. Kambartel, Frankfurt a.M. 1992, 220, 217. 83 G.W. Leibniz, "Zur allgemeinen Charakteristik", in ders., Philosophische Werke, hg. v. E. Cassirer, Bd. 1, Hamburg 1996, 16. 84 Vgl. GW 11, 205 und 226. Vgl. dazu auch P. Stekeler-Weithofer, "Hegels Philosophie der Mathematik" (Anm. 82), 214-249 oder auch P. Damerow und W. Lefevre, "Die wissenschaftshistorische Problemlage für Hegels 'Logik'", in Hegel-Jahrbuch 1979, Köln 1980, 349-368. 85 In seiner "Allgemeinen Einteilung der Logik" hat Hegel allgemein darauf gewiesen, daß die Bestimmungen der objektiven Logik nur für die unorganische Natur relevant sind (vgl. dazu den vorhergehenden Abschnitt). Mathematik hat nach ihm wiederum nur ideale Gebilde, d. h. keine realen Größen zum Gegenstand. Sie vermag "nicht Größenbestimmungen der Physik zu beweisen, insofern sie Gesetze sind, welche die qualitative Natur der Momente zum Grund haben" (GW 21, 272), weil das Qualitative außer ihrer Sphäre bleibt. 86 GW 9, 33. 87 "Bekanntlich hat Pythagoras die Vernunftverhältnisse oder Philosopheme in Zahlen dargestellt, auch in neuern Zeiten ist von ihnen und Formen ihrer Beziehungen wie Potenzen u.s.f. in der Philosophie Gebrauch gemacht worden, um die Gedanken darnach zu reguliren oder damit auszudrücken." (GW 21, 203). Vgl. dazu auch Hegels Anmerkung zum Potenzverhältnis (ebd., 321f). 88 Ebd., 321. "Aber mathematische Kategorien herbeyzunehmen, um daraus für die Methode oder den Inhalt philosophischer Wissenschaft etwas bestimmen zu wollen, zeigt sich wesentlich dadurch als etwas Verkehrtes, daß insofern mathematische Formeln Gedanken und Begriffsunterschiede bedeuten, diese ihre Bedeutung sich vielmehr zuerst in der Philosophie anzugeben, zu bestimmen und zu rechtfertigen hat" (ebd., 207).
50
Sein unter dem
Aspekt einer Forschungslogik
das sinnliche Element noch getrübt und verhüllt."89 Seine Logik des Seins läuft bezeichnend mit einer Kritik an einer quantifizierenden Auffassung des Seins aus. Nach Qualität und Quantität, den Sphären des partikularen, bestimmten sowie des mathematischen Seins, geht Hegel schließlich zum Maß als der dritten Grundebene der Seinslogik über. Der Maßbegriff drückt die Vereinigung oder Mitte von Qualität und Quantität aus. Auf dieser Bestimmungsebene wird zum Dasein zurückgekehrt, das nunmehr unter dem Aspekt quantitativer Formbestimmtheit entwickelt wird. Im Maßbegriff liegt für Hegel die "concrete Wahrheit des Seyns",90 worin er bereits die Idee des Wesens erkennt: "nemlich in der Unmittelbarkeit des Bestimmtseyns identisch mit sich zu seyn, so daß jene Unmittelbarkeit durch diese Identität-mit-sich zu einem Vermittelten herabgesetzt ist".91 Zur Entwicklung dieser Bestimmung greift er explizit auf den griechischen Maß-Begriff zurück.92 Die antike Auffassung, daß alles ein Maß hat, wandelt sich in der Seinslogik zur Bestimmung: "Alles Daseyn hat eine Größe, und diese Größe gehört zur Natur des Etwas selbst".93 Hegel selbst verweist hierbei aufschließend auf die Mathematik der Natur.94 Wie der weitere Darstellungsgang zeigt, hebt er den griechischen Maß-Begriff spezifisch in die Tradition der modernen Wissenschaftsentwicklung, deren Ideal die umfassende Berechnung bzw. Mathematisierung der Wirklichkeit gewesen war. In dieser Intention hat u. a. auch Descartes den Maßbegriff gebraucht. Im Zusammenhang mit der Annahme, daß Wissenschaften wie Astronomie, Musik, Optik, Mechanik und andere insgesamt unter die mathematischen Disziplinen zu rechnen sind, hält dieser exemplarisch fest: "Betrachtet man dies aufmerksamer, so erkennt man schließlich, daß man zur Mathematik genau all das rechnen muß, wobei nach Ordnung und Maß geforscht wird, und daß es hierbei gar nicht darauf ankommt, ob man dieses Maß nun in den Zahlen oder in den Tönen oder in irgend einem anderen Gegenstande zu suchen hat, sodaß es also eine bestimmte allgemeine Wissenschaft geben muß, die all das erklären wird, was der Ordnung und dem Maße unterworfen, ohne Anwendung auf eine besondere Materie, als Problem auftreten kann."95 Das Maß wird bei Hegel zunächst in der elementaren Bestimmung des spezifischen Quantums, eines unmittelbaren bestimmten Quantums, dem eine bestimmte Qualität zugehört, entwickelt. "Dieß unmittelbare Maaß ist eine einfache Größenbestimmung; wie z. B. die Größe der organischen Wesen, ihrer Gliedmassen und so fort. Aber jedes Existirende hat eine 89 Ebd., 207. 90 Ebd., 326. 91 Ebd. 92 Hegel setzt sich im Übergang zur Maßbestimmung sowohl von Kants Bestimmung der Modalität ab, wonach diese nur eine Beziehung auf das erkennende Subjekt, keine objektive, den Gegenstand selbst betreffende Kategorie darstellt, als auch von einer pantheistischen Konzeption, wie bei Spinoza, wo Modus generell als ein Nichtsubstantielles, Veränderliches betrachtet wird. Ein "höherer Begriff spricht sich für ihn dagegen im griechischen Bewußtsein, in der Auffassung, daß alles ein Maß hat, aus. Vgl. dazu GW 21, 323ff. 93 Ebd., 330. 94 "Die Entwicklung des Maaßes, die im Folgenden versucht worden, ist eine der schwierigsten Materien; indem sie von dem unmittelbaren äusserlichen Maaße anfängt, hätte sie einerseits zu der abstracten Fortbestimmung des Quantitativen (einer Mathematik der Natur) fortzugehen, andererseits den Zusammenhang dieser Maaßbestimmung mit den Qualitäten der natürlichen Dinge anzuzeigen, wenigstens im Allgemeinen" (ebd., 327; vgl. auch 340). 95 R. Descartes, Regeln zur Leitung des Geistes, Regel IV, 9.
51
Christine Weckwerth
um das zu seyn, was es ist, und überhaupt, um Daseyn zu haben."96 Die folgende Bestimmung, das spezifizierende Maß, drückt bereits eine vermitteitere Beziehung aus. Das Maß ist "specifisches Bestimmen der äusserlichen Grosse [...], die nun von einer andern Existenz überhaupt an dem Etwas des Maaßes gesetzt wird".97 Wie Hegel am Beispiel der Wärmekapazität erläutert, wird hier nicht mehr ein Quantum, sondern ein Verhältnis zwischen verschiedenen Quanten betrachtet, in diesem Fall zwischen spezifischer Wärme der Körper und Temperatur. Das Maß wird zu einem spezifizierten Größenverhältnis, "in welchem die Grossen durch die Natur der Qualitäten bestimmt und different gesetzt sind, und dessen Bestimmtheit daher ganz immanent und selbstständig, zugleich in das Fürsichseyn des unmittelbaren Quantums, den Exponenten eines directen Verhältnißes, zusammen gegangen ist".98 Drückt die spezifische Quantität ein Verhältnis abstrakter Qualitäten wie das von spezifischer Wärme und Temperatur oder Raum und Zeit aus, so entwickelt Hegel unter der folgenden Bestimmung des realen Maßes eine "Beziehung von Maaßen, welche die Qualität unterschiedener selbstständiger Etwas, geläuffiger: Dinge ausmachen [...]; zu den bevorstehenden zu betrachtenden sind specifische Schwere, weiterhin die chemischen Eigenschaften die Beyspiele, welche als Bestimmungen materieller Existenzen sind."99 Unter das reale Maß fallen Formbestimmungen, die sich speziell auf die Verbindung von Dingen richten, die, worauf Hegel selbst verweist, für die chemische Sphäre relevant sind.100 In seinen entwickelt-
Größe,
-
-
-
sten Formen, als Reihe von Maßverhältnissen, Wahlverwandtschaft und Knotenlinie von Maßverhältnissen, drückt das reale Maß jeweils konstante, wiederkehrende Beziehungen bzw. Verhältniszahlen zwischen einzelnen Dingen (Stoffen, Materien) aus. Die Knotenlinie von
Maßverhältnissen ist schließlich der Ausdruck für eine Maßbestimmung der Veränderung selbst, und zwar unter dem Aspekt eines Ineinanderumschlagens von Quantität und Qua-
lität.101 96 97 98 99 100
GW 21, 331. Ebd., 333. Ebd., 343. Ebd., 345. "Es ist hier der Ausdruck Wahlverwandtschaft, wie auch im vorhergehenden Neutralität, Verwandtschaft, gebraucht worden, Ausdrücke, die sich auf das chemische Verhältniß beziehen. Denn in der chemischen Sphäre hat wesentlich das Materielle seine specifische Bestimmtheit in der Beziehung auf sein Anderes; es existirt nur als diese Differenz" (ebd., 352). Wie bei der Quantität bezieht sich Hegel auch auf dieser logischen Ebene auf Beispiele aus zeitgenössischen wissenschaftlichen Theorien, so auf Berthollets Lehre von den Gesetzen der Verwandtschaft, auf Berzelius' Proportionslehre oder auf J.B. Richters Auffassungen zur Stöchimetrie. Vgl. Hegels Anmerkung zur Wahlverwandtschaft (ebd., 354). Vgl. ebd., 365. Die Entwicklung des Maßes endet bei Hegel nicht mit der Knotenlinie von Maßverhältnissen, sondern eigentümlich mit der Bestimmung des Maßlosen und der absoluten Indifferenz. Letztere Bestimmung ist für ihn ein Ausdruck für die Einheit des Seins. "Das Seyn ist nun als diese Indifferenz, das Bestimmtseyn des Maaßes nicht mehr in seiner Unmittelbarkeit; sondern dasselbe auf die so eben aufgezeigte entwickelte Weise; Indifferenz als es an sich das Ganze der Bestimmungen des Seyns, welche zu dieser Einheit aufgelöst sind; ebenso Daseyn, als Totalität der gesetzten Realisation, in welcher die Momente selbst die ansichseyende Totalität der Indifferenz, von ihr als ihrer Einheit getragen, sind" (ebd., 375). Diese Bestimmungen treffen offenbar auf die Schellingsche Philosophie zu. Indem die absolute Indifferenz auf einer Negation aller Bestimmtheiten des Seins gründet, der (qualitative) Unterschied damit negiert wird, kann unter dieser Voraussetzung nach Hegel Einheit nur quantitativ, als ein Gleichgewicht von Faktoren gefaßt werden. Vgl. ebd., 373-381. Darin erkennt Hegel eine theoretisch unbefriedigende Verallgemeinerung des -
101
-
52
-
Sein unter dem
Aspekt einer Forschungslogik
An den Maßbestimmungen wird deutlich, daß gegenüber der Qualitäts- und Quantitätssphäre eine neue logische Ebene aufgespannt wird: sie bedeuten weder bloße Bestimmtheit bzw. partikulares, vergängliches Dasein noch reine Zahlenverhältnisse; sie sind vielmehr ein Ausdruck für quantitative Beziehungen innerhalb der Sphäre des Daseienden selbst, und zwar für konstante, wiederholbare Beziehungen oder Reihen. Auf ihrer Grundlage wird Sein spezifisch als Komplex oder Inbegriff von konstanten Relationen gedacht. Darin kündigt sich bereits der Gesetzbegriff der Wesenssphäre an. Gegenüber der Quantitätssphäre, für die eine Synthese von gleichartigen, numerischen Eins auszeichnend ist, werden auf dieser Bestimmungsebene nunmehr verschiedenartige Qualitäten bzw. qualitative Momente der Daseinssphäre synthetisiert. Worauf Hegel selbst verwiesen hat, bildet der Maßbegriff das logische Fundament spezifisch für die mathematisch-naturwissenschaftliche Begriffsbildung. Anhand der herangezogenen Beispiele zeigt sich, daß sich auf Grundlage der Maßbestimmungen speziell die Sphäre des Mechanischen (Physikalischen) und Chemischen konstituiert, welche sich über das partikulare, bestimmte Sein sowie über das Reich der Zahlen erhebt. Diese Bestimmungsebene setzt sowohl elementare logische Aussageformen als auch die Formbestimmungen der Größe sowie der Bestimmtheit voraus. Darin spricht sich eine bestimmte Notwendigkeit im Fortgang der Seinslogik aus. Dieser Fortgang gründet offenbar in der Logik wissenschaftlicher Objektivierungsprozesse. Er wird in der Hegelschen Logik eigentümlich vom Prozeß der Selbstbewegung der absoluten Idee überlagert, die aus dem spekulativen Geistkonzept Hegels hervorgeht. Nach der spekulativen Seite fungieren die logischen Aussageformen als aufeinander aufbauende Stufen im der Zeit enthobenen Realisationsprozeß der Idee. In dieser Funktion werden sie vom endlichen Wissensprozeß abgekoppelt und zum in sich geschlossenen Reich der "Wahrheit, wie sie ohne Hülle an und für sich selbst ist", überhoben. Daraus entsteht in der Logik das eigenartige Doppel Verhältnis von bestimmtem, an den Wissenschaften orientiertem Wissensprozeß sowie dem außer der Zeit stehenden Selbstbewegungsprozeß der absoluten Idee. An diesem Punkt setzt bezeichnend die Kritik bei Schelling, Ch. H. Weiße, I. H. Fichte, A. Trendelenburg, Feuerbach oder Marx ein.102 Ungeachtet der spekulativen Prämissen sowie ihrer spezifischen Auswirkungen auf das Logikkonzept zeigt der Entwicklungsgang der Logik, zumindest der betrachteten Seinslogik, daß sich Hegel darin an der Logik der wissenschaftlichen Begriffsbildung unter Einbeziehung spezifischer Wissenschaftstypen orientiert. -
-
-
-
mathematischen bzw. naturwissenschaftlichen Erkennens, wie er sie bei Schelling realisiert sieht. 102 Vgl. dazu stellvertretend Schellings Einwände in seinen Münchener Vorlesungen zur Geschichte der neueren Philosophie. Schelling wendet darin kritisch ein, daß Hegel in seiner Logik die Bewegung des Begriffs in den Rang einer allgemeinen absoluten, vom denkenden Subjekt abgelösten Tätigkeit erhebt und an dieser die Notwendigkeit des Fortgangs festmacht, wogegen "das stillschweigend Leitende dieses Fortgangs [...] doch immer der terminus ad quem, die wirkliche Welt, bei welchem die Wissenschaft ankommen soll", ist. F.W.J. Schelling, "Zur Geschichte der neueren Philosophie. Münchener Vorlesungen", in ders., Sämmtliche Werke, hg. v. K.F.A. Schelling, Abt. 1, Bd. 10, Stuttgart und Augsburg 1861, 132. Vgl. dazu auch die zusammenfassende Darstellung der Einwände gegen die gesamtsystematische Stellung der Hegelschen Logik bei B. Burkhardt, Hegels "Wissenschaft der Logik" im Spannungsfeld der Kritik. Historische und systematische Untersuchungen zur Diskussion um Funktion und Leistungsfähigkeit von Hegels "Wissenschaft der Logik" bis 1831, Hildesheim 1993, 329ff.
quantitativen
-
-
53
Christine Weckwerth
Zum Verhältnis von logischem und phänomenologischem Wissen bei Hegel In den vorangehenden Abschnitten wurden Aspekte der Strukturierung sowohl des logischen als auch des phänomenologischen Wissens bei Hegel behandelt. Im folgenden soll abschließend nach dem allgemeinen Verhältnis beider Wissensformen gefragt werden, wobei unter phänomenologischem Wissen das in der Phänomenologie des Geistes entwickelte Wis-
sen verstanden wird.103 Hegel selbst geht auf Grundlage seines Geist-Konzepts ursprünglich davon aus, daß die Kategorientheorien der Phänomenologie und Logik sich gegenseitig entsprechen. Das phänomenologische und logische System sind für ihn, wenn auch auf differenten Darstellungsebenen, Spiegelungen ein und desselben Prozesses des sich realisierenden und reflektierenden Geistes. Den Unterschied zwischen beiden setzt Hegel allgemein in die Differenz erscheinendes reines Wissen. Auf der phänomenologischen Ebene gelangt der Geist nach ihm über die gattungsgeschichtliche Evolution des naiven Bewußtseins, auf der logischen Ebene über die Genese der reinen, logischen Aussageformen zum Bewußtsein seiner selbst. In der Logik stellt er diesen Unterschied später so heraus, daß die Phänomenologie gegenüber dem logischen Wissen das Bewußtsein oder den erscheinenden Geist, den "Geist als concretes und zwar in seiner Aeusserlichkeit befangenes Wissen",104 zum Gegenstand hat. Sie ist in seinen Augen ein an einem konkreten Gegenstand dem Bewußtsein dargelegtes Beispiel für die Methode der philosophischen Wissenschaft, wie sie in reiner, unverhüllter Form in der Logik entwickelt wird.105 Hegel ist von seinem ursprünglichen Systemplan, Phänomenologie als ersten Systemteil, Logik als erste Folge des zweiten Systemteils zu entwickeln, wieder abgegangen. Im Verlaufe der Ausarbeitung seines philosophischen Systems ändert sich offenbar der systemtheoretische Stellenwert der Phänomenologie.106 Ungeachtet dieser systemtheoretischen -
-
103 Die
-
nach dem Verhältnis von phänomenologischem und logischem Wissen erübrigt sich allerdings, der Phänomenologie von vornherein den Rang einer systematischen Schrift abspricht, welche Auffassung viele Hegel-Schüler vertraten. Michelet spricht paradigmatisch davon, daß Hegel in der Phänomenologie "noch nicht auf dem Standpunkt der Wissenschaft selbst [steht], weil dieser dadurch ein unmittelbarer, unbewiesener würde". Das frühe Werk seines Lehrers zeichnet nach ihm "eine Armuth von logischen Kategorien" aus. Vgl. CL. Michelet, Geschichte der letzten Systeme der Philosophie in Deutschland von Kant bis Hegel, Teil 2, Berlin 1838, 616f. Eine ähnliche Auffassung findet man auch bei den HegelSchülern Gabler, Hinrichs oder Erdmann. In neuerer Zeit findet man diese Deutung exemplarisch bei V. Hösle, welcher der Phänomenologie zwar eine "propädeutische Einleitungsfunktion" zuerkennt, im weiteren aber festhält, "daß unter begründungstheoretischen Gesichtspunkten die 'Phänomenologie' kein integrierender Teil des Systems sein kann." Ders., Hegels System. Der Idealismus der Subjektivität und das Problem der Intersubjektivität, Bd. 1, Hamburg 1988, 58. 104 GW 21, 8. 105 Vgl. GW 21, 37. Die Logik als das reine Wissen ist nach Hegel die "Wissenschaft der absoluten Form" (GW 11, 25, 27). Ihr Inhalt ist die "Natur der reinen Wesenheiten", welche sowohl der Fortbewegung des Bewußtseins als auch der "Entwicklung alles natürlichen und geistigen Lebens" (GW 21,8) zugrunde liegen. Indem die Phänomenologie auf der Natur der reinen Wesenheiten gründet, läßt sie sich als eine Art Umhüllung oder Konkretion des logischen Wissens auffassen. 106 Die Phänomenologie tritt bei Hegel später nicht mehr im Rang eines ersten Systemteils auf. Bereits in der Wissenschaft der Logik kennzeichnet er das Verhältnis von Phänomenologie- und Logiksystem in einem
Frage
wenn man
54
Sein
unter
dem
Aspekt einer Forschungslogik
Modifikation des Gesamtsystems bleiben die Erfahrungsgeschichte des Bewußtseins und die Genese des Logischen im Hegelschen System jedoch grundlegend aufeinander bezogen; beide sind ein Ausdruck für den Prozeß des Zu-sich-selbst-Kommens des Geistes. Zwischen dem reinen Wissen und dem Erfahrungswissen besteht bei Hegel prinzipiell kein Wesensunterschied, sondern nur eine Differenz in der Form des Wissens. Geht man auf die Strukturierungsprinzipien in Phänomenologie und Logik zurück, tritt allerdings ein grundlegender Unterschied zutage, der mit der Unterscheidung von erscheinendem und reinem Wissen im Grunde zugedeckt wird. Gegenüber der logischen Wissensgenese, die auf der Struktur der theoretischen Gegenstandsbildung in Form von Aussagen gründet, geht das phänomenologische Wissen eigentümlich auf die Bildungsgeschichte des individuellen, sozialisierten sowie seiner kulturellen Formierung bewußten Subjekts, d. h. auf die Logik heterogener Gegenstandsbildungen (alltagspraktische, rational-systematisierende, gegenständlich-praktische, religiöse, ästhetische, moralische, juridische usw.) zurück, die Hegel in den Zusammenhang eines Erhebungsprozesses des partikularen Subjekts in den geschichtlich-kulturellen Raum des Geistes stellt. Die phänomenologische Wissensgenese verläuft über eine bestimmte Folge heterogener Handlungsbezüge, die spezifisch im Spannungsverhältnis von subjektiven und objektiven Momenten, wie von sinnlicher Gewißheit und gewußtem einzelnem Gegenstand, von Wahrnehmen und wahrgenommenem Ding, von Begierde und begehrtem Gegenstand, von sittlichem Verhalten und (objektiver) Sittlichkeit usw., entwickelt werden. Der dem naiven Bewußtsein gegenüberstehende Gegenstand tritt entsprechend als Objekt der Wahrnehmung, des Verstandes, der Begierde, Beobachtung oder des Glaubens, als ein Objekt von Arbeitsprozessen, von moralischen Handlungen oder, wie im Kampf um Anerkennung, als ein anderes Selbstbewußtsein, in Form von Sittlichkeit, Gesetz oder Recht schließlich als Sphäre der gesamten Gesellschaft auf. Der Gegenstand des logischen Wissens ist dagegen kein sinnlich Wahrgenommenes, Begehrtes, Beobachtetes usw. mehr, sondern wird allein in der Bestimmung von Bedeutung gefaßt. Das betrifft bereits seine elementare Konstitution als ein Daseiendes, welche Bestimmung im Unterschied zum phänomenologischen Dasein spezifisch als Syntheseform elementarer logischer Aussageformen entwickelt wird. Hegels Logik des Seins stellt in dieser Hinsicht meines Erachtens
55
Christine Weckwerth
nicht die logische Form der Anschauung dar,107 weil in ihr genuin die logische, nicht die sinnliche Konstitution des Gegenstandes aufgezeigt wird. Hegel selbst weist vermittelt auf diesen Unterschied, wenn er in der Logik hervorhebt, daß das phänomenologische Wissen auf dem Gegensatz von Bewußtsein und Gegenstand bzw. von Subjektivem und Objektivem beruht, wohingegen das logische Wissen die Befreiung von demselben voraussetzt.108 Die Kategorientheorien in Phänomenologie und Logik, was an diesen Bestimmungen zutage tritt, werden von Hegel jeweils in differenten Begründungszusammenhängen entwickelt. Das logische Wissen, mit dem sukzessive die logischen Schichten des wissenschaftlichen Urteils freigelegt werden, und zwar aufsteigend von elementarsten zu immer komplexeren Aussageformen, läßt sich nicht unmittelbar auf das phänomenologische Wissen wie dieses als (alogische) Erfahrungsgeschichte des Bewußtseins nicht auf das logische Wissen projizieren.109 Aufgrund ihrer Strukturierung läßt sich die Logik meines Erachtens auch nicht als "universale Kommunikationstheorie" auffassen.110 anderen Duktus. Die Funktion der Phänomenologie setzt er nunmehr darin, den Begriff der reinen Wissenschaft zu deduzieren (vgl. GW 21, 33). Das stellt eine offensichtliche Einschränkung zum ursprünglichen Programm der Phänomenologie als einer ersten Wissenschaft dar. Nur noch die Logik besitzt nunmehr den Status einer Grundlegungswissenschaft des philosophischen Systems. Für die Neuauflage der Phänomenologie läßt Hegel 1831 bezeichnend den Titel eines ersten Teils des Systems fallen. Auch die in der zweiten Auflage der Wissenschaft der Logik beigefügte Anmerkung zur ersten Vorrede weist auf diese Titeländerung hin (vgl. ebd., 9); vgl. dazu auch Hegels Anmerkungen zum § 36 der Heidelberger Enzyklopädie (SW 6, 48f.) sowie zum § 25 der Berliner Enzyklopädie (GW 20, 68f.). An die Stelle des ursprünglichen Systementwurfs, Phänomenologie als ersten, Logik sowie Natur- und Geistphilosophie als zweiten Teil des "Systems der Wissenschaften" zu entwickeln, setzt Hegel später das enzyklopädische System (vgl. GW 21, 9). Dieses umfaßt sowohl Logik als auch Realphilosophie, als auch eine phänomenologische Disziplin. Zur Problematik von Hegels gewandelter Stellung zur Phänomenologie vgl. auch O. Pöggeler, "Zur Deutung der Phänomenologie des Geistes", in Hegel-Studien 1 (1961), 255ff., H.-F. Fulda, Das Problem einer Einleitung in Hegels Wissenschaft der Logik (Anm. 8), W. Bonsiepen, "Einleitung", in Phänomenologie des Geistes, neu hg. v. H.F. Wessels und H. Clairmont, Hamburg 1988 oder auch V. Hösles Ausführungen zu Hegels Systemprogramm, in Hegels System (Anm. 103), 52ff. 107 Zu dieser Auffassung vgl. zum Beispiel R. Wiehls Interpretation der Hegelschen Seinslogik. Die Unbestimmtheit der Seinslogik zeigt für Wiehl, "daß die Logik des Seins die Logik des Veränderlichen, die logische Form der Anschauung darstellt, den Begriff der sichtbaren Veränderung und Bewegung, deren Beweggründe unter der Oberfläche des Übergehens verborgen bleiben." R. Wiehl, "Piatos Ontologie in Hegels Logik des Seins", in Hegel-Studien 3 (1965), 179. Eine ähnliche Auffassung findet sich meines Erachtens bei M. Theunissen, der von einer "Strukturähnlichkeit der Anfänge" von Logik und Phänomenologie ausgeht, die sich nach ihm in deren weiterer Bestimmung fortsetzt. Vgl. M. Theunissen, Sein und Schein (Anm. 47), 107. Gegenüber einer solchen strukturellen Annäherung von Phänomenologie und Logik hat Gadamer bezeichnend auf den Unterschied von phänomenologischer und logischer Methode gewiesen. Der "methodische Progreß, durch den die 'Phänomenologie' zu ihrem Ziele kommt, nämlich zu der Einsicht, daß Wissen dort ist, wo das, was wir meinen, und das, was ist, sich in nichts mehr unterscheiden", besitzt in der Logik für ihn keine Relevanz mehr. Bezogen auf die Seinslogik stellt er heraus, daß "wir es in dem grundlegenden ersten Teil derselben, der 'Logik', die die Wissenschaft von den Seinsmöglichkeiten ist, mit dem reinen Inhalt der Gedanken zu tun [haben], mit den Gedanken, die vollkommen von allem subjektiven Meinen der Denkenden abgelöst sind." H.-G. Gadamer, "Die Idee der Hegelschen Logik" (Anm. 18), 74.
108 Vgl. GW 21, 33,45 oder 63. 109 Der différente Begründungszusammenhang des phänomenologischen und logischen Wissens spricht meines Erachtens gegen eine einfache Gleichsetzung von Phänomenologie und Logik, wie sie in der Rezeptionsgeschichte der Hegelschen Philosophie immer wieder aufgetreten ist, so in exemplarischer Form bei Feuer-
56
Sein unter dem Aspekt einer Forschungslogik
In Anbetracht der unterschiedlichen Strukturierungen muß gefragt werden, inwieweit die Kategorientheorien in Phänomenologie und Logik dennoch aufeinander zu beziehen sind, wovon Hegel in seinem Geist-Konzept ursprünglich ausgeht. Läßt sich ein Bezug vielleicht nur auf der spekulativen Ebene auf Grundlage einer Identität von Logischem und Geschichtlichem aufzeigen? In seiner Vorrede zur zweiten Ausgabe der Logik geht Hegel indirekt auf diese Problematik ein. Die reinen Denkformen, der allgemeine Gegenstand der Logik, werden nach ihm "zunächst in der Sprache des Menschen herausgesetzt und niedergelegt".111 Sie werden in einer Sprache "zu Substantiven und Verben herausgestellt und so zur gegenständlichen Form gestempelt".112 Über das sprachliche Medium durchdringt das Logische nach Hegel die Gesamtheit der kulturellen Tätigkeitssphären.113 Innerhalb der allgemeinen Bildungsgeschichte -
-
bach, der in seiner generellen Ablehnung der spekulativen These von der Identität des Gedankens und der Realität, und zwar in bezug auf den Anfang beider Werke, festhält, daß die Phänomenologie "nichts ande-
als die phänomenologische 'Logik'" sei sowie die "Logik wiederum eine "Phänomenologie", weil wir auch "innerhalb der 'Logik' in einem Zwiespalt zwischen Schein und Wahrheit" befinden. L. Feuerbach, "Zur Kritik der Hegelschen Philosophie", in ders., Gesammelte Werke, hg. v. W. Schuffenhauer, Bd. 9, Berlin 1982, 45 u. 35. Insbesondere in der neueren Rezeptionsgeschichte der Phänomenologie hat es Versuche gegeben, zwischen Phänomenologie und Logik eine unmittelbare Strukturidentität aufzuzeigen. Allerdings wurde dazu nicht die Wissenschaft der Logik, sondern frühere Logikentwürfe Hegels zugrunde gelegt. Vgl. stellvertretend H. Heinrichs, Die Logik der 'Phänomenologie des Geistes', Bonn 1974; H.-F. Fulda, "Zur Logik der Phänomenologie von 1807", in Hegel-Studien, Beiheft 3 (1966), 75-102. 110 Diese Auffassung vertritt u. a. M. Theunissen. "Eine spezielle Intersubjektivitätstheorie präsentiert die Hegelsche Logik darum nicht, weil sie als universale Kommunikationstheorie angelegt ist." M. Theunissen, Sein und Schein (Anm. 47), 46. Unter Voraussetzung der hier zugrunde gelegten Strukturierung, wonach Hegels Wissenschaft der reinen Denkbestimmungen auf der logischen Struktur wissenschaftlicher Aussageformen gründet, wird diese Interpretation der Hegelschen Logik meines Erachtens nicht gerecht gleichwohl M. Theunissen auf ihrer Grundlage im Hinblick auf die kritische Funktion der Logik grundlegende Aspekte herausgearbeitet hat. Eine universale Kommunikationstheorie bedarf meines Erachtens eine weitergehende Begründung als in der logischen Struktur der theoretischen Vernunft. Gegen eine Interpretation der Wissenschaft der Logik als eine Theorie der Intersubjektivität, hat sich u. a. auch V. Hösle gewendet. Hösle bringt in diesem Zusammenhang den Einwand vor, "daß Hegels Logik keine Subjekt-Subjekt-Relationen thematisiert" (V. Hösle, Hegels System, Anm. 103, 271). Aus der Perspektive des späteren enzyklopädischen Systems hält er fest: "so ist es doch auf Basis der 'Wissenschaft der Logik' jedenfalls nicht möglich, dieses Übergehen des subjektiven Geistes, der die Stufe der Vernunft erreicht und damit den Gegensatz von Subjekt und Objekt überwunden hat, in den intersubjektiv bestimmten objektiven und absoluten Geist zu legitimieren" (ebd., 122f.). Vgl. dazu auch L.B. Puntel, Darstellung, Methode und Struktur. Untersuchungen zur Einheit der systematischen Philosophie GW F. Hegels, Bonn 1973 (Hegel-Studien, Beiheft 10), insbes. 342. Puntel stellt wie Hösle Hegels Logik auf eine Stufe mit der Lehre vom subjektiven Geist, vgl. z. B. ebd., 339. Der aufgezeigte "Mangel" der Hegelschen Logik ist nach Hösle zu beseitigen, indem die Genese des Logischen um einen objektive und subjektive Logik synthetisierenden Teil erweitert wird, der den Begriff der Intersubjektivität zum Thema hätte. Vgl. V. Hösle, Hegels System (Anm. 103), 264. Auch eine solche Erweiterung des logischen Wissens, wenn sie auf Grundlage von Hegels Logik-Konzepts überhaupt durchführbar ist, würde meines Erachtens keine Basis für eine universale Kommunikationstheorie darstellen. Dazu bedürfte es eines wesentlich umfassenderen Ansatzes, als er dem logischem Programm res
uns
-
Hegels zugrunde liegt.
111 GW 21, 10. 112 Ebd., 11. 113 In alles, was dem Menschen "zu einem Innerlichen, zur Vorstellung überhaupt, wird, was er zu dem seinigen macht, hat sich die Sprache eingedrängt, und was er zur Sprache macht und in ihr äussert, enthält ein-
57
fördern nach ihm insbesondere die Wissenschaften höhere Denkverhältnisse zutage bzw. heben diese zu höherer Allgemeinheit und Aufmerksamkeit hervor.114 Die Philosophie stellt in diesem Zusammenhang diese Allgemeinheiten für sich heraus und befreit sie vom Stoff der Anschauung, des Einbildens, der konkreten Interessen des Begehrens, der Triebe usw.115 In den sprachlichen und wissenschaftlichen Symbolisierungen zeigt Hegel eine Vermittlungssphäre auf, die natürliche und philosophische Logik bzw. im weiteren das phänomenologische und logische Wissen miteinander zusammenschließen. Die logischen Formen treten bereits in der Bildungsgeschichte des natürlichen Bewußtseins auf, dort allerdings unreflektiert, im Zusammenhang des Lebens. Der logischen Wissenschaft erkennt Hegel in diesem Zusammenhang die Funktion zu, die Denkbestimmungen, "die überhaupt unsern Geist instinctartig und bewußtlos durchziehen, und selbst indem sie in die Sprache hereintreten, ungegenständlich, unbeachtet bleiben",116 systematisch zu rekonstruieren, und zwar auf Grundlage der "Entwicklung des Denkens in seiner Nothwendigkeit".117 Die Philosophie bedarf, wie Hegel bemerkt, keiner besonderen Terminologie; denn diese tritt bereits in der Sprache des naiven Bewußtseins auf. Mit diesem Ausblick schlägt er zugleich eine Brücke zwischen der Kategorientheorie der Phänomenologie und der Logik. Beide System-Entwürfe enthalten nicht grundlegend voneinander verschiedene Kategorien; sie werden von Hegel nur in differenten Begründungszusammenhängen im Zusammenhang der geschichtlich-kulturellen Erfahrung des naiven Bewußtseins und im Zusammenhang des wissenschaftlichen Denkens entwickelt. Zwischen phänomenologischem und logischem Wissen besteht im Hegelschen System auf diese Weise Einheit und Differenz. Nur unter Voraussetzung eines solchen Spannungsverhältnisses lassen sich die phänomenologischen Gestalten und logischen Formen im einzelnen aufeinander beziehen. -
-
gehüllter, vermischter, oder herausgearbeitet, eine Kategorie; vielmehr dasselbige ist seine eigenthümliche Natur" (ebd., 10). Vgl. ebd., 11. Vgl. ebd., 12.
114 115 116 Ebd., 17f. 117 Ebd., 18.
sosehr natürlich ist ihm das
Logische,
oder
Pirmin Stekeler-Weithofer
Kritik der Erkenntnistheorie Zur Logik von Gegenstandsbezug und Wahrheit bei Hegel (und Wittgenstein)
1.
Verstehen von Inhalten bei sich wandelndem Ausdruck
1.1. Schematische Ordnungen als Rahmen von Auslegungen 1. Die folgenden Grundsätze oder Thesen zu Hegels Philosophie sind notgedrungen grob, gewissermaßen aphoristisch. Sie verlangen ein verständiges Mit- und Weiterdenken des Lesers. Ohne Vereinfachungen gelangen wir selten oder nie zu einer plastischen Übersicht über einen umfangreicheren Textkorpus. Dies wissen wenige so gut, wie diejenigen, die in der Nachfolge Fichtes das Geschäft der Reflexion auf die Philosophie Kants und seiner Vorläufer betreiben, gerade auch Hegel selbst. An den dabei entstehenden .spekulativen', das heißt hochstufigen und verdichteten Übersichten orientieren wir uns, indem wir im Blick auf eigene Erfahrungen, etwa mit schon bekannten Texten, nahegelegte Weiterungen vornehmen. Diese bestehen in der Regel in weiteren Urteilen, sogenannten Folgerungen. Diese sind dann aber nicht etwa auf rein schematische Schlüsse zu reduzieren. Sie verlangen in der Regel eine freie Unterscheidung oder eben Beurteilung zwischen dem, was in den Kernsätzen mitgesagt oder auch nur konnotativ nahegelegt ist, und dem, was nicht in ihnen intendiert ist. Wie eine Landkarte irreführen, aber auch falsch gebraucht werden kann, so auch ein Vorschlag einer Gesamtsicht auf ein Thema oder einen Autor. Die Frage, ob die kartographische Orientierung als ganze inkorrekt oder nur ihr Gebrauch unrichtig ist, ist also nicht einfach und keineswegs im Rückgriff auf fixe Kriterien zu beantworten. 2. Um im einzelnen zu sehen, ob die folgenden Orientierungen tatsächlich zu dem bei Hegel Gesagten und Gedachten passen, mag mancher sich nicht mit der Versicherung begnügen, daß in einer Gegenüberstellung der Texte die Bewährung gefunden werden könne. Er will die Bewährung gezeigt bekommen. Der Wunsch nach unmittelbar überzeugenden Beweisen dafür, daß ein grundsätzlicher Lesevorschlag eines größeren Textkorpus erhellend oder im Vergleich zum schon Bekannten aufklärend ist, läßt sich allerdings ohnehin nie vollkom-
Pirmin Stekeler-Weithofer
immer nur notdürftig befriedigen. Oft ist es auch wichtiger, eine Interpretationsmöglichkeit rahmenartig zu entwickeln, als nachzuweisen, daß sie in allen Details zum Wortlaut des zu verstehenden Textes bzw. der zu deutenden Erscheinungen passe oder sogar insofern die richtige sei. Derartige Schiedsrichterurteile, die einen Auslegungsvorschlag mit anderen Interpretationsvorschlägen vergleichen, sind sogar methodisch sekundär, da sie den Möglichkeitsrahmen, in dem die Entscheidung getroffen wird, implizit schon voraussetzen. Manches Mal wird das Übliche dabei schon als Maßstab für den Schiedsspruch genommen und damit gar kein eigenes Urteil gefällt. Auch wird manchmal übersehen, daß alle Interpretationen eines Textes mit Präsumtionen und Vorverständnissen beginnen. Diese sollten, im guten Fall, wenigstens in Umrissen, thesenartig, explizit gemacht sein. Sie bestimmen den inhaltlichen Ort des Textes oder Korpus, den Platz in einer Entwicklung des Denkens, zugehörige Fragen und damit Bedingungen dafür, was erwartbare und was mehr oder minder befriedigende Antworten sind. Ein sich (hoffentlich) anschließendes Gespräch wird mit der Nennung eines solchen Leitfadens freilich immer nur angefangen. Viel mehr ist von Vor-Orientierungen auch nicht zu erwarten. Ein guter Anfang ist aber selbst sehr viel, nämlich wenn sich die aus ihm mehr oder minder frei entwickelbaren Gedanken als Einsichten bewähren. 3. Eine Explikation durch Grund-Sätze (Prinzipien, Thesen), die ein vorerst unüberschautes Gebiet aufschließen, sind daher immer von der Art, wie Hegel und vor ihm Novalis sie beschreiben: Sie sind wie Samenkörner, wie Blütenstaub.1 In unserem Fall handelt es sich um das Gebiet von Hegels Kritik der klassischen Erkenntnistheorie und seiner .sozialen' bzw. ,kulturholistischen' Analyse von Begriffen und Redegegenständen. Ein Vergleich mit Wittgensteins Überlegungen, etwa zum Regelfolgen, liegt nahe. Aus dem Samen ergeben sich (hoffentlich) Momente oder Schubkräfte für ein weiteres Denken, etwa in möglichen Gesprächen, also für eine Weiterentwickung des Gesagten zu einem Inhalt oder einem Gedanken, und das heißt im Grunde immer: zu einer gemeinsamen Praxis des weiteren Redens, Urteilens, Handelns. Die entwickelbaren Gedanken oder Ideen sind in den Grundsätzen durchaus schon enthalten, auch wenn sie keineswegs vollständig und exakt durch feste Erlaubnisregeln für formale Schlüsse fixiert sind. Die einen Text fortsetzenden Urteile auf Seiten der Hörer oder Leser sind immer auch frei, lassen sich nicht völlig reduzieren auf das, was sich einfach konventionell aus dem Gesagten ergibt. Der Inhalt eines Textes ist damit immer mehr als die Menge der schematisch deduzierbaren Sätze. Die Beherrschung des konventionellen Schließens ist nur eine wichtige Teilkompetenz des Sinnverstehens. 4. Damit sind wir im Rahmen unserer Vorreflexion auf eine zentrale Metapher Hegels gestoßen, nach welcher eine Idee sich entwickelt wie eine Pflanze: Der Same legt den Rahmen fest, wie sich der Organismus bzw. die Idee oder die Institution weiterentwickeln kann, und zwar im letzten Fall auf Grund von freien Urteilen, in welchen die zur Idee passenden Besonderheiten etwa der je gegenwärtigen Zeit bestimmt werden. Weder ist im Samen die Gesamtentwicklung schon voll determiniert, noch ist jene unabhängig von der seminalen Vorgabe.
men,
-
1
So der Titel des
Beitrags
im ersten Band der
von
F. und A.W.
Schlegel herausgegebenen Zeitschrift Athe-
(Nachdruck Darmstadt 1992), wo Novalis diejenigen kritisiert, die sich ein fertiges deduktives System zimmern, "das sie nur suchten, um der Mühe des Nachdenkens überhoben zu sein" (83), und den er so beendet: "Fragmente dieser Art sind litterarische Sämereyen. Es mag freylich manches taube Körnchen darunter seyn: indessen, wenn nur einiges aufgeht!" (106) naeum, Berlin 1798
60
Kritik der Erkenntnistheorie
Der Entwicklungsrahmen ist durch diese weitgehend bestimmt, und für manche Betrachtungen oder Unterscheidungen durchaus auch schon hinreichend abgegrenzt. 5. Die genetische Analyse Hegels, die zugleich Ideen-, Begriffs- und Präsuppositionenanalyse ist, läßt sich insgesamt als Versuch verstehen, im Streit zwischen Kant bzw. Fichte und deren Nachfolgern zu vermitteln: Kants transzendentale Analyse reflektiert auf Formen und Kriterien, die, so Hegel, nur aufgrund des Gegenwartsbezugs des begrifflichen Rahmens Bedingungen einer (relativ) invarianten oder ,ewigen' Geltung definieren. Mit der Einsicht in die Entwicklung des begrifflichen Kriterienrahmens selbst wird den Forderungen nach diachronen Betrachtungen etwa bei Herder, Schelling oder den Frühromatikern stattgegeben. Und dennoch bleibt jeweils das Begriffliche vom bloß Empirischen unterschieden. Wie dieser Unterschied im einzelnen jeweils zu begreifen ist, das ist hier nur zum Teil Thema. Für uns ist wichtiger, daß jeder rechte Umgang mit (Grund)Sätzen den durch sie offen gelassenen Freiheitsspielraum zu respektieren hat unter Beachtung von dessen Grenzen. In gewissem Sinn behalten daher die Protagonisten der Frühromantik darin recht, daß philosophische Rede in einem tiefen Sinn aphoristisch verfaßt ist und auch noch in einer systematischen Ordnung wie der Hegels (oder dann auch bei Wittgenstein) im genannten Sinn als grundsätzliche bzw. hochstufige, eben als spekulative Rede eine ganz besondere Kompetenz und Urteilskraft von den Adressaten verlangt. -
1.2.
Begriffslogik
1. Es lassen sich nun Stufen spekulativer Reflexion oder Logik unterscheiden, wobei wir hier Hegels Reihenfolge umkehren und gewissermaßen von oben zurückschauen. Hegels Begriffslogik thematisiert in meiner Deutung nämlich eben die spekulative Redeform als solche. Ihr geht es um das rechte Verständnis unserer Rede über Formen, Ideen und Ideale, z. B. auch über das Ideal der absoluten Wahrheit. Diese Wahrheit wird traditionell mit dem identifiziert, was aus der Perspektive eines Gottes erkannt werden würde. Daß gerade auch die Analyse der formalen Logik hier, in einer Ebene hochstufiger Spekulation, angesiedelt ist, liegt daran, daß diese, wie schon Parmenides sieht, überzeitliche und damit ideale Geltungskriterien unterstellt. Somit sind auch alle Darstellungen, die mathematische Modelle gebrauchen, von der Art spekulativer Aussagen: Ihre Projektion auf die Wirklichkeit verlangt ein freies Urteilen. Sie selbst sind aufgrund ihrer Idealisierungen und Schematisierungen bloß grobe Kartographien realer Erfahrungsmöglichkeiten. Eben daher ähneln sich dann auch theologische und physikalistisch-materialistische Metaphysik oder Ontologie, nämlich darin, daß beide die formalen Gegenstände und Wahrheiten spekulativer Rede ohne weiteres Nachdenken für .wirklich' erklären. Beide übersehen, wozu die von uns selbst geschaffene Sprachformen der spekulativen Redeebene taugen, und wozu nicht. Es geht daher einer philosophischen Metaphysikkritik nicht etwa darum, die Idee einer kontrafaktisch unterstellten .Allwissenheit' oder die Idee von einem mit mathematischen Lettern zu schreibenden Buch der Natur abzuschaffen. Es kommt vielmehr darauf an, diese Ideen und Redeformen angemessen zu verstehen, zu begreifen. Es müssen dazu, wie sich Hegel metaphorisch ausdrückt, Begriffe und Ideen ,zu sich selbst' kommen. Das heißt, wir müssen die entsprechenden Redeformen nicht ,
61
Pirmin Stekeler-Weithofer
bloß
gebrauchen (können), sondern auch in ihrem sinnvollen Gebrauch begrenzen, beurteilen
(lernen).
2. Gerade die Analyse unserer Reden über invariante Inhalte und die Reflexion auf die Vorstellung überzeitlicher Bedeutungen, ewiger Begriffe und Ideen sind daher in der Begriffslogik angesiedelt. Wir reden über solche Inhalte in idealer Abstraktion vom Realgebrauch der Zeichen, Wörter und anderer äußerer Formen. Zentral ist hier die Einsicht Hegels, daß das rein Formale und rein Schematisch-Exakte immer hochideal, spekulativ ist, und daß seine rechte Anwendung und Beurteilung daher immer sehr viel an Urteilskraft und Erfahrung voraussetzt. Wenn diese fehlen, wird der Vorteil des Formalen und Idealen, nämlich die Übersicht selbst, zur Ursache für Fehlurteile und Aberglauben. Dies gilt für eine theologische Scholastik ebenso wie für eine szientistische Ontologie. 3. Eine Idee, auch ein Begriff, ist nun aber in Wirklichkeit zunächst oft nur in der Form einer mehr oder weniger grob ausgemalten oder benannten Zielvorstellung gegeben, gewissermaßen als Problem, d. h. wörtlich: als noch auszuführender oder durch Beantwortung zugehöriger Fragen zu erfüllender Vorentwurf, als samenartiger Anfang oder als Ab-Sicht. Doch gerade als Absicht steckt das Problem den Rahmen ab für die weitere Entwicklung der Idee selbst. Entwicklungen sind Ergebnisse eines dialogischen und multilogischen Unterscheidens und Identifizierens, gemeinsamen Redens, Urteilens und Handelns, die als wenigstens partielle Erfüllungen einer zugehörigen Intention, einem Vorentwurf der Idee, zugerechnet werden. Realiter gibt es Ideen nur in der Entwicklung von zugehörigen Entwürfen. Hegels Analyse des Realbegriffs der Idee zufolge können wir daher eine Idee (nur) verstehen als einen Gesamtbereich von Urteilen und zugehörigen Orientierungen, die entworfen und entwickelt sind in der Blickrichtung eines am Ende hoffentlich hinreichend gemeinsamen und 'guten' kooperativen Handelns und Lebens. Eine Idee kann also mit sich gleichbleiben und zugleich in ihren Artikulationsformen und Realisierungen je differieren. Sie kann partiell sogar 'in sich' widersprüchlich sein, da wir im faktischen Urteilen keineswegs immer übereinstimmen werden. Was dabei als Fehler oder Inkompetenz zählt, und was dem geschuldet ist, daß die Urteile in gewissem Maß immer frei (für neue Entwicklungen) bleiben dürfen und sollen, ist nicht immer allgemein zu sagen. Zu den in bezug auf die Ideen oder Inhalte (freilich nur scheinbaren) Äußerlichkeiten gehören die sich wandelnden Artikulationsformen, aber auch die zugehörigen weiteren Praxisformen. Es ist nicht etwa Begriffs- und Ideen/nyííí'ziJTttMS, sondern strenge Sinnanalyse, die Hegel zu seiner zentralen Einsicht führt, daß jeder Begriff und jede Idee eine zeitliche Entwicklung umfaßt, und daß in derartigen Entwicklungen immer auch 'Widersprüche' enthalten sind. Ideen und Begriffe enthalten die Widersprüche, welche ihre reale Anwendung und reale Entwicklung bedingen. Es handelt sich bei diesen Widersprüchen immer auch darum, daß die Menschen ihre Unterscheidungen bestenfalls mehr oder weniger gemeinsam treffen, und daß die Gemeinsamkeit des Urteilens und das Kooperative im Handeln zunächst bloßes Ziel ist, das in der Wirklichkeit nie vollkommen realisiert werden kann. Daher wird jede reale, nicht bloß ideale, Logik des Begriffs zur Dialektik: Hier werden die Formen der Maßnahmen betrachtet, wie die Menschen die immer auftretenden Widersprüche und Unverständnisse real aufheben, und wie sie, also wir, auf die Tatsache der Entwicklung der entsprechenden Formen und Kriterien im Rückblick reflektieren. Wir betrachten dazu ein Beispiel.
62
Kritik der Erkenntnistheorie
4. Die Idee der Demokratie in ihrer realbegrifflichen Entwicklung enthält Widersprüche sowohl aufgrund der Sprach- und Institutionengeschichte, als auch in den gegenwärtigen institutionellen Formen. Die heutigen Demokratien sind in vielem timokratischer, auch plutokratischer und republikanischer im römischen Sinn, als das Wort zu besagen scheint, wenn man an die attische Demokratie denkt. Die moderne Demokratie ist, andererseits, durchaus auch weniger 'aristokratisch' als die attische, da dort der Kreis der Vollbürger im wesentlichen durch Geburt begrenzt war. Unsere bürokratische Expertenherrschaft mit allgemeiner Wahl von Repräsentanten in Kontrollorganen ähnelt dem Leitbild Piatons womöglich viel mehr als der von ihm kritisierten attischen Demokratie. Der Begriff der Demokratie 'enthält' daher immer auch die Entwicklungeschichte sowohl des Wortes in bezug auf andere, ausgrenzende Wörter, als auch der zugehörigen Institutionen, die oft durchaus Kompromisse in sich enthalten, durch die frühere Differenzen (der Anerkennung) und Dysfunktionalitäten aufgehoben werden. 5. Es ist eine derartige Einsicht, welche die Hegeische Dialektik als logische Analyse der Grundformen begrifflicher Realinhalte charakterisiert. Aus der Perspektive einer bloß formalen Logik ist diese Dialektik kaum zu begreifen. Denn die formale Logik unterstellt feste Kriterien ohne Berücksichtigung der realen Pluralität der Menschen, Menschengruppen, ihrer Institutionen und Gebräuche und der damit verbundenen Entwicklung der Kriterien selbst. Formallogisches Analysieren und Deduzieren setzt vielmehr seit Parmenides und Aristoteles auf das Ideal einer situations- und zeitinvarianten Sprache mit fixen Gebrauchskriterien, die es außerhalb formalsyntaktischer Terminologien und Regelungen, wie wir sie z. B. in der Mathematik schaffen, als Sprache realiter gar nicht gibt. Wenn man daher die moderne Fortentwicklung des uralten formalrationalistischen Paradigmas der Pythagoreer, Eleaten, der aristotelischen und scholastischen Logik etwa durch Frege, Russell oder Carnap "linguistic turn" nennt, so ist dies partiell durchaus irreführend, da die Formmomente des realen Verstehens gesprochener Sprache und dann auch von Texten in dieser logizistischen Wende der Philosophie bestenfalls partiell in den Blick kommen.
1.3.
Wesenslogik
Die
Wesenslogik analysiert im wesentlichen Redeformen der Art "etwas ist wesentlich, eigentlich, in Wahrheit, objektiv dieses..., nicht jenes...". Hegels Grundeinsicht ist, daß der normale Gebrauch dieser Ausdrucksweisen gerade keinen Standpunkt des Überall und Nirgendwo, also nicht den Blick sub specie aeterni voraussetzt, sondern einen realen Widerspruch gegen ganz bestimmte alternative Darstellungen oder Erklärungen artikuliert. Der Sprecher, der sagt, etwas sei wesentlich dies..., in Wirklichkeit so..., nimmt einen entschiedenen Standpunkt ein in einem fortlaufenden, zunächst realen und dann oft auch fingierten Gespräch. Dieses Gespräch und der in ihm verteidigte Standpunkt hat immer eine Vorgeschichte. Wenn ich daher z. B. sage, daß das, was ich hier vorstelle, das Eigentliche und Wesentliche von Hegels Logik ausmacht, wende ich mich gegen allerlei genannte oder als bekannt unterstellte Alternativen.
63
Pirmin Stekeler-Weithofer
1.4.
Seinslogik
1. Die Seinslogik besteht im wesentlichen in der Analyse von Ausdrucksformen wie: (1) "x, sich betrachtet, ist ein X", (2) "x für sich, realiter, betrachtet, ist Y" (3) "x, an und für sich betrachtet, ist Z". Die Seinslogik analysiert in (1) den Gebrauch von Namen, Sätzen und anderen Repräsentationen als Repräsentanten für (abstrakte) Gegenstände, die als schon konsitutiert betrachtet werden. In (2) analysiert sie den Realgebrauch der (Re)Präsentationen ,für sich', achtet also auf die reale Gegebenheitsweise der 'Objekte' über die wir reden. Unter (3) thematisiert sie die Tatsache, daß wir, wenn wir über irgendwelche Objekte sprechen, immer zugleich über das Repräsentierte und die Form der Repräsentation reden. Wenn wir z. B. sagen, daß Scott der Autor von Waverley sei, sagen wir in gewissem Sinn zugleich etwas über Scott selbst aus und über alternative Benennungsmöglichkeiten einer einzigen Person. Analoges gilt für Aussagen über Qualitäten, Formen, Quantitäten, oder Zahlen: Es scheint nur so, als wären diese Aussagen nicht immer auch Aussagen über die Art unserer Qualitäts- oder Quantitätsbestimmung oder über Formen- und Zahlenbenennungen. Hegels Seinslogik behandelt daher unter anderem das Verfahren der Konstitution von Gegenständen durch Abstraktion, in dem Äquivalenz- oder eben Gleichgültigkeitsrelationen zwischen verschiedenen Präsentationen zu Gleichungen zwischen Repräsentanten' desselben und damit zu Aussagen über ,Identitäten' werden. Was unter der Betrachtung des Für-sich-seins unterschiedliche Gegebenheitsweisen von Verschiedenem bzw. Unterscheidbarem sind, kann in der Betrachtung des An-und-für-sich zur bloß unterschiedlichen Repräsentation oder Benennung des gleichen Gegenstandes werden. Die Betrachtung der Gegenstände im Modus des An-sich tut und redet dagegen so, als brauchte man deren Konstitution nicht zu beachten, als wäre die je schon etablierte objektstufige Form der Bezugnahme etwa auf Dinge oder Zahlen das Maß allen vernünftigen Urteilens. 2. Um diese Grunddifferenzierungen und die Grundeinsicht in die besonderen Rollen des Äußerlichen, des Realgebrauchs, und daher auch des Geschichtlichen in der logischen Analyse Hegels wenigstens in Umrissen begreiflich zu machen, betrachte ich im folgenden zunächst als paradigmatischen Fall den Begriff der Regel und gehe dabei ganz bewußt, wenn auch extrem kurz, auf Wittgensteins Überlegungen zum Regelfolgen ein.2 Dann gehe ich über zu Kurzbesprechungen des Begriffs des Dinges im Vergleich zu dem eines abstrakten Gegenstandes wie etwa einer Zahl. Erst danach wende ich mich explizit der Hegelschen Kritik an der Erkenntnistheorie zu, und damit an der gesamten Tradition, die von Descartes über den britischen Empirismus zu Kant führt. Diese Kritik wird aber gleich positiv geführt durch Nennung dessen, was das rechte Verständnis der Differenz von Wissen und Wahrheit ist. Die an
2
Richard Raatzsch hat mich auf eine Stelle in dem Buch von Rolf Hochhuth, Jede Zeit baut Pyramiden. Erund Gedichte, hg. v. D. Simon, Berlin 1988, aufmerksam gemacht. Dort findet sich ein Text, in dem ein Verhältnis zwischen Wittgenstein und Hegel unterstellt wird. Hochhuth läßt den berühmten Mathematiker Alan Turing sagen, er wolle gewisse Notizen so organisieren, "daß ich vor Ludwig Wittgenstein, wenn der mir aus dem Jenseits noch zugucken sollte, halbwegs bestehen kann: Du weißt, er hat immer gehöhnt, daß ich nur deshalb dauernd rechne, um nicht denken zu müssen. Es war ihm so verächtlich, daß einer ißt und trinkt, ohne Hegel gelesen zu haben, daß ich endlich eingeschüchtert ihm zuliebe sogar während einer meiner Atlantiküberquerungen Hegel las aber das ist wirklich mehr, als ein Mensch von einem anderen verlangen darf!"
zählungen
-
64
Kritik der Erkenntnistheorie
Grundthese ist: Eine Kritik an Ontisierungen kann nicht die Form einer Erkenntnistheorie, sondern muß die Form einer Ontologie im Sinne einer logischen Analyse von Gegenstandsund Wahrheitsbegriffen annehmen. Zum Schluß soll dann noch angedeutet werden, welche Rolle dabei 'thco-logische' Überlegungen spielen.
2.
Gegenstände an sich, für sich, und an-und-für-sich
2.1
Das Befolgen von Regeln und das Reden über Funktionen als Beispiel
1. Im Unterschied
zu
einer bloßen
Benennung oder Symbolisierung einer Regel umfaßt die
Regel selbst, oder, wie wir dazu oft sagen, der (allgemeine und konkrete) Begriff'einer Regel neben verschiedenen Artikulationen durch Regelbenennungen (a) natürlich auch deren Ge-
brauch in der Form der Befolgung von Aufforderungen, so und nicht etwa so zu handeln (b), aber dann auch die Praxis einer metastufigen Kontrolle der richtigen Regelbefolgung nach gewissen mehr oder minder sicher handhabbaren pragmatischen (nicht idealen) Kriterien (c) und schließlich auch weitere ideale Formen des Redens und Urteilens über die Regel und ihren Werteverlauf an sich (à). Die unter (c) genannten Kriterien sagen uns gewissermaßen, was wir alles als richtige Befolgungen der Regel im Sinne von (b) zählen (würden). Die Regel für sich, wie man mit Hegel sagen könnte, d. h. die Realität der Regel, ist durch (a), (b) und (c), d. h. durch den realen Gebrauch bestimmt. In den unter (d) genannten Reden wird unter anderem über die Gleichheit bzw. Verschiedenheit einer Regel bzw. eines Regel-Verlaufs gesprochen, und zwar auf einer idealen Metaebene. Hier spricht man ideal und abstrakt über die Regel oder ihren Werteverlauf 'an sich', wobei aber auch jetzt die Regel selbst (an und für sich) nicht einfach durch ihren Verlauf, und dieser nicht einfach durch bisher beobachtbare Befolgungsbeispiele bestimmt ist. Diese etwas ungewöhnliche Erläuterung des Hegelschen An-sich, Für-sich und An-undfür-sich soll noch etwas deutlicher werden: Wenn in der Mathematik ganz verschiedene Operationen zu gleichen Werte-Verläufen (qua extensional aufgefaßte Funktionen oder Folgen) ...
...
führen, wäre das wertverlaufsäquivalente, aber verschiedene, Operieren gemäß den Operationen das Für-sich des betreffenden Werteverlaufs an sich. Wenn man will, kann man sagen, daß das Für-sich-Sein die Ebene der Token, der Realvollzüge, das An-sich die Ebene der Typen überschreibt, sofern man nur bedenkt, daß diese Differenzierung kontextrelativ zu lesen ist: Was wir als Token zählen, ist in anderem Betracht womöglich längst schon ein Typ.3 Es gibt keine konkrete Regel als solche (an und für sich) ohne ein Zusammenwachsen (concrescere) dessen, was Regelbenennungen abstrakt oder an sich nennen, und dem zuge-
hörigen realen Regelfolgen. 2. Das Beispiel der mathematischen Folgen und Funktionen macht klar, daß endliche Beispielreihen im allgemeinen eine Funktion an und für sich nicht eindeutig bestimmen, da sie auf ganz verschiedene Weise fortgesetzt werden können. Das heißt, praktisch gesehen, daß 3
Zum besseren Verständnis dieser etwas kryptischen Bemerkung denke man daran, daß nicht bloß eine einzelne Äußerung, sondern auch ein Äußerungstyp als ein Token in bezug auf einen Satz qua Schrifttyp angesehen werden kann.
65
Pirmin Stekeler-Weithofer
eine Beispielreihe dem individuellen Belieben noch einen zu großen Spielraum für die Fortsetzung der Reihe läßt. Demgegenüber bestimmen Erläuterungen von komplexen Regeln durch (rekursive) Schachtelungen einfacherer Operationsschemata, ebenfalls praktisch gesehen, die Regel oder Folge schon viel genauer, wobei jetzt die Beherrschung des Umgangs mit den komplexen, rekursiven Regelbenennungen vorausgesetzt ist. Der neue Typus der Regelbestimmung unterscheidet sich insbesondere dadurch von der bloß vagen Aufforderung, eine Anfangsfolge auf die gleiche Weise fortzusetzen, daß es jetzt ein ganzes System der Regel- oder Folgenbennungen und eine Gesamtpraxis der Unterscheidung des kompetenten und des inkompetenten Umgangs mit ihnen gibt, samt der sich ergebenden Identifikation der Wertverläufe. Was "die gleiche Weise" meint, ist also nicht durch die reale Anfangsfolge gegeben und durch die bloße Disposition der Leute, sie weitgehend übereinstimmend fortzusetzen, sondern durch die freilich in gewissem Sinn holistische Gesamtpraxis des Regelund der mit nennens, Regelfolgens Bewertung des richtigen Umgangs Regelnennungen. Das Beispiel zeigt in hervorragender Weise, daß die berühmte Formel aus Hegels Phänomenologie des Geistes, nach welcher das Wahre das Ganze sei, wahr ist: Das rechte Begreifen ist immer ein Begreifen in einem Gesamtkontext und in einer Gesamtentwicklung. Die Formel ist demnach viel weniger düster und vage, als die meisten Hegel-Kritiker denken. Regeln und Folgen in der Mathematik begreifen wir in der Tat nur, wenn wir den Umgang beherrschen mit Folgenbenennungen oder Folgenbeschreibungen, zusammen mit einer schon gegebenen Praxis der Bewertung dessen, welche Befolgungen oder Anfangsfolgen (beliebiger Länge) zur Benennung passen. Da in bezug auf die komplexe Praxis die Nennung einer bloßen Anfangsfolge nicht ausreicht zur eindeutigen Bestimmung der Folge, scheint es so, als existiere die unendliche Folge unabhängig von allen endlichen Anfängen und allen endlichen Regelbefolgungsversuchen. Das aber ist nur insoweit der Fall, als der Umgang mit Regel- und Folgenbenennungen kategorial von anderer Art ist: Relativ zu den Anfangsfolgen nennen und unterscheiden wir hier Unendliches 'direkt'. Es ist dies die wahre Unendlichkeit, von der Hegel die schlechte Unendlichkeit der drei Punkte im "und so weiter" unterscheidet. Dies alles hängt insgesamt von unserer Gesamtpraxis der gemeinsamen Richtigkeitsbewertungen ab. Deren Sicherheit und Verläßlichkeit bleibt freilich ihrerseits in einem gewissen allgemeinen Sinn 'endlich', da sie im Bereich der Mathematik zunächst abhängt von den realen Möglichkeiten gemeinsamer Figurenunterscheidung, dann aber auch von hochstufigen Bewertungen kontrafaktischer Möglichkeitsurteile, die etwa sagen, was im Prinzip unterscheidbar oder wahr bzw. was in einem Sprachdesign mit geschachtelten syntakto-semantischen Regelungen möglicherweise richtig ist, was nicht. 3. Eine Folge oder Regel ist also nicht einfach dadurch in ihrer Identität bestimmt, daß ein Tun irgendwie so fortgesetzt wurde und daß bisher keine Probleme oder Widersprüche aufgetreten sind. Sondern die Rede über eine Regel setzt schon voraus, präsupponiert, daß wir ein Tun, das wir als das Befolgen der Regel ansprechen, durch eine wiedererkennbare Benennung identifizieren oder wenigstens implizit von einem anderen Tun unterscheiden können, und daß wir zugleich ziemlich sicher sind, unter welchen Umständen keine Probleme bei der Bewertung dessen auftreten, was zu diesem Tun, etwa dem Befolgen der so und so benannten Regel, bzw. zur richtigen Fortsetzung des Tuns gehört, was nicht. Der praktische Unterschied zwischen der Präsentation einer Anfangsfolge mit der Aufforderung, auf die gleiche Weise fortzufahren, und der Benennung von Kriterien, welche die Glieder der Folge defi-
-
...
...
66
Kritik der Erkenntnistheorie
nieren, besteht also darin, daß wir im ersten Fall oft keineswegs wissen, was alles es heißen könnte, die Anfangsfolge so und nicht anders bzw. richtig, d. h. auf gemeinsam anerkannte Weise, fortzusetzen. Im zweiten Fall wissen wir oft praktisch hinreichend genau, wie etwa
aufgrund von Schachtelungen gemeinsam beherrschter einfacher Schemata die Operationen auszuführen sind, welche die Folge definieren mögen. Die Unterscheidung ist freilich weiterhin eine praktische, keine absolute. Sie setzt voraus, daß wir uns auf die gemeinsame Beherrschung etwa einer Instruktion der Art "Man berechne das n-te Glied der Folge a„ gemäß der Formel n2-l" für jede Zahl n schon verlassen können. 4. Es gibt kategoriale Stufungen und 'begriffliche' Unterschiede in Erläuterungen der Art "fahre so fort" oder "und so weiter", je nachdem, von welcher Art die Beschreibung der Anfangsfolge ist, die es fortzusetzen gilt. Wer z. B. (noch) nicht weiß, wie eine unserer symbo-
lischen Zahlwortreihen der Art 1, 2,..., 9, 10, 11,..., 1000, 1001,.... fortzusetzen ist, ist in höherem Grade arithmetisch unverständig als der, welcher (noch) nicht weiß, daß 120 der Wert der geschachtelten Funktion xx-1 für das Argument 11 ist, oder welcher die Formel noch nicht für alle Zahlargumente beherrscht. Dieser wiederum ist in einem höheren Maß unverständig als der, welcher für einen Reihenbeginn wie z. B. 0, 3, 8, 15 (noch) kein passendes Gesetz etwa der Form x -1 oder (bisher) nur eine passende Formel dieser Art findet. Der Begriff des Schemas bzw. der schematischen Regel, der Operation und dann auch der Funktion ist dabei immer nur so klar und deutlich, wie ein praktisch erfolgreiches und als sicher geltendes gemeinsames Können reicht. Dabei ist am Ende auch das metastufige Wissen um Kriterien und Richtigkeiten, mit welchen wir den Objektgebrauch gewissermaßen stabilisieren, ein solches Können. Nur im Blick auf eine unterstellte härtere Sicherheit erscheint das Wissen um ein erfolgreiches Können als bloße Gewißheit. Wenn man diese Differenz als praktischen, nicht als einen prinzipiellen, und das heißt: schon ideal überhöhten, Unterschied begreift, lassen sich die skeptischen Argumente gegen die Eindeutigkeit von Regeln, wie sie Kripkes Deutung Wittgensteins berühmt gemacht haben, als überschwenglich erweisen. Wenn wir ihn richtig verstehen und verteidigen wollen, dann zeigt Wittgenstein, daß die Annahme prinzipieller (Verstehens-) Möglichkeiten, die es angeblich auszuschließen gibt und auf die sich der Regel-Skeptiker berufen muß, gänzlich unklar ist. Anders gesagt, jedes konkrete Verstehen setzt normale, praktisch funktionstüchtige, Urteilskraft voraus. Daher ist es abwegig, und das ist in einem gewissen Sinn auch gegen Wittgestein gesagt, die Instruktion "addiere immer 2" ab der Zahl 1000 als "addiere 4" zu deuten: Dies ist zwar prinzipiell möglich, aber nicht, wenn man schon weiß, daß "addiere immer 2" heißt: "lasse immer genau eine Zahl in der Zahlenreihe aus" was natürlich voraussetzt, daß man die Zahlenreihe über 1000 .richtig' fortsetzen kann. Wittgensteins Überlegungen zum Regelfolgen lassen sich jetzt positiv als Hinweis darauf verstehen, daß alle unsere Eindeutigkeitsunterstellungen, etwa auch in bezug auf mathematische Funktionen, im Rahmen einer kooperativen Gesamtpraxis stehen. Deren kompetente Beherrschung und Fortsetzung setzt Urteilskraft voraus, aber auch den ethischen Willen zur Förderung des gemeinsamen Urteilens und kooperativen Handelns. 6. In dieser Lesart rücken Wittgensteins Überlegungen in eine große Nähe zu dem, was ich für ein Grundanliegen Hegels halte: Es wird jetzt klar, in welchem Sinn nicht einmal die Mathematik ethikfrei ist, schon gar nicht die Gesamtpraxis der Wissenschaft. Nur in bezug auf zufällige und partikulare Werte und Interessen sollte Wissenschaft wertfrei sein. Anson-
-
-
67
Pirmin Stekeler-Weithofer
ist und bleibt sie als kooperatives Unternehmen eingebettet in einem normativen RahIhr (oft vergessenes) Ziel ist die Entwicklung eines auf Kooperation aufgebauten gemeinsamen guten Lebens, nicht etwa ein bloßes Wissen-Wollen, was wahr ist, also die mehr oder minder Befriedigung bloßer Neugier, wobei wir nicht einmal beurteilen können, ob bloß ein subjektives Gefühl befriedigt wurde. 7. Das Beispiel der Regeln und Funktionen zeigt, daß das, was eine Regel R oder Funktion F an sich (d. h. idealiter), für sich (d. h. in ihrem Realgebrauch) und an und für sich (d. h. als normierter, beurteilter, korrekter Gebrauch) ist, durch die praktische Kenntnis all dessen konstituiert ist, was in den Genetivformen "Benennung der Regel X", "Gebrauch der Regel X" und "Kontrolle der Korrektheit der Anwendung der Regel X" angedeutet wird. Demgemäß sind viele metastufigen Reden über die Identität und Eigenschaften der Regel nicht einfach Aussagen über eine schon als bestimmt unterstellte Regel zu verstehen, sondern Bestimmungsstücke der Identität selbst. D. h. die Regel als individuierbare existiert gar nicht unabhängig von einem Gebrauch, einer Praxis der Bewertung des Gebrauchs als zu einem Regelausdruck passend, und einer Praxis der Orientierung eines Tuns an einem Regelausdruck, wenn dieser als Aufforderung, der Regel gemäß zu handeln gebraucht wird. 8. Damit können wir auch sagen, wo wir mit Hegel das ominöse 'Absolute' finden können. Es ist das, worauf alle Redeformen der Art "absolute Wahrheit" oder "absolute Identität" oder "absolutes Wissen" verweisen. Diese machen eine Unterstellung nur explizit, welche die Sprecher oft selbst nicht bemerken, wenn sie mit Wörtern wie "wahr" oder "objektiv" operieren. Hegels Ent-Ontisierung dieser Redeformen besteht in folgender Deutung: Realiter verweisen sie auf das Ideal einer guten Gesamtentwicklung gemeinsamer begrifflicher Unterscheidungen, des Wissens, und eines entsprechend differenzierten gemeinsamen Handelns, der humanen Institutionen samt der Praxis der reflektierenden Bewertung der Güte der Realentwicklungen dieser Institutionen. Sie verweisen, genauer, auf einen fingierten Rückblick auf reale Verhältnisse, reales Urteilen, aus der Sicht vollkommen erfüllter idealer ,Absichten'. sten
men.
2.2.
Objekte der Erfahrung und Dinge an sich
1. Die oben schon erwähnte Zweideutigkeit des Genetivs in einem Ausdruck der Form "Repräsentation des Gegenstandes" ist ganz allgemein. Kant hat sie im Fall der Rede über Dinge aufgezeigt: Ein Objekt oder Ding ist nach Kants Analyse als das bestimmt, was alles als Präsentation, als symbolische oder anderweitige Repräsentation und als (in gewissem Sinn vom Ding verursachte) Erscheinung des Dinges zählt. Unsere Rede über ein Ding umfaßt somit gewissermaßen alle möglichen Äußerlichkeiten des Dinges und präsupponiert Urteile über das, was in bezug auf die Dingidentität als äquivalent oder gleichwertig angesehen wird.
Diese Äquivalenzen drücken wir aus mit Hilfe von Genetivkonstruktionen der Art: "Erscheinungen des Dinges", "wahrnehmbare Folgen des Dinges" bzw. allgemeiner "durch das Ding verursachte Folgen bzw. durch das Ding verursachte Empfindungen", womit ein Bezug auf ein ganzes System von Erscheinungen artikuliert ist, die mit dem Ding verbunden sind. Mit anderen Worten, Dinge gibt es als solche (qua konkretem An-und-für-sich-sein) nur in einem komplexen System des Umgangs mit und der Rede über Dinge, im Zusammenhang der durch diese Reden ausgedrückten oder mitorganisierten Unterscheidungen, Identifzierungen, Erfah68
Kritik der Erkenntnistheorie
rungen und Erklärungen. Dabei verweist jede Rede über ein Ding an sich, wie Hegel betont, im Grunde nur auf die Form der Rede über bloß noumenale, bloß .vorgestellte', Gegenstände oder, wenn man lieber will, auf eine ganz abstrakte Belegung einer Gegenstandsvariable. Auf der Ebene des Für-sich-seins eines Dinges sind immer konkrete Präsentationen angesprochen, die als gegenwärtige Anzeichen oder gar als (Re)Präsentationen des betreffenden Dinges gewertet werden. Es wäre hierzu sicher viel mehr zu sagen. Für uns möge folgendes reichen: In der üblichen Lesart unterstellen die vorgeführten Genetivkonstruktionen gewissermaßen post hoc, daß es das Ding (an sich) ohne seine (wahrnehmbaren) Folgen in seiner Existenz und Essenz schon gäbe, d. h. daß es in seiner (grundsätzlichen) Gegebenheit und in seinen charakteristischen, das Ding als Ding individuierenden, Eigenschaften schon bestimmt wäre. 2. Kant redet nun so, als wäre es sinnvoll, hinter die Objekte, über die wir in unserer Erfahrungsurteilen reden und die wir in diesen Reden als Ursachen unserer Wahrnehmungen ausgeben, noch eine andere Art von Ursachen für unsere Wahrnehmungen und Erfahrungen anzunehmen, die als solche grundsätzlich unerkennbar seien. Für Hegel ist dieses Gerede unverständlich, ein Zeichen dafür, daß das (bloß) erkenntniskritische und (bloß) bewußtseinsanalytische Vorgehen Kants einen grundsätzlichen Mangel enthält, und zwar weil es sich selbst nicht radikal genug begreift als Begriffsanalyse bzw. als kritische Onto-Logie. 3. Schon Berkeley hatte die Erkenntniskritik Lockes in die Richtung der onto-logischen Frage nach der Form der Konstitution unserer Rede von Dingen entwickelt. Am Beispiel der Konstitution der Rede über abstrakte Gegenstände hatte er gesehen, was es hier zu beachten gilt: So, wie es etwa die Zahl 7 oder die Form des gleichseitigen Dreiecks nicht unabhängig davon gibt, was wir alles als verschiedene Repräsentationen der Zahl 7 oder des gleichseitigen Dreiecks gebrauchen bzw. anerkennen, können wir auch nicht einfach über (mit sich identische) Dinge reden, ohne auf die unterstellten Zugehörigkeiten und Äquivalenzen von Erscheinungen und Repräsentationen des jeweiligen besonderen Dinges implizit Bezug zu nehmen. Wie es Zahlen nicht gäbe ohne (im Prinzip wahrnehmbare) Zahlrepräsentanten und ohne die Beziehung der Gleich-Gültigkeit, d. h. der äquivalenten Zuordnung zwischen den möglichen Zahlrepräsentationen,4 so bezieht sich auch die Rede von einem Ding auf nichts, wenn dieses gänzlich unabhängig von seinen möglichen Erscheinungen bliebe. Daher besagt für Hegel die Rede von einem Ding an sich oder von einer Quantität (Zahl) an sich entweder überhaupt nichts, oder es ist das Ergebnis eines idealisierenden Abstraktionsprozesses gemeint: Der Bereich des An-sich ist dann die hochideale Ebene formaler Rede, in welcher von allen realen Problemen (samt den real auftretenden Widersprüchen oder Mißverständnissen) unseres wirklichen Redens über abstrakte Gegenstände, seien diese Zahlen, Regeln, Funktionen, geometrische oder andere Formen oder physische Entitäten, in gewissem Sinn abgesehen wird. Wenn man dies erkennt, sieht man, daß eine bloß formale Analyse äußerst großzügig voraussetzt, daß ihre idealen Redegegenstände schon konstituiert sind.
4
In der Handlung des Zählens ist diese Zuordnung konkret bestimmt, so daß der Begriff der Zahl offenbar einer gemeinschaftlich geformten komplexen Praxis mit ihren diversen Handlungs-, Rede- und Urteilsformen abhängt wie uns dies Wittgenstein später lehren wird. von
-
69
Pirmin Stekeler-Weithofer
2.3.
Begrifflich-konstitutive und 'kontingente' Zugehörigkeit
1. Jetzt können wir die Zweideutigkeit von Genetiven wie "die Erscheinungen des Dinges X" oder "die Repräsentationen der Zahl 7" noch deutlicher machen: In der einen Lesart wird davon ausgegangen, daß es den Gegenstand, etwa den Eiffelturm oder die Zahl 7, schon gibt, daß sie in ihrer Existenz und ihrem Wesen (was auch immer das sei) schon bestimmt seien. Das Ding ist dann, wie dies etwa Hobbes und wohl auch noch Spinoza darstellen, Ursache der Erscheinung, etwa qua Wirkung auf mein Sinnenkostüm. Ziffern und andere Notationen sind dann bloße Benennungen von schon (platonistisch) als existent unterstellten Zahlen. Diese Lesart präsupponiert offenbar, daß schon klar ist, was es heißt, daß Dinge und Zahlen existieren. Die Präsupposition selbst wird nicht weiter untersucht. Es wird auf die reallogischen und realsemantischen Voraussetzungen der so interpretierten Redeform nicht weiter
reflektiert.
2. Die Abfolge der Analyse Hegels etwa in der Seinslogik selbst und dann von der Seinslogik über die Wesenslogik zur Begriffslogik ist nun eine fortlaufende Explikation von Präsuppositionen, die auf den .unmittelbareren' Redebenen implizit bleiben. Die Übergänge sind daher so schwer zu verstehen, weil sie für Schlüsse gehalten werden. Es handelt sich eher um Begründungen von Problemen, die sich nur durch eine entsprechende .transzendentale', d. h. Präsuppositionen explizierende, Analyse aufheben lassen. Dazu ist der Rahmen präsuppositionsanalytischer Reflexion zu begreifen. Erst dann kann man begreifen, daß etwa die Zahl 7 durch den Bereich dessen bestimmt ist, was alles als Präsentation und Repräsentation der Zahl 7 zählt, und daß Analoges etwa für den Eiffelturm als Ding und dann übrigens auch für die Gestalt des Eifellturms gilt. 3. Berkeleys "esse estpercipi (posse)" hatte hier schon die Richtung gezeigt und der nachfolgenden Philosophie den Namen "Idealismus" gegeben, der dann aber zu allerlei subjektivistischen Fehlverständnissen Anlaß gibt. Die Wirklichkeit der physischen Dinge besteht im Gesamt ihrer Wahrnehmbarkeit bzw. Erfahrbarkeit und wird damit als ein besonderer Möglichkeitsbegriff bestimmt.5 Damit ist aber keineswegs gefordert, daß alles Reale von mir sinnlich erfahrbar sei. Vielmehr ist der Begriff der Möglichkeit in seiner Komplexität angemessen zu erfassen. Descartes, Leibniz, Spinoza und Berkeley lassen sich dann mit einigen Prisen Salz so lesen, daß sie alle die Rede von Gott mit einem Gesamt aller prinzipiellen Erkenntnismöglichkeiten identifizieren und damit einen (idealen) Wahrheitsbegriff definieren. Bei allen Unterschieden ist es diese Tradition, auf die Hegel (in gewisser Umgehung von Berkeley) zurückgreift. Die Formel "Gott ist die Wahrheit" besagt in diesem Zusammenhang (nur), daß der Wahrheitsbegriff durch Idealisierung und das heißt, durch eine gewisse Form der Entfinitisierung6 des Begriffs des realen Wissens entsteht: Wahr im absoluten Sinn heißt der Wissensinhalt eines von uns fingierten allwissenden Wesens. 4. Für Hegel ist jede ernstzunehmende Philosophie spinozistisch. Das heißt, in der Analyse von Begriffen und dabei insbesondere des Wahrheitsbegriffs, geht es immer um Mög5 6
70
Zum Wirklichkeitsbegriff vgl. meinen Artikel "Vernunft und Wirklichkeit", in Deutsche Zeitschrift für Philosophie 1996, 187-208. Vgl. dazu meine Überlegungen "Ideation und Projektion. Zur Konstitution formentheoretischer Rede", in Deutsche Zeitschriftfür Philosophie 1994, bes. 786.
Kritik der Erkenntnistheorie
lichkeiten, Sinn und Gefahren einer hochidealen, spekulativen Betrachtung der Welt sub specie aeternitatis. Die Formel, daß Gott bzw. das Absolute als Begriff, Idee und Geist bzw. Vernunft und nicht etwa bloß als Sein oder Wirklichkeit aufzufassen sei, ist dann aber schon Kritik an Spinozas Materialismus, der den Gegenstandsbereich intersubjektiver Wissenschaft mit der ganzen Welt identifiziert. Er sieht nicht, daß die Welt der Wissensbezüge, die ich hier "Bezugswelt" nennen möchte, immer schon konstituiert ist im Blick auf präsupponierte
praktische Orientierungen und daher die Vollzugswelt, die Handlungswelt humaner Praxis mit ihren (freien) Urteilen längst schon implizit voraussetzt. Mit Fichte sieht Hegel, daß die Identifikation der Bezugswelt als eines Teils der Welt mit dem, was man später Lebenswelt
im Ganzen nennen wird, das Bornierte der materialistischen oder auch szientistischen Weltanschauung ausmacht. Borniert ist jemand, der im besten Glauben an die Objektivität seiner Aussagen nicht bemerkt, welche Voraussetzungen, etwa auch implizite Machtansprüche, hinter den von ihm scheinbar ohne eigenes Interesse vertretenen objektiven Wahrheiten stehen.
3.
Erkenntnistheorie und Wahrheitsbegriff
3.1.
Hegels ontologische Wende
1. Hegels kritische Abwendung von einer bloßen Erkenntniskritik führt weg von einer bloßen Eingrenzung des Wissbaren hin zu einer logischen Analyse des Begriffs des Wissens, der Wahrheit und der Objektivität selbst. Dabei ist die Konstitution (Verfassung) von (begrenzten) Gegenstandsbereichen und (endlichen) Wahrheitsbegriffen als Faktum zu begreifen, als etwas Gemachtes, d. h. als in der Entwicklung von Handlungs- und Redeformen Geschaffenes.7 Hegel liest Kants Überlegungen ontologisch-begrifflich und nicht bloß bewußtseinstheoretisch oder erkenntniskritisch. D. h. er liest sie als modellartige Explikation von realen Denk-, Aussage- und Urteilsformen. Die Formen selbst sind als implizites Ergebnis einer kulturgeschichtlichen Entwicklung von sprachlichen und anderen, etwa auch wissenschaftlichen, Institutionen zu begreifen. D. h. es gibt sie in der Form einer geformten Praxis, oder, wie ich dazu kurz sagen möchte, sie existieren empraktisch. 2. Logische oder konzeptuelle Analysen wickeln dabei gewissermaßen das Implizite eines schon längst in bestimmter Form kulturell verfaßten gemeinsamen Handelns aus und machen empraktische Formen realer Institutionen explizit. Kants apriorische Form-Urteile sind damit selbst als geschichtlich bedingt zu verstehen. (Formal)analytisch wahre Aussagen sind schematische Folgen rein terminologischer Ausdrucksgebrauchsregeln. Begrifflich wahre Aussagen sind dagegen, allgemeiner, solche, die in einem bestimmten Redekontext in der einen oder anderen Form als gültig präsupponiert werden, bevor man den Inhalt des Gesagten voll begreifen kann. Demnach sind formalanalytische Aussagen begriffliche Aussagen, aber die Umkehrung gilt nicht, da sogenannte synthetisch-apriorische Wahrheiten ebenfalls als begriffliche Wahrheiten relativ zum betreffenden Sprechakt oder Redekontext anzuerkennen
7
Diese Einsicht zeichnet
Hegel vor Kant aus
und
gibt auch Fichtes Philosophie der Tat eine neue Wendung. 71
Pirmin Stekeler-Weithofer
sind.8 So gehört es z. B.
zum Realbegriff der natürlichen Zahl 7, nicht nur daß sie die Nachfolgerzahl der 6 ist, sondern daß das Zahlzeichen "7" in der Gesamtordnung aller möglichen Zahlworte (vermöge von Übersetzungen in das indisch-arabische System) immer ein ganz bestimmte, eben die siebte, Stelle einnimmt. Ferner gehört es zur Zahl 7, wie zu jeder anderen Zahl, daß ihre Ausdrücke oder Repräsentationen sowohl zu Ordnungszwecken (als wohlgeordnete Ordinalzahlen) als auch zu Quantitätsangaben verwendbar sind. Rationale (und reelle) Zahlen sind dagegen deswegen keine eigentlichen Zahlen, sondern bloß (verallgemeinerte) Proportionen, weil für sie keine Wohlordnung, sondern nur eine Linearordnung definiert ist.9 Hegel sieht gerade in diesem Bereich, wie übrigens vor ihm Berkley oder Lagrange, warum die sogenannten Infinitesimalzahlen überhaupt keine Gegenstände (keine Zahlen, Proportionen, oder Quantitäten) sind: Es sind gar keine Identitätsbedingungen zwischen möglichen Repräsentanten definiert.10 Insgesamt setzt Hegel die transzendentalanalytische Methode Kants an ihren kontext- und situationsbezogenen Ort und gibt ihr eine handlungs- und entwicklungslogische Begründung: Es handelt sich um Explikationen von empraktischen Präsuppositionen, um Begriffsanalysen, die mehr sind als bloße Verbaldefinitionen in (oft nachträglichen) Schematisierungen von Terminologien. 3. Die berühmte Frage Kants: "Was können wir wissen?" unterstellt schon, daß bekannt ist, was Wissen und Wahrheit sei. Auch die Frage nach einer absolut sicheren Grundlage des Wissens bleibt abhängig von einer vorgängigen Beantwortung der Frage, was hier "Grundlage", "sicher" und "absolut" bedeuten könnte, etwa im Unterschied zu "grundlos", "unsicher" oder "bloß relativ". Hegel hat (zum Teil über Spinoza) eingesehen, daß jede Bedeutung oder jeder Inhalt wesentlich dadurch bestimmt ist, was wir mit den Bedeutungsträgern zu welchem Zweck von was differenzieren wollen und daher sollten, und was wir in bezug auf den betref-
fenden Kontext oder Zweck nicht zu differenzieren brauchen und daher identifizieren können.
3.2. Wahrheit als
Kriterium, als Idee und Ideal
Bei der Bestimmung der Rede von Wahrheiten sind dann zwei Fälle zu unterscheiden: 1. Es werden zunächst real kontrollierbare Kriterien angegeben und dann, oft in einem weiteren Schritt, auch ideale Kriterien dafür entwickelt, wann in einem begrenzten System möglicher Sätze resp. Aussagen eine konkrete Aussage p als wahr oder als falsch zu bewerten ist bzw. zu bewerten wäre. Dann erst lassen sich Methoden entwickeln, die uns helfen, die Wahrheiten aufzufinden bzw. die Kriterien realiter zu kontrollieren so daß man entweder -
8
Quines berühmte These gegen eine scharfe Abgrenzung analytischer und synthetischer Urteile bezieht sich nicht auf formalanalytische Sätze einer explizit geregelten Terminologie, sondern auf begriffliche Aussagen. Sie stimmt nach meinem Urteil mit allem überein, was Hegel dazu in seiner Ausdrucksweise sagt: Die Differenz zwischen Begriff und Urteil ist nur eine relative. Der Begriff 'enthält' Urteile. Das besagt: Begriffliche Aussagen sind immer auch Aussagen über grundsätzliche und reale Formen humaner Lebens- und
Redepraxis.
9 Daß die reellen Zahlen wohlordenbar sind, ist eine ganz andere Sache. 10 Dies wird erst mit Abraham Robinsons Nonstandard Analysis. Amsterdam 1966,
72
geleistet.
Kritik der Erkenntnistheorie
sicher wie nur irgend möglich oder wenigstens einigermaßen sicher ist, daß die (realen oder idealen) Wahrheitskriterien erfüllt sind. 2. Eine andere Möglichkeit der Konstitution eines Wahrheitsbegriffs beginnt mit einem weiten Begriff des Könnens und praktischen Wissens (know how). In diesem Sinn weiß einer etwas nicht erst dann, wenn sein Wissen über jeden möglichen Zweifel erhaben ist, sondern schon dann, wenn es faktisch das hinreichend leistet, was es leisten soll, und konkrete Probleme noch nicht aufgetreten sind, auch wenn nicht ausgeschlossen ist, daß solche Probleme noch auftreten können oder könnten. Vermöge der Regel, daß das, was ich weiß, wahr ist, gehe ich dann von meinem praktischen Wissen zur Rede von einer (praktischen) Wahrheit über. ad 1 : Das Paradigma für die erste Art des Verhältnisses von Wahrheit und Wissen liefert seit der Antike (und nicht etwa erst seit dem logischen Empirismus) die Mathematik. Dort werden begrenzte, in diesem Sinn endliche, Bereiche von (rein arithmetischen und geometrischen) Sätzen resp. Aussagen und ihre Wahrheitskriterien durch bestimmte Kriterien festgelegt bzw. erläutert. Ein Beweis einer Aussage zeigt dann, daß die Kriterien in diesem Fall erfüllt sind. Es kann dabei durchaus Grenzen mathematischen Wissens geben, die viel enger sind als der Bereich der mathematischen Wahrheit, und zwar nicht etwa aus bloß kontingenten, historischen, sondern aus prinzipiellen Gründen. Wenn wir z. B. nur verlangen, daß für jedes Argument einer Funktion f(x) nach bestimmten Kriterien ein Wert bestimmt ist, verlangen wir in der Regel weniger, als wenn wir ein schematisches Verfahren fordern, das uns jeweils die Berechnung des Wertes in endlichen Schritten gestattet. Die faktischen Möglichkeiten der Berechnung von Werten sind dann abhängig vom historischen Stand der Mathematik. Auch historische und in gewissem Sinn sogar prognostische Aussagen über ein Geschehen an fernen Orten und Zeiten können von der ersten Art sein. Wir setzen dann voraus, daß klar sei, wie man an Ort und Stelle die Wahrheit der Aussage kontrollieren ,könnte', und sagen, daß aufgrund der räum-zeitlichen Distanz jeder Wissensanspruch über ein raumzeitlich entferntes Geschehen in dem Maß fallibel ist, wie es Unsicherheiten im Informationstransfer und in der Deutung der je hier und jetzt verfügbaren Zeichen und Anzeichen gibt, aus denen wir .wahrscheinliche' Aussagen über das entfernte Geschehen auf die ein oder andere Weise so
erschließen.11
ad 2: Der zweitgenannte Fall ist im Grunde der allgemeinere Fall. Denn für all die Redeformen und Redebereiche, in denen weder ein mathematisch-interner, noch ein bloß historisch-konstativer Gültigkeits- bzw. Wahrheitsbegriff definiert ist, sondern sich die Richtigkeit auf praktisch hinreichend gute Orientierungen und deren reale Entwicklung bezieht, bezieht sich auch der ideale Wahrheitsbegriff auf eine ideal gedachte Entwicklung und nicht auf vorab gesetzte Kriterien.
11 Diese Rede über eine 'Wahrscheinlichkeit' im Sinne der 'verisimilitudo' oder 'hinreichenden Wahrheitsähnlichkeit' ist als solche nicht zu verwechseln mit einer numerischen Abschätzung relativer Häufigkeiten einer bestimmten Art in einem mehr oder weniger unüberschaubaren Bereich von (ggf. auch zukünftigen) Fällen.
73
Pirmin Stekeler-Weithofer
3.3. Wissen und Wahrheit 1. Wenn
das Verhältnis von Wissen und Wahrheit geht, dann betrachten wir in der ReAussage als analytisch wahr, d. h. als Ausdruck einer zulässigen Prädikatoren-
es um
gel folgende regel:
Der Inhalt jedes Wissens muß wahr sein. Man kann nur Wahres wissen. In gewissem Sinn ist es diese Regel, die im Mittelpunkt schon der Überlegungen des Parmenides in seinem zurecht berühmten Lehrgedicht und dann auch in den sich auf Parmenides beziehenden großen platonischen Dialogen "Parmenides", "Theaitetos" und "Sophistes" steht. Eine Regel dieser Art unterstellt schon als bekannt, was mit den Worten "wahr" und "wissen" gesagt oder vielleicht auch nur angedeutet ist. Sie schreibt eine formale Beziehung
fest.
2. Eine andere Aussage wird in der Regel ebenfalls als begriffliche Wahrheit anerkannt, obwohl auch sie nicht einfach aus rein verbalen Regeln folgt. Es handelt sich um folgende
Aussage: Es gibt viele wahre Aussagen,
z. B. über die Historie oder die Zukunft, deren Wahrheit wir faktisch nie im vollen Sinn des Wortes (sicher) wissen können insbesondere wenn wir die Gruppe, auf die das Pronomen "wir" verweist, entsprechend einschränken und nicht etwa mit dem Konzept möglicher Personen oder gar einer göttlichen, in einem Wahrheitsbereich allwissenden Person (etwa einem Gott der Mathematiker) operieren. Die Richtigkeit dieser Aussage zeigt sich schon dann, wenn wir die Differenz zwischen dem Umfang wirklichen mathematischen Wissens und dem Begriff mathematischer Wahrheit betrachten. Aber auch wenn wir auf die Entwicklung eines pragmatischen Könnens und Wissens zurückblicken, sehen wir oft Verbesserungen und bewerten das, was es dabei je zu verbessern galt, als Irrtum. Irrtümer sind oft erst im Blick auf die besseren Verhältnisse als solche bestimmt. Erst wenn wir, in einem weiteren Schritt, eine ganze Fortschrittsgeschichte wenigstens als Möglichkeit entwerfen (erzählen, ausmalen), gelangen wir über den sprachlichen Schachzug der Ideation, also über einen Idealisierungsprozess, zur Rede von einer Wahrheit in einem nicht mehr bloß zeitrelativen und daher absoluten Sinn. Nur in bezug auf diesen macht es Sinn, eine heutiges praktisches Wissen als möglichen Irrtum zu betrachten. 3. Hegel sieht nun, daß Erkenntnis-Skeptiker einen absoluten Wahrheitsbegriff oder das Bild eines vollkommenen Wissens unterstellen. Es ist dann fast eine Tautologie zu sagen, daß in bezug auf einen solchen idealen, kontrafaktischen, Wahrheits- und Wissensbegriff unsere faktischen Wissensansprüche grundsätzlich fallibel, immer möglicherweise falsch sind. Wenn wir mit einem auf den jeweiligen Problemkontext bezogenen praktischen Verstehen und Wissen nicht zufrieden sind, sondern jedes irgend mögliche Miß- oder Fehlverständnis ausschließen wollen, oder wenn wir einen solchen Ausschluß in unserer hochidealen Rede von einer absoluten Klarheit und Wahrheit unterstellen, dann ist geradezu selbstverständlich, daß unser reales Verstehen und reales Wissen die hohen, idealen, Ansprüche nie voll erfüllen. Damit werden die Thesen des Skeptikers und Sinnkritikers, denen zufolge wir absolute Wahrheiten nie erkennen und uns gegenseitig nicht vollständig, nicht ohne Berücksichtigung der Indeterminiertheit von Interpretationen, verstehen können, zu einer begrifflichen Wahrheit. Sie sagt, was wir vorher schon wissen, nämlich daß sich unsere Ideale, wie die idealen -
74
Kritik der Erkenntnistheorie
Formen der Geometrie, von der Realität kategorial unterscheiden, und das heißt, daß die Form des Sprechens wesentlich anders ist. Denkwürdigerweise ruht daher gerade eine empiristische, skeptische oder fallibilistische Erkenntnisheorie, wie sie von Hume bis Popper gang und gäbe ist, auf einer idealistischen Präsupposition, auf der unanalysierten Unterstellung eines absoluten Objektivitäts- und
Wahrheitsbegriff. 4. Es ist
zum
Beispiel jede Prognose, die von hier und jetzt aus sagt, was dort und dann
passieren wird, aus tautologischen (begrifflichen) Gründen fallibel, sonst wäre es keine Pro-
gnose. Aber auch für Berichte gilt, daß sie nicht die Wahrheit des Geschehens in gleicher Weise verbürgen, wie sie etwa den Augenzeugen verbürgt ist. Und auch Augenzeugen können sich täuschen, und zwar im Blick auf wirkliche oder mögliche Augenzeugen, welche aus dem einen oder anderen Grund die unterstellten Aussage-Kriterien besser überprüfen können oder könnten. Sogar Rekonstrukteure von Vergangenheiten können Augenzeugenberichte partiell mit gutem Grund korrigieren, und zwar indem sie Kohärenzüberlegungen anstellen. Dabei gibt es durchaus auch in der Geschichtswissenschaft so etwas wie Prognosen, nämlich in bezug darauf, daß weitere Überreste die zur Debatte gestellten Aussagen über Historisches bestätigen bzw. daß die Rekonstruktionen im weiteren DissToissionsverlauf wenigstens als möglich oder gar als hinreichend bestätigt anerkannt werden und bleiben. Das Eintreten von etwas Prognostizierten muß in gewissem Sinn immer abgewartet werden. Dennoch betrachten wir das, was ein Bericht oder eine Aussage über ein historisches Geschehen oder ein Ereignis an anderen Orten besagt, schon jetzt als wahr oder falsch. Denn im Fall des historischen Wissens bezieht sich das Abwarten auf die Ebene der Wissenskontrolle und Bestätigung, nicht, wie bei echten Prognosen, auf die Ebene des Geschehens selbst. Daher ist die Idealisierung, nach der wir davon reden, daß eine Prognose schon jetzt wahr oder falsch sei, je nachdem, ob das Prognostizierte eintreten wird, viel problematischer als die Idealisierung, nach der wir davon reden, daß historische Aussagen wahr oder falsch seien, unabhängig davon, ob und wie wir entsprechende Aussagen noch kontrollieren können. Der ideale Begriff der historischen Wahrheit sollte daher auf keinen Fall mit dem noch idealeren Begriff einer überhistorischen Wahrheit bzw. einem idealen Wissen aus der Perspektive Gottes bzw. von einer vollendeten Zukunft her verwechselt werden. Ebenso sollte ein bloß epistemischer Möglichkeitsbegriff, dem zufolge wir nur noch nicht sicher wissen, ob bzw. daß etwas der Fall ist, von einem ontisch-temporalen Möglichkeitsbegriff unterschieden bleiben, dem zufolge hier und jetzt möglicherweise noch gar nicht bestimmt ist, ob p geschehen wird. Noch allgemeiner gilt: Auch jeder reale Erfolg der Verständigung und des Verstehens und jede praktische Orientierungsrichtigkeit einer kommunikativen Handlung muß im Grunde abgewartet werden.
75
Pirmin Stekeler-Weithofer
4.
Von der Erkenntnis-
zur
Metaphysikkritik
4.1. Wissen und Wahrheit 1. Kant hatte schon unterschieden zwischen Überlegungen, welche die Grenzen unseres (faktischen oder möglichen?) auf Dinge bezogenen Erfahrungswissens bestimmen, und einer Reflexion auf den Begriffdes Dinges bzw. auf den Begriff ding- oder gegenstandsbezogener
Hegel fragt darüber hinaus, wie denn eine Erkenntniskritik etwa im Rahmen einer modellartig ausgemalten Erkenntnistheorie möglich sein sollte, ohne daß man schon zu wisWahrheit. sen
unterstellt, wie denn unsere Rede über Wahrheiten und unser Urteilen über Wahrheitsan-
Denn nur in bezug auf einen schon unterstellten Wahrheitsbegriff lassen sich Grenzen der Erkennbarkeit oder des möglichen Wissens definieren. Man kann die Frage auch so stellen: Was heißt es, auf ein Ideal oder eine Idee der Wahrheit losgelöst oder jenseits von faktischem Wissen Bezug zu nehmen? 2. Hegels eigener Vorschlag zur Analyse der Rede über idealisierte Begriffe, über absolute Ideen bzw. die absolute Idee der Wahrheit besteht in der Anerkennung, daß diese Reden die innere Dynamik, die geschichtliche Entwicklung der Idee selbst und damit auch allerlei Widersprüche (gegen alte Fassungen der gleichen Idee) immer schon einschließen. Wir fingieren, nach Art der Redeweisen des Spinoza, eine Perspektive des (absoluten) Rück- und Überblicks und betrachten im Rahmen einer solchen offenen Fiktion die Gesamtentwicklung menschlichen Begreifens, Wissens bzw. menschlicher Institutionen und menschlichen Handelns sub specie aeternitatis. In dieser Perspektive fällt der Inhalt des idealen Wissens mit der Wahrheit zusammen. Es wird dabei eine ideale Entwicklung des Wissensfortschritts der bloß faktischen entgegengestellt. Im idealen Blick vom perfekten Ende her fallen Wahrheit und Wissen zusammen. Analoges gilt für das Spannungsverhältnis zwischen (idealem) Inhalt (Bedeutung) und konkreter (äußerer) Form. 3. Dabei sind freilich allerlei Fehlverständnisse dieser Redeformen und auch ihrer Analysen möglich. Ein Fehlverständnis wäre es, das Ideal einer vollkommenen Entwicklung mit einer realen Zukunft zu identifizieren. Ein anderes besteht in der Reifizierung des fingierten Großsubjekts, aus dessen Perspektive Wissen und Wahrheit, Urteil und gutes Urteil in eins fällt. Das ist der Fehler der Ontisierung der Idee Gottes. Eine derartige Ontisierung besteht darin, daß man die ontologische Frage nach Verfassung und Funktion der jeweiligen Idee, hier: des Redens und Denkens über Gott, nicht weiter reflektiert. 4. Daraus ergibt sich eine weitere Grundeinsicht Hegels in bezug auf die Tendenz zur Ontisierung objektstufiger Redeformen. Diese Tendenz resultiert aus dem Verzicht auf metastufige Reflexion, in welcher die zweckbezogen-endliche Verfassung der betreffenden Redeformen nicht bedacht wird. Dies gilt nicht etwa nur für die Ontisierung der Rede von Gott in der hellenistisch-jüdisch-christlichen Tradition. Es gibt ebenso für die Tendenz der Ontisierung der Dinge, d. h. des Bereichs unseres Redens über Dinge und unseres Umgangs mit Dingen. Eine derartige Ontisierung führt zur Idee der Mechanik, alles sei in Wirklichkeit Ding und Dingbewegung bzw. zur moderneren physikalischen Idee, alles, was es wirklich gibt, seien im Grunde Prozesse der Umwandlung von Materie und Energie in einem RaumZeit-Feld. Es sind dies nur zwei Varianten der einen Idee des Materialismus. Und diese ist, wenn man sie aus der Perspektive der traditionellen Rede über Gott darstellt, die Idee einer
sprüche real verfaßt ist.
-
76
-
Kritik der Erkenntnistheorie
mit Gott identifizierten Natur, d. h. sie ist der materialistische Pantheismus Spinozas, der diese Perspektive allererst auf den Begriff gebracht hat. Sie bleibt die ontisch, d. h. als absolute Wahrheit unterstellte, Leitidee in der naturwissenschaftlichen Weltanschauung oder Kosmologie, bei allen besonderen Entwicklungen.
4.2.
Onto-(Theo-)Logie als Analyse des Begriffs der Wahrheit
Jetzt können wir unsere Rahmenthese zu Hegels theoretischer Philosophie explizit wie folgt artikulieren: Hegel betreibt eine kritische Aufhebung des erkenntnistheoretischen Paradigmas, das seit Descartes und Locke, Hume und Kant durch die Leitfragen bestimmt ist: "Welche Arten von Gewißheit sind mit welchen Arten von Geltungsansprüchen verbunden?" Dabei möchte Hegel diese Frage nicht etwa völlig ersetzen, sondern ergänzen, unter anderem durch die Frage nach der Konstitution unterschiedlicher Wissens-, Wahrheits- und Geltungsbegriffe. Hegel erkennt, daß die zentrale Frage kritischer Philosophie die nach den unterschiedlichen und sich möglicherweise entwickelnden Gültigkeitskriterien in den betreffende Aussage- und Urteilsbereichen im Blick auf ihren handlungsorientierenden Zweck ist. Gefragt wird damit nach der Realverfassung der Idee bzw. des Ideals des Wissens und der Wahrheit selbst, und zwar im Rahmen einer gewissen Gesamtordnung humanen Wissens, humaner Institutionen und humaner Praxis. Die onto-logische Wende bei Hegel ist also nicht etwa ein Rückfall in vorkritische, ontisierende Metaphysik, sondern eine Radikalisierung der Erkenntniskritik in Richtung einer kritischen Analyse der Gesamtverfassung des Erhebens von Wissens- und Wahrheitsansprüchen, des Habens von Überzeugungen, Erwartungen und Hoffnungen, der reflektierenden Bewertung von Ansprüchen und Haltungen und insbesondere des Umgang mit idealen Redeformen. Der letzte Punkt führt uns offenbar wieder zur schon skizzierten dynamischen Deutung unserer Rede von Ideen zurück. Die wichtigsten Probleme, die sich nach Hegels Urteil im Rahmen der bisherigen Erkenntnistheorie überhaupt nicht angemessen behandeln lassen, sind in den folgenden Thesen
zusammengefaßt:
1. Eine Kritik des faktischen und auch des faktisch möglichen Wissens reicht nicht aus, einen sinnvollen von einem sinnlosen Glauben (qua Möglichkeitsurteil) zu unterscheiden. Es ist daher die Erkenntnistheorie zu radikalisieren in Richtung einer kritischen Rekonstruktion der idealen Begriffe der Wahrheit und des Wissens in ihrem je bereichsbezogenen Gebrauch und der Entwicklung der jeweiligen leitenden Idee der (vollkommenen) Gültigkeit. Dies und die Analyse der Methode der Ideation und aller idealisierenden Formalisierungen oder Schematisierungen ist das Thema der Begriffslogik. 2. Es geht Hegel des weiteren um eine kritische Formbestimmung unseres Gebrauchs emphatischer Bewertungsworte wie "wesentlich" und "Wirklichkeit". Eine solche Wesenlogik ist in einer reinen Erkenntnistheorie schlicht nicht zu leisten. 3. Zuvor aber ist in der Seinslogik die Rolle von Gleichgültigskeitsbeziehungen im Blick auf bestimmte Systeme prädikativer Unterscheidungen einerseits, wesentliche oder relevante Differenzierungen anderereits bei der abstraktiven Gegenstandskonstitution zu beachten. Wenn man, mit Hegel, die Reihenfolge der Darstellung umkehrt, führen gerade um
77
Pirmin Stekeler-Weithofer
Relevanzbetrachtungen von der Seinslogik zur Wesenslogik, und Idealisierungen von der Wesenslogik zur Begriffslogik. 4. Das Hauptproblem besteht in der Anerkennung, daß praktisch alle unsere Urteile als Urteile über Möglichkeiten aufzufassen sind. Diese sind als solche nicht einfach als ein Erkennen aufzufassen. Soweit wir in den Wissenschaften immer schon über Möglichkeiten urteilen, ist es irreführend, Wissenschaftsanalyse als Erkenntnisanalyse zu betreiben und damit auf eine Stufe mit der Analyse des Erkennens bei Tieren oder etwa auch des automatischen Erkennens zu setzen. Der Begriff der Möglichkeit ist so eng mit unserem Handeln in einer humanen Praxis und der Entwicklung der sie formenden Institutionen verbunden, daß die Analogisierung von Erkenntnis und Wissen als der Grundfehler der Erkenntnistheorie von Locke bis Kant und bis in die moderne Kognitionswissenschaften erscheint, sofern diese sich nicht auf eine viel engeren Gegenstandsbereich als den des Wissens, nämlich etwa auf Wahrnehmung, Gedächtnis, elementares Lernen und elementare Verhaltenssteuerungen be-
schränken. 5. Während eine Erkenntnistheorie fragt, wie wir was erkennen, und eine Erkenntnis- und Wissenskritik nur fragt, was wir über die Natur, Welt, uns selbst oder auch über Gott, Freiheit und Unsterblichkeit der Seele (mehr oder minder sicher) wissen können, fragt eine ontologische Analyse nach dem Sinn, d. h. nach einem funktional erfolgreichen und nicht irreführenden Gebrauch der betreffenden Worte und Urteile. So wird z. B. bei Locke oder Hume oder Kant nur diskutiert, was wir über Gott mit welcher Sicherheit wissen können, nicht, was die Rede über Gott bedeutet, was Gott eigentlich ist, d. h. welche Funktion die Rede über Gott hat, haben kann oder haben sollte. Die Folge ist, daß eine bloß erkenntnistheoretische und wissenskritische Religions- und Theologiekritik einerseits zu weit geht, andererseits zu kurz greift: Sie greift zu kurz, weil sie nur die Erkennbarkeit bezweifelt, nicht den Begriff Gottes bedenkt. Sie geht zu weit, wenn aus der offenkundigen Beliebigkeit des Glaubens an einen ontisierten Gott gefolgert wird, daß man besser auf alle Reden über Gott verzichten solle, da diese doch immer einen Aberglauben unterstelle. 6. Die Unterstellung, Gott sei als eine Art transzendente Person mit gewissen absoluten Eigenschaften zu denken, wird von Theisten wie Augustinus, Anselm oder Thomas, von Philosophen wie Descartes oder Leibniz, auch Voltaire, Hume oder LaMettrie, und am Ende auch noch von Kant im Grunde geteilt. Sie alle stellen nur die er&enrtfm'stheoretische Frage nach dem Wissen oder Glauben an Gottes Existenz und nicht die onto-logische Frage Hölderlins oder Hegels nach der Idee der Praxis der Rede von Göttern bzw. nach der Funktion der Rede von einem (einzigen) Gott. Sie unterstellen, es sei schon klar, wie spekulative Sätze der Form "Gott existiert", "Gott ist die absolute Wahrheit" oder "das Absolute ist das Sein bzw. das Wesen bzw. der Begriff oder die Idee" überhaupt zu verstehen sind, ohne selbst zu bedenken, in welchem Betracht sie als wahr bzw. als falsch zu bewerten wären. Hier werden Hegels Überlegungen onto-theo-logisch: Sie denken über den Begriff des Absoluten nach und fragen, was wir denn wirklich tun, wenn wir so tun, als wären die Begriffe bzw. Ideen der Wahrheit und des Wissens, der Bedeutung und der Referenz oder dann auch der Gerechtigkeit und des Rechts frei von zeitlichen und lokal-partikularen Perspektiven und losgelöst von geschichtlichen Relativitäten bestimmt. 7. Wenn in der modernen Philosophie Hegels Reden über das Absolute als Beispiel sinnloser Sätze angeführt werden, dann wird der Bote für eine Nachricht geschlagen, die uns 78
Kritik der Erkenntnistheorie
selbst betrifft. Sollten wir uns wundern, daß jemand, der die Bedingungen objektiver Wissensansprüche und die idealisierende Präsuppositionen formaler Logik befragt, schon in seinen Fragen nicht begriffen wird, um von folgender Provokation ganz zu schweigen: Gerade ein szientifischer Objektivitätsglaube und der Gebrauch der formalen Logik unterstellen eine Art Gottes-Perspektive. Ironischerweise ist damit, wie auch Heidegger erkennt, gerade die abendländische Idee der Wissenschaft verantwortlich für den abendländischen Gottesglauben.
79
Milan Sobotka
Hegels Abhandlung Womit muß der Anfang der Wissenschaft gemacht werden ? und Reinholds Beyträge
Hegel erwähnt die Theorie Reinholds, nach der die philosophische Wissenschaft nur mit Erkenntnissen anfangen kann, die erst später als berechtigt erwiesen werden können, sowohl zustimmend als auch kritisch in der einleitenden Passage der Wissenschaft der Logik sowie in den Abschnitten zur Logik im Rahmen der Enzyklopädie.1 Reinholds methodologische Konzeption bildet das Leitmotiv der Abhandlung Womit muß der Anfang der Wissenschaft gemacht werden? im 1. Band der Wissenschaft der Logik aus dem Jahre 1812 sowie ihrer überarbeiteten Gestalt aus dem Jahre 1831. Kurz, aber in demselben Sinne, erklärt sich Hegel zur Reinholdschen Theorie in dem ersten, logischen Teil der Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften. Erwähnen wir zuerst die Hauptstelle, auf die sich Hegels Überlegungen beziehen: "Daß der in dieser vorläufigen Erörterung gefundene, und nochmals bey der Analysis des Denkens, als Denkens, anfangs nur hypothetisch und problematisch zum Grunde zu legende Charakter des Denkens, als Denkens, der Einzig mögliche und reellwahre sey, kann, und soll, sich erst in jener Analysis, dadurch und insofern ergeben, daß man, und inwieferne man in derselben
auf das Urwahre am Wahren und auf das Wahre durchs Urwahre gelangt".2 Die Einsicht, daß in der Philosophie nur so vorwärts gegangen werden kann, daß der Anfang zwar nicht beliebig ist, daß aber auch der nicht beliebige, sondern einzig für uns mögliche Anfang erst später als berechtigt erwiesen werden kann, nachdem wir zum ontologischen Grund der Wahrheit durchgedrungen sind, aus dem der Anfang als berechtigt erscheint, diese Einsicht bildet bei Reinhold einen Teil einer breiter angelegten Theorie, die systematisch und historisch in den erwähnten Beyträgen erläutert wird. Wir werden zuerst den Inhalt dieser Theorie darstellen, damit Hegels Beziehung zu ihr klar wird. Die Theorie Reinholds ist auf eine Interpretation von Descartes' Meditationen gegründet, welche Reinhold für denjenigen Teil der philosophischen Wissenschaft hält, der sich mit der -
1 2
Enz. § 10. Carl Leonhard Reinhold, Beyträge zur leichteren 19. Jahrhunderts, Hamburg 1801, 101.
Übersicht des Zustandes
der
Philosophie beym Anfang des
Hegel und Reinhold Erkenntnis und deren ersten Gründen beschäftigt. Reinhold übernimmt diese Auffassung aus den Prinzipien der Philosophie Descartes' .4 Wichtiger ist, daß er zugleich Descartes für den Stifter eines für die Philosophie universellen Paradigmas hält. In diesem Paradigma "die Realität der menschlichen Erkenntnis zu ergründen"5 verbindet Reinhold zwei grundlegende Motive der Philosophie Descartes', welche für den heutigen Leser in zwei verschiedene Bereiche, ja in zwei verschiedene Komplexe der Philosophie gehören. Das erste besteht in der Zurückführung der Wahrheit auf das Denken, d. i. auf die Gesetzlichkeit des Denkens und auf die Gewißheit des Zweifelnden über sich selbst. In diesem Zweifel bleibt wenigstens das Denken (als allgemeine Art des Zweifeins) und die Existenz des Zweifelnden gewiß. "Allein ist diese Gewißheit selber, ist die Wirklichkeit des Zweifeins, und die davon unzertrennliche Existenz des Zweifelnden als eines Denkenden darum schon wahr, real, keine bloße Einbildung?"6 Das zweite Motiv bildet die Notwendigkeit Gottes als Prinzip alles Seins und aller Wahrheit: "die cartesianische philosophia prima unterscheidet sich von jeder anderen Metaphysik und Ontologie [...] wesentlich dadurch, daß sie die Wahrheit ihres Grundbegriffes von der realen Erkenntniß, bevor sie denselben als Prinzip geltend macht, durch die Zurückführung desselben auf das Urwahre zu bewähren versucht, und daß sie sich selber nur in der Anerkennung der Gottheit, als des Urwahren und Wesens der Wesen, und durch diese Anerkennung als Wissenschaft des Wahren (Gen. subiect. sowie Gen. obiect.) und des Wesens der -
-
-
Dinge konstituiert".7 Wir könnten fragen, mit welchem Recht Reinhold das Muster, welches die neuzeitliche philosophische Wende widerspiegelt, für das universelle Muster der Philosophie überhaupt halten kann? Das läßt sich positiv mit dem Hinweis auf die ähnliche Platon-Interpretation Reinholds Piaton als Philosoph der Liebe zur Wahrheit, die zur Wahrheit führt beantworten und negativ mit dem Hinweis auf die Unterbrechung der philosophischen Entwicklung nach den großen Griechen.8 Die von der Philosophie Descartes' abgeleitete Formel der Philosophie findet Reinhold bewährt oder teilweise realisiert, bzw. korrigiert in der nachfolgenden Geschichte der neueren Philosophie. Es gibt allerdings Fälle, daß sie nur teilweise übernommen und realisiert wurde. So ist die Realität der Erkenntnis bei Spinoza "schlechthin durch sich selbst klar, und daher durchaus keiner Erklärung fähig und bedürftig".9 Dagegen bietet die Philosophie Leibniz' Reinhold Gelegenheit, die Charakteristik der Philosophie, die durch die Interpretation Descartes' gewonnen wurde, zu vertiefen. Auch Leibniz "ergründet die Realität der Erkenntniß lediglich durch die Zurückführung derselben auf die Gottheit";10 auch bei Leibniz ist Gott "nicht nur die Quelle alles wahren Seins, sondern auch aller wahren Erkenntniß"; auch Leibniz leitet "das Wahre [...] nur aus dem Urwahren" ab. ' ' Gerade in der Interpretation von Leib-
-
3 Ebd., 13. 4 Vgl R. Descartes, Prinzipien der Philosophie, übers, 5 CL. Reinhold, Beyträge (Anm. 2), 16. 6 Ebd., 15. 7 Ebd., 13-14.
8 9 10 11
v.
A.
Buchenau, Hamburg 1955, 1.
Ebd., 6. Ebd., 24. Ebd., 27 Ebd.
81
Milan Sobotka
niz stellt Reinhold die ontotheologische Konzeption der Erkenntnis in aller Konsequenz heraus: "die bewährte Erkenntniß, das philosophische Wissen geht auch im Leibnizischen Systeme, nur mit der sich, in diesem Wissen, selbst bewährenden Erkenntniß Gottes an".12 Nach Reinhold korrigierte Leibniz einige Mängel des cartesianischen Systems. In dem Aufsatze De primae philosophiae emendatione et de notione substantiae berichtigte Leibniz Descartes fehlerhaften Begriff der Substantialität. Demnach kann die Substanz nicht dadurch bestimmt werden, daß sie "nichts Anderes voraussetzt, sondern, inwieferne" sie "nicht aus Andern zusammen gesetzt" ist.13 Weiterhin unterschied Descartes nicht zwischen bloßen Perzeptionen, die den inneren Zustand der Monaden bilden, in denen sie die äußeren Dinge repräsentieren, und der Apperzeption als der reflektierten Wahrnehmung jenes Zustandes. Infolgedessen haben "die Cartesianer die Perceptionen, die nicht appercipiert werden,"14 für nichts gehalten und den endlichen Substanzen außer den Geistern das Leben abgesprochen. Wolffs Philosophie dagegen erfüllt für Reinhold nicht die Anforderungen der Leibnizschen Philosophie, d. h. sie verfehlt den "wahren Geist aller Philosophie".15 Dieser besteht in dem Kreise, der durch die "Aufweisung des Urwahren an dem Wahren" und durch die "Herleitung des Wahren aus dem Urwahren" gebildet wird. Es ist ein Kreis, in dem "das philosophische Wissen nur durch die Anerkennung der Gottheit sich selber als ergründete Erkenntnis -
-
konstituiert".16
Ein solcher Geist fehlt jeder Philosophie, "die ein Wahres überhaupt ohne die Gottheit" finden "wähnt, gesetzt auch, daß sie das Daseyn Gottes hinterher aus Grund- und Lehrsätzen zu beweisen versuchte",17 d. h. aus Grundsätzen, die ohne die Annahme Gottes angenommen würden. Dieser Einwand trifft nach Reinhold nicht nur Wolff, sondern auch Kants Kritik der reinen Vernunft sowie Fichtes Wissenschaftslehre}* Die Philosophie müsse zunächst die Einheit des göttlichen Prinzips und der Wahrheit sichern, sonst verfehle sie ihr Ziel. Philosophie ist für Reinhold wesentlich eine Ontologie der Wahrheit. Den Vorgarten der Philosophie stellen die Liebe zur Wahrheit und der lebendige "Glaube an Wahrheit" dar, sowie der Glaube, daß die Wahrheit durch das Denken erreicht werden kann. Nicht ein Glaube daran, daß die Wahrheit zu erahnen, zu erträumen oder in der Phantasie zu erfassen ist, konstituiert die Philosophie, sondern ein Glaube daran, daß man die Wahrheit zu denken vermag. Es gibt also eine vorläufige Bedingung der Philosophie, welche in dem enthusiastischen Glauben an Wahrheit besteht.19 Nicht der Mangel, wie die Skeptiker meinen, sondern "die Fülle des Glaubens an Wahrheit" ist "die Triebfeder" des Philosophierens. Nachdem die Philosophie erreicht wird, macht sie allerdings den bloßen Glauben an Wahrheit entbehrlich.20 Darin besteht der platonische Bestandteil jedes echten Philosophierens. zu
12 13 14 15 16 17 18 19 20
82
Ebd. Ebd.
Ebd., 30. Ebd., 41. Ebd.
Ebd., 42. Ebd.
Ebd., 68. Ebd.
Hegel und Reinhold Die
Philosophie
unterscheidet sich
vom
Skeptizismus
auch dadurch, daß sie
von
der
Überzeugung ausgeht, es gebe "ein An sich, selbst Wahres",21 sowie dadurch, daß der Philosoph in seinem Streben nach Wissen schon "bey" diesem "An sich selbst Wahren und Gewissen"22 sei.
Reinhold betont, daß das An-sich-selbst-Wahre nicht auf solche Weise existiert, daß es und Finden zu dem wird, was es ist. Damit will er nur betonen, daß das An-sich-selbst-Wahre Voraussetzung und Prinzip aller Erkenntnis ist, da die Erkenntnis nichts anderes ist, als daß sich das Wahre zu erkennen gibt. Auf der anderen Seite gehört zu den Voraussetzungen der Philosophie auch die Möglichkeit des Irrtums, welcher durch die Philosophie aufgehoben werden soll. Daraus ist ersichtlich, daß es eine nicht zutreffende, auf einem Mißverständnis beruhende Interpretation ist, wenn Hegel in der Differenzschrift (1801) über Reinhold sagt, daß er die Philosophie für "eine Art von Handwerkkunst"23 halte, für eine dem zu erkennenden Gegenstand "fremde Geschicklichkeit".24 Die Vorstellung der Philosophie als einer solchen Geschicklichkeit setze "die Kenntniß der schon gebrauchten Handgriffe [...] voraus".25 Auf diesen Punkt sowie auf die Reinhold unterstellte Perspektive, daß ein "allgemeingültiger letzter Handgriff'26 zu finden sei, scheint Hegel Reinholds Verständnis der Geschichtlichkeit der Philosophie zu beschränken. Hierbei handelt es sich aber ersichtlich um eine schwerwiegende Fehlinterpretation der Beyträge. Ebenso steht es mit dem zweiten Einwand Hegels gegen Reinhold, der sich dagegen wendet, daß wir die Ergründung der Erkenntnis "eigentümlichen Ansichten" der Philosophen verdanken. Hegel sagt, daß es in der Philosophie für "eigentümliche Ansichten" keinen Platz gibt, weil die Philosophie ein Werk der Vernunft ist, welche sich in verschiedenen Gestalten der Philosophie ausdrückt. Bei Reinhold handelt es sich aber bei der Abfolge der "eigentümlichen Ansichten" um den Fortschritt des Eindringens "in den Geist der Philosophie", der stets derselbe bleibt, wobei der Fortschritt nicht "auf Gerathewohl, auf gut Glück"27 geschieht, sondern in Anknüpfung an die Einsichten der Vorgänger und deren Weiterbildung. Was das Wort "eigentümlich" betrifft, so meint Reinhold damit nicht etwas rein Individuelles, sondern eben dasselbe, was Hegel mit dem Ausdruck "interessante Individualität" meint, mit dem er die großen Philosophen bezeichnet. Was den historischen Hintergrund der Philosophie angeht, so gilt die Geschichtlichkeit der Philosophie für Reinhold nicht weniger als für Hegel, nur daß er sich für einen "teilnehmenden Begleiter"28 dieses Prozesses hält. Für die Aufgipfelung dieses Prozesses, an dem er sich auch beteiligte, hält er den "rationalen Realismus" Bardilis, der die Einseitigkeit der Philosophien der Subjektivität sowie der Objektivität überwinde. erst durch das Suchen
21 Ebd., 70. 22 Ebd. 23 G.W.F. Hegel, "Differenz des Fichteschen und 24 Ebd., 10.
25 26 27 28
Ebd. Ebd. CL. Reinhold, Ebd., V.
Beyträge (Anm. 2),
Schellingschen Systems der Philosophie", GW 4,
10.
3.
83
Milan Sobotka
Die Ungerechtigkeit Hegels in der Beurteilung des von Reinhold vertretenen Standpunktes wird in dem abschließenden Teil der Differenzschrift gemildert, in dem er beide Einwände
dem anfänglichen Teil der Schrift konkretisiert. Hegel sagt zunächst, daß Reinhold die Differenz zwischen Fichte und Schelling sehr unvollkommen verstehe. Reinhold begreife zwar, daß Schelling transzendentaler Idealismus und dessen Philosophie der Natur nur "verschiedene Ansichten von einer und ebenderselben Dieselbigkeit, von dem Alleins seyen", er versäume es aber, daraus zu folgern, daß der Schellingsche transzendentale Idealismus keine bloße Subjektivität zum Prinzip habe und dessen Naturphilosophie keine bloße Objektivität. Der absolute "Indifferenzpunkt", in dem sich beide Prinzipe durchdringen, könne nicht reine Ichheit sein.29 Im weiteren konkretisiert Hegel beide Einwände. Reinhold mache das Bestreben, "die Realität der Erkenntniß durch Analysis, d. h. durch Trennen zu begründen",30 zum Thema der Philosophie. Reinhold verstehe nicht das echte philosophische "Bedürfniß, die Entzweyung in der Form von Geist und Materie aufzuheben".31 Aufgrund seiner eigentümlichen Ansicht halte er die Philosophie Fichtes sowie diejenige Schellings bloß für eigentümliche Ansichten. Zuletzt wiederholt Hegel, daß Reinholds "Begründungs- und Ergründungs-Tendenz" ein "Philosophieren vor der Philosophie"32 darstelle. Den Vorwurf des Philosophierens vor dem Philosophieren formuliert Hegel jetzt als Vorwurf einer Reduktion der Philosophie auf die Logik ("Analysieren, Methodisieren"33), d. i. auf die Analyse des Denkens als Denken und auf die Liebe zur Wahrheit, bzw. auf den Glauben an Wahrheit. Hegel setzt dagegen die These, die philosophische Wissenschaft begründe sich dadurch, "daß sie jeden ihrer Theile absolut setzt, und hierdurch in dem Anfang und in jedem einzelnen Punkt eine Identität und ein Wissen konstituiert; als objektive Totalität begründet das Wissen sich zugleich immer mehr, je mehr es sich bildet, und seine Theile sind nur gleichzeitig mit diesem Ganzen der Erkenntnisse begründet".34 Hegel entwickelt hier eine Theorie des sich selbst bewährenden philosophischen Wissens, welches keine Vorübung, keinen Vorgarten braucht, sondern einen in sich geschlossenen Kreis bildet. Auf diese Weise kritisiert er Reinholds "Bedingungen" der Philosophie. Wenn es sich beim "Begründen" um das Bewähren unseres auf das Urwahre, das Absolute gerichteten Gedankenganges handelt, dann wird das Absolute als "an und für sich ein Wahres und Gewisses, also ein Erkanntes und Gewußtes vorausgesetzt"; das als Wahrheit gewußte Absolute ist in diesem Fall "nicht ein Werk der Vernunft [...], sondern es ist schon an und für sich ein Wahres und Gewisses [...] Philosophieren heißt demnach das schon ganz fertige Gewußte mit schlechthin passiver Rezeptivität in sich aufnehmen".35 Nach Hegel muß Reinhold um das Absolute wissen, ehe er zu philosophieren anfängt; er gelangt zu ihm nicht auf eine diskursive Weise, die nur als "ein Werk der Vernuft" realisierbar ist. aus
-
Hegel, "Differenzschrift", GW 4, 78. Vgl. damit System", in ebd., 140. 30 G.W.F. Hegel, "Differenzschrift", GW 4, 79. 29 G.W.F.
31 32 33 34 35
84
Ebd., Ebd., Ebd., Ebd., Ebd.,
80 81. 83. 82. 85.
FW.J.
Schelling, "Über das
absolute Identitäts-
Hegel und Reinhold Hierbei handelt sich um eine methodologische Auseinandersetzung des "vernüftigen" Denkens mit dem Verstandensdenken, d. h.: mit dem Denken in logischen Identitäten. Nach Hegels Ansicht ist es unmöglich, in dem Fortschreiten durch Identitäten zu etwas gelangen, was nicht bereits in dem Vorhergehenden enthalten war. Das ist nur als Werk der Vernunft möglich durch eine Konstruktion, die sich der "Antinomien" bedient: "aus einer absoluten Formalität ist zu keiner Materialität zu kommen".36 Ohne uns auf diese methodologischen Fragen einzulassen, möchten wir bemerken, daß Reinhold mit keiner reinen Formalität anfangen will er verfolgt vielmehr den Fortgang der Meditationen beginnend mit der Skepsis, um dann zur Sicherung des Denkens als Zweifeln und des Zweifelnden überzugehen und von da aus zum notwendigen Wesen (als Quelle alles Seins und Erkennens), dessen Gedachtsein mit dem Gedachtsein des Zweifelnden in eins zusammenfällt. Da Reinhold mit dem Ich beginnt, ist sein Verfahren dem späteren in Hegels Phänomenologie nicht unähnlich. Hegel vertritt in der Differenzschrift den Standpunkt der Autonomie der philosophischen Wissenschaft, des reinen Wissens, dessen Gegenstand auch "Geist" genannt werden kann. Erinnern wir uns nochmals an diese Stelle: "Die Wissenschaft behauptet, sich in sich dadurch zu begründen, daß sie jeden ihrer Teile absolut setzt, und hierdurch in dem Anfang und in jedem einzelnen Punkt eine Identität und ein Wissen konstituiert".37 Wir wiederholen dies, weil Hegel diesen Standpunkt in seinen späteren methodologischen Überlegungen in der Phänomenologie und in der Wissenschaft der Logik unter dem Einfluß Reinholds verläßt, aber schließlich zu ihm, wenigstens teilweise, zurückkommt. Die Phänomenologie wurde in der ersten Auflage als erster Teil des Systems der (philosophischen) Wissenschaft bezeichnet. In Übereinstimmung damit sagt Hegel in der Vorrede, daß "das reine Selbsterkennen [als "Erkennen" bezeichnet Hegel den Grund von Allem in seinen Jenenser Jahren38] im absoluten Anderssein, dieser Äther als solcher" Gegenstand der Wissenschaft sei, daß den Anfang der Philosophie aber "die Voraussetzung oder Forderung" bilde, daß das Bewußtsein sich "in diesem Elemente befinde".39 Man kann nicht unmittelbar mit dem absoluten Wissen beginnen, sondern nur mit dem Weg des Bewußtseins zu ihm. Hierfür gibt es für Hegel noch einen weiteren Grund: "Umgekehrt hat das Individuum das Recht zu fordern, daß die Wissenschaft ihm die Leiter wenigstens zu diesem Standpunkt reiche".40 Beide Argumente macht Hegel gegen die Konzeption geltend, welche aufgrund einer "Begeisterung" "mit dem absoluten Wissen unmittelbar wie aus der Pistole" anfängt. Dies zeugt von einem veränderten Verhältnis zu Reinhold. Hierzu gehört, daß Hegel sein Hauptargument aus der Differenzschrift daß Reinhold das Erkennen als einen dem zu erkennenden Gegenstande äußeren Akt auffaßt -jetzt gegenüber anderen Adressaten geltend macht. Hegel überführt jetzt das Argument in die Metapher der Erkenntnis als ein Medium, welches das von dem Gegenstande ausgehende Licht bricht (Locke), sowie in der Metapher der Erkenntnis als Werkzeug (Kant).41 -
-
-
-
36 Ebd., 82. 37 Ebd. 38 T.S. Hoffmann, "Der Begriff des Erkennens beim Jenenser Hegel", in Aufhebung der Transzendentalphilosophie? hg. v. T.S. Hoffmann und F. Ungler, Würzburg 1994, 103ff. 39 G.W.F. Hegel, Phänomenologie des Geistes, hg. v. H.-F. Wessels und H. Clairmont, Hamburg 1988, 19. 40 Ebd., 20. 41 Ebd., 57.
85
Milan Sobotka
Das geänderte Verhältnis zu Reinhold kommt in methodologischen Überlegungen in der einleitenden Abhandlung zur Wissenschaft der Logik ( "Womit muß der Anfang der Wissenschaft gemacht werden?") zum Vorschein. Hegel übernimmt Reinholds Formulierungen über das Fortschreiten von der Gewißheit zur Wahrheit42 und über die zur Wahrheit gewordene Gewißheit aus dessen Interpretation des Fortgangs der Meditationen.43 Das Vorwärtsschreiten in der Philosophie führt von der Gewißheit zum Grund der Gewißheit, wobei dieses "Letzte, der Grund [...] denn auch dasjenige" ist, "aus welchem das Erste hervorgeht, das zuerst als Unmittelbares auftrat".44 Darum ist "das Vorwärtsschreiten in der Philosophie vielmehr ein Rückwärtsgehen und Begründen".45 Der Anfang der Logik sei kein absoluter Anfang, weil er die Bewegung des Bewußtseins, die den Gegenstand der Phänomenologie bildet, zur Voraussetzung hat. Der absolute Anfang ist also nicht in der Logik zu finden, sondern in der Wissenschaft der Bewegung des Bewußtseins. Es ist das unmittelbare Bewußtsein, daß etwas ist.46 Von der folgenden Bewegung gilt, daß das Vorwärtsgehen ein Rückgang in den Grund und zu dem Ursprünglichen ist, von dem das, womit der Anfang gemacht wurde, abhängt. Diese Formulierungen erinnern stark an Reinhold. Im Unterschied zu Descartes und Reinhold geht es bei Hegel um zwei Bereiche der Erkenntnis, um die Wissenschaft von der Bewegung des Bewußtseins, die Phänomenologie des Geistes, und um die Wissenschaft der Logik, des "reinen Wissens", welches mit dem reinen Sein anfängt. Das reine Wissen der Logik ist "der Geist, der sich von seiner Erscheinung als Bewußtsein befreit hat" oder "die Idee".47 "Das reine Wissen als in diese Einheit" mit sich selbst (durch Aufhebung der Gegenständlichkeit) "zusammengegangen, hat alle Beziehung auf ein Anderes und auf Vermittlung aufgehoben".48 Das reine Wissen ist vermittelt, aber es stellt eine selbständige und eigentliche philosophische Wissenschaft dar, die Wissenschaft vom "Grund", vom "Absolut-Wahren"49 oder vom Ur-Wahren, wie Reinhold gesagt hätte. Hegel ist vor allem an dem hermeneutischen Zirkel interessiert. Auf der einen Seite ist das, was das erste im Gang des Denkens ist, der absolute Anfang, auch als bedingt durch die Logik zu betrachten. Anderseits ist das Letzte weil die Bewegung ganz konsequent sein muß und in dem weiteren Bestimmen dessen besteht, was das erste "im Gange des Denkens" ist auch als abgeleitet zu betrachten. Der faktische Anfang, der "absolute Anfang", ist also in gewissem Sinne auch Grund der Erkenntnis. Hegel betont, daß in dem Fortgang nicht zu etwas Anderem fortgeschritten werde.50 "Der Fortgang von dem, was den Anfang macht, ist ferner nur eine weitere Bestimmung desselben, so daß dies allem Folgenden zugrunde liegen bleibt und nicht daraus verschwindet. Das Fortgehen besteht nicht darin, daß ein Anderes abgeleitet oder daß in ein wahrhaft Anderes übergegangen würde [...] So ist der Anfang der Phi-
-
42 43 44 45 46 47 48 49 50
G.W .F.
Hegel, Wissenschaft der Logik. Das Sein (1812), hg. v.
H.-J. Gawoll, 36. Sein (1832), hg. v. H.-J. Gawoll, Das Sein (1812) (Anm. 42), 37.
Ebd., 35; vgl. Wissenschaft der Logik, Die Lehre
Hamburg 1990, 57.
G.W .F. Hegel, Wissenschaft der Logik. Ebd., 36. Ebd. G.W.F. Hegel, Wissenschaft der Logik. Die Lehre vom Sein (1832) (Anm. 43), 57. G.W.F. Hegel, Wissenschaft der Logik. Das Sein (1812) (Anm. 42), 35. G.W.F. Hegel, Wissenschaft der Logik. Die Lehre vom Sein (1832) (Anm. 43), 59. Ebd., 60f. Vgl. die Einleitung von F. Hogemann und W. Jaeschke zu Hegel, Wissenschaft der Sein (1812) (Anm. 42), XLII. -
86
vom
Logik.
Das
Hegel und Reinhold
losophie, die in allen folgenden Entwicklungen gegenwärtige und sich erhaltende Grundlage, der seinen weiteren Bestimmungen durchaus immanente Begriff'.51 Dem entspricht der Ausspruch am Schluß des 3. Bandes der Logik, nach dem in dem Fortgang des Bestimmens "das rückwärts gehende Begründen des Anfangs, und das vorwärtsgehende Weiterbestimmen desselben ineinander fällt und dasselbe ist".52 Hegel polemisiert hier gegen die Kennzeichnung des Anfangs als provisorisch oder hypothetisch. Dasselbe Motiv bildet den eigentlichen Kern der Abhandlung Womit muß der Anfang der Wissenschaft gemacht werden ?. Hegel hebt auf der einen Seite die Bedeutung der methodologischen Erwägungen Reinholds hervor man müsse "zugeben, daß es eine wesentliche Betrachtung ist"53 und schließt an sie an, wie wir schon gesehen haben. Auf der anderen Seite macht er aber seinen Vorbehalt gegen die Reinholdschen Ausdrücke "provisorisch", "problematisch", "hypothetisch" und "Suchen" deutlich.54 Ist alle weitere Entwicklung in der Wissenschaft nur das weitere Bestimmen von dem, was ihr zugrunde liegt, und wird darin nur die -
-
"Natur des Anfangs"55 weiterbestimmt, so sind diese Ausdrücke irreführend, weil sie den Eindruck erwecken, daß der Anfang "etwas Willkürliches und nur einstweilen Angenommenes"56 gewesen sei, "von dem sich aber doch in der Folge zeigt, daß man das Recht daran habe, es zum Anfang zu machen".57 Die genaue Analyse des Textes Reinholds würde ergeben, daß er sich dieses Problems auch bewußt war. Das Resultat des Denkens, das Erreichen des ontologischen Grundes, ist nicht zufällig und durch Glück gefunden worden, sondern wird in dem Fortgang der Darlegung vorausgesetzt und methodisch streng verfolgt. In einem Punkte unterscheiden sich allerdings die methodologischen Überlegungen Hegels von denen Reinholds. Hegel betont, daß der Anfang des reinen Wissens (denn das reine Wissen muß in seinem "ganzen Umfang"58 entwickelt werden), obwohl vermittelt, doch zugleich "das Rein-Unmittelbare" darstellt, an dem verschwunden ist, daß es Resultat der vorherigen Bewegung ist. Auf der "höchsten Spitze der Einigung"59 des Bewußtseins mit seinem Objekt mit dem Geist, mit der Idee ist verschwunden, daß sie ein Resultat ist, und wir haben es mit dem "Rein-Unmittelbaren" zu tun. Ohne uns auf die Geschichte dieser dialektischen Figur weiter einzulassen, möchten wir nur auf eine Parallele aus der Phänomenologie hinweisen. An dem Staat und dem Reichtum in der Neuzeit ist ebenfalls verschwunden, daß sie "das Werk und einfache Resultat" des Tuns der betreffenden Individuen" sind.60 Am Beginn der zweiten Fassung der Abhandlung entwickelt Hegel diese Überlegung viel ausführlicher. Hegel sagt hier, daß der Anfang in der Philosophie zweierlei bedeutet. Nach der ersten Bedeutung ist er das Prinzip von Allem "das Wissen, das Eine, Nus, Idee, Substanz, Monade usf. Als Prinzip werden auch "Denken, Anschauen, Empfinden, Ich, die Subjektivität selbst" angenommen, die früher in der Funktion des Kriteriums gegen das dogmati-
-
-
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
G.W.F. Hegel, Wiisen.sc/ia/f der Logik. Das Sein (1812) (Anm. 42), 37. G.W.F. Hegel, Wissenschaft der Logik. Die Lehre vom Begriff, hg. v. H.-J. Gawoll, G.W.F. Hegel, Wissenschaft der Logik. Das Sein (1812) (Anm. 42), 37. Ebd., 38. Ebd. Ebd. Ebd. G.W.F. Hegel, Wissenschaft der Logik. Die Lehre vom Sein (1832) (Anm. 43), 57. G.W .F. Hegel, Wissenschaft der Logik. Das Sein (1812) (Anm. 42), 39. G.W.F. Hegel, Phänomenologie des Geistes (Anm. 39), 327f.
-
Hamburg 1994, 303.
87
Milan Sobotka
sehe Philosophieren auftraten.61 Hat der Anfang die Bedeutung des Prinzips, so scheint der konkrete Anfang des "Vortrags" selbst etwas Subjektives und also Zufälliges gegenüber dem zu sein, was das Wahre ist.62 Das abstrakte Denken interessierte sich früher nur für das Prinzip im ersten Sinne, aber im Fortgang der Bildung kam es dazu, daß die subjektive Tätigkeit als wesentliches Moment der Wahrheit anerkannt wurde. Das führte zu der Forderung, daß die Methode der Darstellung mit dem Inhalt, die Form mit dem Prinzip vereint sein müsse. So soll das Prinzip auch der Anfang sein. Damit ist Fichtes Philosophie gemeint, welche in dem Anfang beide Bedeutungen vereinigt. Das objektive Prinzip ist auch das Erste im subjektiven Sinne und das Prius für das reine Denken, welches sich zum Prinzip macht, ist auch das Erste im Gange des Denkens. Nachdem Hegel erklärt hat, wie es sich mit dem Prinzip und dem Anfang bei Fichte verhält, löst er das Problem des Anfangs im subjektiven und objektiven Sinne von seinem eigenen Standpunkt aus. Es handelt sich um die uns schon bekannte Theorie der zwei Wissenschaften. In der ersten Auflage bildet die Phänomenologie den ersten Teil der Wissenschaft und die gleichwertige Stellung mit dem zweiten Teil der Wissenschaft der Wissenschaft der Logik wird dadurch bestätigt, daß der Geist am Ende seiner Entwicklung, im reinen Wissen, sich in das unmittelbare Bewußtsein enläßt. Das Problem dieser Theorie, welche Hegel in der zweiten Fassung unserer Abhandlung korrigiert (sie war nicht in Übereinstimmung mit dem Schluß der Logik) lag u. a. darin, daß sie nur das Verhältnis von Phänomenologie und Logik zu begründen vermochte. Die beiden "realen Wissenschaften" Philosophie der Natur und Philosophie des Geistes liegen eigentlich außerhalb ihres Rahmens. Die zweite Lösung wie sie dann in dem dritten Band der Logik durchgeführt wird bevorzugt die Einheit von Logik, Philosophie der Natur und Philosophie des Geistes. Das reine Wissen der Logik geht am Ende seiner Entwicklung in das unmittelbare Sein die Natur und nicht in das unmittelbare Bewußtsein über. "So wird noch mehr der absolute Geist, der als die konkrete und letzte Wahrheit alles Seins sich ergibt, erkannt als am Ende der Entwicklung sich mit Freiheit entäußernd und sich zur Gestalt eines unmittelbaren Seins entlassend".63 Die Phänomenologie ist nicht mehr der erste Teil der (philosophischen) Wissenschaft, obwohl sie "die Wissenschaft des erscheinenden Geistes"64 bleibt. Die eigentliche philosophische Wissenschaft ist autonom und man braucht die Phänomenologie nicht unbe-
-
-
-
-
-
-
-
dingt.
Der enge Zusammenhang der Logik, der Philosophie der Natur und der Philosophie des Geistes wiederspiegelt sich auch in der zweiten Fassung unserer Abhandlung, und zwar in dem Gedanken, daß es nichts gibt ("nichts im Himmel oder in der Natur oder im Geiste"65), was nicht ebenso unmittelbar wie vermittelt wäre, sowie in der darauf folgenden Theorie des spekulativen Satzes, nach der jeder logische Satz ebenso Unmittelbarkeit wie Vermittlung enthält.
61 62 63 64 65
88
G.W.F. Hegel, Wissenschaft der Logik. Die Lehre Ebd. Ebd., 60.
Ebd., 57. Ebd., 56.
vom
Sein (1832) (Anm. 43), 55.
Hegel und Reinhold Auf der anderen Seite behält Hegel die die Phänomenologie begründende Theorie bei; er differenziert sie sogar durch die ausdrückliche Unterscheidung des Prinzips und des Anfangs im subjektiven Sinne und durch die methodologische Reflexion über die Anerkennung des subjektiven Tuns als Moment der Wahrheit in der neuzeitlichen Philosophie (woraus die Trennung des Anfangs im Gange des Denkens von der Erörterung des Prinzips folgt). Schließlich entwickelt Hegel noch in der zweiten Fassung unserer Abhandlung ein Motiv, auf welches sich das wechselseitige Ineinanderübergehen der Logik und der Phänomenologie stützen könnte. Er sagt hier von der "zur Wahrheit gewordenen Gewißheit", daß sie nicht nur das Gegenständliche verinnerlicht, sondern auch das Wissen von sich als bloßer Vernichtung des Gegenständlichen aufgegeben habe, so daß sie sich der "Subjektivität entäußert und Einheit mit seiner Entäußerung"66 sei. Das ist eine Anspielung auf die Leiblichkeit und gesellschaftliche Praxis. In dem reinen Wissen wird nicht nur die Gegenständlichkeit aufgehoben, sondern auch die Subjektivität im Sinne einer bloßen Negation des Gegenständlichen. Wir möchten unsere Überlegungen mit Fragen statt mit Feststellungen abschließen: Gibt es nicht in der zweiten Fassung eine Spannung zwischen dem von Reinhold inspirierten methodologischen Konzept und der Theorie der philosophischen Wissenschaft(en)? Und kehrt Hegel in der Theorie der Philosophie als Kreis von Logik, Philosophie der Natur und Philosophie des Geistes nicht gewissermaßen zurück zu seiner frühen These, die Philosophie sei eine sich selbst begründende Totalität?
66 Ebd., 57f.
89
Hans-Jürgen Gawoll Der logische Ort des Wahren. Jacobi und Hegels Wissenschaft vom Sein
Die Wende und der Gang, den die nachkantische Philosophie an der Epochenschwelle um 1800 genommen hat, lassen sich nicht ohne einen Bezug auf die Schriften Friedrich Heinrich Jacobis begreifen. Seit seinen Briefen Über die Lehre des Spinoza, dessen Metaphysik der einen Substanz er ungewollt zu einer Renaissance im avangardistischen Frühidealismus verhalf, kritisiert Jacobi jede Philosophie, die ihr spekulatives Geschäft auf die progressive Verknüpfung von Begriffen nach den Gesetzen des "idem est idem" und des "ex nihilo nihil fit" gründet. Die in der Auseinandersetzung mit dem spinozianischen more geométrico gewonnene Einsicht, daß es keine Möglichkeit gibt, den Übergang von Gott zur Schöpfung, vom Unendlichen zum Endlichen zu beweisen, ohne das Unbedingte als ein bloßes Produkt des Denkens zu bestimmen, bildet für Jacobi den Maßstab, an der er die Entwicklung der Philosophie beurteilt, die von Kant über die Wissenschaftslehre Fichtes zur Naturphilosophie Schellings führt. In diesem Fortgang sieht Jacobi die methodisch folgerichtige Transformation des Spinozismus, der kraft eines konstruierenden und damit demonstrierenden Wissens logisch den Fatalismus und den nihilistischen Atheismus nach sich zieht. Sofern Jacobi unablässig vor der Hybris eines rein verknüpfenden Verstandesdenken warnt, den Ort eines bewußtseinsunabhängigen Wahren in den Bezirk der philosophischen Wissenschaft einbringen zu wollen, weist er auf die dem Glauben allein zugängliche Unmittelbarkeit eines göttlichen Seins hin, das sich der Besitznahme durch Begriffe entzieht. Pointiert heißt es dementsprechend im Sendschreiben an Fichte, daß Gott "nicht gewußt, sondern nur geglaubt werden könne: Ein Gott, der gewußt werden könne, wäre gar kein Gott".1 Jacobis Widersprach gegen den Produktionscharakter des Wissens hat nicht nur Fichte, wie Jean Paul bemerkt, zur Revision der Wissenschaftslehre 'hinaufgepeinigt', "über und außer dem absoluten Ich"2 noch einen Gott anzunehmen, sondern er gab wahrscheinlich auch Impulse für die Ausbildung von Schellings Spätphilosophie eines unvordenklichen Seins. War Jacobi für Fichte und Schelling gleichsam das peinigende schlechte Gewissen der Spekulation, dann tritt bei Hegel der umgekehrte Fall ein. In Glauben und Wissen ist er derje1
Friedrich Heinrich Jacobi, Werke, hg. v. Friedrich Roth und Friedrich Koppen, Bd. 3. Leipzig 1816, 7. Hegel referiert dieses Zitat in seiner Heidelberger Jaocbi-Rezension. Vgl. GW 15, 25. "Jean Paul an Jacobi, 9. April 1801", in Jean Paul's Briefe an Friedrich Heinrich Jacobi, Berlin 1828, 85. -
2
Jacobi und
Hegels Wissenschaft vom Sein
nige, der Jacobi zuerst polemisch attackiert. Hegel rechnet hier Jacobi unter die Reflexionsphilosophen einer sich selbst erhaltenwollenden Subjektivität, die das von ihr vorausgesetzte Absolute nicht in der Form vernünftiger Erkenntnis, sondern nur als "schöne Empfindung, Instinkt, Individualität"3 zu ertragen vermag. Durch die überzogene Schärfe der Polemik, die Jacobi außer einer genialischen Willkür den Schauer vor dem Verlust der endlichen Dinge vorhält, täuscht Hegel jedoch über die gemeinschaftlichen Ausgangspunkte hinweg. Einerseits teilt er mit Jacobi die Kritik an einer beschränkten Verstandesphilosophie, die nicht zu einer höheren spekulativen Erkenntnis hinausgeht, deren absoluter Inhalt andererseits für die Vernunft von vornherein vorhanden ist. Der von Glauben und Wissen hervorgebrachte Mißton gegenüber Jacobi, der das dort über ihn ausgesprochene akademische pereat "wegen der zu starken Begleitung des Scharrivorrorchesters"4 sachlich nicht verstehen konnte, klingt erst
bei einem Zusammentreffen beider ab. Nach einem Besuch Jacobis im Sommer 1812 schreibt Hegel aus Nürnberg an Niethammer, daß er ihm "seine [sc. Jacobis] gültigen Gesinnungen gegen mich und gute Aufnahme"5 zu verdanken habe. Diese positive Reaktion Jacobis, die der scheinbar philosophische Gegner Hegel erwidert, markiert den Anfang eines herzlichen Verhältnisses zwischen ihnen. Es äußert sich z. B. auch darin, daß sich Hegel und Jacobi von nun an ihre jeweils letzten Publikationen zusenden. Während Jacobi jedoch den ersten Band der Wissenschaft der Logik "nur einmal angesetzt und dann auf immer bei Seite gelegt hat",6 erwartet Hegel im November 1815 den zweiten Band der Ausgabe von dessen Werken "mit Sehnsucht", "um wieder einmal an Philosophie erinnert und erregt zu werden."7 Aber Jacobis Schriften werden nicht nur zur Zeit der Wissenschaft der Logik von Hegel geschätzt, sondern sie boten ihm lebenslang Anstöße zur Philosophie, was er sich in einem Brief an Niethammer vom 26. März 1819 zu Bewußtsein bringt. Den Verlust des am 10. März verstorbenen Jacobi bedauert Hegel mit den Worten, daß man sich immer verlassener fühle, "je mehr dieser alten Stämme, zu denen [man] von Jugend an hinaufgeschaut hat, eingehen."8 Hegel zählt Jacobi zu solchen herausragenden Persönlichkeiten, "die einen Wendepunkt der geistigen Bildung der Zeit sowie der Individuen formiert und die für die Welt, in der wir unsere Existenz vorstellten, einer der festen Halte waren."9 Eine derartig paradigmatische Wichtigkeit, die dieser Brief Jacobi nachträglich zuspricht, läßt sich nicht nur für Hegels schriftstellerische Entwürfe zur Volkserziehung und zur Geschichte des Christentums plausibel machen, die von 1793 bis 1800 verfaßt worden sind; darüber hinaus legt Hegel die These nahe, daß Jacobi prinzipiell ein Umorientieren in der Philosophie ermöglichte, das ihre theoretische Grundlegung betrifft. So sieht Hegel, nachdem er 1816 mit dem dritten Band der 3 4 5 6 7
GW 4, 21. Friedrich Koppen, Schellings Lehre oder das Ganze der Philosophie des absoluten Nichts, mit drey Briefen an F.H. Jacobi, Hamburg 1803, 210. "Hegel an Niethammer, 19. Juli 1812", in Briefe von und an Hegel, hg. v. J. Hoffmeister, Hamburg 31969, Bd. 1,413. "Jacobi an Fries, 29. Oktober 1812", in Hegel in Berichten seiner Zeitgenossen, hg. v. G. Nicolin, Hamburg
1970,118. "Hegel an Niethammer, 23. November 1815", in Briefe von und an Hegel (Anm. 5), Bd. 2, 62. Eine biographische Darstellung des späten Verhältnisses zwischen Hegel und Jacobi findet man bei Walter Jaeschke, "Einleitung", in G.W.F. Hegel, Berliner Schriften, Hamburg 1997, XXVIff. Briefe von und an Hegel (Anm. 5), Bd. 2, 213. -
8 9
Ebd.
91
Hans-Jürgen
Gawoll
Wissenschaft der Logik seine Neufundierung der Spekulation abschloß, in der Heidelberger Rezension des dritten Bandes der Werke Jacobis dessen epochemachende Leistung darin, gemeinsam mit Kant der vormaligen metaphysischen Weise des Erkennens "ein Ende gemacht und damit die Nothwendigkeit einer völlig veränderten Ansicht des Logischen begründet zu haben."10 Die spät erwachsene persönliche Wertschätzung und vor allem der philosophische Rückblick Hegels geben nun Anlaß genug, danach zu fragen, vermöge welcher kritischen Überlegungen Jacobi für Hegel sowohl
entwicklungsgeschichtlich als auch sachlich zum WegbereiSpekulation werden konnte. Hierbei stellt ein Hegels Auffassung des Seins, an deren Ende Wissenschaft der Logik steht, von einem sich jeweils ändernden Bezug auf Jacobi beglei-
ter einer neuartigen logischen Wissenschaft der erster Teil umrißhaft dar, wie die Wandlungen in
die
werden und sich dadurch erläutert lassen. Anschließend versucht ein zweiter Teil den Anfang der Wissenschaft der Logik als den Ausgangspunkt für die Begründung einer Möglichkeit zu interpretieren, den Ort des Wahren begrifflich auszusagen, ohne seine von Jacobis behauptete Unmittelbarkeit aufzugeben. tet
L
Von der Unmittelbarkeit des Seins Methode
zur
Vermittlung der
Die zweite Auflage des Buches Über die Lehre des Spinoza in den Briefen an den Herrn MoMendelssohn, die er neben Jacobis philosophischen Romanen Woldemar und Allwill bereits während der Tübinger Studienzeit gemeinsam mit Freunden gelesen hat,11 stellen bei Hegel einen der damals aktuellen Ausgangspunkte für die Entfaltung seines Denkens dar. Ihren ersten, sicher nachweisbaren Niederschlag findet Hegels Jacobi-Lektüre in den Erörterungen über Glauben und Sein, die wahrscheinlich Ende 1797/Anfang 1798 abgefaßt und niedergeschrieben wurden. In diesem Fragment schließt sich Hegel inhaltlich der Vereinigungsphilosophie Hölderlins an, die als Grund alles Mannigfaltigen und aller Entgegensetzung ein bewußtseinstranszendentes einiges Sein annimmt. Den modalen Zugang, durch den man der Immanenz des Seins im Bewußtsein inne wird und sie sich vergegenwärtigt, faßt Hegel im Horizont von Jacobis Spinoza-Buch als Glauben auf, der eine Antinomie einander widerstreitender Teile vereinigt. Die notwendige Faktizität eines in sich entgegengesetzten Seins, auf das die Zerrissenheit eines Lebensganzen hindeutet und das man dadurch antizipatorisch erkannt hat, sofern immer "schon vereinigt worden ist",12 entzieht sich der Kraft beweisender Demonstration. Da für Hegel der Beweis seiner Struktur auf logischen Abhängigkeitsverhältnissen von Grund und Folge, Bedingung und Bedingtem beruht, macht er die Vorgängigkeit des Seins zunichte. Auf diese Weise forderte man nicht allein, daß die Vereinigung allererst für das Bewußtsein sein soll, sondern die Einheit des Seins würde zudem eine Funktion derjeses
10 GW 15, 25.
Zu den Anfangen von Hegels Beschäftigung mit Jacobi in Tübingen, Bern und Frankfurt vgl. Hans-Jürgen Gawoll, "Glauben und Positivität. Hegels frühes Verhältnis zu Jacobi", in Hegels Denkentwicklung in der Berner und Frankfurter Zeit, hg. v. Martin Bondeli, Bern 1999, 18ff. Vgl. dazu Karl Rosenkranz, G.W.F. Hegel's Leben, Berlin 1844, 40. G.W.F. Hegel, Theologische Jugendschriften, hg. v. Hermann Nohl, Tübingen 1907, 382. -
11 12
92
Jacobi und
Hegels Wissenschaft vom Sein
Teile oder antinomischen Glieder, deren gegenseitige Beziehung sie ermöglicht. Im Unterschied zur Normativität eines bloßen Seins, das der Beweise impliziert, gilt für die Unabhängigkeit und Absolutheit des Seins, daß sie ausschließlich im logikfreien Medium des Glaubens zu erreichen ist. Diese Grenzziehung zwischen Beweisen und Glauben geht nun in doppelter Hinsicht auf eine frühe Beschäftigung mit Jacobi zurück, auf dessen Spinoza-Buch Hegel sich hier unausgesprochen besinnt. Hegels Argumentation gegen die Beweisbarkeit der Vereinigung, die solchermaßen zu etwas Abhängigem und Relativem herabgesetzt würde, hat ihre sachliche Parallele in der siebenten Beilage der Spinoza-Briefe. Dort behauptet Jacobi, daß "unser bedingtes Daseyn auf einer Unendlichkeit von Vermittlungen beruht",13 durch die man den Zusammenhang der Natur auf mechanische Weise begreift. Wollte man einen absoluten Anfang und Ursprung der Natur beweisen, dann liefe ein derartiges Verfahren für Jacobi auf nichts anderes als auf die Vernunftwidrigkeit hinaus, die Bedingungen des Unbedingten zu entdecken und zu demonstrieren. Ebenso wie Hegel jetzt bereits eine rein mechanische Methode der Erkenntnis ablehnt, übernimmt Glauben und Sein die These Jacobis, derzufolge das Bewußtsein des Menschen aus den zwei ursprünglichen Vorstellungen des Bedingten und Unbedingten zusammengefügt ist. Die bewußtseinsinterne Relation beider Vorstellungstypen gestaltet sich so, daß das Bedingte das Unbedingte, dessen Gewißheit diejenige der Endlichkeit des menschlichen Daseins noch übersteigt, notwendig voraussetzt und nur mit ihr gegeben werden kann. Nach Jacobi bildet die stets implizierte Vorstellung des Unbedingten eine untilgbare Tatsache des Bewußtseins, das sie in der emphatischen Affirmation eines 'Es ist' ausdrückt: "Dieses Uebernatürliche, dieses Wesen aller Wesen, nennen alle Zungen: den Gott".14 Was Jacobi undifferenziert mit dem theologischen Ausdruck Gott belegt, nennt Hegel das Sein oder die Vereinigung, die Widerstreitendes und die "entgegengesetzten Beschränkten"15 ermöglicht. Trotz der inhaltlichen Unterschiede betont Hegel aber durch seinen stillschweigenden Rekurs auf Jacobische Argumente das ontologische Primat wie den gnoseologisch direkten Zugang zu dem einen, unabhängigen Sein. Für das menschliche Bewußtsein bedeutet diese Absolutheit des Seins den letztverbindlichen Ort des Wahren, der ihm a priori innewohnt und ohne den Vollzug einer Reflexion, die das Gedachte vom Denken trennt, in der Unmittelbarkeit des Glaubens erscheint. Die ontologische Bestimmung des Seins, das den vorgängigen Vereinigungsgrund einer Antinomie meint, findet sich ebenfalls im späten Frankfurter Entwurf zum Geist des Christentums. Sein bedeutet hier "die Synthese des Subjekts und Objekts",16 in der beide Glieder ihre Entgegensetzung verloren haben. Theologisch wird diese in sich differenzierte Einheit von Hegel als göttlicher Geist verstanden, der zwar außerhalb des endlichen Denkens existiert, ihm aber gleichwohl immanent ist. Da jeder Versuch, den göttlichen Geist durch den menschlichen Verstand zu denken, in Widersprüche von endlichen Bestimmungen führt, die sich damit aufheben, stellt sich die Frage, wie die zwei zunächst offensichtlich voneinander
nigen
13 F.H. Jacobi, Werke (Anm. 1), Bd. 4, 2, Leipzig 1819, 152. 14 Ebd., 156. 15 Hegel, Theologische Jugendschriften (Anm. 12), 382. Daß Glauben und Sein auch eine Auseinandersetzung mit Jacobi impliziert, macht Manfred Baum deutlich in Die Entstehung der Hegelschen Dialektik, Bonn 21989, 59f. 16 Hegel, Theologische Jugendschriften (Anm. 12), 268.
93
Hans-Jürgen
Gawoll
geschiedenen Sphären aufeinander bezogen sind. Formal haben Schellings Philosophische Briefe über Dogmatismus und Kriticismus die Antwort vorgezeichnet, indem sie eine von Jacobi vorgegebene Interpretation aufnehmen und verwandeln. Wenn für Jacobi das Wesen des Spinozismus darin besteht, daß er grundsätzlich einen Übergang vom Unendlichen zum Endlichen verbietet, so wird diese kritische These von Schelling zum schlechthinnigen Problem aller Philosophie erhoben, das sie aber bislang nicht lösen konnte. Nach Schelling läßt sich allerdings seine Lösung finden, indem man die Richtung der Relation umkehrt: "Das Streben keinen Uebergang vom Unendlichen zum Endlichen zuzulassen, wird eben dadurch zum verbindenden Mittelglied, auch für die menschliche Erkenntniß. Damit es keinen Uebergang vom Endlichen zum Unendlichen gebe, soll dem Endlichen selbst die Tendenz innewohnen, das ewige Streben, im Unendlichen sich zu verlieren."17 Hegel, der die bedeutendsten Frühschriften Schellings kannte, übernimmt den Ansatz dieser positiven Transformation einer Jacobischen These. Im Unterschied zu Schelling, für den der Übergang vom Endlichen zum Unendlichen ein rein praktisch-ethisches Streben darstellt, bleibt Hegel jedoch inhaltlich stärker Jacobi verpflichtet, sofern nämlich das reine Denken den göttlichen Geist nicht zu erkennen vermag. Die Affinität zu Jacobi zeigt sich vor allem am Argumentationsgang des Systemfragments von 1800, in dem Hegel zu verdeutlichen sucht, warum Philosophie "mit der Religion aufhören muß",18 die jetzt der Name für die glaubensmäßige Gewißheit eines
absoluten Seins ist. Methodisch geht das Systemfragment Hegels in der Weise vor, daß es die Unzulänglichkeiten der Philosophie gegenüber der Religion von der Struktur ihres gemeinsamen Erkenntnisgegenstandes aufweist. Sofern die Philosophie das monistische All des Lebens als Natur fixiert und begrifflich faßt, gelingt es ihr lediglich, die Einheit des Mannigfaltigen in "eine gedachte Beziehung zu setzen".19 Man scheint den Geist Jacobis zu hören, wenn Hegel die Philosophie wegen ihrer begrifflichen Anstrengungen in den Bereich des Endlichen und Beschränkten verbannt, dessen nachträgliche Vereinigung vermöge der Reflexion die supponierte Einheit des Allebendigen verfehlt. Der Grund dafür liegt in dem methodischen Prozedere der Vernunft, "zum Beschränkten das Beschränkende"20 zu suchen, was seinerseits stets nur eine hinzugefügte endliche Bedingung wäre. Unschwer kann man in diesem Einwand eine erneute Aufnahme von Jacobis Spinoza-Kritik aus der siebenten Beilage erkennen, wonach das Denken des Verstandes niemals über den Bereich der Bedingungen hinauskommt. Während jedoch für Jacobi der Verstand wegen der seine Erkenntnisleistungen konstituierenden Struktur eines infiniten Progresses vom Unendlichen prinzipiell ausgeschlossen bleibt, argumentiert Hegel im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Denken heraus. Zwar hält Hegel formal mit Jacobi übereinstimmend an einen vorreflexiven Zugang zum Unendlichen fest, wie man ihn in religiösen Anschauungen, Gefühlen und Lebensvollzügen erlebt. Aber die Religion als eine "Erhebung des Menschen [...] vom endlichen Leben zum unendlichen Leben",21 dessen interne, dynamische Mannigfaltigkeit man Gott nennt, wird bei Hegel -
-
17 Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, Werke, Historisch-kritische Wilhelm G. Jacobs und Annemarie Pieper, Stuttgart 1982, 83. 18 Hegel, Theologische Jugendschriften (Anm. 12), 347. 19 Ebd.
20 Ebd. 21 Ebd.
94
Ausgabe,
Bd. 3,
hg.
v.
Hartmut Buchner,
Jacobi und
Hegels Wissenschaft vom Sein
Philosophie vorbereitet. Da die vernünftige Reflexion auf der ontologisch unhintergehbaren Gegensätzlichkeit "teils des Nicht-Denkens [...] teils des Denkenden und Gedachten"22 beruht, ist der Philosophie ein Akt der Selbsterkenntnis möglich, das wahre Unendliche außerhalb ihres Umkreises zu setzen. Laut Hegel besteht also die von Jacobi vernachlässigte propädeutische Funktion der Philosophie darin, kraft der Reflexion in "allem Endlichen die Endlichkeit aufzuzeigen und durch Vernunft die Vervollständigung"23 vermöge der Religion zu fordern. Die der Religion entsprechende Erkenntnisweise identifiziert Hegel am Ende der Frankfurter Zeit mit dem Vereinigungsgefühl der Liebe, "in der sich das Sein und Alleben als eine Verdoppelung seiner selbst, und Einigkeit derselben"24 findet. Innerhalb einer philosophischen Problemkonstellation, die Jacobi weitgehend festgelegt hat, kommen Hegels Frankfurter Schriften zu dem Ergebnis, daß man den übersinnlichen Wahrheitsgehalt eines absoluten, göttlichen Seins annehmen muß, der jedoch durch die Sätze des bloßen Verstandesdenkens nicht zu fassen ist. Die Wahrheit des göttlichen Seins hat vielmehr ihren Ort unmittelbar in einem religiösen Erleben, das ein beherrschendes Objektivieren vermeidet und von höchster Evidenz ist, die man allerdings nicht explizieren kann. Aus einem derartigen frühidealistischen Ansatz folgt konsequenterweise, daß sich über das Göttliche nur in der Begeisterung und mystisch reden läßt, was Hegel mit der impliziten Anspielung an den Neuplanotiker Numenios von Apameia schildert.25 Dieser Rekurs auf eine begrifflose Begeisterung steht aber im Gegensatz zum Argumentationsgang, den das Systemfragment entwickelt. Die mystische und unmittelbare Vereinigung mit dem Unendlichen wird hier erst durch die Reflexion ermöglicht, die ontologisch die Unselbständigkeit und erkennntistheoretisch die Nichtigkeit der Aussagen über die empirische Welt aufgezeigt hat. Eine solche konstitutive Bedeutung der Reflexion, die den Aufweis der Evidenz eines spekulativ-religiösen Inhaltes methodisch vorbereitet, macht für Hegel die Revision seines anfänglich von Jacobi mitgeprägten Ansatzes notwendig. Soll die der Religion zuerkannte Aufgabe der Vereinigung prinzipiell begriffen werden, dann muß sich das theologische "Ideal des Jünglingsalters [...] zur Reflexionsform, in ein System zugleich verwandeln",26 wie Hegel kurz nach Abfassung des Systemfragments in einem Brief an Schelling vom 2. November schreibt. Wenn Hegel demzufolge schon am Ende seiner Frankfurter Zeit plant, den Zusammenhang des Endlichen und Unendlichen als zwingenden Übergang theodurch die
retisch zu entwickeln, dann zeichnet sich hier der Gedanke einer vermittelten Unmittelbarkeit ab, durch den sich Hegel von dem mit Jacobi geteilten Anliegen unterscheidet, den spekulativen Inhalt, heißt er nun Leben, Sein oder Geist, darzustellen.27 22 Ebd. 23 Ebd. 24 Ebd. 25 Vgl. dazu jetzt Jens Halfwassen, "Die Bedeutung des spätantiken Piatonismus für Hegels Denkentwicklung in Frankfurt und Jena", in Hegel-Studien 33 (1998). 26 Briefe von und an Hegel (Anm. 3), Bd. 1, 59. 27 Zu Recht weist Michael Theunissen darauf hin, daß Hegel die von Jacobi behauptete Unmittelbarkeit des Seins verdrängt, obwohl er sie am Anfang der Wissenschaft der Logik vermutlich mitdenke. Vgl. Michael Theunissen, Sein und Schein. Die kritische Funktion der Hegelschen Logik. Frankfurt a.M. 1978, 209f. Noch darüber hinausgehend entdeckt Andreas Arndt, Dialektik und Reflexion. Zur Rekonstruktion des Vernunftbegriffs, Hamburg 1994, insbes. 144ff., in der Denkfigur einer reflektierten Unmittelbarkeit einen heimlichen Romantizismus Hegels.
95
Hans-Jürgen Gawoll Daß sich Hegel dieser internen Theoriedynamik, die über die mit Jacobischen Argumenkonzipierte Position der Frankfurter Zeit hinaustreibt, durchaus bewußt war, gibt die implizite Selbstkritik an der epistemologischen Auszeichnung des Glaubens in der Differenzschrift zu erkennen. In dem Kapitel über das "Verhältniß der Spekulation zum gesunden Menschenverstand" sieht Hegel zwar im Glauben eine Reflexionsform, die jedoch keine wahrhafte Erhebung des Endlichen zum Unendlichen leistet, weil sie in einer Entgegensetzung zur gewußt-bewußten Vereinigung verharrt: "der Glaube drükt nicht das Synthetische des Gefühls oder der Anschauung aus, er ist ein Verhältniß der Reflexion zum Absoluten, welche in diesem Verhältniß zwar Vernunft ist und sich als ein trennendes und getrenntes, so wie ihre Produkte ein individuelles Bewußtseyn zwar vernichtet, aber die Form der Trennung noch beibehalten hat; die unmittelbare Gewißheit des Glaubens, von der, als dem Letzten und Höchsten des Bewußtseyns so viel gesprochen worden ist, ist nichts als die Identität selbst, die Vernunft, die sich aber nicht erkennt, sondern vom Bewußtseyn der Entgegensetzung begleitet ist."28 Diese Charakterisierung des Glaubens, der gleichsam ein Konglomerat von gesundem Menschenverstand, dem viel besprochenen Jacobi und Hegels eigenen 'theobefindet sich auf einem theoretisch logischen Jünglingsideal' darstellt, unbefriedigenden Standpunkt des Nicht-Wissens. Daß ein derartiger Standpunkt die Widersinnigkeit beinhaltet, das Unendliche zu besitzen, ohne es mit ihm erkennend vereinigen zu können, bedeutet für Hegel eine aktuelle Grundform der Entzweiung des Absoluten, die Jacobis These von der prinzipiellen Unmöglichkeit eines vernunftgemäßen, begrifflichen Wissens von Gott festgeschrieben hat. So wird gerade die zu allen Zeiten notwendige Entzweiung "zu einem Qell des Bedürfnisses der Philosophie",29 die die Wiederherstellung der einen Totalität des Absoluten zur Aufgabe hat. Bei diesem Programm betont Hegel die Erkenntnisbewegung einer absolut und obiectivus, die die Identität der Vernunft im Sinne eines subiectivus gedachten genitivus "Reflexion als Vermögen des Endlichen mit dem ihr entgegengesetzten Unendlichen"30 im Wissen des Bewußtseins rekonstruiert. Nicht nur die Wahl einer solchen Terminologie zeigt, daß die Differenzschrift wiederum an eine in den Spinoza-Briefen aufgestellte Problematik anknüpft, sondern sie macht sich ganz konkret das dort von Jacobi zustimmend kolportierte Diktum Lessings zunutze, wonach es "keine andre Philosophie als die des Spinoza"31 gibt. Im Hinblick auf eine Wissenschaft vom Absoluten betont Hegel gemäß dieser interpretatorischen Auszeichnung die "Einfalt Spinoza's, welche die Philosophie mit der Philosophie selbst anfangt, und die Vernunft gleich unmittelbar mit einer Antinomie auftreten läßt",32 da die Definition der Substanz aus der Ethica die widersprüchliche Einheit von Ursache und Wirkung, Begriff und Sein behauptet. Für Hegel sind daher der Standpunkt der Entzweiung, die z. B. bei Jacobi die Gestalt eines unaufhebbaren Dualismus von Endlichkeit und Unendlichkeit angenommen hat, ebenso wie der spinozianische Anfang der Metaphysik mit einer antinomisch gedachten Substanz die das Zeitalter bestimmenden Voraussetzungen, die seine Philosophie vereinigen will. Rein theoretisch spezifiziert Hegel die sich aus der eigenen Zeit ergebende Aufgabe der Philosophie dahin, "das Seyn in das Nichtseyn als Werden, die Entten
-
-
-
28 29 30 31 32
96
Vgl. GW 4, 21. Ebd., 12. Ebd., 18. F.H. Jacobi, Werke (Anm. 1), Bd. 4, 1, 55. GW 4, 24.
Jacobi und
Hegels Wissenschaft vom Sein
zweiung in das Absolute als seine Erscheinung, das Endliche in das Unendliche als Leben zu setzen."33 Gegenüber der Frankfurter Konzeption sieht Hegel im Absoluten nicht mehr allein ein die Gegenstäze umfassendes Alleben, sondern die ihm logisch zuerst zukommende Bestimmung ist das Werden, das aus der Einheit des Seins der endlichen Dinge mit dem Nichtsein resultiert, das gleichsam aus dem bloß verstandesmäßig verfahrenden Denken des Subjektes herausspringt. Die logische Genese des Nichtseins, das hier die unterschiedsfreie Abwesenheit von jeglichem besonderen Seienden bedeutet, wird nach Hegel durch die "geheime Wirksamkeit der Vernunft"34 initiiert. Sofern sich die Vernunft auf ein einigendes Sein bezieht, versucht der Verstand diesen Inhalt durch das Hervorbringen der Grenzenlosigkeit einer objektiven Totalität zu erreichen, dessen sich selbst aufhebende Negativität Hegel mit Begriffen beschreibt, die zum wiederholten Male an die siebente Beilage der Spinoza-Briefe Jacobis erinnern: "denn jedes Seyn, das der Verstand producirt, ist ein Bestimmtes, und das Bestimmte hat ein Unbestimmte vor sich und hinter sich, und die Mannichfaltigkeit des Seyn liegt zwischen zwey Nächten, haltungslos, sie ruht auf dem Nichts, denn das Unbestimmte ist Nichts für den Verstand, und endet im Nichts."35 Einerseits handelt der Verstand ursprungsvergessen, weil die von ihm gedachten Bestimmungen nur auf der Grundlage eines in seinen Hintergrund bereits gegebenen Absoluten möglich sind, das er jedoch nicht erkennen kann. Gleichzeitig versucht er andererseits seine begrifflichen Beschränkungen zu überwinden, indem er zu ihren Bedingungen fortschreitet, die sich allerdings in einem infiniten Progreß des ständigen Neu-Setzens niemals erreichen lassen. Weil für eine solche Reflexion die absolute Synthese ein gestaltloses Jenseits bleibt, greift die Kraft der Vernunft auf die Negativität des Verstandes über. Nachdem sie den Verstand zur nachahmenden Produktion einer in sich haltlosen Totalität verleitet hat, vernichtet sie mit dem Bewußtsein der Beschränkung auch dessen ontologische Eigenständigkeit. Sofern die Vernunft das durch sie veranlaßte Reflektieren auf eine totale Einigkeit "in ihren eignen Abgrund" versenkt, erscheint laut Hegels metaphernreicher Sprache "in dieser Nacht der blossen Reflexion und des räsonnirenden Verstandes das Absolute als das Nichts, woraus alles Seyn",36 alle Mannigfaltigkeit des Endlichen hervorgegangen ist. Das Nichts meint hier den Prozeß eines unaufhörlichen Produzierens, durch den das Absolute selbst in der objektiv erkennbaren Welt der endlichen Dinge zum Vorscheint kommt. Während gerade für Jacobi die Produktion von Wissen den Nihilismus impliziert, der jegliches Sein, die empirische Realität der Dinge ebenso wie die Existenz Gottes, in bloße Bewußtseinsgehalte auflöst, erhebt ihn Hegel emphatisch zur Methode der Spekulation. Laut Glauben und Wissen, das die Programmatik der Differenzschrift anhand einer Auseinandersetzung mit den die Zeit bestimmenden Philosophien der Subjektivität von Kant, Jacobi und Fichte fortsetzt, besteht die wahre Aufgabe der Philospohie darin, "das absolute Nichts zu erkennen",37 in das alles endliche Sein immer schon versunken ist. Der methodische Nihilismus der Metaphysik hat die katharsische Funktion, die Subjektivität von den Gegensätzen der Reflexion zu befreien, so daß sich aus der daraus entstandenen "reinen Nacht der Unend-
33 34 35 36 37
-
Ebd., 16.
Ebd., 17. Ebd.
Ebd., 23. Ebd., 398.
97
Hans-Jürgen Gawoll
lichkeit"38 die Wahrheit des Absoluten erhebt. Die solchermaßen möglich gewordene Ge-
burtsstätte der die Vielheit erzeugenden wahren Substanz zeigt die Unmittelbarkeit einer intellektuellen Anschauung, die inhaltlich mit der integrativen Aufhebung des Endlichen in das Unendliche zusammenfällt. In der Sprache des Begriffs theoretisiert Hegel das christliche Heilsgeschehen des historischen Karfreitags, an dem der Gottmensch Jesus den Kreuzestod auf sich nahm. Analog dazu erfährt das Denken durch den Weg und die Methode der Vernichtung von Endlichkeit die Negativität des Absoluten, aus der die Totalität einer allumfassenden Substanz wieder "auferstehen kann"39 und gewußt werden muß. Das kritische Hinausgehen aus der Reflexionsphilosophie in Glauben und Wissen macht erneut deutlich, daß Hegel mit Jacobi zwar den religiös-spekulativen Inhalt für das Denken teilt, aber sich von seinem Antipoden vor allem durch eine Methode unterscheidet, die sowohl die Genese ihres Erkenntnisgegenstandes rekonstruiert als ihn auch begrifflich entfaltet. Eine derartig ambivalente Einstellung zu Jacobi gibt Hegel implizit zu, wenn er bei ihm das Bemühen würdigt, sich über die Verstandesreflexion zur Vernunft erhoben zu haben, obwohl er dabei den Dualismus von Endlichem und Unendlichem beibehält. Nichtsdestoweniger nötigt Hegel die Abhandlung Ueber das Unternehmen des Kriticismus die Vernunft zu Verstände zu bringen in einem fast verschämt wirkenden Konjunktiv das Zugeständnis ab, daß man bei Jacobi die wahre Idee der Vernunft finden könne, sofern er außer Sinnlichkeit und Verstand ein Prinzip des Individuierens annehme, welches in dem substantiellen Sein (Gottes) die Mannigfaltigkeit mit der Einheit verbinde. Auf eine geistreiche Weise habe Jacobi die spekulative Eigenheit einer zweiendigen Identität antizipatorisch ausgedrückt, "die den Wechsel festhält, nicht eins verschwinden läßt, so wie das Andre auftritt."40 Gegenüber einer solchen Idee der Vernunft ist jedoch laut Hegel der von Jacobi präferierte Glaube epistemologisch inadäquat, weil er sich lediglich aus einer Analyse der Tatsachen des Bewußtseins ergibt, das sich ursprünglich in die Vorstellungen des Bedingten und Unbedingten aufspaltet. Vielmehr erfordert die Voraussetzung einer in Vielgestaltigkeit ausdifferenzierten Einheit eine neue Ansicht des Erkennens und Wissens, zu der dann die Phänomenologie des Geistes hinleiten und dessen dynamische Struktur die Wissenschaft der Logik ausführen wird. Damit übernimmt die Philosophie nicht länger die Beschreibung von bewußtseinsimmanenten Leistungen, sondern ihr fällt die Aufgabe des Nachvollzugs des sich zum Wissen über sich bringenden Absoluten zu, das jede Erscheinung aus der synthetischen Einheit von Gegensätzen konstruiert. Den ersten Aspekt faßt zum Abschluß der Jenaer Zeit die "Vorrede" der Phänomenologie des Geistes in der paradigmatischen These zusammen, derzufolge alles darauf ankommt, "das Wahre nicht als Substanz, sondern eben so sehr als Subjekt aufzufassen und auszudrücken."41 In der logischen Transformation einer Metaphysik der Substanz zu einem Denken ihrer Subjektivität, die Hegel entwicklungsgeschichtlich seit 1804/05 vollzog,42 kann 38 Ebd., 413. 39 Ebd., 414. 40 Ebd., 361. Zur Idee einer spekulativen Vernunft bei Jacobi vgl. Werke (Anm. 1), Bd. 3, 225, Anm. 41 GW 9, 18. 42 Diese Entwicklung im Hinblick auf den Seinsbegriff und die Systemkonzeption bei Hegel stellt ausführlich Takako Shikaya dar: "Die Wandlung des Seinsbegriffs in Hegels Logik-Konzeption", in Hegel-Studien 13 (1978), 199ff. -
98
Jacobi und
Hegels Wissenschaft vom Sein
auch eine Reaktion auf die wirkungsmächtige, frühromantische Konzeption einer transreflexiven Unmittelbarkeit sehen, die außer Schleiermacher insbesondere Jacobi vertreten hat. So weiß sich Hegel 1807 im Widerspruch zu den dominierenden Vorstellungen seines Zeitalters, die das Wahre nur als Gefühl und anschauliche Unmittelbarkeit des göttlichen Seins kennen, der Jacobi bereits in seinem David Hume mit Blick auf einen reinen Bewußtseinsidealismus wieder Geltung verschaffte. Gegenüber der zum Typus stilisierten Annahme einer begriffslosen Unmittelbarkeit, die, weil sie sich jedes Maßes und jeder Bestimmung entschlägt, in sich entweder nur die Zufälligkeit des Inhaltes oder das bloße Spiel der subjektiven Willkür erlaubt, betont Hegel, daß die Substanz bereits eine Form des Wissens beinhaltet: "Zugleich ist zu bemerken, daß die Substanzialität so sehr das Allgemeine, oder die Unmittelbarkeit des Wissens, als diejenige, welche Seyn oder Unmittelbarkeit für das Wissen ist, in sich schließt."43 Statt sich auf den erbaulichen Genuß einer unbestimmten Göttlichkeit zu beschränken, sieht Hegel in der unmittelbaren Anschauung der Substanz ein Denken am Werk, das einen Rückfall in die träge Einfachheit reiner Präsenz verhindert. Dem Sein, mit dem es die Phänomenologie des Geistes zu tun hat, liegt eine lebendige Substanz zugrunde, die ihrem Wesen nach ein Subjekt ist, das sich durch die Bewegung des Sich-AndersWerdens in den gewußten Gegenständen mit der Fülle ihres Reichtums vermittelt und darstellt. Auf diese Weise wird aus der scheinbar begriffslosen Unmittelbarkeit ein substantielles Wissen des Absoluten, das wie im Glauben, im Gefühl und in der Anschauung ganz im Gewußten aufgeht. Indem das begriffliche Wissen die Unmittelbarkeit gleichsam bezwingt, geht das Absolute seinerseits aus einem teleologischen Prozeß hervor: "Es ist vom Absoluten zu sagen, daß es wesentlich Resultat, daß es erst am Ende das ist, was es in Wahrheit ist; und hierin eben besteht seine Natur, wirkliches Subject, oder sich selbst Werden zu sein."44 Für Hegel gehört zur Seinsweise des Absoluten eine sich produzierende Subjektivität, die den Ort herbeiführt, wo die Erkenntnis seines wahren Seins möglich wird. Solchermaßen verwandelt sich der methodische Nihilismus der endlichen Reflexion in die phänomenologische Wissenschaft von der Erfahrung des Bewußtseins, die das Absolute in Gestalt einer vermittelten Unmittelbarkeit für eine universale und metaphysische Wissenschaft der Logik zur Verfügung stellt. man
H.
Vom Sein zum Werden
Entwicklungsgeschichtlich gesehen besteht die theoretische Bedeutsamkeit Jacobis bis zu Phänomenologie des Geistes darin, daß die fortwährende Bezugnahme und Auseinandersetzung mit der Glaubensphilosophie Hegel in der Einsicht bestärkte, logisch die Unmittelbarkeit eines absoluten Seins nicht unverändert hinzunehmen, sondern aus ihrem subjektiven Wesen erst hervorgehen zu lassen. Vermöge der Beschreibung des Werdens eines Seins, das auch das ihm Entgegengesetzte mit sich identifiziert, erreicht Hegel zweierlei. Erstens korrespondiert die Phänomenologie des Geistes dem 'Quell des Bedürfnisses der Philosophie' aus der Differenzschrift, wenn sie kraft der Negativität des Subjektes, das sich in den Gegenstän43 GW 9, 18. 44 Ebd., 19.
99
Hans-Jürgen
Gawoll
den des Bewußtseins anders wird, die Entzweiung zum integralen Bestandteil der Genese des absoluten Wissens macht. Zweitens verhindert der teleologische Charakter des Absoluten, Endzweck eines Prozesses zu sein, den Vorwurf des Atheismus einer unbewegten Substantialität gegen sich aufzubringen. Denn ohne die Negativität, durch die sich die Substanz zur Erkenntnis ihrer Subjektivität bewegt, besäße das Absolute bloß die Anonymität eines leblosen und ununterschiedenen Einen. Auf welche Weise Jacobi auf das ambitionierte Vorhaben der Phänomenologie des Geistes reagierte, die implizit seine Theorie der Unmittelbarkeit einer Revision unterzieht und darüber hinaus eine Kritik an der von ihm beschriebenen Moralität der 'schönen Seele' aus dem Woldemar übt,45 kann man bislang nicht belegen. Obwohl er die Phänomenologie des Geistes wahrscheinlich nicht gelesen hat, machten ihn Gespräche mit Niethammer auf dieses Werk aufmerksam; über dessen allgemeinste Grundstruktur ist er zudem durch einen Brief von Fries unterrichtet, der ihm am 10.12.1807 schreibt: "Hegels Werk [Phänomenologie des Geistes] ist seiner Sprache wegen mir fast ungenießbar. Doch ist das allgemeine seiner Ansicht leicht zu finden. Er will eine allgemeine philosophische Geschichte des menschlichen Geistes oder der Vernunft geben. Diese ist völlig Schellings Naturphilosophie nur auf der Seite des Geistes ausgeführt, auf die Schelling in der Regel nie hat hinüber kommen können. Hegel lobt also den Begriff und die Reflexion, aber es gilt ihm keine stehende Wahrheit sondern nur Wahrheit im Fluß, das heißt für diesen oder jenen Standpunkt der Entwicklung des Geistes, ungefähr eben wie die neue plausibler beschriebene der Weltansichten bei Fichte. Indem Hegel aber an die Spitze aller dieser Weltansichten doch wieder absolutes Wissen setzt, welches doch mehr sein soll als die andern Wissensarten, so widerspricht er sich selbst. Denn die wahre Wahrheit ist nun nicht mehr der Fluß, dessen Lauf wir beobachteten, sondern allein das tote Meer des absoluten, in das er sich ergießt und an dessen Strand wir endlich ankommen."46 Sieht man einmal davon ab, daß die Parallelisierung mit Schelling sachlich nicht zutrifft, dann deutet Fries' Diagnose eines Widerspruchs auf eine Theoriedynamik bei Hegel hin. Soll das aus den Erfahrungen des endlichen Bewußtseins gewonnene Absolute selbst beschrieben werden, läßt sich dies nicht mit dem Mittel einer von Fries offensichtlich unterstellten Metaphysik leisten, für die sich traditionell der Fluß des Werdens und die starre Unveränderlichkeit des Seins ausschließen. Während die Phänomenologie des Geistes zum absoluten Wissen überleitete, indem sie aus dessen Entzweiung das Bedürfnis nach einer spekulativen Philosophie weckt, erwächst 1812 mit Bezug auf eine systematische Grundlegung der Metaphysik aus der Unangemessenheit der Logik an den Entwicklungsstand des Geistes die Notwendigkeit einer vollkommenen Umgestaltung dieser Wissenschaft, "durch die er sich ein höheres Bewußtseyn über sein Denken und über seine Wesenheit in sich selbst verschaft haben müsse."47 Daß man eine solche Umgestaltung überhaupt für erforderlich hält, ist laut der Lehre des Begriffs Jacobi und Kant zu verdanken, denen gemeinsam das Verdienst zukommt, "die ganze vormalige Metaphysik und damit ihre Methode über den Hauffen gewor45
Vgl. dazu Gustav Falke, "Hegel und Jacobi. Ein methodisches Beispiel zur Interpretation der 'Phänomenologie des Geistes'", in Hegel-Studien 22 (1987), 129ff., sowie die Nachweise in ders., Begriffene Geschichte. Das historische Substrat und die systematische Anordnung der Bewußtseinsgestalten in Hegels "Phänomenologie des Geistes". Interpretation und Kommentar, Berlin 1996. Hegel in Berichten seiner Zeitgenossen (Anm. 6), 87f.
46 47 GW 21, 35.
100
Jacobi und Hegels Wissenschaft
vom
Sein
fen"48 zu haben. Im Unterschied zu Kant, der vor allem den Inhalt der rationalen Metaphysik angriff und die Erkenntnis auf die Erscheinungen beschränkte, ging Jacobi noch einen Schritt weiter. Er konzentrierte sich auf das die Metaphysik überhaupt bestimmende Beweisverfahren und hob, wie Hegel mit Blick auf die siebente Beilage des Spinoza-Buches vermerkt, deutlich
hervor, daß "solche Methode der Demonstration schlechthin in den Kreis der starren Nothwendigkeit des Endlichen gebunden ist und die Freyheit, das ist, der Begriff, und damit alles, was wahrhaft ist, jenseits derselben liegt und von ihr unerreichbar ist."49 Die Tatsache, daß Jacobi zusammen mit Kant den Wendepunkt für die Geschichte der Philosophie markiert, deutet auf die paradoxale Situation hin, in die sich die Wissenschaft der Logik gleich
zu Beginn begibt. Einerseits charakterisiert Hegel die Wissenschaft der in der Logik "Einleitung" als ein "Reich der Schatten" und der "einfachen Wsenheiten",50 die von allen äußerlichen Zufälligkeiten gereinigt sind. Andererseits jedoch betont Hegel ebenfalls, daß die Philosophie nicht anfängt "wie aus der Pistole, aus ihrer innern Offenbarung, aus Glauben und intellectueller Anschauung".51 Was gleichsam seinen Schatten wirft und damit ein überzeitlich gültiges Denken verhindert, ist für Hegel die Geschichtlichkeit der Philosophie. So ist es für die spekulative Logik erforderlich, daß sie theoretisch den Anfang der Geschichte der Philosohie aufnimmt, durch den diese bei den Eleaten allererst zu einem Wissen von dem Einen und dem Sein geworden ist. Die von Hegel behauptete Koinzidenz von logischem und geschichtlichem Anfang meint allerdings nicht, das Seinsdenken der Eleaten unverändert wieder herzustellen. Statt naiv zur Vergangenheit zurückzukehren, stellt Hegel sie in Kontinuität zur eigenen Gegenwart, die die geistigen Konstellationen vorgibt, um eine produktive und weiterführende Aneignung der philosophischen Tradition zu gewährleisten. Wenn historisch und sachlich die Gegenwart zu dem Ort wird, der eine Revision des Seinsverständnisses ermöglicht, dann ist es nur eine Konsequenz von Hegels Ansatz, sich in der Wissenschaft der Logik auch verstärkt mit der die Zeit prägenden Position Jacobis auseinanderzusetzen. Nachdem er bereits in der Heidelberger Rezension des dritten Bandes der Werke von Jacobi dessen antizipatorische Einsichten gewürdigt hatte, setzt Hegel diese positive Beurteilung in einer Anmerkung fort, die zur zweiten, bearbeiteten Auflage der Seinslogik hinzugefügt wurde. Bezeichnenderweise folgt die Auseinandersetzung mit Jacobi auf eine kritische Darlegung des parmenideischen Anfangs der Philosophie, den Hegel für die Neuzeit im Denken der einen Substanz bei Spinoza erneuert sieht. In bezug auf einen derart monistischen Anfang macht Jacobi die "beredsten und vielleicht auch vergessenen Schilderungen über die Unmöglichkeit, von einem Abstrakten zu einem Ferneren und zu einer Vereinigung beider zu kommen [...] im Interesse seiner Polemik gegen die Kantische Synthesis des Selbstbewußtseins à priori."52 Weit mehr als die spezifischen Vorbehalte, die Jacobi in der Abhandlung Ueber das Unternehmen des Kriticismus die Vernunft zu Verstände zu bringen gegen Kant einwendet, betont Hegel die Struktur des Argumentes, das für eine neue Ansicht des logischen Anfangs fruchtbar sein könnte. Laut Hegel gibt Jacobi, wenn er an Kant die Aufgabe heranträgt, daß in dem von allem empirisch Mannigfaltigen gereinigten Einen, sei
48 49 50 51 52
GW 12,229. Ebd. GW 21, 42. Ebd., 53. Ebd., 82.
101
Hans-Jürgen Gawoll das Bewußtsein, der Raum oder die Zeit, "das Hervorbringen einer Synthesis"53 aufgezeigt werde, die Unfruchtbarkeit und das Unwesen der Abstraktion für ein spekulatives Denken auf das Genaueste an. Das aus dem Abziehen von jeglichem Sinnlichen gewonnene Eine besitzt lediglich die Einheit einer Leere, die, weit davon entfernt, sich in der Tätigkeit der Synthesis zu teilen, Vielheit überhaupt von sich ausschließt. Für Hegel hat allerdings Jacobi mit seinem Einwand die Kantische Synthesis derart ausgedünnt, daß er bloß die empirische Nichtigkeit einer leeren Einheit aufzeigte und auf die Kopula eines in sich ununterschiedenen Ist reduzierte, um daraus die Unmöglichkeit eines Übergangs vom Unendlichen zum Endlichen zu verifizieren. In der Terminologie der spekulativen Logik ausgedrückt, verharrt Jacobi mit seiner Kantkritik auf dem Standpunkt einer äußerlichen Reflexion, die den Gedanken eines abstrakten und starren Seins fixiert. Obwohl Hegel inhaltlich Jacobi ein Mißverstehen der transzendentalen Einheit des Selbstbewußtseins vorwirf, macht er sich das daraus resultierende Argument dem Prinzip nach zu eigen, indem er es auf den eleatischen und modern spinozianischen Anfang der Philosophie anwendet: "bey Parmenides wie bey Spinoza soll von dem Seyn oder der absoluten Substanz nicht forgegangen werden zu dem Negativen, Endlichen [...] Es [sc. das Sein] ist das Unmittelbare, das noch schlechthin Unbestimmte."54 Der hiermit implizierte Einwand, daß die bisherigen monistischen Ansätze der Philosophie aufgrund der Voraussetzung einer abstrakten und beziehungslosen Unmittelbarkeit keine lebendige Entwicklung zulassen, reformuliert nicht nur Jacobis existentielle Befürchtung, daß die rationale Metaphysik des Einen ontologisch den Verlust der endlichen Welt nach sich ziehe. Seinem vollen kritischen Gehalt nach kann man in ihm eine zusammengedrängte Adaption von Jacobis Erläuterung des spinozianischen Satzes "determinado est negatio" sehen, die Hegel ausgeweitet und generalisiert hat. Das ontisch Negative und Endliche bei Hegel entspricht Jacobis Interpretation der einzelnen Dinge als non-entia im 50. Brief an Spinoza, "in so fern sie auf eine gewisse Weise bestimmt da sind", so daß "das unbestimmte unendliche Wesen das einzig wahrhafte ens reale ist."55 Neben dieser Belegstelle aus dem Spinoza-Buch, die überhaupt die Auffassung des Endlichen für die Philosophie des deutschen Idealismus wesentlich mit beeinflußt zu haben scheint, versuchten die bisherigen Ausführungen deutlich zu machen, auf welche metaphysikkritische Weise Jacobi in die Wissenschaft der Logik hineinwirkt. Daß ihm darüber hinaus eine positive Bedeutung für die Neubegründung des Logischen zukommt, suggeriert Hegels Heidelberger Rezension. In radikaler Umkehrung der Perspektive aus Glauben und Wissen zieht sich Jacobi gegenüber der Aufklärung nicht auf das religiöse Gefühl und die "Sicherheit seines Gemüths" zurück, sondern er vertiefte sich in das Studium der Vernunftmetaphysik Spinozas. Dergestalt faßte er für Hegel "die Philosophie in den Quellen des Wissens auf, dem die Anschauung des "Einen Substanziellen" zugrunde liegt, das man bei jeder Erkenntnis logisch vorauszusetzen hat. Jacobi erhob sich mit Spinoza "durch den höhern es
53 Ebd. 54 Ebd. 55 F.H. Jacobi, Werke (Anm. 1), Bd. 4, 1, 182. Manfred Baum, Die Entstehung der Hegelschen Dialektik. Bonn 1989, 56, weist nach, daß Hegel diese von Jacobi bestimmte Auffassung des Endlichen bereits in dem Fragment über Glauben und Sein übernimmt. -
102
Jacobi und
Hegels Wissenschaft vom Sein
Weg des Gedankens"56 zu dem letzten und wahrhaften Resultat des Denkens, das mit der Unmittelbarkeit eines absoluten Seins anfängt. Ohne den phänomenologischen Weg der Erfahrung des Bewußtseins beschritten zu haben, der genetisch die Notwendigkeit des absoluten Wissens aufzeigt, fand Jacobi kraft seiner Darstellung der Lehre des Spinoza den logischen Ausgangsort des Wahren. So darf Hegel sicherlich auf die Zustimmung Jacobis rechnen, wenn die Nachfolge des absoluten Wissens, das am Ende der Phänomenologie des Geistes das Bewußtsein vom Gegensatz zwischen Subjekt und Objekt befreite, in der Wissenschaft der Logik das Sein antritt. Zwar knüpft die Wissenschaft der Logik in der Weise an die Phänomenologie des Geistes an, daß sie die Vermittlung zum reinen Wissen des Absoluten voraussetzt, wodurch jede Beziehung auf ein ihm Fremdes und Äußerliches vernichtet wurde, aber das reine Sein läßt sich dennoch nicht schlechthin mit einer bereits gegebenen Erkenntnisleistung identifizieren.
Während das absolute Wissen die "Wahrheit aller Weisen des Bewußtseyns"57 beinhaltet, muß die logische Wissenschaft selbst, die dem Anspruch einer vollständigen Voraussetzungslosigkeit zu genügen hat, von jeglichem Vermittlungsprozeß und vorgängig bekanntem Seinsverständnis absehen. Die damit sich ergebende Forderung nach einem außerhalb jeder Relation stehenden und derart absoluten Anfang läßt sich laut Hegel nur durch den Entschluß einlösen, "den man auch für eine Willkühr ansehen kann, nemlich daß man das Denken als solches betrachten wolle."58 Formell ähnelt dieser methodische Rekurs auf die empirische Instanz des Willens dem Jacobischen salto mortale aus der Diskursivität einer monistischen Metaphysik (à la Spinoza); jedoch besteht der gravierende Unterschied darin, daß Hegel nicht in die Alogizität einer durch die Innerlichkeit überlieferten Gottesgewißheit springt, sondern sich für die Wissenschaft des logischen Hervorbringens von Denkbestimmungen entscheidet. Diese Wissenschaft der Logik hat zum Inhalt "den Gedanken, in sofern er eben so sehr die Sache an sich selbst ist, oder die Sache an sich selbst, in so fern sie eben so sehr der reine Gedanke ist. Als Wissenschaft ist die Wahrheit das reine sich entwickelnde Selbtbewußtseyn, und hat die Gestalt des Selbst, daß das an und für sich seyende gewußter Begriff, der Begriff als solcher das an und für sich Seyende ist."59 Gemäß dieser Auffassung einer spekulativen Wissenschaft thematisiert Hegel das eine substantielle Sein in Gestalt des Gedankens, der von vornherein unter dem Aspekt einer selbstreferentiellen Subjektivität steht, die sich kraft einer logischen Bewegung und Tätigkeit herstellt und ausdrückt. Berücksichtigt man zudem die phänomenologische Befreiung vom materiellen Gegensatz des Bewußtseins, dann verbietet es sich konsequenterweise, das Sein zu objektivieren. Zu Beginn der Wissenschaft der Logik muß man das substantielle Sein des Gedankens von der dezisionistisch erreichten Einseitigkeit einer reinen Unmittelbarkeit aufnehmen, von der sich jeder aus
56 GW 15, 9. Zu Hegels Heidelberger Jacobi-Rezension vgl. Hans-Jürgen Gawoll, "Von der Unmittelbarkeit des Seins zur Vermittlung der Substanz. Hegels ambivalentes Verhältnis zu Jacobi", in Hegel-Studien 33 -
(1998).
57 GW 21, 33. 58 Ebd., 86. An diesem dezisionistischen Einstieg in die Enzyklopädie fest. Vgl. Enz. § 17; GW 20, 59.
spekulative Philosophie hält Hegel bis hin zur Berliner
-
59 GW 21, 33.
103
Hans-Jürgen
Gawoll
der endlichen Äußerlichkeit stammende Inhalt zurückzuziehen hat, um das reine Wissen "für sich selbst gewähren zu lassen."60 Entsprechend dieser vorausgeschickten Bemerkungen, die den allgemeinen Begriff der Logik betreffen, beginnt die spekulative Wissenschaft mit dem Anakoluth: "Seyn, reines Seyn ohne alle weitere Bestimmung."61 Die hier gebrauchte grammatikalische Unkorrektheit wird gleichsam durch die Sache selbst erzwungen, von der Hegel bereits in der sprachlichen Ausdrucksform alle geläufigen Vorstellungsweisen abzuhalten sucht. Reines Sein ist kein reales Prädikat oder eigene Eigenschaft von etwas, wie es die Verwendung des bestimmten Artikels nahelegen würde und so den Schein einer Vergegenständlichung erzeugte. Hegels sprachlich zusammengedrängte These vom Sein, die auch dessen exponierter Stellung zu Beginn der Wissenschaft der Logik entspricht, findet man ausführlich beschrieben in Jacobis Interpretation der spinozianischen Substanz: "Das erste nicht in den ausgedehnten Dingen, nicht in den denkenden Dingen allein; sondern was das erste ist in den Einen wie in den andern, und auf gleiche Weise in allen Dingen: das Urseyn, das allgegenwärtige unwandelbare Wirkliche, welches selbst keine Eigenschaft seyn kann, sondern an dem alles andre nur Eigenschaft ist, die es hat; dieses einige unendliche Wesen aller Wesen nennt Spinoza Gott oder die Substanz."62 Nach Jacobi meint die spinozianische Substanz nicht bloß kein Substrat, das man für alle möglichen Prädikationen voraussetzt, sondern ihr dürfen darüber hinaus "keine von den Bestimmungen zukommen, welche einzelne Dinge unterscheiden."63 An diese Auffassung eines nicht-prädikativen und von allen Eigenschaften der endlichen Welt befreiten Seins, zu dessen Analyse das Spinoza-Buch Jacobis wichtige Vorarbeiten geleistet hat, knüpft Hegel zu Beginn der Wissenschaft der Logik an. Das Sein besitzt zunächst eine reine Bestimmungslosigkeit, die die absolute Substanz in Form einer abstrakten Allgemeinheit und so lediglich an sich ausdrückt. Untersucht man die damit gegebene Unmittelbarkeit einer Gleichheit des Seins mit sich logisch näher, dann gebraucht man Termini und Negationen, die offensichtlich in einem Verständnis des Nichts wurzeln. Reines Sein bezeichnet aufgrund seiner Bestimmungslosigkeit die Leere, in der nichts anzuschauen oder zu denken ist.64 Hinsichtlich des Nichts, das schon in der Differenzschrift eine Erkenntnis des Absoluten ermöglichte, nennt das Sein nicht länger allein die Unbestimmtheit des Gedankens, sondern es ist zugleich das Subjekt eines Aktes, kraft dessen es sich immanent seine Unmittelbarkeit aneignet. Durch den Vollzug eines Anschauens oder Denkens des entleerten Seins zeigt sich, daß es sein Gegenteil immer schon in sich enthält. Die abstrakte Einseitigkeit des Seins, die sich nach Jacobis Kritik an der transzendentalen Synthesis à priori prinzipiell jedem Fortgang verschließt, läßt sich demzufolge nicht aufrecht erhalten. Hegel beansprucht vielmehr, diesen berechtigten Einwand berücksichtig und durch den Nachweis außer Kraft gesetzt zu haben, daß das reine Sein vermöge einer internen Relationalität das von ihm Verneinte und abstrahierend Ausgegrenzte als Negatives in sich vorfindet. Daß Hegel in seinem Selbstverständnis beansprucht, auch die von Jacobi herausgestellte Problematik der unproduktiven Unbestimmtheit theoretisch zu lösen, macht die Stellung der erläuternden Ausführung zur -
-
-
-
60 61 62 63 64
Ebd.
Ebd., 68. F.H. Jacobi, Werke (Anm. 1), Bd. 4, 1, 180f. Ebd.
Vgl. GW 21, 69.
104
Jacobi und
Hegels Wissenschaft vom Sein
Einheit von Sein und Nichts deutlich, die in der zweiten Auflage der Wissenschaft der Logik direkt auf das Referat der oben erwähnten Polemik gegen Kant folgt: "Diese Unbestimmtheit oder abstráete Negation, welche so das Seyn an ihm selbst hat, ist es, was die äussere wie die innere Reflexion ausspricht, indem sie es dem Nichts gleichsetzt, es für ein leeres Gedankending, für nichts erklärt, oder kann man sich ausdrücken, weil das Sein das Bestimmungslose ist, ist es nicht die (affirmative) Bestimmtheit, die es ist, nicht Sein, sondern Nichts."65 Weit davon entfernt, daß die (pantheistische) Allgegenwart des Seins bestimmungslos in sich verharrt, bricht für Hegel gleich am Anfang das Nichts unmittelbar an ihm hervor. Was Hegel demzufolge an der ebenfalls von Jacobi zugestandenen logischen Priorität des Seins vermißt, ist die Aktivität einer bestimmenden Negativität, die dem reinen Wissen aus seiner phänomenologischen Genese eingeschrieben bleibt und den Sprung in den Glauben überflüssig macht. Vom Gesichtspunkt der absoluten Idee am Schluß der Wissenschaft der Logik aus gesehen, besitzt der Einsatz mit dem einfachen Gedanken des Seins von vornherein eine Bestimmtheit, wegen der es mit einem Mangel behaftet ist. Zur unmittelbaren Setzung des Seins gehört, daß vermittels des ihm immanenten Tun des Nichts der Trieb wirksam wird, "sich weiter zu führen."66 Der Trieb, das durch Mangel und Negativität determinierte Sein aufzuheben, charakterisiert daher die konkrete Lebendigkeit des Anfangs als eine Weise der Subjektivität, die die triebgeleitete Methode der Vernunft ausmacht, "durch sich selbst in allem sich selbst zu finden und zu erkennen."67 Die Phänomenologie des Geistes verendet daher nicht in einem toten Meer des absoluten Wissens, wie Fries an Jacobi berichtete, sondern sie setzt sich zwanglos in einem Anfang fort, der die Initialstelle für eine solche Unmittelbarkeit ist, die über sich hinaus auf eine Entwicklung von Bestimmungen ausgerichtet ist. Statt die Einseitigkeit von starren Gedankenformen des Seins und des Nichts, das historisch der Buddhismus im Nirwana zum absoluten Prinzip erhoben hat, gegeneinander zu fixieren, bilden sie nach Hegel die antinomische Einheit zweier Momente, die unauflöslich aufeinander bezogen sind. Die provozierende These einer eoineidentia oppositorum von Sein und Nichts bedeutet für Hegel keinen Zustand, der einfach besteht und zwei ruhende Momente in eins setzt. Vielmehr beschreibt die Vereinigung von Entgegengesetzten als Drittes den Bereich eines Geschehens, der sich zwischen Sein und Nichts immer schon ereignet hat: "Was die Wahrheit ist, ist weder das Seyn noch das Nichts, sondern daß das Seyn in das Nichts und das Nichts in das Seyn nicht übergeht sondern übergegangen ist."68 Mit dieser perfektivischen Wendung führt Hegel das Werden ein, das die Bewegung des reinen Wissens, den Gedanken des Seins durch Mangel und Negativität sich aus sich selbst heraus fortbestimmen zu lassen, überhaupt generiert. Die Empha-
-
-
65 Ebd., 86. 66 GW 12, 240. 67 Ebd, 238. Zur Einheit von Trieb und Methode in Hegels Wissenschaft der Logik vgl. Hans-Christian Lucas, Wirklichkeit und Methode in der Philosophie Hegels. Untersuchungen zur Logik. Der Einfluß Spinozas, Diss. Köln 1974, 36f. Gerade die Einheit von Trieb und Methode macht das Zitat eines Heterogenen überflüssig, das nach Ilchmann allein den Fortgang der systematischen Darstellung in der Wissenschaft der Logik ermöglichen soll zumal wenn es sich im Anschluß an Jacobis Spinoza-Interpretation um das allumfassende Eine handelt. Vgl. Achim Ilchmann, "Kritik der Übergänge. Zu den ersten Kategorien in Hegels 'Wissenschaft der Logik'", in Hegel-Studien 27 (1992), 1 Iff. 68 GW 21, 69. -
-
105
Hans-Jürgen Gawoll mit der Hegel den instantanen Umschlag des Seins in das Nichts beschreibt, weist darauf hin, daß im Werden der eigentliche Anfang der Wissenschaft der Logik liegt. Ausdrücklich se,
Hegel den Anfang und das Werden in seinen Diktaten für die Logik der Mittelklasse von gleich, was er unverändert 1814/15 wiederholt: "Das Seyn ist die einfache inhaltlose Unmittelbarkeit, die ihren Gegensatz an dem reinen Nichts hat, und deren Vereinigung der Anfang oder das Werden ist."69 Wenn die Wissenschaft der Logik den Anfang mit dem Werden macht, das erstmalig Heraklit zum ontologischen Prinzip erklärte, transformiert Hegel die gesamte spekulative Tradition. Zwar knüpft er einersetis an den parmenideischen und von Spinoza inaugurierten Monismus an, aber er liquidiert im doppelten Sinn des Wortes das Sein, indem er es durch die antinomische Struktur des einen Werdens ersetzt. Prägnant bringt Hegel die Verflüssigung des Seins in einer Randbemerkung zum Ausdruck, die er dem § 8 der Logik-Diktate von 1814/15 hinzufügt: "Alles was ist, ist ein Werden."70 Was Hegel mit einer solchen Formulierung plakativ abwehrt, ist die Vorstellung eines einengenden Inbegriffs des Absoluten, der alle Prädikate wie ein Behälter aufbewahrt. Sofern Hegel die Macht des Negativen in das Sein als Werden hineinnimmt, verwandelt er die bloße Substantialität des Absoluten zu einem Prozeß, der alle Bestimmungen produzierend umfaßt. Durch diese Dynamisierung des Absoluten entfernt sich Hegel einerseits sicherlich am weitesten von Jacobi, der ontologisch am Begriff des Ewigen und Ständigen festhält, das dem Werden enthoben ist. Andererseits erreicht Hegel paradoxerweise aber dadurch die größte Nähe zu Jacobi, daß für ihn das Werden den ausgezeichneten Ort einer spekulativen Logik bildet, setzt
1810/11
kraft dessen ein Wissen des Absoluten von sich stattfindet. Eine solche Affinität zu Jacobi tritt dann zutage, wenn man das Hegeische Projekt einer metaphysischen Logik in theologischen Termini reformuliert. Angesichts der einschlägigen Aussage, daß die Wissenschaft der Logik die Darstellung Gottes beinhaltet, "wie er in seinem ewigen Wesen vor der Erschaffung der Natur und eines endlichen Geistes ist,"11 wird Hegels Versuch der Neubegründung einer philosophischen Theologie offenkundig. Theo-logisch gesehen, hätte für Hegel demzufolge Gott das unbestrittenste Recht, "daß mit ihm der Anfang gemacht werde."72 Die sachliche Zusammengehörigkeit einer spekulativen Ontologie und einer philosophischen Theologie erläutert Hegel im § 1 der Nürnberger Religionslehre für die Mittel- und Oberklasse von 1811-1813, nach der Gott zuerst "das Sein in allem Sein, das einfache Erste und Unmittelbare"73 meint, das ebenso wie nach der Wissenschaft der Logik eine Abstraktion (von aller Bestimmtheit) darstellt, die als solche jede fortschreitende begriffliche Bewegung ausschließt. 69 G.W.F. Hegel, Logik für die Mittelklasse des Gymnasiums, Nürnberg 1810-1811ff Die Diktate Hegels und ihre späteren Überarbeitungen, hg. v. Paolo Giuspoli und Helmut Schneider, Frankfurt a.M. 1999, Diktate Hegels 1810-11 (1814-15) § 7. Ich danke Herrn Dr. Helmut Schneider (Bochum) für die Erlaubnis, aus den Fahnen zitieren zu dürfen. In dem entsprechenden Paragraphen bei Rosenkranz steht statt dessen bloß "[...] und deren Vereinigung das Werden ist" (Ebd. § 9 im Text nach Rosenkranz). 70 Ebd. Randbemerkung zum § 8 in den Umarbeitungen Hegels 1814-15. Eugen Fink betont in seiner Interpretation des Anfangs der Wissenschaft der Logik, daß Hegel durch die Verflüssigung des Seins als Werden mit der Tradition des metaphysischen Seinsbegriffs seit Parmenides bricht. Vgl. Eugen Fink, Metaphysik und Tod, Stuttgart 1969, 150ff. 71 GW 21, 34. 72 Ebd., 65. 73 HW 4, 280, auch 279. Den Hinweis auf diese Stelle verdanke ich Herrn Professor Dr. Walter Jaeschke (Bo-
chum).
106
Jacobi und
Hegels Wissenschaft vom Sein
Bei diesem ersten Begriff eines unmittelbar gegebenen Gottes handelt es sich sachlich um eine interpretatorische Anknüpfung von Jacobis Auslegung des einen Gottes bei Spinoza, der das "lautere Principium der Wirklichkeit in allem Wirklichen, des Seyns in allem Daseyn"74 ist, dem allerdings Individualität und Persönlichkeit fehlen. Wenn sich die Nürnberger Religionslehre von 1811/13 also implizit auf die Spinoza-Briefe bezieht, so liegt ein weiterer Beleg dafür vor, daß bei Hegel zur Zeit der Abfassung der Wissenschaft der Logik jene Seinsauffassung im Hintergrund steht, die Jacobi dem Gottesbegriff des ersten Buches der Ethica gegeben hat. Gleichzeitig grenzt sich Hegel von einem rein spinozistischen und pantheistischen Gottesverständnis durch seine Analyse des Anfangs ab, der die in sich unterschiedene Einheit des Seins und des Nichts enthält, der zumindest der christlichen Vorstellung einer creatio ex nihilo nicht zu widersprechen scheint. Gegenüber dem von Jacobi entdeckten spinozistischen Geist des Prinzips "ex nihilo nihil fit" mit der von ihm implizierten abstrakten Bewegungslosigkeit besagt der Anfang mit dem Gedanken Gottes "die Identität der Identität und Nicht-Identität",75 wodurch alle weiteren Bestimmungen des Absoluten immanent erzeugt werden. Die philosophische Theologie Hegels fängt mit dem allgegenwärtigen Werden des einen Gottes an, der durch die Entwicklung begrifflicher Bestimmungen eine Synthese des von ihm Unterschiedenen zustandebringt, die den Reichtum und die Fülle des Geistes und des Johanneischen logos ausmacht. Aufgrund des Gedankens eines Gottes, der sich in einem begrifflichen Prozeß am Ende als Geist expliziert und erkennt, reicht Hegel auch in seiner Selbsteinschätzung sachlich nah an Jacobi heran. So schreibt er in der schon mehrfach zitierten Heidelberger Rezension, die einen ontotheo-logischen Rückblick auf die Wissenschaft der Logik bietet, ebenfalls Jacobi ein metaphysisches Unbehagen an der spinozianischen Leere des Seins zu, indem er den "Übergang von der absoluten Substanz zum absoluten Geiste in seinem Innersten gemacht und mit unwiderstehlichem Gefühle der Gewißheit ausgerufen hat: 'Gott ist Geist, das Absolute ist frey und persönlich'."76 Der Sache nach ist sich Hegel mit Jacobi darin einig, daß es von der rein abstrakten Substanz ein unmittelbares Wissen geben muß, das eine erfüllte Anschauung des lebendigen Geistes und der ewigen Liebe Gottes gewährleistet, die in der letzten Vorlesung über Logik und Metaphysik von 1831 die Form des Begriffs an und für sich darstellt sowie qua Vereinigung mit dem Absoluten "das Gefühl der Befriedigung und dieses Friedens"77 erahnen läßt. Mit Hinblick auf eine philosophische Theologie sieht Hegel die Wichtigkeit Jacobis darin, das Moment der Unmittelbarkeit der Erkenntnis Gottes herausgehoben zu haben. Aber indem sich Jacobi bloß auf (s)eine subjektive Evidenzerfahrung zurückzieht, kann er keine Erkenntnisform aufweisen, die die lebendige Prozessualität eines in sich werdenden Gottes ausweist. Was Hegel einzig und allein an Jacobi kritisiert, ist die Tatsache, daß er methodisch die Vermittlung zur Unmittelbarkeit verfehlt, die als Konsequenz in der von ihm versicherten Vergeistigung der Substantialität liegt. Diese Ambivalenz in der sachlichen Übereinstimmung macht sich auch Jacobi bewußt, wenn er in einem Brief an Neeb vom 30. Mai 1817 schreibt: "Der Unterschied zwischen Hegel und mir besteht darin, daß er über den Spi-
-
74 F.H. Jacobi, Werke (Anm. 1), Bd. 4, 1, 87. 75 GW 21, 60. 76 GW 15, 11. 77 Zitiert nach Hans-Christian Lucas, "Spinoza in
huis, Leiden 1982, 13.
Hegels Logik",
in
Mededelingen
XLV vanwege het
Spinoza-
107
Hans-Jürgen Gawoll
('jenes substantielle Absolute, in welchem alles nur untergeht, alle einzelne Dinge aufgehoben und ausgelöscht werden',) welcher Spinozismus auch ihm das letzte, wahrhafte Resultat des Denkens ist, auf welches jedes konsequente Philosophieren führen muß, hinauskommt zu einem System der Freiheit, auf einem nur noch höheren, aber gleichwohl demselben (also im Grunde auch nicht höheren) Weg des Gedankens. ohne Sprung; ich aber nur mittelst eines Sprunges, eines voreiligen, dem Schwungbrette aus des bloß substantiellen Wissens, welches zwar Hegel annimmt und voraussetzt, aber anders damit umgegangen haben will, als es von mir geschieht, dessen Methode ihm Ähnlichkeit zu haben scheint mit der, welche wir als lebendige Wesen befolgen bei der Verwandlung von Nahrungsmiteln in Säfte und Blut durch bewußtlose Verdauung, ohne Wissenshaft der Physiologie. Er mag nozismus nur
-
wohl recht haben, und gern wollte ich mit ihm noch einmal alles durchversuchen, was die Denkkraft allein vermag, wäre nicht der Kopf des Greises zu schwach dazu."78 Überraschend genug räumt Jacobi hier die Möglichkeit eines Wissens von Gott ein, die er gegenüber Spinoza, Fichte und Schelling so polemisch heftig bestritt. Obwohl Hegel Recht haben mag, sind jedoch bei Jacobi noch nicht jegliche Vorbehalte beseitigt, wie der Rückzug auf die altersbedingte Schwäche des Geistes andeutet. Auch wenn Jacobi am Ende seines Denk- und Lebensweges ein theoretisch abgesichertes Wissen von Gott eingesteht, vermißt er darin doch weiter den existentiellen Vollzug, den nur ein gelebter Glaube bewahrheitet. Er beschließt seinen Brief mit einem Zitat von Kästner, der den "Luchs lieber von dem Jäger kennenlernen als von dem Methodisten"79 eine wissenschaftliche Definition hören will. Eine entwicklungsgeschichtliche Betrachtung des Verhältnisses von Hegel und Jacobi erspart sicherlich nicht die Mühe, sich die Tragweite der Anfangsproblematik aus der Wissenschaft der Logik selbst zu erschließen. Jedoch vermag eine durch sie geleistete Kontextualisierung den sachlichen Hintergrund zu erhellen, ohne den einige Gedankengänge im Dunkeln blieben, so daß man sich über deren Unverständlichkeit beklagte. Anhand einer Kontextualisierang mit Jacobi läßt sich für Hegel eine erstaunliche Kontinuität seines Denkens ablesen, die sich von den 'theologischen Jugendschriften' bis hin zur Wissenshaft der Logik durchhält. Einerseits mag die auf die Tübinger Studienzeit zurückgehende Beschäftigung mit Jacobi bei Hegel die Einsicht geschärft haben, daß man nach dem alleszermalmenden Kritizismus Kants zur Neubegründung der Spekulation ein unmittelbares Wissen zugrunde legen muß. Dieser Wendepunkt und feste Halt genügte Hegel andererseits seit 1800 nicht mehr, sondern die implizite oder explizite Reaktion auf Jacobi hat ihn neben anderen zu einer Wissenschaft vorangetrieben, die Logik und Metaphysik vereinigt. Im Unterschied zu Fichte und Schelling gewinnt Hegel gegenüber Jacobi, der auf der Unmittelbarkeit des Seins kompromißlos insistiert, eine größere Selbst- und Eigenständigkeit, sofern er das, womit das Wissen anfängt, zur antinomischen Einheit des Werdens dynamisiert. Nach dem Abschluß der Wissenschaft der Logik läuft der Gegensatz zwischen Hegel und Jacobi nicht mehr auf die Alternative von Glauben und Wissen hinaus, sondern es steht die Entscheidung an zwischen einem göttlichen Sein, das man existentiell praktiziert, oder einem Werden des Absoluten, das man in allem, was ist, wissend erkennen kann.
78 Hegel in Berichten seiner Zeitgenossen (Anm. 79 Ebd., 143.
108
6), 143.
Milan Prucha
Seinsfrage und Anfang in Hegels Wissenschaft der Logik
Hegels Philosophie hat ihre Zeitgenossen, aber auch das spätere philosophische Denken, mit einer solchen Intensität angesprochen, daß praktisch alle ihre inneren Probleme immer dann in den Vordergrund getreten sind, wenn es um allerwichtigste Fragen ging. Deswegen gibt es kaum noch irgendeinen Aspekt des Hegelschen Denkens, bezüglich dessen man schon die verschiedensten Interpretationswege nicht erprobt hätte sei es zum Verständnis, zur Kritik oder zur "Überwindung" des Hegelianismus. Das gilt auch oder eher insbesondere vom Anfang der Logik, wo kein heutiger Interpret glücklicherweise mit reinem Tisch beginnen muß oder aber beginnen kann: Jeder hat seine Vorgänger. Radikale Innovationen lassen sich am ehesten im Kontext von "großen" philosophischen Ereignissen erwarten, von konzeptionellen Wenden, deren Projizierung auf den Boden der spezialisierten Hegelforschung für diese und damit auch für die Untersuchung des Anfangs der Logik neue Perspektiven eröffnet. Im vorliegenden Aufsatz möchten wir den entsprechenden Text Hegels vom Standpunkt der Seinsfrage her lesen so wie diese zumindest in dem Teil der gegenwärtigen Philosophie lebendig ist, der sie explizit in den Vordergrund stellt. Wir hoffen, daß auf diesem Wege ebenso eine Erweiterung des Hegelverständnisses erwartet werden kann, wie auch bei diesem Denker neue Impulse für die Behandlung des Problems geschöpft werden können, das in unseren Augen auch heute das Kernproblem der Philosophie bedeutet. Die Frage nach dem Anfang der Logik ist für Hegel die Frage nach dem Sein. Er trägt sie aber so vor, als ob das Problem der Anfang und seine Lösung das Anfangen mit dem Sein wäre. Wir möchten zeigen, daß er damit seinen philosophischen Standpunkt eher suggeriert, als argumentativ rechtfertigt, daß er wenigstens hier die Spannungen in der früheren Philosophie im Schatten läßt, soweit es darum geht, ob sich die Seinsfrage befriedigend als die Frage nach dem Anfang konzipieren und lösen läßt. Gibt es Alternativen, die die Seinsfrage anders als die Frage nach dem Anfang auffassen? Welche Vorteile bringt diese Auffassung der -
-
-
-
Frage nach dem Sein und welche Schwierigkeiten
von anderen Strategien überwindet sie? Mit welchen Schwierigkeiten sind die früheren Versuche, diesen Weg zu bestreiten, konfrontiert worden, und hat Hegel sie tatsächlich überwunden? Führt nicht Hegels Konzeption des Seins-Anfangs zu neuen Schwierigkeiten, an denen sie vielleicht scheitert? Und welche Konsequenzen aus dem eventuellen Hegelschen Mißerfolg zieht dann die spätere Philosophie nicht nur die realistische, sondern auch die, die auf Kants Einordnung der Frage nach der
-
Milan Prucha
Möglichkeit der Metaphysik im Kontext der menschlichen Endlichkeit insistiert und sich als eine Ontologiekonzeption versteht, die "aus einer anderen Fragestellung erwachsen, [...] sich gleichsam in entgegengesetzte Richtung wie die des deutschen Idealismus"1 bewegt? Es ist mehrmals festgestellt worden, daß in der antiken Philosophie nicht erst bei Piaton und Aristoteles, sondern schon früher die Grundfrage der Philosophie, die Frage nach -
dem Sein, in zwei Formen hervortritt: als Frage nach dem Sein des Seienden als solchem, im allgemeinen (nicht im Ganzen), oder aber als Frage nach dem "Sein", als dem ersten oder dem höchsten, aus dem alle Seiende zu erklären sind. Die Untersuchungen von Jäger und Aubenque2 zeigen, wie schwierig dieses Problem für Aristoteles war: Seine deklarierte Bemühung um die Vereinigung der Ontologie und der Theologie führte in der Ausführung nicht zu dem von ihm erwünschten Resultat. Sein Wort zu der Geschichte dieses Problems hat auch M. Heidegger gesagt, für den "'Metaphysik' der Titel für die Verlegenheit der Philosophie schlechthin" bleibt. Die nacharistotelische abendländische Metaphysik verdankt ihre Ausbildung "dem Nichtverstehen der Fragwürdigkeit und Offenheit, in der Plato und Aristoteles die zentralen Probleme stehen ließen."3 Wir werden noch sehen, wie Heidegger die merkwürdige Doppelung der Metaphysik überwinden möchte unserem Dafürhalten nach bloß so, daß er das Modell der theologischen Metaphysikauffassung übernimmt, aber die Theologie dadurch zu vermeiden glaubt, daß er in seiner Ursprungsphilosophie das Erste statt als Gott als "Sein" darstellt oder als "Es", welches das Sein gibt. Hegel interpretiert die Frage nach dem Sein des Seienden in einer Anknüpfung an die Tradition, die das Sein als Anfang aller Dinge verstanden hat. Als für einen solchen noch irgendwelches konkretes Seiendes zählte, Wasser z. B., konnte dieses privilegierte und erste Seiende gleichzeitig als das für alle Gemeinsame angesehen werden: Auf diesem Niveau konnte sich also der Unterschied zwischen den zwei erwähnten Auffassungen der Seinsfrage noch kaum artikulieren. Hegels Interpretation der frühen Philosophiegeschichte wird aber bedenklich schon hinsichtlich Parmenides und Heraklit. Bemerkenswert ist dabei die Ähnlichkeit zu Heidegger: Auch über Hegel läßt sich sagen, daß er für seine Seinsauffassung die entscheidende Inspiration schon bei den Vorsokratikern findet und daß er trotz allem Anschein Piaton und Aristoteles letzten Endes einseitig aus dieser Perspektive heraus interpretiert. Deswegen möchten wir vor der Betrachtung des historisch-philosophischen Umrisses, auf den Hegel im Abschnitt "Womit muß der Anfang der Wissenschaft gemacht werden" seine Position stützt, kurz einige Probleme andeuten, die, wegen seiner Entscheidung für die Philosophie des Anfangs, Hegel in der Darstellung der Entstehungsgeschichte der Metaphysik ausgeklammert hat. Als ihr Anfang sollte sich schon bei den "Physiologen" das "Sein" von den Seienden unterscheiden, die man mit seiner Hilfe erklären wollte. Die Unterscheidung zwischen dem Sein und dem Seienden artikuliert sich weiter nur mit beträchtlichen Schwierigkeiten, mit denen die Philosophie bis heute nicht fertig geworden ist, so daß in ihr die schon seit langem bekannten Aporien weiterleben und die durch die Entwicklung der Philosophie problematisierten "Lösungen" zurückkehren. Die Vertiefung der Einsicht der "Physiologen" ist bei den -
-
1 2
3
Heidegger, Kant und das Problem der Metaphysik, Frankfurt a.M. 1965, 127. Vgl. W. Jäger, Aristoteles. Grundlage einer Geschichte seiner Entwicklung, Berlin problème de l'être chez Aristote, Paris 1962. M. Heidegger, Kant und das Problem der Metaphysik (Anm. 1 ), 18. M.
110
1923. P.
Aubenque,
Le
Seinsfrage und Anfang Denkern zu suchen, für die die Beziehung zwischen dem Sein und dem Seienden zum Problem geworden ist auch dann, wenn sie dazu tendierten, die Möglichkeit der Differenzierung zwischen beidem zu leugnen: entweder wegen der Schwierigkeit vom Sein etwas zu unterscheiden oder aber weil sie in der Bewegung, Veränderung, im Entstehen und Vergehen ein Hindernis sahen, um etwas als seiend anzuerkennen. Als sich die Unterscheidung des Seins von dem Seienden etabliert hat, ist das Problem ihrer Beziehung in den Vordergrund getreten. Öffnet sich zwischen dem Sein und dem Seienden ein Abgrund und reicht es also zu sagen, daß das Sein kein Seiendes ist, oder muß die Formel "das Sein des Seienden" für den Ausdruck ihrer Untrennbarkeit herhalten? Sogar als Anfang konnte das Sein sehr unterschiedliches bedeuten: Ursache des Seienden, nicht nur als seine Quelle, sondern auch in dem Sinne, daß sie als unbewegter Beweger wirkt, als das Geliebte, dem sich die Seienden selbst anzunähern streben; oder das Erste, dessen Degradation das Seiende ist. Das Sein des Seienden konnte aber auch ganz anders verstanden werden als Prinzip-Regel, die unterschiedlichen Seienden gemeinsam ist, so daß sich jedes von ihnen durch die Entsprechung dieser Regel sein Sein gibt. Das sind die Manifestationen der Zweideutigkeit im Verständnis der Seinsfrage, deren Überwindung sicherlich ein legitimes und notwendiges Anliegen war, nicht aber das Schweigen über dieses große Pro-
-
blem. Im Abschnitt "Womit muß der Anfang gemacht werden?" ging es Hegel offensichtlich nicht so sehr um die Berücksichtigung dessen, wie die Philosophie tatsächlich die Seinsfrage in ihrer Geschichte gestellt hat, sondern eher um die Behauptung des eigenen Standpunktes: Die Entwicklung der Philosophie erscheint als dessen progressive Entdeckung. Weil er ihn jedoch nur ungenügend diskutiert, sondern eher als notwendiges Geschichtsresultat eingeführt hat, hat er die Situiertheit seines Standpunktes zwischen den anderen und damit auch seine Originalität schwer verständlich gemacht, was bis heute dazu führt, daß Hegel eher einseitig kritisiert oder abgelehnt als verstanden wird und daß auch seine Nachfolger aus der Philosophie des Meisters sich meistens nur bestimmte Elemente aneignen, ohne imstande zu sein, an sie in ihrem Hauptanliegen anzuknüpfen. Der Anfang der Wissenschaft fällt bei Hegel mit drei weiteren zusammen: mit dem Anfang der Logik, dem Anfang der Philosophie und dem Anfang in der Philosophie. In unserem Zusammenhang ist die abwechselnde Anwendung der beiden letzteren Termini von besonderer Bedeutung: Sie zeigt, daß es Hegel um das Beruhen der Philosophie nur auf sich selbst geht. Deswegen überspringt Hegel die Frage, wie das Problem des Seins anzugehen sei und ob es als Frage nach dem absoluten Anfang auf eine angemessene Weise verstanden werden kann. Die Frage nach dem Anfang der Wissenschaft beruht bei Hegel auf der nicht ausgewiesenen Voraussetzung der "Wissenschaft" des absoluten Anfangs. Dementsprechend bemüht er sich bloß zu zeigen wie der Anfang aufzufassen sei, um diese Konzeption der Wissenschaft oder diese Strategie der Lösung der Seinsfrage haltbar zu machen. Hegel geht es dabei um die Überwindung aller Inkonsequenzen der früheren Anfangsphilosophien, gleichzeitig aber auch um die Eliminierung der konkurrierenden Theorie des Seins des Seienden im allgemeinen, wie sie sich von der Theorie des Seienden im Ganzen unterscheidet. Er tut es aber indirekt und auch nicht durch ihre bloße Ablehnung, sondern durch ihre Unterordnung unter seine eigene Auffassung der Grundfrage der Philosophie.
111
Milan Prucha
Hegel seine Auffassung der Seinsfrage nicht zureichend begründet, ist keine Unterlassung, sondern eine notwendige Folge seines anfangsphilosophischen Standpunktes selbst. Am Anfang der Logik müsse auf jede Reflexion verzichtet werden, weil die Reflexionsbegriffe selbst aus dem Anfang abzuleiten seien und deswegen nur später, nicht jedoch am Anfang auftreten dürfen. Dieses Motiv, das nicht nur bei Hegel, sondern ebenso in der Hegelforschung immer wiederkehrt, projiziert sich auch in die Komposition des Hegelschen Textes, in dem die Unterscheidung zwischen der eigentlichen Darstellung und den "Anmerkungen", in die die Reflexion verbannt wird, kaum die Tatsache verdecken kann, daß auch Hegel und Daß
nicht bloß aus Rücksicht auf den Leser auf die Reflexion nicht verzichten konnte. Es ist deswegen möglich, Hegel vorzuwerfen, daß er das Problem der Reflexion ebenso verharmlost, wie die mit ihm verbundene Auffassung der Seinsfrage selbst. Er schildert die Reflexion als eine durch bloße Einfalle eine strenge Methode ausschließendes Verfahren, das die logische Einordnung der Begriffe nicht respektiert und deswegen mit unausgewiesenen Begriffen oder eher approxmativen Vorstellungen operiert. "Vorstellung" diskreditiert Hegel also durch ihre Entgegensetzung zum Begriff, als ob es selbstverständlich wäre, mit Hilfe von letzterem die Unterscheidung zwischen Vorstellung und Vorgestelltem "aufzuheben". Auch Hegels Kritik des Verstandes gehört in diesen Zusammenhang. Philosophisch wichtig an der "äußeren Reflexion" in ihrem Unterschied zu Hegels Spekulation, an "Vorstellung" im Unterschied zum Hegelschem "Begriff ist aber nicht die angebliche Willkürlichkeit, Oberflächlichkeit etc. der "äußeren Reflexion" und der "bloßen" Vorstellungen, sondern daß sie einer anderen Seinsauffassung verpflichtet oder durch sie wenigstens gekennzeichnet sind. Das Sein der Seienden besteht in der letzteren nicht in ihrem Auftreten als sich selbst aufhebende Momente des allumfassenden Ganzen, sondern gehört ihnen selbst, so daß sie nicht bloß "gegeben" sind, sondern sich selbst geben, weil sie durch sich selbst sind auch dann, wenn sie sich dieses Sein vermittelst der Fähigkeit, sich auf andere zu stützen, sichern. Der absolute Grund von allem sagt Hegels kurze geschichtsphilosophische Skizze im Text über den Anfang der Wissenschaft kann nicht ein bloß inhaltliches Prinzip bedeuten, sondern, wie es die Philosophie der Moderne eingesehen hat, ebenso ein Verhalten des Erkennens: "So soll das Prinzip auch Anfang und das, was Prius für das Denken ist, auch das Erste im Gange des Denkens sein."4 Kann aber in der Philosophie, wie man es von ihr Hegels Überzeugung nach verlangen muß, voraussetzungslos angefangen werden? Hegel wirft die Aporie des unmittelbaren und des vermittelten Anfangs auf und will sie im Sinne der These überbrücken, daß es im Himmel, in der Natur oder im Geiste nichts gäbe, was nicht ebenso Unmittelbarkeit wie Vermittlung enthielte. Jeder Satz der Logik soll diese These bestätigen und ihr entsprechend soll auch der Anfang der Logik konzipiert werden. Besteht deswegen die Lösung des Problems des Anfangs in dem, daß er im Rahmen der Logik ein unmittelbarer, doch vermittelt ist, soweit die Logik sich auf die Phänomenologie des Geistes stützt, die das reine Wissen das Element, in dem sich die Logik bewegt zum Resultate hat? Hegels Berufung auf die Phänomenologie in der Sache des Anfangs der Logik hat zahlreiche Mißverständnisse und Streitigkeiten zwischen seinen Interpreten hervorgerufen. Für problematisch halten wir insbesondere die Bejahung der eben gestellten Frage, die These (und -
-
-
-
-
-
-
-
-
4
G.W.F. Hegel, zitiert: WdL I.
112
Wissenschaft der Logik, hg.
v.
Georg Lasson, Hamburg 1975,
Erster Teil, 52. Im
folgenden
Seinsfrage und Anfang
Hegel ist nicht ganz unschuldig daran, daß man sie formuliert), daß der Phänomenologie das Privileg der Ableitung dessen zuzurechnen sei, womit die Logik anfängt. Stellte sich dann nicht das Problem der Unmittelbarkeit des Anfangs in der Phänomenologie selbst? Hegel
sagt zwar, daß in der Wissenschaft des erscheinenden Geistes "von dem empirischen, sinnlichen Bewußtsein anzufangen und dieses [...] das eigentlich unmittelbare Wissen"5 sei, was aber nicht bedeutet, daß das sinnliche Bewußtsein eine weiter nicht hintergehbare, letzte Unmittelbarkeit ist. Gegen die Privilegierung der Phänomenologie spricht schon, wie sie Hegel am Ende seines Lebens, bei der Vorbereitung ihrer zweiten Auflage charakterisiert hat: "Eigentümliche frühe Arbeit, nicht umarbeiten". Die Berufung auf die Phänomenologie im Abschnitt über den Anfang der Wissenschaft ist vorsichtig zu nehmen nicht nur wegen der Weise, wie Hegel später die Phänomenologie in sein System in der Enzyklopädie einordnet, sondern im Hinblick darauf, was er über sie schon in der Logik selbst, im dritten Buch schreibt: "eine(r) Wissenschaft, welche zwischen der Wissenschaft des Naturgeistes und des Geistes als solchen steht und den für sich seienden Geist zugleich in seiner Beziehung auf sein Anderes, welches hierdurch sowohl, [...] als an sich seiendes Objekt wie auch als negiertes bestimmt ist, den Geist also erscheinend, am Gegenteil seiner selbst sich darstellend betrachtet."6 Sehr entfernt davon in dieser Einordnung der Phänomenologie bloß Hegels Abschied von seiner frühen Schrift zu sehen, sind wir doch der Meinung, daß diese Veränderung auch den Anfang der Philosophie und Logik bei Hegel verständlicher macht. Sie trägt zur Widerlegung der Vorstellung bei, daß es nur die Phänomenologie ist, die den Eintritt in die Logik eröffnet und zwar nicht nur in dem Sinne, daß die Logik selbst des Anfangens mächtig ist, sondern durch die Klärung dessen, wie Hegel die Aporie des unmittelbaren und vermittelten Anfangs lösen will, nämlich, durch die Einheit des Anfangs und des Resultats nicht weniger in der Logik als im ganzen System. Die Phänomenologie eröffnet den Eintritt in die Logik als eine spezifisch dargestellte Philosophie des Geistes. Bei ihrer Herausgabe war die Phänomenologie für Hegel der erste Teil des Systems, wo der Gang von der einfachsten Erscheinung des Geistes, dem unmittelbaren Bewußtsein, bis zum Standpunkt der philosophischen Wissenschaft führt. Philosophie gilt aber als die höchste Form des Geistes und gerade deswegen konnte die Phänomenologie nicht beim Formellen des bloßen Bewußtseins stehenbleiben. Als Resultat setzte der Standpunkt des philosophischen Wissens die Bewußtseinsgestalten der Moral, Sittlichkeit, Kunst, Religion voraus: "Die Entwicklung des Gehalts, der Gegenstände eigentümlicher Teile der philosophischen Wissenschaft, fällt daher zugleich in jene zunächst nur auf das Formelle beschränkt scheinende Entwicklung des Bewußtseins."7 Wird also die Phänomenologie in die Philosophie des Geistes eingeordnet, dann zeigt sich, daß die Unmittelbarkeit des Anfangs in der Logik durch das Ende vermittelt ist in dieser durch die absolute Idee (im letzten Kapitel der Schrift wird das Problem des Anfangs sehr ausführlich thematisiert), in der Philosophie des Geistes durch den absoluten Geist. So lesen wir im § 574 der Enzyklopädie, der ihre zweite Auflage abschließt: "Dieser Begriff der Philosophie ist die sich denkende Idee, die wis-
-
-
-
5 6 7
WdL I (Anm. 4), 53. G.W.F. Hegel, Wissenschaft der den: WdL II. Enz. § 25.
Logik, hg.
v.
Georg Lasson, Hamburg 1975,
Zweiter Teil, 437. Im
folgen-
113
Milan Prucha
sende Wahrheit, das Logische mit der Bedeutung, daß es die im konkreten Inhalte als in seiner Wirklichkeit bewährte Allgemeinheit ist. Die Wissenschaft ist auf diese Weise in ihren Anfang zurückgegangen, und das Logische so ihr Resultat als das Geistige". Die §§ 575577, die in der ersten Auflage vorkommen und in die dritte wieder aufgenommen worden sind, präzisieren den zirkulären Charakter des Systems und das Zusammenfallen des Anfangs und des Resultats in ihm. Wenn Hegel die These über den provisorischen und hypothetischen Charakter des Anfangs und seiner Rechtfertigung durch die Fortsetzung ablehnt, dann ist ihm in dem Sinne zuzustimmen, daß dies ausgehend von seinen Prämissen konsequent ist. Der Anfang muß bei Hegel ebenso durch sich selbst gerechtfertigt werden, wie durch das, was nach ihm kommt. Daß Hegel seiner Philosophie eine Form des Kreises gibt, weiß selbstverständlich jeder, der sich sei es auch oberflächlich mit ihr beschäftigt hat. Viel schwieriger ist es aber die genauen Gründe dieser Kreisförmigkeit und ihre Implikationen zu verstehen insbesondere, wie es möglich ist, in diesen Kreis einzutreten. Wie schon gesagt, hat Hegel nur sehr mangelhaft die Problemlage offengelegt, die er mit seiner Auffassung der Seinsfrage bewältigen wollte. Genau das ist aber die Sache dieses Aufsatzes: Die Erörterung der Frage nach dem Anfang ist hier nicht Selbstzweck, sondern nur eine Zwischenstufe, die die Dechiffrierung des Anfangs der Hegelschen Logik vom Standpunkt seiner philosophisch wichtigsten Dimension d. h. Hegels Verständnisses der Seinsfrage zum Zweck hat. Wir hoffen, daß die vorhergehenden Überlegungen über die Phänomenologie und Philosophie des Geistes plausibel machen, daß hinter dem Problem "womit anzufangen" eine unausgewiesene Entscheidung sichtbar gemacht werden kann, die Philosophie als Wissenschaft des Absoluten aufzufassen ein Terminus der als genitivus obiectivus und subiectivus zu verstehen ist. Das Hauptanliegen Hegels besteht in der Bestimmung des einzig möglichen verbindlichen Weges, auf dem diese Seinsauffassung sich konsequent durchführen läßt, in der Bestimmung dessen, wie die Philosophie innerlich gestaltet werden muß, um den Anforderungen einer Philosophie des absoluten Anfangs vollständig zu genügen. Die Entscheidung für diesen Standpunkt ist aber bei Hegel ohne angemessene Begründung geblieben: Es ist nämlich zu fragen, ob das "Wofür" dieser Entscheidung nicht in einem kaum überwindbaren Widerspruch mit seiner Begründung steht soweit wenigstens, daß die Begründung einen Blick von außen auf das zu werfen droht, was das allumfassende Eine sein möchte. Diesen, wie viele andere Einwände gegen seine Konzeption der Logik, versucht Hegel gerade dadurch zu entkräften, daß er das ganze Denken in den Kreis des Absoluten einschließt: "Bei dem Sein, dem Anfange ihres [der logischen Wissenschaft M.P.] Inhalts erscheint ihr Begriff als ein demselben äußerliches Wissen in subjektiver Reflexion. In der Idee des absoluten Erkennens aber ist er zu ihrem eigenen Inhalte geworden. Sie ist selbst der reine Begriff, der sich zum Gegenstande hat, und der, indem er sich als Gegenstand die Totalität seiner Bestimmungen durchläuft, sich zum Ganzen seiner Realität, zum System der Wissenschaft ausbildet und damit schließt, dies Begreifen seiner selbst zu erfassen."8 Über die Logik darf man also nicht nachdenken: zulässig ist nur das Denken in ihrem Rahmen, ohne Alternativen. -
-
-
-
-
-
-
8
WdL II (Anm.
114
6), 504f.
Seinsfrage und Anfang Die Forderung absolut anzufangen, die auch bei anderen Denkern aus der Bemühung um "strenge Wissenschaft" (Husserl) ihre Plausibilität schöpft, impliziert bei Hegel mehr, als daß das Absolute selbst den einzigen Gegenstand dieser Wissenschaft ausmache. Wenn wir im Kapitel über die absolute Idee lesen, daß "mit dem Absoluten aller Anfang gemacht werden müsse, so wie aller Fortgang nur die Darstellung desselben ist",9 ist dieses "mit dem Absoluten" ebenso im subjektiven Sinne zu nehmen: Auch die Position, von der aus die Sache der Logik behandelt wird, ist die des Absoluten selbst. Die Grundschwierigkeit des Anfangs besteht also in dem, daß Hegel von sich und vom Leser verlangt, daß in seinem Denken und Sprechen das Absolute selbst denke und rede. Unanfänglich an Hegels absoluten Anfang ist, daß ihm die Entscheidung für diese Anfangsauffassung vorhergeht, trotz Hegels Anstrengung jene im Kreis der absoluten Idee anzusiedeln. Die Bemühung, das Verlassen dieses Kreises unmöglich zu machen, hat die unerwünschte Folge, daß sich in den letzteren auch nicht eintreten läßt. Bevor wir uns zur Stützung und Entfaltung der oben formulierten Thesen dem berühmten und oft interpretierten Text über das Sein im ersten Kapitel der Logik zuwenden, möchten wir einige Bemerkungen über seine Interpretation, die eine immanente sein will, voraus-
schicken.
Immanent im einfachsten Sinne ist die
Deutung, die untersucht,
ob und wie es möglich selbstverständlich etwas anderes bedeutet, als eine Rechtfertigung seiner Position. Offensichtlich unter dem Einfluß von Hegels "Anmerkungen" im ersten Kapitel, wo er stark an der Bewahrung der Reinheit des Anfangs, an der Fernhaltung von allem, was nicht zu ihm gehört, insistiert, wird in der Hegelforschung der Anfang oft im Sinne der Frage diskutiert, ob der Anfang, das Sein als das unbestimmte Unmittelbare, mit dieser "Definition" korrespondieren und auch die Fortbewegung in der Logik eröffnen kann.10 In den Spuren von Trendelenburg, den man öfter als Schelling zur ersten Referenz macht,11 konzentrieren sich dabei Kritik wie Verteidigung von Hegel auf die Frage, wie es möglich sei, aus dem Anfang die Reflexion auszuschließen und ihm die von Hegel verlangte Unmittelbarkeit einzuräumen. Vor allem Henrich verdanken wir die Untersuchung von unterschiedlichen Varianten dieser Argumentation. Die Immanenz einer solchen Zugangsweise läßt sich sicherlich nicht bezweifeln schon deswegen, weil Hegel selbst den Ausschluß der Reflexion aus dem Anfang in den Vordergrund gestellt hat. Es bleibt aber die Frage, ob durch Annahme dieser Perspektive auf den Anfang der Interpret oder Kritiker nicht zu spät ins Spiel einsteigt, nur dann, wenn die wichtigsten philosophischen Entscheidungen schon getroffen worden sind, so daß kaum eine andere Möglichkeit bleibt als: entweder Hegels Gefangener zu sein und die eventuelle Distanzierung von dem Denker auf die Bemühung zu begrenzen, die Aufgabe, die er sich gestellt hat, besser zu erfüllen; oder aber zuzulassen, daß der Anfang die Reflexion notwendigerweise beinhaltet und bloß auf diesem Wege sich aus der Gefangenschaft zu befreien. Gibt es aber nicht eine noch radikalere Möglichkeit zu zeigen, daß die Hegeische Seinsbestimmung sich
ist, Hegels Gedankengang nachzuvollziehen,
was
-
9 Ebd., 490. 10 Vgl. H.G Gadamer, Hegels Dialektik, Tübingen 1980, 74. 11 Über die ältere Reaktion auf Hegels Theorie des Anfangs berichtet kritisch D. Henrich im Aufsatz "Anfang und Methode der Logik", in Hegel im Kontext, Frankfurt a.M. 1971 ; eine kurze Übersicht der gegenwärtigen Diskussion bietet der Aufsatz von A. Arndt in diesem Band.
115
Milan Prucha
zwar
nachvollziehen, doch aber nicht rechtfertigen läßt? Und entstehen nicht die Rechtferti-
gungsschwierigkeiten gerade dadurch, daß man zum Zentralpunkt der Diskussion die Refle-
xion macht, und in der Überzeugung, daß man nicht anders verfahren kann, das ursprünglichere Niveau überspringt, auf dem Hegel dem Seinsbegriff tatsächlich einen spezifischen Sinn gegeben hat? Bedenklich an der Hypostase der Reflexion bei der Behandlung des Anfangs ist auch, daß die Reflexion, deren Bedeutung in Hegels Logik sonst kaum zu überschätzen ist, doch nicht das letzte Wort der letzteren bedeutet. Deswegen ist sicherlich auch die Interpretation des Anfangs berechtigt und immanent, die in den Vordergrund stellt, daß er nicht angemessen verstanden werden kann ohne Berücksichtigung des Resultats der Logik, des Kreises, der sich in der Verbindung des Anfangs mit dem Ende schließt weswegen dann bei der Behandlung des Anfangs dem Kapitel "Die absolute Idee" Vorrang eingeräumt wird. Obwohl diese Zugangsweise im Vergleich mit der Orientierung an der bloßen Reflexion wichtige Vorteile mit sich bringt, sichert auch sie die Immanenz der Anfangsbehandlung nicht vollständig. Noch intensiver denken wir macht es die Interpretation und Kritik des Anfangs der Logik als einer Philosophie des Anfangs in ihrer für Hegel spezifischen Variante. Es geht also darum, den Schlüssel zum Anfang der "Logik" in Hegels Auffassung der Seinsfrage zu suchen, durch die Analyse des Dispositives des ersten Kapitels zu belegen, daß die Frage "womit anzufangen" nicht ursprünglich, sondern abgeleitet ist, untergeordnet der Frage, ob überhaupt die Philosophie als Suche nach dem Anfang aller Dinge verstanden werden darf. Das Resultat dieses Aufsatzes zum Teil vorwegnehmend behaupten wir: Als Philosophie des absoluten Anfangs ist Hegels Philosophie Philosophie des Einen. Hegel lehnt also die Auffassung ab, die das Sein als Sein von unterschiedlichen Seienden versteht, denen gemeinsame Seinsprinzipien eigen sind. Er macht es auf zweifache Weise, in zwei Schritten, von denen der eine in der Phänomenologie, der andere in der Logik stattfindet, beide im Dienste eines Zieles, das die Einheit beider Schriften erklärt. In der Phänomenologie geht es um die "Überwindung des Gegenstandes des Bewußtseins", d. h. um die Aufhebung der Dinge als vom Subjekt unabhängiger Objekte durch ihre Eingliederung ins Subjekt, das dann nur Beziehung zu sich selbst bedeutet. Ähnlich ist es auch in der Logik: Das "Sein" oder das Absolute ist in den logischen Bestimmungen nur mit sich selbst identisch. Die Logik verhilft dazu, die Dinge als unselbständig darzustellen, als bloße Momente des Einen: Die Wahrheit ihrer Realität besteht in ihrer Idealität, meint Hegel. Die Gedankenbestimmungen selbst, die Kategorien, die nach der Aufhebung des Gegenstandes des Bewußtseins ebenso als Prinzipien des Seins der Dinge angesehen werden dürfen, sind in der Logik dementsprechend konzipiert: nicht als Prinzipien, wie sich die Dinge selbst bejahen, sondern als Prinzipien ihrer Selbstaufhebung, ihrer Integration in das Eine. Schon dies kündigt vieles darüber an, wie schwierig es ist, die Hegelsche Dialektik vom Idealismus zu trennen und Hegel wenn nicht "materialistisch", dann realistisch zu lesen. Hegel wendet alle Kategorien gegen die Selbständigkeit der Dinge. Der Gebrauch der Kategorien in ihrer Hegelschen Deutung kann das eigene Sein der Dinge nur problematisieren, nicht aber sie in ihrem Sein hervortreten lassen. Erst die Interpretation der Dialektik in Übereinstimmung mit der Auffassung des Seins als das Sein des Seienden, als eines Ensembles von Prinzipien, die allen Seienden gemeinsam sind, kann der -
-
-
-
116
Seinsfrage
und
Anfang
Dialektik affirmativen Charakter geben im Gegensatz zur Hegelschen, die wegen ihrer Aufhebung der Dinge als eine negative angesehen werden muß. Die Anmerkungen über die Immanenz der Betrachtung der Anfangskonzeption in Hegels Logik führen zum folgenden Resultat: Als Kriterium der Immanenz ist nicht bloß das zu nehmen, was im Rahmen der Logik möglich oder zulässig ist, und was nicht. Notwendige Komponente einer immanenten Interpretation bedeutet sicherlich die Behandlung des Anfangs in den Zusammenhängen der Reflexion, oder auch des Ausgangs der Logik und des ganzen Systems. Die Immanenz läßt sich aber darauf nicht reduzieren. Immanent, und sogar in einem noch höheren Sinne, ist auch die Betrachtung, die auf dieser Grundlage zu zeigen versucht, welches Problem Hegel lösen wollte, als er die Logik und in ihrem Rahmen die Auffassung des Seins als absoluter Anfang konzipiert hat und dies Hegels Bemühung zum Trotz, das Problemfeld, an dem sich seine Philosophie konstituiert hat, durch die Integration -
-
in die letztere auszuschalten.12 Diese Konzeption aber verändert die gewöhnliche Perspektive auf den Anfang. Es gilt falls sie richtig ist nicht mehr die These: "Die Logik des reinen Seins läßt sich überhaupt nur via negationis explizieren, in der Unterscheidung von der Logik der Reflexion",13 und auch die Erklärung des Anfangs durch das Resultat kann nicht per se als zufriedenstellend angesehen werden, sondern durch das, wozu sie gewöhnlicherweise auch führt, d. h. durch die Kritik des Hegelschen Systems. Dabei geht es aber auch um die Identifizierung des Problems, mit dem Hegel rang, und um die Bereitschaft, es wieder aufzunehmen. Falls es gilt, daß bei Hegel die Frage, womit die Wissenschaft anzufangen sei, das Problem der Auffassung der Seinsfrage verdeckt und daß die Zweideutigkeit der Auffassung der letzteren, mit der die Metaphysik nicht fertig werden konnte, die erstrangige Bedeutung im Streit über die Möglichkeit der Metaphysik hat, muß sich auch die Interpretation des Anfangs der Logik in dieser Richtung orientieren. Der Abbau der Verbote, mit denen Hegel den Anfang der Logik gegen das kritische Nachdenken immunisieren wollte, ermöglicht erst, daß man den Anfang als philosophisches Problem frei anspreche. Anstelle des eingeweihten Schweigens, einer schuldigen Extraktion des im Anfang verborgenen Sinnes, anstelle der Interpretation des Anfangs mit Hilfe des Negierens der Begriffe, die angeblich aus dem Anfang abgeleitet worden sind, oder des Stilisierens des Resultats in die Form des Anfangs wird jetzt der letztere als ein Versuch um die Durchführung der Konzeption gedeutet, die ihm vorhergeht und die entscheidet, welche Anforderungen der Anfang bei Hegel zu erfüllen hat. Sein Text zeigt übrigens, daß er selbst ähnlich verfahren ist: Dem Kapitel über das Sein hat er nämlich den Abschnitt "Womit muß der Anfang der Wissenschaft gemacht werden?" vorausgeschickt, in dem die Postulate enthalten sind, die der Seinsbegriff zu beachten hat. Deswegen behaupten wir: Eine angemessene Zugangsweise zum Seinskapitel ist in der ersten Reihe die, die dieses als einen Versuch liest, das Sein im Sinne von Hegels Auffassung der Philosophie und der Grundfrage der letzteren
-
-
zu
konzipieren.
Wie schon gesagt: Obwohl Hegel den Anschein erweckt, daß er den Anfang sucht und ihn im Sein findet, konzipiert er in der Tat das Sein als den absoluten Anfang. Darin besteht sei12 Vgl. K. Schrader-Klebert, Das Problem des Anfangs in Hegels 13 D. Henrich, "Anfang und Methode der Logik" (Anm. 11), 80.
Philosophie, Wien u. München, 1969, 9.
117
Milan Prucha
Orientierung im Labyrinth der metaphysischen Seinsfrage. Der Anfang muß dann das Unbestimmte sein, das, was kein anderes hat und auch selbst keine Bestimmungen: Sonst wäre es nicht der Anfang und Anfang von Allem. Dieser Anfang ist bei Hegel bekanntlich das Sein. Absolut ist er, wenn ihm, der unbestimmt, ohne Anderes und bestimmungslos ist, auch das Nichts nicht bloß als Anderes gegenübersteht, sondern wenn das Sein und Nichts Dasselbe und Unterschied bedeuten. Wie ist dies aber möglich? Nur so, daß die Imperative des absoluten Anfangs die Auffassung des Nichts so prägen, wie schon die des Seins. Das ne
Sein ist dasselbe wie Nichts und von ihm ebenso sehr unterschieden, bedeutet dann: Die einzige Quelle des Unterschieds oder besser der Unterschied selbst ist das Sein; der Unterschied ist nur der Unterschied des Seins von sich selbst, damit auch kein Unterschied. Auch wenn man Hegel folgend zulassen möchte, daß auf diesem "vorreflexiven" Niveau über den Widerspruch von Sein und Nichts noch nicht gesprochen werden darf, muß man sich fragen, inwieweit die hochgeschätzte Widerspruchstheorie bei Hegel ein Produkt seiner Seinsauffassung, seiner Philosophie des allumfassenden Einen ist, deswegen aber auch mit Hegels Idealismus tief verbunden ist. Um die absolute Anfänglichkeit des Seins zum Ausdruck zu bringen, untersagt sich Hegel zuerst sogar die gewöhnliche Satzform und meidet die Prädikation: "Sein, reines Sein ohne alle weitere Bestimmung." Offensichtlich versucht er seinen Anfang vor der Dialektik zu schützen, die im Parmenides gegen die These "Eins ist" Piaton mobilisiert hat. In der Bemühung um den absoluten Anfang respektiert auch Hegel die Mahnung des Parmenidischen Lehrgesichtes nicht: "Denn dazu werden sich Dinge gewiß niemals zwingen lassen: zu sein, wenn sie nicht sind. Du aber halte den Gedanken von diesem Weg des Suchens fern".14 Hegels Einführung des Nichts in das Sein dient aber ausschließlich der Philosophie des Einen, während Piatons "Ungehorsam" auch den Weg von der Philosophie des Einen zur Philosophie des Seins des Seienden im allgemeinen eröffnet. Es ist vielleicht befremdlich, daß wir bei der Darstellung des Hegelschen Seinsbegriffes bisher bloß die Unbestimmtheit ins Spiel gebracht haben, nicht aber die Unmittelbarkeit. Der Grund dafür besteht aber nicht darin, das wir einen Aspekt des Seins und auch des Nichts vermeiden wollten, der bei Hegel zwar im Vordergrund steht, der aber zum Streitpunkt in den Auseinandersetzungen um die Nachvollziehbarkeit von Hegels Auffassung des Anfangs der Logik geworden ist Sein als das unbestimmte Unmittelbare. Uns hat nicht die Bemühung, die Reflexion aus dem Anfang auszutreiben, den letzteren zu "reinigen", geführt, sondern die Überzeugung, daß erst die Aufdeckung dessen, was die Unbestimmtheit bedeutet, auch die Bedeutung des Seins als des Unmittelbaren wie des Nichts als Unmittelbarkeit verständlich machen kann. Nur scheinbar läßt sich nämlich die Unbestimmtheit auf Bestimmungslosigkeit reduzieren. Unbestimmt kann auch etwas sein, weil es schlechthin bestimmend ist, oder wenigstens wie es beim Sein der Fall kein Anderes hat, dasselbe wie Nichts und von ihm unterschieden ist. Genau das entscheidet über den Charakter des Seins als Unmittelbares. Es ist die erwähnte Zuordnung der Unmittelbarkeit zu Reflexionslogischem die zur These führt, daß sich das Sein nur via negationis aus der Reflexion erklären läßt. Nun bedeutet aber bei Hegel die Bestimmtheit (die seiende Bestimmtheit) Qualität, weswegen man vielleicht auch sagen müßte, -
-
-
14 Parmenides, Vom Wesen des Seienden,
118
-
hg. v.
U. Hölscher, Frankfurt a.M., Fr. 7.1-3.
Seinsfrage
und
Anfang
daß via negationis nicht nur im Bezug zur Reflexion, sondern schon in Hinsicht dieses späte-
Begriffes der Seinslogik zu betreten ist. Auch das aber reicht nicht aus. Oben ist die These Hegels zitiert worden, daß alle Begriffe der Logik Beispiele für die Untrennbarkeit von Unmittelbarkeit und Vermittlung bieten und daß es überhaupt nichts gibt, was nicht ebenso unmittelbar wie vermittelt wäre. Was bedeutet dies für das Sein in der Logik? Das Sein versteht Hegel als den ersten Begriff für das Absolute: Das Absolute ist Sein. Ebenso oder desto mehr ist zu sagen: Das Absolute ist Wesen, das Absolute ist Begriff. Gilt dann nicht das Absolute als ein Begriff, der das Sein, Wesen und Begriff erfaßt? Das Sein, das Hegel als das Absolute nimmt, nimmt er auch als das Unmittelbare. Das zeigt aber, daß nicht bloß das Absolute, sondern ebenso das Unmittelbare eine allgemeine Bedeutung hat, so daß es sich nicht ausschließlich der Reflexionslogik zuordnen läßt. Wenn das zutrifft, gewinnt der Ausdruck "das unbestimmte Unmittelbare" statt der negiert-reflexionslogischen eine genuin seinslogische Bedeutung. Die Unbestimmtheit ist dann für das Unmittelbare auf diesem Niveau konstitutiv. Sie ist auch positiv zu verstehen: daß das Sein nicht nur als bestimmungsloses ist zwar noch nicht schlechthin bestimmend, aber unbestimmt auch, weil dasselbe wie Nichts und von Nichts unterschieden, weswegen das Sein auch Anspruch, als das Absolute und Unmittelbare zu gelten, erheben kann. Die Unbestimmtheit, die Hegel dem Sein zuschreibt, hat eine "metaphysische" Bedeutung und darf nicht im Sinne der bekannten logischen These über die umgekehrte Proportionalität des Inhalts und des Umfangs der Begriffe verstanden werden. Das Sein und das Nichts sind also nicht deswegen dasselbe, weil der Umfang des Seinsbegriffes ¥ und sein Inhalt = 0. Eine Approximation zu Hegels Seinsbegriff bietet eher die christliche Theologie, auf die sich in der Logik Hegel selbst beruft mit einem nicht besonders bescheidenen Anspruch, daß ihre Begriffe Gedanken Gottes vor der Erschaffung der Welt bedeuten, die Theologie, die den Glauben an einen Gott mit seiner philosophischen Bestimmung als actus purus verbindet. Das Sein am Anfang ist aber noch nicht bestimmungslos weil bestimmend, sondern wegen der Unmöglichkeit das Sein und das Nichts als Entgegengesetzte gegeneinander auszuspielen, was positiv gesagt ihr Auftreten in einer beweglichen Einheit bedeutet, als Werden. Das Werden (auf dieser Hegelschen These insistiert insbesondere Gadamer) "ist als die erste konkrete zugleich die erste wahrhafte Gedankenbestimmung".15 Das Werden als Ausgang des Anfangs der Logik ermöglicht zu verstehen, welche Konsequenzen für alle weiteren Begriffe die Auffassung der Grundfrage der Philosophie als Frage nach dem Anfang hat, wie sie Hegel im Rahmen der Metaphysik, im Bezug zu anderen Philosophien des Anfangs oder aber im Bezug zur Auffassung des Seins als des Seins des Seienden im allgemeinen situiert. Dazu ist aber nötig, das Werden strikt im Sinne Hegels zu nehmen, in dem es mit der entscheidenden metaphysischen Problematik mit der gleichen Intensität durchdrungen ist wie z. B. Aristoteles' Bewegungslehre. Dies ist zu betonen, weil man Hegels Auffassung des Werdens öfters durch eine Überführung auf Heraklits "alles fließt" vulgarisiert oder des eigentümlichen philosophischen Inhalts beraubt hat durch die Anpassung an die Bedeutungen, die die Bewegung und die Veränderung in der Naturwissenschaften erhalten haben. ren
-
=
-
15 Enz.
-
§ 88, Zusatz.
119
Milan Prucha
Was bei Piaton und Aristoteles nur eine der beiden Tendenzen in ihrer zweideutigen Auffassung der Seinsfrage bedeutet, wird bei Hegel in der Seinslogik und insbesondere in ihrem Teil, der zum Fürsichsein führt als die legitime dargestellt. Hegel konzipiert also die Philosophie des Anfangs dermaßen konsequent, daß er die erwähnte Zweideutigkeit der Metaphysik durch die Eliminierung des konkurrierenden Standpunktes überwindet. In seiner Anknüpfung an die Vorsokratiker stützt er sich aber auch auf den grundlegenden Beitrag von Piaton und Aristoteles zur Philosophie des Anfangs, d. h. auf ihre Umgestaltung der Philosophie der Univozität des Seins in eine Theorie, die den Anfang und die Pluralität der Bedeutungen des Seins vereinbar zu machen versucht. Wie schon angedeutet und wie noch ausführlicher gezeigt wird, bekommen die Begriffe für unterschiedliche Seinsbedeutungen, die Kategorien, bei Hegel eine Interpretation, die der aristotelischen entgegengesetzt ist: Es sind nicht mehr Begriffe dafür, wie das Seiende das Sein erreicht, wie es ist oder sich das Sein gibt, sondern wie es sich selbst durch die Verwandlung ins Moment des allumfassenden Einen negiert. Auch dieser Charakter von Hegels Seinsauffassung zeigt sich deutlich genug schon in der Deduktion der Kategorien, die die logische Bewegung vom Werden zu Fürsichsein darstellen möchte. Die Ableitung von Dasein, Qualität (ihre Vorordnung vor der Quantität, die Hegel als Unterschied von Kant hervorhebt, gehört zur Domestifizierang der Differenz im Rahmen des allumfassenden Einen) und Etwas aus dem Werden bedeutet den Weg ihrer Disqualifizierung als positive kategoriale Bestimmungen des Seienden. Dasein steht dann für eine Einheit von Sein und Nichts, die einseitig in der Form des Seins auftritt und deswegen selbst die Behauptung des Moments des Unterschiedes, der Negation einleitet. "Omnis determinatio est negado" lautet die Devise der Philosophie des Einen, die sich naiv auch die dialektischen Materialisten zueigen machen, stolz darauf, was sie für ihre Dialektik bei Spinoza und Hegel gelernt haben. Sie vergessen dabei, was Marx als große Tat Feuerbachs angesehen hat: Der letztere hat "der Negation der Negation, die das absolut Positive zu sein behauptet, das auf sich selbst ruhende und positiv auf sich selbst begründete Positive entgegenstellt."16 Die Bestimmtheit von Etwas kommt bei Hegel hauptsächlich als seine Begrenzung vor, sie gibt ihm einen provisorischen Charakter, Charakter einer Halbwahrheit, die nur die weiteren Schritte der Logik auf ein richtiges Maß bringen werden. Statt die Bestimmtheit hauptsächlich positiv zu nehmen, als konstitutiv für das Sein des Seienden, ordnet sie die Logik seiner "Aufhebung" unter: "Etwas ist durch seine Qualität erstens endlich und zweitens veränderlich, so daß die Endlichkeit und Veränderlichkeit seinem Sein angehört."17 Die "dialektische" Untergrabung der Positivität von Etwas, äußert sich darin, daß sein "Was" nicht als seine tragende Seinsbestimmung gilt, sondern der Negation unterordnet wird: "Etwas ist nur in seiner Grenze und durch seine Grenze das, was es ist."18 Weil Etwas selbst in das Andere übergeht und selbst ein Anderes ist, geht es in seinem Übergehen in Anderes nur mit sich selbst zusammen. Gerade dadurch eröffnet sich nach Hegel der Weg zur wahren Unendlichkeit in ihrem Unterschied zur bloß schlechten, bloß repetitiven. Fürsichsein, in dem die Dialektik des aus dem Werden abgeleiteten Daseins und 16 K. Marx, Ökonomisch-philosophische 17 Enz. § 2. 18 Ebd. § 98 Zusatz.
120
Manuskripte (1844), in MEW, Ergänzungsband 1,
Berlin 1968, 570.
Seinsfrage
und
Anfang
Etwas ihren Ausgang findet, bedeutet die erste Gestalt von Hegels Leitprinzip: das unendliche Sein, das in den sich selbst aufhebenden Dingen nur mit sich selbst begegnet. Hegel verbirgt keineswegs die weitreichenden philosophischen Konsequenzen, zu denen die Philosophie des Anfangs vermittelst einer ihr entsprechenden dialektischen Interpretation der Kategorien im Übergang zum Fürsichsein führt: "Der Satz, daß das Endliche ideell ist, macht den Idealismus aus. Der Idealismus der Philosophie besteht in nichts anderem als darin, das Endliche nicht als wahrhaft Seiendes anzuerkennen."19 Daß dem "Endlichen" kein wahres Sein zuzuerkennen ist, scheint zuerst plausibel vielleicht sogar zu plausibel. Fragt man nämlich, was das Endliche sei, erfährt man, daß es alle erfahrbaren Dinge seien, die angeblich nicht auf sich selbst ruhend, sondern von Anderem "gesetzt" und in Anderes übergehend, d. i. "ideell" sind. Für die Klärung der Seinsfrage wäre es günstiger, wenn Hegel statt der Suggerierung seines Standpunktes durch die Rede über das Endliche, ganz direkt gesagt hätte: Idealismus ist eine Philosophie, die die Seinsfrage so versteht, daß den bestimmten Seienden die Fähigkeit durch sich selbst zu sein abgesprochen werden muß. Das wahre Sein haben sie nur als Momente des Absoluten, das "nur das Eine konkrete Ganze ist, von dem die Momente untrennbar sind."20 Die letztere Bemerkung ist deswegen nicht überflüssig, weil sie trotz allem Anschein, nicht bloß Hegels Polemik gegen den Realismus betrifft, sondern auch das, was in unserer Zeit zu einer Zuordnung Hegels auf die gleiche Seite der Barrikade wie der Realismus geführt hat, zu einer gleichzeitig gegen Hegel wie gegen den Realismus sich richtenden Kritik, die im Sinne einer anderen Philosophie des Anfangs, die genauer Ursprungsphilosophie, heißen müßte, formuliert worden ist. Konnte Hegel ahnen, daß er in einem Jahrhundert der gleichen Rubrik zugeordnet wird, wie sein realistischer Erzfeind? "Die Unterjochung der aXfjÖEia ist das Vorragen des Erscheinens und Sichzeigens der iSécc [...] Der Vorrang der ISáa [...] bringt mit dem ei'5oç das tí éotiv in die Stellung des maßgebenden Seins. Das Sein ist erstlich das Was-sein [...] Der Vorrang des Was-seins erbringt den Vorrangs des Seienden selbst je in dem, was es ist. Der Vorrang des Seienden legt das Sein als das koivóv aus dem Èv fest. Der auszeichnende Charakter der Metaphysik ist entschieden. Das Eine als die einigende Einheit wird maßgebend für die nachkommende Bestimmung des Seins."21 Hegels Philosophie mag sich als Philosophie des allumfassenden Einen vom Realismus unterscheiden, doch kommt sie mit ihm entsprechend Heidegger soweit überein, daß sie das Seiende als konkrete Totalität des Seienden für eine unverzichtbare Seite des Absoluten hält. Für Heidegger bedeutet dies die Vollendung der Grundtendenz der Metaphysik das Sein aus dem Seienden, statt das Sein selbst, ja das Sein ohne Seiendes zu denken. Für Hegel, umgekehrt, bleibt das "Sein" oder das Absolute ohne Seiendes ein leeres Wort. Mit Recht sieht G. Deleuze diesen Streit auch als einen Streit um die Kategorien. Obwohl im Sinne der Philosophie des Einen umgedeutet, lassen sich bei Hegel die Kategorien, die als Begriffe für das Sein des Seienden im allgemeinen entstanden sind, von dieser Bedeutung nicht völlig "reinigen". Deleuzes "anti-hégélianisme généralisé" bedeutet deswegen auch eine Attacke gegen die Kategorien, soweit sie als Seinsbedeutungen durch ihre Pluralität die -
19 WdL I (Anm.
4), 145.
20 Ebd., 146. 21 M. Heidegger, Nietzsche II,
Pfullingen 1961, 458. 121
Milan Prucha
Möglichkeit bieten, das Seiende als Seiendes anzusprechen: "Es gab immer nur einen ontologischen Satz: das Sein ist univok. Es gab immer nur eine Ontologie, die des Duns Scotus, die dem Sein eine einzige Stimme verleiht. Wir nennen Duns Scotus, weil er das univoke
Sein zu höchster Subtilität zu erheben wußte, sei es auch um den Preis der Abstraktheit. Doch von Parmenides bis Heidegger wird immer dieselbe Stimme aufgenommen, in einem Widerhall, der schon für sich allein die ganze Entfaltung des Univoken darstellt. Eine einzige Stimme erzeugt das Gebrüll des Seins."22 Heidegger kommt das Verdienst zu, daß er noch tiefer als durch die Entgegensetzung des Idealismus und des Realismus auf das Problem hingewiesen hat, das Hegels Konzeption des Seins-Anfangs beinhaltet auch wenn sich die Lösung des Problems vielleicht näher zu der Position Hegels als der von Heidegger situieren sollte. Es ist Heidegger zuzustimmen, wenn er den Kern der Metaphysik in ihrer Verbindung des Seins mit dem Seiendem sucht. Bejaht aber nicht die Metaphysik auf diese Weise genau das, wodurch sich die philosophische Form des Geistes von der mythischen und religiösen unterscheidet? Und bietet nicht die Verbindung des Seins und des Seienden, auch das Kriterium der Beurteilung von den beiden Tendenzen der Metaphysik, die Möglichkeit einer angemessenen Überwindung ihrer Zweideutigkeit? Vielleicht wird sich auf dieser Grundlage zeigen, daß die Philosophie des Anfangs als solche ein Überleben des religiösen Motivs auf dem Boden der Philosophie darstellt, so daß die Bejahung dessen, was die Philosophie zur Philosophie macht, eher von der Auffassung des Seins als der des Seins des Seienden im allgemeinen zu erwarten ist! Im Rahmen des Aufsatzes können wir diesen Problemen nicht den Platz geben, den sie verdienen. Wir werden ihn deswegen bloß durch einige Hinweise darüber abschließen, wie sie die Neuzeit gestellt hat und wo nach unserem Dafürhalten ihre Lösung zu suchen ist. Die Philosophie des Anfangs ist für die Neuzeit vornämlich durch Kants Auffassung der Frage nach der Möglichkeit der Metaphysik reaktualisiert worden, durch seine "Kopernikanische Wende". Er hat der bisherigen Metaphysik vorgeworfen, daß sie in ihrem Anspruch auf allgemeine und notwendige Aussagen die Erfahrung überschritten habe und wollte diesen Mangel der Metaphysik so beheben, daß er das menschliche Subjekt zu ihrem Ausgangspunkt machte, das Subjekt, dessen Aussagen notwendig und allgemein gelten, soweit seine Spontanität reicht, soweit das Subjekt in den Dingen nur das findet, was es selbst in die Dinge gelegt hat. Wenn Heidegger in den zwanziger Jahren seine fundamentalontologische Kantinterpretation entworfen hat und versuchte, das ganze begriffliche Dispositiv von Kant als Auftreten des Seins selbst darzustellen, wußte er dafür in Kants Philosophie günstige Ansatzpunkte zu finden. Trotzdem verliert Heideggers Interpretation den Anspruch auf Plausibilität, ja zeigt sich weitgehend als seine eigene Kreation, wenn sich das Kantverständnis nicht fast ausschließlich auf die Kritik der reinen Vernunft stützt, aber auch die zweite und insbesondere die dritte Kritik in Betracht zieht, um nachzuspüren, wohin sich Kants kritisches Denken bewegt hat. Schon in der Kritik der reinen Vernunft hat Kant seine Zweifel an der selbstverständlichen Anwendbarkeit der a priori konzipierten Gesetze der Natur auf die letztere, zum Ausdruck gebracht.23 In der Einleitung zur Kritik der Urteilskraft heißt es dann: "Denn es läßt sich -
22 G. Deleuze, Differenz und 23 Vgl. KrV B, 675 und 689.
122
Wiederholung, München 1992,
58.
Seinsfrage
und
Anfang
wohl denken, daß ungeachtet der Gleichförmigkeit der Naturdinge nach den allgemeinen Gesetzen, ohne welche die Form einer Erfahrungserkenntnis überhaupt nicht stattfinden würde, die spezifische Verschiedenheit der empirischen Gesetze der Natur so groß sein könnte, daß es für unseren Verstand unmöglich wäre in ihr eine faßliche Ordnung zu entdecken [...] und aus einem für uns so verworrenen (eigentlich nur unendlich mannigfaltigen, unserer Fassungskraft nicht angemessenem) Stoffe eine zusammenhängende Erfahrung zu machen."24 Anfangend mit der Theorie des Schönen, über die des Erhabenen und bis zu der Behandlung der Zweckmäßigkeit der Natur führt Kant eine einzige Rückzugsschlacht, deren vom Standpunkt der Transzendentalphilosophie, katastrophales Resultat ist, daß das a priori ohne den verbotenen Beistand des Aposteriorischen nicht funktionieren kann. Die Endlichkeit des menschlichen Erkennens, die Kant in seiner Rezeptivität gesucht hat, d. h. in der Gegebenheit seiner Inhalte, läßt sich mit der auf die bloße Form begrenzten Spontanität kaum so verbinden, wie es Kants Lösung der Frage nach der Möglichkeit der Metaphysik verlangt. Der deutsche Idealismus versuchte diese Schwierigkeit durch eine Radikalisierung der Spontanität zu überwinden, die auch die Setzung der Inhalte leisten sollte, d. h. die von Kants vorgeschlagene Lösung der Frage nach der Möglichkeit der Metaphysik durch die Ersetzung des Kantischen endlichen menschlichen Subjektes durch ein unendliches, absolutes zu bewältigen. Es ist nicht nötig, weiter zu schildern, wie in der Logik, in seiner Philosophie der Natur und des Geistes Hegel diese Strategie spezifisch angewandt hat. Heidegger und die entsprechende Stelle aus dem Kantbuch haben wir schon zitiert wollte die Frage nach der Möglichkeit der Metaphysik auf dem entgegengesetzten Wege lösen: Nicht mehr die Unendlichkeit und auch nicht Subjektivität, sondern die Endlichkeit des Menschen und seines Seinsverständisses sollen jetzt die Metaphysik tragen, was aber nach Heidegger nicht ausschließt, über das Sein, das in seinem späten Denken durch "Es", das Sein gibt, hinsichtlich der Ursprünglichkeit noch übertroffen wird, mehr sagen zu können, als daß es sich verbirgt und zwar auch wenn es sich dem Menschen entbirgt. Heidegger möchte sich insbesondere von der Armut des Hegelschen Seinsbegriffes absetzen: "Das 'Es gibt Sein' könnte sich um einiges deutlicher zeigen, sobald wir dem hier gemeinten Geben noch entschiedener nachdenken. Solches gelingt dadurch, daß wir auf den Reichtum der Wandlung dessen achten, was man unbestimmt genug das Sein nennt, was man zugleich in seinem Eigensten verkennt, solange man es für den leersten aller leeren Begriffe hält. Diese Vorstellung vom Sein als des schlechthin abstrakten wird im Prinzip auch noch nicht aufgegeben, sondern nur bestätigt, wenn das Sein als das schlechthin Abstrakte in das schlechthin Konkrete der Wirklichkeit des absoluten Geistes aufgehoben wird, was im gewaltigsten Denken der neuen Zeit, in Hegels spekulativer Dialektik sich vollgezogen hat und in seiner 'Wissenschaft der Logik' dargestellt wird."25 Die "Wandlungsfülle des Seins", die die Folge von epochalen Seinsvorstellungen (z. B. bei Platon i5éa, bei Aristoteles èvépyeia, bei Kant Position, bei Hegel absoluter Begriff, bei Nietzsche Wille zur Macht) zum Ausdruck -
-
bringt,
ist auf ein mit der Offenbarung vergleichbares "Geben" angewiesen, in dessen Vernehmen die eigentümliche Aufgabe des Denkens besteht. Eine seltsame Erlösung für die Philosophie: nahestehend der negativen Metaphysik oder negativen Theologie, d. h. einem Dis24 KU, XXXVI-XXXVII. 25 M. Heidegger, Zur Sache des Denkens,
Tübingen 1969,
6.
123
Milan Prucha
nur dadurch erreicht, daß er sich als Diskurs selbst negiert,26 artikuliert sie sich bei Heidegger als eine eigentümliche Mischung von neoplatonischen und christlichen Motiven der Ursprungsverehrung. Wollen wir die Hegeische Philosophie des Anfangs mit der Ursprungsphilosophie vergleichen, die sich in unserer Zeit als Alternative zu Hegel darstellt, kann uns am besten die Gegenüberstellung der Weisen behilflich sein, wie Hegel und Heidegger die metaphysische Frage nach dem Sein des Seienden transformiert haben. Heidegger hat es mit Hilfe der ihm heute zugeschriebenen Theorie der ontologischen Differenz27 erreicht. In seiner Auffassung der letzteren geht es nicht bloß darum, daß sich das Sein nicht als irgend welches privilegierob Wasser, Feuer oder Seiendes "Gott" auffassen läßt und auch nicht als tes Seiendes Wesen oder Substanz, die seiend sind. Das Sein darf überhaupt nicht aus dem Seienden abgeleitet oder erkannt werden. So bedeutet ontologische Differenz bei Heidegger die Getrenntheit des Seins vom Seienden, die so radikal ist, daß auch von einer Teilnahme des Seienden am Sein keineswegs gesprochen werden darf. Heidegger verabsolutiert also die ontologische Differenz (es ist übrigens fraglich, ob Heidegger für das von ihm Gemeinte einen passenden Terminus gewählt hat) und trennt das Sein vom Seienden durch die Unterdrückung dessen, was man "onto-logische Korrespondenz" nennen könnte. Für Hegel unterscheidet sich umgekehrt das "Sein" vom Seienden, die Logik von der Philosophie der Natur und des Geistes bloß durch ihre Abstraktheit, so daß das Logische in der Natur und im Geist direkt seine Realität findet. Man könnte deswegen sagen, daß Hegel die onto-logische Differenz verharmlost, d. h. die Absolutheit "verdinglicht" und das "Dinghafte" verabsolutiert. Darin besteht der wunde Punkt des spekulativen Idealismus und die Möglichkeit seiner "Widerlegung", auf die nach Feuerbach und Marx in unserer Zeit mit besonderer Schärfe Adorno und Lyotard hingewiesen haben, die Auschwitz als den extremsten Beweis der Verfehltheit einer Philosophieauffassung gedeutet haben, für die alles Vernünftige wirklich und alles Wirkliche vernünftig sein muß. Deckt aber die Alternative Hegel Heidegger das ganze Feld einer möglichen Anknüpfung an das Erbe der Metaphysik ab, reicht sie aus für die Bestimmung der möglichen Wege der Überwindung der Zweideutigkeit in der Auffassung der metaphysischen Frage nach dem Sein? Hegel wie Heidegger sind Vertreter der Philosophie des "Anfangs". Wie steht es aber mit der onto-logischen Differenz oder besser mit dem Sein des Seienden, wenn es weder um die bloße Getrenntheit des Seins vom Seienden, noch um das Sein des Seienden im ganzen, sondern Sein des Seienden im allgemeinen geht? Hervorzuheben sind dann insbesondere zwei Momente: Erstens wenn das Sein als das Sein des Seienden selbst, also "realistisch" verstanden wird, sind deswegen nicht auch die Seinsfrage und das Sein als solche auszuschließen etwa im Sinne eines solchen "Realismus", der die philosophische Behandlung der Dinge durch eine spezialwissenschaftliche ersetzt, sich auf das Studium ihrer konkreten Verfaßtheit begrenzt und auf jedwede "Metaphy-
kurs, der das Sein oder Gott
-
-
-
-
-
26 Vgl. P. Aubenque, Le problème de l'être chez Aristote (Anm. 2), 372. 27 Unter Berufung auf v. Weizsäckers These (Logos VI, 193): "Ontologie heißt Seinsartigkeit des Logischen, Transzendentalismus Logizität des Seins" schreibt schon 1921/1924 R. Kroner: "Während von Plato und Aristoteles das Logische auch als ein Ontisches, d. h. ontologisch gedacht wird, sieht Kant, daß das Ontische selbst immer ein Logisches, daß es ein Logisch-Ontisches ist" (R. Kroner, Von Kant bis Hegel, Tübingen
21961, 56).
124
sik" verzichtet. Das wäre eine indirekte Anerkennung, daß Hegel die Philosophie zum Abschluß gebracht hat: Sollte sie nicht in seinem Sinne möglich sein, wäre sie überhaupt nicht möglich. Zum zweiten ist zu betonen, daß sich das Sein nicht bloß induktiv, als eine Reihe von allgemeinsten Prinzipien, denen alle Dinge gehorchen, erfassen läßt etwa: alles ist veralles beinhaltet einen Das Sein des Seienden untersuchen bedeutet etc. änderlich, Widerspruch nicht bloß zu fragen, was allen Dingen gemeinsam ist, sondern, durch welche Verfaßtheit die Dinge aus sich selbst und in wahrem Sinne (wirklich und nicht bloß gebrochen oder scheinbar) sind. Die Erfassung des Seins der Dinge begrenzt sich nicht auf die Feststellung ihrer Prekarität, sondern besteht in der Suche nach den für unterschiedliche, für alle Dinge analog geltenden Prinzipien-Regeln, die soweit die Dinge ihnen durch ihre Verfaßtheit entsprechen Erhebung der Dinge über ihre Prekarität ermöglichen. In der an Hegel sich anlehnenden Sprache könnte man sagen: Der Endlichkeit der Dinge wird zwar nicht mehr das Absolute entgegengestellt, doch geht es um die Absolutheit, wie sie jedem der seienden Dinge eigen ist. Die Entgegnung auf Hegels und Heideggers Philosophie des Seins-Anfangs oder Ursprungs sehen wir also in der Auffassung des Seins als des Seins des Seienden im allgemeinen so, wie es eben angedeutet worden ist. Die Pluralität der Seinsprinzipien, die die Kategorien zum Ausdruck bringen, bietet die Möglichkeit, die Seienden in ihrer ganzen Vielfalt anzusprechen und hinsichtlich ihres Seins zu beurteilen. Weil die Menge der Kategorien eine offene ist, bleibt auch die Möglichkeit aus, die erste Seinsbedeutung festzulegen und ein völlig einheitliches System von Kategorien auszuarbeiten. Aus demselben Grunde ist es auch nicht möglich, die Kategorien auf einem rein deduktiven Wege abzuleiten: Die Peripetien der Kategorie der Freiheit in unserer Zeit zeigen am besten, daß auch die Erkenntnis des Seins sich auf die Erfahrung stützen muß, auf die Seinserfahrung, deren Möglichkeit sich im Namen des in den Spezialwissenschaften geltenden Erfahrungsbegriffes nicht verleugnen läßt. An der Stelle der Einheit der Seinsprinzipien, die in ihrer Deduzierbarkeit aus dem Ersten beruht, tritt die Einheit an, die immer unabgeschlossen in ihrer Bedeutungssimultaneität besteht, in den gegenseitigen Zusammenhängen und Übergängen der Kategorien als Seinsbedeutungen, die immer auf die entsprechende Erfahrung mit den Seienden angewiesen bleibt. Einer in diesem Sinne orientierten Seinsuntersuchung wird hoffentlich der Nachweis gelingen, daß die Lösung der Frage nach der Möglichkeit der Metaphysik in ihrer Umgestaltung zur Dialektik gefunden werden kann. -
-
-
-
Andreas Arndt
Die
anfangende Reflexion.
Anmerkungen zum Anfang der Wissenschaft der Logik
"anfangende Reflexion" bezeichnet diejenige Reflexion, die den Anfang der Hegelschen Wissenschaft der Logik macht, und zugleich auch diejenige Reflexion, mit welcher der Anfang gemacht wird. Es geht in diesem Beitrag um Anmerkungen zum Anfang der Hegelschen Wissenschaft der Logik, und zwar nicht so sehr zur internen Struktur dieses Anfangs, als
Die
vielmehr
zum Problem des Anfangens mit diesem Anfang. Das scheint ein überflüssiges Unterfangen zu sein, ist dieser Anfang doch nach Hegel ebenso voraussetzungs- und bestimmungslos wie einfach. Gerade dies bereitet jedoch, wie zu zeigen sein wird, scheinbar unüberwindliche Schwierigkeiten. Diese Schwierigkeiten hat Hegel sehr wohl gesehen und versucht, mögliche Bedenken und Einwände im Vorfeld der eigentlichen Darlegung des Anfangs zu entkräften. Der Fortgang der Diskussionen bis in die Gegenwart hat aber gezeigt, daß ihm damit weder bei den Zeitgenossen noch bei der Nachwelt Erfolg beschieden war. Damit ist jedoch noch nicht entschieden, daß der Anfang sich nicht rechtfertigen lasse. Wohl aber bedarf es offensichtlich, mehr als Hegel dies zugeben wollte, besonderer Anstrengungen, um ihn selbst dem philosophischen Bewußtsein zugänglich zu machen. Um einen solchen Versuch, dem Anfang der Logik eine Plausibilität für unsere Reflexion, d. h.: für die Einsicht in die Natur unseres Erkennens abzugewinnen, geht es mir im Folgenden. Ich bewege mich also zugegebenermaßen auf dem Niveau einer von Hegel so genannten äußerlichen Reflexion. Der Charakter meiner Überlegungen als Anmerkungen trägt dem Rechnung; gleichwohl hoffe ich, zeigen zu können, daß eine solche äußerliche Reflexion am Ende in den Beginn der Sache selbst einzudringen vermag, indem die den Anfang machende Reflexion als eine äußerliche mit derjenigen zusammenfällt, mit welcher der Anfang gemacht wird. Dies ist auf den ersten Blick eine ganz und gar unhegelsche Behauptung, denn nach Hegel soll der Anfang weder durch eine Reflexion herbeigeführt werden noch soll der Anfang selbst in irgendeiner Weise ein reflektierter sein. Statt in ihn hineinzuführen, ist uns dieser Anfang in seiner Voraussetzungslosigkeit und bestimmungslosen Unmittelbarkeit vielmehr gerade -
-
durch die Einfalle einer ihm gegenüber äußerlichen Reflexion verstellt. Diesen Einfällen ist aber, wie schon die Rezeptionsgeschichte zeigt, nicht allein dadurch zu begegnen, daß sie
Die
anfangende Reflexion
insgesamt als nicht zur Sache gehörig beiseitegesetzt werden und auch nicht allein dadurch, daß der Fortschritt der logischen Entwicklung sie fortschafft. Vielmehr muß der Anfang der Logik, und zwar in seinem Anfangen selbst und nicht erst in seiner rückläufigen Begründung, etwas sein, das ihn für die äußerliche Reflexion (wenigstens für diejenige der Leser der Logik) annehmbar macht, so daß wir uns überhaupt dem Gang der Sache selbst überlassen können. Der unmittelbare Anfang der Logik, so möchte ich meine leitende These formulieren, muß als der voraussetzungslose Anfang des reinen Wissens zugleich etwas sein, wodurch die äußere Reflexion von Anfang an in der Entwicklung der logischen Gedankenbestimmungen steht und in ihr mit thematisiert wird, ohne von außen in sie einfallen zu müssen. Anders gesagt: der Anfang der Logik ist zugleich die anfangende Reflexion in dem Sinne, daß in dem Nullpunkt der bestimmungslosen Unmittelbarkeit äußere und immanente Reflexion zusammenfallen und die äußere in den immanenten Fortgang der Sache selbst hineingerissen wird. Ich werde meine Überlegungen in drei Schritten entfalten. In einem ersten Schritt geht es mir um die Frage, worin eigentlich die Zumutung des Anfangs oder besser: des Anfangens mit demjenigen Anfang, den Hegel macht für das reflektierende Bewußtsein besteht. In einem zweiten Schritt frage ich danach, welche Funktion der bestimmungslosen Unmittelbarkeit, mit der Hegel anfängt, nach Ansicht der Interpreten eigentlich zukommt und was sie für das Verständnis des Anfangs bedeutet. Und schließlich werde ich, in Abgrenzung von diesen Interpretationen, den Versuch unternehmen, diejenige Reflexion zu identifizieren, die sowohl den Anfang macht als auch in der Unmittelbarkeit des Anfangs in Rede steht. -
-
Schwierigkeiten des Anfangs Der Anfang der Wissenschaft der Logik kann inzwischen, trotz seiner langen Interpretationsgeschichte, als eines der schwierigsten Stücke der Hegelschen Philosophie gelten. Hegel selbst war offenbar anderer Ansicht, denn er bezeichnete diesen Anfang als voraussetzungslos und darum als "so einfach", daß er "keiner Vorbereitung noch weiteren Einleitung" bedürfe.1 In diesem Punkt wenigstens, so scheint es, ist Hegel faktisch widerlegt worden, denn die Literatur seit Hegels Lebzeiten bezeugt, daß gerade dieser Anfang Probleme bereitet. Damit ist freilich noch nicht gesagt, daß diese Probleme in dem Anfang selbst liegen. Sie könnten auch in den Einstellungen und Erwartungen der Interpreten begründet sein, also in Vorausset-
zungen, die es schwer machen, sich auf diesen Anfang überhaupt einzulassen. In der Tat ist jeder Interpret von vornherein in der Gefahr, in den Anfang zuviel hineinzulegen und, wie es Wolfgang Wieland formuliert hat, "zuviel hinter dem Begriffdes Seins zu suchen".2 Wenn dem so ist, dann scheint freilich gerade die Unmittelbarkeit, Einfachheit und Voraussetzungslosigkeit des Anfangs, und zwar unabhängig von einer möglichen Rechtfertigung, das Pro1
2
G.W.F. Hegel, Wissenschaft der Logik. Erster Band. Die Objektive Logik. Erstes Buch. Das Sein (1812), neu hg. v. H.-J. Gawoll, mit einer Einleitung von F. Hogemann und W. Jaeschke, Hamburg 1986 (im folgenden WdL 11), 44. Wolfgang Wieland, "Bemerkungen zum Anfang von Hegels Logik", in Wirklichkeit und Reflexion. Walter Schulz zum 60. Geburtstag, hg. v. H. Fahrenbach, Pfullingen 1973, 396.
127
Andreas Arndt
blem zu sein, und zwar offenbar deshalb, weil dieser Anfang für das reflektierende Bewußtsein des Lesers und Interpreten der Logik Zumutungen enthält. Das in dieser Hinsicht Problematische des Anfangs konnte auch Hegel nicht auf sich beruhen lassen, schickte er doch, ungeachtet der "Einfachheit" des Anfangs, dem Anfang selbst umfangreiche einleitende und vorbereitende Erörterungen voraus, um den Leser allererst davon zu überzeugen, daß es "keiner sonstiger Vorbereitungen, um in die Philosophie hineinzukommen, noch anderweitiger Reflexionen und Anknüpfungspunkte"3 bedürfe. Der Anfang solle und müsse vielmehr, so versichert Hegel, "schlechthin ein Unmittelbares sein oder vielmehr nur das Unmittelbare selbst. Wie er nicht gegen Anderes eine Bestimmung haben kann, so kann er auch keine in sich, keinen Inhalt enthalten, denn dergleichen wäre Unterscheidung und Beziehung von Verschiedenem aufeinander, somit eine Vermittlung. Der Anfang ist also das reine Sein."4 Um der Voraussetzungslosigkeit und Unmittelbarkeit des Anfangs willen darf man dieses "also" freilich nicht als eine Schlußfolgerung verstehen. Hegel möchte ja gerade vermeiden, daß der Anfang beim reinen Sein als Resultat einer wie auch immer gearteten Vermittlung erscheint. Das gilt in einer doppelten Hinsicht: er selbst soll ein Unmittelbares sein, und er soll von jeder Beimischung durch eine ihm gegenüber "äußere" Reflexion freigehalten werden; sei es, daß diese den Anfang selbst vermittelt, oder sei es, daß sie sich reflektierend auf ihn bezieht und dadurch den Fortgang bewirkt. Die Zumutung besteht demnach darin, daß wir uns voraussetzungslos auf den Gang einer Sache einlassen und diesen vollziehen sollen, wozu uns nicht nur im Sinne der Phänomenologie Hören und Sehen, sondern auch das Bewußtsein einer Sache als eines bestimmten Objekts und ebenso das Bewußtsein unserer selbst als des reflektierenden Subjekts vergangen sein müssen. Die Voraussetzungslosigkeit des Anfangs erscheint als die ungeheuerste und härteste Voraussetzung, die uns zugemutet werden kann, nämlich als Abstraktion nicht nur von unseren "natürlichen Einstellungen", sondern selbst von einem philosophisch geläuterten Bewußtsein, das aus der Erinnerung an das Resultat der Phänomenologie heraus den Anfang bei einem Wissen einsehen und legitimieren könnte, das sich, wie Hegel es fordert, vom Gegensatze des Bewußtseins befreit hat.5 So ist im Anfang selbst die Philosophie, wie Hegel unterstreicht, "ein leeres Wort oder irgendeine angenommene, ungerechtfertigte Vorstellung."6 Der in diesem Sinne "unphilosophische" Anfang bei einem einfachen, unbestimmten Unmittelbaren, eben beim reinen Sein, den Hegel uns zumutet, muß gerade für ein solches philosophisches Bewußtsein dem Verdacht ausgesetzt sein, hier werde die Grundkonstellation des natürlichen Bewußtseins an einem abstrakten Gegenstand erneuert, denn das reine Sein als Anfang ist hier "vorhanden", es ist ein Gegebenes, und es soll durch die "Betrachtung" dieses Anfangs "das, was darin liegt, ins Wissen hervortreten".7 Die Reflexionsausdrücke, die -
3 4
5 6 7
-
WdL l1 (Anm. 1), 38. G.W.F. Hegel, Wissenschaft der Logik. Erster Teil. Die Objektive Logik. Erster Band. Die Lehre vom Sein (1832), neu hg. v. H.-J. Gawoll, mit einer Einleitung von F. Hogemann und W. Jaeschke, Hamburg 1990 (im folgenden WdL l2), 58f. Vgl. ebd., 57f. WdL l'(Anm 1), 38f. Ebd., S. 43; die Rede vom "Vorhandensein" des Anfangs ebenso wie vom "Betrachten" oder "Zusehen" ist ubiquitär; ersteres ergibt sich dadurch, daß der Anfang ausdrücklich nicht als Resultat der Phänomenologie genommen werden soll, letzteres bezeichnet das reine Zusehen, d. h. den Ausschluß unserer als einer äußerlichen Reflexion von der Konstitution des Prozesses logischer Denkbestimmungen.
128
Die
anfangende Reflexion
Hegel gebraucht, scheinen der unbestimmten Unmittelbarkeit des Anfangs entgegenzustehen, die ja ausdrücklich "frei von der [...] Bestimmtheit gegen das Wesen",8 d. h. von jedem Bezug auf die reflexionslogische Bestimmung der Unmittelbarkeit in der Wesenslogik sein soll. Nun kann kein Zweifel daran bestehen, daß Hegel solche reflexionslogischen Konnotationen vom Anfang gerade fernhalten will und die Schwierigkeiten, die er mit der Darstellung des Anfangs hat, zu einem guten Teil darin bestehen, daß sie sich sprachlich nicht vermeiden lassen und daher fortgesetzt abgewehrt werden müssen. Aber auch, wenn man zu akzeptieren bereit ist, Anfang und Fortgang der Logik hätten eine ganz andere Struktur als Anfang und Fortgang der Phänomenologie (was freilich durch Hegels Zurückhaltung in der Darlegung der methodologischen Unterschiede beider Schriften gewisse Schwierigkeiten bereitet), selbst dann bleibt die Frage, wie wir uns überhaupt in diese unbestimmte Unmittelbarkeit nicht hineinbegeben, sondern in sie fügen und aus ihr heraus den Fortgang machen können. Denn wenn diese Unmittelbarkeit nicht das Ergebnis einer abstrahierenden Reflexion sein soll, wenn also in Hegels Worten der Anfang nicht "herbeigeführt"9 werden soll, so müssen wir uns unmittelbar schon immer in diesem Anfang befinden. Er muß für uns eine Evidenz haben, die geradezu dazu zwingt, sich auf ihn einzulassen und dabei nicht nur unsere, sondern jede Reflexion aufzugeben. So sah sich Hegel trotz aller Einwendungen gegen den Anfang, die bereits zu seinen Lebzeiten vorgetragen worden waren und die er sehr wohl kannte,10 nicht in der Lage, ihn bei der Überarbeitung der Seinslogik für die zweite Auflage im Haupttext in irgendeiner Weise zu revidieren. Er hat allein die negativ vorbereitenden Erörterungen sowie die erläuternden Anmerkungen umgearbeitet. Wie die fortgesetzten, bis heute andauernden Auseinandersetzungen deutlich machen, hat dieser Anfang aber damit nicht an unmittelbarer Überzeugungskraft gewinnen können. Aber selbst dann, wenn man Hegel zugesteht, daß der Anfang in seiner einfachen Unmittelbarkeit jene Evidenz haben mag, die er beansprucht, so ist nicht abzusehen, wie denn eine -
-
reine Unmittelbarkeit, an und in der nichts unterschieden werden kann, aus ihr selbst heraus, ohne die Reflexion eines außerhalb ihrer stehenden Subjekts, in die Vermittlung soll übergehen können. Dieses Argument ist wirkungsmächtig vor allem von Trendelenburg gegen Hegel vorgebracht worden, auch wenn er keineswegs als sein Urheber angesehen werden kann, sondern schon Schelling seine Kritik an Hegel hierauf stützte.11 Sehr verkürzt läßt sich dieser Einwand so wiedergeben, daß Sein und Nichts in ihrer Unmittelbarkeit in sich selbst ruhen und aus ihnen keine wie immer auch geartete Bewegung herausdestilliert werden könne. Dies sei vielmehr das Tun eines vorausgesetzten Subjekts, daß sie miteinander vergleiche und mit Hilfe der vorausgesetzten Anschauung des Werdens aufeinander beziehe, so
8 9 10
Ebd., S. 47. Ebd., S. 44.
Dieter Henrich, "Anfang und Methode der Logik", in (ders.) Hegel im Kontext, Frankfurt a.M. 1971; Bernd Burkhardt, Hegels "Wissenschaft der Logik" im Spannungsfeld der Kritik. Historische und systematische Untersuchungen zur Funktion und Leistungsfähigkeit von Hegels "Wissenschaft der Logik" bis 1831, Hildesheim, Zürich und New York 1993. 11 Zu Schelling vgl. die Studie von Burkhardt (Anm. 10); zu Trendelenburg Josef Schmidt, Hegels Wissenschaft der Logik und ihre Kritik durch Adolf Trendelenburg, München 1977; ferner Jürgen Werner, Darstellung als Kritik. Hegels Frage nach dem Anfang der Wissenschaft, Bonn 1986.
Vgl.
129
Andreas Arndt
daß der Schein einer Selbstbewegung der anfänglichen Kategorien und damit eines immanenten Fortschritts erzeugt werde. Die bisherige Diskussion des Anfangsproblems hat sich, soweit ich sehen kann, vor
allem mit dieser Problematik auseinandergesetzt. Die unbestimmte Unmittelbarkeit des anfänglichen reinen Seins wurde daraufhin befragt, ob sie fähig sei, einen immanenten Fortschritt im Prozeß der logischen Gedankenbestimmungen zu initiieren, d. h. die Unmittelbarkeit aus ihr selbst heraus, ohne die Zuhilfenahme einer äußeren Reflexion, in die vermittelte und vermittelnde Bewegung der Reflexion zu überführen. Dabei ist jedoch m. E. unterbestimmt geblieben, welche Funktion der anfänglichen, unbestimmten Unmittelbarkeit eigentlich zukommt. Die Auskünfte, die hierzu gegeben werden, sind zumeist spekulativer Natur. Sie folgen dem Hinweis Hegels, daß der Fortschritt in der Entwicklung der logischen Bestimmungen zugleich ein rückläufiges Begründen des Anfangs sei. Der Anfang erscheint dann als voraussetzungslos und unmittelbar in dem Sinne, daß er ein schlechthin sich selbst begründendes Absolutum sei, wenn auch ein abstraktes, welches die in sich konkrete Bestimmtheit erst noch gewinnen müsse. Hegel selbst hat zahlreiche Hinweise in dieser Richtung gegeben und das reine Sein mit dem Absoluten und selbst seine Bestimmungslosigkeit mit der Erhebung über das endliche, bestimmte Sein in Verbindung gebracht.12 Die unbestimmte Unmittelbarkeit des reinen Seins wäre dann eine erste Manifestation des Absoluten oder, weil es sich hier voraussetzungslos durch sich selbst gründet, sogar dessen unmittelbare Selbstsetzung.13 Die Voraussetzungslosigkeit des Anfangs wäre dann die Voraussetzung des Absoluten im Sinne der Hegelschen Philosophie und der Beginn seiner Selbstexplikation. Nun trifft dies gewiß auch zu, obwohl damit noch nichts über den Sinn der Hegelschen Rede vom Absoluten gesagt ist. Die Zweifel an dieser Rede und ihrer argumentativen Begründung haben aber nachhaltig die Sicht des Anfangs der Logik geprägt und ihn als problematisch erscheinen lassen, wobei es hier gar nicht darauf ankommt, ob diese Zweifel auf Mißverständnissen beruhen oder nicht. Beginnend mit Schelling und anderen zeitgenössischen Kritikern, über Feuerbach und Kierkegaard bis hin zu zahlreichen Interpreten der jüngsten Zeit wurden die spekulativen Konsequenzen des Systems in den Anfang projiziert und bereits dort kritisiert. Und auch die Verteidiger Hegels haben sich dieser Sichtweise nolens volens weitgehend unterworfen, indem sie den Anfang von dem Verdacht einer petitio principii durch die unbestimmte Unmittelbarkeit, die sich am Ende der Logik als vermittelte wiederherstellt, befreien wollten. Deshalb insistierten sie auf der Reflektiertheit des Anfangs. Dies war, Henrich zufolge, bereits die Strategie der unmittelbaren Schüler Hegels,14 und mehr noch ist es die Strategie einer "rettenden" Kritik in "nachmetaphysischen" Zeiten, de-
WdL 1 (Anm. 4), 80: es sei daran zu erinnern, "daß der Mensch sich zu dieser abstrakten Allgemeinheit in seiner Gesinnung erheben soll, in welcher es ihm in der Tat gleichgültig sei, ob die hundert Taler [...] seien oder ob sie nicht seien, ebensosehr als es ihm gleichgültig sei, ob er sei oder nicht, d. i. im endlichen Leben sei oder nicht". 13 Vgl. hierzu Karin Schrader-Klebert, Das Problem des Anfangs in Hegels Philosophie. Wien und München 1969. Gerade diese Monographie vermittelt den Eindruck, nicht die Interpreten haben in den Anfang zuviel hineingelegt, sondern Hegel selbst habe mit dem Anfang zuviele Intentionen auf einmal auf den Weg bringen wollen, was ihn in eine unauflösliche Ambivalenz und in Aporien getrieben habe. 14 Vgl. Dieter Henrich, "Anfang und Methode der Logik" (Anm. 10).
12
Vgl.
130
Die
anfangende
Reflexion
nen die Philosophie des Absoluten von vornherein als unwiderruflich überwunden und nicht mehr restituierbar gilt.15 Worum es hierbei geht, was dabei gewissermaßen in systematischer Hinsicht auf dem Spiel steht, hat Dieter Henrich als Alternative so formuliert: "Entweder es gelingt, die Struktur des Anfangs der Logik im Unterschied zu der Logik reflektierter Gedankenbestimmungen zu interpretieren und ihr gemäß den Begriff der unbestimmten Unmittelbarkeit zu entwickeln. Oder es müssen auch schon in ihrem Anfang reflektierte Momente unterstellt werden. In diesem Fall ist es unmöglich, an der Idee der Logik als einer Wissenschaft reiner Gedanken festzuhalten. Denn in ihr müßte es notwendig eine erste und schlechthin einfache Grundbestimmung geben."16 Nach Henrich haben sowohl die Kritiker als auch die Verteidiger Hegels den zweiten Weg beschritten. Die Kritiker wollten "allesamt einen Unterschied finden zwischen dem Gedanken der unbestimmten Unmittelbarkeit und der Opposition Sein-Nichts und deshalb beide zunächst voneinander trennen, um sie dann aufeinander zu beziehen".17 Und die Verteidiger hätten, in Ermangelung des Bewußtseins einer Alternative, die Voraussetzungen dieser Kritik kommentarlos akzeptiert.
Unreflektierte Unmittelbarkeit? Henrich selbst hat demgegenüber einen anderen Weg beschritten, der im Anfang, Hegels Hinweisen folgend, seine Nichtreflektiertheit sowohl in sich als auch gegenüber der Reflexionslogik festhalten will. Sein Anliegen ist es, "die Logik des reinen Seins [...] via negations [...], in der Unterscheidung von der Logik der Reflexion"18 zu explizieren. Dieser Versuch, die anfängliche, unbestimmte Unmittelbarkeit ernstzunehmen und ohne Anleihen bei der Logik der Reflexion zu interpretieren, kommt zu dem Ergebnis, daß der Anfang der Logik einen "Zusammenhang von Gedanken evident" machen möchte, "der sich jeder Konstruktion entzieht".19 Er könne daher auch "niemals aufgehoben" und durch die reicheren Strukturen des Fortgangs auch "niemals zureichend interpretiert werden."20 Dies führe dazu, daß es unmöglich werde, ihn im vollen Sinne argumentativ einzuholen und "Einwände durch direkte Gegengründe zu entkräften", wodurch er "eine Quelle unaufhebbarer Zweideutigkeit" sei.21 15
16 17 18
Vgl. z. B. Alexander Schubert, Der Strukturgedanke in Hegels "Wissenschaft der Logik", Meisenheim und Königstein/Ts. 1985; Schubert liefert jedoch eine hellsichtige Interpretation des Bezugs des Anfangs auf die
Problematik der Reflexion, die meine Überlegungen auch dort vielfach beeinflußt hat, wo ich ihr im ganzen nicht zu folgen vermag. Dieter Henrich, "Anfang und Methode der Logik" (Anm. 10), 84. Ebd., 79. Ebd., 79f. Die "via negationis" muß nicht eine Vorwegnahme reflektierter Kategorien in unmittelbarer Gestalt darstellen, wie Schubert, Der Strukturgedanke (Anm. 15), 30f. dies nahelegt. Vielmehr soll das "ex negativo" nur ernstnehmen, daß Hegel den Anfang nicht im Bezug auf die Reflexionslogik bestimmt. Dieter Henrich, "Anfang und Methode der Logik" (Anm. 10), 89. Ebd., 93. Ebd., 90. Friedrike Schick kommt sogar zu dem Schluß, daß sich kontroverse Deutungen des Anfangs gleichermaßen am Text bewähren lassen (Hegels Wissenschaft der Logik metaphysische Letztbegründung oder Theorie logischer Formen? Freiburg und München 1994, 152). Dabei vertritt sie selbst die Lesart, daß der Anfang als Versuch einer metaphysischen Letztbegründung scheitere. In einem schwächeren Sinne haben -
19 20 21
-
-
131
Andreas Arndt
Wenn es sich so verhalten sollte, dann wäre freilich das Unternehmen der Hegelschen Logik gescheitert, einen Anfang zu finden, der einen immanenten Fortgang der Gedankenbestimmungen erlaubt. Die unaufhebbare Unmittelbarkeit des Anfangs stünde dann der Refle-
xion, die sich von dieser Unmittelbarkeit abstößt und sie zerstört, unvermittelt gegenüber. Tatsächlich kommt Henrich ja auch zu einer Konsequenz, die für den Status der Logik als "Wissenschaft reiner Gedanken" keineswegs weniger ruinös ist, als der Versuch, ihrem Anfang von vornherein reflektierte Momente zu unterstellen. Die "Wissenschaft der Logik" nämlich müsse demnach "von dem Prozeß der logischen Gedankenbestimmungen unterschieden werden",22 und da sie "sich vielfach nur in rückläufiger Begründung und mit dem Blick auf das Ganze entfalten" lasse, bedürften wir "einer Methodenlehre dieser Begründungen, die den Charakter einer 'Metalogik' haben würde." Damit aber ist der Hegeische Anspruch einer selbstexplikativen Wissenschaft vernichtet, die sich im Vollzug der Gedankenbestimmungen auch begründet, und der Rettungsversuch zahlt den gleichen Preis, wie die Verteidiger Hegels, die Henrich zufolge den unmittelbaren Anfang vorschnell preisgegeben haben. Michael Theunissen hat im Rahmen seiner in Sein und Schein entfalteten These einer Darstellung der Metaphysik durch Kritik in der Wissenschaft der Logik23 auch den Versuch unternommen, an der Unmittelbarkeit des reinen Seins im Unterschied zu seiner Bestimmungslosigkeit ein Wahrheitsmoment zu reklamieren. Dieses Sein sei in seiner Unmittelbarkeit so etwas wie eine "vorgängige Totalpräsenz" nach dem Vorbild Jacobis,24 nur, daß Hegel es nicht als das Ursprüngliche selbst, sondern nur als die Gegenwärtigkeit des Ursprungs im Anfang verstehe, so daß dieser Anfang in seiner Unmittelbarkeit durch ein wahrhaft Ursprüngliches vermittelt sei, das nicht das Sein sei. Vielmehr weise die "Gewißheit des Seins" auf die "Selbstgewißheit des Denkens" zurück, weshalb sie die "Enthüllung der im Sein liegenden Wahrheit" auch nur "von der progressiven Entwicklung des Denkens selber erwarten" könne.25 Diese Interpretation verdankt sich einer Unterscheidung "zwischen dem Ersten im Gange des Denkens und dem Prius für das Denken",26 einer "Doppelbödigkeit" im unmittelbaren Anfang der Logik selbst. Diese entstehe dadurch, daß das Denken in der Unmittelbarkeit des Anfangs sein Prius gleichsam in diesen versenke, indem es dieses vergegenständliche und somit selbst zu einem unvordenklichen Unmittelbaren mache, durch das die Unmittelbarkeit des Anfangs vorgegeben sei. Nur auf diese Weise könne sich, wie es alle allerdings fast alle
neueren
Interpreten der Logik dem Anfang eine Zweideutigkeit bzw. Ambivalenz zuervon Belegen
kannt; vgl. Alexander Schubert, Der Strukturgedanke (Anm. 15), 23, der hierzu eine Vielzahl
anführt. 22 Dieter Henrich, "Anfang und Methode der Logik" (Anm. 10), 92 (das Folgende 92f.). Michael Wolff hat den interessanten Versuch unternommen, die Zweideutigkeit des Anfangs dadurch zu entschärfen, daß er ihn als formallogische Überführung eines "negativen" in ein "positives" Dilemma interpretiert und rechtfertigt, wobei freilich erklärtermaßen die "inhaltliche Interpretation der logischen Ausangsthese" ausgeklammert bleibt ("Die 'Momente' des Logischen und der 'Anfang' der Logik in Hegels philosophischer Wissenschaft", in Skeptizismus und spekulatives Denken in der Philosophie Hegels, hg. v. H.-F. Fulda und R.-P. Horstmann, Stuttgart 1996, 226-243; hier 238). 23 Vgl. bes. Jürgen Werner, Darstellung als Kritik (Anm. 11). 24 Vgl. Michael Theunissen: Sein und Schein. Die kritische Funktion der Hegelschen Logik. Frankfurt a.M. 1980, 198-215; hierbes. 212f. 25 Ebd., 214. 26 Ebd., 204. -
132
Die
anfangende Reflexion
Philosophen der Unmittelbarkeit gewollt haben, in der anfänglichen Unmittelbarkeit des Denkens zugleich ein Ursprüngliches zeigen, welches ein der Reflexion enthobenes, bewußtseinstranszendentes Sein sei. Indem die Unmittelbarkeit des anschauenden, nicht begrifflich reflektierenden Denkens im Anfang als das "Organ" dieser Vergegenständlichung durchschaut werde, falle auch die Vergegenständlichung selbst der Kritik anheim, so daß diese auch von der Doppelbödigkeit des Anfangs frei sei.27 Das Wahrheitsmoment in der Unmittelbarkeit des Anfangs besteht demnach darin, daß sich in ihr, wenn auch in verzerrter, verdinglichter und damit scheinhafter Gestalt, ein Prius für das Denken aufzeigen läßt, das sich als dasjenige erweist, welches den Anfang des Denkens vermittelt und in dessen Fortgang sich selbst als das Ursprüngliche expliziert, das nun kein Unvordenkliches mehr ist, sondern das seine Wahrheit, wie Hegel es will, nur in dem Ganzen der Bewegung seiner Selbstexplikation hat. Dieses Wahrheitsmoment läßt sich freilich
nur dann als in der Unmittelbarkeit selbst präsent einsehen, wenn der Unmittelbarkeit, die es hier geht, noch eine andere Zweideutigkeit eignet als die des Ersten im Denken und des Prius für das Denken. Das Prius nämlich ist, als den Anfang vermittelnd und sich im Fortgang mit sich selbst vermittelnd, in seiner bisherigen Bestimmung durchaus ein Reflektiertes und kein Unmittelbares. Mit anderen Worten: die Kritik eines verdinglichenden Denkens, welche die Unmittelbarkeit als Schein vorführt, steht zugleich vor der Aufgabe, die Unmittelbarkeit selbst und nicht nur das mit ihr Gemeinte zu rechtfertigen, wenn anders sie dem Vorwurf einer äußeren Reflexion und eines scheinhaften Anfangs entgehen will, der nicht der wahre, sondern nur der schlechthin unwahre Anfang sei. Die erwähnte Auslegung der Unmittelbarkeit als "vorgängige Totalpräsenz" soll dies leisten, indem sie sich auf den Boden der Wahrheit stellt, welche nach Hegel das Ganze ist. Diese Unmittelbarkeit, sollte es sie geben, könnte jedoch in keinem Verhältnis zur Unmittelbarkeit des Anfangs stehen, sondern wäre ganz in sie versenkt und mit ihr unterschiedslos Eins. Wäre sie es nicht, so wäre der Anfang ein in sich Reflektiertes, und auch erst dann ließen sich in ihm überhaupt erst Momente unterscheiden. Das reine Sein ist aber das genaue Gegenteil; es ist bestimmungslos, weil seine wahre Bestimmung ihm nicht an der Stirn geschrieben steht, sondern sich im Resultat erst noch erweisen muß. Die Unmittelbarkeit, welche vorgängig das Ganze umfaßt und in sich schließt, ist im Anfang selbst bloß eine gemeinte, mit der wir Bestimmungen an den Anfang herantragen, die nicht in ihm enthalten sind. Und nur als ein solcher gemeinter Unterschied zu den sonstigen, der Kritik anheimfallenden Aspekten der bestimmungslosen Unmittelbarkeit könnte sie einer vergleichenden Reflexion dienlich sein. Sie selbst wäre, selbst wenn sie sich im Unterschied zu den anderen Aspekten der Unmittelbarkeit auch unmittelbar bewahrheiten ließe, nicht einmal fähig, aus ihr selbst heraus diese Kritik zu vollziehen, solange sie Unmittelbarkeit ist, da sie hierzu allererst in ein Verhältnis treten, d. h. den Status der Unmittelbarkeit schon verlassen haben müßte. Den Versuchen Henrichs und Theunissens, dem Anfang in seiner unbestimmten Unmittelbarkeit ein Wahrheitsmoment abzuringen, steht eine Kritik gegenüber, die in dem Anfang nicht mehr erkennen kann als ein eher bloß diffuses Konglomerat von Argumentationsabsichten, welche in dem Versuch, die Unmittelbarkeit in die Reflexion zu überführen, miteinum
27
Vgl. ebd., 207.
133
Andreas Arndt
ander kollidieren. Hierbei werden vor allem spekulative Absichten Hegels namhaft gemacht, die ihn im Widerspruch zu der Einsicht in die für den Fortgang notwendige Vermitteltheit des Anfangs dazu verleitet hätten, gleichsam wider besseres Wissen seine Unmittelbarkeit als notwendig zu affirmieren und nicht als bloßen Schein zu denunzieren, der dann freilich nicht mehr der wahre Anfang sein könnte.28 Tatsächlich legen die Aporien, die ein Ernstnehmen der unbestimmten Unmittelbarkeit des Anfangs bereitet, eine solche Konsequenz nahe. Man kann zwar den Kritikern mit Recht entgegenhalten, daß sie in der Suche nach einander widerstreitenden Argumentationsabsichten Hegels wiederum zuviel in den Anfang hineinlegen, um die tatsächlichen oder vermeinten spekulativen Konsequenzen bereits dort abzuwehren, wo sie noch gar nicht hervorgetreten sind, und daß sie dabei auch den Gegner nicht im Umkreis seiner argumentativ entfalteten Stärke stellen. Aber auch dann, wenn man den Anfang in seiner bestimmungslosen Unmittelbarkeit so nimmt, wie er sich gibt, wird man Schwierigkeiten haben, aus ihm selbst die Bestimmtheit und Vermittlung hervorgehen zu lassen. Die entsprechenden, hochdifferenzierten Versuche etwa von Heinz Röttges, Jürgen Werner und Bernd Burkhardt, die sich dadurch auszeichnen, daß sie das Problem des Anfangs mit dem Problem der Methode zusammenbringen,29 gehen mehr oder weniger stillschweigend davon aus, daß die Logik als ein Denken des Denkens zu bestimmen sei, so daß es eine, wenn auch methodisch legitimierte und nicht willkürliche begleitende Reflexionsinstanz gebe, welche die Unmittelbarkeit gleichsam beobachte und sich im unvermittelten Übergegangensein des Seins in Nichts seiner Herkunft erinnere, um überhaupt einen Unterschied setzen zu können, der die Reflexion in Gang bringt.30 Die Annahme einer solchen Reflexionsinstanz außerhalb der Entwicklung der logischen Gedankenbestimmungen selbst liegt Henrichs Versuch zugrunde, die anfängliche Unmittelbarkeit ernstzunehmen. Für die Unterscheidung von Logik und Metalogik beruft er sich darauf, daß die Wissenschaft vom Prozeß der logischen Gedankenbestimmungen "eine Weise der Wirklichkeit des Geistes"31 sei. Leider hat er diesen Gedanken nicht näher expliziert, der ja Schwierigkeiten bereitet. Denn nach Hegels Auskunft in der Vorrede zur ersten Ausgabe der Logik ist der Geist die Wahrheit der Vernunft, "die immanente Entwicklung des Begriffs", "die absolute Methode des Erkennens und zugleich die immanente Seele des Inhaltes selbst."32 Der Prozeß der logischen Gedankenbestimmungen wäre demnach gerade "eine Weise der Wirklichkeit des Geistes", nämlich diejenige, in der er sich auf seiner eigenen Grundd. h. wie im Rückblick auf die Phänomenologie des Geistes betont33 lage bewegt, Hegel in der er sich vom Gegensatz des Bewußtseins befreit hat. Wenn nicht diese Wirklichkeit -
-
28 29
30
31 32 33
Vgl. hierzu besonders die erwähnten Arbeiten von Schrader-Klebert (Anm. 13), Schubert (Anm. 15) und Schick (Anm. 21). Vgl., neben den bereits erwähnten Arbeiten, Heinz Röttges: Der Begriff der Methode in der Philosophie Hegels, Meisenheim 1976. Jürgen Werner, Darstellung als Kritik (Anm. 11) stützt sich dabei schließlich auf die wesenslogische Kategorie des absoluten Unterschieds (vgl. § 11); Bernd Burkhardt, Hegels "Wissenschaft der Logik" (Anm. 10) argumentiert dagegen vor allem mit dem spekulativen Satz. Das Problem ist jedoch, daß sich der Anfang im Satz gar nicht aussprechen läßt, da die Unmittelbarkeit jeder Relationalität entbehrt, die erst ein Urteil ermöglichen würde. Dieter Henrich, "Anfang und Methode der Logik" (Anm. 10), 92. WdL l'(Anm 1), 6. Vgl. ebd., 57f.
134
Die
anfangende
Reflexion
des Geistes gemeint sein soll, in der ja Logik und Metalogik zusammenfallen, so ließe sich Henrichs Bemerkung nur im Blick auf eine "weiter konkrete Form" des Erkennens in der Philosophie des Geistes verstehen. Das aber hieße, daß die Logik, sofern sie Wissenschaft der Logik ist, die Methode ihres Begründens bei den konkreteren Formen des Erkennens erborgen müßte. Vielleicht meint Henrich aber auch nur denjenigen Sachverhalt, den Wolfgang Wieland als eine "pragmatische" Voraussetzung Hegels bezeichnet hat, daß nämlich die Logik wenigstens mit der "Reflexionsfähigkeit" ihrer Leser rechnen müsse.34 Die Darstellung der Logik bewege sich daher auf einer Ebene, die "innerhalb ihrer selbst nie thematisch werde, der Ebene des endlichen Geistes."35 Rüdiger Bubner hat dies als "das nicht hinterschreitbare Faktum der Reflexion"36 bezeichnet. Das Sein der Wissenschaft sei von diesem Faktum nicht zu trennen; eine Wissenschaft konstituiere sich allererst, indem sie in diesem Faktum "die entscheidende und letzte Voraussetzung für sich selber akzeptiert",37 und d. h.: indem sie sich Voraussetzungen nicht äußerlich vorgeben läßt, sondern "das Voraussetzen restlos in eigne Regie" übernimmt.38 Dies könne sie nur, wenn sie die äußerliche Reflexion in die innere, die Bewegung "der Sache selbst" umsetze, integriere und dadurch einer inhaltlichen Ordnung unterwerfe.39 Auf den Anfang der Logik bezogen heißt dies, daß die absolute Voraussetzungslosigkeit ihres Anfangs eine Voraussetzung der Wissenschaft formuliert und ausdrücklich setzt, nämlich "die Voraussetzung, daß man keine Voraussetzung unreflektiert hinnehmen solle".40 Hierin wäre das Faktum der Reflexion anerkannt und gleichzeitig wären die Einwendungen durch beliebige Voraussetzungen einer äußeren Reflexion abgewehrt. Die Differenz zwischen dem "Gang der Sache selbst" und den von der äußeren Reflexion herangetragenen Voraussetzungen wäre dadurch aufgehoben, daß der Anfang sie ausspricht.41 Wenn der Gang der Sache selbst, um überhaupt in Gang zu kommen, einer äußeren Reflexionsinstanz bedarf, dann stellt sich freilich um so dringender die Frage, was die anfängliche Unmittelbarkeit für diese äußere Reflexion bedeutet. Ist sie nur ein Anfang, der das Faktum dieser Reflexion überspringen will, um dann doch im Fortgang von der Reflexion eingeholt zu werden? Oder kommt der Unmittelbarkeit ein Wahrheitsmoment gerade im Blick auf diese Reflexion zu, so daß sie durch sie von Anfang an in die Entwicklung der logischen Gedankenbestimmungen integriert ist? Was mit dieser Frage auf dem Spiel steht, ist nicht mehr nur der Ort der Logik im Zusammenhang des Hegelschen spekulativen Systems; auf dem Spiel steht vielmehr der Vernunftbegriff von Rationalität überhaupt, den die Logik in Anspruch nimmt. Ein solcher Begriff kann Geltung nur dann beanspruchen, wenn es gelingt, die subjektive, äußerliche
34
35
Wolfgang Wieland, "Bemerkungen zum Anfang von Hegels Logik" (Anm. 2), 403. Vgl. ebd., 405; gerade weil sie nicht thematisch werde, so Wieland, brauche diese Ebene sen zu
36
Rüdiger Bubner, "Die
'Sache selbst' in Hegels R.-P. Horstmann, Frankfurt a.M. 1978, 107. Ebd., 109. Ebd., 106. Vgl. ebd., 116. Ebd., 106. Vgl. ebd., 109. v.
37 38 39 40 41
werden.
auch nicht verlas-
System", in Seminar: Dialektik in der Philosophie Hegels, hg.
135
Andreas Arndt
Reflexion der Disziplin einer Gedankenbewegung zu unterwerfen, die auch ihre eigene ist, d. h., die sich mit deren Voraussetzungen und "Einfällen" auch zu verständigen vermag. Wie also, so ist zu fragen, kann der Anfang der Logik in der Weise verstanden werden, daß in ihm entgegen allen Anschein eine äußere Reflexion zur Sprache kommt? -
-
Die anfangende Reflexion Bubners Überlegungen zum Faktum der Reflexion zielen auf eine Problematik, die Hegel selbst weitgehend ausgeblendet hat.42 Er habe, wie es bei Bubner heißt, "um der beanspruchten Notwendigkeit der Methode Nachdruck zu verleihen, die Autonomie der Selbstbewegung der Sache überakzentuiert".43 Eben deshalb hat er aber auch nicht das Faktum der Reflexion oder eine Reflexionsdifferenz zum Ausgangspunkt der Logik gemacht, sondern solche Fragen in das Vorfeld der Erörterung der Sache selbst verwiesen. Der Anfang selbst in seiner unbestimmten Unmittelbarkeit soll ja ausdrücklich nicht dadurch herbeigeführt und begründet werden, daß er das Resultat einer "Selbstaufhebung aller vorgängigen Vermittlungen"44 sei. Dies zeigt sich erst im weiteren Gang der Logik. Und ebensowenig soll die schlichte Einfachheit des reinen Seins noch auf Anderes verweisen, denn dann wäre sie nicht mehr reflexionslose Unmittelbarkeit. Bubners Interpretation, so bestechend sie ist, steht demnach vor der gleichen Schwierigkeit wie andere Versuche, dem Anfang der Logik Plausibilität abzugewinnen: um die Reflexion in den Gang der Sache selbst hineinzuzwingen, die äußerliche der immanenten zu unterwerfen, muß der Anfang selbst offenbar schon immer als Moment eines Reflexionsprozesses einsehbar sein. Diese Einsicht will Bubner dadurch herstellen, daß er den Anfang als das als unmittelbar ausgesprochene Resultat einer abstrahierenden Reflexion versteht. Hegel scheint indessen der Ansicht zu sein, daß ein solche abstrahierende Reflexion selbst nur in einem äußerlichen Verhältnis zum Anfang steht. Der Anfang nämlich ist subjektiv nicht durch ein "woher" im Sinne seiner genetischen Begründung motiviert, sondern durch ein "wozu" im Sinne des willkürlichen Sich-Entschließens zum reinen Denken: "Nur der Entschluß, den man auch für Willkür ansehen kann, nämlich daß man das Denken als solches betrachten wolle, ist vorhanden."45 In der ersten Auflage der "Seinslogik" ist diese Will42 Zur grundsätzlichen Poblematik des Verhältnisses von äußerlicher und immanenter Reflexion bei Hegel vgl. Walter Jaeschke, "Äußerliche Reflexion und immanente Reflexion", in Hegel-Studien 13 (1978), 85-117. 43 Rüdiger Bubner, "Die 'Sache selbst' in Hegels System" (Anm. 36), 116. 44 Ebd., 111; Bubner verweist hier auf den § 51 der Enzyklopädie (1830), der das unmittelbare Wissen als "dritte Stellung des Gedankens zur Objektivität" zum Thema hat. Der dort gegen Jacobi entwickelte Gedanke einer Selbstaufhebung der Vermittlung betrifft jedoch m. E. weniger den Anfang der Logik als vielmehr ihr Resultat, die vermittelte, d. h.: aus der Vermittlung hervorgegangene Unmittelbarkeit. Und auch die Anknüpfung an das unmittelbar genommene Resultat der Phänomenologie in der Logik, das vom Gegensatz des Bewußtseins befreite Wissen, ist ja von Hegel ausdrücklich nicht als Begründung des Anfangs aufgefaßt und zugelassen worden; im Gegenteil: der Anfang der Logik vollzieht sich in der Vergessenheit der phänomenologischen Vermittlungen. Sofern der Modus des absoluten Wissens der Phänomenologie aber gerade die Anamnesis ist, wäre geradezu zu fragen, ob somit überhaupt noch eine Anknüpfung der Logik an die Phänomenologie statthaben könne. 45 WdL 4), 58.
l2(Anm.
136
Die
anfangende Reflexion
kür nicht nur auf das Subjekt bezogen, das rein denken will, sondern auch auf die Form, die das "Denken als solches" hat. Die Unmittelbarkeit des Anfangs sei, so schreibt Hegel hier, "da sie nicht begründet ist, etwas Willkürliches und Zufälliges."46 Man wird sich hier unwillkürlich der Worte der Differenzschrift von 1801 erinnern, wonach "Willkür und Zufall, die nur auf untergeordneteren Standpunkten Raum haben, [...] aus dem Begriff der Wissenschaften des Absoluten verbannt" seien.47 Da Hegel auch später seine Ansicht hierüber nicht geändert hat (wie vor allem auch in seiner Polemik gegen die Romantiker deutlich wird), wird man aber kaum davon ausgehen können, daß er ausgerechnet in der Wissenschaft der Logik Willkür und Zufall zum Eingang in die Wissenschaft des Absoluten machen wollte. Dennoch gibt der Terminus "Willkür" einen wichtigen Hinweis auf den formellen Status des Anfangs der Logik: Willkür ist nach Hegel "der Wille in der Form der Zufälligkeit",48 bei dem Form und Inhalt im Widerspruch zueinander stehen, sofern er sich auf etwas bezieht, das zufällig gegeben ist. Der Wille ist hier abstrakt, weil er die Zufälligkeit als bloß abstrakte Möglichkeit zu seinem Inhalt hat. Sein Inhalt ist demnach nur etwas Formelles, und so ist er selbst auch nur formell, nämlich formelle Freiheit des Willens. In dieser Form aber ist er sich selbst gleich; die Willkür erfährt die vom gegebenen Gegenstand äußerlich dargebotene Wahlmöglichkeit unmittelbar als Affirmation der Willensfreiheit, worin "er sich bewußt ist, von jedem Inhalt sogleich wieder abstrahieren und seine Reinheit wiederherstellen zu können".49 Man kann, so glaube ich, den Hinweis auf die Struktur der Willkür mit der Struktur des Anfangs zusammenbringen. In der Willkür sind Subjekt und Objekt gleichermaßen von aller konkreten Bestimmtheit entleert. Subjektiv ist die Willkür nichts weiter als die bestimmungslose, abstrakte Einheit mit sich als bloße Möglichkeit der Selbstbestimmung. Und objektiv entspricht ihr ein bestimmungsloses Substrat als bloße Möglichkeit des Bestimmtwerdens. In dieser Struktur ist, wie es scheint, die Subjektivität auf die Spitze getrieben und hat sich weit davon entfernt, sich der Notwendigkeit des Ganges der Sache selbst zu unterwerfen vielmehr zum "Herrn und Meister über alles" aufgeworfen, wie es Hegel der romantischen Subjektivität vorwarf.50 Die Willkür hat subjektiv alle Voraussetzungen hinter sich gelassen außer sich selbst; sie ist unbestimmte, unmittelbare Sichselbstgleichheit, die sich absolut setzt. Sie ist damit dasselbe, was das reine Sein ist. Die Spitze de Subjektivismus, die äußerste Steigerung der äußerlichen Reflexion, die den Zugang zur Sache der Logik zu verstellen droht ist selbst nichts anderes als der Anfang der Sache selbst in der Wissenschaft der Logik. In der unbestimmten Unmittelbarkeit des Anfangs fallen die äußerliche Reflexion und der Beginn der immanenten Reflexion zusammen. Der Einwand liegt nahe, daß diese Interpretation sich im Rahmen eines Subjekt-ObjektVerhältnisses bewege, mithin innerhalb der Grundstellung der Phänomenologie, die von der Logik schon immer verlassen worden sei. Diesem Einwand läßt sich jedoch dadurch begegnen, daß man darauf achtet, in welchen Verhältnis hier die subjektive Willkür zum Objekt -
-
-
-
-
-
WdL l'(Anm. 1), 36. HW 2, 108. Enz. § 145, Zusatz (HW 8, 285). Vgl. G.W.F. Hegel, Nürnberger Propädeutik. Rechts- Pflichten und Religionslehre (¡810ff.). § 11.HW4, 207. 50 G.W.F. Hegel: Ästhetik, hg. v. F. Bassenge, Berlin und Weimar 21965, Bd. 1, 73.
46 47 48 49
für die Unterklasse
137
Andreas Arndt
des Bestimmens steht. Das Objekt ist hier kein bestimmter Gegenstand, sondern ein bestimmungsloses Substrat, zu dem sich die Subjektivität gleichgültig verhält. Es ist die bloße Möglichkeit des Bestimmtwerdens. Es wird als das angesehen, als was die Subjektivität sich selbst vorstellt, als eine bestimmungslose, einfache Sichselbstgleichheit. In dieser Unmittelbarkeit sind das Subjekt und das Objekt vollkommen austauschbar; ihr Unterschied ist in sich zusammengesunken. Anders gesagt: auch das Objekt ist nichts anderes, als das, was am Anfang der Logik als das reine Sein auftritt. In der ersten Auflage der Seinslogik hatte ja auch, wie erinnert, Hegel die anfängliche Unmittelbarkeit selbst und nicht nur den Entschluß zu ihr als etwas Willkürliches und Zufälliges bezeichnet. Inwiefern aber kann diese Unmittelbarkeit, in der jeder Unterschied verschwunden ist, als Moment einer Reflexion gelten? Steht nicht auch hier wiederum die Unmittelbarkeit der Reflexion unvermittelt entgegen? Die Vorstellung eines bestimmungslosen Substrats (sei es als Objekt des Bestimmtwerdens oder als Subjekt der Selbstbestimmung gemeint), an welchem allererst Bestimmungen durch das Hinzutreten einer Reflexion gesetzt werden, ist die Grundvoraussetzung der äußeren Reflexion. Dieses Substrat wird als ein Unmittelbares im Sinne eines Gegebenen, eines Vorhandenen, einer toten Grundlage der Reflexion vorgestellt. Insofern ist diese bestimmungslose Unmittelbarkeit, wie sie mit dem reinen Sein den Anfang der Logik macht, die verdinglichte Voraussetzung nicht irgendeiner, sondern der äußeren Reflexion, die gerade deshalb meint, aller bestimmten Voraussetzungen ledig zu sein und sich frei in der Äußerlichkeit gegenüber ihrem Substrat konstituieren zu können Diese Differenz der Reflexion zu dem, was sie unmittelbar voraussetzt, oder die Nichtbeziehung von Unmittelbarkeit und Reflexion, wie sie sich im Anfang der Logik wiederholt, ist der äußeren Reflexion selbst eingeschrieben und genau diese Nichtbeziehung ist das Moment der Unwahrheit, das diese Reflexion an ihr selbst hat und dem sie nach Hegel auch erliegen wird. Bevor ich darauf abschließend zu sprechen komme, möchte ich jedoch festhalten, in welcher Weise der Anfang der Logik, nach meiner Interpretation, auf die äußerliche Reflexion bezogen ist. Er nimmt sie in ihrer extremsten, geradezu bis zur Kenntlichkeit verzerrten Gestalt auf. Er nimmt sie als das, als was sie sich selbst gibt: als ein scheinbar voraussetzungsloses Wollen, das sich seine Voraussetzungen erst schafft, indem es alle bestimmten Voraussetzungen hinwegschafft. Ohne Zweifel liegt für Hegel in dieser formellen Freiheit bereits die absolute Würde und das absolute Recht der Subjektivität. Deshalb erscheint sie auch als abstrakte Vorwegnahme dessen, was sich am Ende der Logik abspielt (wodurch freilich der Anfang eher noch problematischer erscheinen mag), wo wiederum die Willkür wenn auch nicht als formelle auftritt, wenn die Idee sich entschließt, sich in die Äußerlichkeit der Natur zu entlassen. Es kann sogar gesagt werden, daß auch das erste und letzte Wort der Hegelschen Wissenschaft der Logik die Freiheit sei. Und ebenso nach der anderen, der "objektiven" Seite liegt in dem bestimmungslosen Substrat die Vorstellung der Substantialität. Indem beides in der bestimmungslosen Unmittelbarkeit zusammenfällt, wird hier, wenn auch auf unwahre Weise, die Substanz "ebensosehr" als Subjekt vorgestellt. Ein Wahrheitsmoment kann der Anfang nur deshalb beanspruchen, weil Hegel sich nicht mit irgendeiner beliebigen, zufälligen Reflexion ins Benehmen setzen will, sondern mit einer Reflexion, die Zufälligkeit und Willkür zum Prinzip hat. In ihr erst wird, nach dem Wegschaffen des Zufälligen, aus dem der räsonnierende Verstand immer neue Voraussetzungen -
-
-
-
-
-
138
Die
anfangende
Reflexion
gewinnt, die immanente Voraussetzung, das konstitutive Prinzip der äußerlichen Verstandesreflexion schlechthin deutlich. Hegels Zumutung an diese Reflexion besteht darin, daß er ihr ihre eignen, unreflektierten eben unmittelbaren Voraussetzungen vorhält und sie zwingt, diese zur reflektieren. Der Anfang der Logik ist daher der Beginn einer Reflexion auf diejenige Reflexion, durch die der Anfang vermittelt wurde. Er ist in diesem Sinne auch eine anfangende Reflexion, als Reflexion der Reflexion, welche den Anfang gemacht hatte. Er gründet sich auf nichts anderes als auf die Selbstermächtigung der auf die Spitze getriebenen äußeren Reflexion, deren behauptete Voraussetzungslosigkeit als dasjenige ausgesprochen wird, was diese bewußtlos voraussetzt, als ein bestimmungsloses Substrat, Sein, reines Sein Die Reflexion der Reflexion will dazu zwingen, diese bewußtlose Voraussetzung zu reflektieren, indem die Erfahrung gemacht wird, daß dieses Substrat, soll es denn gedacht werden, sich nicht festhalten läßt und schon immer in Nichts nicht übergeht, sondern übergegangen ist. Dieses Nichts ist die unvermittelte Kehrseite der anfänglichen Unmittelbarkeit und dasselbe wie das reine Sein. Der absolute Unterschied, der sich daran auftut, erschließt sich freilich nur demjenigen Bewußtsein, das sich des anfänglichen Seins erinnert und an dem unvermittelten Umgeschlagenen des Seins in Nichts und umgekehrt eine Erfahrung zu machen vermag, die Erfahrung einer fundamentalen Negativität. Erst aufgrund dieser Erfahrung kann jene Reflexion immanent in Gang gesetzt werden, in der das äußerlich reflektierende Subjekt in den Gang der Sache selbst hineingezogen wird. Mein Versuch, der anfänglichen Unmittelbarkeit Plausibilität abzugewinnen, war dem Charakter von Anmerkungen entsprechend auf Aspekte der Problematik des Anfangs der Logik beschränkt und konnte und sollte diesen nicht vollständig rekonstruieren. Aber auch im Rahmen dieser insofern notwendig unzulänglich bleibenden Überlegungen trat das m. E. fundamentale Problem des Anfangs deutlich hervor, nämlich, daß Hegel es unterlassen hat, die anfangende Reflexion in den Anfang der Logik selbst einzutragen, obwohl er das Faktum der Reflexion voraussetzen muß, um den Anfang in die Reflexion einer Reflexion überführen zu können, die dieses Faktum vermittelt. In dieser Hinsicht unterläuft der Anfang selbst die Komplexität der Reflexion, die den Anfang erst macht. In der reflexionslosen Unmittelbarkeit ist sie schlechthin vergessen und getilgt. Und der Verdacht ist nicht von vornherein von der Hand zu weisen, dies geschehe, um dem Anfang in seiner bestimmungslosen Unmittelbarkeit eine spekulativ zu erfüllende Komplexität zuwachsen zu lassen, die sich schließlich als das in ihm Gemeinte wiedererkennen kann, darin aber ebenso ihrer realen Voraussetzung, die den Anfang gemacht hatte, nicht gewahr wird. -
-
...
-
-
139
Anton Friedrich Koch
Sein
-
Nichts
-
Werden
Das erste Kapitel der Wissenschaft der Logik (fortan: WdL) handelt unter der knappen Überschrift "Sein" zunächst (A.) vom reinen Sein, sodann (B.) vom reinen Nichts und schließlich (C.) vom Werden als der (C.l) unruhigen Einheit des Seins und des Nichts, deren Momente (C.2) das Entstehen und das Vergehen sind und die (C.3) in das Dasein als die ruhige, einseitige und unmittelbare Einheit des Seins und des Nichts zusammensinkt. Dies (und das Nähere dazu) gilt es im folgenden zu verstehen mit Hilfe der einzigen operativen Vorgabe, die Hegel erlaubt: daß sich in der WdL reines, streng voraussetzungsloses Denken artikuliere. Zwar kann man Hegels frühere Schrift, die Phänomenologie des Geistes, die den theoretischen Standpunkt des reinen Denkens systematisch entwickelt und theoretisch zu legitimieren versucht, als eine Voraussetzung der WdL lesen. Aber erstens heißt das nicht, daß einzelne Ergebnisse der Phänomenologie in der WdL als Prämissen in Anspruch genommen werden dürften. Zweitens können wir die WdL ganz auf eigene Füße stellen, wenn wir ohne Rücksicht auf die vorherige Legitimation ihres Standpunktes uns schlicht entschließen, es einmal mit dem reinen Denken zu versuchen.1 In diesem wagemutigen Geiste unternommen, wird die WdL zu einem Gedankenexperiment mit offenem Ausgang. Ihre charakteristische Arbeitshypothese daß es ein voraussetzungsloses Denken gibt steht dann zur Disposition als eine Annahme, die sich in der Durchführung erst bewähren muß. Den Eingeweihten gibt die Phänomenologie das Versprechen, daß das Gedankenexperiment, richtig durchgeführt, gelingen wird. Aber wir wollen uns in der Folge als Laien verstehen und die Voraussetzungslosigkeit des reinen Denkens nur als Arbeitshypothese (für ein offenes Experiment) gelten lassen. Um naheliegender Kritik zuvorzukommen, sei sogleich betont, daß nicht wir selber rein und voraussetzungslos denken wollen wo nähmen wir unsere Begriffe und unsere Sicherheit im Urteilen her! Was uns betrifft, so wollen wir vielmehr das reine Denken betrachten. Wir vollziehen es nicht, wir sind es nicht, sondern wir sehen ihm zu. Es ist der Gegenstand unserer Theorie; und nur indirekt, durch es hindurch, erkennen wir seine Gegenstände, darunter als den ersten das reine Sein. (Da aber das reine Denken aus bestimmten Gründen anfangs mit seinem Gegenstand zusammenfällt, betrachten wir im besonderen Fall des Anfangs mit dem Denken zugleich das reine Sein. Davon in Kürze mehr.) Natürlich finden wir das reine Denken nicht faktisch vor als ein Phänomen unter anderen. Wir müssen es theoretisch konstruieren bzw. (gesetzt, das Gedankenexperiment nimmt ein -
-
-
1
Enz. § 78.
Sein
Nichts -
Werden -
gutes Ende) nacnkonstruieren. Um sicherzugehen, daß wir nichts als das reine Denken aufbauen und nicht dies und das Unzugehörige in es hineinkonstruieren, dürfen wir von keiner wesentlichen Prämisse als nur von unserer Arbeitshypothese Gebrauch machen. Diese ist freilich auch stark genug. Vielleicht sogar zu stark, wie manche Kritiker vermuten werden: inkonsistent. Aber hier muß man einmal mehr unterscheiden zwischen der Ebene unserer Theorie und der Ebene des reinen Denkens, zwischen unserer Hintergrundtheorie und der voraussetzungslosen Theorie, die unser Gegenstand ist (der Objekttheorie). Wenn letztere widerspruchsvoll ist, so ist damit erstere noch nicht widerlegt. Tatsächlich wird sich zeigen, daß dem Postulat der Voraussetzungslosigkeit nur durch ein Denken entsprochen werden kann, das in offenem Selbstwiderspruch anhebt. Aber erstens können wir uns von diesem inkonsistenten Denken in unserer Hintergrundtheorie distanzieren; und zweitens werden wir vielleicht Zeugen einer schrittweisen Selbstkorrektur des reinen Denkens und sehen ihm zu, wie es sich aus lauter Schein und Selbstwiderspruch allmählich zur Wahrheit befreit. Am Ende der WdL können wir uns dann vielleicht ganz auf seine Seite schlagen und miterleben, wie unsere Hintergrundlogik mit dem reinen Denken konvergiert. Dies wäre der positive Ausgang unseres Gedankenexperimentes; aber das ist nicht unser Thema. Wir haben es vielmehr mit dem Anfang des Experimentes zu tun, und dem wenden wir uns nun zu.
A. Sein Unser tere
Kapitel beginnt mit einer Art Ausruf oder Anruf: "Sein, reines Sein, ohne alle weiBestimmung." Hier soll offenbar nicht eine(r) von uns, näher Hegel, sondern gleichsam -
das reine Denken selber zu Wort kommen. Alles, was es sagen kann, ist "Sein!"; und von dieser Kurzaussage auf der Ebene des reinen Denkens leitet Hegel nun kommentierend über auf die Ebene der Hintergrundtheorie bzw. (wie er es nennt) der äußeren Reflexion: Wir, als äußerlich Reflektierende, d. h. Hegel und seine Leser, sagen nicht bloß "Sein!"; wir reden artikuliert über das Sein: Es ist rein, ohne alle weitere Bestimmung ohne alle Bestimmung jedenfalls für das voraussetzungslose Denken; nicht jedoch für uns, denn gerade indem wir es als bestimmungslos charakterisieren, bestimmen wir es ja, wenn auch auf eine eher negative und dürftige Weise. Hegel macht noch einige weitere Kernaussagen über das reine Sein. Es ist nicht nur, wie schon erwähnt, (1) unbestimmt, sondern außerdem (2) unmittelbar, (3) unvergleichlich ("nur sich selbst gleich und auch nicht ungleich gegen Anderes") und (4) leer: nichts (kleingeschrieben) ist in ihm anzuschauen oder zu denken. Das Sein ist (5) das leere Anschauen oder Denken selbst. Bezüglich seiner läßt sich also weder das Anschauen vom Denken unterscheiden noch auch das Anschauen und Denken auf der einen Seite vom Gegenstand des Anschauens oder Denkens auf der anderen. Anschauen, Denken und Gegenstand sind vielmehr gänzlich amalgamiert als unbestimmtes, unmittelbares, unvergleichliches, leeres Sein. Angesichts dessen erklärt Hegel das Sein (6) für identisch mit dem Nichts (jetzt großgeschrieben): "Das Sein, das unbestimmte Unmittelbare, ist in der Tat Nichts, und nicht mehr noch weniger als Nichts." Und dieses Fazit nimmt er zum Anlaß, sodann (unter B.) das Nichts zu thematisieren. -
141
Anton Friedrich Koch
Dies alles müssen wir nun
verstehen versuchen als sich ergebend aus der Forderung der strengen Voraussetzungslosigkeit der logischen Objekttheorie. Einschränkend sei angemerkt, daß unser Verständnis vorläufig sein wird. Denn die das Sein charakterisierenden Begriffe der Unbestimmtheit, Unmittelbarkeit, Gleichheit und des Leeren haben einen technischen Status in der WdL, von dem wir am Anfang noch nichts Sicheres wissen können. Wir müssen sie vorerst naiv auffassen und mit dem abgleichen, was sich bezüglich ihrer aus dem Postulat der Voraussetzungslosigkeit ergeben mag. Im Fortgang der WdL wird sich das theoretische Verständnis ihres Anfangs sukzessive vertiefen. Am Anfang selber aber wissen wir nur sehr oberflächlich, was wir tun; wir verstehen nur soviel, wie nötig ist, um anzufangen (und dann zu
geregelt fortzuschreiten). Zum Glück ist die Forderung einer voraussetzungslosen Theorie bzw. eines reinen Denkens ihrerseits eine starke und fruchtbare Voraussetzung. Allerdings dürfen wir keine strittigen philosophischen (oder nicht-philosophischen) Lehrmeinungen mit ihr verbinden. Kein Wort also über die Natur des Denkens und seiner Gegenstände, kein Wort über den ontologischen Status von Theorien, Lehrsätzen, Aussagen! Wir halten nur quasidefinitorisch fest, daß theoretisches Denken ein Fürwahrhalten, ein Erheben von (objektiven) Wahrheitsansprüchen ist. Zunächst als bloße Redensarten und ohne Absicht auf Reifizierung können wir ferner die Termini "Sachverhalt" und "Tatsache" zulassen: Wer einen Wahrheitsanspruch erhebt, legt
sich auf das Bestehen eines Sachverhaltes fest; und ein Sachverhalt, der wirklich besteht, ist eine Tatsache. Eine Theorie nun ist ein Ganzes aus Theoremen, also Aussagesätzen, mittels deren irgendwelche Sachverhalte, die auch nicht bestehen könnten, als bestehend, d. h. als Tatsachen ausgesagt werden. Wir fragen also: Welcher Sachverhalt läßt sich voraussetzungslos sowohl erfassen wie auch als bestehend einsehen? Nun, damit er voraussetzungslos erfaßt werden kann, muß er sich unmittelbar darbieten, d. h. so, daß ich nicht erst einen anderen Sachverhalt erfassen und von diesem aus im Denken fortschreiten muß. Damit wäre das Merkmal der Unmittelbarkeit bereits in abstracto hergeleitet, bevor wir noch wissen, was denn nun das reine Sein eigentlich ist. Nun könnte es freilich mancherlei Unmittelbares geben, hier eines, da eines usw. (wie für die sinnliche Gewißheit im Anfangskapitel der Phänomenologie des Geistes). Man müßte dann aber auf jedes dieser Unmittelbaren einzeln Bezug nehmen können was jeweils voraussetzungsvoll wäre. Und man müßte sicher sein können, daß man alle und nur die relevanten Unmittelbaren erfaßt hat was ein Aufzählungsverfahren für die logischen Gegenstände noch vor der Logik erforderlich machte, so daß diese auch insofern nicht mehr voraussetzungslos wäre. Um der Voraussetzungslosigkeit willen müssen wir also fordern, daß es nur ein einziges Unmittelbares für das reine Denken geben kann. Mit dem Gedanken dieses einzigen Unmittelbaren muß das reine Denken bzw. die logische Objekttheorie beginnen, und alles Weitere, was es bzw. sie denkt, muß sich in Beziehung auf dieses eine Unmittelbare -
-
zwingend ergeben.
Natürlich muß der Anfangsgedanke an dieses singuläre Unmittelbare und der Wahrheitsanspruch, der mit diesem Gedanken erhoben wird, jenseits der Möglichkeit und der Notwendigkeit einer Begründung stehen. Was ich begründen kann, das kann ich ebenso in Frage stellen; also muß ich es auch begründen. Was ich aber begründen muß, daß gilt nicht streng voraussetzungslos. Das singuläre Unmittelbare des Denkens muß also etwas sein, das mit jedem 142
Sein
Werden
Nichts -
-
Wahrheitsanspruch rein als solchem immer schon mitbeansprucht wird. Mit anderen Worten, der Anfangsgedanke der Logik darf nicht diesen oder jenen, d. h. keinen bestimmten Wahrheitsanspruch erheben, sondern er muß den Wahrheitsanspruch überhaupt erheben, das neutrale gemeinsame Wesen aller verschiedenartigen Wahrheitsansprüche, die je erhoben werden
können. Gedacht oder gesagt wird also zunächst nur "das, was alle Sätze, ihrer Natur nach, miteinander gemein haben. Das aber ist die allgemeine Satzform." Diese Formulierung stammt aus einem ganz anderen theoretischen Kontext, aus Wittgensteins Logisch-philosophischer Abhandlung (Ziffer 5.47). Die allgemeine Satzform oder das Wesen des Satzes, so lehrt Wittgenstein, ist zugleich die allgemeine Form der Wirklichkeit bzw. das Logische bzw. die "Eine logische Konstante", die sich im Satzgebrauch als solchem zeigt. Da sie sich in wahren und falschen Sätzen gleichermaßen zeigt, ist sie völlig neutral und unbestimmt. Weil nichts Bestimmtes mit ihr in Anspruch genommen wird, kann auch nichts Falsches beansprucht werden. Niemand kann die logische Konstante als nichtig zurückweisen; denn indem er das zu tun versuchte, nähme er sie ja selber insofern in Anspruch, als er einen Wahrheitsanspruch erheben würde. Die Eine logische Konstante als das gemeinsame Wesen aller bestehenden und nicht-bestehenden Sachverhalte und weiter dieses gemeinsame Wesen seinerseits als ein bestehender Sachverhalt genommen, aber dann als ein ausgezeichneter, unvergleichlicher, als der übermäßige Sachverhalt, ist so etwas wie die Platonische Idee des Sachverhaltes, ist der wie Piaton sagen würde Sachverhalt selbst und zugleich die Tatsache selbst. Wir können ihn (bzw. sie) kurz das Sein nennen. Vom Sein, rein für sich, d. h. als reines Sein betrachtet, gilt dann, was Hegel sagt: Es ist (1) unbestimmt und (2) unmittelbar. Ferner bietet es sich dem Denken als das alternativelose Unmittelbare dar, und das führt uns nun zum dritten Punkt unserer Liste, der Unvergleichlichkeit des reinen Seins. Sachverhalte sind im allgemeinen propositional gegliedert. Selbst noch für den einfachsten Fall, den der singulären Proposition bzw. den der prädikativen Aussage, ist eine Zweiheit von Einzelnem und Allgemeinem bzw. eine Bifunktionalität von Bezugnahme-auf-etwas und Charakterisierung-a/i-soundso unabdingbar. Diese Minimalgliederung durch das propositionale oder apophantische Als aber ist im reinen Sein unterschritten. Wir werden das im Fortgang noch deutlicher sehen; aber schon jetzt läßt sich folgendes festhalten. Da jeder Satz an seiner Negation unweigerlich eine Alternative hat, darf das reine Sein gar nicht durch einen Satz (ein Theorem) zum Ausdruck gebracht werden können. Der absolut alternativelose Sachverhalt ist demnach nicht satzartig gegliedert und nicht aussagbar, ist keine Proposition, sondern ein seltsamer Sachverhalt noch unterhalb der logischen Minimalgliederung in Einzelnes und Allgemeines, ein logisches Einfaches. Solche vorpropositionalen Sachverhalte werde ich in der Folge Ursachverhalte nennen und propositionale Sachverhalte kurz Propositionen. Das reine Sein also ist ein Ursachverhalt, und zwar näher ein unmittelbarer und zudem singulärer (weil alternativeloser) Ursachverhalt, demnach nicht einer unter vielen, wie etwa sinnliche Gegebenheiten als Vielheit unmittelbarer Ursachverhalte aufgefaßt werden könnten, sondern ein einfaches Singularetantum und daher unvergleichlich in einem sehr strengen Sinn. Die Proposition, daß Sokrates weise ist, hat etwas gemeinsam sowohl mit dem Sachverhalt, daß Piaton weise ist, als auch mit dem Sachverhalt, daß Sokrates klein ist. Was in eine Proposition eingeht, ist mit anderem vergleichbar. Ebenso sind Propositionen aufgrund ihrer logischen Gliederung mit anderen Propositionen vergleichbar. Das reine Sein hingegen -
-
143
Anton Friedrich Koch
in seiner unbestimmten Unmittelbarkeit ist gänzlich ungegliedert. Es schließt kein Allgemeines und kein Einzelnes ein, die in weiteren Sachverhalten vorkommen könnten, auf welche das Sein dann kraft solchen Vorkommens bezogen wäre. Es ist daher keinem anderen, gewöhnlichen Sachverhalt hierin gleich oder darin ungleich, sondern eben, in Hegels Worten, "nur sich selbst gleich und auch nicht ungleich gegen Anderes". D. h. es ist logisch abgekapselt gegen alles Übrige, eine, wenn man es so nennen will, logische Singularität. Diese logische Singularität ist der homogene logische Raum selber. Unter dem logischen Raum verstehen wir den Inbegriff alles Denkbaren, d. h. aller Sachverhalte. In seiner Homogenität aber ist er unstrukturiert, leer. Es wird nichts, kein Sachverhalt in ihm gedacht oder angeschaut. So wären wir denn über den dritten beim vierten Punkt unserer Liste angelangt. Allerdings bedarf das Entfallen der Differenz zwischen Denken und Anschauen noch einer gesonderten Begründung, und diese wird uns dann ohne Umschweife zum fünften Punkt der Liste führen. Indem wir einen Wahrheitsanspruch erheben, behaupten wir, daß ein bestimmter Sachverhalt besteht, daß dies oder das der Fall ist. Das Bestehen von Sachverhalten bzw. das DerFall-Sein heißt auch das veritative Sein im Unterschied zu anderen Formen des Seins wie etwa dem prädikativen Sein, das in der Kopula ausgedrückt wird, oder dem Sein im Sinne von Existenz. Nun ist im Wahrheitsbegriff eine Tendenz zum Realismus angelegt: Unsere primären Wahrheitsansprüche sind Ansprüche auf objektive Geltung, und sofern sie das sind, wollen wir sie Urteile nennen. Etwas ist objektiv der Fall, wenn es der Fall ist unabhängig von meinem Urteil, daß es der Fall ist. Aus dieser Unabhängigkeit folgt, daß im Akt des Urteilens wesentlich die Möglichkeit des Irrtums eröffnet ist. Denn wenn aus dem Vollzug des Urteils schon seine Wahrheit folgte, dann bestünde der behauptete Sachverhalt nicht unabhängig vom Urteilsakt, also nicht objektiv. Was objektiv der Fall sein soll, muß demnach auch nicht-der-Fall-sein können. Zum Urteil gehört wesentlich die Möglichkeit der Falschheit, das Wahr-oder-falsch-Sein, die Zweiwertigkeit. Die Zweiwertigkeit aber (bzw. unsere durchgängige Fehlbarkeit im Urteilen) ist der Grund der zuvor festgestellten Zweigliedrigkeit selbst noch der einfachsten Proposition bzw. kürzesten Aussage. Die Entdeckung dieses Zusammenhangs verdanken wir Piaton. Im Sophistes fragt er nach der Möglichkeit des täuschenden Scheins und kommt zu dem Ergebnis, daß es die synthetische, d. h. die prädikative Struktur unserer Rede ist, die es uns erlaubt, uns einerseits erfolgreich auf etwas zu beziehen (somit etwas zu denken) und uns andererseits bezüglich des gegebenen Bezugsobjektes zu täuschen, also etwas Falsches über es zu denken, somit einen nicht bestehenden Sachverhalt zu erfassen. Wie wenig trivial diese Platonische Entdeckung ist, zeigt sich nicht nur daran, daß die eleatische Philosophie das Gegenteil annahm: was nicht ist, nicht der Fall ist, das kann dem Parmenides zufolge auch nicht gedacht werden. Es zeigt sich vielmehr auch daran, daß Piatons Entdeckung für allfällige Ursachverhalte nicht gilt. Für Ursachverhalte, demnach auch für das reine Sein, gelten weiterhin die alten, eleatischen Gesetze. Was das heißt, hat Aristoteles im Theta der Metaphysik, Kapitel 10, dargelegt. Sein im Sinne von Wahrsein, so rekapituliert er zunächst die Platonische Entdeckung, bedeutet im allgemeinen Verbundensein, Eines-Sein. Die Urteilssynthesis stiftet Zweiwertigkeit, Irrtumsmöglichkeit, Objektivität. Aber die Synthesis scheint doch auf Einfaches, die Proposition auf atomare Ursachverhalte zu verweisen; und so fragt Aristoteles weiter:
144
Werden
Nichts
Sein -
-
"Was bedeutet nun aber bei dem Unzusammengesetzten Sein und Nicht-sein, Wahr und Falsch? Denn dies ist ja nicht zusammengesetzt, so daß es wäre, wenn es verbunden, nicht wäre, wenn es getrennt wäre" (1051b, 17-20).
Die Antwort lautet (und muß lauten), daß einfache Ursachverhalte keinen Ansatzpunkt für möglichen Irrtum bieten. Sie sind logische Atome, dem Denken entweder völlig verborgen oder aber irrtumsimmun offenbar. Hier also, unterhalb der Satzebene, steht die Wahrheit, als Unverborgenheit, jenseits des Kontrastes zur Falschheit. Ursachverhalte werden demnach nicht ausgesagt, sondern, wie Aristoteles sich ausdrückt, im Denken berührt, in einer Art intellektueller Anschauung, und wenn es denn zur Verlautbarung kommt, allenfalls "gesagt" im Sinne von genannt. Das alles gilt für das reine Sein, von dem wir nun einsehen, daß es nur berührt und genannt werden kann: "Sein, reines Sein, ohne alle weitere Bestimmung", und ferner daß bezüglich seiner das Denken die Form eines vorpropositionalen Anschauens annimmt. Das veritative Sein (oder Bestehen) von Propositionen hingegen ist prädikativ, und dieses notwendige Zusammenfallen von veritativem Sein und prädikativem Sein führt zur Abspaltung einer anderen Form des Seins: der Existenz, die sich von der Proposition löst und mit der Subjektstelle verknüpft. Quine, dem schärfsten Kritiker der Propositionen, ist also zuzustimmen, daß Propositionen nicht eigentlich existieren. Sie haben ihr Bestehen oder NichtBestehen nicht an ihnen selber, sondern an anderem, an existierenden Gegenständen, und zwar entweder, als singuläre Propositionen, an je einzelnen Gegenständen oder, als generelle Propositionen, an der Gesamtheit aller einzelnen Gegenstände. Im Fall der Ursachverhalte andererseits ist das veritative Sein nicht prädikativ. Also kann sich hier die Existenz nicht vom Wahrsein, Der-Fall-Sein, Bestehen ablösen. Folglich entfällt die Möglichkeit nicht-bestehender Ursachverhalte: Sofern ein Ursachverhalt denkend erfaßt wird, besteht er auch. Die Möglichkeit der Täuschung und der Falschheit ist für diesen Bereich ausgeschlossen, und die Bedingungen der Objektivität sind unterschritten. Das aber führt uns nun zum fünften Punkt der Liste. Wenn die Bedingungen der Objektivität im Falle des reinen Seins unterschritten sind, dann ist dieses nicht unabhängig von dem Denken oder Anschauen, in dem es erfaßt wird; dann kann das Denken bzw. Anschauen sich von seinem Gegenstand nicht distanzieren. Unterhalb der Zweiwertigkeit gibt es keinen Raum für die Geltungsdifferenz, d. h. die Differenz von (objektivem) Sein und (subjektivem) Schein, demnach keine Möglichkeit für den Vollzug der Urteilsenthaltung oder Epoche, demnach auch keine Möglichkeit für die Ich-denke-Begleitung. Kant schließt, ganz im Sinne dieser Überlegung, umgekehrt von der Ubiquität der Möglichkeit der Ich-denke-Begleitung auf die Unmöglichkeit atomarer sinnlicher Sachverhalte und weiter auf die Ubiquität des propositionalen Als im sinnlich gegebenen Mannigfaltigen zu Recht; denn Kants Gegenstand ist das diskursive Denken (in Beziehung auf sinnliche Anschauungen). Für das reine Denken aber, das es gemäß unserer Arbeitshypothese doch auch gibt, oder vielmehr für dessen uranfängliches Sich-Regen, gelten andere nämlich, wie schon gesagt, die alten eleatischen Gesetze. Erst zu Beginn der Wesenslogik wird so etwas wie die vertraute Geltungsdifferenz im reinen Denken operativ werden. So fehlt nur noch der sechste Punkt unserer Liste der Kernaussagen über das reine Sein: das (reine) Sein ist das (reine) Nichts. Hier gilt es aufzupassen, daß wir nicht in den Verdacht eines Fehlers kommen, den mancher Absolvent des Logik-Gundkurses gerne dem großen -
-
-
-
145
Anton Friedrich Koch
Hegel in die Schuhe schöbe. Wir alle wissen, daß und wie das kleingeschriebene "nichts" in die Negation und den Existenzquantor aufzulösen ist. Es führt also kein einfacher Weg (sondern allenfalls ein ausgetüftelter Umweg) vom kleingeschriebenen zum großgeschriebenen
"Nichts" außer etwa ein schierer Taufakt. Denn natürlich kann uns niemand verwehren, das Sein (weil nichts in ihm anzuschauen oder zu denken ist oder aus welchem Grund auch immer) "das Nichts" zu nennen. Aber eine bloße Umbenennung gäbe keinen Stoff für einen neuen Textabschnitt unter der Überschrift "B. Nichts" her. Ganz offenkundig glaubt Hegel, daß ein unabhängiger Zugang zu einem logischen Ursachverhalt Nichts besteht und daß es kein Verbalmanöver, sondern eine Entdeckung ist, welche die Gleichsetzung dieses Sachverhaltes mit dem reinen Sein erlaubt. Diesen unabhängigen Zugang gilt es nun zu finden, und zu diesem Zweck will ich im folgenden zwei Wege beschreiten. Der zweite, weniger direkte Weg wird über den Nachfolgersachverhalt des Seins führen, der nicht das Nichts, sondern das Werden ist (das die beiden logisch "gleichzeitigen" Sachverhalte Sein und Nichts beerbt). Vom Sein zum Werden kommen wir dabei über die Operation der Negation; und das Nichts wird dann erst nachträglich "zwischen" das Sein und das Werden interpoliert. Der direktere Weg zum Nichts, den ich als ersten beschreiten will, paßt besser zu Hegels Text. Er führt vom kleingeschriebenen "nichts" in Beziehung auf das Sein zu dem großgeschriebenen Nichts. Und dieses motiviert dann den Fortgang zum Werden, der im anderen, erstgenannten Fall nur Postulat ist (damit die voraussetzungslose Theorie nicht steril bleibe). Daher nun zunächst unter "B. Nichts" der direkte Weg; dann unter "C Werden" auch der indirek-
-
-
te
-
-
(postulative, interpolative).
B. Nichts Unsere nächsten Aufgaben sind es (i), die Rede von dem Nichts unabhängig vom Bisherigen als sinnvoll zu legitimieren. Sodann wird (ii) zu prüfen sein, ob das Sein sich als identisch mit dem so verstandenen Nichts zeigt (Punkt 6 der vorigen Liste). Darauf müssen wir uns wieder dem Nichts zuwenden und (iii) Hegels Kernaussagen über es nachvollziehen, darunter insbesondere (iv) die Aussage, es sei "dasselbe, was das reine Sein ist": sie muß nun auch vom Nichts her einleuchten. Wenn wir dann sowohl das Sein als das Nichts wie auch umgekehrt das Nichts als das Sein erwiesen haben, haben wir als ihre Einheit zumindest dem Namen nach schon das Werden hergeleitet, das in der Folge zu betrachten sein wird. Parmenides hat neben dem Sein keinen zweiten Ursachverhalt zulassen wollen. In gewissem Sinn tritt er also für eine Kurzversion der Logik ein: "Sein!" Der Rest seines Lehrgedichtes sind, Hegelisch gesprochen, äußere Reflexionen, deren methodologischer Status höchst prekär ist; denn alles dem Sein Äußere ist nicht, ist bloßer Schein, also auch wir und unsere Reflexionen. Man kann Parmenides diesen Seinsmonismus kaum verdenken, wenn man sich auf Ursachverhalte einmal eingelassen hat. Denn ein schlechthin einfacher Sachverhalt außer dem Sein wäre seinsfrei man könnte ihn insofern, wenn es genau einen davon gäbe, in der Tat als das Nichts bezeichnen. Und dieser seinsfreie Ursachverhalt müßte gleichwohl bestehen, d. h. sein. Denn für Ursachverhalte fallen Existenz und Bestehen ja zusammen. Dann aber wäre der angenommene Ursachverhalt nicht seinsfrei, entgegen seiner Einführung ein Widerspruch. Also (schloß Parmenides und muß jeder widerspruchsscheue -
-
146
Sein
Nichts
-
Werden
-
Mensch schließen) kann es ihn in keinem Sinn geben. Wenn es aber neben dem atomaren Sein nichts Atomares und Unmittelbares gibt, dann gibt es keine weiteren Bausteine für molekulare Sachverhalte. Also bleibt es beim reinen Sein als dem ewigen All-Einen. Auch der Hegelschen Logik zufolge kann es neben dem Sein kein weiteres Unmittelbares geben. Aber die Logik lehrt gemäß Punkt 6 unserer Liste -, daß dieses eine Unmittelbare, für sich genommen, zugleich das Nichts und insofern selber schon das gleichsam zweite Unmittelbare wäre. Sie nimmt den damit verbundenen Widerspruch in Kauf und löst ihn in der Hintergrundlogik auf, indem sie ihn als Reductio ad absurdum des reinen Seins und des reinen Nichts liest: Keines dieser beiden existiert rein und für sich; sie kommen nur in unauflöslicher Einheit vor. Der objektlogische Widerspruch aber, der im Gedanken dieser Einheit weiterhin liegt, ist der Widerspruch des Werdens, in den nicht wir uns verwickeln, sondern vorübergehend das reine Denken, das ihn ebenfalls auflöst, nämlich durch den Übergang zum Dasein. Das Werden nämlich ist, wie wir noch sehen werden, die instabile, nichtige Einheit des Seins und des Nichts, d. h. ihre Einheit unter der Führung des Nichts. Und diese nichtige Einheit sinkt ohne weiteres in ihre seiende, vergleichsweise stabile Einheit zusammen, die unter der Führung des Seins steht und Dasein heißt. Nach diesen Präliminarien und Erinnerungen also jetzt zur Sache, d. h. (i) zur Einführung des Nichts und (ii) zu dem Nachweis, daß und inwiefern das reine Sein bereits das Nichts wäre. Im Kontext des Propositionalen verbietet sich die reifizierende Rede von dem Nichts. "Nichts ist F' bzw. "Es gibt nichts, das F ist" heißt: Es ist nicht der Fall, daß es etwas gibt, das F ist. "Nichts" darf also nicht aufgefaßt werden nach Analogie eines Eigennamens. "Nichts ist vollkommen" und "Gott ist vollkommen" sind Sätze mit ganz unterschiedlicher logischer Grammatik, jener hat die Form "-(3x)(Fx)", dieser die Form "Fa". Die logische Grammatik der Quantifikationstheorie (bzw. Prädikatenlogik) läßt keinen Raum für ein reifiziertes Nichts. Immerhin gestattet sie aber, den Satz zu formulieren: "Es gibt nichts", oder jedenfalls einen äquivalenten Satz: "Es gibt nichts, das mit sich identisch ist" (und daher, da alles mit sich identisch ist, schlechthin nichts): "-(3x)(x=x)". Diesen Gedanken daß es nichts gibt können wir offenbar fassen i. S. v. erwägen. Leibniz hat ihn erwogen, als er seine metaphysische Grundfrage stellte: "Warum gibt es überhaupt etwas und nicht vielmehr nichts?"2 Der Gedanke freilich, daß es u. U. gar nichts geben könnte, ist überaus befremdlich. Denn wenn es nichts gibt, so muß es doch wenigstens den Sachverhalt geben, daß es nichts gibt. Zwar ist das noch kein ernsthafter Widerspruch. Denn der Sachverhalt, daß es nichts gibt, ist eine generelle Proposition; und wir haben gesehen, daß Propositionen keine eigene Existenz beanspruchen können. Vielmehr hat die generelle Proposition, daß es nichts gibt, ihr offenkundiges Nichtbestehen an der Gesamtheit der existierenden Gegenstände. Doch nun fragen wir nach weiteren Implikationen des befremdlichen Sachverhaltes: Was müßte der Fall sein, wenn er bestünde? Nach Voraussetzung gäbe es in diesem Falle nichts, woran der Sachverhalt sein Bestehen haben könnte. Er müßte also an sich selbst bestehen, d. h. die sonst generelle Proposition, daß es nichts gibt, würde im Falle ihres Bestehens zu einem existierenden Ursachverhalt schrumpfen. Diesen Ursachverhalt aber können wir benennen, z. B. naheliegenderweise -
-
-
-
-
-
-
2
Principes de la Nature et de la Grace fondés en Raison. Ziffer 7. 147
Anton Friedrich Koch
als das Nichts. Das Nichts ist folglich derjenige Ursachverhalt, der bestehen und ipso facto existieren würde, wenn es nichts gäbe, insbesondere auch keine Ursachverhalte. Das Nichts ist demnach ein in sich widersprüchlicher, folglich nicht bestehender, folglich nicht existierender Ursachverhalt. Letzteres aber wissen nur wir, auf der Ebene der Hintergrundtheorie. Das reine Denken hingegen will (noch) das Unmögliche: das reine Nichts denken. Denn es will das reine Sein denken, und das reine Sein ist das Nichts, wie wir sogleich zeigen wollen. Wir haben nun die Rede von dem Nichts eingeführt, allerdings zugleich mit einem offenen Widersprach. Wenn es nichts (kleingeschrieben) gäbe weder Gegenstände noch Ursachverhalte und wenn infolgedessen auch nichts (kleingeschrieben) der Fall wäre, wenn somit der logische Raum völlig leer wäre, dann würde das Nichts (großgeschrieben) existieren, und zwar eben da der logische Raum leer wäre als der seiende logische Raum selber. Der Raum also würde auch dann noch existieren als das Nichts -, wenn nichts (kleinlogische existierte. Das ist der Widerspruch, vor dem Parmenides sich scheute. geschrieben) Die Rede von dem Nichts wäre demnach zwar sinnvoll, aber inkonsistent, etwa wie die Rede von dem gegenwärtigen kahlen und nicht-kahlen König von Frankreich (um ein bekanntes Russellsches Beispiel zu variieren). Parmenides hätte also recht gehabt, die affirmative Rede vom Nichts zu scheuen. Aber in einem anderen Sinne hatte er unrecht. Denn und das ist der springende Punkt wem gelänge, was Parmenides und die Objektlogik versuchen: das reine Sein zu denken, dem geschähe es unter der Hand, daß er ipso facto das Nichts dächte. Denn das reine Sein ist der logische Raum selber, seiend und zugleich leer, und gerade dies war das skizzierte selbstwidersprüchliche Nichts. Das reine Sein, so sehen wir, ist in der Tat "nicht mehr noch weniger als [das] Nichts". Parmenides kann also den Kuchen nicht behalten und essen zumal. Wenn er sich das reine Sein genehmigt, dann ipso facto (obwohl ihm das nicht klar ist) auch das Nichts und dessen Selbstwiderspruch. Nun (iii) zu Hegels weiterem Text. Das Nichts, so lesen wir, ist einfache Gleichheit mit sich. Wir sehen den Grand: es hat als der leere logische Raum keine Struktur, keinerlei interne Komplexion, die es beziehbar und vergleichbar machte. Es ist vollkommene Leerheit, Bestimmungs- und Inhaltslosigkeit; denn es ist eben der leere logische Raum. Bezüglich Denken und Anschauen fügt Hegel hinzu: -
-
-
-
-
-
-
-
"Insofern Anschauen oder Denken hier erwähnt werden kann, so gilt es als ein Unterschied, ob oder nichts [kleingeschrieben] angeschaut oder gedacht wird. Nichts Anschauen oder Denken hat also eine Bedeutung; beide werden unterschieden, so ist (existiert) Nichts [großgeschrieben] in unserem Anschauen oder Denken; oder vielmehr ist es das leere Anschauen oder Denken selbst; und dasselbe leere Anschauen oder Denken als das reine Sein." etwas
Nichts anschauen oder denken heißt das will Hegel sagen nicht einfach: nicht anschauen oder denken. Wer die Sehkraft in totaler Finsternis ausübt, ist in einer anderen Lage als ein Blinder oder als ein Schlafender. Er findet sich, immerhin, nichts sehend, in unterschiedsloser Nacht. (Daß es ihm in ungetrübter Helle nicht besser ginge, weist auf die Verwandtschaft des reinen Seins und des Nichts.) Das leere Denken oder Anschauen ist wie jenes Sehen noch ein Grenzfall von Kognitivität. Und diese leere Kognitivität ist, oder besser: wäre, das reine Sein bzw. das Nichts. Sie wäre es, wenn es sie denn gäbe. Es folgt im Text (iv) die Gleichsetzung des Nichts mit dem Sein (nun vom Nichts her); und auch das ist jetzt nachvollziehbar. Das Sein, so hatten wir gesehen, ist der leere logische -
148
-
Sein
Werden
Nichts -
-
Raum, also identisch mit dem Nichts. Ebenso gilt umgekehrt: Wenn wir nach dem Inhalt
des inkonsistenten Gedankens des Nichts fragen, dann zeigt es sich als dasselbe wie das Sein. Denn der Gedanke des Nichts verlangt einen logischen Raum für sein eigenes Vorkommen, aber einen vollkommen leeren logischen Raum. Das aber ist das reine Sein. Vom Sein her entdecken wir seine Einheit mit dem Nichts, vom Nichts her dessen Einheit mit dem Sein. Diese Einheit und Selbigkeit des Seins und des Nichts bei fortbestehender Unterschiedenheit nennt Hegel das Werden.
C. Werden Im Textabschnitt C. 1 ("Einheit des Seins und Nichts") hebt Hegel zuerst die soeben erwiesene Selbigkeit des reinen Seins und des reinen Nichts hervor, darauf ihre (absolute) Unterschiedenheit. Die Selbigkeit legt er sogleich kinetisch aus: als Übergehen oder vielmehr des Seins in Nichts und des Nichts in Sein. Der kinetische Aspekt wird sodann verstärkt durch die nachfolgende Betonung der fortbestehenden "ebensosehr" wahren, also gleichberechtigten Unterschiedenheit des Seins und des Nichts. Das ist noch zu wenig gesagt. Der kinetische "Aspekt" wird vielmehr zum Ganzen, zu dem zu denkenden Ursachverhalt des Werdens (der kinesis selbst): Die Wahrheit des Seins und des Nichts, sagt Hegel am Schluß von Cl, sei die "Bewegung des unmittelbaren Verschwindens des einen in dem anderen: das Werden, eine Bewegung, worin beide unterschieden sind, aber durch einen Unterschied, der sich ebenso unmittelbar aufgelöst hat". Durch die Reductio ad absurdum des reinen Seins und des reinen Nichts ist offenbar die Arbeitshypothese eines voraussetzungslosen Denkens nicht gleichfalls ad absurdum geführt worden. Vielmehr macht das reine Denken seine Not insofern zur Tugend, als es statt des reinen Seins und des reinen Nichts deren widersprüchliche Einheit denkt, die kinetisch zu fassen und als die logische Grundgestalt des Werdens anzusehen ist. Absehbar ist bereits, daß als Motor des Werdens der Widerspruch fungieren soll: die widersprüchliche Einheit von a und b ist deren kinetische Einheit, ein Übergehen von a nach b bzw. umgekehrt. Ohne weiteres klar dürfte auch sein, daß die kinetische Einheit des reinen Seins und des reinen Nichts (das Werden) nicht deren Aggregat oder mereologische Summe sein kann. Denn ein Ganzes, das die mereologische Summe seiner Teile ist, steht und fällt mit diesen. Wenn es also kein reines Sein und kein reines Nichts gibt, dann auch nicht ihre mereologische Summe. Folglich darf das Werden nicht mereologisch, sondern muß holistisch ausgelegt werden: als ein Ganzes, das den Primat vor seinen "Teilen" hat, die insofern gar keine Teile, sondern unselbständige Momente sind. Dies ist die These von Abschnitt C.2 ("Momente des Werdens: Entstehen und Vergehen"). Bei der Betrachtung des Nichts haben wir gesehen, daß schon im Denken des Seins der Widerspruch, die Negativität, das Nichts regiert. Unter seiner Herrschaft ist die Einheit des Seins und des Nichts selber widersprüchlich. Zum Widerspruch aber gehören Zwei: zwei gleichberechtigte, miteinander unverträgliche Seiten. Daher die Unterschiedenheit des Seins und des Nichts, die ihrerseits im Widerspruch zu ihrer Einheit (unter der Herrschaft des Nichts) steht.
Übergegangensein
-
-
149
Anton Friedrich Koch
Würde das Sein regieren (wie vermeintlich ganz zu Anfang, als wir auf das Nichts noch nicht geachtet hatten), so wäre von der Unterschiedenheit des Seins und des Nichts, somit vom Widerspruch abstrahiert. Die Einheit von Sein und Nichts wäre einseitig als seiend ausgelegt und die Negativität des Nichts erschiene entschärft. Man wird hier einerseits an Tarskis Entschärfung des Wahrheitsbegriffs durch systematische Abstraktion von dessen "antinomogenen" Eigenschaften erinnert, andererseits, in ganz anderer Hinsicht, an die alte Grunddualität des Empedokles: von Liebe (Freundschaft) und Streit (Haß). Die Liebe ist der paternalistische Thronprätendent, der Streit ein egalitärer Jakobiner. Setzt sich die Liebe durch, so herrscht sie allein, der Streit wird liebevoll unterdrückt. Ruhe und Einheit sind die Folge. Setzt sich jedoch der Streit durch, so stehen sich Liebe und Streit als gleichberechtigte Kombattanten gegenüber. Bewegung und Zweiheit sind die Folge. In der Liebe von Liebe und Streit dominiert einseitig die Liebe; im Streit von Liebe und Streit wirken beide gleichermaßen. So auch hier. Das Nichts ist der Demokrat; unter seiner Herrschaft herrscht das Sein gleichberechtigt mit: im Werden. Aber in C.3 ("Aufheben des Werdens") zeigt sich, daß das Werden instabil und selbstzerstörerisch ist in seiner Widersprüchlichkeit: "eine haltungslose Unruhe, die in ein ruhiges Resultat zusammensinkt". Das Sein gewinnt also die Oberhand, Ruhe kehrt ein, es resultiert das Dasein. Vom Widerspruch ist im Dasein abstrahiert; d. h. aus den antinomogenen Eigenschaften der Einheit von Sein und Nichts werden keine Schlußfolgerungen gezogen, sie werden theoretisch brachgelegt. Jedenfalls zunächst. Die Logik des Daseins aber beruht darauf, daß die Abstraktion schrittweise wieder rückgängig gemacht wird und der Widerspruch wieder sein Recht bekommt. Wenn das so etwas wie eine summarische Kurzversion der Logik des Werdens war, so bedarf es nun einer ausführlicheren, argumentierenden Version. In dieser Absicht schlagen wir den angekündigten alternativen Weg zur Einführung des Nichts ein. Wir kehren also zurück zum reinen Sein als dem (vermeintlich) unmittelbaren Ursachverhalt des reinen Denkens, stellen uns unwissend gegen dessen bereits erfolgte Reductio ad absurdum und fragen, angeleitet durch unsere Arbeitshypothese, nach einem möglichen Fortgang des reinen Denkens über das einfache Sein hinaus. Als erstes möchte ich in abstracto zeigen, daß dieser Fortgang nicht nur ein Fortgang unserer Einsicht bzw. der Darstellung, sondern ein Fortgang des reinen Denkens und somit der Sache selber sein muß, daß somit eine ursprüngliche Prozessualität eine kinesis -, zwar noch nicht als Thema, wohl aber als Verfassung des reinen Denkens und zugleich als Verfassung seiner Sachverhalte ins Spiel kommt, von denen es ja zunächst gar nicht ablösbar ist. Damit wir dem reinen, streng voraussetzungslosen Denken etwas zu denken geben konnten, mußten wir ein gemeinsames Wesen aller bestehenden und nicht bestehenden Sachverhalte postulieren, gleichsam die Platonische Idee des Sachverhaltes oder den Sachverhalt selbst, genannt das reine Sein. Dieses reine Sein allein (sonst nichts) sollte vom reinen Denken zu Beginn betrachtet und erfaßt werden. Der logische Raum des reinen Denkens wäre demnach anfangs ganz eintönig. Er ist nicht unser logischer Raum, nicht der entwickelte Inbegriff aller Möglichkeiten und aller logischen Wahrheiten; denn dieser logische Standardraum wäre zu groß. Zu vieles Denkbare böte sich da an, zwischen dem zu wählen wäre, und insbesondere zu jedem Denkbaren sein kontradiktorisches Gegenteil. Das voraussetzungslose Denken darf hingegen keine Wahl haben, für die es sich ja stets zu rechtfertigen hätte, sondern muß einen Sachverhalt erfassen, zu dem es keine Alternative gibt. Dazu bedarf es eben -
-
150
Nichts
Sein -
Werden -
eines ganz primitiven, nämlich völlig homogenen logischen Raumes, der von diesem ausgezeichneten Sachverhalt ganz ausgefüllt wird bzw. mit ihm zusammenfällt. Es ist aber auf Anhieb klar, daß es bei diesem primitiven logischen Raum nicht bleiben kann. Erstens hat er mit unserem logischen Raum kaum etwas zu tun, und wir müßten uns fragen, warum wir uns mit einem solchen Unikum überhaupt in der Theorie beschäftigen sollten, wenn sich keine Verbindungslinien zum logischen Standardraum zeichnen ließen. Zweitens (damit zusammenhängend) bliebe ja das reine Denken als bloßes Erfassen des ungetrübten logischen Nichtstandardraumes steril, homogen, ungegliedert und könnte keine nennenswerte Theorie aus sich freisetzen. Indem das Denken den ersten Sachverhalt (das reine Sein) erfaßt, der absolut alternativelos, ohne Konkurrenz im logischen Raum und dieser logische Raum selber ist, muß demnach ein zweiter Sachverhalt sich zeigen, der relativ zu dem ersten alternativelos ist, und so fort. Das aber bedeutet, daß der logische Raum des reinen Denkens in einem logischen, prätemporalen Sinn dynamisch ist und daß die reinen Gedanken im selben Sinn indexikalische, nicht ewige Gedanken sind. (Indexikalische Gedanken bzw. Sätze haben einen variablen, ewige Gedanken und Sätze einen konstanten Wahrheitswert. Der Satz etwa: "Es regnet (jetzt hier)", ist wahr oder falsch je nach dem Ort und der Zeit seiner Äußerung. Der Satz hingegen: "Am 1. 8. 1997 n. Chr. um 11 Uhr regnet es in der Tübinger Bursagasse" ist entweder zu allen Gelegenheiten seiner Äußerung wahr oder durchgängig falsch.) Auch die Gedanken, die das reine Denken faßt, müssen in einem gewissen, nicht zeitlichen und nicht räumlichen Sinn indexikalische Gedanken sein. Zuerst in einem rein logischen Sinn von "zuerst" muß dieser eine Gedanke erfaßt werden, und kein anderer Gedanke darf wahr sein. Dann geht es irgendwie weiter zu Nachfolgegedanken, die also im theoretischen Fortgang wahr werden. Dem entspricht, daß Hegel das Logische in der Tat als einen Prozeß auffaßt und darstellt. Daß er das tut, läßt sich direkt aus dem Postulat der Vorausset-
-
zungslosigkeit rechtfertigen.
Das Postulat der Voraussetzungslosigkeit trägt also Früchte auch in methodologischer Hinsicht: Beginnen muß das reine Denken mit dem Sachverhalt selbst als dem noch homogenen logischen Raum; und die Gedanken, die es in der Folge faßt und vollzieht, sind im allgemeinen indexikalisch. (Nur der erste Gedanke soll insofern ein ewiger Gedanke sein, als er sich ja als gemeinsames Wesen durch alle Nachfolgegedanken hindurchziehen soll; der logische Raum als solcher soll erhalten bleiben in seinem prätemporalen, rein logischen Wandel. Aber aus der Niehtexistenz des reinen Seins wird dann folgen, daß sich das ewige Sein nicht isoliert aussagen bzw. denken läßt, sondern allenfalls mitdenken als das konstante Substrat der seinslogischen Entwicklung.) Das reine Denken also wird Zeuge eines bzw. wird selber verwickelt in ein rein logisches, prätemporales Werden. Wie dieses seltsame, prätemporale Werden seinerseits zu denken ist, das erfahren wir just zur rechten Zeit. Denn das reine Denken soviel haben wir im Anschluß an die Einführung des Nichts auf dem ersten, direkten Wege schon vorweggenommen denkt alsbald die widersprüchliche Einheit des Seins und des Nichts, und eben diese Einheit ist Hegel zufolge das logische Werden in seiner einfachsten Gestalt. Auf dem zweiten Wege nun erreichen wir das Nichts indirekt, dafür aber das Werden um so direkter; und zwar wie folgt. Damit das reine Denken über seinen ersten Gedanken, die Behauptung des reinen Seins, hinauskommt, bedarf es eines zweiten Gedankens, der in Beziehung auf jenen ersten alternativelos ist. Da es kein zweites Unmittelbares neben dem Sein -
-
151
Anton Friedrich Koch
ist irgendeine Vermittlung, d. h. irgendeine logische Operation in Beziehung auf das Sein erforderlich. Prädikatenlogische Operationen scheiden mangels propositionaler Binnenstruktur aus. Es bleiben wahrheitsfunktionale Operationen in Analogie zu den aussagenlogischen Operationen. Bedienen wir uns zunächst der heuristischen Fiktion, die logische Objekttheorie bestehe per impossibile tatsächlich aus Aussagen. Unsere bislang einzige logische Aussage wäre dann die des singulären logischen Unmittelbaren, formulierbar etwa durch den Ein-Wort-Satz "Sein!". Wenn wir aber nur eine einzige Aussage haben, können wir mehrstellige aussagenlogische Operationen vernachlässigen. Es bleiben die vier einstelligen Wahrheitsfunktionen: die Identitätsfunktion, der Wahrmacher, der Falschmacher und die Negation. Die Identitätsfunktion läßt alles beim alten, der Wahrmacher bekräftigt in einer neuen Aussage nur die vorige, der Falschmacher liefert uns eine falsche Aussage, also kein Theorem (das ja wahr sein soll). So bleibt als die einzige nicht-triviale und brauchbare unter den vier einstelligen Wahrheitsfunktionen die Negation übrig.3 Folglich muß das zweite Theorem die Negation des ersten sein, formulierbar etwa durch den Zwei-Wort-Satz "NichtSein!". Der offenkundige Widerspruch zwischen beiden Theoremen wird aufgefangen durch die ohnehin zu machende Annahme der Prozessualität des Logischen bzw. durch die Annahme einer wesentlichen Ordnung der dann indexikalischen Theoreme. Allerdings widerspräche das zweite Theorem nicht nur dem ersten Theorem, sondern auch sich selber, denn das Sein wird in allen Aussagen, auch in der Negation des Seins, mitausgesagt. Das zweite Theorem müßte also nicht bloß das rein logische, prätemporale Analogon eines zeitlich indexikalischen Satzes wie "Es regnet" sein, der an einem gegebenen Orte eine gute Zeitlang wahr bleiben mag, sondern es müßte spezifischer das rein logische, prätemporale Analogon eines Augenblickssatzes sein. Unter einem Augenblickssatz verstehe ich einen indexikalischen Satz, der nur im Modus der unverzüglichen Selbstfalsifizierang wahr sein kann, z. B. "Jetzt hebt das Flugzeug ab". Es hebt ab und berührt im Augenblick des Abhebens den Boden gerade noch und auch schon nicht mehr. Es kann nicht stundenlang, nicht einmal minutenlang, auch nicht sekundenlang abheben. Das Gerade-noch-und-schon-nichtmehr-Berühren des Bodens ist ein Widerspruch, dessen Behauptung wir uns nur deswegen gestatten (wenn wir sagen: "Das Flugzeug hebt ab"), weil wir ihn zugleich ins Infinitesimale verbannen. So auch im Fall des logischen Nicht-Seins: Es ist ein prätemporales flüchtiges Umschlagen, das Werden selbst (Platonisch geredet), das sich alsbald wieder aufhebt zu seinem Gegenteil, dem ruhigen Sein. Dieses heißt jetzt, da seine Ewigkeit und Reinheit durch das flüchtige Intermezzo des Werdens getrübt ist, Dasein. Ausgesagt wird es wiederum durch den Ein-Wort-Satz des Seins, der aber jetzt als ein logisch indexikalischer Satz fungiert. So hätten wir mit dem zweiten logischen Theorem zugleich ein drittes hergeleitet und in einem einzigen Schritt den Weg bis zur Logik des Daseins durchmessen. Insgesamt hätte das reine Denken drei Aussagen gemacht: (1) die Aussage des reinen Seins mit dem logisch-ewigen Ein-Wort-Satz "Sein!", (2) die Aussage des Werdens mit dem selbstwidersprüchlichen, daher nur flüchtig (augenblicklich) wahren und sich alsbald selbst aufhebenden logisch-inde-
gibt,
-
-
-
-
3
Der harte, undurchsichtige Rest von Unmittelbarkeit, welcher der so eingeführten Vermittlung (der Negation) ihrerseits noch anhaftet, zeigt sich seinslogisch in der Unmittelbarkeit des Nichts. Erst in der Begriffslo-
gik wird die Unmittelbarkeit der Negationsoperation sich restlos auflösen und durchsichtig werden.
152
Sein
Nichts -
Werden -
xikalischen Satz "Nicht-Sein!" und (3) die Aussage des Daseins mit dem logisch-indexikalischen, aber relativ stabilen Ein-Wort-Satz "Sein!" Allerdings ist das Nichts dabei unter die Räder bzw. unter unsere Siebenmeilenstiefel gekommen. Seine nachträgliche Einführung ist also ein wichtiges Desiderat. Sodann würden wir gern mehr über das Werden, über seinen Widerspruch und seine Momente, das Entstehen und Vergehen, erfahren. Das ist ein zweites Desiderat. Außerdem müssen wir uns von der heuristischen Fiktion lösen, daß wir es in der Objektlogik mit Theoremen, Aussagesätzen zu tun haben. Das ist das dritte Desiderat. Das erste Desiderat (die Einführung des Nichts) ist im Rahmen unserer heuristischen Fiktion mit wenigen Worten erfüllbar. Wir müssen erklären, wie in Beziehung auf das reine und ewige Sein das Werden aufbrechen kann. Dazu brauchen wir neben dem Sein einen zweiten Faktor, aber einen, der sich nicht als ein Sachverhalt eigenen Rechtes isolieren läßt (denn es gibt kein Unmittelbares außer dem Sein). Dieser Faktor tritt im Werden als dasjenige auf, was zum Sein noch hinzugekommen ist; und das ist die schiere Negativität, die dem Negationsoperator ("nicht") im zweiten Theorem ("Nicht-Sein!") entspricht. Es liegt nahe, wenn wir denn diesem nichtigen Unbekannten einen Namen geben wollen, es "das Nichts" zu nennen. Dieses Nichts kommt nicht irgendwann zum ruhigen Sein hinzu sonst brauchten wir eine wohlbestimmte Stelle und einen Grund für sein Hinzukommen -, sondern es ist immer schon da und hat immer schon sein negatives Werk getan. Das aber heißt, daß auch das Sein in Wahrheit nie rein vorkommt. Das reine Sein ist wie das reine Nichts nur ein Fluchtpunkt des Denkens in nachträglicher Betrachtung. Der wirkliche Beginn des reinen Denkens liegt in dem zweiten Theorem, d. h. im flüchtigen Werden, und insoweit, als das Werden flüchtig ist, liegt er sogar erst im Dasein. Im nachhinein also erweist sich, aufgrund der Einfügung des Nichts zwischen das reine Sein und das Werden, das reine Sein als der imaginäre Fluchtpunkt des reinen Denkens (bzw. als das nicht isolierbare Substrat der logischen Sphäre des Seins), das Nichts als der imaginäre Auslöser des Werdens (in dem die Operation der Negation als ein Unmittelbares gedacht werden soll), das Werden als der infinitesimale logische Urknall (mit dem der logische Raum allererst entsteht) und das Dasein als der erste, relativ stabile Zustand, der Anfangszustand des logischen Raumes. Das erste Desiderat ist damit auf eine vorläufige Weise erfüllt vorläufig, weil wir uns noch nicht von der heuristischen Fiktion objektlogischer Theoreme verabschiedet haben. Betrachten wir nun zweitens das Werden. Anders als im Fall des Nichts haben wir hier die Möglichkeit, unseren Gegenstand mit dem vergleichen zu können, was wir gewöhnlich unter Werden verstehen. (Ein gewöhnliches Verständnis des Nichts hingegen gibt es wohl nicht.) Fangen wir also beim gewöhnlichen Werden an. Es ist immer zeitlich; aber von der Zeit wird im Kontext der Logik zu abstrahieren sein. Das rein logische Werden wird prätemporal verfaßt sein müssen. Es wird die rein gedankliche Grundlage des wirklichen, zeitlichen Werdens und in gewissem Sinne vielleicht auch der Zeit sein müssen. Zum gewöhnlichen Werden gehört ein zeitlich geordnetes Paar von Zuständen, ein Ausgangs- und ein Zielzustand nämlich, geordnet längs des Zeitpfeils, die sich negativ zueinander verhalten. Der Ball ist unterwegs zum Tor; der Torwart hat ihn noch nicht. Jetzt also gilt der indexikalische Satz: "Der Torwart hat den Ball nicht". Dann fängt er ihn. Und nun gilt der Satz: "Der Torwart hat den Ball". Das Werden, das hier unser Beispiel ist, ist das Fangen, also das Übergehen oder Umschlagen vom Nichthaben zum Ha-
-
153
Anton Friedrich Koch
ben des Balles (durch den Torwart). Dieses Umschlagen findet statt zwischen dem Ausgangsund dem Zielzustand. Was aber ist das Umschlagen selber, sozusagen in eigener Sache? Nehmen wir die Zeitlupe, und verkleinern wir den Abstand zwischen Ausgang und Ziel. Betrachten wir nur die Zehntelsekunde des eigentlichen Fangens. Aber auch dann gilt noch: Wir haben einen Übergang vom Nichthaben zum Haben bzw. vom Freisein des Balles zum Nichtfreisein. Wenn wir den Abstand zwischen Ausgang und Ziel weiter verringern, dann werden wir schließlich nicht mehr vom Fangen sprechen dürfen, weil das Fangen ein Bewegungsablauf ist, der eine gewisse Dauer erfordert. Aber immer noch gilt: Erst haben wir einen Stand der Dinge A, dann einen Stand der Dinge Non-A. Erst berührt der Ball die Handschuhoberfläche des Torwarts noch nicht, dann berührt er sie. Wir können den Prozeß der Abstandsverkleinerung theoretisch endlos fortsetzen, denn die Zeit und die Abläufe in ihr sind kontinuierlich. Das eigentliche Umschlagen von A nach Non-A (oder umgekehrt) entzieht sich uns systematisch. Wenn wir es auf den Grenzwert, gegen den die Verkleinerung strebt, festnageln, auf einen Zeitpunkt, dann müssen wir das durch einen Widerspruch bezahlen: Das eigentliche Umschlagen von A nach Non-A ist der sich entziehende infinitesimale Zwischenbereich zwischen dem konsistenten A und dem ebenso konsistenten Non-A, in dem inkonsistenterweise sowohl A als auch Non-A der Fall sein würde. Das eigentliche Werden also, wenn man es nicht äußerlich, durch seine beiden je für sich konsistenten Randzustände, sondern innerlich, an ihm selbst zum sprachlichen Ausdruck bringen will, verlangt eine widersprüchliche Aussage: Der Torwart hat den Ball und hat ihn nicht im eigentlichen Augenblick des Fangens nämlich. Nun lehrt uns der ehrwürdige Satz des Widerspruchs, daß nicht etwas sein-und-nicht-sein kann. Wir ziehen daraus die Konsequenz, daß das Werden eben überhaupt kein Fall von Sein ist. Es muß, da es im Widerspruch wurzelt, grundsätzlich vom Sein unterschieden werden. Es ist nicht reduzierbar auf das Sein, sondern enthält Sein und ebenso Negativität als seine Momente. Es ist daher auch nicht einfachhin, sondern wird auch seinerseits nur. Es ist also wesentlich instabil, vorübergehend. Denn der Widerspruch, der ihm innewohnt und es gleichsam antreibt, drängt zur Auflösung. Er ist wesentlich zu vermeiden das eben besagt ja die geläufige Bezeichnung "Satz des zu vermeidenden Widerspruchs". Das Werden als in sich widersprüchlich treibt wesentlich über sich hinaus zu einem ruhigen Sein. (Auf diese Weise tragen wir dem Satz des Widerspruchs auch noch in Beziehung auf das Werden Rechnung.) Wir haben also ausgehend von gewöhnlichen Fällen des Werdens ein starkes theoretisches Motiv dafür gewonnen, einen selbstwidersprüchlichen Satz, den wir aus unabweisbaren Gründen behaupten müßten, als einen Augenblickssatz, d. h. als die selbstfalsifizierende Aussage eines Werdens, momentan gelten zu lassen. Freilich müssen wir für das logische Werden, um das es uns geht, von der Zeit abstrahieren und sind dabei angewiesen auf ein prätemporales Analogon des Zeitpfeils. Doch siehe da, etwas Zeitanaloges, einen logischen Pfeil oder eine logische Ordnung, besitzen wir schon aus unabhängigen Gründen ! Denn die voraussetzungslose Theorie muß, wie wir gesehen haben, Stellen generieren, an denen verschiedene Sätze jeweils gelten, und zwar mindestens eine Stelle 0 für den Satz "Nicht-Sein!" und eine Stelle 1 für den Satz "(Da-)Sein!". Oder, um die heuristische Fiktion objektlogischer Sätze nicht zu stark zu machen: Das reine Denken muß seine Gedanken in einer streng geregelten logischen Ordnung fassen. Den Anfang machte, wie es zunächst schien, das reine Sein bzw., mit ihm zugleich, das Nichts. Wenn nun der nächste, der zweite (und in Wahrheit -
-
-
-
154
Sein
Nichts -
Werden -
sogar der erste) Gedanke der des Werdens wäre, dann käme er genau zur rechten Zeit oder vielmehr an der rechten logischen Stelle, damit das reine Denken das denken kann, was ihm bzw. seinem Thema widerfährt: ein rein logisches Werden. Die logische Objekttheorie würde uns mit dem Werden also denjenigen Gedanken an die Hand geben, den wir in der Hintergrundlogik brauchen, um den prätemporalen objektlogischen Prozeß angemessen zu konzi-
pieren.
Mit der logischen Ordnung steht uns eine abstrakte Unterscheidung zwischen jeweiligem Ausgang und Ziel eines logischen Werdens zur Verfügung, die es von Fall zu Fall mit einem konkreten Gegensatzpaar zu besetzen gilt. Wie sieht es mit den beiden Termini oder Rändern des uranfänglichen Werdens selbst und mit dem Widerspruch zwischen ihnen aus? Als alternativelose Kandidaten präsentieren sich hier dem reinen Denken das Sein und das Nichts, das Sein als das singuläre Unmittelbare und das Nichts als die (nicht minder unmittelbare und insofern vom Sein gar nicht unterschiedene) Quelle der Vermittlung. Weitere Faktoren als diese beiden, die ebensosehr ein und derselbe sind, stehen ihm nicht zur Verfügung. Als die beiden Termini des Werdens und in einem damit als zwei gegenläufige Umschlagsrichtungen ergeben sich das Umschlagen vom Sein zum Nichts oder das Vergehen und das Umschlagen
Nichts zum Sein, also das Entstehen. Diese Umschlagsrichtungen sind zugleich die beiden Momente des Werdens, die Hegel unter C.2 vorstellt. Wir haben anläßlich der ersten Einführung des Nichts gesehen, was die zweite inzwischen bestätigt hat: daß das reine Sein und das reine Nichts nicht frei, d. h. nicht als selbständige Sachverhalte vorkommen. Also ist das Werden keinesfalls ihre mereologische Summe und sind sie nicht seine vorgängigen Bestandteile. Durch die zweite Art der Einführung ist diese Vorstellung ohnehin von vornherein abgewiesen; aber eine verwandte Vorstellung, nämlich die eines logischen Aufbaus des Werdens aus dem unmittelbaren Sein mittels der Operation der Negation, könnte noch Anklang finden und bedarf daher der gesonderten Zurückweisung durch den Hinweis, daß das reine Sein sich als Operandum der Negation gar nicht isolieren läßt. Operation und Operandum, Vermittlung und Unmittelbares, Nichtsartiges und Seinsartiges sind die "Ingredienzien" des Werdens so, wie die beiden gegenläufigen Gestalten des Werdens es sind: als Einheiten von jeweils beiden. Eine logische Analyse des Werdens würde also unweigerlich in einen infiniten Progreß münden. Das seinsartige Element und das nichtsartige Element wären ihrerseits jeweils zusammengesetzt aus einem seinsartigen und einem nichtsartigen Element usf. ad infinitum. In dieser Flüchtigkeit der vermeintlichen Elemente Sein und Nichts erweisen sie sich als Nicht-Elemente, als bloße Momente: Im Werden ist alles Werden, auch das Sein und das Nichts. Sofern diese Momente voneinander unterschieden werden müssen (damit von zweien die Rede sein kann), müssen sie durch ihre Umschlagsrichtung unterschieden werden: einmal von einem seinsartigen Ausgang zu einem nichtsartigen Ziel das Vergehen und sodann umgekehrt das Entstehen. Aber dieser Unterscheidungsgrand setzt wiederum einen anderen bzw. mangels eines anderen sich selbst voraus. Der Unterschied der Momente des Werdens ist somit bodenlos, und darin manifestiert sich die Widersprüchlichkeit und Flüchtigkeit des Werdens, das ohne weiteres in das ruhige Dasein zusammensinkt. Auf eine Anomalie, die sich in diesem Zusammenhang ergibt, sei wenigstens im Vorbeigehen hingewiesen. Die Termini des Werdens sind für die logische Objekttheorie andere als für die Hintergrundtheorie; für die Binnenbetrachtung, die vom reinen Denken durchgeführt vom
-
-
-
155
Anton Friedrich Koch
wird, andere als für die Außenbetrachtung, die wir in unserer Reflexion durchführen. Für das
reine Denken bietet sich nichts weiter an als das Sein und das Nichts bzw. das Entstehen und das Vergehen. Wir hingegen haben den Überblick bzw. den Vorblick auf das Resultat des Werdens, welches ja wiederum Sein, näher Dasein, ist. Für uns also sind die Termini des Werdens Sein und Sein (ewiges bzw. vergleichsweise stabiles); das Werden erweist sich damit als ein paradoxes, irgendwie verschrobenes Übergehen: nicht von A nach Non-A oder umgekehrt, sondern von A nach A. Was auf diese Weise "wird", ist das Dasein als Insichseiendes: das Etwas. Aber das ist nicht mehr unser Thema. Vielmehr müssen wir uns zum Schluß dem dritten Desiderat zuwenden und, indem wir die heuristische Fiktion objektlogischer Theoreme preisgeben, die indirekte Einführung des Nichts mit der direkten konvergieren lassen. Das Sein war konzipiert worden als ein vorpropositionaler Ursachverhalt, und unterhalb der Propositionalität gibt es keine Theoreme, also auch keine aussagenlogische Negation eines Theorems. Die Verneinung des Seins müßte demnach vorpropositional aufgefaßt werden. Wie aber soll das möglich sein, da wir die Verneinung doch als diejenige Wahrheitsfunktion kennen, die Wahr auf Falsch abbildet und Falsch auf Wahr und die insofern die Zweiwertigkeit voraussetzt? Eine Logik des Vorpropositionalen müßte mit einer Form der Negation operieren, welche die Zweiwertigkeit der Aussage unterläuft. Aristoteles gibt uns hierzu im schon erwähnten Buch Theta, Kapitel 10, nur einen Wink, nicht wie später Hegel eine komplette Theorie. Im Fall des Einfachen, sagt er, -
-
"ist das Wahre das denkende Erfassen. Falsches und Täuschung gibt es da nicht, sondern nur Unwissenheit [Nicht-Erfassen], aber Unwissenheit nicht wie Blindheit; denn der Blindheit entspräche es, wenn jemand die Denkkraft gar nicht hätte." (1052a, 1-4)
Wie aber kann das Denken einen Ursachverhalt ignorieren, da doch im logischen Raum anders als im wirklichen Raum die Sicht nirgends versperrt ist? Das Sein eines Ursachverhaltes ist seine unverborgene Anwesenheit im logischen Raum. Ein Denken, das einen Ursachverhalt negiert, ist dem Aristotelischen Wink zufolge ein Denken, das ihn ignoriert. Ignorierbar aber wird ein Ursachverhalt erst, wenn er seine Anwesenheit im logischen Raum und damit das Sein verliert. Die Negation eines Ursachverhaltes ist also das Erfassen eines Nachfolgersachverhaltes, der seinen Vorgänger aus dem logischen Raum verdrängt. Die Grundform der vorpropositionalen Negation ist die Vernichtung. (Da freilich der logische Raum als der Inbegriff des Denkbaren ganz in dem aufgeht, was ihn füllt, läuft jede Negation eines Ursachverhaltes auf einen Wandel des logischen Raumes selbst hinaus. Die Wissenschaft der Logik erweist sich auch von dieser Seite als die Theorie eines prätemporalen Prozesses.) Die Negation des Seins durch das bzw. in dem Werden ist somit zu fassen als die Vernichtung eines Ursachverhaltes durch einen Nachfolgersachverhalt. Der betreffende Ursachverhalt, der zur Vernichtung ansteht, aber ist das reine Sein; und der ist gleichsam per definitionem vernichtungsresistent. Wir haben ihn ja eingeführt als den unbestimmten und unmittelbaren Rest, der nach Abzug aller möglichen Differenzen zwischen verschiedenen Sachverhalten noch übrig bleibt. Das Werden als Nachfolgersachverhalt des Seins, der sich negativ gegen diesen Vorgänger kehrt, ist daher ohnmächtig. Wenn wir das Ergebnis zugrunde legen, das wir mittels unserer heuristischen Fiktion erzielt haben, dann müssen wir es wie folgt umdeuten: Das Werden vernichtet, indem es sich negativ gegen das Sein kehrt, alsbald sich selbst und restituiert darin das Sein. Dieses wiederhergestellte Sein hatten wir, Hegel fol156
Sein
Werden
Nichts -
-
gend, das Dasein genannt. Es ist Sein, aber nicht mehr rein, nicht mehr negationsfrei. Denn es verhält sich negativ, d. h. vernichtend, gegen das Werden. Jedenfalls konstatieren wir das in unserer äußeren Reflexion. Gesetzt ist diese Negativität am Dasein freilich zunächst noch nicht, d. h. das reine Denken auf der Ebene der Objektlogik nimmt sie zunächst nicht zur Kenntnis. Nichts am Dasein selber deutet auf sie hin. Nur wir auf dem Standpunkt der Hintergrundtheorie sehen, daß das Dasein das Sein ist qua siegreiche Negation (Vernichtung) des Werdens, daß es folglich ist, was es ist, nur relativ zu dem, was es immer schon vernichtet hat. Das Dasein ist das Negative eines von ihm Vernichteten, daher durch dieses bestimmt. (Die Bestimmtheit ist das Inverse der negierenden Natur eines Sachverhaltes, gleichsam die Rache des Negierten.) Aber da das Bestimmende hier nicht nur einfach negiert, sondern in der Weise der Vernichtung negiert ist, erscheint das Dasein als Unmittelbares, durch und durch Affirmatives, als den ganzen logischen Raum in Beschlag nehmend. Seine Bestimmtheit geht nahtlos in seinem Sein auf. Dies gilt zumindest am Ausgangspunkt der Daseinslogik; und es ist dieser anfängliche Gedanke des Daseins, den wir entgegen unserer Absicht konzipieren, wann immer wir das reine Sein zu konzipieren versuchen. In diesem Sinne ist das
Dasein die Einheit des Seins und des Nichts in der Gestalt der Allherrschaft des Seins. Ebenso systematisch verfehlen wir unser Ziel, wenn wir das reine Nichts zu konzipieren versuchen. Das Nichts ist der ersten Einführung zufolge der Widerspruch des seienden, aber leeren logischen Raumes. Also ist es mit Sein behaftet, daher unreines Nichts, daher Werden: derjenige Ursachverhalt, der seine eigene Vernichtung "ist". Die zweite Einführungsart des Nichts ist hier sogar noch deutlicher. Das reine Nichts wäre ihr zufolge das, was dem Negationsoperator im Ausdruck des Werdens entspricht, und das ist jedenfalls kein selbständiger Sachverhalt. Bis das Nichts als absolute Negativität in der Wesenslogik schließlich doch Selbständigkeit gewinnt und bis es zuletzt als absolute Vermittlung in der Begriffslogik jeden Rest von Undurchsichtigkeit und Unmittelbarkeit verliert, ist es noch weit.
157
Heinz Kimmerle
(s)ein Anderes. Wie das 'spekulative Denken' das Andere (des Anderen) zum Verschwinden bringt Das Etwas und
Die hier
gebotene Interpretation einer Passage aus Hegels Seinslogik ist durch das Interesse
motiviert, herauszufinden, wie Hegel das Andere denkt. Dabei wird man sich zunächst auf die
Abschnitte über 'Andersseyn', 'Seyn-für-Anderes', 'Etwas' oder 'Etwas und ein Anderes' verwiesen sehen. Um diese Abschnitte angemessen zu verstehen, wird es nötig sein, das gesamte 2. Kapitel: "Das Daseyn" des I. Abschnitts: "Bestimmtheit (Qualität)" im Ersten Buch: "Das Seyn" in Hegels Wissenschaft der Logik genauer zu betrachten. Ferner ist es aufschlußreich, beide Fassungen dieses Textes von 1812 und 1831 zu vergleichen. Hegel hat in diesem Kapitel nicht nur zahlreiche Änderungen angebracht; in der späteren Überarbeitung des Textes der ersten Auflage lassen sich auch deutliche Verschiebungen im Gedankengang erkennen. Ich werde versuchen, diese Verschiebungen sichtbar zu machen und daraus für meine Fragestellung bestimmte Folgerungen abzuleiten. Zunächst folge ich dem Text der ersten Auflage, um dann zu untersuchen, welche Änderungen Hegel in der Bearbeitung für die zweite Auflage, die er selbst nicht mehr erleben sollte, vorgenommen hat und was sie bedeuten.1
Die erste Auflage von Band 1 der Wissenschaft der Logik zitiere ich nach GW 11 ; für die Bearbeitung des Textes dieses Teils der Logik im Jahr 1831, die Hegel für die zu seinen Lebzeiten nicht mehr erschienene zweite Auflage gemacht hat, beziehe ich mich auf die Ausgabe der Wissenschaft der Logik, hg. von G. Lasson. Erster Teil. Hamburg: Meiner 1963 (Unveränderter Abdruck der Ausgabe von 1934. Philosophische Bibliothek. Band 56); im Text zitiert mit der Sigle "L". Der Band 2 der Wissenschaft der Logik von 1816: Die subjective Logik oder Lehre vom Begriff ist bekanntlich nur in der Fassung der ersten Auflage verfügbar.
Das Etwas und (s)ein Anderes
Interpretation des "Daseyns" nach dem Text von
L
1812
"Daseyn als solches" ist bestimmtes Unbestimmtes
A.
Kapitel der Seinslogik endet mit dem "Übergehen" des Werdens als der "Einheit des und des Nichts" in die "Gestalt der [...] Einheit dieser Momente", die selbst "als seySeyns end ist": das "Daseyn" (GW 11, 57). Im Kapitel "Seyn" sind 'Seyn' und 'Nichts' im 'Werden' als unmittelbar ineinander übergehend, das heißt einander negierend gedacht. Nunmehr sind sie "als seyend" Momente einer bestimmten, in sich beruhigten Gestalt. Deshalb beginnt das 2. Kapitel mit dem Satz: "Daseyn ist bestimmtes Seyn" (GW 11, 59), mit dem unbestimmten 'Seyn' des 1. Kapitels und dem zugehörigen 'Nichts' als seinen Momenten. Als 'bestimmtes Seyn' wird das 'Daseyn' indessen sogleich wieder als unmittelbar und damit als Unbestimmtes gesetzt. Diese Denkfigur, die im ganzen als Übergehen bezeichnet wird, charakterisiert die logische Bewegungsform der gesamten Seinslogik. Man kann sie als einen eigenen Typus der Dialektik betrachten, dem in der "Lehre vom Wesen" die "Dialektik des Scheinens" und in der "Lehre vom Begriff die "Dialektik der Entwicklung" gegenüberstehen.2 In der Seinslogik, bei der Erörterung der einfachen Begriffe des 'reinen' (sich selbst denkenden) Denkens, die nicht in sich gedoppelt sind wie in der Wesenslogik die Relations- oder Verhältnisbegriffe, läßt Hegel diese in der beschriebenen Weise "übergehen". Zwei entgegengesetzte Begriffe werden Momente eines neuen "höheren" Begriffs, der sich wiederum einen anderen Begriff entgegensetzt. Hegel spricht wohl auch davon, daß die Begriffe "auseinander hervorgehen". Und er sagt seit seiner Konzeption der 'Logik' in dem Systementwurf von 1804/05, daß sie im Unterschied zu den Verhältnisbestimmungen eine "einfache Beziehung" ausDas 1.
drücken.3 1)
Der Ausgangspunkt:
"Daseyn überhaupt"
Auf diese Weise ergibt sich als Ausgangspunkt für die Ableitung der Kategorien des 'reinen' Denkens der Begriffszusammenhang der 'Qualität', die Hegel auch mit dem deutschen Wort 'Bestimmtheit' bezeichnet. Diesen Ausgangspunkt, mit dem er sich von Kant unterscheidet, dessen Kategorientafel bekanntlich mit den Begriffen der 'Quantität' beginnt, hat er bereits seit den frühesten Entwürfen zur 'Logik' von 1801/02 gewählt.4 Die Kategorien der 'Qualität' (bei Kant sind dies: 'Realität', 'Negation' und 'Limitation') ergeben sich in Hegels Lo2
K.J. Schmidt, G.W.F.
Hegel: "Wissenschaft der Logik
tar,. Paderborn/MünchenAVien/Zürich
3
4
1997, 7.
Die Lehre
vom
Wesen". Ein
einführender Kommen-
-
H. Kimmerle, Das Problem der Abgeschlossenheit des Denkens. Hegels "System der Philosophie in den Jahren 1800-1804. Bonn 21982, 76-80 (Hegel-Studien, Beiheft 8); K. Düsing: Das Problem der Subjektivität in Hegels Logik. Systematische und entwicklungsgeschichtliche Untersuchungen zum Prinzip des Idealismus und zur Dialektik. Bonn 1976, 150-159 (Hegel-Studien, Beiheft 15). H. Kimmerle, Das Problem der Abgeschlossenheit (Anm. 3), 55-56; K. Düsing, Das Problem der Subjektivität (Anm. 3), 83-84. "
159
Heinz Kimmerle
gik aus einer Betrachtung des "Daseyns als solchen". Dieses ist zunächst, als bestimmtes Unbestimmtes, "Daseyn überhaupt". Das heißt, es ist "das einfache Einsseyn des Seyns und
Nichts" oder diese bestimmte Einheit selbst wieder in der Form eines "Unmittelbaren", Unbestimmten. Die nähere Untersuchung der Momente dieser Einheit führt auf den Begriff "Realität".
"Realität" als "Andersseyn" des "Daseyns" und als "dem Andersseyn entnommen"
2)
"Seyn" des 'Daseyns überhaupt' ist aber zugleich "Nichtseyn". Als solches ist es "nichtseyendes Daseyn" oder "Nichtdaseyn". Das 'Nichtseyn' des 'Daseyns' ist also selbst ein zweites, anderes 'Daseyn': ein "Andersseyn" im 'Daseyn'. Es steht hier nicht ein 'Daseyn' dem "Anderen" als "Etwas" gegenüber, sondern beide sind als Andere aufzufassen: das Andere Das
des Anderen. Deshalb ist das "Daseyn selbst" wesentlich 'Andersseyn', es ist "das Andere seiner selbst" und es "steht in Beziehung auf sein Andersseyn". Dadurch wird es als "Seyn-fürAnderes" bestimmt. So gelangt das 'Daseyn' durch sein 'Nichtseyn' zu seiner ersten Bestimmtheit (GW 11, 60-62). Anders ausgedrückt: indem sich das 'Daseyn' als 'Nichtseyn' "in seiner Verneinung zugleich auch erhält", ist es "Seyn-für-Anderes". Darin ist es 'Nichtseyn' und 'Seyn' oder als Beziehung auf das 'Andersseyn' ausgedrückt: Ungleichheit und Gleichheit mit sich selbst. Aufgrund des Moments des 'Seyns' oder der Gleichheit mit sich selbst ist es "Ansichseyn". Sofern das 'Daseyn' an sich ist, "ist es dem Andersseyn und dem Seyn-für-Anderes entnommen". Dies betrifft freilich nur ein Moment des 'Daseyns'; es kann nicht völlig dem 'Andersseyn' entnommen sein. "Denn es selbst ist das Nichtseyn des Seyns-für-Anderes". Die beiden Paare 'Daseyn und Andersseyn': 'Seyn-für-Anderes und Ansichseyn' sind spiegelsymmetrisch angeordnet, wobei die Momente des letzteren ihrerseits aufeinander hinweisen, einander verständlich machen, obschon sich gezeigt hat, daß dem 'Ansichseyn' ein deutliches Übergewicht zukommt (GW 11, 62-63). Auf diese Weise ist 'Daseyn' nicht mehr in der Form der Unmittelbarkeit, sondern "reflectirtes Daseyn", das "sich als Ansichseyn und als Seyn-für-Anderes bestimmt hat", die es als Momente oder seine eigenen "innern Unterschiede" an sich hat. "Als diß reflectirte Daseyn ist es Realität". Eine "Anmerkung" zum Begriff der 'Realität' zeigt, daß es sich bei dem "reflectirten Daseyn" um eine äußere Reflexion handelt, sofern nämlich das 'Daseyn' als 'Seyn-für-Anderes' ein "äusserliches Daseyn" ist, das daneben auch die Bestimmung des 'Ansichseyns' "in sich schließt". Diese "Identität des Ansichseyns und Seyns-für-Anderes" in der 'Realität' "präfiguriert", wie Hermann Schmitz sich ausdrückt,5 das Verhältnis der "Innerlichkeit und Aeusserlichkeit" in der Wesenslogik und die "Einheit des Begriffs und der Wirklichkeit" im dritten Teil der Logik, der "in der Betrachtung der Idee" kulminiert. Diese Struktur, die sich hier in der Seinslogik nur "einem Inhalte nach" oder auf gewisse Weise auch "formell" ergibt (das letztere insofern sich zeigen wird, daß "die Bestimmung in Beschaffenheit übergeht"), wird in der Wesenlogik "ausdrücklicher", in der Begriffslogik "am bestimmtesten" aufgezeigt werden. Damit wird hier auch bereits "vorläufig" eine Antwort möglich auf die Frage nach dem "Sinn des Dings-an-sich" und seiner von Kant behaupteten Unerkennbarkeit. Diese beruht 5
H. Schmitz,
160
Hegels Logik,
Bonn/Berlin 1992, 82-84.
Das Etwas und
(s)ein Anderes
darauf, daß das Ding an sich als "von allem Seyn-für-Anderes abtrahirt" und somit "ohne alle Bestimmung" oder in seiner absoluten, das bestimmte Erkennen übersteigenden Bedeutung
gedacht wird. Die Bestimmungslosigkeit ist durch die Einheit des 'Ansichseyns' und 'Seynsfür-Anderes' in der 'Realität' vorläufig widerlegt. Die Entfaltung der Absolutheit aller Bestimmungen jedoch "ist die Logik selbst" in der Gesamtheit ihrer Teile. Deshalb ist ein bestimmtes Ding an-sich, sofern es, wie die Einheit des 'Seyns-für-Anderes' und des 'Ansichseyns' in der 'Realität', als Begriff innerhalb der gesamten Begriffsentwicklung der Logik
situiert. Wenn der "Begriff von Gott" in der Tradition der europäischen Metaphysik als "Inbegriff aller Realitäten" bestimmt und als ein rein Positives ohne alle Negation aufgefaßt wird, gerät dies zu einer Einseitigkeit und Bestimmungslosigkeit, die von dem hier erarbeiteten Begriff der 'Realität' nicht gedeckt wird. Der Widersprach von "Güte" und "Gerechtigkeit" Gottes muß dann als ein "Temperiren" oder Abschwächen verstanden werden. Demgegenüber wird sich in der Logik die "absolute Einheit" aller Widersprüche ergeben, die nach dem Modell der ersten Einheit von 'Seyn-für-Anderes' und 'Ansichseyn' in der 'Realität' gedacht wird (GW
11,63-65).
'Seyn' des ".Envoi" als 'Nichtseyn' des 'Andersseyns' Im Begriff der 'Realität' stehen 'Ansichseyn' in seiner Beziehung auf das 'Seyn-für-Anderes' und 'Seyn-für-Anderes' in seiner Beziehung auf das 'Ansichseyn' "einander gleichgültig" gegenüber. Sie sind zwar beide "Reflexionsbestimmungen", weil sie die Beziehung aufeinander notwendig enthalten. Wie wir gesehen haben, sind sie jedoch nicht beide gleichwertig, sondern das 'Ansichseyn' erhält ein Übergewicht, wodurch es dem 'Andersseyn' des 'Seyns-für3)
Das
Anderes' entnommen wird. Im Übergang der 'Realität' zum 'Etwas' werden ihre Momente nicht mehr als gleichgültig gegeneinander, sondern als ineinander übergehend gedacht. Das kann nur bedeuten, daß das 'Andersseyn' des 'Seyns-für-Anderes' weiter dem 'Ansichseyn' angeglichen und so beide weiter homogenisiert werden. Im "Etwas" wird das 'Seyn-fürAnderes' in das 'Ansichseyn' aufgehoben. Dadurch ist das 'Etwas' "Insichseyn"; das 'Daseyn' insgesamt ist wie das 'Ansichseyn' "einfache Beziehung auf sich selbst". Das Reflektiertsein des 'Daseyns' ist damit nicht mehr "äusserliche Reflexion", die zwei unterschiedene Seiten hat, sondern "seine Reflexion in sich". Die Seite des 'Seyns-für-Anderes' ist in die des 'Ansichseyns' übergegangen. Auf diese Weise findet das 'Etwas' in sich, auch im aufgehobenen 'Seyn-für-Anderes', nur sich selbst. Es ist "negative Einheit" und "hat Beziehung auf sich, insofern es Negation ist". Was aber im und mit dem 'Seyn-für-Anderes' letztlich negiert wird, ist das 'Andersseyn'. "Das Seyn des Etwas besteht also nicht in seiner Unmittelbarkeit, sondern im Nichtseyn des Andersseyns". Es hat das 'Andersseyn' nunmehr als ein eigenes in sich. Das Unbestimmte in der Bestimmtheit des 'Daseyns' ist damit überwunden. "Das Etwas ist Daseyn allein insofern es eine Bestimmtheit hat" (GW 11, 65-66; Kursivierung von
mir, H.K.).
161
Heinz Kimmerle
"Bestimmtheit" als Sichbegrenzen des 'Etwas'
B.
am 'Daseyn' das Moment der Negativität hervor. Sofern es dieses von sich selbst unterscheidet, erhalten wir die Kategorie der 'Grenze', die Kant Limitation genannt hat. Sie zeigt sich als wesentlich für das 'Etwas', das auf diese Weise erneut die Beziehung von 'Ansichseyn' und 'Seyn-für-Anders' artikuliert und dadurch schließlich als 'Qualität' bestimmt wird.
Im 'Etwas' tritt
"Grenze" als Aufhören des 'Andersseyns' im 'Etwas'
1)
Im 'Etwas' ist "das
Seyn-für-Anderes ins Ansichseyn" aufgehoben oder, wie Hegel hier sagt, "zurückgenommen". Aber damit ist das 'Andersseyn' noch "nicht verschwunden". Es befindet
sich vielmehr außerhalb des 'Etwas', so daß es "im Etwas aufhört". Das 'Etwas' hat seine 'Grenze' "gegen Anderes". Das Andere ist selbst ein 'Etwas'; das "erste Etwas" begrenzt sich, indem es "sein Anderes von sich abhält". Die 'Grenze' ist indessen "so Nichtseyn des Etwas, daß sie zugleich Nichtseyn des Anderen, als Seyn des Etwas ist". Die 'Grenze' "ist die Mitte beyder, in der sie aufhören", Andere füreinander zu sein. "Sie haben das Daseyn jenseits von einander und von ihrer Grenze". Diese 'Mitte' ist im Unterschied zu dem Begriff der Mitte in dem Systementwurf von 1803/04 nicht doppelte Mitte, in der sich die Extreme treffen,6 sondern leere Mitte, die die Extreme aufeinander bezieht, indem es sie auseinander hält. Hegel sagt zur Verdeutlichung, daß die Linie den Punkt als ihre Grenze hat, aber "als Linie nur ausserhalb" des Punktes, das heißt nicht als Aneinanderreihung von Punkten, erscheint. Hegel wählt das Beispiel räumlicher Gegebenheiten, weil von der 'Grenze' hier in der Weise der "Vorstellung", des "Aussersichseyns des Begriffs" gesprochen wird. Das Beispiel ist indessen einseitig, weil das 'Etwas' ohne seine 'Grenze' zum anderen 'Etwas' nicht vorgestellt werden kann. "Etwas ist, was es ist, nur in seiner Grenze". Die 'Grenze' ist ihm wesentlich; sie ist sein 'Ansichseyn'. Es "hat keinen anderen Inhalt oder Bestehen, als die Grenze selbst". Am Beispiel des Punktes und der Linie, die sich gegenseitig begrenzen, muß deshalb auch auf die andere Seite der Sache verwiesen werden, daß im Punkt die Linie nicht nur aufhört, sondern auch anfängt. Er ist ihr wesentlich, denn "er ist ihr absoluter Anfang, er macht ihr Element aus". So ist d»s 'Etwas' nicht ohne seine 'Grenze'; diese ist seine "Bestimmtheit" (GW 11, 67-69). "Bestimmtheit als
2)
"insichseyende Grenze" Dem Titel 'Bestimmtheit' begegnen wir hier zum dritten Mal an unterschiedlicher Stelle. Der gesamte erste Abschnitt der Seinslogik heißt 'Bestimmtheit (Qualität)'. Dann wurde
soeben der zweite Paragraph des hier zu interpretierenden 2. Kapitels 'Das Daseyn' nach dem Paragraphen 'A. Daseyn als solches' mit 'B. Bestimmtheit' überschrieben. Innerhalb dieses Paragraphen begegnet unter 2. erneut derselbe Titel. Das bedeutet im Sinne Hegels, daß die 'Bestimmtheit' hier ihre volle Konkretheit, die vollständige Einheit ihrer unterschiedlichen 6
GW 7, 275-276 u.ö.
162
Das Etwas und (s)ein Anderes
Momente, erhält. Hier zeigt sich definitiv,
was der Satz am Anfang des Kapitels 'Das Daist bestimmtes bedeutet: seyn' "Daseyn Seyn" (GW 11, 59). In der 'Grenze' faßte sich das Resultat der bisherigen Kategorienfolge des 'Daseyns' zusammen. Das 'Etwas' hatte sein 'Ansichseyn' in seiner 'Grenze' gegen sein Anderes, das damit auförte, ein anderes Anderes zu sein. Das 'Etwas' ist also nur, insofern es sich begrenzt und dadurch bestimmt. Sein unmittelbares 'Seyn' als 'Insichseyn' ist bestimmt als sein 'Ansichseyn' oder seine 'Grenze'. Seine Bestimmtheit oder die Bestimmtheit überhaupt "ist Einheit des Insichseyns und der Grenze". Damit hat das 'Etwas' seine "Bestimmung" gefunden. "Es ist aus der Beziehung auf Anderes in sich zurückgenommen". Als solches findet es die 'Grenze' und das Andere auch wieder in sich selbst. Es ist nicht nur sein 'Ansichseyn' in seiner Grenze gegen sich als anderes 'Etwas', sondern hat als solches die 'Grenze' auch an sich als neue Erscheinungsweise des 'Andersseyns'. Es ist eine äußerliche Erscheinungsweise seines 'Seyn-für-Anderes', "so oder anders beschaffen" zu sein. Die jeweilige 'Beschaffenheit' des 'Etwas' ist zwar äußerlich und zufällig, "aber das Etwas besteht darin, dieser Aeusserlichkeit preisgegeben zu syn, und eine Beschaffenheit zu haben". Damit ist das "in sich zurückgenommene Andersseyn" zur "Bestimmung der Bestimmtheit" geworden. Keine Bestimmtheit ohne 'Andersseyn', auch wenn dieses nur dem "äusseren Verhältnisse" des 'Etwas' angehört. Als diese Einheit ihrer Momente, nämlich innerer 'Bestimmung' und äußerer 'Beschaffenheit', ist die 'Bestimmtheit', was sie ist: "Qualität". In einer "Anmerkung" wird näher ausgeführt, daß die 'Qualität' eine "Eigenschaft" ist, deren "äusserliche Beziehung sich als immanente Bestimmung zeigt". Als Beispiel nennt Hegel die Eigenschaften von Kräutern, die ihnen in einer unverwechselbaren Weise, aufgrund ihrer spezifischen Wirkungen, "eigen sind". Daß 'Qualität' gut oder schlecht sein kann, erklärt sich aus der größeren oder kleineren "Uebereinstimmung der Beschaffenheit mit der Bestimmung". Diesen Qualitätsbegriff möchte Hegel von dem Jacob Böhmeschen der "Qualirung" unterschieden wissen, der bedeutet, daß die 'Bestimmtheit' "in ihrer negativen Natur (in ihrer Qual) sich aus anderem setzt und befestigt" und so "nur im Kampfe sich hervorbringt und erhält" (GW 11, 69-72; Kursivierung von mir, H.K.). Wie immer der Unterschied zu Böhme im einzelnen zu definieren ist, scheint das Andere bei diesem nicht nur in der Äußerlichkeit der 'Beschaffenheit' zu liegen.
"Veränderung" als Anderswerden der 'Beschaffenheit' Wie im 'Daseyn' das 'Seyn' die Form der beruhigten, aus dem 'Werden' herkommenden, be3)
stimmten Gestalt des 'Daseyns als solchen' erhalten hat und das 'Nichts' als das 'Andersseyn' in Erscheinung trat, die sich schließlich zum bleibenden, wenn auch nur äußeren 'Andersseyn' der 'Beschaffenheit' in der 'Bestimmtheit' fortbestimmte, ist hier auch ein 'Werden' gesetzt, und zwar ein 'Werden', "welches Veränderung ist". Diese findet sich zunächst nur in der äußeren 'Beschaffenheit'. Denn in der inneren 'Bestimmung' war die 'Grenze' der "Beziehung auf Anderes" entnommen. Es ist indessen "nicht eine Beschaffenheit", die anders wird, sondern "die Beschaffenehit als solche". Dadurch ist die 'Beschaffenheit' selbst so beschaffen, daß sie anders wird, sie "ist selbst die Veränderung". Das 'Etwas' hat so die "unstäte Oberfläche des Andersseyns" an sich, die nicht unmittelbar auch seine innere 'Bestimmung' ist. Weil aber die "Aeusserlichkeit des Andersseyns" in 163
Heinz Kimmerle
'Qualität' mit der Innerlichkeit der 'Bestimmung' zu einer Einheit verbunden ist, betrifft 'Veränderung' nicht nur die Oberfläche, sondern das 'Etwas' selbst in seiner "an-sichseyenden immanenten Bestimmung". Die 'Grenze' bestimmt dann nicht mehr nur das 'Seyn' des 'Etwas', das sich von sich als anderem 'Etwas' unterscheidet. Sie ist sein eigenes 'Nichtseyn', und als solches ist sie "Schranke". Daher "ist die Schranke nicht ein Aeusseres", sondern die eigene 'Bestimmung' des 'Etwas'. Und das 'Ansichseyn' der 'Bestimmung' des der die
'Etwas' in der "Beziehung auf die Grenze [...] als Schranke, ist Sollen". "Als Sollen geht das Etwas [...] über seine Schranke hinaus". Es ist "über seine Schranke erhaben, umgekehrt hat es nur als Sollen seine Schranke". Diese zweifache Beziehung des 'Sollens' zu seiner 'Schranke' bringt Hegel zu einer "Anmerkung" zu der Formulierung des 'Kategorischen Imperativs' bei Kant: "Du kannst, weil du sollst", die er für einseitig hält, da sie nur "das Hinausseyn des Sollens über die Schranke" artikuliert. Aber "im Sollen liegt eben so sehr die Schranke als Schranke. Deshalb "ist es eben so richtig" zu sagen: "Du kannst nicht, eben weil du sollst". In dieser Formulierung zeigt sich, daß im Sollen schon der "Begriff der Endlichkeit" vorhanden ist, "und damit zugleich", wie die erste Formulierung erkennen läßt, "das Hinausgehen über sie, die Unendlichkeit". Diese "Einheit von Sollen und Schranke" nennt Hegel "Negation". Darin faßt sich das 'Daseyn' in seiner 'Bestimmtheit' zusammen. Nach der Einheit des 'Daseyns überhaupt' als 'Ansichseyn' und 'Seyn-für-Anderes' in der 'Realtät' wurde die Einheit der 'Bestimmtheit' als 'Bestimmung' und 'Beschaffenheit' in der 'Qualität' abgeleitet. Der 'Realität' steht aber schon bei Kant die 'Negation' gegenüber. "Die Qualität macht die Mitte und den Uebergang zwischen Realität und Negation aus". 'Mitte' ist hier wohl im Sinne des Systementwurfs von 1803/04 als 'doppelte Mitte' aufzufassen (s.o. I.B.l mit Anm. 6), die zwischen den Extremen vermittelt. "In der Negation tritt das Nichtseyn als die Wahrheit hervor, in welche die Realität übergegangen ist". 'Negation' ist "die Bestimmtheit überhaupt". Diese Formulierung führt Hegel in einer "Anmerkung" auf Spinoza zurück: Determinatio est negatio. Daß Spinoza "Denken und Seyn" in der "Einheit der Substanz" in eins gesetzt hat, bedeutet nach Hegel: Diese "Attribute" sind "bestimmte Realitäten" und damit "Negationen", aufgehobene "Momente" in der Einheit der Substanz. Wir lassen hier beiseite, inwiefern Hegel mit der historischen Herleitung dieser Formel recht hat und inwiefern er Spinoza angemessen interpretiert. In unserem Zusammenhang ist wichtig, welches Verständnis von 'Negation' darin zum Ausdruck kommt. In der 'Negation' ist zusammengefaßt, welche 'Momente' die 'Bestimmtheit' enthält. Um dies angemessen explizieren zu können, ist es notwendig, den Begriff der "zweiten Negation" einzuführen, die Hegel auch "Negation der Negation" nennt und von der er sagt, daß sie "die abstráete Grundlage aller philosophischen Ideen, und des speculativen Denkens überhaupt" sei. 'Bestimmtheit' und 'Negation' beruhen auf dem 'Andersseyn', das sich das 'Daseyn überhaupt' entgegensetzt. Das 'Andersseyn' ist aber im Lauf der Ableitung der Kategorien des 'Daseyns' immer mehr ausgehöhlt worden. Die 'Negation' in ihrer radikalsten Form als "Negativität oder negative Natur" des "speculativen Denkens" bestimmt sich folgerichtig fort zur 'Negation der Negation' oder "Negation des Andersseyns". Im Rückblick auf die Begriffe der 'Schranke' und des 'Sollens' kann man sagen, daß die "erste Negation" sich auf die 'Schranke' als das 'Andersseyn' oder das "Nichtseyn" im Prozeß des Bestimmens be-
164
Das Etwas und
(s)ein Anderes
zieht. Die "zweite
Negation"
bezieht sich auf das 'Sollen' und ist
tion", durch welche die 'erste Negation' negiert wird.
"an-sich-seyende Nega-
In einem Artikel über die Darstellung der 'absoluten Idee' als 'absolute Methode' am Ende der Wissenschaft der Logik habe ich gezeigt, daß der Genitiv in dem Ausdruck 'Negation der Negation' als genitivus subjectivus zu verstehen ist. Die 'erste Negation' bestimmt sich fort zu einer 'zweiten Negation', in der aber nicht die 'erste Negation' negiert wird, sondern der 'Widerspruch', die Entgegensetzung von 'Position und Negation', mit der das 'spekulative Denken' seinen Anfang nimmt.7 Diese Struktur ist hier, bei der ersten Thematisierung der 'Negation der Negation' im Kapitel über 'Das Daseyn', noch nicht erreicht. Die zweite 'Negation' negiert die erste: "beyde Negationen, welche sich aufeinander beziehen, machen die Beziehung der Negation auf sich selbst aus [...] sie sind noch andre für einander". Denn "hier ist die an-sich-seyende Negation nur erst Sollen, zwar Negation der Negation, aber so daß diß Negiren selbst noch die Bestimmtheit ist" (GW 11, 72-77).
(Qualitative) Unendlichkeit als erste Form der 'Unendlichkeit'
C.
Die beiden Negationen in der 'Negation der Negation': die als 'Schranke' und "als Nichtseyn gesetzte Negation" und deren Negation durch die "ansichseyende Negation", das 'Sollen', "machen das (qualitativ) Endliche und (qualitativ) Unendliche, und deren Beziehung aufeinander aus" (GW 11, 77-78). Die 'Negation der Negation' sowie das 'Endliche' und 'Unendliche' müssen innerhalb der Seinslogik noch als 'quantitative' Beziehung und schließlich als 'Maß' gedacht werden, in dem 'Qualität' und 'Quantität' zur Einheit verbunden sind. Und erst nach dem Durchlaufen der Wesenslogik und der Begriffslogik werden sie in der 'absoluten Idee' in ihrer vollen Struktur erfaßt.
"Endlichkeit' als 'Werden'
1)
zur
"Unendlichkeit'
Die 'Unendlichkeit' tritt nicht zur 'Endlichkeit' hinzu als etwas zweites, "für sich fertiges über dem Endlichen"; sie ist im 'Endlichen' bereits mitgedacht. Sie ist "Anderseyn des Andersseyns" oder die Beziehung des 'Andersseyns' auf sich "durch Aufheben der Bestimmtheit". Dadurch ist sie nicht die "schlechte Unendlichkeit" des Verstandesdenkens, sondern "wahrhafte Unendlichkeit" der Vernunft. Wenn das 'Werden' als die erste Definition des 'Absoluten' gelten konnte, muß das 'Unendliche' als dessen "zweyte Definition" angesehen werden. Aufheben der 'Bestimmtheit' bedeutet aber nicht Aufheben der 'Endlichkeit', in der die 'Bestimmtheit' bereits aufgehoben ist. "Also nicht im Aufheben der Endlichkeit überhaupt, besteht die Unendlichkeit überhaupt, sondern das Endliche ist nur diß, selbst durch seine Natur dazu [zur Unendlichkeit; H.K.] zu werden" (GW 11, 78-79; Kursivierung von mir,
H.K.). 7
H. Kimmerle, "Die
allgemeine
Struktur der dialektischen Methode", in
schung 33 (1979), 184-209; s. bes. 198-200.
Zeitschrift für philosophische
For-
165
Heinz Kimmerle
2)
"Wechselbestimmung des Endlichen und Unendlichen" als "Beziehung
schlechthin
Anderer"
Das 'Endliche' ist die "erste Negation" der 'Bestimmtheit' des 'Daseyns', ihre "Negation als Nichtseyn", und das 'Unendliche' die zweite, "an-sich-seyende Negation". Sie sind also "nicht nur andere überhaupt gegeneinander, sondern sind beyde Negationen". Sonst wäre das 'Unendliche' als "das Schlecht-Unendliche" des Verstandes gedacht, als "das Leere, bestimmungslose Jenseits des Daseyns". Dann "scheint das Unendliche an dem Endlichen, und das Endliche an dem Unendlichen, das Andere an dem Anderen, nur hervorzutreten" und ihre Beziehung wäre "nur eine äusserliche". Wenn die "Wechselbestimmung des Endlichen und Unendlichen" in dieser Weise als Beziehung "schlechthin Anderer" aufgefaßt wird, haben wir hier, im Begriff des 'qualitativen Unendlichen', was "im Quantitativen als der Progreß ins Unendliche auftritt": dem 'Endlichen' wird immer wieder aufs Neue eine ihm äußere 'Grenze' gesetzt. Es geht nur in dieser äußerlichen Weise über sich hinaus ins 'Unendliche'. Und die 'Unendlichkeit' ist "nicht an und für sich, sondern nur [...] als Beziehung auf ihr Anderes", das 'Endliche'. Aber "überdiß Hinausgehen" über das 'Endliche' muß "selbst hinausgegangen" werden (GW 11,79-81). Das Andere darf nicht länger die Rolle des Anderen spielen.
3)
"Rückkehr der Unendlichkeit in sich" als das "Verschwinden" des Anderen
Das 'Endliche' und das 'Unendliche' sind aber nach Hegel in Wahrheit nicht Fremde oder Andere gegeneinander, sondern beide von der gleichen Art, daß das eine das andere in sich enthält. "In jedem selbst liegt daher die Bestimmung, welche in der Meynung des unendlichen Progresses oder des Sollens, nur von ihm ausgeschlossen ist, und ihm gegenüber steht". Die Extreme sind auf diese Weise zugleich zur Einheit miteinander verbunden. "Ihre Bestimmtheit gegen einander ist also verschwunden". Die "wahre Unendlichkeit" ist als das "Hinausgehen über das Andersseyn" die "Rückkehr zu sich selbst". Und das 'Andersseyn', "insofern es nicht unmittelbares Andersseyn, sondern Aufheben des Andersseyns" ist, ist selbst "die wiederhergestellte Gleichheit mit mit sich". Zur Bestätigung sagt Hegel: "Die Bestimmtheit des Daseyns ist als Beziehung auf Anderes verschwunden". Damit ist das 'Daseyn' selbst aufgehoben. "Dieses reine Bestimmtseyn in sich, nicht durch Anderes, die qualitative Unendlichkeit, das sich selbst gleiche Seyn, als die negative Beziehung auf sich ist das
Fürsichseyn".
Dieses Resultat wird in einer "Anmerkung" der "Natur des speculativen Denkens" zugeschrieben, das nicht bei der "unvollendeten Reflexion" stehen bleibt, für welche die Anderen Andere sind. Das spekulative Denken läßt die "entgegengesetzten Momente" nicht als Andere gegeneinander bestehen, sondern zeigt sie "in ihrer Einheit", die darauf beruht, daß jedes insofern dem Andern gleich ist als es "sein Gegentheil an ihm selbst" hat. Die Frage, die in der zeitgenössischen idealistischen Philosophie gestellt wurde: "Wie das Unendliche aus sich heraus und zur Endlichkeit komme", beantwortet sich in und mit dem Durchlaufen aller Bestimmungen der 'Logik' und des 'Systems der Philosophie'. In gewissem Sinn erübrigt sie sich. Denn wie das 'Endliche' von sich aus ins 'Unendliche' übergeht, ist dieses ist "für sich selbst schon eben so sehr endlich als unendlich". Auch wenn jedes das 166
Das Etwas und
(s)ein Anderes
Andere an sich hat, kann man nicht sagen, "daß Endliches und Unendliches dasselbe sind", weil dieser Satz "das, was ein Werden ist, als ruhendes Seyn ausdrückt" (GW 11, 82-85).
Tendenzen in der Bearbeitung der Seinslogik von 1831 für die geplante zweite Auflage
II.
Bekanntermaßen hat
Hegel vor seinem Tod nur das Erste Buch seiner Wissenschaft der Lodas er dann 'Die Lehre vom Sein' nennen wollte, für eine geplante zweite gik: Seyn', können. Man sollte also, anders als es in den meisten Hegelausgaben geAuflage bearbeiten schehen ist, die Wissenschaft der Logik im ganzen nach der ersten Auflage betrachten und die Bearbeitung des Ersten Buches daneben als Ergänzung gebrauchen, die diesen Teil des Ganzen betrifft. Für das 2. Kapitel des Ersten Abschnitts dieses Ersten Buches, das Gegenstand der Interpretation in diesem Beitrag ist, lassen sich aus den Änderungen, die Hegel aus Anlaß der Vorbereitung der zweiten Auflage angebracht hat, bestimmte Tendenzen ablesen. Diese sollen im folgenden herausgearbeitet werden. Damit wird nicht nur etwas über dieses Kapitel gesagt, sondern auch über die weiteren Schritte der Logik und diese insgesamt. Denn dieses Kapitel 'präfiguriert' wie wir gesehen haben die weiteren Schritte und das Ganze. 'Das
-
-
Übersicht der Verschiebungen im Aufbau des 2. Kapitels "Das Dasein"
1)
Eine Reihe von Verschiebungen fällt sogleich ins Auge. Die Titel einzelner Paragraphen oder Textpassagen in der ersten Auflage: 'Realität' (2x), 'Andersseyn', 'Bestimmtheit' (2x), 'Veränderung', 'Veränderung der Beschaffenheit' und 'Negation' kommen in der Bearbeitung für die zweite Auflage nicht wieder vor. Neu in dieser Bearbeitung sind die Titel: 'Die Endlichkeit' (2x), 'Die Unmittelbarkeit der Endlichkeit', 'Übergang des Endlichen ins Unendliche' und 'Der Übergang'. Nach dem ersten Paragraphen 'Daseyn überhaupt' sind alle weiteren Paragraphen und Textpassagen in ihrer Abfolge verschoben. Sie sind insgesamt stark erweitert (statt 26 sind es 51 Seiten), obwohl es in der Bearbeitung für die zweite Auflage weniger Gliederungspunkte bzw. Titel und Zwischentitel gibt (statt 22 nur 19). Die Kategorie 'Etwas' erscheint in dem späteren Text zweimal: das erste Mal, wie in der ersten Auflage, als dritte Kategorie von 'A. Dasein als solches', das zweite Mal in erweiterter Form: 'Etwas und ein Anderes', mit drei Unterpunkten ohne eigene Titel,8 als erster Paragraph von 'B. Die Endlichkeit'. Die Kategorie 'Qualität', die ja auch im Titel für alle drei Kapitel des Ersten Abschnitts der Seinslogik erscheint, kommt in der ersten Auflage unter 'B. Bestimmtheit', '2. Bestimmtheit' als dritter Punkt (c) wieder vor; in der Bearbeitung von 1831 bereits als zweiter Punkt (b) von 'A. Dasein als solches'. In einem ersten vorsichtigen Deutungsschritt läßt sich folgendes festhalten: Der Umfang der Veränderungen, die in diesem Kapitel vorgenommen werden, deutet darauf hin, daß es hier 8
Die HK.
zum
Zwecke besserer
Vergleichbarkeit
in
eckigen
Klammern
hinzugefügten
Titel stammen
von
mir,
167
Heinz Kimmerle
schwierigen, nicht ganz glatt zu behandelnden Sachzusammehang geht. Die Verschiebungen und Erweiterungen erweisen sich dann auch in verschiedener Hinsicht als inhaltliche Modifizierungen. In der ersten Auflage ist der Problemzusammenhang einer Ableitung der Kategorien der 'Qualität', wie sie auch bei Kant vorkommen, noch deutlicher zu erkennen. 'Realität', 'Negation' und 'Grenze' kommen an strukturell wichtigen Stellen des Gedankenganges zur Sprache. In dem späteren Text bleibt davon im Gliederungsgefüge nur die 'Grenze' an relativ untergeordneter Stelle übrig (als einer von drei Begriffen in 'B. Die Endlichkeit', 'b) Bestimmung, Beschaffenheit und Grenze'). Hegel folgt hier offensichtlich stärker seinen eigenen Motiven der Darstellung. einen
um
Die Verschiebung der Bedeutung des Anderen
2)
Bei einem mehr inhaltlich orientierten Vergleich, fällt sehr bald auf, daß die Bedeutung des Anderen, die in der ersten Auflage als 'Andersseyn', 'Seyn-für-Anderes' und 'Veränderung' erörtert wird, in der späteren Bearbeitung eine geringere Rolle spielt. 'Andersseyn' und 'Veränderung' kommen nicht mehr als eigene Titel in der Gliederung vor (s. GW 11, 60-62 und 72-78). Dafür wird das 'Andere' als Gegensatz des 'Etwas', der aber sogleich wieder aufgehoben wird, in einem eigenen Paragraphen eingeführt (L, 104-110). Der Gedanke, daß das 'Andere' nicht das 'Andere des Anderen' ist, sondern ein 'Anderes des Etwas', daß es deshalb ein 'anderes Etwas', also eigentlich dasselbe wie das 'Etwas', ein 'zweites Etwas' ist, spielt zwar in der ersten Auflage durchaus schon eine Rolle, wird aber in der späteren Bearbeitung zu einer Art Angelpunkt der gesamten Darstellung. Daß dem 'Etwas' ein 'Anderes' als sein 'Anderes' gegenübersteht, gewinnt eine systematisch zentrale Bedeutung.9 Es scheint in der ersten Auflage nicht ganz leicht zu sein, das 'Andere' zum Verschwinden zu bringen, damit sich schließlich in dem Gegensatz von 'Endlichkeit' und 'Unendlichkeit' gleichartige Momente gegenüberstehen: das 'Endliche', das von sich aus in das 'Unendliche' übergeht, und das 'Unendliche', das sich aufgrund des Durchgangs durch die 'Endlichkeit' als "wiederhergestellte Gleichheit mit sich" darstellt. Bis es soweit ist, behauptet sich das 'Andersseyn' als 'Negation' der 'Realität' des 'Etwas' auf vielfältige Weise. Am Anfang steht die lapidare Feststellung: "das Daseyn ist wesentlich Andersseyn" (GW 11, 60). Und es bedarf der 'Negation' der 'Veränderung' als 'Bestimmung' des 'Daseyns', damit die 'Bestimmtheit' als 'Endlichkeit' begriffen werden kann, die selbst zur 'Unendlichkeit' (hinübergeht (GW 11, 77-78). In der Bearbeitung für die zweite Auflage kann bereits durch den Erweis, daß das 'Andere' ein anderes, zweites 'Etwas' ist, die 'Bestimmtheit' des 'Daseins' als 'Endlichkeit' erfaßt werden, einer 'Endlichkeit' die von der 'Unendlichkeit' nicht wesentlich verschieden ist, da sie unmittelbar in diese übergeht (L, 103-110 und 124-125).
9
Auf diesen
Zusammenhang von 'Etwas' und 'Anderem' habe ich an früherer Stelle bereits hingewiesen; s. H. Kimmerle, "Die Geschichte als das Andere der Gegenwart. Dialektische und différentielle Elemente in der Methodologie der Geschichtswissenschaften", in Hegel-Jahrbuch 1983, Rom 1986, 69-82, bes. 71-72.
168
Das Etwas und
(s)ein Anderes
Wissenschaft der Logik 1. Auflage 1812 Erstes Buch. Das Seyn
Bearbeitung 2. Auflage 1831
Erstes Buch. Die Lehre vom Sein
Abschnitt. Bestimmtheit (Qualität)
Abschnitt. Bestimmtheit
1.
Kapitel. Seyn
1.
Kapitel.
Sein
2.
Kapitel. Das Daseyn A. Daseyn als solches
2.
Kapitel.
Das Dasein
1. 2.
(Qualität)
A. Dasein als solches
a) Dasein überhaupt
Daseyn überhaupt
b) Qualität
Realität
a) Andersseyn b) Seyn-für-Anderes und Ansichseyn c ) Realität 3. B.
c) Etwas
Etwas
B. Die Endlichkeit
Bestimmtheit 1.
Grenze
a) Etwas und Anderes 1. 2. 3.
2.
Bestimmtheit
[Beide sind Daseiende] [Sein-für-Anderes und Ansichsein] [Identität von 1+2.]
b) Bestimmung, Beschaffenheit, Grenze
a) Bestimmung b) Beschaffenheit c) Qualität
3.
Veränderung a) Veränderung b)
c) Die Endlichkeit
der Beschaffenheit Sollen und Schranke
a
ß
c) Negation C.
y
C. Die Unendlichkeit
(Qualitative) Unendlichkeit 1. 2. 3.
Endlichkeit und Unendlichkeit Wechselbestimmung des Endlichen und Unendlichen Rückkehr der Unendlichkeit in sich
a) Das Unendliche überhaupt b) Wechselbestimmung des
Endlichen und Unendlichen
c) Die affirmative Unendlichkeit Der
3.
Kapitel. Das Fürsichseyn
Die Unmittelbarkeit der Endlichkeit Die Schranke und das Sollen Übergang des Endlichen in das Unendliche
3.
Kapitel.
Übergang
Das Fürsichsein
169
Heinz Kimmerle
3)
Die Homogenisierung der Begriffe des
spekulativen Denkens
Im Text von 1831 ist nicht mehr davon die Rede, daß das Andere oder das Anderssein "verschwindet" (s. GW 11, 67, 73, 82, 83). Durch die Entgegensetzung zum 'Etwas', die unmittelbar zu seiner Aufhebung führt, ist das 'Andere' sehr viel weniger widerspenstig als in der ersten Auflage. Es muß nicht zum Verschwinden gebracht werden, sondern fügt sich eher mühelos in den Gang des spekulativen Denkens ein, in dem es nunmehr aufgehoben wird, ohne daß wiederholte Versuche notwendig sind, sein Anderssein hinwegzuarbeiten. Es ist bereits bei der ersten Einführung des 'Etwas' als dessen 'Negatives' "nur ein Anderes über-
haupt" (L, 101-103; Kursivierung von mir, H.K.). Deshalb kann in diesem Zusammenhang auch sogleich die für das spekulative Denken grundlegende Figur der 'Negation der Negation' eingeführt werden. Das 'Insichsein' des 'Etwas' erweist sich im Sinne der 'Präfiguration' der Bewegungsform des reinen sich selbst denkenden Denkens im 'Dasein' für die gesamte Logik als der "Anfang des Subjekts", das schließlich, in der Begriffslogik, im voll entwickelten und in dieser Wortbedeutung 'konkreten' Sinne als "Rückkehr zu sich" bestimmt werden wird. Diese Struktur ist hier zum erstenmal, aber freilich nur als "sehr oberflächliche" und "ganz abstrakte" Bestimmung vorhanden
(L, 102).
Die 'Mitte' zwischen dem 'Etwas' und dem 'Anderen' muß im späteren Text nicht umständlich einmal als die leere Mitte der 'Grenze', das heißt als das "Nichtseyn eines jeden" von beiden, erfaßt werden und ein anderes Mal als doppelte Mitte, in der sich beide auf einander beziehen, wobei sich als die 'Bestimmung' des 'Etwas' die 'Beziehung auf sich selbst' ergibt (s. GW 11, 68 und 70). In der späteren Bearbeitung, in der das 'Etwas' bereits bei seinem ersten Auftreten die Struktur der 'Negation der Negation' hat, kann es auch sogleich als "Vermittlung seiner mit sich selbst" gedacht werden (L, 103). Wie das 'Positive' und das 'Negative' in der Wesenslogik haben das 'Etwas' und das 'Andere' "keinen Sinn ohne einander". In diesem Sinn sind beide 'nur' Schein. Das heißt, sie beziehen sich aufeinander in der Weise der 'Dialektik des Scheinens'. An beiden ist "ihr Scheinen ineinander, das Scheinen seines Andern in jedem, vorhanden" (L, 109; Kursivierung von mir, H.K.). Daraus ergibt sich die 'Bestimmung' des 'Etwas', der es "gegen seine Verwicklung mit Anderem [...] gemäß bleibt, sich in seiner Gleichheit mit sich erhält". Das 'Anderssein' des 'Anderen' findet sich nur noch in der Äußerlichkeit der 'Beschaffenheit' (L, 110111). Schließlich kann vom 'Etwas' und dem 'Anderen' gesagt werden: "Jedes ist nur Etwas überhaupt, oder jedes ist Anderes; beide sind so Dasselbe" (L, 115). Damit ist der Weg frei, die Beziehung des 'Endlichen' und 'Unendlichen' als Beziehung zwischen Entgegengesetzten zu denken, die sich doch gleich sind. Die entgegengesetzten Begriffe sind von gleicher Art, so daß sie einander benötigen, einander verständlich machen und ineinander übergehen. Hegel nennt das 'Unendliche', das aus dem 'Endlichen' hervorgeht und im Durchgang durch das 'Endliche' zu sich zurückkehrt, das "wahrhafte Unendliche" (L, 126). Darin zeigt sich die "Natur des spekulativen Denkens", daß in dieser Einheit des 'Endlichen' und 'Unendlichen' die endlichen Gegebenheiten des 'Etwas' und des 'Anderen' als ideelle Momente erhalten sind. Das heißt, diese sind "nicht abstrakt verschwunden", wie es in der ersten Auflage der Seinslogik dargestellt worden war, "sondern aufgelöst und versöhnt", und die einander widersprechenden "Gedanken sind nicht nur vollständig, sondern sie sind auch zusammengebracht" (L, 142; Kursivierung im Zitat von mir, H.K). 170
Das Etwas und
(s)ein Anderes
Das spekulative Denken kann auf diese Weise in sich konsequent entwickelt werden. Es kann die Widersprüche, die sich immer wieder hervortun, in denen die Entgegengesetzten gleichartige, homogene Momente sind, in einem kumulativen Verfahren 'auflösen' und 'versöhnen'. Der Preis, den Hegel für dieses Verfahren bezahlen muß, ist nicht so sehr, wie es in der ersten Auflage dargestellt worden ist, daß das Andere, das zunächst noch vorhanden ist, 'zum Verschwinden gebracht wird', sondern vielmehr die völlige Nivellierang oder Homogenisierung der Begriffe, so daß das Andere mit seinem Gegenteil dasselbe ist. Louis Althusser vermißt in dieser Konzeption des Widerspruchs die 'wirkliche Komplexität' des Denkens, die notwendig ist, damit es die 'komplexe Wirklichkeit' erfassen kann. Er sieht darin eine "kumulative Verinnerlichung", die nur den Anschein der Komplexität hat und der Wirklichkeit nicht gemäß ist.10 Er drückt sich auch so aus, daß die Teil-Einheiten, die aus homogenen entgegengesetzten Begriffen zusammengebracht werden und aus denen die Einheit der Gesamtheit der Begriffe des reinen Denkens in der Logik schließlich hervorgeht, bereits die Struktur dieser Gesamt-Einheit erkennen lassen, daß sie jeweils 'pars totalis' sind. Wenn die Konzeption des Widerspruchs 'wirklich komplex' ist, so daß darin nicht nur homogene 'Momente' gedacht werden, ist ein wichtiger Schritt getan, um die Eskamotierang des Anderen im spekulativen Denken Hegelscher Prägung zu vermeiden. Althusser führt in diesem Zusammenhang den Gedanken der "Überdeterminierung" ein. Er unterscheidet mit Mao Zedong wechselnde Konstellationen von 'Haupt- und Neben-Widersprüchen' und von der 'hauptsächlichen Seite' in einem Widerspruch.11 Auf diese Weise ergibt sich eine in sich dynamische und veränderliche "Struktur", die aber "in letzter Instanz" von einer "Dominante" bestimmt wird. Diese 'Dominante' ist für Althusser im Marxschen Sinn das "Ökonomi-
sche".12
Es ist indessen ein weiterer Schritt notwendig, um die 'Homogenisierung der Begriffe' rückgängig zu machen und dem Anderen im Denken zu seinem Recht zu verhelfen. Die Dialektik insgesamt muß in ihrer Begrenztheit gesehen werden. Um diesen Schritt tun zu können, ist die 'Differenz' in der Erörterung des Verhältnisses von 'Identität' und 'Unterschied' als eine eigene 'Instanz' zu erfassen, die nicht zu einem 'Moment' des 'Widerspruchs' gemacht und in diesem schließlich 'aufgelöst' wird.13 Es ist sicherlich bemerkenswert, daß Hegel selbst während der Jenaer Periode, genauer gesagt in den Jahren 1804/05, zwar nicht in der 'Logik', aber im Übergang von der 'Logik und Metaphysik', wie er den Ersten Teil seines 'Systems der Philosophie' in dieser Zeit nennt, zur 'Naturphilosophie', bei der Ableitung des "Begriffs der Bewegung", die 'einfache Beziehung' der Begriffe des 'Seins', insbesondere im Blick auf den Begriff der 'Grenze', als "absolut différente Beziehung" auffaßt. Nach dieser Darstellung enthält der "Moment der Gegenwart, das absolute dieses der Zeit, oder das Jetzt", als die "Gräntze" zwischen Zukunft und 10 L. Althusser, Für Marx, Frankfurt a.M. 1968, 52-99; s. bes. 64-67. 11 Mao Tse-tung, "Über den Widerspruch", in Ausgewählte Schriften, Bd. 1, Berlin 1956, 353^100; s. bes. 379388. 12 L. Althusser, Für Marx (Anm. 10), 146-167. 13 Zu dieser Problematik, die Hegel am Anfang der Wesenslogik behandelt, habe ich mich früher mehr im einzelnen geäußert: H. Kimmerle, "Verschiedenheit und Gegensatz. Von der Dialektik zum Denken der Differenz", in Hegels Wissenschaft der Logik. Formation und Rekonstruktion, hg. v. D. Henrich, Stuttgart 1986,
265-282.
171
Heinz Kimmerle
Vergangenheit, diese anderen
'Momente der Zeit' in sich. Es ist "einfache
Beziehung" beider
aufeinander, aber in dieser Einfachheit "différente Beziehung".14 Im Rahmen dieser für die
europäisch-westliche Philosophie seit Aristoteles einzigartigen Philosophie der Zeit erweist
sich der Zeit-Punkt des Jetzt als in sich différente Einfachheit. Das heißt, er enthält in seiner Einfachheit eine nicht reduzierbare interne Differenz. Um diesen Gedanken in seiner vollen Konsequenz zu erfassen, wird man die 'Philosophien der Differenz' heranziehen müssen, wie sie von Adorno und Heidegger, Foucault und Derrida in Ansätzen ausgearbeitet worden sind. Die damit gestellte Aufgabe ist schwierig genug und kann ohne den kritischen Rückbezug auf Hegels Logik von 1812-16 und 1831 nicht gelöst werden. Wenn man freilich bedenkt, zu welchen radikal eurozentrischen geschichts- und kulturphilosophischen Äußerungen Hegel in seiner Berliner Periode (18181831) auf der Grundlage der logischen Homogenisierung des Andersseins gelangt, wird man es ebenso als notwendig einsehen, von den 'Philosophien der Differenz' und ihren Ansätzen, die Anderen zu ihrem Recht kommen zu lassen, die Linie durchzuziehen zu einer Kritik am Eurozentrismus und zur Ausarbeitung einer interkulturellen Philosophie.
14 GW 8, 194-195.
172
Önay Sözer Grenze und Schranke das Mal des Endlichen
-
Der Hegeische Begriff der Grenze hat seine Wurzeln in der Geschichte der westlichen Metaphysik, seine dialektische Bearbeitung ruft alle darin liegenden Probleme zurück, um sie zu abschließenden Ergebnissen zu führen. Seiner doppelten Formulierung nach bei Hegel als und Sich-Verändern der Dinge und als Schranke im Sinne des Endes, des sterblichen Seins, führt uns dieser Begriff zu dem Problem des Seins, des Lebens und des Nichts, des Todes, zu der Beziehung beider zueinander, und letzlich der Beziehung des Seienden auf diese 'Beziehung' selbst. Der bekannte Satz Hegels am Anfang der Wissenschaft der Logik, der das grenzenlose Ineinandergehen des Seins und des Nichts zum Ausdruck bringt: "Das reine Sein und das reine Nichts ist also dasselbe" nähert sich dem Heideggerschen Begriff der "ontologischen Differenz" an, der einen umfassenderen Blick auf dieses Problem bietet. Insofern es hier um die ontologische Differenz geht, hat dieser Satz keine "Unbestimmtheit und Unmittelbarkeit". Seine eigentliche Wahrheit liegt in der Tatsache, daß "das Sein selbst im Wesen endlich ist und sich nur in der Transzendenz des in das Nichts hinausgehaltenen Daseins offenbart".1 In dem ersten Teil dieses Satzes gibt es nichts, was Hegels Bearbeitung der Seinsproblematik im Hinblick auf die Endlichkeit in der Wissenschaft der Logik widersprechen könnte. Muß man nach Heidegger voraussetzen, daß Hegel bereits die ontologische Differenz (des Seins und des Seienden, bzw. des Nichts) vorweggenommen hat? Heidegger selbst stellte sich nachträglich die Frage: "Wenn daher Hegel das "Nichts" mit dem "Sein" in seinem Sinne zusammenbringt, dann scheint er das Nichts nur "abstrakt" einseitig zu fassen, und nicht und nicht einmal als das Nichts der Wirklichkeit. Oder doch? Weil eben das Sein selbst nichts anderes ist als das Nichts der Wirklichkeit, deshalb ist das Nichts im absoluten Sinne mit dem "Sein" dasselbe und es besagt das für die "Wirklichkeit" (das Seyn)."2 Abgesehen von der Problematik des Anfangs der Logik, wird das impizite Verhalten Hegels gegenüber der ontologischen Differenz von Heidegger als eine "Absage" charakterisiert: "die Absolute Wirklichkeit, deren Energie die absolute Negativität, [geht] selbst aus der Absage an das Seiende, genauer: an den Unterschied von Sein und Seiendem" hervor.3
Übergehen
-
1 2 3
M. M.
Heidegger, "Was ist Metaphysik?" in Wegmarken, Frankfurt a.M. 1978, Heidegger, Hegel, Frankfurt a.M. 1993 (Gesamtausgabe, Bd. 68), 50.
Ebd., 24.
119.
Önay
Sözer
Nach unserem Verständnis läßt sich die Heideggersche These der "Absage" mit der Annahme vertragen, daß die Selbigkeit des Seins und des Nichts im Anfang der Wissenschaft der Logik schon die ontologische Differenz beinhaltet, die aber von Hegel gleichzeitig dialektisch interpretiert wurde. Der Beweis dafür ist die Tatsache, daß sich Hegel besonders in der Seinslogik, aber auch weiter in der Wesenslogik auf die ununterscheidbare Differenz zwischen Sein und Nichts immer wieder zurückbezieht und die erreichte dialektische Stufe mit neuen Unterscheidungen gegen ein Zurückfallen in die In-Differenz zu verteidigen versucht. In meiner Interpretation der Grenzproblematik werde ich unten besonders solchen Hinweisen des Begriff des Endlichen folgen, die sich auf das Absolute zurückbeziehen. Was ich hier beabsichtige, ist eine Art der abbauenden Lektüre der Hegelschen "Absage" an das Problem der ontologischen Differenz, bzw. des Nichts, das gleichzeitig von ihm als solches im Blick gewesen ist. Gleichzeitig erfolgt dieser Abbau in Distanz zu Heidegger, indem er sich auf den Weg einer positionalen oder positiven Dekonstruktion begibt. Hegels allgemeines Verständnis vom Sein entspricht dem Heideggerschen Begriff des Seienden (dessen konkrete, intentionale Form das Dasein ist). Aus diesem Grund geht es hier nicht um einen Abbau als vielmehr um eine Rücklektüre, die das Problem des endlichen Seins radikalisiert.4 Durch diese Lektüre werde ich versuchen, dieses "Sein" auf die beziehungslose Beziehung des Seins auf das Nichts, auf das "Nicht" zu beziehen, das, abstrahiert vom Werden und vom Dasein (als seinem Platzhalter), eine Form der ontologischen In-Differenz ist. Wir werden sehen, daß es gerade der Begriff der Grenze ist, der diese Rücklektüre (des Endlichen zur unterschiedlosen Differenz) erfordert.
Die Grenze beim Übergehen
zum
"Nicht"
Sehen wir näher und ausführlicher, was diese Rücklektüre bieten wird. Im Hinblick auf die Beziehung des ersten Kapitels der Wissenschaft der Logik (das mit den leeren Sein und Nichts anfängt) auf die nächsten Kapitel bzw. auf die weitere dialektische Entwicklung sagt Hegel zweierlei: Sein und Nichts bilden "ihre abstrakte Grundlage", wie sie in ihrer "Unwahrheit" sind, aber sie finden erst ihre Einheit in der Form des Werdens "als erste Wahrheit", die "ein für allemal zugrunde liegt und das Element von allem Folgenden ausmacht".5 In dieser Weise basieren alle folgenden gegensätzlichen Begriffspaare wie Etwas und Anderes, das Endliche und das Unendliche usw. (natürlich bis hin zum entwickelteren Gegensatz des
4
5
W. Janke sieht den Begriff der Endlichkeit ummittelbar verbunden mit dem Problem des Seins und des Nichts. Aber eine genauere Interpretation dieser Problematik erfordert das, was ich hier eine Rücklektüre nennen möchte, weil der Begriff der Endlichkeit seinem systematischen Ort nach schon die Behandlung des Widerspruchs des Etwas auf dem Wege der Negation der Negation braucht. Vgl. W. Janke: "Die Trauer des Endlichen. Anmerkungen zur Aufhebung der Endlichkeit in Hegels Seinslogik", in Philosophie der Endlichkeit. Festschrift für Erich Christian Schröder zum 65. Geburtstag, hg.v. Beate Niemeyer u. Dirk Schütz, Würzburg 1992, 92. G.W.F. Hegel, Wissenschaft der Logik. Die Lehre vom Sein (1832). hg. v. H.-J. Gawoll, Hamburg 1990, 75. Im folgenden zitiert: WdL I.
174
Grenze und Schranke
Seins und des Werdens in der Wesenslogik) auf dieser arche-ischen Grundlage und kommen wie parallel laufende Schichten in ihrer Einheit darauf zurück. Nur an einem Punkt geschieht ein unvermeidbarer Rückgang zu diesem (anfangslosen) Anfang des Seins/Nichts, weil er gerade von der Sache her verlangt wird. Das geschieht, wo der Begriff der Endlichkeit behandelt wird. Das endliche, sterbliche Sein vervollkommnet den Bestimmungsprozeß des Etwas gegen die erstere Unbestimmtheit des Seins/Nichts aufgrund der "immanenten Grenze", die ihr gesetzt wird. In dieser Hinsicht ist das endliche Sein einerseits der höchste Punkt des Gegensatzes der Bestimmtheit gegenüber der absoluten Leere des Seins/Nichts. Andererseits steht es dem Nichts am nächsten aufgrund seines Vergehens. Deswegen wird mit dem Begriff des Endlichen die ganze Beziehung zum Sein/Nichts ausgeholt, weiter bearbeitet und zum Ende geführt. An dem noch nicht anfangenden Anfang bedeutete das Sein zugleich das Ende. Nur Kraft dieser interpretierenden Rückbeziehung des schon bestimmten Etwas (nämlich des Endlichen) auf das Nichts wird es möglich, eine neue dialektische Einheit zu gewinnen, nämlich die positive Einheit der Endlichkeit (die das Nichts ersetzt) mit der Unendlichkeit (des Seins). Wenn man die Sache so betrachtet, wird es verständlich, daß es auch eine Zickzackentwicklung, aufsteigend vom Sein/Nichts, gibt, die von der anfänglichen Unbestimmtheit, der Leere, zur Bestimmtheit, zur Unendlichkeit hinübergeht. Es ist nur diese Zickzackbewegung, die es jetzt ermöglicht, daß sich die neue Einheit der Endlichkeit/Unendlichkeit bildet, die das Etwas und das Andere als die Elemente aus der früheren Einheit des Werdens in sich enthält und neu interpretiert. Hegel sieht das Werden, die Einheit des Seins und des Nichts, als ein Drittes gegenüber den beiden Momenten an. Er schreibt: "Übergehen ist dasselbe als Werden, nur daß in jenem die beiden, von deren einem zum anderen übergegangen wird, mehr als außereinander ruhend und das Übergehen als zwischen ihnen geschehend vorgestellt wird. Wo und wie nun vom Sein oder Nichts die Rede wird, muß dieses Dritte vorhanden sein; denn jene bestehen nicht für sich, sondern nur im Werden, in diesem Dritten".6 Von einer umgekehrten Blickrichtung kann man ebenso sagen, daß ihr Bestehen im Werden als ein Drittes auf der ursprünglicheren arche-ischen Zweiheit der beiden beruht, und daß der absolute Grund dessen, was zwischen ihnen geschieht, diese Zweiheit ist. Dieser Punkt zeitigt seine Konsequenz für unser Problem der Grenze. Das problematische, gedoppelte Verhältnis des Seins/Nichts bleibt aufgrund des oben genannten Zickzacks im Hinblick auf das endliche Sein als Grenze und Schranke nicht nur eine bloße Unterlage, sondern es liegt eine Unterlage vor, in die sich die dialektische Entwicklung hineinleben und sich einweben muß. Das Werden oder Übergehen ist eigentlich nichts anderes als dieses "Hineinleben". Die Entwicklung des Etwas bis zum Punkt, wo es mit seiner Grenze definierbar wird, läuft parallel zum Übergehen des Seins zum Nichts. Die "Grenze" ist gerade der Name für diesen Übergang zum Anderen (als die neue Interpretation des Nichts in der Sphäre des bestimmten Etwas), ein Übergang, der von Hegel substantiviert und als ein Drittes konsolidiert und dann zu einem "Prinzip" gemacht wird. -
-
-
6
-
Ebd., 85.
175
Önay
Sözer
Mangel und Grenze Wie
zeigt sich die Grenze? Wo ist die Grenze? Die einfachste Antwort auf die erste Frage vom Etwas gegenüber dem Anderen. Wir haben oben beim Ursprung der Grenze den "Übergang" oder das Übergehen vom Sein zum Nichts wiedergefunden. Nach der nachfolgenden Form der Dialektik ist die Grenze der Übergang vom Etwas zum Anderen, wodurch ein Etwas von einem Anderen negiert wird. Besser ausgedrückt: Die Negation vom Etwas (ihre Bestimmtheit, die sich nach der Reihe als ihre Qualität, Bestimmung und Beschaffenheit erweist) ist nichts anderes als die Substantivierung, die Kodifizierang, die Registrierung des betreffenden Übergangs bis zu dem Punkt, wo sie zum Prinzip gemacht wird. In diesem Übergang wird nochmals übergegangen, indem die Sache vom Standpunkt des Anderen (seiner Bestimmtheit her) auf dem Wege der Vervollkommwäre: Die Grenze ist immer die Grenze
nung der Idee
Etwas betrachtet wird. Solchermaßen entsteht die Negation der Negation zum Anfang, zum Selbst von Etwas führt). Das Hauptcharakteristikum dieser Negation der Negation ist in unserem Zusammenhang das Folgende: Um die Grenze von sich aus zu gestalten, gewinnt die erste Negation eine Selbstständigkeit gegenüber der Negation der Negation, innerhalb deren sie existiert (sonst gibt es keine Grenze). Ich werde auf das Problem der Negation der Negation nochmals zurückkommen. Für unseren jetzigen Zweck reicht es aus, zu bemerken, daß der Begriff der Grenze bei Hegel immer die Spannung der zwei Seiten (des Etwas und des Anderen, oder der ersten Negation und der Negation der Negation) braucht, und daß diese Spannung substantiviert wird, um diese am Ende der eigentlichen Substanz, dem Etwas als seine immanente Grenze zurückzugeben. Dabei bleibt die zu ihrer eigenen Negation sozusagen artikulierte erste Negation als ein Strukturmoment, als ein Referenzpunkt für die ganze Entwicklung des Problems der Grenze erhalten. Die erste Form der Grenze ist der Mangel, der eigentlich alles enthält, was zum Begriff der Grenze notwendig ist. Das Dasein als das erste Produkt des Werdens hat zwar seine Wurzeln in dem anfänglichen Sein, aber als das bestimmte Sein: Es ist erst jetzt bestimmt gegen das Nichts und wird definiert als ein Nicht-Nichtsein. Diese Bestimmtheit vom Dasein ist seine Qualität, wenn man sie isoliert betrachtet; und wenn man ihr die Seiendheit überhaupt zuspricht, ist sie die Realität im allgemeinen, vieldeutigen und auch im metaphysischen Sinne. Aber insofern das Dasein gegenüber seinem Nichtsein bestimmt ist, hat es eine Beziehung zu diesem Nichtsein. Seine Bestimmtheit als Qualität bildet seine Verneinung. In dieser Weise versucht Hegel, die Realität und die Verneinung (die Selbständigkeit und die Abhängigkeit vom Dasein) zunächst getrennt zu halten, um sie dann in der Definition des "Mangels" in der Negation selbst als die Qualität vom Dasein äußerlich zusammenzubringen. Die Bestimmtheit erscheint als "eine Qualität, aber die für einen Mangel gilt, sich weiterhin als Grenze, Schranke bestimmt."7 Auch das, was Hegel über den Jacob Böhmischen Ausdruck der "Qualierang" oder "Inqualierung" sagt, daß sie "die Bewegung einer Qualität (der sauren, herben, feurigen usf.) in ihr selbst" bedeutet, "insofern sie in ihrer negativen Natur (in ihrer Qual) sich aus anderem setzt und befestigt, überhaupt die Unruhe ihrer an ihr selbst ist, nach der sie nur im Kampfe sich hervorbringt und erhält", antizipiert den späteren von
(die affirmativ zurück
-
7
Ebd., 105.
176
Grenze und Schranke
Begriff der immanenten Grenze und das Problem der "Endlichkeit".8 Hierbei muß man allerdings beachten, daß die Realität und die Negation nur implizit ineinander enthalten sind. Anders ausgedrückt: In diesem Fall ist die Negation eine bestimmte Negation und der Mangel ist immer der Mangel von etwas anderem. Das Etwas ist die erste Einheit, das immanente Zusammenkommen der Realität und der Negation, aber eine Einheit, die zugleich als die Negation der Negation bestimmt wird. Ich hatte oben gesagt, daß das Etwas diejenige Negation der Negation ist, die die Selbständigkeit der ersten Negation als die Grenze beibehält oder diese erste Negation immer noch an sich hat. Das ist eigentlich gleichbedeutend damit, daß das Etwas ein dialektisches, unabdingbares Verhältnis mit dem Anderen wachhält. Alle Begriffe der Bestimmung, Beschaffenheit und Grenze ergeben sich aus der Anwesenheit des Anderen gegenüber dem Etwas, aus dem Bestehen der ersten Negation innerhalb der Negation der Negation, und weiter aus der Wechselbeziehung zwischen dem Etwas und dem Anderen (das Etwas ist ein Anderes gegenüber dem Anderen, das das Etwas ist). Wir müssen hier nur hinzufügen, daß das unauflösbare Paar Etwas und Anderes auch nötig für den ganzen Begründungszusammenhang ist, wo die Grenze zum Prinzip, zum Anfang von Etwas (bzw. von Anderem) gemacht wird und wo die Grenze nicht nur als das Ende betrachtet wird. Hegel bezieht sich auf das geometrische Beispiel, das ihm von Aristoteles bis hin zu Kant überliefert wurde: "so ist die eine Bestimmung, daß Etwas das, was es ist, nur in seiner Grenze ist; so ist also der Punkt nicht nur so die Grenze der Linie, daß diese in ihm nur aufhört und sie als Dasein außer ihm ist [...]. Sondern im Punkte fängt die Linie auch an; er ist ihr absoluter Anfang, auch insofern sie als nach ihren beiden Seiten unbegrenzt oder, wie man es ausdrückt, als ins Unendliche verlängert vorgestellt wird, macht der Punkt ihr Element aus, wie die Linie das Element der Fläche, die Fläche das des Körpers. Diese Grenzen sind Prinzip dessen, das sie begrenzen".9 Weiter schreibt er: "Daß Punkt, Linie, Fläche für sich, sich widersprechend, Anfänge sind, welche selbst sich von sich abstoßen, und der Punkt somit aus sich durch seinen Begriff in die Linie übergeht, sich an sich bewegt und sie entstehen macht usf., liegt in dem Begriff der dem Etwas immanenten -
Grenze".10
Der Grund dafür, daß Hegel den Punkt als einen Grenzpunkt als ein Prinzip betrachliegt in der Zufälligkeit des Punktes in der Gestalt der selbstbewegenden Linie, die man traditionell angenommen hat. Wir können hier gegenüber dieser Betrachtung die folgende Frage stellen: Was ist die Beziehung dieser Bewegung auf den absoluten Anfang, der gleichzeitig ein Ende ist? Bleibt nicht der ruhige Punkt innerhalb der ewigen Bewegung der Linie enthalten? In welcher Weise? tet,
-
-
8 Ebd., 109. 9 Ebd., 124. 10 Ebd., 125.
177
Önay
Sözer
Grenze als Schnittpunkt Innerhalb der Problematik der Grenze/Schranke müssen wir zwei Arten der Negation der Negation unterscheiden: 1) "die erste Negation der Negation" ist Etwas "als einfache, seiende Beziehung auf
sich";11
Die vollkommenere Negation der Negation ist aber das Übergehen des Endlichen (das das Etwas ist) zur Unendlichkeit: "Das Unendliche ist die Negation der Negation, das Affirmative, das Sein, das sich aus der Beschränktheit wiederhergestellt hat".12 Wie wir wissen, gewinnt die Negation der Negation ihre letzte Gestalt in der Wesenslogik, wo die Beziehung des Seins auf das Wesen vom Standpunkt des Wesens endgültig definiert und das Sein vom Wesen seinem vollen Inhalt und Reichtum nach gesetzt wird. Die zwei genannten Negationen der Negation innerhalb der Seinslogik präsumieren schon die Probleme und die Begriffsausrüstung der Wesenslogik und wachsen gewissermaßen in ihrem Schatten. Das ist wichtig für unsere Verständnis des Hegelschen Begriffs der Grenze. Die erste Form der Negation der Negation in der Form von Etwas (als das Zusammenbringen der Realität und der Negation, wie wir es gesehen haben) ist nach Hegel schon der Anfang des Subjekts, obwohl es hier um eine niedrigere Stufe des Anfangens geht, insofern die Negation der Negation hier unbestimmt bleibt. Allerdings handelt es sich hier um eine "Vermittlung seiner mit sich selbst', weil beide Seiten, Realität und Negation, in der identischen Selbstheit des Etwas zusammen kommen: "die Vermittlung mit sich ist im Etwas gesetzt, insofern es als einfaches Identisches bestimmt ist".13 Dieses "Setzen", das zunächst nach Hegel -jedem Begriff als solchem zugehört und gegen die Unmittelbarkeit des Wissens (vom Sein und Nichts) nichts erhebliches besagt, läßt sich in der Dialektik von Etwas und Anderem spezifizieren. Daraus resultieren Konsequenzen für den Begriff der Grenze. Hegel schreibt: "In der Sphäre des Seins geht das Dasein aus dem Werden nur hervor [...] aber das Endliche bringt das Unendliche nicht hervor, setzt dasselbe nicht".14 Dieses "Hervorgehen" ist gleichbedeutend mit dem Übergehen. Das Andere ist ein erster Entwurf des Unendlichen; das Etwas, das wesentlich endlich ist, kann nicht das Andere produzieren, kann es nicht setzen. Das Etwas bleibt auf der Seite der ersten Negation, das Andere vertritt dagegen die Negation der Negation. Da aber Etwas schon die Beziehung auf sich selbst (dadurch die erste Form der Negation der Negation) ist, muß jetzt diese Negation der Negation im Hinblick auf das Problem seiner Endlichkeit, der Grenze in der Gestalt des Anderen in ihm gesetzt werden. Das ist jetzt ein Setzen im spezifischen Sinne: "Etwas verhält sich so aus sich selbst zum Anderen, weil das Anderssein als sein eigenes Moment in ihm gesetzt ist".15 Daraus entstehen zwei Bewegungen: Etwas geht in das Andere über (es ist als Etwas schon ein Anderes wie das Andere), das Andere aber wird in ihm gesetzt, wobei es in sich selbst bleibt: "es ist als sich negativ dagegen verhaltend und sich damit erhaltend gesetzt; dieses
2)
-
-
-
-
11 12 13 14 15
Ebd., Ebd., Ebd., Ebd., Ebd.,
178
110. 136. HOf. 117.
121.
Grenze und Schranke
Andere, das Insichsein des Etwas als Negation der Negation ist sein Ansichsein, und zugleich ist dieses Aufheben als einfache Negation an ihm, nämlich als seine Negation des ihm äußerlichen anderen Etwas. Es ist eine Bestimmtheit derselben, welche sowohl mit dem Insichsein der Etwas identisch, als Negation der Negation, als auch, indem diese Negationen als andere Etwas gegeneinander sind, sie aus ihnen selbst zusammenschließt und ebenso voneinander, jedes das Andere negierend, abscheidet, die Grenze".16
Wir können jetzt das Bestehen der ersten Negation als Grenze innerhalb der Negation der Negation besser verstehen: Die Grenze ist der Schnitt- oder Querpunkt des Übergehens (im Sinne der Seinslogik) und des Setzens im Keime (der Wesenslogik), des Ansichseins und des Fürsichseins. Dadurch wird sie aber auch zum Schnittpunkt der "absoluten Negativität" (die von der Negation der Negation vertreten wird) und der "abstrakten Negativität" (die nicht verwechselt werden darf mit der Abstraktheit der unmittelbaren Negation des Seins/Nichts). Weiter ist der Begriff der Grenze die Grenze selbst und der Treffpunkt der bisherigen traditionellen metaphysischen (unkritischen oder kritischen) Philosophie und der Dialektik im Hegelschen Sinne (die erste vertreten von der Seinslogik, die zweite von der Wesenslogik). An diesem Punkt der logischen Entwicklung muß es uns nicht überraschen, daß mit dem Begriff der Grenze das Problem des Todes auftaucht und mit dem "absoluten Anfang" des Seins das Nichts zurückruft.17 Der Tod gehört zwar ursprünglich zu diesem Anfang, aber er wird im Zusammenhang des anfangenden Subjekts (des Etwas) neu definiert. Es ist daher kein Wunder, daß dieser Anfang schon das Ende ist (nämlich des Subjekts), weil das Subjekt wiedergeboren werden muß in der dialektischen Unendlichkeit. -
Die Schranke als die gespaltene Negation der Negation Im "absoluten Anfang" geht es um die Ununterscheidbarkeit von Sein und Nichts in ihrer Differenz. Nur die Einheit des Seins und des Nichts (ihr Ineinanderübergegangensein) ermöglicht die Dialektik, und der erste Anfang der Dialektik ist das Werden, dessen Produkt das Dasein ist. Aber das konkrete Dasein ist das Endliche, das mit seiner immanenten Grenze in einem Widerspruch steht, wodurch es als der eigentliche Anfang betrachtet werden kann. Das Endliche, zu dem sich das Dasein, das Etwas, bestimmen läßt, ist die Zuspitzung des Übergehens des Seins zum Nichts in einer konkreten Form. Alles was bisher über die Grenze gesagt worden ist, muß im Zusammenhang der Veränderung der Dinge verstanden werden. "Grenze" in diesem Sinne entspricht dem griechischen Begriff peras, den Hegel nicht länger als ruhige Grenze der Dinge, sondern als das Dasein im Übergehen zu ihrem Nichtsein interpretiert. Die radikalste, definitive Veränderung ist das Vergehen, das vollkommene Übergehen zum Nichts. Diese unvermeidbare Zickzackbewegung bringt uns zurück zum absoluten Anfang, und zwar nicht allein wegen der Persistenz des Todesproblems, sondern auch aus einem noch aktuelleren Grund, wonach diese "auf die Spitze getriebene qualitative Negation"18 eine Sache der Verstandesphilosophie ist. D. h.: Es gibt ein enges Verhältnis zwi16 Ebd., 122. 17 Vgl. ebd., 86. 18 Ebd., 126.
179
Önay
Sözer
sehen der abstrakten Beziehungslosigkeit von "Sein" und "Nichts" und der Abstraktheit des Verstandes. Die abstrakte Seite der anfänglichen Nichtunterscheidbarkeit des Seins und des Nichts wird als Endlichkeit in die Sprache des Daseins übersetzt. Bei dieser Übersetzung entspricht dem Hin- und Hergehen unseres Denkens zwischen dem Sein und dem Nichts, die Schranke und das Sollen, oder die schlechte Unendlichkeit, wonach der Tod, das Ende, perennierend gedacht, in dieser Weise verabsolutiert, aber gleichzeitig immer wieder als über ihn hinausgehend aufgezeigt wird. Die Schranke gibt uns nicht nur eine neue Interpretation der Grenze, sondern sie muß verstanden werden im Sinne einer Hemmung der eigentlichen Negation der Negation, die jetzt identisch mit dem Übergehen des Endlichen zur Unendlichkeit ist. Bei der Grenze treffen sich das Anderssein und die Identität des Etwas in der Form des Gesetztseins des Anderseins in dem Etwas; bei der Schranke dagegen setzt das Etwas seine Grenze gleichzeitig als negierte. Wir hatten oben gesehen, daß bei der Grenze die Negation der Negation die erste Negation schon umfasste, sie jedoch als Grenze selbständig ließ. Jetzt wird die Negation der Negation selber im Etwas gesetzt, ihm immanent gemacht, so daß sie sich negierend auf die erste Negation als Grenze bezieht, die, weil sie die Qualität des Etwas ausmacht, zugleich Dasein in ihm behält, so daß sie als Schranke gesetzt ist: "Das mit sich identische Insichsein bezieht sich so auf sich selbst als sein eigenes Nichtsein, aber als Negation der Negation, als dasselbe negierend, das zugleich Dasein in ihm behält, denn es ist die Qualität seines Insichseins. Die eigene Grenze des Etwas, so von ihm als ein Negatives, das zugleich wesentlich ist, gesetzt, ist nicht nur Grenze als solche, sondern Schranke"?9 Die negiert gesetzte Grenze, die nicht völlig überwunden werden kann, ist die Schranke. Aber mit der Negation der Grenze ist zugleich die ansichseiende Bestimmung des Etwas selbst tangiert: "die Schranke ist nicht allein das als negiert Gesetzte; die Negation ist zweischneidig, indem das von ihr als negiert Gesetzte die Grenze ist; diese nämlich ist überhaupt das Gemeinschaftliche des Etwas und des Anderen, auch Bestimmtheit des Ansichseins der Bestimmung als solcher. Dieses Ansichsein hiermit ist als die negative Beziehung auf seine von ihm auch unterschiedene Grenze, auf sich als Schranke, Sollen".20 Weil die Negation der Negation schon im Etwas gesetzt wurde und ihm immanent ist (weil sie die Einheit ist), bedeutet diese Zweischneidigkeit, daß nicht nur die Negation als Schranke von der (in dieser Weise abstrakt gebliebenen) Negation der Negation abgeschnitten ist, sondern auch umgekehrt, daß die Negation der Negation als Sollen von der Negation abgeschnitten bleibt. Sofern aber weiterhin die Negation der Negation in beiden Fällen dieselbe (d. h. die eigentliche Einheit) ist, kann man hier von einer in sich gespaltenen Negation der Negation sprechen. Indem das Etwas als das Endliche angesehen wird, entwickelt sich sein Widerspruch als seine Zweischneidigkeit zwischen Schranke und Sollen. Bekanntermaßen gelten für Hegel die Ausdrücke "Du kannst, weil du sollst" und "Du kannst nicht, eben weil du sollst" mit gleichem Recht. Es gibt zudem einen weiteren Aspekt dieser Beziehung. Hegel schreibt: "Das Sollen [...] ist das Hinausgehen über die Schranke, aber ein selbst nur endliches Hinausgehen".21 D. h., das Sollen und das Etwas haben ihre Gemeinsamkeit in der Endlichkeit. Und was wird aus der Schranke? Hegel verleiht der Schranke eine entscheidende Rolle beim Über-
19 Ebd., 129. 20 Ebd. 21 Ebd., 133.
180
-
Grenze und Schranke
gehen des Endlichen zur Unendlichkeit, wobei in eins über die Schranke und das Sollen hinausgegangen wird: ins Unendliche, welches "das Affirmative, das Sein" ist, "das sich aus der Beschränktheit wiederhergestellt hat. Das Unendliche ist, und in intensiverem Sinn als das erste unmittelbare Sein, es ist das wahrhafte Sein: diese Erhebung aus der Schranke".22 Bei diesem Übergehen über die Schranke (und das Sollen) kann das Endliche nicht gleichzeitig über sich selbst hinausgehen, sofern dieses Hinausgehen das Endliche erfordert: "nicht im Aufheben der Endlichkeit überhaupt wird die Unendlichkeit überhaupt, sondern das Endliche ist nur dies, selbst durch seine Natur dazu zu werden. Die Unendlichkeit ist seine affirmative Bestimmung, das, was es wahrhaft an sich ist".23 Das Endliche bleibt dann als ein Problem für die weitere Entwicklung der Dialektik, für die Wesenslogik vorhanden. Hierfür liegt der Grund darin, daß die Hegelesche Philosophie kein subjektiver Idealismus (oder nicht "der bewußtlose Idealismus des Bewußtseins") ist:
"Solcher Idealismus ist formell, indem er den Inhalt des Vorstellens oder Denkens nicht beachtet, welcher im Vorstellen oder Denken dabei ganz in seiner Endlichkeit bleiben kann [...]. Der Gegensatz der Form von Subjektivität und Objektivität ist allerdings eine der Endlichkeiten; aber der Inhalt, wie er in die Empfindung, Anschauung oder auch in das abstraktere Element der Vorstellung, des Denkens, aufgenommen wird, enthält die Endlichkeiten in Fülle, welche mit dem Ausschließen jener nur einen Weise der Endlichkeit, der Form von Subjektivem und Objektivem, noch gar nicht weggebracht, noch weniger von selbst weggefallen sind".24 Es ist dieser endliche Inhalt in seiner Mannigfaltigkeit, der weiter thematisiert werden muß.
Das Mal: die
Spur des Wesens im Sein
Das Endliche wird in der Wesenslogik wieder thematisiert bzw. problematisiert, jedoch nicht mehr im Hinblick darauf, daß es über seine Schranke hinaus in die Unendlichkeit übergeht, sondern darauf hin, daß es als das Beschränkte, als das Nichts schon das Wesen ausmacht. Das geschieht in einer Weise, daß das Sein als das Nichts schon bei sich selbst als Endlichem verbleibt und daß dieses Verbleiben das bestimmende Setzen des Wesens selbst veranlaßt. Der neue Name des Endlichen in der Wesenslogik ist "das Zufällige" (oder "die freie 22 Ebd., 136. 23 Ebd. L. Illetterati's Ausdruck "cattiva limitazione" ("schlechte Beschränkung") ist nicht glücklich gewählt, insofern durch ihn der Eindruck erweckt wird, als ob sich der Begriff der "Schranke" nur mit dem Sollen und der "schlechten Unendlichkeit" identifizieren läßt. Dieser Eindruck verstärkt sich, wenn Illetterati schreibt: "La forma di limitazione che trova la sua espressione nella Schranke evidenzia infatti un légame non accidéntale con la forma che secondo Hegel è propria del cattivo infinito e del progresso ail' infinito Cosí come infatti il cattivo infinito è quello che si presenta nella forma dell'opposizione rispetto al finito [...] e che si riduce perciö all'indefinita e reiterata ripropozisione del finito stesso, la Schranke, in quanto è la fissazione del limite rispetto al suo altro, è quella struttura della limitazione, la quale non puö che riprodurre l'incessante ripetizione del finito" (L. Illeterati, Figure del limite. Esperienze e forme della finitezza, Trento 1996, 44). Die Schranke bleibt beim Über-Sich-Hinausgehen des Endlichen zur wahren Unendlichkeit bestehen, um über sie hinüberzugehen, was weiter die Wesenslogik thematisiert, wie wir unten sehen werden. 24 G.W.F. Hegel, Wissenschaft der Logik. Die Lehre vom Wesen (1813), hg. v. H.-J. Gawoll, Hamburg 1992, 158. Im folgenden zitiert: WdL II.
181
Önay Sözer
Wirklichkeit"), das das Ergebnis eines ständigen Ineinandergehens der Wirklichkeit in die Möglichkeit und umgekehrt ist. Das Wesen stellt sich dabei als die absolute Notwendigkeit gegenüber diesem Endlichen dar. Die Grenze des Endlichen ist nicht mehr Schranke, sondern sie wird jetzt von Hegel "das Mal" genannt: dieses notwendige Zufällige, diese Spur des nichtigen Wesens auf dem Sein.
Dadurch ändert sich die Blickrichtung auf das Endliche, auf die Beziehung des Etwas auf sein Anderes erheblich: wir gehen nicht mehr vom Endlichen zur Unendlichkeit hinüber, das Sein richtet sich nicht mehr nur tastend immer auf dem Weg seiend auf das Wesen aus, sondern es wird vom Wesen, vom Absoluten her in die endlichen Dinge geschaut, ihnen wird ihre Grenze zurückgegeben: "so besteht der wahre Schluß von einem Endlichen und Zufälligen auf ein absolut-notwendiges Wesen nicht darin, daß von dem Endlichen und Zufälligen als dem zum Grundeliegenden und liegen bleibenden Sein, sondern daß, was auch unmittelbar in der Zufälligkeit liegt, von einem nur fallenden, sich an sich selbst widersprechenden Sein aus auf ein Absolut-Notwendiges geschlossen oder daß vielmehr aufgezeigt wird, das zufällige Sein gehe an sich selbst in seinen Grund zurück, worin es sich aufhebt, ferner daß es sich selbst vielmehr zum Gesetzten macht".25 Dieses Zitat soll belegen, daß zunächst die ganze Dialektik des Endlichen mit der Unendlichkeit im Absoluten beibehalten wird. Dieses Beibehalten ist das Resultat der "äußeren Reflexion", das Hegel folgendermaßen beschreibt: "Sie war das Unendliche in der Sphäre des Seins; das Endliche gilt als das Erste, als das Reale, von ihm wird als dem zugrunde Liegenden und zugrunde Liegenbleibenden angefangen, und das Unendliche ist die gegenüberstehende Reflexion in sich".26 Gegenüber dieser äußeren Reflexion beginnt Hegel in der Wesenslogik mit der setzenden Reflexion (die als 'Re-flexion' anfängt) und versucht, beide Reflexionsweisen in der "bestimmenden Reflexion" zu einer Synthese zu führen. Innerhalb dieser Synthese gibt die setzende Reflexion einen Rückblick auf die äußere Reflexion, wo sie den Widerspruch des Endlichen wiederentdeckt. "Das Mal" ist die Spur des Widerspruchs des Endlichen für sich selbst, oder genauer, die Spur einer der widersprechenden Seiten an der anderen. Hegels Gegenüberstellung der Zufälligkeit (die auch "die reale Notwendigkeit" genannt wird27) und der absoluten Notwendigkeit folgt dem Gang der Dialektik des Inhalts mit der Form. "Irgendeine beschränkte Wirklichkeit" ist "ein bestimmter Inhalt",28 der im weiteren Ablauf des Prozesses nicht einfach aufgehoben, sondern gerade als "das Mal" des Endlichen interpretiert wird. Was Hegel die "reale Notwendigkeit" nennt, ist dann die Form dieses beschränkten, zufälligen Inhalts. Der Unterschied dieses Inhalts und jener Form verschwindet nur, wenn sich die äußere Reflexion (der Zufälligkeiten) mit der setzenden Reflexion (der Notwendigkeit) verbindet und man die Zufälligkeit als die Zufälligkeit durch die Notwendigkeit gesetzt oder bestimmt interpretiert: "es ist, weil es ist".29 Daraus entsteht die absolute Notwendigkeit, die die beiden Seiten, das Sein und das Wesen, den Inhalt und die Form am höchsten Punkt ihres Gegenklangs zusammenhält und sogar die Ausblicke von einem zum anderen ermöglicht (je nachdem, ob man die absolute Notwendigkeit als die Zufälligkeit oder -
-
-
25 Ebd., 64. 26 Ebd., 18. 27 Ebd., 185. 28 Ebd. 29 Ebd., 188.
182
Grenze und Schranke
umgekehrt die Zufälligkeit als die absolute Notwendigkeit betrachtet). Hegel versucht, diese gegenseitigen (aber absoluten) Blickpunkte anhand einer Lichtmetaphorik zu illustrieren. Um seine Metaphorik zu verstehen, müssen wir uns daran errinern, daß das unendliche Sein nach Hegel das eigentliche Licht ist.30 Wenn vom Standpunt der absoluten Notwendigkeit her auf die Zufälligkeit geschaut wird, sieht man nichts anderes als eine "seiende Mannigfaltigkeit", die gleichzeitig möglich und wirklich ist. Wegen dieser "leeren Äußerlichkeit" der "freien Wirklichkeiten" kann die absolute Notwendigkeit das Sein nicht wiedererkennen, das Licht kann nicht sehen und ist daher "blind".31 Wenn man umgekehrt von der Zufälligkeit her auf die absolute Notwendigkeit schaut, entsteht ein anderes Problem: Die freien Wirklichkeiten (das Sein) können ihr eigenes Wesen, das Licht der absoluten Wirklichkeit nicht mehr annehzurück, daher sind sie "lichtscheu" geworden.32 Aber in Wahrheit tragen sie ihr Wesen schon als "das Mal", das gleichzeitig ein Grenzzeichen ist. Im Gegensatz zu den Wirklichkeiten (des ersten Blickpunktes), wo "keins im Anderen scheint, [...] eine Spur seiner Beziehung auf das Andere an ihm zeigen will", erhalten dieselben Wirklichkeiten schon in ihrer Scheu eine Spur vom Licht: "Sie sind in ihrer auf sich beruhenden Gestaltung gleichgültig gegen die Form, ein Inhalt, damit unterschiedene Wirklichkeiten und ein bestimmter Inhalt; dieser ist das Mal, das die Notwendigkeit, indem sie, welche absolute Rückkehr in sich selbst in ihrer Bestimmung ist, dieselben als absolut wirkliche entließ, ihnen aufdrückte, worauf sie als den Zeugen ihres Rechtes sich beruft und an dem sie ergriffen nun untergehen".33 Mit diesem Untergehen verwandelt sich das Mal zur Spur der Spurlosigkeit, der Blindheit: "Diese Manifestation dessen, was die Bestimmtheit in Wahrheit ist, negative Beziehung auf sich selbst, ist blinder Untergang im Anderssein; das hervorbrechende Scheinen oder die Reflexion ist an dem Seienden als Werden oder Übergehen des Seins in men, sie ziehen sich
-
Nichts".34
Was für ein Grenzzeichen ist dieses Mal des Endlichen? Wir haben vorher gesehen: Die "Grenze" war nach Hegel die naturhafte oder die strukturelle Grenze, die dem Etwas angehörte, die das Etwas in seiner Beziehung auf das Andere in sich selbst vorgefunden hat. Die "Schranke" ist dagegen definiert worden als die vom Endlichen selbst negiert gesetzte Grenze auf dem Weg zur Unendlichkeit. Das "Mal" ist die Schranke, die von der absoluten Notwendigkeit her auf das Zufällige gesetzt oder diesem "aufgedrückt" wird. Diese Schranke ist die Spur seines Wesens: Das Zufällige ist, was es ist, durch sein "Mal". Es geht um das Endliche, das mit seinem "Schein" identisch ist, sofern es darin identisch sein kann. Hegel schreibt: "Der Schein ist nicht das Nichts, sondern er ist Reflexion, Beziehung auf das Absolute; oder er ist Schein, insofern das Absolute in ihm scheint Diese positive Auslegung -
-
.
30 Vgl. WdL I (Anm. 5), 136. 31 WdL II (Anm. 25), 188f. 32 Ebd., 189. 33 Ebd. Alle diese Gedanken verweisen auf die Leibnizianischen Begriffe der "Monade" und der "Spur". Siehe über das Verhältnis Hegels auf Leibniz im Hinblick auf die Grenzproblematik: Paul Guyer, "Hegel, Leibniz und der Widerspruch im Endlichen", in Seminar: Dialektik in der Philosophie Hegels, hg. v. RolfPeter Horstmann, Frankfurt a.M. 1978, 255ff. Guyer betont, daß Hegel im Gegensatz zu Leibniz, der die Unabhängigkeit der individuellen Naturen voneinander annimt, den Unterschied eines Einzelnen zu dem Anderen ideell in diesem Einzelnen enthalten sieht. Das Motiv des "Mals" bringt die reale und die ideelle Seite zusammen, indem es das Ideelle als das Reale, als das "Mal" des Realen entstehen läßt. 34 WdL II (Anm. 25), 189.
183
Önay
Sözer
hält so noch das Endliche vor seinem Verschwinden auf und betrachtet es als einen Ausdruck und Abbild des Absoluten".35 Das Mal ist dann ein Abbild, wie ein Grenzzeichen (wie ein Stein, wie die Linie eines umgepflügten Landes) ein Ikon der eigentlichen Grenze ist, die hier aber zum Absoluten gehörig verstanden wird.
Das Mal als die Affirmation des Nichts? Die ganze Wissenschaft der Logik beruht auf die Überwindung des unmittelbaren Seins: Es muß überwunden werden, insofern es sich mit dem Nichts identisch erweist. Die Dialektisierung der ununterscheidbaren Differenz des Seins und des Nichts heißt das Werden, das den Anfang aller darauf folgenden Prozessen bildet. Das Werden verflüssigt in sich sowohl das Sein in der Form des Entstehens als auch das Nichts in der Form der Veränderung und des Vergehens. Wir haben gesehen, daß das Problem des Endlichen, bzw. der Schranke nur dem Begriff des Nichts entnommen werden kann und daher eine Rückkehr, ein Zurück zum anfänglichen Nichts erforderlich macht. Das Endliche selber bildet einen Übergang zur Unendlichkeit, aber weil es bei diesem Übergehen nicht endgültig aufgehoben werden kann, erscheint es weiter in der Wesenslogik, wo es die Reflexionsbestimmungen des Wesens thematisch setzt und voraussetzt. In beiden Fällen geht es um die Negation der Negation, die ihre vollkommenere Form in den betreffenden letzten Kapiteln der Wesenslogik bzw. in der Begriffslogik erreicht. Der Problemzusammenhang der Zufälligkeit und der absoluten Notwendigkeit wird über das Mal des Notwendigen hinaus zwar mit dem Übergehen des Wirklichen ins Mögliche, "des Seins ins Nichts", zu Ende geführt, aber dieses Untergehen des Seins selbst wird als "ein Zusammengehen mit sich selbst", d. h. als die Negation der Negation interpretiert.36 Diese Negation der Negation braucht den absoluten Standpunkt, der ohne eine Affirmation des anfänglichen Nichts und der diesbezüglichen ersten Negation (und nicht durch ein bloßes Negieren der Negation) nicht möglich ist. Nur diese Affirmation bildet eine Differenz zur beziehungslosen, arche-ischen, fundamentalen Verneinung des Seins oder zur unterschiedlosen Differenz von beiden und nimmt den Gegensatz der Bestimmtheit (des Daseins) zur anfänglichen Unbestimmtheit vorweg. Diese Affirmation des Nichts findet sich bei Hegel, wenn er am Anfang der Wissenschaft der Logik schreibt, "daß das Sein in Nichts, und das Nichts in Sein nicht übergeht -, sondern übergegangen ist".37 Die Affirmation geschieht in der Enge der Übergangslosigkeit von der In-Differenz zur Differenz, d. h., sie liegt schon in dieser Indifferenz als Differenz. Die Affirmation der In-Differenz bildet diese Differenz. Sie muß grundverschieden von der Positivität der Negation der Negation sein, insofern sie die Negation nicht aufhebt, sondern selbst bei ihrer Aufhebung beibehält, so wie sie ist, als dieses Nichts. Diese Affirmation bildet selber eine Differenz, anstatt wie ein positives Ergebnis der Negation der Negation vorzukommen (der Einfluß dieser Affirmation der Negation auf die Negation selbst ist ein anderes Thema, das hier nicht bearbeitet werden kann). -
-
-
35 Ebd., 164. 36 Ebd., 189f. 37 WdL I (Anm. 5), 72.
184
Es geht weiter um dieselbe Affirmation, wenn Hegel an derselben Stelle vom Existieren des "Nichts in unserem Anschauen und Denken" spricht: "insofern Anschauen und Denken hier erwähnt werden kann, so gilt es als ein Unterschied, ob etwas oder nichts angeschaut oder gedacht wird. Nichts Anschauen oder Denken hat also eine Bedeutung".38 Diese Bedeutung von Nichts ist die Urform des Mangels, der Grenze und der Schranke. Die Grenze ist im Allgemeinen das Nichts qua Bedeutung, die es für uns hat oder haben kann. Diese Affirmation der Negation zeigt sich bei der Grenzproblematik als die Verselbständigung der ersten Negation innerhalb der Negation der Negation, bei der Schranke durch die Zweischneidigkeit der Negation der Negation, wonach die Grenze selbst bei ihrem Negiertgesetztwerden als Schranke bleibt und das Etwas gegenüber der Schranke als Sollen auftritt. Die Nichtaufhebbarkeit des Endlichen bei seinem Übergehen zur Unendlichkeit ist nur ein anderer Ausdruck für diese Affirmation der Negation, die in das Nichts hinabreicht. Das Mal ist aber dann gerade diese affirmierte Schranke, die uns freiläßt inmitten der Zufälligkeiten gegenüber der Notwendigkeit: "Die Einfachheit ihres Seins, ihres Beruhens auf sich, ist die absolute Negativität; sie ist die Freiheit ihrer scheinlosen Unmittelbarkeit. Dieses Negative bricht an ihnen hervor, weil das Sein durch dieses sein Wesen der Widerspruch mit sich selbst ist, und zwar gegen dieses Sein in der Form des Seins, also als die Negation jener Wirklichkeiten, welche absolut verschieden ist von ihrem Sein, als ihr Nichts, als ein ebenso freies Anderssein gegen sie, als ihr Sein es ist".39 Erst an diesem Punkt gewinnt die Affirmation der Grenze einen Inhalt als Freiheit. "Das Mal" ist dann die Affirmation des Nichts in der Form des Seins, oder die Spur des Nichts, deren freie Interpretation (von der Mannigfaltigkeit des Seienden her) gleichzeitig möglich und wirklich ist. Die "Grenze" bei Hegel ist unaufhebbar, zunächst, weil sie das Prinzip jeder dialektischen Bewegung ist, aber auch, weil man sie in der Form der "Schranke und des "Mals" benötigt, um über sie hinauszugehen. Während die Schranke vom Endlichen ausgehend zur Unendlichkeit überschreitbar ist, zeigt "das Mal" als Grenzzeichen das Überschreiten der Unendlichkeit in das Endliche: der Stempel des Schicksals auf dem sterblichen, aber deswegen nicht weniger freien Sein. -
38 Ebd. 39 WdL II
(Anm. 25), 189.
Peter-Ulrich Philipsen
Nichts als Kontexte. Dekonstruktion als schlechte Unendlichkeit?
"Wir suchen überall das nur
Unbedingte,
und finden immer
Dinge." Novalis
"Land Luft."
begrenzt
Land
Land durch Land, nicht durch -
G.W.F. "Il
n'y
a
Hegel
pas de hors-texte."
Jacques Derrida Es ist ein alter Traum der Philosophie, in Begründungen und Argumentationen alle Kontexte beherrschen zu können. Ist dies wie häufig nicht der Fall, drohen infinite Begründungsregresse. Denn wenn ein Argument nur Sinn macht in einem bestimmten Kontext, dieser wiederum aber nur in einem bestimmten weiteren usf., enden Begründungsversuche in einem unendlichen Klärungsprozeß über die Kontextgebundenheit von Argumenten. Seinslogisch hat Hegel dieses Problem in seinem Angriff auf die "schlechte Unendlichkeit" formuliert, der sich selbst in posthegelianisch-antimetaphysischen Zeiten noch als so wirkungsmächtig erweist, daß selbst Dekonstruktivisten meinen, sich gegen das Hegeische Verdikt gegen die "schlechte Unendlichkeit" verteidigen zu müssen. Gegenstand der folgenden Überlegungen ist eine Rekonstruktion der Hegelschen Unendlichkeitskonzeption aus einer dekonstruktiven Perspektive. Jacques Derridas Philosophiemodell, seine Hegel-Kritik und auch sein Verständnis von Endlichkeit und Unendlichkeit bieten die Kontrastfolie für eine Überprüfung der Hegelschen Argumente gegen die "schlechte Unendlichkeit". Den Anlaß dieser Fragestellung bieten Überlegungen Rodolphe Gaschés,1 der versucht, ein dekonstruktives Unendlichkeitsverständnis er nennt es "structural infinity" gegen die Hegeische Kritikfigur zu verteidigen und abzugrenzen. Da mir diese Strategie -
1
-
Rodolphe Gasché, "Nontotalization without Spuriousness: Hegel and Derrida on the Infinite", in Journal of the British Society for Phenomenology 17 (1986), 289-307. Dieser Aufsatz ist später nur leicht verändert erschienen unter dem Titel "Structural Infinity" in R. Gasché, Inventions of Difference: On Jacques Derrida. Cambridge (Mass.)/London 1994, 129-149.
Dekonstruktion als schlechte Unendlichkeit?
erstens als
Hegelkritik inadäquat erscheint und mir zweitens die Behauptung einer strukturellen Unendlichkeit dem Hegelschen Vorwurf der "schlechten Unendlichkeit" nicht zu entkommen scheint, halte ich vielmehr eine Überprüfung der Hegelschen Argumente gegen die "schlechte Unendlichkeit" für geboten. Meine Strategie besteht dann im weiteren darin, den Vorwurf der "schlechten Unendlichkeit" gegenüber dekonstruktiven Verfahren erst einmal als notwendig anzuerkennen und im Gegenzuge nach den spekulativen Voraussetzungen dieser Argumentation zu fragen. Ich wende mich gegen die unreflektierte Selbstverständlichkeit dieser Kritikfigur und gehe der Vermutung nach, daß die spekulativen Voraussetzungen das argumentative Feld präfigurieren. Mein Interesse besteht dabei nicht in einer Rehabilitierung der "schlechten Unendlichkeit", sondern in einer Dekonstruktion der Wirkungsmächtigkeit eines gegen sie gerichteten Arguments. Mein Vorgehen gliedert sich im folgenden in fünf Schritte: Nach einer terminologischen Vorklärung (1) zu Bezügen und "Vorgeschichte"2 der Hegelschen Unendlichkeitskonstruktion, möchte ich (2) die Argumente Hegels bezüglich des spezifischen Verhältnisses respektive Nicht-Verhältnisses von "schlechter" und "wahrer" Unendlichkeit in den drei Abschnitten der Seinslogik rekonstruieren. Dabei interessiert mich auch, welchen strategischen Stellenwert eine spekulative Unendlichkeitskonstruktion für die Seinslogik insgesamt hat. Danach möchte ich (3) die Frage nach einem möglichen rationellen Sinn des Verdikts gegen die "schlechte Unendlichkeit" aufgreifen und zwei grundsätzliche Lesarten des Hegelschen Unendlichkeitsmodells voneinander unterscheiden. Im folgenden Schritt (4) möchte ich als Kontrastfolie kurz Jacques Derridas Hegel-Kritik anhand seiner zwei Angriffe auf die Hegelsche Kategorie der "Aufhebung" seine Phonozentrismus- und seine Phallogozentrismuskritik skizzieren. Dabei will ich sowohl Gaschés Charakterisierung einer strukturalen Unendlichkeit aufnehmen als auch Derridas Philosophie als durch radikale Endlichkeit geprägt darstellen. In einem letzten Schritt (5) werden theoretisch-praktische Konsequenzen eines radikal endlichen Philosophieverständnisses angedeutet. -
1.
-
"Vorgeschichte"
Die Kritik an der "schlechten Unendlichkeit" ist bei Hegel eingebettet in einen spekulativen Rahmen. "Schlechte Unendlichkeit" macht ohne die Voraussetzung der "wahren Unendlichkeit" keinen Sinn. Das Verhältnis oder besser gesagt: das Nicht-Verhältnis dieser beiden Unendlichkeitsmodelle macht die Spezifik des Hegelschen Unendlichkeitsverständnisses aus. Dabei ist die Unterscheidung selbst, zu trennen zwischen einer Verstandes- und einer Vernunftunendlichkeit oder auch zwischen einer empirischen und einer ideellen Unendlichkeit, nicht originär. Hegel kann auf eine lange philosophische Tradition zurückgreifen, die mit Aristoteles damit beginnt, den Unendlichkeitsbegriff aufzuspalten. So ließe sich eine Linie ziehen von Aristoteles über Plotin, Cusanus, Spinoza und Leibniz bis hin zu Kant und von dort über Fichte zu Schelling und Hegel. Aristoteles könnte mit seiner Unterscheidung von potentieller (dynamei apeiron) und aktual-wirklicher Unendlichkeit (energeia apeiron) als der 2
Manfred Baum, "Zur Vorgeschichte des Hegelschen Unendlichkeitsbegriffs", in Hegel-Studien 11 (1976), 89-124.
Vgl.
187
Peter-Ulrich
Philipsen
Kreator der "schlechten Unendlichkeit" gelten. Er bestreitet Vorstellungen von Unendlichkeit als eigenständigem materiellen oder auch als eigenständigem transempirischen Prinzip; Unendlichkeit ist dagegen nur potentiell im progressiven Prozeß von Hinzufügung oder Teilung zu fassen (vgl. Physik III, 4-8). Nach Aristoteles gibt es eine Reihe von verschieden motivierten Versuchen, Unendlichkeit im Sinne von aktualer Unendlichkeit wiederzubeleben und als eigenständiges Prinzip zu behaupten. So beschreibt Plotin das oberste Prinzip des Einen als unendlich und allesverursachend, geistige und irdische Unendlichkeit stehen in einem Emanationsverhältnis (vgl. Enneaden II, 4, 15). Nikolaus von Kues trennt zwischen einer allumfassenden, göttlich-absoluten und einer mit Mangel behafteten, weltlich-eingeschränkten Unendlichkeit (vgl. De docta ignorantia II, 4). Spinoza schließlich unterscheidet zwischen einer Unendlichkeit des Verstandes und einer Unendlichkeit der Einbildungskraft (vgl. Epistolae XII [ed. Gebhardt]). Die göttliche Substanz ist für ihn notwendig unendlich (vgl. Ethik I, 8). Daß Spinoza diese substantielle Unendlichkeit als negationsfreie, absolute Affirmation faßt, bildet für Hegel einen expliziten, positiven Anknüpfungspunkt. Diese spinozistische Bestimmung macht "das Unendliche zum absoluten sich selbst gleichen unteilbaren wahrhaften Begriff'.3 In dieser aufgeladenen Bestimmung wird Unendlichkeit in der Regel auch synonym mit dem Absoluten verwandt. Leibniz und Kant teilen nun wieder eine eher aristotelische Position bezüglich einer Zurückhaltung und Skepsis gegenüber einem aktual Unendlichen. Für Leibniz kann aus der Annahme des unendlichen Progresses niemals die Annahme eines unendlichen Ganzen folgen (vgl. Theodizee II, § 195). So behauptet auch Kant, daß der "wahre (transzendentale) Begriff der Unendlichkeit" progressiv "niemals vollendet sein kann" (KrV B 460). Ein Begriff von Unendlichkeit kann letztlich nur als regulative Idee gewonnen werden. Für Fichte ist das "Ich [...] unendlich, aber bloß seinem Streben nach; es strebt unendlich zu seyn".4 Auch wenn die Setzungsakte des Ichs theoretisch, reflexiv nur als endlich-unendlich bestimmt werden können, ist die Idee einer "vollendeten Unendlichkeit"5 in praktischer Hinsicht Grundlage eines
Sollens.6
3
G.W.F. Hegel, "Glauben und Wissen", in GW 4, 354. Hegel erörtert Spinozas Unendlichkeitskonstruktion anläßlich der Spinozabriefe Friedrich Heinrich Jacobis (vgl. 354-361); vgl. auch HW 20, 170-172. Jacobi schreibt: "Er [Spinoza] verwarf also jeden Uebergang des Unendlichen zum Endlichen; überhaupt alle Causas transitorias, secundarias oder remotas; und setzte an die Stelle des emanirenden ein nur immanentes Ensoph; eine inwohnende, ewig in sich unveränderliche Ursache der Welt, welche mit allen ihren Folgen zusammengenommen Eins und dasselbe wäre" F.H. Jacobi, Werke, hg. v. F. Roth u. R. Koppen, Leipzig 1812-1825 (Reprint Darmstadt 1968), Bd. 4, 1, 56. Die Spinozabriefe sind auch der Ansatzpunkt der Spinozarezeption F.W.J. Schellings (vgl. "Philosophische Briefe über Dogmatismus und Kriticismus" [1795], in Sämmtliche Werke, hg. v. K.F.A. Schelling, München/Augsburg 1856ff., Abt. I, Bd. 1, 313-316, 7. Brief). J.G. Fichte, Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre, Gesamtausgabe, Abt. I, Bd. 2, Stuttgart-Bad Cannstatt 1965,404. Ebd., 403 Zu weiteren Varianten von Unendlichkeitsbegriffen siehe den Artikel "Apeiron" in Historisches Wörterbuch der Philosophie, hg. v. J. Ritter u. K. Gründer, Darmstadt 1971ff., den Artikel "Unendlich" in Wörterbuch der philosophischen Begriffe, hg. v. R. Eisler, Berlin 31910 und den Artikel "infinity" in Michael Inwood, A Hegel Dictionary, Oxford 1992. -
4
5 6
188
Dekonstruktion als schlechte Unendlichkeit?
Kant und Fichte sind die von Hegel benannten Protagonisten der "schlechten Unendlichkeit. Ihr Idealismus "kommt nicht über das Sollen oder den unendlichen Progreß hinaus".7 Interessant ist die Frage nach nicht benannten Protagonisten einer "schlechten Unendlichkeit". Dafür bietet sich das Unendlichkeitsmodell von Friedrich Schlegel8 (aber auch von Novalis) an, weil die Figur des unendlichen Progresses verschärft wird und die Einbettung in einen ideellen Unendlichkeitsbegriff zumindest fraglich wird. Friedrich Schlegel bestimmt in einem emphatischen Sinne das Wesen der Philosophie als die "Sehnsucht nach d[em] Unendlichen".9 Im Gegensatz zu Fichte (und Kant) ist das Absolut-Unendliche prinzipiell der Erkenntnis zugänglich. "Das Unendliche hat Realität für das Bewußtseyn".10 Mit einer komplizierten Methodik des "Wechselerweises",11 bei der das Absolute niemals als Grund oder Erkanntes fungieren darf, besteht die Aufgabe der Philosophie in einer progressiven Approximation ans Absolut-Unendliche. Die philosophische Tätigkeit ist dabei grundsätzlich unabschließbar. "Die Erkenntnis des Unendlichen [ist] selbst unendlich, also immer nur unvollendet, unvollkommen [...]. Sie ist überhaupt mehr ein Suchen, Streben nach Wissenschaft, als selbst eine Wissenschaft".12 Diese Figur einer prinzipiell unabschließbaren Reflexion stützt und akzentuiert die verbreitete These von einer frühromantischen Verankerung dekonstruktiver Verfahren.13 Diese These blendet aus, daß Schlegels Unendlichkeitsbegriff spinozistisch ist.14 Ein erfüllter und in sich substantieller Unendlichkeitsbegriff ist mit einer Formulierung Walter Benjamins "axiomatische Voraussetzung"15 der Schlegelschen Reflexionsrheorie. All diese theoretischen Versuche, die "Gränzen der Erkennbarkeit"16 approximativ zu verschieben, werden wenn auch nur negativ von einem Absoluten gesteuert. Friedrich Schlegels Unendlichkeitsmodell hat zwei Seiten: zum einem die unübersehbare methodische Nähe zu dekonstruktiven Verfahren und zum anderen eine Nähe zu Hegel in dem Versuch, das Absolute in einen reflexiv-dialektischen Zusammenhang zu bringen.17 Für Schelling ist als Unendlichkeitsmodell "Spinozas Lösung die einzig mögliche Lösung", der "Uebergang vom Unendlichen zum Endlichen [ist] das Problem aller Philosophie".18 Endliches und Unendliches sind nur uneigentlich getrennt. Schelling betont die Not-
-
-
-
7 G.W.F. Hegel, Wissenschaft der Logik. Die Lehre vom Sein (1832), GW 21, 150; vgl. a. 123; vgl. a. Hegel, "Differenz des Fichteschen und Schellingschen Systems der Philosophie", GW 4, 6 u. 46f. 8 Vgl. Ernst Behler, "Zum Verhältnis von Hegel und Friedrich Schlegel in der Theorie der Unendlichkeit", in Kodikas/Code Ars Semeiotica 11 (1988), 127-147. 9 Friedrich Schlegel, Werke. Kritische Ausgabe, Paderborn 1958ff„ Bd. 18, 418; vgl. a. Bd. 12, 7f. 10 Ebd., Bd. 12, 6. 11 Ebd., Bd. 18, 505 u. 520f. 12 Ebd., Bd. 12, 166. 13 Vgl. z. B. Winfried Menninghaus, Unendliche Verdopplung. Die frühromantische Grundlegung der Kunsttheorie im Begriff absoluter Selbstreflexion, Frankfurt a.M. 1987, 115-131; Manfred Frank, Die unendliche Fahrt. Die Geschichte des Fliegenden Holländers und verwandter Motive, Leipzig 1995, 210-242. 14 Das "Theorema I" der Schlegelschen Transzendentalphilosophie besteht aus dem spinozistischen hen kai panta, es ist der "Kern aller Theorie" (F. Schlegel, Werke, Anm. 9, Bd. 12, 8). 15 Walter Benjamin, "Der Begriff der Kunstkritik in der deutschen Romantik", in Gesammelte Schriften, Frankfurt a.M. 1991, Bd. 1,31. 16 F. Schlegel, Werke (Anm. 9), Bd. 13, 521. 17 Zu Friedrich Schlegels Konzeption von Dialektik vgl. Andreas Arndt, "Zum Begriff der Dialektik bei Friedrich Schlegel 1796-1801", in Archiv flr Begriffsgeschichte 35 (1992), 257-273. 18 Schelling, Werke (Anm. 3), Abt. I, Bd. 1, 313f.
189
Peter-Ulrich
Philipsen
wendigkeit der spekulativen Annahme einer vorgängig-ursprünglichen Einheit von Endlichem und Unendlichem im Absoluten.19 Nur das "wahrhaft und reell Unendliche", welches unbedingt, göttlich und substantiell ist, kann die "unendliche Copula"20 zwischen Endlichem und Unendlichem sichern. Schlechte Unendlichkeit, "Endlichkeit im eigenen Sein der Dinge", ist "Abfall von Gott".21 Hegel teilt die Schellingsche und die Schlegelsche Emphase für einen spinozistischen Unendlichkeitsbegriff. "Wahrhafte Unendlichkeit" ist "der Grundbegriff der Philosophie",22 sie ist die "seinslogische Theorie des Absoluten".23 Manfred Baum hat die Frage nach einer "Vorgeschichte" gemeint ist die Frankfurter und die frühe Jenaer Zeit des Hegelschen Unendlichkeitsbegriffs gestellt. Baum hat recht, daß besonders in Frankfurt die späteren systemischen Voraussetzungen noch nicht gegeben sind und das Hegeische Unendliche "offenbar (noch) kein Begriff'24 ist. Zugleich ist aber festzuhalten und zu betonen, daß die spätere Grundkonstellation zwischen spinozistisch-substantieller und empirischer Unendlichkeit auch schon für den Frankfurter Hegel gilt. Im Systemfragment von 1800 grenzt Hegel das "wahre Unendliche" (HW 1, 423) von einem täuschenden, letztlich der Reflexion zugehörigen ab. Selbst schon im Geist des Christentums erörtert Hegel in diesem Sinne den "Zusammenhang des Unendlichen und Endlichen". Dieser Zusammenhang ist insofern "ein heiliges Geheimnis", als er der Reflexion nicht zugänglich ist. Die trennende Reflexion ist beschränkt, da sie den "Begriff des Menschen" nur "als dem Göttlichen entgegengesetzt" fassen kann, diese Beschränkung findet dagegen "außerhalb der Reflexion, in der Wahrheit [...] nicht statt" (HW 1, 378). Die Verdoppelung des Unendlichkeitsbegriffs in einerseits "wahre" (vgl. GW 4, 6), "wahrhafte" (vgl. GW 5, 324, GW 6, 266, GW 7, 31), "affirmative" (GW 21, 13Iff.) oder "positive" (vgl. GW 4, 418) und andererseits "schlechte" (vgl. GW 7, 29ff. u. 66, HW 4, 16), "empirische" (vgl. GW 4, 29 u. 355) oder "falsche" (vgl. GW 5, 358) Unendlichkeit ist durchgehend nachweisbar. Hegel hat zwar bezüglich des systemischen Charakters von Unendlichkeit teilweise experimentiert, bezüglich des Binnenkonstruktion von "wahrer" zu "schlechter" Unendlichkeit hat er aber keine Veränderungen vorgenommen und die frühen Äußerungen zur Unendlichkeit sind mit denen in der Seinslogik kompatibel. Wenn Hegel im Systemfragment von 1800 von der religiösen "Erhebung zum Unendlichen" (HW 1, 423) spricht, so ist damit keinesfalls ein genuiner Übergang vom Endlichen zum Unendlichen impliziert, und wenn Hegel in den Vorlesungsmanuskripten Lógica et metaphysica (1801/02) den Gegenstand der Philosophie als "das unendliche Erkennen, oder das Erkennen des Absoluten" bestimmt und für seine Vorlesung ankündigt, "von dem endlichen [...] anfangen um von ihm aus, nemlich insofern es vorher vernichtet wird, zum Unendlichen [zu] gehen", so ist das auf keinem Falle in Richtung eines endlichen Philosophierens mißzuverstehen, sondern lediglich als eine "propädevtische Rüksicht" (GW 5, 271) einer spekulativen Philosophie, -
19 20 21 22 23
-
Ebd., 367; vgl. Abt. I, Bd. 2, 36f. und 360. Ebd., Abt. I, Bd. 2, 361. Ebd., Abt. I, Bd. 6, 566f. Enz. § 95, GW 20, 133. Vgl. Alexander von Keyserlingk, Die Erhebung zum Unendlichen. Eine Untersuchung zu den spekulativ-logischen Voraussetzungen der Hegelschen Religionsphilosophie, Frankfurt a.M. 1995, 179-185. 24 Baum, "Zur Vorgeschichte" (Anm. 2), 91.
190
Dekonstruktion als schlechte Unendlichkeit?
die "Formen der Endlichkeit" als "Formen des gik aufnimmt.
2.
spekulativen Denkens" (ebd., 272) in die Lo-
Unendlichkeit in der Hegelschen Seinslogik
Keine Logik ohne Bilder, auch nicht die Wissenschaft der Logik. Hegel repräsentiert bekanntlich die absolute Totalität durch das Bild eines Kreises von Kreisen, "das Ganze stellt sich daher als ein Kreis von Kreisen dar" (GW 20, 56; vgl. GW 12, 252). Dem korreliert die "wahre Unendlickeit" und ihr Bild: der Kreis. Im Gegensatz zur geraden Linie dem Bild der "schlechten Unendlichkeit", bei der beide Grenzpunkte nur als progressiv ins UnbestimmtUnendliche verlängerbar gedacht werden können symbolisiert der Kreis die ewig in sich ruhende Substanz. Die Linie wird in der Figur des Kreises "in sich zurückgebogen", sie ist "die sich erreicht habende Linie, die geschlossen und ganz gegenwärtig ist, ohne Anfangspunkt und Ende" (GW 21, 136). Welchen Status Hegel dieser Bebilderung des Unendlichen zubilligt, ist nicht eindeutig. Man muß wohl von einer uneigentlichen oder vielleicht propädeutischen Redeweise ausgehen. Ansonsten böten sich zwei Fragen an: erstens inwiefern der Kreis von Kreisen deckungsgleich mit dem Bild des Kreises ist, inwiefern es also eine Differenz zwischen absoluter Totalität und "wahrer Unendlichkeit" gibt und überhaupt geben kann. Hegel benutzt die Termini "der absolute Begriff und "wahre Unendlichkeit" in der Regel als Synonyma (vgl. GW 8, 13, GW 9, 99). Zweitens wäre die Frage zu stellen, inwiefern die "wahre Unendlichkeit" überhaupt mit einem Bild einer endlichen Darstellung repräsentiert werden könnte und ob Hegel nicht konsequenterweiser die Möglichkeit einer Repräsentation des wahrhaft Unendlichen oder auch Absoluten als Verstandesdenken oder als Relativierung des Absoluten bestreiten müßte. Bildliche Repräsentationen bieten gemeinhin mehr mögliche Lesarten, als Autoren bei ihrer Verwendung realisiert sehen möchten. Man mag es in Hegels Sicht als angemessen empfinden, daß der Kreis die Logik der absoluten Substanz (von der Entäußerung über die Rücknahme der Entäußerung bis hin zur Rückkehr zu sich selbst) repräsentiert. Daß Hegel diesen Kreis aus der zurückgebogenen Linie herleitet, suggeriert eine Herleitung der "wahren" aus der "schlechten" Unendlichkeit, was der Hegelschen Intention eindeutig widerspricht. Die Spezifik der Hegelschen Unendlichkeitskonstruktion besteht in einem Nicht-Verhältnis von "wahrer" zu "schlechter" Unendlichkeit. Im Sinne einer Fortentwicklung seinslogischer Kategorien ist zwischen "schlechter" und "wahrer" Unendlichkeit ein Brach zu konstatieren. Es ist für Hegel von entscheidender Bedeutung, daß es keinen Übergang, keine Vermittlung von "schlechter" zu "wahrer" Unendlichkeit gibt und geben kann. Wenn man einmal davon ausgeht, daß der Gegenstand, das Generalthema der Seinslogik "Bestimmtheit" ist, sei sie nun qualitativ, quantitativ oder das Maß betreffend, so besteht für Hegel in allen drei -
-
-
-
Abschnitten dieser Logik strukturell das gleiche Problem, daß diese Bestimmtheit als Bestimmtheit endlich ist und im Rahmen ihrer logisch-kategoriellen Fortentwicklung nur bis zu dem Punkt eines endlich-unendlichen Progresses von Bestimmtheit vorangetrieben werden kann. "Etwas wird ein Anderes, aber das Andere ist selbst ein Etwas, also wird es gleichfalls ein Anderes, und so fort ins Unendliche" (GW 20, 130). An dieser Stelle greift jeweils die "wahre" Unendlichkeit, indem sich aus spekulativer Perspektive die Vorstellung von End191
Peter-Ulrich
Philipsen
lichkeit als der Unendlichkeit entgegengesetzt als Schein, ja sogar als "Verfälschung" (GW 21, 133)25 durch das Verstandesdenken erweist. Nach der reflexionslogischen Formel, daß das "Nichtseyn des Endlichen [...] das Seyn des Absoluten" (GW 11, 290) ist, zeigt sich Endlichkeit als in Wahrheit ideell.26 Die Redeweise vom Bruch bezieht sich darauf, daß Hegel nicht bestrebt ist, einen der "schlechten Unendlichkeit" spezifischen Schein zu destruieren. Ihm geht es vielmehr darum, Endlichkeit überhaupt, diese "hartnäckigste Kategorie des Verstandes" (GW 21, 117), als unwahr zu erweisen. Es dürfte klar sein, daß dieser Rückgang Hegels auf eine vorgängige Einheit von Endlichkeit und Unendlichkeit im Absoluten, also der Rückverweis darauf, was in spekulativer Hinsicht die Endlichkeit an sich ist und je immer schon war, nichts anderes ist als ein relativ gewaltsamer Versuch, die Eigenständigkeit endlicher Bestimmtheit zu eliminieren und das heißt: Endlichkeit zu tilgen.27 "Schlechte Unendlichkeit" ist der Endpunkt des Prozesses endlicher Vermittlung, der als endlicher nicht aufhebungsfähig ist, "wahrhafte Unendlichkeit" ist die Figur der Bemeisterung resistenter endlicher Vermittlung28 und systemische Klammer der seinslogischen Abschnitte Qualität, Quantität und Maß. Hegels Verfahren, Endlichkeit spekulativ zu tilgen, ist in diesen drei Abschnitten der Seinslogik symmetrisch angelegt. Im Abschnitt Qualität entwickelt Hegel die Unendlichkeitsproblematik aus der Dialektik von "Grenze" und "Schranke" bezogen auf das "Sollen" gemeint sind die Sollensbegriffe von Kant und Fichte, die aus Hegels Sicht jeweils "den höchsten Punkt der Auflösung der Widersprüche der Vernunft" (GW 21, 123) in diesen Philosophien markieren. Auch wenn es als unmöglich erscheint, den Bereich endlicher Erkenntnis zu verlassen, ist es ein "Sollen" der Vernunft, Unendlichkeit zu denken. Aus der Perspektive der Endlichkeit erscheint das Unendliche als negative Grenzbestimmung des Endlichen, aus der Perspektive der Unüberschreitbarkeit dieser "Grenze" ist das Unendliche "Schranke". Das Sollen leistet jetzt den -
25 Michael Theunissen weist darauf hin, daß ein "härterer Ausdruck für die Erzeugung von Schein" in der gesamten Wissenschaft der Logik nicht vorkommt (Sein und Schein. Die kritische Funktion der Hegelschen Logik, Frankfurt a.M. 1980, 291). Theunissen erörtert die Hegeische Theorie der Unendlichkeit unter dem Titel "Verlust des Anderen" (ebd., 267-297). Unendlichkeit ist der einzige Begriff in der Wissenschaft der Logik. den Hegel ausdrücklich nach den Aspekten Wahrheit und Schein trennt. Theunissen möchte die These explizieren, daß "die Wissenschaft der Logik just hier, wo sie die beiden Dimensionen verbauter trennt, den Schein in der Kritik reproduziert und für Wahrheit ausgibt, was im Grunde bloß ein Widerschein des Scheins ist" (ebd., 279). Die "kritische Darstellung der Theorie affirmativer Unendlichkeit" zeitigt für ihn ein "desaströse[s] Ergebnis" (ebd., 296). Eine neuere Parallel- und Gegenlektüre zu Theunissens Interpretation des Kapitels "Dasein" in der Seinslogik bietet Christian Iber (7.-9. Vorlesung in Subjektivität. Vernunft und ihre Kritik. Prager Vorlesungen über den Deutschen Idealismus, Frankfurt a.M. 1999, 119-174). Wenn Iber in seiner Rekonstruktion versucht, die Hegeische Theorie affirmativer Unendlichkeit zu motivieren, so ist zu betonen, daß Iber jenes auf der Basis dessen, was er den Hegelschen "Vernunftfundamentalismus" nennt (ebd., 146 u. 174), unternimmt. 26 Vgl. auch GW 20, 133: "die Wahrheit des Endlichen ist vielmehr seine Idealität. [...] Diese Idealität des Endlichen ist der Hauptsatz der Philosophie, und jede wahrhafte Philosophie ist deswegen Idealismus". 27 Vgl. Theunissen, Sein und Schein (Anm. 25), 282. 28 Ich behauptet nicht, daß ein spekulativer Begriff von Unendlichkeit (und damit auch von Endlichkeit) erst in der jeweiligen Abfolge von "schlechter" zu "wahrer" Unendlichkeit in den drei Abschnitten der Seinslogik relevant wird. "Wahrhafte Unendlichkeit" ist Bedingung und Subtext der Hegelschen Erörterung von "Bestimmtheit". Daß der Begriff wahrhafter Unendlichkeit eine nicht eingelöste, logische Prämisse der Hegelschen Wissenschaft der Logik ist, diesen Gedanken findet man übrigens schon bei Adolf Trendelenburg, Logische Untersuchungen, Leipzig 31870, 57ff., hier: 60.
192
Dekonstruktion als schlechte Unendlichkeit?
Spagat der Überschreitung eines Unüberschreitbaren. "Im Sollen beginnt das Hinausgehen über die Endlichkeit, die Unendlichkeit" (ebd., 121). Diese Sollenskonstruktion ist für Hegel "selbst nur endliches Hinausgehen" (ebd., 123), und der Sollensbegriff für ihn der Repräsentant für den "Progreß ins Unendliche" und damit für das "verendlichte Unendliche" (ebd., 124 u. 132). Diese "schlechte Unendlichkeit" bleibt notwendig "mit dem Endlichen als solchem behafftet, ist dadurch begrenzt und selbst endlich" (ebd., 130). Endlichkeit und Unendlichkeit erscheinen als getrennt und entgegengesetzt: "es gibt zwey Welten, eine unendliche und eine endliche" (ebd., 127). Bezüglich einer logischen Bestimmung von Unendlichkeit ist es für Hegel nun aber "die Hauptsache [...], den wahrhaften Begriff der Unendlichkeit, das Unendliche der Vernunft von dem Unendlichen des Verstandes zu unterscheiden" (ebd., 124). Wichtig ist, daß Hegel "wahrhafte Unendlichkeit" nicht aus dem, was er die "Wechselbestimmung des
Endlichen und Unendlichen" (ebd., 126-130) nennt, herleitet. Es verbleibt bei einem NichtVerhältnis und einer Kluft von "schlechter" zu "wahrer" Unendlichkeit. Der Abschnitt "c. Die affirmative Unendlichkeit" (ebd., 130-137) beginnt mit einem Rückverweis auf eine vorgängig-absolute Einheit. Die "Wahrheit" des Wechselbestimmens des Endlichen und Unendlichen ist "an sich schon vorhanden" (ebd., 130). Es gilt die "Einheit des Unendlichen und Endlichen [...], wie schon oft bemerkt, hier aber vornemlich in Erinnerung zu bringen" (ebd.). Mit dieser absoluten Einheit, die "selbst das Unendliche ist, welches sich selbst und die Endlichkeit in sich sich begreifft" (ebd., 132), ist es möglich, Endlichkeit als ideell zu fassen und das heißt auch: zu tilgen. Endlichkeit ist in dieser spekulativen Fassung "nur als Hinausgehen über sich; es ist also in ihr die Unendlichkeit" (ebd., 133). Mit dieser getilgten Endlichkeit ist es dann unproblematisch, daß zum "Fürsichsein" übergegangen wird, in dem das "qualitative Seyn vollendet" (ebd., 144) ist und daß "Qualität" in "Quantität" übergeht. Im Abschnitt Quantität ist die Kluft zwischen "schlechter" und "wahrer" Unendlichkeit ebenfalls dominant. Das Problem endlicher Bestimmtheit zeigt sich aus der Perspektive der Quantität in der Frage, ob ein Quantum als diskret angenommen werden muß oder auch als Kontinuum gefaßt werden kann. Hegel entwickelt das quantitative Unendliche an seinen beiden Fälle: dem Unendlich-Großen und dem Unendlich-Kleinen. Das Unendlich-Große wird für Hegel vornehmlich durch die Bestimmung des "Erhabenen" im Moralischen bei Kant (KrV A, 290f), das Unendlich-Kleine vornehmlich durch das Differenzialkalkül bei Leibniz, Newton und anderen repräsentiert.29 Sowohl durch die Möglichkeit, das Quantum im Unendlich-Großen durch ein immer größeres Quantum, als auch durch die Möglichkeit, das Quantum im Unendlich-Kleinen durch ein immer kleineres Quantum verändern zu können, kann für Hegel der unendlichen Progreß nicht vermieden werden. In beiden Fällen bleibt das Modell eines diskreten, also teilbaren und endlichen, Quantums erhalten. Das Quantum ist bezogen auf die Unendlichkeit wieder nur bestimmt als "ein Sollen" (GW 21,218). Das "fortgehende Ueberfliegen der Grenze" (ebd., 222) ist "keine Näherung zum Unendlichen" (ebd., 221). Als Sollen ist es nur "die Aufgabe des Unendlichen, nicht die Erreichung desselben" Hegels Rezeption des mathematisch Unendlichen vgl. Michael Wolff, "Hegel und Cauchy. Eine Untersuchung zur Philosophie und Geschichte der Mathematik", in Hegels Philosophie der Natur. Beziehungen zwischen empirischer und spekulativer Naturerkenntnis, hg. v. R.-P. Horstmann u. M.J. Petry, Stuttgart 1986, 197-263. Vgl. auch Pirmin Stekeler-Weithofer, "Hegels Philosophie der Mathematik", in Vernunftkritik nach Hegel. Analytisch-kritische Interpretationen zur Dialektik, hg. v. C. Demmerling u. F. Kambartel, Frankfurt
29 Zu
a.M. 1992,214-249.
193
Peter-Ulrich
Philipsen
(ebd., 220), es ist der ohnmächtige Versuch eines Verstandesdenkens, "über das Endliche Meister [zu] werden (ebd., 223). Die "wahrhafte quantitative Unendlichkeit" expliziert Hegel an der Idee des kontinuierlichen Quantums, das erstens nicht diskret ist, zweitens nicht als dem diskreten Quantum entgegengesetzt gedacht wird und drittens diskretes und kontinuierliches Quantum als Ausdruck eines vorgängigen Kontinuums begreift. Diese Idee ist für Hegel der Möglichkeit nach in einem Sonderfall des Unendlich-Kleinen realisiert: im UnendlichKleinen des Differenzialkalküls im "Mathematisch-Unendlichen". Die Beschreibung des Differenzialkalkül ist dabei ambivalent. Einerseits wird es als in den unendlichen Progreß laufend beschrieben, die mathematische "Operation kann der Vorstellung eines bloß relativKleinen nicht entbehren" (ebd., 258). Andererseits deutet Hegel das Differenzialkalkül spekulativ. Dem mathematisch Unendlichen liegt "der Begriff des wahrhaften Unendlichen zu Grande" (ebd., 237). Der Sinn der drei langen Anmerkungen zur Verwendung des UnendlichKleinen in der Mathematik liegt für Hegel in dem Aufweis der "affirmativen Bestimmungen [...], die so zu sagen im Hintergrunde bleiben", es gilt, sie aus ihrer "Nebulosität" (ebd., 308) hervorzuheben. In den "sogenannten unendlich kleinen Differenzen" geht die Bedeutung diskreter Quanta "gänzlich verlohren. dx, dy sind keine Quanta mehr, noch sollen sie solche bedeuten" (ebd., 251). In dieser Fassung einer "wahrhaft quantitativen Unendlichkeit" ist "das Quantum wahrhaft zu einem qualitativen Dasein vollendet; es ist als wirklich unendlich gesetzt" (ebd.). Mit dieser Tilgungsfigur diskreter, endlicher Quanta läßt sich dann ohne Probleme im "quantitativen Verhältnis" das "unendliche Quantum" als "die Einheit [...] der quantitativen und der qualitativen Bestimmtheit" (ebd., 310) fassen und die "Quantität" ins "Maß" überführen. Im Abschnitt Maß als der Einheit von Qualität und Quantität bricht das Problem endlicher Bestimmtheit ebenfalls wieder hervor.30 Die Kluft zwischen "schlechter" und "wahrer" Unendlichkeit wird aus der Perspektive des Maßes thematisch in der Frage, ob die Veränderung von Maßverhältnissen besonders an den Stellen, wo quantitative in qualitative oder qualitative in quantitative übergehen oder umschlagen als diskrete Veränderung dieser Maßverhältnisse gefaßt werden müssen oder ob diese Übergänge auch als ein Kontinuum beschrieben werden können. Hegel erörtert das Unendlichkeitsproblem anhand der chemischen Theorie stöchiometrischer Mengenverhältnisse. Innerhalb der chemischen Maßverhältnisse interessiert er sich besonders für die "Knotenlinie", die den Punkt markiert, an dem kleinste quantitative Veränderungen des Verhältnisses qualitative Veränderungen des chemischen Zustandes bewirken. Im Gegensatz zu einer im Sinne eines "Mehr und Weniger" allmählichstetigen Veränderung von Maßverhältnissen repräsentiert durch das chemische Modell der Wahlverwandtschaft ist bei der "Knotenlinie" der "Uebergang ein Sprung" (GW 21, 366).31 Dieses Hegelsche Modell der Knotenlinie ist bekanntlich sehr wirkungsmächtig geworden in der marxistischen Hegelrezeption. Friedrich Engels leitet aus der Knotenlinie "das Gesetz des Umschlagens von Quantität in Qualität und umgekehrt"32 ab. Für Hegel ist die "Knotenli-
-
-
-
30 Zum Hegelschen Maßkapitel vgl. Ulrich Ruschigs Kommentar zum "realen Maß": Hegels Logik und die Chemie. Fortlaufender Kommentar zum "realen Maß", Bonn 1997 (Hegel-Studien, Beiheft 37). 31 Vgl. GW 21, 367: "Alle Geburt und Tod, sind, statt eine fortgesetzte Allmähligkeit zu seyn, vielmehr ein Abbrechen derselben und der Sprung aus quantitativer Veränderung in qualitative". 32 Friedrich Engels, "Dialektik der Natur", in MEW 20, 348. Daß Engels sich in dieser Rezeption als wahrhafter Hegelianer erweist und gerade auf die spekulativen Elemente der Hegelschen Auslegung der "Knoten-
194
Dekonstruktion als schlechte Unendlichkeit?
wie schon das Unendlich-Kleine im Differenzialkalkül ambivalent. Einerseits ist die Veränderung von Maßverhältnissen, ihr Umschlagen von Quantität in Qualität weiterhin durch "schlechte Unendlichkeit" qualifiziert. Das sprunghafte Umschlagen erzeugt nur einen diskreten, neuen Zustand und progredierend weitere quantitative oder qualitative Umschläge. "Es ist insofern die schlechte Unendlichkeit des Progresses vorhanden" (GW 11, 220). Andererseits wird der Übergang qua Sprung spekulativ aufgeladen und die "Knotenlinie" zum Kreis geschlossen. Das Umschlagen in den Knoten wird von Hegel als Kontinuum beschrieben. Es werden keine neuen, diskreten Zustände erzeugt, sondern das "Uebergehende ist als darin dasselbe bleibend" (GW 21, 371) und "als ein Zusammengehen mit sich selbst gesetzt" (ebd., 370). In der überarbeiteten Fassung der Seinslogik (1832) führt Hegel dafür den substantiellen Terminus "Materie, Sache" ein. Die "so sich in ihrem Wechsel der Maaße in sich selbst continuirende Einheit ist die wahrhaft bestehenbleibende, selbständige Materie, Sache" (ebd.). Als reine, sich auf sich beziehende Substanz kann die Seinslogik dann spekulativ zu einem Ende gebracht werden, denn in der "absoluten Indifferenz" als der "letzte[n] Bestimmung des Seyns" (ebd., 381) kann Endlichkeit in der Form seinslogischer Bestimmtheit als restlos getilgt gedacht werden. Bestimmtheit als absolute Indifferenz ist "nicht ein Uebergehen, noch äusserliche Veränderung, noch ein Hervortreten der Bestimmungen an ihr", sondern sie ist "einfache und unendliche negative Beziehung auf sich" (ebd., 382), und kann in das "Wesen" überführt werden.
nie"
-
3.
-
Zwei Lesarten zum Verhältnis "wahrer" Unendlichkeit
von
"schlechter"
zu
Nachdem es aus der Mode gekommen ist, Philosophie auf der Basis substantieller Totalitäten zu betreiben und die spekulativen Gehalte dieser großen Systeme sich verflüchtigt haben, ist also die Frage zu stellen, was in postmetaphysischen Zeiten von der Hegelschen Kritikfigur gegen die "schlechte Unendlichkeit" übrig bleibt. Ist aus der Tatsache, daß selbst heute Philosophen diese Kritik in einem bestimmten Sinne für gerechtfertigt halten oder daß Philosophen wie etwa Rodolphe Gasché33 meinen, sich gegen diese Kritik verteidigen zu mus-
-
lime" Wert
303ff.).
legt,
führt Ulrich
Ruschig
vor
(Hegels Logik und die Chemie,
Anm. 30., 22ff.,
91f„ 267f.,
Engels schreibt in seiner Adaptation das Hegeische Verdikt gegen die "schlechte Unendlichkeit" ohne Brechung fort: "Schlechte Unendlichkeit. Die wahre schon von Hegel richtig in den erfüllten Raum gelegt, in den Naturprozeß und die Geschichte. Jetzt auch die ganze Natur in Geschichte aufgelöst, und die Geschichte nur als Entwicklungsprozeß selbstbewußter Organismen von der Geschichte der Natur verschieden. Diese unendliche Mannigfaltigkeit von Natur und Geschichte hat die Unendlichkeit des Raums und der Zeit die schlechte nur als aufgehobenes, zwar wesentliches, aber nicht vorwiegendes Moment in sich"
("Dialektik der Natur", 504). 33 "For even if one may no longer find convincing Hegel's speculative solution of the problem of the full totalization of what according to its concept must lend itself to such an operation the Concept itself, or Reason Hegel's arguments against spurious infinity remain perfectly valid. They remain relevant because spurious infinity's relegation to the empirical discredits it as a tool of philosophical analysis. Spurious infinity disre-
-
-
-
195
Peter-Ulrich
Philipsen
sen, entweder auf einen rationellen Kern der
Hegelschen Argumente gegen die "schlechte Unendlichkeit" zu schließen oder auf einen nicht aufgearbeiteten Hegelianismus? Läßt sich also eine Kritik an der "schlechten Unendlichkeit" noch begründen, wenn man ein spekulatives Verständnis wahrhafter Unendlichkeit wegstreicht? Ich möchte im folgenden zwei Lesarten eine weiche und eine harte dieser Hegelschen Kritikfigur unterscheiden. Die weiche Lesart betont einen rationellen Kern, die harte Lesart bestreitet die heutige Begründbarkeit der Kri-
-
-
tikfigur.
Die weiche Lesart besteht in einer Neu- respektive Uminterpretation der Hegelschen wahrhaften Unendlichkeit. "Wahre Unendlichkeit" steht dann für als notwendig anzunehmende Bedeutungsstrukturen, die es gegenüber einem naiven Verstandesdenken zu betonen gilt. Als Beispiel nenne ich die Hegel-Lektüre von Pirmin Stekeler-Weithofer.34 StekelerWeithofer unternimmt den Versuch, die Hegeische Theorie der Unendlichkeit im Rahmen einer kritischen Theorie der Bedeutung zu reformulieren.35 Er plädiert für ein '"formentheoretisches' Verständnis"36 von wahrhafter Unendlichkeit bei Hegel. Aus dieser Perspektive resultiert "schlechte Unendlichkeit" aus einer "sweeping generalization", bei der vermeintlich "mit der Verneinung der Endlichkeit [...] der Begriff der Unendlichkeit schon bestimmt"37 erscheint. Im Gegensatz zu einem so bestimmten naiven, schlichten Verständnis von Unendlichkeit bestehe ein adäquates Verständnis Hegelscher wahrhafter Unendlichkeit in einer Art Metaperspektive in der Notwendigkeit der bedeutungstheoretischen Annahme einer "relative[n] intersubjektive[n] Stabilität des Unterscheidungssystems bzw. der semantischen Formen",38 die unserere Sprachverwendungen kontextuell allererst sinnhaft machen. "Wahre Unendlichkeit" verhält sich zur "schlechten" etwa analog dem Verhältnis von Metasprache zu Objektsprache. Hegels bedeutungstheoretische Einsicht besteht darin, daß "das eigentlich Substantielle unseres Denkens, Redens und Wissens die Bedeutungen oder Geltungsbedingungen oder genetischen Differenzierungen sind".39 Die Formulierungen, die die Hegeische Bezugnahme von wahrhafter Unendlichkeit auf die absolute Substanz charakterisieren, sind in diesem Verständnis dann auch eher als metaphorisch zu nehmen.40 Die harte Lesart die ich favorisiere betont die Abhängigkeit der Hegelschen Argumente gegen die "schlechte Unendlichkeit" von der maßstabgebenden Annahme der "wahren Unendlichkeit". Fällt die spekulative Prämisse weg, so läßt sich das Verdikt gegen die "schlechte Unendlichkeit" auch nicht mehr begründen. Hegel hat im wesentlichen zwei Argumente: Erstens ist für ihn "schlechte Unendlichkeit" Schein des Verstandesdenkens. Aus dieser Perspektive ist Unendlichkeit eine inadäquate Projektion mit endlichen Verstandesmitteln. Die Wahrheit dieses Scheins zeigt sich auf der Basis der Annahme einer spekulativ-vorgängigen Einheit. Zweitens ist "schlechte Unendlichkeit" nur endlich-unendlich, ergo: end-
-
-
gards
-
the fundamental difference -
34 35 36 37 38 39 40
between what is
difference itself
given
and the
given
as
thought"
(R. Gasché, "Nontotalization without Spuriousness", Anm. 1, 290). Vgl. Pirmin Stekeler-Weithofer, Hegels Analytische Philosophie. Die Wissenschaft der Logik als kritische Theorie der Bedeutung, Paderborn 1992; vgl. auch ders., "Hegels Philosophie der Mathematik" (Anm. 29). Stekeler-Weithofer, Hegels Analytische Philosophie (Anm. 34), 128-135. Ebd., 133. Ebd., 129. Ebd., 133. Ebd., 131. Vgl. ebd., 133.
196
-
Dekonstruktion als schlechte Unendlichkeit?
lieh. Reflexion oder Begründungen werden notwendigerweise in einen unendlichen Progreß getrieben und im Rahmen eines endlichen Verstandesdenkens sind Kontexte nicht zu kontrollieren. Ein Begründen, das sich der Kontexte des eigenen Begründens vollständig gewiß ist, und das folglich den Progreß ins Unendliche vermeiden kann, läßt sich wiederum nur auf der Basis der Annahme wahrhafter Unendlichkeit denken. Verflüchtigt sich nun der spekulative Gehalt der Argumentation, verflüchtigen sich auch die beiden Argumente: Erstens ließe sich vielleicht noch feststellen, daß die Bestimmung von Unendlichkeit aus der Perspektive eines Verstandesdenkens eine Projektion ist. Jede andere erfülltere Bestimmung von Unendlichkeit wäre bezüglich dieses Punktes gleichwertig. Ich sehe kein Argument, das etwa bezogen auf die beiden Bilder des Unendlichen die gerade Linie und den Kreis dazu führen könnte, zwischen einer besseren oder schlechteren Projektion unterscheiden zu können. Zweitens könnte man sicher noch behaupten, daß philosophisches Bestimmen progressiv unendlich, also endlich-unendlich ist. Damit hätte man sicher eine sehr plausible Beschreibung der faktischen Wirklichkeit heutiger philosophischer Beschäftigung gegeben, ein Argument gegen die "schlechte Unendlichkeit" wäre es aber nicht. Man kann jetzt aber auch anstelle der "wahren Unendlichkeit" andere, schwächere Voraussetzungen wie etwa Stekeler-Weithofers bedeutungstheoretische Annahmen einführen, um zu versuchen, das Argument gegen die "schlechte Unendlichkeit" aufrechtzuerhalten. Dagegen ist erst einmal überhaupt nichts einzuwenden; jede Uminterpretation Hegelscher Kategorien und jede Neueinschreibung in den Hegelschen Text ist legitim. Zu überlegen ist aber, ob in dieser veränderten Form die ursprüngliche Kritikrichtung nicht unterlaufen wird und inwiefern eine Kritik an der "schlechten Unendlichkeit" dann überhaupt noch aussagekräftig ist. Erstens hat Stekeler-Weithofers "formentheoretisches" Verständnis der Hegelschen wahrhaften Unendlichkeit selbst den Status einer nicht eingeholten Prämisse. Es mag viele gute Gründe geben, die diese Annahme stützen etwa um erklären zu können, weshalb es konstante Bedeutungen im Wortgebrauch gibt -, doch müßten diese bedeutungstheoretischen Voraussetzungen, die in der philosophischen community nicht allgemein anerkannt sind, erst in einem tendenziell unendlichen wissenschaftlichen Klärungsprozeß hergeleitet und begründet werden, so dieses möglich ist. Ein Maßstab für eine Kritik an der "schlechten Unendlichkeit" läßt sich also schwerlich gewinnen. Zweitens fragt sich, wen oder welche Theorie unter der Bedingung relativ schwacher bedeutungstheoretischer Voraussetzungen die Kritik an der "schlechten Unendlichkeit" noch treffen soll. Welchen Theorien wollte man vorwerfen, daß sie ein "schlechte[s], weil allzu schlichte[s] Verständnis des Unendlichen"41 implizieren: denjenigen von Kant und Fichte oder im Kontext meiner Fragestellung: Derrida könnte man dieses wohl kaum nachweisen. So wäre wohl selbst unter abgeschwächten Voraussetzungen einer wahrhaften Unendlichkeit die Begründung einer Kritik an der "schlechten Unendlichkeit" nicht zu retten. -
-
-
-
-
-
-
-
-
41 Ebd., 129.
197
Peter-Ulrich
4.
Philipsen
Unendlichkeit und Endlichkeit bei Derrida
Hegel ist für Jacques Derrida ein, wenn nicht der Kulminationspunkt der griechisch-europäischen Metaphysiktradition, die er in vielen Lektüren nicht nur Hegelscher Texte als durch Logozentrismus und Metaphysik der Präsenz bestimmt beschrieben hat. Ein Begriff von wahrhafter, affirmativer Unendlichkeit ist als Bemeisterungsfigur endlicher Bestimmtheit eine Zentralkategorie dieses metaphysischen Kontextes und Hegel steht für die radikalste Ausprägung dieser Kategorie.42 Die gesamte Geschichte dieser logozentrischen Tradition ist auf die "Reduktion der Spur" ausgerichtet, und allein "das positive Unendliche kann die Spur aufheben [lever], sie 'sublimieren'". Die theologische Konzeption des "Logos als Aufhebung [sublimation] der Spur" läßt sich von Piaton ausgehend bis in "die Zeit der infinitistischen Metaphysik" verfolgen, "vollendet" wird sie in Hegels "Theologie des absoluten Begriffs als Logos".43 Bei Hegel findet sich "versammelt, was das Sein als Präsenz begrenzt".44 Endlichkeit und Unendlichkeit sind innerhalb des logozentrischen Modells aufeinander unter der Dominanz der Unendlichkeit bezogen. Unendlichkeit steht für Fülle, Endlichkeit wird als Mangel bestimmt. Will man nun auf der Basis radikaler Endlichkeit philosophieren -
-
und genau das ist Derridas Intention -, so reicht es nicht hin, Endlichkeit als Differenz oder Andersheit zu privilegieren. Insofern das privilegierte Endliche noch im Muster der Bezogenheit auf das Unendliche gedacht wird, ist es relativ einfach, es im Rahmen eines dialektischen Prozesses wiederanzueignen. Es bedarf also einer Operation, die "den philosophischen Begriff Endlichkeit verschiebt und ihn dem Gesetz und der Struktur des Textes gemäß rekonstituiert [...]. Die Endlichkeit wird so zur Unendlichkeit, einer nicht-hegelschen Identität gemäß".45 Vorbild einer solchen Verschiebung von Endlichkeit ist für Derrida ein a-zentrisches Modell intra- und intertextueller Querverweisungen. Entstanden ist dieses Modell aus Derridas Kritik an einem strakturalistischen, differentiellen Erklärungsmodell Saussurescher Prägung, dem er vorwarf, noch letztendlich die Bezogenheit der Elemente aufeinander durch eine sinnstiftende und sinngarantierende Referenz auf ein Zentrum zu organisieren.46 Dem gegenüber entwickelt Derrida eine a-zentrische Struktur eines textuellen Spiels, das durch eine Logik der Supplementarität (Hinzufügung) gekennzeichnet ist, d. h. daß die faktischen Verweisungen im strikten Sinne nicht auf eine gegebene Bedeutung bezogen werden können, sondern bedeutungsgenerierend sind. Unendlich ist das Spiel in diesem Modell gerade, "weil es endlich ist".47 Diese Logik textueller Verweisung beschreibt Rodolphe Gasché als "structural infinity", um sie von "schlechter Unendlichkeit" abzugrenzen.48 -
42 Vgl. Jacques Derrida, Die Stimme und das Phänomen, Frankfurt a.M. 1979, 162f. 43 Jacques Derrida, Grammatologie, Frankfurt a.M. 1974, 124f. 44 Ebd., 45. 45 Jacques Derrida, Dissemination, Wien 1995, 284. 46 Vgl. Jacques Derrida, Die Schrift und die Differenz, Frankfurt a.M. 1972, A22-AA2. AI Ebd., 437. 48 "As seen, structural infinity is infinite, although it is not subjected, regulated, by the empirical as is spurious infinity. In addition, it is infinite in a necessary manner, which contributes to radically distinguish it from spurious infinity and to bring it into the vicinity of true infinity" (R. Gasché, "Nontotalization without Spuriousness", Anm. 1, 304f). Gasché mag recht haben, daß sich ein Unterschied zwischen "schlechter Unendlichkeit" (spurious infinity)
198
Dekonstruktion als schlechte Unendlichkeit?
Derridas theoretisches Bemühungen, die philosophische Kategorie der Endlichkeit zu verschieben und sie aus der logozentrischen Bestimmheit herauszulösen, lassen sich auch direkt anhand seiner Hegel-Lektüren explizieren. Mir scheint es deshalb sinnvoll zu sein, kurz und kursorisch die Eckpunkte der Hegel-Kritik Jacques Derridas anzugeben. Zentraler Angriffspunkt seiner Hegelauseinandersetzung ist die Hegeische Kategorie der Aufhebung. Gegen sie hat er zwei Kritikmuster entwickelt: zuerst in dem Aufsatz "Der Schacht und die Pyramide. Einführung in die Hegeische Sémiologie"49 die PhonozentrismusKritik im Rahmen einer Lektüre der Hegelschen Sprachtheorie im Psychologieabschnitt der Enzyklopädie, und später in Glas (Totenglocke/Totengeläut)50 die Phallogozentrismus-Kritik im Rahmen einer tour de force durch alle Hegels Theorie der Sittlichkeit betreffenden Texte in seiner gesamten Theorieentwicklung. Bezogen auf die Hegeische Aufhebungskategorie betont Derrida den Aspekt der restlosen Tilgung von Endlichkeit als der Bedingung für "Aufhebung". So hat Derrida dann auch den Übersetzungsvorschlag gemacht, "Aufhebung" im Französischen durch "relève" (Ablösung) zu ersetzen.51 Voraussetzung von Bewahren und Erheben ist Anihilierung von Endlichkeit. Aufhebung ist im strikten Hegelschen Sinne dann und nur dann möglich, wenn in einer Vermittlung ein Drittes als vollständig ausgeschlossen gedacht werden kann. Für diesen Ausschluß des Dritten gibt es in den Hegelschen Texten zwei Modelle, ein phonozentrisches und ein phallogozentrisches. Das erste Argument Derridas besteht darin, zu zeigen, daß ein phonozentrisches Sprachverständnis es ermöglicht, diesen Ausschluß zu realisieren. Die wirkungsmächtige "Illusion" (leurre)52 der griechisch-europäischen Theorietradition, daß in ätherischer, gesprochener Sprache bezogen etwa auf ein Verhältnis von Signifikat, Signifikant und Referent der Signifikant zu verschwinden und durchsichtig zu werden scheint, schafft erst die Möglichkeit eines reines Denkens von Signifikaten. Die Hegeische phonozentrische Sprachtheorie ist somit wohl zu recht in Derridas Sicht eines der geheimen Zentren des Hegelschen Systems, da die Fiktion einer ätherischen phone überhaupt erst diesen endlich-unendlichen Übergang in der -
-
49 50 51
52
und struktureller Unendlichkeit über eine Bindung respektive eine Nicht-Bindung ans Empirische begründen könnte. Das Argument, "schlechte Unendlichkeit" über die Bindung an Empirie herzuleiten, kann ich bei Hegel selbst nicht entdecken. Hegel geht es in seiner Kritik um die Tilgung von Endlichkeit per se, egal ob es sich um endliche Empirie oder endliche Reflexion handelt. Folglich wäre selbstverständlich für Hegel "structural infinity" als "schlechte Unendlichkeit" zu beschreiben. Welchen Sinn Gaschés Unterscheidung in postmetaphysischen Kontexten machen soll, vermag ich nicht einzusehen. Ich kann nur vermuten, daß die Hegeische Empirismuskritik doch noch Pate des Arguments war. Der suggerierten Nähe der strukturellen Unendlichkeit zu "wahrer Unendlichkeit", wenn die Aussage denn so zu verstehen ist, kann ich nur entschieden widersprechen. Ich glaube kaum, daß es Derrida in irgendeinem Sinne um eine Wiederaufladung oder positive Bestimmung von Unendlichkeit geht. Äußerungen über die Unendlichkeit des Spiels oder wie etwa auch: "Die unendliche Differänz [différance] ist endlich" (Derrida, Stimme und Phänomen, Anm. 42, 162) dienen ausschließlich dazu, durch eine paradoxale Formulierung auf die logozentrische Verfaßtheit von Begriffen wie Endlichkeit und Unendlichkeit anzuspielen. Jacques Derrida, Randgänge der Philosophie. Wien 1988, 85-118. Jacques Derrida, Glas, Paris 1974. Zuerst in "Der Schacht und die Pyramide" (1972), in Randgänge (Anm. 49), 102. Noch im Bataille-HegelAufsatz (1967) (Schrift und Differenz, Anm 46, 380-421) hatte Derrida diesen Hegelschen Begriff, "der in seiner Unübersetzbarkeit ausschließliches Eigentum der deutschen Sprache ist" (ebd., 389), nicht übersetzt. Gleiches gilt für die Grammatologie. Jacques Derrida, Positionen, Graz, Wien 1986, 60.
199
Peter-Ulrich
Aufhebung ermöglicht oder in Hegelscher Terminologie gesprochen:
sie
Philipsen
ermöglicht erst, zu
denken, daß das Endliche sich in Wahrheit als ideell erweist. Das zweite Argument besteht darin, zu zeigen, daß eine bestimmte, sehr básale Fiktion
geschlechtlicher Differenz als reinem Gegensatz der Geschlechter das Modell liefert für Übergang in der Wesenslogik, nämlich den Übergang in den "Reflexionsbestimmungen" vom 'Unterschied als Verschiedenheit' zum 'Unterschied als Gegensatz'. Dieser Übergang ist insofern entscheidend für die Reflexionsbestimmungen, weil im 'Unterschied als Gegensatz' das Dritte ausgeschlossen und folglich Aufhebung möglich ist, während im 'Unterschied als Verschiedenheit' Äußerlichkeit notwendig verbleibt und somit Aufhebung nicht möglich ist. Die básale Fiktion, Geschlechterdifferenz als reinen Gegensatz zu denken, ermöglicht überhaupt erst das Denken von Gegensätzen. Derrida ist somit wohl auch darin recht zu geben, den Systemteil der "Familie", in dem man diese spezifische Theorie der Geschlechterdifferenz als Gegensatz bei Hegel repräsentiert in der Antigone-Figur53 verorten muß, zu einem weiteren geheimen Zentrum des Hegelschen Systems zu erklären. Akzeptiert man einmal Derridas Argumente gegen die Hegeische Kategorie der Aufhebung, so dürfte klar sein, daß dieses einerseits mit einem grundlegenden Rekonstruktionsund Umwertungsprozeß der Übergänge im Hegelschen Systems verbunden ist und daß andererseits in zunehmendem Maße die Verwendung Hegelscher Begrifflichkeiten und Argumentationen problematisch wird und nicht mehr angeraten erscheint. Für Derrida ist der Klärungsprozeß über sein Verhältnis zur Hegelschen Theorie unabschließbar.54 von
einen sehr entscheidenden
-
-
5.
Und immer wieder Kontexte
Es ist sicher schöner, in philosophischen Begründungen alle Kontexte der Argumentation kontrollieren und beherrschen zu können, es ist sicher auch angenehmer, lieber in keinen Begründungsregreß zu geraten als in einen oder mehrere, und es ist sicher beruhigender, allen Fallstricken möglicher Relativismen entgehen zu können. Alle diese wünschbaren Zustände begründen aber leider kein brauchbares Argument dafür, die Hegeische Kritik an der "schlechten Unendlichkeit" in nachmetaphysische Zeiten überführen zu können. Derridas Antwort auf die begründungstheoretische Nichtabschließbarkeit von Kontexten in Argumentationen ist das, was er Dekonstruktion nennt. Dekonstruktion kann sich begründungstheoretisch prinzipiell nicht auf wissenschaftliche Standards oder pragmatische, plausible Annahmen verlassen. Der Ansatzpunkt für Dekonstruktion sind in Kontexten vorfindliche Strukturen, die bezüglich ihrer internen Konsistenz und Voraussetzungshaftigkeit zu analysieren sind. Dekonstruktion ist dabei in einem eminenten Sinne regelgenerierend, sie "wird immer auf bestimmte Weise durch ihre eigene Arbeit vorangetrieben",55 und in dieser Perspektive ist Dekonstruktion "keine Methode und kann auch nicht in eine Methode über-
53 Zur Antigone-Interpretation vgl. Derrida, Glas (Anm 50), 164a-215a. 54 Vgl. Ebd., 91 u. 147f.; ferner Schrift und Differenz (Anm. 46), 382. 55 Derrida, Grammatologie (Anm. 43), 45.
200
Dekonstruktion als schlechte Unendlichkeit?
führt werden".56 Dieser radikale begründungstheoretische Ansatz Derridas impliziert keinesfalls die Überführung von Philosophie in Nicht-Philosophie oder gar Literaturtheorie,57 sondern ein stärkeres philosophisches Augenmerk auf Begründungskontexte. Relativismusängste gilt es hinter sich zu lassen, um sich offensiv der Beschreibung von Kontexten zu widmen. Da eine Totalisierung von Argumenten damit tendenziell unmöglich wird, bedeutet ein dekonstruktives Verfahren auch eine stärkere Regionalisierung von Argumenten, der Ort und die Zeit eines Arguments spielen eine Rolle. Da diese Kontextualisierung von Argumenten nicht nur in theoretischer, sondern auch in praktischer Hinsicht gilt, ist ein dekonstruktives Verfahren ebenfalls als ein Modell faktischer, politischer Intervention zu beschreiben.
56 57
Jacques Derrida, Psyché. Inventions de l'autre, Paris 1987, 390 (eigene Übersetzung). Bezüglich der Frage der Regelgenese gibt es eine starke Nähe zur Philosophie Jean-François Lyotards. Vgl. Jürgen Habermas, "Exkurs zur Einebnung des Gattungsunterschiedes zwischen Philosophie und Literatur", in Der philosophische Diskurs der Moderne, Frankfurt a.M. 1985, 219-247. Habermas sieht sehr richtig, daß Derrida die Annahme und Setzung der prinzipiellen Unterscheidbarkeit von sprachlichen Äußerungen mit Wahrheitsanspruch und sprachlichen Äußerungen ohne Wahrheitsanspruch die vorsichtig gesprochen für die Begründung einer "Theorie des kommunikativen Handelns" nicht unwichtig ist bestreitet. Daraus aber zu folgern, daß Derrida eine Einebnung des Gattungsunterschiedes zwischen Philosophie und Literatur intendiere die "Triftigkeit seiner Vernunftkritik" müsse "nach Maßstäben des rhetorischen Gelingens und nicht der logischen Konsistenz beurteilt werden" (ebd., 222) und "stilkritisch" verfahre (ebd., 223), ist absurd. Es macht einen Unterschied, zu behaupten, die Differenz zwischen Philosophie und Literatur prinzipiell aus den einzelnen Praktiken nicht ableiten zu können, und darauf hinzuweisen, daß der Unterschied der Gattungen in den Unterscheidungen dieser Bereiche leider schon wie etwa in der obigen sprachtheoretischen Annahme von Habermas vorausgesetzt ist, oder zu behaupten, daß Unterschiede zwischen Philosophie und Literatur gar nicht existieren. -
-
-
-
-
-
201
Claus-Artur Scheier
Die Negation im Dasein. Zum systematischen Ort eines methodischen Terminus in Hegels Wissenschaft der Logik
Meinem Lehrer Heribert Boeder
zum
siebzigsten Geburtstag
Die gründliche Überarbeitung, der Hegel, nie zufrieden mit dem Getanen, die Seinslogik noch unterziehen konnte, erbrachte nicht nur didaktische Verbesserungen und mannigfache Verdeutlichungen im einzelnen, sondern nach der inhaltlichen Seite eine durchgreifende Umgestaltung vor allem des zweiten Kapitels des ersten Abschnitts: "Das Daseyn". Insbesondre sind die Termini Realität und Negation (wie im dritten Kapitel der Terminus Idealität) aus den Überschriften in eine Anmerkung verschwunden, und weil im Inhaltsverzeichnis gewöhnlich eine Anzeige auf die methodische Einteilung und damit auf den Bau eines philosophischen Werks erwartet wird, scheint es, als seien diese Termini aus dem Gang des Gedankens als solchem getilgt und die Architektonik der Wissenschaft der Logik eine andre geworden. Sie unterscheidet freilich in aristotelischem Geist selber Einteilung (3.3.2.A.b.2)' und Methode (3.3.3), und sogleich in der Einleitung warnt Hegel davor, die Bewegung des Denkens, statt in sie einzutreten, an ihrer äußeren Gliederung ablesen zu wollen. Da keine Darstellungen für wissenschaftlich gelten könnten, "welche nicht den Gang dieser Methode gehen und ihrem einfachen Rythmus gemäß sind", macht er in "Gemäßheit dieser Methode" darauf aufmerksam, "daß die Eintheilungen und Ueberschriften der Bücher, Abschnitte und Kapitel, die in der folgenden Abhandlung der Logik selbst vorkommen, so wie etwa die damit verbundenen Angaben, zum Behuf einer vorläufigen Uebersicht gemacht und eigentlich nur von historischem Werthe sind. Sie gehören nicht zum Inhalte und Körper der Wissenschaft selbst, sondern sind Zusammenstellungen der äussern Reflexion" (GW 11,
25)2
1
Gezählt wird nach Teil
Unterkapitel etc. 2
Zit. wird die erste
(vgl.
GW
1 für die erste,
11,32)
12
für die zweite
Ausgabe
-
Ausgabe der Seinslogik nach GW 11, die
zweite nach GW 21.
-,
Abschnitt, Kapitel,
Die
Negation im Dasein
und haben "keine andere Bedeutung, als einer Inhaltsanzeige" (GW 11, 26). Dies derart, daß der nachdenkende Leser sich gelegentlich zur Vermutung gedrängt finden mag, Hegel habe jenen einfachen Rhythmus gar mit Fleiß verhüllt, um "die wissenschafftliche Organisation" nicht "zur Tabelle herabgebracht" zu sehen (GW 9, 36) eine Furcht, die im Abstand von bald zweihundert Jahren und in einer Welt, die derjenigen Hegels weniger ähnelt als diese der des Aristoteles, eher in die entgegengesetzte umgeschlagen sein müßte.3 Belegt das Verschwinden der beiden Termini zunächst also nur, daß Hegel neunzehn Jahre nach der ersten Fassung keinen Wert mehr darauf legt, sie eigens anzuzeigen, so ist anderseits kaum zu glauben, daß diese Sinnesänderung einem rein didaktischen Eros entsprungen sein sollte. Die Frage bleibt zu beantworten, ob er bis zuletzt Schwierigkeiten mit seiner Methode und der aus ihr sich entwickelnden Architektonik des Systems hatte wie die überraschende Viergliedrigkeit des Urteilskapitels (3.1.2) der Vorstellung Nahrung geben mag, hier sei das logische Urgestein denn doch zu hart gewesen für den dialektischen Meißel -, oder ob er der Einfachheit des logischen Rhythmus längst, nämlich seit der Phänomenologie des Geistes sicher war und die "Schwierigkeit des Gegenstandes für sich und dann seiner Darstellung" vielmehr in den "Denkformen" zu suchen ist, insofern sie "zunächst in der Sprache des Menschen herausgesetzt und niedergelegt" sind (GW 21, 10). Ist doch in manchen Wör-
-
tern
"selbst ein
speculativer Geist der Sprache nicht zu verkennen", und
"es kann dem Denken eine Freude gewähren, auf solche Wörter zu stoßen, und die Vereinigung Entgegengesetzter, welches Resultat der Speculation, für den Verstand aber widersinnig ist, auf naive Weise schon lexicalisch als Ein Wort von den entgegengesetzten Bedeutungen vorzufinden."
(GW 21, 11)
In der Phänomenologie des Geistes jedenfalls ist die Durchführung des "einfachen Rythmus" in ein systematisches Ganzes souverän geleistet: Die Grundfigur der und seine oder der Reflexionsschritt Position (P), Negation (N) und Negation Reflexionsmomente der Negation oder gesetzte Reflexion (NN) wird durch dreimalige Wiederholung, worin die unmittelbare Position (P) des neuen Schritts jeweils die Bestimmung der absoluten Positivität (Pnn) des vorhergehenden hat, insgesamt also durch zwölf Momente, in eine Reflexionstotalität überführt, und sechs Reflexionstotalitäten 1) Ansichsein, 2) Fürsichsein, 3) ansichseiende und 4) fürsichseiende Kategorie, 5) anundfürsichseiende Kategorie oder ansichsei-
Übersetzung
-
-
-
ender Begriff und 6) anundfürsichseiender Begriff4 schließen sich zu einem systematischen Ganzen zusammen als zur Realisation des in der Einleitung exponierten Begriffs der Wissen-
schaft oder des absoluten Wissens
3
4
(Kap. VIII), das als der konkrete Begriff sowenig wie jener
Wenn wir nicht mehr mit dem älteren Denken in seine Sache versenkt sind, sondern nurmehr abgelebte Strukturen zu studieren scheinen, nämlich die Architektoniken, in der Neuzeit die Systeme, in denen jene Sache je ihren geschichtlichen Aufenthalt fand, dann sind wir vielmehr mittelbar, d. h. der Herkunft der eignen Gegenwart nachdenkend, eingelassen in deren Sache. Vgl. C.-A. Scheier, "Die Grenze der Metaphysik und die Herkunft des gegenwärtigen Denkens", in Abhandlungen der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft 46 (1995), 189-196. Nämlich 1) Bewußtsein (Kap. I—III), 2) Selbstbewußtsein (Kap. IV), 3) beobachtende Vernunft (Kap. V.A), 4) die Verwirklichung des vernünftigen Selbstbewußtseins, die Individualität, der wahre Geist und die Bildung (Kap. V.B-VI.B.I.a), 5) der Glauben und die Moralität (Kap. VI.B.I.b-VI.C) und 6) die Religion (Kap. VII) im einzelnen durchgeführt in C.-A. Scheier, Analytischer Kommentar zu Hegels Phänomenologie des Geistes. Die Architektonik des erscheinenden Wissens, Freiburg/München 21986 (11980). -
203
Claus-Artur Scheier
abstrakte eine Gestalt des Bewußtseins ist und daher auch kein Moment in dessen methodischer Entwicklung. Dieser konkrete Begriff- und das Kapitel über das absolute Wissen entfaltet ihn ja wesentlich im Rückblick auf die Gestalten des Bewußtseins und nur summarisch im Unterschied in sich (Logik) und von sich selbst (Realphilosophie) ist die Sphäre der Logik so, daß "jedem abstracten Momente der Wissenschaft eine Gestalt des erscheinenden Geistes überhaupt" entspricht: "Wie der daseyende Geist nicht reicher ist, als sie, so ist er in seinem Inhalte auch nicht ärmer" (GW 9, 432) eine Folge des Hegelschen Axioms, die "Kraft des Geistes" sei "nur so groß als ihre Aeusserung, seine Tiefe nur so tief als er in seiner Auslegung sich auszubreiten und sich zu verlieren getraut" (GW 9, 14), und im übrigen am Gang der Wissenschaft der Logik selbst überprüfbar. Diese Überprüfung sie kann sich, wie gesagt, nicht an die Hegelschen Einteilungen halten wird allerdings die Entdeckung machen, daß die Wissenschaft der Logik genau doppelt soviele Termini oder Momente enthält wie die Phänomenologie des Geistes, nämlich nicht sechs mal zwölf, sondern zwölf mal zwölf. Der Grund dafür ist angedeutet in Hegels Bemerkung, daß jedem abstrakten Moment der Wissenschaft eine Gestalt des erscheinenden Geistes entspricht, denn nicht die Wissenschaft überhaupt ist abstrakt, indem sie in sich selbst, und zwar in jedem Reflexionsschritt, abstrakte und konkrete Momente unterscheidet. Zwar tritt das Moment -
-
-
-
"nicht als diese Bewegung auf, aus dem Bewußtseyn oder der Vorstellung in das Selbstbewußtseyn und umgekehrt herüber und hinüber zu gehen, sondern seine reine von seiner Erscheinung im Bewußtseyn befreite Gestalt, der reine Begriff, und dessen Fortbewegung hängt allein an seiner reinen Bestimmtheit" (GW 9, 432),
aber in dieser ist gleichwohl der für den erscheinenden Geist konstitutive Unterschied von 1) Wahrheit oder Ansichsein, 2) Wissen, Gewißheit oder Fürsichsein und 3) ihrer progressiven Synthese aufgehoben, d. h. er wird in der reinen Selbstbewegung des Begriffs produziert als die Unmittelbarkeit 1) der gesetzten, 2) der entgegengesetzten Bestimmtheit und 3) ihrer Beziehung. Dies Setzen und Aufheben hat in der Logik selber die Gestalt A) des Ansichseins oder Voraussetzens, worin die Bestimmtheiten nur "verschiedene Seiten für die äussere Reflexion" (GW 11, 73) sind und "die gleichgültige, beziehungslose Bestimmung" (GW 11, 62) enthalten, die sich ins Fürsichsein oder die bestimmende Reflexion aufhebt. In dieser sind die Bestimmtheiten dann, B) "indem sie überhaupt zunächst noch als unterschiedene, aber zugleich als aufgehobene betrachtet werden" (GW 11, 56), Momente im engeren Sinn, d. h. "Bestimmungen, welche Beziehungen sind, und in ihrer Einheit" bleiben: "jedes selbst enthält an ihm zugleich auch sein von ihm verschiedenes Moment" (GW 11, 62). Diese Konkretion als ihr Scheinen-ineinander ist es, die in der Phänomenologie, wo nur die Gestalten des Bewußtsein und Selbstbewußtseins einander ablösen weil immer ein neuer Gegenstand entspringt -, nicht vorkommen kann und die eigentümliche Zutat der fürsichseienden Wissenschaft ist. Die einfachste konkrete Gestalt des "einfachen Rythmus" ist also diese Verdopplung in Abstraktion und Konkretion, Realität und Idealität, Ansichsein und Fürsichsein, worin A: 1 ) das Gesetzte, 2) Entgegengesetzte und 3) ihre setzende Beziehung, sodann B: 1) das reflektierte oder selber setzende Gesetzte, 2) Entgegengesetzte und 3) ihre sich selber setzende oder absolute Beziehung zu denken sind, also A) die entgegengesetzten Bezogenen und ihre ein-
204
Die
Negation im Dasein
Beziehung und B) die entgegengesetzten Beziehungen (oder Beziehungs- und Unterscheidungsgrand)5 und die Beziehung der Beziehungen; am Beispiel des ersten der vierundzwanzig Reflexionsschritte der Wissenschaft der Logik:61. Sein (A.l), Nichts (A.2), Werden (A.3), Entstehen (B.l), Vergehen (B.2), Dasein (B.3). Das Dasein macht zugleich II. einen neuen Anfang (A.l), weil der letzte Terminus des Reflexionsschritts als absolute Vermittlung (Pnn) ebenso Unmittelbarkeit (P) ist usf., wie das absolute Wissen der Phänomenologie des Geistes an und für sich selbst das einfache Sein als der einfache Begriff des Seins: fache
"Wenn in der Phänomenologie des Geistes jedes Moment der Unterschied des Wissens und der Wahrheit, und die Bewegung ist, in welcher er sich aufhebt, so enthält dagegen die Wissenschaft diesen Unterschied und dessen Aufheben nicht, sondern indem das Moment die Form des Begriffs hat, vereinigt es die gegenständliche Form der Wahrheit und des wissenden Selbsts in unmittelbarer Einheit." (GW 9, 432)
Die Methode der Logik ist mithin "das Bewußtseyn über die Form ihrer innern Selbstbewegung", und in der Phänomenologie des Geistes war "ein Beyspiel von dieser Methode, an einem concretern Gegenstande, an dem Bewußtseyn, aufgestellt" (GW 11, 24), wo sie sich als "sich vollbringende^] Skepticismus" bestimmte (GW 9, 56). Entsprechend tritt die objektive Logik "an die Stelle der vormaligen Metaphysik" als deren "wahrhafte Kritik" (GW 11, 32), die nicht nur für sie und ihr Bewußtsein "negative Bedeutung" (GW 9, 56) hat. Denn schon in Glauben und Wissen hatte Hegel 1802 in Jacobis Nihilismus-Schelte7 die Aufgabe des nachkantischen Denkens vernommen: "Das erste der Philosophie aber ist, das absolute Nichts zu erkennen" (GW 4, 398), "aus welchem Nichts und reinen Nacht der Unendlichkeit die Wahrheit als aus dem geheimen Abgrund, der ihre Geburtsstätte ist, sich
emporhebt" (GW 4, 413).
Diese Nacht, die der letzte Absatz des Kapitels über das absolute Wissen der Phänomenologie des Geistes noch einmal nach der Seite der Geschichte betrachtet (GW 9, 433f), ist als absolut wiederhergestellte Unmittelbarkeit zwar einerseits "die Gewißheit vom Unmittelbaren [...], oder das sinnliche Bewußtseyn" (GW 9, 432), mit dem die Phänomenologie anfing, anderseits aber auch die im Wissen festgehaltene "unmittelbare Gleichheit mit sich selbst" (ebd.) oder das Sein, mit dem die Logik anfängt, "das noch schlechthin Unbestimmte. Aber eben diese Unbestimmtheit ist das, was seine Bestimmtheit ausmacht, denn die Unbestimmtheit ist der Bestimmtheit entgegengesetzt, sie ist somit als Entgegengesetztes selbst das Bestimmte, oder Negative, und zwar die reine Negativität. Diese Unbestimmtheit oder Negativität, welche das Seyn an ihm selbst hat, ist es, was die Reflexion ausspricht, indem sie es dem Nichts gleichsetzt." (GW 11,51)
Näher betrachtet aber ist es nicht nur die selbst hat", gleichsetzt, denn das Wissen
Reflexion, die das Sein dem Nichts, das es "an ihm
"hat das Element des reinen Denkens dadurch erreicht, daß es alle Mannichfaltigkeit des vielfach bestimmten Bewußtseyns in sich aufgehoben hat. Die ganze Sphäre des Wissens enthält also als unwesentliches Moment, die absolute Abstraction und Negativität; das Seyn, ihr Anfang ist diese reine Abstraction selbst, oder ist wesentlich nur als absolutes Nichts." (Ebd.) 5
6 7
Vgl. J.G. Fichte, Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre (1794), Gesamtausgabe der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Abt. 1, Bd. 2, Stuttgart-Bad Cannstatt 1965, 272. Die Reflexionsschritte werden mit römischen Ziffern gezählt (für die zweite Ausgabe mit Index). F.H. Jacobi, Werke. Bd. 3, Leipzig 1816, 44, vgl. 49, 175.
205
Claus-Artur Scheier
In der Tat anerkennt die Hegeische Spekulation sowenig wie das undogmatischere Denken unsrer Tage ein sei es metaphysisches, sei es Husserlsches "originär Gegebenes" und ist wenigstens insofern nicht "Identitätsphilosophie", als Identität darin immer nur entspringt und konstruiert wird in der Selbstbewegung der Negation. Diese hingegen, um nichts mehr ein Gegebenes als etwa Derridas Différance, ist das schlechthin Un(de)konstruierbare und eben darum die Paradoxie des "absoluten Nichts". Die Frage, wie die Negation in die Wissenschaft der Logik kommt, käme also immer schon zu spät: von Anfang an ist sie nicht nur deren Unruhe, es gibt darin überhaupt nichts anderes als die Negation. Als solche, rein als sie selbst, ist sie darum auch nicht irgendwie, nicht einmal als bloße Namenserklärung, zu "haben", und man könnte sie das reine Sich-Entziehen nennen, das aber eben darum alles andere gibt, so, daß alles andere sie selbst ist in verwandelter Gestalt. Denn das, "wodurch sich der Begriff selbst weiter leitet, ist das Negative, das er in sich selbst hat; diß macht das wahrhaft Dialektische aus" (GW 11,26). Insofern, erinnert Hegel, ist das Resultat der Kantischen Antinomien "in seiner positiven Seite aufgefaßt, nichts anders, als die innere Negativität derselben, oder ihre sich selbstbewegende Seele" (GW 11, 27), und als solche "das allgemeine Blut zu nennen, welches allgegenwärtig durch keinen Unterschied getrübt noch unterbrochen wird, das vielmehr selbst alle Unterschiede ist, so wie ihr Aufgehobenseyn, also in sich pulsirt, ohne sich zu bewegen, in sich erzittert, ohne unruhig zu seyn. Sie ist sichselbstgleich, denn die Unterschiede sind tautologisch, es sind Unterschiede, die keine sind. Dieses sichselbstgleiche Wesen bezieht sich daher nur auf sich selbst; auf sich selbst, so ist diß ein anderes, worauf die Beziehung geht, und das beziehen auf sich selbst ist vielmehr das Entzweyen, oder eben jene Sichselbstgleichheit ist innerer Unterschied. Diese Entzweyten sind somit an und für sich selbst, jedes ein Gegentheil eines andern, so ist darin schon das Andere mit ihm zugleich ausgesprochen; oder es ist nicht das Gegentheil eines andern sondern nur das reine Gegentheil, so ist es also an ihm selbst das Gegentheil seiner; oder es ist überhaupt nicht ein Gegentheil, sondern rein für sich, ein reines sich selbst gleiches Wesen, das keinen Unterschied an ihm hat" (GW 9, 99f). -
Indem
Hegel hier das Entspringen des Andern sowohl in und aus der Negativität wie als sie ausspricht, läßt er zugleich sehen, wie die Negation alles andre gibt; daß sie darin aber auch sich selber gibt wie sie nämlich jeweils im Unterschied oder "Gegentheil" ist -, zeigt zugleich den geschichtlichen Unterschied ihres Sich-Entziehens vom nach-metaphysisch gedachten und zu denkenden (etwa im Sinn des seit Schopenhauer berufenen "blinden Flecks") an: sie ist Sich-selbst-setzen, Manifestation, Offenbarung, und genau weil Hegel an dem, was nur eine allbekannte logische Operation zu sein scheint,8 den Namen für das "Absolute" hat, das für Gefühl, Vorstellung, Einbildung ohnehin, aber auch für das reine Denken nur ist und so ist, wie es sich manifestiert, hat er an jener "Operation" auch das absolute Prius (vgl. GW 21, 15), kraft dessen das System zwar nicht horizontal (als Progreß), wohl aber vertikal -
offen ist und sich nicht das Jacobische Tertium non datur diktieren lassen muß: "Gott ist, und ist außer mir, ein lebendiges, für sich bestehendes Wesen, oder Ich bin Gott. Es giebt kein
8
9
Drittes."9
Vgl. hierzu C.-A. Scheier: "Der vulgäre Zeitbegriff Heideggers und Hegels lichtscheue Macht", in Das Rätsel der Zeit. Philosophische Analysen, hg. v. H.M. Baumgartner, Freiburg/München 1993, 51-73. F.H. Jacobi, Werke, Bd. 3 (Anm. 7), 49 (ohne Jacobis Hervorhebungen).
206
Die
Negation im Dasein "Es gibt ein Drittes, sagt dagegen die Philosophie, und es ist dadurch Philosophie, daß ein Drittes ist; indem sie von Gott nicht blos ein Seyn, sondern auch Denken, d. h. Ich prädicirt, und ihn als die absolute Identität von beydem erkennt, kein Außer für Gott und darum eben so wenig ihn als ein solches für sich bestehendes Wesen, was durch ein: außer ihm bestimmt, das heißt außer welchem noch anderes Bestehen wäre, sondern außer Gott gar kein Bestehen und Nichts anerkennt, also das Entweder, Oder, was ein Princip aller formalen Logik und des der Vernunft entsagenden Verstandes ist, in der absoluten Mitte schlechthin vertilgt" (GW 4, 399).
-
Hegel kann sich daher schon, wo in der Wissenschaft der Logik überhaupt zum erstenmal Beziehung gesetzt ist, in einer Anmerkung zum Werden (l.l.l.C.Anm. 4), gegen die "gewöhnliche Dialektik" wenden,
"die der Verstand gegen den Begriff braucht, [den] die höhere Analysis von den unendlich-kleinen Größen hat. [...] Diese Größen sind als solche bestimmt worden, die in ihrem Verschwinden sind, nicht vor ihrem Verschwinden, denn alsdann sind sie endliche Größen; nicht nach ihrem Verschwinden, denn alsdann sind sie nichts" (GW 11, 55f), -
so daß es "in der That [...] gar nichts gibt, das nicht ein Werden, das nicht ein Mittelzustand zwischen Seyn und Nichts ist" (ebd.), Produkt jener gegen Jacobi geltend gemachten "absolutefn] Identität" als der absoluten Negativität. Obzwar also "öfter die Bemerkung sich aufdringen wird, daß die philosophische Kunstsprache, für reflectirte Bestimmungen lateinische Ausdrücke gebraucht" (GW 11, 58), und ein Terminus wie Negation, auch Realität, demnach erst in der Logik des Wesens, etwa bei
der Behandlung des Gegensatzes (2.I.2.B.3.) zu erwarten wäre,10 haben doch einige Termini "aus fremden Sprachen [...] durch den Gebrauch bereits das Bürgerrecht" in der Philosophie erhalten (GW 21, 11), und Hegel folgt nur dem philosophischen Sprachgebrauch seiner Zeit, wenn er das, was an sich keinen Namen hat, weil bereits im Namen ein Unterschied gegen anderes (und damit ein Ort) gemeint ist, absolute Negativität nennt und die Termini Negation und Realität, ferner Idealität, Repulsion, Attraktion, Quantität usw., obwohl sie an "reflectirte Bestimmungen" erinnern mögen, doch um ihres in der zeitgenössischen Diskussion erscheinenden Gehalts an Unmittelbarkeit willen ohne weitere Bedenklichkeit in die Logik des Seins einführt. Heideggers Problem der Sprachflucht hatte er noch nicht. Es kommt also darauf an, zu sehen, welchen Ort die Negation als Bestimmtheit in der Entwicklung der reinen Negation als des absoluten Prius erhält: "Das Einzige, um den wissenschaftlichen Fortgang zu gewinnen, ist die Erkenntniß des logischen Satzes, daß das Negative eben so sehr positiv ist" (GW 11, 25). Als sein eignes Noch-nicht war es "die reine Abwesenheit des Seyns, das nihil privativum" (GW 11, 53), und als eine Gestalt des "Gegentheil [s]" oder Bestimmtheit als solche wird es sich innerhalb der Reflexionsschritte immer in zweiter Stellung, d. h. nach der obigen Unterscheidung als A.2 und B.2 geltend machen. Weiter aber folgen auch die Reflexionsschritte einander nicht bloß im Sinn progressiver Intensivierung ihres Gehalts, sondern wiederholen als kleinste Ganze (will man nicht schon die beiden im Reflexionsschritt selber zu unterscheidenden Triplizitäten A und B als kleinste Ganze ansehen) das Verhältnis ihrer Momente. So kehrt sich mit dem Etwas 10
Vgl. GW 21,101 f. (l2.1.2.A.b.Anm.): "Die Negation steht unmittelbar der Realität gegenüber; weiterhin in der eigentlichen Sphäre der reflectirten Bestimmungen, wird sie dem Positiven entgegengesetzt, welches die auf die Negation reflectirende Realität ist, die Realität, an der das Negative scheint, das in der Realität als solcher noch versteckt ist."
-
207
Claus-Artur Scheier
(1.1.2.A.3) am Dasein das in diesem noch ansichseiende Moment des Nichtseins heraus (GW 11, 66), oder in der "Endlichkeit" (12.1.2.B) "entwickelt sich die negative Bestimmung, die
im Daseyn liegt, welche dort nur erst Negation überhaupt, erste Negation war, nun aber zu dem Puñete des In-sichseyns des Etwas, zur Negation der Negation bestimmt ist" (GW 21, 104 f.). I. Im eröffnenden Reflexionsschritt also entfaltet sich der einfache Rhythmus der Methode A) vom Sein (P) über das Nichts (N) zum Werden, dem gesetzten Nichts des Nichts (NN), und darin B) in Entstehen (Pr)11 und Vergehen, das zugleich Vergehen des Vergehens ist
(NR), zum Dasein (NNR P^): =
"Im Werden selbst ist sowohl Seyn als Nichts, jedes auf gleiche Weise vielmehr nur als das Nichts seiner selbst. Werden ist die Einheit als Verschwinden, oder die Einheit in der Bestimmung des Nichts. Aber diß Nichts ist wesentliches Uebergehen ins Seyn, und das Werden also Uebergehen in die Einheit des Seyns und Nichts, welche als seyend ist, oder die Gestalt der unmittelbaren Einheit
dieser Momente hat; das Daseyn." (GW 11,
57)
II. Als solche unmittelbare Einheit ist das Dasein wieder A.l) "in der Bestimmung des Seyns, und das Gesetztseyn dieser Einheit ist daher unvollständig; denn sie enthält nicht nur das Seyn, sondern auch das Nichts" (GW 11, 60), nämlich 2) in der Gestalt des Anderssein; und indem das Dasein, wie zuvor das Sein ins Nichts, ins Anderssein übergegangen ist, bezieht dieses sich rein auf sich selbst und ist 3) "Andersseyn an und für sich" (GW 11,61). Dies reflektierte Anderssein ist wohl Anderssein überhaupt, aber nunmehr gesetzt als bestimmte Beziehung, also einerseits Sein-für-Anderes, anderseits als Reflexion-in-sich aus dieser Beziehung auch heraus und Ansichsein das Ansichsein B.l) die Positivität in der
Reflexion, das Sein-für-Anderes 2) die Negativität. Beide sind "die Momente oder innern Unterschiede des Daseyns" (GW 11, 63), das 3) als ihre gesetzte Einheit die Realität ist. -
Im zweiten Reflexionsschritt also entfaltet sich das Resultat des ersten Reflexionsschritts Dasein (P) über das Anderssein (N) zum Anderssein an und für sich, dem gesetzten A) Anderssein des Andersseins (NN), und darin B) in Ansichsein (PR) und Sein-für-Anderes, das vom
zugleich Selbstbeziehung ist (NR), zur Realität (NNR P,™). War das Dasein "nur die unmittelbare Einheit des Seyns und Nichts", dann ist die Realität =
als letzter Terminus des zweiten Reflexionsschritts "diese Einheit in dem bestimmten Unterschiede ihrer Momente, die an ihr verschiedene Seiten ausmachen, Reflexionsbestimmungen, die gegen einander gleichgültig sind" (GW 11, 65). Als vollständige Reflexion aber macht sich die Realität auch wieder zur Unmittelbarkeit, d. h. zu einer "Einheit, welche sie nicht bestehen läßt", und ist "ihre aufhebende einfache Einheit. Das Daseyn ist Insichseyn, und als Insichseyn ist es Daseyendes oder Etwas" (GW 11, 65f.) "insofern in das Negative übergegangen, daß dieses nunmehr zu Grunde liegt" (GW 11, 66). III. Dies zeigt sich unmittelbar darin, daß A.l) dem Etwas 2) ein anderes Etwas gegenübertritt, wogegen das Etwas zwar gleichgültig ist, aber so, daß "das Nichtseyn des Andern [...] wesentliches Moment seiner Gleichgültigkeit" ist (GW 11, 67), d. h. beide sind 3) überhaupt nur in ihrer Grenze. B.l) "Insofern nun Etwas in seiner Grenze ist und nicht ist, und diese Momente in unmittelbarer Unterschiedenheit zunächst genommen werden, so fällt -
11 Der Index R kennzeichnet die reflektierte Bestimmtheit.
208
Die
Negation im Dasein
Wissenschaft der Logik Seinslogik 1812
Seinslogik 1831
[I.
WERDEN]
[I2-
WERDEN]
II.
DASEIN
II2.
QUALITÄT
A. Dasein
A. Dasein
Anderssein (entf.) Anderssein an und für sich (entf.) B.
III.
Bestimmtheit
Qualität
Ansichsein
(>III2.B.l) Sein-für-Anderes (>III2.B.2) Realität (>II2.B.l)
REALITÄT
B. Realität
Negation Daseiendes, Etwas
III2. NEGATION
A. Etwas
A. Etwas
Anderes
Anderes Grenze (>IV2.A.3) B. Dasein des Etwas
Veränderung
(>IV2.B.l)
Nichtdasein als Ansichsein Bestimmtheit (>II2.A.2) IV.
B.
Bestimmung IV,
Bestimmung
BESTIMMUNG A.
Beschaffenheit
(>V2.A.l) (>V2.A.2) gesetzte Negation (>II2.B.2)
Sollen
Schranke
V.
NEGATION A. Ansichsein
Negation (entf)
Unendlichkeit Endlichkeit Wahre Unendlichkeit
[VI.
FÜRSICHSEIN]
B.
Dasein des Etwas Nichtdasein als Ansichsein Endlichkeit
ENDLICHKEIT/UNENDLICHKEIT
Als Nichtsein gesetzte Negation (entf.) Qualitative Unendlichkeit B.
Bestimmung Beschaffenheit Grenze
Qualität (Veränderung) (>II2.A.3) B.
Ansichsein
Sein-für-Anderes
(>IV2.B.2)
QUALITÄT A.
DER NEGATION
A. Sollen
Schranke Unendlichkeit B. Das Unendliche
Unendlicher Progreß Wahre Unendlichkeit
[VI2. FÜRSICHSEIN]
209
Claus-Artur Scheier
das Nichtdaseyn und das Daseyn des Etwas ausser einander", und die Grenze erscheint 2) als "das Nichtseyn eines jeden" (GW 11, 68). Aber dies "Nichtseyn ist hier das Ansichseyn selbst" (GW 11, 69), denn "Etwas ist, was es ist, nur in seiner Grenze". 3) Damit erweist diese sich als das in sich reflektierte Etwas: sie ist "von dem Etwas nicht unterschieden; diß Nichtseyn ist vielmehr sein Grund, und macht es zu dem, was es ist; sie macht sein Seyn aus, oder sein Seyn geht nicht über sein Andersseyn, über seine Negation hinaus. So ist die Grenze Bestimmtheit" (ebd.). Im dritten Reflexionsschritt also entfaltet sich das Resultat des zweiten Reflexionsschritts A) vom Etwas (P) über das Andere (N) zur Grenze überhaupt als zum Andren an und für sich (NN), und darin B) im Dasein der Begrenzten (PR) und der Grenze, ihrem Nichtsein als Ansichsein (NR), zur Bestimmtheit (NNR = P^). IV. Das Dasein als insichseiende Grenze ist Bestimmtheit überhaupt. Sie ist damit auch schon auf "gedoppelte Weise bestimmt. Sie ist einerseits in sich gekehrte Grenze, andererseits aber auch das Insichseyn, das in das Seyn-für-Anderes übergegangen oder als Grenze ist" A.l) als "insichgekehrte Grenze" an sich oder Bestimmung, 2) als "äusserliches Daseyn des Etwas" oder "sein Andersseyn, aber insofern es an ihm ist", Beschaffenheit (GW 11, 70). 3) "Aber beyde sind wesentlich Momente eines und desselben, oder näher ist die Beschaffenheit eigentlich die in der Bestimmung selbst enthaltene Grenze" (GW 11, 71), und die "Bestimmtheit ist Qualität, reflektirte Bestimmtheit, insofern sie die beyden Seiten, der Bestimmung, und der Beschaffenheit, hat": "Indem also Etwas in seiner Bestimmtheit an ihm selbst sein Nichtseyn ist, oder seine Bestimmtheit eben so sehr sein Anderes, als die seinige ist, so ist hier ein Werden gesetzt, welches Veränderung ist." (GW 11, 72) Darin sind die Momente der Bestimmtheit als solche gesetzt, "welche selbst Einheiten von einander sind, wodurch also die Bestimmung sich im Uebergehen zugleich erhält, und hier nicht ein Verschwinden, sondern nur ein Anderswerden gesetzt ist", und es ist darum auch "die Beschaffenheit als solche, die sich verändert; nicht eine Beschaffenheit" (GW 11, 73) B.l) die sich in ihrem eignen Nichtsein und Übergehen erhaltende Bestimmung als Sollen, 2) die sich als solche verändernde, d. h. zu ihrem Andern, der Bestimmung werdende Beschaffenheit als Schranke. 3) Ihre Einheit als die "reflectirte Bestimmtheit" (GW 11, 76) oder "das gedoppelte Moment der Schranke und des Sollens" (GW 11, 77) ist die gesetzte Negation. Im vierten Reflexionsschritt also entfaltet sich das Resultat des dritten Reflexionsschritts A) von der Bestimmung (P) über die Beschaffenheit (N) zur Qualität und qualitativen Veränderung überhaupt (NN), und darin B) in Sollen (PR) und Schranke oder sich wiederherstellender Negation des Sollens (NR), zur Negation (NNR = P^), die als Negation gesetzt ist, indem sie der konkreten Realität überhaupt (III.) gegenübersteht (GW 11, 75f). Ehe sie aber im Ganzen des Daseins wie in ihrer Beziehung zu Sein und Fürsichsein betrachtet werden kann, ist sie noch in ihrer Selbständigkeit als (fünfter) Reflexionsschritt und darüber hinaus auch der ihr im Kapitel "Das Fürsichseyn" (1.1.3) unmittelbar folgende und sie überhaupt erst als absolute Negation entfaltende sechste Reflexionsschritt zu betrachten. V. Die Schranke als Moment ist "auf das Ansichseyn bezogene Negation" und das Sollen "die Bestimmtheit oder Negation als An-sich-seyn. Sie ist insofern die Negation jener ersten Bestimmtheit, welche als Nichtseyn, als Schranke gesetzt ist. Sie ist somit Negation der Negation, und absolute Negation" (GW 11, 77). Darin sind als im "wahrhaftefn] Reale[n] und Ansichseyn" Sollen und Schranke zu zwei Negationen geworden: "Beyde Negationen, -
-
210
Die
Negation im Dasein
welche sich aufeinander beziehen, machen die Beziehung der Negation auf sich selbst aus, aber sie sind noch andre für einander; sie begrenzen sich gegenseitig" (ebd.) A.l) die ansichseyende Negation und 2) die als Nichtsein gesetzte Negation (offenbar um der gesetzten Negation willen nennt Hegel hier das zweite Moment Negation als Nichtsein, Schranke, Endlichkeit -jeweils zuerst). 3) Indem beide Seiten Negation überhaupt und nichts als Negation sind, ist sogleich auch ihre Einheit, die (qualitative) Unendlichkeit (1.1.2.C) gesetzt, aber da diese hier erst Resultat, noch nicht aus und in sich selbst entwickelt ist, insofern beide Negationen darin "sich noch als andere aufeinander beziehen" (ebd.), bleibt das Dasein darin noch "beschränkt; endlich" (GW 11, 78), wiewohl es anders als die vorigen Momente des Daseins in der erreichten Konkretion nicht nur endlich, sondern "die Endlichkeit" ist (ebd.). Ferner aber ist "die Bestimmung des Endlichen" die Unendlichkeit (GW 11, 79) und B.l) als ansichseiende Negation jenem 2) als der "Negation, als nichtansichseyend" entgegengesetzt: das Endliche ist darum "die erste Negation, oder die welche das Seyn zwar in sich aufgehoben hat, aber es in sich aufbewahrt, nur die unmittelbare Negation. Das Endliche steht daher als das reale Daseyn dem Unendlichen als seiner Negation gegenüber" (ebd.), und ihr Verhältnis ist die "Wechselbestimmung des Endlichen und Unendlichen" (1.1.2.C.2). Jedes ist darin aber näher "an ihm selbst das Gegentheil seiner, und Einheit mit seinem Andern. Ihre Bestimmtheit gegen einander ist also verschwunden" (GW 11, 82), und 3) diese "wahre Unendlichkeif' ist "die Negation als sich auf sich selbst beziehend; das Andersseyn, insofern es nicht unmittelbares Andersseyn, sondern Aufheben des Andersseyns, die wiederhergestellte Gleichheit mit sich ist" (GW 11, 82f). Im fünften Reflexionsschritt also entfaltet sich das Resultat des vierten Reflexionsschritts A) von der ansichseienden (P) über die als Nichtsein gesetzte Negation (N) zur qualitativen Unendlichkeit (NN), und darin B) in Unendlichkeit (PR) und Endlichkeit, die die Endlichkeit ihrer selbst ist (NR), zur wahren Unendlichkeit (NNR= PNN), worin die Bestimmtheit "zum absoluten, schrankenlosen Bestimmtseyn" oder zum Fürsichsein geworden ist (GW 11, 83). VI. Dies Fürsichsein, hier nur noch kurz anzugeben, entfaltet sich A.l) als solches 2) über das Sein-für-Eins 3) zur Idealität, die "der positive und reflectirte, bestimmte Ausdruck" (GW 11, 88) der Unendlichkeit ist; indem die "innern Momente des Fürsichseyns" darin "in der That in Unterschiedslosigkeit zusammengesunken" sind (GW 11, 91), ist sie B.l) das Eins, dessen Negation 2) "das Nichts als aufgehobenes Etwas" oder das Leere ist (GW 11, 92): "so hat das Eins und das Leere, das Nichts zu ihrem gemeinschaftlichen oder vielmehr einfachen Boden" (ebd.), 3) und das Eins, das sich in seiner Beziehung auf das Leere nur auf sich selbst bezieht, ist in dieser Repulsion als dem "Werden zu vielen Eins" (GW 11, 94) zugleich "einfache Gleichheit mit sich selbst" (GW 11, 95). Der siebte Reflexionsschritt, der die Momente A.l) daseiendes Eins, 2) andere oder viele Eins, 3) Attraktion, B.l) Ein Eins, 2) Vielheit und 3) Kontinuität durchläuft, macht insgesamt den "Uebergang zur Quantität" (GW 11, 108) aus. Diese sechs bzw. sieben Reflexionsschritte können nun, in ihrem jeweiligen Resultat genommen, selber wieder als (konkrete) Momente des "einfachen Rythmus" der Methode betrachtet werden, und dann zeigt sich, daß dieser das Werden (A) I. der Positivität (vom Sein zum Dasein), II. der einfachen Negativität (vom Dasein zum Etwas), III. der einfachen Reflexion-in-sich (vom Etwas zur Bestimmtheit), sodann (B) IV. der beziehenden Positivität (von der Bestimmung zur Negation), V. der beziehenden Negativität (von der ansichseienden Nega-
-
211
Claus-Artur Scheier
tion zur wahren Unendlichkeit) und schließlich VI. der selber in sich reflektierten oder absoluten Reflexion-in-sich ist (vom einfachen Fürsichsein zur Repulsion). Mit dem siebten Reflexionsschritt (1.1.3.B.3-C.3) beginnt ein neues Werden und so auch eine neue Gesamtheit von (sechs) Schritten (durch Quantität, Maß und Schein), deren Resultat die Identität sein wird, mit der dann die methodische Mitte der Wissenschaft der Logik erreicht ist. Die gesetzte und in einem eignen Kapitel (1.1.2.B.3.c) behandelte Negation enthält also näher die beiden abstrakten Momente (A.l und A.2) des fünften Reflexionsschritts, der im Ganzen der Reflexionstotalität die konkrete als die beziehende Negation (B.2) darstellt. Wenn Hegel bemerkt: "Der Realität steht die Negation gegenüber. Die Qualität macht die Mitte und den Uebergang zwischen Realität und Negation aus, sie enthält diese beyden in einfacher Einheit" (GW 11, 75), dann versteht er unter Realität offensichtlich nicht die Momente des einfachen Daseins (1.1.2.A.l.-2.b), sondern das Resultat dieses zweiten Reflexionsschritts (1.1.2.A.3), wie es als "reflectirte[s] Dasein" (GW 11, 63) den dritten Schritt oder die Entwicklung des Etwas bestimmen wird; die Qualität als die genannte Mitte kennzeichnet ja in der Tat den vierten Schritt, der den Übergang in die Negation macht. In äußerster Verkürzung läßt sich der einfache Rhythmus dieses ersten Viertels der Wissenschaft der Logik darum so kennzeichnen: A.l. Sein, II. Dasein, III. Realität (Etwas), B.L Qualität, II. Negation (Unendlichkeit), III. Idealität. Das ist eine einleuchtende, in ihren Verhältnissen durchsichtige Progression zunehmender Reflexivität des Seins. Gleichwohl war Hegel mit der Zuordnung der Begriffe zu ihr wie zueinander nicht zufrieden. In der zweiten Ausgabe denkt er sie folgendermaßen: II2. A.l) Das Dasein ist die durch das Werden vermittelte Unmittelbarkeit, und 2) "[d]as Nichtseyn so in das Seyn aufgenommen, daß das concrete Ganze in der Form des Seyns, der Unmittelbarkeit ist, macht die Bestimmtheit als solche aus" (GW 21, 97). 3) Gesetzt als sich auf sich beziehende Negativität oder "für sich isolirt, als seyende Bestimmtheit, ist [sie] die Qualität" (21,98). B. Ihre Momente sind 1) die Realität und 2) die Negation (l2.L2.A.b mit Anm.), deren Einheit 3) "Daseyendes, Etwas" ist (GW 21, 103). III2. A.l) Jedes Etwas ist 2) selber ein Anderes, und 3) "[d]as Andere für sich ist das Andere an ihm selbst, hiemit das Andere seiner selbst, so das Andre des Andern, also das in sich schlechthin Ungleiche, sich negirende, das sich Verändernde" (GW 21, 106). B.l) "Seyn im Etwas ist Ansichseyn" (GW 21, 107). 2) "Eben so ist Nichtseyn als Moment des Etwas in dieser Einheit des Seyns und Nichtseyns, nicht Nichtdaseyn überhaupt, sondern Anderes, und bestimmter nach der Unterscheidung des Seyns von ihm zugleich, Beziehung auf sein Nichtdaseyn, Seyn-für-Anderes" (ebd.). 3) Das Ansich des Etwas aber, "als Negation seines Seyns-für-anderes durch dieses vermittelt", ist wieder "einfach seyende" Bestimmtheit, "somit wieder eine Qualität, die Bestimmung" (GW 21, 110). IV2. A.l) In der Bestimmung ist das "An-ihm-seyn" (ebd.) enthalten, das sich teilt und ihr 2) als "Beschaffenheit" auch gegenübertritt (GW 21, 111). Indem die Beschaffenheit aber zum Ansichsein des Etwas gehört, ändert dieses sich mit ihr, d. h. 3) das "Etwas verhält sich so aus sich selbst zum Andern" in der gemeinsamen Grenze (GW 21, 113). B.l) Das Etwas "ist durch sie das, was es ist, hat in ihr seine Qualität" (GW 21, 114), aber 2) "als das Nichtseyn eines jeden" ist die Grenze auch "das Andre von beyden" (ebd.), so daß 3) "das Etwas, welches nur in seiner Grenze ist, eben sosehr sich von sich selbst trennt und über sich hinaus auf sein Nichtseyn weißt und diß als sein Seyn ausspricht, und so in dasselbe übergeht" -
-
212
Die
Negation im Dasein
(GW 21, 115) ein "Werden an ihm selbst" (GW 21, 116), das die "Endlichkeit" (l2.1.2.B.c) als "die auf die Spitze getriebene qualitative Negation" ist (GW 21, 117). -
V2. "Das Endliche hat sich so als die Beziehung seiner Bestimmung auf seine Grenze bestimmt; jene ist in dieser Beziehung [A.l)] Sollen, diese ist [2)] Schranke" (GW 21, 119). Aber 3) "[d]ie Schranke des Endlichen ist nicht ein Aeusseres, sondern seine eigene Bestim-
mung ist auch seine Schranke; und diese ist sowohl sie selbst als auch Sollen; sie ist das Gemeinschaftliche beyder, oder vielmehr das, worin beyde identisch sind" (GW 21, 120) die "Unendlichkeit" (12.1.2.C). B.l) Unmittelbar aber ist das Unendliche 2) "mit dem Gegensatze gegen das Endliche behaftet, welches, als Anderes, das bestimmte, reale Daseyn zugleich bleibt, obschon es in seinem Ansichseyn, dem Unendlichen, zugleich als aufgehoben gesetzt ist" (GW 21, 126), eine Beziehung, die als "Wechselbestimmung" und "Progreß ins Unendliche" der unaufgelöste Widerspruch ist (GW 21, 129). 3) Aufgelöst ist er als "[d]ie affirmative Unendlichkeit" (l2.1.2.C.c) "die Realität in höherem Sinn" (GW 21, 136), nämlich (VI2, VII2) das "Fürsichseyn" (GW 21, 137). In der zweiten Ausgabe ist der einfache Rhythmus der Methode demnach das Werden (A) des Seins zum Dasein (P), II2. des Daseins zum Etwas (N), III2. des Etwas zur BestimI2. mung (NN), sodann (B) IV2. der Bestimmung zur Endlichkeit (PR), V2. der Endlichkeit zur (wahren) Unendlichkeit (NR) und so VI2. zum einfachen Fürsichsein (NNR P^). Entwickelt sich also in der ersten Ausgabe das Werden (I) durch Dasein (II), Realität (III), Qualität (IV) und gesetzte Negation (V) zum Fürsichsein (VI), dann wird das Fürsichsein in der zweiten Ausgabe durch Qualität, als welche das Dasein jetzt sogleich gesetzt ist (II2), Etwas (III2) als "die erste Negation der Negation" im Verlauf nicht der Momente, sondern der Schritte (GW 21, 103), dessen Bestimmung bzw. Grenze (IV2) und Endlichkeit und Unendlichkeit (V2) erreicht. Realität (II.B.3) und Negation (IV.B.3), die in der ersten Ausgabe zugleich die Bedeutung von Reflexionsschritten haben (III und V), bleiben einfache Momente, überdies als abstrakte Qualitäten (II2.B.l/2), als die sie die Termini Ansichsein und Sein-für-Anderes ersetzen (II.B.1/2); und der Reflexionsschritt der Negation (V) wird mit der Tilgung von ansichseiender und als Nichtsein gesetzter Negation (V.A. 1/2) durch Sollen und Schranke (V2.A.l/2) im ganzen zu einer Entwicklung des Verhältnisses von Endlichkeit und Unendlichkeit.12 Was ist für Hegel damit über die kontextuelle Präzisierung der einzelnen Termini hinaus im ganzen gewonnen? Gemeinsam jedenfalls ist beiden Ausgaben die gegenüber der Phänomenologie des Geistes anders gewählte architektonische Einteilung. Die Phänomenologie des Geistes war in 6x4, die Wissenschaft der Logik ist in 4x6 Reflexionstotalitäten gegliedert, d. h. in der Phänomenologie des Geistes folgen sechsmal die vier Schritte P, N, NN, P^ aufeinander, in der Wissenschaft der Logik viermal die sechs Schritte P, N, NN, PR, NR, NNR=PNN, oder die
-
=
12
Hegel verzichtet in der zweiten Ausgabe aber nicht nur auf die Termini der ansichseienden und der als Nichtsein gesetzten Negation (V.A. 1/2), sondern auch auf die von Anderssein und Anderssein an und für sich (II.A.2/3); an deren Stelle treten die Bestimmtheit von III.B.3 und die Qualität von IV.A.3. Den alten Ort der Bestimmtheit nimmt die Bestimmung (III2.B.3), den der Qualität die Grenze ein (IV2.A3). Die durch Realität und Negation ersetzten Termini Ansichsein und Sein-für-Anderes (II.B.1/2) erscheinen nunmehr in III2.B.l/2, die Grenze und ihre Momente (III.A.3, B.l/2) in IV2.A.3, B.l/2 und Sollen und Schranke (IV.B.1/2) schließlich in V2.A.l/2. 213
Claus-Artur Scheier
"Wissenschaft" ist im Unterschied
den "Gestalt[en] des erscheinenden Geistes" (GW 9, 432) durchgängig triplizitär gegliedert. Die Reflexionstotalitäten vollenden sich also im VI., XII. (2.1.1), XVIII. (3.1.1-3.1.2.A) und XXIV. Schritt (3.3.2/3), so daß der V. Schritt dem XI. (1.3.2/3), XVII. (2.3.3) und XXIII. (3.2.3-3.3.1) parallel ist. Mit andern Worten: der in der ersten Ausgabe als Negation bestimmte Schritt V, der den Übergang ins Fürsichsein macht, entspricht a) dem Übergang des Seins ins Wesen, b) dem Übergang des Wesens in den Begriff und c) dem Übergang des Ideologischen und lebendigen Begriffs in die Idee. Wenn Hegel darum in der zweiten Ausgabe diesen erstmals den Gesamtbau der Wissenschaft der Logik artikulierenden Übergang nicht länger durch eine bloße Reflexionsbestimmung, sondern eigens als das Sich-selbst-Aufheben der Endlichkeit gedacht wissen wollte, dann dürfen wir dies wohl zusammenbringen mit der gleichzeitigen Ausarbeitung der die Logik ergänzenden und erläuternden Vorlesungen über die Beweise vom Daseyn Gottes.13 In diesem Sinn heißt es in der zweiten Ausgabe (GW 21, 125): zu
dem Nahmen des Unendlichen geht dem Gemüth und dem Geiste sein Licht auf. denn er ist darin nicht nur abstract bey sich, sondern erhebt sich zu sich selbst, zum Lichte seines Denkens, seiner Allgemeinheit, seiner Freyheit."
"Bey
13
die Entstehungsgeschichte der zweiten Ausgabe der Logik in GW 11,400-403, und der über die Beweise vom Daseyn Gottes" in GW 18, 398^400.
Vgl.
214
"Vorlesungen
Günter Kruck
Moment und Monade Eine systematische Untersuchung zum Verhältnis von G.W. Leibniz und G.W.F. Hegel am Beispiel des Fürsichseins
Vergegenwärtigt man sich den Sachverhalt, daß der Bezug Hegels auf Leibniz speziell im dritten Kapitel der Lehre vom Sein das unter dem Titel 'Das Fürsichsein' steht rein quantitativ, am Seitenumfang des Kapitels selbst gemessen, eher marginal ist und gleichzeitig im vorliegenden Opus eine Interpretation von Hegels Seinslogik beabsichtigt wird, dann bedarf das hier beabsichtigte Unternehmen einer ausdrücklichen Legitimation. Dieser Legitimationsbedarf steigert sich noch angesichts der Tatsache, daß Hegel in dem bereits erwähnten Kapitel nicht nur auf Leibniz, sondern auch auf andere Autoren der philosophischen Tradition (Kant, Malebranche, Heraklit u. a.) rekurriert, die zudem (z. B. im Falle Kants) rein quantitativ extensiver behandelt werden als eben beispielsweise Leibniz. Die damit in zweifacher Hinsicht spezifizierte quantitative Betrachtungsweise scheint so den größten Einwand gegen eine ausführliche Behandlung von Leibniz in einem als Interpretation zur Logik geplanten Gesamtwerk darzustellen. Zumindest könnte man deshalb den Verdacht hegen, daß eine ausdrückliche Behandlung des Verhältnisses von Leibniz und Hegel zumindest im Kontext dieses Teils der Wissenschaft der Logik ephemer ist. Die Grundthese der vorliegenden Abhandlung ist aber entgegen den angestellten Vermutungen -, daß die Berücksichtigung der Überlegungen von Leibniz einen substantiellen Beitrag für Hegels eigenen Begriff des Fürsichseins liefert und die Auseinandersetzung Hegels mit der Position von Leibniz aufgrund der darzulegenden inhaltlichen Bezogenheit beider Auffassungen deshalb im Kontext der Kategorie des Fürsichseins ihren ausgezeichneten Ort -
-
-
-
besitzt. Zur Verifikation dieser These ist es allerdings in der Vorgehensweise für den Beitrag selbst nötig, daß entsprechend dem Untertitel der Untersuchung die Darstellung der Positionen mit Leibniz beginnt, da die Kritik Hegels an Leibniz' Monadologie eine distinkte Kenntnis ihrer Intention voraussetzt. Erst auf diesem Hintergrund kann dann auch die Hegelsche Kritik verständlich werden, da diese sich an der Vorlage der Monadenlehre messen lassen muß, wenn sie als deren Kritik auftritt. Trifft die Kritik aber tatsächlich die von Leibniz vertretene Position, so resultieren aus ihr notwendigerweise Einsichten, die in einer modifizier-
-
-
Günter Knick
'Monadologie' konserviert werden können, so daß die dargelegte Kritik von Hegel zugleich die Darstellung einer eigenen Position impliziert. Damit hätte die Monadologie von Leibniz aber nicht nur einen Beitrag zur Erläuterung der Hegelschen Position geleistet, wenn sich die Einsichten aus der Kritik zudem als Bestandteil des Begriffs des Fürsichseins ausweisen lassen, es wäre darüber hinaus für die Untersuchung insgesamt belegt, daß die Thematider Leibnizschen im sierung Philosophie Zusammenhang der Kategorie des Fürsichseins ihren Platz hat und mit dieser originär verbunden ist. Daß die rudimentären Äußerungen Hegels zu Leibniz in diesem Teil der Logik als Charakteristik von dessen Auffassung ausgeweitet werden müssen, um als Basis der Hegelten
-
schen Überprüfung angesetzt werden zu können, versteht sich von selbst, da sonst die Hegelsche Kritik ihrer eigenen Grundlage entbehrte. Daß Leibniz zudem selbst zu Worte kommt, scheint umso mehr angebracht zu sein, da Hegels eigene Äußerungen zu Leibniz aufgrund seiner polemischen Attitüde generell stark den Verdacht erregen, mehr eine bloße Karikatur der Position dieses Autors zu sein als eine adäquate Darstellung seiner Gedanken. Leibniz' Äußerungen vor allem im Kontext seiner Monadenlehre dienen damit als Folie, anhand deren Hegels Kritik von Leibniz' Vorstellungen erläutert wird, wodurch Hegels eigener Begriff des Fürsichseins an Kontur gewinnt und sich als zweite Grundthese der Abhandlung zugleich zeigt, daß die Kritik Hegels an Leibniz dessen zentrale Einsichten tatsächlich zumindest in Frage stellt. ' Entsprechend dieser Eingangsüberlegungen werden im vorliegenden Beitrag 1. die -
-
-
-
-
erkenntnistheoretischen Voraussetzungen zur Bestimmung von monadologisch individuellen Substanzen geklärt, 2. die Kritik Hegels an diesem Vorgehen mit den entsprechenden Konsequenzen für eine Entwicklung des Wissens in diesem Zusammenhang dargelegt und 3. die Richtigkeit der vorgetragenen Einwände Hegels abschließend diskutiert werden. 1
Daß die vorgelegte Fragestellung keineswegs bereits ein überholtes Unterfangen ist, zeigt ein Blick in die Sekundärliteratur: Die Stellungnahmen, die sich hier finden, beruhen meistens auf einer ungenügenden Rekonstruktion der erkenntnistheoretischen Voraussetzungen der Leibnizschen Philosophie unter der Rücksicht des zentralen von Hegel in seiner Kritik herausgestellten Dilemmas dieser Position. Beide Autoren werden als Folge dieses Ungenügens in ihren Positionen dann als 'Denker der Substanz' und als 'Denker der Dialektik' nur schematisch gegenübergestellt. Eine wirkliche Verknüpfung der Argumentationen von Leibniz und Hegel gerade unter der hier behandelten Perspektive des Fürsichseins entfällt damit und ist in der hier beabsichtigten Systematik auch noch ein Desiderat. Ob es Hegel tatsächlich wie G. Zingari meint "nicht gelungen ist, das Leibnizsche System in seiner spekulativen Gesamtheit zu begreifen", muß sich erst noch erweisen (G. Zingari, "Die Leibniz-Rezeption im Deutschen Idealismus und bei Hegel", in Beiträge zur Wirkungs- und Rezeptionsgeschichte von Gottfried Wilhelm Leibniz, hg. v. A. Heinkamp, Stuttgart 1986, 267288; Zitat 287). Man vgl. auch J.C. Horn, Monade und Begriff. Der Weg von Leibniz zu Hegel, Wien 1965; bzw. J. Manninen, "Die Leibnizsche Monadologie in Hegels Wissenschaft der Logik", in Leibniz. Tradition und Aktualität, Hannover 1988, 519-524. Auch P. Guyer entwickelt in seinem Beitrag zur Diskussion um das Verhältnis von Hegel und Leibniz die erkenntnistheoretischen Grundlagen der Kritik Hegels an Leibniz nur aus dieser Kritik selbst und nicht in einer immanenten Rekonstruktion der Position von Leibniz. Dies führt dazu, daß die von Hegel im Blick auf Leibniz' Philosophie behaupteten Widersprüche nicht an dieser selbst nachgewiesen werden; zudem ergeben sich daraus Mißdeutungen bezüglich Leibnizscher Vorstellungen, auf die im folgenden an der entsprechenden Stelle der vorliegenden Untersuchung eingegangen wird. Zudem setzt Guyer seine Überlegungen zu Leibniz gerade nicht wie hier intendiert zur Kategorie des Fürsichseins in Beziehung, sondern zu den Kategorien 'Etwas' und 'Anderes'; P. Guyer, "Hegel, Leibniz und der Widerspruch im Endlichen", in Seminar: Dialektik in der Philosophie Hegels, hg. v. R.-P. Horstmann, Frankfurt a.M. 21989, 230-260. -
-
-
-
216
-
-
Moment und Monade
1.
Erkenntnistheoretische Voraussetzungen zur Bestimmung von monadologisch individuellen Substanzen
Versucht man sich den zentralen Gedanken von Leibniz' Monadologie anzunähern, fällt zunächst auf, daß im Zusammenhang des Begriffs der Monade eine Reflexion vorgelegt werden soll, in der darüber Auskunft gegeben wird, wie und unter welchen Bedingungen ein Eins (Monas ein Etwas) als Eins (Monas Etwas) angesprochen werden kann. Daß eine solche Auskunft möglich ist, d. h. daß es möglich ist, nach einer Eins (einem Etwas) zu forschen oder, anders formuliert, die Bestimmung eines Etwas als Eins zu versuchen belegt nach Leibniz ein simpler Gedanke am Beginn seiner Schrift gleichen Titels: Selbst wenn man vom Gegenteil der Eins als Grundlage der Bestimmung von Etwas ausgeht und wir prinzipiell 'Alles' als aus Verschiedenen zusammengesetzt denken, müssen wir auch das Eins als Teil(e) des Zusammengesetzten denken, denn als Zusammengesetztes ist das Zusammengesetzte ein Zusammengesetztes seiner Teile. Wird durch diese Problemstellung der primär erkenntnistheoretische Charakter der genannten Schrift angezeigt, in der gemäß der oben skizzierten Fragestellung die prinzipiellen Möglichkeiten von 'Bestimmungs-Wissen' reflektiert werden sollen, so ist die Identifikation des Begriffs der Monade mit dem der Substanz ebenso am Beginn der erwähnten Schrift ein Indiz dafür, daß über diese erkenntnistheoretische Fragestellung hinaus auch die Frage nach der ontologischen Grundlage der Realität überhaupt für Leibniz im Kontext dieser Schrift thematisch ist.2 Die Verbindung der sowohl erkenntnistheoretischen als auch ontologischen Fragestellung wird von Leibniz in demselben, schon genannten werkspezifischen Zusammenhang durch den Begriff der 'individuellen Substanz' hervorgehoben: Von einer individuellen Substanz zu reden, setzt aber voraus, daß das Attribut 'individuell' die Substanz gerade so bestimmt, daß sie nicht nur als allgemeines (ontologisches) Substrat abgesehen von jeglichen konkreten Realisationen ihrer selbst verstanden wird. Damit steht aber sofort die eingangs gestellte Frage wieder im Vordergrund: Unter welchen erkenntnistheoretischen Bedingungen ist die Substanz tatsächlich als individuelle (und somit als Eins) zu qualifizieren und gegenüber einer Substantialitätsvorstellung auszuzeichnen, in der eine Substanz zwar als Grundlage der Realität behauptet wird, diese Substanz aber so abstrakt und unbestimmt bleibt, daß die Ver-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
Diese Vermutung wird editorisch durch den Sachverhalt unterstützt, daß die vorgetragenen Überlegungen von Leibniz alle in den Kontext der Schriften zur Metaphysik integriert sind. Die grundsätzliche Auseinandersetzung um das Problem des Verhältnisses von Erkenntnistheorie (im Falle Hegels der Logik) und Metaphysik wird in der vorliegenden Untersuchung sowohl hinsichtlich der Position von Leibniz wie derjenigen Hegels ausgespart. Diese Diskussion müßte im Zusammenhang der Auseinandersetzung um das Gesamtsystem des jeweiligen Autors behandelt werden. Eine solche Fragestellung überschreitet aber den Rahmen der hier beabsichtigten Detailrekonstruktion eines ganz bestimmten Problemkontextes. Aus diesem Grund wird im vorliegenden Beitrag darauf verzichtet.
217
Günter Knick
bindung ihrer selbst mit ihren entsprechenden 'individuellen' Instantiierungen einer Eins (Monas) gerade nicht begriffen werden kann?3 Diese Problemstellung behandelt Leibniz vor allem in seinem Briefwechsel mit Arnauld, in dem der Begriff der individuellen Substanz durch den Begriff der individuellen Person sub-
-
stituiert ist, die als Ich identifiziert und somit bestimmt werden soll: "Um zu verstehen, was dieses Ich ist, genügt es nicht, daß ich mir bewußt bin, eine denkende Substanz zu sein, sondern ich müßte außerdem in distinkter Weise begreifen, was mich von allen anderen möglichen Geistern unterscheidet, hiervon aber besitze ich nur eine verworrene Erfahrung."4 Die damit von Leibniz gegebene Auskunft zur Bestimmung einer Eins bzw. einer individuellen Person enthält zwar einerseits offensichtlich ein Kriterium, das die beschriebene Aufgabe erfüllen kann, dieses Kriterium scheint ihn selbst andererseits allerdings gleichzeitig nicht vollständig zufriedenzustellen. Aus diesem Grund muß zunächst (1) dargestellt werden, was denn das von Leibniz selbst im Zitat vorgestellte und favorisierte Prinzip der Erkenntnis einer Eins bzw. einer individuellen Person ist und (2) welchem Dilemma dieses Prinzip anheimfällt, so daß es Leibniz selbst wie die vorgelegte Äußerung zeigt relativiert und in einem anderen erkenntnisleitenden Prinzip seine Zuflucht sucht, oder, was in diesem Falle als Lösung und abgeschwächtere Variante im Vergleich zum Vorhergenannten ebenso denkbar wäre, das (noch detaillierter zu beschreibende) erste Prinzip durch ein zweites zu ergänzen trachtet. (1) Die Vorstellung mittels derer Leibniz u. a. in dem erwähnten Zitat bei der Bestimmung eines Etwas (einer individuellen Person) zum Erfolg kommen will, ist sicherlich mit dem traditionellen Spinozistischen Diktum 'omnis determinado est negatio' treffend beschrieben: Die Bestimmung eines Ich, einer denkenden Substanz, ist grundsätzlich nur möglich, indem dieses Ich, das ich bestimmen will, von 'anderen Geistern' zu unterscheiden ist; d. h. konkret für jeden Bestimmungsversuch, daß ein Ich nur bestimmt werden kann, wenn ein Unterschied zu einem anderen Ich artikulierbar ist, so daß damit rückwirkend eine Zuschreibung für das zu bestimmende Ich benannt wird, die dieses Ich exklusiv charakterisiert und die dem jeweils anderen damit aber gerade abgesprochen werden muß. Durch die Nennung bestimmter Unterschiede (Negationen) erscheint daher ein Ich von einem anderen abgesetzt: Aristoteles und nicht Piaton war der Lehrer von Alexander dem Großen. Durch diese Aussage liegt für Aristoteles im Sinne einer inhaltlich gefüllten Bestimmung eine Auskunft über diese Person vor, nämlich Lehrer Alexanders gewesen zu sein, die Piaton gerade nicht zukommt, so daß diese Bestimmung einen Grund der Unterscheidung beider antiker Philoso-
-
-
-
phen abgibt. 3
4
Die hier intendierte Konzeptualisierung der Leibnizschen Monadologie unter dem Gesichtspunkt einer Erkenntnistheorie bildet u. a. bei H. Poser nur ein untergeordnetes Moment in der Rekonstruktion der Monadenlehre, das zudem kaum thematisiert wird. Seine Betrachtung der Monadologie, die darin kulminiert, diese Lehre als Verschmelzung der Komponenten einer analytischen Urteilstheorie, dem Hervortreten des Entelechiegedankens und der Integration eines cartesianischen Erkenntnisideals zu interpretieren, birgt gerade den Mangel in sich, keine einheitliche Perspektive auf das Werk von Leibniz zu entwickeln und damit die Brüche bzw. Übergänge in dessen Philosophie durch die Zulassung dreier gleichwertiger Konstitutionsmomente zu überspielen. H. Poser, "Monade, Monas; II. Von Leibniz bis Kant", in Historisches Wörterbuch der Philosophie, hg. v. J. Ritter und K. Gründer, Bd. 6, Basel 1984, 117-121. G.W. Leibniz: "Aus dem Briefwechsel zwischen Leibniz und Arnauld", in Hauptschriften zur Grundlegung der Philosophie, Bd. 2, hg. v. A. Buchenau, Hamburg 31966, 197.
218
Moment und Monade
Erst
sind nach der Auffassung von Leibniz die "Begriffe der individuellen Substanzen [...] völlig bestimmt und daher imstande [...] ihr Subjekt in vollständiger Unterscheidung von allen anderen darzustellen".5 Diese Auffassung unterstellt aber zugleich nach Leibniz, daß sie selbst nur funktionieren kann, wenn "es nicht wahr ist, daß zwei Substanzen sich völlig gleich und nur der Zahl nach verschieden sind".6 Wären sich nämlich zwei Substanzen oder individuelle Personen gleich, wäre der Umkreis der Bestimmungen, auf deren Hintergrund ich noch eine begründete Entscheidung treffen könnte, ob es sich um diese oder jene Person bzw. Substanz handelte, identisch, so daß ich keine besondere Qualität der einen oder der anderen Eins zusprechen könnte. Damit wäre aber nicht nur das erkenntnistheoretische Prinzip der Bestimmung qua Negation ausgehebelt, wir stünden prinzipiell in diesem Fall vor der Aporie, keine klare und distinkte Erkenntnis überhaupt mehr vorweisen zu können, da 'die Nacht in der alle Kühe schwarz sind' durch keinen Lichtstrahl durchbrochen werden würde und kein bestimmter Unterschied zur Konturierung eines Einzelnen im Kontrast zu einem bestimmten Anderen (im oben beschriebenen Sinne) beitragen könnte. Setzt damit die Bestimmung einer Eins immer den Unterschied von Anderen und die Nennung eines konkreten Unterschieds zu einem konkreten Anderen voraus, um als definitive Bestimmung einer Person gelten zu können, so verbindet Leibniz in der eingangs zitierten Wendung mit dem soeben vorgelegten Gedanken aber offensichtlich einen Mangel, den er selbst an diesem Gedanken, der zunächst wie soeben gezeigt zumindest jeglichen erkenntnistheoretischen Skeptizismus abwehrt, beheben will: Das Manko, das Leibniz den vorgetragenen Gedanken selbst modifizieren läßt, rührt daher, daß die Bestimmung des Eins im konkreten Vorgehen der Formulierung von Abgrenzungsbedingungen gegenüber (konkreten) Anderen ausgeweitet werden müßte, um nach der Meinung von Leibniz als solche eine wirkliche letztgültige und damit ultimative Definition einer Person zu ermöglichen: Will ich nämlich wie Leibniz in seinen metaphysischen Abhandlungen beispielsweise die Person Alexanders des Großen in einer nicht mehr nur vorläufigen Weise bestimmen, reichte es nicht wie dies nach der oben gezeigten Methode der Fall wäre -, daß ich Alexander u. a. als Feldherrn und Staatsmann identifizierte, denn diese Beschreibung würde auch auf andere Heroen der Geschichte zutreffen; d. h., um die gewünschte definitive Bestimmung Alexanders zu erreichen, müßte man ihn in der Folge unterscheiden von Cäsar, Napoleon, etc., die alle als Staatsmänner und Feldherrn zur abgrenzenden Beschreibung der Person Alexanders herangezogen werden könnten. Wie man aufgrund der Einführung der mit der Liste selbst gegebenen Abgrenzungsmodalitäten Alexanders von anderen Personen feststellt, müßte daher nicht die Anzahl der in der Liste genannten prominenten Namen unendlich vermehrt werden, um Alexander in der genannten Hinsicht gegenüber anderen Großen der Geschichte auszuzeichnen. Es müßten vielmehr weitere Bestimmungen als Qualitäten Alexanders genannt werden, die ihn gerade auch noch in anderen Hinsichten als von den aufgeführten Personen so
-
-
-
-
-
-
-
-
-
der Historie unterschieden ausweisen könnten.
5 6
Ebd., 191. G.W. Leibniz, Metaphysische Abhandlungen, hg.
v. H. Herring, Hamburg 21985, 19, § 9. Den gleichen Gedanken artikuliert Leibniz im gleichen Paragraphen in der "Monadologie" (Vernunftprinzipien der Natur und der Gnade. Monadologie, hg. v. H. Herring, Hamburg 21982, 29, § 9).
219
Günter Knick
Aber selbst eine lexikalisch umfassende Definition, d. h. eine Vermehrung von Bestimmungen als beabsichtigte Ausschöpfung der Möglichkeiten des vorgegebenen Prinzips, die als Unterscheidungsmerkmale Alexanders im Vergleich zu anderen Personen dienen könnten, ließe nach Leibniz immer noch die Frage zu, ob es sich tatsächlich bei der beschriebenen Person um Alexander handelte, d. h., inwiefern der Alexander, der durch den vorliegenden Umkreis von Beschreibungen identifiziert wird, wirklich Alexander der Große ist. Dieser Zweifel kann für Leibniz selbst aber nur ausgemerzt werden, wenn nicht nur die Unterschiede zu allen anderen vergleichbaren Personen in der Historie festgestellt werden, sondern wenn Individuen wie Alexander bzw. Adam, den Leibniz ebenso exemplarisch in diesem Zusammenhang erwähnt, überhaupt von 'allen möglichen Geistern' unterschieden werden können. Denn das für ein Individuum zur Bestimmung ins Feld Geführte gibt "noch keine hinreichende Bestimmung von ihm und es könnte demnach, selbst wenn wir alle diese Merkmale festhalten, immer noch mehrere von einander verschiedene Adams geben, d. h. mehrere Individuen, die alle diese Bedingungen erfüllten."7 Der auf dem Gedanken der 'omnis determinatio est negatio' basierende Bestimmungsvorgang eines Individuums kann nach Leibniz' Überzeugung offensichtlich aber nur dann erfolgreich abgeschlossen werden, d. h., das betreffende Individuum ist nur wirklich identifizierbar, wenn im Versuch der Ermittlung von Abgrenzungsbedingungen über die 'reale' Welt hinausgegangen wird und 'alle möglichen Exklusionskonditionen von 'allen möglichen Anderen im Blick auf dieses Individuum mit bedacht werden. Daraus folgt aber erkenntnistheoretisch für Leibniz, "daß jede individuelle Substanz das gesamte Universum nach ihrer Weise und '
'
gemäß einer bestimmten Beziehung oder sozusagen aus dem Gesichtspunkt, aus dem sie es zum Ausdruck bringt und daß jeder ihrer folgenden Zustände eine wenngleich freie und zufällige Folge ihres vorhergehenden Zustandes ist, wie wenn es nur Gott und sie
betrachtet,
-
in der Welt gäbe."8 Spätestens an diesem Punkt scheint das von Leibniz favorisierte Verfahren, mittels variierender Prädikate die Identifizierbarkeit einer Person zu garantieren, in das bereits angekündigte Dilemma (2) zu geraten, das von ihm selbst allerdings klar gesehen wird: Indem nämlich der Regreß der geforderten Abgrenzungsmöglichkeiten erstens auf der Ebene konkreter (realer) Bestimmungen von Personen schon ins Unendliche zu iterieren droht, da die Hinsichten der Unterscheidungen einer Eins von anderen unendlich vermehrt werden könnten, versucht Leibniz diese Gefahr (zweitens) zunächst dadurch abzuwenden, daß er diese Iteration selbst als Modus der Bestimmung einer Person, d. h. im Rekurs auf die unendliche Vielfalt möglicher Abgrenzungen zur Identifikation eines Individuums, affirmiert: Kann ich ein Etwas von allem Möglichen abgrenzen, habe ich es als Etwas bestimmt. Dieser Quantensprung in die Möglichkeit denkbarer Qualitäten zur Identifikation einer individuellen Substanz hat zur Folge, daß diese individuelle Substanz (die Person) als solche, um bestimmt zu sein, zwar zum Universum der Bestimmungen in Beziehung gesetzt werden muß und das Universum so an ihr als Bestimmung 'sichtbar' und es durch sie 'gekennzeichnet' wird, sie ihrer Bestimmung aber damit gerade verlustig geht; denn die von Leibniz zum Erkenntnisprinzip stilisierte Ausweitung des Grundgedankens der Negation zur Bestimmung eines -
7 8
G.W. Leibniz, "Aus dem Briefwechsel zwischen Leibniz und Arnauld", (Anm. 4), 199f. Ebd., 204.
220
Moment und Monade
Etwas auf dem Hintergrund von 'allem Möglichen' kann erstens dem mit ihm selbst verbundenen unendlichen Regreß nicht entkommen, da die Abgrenzung eines Individuums vom Horizont aller nur denkbaren Möglichkeiten letztlich unmöglich ist, insofern der Katalog an Unterscheidungsmerkmalen auch in diesem Fall nicht abschließend festgelegt werden kann. Zweitens scheint dieser Versuch von Leibniz darüber hinaus in eine Aporie zu geraten, da die geforderte Einlösung der Bestimmung eines Individuums auf dem Hintergrund der Prämisse der Unbestimmtheit des Universums ein uneinholbares Unterfangen ist: Wie soll die Ununterschiedenheit des Horizontes des Universums einen Beitrag zur Bestimmung eines einzelnen Individuums leisten, wo doch der Gedanke der Unbestimmtheit des Universums im Gegenteil gerade Resultat der Abstraktion von einem konkreten Etwas ist, von dem man zwar ausgeht, das man aber im Blick auf das Universum verlassen hat? D. h., die Unbestimmtheit des Universums scheint als Ergebnis eines Interpolationsprozesses, in dessen Rahmen man vom Einzelnen auf das 'Alles' schließt, um zum Einzelnen zurückzukehren, gerade keinen Weg zurück zu weisen, auf dem die Unbestimmtheit des Horizontes in die Bestimmtheit eines Individuums zwangsläufig rücktransferiert werden kann. So steht Leibniz mit dem von ihm initiierten Rettungsversuch zur Restitution eines Bestimmungsverfahrens vor dem Problem, daß keine eigentliche Bestimmung für ein Etwas generiert werden kann: Selbst wenn ich die Unterscheidungsmerkmale Alexanders des Großen dadurch vermehrte, daß ich ihn nicht nur von Cäsar und Napoleon abgrenzte, sondern auch von Zerberus, wäre die Liste der anzugebenden Unterscheidungskriterien immer noch nicht klar umrissen und ich könnte die Person Alexanders nicht für definitiv bestimmt erklären, abgesehen davon, daß ich Alexander ohnehin bei der Suche nach möglichen 'Abgrenzungskandidaten' aus dem Blick verloren hätte und ich mich nur im Rahmen potentieller 'Unterscheidungspersonen' bewegte. Genau dieses Dilemma wird von Leibniz selbst aber sowohl in dem angeführten ersten Zitat aus der Korrespondenz zwischen ihm und Arnauld gesehen, als auch im letzten Zitat aus diesem Briefwechsel zumindest angedeutet: Indem die Erfahrung einer denkenden Substanz über ihre Unterschiede von 'allen möglichen Geistern' im ersten Zitat als 'verworren' apostrophiert wird, hat nach Leibniz diese Substanz offensichtlich keine distinkte Kenntnis bezüglich des eigentlich als Erkenntnisprinzip formulierten Sachverhaltes, d. h. ein Individuum ist gerade nicht in der Lage, die eigentlich geforderte Unterscheidungsleistung seiner von dem es umgebenden Universum aufgrund seiner ihm möglichen Erfahrung zu vollbringen, da diese nicht définit und damit präzise genug ist. Im letzten Zitat scheint Leibniz' eigene Einschätzung der Unzulänglichkeit seines eigenen Gedankens nicht so explizit hervorzutreten wie in der genannten ersten Beurteilung: Offensichtlich ist aber, daß Leibniz hier zwei Gedanken durch die Konjunktion 'und' in einem Satz zusammenbindet, die eigentlich zwei unterschiedliche Gehalte haben: Während im ersten Teil des Satzes die bereits kritisierte Repräsentanz des Universums am Individuum zum Zwecke seiner eigenen Bestimmtheit von Leibniz nochmals artikuliert wird, versucht Leibniz im zweiten Teil des Satzes die kontinuierliche Entwicklung einer Substanz in den Vordergrund zu rücken, die die Bedingung dafür ist, daß eine Substanz als sie selbst zu verschiedenen Zeitpunkten identifiziert werden kann; ließe sich nicht eine gedanklich schlüssige Verbindung von variierenden Zuständen einer Substanz (einer Person) über unterschiedliche temporale Fixpunkte als von der Substanz selbst initiierte freie Entwicklungsstufen herstel-
221
Günter Kruck
man nicht, daß es sich zu diesen Zeitpunkten um ein und dieselbe Substanz handelte. Die für die Substanz und ihre sukzessive Genese von Leibniz in Anspruch genommene Freiheit der zufällig, d. h. willkürlich gedachten Möglichkeit ihrer Selbstentwicklung wird durch diese Überlegung aber erkenntnistheoretisch eingerahmt durch die zwangsläufig zu begreifenden unterschiedlichen Zustände einer Substanz, in denen die Substanz überhaupt erst (re)identifiziert werden kann. Die Unterschiedlichkeit der vorgetragenen Gedanken beweist damit aber, daß Leibniz tatsächlich von dem für ihn als problematisch erkannten und hier dargelegten ersten Grundsatz der Bestimmung eines Etwas abrückt, d. h., Leibniz sucht tatsächlich Zuflucht bei einem modifizierten Erkenntnisprinzip im Kontext des Problems der Identifikation eines Individuums, indem er diesen ersten Grundsatz ergänzt. Inwiefern damit zugleich eine Relativierung dieser erkenntnistheoretischen Prämisse einhergeht, mag dahingestellt bleiben, da eine Entscheidung in dieser Frage für die vorzulegende Untersuchung ohne Belang ist. Der Gedanke der kontinuierlichen Entwicklung einer Person oder Substanz (einer Eins) impliziert in der von Leibniz vorgetragenen Fassung im Blick auf die im Veränderungsprozeß konstatierte Identität einer Substanz als Schlußfolgerung den weiteren Gedanken, daß diese Identität nicht auf äußerlichen Einwirkungen beruhen kann: Würde die Substanz über einen Zeitraum hinweg erst zu dem geformt, was sie eigentlich ist, so könnte die Frage, ob es sich denn tatsächlich um dieselbe Substanz oder Person zum Zeitpunkt ti und zum Zeitpunkt t2 gehandelt habe, nicht eindeutig beantwortet werden, da mögliche Einflüsse die Substanz bis zum Zeitpunkt t2 so signifikant modifiziert haben könnten, daß keine Verknüpfung dieser Substanz mit ihrem Zustand von t[ möglich ist. D. h., wie der Anachronismus schon im Gedanken und damit in der Formulierung von temporal-ephemeren Bedingungen der Entwicklung der Substanz ('erst... geformt') und ihrer eigentlichen Subsistenz ('ist') beweist, können zum einen keine äußerlichen Einwirkungen von der Substanz selbst unterschieden werden, die die Substanz erst zu dem konfigurieren, was sie ist, da diese Vorstellung überhaupt auf Kosten der (Re)Identifikation der Substanz als Substanz geht; und zum anderen setzen Einflüsse, die als äußerlich qualifiziert werden, vor allem bereits einen Begriff von der Substanz voraus, gegen den die Einflüsse als solche abgegrenzt werden können. Wenn sich die Substanz aber wirklich durch diese akzidentellen Einflüsse verändert und trotzdem als sie selbst identifiziert werden kann, dann wäre die Formulierung von Bedingungen und Kriterien für die Modifikation einer Substanz dieser Substanz gerade nicht äußerlich, da sie nur auf diese Substanz zutreffen und gerade für sie wesentlich sind: Es folgt deshalb, daß es keine rein äußerlichen Benennungen gibt, die keinerlei Grundlage im benannten Ding selbst besitzen, so "daß der Begriff des Prädikats im Subjekt enthalten zu sein scheint".9
len, wüßte
9
G.W. Leibniz, "Über die ersten Wahrheiten", in Kleine Schriften zur Metaphysik, hg. v. H.H. Holz, Darmstadt 1965, 181. Die Ablehnung und Kritik der Vorstellung einer äußerlichen Beeinflussung einer Substanz zugunsten ihrer Subsistenz wird von Leibniz in seiner Monadologie durch das bekannte Diktum der Fensterlosigkeit der Monaden illustriert. Die in variierenden Situationen identifizierbaren Monaden sind per se unabhängig von äußeren Einflüssen (fensterlos) und nur durch ihr 'inneres Prinzip' bestimmt, da die entgegengesetzte Annahme, d. h. die Behauptung der reinen Zufälligkeit der Entwicklung eines Individuums gerade den Preis der Nichtidentifikation zu zahlen hätte, der mit der Nichtbestimmbarkeit eines Etwas überhaupt identisch wäre; G.W. Leibniz, "Monadologie" (Anm. 6), 29, § 7: "Die Monaden haben keine Fenster, durch
222
Moment und Monade
Damit stellt Leibniz eindeutig ein gegenüber dem ersten erläuterten erkenntnistheoretischen Grundsatz verändertes Prinzip zur Bestimmung eines Individuums vor: Ein Etwas (ein Individuum) kann nur als es selbst identifiziert werden, wenn in ihm als Subjekt bereits alle seine Prädikate, d. h. seine Bestimmungen von seinem (auch zeitlichen) Beginn an enthalten sind, so daß jede unterschiedliche Bestimmung dieses Subjektes als Aktualisierung des in ihm bereits Vorhandenen zu verstehen ist. Damit gilt aber zugleich für das Verhältnis des entsprechenden Subjekts zu seinen Bestimmungen, daß diese Relation begründet begrifflich bestimmbar sein muß, da im gegenteiligen Fall das behauptete Prinzip grundsätzlich falsifiziert wäre; d. h. umgekehrt, keine Eigenschaft eines Subjektes hat den Charakter einer äußerlichen Bestimmung an diesem Subjekt, die sich rein zufällig an ihm zeigt, sondern diese Eigenschaft ist in ihm wesentlich angelegt: "Da es sich so verhält, können wir sagen, daß das Wesen einer individuellen Substanz beziehungsweise eines vollständigen Seienden darin besteht, daß ihm ein derart vollkommener Begriff eigen ist, der ausreicht, alle Prädikate des Subjekts, dem dieser Begriff zukommt, zu verstehen und aus ihm herzuleiten. Hingegen ist ein Akzidens etwas, dessen Begriff nicht alles das enthält, was man dem Subjekt, dem dieser Begriff beigelegt wird, zuschreiben kann. Daher ist die Eigenschaft 'König', die Alexander dem Großen zukommt, wenn man vom Subjekt absieht, zur Bestimmung eines Individuums nicht ausreichend, und sie enthält weder die anderen Eigenschaften desselben Subjekts noch alles das, was der Begriff des Fürsten um-
faßt."10
Die Prädestination der Bestimmungen eines Subjektes durch dieses selbst ist für Leibniz dem obigen Zitat gemäß aber nur die eine Seite der zu beschreibenden Relation beider Entitäten: Von der Seite des Prädikats bedeutet dies für ein bestimmtes Subjekt, daß keine Bestimmung als die 'eigentliche' Bestimmung klassifiziert und damit gegenüber anderen ausgezeichnet werden kann, so daß rückwirkend für die Seite des Prädikats gilt: Jedes Prädikat hat seine Berechtigung und nicht ein, zwei oder drei Prädikate bringen die Bestimmung des Subjektes wirklich repräsentativ zum Ausdruck, sondern nur die Summe aller Prädikate läßt das Subjekt als begriffenes 'erscheinen'. Wie die Eigenschaft 'König' Alexander den Großen nicht exklusiv charakterisieren kann und andere Eigenschaften damit keineswegs in diesem Prädikat enthalten sind oder durch es vernachlässigbar wären, so ungenügend ist auch das Prädikat 'Fürst' für diese Person, obgleich es möglicherweise ein weiteres Feld von Prädikaten miteinzuschließen scheint, da z. B. die Eigenschaft, Schüler von Aristoteles gewesen zu sein, gerade nicht im Prädikat 'Fürst' enthalten ist. Diese von Leibniz als Erkenntnisprinzip vorgetragene Behauptung impliziert damit, daß die Seite des Subjektes und die Seite des Prädikates verstanden als Umkreis der vollständigen Prädikate dieses Subjektes auf dem Hintergrund dieser Vollständigkeitsrelation nur reziprok als (re)identifiziert gelten können: Wie das Subjekt als Subjekt nur im Konzert seiner Prädikate als bestimmt gelten kann, weil es sie von jeher enthält und nur durch sie identifizierbar ist, so ist eine bestimmte 'Prädikatenkonstellation' nur wirklich als Zusammenordnung von Eigenschaften begriffen, wenn durch sie ein bestimmtes Subjekt aus einer -
-
die etwas in sie herein- oder aus ihnen hinaustreten kann. Die Akzidenzien können sich weder von den Substanzen loslösen noch außerhalb ihrer sich ergehen, wie dies ehemals die species sensibiles der Scholastiker taten." 10 G.W. Leibniz, Metaphysische Abhandlungen (Anm. 6), 19, § 8.
223
Günter Krack
Menge anderer Subjekte herausgegriffen wird. Damit behauptet Leibniz aber keineswegs, daß die Seite des Subjektes und die Seite des Prädikates notwendig die gleiche Extension besitzen müssen; d. h., obwohl das Subjekt alle seine Prädikate bereits enthält, ist damit nicht zugleich impliziert, daß das Subjekt nur in seinen Prädikaten subsistiert. Entsprechendes gilt für die Seite der Prädikate: Wie das Subjekt nicht zwangsläufig nur in seinen Prädikaten präsent ist, so ist aufgrund einer bestimmten Prädikatenkonstellation noch nicht notwendig ein Rückschluß auf ein bestimmtes Subjekt möglich, da dieses Subjekt ja noch weitere Eigenschaften besitzen kann, die als zu diesem Zeitpunkt (noch) nicht (oder nicht mehr) vorhanden auch zu diesem Subjekt gehören. D. h. zusammenfassend: Während Leibniz die konkrete Bestimmtheit eines Individuums aufgrund des Diktums der Inklusion der Prädikate in einem Subjekt festzuhalten sucht, beinhaltet die Behauptung von Leibniz zu diesem Paradigma zugleich, daß die beschriebene Relation von Subjekt und Prädikat keine an sich notwendig reziproke ist, so daß sowohl die Prädikate nicht nur exklusiv einem Subjekt zukommen können und sie damit der Notwendigkeit ihrer Zuordnung enthoben sind, wie das Subjekt selbst als aus dem beschriebenen Verhältnis nochmals exkludiert gedacht werden kann. Durch diese Unterscheidung ist aber auch die erkenntnistheoretische Reichweite des vorgestellten Prinzips stark eingeschränkt, da der von Leibniz zugleich behauptete Ausschluß des Subjektes und der Prädikate aus dem konstatierten Prinzip zur Erkenntnistheorie das Prinzip selbst aushöhlt, insofern keine gedanklich (notwendig-) schlüssige Verbindung beider Entitäten möglich gemacht wird: Man kann zwar nach Leibniz zeigen und in Sätzen ausdrücken, "daß es begründet und daher gewiß war, daß sich dieses [oder jenes für ein Individuum; G.K.] ereignen würde, jedoch nicht, daß es an sich notwendig ist und nicht, daß das Gegenteil einen Widerspruch enthält [...] [so; G.K.] daß es zwar Beweise a priori für ihre Wahrheit [die Wahrheit von Sätzen; G.K.] gibt, die sie zu gewissen Sätzen machen, und welche zeigen, daß die Verknüpfung von Subjekt und Prädikat dieser Sätze ihren Realgrund in beider Natur hat, daß es aber keine Notwendigkeitsbeweise für sie gibt, da ihre Begründung auf nichts anderem als dem Prinzip der Zufälligkeit oder der Existenz der Dinge beruht".1 • 11
Ebd., 31f., § 13; P. Guyer behauptet in seinem Artikel, daß das von Leibniz vorgestellte Prinzip der Erkenntnistheorie, nach dem im Subjekt seine Prädikate enthalten sind, nicht als analytisch zu bezeichnen ist, son-
dern als ontologisches Paradigma zu verstehen wäre. Dieses Prinzip wäre nicht analytisch, da 'Änderungen in dem, was von einem Ding wahr ist, Änderungen des Dinges nach sich ziehen', während das Prinzip der Analytizität nur besage, daß die Begriffe aller Eigenschaften eines Dinges im Begriff des Dinges enthalten sind. Diese Ansicht scheint in zweifacher Hinsicht problematisch: Erstens gibt Guyer diese Interpretation als originär 'Leibnizianisch' aus, obwohl nicht ersichtlich wird, inwiefern Leibniz tatsächlich diese Auffassung vertritt. Zweitens scheint die von Guyer vorgenommene Distinktion zwischen dem von ihm beschriebenen analytischen Prinzip und der ontologischen Wahrheit einer Aussage unverständlich; daß die Wahrheit einer Sache diese Sache selbst tangiert, wenn sie als Wahrheit der Sache auftritt, ist trivial und noch nicht als eigenes Prinzip erklärungsbedürftig. Wie darüber hinaus eine ontologische Wahrheit jenseits ihrer begrifflichen Fixierung, d. h. gerade unter Inanspruchnahme des sogenannten Prinzips der Analytizität, präzisierbar ist, bleibt zudem unklar. D. h., die Interpretation Guyers erscheint nicht nur als unzureichende Darstellung der Position von Leibniz, sie schafft zudem Probleme, die kaum auflösbar sind. Guyer ordnet u. a. Leibniz-Interpreten im gleichen gedanklichen Zusammenhang die Vorstellung der Repräsentation des Universums dem skizzierten Prinzip des im Subjekt implizierten Prädikats zu; weil jede Substanz nur sie selbst ist, wenn sie ihre Eigenschaft(en) enthält, darum sei die Beziehung jeder Substanz zu allen anderen im Universum unter ihre Eigenschaften zu rechnen. Auch diese Interpretation der Philosophie von Leibniz scheint mit Leibniz' Ursprungsgedanken nicht viel gemein zu haben, außerdem erscheint sie in sich ebenfalls problematisch:
224
Moment und Monade
Leibniz behauptet demnach, daß zwar aufgrund des 'in-esse'-Seins des Prädikats im Subjekt Voraussagen über die Entwicklung eines Individuums möglich sind bzw. Erklärungen bestimmter Sachverhalte im Zusammenhang mit einem Subjekt retrospektiv gegeben werden können, daß diese Prognosen bzw. Erläuterungen aber aufgrund der kontingenten Existenz der 'Dinge' keineswegs mit den Ansprach der Notwendigkeit zu versehen sind. D. h., ob tatsächlich die für ein bestimmtes Subjekt gegebene Erklärung bzw. Prognose seines Verhaltens zutrifft, ist letztlich dem Zufall überlassen, respektive vom Willen dieses Subjektes selbst abhängig; "täte jemand das Gegenteil, so täte er damit nichts an sich Unmögliches, obgleich es (ex hypothesi) unmöglich ist, daß solches geschieht."12
2.
Hegels Kritik an Leibniz im Zusammenhang des
Fürsichseins
Soll nun in einem zweiten Schritt der Untersuchung die Hegelsche Kritik an Leibniz rekonstruiert werden, so scheint vor allem primär klärangsbedürftig, auf welches der von Leibniz zur Bestimmung eines Etwas vorgestellten Prinzipien sich Hegels Kritik bezieht: Macht Hegel das von Leibniz selbst als ungenügend empfundene Prinzip von Spinoza zum Grund seiner Kritik, oder entfaltet er seine kritische Stellungnahme zu Leibniz in Konfrontation zum Diktum der Inklusion des Prädikates im Subjekt? Im ersten Fall könnte man sofort zurückfragen, ob denn Hegel den von Leibniz selbst vorgetragenen Einwand nur perpetuiert und ob er damit nicht die von Leibniz selbst entworfene Dualität möglicher erkenntnistheoretischer Zugänge bei der Bestimmung eines Etwas perspektivisch verzerrt und einseitig wahrnimmt, bzw. ob Hegel damit nicht die Position von Leibniz durch die Verkennung seiner Vielfältigkeit noch unterbietet? Im Blick auf die vorliegende Untersuchung wäre methodisch analog, d. h. im Sinne des beschriebenen Perspektivismusvorwurfs zurückzufragen, ob denn die Rekonstruktion der Hegelschen Kritik in der Konzentration auf das Fürsichsein vielleicht nicht dessen Zentraleinwände gegen Leibniz unberücksichtigt läßt, so daß eine adäquate Beurteilung der Hegelschen Position durch den eingeschränkten Fragehorizont unmöglich ist und ein Urteil über die Hegelsche Kritik an Leibniz nur eingeschränkte Gültigkeit beanspruchen könnte. Begibt man sich daher, um dem Verdikt des selektiven Mangels durch die thematische Konzentration auf das Fürsichsein zu entkommen, zunächst textspezifisch auf den allgemeiZum ersten scheint Leibniz den Gedanken der Repräsentation des Universums wie gezeigt gerade nicht an das vorgestellte Paradigma zu knüpfen, sondern als Rettungsversuch des Spinozistischen Diktums zur Bestimmung einzuführen. Im gegenteiligen Fall, d. h. entsprechend der Interpretation Guyers, müßte man Leibniz eine gedankliche Unscharfe unterstellen, da der Sachverhalt der Inklusion der Prädikate in einem Subjekt nicht den Gedanken impliziert, daß damit zugleich die Tatsache ihrer Beziehung zu allen anderen Substanzen ausgedrückt ist. Beide Gedanken haben offensichtlich einen unterschiedlichen Gehalt und sind nicht wie Guyer vorschlägt unmittelbar zu verbinden. Zum zweiten ist dadurch Guyers Annahme, daß die Beziehung einer Substanz zu anderen Substanzen des Universums eine ihrer Eigenschaften ist, gerade nicht begründet und bleibt damit eine unausgewiesene Einsicht. Man vgl. P. Guyer, "Hegel, Leibniz und der Widerspruch im Endlichen" (Anm. 1), 238ff. 12 G.W. Leibniz, Metaphysische Abhandlungen (Am. 6), 31, § 13. -
-
-
-
225
Günter Kruck
Boden der Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, so lautet Hegels Vorwurf gegen Leibniz folgendermaßen: "Aus einem Sandkörnchen könnte das ganze Universum in seiner ganzen Entwicklung begriffen werden [so behauptet Leibniz; G.K.], wenn wir das Sandkörnchen ganz erkennten. Das heißt weiter nicht viel gesagt, so glänzend es aussieht; denn das übrige Universum ist noch etwas mehr und anderes als ein Sandkörnchen, das wir erkennen. Sein Wesen sei das Universum, ist ein leeres Geschwätz [...] So hat oder ist also jede Monade die Vorstellung überhaupt, aber zugleich eine bestimmte, wodurch sie diese Monade ist, Vorstellung nach ihrer besonderen Lage und Umstände. Die Monade ist tätig, vorstellend, perzipiierend [...] [sie; G.K.] erscheint als Ursache, wirkend auf andere Monaden. Dies ist aber nur ein Schein. Dies Andere ist das Wirkliche, insofern die Monade es bestimmt, negativ setzt; sie ist dies Passive an ihr selbst, alle Momente sind in ihr beschlossen. Aber eben darum bedarf es nicht anderer Monaden. Wenn dies Für-ein-Anderes-Sein ein Schein ist, so ist es ebenso dies Fürsichsein, das nur Bedeutung hat in Beziehung auf das Für-ein-Anderes-Sein; es bedarf keiner Gesetze als der Monaden in sich selbst." (HW 20, neren
252f.)
Hegels Äußerung
in den Zusammenhang der dargelegten Bestimmungsoptionen von Leibniz einzuordnen, so fällt zunächst auf, daß das Ungenügen, das Leibniz im Zuge seiner Restitutionsintention des Prinzips der Negation mit diesem Paradigma selbst verbindet, von Hegel seinerseits nicht geteilt wird. Im Gegenteil scheint Hegel den von Leibniz selbst eher als vergeblich eingestuften Versuch zur Rettung dieses Prinzips als mißverständlichen Modus seiner Funktion herausstellen zu wollen und damit als dessen Desavouierung, was gleichzeitig eine positive Einschätzung der erkenntnistheoretischen Valenz dieses Prinzips beinhaltet und damit aber auch eine Kritik an Leibniz impliziert: Das Universum ist zur Bestimmung eines Sandkörnchens deshalb untauglich, weil zur Erkenntnis eines Objektes immer konkrete benennbare Unterscheidungen von konkreten anderen Dingen verlangt sind und ein Versuch im Sinne von Leibniz nur allgemeinste und abstrakteste Kennzeichnungen eines Objektes sogar ein Sandkörnchen sieht in dieser Optik glänzend aus liefern kann, da der Bezug des Gegenstandes auf 'Alles' zu keinen konkreten Aussagen für den Gegenstand selbst führen kann, von dem gerade mit Blick auf das Universum abgesehen wird. Damit scheint Hegel selbst allerdings grundsätzlich festhalten zu wollen, daß die Bestimmtheit eines Dinges ausschließlich durch die Beziehung dieses Gegenstandes zu Anderem, durch die Benennung von Unterschieden zu erschließen ist. Dem durch Leibniz vorgetragenen Vorwurf der unendlichen Iteration verschiedenster Relationierungen eines Gegenstandes auf Anderes in der 'realen' oder der 'möglichen' der Welt scheint Hegel auf dieser Stufe der Argumentation zu entgegnen, daß ohne die Auflistung von Unterschieden zu einem konkreten Anderen überhaupt keine Bestimmung eines Gegenstandes zu erreichen ist. Indem das Bestimmen eines Gegenstandes aber nur mit Blick auf die Unterschiede zu einem anderen Gegenstand möglich ist, heißt dies zugleich, daß damit durch die Unterschiede das Unterschiedene selbst als bestimmt gelten kann. Wenn Unterschiede als Unterschiede zwischen zwei Gegenständen benannt werden, heißt dies zunächst für den zu bestimmenden Gegenstand (A), daß eine genannte Aussage genau dann als Unterscheidung fungiert, wenn sie diesem Gegenstand auch wirklich als solchem zukommt. Für den vom zu bestimmenden Gegenstand unterschiedenen Gegenstand (B) heißt dies aber, daß die vorgestellte 'Unterscheidung' des A
Versucht
man nun
-
226
-
Moment und Monade
B als Feststellung des Unterschiedenen A zugleich eine inhaltliche Aussage über B selbst ist, der als unterschiedener Gegenstand für das Profil des zu bestimmenden Gegenstandes konstitutiv ist. Insofern die Bestimmtheit eines Dinges aus der Bezugnahme auf anderes und der mit ihr gegebenen Konstatierung von Unterschieden zwischen zwei Dingen resultiert (1), so ist mit dieser Angabe von Unterschieden zugleich die Aussage verbunden, was die in ein solches Verhältnis gesetzten Gegenstände selbst sind, d. h., was die Dinge sind, von denen in verschiedenen Unterscheidungen die Rede ist (2). Damit wird der Mangel, den Leibniz im Blick auf das beschriebene Verfahren konstatiert, für Hegel zum Grund der Kritik an Leibniz: Wenn die Bestimmung eines Gegenstandes durch das Feststellen von Unterschieden ('Zuschreibungen') im Blick auf einen Gegenstand grundsätzlich für möglich erachtet wird, d. h., der vorgestellten Auffassung trotz eines mit dem Bestimmen zwangsläufig verbundenen Regresses von Abgrenzungen zugestimmt wird und Bestimmtheit grundsätzlich damit auf diese Weise generiert werden kann, dann ist die Extrapolation auf das 'Alles' des Universums nur der Ausdruck der ungenügenden Einsicht bezüglich des vorgestellten Prinzip selbst. Nimmt man nämlich nach Hegel das Prinzip in seiner erkenntnistheoretischen Leistungsfähigkeit ernst, dann ist mit der Konstatierung von Unterschieden zugleich der Gegenstand und das von ihm Unterschiedene als bestimmt zu denken. Nach Hegel geht gerade diese Einsicht in das Bedingungsverhältnis zweier Gegenstände im Zuge des Versuchs ihrer Bestimmung verloren, wenn Leibniz meint, auf ein unbestimmtes 'Alles' in diesem Zusammenhang ausgreifen zu müssen; denn für beide Gegenstände ist die Bezugnahme auf den jeweils anderen Gegenstand nicht ephemer; ihre Bestimmtheit im Sinne ihrer Identität, die Beschreibung dessen, was sie sind, kann nur mittels der skizzierten Relation zum Ausdruck gebracht werden; obwohl beide Gegenstände ihr Bestehen nicht in der angedeuteten Relation haben, ist ihre Bestimmtheit nur nach dem dargelegten Modell zu erheben wie Hegel am 'Negativ-Beispiel' des Sandkörnchens in der bereits zitierten Passage aus der Geschichte der Philosophie darlegt. Bringt die Auflösung dieses Zusammenhangs Leibniz dazu, diese Relation als Relation abzulehnen, so hält Hegel daran fest, daß das Verfahren, durch das ein Gegenstand bestimmt werden soll, zur Formulierung der Bestimmtheit von 'Etwas' überhaupt unumgänglich ist. Leibniz' Auffassung vom Scheitern dieses Verfahrens ist aber nur die Kehrseite seines Beharrens auf der Tatsache, daß ein Gegenstand im voraus zur Benennung der Unterschiede von anderen Gegenständen so vielfältig bestimmt ist und das vorgeschlagene Procederé gerade diesem Sachverhalt nicht gerecht wird: Indem Leibniz prinzipiell davon ausgeht, die Bestimmtheit eines Gegenstandes nicht auf dem beschriebenen Weg sichern zu können, heißt dies für den Gegenstand nicht, daß er 'an sich' nicht bestimmt ist. Im Gegenteil: Leibniz ist eben offensichtlich der Auffassung, daß die vorgestellte 'Methode' nur nicht die adäquate ist, um den der Relation vorausgesetzten und bestimmten Gegenstand zu begreifen; d. h. aber für den vom zu bestimmenden Gegenstand unterschiedenen, daß er von Leibniz in diesem Verhältnis selbst als scheinhaft und damit bedeutungslos zur Bestimmung des vorgestellten Dinges ausgegeben wird. Diese Auffassung gerät aber nach Hegel in das im angeführten Zitat beschriebene Dilemma, daß nämlich die Behauptung der Bedeutungslosigkeit des von ihm sogenannten Für-ein-Anderes-Sein dieses selbst impliziert: Die Betonung der Unabhängigkeit eines Gegenstandes von einem anderen im Rahmen der Bestimmung wird gerade durch die Behauptung als Behauptung konterkariert; d. h., diese Behauptung führt sich deshalb selbst von
-
227
Günter Knick
ad absurdum, weil der Versuch des Ausschlusses der Bezugnahme auf Anderes in der Behauptung das Andere nur so ausschließen kann, daß es als konstitutives Moment in der Bestimmung des betreffenden Gegenstandes selbst erscheint. Indem damit das Für-ein-Anderes-Sein aber zur Identität, zur Bestimmung eines Gegenstandes hinzugehört, ist für Hegel klar, daß Bestimmen als Bestimmen für das zu Bestimmende bedeutet, daß das, wodurch es von anderen unterschieden ist, es selbst ist. Durch diese Darstellung der Position Hegels hat sich aber für die Zuordnung seiner Kritik zu den erkenntnistheoretischen Voraussetzungen von Leibniz bzw. für den in der vorliegenden Untersuchung eigentlich angezielten Bezug zur Kategorie des Fürsichseins folgendes
ergeben: Hegel bezieht sich damit in seiner Kritik sowohl auf das von Leibniz modifizierte Diktum Spinozas wie auf das Paradigma der Inklusion des Prädikates im Subjekt; indem nämlich durch die Angabe von Unterschieden der Gegenstand selbst benannt ist und jeder Versuch des Ausschlusses der Beziehung auf Anderes diese Beziehung selbst bei der Bestimmung eines Gegenstandes funktional impliziert, kann weder ein Verfahren Erfolg in der Bestimmungsfrage versprechen, das diesen Sachverhalt willkürlich abbricht und dadurch die eigentlich gewonnene Einsicht unterbietet, noch kann das Problem der Bestimmung dadurch gelöst werden, daß man diese Tatsache grundsätzlich ignoriert und somit überhaupt zu keiner definitiven Bestimmung eines Gegenstandes in der Lage ist; die behauptete Inklusion der Prädikate im Subjekt entbehrt ja gerade einer notwendigen Kontur, durch die ein Gegenstand selbst als bestimmt gelten könnte, da sich aus der Behauptung der Identität von Subjekt und Prädikat selbst aufgrund der Exklusion des Moments des Unterschieds kein Inhalt entwickeln läßt und somit keine distinkte Bestimmung eines Subjektes vorgelegt werden kann. Das Subjekt ist und bleibt gemäß diesem Paradigma als bestimmtes vorausgesetzt, ohne daß ein Modus der Explikation seiner Bestimmtheit durch ein konkretes Prädikat zur Verfügung steht. Der Satz selbst ist nur die Wiederholung dieser Voraussetzung sowohl im Blick auf das Subjekt wie im Blick auf das Prädikat als extensional gleiche Größen, ohne daß allerdings eine konkrete Bestimmtheit für ein Subjekt aus diesem Satz zu erheben wäre. Hat sich damit herausgestellt, daß Hegel keineswegs eine perspektivische Verzerrung der Leibnizschen Position seiner eigenen Kritik voraussetzt, so bleibt noch für den vorliegenden Beitrag das Problem der bis dato unbegründeten Konzentration auf die Kategorie des Fürsichseins: Selbst wenn Hegel und die Untersuchung selbst aufgrund der Integration der Überlegungen aus der Hegelschen Geschichte der Philosophie dem Perspektivismusvorwurf zunächst zu entkommen scheinen, ist für die letztgenannte die Verbindung der bisherigen Überlegungen mit dem Fürsichsein nicht geleistet bzw. muß die im Vorfeld genannte Grundthese als noch nicht verifiziert gelten. Den entscheidenden Hinweis zur Lösung dieses Problems hat Hegel selbst allerdings in dem bereits angeführten Zitat aus der Geschichtsphilosophie gegeben: Das Fürsichsein firmiert in diesem Zusammenhang nämlich als Titel für den Sachverhalt, daß im Kontext des dargelegten Bestimmungsproblemes im Blick auf einen Gegenstand die definitive Bestimmung dieses Etwas, sein Fürsichsein, nur dadurch zu generieren ist, indem das 'Andere' so von dem 'Etwas' 'negativ gesetzt', d. h. durch den Modus der Negation (des Unterschieds) derart von ihm unterschieden ist, daß dieses Etwas als Etwas gerade dadurch erst sein Fürsichsein gewinnt, es selbst ist. Die Wahrheit des Fürsichseins ist damit ohne die Berücksichtigung des Für-ein-Anderes-Sein gar nicht auszusagen, bzw. dieses Für-
-
-
-
228
Moment und Monade
sichsein hat nur 'die Bedeutung des Für-ein-Anderes-Sein', d. h., die Unterschiede als 'negative Setzungen' des Etwas machen das Etwas selbst aus, so daß das Fürsichsein das Für-einAnderes-Sein als seine eigene Bestimmung und Moment enthält. Damit koinzidieren aber die vorliegenden Untersuchungen zu Hegels Leibniz-Kritik mit dem Begriff des Fürsichseins, wie ihn Hegel in der Logik selbst einführt: "Das Andere [des Fürsichseins; G.K.] ist in ihm nur als ein Aufgehobenes, als sein Moment; das Fürsichsein besteht darin, über die Schranke, über sein Anderes so hinausgegangen zu sein, daß es als diese Negation die unendliche Rückkehr in sich ist." (HW 5, 175.) Indem das Fürsichsein der Begriff für die Einsicht ist, daß das Problem der konkreten Bestimmung eines Gegenstandes nur so gelöst werden kann, daß durch die Unterscheidung von Anderem er selbst als bestimmt gelten kann und so der Unterschied das konstitutive Element für die 'unendliche Rückkehr eines Gegenstandes zu sich' aus diversen Abgrenzungsverhältnissen gegenüber verschiedensten anderen ist, ist das Andere Moment des zu bestimmenden Gegenstandes selbst. Das Defizit der Leibnizschen Position ist es dann aber nach Hegel gerade, daß Leibniz, obwohl er grundsätzlich diesem Gedanken zustimmt, zugleich behauptet, daß dieses Verfahren zur prinzipiellen Ermittlung der Bestimmtheit eines Gegenstandes untauglich ist, der damit aber als ohne daß bestimmter Leibniz selbst einen Gegenstand vorausgesetzt wird, Modus bereithielte, diese Bestimmtheit als Bestimmtheit des Gegenstandes erheben zu können. Die Gegenüberstellung der Positionen von Leibniz und Hegel zeigt aber deutlich, daß die Hegeische Leibniz-Kritik nicht nur für das Verständnis des Begriffs des Fürsichseins von eminenter Bedeutung ist, sondern auch, daß die Kritik an Leibniz im Kontext dieser Kategorie ihren ausgezeichneten Ort hat: Indem Hegel die Leibnizschen Voraussetzungen zur Erkenntnis eines bestimmten Gegenstandes kritisiert, resultiert daraus eine grundsätzliche Einsicht bezüglich der Erkenntnis von Gegenständen überhaupt, die in der Kategorie des Fürsichseins in der Logik kanonisiert ist. Damit bilden aber entsprechend der für die Untersuchung vorgestellten Grundthese die Vorstellungen von Leibniz in diesem Zusammenhang tatsächlich die Basis und die Folie für das Verständnis der genannten Kategorie, da aus Hegels Kritik an Leibniz sich gerade die oben des Fürsichseins im beschriebenen Sinne Bestimmung generiert; sind damit die Vorstellungen von Leibniz von entscheidender Qualität für das Verständnis der Äußerungen Hegels selbst, so ist für den vorliegenden Beitrag selbst deutlich, daß die Thematisierung der Position von Leibniz gerade gemäß dem skizzierten Zusammenhang an die Kategorie des Fürsichseins gebunden ist, die dadurch selbst inhaltlich illustriert wird. Erst durch die Berücksichtigung dieses Sachverhaltes wird auch die Stellungnahme Hegels verständlich, die er selbst im Kapitel des Fürsichseins in der Wissenschaft der Logik zu Leibniz abgibt: "Der Leibnizische Idealismus liegt mehr innerhalb der Grenze des abstrakten Begriffs. Das Leibnizische vorstellende Wesen, die Monade, ist wesentlich Ideelles. Das Vorstellen ist ein Fürsichsein, in welchem die Bestimmtheiten nicht Grenzen und damit nicht ein Dasein, sondern nur Momente sind [...] Es ist in diesem Systeme also das Anderssein aufgehoben; Geist und Körper oder die Monaden überhaupt sind nicht Andere füreinander, sie begrenzen sich nicht, haben keine Entwicklung aufeinander; es fallen überhaupt alle Verhältnisse weg, -
-
-
-
-
229
Günter Kruck
welche ein Dasein zum Grunde liegt [...] Daß es mehrere Monaden gibt, daß sie damit auch als Andere bestimmt werden, geht die Monaden selbst nichts an; es ist dies die außer ihnen fallende Reflexion eines Dritten; sie sind nicht an ihnen selbst Andere gegeneinander, das Fürsichsein ist rein ohne das Daneben eines Daseins gehalten." (HW 5, 179f.) Diese Einschätzung des Leibnizschen Systems durch Hegel scheint zunächst irritierend: Die Charakteristik der Position von Leibniz als Idealismus und die Kennzeichnung der Monade als ideeller lassen auf eine positive Beurteilung der Vorstellungen von Leibniz schließen, die auf dem Hintergrund der bisher dargelegten Kritik unverständlich ist; inwiefern die Monade als ideelles Moment vorgestellt wird und das System von Leibniz damit als Idealismus klassifiziert werden kann, ist erklärungsbedürftig. Die Idealität der Monade besteht offensichtlich darin, daß sie als Monade ihre Bestimmtheit in sich als Moment enthält und diese Bestimmtheit ihr nicht durch eine äußere Reflexion erst 'beigebracht' oder 'attestiert' werden müßte. Setzte diese Auffassung für Hegel selbst den Bezug auf Anderes voraus, indem das Fürsichsein das Ergebnis der Reflexion ist, daß mit den Unterschieden das Unterschiedene bestimmt ist, so basiert für Leibniz diese Annahme auf der Tatsache, daß eine Monade immer schon und im voraus zur Reflexion als bestimmt gedacht werden muß, d. h., auf der erkenntnistheoretischen Prämisse, daß ein Subjekt seine Prädikate enthält und jede Entfaltung dieses Sachverhaltes (durch konkrete benennbare Unterschiede) ihn selbst voraussetzt. Leibniz hält damit als Einsicht für das Bestimmen überhaupt fest, daß das konkret 'Andere' der Monade kein eigenes Dasein, d. h., keine konstitutive Bedeutung für die Monade hat das 'Andere' in ihr 'aufgehoben' ist -, da die Monade ihre Bestimmtheit per se hat. Ist dies für Hegel das Ergebnis der Reflexion, in der über die Feststellung 'daseiender' Unterschiede die Einsicht gewonnen wird, daß das Etwas mit seinen Unterschieden identisch ist was Hegel im Begriff des Fürsichseins kanonisiert -, so fixiert Leibniz die Bestimmtheit der Monade als abstrakte: Die Monade soll ihre Bestimmtheit in Absehung von und im Vorfeld zu der Erörterung 'daseiender' Unterschiede haben, d. h. gerade abgesehen von der und ohne die Berücksichtigung konkreter Unterschiede. Durch diese Vernachlässigung konkreter Unterschiede erweist sich aber nicht nur die Leibnizsche Vorstellung eines 'monadologischen Etwas' als abstrakt, Leibniz kann darüber hinaus bedingt durch diese Abstraktion gerade die Bezogenheit der Monaden untereinander nicht erklären, da die Bestimmtheit eines einzelnen 'Etwas' im voraus zu seiner Bezugnahme auf Anderes von Leibniz festgehalten wird, so daß aus dieser Tatsache notwendig ein abstraktes System unzusammenhängender Vielheiten (Monaden) resultiert, die -jede für sich als durchgängig bestimmt angenommen werden, ohne daß diese Bestimmtheit selbst definitiv zu erheben wäre: "Es ist ein künstliches System, das auf den Verstandeskategorien des Absolutseins der Vielheit, der abstrakten Einzelheit begründet ist." (HW 20, 255.) Das Problem, das damit allerdings keineswegs geklärt ist, ist das der begrifflichen Kennzeichnung des Leibnizschen Systems in der zitierten Passage aus dem Kapitel des Fürsichseins der Wissenschaft der Logik: Warum firmiert die von Hegel so grundsätzlich kritisierte Position von Leibniz für den Kritiker selbst noch unter dem Begriff des Idealismus? Hat doch die Leibnizsche Auffassung, die Monaden als ideelle zu betrachten, nach Hegel gerade den Mangel, daß die Monaden selbst nur Produkte und Konstrukte eines von der ('daseienden') Wirklichkeit absehenden Denkens sind, deren Zusammenhang gerade nicht durch sie selbst einsichtig gemacht werden kann, obwohl sie doch nach dem Willen von Leibniz als be-
-
-
-
-
230
Moment und Monade
stimmte auch eine Auskunft über ihr Verhältnis zu anderen geben können müßten. Wenn aber eine Auskunft über die Relation der Monaden untereinander nur 'durch einen Dritten' möglich ist, mangelt es den Monaden doch gerade an ideeller Bestimmtheit, obgleich sie Leibniz doch für durchgängig (selbst)bestimmt ausgegeben hat, so daß eine entsprechende positive Qualifikation der Position von Leibniz durch Hegel als unbegründet erscheint. Eine entsprechende Charakteristik des Idealismus im Zusammenhang der Hegelschen Begriffslehre und konkret aus seinem Zusatz zum ersten Paragraphen zu dieser dritten Abteilung der Logik innerhalb der Enzyklopädie kann hier weiterhelfen, da man zumal in diesem Kontext von einem für Hegel selbst authentischen Begriff des Idealismus (trotz der vorhandenen editorisch-inhaltlichen Problematik) ausgehen kann, der nicht durch eine polemische Attitüde und Kritik gebrochen ist: "Der Standpunkt des Begriffs ist überhaupt der des absoluten Idealismus, und die Philosophie ist begreifendes Erkennen, insofern, als in ihr alles, was dem sonstigen Bewußtsein als ein Seiendes und in seiner Unmittelbarkeit Selbständiges gilt, bloß als ein ideelles Moment gewußt wird." (Enz. § 160, Zusatz; HW 8, 307). Einer Philosophie kann nach Hegel damit das Prädikat des 'Idealismus' verliehen werden, wenn das Erkennen über die Wahrnehmung der Unmittelbarkeit der sich darbietenden Wirklichkeit so hinausgeht, daß diese daseiende und vielfältige Wirklichkeit als Materialobjekt 'begriffen' wird, d. h., daß die unmittelbar erscheinenden Phänomene in der Realität in einen allgemeinen erkenntnistheoretischen Zusammenhang gestellt werden können, in dem allerdings gerade nicht von der Daseinsverfasssung einzelner Erscheinungen abstrahiert wird. Durch diese gedankliche Operation gehen die konkreten Erscheinungen ihrer Unmittelbarkeit verlustig, indem sie als Zusammenhängende im begrifflich Allgemeinen als vermittelt und damit als ideelle bedacht werden. Entsprechend kommentiert Hegel den Begriff des Idealismus in der Wissenschaft der Logik im unmittelbaren Vorfeld zur Kategorie des Fürsichseins in der Anmerkung 2 zur Unendlichkeit, indem er es als dessen Kennzeichen ansieht, daß "das Endliche nicht als ein wahrhaft Seiendes anzuerkennen" ist, sondern im Idealismus nach dem das Endliche verbindenden Allgemeinen gefahndet wird. (HW 5, 172.) Die Philosophie von Leibniz ist aber dann gerade deshalb mit dem Etikett Idealismus zu versehen, weil in ihr die Monaden als das die daseiende Realität bestimmende Allgemeine angesehen werden. Der nach Hegels Einschätzung vorhandene Mangel der Leibnizschen Position im Blick auf die Monaden beinhaltet allerdings auch eine Kritik von Seiten Hegels, die bei der Qualifikation dieser Philosophie als Idealismus impliziert ist: Wie nämlich die Monaden ihren Status als allgemeine bei Leibniz dadurch erhalten, daß gerade die konkrete Realität unberücksichtigt bleibt und die Monaden als Monaden in ihrer Bestimmtheit als der Wirklichkeit gegenüber abstrakte vorausgesetzt werden, d. h. ihre Allgemeinheit nicht die Allgemeinheit der konkreten daseienden Einzelheit ist, so ist der Leibnizsche Idealismus als Idealismus insgesamt das Resultat der Abstraktion, die sich eben in seinem Zentrum der Monadologie findet, so daß das Attribut des Idealismus dieser Position nur unter Vorbehalt und der Berücksichtigung der entsprechenden kritischen Hegelschen Vorzeichen zukommen kann. -
-
-
-
231
Günter Knick
3.
Hegels Kritik an Leibniz: Ressentiment oder systematische Reformulierung
Versucht man ein Resümee der bisherigen
Erläuterungen zur Leibnizschen Position und der entsprechenden Hegelschen Kritik unter der Leitfrage des Bestimmungswissens als Ausgangspunkt der vorgelegten Überlegungen zu ziehen, dann scheint die Intention von Leibniz, Bestimmungswissen für ein Etwas zu generieren, schon allein in sich durch die dargelegte Zwiefältigkeit seines Ansatzes ein problematisches Unterfangen: Die von Leibniz selbst ge-
forderte 'klare und distinkte' Auskunft über ein Etwas als Etwas, d. h. als ein So-und-so-Bestimmtes, ist nämlich auf keinem der von ihm eingeschlagenen Wege zur Bestimmung einer 'Monas' zu erhalten. Indem Leibniz das Prinzip der Negation zur Bestimmung eines Etwas für unzureichend erklärt und zugleich die Behauptung des Enthaltenseins der Prädikate in einem Subjekt das Subjekt selbst als bestimmtes voraussetzt, ohne einen Modus der definitiven Explikation dieser Bestimmtheit vorzulegen, steht er vor dem Problem, keine Bestimmung für ein Etwas als dessen Bestimmung ausweisen zu können. Diesem vorläufigen kritischen Resultat würde Leibniz selbst im Blick auf seine Theorie der Monaden vehement widersprechen, da diese seiner Auffassung nach "irgendwelche eigentümlichen Beschaffenheiten haben, andernfalls sie [tatsächlich entsprechend der vorgetragenen Kritik -; G.K.] gar keine Wesen sein würden. Denn wenn sich die einfachen Substanzen nicht durch ihre eigentümlichen Beschaffenheiten unterscheiden, so gäbe es überhaupt kein Mittel, irgendeine Veränderung in den Dingen festzustellen";13 diese Beschaffenheiten, die als Bestimmungen der Monaden für Leibniz die Möglichkeit eröffnen, Veränderungen in den Monaden zu konstatieren, d. h. Modifikationen ihrer Bestimmtheit von einer (zum Zeitpunkt t,) zur anderen (zum Zeitpunkt t2) zu beobachten, sind gemäß der Auffassung von Leibniz 'Besonderheiten' der monadologischen 'Allgemeinheiten'. Die Monaden sind dabei ihrerseits als (ontologische) Grundlage die einfachen Einheiten, die die Besonderungen der Vielheiten ihrer Beschaffenheiten in sich enthalten. "Der vorübergehende Zustand, der eine Vielheit [von Beschaffenheiten in; G.K.] der Einheit oder der einfachen Substanz einbegreift und repräsentiert, ist nichts anderes als das, was man Perzeption nennt. Diese muß [...] von der Apperzeption oder dem Bewußtsein unterschieden werden. Gerade hier haben die Cartesianer einen großen Fehler gemacht, insofern sie diejenigen Perzeptionen, deren man sich nicht bewußt wird, für nichts gehalten haben."14 Dient die Unterscheidung zwischen 'perzipierenden' und 'apperzipierenden' Monaden dazu, eine Hierarchie dieser einfachen Einheiten zu konstruieren, so ist diese Ordnung im Blick auf die Beschaffenheiten der Monaden dadurch begründet, daß Leibniz den Ausdruck der Perzeption für die allgemeinsten Bestimmtheiten im Sinne von Vorstellungen verwendet, die ihren Kulminationspunkt im apperzeptiven (reflektierten) Bewußtsein dieser Perzeptionen haben. Diese Auf- bzw. Abstufung von Perzeptionen und Apperzeption und damit die Systematik im Reich der Monaden erklärt allerdings nicht, wie es zu diesem Sachverhalt der Beschaffenheiten der Monaden überhaupt kommt bzw. wie die verschiedenen Monaden zu unterschei-
-
-
13 G.W. Leibniz, 14 Ebd., 31, § 14.
232
"Monadologie" (Anm. 6). 29, §
8.
Moment und Monade
den sind. Selbst wenn man mit Leibniz ein 'inneres Streben' der Monaden als internes Prinzip der Veränderung oder des Übergangs von einer Perzeption zur anderen annimmt, so ist mit diesem Streben keineswegs ein bestimmter Inhalt im Sinne einer Beschaffenheit gegeben, geschweige denn hergeleitet und damit schon gar nicht als bestimmter Gehalt einer bestimmten Monade begründet. Leibniz erkennt diese Problematik selbst, wenn er die Monade mit einer Maschine vergleicht: "Denkt man sich etwa eine Maschine, die so beschaffen wäre, daß sie denken, empfinden und perzipieren könnte, so kann man sie sich derart proportional vergrößert vorstellen, daß man in sie wie in eine Mühle eintreten könnte. Dies vorausgesetzt, wird man bei der Besichtigung ihres Inneren nichts weiter als einzelne Teile finden, die einander stoßen, niemals aber etwas, woraus eine Perzeption zu erklären wäre. Also muß man diese in der einfachen Substanz suchen und nicht im Zusammengesetzten oder in der
Maschine."15
Durch diese Beschreibung der Relation der Beschaffenheiten als Bestimmtheiten und der Monaden als einfacher substantieller Einheiten scheint der Mangel der nicht begründbaren Auskunft über die Qualitäten einer bestimmten Monade in einen desaströsen Widerspruch zu münden: Einerseits attestiert Leibniz den Monaden das 'Haben' von Beschaffenheiten von bestimmten (besonderen) Qualitäten -, illustriert aber durch das Beispiel der Mühle, daß diese Beschaffenheiten selbst als nur untereinander unzusammenhängende Vielheiten verstanden werden können, die zudem nur als behauptete Bestimmtheiten der einfachen Einheit der Substanz auftreten, ohne daß sie konsequent für diese Substanz ableitbar sind. Werden diese Qualitäten aber andererseits als Qualitäten der Substanz ausgegeben, verliert die Substanz den zugleich nur behaupteten Charakter ihrer einfachen Einheit als Voraussetzung ihrer eigenen Besonderheiten, da sie selbst durch die Vielheit der Bestimmtheiten als distinkt vorgestellt wird. Damit treten aber bei Leibniz zwei konkurrierende Bestimmungen der Monaden auf: Sind die Monaden nun einfache Einheiten, die ihre Vielheiten von Beschaffenheiten als Perzeptionen oder Apperzeptionen haben, oder sind die Monaden selbst als Vielheiten zu begreifen, da die Perzeptionen der jeweiligen Monade angehören, so daß damit als Folge aber ihr Charakter der Einheit unverständlich wird? In beiden Fällen bleibt aber selbst wenn die skizzierte, grundsätzlich scheinende Aporie eine Auflösung erführe die tatsächliche Beschaffenheit der Monaden als qualitativ bestimmter dunkel. Ein zwangsläufiger Reflex dieser Unbestimmtheit der Monaden ist die Unbestimmtheit der Begriffe der Perzeption (1) und der Apperzeption (2), die eigentlich als distinkte Beschreibung der Qualitäten der Monaden von Leibniz vorgestellt wurden, die aber als allgemeinste Kennzeichnung eines Gehaltes überhaupt (1) und Charakteristik eines Bewußtseins über einen Inhalt (2) keine klar konturierte Beschaffenheit aufweisen. Genau dieses Problem hat Hegel in einer Passage zu Beginn der Wesenslogik vor Augen: "Die Leibnizsche Monade entwickelt aus ihr selbst ihre Vorstellungen; aber sie ist nicht die erzeugende und verbindende Kraft, sondern sie steigen in ihr als Blasen auf; sie sind gleichgültig, unmittelbar gegeneinander und so gegen die Monade selbst." (HW 6, 21.) Indem Hegel die mangelnde Distinktheit der Monaden kritisiert, die als Monaden in der Formulierung von Leibniz selbst 'irgendwelche' Beschaffenheiten haben, die aber weder untereinander noch mit der Vorstellung der Monade als einfacher Einheit selbst harmonisiert -
-
-
-
-
15 Ebd., 33,
§ 17. 233
Günter Kruck
sind, erweisen sich die Beschaffenheiten und die Vorstellung der Monade als abstrakte: D. h.,
wie die Beschaffenheiten (Perzeption und Apperzeption) selbst keine wirkliche Angabe zu den Qualitäten einer Monade enthalten und sie zur konkreten Bestimmung eines Etwas daher untauglich sind, weil sie von diesem konkreten Etwas gerade absehen und es in diesen Allgemeinbegriffen nicht als besonderes enthalten ist, so ist die Monade als einfache Einheit die 'Abstraktion der Abstraktion', da sie als substantielle Grundlage die Beschaffenheiten ihrerseits einbegreifen soll; sind aber die Beschaffenheiten als Beschaffenheiten schon Resultat einer von der bestimmten Einzelheit absehenden Reflexion, dann muß dieses Verdikt auch zwangsläufig auf die Monaden zutreffen, da ihnen ihre Bestimmtheit ja gerade erst durch die Beschaffenheiten verliehen werden sollte, dies aber angesichts der Unbestimmtheit der Beschaffenheiten selbst aporetisch erscheint. Hat sich damit das Resultat bestätigt, das sich bereits nach der ersten Konsultation der Hegelschen Kritik einstellte und das inhaltlich in der von Hegel her kritisch zu verstehenden Prädikation der Leibnizschen Position als Idealismus seine Spitze fand, so hat doch die nochmalige Konfrontation dieser Kritik mit den entsprechenden Einwänden von Leibniz in diesem dritten Teil deutlich gezeigt, daß diese Kritik Hegels an Leibniz von Leibniz selbst grundgelegt und antizipiert wurde, wie das u. a. das Beispiel der Maschine belegt. Indem Hegel Leibniz' eigene Bedenken aufgreift und entfaltet und in der Kategorie des Fürsichseins produktiv in seine Logik integriert, hat er aber nicht nur dessen zentrale Einsichten tatsächlich kritisch destruiert gemäß der zweiten Grundthese dieser Untersuchung -, sondern grundsätzlich die Erkenntnisse im Zusammenhang der Ermittlung von 'Bestimmungswissen' reformuliert. -
234
Friedrike Schick
Absolutes und gleichgültiges Bestimmtsein Das Fürsichsein in Hegels Logik
-
Einleitung Gegenstände unseres Nachdenkens sowohl qualitativen als auch quantitativen Angaben zugänglich sind, ist ein aus dem Alltäglichen vertrauter Sachverhalt. Weniger alltäglich dagegen ist die Frage ihres Zusammenhangs. Auf diese Frage verspricht das, was Hegel unter dem Titel "Fürsichsein" verhandelt, eine wichtige Teilantwort, nämlich eine Antwort auf die Frage, wie wir von qualitativen zu quantitativen Angaben kommen. In der Terminologie der Hegelschen Logik lautet diese Frage: Wie kommt es von der Einführungsbestimmung des Fürsichseins als Einheit oder Ausgleich von Sein und Bestimmtheit zu jener die Quantität eröffnenden Bestimmung der Gleichgültigkeit von Sein und Bestimmtheit gegeneinander? Um diese Frage bearbeiten zu können, muß man freilich zuerst wissen, was eigentlich der Gegenstand ist, der unter dem Titel "Fürsichsein" behandelt wird. Diese Frage läßt sich umso weniger mit einem einfachen Hinweis beantworten, als in unmittelbar zum Vergleich sich anbietenden Kategorienlehren, vorzüglich derjenigen der Kritik der reinen Vernunft, kein Pendant zum Hegelschen Fürsichsein in Sicht scheint. Diesen beiden Fragen entsprechend teilt sich der folgende Beitrag in zwei größere Schritte.1 Zuerst soll unter selektiver Aufnahme der Vorgeschichte des Fürsichseins in der Hegelschen Logik eine erste Charakterisierung und Begrenzung des Themas gewonnen werden. Das wird in zwei Schritten versucht, nämlich erstens anknüpfend an die Schlußausführungen zu Etwas und Anderem in der Enzyklopädie und zweitens im Anschluß an die Behandlung des Endlichen und Unendlichen in der Wissenschaft der Logik. Zielt die erste Etappe auf die Darstellung des Problems, das sich dem Bestimmen in der rudimentären Form des Etwas und Anderen stellt, so versucht die zweite, die vorläufige Lösung des Problems nachzuzeichnen, die als absolutes Bestimmtsein schließlich die Eingangsdefinition des Fürsichseins ausmaDaß viele,
1
wenn
nicht alle
Berücksichtigt werden die ausführlichere Version in der Wissenschaft der Logik und die Kurzversion in der Logik der Enzyklopädie (1830). Die in beiden Versionen eingebetteten philosophiehistorischen Exkurse Hegels werden um der Logik-internen Ausrichtung des Beitrags willen nicht eigens thematisiert. Für Hegels Bezugnahme auf Leibniz' Monadologie sei auf Günter Knicks Beitrag "Moment und Monade" in diesem Band verwiesen.
Friedrike Schick
chen wird. Beide Rekonstruktionen bleiben selektiv oder beschränkt nicht nur dem Umfang der Darstellung, sondern auch dem Gesichtspunkt nach, unter dem die Darstellung erfolgt und der sich in der Leitfrage zusammenfassen läßt: Was heißt es, denkend etwas zu bestimmen?2 Im zweiten größeren Schritt wird dann auf dieser Basis versucht, die Überführung des Fürsichseins in Eins, Viele und deren Einheit nachzuzeichnen.
Vom Bestimmtsein zur Selbstbestimmung. Elemente der Vorgeschichte des Fürsichseins
1.
1.1. Etwas und Anderes
Eingangs der Behandlung des Fürsichseins charakterisiert Hegel den erreichten Stand als Vollendung des qualitativen Seins und näher als Übergang von einem relativen zu absolutem
Bestimmtsein.3 Um diesen Schritt zu verstehen, sollten wir das Problem kennen, das das zunächst alternativlos gedachte qualitative Bestimmtsein aufwirft. Das ist nicht so leicht, denn
zunächst erscheint der Standpunkt des qualitativ gehaltenen Denkens als zwar schlicht und einfach gestrickt, aber nicht widersprüchlich. Er ist charakterisiert durch das Zusprechen von und Identifizieren mittels Qualitäten, kraft derern Gegenstände des Denkens ebenso separiert, auseinandergehalten werden. Die Schlichtheit, Anfänglichkeit des Standpunkts liegt in der einfachen Identifizierung von etwas und seiner Qualität. Etwas steht und fällt mit seinem SoSein.4 Jeder Wechsel der Qualität macht aus etwas etwas anderes; wie die Sache ist, entscheidet über ihre Identität, Qualität ist ihre einzige Identitätsbedingung. Auf dieser Stufe tritt der Gegenstand als Subjekt zweier Typen von Aussagen auf: einfach affirmativen und einfach negierenden: (1) Etwas ist so-und-so; (2) Etwas ist nicht so-und-so. Aussagen der Form (1) und (2) scheinen die harmloseste Kombination der Welt zu bilden. Daß beides, auch das zweite zur Konstitution des Gedankens eines Etwas gehört, ist leicht zuzugeben. Von jemandem, der den Fall des Auftretens einer Qualität nicht vom Fall ihres Nicht-Auftretens unterscheiden kann, würden wir nicht sagen, er sei mit dieser Qualität vertraut. Was aber macht die Kombination von positiven und negativen Angaben so brisant, daß sich vor Erreichen des Fürsichseins das Etwas in Gestalt des Endlichen zum offenen Wider2
Daß damit jedenfalls dieser Teil der Logik eindeutig als Wissenschaft vom Denken aufgefaßt wird, kann prifacie als willkürliche Beschränkung erscheinen; finden sich doch Textpassagen, in denen von der Veränderung und dem Ende der Dinge, nicht unserer Konzepte von ihnen die Rede zu sein scheint. Dies aufgreifend, konstatiert etwa Charles Taylor eine thematische Zweigleisigkeit der Logik des Daseins: "'Dasein' wird nicht nur aus seinem Widerspruch zu anderen Seinsbestimmungen definiert, sondern auch durch die Weise der kausalen Wechselbeziehungen mit anderen, in die Seiendes dieser Art eintritt" (Charles Taylor: Hegel, Frankfurt a.M. 1983, 310). Diese Lesart hat zum Preis, daß Argumente, für die Hegel systematische Relevanz beansprucht, als unbegründete Antizipationen gebucht werden müssen eine Konsequenz, die Taylor auch mehrfach zieht. Der Preis scheint mir hoch genug zu sein, um den Versuch einer einsinnigen Rekonstruktion zu rechtfertigen die freilich auch im Fall ihres Gelingens alternative Lesarten des Taylorschen Typs nicht schon desavouiert. ma
-
-
3 4
Vgl. HW 5, 174. "Die Qualität ist
236
überhaupt die mit dem Sein identische, unmittelbare Bestimmtheit" (Enz. § 90, Zusatz).
Das Fürsichsein in
Hegels Logik
spruch zersetzt? Das Gesuchte läßt sich in einer ersten selbst noch vagen, erläuterungsbedürftigen Fassung so beschreiben: Unter der Führung des qualitativen Unterscheidens/Identifizierens tritt das Anderssein, der Rekurs auf anderes, doppelt auf: erstens als eigenes Moment des qualitativ bestimmten Etwas und zweitens als Rekurs auf gleichgültig Verschiedenes, darin selber gleichgültiger Rekurs. Das Anderssein ist als zur Bestimmung von etwas gehörig und nicht gehörig gedacht. Die Negation wird auf diesem Stand strikt als seiendes Negatives gedacht. Das ist unter der Voraussetzung der skizzierten Identifikation von Sein und So-Sein von etwas nur konsequent: Wodurch etwas unterschieden werden kann muß jedenfalls sein und bestimmt sein, und das heißt auf dieser Stufe: ein Etwas. Den Unterschied wie das Unterscheidende gibt es so nur erst in Gestalt eines anderen, das auch ist, verschieden von und neben dem ersten. Anders gesagt: die zu Scheidenden selber sind die einzigen Kandidaten, die als Unterscheidungshinsichten zur Verfügung stehen. -
-
-
Eine nähere Fassung des damit anvisierten Problems erhalten wir in der Konzeption der Grenze. In § 92 der Enzyklopädie erläutert Hegel den Begriff der qualitativen im Unterschied zur noch nicht thematischen quantitativen Grenze an einem Beispiel: "Dieses Grundstück ist eine Wiese und nicht Wald oder Teich." Die Grenzziehung erfolgt dadurch, daß ihr Diesseits und ihr Jenseits kombiniert ausgesprochen werden. Zur Angabe dessen, worin etwas dieses Grundstück qualitativ begrenzt ist, sind zwei Parts erfordert: sowohl die positive Angabe als auch die negierende. Weshalb würde eine Teilaussage nicht genügen? Beginnen wir mit dem positiven Teil: Mit der Angabe "... ist eine Wiese" allein ist die Scheidung nicht gewährleistet. Hätten wir nur diese eine positive Charakterisierung, wäre das Charakterisierte nicht gegen selbst Bestimmtes, sondern nur von einer epistemischen Dunkelzone unterschieden, von etwas, worüber wir keine positiven Aussagen treffen können. Abgegrenzt gegen das Unbestimmte wäre dieses Etwas nicht mehr in seinem besonderen, gerade ihm zukommenden Charakter, sondern als Bestimmtes überhaupt ausgesprochen. Das ist aber weniger als das, was wir mit dem Prädikat "Wiese" zu sagen meinen und auch zu Recht meinen können, insofern dieses besondere Prädikat in seinem Gebrauch schon als eines unter anderen vorausgesetzt wird. Das ist der Sachverhalt, der in der kombinierten Grenz-Aussage nur explizit gemacht wird. Sobald wir hingegen den positiven Gehalt im Ernst von diesem Hintergrundwissen isolieren, reduziert er sich auf den selbst unbestimmten Verweis, daß da etwas Bestimmtes vorliegt; das qualitative Prädikat rückt ein in die Funktion des bloßen Namens, der Anzeige von Bestimmtheit. Nun ist Bestimmtheit kein Einteilungsgrund; Bestimmtes und Unbestimmtes verhalten sich nicht wie höchste Gattungen. Daraus können wir den Schluß ziehen: Als dieses eine, besondere So-Seiende ist der fragliche Gegenstand dann nur unter der Bedingung zu fassen, daß er gegen bestimmtes Anderes abgegrenzt wird. Dessen besonderes Bestimmtsein, der positive Charakter des Ausgeschlossenen ist selbst nicht mit der positiven Bestimmung, von der her ausgeschlossen wird, gegeben. Aus "Wiese" ist nicht zu entnehmen, daß es gerade Wald und Teich sind, die ausgeschlossen werden. Es führt kein Weg von der affirmierten Bestimmung zur affirmativen Bestimmung dessen, was ausgeschlossen wird. Der einzige zu erschließende Sachverhalt daß es sich um bestimmtes Anderes handeln muß läßt sich nicht selbst als Einlösung der gesuchten positiven Bestimmung verbuchen; dazu gibt sich "Anderssein" zu offenkundig als relative Bestim-
-
-
-
237
Friedrike Schick
mung
zu
erkennen, die die einfache positive Qualifizierung nicht ersetzt, sondern
voraus-
setzt.5 Umgekehrt reicht damit der zweite, negierende Teil der Grenzziehung Angaben, was dieWald ses hier nicht ist -, nicht wieder an die positive Bestimmung heran. Mit Wiese Teich haben wir einen Verbund von einander ausschließenden Qualitäten aber kein geschlossenes System, in dem die begrifflichen Glieder Alternativen eines Begriffes wären, bei denen dann durch Ausschluß der übrigen auf die positive Bestimmung geschlossen werden -
-
-
-
könnte. Die einzige Verbindung ist vorderhand das Exklusionsverhältnis als Anderssein: Was das eine ist, kann nicht eines der anderen sein. Der Einsatz bestimmter Qualitäten in die negativen Teilaussagen liefert keinen Anhaltspunkt dafür, die Entgegensetzung für kontradiktorisch, Drittes ausschließend, zu halten. Wir verfügen auf dieser Stufe über kein Kriterium der Vollständigkeit von Alternativen, weil Anderssein das einzige Verhältnis ist, in dem Qualitäten zueinander zu stehen kommen. Wir können also festhalten: Die beiden Teilaussagen der Grenzziehung sind nicht von gleichem Informationsgehalt und sind zur Grenzziehung beide erfordert. Noch nicht geklärt ist damit allerdings, weshalb die beiden einander nicht harmonisch ergänzen könnten; denn daß mit dem Gedanken der Grenze ein Widerspruch vorliegt, ist offenkundig Hegels These eine These, die er wie folgt erläutert: "Die Grenze macht nämlich einerseits die Realität des Daseins aus, und andererseits ist sie dessen Negation." (Enz. § 92 Zus.) Darin scheint zunächst der schon bekannte Sachverhalt resümiert, daß zur Grenzziehung zwei Teilaussagen erfordert sind, ein positiver und ein negierender Part. Inwiefern aber ist die Grenze damit auch Negation der Realität des Daseins? Gewiß geht die Grenzziehung als Separieren, Gegeneinanderhalten von Qualitäten über einfache positive Befunde hinaus aber was daran kehrt sich gegen solche positiven Befunde? Wir fanden gerade: Die qualitativ Seienden, gegen die abgegrenzt wird, kommen entweder als schon Vorausgesetzte ins Spiel oder gar nicht. Was ausgeschlossen wird, lag nicht in dem, wovon es ausgeschlossen wird. Sie sind als Bestimmte ihrem Einsatz in dieser Abgrenzung vorausgesetzt. Ebenso war das, was gegen anderes abgegrenzt werden sollte, der für sich kriterienlosen, unabgeschlossenen Reihe der Negationen vorausgesetzt und gegenüber. Damit erscheint der Rekurs, Ausgriff auf anderes (das Plus der Grenzziehung gegenüber einfachen positiven Befunden) als ein sekundärer, für die ursprünglich zu bestimmende Sache gleichgültiger Gegenstandswechsel. Wald, Wiese, Teich gehen einander nichts an. Daß sie schlicht als andere gedacht sind, schließt ein, daß im Rekurs auf eine der anderen Qualitäten der Umkreis der für die eine relevanten Bestimmungen verlassen ist, daß vom einen kein Licht auf das andere fällt. Gleichzeitig ist die Grenzziehung mit ihren beiden Teilen selbst
-
-
-
-
-
-
-
-
5
Mit
Aussagen wie "Dies ist Nicht-Wald" derjenigen Urteile, die Kant "unendliche"
"Wald ist Nicht-Wiese" bewegen wir uns gegenwärtig im Feld und von denen er festhält, daß der Ausschluß einer Bestimmung aus einem selber unbestimmten Raum möglicher Bestimmungen nicht zur positiven Bestimmung zurückführt: "Dieser Raum [der nach Ausschluß einer Bestimmung verbleibende; d. V.] bleibt aber bei dieser Ausnahme noch immer unendlich, und können noch mehrere Theile desselben weggenommen werden, ohne daß darum der Begriff von der Seele [dem Subjekt des Beispielsatzes; d. V] im mindesten wächst und bejahend bestimmt wird." (KrV B, 98) Allerdings verlangt die skizzierte Konstellation nicht die zusätzliche Annahme, daß tatsächlich unabsehbar viele Alternativen des Andersseins vorliegen; worauf es ankommt, ist nur, daß solche Alternativen in der einfachen Form des Andersseins gefaßt werden. (Diesen Hinweis verdanke ich Anton Friedrich Koch.)
238
nennt
-
Das Fürsichsein in
Hegels Logik
nicht gleichgültig für qualitative Identitätsfeststellungen: Die Gewähr des Unterschiedenseins liegt vorerst nur darin, daß es ein Außen, andere gibt: "dem Etwas wird im Anderen seine Grenze objektiv" (Enz. § 92 Zus.). Indem Verschiedenheit die einzige Bezugsweise von A und B ist, wird ihr Bezug als für jeden der Bezogenen gleichgültig ausgesprochen, als weder die Bestimmung von A noch die von B stiftend, und zugleich erscheint beider Verschiedenheit als nicht gleichgültig für ihre Konstitution als Gegenstände des Denkens. Aussprechen, was/wie etwas ist, und Aussprechen, was/wie etwas nicht ist, verhalten sich auf diesem Stand also nicht wie zwei arbeitsteilige Operationen, aus deren Kombination dann ein zuvor unbestimmt anvisierter Gegenstand als stabil und spezifisch charakterisierter hervorginge. Vielmehr scheint der erfolgreiche Abschluß jeder der beiden Operationen den der anderen vorauszusetzen: Das Zusprechen einer Qualität ("Dies ist eine Wiese") ist als Angabe dessen, worin dieses Etwas zuverlässig unterschieden ist, erst inthronisiert durch den Rekurs auf davon Verschiedenes. Der Sachverhalt, daß mit Wiese-Sein etwas unterschieden ist, komplettiert sich erst mit der Angabe negativer Kehrseiten. Zugleich käme diese zweite Operation, die des Negierens, nur in ihr Ziel, wenn sich solche negativen Angaben ihrerseits zum Äquivalent positiver Bestimmung komplettierten. Das aber leisten sie nicht, solange der einzige Zusammenhang von Qualitäten und von qualitativ Seienden ihr Anderssein ist, womit der ursprünglichen positiven Bestimmung selbst die Funktion des Unterscheidenden revindiziert ist. Es ist m. E. dieses Problem im Gang des Bestimmens, das in der Kategorie des Endlichen ausdrücklich als Verfassung des qualitativ bestimmten Etwas niedergelegt und zum Gegenstand gemacht wird. Im Gang der Großen Logik wird dieses Dilemma in Gestalt von Sollen und Schranke als Bestimmung jeder der beiden Seiten des affirmativ auszusagenden So-Seins und des Nicht-Seins ausgesprochen: Indem der Ausgriff auf gleichgültig Anderes die Sache nicht erreicht, bleibt die positive Bestimmung davon unterschieden; und indem sie ohne diesen Ausgriff nicht als diese bestimmte zu fixieren ist, depotenziert sich dieselbe positive Bestimmung zu einer nur gesollten, einer Bestimmung, in der die Sache nicht als unterschiedene festgehalten werden kann.6 Analog tritt der Kreis der Negationen als wesentliches Konstituens des Etwas als dieses unterschiedenen Etwas auf und erscheint im Licht von dessen immer noch als eigentliche Bestimmung festgehaltener nicht-unterscheidender Bestimmung als gegen das Etwas selbst zufällige Zäsur, Trennung des Etwas von dem, was es eigentlich ist: Schranke. Die nächste Lösung dieses Problems und schließlich den Auftritt des Fürsichseins möchte ich nun entlang einiger Etappen des Endlichen und des Unendlichen in der Fassung der Großen Logik erläutern. -
-
6
Diese Differenz zwischen Maßstab und Wirklichkeit der nur affirmativen Bestimmung motiviert m. E. auch die Wahl des Wortes "Sollen", die McTaggart und später Charles Taylor erstens für eine unglückliche Wahl halten und zweitens darauf zurückführen, daß sie Hegel Gelegenheit gab, wieder einmal Kants und Fichtes Ethik zu attackieren. Vgl. John Ellis McTaggart, A Commentary on Hegel's Logic, New York 1964 C11919), 29 (§ 30); Charles Taylor, Hegel (Anm. 2), 315.
239
Friedrike Schick
1.2. Endliches versus Unendliches Der Schritt zum Unendlichen läßt sich auf dieser Basis als die Entdeckung eines Sich-Kontinuierenden verstehen, das der Rede von Sollen und Schranke einbeschrieben ist. Das Etwas, das ich von anderem scheiden und damit in Verkehr mit etwas setzen muß, was es doch nicht ist, und das Etwas, das eigentlich bloß das ist, was es eben ist, sind doch nicht verschiedene. Wären es verschiedene, machte es keinen Sinn, von Sollen und Schranke zu reden. Was als Maßstab eingesetzt wird, vor dem die Abscheidung als Beschränkung erscheint, muß die Bestimmung ebendesjenigen sein, das dann wieder als Beschränktes gedacht wird. Mögen die Ansichten darüber immerhin konfligieren, so bleibt doch, daß sich diese Ansichten gar nicht behaupten lassen, ohne diesen gemeinsamen Boden anzunehmen; und da dieses sich Kontinuierende in den konfligierenden Ansichten auf sich bezogen bleibt, können wir es unendlich nennen.
Eine erste Konsequenz aus dieser Entdeckung kann nun darin bestehen, daß man diesen Fund unter Abstraktion von, neben dem Widerspruch des Endlichen zu sistieren versucht. Das ist die Stellung, die das Unendliche als Schlecht-Unendliches hervorbringt. Im Anschluß an 1.1 läßt sich diese Stellung so charakterisieren: Die Reihe negierender Aussagen (enthalte sie nun de facto ein Glied oder mehrere oder unabschließbar viele Glieder) bringt mich der Bestimmung des ursprünglich zu Bestimmenden (nennen wir es A) nicht näher. Solange der einzige Bezug der des Andersseins ist, verfüge ich nicht über Kriterien dafür, die Negativ-Reihe für durchlaufen zu halten. Gleichwohl hat diese Reihe ein Prinzip ihrer Bildung, über das ich schon verfüge. Dieses Prinzip lautet schlicht: "Nicht-A". Das im zweiten Schritt vermittels der Reihe zu Begrenzende tritt selbst als definitorisches Element der Reihenbildung auf. Das Abzugrenzende liefert das Prinzip seiner Abgrenzung. Wenn A also ohnehin seiner Abgrenzung vorher ist wieso sollte man den Ausgriff auf anderes nicht für einen müßigen Umweg erklären, der am Ende an A als seinen Ausgangspunkt zurückweist? A ist eben nicht anders als es ist, nicht nicht A und das ist nun allerdings eine Aussage, die der Affirmation von A äquivalent ist. Dieser Schritt hat allerdings einen offenkundigen Mangel: Die Rückbesinnung auf das ursprünglich zu Bestimmende erfolgt dann so, daß von einem Fortschritt in seiner Bestimmung nicht die Rede sein kann, kehren wir doch zu ihm als nach wie vor unbestimmtem zurück. Wir hätten dann alle Begrenzung, Verschiedenheit negiert und an ihrer Statt ein sich nur selbst Gleiches eingesetzt, das sich vom anfangs vermeinten reinen Sein nur mehr dadurch unterschiede, daß es als Resultat der Negation von Bestimmtsein gewonnen wäre. Die Minimalbedingungen bestimmter Gegenständlichkeit wären unterschritten. Zudem läßt sich zeigen, daß Unendlichkeit, verstanden als Beziehen von etwas auf sich zu Lasten seines Bestimmtseins, nicht nur eine schlechte, sondern gar keine Alternative zur endlichen Auffassung darstellt. Daß die Sache unbestimmt bleibt, ist nämlich schon das Resul-
-
tat der endlichen Fassung. Wenn der Rekurs auf anderes von der Sache nur entfernt und das einfache Affirmieren sie nur bestimmen soll, dann ist sie selbst eben unbestimmt geblieben. Damit tritt das Problem, das sich an unserem Wald-und-Wiesen-Beispiel zeigte, auf höherer Reflexionsstufe wieder auf. Der Versuch, das Unendliche als bestimmte Alternative gegen
240
Das Fürsichsein in Hegels
Logik
das endliche Bestimmtsein zu etablieren, scheint ebendiesen Unterschied wieder einzuebnen.7 Die vermeinte Alternative wird von einer Prämisse eingeholt, die wir anfangs schon haben passieren lassen: Daß etwas nicht bestimmt ist, wenn wir nicht in der Lage sind, Gegeninstanzen zu ihm als solche zu identifizieren. In diesen negativen Überlegungen liegen die Elemente für einen nächsten Lösungsschritt schon bereit: Daß Bestimmen nicht bloß im Beziehen auf anderes bestehen kann und nicht bloß im einfachen Beziehen von etwas auf sich, wissen wir. Wir wissen nun auch, daß beide keine echten Alternativen bilden, zwischen denen wir zu wählen hätten. Die Lösung wird demnach darin liegen, daß im Rekurs auf anderes etwas auf sich bezogen bleibt. Diese Lösung wird realisierbar, wenn wir die Forderung aufnehmen, daß das, wozu etwas ins Verhältnis gesetzt wird, ein dem ersten Gleichartiges sei. Was sich im Anderssein kontinuiert, ist dann gegen die vermeinte Alternative des Schlecht-Unendlichen nicht ein bestimmungsloses X, sondern eine beide Vergleichsobjekte übergreifende Bestimmung. Inwiefern liegt darin ein Schritt zur Lösung des Ausgangsproblems? Es bestand, kurz gefaßt, darin, daß drei den qualitativen Standpunkt gleichermaßen charakterisierende Aussagen zusammen ein inkonsistentes Ganzes ergaben: (1) Sagen, wie etwas sich unterscheidet, verlangt Angaben über zwei selbständige Gegenstände: die Angabe, was dieses Etwas ist, und die Angabe, wovon es sich unterscheidet. -
-
7
Wissenschaft der Logik verfolgt die Möglichkeit, das Unendliche zu fassen, ohne in seine Definition den negativen Rekurs auf das Endliche aufzunehmen, im Abschnitt "c. Die affirmative Unendlichkeit" (vgl. HW 5, 157f). Die zuvor gegebene "einfache Bestimmung" des Unendlichen "das Affirmative als Negation des Endlichen" (HW 5, 149) könnte sich ja auch nur der besonderen, von der Sache des Unendlichen selbst zu unterscheidenden Zugangsweise zu ihr verdankt haben. Dann hätte sich eine nur akzidentelle Kennzeichnung unvermerkt an die Stelle einer noch ausstehenden positiven Definition des Unendlichen gemogelt: "In diesem Auffassen können sie nach ihrer Beziehung auf ihr Anderes genommen zu sein scheinen. Werden sie hiermit beziehungslos genommen, so daß sie nur durch das Und' verbunden seien, so stehen sie als selbständig, jedes nur an ihm selbst seiend, einander gegenüber." (HW 5, 157) Wird allerdings das negative Element als vermeintlich überflüssiger Appendix aus der Bestimmung des Unendlichen entfernt, erhält man das im Zitat schon angezeigte, von Hegel in der Folge eingeholte Resultat: Endliches und Unendliches verhalten Die
-
-
'
sich zueinander wie Etwas und Anderes. Das Unendliche tritt auf als etwas Bestimmtes unter anderen. Die unter anderen sei (ein Typ des Seins oder Fassens von etwas), hat ihre Bewährung es neben diesem noch anderes gibt. Wenn sich die Negation der Negation nicht in der Bestimmung des Unendlichen auffinden läßt, kommt für den gleichwohl unterstellten Sachverhalt des Unterschiedenseins nicht mehr es selber auf. Genau diese Verfassung: mittels des außer der Bestimmung gelegenen Rekurses auf Verschiedenes unterschieden sein, charakterisierte das Endliche als Endliches. Wir erhalten ein endliches Unendliches auf der einen und, da durch die Überlegungen zum Unendlichen das Endliche als Bestimmungstyp eigenen Rechts bestätigt ist, ein unendliches Endliches auf der anderen Seite. Eine Weise, den Unterschied dingfest zu machen, scheint sich an dieser Stelle allerdings noch anzubieten: Warum sollten wir nicht dem sprachlich durch den Wechsel von adjektivischem und substantivischem Gebrauch angezeigten Unterschied endliches Unendliches versus unendliches Endliches sachliches Gewicht geben, indem im einen Fall Unendlichkeit die eigentliche, substantielle Bestimmung, Endlichkeit hingegen eine dieser externe hinzukommende Bestimmung wäre, während im anderen Fall genau das Umgekehrte vorläge? Doch diese Statusunterscheidung scheitert erstens daran, daß die vermeintlich externe, hinzukommende Bestimmtheit die vermeintlich eigentliche, echte und innere Bestimmung nicht nur voraussetzt, sondern glatt negiert (ein "Attribut" des Typs "der gewesene Herr Kommerzienrat"), zweitens aber auch daran, daß die zweite, attributive Bestimmung gerade aus der streng isolierten eigentlichen Bestimmung erschlossen war (vgl. HW 5, 159f).
Auskunft, daß es eines dann genau daran, daß
-
-
241
Friedrike Schick
wie etwas sich unterscheidet, gehört zu dem, was es heißt, es als bestimmtes Etwas zu fassen. Was zum Bestimmen von etwas gehört, ist seine Bestimmung (oder ein Element da-
(2)
Sagen,
(3)
von).
Da aber das, wovon sich etwas unterscheidet, nach (1) außer das fällt, was dieses Etwas ist, können die drei nicht zusammenbestehen. Die entscheidende Modifikation wäre nach meiner Lesart: Revoziert wird die Annahme der vorausgesetzten Selbständigkeit zweier Gegenstände in (1) oder, mit anderen Worten, die Annahme, daß, was immer einen Unterschied von einem Gegenstand macht, mich von diesem entfernt, weil es nur wieder ein anderer, selbständig zu bestimmender Gegenstand sein kann. Es zeichnet sich ein Typ des Bestimmens ab, in dem die anfängliche einfache Identifikation von etwas mit einer Qualität abgelöst wird durch die Identifikation von etwas als Sonderfall eines Allgemeinen.8 Den Nachweis, damit der Spur des Endlichen und Unendlichen in der Wissenschaft der Logik gefolgt zu sein, muß ich der Kürze halber schuldig bleiben. Doch möchte ich wenigstens auf ein Indiz hinweisen, das für die Möglichkeit der skizzierten Lesart spricht. Es besteht darin, daß Hegel den im "affirmativen Unendlichen" erreichten Stand vorzugsweise mit dem Terminus "Idealität" charakterisiert. Diese Charakterisierung trägt offenbar einiges systematisches Gewicht, soll damit doch nicht nur ein Interimsstandpunkt, sondern auch der Standpunkt der Philosophie überhaupt bezeichnet sein: "Jede Philosophie ist wesentlich Idealismus oder hat denselben wenigstens zu ihrem Prinzip, und die Frage ist dann nur, inwiefern dasselbe wirklich durchgeführt ist." (WdL I; HW 5, 172) Wenn so "idealistisch" nicht wie gewöhnlich als das unterscheidende Attribut einer philosophischen Richtung, sondern als allgemeines Attribut der Philosophie eingesetzt wird, stellt sich die Frage, ob hier nicht unter der Hand die Besonderheit einer Filiale zum Maßstab des ganzen Unternehmens gemacht wird. M. E. machen Hegels anschließende Erläuterungen klar, daß dies nicht der Fall, daß "Idealismus" hier vielmehr tatsächlich allgemein genug gefaßt ist, um als Epitheton des Denkens überhaupt gelten zu können: "Prinzipien älterer oder neuerer Philosophien, das Wasser oder die Materie oder die Atome, sind Gedanken, Allgemeine, Ideelle, nicht Dinge, wie sie sich unmittelbar vorfinden, d. i. in sinnlicher Einzelheit, selbst jenes Thaletische Wasser nicht" (ebd.) also nicht einmal der Prototyp eines sinnlichen Prinzips. Wir gingen aus von der Ansicht: Sagen, was etwas ist, heißt zunächst einmal: Registrieren, Aufnehmen, wie es ist und dann auch: Separieren von anderem. Dabei galt: Wodurch sich etwas separiert, das Auszeichnende sind die Etwas selber. Unterscheidungshinsicht und zu Unterscheidende kollabierten. Dagegen zeigte sich ein interner Grund, diesen Standpunkt des Registrierens und Abscheidens zu verlassen; er bestand in der Einsicht, daß wir, um zwei gegeneinanderzuhalten, einen Beziehungsgrund brauchen. Dieser Beziehungsgrund kann nicht wieder ein anders bestimmtes Dasein sein weder eins der beiden gegeneinander Gehaltenen -
-
-
-
8
Die von mir eingeführte Rede von "Sonderfall" und "Allgemeinem" bedarf allerdings einer Einschränkungsklausel. Gegenwärtig soll damit nicht mehr und nicht Bestimmteres bezeichnet sein als das eben erreichte Ergebnis: der Gedanke eines Verschiedene übergreifenden Beziehungsgrundes, der sie gleichwohl als unterschiedene erhält. Insbesondere ist diese Redeweise nicht dahingehend zu präzisieren, daß gegenwärtig das Verhältnis von Einzelnem zu seiner Art im Unterschied zum Verhältnis einer Gattung zu ihren Arten thematisch wäre: Der Typ numerischen (versus qualitativen) Unterscheidens wird sich erst im Gang des Fürsichseins selbst ergeben.
242
Das Fürsichsein in
Hegels Logik
noch ein gleich verfaßtes, selbständiges Drittes. Würde der Beziehungsgrand als auch noch ein Daseiendes sistiert, das sich von gleichem Rang neben den Verglichenen findet, ergäbe sich ein unendlicher Regreß; denn nun müßte gezeigt werden, was an diesem Dritten den Grund dafür abgibt, als vermittelnde Instanz eingesetzt werden zu können. Das heißt umgekehrt: Der Boden, auf dem zwei Gegeneinandergehaltene der Entgegensetzung fähig werden, kann nur eine beide übergreifende Bestimmung: ein Allgemeines sein.
2.
Die Entwicklung des Fürsichseins
2.1. Fürsichsein
Für-Eines-Sein: Wie wird Fürsichsein Eins? -
Was den
Widerspruch des qualitativen Standpunkts ablöst, ist der bisherigen Rekonstruktion die Einsicht in die Gleichartigkeit Nicht-Identischer. Die gleichermaßen in der zufolge Großen wie der Kleinen Logik gebrauchte Wendung von der nun erreichten Negation der Negation9 fügt sich zwanglos in diese Lesart: Negiert wird die anfängliche Ansicht, jedes Konstatieren von Nicht-Identischem komme dem Wechsel des Gegenstandes, der bloßen Entfernung von einem ursprünglich anvisierten Gegenstand gleich. In beiden Fassungen der Logik wird das Dasein das Sein als bestimmtes als Moment ausdrücklich dem Gedanken der Beziehung auf sich selbst, dem Fürsichsein, integriert. Die Große Logik gewinnt diesen Sachverhalt in drei Schritten,10 deren erster das Fürsichsein affirmativ als Dasein ausspricht, deren zweiter beides voneinander distanziert und deren dritter Dasein schließlich als Moment des Fürsichseins charakterisiert, als welches es dann unter dem Namen Sein-für-Eines weitergeführt wird. Zur Konstitution eines Gegenstands des Denkens gehört also nach wie vor: Er muß als qualitativ verfaßter so-und-nicht-anders-Seiender ansprechbar sein. In einer solchen Bestimmtheit ist er erst selbständig artikuliert, sie ist es, die ihn ausmacht. Aber dieselbe qualitative Verfassung ist nun weiter bestimmt als gleichgültig, dieses oder jenes zu sein als allgemein -, und der Gegenstand entsprechend als Sonderfall dieses Allgemeinen. Gegenüber der unmittelbaren Identifizierung von Etwas und einer Qualität ist nicht die Identität beider aufgekündigt, sondern nur deren Status als unmittelbar vorgefundener; jetzt nämlich ist etwas mit seiner Bestimmung identifiziert mittels des Rekurses auf gleiche Andere. Von diesem Stand aus scheint es eher befremdlich, wenn wir in der Wissenschaft der Logik wenige Seiten später erfahren, die Momente des Fürsichseins seien "in Unterschiedslosigkeit zusammengesunken" (WdL I; HW 5, 182), und alles, was von unserer gegenwärtig als in sich unterschieden gedachten Sache zu vermelden bleibt, sei "das Eins" (ebd.). Das ist deshalb so merkwürdig, weil sich als Nachfolger von Anderssein nicht Unterschiedslosigkeit, sondern ein neuer Typ des Unterscheidens ergeben hatte. Dieser Typ mag vorerst noch undeutlich konturiert sein, eins aber schien über ihn doch festzustehen: daß Bestimmen-vonetwas eine Binnenunterscheidung des Gedachten enthalten müsse, nämlich die von Allgemei-
-
-
-
-
9 Vgl. HW 5, 174; Enz. § 95. 10 Siehe unter "A. Das Fürsichsein als solches" "a. Dasein und Fürsichsein".
243
Friedrike Schick
und Sonderfall.11 Dieser Gedanke scheint abhanden gekommen in der Fassung des Eins als des "in sich selbst Unterschiedslose(n)" (Enz. § 96). Entweder die Rekonstruktion ist an der logischen Genese des Fürsichseins glatt vorbeigegangen oder es gibt einen Schritt, den wir noch nicht vollzogen haben. Dieser zweiten, weniger dramatischen Alternative will ich nem
nun
nachgehen.
Die Momente, deren Unterschied abhanden kommen soll, sind das Fürsichsein (die Selbstbestimmung) selbst und das Sein-für-Eines (das Bestimmtsein); was ihren Unterschied verschwinden macht, muß folgen wir dem Text mit dem Sachverhalt zu tun haben, daß das, was bestimmt wird, gegenwärtig nicht gegen die erschlossene allgemeine, übergreifende Bestimmung profiliert werden kann. Entwickelt wird dieser Gedanke im Ausgang vom Sein-für-Eines. Sein-für-Eines "drückt aus, wie das Endliche in seiner Einheit mit dem Unendlichen oder als Ideelles ist" (WdL I; HW 5, 176). Es gibt immer noch Bestimmungen, ein So-Sein aber eins, das als Seiendes übergreifend gedacht wird; und indem Seiendes als Fall dieses Allgemeinen geführt wird, ist es in der Abgrenzung gegen gleichartige Andere auf seine eigene allgemeine Bestimmung bezogen. Das entscheidende Argument lautet nun: "Indem nun dies Moment als Sein-für-Eines bezeichnet worden, ist noch nichts vorhanden, für welches es wäre, das Eine nicht, dessen Moment es wäre." (WdL I; HW 5, 176). Wenn ich recht sehe, erinnert Hegel damit den Sachverhalt, daß jenseits seiner Erfassung als Sonderfall eines Allgemeinen das vormalige Etwas dem Denken gar nicht zur Verfügung steht. Es ist nicht zuerst eines und dann, auch noch, Sonderfall eines Allgemeinen, sondern eines als Sonderfall dieses Allgemeinen. Das stimmt damit überein, daß wir den Einsatz allgemeiner Bestimmungen als Konstituens eines sachlich relevanten Abgrenzens erschlossen hatten. Damit ist das Verhältnis von Sonderfall und Allgemeinem nicht als Beziehung zwischen Verschiedenen, d. h. einander als bestimmt Vorausgesetzten, zu werten; das Allgemeine nicht als apartes Anderes neben Anderen. Für den Part der Sonderfalle bedeutet das: der Abhängigkeit ihres Unterschiedenseins von einer allgemeinen Bestimmung wegen sind sie auch nur in dieser Bestimmung auf sich bezogen, d. h. insofern sie selbst ideell, eben schon als Fall ihres Allgemeinen genommen sind. Gleichwohl kann die Bestimmung als ideelle oder allgemeine nicht mehr unmittelbar mit dem, wovon sie gilt, identifiziert werden. In der Rede von Gleichartigen ist mitausgesagt, daß die Gleichartigkeit von Fällen mit deren Besonderheit verträglich ist. Nehmen wir hier aber die neue Überlegung hinzu, daß diese erst als gleichartige stabil unterscheidbar geworden sind, so ist über diesen Unterschied zu sagen: Er kann nicht mehr außer dasjenige fallen, was jeder der Fälle ist; er wird, wie immer er näher ausfällt, die Identität der Fälle mit ihrem Allgemeinen als seine eigene Implikation bewahren müssen. -
-
-
-
11 Dasselbe Befremden stellt sich ein, wenn man Hegels Anmerkung zum Sein-für-Eines betrachtet (vgl. HW 5, 177f). Hegel zieht hier den Frageausdruck "Was für ein F' (seine Beispiele für F sind "Ding" und "Mensch") heran, um die Identität des Seins-für-Eines und des Fürsichseins zu erläutern. Hervorgehoben wird von ihm der Sachverhalt, daß auf Fragen dieses Typs nicht eine relative Bestimmung erwartet wird, sondern eine, die in der Bestimmung ganz bei der zu bestimmenden Sache bleibt. Nun ist diese Selbstbezüglichkeit aber sicher nicht die einzige Seite, die dieser Frageausdruck hat. Ungeachtet der geforderten Identität erwarten wir ja als Antwort nicht die Wiederholung eines Bekannten, sondern eine Bestimmung oder Näherbestimmung der Sache. Es ist also die Frage, weshalb im weiteren nicht "Ein-F-Sein" oder "Ein-solchesF-Sein", sondern die Magerversion "Eins", gewissermaßen der absolut gesetzte unbestimmte Artikel, zum Gegenstand der Betrachtung wird.
244
Das Fürsichsein in
Hegels Logik
Von einem Stand aus, der diese Einheit von Unterschiedensein und Gleichsein nur erst Verhältnissen unmittelbaren Andersseins distanziert, ansonsten noch nicht weiter bestimmt hat, bleibt dann wirklich nicht mehr als Bestimmtsein als Verhältnis von etwas zu sich festzuhalten, von etwas, das unterschieden von diesem Verhältnis nicht zu fassen ist. Halten wir dieses Ergebnis vergleichsweise mit der ersten qualitativen Ausgangsansicht zusammen. Dort kollabierten Unterscheidungshinsicht und zu Unterscheidendes und zwar so, daß wir zwei Bestimmte brauchten, ein Diesseits und ein Jenseits der Grenze. Nun ist es auch auf dem gegenwärtigen Stand nicht falsch, von einem Kollaps von Unterscheidungshinsicht und zu Unterscheidendem zu sprechen. Wird Bestimmen als Selbstbestimmen gedacht, so ist das, wodurch sich etwas unterscheidet, es selber. Ein klarer Unterschied zur Ausgangsansicht ist aber, daß nun ein und dasselbe die Rolle des Bestimmenden und des Bestimmten spielt. Was wir eben fanden, läßt sich dann so fassen: Die Rollendifferenz von Bestimmendem und Bestimmtem ist nicht verschwunden, wird aber nicht so dingfest gemacht, daß beide Rollen auf bestimmt unterschiedene Parteien verteilt würden.12 "Es ist nur eine Bestimmung vorhanden, die Beziehung-auf-sich-selbst des Aufhebens." (WdL I; HW 5, 182) Im Licht dieser einen Bestimmung ist dann vom gedachten Gegenstand zu sagen: Er ist eben durch sich unterschieden, "die ganz abstrakte Grenze seiner selbst, das Eins" (ebd.). Die angebotene Lesart schließt freilich die These ein, daß mit dem Schritt zum Eins eine Aufgabe offen bleibt, nämlich die der Differenzierung und Zusammenführung der Momente von Sonderfall und Allgemeinem. Gegenwärtig nämlich wird das zu Bestimmende unmittelbar mit einem negativen Selbstverhältnis identifiziert, ohne inhaltliche Differenzierung der Pole dieses Verhältnisses. Wenn wir im Anschluß die Sache nur noch als Grenze ihrer selbst weiterführen, so tun wir das in Abstraktion von Binnendifferenzen der Sache, die die Grundlage dieser Abstraktion bilden. Wie sich das in dieser Abstraktion selber, auf ihrer Grundlage zeigt, ist Gegenstand der hier folgenden Abschnitte.13 von
-
-
2.2. Wie ist Eins Vieles?
Folgen wir den Ankündigungen der Großen Logik, so ist als Dreh- und Angelpunkt der weiteren Entwicklung der Sachverhalt zu erwarten, daß die Momente des Fürsichseins ihres Kollabierens im Eins wegen in der Folge in der Form Unmittelbarer auftreten.14 Wie ist diese Ankündigung zu verstehen? Als Momente des Fürsichseins alias Selbstbestimmens können wir festhalten:
a) das Bestimmbar-Sein; b) das Bestimmtsein und c) den Sachverhalt, daß der Schritt von a) zu b) durch dasselbe geleistet wird, was sich in a) als bestimmbar und in b) als bestimmt darstellt. Von diesen Momenten heißt es nun: "Aber um der nunmehrigen Unmit12 Man denke
zum
Kontrast
an
die konkretisierte Rollendifferenz
von
Genus
und
als dem Bestimmbaren
spezifischer Differenz als dem Bestimmen dieses Bestimmbaren in der Aristotelischen Metaphysik. Vgl. Metaphysik Z 12, 1038a 5-9. 13 Diese Abstraktion wird im Text der Wissenschaft der Logik bei der Einführung des Eins bereits angezeigt: Mit dem Zusammenfall von Momenten ist Unmittelbarkeit eingetreten die nicht in sich unterschiedene Sache ist natürlich einfach, als einfache, zu fassen -, aber eine eigentümliche Unmittelbarkeit, eine, in der die "innere Bedeutung [des Fürsichseins; d. V.] verschwindet" (HW 5, 182). 14 Vgl. ebd., 182f. -
-
-
-
-
245
Friedrike Schick
telbarkeit willen sind diese Unterschiede nicht mehr nur als Momente einer und derselben Selbstbestimmung, sondern zugleich als Seiende gesetzt." (WdL I; HW 5, 183) Die in a), b), c) angezeigten ideellen Unterschiede Unterschiede, die keinen Wechsel des gedachten Gegenstandes initiieren werden in der Folge zunächst einmal gegen ihren Zusammenhang festgehalten, so nämlich, daß sie sich zueinander wie selbständig Vorausgesetzte verhalten, die ihre positive Bestimmung unmittelbar haben und wie Verschiedene eines dem anderen gegenüberbleiben. Daneben und im Gegensatz dazu wird sich ihre Unselbständigkeit bemerkbar machen mit dem Resultat, daß gegeneinander Selbständige durch ihre Beziehung sind, was sie sind. Weshalb die drei Momente als seiende auftreten werden, läßt sich im allgemeinen schon angeben. Vom Selbstverhältnis des Bestimmens war die kondensierte Information übriggelassen: Es ist am Ende ein und dasselbe, was als Bestimmbares, Bestimmendes, Bestimmtes auftritt; und da dieses Beziehen kein Hinausgehen über die Sache darstellt, erhält es die Sache als einfache. Daß dieses Einfache zugleich nur als Verhältnis zu sich artikuliert ist, macht sich dann in umgekehrter Richtung geltend: Die immer noch mitgedachte Rollendifferenz wird zu einer Beziehung zwischen Verschiedenen da sie doch einmal bloß dasselbe nicht sein können. Während die Wissenschaft der Logik zum Gedanken der vielen Eins über drei eigene Abschnitte gelangt,15 faßt sich die enzyklopädische Version in dieser Frage weit knapper. Doch lassen sich auch in der Enzyklopädie drei analoge Schritte unterscheiden, in denen ausgehend vom Eins das Viele erreicht wird. In beiden Fassungen lassen sich diese Etappen übereinstimmend so markieren: (1) Eins ist Beziehen auf sich. (2) Was sich da auf sich bezieht, ist ein Negatives. (3) Die Beziehung eines Negativen auf sich ist negative Beziehung.16 Diese drei Schritte sollen nun in freierer Erläuterung vollzogen werden: Anstelle einer differenzierenden Antwort auf die Frage, worin die begrenzte, unterschiedene Sache mit anderem gleich, worin sie unterschieden sei, anstelle der qualitativen Zerfällung in Hinsichten erhalten wir mit Erreichen des Eins die Auskunft: Hier ist ein Einfaches, das für beide Rollen aufkommt. Ganz gleich, ob du mit einer Bestimmung anfängst, in der etwas anderem gleicht, oder mit einer, in der es sich unterscheidet, oder mit der in Gedanken von beiden abgehobenen Sache selber von allen Richtungen wirst du auf dasselbe Ergebnis kommen: Grenze seiner selbst oder Selbstbestimmtes. Diese eine, identische Besetzung hebt Aussage (1) hervor. Was allerdings nicht verschwunden ist, ist die Differenz der Rollen selber, der funktionale Unterschied von Grenze und Begrenztem und von Bestimmen und Bestimmtwerden. Wie verhält sich dieser Unterschied zu der Auskunft, daß in beiden Rollen dasselbe Einfache spielt? Für den funktionalen Unterschied heißt es: Er wird ganz formell, leer. Wo aber als Bestimmung eines zu Bestimmenden dasselbe nur wiederholt ist, hat kein Bestimmen stattgefunden. Die Selbstbestimmung wird um das Moment der Bestimmung amputiert. Dieses Ergebnis ist aber zugleich inakzeptabel, denn die Rede von Selbstbeziehung hatte sich hier nur als die abstraktere Fassung des Selbstbestimmens ergeben. Das heißt für das Einfache: Nach Verab-
-
-
-
-
-
-
-
-
15 Der Abschnitt "B. Eins und Vieles" und "c) Viele Eins. Repulsion". 16 Vgl. Enz. §§ 96, 97.
246
gliedert sich in "a) Das Eins an ihm selbst", "b) Das Eins
und das Leere"
Das Fürsichsein in
Hegels Logik
des Bestimmens bleibt uns auch kein einfaches Selbst übrig. Das wird deutlich, sich vergegenwärtigt, was da in Beziehung zu sich gesetzt wurde. Dieses Fürsichseiende oder Eins war nicht etwas, das erstens, logisch vorgängig, irgend etwas war und zweitens, zusätzlich, für sich oder selbstbestimmend Selbstbestimmung war seine ganze Definition. Der Versuch, das was es eigentlich, affirmativ, einfach ist, von seinem Bestimmtsein zu distanzieren, unterschreitet den Gedanken der Selbstbestimmung. Denn damit hätte Eins seine Grenzen wieder durch etwas, was außer es selber fallt. Also bleibt, wenn das Eins selbst bleiben soll, nur festzuhalten: Es ist etwas, zu dessen Definition es gehört, einen Unterschied zu machen. Das fixiert Aussage (2). Damit sind zwei einander widerstreitende Forderungen an den Begriff des Eins gestellt: Er soll nach (1) die interne Unterschiedslosigkeit des Eins bewahren und nach (2) die formell gewordene Differenz der Rollen Bestimmen und Bestimmtwerden.17 Eine Weise, das eine zu denken, ohne vom anderen zu lassen, haben wir eben schon ins Spiel gebracht: Verteilen wir die zwei Rollen des Begrenzens versuchsweise auf zwei verschiedene Pole, so daß, was ausgeschlossen wird, nicht für dasselbe gilt wie das Ausschließende. Dann kann dieses intern unterschiedslos bleiben, der Unterschied ist dann einer zwischen ihm und etwas, was jedenfalls nicht es selber ist. Bestimmtsein und Einfachheit sind dann beide gewahrt aber um den Preis, daß nicht mehr zu sehen ist, wie der konkretere Gedanke, dessen Momente sie sind, gewahrt ist: der Gedanke der Selbstbestimmung. Da dieser Gedanke die Identität des Ausschließenden und des Ausgeschlossenen, die Rollendifferenz als Binnendifferenz des Einen verlangt, kehrt er sich gegen die Forderung der Einfachheit dieses Einen. Auf der fix gesetzten Grundlage dieser Einfachheit kann die interne Differenzierung dann nur eine des Einen von sich sein. Das ist der Stand von Aussage (3): "Die Beziehung des Negativen auf sich ist negative Beziehung, also Unterscheidung des Eins von sich selbst, die Repulsion des Eins, d. i. Setzen vieler Eins." (Enz. § 97) Daß Eins damit als Eins unter vielen Eins bestimmt ist, ist mit der Reflexivität des Unterscheidens eines Einfachen schon entschieden. Dasselbe Resultat läßt sich aber noch einmal verdeutlichen, wenn wir fragen, wie dasjenige, von dem Eins unterschieden ist, bestimmt sein muß, wenn das, wovon es sich unterscheidet, Eins sein soll. Es darf nichts sein, was schlicht außer die Bestimmung des Eins fällt kein Anderes in qualitativ spezifizierbarem Sinn; sonst wäre das Eins wiederum nicht durch sich unterschieden, sondern durch ein Grenzverhältnis der alten, im Eins als überwunden angezeigten Art. Es kann dem Eins auch gar nicht in einer Hinsicht gleich, in einer anderen ungleich sein Eins bietet für solche Differenzierung nach Hinsichten keinen Angriffspunkt mehr (es ist nichts in ihm). So bleibt nur, daß das, was sich von Eins unterscheidet, ganz dieselbe Bestimmung hat: Eins. Zu-
schiedung
wenn man
-
-
-
-
-
-
-
-
17 Unter dem Titel "Das Eins und das Leere" wird genau dieser Sachverhalt in der Wissenschaft der Logik in einem eigenen Abschnitt bedacht. Das Leere kommt nämlich so ins Spiel: Insofern von Selbstbestimmung nur das abstrakte Resultat der Koinzidenz von Ausgangs- und Endpunkt festgehalten wird das Beim-SelbenAnkommen -, wird die Sache, das Eins, als in sich nicht unterschieden betrachtet: "Es ist nichts in ihm" (HW 5, 184). Die negative Aussage daß kein Unterschied vorliegt ergibt aber nicht den Vollsinn des Eins. Gemeint ist die negative Aussage als eine, die in Bezug auf etwas gilt, das selber vorliegt, mit der Negation von Unterschieden in ihm nicht verschwindet. Als dieses muß es von dem negativen Sachverhalt noch einmal abhebbar, unterscheidbar sein: dasjenige, in dem nichts zu unterscheiden ist. "So dies Nichts gesetzt als in Einem, ist das Nichts als Leeres" (ebd.). Die Forderung der Unterschiedslosigkeit und die Forderung, das Eins auch unterschieden von dieser Unterschiedslosigkeit zu fassen, treten auseinander. -
-
-
247
Friedrike Schick
Es muß etwas sein, was sich von Eins unterscheidet. Für diesen Unterschied bleibt nur die formellste, abstrakteste Verschiedenheit: auch Eins, noch Eins.18 Als Zwischenbilanz kann man über diesen Stand im Vergleich mit der Eingangsansicht des Fürsichseins festhalten: Was wir nach wie vor haben, ist eine Selbstbeziehung des Unterscheidens aber hier haben wir sie tatsächlich nicht mehr in der Form gegeneinander unselbständiger Bestimmungen, nicht in der ideellen Form von Momenten, sondern als ein Verhältnis absolut Gleicher und absolut Anderer. Nun weicht der eben entwickelte begriffliche, interne Zusammenhang von Eins und Vielem in einem Punkt erheblich ab von der Weise, in der wir dieses Verhältnis gewöhnlich denken. Daß Eins notwendig als Eins unter Vielen zu denken ist, kommt in der gewöhnlichen Betrachtung nicht vor. Hier gilt stattdessen ein schwächeres logisches Verhältnis, das der asymmetrischen Voraussetzung: Die Eins müssen mir einzeln schon gegeben sein, damit ich sie dann (auch noch) als viele zusammensehen kann. Daß sich hier keine unüberwindbare Kluft zwischen einer gewöhnlichen und einer begreifenden Denkweise auftut, läßt sich aber vom internen Stand der Logik aus zeigen.19 Daß Eins nicht zu Eins wird, weil außer ihm andere Eins sind, ist nämlich im Gang der ersten oder begrifflichen Repulsion damit besiegelt, daß das, wovon Eins sich unterscheidet, ebenso wie dieses als seinerseits durch sich Bestimmtes festgehalten ist. So sind sie einander vorausgesetzt, jedes ist selbst der ganze Grund, dieses und nicht das andere zu sein. Daß ihrer viele sind, bleibt unter diesem Vorzeichen dem, was sie für sich sind Eins äußerlich, ihre Beziehung ist als keine bestimmt.20 Sie als viele zu betrachten, ist dann eine Zusammenfassung, die am Begriff eines jeden von ihnen nichts ändert: eine externe Relation. Was sie scheidet, ist nicht etwas, was das eine hat oder ist, das andere nicht; es gibt keine Hinsicht an ihnen, die sie unterscheidet. Ihr Geschiedensein ist selber bar allen weiteren
gleich gilt die Forderung:
-
-
-
Inhalts.21
Was sich in diesen Schlußüberlegungen zur Repulsion zeigt, läßt sich in freierer Erläuterung auch so fassen: Wenn wir von Gegenständen allein festhalten, daß ihrer viele sind, denken wir sie zusammen. Wir fassen sie darin aber nicht unter einem Gesichtspunkt zusammen, nicht kraft einer ihnen gemeinsamen Bestimmung, die sich an ihnen als je einzelnen Instanzen wiederauffinden ließe. Keiner der so Zusammengehaltenen ist für sich genommen viele; es ist wohl möglich, daß jeder dieser Gegenstände sich intern wieder als Pluralität denken läßt, aber das ist nicht das, was in ihrer Zusammenfassung als "viele" ausgesagt wird. Daß ihrer viele oder mehrere sind, drückt zunächst nur aus, daß sie zusammen- und ausein-
18 Um ein Mißverständnis auszuschließen, sei angemerkt, daß damit nicht der Stand des Zählens, sondern erst der unbestimmtere des Konstatierens von Pluralität überhaupt erreicht ist. Solange die Unterscheidung der Vielen formell, ohne inhaltliche Durchführung, bleibt, läßt sich nur festhalten, daß Eins Eins-unter-anderen-Eins ist. 19 Die Wissenschaft der Logik unterscheidet beide Ansichten des Verhältnisses von Einem und Vielen als "an sich seiende" oder "Repulsion dem Begriffe nach" und "zweite" oder "äußerliche" Repulsion. Vgl. HW 5, 187. 20 Vgl. ebd., 187. 21 Diese Inhaltsleere ist wieder nicht überraschend: Wegen des Ausfalls jeder Differenz zwischen dem Unterscheidenden und dem Unterschiedenen bleibt das, was die Unterschiedenen scheidet unbestimmt voraus-
gesetzt.
248
-
-
Das Fürsichsein in
Hegels Logik
andergehalten werden. Darin hebt sich das "Viele-Sein" deutlich von qualifizierenden Prädikaten erster Stufe ("Ein-F-Sein") ab. Zwischen erster und zweiter Repulsion zeichnet sich nun ein Widerspruch ab. Zunächst galt: Eins ist gar nicht zu denken, ohne es als Vieles zu denken. Jetzt gilt: Jedes dieser vielen Eins braucht, um gedacht werden zu können, das Viele nicht. "Die Vielheit der Eins ist die Unendlichkeit, als unbefangen sich hervorbringender Widerspruch." (WdL I; HW 5, 189) Als Widerspruch ihrer Beziehung der Repulsion ausgedrückt: Der wechselseitige Ausschluß stellt eine Beziehung zwischen solchen dar, die, abgesehen von dieser Beziehung, schon jeweils Eins sind und dies in der Ausschlußbeziehung auch unverändert bleiben. Sobald wir aber danach fragen, was es für jedes der Vielen heißt, Eins zu sein, tritt der Ausschluß anderer Eins, die Repulsion, in dieser Erklärung selbst auf; das war das Ergebnis der ersten Repul-
-
sion.
2.3.
Repulsion und Attraktion
Mit wechselnder Nuancierung wird dieser Widerspruch in den Termini "Ausschließen" und "Selbsterhaltung" terminologisch fixiert und weiter bestimmt: Das Ausschließen wird als eine Beziehung gedacht, die auf der Basis dessen auftritt, was die einander Ausschließenden je schon sind: "Hiermit findet nun die Repulsion das unmittelbar vor, was von ihr repelliert ist." (WdL I; HW 5, 190) Die Frage, was das Ausschlußverhältnis vorfindet, läßt sich nun auf zweierlei Weise beantworten: (1) Folgen wir dem Hinweis, daß wir diejenige Ansicht der Eins suchen, die ihrem Ausschluß vorausgesetzt ist, müssen wir sie in einer Weise charakterisieren, die sie noch nicht als gegeneinander Verschiedene fixiert. Entfernen wir so den wechselseitigen Ausschluß aus der Bestimmung der Eins, bleibt auf dem gegenwärtigen Stand nur, sie, ohne weitere Bestimmung, als sich auf sich Beziehende, als Seiende überhaupt, zu fassen. Damit freilich sind sie nicht mehr als Eins erhalten. Sind sie einander nämlich als bezugslos vorausgesetzt, dann gehört ihre Scheidung nicht zu dem, was sie sind. Ihre Unterscheidung fällt in ein Drittes, und als Geschiedene wären sie nicht mehr selbstbestimmt. (2) Dagegen wird im zweiten Schritt der Gedanke der Selbsterhaltung der Eins mobilisiert. Daß die vielen Eins einander ausschließen, kann kein durch ein nachträgliches Bezogenwerden hinzukommender Zug, sondern muß ihnen selbst einbeschrieben sein. Es muß schon zu jedem von ihnen gehören, auszuschließen und ausgeschlossen zu werden. Die negative Beziehung auf anderes muß sie als das erhalten, was sie, jedes für sich, schon sind. Daß sie unterschieden sind, müßte sich als Charakter an ihnen zeigen; sie müssen durch das unterschieden sein, was sie jeweils sind. Was die Repulsion dann vorfindet, schlägt in die Tautologie um: Das Ausschlußverhältnis findet einander Ausschließende vor. Derselbe Inhalt tritt dann einmal als Bestimmung der Relata und als Bestimmung ihrer Relation auf. Daß auch in dieser Variante die Selbständigkeit der Eins verschwindet, zeigt sich dem Versuch, im Vergleich der Eins den Charakter zu ermitteln, worin sich die Vielen voneinander unterscheiden. Diesem Vergleich stehen zwei Arten von Bestimmungen zur Verfügung: a) die einfache, unbezügliche Angabe dessen, was jedes der (auch noch) Bezogenen ist, und b) eine Angabe über die Beziehung, in der sie stehen. Diese Angaben sind aber für alle Vergleichskandidaten an dieser Stelle dieselben: Jedes ist an sich Eins und jedes unterhält zu
249
Friedrike Schick
nur eine Art von Beziehung: die des Ausschließens. Weder durch das, was sie sind, noch durch ihre Beziehung zueinander sind sie unterschieden. "Diese Vergleichung der Vielen miteinander ergibt sogleich, daß Eines schlechthin nur bestimmt ist wie das Andere; jedes ist Eins, jedes ist Eins der Vielen, ist ausschließend die anderen, so daß sie schlechthin nur dasselbe sind, schlechthin nur eine Bestimmung vorhanden ist." (WdL I; HW 5, 193) Gegen dieses Faktum läßt sich tatsächlich schlecht protestieren: Wo immer als einzige Information über mehrere Gegenstände angegeben wird, daß ihrer viele seien, ist wohl ausgesprochen, daß von Unterscheidbaren die Rede ist; aber in dieser Auskunft selbst sind sie nicht unterschieden. Wir erhalten durch diese Auskunft kein Kriterium zur Absonderung gegenständlicher Einheiten voneinander. In diesem Sinn behandelt die Auskunft die als unterscheidbar Unterstellten wie Eines. Diesen neuen Sachverhalt führt Hegel in der Wissenschaft der Logik unter dem Titel "Das eine Eins der Attraktion" weiter. Erreicht ist damit der Zusammenschluß beider Repulsionen. Daß der Schritt vom Eins zum Vielen aus dem Gedanken des Eins gewonnen ist, stellt sich der isolierenden, die Vielen als gegeben aufnehmenden Betrachtung der Vielen in Gestalt der einen, ihnen unterschiedslos zukommenden Bestimmung wieder her. Dieser Zusammenschluß bringt aber selbst ein Problem hervor, mit dessen Behandlung sich der Gedanke des Einen und Vielen abschließend als quantitativer, d. h. als gleichgültiges Bestimmen, identifizieren läßt. Fragen wir zunächst, wodurch sich nun dieses neue "eine Eins" von den vorangegangenen, den vielen Eins unterscheidet. Im Anschluß an das Vorige wird man sagen müssen: Dies eine Eins ist nichts anderes als die allen Eins gemeinsame und einzige Bestimmung, dasjenige, worin sie ununterschieden sind. Dieses eine Eins ist also nicht mehr als Eins unter vielen Eins gedacht, nicht als diesen nebengeordnetes Eins gleicher Stufe, sondern als Eins-von-vielen, als Einheit auch Unterschieden-Sein-Sollender. Von daher liegt es nahe, das Verhältnis zwischen dem Einen und den Einen nach dem Muster des Verhältnisses zwischen Allgemeinem und Sonderfall zu verstehen. Damit stimmt auch überein, daß die Wissenschaft der Logik an dieser Stelle die Rede von Idealität affirmativ wiederaufnimmt.22 Nun hat sich aber ergeben: In diesem Allgemeinen sind die vielen Eins nur gleich sie haben an diesem keinen Grund, kein Prinzip des Unterscheidens. Insofern diese Bestimmung allen gleich und allen ganz zukommt, kann sie nicht das sein, worin sie unterschieden sind. Gleichzeitig spricht dieses Allgemeine die Pluralität seiner Instanzen selber direkt aus. Wenn nicht jedes von ihnen Eins, ausschließend andere Eins wäre, hätten sie an diesem Allgemeinen nicht die ihnen adäquate, also auch nicht die allen gemeinsame Bestimmung. Wir stehen also vor dem Problem: Orientiert an dem Modell von Sonderfall und Allgemeinem bekommen wir ein Allgemeines, das genau dann, wenn es passende Fälle findet, das Ausschlußverhältnis zwischen seinen Fällen aufhebt und damit seine Anwendbarkeit auf diese Fälle dementiert.23 Daß damit ein unlösbares Problem vorgelegt sein sollte, ist aber wenig wahrscheinlich. Betrachten wir dazu ein Beispiel. Nehmen wir an: Ein Honigglas, eine Zeitung, eine Senftube, ein Reibeisen, drei Stifte, fünf Haferflocken, eine Gurke und ein Hut sind malerisch auf
anderen
-
-
22 Vgl. HW 5, 194. 23 Die Wissenschaft der Logik konstatiert diesen Befund als wechselseitige Voraussetzung von Attraktion und Repulsion. Die Gleichbehandlung der Vielen als vieler setzt die Vielen voraus, während deren wechselseitiger Ausschluß nur unter der Bedingung auszusagen ist, daß sie alle gleichermaßen Eins sind. Vgl. ebd., 195f.
250
einem Tisch verteilt. Gefragt, was für Gegenstände sich auf dem Tisch befänden, antwortet jemand: "Och, viele." Natürlich ist damit die Frage nicht beantwortet. Aber für sich betrachtet, ist die Auskunft, daß da viele sind, nicht schon deswegen falsch, weil die Gegenstände von verschiedener Art sind. Der Antwortende hat sie nicht bestimmt unterschieden aber er einer Art seien. hat sie von Er hat auch nicht die Gegenbehauptung aufgestellt, daß sie genau der Art nach Zu der ein wovon nicht gleichgesetzt. Frage, jedes eines, Exemplar ist, hat er sich schlicht nicht geäußert. Was unsere problematische Fassung von dem problemlosen Beispiel unterscheidet, ist eine Zusatzvoraussetzung, die in unsere Fassung eingeflossen war: die Voraussetzung, daß wir an dem Eins-von-vielen selbst einen affirmativen und einen negativen Beziehungsgrun*/ der Vielen finden müßten. Wird dieser Anspruch erlassen, löst sich auch das Problem. Aber mit welchem Recht kann er erlassen werden? Bleiben wir bei dem sicheren negativen Befund: Die allen gleiche Bestimmung, Eins zu sein, ist offenkundig nicht geschickt, zuvor Unbestimmtes als einen Fall eines Allgemeinen erst herzustellen. Diese Bestimmung ist aber auch nicht das erste Allgemeine, das sich ergeben hat; ihre Grundlage war bereits ein Verhältnis von Allgemeinem und Sonderfall. Eins-von-vielen bezieht sich bereits auf ideell Gefaßtes, auf etwas, was als Sonderfall eines Allgemeinen gewonnen ist. Diese Voraussetzung ist dem Eins-von-vielen auch selbst einbeschrieben. Die gleichermaßen als Sich-Unterscheidende Gefaßten müssen, indem sie als Sich-Unterscheidende gefaßt sind, auch in sich zu unterscheiden sein; denn das Sich-Unterscheiden zeigt an, daß das Unterschiedensein des Gedachten nicht neben, sondern in seine übergreifende Bestimmung fällt. Der Rede von Eins und vielen Eins muß eine Weise des Bestimmtseins logisch vorangehen, in der etwas in seiner Bestimmung auch den Grund seines Unterschiedenseins hat. So bestätigt sich, daß der Schritt zum Eins auf der Nichtexplikation von Binnendifferenzen des Gedachten aufraht, die gleichwohl die bleibende Unterstellung der folgenden Schritte bilden. Das mit der Re-Idealisierung der Vielen, der Entdeckung ihrer unterschiedslosen Gleichheit, eröffnete Problem löst sich also dadurch, daß dieser Schritt als Idealisierung zweiter Stufe verstanden wird. Das Eins-von-vielen eignet sich nicht dazu und ist auch gar kein Versuch, die Frage zu beantworten, was etwas zu Einem macht. Diese Frage wird nicht autark innerhalb der kategorialen Sphäre des Einen und Vielen beantwortet, sondern durch Antworten auf die Was-Frage. Der Gedanke des Eins spricht auf dieser Basis und unter Absehung davon, als was etwas festgestellt wurde, das Resultat dieser Operation aus. In diesem Absehen liegt der Grund dafür, daß sich dieses neue Bestimmen vom qualitativen ablöst, dieses gleichgültig bestehen läßt. Da nämlich das abstrakte Resultat für alles, was bereits als Fall eines Allgemeinen gefaßt worden ist, dasselbe ist, verhält sich die neue, quantitative Weise, die Dinge zu sehen, entsprechend liberal: Sie erlaubt auch noch wie im letzten Beispiel die Gleichbehandlung Heterogener. "Viele" zu sagen, ist also und bleibt eine gleichmachende Behandlung aber zugleich eine, die verträglich ist mit der Anerkennung relevanter Unterschiede der Gleichbehandelten. Das gilt deshalb, weil diese Aussageweise nicht mehr mit erststufigen Antworten auf die Was-Frage konkurriert. Eines-Sagen und Vieles-Sagen setzt mithin eine Grenze aber eine, die nicht selbst ein Kriterium dafür aufbietet, wo sie zu seteine Grenze, "die keine ist, die am Sein aber ihm gleichgültig ist" (WdL I; HW 5, zen ist -
-
-
-
200).
-
-
Wolfgang Lefèvre
Repulsion und Attraktion.
Der Exkurs "Die Kantische Konstruktion der Materie aus der Attraktiv- und Repulsivkraft" in Hegels Wissenschaft der Logik
I
Kant als Vollender des Atomismus
Der Exkurs "Die Kantische Konstruktion der Materie aus der Attraktiv- und Repulsivkraft" gehört zum "Fürsichsein"-Kapitel des ersten Buchs der Hegelschen Wissenschaft der Logik (1812), der "Lehre vom Sein".1 Gegentand des Exkurses ist die dynamische Materietheorie, die Kant in den Metaphysischen Anfangsgründe(n) der Naturwissenschaften (1786) veröffentlicht hatte. Kants Naturphilosophie wurde von Hegel an verschiedenen Stellen seines Werks sowohl lobend als auch tadelnd erwähnt, charakterisiert oder dargestellt, nirgendwo jedoch so umfassend wie in diesem Exkurs. Selbst in seiner Naturphilosophie, dem zweiten Teil der Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften (1816), wo man die ausführlichste Auseinandersetzung erwarten würde, verweist Hegel an der entsprechenden Stelle auf seine Darstellung und Kritik in der Logik.2 Und auch später, als er 1830 das erste Buch der Logik für eine Neuausgabe z. T. dramatisch überarbeitete, scheint er keinen Anlaß gesehen zu haben, an diesem Exkurs etwas Grundsätzliches zu revidieren. Wir können ihn deswegen als den entscheidenden und endgültigen Text Hegels zu Kants Naturphilosophie ansehen. In Hegels Logik finden sich verschiedentlich Exkurse, die nicht zum eigentlichen Argumentationsgang des Werks gehören allein das "Fürsichsein"-Kapitel enthält nicht weniger als vier solcher Exkurse: zur Atomistik, zu Leibniz' Monadologie, zum "Satz der Einheit des Eins und des Vielen", in dem Piatos Parmenides den Hintergrund bildet, und eben zu Kants Materietheorie. Ob diese Ausflüge in philosophiegeschichtliche oder realphilosophische Felder der Verhandlung der Logik und dem Verständnis des Lesers förderlich sind oder nicht, läßt sich natürlich nicht generell sagen, sondern muß in jedem Einzelfall entschieden werden. Dasselbe gilt für die Frage, ob die Einbettung in den Entwicklungsgang der Hegelschen -
1 2
Vgl. HW 5,195ff. Vgl. Enz. §262;HW9, 61.
Repulsion und Attraktion
Logik dem Verständnis der Sachverhalte oder Theorien dient, die Gegenstände dieser Exkurse sind. Aber zweifellos gilt generell, daß diese Verknüpfung und Einbindung zusätzliche Anhaltspunkte bereitstellt, die uns besser verstehen lassen, wie Hegel diese Gegenstände auffaßte. Am Fall der Kantischen Materietheorie zeigt sich das besonders eindrucksvoll. Durch die Einbettung in den Entwicklungsgang des "Fürsichseins" wird eine unerwartete Dimension des Hegelschen Verständnisses dieser Theorie erkennbar, durch die es sowohl dem Selbstverständnis Kants als auch der üblichen Interpretation dieser Theorie diametral widerspricht. In der gerafften Fassung der sog. Kleinen Logik, d. h. des ersten Teils der Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, tritt diese Dimension besonders deutlich hervor: "Die atomistische Philosophie ist dieser Standpunkt, auf welchem sich das Absolute als Fürsichsein, als Eins, und als viele Eins bestimmt. Als ihre Grundkraft ist auch die am Begriffe des Eins sich zeigende Repulsion angenommen worden, nicht aber so die Attraktion [...]. Die neuere Atomistik [...] hat sich [...] dem sinnlichen Vorstellen nähergebracht, aber die denkende Bestimmung verlasIndem ferner der Repulsivkraft eine Attraktivkraft an die Seite gesetzt wird, so ist der Gesen. gensatz zwar vollständig gemacht [...]. Aber die Beziehung beider aufeinander, was das Konkrete und Wahrhafte derselben ausmacht, wäre aus der trüben Verwirrung zu reißen, in der sie auch noch in Kants Metaphysischen Anfangsgründen der Naturwissenschaft gelassen ist." -
Danach wäre Kants dynamische Materietheorie der, wenn auch noch "trübe", Abschluß der bis in die griechische Antike zurückreichenden naturtheoretischen Tradition des Atomismus. Und zwar Abschluß keineswegs in dem Sinne, daß sie den Atomismus überwunden hätte. Vielmehr erscheint sie hier gewissermaßen als der krönende Abschluß des Atomismus, als seine Vollendung. Dies ist eine Einordnung, wie man sie sich befremdlicher kaum vorstellen kann. Kant selbst verstand seine dynamische Theorie der Materie bekanntlich gerade als Alternative zu der atomistischen Materietheorie, die seit dem Aufkommen der neuzeitlichen Mechanik im 17. Jahrhundert zu den kaum hinterfragten Grundannahmen des naturwissenschaftlichen Denkens gehörte. Es ging ihm darum zu zeigen, daß aus den Grundbegriffen der neuzeitlichen Mechanik insbesondere aus der Definition der Dichte als Quotient von Masse und Volumen, wie sie z. B. implizit in der 1. Definition der Principia mathematica Newtons vorliegt,4 keineswegs der Schluß zu ziehen ist, daß nur eine atomistische Materieauffassung mit ihnen vereinbar ist. Mit einem Satz aus der "Allgemeine(n) Anmerkung zur Dynamik" in Kants Metaphysische(n) Anfangsgründen: -
-
"Um zu
nun
eine
dynamische Erklärungsart einzuführen [...],
ist
sei, sich einen specifischen Unterschied der Dichtigkeit der Räume zu denken, durch die bloße Anführung einer Art, wie lasse, zu widerlegen."5
3 4
5
gar nicht
nöthig
Hypothesen unmöglich Materien ohne Beimischung leerer
es
neue
schmieden, sondern allein das Postulat der blos mechanischen Erklärangsart: daß er
sich ohne
es
Widerspruch
denken
Enz. § 98; HW 8, 206f. "The quantity of matter is the measure of the same, arising from its density and bulk conjointly." I. Newton, Mathematical Principles of Natural Philosophy, ed. F. Cajori, Berkeley (University of California Press) 1934, I 1. Immanel Kant, "Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaften", in Werke. Akademie-Textausgabe. Berlin 1968, Bd. 4, 533.
253
Wolfgang
Lefèvre
Dabei richtete sich Kants Kritik des Atomismus keineswegs allein oder in erster Linie gegen die leeren Räume, zu denen zu sagen ist, daß sie zum einen nicht zu den unverzichtbaren Annahmen der neuzeitlichen atomistischen Materietheorien gehörten wie z. B. an Descartes' Materietheorie studiert werden kann und daß sie zum anderen, soweit sie unterstellt wurden, gerade in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts zum Aufenthaltsort einer wachsenden Zahl von "imponderabilen" Materien avancierten des Äthers, des Wärmestoffs, der elektrischen und magnetischen Materien etc. Im Zentrum seiner Kritik stand vielmehr die praktisch von allen damaligen Naturtheoretikern geteilte Annahme, daß Ausdehnung, Gestalt und Undurchdringlichkeit zu den essentiellen und nicht weiter ableitbaren Grundeigenschaften der Materie gehören, aus der alle physikalischen Körper bestehen, d. h. zusammengesetzt sind. Nach Kant sollte dagegen die Tatsache, daß eine Materie einen bestimmten Raum erfüllt (Ausdehnung und Gestalt) und andere Materie von diesem Raum ausschließt (Undurchdringlichkeit), aus dem Zusammenspiel zweier entgegengesetzter Kräfte resultieren, einer ursprünglichen, d. h. nicht weiter ableitbaren, Repulsionskraft und einer ebenso ursprünglichen Attraktionskraft. Kant verstand seine Materietheorie nicht bereits deswegen als eine dynamische Theorie, weil er repulsive und attraktive Kräfte der Materie annahm. Dies Annahme einte im 18. Jahrhundert die Anhänger der Newtonschen Dynamik und grenzte sie von der auf Descartes zurückgehenden mechanizistischen Naturtheorie ab, die die Interaktionen zwischen materiellen Entitäten auf Bewegungsübertragung durch Druck und Stoß beschränkte.6 Die Newtonianer gingen jedoch nicht weniger als die Anhänger der mechanizistischen Naturtheorie von Ausdehnung, Gestalt und Undurchdringlichkeit als den unableitbaren essentiellen Eigenschaften der Materie aus. Dynamisch ist Kants Materietheorie nach seinem eigenen Verständnis deswegen erst dadurch, daß sie diese für ursprünglich gehaltenen Materieeigenschaften aus den als ursprünglich gesetzten Kräften Repulsion und Attraktion ableitet. Materie ist auf diese Weise als "Verbindung der ursprünglichen Kräfte der Zurückstoßung und Anziehung"7 gedacht. Von der alten Materiekonzeption aus betrachtet, mögen diese Kräfte sogar als Materie konstituierende Kräfte erscheinen, weil Kant auf sie das zurückführt, was bis dahin als die Essenz von Materie galt. Indem Kant seine Materiekonzeption in dieser Weise gegen die der neuzeitlichen Naturwissenschaften stellte, brach er zugleich mit der Materiekonzeption in der Tradition des anti-
-
-
6
Insofern ist das Lob, das Hegel Kant in diesem Exkurs zollt, merkwürdig: "Es ist Kant vornehmlich um die Verbannung der gemein-mechanischen Vorstellungsweise zu tun, [...] die Vorstellungsweise, welche wie Kant sagt, sonst keine bewegenden Kräfte als nur durch Druck und Stoß, also nur durch Einwirkung von außen einräumen will. Diese Äußerlichkeit des Erkennens setzt die Bewegung immer schon als [an] der Materie äußerlich vorhanden voraus und denkt nicht daran, sie als etwas Innerliches zu fassen und sie selbst in der Materie zu begreifen, welche eben damit für sich als bewegungslos und als träge angenommen wird. [...] Indem Kant jene Äußerlichkeit zwar insofern aufhebt, als er die Attraktion, die Beziehung der Materien aufeinander, [...] zu einer Kraft der Materie selbst macht, so bleiben" (HW 5, 203f.). Hegel lobt hier zu wenig und zuviel zugleich; zu wenig, indem er etwas hervorhebt, was er bei jedem Newtonianer loben könnte und was Kant gerade nicht spezifisch auszeichnet; zuviel, als er nicht zu Kenntnis nimmt, daß wenigstens der Kant der Metaphysische(n) Anfangsgründe die Materie ausdrücklich als für sich bewegungslos und träge bestimmt vgl. die Anmerkung zum Lehrsatz 3 des Mechanik-Abschnitts in "Metaphysische Anfangs-
gründe" (Anm. 5), -
7
Ebd., 532.
254
544.
Repulsion und Attraktion ken Atomismus. Auch wenn für die neuzeitlichen Naturtheorien die Frage des leeren Raums, wie bereits bemerkt, keine entscheidende Rolle mehr spielte und ebensowenig das Problem der begrenzten oder unbegrenzten Teilbarkeit der Materie, d. h. ob sie als etwas Diskretes oder Kontinuierliches zu denken ist, muß ihr Materiekonzept dieser Tradition zugerechnet werden. Es hielt nämlich an der essentiellen Annahme des antike Atomismus fest, daß alle Körper in letzter Instanz aus einer Grundmaterie zusammengesetzt sind, deren undurchdringliche Einheiten sich nur nach Größe und Gestalt unterscheiden. Zwischen Kants Materietheorie und der der atomistischen Tradition besteht also durchaus eine Affinität, nämlich die einander entgegengesetzter Positionen. Hegels Kant-Exkurs im "Fürsichsein"-Kapitel seiner Logik ist also nicht deswegen überraschend und verwirrend, weil er Kants Materietheorie mit der atomistischen in Zusammenhang bringt, sondern weil er dort Kants Naturphilosophie als Vollendung des Atomismus auftreten läßt, anstatt als eine neuzeitliche Gegenkonzeption zu ihm. Der Hegelschen Einordnung der dynamischen Materietheorie Kants muß deswegen eine fundamentale Voraussetzung zugrundeliegen, die wir noch nicht verstehen. Die nächstliegende Vermutung ist, daß diese Voraussetzung in seiner Atomismus-Auffassung zu entdecken ist. Bevor wir auf Hegels Darstellung und Kritik der Kantischen Materietheorie im einzelnen eingehen, soll deswegen zunächst untersucht werden, ob Hegels Verständnis des Atomismus die Erklärung für seine befremdliche Sicht des Zusammenhangs zwischen Kant und dem Atomismus enthält (Teil II). Der anschließende Abschnitt wird dann den Einwänden gewidmet sein, die Hegel im Zusammenhang mit den logischen Beziehungen des "Fürsichsein"-Kapitels gegen Kants Theorie erhebt (Teil III). Nach einem kurzen Intermezzo zur Verwendung der Termini Repulsion und Attraktion in einer logischen und in einer physikalischen Bedeutung (Teil IV) will ich in einem abschließenden Abschnitt auf den Einwand Hegels eingehen, an dem deutlich wird, worum es bei Hegels Kritik an Kant in naturphilosophischer Hinsicht ging (Teil V).
LT
"Die atomistische Philosophie"
Ein großer Teil dessen, was Hegel im "Fürsichsein"-Kapitel über den Atomismus ausführt, ist nicht weniger befremdlich als seine Einordnung der Materietheorie Kants. Eine merkwürdige Aussage soll uns als Einstiegspunkt dienen. In der oben zitierten Passage aus dem § 98 der Kleinen Logik behauptet Hegel, daß der Atomismus die Repulsion als eine Grundkraft unterstelle: "Die atomistische Philosophie ist dieser Standpunkt, auf welchem sich das Absolute als Fürsichsein, als Eins, und als viele Eins bestimmt. Als ihre Grundkraft ist auch die am Begriffe des Eins sich zeigende Repulsion angenommen worden, nicht aber so die Attraktion, sondern der Zufall, d. i. das Gedankenlose, soll sie
zusammenbringen."8
nicht, welcher Atomist diese Grundkraft angenommen habe, die weiteren Hegel sagt Sätze lassen aber nur den Schluß zu, daß er meint, dies sei bereits eine Annahme der Antike zwar
gewesen. Denkt
8
Enz.
§ 98;
man an
die
Fragmente
und Texte der antiken Atomisten
(Leukipp,
Demo-
HW 8, 206.
255
Wolfgang
krit, Epikur, Lucretius),
Lefèvre
nicht, worauf sich Hegel stützen könnte. Natürlich findet sich bei diesen Philosophen die Annahme, daß kollidierende Atome voneinander abprallen können (was jedoch eher ein Problem für sie darstellte, da sie mit den Kollisionen gerade die Konfiguration von Atomen erklären wollten). Es ist jedoch wenig wahrscheinlich, so
sieht
man
daß Hegel daran gedacht hat. Das Stoßphänomen hat ja nichts mit einer Repulsionskraft zu tun, wenigstens dann nicht, wenn darunter eine Kraft verstanden wird, mit der sich materielle Entitäten auf Distanz halten.9 Und an eine solche scheint Hegel zu denken, weil es sonst keinen Sinn macht, daß er wenige Sätze später die Attraktivkraft als Gegensatz zu dieser Repulsivkraft anführt und schließlich Kants Theorie als eine Theorie der Beziehung dieser beiden Grundkräfte. Aus eben diesem Grund scheint mir klar zu sein, daß auch das "clinamen" (Epikur/Lucretius) nicht gemeint sein kann.10 Es ist also zunächst nicht klar, wie Hegel zu seiner Behauptung kommt, der antike Atomismus habe die Repulsion als eine Grundkraft angenommen, und diese Frage läßt sich auch nicht durch die Feststellung erledigen, daß sich diese Behauptung weder an entsprechender Stelle in der Wissenschaft der Logik findet noch, falls ich nicht etwas übersehen habe, bei der Behandlung des antiken Atomismus in den Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie}^ Denn es ist auszuschließen, daß es sich bei der zitierten Passage aus der Kleinen Logik vielleicht um ein Versehen handeln könnte. Dafür ist die Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften mit ihren drei von Hegel selbst besorgten Ausgaben einfach ein zu sorgfältig redigiertes Werk. Nun gibt es eine ganz deutliche Spur, wie Hegel zu dieser Behauptung kam, eine Spur, die uns direkt zum Kern seiner Atomismus-Auffassung führen wird. In der zitierten Passage hieß es: "Als ihre Grundkraft ist auch die am Begriffe des Eins sich zeigende Repulsion angenommen worden [...]". Die Repulsion zeigt sich also am Begriff des Eins, von dem Hegel natürlich behaupten kann, daß er der Philosophie der Antike angehört. Wenn Hegel weiterhin damit recht haben sollte, daß es das Verdienst des antiken Atomismus war, "das Absolute als Fürsichsein, als Eins, und als viele Eins"12 zu bestimmen, dann scheint er auch berechtigt, ihm darüber hinaus das Verdienst zuzusprechen, implizit auch diejenige Beziehung gefaßt zu haben, die sich am Eins zeigt. Die negative Beziehung auf sich, die dem Eins nach Hegel spezifisch zukommt, ist dadurch charakterisiert, daß es sich von sich selbst abstößt, sich selbst repelliert.13 Wenn dies im antiken Atomismus implizit mitgedacht war, dann kann die Behauptung, er habe die Repulsion angenommen, allenfalls als eine kleine Übertreibung gerügt werden. Natürlich stellt sich als erstes die Frage: An wessen Begriff des Eins zeigt sich die Repulsion an dem eines antiken Philosophen oder an dem Hegels? Diese Frage ist bekanntlich in Hegels Augen prinzipiell unzulässig. Für ihn gibt es nur einen Begriff des Eins. Jeder philosophische Begriff ist für ihn historisch und überhistorisch zugleich. Er tritt zwar erst in einer -
9 Vgl. HW 5, 193: "[...] Repulsion [...] als gegenseitiges Abhalten 10 Die Parallele die Kant selber zwischen Clinamen und Repulsion
[...]". sah, ist von ihm sehr klar als die eines funkgekennzeichnet worden, vgl. Kant, Werke (Anm. 5), Bd. 1, 226 und Bd. 2, 123, und
tionalen Äquivalents diese Parallele bezieht sich selbstverständlich überdies
Materiepartikeln. Vgl. Hegel, Vorlesungen
11 12 Enz. § 98; HW 8, 206. 13 Vgl. HW5, 187.
256
nur
auf eine Repulsion zwischen bereits vorhandenen
über die Geschichte der Philosophie, HW 18, 353ff.
Repulsion und Attraktion bestimmten geschichtlichen Situation, im Rahmen eines bestimmtes Gedankensystem in der Geschichte der Philosophie, hervor, hat jedoch zugleich seinen Ort und seine wahre Bedeutung im vollendeten Netz der philosophischen Begriffe, in der philosophischen Logik. Erinnert sei nur an die bekannte Passage aus der Einleitung zu seinen Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie: "Nach dieser Idee behaupte ich nun, daß die Aufeinanderfolge der Systeme der Philosophie in der Geschichte dieselbe ist als die Aufeinanderfolge in der logischen Ableitung der Begriffsbestimmungen der Idee. Ich behaupte, daß man die Grundbegriffe der in der Geschichte der Philosophie erschienenen Systeme rein dessen entkleidet, was ihre äußerliche Gestaltung, ihre Anwendung auf das Besondere und dergleichen betrifft: so erhält man die verschiedenen Stufen der Bestimmung der Idee selbst in ihrem logischen Begriffe. Umgekehrt, den logischen Fortgang für sich genommen, so hat man darin nach seinen Hauptmomenten den Fortgang der geschichtlichen Erscheinungen; aber man muß freilich diese reinen Begriffe in dem zu erkennen wissen, was die geschichtliche Gestalt enthält."14
Hegel unterscheidet also durchaus zwischen dem Begriff selbst und der Form, in der er in einem bestimmten historischen System der Philosophie gefaßt wurde. Aber aufgrund seiner Sicht, wie die historische und logische Entwicklung der philosophischen Begriffe zusammenhängt, glaubt er sich berechtigt, die Auffassung des jeweiligen historischen philosophischen Systems so darzustellen, wie sie seiner Theorie nach ihrem Begriff entsprochen hätte. Und dies gilt auch in unserem Falle. Der Atomismus, den Hegel im Zusammenhang des "Fürsichsein"-Kapitels anführt, ist der Atomismus, der seinem Begriff entspricht. Der historische Atomismus kommt dagegen mehr oder weniger nur in Hegels abschätzigen Bemerkungen über seine "Inkonsequenzen" und "Gedankenlosigkeiten" zur Sprache. Da es keinen Grund gibt, Hegel unbesehen zu glauben, daß sein Begriff des Atomismus dem historischen Atomismus gerecht wird, ist zunächst nur zu konstatieren, daß Hegel auf einen Atomismus Bezug nimmt, der seiner Idee eines philosophischen Atomismus entspricht und der insofern Hegels Atomismus genannt werden könnte. Hegel sah seinen Atomismus als den "logischen Begriff des historischen Atomismus an, wir dagegen müssen zwischen Hegels Begriff des Atomismus und dem historischen Atomismus unterscheiden. Um Verwechslungen vorzubeugen, werde ich im Folgenden den Hegelschen Ausdruck "atomistische Philosophie" gebrauchen, wenn sein Begriff des Atomismus gemeint ist. Hegels "atomistische Philosophie" interessiert uns hier als ein Hintergrund seiner KantKritik, weshalb ihr Vergleich mit dem historischen Atomismus unterbleiben kann. Gleichwohl werden wir sie nicht ohne philosophiehistorische Rückgriffe verstehen. Hegels "atomistische Philosophie" läßt sich nämlich von einer philosophiegeschichtlichen Konstruktion her verständlich machen, die sich zugleich in seiner Wissenschaft der Logik niederschlug, falls nicht richtiger oder wenigstens genau so richtig gesagt werden muß, daß seine logische Konstruktion ihn bei der Interpretationen des entsprechenden Abschnitts der Philosophiegeschichte leitete. Im "Fürsichsein"-Kapitel lesen wir: -
-
"Das Eins [...] ist die Stufe der Kategorie, die bei den Alten als das atomistische Prinzip vorgekommen ist, nach welchem das Wesen der Dinge ist das Atome und das Leere [...]. Die Abstrak-
14 HW 18, 49.
257
Wolfgang Lefèvre tion, zu dieser Form gediehen, hat eine größere Bestimmtheit gewonnen als das Sein des Parmenides und das Werden des Heraklit "
Die Ansicht, daß der Atomismus Leukipps und Demokrits die Aufhebung des "Seins" des Parmenides und seiner Antithese, des "Werdens" des Heraklit, darstelle, legt Hegel in den Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie mit großer Ausführlichkeit dar. Zunächst im Hinblick auf die Begriffe "Sein" und "Nichts": Das Seins ist, das Nichts ist nicht (Parmenides) / Sein und Nichts sind dasselbe (Heraklit) / Sein und Nichts sind gleichermaßen (Leukipp).16 Sodann im Hinblick auf den Begriff des "Fürsichseins": Das Sein als abstrakt Allgemeines (Parmenides) / Sein und Nichts im Prozeß (Heraklit) / Eins, Fürsichsein (Leukipp). 17 Das "Fürsichsein" erscheint so als die abschließende und aufhebende Kategorie in der Triade "Sein" / "Werden" / "Fürsichsein", und auch die naheliegende Frage, wie sich das zu der Triade "Sein/Nichts/Werden" / "Dasein" / "Fürsichsein" verhält, die er seiner Logik zugrundelegte, also warum es keine philosophiegeschichtliche Entsprechung zur Kategorie des "Daseins" gibt, wird explizit in diesem Zusammenhang erörtert.18 Zu dieser Konstruktion ließe sich philosophiegeschichtlich natürlich Vieles anmerken und mancher Einwand erheben. Deskriptiv und bloß als Schematisierung genommen, also ohne die Entwicklungslogik, die Hegel damit verbindet, wird man mit der ersten Reihe Das Seins ist, das Nichts ist nicht (Parmenides) / Sein und Nichts sind dasselbe (Heraklit) / Sein und Nichts sind gleichermaßen (Leukipp) wohl kaum größere Probleme haben. Anders verhält es sich dagegen mit der zweiten Reihe Das Sein als abstrakt Allgemeines (Parmenides) / Sein und Nichts im Prozeß (Heraklit) / Eins, Fürsichsein (Leukipp) -, und zwar deswegen, weil hier der Begriff "Eins" dem Parmenides ab- und dem Leukipp zugesprochen wird. Zumindest auf den ersten Blick fällt es schwer, das nachzuvollziehen. Parmenides charakterisierte das Sein ausdrücklich als Eins Piatos Dialog Parmenides, in dem es um das Problem von Eins und Viele geht und den Hegel in unserem Zusammenhang ausdrücklich erwähnt,19 ist nicht zufällig ein Dialog mit Parmenides und nicht mit Leukipp. Erinnert sei ferner an die berühmte Paradoxie des Eleaten Zenon, nach der nur Eins ist, nicht Vieles. Der Atomismus von Leukipp und Demokrit läßt sich ja als Antwort auf diese und andere Herausforderungen der eleatischen Philosophie verstehen, und zwar als eine Antwort, die bestimmte Positionen dieser Philosophie revidiert, um an ihren Grundsätzen festhalten zu können: So die Konstruktion des Vollen und des Leeren, die erlauben sollte, Bewegung zu denken (auch hier sei an die berühmte Paradoxie des Zenon erinnert, daß Bewegung nicht möglich ist), ohne das Volle, das Sein, wieder in den Strudel von Werden und Vergehen hineinzureißen; und so auch die Konstruktion der vielen Atome und ihrer unterschiedlichen Konfigurationen, die erlauben sollte, die qualitativen Unterschiede und sogar das Werden und Vergehen selbst zu denken, ohne in das fundierende Sein, die Atome, Zweideutigkeiten hineinzutragen. Aber auch hier soll nicht in eine philosophiegeschichtliche Diskussion mit Hegel eingetreten werden. Dafür müßten wir einerseits Hegels Argumenten weitaus sorgfältiger und umfänglicher nachgehen, insbesondere seiner Parmenides-Interpretation, und andererseits für -
-
-
-
15 HW 5, 184f. 16 HW 18, 355. 17 Vgl. ebd., 356. 18 Vgl. ebd., 357. 19 Vgl. HW 5, 193.
258
Repulsion und Attraktion Einwände mit den Quellen und mit heute anerkannten Interpretationen argumentieren, beides würde uns zu weit von unserem Problem wegführen. Uns interessiert, was diese philosophiegeschichtliche Konstruktion für seine "atomistische Philosophie" bedeutet, und wir sollten deswegen fragen, was Hegel eigentlich durch seine Behauptung gewinnt, erst die Atomisten Leukipp und Demokrit hätten die Kategorie Eins als ein Prinzip der Philosophie unsere -
aufgestellt.
Die Antwort scheint mir eindeutig und zugleich ganz simpel zu sein: Nur so kann Hegel seinen Begriff des Eins mit der ihm eigenen Dialektik von Eins und Viele historisch verorten. Man überlege sich die Alternative! Gesetzt, der Begriffdes Eins gehörte dem Parmenides an, während die Atomisten das Viele zu ihrem Prinzip machten. Dann ergäbe sich, daß der Begriff des Eins bei Parmenides gerade das Viele ausschließt, und das Viele der Atomisten umgekehrt das Eins der Eleaten negiert. Das Eins und das Viele wären so aber sich wechselseitig ausschließende Kategorien, zwischen denen allenfalls ein (oszillierender) Übergang wie das Werden zwischen Sein und Nichts stattfindet. Das wäre jedoch ein unbrauchbares Resultat, wenn der Begriff des Eins im Fortgang der Logik die Rolle spielen soll, die ihm zugedacht ist. Deswegen: "Das Eins ist somit Werden zu vielen Eins. Eigentlich ist dies aber nicht sowohl ein Werden; denn Werden ist ein Übergehen von Sein in Nichts; Eins hingegen wird nur zu Eins. [...] Statt des Werdens ist also erstens die eigene immanente Beziehung des Eins vorhanden; und zweitens, insofern sie negativ und das Eins seiendes zugleich ist, so stößt das Eins sich selbst von sich ab. Die negative Beziehung des Eins auf sich ist Repulsion."
Die Dialektik des Eins und des Viele, um die es Hegel geht, kann nicht entfaltet werden als Dialektik zwischen diesen Begriffen; sie muß vielmehr als interne Dialektik des Begriffs Eins selbst konzipiert werden. Nur dann ist das Eins bzw. das Fürsichsein die geeignete Kategorie, die den Qualitäts-Abschnitt seiner Seinslogik abschließen kann. Auf der anderen Seite ist es außerordentlich schwierig, für die Kategorie des Eins, wie sie Hegel konzipiert und braucht für den Fortgang seiner Logik, eine philosophiegeschichtliche Verortung in der Philosophie der Antike zu finden, die sich so zwanglos anbieten würde wie die für die Kategorien Sein, Nichts und Werden. Daß seine Zuordnung der Kategorie Eins zu Leukipp und Demokrit problematisch ist, gesteht Hegel übrigens unfreiwillig ein: Wenn nicht einmal die großartige, aporetisch endende Untersuchung der Kategorien Eins und Viele, die der alte Plato im Parmenides unternimmt, Gnade in seinen Augen findet,2 ' was kann dann von Leukipp und Demokrit in dieser Hinsicht erwartet werden? Wie auch immer, Hegel verortete seine Kategorie des Fürsichseins philosophiegeschichtlich, indem er das Eins zum Prinzip der Atomisten erklärte: "Die atomistische Philosophie ist dieser Standpunkt, auf welchem sich das Absolute als Fürsichsein, als Eins, und als viele Eins bestimmt."22 Diese Verortung ist die Kreation seiner "atomistischen Philosophie". Die Eigenart dieses "Atomismus" besteht genau darin, daß die Hegeische Kategorie des Fürsichseins oder Eins sein organisierendes Prinzip ist, von dem aus nun diejenigen seiner charakte-
20 Ebd., 187. 21 Vgl. ebd., 193 und 106. 22 Enz. § 98; HW 8, 206.
259
Wolfgang
Lefèvre
ristischen Züge, die für Hegels Einordnung der Kantischen Materietheorie entscheidend sind, mit wenigen Strichen skizziert werden können. Das Eins in der angedeuteten spezifischen Bestimmung ist also das Prinzip dieser "atomistischen Philosophie". Es ist charakterisiert durch eine bestimmte negative Beziehung auf sich, die Hegel "Repulsion" nennt. Die Repulsion ist zunächst "das Setzen der vielen Eins". Diese "an sich seiende" Repulsion "bestimmt sich" zu einer zweiten, "der äußerlichen" Repulsion fort. Bei dieser zweiten handelt es sich um "die der Vorstellung der äußeren Reflexion zunächst vorschwebende" Repulsion, wonach sie nicht als "das Erzeugen der Eins, sondern nur als gegenseitiges Abhalten vorausgesetzter, schon vorhandener Eins" verstanden wird.23 Diese Repulsion, in all ihren dialektischen Zügen durchbuchstabiert, erweist sich schließlich als ein "negatives Verhalten der Eins zueinander", das "nur ein Mit-sich-Zusammengehen" ist, und so als ein "Sich-in-ein-Eines-Setzen", d. h. als "Attraktion".24 Entsprechend folgt eine Entwicklung der dialektischen Beziehung von Repulsion und Attraktion, bei der hier zunächst nur wichtig ist, daß es sich dabei nicht um die Dialektik einer anderen Kategorie handelt, sondern um die entwickelte Gestalt der internen Dialektik des Eins.25 D. h. nicht nur die Repulsion gehört zum Begriff des Eins, sondern ebenso die Attraktion, und die dialektische Beziehung beider ist die ausbuchstabierte Form der Dialektik des Eins als Prinzip der "atomistischen Philosophie". Von hier aus scheint es ganz selbstverständlich, Kants dynamische Materietheorie, die die Materie als "Verbindung der ursprünglichen Kräfte der Zurückstoßung und Anziehung"26 begriff, als eine Theorie zu verstehen, die die Dialektik der "atomistischen Philosophie" in ihrer entwickeltsten Form, nämlich als die von Repulsion und Attraktion, zu fassen versuchte, und so als die bis dahin vollendetste Gestalt dieses Atomismus. Unser anfängliches Befremden über Hegels Einordnung der Kantischen Materietheorie wäre gegenstandslos geworden, wenn wir diese "atomistische Philosophie" Hegels für den historischen Atomismus akzeptieren würden, oder, weniger prinzipiell, wenn wir von der Tatsache, daß beide die Worte "Repulsion" und "Attraktion" gebrauchen, ohne weiteres den Schluß zögen, daß beide über dasselbe reden. In jedem Fall können wir uns jetzt den Einzelheiten der Hegelschen Kritik an Kants dynamischer Materietheorie zuwenden. -
HI
Hegels Kritik I Nichtige Unterschiede und -
bewußtloses Ineinander-Übergehen
Der Exkurs zu Kants "Konstruktion der Materie aus der Attraktiv- und Repulsivkraft"27 ist als "Anmerkung" dem Abschnitt C.c des "Fürsichsein"-Kapitels angefügt, dem Hegel die Überschrift "Die Beziehung der Repulsion und Attraktion" gab.28 Damit ist zugleich der Ge23 Vgl. HW5, 187. 24 Vgl. ebd., 192. 25 Vgl. ebd., 193ff. 26 "Metaphysische Anfangsgründe" (Anm. 5), 532. 27 So die Formulierung im Inhaltsverzeichnis des ersten Bandes der 28 Vgl. HW 5, 195.
260
Wissenschaft der Logik (HW 5).
Repulsion und Attraktion
sichtspunkt angegeben, unter dem er Kants Materietheorie kritisch erörtert, nämlich wie in ihr die Beziehung von Repulsions- und Attraktionskraft gefaßt ist. Während für Hegel Repulsion und Attraktion "nur Momente sind, die ineinander übergehen",29 behandelt sie Kant als distinkte Kräfte. Der überwiegende Teil der Hegelschen Kritik besteht dementsprechend darin,
zeigen, daß die Unterschiede zwischen Repulsion und Attraktion, die Kant hervorhebt, "nichtig"30 sind, zum anderen aber, daß es Kant bei "dem Geschäfte der Festsetzung des Unterschieds beider Kräfte" unfreiwillig und "bewußtlos" zugestoßen sei, "daß [die] eine in die andere übergegangen war."31 Wenden wir uns zunächst den Kantischen Unterscheidungen zwischen der Repulsions- und Attraktionskraft zu, die in Hegels Augen nichtig sind. Hegel greift als erstes Kants Unterscheidung auf, daß im Begriff der Materie unmittelbar die Eigenschaft der Repulsion enthalten sei, nicht dagegen die der Attraktion. In Kants zum
einen
zu
Worten:
"Wenn Anziehungskraft selbst zur Möglichkeit der Materie ursprünglich erfordert wird, warum bedienen wir uns ihrer nicht eben sowohl, als der [von Kant auf ursprüngliche Repulsion zurückgeführten] Undurchdringlichkeit zum ersten Kennzeichen einer Materie? warum wird die letztere unmittelbar mit dem Begriff einer Materie gegeben, die erstere aber nicht in dem Begriffe gedacht, sondern nur durch Schlüsse ihm beigefügt?"
Es ist dann insbesondere Kants Formulierung, daß die Eigenschaft der Attraktion "zum Begriff der Materie eben sowohl gehört, obgleich [sie] in demselben nicht enthalten ist",33 die Hegel aufgreift um zu bemerken: "[...] eine Bestimmung, die zum Begriffe einer Sache gehört, muß wahrhaftig darin enthalten sein".34 Nach Hegel ist diese Unterscheidung darauf zurückzuführen, daß "Kant zum Begriffe der Materie von vornherein einseitig nur die Bestimmung der Undurchdringlichkeit rechnet",35 eine aus der Wahrnehmung genommene Bestimmung. In der Wahrnehmung seien aber auch Bestimmungen anzutreffen, die auf die Attraktion als Eigenschaft der Materie verweisen: "Ausdehnung und Zusammenhalt" ("Starrheit", "Festigkeit").36 Bei einer heutigen Erörterung der Hegelschen Kritik an Kant kann es natürlich nicht um die Frage gehen, wer von beiden sachlich recht hat. Das wäre so sinnvoll wie ein Streit darüber, welches geozentrische Sphärenmodell unserem Sonnensystem besser gerecht wird, das des Eudoxos oder das des Aristoteles, wo doch für uns beide gleichermaßen "falsch" sind. Von Interesse ist dagegen durchaus die Frage, ob Hegels Kritik Kant gerecht wird oder nicht. Und in dieser Hinsicht ließe sich einerseits bemerken, daß die Anführung von Starrheit, Festigkeit und Zusammenhalt in diesem Zusammenhang nicht recht paßt (diese Phänomene betreffen nur Materie in einem bestimmten Aggregatzustand und setzen generell die Materien voraus, zwischen denen Zusammenhalt bestehen soll);37 zum anderen aber, daß die Ausdehnung (Extensio), die in der 29 Ebd., 204. 30 Ebd. 31 Ebd., 206. 32 "Metaphysische Anfangsgründe" (Anm. 5), 509, Einfügung von mir (W.L.). 33 Ebd. 34 HW5, 202. 35 Ebd. 36 Vgl. ebd., 203. 37 Hegel nahm offenbar nicht zur Kenntnis, daß Kant den "Zusammenhang" d. i. Kants Terminus für Kohäsion, die er in den 1750er und 1760er Jahren auf eine von der fernwirkenden Attraktionskraft unterschie-
261
Wolfgang Lefèvre Tat nicht weniger als die Undurchdringlichkeit von alters her als ursprüngliche Bestimmung von Materie verstanden wurde, für Kant nur deswegen und dann Attraktion zu ihrer Erklärung erfordert, weil und wenn zuvor die Undurchdringlichkeit auf eine ausdehnende Kraft (Expansio) zurückgeführt ist. Um die Nichtigkeit der Unterscheidung im Rahmen des naturtheoretischen Ansatzes Kants vorzuführen, hätte Hegel also eigentlich zeigen müssen, daß man genauso gut umgekehrt verfahren und mit Extension und Attraktion beginnen und von dort zu Undurchdringlichkeit und Repulsion gelangen kann. Interessanter als die angeführten physikalischen Einzelheiten selbst ist deswegen vielleicht die Tatsache, daß Hegel überhaupt mit solchen Einzelheiten argumentiert, wenn er weder der Kantischen Exposition der Problematik zu folgen bereit ist noch was in einem Exkurs zum "Fürsichsein"-Kapitel seiner Logik auch nicht erwartet werden kann einen eigenen naturphilosophischen Theorierahmen entfaltet,38 innerhalb dessen diese einzelnen Argumente erst etwas beweisen könnten. Die angeführten physikalischen Phänomene wirken deswegen wie hingeworfene Brocken, von denen man nicht recht weiß, was aus ihnen zu folgern ist, was sie eigentlich bedeuten, außer daß sie in Hegels Augen gegen Kant sprechen. Das gleiche ist im Zusammenhang mit der Kantischen Unterscheidung zwischen Repulsion und Attraktion zu beobachten, die Hegel als zweite aufgreift, um ihre "Nichtigkeit" vorzuführen, nämlich daß die Repulsion eine "Flächenkraft" sei, die Attraktion dagegen eine "durchdringende" Kraft.39 Die physikalischen Details, die Hegel im Zusammenhang mit dieser Unterscheidung, auf die hier inhaltlich nicht eingegangen werden muß, ins Feld führt oder vielmehr eher stichwortartig aneinanderreiht Attraktion zwischen mehr als zwei Massen, Wechselseitigkeit der Attraktion, "fertige" Materie als Voraussetzung der Berührung etc. -, sind unzusammenhängend und lassen deswegen weder den Eindruck entstehen, daß Hegel mit ihnen Kant systematisch zu widerlegen versucht, noch den, daß er eine eigene Theorie zum fraglichen Sachverhalt andeuten will. Sie legen vielmehr die Vermutung nahe, daß Hegel mit ihnen eine ganz andere Diskussionsstrategie verfolgt: Indem die von ihm angeführten physikalischen Einzelheiten suggerieren, daß sich mit guten Gründen auch für ganz andere Unterscheidungen argumentieren ließe (wohlgemerkt: ohne daß Hegel in eine solche Argumentation eintritt), werfen sie auf Kants Unterscheidungen einen generellen Schatten des Zweifels und lassen sie so erscheinen, wie Hegel sie gesehen haben will: als haltlose Distinktionen eines räsonierenden Verstandes, der vergeblich versucht, sie "als etwas Festsein-Soliendes"40 zu fixieren. Eine solche Argumentationsstrategie wäre natürlich nicht ganz fein. Wie dem auch sei, Hegel ist jedenfalls zugute zu halten, daß er im weiteren Fortgang des Exkurses die Vergeblichkeit dieses Räsonierens nicht an irgendeiner beliebigen anderen Unterscheidung zu demonstrieren versucht, sondern an einem Herzstück der Kantischen Materietheorie, nämlich an Kants Unterscheidung zwischen "einen Raum einnehmen (occupare)" -
-
-
dene
"Anziehung in der Berührung", danach auf den Druck des Äthers zurückgeführt hatte in den "Metaphysische Anfangsgründe" (Anm. 5) ausdrücklich als empirischen Begriff bezeichnete, der kein Gegenstand einer Metaphysik der Materie sein könne (vgl. "Metaphysische Anfangsgründe", Anm. 5, 518). Hegel hat auch nicht die Überarbeitung des ersten Buchs der Wissenschaft der Logik für seine zweite Auflage genutzt, um Hinweise auf seine in der Enzyklopädie inzwischen vorliegende Naturphilosophie hinzuzufü-
38
gen.
39 Vgl. "Metaphysische 40 HW5, 204.
262
Anfangsgründe" (Anm. 5),
516 und
Hegels
Kritik in HW 5, 204ff.
Repulsion und Attraktion und "einen Raum erfüllen (replere)". Hier soll, Hegel zufolge, "Kant bewußtlos das begegnen, was in der Natur der Sache liegt, daß er der Attraktivkraft gerade das zuschreibt, was er, der ersten Bestimmung nach, der entgegengesetzten Kraft zuschrieb. Unter dem Geschäfte der Festsetzung des Unterschiedes beider Kräfte war es geschehen, daß eine in die andere übergegangen war."41 Um beurteilen zu können, ob diese Kritik trifft, müssen wir wenigstens kurz auf die fraglichen naturtheoretischen Inhalte eingehen. Kant führte die Unterscheidung zwischen "erfüllen" und "einnehmen" definierend am Beginn des Dynamik-Teils seiner Metaphysischen Anfangsgründe ein: "Einen Raum erfüllen, heißt allem Beweglichen widerstehen, das durch seine gewissen Raum einzudringen bestrebt ist."
Bewegung
in einen
Demgegenüber bezeichne "einen Raum einnehmen, d. h. in allen Punkten desselben unmittelbar gegenwärtig sein", die räumliche Ausdehnung eines Dinges, wenn offen gelassen ist, ob das den Ausschluß anderer Dinge aus diesem Raum bedeutet oder wie im Falle geometrischer Figuren nicht. Insofern kann Kant sagen, "so ist: einen Raum erfüllen, eine nähere Bestimmung des Begriffs: einen Raum einnehmen".43 Von einem Ding sagen, daß es "einen Raum erfüllt", meint danach nicht allein, daß es in einem Räume gegenwärtig ist, sondern darüber hinaus, daß es anderen Widerstand leistet, wenn sie in diesen Raum einzudringen ver-
-
suchen. "Einen Raum erfüllen" steht also nach Kants Definition nicht allein für Ausdehnung, sondern zugleich für (relative44) Undurchdringlichkeit und setzt "eine besondere bewegende Kraft"45 voraus, die Repulsion. Nicht nur geometrische Figuren sind für Kant Beispiele für Entitäten, die einen Raum einnehmen, ohne ihn zu erfüllen. Materie selbst ist in einer gewissen Hinsicht eine solche Instanz, nämlich: "[der] Anziehungskraft, vermittelst deren eine Materie einen Raum einnimmt, ohne ihn zu erfüllen, dadurch sie also auf andere, entfernte wirkt durch den leeren Raum, deren Wirkung setzt keine Materie, die dazwischen liegt, Grenzen".
D. h., die Wirkungssphäre der Attraktionskraft einer Materie nimmt nach Kant einen (potentiell unendlichen) Raum ein, ohne andere Materien aus diesem Wirkungsraum zu verdrängen oder vom Eindringen abzuhalten; im Gegensatz zur Repulsionskraft erfüllt die Attraktionskraft den Raum nicht, den sie einnimmt. Genau hier hakt Hegel ein, indem er zunächst die zuletzt zitierte Ansicht Kants referiert,47 um als nächstes zu erklären, daß Kants Unterscheidung zwischen "einnehmen" und "erfüllen" "ungefähr wie der obige beschaffen [sei], wo eine Bestimmung zum Begriffe einer
41 42 43 44 45 46 47
Ebd., 206.
"Metaphysische Anfangsgründe" (Anm. 5),
496.
Ebd., 497. Vgl. ebd., 501, Erklärung 4. Ebd., 497, Lehrsatz 1. Ebd., 516, Zusatz zu Erklärung 7.
Tatsächlich beinhaltet seine Wiedergabe einen Zusatz: Hegel referiert nämlich den Gedanken so, als sei die bloße Einnahme von Raum durch die Anziehungskraft die Voraussetzung ihrer Fernwirkung: "[...] weil die Materie durch die Anziehungskraft den Raum nicht erfülle, so könne diese durch den leeren Raum wirken" (HW 5, 206). Von einem solchen Bedingungsverhältnis ist bei Kant nicht die Rede.
263
Wolfgang Lefèvre Sache gehören, aber nicht darin enthalten sein sollte".48 Und dann versucht Hegel, in jeweils zwei Sätzen zu zeigen, wie unfreiwilliger Weise erstens die Bestimmungen der Attraktion in die der Repulsion übergehen und umgekehrt zweitens die der Repulsion in die der Attraktion. Für den ersten unfreiwilligen Übergang lauten die beiden Sätze: "Alsdann ist es die Repulsion, wenn wir bei ihrer ersten Bestimmung stehenbleiben, durch welche sich die Eins abstoßen und nur negativ, das heißt hier durch den leeren Raum, sich aufeinander beziehen. Hier aber ist es die Attraktivkraft, welche den Raum leer erhält; sie erfüllt den Raum durch ihre Beziehung der Atome nicht, d. h. sie erhält die Atome in einer negativen Beziehung aufein-
ander.'9
Hegels Argument steht und fällt mit seiner Behauptung, es sei die "erste Bestimmung" der Repulsions gewesen, daß sich vermittels ihrer die Materieeinheiten "abstoßen und nur negativ, das heißt hier durch den leeren Raum, [...] aufeinander beziehen". Die fragliche "erste Bestimmung" ist jedoch keine Bestimmung der Kantischen Repulsion. Der Raum, den die Repulsion einer Materie vom Eindringen einer anderen frei zu halten vermag, ist für Kant kein leerer, sondern im Gegenteil ein erfüllter Raum. Nach Kant stoßen sich Materien per Repulsion nicht durch leere Räume ab, sondern an ihren Berührungsflächen (deswegen seine Kennzeichnung der Repulsion als "Flächenkraft"). Es ist also nicht zu sehen, worauf sich die angeführte "erste Bestimmung" der Repulsion bei Kant beziehen könnte. Dagegen verrät schon
der Gebrauch von Termini wie "die Eins" oder "Atome", die in Kants Naturtheorie keinen Platz haben,50 welcher Theorie der Repulsion diese "erste Bestimmung" angehört sie gehört zu Hegels Begriff der Repulsion: Im Abschnitt B.c. des "Fürsichsein"-Kapitels nennt Hegel die negative Beziehung des Eins auf sich Repulsion und entwickelt sie ausgehend von der negativen Beziehung des "Eins" und des "Leeren", die "das Fürsichsein in seinem nächsten Dasein" ausmachen sollen, zur Selbstabstoßung des Eins von sich als Eins.51 Es ist also Hegel und nicht Kant, dem "bewußtlos" einige Sachen "ineinander übergehen". Er unterstellt Kants Repulsion Bestimmungen, die seiner eigenen Theorie angehören und die im Kontext der Materietheorie Kants keinen Sinn machen, um dann triumphierend zu zeigen, daß Kant, wie es "in der Natur der Sache liegt", seine räsonierenden Unterscheidungen nicht durchhalten kann. Fast noch offenkundiger ist diese Zubereitung Kants als Voraussetzung seiner Kritik im Falle des zweiten zitierten Satzes, nämlich hinsichtlich der Behauptung, Kants Attraktionskraft "erhalte" den Raum "leer": "[...] sie erfüllt den Raum durch ihre Beziehung der Atome nicht, d. h. sie erhält die Atome in einer negativen Beziehung aufeinander". Überflüssig zu sagen, daß diese Erläuterung von: "den Raum nicht erfüllen" Hegel und nicht Kant angehört. Dasselbe ließe sich hinsichtlich des angeblichen "unbewußten" Übergehens der Kantischen Bestimmungen der Repulsion in die der Attraktion zeigen. Die beiden Sätze Hegels lauten: -
48 Ebd. 49 Ebd., alle Hervorhebungen von Hegel. 50 Mit den Metaphysischen Anfangsgründen von 1786 revidierte Kant bekanntlich gerade die erste Konzeption seiner dynamischen Materietheorie von 1756 (Monadologia Physica), bei der er physische Monaden unterstellt hatte vgl. den Lehrsatz 4 der Dynamik mit Beweis und Anmerkungen (Kant, Werke, Anm. 5, Bd. 4,
503ff.).
51
Vgl.
264
-
HW 5, 186f.
Repulsion und Attraktion "So soll dagegen durch die Repulsion die Materie einen Raum erfüllen, somit durch sie der leere Raum, den die Attraktivkraft läßt, verschwinden. In der Tat hebt sie somit, indem sie den leeren Raum aufhebt, die negative Beziehung der Atome oder Eins, d. h. die Repulsion derselben auf; d. i. die Repulsion ist als das Gegenteil ihrer selbst bestimmt"
Das mag für eine Theorie, in der die Aufhebung des leeren Raumes die Aufhebung der Repulsion bedeutet, richtig sein, mit der Repulsionskraft der Kantischen Materietheorie hat es
jedoch nichts zu tun.
IV
Repulsion und Attraktion logisch und physikalisch -
Läßt sich diese Kritik Hegels an Kants Materietheorie rechtfertigen? Wahrscheinlich nicht. Was immer die Gründe sein mögen, warum Hegel Kants Argumente nicht in ihrem eigenen Zusammenhang zur Kenntnis nimmt, warum er sie schief referiert oder um solche ergänzt, die mit Kants Gedankengang unvereinbar sind, soviel scheint klar: Die darauf gestützte Kritik an Kant ist gegenstandslos. Man könnte diese Kritik mit der Bemerkung auf sich beruhen lassen, daß Repulsion und Attraktion in Hegels Logik mit der Repulsion und Attraktion in Kants Metaphysische(n) Anfangsgründen nur den Namen gemeinsam haben. Aber dem steht ein fundamentaler Anspruch der Logik im Wege, den Hegel auch in dem hier erörterten Fall ausdrücklich gelten macht: "Eine solche Existenz wie die sinnliche Materie ist zwar nicht ein Gegenstand der Logik, ebensowenig als der Raum und Raumbestimmungen. Aber auch der Attraktiv- und Repulsivkraft, sofern sie als Kräfte der sinnlichen Materie angesehen werden, liegen die hier betrachteten reinen Bestimmungen von Eins und Vielen und deren Beziehungen aufeinander, die ich Repulsion und Attraktion, weil diese Namen am nächsten liegen, genannt habe, zugrunde."
Die
Kategorien, die Hegel in seiner Logik entwickelt, führen den Anspruch mit sich, die reiDenkbestimmungen zu sein, die realphilosophischen und erfahrungswissenschaftlichen Begriffen zugrunde liegen. Und dies gilt auch für die physikalischen Begriffe Repulsiv- und Attraktivkraft, denen Hegel die reinen Beziehungen von Eins und Viele zuordnet, also Repulsion und Attraktion in einem logischen Sinne. Vor diesem Hintergrund wird seine befremdliche Kant-Kritik besser verständlich. Ihr nen
scheint derselbe Sachverhalt zugrunde zu liegen, der oben im Zusammenhang mit dem Atomismus erörtert wurde: Ausgehend von seiner Entwicklung der Beziehungen der Kategorien Eins und Viele, die er Repulsion und Attraktion nennt, glaubt Hegel zu wissen, worum es Kant bei seiner dynamischen Materietheorie eigentlich nur gehen kann. Aus diesem Grunde hält er es für sinnlos, Kant in dessen eigenem, "trüben" Argumentationszusammenhang verstehen zu wollen anstatt im Rahmen der von ihm entwickelten und zugleich für universell gültig gehaltenen Dialektik von Repulsion und Attraktion. Man muß das nicht akzeptieren, aber
sieht jedenfalls, daß Hegels verfehlte Kritik an Kant kein Fall Nachlässigkeit ist, sondern eine Konsequenz seines Anspruchs, daß die man
wickelten
von
von
Willkür oder ihm rein ent-
logischen Beziehungen den physikalischen Begriffen zugrunde liegen.
52 Ebd., 206. 53 Ebd., 201.
265
Wolfgang
Lefèvre
Anspruch aber zur Debatte steht, ist nicht allein, wie oben im Falle des Atomismus, Hegels Überzeugung, daß die Begriffe, die er in seiner Wissenschaft der Logik entwickelt, zugleich historisch und universell sind und daß sie deswegen in den geschichtlichen Systemen der Philosophie zwar unterschiedlich gefaßt sein mögen, die Differenzen aber letztlich nur die Form der Darstellung betreffen, ihre Klarheit und Konsequenz. Es geht hier zugleich um das Problem des Verhältnisses von logischen und wissenschaftlichen Begriffen in Hegels Logik, ein Problem, das seine Philosophie insgesamt betrifft und das von dem kleinen Kant-Exkurs des "Fürsichsein"-Kapitels aus natürlich nicht behandelt werden kann. Selbst wenn wir uns dabei auf die Begriffe Repulsion und Attraktion beschränken würden, müßten wir in jedem Fall den Mechanik-Abschnitt im zweiten Teil seiner Enzyklopädie (§§ 253-271) heranziehen, um, nach mühsamer Interpretationsarbeit, bei der wir immer wieder zwischen Logik und Mechanik-Abschnitt hin und her geschickt würden, vermutlich zuletzt bei einer sehr ähnlichen Frage anzukommen, nämlich der nach dem Verhältnis von naturphilosophischen und wissenschaftlichen Begriffen in Hegels Naturphilosophie. Aber einige Bemerkungen und Fragen zu einem Seitenaspekt des Problems drängen sich vom Kant-Exkurs her auf, nämlich zur Verwendung von gleichen Namen für logische und wissenschaftliche Begriffe. Die seltsame Idee, Repulsion und Attraktion als Namen für bestimmte logische Beziehungen unter Kategorien zu verwenden, hat vielleicht zunächst nichts Auffälliges bei einem Philosophen, der für seine Versuche bekannt ist, neue philosophische Termini zu prägen. Termini wie Ansichsein, Fürsichsein oder Dasein sind allgemein bekannte Beispiele dafür. Oft greift Hegel dabei auf vieldeutige Worte der deutschen Umgangssprache zurück der Terminus Aufheben ist wohl das prominenteste Beispiel in dieser Hinsicht -, und vielleicht empfiehlt ihre Vieldeutigkeit diese Worte gerade deswegen, weil kein bereits präzisierter Sinn ihrer Umprägung zu philosophischen Termini technici störend in den Weg tritt. Bei den Termini Repulsion und Attraktion fällt dieser Vorteil weg. So umstritten damals die von Newton eingeführte Gravitation unter Massen in mancher Hinsicht war (handelt es sich um eine Fernwirkungskraft? ist sie ein Effekt des Ätherdrucks? etc.), die Bedeutung des sie bezeichnenden Terminus Attraktion war durch das Invers-Quadrat-Gesetz präzisiert, ein Gesetz, das von keinem Physiker in Frage gestellt wurde; und das gleiche gilt bis zu einem gewissen Grad für den physikalischen Begriff Repulsion. Es hat also durchaus etwas Auffälliges, daß Hegel ausgerechnet so wohlgeprägte Termini der Physik als Namen für spezielle logische Beziehungen wählte, für deren Bezeichnung ihm offenkundig die traditionelle Terminologie der Logik unzureichend schien. Warum wählte er nicht die deutschen Worte Abstoßung und Anziehung mit ihrem Bedeutungsreichtum? Und wenn schon wissenschaftliche Begriffe, warum mußten es ausgerechnet physikalische Termini sein? Hätten sich die logischen Beziehungen des Eins nicht ebenso gut mit gesellschaftswissenschaftlichen Begriffen wie Einzelwille und Allgemeinwille oder Eigensinn und GeWas mit diesem
-
-
meinsinn bezeichnen lassen?54 Warum also Repulsion und Attraktion? "Weil diese Namen am nächsten liegen",55 wie Hegel unschuldig begründet? Es ist verführerisch, darüber zu spe54
Vgl. Hegels Bemerkungen zur Bedeutung des Atomismus in der "Sphäre des Willens" in seinen Vorlesungen Geschichte der Philosophie; HW 18, 358. HW 5, 201; dieser Halbsatz ist nebenbei eine Einfügung der zweiten Auflage der Wissenschaft der Logik
zur
55
von
266
1830.
Repulsion und Attraktion
kulieren, in welchem Sinne diese Namen für Hegel "am nächsten lagen". War es vielleicht so, daß nicht, wie Hegel meint, die "reinen Bestimmungen von Eins und Vielen" den der
neuzeitlichen Mechanik angehörenden Kräften Attraktion und Repulsion zugrunde liegen, sondern daß umgekehrt gewisse mit diesen Kräften verbundene Vorstellungen und Begriffe seiner Konzeption der "reinen Bestimmungen von Eins und Vielen" insofern "zugrunde lagen", als sie für bestimmte Seiten dieser Bestimmungen ein Modell darstellten? Aber das sind natürlich nur Spekulationen. Irritierend ist schließlich, daß man sich im Falle der Termini Repulsion und Attraktion nicht sicher sein kann, ob ihnen Hegel überhaupt den Status neugeprägter Termini technici der Logik zudachte oder nicht. Die Wissenschaft der Logik, in der die beiden Namen sogar in Abschnittsüberschriften verwendet werden, scheint keinen Zweifel zuzulassen, daß er ihnen diesen Status zusprach. Aus einem Zusatz zur Logik der Enzyklopädie können wir jedoch erfahren, daß er die Verwendung des Terminus Repulsion als einen "bildlichen Ausdruck" für die negative Beziehung des Eins auf sich bezeichnet und so gewissermaßen entschuldigt hat.56 Es bleiben also viele Fragen offen im Zusammenhang mit den Termini Repulsion und Attraktion, insbesondere natürlich, ob durch die Wahl dieser Namen etwas an den zu entwickelnden logischen Verhältnissen klarer wird oder umgekehrt etwas für das Verständnis dieser naturwissenschaftlichen Begriffe gewonnen ist. Einen Schluß scheint mir jedoch der Kant-Exkurs unzweideutig nahe zu legen: Hegels Verwendung dieser Termini als Termini seiner Logik kann zu Konfusionen führen, sogar bei ihrem Autor.
V
Hegels Kritik LT
-
Keine Konstruktion der Materie
Hegel zu zeigen versuchte, daß Kants Unterscheidungen zwischen Attraktions- und Repulsionskraft nichtig sind und zuletzt gar unfreiwillig ineinander übergehen, war, wie wir sehen konnten, jederzeit der Zusammenhang mit den systematischen Darlegungen im "Fürsichsein"-Kapitel durchsichtig, wie verhängnisvoll sich das auch auf die Beurteilung Kants auswirken mochte. Es findet sich jedoch in dem Kant-Exkurs ein weiteres Argument gegen Kants dynamische Materietheorie, das nichts mit dem Thema dieses Logik- Kapitels zu tun zu haben scheint und von dem sich zeigen läßt, daß es den Nachglanz einer Auseinandersetzung mit Kants Metaphysische(n) Anfangsgründen darstellt, die der Periode angehört, als Hegel mit Schelling zusammenarbeitete. Abgekürzt lautet dieses Argument: Kants Exposition des Materiebegriffs sei keine "Konstruktion", sondern verfahre "analytisch". Dieses Argument begegnet in dem kurzen Exkurs in zwei Varianten. Im Einleitungsteil lauSoweit
tet es:
"Kants Verfahren ist nämlich im Grunde analytisch, nicht konstruierend. Er setzt die Vorstellung der Materie voraus und fragt nun, welche Kräfte dazu gehören, um ihre vorausgesetzten Bestimmungen zu erhalten."5
Gegen Ende des Exkurses lesen wir: 56 Vgl. in Enz. § 97, Zusatz; HW 8, 205. 57 HW5, 201f.
267
Wolfgang Lefèvre [...] die Kantische Darstellung der entgegengesetzten Kräfte analytisch ist und in dem ganzen Vortrag die Materie, die erst aus ihren Elementen hergeleitet werden soll, bereits als fertig und
"daß
konstruiert vorkommt. In der Definition der Flächen- und der durchdringen Kraft werden beide als bewegende Kräfte angenommen, dadurch Materien auf die eine oder andere Weise sollen wirken können. Sie sind also hier als Kräfte dargestellt, nicht durch welche die Materie erst zustande käme, sondern wodurch sie, schon fertig, nur bewegt würde." -
Der letzte Einwand trifft zweifellos eine
Schwierigkeit der Kantischen Darstellung. "Bewegende Kräfte", d. h. solche, vermittels derer eine Materie andere Materie bewegt, können kein Gegenstand des Dynamik-Abschnitts der Metaphysische(n) Anfangsgründen sein, wo es gewissermaßen erst um die Konstitution von Materie geht, nämlich um ihr Erfüllen eines Raumes. Sie werden denn auch konsequenterweise von Kant erst im folgenden MechanikAbschnitt eingeführt.59 Aber Hegel hat insofern recht, als Kant Repulsion und Attraktion im Dynamik-Abschnitt nicht zu charakterisieren vermag, ohne Züge anzusprechen, die ihnen als "bewegenden Kräften" zukommen. Was immer zu dieser Schwierigkeit im einzelnen zu sagen wäre, der wesentliche Kritikpunkt in beiden Versionen des Arguments ist offenkundig der, daß Kant die Materie, um deren Konstitution es geht, als fertige voraussetze. Inwiefern bedeutet das aber, daß Kants Verfahren "analytisch, nicht konstruierend" ist? Und inwiefern ist es überhaupt ein Vorwurf, daß Kants Verfahren "nicht konstruierend" sei? Hat denn Kant beansprucht, daß sein Verfahren eine Konstruktion sei? Nach Hegel ist das der Fall: "Kants Verfahren in der Deduktion der Materie aus diesen Kräften, das er eine Konstruktion nennt, verdient näher betrachtet, diesen Namen nicht, wenn nicht anders jede Art von Reflexion, selbst die analysierende, eine Konstruktion genannt wird, wie denn freilich spätere Naturphilosophen auch das flachste Räsonnement und das grundloseste Gebräue einer willkürlichen Einbildungskraft und gedankenlosen Reflexion das besonders die sogenannten Faktoren der Attraktivkraft und Repulsivkraft gebrauchte und allenthalben vollbrachte ein Konstruieren genannt ha-
ben."60
-
Das Wort "Faktoren" kann wohl als ein Hinweis verstanden werden, daß hier Naturphilosophen in den Fußstapfen Schellings gemeint sind doch, um im Bilde zu bleiben, Schritt für Schritt. "Konstruktion" ist bei Kant die Darstellung eines Begriffes in einer Anschauung a priori; es ist das Verfahren, das die Mathematik auszeichnet.61 "Eigentliche Wissenschaft", d. h. ein Wissen mit apodiktischer Gewißheit,62 setzt nach Kant Mathematik und somit Konstruktion der Begriffe in dem genannten Sinn voraus. Eine solche Konstruktion ist aber nicht etwa das, was in den Metaphysische(n) Anfangsgründen durchgeführt wird. Diese haben vielmehr eine davor liegende Aufgabe zu erfüllen: -
"Damit aber die
Anwendung
der Mathematik auf die
Körperlehre,
die durch sie allein Naturwis-
senschaft werden kann, möglich werde, so müssen Principien der Construction der Begriffe, welche zur Möglichkeit der Materie überhaupt gehören, vorangeschickt werden; mithin wird eine vollständige Zergliederung des Begriffs von einer Materie überhaupt zum Grunde gelegt werden 58 Ebd., 206f. 59 Vgl. "Metaphysische Anfangsgründe" (Anm. 5), 536. 60 HW5, 201. 61 Vgl. z. B. "Metaphysische Anfangsgründe" (Anm. 5), 469. 62 Vgl. ebd., 468.
268
Repulsion und Attraktion müssen, welches ein Geschäfte der reinen körperlichen Natur ist."
Philosophie ist,
die
[...]
eine wirkliche
Metaphysik
der
Kant verfährt also in den Metaphysische(n) Anfangsgründen nicht konstruierend; er versucht vielmehr in ihr, "Principien der Construction der Begriffe" zu gewinnen; und er gewinnt diese Prinzipien durch "eine vollständige Zergliederung des Begriffs von einer Materie überhaupt", und das heißt, er gewinnt sie analytisch. Kant würde also zustimmen, daß sein Verfahren "analytisch, nicht konstruierend" ist. Er würde nur nicht verstehen, wieso ihm das vorzuwerfen ist. Der Vorwurf erscheint in der Tat rätselhaft und ließe sich vielleicht gar nicht verständlich machen, wenn sich in Hegels Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie nicht folgender Satz fände: "Er
[sc. Kant] verlangt Konstruktion der Materie Schelling steckt ganz darin."64
aus
Kräften, Tätigkeiten, Energien, nicht Ato-
men.
Damit wird zweierlei klar. Zum einen, daß es nicht um Kants Begriff von Konstruktion geht, sondern um einen Schellingschen. Zum zweiten aber, wie Hegels Vorwurf zu verstehen ist: Liest man Kants metaphysische Exposition der Materie als ein Analogon zu Schellings Konstruktion der Natur, dann ist allerdings zu beanstanden, daß sie den damit gesetzten Kriterien nicht genügt. Dies hatte schon Schelling in seinem Ersten Entwurf eines Systems der
Naturphilosophie (1799) bemängelt:
hat Kant in seiner Dynamik den Begriff der Materie lediglich analytisch behandelt, und sich wohl enthalten, die Möglichkeit einer Construction der Materie aus jenen beiden Kräften begreiflich zu machen; vielmehr scheint er diese, mehreren Aeußerangen nach, selbst für unmöglich zu halten."65
"Uebringens
Dies ist nicht einfach eine interessante Parallele zu Hegels Kritik, das ist vielmehr unverkennbar der Originalton, der in Hegels Ausführungen von 1812 nur widerhallt. Ich wähle dies mechanische Bild aus der Akustik mit Bedacht: Der Vorwurf, Kants Exposition des Materiebegriffs verdiene nicht den Namen einer Konstruktion, ist meiner Meinung nach ein Fremdkörper im Gedankengefüge der Wissenschaft der Logik, in der der Jenenser Begriff Konstruktion keinen systematischen Status mehr hat. Der zitierte Satz aus dem Ersten Entwurf kann übrigens als ein interessantes Dokument angesehen werden, das bezeugt, wie Kants Äußerungen zur Konstruktion von Begriffen in der Vorrede wie in der "Allgemeine(n) Anmerkung zur Dynamik" der Metaphysische(n) Anfangsgründe, auf die sich Schelling zu beziehen scheint, in den 1790er Jahren (miß)verstanden wurden. Auf den von Schelling in jenen Jahren entwickelten Begriff Konstruktion, der für Hegel am Anfang seiner Jenenser Zeit eine bedeutende Rolle bei der Entwicklung seiner Konzeption von Dialektik spielte, kann im Rahmen dieser Arbeit natürlich nicht näher eingegangen werden. Aber eine naturphilosophische Dimension, die mit diesem Begriff verbunden war, 63 Ebd., 472. 64 Hegel, Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, HW 20, 364. Michelet hatte in einer Fußnote zum ersten der beiden Sätze einen Verweis auf die "Allgemeine Anmerkung zur Dynamik" in Kants "Metaphysische Anfangsgründe" (Anm. 5), 523ff. angefügt. Dort macht Kant aber ironischer Weise klar, daß eine dynamische Materietheorie die Konstruktion des Materiebegriffs gerade ausschließt (ebd., 525). 65 Schelling, "Erster Entwurf eines Systems der Naturphilosophie", in Schriften von 1799-1801, Darmstadt 1975, 101.
269
Wolfgang Lefèvre verdient im Zusammenhang des Kant-Exkurses Interesse, zumal es vermutlich diese Dimension war, warum die alte Auseinandersetzung mit Kants Naturphilosophie Hegel 1812 wieder in den Sinn kam. Im unmittelbaren Kontext des eben zitierten Satzes lesen wir bei Schel-
ling: "Kant geht [...] in diesem Werk [sc. den Metaphysische(n) Anfangsgründen] von dem Produkt, so wie es als bloße Raumerfüllung gegeben ist, aus. Da es nun als solches keine andere Mannigfaltigkeit als die der verschiedenen Grade der Raumerfüllung darbietet, so kann es natürlich auch nicht anders construiert werden, als aus zweien Kräften, deren variables Verhältniß verschiedene Dichtigkeitsgrade gibt. Denn eine andere specifische Differenz der Materie kennt die Mechanik nicht, welche Construktion dann auch recht gut seyn mag zu erklären, warum eine Materie specifisch schwerer ist als die andere, nicht aber um das Produktive in der Materie begreiflich zu machen, daher denn auch diese Principien in der Anwendung ein wahres Blei für die Naturwissenschaft sind. [...] Unsere Philosophie geht den gerade entgegengesetzten Gang. Vom Produkt weiß sie ursprünglich nichts, es ist für sie gar nicht da. Ursprünglich weiß sie nur von dem rein Produktiven in der Natur."66
Hegels oben angeführte Kritik, daß Kant die Materie in ihren elementare Bestimmungen (Ausdehnung und Undurchdringlichkeit) voraussetzt, obwohl er diese Bestimmungen erst aus den Kräften Repulsion und Attraktion ableiten will, liest sich wie die knappe Zusammenfassung dieser reicheren Formulierung Schellings. Was bei Hegel jedoch nur wie ein allgemei-
methodischer Einwand aussieht und dazu ein auf den ersten Blick seltsamer: setzt denn nicht alle Erklärung das zu Erklärende voraus? -, wird bei Schelling in seiner naturphilosophischen Dimension erkennbar: Das Mangelhafte der Naturphilosophie Kants sei, daß sie vom "Produkt" ausgeht, wo es doch darauf ankomme, eine Naturphilosophie zu entwickeln, die "ursprünglich nur von dem rein Produktiven in der Natur weiß". Der Vorwurf, daß Kant "analytisch" verfahre, meint also, daß seine Naturphilosophie von der Natura naturata ausgeht, während eine wahrhaft "konstruierende" Naturphilosophie die Natura naturans zu ihrem Prinzip hätte. Die Frage, wie weit oder in welcher modifizierten Form der Hegel von 1812 und später einem solchen naturphilosophischen Programm verpflichtet war, kann hier nicht einmal angeschnitten werden. Ein Zitat sei aber erlaubt: ner
-
"Die denkende Naturbetrachtung muß betrachten, wie die Natur an ihr selbst der Prozeß ist, zum Geiste zu werden, ihr Anderssein aufzuheben, und wie in jeder Stufe der Natur selbst die Idee vorhanden ist; von der Idee entfremdet, ist die Natur nur der Leichnam des Verstandes."67 -
Es sind Welten, die Kant von einer solchen Naturauffassung trennen. Soweit Gedanken wie diese im Hintergrund der Kritik an Kants Naturphilosophie in Hegels Wissenschaft der Logik stehen, verwendet diese Kritik zweifellos einen unangemessenen Maßstab; aber sie indiziert eine wirkliche Differenz von grundlegender Bedeutung.
66 Ebd. 67 Enz.
270
§ 247, Zusatz; HW 9, 25
Renate Wahsner
"Der Gedanke kann nicht richtiger bestimmt werden, als Newton ihn gegeben hat." Das mathematisch Unendliche und der Newtonsche Bewegungsbegriff im Lichte des
begriffslogischen Zusammenhangs von Quantität und Qualität
Die begriffliche Entwicklung von der reinen Quantität zur Einheit von Qualität und Quantität in Gestalt des quantitativen Verhältnisses, zur Wahrheit des Quantums, Maß zu sein, darlegend, diskutiert Hegel auch verschiedene begriffliche Fassungen des mathematisch Unendlichen und kommt zu dem Ergebnis, daß der Gedanke nicht richtiger bestimmt werden könne, als Newton ihn gegeben habe.1 Hegel lobt, daß Newton die Fluxionen nicht wie andere Gelehrte als Unteilbare verstehe, was eine Form sei, die den Begriff eines an sich bestimmten Quantums enthält, sondern als verschwindende Teilbare. Newton schreibt an der Stelle, auf die Hegel sich bezieht: "Wenn ich ferner in der Folge Grossen als aus kleinen Theilen bestehend betrachten, oder statt gerader unendlich kleine krumme Linien annehmen sollte; so wünsche ich, dass man darunter nicht untheilbare, sondern verschwindend kleine theilbare, nicht Summen und Verhältnisse bestimmter Theile, sondern die Grenzen der Summen und Verhältnisse verstehen und dass man den Kern solcher Beweise immer auf die Methode der hervorgehenden Lehnsätze zurückführen möge. Man kann den Einwurf machen, dass es kein letztes Verhältniss verschwindender Grossen gebe, indem dasselbe vor dem Verschwinden nicht das letzte sei, nach dem Verschwinden aber überhaupt kein Verhältniss mehr stattfinde. Aus demselben Grunde könnte man aber auch behaupten, dass ein nach einem bestimmten Orte strebender Körper keine letzte Geschwindigkeit habe; diese sei, bevor er den bestimmten Ort erreicht hat, nicht die letzte, nachdem er ihn erreicht hat, existiré sie gar nicht mehr. Die Antwort ist leicht. Unter der letzten Geschwindigkeit versteht man diejenige, mit welcher der Körper sich weder bewegt, ehe er den letzten Ort erreicht und die Bewegung aufhört, noch die nachher stattfindende, sondern in dem Augenblick, wo er den Ort -
1
Vgl.
HW 5, 298.
Renate Wahsner
erreicht, ist es die letzte Geschwindigkeit selbst, mit welcher der Körper den Ort berührt und
mit welcher die Bewegung endigt. Auf gleiche Weise hat man unter dem letzten Verhältniss verschwindender Grossen dasjenige zu verstehen, mit welchem sie verschwinden, nicht aber das vor oder nach dem Verschwinden stattfindende. Eben so ist das erste Verhältniss entstehender Grossen dasjenige, mit welchem sie entstehen; die erste und die letzte Summe diejenige, mit welcher sie anfangen oder aufhören zu sein (entweder grosser oder kleiner zu werden). Es existirt eine Grenze, welche die Geschwindigkeit am Ende der Bewegung erreichen, aber nicht überschreiten kann; dies ist die letzte Geschwindigkeit. Dasselbe gilt von der Grenze aller anfangenden und aufhörenden Grossen und Proportionen. Da diese Grenze fest und bestimmt ist, so ist es eine wahrhaft geometrische Aufgabe, sie aufzusuchen."2 Hegel folgert heraus, "daß der von Newton aufgestellte Begriff dem entspricht, wie die unendliche Größe sich in der obigen Darstellung aus der Reflexion des Quantums in sich er-
gab".3
Hegel analysiert im Quantitätsabschnitt mathematische Theorien (insbesondere die des Infinitesimalkalküls) unter dem Gesichtspunkt, inwiefern sie mit den von ihm explizierten Begriffen Unendlichkeit, Quantität und Qualität vereinbar sind. Dabei polemisiert er insbesondere dagegen, das Unendlichkleine als quantitative statt als qualitative Größenbestimmung zu behandeln. Diese Hegeische Analyse ist in verschiedenen Arbeiten mit unterschiedlichen Ergebnissen untersucht worden.4 Einig ist man sich zweifellos darüber, daß Hegels Kritik partiell in der seinerzeit noch unzureichenden erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts vollendeten mathematischen Begründung des Differentialkalküls gründete,5 zugleich aber ebenso wesentlich in seinem Mathematikbegriff bzw. seinem Konzept des Verhältnisses von Mathematik und empirischer Wissenschaft, Mathematik und Philosophie. Die Ergänzungen, die Hegel der zweiten Auflage der Logik hinzufügte, betreffen an erster Stelle den Quantitätsabschnitt.6 Sie waren weitestgehend durch die Diskussion der seinerzeitigen Vorstellung und Begrifflichkeit des Unendlichkleinen und des Gebrauchs, den die dama-
-
-
-
2 3 4
I. Newton, Mathematische Prinzipien der Naturlehre, hg. v. J.Ph. Wolfers, Berlin 1872, 52-55. HW 5, 298f. Siehe z. B. C. Frantz, Die Philosophie der Mathematik, Leipzig 1842; M. Rehm, Hegels spekulative Deutung der Infinitesimalrechnung, Diss. Köln 1963; A. Moretto, Hegel e la "mathematica dell'infinito", Trento 1984 [rezensiert von W. Bonsiepen in Berichte zur Wissenschaftsgeschichte 8 (1985), 58-61]; M. Wolff, "Hegel und Cauchy. Eine Untersuchung zur Philosophie und Geschichte der Mathematik", in Hegels Philosophie der Natur, hg. v. M.J. Petry, Stuttgart 1986; W. Bonsiepen, "Hegels Theorie des qualitativen Quantitätsverhältnisses", in Konzepte des mathematisch Unendlichen im 19. Jahrhundert, hg. v. G. König, Göttingen 1990; A. Moretto, "Hegels Auseinandersetzung mit Cavalieri und ihre Bedeutung für seine Philosophie der Mathematik", in ebd.; A. Klaucke, "Hegels Lagrange-Rezeption", in ebd. Mit Blick auf die systematische Frage nach der physikalischen Fassung der Bewegung, die nach Hegel der daseiende Widerspruch ist, siehe H.-H. v. Borzeszkowski und R. Wahsner, "Physikalische Bewegung und dialektischer Widerspruch", in Deutsche Zeitschrift für Philosophie 30 (1982), 634-644; dies., Physikalischer Dualismus und dialektischer Widerspruch. Studien zum physikalischen Bewegungsbegriff, Darmstadt 1989, insbes. 9-23. Unter dem Titel "Die formal-logisch widerspruchsfreie Fassung des als Bewegung daseienden Widerspruchs" auch in R. Wahsner, Zur Kritik der Hegelschen Naturphilosophie. Über ihren Sinn im Lichte der heutigen Naturerkenntnis, Frankfurt a.M., Berlin, Bern, New York, Paris, Wien 1996, 141-152 (Anhang). Siehe Anm. 137. Vgl. F. Hogemann und W. Jaeschke, "Einleitung" in G.W.F. Hegel, Wissenschaft der Logik. Erster Teil. Die objektive Logik. Erster Band. Die Lehre vom Sein (1832), Berlin 1990, insbes. XV-XVIII. -
5 6
272
Das mathematisch Unendliche und der Newtonsche
Bewegungsbegriff
lige Mathematik davon machte,7 bedingt. Dies und die weitere Tatsache, daß diese Ergänzungen für Anmerkungen, als die sie erschienen,8 außergewöhnlich lang sind, läßt darauf schließen, daß Hegel in der hier behandelten Thematik einen tiefen Sinn vermutete, den er erfassen wollte. Zudem hatte er eben den Verdacht, daß der von Newton aufgestellte Begriff der letzten Verhältnisse seinem begriffslogisch entwickelten der unendlichen Größe entspricht. Aus diesen Gründen scheint eine Konzentration auf Hegels Rezeption des Differentialkalküls gerechtfertigt zu sein und zwar mit Blick auf das hierbei angenommene Verhältnis von Mathematik und Physik. Insbesondere sollen vier Stellen, an denen sich Hegel direkt auf New-
ton
bezieht, betrachtet werden.
Der begriffslogische
Gang von der Quantität zum Maß
Wie hatte sich nun in Hegels Entwicklung die unendliche Größe, der der von Newton aufgestellte Begriff entsprechen soll, ergeben?9 Mit Kant unterscheidet Hegel Größe als quantitas und Größe als quantum}® Nach Hegel ist die Quantität im Gegensatz zu Qualität ihrer Bestimmung nach die gleichgültige Bestimmtheit, eine Bestimmtheit, die nicht Negation eines Andern, sondern dagegen gleichgültig und der das Andere äußerlich ist. Sie hat zwei Formen, die der Diskontinuität und die der Kontinuität, verstanden als zwei Aspekte, die jeweils in unterschiedlicher Stufe resp. unterschiedlichem Verhältnis in Einheit vorhanden sind. Der von der Quantität unterschiedene Begriff des Quantums ist die bestimmte Quantität, der im eigentlichen Sinne der Begriff der Größe entsprechen soll. Diese werde in der Mathematik gewöhnlich als das definiert, was sich vermehren oder vermindern lasse.11 Die Größe ist ebenfalls sowohl diskret als auch kontinuierlich.12 Raumgröße und Zahlgröße unterscheiden sich nur in den verschiedenen Bestimmungen der Kontinuität und der Diskretion.13 An die Problematik der Zenonschen Para-
-
zeitgenössischen Überblick über den Stand und die Problematik des Differentialkalküls zu Hegels Zeigibt E.H. Dirksen mit seinen Rezensionen der Titel Neue Principien des Fluentencalculs von F.W. Spehr, Braunschweig 1826; Resume des Leçons donees à l'Ecole royale Politechnique sur le calcul infinitésimal von A.L. Cauchy, Paris 1823, in Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik 1827, Nr. 153 u. 154, Sp. 1217-1232, Nr. 155 u. 156, Sp. 1233-1248, Nr. 157 u. 158, Sp. 1249-1264, Nr. 159 u. 160, Sp. 1265-1271; Uhrbuch der algebraischen Analysis von A.L. Cauchy, Königsberg 1828, in ebd., 1829, Nr. 27 u. 28, Sp. 211-222. Es handelt sich um die Anmerkungen 2 und 3 zu der Passage "Die Unendlichkeit des Quantums" sowie um eine Hinzufügung zu Anmerkung 1 derselben Passage. Vgl. WdL; GW 11, 231f.; HW 5, 209-385, insbes. 209-211; Enz. §§ 99-106; HW 8, 209-224; siehe auch W. Bonsiepen, "Hegels Theorie des qualitativen Quantitätsverhältnisses" (Anm. 4), 101-108. Ersteres bedeutet bei Kant den Begriff der Größe überhaupt, letzteres die mathematische Größe (geometrische Raumgestalt) oder den äußeren Gegenstand seiner räumlichen Form nach (vgl. I. Kant, Werke, hg. v.
7 Einen ten
8 9
10
W. Weischedel, Frankfurt a.M. 1968, Bd. 4, 615f., 620f.). Die Quantität hat drei Momente: Einheit, Vielheit, Allheit (ebd. Bd. 3, 121-123). 11 Vgl. WdL; HW 5, 209-211; Enz. § 99, Anm.; HW 8, 209. 12 Vgl. WdL; HW 5, 234-236. 13 Eine detaillierte Diskussion der hieraus entspringenden Hegelschen Auffassung, wonach Geometrie nicht Meßkunst ist (vgl. ebd., 234), unter dem Aspekt seiner Rezeption der analytischen Geometrie und der Meßgrundlage einer mathematisierten empirischen Wissenschaft wäre aufschlußreich, würde hier nur zu weit führen.
273
Renate Wahsner
doxien
erinnernd, sich stützend auf die Konzepte von Aristoteles und Spinoza, entwickelt "daß die unendliche, d. h. abstrakte Vielheit nur an sich, der Möglichkeit nach, in der Hegel, Kontinuität enthalten", "daß die Materie nur der Möglichkeit nach ins Unendliche teilbar" ist.14 Er lehnt daher den Atomismus ab und hält ihm die Mathematik entgegen, die eine Metaphysik verwerfe, die die Zeit aus Zeitpunkten, den Raum aus Raumpunkten bestehen lasse.15 Aus gleichem Grund kritisiert er Kants zweite Antinomie. Thesis wie Antithesis seien für sich genommen falsch, vielmehr bedingten sie einander wie zwei Begriffsmomente, hier wie die Momente der Quantität: Diskretion und Kontinuität.16 Zugleich motiviert ihn Kants Antinomie zu der Suche danach, wie die Leibnizsche Monadologie positiv ins Spiel gebracht werden kann. Hegel bemüht sich um eine Synthese zwischen ihr und dem Kontinuitätskonzept des Aristoteles, das nur potentiell unendliche Teilbarkeit kennt, mithin um ein Diskontinuitätsverständnis, das dem Denken der neuzeitlichen Naturwissenschaft angemessen ist. Er sucht eine Vermittlung,17 wobei ihm das Verkennen der erkenntnistheoretischen Leistung des antiken Atomismus und der neuzeitlichen Modifizierung des Atomismus, die Newton mit seiner Mechanik de facto vollzogen hatte, hinderlich ist.18 Ob seine Zahlbestimmung deshalb noch ganz antik verbleibt,19 ist eine interessante Frage, die einer Prüfung wert wäre. Die Zahl ist für Hegel als bestimmte Menge eine Anzahl, und insofern sie sich auf ein Kontinuum bezieht, ist sie Anzahl des Gleichen, also Anzahl einer Einheit.20 Anzahl und Einheit machen so die Momente der Zahl aus eine Bestimmung, die sich in verschiedenen Entwicklungsstufen durch den gesamten Quantitätsabschnitt zieht. Der Zahlbestimmung folgen Anmerkungen, die den Unterschied von Geometrie und Arithmetik, die begriffslogische Bestimmung der vier Grundrechenarten, Kants Auffassung der Sätze der Geometrie und Arithmetik als synthetische Sätze a priori, die pythagoreische Zahlenlehre und das geistige Training beim Umgang mit Zahlen zum Gegenstand haben. Gegen Kant hält Hegel die mathematischen Sätze für analytische.21 Das Potenzieren, eigentlich das Erheben zum Quadrat, stellt für ihn die vollkommenste Rechnungsart dar, weil hier die Einheit die Anzahl selber ist (z.B.: 72 =7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 ).22 Die Frage, ob man mathematische Kategorien herbeinehmen könne, um aus ihnen etwas für die Methode oder den Inhalt einer philosophischen Wissenschaft zu gewinnen, verneint Hegel mit dem Argument, "daß, insofern mathematische Formeln Gedanken und Begriffsunterschiede bedeuten, diese ihre Bedeutung sich vielmehr zuerst in der Philosophie anzugeben, zu bestimmen und -
zu
rechtfertigen hat".23
14 Ebd., 226f. 15 Vgl. ebd., 213f. 16 Vgl. ebd., 225. 17 Vgl. ebd., 184-186, 189. 18 Siehe R. Wahsner, "Die Materie ist nicht ein seiendes Ding, sondern das Sein in der Weise des Begriffs. Hegels Konzept der Materie", Preprint 95 des Max-Planck-Insitutes für Wissenschaftsgeschichte, Berlin 1998, sowie die dort zitierte diesbezügliche Literatur. 19 Vgl. W. Bonsiepen, "Hegels Theorie des qualitativen Quantitätsverhältnisses" (Anm. 4), 103. 20 Vgl. WdL; HW 5, 232, 229. 21 Vgl. ebd., 237-240. 22 Vgl. ebd., 243, 381. 23 Ebd., 248.
274
Das mathematisch Unendliche und der Newtonsche
Bewegungsbegriff
Hernach entwickelt Hegel den Unterschied zwischen extensiver und intensiver Größe. Wurde die Zahl definiert als bestimmte Vielheit, als Vielheit mit einer Grenze, so zeigt sich, daß diese Grenze eine Menge nur unbestimmt begrenzt. Damit das Viele als bestimmtes Quantum sei, dazu gehört das Zusammenfassen der Vielen in eins, "wodurch sie mit der Grenze identisch gesetzt werden".24 Hegel geht hier von der potentiell unendlichen Teilbarkeit zur Betrachtung von Seiendem über, das eine bestimmte Größe hat und dadurch in seinem besonderem Dasein charakterisiert ist. Die Grenze wird nun bestimmt, real gesetzt. Das wird als Übergang von der extensiven zur intensiven Größe charakterisiert. Hierbei hat Hegel im Blick, daß die extensive Größe ein Vielfaches einer zugrunde gelegten Maßeinheit darstellt, während in der intensiven Größe eine solche Ausgangseinheit fehlt, dennoch aber ein Vielfaches existiert,25 das in einer eigentümlichen Weise zusammengefaßt wird, so daß es nicht mehr bloß Menge ist.26 Die entwickelte Identität von extensiver und intensiver Größe besagt, daß mit der Zusammenfassung des Vielen in eins eine Explikation des Einfachen im Vielen erfolgt. Kants Dynamisierung der Materie interpretiert Hegel als Reduktion des Extensiven auf das Intensive und kritisiert es.27 Die umgekehrte Reduktion lehnt er ebenfalls ab. Letztere Versuche betreffen die Grundlagenfragen des Infinitesimalkalküls, den Grenzwertbegriff und die Bedeutung des Unendlichkleinen. Diese Probleme diskutiert er als Probleme des quantitativen unendlichen Progresses, der überwunden werden muß: "Das unendliche Quantum als Unendlichgroßes oder Unendlichkleines ist selbst an sich der unendliche Progreß; es ist Großes und Kleines und zugleich Nichtsein des Quantums. Das Unendlichgroße und Unendlichkleine sind daher Bilder der Vorstellung, die bei näherer Betrachtung sich als nichtiger Nebel und Schatten zeigen. Im unendlichen Progreß aber ist dieser Widerspruch explizit vorhanden und damit das, was die Natur des Quantums ist, das als intensive Größe seine Realität erreicht hat und in seinem Dasein nun gesetzt [ist], wie es in seinem Begriffe ist. Diese Identität ist es, die zu betrachten ist."28 Genau das soll in der angekündigten Auswahl hier geschehen. In den drei nun folgenden, schon erwähnten, Anmerkungen, läßt sich Hegel in seiner Kritik der mathematischen Konzepte von dem Gedanken leiten, daß die in der Einheit von extensiver und intensiver Größe real gesetzte Grenze anerkannt werden muß, man nicht wieder zu der unbestimmten gleichgültigen Grenze zurückkehren darf, die dem Quantum, der Zahl als solcher, eigen ist. Denn die Zahl verwirklicht sich erst in der Identität von extensiver und intensiver Größe. Beide Größen sind ein und dieselbe Bestimmtheit des Quantums, doch die extensive Größe operiert mit der Anzahl, die intensive mit der Einheit. Die Beziehung beider Größen bedarf einer differenzierten Explikation. "Die Größenbestimmtheit kontinuiert sich so in ihr Anderssein, daß sie ihr Sein nur in dieser Kontinuität mit einem Anderen hat; sie ist nicht eine seiende, sondern eine werdende Grenze."29 Die Grenze bestimmt sich nicht in -
-
24 Ebd., 250. 25 So sind 3°
weniger als 22°. Aber im Gegensatz zu extensiven Größen sind intensive Größen (im heutigen physikalischen Verständnis), z. B. Temperaturen, nicht addierbar (vgl. z.B. H. Weyl. Philosophie der Mathematik und Naturwissenschaft, München, Wien 1966, 177-179). Vgl. WdL; HW 5, 252f. Vgl. ebd., 255f. Vgl. ebd., 276.
26 27 28 29 Ebd., 259.
275
Renate Wahsner
einem einseitigen Fortschreiten von extensiver und intensiver Größe, sondern in einem Verhältnis beider Größen zueinander. Dieses Verhältnis kann ein "qualitatives Quantitätsverhältnis" genannt werden,30 weil es ein Verhältnis zwischen Größentypen darstellt, mit deren Identität das qualitative Etwas eintritt, und zwar ein Etwas, das gegen seine quantitative Bestimmtheit gleichgültig ist. Konnte vom Quantum als Zahl ohne ein Etwas, das deren Substrat wäre, gesprochen werden, so ist das hier nun nicht mehr möglich.31 Am Schluß des Quantitätsabschnitts faßt Hegel seine Überlegungen mittels einer Differenzierung verschiedener Formen des quantitativen Verhältnisses zusammen. Er unterscheidet das direkte Verhältnis, das umgekehrte Verhältnis und das Potenzverhältnis.32 Diese Verhältnisse werden charakterisiert durch unterschiedliche Konstellationen von extensiver und intensiver Größe, die wie erwähnt die beiden Momente der Zahl, Anzahl und Einheit, für sich darstellen. Technisch lassen sie sich unterscheiden wie -¡- c, c -¡- bzw. ab b b c -
-
=
=
=
,
—
= Y bzw. a b2 Der Mangel der beiden ersten Arten des Quantitätsverhältnisses besteht darin, daß extensive und intensive Größe sich immer nur vermittels eines vorgegebenen Quotienten ("Exponenten") aufeinander beziehen. Das Potenzverhältnis benötigt einen solchen nicht mehr. Die Grenze (Quotient) wird gemeinsam durch die extensive und die intensive Größe erzeugt. Dieses Verhältnis ist daher das höchste. Hegel glaubte wie in der Literatur gezeigt -,33 mit dem Potenzverhältnis (als der Einheit von quantitativer und qualitativer Bestimmtheit) den Deduktionszusammenhang aller mathematischen Kategorien herstellen zu können. Im Potenzverhältnis soll die Kategorie des Maßes, genommen als das für sich bestimmte quantitative Verhältnis, angelegt sein.
j-
=
.
-
Hegels Lob des Newtonschen Gedankens Hegel hat die Infinitesimalrechnung als philosophisch bedeutsame Theorie reflektiert.34 In diesem Kalkül schreibt er operiert die Mathematik mit qualitativen Größenformen und geht damit über das gewöhnliche Begreifen hinaus, "indem das Quantum, indem es unendlich ist, als ein Aufgehobenes, als ein solches zu denken gefordert wird, das nicht ein Quantum ist und dessen quantitative Bestimmtheit doch bleibt".35 Dieses mathematisch Unendliche entspringt in seiner Sicht daher dem Begriff des wahrhaft Unendlichen. Als unendliches Quantum ist es keine Größenbestimmtheit, die ein Dasein als Quantum hätte, sondern es hat nur Bedeutung als Verhältnis, nur in Einheit mit dem zu ihm im Verhältnis Stehendem, ist außer diesem Verhältnisse Null. Mathematischer gesagt: Nur das Verhältnis der unendlichen, -
-
30 Vgl. ebd., 278, 279, 299. 31 Vgl. ebd., 254f. 32 Vgl. ebd., 372-386. 33 Siehe M. Wolff, "Hegel und Cauchy" (Anm. 4), 263. 34 Vgl. H.-H. v. Borzeszkowski und R. Wahsner, Physikalischer Dualismus und dialektischer
(Anm. 4). 35 WdL; HW 5, 283.
276
Widerspruch
Das mathematisch Unendliche und der Newtonsche
der unbestimmten
Quanta dx
und
dy
,
Bewegungsbegriff
also
nur
der
Differentialquotient
-r-,
ist
etwas
Be-
stimmtes. Sowohl der Limes der Ortsdifferenzen als auch der Limes der Zeitdifferenzen für sich ergibt Null. Das unendliche Quantum ist also bestimmt als etwas, das nur als wesentliche Einheit mit seinem Anderen ist; es ist somit Größenbestimmtheit in qualitativer Form. Dem Einwurf gegen den Differentialkalkül, es könne keinen Mittelzustand zwischen Sein und Nichts geben, was dieser Kalkül aber behaupte, wenn er daran festhielte, daß jene Quantitätsbestimmungen verschwindende Größen, also solche seien, die nicht mehr irgendein Quantum, aber auch nicht nichts, sondern noch eine Bestimmtheit gegen anderes, gegeneinander, sind, begegnet Hegel mit dem Satz: Es "ist die Einheit des Seins und des Nichts kein Zustand", sondern das Verschwinden, ebenso das Werden, also die Mitte oder die Einheit selbst ist allein ihre Wahrheit.36 Sosehr Hegel nun aber die Methode der Infinitesimalrechnung als Vorgehensweise, die dem wahren Unendlichen entspricht, würdigt, so empfindet er es doch als Mangel, daß die Mathematik sie nicht aus dem Begriff ableitet, sondern aus Erfahrungssätzen, und sie auch nur mit den erfolgreichen Ergebnissen, die durch sie erzielt wurden, rechtfertigt. Den Grund dieses Mangels sieht er darin, daß die Mathematik mit der Infinitesimalrechnung ihrer eigenen Methode, auf der sie als Wissenschaft beruht, widerspricht. An sich sei sie Wissenschaft von der Operation mit endlichen Größen. Verfahrensweisen, die sie hierbei verwerfen muß, erfordere aber gerade das Rechnen mit dem Unendlichen. Zugleich aber wolle sie auf die unendlichen Größen dieselben Verfahrensweisen anwenden wie auf die endlichen. Diese begrifflose Form des Differentialkalküls in der Mathematik impliziere die Unfähigkeit der Mathematik, die qualitativen Momente zu beweisen. Zwar überschreite dieser Kalkül die Grenzen der nur zählenden und Zahlenverhältnisse betrachtenden Mathematik, aber um Wissenschaft zu sein, fehle ihm noch etwas. Die Mathematik selbst könne dieses Fehlende nicht erbringen, der Differentialkalkül eröffne Möglichkeiten, die über die Mathematik hinausgingen. Diese Möglichkeiten will Hegel ausarbeiten. Es kommt ihm darauf an aufzuweisen, daß der Einwand gegen den Differentialkalkül, es sei das, was unendlich, nicht vergleichbar als ein Größeres oder ein Kleineres, es könne daher nicht ein Verhältnis von Unendlichem zu Unendlichem geben, unbegründet ist, ihm die Vorstellung zugrunde liegt, daß von Quanta die Rede sein solle, die als solche verglichen werden, Bestimmungen jedoch, die keine Quanta mehr sind, kein Verhältnis mehr zueinander haben. Dem setzt Hegel entgegen, daß das, was nur im Verhältnis ist, kein Quantum ist (wegen der oben angegebenen Bestimmung von Quantum und Qualität), jene unendlichen Größen daher durchaus vergleichbar sind, daß sie überhaupt nur als Momente des Vergleichs, des Verhältnisses sind. Hegel will zeigen, daß dem Differentialkalkül dieser Gedanke zugrunde liegt, die Mathematiker dies (im allgemeinen) nur nicht erkennen ausgenommen Newton. Der denke die Fluente nicht im Zustande des Seins, sondern im Werden, betrachte das Entstehen und Vergehen als solches und stelle die Grundsätze dieses Werdens auf, fasse die in Rede stehenden Größen als erzeugende Größen oder Prinzipien. Newton erkläre die Fluxionen nicht wie andere als Unteilbare (was den Begriff eines an sich bestimmten Quantums enthalte), sondern als verschwindend Teilbare, betrachte nicht Summen und Verhältnisse be-
36 Ebd., 297.
277
Renate Wahsner
stimmter Teile, sondern die Grenzen jener Summen und Verhältnisse und zwar in dem Sinne, daß er die Verhältnisse betrachte, mit denen diese Größen verschwinden. Kurz: er faßt die Differentiale als Größen in ihrem Verschwinden, bestimmt sie mithin als etwas, das nicht mehr Quantum ist. Das Verhältnis, in dem sie noch ein Quantum wären, verschwindet, die Grenze der Größenverhältnisse ist etwas, worin das Quantum ist und nicht ist. Hegel deutet das so, daß die Grenze des Größenverhältnisses das ist, worin das Quantum verschwindet und damit das Verhältnis nur noch ein qualitatives Quantitätsverhältnis ist und die Seiten dieses Verhältnisses als qualitative Quantitätsmomente erhalten sind. Newtons Begriff des letzten Verhältnisses entfernt nach Hegel sowohl die Vorstellung des Verhältnislosen, des gleichgültigen Eins als auch des endlichen Quantums. Doch es gibt auch ein Aber. Dieses konzentriert sich in dem Vorwurf, daß Newton die angenommene Bestimmung des mathematisch Unendlichen nicht zum Begriffe einer Größenbestimmung fortgebildet habe, die rein nur Moment des Verhältnisses ist, was die im Newtonschen Gedanken noch vorhandenen Aspekte des fortschreitenden Abnehmens bzw. Anwachsens (also des schlecht-unendlichen Progresses) und der Teilbarkeit überflüssig gemacht hätte.37 Positiv festgehalten wird jedoch der Gedanke: Erhaltung des Verhältnisses im Verschwinden der Quanta als Quanta.
Hegels Kritik an Newtons Umgang mit dem Differentialkalkül
Trotz der hohen Würdigung des Begriffs der letzten Verhältnisse verdächtigt Hegel Newton merkwürdiger Prozeduren bzw. der Erfindung sinnreicher Kunststücke, um das "arithmetisch unrichtige Weglassen der Produkte unendlicher Differenzen oder höherer Ordnungen derselben beim Finden der Differentialien zu beseitigen". Das Bedürfnis, den Fluxionskalkül wegen seiner Wichtigkeit zu beweisen, habe selbst einen Newton dahin gebracht, sich durch falsche Beweise täuschen zu lassen.38 Diesen Vorwurf zu analysieren empfiehlt sich, da ihm ein grundlegendes Mißverständnis inhärent ist. Es geht um das Differential des Produkts, zum Beispiel von xy. Newton definiert es als:
^-)(y ^-)-(x-^-)(y-^-) frei korrekt.40 die Klammern d(xy)=(x +
darstellt.41 37 38 39
+
Wenn man Er hat auch recht, daß die
=
xdy + ydx.39
Die
Bestimmung ist
zweifels-
auflöst, erhält man genau das, was Hegel zunächst Gleichung auf der nächsten Seite falsch ist. Wenn man
Vgl. ebd., 297-300. Vgl. ebd., 307f. Vgl. I. Newton, Mathematische Prinzipien der Naturlehre (Anm. 2), 243-246. Das von Newton dort Gesagte wird hier in der Schreibweise Hegels wiedergegeben. Newton schreibt für x A, für y B, für dx a, für dy b, für xy AB
usw.
hält dieses Verfahren, das Differential oder wie Newton sagt das Moment zu bestimmen, in einem anderen Zusammenhang für eine zu umständliche Methode "der beiden Bewegungen im entgegengesetzten Sinne" (vgl. L. Lagrange, Theorie der analytischen Funktionen, übers, v. J.Ph. Grueson, Berlin 1798, 214), doch bezweifelt er nicht ihre Korrektheit. 41 Vgl. WdL; HW 5, 307. 40
Lagrange
-
278
-
Das mathematisch Unendliche und der Newtonsche
Bewegungsbegriff
ihre linke Seite einmal verkürzt mit a bezeichnet, dann stünde rechts a + dxdy Hegel gelangt zu diesem zweifelsfrei unrichtigem Ergebnis durch sein Verständnis des Differenzierens. Er hält (JC + dx)(y + dy) xy für die richtige Definition des Differentials von xy. Aber das ist falsch. Es gilt zwar df = f(t + dt) f(t), und diese Struktur meint Hegel mit seiner Definition nachgebildet zu haben. Doch das trifft nicht zu, weil x und y keine unabhängigen Variablen bezüglich der Funktion / sind, sondern selbst Funktionen, und zwar Funktionen einer unabhängigen Variablen, die hier t genannt wird. Demzufolge lautet das Differential des Produkts df x(t + dt)y(t + dt) x(t)y(t). Und dies ist sehr wohl identisch mit dem, was auf der linken Seite der Hegelschen Gleichung steht, mithin also mit Newtons Definition des Differentials von xy .42 Hegels Vorwurf ist hier nicht berechtigt. Man könnte meinen, er resultiere aus einer mathematisch-technischen Unsicherheit Hegels im Umgang mit dem Differentialkalkül. Betrachtet man aber alle drei Anmerkungen zum Thema "Unendlichkeit des Quantums", wird offenbar, daß es um ein konzeptionelles Mißverständnis geht. He.
-
-
=
—
dy
gel diskutiert den Differentialquotienten -£- (also die Ableitung einer Funktion, hier y genannt, nach der unabhängigen Variablen, hier x genannt) nur als Ausdruck eines Bruchs, allerdings eines Bruchs, in dem Zähler wie Nenner unbestimmte, verschwindende Quanta dar-
stellen, die nur im Verhältnis zueinander etwas Bestimmtes sind. Er liest diesen Ausdruck nicht als dy nach dx ", also nicht als Änderung einer Größe y mit X nicht als Änderung der abhängigen Variablen bezüglich der unabhängigen Variablen in einem Gefüge, das durch die jeweilige Funktion / angegeben ist. Hegel unterscheidet nicht zwischen abhängigen und unabhängigen Variablen. Für ihn handelt es sich um "zwei veränderlich[] Größen, die in einer Gleichung verbunden sind, deren die eine als eine Funktion der anderen angesehen wird".43 Gewiß ist die eine Veränderliche Funktion der anderen. Aber im jeweiligen Zusammenhang muß festgelegt werden, welche Variable als unabhängige, welche als abhängige fungieren soll, sonst kann man nicht differenzieren, nichts ausrechnen.44 Wenn Cassirer schreibt, das Verhältnis sei das allein Bekannte, während die Elemente, die es eingehen, erst durch es bestimmt werden, oder daß das Gebilde seinen gesamten Bestand aus den Relationen erhalten solle,45 so würde Hegel dem vehement zustimmen. Aber die Bestimmung der Elemente ist eben ausgeschlossen, wird nicht zwischen abhängiger und unabhängiger Variablen unterschieden. Eine solche Festlegung würde aber vermutlich Hegels Gedankenführung stören, weil man es dann nicht mehr mit dem reinen bloßen Verhältnis zu tun hätte.46 Doch der gesamte Differentialkalkül beruht gerade auf diesem Funktionsgedanken. Dies ist Hegel entgangen oder interessiert ihn nicht. "
,
42 Will man dies überprüfen, so ist zu bedenken, daß dx(t) = x(t + dt) x(t) und dy(t) = y(t + dt) y(t) 43 WdL; HW 5, 313. 44 Rein mathematisch kann man eine gegebene Funktion stets auch umkehren, für die Erfassung eines physikalischen Zusammenhangs steht dies allerdings nicht immer frei. 45 Wörtlich schreibt Cassirer: "Das Verhältnis, das in der Gleichung ausgesagt wird, ist das allein Bekannte, während die Elemente, die dieses Verhältnis eingehen, in ihrer Bedeutung zunächst noch unbestimmt sind und erst kraft der Gleichung allmählich bestimmt werden." (Substanzbegriff und Funktionsbegriff. Untersuchungen über die Grundfragen der Erkenntniskritik, Darmstadt 1990, 59f.). 46 Vgl. dazu die Ausführungen in dem Abschnitt "Die Grenze des Verhältnisses und die qualitative Bestimmtheit". -
-
.
279
Renate Wahsner
Der Differentialquotient ist nicht lediglich ein Bruch der genannten besonderen (begriffslogisch interpretierten) Art, sondern quasi das Symbol eines geronnenen Prozesses, er ist das Ergebnis einer vorangegangenen Operation, der Limesbildung. Obzwar Hegel dies natürlich weiß, argumentiert er häufig so, als sei ihm dies nicht bewußt. Daher mutmaßt Hegel, Newton hätte den von ihm kritisierten Fehler (der wie erwiesen keiner war) begangen, "um das arithmetisch unrichtige Weglassen der Produkte unendlicher Differenzen oder höherer Ordnungen derselben beim Finden der Differentialien zu beseitigen.47 Der Übergang vom Differenzenquotienten zum Differentialquotienten erfolgt nicht durch das (unmotivierte oder nur durch die physikalische Anwendung begründete) Weglassen von Gliedern höherer Ordnung, sondern dadurch, daß der Grenzübergang vollzogen wird, indem die unabhängige Variable gegen Null geht. Das Ergebnis ist exakt. Allerdings kann die Argumentation mit unendlichen Reihen, bei denen man oftmals, vor allem bei physikalischen Anwendungen, abbrechen muß, da dort der Grenzübergang eben noch nicht vollzogen wurde, leicht zu dem Hegelschen Irrtum verleiten.48 Und Hegel hat wohl den Differentialkalkül vorwiegend in dieser Gestalt vor Augen. Den Funktionsgedanken, der dem Differentialkalkül inhärent ist, verkannt zu haben demonstriert Hegel auch durch die folgende erst in der zweiten Auflage hinzugefügte Passage: "Analysieren wir die Methode näher, so ist der wahrhafte Vorgang dieser. Es werden erstlich die Potenzenbestimmungen (versteht sich: der veränderlichen Größen), welche die Gleichung enthält, auf ihre ersten Funktionen herabgesetzt. Damit aber wird der Wert der Glieder der Gleichung verändert; es bleibt daher keine Gleichung mehr, sondern es ist nur ein -
-
-
Verhältnis entstanden zwischen der
ersten Funktion der
anderen;
statt px
ersten =
y2
-
Funktion der einen veränderlichen Größe zu der hat man p:2y oder statt lax x2 =y2 hat man ,
-
dy a x:y, was nachher als das Verhältnis -f- bezeichnet zu werden pflegte. Die Gleichung ist Gleichung der Kurve; dies Verhältnis, das ganz von derselben abhängig, aus derselben (oben nach einer bloßen Regel) abgeleitet ist, ist dagegen ein lineares, mit welchem gewisse Linien in Proportion sind; p: 2y oder a x: y sind selbst Verhältnisse aus geraden Linien der Kurve, den Koordinaten und den Parametern; aber damit weiß man noch nichts. Das Interesse ist, von anderen an der Kurve vorkommenden Linien zu wissen, daß ihnen jenes Verhältnis zukommt, die Gleichheit zweier Verhältnisse zu finden."49 Es sei also die Frage —
-
-
Hegel (Wdl;
47
HW 5,
ten Seite den Term
48 Die
308) glaubt, Newton würde die Gleichung dadurch richtig machen, daß er auf der rechdxdy "wegen seiner Kleinheit" wegläßt.
Entwicklung der Reihe lautet:
f(t + At) f(t) + f(t)At + jf"(t)At2 =
Differenz zwischen der Funktion
f(t + At)-f(t) chung
=
durch At
vollzogen,
so
an
+
j^f'"(t)At3+.
der Stelle
t +
f(t)At + jf'(t)At2+j^f"(t)At3+.
geteilt hat,
ergibt
der
sich exakt
Grenzübergang =
/' (t) [Man
lim
49
WdL;
280
HW
,
/, h ) nicht für endlich ansieht (vgl.
5, 337f.
z.
an
der Stelle
Wird nun, nachdem
-tj /' (t) + jf" (t)At =
muß den Verdacht haben, daß
—
auch mit r>
(wobei Ai ein endlicher Wert ist). Die
At und der Funktion
B.
ebd., 332).]
beträgt: A/
t
man
-f-^r /" Hegel
'
Af
=
diese Glei-
(t)At2+. (bezeichnet
Das mathematisch Unendliche und der Newtonsche
Bewegungsbegriff
fährt Hegel fort -, welches die durch die Natur der Kurve bestimmten Geraden sind, die in dem abgeleiteten Verhältnis zueinander stehen. Dies aber hätten schon die Alten auf sinnreichem geometrischem Wege gefunden, daß dies das Verhältnis der Ordinate zur Subtangente ist. (Die modernen Erfinder des Differentialkalküls hätten nur ein Verfahren erfunden, die die Kurve darstellende Gleichung so zu behandeln, daß durch ihre Depotenzierung das Verhältnis von Ordinate und Subtangente sich ergibt.) Indem dieses Verhältnis die Tangente an die Kurve bezeichnet, gelangt Hegel zur Ableitung der diese Kurve bestimmenden Funktion. Er kommentiert für die von ihm angeführten Beispiele den Weg, auf dem man zu dieser Ableitung gelangt. Seine Darlegungen enthüllen jedoch, daß er einen eingeschränkten Begriff von Funktion hat, und diesen braucht er, weil das Verfahren, das er verwendet, nicht durchgängig zum Erfolg führt. Es funktioniert nur für Potenzfunktionen bedingt dadurch, daß er Differenzieren auf Depotenzieren reduziert oder umgekehrt: er reduziert Differenzieren auf Depotenzieren, weil er nur mit Potenzfunktionen arbeitet. Hegels Verfahren besteht darin, die auf der linken und die auf der rechten Seite der Gleichung stehenden Ausdrücke für sich abzuleiten, je nach der Variablen, die in ihnen vorkommt. Würde er nicht nur diese Ableitungen, sondern die Differentiale bilden, so wäre dieses Vorgehen korrekt. Man erhielte dann sogar wieder eine Gleichung,50 was Hegel ja gerade bestreitet und darauf seine gesamte Argumentation aufbaut.51 Problematisch würde es werden, wenn eine Gleichung differenziert werden soll, in der ein Term xy auftritt (es sei denn, man bildet wieder das Differential).52 Nach Hegels Verfahren, wonach x und y gleichberechtigte Variable sind, nach denen jeweils abgeleitet wird, würde dieser Term nicht behandelt werden können, weil er keine reine Funktion in x oder y, geschweige denn ein Polynom in -
oder y ist. Es scheint nicht zufällig zu sein, daß Hegel hier nicht von der expliziten Form einer Funktion y f(x) oder x f(y) ausgeht, sondern von der impliziten (also einer Gleichung, die nicht nach x oder y aufgelöst ist). Er versteht letztlich die Differentiation einer Kurve bzw. einer Funktion nicht als Änderung der Kurve bezüglich einer unabhängigen Variablen (= Änderung des durch die Funktion fixierten Verhältnisses zwischen den in ihr vorkommenden Größen), sondern als das Erzeugen von "Verhältnissen" (d. i. speziell interpretierten Brüchen), zu denen dann noch jeweils die Verhältnisse zu finden sind, die mit ihnen gleich sind.53 Die Funktion als Zusammenhang interessiert offensichtlich nicht. x
=
50 Um das
erste
=
der
Hegelschen Beispiele zu nehmen:
Von px
=
y2
wäre
zu
bilden
pdx
=
2ydy
,
was
in die
-j-
= Beziehung y- umgeformt werden kann. 51 Siehe den Abschnitt "Die Grenze des Verhältnisses und die qualitative Bestimmtheit".
52 Die angenommene Ausgangsgleichung sei y2 + xy px ; die Bildung des Differentials führt (unter Berücksichtigung der Produktregel dxy xdy + ydx ) zu 2ydy + xdy + ydx = pdx bzw. (2y + x)dy (p y)dx, =
=
=
dy p-y woraus folgt, -^ 2y+x Wo,'te man dasselbe Ergebnis nicht durch die Bildung eines Differentials, sondern durch seine Ableitung erzeugen, müßte man die Ausgangsgleichung so verstehen, daß x und y Funktionen von t sind. Dann hätte man beide Seiten nach t zu diffrenzieren. Das führt dann zu der Gleichung dy p-y dx woraus ebenfalls dy (2y + x)~dt=~dt' IE 2y~+x~ fol&53 Vgl. auch HW 5, 335-345, 350. -
=
•
=
281
Renate Wahsner
Aus diesem Verständnis des Differenzierens erklärt sich auch Hegels Auffassung, daß die Differentiation linearer Gleichungen keinen Sinn habe.54 Es habe keinen Sinn, lineare Gleichungen, z. B. y ax oder y ax + b, zu differenzieren, da man so nur ein Ergebnis erhalte, zu dem man auch durch schlichtes Auflösen der Gleichung komme. Das stimmt aber nicht immer, da aus der zweiten Gleichung durch Auflösen nicht wie im erstgenannten Fall =
-
a
folgt, sondern
= —
tialrechnung, daß
a
a =-.
Doch versteht
das ist
man -
den Anstieg der Geraden,
gegeben durch
richtig
—,
auch ohne Differen-
bedeutet. Aber
gerade weil
in diesem einfachen Falle außerhalb des Differentialkalküls einen Zugang zur Bestimmung der Änderung der Kurve hat, bedarf es der Differentiation der linearen Gleichung, um die Konsistenz dieses Kalküls mit den üblichen Verfahren zu prüfen, mithin seine mathematische Zulässigkeit. In dem Fall allerdings, den Hegel als Korrektur Newtons durch Lagrange zitiert,55 handelt es sich tatsächlich um einen Fehler, der aber im Gegensatz zu Hegels Annahme nichts mit der Ableitung der Produktregel d(xy) ydx + xdy zu tun hat. Wie Lagrange schreibt, hatte bereits Johann Bernoulli gefunden, daß Newtons Auflösung falsch ist, "indem er sie mit derjenigen verglich, welche die Differenzialrechnung giebt; und sein Enkel Nicolas behauptete, daß der Irrthum daher käme, daß Newton das dritte Glied der convergirenden Reihe, durch welche er die Ordinate der gegebenen krummen Linie ausdrückte, für das zweyte Differenzial dieser Ordinate, und das vierte für das dritte Differenzial genommen hätte, statt daß nach den Regeln der Differenzialrechnung diese Glieder, das eine nur die Hälfte, das andere nur der sechste Theil eben der Differenzialien sind".56 Lagrange korrigiert diesen Fehler, um zu zeigen, daß die Methode der Reihen, die Newton zunächst benutzt hatte und dabei in der ersten Auflage der Principia zu eben diesem unrichtigen Ergebnis kam, weshalb er dann ein anderes Verfahren benutzte, mit dem er wie die zweite und dritte Auflage der Principia belegen zum richtigen Resultat gelangte, nicht falsch ist. Lagrange belegt, daß man die Methode der Reihen verbessern kann und dann ohne Schwierigkeit das Ergebnis erhält, zu dem Newton mit seinem anderen Verfahren gekommen war. Er leitet den richtigen Ausdruck für das Verhältnis von Widerstand und Schwere ab und zeigt, daß man dafür die Reihenentwicklung der Funktionen des Ortes in Abhängigkeit von der Zeit bis zur dritten Ordnung in t führen muß.57 Hierbei kann man sich leicht vertun, indem man übersieht, daß man -je nach der vorgesehenen Operation (Multiplizieren, Dividieren, Potenzieren oder dgl.) eventuell in den (abgebrochenen) Reihen, die multipliziert oder dgl. werden sollen, noch Glieder der nächst- oder übernächsthöheren Ordnung hinzunehmen muß, da sie noch Terme der Ordnung, bis zu der man das Ergebnis führen will, enthalten. Newton hatte tatsächlich das Glied der man
-
-
=
-
-
-
54 55 56 57
Vgl. z.B. ebd., 328. Vgl. ebd. 308-310. Vgl. L. Lagrange, Theorie der analytischen Funktionen (Anm. 40), 8f. Vgl. ebd., 214-225. Lagrange entwickelt das "Verhältniß des Widerstands zur Schwere, so wie Newton es gefunden hatte" und resümiert: "In der That, es ist leicht zu sehen, daß diese Analysis [d. i. die von Lagrange entwickelte R.W.] im Grunde keine andere ist als die des Newton, befreyt von der Betrachtung der beiden Bewegungen im entgegengesetzten Sinne und auf die einfachste Form gebracht; sie hat überdem den Vorzug daß sie leicht die Quelle des Fehlers entdecken läßt, und Mittel an die Hand giebt, ihm abzuhelfen." (Ebd., 220). -
282
Das mathematisch Unendliche und der Newtonsche
Bewegungsbegriff
Reihe, das die Potenz enthielt, auf die es ankam, vernachlässigt,58 aber aufgrund eines Rechenfehlers, nicht weil er sich wie Hegel unterstellt "an jenes formelle oberflächliche
Prinzip, Glieder wegen ihrer relativen Kleinheit wegzulassen, gehalten" hat.59 Wegen der -
-
Mängel, die dem Rechnen mit Reihen auch nach der Lagrangeschen Weiterentwicklung noch inhärent waren, wurde der Kalkül ja weiterentwickelt, z. B. von dem französischen Mathematiker Cauchy, dessen Leistung Hegel aber nicht rezipiert,60 obwohl ihn die ihm bekannten -
Rezensionen Dirksens darüber hätten aufklären können. Lagrange nun vernachlässigt in der Anwendung der Theorie der Funktionen auf die Mechanik Glieder der Reihe sowohl wegen ihrer relativen Kleinheit als auch, indem er von ihnen aus physikalischen Gründen abstrahiert. Letzteres ist nach Hegel ein akzeptables Verfahren, da die Glieder der Reihe hiermit "nicht nur als Teile einer Summe", sondern "als qualitative Momente eines Ganzen des Begriffs" angesehen werden.61 Hier werde das Verfahren vom qualitativen Sinn abhängig gemacht. Die ganze Schwierigkeit des Prinzips, also des Differentialkalküls, würde nach Hegel beseitigt sein, "wenn statt des Formalismus, die Bestimmung des Differentials nur in die ihm den Namen gebende Aufgabe, den Unterschied überhaupt einer Funktion von ihrer Veränderung, nachdem ihre veränderliche Größe einen Zuwachs erhalten, zu stellen die qualitative Bedeutung des Prinzips angegeben und die Operation hiervon abhängig gemacht wäre".62 Da also begriffslogisch das "qualitative Quantitätsverhältnis" in die Qualität zurückführt, sieht Hegel in der physikalischen Bedeutung der einzelnen Reihenglieder bzw. in der physikalischen Begründung des Abbruchs der Reihe einen akzeptablen Grund. Hierauf wird noch zurückgekommen werden. Einen Beleg dafür, daß die einzelnen Glieder der Reihe nicht als Teile einer Summe, sondern als "qualitative Momente eines Ganzen des Begriffs" angesehen werden müssen, sieht Hegel darin, daß sich das Differential von x" durch das erste Glied der Reihe, die sich durch die Entwicklung von (jc + dx)n ergibt, gänzlich erschöpft, man es also genau besehen nicht mit einer schlecht unendlichen Reihe zu tun hat.63 Es ist dies eine sehr wichtige Einsicht, -
-
58 Vgl. WdL; HW 5, 309. 59 Ebd. 60 Michael Wolff urteilt: "Hegel unternimmt nicht den geringsten Versuch zu beachten, welche mathematischen Probleme Cauchy mit Hilfe seiner neuen Definitionen, Sätze und Methoden formal bewältigt hat: Ihm scheint es völlig gleichgültig zu sein, daß Cauchys .Theorie der Grenzen' die manifesten Widersprüche und Unklarheiten beseitigt hat, die den bisherigen Begründungen der Regeln der Infinitesimalrechnung anhafteten. Hegel stellt das von Cauchy präzisierte Verfahren der Grenzannäherung mit dem von Newton, Leibniz und anderen benutzten Verfahren der Vernachlässigung infinitesimaler Größen auf eine Stufe, obwohl das neuere Verfahren die Widersprüche gerade vermeidet, die beim älteren aufgetreten waren, und obwohl der Begriff des .Infinitesimalen' im Rahmen des neueren Verfahrens ganz anders verwendet wird, weil er eigentlich nicht mehr als Prädikat von Größen, sondern vielmehr als Prädikat eines bestimmten Funktionsverhaltens gebraucht wird, so daß damit auch die Schwierigkeiten entfielen, welche die Kritiker der Infinitesimalrechnung seit Berkeley stets angeführt hatten." (M. Wolff, "Hegel und Cauchy", Anm. 4, 261). Genauer müßte man sagen, daß mit Cauchy die dem Infinitesimalkalkül immanente Bestimmung des Infinitesimalen, Prädikat eines Funktionsverhaltens zu sein, auf den (mathematischen) Begriff gebracht wurde. 61 "Hierdurch" schreibt Hegel weiter "erhält das Weglassen der übrigen Glieder, die der schlecht unendlichen Reihe angehören, eine gänzlich verschiedene Bedeutung von dem Weglassen aus dem Grunde der relativen Kleinheit derselben." (HW 5, 309). 62 Ebd., 310. 63 Vgl. ebd., 310f, 322. -
-
283
Renate Wahsner
richtig liest: Die Reihe ergibt sich durch die Entwicklung des Bi(x Ax)" [nicht (x dx)n ]. Mit dem ersten Glied ist sie nicht gegeben, sondern man muß alle Glieder nehmen, es sei denn, man hat praktische Gründe, sie abzubrechen. Die andere Möglichkeit ist, daß man es nicht mit dem endlichen Ar, sondern mit dem infinitesimalen dx zu tun hat, es also um (x + dx)n geht. Dann ist das Gesuchte tatsächlich mit dem ersten Glied der ehemaligen Reihe gegeben, weil das definitionsgemäß das Differential von x" darstellt. Die erste Ableitung ist man könnte sagen: trivialerweise durch das erste Glied der Reihe gegeben, weil es das einzige ist, das Ax nicht enthält, beim Übergang von Ax gegen Null daher erhalten bleibt.64 Man könnte dies so interpretieren, daß mit dx" nxn~ldx das Prinzip der Reihe jeweils fixiert ist vorausgesetzt allerdings, man ereine,
wenn man
noms
die Sache
+
+
-
-
=
faßt das Differential als geronnenen Prozeß, als geronnenen Prozeß der Grenzwertbildung.65 Hegels Aufmerksamkeit ist auf die Ganzheit gerichtet, aber er sieht sie nicht dort, wo sie ist, nämlich um das zu wiederholen in der Ganzheit des Übergangs von der Ganzheit der die Stammfunktion (bei Newton "Fluente" genannt) bildenden Gleichung y f(x) (in diesem Fall) x" zu der Ganzheit der die Ableitung dieser Funktion ("Fluxion" genannt bei Newton) bildenden Gleichung y' f (x) (in diesem Fall) nxn~x Daraus, daß Hegel die einzelnen Glieder einer Reihe nicht als Teile einer Summe, sondern als qualitative Momente eines Ganzen des Begriffs angesehen wissen will, resultiert auch seine Kritik an dem Verfahren, das seines Erachtens in der Mechanik angewandt wird, die Bewegung resp. die Kräfte zu zerlegen, z. B. beim Fallgesetz "in die schlecht-gleichförmige Geschwindigkeit, die der Kraft der Trägheit anheimfällt, und die beschleunigende Kraft".66 Somit werde die durch das Potenzverhältnis etablierte Einheit zerstört, ebenso wie bei der durch die Schwere implizierten freien Bewegung der Himmelskörper, die als Wechselspiel von Zentripetal- und Zentrifugalkraft ausgegeben werde.67 Hegel meint, durch die Mechanik würden Linien, die durch geometrische Konstruktion entstanden seien, oder Glieder einer mathematischen Formel, in die die analytische Behandlung beispielsweise die Bewegung zerlegt, eine gegenständliche Bedeutung erhalten, mithin für etwas Existierendes genommen werden (obzwar sie nur Momente eines Begriffs seien).68 Abgesehen davon, daß manche der von Hegel vermuteten Zerlegungen in der Mechanik nicht stattfinden, etwa die Newtonsche Himmelsmechanik nicht mit dem Wechselspiel von Zentripetal- und Zentrifugalkraft arbeitet,69 unterscheidet Hegel nicht sauber zwischen Trägheit und Gegenkraft und übersieht, daß die Mechanik, indem sie keine spekulative, sondern eine messende und rechnende Wissenschaft ist, gewisse Zerlegungen benötigt so die grundlegende Zerlegung in die als Bewegungsetaion gewählte geradlinig gleichförmige Bewegung und die an dieser gemessene beschleunigte Bewegung resp. dynamische Wechselwirkung.70 -
-
-
=
=
=
=
.
-
64 Siehe Anm. 48, 109 [bei dem
/' (t) entsprechend /' (x)
=
von
Hegel gewählten Beispiel
nx"~l ].
wäre statt
f(t)
zu setzen
f(x)
=
x"
,
statt
65 Siehe auch Anm. 109. 66 Enz. § 267, Anm.; HW 9, 77. 67 Vgl, WdL; HW 5, 405-407, 451^*55; Enz. §§ 267, 269, 270; HW 9, 75-77, 83, 85-106. 68 Vgl. WdL; HW 5,319f. 69 Siehe auch W. Neuser, "Einleitung" in G.W.F. Hegel, Dissertatio Philosophica de Orbitis Planetarum, übersetzt, eingeleitet und kommentiert von W. Neuser, Weinheim 1986, insbes 11. 70 Siehe H.-H. v. Borzeszkowski und R. Wahsner, Physikalischer Dualismus und dialektischer Widerspruch
(Anm. 4).
284
Das mathematisch Unendliche und der Newtonsche
Bewegungsbegriff
Bewegungsformen gehen auch nicht ineinander über; es muß also kein "Übergang von jener schlecht gleichförmigen Geschwindigkeit zu einer gleichförmigen beschleunigten begreiflich" gemacht werden.71 Der Zusammenhang dieser Auseinandergelegten ist durch die drei Grundgesetze (Axiome) der Mechanik gegeben. Außerhalb dieser Ganzheit hat es keinen Sinn die Zerlegten für sich zu diskutieren (oder philosophisch zu kritisieren). In der letzten Passage, in der sich Hegel explizit auf Newton bezieht,72 geht es im wesentlichen um die "Ableitung" bzw. den Beweis des Gravitationsgesetzes.73 Hegel hält diesen Vorgang für eine nur formelle Verallgemeinerung.74 Er hat den Eindruck, daß der entwickelte Differentialkalkül benutzt wird, um den Beweis problematischer physikalischer Zusammenhänge vorzutäuschen, mithin rein formale, nur mathematisch zulässige, Zusammenhänge als physikalische Begründungen auszugeben. "Es wird für einen Triumph der Wissenschaft ausgegeben, durch den bloßen Kalkül über die Erfahrung hinaus Gesetze, d. i. Sätze der Existenz, die keine Existenz haben, zu finden."75 Was am Gravitationsgesetz physikalisch ist, dies habe alles schon Kepler erkundet. "Wenn die Newtonsche Form für die analytische Methode ihre Bequemlichkeit nicht nur, sondern Notwendigkeit hat, so ist dies nur ein Unterschied der mathematischen Formel, die Analysis versteht es längst, den Newtonschen AusDiese
druck und die damit zusammenhängenden Sätze aus der Form der Keplerschen Gesetze abzuleiten."76 Es ist dies ein alter und von Hegel offensichtlich sehr geliebter Standpunkt, der seinen Begriff der Schwere und der Gravitation sowie sein Konzept vom Verhältnis zwischen Mathematik und Naturwissenschaft zeitlebens geprägt hat. Von seiner Habilitationsschrift an über die Jenaer Systementwürfe und alle drei Ausgaben der Enzyklopädie bis zur 1831 überarbeiteten Fassung des ersten Buches der Logik bekundet er diese Sicht auf das Kepler-Newton-Verhältnis.77 Daß es eine falsche Sicht ist wurde in der Literatur mehrfach dargetan.78 Vor allem übersieht Hegel, den Charakter einer physikalischen Dynamik im Unterschied zu einer rein kinematischen Theorie, die die Keplersche Astronomie war, und den Umschwung,
71 Vgl. WdL; HW 5, 320. 72 Vgl. ebd., 320-322. 73 Vgl. I. Newton, Mathematische Prinzipien der Naturlehre (Anm. 2), 55-57. 74 Vgl. M. Wolff, "Hegel und Cauchy" (Anm. 4), 254-258. 75 WdL; HW 5, 320. 76 Enz. § 270, Anm.; HW 9, 87. Im Umfeld dieser Textpassage wird auch der Zusammenhang jener Beurteilung des Kepler-Newton-Verhältnisses mit der vermeintlichen Kräfteaufspaltung der Mechanik deutlich. 77 Zu letzterem siehe WdL; HW 5, 407; siehe auch Anm. 67. 78 Siehe z. B.: H.-H. v. Borzeszkowski, "Hegel's Interpretation of Classical Mechanics", in Hegel and Newtonianism, hg. v. M.J. Petry, Dordrecht 1993; R. Wahsner, "The Philosophical Background to Hegel's Criticism of Newton", in ebd. [in dt. Fassung mit einer das Kepler-Newton-Verhältnis erläuternden Anmerkung in dies., Zur Kritik der Hegelschen Naturphilosophie (Anm. 4), 153-165 (Anhang)]; dies., "Hegels spekulativer Geozentrismus", in Hegels Jenaer Naturphilosophie, hg. v. K. Vieweg, München 1998 [auch in dies., Zur Kritik der Hegelschen Naturphilosophie (Anm. 4), 203-215 (Anhang)]; H.-H. v. Borzeszkowski und R. Wahsner, "Die Natur technisch denken? Zur Synthese von TEXvn und çuaiç in der Newtonschen Mechanik oder das Verhältnis von praktischer und theoretischer Mechanik in Newtons Physik", in Sammelband zu Ehren von Paul Lorenzen, hg. v. M. Weingarten, Frankfurt a.M. (im Druck) (auch Preprint 87 des MPI für Wissenschaftsgeschichte, Berlin 1998); H.-H. v. Borzeszkowski, "Hegels Newton-Bild in seinen .Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie'", in Hegel-Jahrbuch 1998, Berlin 1999, 137-141. -
285
Renate Wahsner
der sich im Denken vollziehen
gelangen.79
mußte, um zu einer Bewegungstheorie Newtonschen Typs zu
Mit der Begründung des Newtonschen Gravitationsgesetzes wurde die Synthese von Mechanik (im antiken Verständnis als Technik) und Physik (im antiken Verständnis von Naturphilosophie), von irdischer und Himmelstheorie vollendet. Sie vollzog sich letztlich als Vereinigung der auf experimentellen Untersuchungen der Bewegungen irdischer Körper beruhenden Mechanik Galileis und Keplers Planetentheorie.80 Die Bedeutung der von Hegel fast vollständig vernachlässigten durch Galilei vertretenen Komponente für die Fundierung der neuzeitlichen Mechanik, für die das Gravitationsgesetz hodogetische Bedeutung hat, zeigt in charakteristischer Weise der Weg, auf dem Newton zu diesem Gesetz gelangt ist. So argumentiert er im dritten Buch seiner Principia wie folgt: Die Planeten bewegen sich auf Ellipsen um die Sonne (1. Keplersches Gesetz), wobei der Leitstrahl zwischen Sonne und Planet in gleichen Zeiten gleiche Flächen überstreicht (2. Keplersches Gesetz). Daraus folgt gemäß den ersten drei Propositionen des dritten Buches,81 daß die Planeten durch eine auf die Sonne gerichtete Zentripetalkraft auf ihren Bahnen gehalten werden. Setzt man nun die Gültigkeit der Newtonschen Bewegungsaxiome voraus, so folgt aus dem 3. Keplerschen Gesetz, wonach sich die Kuben der großen Halbachsen zu den Quadraten der Umlaufzeiten konstant verhalten, daß die Gravitationskraft den Massen der Körper proportional und dem Quadrat ihrer Abstände umgekehrt proportional ist. Damit ist die Gravitationskraft bis auf einen konstanten Faktor y deduziert. Dieser Faktor kann erst dann bestimmt werden, wenn man vorausgesetzt oder nachgewiesen hat, daß auch die irdischen Bewegungen der so deduzierten Kraft genügen. Durch das aus der praktischen Mechanik bekannte Verhalten von Gewichten, die sowohl im antiken als auch in Newtons Sinne Kräfte der Hand sind, wird es möglich, die Konstante y mittels der Torsionswaage zu bestimmen, und erst wenn diese Konstante y (die sogenannte Newtonsche Gravitationskonstante) gemessen werden kann und nachgewiesen wird, daß diese experimentell bestimmte Konstante auch die "Phänomene" der Mond- und der Planetenbewegung quantitativ korrekt zu deduzieren gestattet, ist das Newtonsche Gravitationsgesetz etabliert. Die Newtonsche Mechanik mit ihrem Gravitationsgesetz ist also als Vereinigung der genannten Komponenten entstanden, die sich ihrerseits im Vergleich zu ihrem antiken Ausgangsstatus dem neuzeitlichen Denkprinzip gemäß gewandelt hatten (z. B. Funktionsdenken statt Substanzdenken, heliozentrischer statt geozentrischer Standpunkt).82 Die "Ableitung" -
-
79
Einige Aspekte dieses Umschwungs behandelt E. Cassirer, Substanzbegriff und Funktionsbegriff (Anm. 45), B. 88-99, 173-184; siehe auch H.-H. (Anm. 78), insbes. 9-12, 19-26. z.
v.
Borzeszkowski und R. Wahsner, "Die Natur technisch denken?"
80 Dieser sowie der folgende Absatz basiert auf: H.-H. v. Borzeszkowski und R. Wahsner, "Die Natur technisch denken?" (Anm. 78). 81 In der Wolfersschen Übersetzung wird "Proposition" mit "Lehrsatz" wiedergegeben. 82 Zur Erläuterung des neuzeitlichen Denkprinzips siehe K. Laßwitz, Geschichte der Atomistik, Hamburg, Berlin 1890; E. Cassirer, Substanzbegriff und Funktionsbegriff (Anm. 45); ders., Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft der neueren Zeit, Darmstadt 1994 (Reprint), Bd. 1-4: B. Heidtmann, "Die sich selbst bewegende Substanz. Zu Voraussetzungen und Konsequenzen des philosophischen Grundsalzprogramms Hegels", in Arbeit und Reflexion. Zur materialistischen Theorie der Dialektik. Perspektiven der Hegelschen Logik, hg. v. P. Furth, Köln 1980; H.-H. v. Borzeszkowski und R. Wahsner, Physikalischer Dualismus und dialektischer Widerspruch (Anm.4), 149-167; siehe auch Anm. 79.
286
Das mathematisch Unendliche und der Newtonsche
Bewegungsbegriff
des Gravitationsgesetzes, also der Beweis eines physikalischen Gesetzes, das man noch gar nicht kennt, sondern erst aufstellen muß, ist also keineswegs ein linearer Gang von Galilei zu Kepler, auch kein begriffslogisch-linearer. Ihn als "bloße Taschenspielerei und Chalanterie des Beweisens" anzusehen, als bloßen "Schein eines Gerüstes von Beweis", dessentwegen "man Newton bis an den Himmel und über Kepler erhoben hat",83 verkennt den wahren Sachverhalt. Hegels Berufung auf Schubert,84 der belegt haben soll, daß es bei der Verallgemeinerung der Keplerschen Astronomie zum Newtonschen Gravitationsgesetz "in dem Punkte, welcher der Nerv des Beweises ist, sich nicht so verhalte, wie Newton annimmt"85 reproduziert nur seine aufgezeigten Mißverständnisse des Kalküls; sie ist unberechtigt. Schubert schreibt an der von Hegel zitierten Stelle: "Dis [das dritte Keplersche Gesetz R.W.] ist jenes wichtige Gesetz, das Kepler durch die Beobachtung entdeckte (Th. § 118), und das der erste Schritt zu der großen Entdeckung der durch den Weltraum verbreiteten Centralkraft war. Von dem ersten Erfinder [damit ist Newton gemeint R.W.] ward dieses Gesetz auf folgende Art bewiesen. [...] Mithin sind auch die Dreyecke ASB, BSC gleich: die Elemente der Flächen sind den Elementen der Zeit proportional, folglich auch ihre Integrale. Freylich ist es nicht im strengsten Verstände richtig, daß Bc = AB ist, und der Unterschied ist eben das, was oben (§ 16) dds dco = dco hies. Da dis aber ein unendlich Kleines der zweyten Ordnung ist, so verschwindet es gegen die Differenziale der ersten Ordnung AB, ßc."86 Auf eine Analyse des Schubertschen Textes, die hochinteressant wäre, um das Zeitverständnis der Newtonschen Mechanik zu fassen, muß hier ebenso verzichtet werden wie auf die Erläuterung der Schubertschen Rechnung. Evident ist jedoch, daß Hegel sich mit dem erhobenen Anspruch nicht auf Schubert berufen kann. Weder verkennt dieser Newtons von Kepler aus weiterführende physikalische Leistung noch bezieht sich die erwähnte "nicht ganz strenge Richtigkeit" auf etwas anderes als die seinerzeitige Schwierigkeit, den Differentialkalkül begrifflich angemessen zu formulieren. Sachlich nimmt Schubert selbst den Vorwurf zurück. Da Hegel die in der Gravitationstheorie bzw. klassischen Mechanik steckende physikalische und implizit-erkenntnistheoretische Leistung übersieht, scheint ihm die Newtonsche Mechanik für die Himmelsbewegungen identisch mit den Keplerschen Gesetzen diese nur durch die Möglichkeiten des Differentialkalküls mathematisch allgemeiner formuliert zu sein. Dies dann nur als ein Formell-Allgemeines zu charakterisieren ist gewiß konsistent, impliziert aber auch, die Bedeutung des Differentialkalküls für die physikalische (= dynamische) Fassung der Bewegung zu verkennen. -
-
-
-
-
83 Vgl. WdL; HW 5, 320f. 84 Gemeint ist Friedrich Theodor Schubert, Verfasser des dreibändigen Werkes Theoretische Astronomie, St. Petersburg 1798. 85 WdL; HW 5, 320. 86 F.Th. Schubert, Theoretische Astronomie (Anm. 84), Bd. 3, 25.
287
Renate Wahsner
Die Grenze des Verhältnisses und die qualitative Bestimmtheit begriffslogische Anliegen, das Hegel motivierte, den Differentialkalkül so überaus ausführlich zu diskutieren, liegt im Nachweis des qualitativen Charakters der dabei in Rede stehenden Größenform. Diesen Charakter sieht Hegel wie gesagt "am unmittelbarsten in der Kategorie der Grenze des Verhältnisses"*1 Er diskutiert daher den Begriff der Grenze und polemisiert lebhaft gegen ihr Verständnis als etwas, das nur durch unendliche Annäherung erreicht wird. Er wendet sich gegen Lagranges Auffassung, daß die Methode der Grenzen in der Anwendung der Leichtigkeit entbehre (was zutrifft und weshalb Lagrange Newtons Verfahren mit seiner Reihenentwicklung verbesserte)88 und der Ausdruck Grenze noch keine bestimmte Idee darbiete. Vor allem letzteres will Hegel widerlegen. Ihm zufolge liegt worin ja sein Urteil über Newtons richtige Bestimmung des Infinitesimalgedankens gründet in der Vorstellung der Grenze die von ihm entwickelte wahrhafte Kategorie der qualitativen Verhältnisbestimmung der veränderlichen Größen. Denn dx und dy als Formen dieser veränderliDas
-
-
-
-
chen Größen werden
nur
als Momente eines Ganzen
dy angesehen, nämlich von -f-, das seiner-
seits als ein unteilbares Zeichen genommen werden soll.89 Von den Mathematikern werde dies jedoch so nicht erkannt. Sie stießen beim Grenzübergang auf den Begriff des Unendlichen, aber nur deshalb, weil die Grenze, die die Ableitung ist, genau genommen nichts Quantitatives mehr ist. Hegel deutet wie besprochen -90 den Übergang von einer ursprünglichen Funktion f(x) zur Ableitung /' {x) resp. zum Diffe-
dy
rentialquotienten -f- als Übergang von einer bestimmten quantitativen Beziehung, einer Gleichung, zu einem Verhältnis, das mit p bezeichnet wird.91 Er meint: "Die Operation des Depotenzierens einer Gleichung [...] gibt ein Resultat, welches an ihm selbst wahrhaft nicht mehr eine Gleichung, sondern ein Verhältnis ist; dieses Verhältnis ist der Gegenstand der eigentlichen Differentialrechnung."92 Und er glaubt, gezeigt zu haben, "daß die Differentiierung der Gleichung von mehreren veränderlichen Größen die Entwicklungspotenz oder Differentialkoeffizienten nicht als eine Gleichung, sondern als ein Verhältnis gibt; die Aufgabe ist 87 88
89 90 91 92
WdL; HW 5, 312, siehe auch 298, 318-320. L. Lagrange, Theorie der analytischen Funktionen (Anm. 40), insbes. 3-10. Über Newtons Methode schreibt er: "Newton selbst hat in seinem Buche Principia Mathematica &c. die Methode von den letzten Verhältnissen der verschwundenen Größen, als die kürzere vorgezogen; Zergliederung die Beweise welche sich auf die Methode der Fluxionen beziehen reduciren. Aber diese Methode hat, so wie die Methode der Grenzen, [...] welche eigentlich nur eine algebraische Uebersetzung davon ist, die große Unbequemlichkeit, daß man die Größen in dem Zustande, wo sie so zu sagen aufhören, Größen zu seyn, betrachtet; denn wenn man gleich immer sehr gut das Verhältniß zweyer Größen sich vorstellen kann, so lange sie endlich bleiben, so giebt doch dies Verhältniß dem Verstände keinen deutlichen und bestimmten Begriff sobald als seine beyden Glieder zugleich Null werden" (6). WdL; HW 5, 312. Siehe S. 280 f. Vgl. WdL, HW 5, 335-345, 350. Ebd., 335.
288
Vgl.
Das mathematisch Unendliche und der Newtonsche
Bewegungsbegriff
dann für dies Verhältnis, welches die abgeleitete Funktion ist, ein zweites in den Momenten des Gegenstandes anzugeben, das jenem gleich sei".93 Es sei daran erinnert, daß man nach Hegels Erachten durch die Ableitung beispielsweise der Gleichung px = y2 zu p: 2y gelangt oder durch die Ableitung der Gleichung 2ax x2 y2 zu a x:y wobei man durch diese Operation den Wert der Glieder der Gleichung verändert hat und es deshalb keine Glei-
=
,
-
chung
mehr
ist,94 aber eben ein Verhältnis, das, da als
-f-
bezeichnet, gleich p gesetzt
werde. Durch dieses p das in Analogie zu oder wegen der begriffslogischen Herkunft aus dem sogenannten direkten Verhältnis als Verhältniszahl genommen wird, sei dieses Verhältnis ein Grö/tenverhältnis, aber eines, das nicht weiter quantitativ bestimmt werde, da eben das Resultat der Ableitung nicht zu einer Gleichung führe und daher nicht mit einem anderen ma,
-
-
dy verglichen werden könne. Die Formulierung -f- p sage nur aus, daß p ein Verhältnis ist, bestimme es nicht quantitativ, sondern sei nur eine "qualitative Größenbestimmtheit".95 Daher versteht Hegel die Operationen des Infinitesimalkalküls als ein "Operieren mit qualitativen Größenformen".96 Hegels Meinung, daß das Verhältnis p ein Verhältnis zwischen abgeleiteten Potenzenfunktionen sei, hat nun gemäß einer nachvollziehbaren Darstellung etwas mit seinem Gedanken zu tun, daß die Ableitung als Grenze oder als letztes Verhältnis zugleich ein Verhältnis qualitativer Momente ist.97 Denn Potenzfunktionen zeichnen sich nach Hegel dadurch thematischen Ausdruck
=
daß sie Funktionen veränderlicher Größen sind, die in einem Potenzverhältnis stehen (oder in einem, das auf ein solches zurückgeführt werden kann).98 Dadurch ist ihr quantitatives Verhältnis veränderlich, ohne durch einen festen Quotienten ("Exponenten") bestimmt zu sein, vielmehr durch einen, der ganz qualitativer Natur ist, da nur durch die Gegenseitigaus,
dy oder keit der Seiten bedingt. Die Ableitung /' (x) (auch -fp genannt) einer Potenzfunktion f(x) soll nach Hegels Ansicht vermutlich nur diese qualitative Bestimmtheit des quantitativen Verhältnisses der Veränderlichen der ursprünglichen Funktion ausdrücken, sozusagen den qualitativen Aspekt des in der ursprünglichen Funktion zwischen den Variablen bestehenden Potenzverhältnisses. Sie hält den Potenzcharakter (in Hegelscher Bestimmung), den es ursprünglich gab, fest. Denn die Seiten, die sich in dem als p bezeichneten Verhältnis zueinander verhalten, werden nicht mehr als Funktionen variabler Größen genommen, sondern nur noch als Funktionen der Potenzierung, mithin der qualitativen Bestimmtheit variabler Größen. Das p ist so in dem Sinne die Grenze des Verhältnisses von x und y, daß es die qualitative (nicht die quantitative) Bestimmtheit des ursprünglichen Potenzverhältnisses zwischen x und y ausdrückt. 93 Ebd., 350. 94 Vgl. ebd., 338; siehe auch Anm. 50, 52. 95 Zu letzterer Bezeichnung vgl. WdL; HW 5, 294, 312, 316. 96 Vgl. ebd., 324. 97 Vgl. M. Wolff, "Hegel und Cauchy" (Anm. 4), 251. 98 Vgl. WdL; HW 5, 327.
289
Renate Wahsner
Hier wird offenbar, warum nach Hegel der Gedanke nicht richtiger bestimmt werden konnte, als Newton ihn gegeben hat, und: was mit der Kritik gemeint war, Newton habe die geforderte Bestimmung nicht zum Begriffe einer Größenbestimmung, die rein nur Moment des Verhältnisses ist, fortgebildet.99 Wenn gesagt wird: "Hegels Interpretation der Ableitung als .qualitative Bestimmtheit' eines Verhältnisses weicht von allen herkömmlichen und von allen bis heute üblichen Auffassungen ab",100 so kann man dem zweifelsfrei zustimmen. Sie weicht ab, weil sie nur einzelne Aspekte des Differentialkalküls erfaßt und die fehlenden durch eigene Gedanken ausfüllt, die aber die mathematisch-physikalische Verwendung des Kalküls nicht ermöglichen würden. Wenn es so wäre, daß der Differentialkalkül Operationen gestattet, durch die man von einer Gleichung zu etwas gelangt, was keine Gleichung mehr ist, dann widerspräche dies in der Tat wie Hegel kritisiert allen mathematischen Grundsätzen.101 Aber wie schon bemerkt,102 liegt es nur an Hegels eigenwilligem Verfahren, daß er zu keiner Gleichung gelangt. Der Übergang von einer Gleichung zu einem bloßen Verhältnis (Verhältnis mit Hegel genommen als begriffslogisch interpretierter Bruch) findet beim Differenzieren nicht statt. Veranlaßt zu sein scheint Hegels Verfahren wie schon dargestellt in seiner Bestimmung von Gleichung und Funktion.103 Zutreffend definiert Hegel Funktionen als unbestimmte Gleichungen.104 Das heißt: Hat man weniger Gleichungen als Variable, dann kann man die Variablen nicht schlicht durch die Lösung des Gleichungssystems ausrechnen, sondern es sind nur Abhängigkeiten zwischen den Variablen fixiert, die als Funktionen gefaßt werden, indem man festlegt, welche Variable die abhängige und welche die unabhängige sein soll. Da Hegel aber gerade derartige Festlegungen ausmerzen will, interessiert ihn nur die Abhängigkeit als gegenseitige Bestimmtheit. Es soll eine reine Beziehung sein, Beziehung nur als Beziehung.105 Ein anderer Aspekt dieser spezifischen Interpretation des Differenzierens betrifft die quan-
-
-
-
titative Bestimmtheit oder Unbestimmtheit des p bzw. des Ausdrucks = -j- p. Bevor Hegel entwickelt, daß die Grenze Grenze des Verhältnisses sein soll, das die zwei Inkremente zueinander haben, stellt er fest, daß die "bloße Kategorie der Grenze" zwar "den bestimmten Sinn der qualitativen Bestimmtheit des Quantitativen, eines Verhältnismoments als eines solchen" habe,106 jedoch noch kein Verhältnis zu einer gegebenen Funktion, das sie aber haben muß, denn sie solle Grenze von einer gegebenen Funktion sein. Der übliche Weg aber, diese Grenze zu finden, führe jedoch dieselben die auch in den Methoden liegen, Inkonsequenzen herbei, die nicht dem Gedanken des letzten Verhältnisses folgen. Indem Hegel diesen (vermeintlichen) Weg schildert, diskutiert er das "mysteriöse" p .107 Dies offenbart einen weiteren
Mangel. 99 Vgl. ebd., 298f. 100 M. Wolff, "Hegel und Cauchy" (Anm. 101 Vgl. WdL; HW 5, 323. 102 Siehe S. 280 f. 103 Vgl. WdL; HW 5, 326-333. 104 Vgl. ebd., 326. 105 Vgl. ebd., 331. 106 Ebd., 313. 107 Vgl. ebd., 313-316.
290
4),
252.
Das mathematisch Unendliche und der Newtonsche
Die Bezeichnungen p, q
gendes. Wenn
y = f(x), dann
Es ist also k = ph + qh2
+
gilt
setzt es
wie
nicht -
sich also
y(x + h)
=
y
=
Sie bedeuten fol-
Lagrange.
y(x) + y (x)h + ^y" (x)h2
+
^-j y' (x)h3+.... "
=
et
-r
Hegel
=
p + qh + rh2+.... Läßt
meint -
gleich Null),
keineswegs oder wird gesetzt j?,
Ausgangsgleichung
von
rh3+... bzw. k y(x + h)- y(x). Die erstere der beiden Gleich-
chungen geteilt durch h, ergibt (man
k, h übernimmt Hegel
r,
,
Bewegungsbegriff
Denn nach
f(x).
dasselbe ist wie lim
-^-
h gegen Null
man nun
dann
gilt
lim
=
h^Oh
—
p.108 Es ergibt
sondern exakt p bzw. die erste
obigen gilt
Wie gesagt,
auch
gehen
Ableitung
der
y(x h) y(x) dy lim-¡-—--= / -4-, ax +
**
=
—
h—»o
-fax
«
nicht ohne
Limesbildung. Danach, nach der Grenzwertbildung, noch nach der Annäherung an die Grenze zu fragen ist ohne Sinn. (Man ist nicht in der Situation, "den bestimmten Sinn der qualitativen Bestimmtheit des Quantitativen, eines Verhältnismoments als eines solchen" zu haben, jedoch noch kein Verhältnis zu einer gegebenen Funktion.) Es ist entgegen der Hegelschen Behauptung sehr wohl über -r- tt hinausgekommen worden. Der Widerspruch, den Hegel was
=
Ax—»o Ax
-r-.
ax
man
hat
-
=
-
sieht, indem seines Erachtens
zum
k =0 einen -r
,
zum
k = anderen ~r P
(wobei
p etwas
exakt Bestimmtes ist) tritt nicht auf.109 Hegel meint, mit seiner Interpretation das, was in der Vorstellung der Grenze liegt, begrifflich expliziert zu haben, indem er die Frage beantwortet hat, Grenze wovon die Grenze Grenze ist, ihr "Verhältnis zu dem, was eine gegebene Funktion ist", bestimmt zu haben.110 Doch letztere Frage stellt sich nicht mehr, hat man dx und dy ' '1 Denn zweifelsfrei ist es .
so
wie
Hegel sagt,
daß -j- als unteilbares Zeichen genommen werden muß. Aber -f- ist
108 Siehe Anm. 48 sowie S. 283 f.
y(x+Ax)—y(x)
dy = lim -r— Ay lim = 109 Man muß natürlich erkennen, daß -r& r p ist. Die Vernachlässigung 6 dx /Vr->0 Ax Ar->0 -rAx daß Methode die der Differentialrechdieses Sachverhalts ist auch der inhärent, ganze genau Behauptung =
nung in dem Satze, daß dx"
=
nx"'dx oder
f(x+i)-f(x)
--,-=
p absolviert sei.
(Vgl. WdL;
HW 5, 322,
auch 312). Die Beziehung --,-= p ist falsch (es sei denn, daß man Glieder der Reihe weggelassen hat). Erst der Limes dieses Verhältnisses gestattet das Gleichheitszeichen. Daher ist diese Beziehung auch nicht identisch ist mit dx"
=
nxnldx Die Beziehung wäre richtig,
wenn man
i als dx versteht.
.
nx"'dx der spezielle Fall, wo f(x) x" (Vgl. Anm. 64). Dann ist dx" 110 WdL; HW5, 312f. 111 Es gibt verschiedene Anzeichen dafür, daß Hegel zwischen Ax und dx nicht unterscheidet. Siehe auch Anm. 48. =
=
.
291
Renate Wahsner
Symbol des vollzogenen Grenzübergangs. Man gewinnt jedy doch den Eindruck, als stelle sich Hegel dieses spezifische Verhältnis -4- erst einmal für sich vor und frage dann nach der Grenze der Funktion,112 durch die dx und dy miteinander verbunden sind. Anders wäre kein Grund für die geübte Kritik. Lagrange geht natürlich mit ohne die Limesbildung nicht geredet werden Selbstverständlichkeit davon aus, daß von kann, und meint deshalb auch anderes als Hegel liest. Hegel unterstellt Lagrange seinen Begriff des Differentialquotienten. Daraus ergibt sich das Mißverständnis. Überhaupt sei hier vermerkt, daß die philosophischen Reflexionen der Mathematiker über den Differentialkalkül nur in Einheit mit ihren mathematischen Operationen bzw. ihrer mathematischen Fassung des Kalküls zu nehmen sind. Von Ausnahmen abgesehen, rechneten sie richtig, auch wenn ihre begriffliche Fassung dessen, was sie taten, zu wünschen übrigließ. Der mathematische Kalkül erschöpft sich nicht in den philosophischen Reflexionen über ihn. Hegels eigenwillige Art des Differenzierens ist die Grundlage seiner begriffslogischen Weiterentwicklung des Differentialkalküls und geht einher mit seiner Orientierung auf das Potenzverhältnis, um die qualitative Bestimmtheit des Quantums zu demonstrieren. Diese Orientierung ist insofern begründet, als man jede analytische Funktion in eine Potenzreihe entwickeln kann und deshalb in gewissem Sinne tatsächlich zu ihrer Ableitung beliebiger Ordnung nur die Differentiation von x" (bzw. in diesem Beispiel i" ) zu kennen braucht.113 Aber um die Potenzreihe für f (x) zu erhalten, müßten erst einmal alle Koeffizienten dieser Reihe bestimmt werden, wozu man alle Ableitungen der Funktion f(x) muß bilden können. Die Hervorhebung des Potenzverhältnisses ist in diesem Sinne berechtigt, aber eben nur in diesem Sinne, und das heißt: unter dem Aspekt der Ganzheit der Funktion mit allen ihren Ableitungen mit der Folge, daß der jeweilige Differentialquotient ein quantitativ bestimmter ist. Es handelt sich allerdings um die quantitative Bestimmtheit von etwas, was qualitativ dieses Ganze und Unteilbare als
-r-
-
anderer Natur ist als eine bloße Zahl.
112 Auch hier scheint wieder zu Buche zu schlagen, daß Hegel die notwendige Unterscheidung zwischen abhängiger und unabhängiger Variablen, um den Begriff Funktion zu fassen, übersieht. Die gesuchte Grenze "soll die Grenze des Verhältnisses sein, welches die zwei lnkremente zueinander haben, um welche die zwei veränderlichen Größen, die in einer Gleichung verbunden sind, deren die eine als eine Funktion der anderen angesehen wird, als zunehmend angenommen worden". (HW 5, 313). Dafür, daß die genannte Unterscheidung für unwichtig angesehen wird, spricht auch die argumentationslose Verkehrung von Zähler und Nenner in der
und
dy
,
sollen schlechthin
nur
als Momente
gilt
f (x)
=
.u^
f(x+,)~f(x)
für einen festen Wert
x
,
,
den
p da ,
man
\f
f(x
+
i)
=
f(x)+f(x)i + jf"(x)i2
für die Variable
x
~P
1
einsetzt, folgendes:
2^4/'
(a)i2 + 23 /" (fl)/3 + /(fl + i) f(a) + /' (a)/ + («)'4 + • + + + + /' (a /) /' (fl) /' (a)i j f (a)i2 23/" (a)i3 +. usw. /" (fl + i) /" (a) + /" (a)i + jf""(a)i2+. (Vgl. S. 283 f. sowie Anm. 109). =
=
'
=
'
"
'
292
dy
von -r-
genommen
¿T selbst als ein einziges unteilbares Zeichen angesehen werden". (Ebenda, 312).
113 Wenn so
dx und
Formulierung "...
"
'
' '
+j^f(x)i3+...,
Das mathematisch Unendliche und der Newtonsche
Bewegungsbegriff
Begründung des Kalküls durch seine Anwendung? begriffslogische Entwicklung im qualitativen Quantitätsverhältnis die Quantität in die Qualität zurückführt, sieht Hegel in der physikalischen Bedeutung der einzelnen Reihenglieder bzw. in der physikalischen Begründung des Abbruchs der Reihe ein seinem Anliegen entgegenkommendes Verfahren. Er bestimmt sogar die sogenannten Anwendungen als die Sache selbst114 bzw. vermerkt, "daß man es der Methode des Differentialkalküls wohl sogleich ansieht, daß sie nicht für sich selbst erfunden und aufgestellt worden ist".115 Aber eine nur Da die
äußerliche "Anwendung" oder eine Zuordnung von mathematischem Kalkül und "physikalischem Sein" würde Hegel nicht befriedigen. Es bedarf einer ausgearbeiteten Theorie, die diesen Zusammenhang begründet. Von der Mathematik ist das nicht zu erwarten, sie führt nur zu Formal-Allgemeinem. Denn "die Mathematik vermag überhaupt nicht, Größenbestimmungen Physik zu beweisen, insofern sie Gesetze sind, welche die qualitative Natur der Momente zum Grunde haben".116 Man könnte erwarten, daß nunmehr die eigenständige Theorieleistung der Physik ins Spiel gebracht wird. Doch diese Erwartung wird enttäuscht. Das Unvermögen der Mathematik wird damit begründet, daß "diese Wissenschaft nicht Philosophie ist, nicht vom Begriffe ausgeht und das Qualitative daher [...] außer ihrer Sphäre liegt", es sei denn, es wird "lemmatischerweise aus der Erfahrung aufgenommen".117 Eine Wissenschaft, die nicht vom Begriffe (d. i. vom spekulativen Begriffe) ausgeht, in deren Sphäre dennoch aber Qualitatives liegt, wird nicht gedacht. Die oben skizzierte spekulative Interpretation des Differentialkalküls wird damit Notwendigkeit. In der Konsequenz schwebte Hegel eine philosophische Wissenschaft der Mathematik vor, die vom Begriffe ausgeht, die die qualitativen Momente zu beweisen vermag und somit die Unfähigkeit der gewöhnlichen Mathematik überwindet.118 Sie würde als Größenlehre die Wissenschaft der Maße sein119 und somit eine "Mathematik der Natur"120 liefern, die in Hegels Verständnis die ideale Physik darstellen würde. "Die Mathematik soll die Wissenschaft der Naturmaße sein"121 forderte er in einer Vorlesung. Er erwartete, daß Newtons Principia wegen ihres Titels dieser Forderung hätte gerecht werden müssen.122 Seine eigenen Entwicklungen sowohl in der Logik als auch in der Naturphilosophie ordnet Hegel in dieses Ziel (als Idealfall?) ein.123 Dabei werden verschiedene Entwicklungsstu-
-
114 Vgl. WdL; HW 5, 325, 335; siehe auch Anm. 61, 62. 115 Ebd., 323. 116 Ebd., 321. 117 Ebd. 118 Vgl. ebd., 405-407; Enz.§ 259, Anmerkung und Zusatz; HW 9, 52-55; dazu auch H.-H. v. Borzeszkowski und R. Wahsner, Physikalischer Dualismus und dialektischer Widerspruch (Anm. 4), 12; R. Wahsner, Zur Kritik der Hegelschen Naturphilosophie (Anm. 4), 51-53. 119 Enz. § 259, Anm.; HW 9, 54. 120 WdL; HW 5, 406. 121 G.W.F. Hegel, Vorlesungen über Logik und Metaphysik, Heidelberg 1817, mitgeschrieben von F. A. Good, hg. von K. Gloy, Hamburg 1992, 106. 122 Vgl. WdL HW 5, 406. 123 Es bleibe hier unerörtert, wie sich dieses Bestreben zu dem allgemeinen Verfahren in der Naturphilosophie verhält, "die eigene Notwendigkeit der Begriffsbestimmung zu entwickeln, die alsdann als irgendeine natür-
293
Renate Wahsner
fen als Progreß von einem Potenzverhältnis zu einem anderen höherer Stufe unterschieden, z. B. die Entwicklung von s at2 (Fall) zu s3 =at2 (3. Keplersches Gesetz), verstanden als begriffslogischer Übergang von der relativ-freien zur absolut-freien Bewegung.124 Der Abschnitt "Maß" führt diesen Gedanken fort.125 (Die Kategorie des Maßes, genommen als das für sich bestimmte quantitative Verhältnis, soll ja im Potenzverhältnis angelegt sein.) Obzwar eine Untersuchung dieser Weiterführung erforderlich wäre, ist sie hier nicht möglich. Doch ist sicher, daß gewisse Züge des dort Entwickelten maßgeblich angelegt sind in der vorherigen Begrifflichkeit von extensiver und intensiver Größe. Mit der Betrachtung des Verhältnisses von Extensivem und Intensivem greift Hegel ein seit Aristoteles diskutiertes philosophisches Thema auf, das stets auch eine naturwissenschaftliche Problematik enthielt.126 Dazu nur einige kurze Bemerkungen. Die extensive und die intensive Größe als ein und dieselbe Bestimmtheit des Quantums fassend schreibt er: "So ist z. B. eine Masse als Gewicht ein extensiv Großes, insofern sie eine Anzahl von Pfunden, Zentnern usf. ausmacht, ein intensiv Großes, insofern sie einen gewissen Druck ausübt".127 Hiermit wird ein für eine empirische, mathematisierte Naturwissenschaft grundlegender Sachverhalt rezipiert -, grundlegend insofern, als die in einer solchen Wissenschaft auftretenden Größen niemals nur eine quantitative Bestimmung haben (sie müssen einen Wert haben und haben können), sondern auch eine qualitative. Diese besteht darin, daß in jeder (Meß-)Größe ein Verhalten, eine wirkliche Wirkung substantiviert wird, die aus der Totalität der Verhaltensweisen, der Wirkungen, die einen konkreten Naturgegenstand ausmachen, herausgegriffen wurde. (In der Größenart "Masse" ist es ein anderes Verhalten als in der Größenart "Länge" oder ökonomischer "Wert".) Das Herausfinden des geeigneten Verhaltens oder der geeigneten Wirkung (die dann die qualitative Bestimmung einer Größenart ausmacht) geht stets einher mit quantitativen Untersuchungen, insofern es zur Bildung einer Größe beispielsweise des Auffindens resp. der Konstruktion eines Additionsprinzips bedarf.128 Mit dem Nachweis, daß es einer Qualität bedarf, ist natürlich noch nicht bestimmt, um welche es sich handelt, aber auch nicht, in welchen logischen Formen sich das Denken bewegt, soll diese Qualität gefunden werden. =
-
124 125 126 127 128
-
liehe Existenz aufzuzeigen ist" (Enz. § 276; HW 9, 117; siehe auch § 246, Anm., § 254, Zusatz, § 305, Anm.; HW 9, 15, 42, 192. Vgl. Enz. § 9, Anm.; HW 8, 52f. Vgl. HW 8, 405, auch 347; Enz. §§ 267-270; HW 9, 75-106. Vgl. WdL; HW 5, 402-407. Siehe z. B. das Stichwort "Größe", in Historisches Wörterbuch der Philosophie, hg. v. J. Ritter und K. Gründer, Bd. 3, Basel 1974. WdL; HW 5, 257. Über das im Prozeß der Größenbildung zu lösende Problem vgl. H. v. Helmholtz, "Zählen und Messen, erkenntnistheoretisch betrachtet", in ders.. Wissenschaftliche Abhandlungen, hg. v. A. König, Bd. 3, Leipzig 1895; ders., Einleitung zu den Vorlesungen über Theoretische Physik, hg. v. A. König und C. Runge, Leipzig 1903, insbes. 26; K. Marx, "Die Wertform", in K. Marx und F. Engels, Kleine ökonomische Schriften, Berlin 1955, insbes. 262-279; ders. Theorien über den Mehrwert, MEW 26, 3, Berlin 1962, insbes, 125-127, 133, 160f.; M. Wolff, Geschichte der Impetustheorie. Untersuchungen zum Ursprung der klassischen Mechanik. Frankfurt a.M. 1978; H.-H. v. Borzeszkowski und R. Wahsner, Physikalischer Dualismus und dialektischer Widerspruch (Anm. 4), insbes. 149-167; dies.. Die Wirklichkeit der Physik. Studien zu Idealität und Realität in einer messenden Wissenschaft, Frankfurt a.M., Berlin, Bern, New York, Paris, Wien 1992, 271-283; R. Wahsner, Stichwort "Messen", in Europäische Enzyklopädie für Philosophie, hg. v. H. J. Sandkühler,
Hamburg (im Druck).
294
Das mathematisch Unendliche und der Newtonsche
Bewegungsbegriff
Mit dieser notwendigen qualitativen Komponente einer Größe ist aber noch nicht all das abgedeckt, was Hegel mit dem intensiven Aspekt einer Größe im Auge hatte. Seine Kritik an Kants Versuch, die Materie vollständig zu dynamisieren,129 die er zu Recht mit dem Ar-
gument übt, daß das Extensive nicht auf das Intensive reduzierbar ist, betrifft ein anderes Problem, nämlich das des Verhältnisses von aktiven und passiven Prinzipien in der Physik.130 Es ist seinerseits eng mit der Problematik des Atomismus verknüpft,131 und zwar eines vernünftigen Atomismus, eines Atomismus, der in die Einsicht mündet, daß jede Wissenschaft ihr Elementares braucht, daß sie eine Grenze real setzt (real im Sinne der jeweiligen
physikalischen Realität). Ein dritter Aspekt betrifft die komplizierte Unterscheidung von extensiver und intensiver Größe in der heutigen Physik.132 Diese drei Aspekte sind zunächst wohl zu unterscheiden und mit dem Hegelschen Konzept zu konfrontieren, derart, daß die von ihm konzipierte Einheit
von
extensiver und intensiver Größe diskutiert werden kann.
Potenzverhältnis und Bewegung Die Infinitesimalrechnung gründet wie Hegel sehr stark hervorhebt -133 in der Mechanik, und Hegel sieht in dem genannten Sinne in diesem Zusammenhang einen Beleg für die begriffslogische Entwicklung von der Quantität zur Qualität. Doch gleich, nachdem er erklärt hat, daß der Gedanke des mathematisch Unendlichen nicht besser bestimmt werden könne, als Newton dies getan habe, setzt er hinzu: "Ich trenne dabei die Bestimmungen ab, die der Vorstellung der Bewegung und der Geschwindigkeit angehören [...], weil der Gedanke hierin nicht in der gehörigen Abstraktion, sondern vermischt mit außerwesentlichen Formen er-
scheint."134
Nun hat bekanntlich Newton den Differentialkalkül mit dem Begriff der Bewegung begründen wollen. Heute, da man die Ableitungen als Änderungen von Funktionen oder Ände-
rungen von Änderungen von Funktionen versteht, scheint das sehr treffend zu sein. Dennoch sind Lagranges seinerzeitige Bedenken, daß man mit dem Begriff der Bewegung etwas Fremdes "in einen Calcul bringt, der nur algebraische Größen zum Gegenstand hat", in einen Kalkül, in dem die Größe Zeit, mithin Geschwindigkeit nicht definiert ist,135 nicht ohne wei129 130
131 132 133 134 135
Vgl. WdL; HW 5, 250-260, 422. Vgl. dazu H.-H. v. Borzeszkowski
und R. Wahsner, Newton und Voltaire. Zur Begründung und Interpretation der klassischen Mechanik, Berlin 1980; R. Wahsner, Das Aktive und das Passive. Zur erkenntnistheoretischen Begründung der Physik durch den Atomismus dargestellt an Newton und Kant, Berlin 1981. Vgl. I. Newton, Opticks, with a foreword by A. Einstein, an introduction by Sir Edmund Whittaker, a preface by I. B. Cohen, Dover 1952, 397-401 (Query 31). Siehe Anm. 25. Vgl. z. B. WdL; HW5, 322-358, insbes. 346-348. Ebd., 298. L. Lagrange, Theorie der analytischen Funktionen (Anm. 40), 5f. Wörtlich schreibt er: "Newton betrachtete, um die Voraussetzung unendlich kleiner Größe zu vermeiden, die mathematischen Größen als solche, die durch Bewegung erzeugt würden, und er suchte eine Methode, um direkte die Geschwindigkeiten, oder vielmehr das Verhältniß der veränderlichen Größen, durch welche diese Größen hervorgebracht sind, zu bestimmen. Dies nannte man nach ihm die Methode der Fluxionen oder Fluxionsrechnung, weil er jene Ge-
295
Renate Wahsner
der Hand zu weisen. Es bedurfte erst der durch die analytische Geometrie fundierten mathematischen Bestimmung des Begriffs Bewegung oder Änderung,1^ und zwar im Wechselspiel mit der Ausbildung der klassisch-mechanischen Bewegungstheorie, um den Gedanken des Differentialkalküls in der gehörigen Reinheit als Bewegung fassen zu können. Nun ist längst zugegeben, daß der Kalkül seinerzeit mathematisch noch nicht sauber begründet war,137 sondern sich weitgehend nur mit Bezug auf die Anschauung rechtfertigen ließ und mit dem "Zuwachs von der Kraft der Schwere"138 oder mit dem Argument der "Unbedeutendheit der Differenz"139 fundiert werden sollte. Zu Recht hielt Hegel das für keine zureichende theoretische Begründung. Doch hätte er anders geurteilt, wäre der Kalkül schon zu seiner Zeit mathematisch korrekt begründet gewesen? Vermutlich nicht.140 Hegel kommt infolge seiner Untersuchungen zu dem Ergebnis: "Für sich bietet so die Anwendung des Differentialkalküls auf die elementarischen Gleichungen der Bewegung kein reelles Interesse dar; das formelle Interesse kommt von dem allgemeinen Mechanismus des Kalküls."141 Nun trifft es gewiß zu, daß kein mathematischer Formalismus für sich eine reelle Bedeutung hat. Für sich gewiß nicht. Aber der im Zusammenspiel mit der Herausbildung der Mechanik entwickelte Differentialkalkül war wesentlich für die Möglichkeit, die Bewegung teres von
schwindigkeiten Fluxionen der Größen nannte. Diese Methode [...] unterscheidet sich davon [von der Differentialrechnung R.W.] nur durch die Metaphysik, welche wirklich deutlicher zu seyn scheint, weil Jedermann einen Begriff von der Geschwindigkeit hat oder zu haben glaubt. Aber wenn man die Bewegung in einen Calcul bringt, der nur algebraische Größen zum Gegenstand hat, so heißt das auf der einen Seite einen Begriff hineintragen, der ihm fremde ist und der uns nöthiget, diese Größen als Linien zu betrachten, welche von einem beweglichen Dinge durchlaufen sind; auf der anderen Seite muß man gestehen, daß man nicht einmal einen gehörig deutlichen Begriff von der Geschwindigkeit eines Punktes in jedem Augenblick -
habe, 136
wenn
diese
Geschwindigkeit veränderlich ist."
Cassirer, Substanzbegriff und Funktionsbegriff (Anm. 45), 88-147; siehe auch H.-H. kowski und R. Wahsner, "Die Natur technisch denken?" (Anm 78), 17-26.
Vgl.
E.
v.
Borzesz-
137 Der Formalismus der Infinitesimalrechnung fand in der Folgezeit seine Rechtfertigung im mathematischen Begriff, indem er von Cauchy, Weierstraß, Cantor, Dedekind u. a. rein arithmetisch begründet wurde. (Siehe z. B. R. Dedekind, Stetigkeit und irrationale Zahlen, Berlin 1965). Die Begründung besteht darin, die Stetigkeit der reellen Zahlen nachzuweisen, entweder durch den Beweis dafür, daß jeder Dedekindsche Schnitt im Bereich der reellen Zahlen eine Schnittzahl besitzt (Dedekind), oder durch den Beweis dafür, daß jede reelle Fundamentalfolge einen Grenzwert besitzt (Cantor). Mit dieser Zurückführung des Differentialkalküls auf rein arithmetische Begriffe wurde gezeigt, daß die Operationen, die sich die Mathematik im Differentialkalkül erlaubt, der Natur bloß endlicher Bestimmungen und deren Beziehungen, damit der Mathematik, nicht widersprechen. (Vgl. zu diesem von Hegel angegebenen Kriterium WdL; HW 5, 296) Dabei wird vorausgesetzt, daß man unter endlichen Bestimmungen mit Hegel Denkbestimmungen versteht, die im Gegensatz zueinander und gegen das Objektive sowie gegen das Absolute verharren. (Vgl. Enz., -
§25;HW8, 91).
138 WdL; HW 5, 319. 139 Ebd., 302, 307. 140 Vgl. Anm. 60. Um den Zustand des Kalküls zu Hegels Zeiten angemessen beurteilen zu können, müßten außer den Arbeiten Cauchys auch die anderer Mathematiker analysiert werden, so unbedingt das Konzept von Leibniz. (Vgl. hierzu nur exemplarisch: G.W. Leibniz, "Rechtfertigung der Infinitesimalrechnung durch den gewöhnlichen algebraischen Kalkül", in ders., Hauptschriften zur Grundlegung der Philosophie, übers, v. A. Buchenau, hg. v. E. Cassirer, Leipzig 1904-06, Bd. 1; ders., "Brief an Johann Bernoulli vom 7.6.1698", in ebd., Bd. 2; ders., "Brief an P. Varignon vom 2. 2. 1702", in ebd., Bd. 1; ders., "Brief an L. Bourguet vom 5. 8. 1715", in ebd., Bd. 2). 141 WdL; HW 5, 348.
296
Das mathematisch Unendliche und der Newtonsche
Bewegungsbegriff
physikalisch zu fassen und zwar die Bewegung genau im Hegelschen Sinne als daseiender Widerspruch. Hegel erklärt bekanntlich: "Es bewegt sich etwas nur, nicht indem es in diesem -
Jetzt hier ist und in einem andern Jetzt dort, sondern indem es in einem und demselben Jetzt hier und nicht hier, indem es in diesem Hier zugleich ist und nicht ist. Man muß den alten Dialektikern die Widersprüche zugeben, die sie in der Bewegung aufzeigen, aber daraus folgt nicht, daß darum die Bewegung nicht ist, sondern vielmehr, daß die Bewegung der daseiende Widerspruch selbst ist."142 Die Einwände gegen die Fähigkeit der Physik, die Bewegung als daseienden Widerspruch zu fassen, kommen wesentlich dadurch zustande, daß man meint, die Aussage "... ist zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem Ort und an einem anderen Ort" laufe bei physikalisch-mathematischer Betrachtung auf einen logischen Widerspruch hinaus, indem sie nämlich bedeute, zum Zeitpunkt t sei der Ort des Körpers gleich x und zugleich ungleich x, ein und dieselbe Größe habe also zwei verschiedene Werte.143 Dieses Mißverständnis entsteht dadurch, daß man glaubt, die Physik gebe den Bewegungszustand eines Körpers zum Zeitpunkt t nur durch seine Ortskoordinate x an. Das trifft aber nicht zu, denn die Physik beschreibt den Bewegungszustand eines Körpers zum Zeitpunkt t durch die Angabe zweier Größen, der Ortskoordinate x und der Geschwindigkeit V Die Formulierung "... ist und ist nicht ..." bezieht sich also auf zwei verschiedene Größen, wobei die Geschwindigkeit (zum Zeitpunkt t am Orte x ) tatsächlich einen Bezug auf Orte ungleich x impliziert. (Dies drückt Newton mit den Worten aus: "... die letzte Geschwindigkeit, mit welcher ...".) Daß es hierbei nicht zu einem logischen Widerspruch kommt, liegt daran, daß es sich um zwei verschiedene, algebraisch voneinander unabhängige Größen handelt, die man ein und demselben Körper zu ein und demselben Zeitpunkt t zuordnen kann. Für die geradlinig gleichförmige Bewegung ist die Größe Geschwindigkeit bekanntlich dadurch definiert, daß man eine Ortsdifferenz zu einer Zeitdifferenz ins Verhältnis setzt I x, x sich also auf .
),
zwei verschiedene Orte bezieht. Historisch bestand die Schwierigkeit nun darin, eine Methode zu finden, mit der auch für eine ungleichförmige Bewegung einem bestimmten Ort eine bestimmte Geschwindigkeit zugeordnet werden kann, was im Falle der geradlinig gleichförmigen Bewegung relativ unproblematisch war. Die Infinitesimalrechnung liefert diese Methode, indem sie
von
dem
den Differenzenquotienten x,~x 1 -'
Grenzwert lim-= ''-»'
t -t
—
dt
bildet,
also die Zeit t' gegen die Zeit t und somit auch die entsprechenden Orte x' und X gegeneinanderstreben läßt. Durch diese mathematische Operation erhält man eine neue Größe, die Geschwindigkeit, die jeweils einem bestimmten Zeitpunkt t und somit auch dem dazugehörigen Orte x zugeordnet werden kann und muß. Diese Bewegungsbeschreibung erfolgt also dadurch, daß zwar nur mit den Größen Raum und Zeit operiert wird, aber mit Hilfe der Differentialrechnung eine Dualisierung in Raum-Zeit und Geschwindigkeit vorgenommen werden kann. Zugleich macht die Art und Weise, in der die Größe Geschwindigkeit gebildet wurde, deutlich, daß diese Größe stets den Bezug auf (infinitesimal) benachbarte Orte enthält. Es entsteht also eine neue Qualität, nicht nur eine neue Größe, sondern eine neuartige, 142 WdL; HW 6, 76. 143 Dieses Mißverständnis wurde in den unter Anm. 4 zitierten Arbeiten von H.-H. v. Borzeszkowski und R. Wahsner aufgeklärt, auf die sich dieser und die beiden folgenden Absätze stützen.
297
Renate Wahsner
v
=
—r-,
sie ist nur als Ganzes zu nehmen, hat dennoch aber eine quantitative
Bestimmung,
als Quantum mag diese Ganzheit vielleicht nicht so recht zu charakterisieren sein. Mittels der Infinitesimalrechnung kann die Bewegung also gefaßt werden, und zwar nicht etwa als bloße Aufeinanderfolge punktueller Ereignisse bzw. Ruhelagen, sondern, selbst schon unter rein kinematischem Aspekt, durchaus im Sinne der Bestimmung von Hegel als Widerspruch natürlich in einer für die mathematisch-physikalische Betrachtungsweise typischen Form. Ohne in logische Widersprüche zu geraten, gelingt es, den behaupteten Sachverhalt, daß ein bewegter Körper zu ein und demselben Zeitpunkt an einem Ort ist und nicht an ihm ist, in einer Weise darzustellen, die Berechnung und Messung zuläßt. Aber um das zu erreichen, mußten die beiden Momente "ist an einem Ort" und "ist an einem anderen Ort" auf verschiedene, zwar zusammengehörige, aber mathematisch voneinander unabhängige Größen verteilt werden. Nach dem hier dargestellten Prinzip wird in der Physik nicht nur die Ortsbewegung, also die Änderung des Ortes mit der Zeit, sondern werden auch alle anderen physikalischen Bewegungsformen, z. B. Änderungen thermodynamischer Zustandsfunktionen mit der Zeit oder Änderungen physikalischer Felder mit dem Ort und der Zeit behandelt. Erst mit der Begründung der Infinitesimalrechnung wurde eine derartige Möglichkeit erschlossen, die Bewegung physikalisch zu fassen mithin die Möglichkeit, das in der Antike entwickelte Prinzip, das die Bewegung logisch widerspruchsfrei denkbar werden ließ, in eine Form zu bringen, die nicht nur die Denkbarkeit, sondern auch die Meßbarkeit und Berechenbarkeit erlaubt. Als die Mathematik diesen Kalkül entwickelte also das Unendliche, das nichts Quantitatives ist, ihr daher zunächst nicht zugehört einbezog, überschritt sie ihre bisherige Grenze und wurde für die Physik als Bewegungslehre relevant. Hegel selbst sieht diese Potenz nicht, was wesentlich seinem Begriff des Differenzierens geschuldet ist. Denn die physikalische Bewegung wird durch Gleichungen als ganze beschrieben, eigentlich sogar durch Gleichungssysteme, nicht durch einzelne Terme, auch nicht wenn diese "Potenzverhältnisse" sind. Eine Änderung der Änderung (z. B. des Weges nach der Zeit, was ja mit dem Begriff der Beschleunigung ganz wesentlich für die physikalische Bewegungsfassung ist) kann nach der Hegelschen Methode nicht gedacht werden, denn einen solchen Begriff gewinnt man nur, wenn man ein und dieselbe Funktion in ihrer Ganzheit zweimal differenziert. Zu diesem Zweck muß aber die erste Ableitung wieder eine Gleichung sein. Die Ableitung dieser Ableitung muß als /' (x) die zweite Ableitung der Ausgangsfunktion f(x) sein. Um die Bewegung als Widerspruch auch nur kinematisch fassen zu können, bedarf es dreier Relate, des Ortes, der Zeit und der Geschwindigkeit, wobei letztere Größe zugleich eine Beziehung zwischen den beiden ersten fixiert. Ein "punktuell" gefaßtes Verhältnis, der begriffslogisch als Verhältnis von Anzahl und Einheit sowie extensiver und intensiver Größe interpretierte Bruch ist, leistet das nicht. Die Limesbildung kann nur als Werden in Einheit mit dem Produkt dieses Werdens gefaßt werden. Newtons "Genita", von Wolfers übersetzt mit "Funktion",144 ist das die Größen Erzeugende. Mit Blick hierauf diskutierte Hegel den Differentialkalkül. Aber sein Begriff der Funktion ist durch seinen Begriff des Verhältnisses nur
-
-
-
-
'
144
298
Vgl.
I. Newton, Mathematische
Prinzipien der Naturlehre (Anm. 2), 343,
597.
Das mathematisch Unendliche und der Newtonsche
Bewegungsbegriff
geprägt.145 Doch das Verhältnis ist die ganze "Gleichung"
und zwar die Gleichung in der Gesamtheit von ursprünglicher Funktion und ihren Ableitungen. Das war wohl gemeint mit der Formulierung, daß der Begriff des Infinitesimalen nicht mehr als Prädikat von Größen, sondern als Prädikat eines bestimmten Funktionsverhaltens gebraucht wird.146 Die Behandlung des Infinitesimalkalküls unter der Kategorie des Quantums ist unpassend. Nicht ohne Grund ordnet Hegel den Widerspruch, der die Beziehung zum Begriff der Bewegung herstellt, nicht in die Lehre vom Sein, sondern in die vom Wesen ein. Der neuzeitliche Funktionsbegriff ist nur unter der Kategorie der Relation zu fassen.147 Nach Kantischer (und noch älterer) Tradition sind aber die Kategorien der Quantität andere als die der Relation. Hegel ist durch diese Tradition zweifelsfrei geprägt, obwohl er sie aufheben will. Aufheben will er sie, indem er eben eine Logik entwickelt, die den Übergang von der Quantität zur Einheit von Quantität und Qualität im Maß und von diesem zum Wesen demonstriert. Doch seine Logik ist vielleicht eine voreilige, knüpft Zusammenhänge, wo noch Löcher sind, nach dem Prinzip, daß eine als notwendig erwiesene Bedingung als hinreichende resp. notwendige und hinreichende behandelt wird. So kann man vermuten, daß Hegel eine (begriffs)logisch-lineare Entwicklung von der Mathematik zur Physik (als Ideal?) anstrebte. Doch die gibt es grundsätzlich nicht, ebensowenig wie eine (begriffs)logisch-lineare Entwicklung von Galilei (Fallgesetz) zu Kepler (Planetengesetze).148 Vielleicht liegt darin, daß Hegel ein System auf einer solchen Basis anstrebte, auch der Grund dafür, daß er das für das neuzeitliche Denken charakteristische "Funktionsdenken",149 ohne das der Infinitesimalkalkül nicht philosophisch begriffen werden kann, -
145 Alle in Anm. 4 zitierten Arbeiten kritisieren den Hegelschen Funktionsbegriff, wenn auch in verschiedener Hinsicht. Zu Hegels Begriff des Verhältnisses siehe auch R. Wahsner, Zur Kritik der Hegeischen Naturphi-
losophie (Anm. 4).
146 Vgl. Anm. 60. 147 Schon Margarete Rehm kam in ihrer Untersuchung zu dem Ergebnis, daß das Problem der Hegelschen Rezeption des Differentialkalküls darin liegt, der Mathematik keine Logik der Relationen zugrunde gelegt zu haben. Denn "es ist die Kategorie der Relation, unter welche die Begriffsbestimmungen und Deduktionen auch in der reellen Analysis gestellt werden müssen" (Hegels spekulative Deutung der Infinitesimalrechnung, Anm. 4, 117, 113-125). 148 Über derartige Ansätze kann man Analoges sagen wie Einstein über Eddingtons Buch Fundamental Theory: "Auch ist zu beanstanden, dass er die Relativitätstheorie doch zu sehr als logisch notwendig darstellt. Gott hätte sich auch dazu entschliessen können, statt des relativistischen Aethers einen absolut ruhenden zu erschaffen." (A. Einstein, "Brief an A. Sommerfeld vom 28. 11. 1926", in Albert Einstein/ Arnold Sommerfeld, Briefwechsel. Sechzig Briefe aus dem goldenen Zeitalter der modernen Physik, hg. v. A. Hermann, Basel,
Stuttgart 1968, 109).
149
Der Terminus "Funktionsdenken" bezeichnet hier nicht mathematisches Denken; er wird übernommen, weil die sachlich treffenderen Bezeichnungen "Verhältnisdenken" oder "Prinzip-des-kollektiven-Individuums-Denken" zu holprig wären und zudem ebenfalls Mißverständnisse nicht ausschlössen. Die mitunter geäußerte Auffassung, daß die "Übertragung des Funktionsbegriffs aus der Welt der mathematischen Schatten in die der handfesten materiellen Wirklichkeit [...] einer der beliebtesten Schleichwege des Idealismus geworden ist" [A. Thalheimer, "Über einige Grundbegriffe der physikalischen Theorie der Relativität vom Gesichtspunkte des dialektischen Materialismus", Unter dem Banner des Marxismus 1 (1925/26), 306], verkennt sowohl den komplizierten epistemologischen Status der neuzeitlichen Naturwissenschaft als auch den philosophischen Begriff Materie, sofern dieser in einem philosophischen System konzipiert sein soll, das nicht hinter die klassische deutsche Philosophie zurückfallt.
299
Renate Wahsner
nicht voll erfaßt hat. Denn auch das neuzeitliche Denkprinzip läßt sich nicht linear, auch nicht (begriffs)logisch-linear aus dem antiken ableiten. Der Gedanke, der nicht besser bestimmt werden konnte, als Newton ihn gegeben hat, wurde uminterpretiert, um ihn als unendliches Quantum fassen zu können.150 Bewegung läßt sich nicht als unendliches Quantum denken, wird aber meßbar und berechenbar (mithin physikalisch faßbar) vermittels dessen, was Hegel das mathematisch Unendliche nennt.151 Es ist so möglicherweise als unendliches Quantum nicht angemessen begriffen. Ein qualitatives Quantitätsverhältnis mit einem anderen als dem Hegelschen Verhältnisbegriff fundiert, einem durch das Funktionsdenken geprägten, könnte vielleicht den logischen Status der Bewegung, insofern sie meßbar und berechenbar ist, charakterisieren.*
150 Vgl. auch W. Bonsiepen, "Hegels Theorie des qualitativen Quantitätsverhältnisses" (Anm. 151 Es ist dies allerdings nur ein notwendiges, kein hinreichendes Mittel. * Ich danke Horst-Heino v. Borzeszkowski für seine hilfreiche Diskussion des
4), 125.
vorliegenden Beitrags.
300
Ulrich Ruschig
Die "Knotenlinie von Maaßverhältnißen" und materialistische Dialektik
Die "Knotenlinie von Maaßverhältnißen" (GW 21, 364ff.; SW 4, 455ff.)' formuliert für das Verhältnis von kontinuierlich veränderlichen und diskontinuierlichen Maßgrößen einen allgemeinen Grundsatz: Kontinuierliche Veränderung eines quantitativen Maßverhältnisses schlage in eine neue Qualität um; diese neue Qualität sei als Abbruch (bestimmte Negation) der kontinuierlichen Veränderung eines Maßverhältnisses gesetzt und so begründet. Diesen Grundsatz beweist Hegel durch das, was er "Entwicklung des Maaßes" (GW 21, 326, 18; SW 4, 409) nennt. Da diese Herleitung aus den abstrakteren, für alle Gegenstände möglicher Erfahrung zutreffenden Bestimmungen (aus "Qualität", "Quantität" und dem "Maaß" als solchem, der Einheit von "Qualität" und "Quantität") erfolgt, müßte der Grundsatz, falls die Herleitung stimmte, allgemein gelten und konstitutives Prinzip einer jeden Naturwissenschaft sein. Die Herleitung verbürgte die Geltung des Grundsatzes unabhängig vom jeweiligen historischen Stand der Naturwissenschaften, sei es demjenigen zu Hegels Zeit, sei es dem heutigen; sollte gegenwärtige Forschung den Grundsatz nicht erfüllen, müßte es eine zukünftige tun. Als Richtschnur für jegliche Forschung betrachtete auch der Hegelianer Engels die "Knotenlinie". Allerdings habe sie bei Hegel wegen dessen verworrener, weil idealistischer Darstellung ein "äußerst geheimnisvollfes]" Aussehen. Befreit von diesem könne Hegels grundlegende Entdeckung "einfach und sonnenklar" als "das Gesetz des Umschlagens von Quantität in Qualität und umgekehrt"2 formuliert werden, eines der drei dialektischen Grundgesetze für Natur und Gesellschaft. Für dieses Gesetz lieferte Engels "die schlagendsten Einzelbelege"3 und war sich sicher, daß die Naturwissenschaften es mehr und mehr bestätigen werden würden.
1 2 3
Zitiert werden Hegels Schriften entweder nach GW (Band, Seite, Zeilen) und/oder nach SW. F. Engels, "Dialektik der Natur", MEW 20, 348. Ebd., 349.
Ulrich
Ruschig
Von Kant zu Hegel Hegels Herleitung ist nur in der Beziehung zu Kants Darlegung transzendentaler Grundsätze und metaphysischer Anfangsgründe der Naturwissenschaft verständlich. Kant unterscheidet4 zwischen "reiner Vernunfterkenntniß aus bloßen Begriffen" (d. i. die immanente Reflexion der Vernunft auf ihre Begriffe, Kant nennt das "reine Philosophie oder Metaphysik") und Vernunfterkenntnis durch "Construction der Begriffe" (für Kant die "mathematische Vernunfterkenntniß"). Da eine Konstruktion nicht im Nichts ausgeführt werden kann, bedarf es eines Worinnen für das Konstruieren: der "reinen Anschauung". Um von der mathematischen Vernunfterkenntnis dann
zur
Vernunfterkenntnis der Natur (Kant:
zum
"reinen T/heil" aller
"eigentlichen Naturwissenschaft"5) zu gelangen, müssen das "Dasein eines Dinges" und be-
stimmter der "Begriff von einer Materie überhaupt zum Grunde gelegt werden".6 Erst mittels dieses Begriffs gelingt die Beschränkung der mathematisch möglichen Relationen auf die physikalisch sinnvollen. Das Vorhaben, apodiktisch geltende Grundsätze für eine jede Naturwissenschaft zu entwickeln, gibt es also bereits bei Kant. Selbstreflexion der Vernunft (wodurch ja schon synthetische Urteile a priori möglich sind, "aber nur diskursiv, nach Begriffen"7) bleibt nicht bei sich selbst stehen, sondern wird zu einer in den "reinen Anschauungen im Räume und der Zeit" konstruierenden Vernunft, wobei die konstruierende Tätigkeit durch ein Drittes, ein ihr vorausgesetztes Material für die Konstruktion, beschränkt wird, von welchem Kant bezeichnenderweise Widersprüchliches aussagt: Der "Begriff von einer Materie überhaupt" erfordere keine "besonderen Erfahrungen", abgetrennt von solchen sei er jedoch "an sich empirisch".8 Wegen der Schlüsselfunktion der "Construction der Begriffe" konzediert Kant jeder Naturlehre "nur so viel eigentliche Wissenschaft [...], als darin Mathematik anzutreffen ist".9 Hegels "Entwicklung des Maaßes" ist nun sowohl konsequente Fortführung als auch Kritik des Kantschen Vorhabens einer a-priori-Konstruktion von Prinzipien für die Naturwissenschaften. "Mathematische Vernunfterkenntniß" durch "Construction der Begriffe" in "reiner Anschauung" ist bei Hegel behandelt als die Entwicklung der Kategorie "Quantität" im Abschnitt Die Größe (Quantität). Die Beschränkung (Limitation resp. Konkretisierung) der "mathematischen Vernunfterkenntniß" zu apodiktisch geltenden Grundsätzen der Naturwissenschaften erfolgt bei Hegel im Abschnitt Das Maaß. "Mathematische Vernunfterkenntniß" ist dafür in doppelter Weise konstitutiv: erstens als Grundlage und Ausgangspunkt, woraus die "Entwicklung des Maaßes" hervorgeht; zweitens als Form der "Construction" in der "Entwicklung des Maaßes", nämlich als das "quantitative Verhältniß" (GW 21, 310ff.; SW 4, 389ff): ein Maß wird in Relationen zu anderen Maßen gesetzt; diese Relationen von Maßen ergeben Maßverhältnisse; für diese läßt sich ein "Exponent" bestimmen; "Exponenten", die ihrerseits Maße sind, werden in Relationen gesetzt, woraus ein quantitatives Verhältnis dieser Exponenten entspringt usw. Die Kategorien sind bei Kant gegeben und -
-
4 5 6 7 8 9
I. Kant, "Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft", in Werke, Akademie-Textausgabe. Bd. 4, Berlin 1968, 469; KrV B, 741ff. "Metaphysische Anfangsgründe" (Anm. 4), 469. Ebd., 472. KrV B, 748. "Metaphysische Anfangsgründe" (Anm. 4), 472.
Ebd., 470.
302
Die "Knotenlinie
von
Maaßverhältnißen"
fix und als solche für die "vollständige Zergliederung des Begriffs von einer Materie überhaupt"10 in den Metaphysischen Anfangsgründen der Naturwissenschaft vorausgesetzt; sie bleiben der konstruierenden Tätigkeit, die doch ihrer bedarf, äußerlich. Hegel kritisiert an Kants Darstellung der Kategorien, daß dieser sie "empirisch aufgenommen" (GW 12, 44, 5; SW 5, 52), nämlich aus einer "subjektiven Logik" entlehnt habe, welche vorfindliche Urteilsformen sammle und daraus (reine) Verstandesbegriffe abstrahiere. Solch empirischer Zugriff auf die Kategorien stehe im Widerspruch zu ihrer Funktion in einer "transcendentalen Logik". So erkenne Kant auch nicht "die Nothwendigkeit" der Kategorien. "Er denkt nicht daran, die Einheit zu setzen, und aus der Einheit die Unterschiede zu entwickeln", und damit nicht daran, die Kategorien "zu deduciren" (SW 19, 568). Die bei Kant zueinander und zur konstruierenden Tätigkeit äußerlich bleibenden Kategorien (resp. die Titel für die vier Klassen der Kategorien "Quantität", "Qualität", "Relation", "Modalität") ordnet die Wissenschaft der Logik, und zwar dadurch, daß sie als auseinander hervorgehend entwickelt werden. Die "Entwicklung des Maaßes", das seinerseits aus "Qualität" und "Quantität" als deren Einheit hervorgeht, ist Hegels Antwort auf die Metaphysischen Anfangsgründe der Naturwissenschaft. Die innerhalb des Abschnitts Das Maaß entwickelten konkreteren Kategorien wie "reales Maaß", "Maaß als Reihe von Maaßverhältnißen", "Fürsich-bestimmtseyn des Maaßes", "Wahlverwandtschaft", "Knotenlinie von Maaßverhältnißen" sind Bausteine für eine Grundlagentheorie der Naturwissenschaften. Der springende Punkt für Hegels Kritik an der Kantschen "Construction der Begriffe" liegt in dem, was bei Hegel Material für die "Entwicklung des Maaßes" ist und was "den Begriff von einer Materie überhaupt" als das Einschränkende für die "Construction der Begriffe" in "reiner Anschauung" aufhebt und ablöst.
Das Material für die Arbeit des Fortbestimmens Um das Verhältnis von auf ihre Begriffe reflektierender und sie durch "Construction" fortentwickelnder Vernunft zu einem wie auch immer gegebenen Material zu erörtern, sei die ein solches Verhältnis negierende Annahme einer Prüfung unterzogen. Also angenommen, von dem Gegebensein eines spezifisch bestimmten Materials könne nicht ausgegangen werden und von gegebenen Kategorien, unter denen dieses allein erkannt werde, auch nicht. Das Einzige, was gegeben und vorauszusetzen sei und dies stimmt mit der Selbstauskunft Hegels überein, die jedoch nicht unbedingt zutreffen muß sei "Seyn, reines Seyn, ohne alle weitere Bestimmung" (GW 21, 68, 19; SW 4, 87). Die Wissenschaft der Logik wäre dann immanente Reflexion des "reinen Seyns", zwar nicht subjektiv-idealistisch gefaßt als immanente Reflexion der Vernunft mittels der Prinzipien "Einheit", "Mannigfaltigkeit", "Verwandtschaft" auf die in den Urteilsformen gegebenen Kategorien, aber eben doch immanente Reflexion, der nichts anderes gegeben ist, als daß sie überhaupt einen Gegenstand so unbestimmt, wie irgend möglich hat, nämlich "reines Seyn". Die "Entwicklung des Maaßes" wäre immanente Reflexion dessen, was aus dem allein vorauszusetzenden Anfang, der völligen Bestimmungslosigkeit, sich ergeben hätte, immanente Reflexion der "Einheit" von "Qualität" und "Quantität". Prima vista scheint es so zu sein: Ein Maß wird ins Verhältnis -
-
-
-
-
10
Ebd., 472.
303
Ulrich
Ruschig
zu anderen Maßen gesetzt; aus der Relation zweier Maße wird ein "Exponent" dieser Relation erschlossen, welcher wiederum ein Maß ist; "Exponenten" ihrerseits werden ins Verhältnis
gesetzt und so Relationen von Maß-Relationen gebildet;
aus
diesen
neuen
Relationen können
"Exponenten" erschlossen werden usw. Folgte man diesem Schein, dann wäre die "Entwicklung des Maaßes" eine durch die reflektierende Vernunft mittels der Reflexionsbestimmungen "Identität", "Unterschied" usw. bewerkstelligte Permutation der Kategorien "Qualität" und "Quantität". Eine solche Bewegung der reflektierenden Vernunft könnte jedoch nicht von der "Bewegung von Nichts zu Nichts, und dadurch zu sich selbst zurück" (GW 11, 250, 3f.; GW 4, 493) unterschieden werden, weil der Unterschied zwischen ersterer Bewegung, die in "reinem Seyn" und damit völliger Unbestimmtheit stattfindet, und der zweiten, die diese Voraussetzung nicht macht, nicht angegeben werden kann. Dann fiele die Logik des "Seyns" mit der des "Wesens" zusammen. Diese Konsequenz lehnt Hegel ab. Damit räumt er ein, daß die Fortbestimmung des abstrakten Anfangs zu immer konkreteren Kategorien (in der Lehre vom Seyn) auf ein vorausgesetztes Material verwiesen ist. Nur dadurch, daß die weitere
entwickelnde Vernunft durch ein Material eingeschränkt1 ' wird, ist das Fortbestimmen, sei es qua produktiver Einbildungskraft, sei es qua experimenteller Arbeit, die das Material sich aneignet, ein synthetisierendes Fortbestimmen. Oder negativ formuliert: Die Reflexion auf die Kategorien ("Qualität", "Quantität", "Einheit", "Maaß", "Negation", "Relation") und deren Kombinationen liefe leer, wäre sie nicht auf ein spezifisch bestimmtes und jeweils verschiedenes Material bezogen. Deswegen ist für die Logik des "Seyns" und insbesondere die des "Maaßes" das Verhältnis von spezifischem Material und kategorialer Reflexion entscheidend. Da die Lehre vom Seyn ihren Anfang von einem völlig Unbestimmten, dem "reinen Seyn", nimmt, muß das Material für die kategoriale Reflexion als ein schon spezifisch bestimmtes zunächst hinzukommen, also vorausgesetzt werden, wobei dann in der weiteren Entwicklung Maßbestimmungen als Ersatz für diese Voraussetzungen gesetzt werden. Deswegen werden im Abschnitt Das Maaß Modelle aus Chemie und Physik zitiert; chemische Begriffe wie 'Neutralität', 'Affinität'/'Verwandtschaft' werden wesentlich für das Verständnis einer Wissenschaft der Logik; 'Wahlverwandtschaft' und der physikalische Begriff 'Knotenlinie' werden im und durch das synthetisierende Fortbestimmen gar zu logischen Kategorien. Bei Kants "Construction der Begriffe" sind synthetische Urteile a priori nur deswegen möglich, weil das Konstruieren in "reiner Anschauung" ausgeführt wird und so die darin enthaltene 'reine Mannigfaltigkeit' zum Material hat. Die Kantsche Argumentation provoziert die Frage, ob diese 'reine Mannigfaltigkeit' nicht ein in sich widersprüchlicher Begriff sei und ob eine solche von jeder spezifischen Verschiedenheit gereinigte 'Mannigfaltigkeit' überhaupt Material sein könne. Verglichen mit der 'reinen Mannigfaltigkeit', Kants Worinnen der "Construction", erscheint das Substrat für die Hegelsche Entwicklung der Kategorien schon konkreter ob von 'materialistischer' die Rede sein kann, vgl. dazu im folgenden. -
11
Einschränkung der entwickelnden Vernunft durch ein Material bedeutet Limitation. "Limitation" ist die dritte Kategorie unter dem Titel "Qualität" nach "Realität" und "Negation". Wenn mit Hegel diese dritte als aus den ersten beiden als deren Einheit hervorgehend verstanden wird, dann stellt sich das Problem, ob lediglich mit bestimmter Negation und ohne Beziehung auf ein spezifisches Material das synthetisierende Fortbestimmen
304
möglich ist.
Die "Knotenlinie
von
Maaßverhältnißen"
Herleitung der "Knotenlinie" Das Verhältnis von die Kategorien fortbestimmender Reflexion zu dem zitierten Material soll am Beispiel der Herleitung des allgemeinen Grundsatzes vom Umschlagen kontinuierlicher Veränderung von Maßverhältnissen in eine neue Qualität erläutert werden.12 Ausgangspunkt für die Herleitung ist das "reale Maaß", ein "selbstständiges Maaß", welches seinerseits von Hegel hergeleitet wird am Modell des spezifischen Gewichts. Mithilfe der Maßgröße 'spezifisches Gewicht' können chemische Substanzen unterschieden und charakterisiert werden, wobei die Maßgröße zu unterscheiden ist von dem Substrat (der chemischen Substanz), auf das sie bezogen ist und das zunächst gegeben sein muß. Das "selbstständige Maaß" kann weiterbestimmt werden, indem es ins Verhältnis zu anderen solchen Maßen gesetzt wird, was eine "Reihe von Maaßverhältnißen" ergibt. Grundlage für das Ins-Verhältnis-Setzen von "selbstständigen Maaßen" und damit Material für die die Kategorien fortbestimmende Reflexion ist, daß mit den durch das "selbstständige Maaß" charakterisierten Substanzen ein Prozeß angestellt wird. Wenn es sich dabei um chemische Reaktionen handelt, dann kann unter "Reihe von Maaßverhältnißen" die Reihe stöchiometrischer Massenverhältnisse verstanden werden, aus denen eine den chemischen Substanzen zuordnenbare Maßzahl resultiert, das Äquivalentgewicht. Kategorial ist dies als Übergang vom "selbstständigen Maaß" (= spezifisches Gewicht) zum "Fürsich-bestimmtseyn des Maaßes" (= Äquivalentgewicht) gefaßt. Letzteres bestimmt konkreter die vorausgesetzte Substanz und tritt in der weiteren Entwicklung an die Stelle des vorangegangenen Maßes (des spezifischen Gewichts), welches es also 'ersetzt'. Bezogen auf diesen chemischen Gehalt ist der logische Übergang verständlich und auch schlüssig, ohne ihn dagegen nicht.13 Hegel verarbeitete das zu seiner Zeit gerade entdeckte Gesetz der konstanten und multiplen Proportionen und konnte damit Kant direkt widersprechen, der der Chemie die Wissenschaftlichkeit bestritt.14 Der nächste Schritt der Herleitung setzt die im vorherigen Schritt gewonnenen Maßbestimmungen (= Äquivalentgewichte) ihrerseits ins Verhältnis. Für dieses (logische) Ins-Verhältnis-Setzen von Maßen sind besondere chemische Reaktionen, die Neutralisationsreaktionen von Säuren und Basen, Material ein Material, das soweit in den die logische Entwicklung formulierenden Text eingewandert ist, daß darin chemische Begriffe auftauchen, und zwar nicht sowohl als Beispiele, als vielmehr als für die logische Entwicklung wesentlicher Gehalt, ohne den diese leer liefe. Im Neutralisationsprodukt, dem Salz, stehen Säure und Base in einem festen Verhältnis, ge-
-
-
-
12
13 14
Vgl. dazu ausführlich: U. Ruschig, Hegels Logik und die Chemie. Fortlaufender Kommentar zum "realen Maß", Bonn 1997 (Hegel-Studien, Beiheft 37). Vgl. die ebd., 13f. zitierte Sekundärliteratur. Kant in den "Metaphysische Anfangsgründen" (Anm. 4), 470f.: "So lange also noch für die chemischen Wirkungen der Materien auf einander kein Begriff ausgefunden wird, der sich construieren läßt, d. i. kein Gesetz der Annäherung oder Entfernung der Theile angeben läßt, nach welchem etwa in Proportion ihrer Dichtigkeiten u.d.g. ihre Bewegungen sammt ihren Folgen sich im Räume a priori anschaulich machen und darstellen lassen (eine Forderung, die schwerlich jemals erfüllt werden wird), so kann Chemie nichts mehr als systematische Kunst oder Experimentallehre, niemals aber eigentliche Wissenschaft werden, weil die Principien derselben blos empirisch sind und keine Darstellung a priori in der Anschauung erlauben". Aus den Proportionen der "Dichtigkeiten" Maße für die "chemischen Wirkungen der Materien auf einander" zu entwickeln gerade das versucht Hegel. -
305
Ulrich Ruschig nauer: das Verhältnis der stöchiometrischen Mengen ist konstant. Das Salz hat die chemische Eigenschaft, von einigen anderen Säuren unter Bildung eines entsprechenden Salzes aufgelöst zu werden und eine derartige Auflösung durch wiederum andere Säuren auszuschließen. Zeitgenössische Chemiker sprachen von einer 'Wahlverwandtschaft', die Säure und Base in ihrer Verbindung eingehen. In der kategorialen Konstruktion der Wissenschaft der Logik ist der zweite Schritt als Übergang vom "Fürsich-bestimmtseyn des Maaßes", dem "Exponenten" eines Maßverhältnisses, zur "Wahlverwandtschaft" gefaßt, wobei Hegel den aus der Chemie stammenden Begriff unverändert als logische Kategorie des "Maaßes" übernimmt. Wenn so Hegel "Exponenten" ein festes Verhältnis eingehen, so werden sie darin "negativ gesetzt" (GW 21, 351, 25; SW 4, 439). Durch dieses Negativ-Setzen der "Exponenten" werde ein diesem Verhältnis Zugrundeliegendes gesetzt, das zunächst lediglich negativ gegen die bisherigen Maße bestimmt sei (nämlich nicht vorausgesetzte Ausgangsqualität, nicht Quantität, nicht unmittelbares Maß, nicht "Exponent" eines Maßverhältnisses, nicht veränderliche Relation solcher "Exponenten" zu sein), das gleichwohl Substrat (als fürsichseiende negative Einheit der "Exponenten") für die Maß-Relationen und die "Wahrheit" (vgl. GW, 11, 241, 8; SW 4, 481) der vorangegangenen Bestimmungen sein soll. Verständlich wird diese Konstruktion (und insbesondere auch: der kritische Punkt dieser Konstruktion) in der Beziehung -
-
auf das Material: Der Übergang ist zu dechiffrieren als der vom Äquivalentgewicht, das aus stöchiometrischen Massenrelationen resultiert, zur chemischen Affinität, die durch eine Energiegröße wie die Freie Enthalpie gemessen wird. Hegel will die Konstanz des Massenverhältnisses der Bestandteile im Salz durch ein neues Maß erklären, das die chemische Eigenschaft des Ausschließens anderer Salzbildungen ausdrückt; dieses neue Maß (die chemische Affinität) soll aus dem vorherigen Maß (dem Äquivalentgewicht) als das diesem Zugrundeliegende zu entwickeln sein. Wir wissen heute, daß die Triebkraft einer chemischen Reaktion, angegeben durch die Freie Enthalpie, nicht mit den stöchiometrischen Massenverhältnissen der Reaktionspartner nach einer Regel zusammenhängt, daß also hegelsch formuliert das feste Verhältnis der "Exponenten" und die "Wahlverwandtschaft" einander äußerlich sind und deswegen die "Wahlverwandtschaft" nicht aus dem vorherigen Maßverhältnis entwickelt werden kann. Nun erkennt Hegel, daß das neue Maß (die chemische Affinität) von dem vorherigen Maß (dem Äquivalentgewicht) qualitativ verschieden ist, will jedoch nicht anerkennen, daß es sich dabei um eine substantielle Differenz im Substrat, dem Material für die Maßbestimmungen, handelt: Die Massenverhältnisse der Reaktionspartner sind Gegenstand der Stöchiometrie, die freien Enthalpien Gegenstand der von der Stöchiometrie geschiedenen und aus ihr nicht ableitbaren Chemischen Thermodynamik. Eine solche substantielle Differenz, erschlossen daraus, daß in der Entwicklung des "Maaßes" die Reflexion auf die vorangegangene Maßbestimmung (das stöchiometrische Massenverhältnis) die neue Qualität nicht hervorbringen kann, könnte als Hinweis darauf genommen werden, daß die Bestimmtheit des Materials nicht vollständig in Maßbestimmungen aufgeht. Dies widerstritte Hegels idealistischem Gesamtprogramm, vorausgesetzte materiale Bestimmtheiten durch in dem Prozeß der Reflexion auf die Kategorie des "Maaßes" entwickelte Maße zu ersetzen. Die von Hegel durchaus gesehene Differenz von stöchiometrischen Massenrelationen und thermodynamischen Energiegrößen erscheint in der Wissenschaft der Logik nicht als substantielle, sondern in dem Verhältnis von quantitativer und qualitativer Seite der "Wahlverwandtschaft" und bestimmter darin, daß quantitative und qualitative Seite keine konsistente Bestimmung der -
306
-
Die "Knotenlinie
von
Maaßverhältnißen"
"Wahlverwandtschaft" ermöglichen: Die quantitative Seite die aus der Relation der Äquivalentgewichte herrührende, quantitativ bestimmbare Maßzahl (als quantifizierte Verwandtschaft oder Verwandtschaftsstärke interpretiert) könne nicht die spezifische Qualität der "Wahlverwandtschaft", das ausschließende Verhalten, erklären. (Die Erklärung dafür, so der terminus ad quem der Hegelschen Argumentation, soll das dann erst auf der "Knotenlinie" mögliche Umschlagen von kontinuierlicher Veränderung quantitativer Maßverhältnisse in eine neue Qualität liefern.) Die die Bestimmung der "Wahlverwandtschaft" sprengende Inkonsistenz von quantifizierter Verwandtschaft und qualitativem Ausschließen (was modern gesprochen auf die substantielle Differenz von Massenrelation und Energiegröße verweist) ist Reflex der Differenz von vorausgesetzter materialer Bestimmtheit und Entwicklung des "Maaßes" durch Reflexion der Kategorien. Letztere Differenz wird für Hegel zu einer, die in die Entwicklung des "Maaßes" selbst fällt und darin dann und das ist der Knackpunkt für den Idealismus aufgehoben wird. Daher nimmt Hegel gerade jene Inkonsistenz zum Ausgangspunkt der weiteren Argumentation: Wenn das Verhältnis von quantifizierter Verwandtschaft und qualitativem Ausschließen nicht an einer "Wahlverwandtschaft" quasi statisch lösbar sei, so müsse zu den Prozessen der "Wahlverwandtschaften" untereinander übergegangen werden, worin jene Inkonsistenz bestimmbar und in dem Verhältnis von kontinuierlich veränderlichen und diskontinuierlichen Maßgrößen auflösbar werde. Deswegen: Die Fortbestimmung des Maßes "Wahlverwandtschaft" zur "Knotenlinie von Maaßverhältnißen" und dies ist der dritte Schritt der Herleitung soll in den Prozessen geschehen, die die "Wahlverwandtschaften" untereinander eingehen und die sich durch Relationen dieser Maße abbilden lassen. Für diese Relationen sind wiederum andere chemische Reaktionen, nämlich Reaktionen der Salze untereinander, Material. Eine "Wahlverwandtschaft" so die kategoriale Konstruktion "kontinuiere" sich in andere, was durch ein bloß quantitativ kontinuierliches Durchlaufen von Maßverhältnissen ausgedrückt werde. Als Grundlage dafür stelle sich ein Qualitatives, bestimmt als die Beziehung eines der "Wahlverwandtschaft" immanenten "Verhältnißmaaßes" auf sich, heraus. Damit kann Hegel zu dem die "Knotenlinie" Hervorbringenden übergehen, der "an sich selbst specificirende[n] Einheit [...], welche an ihr Maaßverhältnisse producirt" (GW 21, 364, 29f.; SW 4, 456). Dieses neue Maß ist nicht mehr wie die von Hegel zuvor entwickelten Maßbestimmungen Verhältnis von "selbstständigen Maaßen" (spezifischen Gewichten, Äquivalentgewichten, Wahlverwandtschaften) und als solche Verhältnisse von Maßen bezogen auf eine vorauszusetzende, qualitative Vielfalt von Substanzen, sondern es ist Einheit von Prozeß und Substrat, von Reflexivität und quantitativer Äußerlichkeit eine reflexive Einheit, die in einem Prozeß der Selbst-Spezifikation Maßverhältnisse setzt, und zwar abwechselnd solche, die nur quantitative Verschiedenheiten bleiben, mit solchen, die spezifische Maße bilden, durch welche die Qualitäten vollständig bestimmt und in welchen sie aufgegangen sind. -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Hegels Arbeit mit dem Material Die Kategorien ("Qualität", "Quantität", "Einheit", "Maaß", "Negation", "Relation") selbst und die Reflexion auf diese Kategorien und deren Kombinationen können nicht einen Prozeß ergeben, der "Entwicklung des Maaßes" zu sein beansprucht. Für synthetisierendes Fortbe307
Ulrich Ruschig
stimmen ist die Beziehung auf ein spezifisches Material notwendig, weil nur an einem solchen Maße und Relationen von Maßen festzustellen sind. Naturwissenschaftler arbeiten nicht mit Beliebigem, bunt durcheinander Gewürfeltem, sondern mit identischen Stoffen unter standardisierten Randbedingungen, wobei der Gegenstandsbereich der Stoffe, für den Maß-Relationen (Naturgesetze) zutreffen, festgelegt sein muß. Dies weiß Hegel, jedoch erscheint bei ihm die Beziehung auf einen bestimmten Gegenstandsbereich lediglich darin, daß er diesen zitiert und das Zitat als Modell für die logische Entwicklung verwendet. Die zitierten Modelle spielen für Hegel die Rolle von beliebig heranziehbaren Beispielen, die gegen andere, die zur Demonstration vielleicht besser passen, ausgetauscht werden könnten, und er tauscht sie im Fortgang der Argumentation auch aus: die Lösung/Legierung gegen die chemische Verbindung, die Neutralisationsreaktionen gegen die Reaktionen der Salze untereinander. So wird die besondere Bestimmtheit eines zitierten Modells als nicht wesentlich für die logische Entwicklung unterstellt, was auch daran sich zeigt, daß Hegel aus einer Disziplin stammende und für deren Gegenstandsbereich definierte Begriffe umstandslos auf andere anwendet: den aus der Chemie stammenden Begriff 'Wahlverwandtschaft' auf Klangverhältnisse in der Akustik, die physikalische 'Knotenlinie' auf die Reaktionen der Salze und deren 'Wahlverwandtschaften'. Wenn synthetisierendes Fortbestimmen nur in der Beziehung der kategorialen Reflexion auf ein spezifisches Material möglich ist und wenn zugleich dieses Material, wie der Wechsel der zitierten Modelle und die Ausdehnung der Begriffe auf andere Gegenstandsbereiche zeigen, als austauschbar hingestellt wird, dann muß für das Material dieser Modelle eine Analogie unterstellt werden. Falls Bestimmtheiten in eine solche Analogie nicht hineinpassen, wird dies entweder als ein dem augenblicklichen, noch unzureichenden Stand der Wissenschaft geschuldeter Schein deklariert,15 oder diese Bestimmtheiten werden als der entwickelnden Reflexion unzugänglich "in die besondern Theile der concreten Naturwissenschaft" (GW 21, 353, 9f; SW 4, 441) verwiesen. Die Behauptung der Analogie und die Unterscheidung, worin die zitierten Modelle analog sind und worin nicht (was dann in die "besondern Theile" verbannt werden muß), können nicht in dem Material selbst begründet sein, sondern allein in der kategorialen Reflexion, was die bei Hegel vorhandene Einsicht dementiert, daß synthetisierendes Fortbestimmen nur in der Beziehung auf das Material möglich ist. Angenommen, es gäbe jene Analogie, dann taugte wegen desselben Logos jedes Material für die entwickelnde Reflexion, und man könnte bei dem einmal gewählten Modell bleiben. Warum ist dann aber eine besondere Auswahl der zitierten Modelle erforderlich, warum das geradezu virtuose Jonglieren mit ihnen (wenn sie ausgewechselt werden), was das Verständnis des Hegelschen Textes nicht gerade erleichtert? Hegel bemerkt, daß die Entwicklung des "Maaßes" nur an bestimmten Gegenständen und die einzelnen Schritte der Entwicklung nur an jeweils verschiedenen Gegenständen darstellbar sind. Die artistische Komposition der miteinander verschränkten und ineinander übergehenden Zitate soll eine gegenüber dem Material zugleich selbständige wie auf es verwiesene Entwicklung der Kategorien gewährleisten. Doch der artistische Umgang mit den Zitaten findet keinen entsprechenden Grund in dem durch diese Zitate bezeichneten Material. So ist der von Hegel postulierte Übergang vom Äquivalentgewicht zur chemischen Affinität durch das moderne Wissen um den Sachverhalt nicht 15
Belegstellen: GW 21, 362, 32-33; SW 4, 454; GW 11, 214, 31-35; U. Ruschig, Hegels Logik und die Chemie (Anm. 12), 184.
308
GW 21, 363, 4-6; SW 4, 454;
vgl.
Die "Knotenlinie
von
Maaßverhältnißen"
worden. Dies könnte ein Hegelianer damit parieren, daß Hegel lediglich ein schlechtes Beispiel, geschuldet dem damaligen Stand des Wissens, ausgewählt habe. Doch bedürfte es dann besserer Beispiele, denn abgetrennt vom Material kann der Gehalt des Hegelschen Textes gar nicht aufgezeigt werden. Bleibt der artistische Umgang mit den Zitaten dem durch diese Zitate bezeichneten Material äußerlich, dann bleibt ein Moment subjektiver Willkür im Zugriff auf das Material.16 Wenn aber solch 'artistische' Arbeit mit dem Material sich als wesentlich für den Text herausstellt, dann dementiert gerade dies das Gesamtprogramm des objektiven Idealismus.
bestätigt
Was treibt die
logische Entwicklung voran?
Es ist ein
klärungsbedürftiges Kardinalproblem der Wissenschaft der Logik, ob und wie deren logische Übergänge begründet sind. Als Beispiel diene der Übergang von der "Wahlverwandtschaft" zur "Knotenlinie von Maaßverhältnißen". Ausgangspunkt ist die Bestimmung der "Wahlverwandtschaft", "Neutralität" werde durch eine Maßgröße 'Verwandtschaftsstärke', die für Hegel dem vorherigen Maßverhältnis (der Äquivalentgewichte) entnommen ist, zur "Wahlverwandtschaft" spezifiziert. Diese Spezifikation enthält einen Widerspruch: Das Spezifizierende, eine quantitativ veränderliche Maßgröße, und das Woran der Spezifikation, die nicht weiter bestimmte "Neutralität" als die negative Einheit der die "Wahlverwandtschaft" bildenden Maße, sind einander äußerlich und bringen nicht zustande, wozu spezifiziert werden soll, nämlich die spezifische Qualität der "Wahlverwandtschaft".17 Bei Hegel erscheint das als Inkonsistenz im Verhältnis von quantitativer und qualitativer Seite der "Wahlverwandt-
schaft". Diese Inkonsistenz könnte vom darauf reflektierenden Bewußtsein als Hinweis auf eine vorgängige Bestimmtheit des Materials erkannt werden, nämlich daß stöchiometrische Massenrelationen der Ausgangsstoffe und Freie Enthalpie einer Verbindung miteinander inkompatible Größen sind. Antrieb für die logische Entwicklung ist für Hegel das auf einen Widerspruch reflektierende Bewußtsein, das diesen nicht anerkennt und deswegen bei ihm nicht stehen bleiben kann. Die Bestimmung der "Wahlverwandtschaft", "Neutralität" werde durch das Maß 'Verwandtschaftsstärke' zur spezifisch ausschließenden Qualität spezifiziert, widerspricht sich. Das auf diesen Widerspruch reflektierende Bewußtsein macht diesen selbst
und damit das Verhältnis des Prinzips der Spezifikation zu dem Woran der Spezifikation zum Gegenstand der Darstellung. Also muß das reflektierende Bewußtsein zu einem Prozeß der Spezifikation übergehen, in dem der Widerspruch gelöst wird. Dieser Prozeß manifestiert sich in den Relationen, die einzelne und verschiedene "Wahlverwandtschaften" untereinander eingehen. Solche "Wahlverwandtschaften" sind Maße, ihre Relationen Maßverhältnisse. Damit solche Relationen als Maßverhältnisse überhaupt bestimmbar werden, muß es ein Substrat geben, an dem diese Relationen sind. Das Substrat der Relationen taucht bei Hegel im 16 Dieses Moment subjektiver Willkür im Zugriff auf das Material ist auch bei Kant widersprüchlich bestimmt; es wird einerseits zugestanden, andererseits abgewiesen: Der "Begriff von einer Materie überhaupt" sei zwar "an sich empirisch", aber ohne "besondere Erfahrungen" zu gewinnen (I. Kant, "Metaphysische Anfangsgründe", Anm. 4, 472). 17 U. Ruschig, Hegels Logik und die Chemie (Anm. 12), 193f.
309
Ulrich Ruschig
zitierten Modell, den Reaktionen der Salze untereinander, auf. Der logische Übergang zur "Knotenlinie" ist also ein aus einem Widerspruch entwickelter Prozeß, angetrieben durch das auf diesen Widerspruch reflektierende Bewußtsein. Notwendig dafür, daß dieses Bewußtsein nicht bei der Feststellung eines Widerspruchs stehen bleibt, ist ein Zitat. Nur an einem zitierten Material sind die Relationen der Maße (der "Wahlverwandtschaften") bestimmbar. Im Zitat benutzt Hegel eine allerdings erst nach Hegels Tod aufgeklärte Äquivokation im Begriff der "Neutralität" (zuerst ist sie das eine Salz, nachher der Zustand, in dem Salzreaktionen ablaufen) ein Beispiel für das Ineinander-Übergehen der zitierten Modelle. -
Die idealistische crux der "Knotenlinie" Die Hegeische "Knotenlinie von Maaßverhältnißen" beansprucht, Universalerklärung für den Zusammenhang von kontinuierlich veränderlichen Maßverhältnissen und diskontinuierlichen Größen zu sein: Kontinuierliche Veränderung schlage in eine diskontinuierliche um, der Übergang zur neu eintretenden Qualität sei ein "Sprung" (GW 21, 366, 5; SW 4, 458). Dieser qualitative Sprung ist für Hegel durch die bestimmte Negation kontinuierlicher Veränderung von quantitativen Maßverhältnissen zureichend begründet. Substrat sei eine rein quantitativ bestimmte "Scale" (GW 21, 365, 4; SW 4, 457), auf der ein spezifizierendes Prinzip den Wechsel von kontinuierlicher Veränderung und qualitativen Sprüngen hervorbringe, das Maß "ist als an sich selbst specificirende Einheit bestimmt, welche an ihr Maaßverhältnisse producirt" (GW 21, 364, 29f; SW 4, 456). Die idealistische crux liegt in der Behauptung, die bestimmte Negation des Verhältnisses quantitativer Kontinuität zum Vorhergehenden sei das neue Qualitative. Nur wenn diese bestimmte Negation alleiniges spezifizierendes Prinzip für die Qualitäten ist, kann auf das diese bestimmte Negation Hervorbringende oder ihren Grund geschlossen werden: jene "an sich selbst specificirende Einheit". Qualität wäre dann nicht mehr Voraussetzung und Zugrundeliegendes für eine Maßbestimmung, sondern resultierte aus einem Prozeß der Bestimmung von Maßen auf der "Knotenlinie": Die neu (sprunghaft) eintretende Qualität wäre als bestimmte Negation des stetigen Durchlaufens quantitativer Maßverhältnisse gesetzt. In einer seiner raren Bemerkungen zur wissenschaftlichen Vorgehensweise im allgemeinen führt Hegel aus, "daß das den in der Vorwärtsgehen [zu Systematik jeweils folgenden Bestimmungen, U.R.] ein Rückgang in den Grund, zu dem Ursprünglichen und Wahrhaften ist, von dem das, womit der Anfang gemacht wurde, abhängt, und in der That hervorgebracht wird" (GW 21, 57, 14-16; SW 4, 74). Angewandt auf den Fall des "realen Maaßes" bedeutet dies, daß von den zunächst unmittelbaren Kategorien des Seins ("Qualität", "Quantität", "Maaß" als unmittelbares "specifisches Quantum", "selbstständiges Maaß") ausgehend die "Knotenlinie" als deren Grund erkannt werde der allgemeine Grundsatz vom Umschlagen kontinuierlicher Veränderung eines quantitativen Maßverhältnisses in eine neue Qualität sei die Wahrheit des "Maaßes" (vgl. GW 11, 241, 3; SW 4, 481). Dieses Umschlagen begründe Qualität, und damit sei die Voraussetzung gesetzt, die in die "Entwicklung des Maaßes" hineingesteckt werden müsse. So werde die "wissenschaftliche Fortbewegung" (GW 21, 58, 13; SW 4, 75) gemäß der Hegelschen Generalthese zu "ein[em] Kreislauf in sich selbst" (GW 21, 57, 27f.; SW 4, 75). -
-
-
310
Die "Knotenlinie
von
Maaßverhältnißen"
An dem Anwendungsfall für diese These, der "Knotenlinie", soll die crux des Idealismus bloßgelegt werden: Zunächst ist nicht zu bestreiten, daß es in der Natur diskrete Größen und Sprünge gibt, die in einem Zusammenhang mit kontinuierlichen Veränderungen stehen. Zu bestreiten und zu kritisieren ist jedoch Hegels Vorhaben, das universelle Gesetz vom "Umschlagen" auf der "Knotenlinie" aus dem im "Maaß" an sich Enthaltenen immanent, d. h. unter Zurückdrängung des zitierten Materials, zu deduzieren. Für diese Deduktion ist entscheidend, daß Hegel den qualitativen Sprung als zureichend begründet durch die bestimmte Negation der kontinuierlichen Veränderung von Maßverhältnissen ausgibt und so vom "Kontinuieren" der Maße zur sprunghaften Verschiedenheit der Qualitäten als deren wesentlicher Bestimmung übergeht. Nur damit wäre der Rückgang aus den kontinuierlich veränderlichen
deren Grund, nämlich den diskret voneinander verschiedenen Qualitäten, zugleich Entwicklung dieses Grundes als Resultat, der Kreislauf wäre in sich geschlossen, und die zunächst vorausgesetzten Qualitäten wären gesetzt oder begründet. Aber das Abbrechen kontinuierlicher Veränderung ist lediglich notwendige Bedingung, nicht zureichender Grund für die Verschiedenheit von Qualitäten. Das vorwärtsgehende Entwickeln, das auf den qualitativen Sprung führt und damit lediglich auf eine notwendige Bedingung zurückgeht, fällt nicht mit dem Rückgang in den Grund zusammen, welcher Rückgang in Wahrheit bedeutete, das für das "Umschlagen" wesentliche, heterogene Material zu erschließen. In den Naturwissenschaften stehen kontinuierlich veränderliche Maßverhältnisse und qualitative, diskontinuierliche Größen in einer Konstellation, die ihrerseits durch ein bestimmtes Material, nämlich durch zu den in Konstellation stehenden Maßgrößen heterogene Qualitäten, spezifiziert wird. Damit ist das "Umschlagen" nicht als das gesetzt, was an sich im "Kontinuieren" der Maße enthalten ist, sondern verweist auf ein bestimmtes und gerade mittels solcher "Umschläge" bestimmbares Material. Dies kann am Standardbeispiel für den dialektischen "Umschlag", dem des gefrierenden Wassers, erläutert werden: Es gibt sehr wohl einen Zusammenhang zwischen dem kontinuierlichen Entzug von Wärmeenergie und der sprunghaften Änderung von Eigenschaften bei Phasenübergängen. Doch dieser Zusammenhang ist nur an einem Material bestimmbar, d. h. in einem Versuchsaufbau, wo zwei Phasen (Wasser, Eis) für eine gewisse Zeit miteinander koexistieren. Dafür ist dann der Zusammenhang als Konstellation von Momenten bestimmbar, nämlich des Energieinhalts des Systems, des kontinuierlich veränderlichen Maßverhältnisses Masse Eis : Masse Wasser, der sprunghaft sich ändernden Qualität (Dichte, Brechungsindex etc.) und einer konstant bleibenden Maßgröße (Gefrierpunkt). Irrig dagegen ist die Behauptung, der Abbruch der kontinuierlichen Veränderung sei zureichender Grund für die sprunghafte Qualitätsänderung. Maßverhältnissen
zu
Idealistische versus materialistische Dialektik In der
"Entwicklung des Maaßes" treten an die Stelle der "unmittelbaren Qualität" "Maaße", von "Maaßen", "Verhältnisexponenten" dieser Relationen und dann schließlich jener allgemeine Grundsatz. Das ist nicht nur falsch. Es spiegelt den Gang des Wissens der Naturwissenschaften wieder. Zu Anfang hatte man chemische Substanzen durch ihre Eigenschaften wie z. B. Glanz, Schmelzbarkeit und Flüchtigsein ohne Veränderung beim Erhitzen charakterisiert. Von diesen drei Qualitäten ging man zu deren Einheit über, die man als den Relationen
311
Ulrich Ruschig
"Grundstoff "Mercurius" bestimmte. "Mercurius"
war nicht mehr "unmittelbare Qualität", sondern allgemeines Prinzip der Metalle und vermittelt mit dem Mond, dem Weiblichen u. a. An die Stelle solch "unmittelbarer Qualitäten" und deren Einheit formulierender Prinzipien traten in einem Prozeß wissenschaftlichen Fortschreitens, welcher Reflexion und Kritik dieser Prinzipien und experimentelle Tätigkeit mit den Stoffen und deren kontrollierten Reaktionen umfaßt, Maßgrößen wie Dichte, Schmelzpunkt, relative Atommasse; diese Maße können Relationen bilden, die ihrerseits z. T. durch Gesetze bestimmt sind. Gegen solches Weiterbestimmen zu immer spezifischeren Maßgrößen und gegen den Ersatz der vormaligen und überholten 'Qualitäten' ist nichts einzuwenden. Man kann das mit Hegel so auf den Begriff bringen, daß von der "unmittelbaren Qualität" zu dem "realen Maaß", den Relationen solcher "Maaße", den "Exponenten" dieser "Maaßverhältnisse" usw. vorangeschritten wird. Auch gegen den Befund, daß kontinuierliche Veränderungen von Maßverhältnissen mit sprunghaften Qualitätsänderungen verknüpft sein können, läßt sich nicht argumentieren. Jedes spezifizierte Maß (und so auch die spezifische Konstellation von kontinuierlichen und diskontinuierlichen Veränderungen von Maßgrößen auf der "Knotenlinie") enthält qualitative Momente. Diese machen die Reflexion auf die qualitativen Voraussetzungen dieses Maßes möglich, d. h. es kann auf seine qualitative Grundlage, ein "materielles Substrat", geschlossen werden, auf das die spezifizierten Maßverhältnisse passen, das aber nicht vollständig in ihnen aufgeht: qualitativ verschiedene Substanzen und aufeinander nicht reduzierbare Grundgrößen wie Masse, Energie usw. Doch einen substantiellen Unterschied im Substrat erkennt Hegels idealistisches Programm der Entwicklung der Kategorien nicht an. Hegel setzt das (rückwärtsgehende) Erschließen des Grundes in eins mit dem (vorwärtsgehenden) Weiterbestimmen des sich spezifizierenden "Maaßes". Der Grund sei als Resultat der Entwicklung des "Maaßes" gesetzt. Damit behauptet Hegel, die im "Maaß" enthaltenen, qualitativen Momente wären vollständig durch das System von "Maaßverhältnißen" bestimmt und deshalb ließen sich die vorausgesetzten Qualitäten durch aus der Selbst-Spezifikation des "Maaßes" hervorgehende, spezifizierte Maßverhältnisse ersetzen. Für das vollständige Ersetzen hat das Setzen der Qualität durch bestimmte Negation von kontinuierlicher Veränderung eine Schlüsselstellung. Die bestimmte Negation wird dann aus der "an sich selbst specificirenden Einheit" begründet, einer reflexiven Einheit und einem völlig entleerten Substrat. Das Substrat wird gerade im und durch den Fortgang des Fortbestimmens entleert, was damit einhergeht, daß das zunächst vorausgesetzte und spezifisch verschiedene Material aufgebraucht wird. Was an der "Knotenlinie" idealistische Dialektik sei, vermögen die folgenden drei Merkmale zu umreißen: 1) Unmittelbare und vorausgesetzte Qualitäten werden durch Maß-Relationen vollständig
ersetzt.
2) 3)
312
Das Material, woran die Maße sind und das für die Entwicklung des "Maaßes" notwendig ist, wird mit dem Übergang zum "Wesen" aufgebraucht und erscheint dadurch dann
als nicht mehr notwendig. Reflexion und Gegenstand, worauf Reflexion sich bezieht, werden in eins gesetzt (in der "an sich selbst specificirenden Einheit").
Die "Knotenlinie
von
Maaßverhältnißen"
Wie ist nun materialistische Dialektik18 im Unterschied zur idealistischen zu bestimmen? Zunächst kann eine notwendige Bedingung angegeben werden: die Kritik idealistischer Dialektik. Indem offengelegt wird, daß idealistische Dialektik scheitert und woran sie scheitert, nämlich an ihrem Verhältnis zum Material, wird gerade dadurch etwas über das Material offenbar gemacht, was anders, also ohne Beziehung zur idealistischen Konstruktion, nicht zu erkennen wäre. Eine weitergehende Bestimmung von materialistischer Dialektik setzt sich dem Widerspruch aus, über die geforderte konstitutive Bedeutung des besonderen Materials allgemein verhandeln zu wollen. Allerdings lassen sich durch die bestimmte Negation jener drei Merkmale schon konkretere Bestimmungen über materialistische Dialektik herausbekommen: 1) Maß-Relationen sind kein vollständiger Ersatz für die Qualitäten. Maß-Relationen existieren als definierte Relationen überhaupt nur für partikulare Naturzusammenhänge. Diese können in der Regel nur durch experimentelle Arbeit, die sie aus dem universalen Naturzusammenhang isoliert, gewonnen werden. Solche gegenständliche Tätigkeit ist auf ein ihr vorausgesetztes, an sich bestimmtes und spezifisches Material bezogen. Wenn nun das Herauspräparieren partikularer Naturzusammenhänge notwendige Bedingung jeder naturwissenschaftlichen Erkenntnis ist und wenn diese Bedingung im Prozeß weiterer Erkenntnisgewinnung nicht beseitigt werden kann, weil der universale Naturzusammenhang sich nicht als Summe aus den jemals herauspräparierten partikularen Naturzusammenhängen vollständig zusammensetzen läßt, dann kann die "Entwicklung des Maaßes", die die Resultate der Erkenntnisgewinnung als Relationen von Maß-Relationen abbildet, die mit dem universalen Naturzusammenhang gegebenen, an sich bestimmten Qualitäten nicht aufheben. 2) Maße sind Maße an einem Substrat. Dessen zunächst qualitative Bestimmtheiten werden durch Maße, Relationen von Maßen und Regeln über die Relationen von Maß-Relationen (Naturgesetze) ersetzt. Solcherart Maßbestimmung versucht Hegel dadurch auf den Begriff zu bringen, daß reflektierende Vernunft die Kategorie "Maaß" sowohl aus den Kategorien "Qualität" und "Quantität" entwickelt als auch zur "Knotenlinie" fortbestimmt. Diese Reflexion auf die Kategorie "Maaß", welche Reflexion von der Entwicklung dieser Kategorie selbst nicht getrennt werden kann, ist auf das Verhältnis des "Maaßes" zum Substrat verwiesen, das so zum Material für diese Reflexion wird. Hegel bestimmt nun das Verhältnis der immer konkretere Kategorien entwickelnden Reflexion ("Entwicklung des Maaßes") zum Material dergestalt, daß letzteres als austauschbar, lediglich zitiert und ineinander übergehend aufgezeigt und schließlich durch die Bewegung der Reflexion gesetzt wird. Dies ist falsch. Für die Entwicklung des "Maaßes" hin zum "Wesen" ist das (spezifische) Material konstitutiv und nicht vom Resultat her als nichtig zu setzen. Es ist lediglich Schein, als gelänge die Entwicklung bloß mit dem Zitieren von Material und als wäre mit dem Resultat, dem allgemeinen Grundsatz der "Knotenlinie" (oder dann mit dem "Wesen"), das Material aufgebraucht und hätte damit seine Funktion für diese Entwicklung hin zum "Wesen" erfüllt. Es gibt eine Analogie zu diesem Aufbrauchen des Materials durch eine reflexive Bewegung: Es ist die Bewegung des Kapitals, reflexiv als Verwertung des Werts, in dieser Bewegung alles aufbrauchend und nichtig setzend, was ihr zunächst vorausgesetztes Material (Rohstoffe und 18 P. Bulthaup, "Idealistische und materialistische H.-G. Backhaus u. a„ Frankfurt a.M. 1975, 171ff.
Dialektik", in Beiträge
zur
Marxschen Theorie 3,
hg.
v.
313
Ulrich Ruschig
den Konsumtions- und Produktionsmitteln befreite lebendige Arbeit) war und was sie durch den Versuch, ein ihr gemäßes Material zu setzen. Die Analogie liegt auch in dem erzeugten ideologischen Schein, als gelänge eine vom Material sich ablösende Bewegung. Dies haben Systemtheorie und Idealismus miteinander gemein. 3) Bei Kant ist das Verhältnis von Reflexion und Gegenstand verschieden bestimmt, je nachdem ob unter Gegenstand Erscheinung oder Ding an sich verstanden wird. Die Gegenstände möglicher Erfahrung, insofern sie Gegenstände für uns sind, fallen unter die transzendentale Einheit der Apperzeption und sind damit a priori unter das reflexive Selbstbewußtsein subsumiert.19 Insofern die Gegenstände aber Ding an sich sind, bleiben sie der Reflexion äußerlich und damit dem Konstitutionsprozeß des Selbstbewußtseins entzogen. Da das Ding an sich weder eine Bestimmtheit trägt noch erkennbar ist, kann der Unterschied zur Reflexion nicht bestimmt werden. 'Ding an sich' taugt deswegen nicht als Begriff für ein nicht mit Reflexion zusammenfallendes Material. Für Hegel ist alles, was Gegenstand für uns ist, zunächst durch Qualitäten bestimmbar; diese sind durch Maße und die Maße durch ihre Relationen ersetzbar; und die Relationen von Maß-Relationen sind schließlich auf den allgemeinen Grundsatz der "Knotenlinie" zurückführbar. Dieser liegt eine reflexive Einheit zugrunde, die durch Selbst-Spezifikation Knoten und das sind qualitative Bestimmtheiten erzeugt. Hegel setzt vorwärtsgehende Weiterbestimmung und Rückgang in den Grund identisch. Vorwärtsgehende Weiterbestimmung bedeutet: Qualitäten gehen vollständig in den Maßbestimmungen auf; diese werden durch die "an sich selbst specificirende Einheit" produziert; letztere gründet im "Wesen", das sich zu den Reflexionsbestimmungen bestimmt; also gehen im ganzen gesehen die Qualitäten in den Reflexionsbestimmungen auf. Mit der Hegelschen Identitätsbehauptung sind die so erhaltenen Reflexionsbestimmungen zugleich Grund für die Qualitäten und können diese ersetzen. Damit ist das Kantsche Problem, ob und warum die Wirklichkeit der Einheit des Selbstbewußtseins und den reinen Verstandesbegriffen gemäß ist, elegant gelöst; ein der Reflexion äußerlich bleibendes Ding an sich kommt nicht vor und kann nicht vorkommen. Für Hegel bleibt nichts übrig, was nicht mit Reflexion zusammenfallendes Material wäre. In der Lehre vom Seyn markiert die "an sich selbst specificirende Einheit" den entscheidenden Schritt, wo Reflexion und Gegenstand (Tätigkeit und Substrat, Prozeß der Spezifikation und spezifizierbare "Scale") in eins gesetzt werden. Die Durchführung dieses In-Eins-Setzens bei Hegel produziert Widersprüche, die auf ihren Grund verweisen, der so bestimmbar wird. Also: Das Verhältnis von Reflexion und Gegenstand, worauf Reflexion sich bezieht, läßt sich und soweit reicht die Kritik der idealistischen Dialektik durch die bestimmte Negation zweier einander entgegengesetzter Aussagen bestimmen: A) Reflexion und Gegenstand sind nicht einander äußerlich, denn wären sie einander äußerlich, wäre Erkenntnis unmöglich, da diese ohne Gegenstand Erkenntnis von Nichts und ohne Reflexion nicht formulierbar wäre. (Insoweit trifft Hegels Kritik an Kants Ding an sich zu.) B) Reflexion und Gegenstand sind nicht in eins zu setzen. Dafür liefert die Kritik an Hegels Entwicklung des "Maaßes" den Beleg. die
von
ersetzt
-
-
-
-
19 KrV B, 164.
314
Siglen
Enz. GW
HW
KpV KrV KU MEW Phän.
Rph. SW WdL
Hegel, G.W.F., Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften Hegel, G.W.F., Gesammelte Werke. In Verbindung mit der Deutschen Forschungsgemeinschaft hg. der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften, Hamburg. Hegel, G.W.F., Werkausgabe in 20 Bänden. Auf der Grundlage der Werke von 1832-1845, hg. Moldenhauer, E./Michel, K.M., Frankfurt a.M. 1969ff. Kant, L, Kritik der praktischen Vernunft Kant, I., Kritik der reinen Vernunft Kant, I., Kritik der Urteilskraft Marx, K./Engels, F., Werke, Berlin 1956ff. Hegel, G.W.F., Phänomenologie des Geistes Hegel, G.W.F., Grundlinien der Philosophie des Rechts Hegel, G.W.F., Sämtliche Werke. Jubiläumsausgabe, hg. Hegel, G.W.F., Wissenschaft der Logik
v.
H.
Glockner, Stuttgart 1927-1931.
v.
v.
Auswahlbibliographie
Aktualität und Folgen der Philosophie Hegels, hg. v. O. Negt, Frankfurt a.M. 1970,21971. Albizu, E., "Para abrir la lógica de Hegel. Cuatro notas introductiorias", in Signos universitarios 19, Buenos Aires 1991, 33-54. Albizu, E., "Comienzo como concepto especulativo", in Escritos de Filosofía 13, 25-26, Buenos Aires 1994, 5-42. Albrecht, E., "Zu Fragen der methodologischen Funktion der Dialektik", in Wissenschaft der Logik. Formation und Rekonstruktion, hg. v. D. Henrich, Stuttgart 1986, 134-163. Albrecht, W., Hegels Gottesbeweis. Eine Studie zur "Wissenschaft der Logik", Berlin 1958. Aleksandrowicz, D., "Das Problem des Anfangs bei Hegel", in Philosophisches Jahrbuch 92 (1985), 225-238. Alvarez-Gómez, M., "Fundamentación lógica del deber ser en Hegel", in Estudios sobre Kant y Hegel, hg. v. G.M. Alvarez/C. Florez, Salamanca 1982, 171-201. Angehrn, E., Freiheit und System bei Hegel, Berlin, New York 1977. Apostel, P.N., Probleme de lógica dialéctica infilozofia lui G.W.F. Hegel, 2 Bde., Bucuresti 1957-1964. Apóstol, L., "Lógica e dialettica in Hegel", in La formalizzazione della dialettica. Hegel, Marx e la lógica contemporánea, hg. v. D. Marconi, Torino 1979, 85-113. Arbeit und Reflexion. Zur materialistischen Theorie der Dialektik Perspektiven der Hegelschen "Logik", hg. v. P. Furth, Köln 1980. Arndt, A., Dialektik und Reflexion. Zur Rekonstruktion des Vernunftbegriffs, Hamburg 1994. Art and Logic in Hegels Philosophy, hg. v. W.E. Steinkraus/K.I. Schmitz, New Jersey, Sussex 1980. Artola Banenechea, J.M., "La esencia como presuposición en lógica de Hegel", in Estudios Filosóficos 54 (Valladolid 1971), 303-333. Artola Barrenechea, J.M., "Realidad y necesidad en la 'Ciencia de la Lógica' de Hegel", in Revista de Filosofía 3 (Madrid 1979), 139-166. Ashbaugh, A.F., "Hegel's Science of Logic: A Logic of Being and a Logic of Recurrence", in Hegel-Jahrbuch 1979 (1980), 196-209. Aubenque, P., "Hegel et Aristote", in Hegel et la pensée grecque, hg. v. J. D'Hondt, Paris 1974, 97-120. Baillie, JB., The Origin and Significance of Hegel's Logic. A general introduction to Hegel's System, London 1901. Balaban, O., "Circularity of Thought in Hegel's Logic", in The Review of Metaphysics 44 (1990/91), 95-109. Baptist, G., // problema della modalità nelle logiche di Hegel. Un itinerario tra il possibile e il necessario, Genua 1992. Baum, M., "Zur Vorgeschichte des Hegelschen Unendlichkeitsbegriffs", in Hegel-Studien 11 (1976), 89-124. Becker, W., Die Dialektik von Grund und Begründetem in Hegels "Wissenschaft der Logik". Untersuchungen zum Konstitutionsproblem im Deutschen Idealismus anhand einer Textinterpretation, Diss. Frankfurt a.M. 1964. Becker, W., Hegels Begriff der Dialektik und das Prinzip des Idealismus. Zur systematischen Kritik der logischen und phänomenologischen Dialektik, Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz 1969. Bergmann, U„ "Hegel und ein Problem der Dinge an sich", in Erfahrungen der Negativität. Festschrift für Michael Theunissen zum. 60. Geburtstag, hg. v. M. Hattstein u.a., Hildesheim, Zürich, New York 1992, 155-175. Biard, J., "Dialectique et négation de la négation d'après Hegel", in La Pensée 237 (1984), 91-99. -
Auswahlbibliographie Biedermann, G., Kant's Kritik der reinen Vernunft und die Hegel'sehe Logik in ihrer Bedeutung für die Begriffs-
wissenschaft, Prag 1869.
Birault, H., "L'onto-théo-Logique hégélienne
et la dialectique", in Tijdschrift voor Philosophie 20 (1958), 269-300. Birchall, B.C., "On Hegel's Critique of Formal Logic", in Clio 9 (1980), 283-296. Böhling, R., "Zur Materie der Logik", in Hegel-Jahrbuch 1997 (1998), 230-233 Boehme, H., "Die Hegeische Logik des Widerspruchs", in Philosophia Naturalis 17 (1978), 105-119. Boehme, H., "Die Reflexionsbestimmungen der Hegelschen Logik und die Wissenschaftslogik", in Hegel-Jahrbuch 1979 (1980), 226-235. Boehme, H., "Das Leben als Idee. Die Idee des Lebens in Hegels 'Wissenschaft der Logik'", in Die Logik des Wissens und das Problem der Erziehung, Nürnberger Hegel-Tage 1981, hg. v. W.R. Beyer, Hamburg
1982, 154-163. Bole, Th.J., "The Dialectic of Hegel's Logic 144-151.
as
the
Logic of Ontology",
in
Hegel-Jahrbuch 1974 (1975),
Bonsiepen, W., "Hegels Theorie des qualitativen Quantitätsverhältnisses", in Konzepte des mathematisch Unendlichen im 19. Jahrhundert, hg. v. G. König, Göttingen 1990. Borzeszkowski, H.-H. v./Wahsner, R., "Physikalische Bewegung und dialektischer Widerspruch", in Deutsche Zeitschrift für Philosophie 30 (1982), 634-644. Bosanquet, B„ Logic or the Morphology of Knowledge, 2 Bde., Oxford 1888, "1911. Bosanquet, B., The Essentials ofLogic. Being Ten Lectures of Judgement and Inference, London 1895, 1960. Bradley, F.H., The Principles of Logic, 2 Bde., Oxford 1883,21922. Braiding, P., Hegels Subjektbegriff. Eine Analyse mit Berücksichtigung intersubjektiver Aspekte, Würzburg 1991. Brauch, R., Hegels "Wissenschaft der Logik". Untersuchungen zum Verhältnis von Logik und Ontologie, Diss. Tübingen 1986. Brauer, D., "Die dialektische Natur der Vernunft. Über Hegels Auffassung von Negation und Widerspruch", in Hegel-Studien 30 (1995), 89-104. Braun, H., "Spinozismus in Hegels Wissenschaft der Logik", in Hegel-Studien 17 (1984), 53-74. Brinkmann, K., "Intersubjektivität und konkretes Allgemeines. Zur These von der kategorialen Defizienz der Hegelschen Logik", in Kategorien und Kategorialität, hg. v. D. Koch/K. Bort, Würzburg 1990, 131-169.
Bröcker, W., Formale, transzendentale und spekulative Logik, Frankfurt a.M. 1962. Bubner, R., "Zur Struktur dialektischer Logik", in Hegel-Jahrbuch 1974 (1975), 137-143. Bubner, R., Zur Sache der Dialektik, Stuttgart 1980. Bubner, R., Dialektik als Topik. Bausteine zu einer lebensweltlichen Theorie der Rationalität, Frankfurt a.M. 1990. Bucher, T.G., "Zur formal-logischen Identität im Urteil von Hegel", in Philosophia Naturalis 20 (1983), 453^73. Bullinger, A., Hegeische Logik und gegenwärtig herrschender antihegelscher Unverstand, München 1900. Bulthaup, P., "Das Recht der Logik", in Hegel-Jahrbuch 1988 (1989), 69-78. Burbridge, J., On Hegel's Logic. Fragments of a Commentary, Atlantic Highlands, N. J. 1981. Burbridge, J., "Transition or Reflection", in Revue Internationale de Philosophie 36 (1982), 111-123. Burbridge, J., "The first chapter of Hegel's larger Logic", in The Owl of Minerva (1989/1990), 177-183. Burkhardt, B., Hegels "Wissenschaft der Logik" im Spannungsfeld der Kritik. Historische und systematische Un-
tersuchungen zur Diskussion um Funktion und Leistungsfähigkeit von Hegels "Wissenschaft der Logik" bis 1831, Zürich, New York 1993. Burkhardt, B., "Christian Hermann Weißes frühe Hegel-Kritik", in Philosophisches Jahrbuch 101 (1994), 277-306. Butler, C, "Hegel's Dialectic of the Organic Whole as a Particular Application of Formal Logic", in Art and Logic in Hegels Philosophy, hg. v. W.E. Steinkraus/K.I. Schmitz, New Jersey, Sussex 1980, 219-232. Caleo, M., "Ritorno a Hegel? La lógica dell'essenza", in Rassegna di Scienze Filosofiche 28, Napoli 1975, 203-227. The Cambridge Companion to Hegel, hg. v. F.C Beiser, Cambridge 1993. Caramella, S., "Le tre logiche di Hegel", in Hegel-Tage Urbino 1965, hg. v. H.-G. Gadamer, Bonn 1969 (HegelStudien, Beiheft 4), 103-114. Casares, Á.J., "La doctrina del juicio en la Ciencia de la Lógica", in Dialogos, Jg. 7, Nr. 20 (1970), 75-99. 318
Auswahlbibliographie Cave, G.P., "The Dialectic of Becoming in Hegel's Logic", in The Owl of Minerva 16 (1985), 147-160. Ceriani, G„ "La lógica di Hegel", in Rivista di filosofía neo-scolastka 31 (1939), 299-306. Coelln, H. v., Was ist und was heißt Dialektik? eine Frage nach dem Sein, Essen 1989. Collmer, T., Aktuelle Perspektiven einer immanenten Hegel-Kritik. Negative Totalisierung als Prinzip offener Dialektik, Gießen 1992. Comoth, K., "Hegels 'Logik' und die spekulative Mystik", in Hegel-Studien 19 (1984), 65-93. Coreth, E., Das dialektische Sein in Hegels Logik, Wien 1952. Costa, F., "II problema della posizione prima del pensiero e la lógica hegeliana", in Atti della Accademia di Science, Lettere, e Arti di Palermo 1947/48. Tl. 2, 277-326. D'Aulnis de Bouroill, J., De Lógica van Hegel en zijn bewijs van de valwet der lichamen, Amsterdam 1915. D'Ercole, P., La lógica aristotélica, la lógica kantiana e hegeliana e la lógica matemática, con accenno alia lógica indiana, Torino 1912. D'Hondt, J., "Téléologie et Praxis dans la 'Logique' de Hegel", in Hegel et la pensée moderne, hg. v. J. D'Hondt, Paris 1970, 1-26. Dahlstrom, D. O., "Hegel's Science of Logic and the idea of truth", in Idealistic Studies 13 (1983), 33-49. Damerow, P./Lefevre, W., "Die wissenschaftstheoretische Problemlage für Hegels 'Logik'", in Hegel-Jahrbuch
7979(1980), 349-368. Damnjanovic, M., "Der heteroontologische Ansatz in der Hegelschen 'Logik'", in Die Logik des Wissens und das Problem der Erziehung. Nürnberger Hegel-Tage 1981, hg. v. W.R. Beyer, Hamburg 1982, 61-65. De Giovanni, B., "La critica del fundamento nella 'Lógica' di Hegel", in Lógica e storia in Hegel, hg. v. R. Racinaro/V. Vitiello, Napoli 1985, 19-39. De Giovanni, B., "Tempo e storia nella Grande Lógica", in Annali della Facoltà di Lettere e Filosofía 14, Bari 1969, 123-139. De Ruvo, V., /massimi logici e la lógica della possibilità, Aristotele, Leibniz, Kant, Hegel, Napoli 1953. De Vos, L., Hegels Wissenschaft der Logik: Die absolute Idee. Einleitung und Kommentar, Bonn 1983. Devizzi, A., "II significato del principio di contradizzione nella lógica hegeliana", in Rivista di filosofía neo-scolastica 31 (1939), 463-473. Giovanni, G, "Reflection and Contradiction. A commentary on some passages of Hegel's Science of Logic", in Hegel-Studien 8 (1973), 131-161. Di Giovanni, G, "The Category of Contingency in the Hegelian Logic", in Art and Logic in Hegels Philosophy, hg. v. W.E. Steinkraus/K.I. Schmitz, New Jersey, Sussex 1980, 179-200. Doz, A., Georg Wilhelm Friedrich Hegel: La Théorie de la Mesure. Traduction et Commentaire de la 3. Section Di
du premier Livre de la "Science de la
Logique", Paris 1970.
Doz, A., La Logique de Hegel et les problèmes traditionnels de l'ontologie, Paris 1987. Dresser, H.W., "The Logic of Hegel", in ders., The Philosophy of Spirit, New York, London 1908, 387-537. Dubarle, D./Doz, A., Logique et dialectique, Paris 1972. Dubarle, D., "La logique de la réflexion et la transition de la logique de l'être à celle de l'essence", in Revue de science philosophiques
et
théologiques 56 (1972),
193-222.
Dubarle, D., "Sur la Réflexion dans la science de la Logique (IIe Partie, Section I, Chapitre I)", in Hegel-Jahrbuch 1968/69 (1970), 346-354. Dulckeit A.Ch. v„ "Die Dialektik der drei endlichen Seinsbereiche als Grundlage der Hegelschen Logik", in Philosophisches Jahrbuch 66 (1958), 72-93. Düsing, K., Das Problem der Subjektivität in Hegels Logik. Systematische und entwicklungsgeschichtliche Untersuchungen zum Prinzip des Idealismus und zur Dialektik, Bonn 1976 (Hegel-Studien, Beiheft 15), 2., verbesserte und um ein Nachwort erweiterte Aufl. Bonn 1984. Düsing, K., "Hegels Begriff der Subjektivität in der Logik und in der Philosophie des subjektiven Geistes", in Hegel-Tage Santa Margherita 1973. Hegels philosophische Psychologie, hg. v. D. Henrich, Bonn 1979 (Hegel-Studien. Beiheft 19), 201-214. Düsing, K., "Identität und Widerspruch. Untersuchungen zur Entwicklungsgeschichte der Dialektik Hegels", in Giornale di Metafísica 6 (1984), 315-358. Düsing, K„ "Syllogistik und Dialektik in Hegels spekulativer Logik", in Wissenschaft der Logik. Formation und Rekonstruktion, hg. v. D. Henrich Stuttgart 1986, 15-38.
319
Auswahlbibliographie Dialektik. Der dreifache Bruch mit dem traditionellen Denken", in Philosophia perrennis. Erich Heintel zum 80. Geburtstag, hg. v. H.-D. Klein/J. Reikerstorfer, Frankfurt a.M. 1993, 126-138. Eben, Th., Der Freiheitsbegriff in Hegels Logik, Diss. München 1969. Eley, L., "Zum Problem des Anfangs in Hegels Logik und Phänomenologie", in Hegel-Studien 6 (1971), 267-294. Eley, L., Hegels Wissenschaft der Logik. Leitfaden und Kommentar, München 1976. Ellrich, L., "Schein und Depotenzierung. Zur Interpretation des Anfangs der 'Wesenslogik'", in Hegel-Studien 25 (1990), 65-84. Emge, CA., Hegels Logik und die Gegenwart, Karlsruhe 1927. Erdei, L., Der Anfang der Erkenntnis. Kritische Analyse des ersten Kapitels der Hegelschen Logik, Budapest 1964. Erdei, L., "Die dialektisch-logische Theorie des Begriffs und des Urteils", in Aufsätze über Logik, hg. v. G. Tamas, Budapest 1970, 7-84. Erdei, L., Gegensatz und Widerspruch in der Logik, Budapest 1972. Erdei, L., "Der Gegensatz und der Widerspruch in der Hegelschen Logik", in Hegel-Jahrbuch 1973 (1974), 18-23. Erdei, L., Das Urteil. Die dialektisch-logische Theorie des Urteils, Budapest 1981. Erdei, L., Der Schluß. Die Dialektik des Schlusses, Budapest 1983. Erdmann, J.E., Grundriss der Logik und Metaphysik, Halle 1841. Esposito, J.L., "Hegel's dialectical logic. Categories and interpretations", in Nature and System 2, Tucson 1980, 123-134. Essays on Hegel's Logic, hg. v. G. Di Giovanni, Albany, N.Y. 1990. Essler, W.K., "Zur Topologie der Arten dialektischer Logik bei Hegel", in Wissenschaft der Logik. Formation und Rekonstruktion, hg. v. D. Henrich, Stuttgart 1986, 198-208. Falk, H.-P., Das Wissen in Hegels "Wissenschaft der Logik", Freiburg, München 1983. Ferrini, C, "Forma e natura nei presupposti della lógica come scienza in Hegel", in // Pensiero 26 (1985), 137-163. Ferinni, C, "On the relation between 'mode' and 'measure' in Hegel's Science of Logic: Some introductory remarks", in The Owl of Minerva 20 (1988/89), 21-49. Ferrini, C, "Lógica e Filosofia della Natura nella dottrina dell'essere hegeliana", in Revista di Storia della Filosofia AA (1991), 701-735; 47 (1992), 103-124. Findlay, J.N., Hegel. A Re-Examination, London 1964. Fink-Eitel, H., Dialektik und Sozialethik. Kommentierende Untersuchungen zu Hegels Logik, Meisenheim a.G. 1978. Flach, W., Negation und Andersheit, München 1959. Flach, W., "Zum 'Vorbegriff der Kleinen Logik Hegels", in Der Idealismus und seine Gegenwart. Festschrift. für Werner Marx, hg. v. U. Guzzoni/B. Rang/L. Siep, Hamburg 1976, 133-146. Fleckenstein, J.O., "Hegels Interpretation der Cavalierischen Infinitismimalmethode", in Stuttgarter Hegel-Tage 1970, hg. v. H.-G. Gadamer, Bonn 1974 (Hegel-Studien, Beiheft 11) Fleischhacker, L., Over de grenzen van de kwantiteit, Amsterdam 1982. Fleischmann, E., "Die Wirklichkeit in Hegels Logik. Ideengeschichtliche Beziehungen zu Spinoza", in Zeitschrift für philosophische Forschung 18 (1964), 3-29. Fleischmann, E., "Objektive und subjektive Logik", in Heidelberger Hegel-Tage 1962, hg. v. H.-G. Gadamer, Bonn 1964 (Hegel-Studien, Beiheft 1), 45-54. Fleischmann, E., "Hegels Umgestaltung der Kantischen Logik", in Hegel-Studien 3 (1965), 181-207. Fleischmann, E., La science universelle ou la logique de Hegel, Paris 1968. Fulda, HF., Das Problem einer Einleitung in Hegels Wissenschaft der Logik. Frankfurt a.M. 1965. Fulda, H.F., "Über den spekulativen Anfang", in Subjektivität und Metaphysik. Festschrift für W. Cramer, hg. v. D. Henrich/H. Wagner, Frankfurt a.M. 1966, 109-127. Fulda, HF., "Unzulängliche Bemerkungen zur Dialektik", in Seminar: Dialektik in der Philosophie Hegels, hg. v. R.-P. Horstmann, Frankfurt a.M. 1978, 33-69. Fulda, H.F., "Hegels Dialektik als Begriffsbewegung und Darstellungsweise", in Seminar: Dialektik in der Philosophie Hegels, hg. v. R.-P. Horstmann, Frankfurt a.M. 1978, 124-174.
Düsing, K., "Hegels
320
Auswahlbibliographie Fulda, H.F., "Dialektik in Konfrontation mit Hegel", in Hegel Perspektiven seiner Philosophie heute, Köln 1981 (Dialektik 2), 63-84. Fulda, H.F., "Spekulative Logik als die 'eigentliche Metaphysik' Zu Hegels Verwandlung des neuzeitlichen -
Metaphysikverständnisses", jagd, Köln 1991, 9-27.
in
Hegels Transformation
der -
Metaphysik, hg.
v.
D. Pätzold/A. Vander-
Fulda, H.F./Horstmann, R.-P./Theunissen, M.: Kritische Darstellung der Metaphysik. Eine Diskussion über Hegels
'Logik',
Frankfurt a.M. 1980.
Gabler, G.A., Kritik des Bewußtseins. Eine Vorschule zu Hegels "Wissenschaft der Logik", Erlangen 1827, Nachdruck Leiden 1901.
Gadamer, H.-G., "Signification de la 'Logique' de Hegel", in Archives de Philosophie 33 (1970), 675-700. Gadamer, H.-G., "Die Idee der Hegelschen Logik", in ders., Hegels Dialektik. Fünf hermeneutische Studien,
Tübingen21980, 65-85.
Gaos, J., "Seminario sobre la 'Lógica' de Hegel", in Revue philosophique 99 (1964), 67-79. Gasché, R., "Nontotalization without Spuriousness: Hegel and Derrida on the Infinite", in Journal of the British Society for Phenomenology 17:3 (1986), 289-307. Gauthier, Y., "Logique Hégélienne et Formalisation", in Dialogue 6 (1967), 151-165. Gauthier, Y., "Hegel's Logic from a Logical Point of View", in Hegel and the Sciences, hg. v. R.S. Cohen, /M.W. Wartofsky, Dordrecht, Boston, Lancaster 1984, 303-310. Gethmann-Siefert, A.: "Rettung der Dialektik? Rationale Rekonstruktion oder Sacrificium rationis?" in HegelStudien 18 (1983), 245-294. Giacché, V.: Finalità e Soggettività. Forme del Finalismo nella "Scienza della Lógica" di Hegel. Genua 1990. Givsan, H., "Geschichte als absolute Voraussetzung der Hegelschen Logik", in Hegel-Jahrbuch 1983 (1986), 83-92.
Glockner, H„ Der Begriff in Hegels Philosophie. Versuch einer logischen Einleitung in das metalogische Grund-
problem des Hegelianismus, Tübingen 1924. zur Beschreibung des Anfangenden in Hegels Logik", in Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie 32 (1985), 439-354. Grazia, V. de, Su la lógica di Hegel e sulla filosofía speculativa. Discorsi, Napoli 1850. Greene, M., "Hegel's Concept of Logical Life", in Art and Logic in Hegels Philosophy, hg. v. W.E. Steinkraus /K.I. Schmitz, New Jersey, Sussex 1980, 121-149. Griffiss, J. E., "The Kantian Background of Hegel's Logic", in The New Scholasticism 43 (1969), 509-529. Gross, R., "Quality, Quantity and Measure: the outline and explanation of the categories of the 'Logic' and their complementary structures in 'Capital'", in Studies in Soviet Thought 16 (1976). Günther, G., "Das Problem einer Formalisierung der transzendental-dialektischen Logik. Unter besonderer Berücksichtigung der Logik Hegels", in Heidelberger Hegel-Tage 1962, hg. v. H.-G. Gadamer, Bonn 1964 (Hegel-Studien, Beiheft 1), 65-123. Günther, G., Grundzüge einer neuen Theorie des Denkens in Hegels Logik, Leipzig 1933, Hamburg 21978. Guyer, P., "Hegel, Leibniz und der Widerspruch im Endlichen", in Seminar: Dialektik in der Philosophie Hegels, hg. v. R.-P. Horstmann, Frankfurt a.M. 1978,230-260. Guyer, P., "Dialektik als Methodologie: Antwort auf E. Albrecht", in Wissenschaft der Logik. Formation und Rekonstruktion, hg. v. D. Henrich, Stuttgart 1986, 164-177. Guzzoni, U., Werden zu sich. Eine Untersuchung zu Hegels "Wissenschaft der Logik", Freiburg, München 1963. Haag, K.H., Philosophischer Idealismus. Untersuchungen zur Hegelschen Dialektik mit Beispielen aus der Wissenschaft der Logik, Frankfurt a.M. 1967. Hackenesch, C, Die Logik der Andersheit. Eine Untersuchung zu Hegels Begriff der Reflexion, Frankfurt a.M. Graeser, A., "Bemerkungen
1987.
Hansen, F.-P., Ontologie und Geschichtsphilosophie in Hegels "Lehre
Harris, Harris, Harris, Harris,
vom Wesen" der "Wissenschaft der Logik", München 1991. E.E., An Interpretation of the Logic of Hegel, Lanham, New York, London 1983. E.E., Lire la logique de Hegel. Commentaire de la logique de Hegel, Lausanne 1987. E.E., Formal, transcendental and dialectical thinking. Logic and Reality, Albany N.Y. 1987. E.E., "Being-for-Self in the Greater Logic", in The Owl of Minerva 25 (1993/1994), 155-162.
321
Auswahlbibliographie Harris, W.T., Hegel's Logic.
A book
on
the
genesis of the categories of the mind.
A critical
exposition, Chicago
1890, Nachdruck New York 1970. Hartmann, K., "Hegel: A Non-Metaphysical View", in Hegel. A Collection of Critical Essays, hg. v. A.C. Maclntyre, New York 1972, 101-124. Hartmann, K., "Zur neuesten Dialektik-Kritik", in Archiv für Geschichte der Philosophie 55 (1973), 220-242. Hartnack, J., Hegels Logik. Eine Einführung, Frankfurt a.M. 1995. Heede, R., Die göttliche Idee und ihre Erscheinung in der Religion. Untersuchungen zum Verhältnis von Logik
und Religionsphilosophie bei Hegel, Diss. Münster 1972. G.W.F. Hegel. Critical Assessments, hg. v. R. Stem, London, New York 1993. Hegel in der Sicht der neueren Forschung, hg. v. I. Fetscher, Darmstadt 1973. Hegel Reconsidered. Beyond Metaphysics and the Authoritarian State, hg. v. H.T. Engelhardt/T. Pinkard, Dordrecht, Boston, London 1994. Hegels Logik der Philosophie. Religion und Philosophie in der Theorie des absoluten Geistes, hg. v. D. Henrich /R.-P. Horstmann, Stuttgart 1984. Hegels Transformation der Metaphysik, hg. v. D. Pätzold/A. Vanderjagd, Köln 1991. Hegels Wissenschaft der Logik. Formation und Rekonstruktion, hg. v. D. Henrich, Stuttgart 1986. Heiss, R., Logik des Widerspruchs. Eine Untersuchung zur Methode der Philosophie und zur Gültigkeit der formalen Logik, Berlin, Leipzig 1932. Heiss, R., Wesen und Formen der Dialektik, Köln, Berlin 1959. Henrich, D., "Anfang und Methode der Logik", in Heidelberger Hegel-Tage 1962, hg. v. H.-G. Gadamer, Bonn 1964 (Hegel-Studien, Beiheft 1), 19-35. Henrich, D., Hegel im Kontext, Frankfurt a.M. 1967, 21975. Henrich, D., "Formen der Negation in Hegels Logik", in Hegel-Jahrbuch 1974 (1975), 245-256 (wieder abgedruckt in Seminar: Dialektik in der Philosophie Hegels, hg. v. R.-P. Horstmann, Frankfurt a.M. 1978,
213-229). Henrich, D., "Hegels Logik der Reflexion. Neue Fassung", in Die Wissenschaft der Logik und die Logik der Reflexion. Hegel-Tage Chantilly 1971, hg. v. D. Henrich, Bonn 1978 (Hegel-Studien, Beiheft 18), 203-324.
Henrich, D., "Hegels Grundoperation. Eine Einleitung in Hegels Wissenschaft der Logik", in Der Idealismus und
seine Gegenwart. Festschrift für Werner Marx zum 65. Geburtstag, hg. v. U. Guzzoni/B. Rang/L. Siep, Hamburg 1979, 208-230. Henrich, D., "Absoluter Geist und Logik des Endlichen", in Hegel in Jena. Die Entwicklung des Systems und die Zusammenarbeit mit Schelling. Bonn 1980 (Hegel-Studien, Beiheft 20), 103-118. Henrich, D., "Andersheit und Absolutheit des Geistes. Sieben Schritte auf dem Wege von Schelling zu Hegel", in ders., Selbstverhältnisse. Gedanken und Auslegungen zu den Grundlagen der klassischen deutschen Philosophie, Stuttgart 1982, 142-172. Henrich, D., "Die Formationsbedingungen der Dialektik", in Revue Internationale de Philosophie 139/140
(1982), 139-162. Hermann, C, Hegel und die logische Frage der Philosophie in der Gegenwart, Leipzig 1878. Hibben, J.G., Hegel's Logic. An Essay in Interpretation, New York 1902. Hoffmann, Th.S., Die absolute Form. Modalität, Individualität und das Prinzip der Philosophie nach Kant und Hegel, Berhn, New York 1991. Hogemann, F./Jaeschke, W., "Die Wissenschaft der Logik", in Hegel.- Einführung in seine Philosophie, hg. v. O. Pöggeler, Freiburg, München 1977, 75-90 Hogemann, F., "L'idée absolue dans la Science de la Logique de Hegel", in Revue de l'Université d'Ottawa 52 (1982), 536-553. Hogemann, F., "Die 'Idee des Guten' in Hegels 'Wissenschaft der Logik'", in Hegel-Studien 29 (1994), 79-102. Holz, H.H., "Anfang, Identität und Widerspruch. Strukturen von Hegels 'Wissenschaft der Logik', gezeigt an dem Abschnitt 'Womit der Anfang der Wissenschaft gemacht werden muß', sowie der 'Logik des Seins'". in Tijdschrift voor Filosofie 36 (1974), 707-761. Holz, H.H., "Hegels Konzept der eigentlichen Metaphysik", in Hegels Transformation der Metaphysik, hg. v. D. Pätzold/A. Vanderjagd, Köln 1991, 28-42. Horn, J.Ch., Monade und Begriff. Der Weg von Leibniz zu Hegel, Wien 1965. -
322
Auswahlbibliographie Horstmann, R.-P., Ontologie und Relationen, Hegel, Bradley, Russell und die Kontroverse über interne und externe
Beziehungen,
Meisenheim a.G 1984.
Horstmann, R.-P., Wahrheit aus dem Begriff. Eine Einführung in Hegel, Frankfurt a.M. 1990. Houlgate, St., "Necessity and Contingency in Hegel's Science of Logic", in The Owl of Minerva 27 (1995/1996), 37^*9.
Hösle, V., Hegels System. Der Idealismus der Subjektivität und das Problem der Intersubjektivität, Bd. 1, Systementwicklung und Logik, Bd. 2, Philosophie der Natur und des Geistes, Hamburg 1987. Hubbeling, H.G., "Dialektische en klassieke lógica". in Hegel omstreden. Boedelscheiding na 150 jaar, hg. v. W.N.A. Klever, Bussum 1983, 102-112. Huson, T.C., "Der Satz des Widerspruchs bei Aristoteles und Hegel", in Hegel-Jahrbuch 1997 (1998), 239-244. Hyppolite, J., "Essai sur la logique de Hegel", in Revue Internationale de Philosophie 6 (1952), 35-49. Hyppolite, J., Logique et existence. Essai sur la logique de Hegel, Paris 1953. Iber, Chr., Metaphysik absoluter Relationalität. Eine Studie zu den beiden ersten Kapiteln von Hegels Wesenslogik, Berlin, New York 1990. Iber, Chr., Subjektivität, Vernunft und ihre Kritik. Prager Vorlesungen über den Deutschen Idealismus, Frankfurt -
a.M. 1999.
Ijiri, K., Aus der "Wissenschaft der Logik" von Hegel lernen. Kritik der Hegelschen Dialektik. Aus dem Japanischen übersetzt von Mitsuyoshi Ikeda, Tokio 1987. Ilchmann, A., "Zur Kritik der Übergänge. Zu den ersten Kategorien in Hegels Wissenschaft der Logik", in Hegel-Studien 27 (1992), 11-25. Illeterati, L., Figure del limite. Esperienze e forme della finitezza, Trento 1996. Dring, K.-H., "Ontologie, Metaphysik und Logik in Hegels Erörterung der Reflexionsbestimmungen", in Revue Internationale de Philosophie 36 (1982), 95-110. Inwood, M.J., Hegel, London 1983. Jaeschke, W., "Objektives Denken: Philosophiehistorische Erwägungen zur Konzeption und zur Aktualität der spekulativen Logik", in The Indépendant Journal of Philosophy 3 (1979), 23-36. Jaeschke, W., "Äußerliche Reflexion und immanente Reflexion. Eine Skizze der systematischen Geschichte des Reflexionsbegriffs in Hegels Logik-Entwürfen", in Hegel-Studien 13 (1980), 85-117. Jaeschke, W., "Absolute Idee absolute Subjektivität", in Zeitschrift für philosophische Forschung 35 (1981),
358-416. Janke, W., "Die Trauer des Endlichen. Anmerkungen zur Aufhebung der Endlichkeit in Hegels Seinslogik", in Philosophie der Endlichkeit. Festschrift für Erich Christian Schröder zum 65. Geburtstag, hg. v. B. Niemeyer/D. Schütze, Würzburg 1992, 83-100. Jarczyk, G, Système et liberté dans la logique de Hegel, Paris 1980. Jarczyk, G, "Sujet/objet dans la logique de l'essence de Hegel", in Aquinas. Rivista di Filosofía 24 (1981), 337-350. Jarczyk, G, "Une approche de la vérité logique chez Hegel", in Archives de Philosophie 44 (1981), 239-247. Jarzcyk, G./Labarrière, P.-J., "Le statut logique de l'altérité chez Hegel", in Philosophie 13 (1986), 68-81. Jiang, P., "Hegels Auffassung zur Basis der Entgegensetzung in den drei Stufen der Begriffsbewegung" [chinesisch], in Deutsche Philosophie, Beijing 1988, 134-142. Kant oder Hegel? Über Formen der Begründung in der Philosophie. Stuttgarter Hegel-Kongreß 1981, hg. v. D. Henrich, Stuttgart 1983. Kakkuri, M.-L., "Abstract and concrete: Hegel's Logic as logic of intentions", in Ajatus 39 (Helsinki 1983), 40-106. Kawamura, E., Hegels Ontologie der absoluten Idee, Hamburg 1973. Kedrov, B.M., "Die Hegeische 'Wissenschaft der Logik' und die Naturwissenschaft", in Vom Mute des Erkennens. Beiträge zur Philosophie G.W.F. Hegels, hg. v. M. Buhr/T.I. Oisermann, Frankfurt a.M. 1981, 164-182. Kemper, P., Dialektik und Darstellung. Eine Untersuchung zur spekulativen Methode in Hegels "Wissenschaft der Logik", Frankfurt a.M. 1980. Kesselring, Th., "Voraussetzungen und dialektische Struktur des Anfangs der Hegelschen Logik", in Zeitschrift für philosophische Forschung 35 (1981), 563-584. -
323
Auswahlbibliographie
Kesselring, Th., Die Produktivität der Antinomie. Hegels Dialektik im Lichte der genetischen Erkenntnistheorie und der formalen Logik, Frankfurt a.M. 1984. Kesselring, Th., "Rationale Rekonstruktion von Dialektik im Sinne Hegels", in Dialektischer Negativismus. Michael Theunissen zum 60. Geburtstag, hg. v. E. Angehrn/H. Fink-Eitel/Chr. Iber/G. Lohmann, Frankfurt
a.M. 1992,273-303. A. v., Die Erhebung zum Unendlichen. Eine Untersuchung zu den spekulativ-logischen Voraussetzungen der Hegelschen Religionsphilosophie, Frankfurt a.M. 1995. Kimmerle, H., "Die allgemeine Struktur der dialektischen Methode", in Zeitschrift für philosophische Forschung 33 (1979), 184-209. Kimmerle, H., "Hegels 'Wissenschaft der Logik' als Grundlegung seines Systems der Philosophie. Über das Verhältnis von Logik und Realphilosophie", in Die Logik des Wissens und das Problem der Erziehung. Nürnberger Hegel-Tage 1981, hg. v. W.R. Beyer, Hamburg 1982, 52-60. Klauke, A., "Hegels Lagrange-Rezeption", in Konzepte des mathematisch Unendlichen im 19. Jahrhundert, hg. v. G. König, Göttingen 1990. Klaus, G., "Hegel und die Dialektik in der formalen Logik", in Deutsche Zeitschrift für Philosophie 11 (1963), 1489-1503. Klever, W.N.A., "De lógica op het spei", in Hegel omstreden. Boedelscheiding na 150 jaar, hg. v. W.N.A. Klever, Bussum 1983, 113-123. Koch, T., Differenz und Versöhnung. Eine Interpretation G.W.F. Hegels nach seiner "Wissenschaft der Logik", Gütersloh 1967. Konzepte der Dialektik, hg. v. W. Becker/W.K. Essler, Frankfurt a.M. 1981. Kosok, M., "The Formalization of Hegel's Dialectical Logic", in International Philosophical Quarterly 6 (1966), 596-631. Kosok, M., "The Dynamics of Hegelian Dialectics, and Non-Linearity in the Sciences", in Hegel and the Sciences, hg. v. R.S. Cohen/M.W. Wartofsky, Dordrecht, Boston, Lancaster 1984, 311-347. Krahl, H.-J., "Bemerkungen zum Verhältnis von Kapital und Hegelscher Wesenslogik", in Aktualität und Folgen der Philosophie Hegels, hg. v. O. Negt, Frankfurt a.M. 1970,21971, 141-154. Krohn, W., Die formale Logik in Hegels "Wissenschaft der Logik". Untersuchungen zur Schlußlehre, München 1972. Kruck, G./Schick, F., "Identität im prädikativen Urteil? Überlegungen zu einem alten Streit am Fall des 'positiven Urteils' in Hegels 'Wissenschaft der Logik'", in Jahrbuch fir Philosophie 1996, 175-196. Kulenkampff, A., Antinomie und Dialektik. Zur Funktion des Widerspruchs in der Philosophie, Stuttgart 1970. Labarrière, P.-J., "Histoire et liberté. Les structures intemporelles du procèc de l'essence", in Archives de philosophie 33(1970), 719-7'54. Labarrière, P.-J., "L'idéalisme absolu de Hegel: de la logique comme métaphysique", in Aquinas 24 (1981), 406-434. Labarrière, P.-J., "Die Hegeische 'Wissenschaft der Logik' in und aus sich selbst: Strukturen und reflexive Bewegung", in Wissenschaft der Logik Formation und Rekonstruktion, hg. v. D. Henrich, Stuttgart 1986, 94-106. Lakebrink, B., Die Europäische Idee der Freiheit. Teil 1. Hegels Logik und die Tradition der Selbstbestimmung, Leiden 1968. Lakebrink, B., Kommentar zu Hegels "Logik" in seiner "Enzyklopädie" von 1830, Bd. 1, Sein und Wesen, Freiburg, München 1979; Bd. 2, Begriff, Freiburg, München 1985. Landucci, S., "Opposizione e contraddizione nella lógica di Hegel", in Verifiche 10 (1981), 89-105. Lasalle, F.: Die Hegeische und die Rosenkranzische Logik und die Grundlage der Hegelschen Geschichtsphilosophie im Hegelschen Systeme. Vortrag vom 29. Januar 1859, Leipzig 1927,21928. Lécrivain, A. u. a.. Introduction à la lecture de la "Science de la logique" de Hegel, Bd. 1, L'être, Paris 1981; Bd. 2, La doctrine de l'essence, Paris 1983; Bd. 3, La doctrine du concept, Paris 1987. Lefebvre, H., Logique formelle et logique dialectique, Paris 1947. Leonard, A., Commentaire littéral de la logique de Hegel, Paris, Louvain 1974. Ley, H., "Zur Rekonstruktion der Hegelschen Logik", in Wissenschaft der Logik.Formation und Rekonstruktion. hg. v. D. Henrich, Stuttgart 1986, 77-93 (zuerst in Vom Mute des Erkennens. Beiträge zur Philosophie G.W.F. Hegels, hg. v. M. Buhr/T.I. Oisermann, Frankfurt a.M. 1981. 23^15).
Keyserlingk,
324
Auswahlbibliographie Li, W., "Hegels Aufnahme und Fortsetzung der logischen und kategorialen Dialektik Kants" [chinesisch], in Presse der Guanxi Universität 3, Nanning 1988, 1-5. Liebrucks, B., Sprache und Bewußtsein. Sprachliche Genesis der Logik, logische Genesis der Sprache. Band 6, Teil 1-3, Frankfurt a.M., Bern 1974. Livet, P., "Réflexivités et extériorité dans la Logique de Hegel", in Archives de Philosophie Al (1984), 291-318. Lógica e storia in Hegel, hg. v. R. Racinaro/V. Vitiello, Napoli 1985.
Logik und Geschichte in Hegels System, hg. v. H.-Chr. Lucas/G. Planty-Bonjour, Stuttgart-Bad Cannstatt 1989. Die Logik des Wissens und das Problem der Erziehung. Nürnberger Hegel-Tage 1981, hg. v. W.R. Beyer, Hamburg 1982. Longuenesse, B., "Actuality in Hegel's Logic", in Graduate Philosophy Journal 13 (1988), 115-124. Longuenesse, B., Hegel et la critique de la métaphysique. Etudes sur la doctrine de l'essence, Paris 1981. Longuenesse, B., "L'effectivité dans la Logique de Hegel", in Revue de Métaphysique et de Morale 87 (1982), 495-503.
Lorenzen, P., "Das Problem einer Formalisierung der Hegelschen Logik. Korreferat zu einem Vortrag von Gotthard Günther", in Heidelberger Hegel-Tage 1962, hg. v. H.-G. Gadamer, Bonn 1964 (Hegel-Studien, Beiheft
1), 125-130.
Lotz, J. B., "Warum wird die Metaphysik im Denken Hegels zur Logik?" in Aquinas 24 (1981), 435-488. Lucas, H.-Chr., Wirklichkeit und Methode in der Philosophie Hegels, Diss. Köln 1974. Lucas, H.-Chr., Spinoza in Hegels Logik, Leiden 1982 (Mededelingen vanwege het Spinozahuis 45). Lugarini, L., "Lógica hegeliana e problema deU'intero", in // Pensiero 16 (1971), 154-170. Lugarini, L„ "Philosophie et mouvement réfléchissant dans la logique hégélienne", in Logik der Philosophie. Religion und Philosophie in der Theorie des absoluten Geistes, hg. v. D. Henrich/R.-P. Horstmann, Stuttgart 1984, 42-62. Majetschak, S., Die Logik des Absoluten, Berlin 1992. Maluschke, G., Kritik und absolute Methode in Hegels Dialektik, Bonn 1974 (Hegel-Studien, Beiheft 13). Manninen, J., "The Analytic and the Synthetic in Hegel's Logic", in Konzepte der Dialektik, hg. v. W. Becker /W.K. Essler, Frankfurt a.M. 1981, 171-178. Manninen, J., "Die Leibnizsche Monadologie in Hegels Wissenschaft der Logik", in V. Internationaler LeibnizKongreß (Vorträge): Leibniz. Tradition und Aktualität, Hannover 1988, 519-524. Marconi, D., "Logique et dialectique. Sur la justification de certains argumentations hégéliennes", in La revue
philosophique de Louvain 81 (1983), 569-579. Marx, Werner, "Die Logik des Freiheitsbegriffs", in Hegel-Studien 11 (1976), 125-148. Marx, Wolfgang, "Spekulative Wissenschaft und geschichtliche Kontinuität. Überlegungen zum Anfang der Hegelschen Logik", in Kant-Studien 58 (1967), 63-74. Marx, Wolfgang, Hegels Theorie logischer Vermittlung. Kritik der dialektischen Begriffskonstruktion in der "Wissenschaft der Logik", Stuttgart-Bad Cannstatt 1972.
Masci, F., "Le catégorie del finito e deU'infinito. Studio sulla scienza della lógica di G.W.F. Hegel", in Rivista Bolognese 3 (1869), 559-576. Massolo, A., Lógica hegeliana e filosofía contemporánea, Firenze 1967. Maurer, R., "Der Begriff unendlicher Progress", in Hegel-Jahrbuch 1971, 189-196. McGilvary, E.B., "The presupposition question in Hegel's logic", in Philosophical Review 6 (1897), 497-520. McTaggart, J.E., A Commentary on Hegel's Logic, Cambridge 1910, Reprint New York 1964. Menegoni, F., "La recezione della Critica del guidizio nella lógica hegeliana: finalità externa e interna", in Verifiche 18 (1989), 443-458. Menke, Chr., "Der 'Wendungspunkt' des Erkennens. Zu Begriff, Recht und Reichweite der Dialektik in Hegels Logik", in Vernunftkritik nach Hegel. Analytisch-kritische Interpretationen zur Dialektik, hg. v. C. Demmerling/F. Kambartel, Frankfurt a.M. 1992, 9-66. Merker, N., Le origini della lógica hegeliana (Hegel a lena), Milano 1961. Merker, N., "Fragen zur Entstehung der Hegelschen Logik", in Hegel in der Sicht der neueren Forschung, hg. v. I. Fetscher, Darmstadt 1973, 277-287. Meyer, R.W., "Zur Axiomatik von Hegels Logik", in Hegel-Jahrbuch 1979 (1980), 13-21. Michelet, K.L., Das System der Philosophie als exacter Wissenschaft enthaltend Logik, Naturphilosophie und Geistesphilosophie, Bde., Berlin 1876-81.
325
Auswahlbibliographie Moloud, N., "Logique de l'essence et logique de l'entendement chez Hegel", in Revue de Métaphysique et de Morale 66 (1961), 159-183. Moretto, A„ Hegel e la "matemática dell'infinito", Trient 1984. Moría, G., "Finito e infinito e l'idealismos della filosofía. La Lógica hegeliana dell' essere determinato", in Revista di Filosofia neo-scolastica 86 (1994), 110-133; 323-357. Morresi, R., "Du sens de la contradiction. Logique de l'essence et esprit objectif. (Philosophie et violence)", in Hegel-Jahrbuch 1979 (1980). 409-415. Motroschilowa, N.W., "Die Dialektik des Systemprinzips und das Systemprinzip der Dialektik in der Hegelschen 'Wissenschaft der Logik'", in Wissenschaft der Logik. Formation und Rekonstruktion, hg. v. D. Henrich, Stuttgart 1986, 39-64. Mure, G. R. G., A study of Hegel's logic, Oxford 1950,31967. Narskij, I.S., "Die Kategorie des Widerspruchs in Hegels 'Wissenschaft der Logik'", in Wissenschaft der Logik. Formation und Rekonstruktion, hg. v. D. Henrich, Stuttgart 1986, 178-197. Neuser, W., "Der Begriffdes Seins bei Hegel und Heidegger", in Prima Philosophia A (1991), 439-455. Nikolaus, W., Begriff und absolute Methode. Zur Methodologie in Hegels Denken, Bonn 1985. Noël, H„ La logique de Hegel, Paris 1897,21967. Nuzzo, A., Lógica e Sistema sull' Idea Hegeliana di Filosofia, Genova 1992. O'Farrell, F., "Aristotle's, Kant's and Hegel's Logic", in Gregorianum 54 (1973), 477-515 u. 655-677. Ohashi, R., Zeitlichkeitsanalyse der Hegelschen Logik. Zur Idee einer Phänomenologie des Ortes, Freiburg, München 1984.
Opiela, S., Le Réel dans la logique de Hegel. Développement et Auto-Détermination, Paris 1983. Ottmann, H., "Hegels Logik als Dialektik von Freiheit und Herrschaft", in Hegel-Jahrbuch 1979 (1980), 315-323.
Paterson, A.C.T., "Self-reference and the natural numbers
as the logic of Dasein", in Hegel-Studien 32 (1997), 93-121 Pechmann, A. v., Die Kategorie des Maßes in Hegels "Wissenschaft der Logik". Einführung und Kommentar, Köln 1980. Perez Quintana, A., "Posibilidad según condiciones y necesidad en la Lógica de Hegel", in Anales del Seminario de Metafísica 16 (Madrid 1981), 119-136. Pinkard, T., "Hegel's Philosophy of Mathematics", in Philosophy and Phenomenological Research 41 (1980/81), 452-464 Pinkard, T., "The Logic of Hegel's Logic", in Journal of the History of Philosophy 17 (1979), 417^435. Pippin, R„ Hegels Idealism. The Satisfaction of Self-Consciousness, Cambridge 1989. Pöggeler, O., "Phénoménologie et logique selon Hegel", in Métaphysique et phénoménologie, hg. v. J.-L. Marion /G. Planty-Bonjour, Paris 1984, 17-36. Polizzi, P., "La determinazione come concetto e come storia nella lógica hegeliana", in Theorein 5 (1968), 26-71. Das Problem der Dialektik, hg. v. D. Wandschneider, Bonn 1997 (Studien zum System der Philosophie 3). Puntel, L.B., Darstellung und Struktur. Untersuchung zur Einheit der systematischen Philosophie G.W.F. Hegels, Bonn 1973. Puntel, L.B., "Hegels 'Wissenschaft der Logik'. Eine systematische Semantik?" in Ist systematische Philosophie möglich? Stuttgarter Hegel-Kongress 1975, hg. v. D. Henrich, Red. K. Cramer, Bonn 1977 (Hegel-Studien, Beiheft 17), 611-621. Puntel, L.B., "Hegel heute. Zur 'Wissenschaft der Logik'", in Philosophisches Jahrbuch. 82 (1975), 132-162 und 85(1978), 127-143. Puntel, L.B., "Was ist 'logisch'? in Hegels 'Wissenschaft der Logik'?" in Die Logik des Wissens und das Problem der Erziehung. Nürnberger Hegel-Tage 1981, hg. v. W.R. Beyer, Hamburg 1982, 40-51. Radermacher, H., "Zum Problem des Begriffs 'Voraussetzung' in Hegels Logik", in Hegel-Tage Urbino 1965, hg. v. H.-G. Gadamer, Bonn 1969 (Hegel-Studien, Beiheft 4), 115-128. Rademaker, H., Hegels "Objektive Logik". Eine Einführung, Bonn 1969. Erweiterte 2. Ausg.: Hegels "Wissenschaft der Logik". Eine darstellende und erläuternde Einführung, Wiesbaden 1979. Reale, M., "Lógica e ontognoseologia", in Revista Brasileira de Filosofia 20 (1970), 363-372. Redlich, A., Die Hegeische Logik als Selbsterfassung der Persönlichkeit, Meisenheim a.G. 1971. -
-
326
Auswahlbibliographie Rehm, M., Hegels spekulative Deutung der Infinitesimal-Rechnung, Diss. Köln 1963. Richli, U„ "Neuere Literatur zu Hegels Wissenschaft der Logik", in Philosophische Rundschau 18 (1971), 206-241.
Richli, U., "Das Problem der Selbstkonstitution des Denkens in Hegels 'Wissenschaft der Logik'", in Philosophisches Jahrbuch 81 (1974), 284-297. Richli, U., "Wesen und Existenz in Hegels 'Wissenschaft der Logik'", in Zeitschriftfür philosophische Forschung 28(1974),214-227. Richli, U„ Form und Inhalt in G.W.F. Hegels "Wissenschaft der Logik", Wien, München 1982. Richter, L.G., "Das Einleitungsproblem in Hegels Wissenschaft der Logik", in Perspektiven der Philosophie 17, Amsterdam, Atlanta 1991, 161-178. Rickert, H., Das Eins, die Einheit und die Eins. Bemerkungen zur Logik des Zahlbegriffs, Tübingen 1924. Rinaldi, G., "Le prime catégorie della lógica hegeliana e il problema dell origine della dialettica", in Annali della Facoltà di Lettere e Filosofía, Université di Napoli 20 (1977/78), 305-336. Rockmore, T., "Hegel's Metaphysics, or the Categorial Approach to Knowledge of Experience", in Hegel Reconsidered. Beyond Metaphysics and the Authoritarian State, hg. v. H.T. Engelhardt/T. Pinkard, Dordrecht, Boston, London 1994, 43-56. Rodriguez, S., "Das Problem der kategorialen Struktur in Hegels Wissenschaft der Logik" [Russisch], in FilosofskieNauki 2 (Moskva 1983), 118-127. Rohs, P., Form und Grund. Interpretation eines Kapitels der Hegelschen Wissenschaft der Logik, Bonn 1969 (Hegel-Studien, Beiheft 6.), 2., durchgesehene Aufl. 1972. Rohs, P., "Das Problem der vermittelten Unmittelbarkeit in der Hegelschen Logik", in Philosophisches Jahrbuch 81 (1974), 371-380. Römpp, G, "Sein als Genesis von Bedeutung. Ein Versuch über die Entwicklung des Anfangs in Hegels 'Wissenschaft der Logik'", in Zeitschriftßr philosophische
Forschung 43 (1989), 58-80.
Rosen, M., Hegel's Dialectic and its Criticism, Cambridge, London, New York, New Rochelle, Melbourne, Sydney 1992.
Rosen, M., "From Vorstellungen to Thought: is a 'Non-metaphysical' View of Hegel Possible?", in Hegel. Critical Assessments, hg. v. R. Steme, Bd. 3, London, New York 1993, 329-344. Rosenkranz, K., Die Modificationen der Logik, abgeleitet aus dem Begriff des Denkens, Leipzig 1846. Rosenkranz, K., Wissenschaft der logischen Idee, 2 Teile, Königsberg 1858-59. Rotta, P., "Interno alia lógica di Hegel", in Rivista di filosofía neo-scolastica 2 (1910), 679-682. Röttges, H., Der Begriff der Methode in der Philosophie Hegels, Meisenheim a. G. 1976. Rowe, W.V., "Essence, Ground, and First Philosophy in Hegel's 'Science of Logic'", in The Owl of Minerva 18
(1986), 43-56.
Ruben, P., "Von der 'Wissenschaft der Logik' und dem Verhältnis der Dialektik zur Logik", in Zum Hegel-Verständnis unserer Zeit, hg. v. H. Ley, Berlin 1972, 58-99. Ruben, P., "Substanz und Subjekt. Über Voraussetzungen einer Rekonstruktion der 'Wissenschaft der Logik'", in Wissenschaft der Logik. Formation und Rekonstruktion, hg. v. D. Henrich, Stuttgart 1986, 129-138. Rubinstein, M., Die logischen Grundlagen des Hegelschen Systems und das Ende der Geschichte, Halle 1906. Ruschig, U., Hegels Logik und die Chemie. Fortlaufender Kommentar zum "realen Maß" (Hegel-Studien, Beiheft 37), Bonn 1997. Saintillan, D., "Hegel et Heraclite ou le 'Logos' qui n'a pas de contraire", in Hegel et la pensée grecque, hg. v. J. D'Hondt, Paris 1974, 27-84. Salomon, W.: Urteil und Selbstverhältnis. Kommentierende Untersuchung zur Lehre vom Urteil in Hegels "Wissenschaft der Logik", Frankfurt a.M. 1982 Sarlemijn, A., Hegeische Dialektik, Berlin, New York 1971. Sarlemijn, A., "Dialektik, moderne Logik, moderne Systemideologie", in Hegel-Jahrbuch 1973, 127-161. Schaefer, A., "Begriff der Grenze und Grenzbegriff in Hegels Logik", in Zeitschrift für philosophische Forschung 27 (1973), 77-86. Schaefer, A., "Setzen und Voraussetzen in der Wesenslogik Hegels", in Zeitschrift für philosophische Forschung 29(1975),572-583. Schaefer, A., Der Nihilismus in Hegels Logik. Kommentar und Kritik zu Hegels "Wissenschaft der Logik", Berlin 1992.
327
Auswahlbibliographie Schick, F., Hegels Wissenschaft der Logik
metaphysische Letztbegründung oder Theorie logischer Formen?, Freiburg, München 1994. Schmid, A., Entwicklungsgeschichte der Hegel'sehen Logik, Regensburg 1858. Schmidt, F., "Hegels formale Logik", in Deutsche Zeitschriftfür Philosophie 11 (1963), 415-421. Schmidt, K.J., "Formale Logik und Dialektik in Hegels Seinslogik", in Denken unterwegs. Philosophie im Kräftefeld sozialen und politischen Engagements. Festschrift für Heinz Kimmerle zu seinem 60. Geburtstag, hg. v. H. Oosterling/F. de Jong, Amsterdam 1990, 127-143. Schmidt, K.J., G.W.F. Hegel: "Wissenschaft der Logik Die Lehre vom Wesen", Paderborn, München, Wien, -
Zürich 1997. Schmidt, K.J., "Zum Unterschied zwischen wesenslogischer und seinslogischer Dialektik", in Das Problem der Dialektik, hg. v. D. Wandschneider, Bonn 1997, 32-51. Schmidt, J., Hegels Wissenschaft der Logik und ihre Kritik durch Adolf Trendelenburg, München 1977. Schmitz, H„ Hegels Logik, Bonn, Berlin 1992. Schnädelbach, H., "Zum Verhältnis von Logik und Gesellschaftstheorie bei Hegel", in Aktualität und Folgen der Philosophie Hegels, hg. v. O. Negt, Frankfurt a.M. 1970, 58-80. Schnädelbach, H„ Hegel zur Einführung, Hamburg 1999. Schneider, H., "Zur zweiten Auflage von Hegels Logik", in Hegel-Studien 6 (1971), 9-38. Schrader-Klebert, K., Das Problem des Anfangs in Hegels Philosophie, Wien, München 1969. Schubert, A., Der Strukturgedanke in Hegels "Wissenschaft der Logik", Meisenheim u. Königstein/Ts. 1985. Schulz, R.-E., Interpretation zu Hegels Logik, Diss. Heidelberg 1954. Schulz, R.-E., "'Sein' in Hegels Logik: 'Einfache Beziehung auf sich'", in Wirklichkeit und Reflexion. W. Schulz zum 60 Geburtstag, hg. v. H. Fahrenbach, Pfullingen 1973, 365-383. Schwarz, J., "Die Denkform der Hegelschen Logik", in Kant-Studien 50 (1958/59), 37-76. Seebohm, T.M., "The Grammar of Hegel's Dialectic", in Hegel-Studien 11 (1976), 149-180. Seminar: Dialektik in der Philosophie Hegels, hg. v. R.-P. Horstmann, Frankfurt a.M. 1978. Shikaya, T. "Die Wandlung des Seinsbegriffs in Hegels Logik-Konzeption", in Hegel-Studien 13 (1978), 119-173. Sichirollo, L., Lógica e dialettica. Interpretazione e saggi, Milano 1957. Soll, I., "Comments on Kosok's Interpretation of Hegel's Logic", in Hegel and the Sciences, hg. v. R.S. Cohen /M.W. Watofsky, Dordrecht, Boston, Lancaster 1984, 361-364. Souche-Dagues, D., Logique et politique Hégéliennes, Paris 1983. Spaventa, B., "Le prime catégorie della lógica di Hegel", in Atti della Reale Accademia di Scienze, Morali e Politiche di Napoli 1 (1864), 123-185. Stenglin, J. v., Denken und Wirklichkeit. Eine sprachlich und kognitiv fundierte Theorie der Erkenntnis, Würzburg 1990. Stekeler-Weithofer, P., Hegels Analytische Philosophie. Die Wissenschaft der Logik als kritische Theorie der Bedeutung, Paderborn, München, Wien, Zürich 1992. Stekeler-Weithofer, P., "Zu Hegels Philosophie der Mathematik", in Vernunftkritik nach Hegel. Analytisch-kritische Interpretationen zur Dialektik Hegels, hg. v. Chr. Demmerling/F. Kambartel, Frankfurt a.M. 1992, 139-197. Stekeler-Weithofer, P., "Vernunft und Wirklichkeit. Zu Hegels Analyse reflektierender Urteile", in Deutsche Zeitschriftfür Philosophie AA (1996), 187-208. Strukturen der Dialektik, hg. v. H.H. Holz, Hamburg 1992. Studien zur Logik, hg. v. G. Tamäs, Budapest 1983. Tanabe, H., "Zu Hegels Lehre vom Urteil". Übers, von K. Tsujimura und H. Buchner, in Hegel-Studien 6 (1971), 211-229. Taylor, Ch., Hegel, Frankfurt a.M. 1983. Theunissen, M., "Krise und Macht. Thesen zur Theorie des dialektischen Widerspruchs", in Hegel-Jahrbuch -
7974(1975X318-329. Theunissen, M., "Begriff und Realität. Hegels Aufhebung des metaphysischen Wahrheitsbegriffs", in Denken im Schatten des Nihilismus, hg. v. A. Schwan, Darmstadt 1975, 164-195 (wieder abgedruckt in Seminar: Dialektik in der Philosophie Hegels, hg. v. R.-P. Horstmann, Frankfurt a.M. 1978, 324-359). Theunissen, M., Sein und Schein. Die kritische Funktion der Hegelschen Logik, Frankfurt a.M. 1978.
328
Auswahlbibliographie Theunissen, M., "Hegels Logik als Metaphysikkritik", in Richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Festschriftfür Helmut Gollwitzer, hg. v. A.Baudis u.a., München 1979, 260-277. Tomovic, S., "Hegel's view of Logic as a science of the contradiction of notion", in Hegel-Jahrbuch 1979 (1980), 399^t08. Topp, C, Philosophie als Wissenschaft. Status und Makrologik wissenschaftlichen Philosophierens bei Hegel, Berlin, New York 1982.
Trendelenburg, A., Die logische Frage in Hegels System, Leipzig 1843. Trendelenburg, A., Logische Untersuchungen, 2 Bde, Leipzig 31870. Tugendhat, E., "Das Sein und das Nichts", in Durchblicke. Martin Heidegger zum 80. Geburtstag, Frankfurt a.M. 1970, 132-161.
Tuschling, B., "Necessarium est idem simul esse et non esse. Zu Hegels Revision der Grundlagen von Logik und Metaphysik", in Logik und Geschichte in Hegels System, hg. v. H.-Chr. Lucas/G. Planty-Bonjour, Stuttgart-Bad Cannstatt 1989, 199-226. Tuschling, B., "Sind die Urteile der Logik vielleicht insgesamt synthetisch?" in Kant-Studien 72 (1981), 304-335. Ungler, F., "Die Kategorie Widerspruch", in Aufhebung der Transzendentalphilosophie? hg. v. T.S. Hoffmann/F. Ungler, Würzburg 1994, 217-234. Vanni Rovighi, S., La "Sciencia della Lógica" di Hegel i appunti introduttivi. Milano 1974. Vasa, A., "La dialettica della quantité e della misura nella lógica di Hegel", in Giornale della Filosofía Italiana 35(1956),42-78. Velarde, J., "La lógica dialéctica", in Teorema 1 (Valencia 1977), 129-140. Vera, A., Introduction to speculative Logic and Philosophy, St. Louis 1873. Vernunftkritik nach Hegel. Analytisch-kritische Interpretationen zur Dialektik, hg. v. C. Demmerling/F. Kambartel, Frankfurt a.M. 1992. Verra, V., "Idee nel sistema hegeliana", in Idea. Atti a cura di M. Fattori e M. L. Bianchi, Roma 1989, 393-410. Verra, V., '"Eins und Vieles' nel pensiero di Hegel", in L'Uno e i molti. A cura di Virgilio Melchiorre, Milano 1990, 405^119. Virasoro, M. A., La lógica de Hegel, Buenos Aires 1932. Vitiello, V., "Sull'essenza nella Lógica hegeliana", in II Pensiero 22 (1981), 165-177. Vitiello, V., "Möglichkeit und Wirklichkeit in der Kantischen und Hegelschen Logik", in Kant oder Hegel? Über Formen der Begründung in der Philosophie. Stuttgarter Hegel-Kongreß 1981, hg. v. D. Henrich, Stuttgart 1983, 250-266. Volkmann-Schluck, K.-H., "Die Entäußerung der Idee zur Natur", in Heidelberger Hegel-Tage 1962, hg. v. H.-G. Gadamer, Bonn 1964 (Hegel-Studien, Beiheft 1), 37-44. Wagner, F., "Theo-Logik. Ein Beitrag zur theologischen Interpretation von Hegels 'Wissenschaft der Logik'", in
Religionsphilosophie und spekulative Theologie. Der Streit um die göttlichen Dinge (1799-1812), hg. v. W. Jaeschke, Hamburg 1994, 195-220. Wagner, L., Die Untersuchungen über das Verhältnis der Dialektik Hegels zu den Grundgesetzen der formalen Logik, Diss. Freiburg 1924. Wahl, J., "Une interprétation de la logique de Hegel", in Critique 79 (1953), 1050-1071. Wahl, J., La logique comme phénoménologie, Paris 1959. Wahl, J., La Logique de Hegel comme Phénoménologie (Cours de Sorbonne), Paris 1965. Wallace, W., Prolegomena to the Study of Hegel's Philosophy and especially of his Logic, Oxford 1874, 21894, Reprint New York 1968. Wandschneider, D., "Analyse und Synthese bei Hegel", in Konzepte der Dialektik, hg. v. W. Becker/W.K. Ess-
ler, Frankfurt a.M. 1981, 178-181, Wandschneider, D./Hösle, V., "Die Entäußerung der Idee zur Natur und ihre zeitliche Entfaltung als Geist", in Hegel-Studien 18 (1983), 173-199. Wandschneider, D., "Dialektik als antinomische Logik", in Hegel-Jahrbuch 1991, 227-242. Wandschneider, D., Grundzüge einer Theorie der Dialektik. Rekonstruktion und Revision dialektischer Kategorienentwicklung in Hegels 'Wissenschaft der Logik', Stuttgart-Bad Cannstatt 1996. Weersma, H. A., "Der logische Kern von Hegels dialektische Methode", in Annalen der critischen Philosophie 1 (1937), 69-80. Werder, K, Logik. Als Commentar und Ergänzung zu Hegels "Wissenschaft der Logik", Berlin 1841.
329
Auswahlbibliographie Werner, J., Darstellung als Kritik. Hegels Frage nach dem Anfang der Wissenschaft, Bonn 1986. Wetzel, M., Reflexion und Bestimmtheit in Hegels "Wissenschaft der Logik", Hamburg 1971. Wiehl, R„ "Piatos Ontologie in Hegels Logik des Seins", in Hegel-Studien 3 (1965), 157-180. Wieland, W., "Bemerkungen zum Anfang von Hegels Logik", in Wirklichkeit und Reflexion. Walter Schulz zum 60. Geburtstag, hg. v. H. Fahrenbach, Pfullingen 1973, 395-414 (wieder abgedruckt in Seminar: Dialektik in der Philosophie Hegels, hg. v. R.-P. Horstmann, Frankfurt a.M. 1978, 194-212). Winfield, R.D., "The Method of Hegel's Science of Logic", in Essays on Hegel's Logic, hg. v. G. Di Giovanni, Albany 1990,45-57. Die Wissenschaft der Logik und die Logik der Reflexion. Hegel-Tage Chantilly 1971, hg. v. D. Henrich, Bonn 1978 (Hegel-Studien, Beiheft 18). Wohlfahrt, G., Der spekulative Satz. Bemerkungen
zum Begriff der Spekulation bei Hegel, Berlin, New York 1981. Wohlfahrt, G., "Das unendliche Urteil. Zur Interpretation eines Kapitels aus Hegels 'Wissenschaft der Logik'", in Zeitschriftfür philosophische Forschung 39 (1985), 85-100. Wolff, M., "Über das Verhältnis zwischen logischem und dialektischem Widerspruch", in Hegel-Jahrbuch 1979 (1980), 340-348. Wolff, M., Der Begriff des Widerspruchs. Eine Studie zur Dialektik Kants und Hegels, Königstein/Ts. 1981. Wolff, M., "Über Hegels Lehre vom Widerspruch", in Hegels Wissenschaft der Logik. Formation und Rekonstruktion, hg. v. D. Henrich, Stuttgart 1986, 107-128. Wolff, M., "Hegel und Cauchy. Eine Untersuchung zur Philosophie und Geschichte der Mathematik", in Hegels Philosophie der Natur, hg. v. R.-P. Horstmann/M.J.Petry, Stuttgart 1986, 197-263. Wolff, M., "Die Momente des Logischen und der Anfang der Logik in Hegels philosophischer Wissenschaft", in Skeptizismus und spekulatives Denken in der Philosophie Hegels, hg. v. H.-F. Fulda/R.-P. Horstmann, Stuttgart 1996, 226-243. Wölfle, G.M., Die Wesenslogik in Hegels "Wissenschaft der Logik", Stuttgart-Bad Cannstatt 1994. Wundt, M., Hegels Logik und die moderne Physik, Köln, Opladen 1949. Yamane, T., Wirklichkeit. Interpretation eines Kapitels aus Hegels "Wissenschaft der Logik", Frankfurt a.M., Bern, New York 1983. Yang, Z., "Die Subjektivität in Hegels Logik" [chinesisch], in Philosophie-Studien 7, Bejing 1988, 24-33. Zeleny, J., "Parakonsistenz und dialektisches Widerspruchsdenken", in Strukturen der Dialektik, hg. v. H.H. Holz, Hamburg 1992, 57-73. Zhou, L., "Der Formalismus in der dialektischen Logik Hegels" [chinesisch], in Philosophie Studien 3, Beijing
1988,47-51. Zimmerli, W.C., "Aus der Logik lernen? Zur Entwicklungsgeschichte der Hegelschen Logik-Konzeptionen", in Die Logik des Wissens und das Problem der Erziehung. Nürnberger Hegel-Tage 1981, hg. v. W.R. Beyer, Hamburg 1982, 66-79. Zimmerli, W.C., "Die Wahrheit des 'impliziten Denkers'. Zur Logikbegründungsproblematik in Hegels 'Wissenschaft der Logik'", in Studia
Philosophica AI (1982), 139-160. Logic? Analytical Criticism of Hegel's Logic in Recent German PhilosoCritics. Philosophy in the Aftermath of Hegel, hg. v. W. Desmond, New York
Zimmerli, W.C.: "Is Hegel's Logic
phy",
in
Hegel and his
1989, 101-203.
330
a
Personenregister
Das Personenregister erfaßt alle Namen historischer Personen, mit Ausnahme Hegels sowie der in Buch- bzw. Aufsatztiteln erwähnten Namen und den Herausgebernamen in Literaturangaben. Aus Personennamen abgeleitete Bezeichnungen wie "Cartesisch", "Spinozistisch" etc. werden der jeweiligen Person (Descartes, Spinoza)
zugeordnet. Adorno, Th.W. 124, 172 Alexander der Große 218-221,223 Althusser, L. 171 Anaxagoras 15 Anselm von Canterbury 78 Aristoteles 14, 15, 22, 39, 63, 110, 119f, 123f, 144f, 156, 187f, 203f, 218, 223, 245, 261, 274, 294 Arnauld, A. 218, 220f Arndt, A. 94, 115, 189 Aubenque, P. 110, 124 Augustinus 78
Damerow, P. 50 Dedekind, R. 296 Deleuze, G. 121f Demokrit 255f, 258f Derrida, J. 172, 186f, 197-201, 206 Descartes 29, 51, 64, 70, 77f, 80-82, 86, 218, 254 Dirksen, E.H. 273,283
Düsing, K. 159 Duns Scotus, J. 122
Eddington, A.
299
Einstein, A. 299 Bardili.C.G. 83 Baum, M. 93, 102, 187, 190 Beider, E. 189
Empedokles 150 Engels, F. 194f, 301 Epikur 256
Benjamin, W. 189 Berkeley, G. 69f, 72, 283
Erdmann, J.E. 54
Bernoulli, J. 282 Bernoulli, N. 282 Berthollet, CL. 52 Böhme, J. 163, 176 Bonsiepen, W. 56,272, 274,299 Borzeszkowski, H.-H. v. 272, 276, 284-286, 293297,300
Eudoxos 261
Braiding, P.
32
Bubner, R. 135f
Bulthaup, P.
313
Burkhardt, B. 53, 129, 134 Cäsar 219,221 Cantor, G. 296 Carnap, R. 63 Cassirer, E. 279, 285f, 296 Cauchy, A.L. 273, 283, 296 Cusanus (N. v. Kues) 187f
Eschenmayer,
A.C.A. 50
Falke, G. 100 Feuerbach, L. 53, 57, 120, 124, 130 Fichte, J.G. 14, 21, 24, 29, 31-34, 37f, 41, 59, 61, 71, 82, 84, 88, 90, 97, 100, 108, 187-189, 197, 205 Fichte, I.H. 53 Fink,E. 106 Foucault, M. 172 Frank, M. 189 Frantz, C. 272
Frege,G.
63
Fries, J.F. 91, 100, 105 Fulda, H.-F. 34, 44, 56f Gabler, G.A. 54 Gadamer, H.-G. 36, 46, 56, 115, 119
Personenregister Galilei, G. 286,299 Gasché, R. 186f, 195f, 198f Gawoll, H.-J. 92, 103 Goethe, J.W. v. 31 Guyer, P. 183, 216, 224f Habermas, J. 201 Halfwassen, J. 95 Hartmann, N. 36, 44 Heidegger, M. 79, 110, 121-125, 172, 173f, 207 Heidtmann, B. 286 Heinrichs, H. 57 Helmholtz, H. v. 294 Henrich, D. 13, 32, 115, 117, 129-135 Heraklit 106, 110, 119, 215, 257 Herder, J.G. 34,61 Hinrichs, H.F.W. 54 Hobbes, Th. 70 Hochhuth, R. 64 Hölderlin, F. 92 Hösle, V. 24, 54, 56f Hoffmann, T.S. 85 Hogemann, F. 86,272 Horn.J.C. 216 Hume, D. 75, 77f Husserl, E. 115,206
Iber.C. 27f, 192 Ilchmann, A. 105 Illetterati, L. 181 Inwood, M. 188 Jacobi, F.H. 90-108, 132, 136, 188, 205f
Jäger,
W. 110
Jaeschke, W. 86, 91, 106, 136, 272 Janke, W. 174 Jean Paul (Richter, F.) 90 Jesus, Jesus Christus 98 Kästner, A.G. 107 Kant, I. 14, 20f, 24, 29, 32-34, 36-39, 41, 46, 49, 51, 59-61, 64, 68f, 71f, 76-78, 82, 85, 90, 97, 100-102, 105, 109, 120, 122-124, 145, 159, 162, 164, 168, 177, 187-189, 193, 197, 206, 215, 238, 252-270, 273275, 294, 299, 302-305, 309, 314 Kepler, J. 285-287, 293, 299
Keyserlingk, A. Kierkegaard, S.
190 130
v.
Kripke, S. 67
Kroner, R. 43, 124 Kruck, G. 235
Lagrange, L. 50, 72, 278, 282f, 288, 290, 292, 295f La Mettrie, J.O. de 78 Laßwitz, K. 286 Lefèvre, W. 50 Leibniz, G.W. 41, 50, 70, 78,
81f, 147, 183, 187f, 193, 215-235, 252, 274,283,296
Lessing, G.E. 96 Leukipp 255, 258f Locke, J. 69,77f, 85 Lucas, H.-C. 105, 107 Lucretius, T.C. 256 Lyotard.F. 124,201 Malebranche, N. de 215 Manninen, J. 216 Mao
Zedong
171
Marx, K. 20, 30, 53, 120, 124, 194, 294 Marx, W. 34
McTaggart, J.E. 239 Menninghaus, W. 189 Michelet, CL. 54,269 Moretto, A. 272
Napoleon 219,221 Neeb, J. 107 Neuser, W. 284 Newton, I. 253f, 266, 271-274, 276-280, 282-289, 293, 295,297-299 Niethammer, F.I. 91, 100 Nietzsche, F. 125 Novalis 60, 186, 189 Numenios
von
Apameia
Parmenides 63, 102, 106, 110, 118, 122, 146, 148, 257-259
Patzig, G.
44 Paul (s. Jean Paul) Piaton 14f, 17, 22, 40, 63, 70, 74, 81f,
95, 110, 118, 120, 123f, 143f, 150f, 198, 218, 252, 258f
Plotin 187f Pöggeler, O. 56 Popper, K. 75 Poser, H. 218 Puntel, LB. 57
Pythagoras 50,63,274
Kimmerle, H. 159, 165, 168, 171 Klaucke, A. 272 Koch, A.F. 238
Quine, W.O. 72,
Koppen, F.
Raatzsch, R. 64
332
91
95
145
Personenregister Rehm. M. 272, 299 Reinhold 34, 80-89 Richter, J.B. 52 Robinson, A 72 Römpp, G. 38 Röttges, H. 134 Rosenkranz, K. 49, 92 Ruschig, U. 194f, 305, 308f Russell, B. 63, 148
Saussure, F. de 198 Scheier, C.-A. 203,206 Schelling, F.W.J. 21, 34, 43f, 50, 53, 61, 84, 90, 94, 100, 108, 115, 129f, 187, 189f, 268-270 Schick, F. 30,36,131, 134 Schiller, F. v. 31
Schlegel, F. 189f Schleiermacher, F.D.E. 99 Schmidt, J. 129 Schmidt, K.J. 159 Schmitz, H. 160 Schneider, H. 106 Schrader-Klebert, K. 117, 130, 134 Schubert, A. 23,31, 131f, 134 Schubert, F.Th. 287 Scott, W. 64
Shikaya,T.
98 Sokrates 143 Spehr.F.W. 273 Spinoza, B. de 28, 46, 51, 70-72, 76f, 81, 90, 92-
94, 96f, 101-104, 106-108, 120, 164,
187-190,218,224,274
Stekeler-Weithofer,
P. 49f, 70, 193, 196f
Taylor, C. 236,239 Thaies von Milet 242 Thalheimer, A. 299 Theunissen, M. 17, 22, 44, 56f, 95, 132f, 192 Thomas von Aquin 39, 78 Trendelenburg, A. 53, 115, 129, 192 Turing, A. 64
Voltaire (Aronet, F.M.) 78
Wahsner, R. 272, 274, 276, 284-286, 293-298 Wandschneider, D. 16 Weckwerth, C. 26, 34 Weierstraß, K. 296 Weiße, C.H. 53 Weizsäcker, v. 124 Werner, J. 129, 132, 134
Weyl,
H. 275
Wiehl.R. 56 Wieland, W. 127, 135 Wittgenstein, L. 59,61,64,67,69, 143 Wolfers, J.P. 298 Wolff, C. 82 Wolff, M. 132, 193, 272, 276, 283f, 289f, 294 Zenon
von
Elea 258
Zingari, G. 216
Sergio
Freiheit und
Dellavalle
Intersubjektivität
Zur historischen
Entwicklung von Hegels geschichtsphilosophischen und politischen Auffassungen
Hegel-Forschungen 1998. VI, 303 Seiten Gb, DM 120-
ISBN 3-05-003229-4
Das Buch bietet eine Gesamtdarstellung der politischen Philosophie Hegels, die getragen ¡st von der grundlegenden These, daß in den intersubjektivitätstheoretischen Ansätzen, mit denen der junge Hegel die Aufgaben einer politischen Philosophie der damaligen Zeit zu lösen versuchte, ein kritisches Potential liegt, das sein gesamtes Lebenswerk durchzieht. Die falsche Alternative von Liberalismus und Konservatismus vermeidend, wird verdeutlicht, daß Hegel zeitlebens an einem auch heute noch hochaktuellen Problem arbeitete: Ist es möglich, für den Zusammenhalt des soziopolitischen Gemeinwesens eine Grundlage auszumachen, welche sich nicht nur auf einen formalen Kompromiß beschränkt, sondern unmittelbar aus den lebensweltlichen Erfahrungen von jedem einzelnen ausgeht, dabei aber auf präjudizierende kollektive Werte verzichtet und die Individualität nicht verneint, sondern sich vielmehr aus dieser entfaltet? Die theoretische Ansätze u.a. von Adorno, Apel, Habermas, Hösle, Honneth, Marcuse diskutierend, zeigt der Autor, daß die Formulierung eines intersubjektivitätstheoretischen Fundaments für den gegenseitigen Übergang von Vielheit und Einheit sowie für die Aufrechterhaltung einer dauerhaften Spannung zwischen unterschiedlichen Erfahrungsbereichen Hegels Untersuchungen mit der heutigen Debatte unmittelbar verbindet.
Bestellungen richten Sie bitte an Ihre Buchhandlung
Verlag ^f§F Akademie www.akademie-verlag.de
Berliner
Universitätsphilosophie
Volker Gerhardt, Reinhard Mehring, Jana Rindert Berliner Geist Eine Geschichte der Berliner Universitätsphilosophie Mit einem Ausblick auf die Gegenwart der HumboldtUniversität 1999. 330 Seiten
Gb, DM 74,-
48 Abb. -
ISBN 3-05-002961-7
Berliner Universitäts-
philosophie von
1810
bis nach 1945.
Gründung Formierung Blüte Krise
Die 1810 gegründete Berliner Universität hat auf vielen Gebieten Epoche gemacht auch in der Philosophie. Keine andere deutsche Universität brachte eine so große Zahl bedeutender Philosophen hervor, deren Namen in jeder Philosophiegeschichte stehen. Das nunmehr vorliegende Buch bietet die erste Gesamtdarstellung Berliner -
Universitätsphilosophie bis nach 1945. Den Band durchzieht die These, daß die Berliner Universität in ihrer relativ kurzen und überaus wechselvollen Geschichte ein eigenes philosophisches Profil ausgeprägt hat, das auch heute noch philosophisch interessant und bildungspolitisch aktuell ¡st.
Bestellungen richten Sie Ihre Buchhandlung
bitte
an
Verlag ^#F Akademie www.akademie-verlag.de
Nietzscheforschung Jahrbuch der
Nietzschegesellschaft. Band 5/6
Herausgegeben von Volker Gerhardt und
Renate Reschke
1999. Ca. 450 Seiten Qb, ca. DM 98ISBN 3-05-003233-2
Aus dem Inhalt Curt Paul Janz: Nietzsches
Frage nach dem Wesen der Musik
Volker Caysa: Leibkultur und Rausch
Cathrin Nielsen: Nietzsches
.Physiologie der Kunst'
Josef Simon: Nietzsche und der Gedanke einer Kritischen Theorie
Christoph Menke: Genealogie und Moralbefragung
Kritik
Zwei Formen ethischer -
Martin Mühl: Der Leib und die Normativität der Theorie
Grundlagen Kritischer
Stefan Schlagowsky: lut Nachwirkung von Nietzsches »Genealogie der Moral« auf Horkheimer/Adornos Forderung eines Eingedenkens der Natur im
Subjekt
Hermann Josef Schmidt: Nietzsches Leben und Texte 1844-1864 Pia Daniela Volz: Narzißtische jungen Nietzsche
Traumstimmung und Traumdichtung beim
Wiebrecht Ries: Thematische Parallelen in der Kindheits- und
Jugendgeschichte Hölderlins, Nietzsches und Kafkas Wilhelm Schmid: Nietzsche als ökologischer Philosoph Reinhart Maurer: Nietzsche ökologisch? Sigridur Thorgeirsdottir. Die Kritik essentialistischer Bilder der Frauen
Nietzsches Spätphilosophie und ihre Theorien der Geschlechterdifferenz
in
Bedeutung für philosophische
Birgit Recki: Nietzsches Kulturphilosophie zwischen Ästhetik und Ethik Hans-Martin Gerlach: Nietzsches Denken zwischen »aristokratischem Radikalismus« und »Psychopathia spiritualis«?
Bestellungen richten Sie bitte an Ihre Buchhandlung
Akademie Verlag
www.akademie-verlag.de


![Die Frage nach der Philosophie: Interpretationen zu Hegels »Differenzschrift« [2 ed.]
9783787330904, 9783787315055](https://ebin.pub/img/200x200/die-frage-nach-der-philosophie-interpretationen-zu-hegels-differenzschrift-2nbsped-9783787330904-9783787315055.jpg)