Gegenwart in Latenz: Verfahren und Figurationen von Präsenz in der Zeitdiagnostik des Vormärz (1830–1848) [1 ed.] 9783737013819
119 8 8MB
German Pages [199] Year 2022
Recommend Papers
![Gegenwart in Latenz: Verfahren und Figurationen von Präsenz in der Zeitdiagnostik des Vormärz (1830–1848) [1 ed.]
9783737013819](https://ebin.pub/img/200x200/gegenwart-in-latenz-verfahren-und-figurationen-von-prsenz-in-der-zeitdiagnostik-des-vormrz-18301848-1nbsped-9783737013819.jpg)
- Author / Uploaded
- Giuseppina Cimmino
File loading please wait...
Citation preview
Literatur- und Mediengeschichte der Moderne
Band 8
Herausgegeben von Ingo Stöckmann Reihe mitbegründet von Hermann Korte
Giuseppina Cimmino
Gegenwart in Latenz Verfahren und Figurationen von Präsenz in der Zeitdiagnostik des Vormärz (1830–1848)
V&R unipress
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar. © 2022 Brill | V&R unipress, Theaterstraße 13, D-37073 Göttingen, ein Imprint der Brill-Gruppe (Koninklijke Brill NV, Leiden, Niederlande; Brill USA Inc., Boston MA, USA; Brill Asia Pte Ltd, Singapore; Brill Deutschland GmbH, Paderborn, Deutschland; Brill Österreich GmbH, Wien, Österreich) Koninklijke Brill NV umfasst die Imprints Brill, Brill Nijhoff, Brill Hotei, Brill Schöningh, Brill Fink, Brill mentis, Vandenhoeck & Ruprecht, Böhlau und V&R unipress. Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages. Umschlagabbildung: Ausschnitt aus »4. Schwarze Mappe: Die Schrift des Schattens« (1958) von Jean Dubuffet (Köln, Museum Ludwig, Graphische Sammlung), © Rheinisches Bildarchiv Köln, RBA 176 855 (www.museenkoeln.de/rba.de). Vandenhoeck & Ruprecht Verlage | www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com ISSN 2198-5227 ISBN 978-3-7370-1381-9
Dem Andenken meiner Mutter
Inhalt
Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
Kapitel 1: Epistemologie der ›Latenz‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1 ›Latenz‹: Geschichte und Pragmatik des Begriffs . . . . . . . . . . . 1.2 ›Latenz‹ als Ermöglichungsbedingung für Zeitdiagnostik im Vormärz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21 22
Kapitel 2: Historisierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1 Historisierung der ›Gegenwart‹ (Geschichtsphilosophie und Literaturgeschichte) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 Ludolf Wienbargs Ästhetische Feldzüge (1834) . . . . . . . . . . . 2.3 Das »Entwicklungsgesetz der Zeit« sichtbar machen: Ludolf Wienbargs Zur neuesten Literatur (1835) . . . . . . . . . . 2.4 Robert Prutz’ Kleine Schriften. Zur Politik und Literatur (1847–48) 2.4.1 Die politischen Schriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.2 Literaturwissenschaftliche Perspektiven: das Modell ›Geschichte‹ und die Integration peripherer Untersuchungsgegenstände . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.2.1 Genese, Kontinuität, Entwicklungsgeschichte . . . . . 2.4.2.2 Vorstufe des Wandels: Gegenwartsliteratur als Übergangsliteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.2.3 Vom Umgang mit der Zäsur – Komparatistische Perspektiven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.2.4 Charakteristiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5 Die Relativierung der politischen Frage durch den ›Übergang‹ – Theodor Mundts Die Einheit Deutschlands in politischer und ideeller Entwickelung (1832) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6 Zwischen geschichtlicher ›Zäsur‹ und literaturwissenschaftlichen Kategorien: Gutzkows Ueber Göthe im Wendepunkte zweier Jahrhunderte (1836) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
45
. .
45 51
. . .
57 65 68
. .
76 80
.
85
. .
91 93
.
97
.
103
34
8
Inhalt
2.7 Die Zäsur ›Julirevolution‹ und die Bilanz eines Jahrzehntes: Karl Gutzkows Vergangenheit und Gegenwart (1830–1838) (1839) . 2.8 Zeit und Text: Gutzkows Beiträge zur Geschichte der neuesten Literatur (1839) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.9 Theodor Echtermeyers und Arnold Ruges Der Protestantismus und die Romantik. Zur Verständigung über die Zeit und ihre Gegensätze. Ein Manifest (1839) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112 117
122
. . . .
129
. . . .
. . . .
134 135 142 152
. . . . . . . .
156 163
. . . .
167
Kapitel 4: Prognostik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1 Prognostik als Programm: Prognosen aus dem Standpunkt einer Übergangszeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
175
Literaturverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
189
Danksagung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
197
Kapitel 3: Bildgebung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1 ›Bildgebung‹ als zeitdiagnostisches Schreibverfahren: Karl Gutzkows Sammlung Die Zeitgenossen. Ihre Schicksale, ihre Tendenzen, ihre großen Charaktere (1837) . . . . . . . . 3.1.1 Gegen die Geschichtsphilosophie . . . . . . . . . . . . 3.1.2 Charakter – Typus – Zeitgenosse . . . . . . . . . . . . 3.1.3 Zur Funktion fiktionaler Prosa . . . . . . . . . . . . . . 3.2 Die Verzeitlichung kritischer Praxis und die Kategorie des ›Modernen‹ – Laubes Moderne Charakteristiken (1835) . . . 3.2.1 Moderne Erscheinungen . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.2 Modern oder nicht modern? Literaturwissenschaftliche Wertungskriterien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . .
. . . .
175
Einleitung
Die vorliegende Studie ist im Rahmen des DFG-Graduiertenkollegs 2291 »Gegenwart/Literatur. Geschichte, Theorie und Praxeologie eines Verhältnisses« entstanden. Mit dieser Arbeit hat man sich im Wesentlichen vorgenommen, das Verhältnis zwischen ›Gegenwart‹ und ›Literatur‹ sowie dessen Dimensionen anhand der Vormärzliteratur zu spezifizieren. Die Studie untersucht also dieses Verhältnis aus einer geschichtlichen Perspektive mit dem Ziel, den besonderen Beitrag dieser Epoche zu einem solchen Forschungskomplex zutage treten zu lassen. Dass im Zeitraum zwischen 1830 und 1848 Begriff und Geschichte der ›Gegenwart‹1 in eine neue Phase eintreten und ›Gegenwart‹ vermehrt zum Gegenstand der Literatur wird, wurde längst in erster Linie in einigen Beiträgen Ingrid Oesterles festgestellt, die in diesem Forschungsbereich als Pionierstudien gelten2. In diesen Beiträgen wird in Bezug auf den Vormärz der spezifische 1 Hierbei handelt es sich um die erste Forschungsfrage im Rahmen des Programms des Graduiertenkollegs, vgl. dazu ausführlich https://www.grk2291.uni-bonn.de/de/forschungsprofil /forschungsfragen [26. 01. 2021]. 2 Angespielt wird auf den Aufsatz Der ›Führungswechsel der Zeithorizonte‹ in der deutschen Literatur. Korrespondenzen aus Paris, der Hauptstadt der Menschheitsgeschichte, und die Ausbildung der geschichtlichen Zeit ›Gegenwart‹. In: Dirk Grathoff (Hg.), Studien zur Ästhetik und Literaturgeschichte der Kunstperiode, Frankfurt a. M./Bern/New York 1985, S. 11–76. Gemeint ist außerdem ihr späterer Beitrag »Es ist an der Zeit!«. Zur kulturellen Konstruktionsveränderung von Zeit gegen 1800. In: Walter Hinderer/Alexander von Bornmann/Gerhard von Graevenitz (Hg.), Goethe und die Romantik, Würzburg 2002, S. 91–121. In beiden Aufsätzen werden im Grunde die in den soziologischen (Luhmann), geschichtswissenschaftlichen und sprachgeschichtlichen (Koselleck) Großerklärungsmodellen formulierten Thesen von der ›Verzeitlichung‹ gesellschaftlicher Semantik und dem ›Führungswechsel der Zeithorizonte‹ in der Sattelzeit (1760–1830) für die literaturwissenschaftliche Betrachtung geltend gemacht. Insbesondere befasst sich Ingrid Oesterle mit den Wechselbeziehungen zwischen ›Verzeitlichung‹ und literarischen Formen im ersten (1795–1800) und im zweiten Verzeitlichungsschub (um 1830). Niklas Luhmanns und Reinhart Kosellecks viel rezipierte Thesen postulieren eine Verschiebung im Rahmen der Relationen der drei Zeitdimensionen zueinander, die ›moderne‹ Zeiterfahrung überhaupt kennzeichnet: Nicht mehr die ›Vergangenheit‹, sondern die ›Zukunft‹ wird zur strukturierenden Bezugsdimension für die ›Gegenwart‹, die angesichts der nun ›offenen‹ Zeitperspektive ins Zentrum der Betrachtung rückt. Vgl. dazu Niklas Luhmann,
10
Einleitung
Aspekt der »Verschränkung von historischem Tempus – und literarischem Paradigmenwechsel«3 untersucht. Ingrid Oesterle vertritt mithin die These, dass die Erneuerungen im literarischen System in einem kausalen Verhältnis zur neu wahrgenommenen historischen Zeit stehen; dieser These stellt sie einen Überblick über die in Bezug auf die Auseinandersetzung mit ›Zeit‹ und ›Gegenwart‹ relevanten Wissenschaften voran, der nun im Folgenden kurz wiedergegeben werden soll. Unter den (wenigen) Wissenschaften bzw. diskursiven Formationen, die sich damals mit der ›Gegenwart‹ beschäftigten, prägt insbesondere die Geschichtsphilosophie, wie es bereits in Kapitel 1 dieser Studie zu zeigen sein wird, das Zeitdenken maßgeblich. ›Gegenwart‹ untersucht sie aber im Rahmen einer Darlegung des gesamten historischen Prozesses und mit dem Ziel der Kontingenzbewältigung. Demzufolge wohnt ihr die Tendenz inne, die Komplexität der gegenwärtigen Verhältnisse nicht zu berücksichtigen, diese ja geradezu zu relativieren, und generell der Empirie kaum Bedeutung beizumessen. In diesem Zusammenhang reagieren also Autoren wie Heine, Börne, die Jungdeutschen und die Linkshegelianer – Ingrid Oesterles Lektüre nach – auf »die empirische Korrekturbedürftigkeit der Geschichtsphilosophie«4: Die von ihnen oft praktizierten publizistischen Formen und ›Mischformen‹5, wie etwa der Brief, die den Fiktionalitätscharakter nicht vollständig preisgeben, werden also zum Organ der Auseinandersetzung mit und der Darstellung von gegenwärtigen Verhältnissen. Ingrid Oesterles Beiträge stellen in vielerlei Hinsicht Überlegungen an, auf denen die vorliegende Studie wiederum durchaus aufbauen kann. Diese Aufsätze umschreiben in erster Linie den gattungssystematischen Horizont, aus dem das hier untersuchte Textkorpus ebenfalls resultiert: Literatur-, Zeitkritik und Essayistik setzen sich mit Gegenwartsliteratur und Zeitgeschichte auseinander und besetzen somit eine von der akademischen Literaturgeschichte und der Geschichtswissenschaft im Grunde vakant gelassene Stelle. Während sich aber diese Pionierstudien auf der entwicklungsgeschichtlich erreichten Emanzipation der Kategorie ›Gegenwart‹ von der ›Vergangenheit‹ konzentrieren und die daraus Temporalisierung von Komplexität. Zur Semantik neuzeitlicher Zeitbegriffe. In: ders., Gesellschaftsstruktur und Semantik. Studien zur Wissenssoziologie der modernen Gesellschaft, Band I, Frankfurt a. M. 1980, S. 235–300; Reinhart Koselleck, Einleitung. In: Otto Brunner/ Werner Conze/ders. (Hg.), Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politischsozialen Sprache in Deutschland, Band 1, Stuttgart 1972, S. XIII–XXVII, ›Neuzeit‹. Zur Semantik moderner Bewegungsbegriffe. In: ders., Studien zum Beginn der modernen Welt, Stuttgart 1977, S. 264–299, »Erfahrungsraum« und »Erwartungshorizont« – zwei historische Kategorien. In: ders., Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten, Frankfurt a. M. 1989, S. 349–375, Begriffsgeschichten. Studien zur Semantik und Pragmatik der politischen und sozialen Sprache, Frankfurt a. M. 2006. 3 Oesterle I. 1985, S. 26–27. 4 Ebd., S. 15. 5 Vgl. dazu ebd., S. 23.
Einleitung
11
resultierenden, in einigen Fällen ja nur kurzfristigen Umstrukturierungen im Literatursystem untersuchen, rücken in dieser Studie die Äußerungsregeln sowie die Schreibverfahren, die bei der Diskursivierung von ›Gegenwart‹ eingesetzt werden, in den Mittelpunkt. Die Großerklärungsmodelle Luhmanns und Kosellecks werden selbstverständlich nicht in Frage gestellt und auch die Aufwertung und die mit den zwei Verzeitlichungsschüben erreichte Relevanz der Zeitdimension ›Gegenwart‹ wird vorausgesetzt – dafür bedarf es übrigens auch keiner weiteren Belege. Um die Spezifik des Vormärz zu erfassen, wird demgegenüber in dieser Studie die These aufgestellt, dass 1. in diesem Zeitraum eine komplexe Gegenwartserfahrung sowie 2. ein gewisses Verhältnis der ›Literatur‹ zur ›Gegenwart‹ dominant sind. Beide Aspekte können weder die erwähnten Großerklärungsmodelle noch die sich auf die Modernisierungssemantik stützenden Kategorien (Zyklik, Progression, Beschleunigung, s. unten) adäquat erfassen. Es muss deswegen von anderen analytischen Leitkategorien profitiert werden, um diese ästhetisch und sprachlich vermittelte Gegenwartserfahrung sowie die damit verbundenen Fragestellungen zu beschreiben. Im Vormärz handelt es sich also nicht (nur) darum, der ›Gegenwart‹ Darstellungswürde zuzuerkennen, oder einfach eine disziplinäre Leerstelle zu besetzen – ein von solchen Prämissen ausgehendes Verständnis des Verhältnisses ›Gegenwart/Literatur‹ würde dazu tendieren, zugespitzt formuliert, die Vormärzliteratur als Folgeerscheinung der Verzeitlichung zu betrachten. Macht man nämlich die Literatur dieser Zeit zu viel vom Modernisierungsprozess abhängig, dann gerät eine andere, bedeutsame Dimension des Verhältnisses Gegenwart/ Literatur aus dem Blick – die performative und operative Funktion, die sich diese Literatur auf die ›Gegenwart‹ auszuüben vornimmt. In diesem Sinne gelten die Texte dieser Zeit, insbesondere die publizistische Produktion, nicht als bloßes Produkt neuer Verhältnisse und eines ebenfalls neuen Öffentlichkeitsverständnisses; es muss vielmehr im Hinblick auf das Verhältnis zur ›Gegenwart‹ ihre aktive Funktion betont werden. ›Gegenwart‹ fungiert mithin im Rahmen dieser Literatur nicht nur als Entscheidungs- und Verhandlungsraum, also als breiterer (a-temporaler) Rahmen, innerhalb dessen Überlegungen angestellt und unterschiedliche Szenarien durchgespielt werden können, sondern auch als Dimension, welche durch gezielte Maßnahmen verändert werden kann. Demnach lässt sich auf argumentativer Ebene eine interessante Tendenz in den Primärtexten beobachten: Komplementär zu einer immer wieder als ›defizitär‹ beschriebenen ›Gegenwart‹ steht nämlich eine gewissermaßen noch virtuelle bzw. unverwirklichte, durch Dichte, Kohärenz und Einheit gekennzeichnete unsichtbare ›Gegenwart‹. Die gegenwärtigen Verhältnisse erfahren also eine Art ›Verdoppelung‹. Viele Texte verhalten sich zu dieser positiv konnotierten ›Gegenwart‹ als eine Art ›Supplement‹, indem sie auf eine Abwesenheit hindeuten und zugleich die durch diese bedingte Leerstelle besetzen. Dabei handelt es sich um ein Verfahren, das
12
Einleitung
darauf abzielt, ›Präsenz‹ zu erzeugen. Inhaltlich gesehen liefern sie eine Diagnose der gegenwärtigen Verhältnisse und verweisen darauf, wie die als defizitär empfundene Lage aufzuheben ist. In diesem Zusammenhang kann es sich konkret um literarische Programme, Autorinnen und Autoren oder Akteure im politischen Leben handeln, die dabei eine große Rolle spielen können. Im Hinblick auf deren Leistung für das Literatursystem und die Verhältnisse überhaupt werden die Texte – und das betrifft natürlich auch die hier untersuchten Primärtexte – in einem temporalisierten Zusammenhang konzipiert: Die Hochkonjunktur der Publizistik sowie der Mischformen, die sich aus der Verwischung der Gattungsgrenzen ergeben, gilt also als ›notwendig‹ und ›vorübergehend‹. In höchstem Maße ›temporalisiert‹ ist der Vormärz – zumindest in der Wahrnehmung der Zeitgenossen –, weil er in den Selbstbeschreibungen immer wieder als Zeit des ›Übergangs‹ bezeichnet wird. Es handelt sich also um eine Epoche, die ausgerechnet aufgrund des Moments ihrer (zeitlichen) Überwindung existiert. Vor diesem Hintergrund gilt sie also als eine Durchgangsphase, die der Wiedereintritt in eine emphatisch verstandene ›historische Zeit‹ überhaupt ermöglichen kann. Obwohl logisch gesehen der Moment des ›Übergangs‹ in der als Denkform betrachteten ›Geschichte‹ enthalten ist, kann er aufgrund der in der Regel nicht unmittelbar sichtbaren Wirkungen nur schwer in eine ›ereignishafte‹ Auffassung von ›Geschichte‹ integriert werden. Entsprechend dieser Vorstellung macht sich also in den Selbstbeschreibungen und den Diagnosen die Idee geltend, dass die gerade erlebte Zeit eine Suspension der Geschichte darstellt; sie befindet sich außerhalb derselben, kann diese aber wieder in Gang setzen. Eine so empfundene ›Gegenwart‹ entspricht in vielerlei Hinsicht – so die These – der Zeiterfahrung der ›Latenz‹. Wie in Kapitel 1 ausführlich dargelegt wird, hat diese Kategorie in den letzten Jahren u. a. in der literaturwissenschaftlichen Forschung Konjunktur. In dieser Studie wird ›Latenz‹ zur Leitkategorie erhoben, weil sie Begriff und Vorstellung von ›Gegenwart‹ im Vormärz erfassen kann. Damit wird nicht nur behauptet, dass die ›Gegenwart‹ im Vormärz als Latenzzeit gilt – im Prinzip geht es in der vorliegenden Studie auch nicht darum, diese ›Gegenwart‹ ontologisch zu definieren, oder nach dem Wahrheitsgehalt der Aussagen über die eigene Zeit im Vormärz zu suchen. Beabsichtigt ist vielmehr die Beschreibung der Logik, die den textuell und sprachlich vermittelten Gegenwartsdiskurs steuert. Diese Logik sollte einerseits mit der Bestimmung generell gefasster Äußerungsregeln, andererseits medienbezogen mit derjenigen einiger Schreibverfahren Kontur gewinnen. In diesem Sinne leistet also die Analysekategorie der ›Latenz‹ mehr als die zu viel von der Modernisierungssemantik abhängigen Modelle der ›Zyklik‹, der ›Progression‹ oder der ›Beschleunigung‹, welche gleichwohl auch im Vormärz das Zeitdenken prägen. Die mit diesen Modellen verbundenen Zeitkonzepte können allerdings als Leitkategorien in dieser Studie nicht eingesetzt werden,
Einleitung
13
weil sie sich darauf beschränken, ›Gegenwart‹ vor der Folie des Modernisierungsprozesses, des »Führungswechsels der Zeithorizonte« sowie, genereller, der Verzeitlichung zu definieren. Sie sind also nicht in der Lage, komplexere, womöglich durch Aporien gekennzeichnete Zeitlichkeit zu beschreiben. Mit der Kategorie der ›Latenz‹ kann hingegen die Gegenwartserfahrung von der Modernisierungssemantik – und mithin von einer fortschreitenden Logik – emanzipiert werden, wodurch wiederum andere Phänomene erfasst werden können. Die Kategorie der ›Latenz‹ erlaubt nämlich, einige bislang eher unterbelichtete Aspekte der Vormärzliteratur zu untersuchen. Die angedeutete Konjunktur der Publizistik sowie nicht-fiktionaler Literatur überhaupt geht mit der vermehrten Tendenz einher, dadurch (zeit-)diagnostische Beiträge zu liefern. Mit Bezug auf den Schwerpunkt der Studien Ingrid Oesterles erweist sich also in der Vormärzliteratur – so die These – nicht primär der Vorsatz, ›Gegenwart‹ darzustellen, sondern diese zu deuten, als besonders dringend. Eine exegetische Einstellung macht sich demnach geltend und prägt in entscheidender Weise – zumindest auf der Ebene der Aussagen – Ziele, Erwartungen und Wunschvorstellungen, die mit einer ›wissenschaftlichen‹ Beobachtung der Zeitverhältnisse assoziiert werden. ›Latenz‹ definiert somit nicht nur die für diese ›Übergangsperiode‹ kennzeichnende Zeiterfahrung, sondern sie bildet auch die Ermöglichungsbedingung für die erwähnte exegetische Operation. Aus den an dieser Stelle nur kurz skizzierten Überlegungen lässt sich erschließen, dass die Kategorie der ›Latenz‹, neben ihren offenbaren und für diese Studie überaus relevanten zeitlichen Implikationen, auch eine epistemologische Dimension hat. Denn verweist der exegetische Imperativ im Grunde unfreiwillig auch auf das, was als relevantes Wissen zu gelten hat, sowie darauf, wo sich dieses lokalisieren lässt. Unter diesen Prämissen wird dann in Kapitel 1 rekonstruiert, wie mit der Kategorie der ›Latenz‹ von der Begriffsgeschichte ausgehend zeitliche, zeittheoretische, ontologische und eben epistemologische Fragestellungen verbunden sind. Die Verbindung von epistemologischen Aspekten bzw. Aussagen über Möglichkeiten der Wissenserlangung und Zeitdiagnose tritt besonders deutlich nämlich bei Anselm Haverkamps Beiträgen hervor, in denen vorgeschlagen wird, ›Latenz‹ als Leitbegriff der Kulturwissenschaften zu erheben. Eine ähnliche Verbindung lässt sich bei Hans Ulrich Gumbrechts Diagnosen der Nachkriegszeit beobachten. Die Überlegungen beider Wissenschaftler sind viel rezipiert worden und vor allem Haverkamps Vorschlag hat wiederum eine Reihe von Beiträgen angeregt6, die die Beschreibungsfähigkeit der Kategorie der ›Latenz‹ für – im Rahmen der im weitesten Sinne erfassten Moderne – zentrale Begriffe und Theorietraditionen unter Beweis stellen. Neben Theorien, bei denen dieser Begriff explizit vorkommt, wie etwa Blochs Systemphilosophie muss nämlich auf 6 Vgl. dazu Kap. 1 dieser Studie, Fußnote 8.
14
Einleitung
eine unsichtbare, wiederum latente und bislang noch nicht geschriebene Geschichte des Latenzbegriffs als Analysekategorie hingewiesen werden. In dieser Funktion verweist ›Latenz‹ auf wiederkehrende rhetorische sowie metaphorische Elemente; dadurch ermöglicht sie die Bestimmung einer Art Topik, die den modernen ›Diskurs um die Zeit‹ kennzeichnet, und sorgt für die bislang meist unvermutete Vergleichbarkeit heterogener Denktraditionen. Vor diesem Hintergrund lässt sich die vorliegende Studie als Teil einer noch in Ansätzen bestehenden Geschichte betrachten; damit nimmt sie sich zugleich vor, die analytische Angemessenheit der Kategorie der ›Latenz‹ für den Untersuchungsgegenstand ›Vormärzliteratur‹ zu erproben. In diesem Sinne wird in Kapitel 1 die Literatur dieses Zeitraums ebenfalls unvermutet mit Theorieparadigmen in Verbindung gebracht, die sonst als weit entfernte Konstellationen gelten müssen. Dabei handelt es sich um die Dekonstruktion, in deren Nachfolge die bereits erwähnten Beiträge Hans Ulrich Gumbrechts und vor allem Anselm Haverkamps stehen. Im Rahmen dieses Theorieparadigmas stellt ›Latenz‹ die einzig mögliche oder zumindest die privilegierte Modalität der Erfahrbarkeit und Zugänglichkeit dar: Aufgrund der nicht aufzuhebenden, aporetischen Struktur der Erfahrung ist ›Identität‹ nur relational definierbar; somit verweist das, was gewissermaßen vorhanden ist, ohnehin auf das ›Abwesende‹, das ›Unsichtbare‹ und lässt sich nur durch den ergänzenden Bezug auf dieses näher bestimmen. Eine ähnlich aporetische Struktur kennzeichnet die Zeiterfahrung im Vormärz, so dass in der ›Gegenwart‹ noch produktiv zu machende Spuren der ›Vergangenheit‹ sowie zu erkennende Anzeichen der ›Zukunft‹ vorhanden sind. Gerade diese Zeiterfahrung ›verpflichtet‹ die Zeitbetrachterin oder den Zeitbetrachter zu einer deutenden Einstellung. So prägt die bei Anselm Haverkamp und Hans Ulrich Gumbrecht vorhandene Kombination von Zeitdiagnose und Betrachtungen über die Modalitäten der Wissenserlangung auch einige Diskurse im Vormärz; diese Übereinstimmung begründet also die hier ausgewählte Perspektive sowie die Leitkategorie. Dass dadurch eine neue Deutungsperspektive auf die Vormärzliteratur gewonnen und diese in eine bislang als eher fremd empfundene Forschungskonstellation integriert werden kann, steht in Kontinuität mit einer Tendenz der Vormärzforschung, die sich schon längst erkennen lässt. Der größte Teil der Beiträge, die im Rahmen der nun seit über 20 Jahren instituierten Forum-Vormärz-Forschung entstanden sind, hat nämlich die Literatur dieser Epoche für kulturwissenschaftliche Fragestellungen fruchtbar gemacht7. Damit hat sich die 7 Neben den vorwiegend literaturwissenschaftlichen Schwerpunktthemen der ersten, seit 1994 veröffentlichten Jahrbücher (vgl. dazu Autorinnen des Vormärz, 1996; Literaturkonzepte im Vormärz, 2000; Theaterverhältnisse im Vormärz, 2001; Journalliteratur im Vormärz, 2015) lassen sich im Laufe der Jahre dezidiert kulturwissenschaftliche und interdisziplinäre Frage-
Einleitung
15
Emanzipierung der Vormärz-Forschung von einer zu einseitigen, ja verengenden Sicht vollzogen. Angespielt wird auf die Auswirkungen einer weitgehend ›politischen‹ Lesart, die u. a. auf die DDR-Germanistik zurückzuführen ist. Im Rahmen dieser kulturpolitischen Konstellation wurde nämlich das Forschungsinteresse für den Vormärz besonders stark gefördert. Unter den Gründen für die Entstehung und Konsolidierung dieses Forschungsschwerpunktes ist der Umstand zu erwähnen, dass das wirkungsästhetische Programm einiger Tendenzen der Vormärzliteratur diese wiederum als eine der ersten Etappen innerhalb der »Entwicklung zur sozialistischen Gesellschaft«8 sowie einer »Vorgeschichte zur DDR-Literatur«9 erscheinen ließ. Eine solche dogmatisch marxistisch-materialistische Lektüre der Vormärzliteratur konnte sich in einer Phase der DDRGermanistik durchsetzen, in der von einer ›Entdogmatisierung durch Pluralisierung‹ der Forschungsperspektiven und der Theorieoptionen nur in Ansätzen die Rede war10. U. a. wegen dieser dominanten ›politischen‹ Lesart ließen sich alternative Deutungsperspektiven lange nur schwer plausibilisieren. Mit der Zentralität der Kategorie der ›Latenz‹ und der Bestimmung von Schreibverfahren, die wiederum die Erkennung von Regelmäßigkeiten im damaligen Zeitdiskurs voraussetzt, lässt sich außerdem eine Annäherungsschwierigkeit umgehen, die der untersuchte Zeitraum der Literaturwissenschaftlerin oder dem Literaturwissenschaftler fraglos bereitet. Wie es bei der vorliegenden Studie der Fall ist, ist die Darlegungs- und Gliederungslogik nicht zuletzt durch diese Annäherungsschwierigkeit bedingt. So wird hier, im Einklang mit der auf der Ebene des Zeitdiskurses angestrebten Emanzipierung von der Modernisierungssemantik, auf eine chronologische Anordnung verzichtet. Obwohl man diese auch als weitgehend neutrales Gliederungskriterium einsetzen kann, könnte sie die Vorstellung eines, wie auch immer gearteten, ›Wandels‹ innerhalb stellungen erkennen (vgl. dazu Literatur und Recht im Vormärz, 2009; Wissenskulturen des Vormärz, 2011; Geld und Ökonomie im Vormärz, 2013; Das Politische und die Politik im Vormärz, 2015; Zwischen Emanzipation und Sozialdisziplinierung: Pädagogik im Vormärz, 2019). Auf die Eröffnung neuer Forschungsperspektiven sind die seit 1998 erscheinenden Vormärz-Studien-Bände ebenfalls gerichtet (vgl. dazu Philosophie der Sprache im Vormärz, Band 36, 2015; Politik, Porträt, Physiologie. Facetten der europäischen Karikatur im Vor- und Nachmärz, Band 18, 2010); sie haben außerdem den Beitrag geleistet, die Vormärz-Epoche im literaturgeschichtlichen Zusammenhang neu zu reflektieren (vgl. dazu Vormärz und Klassik, Band 1, 1998; Vormärz – Nachmärz. Bruch oder Kontinuität?, Band 5, 2000; Romantik und Vormärz, Band 10, 2003; Der nahe Spiegel. Vormärz und Aufklärung, Band 14, 2008). 8 Jörg Schönert, Literaturgeschichtsschreibung der DDR und BRD im Vergleich. Am Beispiel von »Geschichte der Literatur der Deutschen Demokratischen Republik« (Berlin/Ost 1976) und »Die Literatur der DDR« (München 1983). In: Jan Cölln/Franz-Josef Holznagel (Hg.), Positionen der Germanistik in der DDR: Personen; Forschungsfelder; Organisationsformen, Berlin/Boston 2012, S. 248. 9 Ebd., S. 257. 10 Vgl. dazu ebd., S. 249–251.
16
Einleitung
des untersuchten Zeitraums suggerieren. Mit Blick auf die Darlegungslogik erweist sich nämlich weder die Perspektive einer Innovations- noch diejenige einer Involutionsgeschichte als für die untersuchten Texte angemessen. Um den Umstand zu begründen, stellt Madleen Podewskis und Gustav Franks Analyse einen besonders geeigneten Ausgangspunkt dar: »Die Spezifik dieser Phase besteht geradezu darin, dass sich ihre Texte auffällig gegenüber nicht-literarischen Umgebungen (aus goethezeitlicher, realistischer und literaturwissenschaftlicher Sicht) öffnen, legt man die um 1800 etablierte Gattungstrias als Maßstab zugrunde; und sie bringen dabei Mischformen hervor, für die sich keine der heute etablierten Disziplinen so recht zuständig fühlt: Den Philologen sind diese Texturen Ausdruck epigonaler Schwächung des literarischen Form- und Stilbewusstseins von Klassik und Romantik; den Wissenschaftshistorikern Dokumente einer Frühzeit, an denen sich eben die Emanzipation disziplinärer Wissenschaften als noch nicht endgültig vollzogen und allenfalls die mühsamen Anfänge von strenger, objektiver Wissenschaftlichkeit greifen lassen; den Medienwissenschaftlern unliebsame Textzeugen einer Vorgeschichte der Massenpresse, die erst in der Gründerzeit wirksam wird.«11
Podewski und Frank stellen fest, dass das für die vormärzliche Erzählliteratur typische Phänomen der Integration nicht-literarischer Diskurselemente sie zu einem ›Grenzobjekt‹ macht, zu einem Untersuchungsgegenstand also, der eine ungewöhnliche Vielfalt an Forschungsperspektiven zulässt12. Je nach Perspektive rücken unterschiedliche Aspekte in den Mittelpunkt und das erweist sich ohne weiteres als eine Chance. Solange man sich für eine geschichtliche Makroperspektive entscheidet – sei es eine literatur-, wissenschafts- oder mediengeschichtliche –, bleibt allerdings die Vormärzliteratur in einer Form der Abhängigkeit von ›fortgeschrittenen‹ Paradigmen befangen, die früheren oder späteren Zeiträumen (bspw. der Klassik oder der Romantik) entsprechen können. Allen diesen auf Diachronie basierenden Narrationen ist also die Tatsache gemeinsam – so die These –, die Spezifik dieser Literatur nicht wirklich in den Vordergrund rücken zu lassen. Außerdem erweisen sie sich in erzählökonomischer Hinsicht 11 Gustav Frank/Madleen Podewski, Denkfiguren. Prolegomena zum Zusammenhang von Wissen(schaft) und Literatur im Vormärz. In: dies. (Hg.), Wissenskulturen des Vormärz, Forum Vormärz Forschung, Jahrbuch 17 (2011), Bielefeld 2012, S. 13–14. 12 Das im Rahmen der Sozialwissenschaften entwickelte Konzept des ›Grenzobjektes‹ wird hier lediglich eingesetzt, um die angedeutete Vielzahl an Forschungsperspektiven zu betonen. Bei dieser Begriffsverwendung tritt in erster Linie die Möglichkeit in den Vordergrund, am selben Objekt (im Rahmen einer – wohlgemerkt – wissenschaftlichen Betrachtung) heterogene Fragestellungen gleichzeitig und unabhängig voneinander verfolgen zu können. Nicht in Anspruch genommen werden hingegen die ›Koordination‹ der unterschiedlichen Perspektiven sowie die ›Übersetzung‹ des daraus resultierenden Wissens für alle beteiligten Akteure. Vgl. dazu Susan Leigh Star/James R. Griesemer, Institutionelle Ökologie, ›Übersetzungen‹ und Grenzobjekte. Amateure und Professionelle im Museum of Vertebrate Zoology in Berkeley, 1907–39. In: Sebastian Gießmann/Nadine Taha (Hg.), Susan Leigh Star. Grenzobjekte und Medienforschung, Bielefeld 2017 [1989], S. 81–115.
Einleitung
17
als eher ungünstig. Selbst da, wo Vormärztexte als Teil einer Frühgeschichte fungieren können, weisen diese mit Blick auf den ›Endpunkt‹ nur eine beschränkte Tragweite und eine relative strukturierende Funktion auf. Zu diesem Ergebnis kommen einige Beiträge zum Komplex ›Literatur und Wissen‹, die die Wechselbeziehungen zwischen den beiden Bereichen in der Vormärzepoche untersuchen. Bezüglich des wissenschaftsgeschichtlichen Zusammenhangs lässt sich ein Umstrukturierungsprozess beobachten: Theologie und Philosophie büßen im Rahmen der Wissensordnung an Dominanz ein; andere wissenschaftliche Formationen (insbesondere Soziologie und Psychologie) kommen damit ins Spiel13. In einer frühen Konzeptionsphase der vorliegenden Studie setzte man sich mit der Frage auseinander, ob die Untersuchung des Verhältnisses ›Gegenwart‹/ ›Literatur‹ im Vormärz Rückbezüge auf die epistemische Gemengelage und insbesondere auf die ›Krise‹ des Idealismus ermöglichte. Im Grunde wurde damit der Frage nachgegangen, ob das Textmaterial am Prozess der Verwissenschaftlichung im 19. Jahrhundert teilhatte und dadurch eine im Hinblick auf das Gliederungskriterium chronologische Prozessualität hätte gerechtfertigt werden können. Für die These einer ›Krise‹ der Systemphilosophie kamen in erster Linie die Abhandlungen der philosophischen Ästhetik sowie die dem dominanten Paradigma der idealistischen Philosophie gegenüber alternativen Vorschläge für eine Philosophie der Geschichte in Frage. Wie in Kapitel 1 und vor allem in Kapitel 2 dieser Studie aufgezeigt werden wird, sind in diesen Abhandlungen zwar Stellen vorhanden, die Teilentwicklungen erkennen und somit die Teilhabe an einem längeren Verwissenschaftlichungsprozess vermuten lassen. Die Verweise auf eine solche Umstrukturierung bleiben allerdings nur episodisch und lassen dementsprechend weder einen kohärenten Zusammenhang bestimmen noch sich in irgendeine Prozessualität einfügen. Anhand von diesen Texten kann man also feststellen, dass ›neue‹ wissenschaftliche Formationen im Vormärz noch nicht eindeutig und kompakt lokalisiert werden können, weil sie sich vor ihrer wissenschaftlichen Emanzipierung befinden. Das ›neue‹ Wissen, das sich andeutet, lässt sich allenfalls als ›elementar‹ bezeichnen, »weil es ohne systematische Gründungsurkunden […] auskommt; Elemente dieses Wissens sind auf mehrere Texte verteilt, und keiner bringt sie vollständig hervor oder in einen Zusammenhang«14. Deshalb kann man nur »Teilprozesse« und Entwicklungen beobachten, die »keiner Teleologie gehorch[]en«15. 13 Vgl. dazu Gustav Frank, ›Soziologische‹ und ›psychologische‹ Möglichkeitsbedingungen für Geschichtsmodelle um 1850. In: Norbert Otto Eke/Renate Werner (Hg.), Vormärz – Nachmärz. Bruch oder Kontinuität?, Forum Vormärz Forschung, Vormärz-Studien Band V, Bielefeld 2000, S. 85–124. 14 Ebd., S. 93. 15 Ibidem.
18
Einleitung
Aus diesen Überlegungen lässt sich erschließen, dass die allgemeine Tendenz zur Verwissenschaftlichung im 19. Jahrhundert für die hier behandelten Quellen zwar einen bedeutsamen Hintergrund bildet, aber keine adäquate (und ausschließliche) diskursive Verortung sein kann. Eine solche Leitperspektive könnte dazu führen, die für diese Texte tatsächlich relevanten Entstehungszusammenhänge zu übersehen. Die Texte lassen sich nämlich einem kritischen Rezeptionszusammenhang zuordnen, bei dem in erster Linie Hegels Systemphilosophie und Wolfgang Menzels Literaturgeschichte die Instanzen bilden, gegen die sich die Abgrenzungsbewegungen richten. Vor diesem Hintergrund werden meistens auch die im Rahmen dieser Studie überaus wichtigen Reflexionen über alternative Forschungspraktiken angestellt. Die Autoren des ›Jungen Deutschland‹ übernehmen damit – den dominanten diskursiven Positionen sowie dem politischen Status quo gegenüber – die Funktion des Gegen-Diskurses. Da sie die Position der ›Negation‹ besetzen, bleiben ihre kritischen Überlegungen immer noch Paradigma-intern. Diese diskursive Position ist wiederum nur vor dem Hintergrund einer übergreifenden operativen Funktionalisierung des Literatursystems möglich: Sie betrifft die fiktionale Literatur, erklärt die angedeuteten Entdifferenzierungstendenzen und bedingt die Entwicklung neuer Textsorten sowie die Konjunktur publizistischer Genres. Angesichts der für die untersuchten Texte tatsächlich relevanten Diskurszusammenhänge und der angedeuteten beschränkten Tragweite der Bezüge auf die Umstrukturierungen scheint es also angemessener, eine Arbeit zum Vormärz vom Vorhaben zu entlasten, die entsprechende Phase innerhalb des Verwissenschaftlichungs- und Modernisierungsprozesses zur Darstellung zu bringen. Es erscheint deswegen – auch angesichts der erwähnten Tendenz zur Entdifferenzierung – dem Gegenstand gerechter, nach dessen Beitrag zu einer Geschichte des Zeitdenkens sowie der Zeitsemantik zu fragen und in diesem Sinne hauptsächlich nach formalen Analogien zu suchen. Aus diesem Grund wurde eine mit der Zeitsemantik und der -erfahrung verbundene Leitkategorie – eben ›Latenz‹ – ausgewählt, die zugleich Rückbezüge auf formale und epistemologische Aspekte ermöglicht. Dieser Ausrichtung gemäß sind als Kriterien zur Klassifikation der Texte Schreibverfahren bestimmt worden, die jeweils auf gemeinsamen Äußerungsregeln und Konzeptionen basieren. Nach der Einführung der Leitkategorie der ›Latenz‹ in Kapitel 1, werden also in Kapitel 2 die Texte analysiert, die sich unter das Verfahren der ›Historisierung‹ subsumieren lassen. In Kapitel 3 wird auf das Verfahren der ›Bildgebung‹ und schließlich in Kapitel 4 auf das der ›Prognostik‹ eingegangen. Sämtliche Verfahren sind mit der für diesen Zeitraum grundlegenden epistemologischen Operation verbunden, die die Kategorie der ›Latenz‹ bündelt. So liefert beim Verfahren der ›Historisierung‹ die Denkform der ›Geschichte‹ eine Antwort auf den ubiquitären exegetischen Bedarf; im Rahmen des
Einleitung
19
Verfahrens der ›Bildgebung‹ wird hingegen auf eine ›restlose‹ Deutung verzichtet, um nur einige Bilder und Porträts aus der Latenz (heraus-)treten zu lassen; beim Verfahren der ›Prognostik‹ werden schließlich angesichts des Tatbestands ›plausible‹ Entwicklungsverläufe skizziert. Dadurch dass Analogien auf der Ebene der Schreibverfahren und der Äußerungsregeln geltend gemacht werden, überspielt man bei den Primärtexten andere Klassifikationskriterien, wie beispielsweise die ›chronologische Anordnung‹, ›Autorin‹ oder ›Autor‹, ›thematische bzw. inhaltliche Schwerpunkte‹. Dementsprechend können Werke desselben Autors verschiedenen Schreibverfahren zugeordnet werden und Werke, die jeweils am Anfang und am Ende des untersuchten Zeitraums erschienen sind, auf dasselbe Verfahren bezogen werden. Die auffallend unterschiedliche Länge der Kapitel könnte zunächst einmal irritierend wirken. Dass sich die analysierten Texte größtenteils mit dem Verfahren der ›Historisierung‹ assoziieren lassen, ist aber als Befund zu betrachten. Dieser Umstand spricht eindeutig für die Dominanz der Denkform einer geschichtsphilosophisch-fortschreitend konzipierten ›Geschichte‹ in der ›Übergangsperiode‹.
Kapitel 1: Epistemologie der ›Latenz‹
Der in den letzten Jahren im Rahmen der Literatur- und Kulturwissenschaft Konjunktur erlebende Begriff der ›Latenz‹ definiert Bestimmung und Perspektivierung der für diese Studie relevanten Problemfelder; daher beschäftigt sich das vorliegende Kapitel mit der hier intendierten Operationalisierung des Begriffs. Im ersten Unterkapitel werden Geschichte und Pragmatik des Begriffs in den Blick genommen. Durch die Darlegung der geschichtlichen und pragmatischen Begriffsverwendungen treten folgende Reflexionsebenen in den Vordergrund: 1. Die Verbindung der ›Latenz‹ mit epistemologischen sowie 2. ontologischen Fragestellungen und 3. die zeitlichen und zeittheoretischen Implikationen des Begriffs. Die Unterschiedlichkeit dieser Fragestellungen macht also bei der Auseinandersetzung mit dem ›Latenz‹-Begriff grundsätzlich die Ordnung einer Konstellation geltend. Es wird allerdings versucht, anhand der bisher betriebenen Pragmatik (Haverkamp) die zumindest auf argumentativer Ebene vorhandene Verbindung von epistemologischen Aspekten und Zeitreflexionen zu beweisen. Im zweiten Unterkapitel wird mit Belegen aus den Quellen auf epistemologische Konfigurationen (Forschungshaltung, Modalitäten der Wissenserlangung) im Vormärz eingegangen. Dabei wird die These aufgestellt, dass ›Latenz‹ die Ermöglichungsbedingung für die in den Quellen stets anvisierte und oft tatsächlich durchgeführte Operation der Zeitdiagnose darstellt. Abschließend werden die Schreibverfahren (Historisierung, Bildgebung, Prognostik) kurz eingeführt, die auf dieser Operation basieren und die weitere Gliederung der vorliegenden Studie bestimmen. Bevor Geschichte und Pragmatik des Begriffs rekonstruiert werden, sei noch auf den zitatenhaften Charakter des Titels dieses Kapitels eingegangen und damit eine weitere Perspektive auf die Operationalisierung des Latenzbegriffs eröffnet. Der auf Paul de Mans 1978 veröffentlichten Aufsatz Epistemologie der Metapher anspielende Titel verweist auf die unmittelbare Verbindung der ›Latenz‹ mit epistemologischen Fragestellungen. Bei dieser Nebeneinanderstellung muss aber zugleich auf einige Akzentverlagerungen bezüglich der epistemologischen Aspekte aufmerksam gemacht werden, wegen derer ›Metapher‹ oder ›Latenz‹ je-
22
Epistemologie der ›Latenz‹
weils in den Mittelpunkt rücken können. Anhand einer Neulektüre der sich durch dekonstruktive Textarbeit herausstellenden Sprachtheorien von Locke, Condillac und Kant zeigt de Man auf, dass 1. die Vorstellung eines kontrollierten Gebrauchs figürlicher Sprache in wissensvermittelnden Diskursen unhaltbar ist; 2. Begriffe, Symbole und formale Kategorien, derer sich solche Diskurse bedienen, denselben Abstraktionsprinzipien gehorchen, die figürliche Rede prägen. So beschränkt sich die Metapher bzw. figürliche Rede nicht darauf, als Beiwerk Wissen zu verdeutlichen – Wissen und Erkenntnis werden vielmehr von ihr vorstrukturiert1. Bei de Man geht es darum, die basalen, gewissermaßen ahistorischen sprachlich-rhetorischen Prinzipien der Erkenntnis und Wissensvermittlung zu bestimmen; das erfolgt eben mit dem Ziel, die Unhaltbarkeit der von sprachkritischen Ansätzen tradierten Unterscheidungen (beispielsweise Rhetorik und Philosophie) sowie diejenige der Vorstellung einer der Sprache vorausliegenden ›Wirklichkeit‹ einmal mehr zu betonen. Mittels der Beschäftigung mit ›Latenz‹ wird hingegen genereller auf die diskursiv propagierte, erkenntnisstützende Forschungshaltung und die ›Lokalisierung‹ relevanten Wissens verwiesen. Wie zu zeigen sein wird, fußt die Anspielung auf de Man auf einem allerdings ähnlichen, abstraktionsfähigen Verständnis der semiotischen Leistung der ›Latenz‹: Der Akzent wird u. a. auf die Art der Verbindungen gelegt, die aus einem Latenzzustand resultieren.
1.1
›Latenz‹: Geschichte und Pragmatik des Begriffs
Anhand der Geschichte des Latenz-Begriffs2 lässt sich in erster Linie seine disziplinübergreifende Verwendung feststellen: Theologie, Medizin, Physiologie, Philosophie sowie Freuds Psychologie bilden nur einige der Kontexte, in denen der Begriff erscheint. Der Vielfalt der Gebrauchskontexte entspricht die (sich gerade für diese Studie als produktiv herausstellende) schwere Lokalisierbarkeit und Adressierbarkeit des ›Latenten‹: Simon stellt in seinem Lexikonartikel fest, dass das ›Latente‹ bzw. die Latenzzeit grundsätzlich »das Modell zeitmodularer Formierung [unterwandert]«3 und sich »[i]n der individuellen Psyche[,] [i]m kollektiven Unbewussten[,] [i]n historischen Prozessen [oder sogar] [i]n Tex-
1 Vgl. dazu Paul de Man, Epistemologie der Metapher. In: Anselm Haverkamp (Hg.), Theorie der Metapher, übers. v. Werner Hamacher, Darmstadt 1996 [1978], S. 414–437. 2 Vgl. dazu Ulrich Schönpflug, Artikel ›latent‹, ›Latenz‹. In: Joachim Ritter/Karlfried Gründer (Hg.), Historisches Wörterbuch der Philosophie, Basel/Stuttgart 1980, Band 5 (L–Mn), S. 39–46 und Ralf Simon, Artikel ›Latenzzeit‹. In: Michael Gamper/Helmut Hühn/Steffen Richter (Hg.), Formen der Zeit. Ein Wörterbuch der ästhetischen Eigenzeiten, Hannover 2020, S. 218–225. 3 Simon 2020, S. 219.
›Latenz‹: Geschichte und Pragmatik des Begriffs
23
ten«4 lokalisieren lässt. ›Latent‹ und ›Latenz‹ leiten sich vom lateinischen Verb latere ab, das ›verborgen sein‹ oder ›unbekannt bleiben‹ bedeutet. In der Antike wurde der Begriff u. a. von Cicero als Adjektiv in der Auseinandersetzung mit der Frage nach der ›Kausalität‹ verwendet und bezeichnet dort unsichtbare Gründe, die als solche den (scheinbaren) Zufall steuern. Bei Augustinus erscheint der Begriff in Bezug auf den verborgenen Sinn der Schrift und auf ihre Aufdeckung. Im Zusammenhang des Theodizeeproblems verweist der Begriff, u. a. bei Thomas von Aquin, auf die Verborgenheit Gottes in der Welt. Mit der Bedeutung ›verborgen‹, ›nicht manifest‹ wird der Begriff auch in der Medizin gebraucht. Und in der Psychologie sowie Physiologie kommt ›latens‹ in der Bedeutung von ›(nicht) beobachtbar‹, ›ruhend‹ und ›unbewusst‹ vor. So indiziert der Begriff dort, in Kontinuität mit Augustinus’ Begriffsverwendung, eine Nähe zu Fragen nach den Erkenntnismöglichkeiten sowie die Betonung der Beobachtungsinstanz, die im Hinblick auf die im Folgenden anvisierte Operationalisierung des Begriffs für die Vormärzliteratur hervorgehoben werden müssen. In dieser Beziehung erscheint es außerdem nicht unwichtig, vorab zu betonen, dass ›Latenz‹ erst im 20. Jahrhundert im Rahmen der Theorieentwürfe Sigmund Freuds und Ernst Blochs zum zentralen Begriff wird5. Neben den begriffsgeschichtlichen Beiträgen sind in den letzten Jahren auch metatheoretische und theoriegeschichtliche Reflexionen über ›Latenz‹ angestellt worden, die sowohl rückblickend als auch gegenwartsbezogen der Frage nach der Produktivität dieser Kategorie nachgehen. Von der Vielfalt der Gebrauchskontexte ausgehend avanciert bei Hans Ulrich Gumbrecht der Aspekt der »Zentrifugalität«6 zum wichtigsten Kennzeichen des Begriffs: Damit wird auf eine prägende Dynamik verwiesen, die – so Gumbrecht – weder »ein[en] dominante[n] Konvergenzpunkt [noch] eine zentrale semantische Achse ausmachen«7 lässt. Die irreduzible Vielfalt betrifft dabei nicht nur die Semantik, sondern vor allem die Pragmatik der Kategorie der ›Latenz‹, auf die vor allem Anselm Haverkamp mit seinen Büchern Figura Cryptica. Theorie der literarischen Latenz (2002) und Latenzzeit. Wissen im Nachkrieg (2004) aufmerksam gemacht hat8: Sehr hete4 Ebd., S. 218. 5 Vgl. dazu ibidem. 6 Hans Ulrich Gumbrecht, Zentrifugale Pragmatik und ambivalente Ontologie: Dimensionen von Latenz. In: ders./Florian Klinger (Hg.), Latenz. Blinde Passagiere in den Geisteswissenschaften, Göttingen 2011, S. 10. 7 Ibidem. 8 Haverkamps Vorschlag, ›Latenz‹ zum Leitbegriff der Kulturwissenschaften zu installieren, sind u. a. Stefanie Diekmann und Thomas Khurana nachgegangen: In dem von ihnen herausgegebenen Sammelband Latenz. 40 Annäherungen an einen Begriff (2007) werden Latenzphänomene interdisziplinär bei unterschiedlichen Denkfiguren in den Blick genommen (bspw. ›Funktion‹ im soziologischen Funktionalismus, ›Ironie‹, den Metapherntheorien Derridas und Ricœurs, der Figur der ›Tendenz‹ in der Statistik usw.). Zu erwähnen ist darüber
24
Epistemologie der ›Latenz‹
rogene Problemfelder und kaum miteinander zu vereinbarende Ansätze werden durch diese Kategorie freigelegt. Metatheoretisch argumentierend stellt Gumbrecht zudem fest, dass die Konjunktur des Begriffs u. a. symptomatisch für eine epistemologische Verschiebung innerhalb der Kulturwissenschaften ist: Gemeint ist dabei die Reintegration von ontologischen Fragestellungen nach deren durch die Dominanz poststrukturalistischer Ansätze bedingter Relativierung9. Dass das Neuaufkommen ontologischer Fragestellungen gerade mittels der Beschäftigung mit ›Latenz‹ zumindest sichtbar gemacht werden kann, spricht eindeutig für eine ›unkontrollierbare‹ (und paradoxe) Dynamik des Begriffs. Auf seine bisher wiederum nur ›latente‹ Zentralität ist nämlich im Rahmen der Weiterentwicklung dekonstruktiver Theorieansätze aufmerksam gemacht worden, die bekanntlich die Vorstellung einer vor und außerhalb der Sprache existierenden ›Wirklichkeit‹ dezidiert negieren. Es lässt sich darüber hinaus kaum bestreiten, dass ›Latenz‹ auf die in diesem theoretischen Zusammenhang vertretene Grundvorstellung einer aporetischen Struktur der Phänomene sehr prägnant hinweist10. Die ›unkontrollierbare‹ Dynamik des Begriffs ist zudem, wie unten zu zeigen sein wird, für die Geschichtskonzepte, bei denen ›Latenz‹ als Oberbegriff (Haverkamp, Gumbrecht) oder als interne theoretische Kategorie (Bloch) vorkommt, ebenfalls von Belang; mit ›unkontrollierbarer‹ Dynamik ist gemeint, dass bei solchen Geschichtskonzepten gerade die Kategorie der ›Latenz‹ heterogene Zeitbezüge ermöglicht. Bei Haverkamp und Gumbrecht bildet die ›Vergangenheit‹, bei Bloch hingegen die ›Zukunft‹ die Zeitdimension, welche, eine streng logische bzw. zeitmodulare Schematisierung unterminierend, jeweils die ›Gegenwart‹ prägt. Ein kursorischer Blick auf die von Gumbrecht systematisierten Bedeutungen und Funktionen des Begriffs11 kann weitere Bezugspunkte für die hier angestrebte Heuristik anbieten. Mit unmittelbarem Bezug auf die Beiträge des u. a. von ihm herausgegebenen Sammelbandes Zentrifugale Pragmatik und ambivalente Ontologie: Dimensionen von Latenz bestimmt Gumbrecht vier Richtungen, die dieser Begriff aufzeigt und die somit das Feld der durch ihn ermöglichten hinaus der 2018 im Rahmen des DFG-Schwerpunktprogramms 1688 »Ästhetische Eigenzeiten. Zeit und Darstellung in der polychronen Moderne« von Anna-Katharina Gisbertz und Michael Ostheimer herausgegebene Sammelband Geschichte – Latenz – Zukunft. Zur narrativen Modellierung von Zeit in der Gegenwartsliteratur: Hier werden mithilfe des Begriffs der ›Latenz‹ Zeitlichkeit sowie Textverfahren in den Familien- und Generationenromanen der Gegenwartsliteratur untersucht. 9 Gumbrecht 2011, S. 16. 10 Vgl. dazu Daniel Fulda, Weder Bloch noch Gumbrecht. Latenzen in Stephan Wackwitz’ Generationenerzählungen, besonders in »Die Bilder meiner Mutter«. In: Gisbertz/Ostheimer (Hg.), Geschichte – Latenz – Zukunft. Zur narrativen Modellierung von Zeit in der Gegenwartsliteratur, Ästhetische Eigenzeiten, Band 7, Hannover 2018, S. 63–75, hier: S. 66. 11 Ebd., S. 11–12.
›Latenz‹: Geschichte und Pragmatik des Begriffs
25
epistemologischen Operationen umschreiben. Es handelt sich dabei um eine hermeneutische Richtung, in der Phänomene der ›Latenz‹ vorausgesetzt werden, wodurch die Überführung in Wahrnehmbarkeit in den Mittelpunkt rückt; Gumbrechts Klassifikationsvorschlag ergänzend stellen Sigmund Freuds Traumdeutung sowie sein Gesamtkonzept der Psychoanalyse12 begriffs- und theoriegeschichtlich das Beispiel schlechthin für den Zusammenhang von ›Latenz‹ und ›Exegese‹ dar. Gumbrecht bestimmt zudem eine poetologische Richtung, in der literarisch und künstlerisch generierte Effekte der ›Latenz‹ im Fokus stehen; bei einer genealogischen Richtung wird hingegen die Entstehung von Situationen der ›Latenz‹ zum Gegenstand; bei einer ontologischen Richtung wird schließlich »die Frage nach dem Verhältnis zwischen dem, was latent ist, und dem, was unmittelbar wahrnehmbar ist«13, in den Blick genommen. Daran sei zunächst einmal festzuhalten, dass die hermeneutische und ontologische Richtung sowie die zentrale zeitliche Dimension des Begriffs die hier angestrebte Heuristik anleiten. Eine wichtige Verschiebung ergibt sich aber aufgrund des Untersuchungsgegenstandes und der damit verbundenen historischen – und mithin auch ›historisierenden‹ – Perspektive dieser Studie: Erfassen die von Gumbrecht systematisierten Richtungen die möglichen analytischen Operationen und Erkenntnisinteressen aus synchroner Perspektive, so werden sie im Folgenden in diachroner Perspektivierung auf den Vormärz angewendet. Der anhand der Begriffsgeschichte bewiesene Umstand, dass ›Latenz‹ oder ›latent‹ in diesem Zeitraum keine prominente Verwendung erfahren und erst im 20. Jahrhundert bei Freud und Bloch zu (Leit-)Begriffen der entsprechenden Theorieentwürfe werden, erlaubt es, sie in die Beobachtungssprache dieser Studie aufzunehmen. Dieser Leitbegriff sollte eben aufgrund dessen zentrifugaler Dynamik den auch im Vormärz relevanten Zusammenhang von epistemologischen Reflexionen und Zeitordnung in den Vordergrund treten lassen. Durch das von Gumbrechts Überblick inspirierte Interesse für epistemologische Fragestellungen wird das Augenmerk in erster Linie auf den in den Primärtexten enthaltenen methodischen Reflexionen sowie auf den Ermöglichungsbedingungen für die Produktion des in dem Zeitraum für ›relevant‹ gehaltenen Wissens liegen. Historisch-epistemologisch bilden die bloß diskursiv propagierten oder tatsächlich umgesetzten Operationen – so die leitende These – die Bestandteile ungeschriebener, wiederum ins Manifeste zu überführender Äußerungsregeln. Fragen nach der epistemologischen Ordnung und den Zeitstrukturen bzw. dem zur Geltung gebrachten Zeitregime, die hier zu untersuchen sind, scheinen auf den ersten Blick nicht unmittelbar miteinander vereinbar. Die Logik
12 Vgl. dazu Simon 2020, S. 219–221. 13 Fulda 2018, S. 11–12.
26
Epistemologie der ›Latenz‹
des ›Paradigmenwechsels‹14 zeigt aber beispielsweise auf, dass beide Fragestellungen eigentlich – so die These – diskursiv und argumentativ enge, meist kausale Verbindungen eingehen. Der diskursive Zusammenhang von Zeitreflexionen bzw. Zeitdiagnosen und epistemologischer Verschiebung lässt sich in erster Linie anhand von Anselm Haverkamps Problemstellung plausibilisieren. Außerdem lässt dieser Zusammenhang auch die begriffsgeschichtlich relevante Verbindung der ›Latenz‹ mit unterschiedlichen Geschichtskonzeptionen einleiten. Kennzeichnend für dekonstruktive Theorieansätze, in deren Tradition sich Haverkamps Forschungsbeiträge ansiedeln lassen, ist bekanntlich die Kombination von historisch-epistemologischen, zeitdiagnostischen und wissenschaftspolitischen Argumentationsebenen. Vor diesem Hintergrund resultiert also der Vorschlag, ›Latenz‹ als Leitbegriff der Literatur- und Kulturwissenschaften zu installieren, aus dem Zusammenspiel mehrerer Aspekte. Für dekonstruktive Theorieansätze ist zudem die Postulierung eines sprachlich-rhetorischen Aprioris prägend, infolgedessen die allgemeinen Prinzipien rhetorischer Figuration und die sie textuell und paradigmatisch konkretisierenden Figuren eine ebenfalls kennzeichnende Ausweitung ihrer Geltung hin zur phänomenologischen Ebene erfahren15. Von der Ebene minimaler Texteinheiten über diejenige textueller Verfahren erfassen sie dann auch die Strukturen und die – aus dekonstruktiver Perspektive – durch Wiederholungszwang gekennzeichnete Dynamik von ›Geschichte‹ und ›Kultur‹. In Einklang mit dieser bei solchen Ansätzen wiederkehrenden argumentativen Bewegung wird der von Haverkamp aus Baumgartens Ästhetik entnommene Begriff der ›Latenz‹ (figura cryptica) in Verknüpfung mit grundlegenden rhetorischen Prinzipien (›Verdichtung‹ und ›Verschiebung‹) gebracht. In diesem Sinne weiterargumentierend sind insbesondere ›Metapher‹ und ›Anagramm‹ die paradigmatischen Figuren der rhetorischen ›Latenz‹. Bringt beispielsweise das auf minimaler Textbasis lokalisierbare Anagramm unterschiedliche Zeitschichten in Verbindung, so verweist die ›Anagrammatik‹, bezogen auf ›Ge14 Der bekanntlich auf Thomas Kuhn zurückgehende Begriff verweist darauf, dass der das System ›Wissenschaft‹ betreffende Wandel zu einem metonymisch verstandenen Begriff der ›Zeit‹ nicht unverbunden ist. 15 Vgl. zur Ausweitung rhetorischer Prinzipien u. a. Roman Jakobsons Aufsatz Der Doppelcharakter der Sprache und die Polarität zwischen Metaphorik und Metonymik (1956; übers. v. Georg Friedrich Meier) und Paul de Mans Epistemologie der Metapher (1978; übers. v. Werner Hamacher), beide in: Anselm Haverkamp (Hg.), Theorie der Metapher, Darmstadt 1996, S. 163–174, 414–437. Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang zudem Paul de Man, Die Rhetorik der Zeitlichkeit. In: Christoph Menke (Hg.), Die Ideologie des Ästhetischen, übers. v. Jürgen Blasius, Frankfurt a. M. 1993 [1969], S. 83–130. Als Weiterführung dieser grundlegenden Beiträge im Hinblick auf die Möglichkeit, mittels der »rhetorische[n] Lektüre« eine »diskursive Struktur [zu] beschreiben«, vgl. Michael Cahn, Paralipse und Homöopathie. Denkfiguren als Objekte einer rhetorischen Lektüre. In: Helmut Schanze/Josef Kopperschmidt (Hg.), Rhetorik und Philosophie, München 1989, S. 275–295, hier: S. 286.
›Latenz‹: Geschichte und Pragmatik des Begriffs
27
schichte‹ und ›Kultur‹, auf die verborgene und doch wirksame Präsenz unerledigter Vergangenheiten in der Gegenwart. Explizit auf diese Zeiterfahrung geht Haverkamp in einer Stelle in dem Buch Latenzzeit. Wissen im Nachkrieg (2004) ein, dessen Titel schon eindeutig auf die durch das ›postmoderne‹ Zeitregime bedingte neue Konzeption von ›Wissen‹ hindeutet: »Der Druck des Zukünftigen […] ist nach dem Zeitalter der Revolutionen und Weltkriege zersplittert. Hat man erst den monströsen Anspruch der revolutionären Bewegungen hinter sich […], ist der nach-historische, nach-revolutionsgeschichtliche Druck nicht geringer geworden. Zerstäubt und kontingent liegt er im eigenen Heim, der höheren Ziele beraubt, die außerhalb der Erholung in einem nur unbefriedigend Erreichbaren liegen. […]. Bei dieser Notwendigkeit historischer Reflexionen nach der Geschichtsphilosophie handelt es sich […] nicht mehr um einen Bedarf an Entlastung, […] sondern um die Umschuldung von einer zu groß entworfenen Zukunft auf die allfällige Bewältigung all der kleinlichen Vergangenheiten, zu denen sich die verflossenen nationalen Traumata abgeschliffen haben […]. Die Zukunft, die bleibt, ist die Spur einer zufälligen Vergangenheit: eine Instanz von Latenz […].«16
Wie oben bereits angedeutet wurde, bildet die Vergangenheit bei Haverkamps Geschichtskonzept die vorherrschende Dimension; ›Latenz‹ verweist demnach hier auf die gerade anagrammatische Präsenz vergangener Überreste in der Gegenwart und – mit dem Ende der kollektiven, geschichtsphilosophisch angelegten Nationalprojekte und der nicht mehr zu bewältigenden Kontingenz – auf eine nicht einzudämmende Pluralisierung der Zukunft. ›Latenz‹ setzt sich also der zeitmodularen Schematisierung entgegen und dadurch wird auf ein neues Verhältnis der drei Zeitdimensionen zueinander aufmerksam gemacht: Sie sind nicht mehr voneinander unterschieden, sie lösen nicht mehr einander ab, ohne Spuren zu hinterlassen; mithin lässt sich die Zukunft auch nicht mehr mit dem ›Neuen‹ identifizieren. Die in erster Linie von Haverkamp zum Ausdruck gebrachte Notwendigkeit, kulturwissenschaftliche Begriffe zu bereichern, ergibt sich daraus, dass die oben beschriebene Nachkriegssituation, einer durch Wiederholungszwang gekennzeichneten Geschichtskonzeption entsprechend, z. T. typologisch verstanden wird. Auf diese Aspekte macht folgende Stelle aufmerksam: »Kulturwissenschaft ist eine Nachkriegswissenschaft in dem Sinne, dass die Rückfälligkeit in die Barbarei nicht so sehr ihr Gegenstand als ihre methodische Voraussetzung ist. Nicht allein dieser letzte Weltkrieg und dieser Genozid sind als Gegenstand und Milieu prägend, sie bringen an den Tag, dass Philologie und historisch-hermeneutische Methoden Nachkriegsprojekte von Jahrhunderten sind, aus einer tiefen Verkommenheit kultureller Kämpfe hervorgegangen, die den Bedarf an Kulturwissenschaft pro16 Anselm Haverkamp, Latenzzeit. Wissen im Nachkrieg, Berlin 2004, S. 10–11.
28
Epistemologie der ›Latenz‹
duzieren, hervorrufen und verbrauchen, ohne ihn im Wiederholungszwang der Ereignisse zu befrieden oder zu widerlegen.«17
Den in dieser Studie ebenfalls vertretenen argumentativen Zusammenhang von zeitgeschichtlicher Bilanz und epistemologischem Erneuerungsdrang radikalisierend entwickeln sich laut Haverkamp Kulturwissenschaft sowie die zur jeweiligen ›Entstehungszeit‹ ebenso bahnbrechenden Projekte der Philologie und der Hermeneutik aus analogen historischen Situationen. Die charakteristische Nachkriegserfahrung prägt und bedingt solche im Hinblick auf Fragestellungen und Herangehensweisen voneinander sehr unterschiedlichen Projekte gleichermaßen. Mit Bezug auf Haverkamps Schilderung der Nachkriegssituation lassen sich einige durchaus nicht offensichtliche und doch ernstzunehmende Übereinstimmungen mit dem Vormärz feststellen. Wie die nun nicht mehr umstrittene Epochenbezeichnung ›Vormärz‹ bereits an den Tag legt, prägt in erster Linie die vorrevolutionäre Erfahrung die Zeitreflexionen und die Diskurse der Zeitgenossen. Durch den – durchaus überwiegenden Zukunftsbezug – gerät allerdings der Umstand aus dem Blick, dass der auf jeden Aspekt des ›Lebens‹ gerichtete Erneuerungsdrang sowie die messianisch-teleologische Perspektive auch einer Nachkriegssituation entspringen, deren Erfahrung diskursiv ebenfalls reichlich belegt ist. Nach den Befreiungskriegen, also während der sogenannten Restaurationsperiode, setzt sich ein in jeder Hinsicht reaktionäres Klima durch. Auf dieses reagieren die ›zukunftsbegeisterten‹ Visionen, die die in der Gegenwart vorhandenen Latenzen als Zeichen einer sich zu verwirklichenden ›Utopie‹ deuten, genauso wie die elegisch-resignierenden Rückblicke, die die latenten Überreste erneuernder Tendenzen vielmehr als Zeichen für und Mahnung an eine verpasste Chance betrachten. Die letztgenannten vermehren sich einige Jahre nach der Julirevolution (1830) – als die erhofften Änderungen in Deutschland nicht stattgefunden haben – sowie vor allem nach dem Publikationsverbot (1835). Es handelt sich dabei um Ereignisse, die den hier untersuchten Zeitraum (1830–1848) gewissermaßen taktieren und mithin zu einer an dieser Stelle erst einmal anzudeutenden Pluralisierung der Zeiterfahrungen beitragen. Unter den Übereinstimmungen ist zudem die Tatsache zu erwähnen, dass wie die hier aus Haverkamps Text zitierten Stellen auch viele der zu untersuchenden Primärtexte zeitdiagnostische Passagen enthalten, die sich wiederum auf die ästhetische und auf die Forschungspraxis beziehen. Bezüglich des Verhältnisses zwischen ›Zeit‹, ästhetischer Praxis und Forschungspraxis lässt sich in den besagten Passagen die Struktur der Paradoxien erkennen: Die mehrfach konstatierte defizitäre Lage ist Grund für die Unzulänglichkeit zeitgenössischer ›Poesie‹ 17 Ebd., S. 4.
›Latenz‹: Geschichte und Pragmatik des Begriffs
29
und ›Kritik‹; zugleich sollten aber die ›avancierten‹ Versionen derselben, deren Quelle nicht näher identifiziert wird, ausschlaggebend für die Verbesserung der Lage sorgen. Dieser Aspekt, der nun nur kurz vorweggenommen werden kann, bildet den Rahmen, innerhalb dessen sich die epistemologischen Reflexionen situieren lassen. Über die herausgestellten Ähnlichkeiten hinaus sind grundlegende Unterschiede allerdings immer noch vorhanden. Im Grunde indiziert nämlich die ›Nachkriegszeit‹ im 20. Jahrhundert einen neuen ›Führungswechsel der Zeithorizonte‹ und eine andere Form der Zeitreflexionen: Entsteht die Geschichtsphilosophie um 1800 aus dem Bedarf, die steigernde Kontingenz hin zu einem klar konturierten Ziel zu bewältigen, so dienen Zeitreflexionen in dieser spezifischen nach-revolutionären Zeit einer nie sistierenden Aushandlung der kontingenten Spuren der Vergangenheit. Demzufolge löst die Verarbeitung der unerledigten Vergangenheiten den Modus der diagnostischen und prognostischen Selektion ab. Aus diesen Ausführungen lässt sich also festhalten, dass man mit ›Latenz‹ eine epochenübergreifende, nicht ausschließlich auf die unerledigte Dimension der Vergangenheit bezogene Zeiterfahrung umschreiben kann. Der Bezug auf Haverkamp lässt sich schließlich durch die Skizzierung der Schwerpunkte und Forschungsinteressen einer an Phänomenen der ›Latenz‹ orientierten Literatur- und Kulturwissenschaft ergänzen, die sich als Alternative zu den Nationalphilologien und den historisch-hermeneutischen Methoden versteht. Formen des Nicht-Wissens sowie die Sensibilisierung für und Privilegierung sonst unbeachteter Untersuchungsgegenstände (beispielsweise Phänomene der Unbegrifflichkeit) und textueller Verfahren stehen im Mittelpunkt. Außerdem führt das Interesse für Phänomene der ›Latenz‹ zu einer generellen Relativierung des Klartextes zugunsten der semantischen und strukturellen Tiefendimension. Die zeitdiagnostischen Überlegungen Haverkamps haben auch Hans Ulrich Gumbrechts erstmals im Buch Unsere breite Gegenwart (2010) dargelegte These inspiriert, nach der sich mit dem Ende des zweiten Weltkriegs die Entstehung eines neuen Chronotopen plausibilisieren lässt. Dieses Konzept, bei dem ›Latenz‹ noch dezidierter mit psycho-historischen Akzenten18 verwendet wird, hat Gumbrecht zudem auch in Form eines teilweise autobiographischen Essays19 sowie in Zeitungsartikeln weiterentwickelt. Genauso wie bei Haverkamp wird mit ›Latenz‹ dort auf die verborgene Präsenz von Spuren der Vergangenheit in der Gegenwart verwiesen. Wie übrigens auch die autobiographische Auseinandersetzung und die existentiellen Anklänge beweisen, wird bei Gumbrecht die 18 Vgl. dazu Fulda 2018, S. 63, Fußnote 1. 19 Hans Ulrich Gumbrecht, Nach 1945. Latenz als Ursprung der Gegenwart, übers. v. Frank Born, Berlin 2012.
30
Epistemologie der ›Latenz‹
Nachkriegszeit stärker als bei Haverkamp mit der tatsächlich historischen Situation identifiziert und nicht primär als typologisch verstanden. Genauso wie Haverkamp definiert er die postmoderne Zeiterfahrung und Geschichtsvorstellung vor der Folie der ›historischen Zeit‹: War im 19. Jahrhundert die ›Gegenwart‹ als kurzer Zwischenschritt bzw. als »Übergang«20 zwischen ›Vergangenheit‹ und ›Zukunft‹ wahrnehmbar, so ist in der Nachkriegszeit die Vorstellung »einer sich immer mehr verbreiternden Gegenwart« prägend, eine Gegenwart, »über die hinauszugehen wir nicht mehr ernsthaft hoffen«21. Zugespitzt formuliert: Die ›breite Gegenwart‹ enthält nicht länger eine Instanz des ›Übergangs‹. Gerade der zeitphilosophischen Erklärung dieses Moments22 in der Geschichte dient der Begriff der ›Latenz‹ hingegen im utopischen Denken Ernst Blochs (1885–1977). Erst in diesem System erfährt ›Latenz‹ in der Philosophie nach langer Zeit erneut eine begriffliche Realisierung23 und die im philosophischen Diskurs sonst kaum berücksichtigte Dimension der ›Zukunft‹ tritt erstmals in den Vordergrund24. Stützt man sich auf Haverkamps Leitunterschied zwischen ›revolutionärer‹ und ›nachrevolutionärer‹ Zeit, so ist Blochs Geschichtskonzeption, bei der die Vorstellungen einer offenen und freien Gestaltung der Zukunft sowie des Fortschritts leitend sind, noch Produkt einer ›revolutionären Zeit‹. Dass ›Latenz‹ auch bei einer Haverkamp und Gumbrecht diametral entgegengesetzten Geschichtsvorstellung eingesetzt werden kann, spricht erneut für die auch in zeitphilosophischer Hinsicht nachweisbare, eingangs erwähnte ›Zentrifugalität‹ des Begriffs, von der in dieser Studie, mit Blick auf die oben erwähnte Pluralisierung der Zeiterfahrungen im Vormärz, zu profitieren ist. In seinem Idealismus und Materialismus miteinander vermittelnden philosophischen System reaktiviert Bloch den alten, religiös gefärbten Latenz-Be20 »Für jene ›historische Zeit‹, die in den Jahrzehnten nach 1800 heraufgezogen und für das Handeln bestimmend geworden war, in der Welt von Hegel, Marx und auch Darwin, galt das Durcharbeiten der Vergangenheit als Bedingung für die Möglichkeit, Zukunft als einen offenen Horizont zu gestalten; und zwischen dieser Zukunft und jener Vergangenheit wurde die Gegenwart […] als ein ›kaum wahrnehmbarer kurzer Moment des Übergangs‹ erlebt«, Hans Ulrich Gumbrecht, ›Nach der Latenz‹. In: Neue Zürcher Zeitung 04. 02. 2012; http://www.n zz.ch/nach-der-latenz-1.14771415 [30. 04. 2019]. 21 Gumbrecht 2012, S. 60. 22 Vgl. dazu Johann Kreuzer, Vom Möglichen her denken. Zum Begriff der Latenz bei Bloch. In: Gisbertz/Ostheimer 2018, S. 77–92, hier: S. 79. 23 Leibniz’ Theorie der Perzeptionen und der Monaden ist im Grunde eine Theorie der Latenz. In seiner Naturphilosophie nähert sich auch Schelling dem Latenz-Begriff, indem er »eine innere Identität aller Dinge und eine potentiale Gegenwart von allem in allem« behauptet. Vgl. dazu Ulrich Schönpflug, Artikel ›latent‹, ›Latenz‹. In: Joachim Ritter/Karlfried Gründer (Hg.), Historisches Wörterbuch der Philosophie, Basel/Stuttgart 1980, Band 5 (L–Mn), S. 39– 46, hier: S. 40. 24 Vgl. dazu Simon 2020, S. 222.
›Latenz‹: Geschichte und Pragmatik des Begriffs
31
griff 25. Die Aktualisierung der religiösen Bedeutungskomponente erfolgt dennoch, ohne Transzendenz zu implizieren, denn der Moment des Übergangs wird auf die konkreteren und gewissermaßen immanenten Dimensionen des Bewusstseins und der Geschichte übertragen. Dadurch wird außerdem – in Einklang mit der materialistischen Grundorientierung – menschlicher Anteil im Werdegang der Geschichte integriert. Erst einmal als Randbemerkung sei darauf hingewiesen, dass sich in dieser Hinsicht interessante Berührungspunkte mit philosophischen Projekten des Vormärz wiederfinden lassen. Die Übertragung der prozessualen Logik auf die Dimension der Immanenz und die Integration des menschlichen Tuns in der Geschichte, welche wiederum auf zeitphilosophischer Ebene einer Integration von ›Gegenwart‹ in der Geschichtsphilosophie entspricht, prägen auch Ludolf Wienbargs und Theodor Mundts Ästhetiken – ohne dabei den Begriff der ›Latenz‹ zu verwenden. Genauso wie es bei materialistischen Tendenzen der Fall ist, stellen sie u. a. gerade die Hegelsche Vorstellung einer absoluten Überdeterminierung im Bereich der Geschichte in Frage. Angesichts des Schwerpunktes dieser Studie wäre es wenig zielführend, ausführlich über Blochs komplexes System zu referieren. Aus diesem Grund wird hier erst einmal auf das in Folge der Aktualisierung des Latenz-Begriffs resultierende, Bewusstsein und Geschichte prägende Gegenwartskonzept eingegangen; in den Vordergrund rücken somit die zeittheoretischen und -philosophischen Implikationen dieser Begriffsaktualisierung. Wie man in Bezug auf die neueren Geschichtsphilosophien Haverkamps und Gumbrechts sowie auf Freuds Psychoanalyse festgestellt hat, verweisen Blochs Geschichtskonzeption und ›Latenz‹-Begriff ebenfalls auf ein unerschöpfliches Reservoir an unterhalb der chronologischen Zeit lokalisierten und noch zu aktivierenden Instanzen. Folgendes Zitat verdeutlicht zudem, wie ein nicht-modulares Zeitverständnis in Verbindung zu einer nicht umbruchartig, sondern geplant zu verwirklichenden Utopie26 steht: »Etwas ist noch nicht erschienen, aber es lebt in unserer Erwartung, unserer Hoffnung, unseren Träumen […]. Es ruft auf, […], es bewirkt auch, daß wir unzufrieden sind […]. […]. Dieses Nichtsattwerden – der Geschichte zugewandt – verlangt zu begreifen, daß die Vergangenheit ein Strom ist, der auf uns zufließt, durch unsere Gegenwart hindurch in die Zukunft fließt, dort diesen anderen Namen bekommt und doch der gleiche Strom geblieben ist. […]. Dieser Strom aus einer zum größten Teil offenen Vergangenheit […] 25 Doris Zeilinger, Artikel ›Latenz‹. In: Beat Dietschy/diess./Rainer E. Zimmermann (Hg.), Bloch-Wörterbuch. Leitbegriffe der Philosophie Ernst Blochs, Berlin/Boston 2012, S. 232–242, hier: S. 234. 26 Die Vorstellung eines planbaren politischen und historischen Wandels, bei dem sich menschliches Handeln nicht als diskontinuitätserzeugende Tat, sondern als Selektion und Aktivierung von Instanzen der Latenz konfiguriert, verweist auf das Verfahren der ›Prognostik‹, auf das in Kapitel 4 dieser Studie eingegangen wird.
32
Epistemologie der ›Latenz‹
fließt über ein Jetzt und eine Gegenwart, die zum größten Teil räumlich und nicht zeitlich ist (ein Nebeneinander und nicht ein Zugleich im zeitlichen Sinn), in eine Zukunft und gewährleistet so, daß Utopie nicht utopistisch bleibt oder wird und die Verwirklichung von Utopie, von utopisch Gemeintem, Geplantem nicht putschistisch ausschlägt.«27
Obwohl sich auch bei Bloch ›Latenz‹ nicht mit dem ›Möglichen‹ identifizieren lässt, weil von keiner restlosen Verwirklichung die Rede sein kann, dient dennoch ›Latenz‹ hier als »in zeitlich dynamisierter wie erfahrungsgesättigter Hinsicht«28 notwendige Spezifizierung dieses philosophisch traditionsreichen Begriffs. Diesen identifiziert Bloch in Anlehnung an Aristoteles’ Begriff der Materie und Entelechie-Gedanken mit dem Zustand des ›In-Möglichkeit-Seins‹29. Das ›Mögliche‹ (bzw. das ›Vergangene‹ und das ›Zukünftige‹) wird darüber hinaus in diesem System vom ›Wirklichen‹ (bzw. vom ›Gegenwärtigen‹) nicht unterschieden. Diese postulierte Identität ermöglicht die Integration des ›Übergangs‹ und des ›Fortschritts‹ in der Geschichte, wohingegen dieses Moment in einer Vorstellung von ›Zeit‹ als »logische[m] Raum« ohne Entropie, »als bloße[r] Sukzession [und] Aufeinanderfolge miteinander unverbundener Punkte«30 ausgeblendet und nicht erklärbar wäre. Neben der Integration des ›Übergangs‹ und mithin der Zukunftsperspektive, die Bloch auch mittels des in seinem System zentralen Begriffs der ›Tendenz‹ gelingt, müssen weitere, noch grundlegendere Aspekte berücksichtigt werden. Man muss noch einen Schritt zurück machen und sich fragen, in welchem Zusammenhang ›Latenz‹ entsteht. Die Beantwortung dieser Frage erlaubt es, die im nächsten Unterkapitel in Bezug auf den Vormärz konkreter dargelegte Operationalisierung des Begriffs weiter zu begründen. Blochs System steht offenbar in der Nachfolge idealistischer und materialistischer Philosophie; dementsprechend erfolgt die Produktion von ›Latenz‹ in erster Linie im Zusammenhang des Bewusstseins. Von einer solchen Produktion von ›Latenz‹ kann nicht nur im Rahmen individuellen Handelns, sondern auch in Bezug auf Geschichte und Kultur die Rede sein – das hat Folgen für Rezeptionsprozessen sowie den Umgang mit Traditionsbeständen; wie es zu zeigen sein wird, ist das auch für den Vormärz von Belang. Mit Blick auf die idealistische Philosophie, in deren Zusammenhang Blochs Denken steht, muss auf Fichte hingewiesen werden. Bereits in seiner Wissenschaftslehre (1804) verweist er auf die Tatsache, dass Handeln und Reflexion nicht zeitgleich erfolgen können: Jeder individuelle oder geschichtliche Akt produziert für den Handelnden blinde Flecken, Reste, eben 27 Ernst Bloch, Gibt es Zukunft in der Vergangenheit? In: ders., Tendenz – Latenz – Utopie, Frankfurt a. M. 1978 [1966], S. 297. 28 Kreuzer 2018, S. 80. 29 Ebd., S. 87. 30 Ebd. S. 79.
›Latenz‹: Geschichte und Pragmatik des Begriffs
33
Latenzen, die erst nachträglich mittels Reflexion objektiviert sein können31. Im Rahmen von Blochs ›Latenz‹-Begriff lässt sich mithin betonen, dass Latenzen, 1. weil nur rückblickend wahrnehmbar, einen beinahe intrinsischen Vergangenheitsbezug aufweisen und 2. als ›Motor‹ des Übergangs bzw. des geschichtlichen Wandels zugleich zukunftsbezogen sind. Wie bereits betont, sind sie aber zur vollständigen Auflösung oder Verwirklichung nicht bestimmt, weil jede Handlung (und jede Gegenwart) immer wieder Latenzen produziert. Sie lassen sich zudem nicht auflösen, weil in Blochs System diese praktische und im engeren Sinne zukunftsbezogene Dimension, wie Simon herausstellt, vom Begriff der ›Tendenz‹ übernommen wird32. Wichtiger als die Frage nach der Auflösung sowie dem Unterschied vom Begriff des ›Möglichen‹ erscheint dennoch im Rahmen dieser Studie die aus dem Verweis auf Bloch resultierende Tatsache, dass Latenzen, um aus dem Zustand einer wenigstens kognitiven Verborgenheit herauszutreten, unvermeidbar eine Beobachtungsinstanz voraussetzen, die einen Deutungsakt vornimmt. Dieser Aspekt sowie der überaus relevante Zusammenhang von ›Betrachtbarkeit‹ und ›Wissenschaftlichkeit‹ lässt sich anhand dieses Zitats Blochs verdeutlichen: »Dieses Jetzt kann gelebt werden und wird gelebt, – aber es wird nicht erlebt. Kein Mensch ist jemals in dem Jetzt und Hier, in dem er sich unmittelbar befindet, bewußt anwesend gewesen. Das Jetzt liegt im Dunkel des gelebten Augenblicks […]. Das Jetzt ist unsichtbar […] und erst, wenn sein Inhalt gerade vergangen ist, kann er halb, wahrscheinlich nie ganz, doch genug zum Abhalten und Kennenlernen bewußt werden. […]. [E]rst wenn das Geschehene etwas weiter zurückliegt, gewinnen wir den sogenannten Überblick […]. [D]ann erscheint […] die Vergangenheit ganz und gar betrachtbar. Sie wird im Sinn der Betrachtbarkeit immer wissenschaftlicher, je weiter sie hinter der Menschengeschichte zurückliegt.«33
Überträgt man diese Überlegungen auf die Lage im Vormärz und auf die in diesem Zeitraum konstitutive, diskursive Auseinandersetzung mit den Zeitverhältnissen, also nicht unbedingt wie bei Bloch mit dem Zu-weit-Zurückliegenden, so bildet gerade die Zeiterfahrung der ›Latenz‹ die Ermöglichungsbedingung für die Kommunikationssituation, die damals in der literarischen Öffentlichkeit mit Nachdruck gefordert und wiederholt erzeugt wurde. Gemeint ist die nicht zuletzt durch die Konjunktur essayistischer Literatur begünstigte Situation, in der eine Beobachterin oder ein Beobachter eine Zeitdiagnose leistet. Im nächsten Unterkapitel wird auf diesen Aspekt im Einzelnen eingegangen werden. Nun gilt es nur kurz zu rekapitulieren, was sich aus dieser Darlegung festhalten lässt. Aus dem Vergleich der in Betracht gezogenen Konzepte resul31 Vgl. dazu Simon 2020, S. 221. 32 Ebd., S. 222. 33 Bloch 1978 [1966], S. 286–287.
34
Epistemologie der ›Latenz‹
tiert, dass die Operationalisierungen des Latenz-Begriffs in einer ›postmodernen‹ und einer ›revolutionären‹ Geschichtsvorstellung sehr unterschiedlich sind und somit die Ambivalenz der Kategorie der ›Latenz‹ einmal mehr betont werden muss. In Haverkamps und Gumbrechts Geschichtskonzept verweist ›Latenz‹ auf die Identität des Verschiedenen und ist Instanz einer ›statischen‹ Geschichtsvorstellung: Es handelt sich im Grunde um eine Geschichtsvorstellung, die zwar ›Übergänge‹ im Sinne einer Präsenz der ›Vergangenheit‹ in der ›Gegenwart‹, jedoch keinen auflösenden Übergang zulässt. Bei Bloch wird derselbe Begriff hingegen verwendet, um eine ›dynamische‹ Geschichtsvorstellung zeitphilosophisch zu begründen. Wenn man von den offensichtlich entgegengesetzten ›Rahmenbedingungen‹ abstrahiert und zeittheoretisch argumentiert, macht die Kopräsenz und Interferenz unterschiedlicher Zeitschichten den Grundcharakter einer durch ›Latenz‹ gekennzeichneten ›Gegenwart‹ aus. Wie im textanalytischen Teil der Studie gezeigt werden soll, ist gerade dieser Aspekt für die Konzeption und diskursive Auseinandersetzung mit der ›Gegenwart‹ im Vormärz prägend. Die in den Blick genommenen politisch-progressiven Richtungen dieses Zeitraums nähern sich zwar eher Blochs Konzept; allerdings müssen bei der Dominanz einer dynamischen und zukunftsoffenen Gegenwartsvorstellung im Vormärz interne Verschiebungen in Kauf genommen werden34. In diesem Sinne ist die konstitutive Ambivalenz und Offenheit des Begriffs der ›Latenz‹ eine Stärke, durch welche sich die erwähnten kennzeichnenden ›Interferenzen‹ unterschiedlich perspektivieren lassen.
1.2
›Latenz‹ als Ermöglichungsbedingung für Zeitdiagnostik im Vormärz
Im Folgenden werden konkreter die Aspekte dargelegt, die eine Operationalisierung von ›Latenz‹ als Oberbegriff für ungeschriebene Äußerungsregeln und für grundlegende epistemologische Fragen im Vormärz plausibilisieren lassen. Mit ›ungeschrieben‹ wird in erster Linie auf den Umstand aufmerksam gemacht, 34 Auf die Möglichkeit interner, auch in darstellungstechnischer Hinsicht interessanter Variationen spielt Günter Oesterle mit Bezug auf Heines Verschiedenartige Geschichtsauffassung an: »Heinrich Heines schulemachende Betonung, »dass die Gegenwart ihren Wert behalte, und dass sie nicht bloß als Mittel gelte, und die Zukunft« bloß »ihr Zweck sei« erlaubt, komplexe Zeitüberlagerungen von der Gegenwart aus zu gestalten«. Günter Oesterle, Zum Spannungsverhältnis von Poesie und Publizistik unter dem Vorzeichen der Temporalisierung. In: Wolfgang Bunzel/Peter Stein/Florian Vaßen (Hg.), Romantik und Vormärz. Zur Archäologie literarischer Kommunikation in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, Forum Vormärz Forschung, Vormärz-Studien Band X, Bielefeld 2003, S. 199.
›Latenz‹ als Ermöglichungsbedingung für Zeitdiagnostik im Vormärz
35
dass die Begriffe ›Latenz‹ oder ›latent‹ kaum in den Primärtexten vorkommen. Der Begriff der ›Latenz‹ wird aber analytisch verwendet, um, wie übrigens schon Gumbrechts Systematisierung verdeutlicht, die Aufmerksamkeit auf gewisse für die Zeit relevante, im weitesten Sinne des Wortes ›intellektuelle‹ Operationen zu lenken: ›Latenz‹ – so die These – bildet also die Ermöglichungsbedingung für diskursiv rekonstruierbare Forschungshaltungen. So verstanden stellt sie eine argumentative und semantische Leerstelle dar, die auch für die Denkweise dieser Zeit eine gewisse Relevanz besitzt. Auf semantischer Seite, die in dieser Studie im Hinblick auf die Bestimmung von tiefensemantischen und -strukturellen Aspekten funktionalisiert wird, kann eine Reihe von benachbarten Feldern, Symbolen und Metaphern festgestellt werden. Es handelt sich dabei beispielsweise um die mit ›Licht‹ und dem Akt des ›Sehens‹ assoziierten Metaphern sowie um die bei mehreren Bildern relevante Leitunterscheidung zwischen ›Oberfläche‹ und ›Tiefe‹, welche wiederum auf die im Vormärz angestrebte hermeneutische Leistung verweisen. Hervorzuheben sind darüber hinaus die extrem häufig vorkommenden pflanzlichen Symbole (beispielsweise ›Samen‹, ›Saat‹), die zumeist auf teleologische Entwicklungsvorstellungen hinweisen, zugleich aber, mit einer dem ›Anagramm‹ nahekommenden Struktur, die Präsenz zukünftiger Gegenwarten in der Synchronie der Erscheinungen sichtbar machen. Die ›ungeschriebenen Äußerungsregeln‹ implizieren zudem auch ein zeichentheoretisches Verständnis des Verhältnisses zwischen »dem, was latent ist, und dem, was unmittelbar wahrnehmbar ist« (Gumbrecht): Dementsprechend erfasst ›Latenz‹ die für mehrere Diskurse im Vormärz kaum zu überschätzende Relation zwischen ›Empirie‹ und ›Geist‹. Der metaphysische Grundgedanke einer die Erscheinungen steuernden und mithin dieselben zu Zeichen machenden Instanz prägt so beispielsweise die damalige Geschichtswissenschaft sowie die Literaturgeschichte und -kritik. Dieser Gedanke ist insbesondere in zeitdiagnostischer sowie wertungsästhetischer Hinsicht von Belang: Bei den auf Selektion basierenden Operationen der Zeitdiagnose und der Wertung wird nämlich der Zeichencharakter der Erscheinungen bzw. ihr Verweis auf die metaphysische Größe gegen die ›rohe Empirie‹35 zum Einschluss- und Ausschlusskriterium, zum Prinzip, nach dem Gutes und Schlechtes, Wissenswertes und Nicht-Wissenswertes bestimmt werden können. Aufgrund seines Zusammenhangs mit einer Geschichte der Interpretationstechniken bzw. seiner »diagnostische[n] Karriere«36 rücken anhand des La35 Vgl. dazu Theodor Echtermeyer/Arnold Ruge, Der Protestantismus und die Romantik. Zur Verständigung über die Zeit und ihre Gegensätze. Ein Manifest, Hildesheim 1972 [1839], S. 7b–8b. 36 Anselm Haverkamp, Figura Cryptica. Theorie literarischer Latenz, Frankfurt a. M. 2002, S. 10.
36
Epistemologie der ›Latenz‹
tenzbegriffs Fragen nach dem epistemologischen Regime im Vormärz in den Vordergrund. Die Privilegierung solcher Fragestellungen erweist sich darüber hinaus wegen der untersuchten Textsorten als begründet, da zeit-, literaturkritische Essayistik sowie die philosophische Ästhetik37 unvermittelter als die literarische Praxis dazu tendieren, über ihre Leitkriterien zu reflektieren und somit dieselben transparent zu machen: Welche (Forschungs-)Haltung wird von Literaturkritikerinnen und -kritikern, Zeitbeobachterinnen und -beobachter erwartet? Was gilt in der Zeit zwischen 1830 und 1850 als (nützliches) Wissen? Worin bestehen die Operationen, welche die Produktion relevanter Wissensbestände garantieren? Da es an dieser Stelle nicht beabsichtigt ist, diese Operationen aus einer im strengeren Sinne wissenschafts- und institutionsgeschichtlichen Perspektive zu bestimmen, reicht es aus, sich auf ihre Diskursivierung zu stützen. Bei dieser Rekonstruktion bilden somit Selbstbeschreibungen und programmatische Aussagen den Einstiegspunkt. Die untersuchten Texte machen zumeist die ›Zeit‹ bzw. die ›Zeiterscheinungen‹ zu ihrem Gegenstand. Es kann somit die Hypothese aufgestellt werden, dass ihre Erkenntnisleistung primär in einem Akt der Zeitdiagnose besteht, der, wie im vorigen Unterkapitel aufgezeigt wurde, die Erfahrung einer zeitlichen oder eben kognitiven ›Latenz‹ präsupponiert. Historisch-epistemologisch bildet die Voraussetzung für eine diagnostische, deutende Haltung im Rahmen der ›geistesgeschichtlichen‹ Forschungspraktiken38 der im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts erfolgte Übergang von der ›Gelehrsamkeit‹ hin zum modernen Verständnis von Wissenschaft: Diese kaum zu überschätzende Verschiebung betrifft grundsätzlich die Auffassung von Wissen, die Operationen und Praktiken der Wissenserlangung, die Darstellungsformen sowie die Akteure. Da hier die These eines Zusammenhangs von ›interpretatorischem Turn‹ und Latenzzuschreibungen vertreten wird, scheint es angemessen, die Grundunterschiede zwischen ›gelehrter‹ und ›moderner‹ Forschungshaltung zu reflektieren. Im Rahmen ›gelehrter‹ Forschungspraktiken besteht die Leistung der Wissenschaftlerin oder des Wissenschaftlers darin, auf der Basis eines methodischen Studiums sowie gedächtnisgestützt Kenntnisse zu sammeln und in einem schon bestehenden »Netz von zeitinvarianten Begriffen«39 zu verorten. Die gesammelten Kenntnisse sind prinzipiell unbeschränkt vermehrbar, besitzen per se schon 37 Die Nebeneinanderstellung dieser Diskurse rechtfertigt sich in erster Linie durch die Tatsache, dass viele in der Journalistik tätige Autorinnen und Autoren Ästhetiken schreiben. 38 ›Modellbildend‹ für die hermeneutische Forschungshaltung sind wiederum Praktiken im physiologisch-medizinischen Bereich. Vgl. dazu u. a. Albrecht Koschorke, Körperströme und Schriftverkehr. Mediologie des 18. Jahrhunderts, München 2003. 39 Jürgen Fohrmann, Der Intellektuelle, die Zirkulation, die Wissenschaft und die Monumentalisierung. In: ders. (Hg.), Gelehrte Kommunikation. Wissenschaft und Medium zwischen 16. und 20. Jahrhundert, Wien/Köln/Weimar 2005, S. 334.
›Latenz‹ als Ermöglichungsbedingung für Zeitdiagnostik im Vormärz
37
den Status von Ergebnissen und erlangen ihren – grundsätzlich undifferenzierten – Wert durch die Integrationsfähigkeit in einem ihnen vorausliegenden Wissensschema. Demgegenüber besteht die Leistung der ›modernen‹ Wissenschaftlerin oder des ›modernen‹ Wissenschaftlers in der »Erkenntnis von Ursachen«40. Im Rahmen der neustrukturierten Wissensordnung wird also die Selbstgenügsamkeit der gesammelten Daten in Frage gestellt: Sie werden vielmehr zu Zeichen oder Symptomen einer zu bestimmenden Ursache. Die Wissenschaftlerin oder der Wissenschaftler muss im Hinblick auf die Ermittlung einer unsichtbaren, latenten Instanz die Daten einer Selektion unterziehen, um sie dann in einem kausal und zeitlich verlaufenden Sinnzusammenhang zu verknüpfen41. Die Ermöglichungsbedingung für die zusätzliche hermeneutische Leistung bildet gerade die Annahme eines unterhalb der Oberfläche lokalisierten Wissensgehaltes, auf den die gesammelten Daten verweisen. Dadurch eröffnet sich eine zu erleuchtende Tiefendimension. Der Übergang von der Oberfläche bzw. von der Evidenz hin zur erkenntnisversprechenden Tiefendimension ist der Wissenschaftlerin oder dem Wissenschaftler überlassen. ›Latenz‹ umfasst – so die These – Ort und Zustand dieses zu erreichenden Wissens. Im Lichte dieser Ausführungen offenbart sich übrigens noch deutlicher die Relevanz der oben dargelegten Metaphern und Symbole. Inwiefern sind nun die eben beschriebenen Operationen und Forschungshaltungen für die Zeit um 1830 von Belang? Die entwicklungsgeschichtlich konzipierte, sich ›punktuell‹ vollziehende Überwindung der ›gelehrten‹ Forschungspraxis erweist sich offensichtlich als eine unrealistische Vorstellung. ›Überreste‹ von Gelehrsamkeit sind um 1830 immer noch vorhanden und die Sammlung von Daten kann auch im Rahmen der modernen Disziplinentwicklung immer noch notwendig sein: Vom Kernstück der Forschungspraxis wird sie jedoch in diesem Zeitraum zu einem auf die tatsächliche wissenschaftliche Leistung vorbereitenden Moment. Außerdem sind in der Zeit um 1830 Begriff und Vorstellung von ›Wissenschaft‹ sowie die wissenschaftlichen Operationen »noch eher unter- als überbestimmt«42, so dass es diskursübergreifend notwendig erscheint, sich selbst zu positionieren und auf die richtige Forschungs- oder Beobachtungshaltung aufmerksam zu machen. Im Rahmen dieser noch prekären Begriffs- und Praxisbestimmung bildet die interpretatorische Haltung den in den methodischen Reflexionen selbstgesetzten Imperativ. Die Privilegierung einer auf Deutung und Synthese abzielenden Wissenschaftspraxis geht mit der Indienststellung derselben für das ›Leben‹ und die ›Gegenwart‹ sowie mit dem Anspruch einher, im Hinblick auf das nationale Projekt die Wissensbestände 40 Ebd., S. 327. 41 Ebd., S. 330–331. 42 Ebd., S. 328.
38
Epistemologie der ›Latenz‹
einem größeren Publikum zu vermitteln. Der Bezug auf die ›Gelehrsamkeit‹ und die Lebensform des ›Gelehrten‹ dient somit in den Selbstbeschreibungen der Jungdeutschen und Junghegelianer als Kontrastfolie: Im Zuge einer ideologischen Funktionalisierung zahlreicher Begriffe, die auch die Zeitsemantik umfasst43, wird die ›Gelehrsamkeit‹ mit einer vergangenheitsbezogenen und lebensfernen Haltung sowie mit einer tendenziell ausschließenden und asymmetrischen Form der Kommunikation assoziiert44. Die polemische Engführung der gelehrten Forschungshaltung mit der ausbleibenden Herausbildung eines nationalen Subjekts erfolgt beispielsweise in Ludolf Wienbargs Ästhetischen Feldzügen (1834): »[E]s fehlt uns nicht an Gelehrsamkeit, es fehlt uns an einem gemeinsamen Mittelpunkt der Bildung, und Ursache dessen, es fehlt uns an gemeinsamem Leben. […]. Leben wir, um zu lernen? Oder lernen wir vielmehr, um zu leben? […]. Hat es doch in Deutschland sogar den Anschein, als ob die Menschen der Bücher wegen geboren würden. Kläglicher Irrtum, mönchische Verdumpfung, trauriger Rest aus den Klosterzellen. […]. Das bloße Wissen […] hat kein inneres Maß und Ziel, es geht ins Unendliche, sein Stoff zerfließt in Zentilionenteilchen. […]. O wie dieses gelehrte Unwesen seit Jahrhunderten die edelsten Kräfte Deutschlands zur unfruchtbaren Tantalusarbeit verurteilt hat, wie wir Deutsche aus wandernden Helden Stubensitzer, aus Kriegern und Jägern lebenssieche, tatenscheue Magister geworden sind! […]. Bloßes Wissen, sage ich, kann nicht Zweck der Erziehung, nicht Aufgabe des Lebens sein, und ich habe unter Wissen bisher nur den Ballast historischer Positivitäten verstanden, womit Deutschland zum Versinken befrachtet ist. Es gibt aber ein dem historischen und dogmatischen Wissen entgegengesetztes höheres, ein Wissen nicht des Gedächtnisses, sondern des Verstandes, ein selbsttätiges, verstehendes Wissen [Hervorhebung durch die Verf. der Arbeit], das man mit dem Namen des philosophischen bezeichnet.«45
Die Textauszüge46 machen den assoziationsreichen Bezug auf ›Gelehrsamkeit‹ sichtbar: Sie wird mit trockenem, den meisten Menschen unzugänglichem Wissen sowie mit einer Form der »unfruchtbaren« bzw. tatenlähmenden Wissensaneignung gleichgesetzt. Die damit verbundene Forschungshaltung sowie das Verständnis von Wissenschaft werden für eine im europäischen Vergleich verspätete Entwicklung des öffentlichen Lebens in Deutschland verantwortlich
43 44 45 46
Vgl. dazu Wulf Wülfing, Schlagworte des Jungen Deutschland, Berlin 1982. Fohrmann 2005, S. 328. Ludolf Wienbarg, Ästhetische Feldzüge, Hamburg/Berlin 1919 [1834], S. 55–62. Es handelt sich dabei um Auszüge aus der fünften Vorlesung. Die insgesamt aus 24 Vorlesungen bestehende Ästhetik Wienbargs liefert im ersten Teil (1. bis 5. Vorlesung) die Programmatik und in diesem Zusammenhang Argumente für die vorgeschlagene Neubestimmung des Orts der philosophischen Ästhetik im Wissenssystem und die daraus resultierende Ausweitung ihres Zuständigkeitsbereichs. Wie im nächsten Kapitel ausführlicher dargelegt wird, bettet sich die verfolgte Reform der Ästhetik in ein ambitioniertes Projekt der Erneuerung mehrerer Lebensbereiche und Wissensformationen ein.
›Latenz‹ als Ermöglichungsbedingung für Zeitdiagnostik im Vormärz
39
gemacht (»es fehlt uns an einem gemeinsamen Mittelpunkt der Bildung«) und sie erscheinen angesichts des nationalen Projekts als ›unsittlich‹. Im letzten Teil des Zitats gewinnen die zwei bereits vorab skizzierten Formen von Wissen deutlichere Kontur: Auf der einen Seite steht ein Wissen, das sich auf die Registrierung von Positivitäten und Evidenz(en) beschränkt, auf der anderen ein »verstehendes Wissen«; in Wienbargs Stilisierung werden sie als »historisches« und »philosophisches« Wissen bezeichnet. In Einklang mit der zuvor angedeuteten Ausweitung und Metaphorisierung zahlreicher Begriffe werden darunter nicht in erster Linie die Disziplinen verstanden; vielmehr gilt das Augenmerk den entgegengesetzten Verfahren und Forschungshaltungen, mittels derer entsprechende, qualitativ unterschiedene Wissensformen errungen werden. Die Frontstellung zweier Haltungen zum Zweck der Selbstbeschreibung und der Konturierung des Programms lässt sich auch in der Publizistik wiederfinden: Die sonst mit der ›Gelehrsamkeit‹ assoziierten, negativen und für das öffentliche Wohl sogar schädlichen Aspekte einer sammelnden statt selegierenden Forschungs- und Beobachtungshaltung werden auf die bloß berichtende oder ›blind‹ parteiliche »Tagesschriftstellerei«47 bezogen. Beide sind unfähig – so die These der Jungdeutschen – eine Hermeneutik der Zeitverhältnisse zu leisten. Wie es sich übrigens auch bei Wienbarg nachweisen lässt, knüpft die ›progressive‹ Publizistik mehr oder weniger implizit an Ludwig Börnes Konzept des ›Zeitschriftstellers‹ an. Aufgrund der damaligen starken Resonanz dieses Konzepts, das demzufolge auch für die nächsten Kapitel dieser Studie vorauszusetzen ist, eignet sich hier eine ausführliche Darlegung desselben. Ludwig Börne formuliert sein Konzept des ›Zeitschriftstellers‹ in der Ankündigung der Zeitschrift ›Die Wage‹ (1818). Der Text enthält in nuce schon einige Argumente und Standpunkte, die die jungdeutsche Journalistik ebenfalls kennzeichnen: Im Zeichen einer polemischen Absage an die ›Gelehrsamkeit‹ wird die Anbindung der Wissenschaft an das ›Leben‹ emphatisch bejaht und gefördert; im Rahmen dieser Funktionalisierung der Wissenschaft bilden gerade die Zeitschriften das Medium, das die Wissensbestände größeren Leserkreisen zugänglich machen sollte48. Vor dem Hintergrund des Florierens neuer Zeitschriften, das Börne im Prinzip als zu 47 Wülfing 1982, S. 297. 48 »Alles Wissen ist nicht mehr als das Metall, womit sich das Leben bezahlt; für sich ungenießbar, gibt es nur Anweisung auf Genuß, und erst durch Hingeben empfängt man seinen Wert. Aber die Barren der Wahrheit, von Reichen an Geist in großen Werken niedergelegt, sind nicht dienlich, um die kleinen täglichen Bedürfnisse der Unbemittelten damit zu vergelten. Diese Brauchbarkeit hat nur das ausgemünzte Wissen. Die Zeitschriften sind es, welche diese Münzen bilden; […]. Nur sie führen die Wissenschaft ins Leben ein und das Leben zur Wissenschaft zurück«. Ludwig Börne, Ankündigung der Wage. In: Inge Rippmann/ Peter Rippmann (Hg.), Ludwig Börne. Sämtliche Schriften, Band 1, Düsseldorf 1964 [1818], S. 667.
40
Epistemologie der ›Latenz‹
begrüßende Tendenz betrachtet, ist die Vorstellung einer den Unterschied machenden, zeitdiagnostischen Publizistik auch bereits vorhanden: »Wer mag wohl ohne Lächeln […] die Ankündigung einer neuen Zeitschrift in die Hände nehmen? […]. Den Lesern solcher Gesinnung ihren Wahn zu entziehen, als solle eine Zeitschrift nur als Sekundenzeiger an einer Uhr dienen, um den ungeordneten Puls des Staates zu verraten, nicht aber als das Triebwerk selbst, welches die Gänge der Zeit regelmäßig erhält und ihre Fortschritte abmißt, – dieses zu tun wird ein künftiges Bestreben der hier angekündigten Blätter sein.«49
Korrelat dieses Verständnisses der Aufgabe der Publizistik auf der Seite der Autorschafts-Konzepte ist eben der ›Zeitschriftsteller‹: »Wenn ein Zeitschriftsteller auch nur der Fuhrmann der Wissenschaft und der Geschichte wäre, bliebe er doch ein ehrenwerter Mann; aber er ist mehr als das. Er reicht uns das Gefäß, das unentbehrlich ist, um an der Quelle der Wahrheit für den Durst des Augenblicks zu schöpfen.«50
An Börnes Konzept anknüpfend beschreibt Karl Gutzkow so beispielsweise im ursprünglich als Zeitungsartikel veröffentlichten Text Vorläufer oder Nachzügler? (1850) die gewissermaßen durch (und für) die »Zeit« selbst benötigte, richtige Haltung: »[D]ie Erscheinungen fangen an, auf neue Wurzeln hinzuweisen! Von der Oberfläche [Hervorhebung durch die Verf.] wird man bald nichts mehr abschöpfen können, um täglich seinen Leitartikel für eine Zeitung zu schreiben. Diese Zeit fängt an, eisern zu werden und erfordert Männer. Da soll sich ein solcher blasirter Publicist auf seine Ottomane werfen dürfen? […]. Er soll jetzt aufflammen mit neuen Ratschlägen, er soll der hoffenden, zagenden, verzweifelnden Menschheit einen Lichtschimmer durch die dunkle Gegenwart in die Zukunft zeigen.«51
Der Artikel entsteht in der durch reaktionäre Tendenzen geprägten nach-revolutionären Zeit und spielt im Titel auf einen 1849 in der »Augsburger Allgemeinen Zeitung« veröffentlichten Artikel an. In dem von Gutzkow selbst zitierten Artikel wird mit dem Scheitern der Revolutionen den revolutionären Tendenzen überhaupt aufgrund ihres ›abgeleiteten‹ und nunmehr unzeitgemäßen Status die Möglichkeit abgesprochen, in der Öffentlichkeit nachwirken und noch eine Rolle spielen zu können: »Es sterben dort nur die Nachzügler der Bewegung, keine Vorläufer […]. Ihr Blut wird keine neuen Saaten düngen. Die Trauerbilder mögen in künftiger Zeit die elegische Literatur bereichern, in der politischen Atmosphäre von heut verhallen sie«52. Diese von Gutzkow wiedergegebene Stelle 49 Ibidem. 50 Ebd., S. 668. 51 Karl Gutzkow, Vorläufer oder Nachzügler?. In: ders., Vor- und Nachmärzliches, Leipzig 1850, S. 218. 52 Ibidem.
›Latenz‹ als Ermöglichungsbedingung für Zeitdiagnostik im Vormärz
41
erlaubt es, eine Verbindung zu den Überlegungen herzustellen, die im vorigen Unterkapitel in Bezug auf die Latenzerfahrung angestellt worden sind. Zeitphilosophisch gesehen erleben die Zeitgenossen kurz nach 1848 eine nach-revolutionäre Situation, in der die konservativ-reaktionären Stimmen die Präsenz von Resten revolutionärer Energie, d. h. von Latenzen, absolut negieren. Diese Latenzinstanzen könnten noch einen Wandel (oder zumindest eine Dynamik) in revolutionärem Sinne ermöglichen; sie werden aber von den reaktionären diskursiven Positionen nicht wahrgenommen. Die Latenzzuschreibung geht also mit der Forschungs- und Beobachtungshaltung einher, sie ist mit dieser eng verbunden. Solche – laut Gutzkow – tendenziösen Diagnosen verfehlen nämlich den Kern einer sich verändernden Zeit, weil sie die falsche ›Blickrichtung‹ annehmen und nur die »Oberfläche« sehen, nicht aber die tieferliegenden Gründe für die Erscheinungen ermitteln. In diesem Zusammenhang, in dem die oben beschriebene Haltung noch expliziter als sonst politische Züge annimmt und, angesichts der in diesem Zitat angedeuteten Verantwortung der Öffentlichkeit gegenüber, der Leistung des Intellektuellen53 nahekommt, muss die Zeitbeobachterin oder der Zeitbeobachter der Öffentlichkeit Prognosen liefern und somit unsichtbare Entwicklungslinien aufzeigen. Die auf eine allgemein nützliche ›Orientierung‹ abzielende, objektive Zeitdiagnose kann noch dezidierter ideologiekritische Züge gewinnen, wie etwa folgende programmatische Stelle aus Heinrich Laubes zeit- und literaturkritischer Sammlung Modernen Charakteristiken (1835) belegt: »Diese »Charakteristiken« sollen vor allen Dingen orientieren; wenn sie diesen Zweck erreichen, so werden sie auch beitragen, die Verbindungswege [Hervorhebung durch die Verf.] ausfindig zu machen, welche jetzt zwischen den verschiedenen Manifestationen geistiger Thätigkeit abhanden gekommen sind. […]. Ein Resultat solcher Betrachtungen […] wäre also: das fanatische Rechthaben aus der Literatur zu verdrängen, das Scheeren über einen Kamm zu verleiden […].«54
Die Zeitbeobachterin und Literaturkritikerin oder der Zeitbeobachter und Literaturkritiker, die oder der einen tatsächlichen Beitrag leistet, kann somit einen den kleinen politischen Kämpfen übergeordneten Standpunkt beziehen, statt affektbeladen auf die kontingenten Ereignisse und Erscheinungen zu reagieren. Dieser abstrahierende Blick kommt nicht zuletzt auch der literaturgeschichtlichen Rekonstruktion zugute, weil dadurch ebenfalls Kontinuitäten bestimmt werden können: »[E]s [sey] jetzt nicht unsre Aufgabe, feindliche Erbitterung weckende Elemente hervorzusuchen, sondern im Gegentheile den Verbindungslinien zwischen alter und neuer 53 Vgl. dazu Fohrmann 2005, S. 325–479 sowie Jürgen Fohrmann/Carl Friedrich Gethmann (Hg.), Topographien von Intellektualität, Göttingen 2018. 54 Heinrich Laube, Moderne Charakteristiken, Mannheim 1835, Band 1, S. VI, XIV.
42
Epistemologie der ›Latenz‹
Kultur nachzuspüren, Versöhnlichkeit und Humanität zu predigen, die Literatur zu retten aus den politischen Schlachten.«55
Verlässt man die Ebene der auf die zeit- und literaturkritische Praxis bezogenen Selbstbeschreibungen, so weist der Imperativ der Zeitdiagnose eine systemübergreifende Tragweite auf, denn er umfasst auch die ästhetische Praxis. Dabei handelt es sich um einen zur Spekulation tendierenden Modus, der seine Begründung wiederum in der ›Zeit‹ selbst findet: »Eine Durchgangsepoche wie unsere Zeit, wo Leib und Seele eines scheidenden Jahrhunderts sich unter aufschreienden Schmerzen trennen, wo die Sehnsucht wie durstiges Hochland nach erquickendem Regen lechzt, wird nicht die schönsten, aber die innigsten Gedichte bringen. Denn zur Schönheit [Hervorhebung durch die Verf.] fehlt’s an Ruhe, aber zur Wahrheit ist stachelnde Aufforderung da, und jede Wahrheit trifft tief nach Innen, denn sie kommt tief von Innen.«56
Der ubiquitär festgestellte Übergangscharakter der gegenwärtigen Epoche, in der nicht mehr ›Einheit‹, sondern ›Zerrissenheit‹ dominiert, macht also nicht länger eine auf formale Vollkommenheit abzielende Dichtung zur zeitgemäßen Kunst; sie sollte vielmehr mittels hermeneutischer Entbergung die »Wahrheit« finden. Die Kontrastfolie bildet hier sehr deutlich die Kunstperiode. Dieses Gebot, welches temporalisiert und in den prognostischen Aussagen auch bereits historisiert wird, avanciert somit auch zu einer Instanz literarischer Wertung: »Immermann hat zu wenig Geschichtskenntnis, zu wenig historische Intuition. […]. Er schmäht seine Zeit; der ist aber kein großer Dichter, welcher aus seiner Zeit nichts Schönes zu machen versteht, er hat keine Kraft zusammenzudichten, unser neuer großer Poet ist der, welcher mit glücklichem Auge all die Verbindungslinien entdeckt, wo die wirbelnden Theile unsrer jetzigen Tage zusammengehn.«57
Das eben entfaltete Spektrum an Standpunkten ergibt sich aus Texten, die in den nächsten Kapiteln im Einzelnen untersucht werden; damit sollte allerdings erst einmal aufgezeigt werden, wie der Imperativ der Zeitdiagnose, der ›Aufdeckung‹ und ›Abstraktion‹ impliziert, ›Kritik‹ und ›Poesie‹ gleichermaßen betrifft. Die in den Primärtexten – diesem Imperativ zufolge – häufig vorkommende Feststellung, in einer sich als »Vorstufe von Erneuerung, von Umsturz«58 verstehenden Zeit der ›Kritik‹ oder in einer Zeit des ›Übergangs‹ zu leben, muss nun vor dem Hintergrund der Ausführungen über ›Latenz‹ in einem neuen Licht erscheinen. Wenn Ernst Bloch mit dem Begriffspaar ›Latenz‹/›Tendenz‹ den Moment des ›Übergangs‹ bzw. des historischen Wandels zeitphilosophisch zu begründen 55 56 57 58
Ebd., Band. 2, S. 32. Ebd., S. 70. Ebd., S. 101–102. Wülfing 1982, S. 196.
›Latenz‹ als Ermöglichungsbedingung für Zeitdiagnostik im Vormärz
43
versucht, so lassen sich der hier im Rahmen der Beobachtungssprache verwendete Begriff der ›Latenz‹ und die Selbstbeschreibung der ›Übergangszeit‹ ebenfalls miteinander in Verbindung bringen. Die Zeit des ›Übergangs‹ erscheint demnach zugleich als privilegierte Warte, die sich vielleicht ebenfalls außerhalb der chronologischen Zeit befindet und aus der also Instanzen von ›Latenz‹ ermittelt werden können. Die interpretatorische Einstellung, die durch diese Situation angeregt wird, kann also in dieser Studie radikalisiert und zum Kennzeichen des Zeitraums zwischen 1830 und 1848 werden. In den Primärtexten bilden die Zeitverhältnisse (Gegenwart) und die Gegenwartsliteratur den Untersuchungsgegenstand und mithin die wiederkehrenden Inhalte. ›Latenzen‹ werden also im Rahmen dieser Erscheinungen erkannt und können im Hinblick auf den ubiquitär erhobenen exegetischen Anspruch verschiedenartig interpretiert werden. Aus diesem Grund können also in diesem Zusammenhang entsprechende Schreibverfahren bestimmt werden, die es dann in den nächsten, meist textanalytischen Kapiteln in den Blick zu nehmen gilt. An dieser Stelle sei zunächst einmal eine Übersicht über diese Verfahren gegeben. Es handelt sich dabei um: 1- Das Verfahren der Historisierung, im Rahmen dessen den Latenzinstanzen ein Zukunftsbezug und damit eine gewisse Dynamik zugesprochen werden. Diese Dynamik entspricht wiederum einer klar konturierten ›Tendenz‹. Aufgrund dieser Tendenz können die ›Latenzen‹ restlos entziffert – was mit ihrer Aufhebung ja nicht gleichzusetzen ist – und das, was sich in der ›Gegenwart‹ auf die ›Latenzen‹ zurückführen lässt, kann historisiert werden. Wie zu zeigen sein wird, ist vor allem die Leistung der Geschichtsphilosophie in diesem Zusammenhang in Betracht zu ziehen. 2- Das Verfahren der Bildgebung, bei dem nicht die Entfaltung der zeitlichen ›Latenz‹ auf der Basis einer (wie auch immer gearteten) Prozessualität der Geschichte geleistet wird, wie dies etwa beim Verfahren der Historisierung der Fall ist. Vielmehr geht es bei diesem Verfahren um die Operation einer simultanen Sichtbarmachung von etwas Unsichtbarem (beispielsweise dem ›Zeitgeist‹) und das metonymische Verhältnis zwischen Teil (bzw. der partikulären Erscheinung) und Ganzem (bzw. dem ›Geist‹ oder der ›Zeit‹). Dieses Verfahren reagiert ebenfalls auf den zeitdiagnostischen Anspruch, stellt aber im Vergleich zur Historisierung den Versuch dar, einen vorbegrifflichen Zugriff auf die ›Gegenwart‹ und deren ›Latenzen‹ zu haben. Der in der Bezeichnung ›Bildgebung‹ enthaltene, metaphorische Bezug auf die bildende Kunst, der übrigens in den in der Objektsprache häufig verwendeten Metaphern ebenfalls vorkommt, muss nämlich teilweise auch konkret verstanden werden: Die (biographischen) Porträts bzw. Charakteristiken, aus denen die zu untersuchenden zeit- und literaturkritischen Sammlungen bestehen, heben relevante Erscheinungen aus einem (in seiner Ganzheit unsichtbaren)
44
Epistemologie der ›Latenz‹
Hintergrund heraus. Mit der Nähe zur biographischen Anthropologie und der damit einhergehenden Aufwertung der Empirie setzen sich die diesem Verfahren zugeordneten Texte manchmal ausdrücklich der spekulativ-geschichtsphilosophischen Denkform entgegen. 3- Das vergleichsweise seltener zu beobachtende Verfahren der Prognostik, das schließlich anhand von Karl Marx’ und Friedrich Engels’ Manifest der Kommunistischen Partei sowie einigen Texten Gutzkows untersucht wird. Dieses Verfahren erweist sich ebenfalls als eine Alternative zu spekulativgeschichtsphilosophischen Modellen: Die ausbleibende Vorstellung einer Gesamtentwicklung wird durch eine als Verhandlungs- und Entscheidungsraum konzipierte ›Gegenwart‹ ersetzt. Da dadurch menschliches Eingreifen in die Geschichte an Bedeutung gewinnt, stimmt diese Form von Prognostik in vielerlei Hinsicht mit einer auf Wirkung abzielenden Programmatik überein.
Kapitel 2: Historisierung
2.1
Historisierung der ›Gegenwart‹ (Geschichtsphilosophie und Literaturgeschichte)
Die Auseinandersetzung mit ›Gegenwart‹ und ›Gegenwartsliteratur‹ in den Werken Wienbargs und Prutz’, die in diesem Kapitel – zusammen mit anderen Werken – analysiert werden, lässt sich dem (Schreib-)Verfahren der ›Historisierung‹ zuordnen. Mit diesem Begriff wird auf eine für die Neuzeit typische Operation hingewiesen, der die ›Gegenwart‹ ausgesetzt ist. In diesem Zusammenhang kann mit ›Historisierung‹ einerseits gemeint sein, dass ›Gegenwart‹ aufgrund des ›Führungswechsels‹ und des gesteigerten Bewusstseins eines steten, beschleunigten Wandels vermehrt als ›Vergangenheit künftiger Gegenwarten‹ verstanden wird; andererseits kann mit diesem Begriff auf den Aspekt der ›Genese‹ aktueller Verhältnisse verwiesen und damit die gewissermaßen genealogische Relevanz der ›Geschichte‹ für die ›Gegenwart‹ betont werden. Die Vorstellung des ›Wandels‹ sowie das Verhältnis der ›Kontinuität‹ zwischen ›Vergangenheit‹ und ›Gegenwart‹ rücken also jeweils in den Mittelpunkt. Beim näheren Hinsehen lässt sich aber für die erste Bedeutungsmöglichkeit behaupten, dass ›Gegenwart‹ im Hinblick auf ein vorherbestimmtes Endziel betrachtet und gedeutet wird. Vor dem Hintergrund eines Großerklärungsmodells, das von den Vormärz-Autorinnen und -Autoren vorgeschlagen wird, kann man die Funktion gegenwärtiger Verhältnisse erkennen und die Erscheinungen im Lichte dieses spekulativen Modells jeweils relativieren oder doch höher gewichten. Die Leistung der so gemeinten ›Historisierung‹ entspricht im Hinblick auf die Auseinandersetzung mit ›Zeit‹ und Zeitlichkeit in der Gegenwart also dem, was ›Geschichtsphilosophie‹ schlechthin leistet: Diese philosophische Formation fragt ganz grundsätzlich nach dem »Sinn der Geschichte« und versucht mithin »Ziel«, »Richtung« sowie ein mögliches »ordnende[s] Prinzip«1 derselben zu
1 Matthias Schloßberger, Geschichtsphilosophie, Berlin 2013, S. 11.
46
Historisierung
bestimmen. Solche auf den Gegenstand ›Geschichte‹ gerichteten philosophischen Fragestellungen2 implizieren auch jeweils geltend gemachte Zeit- bzw. Zeitlichkeitskonzepte, Periodisierungsvorschläge sowie einen diagnostischen Anspruch: Die angestrebte Rekonstruktion der Tendenzen der Geschichte und damit die Bestimmung einer Logik innerhalb derselben zielen nämlich häufig darauf ab, »die eigene Gegenwart zu verstehen«3. Die in der Geschichte vorhandene Logik steuert also auch die Ereignisse und Erscheinungen in der ›Gegenwart‹. Die ›Gegenwart‹ kann demnach ›historisiert‹ werden, d. h. man kann im Hinblick auf einen rekonstruierten, sich retrospektiv und prospektiv erstreckenden Entwicklungsverlauf Sinn stiften. Unter Berücksichtigung geschichtsphilosophischen Denkens lässt sich also diese Definition von ›Historisierung‹ skizzieren. Die auf die Zeitverhältnisse gerichtete hermeneutische Anstrengung, auf die im Kapitel ›Epistemologie der Latenz‹ hingewiesen wurde und die die im weitesten Sinne gefasste Literatur sowie die öffentliche Debatte im Vormärz besonders stark prägt, kann somit als Ausdruck der Konjunktur geschichtsphilosophischer Fragestellungen betrachtet werden. Diese hängt wiederum mit der als besonders akut empfundenen Rezeption der Philosophie Hegels zusammen. Mit ›Geschichtsphilosophie‹ als wissenschaftlicher Formation befasst er sich bekanntlich in den Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte (1837), in deren Einleitung zwischen drei Arten der Geschichte – der ursprünglichen, der reflektierten und der philosophischen – unterschieden wird. Bezüglich der philo2 Mit Bezug auf die Begriffsgeschichte ist im Jahr 1764 in Voltaires Rezension über David Humes Complete History of England zum ersten Mal von ›Geschichtsphilosophie‹ bzw. ›Philosophie de l’Histoire‹ die Rede. Vgl. dazu Ulrich Dierse/Gunter Scholtz, Artikel ›Geschichtsphilosophie‹. In: Joachim Ritter/Karlfried Gründer (Hg.), Historisches Wörterbuch der Philosophie, Band 3 (G–H), Basel/Stuttgart 1974, S. 416–439. Geschichtsphilosophische Fragestellungen lassen sich aber bis in die Antike zurückverfolgen; ihr Stellenwert hängt wiederum mit der Relevanz von ›Geschichte‹ im Rahmen einer dominanten Grundanschauung zusammen und bedingt die Stellung geschichtswissenschaftlicher Disziplinen im jeweiligen Wissenschaftssystem. So ist die griechische Geschichtsphilosophie »nicht eigenständig, sondern nur Konsequenz und Folie der Metaphysik«; der stark dualistischen Grundanschauung gemäß entwickeln sich nicht primär die Geschichtswissenschaften (etwa Rechts-, Literatur- oder Kunstgeschichte), sondern diejenigen Disziplinen, die »mit dem zeitlos Bleibenden zu tun haben«, wie etwa Mathematik und Naturwissenschaft. Ohne sich von einer metaphysischen Auffassung vollständig zu emanzipieren, bildet die ›Geschichte‹ im Rahmen der biblischchristlichen Geschichtsphilosophie das »Herrschaftsgebiet« und die Dimension der Offenbarung Gottes. Dementsprechend ist hier »das [philosophische] Wissen um die Geschichte […] mehr als Bildungswissen«. Folgt man noch Landmanns Klassifikation, so lässt sich zudem etwas undifferenziert von einer »goethezeitliche[n] Geschichtsphilosophie« sprechen, die durch »die Anwendung des neuzeitlichen Pantheismus auf die Geschichte« und eine damit konsequente höhere Stellung der Materie gekennzeichnet ist. Michael Landmann, ›Kreis und Pfeil‹. In: Zeitschrift für philosophische Forschung, 1965/4, S. 637–654, hier: S. 637, 639, 641– 642. 3 Schloßberger 2013, S. 13.
Historisierung der ›Gegenwart‹ (Geschichtsphilosophie und Literaturgeschichte)
47
sophischen Behandlung der Geschichte wird mit Blick auf die Methoden der involvierten Disziplinen (Philosophie und Geschichte) eine grundsätzliche Diskrepanz durchaus zugegeben: »Das Allgemeine ist […], daß die Philosophie der Geschichte nichts andres als die denkende Betrachtung derselben bedeutet. […]. Diese Berufung auf das Denken kann aber deswegen hier als ungenügend erscheinen, weil in der Geschichte das Denken dem Gegebenen und Seienden untergeordnet ist, dasselbe zu seiner Grundlage hat und davon geleitet wird, der Philosophie im Gegenteil aber eigne Gedanken zugeschrieben werden, welche die Spekulation aus sich ohne Rücksicht auf das, was ist, hervorbringe. Gehe sie mit solchen an die Geschichte, so behandle sie sie wie ein Material, lasse sie nicht, wie sie ist, sondern richte sie nach dem Gedanken ein, konstruiere sie daher, wie man sagt, a priori. Da die Geschichte nun aber bloß aufzufassen hat, was ist und gewesen ist, […] so scheint mit diesem Treiben das Geschäft der Philosophie in Widerspruch zu stehen, und dieser Widerspruch und der daraus für die Spekulation entspringende Vorwurf soll hier erklärt und widerlegt werden […]. Der einzige Gedanke, den die Philosophie mitbringt, ist aber der einfache Gedanke der Vernunft, daß die Vernunft die Welt beherrsche, daß es also auch in der Weltgeschichte vernünftig zugegangen sei.»4
Mit einem harmlos relativierenden Gestus stellt Hegel fest, dass die spekulative Methode der (idealistischen) Philosophie eigentlich mit dem Untersuchungsgenstand ›Geschichte‹ nicht inkompatibel ist, vor allem wenn man nur einen Gedanken zur Leitperspektive erhebt. Aus dem abschließenden, programmatischen Teil dieser Stelle lässt sich also in erster Linie erschließen, dass die »Weltgeschichte« mit Blick auf das gesamte Hegelsche System nur eine weitere Erscheinungsform des Prinzips der Vernunft ist. Die »Weltgeschichte« ist demnach, wie übrigens mit jenem »auch« diskret offenbart wird, der für das ganze System leitenden These untergeordnet, nach der die Vernunft jede Erscheinungsform prägt. Diese These ist, wenn man so will, selber geschichtsphilosophisch und verweist somit auf die im Rahmen Hegelscher Systemphilosophie kaum zu überschätzende Tragweite geschichtsphilosophischer Denkmuster, die es nun weiter zu begründen gilt. Geschichtsphilosophisches Denken wird hier auf mehreren Ebenen aktualisiert und erfährt dabei eine Art Totalisierung, weil sie auch die letzte Entwicklungsstufe der Philosophie darstellt. Der grundlegende Stellenwert geschichtsphilosophischen Denkens lässt sich in erster Linie mit Blick auf dessen systeminterne Situierung5 feststellen: Da sie im Vergleich zum ›Staat‹ eine höhere 4 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, Leipzig 1924 [1837], S. 6–7. Hervorhebung im Original. 5 Vgl. dazu Emil Angehrn, ›Vernunft in der Geschichte? Zum Problem der Hegelschen Geschichtsphilosophie‹. In: Zeitschrift für philosophische Forschung, 1981/3–4, S. 341–364, hier: S. 341, 343–344.
48
Historisierung
Entwicklungsstufe darstellt, fungiert die (Theorie der) Weltgeschichte als abschließender Teil der praktischen Philosophie; besondere Bedeutsamkeit gewinnt sie aber auch durch ihre »Übergangsbestimmung«6, d. h. als Vorstufe zur Theorie des absoluten Geistes. Wie das oben angeführte Zitat belegt, fungiert die ›Vernunft‹ bei Hegel als sich verwirklichende Instanz in der Geschichte. Die zentrale Verknüpfung von ›Vernunft‹ und ›Geschichte‹ manifestiert sich allerdings nicht nur in diesem Systemteil. Die historische Entfaltung dieser Verknüpfung ist nämlich nicht nur inhaltlich relevant, sondern sie erweist sich für Hegels Systemkonzept überhaupt als strukturierend. Sie bildet außerdem die ausgewählte Darstellungsform eines Entwicklungsgangs, dessen höchste Stufe die ›Philosophie‹ ist. Die Dialektik von ›Form‹ und ›Inhalt‹, welche sich in der ›Zeit‹ bzw. ›Geschichte‹ entfaltet, prägt also alle Erscheinungen, die zur höchsten Stufe des Bewusstseins, d. h. dem absoluten Geist, führen. Dieser Entwicklungsgang kann wiederum erst, wenn er abgeschlossen ist, rekonstruiert und erzählt werden. Als retrospektiv und sich selbst historisierend, also sich deren Geschichtlichkeit bewusst, erweist sich eben die Perspektive, die für Hegels Philosophie kennzeichnend ist und durch die sie ›zu sich selbst kommt‹. So ist ›Geschichtsphilosophie‹ nicht nur systemintern relevant, sondern sie gilt als letzte Entwicklungsstufe des Denkens und wird zu Prädikat und Metakategorie der Hegelschen Philosophie und, Hegel zufolge, der Philosophie überhaupt in der Gegenwart. Bekanntlich ist die Rezeption Hegels für die Jungdeutschen und selbstverständlich für die Linkshegelianer ein konstitutiver Aspekt ihrer Überlegungen. Hegel geschuldete Denkmuster und Begriffe sind bei ihnen dermaßen vorhanden, dass man Odo Marquards These einer ›Unüberwindbarkeit‹ der Geschichtsphilosophie7 paraphrasierend sogar behaupten könnte, ihre alternativen Modelle seien »Schwundstufen«, ja »Reduktionsformen«8 Hegelscher Philosophie: Sie wollen diese überwinden und lassen sich doch ohne den Bezug auf Hegel gar nicht näher beschreiben. Diese unabdingbare Formation, also Hegels (Geschichts-)Philosophie, wollen sie allerdings beim näheren Hinsehen gar nicht ›überwinden‹. So radikal ist ihre Kritik am lange Zeit wirkungsmächtigsten philosophischen System eigentlich nicht9. Sie beschränkt sich auf einige Aspekte und bewegt sich dabei immer noch innerhalb geschichtsphilosophischer Rahmenbedingungen. 6 Ebd., S. 342. 7 Vgl. dazu Odo Marquard, Schwierigkeiten mit der Geschichtsphilosophie, Frankfurt a. M. 1973, S. 23–28. 8 Ebd., S. 25. 9 Viel radikaler ist diese Kritik hingegen bei einigen, im nächsten Kapitel behandelten Texten, die für die Darstellung von und die Reflexion über die ›Gegenwart‹ Alternativen zur Geschichtsphilosophie erarbeiten.
Historisierung der ›Gegenwart‹ (Geschichtsphilosophie und Literaturgeschichte)
49
Da – bis auf Gutzkow und z. T. Mundt – keiner der in diesem Kapitel in Frage kommenden Autoren eine ausführliche und streng philosophische Kritik an Hegels System formuliert, lässt sich ihre meist schlagwortartig – und mithin eher unterkomplex – artikulierte kritische Rezeption demnach auf folgende Punkte zurückführen. Ihre Kritik richtet sich 1. auf die rückblickende Perspektive, aus der die Verwirklichung des absoluten Geistes erzählt wird. Der Entwicklungsgang des Geistes hin zur Freiheit und zum vollen Bewusstsein hat sich eben vervollständigt und die historische ›Gegenwart‹ Hegels und seiner Zeitgenossen ist demnach der Ort, aus dem dieser Prozess in seiner Geschichtlichkeit begriffen und erzählt werden kann10. Diese Auffassung der ›Gegenwart‹ ist mit dem revolutionären Impetus der Jungdeutschen sowie der Vorstellung eines noch nicht vollendeten Prozesses offenbar schwer vereinbar. Immerhin teilen viele der Jungdeutschen mit Hegel eine teleologische Geschichtsauffassung; ihre Teleologie unterscheidet sich allerdings von der Hegelschen in der Lokalisierung der sich abzeichnenden Entwicklungsrichtung: Während Hegel aufgrund seines retrospektiven Blicks die Teleologie primär in der ›Geschichte‹ situiert, vollzieht sich die ›jungdeutsche‹ Teleologie erst in der ›Zukunft‹. Ein weiterer Aspekt, der übrigens nicht nur von den Jungdeutschen und den Linkshegelianern als problematisch rezipiert worden ist, besteht 2. in der Eliminierung des Individuums aus der ›Geschichte‹. Hegels System zufolge rücken nämlich in der ›Geschichte‹ Konflikte zwischen Staaten in den Mittelpunkt; das Individuum und die menschliche Tat, deren geschichtsmachende Wirkung Jungdeutsche und Linkshegelianer dagegen mit Emphase heraufbeschwören, spielen im geschichtlichen Zusammenhang also kaum eine Rolle. Anders als Kant, der die Staatsgründung kontraktualistisch konzipiert und dem Individuum in dieser Beziehung eine wichtige Funktion zuschreibt, lässt sich bei Hegel hingegen eine »Verabsolutierung des Staates« feststellen, der alleine das »ideelle[] Moment eines höheren Allgemeinen«11 bildet. Ein ebenfalls problematischer Punkt Hegelscher Philosophie stellt für die Vormärz-Autorinnen und Autoren schließlich 3. die Zielrichtung des erzählten Prozesses dar. Während bei Hegel die Philosophie das Endziel dieses Prozesses bildet, besitzt die anvisierte Veränderung bei den Jungdeutschen und Linkshegelianern eine vornehmlich politisch-sittliche Dimension, die, wie es zu zeigen sein wird, mit ›Kultur‹ und ›Literatur‹ auf unterschiedliche Art und Weise in Verbindung stehen kann. Von der in streng philosophischer Hinsicht tatsächlichen Verlässlichkeit ihrer Rezeption mal abgesehen, plädieren Jungdeutsche und Linkshegelianer also für die Integration menschlichen Handelns in der Geschichte und, noch grund-
10 Vgl. dazu Angehrn 1981, S. 356. 11 Ebd., S. 346–347.
50
Historisierung
sätzlicher, für die Unabgeschlossenheit derselben12. Im Rahmen der Rezeption Hegels lassen sich wiederum einige Positionen unterscheiden, die von genuin fortschrittlich-teleologischen (Prutz) bis hin zu zyklisch-biologischen (Wienbarg) Vorstellungen reichen. Formal gesehen stimmen diese Positionen allerdings miteinander – und nicht zuletzt auch mit Hegel – in der ›Historisierung‹ der ›Gegenwart‹ überein. Im Rahmen der im Kapitel ›Epistemologie der Latenz‹ bereits beschriebenen Aufgaben des ›Zeitschriftstellers‹ sowie der von Wienbarg und Prutz angestellten Selbstbeobachtungen, Zeitdiagnosen und Prognosen herrscht die gemeinsame Tendenz vor, die ›Gegenwart‹ als Teil eines übergeordneten geschichtlichen Prozesses zu sehen. Die Vorstellung eines ›Zusammenhangs‹, an dem die ›Gegenwart‹ partizipiert, und deren Einbettung in eine synthetisierende historische Erzählung kennzeichnen somit die Analysen und Überlegungen dieser Autoren. Mit dem Verfahren der ›Historisierung‹ kommt auch ein anderes Konzept von ›Gegenwart‹ zur Geltung. Die Vorstellung der ›Flüchtigkeit‹, die sonst im Rahmen moderner Zeitkonzepte der ›Gegenwart‹ anhaften kann, tritt nämlich bei diesen Schriften in den Hintergrund. Die mit der ›Gegenwart‹ assoziierte Vorstellung der ›Flüchtigkeit‹ zeigt in erster Linie eine kognitive Kehrseite: Das, was flüchtig ist, entzieht sich einer Sinnsicherung. Wie im nächsten Kapitel zu zeigen sein wird, spielt diese Idee beim Verfahren der ›Bildgebung‹ eine große Rolle. Insbesondere prägt sie Gutzkows Zeitgenossen und liegt der ›dokumentarischen‹ Funktion seiner Beiträge zugrunde: Der Sinn muss der zeitgenössischen Beobachterin oder dem zeitgenössischen Beobachter, so Gutzkow, teilweise unvermeidlich unzugänglich bleiben; erst die Nachgeborenen werden diesen latent vorhandenen Sinn erfassen können. Bei Wienbargs und Prutz’ Aufsätzen sowie anderen ähnlich konzipierten Beobachtungen wird hingegen alles interpretiert und allem eine Funktion in der Gesamtentwicklung zugesprochen; das, was anscheinend als kontingent gilt, wird damit zum Notwendigen. Es handelt sich dabei also um eine restlose Entzifferung des Latenten. Die ›Historisierung‹ der ›Gegenwart‹ setzt deshalb nicht nur eine teleologische Perspektive voraus, aufgrund derer die aktuellen Erscheinungen und Tendenzen bereits transzendiert und normalisiert werden können; semiologisch betrachtet impliziert sie auch eine restlose Lesbarkeit der Zeichen und der Ereignisse. Mit dem Verfahren der ›Historisierung‹ kann schließlich auch eine (nicht nur) damalige literaturwissenschaftliche Forschungspraktik bezeichnet werden. Im Rahmen einer sich immer deutlicher mit der ›Literaturgeschichte‹ identifizie12 Mit Marquard argumentierend entspricht dieses alternative Modell »einer frühen […] Schwundstufe[]« der Geschichtsphilosophie: »der Mäßigung der Geschichtsphilosophie zur Position des historischen Sinns; er formiert sich durch die Eliminierung des geschichtsphilosophischen Gedankens des Systems aus der Historie durch Ermächtigung der Kategorie der Individualität«. Marquard 1973, S. 25–26.
Ludolf Wienbargs Ästhetische Feldzüge (1834)
51
renden Disziplin, wird ›Geschichte‹ auch bei Beiträgen zur Gegenwartsliteratur zur vorherrschenden und erkennbaren Denkform. Momente des Wandels oder der Kontinuitätsstiftung, welche eine geschichtliche Narration kennzeichnen, werden demnach von literarischen Erscheinungen konkretisiert. Näher beschreiben lässt sich diese Form der ›Historisierung‹ weiter unten u. a. am Beispiel von Prutz’ Kleine Schriften.
2.2
Ludolf Wienbargs Ästhetische Feldzüge (1834)
Der Zusammenhang von Zeitdiagnose und Anspruch auf epistemologische Erneuerung, auf den im ersten Kapitel eingegangen wurde, hat in Wienbargs Ästhetische Feldzüge einen kaum zu überschätzenden Stellenwert. Nicht von ungefähr sind die 24 im Jahr 1833 in Kiel gehaltenen Ästhetik-Vorlesungen sowohl von den Zeitgenossen als auch von der Forschung vor allem hinsichtlich des dargelegten Erneuerungsprogramms rezipiert worden, das viele Bereiche des Lebens betreffen sollte. So gilt Wienbargs Ästhetik-Entwurf in zahlreichen Forschungsbeiträgen zum Vormärz als (unfreiwillige) Programmschrift, die den zeitgenössischen progressiven Autorinnen und Autoren u. a. ein Set von Schlagworten zur Verfügung stellt; zudem tragen diese Ästhetik-Vorlesungen entscheidend dazu bei, die – bereits in der Aufklärung vorhandene – Rhetorik des Kampfes zwischen ›Altem‹ und ›Neuem‹ erneut zu aktualisieren. Wenngleich die Forschung die diskursgeschichtliche Relevanz der Ästhetische Feldzüge mehrfach thematisiert hat, sind deren im Rahmen der ästhetischen Kommunikation diskontinuitätserzeugende Elemente bislang völlig aus dem Blick geraten. Die Studien, welche die philosophische Ästhetik aus literaturwissenschaftlicher Perspektive systematisieren (u. a. Plumpes Studie Ästhetische Kommunikation der Moderne), bestimmen insgesamt drei ÄsthetikTypen – Kants Transzendentalästhetik, die idealistische Gehaltsästhetik (Hegel) und die Ästhetik des Lebens (Nietzsche) –, ohne dabei die Ästhetik-Entwürfe des Vormärz in die Gesamtbetrachtung zu integrieren. Diese werden bei Plumpe eigentlich lediglich im Hinblick auf die Popularisierungstendenzen im 19. Jahrhundert flüchtig angedeutet, um dann auf Nietzsche zu kommen. Völlig außer Acht bleibt also das ›Neue‹ an dieser Ästhetik, die nun im Folgenden darzulegen ist. Weder hier noch in den bereits vorliegenden Studien steht der Umstand in Frage, dass sich die vormärzlichen Ästhetik-Entwürfe dem Paradigma der idealistischen Gehaltsästhetik zuordnen lassen. Durch den unterstellten epigonalen Status werden allerdings kleine und doch bedeutsame Verschiebungen weitgehend übersehen. Im Unterschied zur Systemphilosophie idealistischen Typs konfrontiert Wienbargs Ästhetik nämlich mit einer anderen Problemlage:
52
Historisierung
Während die Systemphilosophie »seit Kant vor der Frage steht, wie die Bereiche von ›Erfahrung‹ und begrifflicher ›Spekulation‹, von ›Sein‹ und ›Begriff‹ zusammenzudenken sind«13, verlegt Wienbarg die immerhin zentrale Vermittlungsproblematik auf die Gebiete der ›Wissenschaft‹ und des ›Lebens‹, auf die Operationen des ›Erkennens‹ und des ›Handelns‹. Man könnte wohl einwenden, dass es sich dabei lediglich um ›andere‹ Begriffe handelt, die die ›alten‹ bzw. etablierten nur ablösen, ohne eine wesentliche Akzentverlagerung zu implizieren. Bei näherem Hinsehen erfolgt dann doch eine wichtige Sinnverschiebung der miteinander zu versöhnenden Bereiche: Während mit ›Erfahrung‹ und ›Sein‹ auf die sich, aufgrund der apriori gegebenen Kategorien, universal gleich konfigurierenden Erfahrungsmodi hingewiesen wird, verweisen ›Leben‹ und ›Handeln‹ spezifischer auf die Möglichkeit, durch ›Taten‹ das Reale zu ändern. Es liegt mithin auf der Hand, dass die etwa bei Hegel rein philosophische Vermittlungsproblematik bei Wienbarg dezidiert – und wahrscheinlich aufgrund kontingenter Zielsetzungen – in den Bereich des ›Politischen‹ verlagert wird. Eine qualitativ ähnliche Verschiebung lässt sich auch bei Theodor Mundts Aesthetik. Die Idee der Schönheit und des Kunstwerks im Lichte unserer Zeit (1845) beobachten: Hier wird das dialektische Denkmodell der idealistischen Philosophie durch Abschaffung der metaphysischen Seite in die Eindimensionalität der ›Immanenz‹ übertragen. Angesichts dieser Verschiebungen kann also nur als konsequent erscheinen, dass diese Ästhetik-Entwürfe für eine Reform dieser Disziplin plädieren, welche in erster Linie zur Neubestimmung ihres Begründungszusammenhangs und zur Ausweitung ihres Zuständigkeitsbereichs führen sollte. Und das auf ›Ästhetik‹ bezogene Attribut ›philosophisch‹ wird mithin fraglich. Im Zuge der unternommenen Revision und Neujustierung dieser Disziplin kennzeichnen sich diese Ästhetik-Entwürfen zudem durch zeitliche Offenheit. Der Entwicklungsgang des Geistes hat sich demnach weder vervollständigt noch ist er vorbestimmt. Dieser Aspekt bringt eine Integration von ›Zeit‹ mit sich, die anders ist als diejenige, die sich in Hegels System beobachten lässt. Aufgrund der ›Offenheit‹ der Perspektive spielt die Dimension der ›Zukunft‹ eine große Rolle und den gegenwärtigen Verhältnissen wird ein höherer Stellenwert eingeräumt. Der Zusammenhang von ›Zeitdiskursen‹ bzw. ›-diagnosen‹ und ›wissenschaftspolitisch bedingter Erneuerung‹, die im ersten Kapitel dargelegt wurde und die Integration des Begriffs der ›Latenz‹ in die Beobachtungssprache begründet, lässt sich also in diesen Ästhetik-Entwürfen ebenfalls feststellen. Folgende Stelle aus Mundts Ästhetik kann das besonders effektiv belegen:
13 Ingo Stöckmann, Artikel ›Ästhetik‹. In: Thomas Anz (Hg.), Handbuch Literaturwissenschaft, Band 1, Stuttgart/Weimar 2007, S. 470.
Ludolf Wienbargs Ästhetische Feldzüge (1834)
53
»Wenn Hogarth die Wellenlinie als das eigentliche Prinzip der Schönheit erkannte, so werden auch wir uns wenigstens darin diesem Prinzip zuzuwenden haben, daß wir in der Wissenschaft des Schönen zugleich die Wellenlinie der Zeit […] abmessen und belauschen wollen. Ja, wir werden die wissenschaftliche Betrachtung der Kunst […] zugleich als eine solche Grundlage unserer Bildung erkennen müssen, die uns würdig und stark macht, das Gesetz der Freiheit in allen unsern öffentlichen Entwicklungen rein und groß zu verwirklichen; wir werden in der wahrhaften Erkenntnis der Kunst und der Schönheit heranzutreten haben zu der ächten Quelle der Verjüngung für unser politisches Leben […]«14
Dieses Zitat verdeutlicht die Tragweite des Projekts der Erneuerung und betont, wie wichtig es ist, sich vor allem in einem vorrevolutionären Zusammenhang mit dieser Disziplin zu beschäftigen. Bei Mundt rückt außerdem die Frage nach der Anschlussfähigkeit der Geschichtsphilosophie Hegels für »die konkrete Situation des Hier und Jetzt«15 in den Mittelpunkt. Inwieweit kann also ein vorgezeichneter und vorherbestimmter Entwicklungsverlauf, nach dem ›Gegenwart‹ nur noch mit elegischen Beiklängen als Zeit der Prosa bezeichnet wird, mit einer ereignishaften und diskontinuitätsgenerierenden Konzeption von ›Zeit‹ bzw. ›Gegenwart‹ vereinbar sein? Die eben beschriebene Verlagerung der Perspektive auf die ›Gegenwart‹ kennzeichnet auch Wienbargs Ästhetik-Entwurf. Da seine Reform der (nun nicht mehr philosophischen) Ästhetik sich in ein ambitioniertes Projekt der Erneuerung mehrerer Lebensbereiche und Wissensformationen einschreibt, schlägt er beispielsweise im Rahmen der Geschichtswissenschaft die Ersetzung der charakteristischen rückblickenden Perspektive durch die etwas paradox anmutende ›Zeitgenossenschaft‹ der Historikerin oder des Historikers vor: »[I]st das der Weg zur Geschichte, kann selbst in späteren, sogenannten hellen und historischen Zeiten etwas zur Geschichte erhoben werden, was nicht im Ursprung Geschichte war? [Hervorhebung durch die Verf.] […]. Geschichte ist nicht das Resultat gelehrter Forschungen, sie springt nackt und schön wie Aphrodite aus dem Schaum der Wellen, wie Minerva in unmittelbarer Vollendung aus dem Haupte der kreisenden Zeit. […]. Der wahre Geschichtsschreiber muß das Spiel der Harmonien in unmittelbarer Gegenwärtigkeit ergreifen, im historischen Konzertsaal, unter den schwellenden Tönen, den ringenden, jauchzenden Menschen, da fesselt er mit unnachahmlichem Zauber das Unsichtbare an das Sichtbare, den Geist an die Erscheinung, den Sinn an die Tat [Hervorhebung durch die Verf.]. Geschichtliche Wahrheit – […] ist sie nicht das Leben, selbst gelebt und angeschaut von einem Genius, schwebend auf den Flügeln seiner Zeit, in ihre Ströme seiner Feder senkend, wie ein begeisterter Apostel niederschreibend, was der zur Tat gewordene, der Fleisch gewordene Geist der Zeiten ihm diktiert?«16 14 Theodor Mundt, Aesthetik. Die Idee der Schönheit und des Kunstwerks im Lichte unserer Zeit, Berlin 1845, S. 20. 15 Norbert Otto Eke, Einführung in die Literatur des Vormärz, Darmstadt 2005, S. 107. 16 Wienbarg 1919 [1834], S. 34, 36.
54
Historisierung
Wie Börnes ›Zeitschriftsteller‹ muss Wienbargs Geschichtsschreiber mit Blick auf die Forschungshaltung in der Lage sein, das Latente und Unsichtbare an den Erscheinungen und Ereignissen, die er miterlebt, zu bestimmen. Steht dieses Gebot im Einklang mit den im ersten Kapitel bereits dargelegten Forschungsmaximen, so stellt sich hingegen die Neukonzeption von ›Geschichte‹ bzw. ›Geschichtswissenschaft‹ als vergleichsweise radikaler heraus: Abgekoppelt wird sie von ihrem Untersuchungsgegenstand schlechthin – der Vergangenheit. Und doch lässt sich das, worauf Wienbarg anspielt, nicht bloß durch Begriffe wie ›Zeitgeschichte‹ oder gar ›Kulturgeschichte‹ umformulieren. Die angestrebte Vermittlung von ›Wissenschaft‹ und ›Leben‹, von ›Geschichte‹ und ›Leben‹ setzt ein qualitativ anderes Verständnis von ›Geschichte‹ voraus. Diesem Verständnis zufolge ist ›Geschichte‹ nicht mit vereinzelten ›Ereignissen‹ identifizierbar, die dann erst mithilfe zeitlichen Abstands angemessen erforscht und eingeschätzt werden können; sie ist vielmehr das, was jede Erscheinung überhaupt prägt und mithin das Leben der Zeitgenossen gewissermaßen mehrdimensional betrifft. Aufgrund der ›direkten Beobachtung‹ zeigt Wienbargs alternative Methode eine Ähnlichkeit mit der empirischen Methode einiger Naturwissenschaften auf. Mit der angestrebten Emanzipierung vom philosophischen Begründungszusammenhang sowie vom Systemzwang will Wienbarg zudem betonen, dass die Ästhetik dem ›Gesetz‹ der historischen Variabilität17 ausgesetzt ist; dieses kann also deren Methode und Untersuchungsgegenstände betreffen. Das wirft die Frage nach dem problematischen Verhältnis zur ›Tradition‹ auf, das Wienbarg besonders intensiv beschäftigt. In der dritten Vorlesung, einer der ›programmatischen‹ und meist rezipierten, geht er auf diesen Aspekt ein und vertritt dabei einen ebenfalls ziemlich radikalen Standpunkt: »[…] die Hoffnung der Zukunft [beruhe] einerseits auf der Jugend, andererseits auf der Wahl desselben Weges, auf dem Luther den ersten Riesenschritt machte und auf dem ihn die Pygmäen der Folgezeit in Stich gelassen haben. Ich meine auf dem Wege des 17 »Nach der gegebenen Einleitung, meine Herren, wird es Ihnen klar geworden sein, daß wir der Ästhetik sowohl einen weitern Umfang, als eine tiefere Bedeutung einzuräumen haben, als dies in den gewöhnlichen Ästhetiken zu geschehen pflegt. Es gibt Wissenschaften, deren Zeitraum und Peripherie seit alters so ziemlich gleichmäßig bestimmt gewesen, wie z. B. die Mathematik, die Logik. Diese stehen gleichsam über der Geschichte, indem sie sich zu allen Zeiten wesentlich gleich sehen, und in Anlage und Ausführung […] nur solcher Veränderungen fähig sind, welche als bloße Erweiterungen von innen heraus treten. […]. Allein es war auch nur meine Absicht, diese Wissenschaft [die Mathematik] […] zum Gegensatz auf jene andern Zweige des Wissens zu leiten, welche von vornherein sich mit irdischem Heimatsgefühl zum Menschen gesellen und an den höheren geistigen Evolutionen des Geschlechts innigen Anteil nehmen. Dahin zähle ich die Studien der Natur und Kunst, die gleichsam Hand in Hand mit ihren Zeitaltern fortgehen, ihre Geschichte teilen. Dieselbe geschichtliche Natur hat die Ästhetik. Sie beruht auf dem Leben, ist mehr oder minder lebendig, tief oder oberflächlich, welk oder blühend, je nachdem das Herz, das in einem Zeitalter pulsierte, das eine oder das andere war«, ebd., S. 68–70.
Ludolf Wienbargs Ästhetische Feldzüge (1834)
55
Protestierens […] gegen totes und hohles Formelwesen, […] wider die Ertötung des jugendlichen Geistes auf unsern Schulen, […], wider die Duldung des Schlechten, weil es herkömmlich und historisch begründet [Hervorhebung durch die Verf.], […], wider die ganze feudal-historische Schule, die uns bei lebendigem Leibe aus Kreuz der Geschichte nageln will […]. Es ist eben zu dieser Zeit […] die Historie selber zur Lüge geworden und die Behauptung, es müsse sich das Neue aus dem Alten […] allmählich fortentwickeln, ist eben die abgeschmackteste Lüge, womit der Anbruch des Neuen zurückgehalten werden soll [Hervorhebung durch die Verf.]. Es ist wahr, es liegt im Gange der Menschheit, sich in der Dauer gewisser Epochen am Positiven weiterzubilden; allein nicht weniger wahr ist es, daß mit dem Schlusse dieser Epochen die geistige Entwicklung völlig aufhört – das Positive verfault, es muß ein neuer Lebensfunke in die Brust der Menschheit fallen, zur neuen Entwicklung von Formen und Gebilden, welche ebenfalls ihre Zeit haben, um zu blühen, zu wachsen, zu welken und zu vergehen [Hervorhebung durch die Verf.]. […] [Ich] sehne mich unter jenen geschichtslosen Menschen zu leben, die nichts hinter sich sehen, als ihre eigenen Fußstapfen und nichts vor sich als Raum, freien Spielraum für ihre Kraft.«18
Im Rahmen einer ›Fortschrittsgeschichte‹ – also einer Geschichtsvorstellung, bei der das ›Neue‹ das ›Gegebene‹ überspielen kann – wird hier die Vorstellung der ›Kontinuität‹, und mithin der (vermeintliche) Beitrag der ›Tradition‹ zum ›Neuen‹, negativ betrachtet. Der Idee, nach der das ›Alte‹ bewahrt werden sollte, damit sich aus diesem das ›Neue‹ entwickeln kann, wird eine Art creatio ex nihilo gegenübergestellt. Für die neuen »Formen und Gebilde[]«, die dank eines zufälligen und voraussetzungslosen »Lebensfunken[s]« entstehen, gilt Wienbargs ›Gesetz des Lebens‹, dem er wiederum die ›Tradition‹ bzw. das ›Alte‹ ausgesetzt sieht: Nachdem sie ihren nahezu biologischen Lebenszyklus durchgemacht haben, bleibt keine Spur mehr von ihnen übrig. Die nun neuen »Formen und Gebilde[]« lösen sie ab. Diese Entwicklungsvorstellung wird in den programmatischen Reflexionen dargelegt und dann in die Ausführungen integriert, die grundlegende Elemente ästhetischer Rede bilden. Dazu zählen die historischen Passagen, in denen die verschiedenen ästhetischen Weltanschauungen wiedergegeben werden. In der siebten Vorlesung wird auf die indische, die griechische und die christliche Weltanschauung eingegangen, während in der achten die Entstehung und vollständige Entwicklung einer neuen ästhetischen Weltanschauung prognostiziert wird, deren Zeichen in der Gegenwart bereits vorhanden sind und allerdings nur von der Zeitdiagnostikerin oder dem Zeitdiagnostiker erkannt werden können19. Bei der Darlegung der Aufeinanderfolge der ver18 Ebd., S. 26–28. 19 So wird am Ende der siebten Vorlesung angekündigt, dass die »neue ästhetische Anschauungsweise […] [m]ehr in ahnenden Zügen als in wirklichen Umrissen« dargestellt werden kann, ebd., S. 90. Mit Blick auf die entstehende neue ästhetische Anschauungsweise wird die gegenwärtige Lage folgendermaßen beschrieben: »Die Manifestation einer neuen Anschauungsweise […] ist […] kein momentaner Akt, der sich sofort aller geschichtlichen Elemente
56
Historisierung
schiedenen Weltanschauungen macht sich eine organologische Vorstellung geltend. Dementsprechend wird der Übergang von der griechischen – über die Zwischenphase der römischen – hin zur christlichen ästhetischen Weltanschauung folgendermaßen dargestellt: »Leider war auch diese Blüte vom Schicksal bestimmt, um zu verwelken und andern Blüten des menschlichen Geistes Platz zu machen. Die Römer haben Griechenland nicht zerstört, sie haben nur die letzte Hand daran gelegt, sie haben die sterbende Nationalexistenz nach höherem Beschluß exekutiert.«20
Diese Regelmäßigkeit, die in der Geschichte selber liegt, ermöglicht es, genaue Prognosen zu formulieren sowie Analogien herzustellen: »Dem germanisierten Europa bleibt die dritte Entwicklungsstufe der Menschheit vorbehalten […]. So gleicht das Menschengeschlecht in seiner geschichtlichen Entwicklung einem wahren Organismus, einer erhabenen Pflanze, die von Zeit zu Zeit in neuen Knoten anschießt, sich zusammenschließt, um sich desto kräftiger wieder zu entfalten.«21
Obwohl die »dritte Entwicklungsstufe« als die gelungene Verbindung des Elements des ›Sinnlichen‹ (der Griechen) mit dem ›Geistigen‹ (der Christen) dargestellt wird22, werden die drei- und gegebenenfalls auch vierstufigen historischen Teile beispielsweise im Vergleich zu Hegel neu funktionalisiert: Zwischen den ästhetischen Weltanschauungen besteht keine Relation des kontinuierlichen, sich steigernden Übergangs. Im Einklang mit dem im Grunde ideologischen Subtext der Vorlesungen Wienbargs sollten die kulturhistorischen Ausführungen vielmehr als Beweise für die immerwährende Gültigkeit des Gesetzes einer historischen Variabilität dienen; dadurch werden das Anrecht auf Durchsetzung des ›Neuen‹ gegen das ›Alte‹ und die These nach der hemmenden Anbetung der Tradition bekräftigt. Die beschriebene Revision und Neufunktionalisierung der Ästhetik bringt nicht zuletzt eine Verschiebung im Rahmen des Gegenstandes dieser Disziplin mit sich: also der Kunst. Die zukunftsbezogene Perspektive sowie die damit verbundene Anpassung der überkommenen philosophischen an die nationalen bemächtigte […], sondern ein progressiver Akt […]. Es verharrt die Zeit so lange im Verpuppungszustande, bis ihr unter der Decke die Flügel ausgewachsen sind, sie dehnt sich, lockert sich, erwartet den Augenblick – dann kostet es nur einen Sonnenstrahl […] und gesprengt ist der alte Leib […]. In solch verpupptem Zustande erscheint uns die Gegenwart. […]. Aber es ist ein neues Leben, so gewiß und wahrhaftig, als das alte tot ist und nur noch mit gespenstischer Hülle das junge drückt, verschließt und beängstigt. […]. Das ist der Fluch der Zeit, der auf einer Übergangsepoche wie der unsrigen ruht, das ist der Schmerz, der die edelsten Geister durchdringt«, ebd., S. 91–93. 20 Ebd., S. 86. 21 Ebd., S. 101. 22 Ibidem.
Ludolf Wienbargs Zur neuesten Literatur (1835)
57
Anforderungen verlegen den Fokus auf die Gegenwartsliteratur, die in diagnostischer und prognostischer Absicht untersucht wird. So fasst Wienbarg seinen Vorlesungsplan wie folgt zusammen: »Beantworte ich also die Frage, was uns gegenwärtig als Ästhetik noch bleibt, damit, daß ich sage: die alte Ästhetik für die, die ihrer noch nicht überdrüssig geworden sind, für die anderen aber, das leise ästhetische Gefühl, das im Schoß der Zeit sich regt, […] die Einleitung zur künftigen Ästhetik. Als eine solche, meine Herren, mögen Sie auch die gegenwärtigen Vorlesungen betrachten. […]. Hören Sie also den Plan, den ich in der Zukunft befolgen werde. […], was den Geist und die Darstellung betrifft, hoffe ich Sie […] an die unfruchtbare Pedanterie früherer Behandlungen, so wenig als möglich zu erinnern, indem es meine Aufgabe sein wird, sowohl Poesie als Prosa im Zusammenhang mit den Richtungen der Zeit aufzufassen […]. Meine Bemerkungen werden sich anreihen an die Werke einiger neuerer Schriftsteller, an Byron und Goethe in poetischer, an Heinrich Heine in prosaisch stilistischer Beziehung. Die Prosa wird vor allen Dingen unser Augenmerk sein […].«23
Der hier angekündigte Plan wird dann in den Vorlesungen 20–24 umgesetzt. Trotz desselben Untersuchungsgegenstandes ist der hier zu beobachtende Zugriff nicht mit dem der Literaturkritik deckungsgleich. Ein wesentlicher Unterschied besteht im Abstraktionsgrad, der mit der Anwendung ästhetischer Kategorien zusammenhängt. So wird am Beispiel einiger Gegenwartsautoren plausibilisiert, dass der ›Witz‹ und das Genre der ›Satire‹ zeitgemäß sind und dementsprechend Heinrich Heines Prosa die neueste und zukunftsfähige Erscheinung darstellt. In den Mittelpunkt rückt außerdem die Frage nach der Vermittlung von ›Schönheit‹ und ›Wirklichkeit‹, deren Integration in die Literatur ein Kennzeichen der neuesten Tendenzen bildet. Sich eines nunmehr bekannten Topos bedienend, der vielleicht erst jetzt entsteht, wird die Integration von Gegenwartsbezügen wiederum auf die ›Verhältnisse‹ zurückgeführt.
2.3
Das »Entwicklungsgesetz der Zeit« sichtbar machen: Ludolf Wienbargs Zur neuesten Literatur (1835)
In Ludolf Wienbargs literaturkritischer Sammlung Zur neuesten Literatur (1835) werden Zeitgeschichte und gegenwärtige literarische Erscheinungen zeitdiagnostischen Überlegungen ausgesetzt und dadurch in einen gemeinsamen Zusammenhang überführt. Insbesondere dienen Wienbargs Analysen dazu, das bereits in den Ästhetische Feldzüge beschriebene Entwicklungsgesetz der Zeit sichtbar werden zu lassen. Im Unterschied zu Gutzkows Sammlung Die Zeitgenossen, die im nächsten Kapitel analysiert wird, herrscht also hier beim ›Beobachter der Zeit‹ volle 23 Ebd., S. 111–112.
58
Historisierung
Gewissheit: Die gegenwärtigen Erscheinungen können zeitgenössisch bereits gedeutet werden. Entscheidend ist für deren definitive Sinnstiftung allerdings, Analogien und wiederkehrende Phasen in der Geschichte zu erkennen. So erweist sich bei Wienbargs Analysen eine Gegenwartserfahrung der notwendigen ›Suspension‹ als für die Zeit kennzeichnend. Die gegenwärtigen Erscheinungen gelten aber als ergänzungsbedürftig. In den Vordergrund tritt deren Verweischarakter, weil sie an sich nicht bedeutungstragend sind; ihr latenter Sinn kann nur dann ins Manifeste überführt werden, wenn sie als erneute Aktualisierungen eines bekannten Verlaufsmusters definiert werden. Die von Wienbarg vertretene These eines Verweischarakters der Erscheinungen lässt sich offensichtlich nur schwer mit den begriffsgeschichtlichen Befunden in Eintracht bringen, nach denen sich die ›Gegenwart‹ vom strukturbildenden Charakter der ›Vergangenheit‹ emanzipiert und immer deutlicher zur voraussetzlosen Dimension wird. Diese These spricht somit nicht nur für eine Pluralität der Forschungshaltungen im Vormärz, sondern auch der Gegenwartskonzepte. Die Sammlung wird von einer sehr kurzen Vorrede eingeleitet, die bezüglich des Auswahl- und Zusammenstellungskriteriums zunächst auf das ›weichere‹ Argument eines aus biographischen Gründen gemeinsamen Entstehungszusammenhangs hinweist. In einem zweiten Schritt wird aber auf ein intertextuelles Verhältnis aufmerksam gemacht, indem das Argument einer konzeptionellen Zusammengehörigkeit mit den viel rezipierten Vorlesungen Ästhetische Feldzüge (1834) betont wird: Wie bereits angedeutet legen beide Texte ihren Diagnosen dasselbe »Entwicklungsgesetz der Zeit«24 zugrunde. Diese Sammlung dient also zur Veranschaulichung dieses Gesetzes, weil es den breiteren Zusammenhang bildet, in den die literarischen Erscheinungen überführt werden. Folgende Aufsätze machen diese Sammlung aus: ›Goethe und die Weltliteratur‹, ›Fürst Pückler‹, ›Raupach und die deutsche Bühne‹, ›Karl Immermann‹, ›Heinrich Heine‹ und ›Lucinde, Schleiermacher und Gutzkow‹. Der Titel der Sammlung unterstellt, dass gerade diese Konzepte, Erscheinungen, Autoren – von der jeweiligen Beurteilung abgesehen – repräsentativ für die gegenwärtigen literarischen Zustände sind. Das Vorhaben der Sammlung erschöpft sich nicht bloß in der Darstellung gegenwärtiger literarischer Verhältnisse; sie zielt auch darauf ab, richtungsweisende Tendenzen sichtbar zu machen und zu Fragen, die das ›Leben‹25 betreffen (Vergeltung, Liebe, Sittlichkeit), in der öffentlichen Debatte Stellung zu beziehen. 24 Ludolf Wienbarg, Zur neuesten Literatur, Mannheim 1835, S. 00. 25 Der zum Schlagwort avancierte Begriff des ›Lebens‹ deutet auf Problemkreise hin, die mit dem Verweis auf die ›Politisierung‹ der öffentlichen Debatte sowie auf das vermeintliche Zurücktreten der Autonomie der Literatur nicht vollständig erfasst werden können. ›Ziel‹ dieser notwendigen »Suspension der Poesie« ist vielmehr eine Erneuerung aller Bereiche des Lebens.
Ludolf Wienbargs Zur neuesten Literatur (1835)
59
Angesichts der gesamten Zusammensetzung übernimmt der erste Aufsatz die (sonst von ausführlicheren Einleitungen geleistete) Funktion, programmatische Sachverhalte zu vermitteln und den Hintergrund für die weiteren Aufsätze zu liefern. Bei der Zusammenstellung der anderen Aufsätze lässt sich systematisierend feststellen, dass das Gebot der thematischen Vielfalt mit dem Anspruch auf Vertiefung kombiniert wird. So werden von den jeweiligen behandelten Gattungen verschiedene Aspekte einer Problemstellung beleuchtet: Der Aufsatz zu Fürst Pückler-Muskau gilt als Beweis für die die jungdeutsche Kritik kennzeichnende Überwindung der textimmanenten Buchrezension, indem er vornehmlich räsonierende essayistische Züge aufweist und die Rezension des dritten Bandes von Tutti Frutti zum Anlass für die Auseinandersetzung mit Sittlichkeitsfragen macht. Der abschließende Aufsatz zum von Gutzkow entdeckten und veröffentlichten Briefwechsel zwischen Lucinde und Schleiermacher geht ebenfalls in diese Richtung. Der dritte und der vierte Aufsatz stellen anhand zweier Autoren die gegenwärtigen deutschen Theaterverhältnisse dar; schließlich werden im fünften Aufsatz anhand der Rezension von Heines ›Salon II‹ erneut und ausführlicher Reflexionen zur literaturkritischen Praxis angestellt. Mit dem ersten Aufsatz schaltet sich Wienbarg in die öffentliche Debatte ein und schlägt seine ›Lektüre‹ vor: Er schließt an Goethes Konzept einer ›Weltliteratur‹ an und macht es zum »Gesetz«26 für geschichtliche und literarische Zustände. Der Anschluss an die Vorstellung einer ›Weltliteratur‹ ist für die jungdeutsche Kritik überhaupt kennzeichnend und nicht zuletzt als Abgrenzung von Menzels einschränkendem Programm einer Literatur im Dienst patriotischer Zielsetzungen zu verstehen. Über die spezifische diskursive Position hinaus macht das Konzept einer ›Weltliteratur‹ zudem die Vorstellung fließender Grenzen und reger Einflussrelationen zwischen fremdsprachigen Literaturen geltend. Bekanntlich lässt sich damit die Genese komparatistisch angelegter Herangehensweisen zurückverfolgen; außerdem ist das Konzept einer ›Weltliteratur‹ – bei einer Engführung mit ›Weltgeschichte‹ umso deutlicher – mit geschichtsphilosophischen Vorstellungen verbunden. Dabei spielt allerdings auch eine räumliche Kategorie eine Rolle, weil die nicht zuletzt darstellungstechnische Notwendigkeit, ›Gegenwart‹ zu lokalisieren27, in den Vordergrund tritt: Um aktuelle, im emphatischen Sinne moderne Erscheinungen und Phänomene in ihrem Größenverhältnis und deren gesamte Entwicklung restlos zu 26 Wienbarg 1835, S. 1. 27 Der von der Kategorie der ›Weltliteratur‹ implizierte Raumbezug lässt sich vor den Hintergrund einer funktionalen Verzahnung von Zeit- und Raumsemantik stellen, auf die u. a. Ingrid Oesterle aufmerksam gemacht hat. Raumbezüge und Lokalisierung von ›Gegenwart‹ sind vor allem für die Reise- und Briefliteratur konstitutiv und erfüllen den kompensatorischen ›Empiriebedarf‹, der bei der Überwindung von kontingenzfreien Zeitmodellen entsteht. Vgl. dazu Oesterle I. 1985, S. 11–76.
60
Historisierung
erfassen, muss die Literaturkritikerin oder der Literaturkritiker zunächst einmal deren Wirkungsfeld bestimmen. Insbesondere besteht Wienbargs These darin, dass die seit der Reformation bis zur Gegenwart in Deutschland erfolgten geschichtlichen und literarischen Entwicklungen im europäischen Kontext wiederum typologischen Charakter aufweisen und somit erlauben, Prognosen zu stellen. In diesem Sinne geht es bei Wienbargs Aneignung dieses Konzeptes in erster Linie um die Bestimmung einer Genealogie der ›Einflussrelationen‹ und demzufolge eines »Typus, der sich in ihnen [den übrigen europäischen Literaturen] wiederholt«28. Wie zu zeigen sein wird, wird bei Wienbarg die gewissermaßen herkömmliche Hierarchie der Einflussrelationen umgekippt: Während Heine Frankreich und England als Präfigurationen der Zukunft Deutschlands betrachtet, besitzt bei Wienbarg hingegen die Kultur- und Literaturgeschichte Deutschlands typologischen Charakter. Eine Konstante bleibt allerdings die Vorstellung einer ›funktionalen Aufteilung‹, indem Deutschland als zuständig für die einleitende systematische Aufarbeitung neuer Gedankenrichtungen angesehen wird; Frankreich und England sei hingegen deren pragmatische Weiterführung überlassen. Zusammen mit der Festlegung des leitenden Konzeptes sind noch drei Aspekte des Eröffnungsessays in struktureller Hinsicht von Belang: Es handelt sich dabei um den Bericht zur gegenwärtigen Lage, die historische bzw. genetische Rekonstruktion der ›Weltliteratur‹ (sowie der Weltgeschichte) und die Prognosen. Es wird die These aufgestellt, dass der historische Teil, weil er typologischen Charakter besitzt, im Analogieverhältnis zur Gegenwart und Zukunft steht und als Deutungsmodell für sie dient. In einem ersten Schritt wird auf die Entstehungsgeschichte der Weltliteratur Bezug genommen, in einem zweiten auf ›Gegenwart‹ und ›Zukunft‹ hingewiesen. Nachdem Goethe als ›Theoretiker‹ und Anreger der ›Weltliteratur‹ dargestellt wird, sein Früh- und Spätwerk als Brennpunkt für moderne literarische Entwicklungen stilisiert werden und das Scheitern, sich als ›Nationalautor‹ durchzusetzen, mit dem Argument der ungünstigen Zeitverhältnisse29 begründet wird, versucht Wienbarg in erster Linie mittels der Darlegungsstrategie, die Plausibilität des Entwicklungsgesetzes der Zeit zu beweisen. Zunächst werden die technischen und sozialen Rahmenbedingungen für weltgeschichtliche und -literarische Entwicklungen genannt und das hier vertretene Konzept durch Abgrenzung 28 Wienbarg 1835, S. 30. 29 Diese Aussagen weisen auf die Wechselwirkung zwischen Literaturkritik und Literaturgeschichtsschreibung hin: Literaturkritische Aufsätze erarbeiten literaturgeschichtliche Beschreibungsmodelle und/oder integrieren in ihren Argumentationsgang bereitliegende Modalitäten. Vgl. dazu Jürgen Fohrmann, Das Projekt der deutschen Literaturgeschichte. Entstehung und Scheitern einer nationalen Poesiegeschichtsschreibung zwischen Humanismus und deutschem Kaiserreich, Stuttgart 1989, S. 131–170.
Ludolf Wienbargs Zur neuesten Literatur (1835)
61
von historischen Parallelsituationen näher präzisiert30. Erst nach dieser Einführung werden die Hauptmomente einer Entstehungsgeschichte der Weltliteratur dargelegt: Interessanterweise überschneidet sich dabei die Gründungsszene der ›Weltliteratur‹ mit der Geschichte der deutschen Literatur. Insbesondere wird dabei ein literaturgeschichtliches Verlaufsschema aktualisiert, das auf der Alternanz von Phasen der Blüte und Phasen des Verfalles basiert und bei dem die Integration von Zeit- und Gegenwartsbezügen eine Rolle spielt. Als Auslöser für weltliterarische Entwicklungen gilt – im Anschluss an Hegel – unverkennbar die Reformation, die den Zug der »Antikatholizität«31 in die Weltgeschichte einführt und, einer genealogischen Vorstellung gemäß, Erscheinungen wie Shakespeare, Rousseau sowie Ereignisse wie die Französische Revolution ermöglicht (und präfiguriert). Einer Phase der Dekadenz auf der Seite von ›Zeit‹ und ›Literatur‹ (Verwüstungen des Dreißigjährigen Krieges, »geistlose geistliche Literatur«32), die sich retrospektiv als Laborzeit herausstellt, folgen bessere Zustände: Die klassische Zeit der Literatur (Winckelmann, Klopstock, Herder, Lessing, Wieland, Goethe, Gebrüder Schlegel). Während dieser Blütezeit sind dennoch Gegenkräfte unterschwellig am Werk, die dann mit der Sturm-und-Drang-Periode die Oberhand gewinnen. Auslöser dieser neuen Phase ist die Hinwendung zu den unzulänglichen gegenwärtigen Verhältnissen (»Er [Herder] schaute über sein Buch hin und suchte auch in der Gegenwart die göttliche Bildkraft, die sich ihm erschlossen in der Vergangenheit«33), die zur ›Abnutzung‹ des Lebens und zu den (aus Wienbargs sowie jungdeutscher Sicht überhaupt) Verfehlungen der Romantiker führt. Mit den kritischen Aussagen zu den Romantikern und der angeblichen Auslassung neuester literarischer Zustände endet der geschichtliche Überblick. Dieser Überblick hat – so die These – keinen Exkurs- oder Digressionscharakter; vielmehr fungiert er als Deutungsmuster und somit als Mittel zur Sinngebung für Gegenwart und Zukunft. Das lässt sich in zwei Schritten belegen. 1. Erst vor der Folie der historischen Rekonstruktion gewinnt der vorangestellte Bericht zur gegenwärtigen Lage der deutschen Literatur substanzielle Konturen: Er erweist sich als wiederkehrende, notwendige Phase des Verfalls und erhält 30 Gemeint ist hier der künstliche »Einfluss der griechischen Literatur auf die römische«: »Dieser Einfluss […] hatte nichts geschichtlich Organisches. Wir sind genöthigt, für die tiefste und lebendigste literarische Wechselwirkung unserer Zeit das Princip eines geschichtlichen Zusammenhanges aufzufinden, […] ein geistig regsames Ideenfluidum vorauszusetzen, das die Welt durchströmt und in dessen Aether die Nationalitäten gleich wie die Literaturen sich begegnen und durchkreuzen, gleich Handelsschiffen auf dem Weltmeer; wir müssen annehmen, daß derselbe Geist, welchem die deutsche Literatur ihr isolirtes fremdartiges Daseyn verdankte, auch in Nachbarländern seine lebendige Kraft äußere«, Wienbarg 1835, S. 21–22. 31 Ebd., S. 23. 32 Ebd., S. 24. 33 Ebd., S. 27.
62
Historisierung
seine Bedeutung, einer latent immer vorausgesetzten geschichtsphilosophischen Vorstellung gemäß, erst durch die kausale Verbindung und die Einbettung in eine geschichtliche Entwicklung sowie als notwendige Zwischenphase zu zukünftigen Entwicklungen. Dieser Konzeption gemäß ist die ›Deutung‹ gegenwärtiger Zustände an sich nicht möglich, ihr faktisches Gewicht wird erst durch die ergänzende geschichtlich-genetische Rekonstruktion und die andeutungsweise formulierten Prognosen sichtbar, durch die der für fremdsprachige Literaturen und europäische Völker postulierte typologische Charakter deutscher Geschichte sich wiederum plausibilisieren lässt. Um zum Verlaufsmuster erhoben zu werden, muss die historische Rekonstruktion in ihrer gesamten Ausdehnung im Text überhaupt vorkommen. Die gegenwärtige Lage wird anhand dieses ›Standardberichts‹ beschrieben: »Eben in Folge dieses Grundsatzes [Poesie und Leben sind Inseparabeln] bemerken wir heutigen Tages eine allgemeine Suspension der Poesie. Die Zustände, die zu Goethe’s Zeit noch eben vorhielten, sind gänzlich verbraucht, so daß man nur die nackten Nothnagel und Eisenklammer der Pietät und der Gewohnheit zu sehen bekommt. Die Verwitterung ist allgemein und die einsamen Sträuchlein und Blümlein, die hie und da aus dem Schutt herauswachsen, sind Elegieen auf den Verfall der mittelaltrigen Größe und verbreiten die schwermüthigen Gerüche der Kerzen, die am Sarge einer Leiche flackern. Das junge Leben ist gehemmt, und muß einen großen Theil seiner Kräfte im offensiven und defensiven Kampf gegen die Zähigkeiten und Widerstände des alten verbrauchen. Daraus resultirt die kritisch-negative Richtung unserer Zeit, die noch immer einen überwiegenden Moment der Literatur bildet und die früheren Gestaltungen anathemisirt, ohne mehr als ihr dürftiges religiöses Creditiv vorzeigen zu können. Die Poesie […] ist gränzenlos unglücklich, und im Begriff, an sich selber zu zweifeln.«34
Diese Stelle schreibt eine von mehreren Seiten verbreitete Darstellung der gegenwärtigen literarischen Zustände fort, bettet ebenfalls konventionell die Konjunktur der Kritik in diesen argumentativen Zusammenhang ein und reflektiert dabei über ihre Praktiken. Ergänzt wird dieser Bericht mittels einer Allegorie der derzeitigen Trennung zwischen Leben und Poesie, die sich zudem des biblischen Bezugs auf Sulamith bedient. Durch diese für die jungdeutsche Kritik bedeutsame stilistisch-rhetorische Strategie35 wird für den Informations34 Ebd., S. 5–6. 35 Gemeint ist damit die für Popularisierungstendenzen sehr bedeutende Strategie der ›Diskursintegration‹, deren Funktionsweise, von Heine ausgehend und mit Betonung ihrer humoristischen Effekte, Wulf Wülfing »auf minimaler Textbasis« veranschaulicht hat. Als Weiterführung der Argumente Wülfings gilt Ekes Kategorie einer »Rhetorik des Indirekten«. Die konkrete Bedingung für diese Strategie(n) stellt bekanntlich die Notwendigkeit dar, sich möglichst effektiv der Zensur zu entziehen; deren textuelle Umsetzung bilden erklärende Digressionen und Metaphern, die eigentlich die angestrebte Sinndispersion manchmal bis zum Paroxysmus steigern lassen. Vgl. dazu Wulf Wülfing, Stil und Zensur. Zur jungdeut-
Ludolf Wienbargs Zur neuesten Literatur (1835)
63
gehalt kein Mehrwert erbracht, sondern dieser nur verdoppelt und dramatisiert. Auf ihn folgt unmittelbar im Text die historische Rekonstruktion, die mit Abrufung eines ähnlichen Verlaufsschemas die gegenwärtige Lage integrieren kann und mithin deren Regelmäßigkeit sichtbar werden lässt. 2. Historischer Überblick und abschließender Teil werden nebeneinandergestellt; der abschließende Teil liefert dabei den Ausblick und betont die »analogen Beziehungen«36 zwischen deutschen und fremdsprachigen Literaturen: »Für diesen Aufsatz wäre es unzulässig alle die Wahrzeichen anzugeben, welche es dem aufmerksamen Beobachter der Zeit zur Gewißheit machen, daß mit Engländern, Franzosen und andern Völkern allmählig dieselbe Verwandlung vorgegangen, aus welcher unsere Literatur ihren obenbezeichneten Ursprung nahm. Eine gewisse Auslebung im Positiven, Historischen, bei Erweiterung des nationalen Gesichtskreises und Würdigung des Allgemein menschlichen, das gemeinsame Bestrebungen der Völker wünschenswerth macht, das sind wohl die wesentlichen Grundzüge der modernen Völkerstimmung […]. Und darin sehe ich ihren Zusammenhang mit der deutschen Literatur als einen nationalen Typus, der sich in ihnen wiederholt, nach Unterschied der Zeiten und Nationen.«37
Diese Stelle verdeutlicht, dass der geschichtliche Überblick ein Verlaufsmuster abgibt und andeutungsweise auf die wichtigsten Phänomene in der Gegenwart aufmerksam macht. Die übrigen Aufsätze unterscheiden sich vom Eröffnungsessay, indem sie sich den zentrierten Formen der Rezension und der Charakteristik zuordnen lassen. Trotz der Aktualisierung dieser im engeren Sinne literaturkritischen Formen ist ein breites inhaltliches Spektrum für diese Aufsätze kennzeichnend, weil politische und sittliche Fragen mit einbezogen werden. Alle Aufsätze weisen eine ähnliche interne Struktur auf: Der Rezension oder der Charakteristik wird immer ein einleitender Teil vorangestellt, in dem Wienbarg polemisch den Unterschied zur ›Tageskritik‹ markiert und sehr apodiktisch die leitenden Kategorien, die Bewertungsmaßstäbe oder ein angestrebtes Ideal festlegt. Konkret kann es sich um eine »einleitende Diatribe«38 (Pückler-Muskau) oder um die Erläuterung eines Begriffs und »eine[s] höheren allgemeinen Maaßstabe[s]«39 (Raupach)
36 37 38 39
schen Rhetorik als einem Versuch von Diskursintegration. In: Joseph A. Kruse/Bernd Kortländer (Hg.), Das Junge Deutschland. Kolloquium zum 150. Jahrestag des Verbots vom 10. Dezember 1835, Hamburg 1987, S. 193–217, hier: S. 202–205; Norbert Otto Eke, ›Man muß die Deutschen mit der Novelle fangen‹. Theodor Mundt, die Poesie des Lebens und die ›Emancipation der Prosa‹ im Vormärz. In: Wolfgang Bunzel/ders./Florian Vaßen (Hg.), Der nahe Spiegel. Vormärz und Aufklärung, Forum Vormärz Forschung, Vormärz-Studien Band XIV, Bielefeld 2008, S. 295–312. Wienbarg 1835, S. 29. Ebd., S. 30. Ebd., S. 49. Ebd., S. 71.
64
Historisierung
handeln; im Mittelpunkt können auch die Diskussion über »dunkel und orakelmäßig Apophlegmen«40 oder die bei einer weltliterarischen Perspektive differenzierten Rezeptionsbedingungen (Heine) stehen; auf universelle Themen wie Sittlichkeit und Liebe kann man schließlich eingehen (Lucinde, Schleiermacher und Gutzkow). Was auch immer thematisch im Mittelpunkt steht, sind die Rezensionen und die Charakteristiken in einer Logik der Beweisführung und der Veranschaulichung mit den jeweiligen Idealen oder Maßstäben verbunden. Im Aufsatz zu Fürst Pückler-Muskau ist die These einer Inkompatibilität des Adels mit der Sittlichkeit leitend, da beim Adel die Standesidentität laut Wienbarg am stärksten ist. Strukturbildend sind die Oppositionen: Menschheit/Zeit/ Sittlichkeit–Egoismus/Nemesis und Geschichte–Privatvorteile, die eine anthropologische Umsetzung jeweils in der Kategorie der ›großen Männer‹ und in derjenigen der ›großen Herren‹ finden. Pückler-Muskau ist der letztgenannten Kategorie zuzuordnen und steht somit in Opposition zum »Entwicklungsgesetz der Zeit«. In den Aufsätzen zur Theaterliteratur (›Raupach und die deutsche Bühne‹, ›Karl Immermann‹) lässt sich dasselbe Schema beobachten: Im Aufsatz zu Raupach wird das Ideal einer Nationalpoesie als Bewertungsmaßstab für sein Werk bestimmt; Raupach gilt als Verfehlung dieses Ideals, da die Bedingung dafür – d. h. eine Volksnation – nicht vorhanden ist. Im Aufsatz zu Immermann werden mittels eines detaillierten Vergleichs einige Stellen aus der ersten und der zweiten überarbeiteten Version des Trauerspiels Andreas Hofer, Sandwirth von Passeyer angeführt, die die eingangs ausgesprochenen »Apophlegmen« erfüllen und somit die gewünschten dramatischen Tendenzen (Primat der »Gestaltung« und Unmittelbarkeit der Handlung) sehr deutlich vergegenwärtigen. Obwohl hier die weltliterarische Perspektive und das »Entwicklungsgesetz der Zeit« als leitende Vorstellungen fungieren, dienen sie im Unterschied zu anderen Sammlungen nicht als koordinierende Elemente: Auf der Ebene der gesamten Organisation führen sie weder zu einer Hierarchisierung noch zu argumentativen Wendepunkten, die eine ›narrative‹ Entwicklung vermuten lassen könnten. Diese Aufsätze zeichnen sich demzufolge eher durch die Wiederholung derselben Struktur aus: Mit einigen kleinen Variationen wird bei allen Aufsätzen der Standardbericht zur gegenwärtigen Lage aktualisiert; bis auf Heine bilden alle literarischen Erscheinungen Verfehlungen, es seien ergänzungsbedürftige Versuche, eine neue Klassik zu errichten. Trotz der inhaltlichen Varietät lässt sich keine Verschiebung innerhalb des Zeitraums erkennen – gerade das Wiederkehrende bei den Argumentationsstrukturen verweist bei allen Teilbereichen auf eine Erfahrung des Gleichen, die wiederum für die gegenwärtige Lage kennzeichnend ist. Das immerwährende Ausbleiben einer deutschen Nation sowie der 40 Ebd., S. 87.
Robert Prutz’ Kleine Schriften. Zur Politik und Literatur (1847–48)
65
Bedingungen überhaupt für die Entstehung derselben dienen nicht nur auf interner Argumentationsebene als Grund für die Unzulänglichkeit der meisten Erscheinungen; bezüglich der Funktionsweise dieser Aufsätze verhindert die Abwesenheit der Nation bzw. einer kohärenzbildenden Instanz (und die Wiederkehr dieses Arguments) die Verabschiedung ihrer supplementären Logik. In diesem Sinne erfüllt (und erschöpft) sich ihre Funktion im Gestus einer Ankündigung.
2.4
Robert Prutz’ Kleine Schriften. Zur Politik und Literatur (1847–48)
Die Auseinandersetzung mit ›Gegenwart‹ und ›Gegenwartsliteratur‹ in der 1847– 48 von Robert Prutz veröffentlichten Sammlung Kleine Schriften. Zur Politik und Literatur lässt sich ebenfalls dem Verfahren der ›Historisierung‹ zuordnen. Im Rahmen dieser einleitenden Betrachtungen lässt sich auf einen damit durchaus verbundenen Aspekt hinweisen: In ›Die niederländische Literatur in ihrem Verhältnis zur deutschen‹, einem Aufsatz aus dem ersten Band, kündigt Prutz an, eine geschichtliche Betrachtung der Literatur betreiben zu wollen und die Literaturgeschichte als »eine Geschichte der Geistesentwicklung«41 zu verstehen. Der von Prutz immer wieder gezeichnete Entwicklungsgang des ›Geistes‹, an dem die untersuchten Erscheinungen partizipieren, lässt sich, wie bereits angedeutet, eindeutig auf Hegels Systemphilosophie zurückführen. In wissenschaftsgeschichtlicher Hinsicht könnten also Prutz’ Aufsätze sowie seine viel rezipierten Vorlesungen über die deutsche Literatur der Gegenwart aufgrund der Zentralität der Kategorie des ›Geistes‹ mit dem in der Literaturwissenschaft traditionsreichen geistesgeschichtlichen Paradigma assoziiert werden. Wirft man einen Blick auf die Begriffsgeschichte, so wird jedoch klar, dass sich diese Assoziation eigentlich aus einer undifferenzierten und vorschnellen Klassifikation ergibt: Im Rahmen des Hegelianismus fungiert der Oberbegriff ›Geist‹ als »leere Markierung des Zusammenhangs mit anderen Teilgeschichten«42. Die Beschäftigung mit Politik und Literatur in Prutz’ Schriften ist eben in diesem Sinne zu verstehen: Politik und Literatur bilden zwei Bereiche der Konkretion bzw. der Verwirklichung des Geistes (Staat und Ästhetik); wie ausführlich zu zeigen sein wird, lassen sich sämtliche Erscheinungen innerhalb derselben auf die Makroge-
41 Robert Eduard Prutz Kleine Schriften. Zur Politik und Literatur, Merseburg 1847–48, Band 1, S. 227. 42 Klaus Weimar, Artikel ›Geistesgeschichte‹. In: ders. (Hg.), Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft, Band 1 (A–G), Berlin/New York 2007, S. 679.
66
Historisierung
schichte des Geistes zurückführen. ›Geist‹ fungiert hier also als aktives Subjekt und Instanz einer transdisziplinären Integration. Im Rahmen der ›Geistesgeschichte‹ als im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts im Gefolge der Arbeiten Diltheys sich etablierender literaturwissenschaftlicher Richtung wird mit dem Oberbegriff ›Geist‹ hingegen nur auf gedankliche bzw. ideelle Substrate hingewiesen, wobei deren Veränderungen43 in den Blick genommen werden. Diese ›neue‹ Begriffsverwendung, bei der die ›Geistesgeschichte‹ auf der Ebene anderer Teilgeschichten steht (bspw. der Sozialgeschichte44), spiegelt also die moderne Neustrukturierung der Disziplinen wider: Die saubere Teilung der Zuständigkeiten löst den im Vormärz immer noch unbestrittenen Universalitätsanspruch der Philosophie ab. Unterscheiden lassen sich diese Richtungen außerdem durch die Kategorien, mit denen sie im Rahmen der Quellenanalyse operieren. Aufgrund der beiden Richtungen zugrundeliegenden Denkform der ›Geschichte‹ stimmen sie jedoch im »genetischen […] Bezug zwischen ihm [einem historischen Gegenstand] und der Gegenwart«45 überein. Die Zentralität der Denkform ›Geschichte‹ lässt bereits erahnen, welches Gegenwartskonzept in den nun zu analysierenden Quellen vorherrschend ist: Bei Prutz sind nämlich die Bestimmung von Kontinuitäten und damit die Rekonstruktion einer Traditionslinie, in der die Gegenwart situiert werden kann, besonders kennzeichnend. Was sich Prutz mit dieser retrospektiven Sammlung von in Zeitungen z. T. bereits erschienenen Aufsätzen46 vornimmt, kündigt er explizit im Vorwort an. Als relevant erweisen sich vor allem folgende Aspekte, die übrigens auch im Hinblick auf eine Geschichte der Gegenwartsliteraturforschung von Belang sind: 1. Entstehung einer literarischen Öffentlichkeit. Prutz diagnostiziert eine bedeutsame Verschiebung im Rahmen der Teilnahme an und Rezeption von literaturwissenschaftlichen Diskursen: Nicht nur die gelehrte bzw. akademische Öffentlichkeit prägt und rezipiert solche Diskurse, sondern auch ein aus ›Laien‹ bestehendes Lesepublikum interessiert sich dafür – und bloß unterhalten werden will es nun nicht mehr. Die Aufsätze werden deshalb vor dem Hintergrund einer möglichst symmetrischen Kommunikationssituation konzipiert und richten sich ausdrücklich auch an die nicht-akademische Öffentlichkeit. In Prutz’ Überlegungen tritt also das Lesepublikum als unerlässlicher Akteur hinzu; Prutz betreibt somit in Ansätzen eine Rezeptionsforschung avant la lettre und erkennt 43 Ebd., S. 678–679. 44 Ibidem. 45 Daniel Fulda, Starke und schwache Historisierung im wissenschaftlichen Umgang mit der Literatur. In: Matthias Buschmeier/Walter Erhart/Kai Kaufmann (Hg.), Literaturgeschichte. Theorien – Modelle – Praktiken, Berlin/New York 2014, S. 114. 46 Die Schriften zur Politik sowie die kurzen Erzählungen, die am Ende beider Bände stehen, sind ausgerechnet anlässlich des Projektes der Sammlung verfasst worden.
Robert Prutz’ Kleine Schriften. Zur Politik und Literatur (1847–48)
67
die verschiedenen Instanzen im Literaturbetrieb an. 2. Auswahl und (eventuelle) Überarbeitung bereits veröffentlichter Aufsätze: Es handelt sich dabei um einen Aspekt, dem man im in dieser Studie untersuchten Textkorpus mehrfach begegnet. Dabei wird oft in den Quellen das Argument einer über den Zeitpunkt der Verfassung hinausreichenden Aktualität der Fragestellungen und der entsprechenden Beiträge auf den Plan gerufen. So beschränkt sich Prutz bei der Auswahl der Texte auf diejenigen Aufsätze, welche »ein allgemeineres und dauerndes Interesse in Anspruch […] nehmen«47 können; »Alles, was an ihren bloß gelegentlichen, journalistischen Ursprung erinnern möchte«, wird entfernt, so dass »in einigen Fällen […] von der ursprünglichen Abfassung nichts übrig«48 bleibt49. 3. Fiktionale Prosa: Bei der Zusammenstellung der Texte wird nicht nur eine Vielfältigkeit der Untersuchungsgegenstände angestrebt, sondern auch der Genres. Beide Bände enden mit einer Erzählung. Prutz bezeichnet diese »novellistischen Versuche« als »Lückenbüßer«50, die für solche Leserinnen und Leser hinzugefügt wurden, die gerne fiktionale Texte lesen. Die Kombination unterschiedlicher Genres kommt also, so die Vermutung, entsprechenden Leseverhalten entgegen. Bei gewissen Typen von Leserinnen und Lesern kann auf die unterhaltende Funktion des Lesens nicht verzichtet werden. Abgesehen von Prutz’ Minimierung ist zu fragen, wie sich diese Texte zu den essayistischen Schriften verhalten. Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass die Erzählungen Die Sage vom Mädelstein und Der Heizer vom Aetna inhaltlich – anders als das Romanfragment in Gutzkows Zeitgenossen – keine unmittelbare Verbindung zu den Fragen aufweisen, die in den Aufsätzen behandelt werden. Da sie aus diesem Grund für die im Folgenden darzulegenden Thesen und Überlegungen nicht relevant sind, werden sie außer Acht gelassen. Es lässt sich deshalb daran festhalten, dass das Vorhandensein fiktionaler Literatur bei der Zusammenstellung der Texte die Berücksichtigung verschiedener Leseverhalten indiziert. Es sorgt somit für die Vielfältigkeit der Sammlung und betont Prutz’ Aufmerksamkeit auf Rezeptionsphänomene.
47 Prutz 1847–48, Band 1, S. IV. 48 Ebd., S. 5. 49 Mit Blick auf die aufklärende Funktion von Zeit ist diese Haltung der eigenen Produktion gegenüber derjenigen Gutzkows bei der ersten Ausgabe der Zeitgenossen diametral entgegengesetzt. Vgl. dazu Kap. 3.1 dieser Studie. 50 Prutz 1847–48, Band 1, S. VI.
68
Historisierung
2.4.1 Die politischen Schriften In beiden Bänden werden den Schriften zur Literatur jeweils zwei Aufsätze zur Politik vorangestellt. Es lässt sich als Erstes feststellen, dass »der Faden einer gemeinsamen Ueberzeugung, der Zusammenhang […] gemeinschaftlicher Principien«51 tatsächlich die Sammlung prägen: Sowohl in den politischen als auch in den literarischen Aufsätzen machen sich eine teleologische Geschichtsauffassung sowie ein Fortschrittsdenken geltend, welche die im Vorwort heraufbeschworene »geistige[] […] Einheit«52 bestätigen sollen. Eng verbunden mit der Vorstellung einer Entwicklung, die, anders als bei Hegel, noch nicht abgeschlossen ist, ist die ausdrückliche Integration jedes untersuchten Phänomens in die Makrogeschichte des Geistes. Mit der nun hier unternommenen separaten Analyse der politischen und der literaturwissenschaftlichen Schriften ist die Ausblendung der in den Quellen beide Bereiche betreffenden, spekulativen Auffassung keineswegs beabsichtigt. Die separate Betrachtung erfolgt nur aus systematischen Gründen. Leitend ist zudem die Annahme, dass man bei Prutz unabhängig vom jeweils untersuchten Gegenstand wiederkehrende Verfahren bestimmen kann. Breit und vielfältig ist das thematische Spektrum der Fragen, welche in den Aufsätzen zur Politik in den Blick genommen werden: Die Aufgabe des Börne’schen Zeitschriftstellers ernstnehmend wird im ersten Aufsatz (›Der nächste Krieg‹) den Leserinnen und Lesern eine ›geistige Vorbereitung‹53 auf den unvermeidlichen nächsten Krieg ›angeboten‹. Dieser Text stellt einen interessanten Kompromiss zwischen Geschichtsphilosophie und auf der Basis sehr genauer, realgeschichtlicher Elemente gestellten Prognosen dar. Im Aufsatz ›Vaterland? oder Freiheit? Brief an einen Freund‹ wird hingegen eine Art ›terminologischer Aufklärung‹ betrieben: Statt sich zu Kampfbegriffen unterschiedlicher politischer Fraktionen entwickeln zu müssen, und somit ein Gegensatzpaar zu bilden, sind ›Vaterland‹ und ›Freiheit‹ vielmehr, so Prutz, sich gegenseitig ergänzende Begriffe; diese Verbindung ergibt sich wiederum, weil beide Begriffe am Entwicklungsprozess des Geistes teilhaben. Für diesen Text ist somit die Denkfigur der Immanenz besonders prägend. Anhand einer seit einigen Jahren die öffentliche Debatte beschäftigenden Diatribe werden im Aufsatz ›Theologie oder Politik? Staat oder Kirche?‹ die andauernden sprachlichen Mystifikationen der Presse demaskiert und die eigentlich politische Natur dieser theologischen Diatribe an den Tag gelegt. Im letzten politischen Aufsatz des zweiten Bandes (›Ueber die gegenwärtige Stellung der Opposition in Deutschland‹) wird 51 Ebd., S. V. 52 Ibidem. 53 Vgl. dazu ebd. S. 24.
Robert Prutz’ Kleine Schriften. Zur Politik und Literatur (1847–48)
69
schließlich die sich nur im Rahmen der Theorie, d. h. durch Worte, artikulierende politische Opposition in Deutschland in den Blick genommen; dabei wird allerdings ihre, aus Prutz’ Perspektive, notwendige und wertvolle Rolle betont. Im Grunde handelt es sich um einen abermaligen Hinweis auf die gegenwärtige Übergangslage Deutschlands, der hier bei einer wenig behandelten, sehr spezifischen Frage Einsatz findet. Dieser Überblick auf die behandelten Fragen verdeutlicht die Dominanz des geschichtsphilosophischen Modells idealistischer Provenienz. In wissenschaftsgeschichtlicher Hinsicht kann das durchaus eine Grenze dieser Texte bilden. Abgesehen von der evolutionsgeschichtlichen Perspektive drängen sich allerdings zwei Fragen vor diesem Hintergrund auf: 1. Kann man von einer Emanzipation von Hegelschen Kategorien sprechen? 2. Gehen Geschichtsphilosophie und Fortschrittsglaube, die für diese Aufsätze grundlegend sind, auf Kosten der analytischen Genauigkeit und der Ermittlung gegenwärtiger Tendenzen (sprich: auf Kosten zeitdiagnostischer Leistungen)? Lässt sich vielmehr eine gewisse Ambivalenz beobachten? Wo und wie werden die herkömmlichen geschichtsphilosophischen Argumente eingesetzt? Wird durch diese Argumente eine Integration des Neuen gewährt? Mit Blick auf die aufgeworfenen Fragen lassen sich die Aufsätze zur Politik im Spannungsfeld zwischen ›starkem Gegenwartsbezug‹ und ›in hohem Maße spekulativer Ausrichtung‹ situieren. Wie der Überblick über die Inhalte veranschaulicht hat und übrigens naheliegende gattungssystematische Überlegungen es schon bestätigen könnten, prägt der starke Gegenwartsbezug im Prinzip jeden Aufsatz. Anhand der heuristisch fungierenden Kategorien sollte jedoch bestimmt werden, ob aktuelle Debatten tatsächlich den Ausgangspunkt der Beobachtungen bilden oder vielmehr die Überlegungen von den gegenwärtigen Verhältnissen insgesamt lediglich ›inspiriert‹ werden. Es geht eigentlich darum, ob die Überlegungen auf etwas reagieren und somit in der öffentlichen Debatte einen bereits entwickelten Komplex an Standpunkten vorfinden oder vielmehr auf der Basis der Gesamtverhältnisse eine für aktuell gehaltene Frage selber aufzuwerfen versuchen. Von diesen Bezugspunkten geleitet lassen sich die Schriften des ersten Bandes (›Der nächste Krieg‹, ›Vaterland? oder Freiheit? Brief an einen Freund‹) als kulturhistorische Überlegungen bezeichnen, weil sie nicht auf ein vereinzeltes Ereignis oder eine Debatte Bezug nehmen; die Aufsätze des zweiten Bandes (›Theologie oder Politik? Staat oder Kirche?‹, ›Ueber die gegenwärtige Stellung der Opposition in Deutschland‹) zeichnen sich hingegen durch einen stärkeren Gegenwartsbezug aus. Bei allen Aufsätzen macht der Verfasser allerdings einen möglichst objektiven, unparteilichen Standpunkt geltend, der im Hinblick auf die angestrebte politische Bildung des Volks ideologiebehaftete bzw. parteiische Positionen zu transzendieren versucht und dabei Fragen von weltgeschichtlicher Relevanz in den Mittelpunkt rückt. Im Einklang mit dem
70
Historisierung
Konzept des ›Zeitschriftstellers‹ besteht die Leistung dieser Beiträge darin, gedankliche Automatismen und Kurzschlüsse in der öffentlichen Debatte zu unterbrechen. Mit einem Wort: aufzuklären. Das kann beispielsweise einen Hinweis auf den prinzipiell ›falschen Boden‹ verdeutlichen, auf dem ein Teil der Öffentlichkeit politische Fragen ansiedelt. So wirft Prutz in ›Der nächste Krieg‹ Deutschland vor, »die Sitte (oder richtiger, die Unsitte) […], wissenschaftliche Untersuchungen ohne Weiteres auf den Boden der Moral hinüberzuspielen und das Gewissen verantwortlich zu machen für Behauptungen und Ansichten, für welche allenfalls die wissenschaftliche Bildung oder die gelehrte Kenntnis einzustehen haben.«54
Die angestrebte Objektivität wird darüber hinaus mittels der systematischen Einbettung von und Auseinandersetzung mit Gegenpositionen und eventuellen Einwänden erreicht. Dadurch gewinnt auch der Anspruch an Wissenschaftlichkeit ein über die programmatische Rhetorik des Abweichens von der ›blinden‹ Tagespresse hinausgehendes Gewicht. Dieser Aspekt ist nicht nur offensichtlich im Hinblick auf die Charakterisierung von Prutz’ essayistischem Stil von Belang (in diesem Sinne wird eine in argumentationstechnischer Hinsicht nahezu unerreichbare Unangreifbarkeit gewonnen); er sorgt darüber hinaus für gewissermaßen lückenlose Überblicke über die Lager im Rahmen der öffentlichen Meinung (also: Gegenwartsbezüge). Auch die politische Bildung des Lesepublikums wird schließlich dabei berücksichtigt. Bezüglich der Frage nach dem Umgang mit Hegels Erbe lässt sich generell eine wohlbekannte, bereits angedeutete Änderung der Zeitperspektive beobachten: Während der Werdegang des Geistes sich bei Hegel in der Philosophie verwirklicht und zu einer Relativierung von ›Gegenwart‹ und ›Zukunft‹ führt, wird bei Prutz (sowie den anderen Autoren im Rahmen des Hegelianismus) das Augenmerk hauptsächlich auf diese Zeitdimensionen gerichtet. Das impliziert eine Erweiterung des Geltungsbereichs des Politischen auf Kosten der Religion. Voraussetzung dafür ist der wesentlich öffentliche Spielraum der als brisant empfundenen Angelegenheiten55. Statt der Religion sind vielmehr Politik und Literatur, Staat und Ästhetik die Dimensionen, in denen die Vermittlung von Idee und Wirklichkeit stattfindet. Bezüglich der daraus resultierenden Fokussierung auf die ›Gegenwart‹ lässt sich ein in den Texten des Hegelianismus ebenfalls ubiquitär vorkommender selbsthistorisierender Gestus beobachten: Die gegenwärtige Zeit wird stets im 54 Ebd., S. 7. 55 »Rein religiöse Angelegenheiten in diesem Sinne giebt es also gar nicht – oder vielmehr es giebt ihrer wohl: aber ein Jeder macht sie mit sich selber ab, sie drängen sich niemals in dem Lärm des Marktes, sie geben niemals Anlaß zu Zwist und Streit, es sei denn zu geistigen Kämpfen, zu inneren Krisen des Individuum selber«, ebd., Band 2, S. 36.
Robert Prutz’ Kleine Schriften. Zur Politik und Literatur (1847–48)
71
Zusammenhang mit der Zukunft betrachtet; sie wird also nicht verabsolutiert, sondern in eine kausale Relation mit der Zukunft gesetzt. So gilt das, was in der Gegenwart erreicht wird oder vorzufinden ist, selbst wenn es als defizitär und fragmentarisch erscheint, als Voraussetzung für die in die Zukunft gestellte Verwirklichung. In Einklang mit basalen zeittheoretischen Überlegungen wird somit die Gegenwart mit der Phase des Übergangs gleichgesetzt. Dabei handelt es sich um ein Gegenwartskonzept, welches aus der Denkform ›Geschichte‹ resultiert. Die solchermaßen geartete Relation zwischen ›Gegenwart‹ und ›Zukunft‹ wird nicht nur mit den äußerst häufig vorkommenden organologischen und pflanzlichen Metaphern56 zum Ausdruck gebracht; diese Verbindung wird auch mittels einer Verzeitlichung der ›Form-Inhalt‹-Relation betont, also eines im metaphysischen Denken lange Tradition aufweisenden Konzepts, welches wiederum u. a. für Hegels Ästhetik äußerst relevant ist. Dass dieses Konzept zu denjenigen zählt, welche sich auf Hegels Rezeption zurückführen lassen, liegt also auf der Hand. Daraus resultiert in Prutz’ Schriften die Vorstellung eines zweiphasigen Geschichtsmodells, das durch mehrere Beispiele veranschaulicht werden kann: So definiert Prutz in ›Der nächste Krieg‹ »Krieg oder Frieden« nicht als »Zweck und Inhalt der Geschichte«, sondern als »Formen, in deren nothwendigem und unablässigem Wechsel alle Geschichte sich bewegt«57. Auf den Begriff der ›Form‹ kann man außerdem aufgreifen, um zu betonen, dass angesichts der aktuellen Lage das Ziel der Geschichte noch nicht erreicht worden ist, und somit die von konservativen Fraktionen unterstützten resignativen Tendenzen eingedämmt werden sollten: »Unsre deutschen Staaten sind bis zur Stunde wesentlich Polizeistaaten, das heißt, bei Lichte besehen: eben keine Staaten. Der wirkliche Staat ist organisches, sich frei bestimmendes, volksthümliches Leben; der Polizeistaat dagegen hat nur die Formen des Staatslebens ohne seinen wirklichen Inhalt, er ist, um es mit einem Worte zu sagen, nur ein abstracter, illusorischer Staat, ein bloßer Staat im Aufriß, ein Staat auf dem Papier, wo Striche und Linien, Sterne und Klammern, […] die wirklichen Größen repräsentiren sollen.«58
Der Polizeistaat entspricht somit nicht der endgültigen Staatsform. Als weitere, hingegen positiv besetzte Übergangsform zu Freiheit und Demokratisierung, welche Prutz als die tatsächlichen Zwecke der Geschichte betrachtet, fungiert die auszubildende konstitutionelle Staatsform. Gegen die Stimmen in der Presse, die die gegenwärtige Zeit als eine Epoche der unwiederbringlichen Dekadenz abtun, ohne mit spekulativer Einstellung und historischem Sinn ihre geschichtliche 56 Zur Verbindung dieser Metaphern, die den ganzen Textkorpus durchziehen, mit der Denkfigur der ›Latenz‹ s. Kap. 1 der vorliegenden Studie. 57 Prutz 1847–48, Band 1, S. 5–6. 58 Ebd., Band 2, S. 58–59.
72
Historisierung
Notwendigkeit doch zu erkennen, ruft er das für sein Denken ebenfalls konstitutive Argument der Historizität der Erscheinungen59 auf den Plan: »Aber für wen soll man es noch wiederholen, daß […], unter allen Umständen, kein Volk, keine Zeit ein Recht hat, größere Männer, kräftigere Charaktere zu verlangen, als sie selbst hervorzubringen im Stande sind?! Auch ist es ja nicht die aus sich heraustretende That, die That des Demagogen, des Kriegers, des Feldherrn allein, was Größe verleiht: auch eine Größe des Duldens giebt es, eine Kraft des Ausharrens, einen Muth des Leidens, der, sei er auch minder glänzend, minder augenfällig, darum dennoch einer Bürgerkrone nicht minder werth ist. Auf Namen kommt es hier überall nicht an […].«60
Die hier der ›Zeit‹ zugeschriebene Zentralität, die als metaphysische Voraussetzung für die Phänomene gilt, stellt eine Verschiebung von Hegels Denken dar: Bei Hegel ist nämlich ›Zeit‹ die Dimension, innerhalb derer sich sein System (sowie der Geist) überhaupt entfalten. Als solche ist ›Zeit‹ in Hegels System weder eine selbstgenügsame Dimension noch ein einheitsstiftender Begriff. Gerade bei Prutz und den Junghegelianern überhaupt ist das hingegen der Fall. Der Rücktritt herausragender Individualitäten ist nicht nur für die von Prutz anvisierte Tendenz zur Demokratisierung und die Herausbildung des Volkes zum historischen und politischen Akteur symptomatisch; das Ausbleiben großer Individualitäten verweist einfach auf die derzeitige Situation sowie auf die Tatsache, dass keiner außerhalb der genetischen Kraft der ›Zeit‹ sein kann. Mit Blick auf die Form-Inhalt-Relation liegt es auf der Hand, dass die von ihr ableitbare Perspektivierung nicht zuletzt eine wertende Einstellung impliziert. So kann alles, was ›Form‹ ist, als negativ und unterentwickelt betrachtet werden. Prutz fordert aber dazu auf, diese Relation nicht als einen Gegensatz zu konzipieren, indem er eben auf das Argument der Verzeitlichung sowie der Immanenz des Geistes setzt. Der Aufsatz ›Vaterland? oder Freiheit? Brief an einen Freund‹ kann das verdeutlichen und die Beschaffung dieser Relation besser charakterisieren. Prutz gibt die Argumente des im Titel genannten Freundes für die Ersetzung im progressiven Lager des Begriffs ›Vaterland‹ durch den semantisch breiteren Begriff der ›Freiheit‹ wieder. Dieser Freund ist ebenfalls als Schriftsteller tätig und seine literarische Praxis ist im Rahmen einer Wirkungsästhetik angesiedelt. Ausgangspunkt seiner Betrachtungen und Grund für die vorgeschlagene Ersetzung ist die reaktionäre diskursive Position, aus der der Begriff ›Vaterland‹ aktuell verwendet wird: Er ist, genauso wie semantisch benachbarte Begriffe wie etwa ›Nationalgefühl‹, ›Nationalität‹ und ›Patriotismus‹, von den 59 Vgl. dazu Michael Ansel, Prutz, Hettner und Haym. Hegelianische Literaturgeschichtsschreibung zwischen spekulativer Kunstdeutung und philologischer Quellenkritik, Tübingen 2003, S. 166–169, 210–213. 60 Prutz 1847–48, Band 2, S. 68–69.
Robert Prutz’ Kleine Schriften. Zur Politik und Literatur (1847–48)
73
Regierungen instrumentalisiert und mithin ideologisch besetzt worden. Eine gewisse semantische Zweideutigkeit ist dadurch bei diesem Begriff entstanden und er kann somit im politisch-progressiven Lager nicht mehr vorbehaltlos verwendet werden. Neben die ideologische Instrumentalisierung des Begriffes tritt ein eher (sprach-)philosophisches Argument hinzu: Dieser Schriftsteller, der auf den Begriff der ›Freiheit‹ setzt und dabei eine eher humanistische Position vertritt, kritisiert noch grundsätzlicher am Begriff des ›Vaterlandes‹ den außersprachlichen Referenzrahmen und dessen basale Inkompatibilität mit der ›reinen‹ Abstraktheit des ›Geistes‹: »Vaterland, sagst Du – was ist es denn eigentlich? Geboren sein an einem bestimmten Orte, aufwachsen in einer bestimmten Umgebung, in bestimmten äußeren Verhältnissen, eine bestimmte Sprache als Mitgift überkommen haben – Aber das sind ja lauter rohe Naturbestimmungen, da ist gar kein geistiger Inhalt, für den man sich interessiren, kein geistiges Prinzip, das man theilen könnte.«61
Auf den Begriff des ›Vaterlandes‹ kann man also verzichten, weil er auf »rohe Naturbestimmungen« hinweist. ›Natur‹–›Geist‹ ist also die bei der Argumentation des befreundeten Schriftstellers übergeordnete Opposition. Gegen den dargelegten Standpunkt argumentiert Prutz folgendermaßen: »Prüfen wir uns, lieber Freund, ob in dem geringschätzigen Zusatz, mit welchem wir dies Wort begleiten, […] nicht noch ein Nachklang liegt von jener abstracten Einseitigkeit des Systems, jenem doctrinären Hochmuth der Schule, von dem wir uns täglich mehr loszuarbeiten suchen, damit das Unvergängliche und Wahre desselben, sein Kern und innerstes Wesen, in freier, eigener Gestaltung, sich desto fruchtbarer in uns bethätige. Natur ist überall schlechter als Geist, sie ist abgefallener, verhüllter Geist – Sehr wohl! so ist doch auch verhüllter Geist noch immer Geist, so wartet doch auch der abgefallene nur der befreienden Versöhnung.«62
Diese Stelle ist im Hinblick auf den Umgang mit Hegels philosophischem Erbe und die kritische Rezeption seines Systems offenbar sehr relevant. Thematisiert wird die Distanzierung von einer orthodoxen und (aus Prutz’ Sicht) Hegels Philosophie missverstehenden Schule. Als Vermittlungsinstanz, welche die »geistige Befreiung der gebundenen ›rohen Naturbestimmungen‹«63 vollbringen und sie zum Geistigen und Sittlichen erheben kann, tritt bei Prutz der Mensch. So werden diese materialistischen Instanzen (Familie, Herkunftsort, usw.), die allerdings Anteil am Geist haben, zu Elementen, welche Charakter und Persönlichkeit des Individuums bestimmen. In Analogie dazu sind diese »rohen Naturbestimmungen« auch für Völker und Nationen von Belang (»Denn dies endlich ist das Resultat dieser ganzen Gedankenreihe: die Nationalität ist die 61 Ebd., Band 1, S. 80. 62 Ebd., S. 83–84. 63 Ebd., S. 87.
74
Historisierung
Persönlichkeit – Patriotismus als das Bewußtsein dieser Persönlichkeit, die Ehre der Völker«64). Die Analogie resultiert aus der Metaphorisierung des menschlichen Bildungsprozesses, der auf abstrakt-kollektive Dimensionen bezogen wird und somit zur beinahe universalen Geltung gelangt. In einem ohne weiteres als hierarchisch konzipierten System bilden die sogenannten »rohen Naturbestimmungen« die erste prägende Instanz, welche bis zum Gipfel des Bewusstseins für ein Volk und eine Nation fortlebt und noch zu spüren ist: »die Erde […] – dieser Ball selbst mit seinem festen Land, seinen Inseln, seinen Meeren, Gebirgen, Flüssen – er ist erwacht, er lebt – in seinen Bewohnern! Die Länder bewegen sich in den Völkern, die sie bewohnen! Die Nationen und ihre Thaten sind die letzten, äußersten Spitzen, die feinsten Nervenenden gleichsam der Erde, welche in ihnen erst ihre volle Entwicklung, ihr wahres Leben hat!«65
Vor dem Hintergrund eines sich im Grunde als pantheistisch kennzeichnenden Zusammenhangs sind diese Formen durch eine Logik der Potenzierung und der Verklärung miteinander verbunden. Ganz zentral ist auch die Vorstellung einer allmählichen Belebung des in den gewissermaßen basalen Formen ruhenden, latenten geistigen Lebens. Prutz bedient sich auch der Metapher des Organismus, um diesen Zusammenhang besser charakterisieren und Begriffe wie »Vaterland«, »Patriotismus«, »Nationalität« von den kurzsichtigen Frontstellungen der Tagespresse emanzipieren zu können. Prutz und der befreundete Schriftsteller sind sich darüber einig, dass das Prinzip der Freiheit als die »eigenste Vollendung«66 des Lebens zu sehen ist. Auf die Begriffe des ›Volks‹, des ›Vaterlandes‹ und der ›Nationalität‹ kann nicht verzichtet werden, weil sie, so Prutz, die Formen sind, in denen sich das Prinzip der ›Freiheit‹ verkörpert und individualisiert. Ganz nach Hegel argumentierend subordiniert er somit jede Erscheinung dem metaphysischen, immateriellen Prinzip der ›Freiheit‹: »[W]ie die Natur nur eine Form, eine verhüllte, des Geistes, so auch ist die Existenz, […] das Individuum als solches nur eine Form, eine beschränkte, endliche des allgemeinen Seins. Aber, Freund, eine nothwendige Form! […]. Ja die ganze Geschichte, die gesammte Entwicklung des Geistes, was ist sie anders als ein fortwährendes sich Individualisiren, ein fortwährendes (damit wir auch die Barbarei der Schulsprache einmal 64 Ebd., S. 89. Folgende Stelle kann das ebenfalls verdeutlichen: »der ganze äußerliche Apparat dessen, was man gemeinhin Heimath oder Vaterland benennt – […] jene Naturbestimmungen [sind] keineswegs so völlig roh, […] wie Du es darstellst; […] sie [übergehen] vielmehr, in der Gestalt geistig sittlicher Mächte, in das Wesen der Völker selbst; […] gerade aus ihnen, wie sie den Charakter eines jeden Einzelnen von uns bilden und bestimmen helfen, so auch aus ihnen die Individualität der Völker, die Persönlichkeit der Nationen sich entwickelt«, ibidem. 65 Ebd., S. 88. 66 Ebd., S. 103.
Robert Prutz’ Kleine Schriften. Zur Politik und Literatur (1847–48)
75
nicht scheuen) sich als Existenzen Setzen des allgemeinen, ewigen Seins? […]. Daß die Erscheinung die Idee niemals völlig decken, die Einzelheit das Allgemeine, die Existenz das Sein niemals völlig enthalten und umschließen wird, das ist richtig genug: aber dies fortwährende Setzen und Aufheben und Drüberhinausgehen, dies Kämpfen und Siegen und in diesem seinem eigenen Siege aufs Neue Unterliegen, diese ewigen endlosen Kreise, aufsteigend in unabsehbarer Reihe […] – ich bitte Dich, Freund, was ist denn Leben, was ist Geschichte, wenn nicht dies?! Und wie willst Du dies Alles ermöglichen ohne Existenz und ohne Persönlichkeit?! – seine Persönlichkeit zum Princip machen, das soll man allerdings nicht: wohl aber das Princip zu seiner Persönlichkeit – da liegt’s! Nicht ich mache mich geltend gegen das Princip, sondern das Princip macht sich geltend in mir.«67
In Prutz’ Worten kommt eine Legitimierung der Erscheinungen zur Geltung, welche wiederum erst berücksichtigt werden können, wenn sie im Dienste eines ihnen übergeordneten Prinzips stehen. Die selbstbezogene Erscheinung, die das ihr überlegene, steuernde Prinzip nicht erkennen kann, besitzt keinen historischen Wert, weil sie keine geschichtliche Entwicklung im Sinne der im obigen Zitat beschriebenen gesetzmäßigen Dynamik ermöglicht. Prutz kommt demnach zu folgender Schlussfolgerung: »Wir sollen nicht bloß Persönlichkeit sein, sondern von dem Allgemeinen erfüllte, geistig berechtigte Persönlichkeit; ebenso die Völker sollen nicht bloß Nationen sein, sondern freie Nationen. So wenig das Allgemeine die Persönlichkeit vernichtet, vielmehr es veredelt sie: so wenig auch von der Freiheit wird die Nationalität vernichtet, vielmehr verklärt von ihr. Nicht also Gegensätze sind Nationalität und Freiheit, Patriotismus und Humanität – vielmehr Ergänzungen; nicht Vaterland oder Freiheit ist die Devise, vielmehr Vaterland und Freiheit, ja in unmittelbarem, organischem Zusammenhang: das freie Vaterland!«68
›Form‹ und ›Inhalt‹ charakterisieren sich also als gegenseitige Ergänzungen und die »rohen Naturbestimmungen« werden mithin in die Geschichte integriert. Bezüglich der eingangs aufgeworfenen Fragen nach dem Umgang mit Hegels Philosophie lässt sich feststellen, dass das Fortschrittsnarrativ (Geschichtsphilosophie) und die für sein System leitende Vorstellung der Vermittlung von Wirklichkeit und Idee als Inbegriff der Dynamik der Geschichte erst einmal in Prutz’ Aufsätzen69 Einsatz finden. Insbesondere handelt es sich um die selektive Rezeption eines Aspektes, der sich dem besonderen politisch-historischen Zusammenhang offenbar leicht anpassen lässt: So wird die gewissermaßen konzeptionell und narrativ einigende Funktion von ›Geist‹ und ›Idee‹ auch von den Begriffen der ›Geschichte‹ und der ›Freiheit‹ geleistet. Diese im Grunde ebenfalls 67 Ebd., S. 90–91. 68 Ebd., S. 93–94. 69 Wie sich weiter unten noch deutlicher zeigen wird, gelten diese Beobachtungen auch für die Schriften zur Literatur.
76
Historisierung
weiten und unspezifischen Begriffe – wie übrigens die zukunftsoffene Zeitperspektive – signalisieren den politischen Schwerpunkt dieser Schriften. Eine weitere bedeutsame Abweichung besteht im kommunikativen Zusammenhang, in dem diese Texte entstehen: Prutz, wie übrigens die meisten Autoren im Kreis des Hegelianismus, hat kein philosophisches System konzipiert; in diesem Fall handelt es sich um Zeitungsartikel, die dann in überarbeiteter Fassung in einer Sammlung erschienen sind. Die Überlegungen werden programmatisch an ein breites Publikum adressiert und das prägt auch – so die These – die Rhetorik der Beiträge. Es scheint somit sinnvoll, diese Aspekte ins Verhältnis zu setzen: Die räsonierende Prozessualität, welche im Aufsatz ›Vaterland? oder Freiheit?‹ durch die Erwähnung der Gegenpositionen und der möglichen Einwände erreicht wird, erstreckt sich auf alle Artikel; sie ist somit keineswegs bloßes Produkt der (fiktiv) informellen Kommunikationssituation (›Brief an einen Freund‹). Diese Strategie der Darlegung sorgt für die Haltbarkeit der Thesen sowie die detaillierte Wiedergabe der Standpunkte in der öffentlichen Debatte und schafft dadurch auf Seiten der Rezipienten Orientierung.
2.4.2 Literaturwissenschaftliche Perspektiven: das Modell ›Geschichte‹ und die Integration peripherer Untersuchungsgegenstände Einige der für die Schriften zur Politik angestellten Überlegungen lassen sich auch auf die Aufsätze zur Literatur beziehen. So kommt ›Literatur‹ in erster Linie als Konkretionsform des ›Geistes‹ in den Blick. Für die Gesamtkonzeption und die daraus resultierenden Zeit- und Gegenwartskonzepte ist die Denkform einer fortschreitenden ›Geschichte‹ hier also ebenfalls von grundlegender Bedeutung. Bezüglich der kompositorischen Verfahren und der Diktion tendiert Prutz auch in den literaturwissenschaftlichen Aufsätzen zu einer dynamischen Darlegung des eigenen Standpunktes und lotet dabei die Gegenpositionen aus. Der Umgang mit Hegel bildet auch in diesen Schriften einen wichtigen Aspekt und ist deswegen im Folgenden zu berücksichtigen. Wieder einmal erweist sich die Frage nach der Vermittlung zwischen geschichtsphilosophischem Modell und Untersuchung der ›Gegenwart(sliteratur)‹ als zentral. Aufgrund des spezifischen Gegenstandes dieser Aufsätze kommen allerdings noch andere Fragen in Betracht, die nun in Verbindung mit den bereits gewonnenen Ergebnissen gesetzt werden sollten. In erster Linie handelt es sich dabei um die Frage nach dem wissenschaftsgeschichtlichen Beitrag dieser Aufsätze. Bislang sind in dieser Beziehung lediglich die zeitgenössischen Literaturgeschichten untersucht worden: Klaus Weimar betont beispielsweise in seiner Geschichte der deutschen Literaturwissenschaft bis zum Ende des 19. Jahrhunderts (2003), wie Robert Prutz mit seinem ersten literaturgeschichtlichen Werk
Robert Prutz’ Kleine Schriften. Zur Politik und Literatur (1847–48)
77
(Der Göttinger Dichterbund. Zur Geschichte der deutschen Literatur, 1841) »konzeptionelle Arbeit«70 im Rahmen dieser Disziplin geleistet hat. Anders als der trotzdem viel rezipierte und wirkungsmächtige Gervinus hat er tatsächlich zur Wissenschaftlichkeit dieser Disziplin beigetragen und sie einen gewissen Rückstand gegenüber Philologie und Geschichtswissenschaft teilweise aufholen lassen71. In einem aus theoriegeschichtlicher Perspektive nicht gerade ergiebigen Zeitraum hat Prutz, so Weimar, der ›Literaturgeschichte‹ einige Bezugspunkte in methodologischer Hinsicht verliehen, an denen andere Literaturhistorikerinnen und -historiker lange festhalten konnten. Gemeint ist in erster Linie die gelungene Vermittlung zwischen spekulativer Forschungsperspektive und Untersuchung von »Einzelheiten des darzustellenden Handlungszusammenhangs«72. Anders als Gervinus’ Literaturgeschichte, die dem »Spielen von Gesellschaft«73 dient und demnach völlig in die Politik übergeht, zeichnet sich Prutz’ Literaturgeschichte durch die unabgeschlossene Perspektive und die »Fixierung auf die Aufgaben der Realphilologie«74 aus. Außerdem weist Weimar auf Prutz’ Leistung hin, unbeachtete Untersuchungsgenstände als Erster in den Blick genommen zu haben75. An Weimar anschließend rückt Michael Ansel in seiner Dissertation Prutz, Hettner, Haym. Hegelianische Literaturgeschichtsschreibung zwischen spekulativer Kunstdeutung und philologischer Quellenkritik (2003) die bislang wenig beachtete Vorläuferleistung der Literaturgeschichten der genannten Autoren für den Historismus und den New Historicism in den Mittelpunkt. In (relativer) Abhebung von einem rein spekulativen Ansatz impliziert das eine Integration von historisch-empirischen Daten in einen grundsätzlich noch metaphysisch konzipierten Bezugsrahmen. Die Vorläuferleistung besteht zudem darin, diese Daten in Verbindung mit der Entstehungszeit gebracht und demnach das Argument der ›Historizität‹ der Erscheinungen geltend gemacht zu haben. Dabei tritt nicht zuletzt das Zurückweisen der literaturgeschichtlichen Tendenzen auf den real- bzw. sozialgeschichtlichen Zusammenhang in den Vordergrund76. Ansels Studie setzt sich außerdem sehr intensiv mit der Frage 70 Klaus Weimar, Geschichte der deutschen Literaturwissenschaft bis zum Ende des 19. Jahrhunderts, Paderborn 2003, S. 325. 71 Ibidem. 72 Ebd., S. 330. 73 Ibidem. 74 Ebd., S. 333. 75 »Geliefert hat er […] einen Längsschnitt durch die ganze Literaturgeschichte unter dem Aspekt des Politischen, Erkundungen in mißachteten oder unbeachtet gebliebenen Sektoren der Literaturproduktion, die umfassend angelegte und Fragment gebliebene historische Darstellung des gesamten Zeitschriften- und Rezensionswesens, den großen historischen Überblick über die Theater- und Aufführungspraxis, biographische Arbeiten und natürlich die literaturgeschichtliche Begleitung der aktuellen Literatur«, ebd., S. 331–332. 76 Vgl. dazu Ansel 2003, S. 292–294.
78
Historisierung
nach der Rezeption Hegels auseinander und nimmt, in Kontinuität mit den zahlreichen Forschungsbeiträgen zur kulturhistorischen Genese der Denkform ›Geschichte‹ sowie zur konkreten philologischen Praxis77, stets auch institutionsgeschichtliche Aspekte in den Blick. Diese haben, zumindest zu Lebzeiten der behandelten Autoren, eine Etablierung dieser Richtung unmöglich gemacht. Obwohl in Ansels Studie auf die große Bedeutung der zur selben Zeit entstandenen Zeitungsartikel und Essayistik »nicht nur […] für die Kunst- und Literaturkritik, sondern […] auch für die Entstehung der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Kunst und Literatur«78 hingewiesen wird, stehen diese nicht im Mittelpunkt der Untersuchung und werden deshalb keiner eingehenden Analyse unterzogen. Der Fokus der Studie liegt vielmehr auf literaturgeschichtlichen Darstellungen der Romantik bei Prutz, Hettner und Haym im Hinblick auf den Prozess der Verwissenschaftlichung der Literaturgeschichtsschreibung. In Ansels Dissertation werden allerdings Beobachtungen formuliert, welche für die hier im Vorfeld angestellten Überlegungen durchaus fruchtbar gemacht werden können. Ansels Studie stellt in wissenschaftsgeschichtlicher Hinsicht eine kennzeichnende Ambivalenz bei den Werken dieser Autoren fest: Einerseits lassen sich zahlreiche Elemente eines modernen Wissenschaftsverständnisses und einer modernen Wissenschaftspraxis nachweisen; andererseits können sich die Autorinnen und Autoren in Hegels Nachfolge von der idealistischen Metaphysik und der Geschichtsphilosophie nicht wirklich emanzipieren. Man könnte beinahe behaupten, sie hätten nur Hegels Begriff der ›Idee‹ durch den Begriff der ›Zeit‹ ersetzt und damit die Entwicklungsgeschichte des ›Volksgeistes‹ in den Blick genommen. Nimmt man diese Vorstellung ernst, dann könnte mit Bezug auf Hegels Erbe allenfalls von unerheblichen ›Variationen‹ die Rede sein. Diese Annahme stellt aber, so die These, eine Pauschalisierung dar, welche den vielen bedeutsamen Verschiebungen von der etablierten philologischen Forschungspraxis nicht gerecht wird und die Unterschiede innerhalb des Hegelianismus verkennt. Um sich als Interpretin und Interpret vom Bann einer, allerdings mit Recht, festgestellten Ambivalenz79 dann doch emanzipieren zu können, sollte man die im Rahmen dieses Paradigmas entstandenen Werke nicht vor der Folie 77 Gemeint sind gemeinsam mit den bereits erwähnten Studien Weimars auch Jürgen Fohrmanns Habilitationsschrift Das Projekt der deutschen Literaturgeschichte: Entstehung und Scheitern einer nationalen Poesiegeschichtsschreibung zwischen Humanismus und deutschem Kaiserreich (1989) sowie die von demselben und Wilhelm Voßkamp herausgegebenen Sammelbände Wissenschaft und Nation. Studien zur Entstehungsgeschichte der deutschen Literaturwissenschaft (1991) und Wissenschaftsgeschichte der Germanistik im 19. Jahrhundert (1994 gemeinsam mit Uwe Meves hg.). 78 Ansel 2003, S. 85. 79 Der Titel dieses Unterkapitels spielt übrigens auch darauf an.
Robert Prutz’ Kleine Schriften. Zur Politik und Literatur (1847–48)
79
›moderner‹ bzw. avancierter Wissenschaftspraxis betrachten. Die Leistungen, die Prutz und generell das Hegelsche Paradigma jedoch erbringen, betreffen in erster Linie den Habitus: Die objektive, unvoreingenommene Einstellung, die Prutz programmatisch besonders stark propagiert, macht die Literaturkritikerin und den Literaturkritiker zu idealen Gegenwartsbeobachterinnen und -beobachtern, denn sie ermöglicht die Wahrnehmung und Untersuchung neuartiger Phänomene. Wenn man also bedenkt, dass sich die wissenschaftsgeschichtlich bemerkenswerten Leistungen eher im Rahmen des Habitus als auf der Ebene der Theorie situieren lassen, ergeben sich mit Blick auf das Verfahren der ›Historisierung‹ zahlreiche Fragestellungen. Wie lassen sich die im Rahmen dieses Paradigmas Kunst- und Literaturbetrachtung betreffenden Grenzen dennoch positiv wenden? Wie lässt sich die Dominanz des Modells ›Geschichte‹ ins Verhältnis zur Gegenwart bringen? Die Integration der Literatur- und Kunstgeschichte in die Geschichte des Volksgeistes und deren demnach angenommene Repräsentativität für eine vordeterminierte Entwicklung haben unvermeidlich die Vernachlässigung deren Eigendynamik80 zur Folge. Zu fragen ist also: Welche Konsequenzen haben die Dominanz und universale Geltung dieses Geschichtsmodells für die Perspektivierung von ›Gegenwart‹ und ›Gegenwartsliteratur‹? Ganz basal betrachtet stellt ein geschichtliches und geschichtsphilosophisches Modell im Hinblick auf die Untersuchung von ›Gegenwart‹ und ›Gegenwartsliteratur‹ stets die Prozesse der ›Genese‹ und des ›Wandels‹ sowie die Operation der Ermittlung von Kontinuitäten (Tradition) und Zäsuren (Erneuerung) in den Vordergrund. Im Sinne einer ›starken Historisierung‹ können also literarische Erscheinungen und Tendenzen zur Sichtbarmachung und »Rekonstruktion historischer Verläufe«81 dienen. Zu überprüfen ist also, ob sich die literaturwissenschaftlichen Leistungen anhand dieser den historischen Verlauf taktierenden Kategorien besser spezifizieren lassen. Wenn ›Zeit‹ und ›Geschichte‹ zu Wertungsinstanzen, Ein- und Ausschlusskriterien werden, so erscheint es sinnvoll, sich zu fragen, ob die von Prutz analysierten literarischen Erscheinungen eine
80 Vgl. dazu Ansel 2003, S. 213ff. 81 Auf eine ›starke Historisierung‹ weist Daniel Fulda mit Bezug auf literaturwissenschaftliche Operationen hin: »Die Literaturwissenschaft ›historisiert‹ üblicherweise, indem sie bei ihren Textinterpretationen historische Kontexte als erklärungsrelevant berücksichtigt – also in einem schwachen Sinn von Historisierung. Sie historisiert jedoch weit seltener, in dem starken Sinne, dass ihre Textanalysen wesentlich auf die Rekonstruktion historischer Verläufe, d. h. von Veränderungsprozessen in der Zeit, zielen und darin ihren Sinn finden«, Fulda 2014, S. 102. Die von Fulda beschriebene Operation wird hier auf historisches Material bzw. Prutz’ Aufsätze angewandt, dabei allerdings berücksichtigend, dass die ›historischen Verläufe‹ teils aus der Realgeschichte teils aus einer geschichtsphilosophischen Stilisierung resultieren.
80
Historisierung
Trägerfunktion für die skizzierten Prozesse und Operationen überhaupt ausüben können. 2.4.2.1 Genese, Kontinuität, Entwicklungsgeschichte Unter dem Gesichtspunkt der ›Genese‹ und somit der Ermittlung von Kontinuität kann der Artikel ›Zur Geschichte der deutschen Übersetzungsliteratur: Sophokles‹ gelesen werden. Prutz berücksichtigt hier insbesondere die Genese formaler Gattungsparadigmen in der deutschen Literatur, welche sich wiederum auf die Rezeption und Übersetzung griechischer und römischer Klassiker zurückführen lässt. Mit durchaus emphatischen Akzenten betont Prutz, dass sich die Wirkungsgeschichte der Antike auch mit Blick auf die gegenwärtige Zeit weiterverfolgen lässt: Sie kann »ein[en] Dichter, ein[en] Künstler […] zu freier Production«82 bewegen. Prutz hebt zudem hervor, dass dieser noch ausbleibende83, konstitutive Teil der Geschichte der deutschen Literatur in dezidierter Abhebung von den Forschungspraktiken der Philologen verarbeitet werden sollte, wie folgende Stelle verdeutlicht: »Dieser […], der Geschichtschreiber der deutschen Literatur, getreu seinem Berufe, das Leben unsers besondern deutschen Geistes in seiner poetischen Gestaltung darzulegen, wird dabei nicht umhin können, eine vorzügliche Aufmerksamkeit auf die Einflüsse zu wenden, welche wir von außen her erfahren und die, gleich Sonnenschein und Regen, die edle Pflanze unserer Bildung zu glücklichem Gedeihen erzogen haben. […]. [S]o sind auch für unsere Literatur diese Jahre der Dienstbarkeit, diese Durchgänge durch fremde Elemente […] dennoch nothwendige Stadien der eigenen Entwicklung gewesen. […]. Der Philolog, in die historischen, fest gewordenen Zustände einer vergangenen Zeit versenkt, in dem redlichen Bemühen, diese Vergangenheit in all ihren Einzelnheiten zu ergründen und zu Tage zu fördern, wird […] verführt, über die Einzelheiten das Allgemeine zu vergessen; die historischen Zustände, indem er es verabsäumt, sie zu neuer Belebung an den Busen unsrer Gegenwart zu legen, werden ihm zur todten Kenntniß; in die Vergangenheit sich einspinnend und aus ihrem behaglichen Besitz auf die wogende Gegenwart und insbesondere auf die Interessen unsrer vaterländischen Literatur wie mit Verachtung herabblickend, verliert er den Ariadnefaden lebendigen Bewußtseins […].«84
Als Erstes wird auf die metaphysische Geschichtsauffassung hingewiesen: Die Geschichte der deutschen Literatur ist eine (historische) Form des Lebens des deutschen Geistes. Zu den Aufgaben der Literaturhistorikerin oder des Litera82 Prutz 1847–48, Band 1, S. 194. 83 Prutz stellt fest, dass »es an einer Darstellung, welche uns aufklärte und unterrichtete über die Art und den Zusammenhang dieser innerlichsten Verwandtschaft [noch fehlt]«. Mit dieser »allgemeinste[n] flüchtige[n] Skizze« nimmt er sich demzufolge vor, »die reifere Kraft gelehrterer Männer für diesen Gegenstand anzuregen«, ebd. S. 111, 116. 84 Ebd., S. 112–114.
Robert Prutz’ Kleine Schriften. Zur Politik und Literatur (1847–48)
81
turhistorikers gehört auch die komparatistisch orientierte Rekonstruktion der Rezeptionsvorgänge, die sich für die gegenwärtige Gestaltung der Literatur bereits als produktiv erwiesen haben oder noch erweisen werden. Gerade der Blick auf die Gegenwart und die Vorstellung einer Kontinuität bzw. eines genetischen Verhältnisses zwischen dieser und dem untersuchten historischen Gegenstand bildet den Unterschied zwischen ›literaturgeschichtlichen‹ und ›philologischen‹ Forschungspraktiken. Wie in der vorliegenden Studie mit Bezug auf die Quellensprache bereits ausführlich dargelegt wurde85, tendiert die Philologie auch in Prutz’ Frontstellung zu detailbesessener und selbstgenügsamer Stellen- und Textexegese (»todte[] Kenntnis«), bei der der Text keinerlei Kontextualisierung erfährt. Die beschriebenen, diametral entgegengesetzten Forschungspraktiken spiegelten wiederum einen im 19. Jahrhundert brisanten institutionspolitischen Konflikt wider: »[I]m ganzen 19. Jahrhundert […] war […] die Literaturgeschichtsschreibung […] nicht das Geschäft der akademischen Philologie, sondern von Historikern und solchen Germanisten, denen die Etablierung als Universitätsprofessor nicht gelang«86. Dabei handelt es sich zum Teil also auch um den Versuch, aus einer institutionspolitisch nicht legitimierten Position einen alternativen Ansatz zu etablieren. Im Rahmen dieses Ansatzes werden die wissenschaftliche Beschäftigung mit antiker Literatur sowie deren historisches Verständnis als produktiv für die Geschichte des Geistes, die sich noch nicht vollzogen hat, betrachtet (»alle historische Kenntniß, alle Vertiefung ins Alterthum, was soll, was allein darf sie auch für den Gelehrtesten sein, als nur ein Durchgang, eine Bildung für das Leben der Gegenwart?!«87). Bezüglich des im engeren Sinne historischen Teils des Aufsatzes wird die Geschichte der deutschen Übersetzungsliteratur koevolutiv bzw. parallel mit der Geschichte der deutschen Literatur sowie mit der Kulturgeschichte überhaupt dargelegt. Nachdem rekonstruiert wird, wie mit dem »Christentum« und der »Entkleidung des römischen Mythus vom Nationalen«88 die Voraussetzungen für eine Vermittlung der klassischen Literatur im deutschsprachigen Raum erst einmal geschaffen wurden, wird dann der Entwicklung dieses Vermittlungsanspruchs nachgegangen: Zunächst war er von einem wesentlich stofflichen Interesse geprägt, das dann von einem formalästhetischen abgelöst wurde. Die Etappen der Geschichte der Übersetzungsliteratur entsprechen somit denjenigen der Entwicklung der deutschen Literatur zu einem ›autonomen‹ Bereich, dessen Organisationsprinzipien also nicht mehr fremdbestimmt sind. So zählt in diesem
85 S. Kapitel 1 der vorliegenden Studie. 86 Fulda 2014, S. 103–104. Zum institutionsgeschichtlichen Zusammenhang vgl. Ansel 2003, S. 303–309. 87 Prutz 1847–48, Band 1, S. 194. 88 Ebd., S. 119–120.
82
Historisierung
Zusammenhang die Reformation89 zu den wichtigsten Zäsuren: Ihre Bedeutung für die deutsche Geschichte überhaupt wird erstmals von Hegel betont und wird dann bei den Autoren im Kreis des Hegelianismus beinahe zum Topos. Als besonders bedeutend erweisen sich zudem die Gründung der Universität Göttingen, wo die Emanzipierung der Philologie von der polyhistorischen Methode angestrebt wird90, sowie die Leistung Lessings, welche in erster Linie in der Befreiung vom französischen Joch besteht. Die Integration der Geschichte der deutschen Übersetzungsliteratur in diejenige der Literatur sowie ins Metanarrativ des Werdegangs des Volksgeistes hat nicht nur zur Folge, diese mehr oder weniger etablierten Narrative samt ihrer Wendepunkte zu bestätigen; eine gegenstandsbezogene Folge sollte dabei ebenfalls in Betracht gezogen werden. Sehr heterogene Untersuchungsgegenstände in denselben Entwicklungsvorgang zu zwingen, verkennt unvermeidlich deren Spezifik; allerdings bewirkt dieser Integrationsgestus, so die These, dass sie überhaupt kanonfähig werden. Bislang unberücksichtigten Untersuchungsgegenständen – in diesem Fall also der Geschichte der deutschen Übersetzungsliteratur – Anteil an der Geschichte des deutschen Geistes zuzuschreiben, bedeutet also, positiv gewendet, das Spektrum des Fachs zu erweitern. Betrachtet man die Leistung Prutz’ aus diesem Gesichtspunkt, dann lässt sie sich kaum überschätzen. Eine solche Erweiterung des Spektrums der Literaturgeschichte kennzeichnet auch den Aufsatz ›Ueber Reisen und Reiseliteratur der Deutschen‹: Prutz konstatiert das Ausbleiben einer Darstellung der Reiseliteratur als ›schöner Literatur‹91 und betont, dass auch »an diesem abgesonderten, mehr blätter- als früchtereichen Zweige […] das […] Wachstum und der gesamte Bildungsgang des großen Baumes unsrer Literatur, ja unsrer geistigen Entwicklung überhaupt nachweisen lassen«92. Die »geistige Entwicklung« wird zudem anhand einer Kulturgeschichte des Reisens veranschaulicht. Davon ausgehend wird die Entstehung und Entwicklung der Reiseliteratur zurückverfolgt. Besonders prägnant markiert Prutz den Unterschied zwischen Reisen im Mittelalter und Reisen in der 89 Ebd., S. 152ff. 90 »Von besonderer Bedeutung ist […] die Gründung der Universität Göttingen (1747), welche, was fünfzig Jahre zuvor Halle für Philosophie und Theologie gewesen, jetzt vornähmlich für die realen Wissenschaften der Philologie und Geschichte ward. Man hatte nicht mehr die rechtgläubige Sicherung des Dogmas, nicht mehr die polyhistorische Anhäufung philologischen Stoffes vor Augen: sondern auch die Kenntniß des Alterthums sollte fruchtbar werden fürs Leben und, den ganzen Menschen ergreifend, ihn harmonisch, gebildet, geschmackvoll machen«, ebd., S. 175. 91 Von einer Fachbezeichnung im vormodernen Wissenschaftssystem wird die Formulierung ›schöne Literatur‹ zum Element einer Binnendifferenz: Sie entspricht einer durch formalästhetische Ansprüche gekennzeichneten Literatur und stellt sich einer serienartig produzierten ›Unterhaltungsliteratur‹ entgegen. Vgl. dazu Weimar 2003, S. 322–323. 92 Prutz 1847–48, Band 1, S. 232.
Robert Prutz’ Kleine Schriften. Zur Politik und Literatur (1847–48)
83
modernen Zeit: Während diese Tätigkeit in der modernen Zeit »eine Schule des Lebens« ist, war sie im Mittelalter »ein Stück des Lebens selbst«93. Reisen hing beispielsweise mit dem Soldatenwesen zusammen und war generell mit dem Wunsch nach Lebensveränderungen verbunden: »es waren mehr Auswanderungen, als Wanderungen, mehr Ansiedlungen, als Reisen«94. Die Bewegung zu jener Zeit war also mehr im Sinne eines endgültigen örtlichen Wechsels zu verstehen, als im Sinne einer dialektischen »innere[n] Erweiterung«95, welche man mit in die Heimat zurückbringen konnte. In dieser frühen Phase der Geschichte des Reisens werden die Verschiebungen mittels der wohlbekannten, oppositiven Begriffe der ›Tat‹ oder des ›Lebens‹ auf der einen Seite, und der ›Philisterei‹ auf der anderen Seite beschrieben. Wie folgende Stelle verdeutlicht, knüpft die Entwicklungsgeschichte des Reisens in Prutz’ Darstellung auch an das Narrativ der ›Nation‹ an: »Eine andere Gestalt gewann dies, seitdem, im Laufe des siebzehnten Jahrhunderts, der ursprünglich ritterliche, thatlustige Charakter der Nation, der namentlich auch in diesen Reisen und Heerzügen sich Luft zu machen gesucht, zurück trat und endlich ganz verschwand gegen gelehrte Stubensitzerei, philologischen und theologischen Pedantismus, Philisterei und Bequemlichkeit.«96
Während im Mittelalter keine Reiseliteratur entstehen konnte, weil die Reisenden bzw. Auswanderer »Leute des Schwertes und der That«97 waren, entstehen im Rahmen dieser gelehrten, enzyklopädischen Reisen die ersten akribischen Dokumentationen, welche allerdings noch nicht als Reiseliteratur im engeren Sinne (d. h. als ›schöne Literatur‹) bezeichnet werden können. Das erfolgt erst später, und zwar in der Epoche der Empfindsamkeit, in der über die Vermittlung englischer Vorbilder eine von ›Naturgenuss‹ und ›Subjektivität‹ geprägte Reiseliteratur gefördert wird. Mit der Romantik erfolgt ein Übergang von Natur- zu Kunstschwärmerei: Das beliebteste Reiseziel bildet nicht mehr ein Land (Italien), sondern eine Epoche – das Mittelalter. In diesem Zusammenhang gewinnen das Reisen und die Reiseliteratur, noch dezidierter als sonst, eskapistische Züge. Dabei handelt es sich um eine Veränderung, die Prutz sehr kritisch betrachtet. Einen Beitrag zur Emanzipierung von dieser eskapistischen Einstellung sowie von Goethes Fixierung auf das ›schöne Subjekt‹, so in Prutz’ durchaus vereinfachter Darstellung, sieht der Verfasser in der Reiseliteratur der 30er Jahre: In diesen Reisekorrespondenzen erkennt er »eine Versöhnung und Durchdringung
93 94 95 96 97
Ebd., S. 233. Ebd., S. 234. Ibidem. Ebd., S. 235. Ebd., S. 234.
84
Historisierung
der Poesie und der Geschichte«98, welche zu den zukünftigen Tendenzen der Literatur gehören. Im Mittelpunkt dieser Reiseliteratur steht nicht mehr Kunst, sondern stehen Politik und öffentliches Leben; beliebtestes Ziel dieser Reisenden sind dementsprechend nicht mehr die geschichtsgesättigten Städte Italiens, sondern die französische Hauptstadt. Prutz betrachtet einige Entwicklungen innerhalb dieser Tendenz nicht ohne Vorbehalt99 und lässt von denselben den aktuellen Verfall dieser Reiseliteratur in eine »Klatschliteratur« ableiten. Die Einbettung der aktuellen Reiseliteratur in ein Verfallsnarrativ kulminiert dann in der Feststellung, sie sei zu einer professionalisierten und mithin dem Markt völlig unterstellten Tendenz geworden. Sie gehöre somit nicht mehr zur ›schönen Literatur‹. Diesen Zustand hält Prutz allerdings nicht für unwiederbringlich: Durch die »Entwicklung der Geschichte«100 wird sich »die Reiseliteratur […] aus dem Pfuhl der Persönlichkeiten und Klatschgeschichten […] erheben«101; somit wird sie »sich dem erneuten Organismus unsrer Literatur als gesundes Glied dienstbar einreihen«102. Die in Aussicht gestellte ›Wiedergeburt‹ der Reiseliteratur als ›schöne Literatur‹ verdeutlicht, wie die ›Geschichte‹ selbst zu einer Instanz literarischer Entwicklung geworden ist. Die unterschiedlichen Phasen dieser Entwicklungsgeschichte wurden wiedergegeben, um zu zeigen, wie sie mit dem literaturgeschichtlichen und – vor allem im Hinblick auf die Verfallsdiagnose – dem gegenwartsliterarischen Narrativ korrelieren. Dieser Integrationsgestus wurde auch bei der Übersetzungsliteratur festgestellt. Einige Unterschiede betreffen allerdings die ›Richtung‹ bzw. ›Lokalisierung‹ dieses Integrationsanspruchs: Während die Untersuchung der Übersetzungsliteratur der Rekonstruktion der Genese von für die deutsche Literatur relevanten Formen dient, ist die Geschichte der Reiseliteratur Teil einer Kulturgeschichte.
98 Ebd., S. 249. 99 »Hätten sie denselben [den sozialen Gesichtspunkt] also nur immer in Wahrheit festgehalten, hätten sie wirklich immer nur den Pulsschlag der Zeit behorcht und in wahrhafter lebendiger Schilderung uns ein Bild eigener wie fremder nationaler Zustände gegeben, so würde diese Reiseliteratur durchaus nur mit Dank aufzunehmen und als ein bedeutender Gewinn und Fortschritt unsrer Literatur überhaupt zu schätzen sein«, ebd., S. 250. 100 Ebd., S. 257. Gemeint ist die durch die Technik ermöglichte Ausweitung des Reisens auf andere Gesellschaftsschichten, welche den Bedarf nach diesen Klatschgeschichten zurücktreten lassen sollte, vgl. dazu S. 256. 101 Ebd., S. 256. 102 Ebd., S. 257.
Robert Prutz’ Kleine Schriften. Zur Politik und Literatur (1847–48)
85
2.4.2.2 Vorstufe des Wandels: Gegenwartsliteratur als Übergangsliteratur Standen im vorherigen Unterkapitel ›Genese‹ und ›Entwicklungsgeschichte‹, also Prozesse, die per se von einer diachronen Entwicklungsrichtung geprägt sind, im Mittelpunkt, so kommen in anderen Aufsätzen Tendenzen der Gegenwartsliteratur in den Blick. Dabei handelt es sich um synchron beobachtbare Phänomene. Als solche werden sie auch präsentiert. Anders als diese Gegenstände und Perspektive der Untersuchung betreffende Differenzierung vermuten lässt, wird die idealtypische Organisationsform ›Geschichte‹ auch in diesem Fall zum Einsatz gebracht. Die Phänomene, die in der Gegenwartsliteratur am häufigsten praktiziert werden (bspw. der historische Roman) oder sich gerade durch ihre ausbleibende Etablierung charakterisieren (die komische Literatur), werden in die Entwicklungsgeschichte der deutschen Literatur eingebettet. In diesem Zusammenhang geben sie der Phase des ›Übergangs‹ als notwendiger Vorstufe des Wandels Gestalt. Die Identifizierung der ›Gegenwart‹ mit der Phase des ›Übergangs‹ setzt bekanntlich ein Gegenwartskonzept voraus, das das Selbstverständnis der Zeitgenossen prägt. Dieses Konzept, bei dem ›Gegenwart‹ erst im Hinblick auf den absehbaren Wandel Sinn erhält, hat sich interessenterweise auch in der einst umstrittenen Epochenbezeichnung niedergeschlagen, über die heute mittlerweile am meisten Konsens herrscht (›Vormärz‹). Die Konzipierung der Gegenwartsliteratur als eine ›Übergangsliteratur‹ verstärkt diese bereits reichlich dokumentierte Vorstellung; an dieser Stelle sind die wiederkehrend gelieferten Argumente zu bestimmen, da sich diese Position, anders als die Organisationsform der ›Genese‹, in erster Linie auf propositionaler Ebene erkennen lässt. In den Aufsätzen ›Ueber die Armut der komischen Literatur, besonders der Deutschen‹ und ›Stellung und Zukunft des historischen Romans‹ werden komische Literatur und historischer Roman im Hinblick auf Aspekte der Produktion und Rezeption in Betracht gezogen. Während von einer deutschen komischen Literatur im Grunde kaum die Rede sein kann, erweist sich der historische Roman als die aktuell meist praktizierte und rezipierte Form. Gleichermaßen verachtet oder ignoriert werden sie aber von der akademischen Kritik bzw. den »Ästhetikern«103: Die komische Literatur wird wegen des postulierten unerheblichen ästhetischen Wertes traditionell vernachlässigt; den historischen Roman bezeichnen sie hingegen als eine »Zwittergattung«, »einen Bastard von Poesie und Prosa, ein Surrogat gleichsam der Kunst, wie es sich ziemt für unsre prosaische, halbe, kunstarme Zeit«104. Wieder einmal versucht Prutz im Einklang mit der oben erwähnten Erweiterung des Kanons diese fest etablierten Positionen 103 Ebd., S. 279. 104 Ebd., S. 279–280.
86
Historisierung
zunächst mithilfe von philosophisch-ästhetischen Argumenten zu hinterfragen. Dadurch gelingt es ihm, beide Erscheinungen zu legitimieren: Die Komik realisiert, so Prutz’ Argument, das »Grundprinzip« der Kunst (»Verklärung und Versöhnung der Welt, wie sie ist«105) und ist der Tragödie komplementär, weil sie die Gegensätze versöhnt, welche die Tragödie hingegen zu regelrechten Konflikten eskalieren lässt. In der unzulänglichen Verklärung besteht hingegen für die kritischen Beobachterinnen und Beobachter des historischen Romans dessen formalästhetische Hauptschwäche. Diesen Standpunkt widerlegt Prutz nicht, weil er ihn in ästhetischer Hinsicht als eine Tatsache betrachtet. Seine Kritik richtet sich vielmehr 1. gegen die Vorstellung einer den Deutschen angeborenen mangelnden Veranlagung zur Komik und 2. gegen die eigentlich auf demselben Prinzip basierende Idee, dass die »Zwitterhaftigkeit« des historischen Romans eine »Wahrheit«106 sei. In einem zweiten Schritt setzt er also dem Argument einer postulierten Unveränderbarkeit das der Historizität der Erscheinungen entgegen. Die einer Literatur zugeschriebenen ›Eigenarten‹ sind ihm zufolge also immer im Zusammenhang mit der ›Zeit‹ bzw. der ›Geschichte‹ zu betrachten – und demnach zu relativieren. Da, komparatistisch betrachtet, die komische Literatur schon immer an der Schwelle zur Moderne entstanden und ein Zeichen für die Reife des öffentlichen Lebens ist, lässt sich das Ausbleiben der Komik in Deutschland auf die verspätete Entwicklung im Bereich des Politischen zurückführen. Dies lässt sich wiederum nur mit »Taten« aufheben. Um den Übergangscharakter des historischen Romans zu beweisen, rekurriert Prutz, allerdings einige Anpassungen vornehmend, auf die hierarchische Gattungstheorie Hegels: Der historische Roman ist eine noch im Werden begriffene Gattung, weil er der Vorstufe des epischen Gedichts107 entspricht. Insbesondere stellt er die niedrigste Stufe der Entwicklung des Epos dar, wofür Deutschland noch nicht reif genug ist. Bezüglich der gedanklichen und kognitiven Voraussetzungen für eine solche Konzipierung der Erscheinungen erweist sich die Figur der (zeitlichen) ›Latenz‹ wieder einmal als angemessen – allerdings auf eine andere Art und Weise als etwa bei Gutzkows Zeitgenossen, einem Werk, das im nächsten Kapitel in den Blick genommen wird. Bei Prutz handelt es sich nicht um eine ›Latenz‹, welche vor dem Hintergrund einer Absage an die Geschichtsphilosophie mit der Undurchsichtigkeit der Zeichen zusammenhängt und somit keine abrundende Aussage erlaubt. Vielmehr liegt die ›Latenz‹ in der Historizität und Entwicklungsfähigkeit der Erscheinungen selbst: Sie verweisen stets auf etwas mehr als sich selbst bzw. als auf ihren aktuellen Zustand. Die Sinnsicherung von diesem nur zeitlich 105 Ebd., S. 263. 106 Ebd., S. 282. 107 Vgl. dazu ebd., S. 282, 286.
Robert Prutz’ Kleine Schriften. Zur Politik und Literatur (1847–48)
87
außerhalb der Erscheinungen stehenden ›Mehr‹ kann nur erfolgen, wenn die Zeitdiagnostikerin oder der Zeitdiagnostiker über ›historisches Verständnis‹ verfügt. Es handelt sich also um eine Frage der Anschauung, die bekanntlich beobachterabhängig ist. In den Aufsätzen im zweiten Band der Sammlung (›Die politische Poesie, ihre Berechtigung und Zukunft‹; ›Ueber das deutsche Theater‹; ›Ueber die Unterhaltungsliteratur, insbesondere der Deutschen‹) geht es ebenfalls um Tendenzen der Gegenwartsliteratur. Bei diesen Untersuchungsgegenständen wird die historische Rekonstruktion, die ja das tragende Merkmal der Aufsätze im vorherigen Unterkapitel bildet, noch stärker durch eine genaue Wiedergabe sämtlicher Standpunkte in der damaligen öffentlichen Debatte ersetzt. Diese beinahe zu gedanklichen Automatismen gewordenen Positionen will Prutz in Frage stellen und unterbrechen. Es handelt sich also um keine Retrospektiven, sondern um Aufsätze, mit denen Prutz in der öffentlichen Debatte Position bezieht. Deren Wirkung und Resonanz können sich also in der ›Gegenwart‹ entfalten. Bezüglich des Aufsatzes ›Die politische Poesie, ihre Berechtigung und Zukunft‹ kann analog zu anderen Beiträgen von einem Legitimierungsversuch die Rede sein. Sowohl von der Partei der »Ästhetiker« als auch von derjenigen der »Politiker« wird die Legitimität der politischen Poesie ontologisch negiert. Auf die ausführlich wiedergegebenen Gegenpositionen antwortet Prutz mit einer philosophischen Legitimierung des Gegenstandes: »Es ist nun […] die Natur des Individuums, als des persönlich gewordenen Geistes, sämmtliche Formen des Geistes […] als ein Besonderes in sich zurück- und aufzunehmen. Auch diesen unermeßlichen Inhalt also wird das schöne Individuum, sobald es ihn in sich aufgenommen, künstlerisch reproduciren. Die Stadien, in denen der einzelne Mensch und in denen ganze Nationen diesen Inhalt in sich aufnehmen und ihn bewußt und thätig wieder außer sich setzen, sind die Epochen in der Entwicklung (oder, wie man es früher nannte, der Erziehung) sowohl des Menschen, als des Menschengeschlechtes. Daß nun auch der Staat eine Form und Offenbarung des Geistes ist und daß solchergestalt zwischen dem Staat, als einer Form des Geistes, und dem Individuum, als dem persönlich gewordenen Geiste […], ein unzerstörbares Band der Verwandtschaft, ein unveräußerliches Recht des Eigenthums besteht, und daß damit die Betheiligung des Individuums am Staat nothwendig ausgesprochen ist, das Alles wird wohl Niemand in Zweifel ziehen […]. Sind nun ein Mensch oder eine Nation in ihrer Entwicklung so weit gediehen, daß sie auch den Staat zu ihrem individuellen und wirklichen Inhalt machen, so wird auch der Ausdruck dieses Inhaltes im Schönen, also die künstlerische Darstellung des Staates und seiner Beziehungen, daß heißt die politische Poesie, nicht ausbleiben.«108
Die Beschäftigung mit dem Staat im Bereich des Schönen wird dadurch legitimiert, dass er ganz im Sinne Hegels eine notwendige Stufe des Werdegangs des 108 Prutz 1847–48, Band 2, S. 127–128.
88
Historisierung
Geistes (sprich: der Vermittlung zwischen ›Wirklichkeit‹ und ›Idee‹) darstellt. Als solche hat diese Stufe natürlich auch Übergangscharakter; ihre Funktion besteht darin, zur ›Tat‹ zu bewegen. Vor diesem Hintergrund bestimmt Prutz unterschiedliche Stadien der Entwicklung der politischen Poesie: Die patriotischen Lieder lassen sich beispielsweise im Hinblick auf ästhetischen Wert und ›Wirkung‹ auf das politische Bewusstsein des Volkes einer niedrigeren Entwicklungsstufe zuordnen als Herweghs Gedichte. Das sich allmählich abzeichnende Desinteresse des Lesepublikums109 an der politischen Lyrik lässt sich laut Prutz als eine Bewegung des Geistes und ein Zeichen für die Historisierung der aktuell bekannten Form der politischen Lyrik deuten: »die Innerlichkeit der Lyrik hat keinen Raum für die neue Welt der Ereignisse und der praktischen Interessen, die sich uns eröffnet«110. Diese Entwicklung sieht Prutz für das ›Volk‹ und die ›Poesie‹ vor: »Wie das Volk von Worten zu Thaten, von Vorsätzen und Plänen zu Ausführungen und praktischen Schöpfungen, so auch die Poesie wird sich herausarbeiten von der Lyrik zum Epos, zum Drama. […] die gegenwärtige particuläre politische Poesie wird sich erweitern zu einer allgemeinen volksthümlich historischen!«111
Aspekte der literarischen Wertung treten im Aufsatz ›Ueber das deutsche Theater‹ noch auffallender in den Vordergrund. Außerdem impliziert hier die Betonung des Anfangs- und Übergangscharakters des gegenwärtigen Theaters eine bedeutende Umkehr der auf das vermeintlich ›Epigonale‹ hinweisenden Verfallsnarrative, wie diese fast am Ende des Beitrags vorkommende Stelle belegt: »Und darum hat auch all dies verdrießliche Gepolter über die schlechten Poesien und über den Verfall unsrer Dichtung im Grunde nichts zu sagen. Die Poesien machen sich nicht selbst, sondern sie werden gemacht von der allgemeinen Mutter aller Dinge, von der Zeit und der Geschichte. […]. Und endlich ist auch dies ein Irrthum, daß man die Poeten der Gegenwart consequent immer nur auf die Vergangenheit bezieht und niemals auf die Zukunft. Man hat da ein bequemes Wort erfunden: Epigonen – […]. Epigonen? Nein, vielmehr Progonen sind wir: Progonen einer künftigen reifen und freien Zeit […].«112
Dieser Pointe, die u. a. das zwischen ›Geschichte‹ und ›Kunst‹ herrschende Widerspiegelungsprinzip noch einmal unterstreicht, wird eine Abrechnung mit den damals im Rahmen der Literaturkritik und -geschichte fest etablierten Standpunkten vorangestellt. Da es sich dabei um über den Vormärz hinaus tradierte 109 Obwohl die Rezeptionsseite ebenfalls als Emanation des Geistes verstanden ist, gilt die auf sie geschenkte Aufmerksamkeit als eine in literaturwissenschaftlicher Hinsicht nicht unwichtige Erneuerung. 110 Ebd., S. 134. 111 Ebd., S. 134–135. 112 Ebd., S. 163–164.
Robert Prutz’ Kleine Schriften. Zur Politik und Literatur (1847–48)
89
Topoi handelt, bildet Prutz’ Auseinandersetzung eine gewissermaßen verfrühte Reflexion, deren Wert nicht zuletzt in wissenschaftshistorischer Hinsicht betont werden soll. Die gegen diese Positionen gelieferten Argumente signalisieren in erster Linie das Bedürfnis nach einer Veränderung der Wertungsmaßstäbe. Prutz’ Kritik richtet sich 1. gegen die in der Forschung zur Literaturgeschichte bereits längst als ›Gipfel-und-Tal‹-These kodierte Vorstellung, nach der mit Goethe und Schiller der Höhepunkt künstlerischer Produktion nunmehr erreicht worden ist; alles, was danach kommt, kann eben nur als epigonal bezeichnet werden. In Frage gestellt wird 2. die These der »katholischen Aesthetik«113, also der Romantiker, nach der Shakespeares Stücke das Drama der Deutschen bilden. Beide Thesen verkennen, so Prutz, das Prinzip der Historizität, dem sowohl die Produktions- als auch die Rezeptionsverhältnisse im Bereich der Kunst ausgesetzt sind. Durch die Verewigung und Verabsolutierung solcher Klassiker gerät der Umstand aus dem Blick, dass wegen der historischen Verhältnisse keine Klassik – gemeint ganz im Sinne Hegels als vollkommene Durchdringung des Ideals in der Form – aktuell möglich ist114. Unter diesen Prämissen müssen andere Wertungskriterien geltend gemacht werden, welche einen eindeutigen Unterschied von einer in formal-ästhetischer Hinsicht normativen Ästhetik markieren: »Denn in der geschichtlichen Betrachtung der Literatur (und sie ist die einzige berechtigte) ist das spezifische Maß des Talentes, die besondere Gabe poetischen Vermögens nur ein untergeordnetes Moment: die Hauptsache bleibt immer, wie weit ein Mann und ein Werk sich zum Organ seiner Zeit zu machen verstanden hat, und wie viel oder wenig der Geist seines Jahrhunderts sich in ihnen offenbart. Und da können wir nicht umhin, Iffland und Kotzebue, trotz ihrer handgreiflichen ästhetischen Mängel, sogar weit über die gloriosesten Namen der Romantik zu setzen.«115
Dichterinnen und Dichter sowie Werke sollten sich zur Entstehungszeit gewissermaßen epiphenomenal verhalten und dem abstrakten Geist Konkretion verleihen. Der Aufsatz zeigt also, wie die Instanz der ›Geschichte‹, als a priori gegebene Entwicklungsgröße der Literatur, auch für deren wissenschaftliche Betrachtung 113 Ebd., S. 148. 114 »[D]er Verfasser […] [theilt] doch vollkommen die Meinung derjenigen, welcher die Poesie der Gegenwart nicht mehr unter die vorzugsweise berechtigten Mächte der Zeit zu zählen vermögen. […] unsre Zeit kommt in der Poesie zu keiner völligen Befriedigung, jene glückliche Uebereinstimmung des allgemeinen Bewußtseins mit dem besonderen Ausdruck der Kunst, jene volle Sättigung des Inhalts und der Form, welche es eben ist, was einer Literatur den Charakter des Klassischen verleiht, fehlt unsrer Dichtung; die Poesie ist in diesem Augenblick nur noch ein apanagirter Prinz und es wird langer Kämpfe und großer Umwälzungen bedürfen, um sie auf den ehemals besessenen Thron wieder zurückzuführen«, ebd., S. 141. 115 Ebd., S. 159.
90
Historisierung
maßgebend werden sollte. Der Literaturgeschichte als bloßer ›Chronologie‹ setzt sich demnach eine entgegen, welche sich vielmehr vornimmt, das ( jeweilige) geschichtliche Prinzip zu bestimmen. Beim Aufsatz ›Ueber die Unterhaltungsliteratur, insbesondere der Deutschen‹ müssen zwei Aspekte hervorgehoben werden: 1. der Übergangscharakter einer von der ›schönen Literatur‹ getrennten Unterhaltungsliteratur; 2. die kulturhistorischen und literatursoziologischen Perspektiven, die die eingangs angedeutete Erweiterung des Spektrums der Untersuchungsgegenstände und der Erkenntnisinteressen verdeutlichen. Die kurz skizzierte Genese der Unterhaltungsliteratur, die Prutz liefert, wird aus der breiteren und transnationalen Perspektive der Zivilisationsgeschichte rekonstruiert: Die Entstehung der Unterhaltungsliteratur ist in diesem Sinne Produkt eines epochalen, durch das Christentum eingetretenen Bruchs mit der Vergangenheit. Diese wohlbekannte Narration des ›Bruchs‹ bringt – gewissermaßen als Folgeerscheinung – die ›Reflexion‹ mit sich: »Nämlich der hauptsächlichste Unterschied zwischen der antiken und der modernen Welt besteht bekanntlich darin, daß die antiken Völker ein ungebrochenes, von keiner Reflexion verkümmertes, von keinem Zwiespalt getrübtes Dasein, ein ganzes, frisches Leben, […] in derber Gesundheit, frei herauslebten: wogegen durch das Leben aller modernen Völker ein geheimer Bruch, ein innerlicher Zwiespalt geht, der die Gesundheit unsers Daseins stört und uns, statt der üppigen Plastik der alten Welt, vielmehr ›die Blässe des Gedankens angekränkelt hat‹.«116
Dieser Bruch begreift Prutz nicht als einen unumkehrbaren ›Verlust‹, sondern ebenfalls als »einen [Zustand], der ihn [den Zustand der alten Welt] unendlich übertrifft und der zugleich eine nothwendige Stufe unsrer künftigen Entwicklungen enthält«117. Dieser Bruch hat im Rahmen der ›Bildung‹ zu einer Trennung zwischen der »Literatur der Gebildeten« und der »Volksliteratur«118 geführt. Das von Prutz in Aussicht gestellte ›Ideal‹ besteht in der Integration des Elements der ›Unterhaltung‹ in die ›schöne Literatur‹. Soweit wird der alle Aufsätze betreffende geschichtsphilosophische und zukunftsbezogene Rahmen mithin garantiert und der Übergangscharakter der gegenwärtigen Unterhaltungsliteratur ist bewiesen. Neben dieser wiederkehrenden Perspektive sind aber auch kulturhistorische und literatursoziologische Analysen vorhanden, durch welche das moderne Phänomen der Unterhaltungsliteratur gründlich ausgelotet wird. Diese kulturhistorischen und zeitdiagnostischen Reflexionsbeiträge ergänzen also auf eine nicht unbedeutende Weise die durchaus dominante geschichtsphilosophische Perspektive.
116 Ebd., S. 180–181. 117 Ebd., S. 182. 118 Ebd., S. 183.
Robert Prutz’ Kleine Schriften. Zur Politik und Literatur (1847–48)
91
In Prutz’ Analyse wird die Unterhaltungsliteratur als die Erscheinung beschrieben, an welcher sich der Geist der Zeit am deutlichsten erkennen lässt: »Aber gerade dieser Zwitterzustand [der Unterhaltungsliteratur] muß in der modernen Zeit, als der Zeit des Schwankens und der Uebergänge, wo Niemand isolirt genug ist, weder um von der allgemeinen Bildung, oder doch einem leisesten Hauch der Bildung, völlig ausgeschlossen zu sein, noch andrerseits, um diese Bildung in sich zu völliger Reife, zu völligem Abschluß zu bringen und gleichsam ihre innersten Tiefen zu erschöpfen, der verbreitetste und eigentlich herrschende sein: mithin auch die Literatur, welche diesem Zustand entspricht, die herrschende Literatur der Zeit.«119
Eine weitere semantische Seite des Begriffs des ›Übergangs‹, welche die Sprache dieser Studie allerdings nicht primär berücksichtigt, wird von Prutz in den Vordergrund gerückt: Bezogen auf die Zeit und die Zeitgenossen spielt er auf eine generell verbreitete und diffusere Teilnahme an Bildung, kulturellen und sozialen Phänomenen an. Die zeitliche Perspektive erneut ausbreitend werden die Bedingungen für eine solche ›Übergangserfahrung‹ durch die Erfindung des Buchdrucks und der Dampfkraft geschaffen: Beide führen nämlich zu einer sich auf mehrere soziale Schichten erstreckenden Teilnahme und einer Annäherung durch Abschaffung geistiger und räumlicher Schranken. Nicht nur im Rahmen der Kulturgeschichte, sondern auch der Rezeptionsforschung scheint dieser Aufsatz einen zu dieser Zeit isolierten Beitrag zu leisten: Bei der Unterhaltungsliteratur handelt es sich ebenfalls um einen von der akademischen Kritik natürlich vernachlässigten und unterschätzten Gegenstand. Laut Prutz ist aber die Unterhaltungsliteratur ein Phänomen, das das Leseverhalten vieler sozialer Schichten so massiv prägt, dass es einer wissenschaftlichen Betrachtung würdig ist. 2.4.2.3 Vom Umgang mit der Zäsur – Komparatistische Perspektiven In den Aufsätzen ›Die niederländische Literatur im Verhältnis zur deutschen‹ und ›Shelley und die Poesie des Atheismus‹ betreibt Prutz eine Art vergleichender Literatur- und Kulturgeschichte. Bloß thematisch betrachtet zieht Prutz einen Vergleich zwischen 1. dem Entwicklungsgang deutscher und niederländischer Literatur, 2. den unterschiedlichen Ausprägungen des Atheismus in Deutschland und England, welche sich wiederum auf unterschiedliche Aneignungen der Gewinne der Reformation zurückführen lassen. Im Hinblick auf das spezifische Geschichtskonzept, das im Umkreis des Hegelschen Idealismus und bei Prutz vorauszusetzen ist (›Geschichte‹ als teleologische Entwicklung), wird in diesen Aufsätzen der Umgang mit der ›Zäsur‹ problematisiert. Insbesondere
119 Ebd., S. 185.
92
Historisierung
wird darüber reflektiert, inwieweit der in kulturgeschichtlicher Hinsicht epochale Schnitt einverleibt worden ist, wie tiefgreifend er auf die jeweilige Kultur und Literatur gewirkt hat. Bei dieser Frage spielen die Strukturierung des jeweiligen Wissenschaftssystems und dabei der Stellenwert der Philosophie eine nicht zu unterschätzende Rolle. Die entscheidenden diskontinuitätserzeugenden Momente bedingen dann den weiteren Verlauf der Geschichte. In ›Die niederländische Literatur im Verhältnis zur deutschen‹ wird der Frage nachgegangen, ob und inwieweit bei diesen im Grunde verwandten Literaturen von einer parallel verlaufenden Entwicklung die Rede sein kann. Bei manchen Entwicklungsstufen habe die niederländische Literatur für den ›deutschen Geist‹ nahezu eine Vorreiterrolle gespielt. Problematische Aspekte für die niederländische Literatur bilden hingegen der Umgang mit der klassischen Tradition und der Protestantismus: »Als solche Momente nun, die der deutsche Geist aus der niederländischen Literatur für sich gewonnen hat, die von ihm sodann in seiner eigensten Heimath fortgeführt und entwickelt worden, bei den Niederländern selbst aber unüberwunden, wie ausgebrannte Schlacken und Pflöcke im Wege der Bildung zurückgeblieben sind, müssen wir hauptsächlich das classische Althertum und den Protestantismus, in seiner einseitigen Auffassung als kirchliches Dogma, bezeichnen.«120
Die einseitige, nicht vollständige Aneignung des Protestantismus hängt damit zusammen, dass diese Erscheinung keine weitere Verarbeitung im Bereich der Philosophie erlebt hat, weil diese Disziplin keine große Tradition in der niederländischen Kulturgeschichte hat und folglich eine marginalisierte Stelle im Wissenschaftssystem besetzt: »[D]ie kirchliche Reformation [soll] nur der Anfang einer Reihe von Reformationen [sein], welche, durch alle Sphären menschlicher und geschichtlicher Entwicklung durchgeführt, überall gegen den fix gewordenen Buchstaben, die hohle Glaubensseligkeit, die Unvernunft protestiren und endlich auch nach Außen hin im Staate sich siegreich vollenden wird. Diese protestantische Reinigung des Geistes geht theoretisch in der Philosophie vor sich; dadurch also, daß die Niederländer sich selbst ausgeschlossen haben von der Philosophie, haben sie auch sich, ihre Geschichte und ihre Literatur ausgeschlossen von einer weiteren weltgeschichtlichen Bedeutung und einem absoluten Werthe, der ja nur dadurch erlangt wird, daß man selbst das Absolute aufnimmt in sich.«121
Neben den nicht selten vorkommenden paradoxen Formulierungen (»einem absoluten Werthe, der ja nur dadurch erlangt wird, daß man selbst das Absolute aufnimmt in sich«) gilt es zu betonen, dass sich bei jeder Entwicklungsstufe eine Steigerung ergeben muss, damit diese Entwicklung, Prutz’ Kategorien einset120 Ebd., S. 207. 121 Ebd., S. 224.
Robert Prutz’ Kleine Schriften. Zur Politik und Literatur (1847–48)
93
zend, nicht nur ›formal‹, sondern auch ›inhaltlich‹ wird. Die Tatsache, keine Philosophie zu betätigen, schließt die niederländische Literatur von der Weltgeschichte aus. Im Aufsatz ›Shelley und die Poesie des Atheismus‹ wird eigentlich ähnlich argumentiert und in Kontinuität mit Hegel ebenfalls in der Reformation ein Wendepunkt erkannt. Die unterschiedliche Wissenschaftstradition und die bloß materialistische und pragmatische Ausrichtung des Denkens in England bedingen, so Prutz, das geistig für deutsche Verhältnisse sehr dürftige Niveau der Debatte um den ›Atheismus‹, die sich, von manchen Frühschriften Shelleys angeregt, entfaltet hatte. Dieses ist laut Prutz auch auf einen Mangel an Theorie und historischem Verständnis zurückzuführen, durch welche der ›formalen‹ Reformation keine »geistige Reformation« gefolgt sei: »Und wie der falsche Reformversuch Heinrich’s des Achten dem englischen Volke durch äußerliche Erhaltung dieses Uebels verderblich geworden ist, eben so viel und noch mehr hat derselbe ihm dadurch geschadet, daß er ein innerliches Gut ihm geraubt und vorenthalten hat: die geistige Bewegung […] der Reformation, die Befreiung von dem Wuste mittelalterlicher Scholastik, die Anregung zu jener freien, selbsteigenen und unaufhaltsamen Entwicklung des Gedankens, welche bei uns in Deutschland auf dem Gebiete der Wissenschaft schon lange die edelsten Früchte reift, und die nun auch unserem übrigen gesammten Leben eine gleiche goldene Frucht mit göttlicher Sicherheit verheißt.«122
Es lässt sich also generell beobachten, dass die zum Topos gewordene Neigung der Deutschen zur ›Theorie‹, die sonst im europäischen Vergleich für die verspätete Entwicklung des Politischen und des öffentlichen Lebens verantwortlich gemacht wird, hier hingegen positiv gewendet wird. 2.4.2.4 Charakteristiken Auf den Zusammenhang von der im Vormärz sehr oft praktizierten Form der ›Charakteristik‹ und der ›Geschichte‹ ist in dieser Studie bereits hingewiesen worden: Es handelt sich dabei um einen gattungsinhärenten Aspekt, aufgrund dessen der behandelten Autorin oder dem behandelten Autor eine exemplarische Funktion zugeschrieben wird. Dieses gattungssystematische Merkmal kommt offenbar der für das Werk Prutz’ und den Hegelianismus überhaupt sehr zentralen Vorstellung einer ›Historizität der literarischen Erscheinungen‹ besonders zugute. Das prinzipielle Primat der ›Zeit‹ über die ›Individualität‹ und die spekulative Ausrichtung des Denkens führen allerdings nicht selten zu Stilisierungen, die nun näher zu untersuchen sind. Das lässt sich am Beispiel des Aufsatzes ›Nicolaus Lenau. Eine Charakteristik‹ besonders gut veranschaulichen. Die sich 122 Ebd., 297–298.
94
Historisierung
anhand von drei seiner Werke (Faust: Ein Gedicht, 1840; Savonarola, 1837; Die Albigenser. Freie Dichtungen, 1838–1842) abzeichnende Entwicklung von »Mann des Zweifels« zum »Mann der That«123 verrät nämlich eine Anpassung an die determinierte Entwicklungsgeschichte des deutschen Geistes. In diesem Sinne verleiht also diese Charakteristik jenem geschichtsphilosophischen Impetus Gestalt, der sonst zumeist in ›Appellen‹ oder ›Zukunftsvisionen‹ kulminiert, deren Wirkungskraft nur in der rhetorischen Machart bestehen kann. Zunächst wird eine geschichtliche Kontextualisierung von Leben und Werk Lenaus124 vorgenommen, um dann zu den – aus heutiger wissenschaftlicher Sicht durchaus fragwürdigen – Wirkungen des ›geographischen‹ Ursprungs auf seinen ›Charakter‹ und auf die dichterische Laufbahn zu kommen. Insbesondere aus dem »magyarischen Element« resultiere ein lebenslanger Zwiespalt zwischen ›Ursprünglichkeit‹ und ›Zivilisation‹, die die Entwicklungsgeschichte des Autors strukturiert. Dazu kommt dann die angedeutete Konkretisierung durch das Werk: »Die Kämpfe des Soldaten sind gewonnene und verlorene Schlachten, eroberte Städte, verheerte Länder; die Kämpfe des Denkers umgestürzte Systeme, zersprengte Kategorieen, umgewälzte Begriffe: der Künstler allein, indem er kämpft, schafft er zugleich; Dichtungen, Kunstwerke bezeichnen das Schlachtfeld seiner Gedanken, die Wahlstatt seiner Empfindungen. […]. So auch Lenau […] hat […] das qualvolle Ringen seines Geistes durch drei große Dichtungen bezeichnet, welche, […] mit außerordentlicher Klarheit die Stufen bezeichnen, welche seine Entwicklung allmälig aufgenommen.«125
Die Analyse der Werke dient also vor allem der ›starken Historisierung‹, welcher Leben und Werk Lenaus ausgesetzt sind. So vergegenwärtigen drei bedeutende Dichtungen Lenaus die entsprechenden Hauptphasen und Veränderungen seines Denkens: Die Phase des Zweifels (Faust), die Annäherung an die Philosophie (»d[ie] vorzüglichste[] Waffe des gegenwärtigen deutschen Geistes«126; Savonarola) und schließlich die Versöhnung mit der Geschichte und der »Welt der Thatsachen«127 (Die Albigenser). Die mit Lebensgeschichte und Denken des Autors zur Identifikation tendierende Lektüre der Werke führt zur beinahe totalen Vernachlässigung formal-ästhetischer Aspekte. Nur flüchtig und oberflächlich wird auf die Unentschiedenheit der Form oder den Mangel an plasti123 Ebd., S. 348. 124 »Jedes Dinges Begriff ist seine Geschichte: und so, indem wir eine geschichtliche Entwicklung und Begründung der Lenau’schen Dichtweise versuchen, sei es uns zunächst vergönnt, mit wenigen Worten an den Charakter der Zeit zu erinnern, in welcher Nicolaus Lenau zunächst als Dichter auftrat. Es war dies aber […] die Zeit des erwachenden politischen Bewußtseins«, ebd., S. 312. 125 Ebd., S. 332. 126 Ebd., S. 338. 127 Ebd., S. 344.
Robert Prutz’ Kleine Schriften. Zur Politik und Literatur (1847–48)
95
scher Darstellung128 hingewiesen; als absolut negativ werden aber solche Fehler nicht bewertet: Die formale »Ungleichheit« bzw. Inkonsequenz ist analytisch ernst zu nehmen, weil sie »dem Zustande der gegenwärtigen Zeit«129 entspricht. Einmal mehr stellt sich also der Einklang mit dem Geist der Zeit als entscheidendes Wertungskriterium heraus – das ist im Grunde, was das Leben und Werk Lenaus überindividuellen bzw. exemplarischen Wert verleiht. Insbesondere bilden die Vertiefung der Philosophie sowie die darauffolgende Emanzipation vom System und die Berührung mit der Geschichte die erhoffte Entwicklung auf nationaler Skala. Symptomatisch und repräsentativ für die eigene Zeit ist auch der wenig bekannte ›Wilhelm Waiblinger‹. Der frühzeitig verstorbene Autor (1804–1830) und sein Werk spiegeln weitgehend und ebenfalls spekulativ die charakteristischen Aspekte der Restaurationszeit wider: So wird diese Zeit »ohne That«130 für Waiblingers abstraktes Verhältnis zur Literatur und sein bloß formales Talent verantwortlich gemacht. Wenn Lenaus Entwicklungsgang eine hoffnungsvolle Zukunftsvorstellung verkörpert, so dient hingegen die Charakteristik Waiblingers, zugespitzt formuliert, als Mahnung: »Weil, wie die Tugenden, so auch die Gebrechen der Einzelnen niemals ihnen allein, sondern auch zugleich der Zeit gehören, in der sie lebten, und weil von diesen Krankheiten der Zeit auch in unsre Gegenwart lebendige Adern herüberreichen. Nicht bloß die gesunden, auch die kranken Lüfte übertragen sich; nicht bloß die Tugenden, auch die Fehler der Vergangenheit […] erben fort und wachen wieder auf in neuen, verderblichen Gestalten.«131
Sind beide Charakteristiken132 für das Prinzip der Widerspiegelung von ›Individuum‹ und ›Geschichte‹ relevant, so lassen sich in ›Wilhelm Waiblinger‹ auch in historisch-praxeologischer Hinsicht interessante Reflexionen anstellen. Diese bekräftigen erneut die These einer von Prutz betätigten Erweiterung der Forschungsperspektiven. Anlass zur Verfassung der Charakteristik über Waiblinger ist die Veröffentlichung einer Gesamtausgabe seiner Werke. Das führt Prutz im einführenden Teil des Aufsatzes zu Überlegungen über diese editorische Praxis und die mit der Literaturgeschichte konfligierenden ökonomischen Gründe, die dabei eine Rolle spielen können. Die verschiedenen Instanzen im Literaturbetrieb werden also überhaupt wahrgenommen und die jeweiligen Prioritäten dadurch berücksichtigt. 128 129 130 131 132
Vgl. ebd., S. 335, 347. Ebd., S. 347. Ebd., Band 2, S. 226. Ebd., S. 251. Die dritte Charakteristik der Sammlung, Dichter und Krieger. Ein Lebensbild (Zum Andenken Joseph Emanuel Hilscher’s), ist primär im Hinblick auf die damaligen Verhältnisse gewisser sozialer Schichten relevant und daher hier nicht berücksichtigt worden.
96
Historisierung
Über die ökonomischen Gründe hinaus stellt die Konjunktur des Formats der Gesamtausgabe aus Perspektive der damaligen Literaturwissenschaft einen – auch einmal einem größeren Publikum angebotenen – Beweis für die epistemische Relevanz des Modells der ›Geschichte‹ dar: »[I]ndem sie jetzt den Ertrag eines Dichterlebens gesammelt vor sich sieht und in zusammenhängender Lesung sich darin vertieft, so bekommt auch die Menge eine Ahnung davon, daß zunächst die Individualität jedes einzelnen Schriftstellers und die Gesammtheit seiner Werke nichts Abgerissenes, Zufälliges und Willkürliches, sondern ein Organismus ist, der als solcher in seinen Voraussetzungen erkannt, in seiner Entwicklung begriffen, in seiner Thätigkeit will verstanden sein.«133
Metareflexionen dieser Art treten außerdem immer hervor, wenn den überwiegend ökonomischen Argumenten der Verlegerinnen und Verleger die literaturgeschichtlichen Maßstäbe entgegengesetzt werden: »Diese Fälle sind – erstlich sobald und so lange die Richtung, aus welcher der betreffende Schriftsteller hervorgegangen und die vielleicht er selbst zuerst eingeleitet, als eine lebendige gegenwärtig und wirksam ist. Oder wenn zweitens aus dieser Richtung sich andere neue Stufen unsers geistigen Lebens entwickelt haben, welche bedeutend genug sind, daß wir ihre Quelle aufsuchen und auch den leisen Anfängen desjenigen, was jetzt als voller und kräftiger Pulsschlag unsere Zeit belebt, mit Theilnahme horchen mögen. Oder endlich wenn bei einem Inhalt, der allerdings von dem neuen Bewußtsein längst überwältigt und untergegangen ist in ihm, wenigstens die Form eine vollendete und für jede Zeit beachtenswerthe, lehrreiche und erfreuliche ist.«134
Aktuelle Relevanz in der Gegenwartsliteratur, Genese einer gegenwärtigen Tendenz und überzeitlich formal-ästhetische Aspekte zählen zu den aus literaturwissenschaftlicher Perspektive nun geltend zu machenden Kriterien. Abschließend lassen sich einige Überlegungen über die Form der ›Historisierung‹ anstellen. Wie bei Wienbargs Werken ist auch hier die Vorstellung zentral, dass ›Gegenwart‹ und ›Gegenwartsliteratur‹ an einem (historischen) Prozess teilhaben und immer im Zusammenhang gesehen werden sollten. Diese Beobachtungshaltung erlaubt es, beim gerade Geschehenden oder bei gegenwartsliterarischen Erscheinungen die tatsächlich relevanten Elemente zu erkennen und die im Hinblick auf das determinierte Ziel unbedeutenden zu relativieren. Während aber bei Wienbarg das Gesetz geschichtlicher Variabilität zur Geltung gebracht wird und dadurch ›Tradition‹ und ›Kontinuität‹ in der Geschichte polemisch hinterfragt werden, rückt bei Prutz eine durch Steigerung und Fortschritt gekennzeichnete Geschichtskonzeption in den Mittelpunkt. Von diesen Unterschieden abgesehen kann allerdings sowohl bei Wienbarg als auch bei Prutz von einer ›starken Historisierung‹ die Rede sein. Wie die erarbeitete 133 Ebd., S. 214. 134 Ebd., S. 217–218.
Theodor Mundts Die Einheit Deutschlands in politischer und ideeller Entwickelung (1832)
97
Gliederung dieses Kapitels verdeutlicht, gelten die jeweils untersuchten Erscheinungen als Funktionsträger für Veränderungsprozesse, die historische Verläufe schlechthin ausmachen. Anders als bei Fulda postuliert, wird aber die Leistung einer (starken) Historisierung nicht nur von Textanalysen und -exegesen, sondern auch von Charakteristiken und Rezensionen erbracht, die übrigens per se stärker zur Kontextualisierung tendieren.
2.5
Die Relativierung der politischen Frage durch den ›Übergang‹ – Theodor Mundts Die Einheit Deutschlands in politischer und ideeller Entwickelung (1832)
In diesem 1832 verfassten politischen Essay kombiniert Theodor Mundt geschichtsphilosophische Denkmuster mit der genauen Analyse der gegenwärtigen deutschen Verhältnisse. Wie der Titel ahnen lässt, rückt hier noch eindeutiger als in einigen politischen Schriften Prutz’ die langwierige Frage nach der Einheit Deutschlands in den Vordergrund. Die Art und Weise, auf die diese Frage behandelt wird, indiziert wiederum, worin das Historisierungsverfahren in diesem Fall besteht. Während die Frage nach der deutschen Einheit in der (auch internationalen) öffentlichen Debatte als besonders dringend empfunden wird, erteilt Mundt ihr – trotz der ausführlichen und detaillierten Auseinandersetzung mit dem Thema – nur Durchgangsstatus. Die Relativierung und mithin Historisierung der politischen Frage hängt mit der hier umgesetzten Adaptation geschichtsphilosophischer Deutungs- und Denkmuster eng zusammen, die mit dem expliziten (kritischen) Bezug auf Hegels Philosophie programmatisch dargelegt wird. Mundts Argumentation verläuft also auf zwei Ebenen und hinterfragt dabei die entsprechenden Gegenpositionen: Mit Blick auf die geschichtsphilosophischen Rahmenbedingungen muss er einerseits mit Hegels Erbe kritisch umgehen; die Berücksichtigung hinsichtlich der politischen Frage der (in erster Linie zeitlich) über sie hinausgehenden Funktion verpflichtet ihn andererseits zur Auseinandersetzung mit verschiedenen Positionen in der öffentlichen Debatte. Bezüglich der Auseinandersetzung mit Hegel lässt sich wie übrigens bei anderen Texten im Rahmen des Hegelianismus beobachten, dass – zumindest auf der Ebene der programmatischen Äußerungen – lediglich der metaphysische ›Fortschrittsglaube‹, d. h. die teleologische Denkrichtung, übernommen wird, ohne den Prozess der Entwicklung für »abgeschlossen« zu halten. Besonders bedeutsam erscheint außerdem die Tatsache, dass die ins Auge gefassten Teilbereiche (Politik, Philosophie, Kulturgeschichte) bei Mundt eine Neuhierarchisierung erfahren:
98
Historisierung
»So glaubte die Hegel’sche Philosophie schon die Geschichte des menschlichen Denkens in sich abgeschlossen zu haben […]; und doch kann dieses erreichte Einheitssystem auch nur wieder für ein einzelnes und individuelles System in der Geschichte des sich hoffentlich weiter entwickelnden philosophischen Begriffs gelten. Die Entwickelung des philosophischen Begriffs wird und muß sich aber noch […] in dem Grade erweitern, als die Geschichte der Philosophie, sich befreiend von der Entfaltung in Schulsystemen, in die allgemeine Geistes- und Culturgeschichte der Menschheit volksthümlich und populair hinüberzugreifen noch die Aufgabe hat.«135
Relativierung der universalen Geltung der Philosophie, Emanzipierung vom schulsystematischen Bezugsrahmen sowie Anspruch auf erweiterte Adressierung und Wirkung der Philosophie sind gewissermaßen die Devisen, welche im Rahmen dieser kritischen Rezeption Hegelscher Philosophie geltend gemacht werden. Im Gegensatz zu Hegel verweist Mundt zudem auf eine sich noch nicht vollzogene Teleologie: Keineswegs kann nämlich die Philosophie als höchste und mithin abschließende Stufe des Entwicklungsgangs des Geistes gelten; der philosophische Begriff muss sich außerhalb des Systems und der Selbstreferentialität weiterentwickeln, in die Geistes- und Kulturgeschichte integriert und allen zugänglich gemacht werden. In diesem Sinne erscheint die sich in der Philosophie vollzogene Entwicklung nicht als alleinstehende Krönung der Bildung, sondern nur als ›Übergang‹. Wie der philosophische Diskurs fungiert auch der politische als Durchgangsstufe zur Steigerung in die Geistes- und Kulturgeschichte. Gerade in der Integration der behandelten Fragen in ein Makronarrativ lässt sich ein in argumentativer Hinsicht wiederkehrender Aspekt erkennen. Die genaue und sorgfältige Analyse der politischen Verhältnisse wird mit der Geschichtsphilosophie kombiniert – zwei Redeweisen werden also eingesetzt. Das Makronarrativ weist eben auf den geschichtsphilosophisch zu erreichenden Zweck hin. Auch bei Prutz werden die literarischen Erscheinungen in ein Makronarrativ eingebettet. Trotz der argumentativen Ähnlichkeiten muss allerdings bei Mundt von einer Umkehr die Rede sein. Während bei Prutz die Literatur, die den Hauptgegenstand bildet, zugleich als Symptom und notwendige Voraussetzung für die Entwicklung der Öffentlichkeit, die Demokratisierung und die ›Freiheit‹ gesehen wird, wird bei Mundt, wie bereits angedeutet, die ›politische‹ Frage als »Durchgangsstufe« definiert; sie wird also nicht zur »wahrhaft menschliche[n] Lebensaufgabe«136 erhoben. Der eigentlich höchste Grad, also derjenige der Vervollständigung (des Lebens) ist, so die These Mundts, nicht in der ›Politik‹, sondern im Bereich der ›Kultur‹ zu lokalisieren: 135 Theodor Mundt, Die Einheit Deutschlands in politischer und ideeller Entwickelung, Leipzig 1832, S. 39–40. 136 Ebd., S. 81.
Theodor Mundts Die Einheit Deutschlands in politischer und ideeller Entwickelung (1832)
99
»[Man] hört [doch] schreien, daß auch in dem metaphysischen Deutschland bereits sogar eine »politische Aera« begonnen habe. Wieder und wieder sind es aber narrenhafte Franzosen, die unser Vaterland gern politisch machen möchten […]. Da sagte neulich ein französischer Schriftsteller, […] daß »mit Göthe’s Tode für die Deutschen jetzt die literarische Aera vorbei sei, dagegen aber die politische Aera angebrochen wäre«. Was heißt es aber überhaupt, […], daß jetzt ein Dilemma zwischen der literarischen und politischen Richtung Deutschlands aufgebracht wird […]? […]. Die Richtung des Menschengeistes auf die Politik […] kann als solche nicht die ihn ausfüllende Bestimmung des Lebens sein. Die Beschäftigung mit politischen Interessen ist nichts Seiendes, sondern nur […] ein Formenkampf, der, wenn er um seiner selbst willen unternommen […] wird, nur als ein Unheil für die Cultur der Menschheit erscheint […]. Der gefundene Inhalt der Politik ist […] nichts als feste Lebensform, und diese verräth ihre Lebendigkeit nur eben wieder dadurch, daß sie in Blüten der Cultur und Kunst, der Literatur und Wissenschaft ausschlägt.«137
Die weit verbreitete These des Endes der Kunstperiode widerlegend und sich der ›französischen Propaganda‹ entgegensetzend betrachtet Mundt in seinen zeitdiagnostischen Überlegungen sowohl ›Politik‹ als auch ›Kunst‹ als notwendig und emanzipiert sich somit von einer dilemmatischen Vorstellung (Kunst oder Politik?). Wie die eben zitierte Stelle verdeutlicht, wird an der dilemmatischen Vorstellung im Grunde die unterstellte Verabsolutierung von jeweils ›Politik‹ oder ›Kunst‹ kritisiert. Die Relation zwischen diesen Teilbereichen muss etwas komplexer gestaltet und aus historischer Perspektive betrachtet werden. Dabei lässt sie sich am besten mit dem ›Form-Inhalt‹-Verhältnis erfassen. Der Bezug auf diese Begriffe ist für die selektive Rezeption Hegelscher Kategorien symptomatisch und wurde bei einigen Essays Prutz’ ebenfalls festgestellt. Dass dieses Entwicklungsmuster auf die Zeitverhältnisse bezogen wird, hat zur Folge, die ›Gegenwart‹, bei der die politische Frage als besonders brisant erscheint, eben als einen »Formenkampf« zu sehen, der ›nur‹ als Voraussetzung für die erst in der Zukunft stattfindende Stufe der Vollendung gilt. Diese Auffassung der eigenen Zeit kommt im Hinblick auf die für Deutschland passende politisch-rechtliche Ordnung sehr eindeutig zum Ausdruck: »Unsere Zeit ist die Zeit der geschichtlichen Uebergänge, und darum eignet ihren in der Bewegung begriffenen Zuständen eine gemischte politische Form wie die constitutionelle ganz naturgemäß; eine Form, welche ebenfalls nur eine Uebergangs- und Durchgangsform ist.«138
In dieser Betonung des kausalen und propädeutischen Verhältnisses von ›Gegenwart‹ und ›Zukunft‹ besteht konzeptionell die ›Historisierung‹ der ›Gegenwart‹: Die Aufgabe der ›Gegenwart‹ wird dadurch weitgehend enträtselt und 137 Ebd., S. 80–81. 138 Ebd., S. 64–65.
100
Historisierung
deren Leistung perspektivisch bereits überwunden. Argumentationstechnisch konkretisiert sich dieses Verfahren hingegen in der bereits angedeuteten Integration (und Relativierung) des jeweiligen Hauptthemas bzw. der politischen Frage in das Makronarrativ der kulturgeschichtlichen Entwicklung. Relativierung und Neukontextualisierung der beschriebenen Sachverhalte erfolgen mittels Passagen wie der oben zitierten sowie der geläufigen organologischen Metaphern (»Blüte«). Der Rekurs auf diese Bilder, die einen bekannten, festen und teleologischen Entwicklungsverlauf evozieren, verdeutlicht die Enträtselung und Aufhebung von Latenzmomenten im Rahmen des Historisierungsverfahrens. Bezüglich der Frage nach der deutschen Einheit – also der im engeren Sinne politischen Frage – ist sie für den Anschluss an das Makronarrativ der Geistesund Kulturgeschichte gewissermaßen prädisponiert. Wie bereits der Titel der Abhandlung Mundts suggeriert, handelt es sich dabei um einen langen, allmählichen Prozess (von »Entwickelung« ist eben die Rede), der ›politisch‹ und ›ideell‹ auszuführen ist. Berücksichtigt man das sich über Jahrtausende hinweg entwickelnde Narrativ der nationalen Einheit, so treten hier, in Abgrenzung zum französischen Vorbild eines Zentralstaates bzw. einer ›Staatsnation‹, die Konzepte der ›Reichs-‹ und der ›Kulturnation‹ in den Vordergrund139. Im ersten Teil des Essays kommt Mundts alternatives Konzept vor allem in Abhebung von demjenigen der Liberalen zum Vorschein. Bezüglich der Diktion und des essayistischen Stils lässt sich bereits hier feststellen, dass Mundt seine Thesen prozessual darlegt; vor der Folie der Ansichten anderer politischer Akteure, die mittels Auszügen aus ihren Vorträgen oder Essays unvermittelt das Wort ergreifen, nehmen Mundts Thesen allmählich Gestalt an. Bei der Auseinandersetzung mit den Liberalen, die die französische Staatsform in Deutschland einführen möchten, wird von Mundt 1. die metaphysische Instanz der ›Geschichte‹ geltend gemacht, welche alleine eine ›organische‹ Entwicklung und mithin eine dauerhafte sittliche Ordnung garantieren kann. Außerdem wird 2. die Inkompatibilität der konstitutiven Vielgestaltigkeit Deutschlands mit dem Modell eines Zentralstaates hervorgehoben (»Die Trennung in Deutschland ist ja eigentlich ein ganz heimischer Zustand, […] denn jedem Volke geschieht in der Geschichte nur nach seiner Gesinnung«140). Im Einklang mit Hegels Vorstellung erscheint die Geschichte (1) als eine Dimension, in der sich die ›Vernunft‹ manifestiert. Sie steht zudem in einem besonderen Verhältnis zu den menschlichen Taten:
139 Zu einer Typologisierung dieser Konzepte aus (begriffs-)historischer Perspektive vgl. Otto Dann, Nationale Fragen in Deutschland: Kulturnation, Volksnation, Reichsnation. In: Étienne François/Hannes Siegrist/Jakob Vogel (Hg.): Nation und Emotion. Deutschland und Frankreich im Vergleich. 19. und 20. Jahrhundert, Göttingen 1995, S. 66–82. 140 Mundt 1832, S. 27.
Theodor Mundts Die Einheit Deutschlands in politischer und ideeller Entwickelung (1832) 101
»Den Völkern, den Individuen gehören nur die einzelnen Thaten in der Geschichte an, die in ihrer Vereinzelung oft wie zusammenhangslos und beziehungslos hervorzugehen […] scheinen; aber der Geist der Geschichte durchdringt befruchtend und belebend die ungewisse Einzelheit der menschlichen Thaten und erhebt sie erst durch seine Vernunft, die höher ist als alle irdische Vernunft, zu bestimmten Ideen in der allgemeinen Weltordnung der Dinge.«141
Eine sinnstiftende Leistung erbringt also die ›Geschichte‹ für die menschlichen Taten. Vor dem Hintergrund dieser Vorstellung der Rolle der ›Geschichte‹ stellt Mundt seine Überlegungen über die eigene Zeit an: Mit ihren Programmen verkennen gewisse politische Akteure, insbesondere die Liberalen, diese Ordnung der Dinge und versuchen durch »Reflexion« und »Abstractionen«142, sich das Wirkungsfeld der ›Geschichte‹ zu eigen zu machen. In diesem Zusammenhang liefert Mundt bedeutsame Beobachtungen über die Instrumentalisierung der Zeitsemantik in der Propagandasprache, bei denen die Opposition ›zeitgemäß‹ – ›historisch‹ als Leitunterscheidung fungiert. In Mundts Begriffsverwendung wird das Adjektiv ›historisch‹ hhingegen mit ›sittlich‹, ›organisch‹ und ›logisch-dialektisch‹ gleichbedeutend verwendet. Als Verfechter einer politischen Einheit Deutschlands nach französischem Vorbild identifizieren die Liberalen ihr politisches Programm mit dem »Zeitgemäßen« und behaupten, dass nur dieses demzufolge dem »Zeitbedürfnis[]«143 nachkomme. Wer, wie etwa Mundt, die Ausführbarkeit einer politischen Einheit in Deutschland prinzipiell bezweifelt und das liberale Programm kritisiert, wird dementsprechend dem reaktionären Lager zugeordnet und als ›unzeitgemäß‹ gebrandmarkt. In seiner Zeitdiagnose betont Mundt, dass die ›Obsession‹ für das »Zeitgemäße« nicht nur gewisse politische Lager betrifft; diese Kategorie wird quasi zur poetologischen Maxime und zum ethischen Imperativ erhoben: »Heut ringen alle Schriftsteller danach, sich in die bereits scurril geworden Kategorie des »Zeitgemäßen« – ein Wort, das sich zum wahren Buchhändlerliebling aufgeschwungen, und an dem der hohnlachende Mephistopheles der Tagesgeschichte seinen größten Spaß hat – hineinzuarbeiten. Es könnte daher einem Schriftsteller kein größeres Unglück widerfahren als von den Liberalen, welche ohne Zweifel die Zeitgemäßesten sind und das Zeitgemäße dieser Zeit als ihre Provinz verwalten, für einen Unzeitgemäßen verschrien zu werden; denn was soll man auch am Ende in einer Zeit anfangen, in der man nicht einmal zeitgemäß ist!«144
Bei dieser Auseinandersetzung mit den Liberalen artikuliert Mundt seine – im Vergleich zur pauschalisierenden liberalen Propaganda – subtilere und demzu141 142 143 144
Ebd., S. 6–7. Ebd., S. 9. Ibidem. Ebd., S. 13.
102
Historisierung
folge schwer einzuordnende Position: Sie besteht darin, gegen die politische Einheit Deutschlands zu sein und doch in Einklang mit dem »Bewegungsprincip der Zeit«145 zu stehen. Bei dieser Polemik mit den Liberalen kommen also zwei rivalisierende Gegenwarts- und Zeitkonzepte zum Vorschein: Das von den Liberalen geförderte ›Zeitgemäße‹ entspricht dem sich genau und unverkennbar profilierenden ›Neuesten‹, welches in diesem spezifischen Fall der Staatsform Frankreichs, also des modernesten Landes Europas, entspricht. Diesem Konzept wird von Mundt, wie übrigens die Formulierung »Bewegungsprincip der Zeit« bereits ahnen lässt, dasjenige einer sich prozessual in der Geschichte und durch die Geschichte entfaltenden Ordnung entgegengesetzt. Mit Bezug auf das politische Narrativ erkennt er im »Kampf gegen die absolute Monarchie«146 und in der Errichtung der Republik Tendenz und Ziel des Zeitalters. Von diesen zeitdiagnostischen Beobachtungen ausgehend erweist sich die Übergangsform der konstitutionellen Monarchie als die ›historische‹ Regierungsform: Die konstitutionelle Monarchie enthält immer noch Elemente der Monarchie, welche allerdings durch das demokratische Element der Konstitution »physiognomielos«147 werden. Diese Regierungsform erweist sich auch angesichts der besonderen Situation Deutschlands als die bestgeeignete. Die Zeitdiagnostikerin oder der Zeitdiagnostiker muss also eine ›historische‹ Perspektive auch insofern einnehmen, als er bei seinen für die Handlung funktionalen Überlegungen die von der Geschichte und der Tradition überlieferten Besonderheiten berücksichtigt. Anders als das Modell eines Zentralstaates, welcher nur eine ›materielle‹ Einheit garantiert, kann eine gemeinsame Konstitution – neben den vielen, anderen regionalen – eine ›ideelle‹ Einheit garantieren. Nur eine solche ließe sich, so Mundt, im Bewusstsein der Deutschen bestimmen. In diesem Sinne ginge diese Regierungsform der vom Mundt vertretenen Idee eines »allgemeinen deutschen Staatsbürgerrechts«148 entgegen: »Gleiche Verkehrsgesetze«, »ein allgemeiner deutscher Münzfuß«, »gleiche Grundlagen der Preßfreiheit«149 – womöglich unter der Führungsrolle Preußens – könnten zunächst einmal eine rechtliche Einheit erbringen, ohne die regional längst verabschiedeten Konstitutionen außer Kraft treten zu lassen. Diese Vorstellung der deutschen Einheit entspricht in vielerlei Hinsicht dem Konzept einer ›Reichsnation‹. Bei der Auseinandersetzung mit den Liberalen wird schließlich deutlich, inwiefern ihr Programm anti-historisch ist: Das Bestehen auf einer politischen
145 146 147 148 149
Ebd., S. 14. Ebd., S. 70. Ebd., S. 73. Ebd., S. 35. Ibidem.
Gutzkows Ueber Göthe im Wendepunkte zweier Jahrhunderte (1836)
103
Einheit ähnelt dem Programm des »deutschen Demagogismus«150 in der Zeit nach den Befreiungskriegen. Allerdings unterscheiden sich diese Fronten darin, dass das Programm des Demagogismus nicht nur ›organisch‹ war, sondern dessen Vertreter dabei an das deutsche Mittelalter, also an die Vergangenheit, die Tradition anknüpften. Das ist bei den Liberalen offenbar nicht der Fall, da sie ein fremdes Land zum politischen Vorbild machen. Ihre Vorstellung von der Einheit ist also auch in dieser Hinsicht nicht historisch bzw. organisch; die Erneuerung eines Programmes aus der nicht allzu fernen Vergangenheit steht zudem in Widerspruch mit einem Geschichtskonzept, bei welchem sich »[d]ieselben Verhältnisse [nie] wiederholen […], sondern [sich] contrastiren«151.
2.6
Zwischen geschichtlicher ›Zäsur‹ und literaturwissenschaftlichen Kategorien: Gutzkows Ueber Göthe im Wendepunkte zweier Jahrhunderte (1836)
Im Rahmen einer Analyse der Verfahren der ›Historisierung‹ ermöglicht Gutzkows Ueber Göthe im Wendepunkte zweier Jahrhunderte152 eine differenzierte Perspektive: In Bezug auf diesen Text, der während einer in den 30er Jahren regen Goethe-Rezeption entsteht, lässt sich von ›Historisierung‹ als literaturwissenschaftlichem Verfahren sprechen. Die Hegel geschuldete geschichtsphilosophische Dynamik spielt hier eigentlich keine große Rolle. Bereits der Titel verweist darauf, dass die historische Kontextualisierung die Leitperspektive bildet; demnach werden Leben und Werk Goethes im Lichte sich epochal verändernder Verhältnisse betrachtet. Wie im Folgenden zu zeigen sein wird, bildet in Gutzkows Essay gerade das Verhältnis zwischen ›Autor‹ und ›Zeit‹ bzw. die Möglichkeit, eine literarische Erscheinung zu historisieren, die grundlegende Fragestellung. In diesem Fall geht es spezifischer darum, inwiefern sich Goethe einer ›starken Historisierung‹ aussetzen lässt und »als Gränzstein, in welcher das Alte ende[t], aber auch das Neue beginn[t]«153 fungieren kann. Inwiefern machen also Goethes Leben und Werk den historischen Wandel sichtbar? Und außerdem:
150 Ebd., S. 26. 151 Ebd., S. 37. 152 Die neueste Ausgabe (2019) dieses Werks, aus der im Folgenden zitiert wird, enthält weitere, wenig bekannte Texte Gutzkows zur Goethe-Rezeption; die Auseinandersetzung mit diesem Autor ist also alles andere als episodisch – sie reicht eigentlich bis in die 70er Jahre (also kurz vor Gutzkows Tod) hinein. 153 Karl Gutzkow, Ueber Göthe im Wendepunkte zweier Jahrhunderte, Münster 2019 [1836], S. 14.
104
Historisierung
Kann man Goethe auch für die ›Gegenwart‹ (d. h. die Entstehungszeit dieses Essays) einen diagnostischen Wert zusprechen? Einleitend lässt sich feststellen, dass Gutzkows Essay im Gegensatz zu Prutz’ Aufsatzsammlung, in der ein geschichtsphilosophisch-spekulatives Modell grundlegend ist und zur Historisierung der ›Gegenwart‹ führt, eine andere Vorstellung von ›Geschichte‹ in Anspruch nimmt. ›Geschichte‹ wird hier als ›Ereignisgeschichte‹ verstanden, und als historische Zäsur, welche die Übergangsjahren zwischen 18. und 19. Jahrhundert zum ›Wendepunkt‹ macht, fungiert die Französische Revolution. Wie in einer Sozialgeschichte der Literatur werden also Ereignis- und Literaturgeschichte miteinander verbunden, weil nur unter Berücksichtigung dieses historischen Geschehens Goethes Werk und die literarischen Verhältnisse überhaupt angemessen untersucht und beurteilt werden können. Der Essay ist in vier Kapitel unterteilt, bei denen unterschiedliche Aspekte der umrissenen Fragestellungen in den Blick geraten. In Kapitel I wird gegen die vorherrschenden literaturkritischen und -geschichtlichen Tendenzen argumentiert (Menzel, Gervinus), die fremde Kriterien auf Literatur anwenden; der angekündigte ›Rettungsversuch‹ Goethes erfolgt unter Rekurs auf produktionsästhetische Begriffe (Genie, Talent, Charakter, Dilettant) sowie den im damaligen literaturkritischen Diskurs geläufigen Vergleich mit Schiller. Kapitel II entspricht in vielerlei Hinsicht einer Charakteristik, in der anhand von gegenstands- und rezipientenbezogenen Kategorien (dem Schönen, dem Erhabenen) auf Goethes Stil eingegangen und dessen Genese rekonstruiert wird. Mit Blick auf das hier verfolgte Erkenntnisinteresse sind die letzten zwei Kapitel besonders relevant: In Kapitel III wird Goethe ›in Zusammenhang gesetzt‹, d. h. seine Produktion wird unter Berücksichtigung der medialen und kulturgeschichtlichen Entwicklungen des 18. Jahrhunderts in den Blick genommen. Wie im Folgenden ausführlicher zu zeigen sein wird, wird das Verhältnis Goethes zu seiner Zeit zu einem ›Antagonismus‹ oder einer ›Allianz‹ stilisiert. Schließlich wird Goethe in Kapitel IV als im Grunde ›überzeitliche‹ Erscheinung definiert; dieser Schlussfolgerung entsprechend geht dieses Kapitel der Frage nach, ob Goethe für die gegenwärtigen und zukünftigen literarischen Verhältnisse eine Orientierungsfunktion ausüben kann. Für den durch die (Ereignis-)Geschichte bedingten Paradigmenwechsel und den notwendigerweise neuen Blick auf Literatur sollte laut Gutzkow die von Goethe eingeführte Kategorie der ›Weltliteratur‹ als Ausgangspunkt dienen. Aus dieser Zusammenfassung der Schwerpunkte resultiert, dass in Ueber Göthe die (metonymische) Relevanz dieses damals umstrittenen Schriftstellers für die jüngste Vergangenheit und die Zukunft erprobt wird. Im Vorwort wird darüber hinaus auf ein vergleichsweise fachbezogenes Vorhaben verwiesen:
Gutzkows Ueber Göthe im Wendepunkte zweier Jahrhunderte (1836)
105
»Diese Schrift hat einen polemischen und einen paränetischen Zweck. Sie sollte eines Theils unsern großen Dichter gegen jene Ausstellungen vertheidigen, welche in neuerer Zeit aus den verschiedenartigsten Interessen gegen ihn gemacht wurden; andern Theils die selbst unter den produktiven literarischen Befähigungen der Gegenwart schwankenden ästhetischen Begriffe regeln und eine gemeinsame Verständigung befördern.«154
Wie übrigens der in der neuen Ausgabe allerdings ausgeblendete Untertitel – Eine kritische Verteidigung – bereits signalisiert, reagiert diese Schrift einerseits auf die sehr negative Beurteilung Menzels, die die Debatte über Goethe damals noch stärker angeregt hatte, andererseits nimmt sie sich vor, zur Intersubjektivität der analytischen Kategorien beizutragen. Gutzkow bekundet also ganz am Anfang ein Problem der damaligen Wissenschaftssprache, für das seine Schrift selbst an vielen Stellen – unfreiwillig – einen Beweis liefert. Man kann sogar behaupten, dass die Mängel, welche er an Gervinus’ analytischer Leistung meldet, also »die Gegenstände mehr durch Vergleichungen, Parallelen, Exkurse zu erläutern, als objektiv zu erschöpfen«155, sich eigentlich auch auf Gutzkows Überlegungen beziehen lassen. Wie Wienbargs literarturkritische Schriften156 tendiert auch Gutzkows Prosa dazu, statt die Ansichten auf den Begriff zu bringen, sie durch Metaphern und gewagte Parallelen zu amplifizieren, mit dem Zweck, sie den Leserinnen und Lesern anschaulicher zu machen. Das mit Blick auf Wienbarg bereits beschriebene Phänomen der ›Diskursintegration‹157 macht aber in der Tat die Argumentationsweise eher chaotisch und sprunghaft und erschwert mithin die Lektüre. Diese Tendenz der vormärzlichen literaturwissenschaftlichen Prosa hängt durchaus mit dem Ausbleiben von Fachbegriffen im modernen Sinne zusammen: Über kaum einheitliche Oberbegriffe und Wertungsmaßstäbe verfügend musste sich die damalige Literaturwissenschaft auf paraphrasierende und vergleichende Operationen stützen, die die Untersuchungsgegenstände nicht aus einer übergeordneten Perspektive definieren, sondern sie nur in andere Bereiche überführen. Zu diesem Aspekt tritt die teilweise unsystematische und inkonsequente Argumentationsstruktur hinzu, welche, wie Podewski es mit Recht formuliert, den jeweiligen »Gegenstand eher [umkreist], als dass sie ihn Schritt für Schritt entwickelt«158. Es handelt sich also um vereinzelt vorkommende Feststellungen, die zu keiner systematischen Auseinandersetzung führen; sie bleiben angekündigte Vorhaben, denen nicht wirklich Folge geleistet wird. 154 155 156 157
Ebd., S. 3. Ebd., S. 5. S. Kap. 2.3 der vorliegenden Studie. Bei Gutzkow werden bes. oft komplexe Parallelen mit naturwissenschaftlichen Prozessen hergestellt. 158 Madleen Podewski, Nachwort. In: Karl Gutzkow, Ueber Göthe im Wendepunkte zweier Jahrhunderte, Münster 2019 [1836], S. 227.
106
Historisierung
Das Problem, das Gutzkow bei Gervinus betont und das eigentlich auch seinen Text betrifft, macht also die Grenzen und Schwächen dieser Phase der Geschichte der Literaturwissenschaft sichtbar. Wie aber auch im Falle Prutz’ argumentiert wurde, erweist es sich nur bedingt als erkenntnisbringend, die damaligen Mängel aus Sicht avancierter Literaturwissenschaft zu betrachten; diese Mängel werden (von Gutzkow sowie anderen) zwar erkannt, allerdings ohne sich darin zu vertiefen und die eigenen Überlegungen mit in dieser Beziehung hingegen relevanten zeitgenössischen Diskursen überschneiden zu lassen. Aus diesem Grund erscheint es ertragreicher, auf die Reflexion über ›Historisierung‹ und ›Geschichtlichkeit‹ literarischer Erscheinungen sowie die Konnotationen und Funktionalisierungen einzugehen, welche angesichts dieses Schwerpunktes die etablierten produktionsästhetischen Begriffe gewinnen. Deshalb stehen im Folgenden hauptsächlich diese Fragen im Fokus. Auf das Verhältnis von literarischer Erscheinung und ›Zeit‹ geht Gutzkow zunächst einmal im Vorwort ein: »Diese Schrift ist ein Versuch, mich den Räthseln Göthe’s auf meine Weise anzunähern. […]. Da man heutiges Tages immer erst von der Zeit auf die Literatur zu kommen pflegt, und man Mühe hat sich allmählig aus einem gewissen allgemeinen Enthusiasmus, und einer durchaus vaguen und gegenstandlosen Leidenschaftlichkeit herauszuarbeiten, so betrachtete ich Göthen durchgehends unter dem Gesichtspunkte seiner Zeit, suchte alle seine Vorzüge verhältnismäßig zu bestimmen, und dachte immer an die Begriffe, welche der heutigen Jugend im Ohre summen.«159
Beide gleichwertig betrachtend setzt Gutzkow Goethe und das 18. Jahrhundert miteinander ins Verhältnis. Seine Perspektive hebt sich mithin von den vorherrschenden Annäherungsweisen ab, die hingegen im Sinne einer ›schwachen Historisierung‹ operieren (»man [pflegt] von der Zeit auf die Literatur zu kommen«) und sich von subjektiven Kriterien leiten lassen. In diesem Zusammenhang kommen auch produktionsästhetische Begriffe ins Spiel, die dazu dienen, diese Relation zu modulieren. Das lässt sich sehr exemplarisch auch bei Wolfgang Menzel betrachten, auf dessen negatives Urteil Gutzkow, wie bereits angedeutet, mit seinem ›Rettungsversuch‹ reagiert. Die Charakteristik Goethes erscheint im dritten Teil von Menzels Die deutsche Literatur (1828, 1836). Folgende Stelle fasst besonders pointiert nicht nur die zentralen Argumente von Menzels Kritik zusammen; sie verweist auch darauf, in welches Verhältnis er ›Autor‹ und ›Zeit‹ miteinander setzt: »Sofern das Talent charakterlos jeder äussern Bestimmung folgt, wird es vorzüglich von der Gegenwart und ihren herrschenden Moden bestimmt und geleitet. Darum hat
159 Gutzkow 2019 [1836], S. 4.
Gutzkows Ueber Göthe im Wendepunkte zweier Jahrhunderte (1836)
107
Goethe alle Moden seiner Zeit gehuldigt, und jeden Widerspruch derselben zu dem seinigen gemacht. Er schwamm immer mit dem Strom und auf der Oberfläche, wie Kork.«160
Das Verhältnis Goethes zu seiner Zeit wird als eines der vollständigen Unterordnung beschrieben: Laut Menzel hat sich Goethe den sich abwechselnden literarischen Moden und Tendenzen der Zeit angeschlossen, weil er ein ›charakterloses Talent‹ war, das als solches über keinen festen Kern verfügte und demzufolge die für die ›Weltgeschichte‹ wirklich relevanten Fragen auch nicht ermitteln konnte. Ohne Goethes »Verzweigung in die Zeit« und dessen »Hingebung an den Moment«161 prinzipiell bestreiten zu wollen, stellt Karl Gutzkow in seiner Abhandlung dagegen fest: »Wer kann sagen, dass Goethe nicht über seiner Zeit gestanden hätte? Aber er benützte seine Zeit als Stoff und verbrauchte sie, um seine Individualität zu arrondieren, in einer Weise, die seit Menschengedenken alle großen Charaktere gemein hatten.«162
Als ›großer Charakter‹ steht er also über seiner Zeit. Aus der Gegenüberstellung beider Standpunkte resultiert, dass die Begriffe ›Charakter‹ und ›Talent‹ eingesetzt werden, um das Verhältnis Goethes zur eigenen Zeit zu markieren und somit auch seine ›Historisierungsfähigkeit‹ zu bestimmen. Während Menzel die These eines unterschiedslosen Anschlusses an alle Tendenzen der Zeit vertritt, plausibilisiert Gutzkow bei Goethe eine komplexere und durchaus ambivalentere Stellung zur eigenen Zeit. Es ist hier keineswegs beabsichtigt, entweder Menzels oder Gutzkows Thesen zu untermauern; aus diesem Grund werden diese Thesen auch nicht ausführlich wiedergegeben. Im Rahmen der Reflexion über Historisierungsverfahren ist es interessanter, zu beobachten, wie die damals in literaturgeschichtlichen und -kritischen Diskursen geläufigen Begriffe funktionalisiert werden. Mit dem Gegensatzpaar ›Talent‹ – ›Genie‹, (das im Grunde auf zwei unterschiedliche ›naturgegebene‹ Veranlagungen hinweist), dem Bezug auf den (vorhandenen oder mangelnden) ›Charakter‹ und schließlich der Bezeichnung ›Dilettant‹ bildet sich ein Begriffsfeld heraus, das in erster Linie für die damaligen Wertungskriterien und deren Orientierung an (aus heutiger Sicht durchaus fragwürdigen) Kategorien der Produktion repräsentativ ist. Wie zu zeigen sein wird, lassen sich am Beispiel von dieser Auseinandersetzung u. a. interessante semantische Verlagerungen beobachten. Noch zentraler für das Verfahren der ›Historisierung‹ ist zudem die Frage nach der Rolle, die in dieser weder von Menzel noch von 160 Wolfgang Menzel, Die deutsche Literatur, Stuttgart 1836, S. 364. 161 Gutzkow 2019 [1836], S. 22. 162 Ebd., S. 22–23.
108
Historisierung
Gutzkow erfundenen Begriffskonstellation die Bestimmungsinstanzen von ›Natur‹, ›Zeit‹ und ›Geschichte‹ spielen. Vor dem Hintergrund eines professionellen Umgangs mit Kunst und Literatur stellen ›Genie‹ und ›Talent‹ zwei unterschiedliche Veranlagungen dar, welche sich, eben weil beide als ›naturgegeben‹ betrachtet werden, nur zum Teil mit dem beim Geniediskurs schon immer vorausgesetzten, traditionellen Gegensatzpaar ›Natur‹ (natur, ingenium) – ›Kunst‹ (ars, studium)163 decken. Im Rahmen einer für die vormärzliche Literaturgeschichtsschreibung und Literaturkritik ja prägenden Gehaltsästhetik ergibt sich die gegenüber dem ›Talent‹ höhere Abstufung des ›Genies‹ vielmehr aus dessen produktiver Kraft, die ›Form‹ und ›Inhalt‹ gleichermaßen beherrscht; das ›Talent‹ zeichnet sich hingegen durch das einseitige Vermögen aus, auf der Ebene der ›Darstellung‹ herausragende Werke zu produzieren. So stellt Menzel fest: »Bei Goethe war die Form alles. Jeden beliebigen, auch den heterogensten Gegenstand durch eine gefällige Form zu empfehlen, Alles, was er ergriff, auch das seinem Wesen nach Unschönste, durch die Einkleidung zu beschönigen, war das Geheimniß seiner glücklichen Hand. Diese Gabe ist das, was man Talent nennt, nicht mehr und nicht weniger.«164
Bei der Verwendung des Begriffes ›Talent‹ handelt es sich um eine gängige, ja weit verbreitete Assoziation, die sich bei Gutzkow ebenfalls wiederfinden lässt. Im Rahmen eines im damaligen literaturgeschichtlichen Diskurs etablierten Vergleichs zwischen Schiller und Goethe assoziiert nämlich Gutzkow im ersten Kapitel seiner Abhandlung die Begriffe ›Talent‹ und ›Genie‹ jeweils mit ›Form‹ und ›Stoff‹: »Talent ist Form, Genie Stoff. Jenes steigert sich in der Anwendung; dieses kann verbraucht und muß ökonomisiert werden«165. Mit dem formalästhetischen Vermögen hängen, laut Menzel, der (stoffliche) ›Universalismus‹ sowie die »Vielseitigkeit«166 des ›Talentes‹ zusammen167. In dieser Bedeutungszuweisung stimmen Menzels und Gutzkows Begriffsverwendung ebenfalls überein: Am Beispiel von Schillers und Goethes Gesamtwerk betont Gutzkow, wie aufgrund des für das ›Talent‹ typischen Universalismus bei Schillers Werk kein Zusammenhang herrscht. Bei Goethes literarischer Produktion lassen sich hingegen Konsequenz und Kontinuität erkennen, weil, wer als ›Genie‹ oder ›Charakter‹ bezeichnet werden kann, sich nur bedingt von in der ›Zeit‹ liegenden 163 Vgl. dazu Klaus Weimar, Artikel ›Genie‹. In: ders. (Hg.), Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft, Band 1 (A–G) 2007, S. 701–703. 164 Menzel 1836, S. 353. 165 Gutzkow 2019 [1836], S. 25. 166 Menzel 1836, S. 361. 167 Ein weiterer Beweis für die Zentralität dieser Kategorien im damaligen literaturwissenschaftlichen Diskurs lässt sich auch bei Robert Prutz’ Kleine Schriften (1847–48) und zwar in seinem Essay über Wilhelm Waiblinger finden. Vgl. dazu Prutz 1847–48, Band 1, S. 231ff.
Gutzkows Ueber Göthe im Wendepunkte zweier Jahrhunderte (1836)
109
Tendenzen leiten lässt. Im Hinblick auf das Verhältnis zur ›Zeit‹ und die ›Historisierungsfähigkeit‹ erweist sich ein ›Talent‹ für die Aufnahme der Zeittendenzen also als prädisponierter als ein ›Genie‹ oder ein ›Charakter‹. Im Rahmen der beschriebenen einheitlichen Bedeutungszuweisungen lässt sich aber auf einen Unterschied hinweisen, in dem Gutzkows Verteidigungsstrategie besteht. Bei Menzels Begriffsverwendung ist sehr eindeutig zu beobachten, wie auf ›Talent‹ semantische Nuancierungen des frühen Begriffs des ›Dilettanten‹ verlagert werden, der nicht von ungefähr in seiner Charakteristik Goethes gar nicht vorkommt: Menzel bezeichnet den talentvollen Künstler aufgrund seines Universalismus auch als »Virtuose[n]«168. In diesem Sinne knüpft also das ›Talent‹ an den ›virtuoso‹ der italienischen Renaissance an, in dessen Tradition wiederum der Begriff des ›Dilettanten‹ bei seinem Eintritt ins Deutsche steht169. Erst im deutschen Klassizismus (bspw. bei Karl Philipp Moritz, Schiller, Goethe) und infolge der sozialen Ausdifferenzierung der modernen Gesellschaft entwickelt sich nämlich ›Dilettant‹ zum Gegenbegriff von ›Kunstgenie‹170. Nun lässt sich bei dieser Auseinandersetzung interessanterweise beobachten, dass der Begriff des ›Dilettanten‹ entweder gar nicht vorkommt, wie das bei Menzel der Fall ist, oder, weil auch in seiner späteren und geläufigeren Bedeutung vom ›Talentbegriff‹ fast vollständig abgelöst, mit einer anderen, ›schwächeren‹ Bedeutung verwendet wird. Und das erfolgt eben bei Gutzkows ›kritischer Verteidigung‹. Zusammen mit der Berücksichtigung der Instanz des Publikums dient der Begriff des ›Dilettanten‹ bei Gutzkows Verteidigungsstrategie dazu, Goethes Verhältnis zur ›Zeit‹ subtilerer zu erfassen. Er verwendet diesen Begriff eher konnotationsfrei, um auf Goethes Offenheit, Neugier und auch einfach vom ›Zufall‹ geleitete, Experimentierfreudigkeit hinweisen zu können, die hingegen Menzel als vollkommene Hingebung an die Zeit darstellt: »Göthe kam so unbewußt in seine Stellung der Nation gegenüber, daß er lange Zeit die Physiognomie eines Dilettanten nicht verlieren wollte; jede neue Kraft, welche auf die Oeffentlichkeit wirken will, wird sie sogleich nach Gesichtspunkten, die in ihrem Interesse gestellt sind, ermessen, und immer das Mangelhafte da als vorhanden auszugeben suchen, wo sie sich einbildet, den Schaden oder das Fehlende ersetzen zu können. Göthe aber war so wenig Willens auf die Theilnahme des Publikums zu spekuliren, daß er selbst nach seinen ersten veröffentlichten Produktionen nicht aufhören konnte, das Publikum lieber nach den Verehrung zu beurtheilen, die ihm Klopstock, Gleim und die seiner Natur entgegengesetztesten Geister zu verlangen schienen. Göthe stand in keinem Rapport zum Publikum. […]. Mit irgend einer Tendenz und Richtung wußte er sich am wenigsten in Einklang zu bringen, und hat, ob seine Wirkung gleich gewaltig war, doch niemals in dem selbst gelebt, oder hat in dem fortgefahren zu leben, wo sein 168 Menzel 1836, S. 361. 169 Vgl. dazu Georg Stanitzek, Artikel ›Dilettant‹. In: Weimar 2007, S. 364–366. 170 Ebd., S. 365.
110
Historisierung
Anfang alle Welt entzündete. […] [Göthe] hielt sich niemals an das, was aus ihm eine Schule hätte machen können, oder eine Religion, deren erster Priester er hätte sein müssen. Freilich hatte er bei dieser Zufälligkeit seiner Bestrebungen den meisten Verlust. […]. Auf Kosten einer ihn, und seinen Genius vernichtenden Monotonie wollte er es [populär] nicht sein. […]. Neuheit in jedem neuen Buche stört die Bequemlichkeit der Leser, setzt eine Beschäftigung mit dem Dichter voraus, wozu nicht alle die gehörige Muße haben, und erschwert somit das allgemeine Verständniß, ohne welches es keine Popularität giebt.«171
Wie diese lange Stelle belegt, wird der Begriff des ›Dilettanten‹ mit Blick auf Reflexionen über Rezeptionsaspekte ins Spiel gebracht. Insbesondere macht Gutzkow das (vermeintlich) zwiespältige Verhältnis Goethes zum ›Ruhm‹ für die Vielfalt seiner Produktion verantwortlich: Er schlug immer wieder neue Richtungen ein, um nicht – oder allenfalls mit Verzögerung und einer gewissen, anfänglichen Irritation – rezipiert zu werden. Anhand der Analyse dieser Begriffskonstellation lässt sich also feststellen, dass 1. der im Vormärz häufiger vorkommende Begriff des ›Talentes‹ einige semantische Aspekte des frühen Dilettantenbegriffs übernimmt. Dabei kann man zudem betonen, dass ›Talent‹, wie bereits erwähnt, einer eindeutig naturgegebenen Veranlagung entspricht, während ›Dilettant‹ auf einen Habitus zu verweisen scheint. Bei diesem Begriff handelt es sich also vielmehr um eine Option, die man auswählt und die eine öffentliche und soziale Relevanz hat. Diese Ausführungen rekonstruieren auf Begriffsebene, wie Gutzkow bei Goethe ein ambivalentes Verhältnis zur eigenen ›Zeit‹ begründet: Nicht von einer passiven und kurzlebigen Aufnahme aller Tendenzen und Anregungen, sondern von einem durch Neugier bedingten selektiven Umgang mit denselben kann die Rede sein. Das Verhältnis zur eigenen Zeit gewinnt allerdings nicht nur anhand dieser Begriffe Kontur. Die Darstellung dieser Relation erfolgt nämlich auf Makroebene auch dynamischer, sie erfährt eine Art Dramatisierung und erlaubt es, ›Historisierung‹ und ›Geschichtlichkeit‹ einer literarischen Erscheinung anders zu denken als nur im Spannungsfeld zwischen dem (genealogischen Vorstellungen geschuldeten) ›Produkt der Zeit‹ und der ›Über-der-Zeit-stehendenErscheinung‹. In dieser Beziehung ist vor allem Kapitel III von Belang, das zudem im Vergleich zu den anderen Kapiteln der Abhandlung sehr konsequent strukturiert ist: Hier wird den historischen Verhältnissen des ausgehenden 18. Jahrhunderts viel Platz eingeräumt, um dann zur vereinzelten Erscheinung (Goethe) zu kommen. In diesem Kapitel wird die Französische Revolution zum auch für literarische Verhältnisse entscheidenden Ereignis, ja zum ›Wendepunkt‹ stili-
171 Gutzkow 2019 [1836], S. 44–45.
Gutzkows Ueber Göthe im Wendepunkte zweier Jahrhunderte (1836)
111
siert. Die Revolution macht demzufolge das 18. Jahrhundert zu einer »so entgegengesetzte Elemente in sich«172 vereinigenden Epoche: »Der Geschichtsschreiber würde Mühe haben, sich in alle diese Anfänge sogleich zurecht zu finden, wenn sie nicht ein so entscheidendes Ende gehabt hätten. Der Abschluß des Jahrhunderts erleichtert ihm sein Geschäft, giebt ihm ein sicheres Ziel, und für die einzelnen Bildungsmassen ein ordnendes Theilungsprinzip.«173
Über die Periodisierungsmöglichkeiten der (Literatur-)Geschichtsschreibung reflektierend fungiert also die Französische Revolution ohne weiteres als ›Zäsur‹. Der Paradigmenwechsel, den dieses historische Ereignis zur Folge hat und den Gutzkow sehr prägnant schildert, hat Auswirkungen auf die Individualitäten: »In einer so leidenschaftlichen Bewegung der Begriffe […] saß nun das Individuum mitten in den meist feindseligen Widersprüchen inne. […] [F]rüher mußte es um Erlaubnis bitten, zu einer Audienz bei der Literatur zugelassen zu werden; aber jetzt ist es plötzlich in den Kreis der Allgemeinheit aufgenommen, und giebt seine eigene Stimme ab. […]. Partheiung tritt an die Stelle der exoterischen Andacht […]. Allmählig werden die, welche lesen, die Faktoren des Schriftwesens; die Büchern nähern sich den Briefen; für alle europäischen Literaturen legt sich der Grund zu jener ungeheuren Produktionsanregung, durch die der Journalismus zuletzt eine Macht wurde, welche die Literatur selbst zu verschlingen drohte.«174
Die beschriebenen Änderungen führen zu einer generellen Desorientierung und einer Pluralisierung der Modalitäten, als Schriftstellerin oder Schriftsteller tätig zu sein. Vor diesem Hintergrund weist das mal als ›Kampf‹ oder ›Antagonismus‹, mal als ›Allianz‹ und ›Aneignung‹ dargestellte Verhältnis Goethes zur eigenen Zeit einen zeitdiagnostischen Wert auf: Seine ambivalente Einstellung und die Tatsache, dass er sich keineswegs von der ›Zeit‹ restlos bestimmen lässt, kann man durchaus darauf zurückführen, dass er ein ›Charakter‹ ist. Diese Einstellung hängt allerdings auch mit der besonderen Wendepunkt-Situation zusammen. So bildet diese Schrift – über die expliziten Reflexionen über ›Historisierungsfähigkeit‹ und ›Überzeitlichkeit‹ hinaus – aufgrund der ausgewählten Modalität der Darstellung eine andere Form der ›Historisierung‹, bei der keineswegs von einer ›Widerspiegelung‹ die Rede sein kann. Vielmehr kann man im Sinne eines ›Kampfes‹ von einem (wohlgemerkt, verzeitlichten) Vorgang gegenseitiger Bestimmung und Auswirkung sprechen, aufgrund dessen bei Ausführungen über diesen Schriftsteller Betrachtungen über die Zeit bzw. den Kontext nicht fehlen dürfen und umgekehrt. Diese Vorstellung kann vielleicht effektiver dargelegt werden, wenn unter ›Kampf‹ kein Durchsetzungsspiel, sondern ein sich gegenseitig bedingender Komplex von Aktion und Reaktion verstanden wird. 172 Ebd., S. 61. 173 Ibidem. 174 Ebd., S. 62.
112
2.7
Historisierung
Die Zäsur ›Julirevolution‹ und die Bilanz eines Jahrzehntes: Karl Gutzkows Vergangenheit und Gegenwart (1830–1838) (1839)
Der 1839 veröffentlichte Aufsatz Vergangenheit und Gegenwart (1830–1838) ist in erster Linie durch einen ›rekapitulierenden‹ Anspruch gekennzeichnet. Dieser im Eröffnungsheft des ›Jahrbuch der Literatur‹ erschienene Text besteht aus zwölf Kapiteln, an deren thematischen Schwerpunkten sich eine gewisse Perspektivenvielfalt bereits erkennen lässt: ›Autobiographie‹, ›Gegenwartsliteratur‹ und ›Zeitgeschichte‹ werden nämlich in diesem die Varietät einer Sammlung simulierenden Essay miteinander verbunden175. Die Kombination von ›Tagebuchschreiber-‹ und ›Zeitschriftstellerperspektive‹ hängt mit der angestrebten Bilanz eines sowohl auf individueller als auch kollektiver Ebene bewegten Jahrzehnts zusammen. Der Anfang dieses Jahrzehnts entspricht einem historischen Ereignis, das auch in Deutschland Diskontinuität erzeugt hatte: der Pariser Julirevolution. Mit Blick auf die mit einer Bilanz (zwangsläufig) einhergehende Operation der Sinnstiftung und die performativ zu etablierende Periodisierung lässt sich dieser Text dem Verfahren der ›Historisierung‹ zuordnen. Auch andere Aspekte, die im Laufe der Analyse herausgehoben werden, führen zu dieser Klassifikation. Stößt die Julirevolution europaweit auf Resonanz, so lässt sich innerhalb des von Gutzkow in den Blick genommenen Zeitraums eine weitere Zäsur bestimmen, auf die der Titel des Essays (Vergangenheit und Gegenwart) anspielt und die hauptsächlich die deutsche Gegenwartsliteratur betrifft. Ein Ereignis, das die die erste Hälfte des Jahrzehnts (›Vergangenheit‹) kennzeichnende Tendenz umkehren lässt und die sich seitdem abzeichnenden (literarischen) Verhältnisse (›Gegenwart‹) entscheidend prägt. Dabei handelt es sich um das von einem Teil der Kritik (sprich: Wolfgang Menzel) unterstützte, ja sogar geförderte Publikationsverbot, das die sogenannten Jungdeutschen, darunter vor allem Gutzkow, traf. Wie sich ab dem Kapitel ›Gedanken im Kerker‹ beobachten lässt, spielt die persönlich-autobiographische Perspektive eine immer größere Rolle; dementsprechend ähnelt die Diktion dann einer ›Abrechnung‹ – im Text selber lässt sich also eine vom Tonwechsel markierte Zäsur bestimmen. Die persönlich-autobiographische Perspektive wird allerdings stets durch die auch in zeitlicher Hinsicht über die partikulären Ereignisse sowie die Gegenwartsliteratur hinausgehende (literatur-)geschichtliche Perspektive ergänzt. Das Publikationsver175 Ein Blick auf die Titel der Kapitel bestätigt die angedeutete Perspektivenvielfalt: ›1830‹, ›Die neue Bildung‹, ›Wolfgang Menzel‹, ›1832‹, ›Heinrich Laube‹, ›Rahel, Bettina, die Stieglitz‹, ›Die Lyriker‹, ›Theodor Mundt‹, ›Das Junge Deutschland‹, ›Gedanken im Kerker‹, ›1836‹, ›Allgemeine Musterung‹.
Karl Gutzkows Vergangenheit und Gegenwart (1830–1838) (1839)
113
bot hat nämlich die Entwicklung der einzig in sich organischen und im Einklang mit dem ›Zeitgeist‹ stehenden Tendenz der deutschen Gegenwartsliteratur zum Stillstand gebracht. In literaturgeschichtlicher Hinsicht bildet das eine versäumte Chance. Demzufolge nimmt sich Gutzkow mit seiner aufwertenden Kritik vor, auf die Rezeption dieser literarischen Erscheinungen langfristig einzuwirken und das, was an ihnen wegen einer parteilichen und kurzsichtigen Sicht ›latent‹ blieb, ans Licht zu bringen. Neben dem für die Denkform ›Geschichte‹ konstitutiven Moment der ›Zäsur‹ prägt demnach das Bewusstsein einer verkannten Erneuerung der deutschen Literatur die historisierende Perspektive dieses Aufsatzes, wie übrigens die Abschlussstelle aus dem Kapitel ›Das Junge Deutschland‹ sehr deutlich belegt: »[A]ber es werden Zeiten und Menschen kommen, die nicht über uns den Stab brechen werden, sondern über die, welche […] aus der Trägheit eines Verständnisses der Literatur, das zehn Jahre hinter dem Werdenden zurück war, eine Erscheinung richteten, die wahrlich eine nicht fruchtlose Blüte tief wurzelnder organischer Voraussetzungen war.«176
Im Vergleich zu anderen in dieser Studie untersuchten Texten fällt bei Gutzkows Essay das innere Strukturmerkmal der chronologischen Aufeinanderfolge auf, das der angestrebten Rekonstruktion der Genese und Entwicklungsgeschichte einer organischen Tendenz der deutschen Literatur sehr gut entgegenkommt. Den Ausgangspunkt bildet die Julirevolution, deren diskontinuitätserzeugender Charakter zunächst im Kapitel ›1830‹ durch die autobiographische Perspektive gefiltert wird. Die kontrastierende Zusammenstellung des ›Vorher-NachherZustandes‹, den zwei Zeitangaben im Text explizit signalisieren (»Ich gestehe, dass ich zwei Monate vor der Julirevolution keinen Begriff von europäischer Politik hatte«, »Es war am dritten August, und die Sonne brannte«177), konkretisiert sich autobiographisch in der jeweiligen Einstellung des Autors im Rahmen zweier höchst symbolischer Begebenheiten. Im anekdotenhaft wiedergegebenen, vor der Julirevolution erfolgten Gespräch mit Saint-Marc Girardin legt Gutzkow die Hoffnung auf eine von den deutschen Burschenschaften angeregte Erneuerung an den Tag, welche aus seiner Sicht nur dem Bereich des ›Wissens‹ und des ›Denkens‹ entspringen könnte178. Mit dem Anbruch der Julirevolution stellt sich Gutzkows Prognose allerdings als falsch heraus. Seine angesichts dieses Ereignisses veränderte Einstellung tritt dann sehr deutlich während der Preisverleihung an der Berliner Universität hervor:
176 Karl Gutzkow, Vergangenheit und Gegenwart (1830–1838), Stuttgart 1910 [1839], S. 119. 177 Ebd., S. 87–88. 178 »Wenn ich Ereignisse erwartete, die in den Lauf der Begebenheiten gewaltsam eingriffen, so hätt’ ich sie eher von Erlangen und Jena als von Paris erwartet«, ebd., S. 87.
114
Historisierung
»[A]lle, die Zeitungen lasen, wußten, daß in Frankreich eben ein König vom Thron gestoßen wurde. Der Kanonendonner zwischen den Barrikaden von Paris dröhnte bis in die Aula nach. […]. Hegel trat auf und nannte die Sieger in den wissenschaftlichen Wettkämpfen der Akademie. Jede Fakultät hatte einen Preisbewerber zu belohnen; aber niemand hörte darauf als der Beteiligte. […]. Ich selbst vernahm mit einem Ohr, daß ich sechs Mitbewerber überwunden und den Preis in der philosophischen Fakultät gewonnen hätte; mit dem andern von einem Volke, das einen König entsetzt hatte […]; ich sah die Hoffnung nicht mehr, die man mir in einigen Jahren auf eine außerordentliche Professur machen konnte; ich […] dachte über Saint-Marc Girardins Prophezeiung und die deutsche Burschenschaft nach. Ich lief dann […] zu Stehely und nahm zum ersten Male eine Zeitung vors Gesicht. Nie war das meine Gewohnheit gewesen. […] ich wollte nur wissen, wieviel Tote und Verwundete es in Paris gegeben, ob die Barrikaden noch ständen, […], ob Lafayette eine Monarchie oder Republik machen würde. Die Wissenschaft lag hinter, die Geschichte vor mir.«179
Der durch episch-erzählerische Stilqualität wiedergegebene Wandel, der durch die Perspektive der unmittelbar betroffenen Zeitgenossen vermittelt wird, besteht in erster Linie darin, dass der Autor den bis zu jenem Zeitpunkt konsequent verfolgten Lebensentwurf revidiert und mit Blick auf die alltäglichen Praktiken mit anderen Publikationsformaten (d. h. der Zeitung) vertraut wird. Die diskontinuitätserzeugende Resonanz der Julirevolution wird außerdem durch die Nebeneinanderstellung zweier gegensätzlicher Zeitstrukturen unterstrichen, die sich wiederum auf den semantisch strukturierenden Leitunterschied ›Wissenschaft‹ – ›Geschichte‹ zurückführen lassen: Der ritualisierten Wiederholung, die die ›Gegenwart‹ der Preisverleihung kennzeichnet, wird die durch die Zeitung vermittelte Erfahrung einer ständig im Wandel begriffenen und folglich auf den neuesten Stand zu bringenden ›Gegenwart‹ gegenübergestellt. Die sich ebenfalls in Deutschland als überindividuell herausstellende Tragweite der Julirevolution kommt im Kapitel ›Die neue Bildung‹ in den Blick. In Gutzkows Darstellung hat dieses Ereignis als Katalysator der bereits längst in Deutschland umlaufenden revolutionären Energien fungiert: »Aus einem allgemeinen und von leeren Überlieferungen befruchteten Idealismus wurden die jugendlichen Gemüter plötzlich auf ein bewegtes Feld unmittelbarer Tagesaufregungen versetzt […]. [A]ls die täglich sich mehrenden politischen Eindrücke selbst auf deutsche Verhältnisse verwirrend übergingen […], da mußte sich dem bisherigen allgemeinen träumerischen Tasten ins Blaue hinein eine von den Tagesumständen bedingte Präzision und Sicherheit mitteilen, die den ganzen Ideenkreis, der der deutschen Jugendbildung vor 1830 zum Grunde lag, erweiterte und ihm zu Radien und Durchmessern neue Begriffe und dem französischen und englischen Staatsleben entnommene Vorstellungen gab.«180
179 Ebd., S. 89. 180 Ebd., S. 90.
Karl Gutzkows Vergangenheit und Gegenwart (1830–1838) (1839)
115
Ähnlich kohärenzstiftend und bereichernd wirkt sich die Julirevolution auf die literarischen Verhältnisse aus. Im Rahmen einer Literatur, in der nun eine allgemein anerkannte Figur mit Vorbild-Funktion ausbleibt, setzen sich allmählich Heine und Börne durch. Sie gelten in Gutzkows Rekonstruktion als die Initiatoren der organischen Richtung der deutschen Gegenwartsliteratur, der er nun nachgeht. Die Kapitel ähneln immer stärker Charakteristiken der für diese Richtung repräsentativen Autorinnen und Autoren. Bei dieser kleinen ›Geschichte der Gegenwartsliteratur‹ herrscht zwischen den Erscheinungen eine Logik der Komplementarität vor: Während beispielsweise Heine der Literatur zeitgenössische Stoffe zugänglich gemacht hat, ist Börne der zeitdiagnostische Blick zu verdanken181. Im Kapitel ›Wolfgang Menzel‹ übernimmt Gutzkow die Perspektive des (Literatur-)Historikers und trotz des späteren ›Verbrechens‹ dieses Kritikers und der daraus entstandenen Rivalität erkennt er ihm den Verdienst zu, den Weg zur Erneuerung der Literatur und zur Entwicklung neuer Begriffe für die Betrachtung derselben vorbereitet zu haben182. Immer noch im Rahmen der Literaturkritik »bot« Theodor Mundt »die […] Materien in rohster Gestalt«183, die dann Wienbarg auf dem Standpunkt des ›Lebens‹ verarbeitete. Ähnlich argumentierend stellt Gutzkow fest, dass Rahel Varnhagen von Ense, Bettina Brentano und Charlotte Stieglitz »[sich] [w]ie durch eine göttliche Verabredung ergänzen«184. Die Beispiele verdeutlichen also, dass diese literarischen Erscheinungen einen kohärenten Zusammenhang bilden, innerhalb dessen sie alle Notwendigkeit aufweisen. Zieht man die am Anfang dieses Kapitels angestellten Überlegungen zum Historisierungsverfahren und zur Geschichtsphilosophie in Betracht, so ist bei Gutzkows Charakteristiken offenbar das Modell einer teleologisch-fortschreitenden Entwicklungsgeschichte – auch als Wertungskriterium – am Werk. Literaturgeschichtliche und -kritische Diskurse nehmen also, wie übrigens auch anhand von Prutz’ Aufsätzen ausführlich bewiesen wurde, geschichtsphilosophische Entwicklungsvorstellungen in sich auf. Im spezifischen Fall dieser Abhandlung bilden der ›Zeitgeist‹, ›das Werdende‹ und ›das Neue‹ die ›Inhalte‹, welchen die ›Form‹ ›Gegenwartsliteratur‹ Konkretion verleiht. Gemäß dieser positiv konnotierten Entwicklungsvorstellung weist das Kapitel ›Das Junge Deutschland‹ darauf hin, dass die durch diese fremdbestimmte Be181 Vgl. dazu ebd., S. 93. 182 »Uns steht es an, ihm den Ruhm zu lassen, daß er der versumpften Literatur der Restaurationsperiode frische Kanäle zuführte, die mephitischen Ausdünstungen derselben erstickte, die auf ihnen wuchernde großblättrige und mattblühende Vegetation der damaligen Belletristik ausreutete. Wir würden an dem Wiederaufbau einer neuen Literatur nicht arbeiten können, wenn nicht seine Kraft dagewesen wäre«, ebd., S. 96. 183 Ebd., S. 112. 184 Ebd., S. 103.
116
Historisierung
zeichnung zu einer ›Gruppe‹ gewordenen Autoren (»Nie ist etwas verabredet worden«185) in der öffentlichen Debatte dann doch für eine Weile als solche aufgetreten sind. Zum Zweck der von der Menzel’schen Kritik gefährdeten Neuerung konnten sie über die jeweiligen Mängel hinwegsehen. Als Gutzkow 1835 am härtesten vom Publikationsverbot getroffen und wegen Wally, die Zweiflerin zu einem Monat Haft verurteilt wurde, trat die bereits forcierte gegenseitige Unterstützung vollständig zurück. Aus dieser erfolgreichen literarisch-reaktionären Initiative, die die zweite Zäsur bildet, ergibt sich die im Kapitel ›1836‹ beschriebene und z. T. während der Schreibzeit noch andauernde Situation. Erneut strukturiert Gutzkow seinen Text – nun aber auf kapitelübergreifender Ebene – nach dem ›Vorher-Nachher-Prinzip‹: Laubes und Mundts Produktion, der bereits ein Kapitel gewidmet wurde, wird noch einmal in den Blick genommen; nun wird aber festgestellt, wie sie sich durch die Vereinzelung und den eingeschlagenen konservativeren Weg deutlich verschlechtert hat186. Der Aufsatz endet mit dem auf die gegenwärtige Lage bezogenen Kapitel ›Allgemeine Musterung‹, in dem im Vergleich zu England und Frankreich die (positive) Tendenz der deutschen Literatur betont wird, aus der ›Geschichte‹ sowie aus der ›Wissenschaft‹ stammende Reflexionen in den eigenen Diskurs zu integrieren. Der Feststellung dieser laut Gutzkow für zukünftige Entwicklungen recht bedeutsamen Integrationsfähigkeit folgen auf einzelne Gattungen bezogene Diagnosen. Mit Blick auf ›Kritik‹ geht Gutzkow erneut auf ihre Schlüsselfunktion und auf das Bedürfnis nach einer Neujustierung ihrer Kriterien und Verfahren ein: »Zur echten Kritik gehört ein Gemüt, das das Gras wachsen hört. Unsere Kritik merkt nicht, horcht nicht, sie liest kaum, wie man lesen soll. Sie tötet ein Buch wie ein Lebendiges[.] […]. Man muß die Erscheinungen aus dem Gewühl des Tages entführen und sie in der Literaturgeschichte […] unterbringen so lange, bis die Zeit erfüllet ist und alles Volk versteht, was vor dreißig Jahren nur Engel und Propheten verstanden.«187
Da der größte Teil der Kritik von Börnes Ideal, das auch hier evoziert wird, noch weit entfernt ist, sollte die Gegenwartsliteratur der vergleichsweise sachlicheren Beobachtung der Literaturgeschichte ausgesetzt werden. Eine künftige ›Arbeitsteilung‹ vorwegnehmend sollte also die Literaturgeschichte vornehmlich eine Archivfunktion ausüben und die literarischen Erscheinungen solange vor solchen Angriffen ›bewahren‹, bis das Publikum in der Lage ist, sie zu rezipieren. Erst dann kann also die Kritik diese Erscheinungen angemessen untersuchen und dadurch eine Interpretation liefern.
185 Ebd., S. 117. 186 Vgl. dazu S. 126–132. 187 Ebd., S. 137.
Zeit und Text: Gutzkows Beiträge zur Geschichte der neuesten Literatur (1839)
2.8
117
Zeit und Text: Gutzkows Beiträge zur Geschichte der neuesten Literatur (1839)
Die Auseinandersetzung mit Wolfgang Menzel durchzieht Gutzkows Werk: Trotz der Abrechnung mit seinem ehemaligen Mentor und der Betonung seiner Relevanz für die Literaturgeschichtsschreibung in Ueber Göthe im Wendepunkte zweier Jahrhunderte (1836) und Vergangenheit und Gegenwart (1830–1838) (1839) hält Gutzkow diese Angelegenheit noch nicht für erledigt. So liefert er mit der 1839 erschienenen doppelbändigen Sammlung Beiträge zur Geschichte der neuesten Literatur ein kritisches Gegenstück zu Menzels umfangreicher Abhandlung Die deutsche Literatur (1828, 1836). Genauso wie Menzel verwendet Gutzkow hier den Begriff ›Literatur‹ mit der überkommenen und doch damals eher marginalisierten Bedeutung von der »Gesamtheit des Geschriebenen bzw. Gedruckten überhaupt«188. Diesem Begriffsgebrauch entsprechend geraten im ersten Band nicht nur prominente zeitgenössische Autorinnen und Autoren sowie die drei Gattungen in den Blick (›Charaktere und Tendenzen‹, ›Dichter im Reime‹, ›Theater‹, ›Roman‹), sondern auch – dabei eine proto-praxeologische Perspektive verratend – das Verlagswesen (›Literarische Industrie‹). Der disziplinübergreifende Bezugsrahmen wird allerdings noch deutlicher im zweiten Band, wo die neuesten Veröffentlichungen und Entwicklungen im Rahmen von ›Geschichte‹, ›Geschichte der Literatur und Kunst‹, ›Philosophie‹, ›Theologie‹, ›Staatswissenschaft‹ und ›Staatswissenschaftslehre‹ behandelt werden, ohne dabei die in wissenschaftsgeschichtlicher Hinsicht bedeutsamen Akzentverschiebungen zu übersehen. In diesem Sinne zielt die Sammlung also darauf ab, das ›Neue‹ am Wissenschaftssystem im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts zu umschreiben. Auch bei diesem Text handelt es sich um eine aus bereits veröffentlichten Artikeln bestehende Sammlung. Und auch hier wird auf den Überarbeitungsprozess eingegangen: »Dies Buch enthält die Resultate einer mehrjährigen kritischen Wirksamkeit. Das Prinzip, welches mich bei seiner Anordnung leitete, lag in Wegräumung aller zufälligen und früher nur vom Augenblick diktirten Erörterungen, namentlich aber in Milderung der vielen Gereiztheiten, mit welchen in Deutschland der junge literarische Enthusiasmus, der seinen Gegenstand noch nicht kennt, aufzutreten pflegt. Eine wirre Periode lag hinter mir. Ihre wuchernden Ueppigkeiten schnitt ich ab, und ließ nur Dasjenige stehen, was schon fester Stamm geworden war und die Wege der Zukunft angenehm beschatten konnte.«189
188 Klaus Weimar, Artikel ›Literatur‹. In: Harald Fricke (Hg.), Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft, Band 2 (H–O), Berlin/New York 2007, S. 443–448, hier: S. 443. 189 Karl Gutzkow, Beiträge zur Geschichte der neuesten Literatur, Stuttgart 1839, S. III–IV.
118
Historisierung
Bei der Operation der Überarbeitung, die Gutzkow mit Rekurs auf Metaphern aus dem Pflanzenbereich effektiv darstellt, erweist sich also das Zusammenspiel von ›Zeit‹ und ›Text‹ als ein Aspekt von entscheidender Bedeutung. Dagegen könnte man wohl einwenden, dass die Überarbeitung eines Textes an sich durch das unterstellte Veränderungspotenzial von ›Zeit‹ ja begründet ist und überhaupt ermöglicht wird. Dem angedeuteten Zusammenspiel und auch der Zeitsemantik wird hier allerdings eine charakteristische Zentralität erteilt. Besonders prägend ist nämlich die entscheidende Funktion von ›Zeit‹ bei der Produktion und bei der Berücksichtigung von Rezeptionsprozessen (»vom Augenblick diktirten Erörterungen«, »[ich] ließ nur Dasjenige stehen, was schon fester Stamm geworden war und die Wege der Zukunft angenehm beschatten konnte«). Auf der Ebene der Argumentation scheint also der Dreischritt ›Vergangenheit‹-›Gegenwart‹›Zukunft‹ Schreibprozesse langfristig zu begleiten und zu lenken. Mit Blick auf den Zusammenhang von ›Zeit‹ und ›Text‹ muss demnach die Leistung dieser Sammlung im Rahmen des Historisierungsverfahrens in erster Linie in Bezug auf ›materiale‹ Aspekte verstanden werden. Ein Vergleich mit einem bereits untersuchten Text kann das vielleicht besser verdeutlichen. Bei Prutz’ Sammlung wird der Aspekt der Überarbeitung ebenfalls thematisiert; nur ist in dem Fall eine andere Form von Historisierung bestimmt worden, weil 1. ›Gegenwart‹ wegen der als fortschreitend konzipierten Geschichtsauffassung stets historisiert bzw. als ›Vergangenheit künftiger Gegenwarten‹ betrachtet wird, 2. noch grundsätzlicher die Denkform ›Geschichte‹ zum Typus erhoben wird, nach dem sämtliche Erscheinungen beschrieben werden können. Aufgrund dieser Aspekte lässt sich also die eigentlich nur pro forma thematisierte Überarbeitung relativieren. Bei Gutzkows Beiträgen muss hingegen gerade dieser Aspekt in den Vordergrund rücken: Eine geschichtsphilosophische Vorstellung, nach der die ›Gegenwart‹ keine Latenzen in sich birgt und demnach gedanklich auch nicht ›überwunden‹ werden kann, ist hier nicht vorhanden; der kritische Blick wird sehr konkret auf die aktuellen Erscheinungen bezogen und dabei kein Anspruch auf eine restlose Deutung erhoben. Vor diesem Hintergrund ist ›Zeit‹ in erster Linie eine den Schreibakt betreffende Größe; dementsprechend besteht die hier gemeinte ›Historisierung‹ in einem Akt der ›Überarbeitung‹, der aufgrund der eben mit der Zeit aus der Latenz heraustretenden Entwicklungen und der nun wahrnehmbaren (einstigen) blinden Flecke durchgeführt wird. Diese ›Überarbeitung‹ ist also durch ein verbessertes Bewusstsein veranlasst, das es nachträglich erlaubt, die notwendigen Erscheinungen zu erkennen. Das Zusammenspiel von ›Zeit‹ und ›Text‹ spielt auch bei der expliziten Abrechnung mit Menzel, die hauptsächlich in der ›Vorrede. Wolfgang Menzel und dessen deutsche Literatur‹ erfolgt, eine kaum zu überschätzende Rolle. So lassen sich die bei der Auseinandersetzung mit jedem Kapitel seiner Abhandlung
Zeit und Text: Gutzkows Beiträge zur Geschichte der neuesten Literatur (1839)
119
ausführlich dargelegten Mankos und Fehldeutungen anhand folgender Stelle besonders prägnant zusammenfassen: »Menzel schrieb ein Buch für eine Zeit, die sich ihm unter der Hand geändert hat. Er ergeht sich in burschikosen Demonstrationen gegen die Trägheit und Philisterei unsrer Zeit; aber unsre Zeit trägt eine andere Physiognomie, als die Restaurationsperiode.«190
Menzels größter Fehler besteht also darin, die unzähligen Zeichen des Anbruches eines neuen Zeitalters nicht wahrgenommen zu haben und mithin ›hinter der Zeit‹ zurückgeblieben zu sein. Seine »kritische Apodiktik«191, die ausbleibende »Bescheidenheit des Empirikers«192 und die fehlende »feine Speculation«193 scheinen mit Blick auf die Ermittlung der sich ändernden Zeit kontraproduktiv zu sein. Andere Fehlgriffe und falsche Kriterien, die ihn bei seinen Analysen leiten, stilisieren ihn wiederum zum Gegenbild des immer wieder angespielten Ideals des ›Zeitschriftstellers‹. Dazu zählen in erster Linie die mangelnde Objektivität und »die heterogensten Maßstäbe«194, die Menzel auf seine Betrachtung der Literatur anwendet. Da er den jeweiligen Untersuchungsgegenstand nicht aus einer historischen – und mithin objektiven – Perspektive beobachtet, gewinnt die subjektive Abneigung die Oberhand. Diese Perspektive hat laut Gutzkow unvermeidlich die Lückenhaftigkeit der Analysen zur Folge. Statt den Grund für die im europäischen Vergleich verspätete Emanzipierung der deutschen Literatur und Kultur, die damals beinahe zum Topos wurde, in den ›Verhältnissen‹ aufzufinden, macht Menzel einen Einzelnen dafür verantwortlich – und zwar Goethe. Die genaue Untersuchung des historischen Zusammenhangs und die Bestimmung eines Netzes von Mitursachen bleibt bei Menzels Abhandlung völlig aus. In dem Kapitel, in dem er sich mit der ›Schulgelehrsamkeit‹ beschäftigt, wird er ebenfalls von falschen Kriterien geleitet: Statt den Übergang von der Regelpoetik zur Genieästhetik zu rekonstruieren – was sich ja in kultur- und literaturhistorischer Hinsicht als der sachgerechte Ansatz erweisen würde –, lässt er vielmehr der Abneigung gegen seinen ehemaligen Lehrer freien Lauf. Kritisiert an seiner (zu viel) zur Klassifikation tendierenden Methode wird, wie übrigens auch in Ueber Göthe im Wendepunkte zweier Jahrhunderte betont, die Tatsache, dass bei der wissenschaftlichen und historischen Betrachtung der Literatur keine ihr intrinsischen Begriffe (sondern »Tugend, Vaterland und Religion«) zu Leitkriterien erhoben werden: »Das ist es: Tugend, Vaterland und Religion sind organische Begriffe, die niemals ausgehen, die zu vertheidigen immer nur ein halbes Verdienst ist, weil sie Niemand 190 191 192 193 194
Ebd., S. XXI. Ebd., S. IV. Ebd., S. XXII. Ebd., S. XXIII. Ebd., S. VI.
120
Historisierung
erfunden hat. Aber etwas Ganzes, Vollkommnes, Nichtüberliefertes, sondern Ureignes ist das Talent, ist die Schönheit, ist das Streben nach der Wahrheit, ist das Kämpfen und Ringen nach einem hohen, die Nation und die Welt befördernden Ziele, ist Alles Dasjenige, was Menzel mit Füßen getreten hat, ohne es tödten zu können.«195
Menzel hat also für Begriffe und Werte gekämpft, welche nicht nur mit Literatur wenig zu tun haben, sondern als apriori gegebene Größen von den wandelbaren Zeitverhältnissen auch nicht wirklich gefährdet sind. Die Aufsätze der Sammlung lassen sich sämtlich im Rahmen der (dann nicht immer explizit erwähnten) Polemik mit Menzel situieren. Mit der Vorrede werden also die allen Beiträgen gemeinsamen Rahmenbedingungen bekannt gegeben. Gutzkows (publizistische) Poetik lässt sich mithin in Abhebung von Menzel definieren. In der Vorrede wird auch darauf hingewiesen, dass bei der Überarbeitung neue Lesehaltungen, bei denen das Zusammenspiel von ›Zeit‹ und ›Text‹ wiederum eine Rolle spielt, berücksichtigt wurden: »Obschon ich seit sechs Jahren kaum eine hervorspringende Erscheinung der deutschen Literatur übersehen und ohne gedrucktes Urtheil gelassen habe, so sprechen diese kritischen Beiträge doch keine Vollständigkeit an. Sie sollen Ergänzungen zu Dem sein, was der Leser seit seiner Antheilnahme an der Literatur sich im Gedächtnisse aufgespeichert hat, oder für Diejenigen, welche so eben erst im Begriff sind, Zeit zurückzulegen, und sich ein kleines Capital Vergangenheit zu sparen, Anregungen und Belehrungen.«196
Gutzkow betont, wie der in der Publizistik tätige Schriftsteller oder die Schriftstellerin die gegenwärtigen Erscheinungen wahrnimmt, ohne dabei Vollständigkeit zu beanspruchen. Nicht beträchtlich anders als die im nächsten Kapitel behandelte, ebenfalls von Gutzkow stammende Sammlung Die Zeitgenossen, erfüllen die Beiträge eine Archivfunktion, die sich nur vor dem Hintergrund eines ›aktiveren‹ Rezeptionsverhaltens nachvollziehen lässt. Damit konsequent sind Ton und Perspektive der Beiträge trotz der aufsatzübergreifenden gegenMenzel’schen Ausrichtung von einer gewissen ›Endgültigkeit‹ bzw. Unwiderruflichkeit weit entfernt. Anders als bei Vergangenheit und Gegenwart (1830– 1838) ist also die Perspektive dieser Sammlung noch offen: Die aufmerksame Beobachtung überwiegt die restlose Deutung. Ihrem journalistischen Ursprung entsprechend beschäftigen sich die Beiträge mit dem ›Neuen‹. Dabei sticht in den einzelnen Aufsätzen die Nüchternheit einer Perspektive hervor, die sich von den sonst in der öffentlichen Debatte stets heraufbeschworenen Verfallsszenarien deutlich abhebt. Die Aufmerksamkeit für neue Praktiken der Produktion, Rezeption und Distribution wird schon im ersten Band sichtbar, in dem auch Phänomene wie etwa »Literarische Industrie« 195 Ebd., S. LXXXI. 196 Ebd., S. IV.
Zeit und Text: Gutzkows Beiträge zur Geschichte der neuesten Literatur (1839)
121
und »Kritik« untersucht werden. Im Aufsatz »Literarische Industrie« bilden also die vielen Änderungen und Schwankungen, welchen der Buchhandel unterworfen wurde, aus Gutzkows Sicht nicht nur einen kennzeichnenden Bestandteil des aktuellen literarischen Lebens, sondern eine geradezu zu ergreifende Gelegenheit. Das Auftreten neuer Akteure – wie etwa der Journalistik – bewege den Buchhandel zu neuen Strategien und ermögliche das Entstehen neuer Praktiken im Rahmen des Verlagswesens: »Die Journalistik hat den alten Buchhandel zu Grund gerichtet; denn die Journale veranlaßten die Lesezirkel und die Lesezirkel absorbirten die Kauflust der Privatleute. So wurden denn zwei Dinge notwendig: neue Käufer zu gewinnen und die Waare selbst von Außen in eine andere Gestalt zu bringen.«197
Um den Vergleich mit der Konkurrenz (sprich: der Journalistik) überhaupt bestehen zu können, entsteht also die »Heftweise- und die Pfennigs-Literatur«198: Es handelt sich dabei um Formate, die sich sowohl dem Erscheinungstakt der Journale als auch dem neuen Leseverhalten anpassen. Sie sind somit in der Lage, »eine ganz neue Klasse von Käufern und Interessenten«199 zu gewinnen. Diese Formate fördern außerdem bei den Buchhändlern einen neuen Habitus (»Auch erfordert die Art, wie die Heftliteratur verbreitet werden muß, eine besondere Betriebsamkeit des Buchhändlers […]. Die alten Firmen verbitten sich Zusendungen dieser Art; sie wollen vor Niemanden den Hut abnehmen«200). Einen weiteren bedeutsamen Aspekt bildet bei dieser Auseinandersetzung die Frage nach dem Risiko, welches die Qualität der Literatur aufgrund dieser neuen Formate eventuell eingeht. Gutzkow betrachtet es als vorteilhaft, gewisse Inhalte in einer popularisierten Form zu verbreiten, und formuliert in diesem Zusammenhang konkrete Vorschläge und Prognosen. Als konstruktiv erweist sich Gutzkows Blick auch im Beitrag zur ›Kritik‹, in dem er die große Rolle rekonstruiert, welche sie im Rahmen der neueren »literarischen Revolution«201 hatte. Dann stellt er aber fest, wie die Kritik, u. a. mit Menzel, das Feld der Literatur im engeren Sinne vollständig zu besetzen droht. In diesem Zusammenhang verweist er erneut auf alternative Formen von Kritik. Im zweiten Band wird die Perspektive in erster Linie in thematischer Hinsicht erweitert, weil nun der Stand zahlreicher Wissensformationen untersucht wird. Dabei fällt insbesondere auf, dass sich der Blick von der Ebene der Tagesdebatte emanzipiert und den bei den jeweiligen Disziplinen erfolgten Paradigmenwechsel zu erfassen versucht. Am interessantesten sind in dieser Hinsicht die 197 198 199 200 201
Ebd., S. 2. Ebd., S. 6. Ebd., S. 16. Ebd., S. 6. Ebd., S. 26.
122
Historisierung
Passagen, in denen die ›Geschichte‹ weder als »Zusammenstellung von Begebenheiten«202 noch als »Regierungsgeschichte«203, sondern als »Spiegelbild des Lebens«204 selbst bezeichnet wird. Im Beitrag ›Geschichte der Literatur und Kunst‹ werden einige zeitgenössisch publizierte Literaturgeschichten miteinander verglichen und dabei mit Beifall festgestellt, dass man sich fast vollständig von einer Rhetorik der Erfindung205 verabschiedet hat. Wie übrigens auch in der Geschichte wechselt man immer deutlicher von einer bloß registrierenden Forschungspraxis hin zur Tendenz, die Untersuchungsgegenstände miteinander zu verbinden.
2.9
Theodor Echtermeyers und Arnold Ruges Der Protestantismus und die Romantik. Zur Verständigung über die Zeit und ihre Gegensätze. Ein Manifest (1839)
Mit diesem Manifest, das sich ohne Zögern dem Verfahren der ›Historisierung‹ zuordnen lässt, entwerfen Echtermeyer und Ruge eine Geschichtsphilosophie, die als Großerklärungsmodell schlechthin ›Vergangenheit‹, ›Gegenwart‹ und ›Zukunft‹ in ihren Deutungsvorschlag mit einbettet. Wie es vielen geschichtsphilosophischen Modellen eigen ist, zeichnen sich Kultur- und Literaturgeschichte bei den zwei Junghegelianern durch den Antagonismus zweier Prinzipien206 – ›Protestantismus‹ und ›Romantik‹ – aus. Da deren Entwicklung sich noch nicht vollzogen hat, hat dieser Text, wie übrigens die Bezeichnung ›Manifest‹ andeutet, den (politischen) Anspruch, eine Zeitdiagnose zu liefern und dadurch auf die Gegenwart zu wirken. Dem teleologisch-fortschreitenden Geschichtskonzept gemäß führt natürlich nur eines dieser Prinzipien – in diesem Fall der ›Protestantismus‹ – zur vollen ›Freiheit‹. Sowohl dieser Umstand als auch das genaue Verhältnis zwischen den beiden Prinzipien werden in den programmatischen Passagen aus dem Abschnitt ›Die Aufgabe‹ verdeutlicht: »Wir haben das Princip der Reformation als das unsrige ausgesprochen […]. Der reformatorische Proceß der Selbstbefreiung ist schon an und für sich eine Kritik des trüben Mediums, durch welches der Geist hindurchgeht, um zu immer höheren Formen zu gelangen. Dieses trübe Mittel haben wir besonders an einer Phase des deutschen Geisteslebens, deren Totalität wir mit dem Namen Romantik bezeichnen, darzustellen uns vorgesetzt, weil das, woran der Protestantismus noch leidet, […], der noch nicht völlig überwundene Dualismus des Bewußtseins ist, in der Sphäre aber […] der Ro202 203 204 205 206
Ebd., Bd. 2, S. 137. Ebd., S. 138. Ebd., S. 137. Vgl. dazu ebd., S. 179. Vgl. dazu Marquard 1973, S. 14–19.
Echtermeyers und Ruges Der Protestantismus und die Romantik (1839)
123
mantik […] dieser Dualismus […] zwischen Natur und Geist, Subjekt und Objekt, Sein und Denken, am schroffsten hervortritt und dadurch […] den Punkt bezeichnet, von dem aus die schwebenden Probleme der Zeit zu lösen und der Zwiespalt und die Gegensätze unserer inneren und äußeren Zustände zu versöhnen sind.«207
Dieser Darstellung nach erweist sich die ›Romantik‹ nicht nur als das notwendige Durchgangsstadium, das der Geist erleben muss, um sich dann weiter zu steigern; aus gegenwartsbezogener Perspektive bildet sie vielmehr die Gesamtheit der problematischen Aspekte, die eine Überwindung des Dualismus immer noch unmöglich machen. Deswegen muss also von diesem Prinzip ausgegangen werden. Die eben zitierte Stelle lässt darüber hinaus ahnen, dass ›Protestantismus‹ und ›Romantik‹ in diesem Text auf etwas mehr hinweisen als auf die wohlbekannten historischen Erscheinungen. Damit ist einer der Aspekte genannt, die mit dem ›Manifest-Charakter‹ verbunden sind und die Zuordnung zum Historisierungsverfahren weiter begründen lassen: Es handelt sich dabei 1. um die semantische Ausweitung sowie die Ideologisierung, die ›Protestantismus‹ und ›Romantik‹, als Partei- bzw. Kampfbegriffe eingesetzt, erfahren. Wie in Bezug auf die Zeitsemantik208 bereits festgestellt worden ist, bekommen viele Begriffe im Vormärz im Zuge einer generellen Ideologisierung der öffentlichen Debatte neue Konnotationen. Aufgrund der Emphase, mit der solche Begriffe verwendet werden, und der emotionalen Wirkung, die sie ausüben, werden sie zu ›Schlagworten‹. Der Prozess der semantischen Ausweitung ist im Falle von ›Protestantismus‹ und ›Romantik‹ von besonderem Interesse, weil diese Begriffe im Unterschied zur Zeitsemantik, die für Abstraktionen und Metaphorisierungen gewissermaßen prädisponiert ist, hingegen genau umschreibbare (kultur-und literatur-)historische Erscheinungen bezeichnen. Von diesen wird nämlich abstrahiert, um Prinzipien und Haltungen zu bezeichnen, die in der (Denk-)Geschichte schon längst gegeben haben. ›Protestantismus‹ und ›Romantik‹ werden also zu Prinzipien, dank derer sich ganze Epochen deuten und erfassen lassen. Mit diesem Aspekt hängt 2. die von den Autoren ausgewählte Form der historischen Darstellung zusammen: Dadurch kann die Genealogie beider Prinzipien, insbesondere der ›Romantik‹, rekonstruiert werden. Diese Form der Darlegung verweist außerdem auf die hier kaum zu quantifizierende Wirkung Hegels, der die ›Geschichte‹ als die Dimension betrachtet, in der der Werdegang des Geistes und die Vernunft sich entfalten. Dadurch gelangt Hegel zu jener bekanntlich glücklichen Verbindung von historischer Rekonstruktion und Einführung der 207 Echtermeyer/Ruge 1972 [1839], S. 1b–2a. 208 Vgl. dazu Wülfing 1982. Mit Blick auf die negativen und positiven Konnotationen, die im Rahmen des progressiven Lagers mit ›Vergangenheit‹ auf der einen Seite und ›Gegenwart‹ und ›Zukunft‹ auf der anderen jeweils assoziiert werden, lässt sich der Begriff ›Romantik‹ der negativ besetzten Dimension der ›Vergangenheit‹, ›Protestantismus‹ hingegen der positiven Dimension von ›Gegenwart‹ und ›Zukunft‹ zuordnen.
124
Historisierung
für sein System relevanten Kategorien. Die historische Darlegung oder Methode wird zudem hier als diejenige bezeichnet, die ›sittlich‹ ist und sich einem subjektiven und mithin unwissenschaftlichen Zugriff entgegenstellt. Die angedeutete Wirkung Hegels macht zudem auf das im engeren Sinne philosophische Substrat der hier verwendeten Leitbegriffe aufmerksam. Kann ›Romantik‹ aufgrund der oben erwähnten semantischen Ausweitung eine jeweils »antiaufklärerisch[e], mittelalterlich[e], […], unfrei[e], irrational[e], subjektivistisch[e], […], reaktionär[e]«209 Haltung bezeichnen, so darf nicht übersehen werden, dass eine genuin philosophische Frage hier im Mittelpunkt steht. Diese Frage lässt sich vielleicht mittels Ruges und Echtermeyers Definition von ›Romantik‹ besser darlegen: »Diesen ganzen Kreis der fixen Idee, des unfrei gewordenen Freiheitsprinzips der Reformation, den Kreis, der die Idee, wie es ihm gemüthlich ist in der Willkür des Subjekts, theils als Gemüths-, theils als Reflexionsbewegung fixirt, und ihren objectiven, sowohl historischen, als wissenschaftlich methodischen und künstlerisch gesetzlichen Proceß nicht respectirt, – diesen ganzen Kreis also haben wir […] die Romantik genannt.«210
Unmittelbar vor dieser Stelle, also ebenfalls im Abschnitt ›Die Romantik in ihrem Begriff‹, steht, dass die ›Romantik‹ vom mit der Geschichte fortschreitenden Prinzip der ›Reformation‹ aufgenommen worden sei und nun die ›Gegenwart‹ präge und sie verhängnisvoll dominieren könne. Nach der hier gelieferten Definition stellt sich also die ›Romantik‹ dem geschichtlichen Prozess entgegen; sie verweist auf eine Art ›selbstreferentieller Fixierung‹, die eine dialektische Entwicklung verunmöglicht. Diese Stelle spielt also auf die seit Kant zentrale, philosophische Frage nach der ›Vermittlung‹ von ›Denken‹ und ›Sein‹, ›Subjekt‹ und ›Objekt‹ an, auf die u. a. Hegel eine Antwort zu geben versucht, nachdem eben Kant aufgrund der a priori gegebenen Kategorien die Unmöglichkeit postuliert hat, den ›wahren‹ Grund der Dinge zu erfahren. Demgegenüber postuliert Hegel, dass diese Vermittlung in und mit der Zeit – also eben prozessual – stattfinden kann und legt mit seinen Abhandlungen die Phasen dieser Vermittlung dar. Echtermeyers und Ruges Geschichtsphilosophie stellt nun eine – durchaus vereinfachte und auf ein spezifischeres Gebiet beschränkte – Variation Hegelscher Antwort auf die Vermittlungsfrage dar. Der ›Protestantismus‹, als in der Geschichte vorhandenes Prinzip der ›Reformation‹, ermöglicht die Vermittlung, weil er sich von der eigenen Beschränktheit emanzipieren kann; in diesem Sinne kann er auf die historischen Erscheinungen positiv wirken; die ›Romantik‹ bleibt
209 Norbert Oellers, Vorwort. In: ders. (Hg.), Der Protestantismus und die Romantik. Zur Verständigung über die Zeit und ihre Gegensätze. Ein Manifest, Hildesheim 1972 [1839], S. V. 210 Ebd., S. 2b.
Echtermeyers und Ruges Der Protestantismus und die Romantik (1839)
125
hingegen in der Selbstreferentialität befangen und blockiert die dialektischhistorische Entwicklung. Das im zweiten Jahrgang der ›Hallischen Jahrbücher‹ veröffentlichte und in vier Artikeln unterteilte Manifest enthält also die Genealogie der ›Romantik‹ und beschreibt die beschränkte Dynamik dieses Prinzips. Insbesondere entsprechen die vier Artikel ebenso vielen Phasen der Entwicklung, die sich folgendermaßen bezeichnen lassen: 1. Entstehung (›Die Progonen der Romantik‹), 2. Vorbereitung, 3. volle (u. a. begriffliche) Entfaltung und Etablierung (›Die eigentliche Romantik‹), 4. Popularisierung und Epigonentum (›Die Tradition des Salons und die Aristokratie der Geistreichen‹). Zeitlicher Ausgangspunkt für die Entstehung der ›Romantik‹ bildet die Frühaufklärung, in der sich ›Die Progonen der Romantik‹ erkennen lassen: Bei Jacobi, der Fürstin Gallizin, Jung Stilling, den Stürmern und Drängern sowie der Empfindsamkeit und schließlich der für die Zeit typischen Naturschwärmerei treten eine Tendenz zu Selbstbespiegelung und eine Einseitigkeit hervor, die dem hier geltend gemachten formalen Verständnis der ›Romantik‹ entsprechen. Im zweiten Artikel werden weitere Erscheinungen erfasst, die die Entstehung der ›eigentlichen‹ Romantik vorbereiten. Insbesondere in diesem Abschnitt kommt also die Steigerungslogik zum Vorschein, die für die Junghegelianer der Geschichte überhaupt und demzufolge auch dieser Genealogie zugrunde liegt. Goethe und Schiller werden demnach nur »als Durchgangspunkt« und als vorübergehende »Versöhnung«211 des Dualismus in Betracht gezogen; sie sind jeweils für die Seite der ›Bildung‹ und diejenige der ›Natur‹ wichtig, jeder bleibt aber »in der Subjektivität stehen«212. Im Bereich des Denkens tragen hauptsächlich Fichte und Schelling zur Herausbildung einer ›romantischen‹ Philosophie bei. Mit Fichte wird »die subjective Lebendigkeit des Individuums bei Jacobi nun in die Kant’sche Objectivität des Denkens aufgenommen«213. Wie dies bei den anderen Erscheinungen dieser Phase der Fall ist, wird aber »der Dualismus [nur] scheinbar aufgehoben«, weil »die abstracte Unendlichkeit und die schlechte Endlichkeit immer neben einander bestehen und sich nicht durchdringen […] können«214. Schelling hat ebenfalls ›Natur‹ und ›Geist‹ bedient, »ohne [aber] den Proceß, welchen beide machen und darstellen, als den Proceß der denkenden Vernunft aufzeigen und ohne ihm also mit der Vernunft nachgehn zu können«215. Aus der Verbindung beider Subjektivitäten, »ohne wahre Vermittlung und innere Durchdringung«216, ergibt sich, so Echtermeyer und Ruge, die ›Romantik‹. Im dritten Artikel wird dann ausführlich auf 211 212 213 214 215 216
Ebd., S. 21a. Ebd., S. 23b. Ebd., S. 29b. Ebd., S, 30a. Ebd., S. 40b. Ebd., S. 41a.
126
Historisierung
die »eigentliche Romantik« eingegangen, die im Rahmen des von den Autoren rekonstruierten »historische[n] Verlauf[s]« dieses Prinzips dem Übertritt desselben »in die ganze objective Welt […] [,] in die – Anschauung der Phantasie und in die kalte Reflexion«217 – immer noch ohne Vermittlung und Durchdringung – entspricht. Für die hier behandelte Frage nach der Historisierung der ›Gegenwart‹ ist allerdings der vierte Artikel des Manifests am relevantesten, weil in diesem die nicht immer offensichtliche, ja unvermutete Weiterwirkung der ›Romantik‹ auf die ›Gegenwart‹ zum Vorschein gebracht wird und, vor allem, die ›nächste Stufe‹, also ihre Popularisierung und Einführung in das ›Leben‹, in den Mittelpunkt rückt218. In den Abschnitten dieses Artikels treten die Aspekte am deutlichsten hervor, durch die sich die ›Romantik‹ vom Prinzip des ›Protestantismus‹ – und damit einer (positiv besetzten) ›historischen‹ Auffassung – radikal unterscheidet. Die in der Öffentlichkeit von der »Aristokratie der Geistreichen«219 propagierte ›Romantik‹ lässt ihr antidialektisches und antiprozessuales Denken vor allem im Zusammenhang der Rezeption einiger Klassiker sichtbar werden. So wird Goethe im Rahmen des für die ›Romantik‹ typischen Geniekultus sehr emphatisch als »Ausgang«220 bezeichnet; eine ähnliche Verabsolutierung erfährt Shakespeare. Die ›Romantik‹ kann und will den Geist der Geschichte nicht erkennen, dem stellt sie vielmehr »Spuckgestalten«221 entgegen. Die tatsächlichen, »unfreien Ausflüsse dieses Princips […] in die Geschichte der neuesten Zeit«222 werden am Beispiel von Friedrich von Gentz, dem »praktische[n] Romantiker«223 schlechthin, dargelegt. In den letzten Abschnitten des Manifests kommen sehr deutlich der in erster Linie politische Charakter dieses Textes sowie die auf Wirkung bedachte und als Prognose fungierende Historisierung zum Vorschein. Insbesondere verdeutlicht den prognostisch-warnenden Charakter des Manifestes das Fazit: »Die Abklärung dieser Gährung ist die Manifestation unseres Zeitgeistes, der Begriff und Ausdruck dieses Processes aber das Manifest des Protestantismus gegen die Romantik.«224
Nicht nur werden die konkreten Folgen einer Durchsetzung der Romantik im Hinblick auf Innen- und Außenpolitik genannt, sondern in erster Linie – sich auf die erarbeitete Genealogie stützende – eine Regelmäßigkeit ausgemacht, die die 217 218 219 220 221 222 223 224
Ebd., S. 42a. Vgl. dazu ebd. S. 65a–b. Ibidem. Ebd., S. 66b. Ebd., S. 72b. Ebd., S. 76b. Ebd., S. 78a. Ebd., S. 82b.
Echtermeyers und Ruges Der Protestantismus und die Romantik (1839)
127
Prognose ermöglicht und erlaubt, selbst im Jungen Deutschland (»[den] französierenden Romantiker[n]«225) einen Ausfluss der ›Romantik‹ zu erkennen.
225 Ebd., S. 82a.
Kapitel 3: Bildgebung
Im Artikel ›Oeffentliche Charaktere‹, der 1848 in der Zeitschrift ›Die Grenzboten. Zeitschrift für Politik und Literatur‹ (1841–1922) erschien, wird eine besondere Strategie zur Epochendarstellung plausibilisiert: »Uebersichten über gewisse Entwickelungsperioden der Zeit knüpfen sich am bequemsten an Personen an. In der Persönlichkeit ist ein Bleibendes, während die Ereignisse vergehen. Wir beabsichtigen, eine Reihe von Bildern aufzustellen: Männer, in denen der Geist der Zeit Fleisch geworden ist [Hervorhebung durch die Verf.]. Wir wollen weder anklagen noch preisen; sie sind uns eine bestimmende Berechnung des Lichtes, das nur in der Mannigfaltigkeit der Farben zur Erscheinung kommt.«1
Diese programmatische Stelle, die den Charakteristiken dreier »Anführer[] der demokratischen Partei«2 (Robert Blum, Arnold Ruge, Johann Jacobi) vorangestellt wird, liefert zugleich eine Art poetologischer Begründung für die in dieser Zeit besonders oft praktizierte Form der Charakteristik oder des biographischen Porträts. Vor dem Hintergrund eines Verhältnisses der Widerspiegelung von ›Zeit‹ und ›Menschen‹ kann gerade durch das Individuum das Abstrakte (die Zeit, der Geist), das – dieser Vorstellung nach – vor dem Text besteht, konkret werden. Zur poetologischen Stellungnahme gehört zudem die Tatsache, dass der Moment der Wertung ausbleibt (»Wir wollen weder anklagen noch preisen«): Die »Reihe von Bildern« sollte vielmehr der Vielfalt der Zeittendenzen gerecht werden und mithin auf den Bedarf nach einer erschöpfenden Darstellung reagieren. Der im anonym veröffentlichten Zeitschriftenartikel enthaltene poetologische Standpunkt stellt im Vormärz keine isolierte Position dar. Im ebenfalls 1848 erschienenen Text Unsere Zeitgenossen. An den Herausgeber einer vor den neu-
1 Gustav Freitag, Julian Schmidt (Hg.), ›Oeffentliche Charaktere‹. In: Die Grenzboten. Zeitschrift für Politik und Literatur, Jahrgang 7, II Semester, III Band, Leipzig 1848, S. 366. Es handelt sich dabei um den ersten Band, der nicht mehr von Ignaz Kuranda, sondern von Freitag und Schmidt herausgegeben wurde. An der Zeitschrift hatten inzwischen Schriftsteller wie etwa Gutzkow, Heine, Kühne, Laube, Prutz und Willkomm mitgewirkt. 2 Ibidem.
130
Bildgebung
esten Umwälzungen erschienenen Bildnisgalerie damaliger Berühmtheiten betont Karl Gutzkow die in gewissen Epochen im Hinblick auf eine vollständige Zeitdarstellung metonymische Funktion des biographischen Porträts: »Das ist wol die Aufgabe, durch ihre hervorragenden Charaktere die Zeit selbst zu schildern! Der Wassertropfen soll und kann den ganzen Himmel spiegeln. Die Zeitgenossen sind die Träger der Periode, ihre Schlußsteine sind die Zeit selbst. Dem Versuch, den man in unserer Zeit gemacht hat, die Weltgeschichte in Biographien zu schildern, liegt die richtige Ueberzeugung von jenem Zusammenhang zum Grunde, der aus dem Leben der Zeitgenossen die Zeit selbst erkennen läßt. […]. Man schildere die Menschen und man wird ihre Epoche geschildert haben.«3
In diesem zugleich als Rezension und Paratext einer Sammlung repräsentativer Zeitgenossen konzipierten Text erhebt Gutzkow das Verhältnis zwischen dem Einzelnen und der Geschichte zum leitenden Maßstab für die Bestimmung unterschiedlicher Epochen. So sind die Individuen in Zeiten, in denen, in Gutzkows Worten, der »Volksgeist« oder der »Geist der Masse«4 besonders stark und entwickelt ist, ›Emanationen‹ desselben; das Sichtbare wird – einer Vorstellung des metaphysischen Denkens gemäß – von einer unsichtbaren und immateriellen Instanz gesteuert. Es ist also ein Zeichen einer anderswo gelagerten Größe. Über den konkreten Zusammenhang und die Art des Verhältnisses von ›Zeit‹ und ›Menschen‹ hinaus verweisen beide Zitate zudem auf eine präzise Leistung dieser (Lebens-)Bilder: Sie lassen die ›Zeit‹ oder den ›Zeitgeist‹, also das, was immateriell und unsichtbar ist, sichtbar werden. In diesem Sinne lässt sich ihre Leistung als eine Form der ›Bildgebung‹ bezeichnen. Diesen Begriff verwendet Rüdiger Campe, um eine, im Unterschied zur semantisch-kognitiven, weniger bekannte Leistung rhetorischer Figuration zu definieren5. Während beispielsweise die Figur der Metapher, streng genommen, die kognitiv-semantische Funktion hat, einen »Begriff«, »einen Text oder eine diskursive Sequenz«6 durch Unbegrifflichkeit bzw. Bildlichkeit zu ersetzen (Verbildlichung) und mithin den entsprechenden Sachverhalt anders zu vermitteln, erbringt die Figur der Hypotypose oder des Vor-Augen-Stellens eine auf medialer Ebene noch radikalere Leistung der Konkretion (Bildgebung). Sie erzeugt Bildlichkeit, wo es keine gab, und macht demnach etwas sichtbar, das sonst nicht in diesem Sinne ›vorhanden‹ war. Die Operation der ›Bildgebung‹ bringt nämlich in medialer Hinsicht einen 3 Karl Gutzkow, Unsere Zeitgenossen. An den Herausgeber einer vor den neuesten Umwälzungen erschienenen Bildnisgalerie damaliger Berühmtheiten. In: ders., Vor- und Nachmärzliches, Leipzig 1850, S. 200. 4 Ibidem. 5 Vgl. dazu Rüdiger Campe, Aktualität des Bildes. Die Zeit rhetorischer Figuration. In: Gottfried Boehm/Gabriele Brandstetter/Achatz von Müller (Hg.), Figur und Figuration. Studien zu Wahrnehmung und Wissen, München 2007, S. 163–182, hier: S. 164–165. 6 Ebd., S. 164.
Bildgebung
131
Prozess der Verräumlichung und einen Wechsel von einer sequentiellen hin zu einer simultanen Ordnung mit sich – ihre Funktionsweise entspricht also dem, was von einer modernen Theorie des Bildes7 postuliert wird. Von Aristoteles’ Rhetorik ausgehend untersucht dann Campe die unterschiedliche Zeitlichkeit bei diesen Formen rhetorischer Figuration, ohne dabei deren Verbindung zueinander zu übersehen. Campes Überlegungen spielen in diesem Zusammenhang insofern eine Rolle, als sie im Vorfeld der Bestimmung dieses Verfahrens gewisserrmaßen inspirierend waren. Damit ist allerdings kein assoziativer oder durch Ähnlichkeiten angeregter Bezug gemeint; auf relevante Akzentverschiebungen sowie auf durch Untersuchungsgenstand und Fragestellung bedingte Anpassungen muss hingewiesen werden. Vor dem Hintergrund des im Vormärz ubiquitären Anspruchs auf ›Zeitdiagnose‹ bildet in dieser Studie das bereits dargelegte Verfahren der ›Historisierung‹ die Alternative zu demjenigen der ›Bildgebung‹. Bei diesen Verfahren rückt zudem der jeweilige Zeitbezug in den Vordergrund, welcher wiederum mit Blick auf die Frage nach der ›Latenz‹ näher zu definieren ist. Unter den Anpassungen, die hier vorgenommen werden, muss darauf hingewiesen werden, dass auch im Falle der ›Bildgebung‹ Schreibweisen – also keine auf Mikroebene vorhandenen rhetorischen Figuren – untersucht werden. Bei einer Darlegung der kennzeichnenden Aspekte des Verfahrens der ›Bildgebung‹ muss zunächst einmal der im Vergleich zum Verfahren der ›Historisierung‹ unterschiedliche wissensgeschichtliche Zusammenhang berücksichtigt werden. Die in den Zitaten evozierten »lebensgeschichtliche[n] Darstellungen« stehen in Verbindung mit den als ›anthropologisch‹ bezeichneten Wissensformationen und entwickeln sich »in Konkurrenz zu historiographischen und geschichtsphilosophischen Tendenzen«. Bei diesen lässt sich hingegen eine »Abwendung vom Einzelmenschen zugunsten überindividueller Konstellationen und Gesetzmäßigkeiten«8 beobachten. Das Verhältnis der beiden Verfahren zueinander lässt sich demnach als eines der Konkurrenz und der Opposition beschreiben. Man könnte auch behaupten, an Ingrid Oesterle anschließend9, dass diese die Produktion dieses Zeitraums kennzeichnenden Verfahren Ausdruck einer systemtheoretisch konzipierten Doppelbewegung sind: Einerseits führt die Erfahrung des ›Neuen‹ und der gesteigerten Kontingenz bei der Darstellung zu einer entsprechenden Pluralisierung mittels der Lebensbilder; andererseits ent7 Ibidem. 8 Christian von Zimmermann, Biographische Anthropologie. Menschenbilder in lebensgeschichtlicher Darstellung (1830–1940), Berlin/New York 2006, S. 8. 9 In Bezug auf den ersten Verzeitlichungsschub (1795–1800) untersucht Ingrid Oesterle die Wechselbeziehungen zwischen neuen Zeiterfahrungen und literarischen Formen; in diesem Zusammenhang macht sie auf eine ähnliche Doppelbewegung aufmerksam. Vgl. dazu Oesterle I. 2002, S. 91–121, hier: S. 95.
132
Bildgebung
springt gerade diesen Erfahrungen die Bestimmung einer Tendenz in der Geschichte und die Historisierung der Gegenwart. Die wichtigsten Unterschiede ergeben sich allerdings nicht ausschließlich aus der Form der Zeitdarstellung, sondern hängen – so die These – vor allem mit dem bereits angedeuteten Zeitbezug und der damit einhergehenden ›Stärke des Gesamtkonzepts‹ zusammen. Obwohl die Konjunktur der Charakteristik oder des Lebensbildes für Verschiebungen im Bereich des Wissens symptomatisch ist, stellen diese Formen an sich kein prinzipiell entscheidendes Kriterium für die Zuordnung zum Verfahren der ›Historisierung‹ oder der ›Bildgebung‹ dar. Unter den Texten, die im vorigen Kapitel analysiert und unter dem Verfahren der ›Historisierung‹ subsumiert worden sind, sind nämlich auch Sammlungen vorhanden, die aus solchen Charakteristiken bestehen. Für deren Klassifizierung war vielmehr die Tatsache entscheidend, dass dort die Charakteristiken im Dienste eines Gesamtkonzepts stehen, bei dem nicht nur die Diagnose der ›Gegenwart‹, sondern auch ihre Historisierung infolge eines markierten Zukunftsbezugs eine große Rolle spielt. So herrscht beispielsweise bei Prutz’ Sammlung die Prozessualität der Denkform ›Geschichte‹ vor und stiftet bei den einzelnen Porträts Sinn. Wie im ersten Kapitel dargelegt wurde, setzt die Erkennung einer ›Tendenz‹ in der Geschichte die Entzifferung der Latenzinstanzen voraus. In den Texten, die in diesem Kapitel untersucht werden, stellen die Charakteristiken oder Porträts hingegen, trotz ihrer effektiven Zeitdarstellung und impliziten -diagnose, eine bewusste Alternative zu den erschöpfenden geschichtsphilosophischen Narrationen dar. Den in der Bezeichnung ›Bildgebung‹ enthaltenen Bezug auf Verfahren der bildenden Künste ernstnehmend stammen die Porträts aus einem Hintergrund, der eben dadurch nur teilweise Konkretion gewinnt und sonst also ›im Schatten‹ bleibt. Das Verfahren der ›Bildgebung‹ hat also insofern mit dem Problem der ›Latenz‹ zu tun, als die vor dem Text und über den Text hinaus bestehenden Verhältnisse mittels der Porträts aus dem Zustand der Verborgenheit heraustreten. Wie vor allem in Bezug auf Gutzkows Die Zeitgenossen zu zeigen sein wird, erheben diese Porträts mit Blick auf den Zeitbezug allerdings ›lediglich‹ den Anspruch, im aristotelischen Sinne – d. h. durch Selektion und demnach performativ – actualitas darzustellen10. Demzufolge verzichten sie ausdrücklich auf Prognosen und mithin auf eine Entzifferung der zeitlichen Latenz. In dieser Beziehung ist Gutzkows bereits oben zitierte Rezension erneut relevant: »Seiner Natur nach ist ein Werk dieser Art [eine Galerie der Zeitgenossen] recht eigentlich periodisch. Seiner Natur nach hat es keinen Anfang, kein Ende. Es ist ein verdichteter Auszug aus der laufenden Geschichte, die Vorarbeit zu einem abgeschlossenen Ganzen, 10 »Die bildgebende Figuration des Vor-Augen-Stellens ist die Figuration der gegenwärtigenden Wirklichkeit, der actualitas anstelle der potentialitas«, Campe 2007, S. 168.
Bildgebung
133
wie es erst die Folgezeit liefern kann. Alle die Biographien, alle diese Lebensumrisse, welche in diesem Unternehmen aneinandergereiht werden [Hervorhebung durch die Verf.], können bei aller Gewissenhaftigkeit […] doch immer nur eine bedingte Wahrheit ansprechen. […]. Ein Endurtheil über die hier angeführten Charaktere wolle man nie erwarten. Diese Charaktere leben mit uns, unter uns. Ihr eigenes Leben liegt noch unabgeschlossen da, das Buch ihrer Geschichte hat noch hunderte von leeren Blättern. […]. Wer gibt sich dem Jahrhundert so, wie er ist? Und selbst der Ehrlichste, wer ist fertig, wer steht auf der Höhe jenes Ziels, auf der Höhe jenes Ideals, nach welchem wir ihn jetzt mit allen seinen Kräften ringen sehen?«11
Eine so konzipierte Galerie von Zeitgenossen kann also den Blick nur auf die ›Gegenwart‹ richten und viele Fragen offen lassen. Auf geschichtsphilosophische Narrative anspielend stellt die das Zitat abschließende Überlegung zudem fest, dass keiner oder keine der Zeitgenossen, weil in der Zeit ›verwoben‹, das »Ziel« selbst ›sehen‹ kann. In Bezug auf Heinrich Laubes Moderne Charakteristiken, die zweite in diesem Kapitel analysierte Sammlung, spielt bei den Porträts insbesondere der Aspekt der ›Unbegrifflichkeit‹ eine große Rolle. Sämtliche Porträts tragen nämlich zur Verdeutlichung des Begriffs oder des Konzepts des ›Modernen‹ bei, ohne zu einer Definition im engeren Sinne zu führen; geliefert werden vielmehr Beispiele, die aufgrund derer Vielfalt die Komplexität des Phänomens vermitteln. Als Modalität der Darstellung und der Vermittlung löst also die Charakteristik die Begriffe oder gleichermaßen von den Erscheinungen abstrahierende Formulierungen ab. Die Abwendung von der Abstraktionsleistung der ›Begriffe‹ und der Umstand, dass die ›Stärke des Gesamtkonzepts‹ beim Verfahren der ›Bildgebung‹ in den Hintergrund tritt, haben eine in epistemologischer und wissensgeschichtlicher Hinsicht nicht unbedeutende Aufwertung der Empirie zur Folge. Jede Erscheinung ist in diesem Sinne per se bedeutungstragend und kann zum Zweck der Zeitdiagnose nicht relativiert werden. Mit Blick auf die epistemologische Aufwertung der Empirie lässt sie beispielsweise bei der von Gutzkow in Die Zeitgenossen erarbeiteten Galerie von sozialen Typen die – anderswo12 nicht in Frage gestellte – Nähe zur Tradition der aufklärerischen Moralistik revidieren, weil die in der Logik des ›Exempels‹ im11 Gutzkow 1850, S. 210–211. 12 In Karl Gutzkows Rezension wirkt die Anknüpfung an die Tradition der frühaufklärerischen Moralistik mit Blick auf die fragile bzw. prekäre Gültigkeit der gelieferten Diagnosen kompensatorisch: »Ist nun also auch die Natur Ihres Unternehmens eine solche, daß Das, was heute in ihm behauptet wird, morgen schon wieder durch irgendeine Thatsache kann in Abrede gestellt werden, so wird es darum nicht minder ein Spiegel der Zeit sein, ein Unternehmen von sittlicher Bedeutung. Beispiele des Erhabenen und Denkwürdigen aufstellend, muß es die Nacheiferung der Guten und Edlen wecken. In dem Wirrwarr der Parteiung, in dem Strudel des Zeitgeistes ist hier eine sichere Fährte, ein Trost sogar und eine Beruhigung«. Ebd., S. 212.
134
Bildgebung
plizit vorhandene Wertung in dieser Sammlung hingegen in den Hintergrund rückt. Obwohl Charakteristik und Lebensbild gattungs- und wissensgeschichtlich zu dieser Tradition gehören, dienen solche Formen im Vormärz überwiegend zur Darstellung der Zeit und der Verhältnisse. Aufgrund einer Widerspiegelung mit der Zeit werden sie eingesetzt. Vor allem im Falle Gutzkows lassen sich daher interessante Übereinstimmungen mit der frühen Soziologie beobachten. Die jeweils prägenden Wissensformationen verweisen einmal mehr darauf, dass dieses Verfahren in Abhebung von der ›Historisierung‹ Kontur gewinnt: Die Texte, die unter diesem Verfahren subsumiert wurden, stehen nämlich noch fest im »kategoriale[n] Bezugsrahmen«13 der idealistischen Philosophie und sind, wie ausführlich bewiesen wurde, von Denkform und Wissensformation ›Geschichte‹ geprägt. Die dem Verfahren der ›Bildgebung‹ zugeordneten Texte zeugen dahingegen von einem im Rahmen der Wissensordnung langsam stattfindenden Umstrukturierungsprozess und lassen sich vielmehr mit dem kategorialen Rahmen der Soziologie assoziieren. Bekanntlich löst diese Disziplin – gemeinsam mit der Psychologie – im Laufe des 19. Jahrhunderts die Dominanz der Geschichte im Rahmen der Wissensordnung sowie der Ausbildung von Zeit- und Geschichtsmodellen ab. Dennoch kann diese neuartige Wissensformation zu diesem Zeitpunkt nur ›elementares‹ Wissen14 liefern, da sie sich im Vormärz vor ihrer disziplinären Emanzipierung befindet. Dementsprechend lassen sich in den Primärtexten allenfalls »Teilprozesse«15 erkennen.
3.1
›Bildgebung‹ als zeitdiagnostisches Schreibverfahren: Karl Gutzkows Sammlung Die Zeitgenossen. Ihre Schicksale, ihre Tendenzen, ihre großen Charaktere (1837)
Am Beispiel von Gutzkows breit angelegter Sammlung Die Zeitgenossen kann auf das Verfahren der ›Bildgebung‹ und damit auf eine Forschungshaltung hingewiesen werden, die sich in Abhebung von der auf teleologischen Vorstellungen basierenden Methode der Geschichtsphilosophie deutscher Prägung entwickelt; sie stellt sich als eine ihr entgegengesetzte und zugleich komplementäre Tendenz heraus. In Anlehnung an im französischen und englischen Sprachraum verbreitete Publikationsformate integriert sie außerdem Methoden und Beobachtungsweisen der Naturwissenschaften (Physiologie, Medizin). 13 Frank 2000, S. 93. 14 ›Elementar‹ ist ein Wissen, das »ohne systematische Gründungsurkunden […] auskommt«, ibidem. 15 Ibidem.
Karl Gutzkows Die Zeitgenossen (1837)
135
Unter dem Ordnungsprinzip des Enzyklopädischen wird mit dieser Sammlung die ›Gegenwart‹ der 1830er Jahre dargestellt. Weil Gutzkow sich mit dieser Schrift zum Ziel macht, »das [zu] schildern, was man alle Tage selbst sehen kann«16, wird in erster Linie eine Aufwertung des Empirischen angestrebt. Gutzkows programmatische Aussage ist somit als Abhebung von einer definitorischen, durch Abstraktionsleistung gekennzeichneten Beobachtungsweise zu verstehen. Als Alternative dazu werden unterschiedliche Redeweisen und Formen eingesetzt, wie etwa die Bilanz, die Zeitdiagnose und die Charakteristik.
3.1.1 Gegen die Geschichtsphilosophie Karl Gutzkow veröffentlicht 1837 die aus bereits publizierten Artikeln bestehende essayistische Sammlung Die Zeitgenossen. Ihre Schicksale, ihre Tendenzen, ihre großen Charaktere. Die Abschnitte erschienen zwischen Frühjahr 1837 und Ende Dezember 1837/Anfang Januar 1838. Die aus den Überschriften ableitbare thematische Zusammenstellung verrät bereits den enzyklopädischen Anspruch dieser Sammlung – ›enzyklopädisch‹ ist allerdings hier eher im Sinne einer angestrebten Multiperspektivität, die der ›modernen‹ Gesellschaftsstruktur gerecht ist, als im Sinne des gelehrten Diskurses des 17. und frühen 18. Jahrhunderts zu verstehen. Die Sammlung besteht aus folgenden Artikeln: ›Zueignung an Sir Ralph****(einen berühmten Staatsmann)‹, ›Der Mensch des neunzehnten Jahrhunderts‹, ›Das Jahrhundert‹, ›Die neue Welt‹, ›Das Moderne‹, ›Die Existenz‹, ›Der Stein der Weisen‹, ›Das Leben im Staate‹, ›Die Erziehung‹, ›Sitte und Sitten. Aus einem ungedruckten Romane‹ (erster Band); ›Sitte und Sitten‹, ›Religion und Christentum‹, ›Kunst und Literatur‹, ›Wissenschaft. Literatur‹, Anhang (zweiter Band). Wie es in der sich als ›Kulturgeschichte‹ verstehenden Geschichtsphilosophie in der Regel der Fall ist, wird vom ›Menschen‹ ausgegangen, um dann alle Bereiche und relevanten Schauplätze des öffentlichen Lebens im 19. Jahrhundert (Die neue Welt) in den Blick zu nehmen. Die Veröffentlichung von Sammlungen aus bereits publizierten Zeitungsartikeln, die dadurch u. a. die Form des Reviews reproduzierten und zum Anlass wurden, die eigene Produktion im Hinblick auf ihre Repräsentativität und zeitdiagnostischen Wert einer Selektion zu unterziehen, bildete einen etablierten Aspekt vormärzlicher verlegerischer Praxis17. Aus historisch-praxeologischer Perspektive ist allerdings noch ein weiterer Aspekt des verlegerischen Entstehungszusammenhangs dieses Werkes für den Vormärz kennzeichnend: Die 16 Karl Gutzkow, Die Zeitgenossen. Ihre Schicksale, ihre Tendenzen, ihre großen Charaktere, Münster 2010 [1837], S. 15. 17 Ein Blick auf den Textkorpus dieser Arbeit bestätigt den Sachverhalt.
136
Bildgebung
Sammlung Die Zeitgenossen wurde als fingierte Übersetzung des eigentlich in deutscher Sprache bereits erschienenen Buches von Edward Bulwer-Lytton England and the English veröffentlicht. An dieser Stelle ist weder eine historischpraxeologische Untersuchung dieser verlegerischen Tendenz18 noch eine philologisch einlässliche Bestimmung der tatsächlich vom englischsprachigen Vorbild geprägten Textteile beabsichtigt. Interessant scheint vielmehr die Tatsache zu sein, dass die Praxis der Übersetzungsfiktion, die in diesem konkreten Fall u. a. aus finanziellen und zensurpolitischen Gründen19 erfolgt, von der zu dieser Zeit florierenden Übersetzungsindustrie und der Erweiterung des Buchmarkts gewissermaßen glaubwürdig gemacht wurde. Nicht nur gaben die meistens aus dem Englischen und Französischen übersetzten Werke und die in diesen Ländern zirkulierenden Zeitschriften erfrischende Einblicke in das öffentliche Leben fremder Länder, sondern sie boten den deutschsprachigen Schriftstellerinnen und Schriftstellern auch alternative Schreibweisen und Publikationsformate an. Solche Formate waren in der Lage, ›Gegenwart‹ und Zeitgeschichte auf eine aus deutscher Sicht unkonventionelle Art und Weise darzustellen. Insbesondere ließen sich die Jungdeutschen von diesen Vorbildern inspirieren: Das betrifft in erster Linie das Zeitschriftenwesen20 und führt, wie dies etwa bei Gutzkow der Fall ist, zu einer Integration und einem kulturellen Transfer ›fremder‹ Denktraditionen. Über die bereits erwähnten finanziellen und zensurpolitischen Gründe hinaus, die Verleger und Autor zur Übersetzungsfiktion bewegt hatten, müssen im Falle der Zeitgenossen demnach auch Schwierigkeiten bei der Auseinandersetzung mit und der ›Darstellung‹ von Gegenwart und Zeitgeschichte berücksichtigt
18 Von einer ›Tendenz‹ ist hier die Rede, weil beispielsweise auch Willibald Alexis seine ersten zwei Romane als vorgegebene Übersetzungen von Werken Walter Scotts veröffentlichte. 19 Gerade über die zensurpolitischen Gründe berichtet Gutzkow ausführlich im Vorwort zur dritten Ausgabe: »Der Verfasser trug sich mehre Jahre mit der Idee eines Werkes, das den Versuch machen sollte, ein Gesammtbild unsres Jahrhunderts nach seinen vorzüglichsten Lebensäußerungen und Gedankenrichtungen zu geben. Anfangs 1837 hielt er sich für befähigt, an diese schwere Aufgabe zu gehen. Doch mit seinem Namen begleitet würde eine solche, gerade mit der Zeit und ihren Tendenzen sich beschäftigenden Schrift und ohnehin bei seiner ihm zur andern Natur gewordenen liberalen Auffassung in ganz Preußen verboten worden sein, und diejenigen deutschen Regierungen, welche gewohnt waren, alles Preußische nachzuahmen, würden dies Verbot auch für die Kreise der ihnen gehörenden Botmäßigkeit ausgedehnt haben. Unter diesen Umständen entschloß sich der Verfasser, dem es um die Grundsätze seines Buches mehr zu thun war, als um seine Person, auf den Titel desselben den Namen Bulwer’s zu setzen. Nachstehendes Buch erschien unter der Firma Bulwer’s Zeitgenossen«. Gutzkow 1875, S. VI–VII. Über diesen Zusammenhang referiert ausführlich u. a. Martina Lauster, Nachwort. In: Gutzkow 2010 [1837], S. 663–665. 20 Vgl. dazu Helga Brandes, Die Zeitschriften des Jungen Deutschland. Eine Untersuchung zur literarisch-publizistischen Öffentlichkeit im 19. Jahrhundert, Opladen 1991.
Karl Gutzkows Die Zeitgenossen (1837)
137
werden. Eine wichtige Rolle spielt dabei also die Beispiellosigkeit dieses Unternehmens in der deutschsprachigen Publizistik. 1834 wurde Gutzkow vom Stuttgarter Verleger Samuel Gottlieb Liesching mit dem »Projekt einer umfassenden Zeitdarstellung«21 beauftragt. Wie er im Vorwort zur 1875 erschienenen, dritten und letzten Ausgabe22 dieser Sammlung betont, konnte eine möglichst erschöpfende Zeitdarstellung erst nach der Auseinandersetzung mit Hegel und der Geschichtsphilosophie zustande kommen: Diese ›Abrechnung‹ erfolgt hauptsächlich im 1836 im Gefängnis »speziell gegen die Hegelsche Philosophie geschriebenen Buch«23 Zur Philosophie der Geschichte. Wie es sich an einigen Stellen aus Briefen an Liesching zeigen lässt, hegte Gutzkow Zweifel nicht nur prinzipiell an der Tatsache, die noch im Werden begriffene jetzige Zeit erfassen zu können, sondern auch an der Angemessenheit der zur Verfügung stehenden Annäherungsweisen. In Zur Philosophie der Geschichte werden die nach Herder überwiegend philosophisch-spekulierende Ausrichtung dieser Wissenschaft in der deutschen Denktradition sowie ihre Tendenz zur Relativierung der Empirie und des menschlichen Einwirkens auf die Geschichte kritisch betrachtet. Als positive Gegenmodelle werden die entsprechenden Diskurse in der englischen und französischen Denktradition24 angeführt. Dem Hauptteil der Abhandlung wird nämlich eine komparativ angelegte Genese und Bestimmung der Funktion dieses Diskurses im deutschen, französischen und englischen Wissenssystem vorangestellt: In England ist sie aus einer politischen Frage entstanden, erweist einen »anthropologischen Charakter«25 und ist Teil einer »psychologischen Propädeutik«26. Eine ähnlich empirische, menschen- und gegenwartsbezogene (statt gegenwartstranszendierende) Ausrichtung prägt diesen Diskurs in Frankreich, wo er dazu »dient, [den Blick] zu schärfen […], [und] eine Vorbereitung für die politische Debatte [ist]«27. Neben dem nicht-pragmatischen und tatenlähmenden Charakter der Geschichtsphilosophie in der deutschen Denktradition scheint in diesem Zusammenhang der universal-historische Schematismus für die Komplexität und Vielfalt einer modernen ›Gegenwart‹ zu kurz zu greifen. Wissenschafts- und 21 Lauster 2010 [1837], S. 661. 22 Die zweite Ausgabe wurde 1846 mit dem Titel ›Säkularbilder‹ veröffentlicht. Bei der dritten wurde der Untertitel ›Anfänge und Ziele des Jahrhunderts‹ hinzugefügt. Die zu diesem Anlass vorgenommenen Änderungen bestanden vornehmlich darin, die englischen ›Zeitgenossen‹ durch deutsche zu ersetzen und mithin die Schrift – als Mittel zur Selbstbetrachtung konzipiert – noch unvermittelter dem deutschsprachigen Lesepublikum fruchtbar zu machen. 23 Karl Gutzkow, Zur Philosophie der Geschichte, Berlin 1836, S. 18. 24 Mit Blick auf die Begriffsgeschichte ist die Bezeichnung ›Geschichtsphilosophie‹ Voltaire zu verdanken. S. Kap. 2.1, Fußnote 2. 25 Gutzkow 1836, S. 18. 26 Ebd., S. 19. 27 Ebd., S. 20.
138
Bildgebung
kulturgeschichtlich argumentierend entsteht die Geschichtsphilosophie aber ausgerechnet als Strategie der Bewältigung der mit der modernen Gegenwartserfahrung verbundenen gesteigerten Kontingenz28: Vor dem Hintergrund einer sich nicht mehr an der ›Vergangenheit‹ orientierenden Gegenwart, einer, in Gutzkows Worten, in der »Fluktuation« begriffenen Gegenwart, besteht die Leistung dieser Wissenschaft also gerade in der Komplexitätsreduktion. Systematisch betrachtet erfolgt das, indem diese Wissenschaft das spekulative und abstrahierende Moment der Philosophie mit dem für die Geschichte unabdingbaren Referenzverhältnis sowie ihrer Tendenz zur Vereinzelung historischer Tatsachen verbindet. Wie übrigens ein Überblick über die ersten in diesem Sinne konzipierten Entwürfe verdeutlicht, kann das Augenmerk bei einer überwiegend abstrahierenden Absicht auf den ›Zusammenhang‹ bzw. die ›Relation‹ der Ereignisse miteinander und/oder auf das ›Ziel‹ der Geschichte gerichtet werden. Dadurch wird der Blick auf die ›Gegenwart‹ und deren Deutung durch die Zukunftsperspektive und die Konstruktionsleistung transzendiert: Die angeblich einer eigenen Logik folgenden Phänomene werden also entweder aufgrund einer untereinander herrschenden Kausalität oder einer sie steuernden metaphysischen Instanz in die sich prozessual und fortschreitend entfaltende Geschichte integriert und mithin normalisiert. Dabei handelt es sich um eine etablierte Modalität, eine (im zeichentheoretischen Sinne verstandene) Zeitdiagnose durchzuführen: Die Zeiterscheinungen sind nicht per se, sondern nur im Hinblick auf ihre Beweiskraft für ein nicht sichtbares Schema bedeutend, das dadurch aus der Latenz heraustreten kann. In diesem Zusammenhang kommt auch die konstruktive Leistung der Beobachterin oder des Beobachters in den Mittelpunkt. Demgegenüber entwickelt Gutzkow in Die Zeitgenossen, nicht zuletzt dank des englischen Vorbildes, die komplementäre Gegenposition: Zielt die Geschichtsphilosophie zugunsten der Zukunftsperspektive auf die Minimierung und Normalisierung der einzelnen gegenwärtigen Geschehnisse und Erscheinungen ab, so wird in Gutzkows Abhandlung aufgrund der angestrebten, möglichst erschöpfenden Zeitdarstellung gerade von diesen induktiv ausgegangen, um dann auf den kultur- und sozialgeschichtlichen Wandel hinzuweisen. Mittels eines dezidiert anti-synthetischen Blicks, bei dem statt der ›Zukunft‹ die ›Gegenwart‹ im Mittelpunkt steht, wird somit eine breitere und detailliertere Auffächerung des Spektrums der Erscheinungen geleistet. Die Schwerpunktverschiebung auf die ›Gegenwart‹, die eine Abweichung von der Geschichtsphilosophie idealistischer Prägung darstellt, korreliert mit einer Aufwertung des Empirischen und der Anerkennung seines epistemologischen Wertes. Die Aufmerksamkeit für die konkreten Erscheinungen, die zur selbstsprechenden Evidenz avancieren und für den kulturgeschichtlichen Wandel 28 Vgl. dazu Oesterle I. 1985.
Karl Gutzkows Die Zeitgenossen (1837)
139
geradezu emblematisch und symptomatisch sind29, hebt Gutzkow bereits im Eröffnungsabschnitt hervor: In den Zeitgenossen geht es nämlich darum, »das [zu] schildern, was man alle Tage selbst sehen kann«30. Was aus Gutzkows Perspektive einer spekulativen und die Zeitverhältnisse verkennenden Haltung entgegenzustellen ist, ist eine Beobachtungshaltung, die sich ›demokratisch‹ auf das alltäglich Wahrnehmbare richtet. Noch im Eröffnungsabschnitt, der ›Zueignung an Sir Ralph****(einen berühmten Staatsmann)‹, geht Gutzkow ausführlicher auf sein Analyseverfahren und seine Beobachtungshaltung ein: »Ich finde […], daß Diejenigen, welche über die öffentlichen Angelegenheiten schreiben, den Charakter unsrer Zeit nicht gründlich studirt haben, und daß, wenn sie auch die Zeit kennen, ihnen doch wieder die Zeitgenossen gänzlich unbekannt geblieben sind. […]. Was sind nicht für Theorien aufgestellt worden, um unserm Jahrhundert zu Hülfe zu kommen! Sie schöpften alle nur den Schaum von den Zeitgenossen ab und berechneten ihre Schriften für ein Abstraktum, das nirgends existirt.«31
Es handelt sich bei dieser Stelle um eine programmatische Selbstpositionierung bei gleichzeitiger Abhebung von anderen Verfahren der Zeitdiagnose und -darstellung; Gutzkows Verfahren bekommt somit ex-negativo Kontur: Es ist dadurch gekennzeichnet, von den »Zeitgenossen«, d. h. den unmittelbar wahrnehmbaren, menschlichen Erscheinungen auszugehen, statt »Theorien« aufzustellen. Die epistemologische Aufwertung der Empirie, die Martina Lauster mit Recht als »Ersatz eines spekulativen Begriffs vom ›Zeitgeist‹ durch einen physiologischen«32 beschreibt, impliziert in Gutzkows Abhandlung ein Maximum an Konkretion, das nicht nur mittels des häufig rekurrierenden Bezugs auf die Mode, sondern auch mittels der Anführung und Darstellung zeitgenössischer Persönlichkeiten erreicht wird. Verrät die Aufmerksamkeit für Empirie eine Nähe zu zeitgleichen naturwissenschaftlichen Diskursen, so macht der Bezug auf zeitgenössische Sozialfiguren, die zumeist als Einstieg in die Analyse eingesetzt
29 Eine ähnliche, von einer für die Zeitgenossen überhaupt kennzeichnenden Aufmerksamkeit für die Mode geprägte Haltung wird in den ›Briefen eines Narren an eine Närrin‹ (1832) propagiert: »Ich mache mich anheischig, an die Bandschleife Deines Hutes alle Tendenzen unserer Zeit anzuknüpfen«, Karl Gutzkow, Briefe eines Narren an eine Närrin. In: ders., Gutzkows Werke und Briefe, Band 1, Münster 2003 [1832], S. 7. 30 Gutzkow 2010 [1837], S. 15. Hervorhebung durch die Verfasserin. Gutzkow/Bulwer geht noch ausführlicher auf die ›deskriptive‹ und aufklärende Schreibhaltung ein: »Ich will nicht den Sittenprediger in diesem Buche spielen, weil ich mir sonst die Möglichkeit nehmen würde, auf meine Zeitgenossen zu wirken. Sie schildern, ist mehr, als sie belehren wollen, denn das Erstere lässt ihr Urtheil frei, während das Zweite es gefangen nimmt. Ich will keine Anklage stellen, sondern nur die Thatbestände ermitteln. Jeder prüfe sich selbst und richte sich!«, ebd., S. 130. 31 Ebd., S. 11. 32 Martina Lauster, Die Zeitgenossen (Apparat). In: dies./Gert Vonhoff (Hg.), Gutzkows Werke und Briefe, Exeter/Berlin/Münster 2001, S. VI–63.
140
Bildgebung
werden, dieses Werk u. a. zu einem Beitrag zur frühen Soziologie. Die Distanzierung von der Geschichtsphilosophie und das Vorhaben, Zeitdiagnosen und Prognosen anders als im Modus der Weissagung zu artikulieren, machen somit hier spätere Entwicklungen im Wissenssystem bereits erkennbar: Gemeint ist damit die Loslösung des philosophisch-spekulativen Elementes zuerst in der materialen Geschichtsphilosophie, dann in den verschiedenen Formen der Soziologie in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts33. Im Hinblick auf die zentrale Fragestellung dieser Studie suggeriert diese Forschungshaltung in erster Linie eine kontraintuitive Lokalisierung von ›Latenz‹: Weder in der ›Tiefe‹ bzw. ›hinter‹ den Zeichen lässt sie sich verorten, noch mittels begrifflicher Abstraktion lässt sie sich aufheben – vielmehr ist sie in den in diesem Sinne selbstbedeutenden Erscheinungen lokalisierbar. Bildet die Akzentverschiebung auf die Empirie im Vergleich zur zeitgenössischen Essayistik die Besonderheit dieses Werkes, so ändert sich nichts an der Selektionsleistung, die die Publizistin oder der Publizist zu erbringen hat: Durch den ubiquitär erhobenen Anspruch, die ›Jahrhundert-‹ von den bloßen ›Tagesfragen‹ unterscheiden zu können, partizipiert das Werk an den geläufigen Diskursen zur Installierung einer differenzierten Sprechposition in der öffentlichen Debatte, die im vorigen Kapitel skizziert wurden. Gerade diese Perspektive übernimmt die breiter angelegte und abstrahierende der Geschichtsphilosophie und entfaltet sich mittels der Elemente eines besonderen essayistischen Stils. Obgleich in zahlreichen Kapiteln der Zeitgenossen programmatische Aussagen und auf die ausgewählte Darstellungsform bezogene Beobachtungen, die für die Tendenz zur Selbstproblematisierung des Essays typisch sind, enthalten sind34, stellen die Paratexte in dieser Beziehung den angemessenen Ausgangspunkt dar. Insbesondere wird auf die angedeutete Aufgabe der ›Zeitschriftstellerin‹ oder des ›Zeitschriftstellers‹ mit besonderer Prägnanz im als Paratext fungierenden ›Anhang‹ eingegangen, den Gutzkow ausgerechnet für die Veröffentlichung der Sammlung verfasst: »Der Publicist […] hat die Aufgabe, […] die Halbheit der in den Begebenheiten liegenden Keime nachzuweisen, und überhaupt, obschon ein Mann der politischen Debatte, doch die Debatte als das zu zeichnen, was sie ist, als einen oft nur trüglichen Thermometer der Hitze und der Kälte, welche sich in den Empfindungen der Zeitgenossen findet. […]. Es ist Zeit, den Gesichtspunkt aller politischen Betrachtungen nachgerade nur innerhalb der Historie zu nehmen, weniger von Parteien und Systemen zu sprechen, als von Völkern, Nationalinteressen und jenen allgemeinen Individuali-
33 Vgl. dazu Dierse/Scholtz 1974, S. 416–439. 34 Die serielle Wiederkehr derselben Argumente verrät das ursprüngliche Publikationsformat in Lieferungen.
Karl Gutzkows Die Zeitgenossen (1837)
141
tätsbezügen, welche noch jedem Jahrhundert seinen eigenthümlichen Charakter gegeben haben.«35
Relativiert werden sollte die Ebene der »politischen Debatte« zugunsten einer historischen Perspektive, die von der Publizistin oder dem Publizisten vermittelt wird. Gerade die Platzierung dieser Äußerung in einem u. a. der rekapitulierenden Programmbefestigung dienenden Text suggeriert, dass die Bestimmung der tatsächlichen ›Tendenzen‹ des Jahrhunderts die Selektion der in jedem Abschnitt auftretenden Zeitgenossen steuert. Die Aufwertung der Empirie und des ›Momentes‹ als epistemologisch relevante Größe impliziert also keineswegs den Verzicht auf die historische Perspektive. Diese charakterisiert sich allerdings nicht als Bestimmung der Wirkung philosophischer Prinzipien in der Geschichte, sondern der Tendenzen, die das neue Jahrhundert prägen, und die gewissermaßen zukunftsfähig sind36. Auf die Zukunftsperspektive wird nämlich nicht verzichtet. Sie artikuliert sich allerdings nicht als blinde Hoffnung auf Fortschritt, sondern stützt sich auf ›Tatsachen‹ und profitiert von der dem Essay inhärenten räsonierenden Berücksichtigung mehrerer Positionen37. Eine weitere Entscheidung bei der Überarbeitung dieses Textes spricht ebenfalls für die Aufwertung des historischen ›Momentes‹: Anstatt angesichts der erfolgten Entwicklungen die Kapitel einer Revision zu unterstellen, um den ›Tagescharakter‹ der Publikation zu vermindern, wird dieser geradezu dokumentarisch und testamentarisch hervorgehoben: »Wie wir vom Alterthum die klassischen Ueberreste unsterblicher Gedichte, Geschichtswerke, Bauten und Bildsäulen haben, aber […] aus unbedeutenden Votivtafeln und staatsökonomischen Ausgaben, die man auf Inschriften verzeichnet findet, das innere Getriebe des Alterthums noch besser kennen lernt, wie aus jenen; so wird auch dieses Werk, die Zukunft über die Gegenwart aufzuklären, nicht verfehlen. Selbst die Irrthümer dieses Werkes, […], sprechen vielleicht deutlicher für den Charakter der Epoche, welcher es gewidmet ist, als die Wahrheiten, die sich zu allen Jahrhunderten gleichbleiben. Und um diesen Eindruck des unmittelbar vom Tage Gegebenen unserm Werke noch unmittelbarer zu sichern, damit der Moment den später prüfenden Zeiten
35 Gutzkow 2010 [1837], S. 621–622. 36 Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass in den ›Zeitgenossen‹ zwar ein enzyklopädischer bzw. multiperspektivischer, kein aber universalistischer Blick angestrebt wird: »Dennoch wollen wir nicht vom Jahrhundert sprechen, sondern nur von einem hundertsten Theile desselben. Wir wollen hier nicht philosophiren, sondern uns den Moment vergegenwärtigen, klar, lebendig, thatsächlich«, ebd., S. 623. 37 Ein ähnlicher Standpunkt bezüglich der Möglichkeit, über die Zukunft zu reden, lässt sich auch in den bereits erwähnten ›Briefen eines Narren an eine Närrin‹ feststellen: »Ich gründe meine Ansichten der Zeit nie auf die Auslegung meiner Wünsche, sondern nur auf erklärte Thatsachen. Ich wage keine Behauptung über die Zukunft, selbst für die nächste nicht, aber das scheint unwiderleglich, daß die drei Personen der Allianz sich gegen einander zu rectificiren und ihre Einigkeit aufzulösen scheint«. Gutzkow 2003 [1832], S. 13.
142
Bildgebung
noch lebensfrischer und bunter in die Augen springe, folge hier eine Betrachtung, die der Anbruch des Jahres, in welchem diese Blätter vollendet wurden, in ihrem Verfasser anregte. Das siebente Jahr der Julirevolution!«38
Dass die Abschnitte sieben Jahre nach der Julirevolution und gerade unter dem Eindruck dieses Ereignisses und der erhofften, aber sich nicht verwirklichten Umwandlungen geschrieben wurden, muss dezidiert in den Mittelpunkt gerückt werden. Gerade bezüglich dieser Einstellung weicht diese Abhandlung von anderen, zeitgleichen retrospektiven Sammlungen eindeutig ab: Bei diesen wurden die Artikel hingegen überarbeitet, um das ›Kontingente‹, weil unter dem Eindruck des ›Tages‹ geschrieben und damit keinen langfristig zeitdiagnostischen Wert besitzend, so viel wie möglich auszuklammern. Die Vorstellung, dass die Betrachtungen, die sich retrospektiv als falsch herausgestellt haben, dann doch indirekt zeitdiagnostischen Wert aufweisen, indem sie etwas ›Authentisches‹ über die Zeit vermitteln, wird auch am Ende des letzten Kapitels (›Wissenschaft. Literatur‹) verdeutlicht: »Ich aber habe meinen Zweck erreicht, wenn dieses Buch in dem Gewirre von Schriften, die unsre Zeit oft ohne Fug und Grund in die Zukunft vererbt, von irgend einem Weisen, der das neunzehnte Jahrhundert so schildern will wie wir wohl das achtzehnte, als Quelle benutzt wird. Schildert es meine Zeitgenossen nicht immer so, wie sie sind, so genügt es schon, dereinst zu wissen, wofür wir uns gehalten haben. Und wenn sich in diesen anspruchslosen Skizzen und Erörterungen Irrthümer finden, so werden sie auch als solche nicht ohne Gewinn für die Zukunft seyn. Sie werden unsere Zeit vielleicht dadurch am meisten charakterisiren, daß wir sie für Wahrheit gehalten haben.«39
Kein ewig gültiges, gleichbleibendes anthropologisches Wissen, sondern »den Moment« will diese Abhandlung vermitteln. Und sie versteht sich dabei nicht zuletzt als mentalitätsgeschichtliches Dokument.
3.1.2 Charakter – Typus – Zeitgenosse »Meine Schrift sollte alles umfassen, was den Geist unseres Jahrhunderts begreift, aber sie sollte vom Individuum, nicht von den Tendenzen anfangen«40 – mit einem eindeutigen Hinweis auf die epistemologische Akzentverschiebung und die damit konsequent ausgewählten Darstellungsweise und Methode fasst Gutzkow im Eröffnungsabschnitt der Sammlung, der ›Zueignung an Sir Ralph**** (einen berühmten Staatsmann)‹, sein Vorhaben zusammen. Wie bereits angedeutet wurde, entsteht die Sammlung in einem Zusammenhang der Konkurrenz mit der He38 Gutzkow 2010 [1837], S. 620. 39 Ebd., S. 619. 40 Ebd., S. 14.
Karl Gutzkows Die Zeitgenossen (1837)
143
gelschen Geschichtsphilosophie, die teleologische und gegenwartsabstrahierende Vorstellungen animiert. Als Erstes drängt sich daher die Frage nach den möglichen alternativen Darstellungsweisen und Diskursen auf, auf die aufgrund dieser programmatischen Distanzierung rekurriert wird. Indirekt liefert Gutzkow selber eine Antwort auf diese Frage, als er am Anfang des Kapitels ›Die Erziehung‹ behauptet, es sei für den Gegenstand angemessener »statt mit Maximen, […] mit Porträts [zu] beginne[n]«. Er begründet seine Entscheidung mit dem naheliegenden Argument, nach dem die »Individuen, […] uns besser als Raissonement die gegenwärtige Lage unsres Erziehungswesens […] vergegenwärtigen können«41. Das englische Vorbild und generell der Bezug auf die englische Denktradition spielen bei der Aufwertung des Empirischen und seinem Wechsel von fremdgesteuertem Phänomen hin zur selbstsprechenden ›Evidenz‹ eine nicht zu unterschätzende Rolle42. Bei diesem Problemkomplex scheint die Gegenüberstellung von ›Zeit‹ und ›Zeitgenossen‹ zentral zu sein. Die Darstellung von Individuen oder historischen Persönlichkeiten als Ausgangspunkt für die Auseinandersetzung mit einem aktuellen Thema oder als Beiwerk zu den dargelegten Thesen ist fester Bestandteil von Gutzkows essayistischem Stil. Über das Verfahren der Zeitdarstellung und -diagnose, von dem Gutzkow/Bulwer sich entfernt, wird noch ausführlicher in folgender Stelle berichtet, bei der darüber hinaus einige Grundpositionen jungdeutscher Journalistik zusammengeführt werden: »Ich sagte schon, daß es Schriften gibt, wo dieß Alles [die Zeitgenossen] übersehen wird. Die Verfasser derselben thaten die unzähligen Charaktere und Individualitäten unter den Zeitgenossen zusammen in einen großen Trog, wie man die Kartoffeln zusammenstampft und preßt, bis ihre Quintessenz […], ihre Medulla, wie die Alten auch vom Kern der Menschen sagten, herausgedrückt ist. Für diesen Durchschnittscharakter der Zeit stellen sie dann ihre guten Lehren auf, die sie mit Stellen aus antiker und mittelalterlicher Weisheit zu erhärten suchen. […]. Ich billig’ es nicht. Ich mag meine lieben guten Nachbarn, die so wenig Lärm machen und wenn nicht durch das Parlament, doch durch die Kirche mit der Zeit zusammenhängen, […] und meine beiden Holländer nicht um ihr Stimmrecht in den Angelegenheiten des Jahrhunderts bringen. Sie gehören mit dazu […]. Es ist ein Fehler, daß die reformirenden Schriftsteller fast immer nur die Intelligenz, selten die Materie im Auge haben. Es ist sogar ein Nachtheil für Diejenigen, welche durch eine Einseitigkeit dieser Art am meisten geehrt werden. […]. Die Refor-
41 Ebd., S. 266. Hervorhebung durch die Verfasserin. Die in demselben Zitat enthaltene Präzisierung, nach der es sich dabei um Individuen »aus [der] Bekanntschaft« des Autors handele, fungiert als Strategie, Authentizität zu erzeugen, und spricht zugleich für einen protoethnographischen bzw. protosoziologischen Blick, auf den weiter unten ausführlicher eingegangen wird. 42 Vgl. in diesem Zusammenhang Rüdiger Campe, Epoche der Evidenz. Knoten in einem terminologischen Netzwerk zwischen Descartes und Kant. In Sybille Peters/Martin Jörg Schäfer (Hg.), Intellektuelle Anschauung. Figurationen von Evidenz zwischen Kunst und Wissen, Bielefeld 2006, S. 25–43.
144
Bildgebung
matoren wollen immer nur die Ideen gegen einander ausgleichen, statt daß sie die Ideen mit der Materie, mit meinen beiden Holländern ausgleichen sollten. Ob ich dem Systeme der Bewegung, meine Kritiker dem des Widerstandes angehören, das sollte zuletzt weit weniger entscheiden. Ein System ist immer ein weiter Vorsprung. Die Vorzüge des Jahrhunderts mit einander in Kampf zu bringen, ist wahrlich nur eine ganz einseitige Polemik! Mit einem Worte, es handelt sich weit weniger um Revolution, als um Aufklärung.«43
Wenn andere zeitdiagnostische Schriften die Zeitgenossen überhaupt in den Blick nehmen, so werden diese Figuren, ungeachtet der vielen Differenzen, auf gemeinsame, laut jeweiliger Denkrichtung die Zeit steuernde Prinzipien zurückgeführt. Gutzkow/Bulwer macht darüber hinaus auf die belehrende Absicht dieser Schriften aufmerksam, die, indem sie ihre Lehren der Antike oder vergangenen Epochen überhaupt entnehmen, offenbar beweisen, die prägenden Aspekte der eigenen Zeit doch nicht begriffen zu haben – durch die Gleichsetzung mit vergangenen Epochen wird sie vielmehr Gegenstand einer Stilisierung. Werden die Zeitgenossen in besagten Schriften berücksichtigt, so werden nur diejenigen privilegiert, die repräsentativ für die ideellen Substrate der Zeit sind und mithin die avancierten bzw. ›modernen‹ Tendenzen verkörpern. Anhand von Gutzkows Kritik an der »Einseitigkeit« dieses Verfahrens lässt sich ein wichtiger Aspekt des hier eingesetzten Gebrauchs des Begriffs ›Zeitgenossen‹ erhellen: Dem Prinzip der ›Ungleichzeitigkeit des Gleichzeitigen‹44 gemäß, das begriffsgeschichtlich eigentlich erst Anfang des 20 Jahrhunderts im Rahmen der Kunstgeschichte (Wilhelm Pinder) entsteht, will Gutzkow auch denjenigen Erscheinungen Rechnung tragen, die Produkt älterer Tendenzen sind und die Gegenwart genauso prägen wie die avancierten. In diesem Sinne leistet Gutzkows wertungsfreie und inklusive Begriffsverwendung einen kaum zu überschätzenden Beitrag zur »Überwindung der normativen Vorstellung von Ungleichzeitigkeit«45, die der Semantik des ›Zeitgenössischen‹ schon immer inhärent ist46 und allerdings erst durch ihre Abkopplung von einer ebenfalls nor43 Gutzkow 2010 [1837], S. 12–13. 44 Vgl. dazu Johannes F. Lehmann, Artikel ›Zeitgenossen‹; ›Zeitgenossenschaft‹. In: Michael Gamper/Helmut Hühn/Steffen Richter (Hg.), Formen der Zeit. Ein Wörterbuch der Ästhetischen Eigenzeiten, Hannover 2020, S. 451. 45 Ibidem. 46 Gutzkows in begriffsgeschichtlicher Hinsicht wichtige Leistung wird in Lehmanns sonst sehr wertvollem und informationsreichem Artikel nicht beachtet. Die Vorstellung von ›Zeitgenossenschaft‹ als »ein zeit-räumlicher Inklusionsbegriff, der […] alle verschiedenen gleichzeitigen Zeiten und verschiedenen Weisen, in und mit der Zeit zu sein, als gleichwertige Identitäten anerkennt und integriert«, die Lehmann (S. 10) erst Pinders sowie der zeitgenössischen Begriffsverwendung zuschreibt, ist bei Gutzkow bereits vorhanden. Die wertungsfreie Auffassung des ›Zeitgenössischen‹ steht darüber hinaus im engen Zusammenhang mit der in diesen Jahren bereits entwickelten Poetik des Panoramatischen bzw. Enzyklopädischen und dem Sinn für die sich abzeichnenden sozialen Komplexität und Pluralität. Eine
Karl Gutzkows Die Zeitgenossen (1837)
145
mativen Vorstellung des ›Modernen‹ explizit wird47. Zudem wird die Einseitigkeit der Beobachtungen der »Reformatoren« von Gutzkow/Bulwer kritisiert: Sie bewegen sich immer nur im Rahmen der Sphäre der Ideen, ohne diese je in Verbindung mit der Materie zu bringen. Einem Aspekt jungdeutscher Journalistik gemäß wird hier von der eher propagandistischen Tendenz zur Spaltung in der öffentlichen Debatte Abstand genommen. Nicht die eventuelle Verortung des Schreibenden in einem der Lager in der öffentlichen Meinung kann erhellend für diese Schrift sein. Der im engeren Sinne politischen Zielsetzung wird diejenige der Vermittlung und des Verstehens vorangestellt. Wollen diejenigen, die ebenfalls über die Zeit bzw. das Jahrhundert und die Zeitgenossen schreiben, deren »Quintessenz« erfassen, so verfolgt Gutzkow/Bulwer im Gegensatz dazu einen anti-synthetisierenden Anspruch, der als solcher jede Erscheinung als bedeutungstragend betrachtet, jeder Tendenz Rechnung trägt. Schließt man noch an die im Kapitel ›Epistemologie der Latenz‹ entwickelte Idee der ›Latenz‹ als Prädikat des semiologischen Verhältnisses zwischen Signifikant und Signifikat, Zeichen und Abstraktem/Abwesendem an, so sind die Erscheinungen hier nicht nur primär als Konkretionsinstanzen von etwas Immateriellem (Geist) oder von einer aufgrund ihrer Ausdehnung und Komplexität schwer darzustellenden Entwicklung (Kulturhistorie) zu konzipieren. Gilt ›Latenz‹ als Ermöglichungsbedingung für eine zeitdiagnostische Haltung, so lässt sich das Latente anderswo lokalisieren – in den Erscheinungen selber. Sie sind an sich, per se schon bedeutungstragend. Bleiben einige Fragen offen, so liegt das vielmehr am Übergangscharakter des eigenen Zeitalters, an einer zeitlichen, nicht aufzuhebenden Latenz. Der Unterschied des Programms der Kulturphysiologie, die Martina Lauster zufolge diesem Werk zugrunde liegt, besteht in der Tatsache, dass 1. die Entwicklungen des Zeitalters, mit denen die Erscheinungen in Zusammenhang stehen, keinem vorbestimmten Kursus entsprechen; 2. die Erscheinungen wegen gewisser Aspekte ›exzentrisch‹ bleiben können. Im Kapitel ›Das Jahrhundert‹ befasst sich Gutzkow mit der Bestimmung der Tendenzen im 19. Jahrhundert, die von historischer Relevanz sind bzw. sein werden – also einer geschichtsphilosophischen Frage schlechthin (»Welches ist das Saatkorn unsres Jahrhunderts, welches werden seine Früchte seyn?«48). weitere Komponente für die prägende inklusive Haltung bildet das gesteigerte Augenmerk auf Raumkategorien: Bei der jungdeutschen Journalistik impliziert das eine bei den zu analysierenden Phänomenen komparatistische, die nationalen Grenzen übersteigende Perspektive (›Welt‹). Die Fokussierung auf Raumkategorien kennzeichnet die Literaturkritik und auch Gutzkows alternative Geschichtsphilosophie. 47 Den Begriff des ›Modernen‹ verwendet Gutzkow ebenfalls wertungsfrei: »Vorzugsweise das Neue ist es nicht. Es ist […] oft genug das Alte, wenn auch im neuen Sinne genommen«, Gutzkow 2010 [1837], S. 126. 48 Ebd., S. 61.
146
Bildgebung
Während in der öffentlichen Debatte die Vorstellung herrscht, dass das 19. Jahrhundert wie übrigens das vorherige in eine Revolution gipfeln könnte, wird hier die vermeintlich revolutionäre Tendenz der Zeit dezidiert negiert: Das Jahrhundert werde, so die These, den »Dualismus« in der modernen Bildung, also den von Wissen und Leben, überwinden; in diesem Sinne könne vielmehr von einer »Kulturrevolution« die Rede sein. Von dieser Vorstellung ausgehend erfolgt eine Art Korrektur der in der öffentlichen Debatte gängigen Interpretation der Zeiterscheinungen bzw. der doxa: »Die erste große Erscheinung unseres Jahrhunderts beweist die Richtigkeit dieser Ausführung. Die Revolution gebar aus ihrem Schooße einen Tyrannen, der sie bändigte. Napoleon planirte dieß zackige […] Ufer der Revolution, wo eine freche und lüsterne Begier des Individuums, sich selbst an die Spitze der Ereignisse zu stellen, eine Reihenfolge der unglückseligsten Schiffbrüche hervorbrachte. […]. Es ist nicht schwer, von dem Auf- und Niedergang dieses großen historischen Meteors bis auf den heutigen Moment die allmähliche Tendenz der Ereignisse zu verfolgen […].«49
An der Parabel Napoleons lassen sich die Geschichte und die Tendenzen Europas ablesen – gerade aus den unterschiedlichen Interpretationen von Napoleons Aufstieg und Niederlage resultieren die jeweiligen Fronten in der vormärzlichen öffentlichen Debatte. So entspringt der Widerstand gegen Napoleon keineswegs dem Patriotismus, der laut Gutzkow/Bulwer auch nicht mehr unter den Tendenzen des Jahrhunderts zu nennen ist; für den Fall Napoleons sind vielmehr miteinander verwobene Tendenzen verantwortlich zu machen, die für die mit überkommenen Begriffen nicht zu ermittelnde Komplexität der modernen Zeit sowie des modernen Staates repräsentativ sind. In diesem Kapitel werden nicht nur die historische Figur Napoleons, sondern auch lebende Zeitgenossen, die zumeist zum (fingierten) Bekanntenkreis des Schreibenden gehören, kurz dargestellt. Die Darstellung erfolgt unter Rückgriff auf die traditionsreiche, hinsichtlich ihres sozial- und kulturanalytischen Potenzials ebenfalls von englischen und französischen Vorbildern stammende Form der ›Charakteristik‹. Bekanntlich erlebt sie zwischen Frühromantik und Vormärz in literaturkritischen und -geschichtlichen Diskursen Hochkonjunktur50. In diesem Werk erlebt sie allerdings eine spezifische Aktualisierung: Wie sich bereits im Falle Napoleons beobachten lässt, weisen die dargestellten Individualitäten Beispielcharakter auf, indem sie die formulierten Sachverhalte konkretisieren und veranschaulichen. Um die Gleichzeitigkeit von ›avancierten‹ 49 Ebd., S. 69–70. 50 Vgl. dazu Gunter Oesterle, ›Kunstwerk der Kritik‹ oder ›Vorübung zur Geschichtsschreibung‹? Form- und Funktionswandel der Charakteristik in Romantik und Vormärz. In: Wilfried Barner (Hg.), Literaturkritik – Anspruch und Wirklichkeit, Stuttgart 1990, S. 64–86; Francesco Rossi, Prolegomena zur Theorie und Geschichte einer deutschen Gattung – nebst komparatistischer Bemerkungen. In: ›Scientia Poetica‹ 2017/21, S. 38–63.
Karl Gutzkows Die Zeitgenossen (1837)
147
und ›rückgängigen‹ Tendenzen sowie die besondere Rolle des Materialismus im 19. Jahrhundert zu beweisen, beschreibt Gutzkow/Bulwer drei, für unterschiedliche Generationen stehende Mitglieder einer jüdischen Familie: Sie »[veranschaulichen] drei Abstufungen der Bildung [und] die verschiedenen Phasen unsrer Zeit«51. Die Darstellung folgt, wenigstens in diesem Fall, einem festen Schema: Beschrieben werden Aussehen, Kleidung und Verhalten, um dann durch prägnante Formulierungen (und Katachresen) ihre Repräsentativität für die Zeit zu betonen: »Alles dieß [Aussehen und Verhalten des Großvaters des Hauses] ruft eine verschwundene Zeit zurück […]. Der Sohn des Hauses […] spricht die meisten neuern Sprachen, zeichnet, malt, ist Virtuose auf dem Pianoforte, componirt, dichtet, er ist ein Genie. […]. Er steht, kaum wissend, daß er Jude ist, an der Spitze eines Comité’s zur Emanzipation der Israeliten. […]. Moritz ist ein Kind des Tages und des Jahrhunderts. […]. Wer steht […] in der Mitte zwischen diesen beiden Extremen? Der Herr des Hauses, der Besitzer der Firma […]. Aktien, Dividenden, Coupons, Eisenbahnen, Kanäle beleben seine rationelle Phantasie, Tunnelideen untergraben sein Inneres. Er interessirt sich für Alles, wenn es Interessen trägt. […]. Er ist Held des Moments, der Repräsentant einer Weisheit, die in der That die allgemeine Weltweisheit werden wird«52
Die Dichte und erhöhte Zeichenhaftigkeit dieser Porträts können oft auch im Dienste einer karikaturartigen Steigerung stehen. Dies lässt sich mit Auszügen aus der im Kapitel ›Die neue Welt‹ enthaltenen Charakteristik gut verdeutlichen: »Ja, Mr. Point hat mir’s erlaubt, daß ich ihn, ob er gleich mein Freund ist […], in meinen Zeitgenossen aufführen darf, und zwar […] mitten unter den großen und kleinen Charakteren, welche ich mir in diesen Unterhaltungen zu zeichnen vorgenommen habe. Wodurch ist Mr. Point so bemerklich? Durch sein ungeheures Rechnungstalent. […]. Was mir weit bemerkenswerther geschienen hat, ist die mathematische Zurichtung seiner Familie. […]. Jedes Kind hat ein Buch, in welchem die Kosten, die es verursacht hat, eingetragen werden. Es ist dieß eine finanzielle Biographie von Kindesbeinen an. […]. Ich muß gestehen, daß mir diese Methode, alle Tugenden und Thorheiten der Kinder in barem Gelde anzuschlagen, fürchterlich ist. […]. Dieß ganze Prinzip einer allzu gewissenhaften Gerechtigkeit gegen die künftigen Erben scheint mir durchaus nicht dem Charakter der europäischen Gesellschaft angemessen zu seyn. Nur ein Bewohner der vereinigten Staaten dürfte im Stande seyn, bis in diesem entsetzlichen Grade die Mathematik zu einer Hülfwissenschaft der Moral zu machen. Weil ich in diesem Kapitel von Nordamerika sprechen will, spart’ ich mir Mr. Point als einen Uebergang aus der alten in die neue Welt auf.«53
Die zur Karikatur neigende Typologisierung wird bei diesem Beispiel vom offensichtlich symbolischen Namen bereits signalisiert (»Mr. Point«); dass dieser 51 Gutzkow 2010 [1837], S. 90. 52 Ebd., S. 91–92. 53 Ebd., S. 102–104.
148
Bildgebung
Zeitgenosse sich hauptsächlich ausgehend von dem Aspekt, der hier einzuleiten und zu behandeln ist (Verschränkung von ›Moral‹ und ›Quantifizierung‹ in der »neuen Welt«), definieren lässt, ist ebenfalls Teil der angestrebten karikaturartigen Amplifikation. Aus diesem Beispiel lassen sich weitere, für die Form der ›Charakteristik‹ im Vormärz exemplarische Aspekte beobachten: 1. Sie erscheint nur selten als selbstständiger Text und wird vielmehr in breitangelegte Abhandlungen eingebettet. 2. Die ›Charakteristik‹ lässt sich nicht mit der Biographie gleichsetzen, weil sie nicht darauf abzielt, einen Lebensabschnitt chronologisch zu erzählen; in ihrem Fokus steht vielmehr die Charakterstudie54, die Beschreibung von überindividuellen – weil zeittypischen – Aspekten des Verhaltens oder der Persönlichkeit des jeweiligen Zeitgenossen. Es handelt sich somit um ›Porträts‹, bei denen durch die direkte Beobachtung ein Synchronschnitt geliefert wird. Im Rahmen der postulierten Verschränkung von ›Charakteristik‹ und Erfassung gegenwärtiger Verhältnisse erscheint die häufig vorkommende und metaphorisch fungierende Bildsemantik – »Pinselstriche«, »Malerei« – als symptomatisch. Für die programmatisch geäußerte Entscheidung, von den »Individuen« auszugehen, die im Kapitel ›Die Erziehung‹ eine Entsprechung in der textuellen Platzierung der Charakteristik findet, lassen sich unterschiedliche Gründe plausibilisieren: Nicht zu unterschätzen ist die Unterhaltungsfunktion, die mit dieser Modalität der Darstellung korreliert. Die Tatsache, dass über einen vermeintlichen Bekannten referiert wird, vermittelt darüber hinaus den Eindruck einer wirklichkeitsnahen Darstellung, die durch die eingebettete Anekdote noch gesteigert wird. Ein zeitgenössisches Phänomen mittels der entsprechenden Lebensform darzustellen, entspricht einer gewissen erzählökonomischen Strategie, die sich die Unmittelbarkeit der Darlegung zum Zweck macht: Mittels Konkretion kann nämlich sehr prägnant auf in kultureller Hinsicht distinktive Aspekte hingewiesen werden. Gattungs- und wissenschaftsgeschichtlich argumentierend treten allerdings noch weitere Gründe in den Mittelpunkt: Die Charakteristik wird da eingesetzt, wo eine systematische Darlegung oder die tradierten Schemata zu kurz greifen55. Die supplementäre Funktion der Charakteristik ist also in diesem Zusammenhang, so die These, gerade mit der beispiellosen Aufgabe einer möglichst erschöpfenden ›Zeitdarstellung‹, die sich 54 Vgl. dazu Rossi 2017, S. 45. 55 In seinem Forschungsüberblick zur Form der ›Charakteristik‹ verweist Francesco Rossi auf Klaus Weimars Befund, nach dem dieser Gattung eine »zentrale Rolle […] in der Entwicklung der modernen literarischen Historiographie« und zwar »im Übergang von der systematischen Literärhistorie (›historia literaria‹) zu den modernen Literaturgeschichten« zukommt. Bezüglich der Wertungskategorien weist dieser Übergang und mithin die Darstellungsform der Charakteristik auf die Ablösung der »institutionalisierten Regelpoetiken« durch das »Prinzip des Individualstils« hin. Ebd., S. 42.
Karl Gutzkows Die Zeitgenossen (1837)
149
Gutzkow mit dieser Abhandlung vornimmt, in Verbindung zu setzen. Sie signalisiert die Notwendigkeit einer alternativen Darstellungsweise. Es lässt sich die Hypothese aufstellen, dass der Bezugspunkt für diese Aktualisierung der ›Charakteristik‹ die aufklärerische Philosophie sein kann: Gemeint sind Leibniz’ Erkenntnislehre, Wolffs Moralistik sowie Kants ›anthropologische Charakteristik‹56. Während dem aufklärerischen Charakterbegriff das »Schwingen zwischen dem Typischen und dem Individuellen«57 inhärent ist, wird hingegen bei Gutzkow die Kategorie des Sozialen bei der Skizzierung der Charaktere stark gemacht und dabei der Aspekt des ›Typischen‹ bzw. des ›Überindividuellen‹ vom hier zentralen Begriff des ›Zeitgenossen‹58 übernommen. Dass die Individuen primär als »Zeitgenossen«, also im Hinblick auf deren Verwandtschaft mit der ›Zeit‹ betrachtet werden, ist noch in zweierlei Hinsicht bedeutsam: 1. Gutzkows Begriffsverwendung schließt mithin offensichtlich an die sich seit der ›Sattelzeit‹ abzeichnende Bedeutung von ›Zeitgenossenschaft‹/ ›Zeitgenossen‹ an. Dabei wird nicht die Verwandtschaft mit anderen Menschen »in derselben Zeit«59 betont, auf die der Begriffsgebrauch seit etwa dem 16. Jahrhundert hinweist, sondern die ›Genossenschaft‹ mit dem reflexiv gewordenen und metonymisch verwendeten Begriff von ›Zeit‹60. 2. Diese Bezeichnung signalisiert außerdem sehr deutlich die privilegierte Beobachtungsebene bei den durchgeführten Porträts: Nicht die psychologische und/oder private Dimension, die idealerweise das Besondere oder Einmalige an jedem Individuum umschreibt, tritt bei diesen Charakteristiken in den Vordergrund, sondern ihre Angemessenheit, kollektive Erfahrungen zu verkörpern und anschaulich werden zu lassen. Da sie als ›Zeitgenossen‹ bezeichnet werden, ist der Umstand, einen gemeinsamen, öffentlichen raumzeitlichen Zusammenhang zu bewohnen und ihm Kontur zu verleihen, von Belang. Im Hinblick auf diese Funktionalisierung der Porträts gehört diese Sammlung zu den Beiträgen der frühen Soziologie61. Neben der wissenschaftsgeschichtlichen und interdisziplinären Bedeutung muss allerdings die zum Teil bereits angedeutete epistemologische Funktion der Porträts betont werden: Sie ermöglichen – und zwar im Modus des Vortheoretischen und Nicht-Begrifflichen – die Artikulation von und Auseinandersetzung 56 Ebd., S. 47. 57 Ebd., S. 52. 58 Für die kaum zu überschätzende Zentralität dieses Begriffs spricht u. a. die Tatsache, dass er im Titel des englischsprachigen Vorbildes gar nicht vorkommt. 59 Lehmann 2020, S. 448. 60 Vgl. dazu ebd., S. 447–450. 61 Sozialfigurative Darstellungen mit gegenwartsdiagnostischer Funktion weisen in der Soziologie eine lange Tradition auf und bewegen sich gewissermaßen konstitutiv »an der Schnittstelle zwischen Literatur, öffentlichem Diskurs und Soziologie«, Sebastian J. Moser/ Tobias Schlechtriemen, Sozialfiguren – zwischen gesellschaftlicher Erfahrung und soziologischer Diagnose. In: ›Zeitschrift für Soziologie‹ 2018/47 (3), S. 166.
150
Bildgebung
mit neuen sozialen Erfahrungen. Die hier dargelegten Figuren besitzen aufgrund ihrer Fähigkeit, auf historisch-soziale Konstellationen hinzuweisen, den Status von »Emergenzphänomenen«62. Der Aspekt der ›Zeitgebundenheit‹ unterscheidet diese Gebilde noch dezidierter von theoretischen Konzepten; die Porträts sind somit nicht als Supplemente eines Begriffs bzw. einer Definition zu betrachten. Es wird außerdem nicht angestrebt, den Stand des Vortheoretischen zu überwinden; im Einklang mit der anti-spekulativen Ausrichtung des Werks erlangen die Porträts demnach einen intrinsischen epistemologischen Wert. Der antisynthetische Ansatz hängt nicht zuletzt auch mit dem Gegenstand und dem Vorhaben zusammen, über die gegenwärtige Zeit möglichst erschöpfend zu referieren: Dem offenen Gegenwartsbegriff, der sich von der Vergangenheit emanzipiert hat, entspricht der ebenfalls offene und prozessuale Charakter dieses Unternehmens63. Offenheit und Gleichwert der im Prinzip unendlich ausdehnbaren Reihe der öffentlichen Charaktere resultieren auch aus der laut Gutzkow für das moderne Zeitalter grundlegenden Tendenz zur ›Spezialisierung‹, auf die er nicht ohne kulturkritische Akzente mehrfach hinweist64. Diese Tendenz zwingt die Zeitdiagnostikerin oder den Zeitdiagnostiker zu einer Vervielfältigung der Perspektiven, um die entsprechenden Bereiche in den Blick zu nehmen. Die Poetik des Enzyklopädischen, die Gutzkow in diesen Jahren entwickelt, scheint somit für den oft festgestellten Prozess der Ausdifferenzierung symptomatisch zu sein. Neben der Tendenz zur Spezialisierung beschreibt Gutzkow/Bulwer auch diejenige zur Nivellierung als kennzeichnend für das 19. Jahrhundert bzw. das moderne Zeitalter überhaupt. Die folgende zeitdiagnostische Stelle weist auf die Spezifik der neuen Zeit hin: »Die alte Zeit war auf den Menschen berechnet, jetzt muß der Mensch nach ihr sich einrichten. […]. Der Jüngling, der Mann, die Bildung des Weibes; alle diese Stadien sind [im 18. Jahrhundert] leichter zu ermessen, als die entsprechenden in unsrer Zeit. Von
62 Ebd., S. 171. 63 Offenheit und prozessualer Charakter hängen mit den Fragen zusammen, die behandelt werden, wie etwa im Kapitel ›Das Leben im Staate‹ betont wird: »Fragen dieser Art [die politische Frage] kann man nicht erörtern; man kann sie nicht mit Für und Wider dialektisch hin und her werfen, sie lassen sich nur andeuten und festhalten, wie die fliegenden Momente einer räthselhaften Gemüthsstimmung. Das Unterpfand aller ewigen Ideen liegt in der Unfähigkeit, mechanisch manipulirt zu werden, so und so, mit Vorder- und Nachsatz, mit Anfang, Mittel und Ende«, Gutzkow 2010 [1837], S. 214. 64 Ob die oben beschriebene karikaturartige Steigerung auch Produkt einer kritischen Sozialdiagnostik ist, wie dies etwa bei Rosenkranz und Freud der Fall ist, lässt sich an den programmatischen Aussagen nicht festmachen. Die Vermutung ließe allerdings den VorläuferStatus dieses Werks einmal mehr hervorheben. Vgl. dazu Günter Oesterle/Ingrid Oesterle, Artikel ›Karikatur‹. In: Joachim Ritter/Karlfried Gründer (Hg.), Historisches Wörterbuch der Philosophie, Band 4 (I–K), Basel/Stuttgart 1976, S. 695–701.
Karl Gutzkows Die Zeitgenossen (1837)
151
den gestickten Westen Louis XIV. zu den englischen Ueberröcken der Regentschaft, von dieser wieder durch die Erfindung der Haarbeutel bis zu den Stulpstiefeln und den großen Brustklappen an den Röcken der Jakobiner […], ist es ein Zeitraum, wo die äußerlichsten Erscheinungen dazu dienen konnten, die inneren Gefühle und Gedanken anschaulich zu machen. Das ist Alles anders geworden. Der Brutus unsrer Tage versteckt sich in einen gewöhnlichen Frack mit einer Reihe von Knöpfen, hinten etwas spitz zugeschnitten, eben so unsre Appius Claudius, unsre verschlagenen Menenius Agrippa. Eine vague Oberflächlichkeit hat sich über die Individuen gelegt und nivellirt ihre Eigenthümlichkeiten. Das kompresse, knappe und zugeknöpfte Wesen unsrer Zeit schnürt zwar noch nicht alles Blut aus dem Herzen weg; aber die Menschen sind sich ähnlicher geworden, ihr Charakter dehnt sich nicht besonders aus; er ist vielleicht sehr energisch, aber man kann ihn mit zwei Fingern umspannen. Meine Aufgabe ist daher ehr schwierig. Die Massen unsrer Jahrhunderte lassen sich leichter zeichnen, als die Individuen.«65
Diese lange Stelle aus dem Abschnitt ›Der Mensch des neunzehnten Jahrhunderts‹ ermöglicht es schließlich, auf eine Reihe von weiteren, für dieses Werk kennzeichnenden Aspekten aufmerksam zu machen: Die Zeitdiagnose erfolgt hier meistens mittels des Vergleichs mit dem 18. Jahrhundert. Dem Phänomen der Mode wird nicht nur ein großer Teil des Kapitels Das Moderne gewidmet – und dadurch der Bestimmungsversuch dieses »rätselhaften« Begriffs unternommen; detaillierte Beschreibungen der Kleidung sowie der Einrichtung prägen vielmehr das Werk im Ganzen und kommen häufig im Zusammenhang mit den in den Kapiteln unterschiedlich platzierten Porträts vor. Die Hinweise auf Kleidungstrends dienen hier dazu, relevante Phänomene bzw. Änderungen zu offenbaren – sie sind für diese Änderungen symptomatisch und zugleich in der Lage, den tiefgreifenden Wandel unmittelbar zu veranschaulichen. Diese Stelle verweist darüber hinaus auf den Prozess der Typologisierung der Charaktere (»Der Brutus unsrer Tage«, »unsre Appius Claudius, unsre […] Menenius Agrippa«), der zusammen mit der bereits genannten Tendenz zur karikaturartigen Steigerung die Darstellung der Figuren kennzeichnet. Hinsichtlich des propositionalen Gehaltes lassen sich anhand von dieser Stelle in der jungdeutschen Essayistik ebenfalls ubiquitär vorkommende Positionen zusammenfassen: Die Zeit prägt den Menschen; früher bzw. im 18. Jahrhundert wurde das Gegenteil vermutet. Im Grunde handelt es sich dabei um die negative, weil in eine Verlust- und Verfallsgeschichte eingebettete Wendung der – eben in Abhebung vom letzten Drittel des 18. Jahrhunderts – für den Vormärz kennzeichnenden Umkehrung des Bildungsideals66. Im Hinblick auf ihre Funktion stehen Zeichen bzw. »äußerlichste[] Erscheinungen« nicht mehr im Zusammenhang mit einem ›inneren Kern‹, den sie an den Tag legen sollen. Im modernen Zeitalter stehen sie 65 Gutzkow 2010 [1837], S. 16–17. 66 Vgl. dazu Fohrmann 2005.
152
Bildgebung
vielmehr im Dienste der sozialen Zuordnung und der öffentlichen Wirkung und können mithin in völliger Diskrepanz zu dem ›Charakter‹ bzw. dem ›inneren Kern‹ stehen. Die ›totale Öffentlichkeit‹ führt dann aus Sicht des Schreibenden zur negativen Folge der Nivellierung.
3.1.3 Zur Funktion fiktionaler Prosa Am Ende des ersten Buches, eine Scharnierfunktion zwischen erstem und zweitem Band ausübend, ist ein fiktionaler Text platziert: ›Sitte und Sitten. Aus einem ungedruckten Romane‹. Beim Lesen des Inhaltsverzeichnisses fällt auf, dass dieser Auszug aus einem unveröffentlichten Roman dasselbe Thema wie das erste Kapitel des zweiten Buches behandelt (›Sitte und Sitten‹). Es stellt sich somit die Frage nach der Funktion ästhetischer Praxis und deren Beitrag innerhalb einer essayistischen Abhandlung. In welchem Verhältnis steht dieser Text zu den vorherigen und den folgenden Kapiteln? Vermittelt er eine andere Perspektive über das Thema? Einige Informationen über Struktur und Diegese dieses Romanauszuges zu liefern, erweist sich als unerlässlich. Der fiktionale Text ist durch eine intradiegetische Perspektive gekennzeichnet: Er besteht aus Briefen, die sämtlich von der Protagonistin Rebekka an ihren Vetter, den Pfarrer, adressiert sind. Das ländlichkleinstädtische Leben zeitweilig verlassend erzählt sie von den vielen Begegnungen, die sich während der Fahrt nach London ereignen, und dem Wiedersehen mit ihrer Schwester Bab und deren Töchtern. Sowohl im sich on the road entfaltenden Teil als auch nach ihrem Eintreffen in London kommt Rebekka mit neuen Lebensformen und Sitten67 in Berührung, denen gegenüber sie von Anfang an, durch die Adressierung an einen Gleichgesinnten bestärkt, ihren konservativen und kulturkritischen Standpunkt an den Tag legt (»wie weit [hat] sich die jetzige Zeit von dem, was früher Anstand und Schuldigkeit mit sich brachten, entfernt«68). Der Anlass für diesen langen Familienbesuch ist kein glücklicher: Denn der Tod von Rebekkas Schwager bringt eine Reihe von Konsequenzen mit sich: »was hab’ ich mit ansehn und selbst erleben müssen, was kommen jetzt für Dinge vor, für Lebensarten, für Urtheile, was für ein Geist ist in unsere Familie eingedrungen! Meine Schwester wurde früh in den Strudel des londoner Lebens gerissen; allein so 67 Zu erwähnen sind beispielsweise die Figuren bzw. die Zeitgenossen, die Rebekka im Gasthof und in der Landkutsche kennenlernt, sowie das Treffen mit dem Bruder Evan, vgl. dazu Gutzkow 2010 [1837], S. 335–338 (»Von jedem Comfort war er entblößt […]; damit nannte er sich einen Mann des Jahrhunderts, einen indischen Gymnosophisten, einen Johannes in der Wüste, der dem neuen Evangelium des Wassers vorangegangen wäre«). 68 Ebd., S. 340.
Karl Gutzkows Die Zeitgenossen (1837)
153
lange ihr Mann lebte, blieb sie oben auf. Er starb und hinterließ eine trauernde Wittwe mit drei Töchtern; wir alle fürchteten, der Schlag würde ihr ans Leben gehen. Sie ertrug ihn jedoch. Sie tröstete sich. Sie wurde leichtfertig, ach, und ist das nicht mehr, was sie war.«69
Wie das Zitat andeutet, ereignet sich bei Bab und ihren Töchtern eine ›Wende ins Weltliche und Öffentliche‹; sie wird zum Anlass, im Laufe dieser Skizze weiter über die neuen Sitten und das Leben in der Großstadt zu referieren. Ein ›Gegenwartsschlag‹ – im Sinne einer besonders zeittypischen Begebenheit – beunruhigt aber die Familie: Gerade am Tag vor Rebekkas Ankunft erscheint in dem von der Londoner High Society viel gelesenen Blatt ›Der Satirist‹ ein satirisches Pasquill, das den neuen Lebenswandel dieser Familie böswillig porträtiert. Obwohl die Form des Pasquills bis mindestens in die Frühe Neuzeit zurückreicht, dient dieses Handlungselement offenbar der zugespitzten Darstellung der Zeitverhältnisse, des neuen Leseverhaltens sowie des Milieus, welches nun Bab und ihre Töchter umgibt. Diese Begebenheit ist nämlich für eine hoch-zivilisierte soziale Umwelt repräsentativ, die sich ausschließlich im und für das Öffentliche(n) entfalten und durchsetzen will. Sie verweist damit aber auch auf neue Literatur- und Leseverhältnisse70. Zur Öffentlichkeit sowie zur Emanzipation der Frau äußert sich hingegen Bab in einem Dialog mit der Schwester:
69 Ebd., S. 323–324. 70 Vgl. zur Tendenz zur Selbstreflexion in der Vormärzliteratur Christoph Schmitt-Maaß ›Ein nothwendiges Product dieser Zeit und der eigentliche Spiegel ihrer selbst‹ (Robert Prutz). Die poetologische Reflexion der Vormärzliteratur auf geänderte Produktionsverfahren. In: Christian Liedtke (Hg.), Literaturbetrieb und Verlagswesen im Vormärz, Forum Vormärz Forschung, Jahrbuch 16 (2010), Bielefeld 2011, S. 39–59. Schmitt-Maaß sieht »ein[en] Perspektivwechsel gegenüber der älteren Vormärzforschung [als] angebracht. Die Literatur der Jahre zwischen 1815 und 1848 wäre […] nicht länger ein vornehmlich politischer, sondern ein poetologischer Akt, also eine durch neue Produktionsbedingungen erzwungene Form der poetischen Selbstreflexion – und zwar mit den Mitteln der Poesie selbst«, S. 42. Die Tendenz zur Selbstreflexion in der Literatur lässt sich auch an einer anderen Stelle dieser Skizze beobachten: Mit Bezug auf neue Rezeptionsverhältnisse, und zwar auf die Wechselwirkung von Literatur und Leben, referiert Rebekka, auch diesmal in der Funktion einer höchst kritischen Beobachterin, über das Leseverhalten ihrer Nichten: »Die Töchter lasen […] die Erzeugnisse einer Literatur, die in Frankreich und England allmählig alle Sittlichkeit zu untergraben droht. Mit gierigen Blicken hafteten sie an den leidenschaftlichen Gemälden, welche in diesen sich jetzt täglich mehrenden staatswidrigen Schriften aufgestellt werden. […]. Meine Schwester, statt diese Schriften zu verbrennen, las sie selbst mit der größten Theilnahme und entgegnete mir, als ich ihr darüber Vorwürfe machte, daß es nur der Styl und die kunstvolle Behandlungsweise wären, welche sie zur Theilnahme an diesen, wie sie sagte, interessanten und für die Bildung der jetzigen Jugend beinah’ unerlässlichen Schriften bestimmte. Konnte es unter solchen Umständen fehlen, daß diese dem Verderben entgegeneilende Familie sich auch Verhältnisse zu schaffen suchte, welche ganz nach der romanhaften Musterwirthschaft, die in ihrer Phantasie lebte, eingerichtet waren!«, Gutzkow 2010 [1837], S. 341.
154
Bildgebung
»›Unsere ganze jetzige Gesellschaft geht darauf aus, die Fesseln der überlieferten Gewohnheit zu sprengen. Ein junges Mädchen war früher nur dazu bestimmt, sich von den Männern aufsuchen zu lassen und sich so viel wie möglich das interessante Lüstre einer nonnenhaften Zurückgezogenheit zu geben. Jetzt würde aber der, welcher sich zu verbergen sucht, auch wirklich in die Gefahr kommen, verborgen zu bleiben; alles will jetzt heraus, alles will sich jetzt sehen lassen und an dem Wettkampf der öffentlichen Meinung Theil nehmen; das Talent, was man gegenwärtig hat, kann man nur in seiner öffentlichen Entfaltung bewähren, man kann sich nicht mehr auf sein Wesen verlassen, sondern muß suchen, es auch durch den Schein zu unterstützen. […].‹«71
An dieser äußerst nüchternen Zeitdiagnose, die Rebekka dann in ihrem Brief nicht ohne Kritik und Ironie als »Vortrag« bezeichnet, lassen sich bedeutsame Aspekte von Gutzkows fiktionaler Produktion sowie der Erzählliteratur im Vormärz überhaupt exemplarisch beobachten: Sie oszilliert, so Peter Hasubek, zwischen »erzählerisch-fiktionalem Erzählansatz und kulturgeschichtlich-belehrender Schreibintention«72. Die zum Essayistischen tendierende Schreibweise lässt sich nicht nur inhaltlich anhand von Stellen wie der eben wiedergegebenen feststellen – sie steuert in diesem Fall, so die These, auch die (vermutlich fingierte73) Selektion (oder eben die Konzeption) des in die Sammlung eingebetteten Auszuges: Im Mittelpunkt steht hier nicht »die Schilderung eines kontinuierlichen spannenden Geschehens, sondern die […] Vermittlung eines zeittypischen Phänomens […] von allgemein gesellschaftlichem Interesse«74. So werden die für die Zeit- und Kulturgeschichte besonders repräsentativen Figuren, denen Rebekka begegnet, sehr ausführlich beschrieben, ja porträtiert (man denke auch an die karikaturartige Darstellung des Bruders). Ähnliche Beobachtungen lassen sich in Bezug auf andere, für den Sittenwandel sehr bedeutsame Phänomene anstellen, wie etwa die täglichen Unterrichtsstunden »in mimischplastischen Darstellungen«, die ein französischer Schauspieler Lettice, einer der Töchter Babs, gibt. Im Einklang mit der geradezu totalitären Tendenz zum Öffentlichen lehrte dieser Schauspieler der jungen Frau »für jedes ihren Busen bewegende Gefühl [,] eine entsprechende Attitüde«75 zu entwickeln und somit in öffentlichen Zusammenhängen parat zu haben. Noch symptomatischer für die »kulturgeschichtlich-belehrende[] Schreibintention« erweist sich die Entscheidung, den Auszug enden zu lassen, ohne über 71 Ebd., S. 341–342. 72 Peter Hasubek, Zwischen Essayismus und Poesie. Karl Gutzkows Erzählungen. In: Roger Jones/Martian Lauster (Hg.), Karl Gutzkow. Liberalismus – Europäertum – Modernität, Forum Vormärz Forschung, Vormärz-Studien, Band VI, Bielefeld 2000, S. 203. 73 Der Text ist wahrscheinlich nur als Skizze in diesem besonderen Publikationszusammenhang konzipiert worden. Im Nachlass ist keine Spur von diesem Roman- oder Novellenprojekt zu finden. 74 Hasubek 2000, S. 203. 75 Gutzkow 2010 [1837], S. 343.
Karl Gutzkows Die Zeitgenossen (1837)
155
das Schicksal Felicias, einer anderen Tochter Babs, die entführt worden ist, zu referieren. Eine in handlungs- und darstellungstechnischer Hinsicht wichtige und spannende Entwicklung fällt also aus, weil sie für die angestrebte Vermittlung eines Zeitgemäldes nicht relevant ist. Aus diesem Grund wird es dem Nachtrag des Autors der essayistischen Sammlung überlassen, vergleichsweise sehr schlicht darüber zu referieren. Er begründet diese Entscheidung folgendermaßen: »Sollten sich unsre Leser für das Schicksal Feliciens inniger interessiren als ihre Mutter und Schwestern, so müssen wir leider gestehen: daß eine Darstellung desselben dem Zweck unsres Buches nicht angemessen seyn würde. Tante Rebekka hat uns nur eine ungefähre Fernsicht in das Kapitel: Sitte und Sitten der Zeitgenossen eröffnen sollen.«76
So besteht die Funktion dieser Skizze im Kontext der Sammlung darin, in das Thema des nächsten Abschnittes einzuführen und mittels erzählerisch-darstellender Abrundung einige in den vorherigen Kapiteln behandelte Phänomene zu rekapitulieren. Erst im Nachtrag wird darüber hinaus referiert, dass Macready, ein von Bab und ihrer Tochter Felicia angehimmelter Gentleman, »aus Neckerei und fashionablem Zeitvertreib«77 mit der Unterstützung Hilarys, einer Dienstperson im Haus Babs, das Pasquill geschrieben und verbreitet hat. Das führt zu der These, dass Phänomene wie die auf die Verschlechterung des Rufs bedachte Veröffentlichung des Pasquills und die (doppelte) Entführung – obwohl eindeutige Momente einer Trivial- bzw. Unterhaltungsliteratur – nicht primär als handlungs- und spannungsgenerierende Elemente eingesetzt werden, sondern der Darstellung der Zeit und insbesondere dieses Milieus dienen. Im Nachtrag referiert der Autor darüber hinaus über intertextuelle Bezüge: Einige im Romanfragment dargestellte Situationen seien nämlich von einem Roman des französischen Autors Leone Leoni inspiriert worden, dessen Lektüre er seinen Leserinnen und Lesern empfiehlt, »wenn sie, vor Beginn des zweiten Bandes unsrer Zeitgenossen erst eine andere zerstreuende Abwechslung haben wollen«78. Die Skizze fungiert somit auch als Intermezzo und dient der Unterhaltung sowie der Einprägung bereits thematisierter und der Einführung neuer Inhalte. Der ausdrückliche Verweis auf intertextuelle Bezüge verrät, so die These, die Absicht, den Text in einen gewissen literarischen Diskurs einzubetten, statt auf Wertungskriterien, wie etwa ›Originalität‹, zu setzen.
76 Ebd., S. 352. 77 Ebd., S. 352. 78 Ebd., S. 353.
156
3.2
Bildgebung
Die Verzeitlichung kritischer Praxis und die Kategorie des ›Modernen‹ – Laubes Moderne Charakteristiken (1835)
Die Publikation von zeit- und literaturkritischen Sammlungen zählt im Vormärz zu einem konstitutiven Aspekt editorischer Praxis. Da historisch-praxeologische Untersuchungen, die als solche eher kontextorientierte Informationen über diese Tendenz liefern könnten, (noch) nicht vorliegen, kann man sich bei einer Auseinandersetzung mit dieser Publikationsform und der Skizzierung einer ›Poetik der Sammlung‹ nur auf die zumeist in den Paratexten (Titel, Einleitungen, Vorworten, usw.) enthaltenen Aussagen stützen. Von einigen Ausnahmen abgesehen (bspw. Gutzkows Die Zeitgenossen) gehen diese kaum auf die ›materiellen‹ Bedingungen dieser Publikationen ein; sie bringen vielmehr die gleichermaßen auf Produktion und Rezeption wirkende ›metaphysische‹ Instanz der ›Zeit‹ als Bedingung für diese Publikationsform vor. Verweise auf editionsgeschichtliche Aspekte müssen also in der im Folgenden zu skizzierenden ›Poetik der Sammlung‹ teils wegen der Quellen- und Forschungslage, teils aufgrund des überwiegend textwissenschaftlichen Fokus dieser Studie ausbleiben. Einmal mehr wird also auf der Ebene der Aussagen ›Zeit‹ in den Mittelpunkt gerückt. Ganz davon entfernt darin den ›wahren‹ Grund erkennen zu wollen, lässt sich also immerhin an ihrer diskursiven und argumentationslogischen Omnipräsenz festhalten. Heinrich Laubes doppelbändige Sammlung Moderne Charakteristiken bildet in diesem Sinne keine Ausnahme: Die Entscheidung, die zwischen 1833 und 1834 zumeist in der ›Zeitung für die elegante Welt‹ veröffentlichten Artikel retrospektiv als Sammlung zu publizieren, reagiere, so Laube, auf einen besonders dringenden Orientierungsbedarf des Lesepublikums, welcher sich wiederum auf eine neuartige Zeiterfahrung zurückführen ließe. Solche Hintergrundinformationen sind zumeist im als Vorwort fungierenden Textteil enthalten. Im Rahmen einer in der Regel kurzen Textform wiederholt sich die ›Logik der Sammlung‹: Das Vorwort ist nämlich genauso wie die Sammlung Produkt einer retrospektiven Deutungsoperation. Mit anderen Worten: Vorwort und andere Paratexte sind, trotz ihrer mit Blick auf den Gesamttext vorangestellten Situierung, dadurch gekennzeichnet, dass sie zeitlich nach dem Haupttext konzipiert und geschrieben worden zu sein79. Zu einer Theorie des Vorworts sowie zur Funktion der Paratexte überhaupt könnten viele Überlegungen angestellt werden; mit Bezug auf Laubes Sammlung lässt sich jedenfalls daran festhalten, dass Titel und Einleitung in erster Linie eine kohärenzstiftende Funktion haben: Beide weisen auf das ›Moderne‹ als allen Beiträgen, wenngleich 79 Vgl. dazu Uwe Wirth, Das Vorwort als performative, paratextuelle und parergonale Rahmung. In: Jürgen Fohrmann (Hg.), Rhetorik. Figuration und Performanz, Stuttgart/Weimar 2004, S. 603–628, hier: S. 615.
Laubes Moderne Charakteristiken (1835)
157
auf unterschiedliche Art und Weise, gemeinsamen und zugleich zu definierenden Gegenstand hin. Da es sich um eine ›Tendenz‹ handelt, die noch im Entstehen begriffen ist, kann vom ›Modernen‹ keine zufriedenstellende Definition geliefert werden. In diesem Sinne verweist die im Titel enthaltene Pluralisierung samt dem Gattungsbezug (Moderne Charakteristiken) auf den Verzicht auf eine einheitliche begriffliche Zuspitzung. Statt Definitionen werden Beispiele bzw. Porträts angeführt, welche dem hier zu untersuchenden Verfahren der ›Bildgebung‹ gemäß die Funktion haben, dem ›Modernen‹ und seinen vielfältigen Formen Konkretion zu verleihen. Zur hier eingesetzten Form der Charakteristik und zum Verhältnis der Aufsätze zum ›Modernen‹ wird weiter unten ausführlicher referiert. Indem Titel und vor allem Vorwort das, was allen Aufsätzen zugrunde liegt und sich aufgrund der Zusammenstellung überhaupt voraussetzen lässt, zu allererst nennen, erbringen sie die Leistung, die latenten gemeinsamen Fragestellungen manifest werden zu lassen. Über diese Leistung hinaus muss bei Laubes Einleitung auch deren Beitrag zu einer »Praxis der Vorredenreflexion«80 berücksichtigt werden. Eine solche Praxis lässt sich seit dem 18. Jahrhundert beobachten und hängt bei Laube im Grunde auch mit dem Versuchscharakter der Sammlung zusammen. Seine Auseinandersetzung mit der Praxis der Vorredenreflexion und der Vorrede überhaupt geht von der basalen Frage nach der Bezeichnung dieses Textteils aus: »Ich möchte die nächstfolgenden Worte nicht gern übersehen wissen, und nenne sie deshalb nicht Vorrede; obwohl man sich heutiges Tages mehr als sonst um die Wirtshausschilder bekümmert, vielleicht gar zu großen Werth auf Unterscheidungszeichen legt. Auch die Literatur ist in Parteinamen zerspalten und wimmelt von vorgefaßtem Haß und vorgefaßter Liebe. Insofern wäre keine Besorgnis bei dem Titel »Vorrede« nöthig gewesen, denn man pflegt die Vorwörter wie Parteiparolen zu betrachten. Ich wünsche aber nicht, Kampfes-, sondern Friedensgedanken in Bewegung zu setzen, und die folgenden Bände sind nicht geschrieben, um die Fraktionen unsrer Denk- und Schreibweise noch weiter auseinander zu drängen, sondern sie dadurch gegenseitig näher zu bringen, daß ihre Unterschiede klar ausgesprochen, und die Motive derselben im mannigfachen, breiten Leben, nicht bloß in Einzelheiten aufgesucht werden.«81
Bei der Reflexion über die Vorredenpraxis sowie deren Rezeption (»man pflegt die Vorwörter wie Parteiparolen zu betrachten«) vollzieht Laube seine Abgrenzungsbewegung, welche sich in erster Linie darin konkretisiert, diesen Textteil nicht als »Vorrede«, sondern als »Einleitung« zu bezeichnen. Stellt man zunächst einmal bloß lexemgeleitet einige Überlegungen an, welche sich dann im Zusammenhang mit den oben im Klartext genannten Gründen betrachten ließen, 80 Ebd., S. 614. 81 Laube 1835, Band 1, S. V–VI.
158
Bildgebung
dann kann die Bezeichnung ›Vor-Rede‹ die Relevanz dieses Textteils mindern, indem sie betont, dass er vor dem regelrechten Text steht und somit nicht Teil desselben ist. Mit der Bezeichnung ›Einleitung‹ wird hingegen ein inhaltliches Verhältnis zum Haupttext unmittelbar postuliert. Anders als die Vorrede, die durch ihre Voranstellung und mithin ihr Ende den Anfang des Haupttextes markiert, entspricht die Einleitung – nicht zuletzt etymologisch – dem Anfang des Textes. In Laubes Ausführung wird allerdings nicht lexemgeleitet argumentiert, sondern die kritische Reflexion über die zeitgenössische Vorredenpraxis mit dem programmatisch-poetologischen Diskurs verbunden. Die von der Konvention abweichende Bezeichnung sollte in erster Linie die gängige Rezeptionspraxis ent-automatisieren: Die Leserinnen und Leser werden dadurch auf den Textteil überhaupt aufmerksam gemacht und zur Lektüre geführt. Die Tendenz, die Vorrede zu übersehen, verrät, dass sie im Vormärz zum leeren bzw. rhetorischen Ritual geworden ist. Im Rahmen der ideologischen, parteiischen Kritik, die laut Laube in der zeitgenössischen Journalistik immer noch dominant ist, besteht die der Vorrede inhärente performative Funktion höchstens darin, den Leserinnen und Lesern die Positionierung des Haupttextes innerhalb der öffentlichen Debatte bekannt zu machen – und das eben durch auf ein bestimmtes Lager leicht zurückführbare Formeln. Mit Blick auf das Verhältnis zwischen Vorrede und Haupttext besteht also die Leistung der ›ideologischen‹ Vorrede in einem vorweggenommenen Tendenzbekenntnis. In diesem Sinne leistet sie zwar eine Lektürelenkung, zusätzliche Informationen, welche also im Haupttext nicht enthalten sind, gibt sie aber nicht. Sie bringt nichts Latentes ans Licht. Anders fungiert hingegen Laubes Einleitung: Sie ist keine verknappte Version des ideologischen Inhaltes des Haupttextes, sondern expliziert die latenten, unausgesprochenen artikelübergreifenden Fragestellungen. Außerdem verhält sie sich zum Haupttext kohärenzstiftend und führt retrospektiv einige Leitbegriffe (bspw. das Moderne) ein. Da die differenzierte Bezeichnung (›Einleitung‹ statt ›Vorrede‹) in Laubes Ausführung den Übergang von einer bloß parteiischen hin zu einer zeitdiagnostischen und analytischen Kritik markieren sollte, hat die Einleitung auch eine programmatisch-poetologische Funktion. Wie es im Klartext heißt, will Laube mit seinen zeit- und literaturkritischen Beiträgen nicht die gängigen Frontstellungen noch einmal reproduzieren, sondern die Gründe für dieselben bestimmen. Im Vergleich zu anderen Publikationen werden mithin die Perspektive erweitert und die Überlegungen auf einer tieferen Ebene angestellt als bei der parteiischen Kritik. Auf eine Begründung der für die Modernen Charakteristiken geltenden Produktionsbedingungen, welche die hier zu skizzierende Poetik der Sammlung ebenfalls ausmachen, geht ausführlicher diese Stelle ein:
Laubes Moderne Charakteristiken (1835)
159
»[E]s hat auch […] seinen großen Nutzen […] das früher Geschriebene zu sichten, Spreu von Körnern zu sondern […]. Mein Examen mit der »Eleganten Zeitung« brachte mir nicht die günstigste Censur, und die Aufsätze, welche ich daraus entnehmen wollte, verwandelten sich mir unter den Händen, besonders erhielten sie beweglichere Augen und sanftere Züge. Ein großer Theil bestand die Probe gar nicht, und ich mußte denn am Ende ein ganz neues Buch schreiben. Dabei gewann ich jene Anklage gegen die Kritik, die sich mir auf folgende Weise noch deutlicher entwickelte: Das Leben ist gewiß nicht so einseitig, daß wir’s mit unsern kurzen Rede- und Gedankenformeln erschöpfen könnten. […]. Wie wenig mögen wir treffen mit unserer Kunst zu denken, wie wenig (sic) Linien der Welt. […]. Alle Dinge sind uns nur durch unser Denken überliefert, und wir schwören darauf, und schlagen einander todt für solche prekäre Objektivität – die Welt kann ja tausendmal reicher und komplicirter seyn, als unsre Formeln besagen. Beim Anblicke alter Gedanken fällt es uns schwer auf ’s Herz, daß die meisten Gedanken doppelte Gesichter haben, und oft noch mehr.«82
Die bereits im vorigen Zitat betonte Relativierung der gängigen kritischen Praxis wird bei dieser Stelle mit einem grundlegenderen, ontologischen Argument versehen, das in Kombination mit dem ›Zeitargument‹ eingesetzt wird. Die aus dem zeitlichen Abstand durchgeführte und wegen des zeitlichen Abstands als erforderlich erscheinende Überarbeitung der Aufsätze macht nämlich die Grenzen der Kritik überhaupt sichtbar. Wenn Kritik im weiteren Sinne darin besteht, mittels Sprache und Denken »die Welt« aus der jeweiligen Perspektive auf den Begriff zu bringen, können die apriori gegebenen Kategorien die Vielfältigkeit des Realen nie erschöpfend erfassen. Daraus resultiert ein Rest an latenten, unberücksichtigten Aspekten, welche sich dann erst aus der zeitlichen Distanz z. T. erblicken lassen. Die u. a. nach Kant klingenden Aussagen (»Alle Dinge sind uns nur durch unser Denken überliefert«) werden hier also neuartig funktionalisiert: Sie führen zu einer Relativierung der Kategorie der »Objektivität« und werden in der für die vormärzliche Journalistik virulenten Debatte über unterschiedliche Konzepte kritischer Praxis kontextualisiert. Diese Stelle, genauso wie die weiter unten angeführte, markiert einmal mehr also die mit Blick auf den Textkorpus dieser Arbeit keineswegs isolierte Kommunikationslage, unter der diese Sammlung konzipiert wird: Als Opposition zu einer dominanten, parteiischen (Tages-)Kritik. Dass das von Laube vertretene und propagierte Kritikkonzept in mehrfacher Hinsicht mit Börnes Konzept des ›Zeitschriftstellers‹ in Einklang steht, bildet ebenfalls keine isolierte Position. Auf die konkreten Tendenzen innerhalb der ›Kritik‹ geht folgende Stelle näher ein; sie hebt erneut die Vorstellung einer Latenz in der (Zeit-)Geschichte vor und verweist dabei auf die Einstellung, mit der ein Buch über »Zeit und Literatur« verfasst werden sollte: 82 Ebd., S. X–XII.
160
Bildgebung
»[U]nsre junge Kritik reducirt sich auf die Erscheinungen des Allzuvielsagens und das gespenstische Auftauchen der doppelten Gesichter menschlicher Auffindungen. In dem Allzuvielsagen liegt jene Ungerechtigkeit gegen alle Persönlichkeit, liegt […] aller Fanatismus; in dem zweiten liegt das ganze dunkle Schlachtfeld neuer unausgekämpfter Zeiten. Diese Zeiten datiren von der Reformation. Es ist recht beglückend, aber es ist sehr kurzsichtig, mit den Einsichten unsrer Bildung zufrieden zu seyn […] bei gewissenhaftem Anblicke müßen mir die doppelten Gesichter aller Dinge eingestehen, […] daß von jenem großen Umsturze der Autorität, […] vom Umsturze jener Autorität en Gros an alle Kultur neu und noch nicht fertig ist. Gott weiß, wenn sie’s wird, und wir erleben’s schwerlich. Ich will auch den glücklichen Philosophen, die mit diesem oder jenem Hauptschlüssel Alles aufschließen oder aufbrechen, ihre Zufriedenheit nicht beneiden. Dies scheint mir das erste Allgemeine zu seyn, was einem, Zeit und Literatur besprechenden Buche, anzudeuten obliegt als ein Symptom, tief unter der bekannten Maschinerie ruhend. Man schafft es nicht durch die alte Benennung »ein wenig Skepticismus oder so Etwas« bei Seite – wirklich neue Zustände lassen sich nimmer mit alten Namen ausreichend benennen. Skepticismus ist ein Anderes, als das hier angedeutete, was vielfach mit dem später erwähnten »Modernen« in Berührung kommt.«83
Diese Stelle verdeutlicht, welche Tendenzen laut Laube die zeitgenössische Kritik prägen: Mit dem »Allzuvielsagen« wird – mehr oder weniger effektiv – eine kritische Praxis auf den Begriff gebracht, welche die oben angedeutete Unzulänglichkeit sprachlicher Versinnlichung nicht berücksichtigt und die Erscheinungen nicht als Teil eines historischen Zusammenhangs betrachtet. Geleitet wird sie vielmehr vom »Fanatismus«, welcher hier mehrfach vorkommt und somit im Rahmen von Laubes Begriffsinventar als Gegenbegriff zur positiv konnotierten kritischen Praxis fungiert. Die zweite Tendenz, der sich auch Laubes Zeit- und Literaturkritik zuschreiben lässt, ist mit Blick auf den Schwerpunkt dieser Studie besonders interessant: Im Rahmen derselben ist die Kritik damit befasst, die unsichtbaren, ja latenten Aspekte der Zeitgeschichte und der Geschichte überhaupt zu bestimmen. Sie werden wiederum erst aus dem zeitlichen Abstand sichtbar (»das gespenstische Auftauchen der doppelten Gesichter menschlicher Auffindungen«, »das […] dunkle Schlachtfeld neuer unausgekämpfter Zeiten«). Eine Typologie und Genealogie dieser Zeiten versucht Laube zu skizzieren: Gemeint sind die Zeiten, in denen sich ein »Umsturz[] der Autorität« vollzieht; es handelt sich dabei um jene Ereignisse in der (Zeit-)Geschichte, welche zur Umwälzung der bestehenden Ordnung führen und mithin als Zäsur fungieren (Reformation, Französische Revolution). Durch diese Ereignisse etabliert sich eine neue Ordnung, welche noch nicht erkannt und über die noch sehr wenig gesagt werden kann. Diese Erfahrung des ›Neuen‹ lässt sich offenbar mit Blick auf deren Standortbestimmung nicht ausschließlich auf die einmalige ›Gegenwart‹ der Entste83 Ebd., S. XII–XIII.
Laubes Moderne Charakteristiken (1835)
161
hung der Sammlung beschränken. Sie ›wiederholt‹ sich vielmehr, so lässt sich die Argumentation rekonstruieren, in jeder historischen Gegenwart, die aufgrund eines revolutionären Ereignisses in einem Verhältnis der Diskontinuität mit der ›Vergangenheit‹ steht und keine verlässliche Aussage über deren zukünftige Entwicklung erlaubt. Diese Zeiterfahrung erweist sich also als ›neu‹ und ›beispiellos‹ aus der Sicht jeder direkt davon betroffenen Generation. Es ist eben die Erfahrung einer im Wandeln begriffenen und nur retrospektiv ausdeutbaren ›Gegenwart‹ – einer ›Gegenwart‹ also, der eine ›Latenz‹ inhärent ist –, welche einige Aspekte einer ›Poetik der Sammlung‹ ausmacht und die ›sachliche‹ Bedingung für die Entstehung einer Sammlung überhaupt bildet. Das Bedürfnis, ›Kritik‹ – und ›Bildung‹ im Allgemeinen – neu aufzufassen, lässt sich nicht nur auf die Unzulänglichkeit von Sprache und Denken der Komplexität des Realen gegenüber zurückführen. Es hängt auch mit einer Zeiterfahrung zusammen, welche durch das Bewusstsein gekennzeichnet ist, dass sich jede Epoche von der vorherigen unterscheidet. Dieses Bewusstsein führt auch zu der Einsicht, dass kritische und wissenschaftliche Kategorien dem Prozess der ›Verzeitlichung‹ ebenfalls ausgesetzt sind. Trotz der konstitutiven Unzulänglichkeit sprachlicher Kategorien ist Laube sich also auch deren Unausweichlichkeit bewusst (»wirklich neue Zustände lassen sich nimmer mit alten Namen ausreichend benennen«). Die Erfahrung des ›Neuen‹ kann nur mithilfe neuer Begriffe halbwegs zum Ausdruck gebracht werden. In diesem Zusammenhang wird die schwer definierbare Kategorie des ›Modernen‹ eingeführt. Sie hat nicht nur die Funktion, einen neuen Gegenstand zu bezeichnen, sondern sie signalisiert auch einen Wandel der Wertungskriterien im Rahmen der Kritik. Wenn die oben angeführten Betrachtungen über die Unzulänglichkeit von Sprache und Denken dem Realen gegenüber die Unterscheidungen ›richtig‹ – ›falsch‹ oder ›objektiv‹–›subjektiv‹ bei den Wertungskriterien unangemessen erscheinen lassen, dann muss man die Analyse auf eine andere Ebene verlagern – auf die Ebene des Verhältnisses der Erscheinungen zur ›Zeit‹. Eben darin besteht, so die These, die wichtigste Leistung des Begriffs des ›Modernen‹. Dass das Prädikat ›modern‹ in Verbindung mit dem Gegenwartsbewusstsein und der -erfahrung steht, wird übrigens im Rahmen der Forschungsliteratur bereits in Gumbrechts grundlegendem begriffsgeschichtlichem Beitrag hervorgehoben: Die dort bestimmten Bedeutungsmöglichkeiten (›gegenwärtig‹, ›neu‹ und ›vorübergehend‹) hängen mit der jeweils vorherrschenden Gegenwartserfahrung und -konzeption zusammen84. So sind ein Verhältnis der Diskontinuität 84 Vgl. dazu Hans Ulrich Gumbrecht, Artikel Modern, Modernität, Moderne. In: Otto Brunner/ Werner Conze/Reinhart Koselleck (Hg.), Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, Band 4, Stuttgart 1978, S. 93–131.
162
Bildgebung
zur Vergangenheit und die Erfahrung der ›Beschleunigung‹ bei den für die Neuzeit prägenden Bedeutungsmöglichkeiten (›neu‹ und ›vorübergehend‹) maßgeblich. Bezieht man sich also auf Gumbrechts Aufsatz, so oszilliert Laubes Begriffsverwendung zwischen ›neu‹ und ›vorübergehend‹. Eine Reihe von in den Modernen Charakteristiken zueinander analog fungierenden Leitunterscheidungen (modern – klassisch, jung/neu – alt, Barbarei – Zivilisation) bestätigt die Nähe von Laubes Begriffsverwendung zur Bedeutungsmöglichkeit ›neu‹. Allerdings weist Laubes Begriffsverwendung weitere wichtige semantische Nuancierungen auf, die mit der Bedeutungsmöglichkeit ›vorübergehend‹ nur teilweise erfasst werden können. Die Erfahrung »eine[r] als Durchgangspunkt empfundenen Gegenwart«85 ist zwar für Laubes Zeitdiagnosen prägend, nur ist dabei nicht die Erfahrung einer vor allem durch neue Erfindungen bedingten ›Beschleunigung‹ entscheidend. Vielmehr tritt hier m. E. eine andere Bedeutungsnuance hinzu, welche dem Prädikat ›modern‹ eine räumliche Qualität verleiht. ›Modern‹ verwendet Laube primär, um die Erfahrung des ›Übergangs‹ bzw. des Sich-zwischen-zwei-Epochen-Befindens zum Ausdruck zu bringen. Literaturund kulturgeschichtlich ist dementsprechend die Erfahrung kennzeichnend, sich in einer entscheidenden Durchgangsphase zu befinden, welche wiederum das Ende mehrerer bislang vorherrschender Tendenzen (der »idealistischen Schreibart« im Rahmen der ästhetischen Praxis und des »Fanatismus« im Rahmen der Kritik) und den Anfang eines neuen Zeitalters markiert. Mit ›modern‹ wird also ein besonderer Zustand beschrieben, der sich am besten räumlich metaphorisieren lässt86. Im Rahmen dieser Metaphern liegt die Unmöglichkeit, eine Definition dieses Prädikats zu geben, in dessen ›Unsichtbarkeit‹, die wiederum in Verbindung mit dem Latenzproblem steht. Neben dem ›Modernen‹ als übergreifendem Phänomen, das bspw. Zeit- und Kulturgeschichte prägt, nimmt sich Laube mit den Aufsätzen des zweiten Bandes vor, spezifischer die »moderne Schreibart« in den Blick zu nehmen. Was programmatisch zu dieser literarischen Tendenz behauptet wird, besagt im Grunde 85 Ebd., S. 110. 86 Um diese Bündelung von Bedeutungsmöglichkeiten zu verdeutlichen, kann eine Stelle aus dem im Teil IV, ›Das Theater‹, enthaltenen Aufsatz ›Die Opernsängerin‹ dienen: »Die neuen Gestalten entwickelten sich in so viel Jahren als sie einst Jahrhunderte brauchten, und das oft unverstanden genannte moderne Moment ist erfunden worden. […] Es muß seiner Natur nach unvollständig seyn, weil es anticipirt, und so schnell als möglich die Hauptgedanken des neuen Kampfes und somit der neuen Geschichte in tausend kleine Kanäle leitet. […]. Aber es wird wohl noch lange so gehen, daß man das Moderne einer Zeit für Modetand einer müßigen Jugend ansieht, daß man […] nicht dahinter kommt, in diesem modernen Punkte die Civilisationsbrücke zu entdecken, welche den Zwischenraum von Barbarei ausfüllt. Denn ein solcher entsteht immer, wenn ein Altes stirbt«, ebd., S. 226–228. Die Kampfsemantik sowie die zeitgenössische und retrospektive negative Rezeption moderner Tendenzen müssen in diesem Zusammenhang ebenfalls hervorgehoben werden.
Laubes Moderne Charakteristiken (1835)
163
viel über den Versuchs- und, wenn man so will, Vorwortcharakter dieser Sammlung selbst. Darin lässt sich außerdem eine zeitliche Perspektive bestimmen, welche sich von der für das Verfahren der ›Historisierung‹ prägenden deutlich unterscheidet: »Uebrigens ist’s in keinerlei Weise darauf abgesehn, dieser modernen Schreibart […] das Wort zu reden: es sind eine Menge ihrer Konsequenzen angeführt, man prüfe, urtheile, wähle. Sie besteht auch vor der Hand noch aus nicht viel mehr, denn aus Anfängen, und hat kaum einige künstlerisch erfüllte Bestrebungen aufzuweisen. Aber ihr Odem ist da, und es fragt sich, ist er werth, zu befruchten, und zu gestalten.«87
Wie diese Stelle verdeutlicht, können das ›Moderne‹ und die moderne Schreibart nicht begrifflich (erschöpfend) herausgearbeitet und dargelegt werden. Da letztere sich noch nicht hinlänglich entfaltet hat, ist es angemessener, Konstellationen darzustellen, bei denen dieses Phänomen durch Vergleich, Parallelismen usw. sichtbar wird. Das u. a. anhand dieser Sammlung zu untersuchende Verfahren der ›Bildgebung‹ kennzeichnet sich also als Gegenmodell zu einem ›begrifflichen‹ Verfahren. Der Hang zu metaphorischen und allegorischen Darlegungen erweist sich Teil davon.
3.2.1 Moderne Erscheinungen Wie in der Einleitung mit Bezug auf die ›moderne Schreibart‹ angekündigt wird, sind im zweiten Band der Sammlung Charakteristiken zu Einzelautorinnen und -autoren, ästhetisch-literarischen Begriffen sowie literarischen Gattungen enthalten. Charakteristiken zu Literatur und Literaturbetrieb sind allerdings auch im ersten Band vorhanden (Karl Schall, Das Theater, Die Memoiren). Während aber im zweiten Band bei der Beurteilung der Gegenwartsautorinnen und -autoren mit Blick auf die Kategorie des ›Modernen‹ eine Logik der Inklusion und Exklusion herrscht, nehmen die Charakteristiken im ersten Band sämtlich moderne Erscheinungen aus der Zeitgeschichte sowie der Literatur in den Blick. Anders formuliert, werden Akteure und Situationen geschildert, welche gewissermaßen aufgrund des Instruktionscharakters der Paratexte als Produkt der Neuzeit eingestuft werden können. Versucht man anhand der Beiträge das Emergenzphänomen des ›Modernen‹ zu definieren, so rückt vor allem im ersten Band dessen Heterogenität und diffuser Charakter in den Vordergrund. Das, was ›modern‹ ist, lässt sich auf keine eindeutige Zeiterfahrung zurückführen. Bevor die Charakteristiken in den Blick genommen werden, scheint es angemessen, Überlegungen über die Organisationsform der Sammlung anzustellen. 87 Laube 1835, Band 1, S. XVIII.
164
Bildgebung
Im Vergleich zu einer zeitlich-linear verlaufenden Darlegung kennzeichnet sich die Sammlung überhaupt durch die Aufeinanderfolge von in sich abgeschlossenen Aufsätzen oder Charakteristiken. Prägend ist also die anaphorische Struktur, d. h. die eventuelle Wiederkehr von gewissen Argumentationssequenzen. Eine eindeutige Wiederholungsstruktur weisen zum Beispiel die zeitdiagnostischen Sequenzen auf, welche den gegenwärtigen Verhältnissen einen Übergangscharakter erteilen. Dem Instruktionscharakter der Einleitung gemäß verweist sie nicht primär auf die Wiederholungsstrukturen, sondern auf implizit wiederkehrende Fragestellungen, die die Sammlung durchziehen. Dass die Sammlung als ganzer Text im Vergleich zu einer chronologisch verlaufenden Darstellung der Geschichte der Literatur oder der Gegenwartsliteratur sich durch eine parataktische und anaphorische Struktur kennzeichnet, lässt sich kaum bezweifeln. Der Umstand lässt allerdings nicht ausschließen, dass auf der Mikroebene eine Art ›Genealogie des Modernen‹ rekonstruierbar sein kann. Bei dieser bildet die Französische Revolution den Auslöser und die modellierende Grunderfahrung. Dieses historische Ereignis samt seiner Akteure und wichtigsten Phasen gewinnt nämlich eine gewisse Modellfunktion im Rahmen der Diagnosen gegenwärtiger Verhältnisse sowie der Prognosen. Die Revolution fungiert in diesem Zusammenhang als moderner Mythos, der für Gegenwart und Zukunft sinnstiftend sein kann – sie kann diese noch schwer zu erfassenden, unbekannten Zeiten strukturieren. Außerdem verleiht die von Laube nicht selten praktizierte Identifikation einiger prominenter Zeitgenossen mit Hauptakteuren der Revolution den Handlungen dieser Zeitgenossen eine schon bekannte Richtung, die durch die bloßen Namen unmittelbar aufgerufen werden kann. Diese ›Operation‹ ruft also eine Konstellation hervor. Die Funktion eines modernen Mythos übt die Revolution nicht nur bei der Modellierung von Zeitgeschichte aus, sondern vor allem bei der Auseinandersetzung mit Gegenwartsliteratur, wie weiter unten dargelegt wird. Mit Blick auf die Zentralität dieses Ereignisses fängt der erste Band nicht von ungefähr mit den Charakteristiken von Mirabeau (1749–1791) und Talleyrand (1754–1838) an, d. h. mit zwei wichtigen historischen Figuren aus der Zeit der Revolution88. Die Lebensgeschichte dieser historischen Figuren wird sehr detailliert und sorgfältig dargestellt. Über diesen Aspekt hinaus, der übrigens einen Unterschied zu den literaturwissenschaftlichen Charakteristiken im zweiten Band ausmacht, erscheint mit Blick auf deren Beitrag zu einer Definition des ›Modernen‹ das Verhältnis von Mirabeau und Talleyrand zur eigenen Zeit als besonders wichtig. Genauer gesagt: Sie verkörpern zwei unterschiedliche Gegenwartskonzeptionen 88 »In ihnen [=Talleyrand, Mirabeau Lafayette] finden sich alle Vorzüge und Schwächen der Revolution, die Guillotine ausgenommen, welche dem bürgerlichen Terrorismus vorbehalten blieb«, ebd., S. 78.
Laubes Moderne Charakteristiken (1835)
165
im Rahmen des Spektrums der möglichen Gegenwartsverständnisse, welches sich mit der Neuzeit eröffnet. So ist Mirabeau eine für eine Durchgangsepoche typische Erscheinung, indem er von Elementen aus der alten und der neuen Zeit gleichermaßen geprägt ist. Seine adelige Herkunft scheint beispielsweise mit seiner Nähe zu progressiven Denkerinnen und Denkern schwer vereinbar (»Mirabeau war ein Marquis und ein Anhänger Voltaire’s«, »Mirabeau ist die verkörperte neufranzösische Romantik. […] ein Mann der buntesten Kontraste, der bizarrsten Widersprüche«89; »Diese Frage des Namens lag schwerlich in seinem Ideengange; er half die wichtige historische Erfindung verbreiten, den Staat vom bloßen Rechte des Herkommens […] zu emancipiren, ihm ein rechtliches Garantieenverhältnis zur Stütze zu geben«90); gerade diese neuartige Kombination macht ihn aber zu einer modernen Erscheinung. Während Mirabeau für die sich langsam durchsetzenden zivilisatorischen und emanzipatorischen Tendenzen repräsentativ ist, verkörpert der zur Schreibzeit des Aufsatzes noch lebende Talleyrand die einem schnelleren Takt entsprechende, unaufhaltsame Bewegung der Geschichte. Durch die Charakteristik dieses Protagonisten der Revolutionszeit gewinnt der Verlauf der Geschichte deterministische Züge. Im Laufe seiner langen Karriere konnte er sich immer auf die Höhe der Zeit stellen, weil er keine Prinzipien und keine zu bewahrende Tradition hatte. Statt darin eine in ethischer Hinsicht zu verwerfende Handlungsweise zu sehen, wie dies etwa bei den meisten Zeitdiagnostikerinnen und -diagnostikern sowie Historikerinnen und Historikern zu Laubes Zeit der Fall ist, hält dieser Talleyrand für die moderne Erscheinung schlechthin: »Schnelle, kurzsichtige Leute haben ihn einen Betrüger genannt. Man kann sich nicht plumper ausdrücken. Es ist eben so thöricht, als wenn die Historiker ein fatales geschichtliches Ereignis einen Irrthum nennen. Talleyrand ist das Fatum der modernen Geschichte, das Fatum hat kein Gewissen, es ist ein Gewissen. Er ist ein Bild moderner Liebe, die keine Treue mag, wenn diese nicht aus der Liebe fließt – er liebt nur das, was ihm liebenswerth ist, und darum auch nur so lange es ihm liebenswerth ist, er thut nichts aus Gewohnheit […].«91
89 Ebd., S. 4–5. 90 Ebd., S. 63. Die Leitidee einer zwischen Vergangenheit und Gegenwart stehenden Erscheinung wird auch bei der Jules Janins Berichten entnommenen Beschreibung seiner Wohnung betont: »es war eine seltsame Wohnung, für den Edelmann und für den Bürger, für den Greis und für den Jüngling zugleich eingerichtet, eine Wohnung, die augenscheinlich so viel Laster als Tugenden barg. Nie habe ich eine ähnliche gesehn. Geschnitztes Eichenholz, die alten Rahmen mit Blumengehängen verziert, Fauteuils mit breiten Armen, vergoldete Bergères, Stickereien, alles reich und im Ueberfluß, und auf diesen Meubles Bücher, Journale, Reden von Deputirten, die ganze moderne Zurüstung der umgestalteten Ideen«, ebd., S. 68. 91 Ebd., S. 80.
166
Bildgebung
Talleyrand verkörpert also die strebende, für das ›Neue‹ stehende Tendenz der Geschichte. Mirabeau und Talleyrand stehen für die Pluralisierung der Gegenwartskonzepte, bei denen allen allerdings die Diskontinuität zur Vergangenheit ein konstitutives Merkmal ist. Den zwei Charakteristiken über Protagonisten der (Zeit-)Geschichte folgen diejenigen über Literatur und Literaturbetrieb. Bei Karl Schall, einem damals seit kurzem verstorbenen Lustspieldichter, Übersetzer und Journalisten, und Die Memoiren handelt es sich um Charakteristiken, deren Untersuchungsgegenstände als Produkte der Zeit Relevanz gewinnen. So ist Karl Schall im Rahmen einer Literaturgeschichte keine unbedingt nennenswerte Erscheinung, in einer Sammlung über die Zeit aber doch: »Für seine Lustspiele ist ihm vielleicht nur ein kleines Eckchen in einer ausführlichen Literaturgeschichte anzuweisen, aber in einem Journal, das von und mit den kommenden und fliegenden Tagen lebt, in einem Buche, das die Zeit schildert, verdient Karl Schall […] einen wichtigen Platz. Er ist eine volle historische Erscheinung zu Breslau gewesen […].«92
Aufgrund seiner vielfältigen Tätigkeiten und anti-gelehrten Einstellung erweist er sich insbesondere als eine für den Zeitwandel repräsentative Erscheinung. In der den ersten Band abschließenden Charakteristik Die Memoiren wird diese neue, moderne Form, die nicht von ungefähr in Frankreich entstanden ist, als die einzig angemessene bezeichnet, um sich dem Takt des modernen Lebens und der modernen Zeiterfahrung anzupassen. Anders formuliert: Dieser Aufsatz fußt auf dem Zusammenhang von Zeitbewusstsein und Schreibform: »Die Memoirenform ist eine sehr wichtige und ein Hauptausdruck neuerer Schriftstellerei. […]. Das Ich ist das einzige Medium, man ist noch nicht reif, noch nicht ausgebildet genug, die Zeit zu schildern, man hat noch kein allgemeines Urtheil, nur einzelne Gedanken; die Stunden werden abgeschrieben.«93
Thematisiert wird also ein (in der Ökonomie dieser Studie und) im Grunde auch für Laubes Sammlung relevanter Aspekt: Es handelt sich dabei um eine epistemologische und mit Blick auf die unmittelbar verlaufende Gegenwart das SichÄußern überhaupt betreffende Grenze. Der Gegenstand verbietet den hohen Abstraktionsgrad historisch-philosophischer Betrachtungen. Genauso wie der in der Einleitung betonte Verzicht auf »diese[n] oder jene[n] Hauptschlüssel«, mit welchem hingegen der Philosoph »[a]lles aufschließen oder aufbrechen«94 kann, signalisiert, wird das erschöpfende Urteil gegenstandsbedingt (und wegen der 92 Ebd., S. 166. 93 Ebd., S. 343. 94 Ebd., S. XIII.
Laubes Moderne Charakteristiken (1835)
167
Zeitperspektive) suspendiert. Verzichtet wird aber vor allem auf den Einbezug dieser Porträts in ein geschichtsphilosophisches Narrativ, welches die Priorisierung oder Relativierung der Erscheinungen ermöglichen könnte. So charakterisiert sich das in diesem Kapitel untersuchte Verfahren der ›Bildgebung‹ als Gegenbild zum Verfahren der ›Historisierung‹. Bezogen auf die Memoiren bedingt das eine (überwiegende) Fokussierung auf den Stoff. Und diese ( jüngste) Gattung stellt ebenfalls ein Gegenbeispiel zur Methode der Philosophie: »Zum Urtheil ist Form und Wesen zu flüchtig, man will nur Stoff. Es wird eben so störend seyn, wenn die Dame, welche just vom Anschaun irgend eines Ereignisses zurückkommt und nur im Vorübergehn mittheilt, was sie gesehn, wenn diese Dame allerlei schwierige historisch-philosophische Bemerkungen dazu machen, das Ereignis sogleich unter Glas und Rahmen bringen wollte – Memoiren sind Studien, hingeworfene Skizzen, telegraphische Fernschrift.«95
Die Aufsätze, die das Kapitel Das Theater ausmachen, sind nicht im Hinblick auf den Gegenstand selbst, sondern aufgrund der vertiefenden Rückverweise auf die Einleitung wichtig. Gemeint ist der für die Kulturgeschichte prägende Kampf zwischen den Generationen, zwischen Altem und Neuem, auf den zum Teil bereits hingewiesen wurde und der die Liminalität des ›Modernen‹ verdeutlicht.
3.2.2 Modern oder nicht modern? Literaturwissenschaftliche Wertungskriterien Im zweiten Band der Sammlung wird der Versuch unternommen, die Grundzüge einer ›neuen‹ literaturästhetischen Richtung – der modernen Schreibart – zu bestimmen. ›Modern‹ verweist auch hier nicht auf eine Tendenz, die sich nur in der Gegenwartsliteratur auffinden lässt, sondern in erster Linie auf eine poetologische Einstellung, die in der Literaturgeschichte phasenhaft in Erscheinung getreten ist96. Diese bedingt die Auswahl der Gegenstände bzw. der Stoffe sowie die Art der Darstellung. In ›modernen‹ literarischen Werken werden Fragen, Situationen usw. zur Darstellung gebracht, die die Entstehungszeit des Werkes selbst unmittelbar betreffen und sich womöglich als das ›Neue‹ bezeichnen lassen. Sie werden ohne Verklärung gestaltet, d. h. beispielsweise ohne in eine andere Epoche übertragen zu werden. Um das ›Neue‹ sowie die wissenschaftliche
95 Ebd., S. 344. 96 »Alle vorgreifenden Erscheinungen der Geschichte sind moderne, man nennt nur par excellence die letzten immer so, Huß war’s, Cervantes, Luther, Goethe ganz und gar. Dieser hat sich in unsrer Poesie mit Riesenkraft der Objektivität voraus bemächtigt, ehe sie in der Zeit war, als sein Wesentliches erscheint zwar das Abbilden, aber die ironischen Zweifel, eine moderne Interpunktion gehen durch die Sachen«, ebd., Band 2, S. 112–113.
168
Bildgebung
Beschäftigung mit demselben zu legitimieren, verweist Laube auf Hegels Satz »Alles was ist, ist vernünftig«97. Mit Blick auf den in der Einleitung hervorgehobenen Abstand von der – ohne Zweifel zu schablonenhaft beschriebenen – philosophischen Einstellung und Perspektivierung des Erscheinenden, indiziert diese Inanspruchnahme einen selektiven Umgang mit dieser Disziplin. Wie der erste Aufsatz, also die Uebersicht, beweist, verzichtet Laube allerdings nicht darauf, die Perspektive auf viele der zeitgenössischen Disziplinen zu erweitern und mithin einen Überblick über »[d]ie neueste Bildung«98 zu verschaffen. Die These Laubes besteht darin, dass die Zeit der ›Trennung‹ im Einklang mit den in der Einleitung enthaltenen Aussagen vorbei ist. Es herrscht ihm zufolge nun die Tendenz zur Versöhnung, bei deren Schilderung sich die Denkfigur der ›Dialektik‹ erkennen lässt: »Ein trennender Dualismus geht noch durch alle Branchen, und unser gewonnener Fortschritt besteht wohl erst darin, daß wir nicht mehr an einen unbedingten Sieg dieser oder jener Einseitigkeit glauben. […]. Die neueste Bildung sucht eine Verbindung des Getrennten wie dieses juste milieu, aber es sucht sie, eine Stufe höher schreitend«99. Die Vorrangstellung der ›schönen‹ Literatur im Rahmen eines Buches, das ›Zeit‹ und ›Literatur‹ untersuchen will und somit mittels der Literatur einen zeitdiagnostischen Anspruch verfolgt, wird von der Vorstellung genährt, nach der »die Figur«, welche das Verhältnis der Literatur zur ›Zeit‹ am besten beschreibt, »die Vorrede der kommenden Geschichte«100 ist. Ein gängiges Argument, nach dem die Literatur Produkt der Zeitverhältnisse wäre, erfährt also hier eine bedeutsame Variation: Epochale Änderungen sind, so Laube, bereits in der Literatur angekündigt bzw. präfiguriert. Eine aktivere, ja sogar performative Rolle der – nicht nur ›schönen‹ – Literatur wird in der Uebersicht, und zwar in einer in zeitdiagnostischer Hinsicht wichtigen Passage, erneut verdeutlicht: »Diese Verhältnisse erinnern […] daran, wie das Entwicklungsleben, durch temporaire Kraft und Macht aus den auffallenden Erscheinungen verdrängt, in den verschiedenartigen Literaturen fortsickert, fortwuchert, seine baare, nackte Gestalt mit den Gewändern dieser oder jener Wissenschaft und Kunst bekleidet. Man wird an jene wilden Bergströme erinnert, die stürmisch brausend und wild von den Höhen herabstürzen, von drohenden Felsen aufgehalten plötzlich zu verschwinden scheinen, und erst nach langem Zwischenraume am Anfange der Ebene wieder zum Vorschein kommen. Der wilde Fall ist verschwunden, sie fließen sanft und friedlich, aber sie führen dasselbe Wasser, ja sie sind in der Verborgenheit durch neue unterirdische Quellen reicher,
97 Ebd., S. 2. »Diesen Beweis, welchen ich den historisch-philosophischen […] nennen möchte, nehme ich in Anspruch für die folgenden Betrachtungen neuer literarischer Zustände«, ebd., S. 2–3. 98 Ebd., S. 9. 99 Ibidem. 100 Ebd., S. 4.
Laubes Moderne Charakteristiken (1835)
169
breiter und tiefer gemacht worden. Dieses Moment der Entwicklungsgeschichte muß jetzt alle Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen. Die Literatur wird wieder der Mittelpunkt unsers Lebens. […]. Die Literatur ist nicht bloß das Archiv der Civilisation, sie ist auch das Medium derselben.«101
Diese Stelle ist nicht nur wegen der performativen Rolle, welche der Literatur zuteilwird, von Belang. Indem sie eine ›verborgene‹, ja unsichtbare Phase der Entwicklungsgeschichte postuliert, verleiht diese Passage der am häufigsten zirkulierenden Zeitdiagnose – man befinde sich in einer Zeit des Übergangs – eine zusätzliche Konnotation. Nicht nur erscheint diese Phase aus dialektischer Perspektive als ›notwendig‹, denn sie bildet ja die Ermöglichungsbedingung bzw. die Vorstufe für die nächste Phase. Zu beachten sind eigentlich auch die Einflussrelationen und Wechselwirkungen, die sich während dieser Phase entwickeln. Sie ist also nicht nur in logischer, sondern auch in sachlicher Hinsicht bedeutungsvoll. Die Unsichtbarkeit dieses »Moment[s] der Entwicklungsgeschichte« trägt nicht zuletzt dazu bei, die Rolle und Aufgaben der Zeitbeobachterin oder des Zeitbeobachters neu zu definieren. Mit Blick auf die Uebersicht besteht diese Aufgabe in einer Art Diskursanalyse avant la lettre, weil bei unterschiedlichen Disziplinen bzw. Diskursen (Kritik bzw. Zeitschriftenwesen, Philosophie, Jurisprudenz, Theologie, Philologie, Geschichtsschreibung) ähnliche Tendenzen bestimmt werden sollten. So wird vor allem der Hegelschen Philosophie eine diskursübergreifende, ja epistemische Tragweite zugeschrieben; sie hat, so Laube, bei vielen Disziplinen »einen neuen Standpunkt gegeben«102. Eine solche Untersuchungsperspektive, die ja auf die Bestimmung grundlegender und gemeinsamer Tendenzen bedacht ist, löst die meist auf disziplininterner Ebene vorhandene Tendenz zu kurzsichtigen Frontstellungen offenbar ab. Um den Übergang von diesem Überblick hin zum eigentlichen Gegenstand des zweiten Bandes, also der »schönen Literatur«103, herzustellen, führt Laube das Werk Woltmanns ein, das dann mit Fokus auf der Belletristik auch in einem Aufsatz behandelt wird. Erst da findet diese Schlüsselstellung darin eine Begründung, dass er eine »Mittelfigur«104 ist. Inwiefern die Überlegungen über die unterschiedlichen Diskurse mit dem Hauptteil des Bandes zusammenhängen, wird auf den ersten Seiten der Uebersicht verraten. Die kritische Periode, während der alles labormäßig geprüft wird, ist laut Laube vorbei. Für ihn ist es nun höchste Zeit, die neuen literarischen Zustände nicht mehr mit einer ›kritischen‹ bzw. ideologischen Haltung zu betrachten, sondern sie ernst zu nehmen, ›objektiv‹ zu betrachten und somit in 101 102 103 104
Ebd., S. 38–40. Ebd., S. 41. Ebd., S. 61. Ebd., S. 273–274.
170
Bildgebung
Verhältnis zur literarischen Tradition zu setzen. Wie bei den neuen literarischen Zuständen ist die Tendenz zur Trennung in den anderen wissenschaftlichen Bereichen ebenfalls zurückgetreten. Die Feststellung einer Produktion und Rezeption gleichermaßen betreffenden ›Demokratisierung‹ (»Die einzelnen Höhen verschwinden, aber die ganze Masse rückt höher – es entsteht eine Hochebene«105) sowie eines Orientierungsbedarfs beim Lesepublikum, dem der Band nachkommen sollte, vervollständigen das Set an zeitdiagnostischen Beobachtungen, die für die weiteren Ausführungen vorausgesetzt oder dabei einfach wiederholt werden. Mit Blick auf die genannte Orientierungsfunktion des literaturkritischen Teils zeigt sich, dass die Überarbeitung der Aufsätze keineswegs mit Pathos beladen ist; sie ist an keinen Anspruch auf Selbstüberbietung gekoppelt. Revision und Selektion erfolgen auch hier vielmehr aus rezeptionsorientierter Perspektive und dienen also der gewünschten Orientierungsleistung. Dass die Voraussetzung dafür wiederum der durch die Zeit bedingte Wandel ist, wurde bereits eingangs ausführlich dargelegt. Nimmt man auch die textinterne zeitliche Perspektive als Systematisierungskriterium für die Quellentexte hinzu, so zeigt sich für den zweiten Band noch deutlicher die Offenheit derselben. Anders formuliert: Das Vorhaben, die Grundzüge einer neuen bzw. im Entstehen begriffenen ästhetischen Richtung zu bestimmen, macht die Vorstellung des Anfangs zur für diese Sammlung zeitlich übergeordneten Perspektive. Laube nimmt sich demnach vor, eine noch latente Tendenz der deutschsprachigen Literatur zu ermitteln und manifest werden zu lassen. Der zweite Band der Sammlung besteht zumeist aus Charakteristiken von Gegenwartsautorinnen und -autoren (u. a. Lenau, Immermann) und zeitgenössische Kritikerinnen und Kritiker (Menzel, Varnhagen von Ense), Aufsätze mit komparatistischer Ausrichtung (›Die französischen Romantiker‹, ›Die fremden Sprachen‹), Charakteristiken über ästhetische Größen (›Der Stil‹) und literarische Gattungen (›Der Roman‹) vervollständigen schließlich das von Laube entfaltete Themenspektrum. In den Aufsätzen lassen sich hier und da weitere Stellen erkennen, welche der Methodenreflexion und der Programmatik dienen. Aufgrund dieser Elemente kann diese Sammlung nicht zuletzt als ein Beitrag zur Geschichte der Gegenwartsliteraturforschung betrachtet werden. Wie unten ausführlich dargelegt wird, wird in vielen Aufsätzen immer wieder für das Durchsetzen neuer Wertungskriterien plädiert, welche den Besonderheiten der modernen Schreibart gerecht sind. Das bringt mit sich, dass bei den Analysen andere Aspekte Beachtung finden (bspw. formale Aspekte). Die Methodenreflexion impliziert außerdem einen übrigens bereits in der Uebersicht vorhandenen ideologiekritischen Gestus: Man solle von bloß parteilicher zu zeitdiagnostischer Kritik übergehen. Die erste Phase der ›kritischen Periode‹, die Phase 105 Ebd., S. 5.
Laubes Moderne Charakteristiken (1835)
171
also der unversöhnlichen Abrechnung mit der Vergangenheit bzw. der Tradition, ist zu Ende gekommen. Dieser Tendenz zu Frontstellungen und Polarisierungen, die lange bei vielen Diskursen bzw. Wissensbereichen dominant war, sollte ein neues Kritikkonzept gegenübergestellt werden, das, statt die geläufigen Feindkonstellationen zu reproduzieren und planlos auf die kontingenten Ereignisse zu reagieren, von der eigenen Zeit Distanz gewinnt und dadurch die »Verbindungswege«106 hervortreten lässt. Damit wird das allen geistigen Erscheinungen zugrundeliegende Prinzip an den Tag gelegt. Wie bereits erwähnt, ist im zweiten Band eine Logik der Inklusion und Exklusion der Erscheinungen am Werk. Die Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die als Beispiele für die moderne Schreibart fungieren, können zur Ausbildung einer neuen Klassik beitragen. Mit dieser in Aussicht gestellten Entwicklungsstufe wird die (zeitlich auf die Gegenwart beschränkte) Perspektive der Literaturkritik überwunden und diejenige der erst später operierenden Literaturgeschichte eingeschlossen. Den Ausgangspunkt bilden zeitdiagnostische Beobachtungen sowie Behauptungen zur Auswirkung der Situation auf die Poesie (»Eine Durchgangsepoche, wie unsere Zeit, wo Leib und Seele eines scheidenden Jahrhunderts sich unter aufschreienden Schmerzen trennen, […] wird nicht die schönsten, aber die innigsten Gedichte bringen«). Die Offenheit der zeitlichen Perspektive, die sich wiederum aus der Einbettung der Perspektive der Literaturgeschichte ergibt, wird von folgender Stelle aus der Charakteristik Lenaus besonders effektiv verdeutlicht; sie zeigt darüber hinaus die bereits angedeutete Modellfunktion der Französischen Revolution: »[…] es ist Dantons und Robespierre’s Terrorismus, dem sich unsere Poesie hingegeben. Es wäre trostlos, wenn dieser Zustand stetig werden sollte, aber er war an der Zeit, […] unsre Poeten logen, die wirklichen Zustände erschienen nicht in ihrer Poesie. Die Frucht der Civilisation diene dazu, daß jener Terrorismus in der Literatur nicht weiter gehe als Noth thut, und die äußeren Verhältnisse mögen sich aus ihrer Zerrissenheit zu einer stetigen, festen Form gestalten. […]. [E]s mußte der Anschein einer neuen Barbarei gewagt werden, um eine neue Klassik vorzubereiten. Und wenn es die Gegenwart aus vielen andern Rücksichten nicht kann und nicht darf, die Literaturgeschichte wird einst mit Achtung die Namen ihrer Schreckenshelden nennen: Danton-Menzel mit der Löwenstimme, Robespierre-Börne mit dem ursprünglich weichen Gemüthe und Sanct Justus Heine mit dem blutigen Herzen und der schonungslosen, schwertscharfen Lippe.«107
Vor dem Hintergrund dieses Entwicklungsganges, den die deutschsprachige Literatur als Subjekt durchlaufen muss, können die behandelten Autorinnen und Autoren als Funktionsträgerinnen und Funktionsträger dienen. So wird der 106 Ebd. S. VI. 107 Ebd., S. 71–72.
172
Bildgebung
positiv bewertete Lenau als eine notwendige Übergangserscheinung bezeichnet und ihm eine ›Synthesefunktion‹ zugesprochen, indem er als synthetische Steigerung einiger Aspekte Uhlands und Heines gilt108. Diese erweiterte Auffassung der Funktion einzelner Autorinnen und Autoren, welche allerdings nicht mit dem Verfahren der Historisierung gleichzusetzen ist, ist mit der angedeuteten Nivellierung nicht unvereinbar; sie hat vielleicht auch mit der von Laube praktizierten Form der Charakteristik zu tun. Es werden keine ausführlichen, chronologisch verlaufend den ganzen Lebenslauf rekonstruierenden Abschnitte von Laube verfasst, weil es relevanter ist, über die jeweils behandelten Autorinnen und Autoren Konstellationen zu vergegenwärtigen, die Autorinnen und Autoren also ›im Netz‹ erscheinen zu lassen. Während etwa Lenau, Chamisso, Bettina Brentano als moderne Erscheinungen bezeichnet und somit positiv bewertet werden, wird anderen Autoren und Autorinnen ein negatives Urteil erteilt. Im Falle Immermanns wird für die ›Exklusion‹ eine den zeitgenössischen Tendenzen gegenüber in der Literaturgeschichte fast ungebrochen fortgeschriebene Exzentrizität verantwortlich gemacht109. Wegen des Desinteresses an nationalen Fragen wird Tieck eine Stelle in einer streng nach dem Regulativ einer modernen Schreibart wertenden Literaturgeschichte abgesprochen110. Die Exklusion der Romantiker sowie die Funktion Goethes als Folie einstiger ›Einheit‹ bilden nur einige der bei Laube und der jungdeutschen Kritik überhaupt wiederkehrenden Standpunkte. Die Operationen der Inklusion und Exklusion führen unmittelbar zu den literaturwissenschaftlichen Wertungsmaßstäben, welche vor dem Hintergrund einer Priorisierung von ›Zeit‹ zur Geltung kommen. Nicht die nunmehr veraltet wirkende Kategorie des ›Geschmacks‹, sondern die »historische Intuition«111 und der Hang zur Spekulation bekommen bei der Beurteilung der ästhetischen Praxis sowie der Kritik einen ihnen bislang nie beigemessenen Stellenwert. So werden beispielsweise dem umstrittenen Menzel zwar einige Verdienste eingeräumt, abgesprochen wird ihm aber die Fähigkeit, eine ›genealogische‹ Entwicklung vermuten und somit vergangene und zeitgenössische literarische Erscheinungen
108 »Das ist der Uebergang von der allzu großen Subjektivität. Und diesen Uebergang bildet Lenau. Die Interessen des Individuums werden sich verallgemeinen (sic), ausbreiten, das Individuum wird sich selbst universell bilden, und wenn einst das Individuum und die Allgemeinheit einander liebend unauflöslich in die Arme sinken, dann ist die Zeit erfüllt, und es kann wieder von klassischen Zuständen die Rede seyn«, ebd., S. 74–75. 109 »Es ist ihm nicht geglückt, den Lebenston der neuen Richtung anzugeben, und obwohl er nun auch in vielen Dingen mit ihr übereinstimmt, so mag er es doch nicht bekennen, […], drängt sich an die Vergangenheit. Diese empfängt ihn gleichgültig, und so ist und bleibt er ohne Publikum«, ebd., S. 91. 110 Ebd., S. 160. 111 Ebd., S. 100.
Laubes Moderne Charakteristiken (1835)
173
in Verbindung setzen zu können112. Die positiv konnotierte kritische Praxis wird hingegen mit Varnhagen von Ense113 und Pückler-Muskau identifiziert. Dem zeitdiagnostischen Anspruch auf der Ebene der gesamten Betrachtung entspricht auf der Ebene der Charakteristik – wenigstens programmatisch – die im Grunde ebenfalls als Abgrenzung von Menzel zu verstehende Hinwendung zur ästhetischen Form und weg von den Ideengehalten: Während die Inhalte auf die bekannten, leicht begrenzbaren Zeitfragen zurückführbar sind, bieten formal-ästhetische Aspekte Raum für eine differenzierte Betrachtung, für Spekulation und Erkenntnisgewinn114.
112 »[E]s fehlt die Spekulation und der Sinn für Form […] und es ist ein Beisatz in Wolfgang Menzel, welcher ewig lebensgefährlich bleiben wird für alle höhere Kultur, das ist der Fanatismus. […] Ein Kritiker, dessen System keine Prospektive hat, kann für ein Land ein Unglück werden, wenn er sich Einfluß und Glaubwürdigkeit errungen, denn er erkennt keinen Embryo, keine Knospe, er zertritt die Zukunft«, ebd., S. 244–245. 113 »Sie [Varnhagen und Rahel] übernahmen die Gedanken der Welt nicht als ein Hergebrachtes, sondern als ein stets neu zu Schaffendes, sie achteten und erkannten den Wechsel der Bildung, darum wurden sie spekulativ […]«, ebd., S. 291. »In Summa ist Varnhagen von Ense der Inbegriff jener höheren deutschen Kritik, an die wir denken, wenn wir uns in Kunst und Wissenschaft anderer Völker überheben, jener Kritik, welche […] doch klare Worte strenger Unparteilichkeit über Freund und Feind auf der Lippe haben kann«, ebd., S. 303. 114 »Man kann es gewöhnlich schon nach der Vorrede wissen, zu welcher Formel dieser oder jener Schriftsteller gehört, nach bestimmten Rechengesetzen kombiniren, entwickeln sich nun die Einsichten von der Eisenbahn, vom Laokoon, von der Dreieinigkeit, vom Sein oder Nichtsein. Und deshalb brauchte man im Grunde nicht viel Bücher um der letzten Gründe willen zu lesen, und darum ist’s keineswegs so unrichtig, wenn man Viel und Alles auf Form gibt und ein Wesentliches darin sucht. Es gibt selten mehr als zwei bis drei Leute, welche bei strebsamer Seele volle Eigenthümlichkeit sich bewahren, nicht Ergebnisse der Zeitrechnung sind«, ebd., S. 171.
Kapitel 4: Prognostik
4.1
Prognostik als Programm: Prognosen aus dem Standpunkt einer Übergangszeit
Die in den vorangehenden Kapiteln geschilderten Verfahren verweisen auf entsprechende Tendenzen innerhalb der Vormärzliteratur im Hinblick auf die Auseinandersetzung mit der ›Gegenwart‹, die unverkennbar den thematischen Schwerpunkt der Produktion dieses Zeitraums bildet. Mit dem Verfahren der ›Historisierung‹ wurde darauf aufmerksam gemacht, dass die ›Gegenwart‹ Teil einer für die Zeitschriftstellerin oder den Zeitschriftsteller bereits eindeutigen Gesamtentwicklung ist; zugespitzt formuliert erfolgt in diesem Zusammenhang auch eine Art ›Selbsthistorisierung‹, weil alles, was die (zumeist öffentliche) Gegenwart ausmacht, im Lichte der beschriebenen Entwicklung den Status einer historischen Quelle bereits erreicht hat. Aufgrund einer geschichtsphilosophisch bedingten ›Transparenz der Zeichen‹ verfügt man nämlich bereits über die notwendige Distanz, um an den gegenwärtigen Erscheinungen die relevanten von den nebensächlichen Aspekten unterscheiden zu können. Im Rahmen des Verfahrens der ›Bildgebung‹ werden hingegen der starke Zukunftsbezug und die Entzifferung der zeitlichen Latenz durch die Kategorie des ›Raums‹ und die entsprechende räumliche Latenz ersetzt. Die Charakteristiken zielen nämlich in diesem Fall darauf ab, eine gegenwärtige Erscheinung oder ein gegenwärtiges und mithin teilweise unbekanntes Phänomen genau zu schildern, ohne dabei den eventuellen Zukunftsbezug und die zeitliche Latenz zu berücksichtigen. Bei diesem Verfahren ist also im Hinblick auf die Skizzierung eines Zeitporträts vielmehr die Verankerung der jeweiligen Erscheinung im Zeitraum von Belang. Die gegenwärtige Erscheinung ist an sich bereits bedeutungstragend und die ›Gegenwart‹ wird erst einmal als unabhängig von ›Vergangenheit‹ und ›Zukunft‹ betrachtet. Neben diesen Verfahren lässt sich ein drittes bestimmen, bei dem die Operation der Prognostik in den Vordergrund rückt. Im Vormärz lässt sich also – so
176
Prognostik
die These – eine Art und Weise erkennen, Prognosen anzustellen, die sich von der im Grunde ›fingierten‹ prognostischen Modalität geschichtsphilosophischer Modelle unterscheidet. Die Hauptmerkmale und Leistungen dieses Verfahrens können in einem ersten Schritt anhand folgender Überlegung Günter Oesterles eingeführt werden: »[sie] [die Vormärzautorinnen und Vormärzautoren] geben der Gegenwart […] zunehmend breiteren Darstellungsraum; [ihre erschriebene und erlesene Prognostik] vollzieht sich nicht als Sprung aus der Gegenwart, sondern in deren intensivem literarischem Erfassen und Lesen. Heinrich Heines schulemachende Betonung, dass »die Gegenwart ihren Wert behalte, und dass sie nicht bloß als Mittel gelte, und die Zukunft« bloß »ihr Zweck sei« erlaubt, komplexe Zeitüberlagerungen von der Gegenwart aus zu gestalten.«1
Dieses Zitat stammt aus einer Passage, in der Oesterle einen Vergleich mit der Romantik anstellt: Dieser Vergleich erlaubt ihm, zwei Formen von Prognostik auszumachen, die wiederum auf ein unterschiedliches Verhältnis zur ›Gegenwart‹ verweisen. Im Rahmen der Romantik konfiguriert sich die ›Gegenwart‹ als ›Punkt‹, der aufgrund des überwiegend zukunftsbezogenen Blicks nur sehr vorläufig besetzt werden soll; die Zukunftsszenarien, die dargelegt werden, haben und brauchen vor allem keine ›starke‹ Verbindung zur ›Gegenwart‹; die Relation konfiguriert sich in Oesterles Worten allenfalls eben als »Sprung«. In diesem Zusammenhang erfährt die ›Gegenwart‹ eine Minimierung und ist also kein Ermöglichungsgrund für die im Mittelpunkt stehenden zukünftigen Entwicklungen, sondern bloß der Punkt, der vor der erhofften Zeitauflösung unumgänglich durchgegangen werden muss. Im Vormärz ist die ›Gegenwart‹ hingegen ein »breitere[r] Darstellungsraum«, in dem sich eine komplexe Verflechtung verschiedener Tendenzen erkennen lässt und die Zeitschriftstellerin oder der Zeitschriftsteller demzufolge ›verweilen‹ sollte, um diese zu entziffern. Diese Komplexität führt zwangsläufig zu einer anderen Form von Prognostik, im Rahmen derer in erster Linie das breite Spektrum an Möglichkeiten und Optionen zu berücksichtigen ist, welches die ›Gegenwart‹ selbst anbietet. Gerade dort, wo die geschichtsphilosophische Gesamtentwicklung ausbleibt, gilt also die ›Gegenwart‹ als Verhandlungs- und Entscheidungsraum. Die unterschiedliche Form von Prognostik entspringt somit einer ebenso unterschiedlich wahrgenommenen und erlebten ›Gegenwart‹. Beim daraus folgenden Relevanzgewinn von menschlichem Handeln und genereller von selbstgesteuerter Wirkung auf die Geschichte muss diese Prognostik – so die These – immer deutlicher einem ›Programm‹ gleichkommen, das auch für die Rezipienten Instruktionscharakter haben sollte. Die Vorstellung einer als breite Durchgangsphase konzipierten
1 Oesterle G. 2003, S. 211. Vgl. dazu Kap. 1.1 dieser Studie (Fußnote 34).
Prognostik als Programm: Prognosen aus dem Standpunkt einer Übergangszeit
177
›Gegenwart‹ kann auf Makroebene geltend gemacht werden, wie das übrigens auch bei Oesterles Überlegung der Fall ist. Insofern übernimmt also die Vormärzliteratur – im Rahmen einer als reich an Optionen empfundenen und zugleich durch grundlegende Mängel gekennzeichneten ›Gegenwart‹ (man denke nur an die nationale Einheit oder an eine im wertenden Sinne gemeinte ›klassische‹ Literatur) – eine gewisse ›operative‹ Funktion2. ›Operativ‹ ist hier nicht im engeren (und konventionelleren) Sinne als Aufruf zur Tat, sondern als ›auf Wirkung bedachte hermeneutische Anstrengung‹ gemeint. Im Folgenden sollten diese Funktionalisierung der Literatur und die skizzierte Form von Prognostik allerdings auf der Mikroebene untersucht werden. In den Texten, die in diesem Zusammenhang in Betracht gezogen werden, erleben dieses Verständnis der Literatur, das nicht zuletzt mit dem Zeitschriftsteller-Konzept zusammenhängt, sowie das für die Epoche typische ›Übergangsgefühl‹ eine dem stärkeren und präziseren Gegenwartsbezug geschuldete Radikalisierung. Außerdem lassen sich auf der Ebene der Argumentation weitere Besonderheiten beobachten, die dieses Verfahren von den anderen bzw. vor allem von demjenigen der ›Historisierung‹ trennschärfer separieren lassen. Bei den Texten, die dieses Verfahren verdeutlichen, handelt es sich um zwei Zeitungsartikel Gutzkows: Ansprache an die Berliner im März 1848, also die Rede, die er unmittelbar nach der Märzrevolution hielt, und den Aufsatz Vorläufer oder Nachzügler?. Hinsichtlich der prognostischen und programmatischen Leistung wird zudem Karl Marx’ und Friedrich Engels’ Manifest der Kommunistischen Partei (1848) untersucht. Mit Blick auf das Verfahren der Prognostik ist es kein Zufall, dass diese Texte um oder nach 1848 erschienen sind: Eine besonders ereignishafte Zeit bzw. eine Zeit, in der potenziell große Umwälzungen zu erwarten sind, stellt also für die prognostische und programmatische Einstellung eine unabdingbare Voraussetzung dar. Genauso kennzeichnend für dieses Verfahren sind übrigens auch die involvierten Textsorten. Bei den Zeitungsartikeln handelt es sich um eine Anrede, die der Funktion eines offenen Briefes gleichkommt, und um eine polemische bzw. beinahe pamphletartige Stellungnahme im Rahmen einer öffentlichen Diatribe, die wiederum ein Zeitungsartikel zum Entstehen gebracht hat; das Manifest lässt sich der gewissermaßen eigenständigen, gleichnamigen Gattung3 zuordnen, die allerdings Funktionen erfüllt, die mit den untersuchten Zeitungsartikeln gemeinsam sind. Bei 2 Vgl. dazu die in der Einleitung sowie im ersten Kapitel dieser Studie enthaltenen Überlegungen. 3 Vgl. dazu Hubert van den Berg, Das Manifest – eine Gattung? Zur historiographischen Problematik einer deskriptiven Hilfskonstruktion. In: ders./Ralf Grüttemeier (Hg.), Manifeste: Intentionalität, Amsterdam 1998, S. 193–225 sowie Stefan Rieger, Manifest. Zur Logik einer Erzählform. In: Nach Feierabend. Zürcher Jahrbuch für Wissensgeschichte 2014/10, Erzählen, S. 133–152.
178
Prognostik
diesen Texten treten im Vergleich zu den anderen Verfahren eine tendenziell affektbeladene Darlegung der eigenen Perspektive sowie die damit verbundene Vernachlässigung anderer Perspektiven4 hervor. Die zentrale Rolle der Programmatik, die nicht zuletzt einen starken Zukunftsbezug bedingt, hat trotz des sehr konkreten Gegenwartsbezugs zur Folge, dass diese Texte anders als die in den vorigen Kapiteln behandelten Essays ihren »Gegenstand [nicht] aus einer Vielzahl von verschiedenen Perspektiven zu umkreisen such[en]«5. Obwohl die Komplexität der Gegenwart – vor allem im Unterschied zur Romantik – nicht übersehen wird, zielen die prognostischen Elemente darauf ab, die vertretene These zu plausibilisieren. Im Hinblick auf die Latenzfrage tritt im Rahmen dieses Verfahrens die zeitliche Dimension in den Vordergrund; wie beim Historisierungsverfahren kann auch hier in den meisten Fällen von einer Transparenz der Zeichen die Rede sein; entscheidend erscheint allerdings bei dieser Form von Prognostik das notwendigerweise zu lenkende menschliche Handeln. Diese Aspekte sollten nun anhand von Karl Marx’ und Friedrich Engels’ Manifest der Kommunistischen Partei illustriert werden, einem im Vergleich zu Gutzkows Artikeln fraglos viel bekannteren und wirkungsmächtigeren Text. Das 1848 im Rahmen der Londoner Versammlung der Kommunisten entstandene Manifest ist in vier Teile gegliedert (I. Bourgeois und Proletarier, II. Proletarier und Kommunisten, III. Socialistische und kommunistische Literatur, IV. Stellung der Kommunisten zu den verschiedenen oppositionellen Parteien), die jeweils die Funktion haben, 1. das sich bislang konfigurierte Verhältnis der (unterdrückenden) Bourgeoisie zum (unterdrückten) Proletariat als nicht mehr haltbar bzw. vergangenheitsbezogen zu schildern; 2. das Verhältnis der Kommunisten zu den Proletariern zu klären; 3. die bislang international entstandene sozialistische und kommunistische Literatur kritisch zu betrachten; 4. die politischen Allianzen der Kommunisten in den verschiedenen Ländern sowie ihr transnational einheitliches Programm zu illustrieren. Den vier Teilen wird eine kurze Einleitung vorangestellt, die in erster Linie die Bedingungen verdeutlicht, die das Manifest überhaupt zustande gebracht haben; außerdem zeigt sie dessen militanten und streckenweise unbescheidenen6 Ton auf:
4 Vgl. dazu Rieger 2014, S. 134. 5 Ibidem. 6 Auf diese rhetorische Besonderheit von Manifesten macht Stefan Rieger aufmerksam: »Als erzählerische (!) Form steht das Manifest im Zeichen größtmöglicher Unbescheidenheit. […]. Das Manifest ist keine Textsorte der Abstufung und Nuancierung, der Pluralität und der Meinungsvielfalt, der Vorsicht und Behutsamkeit. Seine Farbgebung erfolgt nicht im Modus sorgfältig abzustufender Grautöne, sondern in dem eines plakativen Schwarz und Weiß«, Rieger 2014, S. 133.
Prognostik als Programm: Prognosen aus dem Standpunkt einer Übergangszeit
179
»Ein Gespenst geht um in Europa – das Gespenst des Kommunismus. Alle Mächte des alten Europas haben sich zu einer heiligen Hetzjagd gegen dies Gespenst verbündet […]. Wo ist die Oppositionspartei, die nicht von ihren regierenden Gegnern als kommunistisch verschrieen worden wäre, wo die Oppositionspartei, die den fortgeschritteneren Oppositionsleuten sowohl, wie ihren reaktionären Gegnern den brandmarkenden Vorwurf des Kommunismus nicht zurückgeschleudert hätte? Zweierlei geht aus dieser Tatsache hervor. Der Kommunismus wird bereits […] als eine Macht anerkannt. Es ist hohe Zeit, daß die Kommunisten ihre Anschauungsweise, ihre Zwecke, ihre Tendenzen vor der ganzen Welt offen darlegen, und den Mährchen vom Gespenst des Kommunismus ein Manifest der Partei selbst entgegenstellen. Zu diesem Zweck haben sich die Kommunisten der verschiedensten Nationalität versammelt und das folgende Manifest entworfen […].«7
Diese Stelle beschreibt die sonderbare diskursive Situation, die den Kommunismus – als Sache und Begriff – betrifft: Als »Gespenst« bzw. Tendenz ohne klare Konturen, die allerdings den Status quo umstürzen will und mithin von den konservativen und reaktionären Parteien als Drohung empfunden wird, kann er von unterschiedlichen diskursiven Positionen aus auf beliebige Gegner bezogen werden. Die Gespenst-Metapher ernst nehmend offenbart sich der Kommunismus mit dem Manifest in der öffentlichen Debatte; der ursprünglichen Bedeutung des lateinischen Verbs manifestare gemäß macht er sich dadurch ›handgreiflich‹8. In diesem Zusammenhang besteht die Leistung des Manifestes also nicht nur in einem wesentlichen Schritt zur Institutionalisierung dieser politischen Tendenz (vom »Mährchen vom Gespenst des Kommunismus« zum »Manifest der Partei«), sondern vor allem darin, den Kommunismus den Fremdbestimmungen und propagandistischen Verzerrungen der politischen Gegner zu entziehen. Der Gegenwartsbezug des Textes macht also in erster Linie den Umstand aus, in der öffentlichen Debatte das Wort zu ergreifen und den propagandistischen Begriffsgebrauch zu unterbrechen. Nach dieser notwendigen klärenden Prämisse wird im ersten Teil unvermittelt und sehr apodiktisch das Gesetz geschichtlicher und gesellschaftlicher Entwicklung dargelegt: »Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen. […] Unterdrücker und Unterdrückte standen in stetem Gegensatz zu einander, führten […] einen Kampf, der jedesmal mit einer revolutionären Umgestaltung der ganzen Gesellschaft endete, oder mit dem gemeinsamen Untergang der kämpfenden Klassen.«9
7 Karl Marx/Friedrich Engels, Manifest der Kommunistischen Partei, London 1848, S. 3. 8 Rieger 2014, S. 133. 9 Marx/Engels 1848, S. 3.
180
Prognostik
Der Titel dieses Teils verweist mithin eindeutig auf den sich profilierenden Klassenkampf (Bourgeois und Proletarier10) und die eben zitierte Passage bestimmt prognostisch die möglichen Ausgänge. Dieser Teil schildert dann die Epoche der Vorherrschaft der Bourgeoisie und, da diese Klasse entscheidend sämtliche Verhältnisse prägt (»sie schafft sich eine Welt nach ihrem eigenen Bilde«11), liefert er zugleich eine Diagnose der Gegenwart. Dargelegt wird also eine kurze Geschichte der Bourgeoisie, die im Grunde der Hauptträger der Entwicklungen und Veränderungen war, die sich von der feudalen bis hin zur industriellen Gesellschaft ergeben haben: »Die Bourgeoisie kann nicht existiren, ohne die Produktionsinstrumente, also die Produktionsverhältnisse, also sämmtliche gesellschaftlichen Verhältnisse fortwährend zu revolutioniren. Unveränderte Beibehaltung der alten Produktionsweise war dagegen die erste Existenzbedingung aller früheren industriellen Klassen. Die fortwährende Umwälzung der Produktion, die ununterbrochene Erschütterung aller gesellschaftlichen Zustände, die ewige Unsicherheit und Bewegung zeichnet die Bourgeois-Epoche vor allen früheren aus. Alle festen, eingerosteten Verhältnisse mit ihrem Gefolge von altehrwürdigen Vorstellungen und Anschauungen werden aufgelöst, alle neugebildeten veralten, ehe sie verknöchern können. Alles Ständische und Stehende verdampft, alles Heilige wird entweiht, und die Menschen sind endlich gezwungen, ihre Lebensstellung, ihre gegenseitigen Beziehungen mit nüchternen Augen anzusehen.«12
Was die Bourgeoisie von den anderen, einst vorherrschenden Klassen unterscheidet, ist die intrinsische Tendenz zur ständigen Erneuerung, die in erster Linie die Produktionsverhältnisse betrifft. Das machte sie zum Anreger und zugleich zum Produkt der neuesten Zeit. Bei näherem Hinsehen entspringt ja das moderne, schlechthin ›flüchtige‹ Gegenwartskonzept13 im Grunde dem Erneuerungsdrang der Bourgeoisie. Solange sie als Trägerin der Bewegung agieren konnte und mithin für die ›Gegenwart‹ stand, war ihre gewissermaßen weltweite Hegemonie nicht in Frage zu stellen. Nun aber – und u. a. darin besteht die diagnostisch-prognostische Leistung des Manifestes – ist sie nicht mehr in der Lage, die Erneuerung zu ermöglichen14. Nachdem sie zu einer Vereinfachung des Klassenkampfes geführt hat, bei der bis auf das Proletariat die übrigen Klassen im 10 »[D]ie feudalen Eigenthums-Verhältnisse […] wurden gesprengt. An ihre Stelle trat die freie Konkurrenz […] mit der ökonomischen und politischen Herrschaft der Bourgeois-Klasse. Unter unsren Augen geht eine ähnliche Bewegung vor. Die bürgerlichen Produktions- und Verkehrs-Verhältnisse, die bürgerlichen Eigenthums-Verhältnisse, die moderne bürgerliche Gesellschaft, die so gewaltige Produktions- und Verkehrsmittel hervorgezaubert hat, gleicht dem Hexenmeister, der die unterirdischen Gewalten nicht mehr zu beherrschen vermag, die er herauf beschwor«, ebd., S. 6. 11 Ibidem. 12 Ebd., S. 5. 13 Vgl. dazu u. a. Gumbrecht 1978, S. 93–131. 14 Vgl. dazu Marx/Engels 1848, S. 10.
Prognostik als Programm: Prognosen aus dem Standpunkt einer Übergangszeit
181
Begriffe sind, zu verschwinden, gilt vielmehr die Erstarrung (und höchstens die Potenzierung) der aktuellen Verhältnisse als die Bedingung für ihre weiterhin fraglose Vorherrschaft. Um diese nun eher konservative Einstellung der Bourgeoisie zu betonen, bedient sich das Manifest – neben der plakativen Gegenüberstellung – nun explizit auch der Zeitsemantik: »In der bürgerlichen Gesellschaft ist die lebendige Arbeit nur ein Mittel, die aufgehäufte Arbeit zu vermehren. In der kommunistischen Gesellschaft ist die aufgehäufte Arbeit nur ein Mittel, um den Lebensprozeß der Arbeiter zu erweitern, zu bereichern, zu befördern. In der bürgerlichen Gesellschaft herrscht also die Vergangenheit über die Gegenwart, in der kommunistischen die Gegenwart über die Vergangenheit.«15
Dieser konnotierende Gebrauch der Zeitsemantik lässt die Thesen Wulf Wülfings16 auch auf das Manifest beziehen: Die Zeitsemantik steht nämlich auch hier im Dienste der Rhetorik einer positiv besetzten Bewegung und der daraus resultierenden Frontstellungen. In diesem Sinne trägt sie also dazu bei, effektiver als ein komplexer Argumentationsgang die formulierten Prognosen und das Programm noch überzeugender zu machen. Dementsprechend wird das Proletariat, das vorher nicht existierte und mithin erst Produkt der industriellen Gesellschaft ist, als die Klasse bezeichnet, »welche die Zukunft in ihren Händen trägt«17. Mit Blick auf die (als nahezu unvermeidlich betrachtete) revolutionäre Umgestaltung der Gesellschaft müssen noch einige Schritte getan werden, um das Proletariat zum revolutionären Subjekt werden zu lassen. In diesem Zusammenhang kommt der Kommunismus als entscheidender Akteur hinzu und die Prognose trifft auf das Programm. Was der Kommunismus ist und in welchem Verhältnis die Kommunisten zum Proletariat stehen, wird im zweiten Teil des Manifestes (Proletarier und Kommunisten) dargelegt, der insofern eine Art begrifflicher Aufklärung liefert: »Die Kommunisten sind […] der entschiedenste immer weiter treibende Theil der Arbeiterparteien aller Länder, sie haben theoretisch vor der übrigen Masse des Proletariats die Einsicht in die Bedingungen, den Gang und die allgemeinen Resultate der proletarischen Bewegung voraus. Der nächste Zweck der Kommunisten ist derselbe wie der aller übrigen proletarischen Parteien: Bildung des Proletariats zur Klasse, Sturz der Bourgeoisieherrschaft, Eroberung der politischen Macht durch das Proletariat. Die theoretischen Sätze der Kommunisten beruhen keineswegs auf Ideen, auf Prinzipien, die von diesem oder jenem Weltverbesserer erfunden oder entdeckt sind. Sie sind nur allgemeine Ausdrücke thatsächlicher Verhältnisse eines existirenden Klassenkampfes, einer unter unsern Augen vor sich gehenden geschichtlichen Bewegung [Hervorhebung durch die Verf.]. Die Abschaffung bisheriger Eigenthumsverhältnisse ist nichts dem Kommunismus eigenthümlich Bezeichnendes. Alle Eigenthumsverhältnisse waren 15 Ebd., S. 12. 16 Vgl. dazu Wülfing 1982. 17 Marx/Engels 1848, S. 9.
182
Prognostik
einem beständigen geschichtlichen Wechsel, einer beständigen geschichtlichen Veränderung unterworfen.«18
Aufgrund deren Hellsichtigkeit haben die Kommunisten die Aufgabe, dem Proletariat die nächsten Entwicklungsstufen zum Klassenbewusstsein erreichen zu lassen. Die drei Hauptzwecke könnten in dieser Passage übrigens kaum expliziter genannt werden. Neben dem Element des Programmatischen, das hier zum Nominalstil führt, sorgt auch die bekanntlich die ganze Bewegung prägende materialistische Tendenz für das Ausbleiben komplexer Argumentationsgänge. Es reicht die strenge Beobachtung der Tatbestände aus, um die Richtigkeit dieses Programms zu beweisen. Nur die tatsächlichen Verhältnisse, nicht die Spekulationen eines den Tatsachen fremden Gedankensystems, bedingen das revolutionäre Programm der Kommunistischen Partei. Außerdem fungiert die Denkform ›Geschichte‹ als die das revolutionäre Vorhaben legitimierende Instanz; übrigens untermauert diese Vorstellung bereits das eingangs postulierte Gesetz gesellschaftlicher Entwicklung als Geschichte der Klassenkämpfe19, nach dem die nun zu vollziehende Abschaffung der Eigentumsverhältnisse ein Element darstellt, das der Geschichte schon immer innewohnte. Der zweite Teil, der trotz des plakativen Stils noch eine Plausibilisierungsfunktion erfüllt, endet mit den zehn Maßregeln20, die den programmatischen Teil im engeren Sinne darstellen. Im dritten Teil (Socialistische und kommunistische Literatur) werden mit einem selbstreferentiellen und selbsthistorisierenden Gestus die in den verschiedenen Ländern entstandenen Literaturen sozialistischer und kommunistischer Gesinnung behandelt, die wiederum für die jeweils unterschiedlichen Entwicklungsstufen dieser politischen Tendenzen symptomatisch sind. Die Leistung dieses Teils des Manifestes besteht darin, den wahren bzw. reifen Kommunismus ex-negativo in Erscheinung treten zu lassen. Im vierten, abschließenden Teil wird auf die Stellung der kommunistischen Bewegung in den verschiedenen Ländern kurz eingegangen, um dann die besonders vielversprechende Lage Deutschlands zu betonen: »Auf Deutschland richten die Kommunisten ihre Hauptaufmerksamkeit, weil Deutschland am Vorabend einer bürgerlichen Revolution steht, und weil es diese Umwälzung unter fortgeschritteneren Bedingungen der europäischen Civilisation überhaupt, und mit einem viel weiter entwickelten Proletariat vollbringt als England im siebenzehnten und Frankreich im achtzehnten Jahrhundert, die deutsche bürgerliche Revolution also nur das unmittelbare Vorspiel einer proletarischen Revolution sein kann.«21
18 19 20 21
Ebd., S. 11. Ebd., S. 3. Ebd., S. 16. Ebd., S. 23.
Prognostik als Programm: Prognosen aus dem Standpunkt einer Übergangszeit
183
Diese abschließende Prognose hat sich wenigstens im Hinblick auf das Vorkommen einer Revolution in Deutschland als richtig herausgestellt. Beide nun zu behandelnde Zeitungsartikel Gutzkows geben Prognosen in diesem nach-revolutionären Zusammenhang ab. Sie sind in der 1850 publizierten Sammlung Vorund Nachmärzliches enthalten, deren Titel es bereits erlaubt, Überlegungen zum ›praktizierten‹ Gegenwartsbezug anzustellen. Mit Blick auf das historische Geschehen zeugt der Titel in erster Linie von der umgehenden Prägung und Verwendung der Begriffe ›Vormärz‹, ›vormärzlich‹, ›Nachmärz‹, ›nachmärzlich‹22. Der begriffsgeschichtliche Befund signalisiert zugleich, dass die in der Sammlung enthaltenen Texte von deren (politisch-geschichtlichen) Entstehungszusammenhang gewissermaßen unzertrennbar sind. Außerdem verweist die Kombination beider Epochenbezeichnungen auf einen bereits festgestellten Wandel. Es handelt sich also um einen bilanzierenden Rückblick, der der Märzrevolution eindeutig den Status einer Zäsur beimisst. Gegen die um 1850 sich abzeichnenden reaktionären Entwicklungen muss der in einigen Texten der Sammlung teilweise begeisterte und hoffungsvolle Ton Gutzkows durchaus grell abstechen. Dennoch liefert gerade dieser Kontrast den Beweis für eine aus revolutionärer bzw. politisch-progressiver Sicht ungünstige Wendung in der Geschichte; eine vielsagende und effektive Diagnose erfolgt also – mehr oder weniger unfreiwillig – durch das bloße Publikationsdatum. Dieser durchaus bedeutsame Aspekt, der zumindest zu einer kritischen Reflexion drängt, ändert allerdings nichts an der prognostischen Leistung, die die Texte zum Zeitpunkt ihrer Entstehung zu erbringen suchten. Gemeinsam mit der programmatischen sollte nun diese Leistung in den Blick genommen werden. Ansprache an die Berliner im März 1848 entsteht ursprünglich als Rede, um die Teilnahme des Volkes am revolutionären Geschehen zu feiern, preisen und zugleich, den Gebrauchscharakter und starken Gegenwartsbezug betonend, auf die nächsten Schritte hinzuweisen, die während der bevorstehenden, heiklen und entscheidenden Phase der Festigung einer neuen Ordnung zu veranlassen sind: »Ihr Alle habt gekämpft! Der Eine mit der Waffe, der Andere mit dem Wort, Alle mit der Gesinnung. […]. Und in unser Gedächtnis, in unser Herz nicht nur sind diese Tage eingeschrieben, nein, ihr unsterblicher Stoff, ihre ätherische Idee muß sich einigend verflüchtigen mit unserm Blut, mit unserm Leben, unserer Bildung, unserer Erziehung, mit der Luft, die wir athmen, mit dem Brot, das wir essen.«23
22 Vgl. dazu Udo Roth, Artikel ›Vormärz‹. In: Jan-Dirk Müller (Hg.), Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft, Band 3 (P–Z), Berlin/New York 2007, S. 803–805. 23 Gutzkow 1850, S. 107–108.
184
Prognostik
Mit einem durchaus sehr metaphorischen Stil, der auch für andere Jungdeutsche typisch ist und bereits damals der Kritik unterzogen wurde24, verdeutlicht diese Passage die Vorstellung, dass die gerade erzielten Ergebnisse immer ›organischer‹ werden müssen. Konkrete Hinweise, die zur erhofften Festigung beitragen könnten, gibt Gutzkow den Berlinerinnen und den Berlinern in folgender Passage: »Man hat die Begebenheiten dieser Tage eine Revolution genannt. Sie ist es. Preußen reiht sich jetzt den Staaten an, welche auf den Grund des Volkwohles angelegt sind, und damit wir nie wieder zurückfallen in jenen Zustand localer Sklaverei und unterbundener persönlicher Freiheit, was ist zu thun? Zunächst denkt Euch, dass der Staat nichts ist, was außer Euch lebt!«25
Wie diese Stelle verdeutlicht, ist die Auffassung des Volkes als bewusstes und selbstbestimmtes Subjekt bei Gutzkow von zentraler Bedeutung. Die in diesem Sinne gemeinte Herausbildung des Volkes kann nur unter effektiver Mitwirkung der Presse erfolgen: »Um sich zurechtzufinden in den oft labyrinthischen Gängen dieses Gebäudes, sucht Euer Urtheil zu bilden, Eure Kenntnisse zu vermehren, und wenn Ihr Wegweiser bedürft, wählt diejenigen Zeitungen, die nicht nur eine freie, sondern auch eine anregende Sprache führen [Hervorhebung durch die Verf.]. […]. Denn der Schwierigkeiten werden sich zahllose finden, und es ist Pflicht der Presse, sich schnell aus einem gehaltlosen, breiten Hin- und Herwogen der Notizen, aus dem Gefühl der Bequemlichkeit zu erheben zur That, zur Unterstützung der Gesetzgebung, zur Vorzeichnung der Wege, die die Staatsmänner wandeln sollen. Die Zügel der Bewegung in der Hand zu behalten, erfordert Muth und Ausdauer. Eine freie Presse ist ein Aufruf an die Feder, nicht sich auszuruhen, sondern ihre Anstrengung zu verdoppeln.«26
In dieser Skizzierung der anregenden und inspirierenden Rolle der Journalistik (»Die Zügel der Bewegung in der Hand zu behalten«) lässt sich die offensichtliche Nähe zu Börnes Konzept des ›Zeitschriftstellers‹ einmal mehr beobachten. Das sonst in der Rhetorik dieser Zeit wiederkehrende Argument einer von der Presse
24 Interessant ist in diesem Zusammenhang die in der Rezension zu dieser Sammlung geäußerte Bemerkung über »eine echt jungdeutsche Phrase«: »bei d[iese]r«, so der anonyme Rezensent oder die anonyme Rezensentin, »[kann] man sich so viel und so wenig denken, als man gerade Lust hat«. Der Kommentar bezieht sich nicht auf die im Fließtext zitierte Stelle, er verweist allerdings – trotz der Kritik – ebenso passend auf die prägende Offenheit solcher Formulierungen. Zu betonen ist die Tatsache, dass diese Beobachtungen zeitgenössisch entwickelt werden und damit die Merkmale dieser Prosa, die dann die spätere Kritik ›positiv‹ wenden wird (Tendenz zur ›Diskursintegration‹ und zum ›Indirekten‹), bereits erkennen. Gustav Freitag/Julian Schmidt (Hg.), ›Karl Gutzkow. Vor- und Nachmärzliches‹. In: Die Grenzboten. Zeitschrift für Politik, Literatur und Kunst 1850/9 (II), S. 407. 25 Gutzkow 1850, S. 112. 26 Ebd., S. 116–117.
Prognostik als Programm: Prognosen aus dem Standpunkt einer Übergangszeit
185
bzw. der »Feder« nur zeitweise zu erfüllenden Aufgabe wird hier nicht zum Einsatz gebracht27. Mit Blick auf die nun näher zu verfolgende Form der Prognostik stellt man fest, dass diese im Rahmen einer sich von geschichtsphilosophischen Vorstellungen emanzipierenden politischen Essayistik von Hinweisen auf eine strategische Haltung und ein ebenso strategisches Verhalten nicht zu trennen ist. Zugespitzt formuliert entfaltet sich diese Prognostik im Modus programmatischer Äußerungen mit Instruktionscharakter, weil sie dabei die Rezipienten aktiv involviert. Keine transzendente Instanz, sondern politische Akteure müssen bewusst die Strategien in Gang setzen, die nach dem ›Ereignis‹ tatsächliche und langfristige Änderungen auf der Ebene der ›Struktur‹ zeitigen können. Wie es oft bei Manifesten der Fall ist28, kann allerdings die Emphase hier und da die konkreten Hinweise ablösen. Eine ähnliche Funktion, dennoch unter leicht veränderten Verhältnissen, erfüllt der ebenfalls in dieser Sammlung publizierte Aufsatz Vorläufer oder Nachzügler?; entstanden ist er aber vermutlich 1850. Wie Ansprache an die Berliner zeugt dieser Aufsatz von den vielen Wandlungen in der unmittelbar nach-revolutionären Zeit sowie von der damaligen regen und ziemlich angespannten Lage in der öffentlichen Debatte. Bereits im Titel ist eine zentrale Frage umrissen, die die Presse und die öffentliche Meinung beschäftigt. Dabei handelt es sich um ein diagnostisches Dilemma, das aufgrund der internen Zeitlichkeit dieser Bezeichnungen29 (»Vorläufer«, »Nachzügler«) einen Zukunftsbezug aufweist und somit auch selber als Prognose gelten kann. Gutzkows Aufsatz reagiert nämlich auf einen 1849 in der Augsburger Allgemeine Zeitung veröffentlichten Artikel, in dem folgende These vertreten wird: »[E]s sterben dort [mit den badener Bluturtheilen] nur die Nachzügler der Bewegung, keine Vorläufer […]. [I]hr Blut wird keine neuen Saaten düngen. Die Trauerbilder um Kinkel mögen in künftiger Zeit die elegische Literatur bereichern, in der politischen Atmosphäre von heut verhallen sie.«30
27 Angespielt wird in diesem Zusammenhang auf die temporalisierten Rahmenbedingungen, innerhalb derer die Journalistik und die Literatur bzw. die schriftliche Kommunikation insgesamt lediglich im Vorfeld geschichtemachender Taten, d. h. in einer Phase der Vorbereitung, eine entscheidende Rolle spielen würden, um dann von der ›Politik‹ im engeren Sinne abgelöst zu werden. Belege für diesen Standpunkt, der mit fortschreitend-geschichtsphilosophischen Zeitvorstellungen zusammenhängt, lassen sich u. a. bei Wienbarg finden. Vgl. dazu Kap. 2.2 und 2.3 dieser Studie. 28 »Seine Affektstruktur ist […] nicht die der Immersion, sondern die der Berauschung«, Rieger 2014, S. 136. 29 Die Begriffe ›Vorläufer‹ und ›Nachzügler‹ gelten außerdem als weiteres Beispiel für die bereits dargelegte ›Verzeitlichung der Semantik‹ und deren ideologische Indienstnahme in der öffentlichen Debatte. Vgl. dazu Wülfing 1982. 30 Gutzkow 1850, S. 217.
186
Prognostik
Vor dem Hintergrund einer eher parabelhaften Vorstellung des revolutionären Geschehens, stellen die neuesten revolutionären Entwicklungen laut der Befürworterinnen und Befürworter der Reaktion keineswegs einen neuen Anfang, sondern das Ende dieser Tendenzen dar. Es handelt sich also um die letzten Lebenszeichen, die auf die gegenwärtigen Verhältnisse keine Wirkung mehr haben können (»in der politischen Atmosphäre von heut verhallen sie«) und deswegen zur Erstarrung bzw. zur Monumentalisierung im Rahmen einer Art ›Elegie der Revolution‹ bestimmt sind (»Die Trauerbilder um Kinkel mögen in künftiger Zeit die elegische Literatur bereichern«). Gutzkow reagiert auf diesen Standpunkt folgendermaßen: »Wir nennen die handelnden Personen des verflossenen Jahres keine Vorläufer und auch keine Nachzügler; wir wollten nur Einspruch thun gegen die blasirten Publicisten, die von einem Schicksale, wie das Gottfried Kinkel’s, nichts Anderes zu sagen wissen, als: ›es gehöre der künftigen elegischen deutschen Literatur an!‹«31
Gutzkows Stellungnahme besteht nicht in erster Linie darin, im Sinne einer bloßen schlagwortartigen Benennung die in Frage kommenden historischen Akteure als »Vorläufer« oder »Nachzügler« zu bezeichnen. Wie sich übrigens auch auf der Ebene des Klartextes an anderen Stellen erkennen lässt, tendiert er zwar zur »Vorläufer«-These; dadurch, dass sich die revolutionären Energien noch nicht erschöpft haben, sollte sich allerdings die Publizistik Lenkung und Wirkung in politisch-progressiver Richtung weiterhin zum Ziel machen. Seine Kritik richtet sich also auf einen Teil der Publizistik, die von einer entgegengesetzten Prognose ausgehend dazu auffordert, die Haltung des ›Zeitschriftstellers‹ aufzugeben. Gutzkows Bestehen auf dieser Auffassung der journalistischen Tätigkeit erfährt hier also eine Neukontextualisierung und gewinnt dadurch prognostischen Wert: »Gerade jetzt, […], im Angesicht des gedankenlosen Rückfalls in den alten beschränkten Unterthanenverstand und die alte soldatische und bürgerliche Sondereitelkeit der Stämme, beginnt die schöne Aufgabe eines freien und selbständigen Publicisten.«32
Gerade jetzt erweist sich also als entscheidend, die Aufgabe der Zeitschriftstellerin oder des Zeitschriftstellers zu erfüllen, ohne sich von anscheinendem Durchsetzen der Reaktion verwirren zu lassen. Um diese Funktion weiterhin von jedem politischen Einfluss unabhängig ausüben zu können, gilt wiederum eine richtige Interpretation des sich abzeichnenden Szenarios als Voraussetzung. Klargestellt werden muss in erster Linie, was für eine »Reaction« die gegenwärtigen Entwicklungen steuert: 31 Ebd., S. 223. 32 Ebd., S. 220.
Prognostik als Programm: Prognosen aus dem Standpunkt einer Übergangszeit
187
»Wir wissen nicht, bis wie weit die Reaction gehen wird. Eine Reaction gibt es, die gerechtfertigt und natürlich ist. Es ist die Reaction der im Kreise, aber aufwärts gehenden Spirallinie. Jedes ausgetretene Wasser kehrt naturgemäß in sein Bett zurück. Noch keine Idee hat die Welt im ersten Anlauf umgestalten können. Wer Staatsmann war in diesen letzten beiden Jahren hatte unverkennbar die Pflicht, diese natürliche Reaction anzubahnen, die eben darin besteht, daß man mit der Gesellschaft und ihrer nächsten Ordnung keinen andauernden Zustand des Experimentes dulden kann. Ob aber für die Reaction, die über dies natürliche Maß noch hinaus will und sich einbildet, die Februarrevolution und ihre Folgen wären das Werk eines Versehens, eines tollen unbegründeten Missverständnisses gewesen, ob für diese Reaction die wilde geballte Faust des Jahres 1849 nur das ohnmächtige Höhnen der Nachzügler gewesen, muß die Zukunft lehren. Der Anwald (sic) der großen Zeitfrage darf nicht vor Dem furchtsam zusammen schrecken, was allerdings das Menschenherz erzittern läßt. Er muß das Schreckliche prüfen, nicht mit dem Riechfläschchen fliehen und in der eigenen Ohnmacht, die ihn wohl bei dem Rückblick auf das schreckenvolle Jahr 1849 befallen kann, auch die Ohnmacht eines Princips sehen.«33
Die gerade zu beobachtende Reaktion hängt – Gutzkows Argumentation zufolge – mit dem notwendigen Institutionalisierungsprozess zusammen, der jeder großen politischen Veränderung folgt. Wie die verwendete Metapher verdeutlicht, hält Gutzkow diese Reaktion für eine »natürliche«. Bedeutsam ist vor allem der Umstand, dass sich der Zeitschriftsteller Gutzkow auf die Naturgesetze stützt, um Diagnose und Prognose anzustellen. Wenn hier überhaupt von einer ›Geschichtsphilosophie‹ die Rede sein kann, dann gewinnt sie am Beispiel der Naturgesetze bzw. der physikalischen Gesetze Kontur. Die demgegenüber hier kritisierte politische Reaktion, die die Folgen der Revolution nicht einfach »an[] bahnen«, sondern rückgängig machen möchte, liefert deshalb eine falsche Diagnose/Prognose und ein ebenfalls falsches Programm, weil sie gegen die Naturgesetze operieren möchte. Ob sie sich dadurch auch der ›Zeit‹ entgegensetzt, kann nur »die Zukunft lehren«. Anders als beim Manifest der Kommunistischen Partei und der Ansprache an die Berliner bleiben hier Aussagen über einen gewissermaßen vorhersehbaren Ausgang oder eine sichere Entwicklung aus. Das Einzige, was vor diesem Hintergrund gelenkt werden kann, wird im programmatischen Modus geäußert und ist dem Zeitschriftsteller überlassen, der aufgrund ihrer Aufgabe mit stets prüfenden Augen die Verhältnisse und die Ereignisse beobachten sollte.
33 Ebd., S. 222–223.
Literaturverzeichnis
a.
Quellen
Börne, Ludwig, Ankündigung der Wage. In: Rippmann, Inge/Rippmann, Peter (Hg.), Ludwig Börne. Sämtliche Schriften, Band 1, Düsseldorf 1964 [1818], S. 667–685. Echtermeyer, Theodor/Ruge, Arnold, Der Protestantismus und die Romantik. Zur Verständigung über die Zeit und ihre Gegensätze. Ein Manifest. Herausgegeben, kommentiert und mit einem Vorwort versehen von Norbert Oellers, Hildesheim 1972 [1839]. Freitag, Gustav/Schmidt, Julian (Hg.), ›Oeffentliche Charaktere‹. In: Die Grenzboten. Zeitschrift für Politik, Literatur und Kunst, 1848/7 (III), S. 366–386. – (Hg.), ›Karl Gutzkow. Vor- und Nachmärzliches‹. In: Die Grenzboten. Zeitschrift für Politik, Literatur und Kunst 1850/9 (II), S. 406–408. Gutzkow, Karl, Briefe eines Narren an eine Närrin, hg. v. R. J. Kavanagh. In: Gutzkows Werke und Briefe. Kommentierte digitale Ausgabe, Abteilung 1, Erzählerische Werke, Band 1, Münster 2003 [1832]. – Ueber Göthe im Wendepunkte zweier Jahrhunderte. Mit weiteren Texten Gutzkows zur Goethe-Rezeption im 19. Jahrhundert, hg. v. Madleen Podewski. In: Gutzkows Werke und Briefe. Kommentierte digitale Ausgabe, Abteilung 4, Schriften zur Literatur und zum Theater, Band 3, Münster 2019 [1836]. – Zur Philosophie der Geschichte, Berlin 1836. – Die Zeitgenossen. Ihre Schicksale, ihre Tendenzen, ihre großen Charaktere, hg. v. Martina Lauster. In: Gutzkows Werke und Briefe. Kommentierte digitale Ausgabe, Abteilung 3, Schriften zur Politik und Gesellschaft, Band 3, Münster 2010 [1837]. – Beiträge zur Geschichte der neuesten Literatur, Stuttgart 1839. – Vergangenheit und Gegenwart 1830–1838. In: ders., Gutzkows Werke. Auswahl in zwölf Teilen, 8. Teil, Berlin/Leipzig/Wien/Stuttgart 1910 [1839], S. 85–137. – Ansprache an die Berliner im März 1848. In: ders., Vor- und Nachmärzliches, Leipzig 1850, S. 105–119. – Unsere Zeitgenossen. An den Herausgeber einer vor den neuesten Umwälzungen erschienenen Bildnißgalerie damaliger Berühmtheiten. In: ders., Vor- und Nachmärzliches, Leipzig 1850, S. 191–213. – Vorläufer oder Nachzügler? In: ders., Vor- und Nachmärzliches, Leipzig 1850, S. 215– 223.
190
Literaturverzeichnis
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, Leipzig 1924 [1837]. Laube, Heinrich, Moderne Charakteristiken, 2 Bände, Mannheim 1835. Marx, Karl/Engels, Friedrich, Das Manifest der Kommunistischen Partei, London 1848. Menzel, Wolfgang, Die deutsche Literatur. Zweite vermehrte Ausgabe, Stuttgart 1836. Mundt, Theodor, Die Einheit Deutschlands in politischer und ideeller Entwicklung, Leipzig 1832. – Aesthetik. Die Idee der Schönheit und des Kunstwerks im Lichte unserer Zeit, Berlin 1845. Prutz, Robert Eduard, Kleine Schriften. Zur Politik und Literatur, 2 Bände, Merseburg 1847–48. Wienbarg, Ludolf, Zur neuesten Literatur, Mannheim 1835. – Ästhetische Feldzüge, 2. Auflage mit einem Vorwort von Alfred Kerr, Hamburg/Berlin 1919 [1834].
b.
Forschungsliteratur
Angehrn, Emil, ›Vernunft in der Geschichte? Zum Problem der Hegelschen Geschichtsphilosophie‹. In: Zeitschrift für philosophische Forschung 1981/3–4, Zum 150. Todestag von Georg Friedrich Wilhelm Hegel, S. 341–364. Ansel, Michael, Prutz, Hettner und Haym. Hegelianische Literaturgeschichtsschreibung zwischen spekulativer Kunstdeutung und philologischer Quellenkritik, Tübingen 2003. Bloch, Ernst, Tendenz – Latenz – Utopie, Frankfurt am Main 1978. Brandes, Helga, Die Zeitschriften des Jungen Deutschland. Eine Untersuchung zur literarisch-publizistischen Öffentlichkeit im 19. Jahrhundert, Opladen 1991. Brandes, Helga/Kopp, Detlev (Hg.), Autorinnen des Vormärz, Forum Vormärz Forschung, Jahrbuch 2 (1996), Bielefeld 1997. Bunzel, Wolfgang/Stein, Peter/Vaßen, Florian (Hg.), Romantik und Vormärz. Zur Archäologie literarischer Kommunikation in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, Forum Vormärz Forschung, Vormärz-Studien X, Bielefeld 2003. Cahn, Michael, ›Paralipse und Homöopathie. Denkfiguren als Objekte einer rhetorischen Lektüre‹. In: Schanze, Helmut/Kopperschmidt, Josef (Hg.), Rhetorik und Philosophie, München 1989, S. 275–295. Campe, Rüdiger, ›Epoche der Evidenz. Knoten in einem terminologischen Netzwerk zwischen Descartes und Kant‹. In: Peters, Sybille/Schäfer, Martin Jörg (Hg.), Intellektuelle Anschauung. Figurationen von Evidenz zwischen Kunst und Wissen, Bielefeld 2006, S. 25–43. – ›Aktualität des Bildes. Die Zeit rhetorischer Figuration‹. In: Boehm, Gottfried/Brandstetter, Gabriele/Müller, Achatz von (Hg.), Figur und Figuration. Studien zu Wahrnehmung und Wissen, München 2007, S. 163–182. Conter, Claude D. (Hg.), Literatur und Recht im Vormärz, Forum Vormärz Forschung, Jahrbuch 15 (2009), Bielefeld 2010.
Forschungsliteratur
191
Dann, Otto, ›Nationale Fragen in Deutschland: Kulturnation, Volksnation, Reichsnation‹. In: François, Étienne/Siegrist, Hannes/Vogel, Jakob (Hg.), Nation und Emotion. Deutschland und Frankreich im Vergleich. 19. und 20. Jahrhundert, Göttingen 1995, S. 66–82. de Man, Paul, ›Die Rhetorik der Zeitlichkeit‹. In: Menke, Christoph (Hg.), Die Ideologie des Ästhetischen, übers. v. Jürgen Blasius, Frankfurt am Main 1993 [1969], S. 83–130. – ›Epistemologie der Metapher‹. In: Haverkamp, Anselm (Hg.), Theorie der Metapher, übers. v. Werner Hamacher, Darmstadt 1996 [1978], S. 414–437. Diekmann, Stefanie und Khurana, Thomas (Hg.), Latenz. 40 Annäherungen an einen Begriff, Berlin 2007. Dierse, Ulrich/Scholtz, Gunter, [Art.] Geschichtsphilosophie. In: Ritter, Joachim (Hg.), Historisches Wörterbuch der Philosophie, Band 3 (G–H), Basel/Stuttgart 1974, S. 416– 439. Ehrlich, Lothar/Steinecke, Hartmut/Vogt, Michael (Hg.), Vormärz und Klassik, Forum Vormärz Forschung, Vormärz-Studien I, Bielefeld 1998. Eke, Norbert Otto, Einführung in die Literatur des Vormärz, Darmstadt 2005. – ›»Man muß die Deutschen mit der Novelle fangen«. Theodor Mundt, die Poesie des Lebens und die »Emancipation der Prosa« im Vormärz‹. In: Bunzel, Wolfgang/ders./ Vaßen, Florian (Hg.), Der nahe Spiegel. Vormärz und Aufklärung, Forum Vormärz Forschung, Vormärz-Studien XIV, Bielefeld 2008, S. 295–312. Eke, Norbert Otto/Füllner, Bernd (Hg.), Das Politische und die Politik im Vormärz, Forum Vormärz Forschung, Jahrbuch 21 (2015), Bielefeld 2016. Fischer, Hubertus/Vaßen, Florian (Hg.), Politik, Porträt, Physiologie. Facetten der europäischen Karikatur im Vor- und Nachmärz, Forum Vormärz Forschung, VormärzStudien XVIII, Bielefeld 2010. Fohrmann, Jürgen, Das Projekt der deutschen Literaturgeschichte: Entstehung und Scheitern einer nationalen Poesiegeschichtsschreibung zwischen Humanismus und deutschem Kaiserreich, Stuttgart 1989. – ›Der Intellektuelle, die Zirkulation, die Wissenschaft und die Monumentalisierung‹. In: ders. (Hg.), Gelehrte Kommunikation. Wissenschaft und Medium zwischen dem 16. und dem 20. Jahrhundert, Wien/Köln/Weimar 2005, S. 325–479. Fohrmann, Jürgen/Voßkamp, Wilhelm (Hg.), Wissenschaft und Nation. Studien zur Entstehungsgeschichte der deutschen Literaturwissenschaft, München 1991. – (Hg.), Wissenschaftsgeschichte der Germanistik im 19. Jahrhundert, Stuttgart 1994. Fohrmann, Jürgen/Gethmann, Carl Friedrich (Hg.), Topographien von Intellektualität, Göttingen 2018. Frank, Gustav, »›Soziologische‹ und ›psychologische‹ Möglichkeitsbedingungen für Geschichtsmodelle um 1850«. In: Eke, Norbert Otto/Werner, Renate (Hg.), VormärzNachmärz. Bruch oder Kontinuität?, Forum Vormärz Forschung, Vormärz-Studien V, Bielefeld 2000, S. 85–124. Frank, Gustav/Podewski, Madleen, ›Denkfiguren. Prolegomena zum Zusammenhang von Wissen(schaft) und Literatur im Vormärz‹. In: dies. (Hg.), Wissenskulturen des Vormärz, Forum Vormärz Forschung, Jahrbuch 17 (2011), Bielefeld 2012, S. 11–53. Fulda, Daniel, ›Starke und schwache Historisierung im wissenschaftlichen Umgang mit der Literatur. Zur Frage, was heute noch möglich ist – mit einer disziplingeschichtlichen Rückblende‹. In: Buschmeier, Matthias/Erhart, Walter/Kaufmann, Kai (Hg.), Literaturgeschichte. Theorien – Modelle – Praktiken, Berlin/New York 2014, S. 101–121.
192
Literaturverzeichnis
– ›Weder Bloch noch Gumbrecht. Latenzen in Stephan Wackwitz’ Generationenerzählungen, besonders in »Die Bilder meiner Mutter«‹. In: Gisbertz, Anna-Katharina/Ostheimer, Michael (Hg.), Geschichte – Latenz – Zukunft. Zur narrativen Modellierung von Zeit in der Gegenwartsliteratur, Aesthetische Eigenzeiten Band 7, Hannover 2018, S. 63– 75. Gather, Katharina (Hg.), Zwischen Emanzipation und Sozialdisziplinierung: Pädagogik im Vormärz, Forum Vormärz Forschung, Jahrbuch 25 (2019), Bielefeld 2020. Gumbrecht, Hans Ulrich, [Art.] Modern, Modernität, Moderne. In: Brunner, Otto/Conze, Werner/Koselleck, Reinhart (Hg.), Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, Band 4, Stuttgart 1978, S. 93–131. – ›Zentrifugale Pragmatik und ambivalente Ontologie: Dimensionen von Latenz‹. In: ders./Klinger, Florian (Hg.), Latenz. Blinde Passagiere in den Geisteswissenschaften, Göttingen 2011, S. 9–22. – Nach 1945. Latenz als Ursprung der Gegenwart, übers. v. Frank Born, Berlin 2012. – ›Nach der Latenz‹. In: Neue Zürcher Zeitung 04. 02. 2012, verfügbar unter: http://www.n zz.ch/nach-der-latenz-1.14771415 [30. 04. 2019]. Hasubek, Peter, ›Zwischen Essayismus und Poesie. Karl Gutzkows Erzählungen‹. In: Jones, Roger/Lauster, Martina (Hg.), Karl Gutzkow. Liberalismus – Europäertum – Modernität, Forum Vormärz Forschung, Vormärz-Studien VI, Bielefeld 2000, S. 197–215. Haverkamp, Anselm, Figura cryptica. Theorie literarischer Latenz, Frankfurt am Main 2002. – Latenzzeit. Wissen im Nachkrieg, Berlin 2004. Jakobson, Roman, ›Der Doppelcharakter der Sprache und die Polarität zwischen Metaphorik und Metonymik‹. In: Haverkamp, Anselm (Hg.), Theorie der Metapher, übers. v. Georg Friedrich Meier, Darmstadt 1996 [1956], S. 163–174. Koschorke, Albrecht, Körperströme und Schriftverkehr. Mediologie des 18. Jahrhunderts, München 2003. Koselleck, Reinhart, Einleitung. In: Brunner, Otto/Conze, Werner/ders. (Hg.), Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, Band 1, Stuttgart 1972, S. XIII–XXVII. – ›»Neuzeit«. Zur Semantik moderner Bewegungsbegriffe‹. In: ders., Studien zum Beginn der modernen Welt, Stuttgart 1977, S. 264–299. – ›»Erfahrungsraum« und »Erwartungshorizont« – zwei historische Kategorien‹. In: ders., Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten, Frankfurt a. M. 1989, S. 349– 375. – Begriffsgeschichten. Studien zur Semantik und Pragmatik der politischen und sozialen Sprache, Frankfurt a. M. 2006. Kreuzer, Johann, ›Vom Möglichen her denken. Zum Begriff der Latenz bei Bloch‹. In: Gisbertz, Anna-Katharina/Ostheimer, Michael (Hg.), Geschichte – Latenz – Zukunft. Zur narrativen Modellierung von Zeit in der Gegenwartsliteratur, Aesthetische Eigenzeiten Band 7, Hannover 2018, S. 77–92. Landmann, Michael, ›Kreis und Pfeil‹. In: Zeitschrift für philosophische Forschung 1965/4, S. 637–654. Lehmann, Johannes F., [Art.] Zeitgenossen; Zeitgenossenschaft. In: Gamper, Michael/ Hühn, Helmut/Richter, Steffen (Hg.), Formen der Zeit. Ein Wörterbuch der ästhetischen Eigenzeiten, Hannover 2020, S. 447–455.
Forschungsliteratur
193
Luhmann, Niklas, Temporalisierung von Komplexität. Zur Semantik neuzeitlicher Zeitbegriffe. In: ders., Gesellschaftsstruktur und Semantik. Studien zur Wissenssoziologie der modernen Gesellschaft, Band I, Frankfurt a. M. 1980, S. 235–300. Markewitz, Sandra (Hg.), Philosophie der Sprache im Vormärz, Forum Vormärz Forschung, Vormärz-Studien XXXVI, Bielefeld 2015. Marquard, Odo, Schwierigkeiten mit der Geschichtsphilosophie – Aufsätze, Frankfurt a. M. 1973. Moser, Sebastian J./Schlechtriemen, Tobias, ›Sozialfiguren – zwischen gesellschaftlicher Erfahrung und soziologischer Diagnose‹. In: Zeitschrift für Soziologie 2018/47 (3), S. 164–180. Nickel, Jutta (Hg.), Geld und Ökonomie im Vormärz, Forum Vormärz Forschung, Jahrbuch 19 (2013), Bielefeld 2014. Oellers, Norbert, Vorwort. In: ders. (Hg.), Der Protestantismus und die Romantik. Zur Verständigung über die Zeit und ihre Gegensätze. Ein Manifest, Hildesheim 1972 [1839], S. I–VIII. Oesterle, Günter/Oesterle, Ingrid, [Art.] Karikatur. In: Ritter, Joachim/Gründer, Karlfried (Hg.), Historisches Wörterbuch der Philosophie, Band 4 (I–K), Basel/Stuttgart 1976, S. 695–701. – ›»Kunstwerk der Kritik« oder »Vorübung zur Geschichtsschreibung«? Form- und Funktionswandel der Charakteristik in Romantik und Vormärz‹. In: Barner, Wilfried (Hg.), Literaturkritik – Anspruch und Wirklichkeit, DFG-Symposion 1989, Stuttgart 1990, S. 64–86. – ›Zum Spannungsverhältnis von Poesie und Publizistik unter dem Vorzeichen der Temporalisierung‹. In: Bunzel, Wolfgang/Stein, Peter/Vaßen, Florian (Hg.), Romantik und Vormärz. Zur Archäologie literarischer Kommunikation in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, Forum Vormärz Forschung, Vormärz Studien Band X, Bielefeld 2003, S. 199–211. Oesterle, Ingrid, ›Der »Führungswechsel der Zeithorizonte« in der deutschen Literatur. Korrespondenzen aus Paris, der Hauptstadt der Menschheitsgeschichte, und die Ausbildung der geschichtlichen Zeit »Gegenwart«‹. In: Grathoff, Dirk (Hg.), Studien zur Ästhetik und Literaturgeschichte der Kunstperiode, Frankfurt a. M./Bern/New York 1985, S. 11–76. – ›»Es ist an der Zeit!«. Zur kulturellen Konstruktionsveränderung von Zeit gegen 1800‹. In: Hinderer, Walter/Bornmann, Alexander von/Graevenitz, Gerhard von (Hg.), Goethe und die Romantik, Würzburg 2002, S. 91–121. Plumpe, Gerhard, Ästhetische Kommunikation der Moderne, 2 Bände, Opladen 1993. Podewski, Madleen, Nachwort. In: dies. (Hg.), Ueber Göthe im Wendepunkte zweier Jahrhunderte. Mit weiteren Texten Gutzkows zur Goethe-Rezeption im 19. Jahrhundert, Münster 2019 [1836], S. 213–239. Porrmann, Maria/Vaßen, Florian (Hg.), Theaterverhältnisse im Vormärz, Forum Vormärz Forschung, Jahrbuch 7 (2001), Bielefeld 2002. Rieger, Stefan, ›Manifest. Zur Logik einer Erzählform‹. In: Nach Feierabend. Zürcher Jahrbuch für Wissensgeschichte 2014/10, Erzählen, S. 133–152. Rosenberg, Rainer/Kopp, Detlev (Hg.), Journalliteratur im Vormärz, Forum Vormärz Forschung, Jahrbuch 1 (1995), Bielefeld 1996.
194
Literaturverzeichnis
Rossi, Francesco, ›Prolegomena zur Theorie und Geschichte einer deutschen Gattung – nebst komparatistischer Bemerkungen‹. In: Scientia Poetica. Jahrbuch für Geschichte der Literatur und der Wissenschaften 2017/21, S. 38–63. Roth, Udo, [Art.] Vormärz. In: Müller, Jan-Dirk (Hg.), Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft, Band III (P–Z), Berlin/New York 2007, S. 803–805. Schloßberger, Matthias, Geschichtsphilosophie, Berlin 2013. Schmidt-Maaß, Christoph, ›»Ein nothwendiges Product dieser Zeit und der eigentliche Spiegel ihrer selbst« (Robert Prutz). Die poetologische Reflexion der Vormärzliteratur auf geänderte Produktionsverfahren‹. In: Liedtke, Christian (Hg.), Literaturbetrieb und Verlagswesen im Vormärz, Forum Vormärz Forschung, Jahrbuch 16 (2010), Bielefeld 2011, S. 39–59. Schönert, Jörg, ›Literaturgeschichtsschreibung der DDR und BRD im Vergleich. Am Beispiel von »Geschichte der Deutschen Demokratischen Republik« (Berlin/Ost 1976) und »Die Literatur der DDR« (München 1983)‹. In: Cölln, Jan/Holznagel, Franz-Josef (Hg.), Positionen der Germanistik in der DDR: Personen; Forschungsfelder; Organisationsformen, Berlin/Boston 2012, S. 248–268. Schönpflug, Ulrich, [Art.] latent, Latenz. In: Ritter, Joachim/Gründer, Karlfried (Hg.), Historisches Wörterbuch der Philosophie, Basel/Stuttgart 1980, Band 5 (L–Mn), S. 39– 46. Simon, Ralf, [Art.] Latenzzeit. In: Gamper, Michael/Hühn, Helmut/Richter, Steffen (Hg.), Formen der Zeit. Ein Wörterbuch der ästhetischen Eigenzeiten, Hannover 2020, S. 218– 225. Stanitzek, Georg, [Art.] Dilettant. In: Weimar, Klaus (Hg.), Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft, Band I (A–G), Berlin/New York 2007, S. 364–366. Star, Susan Leigh/Griesemer, James R., ›Institutionelle Ökologie, »Übersetzungen« und Grenzobjekte. Amateure und Professionelle im Museum of Vertebrate Zoology in Berkeley, 1907–39‹. In: Gießmann, Sebastian/Taha, Nadine (Hg.), Susan Leigh Star. Grenzobjekte und Medienforschung, Bielefeld 2017 [1989], S. 81–115. Stöckmann, Ingo, [Art.] Ästhetik. In: Anz, Thomas (Hg.), Handbuch Literaturwissenschaft. Gegenstände und Grundbegriffe, Band 1, Stuttgart/Weimar 2007, S. 465–491. Stüssel, Kerstin, ›Punkt, Punkt, Komma, Strich – Revolution(en) und die Geschichte von »Gegenwartsliteratur«‹. In: Fohrmann, Jürgen/Schneider, Helmut J. (Hg.), 1848 und das Versprechen der Moderne, Würzburg 2003, S. 33–48. van den Berg, Hubert, ›Das Manifest – eine Gattung? Zur historiographischen Problematik einer deskriptiven Hilfskonstruktion‹. In: ders./Grüttemeier, Ralf (Hg.), Manifeste: Intentionalität, Amsterdam 1998, S. 193–225. Vogt, Michael/Kopp, Detlev (Hg.), Literaturkonzepte im Vormärz, Forum Vormärz Forschung, Jahrbuch 6 (2000), Bielefeld 2001. Weimar, Klaus, Geschichte der deutschen Literaturwissenschaft bis zum Ende des 19. Jahrhunderts, Paderborn 2003. – [Art.] Geistesgeschichte. In: ders. (Hg.), Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft, Band I (A–G), Berlin/New York 2007, S. 678–681. – [Art.] Genie. In: ders. (Hg.), Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft, Band I (A–G), Berlin/New York 2007, S. 701–703. – [Art.] Literatur. In: Fricke, Harald (Hg.), Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft, Band II (H–O), Berlin/New York 2007, S. 443–448.
Forschungsliteratur
195
Wirth, Uwe, ›Das Vorwort als performative, paratextuelle und parergonale Rahmung‹. In: Fohrmann, Jürgen (Hg.), Rhetorik. Figuration und Performanz, DFG-Symposion 2002, Stuttgart/Weimar 2004, S. 603–628. Wülfing, Wulf, Schlagworte des Jungen Deutschland. Mit einer Einführung in die Schlagwortforschung, Berlin 1982. – ›Stil und Zensur. Zur jungdeutschen Rhetorik als einem Versuch von Diskursintegration‹. In: Kruse, Joseph A./Kortländer, Bernd (Hg.), Das Junge Deutschland. Kolloquium zum 150. Jahrestag des Verbots vom 10. Dezember 1835 (Heine-Studien), Hamburg 1987, S. 193–217. Zeilinger, Doris, [Art.] Latenz. In: Dietschy, Beat/dies./Zimmermann, Rainer E. (Hg.), Bloch-Wörterbuch. Leitbegriffe der Philosophie Ernst Blochs, Berlin/Boston 2012, S. 232–242. Zimmermann, Christian von, Biographische Anthropologie. Menschenbilder in lebensgeschichtlicher Darstellung (1830–1940), Berlin/New York 2006.
Danksagung
Die Arbeit wurde im Sommersemester 2021 von der Philosophischen Fakultät der Universität Bonn als Dissertation angenommen. Dieses Buch ist eine leicht überarbeitete Fassung. Für die jederzeit anregende Betreuung danke ich Prof. Dr. Ingo Stöckmann und Prof. Dr. Kerstin Stüssel. Mein Dank gilt zudem dem DFG-Graduiertenkolleg »Gegenwart/Literatur. Geschichte, Theorie und Praxeologie eines Verhältnisses« für die dreijährige fachliche und finanzielle Unterstützung, die es mir auch bei der Publikation dieses Buches gewährt hat. Für die zahlreichen Diskussionen und kritischen Anregungen danke ich den Kollegiatinnen und Kollegiaten. Mein letzter Dank gilt meiner Familie und meinen Freundinnen und Freunden, auf deren Unterstützung ich jederzeit rechnen konnte. Giuseppina Cimmino
![Die Musealisierung der Gegenwart: Von Grenzen und Chancen des Sammelns in kulturhistorischen Museen [1. Aufl.]
9783839424940](https://ebin.pub/img/200x200/die-musealisierung-der-gegenwart-von-grenzen-und-chancen-des-sammelns-in-kulturhistorischen-museen-1-aufl-9783839424940.jpg)
![Verschwiegene Macht: Figurationen von Macht und Ohnmacht in der Kirche [1 ed.]
9783666600159, 9783525600153](https://ebin.pub/img/200x200/verschwiegene-macht-figurationen-von-macht-und-ohnmacht-in-der-kirche-1nbsped-9783666600159-9783525600153.jpg)
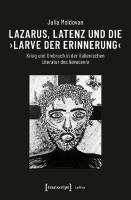


![Bild und Geste: Figurationen des Denkens in Philosophie und Kunst [1. Aufl.]
9783839424742](https://ebin.pub/img/200x200/bild-und-geste-figurationen-des-denkens-in-philosophie-und-kunst-1-aufl-9783839424742.jpg)

![Von der Existenzsicherung zur Wohlstandsgesellschaft: Überlebensbedingungen und Lebenschancen in Wien und Niederösterreich von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart [1 ed.]
9783205209966, 9783205209942](https://ebin.pub/img/200x200/von-der-existenzsicherung-zur-wohlstandsgesellschaft-berlebensbedingungen-und-lebenschancen-in-wien-und-niedersterreich-von-der-mitte-des-19-jahrhunderts-bis-zur-gegenwart-1nbsped-9783205209966-9783205209942.jpg)
