Geflüchtete und Kulturelle Bildung: Formate und Konzepte für ein neues Praxisfeld 9783839434536
How can people who arrive in Germany fleeing from war, persecution, hunger and economic need exercise their right to edu
231 86 3MB
German Pages 440 Year 2016
Inhalt
Table of Contents
Grußwort des Bundesverbandes Museumspädagogik e.V
Grußwort der Arbeiterwohlfahrt
1. Einleitung
Flucht und Kulturelle Bildung. Bestandsaufnahme, Reflexion, Perspektiven
Asylum and Cultural Education. Surveying, Reflecting and Looking Forward
2. Bildung und Perspektiven
Mitleid, Paternalismus, Solidarität. Zur Rolle von Affekten in der politisch-kulturellen Arbeit
Refugees sind keine Zielgruppe
Die Kolonialität der Willkommenskultur. Flucht, Migration und die weißen Flecken der Kulturellen Bildung
Zur Bedeutung von Kulturarbeit für Geflüchtete. Erfahrungen aus dem Libanon und Überlegungen zum deutschen Kontext
Es bleibt anders. Kämpfe um die (Pädagogik der) Migrationsgesellschaft
Flucht und Handlungsfähigkeit, kulturelle Bildung und globale Ungleichheit
3. Künstlerische und aktivistische Positionen
»The Infiltrators« – Crossing borders with participatory art (»The Infiltrators« – Mit partizipativer Kunst Grenzen überschreiten)
Die Gedächtnisarbeit mit Geflüchteten als Kampf um Gerechtigkeit
Can we talk about it? Über das Ankommen von LGBTIQ-Geflüchteten und eine sich verändernde Community
Solidarität und Dissens. Ülkü Süngün im Interview mit Caroline Gritschke
Wir sind die Zukunft: Wir bleiben hier. Mohammed Jouni im Interview mit Maren Ziese
4. Methoden und Standorte
Strategien für Zwischenräume. Ver_Lernen in der Migrationsgesellschaft
Globales Lernen in Museen als Form der kulturellen Bildung? Praxisbeispiele
»Rassismus und Weißsein, das spielt bei uns keine Rolle«!? Critical Whiteness-Perspektiven auf Kulturelle Bildung
Diversitätsbewusste kulturelle Bildung und Vermittlung im Kontext von Flucht. Von der Idee zum institutionellen Arbeitsalltag
Erst eingeladen, dann fotografiert. Bilder von Geflüchteten in Museen und anderen Bildungsinstitutionen
Geschichtsvermittlung und historische Gerechtigkeit. Überlegungen zu Flucht, Asyl und postkolonial informierter Globalgeschichte im Museum
Kulturprojekte für und mit, aber selten von…. Eine Spurensuche nach Motivationen und Haltungen nicht-geflüchteter Kulturschaffender im Theater
Selbstbemächtigung und Würdigung der Überlebensleistung von traumatisierten Geflüchteten
5. Sprachen und Räume
Die Erfindung der Einsprachigen. Überlegungen zur sprachlichen Vielfalt
Professionalisierung von Lehramtsstudierenden im Kontext von Fluchtmigration
ICOON for Refugees. Ein Bildwörterbuch zur ersten Kommunikation für Geflüchtete und ihre Helfer_innen
Kulturelle Bildung und das Erlernen der Mehrheitssprache in Zeiten der (expliziten) Wertevermittlung. Rubia Salgado in Zusammenarbeit mit Lernenden und Lehrenden im Verein das kollektiv
Acting in Art and Society. Der Kunstraum als Raum für Geflüchtete
Grandhotel Cosmopolis als Ort der Bildung von Gesellschaft. Spannungen zwischen Utopie und Wirklichkeit
Nach der Flucht. In einem neuen Leben Fußfassen am Beispiel des Übergangswohnheims Marienfelder Allee
6. Reflektierte Projekterfahrungen
»Kunst ist ein Grundbedürfnis«. Ein Praxisbericht der Hamburger Kunsthalle über ihre Arbeit mit Geflüchteten
Fragen statt Antworten. Internationale Klassen in der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen
»Kultur öffnet Welten«. Interkulturelle Erfahrungen an der Basis
Multaka: Treffpunkt Museum. Geflüchtete als Guides in Berliner Museen Razan Nassreddine in Zusammenarbeit mit dem Projektleitungsteam
Ehrenamt und Geflüchtete als Beteiligte in kulturellen Projekten. Kritik an Selbstverständnis und Positionen
Interkulturelle Öffnung – notwendiger denn je? Ein Veränderungsmodell am Beispiel der Arbeiterwohlfahrt
Einander begegnen und voneinander lernen. Kultur als Türöffner
7. Projektsteckbriefe
boat people projekt, Göttingen
KINO ASYL, München
KUNSTASYL
Lokstoff: »Pass.Worte. Wie Belal nach Deutschland kam«, Stuttgart
Refugees’ Kitchen, Oberhausen
reisegruppe heim-weh! (2014/15), Leipzig. Eine performative Stadtrundfahrt von und mit Asylsuchenden in Leipzig
»Stadt-Spaziergang«, Ludwigshafen
Völkerwanderung – Ein lebendiges Archiv für Geschichten von Kommen, Gehen und Bleiben, Freiburg
»Zugvögel«, Heinersdorf (Brandenburg)
Materialien
Materialien: Positionen, Tipps und Links
1. Haltung
2. Diversität, Antirassismus-Arbeit und interkulturelle Öffnung
3. Didaktische Materialien
4. Arbeit und Praktika
5. Verständigung
6. Projekte: Übersichten und Datenbanken
Autor_innen
Recommend Papers

- Author / Uploaded
- Maren Ziese (editor)
- Caroline Gritschke (editor)
File loading please wait...
Citation preview
Maren Ziese, Caroline Gritschke (Hg.) Geflüchtete und Kulturelle Bildung
Kultur und soziale Praxis
Maren Ziese, Caroline Gritschke (Hg.)
Geflüchtete und Kulturelle Bildung Formate und Konzepte für ein neues Praxisfeld
Die Publikation wurde gefördert von der »Aktion Deutschland hilft!« und dem AWO Bundesverband e.V.
Zudem wurde sie realisiert in Kooperation mit dem Bundesverband Museumspädagogik e.V.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. © 2016 transcript Verlag, Bielefeld
Die Verwertung der Texte und Bilder ist ohne Zustimmung des Verlages urheberrechtswidrig und strafbar. Das gilt auch für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Verarbeitung mit elektronischen Systemen. Umschlaggestaltung: Kordula Röckenhaus, Bielefeld Umschlagabbildung: Milad Ahmadvand Lektorat: Inken Tegtmeyer Übersetzungen: Joel Scott Satz: Justine Haida, Bielefeld Printed in Germany Print-ISBN 978-3-8376-3453-2 PDF-ISBN 978-3-8394-3453-6 Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier mit chlorfrei gebleichtem Zellstoff. Besuchen Sie uns im Internet: http://www.transcript-verlag.de Bitte fordern Sie unser Gesamtverzeichnis und andere Broschüren an unter: [email protected]
Inhalt
Table of Contents | 11 Grußwort des Bundesverbandes Museumspädagogik e.V. Anja Hoffmann | 17
Grußwort der Arbeiterwohlfahrt Brigitte Döcker | 19
1. E inleitung Flucht und Kulturelle Bildung Bestandsaufnahme, Reflexion, Perspektiven Maren Ziese und Caroline Gritschke | 23
Asylum and Cultural Education Surveying, Reflecting and Looking Forward Maren Ziese and Caroline Gritschke | 35
2. B ildung und P erspek tiven Mitleid, Paternalismus, Solidarität Zur Rolle von Affekten in der politisch-kulturellen Arbeit María do Mar Castro Varela und Alisha Heinemann | 51
Refugees sind keine Zielgruppe Carmen Mörsch | 67
Die Kolonialität der Willkommenskultur Flucht, Migration und die weißen Flecken der Kulturellen Bildung Sandrine Micossé-Aikins und Bahareh Sharifi | 75
Zur Bedeutung von Kulturarbeit für Geflüchtete Erfahrungen aus dem Libanon und Überlegungen zum deutschen Kontext Leila Mousa | 87
Es bleibt anders Kämpfe um die (Pädagogik der) Migrationsgesellschaft Paul Mecheril | 101
Flucht und Handlungsfähigkeit, kulturelle Bildung und globale Ungleichheit Louis Henri Seukwa im Interview mit Maren Ziese | 107
3. K ünstlerische und ak tivistische P ositionen »The Infiltrators« – Crossing borders with participatory art (»The Infiltrators« – Mit partizipativer Kunst Grenzen überschreiten) Mayaan Sheleff | 123
Die Gedächtnisarbeit mit Geflüchteten als Kampf um Gerechtigkeit Felipe Polanía | 131
Can we talk about it? Über das Ankommen von LGBTIQ-Geflüchteten und eine sich verändernde Community Marty Huber und Queer Base | 141
Solidarität und Dissens Ülkü Süngün im Interview mit Caroline Gritschke | 149
Wir sind die Zukunft: Wir bleiben hier Mohammed Jouni im Interview mit Maren Ziese | 155
4. M ethoden und S tandorte Strategien für Zwischenräume Ver_Lernen in der Migrationsgesellschaft Büro trafo.K | 169
Globales Lernen in Museen als Form der kulturellen Bildung? Praxisbeispiele Katrin Boemke | 177
»Rassismus und Weißsein, das spielt bei uns keine Rolle«!? Critical Whiteness-Perspektiven auf Kulturelle Bildung Tobias Linnemann und Kim Annakathrin Ronacher | 187
Diversitätsbewusste kulturelle Bildung und Vermittlung im Kontext von Flucht Von der Idee zum institutionellen Arbeitsalltag Maren Ziese | 201
Erst eingeladen, dann fotografiert Bilder von Geflüchteten in Museen und anderen Bildungsinstitutionen Kea Wienand | 217
Geschichtsvermittlung und historische Gerechtigkeit Überlegungen zu Flucht, Asyl und postkolonial informierter Globalgeschichte im Museum Caroline Gritschke | 225
Kulturprojekte für und mit, aber selten von… Eine Spurensuche nach Motivationen und Haltungen nicht-geflüchteter Kulturschaffender im Theater Marlene Helling und Nina Stoffers | 237
Selbstbemächtigung und Würdigung der Überlebensleistung von traumatisierten Geflüchteten Maria Heller im Interview mit Caroline Gritschke | 253
5. S prachen und R äume Die Erfindung der Einsprachigen Überlegungen zur sprachlichen Vielfalt Radhika Natarajan | 261
Professionalisierung von Lehramtsstudierenden im Kontext von Fluchtmigration Mona Massumi und Karim Fereidooni | 275
ICOON for Refugees Ein Bildwörterbuch zur ersten Kommunikation für Geflüchtete und ihre Helfer_innen Gosia Warrink und Monika Pfau | 285
Kulturelle Bildung und das Erlernen der Mehrheitssprache in Zeiten der (expliziten) Wertevermittlung Rubia Salgado in Zusammenarbeit mit Lernenden und Lehrenden im Verein das kollektiv | 295
Acting in Art and Society Der Kunstraum als Raum für Geflüchtete Amelie Deuflhard | 305
Grandhotel Cosmopolis als Ort der Bildung von Gesellschaft Spannungen zwischen Utopie und Wirklichkeit Julia Costa Carneiro | 313
Nach der Flucht In einem neuen Leben Fußfassen am Beispiel des Übergangswohnheims Marienfelder Allee Uta Sternal im Interview mit Maren Ziese | 325
6. R eflek tierte P rojek terfahrungen »Kunst ist ein Grundbedürfnis« Ein Praxisbericht der Hamburger Kunsthalle über ihre Arbeit mit Geflüchteten Wybke Wiechell | 337
Fragen statt Antworten Internationale Klassen in der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen Julia Hagenberg | 345
»Kultur öffnet Welten« Interkulturelle Erfahrungen an der Basis Lydia Grün | 353
Multaka: Treffpunkt Museum Geflüchtete als Guides in Berliner Museen Razan Nassreddine in Zusammenarbeit mit dem Projektleitungsteam von Multaka | 361
Ehrenamt und Geflüchtete als Beteiligte in kulturellen Projekten Kritik an Selbstverständnis und Positionen Misun Han-Broich | 367
Interkulturelle Öffnung – notwendiger denn je? Ein Veränderungsmodell am Beispiel der Arbeiterwohlfahrt Talibe Süzen | 377
Einander begegnen und voneinander lernen Kultur als Türöffner Mohammad Alhamwi im Interview mit Caroline Gritschke | 385
7. P rojek tsteckbriefe boat people projekt, Göttingen | 391 KINO ASYL, München | 393 KUNSTASYL | 396 Lokstoff: »Pass.Worte. Wie Belal nach Deutschland kam«, Stuttgart | 399 Refugees’ Kitchen, Oberhausen | 402 reisegruppe heim-weh! (2014/15), Leipzig. Eine performative Stadtrundfahrt von und mit Asylsuchenden in Leipzig | 405 »Stadt-Spaziergang«, Ludwigshafen | 408 Völkerwanderung – Ein lebendiges Archiv für Geschichten von Kommen, Gehen und Bleiben, Freiburg | 410 »Zugvögel«, Heinersdorf (Brandenburg) | 413
M aterialien Materialien: Positionen, Tipps und Links Caroline Gritschke und Maren Ziese | 417 1. Haltung | 417
2. Diversität, Antirassismus-Arbeit und interkulturelle Öffnung | 419 3. Didaktische Materialien | 427 4. Arbeit und Praktika | 429 5. Verständigung | 430 6. Projekte: Übersichten und Datenbanken | 431 Autor_innen | 433
Table of Contents
Foreword from the German Association of Museum Education Anja Hoffmann | 17
Foreword from the Workers’ Welfare Association Brigitte Döcker | 19
1. I ntroduction Flucht und Kulturelle Bildung Bestandsaufnahme, Reflexion, Perspektiven Maren Ziese und Caroline Gritschke | 23
Asylum and Cultural Education Surveying, Reflecting and Looking Forward Maren Ziese and Caroline Gritschke | 35
2. E ducation and P erspectives Compassion, Paternalism, Solidarity On the Role of Affect in Political and Cultural Work María do Mar Castro Varela and Alisha Heinemann | 51
Refugees are not a Target Group Carmen Mörsch | 67
The Colonial Nature of the Willkommenskultur Flight, Migration and the White Stains of Cultural Education Sandrine Micossé-Aikins and Bahareh Sharifi | 75
On the Significance of Cultural Work for Refugees Experiences from Lebanon and Considerations for the German Context Leila Mousa | 87
It’s Still Different Conflict around the (Pedagogy of a) ›Migration Society‹ Paul Mecheril | 101
Refuge and Agency, Cultural Education and Global Inequality Louis Henri Seukwa in conversation with Maren Ziese | 107
3. A rtistic and A ctivist P ositions The Infiltrators – Crossing borders with participatory art Mayaan Sheleff | 123
Reflecting on History with Refugees as a Struggle for Justice Felipe Polanía | 131
Can we Talk about it? On the Arrival of LGBTIQ Refugees and a Changing Community Marty Huber and Queer Base | 141
Solidarity and Dissent Ülkü Süngün in conversation with Caroline Gritschke | 149
We are the Future: We’re Staying Here Mohammed Jouni in conversation with Maren Ziese | 155
4. M ethods and S tandpoints Strategies for the Interstices (Un)Learning in the ›Migration Society‹ Büro trafo.K | 169
Global Learning in Museums as a Form of Cultural Education? Case studies Katrin Boemke | 177
Racism and Whiteness is Irrelevant to us!? A Look at Cultural Education from the Perspective of Critical Whiteness Theory Tobias Linnemann and Kim Annakathrin Ronacher | 187
Diversity Awareness in the Context of Cultural Education and Outreach with Refugees From the Idea to the Day to Day of the Institution Maren Ziese | 201
First Invited, then Photographed Images of Refugees in Museums and other Educational Institutions Kea Wienand | 217
Museum Education and Historical Justice Reflections on Forced Migration, Asylum and Postcolonial Approaches to Global History in the Museum Caroline Gritschke | 225
Cultural Projects for and with, but rarely by … An Investigation of Motivations and Stances of Non-Refugee Theater Practitioners Marlene Helling and Nina Stoffers | 237
Empowerment and Acknowledgement of the Survival Tactics of Traumatized Refugees Maria Heller in conversation with Caroline Gritschke | 253
5. L anguages and S paces The Invention of Monolingualism Thoughts on Linguistic Diversity Radhika Natarajan | 261
The Professionalization of Education Students in the Context of Forced Migration Mona Massumi and Karim Fereidooni | 274
ICOON for Refugees A Pictorial Dictionary for Initial Communication between Refugees and their Supporters Gosia Warrink and Monika Pfau | 285
Cultural Education and the Acquisition of the Majority Language in Times of an (Explicit) Imparting of Values Rubia Salgado in collaboration with students and teachers from the association das kollektiv | 295
Acting in Art and Society The Artistic Space as a Space for Refugees Amelie Deuflhard | 305
Grandhotel Cosmopolis as a Site for Community Building Tensions between Utopia and Reality Julia Costa Carneiro | 313
After the Escape Gaining a Foothold in a New Life – The Example of the Marienfelder Allee Transitional Accommodation Center Uta Sternal in conversation with Maren Ziese | 325
6. R eflections on P roject E xperiences »Art is a Fundamental Need« A Review of the Hamburger Kunsthalle’s Work with Refugees Wybke Wiechell | 337
Questions Instead of Answers International School Classes Visiting the North Rhine-Westphalia Art Collection Julia Hagenberg | 345
Culture Opens Worlds Intercultural Experiences at the Grass Roots Level Lydia Grün | 353
Multaqa: Museum as Meeting Point Refugees as Guides in Berlin Museums Razan Nassreddine in collaboration with the project management team of Multaqa | 361
Volunteer Work and Refugees as Participants in Cultural Projects A Critique of Self-Conceptions and Positions Misun Han-Broich | 367
Intercultural Opening – More Necessary than Ever Before? A Model for Change using the Example of the Workers’ Welfare Association Talibe Süzen | 377
Coming Together and Learning from One Another Opening Doors with Culture Mohammad Alhamwi in conversation with Caroline Gritschke | 385
7. P roject P rofiles boat people projekt, Göttingen | 391 KINO ASYL, München | 393 KUNSTASYL | 396 Lokstoff: »Pass.Worte. Wie Belal nach Deutschland kam«, Stuttgart | 399 Refugees’ Kitchen, Oberhausen | 402 reisegruppe heim-weh! (2014/15), Leipzig. Eine performative Stadtrundfahrt von und mit Asylsuchenden in Leipzig | 405 »Stadt-Spaziergang«, Ludwigshafen | 408 Völkerwanderung – Ein lebendiges Archiv für Geschichten von Kommen, Gehen und Bleiben, Freiburg | 410 »Zugvögel«, Heinersdorf (Brandenburg) | 413
M aterials Materials: Positions, Tipps and Links Caroline Gritschke and Maren Ziese | 417 1. Stance | 417
2. Diversity, Anti-Racism Work and Intercultural Opening | 419 3. Educational Materials | 427 4. Work and Internships | 429 5. Communication | 430 6. Projects: Synopses and Databases | 431 Authors | 433
Museumspädagogik als Schnittstelle des transkulturellen Dialogs im Museum Grußwort des Bundesverbandes Museumspädagogik e.V.
Der Anstieg internationaler Mobilität in den letzten Jahren, insbesondere auch von Menschen, die Asyl suchen, stellt die Gesellschaft vor große Herausforderungen und bietet ihr zugleich große Chancen, sich selbst immer wieder neu zu verorten und neue Perspektiven zu öffnen. Gerade Museen, Gedenk- und Kulturerbestätten stehen – wie andere Bildungseinrichtungen auch – vor der Aufgabe, Wege zu finden, auch geflüchtete Menschen an Bildung, Kultur und Gesellschaft aktiv teilhaben zu lassen. Der Museumspädagogik bzw. der Bildungs- und Vermittlungsarbeit kommt dabei eine entscheidende Rolle zu: Sie gestaltet die Schnittstelle zwischen dem Museum mit seinen Inhalten und Exponaten und den Museumsbesucherinnen und -besuchern und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Öffnung und Veränderung des Museums. Der Bundesverband Museumspädagogik e.V. (BVMP) unterstützt daher die Veröffentlichung der Publikation »Geflüchtete und Kulturelle Bildung« unter der Herausgeberschaft von Caroline Gritschke und Maren Ziese. Er trägt damit seinem Anspruch Rechnung, die Museumspädagogik in Forschung und Praxis weiterzuentwickeln. Diversität, Inklusion und Partizipation sind dabei seit jeher wichtige Leitlinien für die Arbeit des Bundesverbandes Museumspädagogik. Die Vielfalt unserer Gesellschaft, die spezifischen Erfahrungen, Bedürfnisse und Interessen der Bürgerinnen und Bürger stehen im Mittelpunkt der museumspädagogischen Arbeit. Vermittlungsangebote im Museum ermöglichen formelle und informelle Bildung sowie Begegnungen in einer Institution, die Wissensspeicher, Medium und Erlebnisort zugleich sein kann. Kulturell-ästhetische Bildung stellt einen eigenen Zugang zur Welt dar und ist gerade in einer sich schnell verändernden Welt von herausragender gesellschaftlicher Bedeutung. Museumspädagoginnen und -pädagogen haben bereits in vielen Museen erste Programme konzipiert und umgesetzt, die an erprobte Zugänge etwa im Bereich des Sprachenlernens und der interkulturellen Arbeit im Museum anknüpfen. Sie
18
Anja Hoffmann
machen die Institutionen, in denen sie arbeiten, zunehmend zu Orten der Begegnung zwischen Menschen mit und ohne Fluchterfahrung. Auch bieten sie für internationale Klassen oder sogenannte Eingangsklassen, die die neu hinzugekommenen Kinder und Jugendlichen an das Schulsystem heranführen, vielerorts bereits spezielle Vermittlungsprogramme an. Seit 2013 ist der Bundesverband Museumspädagogik mit seinem Projekt »MuseobilBOX« Teil des Förderprogramms »Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung« des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Hier sind bildungsbenachteiligte Kinder und Jugendliche eingeladen, die Museen als Lernorte zu entdecken. Museen können ihre Kooperationsmöglichkeiten mit nicht-musealen Partnerorganisationen erweitern. Das Thema »Geflüchtete und Kulturelle Bildung« ist ein hoch aktuelles und zugleich noch junges Forschungs- und Praxisfeld. Bei der grundsätzlichen Ausarbeitung museumspädagogischer Strategien, Konzeptionen und Angebote stehen nach wie vor oft grundlegende Fragen im Raum: Wie findet sich Zugang zu dieser Zielgruppe und wie kann inklusiv gearbeitet werden? Welche Qualifikationen und Kompetenzen brauchen Museumspädagog_innen, die mit geflüchteten Menschen arbeiten? Wie können Geflüchtete im Museum so gestärkt werden, dass sie für ihre eigenen Anliegen selbstbewusst eintreten und damit auch unsere Gesellschaft aktiv mitgestalten? Und nicht zuletzt: Wie müssen sich das Museum und die museale Arbeit selbst verändern? Das vorliegende Buch eröffnet verschiedene Zugänge zu Antworten auf diese Fragen. Es skizziert gelungene Beispiele aus dem Bereich der Kulturellen Bildung in Museen wie auch anderen Kultursparten. Viele der innovativen Projekte zeigen Kooperations- und Vernetzungsmöglichkeiten auf. Die Publikation lädt zum interdisziplinären Austausch ein. Anja Hoffmann Vorsitzende Bundesverband Museumspädagogik e.V.
Grußwort der Arbeiterwohlfahrt
Weltweit sind fast 60 Millionen Menschen auf der Flucht – so viele wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Sie verlassen ihre Heimat, Verwandte und Freunde, weil sie aus politischen, religiösen, sozialen, geschlechtsspezifischen oder ethnischen Gründen verfolgt werden, weil ihnen Haft, Misshandlung oder Folter drohen. In der Hoffnung auf ein besseres und sicheres Leben machen sich diese Menschen auf den Weg – auch nach Europa und Deutschland. Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) gehört zu den sechs Spitzenverbänden der Freien Wohlfahrtspflege in Deutschland. Sie betreut und unterstützt in zahlreichen Wohnheimen, Erstaufnahmeeinrichtungen und in mehr als 200 Migrationsfachdiensten Flüchtlinge in ganz Deutschland. Ganz konkret setzt sich die AWO für einen menschenwürdigen Umgang mit Flüchtlingen ein. So engagiert sich die AWO für die Verbesserung ihrer rechtlichen und sozialen Situation und als Trägerin von Unterkünften in der Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen, besonders Schutzbedürftigen und unbegleiteten Minderjährigen. Ihre Beratungs- und Unterstützungsangebote reichen von der Asylerst- und Asylverfahrensberatung, der psychosozialen Unterstützung, Hilfestellungen im Umgang mit Behörden bis zu speziellen Angeboten wie z.B. für Flüchtlingsfrauen. In den letzten Jahren kooperierte die AWO bundesweit sehr erfolgreich mit Kulturinstitutionen, um Bildungsangebote für Geflüchtete zu realisieren. Als Modellbeispiele können die zahlreichen Berliner Projekte fungieren. So kooperiert das Berliner AWO Refugium Pankstraße mit den Uferstudios (Zentrum für zeitgenössischen Tanz). Das AWO Refugium Berlin-Buch und die dort lebenden Geflüchteten veranstalteten eine Aktionsreihe mit dem Deutschen Architektur Zentrum DAZ. Junge Geflüchtete aus dem Berliner AWO Refugium am Kaiserdamm arbeiteten mit den Berliner Festspielen und der Universität der Künste Berlin zusammen. All dies sind sehr gelungene Beispiele für Kooperationen und innovative Kulturprojekte, in denen neuangekommene und etablierte Bürgerinnen und Bürger gemeinsam mitmischen und Geflüchtete auch selbstorganisiert tätig sind. Zudem engagiert sich der AWO Bundesverband für eine grundlegende Verbesserung der oftmals schwierigen sozioökonomischen Lebenslagen von Einwanderer_innen
20
Brigitte Döcker
und versucht in vielfältigen migrations- und flüchtlingspolitischen Foren, diskriminierende Strukturen aufzubrechen. Auf Grundlage des AWO-Leitbildes und der Erfahrungen vor Ort signalisiert die AWO immer wieder, welcher politische und gesellschaftliche Handlungsbedarf besteht, um die Lebensbedingungen von Menschen mit Migrationshintergrund nachhaltig zu verbessern und echte Teilhabe zu ermöglichen. Die AWO setzt sich dafür ein, das einseitige Konzept der Integration als individuelle Anforderung an Einwander_innen durch die aktive Gestaltung einer inklusiven Gesellschaft zu ersetzen. Von dieser Arbeit und den Grundlagen der Interkulturellen Öffnung berichtet der Artikel von Dr. Talibe Süzen in diesem Buch. Die AWO hat den Anspruch, ihre Dienste allen Menschen zur Verfügung zu stellen und inklusiv zu sein. Für die AWO kann gesagt werden, dass hier schon vor den aktuellen Fluchtbewegungen erkannt wurde, dass die Mitgestaltung der Einwanderungsgesellschaft und die interkulturelle Öffnung viele Vorteile mit sich bringen. Wir wünschen uns auch weiterhin erfolgreiche Kooperationen, um uns gemeinsam mit Kunst-/Kulturschaffenden und Kultureinrichtungen für das Ankommen von Geflüchteten und ihre dauerhaften Perspektiven nachhaltig zu engagieren. Dieses Buch ist eine dringende kulturpolitische Notwendigkeit, Projekte mit Modellcharakter, erfolgreiche Methoden und Ansätze möglichst vielen Kulturschaffenden und Geflüchteten, Sozialarbeitern und Wohnheimleiterinnen bekannt zu machen. Nur so kann die Diskriminierung von Newcomer_innen in Gesellschaft und Alltag, auf dem Wohnungs- und Arbeitsmarkt, in Bildung und im Kulturbereich für Geflüchtete überwunden werden und eine inklusive Gesellschaft gemeinsam und aktiv gestaltet werden. Brigitte Döcker AWO-Bundesverband, Mitglied des Vorstandes
1. Einleitung — Introduction
Flucht und Kulturelle Bildung Bestandsaufnahme, Reflexion, Perspektiven Maren Ziese und Caroline Gritschke
Das Umschlagsbild der vorliegenden Publikation entstand im Rahmen eines viertägigen Workshops mit Geflüchteten und dem Vermittlungsteam der Kunsthalle Shedhalle Zürich. Die Vielfalt von Erinnerungen und Emotionen von Geflüchteten trat in Dialog mit den künstlerischen Positionen der Ausstellung »… The others have arrived safely. Gedächtnisverlust und Geschichtspolitik: Künstlerische Strategien«1 und fand eine eigene, kreative Ausdrucksform, die auf dem Foto festgehalten ist. Der abgebildete Gruppenprozess unter Einsatz künstlerischer Mittel und Methoden ist eine typische Vermittlungssituation und zeigt ein konkretes Beispiel für die Aktivitäten der Kulturellen Bildung im Themenfeld »Flucht«. Kulturelle Bildung, d.h. die Auseinandersetzung mit Kunst und Kultur, wird in diesem Beispiel als eigenständige kulturelle Praxis verstanden, die Beziehungen herstellt, Handlungsräume eröffnet und die kritische Reflexion und Umgestaltung von Verhältnissen anstrebt. Dabei verstehen die Herausgeberinnen Kulturelle Bildung nicht als »Werteerziehung«, doch zugleich sind Kunst und Kulturelle Bildung unserem Verständnis nach auch nicht »neutral«, sondern haben immer auch eine gesellschaftliche Prägung und Relevanz. Die Kulturelle Bildung ist ein Feld, in dem viele ambitionierte Projekte mit Geflüchteten realisiert werden. Kulturinstitutionen haben sich ihrem eigenen Selbstverständnis nach als wichtige zivilgesellschaftliche Akteure für Geflüchtete und ihre kulturelle Teilhabe engagiert eingesetzt. Im Kulturbereich werden zur Zeit zahlreiche finanzielle Mittel bereitgestellt, um Geflüchteten Angebote in Museen, Theatern, Konzerthäusern oder Bibliotheken zu machen. Hier herrscht die Überzeugung: Kunst und Kultur kommen aufgrund ihrer übergreifenden kommunikativen und in ihrer Kreativität besonders zukunftsweisenden Potentiale eine Schlüsselfunktion bei der sogenannten gesellschaftlichen Integration zu. Zur Zeit sind über 65 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht, davon wurden 1,1 Millionen Menschen als Asylsuchende in Deutschland statistisch im 1 | In der vorliegenden Publikation berichtet Felipe Polanìa von diesem Projekt.
24
Maren Ziese, Caroline Gritschke
EASY-System erfasst. Wir sind Zeitzeugen dieses Geschehens. Die Ankunft der Menschen, die ihre Heimat verlassen haben, ist für uns leiblich spürbar. Diese transnationale, transkontinentale Mobilität mit vermehrter Zuwanderung führte und führt zu demografischer Vielfalt. Es findet eine umfassende Dekonstruktion überkommener Ordnungsvorstellungen statt. Ein gleichberechtigtes Miteinander außerhalb einer »Willkommenskultur« besitzt oft noch keine Alltagspraxis. Besonders Menschen mit Fluchthintergrund werden aus vielen gesellschaftlichen Bereichen ausgeschlossen. Wenn wir über die Neuankömmlinge sprechen, tun wir das häufig mit unreflektierten oder kollektivierenden Begriffen, die eine Ausgrenzung erleichtern. »Vor allen Dingen mögen wir es nicht, wenn man uns ›Flüchtlinge‹ nennt«, schrieb Hannah Arendt 1943 in ihrem Essay »We Refugees« in der Zeitschrift Menorah Journal. Wie wir über die Menschen sprechen, die in Deutschland Schutz suchen, wie wir sie benennen, prägt die Perspektiven und den Diskurs. Im vorliegenden Sammelband werden verschiedene Bezeichnungen verwendet, die möglichst reflektiert die Gruppe von Personen, die gemeint ist, im jeweiligen Kontext beschreiben. Dabei wird in jedem Fall auf entindividualisierende Vokabeln verzichtet, wie z.B. auf die bereits in den Debatten um die Änderung des Grundgesetzartikels 16 von 1993 beliebten Wassermetaphern (»Asylantenflut«, »Flüchtlingswelle«, »Flüchtlingsströme«). Der Begriff »Flüchtling« ist insofern ebenfalls problematisch, als er die so Bezeichneten auf den Aspekt der Flucht reduziert und gleichzeitig einen Rechtsbegriff beschreibt. Wer spricht hier also über wen und wer besitzt die Macht, Begriffsbildungen und Definitionen im öffentlichen Diskurs zu setzen und durchzusetzen? Die Zuweisung eines Status durch einen definierenden Begriff ist ein rechtsetzender Akt. Hier ist zunächst an den Begriff des »Flüchtlings« zu denken, wie er in der engen Auslegung des wichtigsten völkerrechtlichen Dokuments zum Schutz von Flüchtlingen, der Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 (Artikel 1), niedergelegt ist. Danach wird einer Person die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt, die »aus der begründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung sich außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt, und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Befürchtungen nicht in Anspruch nehmen will; oder die sich als staatenlose infolge solcher Ereignisse außerhalb des Landes befindet, in welchem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt hatte, und nicht dorthin zurückkehren kann oder wegen der erwähnten Befürchtungen nicht dorthin zurückkehren will.«
Das Dokument war zunächst darauf ausgelegt, europäische Flüchtlinge nach dem Zweiten Weltkrieg zu schützen. Mit dem Protokoll von 1967 wurde der Geltungs-
Flucht und Kulturelle Bildung
bereich zeitlich und geografisch erweitert. Nicht erfasst sind in dieser Definition Menschen, die vor Folter oder Todesstrafe fliehen, vor Krieg oder Bürgerkrieg, wegen des Klimas oder aus existentieller, wirtschaftlicher Not. Diese Menschen sind entweder in der nationalen Gesetzgebung an anderer Stelle rechtlich erfasst und können Schutz im Aufnahmeland erlangen, oder sie sind von der Erlangung eines Aufenthaltsstatus weitgehend ausgeschlossen. Im vorliegenden Buch, in den Perspektiven und Projekten unterscheiden wir nicht nach Rechtsstatus und bewerten nicht die Motive der Flucht, sortieren nicht zwischen »guter«, »mittlerer« und »geringer Bleibeperspektive«, wie es inzwischen ohne juristische Grundlage bei der Zumessung von Leistungen und Inklusionsangeboten an vielen Stellen üblich geworden ist. Dennoch ist es aus unserer Sicht sinnvoll, Menschen, die seit 2015 (und auch schon darüber hinaus) in Deutschland Zuflucht suchen, in dieser Publikation sowie in der Kultur- und Bildungsarbeit in den Blick zu nehmen. Es besteht die Gefahr, dass sie mit ihrer Sichtbarkeit im Rahmen der postulierten Migrationsgesellschaft verschwinden oder unter dem Stichwort »Diversität« unsichtbar gemacht werden können. Die fokussierte Betrachtung ist vor allem notwendig, um strukturelle Ungleichheiten nicht zu verdecken. Keine in Deutschland lebende Gruppe ist mit weniger Rechten und Partizipationsmöglichkeiten ausgestattet. Während des Asylverfahrens und ohne Schutzstatus nach der Genfer Flüchtlingskonvention sind die Zugänge zu medizinischer Versorgung, zu Arbeit und selbstbestimmtem Wohnen stark eingeschränkt Letzteres soll nach dem geplanten Integrationsgesetz sogar für Menschen gelten, denen die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt wurde. Zu keinem Zeitpunkt ist somit der Rechtsstatus geflüchteter Menschen auf Dauer ausgelegt. Das hat Auswirkungen auf Handlungsmöglichkeiten und Selbstkonzeption. Es wäre falsch, diese Ungleichheiten im Mainstream der Migrationsgesellschaft verschwinden zu lassen und eine falsche Augenhöhe zu postulieren, um damit die Bemühungen der Neuangekommenen um Integrität zu unterlaufen, die oftmals als Zwang zur Assimilierung empfunden werden, wie schon Hannah Arendt in ihrem bereits zitierten Essay beklagt: »Nur sehr wenige Individuen bringen die Kraft auf, ihre eigene Integrität zu wahren, wenn ihr sozialer, politischer und juristischer Status völlig verworren ist.« (Arendt 1943/1986: 16) Dabei gilt es, Menschen mit Fluchterfahrung nicht zur Zielgruppe pädagogischer Bemühungen und zu Objekten des Handelns der Mehrheitsgesellschaft zu machen, sondern sie als Beteiligte, Gesprächspartner*innen,2 als Lehrende und Lernende, als Akteur*innen wahrzunehmen. Wir verwenden dafür vor allem den Begriff »Geflüchtete«, der als substantiviertes Partizip lediglich einen Aspekt ausdrückt, den alle gemeinten Personen gemeinsam haben: Sie sind aus einem 2 | Zur Bezeichnung mehrerer Geschlechter wird von Seiten der Herausgeberinnen im Band eine Variante der Gap-Schreibweise verwendet (* oder _), um sprachlich mehr als zwei Geschlechtsidentitäten zu bezeichnen. Einige Autor*innen haben die Schreibweise unterschiedlich gehandhabt und wir haben diese Vielfalt auch bewusst bestehen lassen.
25
26
Maren Ziese, Caroline Gritschke
anderen Land nach Europa geflohen, um hier Schutz zu suchen. Der alternative, den Ort des Schutzes ebenfalls primär in den Blick nehmende Begriff »Refugees« verweist inhaltlich auf Ähnliches und wird in einigen Beiträgen des Bandes anstelle des Begriffs »Geflüchtete« variierend und mit der jeweils im Beitrag ihm zugeschriebenen Konnotation verwendet. Auch wenn die Faszination von Kulturschaffenden für das Thema Flucht kritisch überdacht werden muss, bietet sich nun die positive Gelegenheit, für den Kulturbereich eine umfassende Repositionierung vorzunehmen, Diversität neu zu denken. Kritische, von Geflüchteten und migrationserfahrenen Menschen selbst erstellte Hinweise, Fragen und Leitfäden können helfen, die Angebote der kulturellen Bildung zu reflektieren. In Zeiten von Flucht und Migration wirft das Thema »Geflüchtete« alte und neue Fragestellungen auf und bringt neue Chancen, um gemeinsam an einem inklusiven Gesellschaftsmodell zu arbeiten und den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken.
L eitfr agen des B uches Nach der engagierten Zunahme von Projekten mit Geflüchteten im Bereich der Kulturellen Bildung ergaben sich schnell sehr unterschiedliche Fragestellungen: Praktische Umsetzungsmöglichkeiten, Gelingensbedingungen bzw. die Schwierigkeiten einer kontinuierlichen Bildungsarbeit wollten ebenso reflektiert und diskutiert sein wie Fragen nach der eigenen Haltung und nach der Rolle der Kulturinstitutionen als gesellschaftliche Akteure. Daraus ergaben sich für uns Leitfragen, die wir mit dem Sammelband zu beantworten versuchen: • Was ist das Ziel Kultureller Bildung im Bereich Flucht? • Was kann Kulturarbeit und Kulturvermittlung mit Geflüchteten leisten? • Welche Relevanz hat die Arbeit mit Geflüchteten in einer komplexen, heterogenen Gesellschaft? • Warum sollen Geflüchtete an Bildungs- und Vermittlungsprojekten teilnehmen? • Was für ein Angebot sollten die Kulturinstitutionen zum Thema »Flucht« unterbreiten? Sollten sie Raumgeber, Ermöglichungsinstitutionen oder ein Aushandlungsort für gesamtgesellschaftliche Fragestellungen sein? • Wie vermeiden Akteur*innen der Kulturellen Bildung es, Menschen auf ihren Fluchtstatus zu reduzieren, und wie schaffen sie es dennoch, Geflüchtete und ihre Geschichten sichtbar zu machen? • Wie sollte Kulturarbeit mit Geflüchteten gestaltet werden? Mit welchen Perspektiven und Methoden kann und sollte gearbeitet werden? • In welchem Verhältnis stehen Kulturelle Bildung und Antirassismus-Arbeit?
Flucht und Kulturelle Bildung
• Welche Rolle spielen Kulturarbeit und Kulturelle Bildung bei der Verwirklichung von Teilhaberechten (selbstbestimmtes Wohnen, Arbeiten, Zugang zu Bildung etc.)? • Wie kann eine zeitgemäße solidarische Bildung aussehen?
Z ielse t zungen des B uches Bei der vorliegenden Publikation handelt es sich um eine substantielle Bestandsaufnahme, welche aktuelle Theorien, Methoden und Praktiken in den Blick nimmt und eine Reaktion auf den dringenden Reflexions- und Handlungsbedarf darstellt. Es fehlt bislang ein Diskursbuch zu diesem Thema und der Bedarf nach Antworten, Anregungen und Austausch unter den Akteur*innen der Kulturellen Bildung ist immens. Auf diesen Bedarf möchte der Sammelband reagieren. Das Buch stellt tragfähige Konzepte und Strategien vor und die Texte zeigen einen Ausschnitt der vielfältigen Ansätze und Arbeitsformen sowie der Fragen, die sich in ihnen stellen. Ausgangspunkt ist die wertschätzende Verdeutlichung, welche Arbeit bereits engagiert geleistet wurde im Feld der Kulturellen Bildung für, mit und von Geflüchteten. Dabei geht es bei den Projektvorstellungen nicht um »best practice«-Vorhaben, sondern um eine Mitteilung von Erfahrungswissen, um voneinander zu lernen. Die Autor*innen bieten Ansatzpunkte für eine intersektionale3 kritische Reflexion der Projektarbeit. Um ausgehend von den mitgeteilten Praxisperspektiven eine kritische Evaluation der geleisteten Arbeit zu ermöglichen, haben wir auch Beiträge aus Pädagogik, Antirassismusarbeit und Wissenschaft angefragt. Im Nachdenken über Möglichkeiten und Notwendigkeiten einer Revision etablierter Handlungsroutinen ist es uns wichtig, differenz- und machtsensible Ansätze zu verfolgen, die vor allem die Kritik von Seiten der Aktivist*innen und postkolonialen Theoretiker*innen an der Dominanz weißer Sichtweisen und Repräsentationspraktiken im Kulturund Bildungsbereich aufgreifen will.
A ufbau des B uches Das Buch gliedert sich in fünf inhaltliche Rubriken, wobei viele Beiträge auf mehrere Rubriken verweisen. Das ist durch die Vielfalt und Heterogenität des Themenfeldes Flucht und Kultur begründet sowie durch die Diversität der Autor*innen. Die Zuordnung zu den Rubriken entspricht den Schwerpunkten, die
3 | Zum Konzept der Intersektionalität, das Kategorien wie Ethnizität, Nation, Klasse oder Gender nicht getrennt, sondern als miteinander verwoben betrachtet und analysiert, vgl. Crenshaw (1989); Walgenbach (2012).
27
28
Maren Ziese, Caroline Gritschke
wir in den Beiträgen gesehen haben und die lediglich eine erste Orientierung für die Leser*innen bieten soll. Im Kapitel Bildung und Perspektiven werden thematisch übergreifend und intersektional zentrale Aspekte der aktuellen Debatte um Flucht und Asyl im Kontext von Bildung und Kulturarbeit analysiert. Die Beiträge aus Kunst, Kunstvermittlung, Migrationspädagogik, Politikwissenschaft, Geografie und aus dem kuratorischen Bereich überschreiten nationale und disziplinäre Grenzen. Sie nehmen grundlegend gegenwärtige Projektarbeit mit und für Geflüchtete in den Blick, einige aus der Perspektive postkolonialer Kritik. Die Texte fordern vor allem zur Selbstreflexion der beteiligten Kulturakteur*innen auf. Im Rahmen der Kulturellen Bildung sollten Affekte, Privilegien, strukturelle Ungleichheiten und die Funktion von Kulturprojekten in der Gesellschaft stets mitbedacht und diese Überlegungen in die konkrete Arbeit eingebracht werden. Künstlerische und aktivistische Positionen von Menschen mit und ohne Fluchterfahrung stehen im Mittelpunkt des nächsten Kapitels. Die Autor*innen stellen in ihren Arbeiten und Projekten einen engen Zusammenhang zwischen Kunst und Politik her. Die partizipative Arbeit mit Geflüchteten und zum Thema Flucht bewegt sich im Kontext der aktuellen gesellschaftlichen Debatten über Flucht und Asyl und will Verschwiegenes und Verdrängtes sichtbar machen. Geflüchtete Autor*innen beschreiben Prozesse der Selbstermächtigung, um im Rahmen von Kulturprojekten mit eigenen Positionen wahrgenommen zu werden. Auf Fragen nach Methoden und Standorten antwortet der folgende Abschnitt des Buches. Hier werden einerseits konkrete Techniken für eine diversitätssensible Bildungs- und Vermittlungsarbeit vorgestellt und das Konzept des Globalen Lernens diskutiert. Auch der Umgang mit Traumata in der Zusammenarbeit mit Geflüchteten kommt zur Sprache. Andere Texte des Kapitels machen den eigenen Standort rassismuskritisch zum Thema der Kulturarbeit mit Geflüchteten und beschäftigen sich mit Positionierungen von Flucht und Asyl in Kulturinstitutionen und in der Gesamtgesellschaft. In Kulturinstitutionen und -projekten wird häufig davon gesprochen, dass man sich »für Geflüchtete öffnen« möchte. Was das konkret heißt, ist das Thema der Artikel, die unter dem Titel Sprachen und Räume versammelt sind. Autor*innen reflektieren die Bedingungen und interkulturellen Wirkungen von Projekten, in denen Geflüchtete in einer Kultureinrichtung Raum gegeben wird für eigene und vernetzte Arbeiten. Wie und worüber Kulturvermittler*innen und Geflüchtete in diesen Räumen sprechen, hängt auch davon ab, ob man miteinander kommunizieren kann. Performative oder zeichengestützte Wege der Verständigung bieten Möglichkeiten jenseits der Zusammenarbeit mit Sprachlernkursen. In diesem Abschnitt wird auch der Umgang mit Sprachenlernen in Schulen und Kultureinrichtungen beleuchtet und die Frage nach der Bewertung von Mehrsprachigkeit in diesen Zusammenhängen aufgeworfen. In einem letzten Kapitel stehen ganz konkrete reflektierte Projekterfahrungen im Mittelpunkt. Bildungs- und Vermittlungsarbeit mit geflüchteten Schülerin-
Flucht und Kulturelle Bildung
nen und Schülern, Projektarbeiten, die plötzlich auch politisches Handeln erforderlich machten. Kulturarbeit zum Thema »Flucht« in ländlichen Regionen werden hier ebenso vorgestellt und analysiert wie die Erfahrungen Teilnehmender mit Fluchterfahrung. Am Ende des Kapitels werden einige ausgewählte Projektbeispiele vorgestellt. Sie sind ein kleiner Ausschnitt der unglaublichen Fülle von tatkräftigen Kulturinitiativen und engagierten Vorhaben. Anhand von vier Fragen zeichnen die angefragten Projektinitiator*innen die ursprünglichen Intentionen und die Veränderungen im Projektverlauf nach und geben praktische Tipps und Reflexionshinweise. Die gewählte Gliederung ist darum bemüht, die unterschiedlichen Sichtweisen auf das Thema zur Geltung kommen zu lassen. Dem wird auch durch eine Vielfalt von Textformen Rechnung getragen: Neben wissenschaftlichen Aufsätzen finden sich Gespräche, ein Vortrag, kürzere Stellungnahmen und leitfragengestützte Projektsteckbriefe.
S elbstpositionierung der H er ausgeberinnen Wir Herausgeberinnen arbeiten beide festangestellt in Ausstellungsinstitutionen, die sich mit ihrer Bildungs- und Vermittlungsarbeit im Themenfeld des Buches bewegen. Lehrer*innen von Sprachlernklassen oder auch sogenannte Willkommensklassen meldeten sich bei uns und fragten »Welche Angebote bietet Eure Institution für uns?« Wir haben Bildungs- und partizipative Vermittlungsprojekte mit Geflüchteten an Schulen, in Wohnheimen und an unseren Häusern konzipiert sowie realisiert und erhielten Anrufe von Kolleg*innen aus dem Kulturbereich, die an einem Austausch interessiert waren. Dozent*innen, Lehrer*innen, Sozialarbeiter*innen und andere Akteure aus dem Praxisfeld »Bildung, Migration und Flucht« kamen in unsere Häuser, nutzten die Ausstellungen für selbsterarbeitete Zugänge zum Thema »Flucht, Migration und Diversität« und arbeiteten losgelöst von uns an Aspekten der Ausstellung(en), in und außerhalb der Grenzen der Institution. Wir hatten Menschen mit Fluchterfahrung zur Hospitation an unserem Arbeitsplatz und unterzogen uns und unser Team an freien Mitarbeiter*innen Schulungen zu »Globalem Lernen« oder »Diversität«. Aufgrund unserer eigenen Ausbildungswege und Prägungen durch Denkschulen und Praxisansätze wie Postkolonialismus, Migrationsgeschichte, AntiBias-Arbeit, Kritisches Weißsein, Antisemitismusforschung, Kritische Kulturvermittlung und Institutionskritik war und ist es uns ein Anliegen, unsere Arbeitsorte für uns als lernende Institutionen zu definieren. Dabei gilt auch für uns als Herausgeberinnen, dass wir uns in der paradoxen Anforderung an pädagogisch Handelnde verorten, wie sie von Paul Mecheril beschrieben worden ist: Zum einen müssen Differenz und die damit verbundene
29
30
Maren Ziese, Caroline Gritschke
Ungleichheit anerkannt werden. Davon auszugehen, dass alle gleich sind, hat Ausschlüsse und Benachteiligungen zur Folge für alle, die nicht in die Vorstellung passen, die sich zum Beispiel unsere Ausstellungsinstitution von unseren »Besucher*innen« macht. Zugleich basiert die Anerkennung aber immer auf Kategorien, die auch Zuschreibungen produzieren, nämlich dass Menschen auf der Ebene von Kultur oder Herkunft festgeschrieben werden. In unserer Migrationsgesellschaft bemühen wir uns daher, die Anerkennung in einer reflektierten Bildungspraxis von Dekonstruktion zu begleiten, die Kategorien und die damit verbundenen Vorannahmen wollen wir hinterfragen, und – wenn möglich, verschieben oder aufheben. Auch für uns als Herausgeberinnen gilt: Kulturvermittlung ist weiterhin ein mehrheitsgesellschaftlich-weiß dominiertes Arbeits- und Handlungsfeld. Wie können wir als weiße Herausgeberinnen über eine Kulturelle Bildungsarbeit sprechen, die einer heterogenen und mehrsprachigen Gesellschaft Rechnung trägt, wenn die Definitionsmacht, die bezahlten Jobs, die pädagogischen Rollen vielfach bei uns Mehrheitsangehörigen verbleiben? Wir können diesen Ausschluss im Feld der Kulturvermittlung nicht ignorieren, sondern nur benennen und anstreben, diesen Ausschluss zu unterbrechen. Wir wünschen uns für uns selbst eine Reflexivität gegenüber unseren Vorannahmen, was die institutionellen Strukturen und gesellschaftlichen Verhältnissen anbetrifft, die unsere Arbeit mitbestimmen. Doch können wir als festangestellte Kulturvermittlerinnen in Leitungspositionen bei einer Selbstkritik und -reflexion nicht stehen bleiben, sondern sind immer auch Handelnde. Irit Rogoffs Fragen »Was kommt eigentlich nach der Kritik? Wie kann Kritik Folgen haben, die wir nicht bereits vorher definieren und kennen?« versuchen wir in eine methodisch und theoretisch informierte Praxis einzubringen, ohne schon vorher zu wissen, was dabei herauskommen wird.
A utor*innen Die Veränderungen, die wir erleben, verlangen danach, dass sie aus vielen Perspektiven angesehen und gedeutet werden. Der Kulturbetrieb sollte vielstimmiger werden, daher kommt eine Vielzahl an Stimmen in diesem Buch zu Wort (kulturelle Bildungs- und migrationswissenschaftliche Perspektiven, Aktivist*innen, festangestellte Museumspädagog*innen, Sozialarbeiter*innen, Menschen ohne Job, Studierende, Professor*innen, Künstler*innen und Kurator*innen, Theaterschaffende). Die ausgewählten Autor*innen verdeutlichen unterschiedliche Blickwinkel auf das Feld und bringen ihr Expert*innen-Wissen ein. Sie repräsentieren wichtige und innovative Zweige dieses neuen und auch historisch fundierten Themenfeldes.
Flucht und Kulturelle Bildung
Darüber hinaus soll durch die Auswahl der Autor*innen und die Struktur des Buches der Wissens- und Erkenntnisaustausch angeregt werden, wobei eine Wechselwirkung zwischen Praxis und Wissenschaft angestrebt wird. Gelegentlich beziehen sich Praxiserfahrungen und akademische Reflexion aufeinander oder stehen sich kontrovers gegenüber. Wir haben hier nicht glättend oder bewertend eingegriffen, sondern sind von der Produktivität des Dialogs zwischen unterschiedlichen Wissensbereichen überzeugt. Die Leser*innen des Bandes sollen sich selbst ein Bild machen und den Austausch aktiv weiterführen. Daher sind auch die Mailadressen vieler Autor*innen für eine Kontaktaufnahme im Anhang genannt. Die Frage, »wer spricht«, haben wir uns bei der Anfrage an die Autor*innen stets vor Augen geführt. Von unserem Anspruch her sollte dieses Buch eine Ressource der Sichtbarkeit sein und einen alternativen Referenzrahmen erzeugen, indem sich alte und neue Stimmen in die Diskussion einbringen. Es gibt jedoch einige Stimmen, die in diesem Buch leider nicht sprechen, obwohl sie ein Recht auf Teilhabe an einem sie direkt betreffenden Diskurs haben. Wir haben mehr Personen und Organisationen um Beiträge gebeten, als sich jetzt im Buch wiederfinden. In diesem Prozess haben wir uns selbstkritisch gefragt, warum es uns trotz zahlreicher Bemühungen nicht gelungen ist, kontaktierte Selbstorganisationen und Geflüchtete für einen Buchbeitrag oder ein Gespräch zu gewinnen. Wir fragen uns, ob wir nicht andere Formate der Ansprache und Einbeziehung hätten finden können. Haben wir die Angefragten auf ihren »Status als« bei den Anfragen reduziert? – Warum haben wir angenommen, dass bei einem Diversitätsperspektiven abbildenden Buch über »Kulturelle Bildung und Geflüchtete« ausgerechnet Geflüchtete ein größeres Gewicht haben sollten? Warum erlauben wir uns, zu erwarten, dass »Geflüchtete« sich für ein Buch über »Geflüchtete« interessieren sollten? Wir fanden uns in dem fortdauernden Rezeptionsmuster, das bspw. auch die afrikanische Kunst und Kultur im eurozentristischen Kontext widerfuhr: »Afrikanische« Künstler*innen wurden zu »Afrika-Ausstellungen« eingeladen und es wurde erwartet, dass vor allem auch »afrikanisches« Publikum sich für dieses Thema interessiert. – Stereotypisierungen und Fixierungen sind Themen dieses Buches, mit denen wir uns nicht zuletzt mit der Begrenztheit unseres eigenen Horizonts auseinandersetzen.
Z wischenstand , F orschungsaufgaben und A usblick Als Maren Ziese zu Beginn des Jahres 2015 die Idee zu dem vorliegenden Band hatte, war das Thema »Flucht« in der öffentlichen Debatte sehr präsent. »Willkommenskultur« dominierte den Diskurs. Parallel dazu waren Anschläge auf geplante oder bereits im Betrieb befindliche Unterkünfte und rassistische Übergriffe stets gegenwärtig. Während die Anzahl der rassistischen Gewalttaten weiterhin steigt, sind die Medienbilder des fröhlichen Miteinanders auf Willkommensfes-
31
32
Maren Ziese, Caroline Gritschke
ten nahezu verschwunden. Die Zahl der neu eintreffenden Geflüchteten ist stark gesunken – eine Momentaufnahme zum Zeitpunkt der Textabfassung, denn die Situation kann sich jederzeit auch wieder ändern. Deutschland und Europa beschäftigen sich mit der Abwehr der Schutzsuchenden an den südlichen Außengrenzen; im Inland werden gleichzeitig die Möglichkeiten, Schutz in einem sicheren Aufenthaltsstatus zu finden, immer weiter eingeschränkt. Seit die körperliche Präsenz der Geflüchteten uns nicht mehr direkt an die Ursachen ihrer Flucht erinnert, verringern sich die Debatten. Es bleibt zu hoffen, dass die Förderprogramme für die Kulturarbeit mit Geflüchteten weiter bestehenbleiben und verstetigt werden. Das Buch erscheint mitten in diesem zu beobachtenden Perspektivwechsel der deutschen und europäischen Öffentlichkeit. Dabei sind das ursprüngliche Vorhaben und die Ziele des Buches aktueller denn je. Die Fragen und Probleme, Inkonsistenzen und exkludierenden Faktoren, auf die die Anwesenheit der Geflüchteten wie ein Brennglas unsere Aufmerksamkeit richtete, sind weiterhin vorhanden: Wie gestalten wir eine vielfältige Gesellschaft, in der alle zwar nicht gleich sind, aber gleiche Rechte haben, die auch praktisch in Lebens- und Partizipationschancen umgesetzt werden? Welche Rolle spielen Kultur und Bildung in diesen Prozessen? Die zentrale Aufgabe, die sich aus dem Themenfeld »Flucht und Kulturelle Bildung« ergibt, ist die Entwicklung nicht nur der Kulturellen Bildung, sondern des gesamten Kulturbetriebs entlang eines inklusiven Gesellschaftsmodells. Das bedeutet unter anderem die Einbeziehung vielfältiger Sicht- und Arbeitsweisen, Repräsentation statt Präsentation und damit eine vielfaltssensible Öffnung der Kulturinstitutionen. Auch eine Verstetigung und Verankerung der Bildungsprogramme und Vermittlungsangebote gehören dazu. Darüber hinaus stehen zur Zeit Vorschläge im Raum, vergleichbare Qualitätsvorstellungen von eben diesen Bildungsprogrammen und Vermittlungsangeboten sowie Qualifizierungsmaßnahmen für Akteure*innen des Kulturbetriebs zu entwickeln. Den von Michael Wimmer im Auftrag der BKM erarbeiteten Empfehlungen des Instituts Educult zufolge fehlen systematische Studien, die die aktuellen Bemühungen um kulturelle Integration geflüchteter Menschen wissenschaftlich begleiten und erforschen. Inhaltliche wie methodische Fragen dieses Forschungsfeldes sind noch nicht festgelegt. Für die Entwicklung von Qualitätsstandards müssen zudem Kulturbegrifflichkeiten und Bildungsvorstellungen postkolonial informiert geprüft und im Hinblick auf die gegenwärtigen und zukünftigen gesellschaftlichen Erfordernisse weitergedacht werden. Es gibt viel zu tun für das Feld der Kulturellen Bildung. Allen Beteiligten ist jedoch gemeinsam, dass sie an die Wirkungsmacht von Kunst und Kultur glauben und Möglichkeitsräume eröffnen möchten. Auch wenn wir (noch) nicht wissen, was für Räume es sein werden, und auch nicht, wer darin agiert. Es bleibt also spannend. Und darauf kommt es an.
Flucht und Kulturelle Bildung
D ank Unser herzlicher Dank gilt allen Autor*innen für ihre Mitwirkung. Sie haben diesen Sammelband zu dem gemacht, was er ist. Wir möchten uns auch ausdrücklich bei Inken Tegtmeyer für das engagierte und umsichtige Lektorat bedanken sowie bei Joel Scott für Übersetzungen, bei Barbara Driesen, Ursula Achternkamp und Mona Pfeifer für die Transkriptionen und weitere Textarbeiten. Dem transcript Verlag danken wir für die engagierte Betreuung des Projekts. Dem Bundesverband Museumspädagogik verdanken wir seine Unterstützung. Ohne die finanzielle Hilfe der Arbeiterwohlfahrt wäre dieses Vorhaben nicht möglich gewesen. Ihr gilt unser ausdrücklicher Dank. Wir hoffen, die vorliegende Publikation inspiriert und bestärkt die Leser*innenschaft in der eigenen Arbeit und bietet neue und vielleicht unerwartete Betrachtungen und Ansätze. Berlin und Stuttgart, Juli 2016 Maren Ziese, Caroline Gritschke
33
Asylum a n d Cultural Education Surveying, Reflecting and Looking Forward Maren Ziese and Caroline Gritschke
The cover image for this publication was produced as part of a four-day workshop with refugees and the education and outreach team from the art gallery Shedhalle Zürich. The diversity of memories and emotions of refugees entered into a dialog with the artistic positions of the exhibition … The others have arrived safely: Memory Loss and The Politics of History – Artistic Strategies,1 developing a unique form of expression which is captured in the photo. The group process which is pictured here, applying artistic media and methods, represents a typical educational setting, and shows a specific example of the activities carried out in the field of cultural education and outreach work with refugees. In this example, cultural education – that is, the critical confrontation between art and culture – is understood as an independent cultural practice which creates relationships, opens up space for forms of agency, and strives to critically reflect upon and restructure social relations. Though the editors do not conceive of cultural education as »further education;« neither do we do believe that art and cultural education are »neutral,« but rather always shaped by, and relevant to, society. Cultural education is a field in which a great deal of ambitious projects are being carried out with refugees. In keeping with their own self-image as active members of civil society, cultural institutions have been committed advocates for refugees and for their participation in cultural life. In the cultural sector, a great deal of funding is currently being made available for providing services for refugees in museums, theaters, concert halls and libraries. In this context, there is a strong conviction that art and culture, due to their far-reaching, communicative capacities, which in their creative nature are especially innovative, possess a key function in what we refer to as social integration. 1 | Felipe Polanía discusses this project in this publication. The original title of the exhibition is … The others have arrived safely. Gedächtnisverlust und Geschichtspolitik: Künstlerische Strategien.
36
Maren Ziese, Caroline Gritschke
There are currently over 65 million displaced people across the world, and of these, 1.1 million people have been registered as seeking asylum in Germany by the EASY2 system. We are eyewitnesses to these events. The presence of these people, who have left their homelands behind them, is physically perceptible to us. This transnational, transcontinental mobility and the increase in immigration have led to demographic diversity, and continue to do so. A comprehensive deconstruction of long-standing concepts of social orders is taking place. An equitable form of togetherness beyond the confines of the Willkommenskultur (culture of welcome) is often absent when it comes down to everyday practices. People who have fled their homelands are especially excluded from a whole range of social sectors. When we speak about newcomers, we often do so without thinking critically about collectivizing concepts which facilitate processes of exclusion. »In the first place, we don’t like to be called ›refugees,‹« wrote Hannah Arendt in her 1943 essay »We Refugees,« published in the Menorah Journal. How we talk about and name the people who seek refuge in Germany shapes perspectives and the discourse. In this anthology, various designations are used which aim to describe the respective groups of people in their specific contexts in the most considered ways possible. In doing so, there is a consistent avoidance of de-individualizing terms, such as the popular aquatic metaphors which were used in the debates around the amendment of Article 16 of the German constitution in 1993 (»floods of asylum seekers,« »waves of refugees« »swamped by refugees«). As such, the concept of the »refugee« is likewise problematic, since it reduces those whom it designates to the aspect of their seeking refuge, and at the same time refers to a legal concept. Who is speaking here about whom, and who possesses the power to set and enforce the formation of concepts and definitions in public discourse? The ascription of a status through a defining concept is a legislative act. Here, we first of all need to think about the concept of the »refugee« as it is stipulated in the narrow interpretations of the most important human rights document for the protection of refugees, the 1951 Refugee Convention (Article 1). According to this, a person will be recognized as a refugee if he or she, owing to a well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality and is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country; or who, not having a nationality and being outside the country of his former habitual residence as a result of such events, is unable or, owing to such fear, is unwilling to return to it. 2 | Translator’s note: EASY stands for Erstverteilung der Asylbegehrenden (Initial Distribution of Asylum Seekers), and is a software application which the German government uses to distribute asylum seekers through the various federal states while their asylum claims are being processed.
Asylum and Cultural Education
The document was initially designed to protect European refugees in the wake of the Second World War. With the 1967 protocol, the scope of application was expanded temporally and geographically. This definition fails to recognize people who flee from torture or the death penalty, from war or civil war, due to climate change or out of severe economic hardship. These people are either covered legally by another point in the national constitution and can secure asylum in their country of reception, or they are largely excluded from obtaining legal residency. In the perspectives and projects covered in this book we do not make distinctions based on legal status, nor do we judge motives for seeking asylum. We do not sort between those with »good,« »medium« and »minimal prospects of attaining residency,« as has become typical – without any legal basis – at many stages in the process of assessing social and inclusion services. However, we believe it is worthwhile to address people who have sought refuge in Germany since 2015 in this book and in cultural and education work. There is a risk that with their visibility within the framework of the ›migration society,‹3 that they might disappear or be made invisible by being placed under the banner of ›diversity.‹ A focused examination is above all necessary in order to avoid concealing structural inequalities. No group of people living in Germany possesses less rights and possibilities of social participation. During the process of lodging a claim for asylum, and without being recognized as a refugee in accordance with the 1951 Refugee Convention, access to health care, work and self-determined living situations are heavily limited. According to the proposed Integration Act, the latter will even apply for people who have already been recognized as refugees. Thus, at no point is the long-term legal status of refugees clarified. This has effects on what refugees can do, and on their conceptions of self. It would be wrong to obscure these inequalities in the mainstream of the migration society, and to make false claims about the existence of a level playing field, thus undermining the efforts of these newcomers to integrate, which they often perceive as a compulsion to assimilate. As Hannah Arendt laments in the essay that we cited above: »very few individuals have the strength to conserve their own integrity if their social, political and legal status is completely confused« (Arendt, 1996:116). The task here is to not to make refugees into target groups for pedagogical initiatives and subject to the actions of the members of mainstream society, but rather to perceive them as participants, interlocutors, as teachers and students, as active stakeholders. To do so, we predominantly use the concept of the Geflüchtete, 3 | Translator’s note: The term Migrationsgesellschaft (lit. migration society) is used in certain German-speaking discourses to refer to the societal significance of migration – primarily within these German-speaking societies – and is not directly reducible to Englishlanguage concepts such as »immigrant societies« or »multicultural societies.« The term refers to the fact that society is affected by migratory processes on every level – in the fields of economics, politics, culture, education and beyond – and to the fact that privilege is distributed by an order of belonging.
37
38
Maren Ziese, Caroline Gritschke
which as a nominalized participle ultimately conveys an aspect which is common to all the people it refers to: having fled from another country to Europe in order to seek refuge here. The alternative, which focuses primarily on the site of asylum, the English term »refugee,« has a similar scope of semantic content, and in some of the contributions in this volume, is used interchangeably with »Geflüchtete,« always with the connotations associated with it in the respective articles.4 Even though the fascination of cultural workers with the topic of refugees and asylum needs to be critically rethought, we are now faced with the positive opportunity of carrying out a comprehensive repositioning of the cultural sector, of thinking diversity anew. Critical tips, questions and guidelines – produced by refugees and people with migrant backgrounds themselves – can assist in the reflection upon the composition of cultural education initiatives. In these times of displacement and migration, the topic of »refugees« throws up old and new questions, bringing with it new opportunities to work together on an inclusive model of society, and to strengthen social cohesion.
C entr al Q uestions of the B ook As a result of the dynamic increase in projects with refugees in the field of cultural education, a whole range of different questions quickly arose: questions around the practicality of implementation, conditions of success, or the difficulty of ongoing education work needed to be discussed, as did questions about the approach and the role of the cultural institutions themselves as social agents. This led us to the formulation of a number of central questions, which we have attempted to answer in this anthology: • What is the goal of cultural education which works with refugees or addresses the topic of asylum? • What can cultural work and cultural education with refugees achieve? • What is the relevance of work with refugees in a complex, heterogeneous society? 4 | Translator’s note: The traditional German term for refugee, Flüchtling, has become an object of debate in recent times. The suffix -ling, which forms nouns designating people who are characterized by the adjective, noun or even verb stem to which the suffix is attached, often has pejorative connotations, in some cases even lending negative connotations to positively connoted words (e.g. Schönling, derived from schön, beautiful, could be translated as pretty boy). In recent years, the term Geflüchtete, a nominalization of the past participle geflüchtet (fled), has become popular in certain circles as more neutral, less reductive, along with the English term refugee, which, incidentally, has been used in all cases in the English translations.
Asylum and Cultural Education
• Why should refugees participate in education and outreach projects? • What kinds of programs should cultural institutions offer on the topic of »asylum«? Should they offer their spaces, become facilitating institutions, or sites of negotiation for questions affecting society as a whole? • How can individuals working in cultural education and outreach avoid reducing people to their status as refugees, and how do they nevertheless manage to make refugees and their stories visible? • How should cultural work with refugees be structured? What are the perspectives and methods which should guide the work? • What is the relation between cultural education and anti-racism work? • What role does cultural work and cultural education play in allowing refugees to make use of their participation rights (self-determined living, work, access to education etc.)? • What might a contemporary, solidarity-based approach to education look like?
O bjectives of the B ook This book carries out a substantial survey of current theories, methods and practices, and responds to the urgent need for reflection and action. Until now there has not been a book which sets out the discourse surrounding this topic, and the need for answers, proposals and dialog among people working in cultural education is immense. This anthology aims to respond to this need. The book presents workable concepts and strategies, and the texts display a sample of the diverse approaches and methodologies in the field, and of the questions which they raise. The point of departure is a clarification and acknowledgement of the dedicated work which has already been carried out in the field of cultural education for, with and by refugees. In the project presentations, the aim is not to show best practice models, but rather to communicate experiential knowledge so that we can learn from one another. The authors offer starting points toward an intersectional,5 critical reflection on such projects. In order to facilitate a critical evaluation of the work that has been carried out based on the practical perspectives shared here, we have also sought out contributions from the fields of education, anti-racism work and academia. In contemplating the possibilities and necessities of a revision of established practices, we find it important to pursue approaches which are sensitive to relations of alterity and power, which above all aim to take up the critiques that have been made by activists and postcolonial theorists identifying the dominance of ›white‹ ways of seeing and practices of representation in the cultural and educational field. 5 | On the concept of intersectionality, which makes no separations between categories such as ethnicity, nation, class or gender, but rather views and analyzes them as intertwined phenomena, see Crenshaw (1989); Walgenbach (2012).
39
40
Maren Ziese, Caroline Gritschke
B ook S tructure The book is divided into five thematic rubrics, although many of the contributions bear connections to multiple rubrics. This is a result of the diversity and the heterogeneity of the area of study associated with asylum and culture, and of the diversity of the authors. The contributions are assigned to the rubrics according to the main focuses which we have identified in them, and are ultimately intended to provide a rough orientation for the reader. In the chapter Education and Perspectives, central, thematically overarching and intersectional aspects of the current debate around asylum in the context of education and cultural work are analyzed. The contributions from the fields of art, art education and outreach, migrant education, political science, geography and curation transcend national and disciplinary borders. They look at fundamentally contemporary projects working with and for refugees, in some cases from a perspective of postcolonial critique. Above all, the texts challenge cultural workers involved in the projects to critically reflect on their role. In the context of cultural education, affects, privileges, structural inequalities and the social function of cultural projects should always be kept in mind, and these considerations should then be incorporated into the work in concrete ways. Artistic and Activist Positions of refugees and non-refugees are at the center of the next chapter. In their work and projects, the authors bring about an intimate relationship between art and politics. Participatory work with refugees and on the topic of asylum operates within the context of current social debates about forced migration and asylum, and aims to bring to the surface that which has been silenced and repressed. Refugee authors describe processes of self-empowerment involved in getting their personal positions acknowledged in the context of cultural projects. The following section of the book responds to questions of Methods and Standpoints. In this section, practical techniques for diversity-sensitive education and outreach work is presented, and the concept of global learning is discussed. Strategies for dealing with trauma in collaborations with refugees also comes up. Other texts in the chapter, informed by anti-racism work, make their own positions the subject of their cultural work with refugees, dealing with how forced migration and asylum is positioned in cultural institutions and in society at large. In cultural institutions and projects, people often speak of wanting to »open themselves up to refugees.« Exactly what this means in a practical sense is the subject of the articles gathered together under the title Languages and Spaces. Authors reflect upon the conditions and intercultural effects of projects in which refugees are given space within a cultural institution for independent and collaborative work. How cultural facilitators and refugees converse in these spaces and the topics they address also depends on whether people are able to communicate with each other. Performative or sign-assisted paths toward communication offer opportunities beyond the confines of language-course collaborations. This section
Asylum and Cultural Education
also sheds light on the approach to language learning in schools and cultural institutions, and the question of the valuing of multilingualism in this context is posed. In the final chapter, concrete Reflections on Project Experiences are front and center. Education and outreach work with refugee students, projects that suddenly also made political action necessary. Cultural work on the topic of »refugees and asylum« in regional and rural areas are also presented and analyzed here, as are the experiences of participating refugees themselves. At the end of the chapter, a number of selected projects are presented as examples. They constitute a small sample of the incredible abundance of dynamic cultural initiatives and dedicated projects. By way of four questions, the project initiators that have been invited to contribute trace out the development of their projects, from the original intentions through all of the changes that occurred through implementation, offering practical tips and hints for reflection. The structure that we have chosen endeavors to allow the diverse perspectives on the topic to come into their own. This is accounted for through a diversity of text forms: alongside academic essays, there are interviews, a lecture, shorter statements and project profiles structured around the central questions of the book.
S elf -P ositioning of the E ditors We, the editors, are both permanently employed by exhibiting institutions which are active in education and outreach work in the areas addressed in this book. Teachers of language classes and of so-called »welcome classes« approached us to ask about the programs our institutions offer for them. We have developed and carried out education and participatory outreach projects with refugees in schools, in accommodation centers and in-house in our institutions, and received phone calls from colleagues in the field of cultural work who were interested in exchanging ideas with us. Lecturers, teachers, social workers and other stakeholders working in the field of »education, migration and asylum« visited our institutions, used the exhibitions for their own approaches to the topic of »asylum, migration and diversity,« and worked independently from us on aspects of the exhibition(s), both inside the confines of the museum and beyond these. We had refugees job shadowing in our workplaces and put ourselves and our team of freelancers through training courses on »global learning« and »diversity.« Due to our own educational backgrounds and the influence that different schools of thought and methodologies – such as postcolonialism, the history of migration, anti-bias work, critical whiteness and anti-Semitism studies, critical cultural education and institutional critique – have had on us, it is important to us to define our workplaces as institutions that are always learning.
41
42
Maren Ziese, Caroline Gritschke
In doing so, as editors, we also have to respond to the paradoxical demand on educators as described by Paul Mecheril: first of all, difference and the inequality associated with it need to be recognized. To presume that everyone is the same brings about exclusions and disadvantages for anybody who does not fit into this image – an example of which would be the image that our exhibiting institutions have of our »visitors.« At the same time however, recognition is always based on categories, which also ascribe characteristics to people, allowing them to be defined by their culture or background. In our ›migration society‹ we thus make great efforts to accompany recognition with a reflexive educational practice of deconstruction, which aims to interrogate categories and the presuppositions associated with them, and, where possible, to shift them. As editors, we also have to acknowledge the fact that cultural education and outreach continues to be a field dominated by ›white‹ mainstream society. How can we, as white editors, speak about cultural education work which responds to a heterogeneous and multilingual society, when the power of definition, the paid jobs, the educational roles so often remain with us members of the ›majority‹? We cannot ignore this exclusion in the field of cultural education and outreach, we can only name it, and strive to disrupt this exclusion. For ourselves, we hope to reach a level of reflexivity toward our presuppositions, in terms of the institutional structures and social relations that influence our work. Yet as permanently employed cultural educators in executive positions, we cannot just stand still in the process of self-criticism and reflection, rather we are always simultaneously active agents. Without knowing what will come out of it, in a methodologically and theoretically informed practice, we attempt to incorporate Irit Rogoff’s questions of »what comes after critique? How can critique have consequences which we do not define and know in advance?«
A uthors The changes that we are experiencing need to be viewed and interpreted from a range of perspectives. The cultural sector needs to become more plurivocal, which is why a range of voices have their say in this book (perspectives from cultural education and migration studies, activists, permanent museum education staff, social workers, people without jobs, students, professors, artists and curators, theatermakers). The selected authors employ their specialist knowledge in order to outline a range of perspectives on the field. They represent important and innovative branches of this newly and also historically-founded area of study. Additionally, the selection of the authors and the structure of the book is intended to encourage the sharing of knowledge and findings, whereby we hope to create a reciprocal interchange between the fields of praxis and academic study. At some points, practical experiences and academic reflection are interrelated or
Asylum and Cultural Education
stand in stark opposition to one another. In these instances, we have not intervened to smooth out differences or to make judgments, but rather we strongly believe in the productivity of dialog between various fields of knowledge. The readers of this volume should be able form their own opinion, and actively pursue the exchange. For this reason, the email addresses of many of the authors are included in the Appendix, in order to aid contact. In choosing the authors, we were always mindful of the question of »who speaks.« As a response to the demands we have placed on ourselves, this book is intended as a resource of visibility, creating an alternative frame of reference through the incorporation of old and new voices into the discussion. However there are a number of voices which unfortunately do not speak in this book, although they have a right to participation in a discourse which directly affects them. We approached more people and organizations for contributions than those who ended up represented in the book. Throughout this process, we asked ourselves in a self-critical fashion why, despite significant effort, we were unable to convince the self-run organizations and refugees we contacted to write an article for the book or to conduct an interview. We asked ourselves whether we could have found other forms of address and inclusion. In our approaches, did we reduce the potential contributors to their »status as« refugees, migrants etc.? Why did we assume that in a book which aims to represent perspectives on diversity in relation to »cultural education and refugees,« that refugees should bear more importance? Why do we allow ourselves to expect that »refugees« would be interested in a book about »refugees«? We found ourselves mirroring that enduring pattern of reception that, for example, African art and culture are subjected to in a Eurocentric context: »African« artists are invited to »African Exhibitions,« and there is an expectation that a primarily »African« audience will be interested in the topic. Stereotyping and fixation are among the topics of this book, and one of the aims of this is the interrogation of the limitations of our own perspectives.
P reliminary R esults , R ese arch A ssignments and F uture P rospects When Maren Ziese first had the idea for this book at the beginning of 2015, the issue of »asylum« and »refugees« was very present in public debates. The discourse was dominated by the Willkommenskultur. Running parallel to this were attacks on buildings which were either intended to be used to house refugees, or were already in use, and racist assaults were a continual presence. While the number of acts of racist violence continues to rise, the images in the media of happy cohabitation and welcome celebrations have virtually disappeared. The number of the new arrivals of refugees has dropped drastically – a snapshot at the moment of writing, since the situation can change once again at any time. Germany and Europe are busy defending themselves against those seeking protection at their southern
43
44
Maren Ziese, Caroline Gritschke
borders; at the same time, within those borders, the opportunities for gaining protection in the form of a secure residency status are becoming increasingly limited. Since the physical presence of the refugees ceased to directly reminds us of the causes of their displacement, the debates have diminished. One can only hope that the funding programs for the cultural work with refugees will persist and be made permanent. This book appears right in the middle of this palpable shift in perspective of the German and European public. Nevertheless, the original intentions and the objectives of the book are more current than ever. The questions and problems, inconsistencies and exclusionary factors to which the presence of the refugees directs our attention like a burning glass, are still valid: how can we structure a diverse society in which everyone is not the same, yet has equal rights, which are also practically implemented in creating equal life opportunities and chances for participation? What role do culture and education play in these processes? The central task which ensues from the area of study around »asylum and cultural education« is the development not just of cultural education, but of the entire cultural sector in accordance with an inclusive model of society. That means, among other things, the inclusion of diverse ways of seeing and working; representation instead of presentation; and with this, a diversity-aware opening up of cultural institutions. Making education programs and outreach initiatives permanent and consolidating their role in the museum is part of this as well. In addition to this, there are currently suggestions being made to develop comparable benchmarks of precisely these educational programs and outreach initiatives, as well as qualification standards for those working in the cultural sector. According to the recommendations made by Michael Wimmer’s report from the Educult Institute (commissioned by the BKM), there is a lack of systematic studies which follow and research the current efforts at cultural integration of refugees in an academically rigorous manner. Thematic and methodological questions in this field of research have not yet been determined. In order to develop quality standards, cultural concepts and education models need to be examined with postcolonial critiques in mind, and considerations need to be made about present and future social needs. There is a lot to be done in the field of cultural education. However all those involved have one thing in common: they believe in the impact of art and culture and want to open up spaces of possibility. Even though we might not (yet) know what kind of spaces these might be, nor who will operate within them. So there are exciting times ahead. And that’s what it’s all about.
Asylum and Cultural Education
Thanks We would like to express our sincere gratitude to all the authors for their involvement. They have made this anthology what it is. We would also like to sincerely thank Inken Tegtmeyer for her dedicated and meticulous editing, and Joel Scott for his translations, Barbara Driesen, Ursula Achternkamp and Mona Pfeifer for the transcriptions and other editorial work. We want to thank transcript Verlag for their dedicated support of the project. Our thanks goes to the Federal Association of Museum Education for their support. Without the financial support of the Workers’ Welfare Association, this project would not have been possible. We would also like to offer them our heartfelt thanks. We hope this publication provides its readership with inspiration and encouragement for their own work, as well as new and perhaps unexpected observations and approaches. Berlin and Stuttgart, July 2016 Maren Ziese, Caroline Gritschke
L iter atur /L iter ature Unsere Gedanken in der Einleitung sind dieser für uns zentralen Literatur entlehnt/Our ideas in the introduction are indebted to the following texts, which were central for our thinking on the topic: Amadeu Antonio Stiftung (2015): 15 Punkte für eine Willkommenskultur in Jugendeinrichtungen. Handreichung für Einrichtung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit. Zu finden unter: https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/w/ files/juan/15-punkte-plan_web.pdf (letzter Zugriff: 09.05.2016). Arendt, Hannah (1943/1986): »Wir Flüchtlinge«, in: dies., Zur Zeit. Politische Essays, Berlin: Rotbuch-Verlag, S. 7-21. [Arendt, Hannah (1999): »We Refugees« in Robinson, Marc (Hg.), Writers on Exile, Faber and Faber, London, S. 110-119.] Crenshaw, Kimberlé (1989): »Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine«, in: The University of Chicago Legal Forum 139, S. 139-167. EDUCULT (2016): Empfehlungen an die BKM im Hinblick auf Maßnahmen zur kulturellen Integration von geflüchteten Menschen, Wien. http://educult.at/ wp-content/uploads/2016/03/EDUCULT_Maßnahmen-zur-kult_Integr-vongefl_Menschen_Vers-April16.pdf (letzter Zugriff: 03.07.2016). Grenz, Wolfgang/Lehmann, Julian/Keßler, Stefan (2015): Schiff bruch. Das Versagen der europäischen Flüchtlingspolitik, München: Knaur.
45
46
Maren Ziese, Caroline Gritschke
Keuchel, Susanne/Kelb, Viola (Hg.) (2015): Diversität in der Kulturellen Bildung. Bielefeld: transcript. Mecheril, Paul: Anerkennung des Anderen als Leitperspektive Interkultureller Pädagogik? Perspektiven und Paradoxien, Vortragsmanuskript zum interkulturellen Workshop des IDA-NRW 2000. www.forum-interkultur.net/uploads/ tx_textdb/22.pdf (letzter Zugriff: 12.06.2016). Meyer, Barbara (2015): »Versuch einer neuen Balance«, in: Kulturpolitische Mitteilungen (150), S. 59-61. Mörsch, Carmen (2009): »Am Kreuzungspunkt von vier Diskursen: die documenta 12 Vermittlung zwischen Affirmation, Reproduktion, Dekonstruktion und Transformation«, in: dies, Kunstvermittlung 2. Zwischen kritischer Praxis und Dienstleistung auf der documenta 12. Ergebnisse eines Forschungsprojekts. Zürich/Berlin: Diaphanes, S. 9-33. Mörsch, Carmen (2003): Zeit für Vermittlung. Eine online Publikation zur Kunstvermittlung. Herausgegeben vom Institute for Art Education der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK), im Auftrag von Pro Helvetia, als Resultat der Begleitforschung des »Programms Kulturvermittlung« (2009-2012). www. kultur-vermittlung.ch/zeit-fuer-vermittlung/ (letzter Zugriff: 09.05.2016). NGBK – Neue Gesellschaft für Bildende Kunst (2009): Re/Positionierung. Critical Whiteness/Perspective of Color. (Post-)Koloniale Sphären im Kunstbetrieb. Berlin: Verlag Berlin NGBK. RISE – Refugees, Survivors and Ex-detainees (2015): 10 Things you need to consider if you are an artist – not of the refugee and asylum seeker community – looking to work with our community. http://riserefugee.org/10-things-you-need-toconsider-if-you-are-an-artist-not-of-the-refugee-and-asylum-seeker-communitylooking-to-work-with-our-community/ (letzter Zugriff: 09.05.2016). Rogoff, Irit (2005): »Looking Away. Participations in Visual Culture«, in: Gavin Butt (Hg.): After Criticism. New Responses to Art and Performance. Oxford: Blackwell, S. 117-134. https://kvelv.files.wordpress.com/2013/10/irit_rogoff_loo king_away_participations_in_visual_culture.pdf (letzter Zugriff: 30.06.2016). Seukwa, Louis-Henri (2015): »Flüchtlinge: Von der Kunst des Überlebens.« Interview mit der deutschen Kinder- und Jugendstiftung, erschienen am 05.01.2015. https://www.dkjs.de/aktuell/meldung/news/von-der-kunst-des-ueberlebens/ (letzter Zugriff: 09.05.2016). Stemmler, Susanne u.a. (2015) (Hg.): Interventionen 2015. Refugees in Arts and Education, Dokumentation der gleichnamigen Tagung vom 11. bis 13.06.2015 im Podewil in Berlin. www.kulturprojekteberlin.de/fileadmin/user_upload/ Kulturelle_Bildung/Interventionen/Interventionen-Dokumentation-Final.pdf (letzter Zugriff: 09.05.2016). Sternfeld, Nora (2010): »Das gewisse Savoir/Pouvoir. Möglichkeitsfeld Kunstvermittlung«, in: Arbeitsgemeinschaft Deutscher Kunstvereine ADKV (Hg.), Collaboration: Vermittlung – Kunst – Verein. Ein Modellprojekt zur zeitgemäßen Kunstvermittlung an Kunstvereinen in Nordrhein-Westfalen, Köln: Salon
Asylum and Cultural Education
Verlag. www.rueckkopplungen.de/PDF/Katalog%20Collaboration_Sternfeld. pdf (letzter Zugriff: 03.07.2016). Sternfeld, Nora (o.D.): Möglichkeitsräume, Kontaktzonen und Machtverhältnisse. www.rueckkopplungen.de/?p=1349 (letzter Zugriff: 03.07.2016). Terkessidis, Mark (2016): »Parallelgesellschaften im Kulturbetrieb?« Mark Terkessidis im Gespräch im Silvia Fehrmann. Interview erschienen am 07.03.2016, in: Kultur öffnet Welten. www.kultur-oeffnet-welten.de/positionen/position_ 1024.html (letzter Zugriff: 09.05.2016) Wachendorfer, Ursula (2004): »Weiß sein in Deutschland. Zur Unsichtbarkeit einer herrschenden Nationalität«, in: Susan Arndt (Hg.): AfrikaBilder. Studien zu Rassismus in Deutschland. Münster: Unrast Verlag. Walgenbach, Katharina (2012): Intersektionalität – eine Einführung. www.portalintersektionalität.de (letzter Zugriff: 30.06.2016). Wimmer, Michael (2015): Kulturelle Bildung in Zeiten wachsender Unterschiede, in: Susanne Keuchel/Viola Kelb (Hg.), Diversität in der Kulturellen Bildung. Bielefeld, S. 15-35.
47
2. Bildung und Perspektiven — Education and Perspectives
Mitleid, Paternalismus, Solidarität Zur Rolle von Affekten in der politisch-kulturellen Arbeit María do Mar Castro Varela und Alisha M.B. Heinemann »When we talk about an object of desire, we are really talking about a cluster of promises we want someone or something to make to us and make possible for us.« (L auren B erlant 2010: 93)
Zusammenfassung Die Arbeit mit geflüchteten Menschen ist eine in vielfacher Hinsicht herausfordernde Arbeit. Sie kann zermürbend sein, weil das Leid, das spürbar ist, unter die Haut geht, während die strukturelle und auch direkte Gewalt, die diese Menschen erfahren, Wut erzeugt. Sie kann aber auch als befriedigend und glücklich machend beschrieben werden, weil das Geben, in Anbetracht von Bedürftigkeit, die Helfenden Menschlichkeit empfinden lässt. Allein diese kurze Beschreibung verdeutlicht, wie wichtig es ist, sich mit der politisch-affektiven Seite von Bildung auseinanderzusetzen. Eine romantisierte Solidarität kann dabei ebenso problematisch sein wie ein unhinterfragter Paternalismus, während Mitleid nicht immer nur negativ sein muss, sondern durchaus auch als Motor von Gerechtigkeitspraxen gelebt werden kann. Der Beitrag setzt sich mit diesen Ambivalenzen auseinander und arbeitet anhand einer Analyse von Stellungnahmen, Studien und Aufrufen zur Kulturellen Bildung mit geflüchteten Menschen (etwa der BK J, der AG Junge Flüchtlinge NRW, des ifa etc.) die affektiven Seiten einer kulturellen Arbeit im Feld von Flucht heraus. Die angelegte Perspektive ist dabei eine dezidiert postkoloniale. Affekte sind hierin keine natürlichen Ausdrucksformen, sondern historisch geformte Reaktionen, die einen Blick auf machtvolle Beziehungsstrukturen ermöglichen.
Abstract: Compassion, Paternalism, Solidarity – On the Role of Affect in Political and Cultural Work Working with refugees is challenging work in a variety of ways. Since the suffering is palpable and gets under the skin, it can be grueling; and the structural and direct violence that these people experience can cause anger. Nevertheless it can also be described as satisfying and enjoyable, since giving – in the face of need – allows those who help to feel a heightened sense of humanity. In itself, this brief statement illustrates how crucial it is
52
María do Mar Castro Varela und Alisha M.B. Heinemann to address the role of affect in the politics of education. To this end, a romanticized image of solidarity can be just as problematic as unchallenged forms of paternalism, whereas compassion is not necessarily negative, and in fact can be experienced as a driving force towards practices of justice. This paper investigates these ambivalences and, by way of an analysis of opinions, studies and appeals for cultural education work with refugees [e.g. from the BK J (the German Federation of Associations for Cultural Youth Education), the AG North Rhine-Westphalia Youth Refugees, the ifa (Institute for Foreign Cultural Relations) etc.] – sketches out the affective side of cultural work in the field of forced migration. The framework is decidedly post-colonial, with ›affects‹ formulated not as natural forms of expression but rather as historically determined responses that can provide an insight into powerful structures of relation.
Geflüchteten Menschen in prekären Lebenslagen zu begegnen und mit ihnen zu arbeiten, ist in vielfacher Hinsicht herausfordernd. Es kann zermürbend sein, weil das Leid, das spürbar ist, unter die Haut geht, während die strukturelle und auch direkte physische und psychische Gewalt, die Menschen auf der Flucht und im Aufnahmeland erfahren, Wut und Hilflosigkeit erzeugt. Es kann aber auch als befriedigend und glücklich machend beschrieben werden, weil das Geben beim Anblick von Bedürftigkeit die Helfenden Menschlichkeit empfinden lässt. Allein diese kurze Beschreibung verdeutlicht, wie wichtig es ist, sich auch mit der politisch-affektiven Seite von (Kultureller) Bildungsarbeit auseinanderzusetzen. Eine romantisierende Solidarität kann dabei ebenso problematisch sein wie ein unhinterfragter Paternalismus, während Mitleid nicht immer nur negativ gelesen werden muss, sondern durchaus auch als Motor von Gerechtigkeitspraxen gedacht werden kann. Als im Sommer 2015 Tausende von Menschen sich zeitgleich auf den Weg nach Europa machten, weil ihr bisheriger Lebensmittelpunkt durch einen andauernden Krieg zerstört wurde; weil Regierungen sich nicht mehr in der Lage sahen, ihre Bürger_innen zu schützen, oder sie zwangen, in einen Krieg zu ziehen bzw. die Lebensgrundlagen nach und nach zerstört wurden, mobilisierten die schmerzvollen, medial kommunizierten Bilder – insbesondere von syrischen Geflüchteten – etwa an den Bahnhöfen von Salzburg, Budapest und Wien eine Welle der Solidarität und des Mitleids. Euphorisch wurde vor allem in Deutschland und Österreich eine »neue Willkommenskultur« gefeiert, die, gemäß der emphatischen Proklamationen, das menschliche Gesicht der europäischen Zivilgesellschaft zu symbolisieren schien. Neben eher apolitischen Bürger_innen, die spontan an die Bahnhöfe gingen und dort Kleidung und Nahrungsmittel verteilten und den Kindern Spielzeug in die Hand drückten, Ermüdete in ihren Privatautos über die Grenzen fuhren, während andere Betten in Erstunterbringungen zusammenschraubten, dolmetschten oder auch Zimmer in ihren Wohnungen zur Verfügung stellten, gab es auch jene, die massiver als zuvor das europäische Migrationsregime kritisierten, weil sie nun auch mit großer Anstrengung nicht
Mitleid, Paternalismus, Solidarität
mehr übersehbar vor ihrer eigenen Haustür mit den tödlichen Effekten dieser Grenzpolitik konfrontiert wurden. Letztere sind jedoch mit der Zeit leiser geworden. Die Medien zeigten sich mehr interessiert an der karitativen Hilfe, die zwar notwendig und tatsächlich aufgrund der vielen Menschen, die daran teilnahmen, beeindruckend war – solange sie anhielt. Letztendlich konnte und kann diese praktizierte Karitas jedoch ein massives Unrechtssystem, wie es das europäische Grenzregime ist, nicht überwerfen. Im Gegenteil, es stabilisiert dasselbe paradoxerweise, denn wie Paolo Cuttitta (2010: 36) feststellt, bedeutete die »Europäisierung des Grenzregimes […] eine Flexibilisierung der Grenzen und Grenzkontrollen«. Dies hat zur Folge, dass das Grenzregime immer wieder flexibel auf neue Ereignisse reagiert. Es lernt gewissermaßen. Die Breite der Solidarität überraschte und war gleichzeitig ein wichtiger Werbemotor für die deutsche konservative Regierung. Die Kanzlerin wurde weltweit gefeiert. Kaum diskutiert wurde dabei, dass die Staaten der bürgerlichen Zivilgesellschaft die Hilfeleistungen überließen, die sie eigentlich hätten professionell organisieren müssen. Die Ressourcen und Zeit, die dabei eingespart wurden, konnten dann u.a. genutzt werden, um sich neue Strategien der Grenzsicherung und Deportation der unliebsamen Neuangekommenen zu überlegen, während beispielsweise die Organisation einer menschenwürdigen Unterbringung, die Bereitstellung adäquater Rechtsberatung und eine humane Asylregelung auf der Strecke blieben. Neben den spontanen solidarischen Aktionen begannen Nichtregierungsorganisationen, Künstler_innen wie auch kommunale Institutionen Solidarität zu reflektieren, zu organisieren und damit auch nachhaltiger zu gestalten. Recht bald schon gab es Angebote der Kulturellen Bildung, die sich an Geflüchtete wendeten. Welche Ziele können diese verfolgen? Für wen kann was erreicht werden? Und in welcher Beziehung stehen politisch-ethisches Handeln und ästhetische Bildung? Dies sind einige Fragen, die wir im nachfolgenden Text kurz besprechen wollen. Hierfür werden wir einige Mutmaßungen einer kritischen Kulturellen Bildung mit affekt-theoretischen Annahmen verknüpfen und innerhalb einer postkolonial-theoretischen Rahmung einer Betrachtung unterziehen. Unser Ziel ist es, Kulturelle Bildung einerseits als ethisch-politisches Projekt zu bestimmen und anderseits einen oft vernachlässigten Teil derselben – nämlich den affektiven – sichtbar zu machen. Absicht ist es zudem, die Widersprüchlichkeit der wohlmeinenden Praxen offenzulegen und die Unmöglichkeit zu betonen, Unrecht mittels ästhetischer Praxen beheben zu können. Kultur ist, wie Edward Said bereits in Culture and Imperialism (1993) feststellt, niemals unschuldig. Im Gegenteil: im Zusammenhang mit dem Imperialismus stellt Said pointiert fest, dass Kultur eine moralische Macht darstellte, die eine »ideologische Befriedung« (ideological pacification, ebd.: 67) herbeirief, in deren Folge die Beherrschten nicht rebellierten, sondern oft sogar Dankbarkeit äußerten (vgl. ebd.: 9; auch Castro Varela/Dhawan 2015). Daher ist es wichtig zu analysieren, wie kulturelle Praktiken über die Produktion von »Gefühlsstrukturen« (ebd.: 14) die hegemoniale Macht konsolidieren können, wie Said ausführt.
53
54
María do Mar Castro Varela und Alisha M.B. Heinemann
Desgleichen scheint es uns notwendig, Gayatri Chakravorty Spivaks (etwa 2008) Plädoyer für ein kontraintuitives (counter-intuitiv) Handeln ernstzunehmen, denn unreflektierte Hilfe ist nicht selten destruktiv – ganz gleich, wie gutgemeint sie ist. Nichts ist wirklich klar, schreibt Lauren Berlant (2004: 1), wenn wir über Mitleid nachdenken, »… except that it implies a social relation between spectators and sufferers, with the emphasis on the spectator’s experience of feeling compassion and its subsequent relation to material practice«. Holen wir die strukturell-politische Ebene mit hinein, so kompliziert sich das Anliegen – spontanes Handeln ist dann zuweilen unangemessen. Die Intuition ist zu stark beeinflusst von unserem erlernten worlding, der Art und Weise, wie wir die Welt wahrnehmen. Die Reflexion darüber, welche Auswirkungen unser intuitives Handeln haben kann, kommt oftmals einen Schritt zu spät – und das nicht ohne Folgen.
E ine affek tive P erspek tive auf M enschen auf der F lucht Geflüchtete, ihr Leiden, ihre Ansprüche, ihr bloßes Dasein, affizieren die Gemüter. Während die einen durch den Diskurs um die Präsenz und die Bewegungen der Geflüchteten Ängste vor und Wut auf diese entwickeln, erfreuen sich andere an ihrer eigenen Hilfsbereitschaft und/oder entwickeln Wut und Ohnmachtsgefühle ob der Größe der Not, mit der sie konfrontiert sind. Angst scheint die dominierende Emotion im politischen Diskurs rund um Geflüchtete zu sein. Der Fluchtdiskurs geht dabei eine äußerst bedrohliche Allianz mit dem Sicherheitsdiskurs ein, der in Politik und in den Medien immer wieder bestätigt, dass die »vielen Fremden« die Sicherheit des Landes ungünstig beeinflussen. Terror und Flucht werden so eng zusammengedacht, dass rechte Populist_innen wenig Mühe haben, die Mehrheit für sich zu gewinnen. Ob in Ungarn, Polen, Österreich oder Frankreich: Es fällt den rechten Parteien nicht mehr schwer, mit simplen rassistischen Parolen Stimmen zu gewinnen und immer stärker in die hegemonialen Diskurse einzugreifen. Die Angst ist dabei nicht einfach mit fehlender Information erklärbar, denn wie wir wissen, verzeichnen rechte Parteien einerseits oft gerade dort hohe Zuwachsraten bei kommunalen und nationalen Wahlen, wo die migrantischen Bevölkerungen besonders gering sind. Rassistische Praxen benötigen keines konkreten Objektes, gegen den sich der Hass richtet. Ist der Diskurs, der Geflüchtete als »Kriminelle« diskreditiert, einmal etabliert, dann entfaltet sich eine Gewalt, die immer die direkt trifft, die als »anders« markierbar sind bzw. gewaltvoll markiert werden. Paul Virilio zufolge ist die Angst nicht mehr verortbar, vielmehr ist sie »Welt geworden« (Virilio 2016: 16), und die Verwaltung dieser Angst wird durch die Staaten, wie er richtig bemerkt, orchestriert, um mit ihr Politik zu machen (ebd.). Die Verwaltung der Angst deutet auf eine omnipräsente Angst, die von der hegemonialen Macht flexibel zum Anschlag gebracht werden kann, um eine breite Unterstützung für ansonsten eher schwer
Mitleid, Paternalismus, Solidarität
durchsetzbare politische Agenden zu erhalten. Angst ist gewissermaßen transgressiv. Dies ist einer der Gründe, warum wir denken, dass Überlegungen zu den Affekten innerhalb der Arbeit mit Geflüchteten dringend geboten sind. Affekte sind, so wissen wir – unter anderen informiert von den in den letzten Jahren in den Sozial- und Humanwissenschaften stark rezipierten Affekttheorien –, keineswegs sich zufällig einstellende körperlich-seelische Reaktionen (vgl. Gregg/Seigworth 2010). Vielmehr reflektieren sie die in den Subjekten sedimentierte(n) kollektive(n) Geschichte(n). Affekte sind Teil dessen, was innerhalb der Postkolonialen Theorie als »Welt-machen« (worlding) verstanden wird. Letzteres bezeichnet die Art und Weise, wie differente Subjekte, die historisch hervorgebracht wurden und entsprechend unterschiedliche soziale Positionen einnehmen, die Welt wahrnehmen und repräsentieren. Die Mehrheit der europäischen Bevölkerung beschreibt den ›Rest der Welt‹ (Hall 1992) immer noch als zurückgeblieben, konfliktbelastet und hilfsbedürftig, weshalb es nicht verwundern muss, dass Angst- und Sicherheitsdiskurse die Debatten um Flucht aus dem globalen Süden bestimmen. Die ›Anderen‹, das sind jedoch kaum zufällig die, die aus den ehemaligen Kolonien stammen; und kaum zufällig diejenigen, deren Menschlichkeit immer noch in Frage gestellt wird (vgl. Fanon 1981/1961). Die ›andere Welt‹ und ihre Bevölkerungen sind nicht einfach anders, sie werden als gefährlich anders, bedrohlich fremd und/oder angenehm exotisch repräsentiert. Repräsentationen – im Sinne von Darstellungen – werden dabei immer von Affekten begleitet und mobilisieren diese auch. Die Bilder der ›edlen Wilden‹, der ›sexuell Attraktiven‹ wie auch der ›beängstigenden Barbaren‹ und ›bemitleidenswerten Anderen‹ waren nicht nur bedeutsame Kolonialaffekte, die Kolonialherrschaft legitimierten und anfeuerten,1 sie bestimmen auch heute noch den Blick Europas in Richtung (ehemalig) kolonisierter Gebiete. Kurzum: Worlding und die damit einhergehenden Affekte schlagen sich in gewaltvoller Weise in den Repräsentationen der Welt nieder. Ilan Kapoor (2008: 43) zieht Spivak folgend demgemäß Parallelen zwischen dem worlding und dem Warenfetischismus, der entsprechend Marx‹ Kapital Waren in einem Maße fetischisiert, dass der in ihrer Produktion angewandte (entfremdete) Arbeitsprozess nicht mehr zu erkennen ist. Spivak zufolge ist eine Folge der epistemischen Gewalt des Imperialismus, dass der globale Süden in ein Zeichen transformiert wurde, dessen Produktion nicht mehr nachvollziehbar ist. In der Folge wird die westliche Überlegenheit und Dominanz naturalisiert und schlechterdings zur empirisch nachweisbaren Wahrheit bestimmt (vgl. Spivak 1999: 114ff.), wie auch die diese Prozesse begleitenden Affekte natürlich erscheinen. Die Verleugnung des ›Weltenmachens‹ als gewalttätigen Prozess versetzt das imperialistische Subjekt in die Lage, den Kolonialismus im kollektiven Gedächtnis zu löschen oder weit weg in die Vergangenheit an weit entfernte Orte zu katapultieren. In der Folge kann Migration und Flucht aus 1 | Immer noch die beste Analyse dieser Form von Herrschaftspolitiken liefert Saids Orientalism (1978).
55
56
María do Mar Castro Varela und Alisha M.B. Heinemann
den ehemals kolonisierten Territorien und die gewalttätige Geschichte des Kolonialismus nicht mehr zusammengedacht werden. An dieser Stelle ist das Konzept Aníbal Quijanos interessant, insoweit es auf die ungebrochene Kontinuität des Kolonialismus verweist und gleichsam auf die bestehenden Strukturen deutet, die aus den kolonialen Verhältnissen hervorgegangen sind und die aktuellen Machtund Herrschaftsverhältnisse prägen. Der Fokus der Analyse liegt entsprechend in der Kontinuität einer »kolonialen Machtmatrix« (vgl. Quijano 2008), die auch die affektiven Bindungen und Abstoßungen bestimmt. Mithilfe der Kolonialität der Macht lässt sich nicht nur begreifen, warum Fluchtbewegungen scheinbar nur in die Richtung des globalen Nordens verlaufen, sondern auch, warum die Mehrheit der europäischen Bevölkerung diese spezifischen menschlichen Bewegungen selten in Verbindung mit kolonialer Herrschaft und neokolonialen Strukturen bringt. Vergessen und Erinnern spielen bei der Produktion von Affekten, die uns bekanntlich nicht direkt erklärbar sind, eine zentrale Rolle. Assoziationen, Attraktion, Aversion vis-à-vis spezifischer Körper und sozialer Praxen bestimmen so Erklärungs- und Legitimationsmuster für nicht sogleich erklärbares Verhalten. Woher kommt die angebliche Angst vor Menschen, denen wir vorher noch nie begegnet sind? Woher rührt die spontane Hilfsbereitschaft, die den (neo-) kapitalistisch-gepflegten Nihilismus überwindet und auch apolitische Menschen mobilisiert? Die affektive Seite der Kolonialität führt uns hier zu einem neuen Terrain des Erklärbaren. Die ärgerliche Diskussion um ›europäische Werte‹ nutzt, wie hinlänglich bekannt, vor allem der Stabilisierung der weißen-europäischen Suprematie, bei der dem weißen-europäischen rationalen Selbst ein von Emotionen bestimmtes Anderes gegenübergestellt wird, das das konstitutive Außen darstellt. Die ›europäischen Werte‹, die durchaus auch von Liberalen als positiv handlungsleitend proklamiert werden, sind dabei nichts anderes als eine Chimäre westlicher Ethik. Aufgezählt werden regelmäßig die Tugenden der Aufklärung: Redefreiheit, Emanzipation wie auch Solidarität. Den nach Europa geflüchteten Menschen, insbesondere wenn sie muslimischen Glaubens sind – oder ein solcher Glauben ihnen von der Mehrheit zugeschrieben wird –, wird dagegen die bloße Möglichkeit, nach den Prinzipien der Aufklärung auch nur handeln zu können, schlicht abgesprochen. Und so werden sie nur unter der Voraussetzung willkommen geheißen, dass sie sich die (imaginierten) Werte nicht nur aneignen, sondern diese auch internalisieren und offenkundig performieren. Gelernte Affekte regulieren die Wahrnehmung. Und so sehen (wohlmeinende) Europäer_innen immer dort ein problematisches Verhalten, wo sie Subjekten im Feld der Andersplatzierten begegnen. Die Anderen sind nie in der Lage, tatsächlich im aufgeklärten Wir aufgenommen zu werden. Demonstrationen der Anderen empfinden Liberale deswegen oft als »unangemessen«, »deplatziert« und Konservative als »Farce« und »unrechtmäßig«. Für beide Gruppen entfaltet sich die Demonstration – und mithin die Wahrnehmung demokratischer Rechte – von Geflüchteten als bloße Katachrese.
Mitleid, Paternalismus, Solidarität
Affekte produzieren in ihrer massiven Ambivalenz zwar Solidaritäten, aber eben auch Abwehr und Zurückweisung gegenüber den Neuangekommenen. Als ›unaufgeklärte Massen‹ werden sie nicht selten ähnlich der Bevölkerung der Ghettos in den Metropolen Europas im 17. und 18. Jahrhundert repräsentiert: beängstigend, bedrohlich und unberechenbar. Und so entladen sich in der Mehrheitsbevölkerung Affekte der Abwehr, die zuweilen (und immer öfter) in physische Gewalt umschlagen. So stiegen in den letzten Monaten die Anschläge auf Unterbringungen von Geflüchteten ebenso wie die rassistischen Übergriffe auf Menschen, die nicht als zugehörig zur Nation gesehen werden, weil sie nicht weiß, nicht christlich sind oder eben schlicht nicht in Europa geboren wurden. Was ist nun zu tun? Wie kann auf die wachsende Gewalt auf der einen Seite sowie Angst und Trauma auf der anderen reagiert werden? Wie lässt sich intervenieren in einem aufgeladenen Feld, das danach strebt, Differenzen neu und brutal zu markieren? Kann Kultureller Bildung in diesem spannungsreichen Raum eine bedeutsame Rolle zukommen? Und wenn ja, welche?
Trickreich und ambivalent : M itleid , Paternalismus und S olidarität »Gefühle können an bestimmten Körpern kleben, in derselben Art und Weise, wie wir Räume, Situationen, Dramas beschreiben.« (A hmed 2010: 39)
Um die obengenannten Fragen beantworten zu können, wenden wir unseren Blick auf einige der dominierenden Affekte bei der Arbeit mit Geflüchteten: Mitleid, Solidarität und Paternalismus. Ein dominanter und oft problematisierter Affekt im Zusammenhang mit Geflüchteten ist das Mitleid. Jenes spontane Gefühl, das unsere Körper überrascht und uns erstarren lässt und welches bereits bei Aristoteles als eines der sieben menschlichen Affekte bestimmt wird (vgl. Aristoteles Rhetorik). Wenn bspw. Menschen vor dem Fernseher weinen, weil sie die Bilder des Leids nicht begreifen können, oder weil sie gegenteilig nur allzugut verstehen, was anderen Menschen in ihrem Namen angetan wird, sprechen wir von Mitleid. Mitleid kann als eine Art sekundärer Schmerz beschrieben werden, der das rational verstandene Leid in einen Affekt übersetzt: Wut, Hilflosigkeit, Trauer etc. In den Worten von Martha Nussbaum handelt es sich beim Mitgefühl (compassion) um »ein schmerzhaftes Gefühl, das durch das ernsthafte Leiden eines anderen oder anderer Lebewesen ausgelöst wird« (Nussbaum 2016: 217). Mitleid ist mithin Effekt einer starken empathischen Zuwendung. Einen kurzen Moment lang scheinen uns die Menschen, die leiden, unglaublich nahe zu sein. So ist vielleicht zu erklären, warum sich so viele Menschen aus ihren Wohnzimmer heraus tatsächlich in Richtung Geflüch-
57
58
María do Mar Castro Varela und Alisha M.B. Heinemann
teter bewegt haben – etwa an die Grenzen, an die Bahnhöfe, zu den Erstunterbringungen. Nussbaum zufolge sind am Mitgefühl drei Gedanken beteiligt: (1) Es liegt ein ernsthafter Grund für das Leiden der anderen vor; (2) die, die leiden, tragen keine eigene Schuld an ihrem Leiden, und (3) die Vorstellung, dass das, was den leidenden Menschen passiert ist, alle betreffen könne (ebd.: 218ff.). Und schließlich fügt Nussbaum noch ein weiteres wichtiges Element hinzu: einen »eudämonistischen Gedanken«: »Das ist ein Urteil oder ein Gedanke, der der leidenden Person oder den leidenden Personen einen wichtigen Platz im Leben des Menschen zuweist, der diese Empfindungen hat.« (Ebd.: 221) Mitleid ist mithin an ein Gefühl der Gemeinsamkeit gebunden, weswegen es schockiert, wenn Menschen kein Mitgefühl haben, mit denen wir uns verbunden fühlen. Doch wie Lee Edelman in seiner durchaus provokativen Schrift Compassion’s Compulsion bemerkt: »Compassion can be a touchy subject, touching, as it does, on what touches the heart by seeming to put us in touch with something other than ourselves while leaving us open, in the process, to being read as an easy touch.« (Edelman 2004: 159) Edelman beruft sich hier auf Jacques Lacan und entfaltet die paradoxen Verflechtungen von Liebe, Todestrieb, der Sehnsucht nach Reproduktion und dem damit zusammenhängenden Mitleid mit sich selbst und anderen. Wie wenig Selbst-los Mitleid ist, wird hier ebenso deutlich, wie auch verständlich dargelegt wird, wie eng Mitleid mit der menschlichen Todesangst und dem immer wieder scheiternden Versuch, die verlorene Ganzheit wiederzuerlangen, verschlungen ist. Weswegen Edelman richtig bemerkt: »…whatever its object or the political ends it serves, compassion is always conservative, always intent on preserving the image in which the ego sees itself« (ebd.: 173). Einen anderen Zugang bietet die indische Rasa-Theorie2 (vgl. etwa Rangacharya 2005), die eine interessante Zusammenführung von Logik, Gefühlen und Ästhetik bietet. Das Berührt- oder Affiziertwerden wird aus zwei Perspektiven beschrieben: der Auslösenden und der Aufnehmenden. Die sehr komplexe Theorie, auf die hier nicht detailliert eingegangen werden kann, veranschaulicht, wie eine künstlerische Darbietung (etwa Komödie, Tanz, Drama) Affekte bei den Zuschauenden hervorbringt. Sie betrachtet dabei einerseits die Seite der Produktion von Affekten und anderseits die Rezeption derselben. Mittels Gesten, Sprache und Bewegungen werden bei den Zuschauenden spezifische Gefühle affiziert. Das ist nicht zufällig, sondern will erlernt sein. Kāruņyam (Pathos) etwa ist ein Rasa, welches der Theorie folgend ausgelöst wird durch die Darstellung des Sterbens einer nahestehenden Person oder die Übermittlung einer schlechten Nachricht. Es können dadurch, der Theorie folgend, 49 Gefühle (Bhavas) ausgelöst werden. In der ästhetischen Rasa-Theorie wird dabei ein direkter Zusammenhang zwischen Wissen und Gefühl angenommen, denn ein Gefühl kann, so die Annahme, nur ausgelöst werden, wenn die Kunst verstanden wird. So ist die Rede von 2 | Rasa ist der Kern aller Qualitäten, die durch eine ästhetische Darstellung (etwa Drama oder Gedicht) hervorgerufen werden.
Mitleid, Paternalismus, Solidarität
einem gefühlten Wissen. Rasa ist dabei das Gesamtergebnis eines Auslösers, der damit einhergehenden unwillkürlichen und gleichzeitig willkürlichen Reaktion, wodurch Gefühl und Wissen unlösbar miteinander verbunden werden. Wenn Edelman von einem »touchy subject« spricht, so könnten wir dies nun ergänzen durch das Wissen, das benötigt wird, um im Subjekt Mitleid zu erzeugen. Wir könnten des Weiteren analysieren, wie genau Mitleid sich physisch und psychisch äußert. Das mediale Theater (die Presse, die Performativität von Talkshows und Tagesthemen) wirft Bilder, Worte und Gesten auf die Zuschauenden, die Mitleid affizieren – denken wir etwa an das infame Bild des leblosen Körpers des kleinen syrischen Jungen, der bei der versuchten Überfahrt von der Türkei nach Griechenland ertrinkt und dessen toter Körper an den Strand gespült wird –, Bilder, Worte, Gesten treffen auf zuschauende Subjekte, die mit Unwohlsein, Zittern, Weinen oder einem stoischen Unberührtsein reagieren. Der Rasa-Theorie folgend können dabei Gefühlszustände erreicht werden, die nicht mehr mit Sprache erfassbar sind. Was auch damit zu tun hat, dass das Kunstwerk die Emotion überschreitet und transformiert in eine ästhetische Erfahrung »as rasa, the ›juice‹ or ›savour‹ that makes art into something beyond ordinary life« (Biernacki 2011: 263). Auch wenn die Theorie als ästhetische Theorie lediglich versucht zu erklären, wie bei Zuschauenden von Theater der ideale Zustand der Glückseligkeit ausgelöst werden kann, so kann sie uns doch auch helfen, die Komplexität von Affekten besser zu verstehen. Gefühle werden affiziert und treten in Kontakt mit bestehendem Wissen. Dies löst körperlich und psychisch erfahrbare Zustände aus, die auch handlungsleitend sein können. »When the emotion is grief, the form the rasa takes is compassion. […] However, the transformation is not simply from one emotion to another. Something is added in the process which leaves mere emotion behind – a transcendence that passes into a mode of awareness that entails a universalisation that bursts the bounds of ordinary egoic identity.« (Biernacki 2011: 267) Der ästhetische Prozess impliziert mithin eine wichtige Transformation, die eine Selbstwahrnehmung voraussetzt und in Prozess bringt. Es ist dies eine ästhetisch wie auch ethische Erfahrung. Dabei konkordiert ein Auslöser nie nur mit einer einzigen psycho-physischen Reaktion. Zudem lernen wir in der Rasa-Theorie, dass Kunst nicht »Wirklichkeit« darstellt, sondern diese erst schafft. So wird auch das mitleidende Subjekt in der Dynamik zwischen rasa und bhava hervorgebracht. Dies macht Kunst zu einer wichtigen Intervention. Sie schafft, sie ermöglicht, sie nimmt nicht einfach hin, sie ist produktiv. Wir folgen hier auch Jacques Rancière, der in seinem Essay »Ist Kunst widerständig?« (2008: 34) bemerkt, dass das »Politik-Werden der Kunst« eine »ethische Konfusion« wird, »in der die Kunst und die Politik sich gegenseitig verschwinden lassen, im Namen ihrer Vereinigung. Was aus dieser Konfusion logischerweise folgt, ist nicht die – durch die Erfahrung des Nichtmenschlichen – brüderlich gewordene Menschheit. Es ist eine Menschheit, die zurückgewiesen wird an der Vergeblichkeit jedes brüderlichen Traums.« (Ebd.)
59
60
María do Mar Castro Varela und Alisha M.B. Heinemann
Mediale Bilder bringen ebenso eine neue Wirklichkeit hervor wie künstlerische Interventionen. Sie repräsentieren diese nicht einfach – wie dies immer noch allzu oft angenommen wird (vgl. hierzu auch Sontag 2003). Entsprechend können wir Mitleid in seiner ganzen Ambivalenz fassbar machen. Mitleid verweist auf ein sedimentiertes (kollektives) Wissen, welches immer wieder zu löschen versucht wird, aber im kollektiven Gedächtnis weiterlebt – etwa das Wissen von der Schneise der Gewalt, die Europa und seine Zivilisierungsmission bei der eigenen Hervorbringung geschlagen hat: Kolonialismus, Faschismus, Holocaust, Genozide, Sklaverei etc. (vgl. Castro Varela 2015). Im Gegensatz zu dem hegemonialen abendländischen Narrativ, das Europa als die Wiege des Humanismus bestimmt, deutet das Mitleid beim Betrachten der Leiden anderer (Susan Sontag) auf ein gefühltes Wissen, das beunruhigt. Dies ist auch der Grund dafür, warum eine spürbare Ambivalenz Hilflosigkeit hervorruft. Mitleid ist der indirekte Weg, auf hervorgebrachtes Leid zu reagieren. Die Reaktionen sind allerdings erst dann verantwortlich, wenn sie Raum für Reflexion – im Sinne kritischer Hinterfragung – eröffnen. Kulturelle Bildung – wie auch künstlerische Praxen – könnte hier durchaus bedeutsam sein. Paternalismus dagegen, diese väterliche Herrschaftsordnung, die sich affektiv in schützenden Gesten entladen kann, ist etwas komplexer als die Ko-Passion, weil dieser direkter noch im Kollektiven verhaftet ist. Der väterliche Schutz, der sich im Paternalismus Raum verschafft, ist nicht nur eng mit der Nationenbildung verlinkt, sondern zudem nur möglich, solange die eigene (nationale) Überheblichkeit erhalten und ein desaströser Narzissmus gepflegt werden. Helfen wird hier zu einer Möglichkeit, die Großartigkeit der (nationalen) Zugehörigkeitsgruppe zu demonstrieren: »Schaut, wir Deutschen sind gut!« In ihrem Essay Righting Wrongs setzt sich Spivak (2007) genau mit dieser sozialen Struktur auseinander. Und bemerkt, dass der Wunsch Rechte zu bringen eben deshalb problematisch ist, weil die die Rechte bringen, die Anderen im Feld der Entrechteten fixieren und damit nolens volens abwerten und abwehren. Paternalismus ist ohne Mitleid nicht denkbar. Mitleid ohne Paternalismus schon.
K ulturelle B ildung . V ersuch einer kritisch - affek tiven B estimmung Verschiedenste Bestimmungen Kultureller Bildung kursieren sowohl im pädagogischen als auch im politischen und künstlerischen Feld. Sowohl die affektive Seite als auch die subjektkonstituierende Seite werden dabei jedoch nur selten berücksichtigt. Vielmehr wird Kulturelle Bildung oftmals nur funktional bzw. instrumentell gedacht. So werden die positiven Seiten einer künstlerischen Betätigung hervorgehoben: Malen, Zeichnen, Theaterspielen etc. sollen Geflüchteten helfen, Freund_innen zu finden, sich Zuhause zu fühlen, einen Ausdruck zu finden, am politischen-sozialen Leben zu partizipieren.
Mitleid, Paternalismus, Solidarität
Die Tagung bzw. das Festival »Interventionen. Refugees in Arts and Education«, das im Juni 2016 in Berlin stattgefunden hat, hatte als Ziel, »gemeinsame Handlungsperspektiven und nachhaltige Strategien weiter zu entwickeln und notwendige politische Forderungen zu formulieren.«3 Hier wird das Feld der Diskriminierung ganz deutlich benannt – wie auch für eine Nachhaltigkeit der kulturellen Praxis geworben wird. In erfrischender Weise wird zudem kritisch die gängige Kulturelle Bildung hinterfragt. »Kulturelle Projekte von und mit Geflüchteten«, so lesen wir in der Dokumentation, »laufen Gefahr, dass sie als ›Beschäftigungsmaßnahme‹ für Geflüchtete und zur Beruhigung der Gesellschaft dienen.« Doch bleiben solche »Interventionen« eher die Ausnahme. Kulturelle Bildung mit Geflüchteten konzentriert sich häufig nur auf den selbstständig-kreativen Bereich und reduziert ihre Tätigkeit auf das praktische Tun und weniger auf die Vermittlung eines spezifischen widerständigen Wissens. In der konservativen Variante Kultureller Bildung wird Kultur und Kunst lediglich als Distinktionsmoment vermittelt. Es wird gewissermaßen eine bürgerliche Kultur vermittelt, die einen stratifizierenden Effekt hat. Kulturelle Bildung schreibt sich hier weich in den Integrationsdiskurs ein: Sie vermittelt national geprägte kulturelle Bezugspunkte, die eine soziale Eingliederung der Geflüchteten ermöglichen sollen (vgl. Grotlüschen 2010: 4). Die Wirkung dieser Praxis wird unseres Erachtens nicht nur überschätzt, sondern Kunst ihrer kritischen Kraft beraubt und Kulturelle Bildung für staatliche Integrationspolitik instrumentalisiert. Wie kann, so müssen wir uns fragen, gemeinsames Theaterspielen die strukturellen Begrenzungen brutaler Migrations- und Fluchtregimes überschreiten? Wie können Traumatisierungserfahrungen über Malworkshops bearbeitet werden, wo wir doch wissen, dass Traumata die Seele in unglaubliche Abgründe stürzt und die Heilung derselben, wenn dies überhaupt möglich ist, viele Jahre mit intensiver therapeutischer Begleitung in Anspruch nimmt? Kulturelle Bildung kann dennoch durchaus ein hilfreicher, stabilisierender Bestandteil in der Arbeit mit Geflüchteten sein und die gesellschaftliche Partizipation befördern – und mithin Solidarität im positiven Sinne befördern. Nur dürfen ihre von struktureller Gewalt geprägten Lebenslagen dabei nicht aus dem Blick geraten. Anbieter Kultureller Bildung für Geflüchtete sollten es sich daher zur Aufgabe machen, sich über das selbstständig-kreative Arbeiten hinaus auch mit dem Potential widerständiger Praxen in und durch künstlerische Interventionen auseinanderzusetzen. Das könnte dann bspw. dazu führen, dass Kulturelle Bildung und die Idee des »Regeln-Brechens« zusammengedacht werden (vgl. Castro Varela/Dhawan 2009).
3 | Vgl. http://interventionen-berlin.de/interventionen/ (letzter Zugriff : 10.06.2016).
61
62
María do Mar Castro Varela und Alisha M.B. Heinemann
K ulturelle B ildung als politischer A k tivismus Initiativen wie die Silent University 4, die in London unter Beteiligung der Tate Gallery gegründet wurde, deuten auf die frühe Beteiligung künstlerischer Initiativen bei solidarischen Aktionen mit Geflüchteten. Vom 3. bis 5. März fand in Berlin am Haus der Kulturen der Welt der Kongress »Civil Society 4.0. – Refugees and Digital Self-Organization« statt, bei dem es darum ging, die digitalen Möglichkeiten für die Selbstorganisation von Geflüchteten auszuloten und zu erweitern. Eines der Ergebnisse war ein unseres Erachtens bemerkenswertes Paper mit elf Empfehlungen zur Organisierung von Transformation.5 Diese Empfehlungen sind sehr kurz und konzise formuliert und reichen von der Forderung, die Isolation von Geflüchteten zu durchbrechen, bis hin zur Empfehlung, Frauen in digitalen Medien zu schulen, um ihre Chancen zur Selbstbestimmung zu erhöhen. Interessant ist die Breite der Empfehlungen, die eigentlich eher im Duktus von Forderungen formuliert wurden, wie auch der starke politische Inhalt, der weit über das Thema des Kongresses hinausreicht. Deutlich wird, dass, wenn es um Geflüchtete geht, Kulturelle (in diesem Falle digitale) Bildung nicht apolitisch gedacht werden kann. Kulturelle Bildung wird als politische Strategie genutzt, um gesellschaftliche Verhältnisse zu skandalisieren, aus dem gesättigten bürgerlichen Milieu herauszukatapultieren und als Vehikel für politische Mobilisierung zu (re-)aktivieren. Und so lautet die letzte Empfehlung des Papers denn auch »We are all born free/my right is your right«. Der emphatische Ton, der klare Gestus befremdet auf den ersten Blick, weil er einen bekannten und doch neuen Gestus darstellt, insofern die Orte der Kulturellen Vermittlung und Bildung sich heutzutage eher selten einer solchen Sprache und eines solchen Gestus bedienen. Es zeigt aber auch, dass die Wahrnehmung von »Flucht« die Kulturelle Bildung belebt und politisiert hat. Rancière zufolge sind Künste immer als in die Seinsweise einer Gemeinschaft assimiliert zu denken. Er stellt sie als »technische Erfindungen« dar, »die spezifische Affektionsformen, zum Beispiel die Furcht und das Mitleid der Tragödie, produzieren« (Rancière 2008: 40). Nun verändert sich die Seinsweise der Gemeinschaft über die Verhärtung der Grenzen, die sich dennoch als durchlässig erweisen, kontinuierlich. Die Effekte von »Flucht« erschüttern die Gemeinschaft. Kunst und Kulturelle Bildung können eine Plattform und einen 4 | Die Silent University wurde 2012 in London als ein Kollaborationsprojekt zwischen der Delfina Stiftung und der Tate Gallery gegründet. 2013 wurde eine weitere in Schweden mit der Tensta Kunsthalle und dem ABF Stockholm gegründet. In Deutschland etablierte sie sich 2014 in Hamburg, initiiert durch die hiesige Stadtkuratorin Hamburgs in Kollaboration mit der W3 – Werkstatt für internationale Kultur und Politik. Es handelt sich um eine Bildungsplattform, in der Künstler_innen, Kunstinstitutionen, Akademiker_innen, Geflüchtete und Migrant_innen zusammenarbeiten. Vgl. http://thesilentuniversity.org/ 5 | Vgl. www.hkw.de/de/programm/projekte/2016/civil_society_4_0/deklaration_civil_ society/zivilgesellschaft_11_handlungsempfehlungen.php (letzter Zugriff: 10.06.2016).
Mitleid, Paternalismus, Solidarität
Raum darstellen, diese Transformationen vermittelbar und reflektierbar zu machen. Allerdings nur dann, wenn Affekte bei der Betrachtung Kultureller Bildung zentral mitgedacht werden.
F a zit : A ngst und H offnung »Selbst bei der progressivsten Politik von heute liegt die Gefahr nicht in der Passivität, sondern in der Pseudoaktivität, im Zwang, aktiv zu sein und teilzunehmen. Die Leute intervenieren die ganze Zeit, versuchen, ›etwas zu tun‹, die Akademiker nehmen an bedeutungslosen Debatten teil. Das wirklich Schwierige ist, einen Schritt zurückzutreten und sich zu entziehen.« (Ž ižek 2013: 40)
Kulturelle Bildung kann, so unsere These, bei der Sichtbarmachung, aber auch bei der Arbeit mit Affekten eine entscheidende Rolle spielen. Dies fand bisher im Fachdiskurs nur wenig Berücksichtigung. Ebenso lässt sich feststellen, dass in der Forschungslandschaft der Erwachsenenbildung bisher nur wenige Arbeiten zu finden sind, die sich kritisch-reflexiv mit der Tatsache einer bestehenden Migrationsgesellschaft auseinandersetzen (vgl. Heinemann 2014). Eine Kulturelle Bildung könnte deswegen in der Stärkung der Handlungsmächtigkeit von Geflüchteten ebenso eine Rolle spielen wie in den Politisierungsprozessen von Mehrheitsangehörigen. Helle Becker (2009) schreibt zwar, dass sich Kulturelle und Politische Bildung nicht gegenseitig »kolonialisieren« sollten, doch sind wir der Meinung, dass jedwede verantwortliche Kulturelle Bildung mit Geflüchteten politisch sein muss, wiewohl es keinen Grund gibt, warum Politische Bildung nicht mit Elementen Kultureller Bildung verlinkt werden könnte. In vielen Ländern Lateinamerikas oder auch in Indien ist dies beispielsweise gang und gäbe. Wie Rancière (2008) bemerkt, geht es um die Vereinigung von Kunst und Politik – ihre Supplementierung. Politisch-ethisches Handeln entsteht im Spannungsfeld zwischen Recht und Gerechtigkeit und muss Wege suchen, die weder paternalistische Solidarität befördern noch eine mitleidige Hilfe der Privilegierten gegenüber den Subalternisierten. Wenn Kulturelle Bildung nicht eine der Pseudoaktivitäten repräsentieren will, wie sie der slowenische Philosoph Slavoj Žižek (2013) beschreibt, dann ist es notwendig, sich der kulturellen Praxis dekonstruktiv zu nähern und die Affekte, die an dieser kleben, genauer zu betrachten. Wenn Mitleid paternalistisch oder ermächtigend sein kann und Solidarität die europäische, weiße Suprematie befördern oder diese ins Wanken bringen kann, dann kann Kulturelle Bildung, wenn sie denn selbstkritisch ist und sich nicht davor scheut, die Regeln zu brechen, der sich ausbreitenden, geradezu mythischen Angst den ankommenden Geflüchteten
63
64
María do Mar Castro Varela und Alisha M.B. Heinemann
gegenüber eventuell utopischen Sachverstand entgegenstellen. Geflüchtete müssten dann aber in dieser Kulturellen Bildung in vielfacher Weise Protagonist_innen sein, die nicht nur an der europäischen Vorstellung von Kultur teilnehmen, sondern diese radikal in Frage stellen. Dann kann Kulturelle Bildung der fortschreitenden Subalternisierung von Geflüchteten vielleicht doch etwas entgegensetzen und selber in einen Prozess der Provinzialisierung Europas (Chakrabarty 2000) und der Ent-Bourgeoisierung treten. Eine erfrischende Vorstellung – und hoffnungsvoll zugleich.
L iter atur Ahmed, Sara (2010): »Objects«, in: Melissa Gregg/Gregory J. Seigworth (Hg.), The Affect Theory Reader, Durham/London: Duke University Press, S. 29-51. Aristoteles (2002): Rhetorik. Übersetzung Christof Rapp. 2 Halbbände, Berlin: Akademie Verlag. Becker, Helle (2009): »Kulturelle und politische Bildung sollen sich nicht gegenseitig kolonialisieren.« Interview in der bpb. www.bpb.de/gesellschaft/kultur/ kulturelle-bildung/59945/interview-bildung-nicht-kolonialisieren?p=1 (letzter Zugriff: 06.06.2016). Berlant, Lauren (2004): »Introduction. Compassion (and Withholding)«, in: dies. (Hg.), Compassion: The Culture and Politics of an Emotion, London/New York: Routledge, S. 1-13. Berlant, Lauren (2010): »Cruel Optimism«, in: Melissa Gregg/Gregory J. Seigworth (Hg.), The Affect Theory Reader, Durham/London: Duke University Press, S. 93-117. Biernacki, Loriliai (2011): »Towards a Tantric Nondualist Ethics through Abhinavagupta’s Notion of Rasa«, in: The Journal of Hindu Studies, 4, S. 258-273. Castro Varela, María do Mar (2015): »Europa. Ein Gespenst geht um«, in: Gregor Maria Hoff (Hg.), Europa: Entgrenzungen, Innsbruck/Wien: Tyrolia, S. 4982. Castro Varela, María do Mar/Dhawan, Nikita (2009): »Breaking the Rules. Bildung und Postkolonialismus«, in: Carmen Mörsch (Hg.), Kunstvermittlung II. Zwischen kritischer Praxis und Dienstleistung auf der documenta 12. Ergebnisse eines Forschungsprojekts, Zürich/Berlin: diaphanes, S. 339-353. Castro Varela, María do Mar/Dhawan, Nikita (2015): Postkoloniale Theorie. Eine kritische Einführung, 2. überarbeitete und ergänzte Ausgabe, Bielefeld: transcript. Chakrabarty, Dipesh (2000): Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference, Princeton: Princeton University Press. Cuttitta, Paolo (2010): »Das europäische Grenzregime: Dynamiken und Wechselwirkungen«, in: Sabine Hess/Bernd Kasparek (Hg.), Grenzregime. Diskurse, Praktiken, Institutionen in Europa, Berlin/Hamburg: Assoziation A, S. 23-40.
Mitleid, Paternalismus, Solidarität
Edelman, Lee (2004): »Compassion’s Compulsion«, in: Lauren Berlant (Hg.), Compassion: The Culture and Politics of an Emotion, London/New York: Routledge, S. 159-186. Fanon, Frantz (1981/1961): Die Verdammten dieser Erde, Frankfurt a.M.: Suhrkamp. Gregg, Melissa/Seigworth, Gregory (Hg.) (2010): The Affect Theory Reader, Durham/London: Duke University Press. Grotlüschen, Anke (2010): »Kulturelle Erwachsenenbildung«, in: Enzyklopädie Erziehungswissenschaften online, Weinheim/München: Juventa. Hall, Stuart (1992): »The West and the rest: discourse and power«, in: Stuart Hall/ Bram Gieben (Hg.), Formations of modernity, Cambridge: Polity Press in association with the Open University, S. 275-331. Heinemann, Alisha M.B. (2014): Teilnahme an Weiterbildung in der Migrationsgesellschaft. Perspektiven deutscher Frauen mit »Migrationshintergrund«, Bielefeld: transcript. Kapoor, Ilan (2008): The Postcolonial Politics of Development, London/New York: Routledge. Nussbaum, Martha C. (2016): Politische Emotionen, Berlin: Suhrkamp. Quijano, Aníbal (2008): »Coloniality of Power, Eurocentrism, and Social Classification«, in: Mabel Moraña u.a. (Hg.), Coloniality at Large. Latin America and the Postcolonial Debate, Durham/London: Duke University Press, S. 181-224. Rangacharya, Adya (2005): Introduction to Bharata’s Nātyasāstra, Neu-Delhi: Munshirm Manoharlal. Said, Edward (1978): Orientalism, New York: Vintage. Said, Edward (1993): Culture and Imperialism, London: Chatto & Windus. Sontag, Susan (2003): Das Leiden anderer betrachten, München: Hanser. Spivak, Gayatri Chakravorty (1999): A Critique of Postcolonial Reason. Towards a History of the Vanishing Present, Calcutta/New Delhi: Seagull. Spivak, Gayatri Chakravorty (2007): »›Righting Wrongs‹ – 2002: Accessing Democracy among Aboriginals«, in: dies. (Hg.), Other Asias, Hoboken (New Jersey): Wiley-Blackwell, S. 14-57. Spivak, Gayatri Chakravorty (2008): »More Thoughts on Cultural Translation«. http://eipcp.net/transversal/0608/spivak/en (letzter Zugriff: 06.07.2016). Virilio, Paul (2016): Die Verwaltung der Angst, 2. überarbeitete Auflage, Wien: Passagen. Žižek, Slavoj (2013): Lacan. Eine Einführung, Frankfurt a.M.: Fischer.
65
Refugees sind keine Zielgruppe Carmen Mörsch
Zusammenfassung Der Beitrag kritisiert die Anwendung des Konzepts der »Zielgruppe« in der kulturellen Bildung, da dieses zu konservativen Entwürfen gesellschaftlicher Gruppen führt und Solidarisierung durch Marktlogik verhindert. Er verweist darüber hinaus auf das Machtverhältnis, das in die Adressierung von Minorisierten durch mehrheitsangehörige Akteur_innen eingeschrieben ist: Einerseits erfolgt die Ansprache zumindest augenscheinlich mit dem Ziel, Gleichberechtigung her- oder zumindest als anzustrebendes Ergebnis in den Raum zu stellen. Andererseits aber bedingt Adressierung eine Identifizierung und damit eine Festschreibung der Angesprochenen als Andere, und eben gerade nicht als Gleiche. Der Beitrag schlägt demgegenüber vor, statt Refugees als »Zielgruppe« zu adressieren, kulturelle Bildung über ein klar formuliertes Handlungsziel – die Freiheit von Rassismus – zu perspektivieren. Damit wären dann nicht nur minorisierte Gruppen, sondern alle Mitglieder einer Gesellschaft adressiert. Eine der wichtigsten Konsequenzen einer antirassistisch ausgerichteten kulturellen Bildung wäre die Zunahme von Initiativen, Projekten, Vernetzungsforen und Organisationen, in denen die seitens der Mehrheitsgesellschaft als Problem markierten Gruppen Regie führen. Der Beitrag schließt mit vier Punkten, welche die Planung, Durchführung und Reflexion von Projekten der kulturellen Bildung in antirassistischer Perspektive unterstützen sollen.
Abstract: Refugees are not a Target Group This paper critiques the use of the concept of the ›target group‹ in cultural education as leading to conservative interpretations of social groups and impeding solidarity through its market-based logic. Furthermore, the paper addresses the power relations that are inscribed in the ways that minoritized individuals are addressed by members of the majority. On the one hand, the apparent aim of the address is to produce equality (or at least present equality as something to be strived for); but on the other hand, address is conditioned by an identification, and as such a codification, of the addressee as Other, and precisely not as an equal. Instead of addressing refugees as a ›target group‹, this paper suggests that cultural education ought to explore a more clearly formulated perspective that is free of racism. This would mean that it is not just minoritized groups that are addressed, but society at large. One of the fundamental consequences of an anti-racist cultural education would be
68
Carmen Mörsch the growth of initiatives, projects, networking forums and organizations which are directed by the groups designated as ›problem groups‹ by the broader society. The paper ends with four points which are designed to support the planning, implementation and reflexivity of cultural education projects with anti-racist perspectives.
»Was sind geeignete Formate der Kulturellen Bildung, um auf die Realität der Geflüchteten aufmerksam zu machen und um Vernetzung und Solidarisierung herzustellen? Das Phänomen Flucht bietet Möglichkeiten für eine macht- und differenzsensible Veränderung von Kultur- und Bildungsinstitutionen und eröffnet Chancen für die Revision etablierter Handlungsroutinen.«1
Bei der Definition von Zielgruppen entlang soziodemografischer Marker handelt es sich um ein Instrument aus der Marktforschung. Diese in der Kulturellen Bildung weit verbreitete Praxis weist ihr also impliziert die Rolle eine_r Anbieter_in von Waren oder Dienstleistungen zu; die adressierten Nutzer_innen werden zu Kund_innen beziehungsweise Konsument_innen. Definitionen von Zielgruppen haben zudem die Tendenz, gegenüber der Komplexität, Vieldeutigkeit und Dynamik von Gesellschaft konservativ und vereinfachend zu sein.2 Problematisch sind sie insbesondere dann, wenn sie Zuschreibungen von Defiziten enthalten. Dazu gehören zum Beispiel die im Fachdiskurs der Kulturellen Bildung häufig auftauchenden Kategorien »bildungsfern« oder »kulturfern«. Solche Bezeichnungen setzen unhinterfragt voraus, dass geklärt ist, was »Bildung« und »Kultur« jeweils bedeuten, wer sie hat und wer sie nicht hat. Angebote für auf diese Weise definierte Zielgruppen laufen Gefahr, die Ungleichheit, die durch sie eigentlich bekämpft werden soll, zu verstärken (vgl. Ribolits 2011). Demgegenüber steht der zu Beginn zitierte Text, der für die vorliegende Publikation wirbt. Kulturelle Bildung wird dabei im ersten Satz des Zitats als Handlungsrahmen verstanden, in dem für Geflüchtete Partei ergriffen wird und in dem Austauschbeziehungen im Zeichen von Solidarität stattfinden. Im zweiten Satz wird postuliert, dass Lernprozesse in der Kulturellen Bildung wechselseitig gedacht werden müssen, und dass das Wissen, das minorisierte Akteur_innen, zum Beispiel Geflüchtete, in Projekte hineintragen, etwas ist, von dem Kulturelle Bildung für ihre eigene Weiterentwicklung profitiert. Unter diesen Vorzeichen wäre sie gerade nicht an Marktlogiken gebunden und verfügte über die Freiheit, Risiken einzugehen und sich selbst aufs Spiel zu setzen. Die Nutzer_innen würden nicht als Kund_innen, sondern als aktive Mitgestalter_innen und Diskussionspartner_innen verstanden. 1 | Aus dem Werbetext des vorliegenden Bandes. 2 | So meint die Adressierung »Familie« zum Beispiel meist die heterosexuelle Kleinfamilie, welche in pluralisierten Gesellschaften längst nicht die einzige Form des Zusammenlebens ist.
Refugees sind keine Zielgruppe
Soweit der Anspruch. In dem Moment aber, wo Geflüchtete zur »Zielgruppe« werden, ist dieser Anspruch nicht mehr einlösbar. Zum einen lassen sich die zuvor skizzierten Entwürfe Kultureller Bildung tatsächlich nicht miteinander vereinbaren: Man kann nicht radikal solidarisch und auf dieser Grundlage zur Selbstveränderung bereit sein wollen und gleichzeitig den Leuten, mit denen man sich solidarisiert und die einen verändern können sollen, etwas verkaufen und aus ihnen Kapital schlagen wollen. Das heißt, man kann schon, aber dieses Mehrfachwollen führt, wie sich immer wieder zeigt, in höchst konfliktreiche Sackgassen, in deprimierende Leerläufe oder im schlimmsten Fall zu Ausbeutungsverhältnissen. Das in der Adressierung von Minderheiten durch mehrheitsangehörige Akteur_innen eingeschriebene Machtverhältnis entsteht jedoch nicht nur im Kontext von Flucht, sondern auch bei anderen als migrantisch markierten Gruppen; es handelt sich bei ersterem um eine Zuspitzung aufgrund der durch den unsicheren Status von Refugees gesteigerten Verletzungsgewalt. Einerseits erfolgt die Ansprache zumindest augenscheinlich mit dem Ziel, Gleichberechtigung her- oder zumindest als anzustrebendes Ergebnis in den Raum zu stellen. Andererseits aber bedingt Adressierung eine Identifizierung und damit eine Festschreibung der Angesprochenen als Andere, und eben gerade nicht als Gleiche.3 Dabei sind die jeweils vorgenommenen Identifizierungen weder zufällig noch neutral, sondern von den Perspektiven und Interessen der Einladenden geformt. Sie haben nicht nur die Funktion, das Andere herzustellen, sondern auch, das Eigene als angestrebte Norm zu bestätigen. Die von Akteur_innen der Kulturellen Bildung – nicht zuletzt in Reaktion auf förderpolitische Vorgaben – vorgenommene Adressierung »Migrationshintergrund« verfehlt dabei die enorme Pluralität und Komplexität von Identitätskonstruktionen in Einwanderungsgesellschaften, weil sie sich vornehmlich an ganz bestimmte, ethnisch und national als »Andere« markierte Gruppen wendet. Konkret: Durch die Angebote sollen nicht etwa gutverdienende »Expats« eingeladen werden, sondern eben als »mit Migrationshintergrund« identifizierte »Bildungsferne«. Bei dieser Form der Identifizierung handelt es sich um eine Kulturalisierung von strukturellen und sozialen Missständen. Die durch die Strukturen der Mehrheitsgesellschaft verursachten Effekte von sozialer, rechtlicher und politischer Ungleichbehandlung werden nicht thematisiert; stattdessen wird die zuvor festgeschriebene kulturelle Differenz der Eingeladenen, wird deren »Integration« selbst zum Begründungsmuster. Paul Mecheril schlug demgegenüber bereits vor 16 Jahren »kommunikative Reflexivität« als professionelle Haltung vor: »Professionelle Handlungen und Strukturen werden daraufhin befragt, inwiefern sie zu einer Ausschließung des Anderen und/oder zu einer reproduktiven Erschaffung des Anderen beitragen. […] Kommunikative Reflexivität – als das Medium, in dem sich eine Anerken3 | Paul Mecheril bezeichnet dieses Spannungsverhältnis als »Paradox der Anerkennung«, vgl. Mecheril 2000.
69
70
Carmen Mörsch nungspädagogik entfalten kann, […] meint weiterhin, dass das auf Veränderung zielende Nachdenken über die Verhinderungs- und Produktionsbedingungen des und der Anderen einen kommunikativen Vorgang bezeichnen sollte, der […] die Anderen mit einbeziehen sollte.« (Mecheril 2000: 11)
Es geht demzufolge nicht nur um einen reflexiven Umgang mit den eigenen Begriffen, Strukturen und Handlungsweisen, sondern um eine Reflexion und Aktion gemeinsam mit den jeweils Adressierten. Mit ihnen zusammen muss geklärt werden, was die gegenseitigen Interessenlagen sind und wer aus der Zusammenarbeit was gewinnt. Dafür ist ein weiterer Aspekt von Reflexivität notwendig: das Wissen um die Verletzungsgewalt, welche die Anbieter_innenseite der Kulturellen Bildung aufgrund ihres symbolischen Kapitals besitzt, und ein verantwortungsbewusster Umgang mit dieser Macht. Es bedeutet, immer wieder Raum zu schaffen, damit sich diese Verständigung und auch die Bearbeitung von Konflikten ereignen können – Raum für die »Fähigkeit, sich irritieren zu lassen« (Varela o.D.). Das beschriebene Paradox der Anerkennung, die eine Identifizierung und damit eine Festschreibung voraussetzt, bleibt bei diesem Zugang jedoch weiter bestehen. Ein konsequenterer Umgang damit wäre eine Verschiebung der Perspektive weg vom »Migrationsanderen« auf Kultur, Bildung und ihre Institutionen selbst: Sie sind ebenso Bestandteile der Migrationsgesellschaft, geprägt durch strukturell bedingte Ausschlussmechanismen, beinhalten aber auch ein Potential zur Selbstveränderung und zur Veränderung von Gesellschaft. Eine Voraussetzung dafür, dass dieses Potential realisiert werden kann, ist, dass minorisiertes, widerständiges Wissen und die Aktuer_innen, welche dieses Wissen tragen, Platz und Ressourcen einnehmen können. Zur Veranschaulichung ein Beispiel: Im Herbst 2011 wurde über die Tiroler Kulturinitiative ein Workshop von Vlatka Frketić4 unter dem Titel »Antirassismus und Kulturarbeit« mit folgender Ausschreibung angeboten: »Mittlerweile ist in ›kritischen‹ bzw. antirassistischen Kontexten mehr oder weniger Konsens, dass sich die öffentlichen Migrationsdebatten von den Migrant_innen auf die Probleme der Gesellschaft verschieben sollen: nicht über ›bildungsferne‹ Migrant_innen reden, sondern über die Misere und rassistischen Strukturen des Bildungssystems; nicht über Migrant_innen, die das Sozialsystem ausnutzen, sondern über Mechanismen, die ausgrenzend wirken etc. Auch hat sich die Migrationsdebatte stark auf Migrant_innen aus muslimischen Ländern verschoben: War vor ein paar Jahren noch die Rede von Migrant_innen mit türkischen Eltern bzw. Großeltern, ist jetzt die Rede von muslimischen Migrant_innen.
4 | Vlatka Frketić ist Texterin, Aktivistin und arbeitet in der Erwachsenenbildung. In Vorträgen und Seminaren beschäftigt sie sich aus kritischen diskursanalytischen Perspektiven mit gesellschaftlichen Ungleichheiten, Diskriminierung, Sprache und Macht. Aktuell arbeitet sie im Bereich Mehrsprachigkeit im Kontext von Migration.
Refugees sind keine Zielgruppe
Fragen, ausgehend vom Umstand, dass Kulturarbeit diskursbildend ist: • Welchen Beitrag leistet die freie Kulturarbeit in der Migrationsdebatte? • Wie kann antirassistische Kulturarbeit geleistet werden, ohne auf die aktuelle Migrationsdebatte einzugehen? • Können z.B. Förderanträge gestellt werden, ohne Teil dieser Debatte zu werden? • Geht es auch ohne ›Migrant‹*? Oder: AntiRa-Arbeit abseits von identitären Zuschreibungen. Neben diesen Fragen sollten im Workshop auch folgende Fragestellungen bearbeitet werden: • Wie wird in der freien Kulturarbeit mit Rassismen innerhalb und außerhalb der eigenen Arbeit umgegangen? • Hat Antirassismusarbeit etwas mit Ressourcenverteilung zu tun? • Nach welchen Kriterien wird Rassismus identifiziert? • Nach welchen Kriterien wird Anti-Rassismus identifiziert?«5 Diesen Zugang auf die Praxis Kultureller Bildung zu übersetzen, würde bedeuten, dass diese sich nicht durch die Adressierung von Zielgruppen, sondern stattdessen über ein klar formuliertes Handlungsziel – die Freiheit von Rassismus – perspektiviert. Dieses Handlungsziel betrifft alle Mitglieder einer Gesellschaft. Für die einen mag es ein Versprechen sein, die Privilegien der anderen mag es bedrohen – klar ist, dass seine Verwirklichung nicht an eine durch mehrheitsgesellschaftliche Zuschreibungen markierte Teilgruppe delegiert werden kann. Aus dieser Perspektive ergeben sich, wie aus den Einzelthemen, die in dem beispielhaft angeführten Workshop von 2011 behandelt werden, abzulesen ist, massive Konsequenzen für die verschiedenen, miteinander verknüpften Ebenen der Praxis, von den hier behandelten Fragen der Adressierung bis hin zu Strategien der Beantragung von Fördermitteln. Eine der wichtigsten Konsequenzen einer antirassistisch ausgerichteten Kulturellen Bildung aber ist die Zunahme von Initiativen, Projekten, Vernetzungsforen und Organisationen, in denen die seitens der Mehrheitsgesellschaft als Problem markierten Gruppen Regie führen. Die meist hohe Prekarität ihrer Arbeitsbedingungen spricht für sich; sie mindert jedoch nicht die transformative Wucht der Unterbrechungsleistung, die sie für den Kulturbetrieb erbringen. Auch wächst der Bestand an Informations- und 5 | www.freirad.at/?p=3644, publiziert am 05.09.2011 (letzter Zugriff 12.06.2016). Absichtlich habe ich hier ein etwas weiter zurückliegendes Beispiel gewählt, um darauf hinzuweisen, dass die Debatten einige Zeit (und noch viel weiter als 2011) zurückreichen, auch wenn sie durch die steigende Zahl von Projekten im Kontext Flucht zur Zeit besonders virulent erscheinen.
71
72
Carmen Mörsch
Bildungsmaterialien, welche einer kommodifizierenden Vorstellung von »Diversität« die Forderung nach Antidiskriminierungshandeln entgegenhalten und die von denen, die sich in der Position von Lehrenden und Zeigenden wähnen, verlangen, »ihre Hausaufgaben zu machen«,6 wie es Gayatri Chakravorty Spivak bereits 1990 einforderte. Solche Beispiele finden sich auch in dem vorliegenden Band, der mithin optimistisch als Symptom für einen Perspektivwechsel im Feld der Kulturellen Bildung gelesen werden könnte. Dennoch: Viele Projekte der Kulturellen Bildung im Kontext Flucht werden weiterhin ausschliesslich von mehrheitsangehörigen Kulturschaffenden gestaltet, welche die Verwendung der Ressourcen, die Inhalte, die Praktiken und die Repräsentationen kontrollieren. Die Förderlogiken drängen institutionelle Akteur_ innen in die Arbeit mit Geflüchteten, die nicht über das geringste Wissen über Antidiskriminierung oder Dekolonisierung verfügen. Die Förderstellen erwarten ein Engagement in diesem Feld, ohne dafür Sorge zu tragen, wie und vor allem unter Beteiligung von wem dieses Wissen aufgebaut werden könnte. Refugees ist darin der Platz von hilfebedürftigen, in dominante Konzepte von Kultur zu integrierenden Anderen zugewiesen. Wenn sie diesen Platz verweigern und andere Forderungen oder Vorstellungen haben – seien diese über westlich-demokratische kommunikative Konventionen (»ich stelle hiermit eine Forderung zur 6 | »I will have in an undergraduate class, let’s say, a young, white, male student, politically-correct, who will say: ›I am only a bourgeois white male, I can’t speak.‹ In that situation – it’s peculiar, because I am in the position of power and their teacher and, on the other hand, I am not a bourgeois white male – I say to them: ›Why not develop a certain degree of rage against the history that has written such an abject script for you that you are silenced?‹ Then you begin to investigate what it is that silences you, rather than take this very deterministic position – since my skin colour is this, since my sex is this, I cannot speak. I call these things, as you know, somewhat derisively, chromatism: basing everything on skin colour – ›I am white, I can’t speak‹ – and genitalism: depending on what genitals you have, you can or cannot speak in certain situations. From this position, then, I say you will of course not speak in the same way about the Third World material, but if you make it your task not only to learn what is going on there through language, through specific programmes of study, but also at the same time through a historical critique of your position as the investigating person, then you will see that you have earned the right to criticize, and you will be heard. When you take the position of not doing your homework – ›I will not criticize because of my accident of birth, the historical accident‹ – that is a much more pernicious position. In one way you take a risk to criticize, of criticizing something which is Other – something which you used to dominate. I say that you have to take a certain risk: to say ›I won’t criticize‹ is salving your conscience, and allowing you not to do any homework. On the other hand, if you criticize having earned the right to do so, then you are indeed taking a risk and you will probably be made welcome, and can hope to be judged with respect.« (Spivak 1990: 62f.)
Refugees sind keine Zielgruppe
Diskussion«) artikuliert oder über andere Formen (»ich komme nicht mehr zum Projekt oder nutze das Projekt für nicht darin vorgesehene Praktiken«) – sind die entsprechenden Projektemacher_innen schnell in einer Krise, und kulturalisierende Zuschreibungen sowie Ausschlüsse brechen sich im Mantel von Ratlosigkeit Bahn. Der größere Teil von Projekten mit migrationsgesellschaftlichem Fokus wiederum wird ebenfalls von Mehrheitsangehörigen vorangetrieben, welche sich über als migrantisch markierte Teilnehmende freuen, aber die Jobs im Kulturbetrieb gerne weiterhin selbst besetzen wollen: Die Forderung »Migrant_innen ins Museum« beispielsweise meint in der Regel nicht das Direktor_innenzimmer. Der Deutsche Museumsbund kann im Jahr 2015 erstaunlicherweise eine fast fünfzigseitige Handreichung für Museen zu Migration und kultureller Vielfalt herausgeben, in dessen Autor_innen- und Redaktionsteam, folgt man der Namensliste, kaum etwas von dieser Vielfalt zu vermuten ist – erst in der Liste der zur Beratung Hinzugezogenen finden sich Spuren der real existierenden gesellschaftlichen Vielfalt (vgl. Deutscher Museumsbund 2015). Auch in der deutschen Kunstpädagogik ist das Thema »Transkulturalität« oder »Kulturelle Vielfalt« in den letzten zehn Jahren von weißen mehrheitsangehörigen Fachleuten entdeckt worden, die sich damit profilieren und akademische und politische Positionen besetzen. Es bleibt also noch viel zu tun. Ich beschließe diesen Text versuchsweise mit der Aufzählung von vier Kriterien, die möglicherweise bei der Planung von Projekten der Kulturellen Bildung im Kontext Flucht helfen können, die den von den Herausgeberinnen formulierten Anspruch einlösen können. 1. »Nothing about us without us«: In den Projekten sind die Refugees die Akteure. Sie kontrollieren die Inhalte, Formen, Ressourcen und Repräsentationen. Das heißt, sie entscheiden auch selbst, ob, wie und von wem sie dargestellt werden. 2. Beteiligte Mehrheitsangehörige und Institutionen arbeiten in den Projekten nachweislich an einer aktiven Umverteilung von Mehrwert und Privilegien. Sie solidarisieren sich öffentlich mit den politischen Anliegen der Refugees. 3. Wissenschaftliche Begleitung oder formative Evaluation unterstützen die Herstellung von Zeit und Raum für eine kritische Reflexion und Bearbeitung der jedes Projekt durchziehenden Machtverhältnisse, wobei diese kritische Reflexion nicht in Lähmung resultiert und dadurch selbst zum Alibi für den Erhalt von Privilegien führt (»Do your homework«). 4. Findet das Projekt in einer Kulturinstitution statt, so trägt es dazu bei (zum Beispiel, indem es dies zur Bedingung macht), dass sich Diversifizierung von Strukturen ereignet, zum Beispiel in der Personalzusammensetzung, der Programmgestaltung oder den Curricula, nicht nur im Werbematerial.
73
74
Carmen Mörsch
L iter atur Castro Varela, Maria del Mar: »Interkulturelle Vielfalt, Wahrnehmung und Reflexion aus psychologischer Sicht.« o.D., S. 3. www.graz.at/cms/dokumente/ 10023890_ 415557/0a7c3e13/Interkulturelle%20Vielfalt,%20Wahrnehmung %20und%20Sellbstreflexion.pdf (letzter Zugriff: 12.06.2016). Deutscher Museumsbund (2015): Museen, Migration und kulturelle Vielfalt. Handreichungen für die Museumsarbeit, Berlin: Deutscher Museumsbund. www.museumsbund.de/fileadmin/geschaefts/dokumente/Leitfaeden_und_ anderes/Leitfaden_KulturelleVielfalt.pdf (letzter Zugriff: 27.06.2016). Mecheril, Paul (2000): Anerkennung des Anderen als Leitperspektive Interkultureller Pädagogik? Perspektiven und Paradoxien, Vortragsmanuskript zum interkulturellen Workshop des IDA-NRW 2000. www.forum-interkultur.net/ uploads/tx_textdb/22.pdf (letzter Zugriff: 12.06.2016). Ribolits, Erich (2011): »Wer bitte ist hier bildungsfern? Warum das Offensichtliche zugleich das Falsche ist«, in: HLZ, Zeitschrift der GEW Hessen, Nr. 9/10, 2011. www.gew-berlin.de/968_1161.php (12.06.2016). Spivak, Gayatri Chakravorty (1990): The Postcolonial Critic: Interviews, Strategies, Dialogues, London: Routledge.
Die Kolonialität der Willkommenskultur Flucht, Migration und die weißen Flecken der Kulturellen Bildung Sandrine Micossé-Aikins und Bahareh Sharifi
Zusammenfassung »Geflüchtete« sind zum neuen Lieblingsthema auch arrivierter Akteur_innen in der Kulturszene geworden. Insbesondere in der Kulturellen Bildung und Kulturvermittlung machen Geflüchtete inzwischen einen großen Teil der Zielgruppe aus. Anders als in Kunstprojekten wie jenen des Zentrums für politische Schönheit sollen sie hier zumeist nicht nur als dekorative Motive dienen, sondern als Akteur_innen auf Augenhöhe selbst kreativ werden. Wie oft jedoch werden Projekte diesen Ansprüchen tatsächlich gerecht, und kann eine Augenhöhe angesichts des extremen Machtgefälles zwischen den überwiegend weißen, bürgerlichen (bezahlten) Initiator_innen und den teilnehmenden Geflüchteten überhaupt hergestellt werden – insbesondere dann, wenn eine Reflexion der zum Tragen kommenden Machtverhältnisse (Rassismus, Klassenprivilegien, unterschiedliche Rollen innerhalb einer kapitalistischen Arbeitsteilung) sowie der Kolonialität deutscher Kulturinstitutionen im Vorfeld ausbleibt? Die Autorinnen möchten mit diesem Text eine Rekontextualisierung des Themas »Flucht und Migration« bzw. »Geflüchtete« anstoßen, mit der sie hoffen, zu einer ganzheitlicheren, nachhaltigeren und dezidiert machtkritischen Diskursführung beizutragen, ohne einen Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben.
Abstract: The Colonial Nature of the Willkommenskultur Flight, Migration and the White Stains of Cultural Education »Refugees« have become the hot new topic, even amongst established figures in the cultural scene. Particularly in cultural education and outreach work, refugees now make up a large portion of their target group. Unlike in art projects such as those by the Center for Political Beauty, they are usually not intended to be included in these as mere decorative motifs, but rather as equals who are also supposed to become creative themselves. But how often do projects actually live up to this claim, and can an equality of agency be produced, given the extreme power difference between the predominantly white, middle class (paid) creators of the projects and the participating refugees – particularly when a reflection on the power relations in effect (racism, class privileges, differing roles within a capitalist division of labor) as well as the colonial nature of German cultural institutions
76
Sandrine Micossé-Aikins und Bahareh Sharifi fails to be foregrounded? With this text, the authors hope to spark a re-contextualization of the topic of »flight and migration« and »refugees«, with which they aim to contribute to a more holistic, long-term discourse which enacts a marked critique of power structures, yet which eschews claims to totality.
»Geflüchtete« sind zum neuen Lieblingsthema auch arrivierter Akteur_innen in der Kulturszene geworden. Menschen mit Fluchterfahrung stehen plötzlich – zum Teil kulissenhaft – auf Bühnen, die ansonsten überwiegend weißen, deutschen Ensembles vorbehalten sind (und vehement als weiße Räume verteidigt werden), sie schmücken dramatische Fotografien in Ausstellungen, sie werden Teil von Projekten an der Schnittstelle von Kunst und Start-Up-Kultur, sie führen durch Museen. Insbesondere in der Kulturellen Bildung und Kulturvermittlung machen Geflüchtete inzwischen einen großen Teil der Zielgruppe aus. Anders als in Kunstprojekten wie jenen des Zentrums für politische Schönheit1 sollen sie hier zumeist nicht nur als dekorative Motive dienen, sondern als Akteur_innen auf Augenhöhe selbst kreativ werden. Wie oft jedoch werden Projekte diesen Ansprüchen tatsächlich gerecht, und kann eine Augenhöhe angesichts des extremen Machtgefälles zwischen den überwiegend weißen, bürgerlichen (bezahlten) Initiator_innen und den teilnehmenden Geflüchteten überhaupt hergestellt werden – insbesondere dann, wenn eine Reflexion der zum Tragen kommenden Machtverhältnisse (Rassismus, Klassenprivilegien, unterschiedliche Rollen innerhalb einer kapitalistischen Arbeitsteilung) sowie der Kolonialität deutscher Kulturinstitutionen im Vorfeld ausbleibt? Das Engagement zivilgesellschaftlicher Akteur_innen hat angesichts der in der Politik herrschenden Überforderung einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, eine Grundversorgung zumindest eines Teils der Geflüchteten zu gewährleisten, die seit 2012 nach Deutschland gekommen sind. Die sogenannte Willkommenskultur, die 2015 kurzzeitig mit Plüschtieren und Teddybären ausgestattete Begrüßungskommitees an die Bahnhöfe trieb, wurde jedoch schnell vom Anstieg rassistischer Angriffe auf Unterkünfte, Menschen of Color und gelegentlich auch Unterstützer_innen von Geflüchteten überschattet. Diese Gewalt ist keine neue Erscheinung. Sie ist Ausdruck des strukturellen und institutionellen Rassismus, der seit langem von Betroffenen markiert, mehrheitsgesellschaftlich jedoch ausgeblendet, verharmlost und negiert wird. Nicht zum ersten Mal bietet eine vermeintliche »Flüchtlingskrise« Politiker_innen eine Grundlage, diese rassistischen Diskurse, Handlungen und Entscheidungen zu legitimieren. Darüber hinaus wird Rassismus erneut als Problem des »rechten« Randes anstatt als gesamtgesellschaftliches, auf Machtverhältnissen und Privilegien beruhendes, historisch gewachsenes Ordnungsprinzip dargestellt, das auch und nicht zuletzt die Kunstwelt durchwirkt.
1 | Vgl. www.politicalbeauty.com/
Die Kolonialität der Willkommenskultur
Das plötzliche Interesse an einem Thema (»Flüchtlinge«), das noch vor wenigen Jahren kaum jemanden als die Betroffenen selbst zu tangieren schien, in einem Kulturbetrieb, der sich seit Jahren größtenteils ebenfalls hartnäckig weigert, sich mit seinen eigenen politischen Strukturen und den daran gekoppelten Ausschlüssen zu beschäftigen, erscheint vor diesem Hintergrund mehr als fragwürdig. Wenig überraschend, aber höchst problematisch, ist dabei die in den meisten Kulturprojekten »mit/von oder für Geflüchtete« weitestgehend ausbleibende sowohl historische als auch politische Kontextualisierung der Themen Flucht und Asyl. Nicht sie, sondern »Geflüchtete« fungieren zumeist als thematische Fokuspunkte, ohne dabei jedoch tatsächlich als Individuen oder gar Träger_innen dekolonialen Wissens und dekolonialer Perspektiven wahrgenommen zu werden. Es stellt sich die Frage, wie gewinnbringend Projekte der Kulturellen Bildung für Geflüchtete sein können, wenn die rassistischen Zugangsbarrieren und das eurozentrische Kunstverständnis deutscher Kulturinstitutionen nicht gleichzeitig aktiv markiert, infrage gestellt und abgebaut werden. Die Autorinnen möchten mit diesem Text daher eine Rekontextualisierung des Themas anstoßen, mit der wir hoffen, zu einer ganzheitlicheren, nachhaltigeren und dezidiert machtkritischen Diskursführung beizutragen, ohne den Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben. Hierzu möchten wir: (1) den selbstorganisierten und langjährigen Widerstand von Refugee-Aktivist_innen und seine fehlende Sichtbarkeit und Berücksichtigung in vielen Kultur- sowie anderen Hilfsprojekten thematisieren und (2) den strukturellen und institutionellen Rassismus, der eine Mehr-Klassen-Gesellschaft wie die deutsche und eine »Flüchtlingskrise« überhaupt erst ermöglicht, in seiner Relevanz für die Arbeit mit Geflüchteten im Kunstfeld markieren. Anhand des Beispiels des Projektes »Multaka: Treffpunkt Museum – Geflüchtete als Guides in Berliner Museen« zeigen wir auf (3), wie die fehlende Auseinandersetzung des deutschsprachigen Kulturbetriebs mit seiner Kolonialgeschichte und ihren Kontinuitäten potentiell ermächtigende Prozesse untergräbt.
1. Refugee-Aktivismus in Deutschland und Europa als potentieller Ansatzpunkt für solidarische Kulturprojekte Ohne Frage können Kunst und Kulturelle Bildung als Motor nachhaltigen gesellschaftlichen Wandels wirken. Zahlreiche Projekte wie das Jugendtheaterbüro Berlin,2 der Verein maiz aus Linz,3 Label Noir 4 oder das Theater RambaZamba5 haben gezeigt, wie über die Vermittlung sowie Stärkung künstlerischer und 2 | Vgl. www.grenzen-los.eu/jugendtheaterbuero/ 3 | Vgl. www.maiz.at/ 4 | Vgl. www.labelnoir.net/ 5 | Vgl. www.theater-rambazamba.org/
77
78
Sandrine Micossé-Aikins und Bahareh Sharifi
ästhetischer Fähigkeiten Zugänge, Sichtbarkeit und Aufwärts-Mobilität für gesellschaftlich marginalisierte Personen hergestellt werden kann. Der Erfolg dieser Projekte beruht jedoch – neben der maßgeblichen Beteiligung von Betroffenen als Initiator_innen und Träger_innen der Projekte – auf einem grundlegenden und kritischen Verständnis der gesellschaftlichen Machtverhältnisse, die die Marginalisierung bedingen, sowie einer Berücksichtigung des Wissensarchives, das aus den jeweiligen Marginalisierungserfahrungen hervorgeht. Diese Grundsätze finden sich auch in den 2015 von der australischen Selbstorganisation Rise6 herausgegebenen Guidelines zur künstlerischen Arbeit mit Geflüchteten (Canas 2015). Insbesondere die Forderung nach einer positionierten, solidarischen, nicht »neutralen« künstlerischen Praxis trifft aber nur auf einen sehr kleinen Teil der existierenden Projekte zu. Geflüchtete stehen in Deutschland nicht erst seit 2015 für ihre Rechte ein. In ihrem langjährigen und hochpolitischen Widerstand haben Refugee-Aktivist_innen immer wieder auf die größeren historischen und geopolitischen Zusammenhänge verwiesen, die Flucht und unfreiwillige Migration, aber auch Ungleichheiten in der internationalen Bewegungsfreiheit bedingen und die insbesondere die Rolle Europas und Deutschlands für die Beförderung von Krisen in ihren Herkunftsländern und die rassistische Diskriminierung im (europäischen/deutschen) Exil beleuchten (vgl. z.B. Langa 2015). Darüber hinaus zeichnen sich die Bewegungen durch klare politische Forderungen aus, die die Verbesserung der Lebenssituation von Geflüchteten in Deutschland und die rechtliche Verankerung ihrer Gleichstellung und des Rechts auf Asyl zum Ziel haben. Eine solche Form des Widerstandes erfordert die Benennung von Ursachen und Adressat_innen, die zur Durchsetzung der Forderungen bevollmächtigt sind. Sie zielt auf längerfristige strukturelle und institutionelle Veränderungen ab, die ein stärkeres Gleichgewicht zwischen Privilegierten und Diskriminierten herstellen soll. Diese weitestgehend selbstorganisierten Bewegungen, ihre Forderungen und Inhalte, selbst jene der Jahre seit 2012, die endlich auch das Bewusstsein der Mehrheitsgesellschaft und die Mainstreampresse erreichten, erscheinen in den Diskursen, die in der Kulturellen Bildung geführt werden, als randständig oder fehlen gänzlich als Referenzen. Der Marsch der Geflüchteten nach Berlin, die Besetzung und Zerschlagung des Oranienplatzes, die Besetzung und versuchte gewaltsame Räumung der ehemaligen Gerhard-Hauptmann-Schule in der Ohlauer Straße und somit auch die dabei im Vordergrund stehenden Forderungen scheinen mit der Zunahmen von Hilfsprojekten sogar weniger sichtbar zu werden. Selbstverständlich kann die Aufgabe von Projekten der Kulturellen Bildung – insbesondere dann, wenn sie von ausschließlich »weißen« Teams ohne eigenen Fluchtbezug geleitet werden – nicht darin liegen, sich diese Themen anzueignen oder gar geflüchtete Teilnehmer_innen dazu zu drängen, sich politisch damit auseinanderzusetzen. Eine Reduktion von Teilnehmer_innen auf ihre 6 | Vgl. http://riserefugee.org/
Die Kolonialität der Willkommenskultur
Fluchtgeschichte kann aber eben gerade nur dann vermieden werden, wenn die eigene (zumeist privilegierte) Position und das damit einhergehende Weltverständnis eingehend hinterfragt und praktische Konsequenzen daraus gezogen werden. Kulturinstitutionen, insbesondere solche der Kulturellen Bildung, die mit Geflüchteten aktiv werden möchten, haben zunächst die Aufgabe, die Arbeit von selbstorganisierten Geflüchtetenbewegungen zu kennen, zu würdigen und sich dazu zu positionieren. In welchem Verhältnis steht beispielsweise das Engagement, Geflüchteten künstlerische Praktiken zu vermitteln oder ihnen Raum und Ressourcen für kreatives Arbeiten zu verschaffen, zu den immer stärkeren Verschärfungen der Asylgesetzgebung, die gleichzeitig und weitestgehend ohne auf Widerstand zu treffen im Hintergrund beschlossen werden? Welchen Nutzen haben Kulturprojekte, die einzelnen Geflüchteten vorübergehend Raum für Kreativität, eine Ausbildung oder Unterkunft bieten, langfristig, wenn nicht gleichzeitig ein (antirassistisches) Engagement auf der politischen Ebene stattfindet, das die Chancen auf ein Bleiberecht erhöht und ihrer strukturellen und institutionellen Diskriminierung als von Rassismus Betroffenen entgegenwirkt? An welcher Stelle werden Kulturangebote zum sprichwörtlichen Kuchen für Verhungernde?
2. Who knows tomorrow? Von der Krisenbewältigung zur nachhaltigen Strukturreform? Trotz der steigenden Zahl jener Kulturprojekte und -institutionen, die sich Geflüchteter annehmen, ändert sich wenig an den Strukturen innerhalb der Häuser oder der Kulturpolitik. Die Umschiffung (alltags-)rassimuskritischer Diskurse führt zu einer Darstellung, in der Geflüchtete als »Andere« auf eine als mehrheitlich »weiß« imaginierte deutsche Gesellschaft treffen, in der es »anzukommen« gilt. Wenn nicht im schlimmsten Falle ein »Integrationsanspruch« an die Geflüchteten gestellt wird, so wird davon ausgegangen, dass es hier zentral um zwei Gruppen geht, die wenig oder kaum Kenntnisse über die kulturellen Hintergründe des Gegenübers haben und diese kennen und »tolerieren« lernen müssen. Tatsächlich gibt es jedoch in Deutschland diverse diasporische Gemeinschaften – von Menschen, die bereits vor Jahren auch aus den gegenwärtigen Krisenregionen nach Deutschland geflüchtet oder aus anderen Gründen migriert sind sowie ihrer Kinder – die genau diese Ankommensprozesse mit all ihren (zum großen Teil durch die Gesellschaft kreierten) Hürden bereits durchlaufen haben. Diese Menschen verfügen aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung über ein Doppelbewusstsein – einen gelebten Alltagsbezug zu den vermeintlich neuen oder fremden Kulturen sowie eine Kenntnis der Strukturen, mit denen sich von Rassismus betroffene Menschen bei ihrer Ankunft in Deutschland und danach konfrontiert sehen. Diese Expertise könnte eine wichtige Brückenfunktion nicht nur, aber auch in der Kulturellen Bildung übernehmen, weil sie eben nicht von den Perspektiven »weißer« deutscher Helfer_innen/Projektleiter_innen ausgeht – und somit auch von einem eurozentrischen Kunst- und Weltverständnis
79
80
Sandrine Micossé-Aikins und Bahareh Sharifi
–, sondern von denjenigen derer, die »ankommen« sollen (und vielleicht auch möchten). In diesen diasporischen Communities befinden sich Kulturschaffende, Psycholog_innen und Pädagog_innen, die jedoch aufgrund der machtbedingten Ausschlüsse in den wenigsten Kulturinstitutionen zu finden sind. Es liegt an den Institutionen, diesen Fehler zu beheben und sich einer anti-rassistischen (nicht inter-kulturellen), anti-ableistischen und anti-klassistischen Öffnung auf allen Ebenen zu unterziehen, die marginalisierten Personen auch jenseits ihres Geflüchteten-Status dauerhafte Zugänge ermöglicht. Welche Optionen haben z.B. Kinder und Jugendliche of Color bzw. mit Fluchtgeschichte, die sich nach der Inspiration durch ein Projekt der Kulturellen Bildung für einen künstlerischen Werdegang entscheiden? Wo oder wie sollen diese Menschen als Künstler_innen – nicht als Geflüchtete – arbeiten und Geld verdienen? Gerade so vielversprechende Projekte wie der Grundlagenkurs der Kunsthochschule Weißensee, die das Potential haben, für einzelne Geflüchtete nachhaltige und individuelle ermächtigende Unterstützung zu generieren, müssen auch in den größeren Kontext jener gesellschaftlichen Mechanismen gestellt werden, denen die Geflüchteten begegnen werden, wenn sie eines Tages ein dauerhaftes Bleiberecht erlangen sollten. Dazu gehört die bisher nicht gegebene Gewährleistung gleichberechtigter Zugänge zu Arbeitsplätzen und Förderprogrammen in Kunst und Kultur (vgl. z.B. Vielfalt Entscheidet 2015), aber auch zu Kunsthochschulen (vgl. Saner/Seefranz 2012). Letztlich bedeutet eine konsequente Öffnung auch die Notwendigkeit zur Beschäftigung mit rassismus- und kolonialismuskritischen Perspektiven auf deutsche und europäische Kunstgeschichte, künstlerisch-kulturelle Praxen und Kunstverständnisse.
3. »This belongs to Iraq« – Vom Kolonialismus im Kasten zu Multaka: Treffpunkt Museum Ein Beispiel, bei dem sich die Frage nach der Intention des Programms besonders dringlich stellt, ist das Pilotprojekt »Multaka: Treffpunkt Museum«. In diesem führen nach einem Fortbildungstraining seit Dezember 2015 rund 19 Guides durch die Berliner Museumsinsel der Staatlichen Museen zu Berlin (SMB) und des Deutschen Historischen Museums (DHM). Sie alle haben eine kürzlich zurückliegende Fluchtgeschichte gemeinsam. In ihrer jeweiligen Herkunftssprache führen sie Besucher_innengruppen, überwiegend ebenfalls Asylsuchende, durch die Museen. Auf der Webseite der SMB heißt es dazu: »Dem Museum für Islamische Kunst, dem Vorderasiatischen Museum, der Skulpturensammlung und Museum für Byzantinische Kunst sowie dem Deutschen Historischen Museum geht es um eine große kulturhistorische und epochenübergreifende Erzählung, die die Chance bietet, Verbindungslinien zwischen den Herkunftsländern der Geflüch-
Die Kolonialität der Willkommenskultur
teten und dem Aufnahmeland zu finden. Die Museen wollen den Flüchtlingen helfen, soziale und kulturelle Anknüpfungspunkte zu finden, um in Deutschland ankommen zu können.« (Staatliche Museen zu Berlin, 10.12.2015). Die Ausrichtung des Projekts ist dabei einseitig und adressiert die Guides als Lernende. Dabei geht es weniger um einen (macht-)kritischen Dialog, bei dem die Guides mitgestalten und ihr außereuropäisches und damit dekoloniales Wissen in die Museumsgestaltung und -vermittlung einfließen lassen können. Sie werden vielmehr vornehmlich als Integrationsmultiplikator_innen imaginiert, die anderen geflüchteten Menschen die europäische Lesart historischer Entwicklungen weitervermitteln sollen. Auch aufgrund dieser konzeptuellen Setzung wird »Multaka« zu einem Beispiel dafür, wie langfristig unberücksichtigte Leerstellen und die konsequente historische und politische Entkontextualisierung der Themen Flucht und Migration problematische Spannungsfelder entstehen lassen. Zwei Jahre vor dem Pilotprojekt hatte der irakische Student Zeidoun Alkinani auf eben jene vermeintliche »Verbindungslinie« verwiesen, als er vor dem Ischtar Tor mit einem Schild posierte auf dem stand: »This belongs to Iraq«.7 Das Bild verbreitete sich rasant in den sozialen Medien und stellte unweigerlich den Zusammenhang zu Forderungen her, die bereits zehn Jahre zuvor der Irakische Staat auf offiziellem Wege formuliert hatte (MacAskill 2002). Anfang des 20. Jahrhunderts hatten deutsche Archäolog_innen bei der Suche nach dem antiken Babylon das Ischtar Tor ausgegraben. Um das Tor zur Rekonstruktion nach Berlin zu bringen, trafen die damals noch so genannten »Königlichen Museen zu Berlin« ein Abkommen mit dem Osmanischen Reich, unter dessen kolonialer Vorherrschaft der heutige Staat Irak stand. In den späten 1920er Jahren konnten die Berliner Museen mit dem neu gegründeten Irakmuseum erwirken, dass auch die restlichen Funde zur Vervollständigung nach Berlin verschifft wurden. Zu diesem Zeitpunkt unterstand das damalige Königreich Irak der britischen Kolonialherrschaft. Auch wenn das Deutsche Kaiserreich selbst keine eigenen Kolonien in der Region hatte, agierte und profitierte es von den unterschiedlichen Kolonialstaaten, mit denen es in den verschiedenen Epochen zusammenarbeitete. Diese kolonialen Verflechtungen werden von den SMB bei der Thematisierung der Erwerbsgeschichte der Objekte weitestgehend ausgeblendet. Für Geflüchtete und Migrant_innen aus den entsprechenden Regionen hingegen hängt die eigene Migrationsgeschichte zumeist mit der kolonialen Vorgeschichte ihrer Heimatländer zusammen. Diese bleibt somit auch beim Museumsbesuch vordergründig. »The first question we usually get asked is: how did all this end up in Germany?«, said guide Razan Nassreddine, a cultural curator from Damascus who arrived in Germany four years 7 | Vgl. den Facebook-Post des Ajam Media Collective vom 05.12.2013 https://www.face book.com/AjamMediaCollective/photos/a.353759758026997.76607.2242007409829 00/551259288277042/?type=1&theater (letzter Zugriff: 28.06.2016).
81
82
Sandrine Micossé-Aikins und Bahareh Sharifi ago. Sometimes the answer can produce awkward moments, such as with the Pergamon Museum’s most famous display, the Ishtar Gate. Since the Babylonian gate was reconstructed in Germany with original bricks in the 1930s, Iraq has repeatedly called for its return.« (Oltermann 2016)
Koloniale Kontinuitäten und ihre Bedeutung für die Nachfahren der Kolonisierten wird nicht selten im Rahmen dominanter Umdeutungspraktiken unsichtbar gemacht. Dies zeigt sich z.B. anhand des Ausdrucks der »shared heritage«, der im Sommer 2015 von den SMB als Grundposition im Umgang mit außereuropäischen Sammlungen eingeführt wurde (Staatliche Museen zu Berlin 2015b). Damit werden nicht nur die damaligen gewaltvollen Herrschaftsverhältnisse verschleiert, sondern auch eine gleichberechtigte Aushandlungsbasis suggeriert, auf der die Herkunftsregionen angeblich über den Verbleib der jeweiligen Objekte mitentscheiden können. In vielen Fällen jedoch befinden sich außereuropäische Länder aufgrund der weiterhin vorherrschenden ökonomischen und politischen Abhängigkeitsverhältnisse gar nicht in der Position, Restitutionsforderungen zu stellen. Somit liegt die Entscheidung über die Aufarbeitung der Erwerbsgeschichte faktisch weiterhin bei der SMB. Vorausgegangen war der Einführung des Begriffes »shared heritage« eine jahrelange Kritik an den SMB, insbesondere hinsichtlich der Pläne um das »Berliner Schloss – Humboldt Forum«. Mit diesem Vorhaben sollen die »außereuropäischen Sammlungen« in einer an die Wilhelminische Epoche angelehnten Rekonstruktion der kaiserlichen Residenz des Berliner Stadtschlosses ausgestellt werden. Federführend wurde diese Kritik von der Initiative »No Humboldt 21!« formuliert, die deutlich machte, dass die mangelnde Aufarbeitung der Objektgeschichte sich auch darin begründet, dass sie in vielen Fällen eine Rückführung in die Ursprungsländer zur Folge haben würde. In ihrer von zumeist migrantisch-diasporischen Selbstorganisationen unterzeichneten Resolution rückte die Initiative damit folgenden zentralen Aspekt in den Mittelpunkt ihrer Kritik: »Das vorliegende Konzept verletzt die Würde und die Eigentumsrechte von Menschen in allen Teilen der Welt, ist eurozentrisch und restaurativ. Das Humboldt Forum steht dem Anspruch eines gleichberechtigten Zusammenlebens in der Migrationsgesellschaft entgegen« (N0 Humboldt 21! 2013). Auf die Kritik wurde von Seiten der SMB kaum eingegangen, man entzog sich einer machtkritischen Auseinandersetzung, wie u.a. an zahlreichen Absagen von Dialogveranstaltungen mit »No Humboldt 21!« deutlich wurde (No Humboldt 21! 2014). An kaum einer Stelle der Konzeption und Durchführung des Projektes Humboldt Forum sind bisher Kurator_innen oder Wissenschafter_innen of Color beschäftigt gewesen, die aus postkolonialer Perspektive macht- und herrschaftskritische Fragestellungen formulieren könnten. Auch deshalb kann die dringend notwendige Perspektivumkehr beziehungsweise tiefergehende Auseinanderset-
Die Kolonialität der Willkommenskultur
zung mit den weißen Flecken klassischer deutscher Museumskonzepte nicht stattfinden. Dabei hatte die Initiative »Kolonialismus im Kasten?« bereits einige Jahre zuvor sehr eindrücklich gezeigt, wie die Sichtbarmachung von Leerstellen in der dominanten deutschen Geschichtsschreibung funktionieren kann.8 Die vielversprechende Darstellung von »Multaka« als »eine Chance […], neue Wege von Verständigung und Akzeptanz in einer heterogenen und ethnisch vielfältigen Gesellschaft zu gehen« (Staatliche Museen zu Berlin 2015), kann nur Erfüllung finden, wenn zum einen sowohl die bereits existierenden, kolonialismuskritischen, diasporischen Diskurse als auch die Perspektiven der Geflüchteten berücksichtigt werden und zum anderen Menschen aus den Ursprungskontexten der Objekte auch als Ausstellungsgestalter_innen und Wissenschaftler_innen einbezogen werden. Solange sich jedoch die Museen einer grundsätzlichen Auseinandersetzung mit ihrer eigenen Kolonialgeschichte entziehen, wird auch »Multaka« lediglich ein weiterer von vielen »derailing«9 -Ansätzen bleiben müssen. Die Kuratorin Ariella Azoulay beschreibt treffend: »The artifacts preserved in European museums are not just exemplary masterpieces but also mummies of imperial violence that should be transformed. […] The Right To Live Where One’s Culture Was Museified. The right to have rights to one’s objects. Only by introducing such rights can phenomena like the hiring of refugees as guides in museums that archive and present artifacts plundered from their homelands be not just another way to exploit people, but a way to ›excavate the wound‹ (Saidiya Hartman) of imperial crimes and respond to the plea of people who, in the one world created by imperialism, have the right to a place within living communities created with and around shared objects and not in their outskirts.« (Azoulay 2016)
4. »We are Here because You were There« – Fazit Menschen mit Flucht- und Menschen mit Rassismuserfahrungen sollten auch in Kulturprojekten nicht nur als Statist_innen, sondern Autor_innen, Dramaturg_ innen und Editor_innen ihrer eigenen Geschichten, Gestalter_innen ihrer eigenen Lern- und Empowermentprogramme sein dürfen. Hierfür bedarf es vor allem auch eines möglichst direkten Zugangs zu den Ressourcen der Institutionen, der Räume und der Zeit für die Entwicklung und Umsetzung eigener Projekte und Themen, die nicht von anderen gesetzt und durch dominante Perspektiven vorbestimmt werden.
8 | Vgl. www.kolonialismusimkasten.de/ 9 | Mit dem Begriff »derailing« wird im anglo-amerikanischen Raum die Methode bezeichnet, von einem Thema abzulenken, indem ein anderes eingeführt wird.
83
84
Sandrine Micossé-Aikins und Bahareh Sharifi
In der Kulturellen Bildung kann darüber hinaus erst dann ein respektvoller Umgang mit Geflüchteten und anderen Menschen of Color als Zielgruppe stattfinden, wenn darüber hinaus Flucht und Migration auch als Resultate historischer und gegenwärtiger globaler Machtbeziehungen zwischen Europa und dem Rest der Welt begriffen werden. Die in diesem Zusammenhang häufige Verwendung von in der Regel nicht machtkritischen Begriffen, wie »interkulturelle Öffnung«, »Toleranz« und »Integration«, und die Vermeidung von Termini wie »Rassismus« und »Kolonialismus« machen deutlich, dass es einer Diskursentwicklung des Feldes bedarf, die es ihm erlaubt, seinen eignen Ansprüchen von Partizipation und Teilhabe gerecht zu werden. Nicht zuletzt profitiert auch die Mehrheitsgesellschaft von einem Perspektivwechsel, der ihr einen ganzheitlicheren Zugang zur eigenen Geschichte und den sich daraus konstituierenden (auch kulturellen) Identitäten eröffnen kann. Wie es im Sinne anti-rassistischer Kämpfe heißt: »We are here because you were there«.
L iter atur Azoulay, Ariella (2016): »The right to live where one’s culture was musified«, Verso Books, Blog vom 10.03.2016. www.versobooks.com/blogs/2551-the-right-tolive-where-one-s-culture-was-museified (letzter Zugriff: 28.06.2016). Canas, Tania (2015): Some points to consider if you’re an artist who wants to make work about refugees – Frontpage – e-flux conversations. http://conversations.ef lux.com/t/some-points-to-consider-if-youre-an-artist-who-wants-to-makework-about-refugees/2716 (letzter Zugriff: 28.06.2016). Langa, Napuli (2015): About the Refugee movement in Kreuzberg. http://move ments-journal.org/issues/02.kaempfe/08.langa--refugee-movement-kreuz berg-berlin.html (letzter Zugriff: 28.06.2016). MacAskill, Ewen (2002): »Iraq appeals to Berlin for return of Babylon Gate«, in: The Guardian vom 04.05.2002, London: Guardian News and Media Ltd. www.theguardian.com/world/2002/may/04/iraq.babylon (letzter Zugriff: 28.06. 2016). No Humboldt 21! (2013): Resolution, Berlin: 03.06.2013. www.no-humboldt21.de/ resolution/ (letzter Zugriff: 28.06.2016). No Humboldt 21! (2014): Deutschland muss menschliche Gebeine und Kriegsbeute aus Kamerun, Togo, Tansania und Ruanda zurückgeben, Berlin: Pressemitteilung 17. Dezember 2014. http://www.no-humboldt21.de/deutschland-mussmenschliche-gebeine-und-kriegsbeute-aus-kamerun-togo-tansania-und-ruan da-zurueckgeben/ (letzter Zugriff: 28.06.2016). Oltermann, Philip (2016): Berlin museums’ refugee guides scheme fosters meeting of minds, in: The Guardian vom 27.02.2016, London: Guardian News and
Die Kolonialität der Willkommenskultur
Media Ltd. www.theguardian.com/world/2016/feb/27/berlin-museums-refu gee-guides-scheme-fosters-meeting-of-minds (letzter Zugriff: 28.06.2016). Saner, Philippe/Seefranz, Catrin (2012): Making Differences: Schweizer Kunsthochschulen. Zürcher Hochschule der Künste, Zürich. Staatlichen Museen zu Berlin (2015): Geflüchtete als Guides auf der Berliner Museumsinsel Staatliche Museen zu Berlin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und Deutsches Historisches Museum starten Pilotprojekt »Multaka: Treffpunkt Museum«, Berlin: Pressemitteilung 10.12.2015 https://www. preussischer-kulturbesitz.de/pressemitteilung/news/2015/12/10/gefluechteteals-guides-auf-der-berliner-museumsinsel-staatliche-museen-zu-berlin-der-stif tung-preussischer-kulturbesitz-und-deutsches-historisches-museum-startenpilotprojekt-multaka-treffpunkt-museum.html (letzter Zugriff: 28.06.2016). Staatlichen Museen zu Berlin (2015b): Stiftung Preußischer Kulturbesitz legt Grundpositionen zum Umgang mit außereuropäischen Sammlungen vor/Parzinger: Neue Präsentation im Sinne von shared heritage, Berlin: Pressemitteilung 09.06.2015 https://www.preussischer-kulturbesitz.de/pressemitteilung/ news/2015/06/09/stiftung-preussischer-kulturbesitz-legt-grundpositionenzum-umgang-mit-aussereuropaeischen-sammlungen-vor-parzinger-neuepraesentation-im-sinne-von-shared-heritage.html (letzter Zugriff: 28.06.2016).
85
Zur Bedeutung von Kulturarbeit für Geflüchtete Erfahrungen aus dem Libanon und Überlegungen zum deutschen Kontext Leila Mousa
Zusammenfassung Welche Bedeutung haben Kulturelle Bildung und Kulturprojekte für geflüchtete Menschen, aber auch für die Aufnahmegesellschaft? Was kann Kulturarbeit in einem Kontext von Flucht und Verlust, unter prekären Lebensbedingungen, in einer Situation begrenzter Perspektiven und bei einem schwierigen Verhältnis zur Aufnahmegesellschaft für Flüchtlingsgemeinschaften leisten? Auf der Grundlage einer Studie zu Kulturarbeit mit Flüchtlingen im Libanon von 2015 geht der vorliegende Beitrag der Frage nach, welche Erfahrungen aus dem Libanon auf Kulturarbeit mit Geflüchteten in Deutschland übertragen werden können. Anhand von konkreten Projekten und Diskussionen zu Kulturarbeit zeigt die Studie das Feld der Kulturaktivitäten auf, bietet darüber hinaus aber auch einen Einblick in kritische Debatten zu verschiedenen Formaten. Insbesondere macht sie deutlich, dass Kulturakteure den Kontext gut kennen sollten, in dem sie aktiv werden wollen, um sich angemessen einzubringen. Mit einem Blick auf die spezifischen Bedingungen in Deutschland – die kulturelle Vielfalt unter den Geflüchteten, die oft räumliche Isolierung von großen Flüchtlingsgruppen, die gestiegenen Zahlen und damit verbundenen Ängsten – bietet der Beitrag anschließend einige Überlegungen zu Kulturarbeit mit Flüchtlingen in Deutschland an, die Anstoß für weitere Debatten und Reflexion geben sollen.
Abstract: On the Significance of Cultural Work for Refugees Experiences from Lebanon and Considerations for the German Context What significance do cultural education and projects have both for refugees and for the society which takes them in? What can cultural work achieve for refugee communities in a context of forced migration and loss, under precarious living conditions, with limited prospects and a difficult relationship to the host society? Based on a 2015 study on cultural work with refugees in Lebanon, this paper explores the question of which experiences from Lebanon can be transferred to cultural work with refugees in Germany. With reference to specific projects and discussions about cultural work, the study provides a portrait of the field of cultural activities, as well as offering an insight into critical debates about various
88
Leila Mousa approaches. In particular, it makes clear that it is important for stakeholders in the cultural sector to have a good knowledge of the context in which they want to become active, in order to engage with it appropriately. Taking a look at the specific conditions in Germany – the cultural diversity of the refugees, the often geographical isolation of large groups of refugees, the increased figures and the fears associated with this – the paper goes on to present a number of considerations on cultural work with refugees in Germany, which aim to initiate further debates and reflections.
S inn und Z weck von K ultur arbeit für G eflüchte te Die Migrationsbewegung nach Europa hat im Zuge der Syrienkrise an Umfang und Sichtbarkeit stark zugenommen. Die Hauptlast der syrischen Flüchtlingskrise tragen aktuell die syrischen Anrainerstaaten Türkei, der Libanon und Jordanien. Dort leben die Flüchtlinge teilweise unter extrem schwierigen Bedingungen, ohne Perspektiven und ohne Aussicht auf eine schnelle Lösung des Konflikts. Im Libanon beispielsweise leben aktuell circa 6 Millionen Menschen, von denen etwa 1,5 Millionen Flüchtlinge sind. Damit ist der Libanon weltweit das Aufnahmeland mit der größten Flüchtlingsbevölkerung im Verhältnis zur eigenen Bevölkerung (vgl. Schmelter 2015: 10). Kultureller Ausdruck und kulturelle Teilhabe sind ein menschliches Grundbedürfnis und Menschenrecht. Was kann Kulturarbeit in dieser Situation leisten? Im Libanon, aber auch in Deutschland? Welche Bedeutung haben Kulturelle Bildung und Kulturprojekte für geflüchtete Menschen? Welche Rolle Kulturarbeit für Geflüchtete, aber auch für die aufnehmende Gesellschaft spielen kann, war Gegenstand meiner Studie im Rahmen des ifaForschungsprogrammes1 »Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik« (vgl. Mousa 2015)2 . Für die Studie wurden anhand der syrischen und palästinensischen Flüchtlingsgemeinschaften im Libanon, die beide an sehr unterschiedlichen Punkten ihres Flüchtlingsdaseins stehen, die bestehenden Formate im Bereich der Kulturarbeit aufgezeigt sowie die dazu bestehenden Debatten innerhalb der jeweiligen Gemeinschaften dargestellt. Der vorliegende Beitrag geht der Frage nach, welche Erkenntnisse aus der Studie zu Projekten und Erfahrungen im Libanon auf die Kulturarbeit mit Flüchtlingen in Deutschland übertragen werden können. Hierfür wird zunächst (1) – basierend auf den Ergebnissen der Studie – die Situation der Kulturarbeit mit Flüchtlingen im Libanon dargestellt. Im Anschluss werden (2) Überlegungen zu 1 | Vgl. www.ifa.de/kultur-und-aussenpolitik/forschung-und-dialog/forschungsprogramm. html 2 | Die Studie wurde durch das ifa in Stuttgart sowie das BICC in Bonn begleitet. Die Ergebnisse basieren neben zahlreichen Interviews mit Kulturakteuren und humanitären Akteuren im Libanon auf zwei Workshops am Orient Institut in Beirut und am BICC in Bonn.
Zur Bedeutung von Kulturarbeit für Geflüchtete
Kulturarbeit mit Flüchtlingen in Deutschland formuliert, die Anstöße für weitere Debatten und Reflexion geben sollen.
1. Kulturarbeit im Libanon Was kann Kulturarbeit in einem Kontext von Flucht und Verlust, unter prekären Lebensbedingungen und in einer Situation der Perspektivlosigkeit sowie bei einem schwierigen Verhältnis zur Aufnahmegesellschaft für Flüchtlingsgemeinschaften leisten? Welche Formate der Kulturarbeit werden dabei von den Flüchtlingsgemeinschaften eher kritisch gesehen? Kulturarbeit schafft in Flüchtlingsgemeinschaften Raum für kulturelle Teilhabe und Ausdruck. Flüchtlinge haben über Kulturarbeit die Möglichkeit, sich auszudrücken sowie an der Gesellschaft, in der sie nicht wirklich die Möglichkeit haben, sich zu entwickeln, teilzuhaben. Kulturarbeit kann Möglichkeiten anbieten, sich auszudrücken, Bedürfnisse und Kritik zu äußern, Lebensbedingungen zu thematisieren. Kulturarbeit kann wichtige Referenzen zu Herkunft und Identität bereitstellen. Kulturarbeit bietet Ablenkung, Beschäftigung und Erholungsräume an. Nicht zuletzt eröffnen Kunst und kulturelle Aktivitäten einen Raum für Dialog und Begegnung unter den Flüchtlingen sowie mit der Aufnahmegesellschaft. In Anlehnung an derartige Überlegungen sowie anhand existierender Formate bietet die Studie eine Unterteilung von Kulturarbeit in drei Bereiche an: 1. Kultur als »Kunst, der Kunst wegen«. Kunst als Produktion von Kunst, Künstlerförderung und Grundlagenvermittlung, aber auch als potentiell politische Ausdrucksform, 2. Kulturarbeit als Erhalt der eigenen Kultur und zur Auseinandersetzung mit Erinnerung, Geschichte, Identität, 3. Kunst und Kultur als Instrument, also Sport wie auch künstlerische Aktivitäten (Musik, Theater etc.) als Freizeitbeschäftigung oder »Cultural Relief«, als Beitrag zu Bildung, Trauma- oder Dialogarbeit. Kunst und kulturelle Aktivitäten bieten hier lediglich den Zugang.3 3 | Für Kulturschaffende im Libanon handelt es sich hier oftmals nicht um Kulturprojekte oder Kulturarbeit. »Wenn es um kulturelle Aktivitäten als Mittel geht, um Leid zu lindern, Freiräume und Unterhaltung anzubieten, gehen die Vorstellungen der Akteure vor Ort auseinander. Ein Teil besteht dabei auf eine gewisse Kontinuität der Projekte und künstlerische Qualität von Produktionen, die in Projekten mit Flüchtlingen produziert werden. […] Der andere Teil findet die Qualität der kulturellen Produktionen zweitrangig und versteht Kunst als einen Zugang für andere Belange« (Mousa 2015: 9). Es gibt dabei zahlreiche Projekte, die nicht eindeutig einem der o.g. drei Bereiche von Kulturarbeit zuzuordnen sind. Grundsätzlich spielt in der Einschätzung also der Anspruch an Nachhaltigkeit und Qualität eine wichtige Rolle. Das liegt daran, dass es eine Vielzahl von sich stark ähnelnden Projekten gibt, die zeitlich sehr begrenzt ablaufen und möglichst viele Personen erreichen sollen. So
89
90
Leila Mousa
Im Libanon gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Formate, die im weitesten Sinne dem Bereich der Kulturarbeit sowie Kultureller Bildung von, mit und für Flüchtlinge zugerechnet werden können und diese drei Bereiche »bunt bespielen«. Die Grenzen verschwimmen dabei jedoch, da sich viele Projekte unterschiedlichen Kategorien zuordnen lassen. Kulturelle Aktivitäten reichen von Unterhaltungsangeboten wie Malen und Sport über Theatergruppen, über Projekte, in denen Flüchtlingskinder ihre Lebenswelt fotografieren, kunsttherapeutische Maßnahmen, folkloristische Tätigkeiten, so z.B. traditionelle Tänze, story-telling (alte Männer, die Geschichten erzählen), Alphabetisierungsprojekte, Anfertigung von Büchern und Filmen mit dokumentarischem Charakter, Multimedia-Trainings, mobiles Kino oder mobile Musikschulen und vieles mehr. Dahinter stehen die unterschiedlichsten Akteure: Einige Aktivitäten werden von Kulturakteuren finanziert oder durchgeführt, andere wiederum werden durch das humanitäre Regime, d.h. eine Vielzahl lokaler und internationaler Organisationen, bereitgestellt. Zudem gibt es in den Flüchtlingsgemeinschaften auch selbst-organisierte Aktivitäten.
1.1 Kontext Libanon Folgt man den offiziellen Quellen, sind seit Beginn der Syrienkrise 2011 etwa eine Million Syrer_innen und rund 42.000 syrische Palästinenser_innen in den Libanon geflohen, wo bereits ca. 280.000 palästinensische Flüchtlinge in der vierten Generation lebten.4 Vor allem der schnelle Anstieg der Flüchtlingszahlen seit 2013 hatte enorme sozioökonomische Auswirkungen auf das politisch ohnehin instabile Land. Damit hat sich auch das Verhältnis zwischen Libanes_innen und den aus Syrien kommenden Flüchtlingen sehr verschlechtert. Die libanesische Regierung hat 2015 darauf mit einer sehr restriktiven Politik geantwortet. Beide Flüchtlingsgemeinschaften leben heute im Libanon mit enormen rechtlichen Beschränkungen, die sie quasi ohne Perspektiven lassen.5 Die Bedingungen der Flüchtlingsgemeinschaften unterscheiden sich dennoch aktuell stark, sagte ein lokaler Kulturvertreter: »They are coming, take photos of the activities, stay for a week and leave … many activities are performed like fast food.« 4 | Quellen: Flüchtlinge aus Syrien: http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id =122; Stand März 2016 (letzter Zugriff: 17.05.2016), seit Mai 2015 wurde die Registrierung auf Forderung der libanesischen Regierung eingestellt; www.unrwa.org/syria-crisis (letzter Zugriff: 17.05.2016). Bei diesen Zahlen handelt es sich lediglich um die offiziellen Zahlen; Schätzungen liegen durchaus höher. Palästinenser aus dem Libanon: www.unrwa.org/wherewe-work/lebanon (letzter Zugriff: 17.05.2016), insgesamt sind im Libanon 450.000 palästinensische Flüchtlinge registriert; davon leben geschätzt 280.000 im Land. 5 | Zudem gilt das Hilfssystem für die syrischen Flüchtlinge als stark unterfinanziert. Ihre Lebensbedingungen sind teilweise sehr prekär, der Zugang zum Arbeitsmarkt extrem begrenzt und die Bildungssituation dramatisch. Auch die Palästinenser leiden unter Mittelkürzungen.
Zur Bedeutung von Kulturarbeit für Geflüchtete
v.a., da sie an unterschiedlichen Punkten ihres Flüchtlingsdaseins stehen sowie unterschiedlichen Regimen zugeordnet werden: Für die syrischen Flüchtlinge ist die globale Flüchtlingsorganisation UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) zuständig, die Palästinenser_innen aus Syrien und dem Libanon fallen unter das Mandat der UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East). Während etwa 50 % der Palästinenser_innen bis heute in zwölf Flüchtlingslagern leben,6 sind die aus Syrien kommenden Flüchtlinge über etwa 1.700 Gemeinden des Landes verteilt.7
1.2 Angebote und Diskussionen zur Kulturarbeit in den Flüchtlingsgemeinschaften Im Hinblick auf die Rolle von Kulturarbeit hat die Betrachtung der beiden Flüchtlingsgemeinschaften gezeigt, dass es wichtig ist, zu sehen, wie Flüchtlinge bzw. Kulturakteure aus den Flüchtlingsgemeinschaften über den Bereich der Kulturarbeit und Kulturförderung reden. Dabei zeichneten sich selbst im selben Land große Unterschiede unter den Flüchtlingsgemeinschaften ab, die sehr stark mit den unterschiedlichen Situationen zu tun haben: In der syrischen Flüchtlingsgemeinschaft, deren Situation noch sehr jung und volatil ist, gibt es einerseits eine sich aktiv entwickelnde Kulturszene, andererseits zahlreiche Aktivitäten, die darauf abzielen, Leid zu lindern, Kinder zu beschäftigen, das Verhältnis zur Aufnahmegesellschaft zu verbessern oder Traumata anzugehen. Ein Thema v.a. unter Kulturschaffenden war, dass sie sich von der Kategorie des Flüchtlings bewusst distanzierten, da diese als Reduzierung auf eine Empfängerkategorie wahrgenommen wurde (also als kulturelle Aktivitäten für Flüchtlinge), sie jedoch nicht nur als Flüchtlinge Kunst machen wollten, sondern auch als Akteure, die Gesellschaft aktiv mitgestalten. So war z.B. der Anspruch für die Theaterproduktion »Antigone«, dass es sich um eine professionelle Produktion handeln sollte, bei der die Flüchtlinge ihren Teil beitragen. Für das Theaterstück hatten Frauen aus Syrien, die in Shatila – einem palästinensischen Flüchtlingslager in der libanesischen Hauptstadt Beirut – leben, gemeinsam mit einem Theaterautor und einem Regisseur das Stück für sich umgearbeitet und ihre ganz persönlichen Erfahrungen in die Geschichte der Antigone eingeflochten. Antigone erhielt im Libanon große Aufmerksamkeit und wurde mittlerweile auch in Europa aufgeführt u.a. im Februar 2016 in Hamburg. 6 | Die Segregation gilt als weit höher, da zudem viele in sog. »gatherings« leben, also Siedlungen, die nicht durch UNRWA angemietet und verwaltet werden. 7 | Um zu verhindern, dass sich neben den Palästinenser_innen eine zweite große Flüchtlingsgemeinschaft dauerhaft im Land ansiedeln könnte, hat die libanesische Regierung die Errichtung offizieller Lager nicht erlaubt, verwehrt den syrischen Flüchtlingen den Flüchtlingsstatus und behandelt sie vielmehr ähnlich Touristen, die regelmäßig gegen Gebühr einen neuen Aufenthalt beantragen müssen.
91
92
Leila Mousa
Die Studie macht deutlich, dass die Angebote innerhalb der bzw. für die syrische Flüchtlingsgemeinschaft noch wenig verfestigt sind; jedoch gibt es kritische Diskussionen darüber, dass große themengebundene Töpfe dazu führten, dass sich Angebote zunehmend ähneln. Insbesondere im Bereich der Trauma-Arbeit und psychosozialer Angebote habe dies zu einer Verwischung von Formaten und teilweise unseriösen Praktiken geführt. Umgekehrt zeigen Debatten um Kulturarbeit und -förderung in der palästinensischen Flüchtlingsgemeinschaft deutlich, dass sich Strukturen und Angebote in einer verstetigten Fluchtsituation stark verändern: Dort beschränkt sich das Angebot mittlerweile größtenteils auf Unterhaltungsformate und folkloristische Aktivitäten, die Referenzen zur Herkunft bieten. Kulturakteure vor Ort bemängeln, dass auch hier die bereitgestellten Fördermittel das Angebot definieren und alle dasselbe anbieten. Dabei werden Mittel häufig kurzfristig und themengebunden vergeben. Dadurch werden lokale Themen und Potentiale größtenteils ignoriert. Künstler_innen und freie Projekte werden nicht ausreichend unterstützt und politisch heikle Themen werden in der Förderung ausgeklammert. Angesichts fehlender Perspektiven wird die fehlende Förderung freier Arbeiten oder kultureller Kompetenzen bei gleichzeitig starker Förderung von wenig nachhaltigen Unterhaltungsformaten sehr kritisch als eine Form der Ablenkung und ein »Erträglich-Machen des Status quo« diskutiert. Genau deshalb findet man in den palästinensischen Lagern einige Akteure, die selbst-organisiert Kulturprojekte in ihrem Sinne umsetzen. Für sie sind nachhaltige Arbeit, aber v.a. die inhaltliche Unabhängigkeit (selbstständige Themensetzung) und daher auch finanzielle Unabhängigkeit ganz zentral. Dies zeigt sich z.B. in der Arbeit der Nichtregierungsorganisation (NRO) Al-Kamandjati, die heute in zwei palästinensischen Lagern 45 Schüler_innen in vier Instrumenten unterrichten (nay/Flöte, tableh/Trommel, Oud/Laute und Violine). Nach fünf Jahren haben einige Kinder das Niveau erreicht, um am Konservatorium in Beirut Unterricht zu nehmen. Die Organisation ist nicht daran interessiert, so viele Kinder wie möglich zu erreichen, sondern die Qualität der Arbeit zu verbessern. Al-Kamandjati grenzt sich ganz bewusst ab von den zahlreichen Aktivitäten, die – entsprechend der Förderpraxis – zumeist auf kurze Zeit und das Erreichen vieler Jugendlicher ausgerichtet sind, jedoch keinen nachhaltigen Effekt zeigen, und versucht, nachhaltig eine gewisse Qualität musikalischer Auseinandersetzung in die Gesellschaft einzubringen. Auch für das Art Collective, ein über Jahre gewachsenes Netzwerk von Kreativen,8 ist die Nachhaltigkeit der Projekte ein zentraler Aspekt der Arbeit. In Multimedia-Trainings werden Kenntnisse und Fähigkeiten vermittelt. Mit der Etablierung von mehreren kleinen Studios hat es zudem Räume für neue Pro8 | Im Art Collective sind unabhängige Künstler_innen lose miteinander verbunden. Die Zusammenarbeit ist Resultat jahrelanger Arbeit in zahlreichen Lagern und diversen Konstellationen. Die Mitglieder distanzieren sich von dem, was sie als »Elite-Kunst« bezeichnen und produzieren community arts.
Zur Bedeutung von Kulturarbeit für Geflüchtete
jekte zur Verfügung gestellt. Zudem verstehen die Mitglieder des Art Collective jedoch Kunst und Kultur als den Raum, in dem die sonst gesetzten Beschränkungen nicht gelten, als einen Raum für Rebellion (cultural resistance). Aus diesem Grund besteht hier eine große Sensibilität gegenüber Einmischung und Fremdbestimmung. Sie thematisieren die Abhängigkeit von externen Mitteln als großes Problem9 und betonen ihre inhaltliche Unabhängigkeit, die ihnen erlaubt, eigene Themen zu setzen sowie kritische Kunst zu produzieren: »you have to throw questions at things«.10
1.3 Zentrale Ergebnisse und Übertragbarkeit Die Studie zeigt, dass Akteure beider Flüchtlingsgemeinschaften auf mehr Freiräume für kreatives, kritisches und konstruktives Arbeiten hoffen – durch Geldgeber, die nicht fertige Konzepte mitbringen, sondern lokal entwickelte, bedarfsorientierte Projekte fördern. Sie fordern dazu auf, in den Auf bau langfristiger kultureller Infrastrukturen zu investieren und bestehende Fördermöglichkeiten der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik (AKBP) stärker bei den Zielgruppen bekannt zu machen. Grundsätzlich wurde der Nachhaltigkeit der Projekte sowie Kontinuität große Bedeutung beigemessen. Dies wird relevant im Kontext von Langzeitflucht und Perspektivlosigkeit, da dort die Bereitstellung von Ausdrucksräumen eine besondere Rolle erfährt. Unterhaltungsangebote wurden v.a. vor dem Hintergrund einer einseitigen Förderung und Reduzierung auf diese Formate problematisiert. Die Bedeutung von Dialogprojekten wurde betont, jedoch wurden diese von vielen Akteuren nicht als Kultur-Arbeit verstanden. Die Studie macht deutlich, dass es im selben Kontext große Unterschiede gibt: Obwohl es sich um zwei Flüchtlingsgemeinschaften im selben Land handelt, unterscheiden sich die Problemlagen und Herausforderungen sowie die kulturelle Situation (d.h. kulturelle Angebote und Diskussionen zum Kulturbereich) sehr. Dies hat ganz zentral mit der Dauer der Flucht und ihrer Wahrnehmung als verstetigt bzw. unverstetigt zu tun. Gerade dieser Unterschied innerhalb desselben Aufnahmelandes macht deutlich, wie wichtig es ist, jeden Kontext gesondert zu betrachten. Um sich angemessen einbringen zu können, sollten Kulturakteure den jeweiligen Kontext gut kennen, in dem sie aktiv werden wollen. Das umfasst die Kenntnis der Flücht9 | Die Arbeit der Mitglieder des Art Collective ist projekt-, nicht mittelbasiert. Sie freuen sich über finanzielle Unterstützung, wollen sich jedoch nicht davon abhängig machen, zumal Finanzierungen häufig einen enormen Verwaltungsaufwand bedeuten. 10 | In der syrischen Flüchtlingsgemeinschaft gibt es kaum derartige Diskussionen um Themen wie »ownership« und »Nachhaltigkeit« oder »Entertainment/Ablenkung«. Auch findet man dort nur wenige Aktivitäten, die man dem Bereich »Erhalt der Kultur« (folkloristische Aktivitäten) zuordnen würde. Vermutlich liegt das daran, dass sich noch nicht durchgesetzt hat, dass sich die Situation verstetigen könnte.
93
94
Leila Mousa
lingspolitik des Aufnahmelandes11 wie auch die der »Möglichkeiten« kultureller Arbeit. Dazu zählt auch die Kenntnis der Akteure und Angebote im Kulturbereich sowie die dazu bestehenden Debatten, da bereits durch den humanitären Komplex eine Vielzahl von kulturellen Aktivitäten bereitgestellt wird.12 Als Kulturakteur in einem Flüchtlingskontext klinkt man sich unweigerlich in diesen Komplex von Angeboten ein und sollte ihn daher verstehen. Hinsichtlich der Übertragbarkeit auf andere Kontexte bietet die Studie einige Referenzpunkte für die Betrachtung der Fragestellung, was Kulturarbeit für Flüchtlinge leisten kann. So stellt sie mit der Sortierung von Formaten in drei Bereiche einen Ansatzpunkt zur Verortung von kulturellen Projekten und Aktivitäten zur Verfügung, sensibilisiert für potentielle Debatten, aber macht auch deutlich, dass spezifische Herausforderungen stark kontextabhängig sind.
2. Überlegungen zu Kulturarbeit und Kultureller Bildung für Geflüchtete in Deutschland Was hat nun dieser Blick auf Kulturarbeit mit Geflüchteten im Libanon mit Kulturakteuren und ihrer Arbeit mit Geflüchteten in Deutschland zu tun? Wo gibt es Anschlussstellen für Überlegungen zu einer Kulturarbeit mit oder für Geflüchtete in Deutschland?
2.1 Kontext Die »Flucht nach Europa« ist ein viel weiter gefasstes Migrationsthema, als es der Begriff der »Geflüchteten« nahelegt. Hier ist es zu einer Vermengung und sprachlichen Verwischung unterschiedlicher Migrationsformen gekommen. Die aktuelle Migrationsbewegung nach Europa kann nicht auf Flüchtlinge im Sinne der Genfer Konvention reduziert werden.13 Migration nach Deutschland ist kein neues Phänomen. Das Ausmaß der Zuwanderung mit etwa 1,1 Mio. Zugängen von Asylsuchenden14 wie auch ihre Sicht11 | Die Kenntnis der Flüchtlingspolitik des Aufnahmelandes ist vor allem deswegen wichtig, da sich Bemühungen, die sich an eine Flüchtlingsgemeinschaft richten, an eine Gruppe richten, die nicht zur Bevölkerung des Landes zählt, in dem man aktiv wird. So unterscheiden sich z.B. die Möglichkeiten kultureller Arbeit massiv im direkten Vergleich der Aufnahmeländer Türkei, Jordanien und Libanon. Der Libanon ist wohl im Hinblick auf freie Äußerung ein alleinstehender »Möglichkeitsraum«. 12 | Gemeint sind v.a. Debatten um Steuerung, Verwaltung und Versorgung der Flüchtlingsgemeinschaften im Allgemeinen sowie Debatten zum Kulturbereich. 13 | Im Gegensatz dazu konzentriert sich die Studie im Libanon allein auf die Thematik der Flüchtlinge, während auch im Libanon Migration ein existierendes, jedoch viel weiter gefasstes Thema ist. 14 | Vgl. www.bmi.bund.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2016/01/asylantraegedezember-2015.html; Diese Zahl entspricht den im EASY-System 2015 bundesweit regi-
Zur Bedeutung von Kulturarbeit für Geflüchtete
barkeit im vergangenen Jahr haben jedoch die Dringlichkeit der Auseinandersetzung mit der Migration nach Deutschland, aber auch mit Fluchtursachen und Fragen der Integration deutlich gemacht. Diese vom Innenministerium Anfang 2016 vorgelegte Zahl liegt weitaus höher als die der 2015 formell beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) gestellten Asylanträge (476.649; aber auch diese ist im Vergleich zum Vorjahr massiv angestiegen mit 273.815 mehr Anträgen als in 2014). Trotz einer insgesamt auf europäischer Ebene einzigartigen Willkommenskultur Deutschlands ist dieser Zuwachs in der Zuwanderung aber auch hier mit großen Ängsten, einem Rechtsruck und vermehrten Übergriffen auf Flüchtlinge und Flüchtlingsunterkünfte verbunden.15 Als Reaktion auf die großen Zahlen und den schnellen Handlungsbedarf bei der Unterbringung wurden häufig Großund Massenunterkünfte eingerichtet.16 Diese führten – wenn auch zunächst nur als Übergangslösung geplant – in vielen Fällen zu regelrechten compound-Lösungen mit zunehmender Isolierung der Flüchtlinge, ohne Berührungen zur lokalen Aufnahmegesellschaft zu bieten.
2.2 Herausforderungen Die Flüchtlingsgemeinschaft in Deutschland ist sehr heterogen. Folgt man den Zahlen des BAMF, so bilden Syrer_innen für das Jahr 2015 die größte Gruppe (gemessen an den beim BAMF eingegangenen Asylanträgen für den Berichtszeitraum 2015 mit insgesamt 162.510 aus 476.649 Anträgen, vgl. BAMF 2015), jedoch finden sich hier auch große Gruppen an Flüchtlingen aus den Westbalkanstaaten (Albanien, Kosovo, Mazedonien, Serbien etc.), aus Afghanistan, dem Irak, Eritrea u.v.m.17 (vgl. BAMF 2015: 3). Relevant ist auch, dass es sich bei den Zugewanderten um Personen mit unterschiedlichem Rechtsstatus sowie unterschiedlichen Bleiberechtschancen handelt, da sich dies auf die Möglichkeiten der Teilhabe auswirkt. Für die Bestrierten Zugängen von Asylsuchenden. »Das EASY-System ist eine IT-Anwendung zur Erstverteilung der Asylbegehrenden auf die Bundesländer. Bei den EASY-Zahlen sind Fehl- und Doppelerfassungen wegen der zu diesem Zeitpunkt noch fehlenden erkennungsdienstlichen Behandlung und der fehlenden Erfassung der persönlichen Daten nicht ausgeschlossen.« (Ebd.) 15 | Nicht nur in Deutschland, in diversen europäischen Staaten (Österreich, Skandinavien, Balkan, Großbritannien, Frankreich, Griechenland etc.) werden ein Rechtsruck sowie der Erfolg populistischer Parteien u.a. im Kontext der Flüchtlingskrise thematisiert. 16 | Die anfänglich eingeführte Drei-Monatsregelung, die gewährleistet, dass sich Flüchtlinge nach der Erstregistrierung mindestens drei Monate in den Einrichtungen aufhalten müssen, wurde auf sechs Monate ausgedehnt. De facto verbringen viele mehrere Jahre in diesen Unterkünften. 17 | Unter den TOP-TEN befinden sich mehr als 12.000 Fälle, die als »ungeklärt« gelten. Dahinter verbergen sich häufig Palästinenser_innen aus Syrien.
95
96
Leila Mousa
troffenen relevant ist die Unterscheidung in jene, die relativ gute Bleibechancen haben (größte Chancen haben aktuell Flüchtlinge aus Syrien, dem Irak, dem Iran und Eritrea) und somit über kurz oder lang unsere Gesellschaft aktiv mitgestalten, und jene, deren Bleibechancen sehr gering sind. So lebt in der Praxis in Deutschland eine große Gruppe von »geduldeten Personen« teilweise über viele Jahre ohne die Möglichkeit zur Teilnahme an Sprachkursen und dem Zugang zu Arbeit.18 Während im Libanon eine relative kulturelle Nähe zwischen Syrer_innen und Libanes_innen besteht (man teilt dieselben Feiertage, dieselbe Sprache, zahlreiche kulturelle Praktiken, eine gemeinsame Geschichte etc.), gibt es in Deutschland (und Europa) für die meisten Flüchtlinge und Migrant_innen den ersten Kontakt zu den Aufnahmegesellschaften erst dann, wenn sie dort ankommen. Viele von ihnen haben weder gute Kenntnisse der Sprache noch der lokalen Kultur (Verhaltensweisen, Traditionen etc.). Es existieren auf beiden Seiten Stereotype zum jeweils »Anderen« sowie eine große Unkenntnis der kulturellen Praktiken und der Strukturierung von Gesellschaft. Vor allem dort, wo Flüchtlinge in großen, teilweise sehr entfernt liegenden und isolierten Unterkünften unterkommen, aber auch sonst, sind Kontaktpunkte zur lokalen Bevölkerung rar. Das Kennenlernen der deutschen Kultur und Sprache findet zumeist im Rahmen von Integrationskursen statt, die erst dann besucht werden dürfen, wenn die Geflüchteten einen »Status« erhalten haben. Dann haben sie sich in der Regel jedoch bereits mehrere Monate oder bereits Jahre im Land aufgehalten. Zudem sind die Kurse verschult und bieten keine Anknüpfungspunkte zur deutschen Gesellschaft. Zu den größten Herausforderungen zählen somit der große Flüchtlingszuwachs im letzten Jahr, die daran gebundene Unterbringung in großen Aufnahmeeinrichtungen, der fehlende Kontakt zur Bevölkerung, bestehende Ängste und Stereotype, eine sehr heterogene Flüchtlingsgemeinschaft sowie große sprachliche Barrieren und kulturelle Unterschiede.
2.3 Was kann Kulturarbeit in solch einem Kontext ermöglichen? Was kann Kulturarbeit mit, zu und von Geflüchteten in diesem Kontext leisten? Was gilt es zu bedenken? Welche Erfahrungen kann man ggf. aus dem libanesischen Kontext übertragen? Vor dem Hintergrund der spezifischen Bedingungen im deutschen Kontext, vor allem mit Blick auf die kulturelle Vielfalt unter den Geflüchteten, die oft räumliche Isolierung von großen Flüchtlingsgruppen in zunehmend größer werdenden Unterkünften, die gestiegenen Zahlen und damit verbundenen Ängste und bestehenden Vorurteile, scheint eine der größten Herausforderung darin 18 | Verschiedenen Angaben zufolge scheinen die Zahlen von Personen in der Duldung um die 100.000 zu liegen, wobei etwa 10.000 von ihnen bereits mehr als 15 Jahre in diesem Status »hängen«. Vgl. rbb-online.de (2014); Ghelli (2015).
Zur Bedeutung von Kulturarbeit für Geflüchtete
zu liegen, Kommunikationsbrücken zu bauen, Isolierung entgegenzuwirken und gemeinsame Räume der Begegnung zu schaffen. Hierfür kann Kulturarbeit ein wichtiger Hebel sein: • Sie kann helfen, die Enge und das Leid in diesen Turnhallen und Großaufnahmeeinrichtungen sowie die Isolation etwas zu durchbrechen, Räume der Erholung bereitstellen oder die Geflüchteten aus diesen Einrichtungen kurzzeitig »herausholen«, sei es über Film, Musik, Sport-Aktivitäten etc. Ob und inwiefern es sich dabei um Kultur- oder Sozialarbeit handelt, scheint eine anhaltende Diskussion unter Kunst- und Kulturschaffenden zu sein. • Kulturarbeit und Kunstproduktionen können Flüchtlingen eine Möglichkeit anbieten, sich auszudrücken – sei es sich selbst vorzustellen, Einblicke in ihre Situation zu gewähren oder Kritik und Fragen zu äußern etc. • Projekte der Kulturarbeit können da greifen, wo es um die Schaffung von Räumen der Begegnung, um das gegenseitige Kennenlernen und Verstehen geht sowie um Kontaktpunkte unter verschiedenen Flüchtlings- und Migrantengruppen, aber v.a. zur Aufnahmegesellschaft. Viele Geflüchteten sind daran interessiert, Deutsche kennenzulernen (um die Sprache zu lernen, um etwas über das Land und die Kultur zu erfahren etc.), sehen aber keinen Zugang und kennen kaum Angebote, die solche Schnittstellen zur Verfügung stellen. Die größte Schwierigkeit und Herausforderung scheint zu sein, die Menschen in ihren Lebenssituationen abzuholen. Das gilt gleichermaßen für die Deutschen wie auch für die Flüchtlinge. Möglichkeiten hierfür bieten: • Räume der Begegnung, d.h. gemeinsame Aktivitäten wie Sport oder Theater, aber auch interkulturelle Cafés etc. • Kunstproduktionen oder Aktivitäten, die die eigene Kultur und Traditionen (Verhaltensweisen, Tänze, Werte, Essen, Feiertage, Austausch darüber, wie Gesellschaft strukturiert ist etc.) vermitteln. • Kulturarbeit kann auch deutlich machen, wie vielfältig Deutschland bereits ist, sowie die positiven Aspekte dieser Diversität herausstellen – und das nicht nur in den großen Städten. • Kulturarbeit kann ausbilden helfen und Perspektiven schaffen, sie kann Sprachvermittlung umfassen, zum Erwerb von Fähigkeiten beitragen (Handwerk, Gartenbau) etc.
2.4 Was gilt es dabei zu bedenken? Mit Blick auf die sensiblen Diskussionen im Libanon scheinen mir zwei Punkte wichtig: 1. Kulturarbeit kann helfen, die Isolation zu überwinden. Vor dem Hintergrund dessen, dass Unterbringungszeiten in Heimen, Notunterkünften, Großunterkünften etc. sich möglicherweise über Jahre hinziehen könnten und es eine Tendenz zu größeren Unterbringungsformen gegeben zu haben scheint, hat
97
98
Leila Mousa
sie auch das Potential, integrierter Teil einer Isolation zu sein oder zu werden, nämlich dann, wenn sie in großen Aufnahmeeinrichtungen eingebettet wird, ihr Ziel allein die Unterhaltung der Flüchtlinge ist und sie darüber Gefahr läuft, eine Verstetigung der Anwesenheit der Flüchtlinge in diesen Unterbringungsformen einfacher zu legitimieren, wo doch diese großen Aufnahmeeinrichtungen ganz grundsätzlich in ihrer Anlage der Idee der Integration und Begegnung entgegenstehen. 2. Projekte für, mit oder von Flüchtlingen? Die Erfahrungen von Flüchtlingen (global), die sich auch in wissenschaftlichen Debatten wiederfinden, beziehen sich oft auf die Wahrnehmung einer Reduzierung. Der Flüchtlingsbegriff hat etwas Gleichmachendes und nimmt den Individuen ihre Geschichte, er belegt sie zeitgleich mit Assoziationen der Hilflosigkeit und drängt sie in eine Empfängerkategorie. Wichtig scheint daher, eine Begegnung auf Augenhöhe zu ermöglichen, ein gegenseitiges Voneinander-Lernen, die Einbindung in den Planungsprozess, eine authentische Begegnung. Aktuell sind Flüchtlinge eine Lebensrealität, die Auseinandersetzung damit eine soziale Notwendigkeit, aber auch ein Markt, d.h. für die »Arbeit mit« oder »Projekte zu« Flüchtlingen stehen gesonderte Mittel zur Verfügung. Ein Vertreter der Organisation »Jugendliche ohne Grenzen« berichtete im April 2016 in Karlsruhe, dass regelmäßig fertig-gedachte Projekte an sie herangetragen werden. Den meisten Akteuren fehlten dafür jedoch noch die Flüchtlinge, weshalb man bei ihnen anklopfe. So würden die Flüchtlinge einerseits häufig nicht in die Gestaltung der Projekte einbezogen, andererseits werde von den Flüchtlingen eine Verbindlichkeit erwartet, die ihnen anfangs nicht klar sei, d.h. man erwarte dann eine regelmäßige Präsenz über längere Zeit, was einfach eine falsche Erwartungshaltung sei. Mein Eindruck ist, dass die meisten Akteure sich viele Gedanken darüber machen, was sie tun. Ein großes Anliegen scheint, dass sie nicht nur gönnerhaft etwas zur Verfügung stellen wollen, sondern wirklich auch im Sinne der Flüchtlinge bzw. der Begegnung handeln. Die Studie stellt einige Referenzfragen zur Verfügung, die auch hier hilfreich sein könnten. Eine zentrale Frage für Kulturakteure könnte für die Arbeit mit Geflüchteten sein: Wer wird aktiv, womit und für wen? Mit welchem Ziel? Wer definiert dieses Ziel?
Zur Bedeutung von Kulturarbeit für Geflüchtete
F a zit : K ultur arbeit für G eflüchte te ist K ultur arbeit für uns alle Diese Überlegungen liefern nur erste Ansatzpunkte für eine Sortierung und ein sorgfältiges Reflektieren von Kulturarbeit mit, für und von Geflüchteten in Deutschland. Das Spektrum dessen, was möglich ist und was bereits angeboten wird, ist sehr breit. Es zeigt, dass Kulturarbeit Lösungen und Wege bereitstellen kann, in der aktuellen Flüchtlingskrise die Isolation der Flüchtlinge zu überwinden, ihr Mensch-Sein anzuerkennen und sie mit der lokalen Bevölkerung in Kontakt zu bringen und ein gegenseitiges Von- und Übereinander-Lernen zu ermöglichen. Um aber Potentiale optimal auszunutzen und mögliche Probleme zu erkennen, sollten Akteure der Kulturarbeit diese in ihrem sozialen Kontext sehen. Bei den aktuellen Herausforderungen handelt es sich um eine neue Situation, die einen offenen Lernprozess darstellt. Die Erfahrungen aus dem Libanon zeigen, dass es wichtig ist, die eigene Rolle und die Haltung gegenüber den Flüchtlingen zu hinterfragen, sie zeigen auch, dass sich Debatten mit der Zeit verändern können. Diesen Erfahrungen gilt es zu folgen und vielleicht macht es Sinn, sich mit alten Migrationserfahrungen in Deutschland auseinanderzusetzen und dort stattfindende Debatten um Integration, interkulturelle Kommunikation, Diversität im Allgemeinen, aber auch die Rolle von Kulturarbeit im Besonderen anzusehen. Kulturakteure, die im ausländischen Kontext Kulturarbeit unterstützen, können dort die politischen Rahmenbedingungen nicht verändern (v.a. hinsichtlich der Rechte und somit der Handlungsspielräume und Perspektiven der Flüchtlingsgemeinschaft). Kulturarbeit kann insbesondere dann in solch einem Kontext zum Mensch-Sein beitragen, indem sie die Flüchtlinge nicht zum Gegenstand und zu Empfänger_innen macht, sondern sie ermächtigt und ihnen Ausdruck verleiht. Im Inland können wir die politischen Rahmenbedingungen verändern, d.h. Kulturarbeit kann auch hier Freiräume für Ausdruck und Dialog bereitstellen (außerhalb institutionalisierter Integrationsabläufe), sie kann den Flüchtlingen eine Stimme geben. Sie kann dabei neben Spracherwerb und Zugang zu Arbeit einen wichtigen Beitrag zur Integration und Partizipation leisten, aber diese nicht ersetzen.
L iter atur BAMF – Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (2015): Asylgeschäftsstatistik für den Monat Dezember. www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Down loads/Infothek/Statistik/Asyl/201512-statistik-anlage-asyl-geschaeftsbericht.html; jsessionid=1A5F47643FEE9AD976F2CD9D05715B7B.1_cid359?nn=1694460 (letzter Zugriff: 06.07.2016).
99
100
Leila Mousa
BAMF – Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (2016): Mehr Asylanträge in Deutschland als jemals zuvor. (Pressemitteilung vom 06.01.2016). www.bmi. bund.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2016/01/asylantraege-dezember2015.html (letzter Zugriff: 06.07.2016). BAMF – Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (o.D.): Asyl und Flüchtlingsschutz. www.bamf.de/DE/Migration/AsylFluechtlinge/asylfluechtlinge-node. html (letzter Zugriff: 17.05.2016). Ghelli, Fabio (2015): Bleiberechts-Reform: Langzeit-Geduldete dürfen bleiben (16.07.2015). https://mediendienst-integration.de/artikel/langzeit-geduldetegesetz-neuregelung-bleiberecht-aufenthaltsbeendigung-auslaenderbehoerde. html (letzter Zugriff: 16.07.2015). Mousa, Leila (2015): Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik für Flüchtlingslager? Handlungsfelder und Potenziale in den Flüchtlingslagern des Libanon, Stuttgart: Institut für Auslandsbeziehungen (ifa-Edition Kultur und Außenpolitik). rbb-online.de (2014): Asyl, Duldung, Residenzpflicht – was bedeutet was? (03. 09.2014). www.rbb-online.de/politik/thema/fluechtlinge/hintergrund/asylrechtbegriffserklaerung.html (letzter Zugriff: 06.07.2016). Schmelter, Susanne (2015): »Forschungsbericht Libanon: Perspektiven anthropologischer Forschung im Spannungsfeld zwischen Humanitarismus, Containment und Widerständigkeit«, in: movements. Journal für kritische Migrations- und Grenzregimeforschung 1/2015, S. 1-13. UNHCR (2016): Syria Regional Refugee Response. Inter-agency Information Sharing Portal (März 2016). http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country. php?id=122 (letzter Zugriff: 17.05.2016). UNHCR (o.D.): UNHCR Statistics. The World in Numbers. http://popstats.unhcr. org/en/overview (letzter Zugriff: 05.06.2016). UNRWA (2014): Where we work (01.07.2014) www.unrwa.org/where-we-work/ lebanon (letzter Zugriff: 17.05.2016). UNRWA (2016): 2016 Syria Regional Crisis Emergency Appeal. www.unrwa.org/ resources/emergency-appeals/2016-syria-emergency-appeal (letzter Zugriff: 06.07.2016). UNRWA (o.D.): Syria Crisis. www.unrwa.org/syria-crisis (letzter Zugriff: 17.05. 2016).
Es bleibt anders Kämpfe um die (Pädagogik der) Migrationsgesellschaft 1 Paul Mecheril
Zusammenfassung Jede Pädagogik, will sie nicht weltfremd sein, hat sich auf die je gegebene Realität zu beziehen. Wir leben in einer von Migrationsphänomenen vielfach geprägten Welt. Die Welt ist geschrumpft, die Lebensformen rücken enger an- und auch ineinander. Solche Phänomene verändern die Welt auch für diejenigen, die meinen, keine Migrant_innen zu sein. Das Anliegen der Migrationspädagogik ist hierbei unter anderem, Wissen darüber zu vermitteln, wie moderne Migration soziale Ordnungen problematisiert und beunruhigt und welche Konsequenzen diese Beunruhigung für Bildungsprozesse und die angemessene Ausrichtung von Bildungsinstitutionen hat. 2
Abstract: It’s Still Different – Conflict around the (Pedagog y of a) ›Migration Society‹ Any pedagogy that does not wish to be relegated to an ivory tower needs to create connections with reality. We are living in a world which is increasingly shaped by the diverse effects of migration. The world has grown smaller; all forms of life are drawing closer and becoming more intertwined. Such phenomena also change the world for those who claim not to be migrants. The aim of a pedagogy of migration is, amongst other things, to impart knowledge about how contemporary migration interrogates and unsettles social orders, and about the consequences this unsettling has for education processes, and on how educational institutions should respond.
1 | Frei gehaltener Vortrag von Prof. Dr. Paul Mecheril am 06.11.2015 an der PH der Diözese Linz aus Anlass der Eröffnung des Zentrums für Interreligiöses Lernen, Migrationspädagogik und MehrsprachigkeiT (Z.I.M.T.). Der Vortragsstil ist für die Veröffentlichung weitgehend beibehalten worden. Der Vortrag ist abrufbar unter: https://www.youtube.com/ watch?v=acB2F5nqkDw (letzter Zugriff: 14.06.2016). 2 | Zusammenfassung von Thomas Schlager-Weidinger, publiziert am 07.11.2015, https: //www.dioezese-linz.at/news/2015/11/07/feierliche-eroeffnung-von-zimt (letzter Zugriff: 14.06.2016).
102
Paul Mecheril
Der Titel »Alles bleibt anders« ist ein letztlich alles und nichts sagender Titel, er soll Verschiedenes zum Ausdruck bringen. Ich werde zunächst ein wenig über das Thema Migrationsgesellschaft sprechen und die Herausforderungen, die sich mit diesem Thema für die formelle Bildungslandschaft ergeben, und ich werde darauf hinweisen – und das ist schon die eigentliche Botschaft des Vortrags –, dass diese Herausforderungen, die mit migrationsgesellschaftlichen Fragen und Phänomenen verknüpft sind, nichts ungewöhnliches, sondern allgemeine Herausforderungen sind.
Alles bleibt anders Durch die migrationsgesellschaftliche Tatsache kommen nicht gewissermaßen neue Anforderungen an beispielsweise Professionelle ins Spiel – seien dies Lehrer_ innen, Erzieher_innen, Bildungsplaner_innen, Bildungspolitiker_innen –, sondern die große Chance, die mit Migrationsphänomenen einhergeht, ist, dass beispielsweise diese Berufsgruppen, also wir alle, daran erinnert werden, was eigentlich unsere allgemeine grundlegende prinzipielle Aufgabe ist. »Alles bleibt anders.« Die migrationsgesellschaftliche Realität erinnert daran, dass die formellen Bildungsinstitutionen hoch ambivalente Gestalten sind im Hinblick auf die Wirkungen, die sie entfalten. Sie und vielleicht in erster Linie die moderne Schule, die wir kennen, treten mit dem Versprechen auf, so etwas wie ein »Raum der Ermöglichung« zu sein von zumindest Handlungsfähigkeit, wenn nicht sogar von Mündigkeit. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die, dass diese organisierten Gestalten der Ermöglichung von Bildung überaus machtvolle Räume der Herstellung von Unterschieden darstellen, die zu sozialen, gesellschaftlichen Ungleichheiten werden. Das heißt, wir haben es bei unserer Kerninstitution Schule mit einer konstitutiv strukturell ambivalenten oder widersprüchlichen Institution zu tun. Das wird sie selbstverständlich nicht erst durch Migrationsphänomene. Das ist sie sozusagen in sich und an sich. Und dieses in sich und an sich Ambivalentsein mit Bezug auf Machtverhältnisse wird durch die Migrationsphänomene besonders augenfällig.
Migration als Irritation der Ordnungen Ich verstehe Migration im Wesentlichen als Phänomen, das dazu beiträgt, dass Gegebenes und die Ordnung des Gegebenen irritiert, aufgewühlt, beunruhigt, provoziert und herausgefordert werden. Ich finde es interessant, die Auseinandersetzungen um diese Ordnungen zu betrachten. Vieles, was im öffentlichen Raum, aber auch im Klassenzimmer oder im Lehrer_innenzimmer passiert, kann interpretiert werden als ein Kampf um Ordnungen. Dass es in Europa wieder legitim ist, im öffentlichen Raum darüber zu sprechen, dass man darüber nachdenken sollte, einen Schießbefehl an europäischen Grenzen einzuführen, diese Rede ist umstritten, aber sie ist möglich. Dies ist Ausdruck eines Kampfes, den wir um die
Es bleibt anders
Ordnung führen. Meines Erachtens geht es um die Ordnung, die es ermöglicht, dass in Europa Privilegien fraglos vorhanden sind, die anderen Teilen der Welt fraglos nicht zukommen. Diese Ordnung steht gerade zur Disposition. Sie wird gerade zur Disposition gebracht durch die Körper der Geflohenen. Es sind ja im Wesentlichen keine politischen Aktivist_innen, sie gerieren sich zumindest nicht als politische Aktivist_innen im öffentlichen Raum, aber allein die Anwesenheit ihrer Leiber artikuliert politisch die Infragestellung einer globalen Privilegienstruktur, von der wir profitieren. Was jetzt gerade in Europa passiert, ist der Kampf um die Frage der Legitimität dieser Ordnung. Eine Variante der Legitimierung der gegebenen Ordnung besteht darin, zum Beispiel Flucht und Flüchtlinge zu illegitimieren. Ein Beispiel dafür erlebte ich gestern in Graz in einem Seminar mit Lehramtsstudierenden, die vermutlich in ihrem bisherigen Studium nur wenig über Migration gehört haben. Am Anfang des Seminars haben wir über das Thema Flucht gesprochen. Es war ganz interessant, wie diese Studierenden – Mitglieder des bürgerlichen Bildungsmilieus – über Flucht gesprochen haben. Es wurde über vieles gesprochen, und relativ schnell war der Punkt auf dem Tisch – und der blieb auf dem Tisch –, dass es doch erstaunlich sei, dass viele Flüchtlinge undankbar sind. Dass sie bestimmte Geschenke und Angebote, die ihnen von ehrenamtlich-barmherzigen Mehrheitsangehörigen gemacht werden, nicht annehmen. Es wurde berichtet, dass bei der Essensausgabe, bei der ein Student geholfen hat, ein Flüchtling gesagt hat, »nö, das Essen mag ich nicht«. Es war eine Mischung einerseits aus ungläubigen Erstaunen, dass diese bedürftigen Menschen Wünsche formulieren, die sie an der Grenze zum Frechen artikulieren. Zum anderen war eine Empörung im Raum, die das Sprechen über das Thema Flucht dominiert hat. Was findet statt in diesem Sprechen? Es findet statt die Illegitimierung der Flüchtlinge. Ich würde das als mikropolitische Kämpfe um die Ordnung interpretieren. Migration verstehe ich als Phänomen der Infragestellung grundlegender gesellschaftlicher Ordnungen, auch unserer Privilegien. Es ist eine doppelte Leiblichkeit, die wir gegenwärtig beobachten können. Es ist der Leib der Anderen, der Leib der geopolitisch Anderen. Solange die Leiber nur auf der Mattscheibe erscheinen, hat das eine andere phänomenale Qualität. Das sagt uns die Leibphänomenologie. Ihre Leiber hier haben eine ganz andere Wirkung, als wenn ich wüsste, dass sie hunderte von Kilometern entfernt sind. Diese Leiber der Anderen, der geopolitischen Anderen, die rücken an und auf unseren Leib. Eine doppelte Leiblichkeit also. Das rückt an unseren Leib, auch mit dem Moment der Infragestellung unserer Person und der Legitimität der Privilegien, die wir haben, von denen ich sagen würde, dass sie unverschuldet sind. Wir sind unverschuldet privilegiert. Dafür können wir – in der Regel – nichts. Dieser Umstand wird gegenwärtig problematisiert – und damit die Selbstverständlichkeit der geopolitischen Ordnung. Genau das passiert durch Migration. Die zentrale Bildungsaufgabe des 21. Jahrhunderts unter dem Label »Migrationspädagogik« ist nicht: Alle sollen Deutsch lernen. Auch wenn vielleicht, aus
103
104
Paul Mecheril
der deutschen Perspektive, das Goethe Institut das ein bisschen anders sieht. Meines Erachtens ist die zentrale Bildungsaufgabe des 21. Jahrhunderts – und ich spreche jetzt mit Wolfgang Klaf ki und seiner allgemeinen Didaktik – einen Beitrag dazu zu leisten, dass Menschen allgemeingebildet sind. Allgemeingebildet sein heißt – mit Klaf ki – unter anderem ja auch, sich in ein Verhältnis zu den epochaltypischen Schlüsselproblemen zu setzen, also zu den signifikanten Problemen, die eine bestimmte Epoche kennzeichnen. Unsere Epoche ist ganz offensichtlich gekennzeichnet durch die Prägnanz und Evidenz globaler Ungleichheit, die mit mindestens zwei Dingen zusammenhängen: erstens damit, dass wir noch nie in einer Welt gelebt haben, in der die Differenz zwischen Arm und Reich so ausgeprägt war. Das stimmt allein deshalb, weil noch nie so viele Menschen auf der Welt gelebt haben wie gegenwärtig. Zumindest in absoluten Zahlen haben wir es mit einem zuvor noch nicht gekannten Gefälle des Wohlstandes und auch der angemessenen Existenzbedingungen zu tun. Zweiter Punkt: Wir leben in global mediatisierten Gesellschaften, die die Globalität ständig präsentieren und repräsentieren. Dadurch rückt diese geopolitische Ungleichheit allen viel stärker in den Sinn. Die Auseinandersetzung mit dieser globalen Ungleichheit, manche sagen auch Ungerechtigkeit, ist meines Erachtens eine der zentralen Bildungsaufgaben des 21. Jahrhunderts. Gebildet sein im 21. Jahrhundert heißt, sich zu den epochaltypischen Schlüsselproblemen globaler Ungleichheit in ein Verhältnis zu setzen. Sie alle wissen, dass gebildet zu sein, nicht nur meint, Wissen zu akquirieren, sondern auch, sich selbst durch Wissen in Frage stellen zu lassen. Wenn Sie also hier in Linz Migrationspädagogik studieren wollen, dann betrachten Sie Ihre Curricula unter der Fragestellung, wo dieses Thema auftaucht. Wo taucht das Thema Globalität oder, wenn Sie so wollen, Glokalität auf? Wo tauchen diese Verschränkung der Welt und die darin enthaltene Ungleichheit in Ihren Curricula auf, als Auseinandersetzung nicht nur in der Politikwissenschaft, sondern in der Bildungswissenschaft? Das Bildungsziel des 21. Jahrhunderts für mich lautet Solidarität unter einander Unvertrauten. Dies würde ich gerne auch hier ansprechen. Mit »hier« meine ich einen Nationalstaat, in dem, was immer darin zum Ausdruck kommt, nahezu 30 Prozent FPÖ wählen. Das, was uns in dieser Modernität, die wir vielleicht gewollt haben, die wir auf jeden Fall zu verantworten haben, weil sie uns nicht einfach widerfahren ist, sondern wir sie erzeugt haben, das, was uns in dieser Modernität widerfährt, ist sozusagen eine Intensivierung von Unvertrautheit. Die alltäglichen Lebenszusammenhänge werden mehr und mehr geprägt durch Unvertrautheit, durch Fremdheit. Damit meine ich ganz sicher nicht Migranten. Fremdheit kommt nicht durch die sogenannten Migrantinnen ins Spiel, sondern ist konstitutiver Teil pluraler, demokratischer Gesellschaften. Unter diesen Bedingungen ist die Idee von Solidarität, die eine Solidarität unter Freunden ist – das ist das übliche Modell: eine Solidarität unter Genossen, eine Solidarität im Rahmen gemeinschaftlicher Bezüge – nicht mehr angemessen. Ich habe FPÖ gesagt, weil in meiner Innsbrucker Zeit
Es bleibt anders
im Rahmen einer Konferenz genau dies Thema war. Die FPÖ-Vertreter und ich, wir hatten sofort einen Konsens darüber, dass Solidarität wichtig ist. Das war gar kein Problem. Der Dissens, und der ist grundlegend, entsteht an dem Punkt, wo zu fragen ist, wer potentieller Adressat dieser Solidarität ist. Das sind im Rahmen identitärer Politiken – und die FPÖ vertritt eine identitäre Politik – diejenigen, mit denen ich in einem Identitätsbund stehe: Gemeinschaft, Volk, Wacker Innsbruck, was auch immer. Gehen Sie Ihre Curricula durch, inwiefern dort Beiträge geleistet werden zu dem, was Hauke Brunkhorst beispielsweise »Solidarität unter Fremden« nennt.
Zeitalter der Migration Wir leben im Zeitalter der Migration. Dazu vielleicht zwei Punkte: Dass wir im Zeitalter der Migration leben, heißt nicht, dass es Migration erst mit der Moderne gibt. Migration hat es immer schon gegeben. Es scheint immer, solange es Menschen gibt, Bewegungen von Körpern über relevante Grenzen gegeben zu haben, Ortsveränderungen, Verlagerungen des Lebensmittelpunktes, aus Interesse, aber auch aus Not. In der Moderne nimmt diese Bewegung aus verschiedenen Gründen aber zu. Aus welchen Gründen das geschieht, wäre mindestens eine eigene Vorlesungsreihe wert, die sind natürlich sehr divers. Es gibt sehr unterschiedliche Formen von Migrationen. Ich will zwei Punkte hervorheben: Der eine Punkt ist: Migration nimmt zu, weil wir in einer Welt leben, die zunehmend von Ungleichheit geprägt ist. Viele sagen – und ich finde das nicht unplausibel –, dass diese globale Ungleichheit durchaus zum Vorteil des sogenannten Westens gereicht. Nicht nur zum Vorteil, sondern durch Aktivitäten in Vergangenheit und Gegenwart des sogenannten Westens, in denen sich der Westen konstituiert, erfolgt ist. Dieser Hintergrund ist bedeutsam. Es scheint so zu sein, dass es keine ernsthaften Versuche gibt auf oberster politischer Ebene, das wirklich anzugehen. Das heißt, es wird noch eine Weile so bleiben. Das ist ein Grund für die weltweiten Migrationsbewegungen, von denen Europa sich bisher weitgehend hat abschotten können. Durch eine Intensivierung einer Grenzregimepolitik an den europäischen Grenzen, die jetzt wieder perfektioniert eingeführt werden wird, so dass wir bald wieder Ruhe haben werden, mehr oder weniger. Das heißt, es wird nicht mehr so ungemütlich sein, auf Lesbos Urlaub zu machen. Ist ja auch eine Zumutung, oder? Da will man sich erholen. Erster Punkt im Hinblick auf Migration. Der zweite Punkt ist, und der ist fast komplementär dazu: Ich betrachte transnationale Migration als Ausdruck einer modernen Programmatik. Wenn moderne Programmatik mit der sukzessiven Erweiterung der Legitimität, über sich selbst bestimmen zu dürfen, einhergeht, also wenn Moderne nicht auf der praktischen Ebene, sondern auf der programmatischen Ebene damit verknüpft ist, dass wir davon ausgehen, dass der Mensch befugt ist, auf sein Schicksal Einfluss zu nehmen,
105
106
Paul Mecheril
und zwar grundlegend. Meine Herkunft, meine ständische Herkunft, die Geburt in einen Stand ist sozusagen nicht das mich determinierende Schicksal. Als Frau in einer patriarchalen Ordnung geboren zu sein, ist das determinierende Schicksal, das in der Moderne programmatisch problematisiert wird. Wenn wir uns das vergegenwärtigen, dann ist Migration Ausdruck eines Selbstbestimmungsanspruchs. Transnationale Migration, also der Anspruch, über den Ort mitbestimmen zu können, an dem ich lebe, ist Ausdruck einer programmatischen Modernität. Migration erinnert insofern Organisationen und Institutionen an ihre Modernisierungsdefizite. Die große Chance, die mit Migrationsbewegungen verbunden ist, besteht darin die eigenen Moderne-Defizite wahrzunehmen und zu verändern. Der andere Punkt ist die Beunruhigung, die mit Migrationsphänomenen verknüpft ist. Diese Beunruhigung liegt auf drei Ebenen. Migration problematisiert das politische Wir. Wer ist das Wir? In Deutschland beispielsweise wird die Frage des politischen Wir im Hinblick auf Flüchtlinge gar nicht gestellt. Die politische Repräsentation von geflüchteten Menschen ist in Deutschland keine Frage, sie wird nicht thematisiert. Es wird im öffentlichen Raum nur über Flüchtlinge gesprochen. In den Stadtvierteln, auf der Straße, in den Projekten sprechen Geflüchtete natürlich und artikulieren sich auch als politische Subjekte. Aber im öffentlichen Raum ist das getilgt, taucht es nicht auf. Ich interpretiere dies als Praxis der hermetischen Abschottung eines politischen Wir von hier Anwesenden. Erst diese Abschottung ermöglicht die barmherzigen Inszenierungen der Zivilgesellschaft. Genau dieses Wir wird aber beständig problematisiert und befindet sich in einer Dauerkrise. Aber auch die Routinen der Institutionen werden durch Migrationsphänomene problematisiert. Zum Beispiel wird die Sprache der Institutionen durch Migrationsphänomene herausgefordert. Die Normalitätsskripts, die den Institutionen innewohnen, werden herausgefordert. Die Macht der Institutionen wird durch Migrationsphänomene besonders deutlich. Schließlich werden individuelle Privilegien problematisiert. Das Privileg, an einem sicheren Ort zu leben, das ist weltpolitisch ein Privileg, das wissen wir. Dieses Privileg, das die meisten von uns vermutlich haben werden, wird herausgefordert durch Migrationsprobleme. Migrationspädagogik, das ist vielleicht deutlich geworden, ist nicht eine Art »Migrantenpädagogik«. Also Migrationspädagogik ist nicht ein pädagogisches Angebot, das in erster Linie darauf zielt, Migrantinnen so zu fördern, dass sie an den Funktionssystemen des Gegebenen teilhaben können. Das ist nicht die erste Aufmerksamkeitsrichtung der Migrationspädagogik, sondern Migrationspädagogik ist eine Pädagogik, die versucht, im Anschluss an die Analyse der durch Migrationsbewegungen deutlich werdenden sozialen Ordnungen und hegemonialen Verhältnisse darüber nachzudenken, wie Bildungsperspektiven und Bildungsräume für alle geschaffen werden können. Für alle! Die es allen ermöglichen, angemessener in diesen geopolitisch migrationsgesellschaftlichen Verhältnissen arbeiten, leben und handeln zu können. Und mit »angemessener« meine ich, so leben, arbeiten und handeln zu können, dass weniger Gewalt gegen andere notwendig ist.
Flucht und Handlungsfähigkeit, kulturelle Bildung und globale Ungleichheit Louis Henri Seukwa im Interview mit Maren Ziese
Zusammenfassung Das Interview wirft einen (de-)konstruktivistischen Blick auf Fluchtphänomene, wobei aufgezeigt wird, welche gesellschaftlichen Mechanismen der Konstruktion eines dominanten Bildes des Flüchtlings als Opfer zugrunde liegen. Die so konstruierte Figur des Flüchtlings wird par excellence das Objekt defizitärer Ansätze und paternalistischer Haltungen in allgemeinen gesellschaftlichen Interaktionen mit Geflüchteten sowie spezifisch im (sozial-) pädagogischen Handeln. Um diesen desaströsen Effekten der Opferkonstruktion entgegenzutreten, präferiert der Autor den Ressourcenansatz als einen der wichtigsten pädagogischen Grundsätze in der Arbeit mit geflüchteten Menschen. Denn letztere sind durch ihre oft transnationalen Fluchtbiografien im Besitz zahlreicher Kompetenzen, die sich u.a. in den Resilienzfähigkeiten äußern, die ihnen ermöglichen, unzähligen Widrigkeiten eines Flüchtlingsdaseins in Deutschland zu trotzen. Dieses Plädoyer für eine kompromisslose Ressourcenorientierung wird mit Beispielen über die Funktion von ästhetischen Erfahrungen in der Geschichte von unterdrückten Völkern illustriert, um schließlich ihre Notwendigkeit für eine Pädagogik, die sich den Idealen der individuellen Emanzipation und der globalen Solidarität verpflichtet fühlt, zu betonen.
Abstract: Refuge and Agency, Cultural Education and Global Inequality This interview looks into different aspects of forced migration from a (de-)constructivist perspective, highlighting the social mechanisms that underlie the construction of the dominant image of refugees as victims. This figure of the refugee becomes the target par excellence for deficient approaches and paternalistic attitudes in social interactions with refugees in general, and in social and educational work more specifically. To counteract the disastrous effects of this construct of the ›victim,‹ the author proposes a resource-oriented approach as a key pedagogical paradigm in working with refugees. As a result of their transnational biographies, refugees have competencies at their disposal that constitute valuable resources, as shown in their resilience, which enables them to overcome the countless difficulties of being a refugee in Germany. This plea for an uncompromising application of
108
Louis Henri Seukwa im Inter view mit Maren Ziese such a resource-oriented perspective is illustrated with examples relating to the function of aesthetic experiences in the history of oppressed peoples, in order to emphasize the importance of individual emancipation and global solidarity as guiding principles in the realm of education.
Sie kritisieren, dass das Thema »Geflüchtete« in Deutschland oft von einem »Opferdiskurs« begleitet wird. Was ist damit gemeint? Mit »Opferdiskurs« meine ich ein Ensemble von Gesetzgebungen, Wissensproduktionen und Gesellschaftspraktiken, die die gesellschaftlich dominante Figur dessen, was wir Flüchtling nennen, hervorbringt. Nehmen wir beispielsweise die Genfer Flüchtlingskonvention (»Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge«) vom 28. Juli 1958, die in Verbindung mit dem Anschlussprotokoll vom 31. Januar 1967 das völkerrechtlich wichtigste Abkommen zum Schutz von Flüchtlingen im internationalen Kontext darstellt. Demnach ist ein Flüchtling eine Person, die »[…] aus der begründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung sich außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt, und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Befürchtungen nicht in Anspruch nehmen will; oder die sich als staatenlose infolge solcher Ereignisse außerhalb des Landes befindet, in welchem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt hatte, und nicht dorthin zurückkehren kann oder wegen der erwähnten Befürchtungen nicht dorthin zurückkehren will.« (Artikel 1 GFK)
Diese Definition ist eindeutig. Sie besagt, anders formuliert, dass ein Flüchtling ist, wer Opfer bestimmter Umstände in seinem Herkunftsland ist. Folglich rufen die darin für die Anerkennung als Flüchtling festgelegten Kriterien eine Opferkonstruktion hervor. Entsprechend werden Asylsuchende gezwungen, ihre Biografien so zu strukturieren, dass sie glaubhaft als Opfer von Verfolgung und Missbrauch aus politischen, religiösen, ethnischen Gründen oder wegen ihrer sexuellen Orientierung etc. erscheinen. So gesehen ist ein anerkannter Flüchtling nach der Genfer Flüchtlingskonvention grundsätzlich ein Opfer. Ein anderer folgenreicher Effekt für die Entstehung der Opferidentität des Flüchtlings, der mit diesem juristischen Diskurs verbunden ist, stellt die eindeutige Lokalisierung der Fluchtursachen in den Herkunftsländern der Geflüchteten dar. Die Zuerkennung des Flüchtlingsstatus im Ankunftsland erfolgt in ausschließlicher Einschätzung und Bewertung der gesellschaftlichen Verhältnisse im Herkunftsland des Asylsuchenden. In dieser Perspektive werden die Flüchtlinge im Raum eindeutig verortet, indem Herkunftsort und Flucht in einen kausalen und unauflösbar erscheinenden Zusammenhang gestellt werden. Ebenso wird die Tatsache der Flucht zum bestimmenden Merkmal der Biografie des
Flucht und Handlungsfähigkeit, kulturelle Bildung und globale Ungleichheit
Flüchtenden. Denn die Anerkennung oder Nichtanerkennung des Flüchtlingsstatus hat für die Flüchtenden eine wahrlich existentielle Bedeutung; es ist aber auch der entscheidende juristische Akt zur Platzierung (oder Nicht-Platzierung) des Flüchtlings im sozialen Raum der Ankunftsgesellschaft. Die Flucht wird somit gleichsam zu einer identitätsbildenden Handlung, denn die gerichtliche Anerkennung als Flüchtling bedeutet nichts anderes, als diesem eine (neue bzw. rechtmäßige) Identität zuzusprechen: eben die des Flüchtlings. Diskurs- und Rechtspraktiken, in denen Identitäten konstruiert werden in monokausalen und vereindeutigenden Bezügen zu einzelnen Merkmalen von Individuen oder sozialen Gruppen – seien es Geschlecht, Rasse, sexuelle Orientierung, Behinderung etc. –, solche Konstruktionspraktiken werden identitätstheoretisch als naturalisierend oder essentialisierend charakterisiert. Den flüchtenden Menschen wird im Asylrecht des Aufnahmelandes eine Identität zugeordnet, die umfassend über sie bestimmt. Zum identitätsbestimmenden Merkmal wird stilisiert, ein Flüchtling zu sein, alle anderen Persönlichkeitsmerkmale werden diesem einen Kriterium nach- und untergeordnet. Die gesamte individuelle Lebenslage des Flüchtlings wird in ihren rechtlichen, ökonomischen und sozialen Dimensionen aus diesem einen Kriterium – essentialisierend – strukturiert, der Zugang und die Verfügungsmacht zu Ressourcen abgeleitet und geregelt. Naturalisierend ist diese Identitätskonstruktion deshalb, weil darin die Wahrnehmung der Flüchtlingsidentität als »natürlich« und selbstverständlich gegeben betrachtet, nicht aber als in Diskurs- und Rechtspraxen konstituiert und somit als artifiziell verstanden wird. Nun ist das Herkunftsland, worauf ein monokausaler Bezug für die Zuerkennung des Flüchtlingsstatus im Ankunftsland genommen wird, ein Ort des Umbruchs, ein Ort, an dem das Leben für viele Menschen nicht mehr lebenswert ist, ein Ort, der Flucht verursacht, der Menschen zu Flüchtlingen macht. Diese Menschen sind Opfer der Umstände dort und die Aufnahmeländer sind ihre Retter. Die essentialisierenden und naturalisierenden Diskurse, die durch eine ausschließliche Lokalisierung der Fluchtursachen in den Herkunftsländern der Flüchtenden ermöglicht werden, blenden nicht nur die globalen Zusammenhänge der Fluchtursachen aus, wobei die Aufnahmeländer in deren Produktion verstrickt sind, sowie die Tatsache, dass es die Aufnahmeländer sind, die Asyl gewähren, also Menschen den Flüchtlingsstatus verleihen, sondern dadurch wird auch die Opferkonstruktion des Flüchtlings als hilfsbedürftig und die Position der Aufnahmeländer als Retter und Helfer legitimiert. Der als Opfer konstruierte Flüchtling ist in diesem Zusammenhang der ›wahre Flüchtling‹. Die Attribute, die mit dieser Figur assoziiert werden, sind: Elend, Traurigkeit, Leidensfähigkeit, Bescheidenheit, Gehorsamkeit, Dankbarkeit und so weiter. Dies ermöglicht einem großen Teil der »Helfer*innen«, die Flüchtlingsarbeit leisten, sich in der Interaktion als überlegen zu positionieren und den betreuten Flüchtlingen mit paternalistischen und Mitleidshaltungen zu begegnen. Eine reflexive Distanz zu »Viktimisierungsdiskursen« ist m.E. also hier erforderlich, um ihre problematischen Effekte zu meiden und sich gleichzeitig einer Instrumentalisierung für
109
110
Louis Henri Seukwa im Inter view mit Maren Ziese
»Flüchtlingsabwehrdiskurse« zu entziehen, letzteres insbesondere, wenn (Migrations-)Strategien und Ressourcen betrachtet werden, die nicht zum Konzept des Flüchtlings als »hilfloses Opfer« passen. Denn nicht selten wird das wohlwollende Mitgefühl der »Helfer*innen« zu enttäuschtem Zynismus, wenn die Geflüchteten zügig wieder autonom und handlungsfähig werden und somit dem gesellschaftlichen Opferklischee nicht mehr entsprechen. Es scheint mir daher wichtig, sich den Fallstricken der »political correctness« zu stellen und differenziertere Sichtweisen auf die Lebenslagen der Flüchtlinge zu ermöglichen. Ein weiterer und letzter erwähnenswerter Mechanismus, den die Opferkonstruktion bewirkt, stellt die Logik der Zielgruppenkonstruktion sowie die Finanzierung und Zuwendungslogik in der Sozialen Arbeit dar. Diese bewirkt, dass das »Klientel« immer als defizitär dargestellt werden muss, als eine Art Mangelwesen. Die pädagogischen Maßnahmen, die dementsprechend nur kompensatorisch sein können, sollen helfen, diese Defizite oder diesen Mangel zu beseitigen. Tatsächlich sind Flüchtlinge genau wie alle anderen Menschen jedoch Personen mit Kompetenzen, mit Stärken, mit Ressourcen, die Grundlage für jede sinnvolle pädagogische Arbeit sind. Selbstverständlich haben einige Geflüchtete besonderen Unterstützungsbedarf, zum Beispiel bei der Bewältigung von Traumata, aber auch dies sollten wir nicht verallgemeinern. Kurzum, wenn wir als Pädagogen die Ideale der Emanzipation und Handlungsfähigkeit von Subjekten ernst meinen in der Bildungsarbeit mit Geflüchteten, müssen wir weg von dieser Opferkonstruktion und ihre Ressourcen zum Ausgangspunkt zu nehmen. Das heißt, wir brauchen einen Perspektivwechsel, wir müssen den Opferdiskurs hinter uns lassen. Diese Ressourcen-Orientierung Ihres Ansatzes hängt mit dem Begriff der Überlebenskunst zusammen? Gewissermaßen ja! Der Überlebenskunstbegriff ist im Grunde genommen ein theoretisches Instrument, mit dem ich versuche, Handlungsfähigkeit unter der Bedingung von Heteronomie zu beschreiben und zu analysieren. Und somit ein Beitrag zu der in unseren heutigen Gesellschaften bedeutsam bleibenden Debatte des Subjektkonstitutionsprozesses, so wie dieser sich in der andauernden Konfrontation und Auseinandersetzung mit den entfremdenden Sozialstrukturen vollzieht. Dass Geflüchtete es nicht nur aufgrund der schon angesprochenen diskursiven Konstruktionen in der Gesellschaft schwer haben, sondern auch ihre Lebenslage und ihr Alltag in hohem Maße negativ bestimmt ist, zeigen uns unmissverständlich alle Untersuchungen, die wir seit 15 Jahren mit und über Flüchtlinge in Deutschland durchgeführt haben. Dies ist auf eine essentiell auf Abschottung und Abschreckung gerichtete Asylpolitik zurückzuführen, die mit Rechtsdispositiven einhergeht, kombiniert mit restriktivem behördlichem Handeln bei ihrer Umsetzung sowie sozialen Stigmatisierungen und Rassismus. Trotz der desaströsen Effekte dieses Asylregimes auf die Integrationsbemühungen von Flüchtlingen in die verschiedenen gesellschaftlichen Funktionssysteme, wie das Bildungssystem, Ge-
Flucht und Handlungsfähigkeit, kulturelle Bildung und globale Ungleichheit
sundheitssystem, Arbeitssystem etc., zeigen mehrere Untersuchungen, dass viele von ihnen in ihren Bildungsambitionen – um uns nur auf dieses Feld zu limitieren –, erstaunlich erfolgreich sind. Dies hat mich neugierig gemacht und dazu bewegt, zu untersuchen, auf welche Ressourcen und Kompetenzen solche Flüchtlinge mit ungesichertem Aufenthaltsstatus sich stützen (können), um trotz all der Widrigkeiten, die oft ihr alltägliches Leben in Deutschland kennzeichnen, handlungsfähig zu bleiben und erfolgreich in ihren Bildungsbestrebungen zu sein. Die biografische Narration der Geflüchteten, ihre langjährige Alltagsbegleitung und Beobachtungen machen tatsächlich Vorgehensweisen deutlich, die eine ganze Reihe von Taktiken zu Tage bringt. Mit Hilfe dieser Taktiken werden repressive Maßnahmen spielerisch umgangen. In der Falle einer unerwarteten Notlage gefangen, ist es eine wahre Kunst, sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen. Es ist die Kunst der Transgression, die es durch die Kombination von verschiedenen Taktiken ermöglicht, innerhalb eines restriktiven und repressiven Systems, wie es die aus dem Asylrecht abgeleiteten Maßnahmen bilden, zu überleben, ohne es zu verlassen oder sich damit abzufinden. Man muss mitmachen, indem man etwas damit macht. Bei diesen Kriegslisten gibt es so etwas wie die Kunst, einen Coup zu landen, gewissermaßen ein Vergnügen daran, die Regeln einer aufgezwungenen Umwelt auf den Kopf zu stellen. Diese Kompetenz, die sich u.a. in der Resilienzfähigkeit äußert, selbst in Situationen extremer Fremdbestimmung Formen der Selbstgestaltung zu entfalten und Bildungserfolge zu erzielen, wie sie sich beispielsweise aus dem prekären Status der Asylbewerberinnen und Flüchtlinge in Deutschland ergibt, habe ich »Habitus der Überlebenskunst« genannt. Welche Beiträge liefert aus Ihrer Sicht die Fluchtforschung für die Kulturelle Bildung mit Geflüchteten? Die Frage ist komplex und bedarf einer Differenzierung. Fangen wir mit der Fluchtforschung an; ohne den geringsten Anspruch, exhaustiv zu sein, möchte ich mich hier auf nur drei m.E. wichtige Erkenntnisse beziehen: (1) auf Forschungen über Fluchtursachen, (2) auf Forschungen über die Fluchtwege und (3) auf die methodologischen Vorzüge der Flüchtlingsforschung für eine kritische Gesellschaftsanalyse, bevor ich mögliche Konsequenzen dieser Erkenntnisse für die kulturelle Bildung mit Geflüchteten anspreche. (1) Es hat sich, was die Fluchtursachen angeht, die Sichtweise etabliert, dass sie sinnvollerweise nur im globalen Zusammenhang zu begreifen sind. Und zwar, weil es die globalen Strukturen der Ungleichheiten sind, an deren Produktion Europa und generell der Westen durch die rücksichtslose Praxis von ungleichem Handel, Militärinterventionen zur Sicherung von natürlichen Ressourcen und geostrategischen Interessen, Entwicklungshilfe – oder besser: »tödlicher Hilfe« – etc. maßgeblich beteiligt ist, die ökologische und soziale Umbrüche in den Herkunftsregionen verursachen und die dort lebenden Menschen in die Flucht treiben. So lässt sich der Reichtum und die politische Stabilität der Länder des
111
112
Louis Henri Seukwa im Inter view mit Maren Ziese
sogenannten globalen Nordens kausal nicht von der Armut und der politischen Instabilität der Länder des globalen Südens (push-pull-Faktoren) und der damit einhergehenden Flucht der Bevölkerung trennen. Es ist mit anderen Worten illusorisch zu glauben, dass wir als Land und Mitglied der Europäischen Gemeinschaft, durch die rücksichtslose Vertretung unserer nationalen und gemeinschaftlichen Interessen weltweit immer mehr Fluchtgründe schaffend, die ausgebeuteten und verarmten Menschen daran hindern können, hierher zu kommen, zumal unser Leben in Wohlstand – dank medialer Macht – überall auf dem Globus wahrgenommen wird. Flüchtlinge sind insofern die bittere Rendite unserer Sicherheits-, Wachstums- und Wohlstandsideologien, die weltweit Inhumanität verbreiten und »Zombies« fabrizieren. Eben deshalb kommt den Ländern des Nordens auch eine erweiterte Verantwortung in der Lösung der Flüchtlingsproblematik zu: Verantwortlich können sie nicht nur für die Versorgung der Flüchtlinge sein, denen die Flucht bis in den Norden gelingt, vielmehr leitet sich aufgrund der Verstrickung in der Verursachung von Flucht eine besondere Verantwortung zur Bereitstellung von Ressourcen zur Beseitigung fluchtproduzierender Strukturen in den Herkunftsländern der Flüchtlinge ab. Die ethische Begründung für eine aktive Mitarbeit bei der Bewältigung der Flüchtlingsproblematik ist also nicht nur aus allgemeinen humanitären Argumenten abzuleiten, sondern aus dem Tatbestand der Mitverursachung oder der vorsätzlichen Nicht-Verhinderung der fluchtproduzierenden Ursachen. (2) Ein zweiter wichtiger Ertrag der Fluchtforschung scheinen mir die immer systematischer werdenden Rekonstruktionen der Fluchtwege zu sein, die Schutzsuchende nach Europa führen. Diese Rekonstruktionen der Fluchtwege, vor allem unter Berücksichtigung der essentiell auf Repression und Abschottung zielenden Grenzregimes der Europäischen Union, zeigen deutlich, dass die transnationalen Fluchtwege eher einem Kreuzweg mit mehreren Stationen des Leidens gleichkommen, der jedoch nicht zu einem Tod führt, worauf sich die Verheißung einer hoffnungsvollen Zukunft für die Menschheit begründen ließe. Nein, Golgota, als paradigmatische Endstation des Kreuzweges, ist für viele Geflüchtete das Mittelmeer geworden, wo sie fortan dank ihrer großen Menge wahrlich keine Rarität mehr sind auf der makabren Speisekarte einiger Fische sowie anderer Meeresmonster, die unsere Fantasien bewohnen! Sinnlose Tote also, die wir in dem Abschottungswahn, der ein Markenzeichen Europas in diesem Jahrhundert zu sein scheint, nicht nur in Kauf nehmen, sondern auch als Abschreckungsinstrument einkalkulieren. Bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist die unaufhörliche Selbstinszenierung Europas als Gemeinschaft mit gemeinsamen Werten, die auf Humanismus fuße und universellen Charakter habe. Von welchem Menschen sprechen wir in diesem Humanismus, der sich historisch als partikular, gar ethnisch erwiesen hat, und dessen behauptete Universalität sich für die Verdammten dieser Erde immer wieder als abstraktes und gefährliches Gerede zeigt, das zur Legitimation von unsagbaren Verbrechen Europas gegenüber der Menschheit in an-
Flucht und Handlungsfähigkeit, kulturelle Bildung und globale Ungleichheit
deren Regionen der Welt gedient hat und immer noch dient? Denn eine nähere Betrachtung der Handlungslogik offenbart eine immense Kluft zwischen einerseits der Ordnung der Praxis, die auf einer instrumentellen Rationalität basiert, einer Art Reptilienintelligenz, die sich weltweit in Gestalt von Raubtierverhalten – sprich Kolonialismus und seine Korollare, wie Genozide, Epistemizide, Zombifizierung von Menschen – manifestiert, und anderseits der Ordnung der Diskurse, die auf Normativitäten wie Menschenrechte, Demokratie etc. fußen und deren Funktion die Rationalisierung der inhumanen Machenschaften in der Ordnung der Praxis ist. So kann die Barbarei der Kolonisierung zur Entdeckung der Welt und ihrer Zivilisierung werden, Genozide der autochthonen Einwohner werden zum Bevölkerungsaustausch, Entfremdung und Ausbeutungsprozesse werden zur Entwicklungshilfe etc. Die Handlungslogik Europas in der aktuellen als »Krise« bezeichneten Flüchtlingsfrage ist in ihren Grundzügen ein Déjà-vu. Die physische, institutionelle und symbolische Gewalt, die aus einer solchen Handlungslogik entspringt, zeigt sich aktuell beispielsweise im deutschen Kontext u.a. in Stigmatisierungsdiskursen gegenüber Geflüchteten und denjenigen, die sich mit ihnen solidarisieren, in Gesetzgebungen – den sogenannten »Asylpaketen« –, die das Recht auf Asyl substantiell aushöhlen, in Disziplinierungsund Assimilationsgewalt, die missbräuchlich »Integrationspaket« genannt wird, sowie in einer wachsenden Zahl von sogenannten »besorgten Bürgern«, deren Angst vor »Überfremdung im eigenen Land« so groß und für die Politik so wichtig zu sein scheint, dass Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte und deren Bewohner und Bewohnerinnen, die kausal in Relation zu den Sorgen dieser Bürger stehen, zu abstrakten Statistiken verkommen, die ab und zu mal in den Medien erwähnt werden. Die Handlungslogik Europas in der Flüchtlingsfrage ist mit anderen Worten eine Metonymie der westlichen Rationalität. Immer mehr drängt sich die Frage auf, was diese gebetsmühlenartig proklamierten Werte Europas angesichts der Flüchtlingstragödie überhaupt noch wert sind. (3) Der dritte Ertrag der Fluchtforschung, den ich hier ansprechen möchte, bezieht sich auf die methodologischen Vorzüge der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit den Flüchtlingsbiografien in den Aufnahmeländern für eine kritische Gesellschaftsanalyse. Als extrem marginalisierte Gruppe und Subjekte ermöglichen beispielweise die Biografien von Flüchtlingen mit ungesichertem Aufenthaltsstatus eine Untersuchung der Aufnahmegesellschaften von ihren Rändern her. Diese Vorgehensweise hat sich im Fall Deutschlands als sehr geeignete Basis für die Analyse der Machtstrukturen und Ausschlussmechanismen in der deutschen Sozial- und Integrationspolitik erwiesen. Denn der »Flüchtling« erscheint als eine soziale Produktion, dessen miserablen Lebensbedingungen durch ihre Unausweichlichkeit viel über die Natur des Systems aussagen, das sie hervorgebracht hat. Die Flüchtlingsbiografien als Spiegelung der diffusen Machtmechanismen eines ideologischen Systems eröffnen eine dezentrierte Perspektive auf soziale Prozesse, die einen Einblick in ihren Gesamtzusammen-
113
114
Louis Henri Seukwa im Inter view mit Maren Ziese
hang erlauben. Um eine sprachliche Anleihe aus der Fotografie zu nehmen: Als Untersuchungsgegenstand stellen Flüchtlingsbiografien eine Art »Negativ« dar, das es zulässt, ein Bild des Netzwerks repressiver Zwänge zu erhalten, welches die herrschenden Systeme, wenn sie von innen heraus betrachtet werden, nur sehr unfreiwillig preisgeben. Der Flüchtling kann von diesem Gesichtspunkt aus als der »unanfechtbarer Zeuge« der herrschenden Systeme mit ihren Entfremdungsstrukturen und Marginalisierungsmechanismen angesehen werden. Die unhintergehbaren Erfahrungen des Flüchtlings, die auf den Ausschluss und die Marginalisierung als Effekte der besagten Systeme fokussieren, werden so selbst zum Gegenstand der Reflexion und ermöglichen, das ins Zentrum der Analyse zu rücken, was an den Rand gedrängt war. Was können nun die möglichen Konsequenzen dieser Erkenntnisse für die Kulturelle Bildung mit Geflüchteten sein? Ein Blick zurück in die Widerstandsgeschichte der unterdrückten Völker zeigt unmissverständlich, welchen Platz Kunst und Kultur dort eingenommen haben. Die artistische und ästhetische Erfahrung ist im Kontext von Sklaverei und Kolonialherrschaft das Medium par excellence gewesen, das es den Leidenden ermöglicht hat, ihren rational unsagbaren Schmerzen Ausdruck zu verleihen. W.E.B. Dubois spricht in seiner brillanten Analyse der Lieder von versklavten Menschen in Amerika von den »alten mysteriösen Liedern, wodurch die Seele der versklavten Schwarzen zu der Menschheit gesprochen hat.« Lassen Sie uns eine Strophe davon kosten! »I walk through the churchyard To lay this body down; I know moon-rise, I know star-rise; I walk in the moonlight, I walk in the starlight; I’ll lie in the grave and stretch out my arms, I’ll go to judgment in the evening of the day, And my soul and thy soul shall meet that day, When I lay this body down.«
Da jedoch das ethische Substrat jeder künstlerischen Tätigkeit darin besteht, den Menschen alternative Vorstellungen und Zugänge zu den gegebenen Realitäten zu ermöglichen, ist die ästhetische Performanz unter Bedingungen von Entmenschlichung und Unterjochung dafür prädestiniert, nicht nur den erfahrenen Schmerzen Ausdruck zu verleihen, sondern auch das Leiden zu sublimieren und dadurch Hoffnung für die Zukunft zu schöpfen. Es lohnt sich die Motive von Soul, Jazz und Reggae aus dieser Perspektive zu betrachten. Hören Sie Bob Marley im »Redemption Song«, wie er mit einer kaum zu übertreffenden Genialität sowohl die Leidensgeschichte der versklavten Menschen als auch die Verheißung einer hoffnungsvollen Zukunft artikuliert!
Flucht und Handlungsfähigkeit, kulturelle Bildung und globale Ungleichheit Redemption song Old pirates, yes, they rob I Sold I to the merchant ships Minutes after they took I From the bottomless pit. But my hand was made strong By the ’and of the almighty. We forward in this generation Triumphantly. Won’t you help to sing These songs of freedom? ’cause all I ever have: Redemption songs Redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy ’cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets While we stand aside and look? ooh! Some say it’s just a part of it: We’ve got to fulfil the book. Erlösungslied Die alten Piraten, ja, sie haben mich verschleppt; Verkauften mich an die Handelsschiffe, Minuten nachdem sie mich mitgenommen hatten Aus der bodenlosen Untiefe. Meine Hand jedoch wurde gestärkt Durch die Hand des Allmächtigen. Wir erheben uns in dieser Generation Triumphierend. Möchtest du nicht helfen Diese Freiheitslieder zu singen Denn alles, was ich jemals hatte: Erlösungslieder; Erlösungslieder. Emanzipiert euch von geistiger Sklaverei; Niemand außer uns selbst kann unseren Geist befreien. Habt keine Angst vor Atomenergie, Denn keiner von ihnen kann die Zeit aufhalten. Wie lange sollen sie noch unsere Propheten töten Während wir danebenstehen und zuschauen? Ooh! Manche sagen, dass sei ein Teil davon: Wir haben die biblischen Prophezeiungen zu erfüllen.
115
116
Louis Henri Seukwa im Inter view mit Maren Ziese
Kunst ist aus der hier erwähnten Perspektive zugleich gelebte Utopie. So wird im Jazz geraubte Freiheit wiedererobert, wobei dank der Kanonisierung der Improvisation keine Orthodoxie des Genres mehr respektiert und somit auch Grenzen abgeschafft und Chaos als neue Ordnung zelebriert wird. Durch den transgressiven Gebrauch von Instrumenten, die von den Sklavenbesitzern erfunden wurden, wie Kontrabass, Saxophone etc., wird die Identitätsproduktion als Grundlage für rassistische Ideologien dekonstruiert und in dieser Weise die Hybridität von Genre, Rhythmen und Stil als Metapher einer gemeinsamen Zukunft in Freiheit von Unterdrückern und Unterdrückten proklamiert. Dies ist die Botschaft, die die Geschichte des Jazz als ästhetischer Ausdrucksform unter Bedingungen von Unterjochung und Entmenschlichung von versklavten Menschen uns sendet. Darin ist die problematische, jedoch sehr reale Dichotomie von Täter und Opfer überwunden. Ein dritter Raum wird von den Opfern geschaffen, wo gemeinsam mit den Tätern Menschsein und Menschlichkeit in geteilter und gelebter Freiheit erfahren wird, wo wahrlich liberté, fraternité, égalité keine ideologische Formel oder ein Privileg des weißen Menschen sind. In den Bemühungen, die Täter-Opfer-Helfer-Konstruktion, die strukturierend in mehrere Arbeitsfelder mit Flüchtlingen in Deutschland wirkt, zu überwinden, können wir uns m.E. von einem solchen Model inspirieren lassen. Last but not least sollen hier die Darstellenden Künste erwähnt werden. Theater beispielsweise ermöglicht als intermediale Kunst die szenische Kombination von verschiedenen künstlerischen Elementen, wie Musik, Poesie, Bühnenbild, Tanz etc. und deren Performanz, und erhöht somit auch die kreative Komplexität. Diese Möglichkeit bildet zugleich die Grundlage für die spielerische Darstellung von gleichfalls komplexen und subtilen Mechanismen der Macht und Unterdrückungen, wie sie aktuell in postmodernen Gesellschaften existieren. Der Flüchtlingsraum in Deutschland ist paradigmatisch für einen derart strukturierten Raum der Heteronomie. Denn durch die Verflechtung von äußerst restriktiven Asylgesetzen, demütigenden Behördenpraktiken, medialen Stigmatisierungen, institutionalisierten und Alltagsrassismen etc. wird der Flüchtlingsraum in Anlehnung an Goffmann zum »totalen Raum«, gewissermaßen ein offenes Gefängnis. All dies bildet das, was wir mit Michel Foucault »Asyl Dispositiv« nennen können. Unter Dispositiv versteht er ein Ensemble von Diskursen und Praktiken, das es einem Staat ermöglicht, auf einen Notstand zu reagieren und somit Zugriff auf das Phänomen zu haben. In Theaterstücken wird zunehmend das Asyldispositiv performiert. Die Mikrophysik der Macht und die Struktur der hegemonialen Verhältnisse, worunter Asylsuchende in angeblich »offenen« Gesellschaften leben müssen, werden inszeniert und ihre Subtilitäten offenbart. Zu dieser gesellschaftskritischen Funktion von Theater kommt der Kampf um die Repräsentation bzw. Selbstpräsentation hinzu, d.h. die Möglichkeit und Fähigkeit für Geflüchtete, für sich zu sprechen, dank theatralischer Performanz. So wird beispielsweise in der hamburgischen Premiere des Stücks »Die Schutzbefohlenen« von Elfriede Jelinek dieses Dilemma der Repräsentation von Benachteiligten
Flucht und Handlungsfähigkeit, kulturelle Bildung und globale Ungleichheit
durch Dritte in einer Szene im Chor auf den Punkt gebracht: »Wir können euch nicht helfen, wir müssen euch ja spielen!« Es wird versucht, dieses Dilemma, das sich – so das Problem – in der Ausübung einer symbolischen Gewalt äußert, wobei die Unterdrückten als »Objekt« der Repräsentation durch Dritte deklassiert würden, zu umgehen, indem manche Theaterstücke nur von Geflüchteten selbst performiert werden. Ihre Präsenz auf der Bühne beansprucht, ein Akt der Subjektaffirmation zu sein, wobei sie sich diskursiv einmischen, indem sie die mit ihrer Unterdrückung einhergehenden Bedingungen, Mechanismen und Erfahrungen etc. selbst (re-)präsentieren, dramatisch darstellen oder auch ins Lächerliche ziehen. Dies kann ein sehr spielerischer Umgang mit repressiven Techniken der Macht sein, der etwas Transgressives in sich hat. Transgressionen stellen in diesem Fall Grenzüberschreitungen innerhalb des Asyldispositivs dar, dem Geflüchtete nicht entfliehen, jedoch damit umgehen können, indem es künstlerisch sublimiert wird. Nun – so hoffe ich –, ist deutlich geworden, in welchem fruchtbaren Verhältnis Kunst und Unterdrückung stehen und welche Funktionen künstlerische Produktionen unter heteronomen Bedingungen für die Benachteiligten – in diesem Fall die Geflüchteten – haben können. Es gilt in der kunst- und kulturbezogenen Bildungsarbeit mit Geflüchteten als oberste Maxime, die Wiederholung der Gewalt, die diese Menschen schon erlebt haben, durch eine instruktive und defizitorientierte Pädagogik zu vermeiden. Denn eine autoritäre Pädagogik, die die ästhetische Sensibilität von Geflüchteten symbolisch deklassiert und missachtet, also diese nicht ins Zentrum des Bildungsprozesses stellt, ist nicht nur pädagogisch kontraproduktiv, sondern wirkt zudem für diese Bildungssubjekte unter erschwerten Lebenslagen entfremdend. Wie schon dargestellt, sind die Leidenserfahrungen von Geflüchteten eine unschätzbare Quelle der künstlerischen Produktion. Die Förderung dieser verborgenen Schätze, die als mitgebrachte Kompetenzen fungieren, soll Anlass, Gegenstand und Zielhorizont jeder pädagogischen Praxis sein, die auf Subjektemanzipation und individuelle Handlungsfähigkeit von Geflüchteten zielt. Diese Zielsetzung stellt m.E. eine der zentralen Qualitätsmerkmale der kulturellen Bildungsarbeit mit Geflüchteten dar – und daran soll sie u.a. auch gemessen werden. Es handelt sich in einer derart Ressourcenorientierten Vorgehensweise um ein epistemisches, normatives Projekt, dessen Ziel darin besteht, (1) die Kompetenzen der Geflüchteten zu erkennen, (2) diese durch ihre Sichtbarmachung zu objektivieren und (3) sie wertzuschätzen, also anzuerkennen. Nur auf diese Weise wird m.E. die ästhetische Bildung für Geflüchtete ihrer für diese Zielgruppe so notwendigen, befreienden Funktion gerecht werden können.
117
118
Louis Henri Seukwa im Inter view mit Maren Ziese
Welche Aufgaben hat die Pädagogik im 21. Jahrhundert in Hinblick auf globale Ungleichheit und Bildung? Das ist eine große Frage: Ich verstehe die Pädagogik immer als ein Handeln, als ein Tun. Wie wir handeln, hängt davon ab, welches Bild wir von uns als Pädagogen oder als Handelnde im pädagogischen System haben. Dabei sind die Klärung der normativen Standpunkte bei der Zielsetzung und des Rollenverständnisses in der Praxis m.E. fundamental. Angesichts der angesprochen Problematik der globalen Ungleichheit scheint mir die kollektive und individuelle Emanzipation sowie die globale Solidarität als Zielsetzung angemessen. Dabei sollte sowohl auf die ungleichheitsproduzierenden Strukturen fokussiert werden als auch auf die Individuen und Kollektive, die sich in diesen Strukturen befinden. Für eine pädagogische Praxis, die sich mit Folgen der globalen Ungleichheit für Bildungsprozesse auseinandersetzen will, ist die Annahme der transnationalen Perspektive unabdingbar. Und zwar, weil Flucht und Migration für Bildungssysteme der europäischen Länder zweifelsohne zu den sichtbarsten Folgen globaler Ungleichheiten geworden sind. In diesem Zusammenhang besteht ein wichtiger durch den Transmigrationsforschungsansatz für die Erziehungswissenschaft erzielter Erkenntnisgewinn darin, dass eine institutionell organisierte Erziehungs- und Bildungspraxis, die dem Ziel der Emanzipation von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund gerecht werden möchte, es sich nicht leisten kann, die bloße pädagogische Assimilation dieses Klientels im System der Aufnahmeländer anzustreben. Weil ihre Bildungsorientierung, Zukunftsplanung, Lebensentwürfe und Kompetenzen sich oft durch als transnational zu bezeichnende Erfahrungen und Sozialisation konstituiert haben, sind sie tendenziell komplexer bzw. reicher, als wenn sie lediglich in einem einzigen Kontext erworben würden. Aus diesem Grund bedeutet eine Assimilation im System des Aufnahmelandes für diese biografiebedingt komplexen und vielfältigen Kompetenzen der betroffenen Migrantinnen und Migranten de facto eine Verarmung. Mit anderen Worten, die transnationale Perspektive ermöglicht den ressourcenorientierten Ansatz im Sinne einer Einbeziehung der Migrantenperspektive, die Wahrnehmung und Nutzung ihrer multikontextuellen Sozialisationserfahrungen einschließlich der damit einhergehenden Kompetenzen als strukturierende Elemente in der Gestaltung von emanzipatorischen Bildungsprozessen auch für Migrant*innen. Daraus ergibt sich für die Praxis ein Rollenverständnis der Pädagogen, das auf Ermöglichung fußt. Der Pädagoge versteht sich hier als Geburtshelfer, als Hebamme, die zur Aktualisierung von mitgebrachten Kompetenzen der Lernenden respektive zur Kapitalisierung dieser Kompetenzen als Bildungsressource verhilft. Für das Erreichen des erwähnten Ziels der globalen Solidarität scheint es mir notwendig – zumindest, was das formale Bildungssystem angeht –, eine Reform der Curricula einzuleiten, wobei nicht mehr abstrakt über globale Ungleichheit gesprochen wird. Eine historische Rekonstruktion und Archäologie der Entstehung dieser Ungleichheiten sind unabdingbar, wobei die unrühmliche Rolle der westlichen Staaten darin, damals und heute, schonungslos klargestellt und den
Flucht und Handlungsfähigkeit, kulturelle Bildung und globale Ungleichheit
Lernenden vermittelt wird. Die Zielperspektive soll hier nicht die Schuldzuweisung sein, sondern eine radikale Diagnose, die zum Einen dafür sorgen wird, dass Ursachen und Folgen sowie Probleme und Lösungen nicht durcheinandergebracht werden, und zum Zweiten, dass der Verweigerung, Verantwortung zu übernehmen, die faktische Grundlage entzogen wird. Zu guter Letzt möchte ich darauf hinweisen, dass allein die Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsperspektive mir einen realistischen Ausweg aus der Logik des Egoismus einzelner mächtiger Staaten oder Staatsgemeinschaften zu bieten scheint. Denn viele lokal auftretende Probleme, wie Flüchtlingsströmungen, Klimawandel, Terrorismus etc., sind global verursacht und ihre nachhaltige Bewältigung auch nur global möglich. Mit anderen Worten, die Menschheit sitzt in einem Boot auf stürmischer See. Die mächtigen Staaten dieser Welt mögen sich zur Zeit noch sicher fühlen, weil sie sich auf der Brücke aufhalten, sinkt das Schiff, sind jedoch alle gleichermaßen verloren. Das Nachhaltigkeitsgebot lautet also: Wir werden gemeinsam als Partner die globalen Probleme bewältigen oder egoistisch individuell sterben.
119
3. Künstlerische und aktivistische Positionen — Artistic and Activist Positions
»The Infiltrators« Crossing borders with participatory art Maayan Sheleff
Abstract In the spring of 2014, the exhibition »The Infiltrators« opened in South Tel Aviv, Israel. It examined the state of asylum seekers through participatory projects, reflexively exploring the notion of participatory art as constituting an act of infiltration. Reclaiming the term »Infiltrators« that was coined as a derogatory reference to the African asylum seekers in Israel, the infiltrating art attempted to destabilize power positions and undermine identity preconceptions. In this article, exhibition curator Maayan Sheleff describes the exhibition and work process, with works by Ghana Think Tank, Documentary Embroidery, and Daniel Landau – new commissions that engaged communities of African asylum seekers in Israel. The article focuses on the artistic conflict resolution methods of Ghana Think Tank, that engaged both asylum seekers and Israeli citizens, and the questions that they raise regarding agency, ethics, and art’s potential of instigating change. The article also addresses the parallels between the current state of affairs in Europe to the situation in Israel, through discussion of the film Ausländer Raus! Schlingensief’s Container, by Paul Poet, also included in the exhibition.
Zusammenfassung: Mit partizipativer Kunst Grenzen überschreiten Im Frühling 2014 eröffnete in Süd-Tel Aviv, Israel, die Ausstellung »The Infiltrators«. Sie untersuchte die Situation von Asylbewerber_innen mit Hilfe von partizipatorischen Projekten und befasste sich reflexiv mit der Idee von Partizipationskunst als einem Akt der »Infiltration« (Unterwanderung, Eindringen). Durch die Neubewertung und Rückgewinnung des Begriffs »Infiltrators«, der als herabwürdigende Bezeichnung für afrikanische Asylbewerber_innen in Israel geprägt wurde, zielt die »infiltrierende Kunst« darauf ab, Machtpositionen zu destabilisieren und Vorurteile gegenüber Identitäten zu untergraben. In ihrem Beitrag beschreibt die Ausstellungskuratorin Maayan Sheleff ihren Arbeitsprozess und die Ausstellung mit Werken von Ghana Think Tank, Documentary Embroidery und Daniel Landau – neue Auftragsarbeiten, für die Gemeinschaften von afrikanischen Asylbewerber_innen in Israel engagiert wurden. Der Aufsatz fokussiert einerseits auf die künstlerischen Methoden der Konfliktlösung von Ghana Think Tank, die sowohl Asylbewerber_innen als auch israelische Bürger_innen beschäftigten. Andererseits konzentriert er sich auf die Fragen, die sie zu den Themen Stellvertretung und Ethik aufwerfen sowie zu dem Potential von
124
Maayan Sheleff Kunst, Veränderungen anzustoßen. Der Artikel verdeutlicht zudem die Parallelen zwischen der aktuellen Situation in Europa und der in Israel, vor allem durch die Diskussion des Films »Ausländer Raus! Schlingensiefs Container« von Paul Poet, der ebenfalls in der Ausstellung zu sehen war.
In Israel, the term »infiltrators« is used to describe the transgression of the country’s political borders in order to commit a terrorist act, while the more general meaning of this term describes the hostile crossing of enemy lines or the covert transgression of a given territory’s borders for the purpose of espionage, a political coup, or a gradual conquest. At present, this term is commonly used to refer to Africans who have crossed the border from Africa into Israel; alongside additional terms such as »refugees,« »asylum seekers,« and »immigrant workers,« it plays an important role in the discussion of the status and future of these groups. In this context, the term »infiltrators« fixes the status of border crossers as that of liminal subjects who remain trapped between here and there, citizens of a no place. In the spring of 2014, the exhibition The Infiltrators opened in Artport, a non-profit art organization located in South Tel Aviv. The exhibition examined the local and global state of asylum seekers and refugees through works created with the participation of communities of asylum seekers in Israel and elsewhere in the world. The exhibition title played a double role, since it aspired to look at the included art projects as constituting an act of infiltration. The featured artists attempted to undermine existing stereotypes by enacting different forms of participation, thus questioning common perceptions of the complex state of asylum seekers. These artists infiltrate the communal sphere as cunning spies, in order to examine and destabilize the power relations that control and define it. They search for the liminal spaces between points of contention, and linger within these borderline spheres. The exhibition I curated included projects by Ghana Think Tank, Documentary Embroidery, and Daniel Landau, which were undertaken with the participation of African asylum seekers and Israelis from south Tel Aviv. The first two works were commissioned for the exhibition. It also included the film Ausländer Raus! Schlingensief’s Container, by Paul Poet, that documented the infamous project by the German artist Christoph Schlingensief, who worked with asylum seekers in Vienna in 2001. Ghana Think Tank works with an international network of think tanks producing strategies for the solution of local problems in the »developed« world. For The Infiltrators, think tanks composed of asylum seekers from Eritrea and Sudan offered solutions to the problems of Israelis from south Tel Aviv, and vice versa. Documentary Embroidery employs embroidery as a documentary medium, unfolding in real time. Their project was the result of a month-long stay in Levinsky garden in south Tel Aviv, the site of political struggles involving the African asylum seekers, where they embroidered their encounters with inhabitants and passer byes.
»The Infiltrators«
Daniel Landau has been working with asylum seekers from Darfur, as part of Resident Alien, a global project with immigrants and refugees that examines the limits of documentary and performative actions in the context of testimony. In the documentary film Ausländer Raus! Schlingensief’s Container, Paul Poet follows the project Please Love Austria, created by artist Christoph Schlingensief in 2001. For this project, Schlingensief set down a container inhabited by twelve asylum seekers in the square outside Vienna’s opera house. The audience was asked to vote daily in order to decide which of the asylum seekers would be deported from Austria. The Infiltrators was created in the wake of the refugee crisis in Europe, and while the issues concerning the African asylum seekers in Israel were constantly on the news. While we were working on the exhibition, a detention center in the Israeli Negev desert became active and more asylum seekers were sent to it every day. At the same time a vast protest has begun, that became known as the largest self organized refugee protest movement ever. Three of the four works presented in the exhibition, were concerned with the local sphere and with the place of asylum seekers within it. At the same time, they echoed the existence of a more global reality, much like the work of the Austrian artist Paul Poet echoes contemporary Israeli reality. The relations between the Western world and between refugees and immigrants – the hundreds of thousands of Syrians seeking refuge in Europe, the Mexican immigrants entering the United States by crossing its southern borders, the African refugees who reach Europe by sea, and many others – are a complex subject that occupies a central place in the global media and in world politics, while serving as the subject of numerous contemporary artworks. Among these works are long-term art projects that are not documentary or representational, but rather participatory or collaborative: these include Tania Bruguera’s Immigrant Movement International; the shared struggle of refugees and artists in Holland, which is addressed by the artist Jonas Staal in his project New World Academy; the Silent University created by the Turkish artist Ahmet Ögüt in London, and more. Much like the artists participating in The Infiltrators, these artists have created platforms that undermine the hierarchy and boundaries between different genres of art, as well as between art and activism. These platforms or models can be recreated in various locations, thus looking at local struggles in an international context, and creating potential networks of solidarity. By putting forth initiatives that combine theater, education, political activism, squatting, hacking, and more, they attempt to examine the artistic sphere’s ability to instigate actual change in reality without relinquishing the open-ended, poetic, even ambiguous nature of art, which is capable of impacting our consciousness in non-restrictive ways. At the same time, it is important to note that The Infiltrators exhibition was born of a sense of urgency, as a reaction to an acute situation in the local sphere. To date, approximately 45,000 asylum seekers from Africa, most of whom fled ethnic
125
126
Maayan Sheleff
or political persecution in Sudan or Eritrea, are living in Israel and are asking for recognition as refugees. Israel’s policy vis-à-vis these asylum seekers is one of non-deportation, based on the alleged recognition that their life would be endangered if they were sent back to their countries of origin. At the same time, until recently Israel did not examine any such applications for asylum, and applicants had no possibility of receiving refugee status. According to data provided in 2012 by the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, 83.6 % of the Eritreans and 69.3 % of the Sudanese who submit applications for asylum in various countries are recognized as refugees according to the strict standards of the UN’s treaty of refugees. By contrast, the percentage of asylum seekers recognized as such in Israel was 0.2 %. According to Assaf’s (Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel) spokesperson, in the last few years 18,000 refugee status requests were submitted, but only 50 received refugee status. The majority of asylum seekers who end up in Israel thus remain in an intermediate state – they are not deported, yet their status is not regulated, and they are not awarded basic rights. As aforesaid, during the months before the exhibition’s opening, thousands of asylum seekers were summoned to the »open« detention center in Holot, where they were kept indeterminately in an attempt to encourage them to return to their countries of origin or to a third African country in a process termed »consensual departure.« In the two years that passed, and after three appeals to the high court of law by human rights organizations, the law has changed and it is now possible to detain the asylum seekers for up to 20 months. Also, they now have to sign in once a day instead of three times. However, they are still not allowed to work or cook their own food, and there are constant complains on the quality and amount of food and the lack of proper health conditions. They suffer extreme cold in the winter and heat in the summer, and constant pressure to leave the country. If they break any rule, they are locked in a closed prison, and there are no clear regulations as to how long they can be kept there. The threat of being locked indefinitely is also used against those who refuse to leave to a third country. Until today thousands of asylum seekers left back to Africa, after they have been offered money, documents and security by the Israeli government. However, there have been reports that many of them became refugees again, disappeared, or died.1 In Israeli society, the term »refugee« is especially charged, since it relates both to the Jewish refugees who fled Nazi Europe or who suffered persecution and violence in Arab countries, and to the Palestinian refugees deported from the country in 1948. The consideration of non-Jewish refugees is related, in collective Israeli consciousness, to a change in the country’s demographic balance and to a threat 1 | For more information and up to date news about the African asylum seekers in Israel please see the website of Assaf – Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel: http://assaf.org.il/en/
»The Infiltrators«
to Israel’s status as an asylum to the Jewish people. This is perhaps one of the reasons for the institutional rhetoric that refers to asylum seekers as »infiltrators« or »immigrant workers,« or brands them violent, or as carriers of various diseases. This rhetoric filters down to the street, where it is fused with the real distress of Israeli citizens living in areas characterized by a high concentration of asylum seekers, such as the south of Tel Aviv. The South Tel Aviv neighborhoods which were already suffering from neglect, and which were home to crime, drug abuse, and prostitution, became the focal point of tensions around the asylum seekers. The exhibition attempted to bring to the surface repressed issues and expose the lacunas concerning the suffering of both local citizens and asylum seekers through an open discussion with the various participants in the featured projects – asylum seekers from Eritrea and Sudan, Israeli residents, artists, and community activists. It also attempted to create alliances between the local art, activism and education communities, who often act in related social or political contexts, but seldom meet, collaborate or even acknowledge each other’s work. One of the projects created for this exhibition with communities in the south of Tel Aviv was by Ghana Think Tank, a group of American artists including Christopher Robbins, John Ewing, and Maria del Carmen Montoya. Ghana Think Tank was established in 2006, and has since founded an international network of think tanks in Ghana, Cuba, El Salvador, Serbia, Mexico, Ethiopia, and Gaza, which produce strategies for the solution of local problems in the »developed« world. The initial idea of the founding artists was that think tanks in the so-called »third world« could offer solutions to »first-world« problems. They later discovered that this process could serve to create encounters between groups in conflict and to produce unexpected alliances. They have recently been working with groups of Mexican immigrants and American citizens who opposed immigration on the Mexico-US border. GTT relates to the West’s colonialist attitudes toward the »Third World,« and employs irony and reflexive strategies to examine their own role as Western artists. They attempt to infiltrate sets of existing stereotypes and overturn them by transforming the traditional division between those who offer assistance and those in need of assistance, consultants and those receiving counsel. Their work with different communities strives to serve as a catalyst for real change and empowerment by raising problems and offering solutions, while also consciously exposing conflicts and antagonisms that arise through participatory art practices. In working with residents of south Tel Aviv and asylum seekers, two groups that often suffer from prejudices and discrimination, the project attempted to approach these problems from a perspective that is not often addressed in the media: rather than situating the two groups as enemies, it attempted to see whether they could stand on the same side of the divide, in opposition to their stereotypical perceptions by certain sectors of Israeli society. However, this proved to be difficult to accomplish, as the group of Israeli south Tel Aviv residents had too many disagreements amongst themselves, and did not last throughout the process. They
127
128
Maayan Sheleff
were also antagonized by the fact that »foreign privileged artists« are behind this attempt of conflict resolution. The installation at the Artport Gallery attempted to follow the processes undertaken by means of documentation, sculptural and graphic representations, and a series of workshops and tours. The outcome, as in other GTT projects, was a take on community-based aesthetics that appeared to be appealing and antagonizing, ironic and honest, all at the same time. All the projects shown in The infiltrators examined participatory art in a reflexive, critical manner by creating different levels of participation, and by addressing diverse groups of participants. Within the framework of this exhibition, Paul Poet’s documentary Ausländer Raus! Schlingensief’s Container (2002) was presented as a test case for participatory art in the public sphere. Its participatory scope encompassed various groups – the asylum seekers in the container, the audience that experienced the events in real time, the 800,000 people who watched and voted online on which asylum seeker should be deported from Austria, and the viewers who reflected on the project in retrospect through the documentation. The film, and the project it follows, brought up questions regarding the nature of spectatorship and participation, and how these may serve neoliberal agendas. The period in which this project was presented was marked by the appearance of the first reality TV shows and by the beginning of online sharing and collaboration, which has since expanded significantly. The manner in which such forms of participation presume to reflect democracy or present an alternative to hegemony, underscores the fragile and elusive status of participation, and the ease with which it may be co-opted by various agents. In addition, it brought up questions regarding forms of presentation and representation, touching the ›soft spot‹ of participatory art – the ethics of working with underprivileged communities as an artist/author, particularly in such projects that make use of provocative and antagonistic methods. The projects featured in The Infiltrators reflect a range of participatory strategies that do not shy away from provoking conflict and walking the thin line between ethics and aesthetics. While Ghana ThinkTank offers a platform that calls for a reflexive collectivity, Schlingensief’s approach is one of total authorship, in which the participants enter a realm created by the artist. In this realm, Schlingensief appropriates and renders extreme the very means and characteristics he wishes to protest against. The work and the film documenting it cynically reflect the image of fascism in the 21st century as interactive and amusing – while exposing the dark, terrifying dimension lying beneath its attractive packaging. From today’s perspective, with the increasing popularity of right-wing rhetoric in the light of the refugee crisis in various European countries and in Israel, the work seems horribly prophetic. These themes are thoroughly addressed in »Participation and Spectacle: Where Are We Now?«, an article by the critical thinker Claire Bishop (Bishop 2012: 34-45), which was included in the exhibition’s catalogue. Bishop surveys the
»The Infiltrators«
history, theory, characteristics and limitations of participatory art in the neo-liberal age, while providing an in-depth examination of Schlingensief’s container project. According to Bishop, this project is an example of strong participatory art that enables the ethical, the aesthetic, and the political to coexist, while building on the antagonisms, contrasts, provocations, uncertainty, and ambiguousness to which their coexistence gives rise. To conclude, The Infiltrators attempted to examine participatory art’s forms of representation and display as well as its limitations, while probing the relations between artist, community, and audience. It brought to the surface issues of authorship and power relations. It raised questions that still remain unanswered regarding the artistic and aesthetic representation of complex community based processes. At times the ephemerality of participatory activist art seems to be its main weak spot: on the one hand, there is the desire to produce a communal experience that contains a promise for a better future, and which may lead to a change in collective perceptions; at the same time, art funding usually amounts to a short term action at best, and the outcome is seldom satisfying. The hybrid art-activism-education seems to scare many non-artistic funding organizations, as art’s insistence on complexity, nuances, and contradictions doesn’t neatly fit into their criteria. Thus, our attempts to continue the project with a school for art and activism in »Holot« detention center have so far failed due to lack of funding. The Infiltrators did have a concrete activist aim, which was to raise awareness to the condition of the African asylum seekers in Israel, and subsequently encourage change in how the country treats them. The exhibition allowed many people to meet and speak to the asylum seekers for the first time. Some of the alliances between asylum seekers, activists and artists, created during the work process, continue today. In addition, more and more art projects deal with this subject, three of which will be presented in the two major museums in Israel during 2016. However, despite minor changes in the laws and regulations, one cannot say that the condition of the asylum seekers has changed much. Artistic practices could only be a drop in a big pool of ideas, actions and struggles. In this case, they might provide a small contribution to the brave and consistent long-term struggles of the asylum seekers and the human rights activists. These days I am trying to reunite the group of Sudanese asylum seekers that formed the detention center think tank, and find out whether they want to continue, and how. They have been released after the new ruling that limited the time they could be detained in the detention facility, but a new decision by the interior ministry forbids them to return to Tel Aviv, where most of them lived and worked. They are now scattered around the country, struggling to make a living and dealing with old and new trauma without a supportive community nearby. Two of them are working independently on a documentary about their lives, shot with their cellular phones. Others are taking pictures or writing blogs. They are
129
130
Maayan Sheleff
also helping new detainees in »Holot« to find ways to secretly document human rights violations. Despite the logistical setbacks, the ethical complications and the constant doubts from amongst both art and activism communities, I believe that participatory art processes are a meaningful activist tool, as well as a fascinating and important form of contemporary art. They could offer a sort of lingering on the borders that make up our realities and restrict our visions: between art and activism and education, between a grim reality to a vision of a new future, between one territory and the next, between one person and another; the development of more concrete models of these practices in multiple locations could create affiliations between various communities who may experience similar difficulties. Within this wider network of solidarity and awareness, the lingering could become an infiltration that will help to undermine these borders.
L iter ature Bishop, Claire (2012): »Participation and Spectacle: Where Are We Now?«, in: Nato Thompson (Hg.), Living as Form, Socially Engaged Art from 1991-2011, New York: Creative Time Books [u.a.], S. 34-45.
Die Gedächtnisarbeit mit Geflüchteten als Kampf um Gerechtigkeit Felipe Polanía Ce coeur obsédant, qui ne correspond Pas à mon langage ou à mes costumes Et sur lequel mordent, comme un crampon, Des sentiments d’emprunt et des coutumes D’Europe, sentez-vous cette souffrance Et ce désespoir à nul autre égal D’apprivoiser, avec des mots de France, Ce coeur qui m’est venu du Sénégal? (L eon L aleau 1931)1
Zusammenfassung Ist es möglich, von einem kollektiven Gedächtnis von geflüchteten Menschen zu sprechen? Im Artikel wird thematisiert, welche Rolle das Gedächtnis in der Vermittlungsarbeit mit geflüchteten Menschen spielt. Die Charakterisierung von Flüchtlingen in politischen und medialen Diskursen als Opfer von Armut und Krieg blendet die Kritik an den vom europäischen Kolonialismus geerbten strukturellen Fluchtgründen aus. Das kollektive Gedächtnis von Geflüchteten liegt teilweise bei einer diskursiven Artikulation von den Fluchtgründen als Reaktion gegen den Kolonialismus. In diesem Sinne kann die Fluchtbewegung nach Europa aus der Perspektive der Opfer als Gerechtigkeitsforderung betrachtet werden. Die Suche nach dieser Artikulation benötigt methodologische Ansätze, die Geflüchtete als politische Subjekte betrachten und Rahmen für die (Re-)Konstruktion ihrer autonomen Handlungsmöglichkeit begünstigen. Der vorliegende Artikel zeichnet eine Arbeitsperspektive anhand von drei konkreten Vermittlungserfahrungen in Zürich. Diese Perspektive basiert auf der emotionalen Vergegenwärtigung, der Orientierung in Flucht- und Exilräumen, der Konstruktion einer gemeinsamen Erzählung der Flucht und der Identifikation von Verbindungslinien zwischen der Schweizer Asylpolitik während des Zweiten Weltkrieges und der Asylpolitik der letzten Dekaden.
1 | Leon Laleau (1892-1979) war ein Haitianischer Schriftsteller und Politiker.
132
Felipe Polanía
Abstract: Reflecting on Histor y with Refugees as a Struggle for Justice Is it possible to speak of a collective memory of refugees? This article deals with the role of memory and history in cultural education and outreach work with refugees. The characterization of refugees in political and media discourses as victims of poverty and war obscures the critique of the structural reasons for seeking asylum, which are inherited from European colonialism. The collective memory of refugees is in part located in a discursive articulation of the reasons for seeking asylum as a reaction against colonialism. In this sense, from the perspective of the victim, the movement of refugees toward Europe could be viewed as a demand for justice. The search for this articulation requires methodological approaches which view refugees as political subjects, and promote frameworks for the (re)construction of their ability to act autonomously. This article sketches out a possible methodology, using three specific experiences of education and outreach in Zurich. This methodology is based on emotional visualization, on orientation in spaces of refuge and exile, on the construction of a collective narrative of seeking refuge and on the identification of parallels between Swiss asylum policies during the Second World War and the asylum policies of recent decades.
Von Oktober 2014 bis Mai 2015 führte ich im Rahmen eines Vermittlungsauftrages der Shedhalle2 ein Projekt über das Gedächtnis der Asylpolitik und der Geflüchteten in der Schweiz durch. Zur Shedhalle kam ich aus meiner beruflichen Erfahrung als Kunstvermittler, zum Thema Gedächtnis aus meiner eigenen Lebenserfahrung. Seit 1997 lebe ich als politischer Flüchtling in der Schweiz. Ich kam aus einem entlegenen Gebiet am Ende des Meeres, wo die Sonne immer scheint und die Flüsse reden.3 Die Kolonialist_innen des 16. Jahrhunderts nannten dieses Gebiet »die neue Welt« und nicht wenige von ihnen verorteten den Garten Eden in dem von Europa damals neu gesichteten Erdteil.4 Ich bin ein geflüchteter Mensch und habe mich oft in Bildungs- und Kunstprojekten mit Geflüchteten engagiert. Die Frage nach dem Gedächtnis und, konkreter, ob es überhaupt möglich ist, von einem kollektiven Gedächtnis von geflüchteten Menschen zu sprechen, entwickelte sich während meiner Arbeit als Vermittler und meines Engagements als politischer Aktivist über mehrere Jahre. Jedoch war dies kein bewusster und gesteuerter Prozess, vielmehr hat sich mir die Notwendigkeit dieser Auseinandersetzung während des Arbeitsprozesses aufgedrängt. In den verschiedenen Projekten mit Geflüchteten, die ich bis 2 | Die Shedhalle ist ein staatlich subventionierter Kunstraum in Zürich, der sich als Raum für alternative und politische Kunst positioniert (vgl. www.shedhalle.ch). 3 | Freie Übersetzung vom Lied »América« vom spanischen Sänger Nino Bravo. 4 | Als Beispiel genügen die Eindrücke von Kolumbus bei der ersten Besichtigung der Mündung des Orinoco Flusses, wie Alexander von Humboldt in seinem Buch Ansichten der Natur (1808) erzählt.
Die Gedächtnisarbeit mit Geflüchteten
jetzt (mit-)geleitet habe, war ich immer auch ein Teilnehmender. Die Reflexionen mit Geflüchteten und die gemeinsam hergestellten Materialen waren für mich immer Teil eines Lernprozesses über mich selbst und über meine Suche nach politischer Affirmation. So stellte sich mir die Frage nach dem kollektiven Gedächtnis, die in dem Ausstellungsprojekt in der Shedhalle einen ersten Versuch fand, um ausgelotet zu werden. In diesem Text möchte ich einige meiner Reflexionen über diesen Prozess darstellen und als eine mögliche methodologische Herangehensweise für die Arbeit am Gedächtnis mit Geflüchteten präsentieren. Dafür werde ich erst meine Gedanken über das Exil schildern und danach anhand dreier Projekte die Suche nach Methoden in der Kunstvermittlung mit Geflüchteten aufnehmen. Ich muss aber auch anfügen, dass ich aus einer privilegierten Position spreche. Ich habe seit mehr als 15 Jahren den Status als anerkannter politischer Flüchtling in der Schweiz. Dieser Status beinhaltet viele rechtliche Garantien für meinen Aufenthalt im Exil und diese Garantien sind in der letzte Dekade für Geflüchtete systematisch abgebaut worden. Die Herstellung von Gemeinsamkeiten mit anderen Geflüchteten geschieht innerhalb eines Systems, das charakterisiert ist durch zahlreiche Stufen von Ausschlüssen und Entrechtungen, die jedoch nicht immer deutlich erscheinen.
Das E xil als Territorium der Erinnerung und die Asylpolitik als Ort der Entrechtung In meinen ersten Jahren im Exil musste ich mich in der neuen Umgebung zurechtfinden, jedoch war ich überzeugt, dass das Exil eine vorläufige Erfahrung und ein Ausnahmezustand sein würden und ich nach einigen Jahren nach Kolumbien zurückkehren könnte. Trotzdem musste ich mich im Laufe der Zeit mit dem endlosen Exil auseinandersetzen. Der Ausnahmezustand wurde zur Regel. Das Exil als emotionale Erfahrung zeigt sich mir als ein Territorium der Erinnerung. Die im Exil lebende Person klammert sich zuerst an ihre Erinnerungen, um sich selber wahrnehmen zu können. Sie füllt den Ort des Exils mit Erzählungen über das vergangene Leben und die Bedeutsamkeit der Gegenwart nimmt erst Gestalt an durch eine abwesende Realität. Die rechtlichen und politischen Rahmen des Exils sind von der Asylpolitik vorgegeben. Nach dem Zweiten Weltkrieg erließen die Vereinten Nationen (UN) die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte: »Jeder hat das Recht, überall als rechtsfähig anerkannt zu werden« (Art. 6) und »Jeder hat das Recht, in anderen Ländern vor Verfolgungen Asyl zu suchen und zu genießen« (Art. 14). Jedoch ergaben diese internationalen Vorgaben in Bezug auf die Asylpolitik nur Sinn für die europäischen Länder, solange der Kalte Krieg herrschte. Das Asyl wurde als antikommunistische Propaganda instrumentalisiert, wie zum Beispiel in der Schweiz, wo von den späten 1950er bis in die 1970er Jahre hinein vielen Geflüchteten aus kommunisti-
133
134
Felipe Polanía
schen5 Ländern als »Opfern des Kommunismus« Asyl gewährt wurde.6 Hingegen galt dies nicht für Geflüchtete aus der Pinochet-Diktatur in den 1970er Jahren. Die Bundesregierung wollte damals nur eine sehr geringe Zahl an Chilen_innen aufnehmen, doch aufgrund der gesellschaftlichen Solidarität konnten viel mehr Geflüchtete aus Chile in die Schweiz kommen. Heutzutage ist die Figur des Asyls in den gesellschaftlichen Diskursen politisch entwertet. Stattdessen tauchen Flüchtlinge, Geflüchtete und Refugees als Bezeichnungen für Menschen auf, die aus wirtschaftlicher oder politischer Not migrieren. Längst kümmert sich die Asylpolitik vornehmlich um die Beschränkung der sozialen Rechte von Menschen mit Asyl oder in Asylverfahren. Die politischen und medialen Diskurse drehen sich um die Einteilung von Geflüchteten in »echte« und »falsche« Flüchtlinge, in solche mit legitimen und illegitimen Fluchtgründen. Staatliche Akteure, Medien und politische Diskurse haben in den letzten Jahren daran gearbeitet, der Figur des Geflüchteten systematisch jegliche politische Legitimität zu entziehen. Die Wortwahl Exil als Bezeichnung für die Erfahrung Geflüchteter ist zentraler Teil meiner politischen Affirmation als Geflüchteter. Damit möchte ich auf das Trauma der Verbannung aufmerksam machen, weil Menschen, die ihr Land verlassen müssen, Opfer staatlicher Praktiken des Verbannens sind. Die Entscheidung zu flüchten ist oft verknüpft mit einer strukturellen Verarmung und Repression, die in der langen Geschichte des europäischen Kolonialismus im globalen Süden ihre Wurzeln haben. Das Wort Exil möge daran erinnern, dass Flucht eine Reaktion auf globale Politiken ist und dass Menschen auf der Flucht der Wiederherstellung ihrer politischen und sozialen Rechte bedürfen. Die emotionale Neuorientierung im Exil wird von Erinnerungen an und Vergleichen mit den Lebenserfahrungen in den einstigen Heimatländern der Geflüchteten begleitet. Menschen, die in ihrem Herkunftsland politisch aktiv waren, fokussieren ihr politisches Engagement auch im Exil weiterhin auf die Unterstützung dieser politischen und sozialen Kämpfe und wollen auf diese Weise ihre früheren Kämpfe weiterführen. Die Verbindung zu ihren unmittelbaren Lebensumständen scheint nicht so wichtig zu sein wie die Verbindung zu den Lebensumständen in ihren Herkunftsländern. Ich verstehe die Arbeit am Gedächtnis demgegenüber als eine emotionale Vergegenwärtigung. Die Erinnerung ist »nie ein Spiegel der Vergangenheit, wohl aber ein aussagekräftiges Indiz für die Bedürfnisse und Belange der Erinnernden in der Gegenwart« (Erll 2011: 7). Dieser 5 | Darunter verstehe ich Länder, die von einer Kommunistischen Partei regiert wurden und in der Logik des Kalten Krieges als »Osten« bzw. »prosowjetisch« bezeichnet worden sind. 6 | Das galt nach 1956 für rund 12.000 Geflüchtete aus Ungarn, im Jahr 1959 und in den folgenden Jahren für etwa 1.700 Geflüchtete aus Tibet, Ende der 1960er Jahre 12.000 Geflüchtete aus der damaligen Tschechoslowakei und in den 1970er Jahren etwa 8.500 aus Vietnam, vgl. www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D16388.php (letzter Zugriff: 07.07.2016).
Die Gedächtnisarbeit mit Geflüchteten
Gegenwartsbezug der Erinnerung und folglich der Arbeit am Gedächtnis kann, so meine These, eine im Exil lebende Person bei einem Übergang von einem rückwärtsgerichteten Erinnern zu einer aktiven Reflexion über die politischen Umstände im Exilland unterstützen. Entsprechend können geflüchtete Menschen die Gegenwart mit Blick auf den Kampf um ein Leben mit Rechten betrachten und demzufolge sich als politische Subjekte (re-)konstituieren.
Die Orientierung im Raum des E xils Eine erste Besinnung auf die Gegenwart als Geflüchteter fand ich durch die Wahrnehmung des Raumes und die eigene Position innerhalb des Raumes. Das nenne ich Orientierung. Eine Methodologie dafür fand ich in der Arbeit an Kartografien. Im Jahr 2010 leitete ich zusammen mit Nora Landkammer das Projekt »Atelier« 7 in Zürich. Ausgehend von der Ausstellung Global Design am Museum für Gestaltung Zürich8 arbeiteten wir zusammen mit einer Gruppe von Kursteilnehmenden9 der Autonomen Schule Zürich.10 Ziel war die Auseinandersetzung mit der Ausstellung und eine kollektive Reflexion über die Globalisierung aus der Perspektive von Asylsuchenden. Mehrere Monate lang traf sich die Gruppe, um mit Kartografien zu arbeiten. Wir diskutierten über die Karten als Repräsentation der Welt, als (Re-)Produktion von globalen Verhältnissen, als Wissenssysteme und als Ordnungsprinzipien. Ebenso haben wir zusammen verschiedene Karten hergestellt: eine Weltkarte von den Herkunfts- und Exilländern, eine emotionale Fluchtkarte und verschiedene Stadtkarten. Es war eine Übung zur Repräsentation der eigenen Welt und eine Auseinandersetzung mit der unmittelbaren Umgebung. Das Resultat der Reflexion war die Produktion eines Heftes mit nützlichen Informationen über das Bleiben in der Stadt Zürich für Menschen in gesellschaftlich prekären Situationen und unter rechtlichen Ausschlüssen. Das Heft wurde Bleibeführer genannt, als Antonym zum Reiseführer der Tourist_innen.11 Damit haben wir das Wissen über die Stadt und die Hilfsmöglichkeiten in der Stadt zum Überleben, die aufgrund der langjährigen Erfahrung von einigen Geflüchteten vorhanden waren, gesammelt und als solidarisches Instrument für den Kampf ums Überleben zur Verfügung ge7 | Vgl. https://www.zhdk.ch/index.php?id=95046 (letzter Zugriff: 17.03.2016). 8 | Vgl. www.museum-gestaltung.ch/de/ausstellungen/rueckblick/2010/global-design/ (letzter Zugriff: 17.03.2016). 9 | Ibrahim Haydari, Benjamin Jafari, Zuher Ahmad, Saleban Abdi Askar, Aras Hemn Hassan, Tagharrobi Farzad, Fabiana González, Khider Karim, John Mwangi Njuguna, Rose, Tena, Katy Ekator, Marguerite Kengmoe, Nareeman Shawkat. 10 | Selbstorganisiertes Bildungsprojekt für Geflüchtete und Migrant_innen in der Stadt Zürich, vgl. www.bildung-fuer-alle.ch/ (letzter Zugriff: 07.07.2016) 11 | Das Heft zum Download: https://drive.google.com/file/d/0B8GZVOlCv9OPSk5sSk J1MVZ1R2c/view?pref=2&pli=1 (letzter Zugriff: 07.07.2016).
135
136
Felipe Polanía
stellt. Insgesamt hat mir das Projekt vieles über das Potential des kollektiven Kartierens eines Lebensraumes gezeigt. Das kollektive Kartieren12 erlaubte die Markierung von Erinnerungen an Gefühle auf der Flucht und die Konstruktion einer emotionalen Vergangenheit, die vom aktuellen Standpunkt der Erinnernden aus betrachtet wird. Das Kartieren war sowohl eine geografische und emotionale Verortung in der Gegenwart als auch eine symbolische Aneignung der Stadt. Verortung von sich selbst und Aneignung des bewohnten Raumes können zur Selbstgestaltung und Selbstbestimmung des alltäglichen Lebens führen und Handlungsmöglichkeiten aufzeigen. Ansätze dieser Methodologie sind auch bei der Psychogeografie13 und dem kollektiven Kartieren zu finden.
Die Konstruktion einer kollektiven Erinnerung Nach der Orientierung mit den Kartografien habe ich drei Jahre später im Vermittlungsteam der Shedhalle einen Austausch zwischen dem Projekt PortoM des Kollektivs Askavusa aus Lampedusa14 und einer Gruppe Aktivist_innen des Raums für die Autonomie und das Ferlernen (RAF-ASZ) von Zürich organisiert.15 Das Kollektiv Askavusa brachte verschiedene Objekte von Geflüchteten, die sie an den Stränden von Lampedusa gefunden und über einen längeren Zeitraum gesammelt haben. Mit diesen Objekten hat die Gruppe aus Zürich eine Ausstellung konzipiert. Die Ausstellung hieß hin und her, Gedächtnis im Widerstand, Lampedusa in Zürich und fand im Rahmen des 1. Mai-Fests in Zürich statt.
12 | Die Gruppe Iconoclasistas aus Argentinien hat eine lange Erfahrung im kollektiven Kartieren und ebenso in der Reflexion über die Kartografien. Sie sehen die traditionellen Karten als ideologische Repräsentationen der Klassenherrschaft und als Werkzeuge zur Kontrolle des Territoriums und der gesellschaftlichen Ressourcen. Das kollektive Kartieren kann diesen alternative Erzählungen und Repräsentationen gegenüberstellen, die hegemoniale Strukturen des öffentlichen und gesellschaftlichen Raums bestreiten; vgl.: www.iconoclasistas.net/post/manual-de-mapeo-colectivo-en-pdf/ (letzter Zugriff: 17.03.2016). Eine Gruppe aus Berlin hat auch Material über kollektives Kartieren auf Deutsch produziert, vgl.: http://orangotango.info/projekte/kollektives-kartieren/ (letzter Zugriff: 17.03.2016). 13 | Untersuchung der Wirkungen der physischen Umgebung auf die Wahrnehmung der sozialen Realität und der sozialen Verhältnisse sowie das Verhalten der Menschen. Der Begriff wurde geprägt von der Künstler_innengruppe Situationistische Internationale. 14 | Vgl. https://por tommaremediterraneomigrazionimilitarizzazione.wordpress.com/ (letzter Zugriff: 17.03.2016). 15 | Vgl. www.shedhalle.ch/2016/de/416/LAMPEDUSA_IN_Z%C3%9CRICH (letzter Zugriff: 17.03.2016).
Die Gedächtnisarbeit mit Geflüchteten
Der Ausstellungstext zeigte die Gedanken der Gruppe über das Risiko der Vereinnahmung der Repräsentation der Geflüchteten und wollte die Sprechposition der Gruppe sichtbar machen: »Wir wollten uns mit diesen menschlichen Geschichten auseinandersetzen. Wir haben andere Fluchterfahrungen als die Menschen, die einmal diese Objekte in ihren Händen hatten, aber wir teilen mit diesen menschlichen Geschichten den Kontext der Flucht: des europäischen Kolonialismus, des globalisierten Kapitalismus. Wir nehmen uns das Unrecht, von, mit, über diese Objekte zu reden. Und wir nennen das ›Selbstrepräsentation‹. Aber wir reden nicht im Namen der Flüchtlinge. Wir können nicht diese menschliche Geschichte als Legitimation für unsere Wörter nehmen. Wir repräsentieren nur uns selber, aber wir sind Teil eines kollektiven Gedächtnisses der Flucht. Unsere politischen Kämpfe hier in der Schweiz sind Teil dieses kollektiven Gedächtnisses. Wir reden nicht im Namen der Flüchtlinge, wir reden aus einem bestimmten Ort unseres gemeinsamen kollektiven Gedächtnisses.« (Ausstellungstext von hin und her, Gedächtnis im Widerstand, Lampedusa in Zürich)16
Die Gruppe entschied sich dafür, die Objekte mit eigenen Erfahrungen von Widerstand, die in unserer Vergangenheit Relevanz hatten, zu verbinden. Die Ausstellung bestand unter anderem aus einer Installation, wo Kleider, die vom Projekt PortoM an den Stränden Lampedusas gefunden und für eine Spur von Geflüchteten gehalten wurden, über der Projektion eines Fotos von einer Straße in Istanbuls Stadtviertel Talabarsi aufgehängt wurden. Die Kleider aus Lampedusa kamen auf diese Weise zusammen mit einer Erzählung und Repräsentation eines Stadtviertels, das einen hohen Flüchtlingsanteil und vielfältige Erfahrungen von Widerstand und Selbstorganisation aufweist. In einer anderen Installation wurden Teekannen und -packungen, die Flüchtlinge in Lampedusa hinterlassen haben, in die Imitation einer Guerillastube in den Bergen Kurdistans eingebunden. Damit wurde eine kulturelle Praktik wie das Teetrinken zu einer Erzählung des Widerstands und zu einem gemeinsamen Nenner. Mit solchen Intertextualitäten zwischen unseren Fluchterfahrungen und den Objekten von Menschen in Lampedusa schufen wir einen gemeinsamen Diskurs. Die Objekte, die im Mittelmeer ertrunkene Menschen vertreten sollten, wurden eingebaut in Widerstandserfahrungen, die wir als Teil des kollektiven Gedächtnisses von Menschen im Exil betrachten. Das Geflecht aus Erinnerungen an organisierte und politische Widerstände und die Materialität von Objekten aus Lampedusa sollte den politischen Charakter der monate- und jahrelangen Reisen von Menschen auf der Flucht hervorheben. Die Perspektive und der gemeinsame Nenner der Ausstellung waren der Kampf um das Recht auf Leben und Würde als Antagonismus zum europäischen Kolonialismus und Kapitalismus.
16 | Aus dem persönlichen Archiv des Autors.
137
138
Felipe Polanía
Von der kollektiven Erinnerung der Flucht zur Inter vention gegen die hegemoniale Erzählung der Vergangenheit 2014 kam ich zu einem neuen Projekt: Ein Archiv der Asylpolitik und der geflüchteten Menschen in der Schweiz sollte entstehen, diesmal in einer Vierergruppe von politischen Flüchtlingen, die bereits mit dem Kunstfeld vertraut waren. Im Laufe des Projekts wurden mehrere öffentliche Veranstaltungen durchgeführt: ein Austausch mit alternativen Projekten zum Gedächtnis als Dekolonisierungsstrategie,17 ein Diskussionspodium über Kunst, Politik und Gedächtnis in der Asylgeschichte der Schweiz,18 auch Filmvorführungen über Asyl und Flucht in der Schweiz.19 Wir beteiligten uns ebenso an einem Workshop über das Gedächtnis anlässlich des 20. Jubiläums der autonomen migrantischen und feministischen Bildungsinstitution MAIZ in Linz.20 Gleichzeitig recherchierte die Gruppe in der Plakatsammlung des Museums für Gestaltung,21 im Schweizerischen Sozialarchiv,22 in der Online-Bildersammlung der Eidgenossischen Technischen Hochschule ETH und in weiteren lokalen Archiven. Wir sammelten Informationen und Dokumente, grafisches Material über die Schweizer Asylpolitik während des Zweiten Weltkrieges. Das gesammelte Material ordneten wir thematisch in: das Lagersystem, die medialen und öffentlichen Diskurse, den rechtlichen Rahmen, Grenzkontrollen und die kulturelle Wiedererfindung des Fremden. Das Gedächtnis erschien weniger in der Erzählung des eigenen Lebens als Zeitzeugnis, sondern eher in der Auseinandersetzung mit Kontinuitäten der Asylpolitik in der Schweiz. Eine wichtige Kontinuität zeigte sich z.B. beim Lagersystem. 2011 gab die Justizministerin der Schweiz Simonetta Sommaruga einen 17 | Mit Juana Paillalef, Direktorin des Museo Mapuche de Cañete; Adriana Muñoz, Kuratorin der National Museums of World Culture, Göteborg, Schweden; Bernadette Lynch, Autorin, Forscherin, Beraterin aus London/Manchester, England; und Alejandro Cevallos, Koordinator der investigación mediación comunitaria, Fundacion de Museos de la Ciudad, Quito, Ecuador; vgl.: www.shedhalle.ch/2016/de/335/Das_Ged%C3%A4chtnis_als_De kolonisierungs-strategie (letzter Zugriff: 17.03.2016). 18 | Vgl.: www.shedhalle.ch/2016/de/349/Kunst,_Politik_und_Ged%C3%A4chtnis (letzter Zugriff: 17.03.2016). 19 | Unter anderem die Premiere des Dokumentarfilms Rubén, Fragmente aus der Exil (2015) (R: Eva Danzl) www.ruben-doc.com/(letzter Zugriff: 17.03.2016) oder die Vorführung von Filmen wie Akte Grüninger (2013) (R: Alain Gsponer), http://grueninger-film.com/ (letzter Zugriff: 17.03.2016). 20 | Vgl. ht tp://maiz.at/sites/default/files/files/programm_20_ jahre_maiz _0.pdf (letzter Zugriff: 17.03.2016). 21 | Vgl. www.museum-gestaltung.ch/de/sammlungen/sammeln/plakat (letzter Zugriff: 17.03.2016). 22 | Vgl. www.sozialarchiv.ch/ (letzter Zugriff: 17.03.2016).
Die Gedächtnisarbeit mit Geflüchteten
neuen Plan im Asylbereich bekannt: die Schaffung von fünf neuen Bundeslagern in der Schweiz, wo Asylsuchende interniert werden und die Entscheide über ihre Asylanträge schneller erfolgen sollten. Diese Entscheidung, wie so oft im Asylbereich, wurde in den medialen Diskursen als »Ausnahme« dargestellt. Sie sollte die behördlich-administrative Antwort auf einen Ausnahmezustand sein. Trotzdem schien dieser Ausnahmezustand zur Regel zu werden. Die Antwort auf die Ausnahmesituation – auch Flüchtlingskrise, Überfremdung oder Migrationswelle genannt – ist die Internierung, die Beschränkung der Mobilität von Menschen auf der Flucht. Das Lager scheint ein wesentliches Merkmal der Asylpolitik in den letzten Jahren in der Schweiz zu sein. Ebenfalls war das Lager ein konstituierender Teil der Asylpolitik in der Schweiz während des Zweiten Weltkrieges. Bereits damals wurden verschiedene Lager für Flüchtlinge in der Schweiz gebaut (vgl. Erlanger 2006). Giorgio Agamben nennt das Lager das biopolitische Paradigma der Moderne. Das Lager ist nach Agamben der Ort der Entrechtung par excellence. Es ist der Ort, wo der Ausnahmezustand die rechtlichen Garantien aushebelt (vgl. Agamben 2002: 127-209). Der Versuch, eine Erzählung über die Asylpolitik und die Geflüchteten in der Schweiz aus der Perspektive der Geflüchteten zu flechten, brachte uns zu verschiedenen thematischen Knoten, die wir jeweils in Gruppen bearbeiteten. In jeder thematischen Gruppe konnten wir dabei Verbindungslinien zwischen der Schweizer Asylpolitik während des Zweiten Weltkrieges und der Asylpolitik der letzten Dekaden identifizieren. Diese Vergegenwärtigung zeigte Alternativen zu den hegemonialen Deutungen von vergangenen Ereignissen und deren Wirkmächtigkeit in der Gegenwart auf. Unsere Arbeit am Gedächtnis suchte nach den Grenzen zwischen dem gesellschaftlichen Erinnern und dem Vergessen. Beispielsweise der auf Verlangen der Schweizer Regierung eingeführte rote »J«Stempel im deutschen Pass von in die Schweiz geflüchteten Juden,23 die Internierungslager, die Grenzschließung oder die Aberkennung von Juden als politische Flüchtlinge werden in keiner offiziellen Erzählung in einer Kontinuität der Schweizer Asylpolitik bis in die Gegenwart betrachtet. Erst 1999, 54 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, wurde erstmals überhaupt eine staatlich beauftragte, historische und rechtliche Untersuchung zum Umfang und Schicksal der vor, während und unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg in die Schweiz gelangten Vermögenswerte veröffentlicht,24 auch Bergier-Bericht genannt. Dieser Bericht hat bis jetzt noch nicht die gesellschaftliche Relevanz bekommen, die angesichts seiner bahnbrechenden Offenlegungen angemessen wäre. Mit diesem Beispiel möchte ich in aller Kürze andeuten, wo die Grenzen des Vergessens in der Schweiz liegen könnten und auf welche Weise die Arbeit von Geflüchteten am nationalen Gedächtnis diese Grenzen verschieben kann. 23 | Alle diese Ereignisse sind dokumentiert im Schlussbericht der Unabhängigen Expertenkommission Schweiz – Zweiter Weltkrieg (2002). 24 | Ebd.
139
140
Felipe Polanía
Die Perspektiven des Gedächtnisses Die Konstruktion eines kollektiven Gedächtnisses der Geflüchteten kann geschichtliche Paradigmen umdeuten. Es wird dann unumgänglich, die Fluchtbewegungen nach Europa im Kontext der historischen Konstituierung des kolonialen, kapitalistischen und modernen Europas zu begreifen. Diese historische Kontinuität soll uns erlauben, die Fluchtbewegungen als Anspruchsäußerung der Geflüchteten auf Wiederherstellung von politischen und sozialen Rechten in Europa zu betrachten und somit als Forderung nach Gerechtigkeit zu verstehen.25 Die Arbeit am Gedächtnis bietet die Möglichkeit, Räume und Momente zu schaffen, wo die Geflüchteten sich als politische Subjekte (re-)konstituieren können, vor dem Hintergrund einer über Jahrhunderte andauernden Verarmung und Zerstörung der von europäischen Mächten kolonisierten Welt. Wir Geflüchtete sind hierher gekommen, nicht um die Gnade Europas zu erfahren, sondern um unseren Anspruch auf historische Gerechtigkeit einzufordern. Die gegenwärtigen und zukünftigen Kämpfe werden davon berichten.
L iter atur Agamben, Giorgio (2002): Homo sacer – Die souveräne Macht und das nackte Leben, Frankfurt a.M.: Edition Suhrkamp. Erlanger, Simon (2006): Nur ein Durchgangsland. Arbeitslager und Internierungsheime für Flüchtlinge und Emigranten in der Schweiz 1940-1949, Zürich: Chronos Verlag. Erll, Astrid (2011): Kollektives Gedächtnis und Erinnerungskulturen, Stuttgart: Metzler. Léon, Laleau (1931): Trahison, Musique nègre, Port au Prince: Imprimerie de l’État. Unabhängige Expertenkommission Schweiz – Zweiter Weltkrieg (2002): Die Schweiz, der Nationalsozialismus und der Zweite Weltkrieg. Schlussbericht. Zürich: Pendo. https://www.uek.ch/de/schlussbericht/synthese/uekd.pdf (letzter Zugriff: 21.03.2016). von Humboldt, Alexander (2004): Ansichten der Natur (1808), Die Andere Bibliothek/Eichborn: Frankfurt a.M.
25 | Vgl. www.timesofmalta.com/articles/view/20130719/opinion/We-re-here-becauseyou-were-there.478619 (letzter Zugriff: 21.03.2016).
Can we talk about it? Über das Ankommen von LGBTIQ-Geflüchteten und eine sich verändernde Community Marty Huber und Queer Base
Zusammenfassung Queer Base wurde 2015 gegründet und ist eine Gruppe von Menschen mit und ohne Fluchterfahrung, die sich zusammengeschlossen hat, um LGBTIQ-Geflüchtete willkommen zu heißen und zu unterstützen. Während in Medien und Politik vom Ende der Willkommenskultur gesprochen wird, organisieren sich Menschen, um das Ankommen von LGBTIQ-Geflüchteten zu erleichtern. Welche gemeinsamen Räume braucht es dafür, welche Vermittlungen und Übersetzungen in Sprachen, Erfahrungen, Erinnerungen und Vorstellungen von Zukunft sind nötig? Die Queer Base ist ein Anfang, und der Artikel versucht Fragen von Zuhören, Öffnen von Möglichkeitsräumen und einen kritischen Blick auf hegemoniale Strukturen zu vereinen. Über was kann gesprochen werden und was wird verschwiegen? Zum Beispiel, dass es in Europa Übergriffe auf Trans*Personen, Lesben und Schwule gibt? Dass Rassismus und Islamophobie in den eigenen LGBTIQ-Communitys grassieren? Ein Anfang.
Abstract: Can we Talk about it? – On the Arrival of LGBTIQ Refugees and a Changing Community Queer Base was founded in 2015 made up of a group of refugees and non-refugees who have rallied together in order to welcome and support LGBTIQ refugees. Whilst in the media and politics there are discussions of the Willkommenskultur (welcome culture) coming to an end, there are people who are organizing and working to help LGBTIQ refugees to orient themselves in their new home. What are the common spaces that are necessary for this? And which negotiations and translations of languages, experiences, memories and visions of the future are required? Queer Base is a first step towards this, and this paper attempts to bring together issues around listening and opening up spheres of possibilities with a critical perspective of hegemonic structures. What can be spoken about and what is kept silent? For example, that there are assaults on gay, lesbian and transgender people in Europe? Or that racism and Islamophobia is rife within the LGBTIQ community? A first steps.
142
Mar ty Huber und Queer Base
Am Rande der Veranstaltung »Human Rights Talk: LGBTQI Movements – Leaps, Bounds and Baby steps«1 wurde ich gefragt, was ich vom Vorschlag des niederländischen Kabinetts hielte, LGBTIQ (Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans, Intersex und Queer)-Geflüchtete in den allgemeinen Asylunterbringungen trotz Gewaltandrohungen und Übergriffen zu belassen. Die Regierung begründete dies mit dem Hinweis, dass sich alle von Beginn an an die niederländischen Werte zu halten haben, dazu gehöre auch die Anerkennung von Minderheiten. Außerdem wäre eine getrennte Unterbringung zu stigmatisierend, so der Staatssekretär für Migration Klaas Dijkhoff aus dem Ministerium für Sicherheit und Justiz (vgl. Müller 2015).
Stigma, Werte, Sicherheit? Wer zahlt den Preis? Das Beispiel der niederländischen Regierung zeigt, entlang welcher Grenzlinien viele Diskussionen verlaufen, bei denen es um die Durchsetzung von Vorstellungen, von Werten und Regierungstechnik geht. Der Staat bestimmt, wann etwas als Bedrohung, als Stigma und Sicherheitsfrage definiert werden kann. Europäische Werte sind per se omnipräsent in den gesellschaftlichen Strukturen, europäische Werte sind per se gut, oder jedenfalls besser. Wer hierher kommt, weiß das, und auch wenn nicht, muss er oder sie sich daran halten. Die Vorstellung der die Minderheiten integrierenden, assimilierenden Gesellschaft nivelliert alle immer noch existierenden Ungleichheitserfahrungen und projiziert daraus resultierende Ängste je nach Möglichkeiten auf das Andere, die Fremden der gegenwärtigen Zeit – in diesem Fall – auf LGBTIQ-Geflüchtete, die nicht nur ihr Stigma überwinden, sondern bestmöglich auch noch Stigmatisierungen und Homo- und Transphobie in den Asylunterkünften bekämpfen sollen. Wir sind hier schließlich emanzipiert. Es gibt immer wieder Gelegenheiten, diese Form der Auseinandersetzung um Räume und Sicherheit zwischen westlichen Regierungen, supranationalen Organisationen und LGBTIQ-Selbstvertretungen zu beobachten, die im Kontext von Menschenrechtsdiskussionen ohne Rücksicht auf lokale oder persönliche Verhältnisse ihre Vorstellung von Gleichstellungspolitik durchsetzen (vgl. auch Huber 2013). Doch wer zahlt den Preis für diese Idee, dass öffentliche Räume, öffentliche Einrichtungen und Apparate in demokratischen Ländern immer schon antidiskriminierend seien und sind? Kann über Gewaltandrohung und -erfahrung in diesen Institutionen überhaupt laut gesprochen werden? Und welche Bilder werden forciert, wenn Übergriffe in Asylunterkünften bekannt gemacht wer-
1 | »Human Rights Talk: LGBTQI Movements – Leaps, Bounds and Baby steps«. Diskussionsveranstaltung des Ludwig Boltzmann Institutes für Menschenrechte. 03. März 2016, Juridikum Wien. Eine Videoaufzeichnung der Veranstaltung findet sich unter https://www. youtube.com/watch?v=HqcXYffmcs8 (letzter Zugriff: 08.07.2016).
Can we talk about it?
den? Welche (staatlichen und gesellschaftlichen) Gewaltformen verschwinden, werden unter den Teppich gekehrt?
Taking Place Ein Sonntagnachmittag in der Türkis Rosa Lila Villa, dem Lesben-, Schwulenund Trans*haus in Wien2, ein Treffen der Queer Base, einer Gruppe von Menschen mit und ohne Fluchterfahrung, die sich zusammengeschlossen hat, um LGBTIQ-Geflüchtete willkommen zu heißen und zu unterstützen. Queer Base ist 2015 entstanden und keine reine Selbstorganisation, sondern besteht aus queerfeministischen Aktivist_innen, Migrant_innen und Flüchtlingen.3 Die Flüchtlingsbewegung des späten Sommers 2015 hat uns zwar nicht initial, aber doch massiv verstärkt zusammengebracht. Bei diesem Treffen werden die Sprachen Bangla, Englisch, Farsi, Arabisch, Französisch und Deutsch erstsprachlich gesprochen, meist gibt es sonst auch noch Russisch und Tadjik. Wir versuchen, mit Englisch auszukommen. Thema des gemeinsamen Treffens ist, über die Queer Base zu reflektieren, was sie für uns bedeutet, wie es eigentlich zu ihr kam, wie wir zu ihr kamen. Die letzten Monate waren so dicht gedrängt, dass für manche die gemeinsame Geschichte auf der Hand liegt, andere sind gerade angekommen. Alle sind froh, da zu sein. Yousuf aus Bangladesh ist einer derer, die schon vor der Queer Base da waren. »Heart was little, no hope.« sagt er, seine Homosexualität hat er im Asylverfahren verheimlicht, seine Chancen stehen trotz Änderung des Fluchtgrundes nicht so gut. Er hat massive Übergriffe in den Asylunterkünften erlebt. Sein Wunsch war es, mit anderen LGBTIQ zusammenzuwohnen, ein faires Verfahren zu bekommen, sich nicht schämen zu müssen. »Bitte sich nicht zu schämen!« ist auch das Motto des FreiRäumchen, eines offenen Treffs in der Villa, der schon für geraume Zeit ein Ort zum Kennenlernen und Austausch für alle möglichen neu Angekommen und Dagebliebenen ist. Getanzt wird hier quasi immer und aufgelegt wird in letzter Zeit arabischer und anderer Pop. »How did you hear about Queer Base?« – »First I went to HOSI4 and then they told me about Villa and I talked to Philip!« Mastula aus Uganda lächelt und meint weiter, dass sie sich da erstmals wieder zu Hause gefühlt hatte. »Home, 2 | Die Türkis Rosa Lila Villa ist das Community-Zentrum für Lesben, Schwule und Trans*Personen in Wien: Es entstand 1982 aus der Hausbesetzer_innenbewegung und vereint heute ein Projekt für kollektives Wohnen, ein Beratungs- und Informationszentrum und ein Café-Restaurant. Mehr Informationen zur Türkis Rosa Lila Villa unter http://dievilla. at/ (letzter Zugriff: 01.04.2016). 3 | Queer Base – Welcome and Support for LGBTIQ Refugees. Mehr Informationen unter http://queerbase.at/?lang=de (letzter Zugriff: 01.04.2016). 4 | Die HOSI Wien (Homosexuellen Initiative) wurde 1979 gegründet und ist eine politische Interessensvertretung für Lesben und Schwule in Österreich. Mehr Informationen unter www.hosiwien.at/ (letzter Zugriff: 03.04.2016).
143
144
Mar ty Huber und Queer Base
like a family« setzt Omar aus dem Irak fort, und es fand sich sogar ein schwuler Iraki, mit dem er sich auf Arabisch besprechen konnte. Ali, der sich schon länger in der Flüchtlingsbetreuung engagieren wollte, erinnert sich an das erste Organisationstreffen im August, ein Barbecue in »unserem« neuen Haus mit Garten, mittlerweile selbstorganisierte Wohngemeinschaft von Yousuf. Beim zweiten Treffen kam es nach langem Ringen zum Namen Queer Base und zu Logo-Ideen. Origamivögel und Regenbögen, irgendwie so. Alles sehr chaotisch und noch vor dem großen Stress im Herbst. Aber Queer Base wird besser in der Selbstorganisation und darin, füreinander zu sorgen. Neben ihm sitzt Ali, er ist am Kürzesten in Wien. Es hat über vier Monate gedauert, bis er und sein Partner sich in Wien wieder trafen. Während der Zuteilung in die Grundversorgung waren sie getrennt voneinander in zwei unterschiedliche Bundesländer geschickt worden, obwohl sie vor den Behörden angegeben hatten, ein Paar zu sein. Mittlerweile sind sie beide in einer Schwulen-WG, und ein Haus wie die Villa ist immer noch unvorstellbar und einschüchternd. Omar wirft grinsend ein, er durfte sie beim ersten FreiRäumchen-Besuch gar nicht allein lassen. Dieses weithin sichtbare und bekannte Haus zu betreten, ist eine Hürde. »Also for Austrian LGBTIQ« wirft Marty ein – bis heute ist das Betreten der Villa für viele ein Coming Out durch ein Coming In. Aber die Sehnsucht nach Community hilft dabei, die Scham zu überwinden. Sahab hat in einem anarchistischen Buchladen von der Villa gehört. Er fand, die Buchhandlung hatte eine gut sortierte Abteilung zum Thema Homosexualität. Sahab ist mittlerweile anerkannter Flüchtling aus dem Iran und einer, der immer da ist, wenn etwas gebraucht wird, z.B. Beratung und Übersetzung auf Farsi. Die Ablehnung durch Herkunftsfamilien ist leider immer noch für alle Anwesenden ein Thema, egal ob in Österreich geboren, hierher migriert oder geflüchtet. Cécile ergänzt, dass gerade deswegen der Austausch untereinander so wichtig ist, um Vorstellungen von ausschließlich hilfsbedürftigen Geflüchteten auf der einen Seite und allseits bereiten Unterstützenden auf der anderen zu untergraben.
»Can we talk about it?« Können wir über Homo- und Transphobie sprechen, ohne zu behaupten, es gäbe diese nicht auch hier mitten in Europa? Will das jemand hören? Wollen wir uns nicht alle in Sicherheit wiegen und insbesondere traumatisierten Geflüchteten eine heile Welt vorgaukeln? Was heißt es, in diesen Räumen Schmerzen und Wut zu teilen, selbst die Geschichte des Hass-Grafitti »Töte Schwule! – Ubi Pedera!« an der Fassade der Villa zu erzählen? Und auch die Ermordung von Hande Öncü, einer türkischen Trans*frau, Asylwerber_in und Sexarbeiter_in gehört zur Geschichte der Queer Base, weil Trauer und Wut das politische Handeln befeuert haben.5 Auch hier bleiben wir verletzbar, unterschiedlich gefährdet durch Rassis5 | Vgl. auch den Nachruf Hande Öncü http://dievilla.at/nachruf-hande-oncu/ (letzter Zugriff: 03.04.2016).
Can we talk about it?
mus, Vorstellungen von Geschlechtern und die Urteile, die darüber gefällt werden. Kann darüber gesprochen werden, dass LGBTIQ-Geflüchtete von anderen Asylsuchenden bedroht und geschlagen werden, ohne wiederum rassistische und islamophobe Demagogie zu bedienen? Es werden die Tunten auf den Straßen und in Hauseingängen verprügelt. Wo gibt es einen Platz für die verschiedenen Vorstellungen von Männlichkeiten und Weiblichkeiten? Viele von uns kennen den Verlust der Familie und der gewohnten sozialen Gemeinschaften, und trotzdem sind die Betroffenheiten, Geschichten, Erfahrungen und Strategien der Überwindung so verschieden, wie jede_r von uns. Im FreiRäumchen erzählt dir ein lachendes Gesicht davon, keine Angst davor zu haben, dass die Polizei das Tanzen stört, die Party auflöst und ihre Gäste verhaftet. In diesem Moment verschwindet das strengste Asylgesetz der EU in den Hintergrund, die strukturelle Gewalt des österreichischen Staates als permanente Verhandlungsmaterie wird übertönt von den Bässen aus den Boxen. Wir, die mindestens auf die Einhaltung der Flüchtlingskonvention pochen, sind immer auf dem absteigenden Ast. Wann ist ein guter Moment, dies zu besprechen, wenn gerade die Sehnsucht nach Sicherheit und einem besseren Leben so groß ist?
Make Yourself At Home – Ankommen Als Ali nach vier Monaten endlich das Okay für seinen Transfer nach Wien bekommt, hat er sich einfach in den Bus gesetzt und stand ohne Ankündigung vor dem Haus, in dem er fortan wohnen sollte. Zuerst war niemand da, doch dann hat Omar ihm geöffnet. Alis Partner kam zwei Wochen später. Die Queer Base betreut Wohngemeinschaften von LGBTIQ-Geflüchteten, einige von ihnen werden von der Diakonie organisiert und zur Verfügung gestellt. Das erste Mal gibt es relative Sicherheit, und die Möglichkeit, mit anderen LGBTIQ zusammenzuwohnen, erleichtert es, sich in der eigenen Haut wohler zu fühlen. Nicht allein zu sein mit den Erfahrungen der Ablehnung und die Stärke im Überlebenskampf anzuerkennen, sind wichtige Momente des beginnenden Ankommens. Die Diversität innerhalb von Queer Base bietet die Chance, voneinander zu lernen. Jedoch wird im Gespräch schnell klar, dass es weitere, andere Räume braucht und das FreiRäumchen nicht reicht. »Chatting like now, would be good«, meint Mastula, »especially for new people.« Auch um zu erzählen, was bisher erreicht wurde, dass wir im Ringen um faire Asylverfahren für einander da sind. Asylverfahren im LGBTIQ-Kontext verlangen nach Glaubwürdigkeit, du musst der Behörde klar machen, dass du wirklich dieser sozialen Gruppe angehörst. Räume wie die Queer Base sind deswegen nicht nur eine Frage des Community-Findens, sondern auch der Selbstbestärkung. Der Austausch ermöglicht eine beginnende Auseinandersetzung mit Fragen der internalisierten Homophobie und Vorstellungen von Geschlecht, Eindeutigkeit, Normalität. »Talk-Cafés would be fine«, um sich ein Thema gemeinsam auszusuchen, zu erzählen und zuzuhören. Das gemeinsame Essen ist wichtig, getanzt werden
145
146
Mar ty Huber und Queer Base
kann danach, aber es braucht mehr Platz für das Entstehen von Beziehungen durch geteilte Geschichten.
Creating Communal Change In einem Jahr ist viel entstanden, es gibt Rechtsberatung, ein Buddy-System ist im Entstehen, Wohnungen werden organisiert und der Zugang zur Grundversorgung wird geklärt. Dolmetscher_innen, die nicht homo- oder transphob sind, werden vernetzt und hoffentlich in Zukunft als Übersetzer_innen im Asylverfahren anerkannt. Trauma-Therapieplätze werden gesucht und die medizinische Versorgung speziell von geflüchteten Transpersonen soll verbessert werden. Die Zustimmung der Wiener LGBTIQ-Community ist groß und es wird ideell wie finanziell unterstützt. Doch wird sich die Community selbst ändern müssen, wenn es nicht nur darum gehen soll, eine Service-Einrichtung für LGBTIQ-Geflüchtete zu etablieren. Was heißt das im Kontext kultureller Teilhabe und für die Entwicklung partizipativer Räume von und für LGBTIQ-Geflüchtete? Sind die Begriffe ›Teilhabe‹ und ›Partizipation‹ als Marker für kulturelle Arbeit Ausgangspunkte, die zu früh ansetzen, zu viel voraussetzen? Vielleicht braucht es vielmehr Zurückhaltung von mehrheitsangehörigen Kulturtragenden, um das an kulturellen Ausdrucksformen Mitgebrachte ankommen zu lassen? Gibt es die Zeit, die internalisierten Abwertungen gegenüber niederschwelligen Formen der kulturellen Äußerungen – seien es im Tanz oder im Essen – abzulegen und einen unbesetzten Raum entstehen zu lassen, der im zu entstehenden Vertrauen das Wertvolle erscheinen lässt? Selbstorganisation braucht diese Zeit, jedoch können die Bande, die zwischen Menschen mit und ohne Fluchterfahrung entstanden sind, genau jene Gelegenheiten schaffen, die selbstgewählte Formen und Formate erscheinen lassen.6
Last E xit Main Street – Orientierung Abschließend erscheint noch die Frage der kulturellen, politischen und sozialen Implikationen am Horizont, die sich in das Verhältnis von Flucht aufgrund von sexueller Orientierung und Geschlechteridentität einschreiben. Westliche Vorstellungen von (sexuellen) Identitäten prägen insbesondere Rechtsentwicklung und Rechtsmaterien, die in Asylverfahren schlagend werden. Welchen Beitrag 6 | Ein Beispiel für selbstorganisierte Kulturarbeit ist die Modenschau von Khusen Khaydarow (Mitbegründer von Queer Base), die am 10. März 2016 in Wien stattfand. Er schreibt über die Idee zu seinen Designs, dass er traditionelle Techniken aus Zentralasien mit europäischen Einflüssen verwebt. Neben verschiedenen Stoffen ist Zeitungspapier ein unverzichtbares Material der Kollektion. »In den Zeitungen hier, haben wir viel Negatives über Flüchtlinge gelesen. Dem wollte ich etwas Positives entgegensetzen.« https://www.face book.com/events/928373620565207/ (letzter Zugriff: 05.04.2016).
Can we talk about it?
liefern dazu kulturelle Äußerungen der LGBTIQ-Communities des globalen Nordens? Beliebte Kampagnentitel wie »Born this Way!« nach einem Pop-Song von Lady Gaga suggerieren eine biologistische Determiniertheit, die z.B. im Kontext von Lesben und Mutterschaft zum Verhängnis werden kann,7 ebenso wird die Frage von Trans*Gender (die nicht einfach so geboren sind) wiederum an den Rand des Erzählbaren gedrängt. Postkoloniale Verhältnisse wiederum werden von afrikanischen Regierungen in den Vordergrund geschoben, um Gewalt gegen LGBTIQ zu rechtfertigen. Homosexualität sei eine Orientierung, die der Westen z.B. nach Afrika exportiert habe. Für all das bleibt – im Moment – keine Zeit, jedoch ist Rassismus in der Szene ebenso verbreitet wie die Exotisierung des »Fremden«; Islamophobie und eurozentrische Sehnsucht nach dem Orient teilen sich dieselben Terrains. Auseinandersetzungen mit Religiosität, mit psychischen Erkrankungen und posttraumatischen Störungen, mit verklärten Vorstellungen vom westlichen Paradies stehen noch bevor. Wer genießt Sicherheit und welche Räume sind für wen nötig? »We need to talk about it!«
L iter atur Cohen, Claire (2015): »Home Office tells Nigerian asylum seeker: ›You can’t be a lesbian, you’ve got children‹«, in: The Telegraph vom 04.03.2015, www.tele graph.co.uk/women/womens-life/11448766/Lesbian-Nigerian-woman-toldProve-youre-gay-to-stay-in-Britain.html (letzter Zugriff: 08.04.2016). Huber, Marty (2013): Queering Gay Pride. Zwischen Assimilation und Widerstand, Wien: Zaglossus. Müller, Tobias (2015): »Streit um separate Unterkünfte. Wegen Bedrohung und Diskriminierung in Asylheimen stellt Amsterdam gesonderte Plätze für LGBTFlüchtlinge bereit. Das passt der Regierung nicht«, in: taz vom 10.12.2015. www.taz.de/!5256509/ (letzter Zugriff: 29.03.2016).
7 | Wie Asylbehörden über die Glaubwürdigkeit von LGBTIQ-Geflüchteten entscheiden, hängt sehr stark mit den jeweiligen Vorstellungen von Homosexualität und Geschlechtsidentitäten zusammen. Ein Beispiel für die Auswirkungen für diese Vorstellungen ist das ablehnende Urteil gegen Aderonke Apata, eine nigerianische Lesbe, die nach Großbritannien geflohen war, mit der Begründung, als Mutter könne sie keine Lesbe sein, vgl. Cohen (2015).
147
Solidarität und Dissens Ülkü Süngün im Interview mit Caroline Gritschke
Zusammenfassung Die Stuttgarter Künstlerin Ülkü Süngün zeichnet die Erfahrungen nach, die sie in ihren Projekten mit Geflüchteten seit 2013 gemacht hat. Mit der Zeit veränderte sie dabei ihre produktorientierte künstlerische Praxis zugunsten einer prozessorientierten Arbeitsweise, die die eigene Position permanent hinterfragt. Zugänge zu Ressourcen in den durch ungleiche Macht- und Rechtsprivilegien gestalteten Begegnungen mit Geflüchteten, unterschiedliche Interessen und ungleiche Profitverteilung monetärer und symbolischer Art sind einige der Probleme, die sie anspricht. Diese Betrachtungen zielen – neben eines parallelen direkten Involviertseins – darauf ab, eine Haltung zu entwickeln, die neue Projekte und ein Solidarisieren mit Geflüchteten möglich macht, also Handlungsspielräume eröffnet, ohne Geflüchtete zu instrumentalisieren oder für sie zu sprechen. Diese emanzipatorischen Praktiken orientieren sich an politischen Subjekten, die sie für die wirksame Gestaltung von Kunstprojekten in diesem Feld (voraus-)setzt. Es sind Kunstprojekte, die nicht allein die Lebensrealitäten abbilden, sondern die sie produzierenden Strukturen sichtbar machen und in Frage stellen.
Abstract: Solidarity and Dissent In this conversation, the Stuttgart-based artist Ülkü Süngün illustrates her experiences with the refugees that have participated in her projects since 2013. Over time she has altered her product-oriented artistic practice in favor of a process-oriented method, and one that also constantly questions her own role. Some of the issues that she addresses in her work are inequalities of both power and legal privileges in terms of access to resources, conflicting interests and unequal distribution of profits – both monetary and symbolic. These observations – alongside observations of her direct, simultaneous involvement – aim to develop a position which enables new projects and solidarity with refugees, that is, to create spaces of action in which refugees are not exploited and in which artists do not speak on behalf of refugees. These emancipatory practices are oriented towards political subjects that she posits as prerequisites for effective forms of organizing art projects in this field. These are art projects that don’t only illustrate lived realities, but also reveal and interrogate the structures which produce them.
150
Ülkü Süngün im Inter view mit Caroline Gritschke
Du arbeitest als Künstlerin zum Thema Flucht und mit Geflüchteten. Mit dieser Arbeit hast Du anders als viele andere nicht erst im letzten Herbst begonnen. Genau. Seit 2013 mache ich sehr unterschiedliche künstlerische Projekte mit Geflüchteten. Meine Sprecherposition hier ist also die einer Künstlerin. Die künstlerische Entwicklung, die ich in den letzten Jahren aufgrund der Begegnung und Arbeit mit Geflüchteten oder mit der Asylthematik insgesamt durchlaufen habe, setze ich immer wieder in Beziehung zu den Strukturen, in denen sie stattfindet. Das Produkt meiner Arbeit ist eine Verknüpfung und Reflexion der künstlerischen Praxis und der Konflikte, die sie auslöst, mit der eigenen Biografie und mit den Verhältnissen der Produktionsbedingungen. Dies sichtbar zu machen, ist meine künstlerische Strategie. Die Selbstreflexion spielt also eine entscheidende Rolle. Es gibt oft Kritik an künstlerischen Projekten mit Geflüchteten, die quasi hermetisch abgeschlossen sind und dann auf ihre Zielgruppe zugehen. So würdest Du nicht arbeiten? Für mich sind andere, prozessorientierte Ansätze interessanter. Ich versuche, in meiner Kunst über die Möglichkeit von emanzipatorischer Praxis nachzudenken. Das Politische begreife ich mit Rancière als Dissens. Die Machtstrukturen, die in diesem Feld wirken, sind nicht sichtbar. Sie werden sichtbar gemacht durch Konflikte und Gefühle von Subjekten. Sie werden hervorgerufen oder produziert. Das eigene Scheitern an diesen Bedingungen und Strukturen versuche ich zu zeigen. Das ist das Politische der Kunst: Die Ordnung des Feldes wird gezeigt und in Frage gestellt und möglicherweise verschoben. Die Verschiebungen werfen auch unweigerlich Fragen auf wie: Ist das Kunst oder Politik? Wer entscheidet darüber, wer ist legitimiert, darüber zu sprechen? In der künstlerischen Praxis kommen dann auf diese Weise Macht- und Rechtsprivilegien zum Ausdruck. Ist das Sichtbarmachen allein bereits eine politische Handlung in Deiner künstlerischen Praxis? Reicht das Aufzeigen Deines Erachtens aus? Für mich selber nicht. Das hat mit meinen Begegnungen und meiner Arbeit mit Geflüchteten zu tun. Im Mai 2013 wurde mir die künstlerische Betreuung und Realisierung eines Interventionsprojektes in zwei Museen angeboten. Es handelte sich um eine Kooperation von verschiedenen Institutionen, einer Bildungseinrichtung und den Bewohnern einer Sammelunterkunft. In der Arbeit kamen für mich verschiedene Fragen auf, vor allem: Welche Rolle spielen die Geflüchteten hier? An dieses Projekt schloss sich dann eine künstlerische Arbeit an, die sich über einen intensiven Austausch mit einem einzelnen Geflüchteten entwickelte. Durch die entstehenden Fragen aus dieser Zusammenarbeit musste ich am Ende meine gesamte künstlerische Praxis in Frage stellen. Ich kann sie bis heute nicht abschließend beantworten. Unter den Fragen, die so dringend wurden, standen z.B. meine Privilegien in der eigenen künstlerischen Arbeit im Konflikt mit mei-
Solidarität und Dissens
nem humanistisch-ethischen Selbstbild als Teil dieser Gesellschaft. Im Kontrast dazu stand die Position des Geflüchteten, seiner Rolle in der künstlerischen Produktion. Hier habe ich zum ersten Mal den Umstand, Europäerin zu sein, als Makel und Schuld erlebt. Ich war Bestandteil einer elitären Produktion, die sich an ein elitäres Publikum richtet. In Konfrontation mit Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, die keine meiner Rechte und Privilegien genießen, habe ich die Glaubhaftigkeit und Vertrauenswürdigkeit meiner eigenen Motive in Frage gestellt. Circa 400 Menschen, die mehr oder weniger irgendwie alle mit mir einer Meinung sind, besuchten die letzte Ausstellung, in der ich die Installation Lacrimarium Europae zeigte. Welche Rolle spielten die Geflüchteten? Waren sie lediglich eine Art Illustration oder ein Glaubwürdigkeitsbeweis? Was hatte die Ausstellung verändert? Was ist mit der finanziellen und symbolischen Profitverteilung? In unserer Zusammenarbeit, in der es eine Ungleichverteilung von Macht und Rechten gab zwischen mir und den Geflüchteten, spielten auch Gefühle eine wichtige Rolle: Traurigkeit, Wut, sehr große Angst und tiefes Misstrauen. Wegen der großen Unterschiede zwischen uns war es kaum möglich, hinter die Figuren des Künstlers und des Geflüchteten zu blicken. Diese Inszenierung der Figuren will ich sichtbar machen. Aber reicht das Aufzeigen? Ich war mit meiner eigenen Machtlosigkeit konfrontiert. Ich konnte mit meiner Kunst nicht wirksam sein an den Orten, an denen ich es sein wollte. Das künstlerische Produkt wurde immer unwichtiger und der Prozess rückte in den Mittelpunkt. Über den Austausch mit anderen Künstlern und Aktivisten bemerkte ich Parallelen in den Beobachtungen. Ich begann, darüber zu schreiben, gestaltete eine Lehrveranstaltung und ein Symposium an der ABK Stuttgart hierzu, um unterschiedliche künstlerische Praktiken sichtbar zu machen. Mit den Projektförderbedingungen waren meine Ideen nur schwer zu vereinbaren. Geflüchtete sind mir neu und anders begegnet, als ich das vorher erwartet hatte oder als wir sie zu sehen gewohnt sind. Sie haben sich in den Unterkünften effizient selbst organisiert, haben eigene Strukturen entwickelt und Verantwortliche benannt. Sie haben sich selbst um Kranke und Behinderte gekümmert und eigene Hierarchien gebildet. Das wird oft übersehen. Flüchtlinge, die bereits einen sicheren Status hatten, waren oft Brückenbauer, die sich um ihre Landsleute gekümmert haben. Was war meine Rolle? Es ist auch falsch zu denken, man könne als Künstler eine heterogene Gruppe mit Geflüchteten als Kollektiv von Gleichberechtigten auffassen, wenn es eine rechtliche Gleichstellung nicht geben kann. Natürlich kann ich meine Rechte und Privilegien einsetzen, Ressourcen umverteilen und den Rechtlosen zur Verfügung stellen, um so zu helfen. Ich kann meine Sprecherposition den Geflüchteten als Sprachrohr zur Verfügung stellen. Mit der Kunst kann ich ein Archiv sein, ein Ort des Aufzeichnens und Erscheinens. Aber das verpufft schnell als linker Aktivismus oder als unreflektiertes, neokoloniales künstlerisches Helfertum, als Abtragen von Privilegienschuld, das eine Emanzipation verhindert und neue Abhängigkeiten schafft. Wenn ich nicht selber politisches Subjekt bin, kann
151
152
Ülkü Süngün im Inter view mit Caroline Gritschke
ich nicht mit der Refugee Protest Bewegung zusammenarbeiten, deren Mitglieder sich als solche politischen Subjekte begreifen. So haben die Refugee Aktivisten beim Marsch der KARAWANE/THE VOICE von Würzburg nach Berlin ihren Protest verkörpert und sichtbar auf die Straße getragen. Bei vielen ehrenamtlich aktiven Künstlern sehe ich oft einen resignierten Rückzug aus dieser fruchtlosen Position des Helfens zurück in das Private. Hier müssen wir das Scheitern der politischen Aktivitäten von Künstlern mit und für Geflüchtete hinterfragen und zu einem produktiven Scheitern machen, das gezeigt wird, da sich sonst Handlungsspielräume schließen. So kann eine Form von Solidarität entstehen, die die eigenen Produktionsbedingungen und -unmöglichkeiten mit thematisiert. Ist das nicht sehr zirkulär? Nachdem Du zunächst Geflüchtete nur aus der privilegierten Position der Künstlerin wahrgenommen hast, durchläufst Du diverse künstlerische und reflektierende Prozesse, siehst Dich dann aber doch nicht als politische Akteurin und ziehst Dich wieder zurück in die Position als Künstlerin, die das Geschehen von Ferne wahrnimmt wie vorher? Das ist nicht ganz richtig. Einerseits hat Kunst auch eine eigene politische Dimension in einem ästhetischen Regime. Aber für mich persönlich reicht das nicht aus: In Abhängigkeit von den eigenen limitierten Ressourcen versuche ich, mich so aufzustellen, dass ich einerseits unterstütze und mich involviere, andererseits verbinde ich dies mit politischen Forderungen, die ich künstlerisch organisiere und artikuliere. Es geht mehr um eine Haltung und um Kontinuität, aus der Vertrauen wächst. Zeit- und Finanzökonomien geschuldet, findet man schnell zu einer kollektiven Arbeitsweise. Allain Badious Überlegungen und Forderungen zu den ›Sans-Papiers‹ waren mir wichtig, aber sie müssen aktualisiert werden. Ich betrachte meine Kunst als künstlerisch-politischen Aktivismus. Das ist dann Solidarität im politischen Feld, wenn jeder für sich selbst spricht, sich abgrenzen kann und unterstützt, ohne zu instrumentalisieren. Wenn ich z.B. sage, ich habe keine freien künstlerischen Räume in der Stadt, dann bin ich ganz nah bei den Geflüchteten, die sagen, wenn ich mich selbst organisiere und repräsentiere, habe ich keine politischen Räume. Hier lässt sich konkret zusammenarbeiten.
Solidarität und Dissens
Aber verdeckt das dann nicht wieder die Situation der ungleichen Rechte, wenn jede*r aus der eigenen Position heraus spricht, aber es sind eben keine vergleichbaren Positionen? Blendet das nicht die Machtverhältnisse aus, auf deren Grundlage Solidarität stattfinden soll? Ich lege meine eigene Position, meine Motive und Abhängigkeitsverhältnisse offen, mache sie angreif bar und verhandelbar und denke laut und sichtbar nach über die Möglichkeitsbedingungen von Kunst und politischem Handeln. Das schafft eine gemeinsame Basis, auf der eine weitere Zusammenarbeit gestaltet werden kann. Den Widerspruch und Dissens darin muss man aushalten und nicht nivellieren. Es gibt da keinen generellen Weg, sondern es muss stets lokal und partikular in einem sehr dynamischen Feld immer wieder neu ausgehandelt werden. Indem wir das performativ gestalten und Konflikte aushalten, werden diese produktiv und die Solidarität real und wirksam. Dabei wird ein Raum entworfen, in dem wir gemeinsam – trotz Heterogenität – handeln, Grenzen von Kunst und Politik sich auflösen und herrschende Machtstrukturen ausgesetzt werden können – wenn auch nur vorübergehend.
153
Wir sind die Zukunft: Wir bleiben hier Mohammed Jouni im Interview mit Maren Ziese
Zusammenfassung In dem Interview mit Maren Ziese berichtet Mohammed Jouni, der Sprecher der Organisation Jugendliche ohne Grenzen, von den Erfahrungen der Organisation im Hinblick auf Projekte der Kulturellen Bildung und Kooperationen in diesem Bereich. Er hinterfragt den Sinn von Aktivitäten, die hegemonial strukturiert sind, und kommentiert den aktuellen Hype um das Thema »Geflüchtete«. Dies steht seiner Meinung nach vor allem im Kontrast zur realen Diversitätsentwicklung in Deutschland und dem von ihm gering eingeschätzten Veränderungspotential. Jouni betont die Wichtigkeit, dass Geflüchtete eine eigene Stimme haben, für sich selber sprechen, und hebt die längerfristigen und dringlichsten Herausforderungen hervor, die es in Deutschland für Geflüchtete auf politischer Ebene zu bewältigen gilt.
Abstract: We are the Future: We’re Staying Here Mohammed Jouni is the spokesperson for the organization Jugendliche Ohne Grenzen (Youth Without Borders). In an interview with Maren Ziese, he discusses the organization’s experiences with cultural education projects and partnerships. He interrogates the value of hegemonically structured activities and comments on the current hype around the issue of ›refugees‹. In his opinion, this stands in stark contrast to Germany’s actual development in cultural diversity and the potential for change, which he considers to be minimal. Jouni stresses the importance of refugees speaking for themselves and in their own voice, along with emphasizing the challenges – both the immediately urgent and the long-term – that refugees have to contend with on a political level.
Jugendliche ohne Grenzen (JOG) ist ein 2005 gegründeter bundesweiter Zusammenschluss von jugendlichen Geflüchteten verschiedener Herkunftsländer. Manche sind geduldet, manche haben eine Aufenthaltserlaubnis. Tätigkeitsschwerpunkt ist vor allem die politische Arbeit. JOG setzt sich gegen Rassismus, drohende Abschiebung und für ein Bleiberecht für alle Geflüchteten ein und macht Bildungs- und Kulturangebote. Mohammed Jouni wurde 1985 im Libanon geboren. 1998 floh er mit seiner Familie nach Deutschland und beantragte Asyl in Berlin. Nach einer fünfjähri-
156
Mohammed Jouni im Inter view mit Maren Ziese
gen Bearbeitungszeit wurde dieser Antrag abgelehnt und die Familie bekam den Status der Duldung. Daher durfte Jouni weder arbeiten oder studieren noch das Bundesland Berlin verlassen. Zu dieser Zeit gründete er gemeinsam mit einer Gruppe ebenfalls Geduldeter die Initiative Jugendliche ohne Grenzen, mit der sie auf ihre Lage öffentlich aufmerksam machen wollten. Mohammed Jouni legte 2006 sein Abitur ab und absolvierte danach ein Praktikum in einem Krankenhaus. Anschließend konnte er von einer damaligen Altfallregelung profitieren und bekam ein Bleiberecht »auf Probe«. Im Jahr 2010 schloss er erfolgreich eine Ausbildung zum Krankenpfleger ab und arbeitete in der Folge im Krankenhaus. Inzwischen ist Jouni deutscher Staatsbürger, studiert Soziale Arbeit, hat seine eigene Familie gegründet und setzt sich in vielen Gremien für die Rechte von (jungen) Geflüchteten ein. Er ist Sprecher von Jugendliche ohne Grenzen, Vorstand des Bundesfachverbands unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge und vertritt den Berliner Flüchtlingsrat im Migrations- und Integrationsbeirat. Welche konkreten Erfahrungen hast du mit Projekten der kulturellen Bildung gemacht? Ich habe einmal an einem Videofilmprojekt teilgenommen. Das war durchaus nett gemeint und gemacht und es klang auch ganz toll. Dabei weiß ich im Nachhinein nicht mehr genau, was das Ziel war. Im Groben ging es darum, irgendetwas mit Medien zu machen, den Umgang mit dem Medium Film zu lernen und so weiter. Jemand war an uns herangetreten und hatte uns gefragt, ob wir da mitmachen wollten. Das klang erst mal gut, aber dann ist es ziemlich schiefgelaufen. Aus welchem Grund – das ist etwas, das ich sehr interessant finde und das es wert wäre, erforscht zu werden. Es besteht ja eine Art Abhängigkeit zwischen Projektleiter, Projektbetreuer und den übrigen Teilnehmenden, also den angeblichen Profiteuren von diesem Projekt, den Empfängern von Hilfe und Unterstützung. Es ist zwar klar: Na ja, die bringen mich jetzt nicht um, wenn ich bei dem Projekt nicht weiter mitmache – aber ich bin trotzdem irgendwie verpflichtet. Dabei war der Knackpunkt, dass ich eigentlich gar nicht verstanden habe, worum es denen ging. Ich wusste nur, dass wir eine teure Kamera kaufen, und es wurde auch gesagt, dass die soundso viel tausend Euro wert ist. Es hieß auch, dass wir jetzt eine Lizenz für Photoshop Movie für soundso viel tausend Euro erwerben und auch Musik wegen der GEMA kaufen. Dann fahren wir ein Wochenende weg, ich glaube nach Mecklenburg-Vorpommern auf einen Bauernhof, und da haben wir ein bisschen Zeit. In dem Moment merkst du langsam, okay, das wird irgendwie viel, möglicherweise zu viel. Andererseits ist schon einiges in dieses Vorhaben investiert worden. Und da entsteht dann vielleicht Druck: Da ist jemand, der dir irgendwie helfen und das Werk fertigstellen möchte. Und der Hype ist ja auch ganz gut und es wurde schon so viel Geld und Zeit investiert. Da kannst du doch nicht mehr Nein sagen. Und dann haben wir eben mitgemacht. Ein paar eher überzeugt, ein paar nur halbherzig und ein paar irgendwie nur unter dem Druck der anderen. Im Sinne von: Komm, jetzt haben wir schon so viele
Wir sind die Zukunf t: Wir bleiben hier
Sachen, jetzt machen wir das noch mit, es ist ja bald zu Ende. Zum Schluss waren alle frustriert, denn es sind nur zwei dabeigeblieben, ein Mädchen und ich, weil wir uns auch privat gut verstanden haben. Der Rest ist gar nicht mehr gekommen. Der Produzent, der noch engagiert wurde, um uns ein paar Tricks zu zeigen, war auch frustriert, weil nur zwei, drei Menschen kamen. Der Projektmanager oder -betreuer war ebenfalls frustriert, weil er sich das ganz anders vorgestellt hatte. Und wir waren erst recht frustriert, weil wir wie gesagt die Einzigen waren, die noch dabei waren, und dann fiel das Ganze auf uns allein: Deadline zur Abgabe, Deadline zum Entwurf, Deadline für dieses, Deadline für jenes. Das war alles sehr stressig und nervig. Wie kam das ganze Projekt zustande und was war rückblickend betrachtet vom Ansatz her falsch, dass es dann so schiefgelaufen ist? Die Leute waren auf uns zugekommen, weil sie irgendetwas mit Flüchtlingen und jungen Leuten machen wollten. Ich weiß noch nicht mal, warum sie gerade uns gefragt haben, aber für uns klang das ganz interessant. Dann hat man sich mit uns zusammengesetzt. Angeblich, um den Film zu konzipieren, wobei ich denke, dass das Konzept schon längst feststand. Also, die Problematik ist, dass sich einer als weißer deutscher Mann hinstellt und denkt: Ich bin ja so toll, ich kann mir überlegen, was die brauchen! Dabei hat er gar keine Ahnung davon und sollte hingehen und einfach mal nachfragen, was gebraucht wird. Aber nein, denn irgendwie ist ja klar, dass etwas zu den Themen Flucht, Grenzen, Elend, Trauer und Traumata angeboten werden muss. Dabei kann es sein, dass da ein Sprachkurs gebraucht wird, es kann sein, dass die Leute Lust haben, ein Theaterstück zum Thema Liebe zu machen. Und es gibt vielleicht Jugendliche, die gerne einen Film zum Thema Umwelt oder Pflanzen oder was weiß ich machen würden. Aber das ist nicht förderungswürdig oder es ist nicht so interessant für eine Stiftung oder für irgendeinen Geldgeber, weil schon andere etwas zum Thema Liebe machen. Die sollen sich weiter mit diesem Thema beschäftigen, und die Flüchtlinge sollen sich mit dem Thema Flucht und Ähnlichem beschäftigen, und da es Mädchen sind, sollen sie sich auch mit Mädchenprojekten beschäftigen, und so weiter. Was denkst du über andere Projekte für kulturelle Bildung, von denen du etwas mitbekommst? Ich gehe öfter mal zu Veranstaltungen und schaue mir Sachen an. Neulich bin ich zu einer Filmvorführung gegangen. Die Ankündigung klang gut: Es hieß, dass junge Leute, also jugendliche Geflüchtete, einen Film zum Thema Flucht konzipiert haben und sich mit ihrer eigenen Flucht beschäftigen. Und bei der Ankündigung gab es auch eine kritische Reflexion der »Willkommenskultur« im Sinne von: Essen oder halb kaputte Teddybären austeilen, das reicht nicht aus. Cool, dachte ich, da gehe ich auf jeden Fall hin. Dann war ich dort und wurde wirklich enttäuscht. Im Film fiel kein einziges Wort, und ich übertreibe jetzt nicht, kein einziges Wort zum Thema »Willkommenskultur«, kein einziges Wort
157
158
Mohammed Jouni im Inter view mit Maren Ziese
zum Thema »Essen austeilen reicht nicht aus«. Nichts, gar nichts. Stattdessen waren das kurze Filmporträts von etwa vier, fünf oder sechs Jugendlichen aus Afghanistan, Armenien, Syrien und was weiß ich. Das hat man dann als superkritischen Film verkauft. Ich fand den Film okay, aber ich weiß schon, wie schwierig der Weg nach Europa ist und wie es sich anfühlt, von seinen Eltern getrennt zu sein und so etwas. Wenn da jetzt gestanden hätte: Hassan, Ali, Fatma und Sarah erzählen ihre Geschichten von der Flucht – in Ordnung. Warum macht man das nicht? Dann kommen ja auch Leute dahin, aber es kommen nur bestimmte Leute. Die, die denken: Aha, das ist so traurig, ich muss mir das anschauen. Gab es auch gute Erfahrungen einer Zusammenarbeit von Jugendliche ohne Grenzen mit einem Kulturprojekt? Also, das Wichtigste, was wir je gemacht haben, war die Anbindung an das GripsTheater, weil es seine Kanäle hat und einfach ein Name im Kulturbetrieb und in der Politik ist. Und vor allem, weil da sehr viele kreative Köpfe zusammensitzen, die unsere Anliegen interessant gemacht haben für viele, die sich sonst nie mit diesen Themen beschäftigen würden. Seit zwei Jahren beschäftigen sich viele mit dem Thema Flucht, aber davor hat es gar keinen interessiert. Deswegen war das von Anfang an so eine erfolgreiche Symbiose – Symbiose deswegen, weil auch wir eine bestimmte Expertise haben und weil wir bestimmte Fähigkeiten haben, die das Grips-Theater nicht hat. Eine bestimmte Glaubwürdigkeit und Authentizität zum Beispiel bei den Themen Flucht und Migration – die hat das Grips-Theater nicht, weil die Leute dort selbst keine Geflüchteten sind. Bei den Interventionen – also bei der Tagung »Refugees in Art and Education« – ging es darum, dass wir einen Film über die zehnjährige Geschichte von »Jugend ohne Grenzen« machen wollten. Es war klar, dass wir einen Film aus den ganzen Bildern machen wollten, die wir bis jetzt aus den Aktionen gesammelt haben. Da hieß es: Ja, es gibt die Intervention, das wird bezahlt, wenn wir im Gegenzug bei der Intervention mitmachen, wenn wir beispielsweise Workshops anbieten. Diese Art von Tausch ist für mich ein Beispiel für einen gleichberechtigten Dialog: Jugendliche ohne Grenzen hat etwas, was Grips nicht hat, und Grips hat etwas, was Jugendliche ohne Grenzen gebrauchen kann – und das ist eine gute Grundlage für erfolgreiche Kooperationen. Hier haben beide davon profitiert. Klar gab es auch einige Sachen, die nicht so schön waren bei der Vorbereitung, irgendwelche Missverständnisse. Aber zum Schluss kann ich sagen, es war trotzdem eine gute Erfahrung für uns, weil wir dadurch unter anderem mit Leuten in Kontakt gekommen sind, mit denen wir sonst nie in Kontakt gekommen wären. Wir haben unsere Anliegen bei einem ganz anderen Publikum publik machen können. Was macht in deinen Augen ganz allgemein gelungene Projekte aus? Gelungene Projekte sind langfristiger Natur. Und die Macher_innen müssen sich auch damit beschäftigen, wie rassistisch und diskriminierend und wie privi-
Wir sind die Zukunf t: Wir bleiben hier
legiert sie sind. Dabei geht es gar nicht darum, sich schlecht zu fühlen oder sich zu entschuldigen, weil man jetzt weiß ist und weil man Hans-Peter heißt. Vielmehr geht es darum, sich einer bestimmten Verantwortung bewusst zu sein und über bestimmte Themen nachzudenken – Rassismus, Kolonialismus, wie sind bestimmte Machtverhältnisse entstanden, warum fliehen Menschen und welche Verantwortung trage ich? Und ich sage jetzt extra »ich«, weil ich auch ein Konsument in dieser Gesellschaft bin. Ich habe ein Handy, ich fahre ein Auto, ich trage Kleidung von H&M, ich konsumiere hier auch. Wie trage ich als Konsument dazu bei, dass Menschen ihre Freunde, Familien und so weiter verlassen müssen? Das ist, finde ich, eine gute und wichtige Grundlage, derart an Projekte heranzugehen: mir meiner Verantwortung bewusst und reflektiert sein. Dann denkt man auch nicht mehr einfach – wie viele, die an Hilfsprojekten beteiligt sind: Toll, ich helfe denen. Nein: Die haben ein Recht darauf, und du unterstützt sie dabei, ihr Recht zu bekommen. Die haben das Recht auf Schule, ob du es willst oder nicht, ob es dir passt oder nicht, die haben das Recht darauf. Und die haben das Recht auf Eltern, das heißt, du musst dafür sorgen, dass ihre Eltern herkommen und hier bleiben. Dabei geht es schließlich nur darum, von unseren Erfahrungen zu berichten. Und wir hoffen, die Menschen dadurch ein bisschen wachzukriegen, sodass sie denken: Gut, okay. Vielleicht kann ich einfach mal so ein Café organisieren, wo sich die Leute aus dem Heim unkompliziert, unabhängig und unverbindlich treffen können. Vielleicht gehen sie nur einmal hin, vielleicht mehrmals, vielleicht stellen sie irgendwann fest, dass sie da viele nette Leute kennengelernt haben, Frauen, Männer, Leute aus Afghanistan, aus Syrien und so weiter, und irgendwie verbindet sie alle ja doch etwas. Was müsste bei Kulturprojekten anders sein, damit man etwas davon hat? Ich glaube, entscheidend ist, dass man von vornherein zuhört. Das klingt so banal, aber das wird oft vernachlässigt, einfach mal zuzuhören und herauszufinden: Was interessiert sie, was ist ihre Lebensrealität, was bewegt sie? Das kann Flucht sein, aber das kann auch etwas ganz anderes sein. Und wenn das ermittelt ist, dann habe ich als weißer deutscher Mann vielleicht die Expertise, wo man die Gelder für diese Sachen herbekommt und wo man was beantragt. Und dann ist es legitim, wenn ich Privilegien einsetze – die ich ja habe, weil ich über bestimmte Kenntnisse und Kontakte etc. verfüge. Damit die Leute, die irgendwelche Bedürfnisse oder einfach mal auf irgendetwas Lust haben, das auch realisieren können. Dann setze ich meine Kenntnisse und meine Expertise aber nicht so ein, dass ich der Hauptprofiteur bin, sondern als Unterstützer, der natürlich honoriert werden muss. Einen solchen Umgang mit Privilegien würde ich mir wünschen, oder besser gesagt: Das ist, finde ich, schon eine Pflicht. Und dann ist ebenso wichtig, dass man sich fragt: Was habe ich davon, und was haben die anderen davon? Wenn man sich als in der Regel deutscher Projektmacher darüber im Klaren ist, was man selbst davon hat, zum Beispiel Geld
159
160
Mohammed Jouni im Inter view mit Maren Ziese
oder eine Projektstelle, ist das schon gut. Aber dann muss man sich weiterfragen: Was haben die anderen davon? Wenn man die Projektmacher darauf anspricht, kommt oft keine Antwort. Die klassische Argumentation des Projekt-Nutzens ist: Geflüchtete lernen Deutsch, lernen ihr neues Lebensumfeld kennen, kommen in Kontakt mit der Bevölkerung, oder es ist eine Abwechslung vom Alltag. Okay, aber dann muss man sie aus den Turnhallen herausholen, ihre rechtlich prekäre Situation auflösen, ihnen die Strukturen öffnen, die es schon gibt: Schule, Förderunterricht, Arbeit, Wohnung, freiwillige Feuerwehr und andere Dinge dieser Art. Sie brauchen ja nichts extra, nichts Spezielles. Das heißt, diese Sachen, die extra entstehen, sind dadurch bedingt, dass Leute in Heime und Turnhallen und Baracken gehen und merken, dass das nicht gut aussieht, und dann wollen sie es schöner machen. Dabei vergessen sie aber ganz oft, nach der grundsätzlichen Situation zu fragen. Mir fällt gerade dieses Bild vom goldenen Käfig ein: Der ist ja aus Gold und Edelsteinen, aber er ist trotzdem ein Käfig. Das heißt übertragen auf die Situation in den Wohnheimen: Solange sich diese sozialarbeiterischen Projektmacher nicht politisch engagieren und sich nicht als politisch verstehen, sondern immer nur helfen und helfen und helfen wollen, können sie Projekte machen, bis sie umfallen. Solange sie nicht politisch arbeiten, wird sich sowieso nichts verändern. Fließen das zeitliche und das geldliche Engagement oft in die falsche Richtung? Ja, das kann man so sagen. Es fehlt an Geld für viele Sachen, zum Beispiel für Begegnungsräume. Und die sind in der Regel viel preiswerter als irgendwelche Filmprojekte, weil man im Prinzip nur einen größeren Raum und ein paar Kekse und vielleicht einen CD-Player oder etwas in der Art braucht. Das ist viel günstiger, als für irgendwelche Honorar- und Personalkosten auf kommen zu müssen. Aber diese Begegnungsräume werden als nicht so interessant eingestuft. Wir von Jugendliche ohne Grenzen zum Beispiel befinden uns auch in einer sehr prekären Lage, und das nun schon seit zehn Jahren. Jedes Mal, wenn wir uns alle treffen und austauschen wollen, müssen wir Kirchen und Stiftungen anschreiben und dann 20 Euro oder 100 Euro sammeln, um einen Raum bezahlen zu können. Dann fahren wir noch mit dem Bus oder den halben Tag mit einem Wochenendticket zu dem Treffen. Das macht es einfach schwieriger, sich zu koordinieren. Aber, das ist meine These, es besteht auch kein Interesse daran, so etwas zu fördern. Weil man das, was wir machen, nicht dekorativ darstellen kann. Das ergibt keinen schönen Flyer, auf dem man beispielsweise eine weiße Frau oder einen weißen Mann sieht, der mit »denen« Fahrräder repariert oder mit ihnen kocht, weil sie ja alle so gut kochen können, die Araber. In dem Fall hast du nämlich schöne Plakate und kriegst dafür Gelder. Wenn du aber sagst, die Flüchtlinge wollen sich einfach mal so treffen, die wollen einen Raum für sich haben und sich austauschen, dann ist das vollkommen uninteressant.
Wir sind die Zukunf t: Wir bleiben hier
Und es kann außerdem sein, das ist mein Resümee nach zehn Jahren in dem Bereich, dass die Mehrheitsgesellschaft auch ein bisschen Angst hat, die Kon trolle zu verlieren. Wer weiß, was dabei herauskommt? Nachher wollen sie noch irgendetwas haben oder sie tun sich zusammen, fordern noch mehr und noch mehr. Aber so, wie es jetzt läuft, hat man sie ein wenig im Blick. Die kriegen dann ein bisschen was und einige schöne Projektchen, aber die tun sich nicht zusammen und werden stark. Wir haben uns jetzt zum Beispiel bei der Bundeszentrale für politische Bildung beworben, da gab es eine Ausschreibung. Und wir haben Unterstützung beantragt. Wir haben ein paar Landesgruppen, aber die sind auch nur dann aktiv, wenn die Strukturen vor Ort stimmen, wenn sie Unterstützung bekommen – Beratung und einfach einen Raum haben, wo sie sich treffen können. So wie wir in Berlin das von Anfang an durch die BBZ (Beratungs- und Betreuungszentrum für junge Flüchtlinge und Migrant*innen, Berlin) hatten. Die Beratungsstelle spendiert uns schon seit zwei Jahren aus irgendeinem Projekt eine Viertelstelle, eine Koordinierungsstelle für Berlin, damit eine Person ein bisschen Geld dafür bekommt, zu den Treffen einzuladen, ein paar Kekse zu kaufen, Anfragen zu sammeln. Und wir haben bei der Bundeszentrale beantragt, dass so eine Stelle oder auch nur eine Viertelstelle für die Koordinierung geschaffen wird. Das wurde abgelehnt. Klar, es haben sich viele beworben. Aber ich glaube auch, dass so was für eine Stiftung oder Institution unattraktiv ist. Warum ist Selbstorganisation so ein wichtiges Stichwort? Solche Treffen unter sich finden in geschützten Räumen statt. Im Nachhinein kann ich sagen, das sind Räume, in denen Leute wachsen, die klein sind. Ob das jetzt Frauen sind, Behinderte, Ausländer oder Flüchtlinge oder andere Benachteiligte. Diese Räume, in denen man unter sich ist, sind einfach extrem wichtig, um sich auszutauschen, um sich auch mal die Köpfe einzuhauen und dann wieder zu verständigen und auf einen Nenner zu kommen. Ich habe ja auch im Heim gewohnt, beziehungsweise wir: Wir waren sieben Personen auf 35 Quadratmetern, zwei kleine Zimmer, eine kleine Toilette, eine kleine Küche und so weiter. Das Einzelzimmer war das Elternzimmer und das andere Zimmer war gleichzeitig Wohnzimmer, Esszimmer, Lernzimmer und Spielzimmer für sieben Leute. Da haben wir fünfeinhalb Jahre gelebt. In dieser Zeit habe ich kein einziges Mal einen Freund von der Schule oder von draußen mitgebracht, kein einziges Mal. Ich habe aber auch nie von den beengten Wohnverhältnissen erzählt, wenn mich deutsche Freunde gefragt haben, ob sie mal zu mir kommen können, sondern bin ausgewichen: Nee, wir haben zur Zeit Besuch, wir renovieren, wir sind krank oder ich kann heute nicht. Fünfeinhalb Jahre lang durchweg lügen. Wenn wir aber unter uns waren, gab es keine Hemmungen, solche Sachen zu erzählen. Ich brauchte den anderen auch gar nichts zu erklären, weil sie ja in einer ähnlichen Situation wie wir lebten oder gelebt hatten. Das heißt, wenn Deutsche mit dabei sind, gut, die solidarisieren sich und so weiter.
161
162
Mohammed Jouni im Inter view mit Maren Ziese
Aber trotzdem ist da eine Hemmschwelle, so was zu erzählen, weil es peinlich ist, es ist vielleicht auch dreckig. Dann fragt man sich, was die wohl von einem denken. Ich tu hier vor denen so cool und so sauber und so entspannt. Wenn dann eine Freundschaft entsteht und sie wollen gleich mitkommen und sehen die Gegebenheiten, dann denken sie möglicherweise, was ist das denn für eine Type. Solche Sachen. Was fehlt – neben Schutz- und Begegnungsräumen für politische und kulturelle Arbeit – noch? Ich finde, es fehlt ganz viel. Was mir spontan einfällt, ist, dass sehr, sehr oft Diversity kein Thema ist. Das heißt zum Beispiel, von vielen Beratungsstellen, die existieren, werde ich nicht repräsentiert oder widergespiegelt. Auch viele andere öffentliche Räume sind noch nicht divers, sind noch nicht bunt. Das nehme ich als ein Hindernis für viele Leute wahr, sich zu öffnen, zu entfalten und zu präsentieren. Gilt das auch für den Kulturbetrieb? Für den Kulturbetrieb sowieso, die tun zwar immer so cool und offen, aber trotzdem sind die meisten Projekte weiß und alt und wenig offen. Sie öffnen sich sehr langsam, wahrscheinlich aber noch schneller als andere Institutionen wie zum Beispiel die Polizei. Ganz anders in Amsterdam. Da war ich neulich, und am Flughafen waren viele Frauen mit Kopftuch, die das Gepäck durchsucht haben: Sie hatten eine Uniform mit einem dazugehörigen Kopftuch, und ein paar Schritte weiter stand ein Sikh mit seinem Turban. Und auf der Straße siehst du schwarze Polizisten, und das ist so normal. Sollte – z.B. aufgrund der Vorfälle in Köln – das Geschlechterthema im Kulturbetrieb stärker aufgegriffen werden? Ich finde das Thema auf jeden Fall sehr wichtig, aber es hängt davon ab, wie man das aufgreift. Wir brauchen uns gar nichts vormachen: Viele der Geflüchteten kommen aus patriarchal aufgebauten Familien. Das ist ja auch in Deutschland der Normalfall, jedoch nicht so krass wie in manch anderen Ländern. Damit müssten wir uns natürlich auch beschäftigen, aber die Frage ist, wie und warum. Beschäftige ich mich jetzt deswegen damit, weil du da sitzt und mir sagst: Ich als Deutsche oder Deutscher habe so ein Problem nicht. Aber du hast es, und jetzt beschäftige dich endlich mal damit, du Macho. Dann stehe ich unter Druck: Okay, ich muss jetzt für jede Frau die Tür aufhalten und ganz lieb und nett sein, weil sie das von mir verlangt. Oder aber ich beschäftige mich ernsthaft und langfristig damit, wo das herkommt, warum das so ist, wie das entstanden ist. Das dauert nicht ein halbes Jahr, sondern vielleicht fünf oder zehn Jahre. Wir müssen uns damit beschäftigen, wir müssen uns auch mit vielen anderen Themen beschäftigen. Die Frage ist, wie und unter welchem Druck und mit welcher Intention: Also, machen wir das nur, um der Mehrheitsgesellschaft und ihren Forderungen zu entspre-
Wir sind die Zukunf t: Wir bleiben hier
chen? Oder machen wir das, weil das Verständnis da ist, dass es wichtig ist, sich damit zu beschäftigen, welche Machtstrukturen da sind? Ob das jetzt Frau/Mann ist, ob groß/klein, weiß/schwarz, es gibt ja viele Machtstrukturen. Grundsätzlich hat jedenfalls das, was in Köln passiert ist, nicht dazu beigetragen, dass wir uns ernsthaft damit beschäftigen, sondern viele widmen sich nur kurzfristig diesen Geschehnissen und brüsten sich damit. Sie sehen sich auch gezwungen, jetzt zum Beispiel der Rat der Muslime, sich damit zu beschäftigen und sich zu distanzieren und sich zu rechtfertigen. Von mir zum Beispiel wurde ebenfalls verlangt, dass ich das tue: Warum demonstrierst du nicht dagegen? Aber ich frage mich, warum soll ich jetzt dagegen demonstrieren? Soll ich mich nur damit beschäftigen, weil ich Mohammed heiße oder weil ich angeblich Moslem bin? Beschäftigt sich der Dorfmeier damit, der Ausländerfrauen für seinen Besitz hält, demonstriert der auch? Demonstrieren die Berliner dagegen, dass es so viel häusliche Gewalt in der Republik gibt? Nee, das machen sie auch nicht. Wie beurteilst Du die aktuellen Entwicklungen? Definitiv ist die öffentliche Aufmerksamkeit eine andere: Ich habe zum Beispiel schon vor acht Jahren Workshops zum Thema Flucht gegeben, zu Fluchtursachen und wie die Leute nach Deutschland kommen. Die brauche ich inzwischen gar nicht mehr zu machen, weil im Prinzip fast jeder Kontakt zu Flüchtlingen hat oder angeblich weiß, wie sie nach Deutschland kommen, warum sie kommen und so weiter. Dieses Thema ist überall und en vogue; das ist jetzt Pop. Das führt dazu, dass viele, die früher nach Deutschland migriert sind, sich nun denken: Na toll, für mich hat sich nie irgendeiner interessiert. Das Verrückte und Interessante ist ja auch, dass Leute, die nicht vor zwei Jahren, sondern vor 50 Jahren nach Deutschland kamen, die ersten sogenannten Gastarbeiter zum Beispiel, nicht nur unsichtbar waren, sondern zum Teil auch verhasst. Und vor allem hat sich kein Mensch für sie interessiert. Sie sollten nicht integriert werden oder irgend so ein Blödsinn, und sie leben inzwischen in der dritten Generation hier. Aber es ist nie wirklich anerkannt worden, was sie geleistet haben. Die haben hier aufgebaut, getan und gemacht, und das wurde nie anerkannt. Und sie selbst auch nicht. Sie werden in der Gesellschaft nicht repräsentiert. Die Politik, die Entscheidungsträger: Sie sind weiß, männlich und alt. Darum sehen sich viele, die das Ganze hier mit aufgebaut haben, nirgendwo repräsentiert: weder bei der Polizei noch bei der Feuerwehr noch im Krankenhaus noch in der Politik. Es reicht nämlich nicht, einen Cem Özdemir zu haben, sondern es ist mehr nötig. Zum Beispiel sitzen in vielen Beratungsstellen überhaupt keine Geflüchteten oder Menschen mit Migrationshintergrund, sondern Weiße, die sie beraten. Und viele leben jetzt noch in sehr, sehr prekären Wohnund Arbeitsverhältnissen und so weiter. Das muss zum Thema werden, sonst wiederholt sich in 30 Jahren das, was da passiert ist, mit den Leuten, die heute hier ankommen. Das heißt, diese Leute sind irgendwann sehr lange hier und brau-
163
164
Mohammed Jouni im Inter view mit Maren Ziese
chen bestimmte Strukturen. Und wenn wir jetzt nicht daran arbeiten, dass diese Strukturen geschaffen werden, dann werden wir in fünf Jahren ein größeres Problem haben. Deswegen konzentrieren wir uns nun auf das Thema Bildung und schauen, was sich ergibt. Braucht Deutschland neben einer »Willkommenskultur« auch eine andere »Willkommensstruktur«? Gibt es eine Hierarchisierung verschiedener Geflüchtetengruppen? Beides absolut, ja. Letzteres merke ich auch, und das schafft Konflikte unter den Leuten. Die Regierung oder der Staat oder das System hat es geschafft, eine bestimmte Hierarchie herzustellen: Die guten, beliebten Syrer_innen, die, glaubt man dem medialen Bild, zu 100 Prozent Ingenieur_innen und Ärzt_innen sind – und die schlechten anderen Flüchtlinge, die ja eigentlich gar keine Flüchtlinge sind, sondern Schmarotzer. Die tun ja nur so, als wären sie Flüchtlinge. Darunter fallen zum Beispiel Roma, darunter fallen ganz viele andere Gruppen. Die Afghanen sind jetzt auch in einer sehr besonderen Lage, weil Thomas de Maizière in Erwägung zieht, Afghanistan beziehungsweise Bereiche von Afghanistan als sichere Orte zu deklarieren. Durch so etwas entsteht Spannung. Die Hierarchisierung ist ja nicht nur eine gefühlte, sondern eine tatsächliche. Zum Beispiel haben Syrer, Iraker, Iraner und Eritreer direkt Zugang zu Sprachkursen, sofort. Weil sie eine sichere Bleibeperspektive haben. Die anderen müssen warten oder haben Glück, wenn sich zum Beispiel irgendeine pensionierte Lehrerin denkt: Na ja gut, ich gehe jetzt mal ins Heim und mache da was. Das heißt, viele sind tatsächlich benachteiligt, und so etwas spricht sich herum. Das provoziert Frustration, und dann reicht ein kleiner Funken im Heim oder beim LAGeSo, wenn man sich in seinen Annahmen bestätigt fühlt, wodurch ein Streit entfacht wird. Es entstehen Spannungen, die aber nicht auf das System gerichtet werden, sondern auf die bevorzugte oder angeblich bevorzugte Gruppe. Das dürfen wir wirklich nicht machen, also wir als Flüchtlinge, wir dürfen bei diesem Spiel auf keinen Fall mitmachen. Auch als Gesellschaft dürfen wir das nicht machen, weil es auch in Syrien sichere Orte gibt. Aber das heißt nicht, dass man jetzt Syrer benachteiligen muss. Und es gibt im Libanon unsichere Orte für bestimmte Gruppen. Diese Idee von »sicheren Herkunftsstaaten«, die ist ja an sich falsch und diskriminierend. Könnte man dem bei der kulturellen Arbeit entgegenwirken oder es zumindest vermeiden? Natürlich. Wir reagieren zum Beispiel darauf, indem wir bei uns in der Gruppe solche nationalen oder auch religiösen Grenzziehungen überschreiten. Wir sind Christen und Moslems, Schiiten, Aleviten und Sunniten, Afghanen, Syrer, Libanesen, Menschen aus Kambodscha, Iraner. Es geht um grundlegende Solidarität. Heute sind zum Beispiel die Syrer die Bevorzugten, was eine politische Entscheidung ist. Das bedeutet, es kann sein, dass sich morgen oder in zwei Jahren die
Wir sind die Zukunf t: Wir bleiben hier
Regierung denkt: So, gut, heute sieht es in Syrien anders aus – dann werden die Syrer abgeschoben. Daraufhin sind die besonders Geschützten oder Bevorzugten vielleicht plötzlich die Roma, ein Jahr später sind es die Afghanen und so weiter. Das heißt, wenn wir nicht von vornherein solidarisch miteinander sind und bestimmte Merkmale vernachlässigen, dann haben wir irgendwann gar keinen mehr, der sich um uns kümmert und der mit uns solidarisch ist. Deswegen müssen sich bestimmte Angebote, ob das jetzt im kulturellen oder politischen Bereich ist, für jeden öffnen: für Kinder von Alleinerziehenden, für benachteiligte Hartz-IV-Kinder und so weiter. Es gibt ein paar Gruppen, die sind von vornherein benachteiligt, und das ist eine politische Entscheidung. Das heißt, ein Kind aus einer Hartz-IV-Empfängerfamilie kommt in der Regel auf die Hauptschule oder auf die Sonderschule, es wird schlecht behandelt und später sein eigenes Kind auch und sein Enkelkind ebenfalls und so weiter. Es ist eine politische Entscheidung, dass bestimmte Menschen verarmt bleiben, dass sie Hilfeempfänger bleiben. Nehmen wir mal diese Gruppen, wenn sie gegeneinander hetzen, wie zum Beispiel jetzt in Dresden – was diese Leute nicht sehen, ist, dass nicht die Syrer oder die Flüchtlinge schuld sind, sondern dass das System Schuld oder Verantwortung trägt. Wenn das nicht gesehen wird, dann bekämpfen wir uns gegenseitig. Also haben die Leute, die das verursacht haben, den Streit gewonnen, würde ich sagen. Wird Deutschland durch die Geflüchteten vielfältiger und diverser werden? Ich glaube eher nicht. Es werden einfach die falschen Fragen gestellt. Eigentlich müssten wir uns fragen: Warum sind überhaupt so viele auf der Flucht, und wie können wir uns verändern? Gefragt wird aber: Wie halten wir sie auf? Solange das noch das Prägende bei dieser Diskussion ist, glaube ich nicht, dass sich viel verändern wird. Das ist ein Thema, das jetzt eine Weile sehr viel Hype hatte, und es wird sich sicherlich auch einiges tun – ich kann mir zumindest nicht vorstellen, dass sich nun gar nichts verändert. Aber ich denke, wir dürfen nicht zu optimistisch sein, dass die Gesellschaft jetzt plötzlich diverser wird. Ich glaube nicht daran. Doch das sollte das Leitbild sein, an das Institutionen und Helfende, Unterstützer und Mächtige in dieser Gesellschaft anknüpfen, und das könnte einiges verändern. Nur nicht so viel, wie es nötig wäre, glaube ich. Allerdings hoffe ich, dass ich da falsch liege. Ich hoffe wirklich sehr, dass ich falsch liege und dass wir in fünf Jahren hier sitzen und denken: Wow, ist die Gesellschaft jetzt divers.
165
4. Methoden und Standorte — Methods and Standpoints
Strategien für Zwischenräume Ver_Lernen in der Migrationsgesellschaft Büro trafo.K Verlernen bedeutet nicht vergessen, ebensowenig löschen, annulieren oder niederbrennen. Es bedeutet mutiger zu schreiben, von Neuem zu schreiben. Es bedeutet, neue Fußnoten an alte oder andere Narrative zu heften. Es bedeutet, den Staub wegzuwischen, das Gras zu belüften und den Putz vom Verdeckten abzuklopfen. Verlernen bedeutet, die Medaille umzudrehen und die Geister wiederzuerwecken. Verlernen heißt, in den Spiegel zu schauen und die Welt zu sehen. (B onaventure S oh B ejeng N dikung 2016)
Zusammenfassung Wie können wir Bildung, Kultur und Gesellschaft aus der Perspektive von Jugendlichen in der Migrationsgesellschaft neu denken? Der Text reflektiert Ausgangspunkte und Prozesse des Projekts »Strategien für Zwischenräume. Ver_Lernen in der Migrationsgesellschaft«. Mit dem Projekt wollen wir einen Anfang machen, um die Idee des ›Verlernens‹ nicht nur zu denken, sondern auch mit konkreten Lernformaten in Verbindung zu bringen. Es geht darum, Zugänge zu eröffnen, Formate zu entwickeln, emanzipatorische Praxen zusammenzutragen und zugänglich zu machen, Diskussions-, Bildungs-, Ausstellungs- und Informationsraum zu Geschichte, Stadt, Sprache und Kunst zu schaffen. Selbstverständlich ist unser Projekt ambitioniert und voller impliziter und expliziter politischer und pädagogischer Ziele. Wir haben allerdings die Erfahrung gemacht, dass wir lernen müssen, diese zu hinterfragen und in der Zusammenarbeit auch loszulassen oder zu verändern. Wir haben dabei gelernt, unsere Fragen zuzuspitzen und zu revidieren – zum Beispiel im Hinblick darauf, was die Jugendlichen, mit denen wir arbeiten, bewegt oder warum sie sich beteiligen.
Abstract: Strategies for the Interstices (Un)Learning in the ›Migration Society‹ How can we rethink education, culture and society from the perspective of young people in a ›migration society‹? This paper reflects upon the origin and processes involved in the
170
Büro trafo.K project Strategies for the interstices: (Un)Learning in the ›migration society‹. This project aims to investigate the notion of ›unlearning‹ – not only conceptually, but also in combination with specific learning formats. The aim is to improve accessibility, to develop formats, to gather together and make accessible emancipatory practices, and to create a space for discussion, education, exhibitions and information on topics related to history, the city, language and art. Obviously our project is ambitious and full of implicit and explicit political and educational objectives. However we have come to learn that we need to question these objectives, abandoning or altering them in response to the process of collaboration. This has taught us to refine and revise our questions: for example, in response to the motivations of the young people with whom we work and their reasons for participation.
Wenn wir diese wunderschöne Definition des Verlernens für Vermittlungsprozesse ernst nehmen wollen, dann stellen sich sofort zahlreiche Fragen. Manche sind sehr grundsätzlich, andere richten sich an konkrete Praxen, Lehrpläne und Vorgangsweisen: Wie können wir Bildung, Kultur und Gesellschaft aus der Perspektive von Jugendlichen in der Migrationsgesellschaft neu denken? Was sind Strategien, um vorherrschende Wissensformen zu unterlaufen? Wie können Lehr- und Lernformate neue Sichtweisen auf Wissensformen, darauf, was wir zum Beispiel als Geschichte, Stadt, Sprache und Kunst verstehen, eröffnen? Diese Fragen bilden den Ausgangspunkt eines Projekts, das wir seit einem Jahr verfolgen und das den Titel »Strategien für Zwischenräume. Neue Formate des Ver_Lernens in der Migrationsgesellschaft«1 trägt. Mit dem Projekt wollen wir einen Anfang machen, um die Idee des Verlernens nicht nur zu denken, sondern auch mit konkreten Lernformaten in Verbindung zu bringen. Zugänge eröffnen, Formate entwickeln, emanzipatorische Praxen zusammentragen und zugänglich machen, Diskussions-, Bildungs-, Ausstellungs- und Informationsraum zu Geschichte, Stadt, Sprache und Kunst schaffen – so lassen sich Inhalt und Ziele des Projekts in einem Satz zusammenfassen. Dies tun wir ausgehend von der Idee eines geteilten Raums, den wir zugleich als shared und divided space verstehen. Dieser Text entsteht mitten im Prozess des Projekts und wir möchten ihn dafür nützen, verschiedene Fragen zu diskutieren, die uns beschäftigen, während wir daran arbeiten: 1 | Ein Projekt von Büro trafo.K (Ines Garnitschnig, Renate Höllwart, Elke Smodics, Nora Sternfeld), durchgeführt gemeinsam mit Sheri Avraham und Regina Wonisch, in Zusammenarbeit mit Arif Akkılıç, Maia Benashvili, Gabu Heindl, Xhejlane Rexhepi und Daniel Schweiger. Projektpartner_innen: WUK m.power und Jugend am Werk, Forschungszentrum für historische Minderheiten, maiz – Autonomes Zentrum von und für Migrantinnen und Arbeitskreis Archiv der Migration. Gestaltung: Sonia Garziz, Franziska Kabisch. Projektzeitraum: Juli 2015 bis Juni 2016. Gefördert aus den Mitteln von SHIFT. Das Teilprojekt Ringvorlesung und Publikation wird finanziert von der AK–Wien und erfolgt in Zusammenarbeit mit schulheft. www.trafo-k.at/verlernen/
Strategien für Zwischenräume
Was wird als relevantes Wissen zu Geschichte, Stadt, Sprache und Kunst verhandelt und was nicht? Um wessen Wissen handelt es sich dabei? Welche Vorstellungen gibt es davon, mit welchen Fragen sich wer wie beschäftigen soll? Und wie können wir diesen Kanon herausfordern und hegemoniale Wissensformen unterlaufen? Und dann: Was bedeutet das alles für die gemeinsame Arbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der Migrationsgesellschaft? Wer lernt von wem und was? Wer verlernt? Wie kann das unterschiedliche Wollen der Einzelnen im Prozess Raum haben? Wie können wir uns dafür offen halten, das zu verlernen, was am selbstverständlichsten, am grundlegendsten, oft am wenigsten bewusst ist und was wir am wenigsten zu verlernen erwarten? Und wie können Verunsicherungen, die – als Aspekt des Verlernens – alle am Prozess Beteiligten betreffen, produktiv einbezogen werden?
Das Problem mit den Zielgruppen und das Paradox der Anerkennung: Wie können wir über Differenz sprechen, ohne sie zu reproduzieren? Wenn wir über Verlernen in der Migrationsgesellschaft nachdenken, begegnen wir unweigerlich einem Problem. Denn wenn wir mächtige Sichtweisen herausfordern, »den Putz vom Verdeckten abklopfen wollen«, dann müssen wir nach den Lücken fragen und diese gewissermaßen adressieren oder benennen. Beim Benennen nehmen wir allerdings bereits Zuschreibungen vor, die wiederum nicht frei von mächtigen Wissensformen sind. Wenn wir uns also bewusst an bestimmte Jugendliche wenden, um den Kanon herauszufordern, haben wir bereits Bilder im Kopf, die es doch zu verlernen gilt. Die kritische Kunstvermittlerin Carmen Mörsch und der Bildungstheoretiker Paul Mecheril haben dies sehr treffend thematisiert. So schreibt Carmen Mörsch: »Einerseits wird durch die Adressierung der oder die ›Andere‹ hergestellt, Ungleichheit also manifestiert. Andererseits lässt sich an bestehenden Ungleichheiten nur etwas ändern, wenn entlang eben dieser Ungleichheitskategorien aktiv Gegensteuer gegeben wird.« (Mörsch, 2013: 47f.) Das wirft eine komplizierte Frage auf, deren inhärente Unmöglichkeit einer eindeutigen Beantwortung Paul Mecheril mit dem »Paradox der Anerkennung« (vgl. Mecheril 2000) beschrieben hat: Wie können wir Homogenität auf brechen und Differenz möglich machen, ohne diese dabei zu reproduzieren? Beide Autor_innen schlagen vor diesem Hintergrund einen Perspektivwechsel vor: »Der konsequenteste Umgang mit dem Paradox der Adressierung am Beispiel ›Migrationshintergrund‹ ist eine Verschiebung der Perspektive weg vom ›Migrationsanderen‹ auf die Kulturinstitutionen selbst als Bestandteil der Migrationsgesellschaft, auf ihre strukturell bedingten Ausschlussmechanismen, auf ihr Transformationspotential.« (Mörsch, 2013: 61) Und genau dies sollte mit unserem Projekt geschehen: In der Zusammenarbeit mit Jugendlichen entkommen wir dem Paradox nicht. Allerdings wollten wir möglichst viele Strategien entwerfen, um es zu durchkreuzen. Vor allem aber geht es uns dabei darum, Mittel und
171
172
Büro trafo.K
Wege zu finden, um die Homogenität von Institutionen und Curricula in einer heterogenen Gesellschaft zu unterlaufen.
Methoden, Strategien und Rahmenbedingungen Nachdem die Idee des Verlernens in den letzten Jahren immer wichtiger geworden ist, stellte sich uns die Frage, wie wir ein konkretes Setting für eine Praxis des Verlernens schaffen könnten. Wir haben uns dafür entschieden, unser Projekt auf vier Themenbereiche zu fokussieren: Geschichte, Kunst, Stadt und Sprache.2 Sie werden mittels künstlerischer und aktivistischer Strategien erkundet und untereinander verknüpft. Konkret umfasst das Projekt wiederum vier Elemente: erstens die Entwicklung von Lern- und Ausstellungsformaten in Workshops mit Jugendlichen, zweitens die Versammlung von Materialien und Praxiserfahrungen in einem Archiv, drittens die kritische Wissensproduktion in einer Ringvorlesung und schließlich die Zusammenfassung der Ergebnisse in einer Publikation. Eine wichtige Ausgangsbedingung für uns war es, eine Projektstruktur zu schaffen, die Heterogenität als Basis hatte: Heterogen waren etwa die Ausgangskontexte der Projektbeteiligten. So hatten wir im Team bereits alle einiges zu verlernen, denn unsere Unterschiede in Alter, Herkunft, Sprache, Erfahrungen, Kenntnissen und Tätigkeitsbereichen machten viele verschiedene Zugänge möglich, brachten uns aber auch alle immer wieder in die Lage, uns in unseren Vorannahmen und Selbstverständnissen herausgefordert zu sehen. Ebenso wichtig schien es uns, bewusst nicht auf eine bestimmte zugeschriebene Gruppe von Jugendlichen zu fokussieren. Wir legten vielmehr auch hier Wert auf einen Prozess, in dem Jugendliche aus unterschiedlichen Ausbildungsstätten aufeinandertreffen können sollten, in dem Lehrlinge ebenso adressiert waren wie Schüler_innen, die ein Gymnasium besuchten, in dem Wissenschaftler_innen ebenso an der Wissensproduktion beteiligt waren wie Schüler_innen, Lehrende, Aktivist_innen und Studierende. In der Wahl der Herangehensweisen in den Workshops wählten wir viele freie Formen der Recherche und unterschiedliche inhaltliche Aneignungsstrategien. Dabei verdanken wir viele Ansätze der kritischen Kunstvermittlung und der künstlerischen Forschung. Wir arbeiteten mit Ansätzen aus der Performance, dem Statuentheater, mit Stadtrundgängen, machten gemeinsam Fotorecherchen im öffentlichen Raum, entwickelten Zines (selbst produzierte kleine Heftchen, in denen wir eigene und vorgefundene Texte und Bilder zu einem Thema zusammenführen), zeichneten, führten Interviews, diskutierten Bilder, die die Jugendlichen mitgebracht hatten. 2 | In ihnen werden Ungleichheitsverhältnisse und Spannungsfelder in der Migrationsgesellschaft besonders deutlich und sie eröffnen gleichzeitig besonders interessante inhaltliche und didaktische Perspektiven. Außerdem lassen sie sich mit bestehenden Schulfächern zusammendenken, z.B. Geschichte, Geografie, Deutsch und Bildnerische Erziehung.
Strategien für Zwischenräume
Ein wesentlicher Aspekt des Verlernens besteht für uns in einer Reflexion der Verhältnisse von Lehrenden und Lernenden: So ging es in dem Projekt auch um die Sichtbarmachung von Wissen, Erfahrungen und Kompetenzen der Jugendlichen, die ansonsten immer in eine Situation gebracht sind, etwas »erst« erlernen zu müssen.
Ziele verlernen. Erfahrungen aus dem Projekt Selbstverständlich ist unser Projekt ambitioniert und voller impliziter und expliziter politischer und pädagogischer Ziele. Wir haben allerdings die Erfahrung gemacht, dass wir lernen müssen, diese zu hinterfragen und in der Zusammenarbeit auch loszulassen oder zu verändern. Wir haben dabei gelernt, andere Fragen zu stellen – zum Beispiel die Fragen, was die Jugendlichen, mit denen wir arbeiten, bewegt oder warum sie sich beteiligen. Denn viel interessanter, als den Kanon herauszufordern (was ja vor allem unser politisches Ziel ist), war es für die Jugendlichen, die Möglichkeit zu erhalten, sich Fertigkeiten und Praxiswissen anzueignen. Konkret waren dies etwa auf die Workshops bezogene Techniken wie Radiomachen, Zeitungmachen, Film schneiden, Interviewentwicklung und -führung. Auch die Erprobung und Entwicklung allgemeiner Fertigkeiten, die mit Üben, Sich-Trauen und Ausprobieren zu tun haben können, machte den Jugendlichen Spaß. Sie hatten Lust daran, Inhalte aufzubereiten, zu präsentieren und zu moderieren. Wichtig war es auch, Themen zu transportieren, die die Jugendlichen bewegen. Gerade bei Geflüchteten machten wir die Erfahrung, dass die Erarbeitung dieser Themen oft mit autobiografischen Elementen verbunden war, allerdings nicht, wenn solche Bezüge direkt zum Thema gemacht wurden. Am besten schien es, wenn die Themen allgemein relevant waren und die Bezüge selbst hergestellt wurden. So beschäftigte sich eine Gruppe im Rahmen der Workshopreihe zum Schwerpunkt Geschichte etwa mit einem breiten Spektrum an Themen: Einige Teilnehmer_innen bearbeiteten ausgehend von einem Gedicht ihre Erfahrungen mit Hass, Gewalt und Tod und warfen die Frage auf, was diese Erfahrungen für die Gestaltung des eigenen Lebens bedeuten. Dabei wurde hier gleichzeitig ein zentraler Aspekt für die Auseinandersetzung mit Geschichte deutlich: wie individuelle Lebenswege mit gesellschaftlichen und politischen Bedingungen zusammenhängen. Das Sich-ins-Verhältnis-Setzen zu Geschichte machte diese so im Workshopverlauf zu etwas, das mit dem eigenen Leben zu tun hat. In einem weiteren Teilprojekt schilderten die Jugendlichen ihren Alltag: Sie fotografierten ihre Ausbildungsstelle sowie sich gegenseitig bei unterschiedlichen sportlichen Aktivitäten im öffentlichen Raum. Erst spät erschloss sich uns, wie bedeutsam diese Themenwahl war: Aus der Erfahrung von Selbstwirksamkeit und Gestaltungsmacht im Alltag und im Umgang mit dem eigenen Körper entwickelten die Jugendlichen Strategien, um mit Erfahrungen des Ausgesetztseins und Kontrollverlusts im Kontext von Verfolgung, Flucht und
173
174
Büro trafo.K
Asylverfahren umzugehen und fanden Ansatzpunkte, um über die Gestaltung des eigenen Lebens zu reflektieren und sich als wirkmächtig zu erfahren. So kann die Arbeit der gesamten Gruppe als Auseinandersetzung mit Gestaltungsspielräumen und Selbstbestimmung über das eigene Leben einerseits und Beschränkungen und Grenzen andererseits verstanden werden, und die Analyse und Reflexion dieser Themen kann auch als Ausgangspunkt für die Auseinandersetzung damit genommen werden, wo Gestaltungsmöglichkeiten und wo deren Grenzen liegen. Die Auseinandersetzung mit dieser Unterscheidung erscheint uns nun wiederum wichtig im Sinne der Möglichkeit, Handlungsmacht auszuweiten. Gleichzeitig ist sie auch als ein Beitrag zum Thema Geschichte zu lesen: In der Herstellung einer Beziehung zwischen (allgemeiner) Geschichte und (eigener) Vergangenheit – und sei es auch aus einer Perspektive fehlender Gestaltungsmöglichkeiten im »Großen« – geschieht ein Sich-ins-Verhältnis-Setzen zur Welt, das Geschichte subjektiv bedeutsam und erfahrbar macht. Bei der Auseinandersetzung mit dem Thema »Stadt« machte eine Gruppe einen Film, dem sie den Titel »Welcome Refugees« gab. Die Intention der Jugendlichen war es, den öffentlichen Medien und dem, was alles über Flüchtlinge gesagt wird, etwas entgegenzusetzen. »Das ist das wichtigste aktuelle Thema in Zusammenhang mit der Auseinandersetzung mit Stadt«, meinte die Gruppe bei der Präsentation, »es betrifft alle«. Der Film ist ein öffentliches Statement, in dem Forderungen, Interviews mit Geflüchteten und eigene Erfahrungen miteinander verknüpft werden. Besonders wichtig war es den Jugendlichen, das zu thematisieren, was bei der aktuellen Präsenz des Thema ausgespart wird: ein Wissen über die Situation der Flüchtlinge, über Gesetze und Fluchterfahrungen. Und bei der Präsentation des Films analysierten die Refugees, die Teil der Gruppe waren, in Gegenüberstellung mit ihren eigenen Erfahrungen Veränderungen und Kontinuitäten europäischer Flüchtlingspolitik und mediale Diskurse. Im Rahmen des Workshops zu Sprache eröffnete ein Input zum Umgang mit der tschechischen Minderheit rund um 1900 in Wien eine Möglichkeit, historische Ereignisse mit aktuellen Entwicklungen ins Verhältnis zu setzen. Die Frage der gleichen bzw. ungleichen Rechte regte eine lebhafte und kontroverse Diskussion rund um unterschiedliche Minderheiten und Minderheitenpolitik in der Türkei an und ermöglichte es, konkrete Aspekte auch vor dem Hintergrund des historischen Beispiels analytisch herauszuarbeiten. Hier kam es durchaus zu emotional aufgeladenen Diskussionen. In dieser und einigen ähnlichen Situationen hat uns immer wieder die Frage beschäftigt, was solche Auseinandersetzungen für die Jugendlichen bedeuten. Wir haben hier immer wieder eine gewisse Ambivalenz erfahren. So wurden Konflikte einerseits durchaus als produktiv wahrgenommen, stießen aber andererseits oft auch an Grenzen und Tabus und waren mit der Sorge verbunden, die oft prekäre und doch so wichtige Gemeinschaft in der Gruppe nicht zu zerstören. Gerade im Zusammenhang mit Themen rund um Politik in den Herkunftsländern der Jugendlichen sowie Religion hören wir in letzter Zeit
Strategien für Zwischenräume
vermehrt: »Wir reden nicht darüber.« Die Jugendlichen schützen sich hier offenbar – auch gegenseitig: vor belastenden Themen, vor Abwertung durch andere, vor einem Auseinanderbrechen von Freundschaften oder der Gruppe (aus der sie ja nicht ausbrechen können), vor Bloßstellung und auch vor othering. Und gleichzeitig führt auch das Schweigen über bestimmte Themen immer wieder zu neuen Missverständnissen, Verletzungen und Gräben. Und manchmal bietet auch eine neue Situation des Miteinanderarbeitens – wie eben eine Workshopreihe mit (anderen) Vermittler_innen – gerade für solche Auseinandersetzungen Raum. In jedem Fall erwies es sich in solchen Situationen als wichtig, sehr genau hinzuschauen und gleichzeitig nie zu glauben, wir könnten die Situation in vollem Umfang begreifen, unterschiedliche Arten des Umgangs mit Konflikten zuzulassen, klar zu moderieren, gut auf alle aufzupassen und wenn nötig auch nachträglich noch Gespräche zu führen. Hier gibt es für alle viel zu lernen und zu verlernen. In den Projekten von Büro trafo.K geht es uns immer darum, unterschiedliche Erfahrungen, differentes Wissen und vielfältige Fähigkeiten in Austausch zu bringen und daraus etwas Neues entstehen zu lassen. Was das sein wird, weiß vorher niemand. Es geht darum, gesellschaftliche Realitäten ernst zu nehmen. Es geht auch darum, Migrationsgesellschaft dort zu denken, wo Migration als gesellschaftliche Realität ausgeblendet oder auf migrantische Subjekte fokussiert wird. Migrationsgesellschaft ist die Gesellschaft, in der wir alle leben. Wenn wir zusammenarbeiten, geht es immer um konkrete Verhältnisse mit konkreten Menschen, deren Leben und Geschichte, deren Fähigkeiten und Träume. Das schließt ein Denken in Zielgruppen aus. Es geht um einen wechselseitigen Prozess, in dem alle am Prozess Beteiligten voneinander lernen und verlernen. Statt auf Lernzielen für Zielgruppen zu bestehen, wollen wir uns auf die Zwischenräume einlassen, die entstehen, wenn wir etwas gemeinsam entwickeln und wenn sich unsere Vorstellungen herausgefordert sehen. Auch Andere zu werden, ist das, was wir unter Verlernen verstehen. Diese Zwischenräume, wie sie etwa in den beschriebenen Verhandlungen entstehen, sind dabei nicht immer leicht auszuhalten. Wir wissen, dass sie von Machtverhältnissen durchkreuzt sind, dass wir von diesen bestimmt sind, aber wir wissen auch, dass alle im Zwischenraum handeln können. Uns diesen Auseinandersetzungen zu stellen und dabei im Zwischenraum auch andere zu werden, ist das, was wir unter Verlernen verstehen.
175
176
Büro trafo.K
L iter atur Mecheril, Paul (2000): »Anerkennung des Anderen als Leitperspektive Interkultureller Pädagogik? Perspektiven und Paradoxien«, Vortragsmanuskript zum interkulturellen Workshop des IDA-NRW 2000, in: Zeit für Vermittlung. www.kultur-vermittlung.ch/zeit-fuer-vermittlung/download/materialpool/ MFV0201.pdf (letzter Zugriff: 02.05.2016). Mörsch, Carmen (2013): »Adressierung und das Paradox der Anerkennung«, in: Zeit für Vermittlung. www.kultur-vermittlung.ch/zeit-fuer-vermittlung/v1/ ?m=2&m2=6&lang=d (letzter Zugriff: 02.05.2016). Ndikung, Bonaventure (2016): »Das Gegebene verlernen. Übungen in Demodernität und Dekolonialität von Ideen und Wissen«. http://savvy-contemporary. com/index.php/projects/presentations--talks/ (letzter Zugriff: 15.05.2016).
Globales Lernen in Museen als Form der kulturellen Bildung? Praxisbeispiele Katrin Boemke Zusammenfassung Der Aufsatz zeigt, dass sich der Lernbereich Globales Lernen in Verbindung mit kultureller bzw. künstlerischer Vermittlung besonders für die Arbeit mit und für Geflüchtete eignet. Begonnen wird mit der geschichtlichen und gesellschaftspolitischen Einordnung des Globalen Lernens als Teil der politischen Bildungstradition. Je nach Anlass und Ziel der politischen Bildungsmaßnahme agieren unterschiedliche Akteur_innen und Fördergeber_innen mit jeweils spezifischem Sprachgebrauch. Im Anschluss werden am Beispiel des Vereins Jugend im Museum die Herausforderungen verdeutlicht, die eine praktische Umsetzung von Globalem Lernen mit kultureller Bildung mit sich bringt. Am Ende werden Praxisbeispiele des Vereins vorgestellt, in denen Tandems aus Referent_innen des Globalen Lernens, oft mit Migrationserfahrungen, und Vermittler_innen ihre jeweilige Expertise einbringen. Die Beispiele sind als Zwischenstand zu verstehen und können als Anregungen für Multiplikator_innen der kulturellen Bildung dienen.
Abstract: Global Learning in Museums as a Form of Cultural Education? Case studies This paper illustrates that the teaching field of global learning, in combination with cultural or artistic education is well suited to working with and for refugees. The paper commences with the historical and socio-political classification of global learning as a component of the tradition of political education. Depending on the occasion and objective of the political education strategies, various stakeholders and funding bodies operate with their own, specific forms of language use. By way of an example from the association Jugend im Museum (Young People in the Museum), the challenges associated with a practical implementation of global learning involving cultural education are elucidated. In conclusion, case studies from the association are presented, in which tandems of global learning advisors – often with migrant backgrounds themselves – and education staff apply their expertise. The examples in this paper should be considered preliminary results, and can serve as stimulus for facilitators working in cultural education.
178
Katrin Boemke
Als ich die Zusage gab, einen Beitrag für diesen Sammelband über die Arbeit des gemeinnützigen Vereins Jugend im Museum im Bereich des Globalen Lernens zu verfassen, war ich guter Dinge und freute mich auf die schriftliche Ausarbeitung. Als ich jedoch begann, merkte ich, wie schwer es ist, die richtigen Worte zu finden, ohne den Verdacht zu erwecken, diskriminierend zu sein, unreflektiert über die Herkunft vieler Sammlungen der Museen zu denken und wirklich alle Stolpersteine zu umgehen. Da die zweite aktualisierte und erweiterte Auflage des »Orientierungsrahmens für den Lernbereich Globale Entwicklung« der Kultusministerkonferenz und des Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung vom Juni 2015 eine breite Akzeptanz bei Akteur_innen der politischen Entwicklungsarbeit findet sowie die Grundlage für die praktische Arbeit des Vereins bildet, berufe ich mich im Folgenden auf die dort verwendeten Begriffe. In dem Aufsatz soll aufgezeigt werden, dass sich der Lernbereich Globales Lernen, verknüpft mit kultureller bzw. künstlerischer Vermittlung besonders für die Arbeit mit und für Geflüchtete eignet. Beginnend mit der geschichtlichen und gesellschaftspolitischen Einordnung des Globalen Lernens als Teil der Tradition politischer Bildung, in der unterschiedliche Akteur_innen mit spezifischen Sprachgebrauch agieren und in dem unterschiedliche Fördermaßnahmen greifen, werden anschließend die Herausforderungen am Beispiel des Vereins Jugend im Museum verdeutlicht, die eine praktische Umsetzung bei der Verbindung von Globalem Lernen mit kultureller Bildung mit sich bringt. Am Ende werden drei Praxisbeispiele als Anregung für die eigene Arbeit vorgestellt.
G lobales L ernen im K onte x t interkultureller und antir assistischer B ildungstr adition Das Entstehen des »Lernbereichs Globale Entwicklung im Rahmen einer Bildung für nachhaltige Entwicklung« als pädagogisches Konzept und eines der jüngsten politischen Bildungsbereiche ist wie auch die antirassistische und interkulturelle Bildung nicht ohne den politischen und gesellschaftlichen Diskurs zu verstehen. In den überwiegend angelsächsischen Ländern und den Niederlanden entwickelte sich in den 1950er und 1960er Jahren ein pädagogischer antirassistischer Ansatz, der von den von Diskriminierung betroffenen Minderheiten, vor allem der black communities selbst ausging und dem Kontext der Entkolonialisierung entsprang. Er setzte sich mit Diskriminierung unter dem Blickwinkel der Dominanzbeziehungen und der Machtverhältnisse auseinander. Weitere pädagogische antirassistische Ansätze führen auf die Diskriminierung eingewanderter und asylsuchender Bevölkerungsgruppen zurück oder schließen die Erinnerungs- und Aufarbeitungsarbeit der NS-Verbrechen ein (vgl. Eckmann/ Davolio 2003).
Globales Lernen in Museen als Form der kulturellen Bildung?
Die interkulturelle Bildung hat ihren Ursprung in den Anwerbeabkommen der europäischen Länder in den 1960er und 1970er Jahren. Die Anwerbeländern waren damit konfrontiert, dass sich die Arbeitsmigrant_innen, deren Aufenthalt lange als vorübergehend betrachtet wurde, dauerhaft mit ihren nachgekommenen Familien niederließen. In den 1980er Jahren kamen politisch Verfolgte und Menschen aus Kriegs- und Krisengebieten hinzu. Sprachbarrieren und kulturelles Unverständnis zwischen Pädagog_innen, einheimischen und migrantischen Schüler_innen führten zu dem Gefühl, das andere als fremd wahrzunehmen, was nicht selten zu Ausgrenzung und Diskriminierung führte und nach pädagogischen Lösungen verlangte. Dabei galt es nicht nur, Verständnis für die jeweils andere Gruppe zu entwickeln, sondern vorerst um eine Integration, in der die zugezogene Bevölkerung sich kulturell anpassen sollte (vgl. ebd.). Der Kontext, aus dem die pädagogische Praxis des Globalen Lernens entspringt, ist wiederum ein anderer: »Schwerwiegende Umweltveränderungen, wie die Gefahren der globalen Erwärmung, die Verknappung natürlicher Ressourcen und der Verlust an Biodiversität sowie das Ausmaß der weltweiten Armut, eine zunehmende Einschränkung politischer Rechte und ziviler Freiheiten in vielen Teilen der Welt, Kriege und Bedrohung durch Terrorismus sowie Risiken und Krisen der Finanzsysteme, stellen uns vor politische, ökonomische, soziale und ökologische Herausforderungen.« (Appelt/Siege 2015: 21)
Diese Tatsache wurde auf dem Erdgipfel in Rio 1992 international anerkannt. Aus ihr entstand das Leitbild nachhaltiger Entwicklung. 2002 legte die deutsche Bundesregierung erstmals eine nationale Nachhaltigkeitsstrategie vor und im Mai 2004 hatte die Deutsche UNESCO-Kommission (DUK) zur Umsetzung der UNDekade »Bildung für nachhaltige Entwicklung« (BNE) ein Nationalkomitee einberufen. Daraus resultierend verfasste die Kultusministerkonferenz in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 2007/2008 den »Orientierungsrahmen für den Lernbereich Globale Entwicklung im Rahmen einer Bildung für nachhaltige Entwicklung«, der die Leitlinien für schulische und außerschulische Aktivitäten in diesem Bereich vorgibt und in überarbeiteter Form 2015 veröffentlicht wurde. Wer sich jedoch nach einer Definition des »Globalen Lernens« sucht, wird nicht fündig. »Die Frage, wie eigentlich ›Globales Lernen‹ genau zu definieren sei, ist kaum zu beantworten. Der Begriff des Globalen Lernens ist weder einheitlich definiert noch kann seine konzeptionelle Entwicklung als abgeschlossen betrachtet werden. Auch die Abgrenzungen gegenüber anderen Begrifflichkeiten wie ›entwicklungspolitische Bildung‹, ›Bildung für nachhaltige Entwicklung‹ oder auch ›interkulturelles Lernen‹ sind nicht trennscharf.« (Krämer 2008: 8) Als pädagogisches Konzept gilt es, durch das Globale Lernen die gesamte Bevölkerung und im speziellen Kinder und Jugendliche von Anfang an auf diese sich veränderte und global funktionierende Welt vorzubereiten, Kompetenzen zu
179
180
Katrin Boemke
entwickeln und Handlungsoptionen aufzuzeigen. Als Leitideen des Lernbereichs gelten: • Orientierung am Leitbild der nachhaltigen Entwicklungen • Analyse von Entwicklungsprozessen auf unterschiedlichen Handlungsebenen • Umgang mit Vielfalt • Fähigkeit zum Perspektivenwechsel • Kontext- bzw. Lebensweltorientierung Der Orientierungsrahmen ist das aktuell am breitesten angelegte Bildungskonzept für ein globales Verständnis. Er umfasst alle Schultypen und gängigen Fächer und er hat das Ziel einer Bildung in globalen Zusammenhängen, die die außerschulische Bildung einschließt. Es ist eine Bildung, die einer vielschichtigen und globalisierten Welt entspricht. Eingeschlossen sind auch Bereiche der antirassistischen und interkulturellen Bildungstraditionen sowie Ansätze der kulturellen und künstlerischen Bildung. In dem Artikel ›Beitrag des Faches Kunst zum Lernbereich Globale Entwicklung‹ wird deutlich, dass dem Orientierungsrahmen die ›Einheitlichen Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung Kunst‹ (2005) zugrunde liegt. Dabei wird ›Bild‹ als »ein umfassender Begriff für zwei- und dreidimensionale Objekte, Artefakte, visuell geprägte Informationen, Prozesse und Situationen visueller Erfahrung« (zitiert nach Grosser/Preuss/Wagner 2015: 189) verstanden, das unter anderem der sprachlichen Auseinandersetzung in Kontexten bedarf. Wird davon ausgegangen, dass Kunst auf universalen Grundprinzipien einer globalen Bildsprache basiert, unterliegen Bildproduktion sowie -rezeption dennoch einer kulturell geprägten Sicht. Es wird erkannt: »Auch in der Kunst, v.a. der zeitgenössischen Kunst, ist die Globalisierung längst angekommen« (ebd.: 190). Hier setzt die Arbeit des Vereins »Jugend im Museum« an. In verschiedenen Veranstaltungsformaten verknüpft der Verein Museums- und Ausstellungsinhalte mit global relevanten Themen.
J ugend im M useum goes G lobales L ernen Der Verein Jugend im Museum (JiM e.V.) wurde 1972 von Mitarbeiter_innen der heutigen Staatlichen Museen zu Berlin gegründet, um Kinder und Jugendliche über ein abwechslungsreiches Freizeitangebot an die Berliner Museen heranzuführen. Von Anbeginn an liegt der Schwerpunkt auf mehrtägigen künstlerischen, (kunst-)handwerklichen und musisch-ästhetischen Bildungsangeboten, die überwiegend von Honorarkräften aus der bildenden Kunst angeleitet werden. Entsprechend ist auch die Vermittlung in den Museen, ob kulturhistorisches, naturkundliches oder Kunst-Museum, stark auf die ästhetische Wahrnehmung und Aneignung von Exponaten ausgelegt, die anschließend in den historischen
Globales Lernen in Museen als Form der kulturellen Bildung?
oder (sozio-)kulturellen Kontext gestellt werden. Durch die enger werdende Zusammenarbeit mit der Berlinischen Galerie, dem Landesmuseum für Moderne Kunst, Fotografie und Architektur, nehmen die künstlerische Kunstvermittlung und das künstlerische Experiment einen immer höheren Einfluss auf die Vermittlungsarbeit des Vereins. Der Verein arbeitet in einem breiten Netzwerk von Akteuren der (kulturellen) Kinder- und Jugendarbeit und Museen und organisiert über 600 verschiedene und teilweise mehrtägige Veranstaltungen, über die ca. 10.000 (ca. 15.000 Teilnehmertage) Kinder und Jugendliche erreicht werden. Da viele Berliner Sammlungen aus Artefakten unterschiedlicher Kulturkreise bestehen, spielt die Sensibilisierung für inter- und soziokulturelle Themen ebenfalls eine wichtige Rolle. In den Programmen und Veröffentlichungen des Vereins fällt auf, dass bis über das Jahr 2000 hinaus noch der Fokus auf Kinder und Jugendliche aus der Mehrheitsgesellschaft gelegt wurde, denen ›fremde‹ Kulturen näher gebracht werden sollten. Mit den gesellschaftlichen Veränderungen hin zur Ganztagsschule, dem wachsenden Bewusstsein für eine diverse Gesellschaft und der zunehmenden öffentlichen Kritik am Umgang mit Sammlungsbeständen von Museen, deren legaler Erwerb nicht hinlänglich geklärt ist, stellt sich JiM e.V. den Herausforderungen einer Diversität seiner Teilnehmergruppen. Die Entwicklung von Vermittlungsformaten für Schule wie für Freizeit gehört ebenso dazu wie die Erprobung inklusiver, intergenerativer und partizipativer Methoden. JiM e.V. leistet so seinen Beitrag für mehr Teilhabegerechtigkeit. Als 2011 die Nichtregierungsorganisation (NGO) OIKOS Eine Welt e.V. auf den Verein zutritt, um ihn für eine Kooperation für den Lernbereich »Globales Lernen« zu gewinnen, nimmt er die Chance wahr, sein Vermittlungsspektrum mit einem weiteren kompetenten Partner zu erweitern. OIKOS ist in Berlin einer der profiliertesten privaten Träger entwicklungspolitischer Projekte mit Schwerpunkt im portugiesischsprachigen Afrika. Von 2012 bis 2014 entstehen gemeinsam jährlich um die 100 Veranstaltungen unter Trägerschaft von OIKOS (oikos-berlin.de), die 2014 auf dem Kongress WeltWeitWissen in Stuttgart als besonders herausragend prämiert wurden. Innerhalb der ersten Jahre entstehen erste Formate des Globalen Lernens, die dem Profil des Vereins mit seiner stark praxisorientierten Ausrichtung auf eine künstlerische und (kunst-)handwerkliche Vermittlung entsprechen. Gelungene Praxisbeispiele Globaler Lernangebote im Rahmen von musealer Vermittlungsarbeit anderer Institutionen stehen dem Verein dabei kaum zur Verfügung. Meist beruhen diese auf der Einbindung von Ausstellungsgestaltungen, wie beispielsweise das Projekt Museo Mundial mit seinen Installationen der finep, Forum für internationale Entwicklung und Planung (finep.org). Anfänglich konnte das Ethnologische Museum der Staatlichen Museen zu Berlin, das Museum für Kommunikation, das Märkische Museum des Stadtmuseums Berlin und das Museum für Naturkunde für unser Experiment gefunden werden. Im Rahmen der Projekte »Brücken zur Welt« (2015) und »Wenn Dinge sprechen« (2016) ist Jugend im Mu-
181
182
Katrin Boemke
seum selbst Träger entwicklungspolitischer Veranstaltungen und kooperiert mit weiteren Partnern. Durch die Ausrichtung des Vereins Jugend im Museum auf die überwiegend künstlerische Vermittlung im Museum und das neue Feld des Globalen Lernens, dessen Praxis in vielen Museen nicht stattfindet, verhält er sich subsidiär zu den bestehenden Bildungsangeboten in den Museen.
P r a xisbeispiele Für die Umsetzung verfolgt der Verein das Prinzip der Tandemteams mit jeweils einer/m Referent_in des Globalen Lernens – meist mit Migrationserfahrung und Herkunft aus dem Globalen Süden – und Vermittler_innen aus Museen bzw. Kursleiter_innen des Vereins mit und ohne Migrationserfahrung. In den Projekten gehört der Verzicht frontaler Vermittlung und das Nutzen partizipativer Ansätze ebenso dazu wie das Entwickeln eigener Handlungsoptionen seiner Teilnehmenden, was durch die Themenauswahl mit engem Lebens- bzw. Alltagsbezug ermöglicht wird. Sie eröffnen einen Perspektivwechsel, um die Sicht aus dem Blickwinkel der Menschen aus dem Globalen Süden einzunehmen. Durch die Anleitung von Menschen, die mit eigenen Migrationserfahrungen in die Gruppen kommen, werden Prozesse des Perspektivwechsels vereinfacht und machen die Auseinandersetzung der Themen und auf Augenhöhe mit Gruppen mit Kindern mit Migrationserfahrung oder von Geflüchteten einfacher. Entsprechend stärken die Projekte die kritische Auseinandersetzung gegenüber Meinungen und Aussagen anderer und gegenüber Stereotypen. Dabei soll nicht missverstanden werden, dass der Verein davon ausgeht, dass Menschen mit Migrationshintergrund grundsätzlich die besseren Pädagog_innen für den Lernbereich darstellen; die eingesetzten Referentinnen verfügen jedoch über jahrelange Erfahrungen und sie fungieren als Zeit- und »Kulturzeugen«, die ihre gelebte Kultur und die Folgen des Kolonialismus sowie einer globalisierten Welt in ihren Herkunftsländern wie Indonesien, Indien, Peru, Ecuador, Nigeria, Ghana, Senegal und Togo bezeugen können. In den folgenden Beispielen werden drei verschiedene Formate vorgestellt.
Beispiel 1: Eine Zeit- und Raumreise von Berlin nach Bali Das Projekt ist als Basisprogramm über zwei Tage für Hortgruppen konzipiert. Der Projekteinstieg findet in den Ausstellungsräumen des Märkischen Museums – Stadtmuseums Berlin statt. Im Tandem haben sich die aus Bali stammenden Referentinnen des Globalen Lernens sowie die deutsche Führungskraft des Museums zusammengefunden. Als Einstieg werden balinesische, indonesische, AltBerlinerische und den Kindern bekannte Begrüßungsrituale erprobt. Während des Ausstellungsbesuchs nähern sich die Kinder über Erzählrunden dem Berli-
Globales Lernen in Museen als Form der kulturellen Bildung?
ner Leben von Gleichaltrigen vor ca. 100 Jahren. Es werden Gespräche angeregt und moderiert, mit denen die Kinder das Damals mit dem Heute in Berlin und in Indonesien vergleichend reflektieren. Das Märkische Museum verfügt in seiner Sammlung über Papiertheater, die zum Spielalltag der Berliner Kinder zählen. In Indonesien und auf Bali hingegen besteht eine lange und noch heute gelebte Tradition von Schattenspieltheatern. In der Vermittlungsarbeit wird verdeutlicht, wie sich über die Zeit Sprache, Kommunikation und Spiele mit den veränderten Lebenssituationen und den technischen Möglichkeiten in Nord und Süd verändert haben. Auch gehen die Kinder im Museum auf Entdeckungstour nach Gegenständen, die eine Migrationsgeschichte aufweisen (vgl. Stiftung Stadtmuseum Berlin 2011). Über diese Themen ergründen die Kinder, warum Menschen ihre Heimat verlassen. Die Ausstellungsgespräche werden durch eigenes Tun ergänzt: Einfache Spiele werden kennengelernt, hergestellt und ausprobiert. Durch die Möglichkeit, Empathie für verschiedene Lebenswelten entwickeln zu können, kann auch ein Perspektivwechsel stattfinden. Der zweite Tag, der in der Schule bzw. im Hort stattfindet, greift die Erkenntnisse aus dem Museumstag auf und lenkt den Fokus verstärkt auf das Leben auf Bali. Aus dem angeeigneten Wissen im Museum, entwickeln die Kinder eine eigene kleine Geschichte mit entsprechenden Schattenspielfiguren, in der sie Handlungsoptionen für ihre Figuren – oft von den Kindern selbst mit einem Plädoyer für eine diverse Gesellschaft hinterlegt – probieren können.
Beispiel 2: CUT! Das Projekt wurde als eintägige Veranstaltung für Schüler_innen ab der Klassenstufe 5 und zu beiden Ausstellungen »Der ewige Augenblick. Fotografien und Filme von Digne M. Marcovicz« und »Papas Kino ist tot. Filme von Hansjürgen Pohland und unveröffentlichte Fotografien von Will McBride, Michael Marton, Jean-Gil Chodziesner-Bonne« des Freundeskreis Willy-Brandt-Haus e.V. konzipiert. CUT! versuchte auf kreativ-praktische und experimentelle Weise den Brückenschlag zwischen dem Neuen Deutschen Film Ende der 1960er und der fast zur gleichen Zeit aufkeimenden Filmindustrie Nigerias. In Anlehnung an Hollywood wird der nigerianische Film auch unter dem Namen Nollywood vermarktet. Nollywood-Filme werden heutzutage vorwiegend mit einfachen DV-Camcordern in nur wenigen Tagen gedreht und überwiegend für den heimischen Markt und für weite Teile Westafrikas produziert. Im Tandem arbeiteten ein aus Nigeria stammender Künstler und eine deutsche bzw. österreichische Künstlerin gemeinsam als Vermittler_innen. Der gesamte Projekttag fand in den Ausstellungsräumen statt. Als Einstieg wurden die beiden Ausstellungen vermittelt. Anschließend setzten sich die Schüler_innen mit den jeweiligen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen der Filme und deren Auswirkungen auf die Filmproduktion auseinander. Wie waren die Ländergrenzen in Afrika entstanden und wie sehen die heutigen Lebensbedingungen von nigerianischen Kindern aus? Unabhängig davon,
183
184
Katrin Boemke
wie oder wo Filme entstehen – oft sind sie Träger der gleichen Themen wie Liebe, Tod, (Aber-)Glaube, Verrat, Betrug und Intrigen. Die Teilnehmenden entwickelten Storyboards, drehten mit einfachen digitalen Fotocams und schnitten am Laptop ihren Klassenfilm. An dem Projekt nahmen auch Willkommensklassen teil.
Beispiel 3: Mein textiles Fototagebuch In dem Ferienkurs, der auf vier Tage angelegt ist, von denen drei Tage in der Werkstatt des Vereins stattfanden und an einem das Deutsche Technikmuseum besucht wurde, konnten sich Kinder ab acht Jahren anmelden. Im Tandem arbeiteten ein Berliner Künstler und eine aus Peru stammende Referentin des Globalen Lernens zusammen. Die Idee war, dass sich die Teilnehmenden aus ihren eigenen Kleidungsstücken eines auswählten, dessen Reise sie von der Herstellung bis zum Verkaufsshop kreativ begleiteten. Die Fragen stellten sich nach Herstellungsweise, Material, Färbung und weiteren Zutaten (z.B. Knöpfe oder Pailletten). Zur Materialerforschung wurden eigene gewebte, gestrickte, gehäkelte oder geknüpfte Proben hergestellt, Stoffe wurden in Batiktechniken gefärbt. Mittels Fotogrammen konnten die textilen Strukturen erfasst werden. Die eigenen Erfahrungen wurden durch Wissensvermittlung im Museum ergänzt. Auch wurde vermittelt, welche Auswirkungen der weltweite Handel auf einheimische Produktionen, aber auch auf die Umwelt hat. In dem künstlerisch angelegten und mit Texten ergänzten Tagebuch des Kleidungsstückes wurden aber auch Alternativen des eigenen Handelns gefunden und aufgezeigt. Wie schon anfangs erwähnt, stehen für den Bereich des Globalen Lernens im Museum keine konkreten Praxisbeispiele zur Verfügung, auf die der Verein zurückgreifen kann. Auch stellt der Orientierungsrahmen ein breites Spektrum an Themen mit Umsetzungsvorschlägen zur Verfügung, ist jedoch so global angelegt, dass in der Umsetzung nur Defizite entstehen können. Gerade aber Kindern im Vorschul- oder Grundschulalter können nur Teilaspekte der Globalisierung vermittelt werden und die Gefahr besteht, bei dem Umfang an Problemstellungen in eine fatalistische Haltung abzudriften. Somit sind diese Praxisbeispiele als Zwischenstand eines Lernprozesses zu verstehen, die sich auch aus den Bedingungen der Fördergeber Brot für die Welt, Engagement Global und Stiftung Nord-Südbrücken ergeben. Vor den Auswirkungen einer globalisierten Welt und den Spätfolgen der Kolonisation kann sich heute auch durch die Anzahl an Geflüchteten kaum jemand verschließen. Dabei entstehen Chancen, aber auch Herausforderungen an eine inklusive Gesellschaft. Der Lernbereich Globale Entwicklung kann hier einen wertvollen Beitrag leisten, indem er sich den Themen stellt und Perspektivwechsel der bestehenden Bevölkerung und der Ankommenden initiieren und herbeiführen kann. Da sich auch in den Führungsebenen kultureller Institutionen die Diversität der Gesellschaft kaum abbildet, können Vemittler_innen mit Migrationshin-
Globales Lernen in Museen als Form der kulturellen Bildung?
tergrund, ob mit oder ohne Fluchterfahrung, wichtige Mittler_innen globaler und kultureller Bildung sein. So hat sich beispielsweise aus dem Projekt von JiM e.V. durch den Einsatz eines migrantischen Bildungsreferenten ein erfolgreiches Vermittlungsformat für Willkommensklassen im Märkischen Museum entwickelt. Neben Überlegungen, wie Geflüchtete selbst in die Arbeit in den oben genannten Tandems eingebunden werden können, gilt es als Leistung von JiM e.V., sich noch stärker als bisher eigene Rahmenbedingungen für eine gelungene Vermittlung globaler Zusammenhänge im Einklang mit Sammlungspräsentationen zu schaffen. Dies gilt jedoch nicht nur für den Verein. Ich verstehe Globales Lernen als Chance, integriert in die Vermittlungsarbeit von Museen und aller Bereiche der Kulturvermittlung, neue Perspektiven zu eröffnen, für die bestehende Bevölkerung, für die Ankommenden und die Vermittler_innen, denn sein Ansatz ist als Methode für die Schaffung einer inklusiven Gesellschaft besonders geeignet und nachhaltig.
L iter atur Appelt, Dieter (bis 2013)/Siege, Hannes (2015): »1.1 Aufgaben und Zielsetzung des Orientierungsrahmens«, in: KMK, Orientierungsrahmen, S. 21-25. Eckmann, Monique (2003): »Interkulturelle und antirassistische Bildung: Unterschiede und Ergänzungen«, in: Miryam Eser Davolio/Monique Eckmann (Hg.): Rassismus angehen statt übergehen. Theorie und Praxisanleitung für Schule, Jugendarbeit und Erwachsenenbildung, Zürich: Pestalozzianum, S. 25-36. Grosser, Sabine/Preuss, Rudolf/Wagner, Ernst (2015): »4.2.3 Bildende Kunst«, in: KMK, Orientierungsrahmen, S. 189-206. KMK – Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (Hg.) (2015): Orientierungsrahmen für den Lernbereich Globale Entwicklung, zusammengestellt und bearbeitet von Hannes Siege und Jörg Robert Schreiber (bis 2008 Dieter Appelt), 2. aktualisierte und erweiterte Aufl., Berlin. www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_be schluesse/2015/2015_06_00-Orientierungsrahmen-Globale-Entwicklung.pdf (letzter Zugriff: 01.07.2016). Krämer, Georg (2008): »1.1 Was ist und was will ›Globales Lernen‹?«, in: VENRO (Hg.). Jahrbuch Globales Lernen 2007-2008, Bonn: S. 7-10. Stiftung Stadtmuseum Berlin (Hg.) (2011): ABC der Vielfalt – Entdeckungen im Stadtmuseum Berlin. Berlin.
185
186
Katrin Boemke
W eiterführende L iter atur Engagement Global, Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft, EPIZ (2013): Globales Lernen an Berliner Schulen. Angebote außerschulischer Partner, Berlin. Gugel, Günther (2012): Praxisbox. Interkulturelles Lernen. Grundlagen, Ansätze, Materialien, Tübingen: Berghof Foundation. Joppich, Andreas (2010): Think Global! Projekte zum Globalen Lernen in Schule und Jugendarbeit, Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr. Südwind Agentur, Anthropolis, C.E.G.A., CSDF, European Perspective, Nazemi (Hg.) (2011): Blickwechsel. Handbuch Globales Lernen, Wien. Zimmermann, Olaf/Geißler, Theo (Hg.) (2012): Kulturelle Vielfalt leben: Chancen und Herausforderungen interkultureller Bildung. Aus Politik und Kultur Nr. 8, Berlin: AZ Druck.
»Rassismus und Weißsein, das spielt bei uns keine Rolle«!? Critical Whiteness-Perspektiven auf Kulturelle Bildung Tobias Linnemann und Kim Annakathrin Ronacher Zusammenfassung Rassismus prägt grundlegend die Erfahrungen und die Perspektiven von weißen Menschen in dieser Gesellschaft, die Bedeutung von Weißsein wird jedoch von weißen Menschen (in der Regel) weder wahrgenommen noch benannt. Die Perspektive Critical Whiteness, die im Widerstand gegen Rassismus von Schwarzen Menschen und People of Color entwickelt wurde, richtet den Fokus auf das sonst meist unmarkierte weiße Subjekt und auf weiß dominierte Strukturen. Der Artikel bietet eine Einführung in Critical Whiteness-Perspektiven in Hinblick auf Kulturelle Bildung. Anhand von vier Methoden wird erläutert, wie die Auseinandersetzung mit Rassismus und Weißsein in Institutionen und Projekten der Kulturellen Bildung gestaltet werden kann. Diese Auseinandersetzung wird als Teil von Professionalität verstanden, die es ermöglicht, die eigene Praxis zu reflektieren und so zu verändern, dass weniger Ausschlüsse und Reproduktionen von Rassismus stattfinden.
Abstract: Racism and Whiteness is Irrelevant to us!? A Look at Cultural Education from the Perspective of Critical Whiteness Theory Racism underlies the experiences and perspectives of ›white‹ people in our society, although generally speaking, the significance of whiteness is not perceived, nor mentioned by, white people. The perspective of critical whiteness, which was developed by people of color in opposition to racism, focuses on the otherwise undefined white subject and on white-dominated structures. This paper offers an introduction to the views of critical whiteness theory in relation to cultural education. Four methodologies are reviewed, with respect to how the interrogation of racism and whiteness can be structured in institutions and cultural education projects. This interrogation is to be understood as a component of professionalism, which enables educators to reflect upon their own practice, and to reduce instances of exclusion and the reproduction of racism.
188
Tobias Linnemann und Kim Annakathrin Ronacher
Welche Rolle spielen Rassismus und Weißsein in meiner Arbeit? Über diese Frage haben viele weiße 1 Leser_innen vielleicht noch nicht nachgedacht. Die Annahme, Kulturelle Bildung könnte etwas mit Rassismus zu tun haben, erscheint möglicherweise erst einmal abwegig. Einigen geht eventuell ein ähnlicher Gedanke durch den Kopf, wie ihn ein Fortbildungsteilnehmer aus einer Kultureinrichtung mal auf den Punkt gebracht hat: »Rassismus und Weißsein, das spielt bei uns keine Rolle!« Wenn wir jedoch davon ausgehen, dass Kulturelle Bildung nicht außerhalb von gesellschaftlichen Verhältnissen und damit auch nicht außerhalb von Rassismus stattfindet, erscheint es naheliegend, sich als Professionelle in diesem Bereich mit der Bedeutung von Rassismus und Weißsein für die eigene Praxis zu beschäftigen. Im Folgenden wird zunächst die Perspektive Critical Whiteness vorgestellt. Im Anschluss werden vier ausgewählte Seminarmethoden dargestellt, die wir in Fortbildungen – auch im Kontext Kultureller Bildung – nutzen.
Weißsein und Critical Whiteness Die Perspektive Critical Whiteness richtet den Fokus auf das sonst meist unmarkierte weiße Subjekt und auf weiß dominierte Strukturen – sowohl in der gesamten Gesellschaft als auch in Institutionen wie z.B. Kultureinrichtungen und Projekten der Kulturellen Bildung. Weiß dominiert bedeutet u.a., dass Positionen mit Entscheidungsmacht in der Gesellschaft, in Institutionen und in Projekten fast ausschließlich von weißen Personen eingenommen werden. Doch wer ist eigentlich in dieser Gesellschaft weiß? Wer ist damit gemeint? Weißsein verstehen wir – genauso wie Schwarzsein – nicht als wesenhafte Eigenschaften von Menschen, sondern als soziale Konstruktionen, die jedoch wirkmächtig sind und unsere Lebensrealitäten prägen: »›Rassen‹ sind zwar keine biologische Realität, das Rassekonzept hat aber soziale, ökonomische, politische, psychologische Fakten geschaffen, hat nachhaltig und bis in die Gegenwart unsere Wahrnehmung der Welt strukturiert.« (El-Tayeb 2005: 7) Das lässt sich zusammenfassen in der Formulierung »Race does not exist but it does kill people« (Guillaumin 1995: 107). Weiß zu sein bedeutet, in Bezug auf Rassismus die privilegierte Position innezuhaben, d.h. als weiß werden Menschen bezeichnet, die in dieser Gesellschaft keine Rassismuserfahrungen machen, sondern durch Rassismus Privilegien erhalten.2 Diese Privilegien werden von den meisten weißen 1 | Wir übernehmen die kursive Schreibweise von ›weiß‹ von den Herausgeberinnen des Sammelbandes »Mythen, Masken und Subjekte«, um den Konstruktionscharakter von Weißsein zu betonen, während ›Schwarz‹ als Selbstbezeichnung großgeschrieben wird, um das Widerstandspotential zu betonen (vgl. Eggers u.a. 2005: 13). 2 | Gleichzeitig ist die Frage, wer weiß ist und wer nicht, nicht immer eindeutig zu beantworten. So erleben beispielsweise einige Menschen, die als weiß wahrgenommen werden, im Zusammenhang mit ihrem jüdischen, osteuropäischen oder südeuropäischen Hinter-
»Rassismus und Weißsein, das spielt bei uns keine Rolle«!?
Menschen »als dermaßen selbstverständlich [empfunden], dass [s]ie noch nicht einmal wissen, dass sie existieren und welche das sind« (Sow 2009: 42). Weiße Privilegien zeigen sich zum Beispiel in der Erfahrung, als selbstverständlich zur deutschen Gesellschaft zugehörig zu gelten: Auf die Frage »Wo kommst du her?« reicht die Antwort »Bremen« völlig aus (vgl. Kilomba 2008: 64ff.). Sie zeigen sich auch in einem erleichterten Zugang zu gesellschaftlichen Ressourcen, wie zum Arbeitsmarkt, Wohnungsmarkt (vgl. Müller 2015) oder Entscheidungspositionen und in zahlreichen Räumen, Darstellungen, Medien, Theaterstücken, in denen ausschließlich weiße Menschen vorkommen und als Individuen repräsentiert sind. Rassismus prägt grundlegend die Erfahrungen und die Perspektiven von weißen Menschen in dieser Gesellschaft. Die Bedeutung von Weißsein wird jedoch von weißen Menschen (in der Regel) weder wahrgenommen noch benannt; nur die ›Abweichung‹ von der Norm, das Schwarzsein, of Color-Sein3 oder Migrantisch-Sein wird wahrgenommen, markiert, benannt und thematisiert. Beispielsweise werden wir, die beiden weißen Autor_innen dieses Textes, in der Regel nicht gefragt, welchen Einfluss unser Weißsein auf unsere Arbeit als Bildungsreferent_innen hat oder auch auf das Schreiben dieses Textes. Uns wird meist zugeschrieben, für fast jede Funktion, für viele Themen und die verschiedensten Zielgruppen kompetent zu sein. Die unbenannte Norm von Weißsein legt weißen Menschen nahe, von einer scheinbar neutralen Position aus professionell handeln, künstlerisch wirken und Bildungsangebote machen zu können. Darin spiegelt sich die gesellschaftliche Struktur der Verknüpfung von Weißsein mit Neutralität und Objektivität und von Schwarzsein mit Parteilichkeit und Subjektivität wider (vgl. Kilomba 2008: 27f.). Mit der Perspektive Critical Whiteness lässt sich analysieren, wie Weißsein und rassistische Strukturen wirken und reproduziert werden. Dabei ist diese Perspektive nicht neu und nicht von weißen Menschen entwickelt worden. Im Gegenteil, historisch ist Critical Whiteness über Jahrhunderte hinweg in Kämpfen von Schwarzen Menschen und People of Color gegen weiße Dominanz und Unterdrückung an verschiedenen Orten der Welt entstanden (vgl. Piesche 2005; El-Tayeb 2005).4 Critical Whiteness wird deshalb auch als eine »Überlebensstragrund Privilegien anders oder nicht mehr, wenn sie ihren Namen sagen, über ihre Familie sprechen, ihr Akzent hörbar wird, sie religiöse Symbole verwenden etc. Selbstverständnisse von Menschen, die etwa Antisemitismus oder Antislawismus erfahren, sind vielfältig – einige verstehen sich selbst als weiß, andere nicht. Das Verhältnis von Rassismus und Antisemitismus ist komplex: Wir verstehen Antisemitismus nicht einfach als eine Variation von Rassismus, auch wenn sich einige Erscheinungsformen ähneln (vgl. Messerschmidt 2012). 3 | People of Color ist ein politischer Bündnisbegriff, der von vielen Menschen, die Formen von Rassismus erfahren, als Selbstbezeichnung verwendet wird (vgl. Ha 2007; Dean 2011). 4 | Dazu zählen beispielsweise Widerstandsbewegungen gegen Versklavungshandel in der Karibik und den Amerikas, antikoloniale Kämpfe in Afrika, Asien und den Amerikas und
189
190
Tobias Linnemann und Kim Annakathrin Ronacher
tegie« (Piesche 2013; vgl. auch hooks 1994: 204) von Schwarzen Menschen und People of Color beschrieben. Denn Teil dieser Kämpfe war und ist immer auch die Beobachtung und Analyse des Verhaltens und der Ausübung von Macht von weißen Menschen und weißen Institutionen: »Schwarze Menschen haben Weiße immer ganz genau […] observiert, taxiert und analysiert« (Eggers 2005: 19). Darin wurde ein »Wissensarchiv« (ebd.) über Rassismus und Weißsein herausgebildet und tradiert. Dieses Wissen fließt auch in die Empowerment-Arbeit von Menschen mit Rassismuserfahrungen ein.5
Auseinandersetzungen mit Rassismus und Weißsein gestalten Die Auseinandersetzung mit Rassismus und Weißsein ermöglicht es, die eigene Praxis zu reflektieren und so zu verändern, dass weniger Ausschlüsse und Reproduktionen von Rassismus stattfinden. Wir begreifen diese Auseinandersetzung als Teil von Professionalität, ohne die es für Kultureinrichtungen heutzutage nur schwer möglich ist, angemessen auf die aktuellen künstlerischen und gesellschaftlichen Entwicklungen, auf Diskurse, Aufträge und Zielgruppen einzugehen. Doch wie können Institutionen diese Auseinandersetzungen gestalten? Wie kann pädagogisch zu Rassismus und Weißsein gearbeitet werden? Weiße Menschen machen andere Erfahrungen mit Rassismus als beispielsweise Schwarze Menschen, People of Color, Migrant_innen, Roma und Sinti, Geflüchtete. Die Auseinandersetzungen mit und Lernprozesse zu Rassismus sind daher durch unterschiedliche Fragen und Bedürfnisse geprägt. Darauf auf bauend sind Fortbildungs- und Workshopkonzepte entwickelt worden, die mit verschiedenen Lernräumen arbeiten. Fortbildungen zur kritischen Reflexion von Rassismus und Weißsein (oft bezeichnet als Critical Whiteness-Workshops) richten sich ausschließlich an weiße Personen – also an Menschen, die in Deutschland keine Rassismuserfahrungen machen. Parallel dazu finden in der Regel Fortbildungen aus einer Empowerment-Perspektive statt, die sich an Menschen mit Rassismuserfahrungen richten und von Kolleg_innen mit Rassismuserfahrungen konzipiert und gestaltet werden.6 Des Weiteren gibt es gemeinsame Fortbildungen für Mengegen den Deutschen Kolonialismus (zum Beispiel im heutigen Namibia) (vgl. Diallo 2014; Kraft/Ashraf-Khan 1994), die Bürgerrechtsbewegung in den USA, gegen das Apartheidsystem in Südafrika und die vielfältigen Kämpfe gegen Rassismus in Deutschland (vgl. Bojadžijev 2007; Çetin/Taş 2015; Oguntoye/Ayim/Schultz 1986). 5 | Seitdem Critical Whiteness zunehmend in akademischen Diskursen aufgegriffen wird, lässt sich eine Vereinnahmung dieses Wissensarchivs durch weiße Personen ausmachen, die kritisch zu betrachten ist. In diesem Spannungsfeld zwischen Anerkennung, Aneignung und Vereinnahmung bewegen wir uns auch als weiße Trainer_innen, wenn wir diese Perspektiven als Grundlage für unsere Fortbildungen und Workshops verwenden. 6 | Fortbildungen mit einer Empowerment-Perspektive bieten einen Raum für die Analyse der Bedeutung von Rassismus für die eigene Biografie, den beruflichen Kontext und
»Rassismus und Weißsein, das spielt bei uns keine Rolle«!?
schen mit und ohne Rassismuserfahrungen. Dies bietet sich erfahrungsgemäß für Gruppen an, die sich schon kennen und die zusammen arbeiten, wie Teams oder Projektgruppen; hier gibt es dann innerhalb der Fortbildung die Möglichkeit, phasenweise in getrennten Räumen zu arbeiten.7 In Fortbildungen und Workshops zur kritischen Reflexion von Rassismus und Weißsein geht es um die Sensibilisierung für eigene Verstrickungen, Privilegien und erlernte rassistische Bilder. Die Auseinandersetzung mit dem eigenen Wissen sowie mit Unsicherheiten ist dabei zentral. Mit verschiedenen Methoden werden folgende Fragen thematisiert: Was bedeutet Weißsein? Was ist unsere (unterschiedliche) gesellschaftliche Position in Bezug auf Rassismus? Welche Privilegien sind mit Weißsein verknüpft? An welchen Punkten reproduzieren wir (unbewusst) Rassismus? Wie ist unser Blick auf ›die Anderen‹, unser ›Umgang‹ mit ihnen durch Rassismus geprägt? Wie kann ich meinen Alltag, mein berufliches Umfeld und meine Projekte rassismuskritisch gestalten? Was sind Möglichkeiten für weiße Menschen, sich wirksam und nachhaltig gegen Rassismus zu engagieren?
Was passiert in der Praxis? – Methoden zur kritischen Reflexion von Rassismus und Weißsein In Workshops und Fortbildungen zur kritischen Reflexion von Rassismus und Weißsein arbeiten wir mit unterschiedlichen Methoden der Selbstreflexion, der Praxisreflexion und der Reflexion von Organisationsstrukturen, von denen wir im Folgenden eine Auswahl vorstellen. Die ausgewählten Methoden setzen jeweils auf verschiedenen Ebenen an und beinhalten unterschiedliche Zugänge zu der Auseinandersetzung mit Rassismus und Weißsein. So liegt bei einigen Methoden der Fokus auf Selbstreflexion (Biografiearbeit, Privilegiengalerie), andere ermöglichen die Auseinandersetzung mit der eigenen Praxis und institutionellen Strukturen (Praxis- und Organisationsreflexion). Methoden wie die Medienanalyse arbeiten eher auf einer kognitiven Ebene, andere, wie die Privilegiengalerie, beinhalten auch die Auseinandersetzung mit den eigenen Emotionen. Ein weiteres Kriterium für die Auswahl war, dass die Methoden auch für den Kontext den Alltag. Zentral ist dabei die Einbettung individuell erlebter rassistischer Situationen in einen strukturellen Hintergrund. Ziel der Fortbildungen ist eine Vernetzung, Stärkung und Selbstermächtigung der Teilnehmenden sowie das Erarbeiten von Handlungsspielräumen und Strategien gegen Rassismus (vgl. Can 2013; Gonzalez Romero 2013; Fleary/El Omari 2015; Nassir-Shahnian 2013; Nguyen 2013; Rotter 2013; Yiğit/Can 2006). 7 | Ein grundlegendes Dilemma: Bei beiden Varianten findet eine Wiederholung von Unterscheidungen und Eindeutigkeiten statt. Für einzelne Teilnehmende ist es leichter und eindeutiger, sich für einen Raum zu entscheiden, als für andere (vgl. Linnemann/Mecheril/ Nikolenko 2013). Dies ist ein Widerspruch, in dem sich Bildungsangebote zu Rassismus bewegen.
191
192
Tobias Linnemann und Kim Annakathrin Ronacher
von Kultureinrichtungen und Kultureller Bildung sinnvoll sind. Ausgehend von unseren Erfahrungen als Bildungsreferent_innen beschreiben wir Prozesse, die sich im Zuge der Auseinandersetzung mit Rassismus und Weißsein häufig beobachten lassen.
Privilegiengalerie Die Methode Privilegiengalerie zielt auf die Reflexion weißer Privilegien im Zusammenhang mit Rassismus ab. Der Fokus liegt darauf, welche Auswirkungen rassistische Strukturen und Privilegien auf die Lebensrealität, den Alltag und die Professionalität von weißen Menschen haben. Die Methode beinhaltet dabei sowohl eine kognitive Ebene (Wissen um Privilegien) als auch eine emotionale Ebene (Gefühle, die mit den Privilegien sowie deren Bewusstwerdung verbunden sind). Die Methode wurde von Mitja Lück-Nnakee und Kevin Stützel (Lück/Stützel 2009) auf der Grundlage einer Sammlung weißer Privilegien von Peggy McIntosh (McIntosh 2000) entwickelt und wird jeweils auf den spezifischen Kontext der Fortbildung angepasst. Hier eine Auswahl weißer Privilegien: • Ich bin selbstverständlich mitgemeint, wenn von ›der deutschen Gesellschaft‹ die Rede ist. • Ich werde nie gefragt, für alle Leute meiner ›Hautfarbe‹/›Herkunft‹ zu sprechen. • An einem Bahnhof werde ich nicht ohne Anlass von der Polizei kontrolliert. • Ich kann mir aussuchen, wann ich mich mit Rassismus beschäftige. • Bei der Rollenvergabe im Theater denke ich nicht darüber nach, ob ich diese Rolle möglicherweise trotz oder wegen meiner ›Hautfarbe‹/›Herkunft‹ bekommen habe. • Ich kann davon ausgehen, dass meine künstlerischen oder kulturellen Beiträge eher als individuell anerkannt werden und nicht primär als Repräsentation meiner ›Hautfarbe‹/›Herkunft‹ angesehen werden. Die Teilnehmenden lesen einzeln und in Stille die Privilegien durch, die in einem Gang oder Treppenhaus aufgehängt sind. In der gemeinsamen Reflexion liegt zunächst ein Fokus auf Gefühlen, die spürbar wurden. Die geäußerten Gefühle ähneln sich von Fortbildung zu Fortbildung sehr, häufig genannt werden Schuld, Scham, Wut, Ärger, Abwehr, Erstarren, Erstaunen, Unsicherheit, Ohnmacht, aber auch Erleichterung, Sicherheit und Macht (vgl. Lück/Stützel 2009: 342f.). Die Gefühle und inneren Prozesse, die in der Privilegiengalerie ausgelöst werden, sind generell in der Auseinandersetzung von weißen Menschen mit Rassismus und dem eigenen Weißsein immer wieder präsent. Durch die Privilegiengalerie wird ihre Thematisierung und Reflexion ermöglicht.
»Rassismus und Weißsein, das spielt bei uns keine Rolle«!?
Während der Durchführung der Methode lässt sich oft die Tendenz beobachten, über diejenigen zu sprechen, die Rassismus erfahren, statt sich mit der Bedeutung von weißen Privilegien für das eigene Leben und das eigene Selbstbild zu beschäftigen. Solche Themen- bzw. Fokusverschiebungen finden häufig in Auseinandersetzungen mit Rassismus und Weißsein statt – es ist für weiße Menschen sehr herausfordernd, beim eigenen Weißsein zu bleiben (vgl. Pech 2006: 80). Dies kann als ein Moment von Abwehr verstanden werden, der durch diese Methode ausgelöst und zugleich dadurch auch besprechbar wird. Des Weiteren thematisieren Teilnehmende in der Auswertung häufig eigene Diskriminierungserfahrungen z.B. aufgrund von Sexismus, Heteronormativität oder Klassismus. Hier findet ebenfalls eine Themen- und Fokusverschiebung statt, wenn dadurch nicht mehr über die eigene privilegierte Position in Bezug auf Rassismus gesprochen wird. Gleichzeitig kann dies auch einen Raum eröffnen, um Unterschiede, aber auch Parallelen in verschiedenen Machtverhältnissen sowie das Zusammenwirken von Privilegierung und Diskriminierung zu besprechen. Die emotionale Bewusstwerdung von Privilegien kann eine Bewegung zu Handlungsfähigkeit bedeuten. So kann z.B. Scham ein Anlass sein, die bisherigen Selbstbilder in Frage zu stellen, Wut kann ein Antrieb sein, um rassismuskritisch aktiv zu werden (vgl. Wollrad 2009: 9). Auch die kognitive Bewusstwerdung von Privilegien hat eine Bedeutung für Handlungsfähigkeit: Das Wissen um konkrete Privilegien ermöglicht es, diese im Sinne von Powersharing (vgl. Meza Torres/Can 2013) für gesellschaftliche und institutionelle Veränderung einzusetzen. Durch die Methode wird deutlich, dass weiße Auseinandersetzungsprozesse mit Rassismus in Spannungsfeldern geschehen. So stehen die Gefühle von Verunsicherung und Sicherheit in einer Spannung, die nicht auflösbar ist. Beide Gefühlszustände halten wir für wichtige Momente in der Auseinandersetzung mit Rassismus und Weißsein, auch wenn das Bedürfnis der meisten Teilnehmenden nach Sicherheit sehr stark ist. Zusammen mit der Gruppe überlegen wir, welche positiven Momente es auch an dem Gefühl der Verunsicherung gibt. Im Anschluss an den Austausch zu Gefühlen lässt sich darüber sprechen, welche Privilegien in den konkreten privaten und professionellen Kontexten der Teilnehmenden bedeutsam sind und welche Anknüpfungspunkte für Veränderung sie bieten. Ein Risiko, das diese Methode – aber auch weiße Selbstreflexion allgemein – mit sich bringt, ist die Tendenz, Privilegien zu individualisieren. Privilegien werden dann nicht als Effekt der eigenen Involviertheit in rassistische gesellschaftliche Strukturen verstanden, sondern als individuelle Schuld erlebt, die es durch eigene Anstrengung zu überwinden gilt, um zu moralisch besseren Weißen zu werden. Dies gründet auf der Illusion, rassistische Strukturen und Privilegien durch eigene individuelle Anstrengung überwinden zu können (vgl. Arndt 2005: 348ff.). Die Auseinandersetzung mit der Tendenz der Individualisierung birgt jedoch die Chance, das Potential kollektiver Verantwortungsübernahme zu erkennen.
193
194
Tobias Linnemann und Kim Annakathrin Ronacher
Medienanalyse In der Methode Medienanalyse geht es darum, die eigene Perspektive dafür zu sensibilisieren, inwiefern Werbung, Medien, Kunst oder auch Produkte alltäglich und permanent Botschaften über weiße Menschen und People of Color transportieren, inwiefern also auch hier Rassismus wirkt und Weißsein als Normalität und das Überlegene (re-)präsentiert wird. Die Methode ermöglicht, anhand von konkreten Beispielen grundlegende Funktionsweisen und Repräsentationspraktiken von Rassismus und Weißsein herauszuarbeiten und sowohl die drastischen als auch die subtilen Botschaften von Werbung und Medien zu untersuchen. Die Grundlage dieser Methode bilden Medienanalysen von rassismuskritischen Expert_innen wie Noah Sow (2009: 147ff.), Grada Kilomba und Peggy Piesche (u.a. im Film »White Charity« (2011) (Deutschland, R: Philipp/Kiesel) und von glokal (2013) sowie (Kunst-)Projekte wie die Wanderausstellung EDEWA. In Kleingruppen analysieren die Teilnehmenden Werbung, Zeitschriften, Spendenplakate, Kunstgegenstände und auch Produkte wie z.B. Pflaster mit der Bezeichnung ›hautfarben‹ anhand der Fragen: • Welche Botschaften enthält das Bild/Produkt über weiße Menschen? Welche über People of Color, Schwarze Menschen, Migrant_innen, Roma und Sinti? • An wen richtet sich das Produkt oder die Werbung? Wer ist die Zielgruppe? Die Ergebnisse werden im Plenum präsentiert und diskutiert. Für Teilnehmende, die bildend künstlerisch oder in der Marketing- und Öffentlichkeitsarbeit tätig sind, kann in einer anschließenden, gezielten Reflexion ein Transfer zur eigenen Praxis erfolgen. Mögliche Fragen sind hier: Mit welchen Bildern arbeite ich, arbeitet meine Einrichtung? Wer ist auf unseren Werbematerialien abgebildet? Wer steht wofür auf unseren Flyern? Wen nenne ich wie in meinen Texten? Wer wird extra markiert oder benannt in meinen Texten, wer nicht? Eine Grenze der Methode ist, dass die einzelnen (Medien-)Produkte und die darin enthaltenen Botschaften zwar sehr vielschichtig analysiert werden, dabei jedoch meist keine Bezugnahme auf eigene rassistische Bilder und Wissensbestände stattfindet. Die rassistischen Bilder und Stereotype werden vor allem im Außen verortet und analysiert, ohne die eigene Perspektive einzubeziehen (vgl. Pech 2006: 79). Die Benennung dieses Musters ermöglicht wiederum die Auseinandersetzung damit und einen Austausch darüber, inwiefern die in der Werbung verwendeten Bilder auch eigenen Bildern entsprechen.
Biografiearbeit Biografiearbeit ist eine Methode, die wir hier in Bezug auf früh erlernte rassistische Begriffe, Bilder und Stereotypen vorstellen. Diese Methode kann also eine Bewusstmachung, Reflexion und dadurch auch Veränderung des eigenen rassis-
»Rassismus und Weißsein, das spielt bei uns keine Rolle«!?
tischen Wissens ermöglichen. Früh und auf vielfältige Weise erlernte rassistische Bilder und Begriffe prägen das eigene (auch professionelle) Wahrnehmen und Handeln. Ziel der Methode ist es, dass durch die Reflexion der rassistischen Bilder das aktuelle Handeln weniger durch diese bestimmt wird. Bei dieser Variante der Biografiearbeit werden die Teilnehmenden gebeten, sich zunächst in Einzelarbeit an Botschaften, Bilder, Begriffe und Stereotype zu erinnern, die sie im Laufe ihres Lebens über Schwarze Menschen, People of Color, Migrant_innen, Roma und Sinti, Jüd_innen, geflüchtete Menschen8 gelernt haben sowie die Situation oder die Person zu benennen, in bzw. von der diese jeweils gelernt wurden. Dazu erstellen die Teilnehmenden eine biografische Zeitleiste und halten dort die Begriffe und Stereotype chronologisch fest. Für die gemeinsame Auswertung werden die Ergebnisse aufgehängt, so dass die eigenen Bildungsbiografien in Bezug auf Rassismus sichtbar werden. Auffällig ist dabei, dass die meisten Situationen in den ersten zehn Lebensjahren aufgeschrieben sind. Die meisten Bilder und Begriffe scheinen also in diesem Zeitraum erlernt zu werden. Die ersten Reaktionen von Teilnehmenden in der gemeinsamen Betrachtung und Auswertung sind oft »Krass, so viel« und »Stimmt, das kenne ich auch, das fällt mir jetzt erst wieder ein«. Häufig berichten Teilnehmende, wie schwer es fiel, sich an Bilder und Begriffe sowie die entsprechenden Situationen zu erinnern und ihnen diese erst nach und nach oder im gemeinsamen Austausch einfielen. Trotz aller Unterschiede werden große Parallelen in der rassistischen Sozialisation der Teilnehmenden deutlich und es zeigt sich ein umfassender, geteilter Wissensbestand rassistischer Bilder und Begriffe, der in seiner Massivität bei den Teilnehmenden oft Erschütterung und Betroffenheit auslöst. Gleichzeitig wird als entlastend benannt, dieses Wissen nicht alleine zu haben und keine individuelle Schuld daran zu tragen, diese Bilder als Kinder erlernt zu haben. In der gemeinsamen Reflexion diskutieren wir, wie diese rassistischen Bilder, mit denen wir aufgewachsen sind, heute noch wirken und das eigene Verhalten zum Beispiel im Kontakt mit geflüchteten Menschen beeinflussen. Außerdem überlegen wir, wie ein verantwortungsvoller Umgang mit diesen Bildern heute aussehen kann. Wichtig ist auch die Frage, welche impliziten Botschaften diese Bilder und Begriffe über weiße Menschen enthalten. Von weißen Menschen wird angenommen, all das nicht zu sein, was People of Color oder Migrant_innen zugeschrieben wird. Exemplarisch lässt sich dies verdeutlichen anhand der Konstruktionen von weißen deutschen Männern als nicht sexistisch oder nicht homophob in Abgrenzung zu Männern of Color, denen zugeschrieben wird, besonders patriarchal zu sein. Oder in Diskursen, die Antisemitismus vor allem bei (vermeintlich) muslimischen Menschen verorten – so wird der Antisemitismus 8 | Je nach Generation und den Diskursen, die zu der Zeit jeweils dominant waren, werden zu ›Geflüchteten‹ direkt mehr oder weniger Stereotype und entsprechende Situationen genannt.
195
196
Tobias Linnemann und Kim Annakathrin Ronacher
ausgelagert und die deutsche Dominanzgesellschaft kann sich als frei von Antisemitismus imaginieren. Da während dieser Methode rassistisches und gewaltvolles Wissen in Form von Bildern und Begriffen massiv reproduziert wird, führen wir die Methode so nicht in Gruppen durch, in denen Menschen mit und ohne Rassismuserfahrung gemeinsam lernen.
Praxisreflexion und Organisationsreflexion Ein weiterer methodischer Zugang ist das Aufwerfen von Fragen an die eigene Institution, Einrichtung oder Praxis. Hier geht es darum, diese als eingebettet in gesellschaftliche Verhältnisse wie Rassismus zu verstehen und nach Ansatzpunkten zu suchen, sie rassismuskritisch zu verändern. Methodisch können diese Fragen auf unterschiedliche Art bearbeitet werden. • Die folgenden Fragen9 richten sich vornehmlich an mehrheitlich weiße bzw. weiß dominierte Kultureinrichtungen und Projekte.10 • Worum geht es bei dem Projekt der Kulturellen Bildung mit Geflüchteten eigentlich? Was ist die Motivation? ›Integration‹? Assimilation an eine vermeintliche deutsche Leitkultur? Solidarität? Powersharing? Gesellschaftliche Veränderung? Welche Erwartungen an geflüchtete Menschen gehen damit einher? • Inwiefern trägt das Projekt möglicherweise dazu bei, dass geflüchtete Menschen auf Geflüchtet-Sein, auf vermeintliches ›Fremd-Sein‹ oder auf eine essentialistische ›authentische‹ und ›exotische‹ Kultur festgeschrieben werden? Welche z.B. national-ethnisierte Performance von Kultur wird von geflüchteten Menschen erwartet? Wie wirken dabei rassistische Bilder fort? • An welchen Stellen werden Unterscheidungen zwischen ›wir‹ (z.B. Nicht-Geflüchtete) und ›die‹ (Geflüchtete) bedeutsam? Wann und durch wen werden sie zum Thema (obwohl sie möglicherweise nicht bedeutsam sind)? Wann und wie werden sie nicht zum Thema (obwohl sie möglicherweise bedeutsam sind, z.B. durch den Zugang zu Privilegien und Ressourcen)? Wer entscheidet darüber, ob sie bedeutsam sind? • Wie vermeidet das Projekt, zu einer Hierarchisierung oder Unterteilung von Geflüchteten (erwünschte, brauchbare Menschen vs. nicht-erwünschte) und Fluchtursachen (legitim und nicht-legitim) beizutragen? • Wer profitiert von dem Projekt?
9 | Die Fragen sind unter anderem inspiriert durch Veröffentlichungen von RISE – Refugees, Survivors and Ex-detainees (vgl. Canas 2016). 10 | Also Einrichtungen und Projekte, in denen wesentliche Entscheidungspositionen von weißen Menschen besetzt sind.
»Rassismus und Weißsein, das spielt bei uns keine Rolle«!?
• Wer bekommt welche Form der Anerkennung für welche Arbeit (ideell, finanziell etc.)? • Wer hat Entscheidungsmacht in dem Projekt bzw. der Institution? Wer ist in dem Projekt wie präsent? Wer wird (wie) benannt? Sind geflüchtete Menschen in anleitenden und entscheidenden Positionen? • Werden Geflüchtete als politische Subjekte anerkannt? • Wessen Wissensbestände und Narrative werden anerkannt, getilgt oder enteignet? • Wie verortet sich die Kultureinrichtung im spezifischen deutschen Kontext der postkolonialen, postnationalsozialistischen Gesellschaft und ihrer Widersprüche? Was bedeutet das konkret für geflüchtete Menschen, in dieser kulturellen Einrichtung zu sein? • Welche Expertise für die Zusammenarbeit mit Geflüchteten gibt es in dem Projekt und der Institution? Wie wurde sich für die Zusammenarbeit mit Geflüchteten qualifiziert? • Gibt es eine (gedankliche) Differenzierung zwischen ›regulärer‹ Zielgruppe der Kultureinrichtung und ›Sonderzielgruppen‹? Wenn ja, wer wird jeweils als ›reguläre‹, wer als ›Sonderzielgruppe‹ gedacht? Warum? Wie werden diese jeweils adressiert? • Wie werden weiße Normen (z.B. die Idee von weißer Objektivität und Neutralität) und/oder homogenisierende und ausschließende Normen in dem Projekt explizit oder implizit fortgesetzt? • Inwiefern werden weiße Privilegien (z.B. für alle Rollen und Themen kompetent zu sein, als Individuum anerkannt zu sein) reproduziert? Wenn Projekte der Kulturellen Bildung sich anhand einiger dieser Fragen mit Rassismus und Weißsein beschäftigen, kann das ein Schritt sein, die eigene Arbeit und die eigenen Strukturen rassismuskritisch zu verändern. Damit können sie zum Abbau von Rassismus und zu Veränderungen hin zu einer gerechteren Gesellschaft beitragen. Wir danken Pasquale Virginie Rotter für die konzeptionelle und inhaltliche Beratung.
L iter atur Arndt, Susan (2005): »Mythen des weißen Subjektes. Verleugnung und Hierarchisierung von Rassismus«, in: Eggers u.a., Mythen, Masken und Subjekte, S. 340-362. Bojadžijev, Manuela (2007): Die windige Internationale. Rassismus und Kämpfe der Migration, Münster: Westfälisches Dampf boot. Çetin, Zülfukar/Taş, Savaş (2015): Gespräche über Rassismus. Perspektiven und Widerstände, Berlin: Verlag Yılmaz-Günay.
197
198
Tobias Linnemann und Kim Annakathrin Ronacher
Can, Halil (2013): Empowerment aus der People of Color-Perspektive. Reflexionen und Empfehlungen zur Durchführung von Empowerment-Workshops gegen Rassismus, Berlin: Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen. Canas, Tania (2016): »Wir sind nicht dein nächstes Kunstprojekt«. www.kulturoeffnet-welten.de/positionen/position_1536.html (letzter Zugriff: 18.04.2016). Dean, Jasmin (2011): »Person/People of Colo(u)r«, in: Susan Arndt/Nadja OfuateyAlazard (Hg.), Wie Rassismus aus Wörtern spricht. (K)Erben des Kolonialismus im Wissensarchiv deutsche Sprache. Ein kritisches Nachschlagewerk, Münster: Unrast, S. 597-607. Diallo, M. Mustapha (2014): Visionäre Afrikas. Der Kontinent in ungewöhnlichen Porträts, Wuppertal: Peter Hammer Verlag. Eggers, Maureen Maisha/Kilomba, Grada/Piesche, Peggy/Arndt, Susan (Hg.) (2005): Mythen, Masken und Subjekte. Kritische Weißseinsforschung in Deutschland, Münster: Unrast. Eggers, Maureen Maisha (2005): »Ein Schwarzes Wissensarchiv«, in: Eggers u.a., Mythen, Masken und Subjekte, S. 18-21. El-Tayeb, Fatima (2005): »Vorwort«, in: Eggers u.a., Mythen, Masken und Subjekte, S. 7-10. Fleary, Sebastian/El Omari, Mona (2015): »If you can’t say love …« – Ein Empowerment-Flow zu Individuum, Diaspora-Community und pädagogischer Reflexion. antifra.blog.rosalux.de/if-you-cant-say-love-ein-empowerment-flowzu-individuum-diaspora-community-und-paedagogischer-reflexion/ (letzter Zugriff: 18.04.2016). glokal e.V. (2013): Mit kolonialen Grüßen … Berichte und Erzählungen von Auslandsaufenthalten rassismuskritisch betrachtet, Berlin: glokal e.V. Gonzalez Romero, Maria Virginia (2013): »Se trata de Autonomia – Es geht um Autonomie«, in: HBS, Empowerment, S. 76-86. Guillaumin, Colette (1995): Racism, sexism, power, and ideology, London: Routledge. Ha, Kien Nghi (2007): »People of Color – Koloniale Ambivalenzen und historische Kämpfe«, in: Kien Nghi Ha/Nicola Lauré al-Samarai/Sheila Mysorekar (Hg.), re/visionen – Postkoloniale Perspektiven von People of Color auf Rassismus, Kulturpolitik und Widerstand in Deutschland, Münster: Unrast, S. 31-40. HBS – Heinrich-Böll-Stiftung (Hg.): Empowerment. MID-Dossier, Berlin: Heinrich-Böll-Stiftung. hooks, bell (1994): »Weißsein in der schwarzen Vorstellungswelt«, in: Black Looks. Popkultur – Medien – Rassismus, Berlin: Orlanda Frauenverlag, S. 204-220. Kilomba, Grada (2008): Plantation Memories, Münster: Unrast. Kraft, Marion/Ashraf-Khan, Rukhsana Shamim (1994) (Hg.): Schwarze Frauen der Welt. Europa und Migration, Berlin: Orlanda Frauenverlag. Linnemann, Tobias/Mecheril, Paul/Nikolenko, Anna (2013): »Rassismuskritik. Begriffliche Grundlagen und Handlungsperspektiven in der politischen Bil-
»Rassismus und Weißsein, das spielt bei uns keine Rolle«!?
dung«, in: Zeitschrift für internationale Bildungsforschung und Entwicklungspädagogik, 2/2013, S. 10-14. Lück, Mitja Sabine/Stützel, Kevin (2009): »Zwischen Selbstreflexion und politischer Praxis. Weißsein in der antirassistischen Bildungsarbeit«, in: Janne Mende/Stefan Müller (Hg.), Emanzipation in der politischen Bildung. Theorien – Konzepte – Möglichkeiten, Schwalbach/Ts: Wochenschau-Verlag, S. 330353. McIntosh, Peggy (2000): »White Privilege and Male Privilege. A Personal Account of Coming to See Correspondences Through Work in Women’s Studies«, in: Anne Minas (Hg.), Gender Basics. Feminist Perspectives on Women and Men, Belmont: Wadsworth. Messerschmidt, Astrid (2012): »Zusammenhänge von Rassismus und Antisemitismus in der postnationalsozialistischen Gesellschaft«, in: quer. denken lesen schreiben, 18/2012, S. 43-46. Meza Torres, Andrea/Can, Halil (2013): »Empowerment und Powersharing als Rassismuskritik und Dekolonialitätsstrategie aus der People of Color-Perspektive«, in: HBS, Empowerment, S. 26-41. Müller, Annekathrin (2015): Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt. Strategien zum Nachweis rassistischer Benachteiligungen. Eine Expertise im Auftrag der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, Berlin: Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Nassir-Shahnian, Natascha (2013): »Dekolonisierung und Empowerment«, in: HBS, Empowerment, S. 16-25. Nguyen, Toan Quoc (2013): »›Was heißt denn hier Bildung?‹ – Eine PoC-Empowerment-Perspektive auf Schule anhand des ›Community Cultural Wealth‹Konzepts«, in: HBS, Empowerment, S. 53-65. Oguntoye, Katharina/Ayim, May/Schultz, Dagmar (1986): Farbe bekennen. Afrodeutsche Frauen auf den Spuren ihrer Geschichte, Berlin: Orlanda Frauenverlag. Pech, Ingmar (2006): »Whiteness – akademischer Hype und praxisbezogene Ratlosigkeiten? Überlegungen für eine Anschlussfähigkeit antirassistischer Praxen«, in: Gabi Elverich/Annita Kalpaka/Karin Reindlmeier (Hg.), Spurensicherung. Reflexion von Bildungsarbeit in der Einwanderungsgesellschaft, Frankfurt a.M. [u.a.]: Iko-Verlag für Interkulturelle Kommunikation, S. 63-94. Piesche, Peggy (2005): »Die Frage nach dem Subjekt, oder Wem gehört die Kritische Weißseinsforschung?«, in: Eggers u.a., Mythen, Masken und Subjekte, S. 14-17. Piesche, Peggy (2013): »Kritisches Weißsein ist eine Überlebensstrategie«, in: an.schläge, Das feministische Magazin, November 2013. Philipp, Carolin/Kiesel, Timo (2011): White Charity. Schwarzsein und Weißsein auf Spendenplakaten. https.//www.youtube.com/watch?v=kUSMh8kV-xw (letzter Zugriff: 18.04.2016).
199
200
Tobias Linnemann und Kim Annakathrin Ronacher
Rotter, Pasquale Virginie (2013): »Empowerment in Motion – Körper und Bewegung in Empowerment-Prozessen«, in: HBS, Empowerment, S. 117-126. Sow, Noah (2009): Deutschland Schwarz Weiss: Der alltägliche Rassismus, München: Goldmann Verlag. Wollrad, Eske (2009): »Der Baum des Zorns hat viele Wurzeln« – Wie weltoffen kann ich als Weiße sein? www.kirche-oldenburg.de/fileadmin/Redakteure/ PDF/DEKT_Zentrum_Frauen_Wollrad.pdf (letzter Zugriff: 27.03.2012). Yiğit, Nuran/Can, Halil (2006): »Politische Bildungs- und Empowerment-Arbeit gegen Rassismus in People of Color-Räumen – das Beispiel der Projektinitiative HAKRA«, in: Annita Kalpaka/Karin Reindlmeier/Gabi Elverich (Hg.), Spurensicherung. Reflexion von Bildungsarbeit in der Einwanderungsgesellschaft, Frankfurt a.M. [u.a.]: Iko-Verlag für Interkulturelle Kommunikation, S. 167-193.
Diversitätsbewusste kulturelle Bildung und Vermittlung im Kontext von Flucht Von der Idee zum institutionellen Arbeitsalltag Maren Ziese
Zusammenfassung Das Diversity-Konzept wird zur Zeit als zukunftsweisende Antwort auf die mannigfaltigen Herausforderungen diskutiert, die im Feld von »Kultureller Bildung und Geflüchteten« entstehen. Es verspricht einen »angemessenen« Umgang mit gesellschaftlicher Wirklichkeit, wenn es bei der Programmgestaltung, bei Personal und Publikum Berücksichtigung findet. Der Beitrag diskutiert die zugrunde liegenden Erwartungen an das Konzept und welches Verständnis von »Diversity« damit verbunden ist. Anhand der Praxisreflexion ihrer eigenen Arbeit im Feld »Bildung und Vermittlung« legt die Autorin Möglichkeiten zur Nutzbarmachung, Erweiterung und Umwidmung des Diversity-Konzepts dar.
Abstract: Diversity Awareness in the Context of Cultural Education and Outreach with Refugees – From the Idea to the Day to Day of the Institution The concept of diversity is currently being discussed as a progressive response to the manifold challenges that crop up in the field of »cultural education with refugees«. It promises to »appropriately« address social reality if it is taken into account in the process of program design, and in selecting personnel and audience groups. This paper discusses the underlying expectations behind the concept, and the understanding of »diversity« it implies. By way of reflections on her own work in the field of »cultural education and outreach«, the author sketches out the possibilities for the utilization, expansion and repurposing of the concept of diversity.
Diversity als Programm wird zur Zeit als zukunftsweisende Möglichkeit genannt, um auf die mannigfaltigen Herausforderungen zu reagieren, die im Feld von »Kultureller Bildung und Geflüchteten« entstehen (vgl. z.B. Educult 2016: 34, 39, 47). So wird gefordert, dass Kultureinrichtungen in der deutschen Gesellschaft
202
Maren Ziese
gerade im Kontext von Flucht und Asyl endlich ihren eigenen Ansprüchen an Teilhabe, Gerechtigkeit und Vielfalt folgen sollten, damit sich die Diversität des Landes zumindest in der Kulturlandschaft abbildet, wenn es schon nicht gelingt, dies in den Bereichen der gesellschaftspolitischen Teilhabe, im Arbeitsmarkt oder im Bildungsbereich umzusetzen. Kulturinstitutionen in Deutschland sind bis heute wenig divers aufgestellt. Unterschiedliche kulturelle Erfahrungen sind im Personal kaum erkennbar, die Diversität der Mitarbeiter_innen lässt noch viele Wünsche offen (vgl. Völckers 2016). Höchste Zeit für die Museen, ihre Unternehmensstrukturen an die veränderten Rahmenbedingungen einer inklusiven Gesellschaft des 21. Jahrhunderts anzupassen. Dazu wäre die Implementierung des Diversity-Ansatzes in zweierlei Hinsicht nötig: Zum einen beträfe es das interne Handlungsfeld Personal, zum anderen neue Formate und Konzepte für Programm und Publikum (vgl. Grütters 2015: 39). In den vergangenen Jahren haben Museen erkannt, dass sie andere Methoden und Wege finden müssen, um ein komplexer gewordenes Publikum anzusprechen und zu beteiligen. Wesentliche Teile der Bevölkerung fühlen sich von den bestehenden Angeboten der öffentlich geförderten Kultureinrichtungen nicht angesprochen (vgl. Terkessidis 2016). Vielfalt aber gilt als Grundprinzip und große Stärke der Kulturellen Bildung, schließlich sei sie eine der wesentlichen kulturpädagogischen Qualitätskriterien (vgl. Keuchel/Kelb 2015, passim). Aufgrund ihrer machtvollen Position können gerade Kulturinstitutionen Akteure der Veränderung sein (vgl. Mörsch 2011).1 Aus diesen Erkenntnissen ergeben sich sowohl allgemeine Fragen für Kultureinrichtungen als auch konkrete Fragen, die mein persönliches Arbeitsfeld im Bereich Bildung und Vermittlung betreffen.2 Dieser Artikel wird folgende Fragen thematisieren: Was kann Diversity leisten? Welches Verständnis von Diversity ist gemeint? Wie habe ich als Leiterin für Bildung und Vermittlung Diversity-Konzepte in der Praxis meiner eigenen Vermittlungsarbeit bislang genutzt? Welche Schwierigkeiten und Vorteile bringt der Diversity-Ansatz mit sich? 1 | Mörsch bezieht sich in ihren Ausführungen auf Museen, ich denke aber, das ist auch auf andere Kulturinstitutionen übertragbar. 2 | Der Freundeskreis Willy-Brandt-Haus ist ein Kulturverein und eine Ausstellungsinstitution ansässig in Berlin, zu dessen Aufgaben die kuratorische Betreuung und Verwaltung einer Kunstsammlung mit Werken der Gegenwartskunst und Klassischen Moderne gehören sowie die Entwicklung von Ausstellungen für eine 750 Quadratmeter große Galeriefläche. Dazu realisiert der Verein ca. zwölf Ausstellungen pro Jahr. Die Schwerpunktsetzung der Ausstellungen ist »sozial engagierte Fotografie« aus allen Teilen der Welt. Seit Januar 2013 besteht der Bereich Bildung und Vermittlung aus einem Galerie- und Vermittlungsteam von ca. zehn Personen, von denen die Mehrzahl einen künstlerischen Ausbildungshintergrund hat und die neben der Vermittlungstätigkeit auch als selbstständige Künstler_innen mit Ausstellungstätigkeit wirken. Zum Aufgabenbereich der Leiterin für Bildung und Vermittlung zählt auch die Bespielung des Projektraums Kunstvermittlung als Ausstellungsfläche und Experimentierraum.
Diversitätsbewusste kulturelle Bildung und Vermittlung im Kontext von Flucht
Im vorliegenden Beitrag werden einige für meine Fragestellung wichtige Kennzeichen des Diversity-Ansatzes vorgestellt, die Auseinandersetzungsphase mit dem Diversity-Ansatz beschrieben, um dann anhand des von mir konzipierten Projektes »Bridge the Gap« die Chancen des Diversity Ansatzes in der Vermittlungsarbeit zu skizzieren. Ich verwende die Formulierung »Diversity-Ansatz« statt »Konzept«, da im Rahmen dieses Beitrags eine Systematisierung der vielschichtigen Diversity-Konzepte nur schwer möglich ist. Diversity-Konzepte lassen sich grob unterscheiden in politische Ansätze, die auf die Herstellung von mehr Gerechtigkeit zielen, und in betriebswirtschaftliche Managing-Ansätze, die eine Profitmaximierung in Unternehmen anstreben. Daneben gibt es noch leichtfüßige Programme, die eher »alles so schön bunt hier« verkörpern (vgl. Kuhn 2012, Merx 2011). Für meinen Beitrag nehme ich mir die Freiheit heraus, mit der Unabgegrenztheit der zur Zeit zirkulierenden Ideen und Ansprüche, was Diversity im Kulturbereich für Flucht und Asyl alles leisten soll, zu hantieren.
D er D iversit y -A nsat z Was kann der Diversity-Ansatz? Welche Erwartungen darf man hegen? Der Begriff »Diversity« meint – wörtlich übersetzt – »Vielfalt« und »Heterogenität«. Beim Diversity-Ansatz steht die Auseinandersetzung mit der Eigen- und Fremdwahrnehmung im Zentrum, denn diese beeinflussen unsere Beurteilungen und sind damit handlungsleitend. Der Diversity-Ansatz kann helfen, Ursachen für Zugehörigkeiten und Identifikationsmuster, die Menschen selbst wählen oder die ihnen von anderen vorgegeben werden, zu erkennen. Dadurch können solche Zuschreibungsprozesse reflektiert und eigene Normalitätsvorstellungen hinterfragt werden. Beim Diversity-Ansatz geht es darum, Unterschiedlichkeiten und Differenzen grundsätzlich zu bejahen, wertzuschätzen und anzuerkennen. Vielfalt und Heterogenität sollen als Ressourcen verstanden werden, die ein hohes kreatives und individuelles Potential bergen (vgl. Mecheril/Plößer 2011). Die Unterschiede, die für »Diversity«-Ansätze von zentraler Bedeutung sind, beziehen sich auf sechs Kerndimensionen: gender/sexuality, age, religion, race, class, handicap. Diese sozialen Phänomene zeigen sich als wechselseitige Zuschreibungen und Rückkoppelungen, die Zusammenhänge und Zugehörigkeiten können sich überlappen, so dass sie nicht eindeutig gegeneinander abgrenzbar sind. Alle diese Definitionen existieren nicht »von sich aus«, sondern werden in sozialen Prozessen konstruiert. Unterscheidungskriterien zwischen Gruppen werden beispielsweise je nach politischem und gesellschaftlichem Kontext anders festgeschrieben. Theorien zur Diversity beziehen sich vor allem auf diejenigen sozialen Phänomene, bei denen Einzelne oder Kollektive durch gesellschaftliche Zuschreibungen zu »Anderen« werden, die nicht Teil der »Mehrheit« sind. Wenn Diversity-Ansätze aber diese gesellschaftlich gezogenen Trennungslinien benen-
203
204
Maren Ziese
nen, impliziert das zugleich auch eine nicht unproblematische Anerkennung derselben. Bei einer Orientierung an äußerlichen Merkmalen, Eigenschaften und Kriterien verstetigen sich dann gesellschaftliche Vorurteile. Wenn Diversity-Ansätze gesellschaftliche Zuschreibungen von Anderssein (und die damit verbundenen Wertungen) nicht mitbedenken, sind sie nicht in der Lage, alternative Sichtweisen zu entwickeln. Hier liegt eine zentrale Anforderung an diesen Ansatz. Eine andere Anforderung betrifft das Risiko der Identitätsfestschreibung: Durch den Diversity-Ansatz könnte das fixierende Identitätsdenken nicht überwunden, sondern nur vervielfältigt werden. Die Gefahr besteht, dass man Menschen durch den Diversity-Einbezug auf Identitätspositionen reduziert oder gar in einer eher inferioren Position bestätigt. Eine weitere Anforderung liegt deshalb in einem »Diskriminierungsbewusstsein« derjenigen, die mit diesem Ansatz arbeiten. Es genügt nicht, dass Individuen für ihre eigene und andere Identitätsvielfalt sensibilisiert werden. Die Herausforderung liegt darin, Machtstrukturen zu erkennen und zu reflektieren. Relevant ist dabei die Frage, ob Diversity im Hinblick auf Programmatik, Praxis und Wirkung eine hegemoniale oder emanzipative Angelegenheit ist (vgl. Mecheril 2007). Unter dem Label »Diversity« existieren ganz unterschiedliche Deutungsmöglichkeiten auf theoretischer Ebene und vielschichtige Umsetzungsmöglichkeiten/Anwendungsfelder auf praktischer Ebene (vgl. Merx 2011). Daher ist auch hier ein differenzierter Blick je nach Bereich und beteiligten Akteuren angemessen, den ich im Folgenden auf mein Tätigkeitsfeld richten möchte.
V orbereitungen zur N ut zbarmachung Warum Diversity-Ansätze? Zunächst unabhängig von dem Thema »Flucht« entstand aus meinem Arbeitsverständnis heraus der Wunsch, mich mit den Strukturen, Aufgaben und Handlungsoptionen des Diversity-Ansatzes auseinanderzusetzen, mit Blick auf unsere Teamzusammensetzung und unsere Besucherschaft. Im Zusammenhang mit dem Thema »Flucht« war es mir wichtig, grundsätzliche Haltungen und Denkmuster zu analysieren und zu hinterfragen, die dann wiederum auf konkrete Situationen, Projekte und Maßnahmen in der kulturellen Zusammenarbeit mit Geflüchteten anwendbar sein sollten. Mir erschien der Diversity-Ansatz nützlich für neue Vermittlungsstrategien, für neue Außenwirkungen, Umstrukturierungen und für dem sich verändernden Publikum angepasste neue Aufgabenstellungen. Der gesellschaftspolitische Diskurs »Flucht« wirkte auch auf unsere Arbeit ein und führte zu einer verstärkten Auseinandersetzung und einer Verankerung des Themas im Programm von 2014 bis 2016. Die Konfrontation mit den Ereig-
Diversitätsbewusste kulturelle Bildung und Vermittlung im Kontext von Flucht
nissen und den Medienbildern verstärkte die Haltung, sich auf neue Sicht- und Arbeitsweisen einzulassen und den Diversity-Ansatz in ein erstes Projekt einzuweben. Für mich war es zunächst einmal das Ziel, den Diversity-Ansatz zu verstehen und eigene Haltungen und Handlungen zu reflektieren, um persönliches und institutionelles Lernen zu erreichen. Dabei habe ich als Leitungsperson im Vermittlungskontext angestrebt, dass wir uns im Team mit Fragen der Fremdzuschreibungen und Selbstpositionierungen befassen. Gute Vermittlungsarbeit braucht jedoch aus meiner Sicht nicht nur fortwährende Wachsamkeit gegenüber den eigenen Werturteilen und Anschauungen, sondern auch eine offene, frische und kritische Auseinandersetzung mit den Erfahrungen und erhaltenen Informationen (beobachten, fragen, reflektieren). Meinem Verständnis nach sind Museen machtvolle Institutionen mit etablierten Praktiken, die eine selbstreflexive Vermittlung erfordern, welche nach Handlungsmöglichkeiten fragt und ihre Komplizenschaft in diesen Prozessen erkennt. Mit Institutionskritik als Arbeitsmethode schwingt immer die Frage mit: Welche Erzählungen und Bilder werden im Kulturbetrieb vermittelt? Wer erzählt was, wem und warum? Wem höre ich wie zu? Das heißt, dass in den von meinem Team konzipierten Projekten auch nur eine bestimmte Variante des Diversity-Ansatzes zum Tragen kam, nämlich jene, die auch emanzipative Elemente enthält, also unter anderem auf die Herstellung von Gerechtigkeit zielt.
Einstieg ins Thema Diversität: Das Projekt »Nürtikulti« Die erste Gelegenheit für eine praktische Erfahrung mit dem Diversity-Ansatz ergab sich im Frühjahr 2014 durch meine Teilnahme an der Ergebnispräsentation des dreijährigen Projektes »NÜRTIKULTI – Vielfalt gestaltet Grundschule« an der Nürtingen-Grundschule Berlin-Kreuzberg.3 Es wurden die Projektidee und Ergebnisse vorgestellt, um ähnliche Prozesse an weiteren Bildungseinrichtungen anzustoßen, zu begleiten sowie interessierte Akteure zu vernetzen. Mich hat insbesondere die Übertragungsmöglichkeit schulischer Projekte auf andere Bildungseinrichtungen interessiert. Aus der Ergebnispräsentation entwickelte sich eine einjährige Teilnahme an der Berliner Netzwerkrunde zum Thema »Vielfalt und Bildung«, die um das Projekt »Mobiles Beratungsteam ›Ostkreuz‹« des Geschäftsbereichs »Soziale Räume und Projekte« der Stiftung Sozialpädagogisches Institut (SPI) entstanden war.4 Die Stiftung SPI bietet Diversity-Trainings, Workshops, Fortbildungen, Inklu3 | In diesem Modellprojekt der Stiftung Sozialpädagogisches Institut »Walter May« (SPI) in der Berliner Nürtingen-Grundschule ging es um die Überwindung von Diskriminierungen jeglicher Art im Schulalltag. Schüler_innen, Pädagog_innen und Eltern sollten eine positive Einstellung zur Vielfalt gewinnen; vgl. www.mbt-ostkreuz.de/ostkreuz/nuertikulti/index. php (letzter Zugriff: 09.07.2016). 4 | Zum Beratungsteam zählten Ann-Sofie Susen und Ibrahim Gülnar.
205
206
Maren Ziese
sionsansätze, Coaching und Beratungen für Einrichtungen an, die einen Diversity-Prozess auf Organisationsebene anstoßen wollen. Die Netzwerktreffen fanden nach mehreren Austauschrunden rotierend an den Orten der Mitglieder auf Einladung in die jeweiligen Institutionen statt. Durch die gegenseitige Vorstellung der jeweiligen Diversity-Ansätze kam es zwischen den Teilnehmenden zu fruchtbarem Erfahrungsaustausch, Praxistransfer und Networking. Über die Netzwerkrunde entstanden auch immer wieder bilaterale Kontakte. Nicht zuletzt wurde das »Vielfalt-Team« der Stiftung SPI von verschiedenen Einrichtungen zur Beratung und Prozessbegleitung angefragt.
Diversity Training Für das Galerie-Team realisierten wir im Dezember 2014 eine Schulung durch das SPI. Das Diversity-Training des SPI hat den Anspruch, Fremd- und Eigenwahrnehmung, Zuschreibungsprozesse und unbewusste eigene soziale Vorurteile sichtbar zu machen (vgl. Stiftung SPI 2013). Es bietet Gelegenheit für die Auseinandersetzung mit Ungleichheit – für Menschen, die in der Minderheit sind, genauso wie für Menschen, die sich in einer privilegierten Position befinden. Im Gegensatz zu einigen Interkulturellen Trainings wollen die Diversity-Trainings kein Wissen über die Anderen vermitteln, sondern Prozesse verdeutlichen und Fertigkeiten entwickeln. Sie thematisieren die unterschiedlichen Identitätsdimensionen, die jede_n Einzelne_n auszeichnen, und wie sie miteinander verflochten sind. Dabei werden bestehende Hierarchien und die ungleich verteilten Ressourcen und Chancen beleuchtet, die Menschen in unterschiedlichen Positionen haben. Diversity-Trainings zeigen somit auf, wie Diskriminierung funktioniert. Es wird die Kompetenz im Umgang mit sich selbst trainiert und nicht die mit anderen Gruppen. Im Rahmen des Trainings haben wir über Diversität an unserem Arbeitsplatz nachgedacht und die Felder Programm, Publikum und Personal in Ansätzen durchleuchtet. Uns wurden der Diversity-Ansatz und Übungen für die Arbeit mit Gruppen vorgestellt, die wir zur Selbstreflexion auch ausprobiert haben.5 Das Ergebnis des Workshops war zunächst eine neue Wahrnehmung und Wertschätzung der vielfältigen Menschen mit unterschiedlichen Aufgabengebieten und Qualifikationen, die an unserem Haus arbeiten. Bezogen auf unser Team war es aus meiner Sicht überraschend und lohnend, den Blick auf langjährige Mitarbeiter_innen neu zu weiten. Die auf den ersten Blick homogenen, da weißen Teammitglieder entpuppten sich als ziemlich divers in ihren Prägungen und 5 | Bspw. das Spiel »Ein Schritt nach vorn – in der Mitte der Gesellschaft«. Bei dieser Übung zur Sensibilisierung für Lebenslagen von Minderheiten nehmen die Teilnehmenden anhand von Rollenkarten gesellschaftliche Positionen ein, die sie entweder an den Rand oder in die Mitte der Gesellschaft stellen. Vgl. auch www.bpb.de/lernen/grafstat/projektintegration/134550/info-01-01-wie-im-richtigen-leben (letzter Zugriff: 09.07.2016).
Diversitätsbewusste kulturelle Bildung und Vermittlung im Kontext von Flucht
Hierarchiezuschreibungen, wie bspw. durch das Aufwachsen in Ost- oder Westdeutschland, Wohnorterfahrung Stadt oder Land, Familienstatus und Wohnform oder hinsichtlich religiöser Zugehörigkeiten (jüdisch, katholisch, atheistisch sozialisiert). Des Weiteren war es bereichernd, mit dem »Diversity-Blick« auch noch einmal auf die Besucher_innen zu schauen und unsere Zuschreibung, wer das Stammpublikum ist, zu hinterfragen. Auch wenn es banal klingt: Unsere Besucher_innen stammen aus verschiedenen Ländern und Kulturen, sie sind unterschiedlich alt und bringen verschiedene Erfahrungen und Fachinteressen mit. Sie sind unterschiedlichen Geschlechts und besitzen verschiedene Fähigkeiten. Hinsichtlich unserer praktischen Vermittlungsarbeit brachte das Training die erlebbare Erkenntnis: Kulturelle Bildung und Vermittlung lebt von der Diversität der Themen im Programm und benötigt Diversität von Blickwinkeln und Fragen. Die praktische Anwendung des Diversity-Ansatzes begann für mich intern mit dem Bemühen, einen für Verschiedenheiten sensibilisierten kollegialen Umgang anzustoßen. Parallel dazu floss der »Diversitätsblick« in die kulturelle Bildungs- und Vermittlungsarbeit mit Schulklassen und anderen Besuchergruppen ein und wir prüften eine Auffächerung des methodischen Einsatzes (weitere Vielfalt in den Formaten innerhalb eines Bildungsprogramms). Auch auf die eigene künstlerische Praxis hatte das Training Auswirkungen: Die Kunstvermittlerinnen begannen, das Thema Diversität mit künstlerischen und ästhetischen Mitteln erfahrbar zu machen.
Praktische Übung des Diversitätsansatzes: Vielfalt als Vermittlungsthema Um darüber hinaus vertiefend mit dem Diversity-Ansatz zu arbeiten und ihn zu erproben, entstand für die Fotoausstellung »Ara Güler. Das Auge Istanbuls – Retrospektive von 1950 bis 2005« (15.10.2014-15.01.2015) eine Kooperation mit dem Institut für Kulturpolitik (Schwerpunkt Diversität) der Universität Hildesheim. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit übertrugen Studierende den Diversitätsansatz auf die Angebotsformate, die Methodik, den Blick auf die Künstlerrolle und Biografie Ara Gülers, das Thema der Ausstellung, die Bildinhalte und die Rolle der Vermittler_in. Hierfür entwickelten Studierende vielfältige und partizipatorische Angebote für Grundschüler_innen unserer Kreuzberger Kooperationsschule Galilei-Grundschule und erprobten diese in der alltäglichen Vermittlungsarbeit. Unterstützung erhielt das Bildungsprogramm durch das Kiezlabor am Mehringplatz,6 das seine Reflexionen über die Arbeit mit der heterogenen Nachbarschaft einbrachte.
6 | Design Research Lab der Universität der Künste, Berlin, vgl. www.design-researchlab.org/projects/pinpoint-mehringplatz/ (letzter Zugriff: 09.07.2016).
207
208
Maren Ziese
Das Projekt zeigte deutlich die praktische Nutzbarkeit des Diversity-Ansatzes und den Zugewinn für die Bildungs- und Vermittlungsarbeit. Interessant war das Aufscheinen seines emanzipatorischen Potentials: So offenbarte sich hier bereits die von Teilnehmenden geäußerte Kritik an den Identitätszuschreibungen und -fixierungen, die dem Ansatz eben auch inhärent sind. Die Teilnehmer_innen brachten von sich aus Umdeutungen, Ablehnungen und Erweiterungen der Angebote mit ein. So forderten die Schüler_innen Namensschilder, lehnten einen Schreibworkshop zum Thema Vielsprachigkeit ab, wählten eigentlich nicht zugängliche (d.h. nicht eingeplante), aber sie inspirierende, empowernde Orte für ihre Fotoerkundungen (Parkdeck und Baustelle) und nahmen sich einen Teil ihrer Sichtbarkeit, indem sie ihre Ergebnisse im Ausstellungsraum auf eine für andere Besucher_innen unbequeme Weise präsentierten. »Ich sehe mich nicht, wir ihr mich seht«, war die Haltung, die sich manifestierte. Für die Konzeption des nächsten Projekts schrieb ich den Diversitätsansatz nicht explizit als Thema auf die Fahnen, sondern legte diesen der Planung zugrunde. Da es sich bei diesem Projekt um das zeitlich bislang längste Bildungsangebot unter dem Aspekt »Vielfalt« handelt und zudem das Thema »Flucht« ihm explizit eingeschrieben ist, nimmt es in diesem Artikel auch den meisten Raum ein.7
B eispiel impliziter D iversitäts -A nsat z : F otoprojek t mit geflüchte ten J ugendlichen »Bridge the Gap I: Ein Fotografie-Projekt mit Berliner Flüchtlingsjugendlichen« (01.01.2015-31.12.2015) war ein Kooperationsprojekt mit der Gesellschaft für Humanistische Fotografie und dem Internationalen Bund IB Berlin-Brandenburg GmbH.8 Vielfalt fand sich auf allen Ebenen: in der Gruppe und dem Thema, in den beteiligten Personen des Vermittlerteams (Künstlerinnen und Sozialpädagogin), im Ausstellungsthema (Identität, Stadt), in der Biografie der ausgestellten Künstlerin Vivian Maier, in den Methoden und künstlerischen Erzeugnissen des Workshops (Fotoboxen, Fotografien, Stadtraumerkundungen, Ausstellung, Fotobuch) sowie in den Sprachen der Teilnehmer_innen (Deutsch, Englisch, Farsi, Arabisch etc.) und in den Kooperationspartnern. Die Berliner Jugendlichen stammten aus der Evangelischen Schule Berlin Zentrum, die Neu-Berliner Teenager kamen aus dem Übergangswohnheim Ma7 | »Bridge the Gap« wurde sogar für ein Folgejahr verlängert. Ich berichte hier jedoch von den Vorbereitungen und der Planung der ersten Phase, »Bridge the Gap I«. Vgl. auch: www. jugend-ins-zentrum.de/node/376 (letzter Zugriff: 09.07.2016). 8 | Gefördert durch »Jugend ins Zentrum!« der Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V. im Rahmen des Programms »Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung« des Bundesministerium für Bildung und Forschung.
Diversitätsbewusste kulturelle Bildung und Vermittlung im Kontext von Flucht
rienfelder Allee. In regelmäßigen (teilweise einmal wöchentlichen) Terminen im Wohnheim, im Ausstellungsraum und an unterschiedlichen Orten der Stadt beschäftigte sich die Gruppe aus afghanischen, tschetschenischen, syrischen und deutschen Teilnehmenden unter Anleitung der Multimedia-Künstlerin Lela Ahmdzai, der Bildenden Künstlerin Anke Göhring sowie der Diplom-Sozialpädagogin Murwarid Abdul Basir mit Fragen wie »neue/alte Heimat Berlin und anderswo« und »Identität«. Insgesamt nahmen 19 Jugendliche im Alter von 12 bis 14 Jahren an dem Projekt teil, trotz Fluktuationen wegen Wohnheimwechseln. Bei vielen Bildungs- und Vermittlungsprojekten im Themenfeld »Flucht« wird kritisiert, dass die Kulturschaffenden den gesellschaftlichen Mehrheiten angehören, welche u.a. basierend auf den Förderlogiken die Inhalte, die Praktiken und die Repräsentation kontrollieren (vgl. Sharifi 2015: 17). Das traf in unserem Fall weder in Bezug auf die teilnehmenden Jugendlichen noch hinsichtlich der Künstlerinnen bzw. Kunstvermittlerinnen zu. Bei »Bridge the Gap I« spielte die Multimedia-Künstlerin Lela Ahmadzai eine zentrale und leitende (Vorbild-)Rolle. Als professionelle Fotografin, Afghanin mit Fluchterfahrung in der Jugendzeit, als Frau, Unternehmerin, etablierte Berlinerin, Preisträgerin und Multi-Media-Journalistin vereinte sie verschiedene Fremd- und Selbstzuschreibungen in ihrer Person.9 Nach einigen Treffen im Übergangswohnheim erkundeten die Teilnehmer_ innen zusammen mit der Künstlerin Anke Göhring die Ausstellung »Vivian Maier. Street Photographer« zum Thema »Identitätszuschreibungen und Selbstbefragungen« und befassten sich mit Fragen von Spiegelungen und Selbstporträt in Kunst und Fotografie und dem Genre der Straßenfotografie.10 Im Anschluss an den Ausstellungsbesuch fand eine Foto-Session im Außenraum der Galerie statt und die Jugendlichen experimentierten mit Architekturfotografie und künstlerischen Selbstporträts in unterschiedlichen Perspektiven. Im Willy-Brandt-Haus fertigten und klebten die Jugendlichen auch Spiegelboxen aus Pappkarton und Silberfolie mit eigenen Bildern zur Selbstdarstellung und Identitätsdokumentation, die später auch in ihrer Ausstellung gezeigt wurden. Einige Wochen des Projektes galten der fotografischen Stadterkundung Berlins, angelehnt an Vivian Maier und den Umstand, dass die geografische Lage des Übergangswohnheims ein Thema für die Jugendlichen war. Dabei lernten die Beteiligten technische und kreative Grundlagen der künstlerischen Fotografie sowie Straßenfotografie kennen. Der inhaltliche Fokus des Vorhabens wurde auf das allen gemeinsame Leben in der Stadt Berlin gelegt und nur nachrangig auf 9 | Vgl. www.ahmadzai.eu/info (letzter Zugriff: 09.07.2016). 10 | Die Ausstellung zu Vivian Maier zeigte sich als Verhandlungsort von Differenz: Nicht nur die Lebensgeschichte der Fotografin zeugte von Widerstreit und Brüchen, sondern auch die Bildinhalte sowie die Entdeckungs- und Eigentümergeschichte um die Person Vivian Maier. Vivian Maier hat sich mehr als dreißig Jahre lang immer wieder selbst fotografiert, am liebsten in Spiegeln oder in Schaufenstern, um durch Selbstporträts ihren Platz in der Welt zu erkennen, vgl. Greenberg (2014).
209
210
Maren Ziese
die Fluchterfahrung der Beteiligten. Gemeinsam suchte sich die Gruppe Orte, die für alle neue Erfahrungen beinhalteten. Die Unmittelbarkeit des Mediums Fotografie beinhaltete die Möglichkeit der eigenen Perspektive, in der Gedanken, Vorstellungen, aber auch Wünsche und Träume ohne sprachliche Barrieren zum Ausdruck gebracht werden konnten. Nach mehreren Wochen der Fotopirsch durch die Stadt stand am Ende eine Ausstellung im Projektraum Kunstvermittlung des Willy-Brandt-Hauses, welche auch im Übergangswohnheim in der Marienfelder Allee gezeigt wurde.11 Durch die beiden Ausstellungsstationen war die Schau auch ein sichtbares Element der persönlichen, ideellen und strukturellen Verbindung zwischen zwei Orten (Kulturbetrieb und Wohnheim) mit den jeweils ihnen innewohnenden Logiken. Das Projekt endete mit der Verleihung eines Fotobuchs an die Jugendlichen, von Lela Ahmadzai als »Archiv« für ihre im Laufe des Projektes gemachten Erfahrungen und Erinnerungen zusammengestellt. Das Fotobuch war eine Idee von Lela Ahmadzai, die aus ihrer Fluchterfahrung heraus viele Jahre bedauerte, kein Tagebuch oder ähnliches zu besitzen, welches das Gefühl dieser Zeit und die Situation damals hätte einfangen können.
A neignungen , V erschiebungen , U mdeutungen Wie gestaltete sich in diesem Projekt der Umgang mit Diversität? Ähnlich wie bei dem Bildungs- und Vermittlungsprojekt bei Ara Güler, das Diversität von Anfang an als Thema hatte, ließen sich auch bei »Bridge the Gap« Umwidmungen, Neuinterpretationen und Experimente im Feld des Identitären bei den Beteiligten festmachen. Vielfalt durchzog als indirektes Thema das ganze Projekt und war Leitlinie für neue Strategien und Prozesse: Von der Projektkonzeption her waren die Jugendlichen eingeladen, sich mit sich selbst und ihrem Sein zu befassen und diese Auseinandersetzung mittels Fotografie im Format einer Ausstellung sichtbar und festhaltbar zu machen. Somit erfolgte eine Auseinandersetzung mit dem eigenen Blick auf die Welt und mit den von sich selbst angenommenen Identitäten. Bei der Abschlusspräsentation zeigte sich allerdings, dass die Differenzinstrumentalisierung und Identitätsfixierung von den Beteiligten überraschend ausgehebelt wurde. D.h. ganz konkret: Bevor die Jugendlichen in die Vorbereitungsphase der Abschlussausstellung gingen, galt es, eine Bildauswahl zu treffen. Jede, jeder konnte vier Bilder zur Selbstdarstellung und Vorstellung der eigenen Person auswählen. Die Jugendlichen griffen jedoch nicht nur auf die von ihnen selbst geschossenen Fotos zurück, sondern nutzen das Fotokonvolut der gesamten Gruppe für alle. Dieser Kollektivgedanke des Fotofundus und die Arbeitsweise »alles für alle« zeigte sich auch in der Bildauswahl. Am Ende wählten die Jugendlichen Fotografien, von denen sie sich am besten wiederge11 | Vgl. www.notaufnahmelager-berlin.de/de/sonderausstellungen-21.html (let z ter Zugriff: 09.07.2016).
Diversitätsbewusste kulturelle Bildung und Vermittlung im Kontext von Flucht
geben fühlten, egal, ob sie selbst das Foto gemacht hatten oder nicht, und hoben das Prinzip der individuellen Autorschaft damit auf. Diese Bildauswahl demonstrierte sowohl wahrgenommene Verbindungs- als auch Trennungslinien zwischen den Jugendlichen untereinander und war ein eindrückliches Beispiel dafür, dass Diversität je nach Situation neu besetzt und ausgehandelt wird und sich damit einer eindeutigen Zuordnung entzieht. Vor allem geflüchtete Menschen haben es schwer, anders wahrgenommen zu werden als nur unter der Überschrift »Flüchtling«. Flucht und Asylsuche allein beschreiben nicht die ganze Identität eines Menschen. Zur Wertschätzung der Vielschichtigkeit und Diversität aller Beteiligten wurden die Fotos von Steckbriefen begleitet, welche nicht nur Name und Alter auswiesen, sondern auch eine Würdigung der Sprachenvielfalt zum Ausdruck brachte. Außerdem hatten die Jugendlichen einen Berufswunsch formuliert und damit den Blick nach vorn in die Zukunft (und nicht nach hinten auf ihre Fluchtgeschichten) gerichtet. Diese Idee von Lela Ahmdazai sollte verdeutlichen »Geflüchtete sind Menschen mit Zielen« und alle Jugendliche haben Träume. Alt-Berliner und Neu-Berliner Jugendliche erlebten durch die Teilnahme am Projekt mehrere Perspektivwechsel und lernten die vielfältigen Lebensrealitäten der Mit-Beteiligten kennen. Gerade künstlerische Projekte wie dieses, so zeigte sich, sind für eine explizite oder implizite Auseinandersetzung mit Diversität hoch wirksam, denn sie erlauben einen spielerischen Umgang mit Fremd- und Selbstzuschreibungen. In diesem Projektbeispiel eröffnete sich der Möglichkeitsraum, Diversität nicht nur zu reflektieren, sondern zuordnende Label zu hinterfragen und für eigene Interessen umzudeuten.
D iversität als L eitlinie für eine neue innere und äussere A usrichtung Um nach diesen bereichernden Lernerfahrungen Diversität in Programm, Personal und auch Publikum aufrechterhalten zu können, nahmen wir in Schulungen eine weitere Methode, die des globalen Lernens, in den Blick.12 Ferner entwickelten wir zusätzliche Kooperationen im Feld von Kultureller Bildung und Flucht, die auf eine Zurverfügungstellung von Räumen für Austausch und Diskussion zielte sowie institutionsübergreifende Zusammenarbeit förderte.13 Konkret haben wir jüngst eine Zusammenarbeit mit dem Verein »Board of Participation – Verein für kulturelle Partizipation und Bildung e.V.« begonnen, 12 | Vgl. den Beitrag von Katrin Boemke zum Globalen Lernen in diesem Band. 13 | Beispielsweise stellten wir unseren Projektraum Kunstvermittlung einem Brown Bag Dialogue zur Verfügung, in dessen Rahmen sich Vertreter_innen des Flüchtlingsrats Berlin e.V., betterplace lab, change.org, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung u.a. zur Diskussion der aktuellen Flüchtlingspolitik trafen.
211
212
Maren Ziese
der Geflüchteten innerhalb und außerhalb der Heime hilft, selbstständig Kurse zu gestalten und zu unterrichten, sowie akademische Fortbildungsveranstaltungen organisiert.14 Ein Tandem aus einer Person des Vereins und einer Vermittlerin von uns wird für einige Ausstellungen gemeinsam Angebote im Rahmen des Vermittlungsprogramms realisieren. Ressourcen und Kompetenzen der Bündnispartner stehen allen zur Verfügung, aber bedeuten auch bewusstes Aushandeln, Verwebungen und Verflechtungen, was eine kreative Anwendung des Diversitätsansatzes ist. Für mich persönlich zeigen sich seit der Schulung, den Erfahrungen der ersten Versuchsprojekte und der damit einhergehenden tieferen Auseinandersetzung mit dem Diversitätsansatz ein bewussterer Umgang mit diesem Ansatz in der Bildung und Vermittlung. Die Fähigkeit des Bestehenlassens von Widerständigem und Unbequemen ist allerdings nicht nur eine Frage des Diversity-Ansatzes als emanzipativer oder hegemonialer Praxis, sondern resultiert meiner Meinung nach vor allem aus dem Ansatz der künstlerischen Kunstvermittlung (vgl. Maset 2007). Gerade Kunst und Kultur sind laut Carmen Mörsch gut dafür geeignet, Unschärfen und Regelüberschreitungen zu ermöglichen sowie Raum für Existenzen und Artikulationen jenseits der gerade gültigen Normalität zu schaffen. Kunst ist ein ideales Instrument, um mit Unterschieden umgehen zu lernen (vgl. Mörsch 2016), auch wenn man die in der Kunst, im Kunstbegriff und in den Kulturinstitutionen eingeschriebenen Hierarchien und Machtverhältnisse nicht übersehen darf. Ästhetisch-künstlerische Praktiken und ästhetische Erfahrungen sind zentral, denn sie eröffnen neue Perspektiven auf Denk-, Wahrnehmungs- sowie Handlungsformen und fördern oft die selbstbestimmte Teilhabe des Subjekts (vgl. Wimmer 2015: 28ff.). Diese Prozesstoleranz, diese Weitung der Fixierungen und der Protest gegen starre Ergebniserwartungen und Hierarchien werden bei uns verstärkt von Künstler_innen-Seite eingefordert. Kunstvermittlung ist – vom Verständnis unserer Vermittlerinnen her – heute selbst auch künstlerische Praxis, denn sie bringt künstlerische Verfahren hervor und wendet sie an. Bezogen auf das Publikum, Programm und Personal ist jedoch auch wieder die Frage zu stellen, wer mit wem spricht, wessen Diversitätsverständnis und Erfolgskriterien angelegt werden und was bspw. ein »gutes« Diversity-Programm ist.
F a zit – E in A nfang! Was hat die Auseinandersetzung mit Diversity gebracht? Als Ergebnis der hier beschriebenen Erfahrungen wurde erneut deutlich: Bildung und Vermittlung sind immer von Diversität geprägt und durchdrungen, hier finden Begegnungen, Dialoge und Handlungen zwischen heterogenen Partnern, Fächern, Wissenskulturen und Diskursen statt. Die vorangegangenen Ausführungen nahmen exemp14 | Vgl. Board of Participation (2016) und http://boardofparticipation.de
Diversitätsbewusste kulturelle Bildung und Vermittlung im Kontext von Flucht
larisch eine Institution kultureller Bildung ins Visier, um deren Erfahrungen mit dem Diversity-Ansatz zu diskutieren und seine Nutzbarmachung (mit Blick auf Personal und Programm) auszuloten. Das erste Projekt thematisierte von vornherein Diversität. Im zweiten Vermittlungsprojekt zum Thema »Flucht« wurde ausprobiert, was geschieht, wenn man Diversität nicht als Thema oder Marketingstrategie propagiert, sondern als Methodik und Haltung in das Angebot mit einschreibt. Es wurde schnell sichtbar, dass ungeachtet der vorauseilenden Problematisierung von den eingeschriebenen Hierarchien und Machtverstärkern im Diversitätsansatz die Teilnehmer_innen beider Projekte selbstermächtigt das Konzept umdeuteten und sich neue Experimentierräume öffneten. Das heißt, dass trotz aller berechtigten Kritik am Diversity-Ansatz diesem auch ein »unplanbares« Potential innewohnt. Bei allem Reflektieren über Festschreibung und Differenzlinien gibt es auch den Augenblick der Performativität und Zufälligkeit in der Frage, wer sich etwas nimmt und sich selbst zuschreibt. Somit muss Diversität nicht immer angekündigt werden, man kann auf den künstlerischen Vermittlungsprozess vertrauen. Des Weiteren wurde deutlich: Damit Verschiedenheiten und Zuschreibungen nicht nur erkannt, sondern auch in ihren unterschiedlichen Funktionen, Wirkungen und Machtmechanismen verstanden werden, ist die bewusste Reflexion der eigenen Sichtweisen und machtvollen Verstrickungen am Ende des Projekts unabdingbar. Erst dann wäre die Eingangsforderung erfüllt, Kulturinstitutionen sollten Diversität bewusster und gezielter gestalten, damit sie ihren Aufgaben einer sich verändernden Gesellschaft gerecht werden können und sich gemäß ihrem Auftrag in der Zukunftsgestaltung engagieren können. Generell braucht es in der anfangs erwähnten Diskussion um die Anwendung des Diversity-Ansatzes im Kulturbereich deutlich auch ein Mehr an Stimmen, um gemeinsam zu klären: Welche Strategien und Ansätze müssen Kultureinrichtungen in ihrer Programmatik, der Personalzusammensetzung, der Publikumsansprache und in der Kunstvermittlung entwickeln, um den verschiedenen Perspektiven, ästhetischen Vorstellungen und Narrativen – die in einer vielfältigen Gesellschaft existieren – gerecht zu werden bzw. sie in die Arbeit miteinzubeziehen? Für mich waren Überlegungen zur Diversity zunächst ein Startpunkt und Anlass, künstlerische Kunstvermittlung mit Diversität und Globalem Lernen zu kombinieren und somit einen Methodenmix in der Programmgestaltung zu erproben. Es finden sich aber auch andere Empfehlungen, wie der Diversitätsansatz weiterzudenken ist: María do Mar Castro Varela bringt Postkoloniale Theorie und Diversity zusammen (vgl. Castro Varela 2010) und Susanne Keuchel bezieht sich in ihrer Publikation auf die Zusammenfügung von Diversity mit einem transkulturellen Kunstverständnis (vgl. Keuchel/Dunz 2015; vgl. auch Keuchel 2015). Der Diversitätsansatz bietet meiner Ansicht nach auch Andockpunkte, um Führungsund Verwaltungsstrukturen neu zusammenzudenken, bspw. systemische Führungsprinzipien zu addieren. Statt die Aufgabe einer Unternehmensführung in
213
214
Maren Ziese
der Lösung von Problemen zu sehen, ist es bei systemischen Führungsprinzipien so, die Potentiale der Vielfalt in Institutionen und in den Mitarbeiter_innen wahrzunehmen und zu entfalten. Dazu zählt unter anderem auch, eine ausgeprägte Fragekultur im Betrieb zu entwickeln, die ermöglicht, gemeinsam Standpunkte zu erforschen und Lösungen zu erdenken. So haben nicht allein die Leitungspersonen die »richtigen« Antworten und das »passende Wissen«, sondern aktivieren die Expertise und Problemlösefähigkeit aller Kolleg_innen. Educult schlägt in seinem Empfehlungsbericht an die BKM vor, dass die Anforderungsprofile für Führungskräfte im Kulturbereich überdacht werden sollen, und konstatiert, dass eine Forcierung von einschlägigen Qualifikationsmaßnahmen im Bereich Cultural Diversity für im Kulturbetrieb Tätige anstünde (vgl. Educult 2016: 34, 38ff.). Um konkreter auszuloten, wie das Diversity Management im Zuge der aktuellen Erfordernisse an die Spezifika des Kulturbetriebs angepasst werden könnte und welche Leerstellen es beim Diversity Management für den Kulturbereich noch gibt,15 lohnt sich ein Blick auf einige Institutionen in Deutschland, die Erfahrungen mit dem Diversity-Ansatz haben. Bezogen auf die deutsche Hauptstadt stehen dafür das Jüdische Museum, die Komische Oper und das Rundfunk-Sinfonieorchester. Konkret bezogen auf den Themenbereich Flucht und Asyl ist der Berliner Projektfonds Kulturelle Bildung im Jahr 2016 eine Kooperationsvereinbarung zur Diversitätsentwicklung eingegangen, um Flucht und Asyl angemessen in der Förderlandschaft würdigen zu können.16 Wenn man Diversity als anti-hegemoniales Programm definiert und ernstnimmt, müsste auch konkret darüber nachgedacht werden, wer die Aufgabe bekommt, Anforderungsprofile zu überdenken und Qualifikationsmaßnahmen durchzuführen. Strategien für mehr Diversität in Kultureinrichtungen wurden beispielsweise von Kwesi Aikins (Vielfalt entscheidet) und Lena Nising (W3 – Werkstatt für Internationale Kultur und Politik, Hamburg17) im Rahmen der Tagung »Interventionen. Refugees in Arts and Education« (Berlin, 3./4. Juni 2016) diskutiert, die nicht nur die Leerstellen, sondern genau auch solche Modelle zur Sprache brachten. Dies ist eine eindeutige Chance für eine Neuausrichtung des Kulturbetriebs im Kontext von Flucht und Asyl. Die eingangs gestellte Frage, ob der Diversity-Ansatz eine gute Möglichkeit ist, um auf die aktuellen Herausforderungen zu reagieren, mit denen Kulturinstitu15 | Die Akademie Remscheid hat eine Fortbildung in diversitätsbewusster kultureller Bildung (DiKuBi) gestartet, die laut Rezensent Berg ihre Praxis für interkulturelle Trainings und Lernziele gerade noch entwickelt, vgl. Berg (2016). 16 | Vgl. www.kubinaut.de/de/finanzen/berliner-projektfonds-kulturelle-bildung/nichtverpassen/2016/1/26/ (letzter Zugriff: 09.07.2016). 17 | Bei dem Projekt der W3 – Werkstatt für internationale Kultur und Politik e.V. wird die Notwendigkeit eines diversitätsbewussten Selbstverständnisses von Kultureinrichtungen in der Einwanderungsgesellschaft in den Fokus gerückt. Es begleitete sieben Hamburger Kultureinrichtungen im interkulturellen Öffnungsprozess und ist spezialisiert auf DiversityManagement in Kultureinrichtungen.
Diversitätsbewusste kulturelle Bildung und Vermittlung im Kontext von Flucht
tionen konfrontiert sind, kann aus meiner Sicht klar mit »Ja« beantwortet werden. Jedoch sollte auch deutlich geworden sein, dass die Umsetzung kein kurzfristiges Projekt ist, sondern eine längerfristige Veränderung der Organisationskultur nach sich zieht. Aber die Schaffung eines reflexiven Bewusstseins für Vielfalt und für die damit zusammenhängenden, machtvollen Strukturen ist ein guter, wenn nicht sogar der wichtigste Anfang.
L iter atur Berg, Wolfgang (2016): Rezension zu: Susanne Keuchel/Viola Kelb (Hg.): Diversität in der kulturellen Bildung. transcript (Bielefeld) 2015. Perspektivwechsel kulturelle Bildung, Band 1, in: socialnet Rezensionen. www.socialnet.de/rezen sionen/20202.php (letzter Zugriff: 07.07.2016). Board of Participation (Hg.) (2016): Teachers for Life. Empowering Refugees to teach and share knowledge, Berlin. Castro Varela, María do Mar (2010): »Un-Sinn: Postkoloniale Theorie und Diversity«, in: Fabian Kessl/Melanie Plößer (Hg.), Differenzierung, Normalisierung, Andersheit. Soziale Arbeit als Arbeit mit den Anderen, Wiesbaden: VS-Verlag, S. 249-262. Educult (2016): Empfehlungen an die BKM im Hinblick auf Maßnahmen zur kulturellen Integration von geflüchteten Menschen, Wien. http://educult.at/ wp-content/uploads/2016/03/EDUCULT_Maßnahmen-zur-kult_Integr-vongefl_Menschen_Vers-April16.pdf (letzter Zugriff: 01.07.2016). Greenberg, Howard (Hg.) (2014): Vivian Maier – Das Meisterwerk der unbekannten Fotografin 1926-2009. Die sensationelle Entdeckung von John Maloof. Mit Texten von Marvin Heifermann und Laura Lippmann, übersetzt von Ursula Wulfekamp, München: Schirmer Mosel. Grütters, Monika (2015): »Kultur öffnet Welten: Über eine gemeinsame Initiative von Bund, Ländern und Kommunen, künstlerischen Dachverbänden und Akteuren aus der Zivilgesellschaft«, in: Kulturpolitische Mitteilungen, Nr. 150, III/2015, S. 37-39. Keuchel, Susanne (2015): »Diversität, Globalisierung und Individualisierung. Zur möglichen Notwendigkeit einer Neuorientierung in der Kulturpädagogik«, in: Keuchel/Kelb, Diversität in der kulturellen Bildung, S. 37-58. Keuchel Susanne/Dunz, Maria (2015): »Diversitätsbewusste kulturelle Bildung (DiKuBi). Ein Fortbildungskonzept für Multiplikatoren im Aufbau«, in: Keuchel/Kelb, Diversität in der kulturellen Bildung, S. 185-204. Keuchel, Susanne/Kelb, Viola (Hg.) (2015): Diversität in der kulturellen Bildung. Bielefeld: transcript. Kuhn, Melanie (2012): Herrschaftskritische Perspektiven auf Diversity-Konzepte in der Pädagogik. Potenzial und Grenzen. www.wir-falken.de/sl_startseite/ sl_internat/6013561.html (letzter Zugriff: 01.07. 2016).
215
216
Maren Ziese
Maset, Pierangelo (2007): Perspektive Kunstvermittlung (22.02.2007). http:// archiv.ask23.de/draft/archiv/misc/mediation_maset.html (letzter Zugriff: 08.07.2016). Mecheril, Paul (2007): Diversity. Die Macht des Einbezugs. www.migration-boell. de/web/diversity/48_1012.asp (letzter Zugriff: 01.07.2016). Mecheril, Paul/Plößer, Melanie (2011): »Diversity und Soziale Arbeit«, in: HansUwe Otto/Hans Thiersch (Hg.), Handbuch Soziale Arbeit, München: Ernst Reinhardt. Merx, Andreas (2011): »Alles so schön bunt hier!« Diversity zwischen Lippenbekenntnis, Marketing-Label und nachhaltigem Wandel zur offenen Unternehmung. Ein Einführungsvortrag von Andreas Merx, Internationale Gesellschaft für Diversity Management (idm e.V.), im Rahmen der Konferenz »Rethinking Migration: Diversity Policies in Immigration Societies. International Conference 8.-9. December 2011 in Berlin. www.network-migration.org/rethinkingmigration-2011/3/papers/Merx_idm_Rethinking_Migration091211.pdf (letzter Zugriff: 08.07.2016). Mörsch, Carmen (2011): Arbeiten im Widerspruch. www.goethe.de/wis/bib/prj/ hmb/the/156/de8622710.htm (letzter Zugriff: 08.07.2016). Mörsch, Carmen (2016): Urteilen Sie selbst: Vom Öffnen und Schließen von Welten (13.06.2016). www.kultur-oeffnet-welten.de/positionen/position_2944. html (letzter Zugriff: 08.07.2016). Sharifi, Azadeh (2015): Evaluation. Berlin Mondiale – Flüchtlinge & Kulturinstitutionen: Zusammenarbeit in den Künsten. www.kubinaut.de/media/down loads/berlin_mondiale_evaluation_public.pdf (letzter Zugriff: 08.07.2016). Stiftung SPI – Sozialpädagogisches Institut Berlin »Walter May« (Hg.) (2013): Vielfalt gestaltet Grundschule. Nürtikulti. Ein Modellprojekt stellt sich vor. Dokumentation, Handreichung und Ausblick. www.mbt-ostkreuz.de/ostkreuz/ mbt/aktuelles/Startseite/5-Nuertikulti_Abschlussdoku.pdf (letzter Zugriff: 08.07.2016). Terkessidis, Mark (2016): Parallelgesellschaften im Kulturbetrieb? Mark Terkessidis im Gespräch im Silvia Fehrmann (07.03.2016). www.kultur-oeffnet-welten. de/positionen/position_1024.html (letzter Zugriff: 01.07.2016). Völckers, Hortensia im Gespräch mit Mascha Drost (2016): »Weiß und sehr männlich« (26.03.2016). www.deutschlandfunk.de/kulturinstitutionen-weiss-undsehr-maennlich.691.de.html?dram:article_id=349485 (letzter Zugriff: 08.07. 2016). Wimmer, Michael (2015): »Kulturelle Bildung in Zeiten wachsender Unterschiede«, in: Keuchel/Kelb, Diversität in der Kulturellen Bildung, S. 15-35.
Erst eingeladen, dann fotografiert Bilder von Geflüchteten in Museen und anderen Bildungsinstitutionen Kea Wienand Zusammenfassung Berichte über Veranstaltungen für und mit Geflüchteten in Museen werden aktuell meist bebildert mit fotografischen Aufnahmen von Menschen, die lächelnd vor Ausstellungsobjekten posieren oder die andächtig einer Vermittler_in lauschen. Kea Wienand geht in ihrem Beitrag aus repräsentationskritischer und postkolonialer Perspektive der Frage nach, welche Bedeutungen und Aussagen diese Bild-Text-Kombinationen produzieren und welche Funktionen sie im Kontext gegenwärtiger Bilderpolitiken übernehmen. Sie formuliert Überlegungen zu möglichen Dokumentationsformen, die gerade nicht dazu dienen, die tradierte Annahme einer »weißen«, europäischen Überlegenheit und das Selbstverständnis eines westlichen Paternalismus zu bestärken.
Abstract: First Invited, then Photographed – Images of Refugees in Museums and other Educational Institutions Reports on events for and with refugees in museums are mostly accompanied by photographs of people posing smiling in front of exhibits, or listening intently to educators. From a perspective of postcolonial and representational critique, in her paper, Kea Wienand looks into the question of which meanings and statements these combinations of image and text produce, and which functions they carry out in the context of the contemporary politics of the image. She formulates considerations on possible forms of documentation which explicitly resist the purpose of strengthening the traditional assumption of »white« European supremacy and the self-image of a Western paternalism.
218
Kea Wienand
In Reaktion auf die sogenannte ›Flüchtlingskrise‹ im Sommer/Herbst 2015 konzipieren zahlreiche Kulturinstitutionen Angebote für und mit Geflüchtete(n). Um zu diesen Veranstaltungen einzuladen, vor allem aber um sie zu dokumentieren und mit ihnen zu werben, werden Bild-Text-Kombinationen in verschiedenen Medien (Internet, Broschüren, Zeitungen etc.) veröffentlicht. Die Produktion dieser öffentlichkeitswirksamen Repräsentationen ist Teil der Arbeit von Museumsmitarbeiter_innen, Vermittler_innen, Pädagog_innen etc. und stellt diese zusätzlich zu der Konzipierung, Organisation und Durchführung der Projekte auch noch vor spezifische Herausforderungen. Stephan Fürstenberg hat in verschiedenen Veröffentlichungen bereits deutlich gemacht, dass die Dokumentation von Kunstvermittlungsaktivitäten eine machtvolle Aufgabe ist, da sie Normalitäten und Ausschlüsse (re-)produzieren kann (vgl. Fürstenberg 2013). Zugleich ergibt sich mit dieser Aufgabe aber auch ein »Möglichkeitsfeld« (ebd.: 238), auf dem dominante Formen der Repräsentation unterbrochen werden können. Im Folgenden formuliere ich ähnliche repräsentationskritische Überlegungen in Bezug auf die Darstellung, vor allem die Visualisierung, von Veranstaltungen für und mit Geflüchteten in Museen und anderen Orten kultureller Bildung.1 Die Brisanz dieser Bilder und Texte scheint momentan darin zu liegen, dass die Einrichtungen, die solche Formate konzipieren, unter besonderem Druck stehen, da erste Angebote, wie der freie Eintritt in Museen und Ausstellungen für Asylsuchende im Herbst 2015, nicht nur zu einer gewissen medialen Aufmerksamkeit, sondern auch zu rassistisch motivierten Protesten von Bürger_innen geführt haben. Ohne diese Proteste hier zu stark skandalisieren zu wollen (unklar bleibt nach wie vor, wie viele Bürger_innen derartige Initiativen befürworten), stehen die Veranstalter_innen somit unter besonderer medialer Beobachtung, geraten teilweise unter Rechtfertigungszwang und ihr Auftrag hinsichtlich einer antirassistischen Bildungsarbeit für die ›weiße‹ Mehrheitsbevölkerung wird durch die genannten Reaktionen umso deutlicher. Jede Institution und alle Akteur_innen, die Aktionen mit Geflüchteten organisieren, sollten sich daher überlegen, was für Aussagen und Bedeutungen die entworfenen Veranstaltungsformate sowie die in diesem Zusammenhang publizierten Bild-Text-Kombinationen produzieren und vermitteln. Sie können sich mit diesen aktiv an einem Prozess beteiligen, in dem man sich in der Bundesrepublik Deutschland (endgültig) von der Auffassung verabschiedet, kein Einwanderungsland zu sein und Rassismus auf verschiedenen Ebenen entgegnet. Notwendig 1 | Ich formuliere diese Überlegungen aus der Perspektive einer ›weißen‹ Kunstwissenschaftlerin, die selbst nie flüchten musste. Daher konzentriere ich mich hier auf die Frage, welche Bedeutungen und Aussagen die Bild-Text-Kombinationen einer ›weißen‹ Mehrheitsbevölkerung vermitteln und inwiefern sie tradierte ›weiße‹ Überlegenheitsvorstellungen weiter stützen. Ich überlege zwar auch, was für Bilder von Geflüchteten gezeigt werden könnten, aber um diese Frage zu beantworten und einen Paternalismus nicht weiter fortzuführen, müssten Personen gefragt werden, die selbst geflüchtet sind.
Erst eingeladen, dann fotografiert
dafür ist, die eurozentrische Annahme einer ›weißen‹ Überlegenheit und eines ›weißen‹ Paternalismus aufzugeben sowie sich von der tradierten Vorstellung zu verabschieden, Deutschland oder das ›Abendland‹ besäßen eine homogene, stabile und von anderen Ländern bzw. Kontinenten unabhängige und abgrenzbare ›eigene‹ Kultur und Geschichte.2 Identität lässt sich aus einer solchen postkolonialen Perspektive nicht mehr in einfachen und als starr sowie ›natürlich‹ vorgestellten ›wir‹- und ›sie‹-Kategorien denken. Die Frage ist nun, welche Bilder und Texte es braucht, um diesen Prozess der Dekolonisierung und des Verlernens ›weißer‹ Privilegien3 zu unterstützen, oder andersherum: welche einem solchen Prozess entgegenstehen. Dass die visuellen Repräsentationen von Menschen, die sich von ›uns‹ unterscheiden, als Konzept und Praxis eine komplexe Angelegenheit und nach wie vor heftig umkämpft sind, ist von postkolonialen und feministischen Theoretiker_innen verschiedentlich dargelegt worden (vgl. z.B. Hall 2004). Gerade in der Bebilderung von Differenzen, seien es ethnische, rassisierte oder kulturelle, wird häufig auf visuelle Motive zurückgegriffen, die eine lange Tradition besitzen und dadurch – von den Produzent_innen oft ungewollt – Bedeutungen mit transportieren, die Stereotype reproduzieren und Andersheit spektakularisieren, vorhandene Machtverhältnisse dabei aber verschleiern und zugleich stützen (ebd.). Gelesen werden diese (wie auch alle anderen) Bilder von Differenz immer in Verbindung mit anderen Darstellungen, wir verstehen sie nur, weil wir sie mit ähnlichen oder gänzlich anderen Bildern, die wir kennen und die in unseren Köpfen sind, abgleichen. In diesem intertextuellen Gefüge produzieren sie Bedeutungen und formulieren Aussagen.4 Ein aktuell beliebtes fotografisches Motiv für die Bebilderung von Aktionen in Museen für und mit Geflüchteten zeigt meist eine Gruppe junger Menschen mit unterschiedlichen Hautfarben, die in modischer Freizeitkleidung lächelnd in die Kamera schauen oder gebannt auf ein Museumsobjekt und die/ den jeweilige_n Vermittler_in blicken.5 Fast immer ist der Raum der Aufnahme eindeutig als Museum erkennbar, das Licht ist gedämpft, die eingefangene Stimmung freundlich und konzentriert, die Eingeladenen haben sich ordentlich zum Gruppenporträt oder im Halbkreis als Zuhörende aufgestellt, der 2 | Gerade Kulturwissenschaftler_innen wissen, dass Kulturen nie hermetisch abgeschlossene und in sich homogene Gebilde waren, sondern dass sie immer schon durchlässig und hybride sowie durch Machtbeziehungen miteinander verbunden sind. 3 | Zum Verlernen weißer Privilegien als notwendigem Teil der Dekolonisierung vgl. María do Mar Castro Varela und Nikita Dhawan (2009). 4 | Zur ausführlichen Darlegung der Perspektive der Repräsentationskritik vgl. Stuart Hall (1997) sowie Sigrid Schade und Silke Wenk (2011). 5 | Meine Argumentation beruht hier nicht auf einer systematischen Untersuchung (eine solche steht leider noch aus), sondern auf einer ersten Bildersammlung und -recherche u.a. über einschlägige Internetsuchmaschinen. Das beschriebene Motiv habe ich dabei am häufigsten gefunden.
219
220
Kea Wienand
Gesamteindruck ist eher statisch, kaum etwas weist auf Bewegungen hin. Die überwiegend jungen Leute blicken mich als Betrachtende entweder direkt und freundlich an, oder ich kann sehen, wie sie sich interessiert dem jeweiligen Geschehen und den Ausstellungspräsentationen zuwenden. Die Botschaft, die diese Fotografien vermitteln, ist nicht schwer zu entschlüsseln: Die geflüchteten Menschen haben die Einladung der Museen gerne und dankbar angenommen. Das Museumsdirektorium hat den Eintritt erlassen, hat dafür gesorgt, dass den Menschen etwas geboten wird, und um das Ganze zu dokumentieren, quasi als Dank, wird ein Foto gemacht. Aber diesen und ähnlichen fotografischen Aufnahmen haften noch mehr Bedeutungen an, zusammen mit den sie begleitenden Bildunterschriften und Texten sowie im Kontext aktueller Bilderpolitiken vermitteln sie weitere, weniger offenkundige, aber trotzdem wirkmächtige Aussagen. Zugleich verschweigen bzw. verdecken sie unangenehme Aspekte und können spezifische Funktionen übernehmen, denen ich hier noch ein Stück weiter nachgehen will. Die Gruppenaufnahmen machen insbesondere Aussagen über diejenigen, die als ›Flüchtlinge‹ angerufen werden. Sie geben sie zu sehen, die Fotografien behaupten also auch: So sehen sie aus, die Flüchtlinge, zumindest die, die ins Museum kommen. Da sich sowohl die Herkunft als auch Erfahrungen der Flucht jedoch gerade nicht aus dem fotografischen Porträt eines Menschen herauslesen lassen und die hier Fotografierten zum Beispiel auch in Deutschland geborene und lebende Studierende sein könnten, arbeiten die meisten Bilder daran, über das Setting der Aufnahme sowie durch die Bildunterschriften eine Differenz herauszustellen und gerade dort wieder festzuschreiben, wo eine solche eben nicht augenscheinlich ist. Fast in allen Aufnahmen befinden sich im Hintergrund oder in direkter Nähe zu der fotografierten Gruppe Ausstellungsobjekte, die entweder als ›typisch‹ deutsch bzw. europäisch-christlich gelten oder die – auch für Laien ersichtlich – aus nicht-europäischen Ländern stammen und z.B. der islamischen Kunst zuzuordnen sind. Die rahmenden Texte betonen diese visuellen Differenzsetzungen zusätzlich, indem sie entsprechend erläutern, dass eine Gruppe ›Flüchtlinge‹ hier ›der fremden‹ oder ›der eigenen‹ Kultur begegnet. Ich will nicht in Abrede stellen, dass Geflüchtete ihre Erfahrungen während ihres Museumsbesuchs mit diesen im Diskurs gerade omnipräsenten Begriffen beschreiben, aber auffällig ist, wie in Bild-Text-Kombinationen versucht wird, ›sie‹ zu identifizieren (aber nicht zu individualisieren!) und eine Differenz zwischen ›ihnen‹ und ›uns‹ bzw. zwischen ›ihrer‹ und ›unserer‹ Kultur und Geschichte gerade da herauszustellen und zu fixieren, wo eine solche eben nicht sichtbar ist, nicht sichtbar sein kann. Einmal mehr wird die Fotografie hier in den Dienst der Fremddarstellung genommen, eine Aufgabe, die ihr seid ihrer Erfindung Mitte des 19. Jahrhunderts zuteilwurde (vgl. Brandes 2010). Verschiedentlich haben Wissenschaftler_innen und Künstler_innen dargelegt, dass die Fotografie zusammen mit wissenschaftlichen Disziplinen, wie etwa der Anthropologie, daran beteiligt war, die Bevölkerungen kolonialisierter Länder zu dokumentieren und als ›Andere‹ zu
Erst eingeladen, dann fotografiert
klassifizieren (vgl. z.B. Wenk 2007).6 Durch die darüber vorgenommene Wissenskonstitution, in der die Aufteilung davon, wer zu sehen gegeben wurde und wer wie zu sehen gab, bis auf wenige Ausnahmen hierarchisch verteilt war, war die Fotografie in die Reproduktion von Machtverhältnissen involviert. Anstelle heute nun für Museumshomepages etc. diese Motive, Praktiken und Strukturen des Zeigens und Bezeichnens zu wiederholen, wäre zu überlegen, ob man die vermeintliche Eindeutigkeit von Fotografien nicht mit simplen Mitteln durchkreuzen kann, indem man eine Identifikation der Akteur_innen als gänzlich ›Andere‹ mittels verschwommener Aufnahmen erschwert, oder indem zumindest in den Bildunterschriften offen gelassen wird, wer hier Geflüchtete_r, wer betreuende Person oder Museumsmitarbeiter_in mit oder ohne ›Migrationshintergrund‹ ist. Eine weitere Möglichkeit ist, den zu Porträtierenden selbst die Kamera zu überlassen oder mit ihnen die Inszenierung ihres Bildes zu besprechen. Einwenden ließe sich gegen die Kritik an vermeintlich eindeutig identifizierbaren Bildern, dass Fotografien von Geflüchteten in Museen auch zu einer gewissen positiven Sichtbarkeit von diesen beitragen, indem sie sie in überwiegend ›weiß‹ gehaltene Orte – wie Museen – einschreiben und damit in gewisser Hinsicht auch aufwerten und für Akzeptanz sorgen.7 Ein solcher Einspruch ist nicht gänzlich abzuweisen, eine individualisierende Form der Sichtbarkeit von einzelnen ist dringend nötig. Und doch muss gefragt werden, wie die Fotografien und Texte die Geflüchteten nicht nur zu sehen geben, sondern auch positionieren, welche Subjektpositionen hier von wem für sie bereitgestellt und wie sie daraufhin akzeptiert werden. Das hier besprochene Bildmotiv zeigt mit nur wenigen Variationen junge Erwachsene, deren Gesten in dem skizzierten Kontext als dankbar lächelnd oder als begierig aufnehmend gelesen werden können. Nur wenige Bilder visualisieren Situationen, in denen die Rollen der Gebenden und der Nehmenden nicht eindeutig verteilt sind. Die Institutionen und ihre Mitarbeiter_ innen bleiben dabei als Personen oft unsichtbar oder nur angedeutet, als ›über allem schwebende‹ Instanzen werden sie eher implizit über Text als ›wohltätig‹, ›offen‹ und ›moralisch gut‹ repräsentiert. Die Eingeladenen dagegen erscheinen als ›lernwillig‹, ›anpassungsbereit‹ und ›aufnahmefähig‹, dabei aber auch als ›reagierend‹, ›unwissend‹ und ›zu belehren‹. Selten ist ein Hinweis auf kontroverse Diskussionen, unterschiedliche Sichtweisen oder kritische Nachfragen von Seiten der Migrant_innen vorhanden. Noch seltener finden sich Anspielungen auf Situationen, in denen die Eingeladenen ihr Wissen und ihre Erfahrungen vermitteln oder Einspruch erheben. Gerade bezüglich musealer Artefakte aus außer6 | Die Fotografie knüpfte mit dieser Praxis auch an Darstellungskonventionen der Malerei und Grafik an, mit denen spätestens seit dem Barock die Bewohner_innen ›fremder‹ Länder als Exoten und ›Curiosa‹ verbildlicht wurden. Gruppenporträts von diesen wurden erst im 19. Jahrhundert und im Kontext der Hochzeit des Kolonialismus üblich. 7 | Zu Ambivalenzen von Sichtbarkeit und dem Einspruch dagegen, dass eine stärkere visuelle Präsenz per se zu mehr Macht führen würde vgl. Johanna Schaffer (2008).
221
222
Kea Wienand
europäischen oder/und ehemals kolonisierten Ländern drängt sich die Frage auf, was die Eingeladenen zu der Rechtmäßigkeit des Verbleibs von diesen Objekten in europäischen Museumssammlungen sagen.8 Selbst die visuelle Hervorhebung von einzelnen Geflüchteten, denen Sprecher_innenrollen zukommen, ist häufig so kontextualisiert, dass sie als in den jeweiligen Ort angepasst erscheinen. Jung, hübsch – d.h. den gängigen Schönheitsidealen entsprechend –, ordentlich angezogen, in vorgegebenem Rahmen dynamisch und engagiert, erscheinen sie als Rollenmodelle für ›Integration‹.9 Auch ›gemischte‹ Gruppenporträts von jungen Erwachsenen im Stil der Benetton-Werbung tendieren eher dazu, bildungsbürgerliche Normierungen bezüglich Körper, Kleidung, Aussehen etc. zu bekräftigen und die Einwanderungsgesellschaft als ›kulturalistische Bereicherung‹ nach westlichen Maßstäben zu proklamieren. Im Kontrast dazu stehen Bilder von Flüchtenden, wie sie seit einigen Jahren und seit Sommer 2015 zunehmend im Diskurs sind: Aufnahmen von überfüllten Booten, von Trecks von Menschen und Flüchtlingscamps.10 Häufig zu sehen sind Bilder von Situationen an Grenzzäunen und Bahnhöfen, die zu eskalieren drohen oder ›außer Kontrolle‹ zu geraten scheinen. Fast alle vermitteln eher chaotische Eindrücke und zeigen Zustände der Unordnung.11 Die Bilder von Geflüchteten, die in die Museen oder andere Bildungseinrichtungen kommen, wirken vor dieser Folie dagegen wie komplementäre Gegenbilder, die signalisieren: Hier ist alles ›in Ordnung‹, in den deutschen Bildungseinrichtungen hat die ›Willkommenskultur‹ und vor allem die ›Integration‹ funktioniert. Für besorgte ›weiße‹ Bildungsbürger_innen können solche Bilder möglicherweise beruhigende Funktionen haben: Diese ›Flüchtlinge‹ – so die Botschaft – sind integrierbar, sie stören die musealen und generell die kulturellen und gesellschaftlichen Ordnungen (z.B. die Ge8 | Dass solche Debatten bei Führungen für Geflüchtete entstehen, beschreibt Sonja Zekri in einem Artikel der Süddeutschen Zeitung vom 07.04.2016. 9 | Um hier keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Die Anpassung an Kleidungsnormierungen als bewusste Strategie, um sich Gehör zu verschaffen oder bestimmte Positionen zu erlangen, kritisiere ich hier ausdrücklich nicht. Zur problematischen und historisch veränderlichen Definition von ›Integration‹ in der Bundesrepublik vgl. Terkessidis (2010: 39ff.). 10 | Eine erste ikonologische Analyse aktueller Bilder von Geflüchteten in europäischen Medien hat Francesca Falk vorgenommen (2010). Sie legt dar, dass diese als Invasion dargestellt werden. Dabei sind sie entweder als anonyme und bedrohliche Masse oder als individuelle Flüchtlinge, als Opfer porträtiert. 11 | Ich will hier nicht in Abrede stellen, dass die Flucht für die meisten, die aktuell versuchen, nach Europa zu gelangen, furchtbar und eine Erfahrung der totalen Unordnung ist, und ich will auch nicht leugnen, dass Einzelne, die einst geflohen sind, sich heute in Museen oder anderen Orten Positionen erarbeitet haben. Mir geht es vielmehr darum, in Frage zu stellen, dass Bilder diese Erfahrungen abbilden können, und zum anderen geht es mir darum, die Bilderpolitiken zu befragen, in die auch Bildungseinrichtungen verwickelt sind.
Erst eingeladen, dann fotografiert
schlechterordnung) nicht, sondern passen sich unter Anleitung, aber aus eigener Kraft heraus, gut ein und an. Aber sollte es wirklich das Ziel sein, Museen als möglichst ›störungsfreie‹, widerspruchslose und harmonische Orte zu konzipieren und zu repräsentieren? Geht es darum, sie als Institutionen darzustellen, die westliche Normierungen und Maßstäbe auf Dauer sichern? Wollen wir Bildungseinrichtungen, die stur an tradierten Ordnungen festhalten und in denen nur diejenigen, die sich anpassen, es selbstverantwortlich schaffen können, um dann als Dankbare akzeptiert zu werden? Oder sollten Museen nicht eher Orte des Disputs und der Debatte sein, die sich durch verschiedene Veränderungen, Perspektiven und Positionen herausfordern lassen und in denen auch Fragen gestellt werden, die unbequem sind? Es geht mir hier nicht darum, für ein bestimmtes Bild zur Repräsentation von Museen und Geflüchteten zu plädieren. Notwendig ist vielmehr, – vor allem in Hinblick auf die ›weiße‹ Mehrheitsbevölkerung –, sich darüber bewusst zu sein, dass Repräsentationen nicht ›unschuldig‹ sind und dass simplifizierende, vereindeutigende und beruhigende Bilder von Geflüchteten letztlich nur dazu dienen, erneut die Annahme einer ›weißen‹ (deutschen) Überlegenheit und das Selbstverständnis eines europäischen Paternalismus zu bestärken.
L iter atur Brandes, Kerstin (2010): Fotografie und Identität. Visuelle Repräsentationspolitiken in künstlerischen Arbeiten der 1980er und 1990er Jahre, Bielefeld: transcript. Castro Varela, María do Mar/Dhawan, Nikita (2009): »Breaking the Rules. Bildung und Postkolonialismus«, in: Carmen Mörsch/Forschungsteam der documenta 12 Vermittlung (Hg.), Kunstvermittlung II. Zwischen kritischer Praxis und Dienstleistung auf der documenta 12 – Ergebnisse eines Forschungsprojekts, Zürich: diaphanes, S. 339-351. Falk, Francesca (2010): »Invasion, Infection, Invisibility: An Iconology of Illegalized Immigration«, in: Christine Bischoff/Francesca Falk/Sylvia Kafehsy (Hg.), Images of illegalized immigration: towards a critical iconology of politics, Bielefeld: transcript, S. 83-100. Fürstenberg, Stephan (2013): »Arbeiten in Spannungsverhältnissen 9: Herausforderungen bei der und durch die Dokumentation von Kunstvermittlung«, in: Institute for Art Education der Zürcher Hochschule der Künste (Hg.), Zeit für Vermittlung. Eine Online Publikation zur Kulturvermittlung. www.kultur-ver mittlung.ch/zeit-fuer-vermittlung/v1/?m=9&m2=5&lang=d, S. 236-242 (letzter Zugriff: März 2016). Hall, Stuart (1997): »The Work of Representation«, in: ders. (Hg.), Representations: Representations and Signifying Practices, London u.a.: SAGE, S. 15-61.
223
224
Kea Wienand
Hall, Stuart (2004): »Das Spektakel des Anderen«, in: Juha Koivisto/Andreas Merkens (Hg.), Ideologie. Identität. Repräsentation, Hamburg: Argument, S. 108166. Schade, Silke/Wenk, Silke (2011): Studien zur visuellen Kultur. Einführung in ein transdisziplinäres Forschungsfeld, Bielefeld: transcript. Schaffer, Johanna (2008): Ambivalenzen der Sichtbarkeit. Über die visuellen Strukturen der Anerkennung, Bielefeld: transcript. Terkessidis, Mark (2010): Interkultur, Berlin: Suhrkamp. Wenk, Silke mit Rebecca Krebs (2007): Analysing the Migration of People and Images: Perspectives and Methods in the Field of Visual Culture, www.uni-ol denburg.de/fileadmin/user_upload/studium-geschlechterstudien/download/ Wenk_Visual_Culture_-_Migrations__April_2007.pdf (letzter Zugriff: März 2016). Zekri, Sonja (2016): »Wiedersehen«, in: Süddeutsche Zeitung vom 07.04.2016.
Geschichtsvermittlung und historische Gerechtigkeit Überlegungen zu Flucht, Asyl und postkolonial informierter Globalgeschichte im Museum Caroline Gritschke »The statues are no longer dead in their cases. Our histories are no longer mute. The hierarchy of value is being replaced by an equality of curiosity and exchange.« (N ana O foriat ta Ayim)1
Zusammenfassung Der Beitrag beschäftigt sich mit den Geschichtserzählungen in regionalen und nationalen (kultur-)historischen Museen, die als Gedächtnisspeicher und als Akteure des kollektiven Gedächtnisses fungieren. Aspekte der Kolonialgeschichte und ihrer Wirkungen bis in die Gegenwart sowie globalhistorische Perspektiven bleiben häufig unerzählt. Für Geflüchtete als Museumsbesucher_innen bieten historische Museen in Deutschland noch wenig Anknüpfungspunkte. Das Einbeziehen ihrer Geschichten, der Hintergründe ihrer Flucht, der Kämpfe um Anerkennung und Partizipation könnten regionalgeschichtlich Verbindungen zur geteilten Globalgeschichte schaffen und die bislang blinden Seiten der lokalen und nationalen Geschichtsnarration erhellen. Das Museum als Ort der Diskussion und Begegnung zwischen Menschen mit und ohne Fluchterfahrung kann sich im Rahmen der Geschichtsvermittlung selbst zum Thema machen und so einen Beitrag zu einer historisch und postkolonial informierten Gestaltung der Gegenwart leisten.
1 | Zitiert aus dem im Frieze Magazin 2011 erschienen Artikel »Speak now« der in Accra lebenden Kulturhistorikerin, Autorin und Filmemacherin Nana Oforiatta Ayim (vgl. Oforiatta Ayim 2011).
226
Caroline Gritschke
Abstract: Museum Education and Historical Justice – Reflections on Forced Migration, Asylum and Postcolonial Approaches to Global History in the Museum This paper is concerned with the narratives in regional and national (cultural)-historic museums, which function as memory banks and agents of collective memory. Aspects of colonial history and its impact right up to the present, as well as global historical perspectives are often left untold. Germany’s historical museums offer few points of reference for refugees as museumgoers. The integration of their stories, the backgrounds to their journeys of escape, and of their struggles for recognition and participation could reveal regional and historical connections within the fractured history of the world, and shed light on local and national historical narratives which have previously remained obscured. In terms of conveying history, the museum too can in itself become an issue to be explored – as a place of discussion and connection between refugees and non-refugees – and thus contribute towards a historic and post-colonially informed narrative of the present.
Museen erzählen halbe Geschichten. Die unbeachteten Dinge und Wissensbestände schlummern im Verborgenen, werden nicht gesammelt, nicht exponiert oder verbleiben in den Fluren der Depots und in den Köpfen der Menschen, die im Museum nicht vorkommen. Ausgehend von der Geschichtserzählung mit Objekten in historischen Museen und ihrer Bedeutung für das kollektive Gedächtnis soll im Folgenden gezeigt werden, welche Erzählstränge und Perspektiven bislang in Ausstellungen weitgehend vernachlässigt werden. Welche Fragen stellt die Anwesenheit von Geflüchteten an Geschichtsmuseen, wenn man die Neuangekommenen mit ihren Lebensgeschichten als Teil der Städte und Regionen versteht? Das Konzept der »verflochtenen Geschichte« soll in den folgenden Überlegungen auf museale Narrationen angewandt werden, um einerseits in Richtung Globalgeschichte und andererseits im Themenfeld der Geschichte der Partizipation neue Horizonte zu eröffnen. Am Ende soll das Potential dieser Weiterungen für die Geschichtsvermittlung, für gemeinsame Diskussions- und Bildungsprozesse von Menschen mit und ohne Fluchterfahrung erwogen werden.
Museumsobjekte im Kontext transnationaler Erinnerungen Historische Museen schreiben mit Objekten Geschichte(n), die durch Inszenierungen und Texte Authentizität und historische Wahrheit beanspruchen. Aus der Vielzahl der überlieferten Dinge mit ihren vielfältigen möglichen Bedeutungen wählen fachwissenschaftlich ausgebildete Kurator_innen aus, was die Besucher_ innen wahrnehmen und lernen sollen. Die Geschichtserzählungen mit Dingen in historischen Museen fokussieren und reduzieren, suchen und erwählen Objekte und laden sie eindimensional mit Bedeutung auf, indem sie sie im Rahmen der Ausstellung in einen narrativen
Geschichtsvermittlung und historische Gerechtigkeit
Kontext stellen. Die latente Polyvalenz der Objekte wird auf dem Weg zum Exponat unsichtbar (vgl. Parmentier 2012: 148). Aus der Menge möglicher Bedeutungen wählen Museen diejenigen aus, die sich für sie aus der Erzählabsicht und auf der Grundlage des aktuell verfügbaren historischen Wissens ergeben. Diese Konstruktion von Wissen über die Vergangenheit wird durch die Inszenierung offengelegt. Reduktion und thesenhafte Zuspitzung ermöglichen didaktisch eine kritische Auseinandersetzung und sollen Fragen evozieren, die die Betrachter_innen an Vergangenheit und Gegenwart stellen. Aber werden die richtigen Fragen gestellt? Regen historische Museen mit ihrer gegenwärtigen Reduktion und Fokussierung zu multiperspektivischem Denken an? Wie werden Objekte gesammelt und Geschichtserzählungen ausgewählt? Von wem und aus welchen Positionen heraus? Ordnen Besucher_innen den Dingen überhaupt die von den Kurator_innen zugewiesenen Bedeutungen zu? Sehen sie dasselbe wie die Museumsmacher_innen? Die Betrachter_innen der historischen Ausstellungen sind nicht selten widerspenstig in dem Sinne, dass sie ausgestellte Exponate in andere Kontexte stellen und mit eigenen Geschichten, Erinnerungen und Vergleichen verbinden.2 Das öffnet den Raum für neue Kontexte und neue Erzählungen, für ein Freilegen auch der vergessenen oder unterdrückten Bedeutungen und Geschichten. Der Verweis auf einen allgemeingültigen, objektiven geschichtswissenschaftlichen Rahmen, der die Referenzerzählung für die Museumsnarration bilden würde,3 greift zu kurz, will man die Standorte der Wissensformation und die unterschiedlichen kollektiven Gedächtnisse nicht außer Acht lassen. Museumsbesucher_innen, die nicht mit dem kanonisierten nationalhistorischen Wissen über Geschichte, wie es in unseren Schulen gelehrt wird, aufgewachsen sind, Menschen, die erst vor kurzem aus den Ländern Arabiens, aus Osteuropa oder aus den ehemaligen europäischen Kolonien Afrikas nach Deutschland gekommen sind, betreten regionale und nationale historische Museen mit verschiedenen und ähnlichen Fragen und anderen, neuen erinnerungskulturellen Anknüpfungspunkten. Geschichte und Erinnerung sind nicht deckungsgleich, aber eng miteinander verwoben.4 Aleida Assmann ordnet Geschichte und Gedächtnis zwei Modi 2 | Die Bedeutung der Objekte wird nach Pearce in der Ausstellung dynamisch konstruiert in einem Raum zwischen dem Exponat selbst und der Wahrnehmung der Betrachtenden, die von persönlicher Disposition und Erfahrung abhängig ist (vgl. Pearce 1994: 26f.). 3 | Auf die vermeintlich objektiven Wissensbestände der historischen Forschung als Richtschnur und Korrektiv des Umgangs mit Objekten in historischen Ausstellungen verweist Parmentier, um aufzuzeigen, dass Geschichtserzählungen mit Objekten nicht unendlich und willkürlich seien (vgl. Parmentier 2012: 162). 4 | Zu den Positionen in der Diskussion um das Verhältnis von Geschichte und Gedächtnis bzw. zu der Frage, ob nicht die wissenschaftliche Geschichtsdarstellung selbst eine Form kollektiver Erinnerung sei, vgl. Erll (2011: 43-45).
227
228
Caroline Gritschke
der Erinnerung zu: dem lebendigen Gedächtnis das Funktionsgedächtnis, der wissenschaftlichen, entkörperten Geschichte hingegen das Speichergedächtnis. Unter dem Dach des Speichers haben viele »unbewohnte Relikte und besitzerlos gewordene Bestände« Platz, die – wieder auf bereitet – potentiell Anschlussmöglichkeiten zum Funktionsgedächtnis bieten (vgl. Assmann 2003: bes. 133f.). Museen und Archive sind Bestandteile dieses Speichers. Als Teil des kulturellen Gedächtnisses der Stadt, der Region oder der Nation sind sie auf diese Weise an der Bildung von Identitäten beteiligt. Sie bieten das Material, die Bausteine für das kollektive Gedächtnis. Dabei bezieht sich die Erinnerung als Konstruktionsprozess immer auch auf das Vergessen, Verdrängen, Beschweigen. Dieser Prozess des Erinnerns und Nicht-Erinnerns ist ein politischer Akt der Gegenwart und der Zukunft, so der Ägyptologe und Kulturwissenschaftler Jan Assmann: »In ihrer kulturellen Überlieferung wird eine Gesellschaft sichtbar: für sich und für andere. Welche Vergangenheit sie darin sichtbar werden und in der Wertperspektive ihrer identifikatorischen Aneignung hervortreten lässt, sagt etwas aus über das, was sie ist und worauf sie hinauswill.« (Assmann 1988: 14; vgl. auch Assmann 2005: 36)
Menschen mit Fluchterfahrungen und mit außerwesteuropäischen Lebenserfahrungen, mit individuellen Erinnerungen verankert in unterschiedlichen Kontexten kommunikativer und kultureller Gedächtnisse verweisen zunächst durch ihre körperliche Anwesenheit in Stadt- und Kulturräumen der Ankunftsgesellschaft auf das Vergessen und das im Museum nicht Erzählte. Denn Erinnerung ist stets ein leibliches Geschehen (vgl. Gugutzer 2002: 105). Das gilt zunächst einmal zentral für die Grundlagen der personalen Identität, spielt aber auch überindividuell eine Rolle. Für den Kulturwissenschaftler Mathias Berek ist Leiblichkeit 5 die Grundlage der Räumlichkeit der Erinnerung. Durch den Leib nehmen wir nicht nur uns selbst, sondern auch den Anderen wahr. Der Körper ist dabei das Ausdrucksfeld sowohl für die Wahrnehmung durch Andere als auch für das Sichtbarwerden des Anderen. Der Leib ist damit Hauptort menschlicher Kommunikation, seine Präsenz Voraussetzung für Speicher- und Funktionsgedächtnis. Denn ob eine Wahrnehmung, eine Erfahrung oder ein Ereignis überhaupt abgespeichert wird, hängt von der Beziehung der Körper zueinander und ihrer Positionierung im Raum ab. Mit der zunehmenden Entfernung der Menschen voneinander nimmt die Komplexität und Emotionalität der Erinnerung ab, damit auch die Gegenwartsrelevanz und die Neigung, diese Erinnerungen im kollektiven Wissensvorrat abzulegen:
5 | Im Sinne von Alfred Schütz als menschliche Körperlichkeit (vgl. Schütz/Luckmann 2004).
Geschichtsvermittlung und historische Gerechtigkeit »Die Sedimentation von Wissensinhalten im Gedächtnis und die Erinnerung an sie erfolgt [sic!] in der Regel nicht nur unter den Bedingungen, die uns unser Körper und seine Situierung im Raum auferlegt [sic!]; sondern die räumliche Distanz und Perspektive definiert [sic!] auch die Beziehungen zu anderen Individuen, mit denen zusammen wir gemeinsame zu sedimentierende Erlebnisse haben oder denen gegenüber wir Erinnerungen reproduzieren.« (Berek 2009: 81)
Der zahlenmäßig verstärkte Zuzug von Geflüchteten seit 2015 stellt eine leibliche Nähe her, die verflochtene Geschichten aktualisiert und Wissensinhalte neu erinnern lässt. Eine zuvor vorwiegend mediale Präsenz von physisch sehr weit entfernten »Flüchtlingen« in den Zeltstädten des Libanon, der Türkei oder des Kongo6 erlaubte es dagegen, Sichten auf Kolonialgeschichte, De- und Rekolonialisierung in den Bereich des gegenwärtig nicht Anschließbaren, nicht Relevanten zu drängen und diese Themen unerforscht, nicht ausgestellt und unerzählt zu lassen. Ob wir diese globalhistorischen Verbindungen wahrnehmen, hängt also von unserem Standort ab, davon, wen wir als zugehörig definieren und wessen Fragen an die Geschichte wir zulassen. Dabei werden Museen, Denkmäler und andere Orte der Materialisierung zu Kontaktzonen mit der Vergangenheit. Individuelle und kollektive Gedächtnisse benötigen materielle Manifestationen in Dingen. Menschen strukturieren Räume durch historische Objekte, »auf die sie immer wieder stoßen und die je nach Situation Anlass zum Erinnern geben.« (Berek 2009 unter Verweis auf Assmann 2006: 84f.)
Wessen Wissen? Postkolonial informierte Multiperspektivität im Geschichtsmuseum Die blinden Seiten der Geschichtserzählung im Museum entstehen nicht durch Nichtwissen oder durch die Nichtverfügbarkeit von Objekten für die Narrationen, sondern hängen mit den Mechanismen der Generierung von Wissen im Rahmen der Wissensregime zusammen bzw. mit der »Geopolitik der Wissensproduktion« (vgl. Mezzadra 2013: 379). Die interdisziplinäre Künstlerin und Theoretikerin Grada Kilomba beschreibt in ihrem Buch »Plantation Memories« ein mündliches Kurzexamen, dem sich Studierende zu Beginn ihres Seminars in Berlin unterziehen mussten. Dabei stellte sie aus ihrer Sicht sehr einfache Fragen an die jungen Leute aus nichthistorischen Fächern: »What was the Berlin Conference of 1884-5? Which African countries were colonized by Germany? How many years did German colonialization in the continent of Africa last?« Kilombas zweite Quizrunde verlief spezifischer und umfasste einen weiteren chronologischen Rahmen, wie die Frage nach 6 | Diese drei Länder sind Hauptaufnahmeländer jeweils gemessen am Anteil der Bevölkerung, in absoluten Zahlen und im Hinblick auf die Wirtschaftsleistung des Landes, vgl. UNHCR 2015.
229
230
Caroline Gritschke
der Rolle von Königin Nzinga im Kampf gegen die europäische Kolonisation. Im Seminarraum blieben die weißen Studierenden stumm, während die Schwarzen Studierenden7 fast alle Fragen fehlerfrei beantworten konnten (vgl. Kilomba 2013: 25). Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit von Personen und Wissen hatten sich durch die Fragen und die Bezugnahme auf unterschiedliche Wissensbestände verschoben, so Kilombas Analyse. In Geschichtsschreibung und Geschichtsdidaktik steht »Europa« auch sechzehn Jahre nach dem Erscheinen der Aufsatzsammlung »Provincializing Europe« von Dipesh Chakrabarty im Mittelpunkt und ist das »souveräne, theoretische Subjekt aller Geschichten«, wie der Historiker damals kritisierte. Was als historisches Wissen generiert und sichtbar wird, nimmt das nationalstaatliche Europa stillschweigend zum Maßstab. Während sich Historiker_innen aus ehemaligen kolonialisierten Ländern verpflichtet fühlten, europäische Geschichtsschreibung zu berücksichtigen, erwiderten Fachkolleg_innen aus Europa dieses Interesse in keiner Weise (vgl. Chakrabarty 2010: 41). Postkoloniale Kritik setzt hier an und nimmt stattdessen die verbundene Geschichte in den Blick, die vielfältigen Perspektiven und Standorte einer Verflechtungsgeschichte von kolonialisierenden und kolonialisierten Gesellschaften. Diese postkolonial informierte transnationale Sichtweise ermöglicht die Analyse von personalen Netzwerken, politischen Mechanismen von Aneignung, Exklusion, Kollaborationen und Widerstandsstrategien, von ökonomischen und institutionellen Verbindungen (vgl. ausführlich Randeria/Römhild 2013; Castro Varela/ Dhawan 2015: bes. 15-39). Dabei zeigt sich auch die große Differenziertheit kolonialer Handlungsstrategien, die komplexe koloniale Gesellschaften hervorbrachten. »Keine Kolonie bestand einfach aus einem unverbundenen und statischen Nebeneinander von kolonialisierender und kolonialisierter Gesellschaft.« (Osterhammel/Jansen 2012: 88) In dieser historischen Horizonterweiterung hat selbstverständlich auch die deutsche Kolonialgeschichte ihren Platz, die lange Zeit als kurzzeitige Randnotiz abgetan wurde und in der national- und regionalhistorisch orientierten Forschung kaum eine Rolle spielte. Neuere Überblickswerke zur deutschen Kolonialgeschichte ordnen diese in globalhistorische, transnationale Zusammenhänge des Imperialismus ein und untersuchen die Folgen der Kolonialisierung, die Prozesse der Dekolonialisierung und der verwobenen Erinnerungskulturen bis zur Gegenwart (vgl. vor allem Conrad/Osterhammel 2004; Conrad 2008). Auch die Zahl der Einzelstudien hat in den letzten Jahren zugenommen; dabei widmen sich neuere Arbeiten auch erinnerungskulturellen Vergleichen und beziehen dabei multiperspektivisch nicht nur westlich generierte Quellen mit ein (vgl. Förster 2010; Zimmerer 2013). Zwar bestehen weiterhin Lücken in der wissenschaftlichen Erforschung der komplexen Kolonialgeschichte, noch schlechter ist es aber um die Sichtbarma7 | Die Schreibweisen von ›weiß‹ und ›Schwarz‹ verweisen auf Konstruktion und Selbstbezeichnung in den beiden Begriffen (vgl. Eggers u.a. 2005: 13).
Geschichtsvermittlung und historische Gerechtigkeit
chung und Vermittlung der postkolonialen und transnationalen historischen Perspektiven bestellt. Eine postkoloniale Geschichtsdidaktik ist im deutschen Sprachraum bislang nur selten zu finden.8 Auch im »Public history«-Bereich sucht man postkolonial informierte Geschichtserzählungen in der Regel vergeblich. Kapitel der deutschen Kolonialgeschichte finden bislang noch kaum Eingang in die Narrationen der nationalen und regionalen Geschichtsmuseen bzw. sind dort bestenfalls ein exotisches Seitenkapitel. Mit wenigen Objekten wird dann in der Regel ausschließlich die Blickrichtung der kolonialisierenden Gesellschaft eingenommen. Perspektiven von People of Color sucht man allenthalben vergebens; Dinge, die nicht durch Kolonialisierung auf uns gekommen sind, sondern die z.B. von Widerstandsstrategien der Kolonialisierten zeugen, finden keinen Platz unter den Vitrinenhauben. Prozesse der Dekolonialisierung und der Erinnerung an Kolonialisierung stellen ebenfalls ein Desiderat der Erzählungen der Geschichtsmuseen dar. Interessante aktuelle Perspektiven könnten sich durch den überwiegend politisch verordneten Aufschwung in der Provenienzforschung in den Sammlungen der ethnologischen und (kultur-)historischen Museen ergeben. Neben der Recherche nach unrechtmäßig angeeigneten Gegenständen aus jüdischem Besitz geht man in letzter Zeit verstärkt Fragen nach dem Umgang bzw. der Restitution geraubter Dinge aus den kolonialisierten Gesellschaften nach (vgl. Zimmerer 2015). Museumsobjekte und ihre Herkunftsgeschichten sollten in einen vielstimmigeren Dialog miteinander gebracht werden. Die »verflochtenen Modernen« (Randeria) wären dann durch die Exponatsauswahl und das Transparentmachen der Konfliktfelder um ihren rechtmäßigen Besitz in Ausstellung und Vermittlung für Museumsbesucher_innen mit und ohne Flucht- und Migrationserfahrung erfahrbar. Postkoloniale »entangled histories« erweisen sich somit als relevant für das Verständnis von Fluchtursachen, für gegenwärtige Handlungsmöglichkeiten und Verpflichtungen. Postkolonial informierte Globalgeschichte im Museum stellt den Anspruch der Geflüchteten, bei uns nicht nur Schutz zu erhalten, sondern auch partizipieren zu können, in einen historischen Zusammenhang zur Kolonialisierung, die bis heute wirkmächtig ist.
8 | Der 15. Band der Zeitschrift für Geschichtsdidaktik ist mit dem Themenschwerpunkt »Geschichtsdidaktik postkolonial« angekündigt und soll unter der Federführung von BerndStefan Grewe im Jahr 2016 erscheinen (vgl. Grewe 2015).
231
232
Caroline Gritschke
Transnationale Grenzregimes und die Geschichte der Asylpolitik Das Erbe des Kolonialprojekts zeigt sich nach Sandro Mezzadras Analyse in einem europäischen Grenzregime, das nicht nur die Außengrenzen umreißt, sondern durch die ungleiche Zumessung von Rechten einen heterogenen europäischen Raum schafft. Auf diese Weise entstehen »unterschiedliche Grade eines ›Innerhalb‹ und eines ›Außerhalb‹« (Mezzadra 2009: 208). Die Rechtsungleichheit sortiert Partizipationsmöglichkeiten nach kolonialen Mustern: auf der einen Seite die »Bürger« als voll gleichberechtigte Mitglieder, auf der anderen Seite die »Untertanen«, kulturell minderwertig, abhängig und ohne Zugang zu gesellschaftlichen Ressourcen (vgl. Mezzadra 2009). Diese »postkoloniale Genealogie« (Randeria/Römhild 2013: 25) schreibt sich auf unterschiedliche Weise in die Staaten Europas ein und ist verwoben mit – im doppelten Wortsinn – geteilten historischen Rahmungen. Die Erforschung dieser Zusammenhänge ist bislang weitgehend Desiderat, wie überhaupt die Untersuchung der Geschichte von Asylrecht und -politik in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg bislang Lücken aufweist. Die Verortung des Asylrechts im historischen Kontext geschieht dabei selten innerhalb einer Geschichte von Inklusion und Exklusion, sondern vielmehr unter dem Aspekt der Geschichte der Schutzgewährung nach den Erfahrungen der beiden Weltkriege. Dabei spielen nationalhistorische Narrative eine Hauptrolle, insbesondere werden die Schicksale von schutzsuchenden Deutschen während des Nationalsozialismus als Motiv für die Entwicklung des deutschen Flüchtlingsschutzes im Grundgesetz betont (vgl. Oltmer 2016, 2002; Bade 1993: 61f.). Dabei stellt Stefan Keßler fest, dass die Aufnahme des Grundrechts auf Asyl keineswegs, wie in öffentlichen erinnerungskulturellen Diskursen häufig behauptet, Folge persönlicher Erlebnisse der Mitglieder des Parlamentarischen Rat gewesen ist, sondern dass sich das Asylgrundrecht zunächst in einzelnen Ländern (Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz) finden lässt. Insbesondere der Grundsatz der Nichtauslieferung und Nichtausweisung von verfolgten Ausländer_innen speiste sich aus diesen Bestimmungen der Landesverfassungen und galt als unstrittiges klassisches Grundrecht, das erst in der späteren Rezeption zu einem neu- und einzigartigen Rechtsgrundsatz wurde (vgl. Keßler 2006). Dabei ist der Geltungsbereich des Asylrechts sowohl in der aktuell für die Schutzgewährung in Deutschland relevanteren Genfer Flüchtlingskonvention als auch in den Bestimmungen des Grundgesetzes lediglich auf eine kleine Gruppe von Geflüchteten bezogen, nämlich auf die individuell politisch Verfolgten. In der rechts- und politikhistorischen Geschichte des Asylrechts zeigen sich die Verbindungen zum Migrationsregime. Bleibe- und Partizipationsrechte wurden lange Zeit mit abstammungsrechtlichen Zugehörigkeitsbestimmungen verbunden. Die Herkunft der Schutzsuchenden wurde dabei zunehmend zum entscheidenden Faktor in den politischen Debatten um Begrenzung und Ausschluss der Fliehenden zu Beginn der 1990er Jahre (vgl. Münch 2014; Herbert 2001).
Geschichtsvermittlung und historische Gerechtigkeit
Das Kriterium der Herkunft zum Maßstab der Beurteilung der Schutzbedürftigkeit zu machen, anstelle die Fluchtursachen zu berücksichtigen, war bereits in der NS-Zeit nach dem Austritt des Deutschen Reichs aus dem Völkerbund für die deutsche Flüchtlingspolitik handlungsleitend gewesen (vgl. Grenz/Lehmann/ Keßler 2015: 31f.). Von diesen historischen Zusammenhängen erfahren Museumsbesucher_innen in der Regel nicht viel. Zwar sind mit der Musealisierung der Migration auch Flucht und Exil in den Blick gekommen, allerdings endet die Darstellung zumeist mit der Flucht und Vertreibung der Deutschen aus Ost- und Südosteuropa. Die Geschichten der ungeliebten schutzsuchenden Bürgerkriegsflüchtlinge aus dem ehemaligen Jugoslawien, den Vertriebenen aus den kurdischen Gebieten der Türkei oder des Irak oder aus der äthiopischen Diktatur seit den 1970er Jahren sucht man dagegen in den historischen Dauerausstellungen zumeist vergebens. Den Kämpfen der Geflüchteten um Bleiberecht und Partizipation, gegen Residenzpflicht, Arbeitsverbot und Kettenduldungen9 blieb eine museale Repräsentation bisher versagt; sie waren auch nicht Gegenstand von Sammlungsaktivitäten der Archive und Museen. Damit sind Geflüchtete gleichsam doppelt Exkludierte. Der Ausschluss aus dem Archiv als Herrschaftsort ist ein machtvoller Akt nach Jacques Derrida: »Keine politische Macht ohne Kontrolle des Archivs […]. Die wirkliche Demokratisierung bemißt sich stets an diesem essentiellen Kriterium: an der Partizipation am und dem Zugang zum Archiv, zu seiner Konstitution und Interpretation.« (Zitiert nach Erll 2011: 49f.) Archive und Museen sammeln, vergessen und zerstören; durch ihre Aktivitäten bringen sie Derrida zufolge die Ereignisse in gleichem Maße hervor, wie sie sie aufzeichnen. Museen wären demnach an der von Mezzadra beschriebenen Grenzziehung, an der Zumessung und Verweigerung von (Partizipations-)Rechten beteiligt. Die Anwesenheit der Geflüchteten aktualisiert die Notwendigkeit, sich dieser eigenen Beteiligung an Prozessen von Ein- und Ausschluss bewusst zu werden.
Geflüchtete im Museum – Aufgaben der Geschichtsvermittlung Geflüchtete kommen zumeist eingeladen ins historische Museum. Mitarbeiter_ innen der Abteilung Bildung und Vermittlung entwickeln spezielle, zielgruppengerechte Workshops und Führungen, die fast immer mit dem Sprachenlernen verbunden werden. Menschen mit Fluchterfahrung sind vor allem Kursteilnehmende, weniger vollwertige Besucher_innen. Wenn die Geschichtsvermittlung Geflüchtete ihres zugewiesenen defizitären Sonderstatus zeitweilig entheben würde, könnte Kulturelle Bildung im Museum 9 | Die Duldung ist kein Aufenthaltstitel, sondern lediglich die Aussetzung der Abschiebung mit extrem eingeschränkten Rechten und der ständigen Gefahr der Nichtverlängerung des Status; bis 2009 hielten Kettenduldungen die Inhaber_innen auf unbestimmte Zeit in diesem Zustand (vgl. Riecken 2006).
233
234
Caroline Gritschke
sich auf ihre Kernaufgaben im Museum besinnen und Moderatorin eines Dialogs zwischen neuangekommenen und länger anwesenden Besucher_innen im Forum Museum werden. Voraussetzung für einen Prozess gemeinsamer und gegenseitiger Bildung von Menschen mit und ohne Fluchterfahrung, für die Möglichkeit in der Interpretation der Vergangenheit eine gemeinsame Zukunft zu diskutieren (vgl. zu diesen Anforderungen an die Museumspädagogik Parmentier 2008), sind Ausstellungen, die dafür Anknüpfungspunkte bieten. Wenn regionale und nationale historische Museen Kolonialgeschichte als Verflechtungsgeschichte mit mehr als einer Perspektive postkolonial informiert zeigen, transnationale Geschichte lokalhistorisch ausbuchstabieren und mit der Geschichte von Flucht, Asyl und den Kämpfen um Teilhabe in Beziehung setzen, ist die Bühne für gemeinsames Lernen und Aushandeln geschaffen, ohne vorhandene Ungleichheiten zu verdecken. Museen als Speicher und Orte der Herrschaft über den Zugang zum kollektiven Gedächtnis könnten somit zur »Provinzialisierung« der Geschichtswissenschaft und Geschichtsvermittlung und im Sichtbarmachen verschwiegener Geschichten zu historischer Gerechtigkeit beitragen.10
L iter atur Assmann, Aleida (2003): Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses, München: Beck. Assmann, Aleida (2006): Der lange Schatten der Vergangenheit. Erinnerungskultur und Geschichtspolitik, München: Beck. Assmann, Jan (1988): »Kollektives Gedächtnis und kulturelle Identität«, in: ders./ Tonio Hölscher (Hg.), Kultur und Gedächtnis, Frankfurt a.M.: Suhrkamp. Assmann, Jan (2005): Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen, 5. Aufl., München: Beck. Bade, Klaus J. (1992): »Ausländer- und Asylpolitik in der Bundesrepublik Deutschland: Grundprobleme und Entwicklungslinien«, http://library.fes.de/fulltext/ asfo/01011002.htm (letzter Zugriff: 01.07.2016). Berek, Mathias (2009): Kollektives Gedächtnis und die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Eine Theorie der Erinnerungskulturen, Wiesbaden: Harrassowitz. Chakrabarty, Dipesh (2010): Europa als Provinz. Perspektiven postkolonialer Geschichtsschreibung, Frankfurt/New York: Campus. 10 | Die Forderung, über Gedächtnisarbeit historische Gerechtigkeit herzustellen, erhebt Felipe Polanía in diesem Band. Der Begriff »historische Gerechtigkeit« kommt ansonsten oftmals im Zusammenhang mit Wahrheitsfindungskommissionen und anderen Instrumenten von »Transitional Justice« vor (vgl. aus philosophischer Sicht z.B. Meyer 2005).
Geschichtsvermittlung und historische Gerechtigkeit
Castro Varela, María do Mar/Dhawan, Nikita (2015): Postkoloniale Theorie. Eine kritische Einführung. 2. überarbeitete und ergänzte Ausgabe, Bielefeld: transcript. Conrad, Sebastian (2008): Deutsche Kolonialgeschichte, München: Beck. Conrad, Sebastian/Osterhammel, Jürgen (Hg.) (2004): Das Kaiserreich transnational. Deutschland in der Welt 1871-1914, 2. Aufl., Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. Conrad, Sebastian/Randeria, Shalini/Römhild, Regina (Hg.) (2013): Jenseits des Eurozentrismus. Postkoloniale Perspektiven in den Geschichts- und Kulturwissenschaften, 2. erw. Aufl., Frankfurt/New York: Campus. Eggers, Maureen Maisha/Kilomba, Grada/Piesche, Peggy/Arndt, Susan (Hg.) (2005): Mythen, Masken und Subjekte. Kritische Weißseinsforschung in Deutschland, Münster: Unrast. Erll, Astrid (2001): Kollektives Gedächtnis und Erinnerungskulturen, 2. Aufl., Stuttgart/Weimar: J.B. Metzler. Förster, Larissa (2010): Postkoloniale Erinnerungslandschaften. Wie Deutsche und Herero in Namibia des Kriegs von 1904 gedenken, Frankfurt a.M.: Campus. Grenz, Wolfgang/Lehmann, Julian/Keßler, Stefan (2015): Schiff bruch. Das Versagen der europäischen Flüchtlingspolitik, München: Knaur. Grewe, Bernd-Stefan (2015): »Call for Papers: Zeitschrift für Geschichtsdidaktik Jg. 15, 2016«, https://www.historicum.net/fileadmin/sxw/Didaktik/05_Zeit schrift/CfP_ZfGD_2016.pdf (letzter Zugriff: 01.07.2016). Gugutzer, Robert (2002): Leib, Körper, Identität. Eine phänomenologisch-soziologische Untersuchung zur personalen Identität, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. Herbert, Ulrich (2001): Geschichte der Ausländerpolitik in Deutschland. Saisonarbeiter, Zwangsarbeiter, Gastarbeiter, Flüchtlinge, München: C.H. Beck. Keßler, Stefan (2006): »Ausländerpolitik in Deutschland 1945-2000«, in: Clemens Burrichter/Detlef Nakath/Gerd-Rüdiger Stephan (Hg.), Deutsche Zeitgeschichte von 1945-2000. Gesellschaft, Staat, Politik. Ein Handbuch, Berlin: Dietz, S. 1234-1252. Kilomba, Grada (2013): Plantation Memories, 3. Aufl., Münster: Unrast. Meyer, Lukas H. (2005): Historische Gerechtigkeit, Berlin/New York: de Gruyter. Mezzadra, Sandro (2009): »Bürger und Untertanen. Die postkoloniale Herausforderung der Migration in Europa«, in: Jana Binder/Sabine Hess/Johannes Moser (Hg.), No Integration?! Kulturwissenschaftliche Beiträge zur Migrationsdebatte in Europa, Bielefeld: transcript, S. 207-224. Mezzadra, Sandro (2013): »Kämpfe für Gerechtigkeit an den Grenzen: Die Suche nach einem neuen politischen Subjekt im globalen Zeitalter«, in: Conrad/ Randeria/Römhild, Jenseits des Eurozentrismus, S. 379-401.
235
236
Caroline Gritschke
Münch, Ursula (2014): »Asylpolitik in Deutschland – Akteure, Interessen, Strategien«, in: Stefan Luff/Peter Schimany (Hg.), 20 Jahre Asylkompromiss. Bilanz und Perspektiven, Bielefeld: transcript, S. 69-86. Oforiatta-Ayim, Nana (2011): »Speak now«, in: Frieze, www.frieze.com/article/ speak-now/ (letzter Zugriff 24.06.2016). Oltmer, Jochen (2002): »Flucht, Vertreibung und Asyl im 19. und 20. Jahrhundert«, in: Klaus J. Bade (Hg.), Migration in der europäischen Geschichte seit dem späten Mittelalter. Vorträge auf dem Deutschen Historikertag in Halle a.d. Saale, 11. September 2002, Osnabrück: IMIS, S. 107-134. Oltmer, Jochen (2016): Wie ist das Asylrecht entstanden? Bundeszentrale für politische Bildung, Kurzdossier, www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers /224641/wie-ist-das-asylrecht-entstanden? (letzter Zugriff: 29.06.2016). Osterhammel, Jürgen/Jansen, Jan. C. (2012): Kolonialismus. Geschichte, Formen, Folgen, 7. Aufl., München: C.H. Beck. Parmentier, Michael (2008): »Agora. Die Zukunft des Museums«, in: Standbein – Spielbein (81), S. 34-40. Parmentier, Michael (2012): »Mit Dingen erzählen. Möglichkeiten und Grenzen der Narration im Museum«, in: Tobias G. Natter/Michael Fehr/Bettina Habsburg-Lothringen (Hg.), Die Praxis der Ausstellung. Über museale Konzepte auf Zeit und Dauer, Bielefeld: transcript, S. 147-164. Pearce, Susan M. (1994): »Objects as meaning; or narrating the past«, in: dies. (Hg.), Interpreting Objects and Collections, London/New York: Routledge, S. 19-29. Randeria, Shalini/Römhild, Regina (2013): »Das postkoloniale Europa: Verflochtene Genealogien der Gegenwart – Einleitung zur erweiterten Neuauflage«, in: Conrad/Randeria/Römhild, Jenseits des Eurozentrismus, S. 9-31. Riecken, Philipp A. (2006): Die Duldung als Verfassungsproblem. Unrechtmäßiger, nicht sanktionierter Aufenthalt von Ausländern in der Bundesrepublik Deutschland, Berlin: Duncker & Humblot. Schütz, Alfred/Luckmann, Thomas (2004): Strukturen der Lebenswelt, Konstanz: UTB. UNHCR (2015): Global Trends. Forced Displacement in 2015, www.unhcr.de/filead min/user_upload/dokumente/06_service/zahlen_und_statistik/global_ trends_2015.pdf (letzter Zugriff: 01.07.2016). Zimmerer, Jürgen (2015): »Kulturgut aus der Kolonialzeit? – ein schwieriges Erbe«, in: Deutscher Museumsbund (Hg.), Museumskunde, Bd. 80, 2/2015, Berlin, S. 22-25. Zimmerer, Jürgen (Hg.) (2013): Kein Platz an der Sonne. Erinnerungsorte der deutschen Kolonialgeschichte, Frankfurt/New York: Campus.
Kulturprojekte für und mit, aber selten von … Eine Spurensuche nach Motivationen und Haltungen nicht-geflüchteter Kulturschaffender im Theater Marlene Helling und Nina Stoffers Zusammenfassung Der Artikel ist als Text eines Kollektivs zu verstehen, auch wenn er in zwei klar abgegrenzte Teile untergliedert ist. Diese ergänzen sich durch ihre unterschiedliche Schwerpunktsetzung, die sich beide auf den Bereich Theater beziehen: Nina Stoffers setzt sich zunächst überblicksartig damit auseinander, welche Motivationen und Haltungen Kulturschaffende durch künstlerische Projekte zum Ausdruck bringen, für wen solche Projekte eigentlich sind, und analysiert dafür verschiedene schriftliche Materialien. Marlene Helling geht im Anschluss auf zwei Inszenierungen von Elfriede Jelineks aktuell häufig aufgeführtem Stück »Die Schutzbefohlenen« ein und untersucht, welches »Wir« nicht nur von der Autorin konstruiert, sondern vor allem von den Regisseur_innen verhandelt und präsentiert wird – als Ausdruck unterschiedlicher Haltungen.
Abstract: Cultural Projects for and with, but rarely by … – An Investigation of Motivations and Stances of Non-Refugee Theater Practitioners This paper is to be viewed as an article written by a collective, even though it is divided into two distinct parts. The sections compliment each other through their diverse emphases, however both belong to the domain of theatre. Through the analysis of various forms of written material, Nina Stoffers provides an overview of the motivations and stances that cultural workers convey through creative projects, and outlines who the projects are actually aimed at. Marlene Helling follows on with an analysis of two productions of Elfriede Jelinek’s currently oft-performed play, Die Schutzbefohlenen (lit. The Protected) and investigates the ›we‹ that is not just being constructed by the author, but above all being negotiated and presented by the directors – as an expression of diverse stances.
238
Marlene Helling und Nina Stoffers
Einleitung Wir haben uns entschieden, zwei Auseinandersetzungen in einem Artikel zu bearbeiten und diese, anstatt sie miteinander zu verflechten, in sich geschlossen zu halten, um eine je innere Stringenz und eine ganz persönliche Verortung zu ermöglichen. Gleichzeitig ist der Artikel aber ein gemeinsamer, weil wir uns beide aus einer wissenschaftlichen Perspektive mit der Frage nach den Gründen für Kulturprojekte für und mit Geflüchteten nähern und unsere Analyse und Interpretation nicht aus einer Position des persönlichen Involviertseins z.B. als Beteiligte und Akteurinnen eines Theaterstückes heraus geschieht, sondern aus einer Position der Beobachtung. Die in dem Artikel behandelte Thematik der Motivation nichtgeflüchteter Kulturschaffender, die Projekte oder Stücke – in unserem Fokus: an Theatern – mit Geflüchteten initiieren, betreuen und umsetzen, und ihr Umgang mit der »Zielgruppe« Geflüchtete gewinnen vor dem Hintergrund unserer eigenen Hintergründe »ohne Fluchterfahrung« an Brisanz: Welche Legitimationen, so fragen wir uns, werden ins Spiel gebracht, wenn (vermeintlich) partizipative Projekte und Angebote für diese Zielgruppe als wichtig, richtig und gut postuliert werden? Und welche Legitimation geben wir uns selber, wenn wir uns als »weiße«, nicht-geflüchtete Zuschauerinnen und wissenschaftlich Forschende verorten?
Wie wird gesprochen? Über Motivationen und Haltungen Nina Stoffers 1 Allerorten finden momentan kulturelle Projekte für, mit und manchmal auch von Menschen statt, die in den vergangenen Monaten und Jahren nach Deutschland 1 | Der Artikel baut auf dem Seminar »Zwischen Kunst und Politik. Kulturprojekte mit Flüchtlingen« auf, das ich mit meinem Kollegen Hannes Schammann, Juniorprofessur für Migrationspolitik am Institut für Sozialwissenschaften, konzipierte und an der Universität Hildesheim im Wintersemester 2015/16 durchführte. Gemeinsam mit Studierenden der Kultur- und Sozialwissenschaften haben wir uns auf die Suche nach Projekten begeben, die an der Schnittstelle von Politik und Kultur arbeiten und Menschen mit Fluchterfahrungen zum Ausgangs- und Mittelpunkt ihrer Arbeit machen. Die Studierenden recherchierten in Kleingruppen bundesweit nach Projekten aus unterschiedlichen Kunstsparten und nach Kriterien wie Inhalt und Form, Intentionen und Zielgruppen, Akteur_innen, Kooperationspartner_innen, Wirkungen und Rahmenbedingungen. Die Ergebnisse der Untersuchung wurden in einer eintägigen Ausstellung aufbereitet auf dem Kulturcampus der Universität Hildesheim gezeigt. Die Kleingruppen stellten ihre Ergebnisse als eigene künstlerische Installationen vor und gaben damit einen Einblick in die Vielfalt der Projekte, teils zusammen mit Künstler_innen, z.B. vom Refugee Club Impulse (Berlin), der Band SP Music (Hannover), dem Fotografieprojekt We Refugees (Berlin) sowie des Films Beeman (Hamburg). Es entsteht derzeit eine Online-Dokumentation über Seminar und Ausstellung, die gerne bei mir angefordert werden kann.
Kulturprojekte für und mit, aber selten von …
geflüchtet sind. Man bekommt derzeit den Eindruck, als ob Kunst und Kultur eine ideale Spielwiese der Integration für Geflüchteten seien, weil sie teils wie Wundermittel der Flüchtlingspolitik gehandelt werden. Tagungen widmen sich explizit diesem Thema,2 ein eigenes online-Dossier als Netzwerkknoten wird von der Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung (BKJ e.V.) eröffnet,3 die Kulturstaatsministerin Monika Grütters lobt Mitte Dezember 2015 erstmals einen Sonderpreis für Projekte dieser Art aus, 4 vielfach werden Stellungnahmen gegeben (z.B. vom Deutschen Kulturrat5) oder in Form von Spruchbändern an Theatern öffentlich platziert,6 und neue Projekte und Angebote schießen wie Pilze aus dem Boden. Schaut man sich aus einer Metaperspektive zunächst nicht einzelne Projekte an, sondern versucht, sich einen eher allgemeinen Überblick zu verschaffen, was es an Projekten mittlerweile alles gibt, so lässt sich das vorhandene Angebot (neben vielen weiteren Möglichkeiten der Kategorienbildung, wie z.B. der Unterteilung in Projekte, die es schon länger als seit dem Jahr 2015 gibt, und solchen, die sich neu gegründet haben) relativ grob einteilen in Projekte, die von Geflüchteten7 selbst ins Leben gerufen und organisiert werden, und solchen, die von Menschen ohne Flucht- und Asylerfahrungen initiiert werden, z.B. an etablierten Kulturinstitutionen. Diese Unterteilung scheint wichtig, weil die Frage danach, wer den Rahmen steckt und Entscheidungen treffen kann, eine elementare ist, wenn es um eine sogenannte Zielgruppe geht, die in asymmetrischen Machtverhältnissen qua definitionem gefangen ist, wie es bei Flüchtlingen durch die 2 | Z.B. die Tagung sowie das Festival »Interventionen. Refugees in Arts & Education«, die 2016 bereits zum zweiten Mal organisiert werden, vgl. http://interventionen-berlin.de/ interventionen/ (letzter Zugriff: 31.03.2016). 3 | Vgl. https://www.bkj.de/kulturelle-bildung-dossiers/fluechtlinge-und-kulturelle-bil dung.html (letzter Zugriff: 31.03.2016). 4 | Vgl. https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Pressemitteilungen/BPA/2015/12/ 2015-12-16-bkm-sonderpreis.html (letzter Zugriff: 31.03.2016) sowie www.kultur-oeffnet-welten.de/positionen/position_2816.html (letzter Zugriff: 28.05.2016). 5 | Vgl. www.kulturrat.de/detail.php?detail=3416&rubrik=4 (letzter Zugriff: 19.05.2016). 6 | An den Außenwänden vieler Theater finden sich Spruchbänder wie etwa »Refugees are welcome here!« (Festspielhaus Hellerau Dresden), der Spruch »Alle Menschen sind Ausländer, fast überall« (Schauspiel Hannover), das Goethe-Zitat »Das Land, das die Fremden nicht beschützt, geht bald unter« (Schauspiel Leipzig) oder das ironisch-bissige »REGIDA! Residenztheater gegen Idiotisierung des Abendlandes« (Residenztheater München). 7 | Ich habe mich entschieden, die Begriffe »Flüchtling«, »Geflüchtete« etc. in diesem Artikel bewusst inkonsequent zu verwenden, um damit die Schwierigkeiten von einmal als adäquat empfundenen Begriffen aufzuzeigen und die kritische Begleitung und Suche zu verdeutlichen. Ein Aufbrechen von Zuschreibungen ist m.E. so einfacher möglich, als wenn man sich für einen bestimmten Begriff entscheidet, der dann möglicherweise nicht mehr kritisch hinterfragt und somit zu einem starren Konstrukt wird.
239
240
Marlene Helling und Nina Stoffers
alltagsbestimmende Asylgesetzgebung der Fall ist. Im Folgenden soll es also um Projekte gehen, in denen Nicht-Geflüchtete (Künstler_innen, Pädagog_innen) Angebote bereitstellen oder gefragt werden, dies für Geflüchtete zu tun, sodass auf diese als Zielgruppe fokussiert wird. Durch diese Themensetzung befrage und beschäftige ich mich folglich nicht mit den Erwartungen, Bedürfnissen, Fragen oder der Kritik von an solchen Angeboten teilnehmenden Geflüchteten oder aber den Motivationen und Haltungen von Akteur_innen mit Fluchterfahrungen, die künstlerische Projekte initiieren und durchführen, sondern dezidiert mit zumeist »weißen« Kulturschaffenden ohne Flucht- und Asylerfahrungen. Ich fokussiere die Untersuchung dabei auf Projekte und Angebote Kultureller Bildung aus dem Bereich Theater, verwende – als eine erste Stichprobe – schriftlich verfügbare Artikel und Interviews aus Zeitschriften sowie in den letzten Jahren erschienene Publikationen und verwende für meine Analyse die Parameter, die von Carmen Mörsch als Legitimationen bezeichneten Strategien, mit denen untersucht werden kann: »Warum (keine) Kulturvermittlung?« (ZHdK 2012). Als These stelle ich zunächst provozierend in den Raum, dass Projekte Kultureller Bildung, wenn sie von nicht-geflüchteten Kulturschaffenden für und mit, aber nicht von Geflüchteten initiiert werden, in erster Linie zur Selbstbeschäftigung und Beruhigung des eigenen Gewissen stattfinden und nur in zweiter Linie für Flüchtlinge selbst.
Das Wording … Vergegenwärtigt man sich die Gründe und Begrifflichkeiten, das Wording, mit denen Projekte Kultureller Bildung für Geflüchtete als sinnvoll und gut bezeichnet werden, so finden sich häufig ähnliche Argumentationen. Dabei ist festzustellen, dass als Gründe meist solche benannt werden, die als Ziele für die teilnehmenden Flüchtlinge anvisiert werden. In einem weiteren Schritt lassen sich die darunter liegenden Motivationen oder besser: Haltungen, herauslesen. Als Gründe werden genannt: • Rhythmus & Struktur: Die Projekte sind eine willkommene Ablenkung und Zeitvertreib während des durch das Asylsystem erzwungenen Wartens und der dadurch entstehenden Langeweile; sie »bringen Rhythmus und Bewegung in den Tag« (z.B. Schneider 2015: 34). • Soziales Netz & Freundschaften: Mithilfe von Projekten, die in Kulturinstitutionen stattfinden, kann die Isolation von Asylunterkünften durchbrochen werden, weil Begegnungen ermöglicht werden zwischen Geflüchteten, »die in einer ähnlichen Lebenssituation stecken« (z.B. Küpper 2004: 68) sowie zwischen Geflüchteten und Nicht-Geflüchteten (vgl. z.B. Tscholl/Köhler 2015: 12). Häufig findet sich in diesem Kontext auch das Zauberwort Integration. • Schutzraum & Kontinuität: Projekte, die sich künstlerischer und performativer Mittel bedienen, heben sich von anderen Tätigkeiten ab und laden zum Aus-
Kulturprojekte für und mit, aber selten von …
probieren und Experimentieren ein. Die Künste bieten dadurch eine einzigartige Kontingenzerfahrung, denn im Kern der Kunst liegt die Möglichkeit, sich auf der Bühne neu zu schaffen, durchaus in Distanz zu sich selbst. Durch die gleichzeitige Selbstreflexion können »neue und veränderte Wahrnehmungen von sich und Welt« (Küpper 2004: 69) ermöglicht werden. Ebenfalls können Projekte – so sie denn auf Langfristigkeit angelegt sind – eine Kontinuität bieten »im Gegensatz zum häufigen Wechsel der Bezugspersonen [insbesondere für minderjährige, unbegleitete geflüchtete Kinder und Jugendliche]« (Reinicke 2015: 41). • Individualität & Selbstwirksamkeit: Ein besonders wichtiges Argument, quasi als Fortführung der zuvor genannten Gründe, zielt darauf ab, dass künstlerische Tätigkeiten immer das einzelne Individuum fordern und dadurch Zuschreibungen wie »Flüchtling« gerade mithilfe von Kunst überwunden werden können (vgl. Küpper 2004: 71f.) und der »Opferdiskurs« durchbrochen werden kann (vgl. Strohm/Feger 2015: 16). Zudem kann über (Bühnen-) Erfolgserlebnisse die Selbstwirksamkeit erfahrbar werden, so die Argumentation, d.h. sich in seinen »Stärken und Talenten« (vgl. Bochnig 2015: 28) und nicht in seinen Defiziten erleben, als »aktive Gestalter« (vgl. Strohm/Feger 2015: 16). • Sprache & Ausdruck: Teilweise wird Kunst als quasi universelle Sprache herauf beschworen; teils wird damit argumentiert, dass sich durch künstlerische Projekte neue »kommunikative Infrastrukturen« (Meyer Marenbach, zit.n. Küpper 2004: 68) herausbilden, etwa durch Übungen, die nicht über Sprache, sondern über Körper- und Zeichensprache funktionieren (vgl. z.B. Lange 2015: 33). In jedem Fall wird Sprache-Lernen sehr häufig als beiläufig und zwanglos in Projekten Kultureller Bildung bezeichnet (vgl. Küpper 2004: 68). Beim Lesen von Projektbeschreibungen und Konzepten, Interviews und Selbstdarstellungen wird zunächst klar, dass Kulturschaffende sehr wenig über sich selber reden und sehr viel über die Zielgruppe und darüber, was Kulturelle Bildung alles vermag; Kulturelle Bildung als »Türöffner« (vgl. Kröger 2015: 69) und als »Überlebensmittel« (vgl. Schneider 2016: 11). Verschiedene Aspekte spielen zusammen, versucht man herauszulesen, warum Projekte ins Leben gerufen werden: mal sind es persönliche Begegnungen und das Helfen- und Etwas-TunWollen angesichts gesellschaftlich relevanter Ereignisse, mal sind es Anfragen, Aufträge oder Förder-Ausschreibungen von ganz unterschiedlichen Seiten. Teilweise entsteht durch Begrifflichkeiten und Argumentationsmuster allerdings ein Unbehagen, weil es die Kluft verstärkt zwischen Eigen und Fremd, zwischen Wir und den Anderen. Im Reden über wird häufig auf Legitimationen zurückgegriffen, die im Folgenden aufgeschlüsselt werden.
241
242
Marlene Helling und Nina Stoffers
… als Ausdruck von Legitimationen Vor dem Hintergrund der von Mörsch identifizierten sieben Legitimationen von Kulturvermittlung8 werden drei heraus gegriffen, die im Wording der hier untersuchten Projekte zum Tragen kommen. Die vierte Legitimation wird bezeichnet als »Kulturvermittlung zur Inklusion«, da sie diejenigen Bevölkerungsgruppen, die bislang (noch) nicht in den Institutionen der Hochkultur präsent sind, durch Kulturvermittlung an diese heranführen und zur kulturellen Teilhabe motivieren will; im Kern soll soziale Ungleichheit verringert werden (vgl. ZHdK 2012: 143ff.). Dadurch werden allerdings Kultur und Institutionen als »unveränderliche Größe« (vgl. ebd.) vorausgesetzt und es besteht die Gefahr, dass Projekte paternalistisch ausgerichtet sind und eine klare Hierarchie herrscht zwischen denjenigen, die geben, und denjenigen, die nehmen. Dass dies so pauschalisierend für viele Projekte für Geflüchtete nicht zutreffend ist, davon berichten diverse Projektbeschreibungen (vgl. z.B. Bröckelmann 2015: 36, Tinius 2015: 37, Rollenmiller 2015: 33, Kontny 2014: 35). Dennoch: Sehr häufig werden gerade Kunst und Kultur als etwas angesehen, dass Wir den Anderen vermitteln. Möglicherweise zeigt die aktuelle Situation wie in einem Brennglas, dass Kultureinrichtungen gerade nicht als Spiegel der Gesellschaft fungieren und eine »Kultur für alle« längst nicht realisiert ist. Eine für die Analyse weitere wichtige Legitimation, die fünfte, besteht darin, die Künste und die Beschäftigung mit ihnen als Bildungsgut zu postulieren, das für alle per se und grundsätzlich positiv, wichtig und gut sei (vgl. ZHdK 2012: 144f.); als implizite Fortschreibung von bürgerlich-westlichen bis hin zu kolonialen Wertvorstellungen muss diese Legitimationsstrategie sehr kritisch hinterfragt und aufgedeckt werden, wo es z.B. um strukturellen Rassismus geht. Die siebte Legitimation »Kulturvermittlung als Werkzeug zur Verbesserung sozialer Missstände« ist von Bedeutung, da kulturelle Teilhabe durch diese Argumentation »häufig an die Stelle realer politischer Mitbestimmung tritt und Kulturprojekte eher zur Beruhigung und Dekoration und nicht zur Bekämpfung von Problemen dienen« (ZHdK 2012: 148). Dies ist folgenschwer, wenn ein Engagement im kulturellen Bereich die wachsame und kritische Begleitung politischer Prozesse oder den Protest gegen Gesetzesänderungen oder Forderung der Umverteilung von Ressourcen aus dem Blick verliert.
8 | Diese sind: 1. Kulturvermittlung als Wirtschaftsfaktor, 2. Kulturvermittlung fördert die kognitive Leistungsfähigkeit, 3. Erweiterung des Publikums auf alle Bevölkerungsschichten aus fiskalischer Verantwortung, 4. Kulturvermittlung zur Inklusion, 5. Die Künste als Bildungsgut, 6. Kulturvermittlung als Ermöglichung aktiver Mitgestaltung der Künste und ihrer Institutionen, 7. Kulturvermittlung als Werkzeug zur Verbesserung sozialer Missstände. Vgl. ZHdK 2012: 137ff.
Kulturprojekte für und mit, aber selten von …
Schließlich bergen kulturelle Projekte die Gefahr der ethnischen Essentialisierung, d.h. einer starren und homogenisierenden Zuschreibung auch positiver Eigenschaften auf Personen bestimmter Kulturen. Dies kann sich im kulturellen Rassismus äußern, wenn Kultur als Differenzlinie absolut gesetzt wird, etwa zwischen einem vermeintlich westlich-christlichen, aufgeklärten Abendland und einem fundamentalistischen Islam (vgl. ZHdK 2012: 159ff.). Dienen Projekte Kultureller Bildung also teils – unbewusst, unreflektiert, durchaus ungewollt! – der Reproduktion von Zuschreibungen, Stereotypen, Exotisierungen, ungleichen Machtverhältnissen, sind sie also mithin hegemoniestützend und richten mehr Schaden als Nutzen an?
Ein Fazit für den Moment Sehr eindeutig und kritisch sieht das das Bündnis RISE in Australien, das von Refugees und anderen gegründet wurde, um für sich selbst zu sprechen: Sie benennen klar, dass gut gemeinte Kulturprojekte mit und für, aber nicht von Geflüchteten sehr wohl Schaden anrichten können (vgl. RISE 2015). In ihrer Evaluation der Berlin Mondiale gibt Azadeh Sharifi zehn Empfehlungen zur »Zusammenarbeit in den Künsten« von Flüchtlingen und Kulturinstitutionen und formuliert, dass Geflüchtete und Asylsuchende viel stärker eingebunden werden müssen in die Steuerungs-, Konzeptions- und Organisationsgestaltung: als Künstler_innen und Vermittler_innen, als Gestaltende wie auch als durch Finanzmittel honorierte Projektbeteiligte (vgl. Sharifi 2015: 38ff.) – sehr notwendige und häufig noch wenig umgesetzte Forderungen in der aktuellen Projektlandschaft. Die eigenen Legitimationen zu hinterfragen und aufzudecken, ist ein laufender Prozess, der Projekte stets begleiten sollte. Wichtig ist aber auch, nicht aus Angst vor Fehlern sich gar nicht mehr zu rühren. Als »weiße« Kulturschaffende und Wissenschaftlerin gilt es, die eigene Privilegiertheit und Verantwortung mitzudenken und einzusetzen, z.B. um Räume und Finanztöpfe zu vermitteln, zu öffnen und – womöglich am Wichtigsten – zu teilen und abzugeben, also nicht die eigene Stimme zu leihen, sondern den Platz frei zu machen für Leute, die selbst ihre Stimme erheben.
Wer darf sprechen? Marlene Helling Auch einige deutsche Theaterhäuser wollen ihre Stimme für Geflüchtete erheben und zeigen »Die Schutzbefohlenen«. Dieses derzeit viel gespielte Stück von Elfriede Jelinek, der österreichischen Dramatikerin, wirft einige Fragen auf in Bezug auf den Umgang von Regisseur_innen mit dem Text sowie auf das Einbeziehen von Geflüchteten auf der Bühne. In vielen Kritiken zum jelinekschen Text sowie zu verschiedenen Inszenierungen ist zu lesen, dass die Autorin Geflüchteten eine
243
244
Marlene Helling und Nina Stoffers
Stimme verleiht, gibt oder schenkt. Der Text sei ein Geschenk, so auch Andreas Listowell von der sogenannten Lampedusa-Gruppe in Hamburg9: »The statement we give is our text, it’s not written by Jelinek alone. She didn’t take anything from us, she gave us something.« (Behrendt 2015). Wie wird dieses Geschenk auf deutschen Bühnen dargestellt und wie ist der Umgang mit den Menschen, die in dem Text das »Wir« bilden? Bei Jelinek heißt es: »Wir leben. Wir leben. Hauptsache, wir leben, und viel mehr ist es auch nicht als leben nach Verlassen der heiligen Heimat. Keiner schaut gnädig herab auf unseren Zug, aber auf uns herabschauen tun sie schon. Wir flohen, von keinem Gericht des Volkes verurteilt, von allen verurteilt dort und hier.« (Jelinek 2013)
Um zu verstehen, worauf der Text basiert und wer bei Jelinek mit dem »Wir« gemeint ist, sind einige der sich überschlagenden politischen und gesellschaftlichen Ereignisse der letzten Jahre von Bedeutung: ein Protestmarsch von Geflüchteten, der das »Refugee Protest Camp Vienna« zur Folge hatte, die Vergabe von befristeten Visa an die Lampedusa-Gruppe durch die italienische Regierung und die »Blitzeinbürgerungen« von zahlungsfähigen Prominenten (die Opernsängerin Anna Netrebko und die Tochter des ersten russischen Präsidenten, Tatjana Brissowa Jumaschewa). Als Grundlage des Textes »Die Schutzbefohlenen« gilt »Die Schutzflehenden« von Aischylos.10 Neben diesen Themen ist die von Jelinek verwendete Sprache maßgeblich für die Inszenierungen an deutschen Theatern. Die Autorin bedient sich einer verschachtelten, artifiziellen Sprache. Diese lebt von einer Mischung aus Ironie und Kontextverschiebungen: »Es gibt keinen Allaufnehmenden. Da könnte jemand eher das All bei sich aufnehmen.« (Jelinek 2013) Außerdem stellt die Autorin potentielle, bittere Wahrheiten von Geflüchteten dar: »Auf die Toten können wir uns nicht berufen, wenn wir ein Aufenthaltsrecht ableiten wollen, die wollen uns hier ja selber ableiten wie Flüsse.« (Ebd.) Bemerkenswert ist auch die Erzählperspektive: Es kommen vermeintliche »Stimmen aus der Gesellschaft« zu Wort: »Heute wollen Sie [die Geflüchteten] Decken, Wasser und Essen, was werden Sie morgen verlangen? Unsere Frauen, unsere Kinder, unsere Berufe.« (Ebd.) Die Perspektive wird im Text immer wieder unterschwellig gewechselt. Man selbst möchte nicht zu diesen »Stimmen aus der Gesellschaft« gehören. 9 | Die Lampedusa-Gruppe ist eine Protestaktion von rund 300 Geflüchteten, die 2013 von der italienischen Regierung unbefristete Visa bekamen und nun für ein Bleiberecht in Hamburg kämpfen. 10 | Diese klassische Tragödie thematisiert die Flucht der fünfzig Töchter Danaos. Die Frauen sollen ungewollt ihre Vettern heiraten, weshalb sie Schutz bei dem König Pelasgos suchen. Nach einem moralisch-politischen Konflikt muss Pelasgos den Frauen trotz des Risikos, einen Krieg mit den Vettern der Frauen anzuzetteln, aufgrund ihrer argeischen Abstammung Schutz gewähren.
Kulturprojekte für und mit, aber selten von …
Der Theatertext benennt explizit die oben genannten Ereignisse, die mit Flucht und den daraus resultierenden Erfahrungen für die geflüchteten Menschen im Einreiseland verbunden sind. Die vielen Fluchtgeschichten werden zu einer zusammengefasst und mit einem »Wir« versehen. Es kommt zu einer Generalisierung, wie sich Geflüchtete – aus Jelineks Perspektive – fühlen und behandelt werden. Verschiedene Menschen mit verschiedenen Erfahrungen bilden in ihrem Text das »Wir« – es ist ein »Wir« aus der (vermeintlichen) Perspektive von Geflüchteten, das sich wie ein roter Faden durch den Text zieht. »Die Schutzbefohlenen« ist zwar ein fiktiver Text, dennoch greift er reale Probleme von Geflüchteten mit auf und spricht von »Wir«. Und genau darin liegt meines Erachtens vor dem Hintergrund der aktuellen politischen Ereignisse das Problem: Warum darf eine österreichische Dramatikerin von »Wir« sprechen, wenn dieses »Wir« im Text die Perspektive von Geflüchteten darstellen soll, und wer spricht dieses »Wir« in den Inszenierungen von »Die Schutzbefohlenen«? Auf den Mühlheimer Theatertagen im Mai 2014 wurde diese Frage diskutiert. Nicolas Stemann, der Regisseur der vielbesprochenen Inszenierung am Thalia Theater Hamburg, der schon häufig Stücke von Jelinek inszeniert hat, argumentierte, dass Jelinek in einer Kunstsprache schreibe, die nur von ausgebildeten deutschen Schauspieler_innen gesprochen werden könne. Aus diesem Grund können Laienschauspieler_innen oder Schauspieler_innen, die die deutsche Sprache nicht flüssig beherrschen, also z.B. gerade in Deutschland angekommene Geflüchtete, nur schwer Texte von Jelinek auf einer Bühne sprechen. Bei professionellen Schauspieler_innen sei eindeutig, so Stemann, dass sie nicht mit dem »Wir« im Text gemeint seien (vgl. Behrendt 2015). Die Uraufführung von »Die Schutzbefohlenen« fand 2014 beim Festival »Theater der Welt« in Mannheim statt. Die Proben für die Premiere, so der DIE ZEIT-Redakteur Peter Michalzik, gingen turbulent zu und waren von aktuellen Themen und Experimenten geprägt (vgl. Michalzik 2014). Ein Experiment war das Blackfacing – weiße Schauspieler malen sich schwarz an. »Natürlich ist Blackfacing rassistisch«, so Stemann, »aber muss man nicht gerade deshalb sagen, es gehöre auf die Bühne?« Nach vielen kritischen Kommentaren und knapp zwei Spielzeiten später durften alle Akteure, so schien es, ihre ursprüngliche Hautfarbe »behalten«. Die vielen Änderungen, die im Laufe der Zeit vorgenommen wurden, werte ich als eine Unsicherheit und Suche Stemanns in der Positionierung zum Thema »Geflüchtete auf der Bühne«. Wo doch erst kein einziger Geflüchteter auf der Bühne stand, sind es in der laufenden Inszenierung (Spielzeit 2015/2016) viele Menschen mit Fluchterfahrung. Welche Chancen ergeben sich für die Geflüchteten, wenn sie in manchen Szenen eher als Requisit fungieren, anstatt als Menschen auf einer Bühne stehen? Traf der Regisseur Nicolas Stemann die Entscheidung, Geflüchtete auf die Bühne zu holen, nur, um dem Text von Jelinek, einer Autorin ohne Fluchterfahrung, Authentizität zu verleihen? Und braucht es, wie die Theaterkritikerin Esther Boldt feststellt, »bei schmerzlich gegenwärtigen Themen […] einen Erfahrungshintergrund, um ihre Verhandlung
245
246
Marlene Helling und Nina Stoffers
auf der Bühne zu legitimieren, braucht es echte Asylbewerber, die als verkörperte Geschichte der dürren Inszenierung Gewicht verleihen« (Boldt 2014)? Als diskussionswürdig empfinde ich ebenfalls die Besetzungsliste, die im Internet und im Programmheft vom Thaila Theater zu finden ist und wie folgt aussieht: Regie und Bühne: Nicolas Stemann, Kostüme: Katrin Wolfermann […] und ein Flüchtlingschor (vgl. Thalia Theater 2016). Das Argument, die Geflüchteten seien noch illegal in Deutschland, weshalb die Betitelung »Flüchtlingschor« sie schütze, reicht nicht aus. Zumindest konnte Esther Boldt in dem eben bereits zitierten Artikel »Sprecht doch selbst!« (Boldt 2014), der nach der Uraufführung in Mannheim erschien, alle Namen der Mitwirkenden nennen. »Flüchtlingschor: Mayila Ainiwaer, Ouja Arjmand, Arman Dalir, Lida Daniel, Alexander Doderer, René Ehringer, Doris Ehrlich, Mireira Ginestí, Santiago Jiménez Giraldo, Hanna Green, Wakaso Kalibo, Barbara Krebs, Atabak Hoshmand, Wolfgang Huth, Ali Kabir, Filar Kanzler, Satar Karim, Alexandra Kilian, André Meyer, Youssef Moufakhir, Philipp Schneider.« (Boldt 2014)11
Trotz alledem ist auffällig, welchen schwierigen und notwendigen Fragen sich der Regisseur Nicolas Stemann aussetzt, wenn er die geflüchteten Menschen als ein inszenatorisches Mittel »einsetzt«. Auch unter den Ensemblemitgliedern sei dies lange Thema gewesen. Welchen Nutzen haben die Geflüchteten von ihrer Arbeit im Theater? Bei den Tischgesprächen, die es nach jeder Thalia-Aufführung gibt, wurde von einem Schauspieler stolz berichtet, dass ein Geflüchteter nun auch bei Mercedes oder Audi arbeitet. Dieser Job hat allerdings wenig mit der Arbeit am Theater zu tun. Trotzdem finden die Geflüchteten in manchen Szenen Gehör, haben »Spaß bei der Sache«12 , werden bezahlt und können bei den Tischgesprächen Leute aus dem Publikum befragen – z.B. zum rechtlichen Werdegang ihres Asylantrags. Bei einer anderen Inszenierung des Stücks am »Theater Bremen« versammelte Regisseur Mirko Borscht Ensemblemitglieder, Laien, einen Tänzer und eine Musikerin auf der Bühne. Diese formulierten nicht den Anspruch, die im Text »Die Schutzbefohlenen« erzählten Geschichten nachzuempfinden. Eher wurde das Publikum dazu gebracht, sich dem Gedanken, selbst ein Geflüchteter zu sein, anzunähern. So wurde beim Einlass von jedem Zuschauer ein Passbild-ähnliches Foto gemacht. Im Laufe der Aufführung bemerkte man, dass das eigene Gesicht plötzlich auf dem eines EU-Abgeordneten klebte. Das Publikum sah sich umringt von den Entscheidungsträgern der Flüchtlingsproblematik – und das eigene Gesicht entschied mit. Gegen Ende der Aufführung klebten die Passbilder auf Papp11 | In der Besetzung des »Flüchtlingschores« gab es allerdings immer wieder Änderungen, die ich nicht hinreichend recherchieren konnte. 12 | Aussage eines Ensembleschauspielers bei dem Tischgespräch im Anschluss an die Aufführung am 21.01.2016 im Thalia Theater, Hamburg.
Kulturprojekte für und mit, aber selten von …
figuren, die einem medialen »Klischee-Geflüchteten« entsprachen. Die Pappfiguren wurden schließlich durch einen Schredder gejagt. Die Entscheidung, keine Geflüchteten auf der Bühne zu sehen, finde ich in dieser Inszenierung sehr passend. Ich selbst wurde durch diese Entscheidung dazu angeleitet, mir vorzustellen, zu einer Gruppe von Geflüchteten zu gehören – auch wenn ich nicht im Stande dazu bin, diese Zugehörigkeit tatsächlich nachzuempfinden. Das »Wir« wendete sich in dieser Inszenierung an uns Zuschauer: als Europäer_innen, als politische Vertreter_innen, als Geflüchtete? In der Bremer Inszenierung war ich beeindruckt davon, wie das Publikum zum Akteur wurde und sich direkt mit den Fragen des Textes »Die Schutzbefohlenen« konfrontiert sah. In dem anschließenden Gespräch mit den Schauspielern der Bremer Inszenierung wurde deutlich, dass sie das Stück noch solange spielen wollen, bis es annehmbare Verhältnisse in der Einwanderungspolitik gibt. Wahrscheinlich wird demnach das Stück noch einige Male in Bremen gespielt werden … Nach meiner Einschätzung besteht die Schwierigkeit von »Die Schutzbefohlenen« schon darin, dass der Text von einer Autorin ohne Fluchterfahrung geschrieben wurde. Auch wenn Theater oft nicht dokumentarisch ist, werden in diesem Text reale Probleme, Fiktion und die prekäre Lage vieler Menschen auf eine Stimme reduziert. Und ob Elfriede Jelinek mit ihrem Text so vielen verschiedenen Menschen eine Stimme verleiht, gibt oder schenkt, zweifele ich an. Sie kanonisiert mit ihrem Text viele Menschen zu einem »Wir«. Dieses »Wir« im Text wird in den beiden Inszenierungen verschieden interpretiert. In Bremen ist mit dem »Wir« auch das Publikum gemeint. Dadurch wurde jeder Einzelne zum Nachdenken angeregt. In Hamburg blickt das Publikum auf Menschen mit Fluchterfahrung, sieht sich damit nicht direkt mit der Problematik konfrontiert und kann sich von »den Anderen« auf der Bühne abgrenzen. Ich habe das Gefühl, dass es bei Stemann weniger um die Geflüchteten am hinteren Bühnenrand geht als um eine Ästhetisierung einer Personengruppe. Eine Personengruppe, die in Deutschland nun ihren Status als Flüchtling spielt und nicht selbst gewählte Themen. Trotzdem denke ich, dass der Text »Die Schutzbefohlenen« wichtig ist für diese Zeit. Natürlich darf man ihn nicht als einen Text von Geflüchteten für Geflüchtete verstehen, sondern von einer österreichischen Autorin für ein privilegiertes Theaterpublikum. Auch ich gehöre zu diesem Theaterpublikum und kann genauso wenig wie Jelinek und Stemann eine Flucht nachempfinden. Ich kann nur berichten, dass ich mit dem »Ausstellen« der Geflüchteten kein Theater sehe, was diesen Menschen weiterhilft.
Schluss Die zwei verschiedenen Textteile dieses Artikels haben die Motivationen und Haltungen von nicht-geflüchteten Kulturschaffenden, die in Projektbeschreibungen und in der Regie sichtbar werden, analysiert, um der Frage auf den Grund zu gehen, mit welchen Legitimationen Angebote Kultureller Bildung ins Leben gerufen
247
248
Marlene Helling und Nina Stoffers
und Stücke auf die Bühnen gebracht werden. Sehr schnell wird deutlich: »Wir« reden lieber über andere als über uns selbst und argumentieren lieber im Namen guter Kulturprojekte und der schönen Kunst, als kritisch zu analysieren, was wir da eigentlich machen. Auch wir als Autorinnen stellen die Gratwanderung fest, dass es schnell geht mit Pauschalisierungen, und dass wir als Beobachterinnen sehr stark differenzieren müssen, um wen und was es eigentlich geht: Geht es um meine künstlerische Idee, die durch »echte« Geflüchtete an Glaubwürdigkeit und Authentizität gewinnen soll und bei der ich als vermeintlich neutrale und objektive Beobachterin, Interpretin, Regisseurin beiwohne? Oder um (m)eine Auseinandersetzung mit gesellschaftspolitisch aktuellen Themen, zu denen ich auch mich selbst befragen und verunsichern lasse, also Teil des Prozesses bin (vgl. Tscholl/ Köhler 2015: 13)? Müsste es nicht vor allem darum gehen, gemeinsam auszuloten, was für Themen uns, die wir alle gerade in Deutschland leben, interessieren, und in was für einer Gesellschaft wir leben wollen, also im Kern um einen gemeinsam zu gestaltenden Raum, in dem wir eine »gemeinsame Stimme« erarbeiten (vgl. Hormain 2012: 3, Kontny 2016: 7)? Aber was kann das nun heißen für die Praxis? Die eigenen Motivationen selbstkritisch zu befragen und Legitimationsstrukturen zu analysieren, könnte z.B. auch dazu führen, sich zu fragen, ob es einen solchen Text, ein solches Buch überhaupt braucht, ob »weiße« Autorinnen in einer Wir-Position schreiben dürfen, zu der sie nicht durch eigenes Erleben gehören, ob »weiße« Regisseure diese Stücke mit Flüchtlingen als »Stoff« inszenieren dürfen. Am liebsten würden wir mit Oliver Kontny rufen: »Lassen wir ab von den Projekten mit Geflüchteten!« (Kontny 2016: 7) und ebenso wie er unterstreichen: »Geflüchtete brauchen nicht die Hilfe der Kulturinstitutionen. Sie brauchen vielmehr Kulturinstitutionen […], die dazu beitragen, dass ein bürgerrechtliches Bewußtsein entsteht, kraft dessen ihnen Grundrechte gewährt und ihre Würde nicht länger abgesprochen werde.« (Ebd.) Denn ist dabei nicht die wichtigste Frage: Wer darf entscheiden, seine eigene Stimme zu erheben, wer darf bzw. kann dies nicht? Die allzu häufig homogenisierende Einteilung in Flüchtling und Nicht-Flüchtling ist zwar konstruiert, es wird aber mittels dieser Einteilung in der Analyse sichtbar, wie durch Legitimationen unhinterfragte Machtverhältnisse reproduziert werden, sodass hegemoniale Hierarchien und Zuschreibungen klar herausgearbeitet werden können. Gleichzeitig sollten wir diese Einteilung aber tunlichst vergessen, weil es langfristig nicht um Geflüchtete und Nicht-Geflüchtete gehen sollte, sondern um ein gemeinsames Wir. Und dazu können wir gerade Theater brauchen, die Orte sein können der gesellschaftlichen Auseinandersetzung, der Fragen und Verunsicherung und gerade bei dem aktuellen labilen Gesellschaftszustand unersetzlich sind (vgl. Tscholl/Köhler 2015: 11).
Kulturprojekte für und mit, aber selten von …
Ausblick Einen tatsächlichen Schluss ziehen können wir hier nicht abschließend und befriedigend, aber ein Ausblick mit Ideen erscheint notwendig, um nicht die Hände in den Schoß zu legen und sich einzureden, ich könne nichts gegen Ungerechtigkeiten und Zuschreibungen tun. Was wir aus der Analyse des Wording und den untersuchten Inszenierungen von Jelineks »Die Schutzbefohlenen« herauslesen, führt uns zu folgenden Forderungen für die praktische künstlerische (und politische) Arbeit ebenso wie für die Rahmenbedingungen (z.B. was Förderungen angeht): • Weniger Sondertöpfe und Extra-Projekte und mehr strukturelle Öffnungen von Kultureinrichtungen; weniger Statisten, mehr Intendanten und Regisseurinnen of colour. • Lieber ein Projekt weniger, das die Zugehörigkeit einer Person auf den sozialen Status als »Flüchtling« reduziert und diesem mit ausstellendem Mitleid begegnet, und ein Projekt mehr, das Normalität schafft durch Selbstverständlichkeiten, indem geflüchtete Künstler_innen Teil des Programms sind, aber ohne explizite Nennung als Besonderheit (Theater der Jungen Welt, vgl. Schneider/ASSITEJ 2016: 9). • Nicht einerseits eine Willkommenskultur feiern und gleichzeitig die Verschärfung des Asylrechts und rassistisch motivierte Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte und Geflüchtete hinnehmen, sondern auch politisch aktiv werden. • Vorurteilsbewusste, rassismuskritische Arbeit mit Kultureller Bildung verschränken und eigene Privilegien erkennen und einsetzen; so kann z.B. die Distanz von Nicht-Geflüchteten gegenüber dem Thema Flucht auch hilfreich sein, um Strukturen anzubieten und Positionen zu nutzen (vgl. Huck/Reinicke 2014: 141). • Räume und Mittel bereit stellen (wie z.B. das »Montagscafé« der Bürgerbühne Dresden) und damit Theater als gemeinsamen Begegnungs- und Experimentierraum zu gestalten, denn: »Theater bzw. Kultur muss die Menschen wieder handlungsfähig machen gegenüber Problemen.« (Kontny 2016: 5)
L iter atur Behrendt, Barbara (2015): Diskussion: Elfriede Jelinek »Die Schutzbefohlenen«. www.theaterheute.de/blog/muelheimstuecke/diskussion-elfriede-jelineksdie-schutzbefohlenen-2/ (letzter Zugriff: 09.03.2016). bjke/LKD (2015) – Bundesverband der Jugendkunstschulen und Kulturpädagogischen Einrichtungen e.V.(bjke)/Landesarbeitsgemeinschaft Kulturpädagogische Dienste/Jugendkunstschulen NRW e.V. (LKD): Infodienst. Das Magazin für kulturelle Bildung. Jugendliche Flüchtlinge. Eine Aufgabe für die kulturelle Bildung. Heft 04/2015, Nr. 115.
249
250
Marlene Helling und Nina Stoffers
Bochnig, Annika (2015): »Spurensuche Flucht«, in: bjke/LKD, Infodienst 04/2015, S. 28-29. Boldt, Esther (2014): Sprecht doch selbst! www.nachtkritik.de/index.php?option =com_content&view=article&id=9574:die-schutzbefohlenen-nicolas-ste manns-jelinek-urauffuehrung-blickt-zur-eroeffnung-des-festivals-theater-derwelt-in-mannheim-auf-das-elend-der-anderen&catid=724:theater-der-welt2014-mannheim&Itemid=100190 (letzter Zugriff: 11.03.2016). Bröckelmann, Heinrich (2015): »Weltentheater«, in: bjke/LKD, Infodienst 04/2015, S. 36. Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung e.V. (BKJ): Dossier Flüchtlinge und Kulturelle Bildung. https://www.bkj.de/kulturelle-bildungdossiers/fluechtlinge-und-kulturelle-bildung.html Hormain, Maéva (2012): »Flüchtlinge als ›Stoff‹ für Kunstprojekte?«, in: Arts Education Research. Jg. 3 (6), S. 1-5. http://iae-journal.zhdk.ch/files/2012/12/AER6_ antikulti2.pdf Huck, Ella/Reinicke, Dorothea (2014): Masters of Paradise. Der transnationale Kosmos Hajusom. Theater aus der Zukunft, Berlin. Jelinek, Elfriede (2013): Die Schutzbefohlenen. http://204.200.212.100/ej/fschutz befohlene.htm, (letzter Zugriff: 22.03.2016). Kontny, Oliver (2014): »Etwas anderes als die Oberfläche«, in: Ella Huck/Dorothea Reinicke (Hg.), Masters of Paradise. Der transnationale Kosmos Hajusom. Theater aus der Zukunft, Berlin. S. 21-35. Kontny, Oliver (2016): »Die selbstverschuldete diverse Leerstelle. Visionen für eine Kulturinstitution in der Stadtgesellschaft.«, in: Stiftung Genshagen (Hg.): Dokumentation des vierten Netzwerktreffens Kulturelle Bildung und Integration. Eigene Paginierung. www.zaknrw.de/files/redaktion/Texte/dokumentation _netzwerktreffen_kulturelle_bildung_und_integration_2015.pdf (letzter Zugriff: 01.07.2016). Kröger, Franz (2015): »Neue Heimat Kultur? Ratschlag Interkultur diskutiert Projekte mit Geflüchteten«, in: Kulturpolitische Mitteilungen. Nr. 149, II/2015, S. 69. Küpper, Britta Marie (2004): »Künstlerische Projekte mit jungen Flüchtlingen«, in: Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung e.V. (BKJ) (Hg.): Kultur öffnet Welten, Remscheid, S. 67-71. Lange, Isa (2015): »Mehr als nur Theater«, in: Stiftung Universität Hildesheim. Der Präsident (2015): Das Magazin. Heft 01/2015, Hildesheim, S. 32f. Michalzik, Peter (2014): Regisseur Nicolas Stemann: Wahrheit im Bruch. www.zeit. de/2014/18/stemann-jelinek-theater-mannheim (letzter Zugriff: 09.03.2016). Reinicke, Dorothea (2015): »Neue Sterne für Hajusom«, in: bjke/LKD, Infodienst 04/2015, S. 41. RISE (2015): 10 things you need to consider if you are an artist – not of the refugee and asylum seeker community- looking to work with our community. http:// riserefugee.org/10-things-you-need-to-consider-if-you-are-an-artist-not-of-the-
Kulturprojekte für und mit, aber selten von …
refugee-and-asylum-seeker-community-looking-to-work-with-our-community/ (letzter Zugriff: 01.07.2016). Rollenmiller, Annette (2015): »Farbe bekennen«, bjke/LKD, Infodienst 04/2015, S. 32-33. Schneider, Wolfgang (2015): »Rhythmus im Tag«, in: Stiftung Universität Hildesheim. Der Präsident: Das Magazin. Heft 01/2015, Hildesheim, S. 34. Schneider, Wolfgang (2016): »Fair Cooperation«, in: Deutscher Kulturrat e.V.: Politik & Kultur. Zeitung des Deutschen Kulturrates. Nr. 02/2016, S. 11. Schneider, Wolfgang/ASSITEJ e.V. (2016): IXYPSILONZETT. Jahrbuch für Kinderund Jugendtheater. Kinder, Theater und Krieg. Vom Inszenieren des Grauens für junges Publikum, Frankfurt a.M. Sharifi, Azadeh (2015): Berlin Mondiale – Flüchtlinge und Kulturinstitutionen: Zusammenarbeit in den Künsten. Hgg. v. Kulturprojekte Berlin GmbH, Berlin. www.kubinaut.de/media/downloads/berlin_mondiale_evaluation_public.pdf (letzter Zugriff: 01.07.2016). Strohm, Judith/Feger, Linda (2015): »Neue Lebenswelten gestalten«, bjke/LKD, Infodienst 04/2015, S. 16-18. Thalia Theater (2016): Spielplan: Die Schutzbefohlenen. www.thalia-theater.de/de/ spielplan/repertoire/die-schutzbefohlenen/ (letzter Zugriff: 11.03.2016). Tinius, Jonas (2015): »Erinnern und Vergessen«, in: bjke/LKD, Infodienst 04/2015, S. 37. Tscholl, Miriam/Köhler, Tilmann (2015): »Montagswirklichkeit Dresden«, in: Theater der Zeit. Heft 11/2015, S. 10-13. ZHdK: Institute for Art Education der Zürcher Hochschule der Künste (Hg.) (2012): Zeit für Vermittlung. Im Auftrag von Pro Helvetia, als Resultat der Begleitforschung des »Programms Kulturvermittlung« (2009-2012). Verantwortlich für die Begleitforschung des Programms Kulturvermittlung: Carmen Mörsch und Anna Chrusciel. Insbesondere: Kapitel 6: Warum (keine) Kulturvermittlung? www.kultur-vermittlung.ch/zeit-fuer-vermittlung
251
Selbstbemächtigung und Würdigung der Überlebensleistung von traumatisierten Geflüchteten Maria Heller im Interview mit Caroline Gritschke
Zusammenfassung Im Gespräch wird die kunsttherapeutische Arbeit mit geflüchteten traumatisierten Schüler*innen in verschiedenen Schulen und in Einzeltherapien in den Räumen von Refugio, einem Beratungs- und Behandlungszentrum für Flüchtlinge und Folteropfer in München, vorgestellt. Im Rahmen der Einzeltherapie erfordert die notwendige Anwesenheit von Dolmetscher*innen im sensiblen Therapieprozess eine besondere Aufmerksamkeit. Die Kunsttherapie kann aber auch nichtsprachlich arbeiten und bietet somit zusätzliche Zugänge für traumatisierte Menschen. Während eines der wichtigsten Therapieziele die Selbstbemächtigung der Klient*innen ist, sollten nichttherapeutisch ausgebildete Akteur*innen der Kulturarbeit sehr reflektiert mit der Gefahr einer Verstärkung der Traumata umgehen und traumatisierende Erlebnisse der Flucht nicht aktiv zum Thema machen. Indem sie die Überlebensleistung der traumatisierten Geflüchteten würdigen, mit denen sie zusammenarbeiten, können aber auch Künstler*innen und Pädagog*innen auf schwierige Situationen und retraumatisierende Momente im Rahmen ihrer Kulturarbeit angemessen reagieren.
Abstract: Empowerment and Acknowledgement of the Sur vival Tactics of Traumatized Refugees This paper deals with the use of art therapy with traumatized refugee students in various schools and in the context of therapy for individuals carried out in Refugio, an advisory and treatment center for refugees and torture survivors in Munich. The requirement of interpreters during individual therapy sessions deserves particular attention, given the sensitive nature of the process. However since art therapy does not have to work with language, it can offer additional approaches for traumatized people. While one of the most crucial goals of therapy is the empowerment of clients, it is important that cultural professionals who do not have therapeutic qualifications work sensitively with the risk of intensifying trauma associated with forced migration, avoiding the direct discussion of these traumatic experiences. Artists and educators can nonetheless find appropriate ways to deal with difficult
254
Maria Heller im Inter view mit Caroline Gritschke situations and re-traumatization within their activities, by acknowledging the survival tactics employed by the traumatized refugees they work with.
Sie arbeiten als Kunsttherapeutin mit traumatisierten geflüchteten Menschen in München bei Refugio, einem Beratungs- und Behandlungszentrum für Flüchtlinge und Folteropfer. Was machen Sie dort genau? Einerseits gibt es bei Refugio das Projekt »Kunsttherapie an Schulen«, d.h., dass ich ein- bis zweimal in der Woche an einer Schule bin, die Flüchtlingskinder oder -jugendliche unterrichtet. Die Lehrer berichten uns über geflüchtete Kinder oder Jugendliche, die besonders schwierig, besonders auffällig oder sehr traurig sind. Mit ihnen arbeite ich in Kleingruppen und mache parallel zum Unterricht Kunsttherapie an der Schule in Abstimmung mit Lehrern, so dass die Kinder besonders intensiv betreut werden. Mein anderer Aufgabenbereich ist Einzeltherapie oder Gruppentherapie bei Refugio. Dieser Kontakt zu den Schulen wird über Refugio hergestellt? Handelt es sich um staatliche Schulen? Es sind staatliche Schulen oder städtische Schulen in München und im Landkreis, die an Refugio herangetreten sind, damit wir den Übergang der Geflüchteten begleiten. Wir machen das schon seit fast zehn Jahren, also lange vor der aktuellen Zuwanderung von Flüchtlingen. Für die Kunsttherapie bekommen wir einen Raum zur Verfügung gestellt, den Kunstraum, für einen Vormittag und machen dort mit Kleingruppen von drei, vier, fünf Kindern und Jugendlichen Kunsttherapie. Und ist das dann ein einmaliger Besuch oder überprüfen Sie nachher nochmal, ob sich die Kinder stabilisiert haben? Wir kommen ein ganzes Schuljahr lang in die Schulen. Im Austausch mit den Lehrkräften arbeiten wir regelmäßig einmal in der Woche mit den jährlich etwa 16 Kleingruppen. Das Projekt wird über Spenden finanziert, die Refugio einwirbt. Für die Schulen ist das kostenlos. Zum anderen arbeiten Sie direkt therapeutisch mit Geflüchteten bei Refugio. Sind Sie dort ebenfalls spezialisiert auf Kinder und Jugendliche? Ich arbeite in erster Linie mit Kindern oder Jugendlichen bis zum Alter von etwa 23-24 Jahren. Die jungen Leute werden in der Regel von Betreuern oder Institutionen bei Refugio angemeldet. Sehr viele unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sind dabei. Zunächst gibt es ein Erstgespräch, in dem die Bereichsleitung oder ein anderer approbierter Psychotherapeut eine Diagnose stellt. Es wird untersucht, ob jemand Therapiebedarf hat und ob Therapiebereitschaft vorhanden ist.
Selbstbemächtigung und Würdigung der Überlebensleistung
Refugio hat sehr viele Anfragen. Nicht alle Menschen können sofort behandelt werden. Zuerst erhalten die Schwertraumatisierten eine Therapie. Die Versorgungslage ist hier leider allgemein sehr schlecht. Es gibt zu wenige Therapieplätze. Nach der Diagnose wird entschieden, welche Therapieform am besten passen könnte für den Klienten u.a. die Kunsttherapie. Setzen Sie bei Ihrer Arbeit auch Dolmetscher*innen ein? Sind diese in besonderer Weise geschult? Wir haben tatsächlich eine Gruppe von Dolmetschern, die werden von einem Kollegen von Refugio in Vorgesprächen ausgewählt und sie erhalten auch eine inhaltliche Einführung in die Arbeit. Auf diese Gruppe können wir bei Bedarf zugreifen. Ich arbeite meistens ein bis vielleicht eineinhalb Jahre in der Kunsttherapie mit Dolmetschern. Wenn die Sprachkenntnisse besser werden, dann ist der Dolmetscher zwar noch anwesend, aber übersetzt nur noch, wenn der Klient etwas missversteht oder etwas Spezielles ausdrücken möchte. Nach und nach kann man dann ohne Dolmetscher weiterarbeiten. Manchmal verzichten wir auch früher auf Dolmetscher, zeichnen dann die Dinge, die nicht erzählt werden können oder arbeiten mit dem Bildlexikon. Dennoch ist der Einsatz von Dolmetscher*innen in der Therapie umstritten, weil eine fremde Person zum Zwiegespräch oder Gruppengespräch hinzukommt. Haben Sie es da in der Kunsttherapie leichter, weil nicht alles über Sprache funktioniert? Man braucht ein wenig Übung. Die Dolmetscher müssen sich auf die Situation einlassen. Vor allem dürfen sie nur sachlich übersetzen und dürfen sich nicht einmischen. Es gibt aber auch einen wichtigen Austausch mit dem Dolmetscher, der für mich ja auch Kulturmittler ist. Ich kann ihn fragen, ob man eine bestimmte Frage überhaupt stellen kann, was üblich ist, was ich vielleicht falsch einschätze. Es geht auch um den kultursensiblen Austausch. Er ist also nicht nur eine fremde Person. Man muss u.a. über die Sitzordnung steuern, dass die Beziehung zwischen Klient und Therapeut entsteht und nicht zwischen Klient und Dolmetscher und der Therapeut sitzt nur dabei. Der Blickkontakt ist dabei wichtig, damit beide Seiten nicht nur mit dem Dolmetscher sprechen. Manchmal möchte auch der Klient, dass der Dolmetscher ihn unterstützt, sich für ihn einsetzt und bringt ihn damit in einen Zwiespalt. Wenn nun also eine Beziehung aufgebaut wurde: Wie würden sie die Ziele der Kunsttherapie mit traumatisierten Menschen beschreiben? Zum einen ist der Zugang, der Einstieg relativ sprachunabhängig möglich. Das ist eine große Erleichterung für die Flüchtlinge. Das Hauptziel der Kunsttherapie ist die Stabilisierung – und zwar auf der einen Seite Beruhigung, so dass sich die
255
256
Maria Heller im Inter view mit Caroline Gritschke
Psyche, das Selbstvertrauen mehr entwickeln kann. Eine Stärkung von inneren positiven Bildern und dann natürlich auch der Umgang mit den schrecklichen Bildern. Können Sie etwas zur durchschnittlichen Dauer der therapeutischen Begleitung sagen? Wie ist die Therapie in das Leben, in die Bewältigung des Alltags der jungen Geflüchteten eingeordnet? Bei der Arbeit an den Schulen gehen wir davon aus, dass sie mindestens ein Schuljahr lang dauert, außer wenn das Kind die Schule bzw. den Wohnort wechseln muss. Im folgenden Schuljahr überlegt man gemeinsam mit den Lehrern, ob es sinnvoll wäre, eine Kleingruppe weiterzuführen. Bei den Einzeltherapien ist das ganz unterschiedlich. Zur Alltagsbewältigung ist zu sagen, dass das gestalterische Tun per se schon ein wichtiger Beitrag ist, um aus Hilflosigkeiten herauszukommen, die man ausgelöst durch die Traumatisierung empfindet. Das versteht man in der Traumatherapie als Selbstbemächtigung. Welchen Beitrag leistet die Kunst bzw. Kunsttherapie im Rahmen dieses therapeutischen Prozesses? Das Gestalten wirkt unter Umständen schneller und anders als Gespräche allein. Man braucht andere Sinne und das Tun hat eine starke Wirkung. Ich traue mir mehr zu, wenn ich Herausforderungen in der gestalterischen Arbeit schon einmal durchgestanden habe und zu einem guten Ergebnis gekommen bin. Was würden Sie Kunst- und Kulturschaffenden raten, die mit Geflüchteten zusammenarbeiten möchten? Wo sind Gefahren und Grenzen der Zusammenarbeit, wenn man nicht therapeutisch ausgebildet ist? Zunächst einmal muss man sagen, Kunst und Kultur leisten einen wichtigen Beitrag, und aktive Beschäftigung damit ist immer sinnvoll, auch ohne traumatherapeutischen Hintergrund. Einige Punkte gibt es aber, bei denen man aufpassen sollte: Kulturschaffende sollten nicht provozieren, dramatische Erlebnisse zu erinnern und erneut zu durchleben. Die Erinnerung verstärkt oftmals das Trauma und behindert den Heilungsprozess. Wenn ein Flüchtling sich im eigenen Gestalten auf die traumatisierenden Ereignisse der Flucht bezieht, sollte man auch nicht nachfragen. Ist es für Kulturschaffende anzuraten, Schulungen zum Thema Trauma zu besuchen, bevor man ein Projekt beginnt? Es gibt ja inzwischen viele Fortbildungen für Ehrenamtliche zum Umgang mit traumatisierten Menschen. Refugio veranstaltet auch des Öfteren solche Schulungen, die Kulturschaffende besuchen könnten. Das wäre sinnvoll – auch um ihnen die Angst davor zu nehmen, dass Situationen außer Kontrolle geraten könnten.
Selbstbemächtigung und Würdigung der Überlebensleistung
Wenn Dinge zur Sprache kommen oder im gestalterischen Prozess zum Thema werden, die traumatisierend waren und sind, sollte man das mit Wohlwollen wahrnehmen und die Überlebensleistung würdigen. Auch kann man nachfragen, wie man jetzt mit dem gestalterischen Produkt oder der Erzählung umgehen soll, ob das auf bewahrt werden soll, was ja auch die Überlebensleistung dokumentieren würde. Es sollte eine reflektierte gemeinsame Entscheidung darüber gefällt werden, wie mit der Darstellung, mit der Thematisierung des traumatisierenden Teils der Biografie umgegangen wird, ohne an dieser Stelle noch tiefer in die Lebensgeschichte einzudringen.
257
5. Sprachen und Räume — Languages and Spaces
Die Erfindung der Einsprachigen Überlegungen zur sprachlichen Vielfalt Radhika Natarajan Zusammenfassung Der Beitrag beschäftigt sich mit der Einsprachigkeit als Fiktion, die mit der unüberhörbaren Vielfalt an Sprachen in den europäischen Stadtgesellschaften nicht in Einklang zu bringen ist. Es wird der Frage nachgegangen, wie es zur Erfindung des native speakers kommen konnte und welche Folgen dieser Mythos der Einsprachigkeit bis heute hat. Es zeigt sich in der Konsequenz bis heute, dass Mehr- und Vielsprachigkeit zwar im Kontext von Vielfalt und Diversität betont werden, aber im Rahmen des vorherrschenden Denkens gesteht man dennoch jeder Person nur eine Sprache, die ›Muttersprache‹ zu. Damit wird das Individuum nicht als unterschiedlich kompetent in mehreren Sprachen wahrgenommen. Der mehrsprachigen Person fehlt es somit an Identifikations-, Benennungs- und Beschreibungsmöglichkeiten. Allerdings ist diese Abwehr der Mehrsprachigkeit in der globalisierten, medial vernetzten Welt nicht aufrechtzuerhalten, da wir längst in einer post-einsprachigen Welt angekommen sind.
Abstract: The Invention of Monolingualism – Thoughts on Linguistic Diversity This paper deals with monolingualism as a fiction that cannot be harmonized with the unmistakable diversity of languages in European urban communities. It explores the question of what led to the invention of native speakers, and what consequences this myth of monolingualism still has today. This is revealed in the consequence that even today, although multilingualism is emphasized in the context of diversity and pluralism, in the realm of prevailing perceptions, every individual is accorded only one ›mother tongue,‹ meaning that the individual is not perceived as being differently competent in various languages. Thus the multilingual person lacks possibilities of identification, nomenclature and description. However this defense against multilingualism cannot be maintained in a globalized, medially networked world, given that we long ago entered a post-monolingual world.
262
Radhika Natarajan
Einführung Angesichts der unüberhörbaren Vielfalt in den europäischen Stadtgesellschaften hält die Fiktion vom Vorrang der Einsprachigkeit nicht mehr stand. Wie ist es allerdings überhaupt dazu gekommen, dass sich diese reale Fiktion einige Jahrhunderte durchsetzen konnte?1 Und inwiefern hat dies mit der Formel ›eine Sprache – eine Nation‹ (vgl. Anderson 1991) und mit der regelrechten Erfindung von native speakers (vgl. Bonfiglio 2013) zu tun?2 Neuere sprachwissenschaftliche Texte (vgl. Edwards 2004, 2013) leiten eine Kehrtwende von der ansonsten vorurteilsbeladenen und abweisenden Haltung gegenüber der Mehrsprachigkeit ein und nehmen stattdessen die gesellschaftlich erlebte Realität zum Ausgangspunkt (vgl. Busch 2004, 2013; Pavlenko 2005). In diesem Zusammenhang ist von einem »social« (vgl. Block 2003) bzw. »multilingual« (vgl. May 2013) Turn die Rede. Konsequenterweise ist ebenfalls zu hinterfragen, ob diese_r eigentlich nicht anzutreffende, als monolingual konstruierte Idealsprecher_in3 fortwährend für den Erwerb weiterer Sprachen als Vorbild dienen kann oder ob dieses binäre Denken nicht längst als überholt gilt, so dass andere Aspekte und Facetten in den Mittelpunkt rücken sollten. Die These von der Erfindung der Einsprachigen bringt zweierlei mit sich: zum einen den Verweis auf die verdrängten, vernachlässigten und oft zu Dialekten heruntergestuften Minderheitensprachen der Autochthonen, die entweder abgeschlagen bzw. ausweglos der Vergessenheit überlassen oder aber auch teils mit energetischem Lokalpatriotismus und teils mit Nationalismen unterschied1 | An dieser Stelle sei den Teilnehmenden des gleichnamigen Seminars wie des Beitragstitels gedankt, die am Deutschen Seminar der Leibniz Universität Hannover in den Sommersowie Wintersemestern 2015 Originaltexte von Anderson et al. gründlich gelesen, diskutiert und mir dabei zum besseren Verständnis der Texte verholfen haben. Grundsätzlich gilt mein Dank Prof. em. Dr. Detlev Claussen für die Schärfung meines Blicks für den historisch zu betrachtenden gesamtgesellschaftlichen Kontext, die Bedeutung der bürgerlichen Gesellschaft für die Gegenwart und insbesondere für die Idee der realen Fiktion. 2 | Zur Auslegung der weitreichenden Auswirkungen einer nationalstaatlichen Sprache und daraus ableitend eines nationalsprachlich festgelegten Prüf- und Testregimes für Neuzuwanderende nach Europa vgl. Extra/Spotti/Avermaet (2009), Hentges/Hinnenkamp/ Zwengel (2010), Natarajan (2013a) sowie Sachverständigenrat (2011). 3 | Das Konzept einer Idealsprecher_in entstammt der Tradition der Universal Grammatik von Noam Chomsky und bestimmte über Jahrzehnte das ganze Feld der Theoretischen und der Angewandten Linguistik. Auf das Feld der Zweitspracherwerbsforschung übertragen führte dies u.a. zur vereinfachenden, realitätsfernen, binären, einander ausschließenden Kategorisierung in native speaker und non-native speaker, die jedoch der Realität einer sich zunehmend globalisierenden Welt und einer multilingualen Stadtlandschaft (vgl. Block 2008; Extra/Yagmur 2004) nicht länger standhält, effektiv hinterfragt wurde (vgl. Firth/Wagner 1997, 1998) und mittlerweile als abgelöst gilt (vgl. Davies 2001).
Die Er findung der Einsprachigen
licher Couleur einer Revitalisierung unterzogen werden.4 Dass es bis vor einigen Jahrhunderten eine Vielzahl an Sprachen neben- und miteinander auf europäischem Boden gab, dass sie im Zuge der Nationalstaatswerdung an Bedeutung und buchstäblich an Boden verloren, aus dem Kollektivgedächtnis verbannt und ihnen sozusagen die Treue entzogen wurde (vgl. Heller 2007), ist eine Geschichte für sich, auf die hier nicht eingegangen wird. Zum anderen unterstreicht diese These allerdings eine weit verbreitete Verknüpfung von Mehrsprachigkeit mit Migration im engeren und Mobilität im weiteren Sinne. Durch diese Verquickung entsteht eine räumliche Abgrenzung5 und eine affektive Distanzierung von gesellschaftlich vorzufindender sowie sich ständig reproduzierender sprachlicher Vielfalt, sogar Vervielfältigung und Diversifizierung (vgl. Blommaert 2015).6 Verkürzend und dahingehend folgenschwer ist diese Gleichsetzung insofern, als sie somit Mehrsprachigkeit vorwiegend mit dem Anderen verbindet, dem Nichteigenen bzw. dem Fremden zuschreibt und von sich räumlich, körperlich, individualgeschichtlich und emotional weg weist. Im Gegensatz dazu scheint Einsprachigkeit Sicherheit zu gewähren, wird als von vermeintlich Eigenem herrührend positioniert (vgl. Anderson 1991: 67f.) und be4 | Für eine theoretische Diskussion zur Bezeichnung Sprache oder Dialekt vgl. Block 2003: 56-91; Oksaar 2003. Für mittlerweile etablierte und facettenreiche Diskussionen zum sozialen Ansatz der Zweisprachigkeit vgl. Heller (2007), Treichel (2004), und für eine brandaktuelle, länderübergreifende Diskussion zur Aufbewahrung und Revitalisierung von Minderheitensprachen sei auf das New Speakers Netzwerk COST hingewiesen, das unter www.nspk.org.uk zu erreichen ist. 5 | Vielsprachigkeit wird mit fernen Kontinenten und anderen Ländern wie dem afrikanischen Kontinent oder dem indischen Subkontinent assoziiert, aber nicht mit der eigenen europäischen Stadtgesellschaft, obwohl die Zeichen dafür nicht zuletzt dank innereuropäischer Freizügigkeit ersichtlich sowie aufgrund Arbeits-, Bildungs-, Familien-, Heirats-, Umwelt- und Zwangsmigration deutlich vernehmbar sind. Für biografisch verankerte, raumübergreifende Mehrsprachigkeit vgl. bspw. Betten (2013); Franceschini (2010); Natarajan (2009, 2012). 6 | Ab dem ausgehenden 19. Jahrhundert war Zweisprachigkeit im diskursbestimmenden und forschungtreibenden angelsächsischen Raum mit hierarchisch unterlegenen Positionierungen verbunden, nämlich mit der Arbeitsmigration in die Vereinigten Staaten, größtenteils aus Europa, und mit dem kolonialen Subjekt in Großbritannien. Bilingualität wurde bis in die 1970er Jahre für defizitär gehalten und sogar als Intelligenz beeinträchtigend angesehen (vgl. Edwards 2004, 2013). Dahingegen war die Mehrsprachigkeit und Mehrschriftlichkeit der Eliten, die wenigen Privilegierten zugänglich war, weiterhin hoch angesehen und bildet sogar die Grundlage für schulisch-universitäres, systemisches Angebot an ausgewählten, als prestigeträchtig angesehenen Sprachen. Das kann als die bottom-up versus top-down Problematik verstanden werden, wobei gesellschaftlich vorhandene und entstehende Sprachenvielfalt der institutionell oktroyierten entgegengesetzt und als bedrohlich empfunden wird.
263
264
Radhika Natarajan
reitet damit die Grundlage dafür, Mehrsprachigkeit in bestimmten Situationen Einhalt zu gebieten und zu verwehren. Gesamtgesellschaftlich betrachtet führt diese Gemengelage am deutlichsten in als Ausnahme wahrgenommenen, als verunsichernd bzw. sogar bedrohlich empfundenen Zeiten zu nicht vernunftgemäß zu rechtfertigenden, doch anscheinend reflexartigen und damit salonfähigen Kurzschlussreaktionen: einerseits zu Versuchen rückschrittlicher und historisch inakkurater Besinnung, einer scheinbaren Retraditionalisierung wie Renationalisierung (vgl. Busch 2004, 2013), und andererseits zum vergeblichen sowie widersprüchlichen, aber umso lautstärkeren und beharrlichen Klammern an der vermeintlich gemeinsam geteilten einzigen Sprache, in unserem Falle Deutsch. Ziel dieses Artikels ist es, ansatzweise einige ansonsten als getrennt wahrgenommene Aspekte der Mehrsprachigkeit zusammenzubringen, selbstverständlich gewordene Annahmen sichtbar zu machen und zu hinterfragen sowie Aspekte gesellschaftspolitischer und soziolinguistischer Anliegen miteinander in Verbindung zu bringen. Angestrebt wird damit, sich der gesellschaftlichen Realität des 21. Jahrhunderts und der sich sprachlich im Zuge der Mobilität und aktueller Fluchtmigration ändernden Stadtgesellschaft anzunähern, ohne sie jedoch der Komplexität und der Vielschichtigkeit zu berauben. Dies wird im Folgenden in zwei Schritten entfaltet: Im ersten Schritt wird die gesellschaftliche Haltung Sprachen in der Ein- bzw. Mehrzahl gegenüber dargestellt. Im zweiten Schritt wird der historische Kontext kurz angerissen und Fragen danach in den Mittelpunkt gestellt, welche Sprecher_innen als berechtigt angesehen werden und sich Gehör verschaffen können. Der Artikel schließt bezugnehmend auf die gegenwärtige sprachliche Stadtlandschaft in der Bundesrepublik Deutschland mit offenen Fragen ab.
Ein- bzw. Mehrsprachigkeit als gesellschaftliche Haltung Seit dem Erscheinen ihrer Habilitationsschrift im Jahr 1994 haben wir uns daran gewöhnt, fast gebetsmühlenartig einen Teil des Titels anzurufen, wenn es um aufgeklärte Diskussionen über Mehrsprachigkeit im deutschsprachigen Raum geht. Die Rede hier ist vom »monolingualen Habitus« und von der Hamburger Forscherin Ingrid Gogolin. Die Erziehungswissenschaftlerin bezieht sich in erster Linie auf die sich als einsprachig positionierende, aber der Sozialisation der Schülerschaft nach und der aufgezeichneten, vorherrschenden Kommunikation zufolge in der Tat multilinguale Schule. Darin zeigt sie das Untertauchen bzw. Ausblenden des historischen Gewordenseins einer im Zuge der Staatswerdung postulierten Einsprachigkeit auf.7 Diese geht mit einer gewissen Naturalisierung 7 | Für eine ausführliche Untersuchung zum Entstehen der Volksschule in Deutschland und wie diese Schule zur deutschen Schule wurde, vgl. die Schriften und Herausgeberschaften von Marianne Krüger-Potratz (bspw. 1998), zu migrationspädagogischen Auswirkungen Mecheril (2004), für Beispiele internationaler Schulpraxen Gogolin/Kroon (2000),
Die Er findung der Einsprachigen
und somit Selbstverständlichkeit einer Muttersprache einher. Doch wie bei einer Idee, die gesellschafts- und wissenschaftsreif geworden ist, trifft die historisch begründete Überkreuzung zwischen dem vom französischen Philosophen und Soziologen Pierre Bourdieu entwickelten Habitusbegriff und der bis dahin als Tatsache angesehenen und insbesondere in der angloamerikanischen Sprachwissenschaft eher positiv besetzten Monolingualität den Nerv der Zeit. Verschiedentlich als monolingual bias berüchtigt (vgl. Block 2003: 34; Pavlenko 2005: 3), als monolingual ideology enttarnt (vgl. Auer/Wei 2007: 8) bzw. als monolingual paradigm bezeichnet (vgl. Yildiz 2012: 2), bestimmte dieser Habitus den Großteil der sprachwissenschaftlichen Forschung und des Diskurses;8 es ist allerdings fraglich, ob dies trotz anderweitiger Lippenbekenntnisse und faktischen Wissens, dass Zwei- und Mehrsprachigkeit weltweit die gesellschaftliche Norm ausmache (vgl. Bhatia/Ritchie 2013; Grosjean 2010), dennoch weiterhin der Fall sei.9 Damit stellt diese einverleibte und inkorporierte Haltung – denn nichts Geringeres ist Habitus als Leib Gewordenes (vgl. Bourdieu 1977) – die unhinterfragte Vorannahme der Einsprachigkeit bei jedweder Aussage bezüglich Sprachen und Sprach(en)erwerb dar. Konzeptionell vergleichbar und wissenssoziologisch nachvollziehbar ist der monolinguale Habitus in seiner Allgegenwärtigkeit und Allmacht annäherungsweise mit der androzentrischen Haltung, die lange unser Denken, Handeln, Schreiben und Verstehen strukturell durchdrungen und geprägt hat und sogar fortwährt und erst effektiv seit der zweiten Frauenbewegung entlarvt und radikal bekämpft wird. Die erneute Umwälzung der 1990er Jahre in den Gender Studies, die mit den Intersektionalitätstheorien, aber auch mit der Etablierung der Migrationsforschung, der Debatte einen neuen Schub gegeben und Kraft verliehen hat (vgl. Knapp 2012; Natarajan 2013b: 287ff., 2016: 185f.), ist noch in der Mehrsprachigkeitsforschung abzuwarten bzw. steckt erst in den Kinderschuhen. Der besagte monolinguale Habitus lässt sich in der Tat fruchtbar auf die deutsche Gesellschaft erweitern und bezieht sich auf die innerhalb, aber auch außerhalb der Schule vorhandene, doch meist verkannte lebensweltliche Mehrsprachlichkeit. Erst durch die Benennung und Sichtbarmachung ist es möglich festzustellen, inwieweit das ideologische Bild von der praktischen Erfahrung abNeumann/Schneider (2011) und zur Schnittstelle Migration und Differenzierung Gogolin/ Nauck (2000), Hamburger/Badawia/Hummrich (2005). 8 | Hier sei angemerkt, es ist zwar ein erster wichtiger und unentbehrlicher Schritt, wenn turns, Wenden und Paradigmenwechsel ausgerufen werden, aber dieser Erkenntnis steht ein langer Weg bevor, bis sich eine flächendeckende Änderung durchsetzt. 9 | Angebracht und eventuell aufschlussreich wäre es hier zu erwähnen, dass lange nur bis zwei gezählt wurde und von Bilingualismus bzw. Zweisprachigkeit die Rede war, wie aus dem Titel eines grundlegenden Handbuchs ersichtlich wird, das erst ab 2012 den Zusatz ›Mehrsprachigkeit‹ bekam und von nun an The Handbook of Bilingualism and Multilingualism heißt. Das lässt sich teilweise als Folge des Paradigmenwechsels bezeichnen.
265
266
Radhika Natarajan
weicht. Die ungewöhnliche Zusammensetzung ›monolingualer Habitus‹ lässt sich als Symptom deuten: das Symptom für eine Krankheit namens Einsprachigkeit. Das weniger Jahre später von Peter Nelde (1997) herausgegebene internationale Jahrbuch der europäischen Soziolinguistik Sociolinguistica nimmt diesen Gedanken auf und betitelt die Ausgabe »Einsprachigkeit ist heilbar«. Ein weiterer sowohl im schulisch-institutionellen als auch im außerinstitutionell-gesellschaftlichen Kontext zu beobachtender Aspekt besteht meiner Auffassung nach in der (Un-)Kontrollierbarkeit von und im Hegemonieanspruch an Sprachen. Wenn Zugang zu Sprachen institutionell angeboten wird, sodass Sprachen bewusst vermittelt und gelernt werden, dann obliegt der Grad der Beherrschung und seine Überprüfung der Macht der Institution. Damit kann den potentiellen Subjekten und werdenden Bürger_innen eines Nationalstaats Zugang gewährt oder verwehrt werden, wie es u.a. in elaborierter Form des selegierenden und segregierenden dreigliedrigen Schulsystems geschieht: Je höher die Anzahl an zurückgelegten Schuljahren ist, desto mehr Sprachen dürfen – allerdings portioniert und kontrolliert – erlernt werden. Diesen Sprachen werden allerdings andere nationalstaatliche Zugehörigkeiten zugeschrieben10 und so die Gefahr herauf beschworen, wonach eine unmittelbare Identifikation mit der erlernten Fremdsprache der Treue einem anderen Staat und dem Verrat der eigenen Nation gegenüber gleichkommen würde und damit effektiv zu unterbinden sei. Demzufolge sträubt sich die sich als einsprachig ansehende, nationalstaatlich geprägte Gesellschaft gegen eine unbewusst und beiläufig erworbene Mehrzahl an Sprachen, nämlich die lebensweltliche Mehrsprachigkeit, die echten Kommunikationsbedürfnissen und -situationen entstammt. Dass sich diese Einsprachigkeit als nicht nur konstituierend für die Nation erwies, sondern dass sie mit biologisierenden Attribuierungen versehen wurde (vgl. Bonfiglio 2010), führte dahin, dass mensch in der Regel eine Sprache innehaben, einer einzigen Sprache innewohnen durfte, dafür aber eigentlich keine andere im gleichen Sinne besaß bzw. besitzen konnte. Das führte zum Klammern am einzigen Sprachbesitz, zum Mythos der Muttersprache und notgedrungen zur Erfindung von native speakers. Auf einen weiteren Aspekt weist Thomas Bonfiglio zudem hin, indem er nicht nur native speakers, sondern auch die native writers in den Mittelpunkt stellt. Dies schließt nahtlos an die Ausführungen zur Erfindung von Traditionen an: Die Art und Weise, in der einem für die Gegenwart als relevant erachteten Phänomen eine plausible Vergangenheit angedichtet wird, beschreibt Eric Hobsbawm (1992: 1f.) mit Beispielen aus England und Schottland als Kulisse. 10 | Sprachen wie Latein, Altgriechisch (wenn das Muster zu erkennen, aber der Blick zu erweitern wäre, dann auch Aramäisch, Sanskrit), die u.a. als heilige Schrift bzw. Sprache der Gelehrten zu verstehen wären, folgen hierbei einer anderen Logik; doch als pränationalstaatlich herrschende Sprachen verkörpern und tragen sie weiterhin im erst in der bürgerlichen Gesellschaft entstandenen, zur Formung treuer und gehorsamer Bürger sowie Soldaten vorgesehenen Schulsystem den Hegemonie- und Exklusivitätsgedanken in sich.
Die Er findung der Einsprachigen
Mit der Zeit erfährt der neu-alte Brauch solch eine Wirkmächtigkeit, gewinnt sogar die Deutungshoheit bzw. reißt sie an sich, dass es weder zu leugnen ist noch einer Kritik unterzogen werden kann. Dieses Verfahren, das immer wieder zu beobachten ist und keinen Einzelfall ausmacht, bezeichnet er als »Erfindung einer Tradition«. Dabei ist zu unterstreichen, dass es hierbei um keinerlei Fortführung oder Aufrechterhaltung schon lange vorhandener Praxen geht, sondern dass Praxen je nach gegenwärtigem Bedarf zurückdatiert, erweitert und neu gewichtet werden. Gänzlich unerhört ist das allerdings nicht, denn zum einen war dieses Vorgehen lange in der Oraltradition Brauch, damit die seinerzeit aktuellen Bedürfnisse und die neue gesellschaftliche und politische Ordnung berücksichtigt werden konnten. Zum anderen ist es genau dieses Verfahren, das die Grundlage für die Memory Studies bildet und das Wiederbeleben bzw. scheinbare Wiederaufkommen von Riten, Ritualen und Gedenkpraxen nachvollziehen lässt.11
Legitimität und Stimme Der Mainzer Gutenberg ist nicht ohne Grund zur Person des Jahrtausends gekürt worden, denn mit seiner Erfindung des Buchdrucks hat er unser Leben bis ins 21. Jahrhundert maßgeblich geprägt und beeinflusst. Benedict Anderson hat den Buchdruck und die Zeit, in der dieser seine bis dato ungeahnte Wirkmacht entwickeln und ausfalten konnte, mit dem zweiten Phänomen dieser historischen Periode gedanklich verbunden, nämlich mit dem Aufkommen des Kapitalismus. In seinem epochalen Werk The Imagined Community hat Anderson (1991) jene Verbindung herausgearbeitet und legt uns nahe, warum es überhaupt zu einer Verschiebung, Verschmelzung und Festlegung von später als Standardsprachen zu bezeichnenden Entitäten kam.12 Es bedarf der Vorstellung von einer Gemeinschaft, die mehrere Sachen teilt, exklusiv ist und andere notgedrungen ausschließt, um annähernd zu einer Idee der Nation zu kommen. Mit dem Auf11 | Für eine ausführliche Auseinandersetzung mit unterschiedlichen theoretischen und Empirie-gestützten Konzepten zu sozialem Gedächtnis und dafür, wie die Gegenwart die Erinnerungen an die Vergangenheit und für die Zukunft bestimmt, vgl. Sebald/Wagle (2016), und zu vergeschlechtlichter Erinnerung im diasporischen Kontext Natarajan (2016). 12 | Mit zahlreichen Beispielen aus einem erstaunlich umfangreichen Wissensrepertoire bezaubert uns Anderson, indem er Martin Luther als den ersten Bestsellerautor, die Gleichwertigkeit von Sprachen mit dem Drucken von zweisprachigen Wörterbüchern, die zuvor Exklusivität beanspruchende Rolle und die Entthronung heiliger Schriften, den Sprachwandel in den später als Großbritannien, Frankreich, Deutschland zu bezeichnenden Nationalstaaten, die Entstehung und die bis in die Gegenwart zur Spaltung führende Sprachpolitik von der Ukraine, die von oben verordnete Russifizierung, die kühne Entscheidung zur lateinischen Schriftart im Türkischen und vieles mehr ausführlich und zugleich atemberaubend zügig beschreibt. Zur zugänglichen und erleichternden Einordnung dieses Klassikers vgl. die Rezeption und den Kommentar von Ruth Mayer (2015).
267
268
Radhika Natarajan
kommen der bürgerlichen Gesellschaft des ausgehenden 18. Jahrhunderts ergibt sich im 19. Jahrhundert die Möglichkeit, eine Nation und einen Nationalstaat zu bilden. Als »verspätete Nation« bezeichnet (vgl. Natarajan 2013a: 314f.), mündet dieser Gedanke in der Bildung des zweiten Reiches und damit in die Gründung der deutschen Nation. Schon hier ist allerdings klar, dass die vermeintlich einheitliche Kategorie des gesprochenen Wortes nicht in der einen Sprache Deutsch zu finden ist. Diese Vorstellung ist schon Anfang des 19. Jahrhunderts, genauer gesagt in den Beschlüssen des Wiener Kongresses von 1815, zunichte gemacht worden.13 Die aktuelle gesellschaftliche Situation zwei Jahrhunderte später verleitet zu dem Gedanken – sofern dem medialen Diskurs Glauben zu schenken wäre –, dass Fluchtmigration eine einmalige historische und gesellschaftliche Gemengelage sei. Ein kurzes Innehalten lehrt bereits, dass Flucht, so tragisch der Gedanke sein mag, bedauerlicherweise weder auf den jetzigen Zeitrahmen begrenzt noch typisch für eine bestimmte Zeitperiode ist. Auch wenn uns ein umfassender Blick auf die Gesamtgeschichte nicht gelingt, können wir im Kontext der Bundesrepublik Deutschland folgendes feststellen: Seit es die Bundesrepublik in der ersten Version gibt, nämlich seit 1949, fand die erste große Menschenwanderung innerhalb dieses Territoriums kurz nach dem Zweiten Weltkrieg statt.14 Ein ähnlicher Tumult, der anderen, geografisch naheliegenden Regionen und Ländern entstammt, führte zum Steigen der Anzahl Asylsuchender Anfang der 1990er Jahre in Folge der Kriege im ehemaligen Jugoslawien. Dies ereignete sich allerdings in der Bundesrepublik der zweiten Version, mit erweitertem Territorium und mit einem schon als innerdeutsch verstandenen Zuwachs der Bevölkerung um etwa 17 Millionen DDR-Bürger_innen, die ab der Vereinigung automatisch – je nach Perspektive – ein- bzw. ausgewandert sind, ohne buchstäblich vom Fleck zu kommen. Ob dieser Zusammenschluss zweier Staaten dazu beitrug, dass Menschen im übertragenen Sinne nicht voran – sozusagen vom Fleck – kamen, oder ob dies zu einer erzwungenen Mobilität führte, sei dahingestellt.15 Außerdem kamen um diese Zeit die aufgrund des Prinzips des ius sanguinis und der Volkszugehörigkeit als dazugehörig und meist als Vertriebene verstandenen Aussiedler_innen und Spätaussiedler_innen dazu. Sie trugen nicht nur zum Anstieg der Bevölkerung, sondern auch zur Mehrsprachigkeit des bundesdeutschen Sprachraums bei.16 13 | Zum Sprachnationalismus im deutschen Kontext vgl. Stukenbrock (2005). 14 | Für einen genaueren Überblick zu dieser Zeit vgl. Bade (2000). 15 | Hier sei angemerkt, dass erzwungene Mobilität gewissermaßen einen Widerspruch darstellt. In den Wortzusammensetzungen oder sprachwissenschaftlich als Kollokationen zu bezeichnenden zwei-Wörter-Paaren wird Zwang mit Armut oder Flucht zusammengesetzt, während Mobilität einen Hauch von Freiheit trägt und einen Zug von Entscheidungsraum enthält. 16 | Statt einer umfassenden Bestandsaufnahme wird hier stellvertretend auf die Schriftenreihen des Instituts für Deutsche Sprache und dessen 2012 von Arnulf Deppermann herausgegebenen Tagungsband Das Deutsch der Migranten hingewiesen.
Die Er findung der Einsprachigen
Der dritte in diesem Zusammenhang relevante Zeitraum wäre die aktuelle Zeit seit etwa 2015 mit der bewussten Entscheidung von oben, Menschen Schutz zu gewähren und damit bestimmte vorherrschende Vereinbarungen und Verträge zeitweise außer Kraft zu setzen; wie z.B. das Dublin-Abkommen, dem zufolge der erste Staat, den potentielle Asylsuchende betreten, für diese Personen und die Bearbeitung ihrer Asylanträge zuständig ist. Mein Anliegen ist es allerdings nicht, eine migrationshistorische Beschreibung und Analyse anzustreben, sondern den Aspekt der Sprache(n), der ihnen zu- und abgeschriebenen Legitimität (vgl. Bourdieu 1977) hervorzuheben und der sich Gehör verschaffenden bzw. überhörten Stimme (vgl. Hymes 1996) mit der realen Fiktion der alleinigen stimmberechtigten Einsprachigen und Muttersprachler_innen in Verbindung zu setzen. Wie die Welt der Gelehrten und der Zugang zu Wissen in den Zeiten vor dem Nationalstaat funktionierte, kann uns als Gegenbeispiel dienen. Bonfiglio (2010: 32f.) ruft dabei in Erinnerung, dass die Sprache der Wissensproduktion und des Wissensaustausches in Europa auf Latein vonstatten ging, welche von keinem der Gelehrten die sogenannte Muttersprache war. Weder »auf dem Schoß der Mutter« noch »mit der Muttermilch einsaugend«, wie uns die biologisierenden und nativistisch geprägten Auslegungen nahebringen wollen, wurde der Zugang zur lateinischen Sprache in Wort und Schrift gesellschaftlich, strukturell und institutionell ermöglicht. In diesem Sinne waren alle insofern gleichgestellt, dass keiner – und ich verwende hier bewusst die männliche Form, weil Frauen lange von dieser Wissensproduktion ausgeschlossen und ferngehalten wurden – bereits eingangs mit der später zu erfolgenden Bildungssprache vertraut gemacht wurde, sondern sie hatten, konnten bzw. beherrschten unterschiedliche Erstsprachen, Dialekte und Mundarten. Demzufolge waren die Gelehrten dieser Zeit alle zwei-, wenn nicht mehrsprachig und mussten sich bewusst die Zweitsprache Latein aneignen. Doch scheinen sie letztendlich in der Lage gewesen bzw. in die Lage versetzt worden zu sein, legitime und berechtigte Anwender der Zweitsprache Latein zu werden. Ihnen wurde nicht von Anfang an die Möglichkeit streitig gemacht, dass sie legitime und berechtigte Nutzer der lateinischen Sprache werden können. Wenn die Frage aufgeworfen wird, warum den Zugewanderten von vornherein der Zugang zu und das Erlernen der jeweiligen Nationalsprache streitig gemacht wird, dann muss die Antwort zwangsläufig in dem Zusammenschluss und der Verschränkung von dem Nationalstaat, der Formel ›eine Sprache – eine Nation‹ und der realen Fiktion der Einsprachigen liegen. Real ist die Narrative, weil sie Konsequenzen nach sich zieht und die Lebensgestaltung von etlichen Menschen prägt und beeinflusst.
Menschen, nicht Sprachen auf der Flucht Wenn ›Sprache‹ erwähnt wird und der vorliegende Text auf Deutsch verfasst und dementsprechend rezipiert wird, dann entsteht unbedacht die Gleichsetzung von ›Sprache‹ mit der deutschen Sprache. Damit geht der automatische, unbewus-
269
270
Radhika Natarajan
ste Ausschluss von fast allen anderen Sprachen aus der Bezeichnung ›Sprache‹ einher. Der deutschen Sprache – und diese Aussage gilt für jeden Nationalstaat, der sich als einsprachig oder mit bestimmten anerkannten bzw. zugelassenen Amtssprachen vorstellt – wird der Status von »Sprache schlechthin« zuerkannt, während alles andere Gesprochene nach dieser Logik zunächst entweder dem Anderen, darauf dem Fremden zugeordnet oder sogar zu einer Nichtsprache heruntergestuft und somit degradiert wird. Dies mag auf den ersten Blick allzu einseitig und radikal wirken, aber wie ist der formelhafte Satz ›Sprache ist der Schlüssel zu …‹ ansonsten zu verstehen und zu deuten? Denn wir unterstellen implizit, die Menschen, welche die Flucht ergreifen und Schutz suchen, seien entweder stumm, sprachlos, ohne Sprache, der Sprache beraubt oder dass eventuell ihrem Leib Schutz gewährt werden könnte, dass sie dafür aber ihre Sprache(n) zurücklassen bzw. aufgeben müssten und sich zum einzigen, die Bezeichnung ›Sprache‹ verdienenden Kommunikationsmittel, nämlich in unserem Fall zur deutschen Sprache, bekennen müssten, um eine Stimme zu bekommen. Inwieweit die Vorannahme der Einsprachigkeit trotz anderweitiger Feststellung, sogar Bloßstellung weiterhin die Forschung beherrscht und das Denken prägt, zeigen die oft angeführten Beispiele von der Vielzahl an Sprachen in einer Stadt. Menschen werden nach ihren Sprachen gefragt, ihre Anzahl wird erhoben, quantitativ gemessen und jeder Person eine Sprache zugeordnet und zugerechnet, damit Großstädte feststellen können, wie viele Sprachen in ihren Städten gesprochen werden (dazu kritisch: zu London vgl. Block 2008; zu Manchester vgl. Robertson et al. 2013; zu New York vgl. Yildiz 2012). Fehlerhaft und unzulänglich ist dieses Denken insofern, als hier scheinbar mit einem neuen Vokabular hantiert wird, indem Bezeichnungen wie Vielfalt, Diversität, Mehrsprachigkeit, Vielsprachigkeit, Pluralismus, Plurilingualität zwar Anwendung finden, aber dennoch im Muster des vorherrschenden Denkens und der Praxis letztlich jeder Person nur eine Sprache, die sogenannte Muttersprache, zugestanden wird. Damit werden Sprachen nebeneinander vorgestellt, statt dass jede einzelne Person in der globalisierten Stadtgesellschaft als mit mehreren Sprachen in unterschiedlicher Ausprägung und mit verschiedenen Kompetenzstufen wahrgenommen und vorgestellt wird. Die eingangs aufgestellte These zur Erfindung der Einsprachigen und zu entstehenden Arten der Distanzierung lässt sich folgendermaßen aufschlüsseln: Die räumliche Distanzierung zur Mehrsprachigkeit erfolgt mit der Benennung von Migration als Grund für Mehrsprachigkeit und daraus folgend die körperliche Distanzierung als Habitus einsprachiger Art. Der eigene institutionelle Bildungsweg mit Kontakt, auch wenn nicht unbedingt erfolgreiches Lernen von mehr als einer Sprache, und die erlebte gesellschaftliche Realität der Stadtgesellschaft werden zugunsten der fiktiven Narrative der Homogenität und Einsprachigkeit zurückgedrängt, folglich zeichnet sich die Distanzierung individualgeschichtlich aus. Daraus ableitend erfolgt die emotionale Distanzierung aufgrund fehlender Identifikation mit sowie Benennungs- und Beschreibungsmöglichkeiten der
Die Er findung der Einsprachigen
eigenen erlebten sprachlichen Vielfalt. Widersprüchlich ist dies, da der Mythos von Einsprachigkeit nicht mit den in der Tat gelebten und erlebten sprachlichen Wirklichkeiten, ausgesprochen in der Mehrzahl, im Einklang steht. Vergeblich ist dieses Abwehren insofern, als Mehrsprachigkeit in der globalisierten, mehrfach medial vernetzten und post-einsprachigen Welt unaufhaltsam und längst in der sich doch mittlerweile nicht ausschließlich als einsprachig vorstellenden Welt angekommen ist.
L iter atur Anderson, Benedict (²1991): Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, London: Verso. Auer, Peter/Wei, Li (2007): »Introduction: Multilingualism as a problem? Monolingualism as a problem?« in: dies. (Hg.), Handbook of Multilingualism and Multilingual Communication, Berlin/New York: Moution de Gruyter. S. 1-12. Bade, Klaus (2000): Europa in Bewegung: Migration vom späten 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart, München: Beck. Betten, Anne (2013): »Sprachbiographien deutscher Emigranten. Die »Jeckes« in Israel zwischen Verlust und Rekonstruktion ihrer kulturellen Identität«, in: Deppermann, Das Deutsch der Migranten, S. 145-191. Bhatia, Tej K./Ritchie, William C. (2013) (Hg.): The Handbook of Bilingualism and Multilingualism, 2. Aufl., Malden: Blackwell. Block, David (2003): The Social Turn in Second Language Acquisition, Washington: Georgetown University Press. Block, David (2008): Multilingual Identities in a Global City: London Stories, Basingstoke: Palgrave Macmillan. Blommaert, Jan (2015): »Language: The Great Diversifier«, in: Steven Vertovec (Hg.), Routledge International Handbook of Diversity Studies, Abingdon: Routledge, S. 83-90. Bonfiglio, Thomas Paul (2010): Mother Tongues and Nations: The Invention of the Native Speaker, New York: de Gruyter Mouton. Bonfiglio, Thomas Paul (2013): »Inventing the Native Speaker«, in: Critical Multilingualism Studies 1(2), S. 29-58. Bourdieu, Pierre (1977): »The Economics of Linguistic Exchanges«, in: Social Science Information 16(6), S. 645-668. Busch, Brigitta (2004): Sprachen im Disput: Medien und Öffentlichkeit in multilingualen Gesellschaften, Klagenfurt: Drava. Busch, Brigitta (2013): Mehrsprachigkeit, Wien: UTB. Davies, Alan (2001): »Native Speaker«, in: Rajend Mesthrie (Hg.), Concise Encyclopedia of Sociolinguistics, Amsterdam/New York: Elsevier, S. 512-519. Deppermann, Arnulf (2012) (Hg): Das Deutsch der Migranten, Jahrbuch des Instituts für deutsche Sprache, Berlin: de Gruyter.
271
272
Radhika Natarajan
Edwards, John (2004): Foundations of Bilingualism, in: Bhatia/Ritchie, Handbook, S. 7-31. Edwards, John (2013): »Bilingualism and Multilingualism: Some Central Concepts«, in: Bhatia/Ritchie, Handbook, S. 5-25. Extra, Guus/Yagmur, Kutlay (2004): Urban Multilingualism in Europe: Immigrant Minority Languages at Home and School, Clevedon/Buffalo/Toronto: Multilingualism Matters. Extra, Guus/Spotti, Massimiliano/van Avermaet, Piet (2009): »Testing Regimes for Newcomers«, in: dies. (Hg.), Language Testing, Migration and Citizenship. Cross-National Perspectives on Integration Regimes, London/New York: Continuum, S. 3-33. Firth, Alan/Wagner, Johannes (1997): »On Discourse, Communication, and (Some) Fundamental Concepts in SLA Research«, in: The Modern Language Journal, 81(3), S. 285-300. Firth, Alan/Wagner, Johannes (1998): »SLA Property: No Trespassing!«, in: The Modern Language Journal, 82(1), S. 91-94. Franceschini, Rita (Hg.) (2010): Sprache und Biographie. (Themenheft). Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik (LiLi) 160. Gogolin, Ingrid (1994): Der monolinguale Habitus der multilingualen Schule, Münster/New York: Waxmann. Gogolin, Ingrid/Kroon, Sjaak (2000): »Einsprachige Schule, mehrsprachige Kinder: Erfahrungen aus einem international vergleichenden Projekt über Unterricht in der Sprache der Majorität«, in: dies. (Hg.), ›Man schreibt wie man spricht‹: Ergebnisse einer international vergleichenden Fallstudie über Unterricht in vielsprachigen Klassen, Münster/New York: Waxmann Verlag, S. 1-25. Gogolin, Ingrid/Nauck, Bernhard (2000) (Hg.): Migration, gesellschaftliche Differenzierung und Bildung. Resultate des Forschungsschwerpunktprogramms FABER, Opladen: Leske und Budrich. Grosjean, François (2010): Bilingual: Life and Reality, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. Hamburger, Franz/Badawia, Tarek/Hummrich, Merle (2005) (Hg.): Migration und Bildung: Über das Verhältnis von Anerkennung und Zumutung in der Einwanderungsgesellschaft, Wiesbaden: Springer VS. Heller, Monica (Hg.) (2007): Bilingualism: A Social Approach, Basingstoke: Palgrave Macmillan. Hentges, Gudrun/Hinnenkamp, Volker/Zwengel, Almut (Hg.) (2010): Migrations- und Integrationsforschung in der Diskussion. Biografie, Sprache und Bildung als zentrale Bezugspunkte, 2. aktualisierte Auflage, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. Hobsbawm, Eric (1992): »Introduction: Inventing Traditions«, in: ders./Terence Ranger (Hg.), The Invention of Tradition, Cambridge: Canto Cambridge University Press, S. 1-14.
Die Er findung der Einsprachigen
Hymes, Dell (1996): Ethnography, Linguistics, Narrative Inequality. Towards an Understanding of Voice, London/Bristol: Taylor & Francis. Knapp, Gudrun-Axeli (2012): Im Widerstreit: Feministische Theorie in Bewegung. Wiesbaden: Springer VS. Krüger-Potratz, Marianne (1998): »Fremdsprachige Volksteile« und deutsche Schule: Schulpolitik für die Kinder der autochthonen Minderheiten in der Weimarer Republik, Münster: Waxmann. May, Stephen (2013): The Multilingual Turn: Implications for SLA, TESOL and Bilingual Education, Abingdon: Routledge. Mayer, Ruth (2015): »Die Geburt der Nation als Migrationspraxis. Benedict Anderson’s ›Imagined Community‹«, in: Julia Reuter/Paul Mecheril (Hg.), Schlüsselwerke der Migrationsforschung, Wiesbaden: Springer Verlag VS, S. 263273. Mecheril, Paul (2004): Einführung in die Migrationspädagogik, Weinheim: Beltz. Natarajan, Radhika (2009): »Die Flucht ergreifen, die Initiative auch?«, in: Herkunft als Schicksal? Hürdenlauf zur Inklusion. Dossier, Berlin: HeinrichBöll-Stiftung. Natarajan, Radhika (2012): »Multilingualität einer Flüchtlingsfrau. Zwei Welten durch die Sprachbrille«, in: Crossing Germany: Bewegungen und Räume der Migration. Dossier, Berlin: Heinrich-Böll-Stiftung, S. 40-43. Natarajan, Radhika (2013a): Mannigfaltig unisono? Integration durch Sprach- und Orientierungskurse, in: Katrin Hauenschild/Steffi Robak/Isabel Sievers (Hg.), Diversity Education. Zugänge – Perspektiven – Beispiele. Buchreihe Bildung in der Weltgesellschaft Band 6, Frankfurt a.M.: Brandes & Apsel, S. 313-330. Natarajan, Radhika (2013b): »Das biographische Gepäck: Ehrenamtliches Engagement bei sri-lankisch tamilischen Flüchtlingsfrauen«, in: Susanne Brogi/ Carolin Frier/Ulf Freier-Otten/Katja Hartasch (Hg.), Repräsentationen von Arbeit: Transdisziplinäre Analysen und künstlerische Produktionen, Bielefeld: transcript, S. 281-298. Natarajan, Radhika (2015): »Memories Engendered in Diaspora: Multivocal Narratives of Tamil Refugee Women«, in: Gerd Sebald/Jatin Wagle (Hg.), Theorizing Social Memories: Concepts and Contexts, Abingdon: Routledge, S. 184207. Nelde, Peter H. (1997) (Hg.): Einsprachigkeit ist heilbar: Überlegungen zur neuen Mehrsprachigkeit Europas. Socolinguistica Band 11, Tübingen: Niemeyer. Neumann, Ursula/Schneider, Jens (2011) (Hg.): Schule mit Migrationshintergrund, Münster: Waxmann. Oksaar, Els (2003): Zweitspracherwerb. Wege zur Mehrsprachigkeit und zur interkulturellen Verständigung, Stuttgart: Kohlhammer. Pavlenko, Aneta (2005): Emotions and Multilingualism, Cambridge: Cambridge University Press.
273
274
Radhika Natarajan
Robertson, Alex/Gopal, Deepthi/Wright, Marie/Matras, Yaron/Jones, Charlotte (2013): Mapping Community Language Skills: The School Language Survey in Manchester, Manchester: University of Manchester. Sachverständigenrat (2011): »Zuwanderung von Familienangehörigen«, in: Migrationsland 2011. Jahresgutachten 2011 mit Migrationsbarometer des Sachverständigenrates der deutschen Stiftungen für Integration und Migration, Berlin, S. 97-114. Sebald, Gerd/Wagle, Jatin (Hg.) (2015): Theorizing Social Memories: Concepts and Contexts, Abingdon: Routledge. Stukenbrock, Anja (2005): Sprachnationalismus. Sprachreflexion als Medium kollektiver Identitätsstiftung in Deutschland (1617-1945), Berlin: de Gruyter. Treichel, Bärbel (2004): Identitätsarbeit, Sprachbiographien und Mehrsprachigkeit: autobiographisch-narrative Interviews mit Walisern zur sprachlichen Figuration von Identität und Gesellschaft, Frankfurt a.M.: Lang. Yildiz, Yasemin (2012): Beyond the Mother Tongue: The Postmonolingual Condition, New York: Fordham University Press.
Professionalisierung von Lehramtsstudierenden im Kontext von Fluchtmigration Mona Massumi und Karim Fereidooni
Zusammenfassung Wie muss sich Lehrer*innenbildung in Bezug auf die Beschulung neu zugewanderter Schüler*innen verändern, um angehende Lehrer*innen für den Umgang mit Traumatisierung, Alphabetisierung, Spracherwerb im Deutschen und den Aufbau einer reflexiven Haltung unter rassismuskritischer Perspektive zu qualifizieren? Dieser Beitrag widmet sich diesen Fragestellungen, indem zunächst die bildungsrechtliche Situation geflüchteter Kinder und Jugendlicher in NRW dargestellt wird, um daran anknüpfend das universitäre Angebot PROMPT als Beispiel zu präsentieren, wie auf die neuen Herausforderungen reagiert werden kann. Ferner werden die Chancen dieses Projekts für die Professionalisierung angehender Lehrer*innen herausgestellt und ein Ausblick auf die zukünftigen Perspektiven des dargestellten Handlungsprogramms gegeben.
Abstract: The Professionalization of Education Students in the Context of Forced Migration With regards to the education of newly arrived migrant students, how should teacher training programs be transformed to assist prospective teachers to better deal with trauma, literacy teaching and German language acquisition, and to promote the development of reflective attitudes informed by anti-racist perspectives? This paper focuses on these questions by first outlining the legal situation of refugee children and youth in North Rhine-Westphalia (NRW), and follows on by presenting the university program PROMPT as an example of how these new challenges can be addressed. Furthermore, the paper emphasizes the opportunities that the project offers for the professionalization of prospective teachers, and provides an insight into the future prospects of this particular program.
276
Mona Massumi und Karim Fereidooni
1. E inleitung Bereits seit den 1970er Jahren findet die schulische Auseinandersetzung mit Schüler*innen ohne bzw. mit unzureichenden Deutschkenntnissen im deutschen Schulwesen statt (vgl. Fereidooni 2012: 263f.), doch seit 2015 steht fast ausschließlich die sprachliche Bildung geflüchteter Kinder und Jugendlicher im Fokus des schulischen Interesses. Diesbezüglich werden insbesondere die folgenden Fragen diskutiert: Wie können die finanziellen und personellen Ressourcen der jeweiligen Schule mit den Bedürfnissen der neu zugewanderten Schüler*innen in Einklang gebracht werden? Welche Unterrichtsformen eigenen sich für die Beschulung geflüchteter Kinder und Jugendlicher? Inwiefern muss sich Lehrer*innenbildung der veränderten Ausganglage in Bezug auf die Beschulung schutzbedürftiger Schüler*innen verändern, um angehende Lehrer*innen für die nachfolgenden Aufgaben zu qualifizieren: Umgang mit Traumatisierung, Alphabetisierung, Spracherwerb im Deutschen, Auf bau einer reflexiven Haltung unter rassismuskritischer Perspektive. Dieser Beitrag widmet sich diesen Fragestellungen, indem nachfolgend zunächst die bildungsrechtliche Situation geflüchteter Kinder und Jugendlicher in NRW dargestellt wird (2), um daran anknüpfend, beispielhaft das universitäre Angebot »PROMPT! Deutsch lernen« zu präsentieren (3). Ferner werden die Chancen dieses Projekts für die Professionalisierung angehender Lehrer*innen herausgestellt (4) und ein Ausblick auf die zukünftigen Perspektiven des dargestellten Handlungsprogramms gegeben und die Bedeutsamkeit von Sprache und Sprachlernen als unabdingbares Instrument der kulturellen Partizipation neuer Bürger*innen dargestellt (5).
2. B ildungsrechtliche R ahmenbedingung Obwohl für alle Kinder und Jugendlichen im schulpflichtigen Alter nach der Migration in die BRD theoretisch das Recht auf Schulbildung besteht,1 ergeben sich in der Praxis Einschränkungen aus Regelungen zur Schulpflicht, die sich explizit auf Asylbewerber*innen sowie Menschen ohne aufenthaltsrechtlichen Status beziehen. So gilt die Schulpflicht in den meisten Bundesländern, wie z.B. Hessen, Mecklenburg-Vorpommern oder Nordrhein-Westfalen, erst ab der Zuweisung an eine Gebietskörperschaft oder nach einem bestimmten Zeitraum, z.B. von drei Monaten in Thüringen (vgl. Massumi/von Dewitz et al. 2015: 38f.). Auch wenn in dem Zeitraum, in dem die Schulpflicht noch nicht greift, ein Schulbesuchsrecht 1 | Vgl. Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen (Artikel 26), die Genfer Flüchtlingskonvention (Artikel 21), die UN-Kinderrechtskonvention (Artikel 28) sowie den Gleichbehandlungsgrundsatz des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland (Artikel 3).
Professionalisierung von Lehramtsstudierenden
besteht, sind die Kinder und Jugendlichen oft faktisch vom Schulbesuch ausgeschlossen, da sie von der jeweiligen Gebietskörperschaft (aufgrund der fehlenden Zuweisung) keiner Schule zugeteilt werden. Angesichts der ausgeschöpften Kapazitäten in vielen Kommunen, der steigenden Zahlen geflüchteter Menschen in Deutschland und den damit verbundenen Bearbeitungsbelastungen beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) verzögert sich die Zuweisung der Menschen in Kommunen, Gemeinden oder einen Landkreis, so dass geflüchtete Kinder und Jugendliche in dieser Wartezeit in vielen Bundesländern vom Zugang zu Schulen faktisch ausgeschlossen bleiben und sich ihre schulbiografischen Brüche vergrößern. Neben der prekären Situation für geflüchtete Kinder und Jugendlichen hinsichtlich des faktischen Schulzugangs werden Lehrkräfte sowie Lehramtsstudierende bisher unzureichend auf die Arbeit mit neu zugewanderten Schüler*innen mit fehlenden bzw. geringen Sprachkenntnissen im Deutschen vorbereitet. In NRW ist das Modul »Deutsch für Schülerinnen und Schüler mit Zuwanderungsgeschichte« unabhängig der studierten Schulform und -fächer zwar obligatorisch für Lehramtsstudierende (MSW 2009, §11 (7) LABG), jedoch kann mit Veranstaltungen im Umfang von sechs Leistungspunkten der Komplexität des Feldes kaum Rechnung getragen werden. Es stellt sich also die folgende Frage: Wie können angehende Lehrkräfte auf die pädagogische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im Kontext von Migration und Fluchterfahrungen vorbereitet werden?
3. »PROMPT! D eutsch lernen « Seit April 2014 existiert das Kooperationsangebot »PROMPT! Deutsch lernen« zwischen der Stadt Köln, dem Deutschen Roten Kreuz sowie dem Zentrum für LehrerInnenbildung der Universität zu Köln.2 Im Rahmen von PROMPT werden Lehramtsstudierende, unabhängig von ihrer studierten Schulform und ihren Fächern, universitär von einer in dem Feld erfahrenen, abgeordneten Lehrkraft und einer Kinder- und Jugendpsychotherapeutin mit Schwerpunkt auf Traumatisierung professionell angeleitet, um in ihrem Berufsfeldpraktikum (BFP) Sprachförderangebote für geflüchtete Kinder und Jugendliche (ohne Schulplatz) im Alter zwischen sechs und 18 Jahren in Notunterkünften der Stadt Köln durchzuführen.3 Nachfolgend werden die einzelnen Bestandteile von PROMPT vor-
2 | Seit September 2015 wurde »PROMPT! Deutsch lernen« auf die Stadt Düsseldorf ausgeweitet. Es findet eine Kooperation zwischen der Stadt Düsseldorf, dem Malteser Hilfsdienst und dem ZfL der Universität zu Köln statt. 3 | Angesichts der unterschiedlichen Auslastungszahlen der Bewohner*innen in den Notunterkünften (zwischen 190 und 600 Personen) und der hohen Fluktuation der Bewohner*innen können keine genauen Angaben zu den geförderten Kindern und Jugendlichen
277
278
Mona Massumi und Karim Fereidooni
gestellt: (3.1) Vorbereitungs-, (3.2) Durchführungs- und Begleitungs- sowie (3.3) Abschlussphase.
3.1 Vorbereitungsphase Die Lehramtsstudierenden müssen an die Besonderheiten ihrer zukünftigen Lerngruppe in den Notunterkünften herangeführt werden. Gemeinsam ist den zu fördernden Lernenden, dass sie zum einen keine bzw. rudimentäre Sprachkenntnisse im Deutschen besitzen und zum anderen eine persönliche Fluchterfahrung mitbringen. Insgesamt weisen sie jedoch hinsichtlich ihrer bisherigen (Bildungs-)Biografien eine hohe Heterogenität auf. Die folgenden fünf thematischen Schwerpunkte sind Gegenstände der Vorbereitungsphase: (1) Rollen- und Selbstreflexion, (2) Grundlagen zur Situation geflüchteter Menschen in Deutschland, (3) Umgang mit belastenden Lebenssituationen, (4) Spracherwerb, -förderung und Alphabetisierung, (5) Methodischdidaktische Grundlagen.
3.2 Durchführungs- und Begleitungsphase Die Lehramtsstudierenden entwickeln – vor dem Hintergrund der Vorbereitungsphase – eigenständig ihr Unterrichtsmaterial und führen semesterbegleitend in Lehrteams von je zwei Personen über zwei Stunden pro Woche Sprachförderkurse im Deutschen in den Förderräumen der zugewiesenen Notunterkunft durch. Bei den Lerngruppen wird auf Altershomogenität geachtet und die Gruppengröße umfasst sechs bis acht Lerner*innen, wobei sich die Lerner*innenkonstellation – aufgrund der hohen Fluktuation der Notunterkunftbewohner*innen wöchentlich verändern kann. Vorrangige Ziele der Sprachförderkurse sind: (1) eine positive Lernatmosphäre zu schaffen und (2) Sprachförderung im Deutschen sowie ggf. Alphabetisierung (im lateinischen Schriftsystem) zu ermöglichen. Angesichts der unterschiedlichen Voraussetzungen und der individuellen Verweildauer der Lernenden (von einer bis mehreren Kursstunden) ist es nicht möglich, einen einheitlichen Sprachstand (und Alphabetisierungsgrad) im Deutschen anzustreben. In der ersten und/oder zweiten Kursstunde werden die Lehrteams von den Dozierenden begleitet. Im Anschluss daran erfolgt ein Reflexionsgespräch über die beobachtete Förderstunde. Die Studierenden werden dabei unterstützt, sich in ihrer Rolle selbstkritisch sowie differenziert wahrzunehmen und über ihr eigenes Handeln nachzudenken und ggf. Handlungsalternativen zu entwickeln. Die Studierenden können sich auf den folgenden Ebenen spezifische Unterstützung einholen:
gemacht werden. Wöchentlich erfahren zum aktuellen Zeitpunkt zwischen 320 und 400 Kinder und Jugendliche Deutschförderung durch PROMPT.
Professionalisierung von Lehramtsstudierenden
1. Inhaltliche sowie methodisch-didaktisch Ebene: durch die Projektleiterin (abgeordnete Lehrkraft) und durch Studierende, die bereits bei PROMPT ihr Praktikum absolviert haben. 2. Psychologische Ebene: durch die Kinder- und Jugendpsychotherapeutin. 3. Sozialpädagogische Ebene: durch Sozialpädagog*innen, die in den jeweiligen Notunterkünften vor Ort tätig sind. Neben den Kursstunden in den Notunterkünften, die die Studierenden wöchentlich in ihrem e-Portfolio protokollieren, hospitieren sie für einen Arbeitstag in der Kinder- und Jugendbetreuung der jeweiligen Notunterkunft, um einen umfangreicheren Einblick in die Lebenswelt ihrer Lernenden zu erhalten. Nach etwa sechs bis sieben Wochen findet eine Zwischenreflexion mit den Studierenden im Plenum statt, bei der die Studierenden sich zum einen über Erfahrungen austauschen können; zum anderen werden diese Erfahrungen in theoretische Zusammenhänge eingeordnet, so dass Reflexionsanlässe initiiert werden.
3.3 Abschlussphase Am Ende des BFP verfassen die Studierenden in ihrem Portfolio eine schriftliche (unbenotete) Abschlussreflexion. In Abgleich mit anfänglich formulierten Erwartungen und Zielsetzungen setzen sich die Studierenden damit auseinander, inwieweit sie ihre eigenen Erwartungen erfüllen konnten und inwiefern das BFP ihr professionelles Selbstkonzept beeinflusst hat.
4. C hancen für die universitäre L ehrer*innenbildung Aus PROMPT lassen sich die folgenden sieben Chancen für die Lehrer*innenbildung ableiten:4 I. Ermöglichung von Selbstwirksamkeitserfahrungen und Unterstützung der Professionalisierung: Bereits zu Beginn der Ausbildung erhalten Lehramtsstudierende die Möglichkeit, praktische Unterrichtserfahrungen zu sammeln und sich in hochkomplexen Lernsituationen auszuprobieren. Diese Lernanlässe fördern positive Selbstwirksamkeitserfahrungen der Studierenden (vgl. Schwerdtfeger 2011: 70) und unterstützen sie frühzeitig in ihrem Professionalisierungsprozess. Die enge Verzahnung zwischen Theorie und Praxis fördert die (nachhaltige) Anwendung didaktischen Wissens (vgl. Arnold et al. 2011: 74).
4 | Vgl. dazu die ausführliche Darstellung in Massumi 2015a: 21f.
279
280
Mona Massumi und Karim Fereidooni
II. Selbstreflexion sowie Nutzung professioneller Netzwerke: Angesichts der Interdisziplinarität weiten die Studierenden ihren Blick für die Komplexität von Lernprozessen. Lehramtsstudierende werden frühzeitig dazu angehalten, ihre eigene Rolle mit den damit einhergehenden Kompetenzen, Handlungsmöglichkeiten sowie -grenzen kritisch wahrzunehmen. Durch den Einbezug professioneller Akteur*innen aus den Bereichen der Kinder- und Jugendpsychotherapie sowie der Sozialen Arbeit werden die Studierenden sukzessive an die Arbeit in multiprofessionellen und interdisziplinär arbeitenden Teams herangeführt. III. Profilbildung unterstützt die Schul- und Unterrichtsentwicklung: Unter Rückgriff auf ihre reflektierten Erfahrungen im BFP können die angehenden Lehrer*innen in ihren Berufskontexten die Schul- sowie Unterrichtsentwicklung vorantreiben. Auf diese Weise können sie dazu beitragen, neu zugewanderte Schüler*innen erfolgreich in den Regelunterricht einzubinden. IV. Notwendigkeit sprachsensiblen Handelns und individuellen Förderns: In den Sprachförderkursen erkennen die Studierenden die Notwendigkeit, in ihrem Berufskontext sprachlich sensibel zu handeln. Außerdem erfahren die Studierenden aufgrund der Heterogenität der Lernenden in den Sprachförderkursen die Relevanz individueller Förderung. V. Diversität der Schüler*innenschaft einer Migrationsgesellschaft anerkennen: Die Studierenden lernen durch ihre Erfahrungen im BFP, geflüchteten Kindern und Jugendlichen mit Selbstverständlichkeit zu begegnen und sie als Teil der gesellschaftlichen Lebenswirklichkeit sowie der diversen Schüler*innenschaft anzuerkennen. VI. Entwicklung einer rassismuskritischen Haltung:5 Durch kontinuierliche Impulse werden die Studierenden angeleitet, sich kritisch mit ihren eigenen normativen Vorstellungen auseinanderzusetzen. Auf diese Weise reflektieren sie ihr eigenes (sowie gesellschaftlich bzw. medial transportiertes) »rassistisches Wissen« (Terkessidis 2004: 10) und defizitorientierte Annahmen über geflüchtete Menschen. Durch die Dokumentation ihrer Reflexionen werden die Studierenden zunehmend dazu angeleitet, sich mit ihren eingangs bestehenden stigmatisierenden Zuschreibungen gegenüber geflüchteten Menschen auseinanderzusetzen. Diese rassismuskritische Auseinandersetzung (vgl. Fereidooni/Massumi 2016) und Sensibilisierung kann dazu beitragen, eigene rassismusrelevante Wissensbestände zu thematisieren (vgl. Fereidooni 2016).
5 | Vgl. dazu die Auswertung der Reflexionen in Massumi 2015b: 207f.
Professionalisierung von Lehramtsstudierenden
VII. Partizipation anleiten und gesellschaftliche Verantwortung übernehmen: Durch die Erfahrungen in den Sprachförderkursen werden die Studierenden in einem professionellen, individuellen sowie gesellschaftlich relevanten Kontext in ihrem Entwicklungsprozess unterstützt. Geleitet durch ein demokratisches Grundverständnis ermöglichen die Studierenden mit den Sprachförderkursen geflüchteten Kindern und Jugendlichen in Notunterkünften, die in dieser Lebensphase explizit (Bildungs-)Benachteiligung erfahren, einen ersten Bildungszugang.
5. A usblick In der vorliegenden Darstellung wurde herausgearbeitet, dass nicht nur das inhaltliche Fundament geschaffen werden muss, sondern auch die grundlegenden organisatorischen und strukturellen Rahmenbedingungen berücksichtigt werden müssen, die ein solches Projekt erst ermöglichen. Voreilige, nicht durchdachte Interventionen bergen die Gefahr, dass Studierende überfordert und den Kindern bzw. Jugendlichen unwirksame Bildungsangebote bereitgestellt werden. Dementsprechend müssen die folgenden Qualitätsstandards auf unterschiedlichen Handlungsebenen eingehalten werden, damit Angebote wie PROMPT wirksam sein können: 1. Die institutionelle Verankerung in die Lehrer*innenbildung sowie die Kooperation zwischen lehrer*innenbildender Institution und Kommune (und ggf. weiteren Akteur*innen) schafft den Rahmen für Praxisangebote. 2. Die Komplexität der Anforderungen für Sprach- bzw. Bildungsangebote für geflüchtete Kinder und Jugendliche muss berücksichtigt werden, indem a) eine interdisziplinäre Auseinandersetzung in multiprofessioneller Zusammenarbeit erfolgt und b) Studierende umfassend vorbereitet sowie begleitet werden. Erst wenn die komplexen Organisations- und Handlungsebenen Berücksichtigung finden, kann ein nachhaltiges Angebot geschaffen werden, in dem sowohl Studierende professionalisiert als auch die neu zugewanderten Kinder und Jugendlichen in einer Notunterkunft gefördert werden. Insgesamt trägt das Angebot dazu bei, im Sinne der gemeinsamen Empfehlung der Hochschulrektorenkonferenz und Kultusministerkonferenz die »Lehrerbildung für eine Schule der Vielfalt« (HRK/KMK 2015) zu gestalten und die Studierenden so auf die Diversität ihrer zukünftigen Schüler*innenschaft vorzubereiten. Zu konstatieren ist, dass die Funktion von Sprache im Prozess der Kulturellen Bildung grundlegend ist. Sprache und Sprachenlernen stellen ein unabdingbares Instrument der kulturellen Partizipation neuer Bürger*innen dar. Kulturelle Teilhabe wird oftmals über Sprache vermittelt und durch sie ermöglicht. Aus
281
282
Mona Massumi und Karim Fereidooni
diesem Grund sind gesicherte Kompetenzen in der (deutschen) Sprache relevant für geflüchtete Kinder und Jugendliche. Das Projekt PROMPT möchte mit seinen beiden Zielaspekten a) Vermittlung der deutschen Sprache für geflüchtete Kinder und Jugendliche und b) Professionalisierung angehender Lehrer*innen im Umgang mit geflüchteten Kindern und Jugendlichen einen Beitrag dazu leisten, dass die Kulturelle Bildung neu nach Deutschland eingereister Menschen möglich wird. Hervorzuheben ist allerdings, dass die Anbahnung der Kulturellen Bildung, die durch PROMPT geschieht, sowohl den involvierten Lehramtsstudierenden als auch den geflüchteten Kindern und Jugendlichen gleichermaßen zugutekommt und nicht einseitig auf die Bildung Zweitgenannter abzielt. Gerade vor dem Hintergrund aktueller Migrationsbewegungen in die BRD muss die Kulturelle Bildung Antworten auf folgende Fragen finden: Wie kann Kulturelle bzw. Ästhetische Bildung für und durch geflüchtete und andere neu zugewanderte Schüler*innen gestaltet werden? Wie können die neuen Bürger*innen bei der Ausgestaltung der Kulturellen Bildung in der BRD partizipieren? Welche Rolle nehmen die nicht-deutschen Sprachkenntnisse der neu zugewanderten Bürger*innen in der Kulturellen Bildung ein?
L iter atur Arnold, Karl-Heinz et al. (2011): Empowerment durch Schulpraktika. Perspektiven wechseln in der Lehrerbildung, Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt. Fereidooni, Karim/Massumi, Mona (i.E. 2016): »Die rassismuskritische Professionalisierung von (angehenden) Lehrkräften. Die Notwendigkeit einer Kompetenzerweiterung«, in: Sebastian Barsch/Nina Glutsch/Mona Massumi (Hg.), Blickwechsel Diversity: Internationale Perspektiven in der LehrerInnenbildung, Münster: Waxmann. Fereidooni, Karim (2016): »Diskriminierungs- und Rassismuserfahrungen von Referendar_innen und Lehrer_innen ›mit Migrationshintergrund‹ im deutschen Schulwesen. Eine quantitative und qualitative Studie zu subjektiv bedeutsamen Ungleichheitspraxen im Berufskontext.« http://archiv.ub.uni-hei delberg.de/volltextserver/20203/ (letzter Zugriff: 15.03.2016). Fereidooni, Karim (2012): »Kinder mit Migrationshintergrund im deutschen Schulwesen – Benachteiligung aus (Bildungs-)politischen Ursachen?«, in: Gesellschaft – Wirtschaft – Politik (GWP), 3/2012, S. 363-371. HRK/KMK – Hochschulrektorenkonferenz/Kultusministerkonferenz (Hg.) (2015): Lehrerbildung für eine Schule der Vielfalt. Gemeinsame Empfehlung von Hochschulrektorenkonferenz und Kultusministerkonferenz. (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 12.03.2015/Beschluss der Hochschulrektorenkonferenz vom 18.03.2015) www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2015/2015_03_12-Schule-der-Vielfalt.pdf (letzter Zugriff: 15.03.2016).
Professionalisierung von Lehramtsstudierenden
Massumi, Mona (2015a): »Sprachförderung für Kinder und Jugendliche in der Notunterkunft für Flüchtlinge im Rahmen des Berufsfeldpraktikums – Das Konzept und bisherige Erfahrungswerte zwischen April 2014 bis Mai 2015.« http://zfl.uni-koeln.de/sites/zfl/pp-innovativ/ZfL-PP-Innovativ02.pdf (letzter Zugriff: 15.03.2016). Massumi, Mona (2015b): »Sprachförderung für geflüchtete Kinder und Jugendliche ohne Schulzugang – Zur Bedeutung eines Angebots von Lehramtsstudierenden im Rahmen des Berufsfeldpraktikums an der Universität zu Köln.«, in: Claudia Benholz/Magnus Frank/Constanze Niederhaus (Hg.): Neu zugewanderte SchülerInnen – Eine Gruppe mit besonderen Potenzialen. Beiträge aus Forschung und Schulpraxis., Münster: Waxmann, S. 197-216. Massumi, Mona/von Dewitz, Nora et al. (2015): Neu zugewanderte Kinder und Jugendliche im deutschen Schulsystem. Bestandsaufnahme und Empfehlungen, Köln: Mercator-Institut für Sprachförderung und Deutsch als Zweitsprache, Zentrum für LehrerInnenbildung, Arbeitsbereich Interkulturelle Bildungsforschung an der Universität zu Köln. MSW – Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen (Hg.), (2009): »Lehrerausbildungsgesetz – LABG vom 12. Mai 2009. Zuletzt geändert durch das Gesetz vom 28. Mai 2013. Stand 01.06.2015.« www. schulministerium.nrw.de/docs/Recht/LAusbildung/LABG/LABGNeu.pdf (letzter Zugriff: 15.03.2016). Schwerdtfeger, Andreas (2011): »Selbstwirksamkeit im Lehramt: Eine Ressource gegen Stress?«, in: Marcia Dursika/Ulrich Ebner-Priemer/Michael Stolle (Hg.). Rückenwind. Was Studis gegen Stress tun können. www.gesundheitsfoer dernde-hochschulen.de/Downloads/2011_KIT_Broschuere_Rueckenwind. pdf (letzter Zugriff: 15.03.2016). Terkessidis, Mark (2004): Die Banalität des Rassismus. Migranten zweiter Generation entwickeln eine neue Perspektive, Bielefeld: transcript.
283
ICOON for Refugees Ein Bildwörterbuch zur ersten Kommunikation für Geflüchtete und ihre Helfer_innen Gosia Warrink und Monika Pfau
Zusammenfassung ICOON for refugees ist ein Bildwörterbuch mitsamt einer Android-App, das speziell für die Bedürfnisse von Geflüchteten konzipiert wurde. 1.200 Symbole, Piktogramme und Fotos helfen bei der ersten Kommunikation. Durch einen einfachen Fingerzeig auf das entsprechende Bild können Bedürfnisse über Sprachbarrieren hinweg kommuniziert werden. Das Hilfsprojekt des Berliner Verlages AMBERPRESS wurde im November 2015 mithilfe einer Crowdfunding Kampagne umgesetzt. Die Erstauflage von 30.000 Büchern wurde im Dezember 2015 an Geflüchtete und ihre Helfer_innen verschenkt. Im Februar 2016 folgte die zweite Auflage von 20.000 Büchern. Die Designerin und Autorin Gosia Warrink und die Kunsthistorikerin Monika Pfau beschreiben den Verlauf des Projektes in seiner kurzen Entstehungszeit von nur sechs Monaten, skizzieren das Grundkonzept des Buches und geben einen Ausblick auf die weiteren Verwendungsmöglichkeiten von Bildsprache innerhalb der interkulturellen Verständigung.
Abstract: ICOON for Refugees — A Pictorial Dictionary for Initial Communication between Refugees and their Supporters ICOON for refugees is a pictorial dictionary and Android app which was specially designed for the needs of refugees. 1,200 symbols, pictograms and photos aid initial communication. Just by pointing a finger at the corresponding picture, needs can be communicated beyond the borders of language. This project was implemented in November 2015 by the Berlin publisher AMBERPRESS with the help of a crowd-funding campaign. The first edition of 30,000 books was given away in December 2015 to refugees and their supporters. In February 2016, the second edition of 20,000 books followed. The designer and author Gosia Warrink and the art historian Monika Pfau describe the process of the project over its short, six-month period of development, sketch out the basic concept of the book and give an overview of the further possibilities of using visual language within the field of intercultural communication.
286
Gosia Warrink und Monika Pfau
Abbildung 1: ICOON for refugees Buchcover © AMBERPRESS/Gosia Warrink
ICOON for refugees1 ist ein Bildwörterbuch, das speziell für Geflüchtete und ihre Helfer_innen konzipiert wurde. 1.200 Symbole, Piktogramme und Fotos helfen bei der ersten Kommunikation. Durch einen einfachen Fingerzeig auf das entsprechende Bild können Bedürfnisse über Sprachbarrieren hinweg kommuniziert werden. Das Hilfsprojekt des Berliner Verlages AMBERPRESS wurde im November 2015 mithilfe einer Crowdfunding Kampagne umgesetzt.2 Die Erstauflage von 30.000 Büchern wurde im Dezember 2015 an Geflüchtete und ihre Helfer_innen verschenkt. Bereits im Februar 2016 folgte die zweite Auflage von 20.000 Büchern. Der Verlag AMBERPRESS, bestehend aus der Gründerin, Designerin und Autorin Gosia Warrink, der Designerin Katja Koeberlin und der Kunsthistorikerin Monika Pfau, verlegt seit 2007 das Bildwörterbuch ICOON. Dieses wird hauptsächlich von Reisenden verwendet, die sich in Gegenden bewegen, in denen sie der Landessprache nicht mächtig sind. Aber auch bei Schlaganfallpatienten oder Gehörlosen hat sich das Bildwörterbuch bewährt. Seit 2004 arbeitet Gosia Warrink an einem ständig wachsenden Pool von mittlerweile über 3.000 hand1 | ISBN: 978-3-9809655-5-2. Über 1.200 Symbole und Fotos, Fragen, Antworten und Aussagen in Deutsch, Englisch, Französisch, Arabisch, Farsi und Urdu, 12 Kategorien, 52 Seiten, Welt-, Europa- und Deutschlandkarte, folienbeschichtetes Softcover, Rückstichheftung. Beziehbar gegen 20 Euro finanzielle Unterstützung unter www.icoon-book.com/ shop; für Hilfsorganisationen auf Anfrage unter www.amberpress.eu. 2 | Vgl. www.startnext.com/icoonforrefugees
ICOON for Refugees
gezeichneten Symbolen und 400 selbst erstellten Fotos. Kurz vor dem Höhepunkt der Flüchtlingsbewegung nach Deutschland im Sommer 2015 bekam der Verlag u.a. aufgrund eines Beitrages im rbb-Fernsehen3 Anfragen vom Deutschen Roten Kreuz und anderen ehrenamtlichen Hilfsinitiativen4 nach kostenlosen ICOON Bildwörterbüchern. Die Vereine und Initiativen klagten über massive Sprachbarrieren und den Mangel an Übersetzer_innen an den Grenzübergängen und in den Notunterkünften. Insbesondere die Fragen nach der Herkunft, Verpflegung und der medizinischen Versorgung bereiteten den Helfer_innen aufgrund der Sprachvielfalt große Probleme. Reguläre Wörterbücher waren aufwändig und langwierig in der Handhabung. Viele Flüchtlinge sprachen aufgrund von Traumata gar nicht, wiederum andere konnten weder lesen noch schreiben. Um schnell helfen zu können, spendete der Verlag in den Monaten Juli bis September 2015 über 2.000 kostenlose ICOON Bücher und begann, sich der Dringlichkeit der Thematik inhaltlich anzunehmen. Um für alle eine rasche Kommunikationshilfe leisten zu können, wurde im September 2015 ein »First Communication Help« DIN A4-Flugblatt mit 300 Symbolen und zwei Weltkarten entworfen, das kostenlos vom Verlag zum Download zur Verfügung gestellt wurde.5 Die Reaktionen der Hilfsorganisationen waren prompt: »Ihre Bücher waren und sind uns wirklich eine große Hilfe. Insbesondere das Flugblatt, das wir, auf A3 kopiert, im Bereich des ›Medical Check‹ und der Registrierung eingesetzt haben. Es ist einfach nur großartig, wie sie die Flüchtlingshilfe kostenfrei unterstützen!« (E‑Mail von Andreas Dümpelmann, DRK Offenbach, 16.10.2015). Aufgrund der zahlreichen Anfragen von Helfern_innen lag es auf der Hand, dass der Bedarf an einer schnellen Kommunikationshilfe enorm ist. Basierend auf den bisherigen ICOON-Bildwörterbüchern sollte ein neues, inhaltlich angepasstes sowie in der Herstellung kostengünstigeres Buch rasch erstellt werden. Der Verlag entschied sich, das Buch ICOON for refugees als ein nicht kommerzielles und insbesondere von Kooperationen getragenes Hilfsprojekt zu initiieren.6 Zusätzlich wurde mit Verweis auf die bereits existierende ICOON I-Phone-App und 3 | TV-Sendung Kowalski & Schmidt im rbb-Fernsehen vom 23.08.2015. http://media thek.rbb-online.de/tv/Kowalski-Schmidt/Ein-Buch-f%C3%BCr-Vielreisende/rbb-Fernse hen/Video?documentId=30206260&topRessort=tv&bcastId=16361776 (letzter Zugriff: 01.04.2016). 4 | Viele Anfragen kamen zunächst von Rettungsassistenten_innen, Feuerwehrmitarbeiter_innen, ehrenamtlich Deutschlehrenden und freiwilligen Helfer_innen in Notunterkünften und Flüchtlingsheimen. 5 | Kostenloser Download als PDF unter: www.icoonforrefugees.com/download. Das Flugblatt basiert auf der CC-BY-ND 4.0. Creative Commons Lizenz und darf für humanitäre Zwecke kopiert und vervielfältigt werden. 6 | Für die erste Auflage konnten folgende Institutionen als Partner gewonnen werden: Goethe-Institut e.V., Deutsches Rotes Kreuz, Der Paritätische Wohlfahrstverband, text & form Übersetzungen Berlin, Pinguindruck Berlin, Sprylab Softwaretechnologien Berlin, On Time PR Berlin.
287
288
Gosia Warrink und Monika Pfau
die starke Nutzung von Android-Smartphones durch die Geflüchteten festgelegt, eine kostenfreie Android-App ICOON for refugees zu entwickeln.7 Die Bezugskosten eines Buches beliefen sich nach Kalkulation auf 1 Euro pro Buch.8 Es sollte funktional, praktisch, klein (durch das Passformat passt es in jede Hosentasche) und stabil sein – ein kompaktes Werkzeug, um in dem unübersichtlichen Sprachwirrwarr für schnelle Klarheit und effektive Hilfe sorgen zu können. Die bereits vorhandenen zwölf Kategorien des Buches ICOON markierten die Anwendungsbereiche.9 U.a. schildert das Deutsche Rote Kreuz folgende Verwendungsfelder: »Mit der Betreuung von Flüchtlingen in einer sog. Erstaufnahmeeinrichtung und Begleitung von Flüchtlingsfamilien im Alltag, wie auch in den DRK Kindertageseinrichtungen, fallen mir gleich mehrfach Verwendungsmöglichkeiten bei uns beim Deutschen Roten Kreuz in Görlitz ein. Sprache lernen, lernen sich bemerkbar zu machen und Kommunikation im Umgang mit Kindern, Familien und Menschen mit Flüchtlingsschicksal sind bei uns Alltag und tägliche Aufgabe. (…) Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass im Laufe unserer Arbeit hier Vorort sich noch einige Gelegenheiten dazugesellen werden, ob in den DRK Kleiderläden, in der Kita, in der Flüchtlingsarbeit oder auch in der Altenpflege.« (E‑Mail von Daniel Breutmann, DRK Kreisverband Görlitz Stadt und Land e.V., 24.08.2015). Abbildung 2: Geflüchtete am Landesamt für Gesundheit und Soziales in Berlin mit dem ICOON Erste Hilfe Flugblatt. Standbild aus dem ICOON for refugees Crowdfunding Video © AMBERPRESS/Gosia Warrink
7 | Download unter https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.amberpress.icoon. refugees 8 | Dieser Betrag deckt die Kosten für Herstellung, Verpackung und Versand der Bücher ab. 9 | Die zwölf Kategorien umfassen: Gesundheit, Hygiene, Kleidung, Gefühle, Unterkunft, Behörden, Geld, Nahrung, Freizeit, Maße, Reise, Welt.
ICOON for Refugees
Abbildung 3 und 4: Innenseiten von ICOON for refugees mit den neu gestalteten Symbolen im Bereich Medizin (links) und Krieg und Flucht. © AMBERPRESS/Gosia Warrink
Die bereits zur Erstellung des Flugblattes geführten inhaltlichen Gespräche mit engagierten Flüchtlingshelfer_innen und Geflüchteten wurden intensiviert, um das Buch inhaltlich an die Bedürfnisse der Geflüchteten und Helfer_innen so gut wie möglich anzupassen.10 Ein großer Fokus lag zunächst auf medizinischen Symbolen und denen zum Thema Krieg und Flucht. Grafisch war es eine große Herausforderung, neue Symbole, z.B. für Tuberkulose, Krätze, Polio oder Traumata zu gestalten. Weiterhin wurden Symbole für Geflüchtete, die sich auf den Fluchtstrecken bewegten, benötigt: Mobiltelefone dürfen nicht an Strommasten angeschlossen, Gleise nicht als Wege benutzt werden. Auch Deeskalationssymbole wurden aufgenommen. Dem Verlag war es wichtig, auch politisch abstrakte Begriffe wie Demokratie und Gleichberechtigung grafisch darzustellen. Einen Teil der Diskussionen nahm auch die Frage ein, wie weit z.B. bei der medizinisch notwendigen Darstellung einer nackten, dennoch schematischen, weiblichen Brust im Symbol für die Milchpumpe auf religiöse Gefühle der Geflüchteten Rücksicht genommen werden soll. Dieses Thema war eingebettet in die größere Frage nach der Universalität von Bildsprache und den auch hier möglichen kulturellen Missverständnissen von Zeichen, Symbolen und Formen. Bei der händischen Gestaltung der Piktogramme ist den Gestalterinnen jederzeit die Chance der Allgemeingültigkeit der Bildsprache sowie deren Einschränkung durch die kulturelle Einbettung in ein westlich geprägtes Bildgedächtnis bewusst. Folglich wurde nicht auf die Darstellung der nackten Brust verzichtet, drückt diese die historisch über Jahrhunderte gewachsene europäische Vertrautheit mit Körperdarstellungen aus und vermittelt somit auch ein westlich-geprägtes, mehrheitlich liberales Körperverständnis. Zu10 | Hier gilt unser Dank vor allem dem Deutschen Roten Kreuz, dem Zentrum für internationale Friedenseinsätze (ZIF), den Mitarbeiter_innen der Berliner Notunterkünfte sowie allen engagierten Helfer_innen und Geflüchteten, die uns mit ihrem kompetenten Wissen beraten haben.
289
290
Gosia Warrink und Monika Pfau
dem wurde in den Gesprächen sichtbar, wie stark die erste inhaltliche Gewichtung auf der Funktionalität innerhalb der Themen Medizin und Flucht lag. Es wurde deutlich, dass das Ziel auch darin liegen sollte, das Ankommen der Geflüchteten im Alltag zu erleichtern und Aktivitäten in die Piktogramm-Auswahl einzubeziehen, die außerhalb der Befriedigung der Grundbedürfnisse liegen.11 Folglich wurden Symbole für sportliche und insbesondere kulturelle Aktivitäten wie Tanz, Musik, Theater und Kunst eingebettet. Konzerte, Gemälde oder auch Filme sind kulturelle Erfahrungen, die auch aus der Heimat der Geflüchteten bekannt sind und die ihnen das Ankommen im neuen Land mit vertrauten Mitteln erleichtern können. Kulturelle Techniken wie Kunst, Musik oder Tanz sind wie die Bildsprache eine non-verbale und universelle Art der Kommunikation, die Menschen zusammenbringen, unterhalten, den Gemeinschaftssinn fördern und inspirieren kann – auch deshalb reiht sich ICOON for refugees ein in das Feld der Kulturprojekte und wird von den dortigen Akteuren wahrgenommen. Abbildung 5: Symbole für kulturelle Aktivitäten. © AMBERPRESS/Gosia Warrink
Das Buch und die geplante App sollten im wahrsten Sinne des Wortes für »Verständnis« füreinander appellieren und einen neutralen Kommunikationsraum zwischen den heimischen und den geflüchteten Menschen auf bauen. Über die Brücke einer dritten Sprache, der Bildsprache, stehen sich beide Kommunikationsteilnehmer in ihrer verbalen Sprachunkenntnis auf Augenhöhe gegenüber. Sie gestalten die Kommunikation über Bilder aktiv, indem sie aufeinander zugehen, sich Symbole zeigen, auf die Reaktion des anderen sensibel achten. Dabei agieren sie gleichzeitig inklusiv, indem sie sich in die Situation des jeweils anderen einfühlen und einander »abholen« müssen. Damit sollte das Projekt den 11 | Zudem sollten Kinder als »Leser« der Bücher berücksichtigt werden. So wurde in der Kategorie »Welt« z.B. eine ganze Seite mit Tieren eingebettet.
ICOON for Refugees
Weg zum Ankommen im Alltag, sowohl der Geflüchteten im deutschen Alltag als auch der Helfer_innen im Alltag der Geflüchteten, ebnen und längerfristig als einer der vielen notwendigen Schritte zu einer besseren Integration beitragen – denn Integration beginnt mit Verständnis. Zeitgleich zur inhaltlichen Arbeit am Buch wurde der Start der CrowdfundingKampagne auf der Plattform Startnext vorbereitet (Laufzeit: 19.10. bis 20.11.2015). Der Verlag hat sich aus mehreren Gründen für den Weg über das Crowdfunding entschieden: zunächst, weil die Kampagne, sollte sie erfolgreich sein, mit einer Laufzeit von nur 30 Tagen am schnellsten die Finanzierung und somit auch die Realisierung der Bücher und der App gewährleisten konnte. Weiterhin konnte durch die digitale Plattform, deren Infrastruktur und die Vernetzung in den sozialen Medien eine größtmögliche Sichtbarkeit für die Bevölkerung und die Flüchtlingshelfer_innen, deren Arbeit die Bücher zu Gute kommen sollten, erreicht werden. Das Fundingziel lag bei 10.000 Euro für 10.000 Bücher. Zum Ablauf der Kampagne wurde das Ziel mit der Einnahme von 23.023 Euro weit übertroffen. Der Paritätische Wohlfahrtsverband unterstützte durch den Druck von 50.000 »First Communication Help« Flugblättern Mitte Oktober 2015 die Bekanntheit der Kampagne.12 Dank der Presseartikel im Bonner Generalanzeiger und der taz (Mischke 2015, Hochgesand 2015),13 der Unterstützung großer Organisationen wie dem Deutschen Roten Kreuz Offenbach e.V. und dem GoetheInstitut14 sowie der finanziellen Unterstützung von 362 Privatpersonen wurden am 15.12.2015 30.000 Bücher im Verlag angeliefert. In nur neun Tagen, pünktlich zu Weihnachten, waren 25.000 Bücher an Hilfsorganisationen, zunächst vorwiegend in Deutschland, kostenlos verteilt worden.15 Das Projekt hatte große Wellen geschlagen und es fanden sich auch nach Ablauf der Crowdfunding-Kampagne weitere Unterstützer_innen, die den Druck neuer Bücher finanzieren wollten.16 12 | » Der First Communication Helper trägt im doppelten Sinne zur Verständigung bei. Es geht darum, akute Bedarfe schnell zu identifizieren, aber auch Berührungsängste aufgrund mangelnder Sprachkenntnisse abzubauen. Wir geben damit den vielen engagierten Helferinnen und Helfern vor Ort sowie den ankommenden Flüchtlingen eine unkomplizierte Hilfe an die Hand, um miteinander auch ohne Worte ins Gespräch zu kommen.« (Martin Wisskirchen, Leiter Information und Kommunikation beim Paritätischen Gesamtverband, Pressemitteilung vom 29.10.2015). 13 | Zusätzlich veranstaltete der Verlag publikumswirksame Events, wie z.B. am 08.11.2015 zur Ausstellungseröffnung »The Taste of Addiction« im Designbereich der Kunstagentur Bernheimer Contemporary Berlin. 14 | Weiterhin wurde das Projekt unterstützt durch das Softwareunternehmen Sprylab Berlin und die Druckerei Pinguindruck Berlin. 15 | Hier gilt unser Dank insbesondere dem Deutschen Roten Kreuz und dem Paritätischen Wohlfahrtsverband, welche die Koordination der Logistik effizient mit unterstützt hat. 16 | Insbesondere als Reaktion auf einen Beitrag in der Frauenzeitschrift Brigitte, Nr. 3, März 2016, Rubrik Magazin, S. 16.
291
292
Gosia Warrink und Monika Pfau
Folglich richtete der Verlag die Möglichkeit ein, das Projekt mit 20 Euro finanziell zu unterstützen.17 Mit dem Geld sollen weitere Auflagen finanziert werden. Im Gegenzug bekommt der/die Unterstützer_in ein Buch als Dankeschön geschenkt, 20 Bücher werden erneut an Hilfsorganisationen verschenkt. Schon Mitte Februar 2016 konnte die zweite Auflage von 20.000 Büchern erneut in den Druck gehen und ist bereits nach sechs Wochen zu zwei Dritteln verteilt. Die Gesamtauflage beläuft sich auf 50.000 Bücher in nur drei Monaten. Abbildung 6 bis 8: Ansichten der kostenlosen ICOON for refugees App für Android. © AMBERPRESS/Gosia Warrink
Das Projekt lebt insbesondere von einer lebendigen Kooperation mit den vielfältigsten Akteuren. Ohne deren Erfahrung, Wissen, Strukturen und Unterstützung wäre es nicht möglich gewesen, innerhalb kürzester Zeit das Buch zu entwickeln, in dieser hohen Auflage zu drucken und an den Knotenpunkten der Flucht einsetzbar zu machen. Aus den Kooperationen ergaben sich weitere Folgeprojekte, die hier noch abschließend kurz erwähnt werden sollten, um die vielfältigen Einsatzbereiche von Bildsprache kurz zu skizzieren: Im November 2015 gestalteten wir unentgeltlich ein Ausschilderungssystem für die Kleiderkammer in der Notunterkunft am Kölner Flughafen sowie Plakate für die Orientierung in den Zelten. Ende Januar 2016 entwarfen wir in Kooperation mit dem Paritätischen Wohlfahrtsverband ein Deutsch-Lernhilfe-Poster im A1 Format, das kostenlos im Internet heruntergeladen werden kann.18 Es beinhaltet 180 Symbole mit deutscher Betitelung, die beim ersten Spracherwerb helfen. Aktuell arbeiten wir mit der Konrad-Adenauer Stiftung an einem speziellen Projekt für Kinder zum 17 | Vgl. www.icoon-book.com/shop 18 | 180 Symbole mit Betitelung auf Deutsch unter www.icoonforrefugees.com/download
ICOON for Refugees
Spracherwerb, das 2016 finalisiert werden soll. Zusätzlich ist für dieses Jahr eines der Ziele, politische Akteure als Unterstützer_innen für das Projekt »Bildsprache« zu gewinnen. Um das zu erreichen wird »ICOON for refugees« am Tag der offenen Tür der Bundesregierung am 27./28. August 2016 im Bundespresseamt präsent sein.
L iter atur Hochgesand, Stefan (2015): »Illustrationen für den täglichen Bedarf«, in: taz. die Tageszeitung vom 18.11.2015, Gesellschaft + Kultur, S. 16. Mischke, Roland (2015): »Einfach draufzeigen«, Bonner Generalanzeiger vom 28.11.2015, Beilage Journal, S. 1. Warrink, Gosia (2015): ICOON for refugees, Berlin: AMBERPRESS.
293
Kulturelle Bildung und das Erlernen der Mehrheitssprache in Zeiten der (expliziten) Wertevermittlung Rubia Salgado in Zusammenarbeit mit Lernenden und Lehrenden im Verein das kollektiv
Zusammenfassung Der Beitrag beschäftigt sich mit den Potentialen und Herausforderungen des Zweitspracherwerbs im Museum. Die Autorinnen des Vereins das kollektiv begleiten eine kritische Aneignung der Mehrheitssprache Deutsch und des Museums bzw. der Kunst- und Kulturvermittlung im Museum. Dabei wird der Spracherwerb innerhalb der gesellschaftlichen Verhältnisse kontextualisiert im Prozess einer »sprachlichen Ermächtigung«. Obwohl der Verein im Einklang mit der Kritischen Pädagogik situationsbezogen Methoden und Materialien für den Zweitspracherwerb im Museum entwickelt, steht die kritische Aneignung des Museums immer wieder vor Schwierigkeiten in der Dekonstruktion der ausgestellten Inhalte. Die Institution liefert dafür nur wenige Anknüpfungspunkte und vermittelt zu wenig Hintergrundwissen über die ausgestellten Kunstwerke. Wünschenswert wäre eine Praxis, die es den Sprachlernenden ermöglicht, soziale, politische und ökonomische Widersprüche wahrzunehmen und zu problematisieren. Aus der Enthüllung der Realität könnten dann Strukturveränderungen organisiert werden.
Abstract: Cultural Education and the Acquisition of the Majority Language in Times of an (Explicit) Imparting of Values This paper deals with the potentials and challenges of second-language acquisition in museums. The authors from the association das kollektiv follow a critical process of learning German and of taking ownership of the museum through learning about its artistic and cultural artifacts. In the process, the acquisition of language is contextualized within the broader social relations in a process of »linguistic empowerment.« Although the association is developing customized methods and materials for the acquisition of a second language in the museum which comply with the concepts of critical pedagogy, the process of critically appropriating the museum faces continual difficulties when it comes to the deconstruction of the contents of the exhibitions. The institution provides too few points of reference for
296
Rubia Salgado this, and conveys too little background knowledge about the exhibited artworks. What would be desirable is a practice which enables the language learners to perceive and problematize social, political and economic contradictions. From this unveiling of reality, it would then be possible to organize structural changes.
Als wir1 die Einladung erhielten, einen Text für diese Publikation zu verfassen, entschieden wir uns für den Versuch eines kollektiven Schreibens. Die Lehrerinnen in den laufenden Kursen (Basisbildungskurse für Migrantinnen 2) trafen sich und einigten sich darauf, mit zwei Gruppen einen Museumsbesuch zu organisieren, um ausgehend von der Erfahrung den Text kollektiv zu konzipieren. Im Vorfeld wurden die Gruppen gefragt, ob auch sie Lust und Interesse hätten, das kleine Projekt mitzugestalten. Es wurde mit den Lernenden vereinbart, das Schlossmuseum in Linz zu besuchen. Es fanden Vorbereitungsgespräche zwischen den beteiligten Lehrerinnen, zwischen den Lehrerinnen und der Vermittlerin, die im Museum arbeitet und die Gruppen begleiten würde, sowie mit den lernenden Gruppen während des Unterrichts statt. Nach dem Museumsbesuch wurden im Unterricht ausgewählte thematische Schwerpunkte bearbeitet. Die Auswahl der Themen bestimmten die Lehrerinnen im Gespräch mit den Lernenden. Unter dem Motto »Oberösterreich entdecken« bietet das Schlossmuseum seit Herbst 2015 einen geführten Rundgang für Asylwerber_innen an. Der Einladungstext auf der Website des Museums kündigt es folgendermaßen an: »Das Oö. Landesmuseum bietet seinen Besucher/innen weitreichende Einblicke in die Natur-, Kultur- und Kunstgeschichte Oberösterreichs und möchte mit ›Oberösterreich entdecken‹ jene Mitmenschen, die aus verschiedensten Gründen ihre Heimat und ihr Zuhause verlassen mussten, einladen und herzlich willkommen heißen.«3
1 | Das »wir« bezeichnet hier die Mitarbeiterinnen vom Verein das kollektiv. kritische bildungs-, beratungs- und kulturarbeit von und für migrantinnen in Linz/OÖ, der seit November 2015 die Bildungsaktivitäten des Vereins maiz – Autonomes Zentrum von & für Migrantinnen weiterführt. 2 | Teilnehmerinnen der Basisbildungskurse sind Lernende mit weniger oder keiner Erfahrung im formalen Bildungssystem. Im Rahmen der Basisbildungsarbeit mit erwachsenen Migrantinnen (Frauen) im Verein das kollektiv wird in folgenden Feldern gearbeitet: Deutsch als Zweitsprache, Alphabetisierung, Mathematik und Informations- und Kommunikationstechnologien. 3 | www.landesmuseum.at/erwachsene-jugendliche.html
Kulturelle Bildung und das Erlernen der Mehrheitssprache
Warum Museumsbesuche im Rahmen von Sprachkursen? Die Beschäftigung mit den Potentialen und Herausforderungen von Zweitspracherwerb im Museum bildet seit Jahren einen Schwerpunkt in der Bildungsarbeit von maiz und wird ebenfalls im neuen Verein das kollektiv als ein relevantes Ziel verfolgt. Dabei geht es um die Förderung einer kritischen Aneignung der Mehrheitssprache Deutsch und des Museums (bzw. der westeuropäischen Praktiken der Kultur- und der Kunstvermittlung). Ausgehend von Postkolonialen Theorien und von Methoden der Kritischen Pädagogik und im Einklang mit unseren pädagogischen Grundsätzen (maiz 2014: 214ff.) werden Methoden und Materialien für den Zweitspracherwerb in Museen oder in Kunsträumen regelmäßig und situationsbezogen entwickelt und erprobt. Die Verknüpfung von Zweitspracherwerb und Lernen im Museum ist in den letzten Jahren in den Fokus zahlreicher Kultur- und Kunsteinrichtungen (nicht nur) im deutschsprachigen Raum gerückt. Um die beabsichtigte kritische Aneignung zu fördern, ist es jedoch aus unserer Sicht notwendig, die hegemonialen Funktionen von Museum und Spracherwerb (in unserem Fall der Erwerb der Mehrheitssprache Deutsch) innerhalb der gesellschaftlichen Verhältnisse wahrzunehmen. Wie andere machtvolle Bildungs- und Kulturinstitutionen sowie Orte der hegemonialen Wissensproduktion bewirkt das Museum Begehren und Ausschlüsse. Die Ausschlussmechanismen zu bestätigen und diese Räume zu meiden, ist ein Ansatz, der im Einklang mit einer kritischen und ablehnenden Haltung diesen Räumen gegenüber stehen könnte. Eine andere Herangehensweise ist, das Nicht-Wissen über das Museum als eine Alternative zur hegemonialen zu idealisieren und nicht zu berücksichtigen, dass das Wissen möglicherweise notwendig wäre, um in der Mehrheitsgesellschaft bestehen zu können. Ein weiterer Ansatz ist, sich für den Abbau der Ausschlussmechanismen und für die Schaffung von Zugängen zu engagieren. Die Annäherung, die hier vertreten wird, beabsichtigt den Abbau von Barrieren bei gleichzeitiger Transformation des hegemonialen Raums (wofür das Museum hier als ein Repräsentant fungiert) und der Machtverhältnisse. Die Kontextualisierung des Spracherwerbs innerhalb der gesellschaftlichen Verhältnisse wird in maiz und in das kollektiv unter der Bezeichnung »sprachliche Ermächtigung« definiert und beschrieben. Diese beinhaltet die kritische Aneignung der hegemonialen Sprache in ihren unterschiedlichen Varietäten und Registern; aktualisiert sich unter anderem in einer ungehorsamen Haltung gegenüber sprachlichen Normen und normierender Sprache; geschieht im Bewusstsein von Sprache als einem Mittel zum Ausschluss sowie zur Herstellung gesellschaftlicher Anerkennung und leitet zur Verschiebung von zugeschriebenen Positionen; ermöglicht einen strategischen Umgang mit der neoliberalen Verwertungslogik von Mehrsprachigkeit; hinterfragt die Konstruktion von nationaler Sprache und thematisiert die Hierarchisierung von Sprachen.
297
298
Rubia Salgado
Sowohl bei der Begegnung mit den hegemonialen Narrativen und Bildern eines Museums als auch bei der Aneignung der dominanten Sprache bedienen wir uns einer doppelten Strategie: Hegemoniale Wissensbestände werden erworben und gleichzeitig dekonstruiert. Der Erwerb dient einer situativen Anwendung, die Migrant_innen beim Erkämpfen von Rechten und Ressourcen (Zugang zum Bildungssystem, zum Arbeitsmarkt usw.) unterstützen soll. Dieser Prozess wird als solcher benannt und von einer Hinterfragung bzw. einer Problematisierung begleitet. Sprachliche Phänomene, Ausdrücke und Register sowie künstlerische Darstellungen und historische Erzählungen werden im Licht normativer Hintergründe kritisch adressiert, die Sprecher_innenpositionen werden erforscht, Prozesse, die zur Legitimierung von Wissen führen, untersucht. Vor allem stellen wir uns die Frage, welche Wahrheiten durch eine Aussage oder ein Bild vermittelt werden. Wir fragen uns, welches Wissen als wahr gilt – und warum. Wir fragen uns, welches Wissen wo und wann als wahr gilt. Und wir fragen uns nach den Effekten eines bestimmten Wissens im Kontext der Migrationsgesellschaft.
Wie heute in Europa ein Museum besuchen? Daher fragten wir uns, wie wir uns einem Museum annähern könnten, das im Ankündigungstext für den geführten Rundgang für Asylwerber_innen »die Wertschätzung und eine Geste des Willkommens gegenüber Menschen, die versuchen, in Oberösterreich eine neue Heimat zu finden« verspricht. Die Frage wurde aus den verschiedenen Perspektiven der jeweiligen Beteiligten behandelt. Trotz der zahlreichen Unterschiede zwischen den Lehrerinnen und den Teilnehmerinnen der Kurse (auch unter einander) erkannten wir einen gemeinsamen Zugang für die Beantwortung der Frage nach der Form der Annäherung: Vorsicht. Vorsichtig nahmen wir die Einladung an. Vor allem, weil die Stimmung zum Zeitpunkt des Museumsbesuchs (April 2016) gegenüber (neu angekommenen) Flüchtlingen in Österreich, die im Sommer 2015 noch als »Willkommenskultur« bezeichnet wurde, längst in eine restriktive und abschottende Haltung umgeschlagen war. Vorsichtig, weil »Wertschätzung« im Alltag von Migrant_innen in Österreich oft leeren Versprechungen eines interkulturellen Dialogs gleichkommt, der letztendlich das Ziel der Zivilisierung (in der Tradition einer kolonialen Pädagogik) und der Anpassung verfolgt. Der interkulturelle Ansatz zieht außerdem die Aufmerksamkeit von strukturellen Problemen ab und lenkt diese auf externe, kulturelle Determinanten. Er ist ein vorherrschender Ansatz, der weder strukturelle Veränderungen im Sinne einer politischen und rechtlichen Gleichstellung noch die Durchführung einer kritischen Gesellschaftsanalyse oder eine Auseinandersetzung mit Machtgefällen im Rahmen pädagogischer Handlungen ermöglicht. Daher fragten wir auch, warum der Begriff »Heimat« im Ankündigungstext verwendet wurde. Wir fragten uns, was der Begriff für Geflüchtete bedeuten könnte, und warum im Text angenommen wird, dass Geflüchtete versuchen würden, hier eine neue Heimat zu finden.
Kulturelle Bildung und das Erlernen der Mehrheitssprache
Kultur vermittlung oder Wertevermittlung oder …? Im Rahmen der Auseinandersetzung im Vorfeld des Museumsbesuchs einigten sich die Beteiligten auf eine Frage, die die Funktion haben sollte, die Blicke und Eindrücke in der Nachbereitungsphase zu verbinden und ein Miteinanderdenken zu strukturieren: Was können wir ausgehend von der Ausstellung im Museum über das heutige Leben als Frauen in Oberösterreich lernen? Diese Entscheidung wurde ebenfalls der Museumsvermittlerin mitgeteilt, mit der sich die Lehrerinnen im Museum trafen und den Rundgang gemeinsam festlegten. Die Auswahl dieses fragenden Blicks bei einem Museumsbesuch, der unter dem Zeichen der Vorsicht vorbereitet wurde, schrieb sich – sehr wahrscheinlich nicht zufällig – in eine Debatte, die Westeuropa im aktuellen Kontext der Migrationsgesellschaft und im Kontext seiner kolonialen Vergangenheit kennzeichnet: Ist die Frauenemanzipation eine Errungenschaft der weißen europäischen Frauen, die durch Wertevermittlung den Migrant_innen und Flüchtlingen beigebracht werden soll? Die untersuchende Beschäftigung mit der Erwachsenenbildung für Migrant_innen im deutschsprachigen Raum bildet seit einigen Jahren einen weiteren Schwerpunkt der Arbeit von maiz.4 Zentrales Ergebnis der Beschäftigung ist das Feststellen einer allgegenwärtigen Ökonomisierung: Bildung müsse sich entsprechend der gesellschaftlichen Transformationen transformieren. Sie müsse mit den schnellen Veränderungen unserer Zeit Schritt halten und auf die neuen Anforderungen angemessen reagieren. Hinter diesen Positionen steht das Einverständnis damit, dass die Verwertungsinteressen der Wirtschaft oberste Priorität haben, auch wenn dies unter dem Deckmantel der Förderung der sozialen Kohäsion und des Umweltschutzes geschieht, wie es in der Lissabon-Strategie von 2000 oder in ihrer aktuellen neuen Auflage formuliert wird (vgl. Europäischer Rat 2000). Die Beobachtungen lassen außerdem – aber nicht überraschend – den Bereich Erwachsenenbildung für Migrant_innen mehrheitlich als einen Raum der hegemonialen Zurichtung erscheinen und rufen Empörung hervor. Die aktuell vom österreichischen Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres verordneten Werte- und Orientierungskurse für Flüchtlinge bilden grundsätzlich kein Novum im Feld der Erwachsenbildung für Migrant_innen. Wertevermittlung im Sinne eines Zivilisierungsprojektes, das Grundzüge einer 4 | In Kooperation mit den Fachbereichen DaZ der Universitäten Wien und Paderborn und mit dem Institut für Erziehungswissenschaft der Universität Innsbruck führte der Verein maiz das Forschungs- und Entwicklungsprojekt »Deutsch als Zweitsprache in der Migrationsgesellschaft: reflexive und gesellschaftskritische Zugänge«. Eine Publikation der Projektergebnisse befindet sich zum freien Download unter: www.maiz.at/sites/default/ files/images/deutsch-als-zweitsprache_www-2.pdf. Das Projekt wurde aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Frauen (bmbf) finanziert.
299
300
Rubia Salgado
Kolonialpädagogik trägt, findet nicht erst seit Dezember 2015 in Österreich statt. Das Neue daran beschränkt sich auf die explizite Benennung der verfolgten Ziele. Vergeben Sie uns bitte die Redundanz, aber das Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres ist nicht das Bundesministerium für Bildung. Ebenfalls das Innenministerium, das 2006 die erste Version der Integrationsvereinbarung verordnete, ist nicht das Bildungsministerium. Die Integrationsvereinbarung verpflichtet »Drittstaatsangehörige«, so die technokratische nationalistische Bezeichnung, Integrationskurse zu besuchen und Prüfungen zu absolvieren. In den Integrationskursen sollen neben Grundkenntnissen der deutschen Sprache auch Themen des Alltags mit staatsbürgerlichen Elementen und Themen zur Vermittlung der sogenannten europäischen und demokratischen Grundwerte vermittelt werden. Erwachsenenbildungseinrichtungen führen im Auftrag des Innenministeriums und im Dienst rassistischer und repressiver Integrations- und Migrationspolitiken Integrationskurse durch und nehmen Integrationsprüfungen ab. (vgl. maiz 2014: 198; Krumm 2007; Mineva/Salgado 2015) Das Bildungsministerium übergibt in schweigender Komplizenschaft seinen Bildungsauftrag an andere Ministerien, die den Bildungsauftrag im Sinn restriktiver, repressiver, sanktionierender und exkludierender Migrations-, Asyl- und Integrationspolitiken umsetzen (vgl. u.a. Ataç 2014; Friedrich/Haupt 2012, Mourão Permoser 2013; Perchinig 2010; Printschitz 2016). Ob im Kulturbereich im Allgemeinen ähnliches zu beobachten ist, können wir hier nicht behaupten, sondern nur vermuten. Wir können uns jedoch aufgrund unserer Erfahrung im Schlossmuseum (und in anderen Kunsteinrichtungen, die wir jedoch aufgrund des formalen und inhaltlichen Rahmens dieses Beitrags nicht explizit behandeln können) dem Thema annähern. Der inszenierte Rundgang im Schlossmuseum erzählte von einem historischen Werdegang der emanzipierten (ober-)österreichischen Frauen. Die beteiligten Lehrerinnen waren sich bewusst, dass es sich dabei um eine inszenierte Erzählung handelte, die Widersprüche oder Leerstellen soweit wie möglich auszulöschen versuchte. Es gab keine andere Wahl. Es gab nicht die notwendigen Zeitressourcen, um die in der Ausstellung gereihten Objekte zu einer anderen Erzählung zu reihen. Es gab auch nicht die Zeit, sich mit der Sammlung und mit nicht ausgestellten Objekten zu beschäftigen, die sich möglicherweise im Museumsdepot befinden würden. Vor allem gab es nicht die Zeit, die zuständigen Funktionäre der Institution von einer solchen Unternehmung zu überzeugen. Es blieb die Hoffnung, Leerstellen und Widersprüche im Rahmen der Auseinandersetzung in der Gruppe und im Sinne einer dekonstruktivistischen Annäherung sichtbar zu machen und zu behandeln. Somit muss hier angemerkt werden, dass diese Erfahrung die Schwierigkeit im Erreichen des Zieles der Transformation der hegemonialen Institution beispielhaft verdeutlicht. Vergeblich versuchte der Verein maiz mehrmals anhand unterschiedlicher Kooperationen mit Forschungsinstituten und Museen, Finanzierung für ein langfristiges Vorhaben zu bekommen.
Kulturelle Bildung und das Erlernen der Mehrheitssprache
Dieser Bericht vermag lediglich einige Momente des Prozesses wiederzugeben. Und es ist dabei selbstverständlich im Bewusstsein, dass die Wiedergabe, auch wenn sie breit gefächert wäre, einen bestimmten Blickpunkt privilegiert. Der erste hier berichtete Moment ergab sich anhand der Besprechung eines Bildes aus dem 16. Jahrhundert, das den Titel »Bauernschenke« trägt und von Lucas I. van Valckenborch gemalt wurde. Das Bild stellt eine Szene in einer Bauernschänke dar, in der einige Männern beim Trinken sowie ein Paar und eine ältere Bäuerin, die sich wütend den Gästen zuwendet, zu sehen sind. Die Vermittlerin erzählte der besuchenden Gruppe, dass der Schlüsselbund, den die Bäuerin trägt, die Betrachter_innen auf ihre machtvolle Position hinweisen würde. Im Zusammenhang mit den Erinnerungen an das Bild wurde von der Mehrheit der Gruppe die Wahrnehmung geäußert, dass Männer in Österreich Frauen nicht verprügeln würden. Die Lehrerinnen berichteten, dass Gewalt gegen Frauen in Österreich gesetzlich verboten ist, dass aber trotzdem zahlreiche Fälle von Gewalt jährlich registriert werden. Die Lernenden waren sehr überrascht, als sie die Zahlen der dokumentierten Fälle von Gewalt gegen Frauen in Linz in den letzten Jahren erfuhren. In einem weiteren Moment kommentierte die Gruppe ein Bild von Quinten Massys mit dem Titel »Ungleiches Paar mit einem Narren« vom Anfang des 16. Jahrhunderts. Im Bild ist eine Szene zwischen einem Mann und einer Frau zu beobachten, in der die Frau möglicherweise für geleistete sexuelle Leistungen bezahlt wird. In der Auseinandersetzung wurde weder die Figur des Narren am Rand des Bildes noch das Thema der Sexarbeit problematisiert oder diskutiert. Im Zentrum stand die Frage nach den Möglichkeiten, die einer Frau zur Verfügung stehen, um Geld zu verdienen oder zu besitzen. Die Kursteilnehmerinnen hatten mehrheitlich den Eindruck, dass in Österreich Männer und Frauen für die gleiche Arbeit gleich bezahlt werden. Wiederum mit Überraschung nahmen die lernenden Migrantinnen die Informationen über die Situation von Frauen auf dem Arbeitsmarkt auf. Diese beide Berichtsmomente wurden unter anderen ausgewählt, weil sie unsere Erfahrungen und Beobachtungen in der Erwachsenenbildung mit Migrantinnen teilweise widerspiegeln: Österreich wird als ein Raum der Gleichberechtigung, der Gendergerechtigkeit und des respektvollen und gewaltfreien Umgangs vermittelt und wahrgenommen. Die Gründe für diese Wahrnehmung sind sicherlich vielfältig und wären u.a. als Folge oder zumindest im Kontext der kolonialen Vergangenheit und ihrer Kontinuitäten zu interpretieren. Eine Vermutung der hier beteiligten Lehrerinnen führt unseren Blick in die Richtung der aktuellen rassistischen Diskurse, die feministische Positionen, Forderungen und Anliegen vereinnahmen, um eine »Andersheit« herzustellen, die im Gegensatz zu einer vermeintlichen europäischen »Normalität der Gendergerechtigkeit« als rückständig gekennzeichnet wird. Leerstellen und Widersprüche im Narrativ einer erfolgreichen Geschichte der Frauenemanzipation in (Ober-)Österreich konnten erst anhand einer intensiven und herausfordernden Zusammenarbeit zwischen den Lehrerinnen und
301
302
Rubia Salgado
den Teilnehmerinnen erkannt und kritisch thematisiert werden. Die Erfahrung bestätigte sowohl die Entscheidung, dem Museum und seinen Erzählungen mit »Vorsicht« zu begegnen, als auch unsere Option für eine kritische pädagogische Praxis. Eine Praxis, die den Lernenden ermöglichen kann, soziale, politische und ökonomische Widersprüche wahrzunehmen und zu problematisieren, um etwas gegen die unterdrückerischen Elemente der Realität zu unternehmen. Eine emanzipatorische und kritische Bildungsarbeit erschöpft sich jedoch nicht in der Enthüllung der Realität. Sie führt zur Organisierung einer Veränderungspraxis. Kritische Bildungsarbeit fordert auch zu Strukturveränderungen heraus – ein langer Weg, der Schritt für Schritt, immer in kollektives Handeln und Denken eingebettet, beschritten wird.
L iter atur Ataç, Ilker (2014): »Die diskursive Konstruktion von Flüchtlingen und Asylpolitik in Österreich seit 2000.«, in: Uwe Hunger/Roswitha Pioch/Stefan Rother (Hg.), Migrations- und Integrationspolitik im europäischen Vergleich, Jahrbuch Migration – Yearbook Migration 2012/2013, S. 113-130. Europäischer Rat (2000): Schlussfolgerungen des Vorsitzes des Europäischen Rats (Lissabon) vom 23. und 24. März 2000. www.europarl.europa.eu/sum mits/lis1_de.htm (letzter Zugriff 14.06.2016). Friedrich, Sebastian/Haupt, Selma (2012): Die Leistung der Leistung. Wie »Leistungsgerechtigkeit« Rassismus verdeckt. www.annotazioni.de/post/416 (letzter Zugriff 14.06.2016). Krumm, Hans-Jürgen (2007): Universitätsprofessor Hans-Jürgen Krumm über Integration, Deutschkenntnisse und Prüfungszwang. derstandard.at/2236212/ Universitaetsprofessor-Hans-Juergen-Krumm-ueber-Integration-Deutsch kenntnisse-und-Pruefungszwang (letzter Zugriff 14.06.2016). maiz (Hg.) (2014): Deutsch als Zweitsprache. Ergebnisse und Perspektiven eines partizipativen Forschungsprozesses. Reflexive und gesellschaftskritische Zugänge. [d_a_] Curriculum für die Erwachsenenbildung: Deutsch als Zweitsprache im Dissens. www.maiz.at/sites/default/files/images/deutsch-alszweitsprache_www-2.pdf (letzter Zugriff 14.06.2016). Mineva, Gergana/Salgado, Rubia (2015): »Mehrsprachigkeit: Relevant aber kulturalisierend?«, in: Nadja Thoma/Magdalena Knappik (Hg.), Sprache und Bildung in Migrationsgesellschaften. Machtkritische Perspektiven auf ein prekarisiertes Verhältnis, Bielefeld: transcript, S. 245-262. Mourão Permoser, Julia (2013): »The Integrationsvereinbarung in Austria: Exclusion in the Name of Integration?«, in: Ilker Ataç/Sieglinde Rosenberg (Hg.), Politik der Inklusion und Exklusion, Göttingen: V&R unipress, S. 155-176. Perchinig, Bernhard (2010): »Von der Fremdarbeit zur Integration? Migrationsund Integrationspolitik in Österreich seit 1945«, in: Vida Bakondy/Simonetta
Kulturelle Bildung und das Erlernen der Mehrheitssprache
Ferfoglia/Jasmina Janković/Cornelia Kogoj/Gamze Ongan/Heinrich Pichler/ Ruby Sircar/Renée Winter (Hg.), Viel Glück! Migration heute, Wien, Belgrad, Zagreb, Istanbul – Good Luck! Migration Today, Vienna, Belgrade, Zagreb, Istanbul; Wien: Mandelbaum, S. 142-160. Printschitz, Boris (2016): Deutschtests im Rahmen von Testregimen – eine migrationspädagogische Betrachtung am Beispiel Österreich. ÖDaF-Mitteilungen: Band 32, Ausgabe 1, S. 63-72.
303
Acting in Art and Society Der Kunstraum als Raum für Geflüchtete Amelie Deuf lhard
Zusammenfassung Vor dem Hintergrund der sich verändernden Zusammensetzung der Gesellschaft, den Millionen Geflüchteten, die nach Europa kommen, und der Spaltung innerhalb der Aufnahmegesellschaften sehen wir uns als Kulturinstitution in einer besonderen Verantwortung: Die aktuelle gesellschaftliche Situation fordert, das Thema ins Zentrum zu stellen, neue Maßnahmen zu planen und Plattformen für Beteiligung und Kommunikation zu schaffen. Das Theater zu öffnen heißt, Platz zu schaffen für neue Kunstformen, für brennende Themen und kritische Akteur*innen aus unterschiedlichen Disziplinen. Die Künstler*innen von Gintersdorfer/Klaßen setzen in diesem Sinne starke inhaltliche Impulse mit Inszenierungen, die den Finger in die Wunden unser (post-)kolonialen Gesellschaft legen. Wir versuchen auf Kampnagel, immer wieder neue Räume zu kreieren, in denen diese verschiedenen Communities und Kulturen zusammenkommen, gesellschaftspolitische Fragen diskutiert und Modelle des Zusammenlebens geprobt werden. Mit Projekten wie die ecoFavela Lampedusa Nord, einem temporären Aktions- und Wohnraum für Geflüchtete, dem MIGRANTPOLITAN, einem selbstverwalteten Refugee-Communityzentrum, und der strukturellen Eingliederung von Geflüchteten in Betrieb und Programmatik versuchen wir, einen Austausch auf Augenhöhe zu schaffen und die unabhängige Kunst- und Kulturproduktion von geflüchteten Menschen nachhaltig zu unterstützen. Abstract: Acting in Art and Society – The Artistic Space as a Space for Refugees Against the backdrop of demographic shifts, the million refugees en route to Europe and the divide within the host societies, we as a cultural institution see ourselves faced with a particular responsibility: the current social situation demands that this issue become central, that new measures be planned and platforms for participation and communication be created. Opening up the theater means creating space for new art forms, for burning issues and critical stakeholders from a variety of disciplines. The artists from Gintersdorfer/Klaßen are making real inroads in this area, staging works that unsettle the sensibilities of our (post) colonial societies. At the Kampnagel theater, we are continually attempting to create new
306
Amelie Deuflhard spaces in which diverse communities and cultures come together, in which sociopolitical concerns are debated and collaborative means of living together are rehearsed. With projects like ecoFavela Lampedusa Nord, which is a temporary living and activity space for refugees; or MIGRANTPOLITAN, which is an autonomous refugee community center; and through the integration of refugees into our operations and programming – we attempt to create equitable forms of exchange and to provide ongoing support to independent artistic and cultural production by refugees.
Wie sucht, wie generiert, wie findet man Projekte aus aller Welt, die uns etwas darüber erzählen, wie sich die Welt verändert? Global führen Klimaverschiebung, Unsicherheit der Finanzmärkte, Monopolisierung des Kapitals, religiöser Fundamentalismus, Armut, Migration und Flucht derzeit an unterschiedlichen Enden der Welt zu übergroßer Anpassung, aber auch zu Aufstandsbewegungen: Größere Teilhabe an politischen Prozessen wird gefordert, eine andere Form von Demokratie. Lokal sind in Hamburg die Diskurse um die Zukunft der Stadt seit Jahren virulent und es gibt eine starke, zunehmend besser vernetzte Bewegung von Aktivist*innen, die sich gegen Gentrifizierung und gesellschaftlichen Ausschluss von Geflüchteten wehrt und vehement eine Mitsprache an der Zukunft ihrer Stadt fordert. Auf Kampnagel – einem internationalen Zentrum für schönere Künste in Hamburg und Deutschlands größte freie Spiel- und Produktionsstätte – arbeiten wir kontinuierlich an der Frage, wie sich das Theater für soziale Bewegungen, lokale und globale Diskurse öffnen kann. Das heißt, Platz zu schaffen für neue Kunstformen, für brennende Themen und kritische Akteur*innen aus unterschiedlichen Disziplinen. Es heißt auch, es zu öffnen für neue Publika, junge und alte Menschen, Akademiker*innen, Nicht-Akademiker*innen, Arbeitslose, Bohemiens, Migrant*innen, Flüchtlinge – sprich: für unterschiedlichste Szenen einer Stadt. Kampnagel begreift sich als ein Ort des Austausches, des künstlerischen Experiments und der gesellschaftlichen Mitsprache. Vor allem aber ist Kampnagel ein Ort für künstlerische Produktion, der von Künstlerinnen und Künstlern und deren Themen definiert wird. Die kuratorischen Suchbewegungen basieren überwiegend auf künstlerischen Arbeiten und Konzepten, auf dem permanenten Austausch mit Künstler*innen. Vor allem sie haben ein Sensorium für die komplexe Gegenwart, in der wir leben. Und so ist es kein Zufall, dass wichtige Themen oft in künstlerischen Arbeiten auftauchen, bevor sie politisch relevant oder gesellschaftstheoretisch verhandelt werden. Was also kennzeichnet Arbeiten, die »politisch Kunst machen«, wie der Theaterwissenschaftler Nikolaus Müller-Schöll es formulieren würde (vgl. Müller-Schöll/Schallenberg/Zimmermann 2012)? Und wie kann ein Kunstort wie Kampnagel auf die sich verändernde Zusammensetzung der Gesellschaft und die damit verbundenen Diskurse reagieren? Wie kann Raum geschaffen werden für die Protagonist*innen der Flüchtlingsdebatte? Ich fokussiere im Folgenden auf Kampnagels Umgang mit Geflüchteten. Dabei greife ich zurück auf jahrelang gehegte und produzierte Praktiken, nämlich
Acting in Ar t and Society
die einer intensiven Beschäftigung mit den Themen Postkolonialismus und Migration und ihren Protagonist*innen, performativen Interventionen und neuen Formen der Partizipation.
Transkulturalität und Beschäftigung mit postkolonialen Ansätzen Künstlerinnen und Künstler, die in unterschiedlichen kulturellen Kontexten arbeiten, verstehen die veränderte Verfasstheit »anderer« Kulturen – häufig intuitiv und ohne einen theoretischen Überbau – im Sinne einer Vielfalt möglicher Identitäten und entwickeln Strategien, um genau damit umzugehen. Beispielhaft seien die Projekte von Gintersdorfer/Klaßen genannt, die Projekte in Abidjan und Deutschland produzieren. Sie arbeiten an einem Prototyp für informelle Produktionsweisen und Vernetzung von Kreativen an der Schnittstelle von Kunst, Style, Alltag, Politik. Mit ihrem deutsch-ivorischen (und zunehmend auch internationalen) Ensemble entwickeln sie Theaterproduktionen, in denen sich Sprache, Theorie, Musik und Tanzstile von Ballett bis Coupé Décalé zu kraftvollen Szenenabfolgen verdichten. Dabei wird nicht versucht, die sprachliche und körperliche Diversität der Performer*innen zu überspielen oder aufzulösen. Stattdessen ist sie etwa über das Mittel der permanenten Live-Synchronübersetzung immer auch Thema der Inszenierungen. Die Hamburger Künstler*innengruppe Hajusom arbeitet seit inzwischen 16 Jahren mit jugendlichen Geflüchteten und produziert mit ihnen nicht nur wegweisende künstlerische Arbeiten, sondern schafft für ihre Company eine kreative Basis und ein Zuhause. Bestens vernetzt in der lokalen Kunst- und AktivismusSzene, hat sich die Gruppe mit ihrer nachhaltigen Arbeit ein Publikum aus Hamburger Theatergänger*innen, migrantischen Communities, Künstler*innen und Jugendlichen aufgebaut – das Publikum der Zukunft.
Performative Inter vention – Reclaiming the City Partizipatorische Ansätze und die Schaffung von niedrigschwelligen Zugängen forcieren die notwendige Offenheit für Teilhabe unterschiedlicher Akteur*innen. Hierfür bieten sich Projekte im öffentlichen Raum an, die neben dem Kunstpublikum auch Passant*innen ansprechen, aber auch künstlerische Interventionen auf dem Kampnagel-Gelände selbst. Die Erweiterung des räumlichen Wirkungskreises und künstlerische Interventionen an neuralgischen Orten der Stadt sind seit 2007 Teil der Kampnagel-Programmatik. Genannt seien Projekte wie Small Metal Objects vom australischen Back to Back Theatre, die eine Bühne in transitorischen Räumen (in Hamburg vor der Wandelhalle am Hauptbahnhof) auf bauten, die gleichzeitig Bühne für ein ›unsichtbares‹ Theaterstück, Beobachtungshochsitz für die Passant*innen und Objekt der Beobachtung der strömenden Menschen war; oder das Schwabinggradballett, ein mobiles Hamburger Künstler*inneninterventionskommando, das mit spontanen Aktionen in unterschiedlichen Stadträumen die Gentrifizierungsdebatte musiktheatral inszeniert.
307
308
Amelie Deuflhard
Im Februar 2016 errichtete die österreichische Performancegruppe God’s Entertainment in einer Fußgängerzone in Hamburg-Altona unter dem Titel »Deutsche, integriert euch!« ein Integrations-Bootcamp für Deutsche, in dem Zuschauer*innen ihre persönliche (In-)Toleranz gegenüber anderen Kulturen testen und gegebenenfalls ihre Integrationsfähigkeit trainieren konnten. God’s Entertainment drehte damit nicht nur die Debatte um den Anpassungswillen von Migrant*innen und Geflohenen auf den Kopf, sie stellten vor allem die Behauptung einer deutschen Leitkultur und die Produktion nationaler Identitäten in Frage. Mit performativen Interventionen wie diesen erobern sich Künstler*innen und Publikum die Stadt zurück: Sie eröffnen Begegnungs- und Diskussionsräume, die das Theater als Ort und Praxis der Versammlung ernstnehmen und die Kunst als Tool für neue Zugänge zu politisch-gesellschaftlicher Teilhabe nutzen.
Räume schaffen In diesem Sinne versuchen wir auch auf dem Kampnagel-Gelände immer wieder neue Räume zu kreieren und Heterotopien zu schaffen, in denen unterschiedlichste Communities und Kulturen zusammenkommen, gesellschaftspolitische Fragen diskutiert und Modelle des Zusammenlebens geprobt werden. Insbesondere vor dem Hintergrund der sich verändernden Zusammensetzung der Gesellschaft, den Millionen Geflüchteten, die nach Europa kommen, und der Spaltung innerhalb der Aufnahmegesellschaften sehen wir uns als Kulturinstitution in einer besonderen Verantwortung: Die aktuelle gesellschaftliche Situation erfordert, das Thema ins Zentrum zu stellen, neue (künstlerische) Maßnahmen zu planen und vor allem Plattformen für Betätigung und Kommunikation zu schaffen. So wurde beispielsweise mit dem Projekt Hamamness (2015) in einer der Kampnagel-Hallen ein voll funktionstüchtiger Pop-Up-Hamam errichtet, in dem über zwei Wochen künstlerische Aktionen und Rituale, Vorträge und Diskussionen stattfanden, Wellness- und Körperkonzepte mit postkolonialen Diskursen gepaart wurden, Vorurteile gegenüber der islamischen Kultur aufgeweicht und kulturelle Verpanzerungen abgewaschen wurden. Für besonderes Aufsehen sorgte das Projekt ecoFavela Lampedusa Nord (2014), für das ich von der AfD-Fraktion Hamburg eine Anzeige wegen »Veruntreuung öffentlicher Gelder« und »Beihilfe zu Ausländerstraftaten« erhielt und das zum Auslöser für eine bundesweite Diskussion über die Freiheit der Kunst und den Umgang der Künste mit Geflüchteten wurde. Während die Nachwirkungen des Projekts weiterhin für äußerst produktive und fruchtbare Kollaborationen und Vernetzungen innerhalb der Geflüchteten-Communities in Hamburg sorgen, ist die Anzeige immer noch nicht fallengelassen worden. Das Gebäude im Kampnagel-Garten – ein Nachbau des Autonomen Zentrums Rote Flora, das seit den 1980er Jahren von Links-Aktivist*innen besetzt ist und dessen geplanter Abriss seit Jahren zu Auseinandersetzungen führt – wurde von der Künstlergruppe Baltic Raw errichtet und war ursprünglich als Veranstaltungs-
Acting in Ar t and Society
ort für das Sommerfestival 2014 geplant. Im Juni 2014, noch vor dem Beginn der Bauarbeiten, fragten mich Aktivist*innen aus dem Umfeld der Gruppe Lampedusa in Hamburg, ob Kampnagel bereit wäre, in einer der Hallen ein Winterquartier für ca. 40 Personen aufzuschlagen, da ihre bisherige Unterbringung in der St. Pauli Kirche aufgelöst werden sollte. Lampedusa in Hamburg ist eine Gruppe von Menschen aus verschiedenen afrikanischen Ländern, die als Gastarbeiter*innen in Libyen lebten, nach dem Sturz Gaddafis vertrieben wurden und über Lampedusa schließlich in Hamburg landeten – abgeschoben von der italienischen Regierung, gegen das EU-Recht. In Hamburg angekommen, kamen sie temporär im Winternotprogramm der Stadt unter, wurden nach dessen Ende jedoch auf die Straße gesetzt. Im Zuge dessen begannen sie, sich politisch zu organisieren und Forderungen an den Hamburger Senat zu stellen. Wir entschieden uns gegen das Bettenlager – Kampnagel bietet weder die nötige Ausstattung noch die sanitären Anlagen für eine angemessene Unterbringung dieser Menge an Menschen, und eine Reproduktion der menschenunwürdigen Situation in den Flüchtlingslagern wollten wir in jedem Fall vermeiden. Stattdessen schlug ich vor, ein Gebäude mit Strahlkraft für eine kleine Gruppe zu bauen, einen Prototyp, der zur Nachahmung empfohlen werden könne. Ein Gebäude, das ein positives Signal setzt und in dem eine andere Art des Zusammenlebens erprobt werden kann. Die Künstlergruppe Baltic Raw machte den Vorschlag, das Festspielhaus Flora nach dem Sommerfestival temporär und transformiert als Unterkunft und Aktionsraum für einige Mitglieder der Lampedusa-Gruppe weiter zu nutzen. Die Finanzierung wurde zu einem großen Teil über eine Crowdfunding-Kampagne erreicht. Die Beteiligung der Zivilgesellschaft war somit von Anfang an in das Konzept eingeschrieben. Nach einer Bedarfsanalyse unter den zukünftigen Bewohner*innen des Gebäudes – die von der Lampedusa-Gruppe selbst ausgesucht wurden – wurde das Gebäude im Herbst 2014 unter Partizipation der Geflüchteten selbst zum winterfesten Wohnraum umgebaut. Es entstand der Prototyp eines von der öffentlichen Infrastruktur unabhängigen, ökologisch nachhaltigen Gebäudes, dessen Pläne und Technologie veröffentlicht wurden, um einen Nachbau zu ermöglichen. Die Baugenehmigung wurde – wie für alle Kunstprojekte, in denen andere Raumnutzungen als üblich vorgenommen werden – vom Bezirksamt Hamburg-Nord bewilligt. Beantragt wurde ein Kunst-, Aktions- und Diskursraum für Flüchtlinge, der über einen Zeitraum von sechs Monaten täglich 24 Stunden bespielt werden sollte. Die ecoFavela produzierte einen Diskurs über alternative Flüchtlingsunterbringungen, der auf dem Kampnagel-Gelände künstlerisch erprobt wurde: kleinteilig, friedlich, vernetzt, aktiv, integrativ, offen und damit fundamental unterschieden von üblichen Flüchtlingsunterkünften, die eher auf Komplettversorgung bei gleichzeitiger räumlicher Abschottung und Desintegration setzen. Es war ein Kunstprojekt, das gleichzeitig als sozialer Generator fungierte, sich auf die Mitarbeiter*innen, die Künstler*innen, die Nachbar*innen, das Kampnagel-Publikum und die Stadt zubewegte, ein Ort, der partiell öffentlich war, aber auch Privatsphäre bot. Die
309
310
Amelie Deuflhard
ecoFavela war im Beuys’schen Sinn ein Ort maximaler Toleranz, ein Ort für den Prozess der »permanenten Konferenz« im Sinne einer sozialen Plastik, in der das Zusammenleben neu gedacht und entwickelt wird (vgl. Wijers 1979: 215ff.). Das Projekt wurde eher gecoacht als gesteuert, vor allem von Móka Farkas von Baltic Raw. Dabei wurden unterschiedliche Aktivitäten gemeinsam mit den Bewohner*innen entwickelt: ein Mittagstisch mit nigerianischem Essen für Kampnagel-Mitarbeiter*innen und Nachbarschaft, selbst gefertigte Produkte wie Taschen, Hemden und Transparente, der Internet-Radiosender »Refugee Radio Network«, Deutschkurse, eine Festivallounge für das Krass-Festival. Somit waren die Bewohner*innen der ecoFavela gut in Kunst und Leben auf Kampnagel eingebunden. Sie waren zu allen Vorstellungen eingeladen und nahmen an vielen Projekten als Akteure teil. Finanziert wurde das Projekt während des Projektzeitraums über Spenden und Solidaritätskonzerte, für die sich einige der Kampnagel-Techniker vorbildlich engagierten. Ab und an gab es Konflikte, persönliche wie soziale, die jedoch stets gelöst werden konnten. Wichtig war, dass die Bewohner*innen über den gesamten Zeitraum von Spendengeldern finanziert wurden, da sie noch keine Möglichkeit hatten, selbst Geld zu verdienen. Dadurch war die finanzielle Abhängigkeit der Bewohner*innen nicht zu verhindern, was im Prinzip nicht den ursprünglichen Intentionen des Projekts entsprach. Nach dem Auszug der Bewohner*innen in eigene Wohnungen und WGs erfuhr das Gebäude eine weitere Transformation: Nach seiner zweiten Saison als Veranstaltungsort während des Sommerfestivals eröffnete es im Frühjahr 2016 unter dem neuen Titel MIGRANTPOLITAN seine Türen und fungiert seitdem als von Geflüchteten selbst verwaltetes Kunst- und Community-Zentrum. Jeder Tag der Woche wird von einem anderen Team gehostet und entsprechend wird mit unterschiedlichen Inhalten und Formen experimentiert. Die Teams bestehen aus Mitgliedern der Lampedusa-Gruppe, aus dem »Refugee Radio Network« und anderen Hamburger Geflüchteten, Künstler*innen, Dramaturg*innen oder Aktivist*innen. Das MIGRANTPOLITAN ist ein Labor für die kommende Gesellschaft, die gemeinschaftlich und gleichberechtigt von Deutschen und Migrant*innen geprägt wird. Aus den Projekten ecoFavela und MIGRANTPOLITAN gehen verschiedenste Kollaborationen mit Hamburger Geflüchteten(gruppen) hervor: So z.B. die »International Conference of Refugees and Migrants«, die im Februar 2016 von einer Reihe Flüchtlings- und Aktivist*innengruppen selbstorganisiert wurde und an drei Tagen über 2000 Migrant*innen und Aktivist*innen aus der ganzen Welt auf dem Kampnagel-Gelände versammelte. Gemeinsam diskutierten sie die aktuelle Situation in Deutschland, verstärkten ihre Netzwerke und arbeiteten an konkreten Ideen, um die Lebensbedingungen von Refugees positiv zu verändern. So manifestierten sie ihre Rolle als Protagonist*innen ihres Diskurses, der leider zu oft ohne sie geführt wird. Mit Anas Aboura, einem der Hauptakteure der Konferenz, ist eine besonders enge Zusammenarbeit entstanden. Er ist nicht nur ein Kernmitglied des MIG-
Acting in Ar t and Society
RANTPOLITAN-Teams, sondern entwickelt auch eigene Formate wie »Oriental Karaoke« und setzt programmatische Impulse mit von ihm kuratierten Musikabenden mit in Diaspora lebenden syrischen Bands. Er spricht damit ein völlig neues Publikum an, das sonst nur selten seinen Weg zu Kampnagel findet, und begeistert ganz nebenbei auch unser Stammpublikum.
Prozesse anregen Unser Ziel als Kulturinstitution ist es, ganz konkret und dauerhaft die unabhängige Kunst- und Kulturarbeit von Geflüchteten zu unterstützen und Vorbildprojekte zu entwickeln, die zeigen sollen, wie sich Kulturinstitutionen in Deutschland engagieren und positionieren können. Es soll nicht darum gehen, Migrant*innen und Geflüchtete in eine vermeintliche deutsche Leitkultur zu integrieren und diese zu repräsentieren, sondern vorhandene Kulturen in ihren Facetten, Fragmenten und Segmenten sichtbar zu machen und in neue hybride Formen und Ästhetiken einfließen zu lassen. Im Sinne der community arts (vgl. Lippard 1973; Terkessidis 2015) bewegen wir uns weg von der Produktion von Objekten hin zur Anregung von Prozessen. Mit Projekten wie der ecoFavela Lampedusa Nord, dem MIGRANTPOLITAN und der strukturellen Eingliederung von Geflüchteten in Betrieb und Programmatik versuchen wir, einen Austausch auf Augenhöhe und die besten Voraussetzungen für ein selbstbestimmtes Produzieren von Kunst, Diskursen und Formaten zu ermöglichen.
L iter atur Lippard, Lucy R (1973): Six Years: The Dematerialization of the Art Object from 1966 to 1972, New York: Praeger. Müller-Schöll, Nikolaus/Schallenberg, André/Zimmermann, Mayte (Hg.) (2012): Performing Politics. Politisch Kunst machen nach dem 20. Jahrhundert, Berlin: Theater der Zeit. Terkessidis, Mark (2015): Kollaboration, Berlin: Suhrkamp. Wijers, Louwrien (1979): »Interview with Louwrien Wijers«, in: Carin Cuoni (Hg.) (1990): Energy Plan for the Western Man – Joseph Beuys in America. Writings by and Interviews with the Artist, New York: Four Walls Eight Windows, S. 195-238.
311
Grandhotel Cosmopolis als Ort der Bildung von Gesellschaft Spannungen zwischen Utopie und Wirklichkeit Julia Costa Carneiro
Zusammenfassung Das Grandhotel Cosmopolis schafft in seiner alltäglichen Praxis Möglichkeiten, andere Erfahrungen zu machen als die gewohnten. Unsicherheiten prägen unseren Alltag und fordern Mut, um gemeinsam an der Überwindung gesellschaftlicher Ungleichheit zu arbeiten. Der utopische Versuch, sich als ungleiche Menschen in einem gesellschaftlichen Gefüge auf Augenhöhe zu begegnen, und die Entgrenzung der eigenen Vorstellungskraft erweitern Perspektiven zur gemeinsamen Gestaltung einer inklusiven Form von Gesellschaft. »In welcher Welt willst du leben?« Im ehrlichen Dialog als Methode des gewaltfreien Protests entwirft sich eine Kritik an den Kriterien, nach denen Gesellschaft herkömmlich reflektiert, strukturiert und geformt wird. Im Grandhotel erforschen wir die Bedingungen einer selbstgestalteten, einbeziehenden Form gegenwärtigen Zusammenlebens. Die wirklich relevante Kategorie, auf die es sich dabei zu beziehen gilt, heißt ›Mensch‹, und wir können uns alle dafür entscheiden, sie für die Ordnung von Gesellschaft ernst zu nehmen.
Abstract: Grandhotel Cosmopolis as a Site for Community Building – Tensions between Utopia and Reality In its daily activities, ›Grandhotel Cosmopolis‹ creates opportunities to experience extraordinary things. Given that uncertainty informs our daily life, it requires courage to work together to overcome social inequality. The prospects of the collective formation of an inclusive form of society are broadened by the utopian attempt to encounter each other as equals despite occupying unequal positions within a social structure, and by the expansion of our individual imaginative capacities. »In which world do you want to live?« In honest dialogue as a method of non-violent protest, an image forms of a critique of the criteria according to which society is traditionally reflected upon, structured and shaped. In the ›Grandhotel,‹ we are exploring the conditions of a self-defined, inclusive form of contemporary cohabitation. The genuinely relevant category that this refers to is the ›human,‹ and we
314
Julia Costa Carneiro all have the power to decide whether or not to take this category seriously with regards to the organization of society.
Prolog Das Grandhotel Cosmopolis ist kein auszudefinierendes Objekt, es lebt von der Vielfalt der Bedeutungen und der Unterschiedlichkeit der hier gemachten Erfahrungen. Aus diesem Verständnis heraus danke ich allen Co-Autor_innen, die verschieden verortet auf das Grandhotel blicken und den Prozess der Textentwicklung mitgestaltet haben, insbesondere: Ferenc, Susa, Simon, Markus, Johannes, Max, Ara, Nora, Astarte, Mona, Stefan, Pam.
»Was ist das Grandhotel?« Das Grandhotel Cosmopolis wird besonders gerne als »gesellschaftliches Gesamtkunstwerk« gefasst – eine vage Deutung – und doch scheint das Bild für viele treffend. Der Ort verbindet Arbeiten und Freizeit, temporäres Wohnen, Produktion und Konsum, Freiwilligkeit und Zwangskontext in einer bisher noch seltenen Weise. Hier entsteht eine neue Form des gesellschaftlich gelebten Dialogs, der niemanden ausschließen soll. Fernab statischer Institutionen erweitert er das Recht auf Mitgestaltung auf den Ort unseres alltäglichen Lebens. Kein Theater, kein Rathaus, keine Ausländerbehörde. Den Zugang zu dem Gebäude, einem ehemaligen Altenheim im Besitz der Diakonie, das über Jahre leer stand, verschaffte sich eine kleine Gruppe selbstbestimmter Stadtentwickler_innen und machten damit den kollektiven Bau an einer sich konkretisierenden Utopie überhaupt erst möglich. 2011 begannen die ersten Hoteliers mit der Renovierung des 2700 qm Objekts, rissen Mauern ein und verlegten Stromkabel, arbeiteten ohne Geld und bezogen die selbst gemachte Wirklichkeit. Einige kamen deshalb hier her, zogen wieder weiter, andere sind noch da. Freunde blieben, um die Zimmer der Gemeinschaftsunterkunft zu streichen. Für eineinhalb Jahre ist das jetzige Hotel Privatherberge für Leute, die hier gestalten und damit anfangen, Räume für die einziehenden Menschen, für den angehenden Kulturbetrieb und mit ihm eine kosmopolitische Drehscheibe in die städtische Öffentlichkeit zu schaffen. Vor der Aktion steht das Gespräch mit verschiedenen Akteur_innen des öffentlichen Lebens. Sie sind allesamt mutig, diese Unternehmung gemeinsam anzugehen.1 Das Viertel wird eingeladen zu gucken, was hier passiert, Musik und Essen überwinden die größten Ängste, erste öffent1 | Beispielhaft dafür positioniert sich 2011 Pfarrer Fritz Graßmann, Theologischer Vorstand des Diakonischen Werkes Augsburg e.V. für die kollektive Unternehmung: »Denn wenn wir in der Gesellschaft der Zukunft nicht in immer strenger voneinander abgetrennten Quartieren unter unseresgleichen leben wollen, sondern in einer offenen, zum Dialog über
Grandhotel Cosmopolis als Or t der Bildung von Gesellschaf t
liche Konzerte schaffen die Vermittlung der Idee, ein menschengroßes Gehirn wird ins Rathaus performt, als dem Umnutzungsantrag stattgegeben wird. Leute vom Theater, Neugierige aus der Stadt feiern die eigene Lobby, Künstler_innen gestalten Hotelzimmer, bringen Reisen und Bleiben in polyfone Kontexte gegenwärtigen Lebens in Knappheit und Überfluss. Es geht ihnen dabei nicht um geplantes Design, nicht um seelenlose Funktionalität oder banale Dekorationen. Im Sommer 2013 ziehen die ersten Hausbewohner_innen ein, die offiziell betriebene Gemeinschaftsunterkunft bietet Platz für etwa 60 Menschen, die, als Asylbewerber_innen bezeichnet, von der Regierung von Schwaben zugewiesen werden. Für manche von ihnen ist das Grandhotel die erste Ankommensstelle in Deutschland, andere haben schon andere ›Lager‹ erlebt und sehen die Möglichkeiten des aktiven Austauschs und der Selbstermächtigung im Kontrast vielleicht eher. Viele aber haben aufgrund ihrer persönlichen Schicksale und im Kampf durch den Behördendschungel kaum mehr Zeit und Kraft, sich überhaupt auf eine Unternehmung einzulassen, die darauf abzielt, etwas Gemeinsames zu schaffen, das wohlmöglich den eigenen Aufenthalt überdauern wird.2 Die fehlende Anerkennung durch Institutionen städtischer Ordnung macht es an vielen Stellen zu einem nicht realisierbaren Vorhaben, dieses Haus in Zusammenarbeit zu betreiben. Vielleicht macht sie es aber auch erst möglich. Die ersten Abschiebungsbescheide kommen nach drei Tagen und erschüttern Bewohner_innen und Hoteliers gleichermaßen. Das Grandhotel ist insofern kein sicherer Ort, aber ein Versuch, sich zur radikalen Unsicherheit der Welt zu positionieren. Als gesellschaftliches Gesamtkunstwerk betrachtet, gestalten wir Tatsachen, die wir als Beweis für unsere eigenen Weltanschauungen verwenden, und wir bauen diesen Ort kontinuierlich weiter. Entsprechend der geteilten Bedürfnisse werden Räume entgrenzt oder auch geschützt. Die Probleme der Welt werden zu Themen der eigenen Biografie, zur Auseinandersetzung mit Verantwortung für das eigene Denken und Handeln. Unterschiedliche (Fach-)Öffentlichkeiten erkennen das Grandhotel Cosmopolis als richtungsweisend für die Arbeit an neuen Lösungen für sich aufdrängende Fragen eines migrationsgesellschaftlichen Zusammenlebens. Das ›Projekt‹3 erdie Grenzen der sozialen, kulturellen und religiösen Milieus hinaus fähigen Gesellschaft, dann sollten wir Räume für diese Kommunikation bereitstellen.« 2 | Pam interessiert dazu die Frage, was es für jemanden bedeutet, hier unfreiwillig auf ein derartiges Engagement zu treffen. 3 | Wer das Grandhotel Cosmopolis als »Projekt« bezeichnet, hat vielleicht nicht ausreichend Zeit hier verbracht. Die Bedeutung, die der Ort und seine Strahlkraft für die mir bekannten Mitgestaltenden haben, ist mehr als »Bürgerschaftliches Engagement« als Form einer sozial motivierten Freizeitgestaltung. Der Ort hat Einfluss auf das Leben der Menschen, die sich bewusst mit ihm und seinen Realitäten auseinandersetzen. Die damit einhergehenden Veränderungen sind nach meinem Verständnis nicht zeitlich und räumlich einzugrenzen, geschweige denn in einem solchen Verständnis kalkulierbar. Der Begriff
315
316
Julia Costa Carneiro
scheint dabei als Lernort für die Entwicklung von Möglichkeiten eines konstruktiven Umgangs mit Migration, Ankommen und gemeinsamem Leben vor Ort. 4 Die Arbeitsweise gilt als modellhafte Praxis für eine transformative Auseinandersetzung in der Konfrontation mit (global-)gesellschaftlichen Veränderungsprozessen. Die Hoteliers5 sind vielerorts eingeladen zu erklären, wie sie diesen Ort gestalten, wie das Kollektiv organisatorisch arbeitet und aus welchem Selbstverständnis heraus hier freiwillig und weitgehend unentgeltlich ein Willkommensort betrieben wird. Das Interesse an der Arbeitsweise Grandhotel wird durch die ungewöhnliche, vielerorts als einzigartig beschriebene Praxis des experimentellen und freiwilligen Arbeitens und des Einbezugs von Geflüchteten in die Gestaltung eines offenen, gemeinsam geformten Kulturraumes bestärkt. Obwohl das Grandhotel bereits vor den zunehmenden Migrationsbewegungen Richtung Zentraleuropa und der politisch-medialen Inszenierung der ›Flüchtlingskrise‹, nämlich 2011, geboren wurde, ist anzunehmen, dass es aufgrund der aktuellen gesellschaftspolitischen Situation überhaupt erst als politisch relevanter Akteur verstanden wird. Dabei geht es uns Macher_innen nicht darum, als Modell für Integration von Geflüchteten zu gelten, ein ›Leuchtturmprojekt‹ für bürgerschaftliches Engagement zu sein oder gar ein ›postmigrantischer‹6 Kulturbetrieb zu werden. »Projekt« wird dem also nicht gerecht. Er wird wie andere Definitionsversuche im Zusammenhang mit dem Grandhotel in diesem Beitrag so verwendet, wie er im jeweiligen Kontext gebräuchlich ist, auch wenn dies nicht der Meinung der Verfassenden entsprechen muss. 4 | Das zeigt sich exemplarisch an der Förderung des Projektes: Das Grandhotel Cosmopolis wird u.a. im Zuge der Anerkennung und Förderung von Kulturstiftungen zunehmend als relevanter Akteur wahrgenommen. Johannes Schammann erklärte im Auftrag der Robert-Bosch-Stiftung in dem Bestätigungsschreiben zur Bereitstellung von Drittmitteln zur Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation der »Grandhotel Cosmopolis Peace Conference 2015« an die Kulturstiftung des Bundes: »Wir sehen in der Konferenz einen wichtigen Meilenstein für die Weiterentwicklung des gesamten Projektes. Bereits heute gilt das Grandhotel über die Grenzen Deutschlands hinaus als beispielhaft dafür, Kunst, Flüchtlingsarbeit und freiwilliges Engagement miteinander zu verbinden. Von dem hier beantragten Projekt erwarten wir einen Ausbau der (inter-)nationalen Kooperationen und gehen davon aus, dass das Grandhotel Cosmopolis zivilgesellschaftlichen und staatlichen Akteuren mit der Konferenz nachhaltige Impulse für eine praktisch gelebte Willkommenskultur für Flüchtlinge geben wird.« (Kulturstiftung des Bundes, 24.07.2014) 5 | Mehrheitlich anerkannte Selbstbeschreibung der Mitwirkenden im Grandhotel Cosmopolis. 6 | Ich distanziere mich an dieser Stelle von dem Begriff des Postmigrantischen, weil er sich meinem Verständnis nach symbolisch selbst von dem Migrantischen distanziert, also Gefahr läuft, die Realität nicht als migrationsgesellschaftlich zu erkennen. Ich denke, dass dekoloniale Optionen aufschlussreicher sind, wenn man als Gesellschaft gemeinsam an der Überwindung eigener kolonialer Denkweisen, historisch geformter Praktiken der Entrechtung oder Rassismen in textlich oder visuell vermittelter Sprache arbeiten will. Darin
Grandhotel Cosmopolis als Or t der Bildung von Gesellschaf t
Das Grandhotel stellt etwas her, das den herkömmlichen Orten der Wissensproduktion etwas hinzufügt: Absichtsvoll und zufällig treffen hier Menschen aufeinander, die verschiedenste Erfahrungen gemacht und in unterschiedlichen Sprachen lernen, miteinander zu leben. In der Zusammenarbeit von Aktiven, die vielleicht ungleiche Interessen verfolgen, aber ihre Qualitäten für die Weiterentwicklung des gemeinsamen Ortes verfügbar machen wollen, die aus den jeweils anderen, vielleicht noch unbekannten Wissensvorräten schöpfen, zeigt sich der Versuch, einnehmende Disziplinierungen zu überwinden, um sich in etwas Gemeinsames hineinzubegeben. In der Gesamtheit der mit dem Ort entstehenden Verhältnisse zeichnet sich etwas ab, das hinter dem Sprechen über Flucht, Asyl und Ankommen steht und in der Komplexität der dort verhandelten Inhalte einen globalen Bedeutungshorizont zu spiegeln vermag. Im Alltäglichen, im Besonderen, im Zusammenleben geht es um die Gestaltbarkeit von Gleichberechtigung der Beziehungen zwischen Menschen. Wir gehen davon aus, dass sich der Mensch als reflexives Wesen in seinem eigenen Denken und Handeln – unbeabsichtigt ebenso wie bewusst betrieben – einer stetigen Selbstkritik aussetzt, die es ihm möglich macht, das Abstrakte im gegenwärtigen Erleben für sich selbst zu überprüfen. Damit kann auch gemeint sein, die herrschenden Ordnungen der Welt in ihren konkreten Äußerungen radikal in Frage zu stellen: Was ist zwischen mir und dir, was bestimmt unser Denken und Handeln, wenn wir uns als Menschen begegnen und damit von begrenzenden Zuschreibungen lösen? Wie (er-)öffnen wir in dieser Unsicherheit gleichberechtigte Möglichkeiten, uns zum Anderen zu verhalten? Was meint Solidarität zwischen ›Flüchtling‹ und ›Bürger_in‹, was, wenn wir nicht mehr von ›Araberinnen‹ und ›Europäern‹ sprechen, wenn unerklärt bleibt, wer ›performt‹ und wer zum ›Publikum‹ gemacht wird? Das Grandhotel präsentiert mit dieser Praxis, forscht zum Selbstzweck daran, wie diskriminierende Machtverhältnisse überwunden werden können, wenn wir uns bewusst dafür entscheiden, offen zu sein für das, was erst entstehen kann, wenn du und ich zusammenkommen, uns Raum für ein gemeinsames Vorhaben aneignen. Das Grandhotel schafft den Rahmen für eine Kultur, die alle miteinbeziehen will. Als Zufluchtsort, als temporäre Heimat, als Raum für Menschen, die Verantwortung für die Zukunft von Zusammenleben übernehmen. Es geht um dich und mich als mögliche Gestaltende von pluriversalen Räumen der Gesellschaft. Real beobachtbare soziale Phänomene beziehen sich in ihrem Ursprung auf transnationale Interaktionen und machen deutlich: Wer für Gesellschaft spricht, sollte bereit sein, sich von den hierzulande als gültig geführten Bezugsrahmen des Ein- und Ausschlusses zu lösen, sich selbst dazu auffordern, die eigenen tradierten Denkrahmungen zu überwinden und die Begrenzung von Gesellschaft nicht mehr länger über eine territorial definierte Sphäre der Zugehöliegt die Anerkennung der Allgegenwärtigkeit des Migrantischen, von wo aus es möglich wird, legitimierte Quellen zur Ordnung von Gesellschaft (politisch, kulturell, epistemisch) migrantisch zu besetzen.
317
318
Julia Costa Carneiro
rigkeit zu bestimmen. Wir brauchen ein Bewusstsein davon, dass spätestens seit der Ausweitung unseres Lebens in virtuelle Räume auch die lokale Interaktion eine globale Dimension hat. Mit dem Grandhotel bilden wir eine Gesellschaft, die lokal entstehendem Wissen einen Wert zuschreibt. Es kommt nicht darauf an, woher du kommst und was du machst, viel interessanter ist doch zu ermöglichen, dass wir hier und jetzt etwas zusammen machen. Wie wir das Gemeinsame machen wollen, bleibt aus dem Inneren heraus zu verhandeln und fordert eine Praxis, die offen gegenüber dem Wandel ist und die Bedürfnisse der ihr zugehörigen Kollektive und Individuen ernst nimmt. Was wiederum nützt die Forderung nach Integration in eine Gesellschaft, die, als Wertegemeinschaft geschmückt, ihren Ein- und Ausschluss per (Aufenthalts-)Statuszugehörigkeit steuert und somit übersieht, dass Kosmopolitisierung im Inneren unserer national gedachten und organisierten Gesellschaften alltägliche Praxis ist? Vergesellschaftung im alltäglichen Leben kann gemeint sein, wenn von ›Integration‹ gesprochen wird, und sie ist möglich, bevor die staatliche Legitimation dazu erfolgt. Gesellschaften entstehen dort, wo sie einen gemeinsamen Raum kultivieren, ihrer Gemeinschaft Sinn und Form geben in der Art und Weise, wie sie miteinander leben. Das Grandhotel kann aus diesem Blick als beständige Intervention in das öffentliche Leben verstanden werden, in die Stadt hinein und in einen herrschenden Bildungsbegriff, der die Kategorien zur Anerkennung von Qualifikationen, Wissen und arbeitspraktischen Tätigkeiten nach wie vor mehrheitlich aus einer Weltanschauung des globalen Nordens formuliert. Von Beginn an setzen die Macher_innen auf den Dialog als Form des Protests und auf Vernetzung als Strategie zum Einbezug in ein Gespräch über das, was uns alle betrifft:
»In welcher Welt willst du leben?« Das Grandhotel ist kein Produkt einer zu Ende gedachten Utopie, vielmehr formuliert es sich ständig selbst, erzählt die Geschichte einer lokalen Gemeinschaft, die nach den und innerhalb der Bedingungen einer kosmopolitischen Gesellschaft forscht und handelt. Das Hotel für Menschen mit und ohne Asyl ist Raum des transkulturellen Austauschs. Es geht um die Begegnung als Menschen und darum, Gelegenheiten zu arrangieren, die gemeinsam geteilte Erfahrungen ermöglichen. Wir sind gefordert, eine eigene Kommunikationsebene zu erfinden, wir wollen uns dem Gefühl von Menschlichkeit zwischen einander nähern. Es kommt darauf an, unsere kosmopolitische Empathie zu befördern, also Unterschiede anzuerkennen und gleichzeitig die Bereitschaft zu haben, einen kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden, der es uns (noch) ermöglicht, miteinander zu denken und zu handeln und diesen Ort gemeinsam zu gestalten. Die Struktur des Grandhotels will improvisiert sein und sich im Austausch zwischen Einzelnen und Kollektiven konkretisieren. Es gibt keinen Plan, denn wir wissen nicht, was morgen wird und wozu wir uns dann versammeln werden müssen. Unser Prozess kann offen sein, weil es nicht egal ist, wie wir uns zu
Grandhotel Cosmopolis als Or t der Bildung von Gesellschaf t
ihm verhalten. Er braucht eine Form, die es ermöglicht, die eigene Seinsweise zu verändern, und nicht davon ausgeht, dass sich jemand dem Etablierten anpassen müsste. Wir sind immer wieder gefordert, ein Ziel zu formulieren, uns selbst zu definieren und zu erleben, dass dies nicht dem entspricht, was wir hier machen. Wie können wir uns organisieren und gleichzeitig organisch bleiben? Wir lernen uns kennen. Im Miteinandermachen zeigen sich die Qualitäten der hier Wirkenden, entsprechend verhandelter Inhalte kommen wir zusammen, wachsam für sich ergebende Zufälle und sinnvolle Unregelmäßigkeiten. Als Zwischenraum, der eine andere Form der Gesellschaft versucht, sich nicht den Zwängen unterwerfen will, die von institutionalisierten Hierarchien ausgehen können. Wir tauschen uns aus, hinterfragen einengende Zuschreibungen, die das, was wir hier machen, in irgendeiner Form bewerten wollen. Wir sind keine Einigkeit, aber eine Ganzheit, wir leben in Widersprüchen und in unterschiedlichen Blicken auf die Dinge, wir (er-) leben den Dissens, sind nicht bereit für Kompromisse, die auf der Grundlage von Abwertung, Ausbeutung oder Abgrenzung eines Menschen, einer Gruppe oder unter Bezugnahme auf ein Herkunftsland eines Menschen verhandelt werden.7 Wir werden uns dessen bewusst, dass wir faktisch eben nicht gleich sind, aber als Menschen als Gleiche gelten müssten. 8 Wir alle kommen von ungleichen Ausgangslagen miteinander in Kontakt und müssen lernen, zusammen zu arbeiten, zusammen zu wohnen, Lebensraum zu teilen. Das Grandhotel setzt ein Zeichen, unternimmt den Gegenentwurf und ist gleichsam doch betroffen von der Ordnung unseres gesellschaftlichen Lebens mit all seinen bürokratischen Abläufen. Wie können wir in diesem Spannungsverhältnis zwischen Utopie und Wirklichkeit, zwischen Organismus und Organisation derartige Möglichkeitsräume erhalten? Wir treffen uns in den einfachen Möglichkeiten der Begegnung, beim Kochen, Bauen, Putzen, Feiern, Pflanzen. Es sollte uns allen darum gehen, unsere alten und neuen Nachbar_innen kennenzulernen, denn die Stadt ist verändert, Orte der Öffentlichkeit zeigen sich verwandelt und werden immer offensiver zum Laufsteg der Eigensinnigkeit, zur Bühne geteilter Unterschiedlichkeit, zum Campus des Erfahrungswissens, zum Ausdruck kosmopolitischer Wirklichkeiten. Es scheint schon länger nicht mehr klar, wie die Welt tatsächlich funktioniert und wie wir sie noch ordnen sollen, um sie zu verstehen, um uns hier wieder sicher zu fühlen. Die Anerkennung der
7 | Simon gibt konsequenterweise zu bedenken: »Starke Aussage, aber ist es nicht schon ein Kompromiss, hinnehmen zu müssen, dass Bewohner_innen des Hotels abgeschoben werden können? Möglicherweise bedarf es hier einer genaueren Spezifizierung.« 8 | Astarte sagt Ja und Nein dazu: »Wir sind als Menschen gleich, wir sind alle Menschen, die wachsen und essen, trinken, schlafen, lieben, zweifeln etc. Aber wir sind auch nicht gleich, weil diese konstruierte Welt Menschen separiert aufgrund von Religion, Hautfarbe, Politik etc. Aber im Grunde sind wir doch alle gleich, aber eben immer auch Repräsentant_ innen einer gewissen gesellschaftlichen Gruppe.«
319
320
Julia Costa Carneiro
radikalen Unsicherheit unserer Welt macht es uns möglich, genau hinzuhören, im Zweifeln und auch wenn die Muße spricht:
»Was bewegt dich wirklich?« Wenn anfangs die freie Aktion, das Miteinandermachen von größter Bedeutung waren, forderten wir 2015 Gelegenheiten zum Reflektieren, um zu erzählen, miteinander zu teilen, hinzuhören: »Was ist das Grandhotel für mich?« Aber das letzte Jahr war viel zu oft ein lautes Streitgespräch, ein Ringen um Zusammenarbeit, ein abgerissener Dialog, ein nicht-weiter-gedachter-Gedanke, ein halbabgebautes Sommer C*amp9 im September. Wir forderten zum Umdenken und haben uns dabei zeitweise selbst überfordert. Die Zeit, die notwendig ist, um das Erlebte kollektiv zu verarbeiten, ist nicht vorhanden. Verstärkt wird die eigene Überlastung durch das Interesse der Medien und Fachöffentlichkeiten einerseits, in der Abfederung von Folgen einer restriktiven Migrationspolitik andererseits. Jetzt meine ich, sind wir dabei, die Art und Weise unserer Zusammenarbeit zu verfeinern, Eingefahrenes zu verändern und eine Atmosphäre zu schaffen, die ermutigt, ehrlich und vom Herzen aus miteinander zu sprechen. Wenn du in die Lobby-Bar kommst, lässt sich erstmal kaum erkennen, wer hier schon länger ist oder noch neu. Wahrscheinlich sind sich die meisten noch fremd, aber die Atmosphäre kann neugierig machen. Manche sehen die niederschwelligen Zugänge des Grandhotels, in dem man einfach mal sein kann, überwinden die Unsicherheit, Hallo zu sagen, ein kurzes Gespräch zu führen, einen Blick zu tauschen. Für manche wirkt es wie eine große Familie, andere sehen die Crew als Freundeskreis, wieder andere verstehen das Grandhotel Cosmopolis als Treffpunkt für Leute, die wohl schon länger miteinander arbeiten. Für viele, die hier neu sind, scheint die Gruppe zunächst geschlossen, und erst, wenn du ein bisschen an dem Ort bist, kannst du erkennen, wer hier schon eine Weile miteinander spricht. Für mich, die ich schon länger hier bin, ist es ein Möglichkeitsraum, um selbstverantwortlich einen Ort der Bildung von Gesellschaft mitzugestalten. Wir erleben, dass Zuhören für eine gemeinsame Kultur des Teilens essentiell ist, dass alles zu jeder Zeit hören zu müssen, überreizt und vielleicht auch ungehört macht, was eigentlich für Gemeinschaft relevant ist. Wir haben erkannt, dass es für unseren Prozess notwendig ist, kommunikationsbereit zu werden und zu bleiben, Ruhezeiten ernst zu nehmen, Wege der eigenen Veränderung bewusst zu gehen.
9 | Das C* war das Camp, auf dem vom 26. Juli bis 8. August 2015 die »Grandhotel Cosmopolis Peace Conference 2015« ihren öffentlichen Ausdruck fand. Gedacht als Plattform des Wissensaustauschs auf Augenhöhe wurde Mitten im restlos gentrifizierten Augsburger Textilviertel eine grüne Wiese bespielt.
Grandhotel Cosmopolis als Or t der Bildung von Gesellschaf t
Wenn wir wirklich längerfristig ein Gefühl von Willkommensein schaffen wollen, was brauchen wir dafür? Zeit. Offenheit. Vertrauen. Wir machen aus dem verfügbaren Raum einen gemeinsamen Lernort oder – entsprechender – gestalten ihn zum geteilten Lebensort. Leute kommen und gehen, manche bleiben länger, niemand ist für immer hier. Das Grandhotel macht Hoffnung auf Heimat für Reisende aller Art, und in der alltäglichen Praxis wächst eine Kultur der Öffnung gegenüber dem Unbekannten. Das ist zugleich nicht einfach und eigentlich doch, wir müssen nur flexibel sein und bereit, uns in andere Menschen hineinzuversetzen. Erweitere deinen Radius! Komm ins Gespräch! Stell in Frage, was du weißt! Während wir miteinander sprechen, wird klar: Es ist ein falscher Glaube, dieser Glaube an die Eindeutigkeit von Sprache. Und bloß, weil wir alle die gleichen Worte verwenden, von Willkommen sprechen, von Menschlichkeit und Solidarität, meint das nicht, dass wir alle das Gleiche damit meinen. Vor allem in unserem Kontext vermag es Sprache allein nicht, Verständigung zu befördern, es wird klar, dass ein reiner Austausch von Wissen allein uns nicht für den Anderen sichtbar macht. Der Organismus Grandhotel ist nicht in Deutschland verwurzelt, und um gesund weiter zu wachsen, fordert er jeden Tag zu einem Mehr an Empathie auf. Hier braucht Gesellschaft inklusive Formen der Vermittlung zwischen unterschiedlichsten Kommunikationssystemen und den kreativen Prozess als Methodik für das kollektive Handeln. Er fordert Flexibilität und Selbstverantwortung, erneuert das Recht auf Subjektivität und widersetzt sich den zu eigen gemachten Grenzen des Denkens und Handelns. Er spannt einen Raum auf, der Freiheit erprobt und Selbstbestimmung fordert. In dem utopischen Versuch, sich als Menschen zu begegnen, formt sich eine Gemeinschaft, in der verhärtende Strukturen einer objektivierenden Ordnung überwunden werden können.10 Wir bewegen uns in einem Dazwischen. Zwischen Bürger_in und ›Flüchtling‹, zwischen Ermächtigung und Ohnmacht, zwischen Privileg und Entrechtung, zwischen Paarkonflikt und WG-Problemen, zwischen Improvisation und Reaktion. Auch über die Mauern des Gebäudes hinaus entstehen Verbindungen. Auf der Basis unterschiedlicher Ausgangssituationen und einander ähnlichen Haltungen entwickelt sich ein gemeinsamer Bedeutungshorizont in einem wachsenden Netzwerk. In transdisziplinären Zusammenkünften werden neue Möglichkeiten für Gesellschaft skizziert, das Grandhotel wird zum Teilnehmer des überörtlichen Diskurses zu der Frage, wie wir miteinander leben wollen. Das Grandhotel als Symbol fordert dazu auf, gesetzte Werte wie Freiheit, Gleichheit und Geschwisterlichkeit, die in der alltäglichen Praxis konkret gedacht werden müssen, auf ihre aktuelle Gültigkeit zu überprüfen.
10 | Noras pointierte Kritik dazu: »Konzept vs. Alltag«.
321
322
Julia Costa Carneiro
»Wer gehört zum Wir?« Das Grandhotel Cosmopolis wurde als offener Ort des Zusammenkommens und der Vergesellschaftung beschrieben, als ein Ort, an dem die kosmopolitische Wirklichkeit konzentriert erfahrbar wird, und damit ist nicht gemeint, dass man hier Geflüchtete sehen kann oder viele Sprachen gesprochen werden. Den Horizont menschlicher Möglichkeiten zeichnen wir mit einem kosmopolitischen Blick auf das, was ist, und was du und ich damit zu tun haben wollen. In der Vernetzung mit Aktiven experimentieren wir in einem kollektiven Formungsprozess, der bunt und fragil bleibt, weil er geübt in Veränderung und offen für Verbindung ist. Das Grandhotel als Raum der Vergesellschaftung widersetzt sich normativen Logiken und arbeitet an der Umsetzung einer inklusiven Idee von Gesellschaft: In der praktischen, nicht geplanten Aneignung eines Ortes, in der Verhandlung der dort gewollten Kultur, in dem Scheitern ideeller Ideen, beim gemeinsamen Arbeiten an schöneren Aussichten schaffen Menschen einen möglichen Raum der Begegnung auf Augenhöhe. Gleichzeitig zeigt sich immer auch eine andere Wirklichkeit im konkreten Lebenskontext der Einzelnen, am deutlichsten bei den Menschen ohne Asyl. Die Möglichkeit zur politischen, sozialen und kulturellen Mitgestaltung an Gesellschaft ist staatlich reguliert, und entsprechende Zugänge sind exklusiv für die geschaffen, die eine entsprechende Staatsbürgerschaft besitzen. Die aktuelle Migrationspolitik manifestiert eine strukturelle Ungleichheit und ignoriert oder verschleiert gar, dass sich Prozesse transnationaler Vergesellschaftung inmitten ungehörter Geschichten des alltäglichen Lebens verwirklichen.11
Epilog Deine Fragen, Anmerkungen, Zweifel, Ergänzungen sind uns Mittel und Motiv, den Dialog weiter zu öffnen in der Frage »Wer gehört zum Wir?«. Alle sind willkommen, über [email protected] ein Arbeitskollektiv im Grandhotel anzusprechen, das sich zur Aufgabe gemacht hat, die hier entstehenden Perspektiven zu sammeln und sie miteinander ins Verhältnis zu setzen. Geteilter Ausgangspunkt ist unsere Absicht, ungehörte Realitäten sichtbar zu machen und damit die eigene Komfortzone zu verlassen, Routinen zu stören und der teils glo11 | Markus: »Hat diese Konstruktion gesellschaftliche Relevanz? Diese Frage zu stellen, würde bedeuten, das Menschliche in Frage zu stellen. Hat sie politische Wirkkraft, ist eine komplett andere Frage, die zu beantworten jedem selbst überlassen ist.« Mona an dieser Stelle: »Ich frage mich und dich, ob man am Schluss noch eine radikalere Aufforderung bringen müsste, sich jetzt in einem gemeinsamen Standpunkt zu vereinen und von dort aus für die politische Umsetzung einer menschlichen Haltung zu kämpfen. Vielleicht wirkt das alles aber auch zu bedeutungsschwanger.«
Grandhotel Cosmopolis als Or t der Bildung von Gesellschaf t
rifizierten Reproduktion einer utopischen Idee – die notwendig auch in diesem Text immer wieder zitiert wird – etwas Neues hinzuzufügen. Konsequenterweise fordert dieser Entwurf dazu auf, derartige Versuche jetzt und zukünftig wirklich für einen Austausch auf Augenhöhe zugänglich zu machen. In einer Sprache, die zwischen vermeintlichen Expert_innen und den eigentlichen Akteur_innen unserer gegenwärtigen Migrationsgesellschaft vermittelt.
323
Nach der Flucht In einem neuen Leben Fußfassen am Beispiel des Übergangswohnheims Marienfelder Allee Uta Sternal im Interview mit Maren Ziese
Zusammenfassung Die Bereichsleiterin des Internationalen Bundes Berlin-Brandenburg gGmbH, Betrieb Berlin Südwest, Uta Sternal, berichtet im Interview mit Maren Ziese von ihren Erfahrungen mit Kulturprojekten und Kulturkooperationen und erläutert die Bedürfnisse und Lebenslagen der Geflüchteten aus ihrer Sicht. Sie gibt Empfehlungen, was Kulturprojekte leisten und berücksichtigen sollten, um eine sinnvolle und nachhaltige Zusammenarbeit von Wohnheimen, kulturellen Projektträgern und mit den Geflüchteten zu realisieren. Ideale Orte und ideale Bedingungen kommen zur Sprache.
Abstract: After the Escape: Gaining a Foothold in a New Life – The E xample of the Marienfelder Allee Transitional Accommodation Center Uta Sternal is the Regional Manager of the Internationaler Bund for southwest Berlin, BerlinBrandenburg gGmbH. In an interview with Maren Ziese, she discusses her experiences with cultural projects and partnerships and outlines the needs and circumstances of refugees as she sees it. She provides recommendations on which aspects cultural projects should perform and consider in order to create meaningful and lasting partnerships between accommodation centers, cultural institutions and refugees. The conversation also touches on ideal spaces and conditions.
Uta Sternal ist Bereichsleiterin im Übergangswohnheim Marienfelde in Berlin und zuständig für drei Einrichtungen: (1) das Übergangswohnheim Marienfelder Allee mit 700 Bewohnerinnen und Bewohnern, (2) das Aufnahme- und Übergangswohnheim Trachenbergring mit 190 Plätzen für Geflüchtete, Spätaussiedler_innen und jüdische Zuwanderer_innen und mit zusätzlichen 97 Plätzen für wohnungslose Männer, (3) das Übergangswohnheim Rankestraße in Charlottenburg-Wilmersdorf mit 90 Plätzen.
326
Uta Sternal im Inter view mit Maren Ziese
Kulturelle Projekte dort waren u.a.: die Mitwirkung Geflüchteter bei der Videoproduktion »Ich will hier nicht sein« der Band Broilers, das Fotoprojekt »Bridge the Gap« mit dem Freundeskreis Willy-Brandt-Haus und der Gesellschaft für humanistische Fotografie, eine Ausstellung in Zusammenarbeit mit der benachbarten Erinnerungsstätte Notaufnahmelager Marienfelde zum Thema Ankunft: »Nach der Flucht. Leben im Übergangswohnheim Marienfelder Allee«, ein Projekt mit dem Anwohner und Galeristen Herrn Haedke mit zehn bundesweit tätigen in Deutschland lebenden Künstler_innen und zwei Geflüchteten, das eine längere Kunstausstellung auf dem Gelände hervorgebracht hat u.a.m. Wie entstehen solche Projekte und wie laufen sie ab? Die Kulturinstitutionen, Partnervereine und -verbände setzen sich mit uns in Verbindung. Wir selbst haben keine Zeit, aktiv auf die Suche zu gehen. Sie wenden sich an uns mit einer Idee und mit der Absicht, Fördergelder für ein Kunst- oder Bildungsprojekt zu beantragen. Dann setzen wir uns zusammen und die Idee wird vorgestellt und erörtert. Wir gucken dann: passt das? Gibt es einen Bedarf und könnten wir das realisieren? In der Regel ist es interessant oder kann interessant gemacht werden und wir setzen es dann um. Ein weiteres Beispiel sind die »Seelengärten«. Dieses Projekt haben wir im letzten Jahr begonnen und wir führen es in diesem Jahr weiter. Es geht darum, Hochbeete mit Kindern und Jugendlichen anzulegen, sie zu bepflanzen und dann zu ernten. Die Politikerin Renate Künast hat hierfür die Patenschaft übernommen. Es gibt viele und ganz verschiedene Projekte. Sind Sie als Bereichsleiterin also eine Art Kulturbeauftragte? Nein, das ist etwas anders: Als Bereichsleiterin bin ich für drei Einrichtungen zuständig. Deren jeweilige Leiter oder Leiterinnen müssen natürlich interessiert, motiviert und begeisternd sein, um Projekte in die Praxis umzusetzen. Ich höre mir in der Regel zunächst die Vorschläge an. Wenn ich denke, das kann was werden, stelle ich das den Leiterinnen und Leitern vor und versuche, diese auch zu begeistern, und so zieht es sich durch. Die Leiter und Leiterinnen motivieren wiederum die Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen oder Erzieher und Erzieherinnen. Alleine könnte ich das hier nie schaffen und umsetzen. Es braucht ein Team. In der Marienfelder Allee haben wir zusätzlich einen Kinder- und Jugendkoordinator, weil da 300 Kinder und Jugendliche leben. Alle Beteiligten müssen begeistert sein und unsere Ideen und Haltung teilen. Zum Beispiel ist es uns wichtig, die Einrichtungen nach außen zu öffnen und sich nicht abzuschotten. Den Geflüchteten, aber auch Außenstehenden, den Anwohnern, der Bevölkerung soll die Möglichkeit gegeben werden, in Kontakt zu kommen. Gleichzeitig soll den Geflüchteten ermöglicht werden, aus den Einrichtungen hinauszutreten. Diese Haltung, dieses Leitbild müssen die Projekte verkörpern und umsetzen. Das ist eine wesentliche Voraussetzung.
Nach der Flucht: In einem neuen Leben Fußfassen
Wie entwickelt man als Kulturinstitution ein Kulturangebot für Geflüchtete? Ein Museum oder andere Interessierte sollten zunächst Auskünfte einholen. Sie könnten zum Beispiel versuchen, über Wohnheime in Kontakt mit Geflüchteten zu treten oder über den Flüchtlingsrat: In Berlin gibt es den Flüchtlingsrat Berlin oder in Brandenburg den Flüchtlingsrat Brandenburg. Wichtig ist der Kontakt zur Basis. In vielen Städten gibt es beispielsweise afghanische oder iranische Vereine, die ihre Landsleute unterstützen und beraten. Das sind gute Stellen, um zu erfahren, was sind Sorgen und Probleme oder was ist der Bedarf. Welche Art von Projekten wird zur Zeit besonders häufig initiiert? In der letzten Zeit sind es Projekte mit Fotografie. Herr Haedke, ein Galerist und Anwohner, ist seit einiger Zeit dabei, ein Projekt mit einer professionellen Fotografin durchzuführen. In diesem Fotobuch porträtieren sie Kinder und Jugendliche und deren Geschichten. Sie schreiben Geschichten, die sie bewegen. Oft werden wir auch wegen Fotos angefragt, zum Beispiel von Studierenden, die eine Masterarbeit schreiben und hier fotografieren wollen. Ich bin aber immer mehr dafür – wie auch bei »Bridge the Gap« –, dass die Kinder und Jugendlichen lernen, selbst mit der Kamera umzugehen und etwas zu schaffen. So, dass nicht nur über sie berichtet wird oder sie dargestellt werden, sondern etwas Gemeinsames mit ihnen entsteht. Das ist das Wichtigste, denke ich. Das Interesse der Menschen ist unser Ausgangspunkt. Projekte sollten bedarfsgerecht sein! Den Bedarf der Geflüchteten selbst muss es treffen und natürlich auch den Bedarf der Aufnahmegesellschaft; dann ist es gelungen. Und es gelingt eben nicht, wenn wir uns irgendwas ausdenken, was wir meinen, was für sie interessant sein könnte und wie sie sich verhalten sollten … Deswegen ist es sinnvoll, im engen Kontakt mit Geflüchteten zu stehen, sich viel mit ihnen zu unterhalten, zu sprechen, auszutauschen, sie bei einer Projektplanung und Umsetzung mit einzubeziehen. Die Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen sollen möglichst viel Kontakt zur Basis haben. Das ist ein Instrument, um die Qualität Ihrer Arbeit zu sichern? Genau! Die Voraussetzung ist, dass es natürlich ein, ich sage jetzt mal, gutes Wohnheim ist. Die Anbieter, die Betreiber, die derzeit Wohneinrichtungen betreiben, sind ganz unterschiedlich. Es gibt Gewerbliche, die nur auf Gewinnmaximierungen aus sind, die nicht die Nähe oder das Interesse haben und die auch keine ausgebildeten, qualifizierten Sozialarbeiter_innen oder Erzieher_innen beschäftigen. Die können teilweise nicht kompetent Auskunft geben, weil sie einfach nicht so nah dran sind, nicht die Empathie haben, sich hineinzuversetzen in die Menschen, und nicht direkt im Kontakt mit den Geflüchteten stehen. In unseren Einrichtungen haben wir immer eine lange Arbeitszeit – zwischen 8:00 und 19:00 Uhr. Das heißt, wir können den Bedarf und die Anfragen der Bewohner und Bewohnerinnen auch morgens, nachmittags oder abends aufnehmen. Es steckt eine bestimmte Haltung dahinter, dass wir viele Angebote machen. Wir
327
328
Uta Sternal im Inter view mit Maren Ziese
schauen, was sie brauchen. Ist der Fitnessbereich, den wir anbieten, noch zeitgemäß? Ist unser Kinderclub, Jugendclub, Mädchentreff noch das, was die Bewohner und Bewohnerinnen brauchen? Oder müssen wir etwas anderes machen? Es wird viel reflektiert. Es gibt beispielsweise Teamsitzungen, Supervisionen oder kollegiale Fallberatungen. Das sind alles wichtige Instrumente, um gute Arbeit zu machen. Treffen die aktuellen Angebote die Bedürfnisse (auch der Aufnahmegesellschaft)? Ich glaube, es gibt in unserer Gesellschaft im Moment einen großen Bedarf an politischer Bildung und Aufklärung, das gilt auch für die Aufnahmegesellschaft: Es sollte deutlich werden, dass bestimmte Erwartungen nicht realistisch sind. Geflüchtete lassen sich nicht in wenigen Monaten integrieren. Sehr gutes Deutsch zu sprechen, bedarf einer längeren Lernzeit. Deutschkenntnisse sind die Grundlage, eine Arbeit aufzunehmen. Erst, wenn zumindest Basis-Deutschkenntnisse vorhanden sind, können sie beginnen zu arbeiten. Dass das einige Zeit in Anspruch nimmt, ist erstmal frustrierend für Betriebe, Firmen und Wohnungsgeber. Wir müssen verstehen, was in welcher Zeit realistisch ist. Was beinhaltet es, eine Sprache zu lernen? Menschen aus Syrien oder Afghanistan zum Beispiel müssen sich zusätzlich ein neues Alphabet aneignen. Wie lange würde es für uns dauern, Arabisch zu erlernen? Experten gehen bei täglichem intensivem Studium davon aus, dass wir zwischen anderthalb und drei Jahren benötigen würden. Und dann müssten wir sehr intensiv lernen. Auch solche Tatsachen und politische bzw. bildungspolitische Aspekte können wir durch künstlerische Arbeiten in Form von Ausstellungen mit Portraits, Objekten oder Ausstellungsprojekten veranschaulichen. Dadurch können falsche Erwartungen deutlich werden, dass Grundlagen und alltägliche Dinge nicht genügend berücksichtigt werden. Die Menschen, die hierherkommen, müssen neue Schriftzeichen erlernen, sind oftmals traumatisiert und machen sich große Sorgen um Menschen in ihrer Heimat. Sie müssen Geld verdienen, um ihre Schlepper zu bezahlen oder ihren Angehörigen Geld schicken zu können. Um ein Verständnis für solche Fragen zu erwecken, sind Projekte wichtig, die den Kontakt zu Deutschen fördern. So etwas wie das Projekt »Deutsche laden Geflüchtete zum Essen ein«? Einerseits schon. Andererseits sagte ein Flüchtling und Bewohner neulich zu mir, es müsste umgekehrt sein: »Wir kochen und wir laden Deutsche ein, damit sie unsere Küche kennenlernen.« Ja, genau, dachte ich! Das ist es auch, was sie möchten. Sie möchten endlich mal etwas zurückgeben und nicht immer nur Empfänger sein von staatlichen Leistungen und Kleiderspenden. Sie sind vielmehr stolz, dass sie eine eigene Kultur haben und es dort tolle Sachen gibt. Sie möchten andere teilhaben lassen. Sie sind großzügig. Das ist es, was wir hier immer erleben: Sie teilen, auch wenn sie nur ganz wenig Geld haben. Und dass
Nach der Flucht: In einem neuen Leben Fußfassen
sie uns einladen, oder, wenn wir hier Feste machen, dass sie dann kochen oder Kuchen backen. Natürlich sagen wir, gebt uns bitte die Quittungen, wir bezahlen sie. Aber das möchten sie nicht. Sie möchten auch etwas geben. Müssten Kulturprojekte in stärkerem Maße Räume schaffen, wo man sich auf Augenhöhe begegnet und zusammenarbeitet? Ja, es geht um die Schaffung von Normalität. Das ist es, was ich von Geflüchteten immer wieder höre. Sie haben ja in ihrer Heimat ein ganz normales Leben geführt. Sie haben gearbeitet und waren nicht abhängig von staatlichen Leistungen. Sie hatten Wohnungen und waren eingebunden. Das möchten sie wiederhaben. Und sie möchten Kontakt zu deutschen Menschen, beispielsweise durch Projekte mit Sprachpaten, wie wir eines entwickelt haben. Dabei setzen sich manche zusammen an den Tisch und lernen Deutsch. Andere lernen besser durch gemeinsames Tun: Ausflüge machen oder in den Zoo gehen. So entstehen Räume, in denen Normalität gelebt wird. Kollidiert das von Kulturprojekten oft gewünschte Erzählen der Fluchtgeschichte mit dem Wunsch vieler Geflüchteter, nicht darauf reduziert werden zu wollen? Ich habe eigentlich nicht erlebt, dass Geflüchtete nicht davon erzählen wollen. Wir machen seit letztem Jahr zusammen mit der Erinnerungsstätte Notaufnahmelager Marienfelde ein Bildungsangebot für Gruppen, das sehr stark nachgefragt wird. Das Programm heißt »Das Beste an Deutschland ist die Freiheit«. Es kann von Jugendgruppen, Schüler-, Studenten-, aber auch Erwachsenengruppen, bildungspolitisch interessierten Menschen gebucht werden. Das Programm dauert eine bis anderthalb Stunden in der Erinnerungsstätte. Es besteht aus Zeitzeugengesprächen zur deutsch-deutschen Fluchtgeschichte und einer Ausstellung. Danach sind sie weitere anderthalb Stunden bei uns und wir machen eine Führung über unser Gelände. Dabei gibt es ein Gespräch mit einem/einer Geflüchteten und der/die erzählt, warum er/sie nach Deutschland gekommen ist, warum er/sie seine/ihre Heimat verlassen hat, wie es ihm/ihr in Deutschland ergangen ist und wie es ihm/ihr jetzt geht. Die Gruppe darf Fragen stellen. Und dann zeigen wir den Film »Das Beste an Deutschland ist die Freiheit«. In diesem achtminütigen Film, den wir mit drei jugendlichen Mädchen gedreht haben, erzählen sie, warum sie hierhin gekommen sind und wie es ihnen ergangen ist. Für diese Veranstaltungen muss ich immer Bewohner suchen, die zu einem solchen Gespräch bereit sind. Ich habe eigentlich immer die Erfahrung gemacht, sie sind bereit und erzählen. Es fällt ihnen in der Regel schwer. Man merkt, es sind authentische Erzählungen. Nichts ist erfunden. Aber es ist wichtig, das zu machen. Ich merke dann auch immer: Die Gruppen sind sehr bewegt und sehr dankbar. Sie klatschen und finden die Offenheit gut. Es sind in der Regel Männer, die bereit sind, ihre Geschichten zu erzählen. Insofern kann ich ihre Beobachtung so nicht bestätigen. Die Fragen gehen natürlich auch darüber hinaus: Wie finden
329
330
Uta Sternal im Inter view mit Maren Ziese
sie es jetzt hier in Deutschland, wie werden sie aufgenommen, was erleben sie an Fremdenfeindlichkeit, welche Probleme haben sie hier? Auch das ist für den Geflüchteten sehr wichtig. Haben Sie den Eindruck, dass unterschiedliche Gruppen – zum Beispiel Frauen und Männer oder verschiedene Nationalitäten – verschiedene Bedarfe haben? Nach Nationalitäten sollten Projekte auf gar keinen Fall getrennt sein. Das leben wir im Wohnheim vor und es ist ganz wichtig, nicht zu separieren. Wir können nicht sagen, dieses Angebot ist jetzt nur für die Syrer und dieses ist nur für die Iraner. Nein, das ist bewusst gemischt und ist so, wie auch unser Leben in Deutschland bunt gemischt ist. Wenn wir Toleranz möchten in unserer Gesellschaft, dann eben auch hier. Toleranz, Demokratie, Freiheit, Meinungsfreiheit, Würde des Anderen und das Recht des Andersdenkenden. Das müssen wir vorleben und praktizieren in allem. Egal, ob Kunstprojekte, Wohnen oder Arbeiten. Von den 700 Bewohnern und Bewohnerinnen des Wohnheims der Marienfelder Allee sind ungefähr 350 aus Syrien, weil wir die Einrichtung sind, die die syrischen Kontingentflüchtlinge in Berlin aufgenommen hat. Wegen der Wohnungen sind da viele Familien. Viele Leute, die sich an uns wenden, möchten etwas mit Familien machen und mit Kindern. Darauf gibt es einen Fokus bei den Projekten, die an uns herangetragen werden, wie z.B. Gärtnern. Es wird viel für Kinder und Jugendliche angeboten, weil die noch den zeitlichen Freiraum haben. Sie gehen zwar zur Schule, haben aber den Nachmittag oder das Wochenende frei. Die Erwachsenen sind oft mit ihren Integrationskursen beschäftigt. Sie lernen Deutsch, gehen zu Behördenterminen oder beschäftigen sich mit den Dingen des Alltags wie Einkaufen, Kochen, Wäsche waschen, Arbeiten und Geld verdienen. Sie haben oft den Kopf nicht frei, um sich mit freizeitpädagogischen Dingen zu beschäftigen. Die Frauen sind mehr zu Hause und können deswegen auch noch nicht so gut Deutsch sprechen wie die Männer. Die Frauen kümmern sich oft um die Kinder und den Haushalt. Deshalb sind solche Projekte für Frauen wichtig. Wir haben für Frauen spezielle Projekte angeboten. Wir wollen das fortführen, wenn wir personell wieder besser mit Sozialarbeitern und Sozialarbeiterinnen besetzt sind. Vor ein paar Jahren haben wir eine Befragung aller Bewohnerinnen gemacht: Was interessiert sie? Welche Freizeitaktivitäten für Frauen sollten angeboten werden? Da hatten sie viele Wünsche. Als wir entsprechende Angebote gemacht haben, kam dann trotzdem kaum jemand. Es stellte sich heraus, dass sie die Wünsche zwar haben, aber wir hatten nicht die Frage gestellt, was sie dazu benötigten, das Angebot auch annehmen zu können. Braucht ihr eine Kinderbetreuung? Braucht ihr einen Mann, der euch unterstützt? Braucht ihr einen freien Kopf oder braucht ihr Geld dafür? Was braucht ihr? Was sind die Rahmenbedingungen? Das hatten wir sie nicht gefragt.
Nach der Flucht: In einem neuen Leben Fußfassen
Sollten etablierte Geflüchtete mit ihrem Wissen und ihren Erfahrungen stärker als Informationsgeber oder Vorbilder eingebunden werden? Ich denke, von großer Bedeutung sind Vermittler, Menschen, die Brücken schlagen können. Das können neben den gut qualifizierten Sozialarbeiter_innen in den Wohnheimen auch Vereine und Verbände, die mit geflüchteten Menschen direkt arbeiten. Wenn aber ein Migrant aus Afghanistan, Iran, Irak schon lange hier ist, zehn Jahre, 15 Jahre, dann ist er kein Geflüchteter mehr. Natürlich versteht er die Kultur und das Denken der Menschen sehr gut, aber er hat die Situation akut nicht erlebt. Er kann jedoch eine Brücke schlagen. Natürlich kann und sollte man dies nutzen. Wichtig ist auch der Kontakt zu Deutschen ohne Migrationshintergrund. Interessierte Geflüchtete sollten auf jeden Fall als Ideen- und Informationsgeber einbezogen werden. Wichtig ist, nicht über sie, sondern mit den Geflüchteten zu reden. Sind die Anbietenden genug ausgebildet, um mit Traumata umzugehen? Wir als Sozialarbeiter_innen sprechen von uns aus keine Traumata in den Beratungsgesprächen mit den Bewohner_innen an, weil wir nicht dafür ausgebildet sind. Wenn wir merken und spüren, da sind traumatisierte Kinder, Jugendliche oder Erwachsene, dann geben wir Hilfestellungen und vermitteln weiter in die entsprechenden Projekte wie das Behandlungszentrum für Folteropfer, Xenion oder empfehlen Therapeuten und Spezialisten. Ich würde hier auch keine Kulturprojekte zulassen, die dann ein- oder zweimal in der Woche im kunsttherapeutischen Bereich irgendwie rumstochern. Das können wir hier im Alltag dann nicht auffangen. Welche Arbeitssprache(n) sollte(n) in Projekten gesprochen werden? Auch (oder: zusätzlich) auf Deutsch ist immer hilfreich. Dann ist es gut, je nachdem, wie die Gruppe zusammengesetzt ist, arabischsprachige Dolmetscher_innen für Syrer_innen oder Iraker_innen oder ein Dolmetscher_innen für Farsi für Iraner_innen oder Afghan_innen hinzuzuziehen. Bei gemischten Gruppen kann Englisch hilfreich sein. Wenn ich die Menschen abholen möchte und ihnen etwas erklären will, dann muss ich das erstmal mit Sprachmittler_innen machen, um sie begeistern und motivieren zu können. Je nachdem, wie sich das Projekt dann entwickelt und die Grundlagen da sind, kann man später vielleicht darauf verzichten. Wichtig ist, dass die Durchführenden ein deutliches Deutsch und keinen Dialekt sprechen. Dass sie langsam sprechen, empathisch sind und sich auf Gesten mit Händen und Füßen einlassen können. Kreativität im Umgang mit Sprache und Medien sind wichtig. Welche Vorbereitungen sollten Kulturinstitutionen für Projekte erbringen? Das Problem ist immer, dass die Wohnheime wenig Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben. Wir sind hier schon relativ gut ausgestattet. Unser Personalschlüssel: Ein_e Sozialarbeiter_in ist zuständig für ungefähr 80 Bewohner_innen. An-
331
332
Uta Sternal im Inter view mit Maren Ziese
dere Wohnheime in Deutschland haben einen Schlüssel von 1 zu 100 oder 1 zu 120. In solchen Fällen ist es für diese Einrichtungen meist nicht möglich, eine intensive Betreuung und Begleitung von Projekten dieser Art hinzubekommen. Es ist aufwendig, Bewohner_innen anzusprechen, zu erinnern, sie zusammenzutrommeln oder lange Projekttreffen, Vorbesprechungen, Zwischenbesprechungen oder Nachbesprechungen zu organisieren. Deswegen ist es wichtig, dass die Projekte personell gut ausgestattet sind. Leider ist das nicht immer der Fall – und auch die Ergebnisse finde ich oft bedauerlich und schade. Wie kann man Projekte in Hinblick auf ihre Nachhaltigkeit verbessern? Das Wichtigste für die Nachhaltigkeit von Angeboten und Kulturprojekten ist, dass sie kontinuierlich sind! Kontinuität in den Mitteln und in den Personen. Schlecht ist immer, wenn es ständig wechselnde Gesichter gibt. Hilfreich ist Beständigkeit. Und immer reflektieren und dem Bedarf anpassen, wenn sich etwas verändert. Es ist auch wichtig, dass etwas dabei entsteht. »Bridge the Gap« hatte mit der Ausstellung, den Fotografien, dem Buch und mit dem Katalog für alle Beteiligten – für die deutschen wie auch für unsere Geflüchteten – ein schönes Ergebnis. Das war eine runde Geschichte, die auch viel Geld gekostet hat, aber am Ende ist etwas Handfestes herausgekommen. Was ich an »Bridge the Gap 2« sehr schön finde, ist, dass es die Kooperation mit der Gustav-Heinemann-Schule gibt. Das ist die Schule, auf die viele unserer Jugendlichen gehen. Die Einbindung des Lebensumfeldes und der Realität der Jugendlichen ist sehr wichtig. Das bedeutete natürlich für die Projektdurchführenden erstmal, Kontakte zu knüpfen und Wege zurückzulegen. Die Vorbereitung ist zeitintensiver. Anderes ist leichter. Bei »Bridge the Gap 2« sind die Gelder wieder begrenzt. Es ist logistisch schwierig, die Gruppe immer irgendwo hinzubringen und zu begleiten, daher wird viel hier stattfinden. Man kann die Kinder und Jugendlichen nicht alleine in ein Museum fahren lassen. Das wird nichts. Die Gruppe muss begleitet werden. Das kostet Geld und ist mit Aufwand verbunden. Deswegen haben wir gesagt, dass viel hier wird stattfinden müssen. Was wäre der ideale Ort für ein Projekt? Besser ist es, wenn mehr außerhalb der Wohnheime stattfindet. Aber dafür müssen die Geflüchteten hier abgeholt werden. Ziel ist es, den Kontakt mit der Umwelt aufzubauen und zu halten. Sie sollten die Stadt kennenlernen und Normalität lernen: die Stadt erkunden, rauskommen und Eindrücke gewinnen. Die Kinder und Jugendlichen – man muss sich das vorstellen – gehen in ihre Schulen und kommen danach wieder hierher zurück. Sie haben in der Regel in ihrer Freizeit keinen Kontakt zu den deutschen Mitschüler_innen. Das sind getrennte Welten. Die laden sich nicht gegenseitig nach Hause ein. Dass ein Jugendlicher sagt, komm heute Nachmittag zu mir in die Wohnung, komm mich besuchen, wir können an
Nach der Flucht: In einem neuen Leben Fußfassen
meinem Computer ein Spiel spielen oder wir spielen zusammen Fußball oder hören Musik – das passiert nur sehr selten. Diese Normalität, die andere Kinder und Jugendliche haben, gibt es hier nicht. Unsere Kinder und Jugendlichen, was machen die am Nachmittag? Die kommen aus der Schule oder aus dem Hort nach Hause, dann sind sie hier auf dem Gelände. Wir versuchen, sie zu beschäftigen, ihnen etwas anzubieten. Wir haben einen Jugendclub, Hausaufgabenhilfe, Mädchentreff, Leseprojekt, Fußballtraining, Tanzgruppen, den Zirkus Cabuwazi, der herkommt, und wir haben ein Spielemobil. Das sind niedrigschwellige Angebote, hier auf dem Gelände etwas zu machen. Wichtig ist auch, sich sportlich betätigen zu können. Das bieten wir an, weil einige es woanders nicht machen. Die Eltern haben ihre eigenen Sorgen und Probleme. Sie sind oft so beschäftigt, dass sie nicht daran denken, dass es wichtig ist, mit ihrem Kind zu einem Sportverein oder anderen Freizeitaktivitäten zu gehen. Manche besuchen einen Fußballverein, da ist das gelungen. Mit Fußball gelingt das gelegentlich, dass die Eltern zu den Spielen mitgehen und sich überwunden haben, obwohl sie kein Deutsch sprechen. Aber es sind getrennte Welten. Und deswegen wäre es eigentlich besser, mehr Normalität kennenzulernen und Eindrücke zu bekommen. Das, was deutsche Jugendliche mit ihren Eltern oder Großeltern an Wochenenden tun, ins Museum, in den Zoo oder sonst wo hin zu gehen, das machen sie hier nicht mit ihren Eltern. Gibt es für Eltern und andere Erwachsene erfolgreiche Projekte? Ja, es gab zum Beispiel ein Projekt, bei dem ein Künstler herkam und mit Bewohnern aus Holzresten Möbel gebaut hat. Das hat die Bedürfnisse getroffen, weil es eben die Interessen abgefragt hat. Es war erfolgreich, obwohl es wieder ein Projekt war, das vor Ort stattfand. Allgemein braucht man viel Personal, am besten Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen hier vor Ort. Sie sind mit den Menschen vertraut, sie haben Zugang, sie können begeistern! Da stellt sich weniger die Frage, was machen wir heute, wo gehen wir in Berlin heute hin, sondern, wer kommt mit. Connie, die bekannte und beliebte Sozialarbeiterin, geht mit uns schwimmen! Ideal ist es, wenn es kein Wildfremder ist. Wie soll jemand, der die Kinder und Jugendlichen erstmal kennenlernen soll, begeistern? Die Mitarbeiter_innen hier vor Ort, die haben das Vertrauen. Aber das ist eine Frage der Qualität und Quantität des Personals! Welche Rolle können Ehrenamtliche spielen? Ehrenamtliche sind wichtig, weil sie sporadisch unterstützen und sich entweder mit oder ohne eine Aufwandsentschädigung einbringen. Wichtig ist, dass sie Lust haben, empathisch sind, und dass sie möglichst viel und regelmäßig Zeit investieren, um unsere Geflüchteten kennenzulernen und Vertrauen zu bilden.
333
334
Uta Sternal im Inter view mit Maren Ziese
Welchen Weiterbildungsbedarf sehen Sie für die Mitarbeiter_innen von Kulturinstitutionen, die mit Geflüchteten arbeiten wollen? Wichtig ist grundsätzlich, dass sie wissen, aus welchen Ländern die Geflüchteten kommen. Länderhintergrundinformationen zu erwerben und die Gründe zu kennen, warum die Menschen hier sind. Was haben sie so ungefähr erlebt? Wie sieht ihre Bleibeperspektive aus? Die Einschätzung des Aufenthaltsstatus: Was bedeutet eine Aufenthaltsgestattung und was eine Duldung? Was macht die Unsicherheit des Bleibestatus mit den Kindern und Jugendlichen? Wenn die Eltern nervös sind, drückt sich das ganz stark auch bei den Kindern aus. Das hat natürlich was mit den Ländern, aus denen sie kommen, zu tun. Sind es sichere Herkunftsländer und droht ihnen bald die Rückkehr oder Abschiebung? Es hilft eben nichts, wenn Ehrenamtliche oder die, die das Projekt durchführen, ein großes Herz haben und etwas machen wollen und es dann aber nicht professionell machen. Das heißt, sie müssen empathisch sein, interkulturelle Kompetenzen aufweisen und methodisch vielfältig und kreativ denken und arbeiten.
6. Reflektierte Projekterfahrungen— Reflections on Project Experiences
»Kunst ist ein Grundbedürfnis« 1 Ein Praxisbericht der Hamburger Kunsthalle über ihre Arbeit mit Geflüchteten Wybke Wiechell
Zusammenfassung Ihrem Gründungsgedanken als Bürgermuseum verpflichtet, versteht sich die Hamburger Kunsthalle als ein offener Ort der Begegnung und des Dialogs für die Menschen aller Generationen, Bildungsniveaus, kulturellen Hintergründe und Herkunftsgebiete. Entsprechend werden seit Sommer 2015 regelmäßig auch Vermittlungsangebote für Geflüchtete durchgeführt. Im Bericht werden zwei unterschiedliche Veranstaltungstypen als mögliche Wege der Kunstvermittlung skizziert, die sich explizit an Geflüchtete in Zentralen Erstaufnahmeeinrichtungen richten: Museumsgespräche für Erwachsene werden im Museum angeboten, praktisch-bildnerische Workshops für Kinder und Jugendliche in den Räumen der Unterkünfte. Der Bericht über dieses Best-Practice-Beispiel fokussiert auf die äußeren Rahmenbedingungen der Organisation, Finanzierung und öffentlichen Bekanntmachung als wichtige Säulen für das gute Gelingen der Programme.
Abstract: »Art is a Fundamental Need« – A Review of the Hamburger Kunsthalle’s Work with Refugees In accordance with its founding principles as a public museum, the Hamburger Kunsthalle operates as an open site of encounter and dialog for people of all generations, educational levels, cultural backgrounds and origins. Pursuant to this commitment are educational programs for refugees that have been conducted regularly since the summer of 2015. This review outlines potential art education and outreach methods as illustrated by two diverse programs explicitly geared towards refugees in central initial registration centers: museum talks offered to adults, and hands-on workshops run in the accommodation facilities and geared towards children and youth. This best practice example review focuses on the overarching framework of the organization, financing and public promotion as essential principles for the success of the programs. 1 | Anja Ellenberger, freie Kunstvermittlerin und Kuratorin, Museumsgespräche für Erwachsene.
338
Wybke Wiechell
»Wichtig für den Erfolg ist nicht nur die Zustimmung einzelner, sondern das Bekenntnis des gesamten Hauses zum Engagement« 2 In diesem Praxisbericht werden am Beispiel der Hamburger Kunsthalle zwei unterschiedliche Modelle von Veranstaltungen für Geflüchtete als mögliche Wege der Kunstvermittlung im Museum skizziert. Der Text basiert auf Interviews mit den Organisator_innen und durchführenden Kunstvermittler_innen der beiden Programmschienen und konzentriert sich auf ihre Organisation, Finanzierung und öffentliche Bekanntmachung. Sie stellen, neben dem Engagement der Kunstvermittler_innen, wichtige Säulen für das gute Gelingen der Veranstaltungen dar. Dieser Fokus auf die äußeren Rahmenbedingungen soll verdeutlichen, dass durch das persönliche Bekenntnis und den Einsatz aller Projektbeteiligten mit verhältnismäßig geringem Aufwand solide Programme gestartet werden konnten. Es werden erstens Museumsgespräche für Erwachsene und zweitens praktisch-bildnerische Workshops für Kinder und Jugendliche durchgeführt. Die Veranstaltungen richten sich explizit an Geflüchtete in Zentralen Erstaufnahmeeinrichtungen. Konzipiert wurden sie im Sommer 2015 zunächst als Ad-hoc-Angebote und sind nun, nach einer mehrmonatigen Erprobungsphase, nachhaltig im allgemeinen Vermittlungsprogramm der Abteilung Bildung und Vermittlung verankert. Alle Veranstaltungen sind kostenfrei und werden in den Sprachen Deutsch und Englisch durchgeführt. Die praktisch-bildnerischen Workshops für Kinder und Jugendliche werden als Outreach-Angebote in den Räumen der Zentralen Erstaufnahmeeinrichtungen durchgeführt. Drei Kunstvermittler_innen besuchen insgesamt fünf verschiedene Unterkünfte im wöchentlichen oder 14-tägigen Rhythmus. Pro Termin nehmen 15 bis 25 Kinder und Jugendliche zwischen fünf und 16 Jahren teil. Eltern werden nicht gezielt angesprochen, sind aber jederzeit willkommen. Die Museumsgespräche für Erwachsene und ihre ehrenamtlichen Begleiter werden in den Ausstellungen der Hamburger Kunsthalle veranstaltet. Zu drei fixen Zeiten pro Woche werden sie als öffentliche Führung zur unverbindlichen Teilnahme angeboten. Die Teilnahmezahlen variieren zwischen fünf und 20 Personen.
»Das ist meine Motivation: Die sind jetzt hier. Da will ich nicht nachdenken, sondern einfach handeln.«3 Aufgrund der drastisch gestiegenen Anzahl an Geflüchteten im Sommer 2015 konnte ein einstimmiger Beschluss zum Engagement des Hauses schnell und unbürokratisch gefasst werden. Die Situation in den Zentralen Erstaufnahmeein2 | Dr. Stefan Brandt, Geschäftsführender Vorstand der Hamburger Kunsthalle. 3 | Martina Ring, freie Kunstvermittlerin und Künstlerin, Workshops für Kinder und Jugendliche.
»Kunst ist ein Grundbedür fnis«
richtungen und besonders am benachbarten Hauptbahnhof war zu dieser Zeit so dramatisch, dass in den Wintermonaten zusätzlich zu den Vermittlungsangeboten auch Übernachtungsmöglichkeiten für die Durchreisenden nach Skandinavien in kurzfristig leerstehenden Werkräumen zur Verfügung gestellt wurden. Mitarbeiter_innen aller Abteilungen standen abwechselnd für die Koordination und als Ansprechpartner_innen für die Verantwortlichen der Hilfsorganisation vom Bahnhof zur Verfügung. Doch der Reflex des schnellen Handelns musste zunächst konzeptionell kanalisiert werden, um nicht durch blinden Aktionismus an den Bedürfnissen der Geflüchteten vorbei zu agieren. Es standen grundsätzliche Vorüberlegungen darüber an, ob und in welcher Form ein öffentliches Museum zu gesellschaftspolitischen Themen Stellung beziehen kann und sollte. Diese Diskussion wurde unter der Leitung der Abteilung Bildung und Vermittlung in kleinen, effektiven Arbeitsgruppen zwischen freien Kunstvermittler_innen, der Abteilung Kommunikation, dem Vorstand und dem Stiftungsrat der Hamburger Kunsthalle sowie Drittmittelförderern und der übergeordneten Kulturbehörde geführt. Als gute Basis für die konkrete inhaltliche Konzeption der einzelnen Veranstaltungen dienten die bereits vorhandenen praktischen Kenntnisse der Kunstvermittler_innen im Umgang mit Geflüchteten. Einige Kolleg_innen waren teilweise schon seit Ende 2014 ehrenamtlich in verschiedenen Einrichtungen tätig, und Schulangebote für Flüchtlingsklassen sind seit Anfang 2015 in der Hamburger Kunsthalle auf Anfrage buchbar. Ebenso hilfreich sind die langjährigen Erfahrungen über geeignete Gesprächsthemen aus der Veranstaltungsreihe »Kunst im interreligiösen Dialog«. Dort werden Kunstwerke aus den Perspektiven der fünf Weltreligionen besprochen und die unterschiedlichen Lesarten, Interpretationen und Deutungen diskutiert – denn gerade, weil sich Kunst in ihrem Wesen jeder Eindeutigkeit entzieht, eignet sie sich als Türöffner zum interkulturellen Austausch.
»Ein Hauptproblem ist die Sprache.« 4 Die Verständigung ist ein erhebliches und nicht zufriedenstellend lösbares Problem. Professionelle Simultanübersetzungen für alle nötigen Sprachen zur Verfügung zu stellen, ist aus Kostengründen und aufgrund der Heterogenität der Gruppen nicht realisierbar. Sie werden nur auf ausdrücklichen Wunsch hinzugezogen. Gezielt werden daher alle Museumsgespräche in deutscher und englischer Sprache angeboten. Dies entspricht am ehesten der Situation, der die Geflüchteten in ihrem Alltag begegnen. Je nach Zusammensetzung und entsprechenden Sprachkenntnissen der Teilnehmenden ist entweder nur eine bruchstückhafte Verständigung möglich oder es können tiefere inhaltliche Diskussionen geführt werden. Dabei sind nicht nur die sprachlichen Fähigkeiten, sondern auch die kul4 | Anja Ellenberger, freie Kunstvermittlerin und Kuratorin, Museumsgespräche für Erwachsene.
339
340
Wybke Wiechell
turelle Herkunft und das Bildungsniveau der Einzelnen von Bedeutung. Auf diesen von Termin zu Termin nicht kalkulierbaren Umstand stellen sich die Kunstvermittler_innen ein. Bei den Workshops hingegen spielt die sprachliche Barriere nur eine untergeordnete Rolle. Die Kunstvermittler_innen bereiten die Materialien so vor, dass alle Kinder sofort mitmachen können. Dabei wird jeder Arbeitsschritt in eine »handwerkliche« Sprache übersetzt, die wie eine einfache Betriebsanleitung gut nachvollziehbar ist. In allen Veranstaltungen wird in einer klar verständlichen Alltagssprache und in normalem Tempo mit den Teilnehmenden kommuniziert, um so spielerisch und nebenbei die aus Schule, Deutsch- und Integrationskursen erworbenen Sprachkenntnisse zu fördern und zu verfestigen.
»Berührt uns das gemeinsam? Sehr gut funktionieren religiöse Themen.«5 Im Vorfeld der Konzeption wurde diskutiert, welche Kunstwerke sich besonders gut oder eventuell gar nicht für die Museumsgespräche eignen könnten. Die Praxis zeigt jedoch, dass es dafür keine Faustregel gibt. Daher richten sich die Kunstvermittler_innen nach den jeweiligen Interessen der einzelnen Gruppen, ohne eine künstliche Schonhaltung einzunehmen. Entgegen den Befürchtungen von einigen ehrenamtlichen Begleiter_innen funktioniert beispielsweise der Einstieg in den gemeinsamen Dialog besonders gut über religiöse Themen. Sie sind das verbindende Moment zwischen Muslimen und Christen und über sie öffnen sich Wege zu Gesprächen über Gemeinsamkeiten und Unterschiede, über historische Bezüge und aktuelle gesellschaftliche Themen, zu Diskussionen über das Bilderverbot oder über das Verhältnis von Kultur und Religion.
»Unser Konzept ist: Wer kommen will, der kommt. Und die Kinder kommen immer auf jeden Fall.« 6 Die Workshops für Kinder und Jugendliche direkt in den Ausstellungen und Werkräumen der Hamburger Kunsthalle durchzuführen, wäre zwar wünschenswert, ist aus organisatorischen und rechtlichen Gründen aber kaum zu realisieren. Zum Ausflug ins Museum müssen schriftliche Einverständniserklärungen aller Eltern vorliegen, ausreichend viele berechtigte Begleitpersonen zur Verfügung stehen, die Kosten für Bus und Bahn gesichert und die meist langen Anfahrtswege von den Unterkünften einkalkuliert sein. Weil die Erfahrung schnell gezeigt hatte, dass fast nie alle Bedingungen zugleich erfüllt werden können, werden die Workshops direkt vor Ort in den Zentralen Erstaufnahmeeinrichtungen durchgeführt. Ein lästiger, aber unvermeidbarer Umstand ist dabei der Transport der Materialien. Sie werden je nach Möglichkeiten öfter variiert. Als Grundaus5 | Jeffrey Turek, freier Kunstvermittler und Künstler, Museumsgespräche für Erwachsene. 6 | Ute Klapschuweit, Mitarbeiterin Bildung und Vermittlung Hamburger Kunsthalle, Workshops für Kinder und Jugendliche.
»Kunst ist ein Grundbedür fnis«
stattung haben die Kunstvermittler_innen immer verschiedene Blei- und Buntstifte, Kreiden, unterschiedliche Papiere und Utensilien für einfache künstlerische Techniken wie Frottagen oder Collagen im Gepäck. Im Idealfall stehen für die Workshops ein separater Raum mit Wasseranschluss, ausreichendes Mobiliar, Malmaterialien sowie Angestellte, Dolmetscher und ehrenamtliche Hilfskräfte als Unterstützung zur Verfügung. Meist sind jedoch nur einige oder sogar gar keine dieser Voraussetzungen erfüllt. Auf diese unterschiedlichen Gegebenheiten reagieren die Kunstvermittler_innen entsprechend flexibel. Da die Gruppen häufig wechseln, werden inhaltlich keine konkreten Vorgaben gemacht und der Anspruch ist auch nicht, bestimmte Bildungsziele zu erreichen.
»Die Finanzierung läuft über viele Kooperationspartner.« 7 In Abstimmung mit dem Stiftungsrat der Hamburger Kunsthalle und der Kulturbehörde Hamburg wurden die Besuche im Museum an kostenfreie Führungen mit Voranmeldungen gebunden. Dieses Modell ist politisch und in der öffentlichen Diskussion gut vertretbar, da der integrative und vermittelnde Aspekt im Vordergrund steht und somit keine unfaire Bevorzugung gegenüber anderen bedürftigen Gruppen entsteht. Ein genereller Freieintritt ohne Programm wurde kurzzeitig diskutiert, aber als ungeeignet verworfen, weil keine zielgruppenspezifische Ansprache möglich ist. Für den mittelfristigen Zeitraum von einem Jahr wurde für die Museumsgespräche ein ausreichendes Budget definiert, um diese zu etablieren und mögliche Anlaufschwächen überbrücken zu können. Honorare für die Kunstvermittler_innen sowie Sonderkosten für professionelle Übersetzungen in Ausnahmefällen sind im Etat enthalten. Der Ausfall durch entgangene Eintritte ist nur marginal, da die Teilnehmer das Museum ohne das Programm nicht oder nur kaum besuchen würden. Im Falle der Workshops hat sich die Finanzierung durch Drittmittel und die verlässliche Zusammenarbeit mit engagierten Partnern als unverzichtbar erwiesen. So werden zur Zeit noch sämtliche Honorare der Kunstvermittler_innen zuzüglich Fahrtkosten sowie eine angemessene Vorbereitungspauschale großzügigerweise allein von der in Hamburg ansässigen Stiftung Kulturglück getragen. Diese Finanzmittel werden zuvor von der Stiftung ihrerseits durch Spenden eingeworben, wodurch sowohl die Bekanntheit als auch die Akzeptanz der Angebote bei potentiellen weiteren Förderern gesteigert wird.
»Tue Gutes und rede darüber, damit solche Projekte auch in der Öffentlichkeit erscheinen.« 8 Mit der Einteilung in die beiden Modellschienen ist eine differenzierte Ansprache der Zielgruppen möglich, die für das Gelingen der Projekte unbedingt nötig ist. Die Bekanntmachung der Museumsgespräche für Erwachsene wurde von der 7 | Nicola Verstl, Gründerin und Vorstand der Stiftung Kulturglück. 8 | Nicola Verstl, Gründerin und Vorstand der Stiftung Kulturglück.
341
342
Wybke Wiechell
Abteilung Kommunikation und dem Geschäftsführer der Hamburger Kunsthalle kommunikativ breit aufgestellt. Da es sich um ein offenes Angebot mit ausschließlich Einzelterminen handelt, sollten nicht nur die Unterkünfte, sondern auch private ehrenamtliche Helfer_innen angesprochen werden. Über die Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Integration (BASFI) wurden die Leitungen der Zentralen Erstaufnahmeeinrichtungen kontaktiert, um von dort aus die Informationen in die jeweiligen Arbeitsebenen zu tragen. Und über Pressemitteilungen und Posts in den Sozialen Netzwerken wurden interessierte Privatpersonen informiert, die sich ehrenamtlich in den Einrichtungen engagieren. Die Anmeldung zu den Museumsgesprächen wird üblicherweise von den deutschsprachigen ehrenamtlichen Begleitpersonen der Geflüchteten übernommen. Sie melden sich telefonisch oder per E‑Mail beim Besucherservice der Hamburger Kunsthalle an, so dass die Zusammensetzungen der Gruppen und ihre Größen gut zu steuern sind. Als Erinnerungsstücke und Werbemittel werden an den Kassen Freitickets mit dem gesonderten Aufdruck »Willkommen« in unterschiedlichen Sprachen an die Teilnehmenden ausgegeben. Die Workshops für Kinder und Jugendliche in den Unterkünften sind hingegen auf Regelmäßigkeit und Langfristigkeit ausgelegt. Entsprechend wird hier die Konzentration auf die enge Zusammenarbeit mit einer beschränkten Anzahl von Einrichtungen gelegt, mit denen die Stiftung Kulturglück in intensivem persönlichen Kontakt steht. Eine Kunstvermittlerin aus dem Team der Abteilung Bildung und Vermittlung fungiert als Ansprechpartnerin für die Verantwortlichen der Zentralen Erstaufnahmeeinrichtungen und gleichzeitig als organisatorisches Bindeglied zwischen der Kunsthalle und der Stiftung Kulturglück. Allgemeine Informationen und Projektberichte werden regelmäßig auf den jeweiligen Websites www.hamburger-kunsthalle.de und www.stiftung-kulturglueck.de öffentlich gemacht und bereits mehrfach wurde in der Lokalpresse über die gemeinsamen Projekte berichtet. Ein Höhepunkt war der Besuch der »Flüchtlingsreporter« im Museum. Sie sind eine Gruppe Journalisten aus unterschiedlichen Herkunftsländern, die in einer wöchentlichen Kolumne im Hamburger Abendblatt über ihre Erlebnisse und Erfahrungen in Hamburg erzählen.
»Das reicht alles noch nicht so richtig. Wir können nur sagen: Wir sind auf dem Weg«9 Wichtig ist der Erfahrungsaustausch mit den Kunstvermittler_innen, um sie mit den besonderen, oft emotional schwierigen Anforderungen der Programme nicht alleinzulassen. Aber auch der Gedankenaustausch mit Kolleg_innen anderer Häuser ist hilfreich – dazu leistet der Museumsdienst Hamburg einen wesentlichen Beitrag. Den Auftakt gab er mit der Organisation und Bereitstellung einer für alle Teilnehmenden kostenfreien Fortbildungsreihe mit den Expert_innen der Initiative stART international e.V. emergency aid for children. Im ersten Teil der 9 | Vera Neukirchen, Leiterin des Museumsdienstes Hamburg.
»Kunst ist ein Grundbedür fnis«
Fortbildung wurden die Vermittler_innen selbst in den Fokus genommen und für den Umgang mit geflüchteten Kindern und Jugendlichen sensibilisiert. Die Möglichkeiten und Grenzen von kreativer Arbeit in den Einrichtungen wurden ebenso thematisiert wie das Erkennen und Beachten der persönlichen Potentiale und Limits. In einer weiteren Einheit sollen die rechtlichen Belange für die Museen, die freien Mitarbeiter_innen sowie die Geflüchteten selbst beleuchtet werden. Weiterhin organisiert der Museumsdienst Hamburg regelmäßige Treffen der hauptamtlichen Leiter_innen der Vermittlungsabteilungen und einen für die Zukunft geplanten Jour Fixe für die freien Mitarbeiter_innen aller öffentlichen Hamburger Museen. Jedes dieser Häuser hat ein etwas anders ausgerichtetes und auf seine individuellen Eigenschaften und Möglichkeiten abgestimmtes Angebot, mit dem die unterschiedlichen Bedürfnisse und Interessen der Geflüchteten in ihrer ganzen Breite angesprochen werden können. So bietet beispielsweise das Museum für Kunst und Gewerbe Gespräche in seiner Abteilung für Islamische Kunst in arabischer und deutscher Sprache an, das Museum für Völkerkunde ermöglicht die Teilnahme an Familienangeboten, die Deichtorhallen konzentrieren sich auf Workshops für unbegleitete Minderjährige oder die Stiftung Historische Museen entwickelt spezielle Sprachkurse im Altonaer Museum und dem Museum für Arbeit. Das Museum für Hamburgische Geschichte bildet Geflüchtete für ihr Programm als Übersetzer aus. Sämtliche Veranstaltungen werden kostenfrei angeboten. Die Museen können so als eine geschlossene Einheit in der Hamburger Kulturlandschaft auftreten und gemeinsam bessere Voraussetzungen für eine langfristige Finanzierung der Angebote aller Häuser schaffen. In den nächsten Monaten muss und wird es sowohl die gemeinsame Aufgabe als auch die der einzelnen Häuser sein, die Fragen der Nachhaltigkeit für die Programme zu beantworten und die sich immer wieder verändernden Herausforderungen zu bestimmen: Welche langfristigen Konzepte sind realistisch? Ist der Paradigmenwechsel vom Aktionismus zum Konzept schon vollzogen? Wie sind die politischen Parameter? Wie gelingen Vernetzungen auf regionaler, überregionaler und Bundesebene? Mit heutigem Stand hat die Hamburger Kunsthalle den Anschluss an ein deutschlandweites Kooperationsprojekt zur Sprachförderung unter der Leitung des Deutschen Volkshochschulverbandes geplant sowie die Zusammenarbeit mit der Initiative zur Jugendförderung »Joblinge« und die Vernetzung mit den Wirtschaftsjunioren Hamburg beschlossen. Möglichst viele weitere Kooperationspartner sollen folgen, denn der Bedarf und die Nachfrage von Seiten der Geflüchteten, von ehrenamtlichen Helfern und weiteren Unterkünften sind erheblich höher, als mit den momentan zur Verfügung stehenden finanziellen und personellen Kapazitäten abdeckbar sind.
343
Fragen statt Antworten Internationale Klassen in der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen Julia Hagenberg Zusammenfassung Seit 2016 besuchen regelmäßig Schüler_innen sogenannter »Internationaler Klassen« die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf. Viele der Jugendlichen, deren Sprachkenntnisse noch nicht ausreichen, um am Unterricht für Regelklassen teilzunehmen, leben erst seit kurzer Zeit in Deutschland. Ziel der Workshopreihe ist es, dass sich die Schüler_innen auf der Grundlage ihrer Interessen, Orientierungen und Lebenswelten Zugänge zum Museum und zur Kunst erschließen. Die Workshops sind darauf ausgerichtet, dass sie eigene Stärken wahrnehmen und sich eigenständig und handlungsorientiert mit der Institution und ihren Inhalten vertraut machen. Das Programm ist Teil des Forschungsprojekts museum global?, mit dem die Kunstsammlung auf die Auswirkungen der Globalisierung reagiert, den Kanon der Klassischen Moderne hinterfragt und vor dem Hintergrund einer sich wandelnden Gesellschaft neue Methoden der Präsentation und Vermittlung von Kunst untersucht. Der Bericht schildert Hintergründe, Methoden und erste Ergebnisse des Programms. Abstract: Questions Instead of Answers: International School Classes Visiting the North Rhine-Westphalia Art Collection Since 2016, students in so-called ›international school classes‹ have frequently visited the North Rhine-Westphalia art collection in Düsseldorf. Many of these youth, whose language skills are insufficient to take part in regular school classes, have only lived in Germany for a short while. On the basis of these students’ interests, orientations and backgrounds, this series of workshops aims to provide avenues to open up the museum and the art to them. The hands-on workshops facilitate an independent familiarization with the institution and encourage the students to recognize their strengths. The program forms part of the research project museum global?, in which the art collection responds to the impacts of globalization, interrogates the canon of classical modernism and – against the backdrop of a society in flux – investigates new methods of art presentation and learning. This report sketches out the setting, methods and preliminary results of the program.
346
Julia Hagenberg
Seit März 2016 nehmen fünf sogenannte »Internationale Klassen« eines Gymnasiums, einer Real-, einer Gesamtschule und zweier Berufskollegs an einer neuen Workshopreihe der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen teil und besuchen regelmäßig das K20, die Dependance des Museums in der Düsseldorfer Altstadt. Die beteiligten Schüler_innen, deren Sprachkenntnisse noch nicht ausreichen, um am Unterricht für Regelklassen teilzunehmen, sind zwischen 13 und 20 Jahren alt und leben erst seit kurzer Zeit in Deutschland. Viele stammen aus Südund Osteuropa, aus der Ukraine, Russland, Afghanistan, aus dem arabischen und nordafrikanischen Raum; einige, aber nicht alle haben Fluchterfahrung. Ziel des Programms in der Kunstsammlung ist es, dass sich die Jugendlichen auf der Grundlage ihrer individuellen Interessen, Orientierungen und Lebenswelten Zugänge zum Museum und zur Kunst erschließen. Die Konzeption ist darauf angelegt, dass die Schüler_innen eigene Stärken wahrnehmen und sich möglichst eigenständig und handlungsorientiert mit der Institution und ihren Inhalten vertraut machen. Inhaltlich konzentriert sie sich auf das Thema Museum und die Kunst der Klassischen Moderne. Das Programm soll jedoch nicht dazu dienen, den der Sammlung zugrundeliegenden westlichen Kanon zu verstetigen und auf diese Weise einen Beitrag zur Integration der Schüler_innen in eine dominante »Leitkultur« leisten. Vielmehr werden ausschließlich Kunstwerke relevant, die die Jugendlichen selbst auswählen. Der Kanon als solcher wird auf diese Weise nicht hinterfragt, wohl aber einer bewusst subjektiven Herangehensweise unterworfen. Die Themen, Methoden und die Abfolge der einzelnen Workshops orientieren sich an Leitfragen, die die Entwicklung der Persönlichkeit in den Mittelpunkt rücken: Wie können Situationen und Umgebungen geschaffen werden, in denen sich die Schüler_innen selbstbestimmt im Museum bewegen und der Kunst annähern? Welche Methoden und kreativen Techniken eröffnen große individuelle Gestaltungsfreiräume, ohne die Jugendlichen zu verunsichern? Wie können sie in Gesprächen und der bildnerischen Praxis darin bestärkt werden, Assoziationen zwischen der Museums- und Kunsterfahrung und ihren Lebenswelten herzustellen, diese zu reflektieren und zu gestalten (vgl. Mecheril 2012: 6)? Dabei richtet das Programm den Blick nicht »nach hinten«, sondern auf die Gegenwart (vgl. Schnurr 2015: 303): Migrations- und Fluchterfahrungen werden nur dann besprochen, wenn die Schüler_innen sie von sich aus zum Thema machen. Die Workshops liefern Anlässe und Gelegenheiten, diese Erfahrungen einzubringen, forcieren die Thematik jedoch nicht.
»Woher kommen diese Bilder?« Das Programm ist Teil des von der Kulturstiftung des Bundes geförderten Forschungsprojekts museum global?, mit dem die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen auf die Auswirkungen der Globalisierung reagiert. Ausgehend von der eigenen Sammlung, die im besonderen Maße auf die Epoche der Klassischen
Fragen statt Antwor ten
Moderne und somit auf Europa und Nordamerika fokussiert ist, widmet sich das Haus in Forschungen, Veranstaltungen und Präsentationen dem Zeitraum ab 1904. Im Projekt werden die Moderne und ihr Kanon hinterfragt, wobei nicht Wissen behauptet, sondern Fragen und Thesen formuliert und im Dialog mit Partner_innen in Kunst, Wissenschaft und Forschung weiterentwickelt werden sollen. Auch im Bereich der Museumspädagogik werden die Auswahl der Sammlungsbestände sowie die Methoden ihrer Präsentation und Vermittlung untersucht. Angesichts der zunehmenden Heterogenität der Lebenswelten in der Migrationsgesellschaft und sich wandelnder Interessen des Publikums zielt das Programm für Internationale Klassen darauf ab, Perspektiven der Jugendlichen kennenzulernen, ihre Fragen, Kommentare und Wünsche in das Museum zu spiegeln und seine Praktiken zu überprüfen.
»Was muss man lernen, um im Museum zu arbeiten?« Der Konzeptionsphase ging ein interner Workshop mit Ansgar Schnurr voraus, in dem Museumspädagog_innen und Kurator_innen über Transkulturalität und Machtverhältnisse im Museum diskutierten. Darüber hinaus suchten wir das Gespräch mit verschiedenen Interessensvertreter_innen in Düsseldorf, darunter die Flüchtlingsbeauftragte der Stadt, die Kommunalstelle für Bildung und Integration und die Diakonie, die zahlreiche Initiativen u.a. mit unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten betreut. Auch die Lehrer_innen der beteiligten Schulen wurden zum Austausch eingeladen und ihre Anregungen in die Konzeption einbezogen. Bei der Planung galt es, sowohl mangelnde Sprachkenntnisse als auch die Diversität der Klassen im Hinblick auf Alter, Herkunft und Milieu sowie mögliche Fluchterfahrungen zu berücksichtigen.1 Um mit Schüler_innen ins Gespräch zu kommen, organisierten wir einen Testworkshop mit einer Internationalen Klasse. Die Jugendlichen, die nie zuvor ein Museum besucht hatten, beteiligten sich aktiv und selbstbewusst an den Gesprächen, hatten jedoch Schwierigkeiten, einen Sicherheitsabstand zu den Kunstwerken einzuhalten. Trotz ihres unterschiedlichen Alters und ihrer heterogenen Herkunft arbeiteten sie unkompliziert zusammen und halfen sich gegenseitig bei Sprachproblemen. Auf die Frage nach eigenen Interessen und Wünschen im Museum reagierten sie dagegen unsicher; aus ihren vorsichtigen Reaktionen war zu schließen, dass sie nach »möglichen« Antworten suchten. Der Testworkshop zerstreute viele unserer Bedenken, machte jedoch deutlich, dass eine Lösung für die Sicherheitsprobleme gefunden werden musste. Er zeigte außerdem, dass ergebnisoffene Aufgabenstellungen die Schüler_innen, die frontal strukturierte Bildungssysteme gewohnt sind, überfordern können. 1 | An der Konzeption des Programms haben Janine Blöß, wissenschaftliche Referentin der Abteilung Bildung in der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Pia Kalenborn, freiberuflich tätige Kunstvermittlerin, und Dr. Karin Mohr, Kunsthistorikerin und freie Mitarbeiterin im Bereich Kulturelle Bildung, mitgearbeitet.
347
348
Julia Hagenberg
Aus umgekehrter Perspektive werfen die Beobachtungen die Frage auf, durch welches Umfeld unsere eigenen pädagogischen Konzepte geprägt sind. Unmittelbar vor Beginn des Programms und der ersten Begegnung mit den Jugendlichen fand daher eine Fortbildung zur Interkulturellen Sensibilisierung statt, in der sich alle beteiligten Museumspädagog_innen mit der eigenen kulturellen Prägung auseinandersetzten.
»Was machen wir im Museum?« In seiner aktuellen Fassung umfasst das Programm für Internationale Klassen zehn Workshops von 120 Minuten. Der erste Workshop findet in der Schule, alle weiteren im K20 statt und werden pro Klasse von je zwei Museumspädagog_innen betreut. In der bildnerischen Arbeit kommt ein breites Spektrum von Methoden zur Anwendung, von der Zeichnung und Malerei über die zwei- und dreidimensionale Collage und die Monotypie bis hin zur digitalen Gestaltung eines Videos. Die künstlerische Praxis wird sowohl in Einzel- als auch in Gruppenarbeit umgesetzt, so dass die Schüler_innen sich individuell entfalten können, aber auch untereinander abstimmen und in Teams kooperieren müssen. Die Workshops starten in der Schule, um den Jugendlichen für die unterschiedlichen Funktionen und Strukturen der Institutionen zu sensibilisieren. In der Schule tauschen die Museumspädagog_innen und Schüler_innen die Rollen: Die Jugendlichen betätigen sich als ortskundige »Guides«, führen die Museumspädagog_innen an ihre Lieblingsorte und geben ihnen Einblick in ihren schulischen Alltag. Schon in den ersten Veranstaltungen wurde offenkundig, dass dieses Konzept aufgeht. Die Schüler_innen waren begeistert von der Chance, ihre Schule zu zeigen, und gaben zu verstehen, dass sie sich stark mit ihr identifizieren. Der darauffolgende erste Termin im Museum beginnt mit einer Übung zur Raumwahrnehmung, bei der die Schüler_innen die Atmosphäre im »white cube« erkunden und in Zeichnungen und Piktogrammen ihre eigene Situation und Befindlichkeit reflektieren. Im dritten Workshop geht es um die klassischen Aufgaben eines Museums, das Bewahren und Präsentieren von Objekten. Zu diesem Termin bringen die Schüler_innen persönliche Gegenstände mit, für die sie einen »Museumsraum« in Form einer Kiste gestalten. Alle Kisten werden zu einem »Museum der Klasse« arrangiert, Inhalte und Ordnungskriterien besprochen und verschiedene Anordnungen der »Räume« probiert. Zum Vergleich untersuchen die Jugendlichen ein Modell des K20 im Maßstab 1:25, das die Kurator_innen für die Planung der Sammlungspräsentation nutzen. Die Einladung, eigene Objekte zu verwenden, nahmen mehrere Schüler_innen zum Anlass, Fotos und Erinnerungsstücke aus ihrer Heimat zu präsentieren und von ihren Erfahrungen zu berichten. Wie der Kommentar einer Schülerin verdeutlicht, trägt der Workshop auch dazu bei, dass sich die Jugendlichen untereinander näher kennenlernen: »Für mich war es sehr interessant, die Schätze von den anderen zu sehen«.
Fragen statt Antwor ten
»Arbeiten wir in Gruppen?« Erst im vierten Workshop widmen sich die Schüler_innen den Kunstwerken, streifen in Teams durch die Sammlung und entscheiden sich für ein Lieblingsbild, mit dem sie sich an den folgenden Terminen intensiver auseinandersetzen. Damit gewährleistet ist, dass keine Kunstwerke berührt werden, bestimmt jede Schülergruppe zuvor eine Person im Team, die für die Einhaltung des Sicherheitsabstands zuständig ist. Durch diese Regelung übernehmen die Jugendlichen selbst die Verantwortung für ihr Handeln und müssen nur selten von den Museumspädagog_innen diszipliniert werden. Im weiteren Verlauf der Workshops erhalten die Jugendlichen zahlreiche Möglichkeiten, eigene Ideen, Erfahrungen und Vorlieben zum Ausdruck zu bringen. Unter anderem wählen sie ein Motiv ihres Lieblingswerks, entwickeln es in ihrer individuellen Bildsprache und in einer selbst gewählten künstlerischen Technik weiter. Darüber hinaus befassen sie sich mit der Biografie der Künstler_innen, die »ihr« Bild geschaffen haben. Viele Vertreter_innen der Klassischen Moderne haben Migration, Flucht und Exil erlebt. Die Beschäftigung mit ihren Lebensgeschichten bietet den Jugendlichen die Möglichkeit, die eigene Situation aus einer historischen Perspektive wahrzunehmen und transkulturelle Aspekte zu entdecken, die die Entstehung vieler Kunstwerke beeinflusst haben. Im Workshop werden den Teams Fotos und Daten zur Persönlichkeit der Künstler_innen, zu ihrem familiären und sozialen Umfeld sowie zu ihren Aufenthaltsorten zur Verfügung gestellt. Mit diesem Material entwerfen die Jugendlichen Collagen im Design von Facebook-Profilen, anhand derer sie die Lebenswelten der Künstler_innen mit ihren eigenen vergleichen können. Der Idee von Freundschaftsanfragen auf Facebook folgend, können die Teams Verbindungslinien zwischen ihren Profilen ziehen und sich die Beziehungen und Netzwerke der Künstler_innen vor Augen führen.2 Zum Abschluss des Programms erstellen die Jugendlichen mit Hilfe einer App ein Video zu ihrem Lieblingswerk, in dem sie ihre Erfahrungen verwerten, aber auch frei experimentieren können. Ob Dokumentation, Reportage oder Experimentalfilm – welche Gattung die Jugendlichen wählen, ist ihnen freigestellt.
»Wir kennen uns jetzt schon ziemlich gut aus im Museum.« Das Programm endet mit einem Termin, zu dem die Schüler_innen eine Partnerklasse aus der eigenen Schule einladen. Im finalen Workshop treten die Jugendlichen als Kunstvermittler_innen auf und erleben sich selbst als kompetente »Guides« im Museum. Sie führen die Partnerklasse zu ihren ausgewählten Kunstwerken und präsentieren ihre Videos. In der bildnerischen Praxis arbeiten sie wiederum in Teams zusammen und erstellen wechselseitig Porträts in Mono2 | Diese Konzeption folgt der Leitlinie des Nürnberg-Papers, das globale Beziehungsgeflecht der Kultur wahrnehmbar zu machen (Lutz-Sterzenbach u.a. 2013: 330).
349
350
Julia Hagenberg
typie-Technik. Die Idee der Kooperation mit einer Partnerklasse verfolgt zwei Zielsetzungen: Einerseits sollen die Schüler_innen die Chance erhalten, sich selbst, ihre Kenntnisse und Kompetenzen im Museum zu erproben, andererseits in den Austausch mit Regelklassen treten, in die sie später wechseln werden. Nach Aussage der Lehrer_innen haben sie in der Schule oft nur wenig Kontakt mit anderen Gleichaltrigen. Im Workshop begegnen sich die Jugendlichen und können im schulischen Alltag an die gemeinsame Erfahrung im Museum anknüpfen.
»Was ist wichtig im Museum?« Parallel zu den Workshops kommen während der gesamten Laufzeit symbolische »Sprechblasen« zum Einsatz, die für das Programm von zentraler Bedeutung sind. Auf diesen Vorlagen können die Jugendlichen Fragen, Kommentare und Wünsche notieren. Die Sprechblasen geben den Jugendlichen eine sichtbare Stimme und sollen sowohl den internen Mitarbeiter_innen als auch dem Publikum zugänglich gemacht werden. Zurzeit werden die ausgefüllten Vorlagen im Museum gesammelt, dokumentiert und für eine Präsentation vorbereitet.3 Es zeigt sich, dass die Schüler_innen sehr unterschiedliche Themen ansprechen. Manche geben persönliche Kommentare ab (»Ich habe mich gefühlt, als wäre ich allein im Museum.«), andere äußern Wünsche (»Alles war super. Und ich will das noch einmal machen.«) oder interessieren sich für Sachinformationen (»Kann man hier ein Praktikum machen?«). Wieder andere stellen Fragen, die die Institution als solche, ihre Gründung und Funktion betreffen (»Warum habt ihr das Museum gemacht?«) Die in den Sprechblasen angesprochenen Themen sollen nicht nur mit den Schüler_innen diskutiert werden, sondern auch als Ausgangspunkt für interne Gespräche dienen, die um Fragen der Transparenz und Diskursmacht im Museum kreisen. Nicht zuletzt werden die Sprechblasen und alle weiteren Produkte der Schüler_innen auch dazu genutzt, das Programm selbst auszuwerten und weiterzuentwickeln. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Textes hat etwa die Hälfte der geplanten zehn Workshops stattgefunden. Schon jetzt lässt sich absehen, dass die Stimmen der Jugendlichen die Kunstsammlung, zumindest ihre Bildungs- und Vermittlungsangebote verändern werden.
L iter atur Lutz-Sterzenbach, Barbara/Schnurr, Ansgar/Wagner, Ernst u.a. (2013): »Nürnberg-Paper 2013. Interkultur – Globalität – Diversity: Leitlinien und Handlungsempfehlungen für eine transkulturelle Kunstpädagogik«, in: Barbara Lutz-Sterzenbach/Ansgar Schnurr/Ernst Wagner (Hg.), Bildwelten remixed. 3 | Einige Fragen und Bemerkungen der Schüler_innen sind in diesem Text als Zwischenüberschriften zu lesen.
Fragen statt Antwor ten
Transkultur, Globalität, Diversity in kunstpädagogischen Feldern, Bielefeld: transcript, S. 325-335. Mecheril, Paul (2013): »Ästhetische Bildung und Kunstpädagogik. Migrationspädagogische Anmerkungen«, in: Art Education Research No. 6. Kunstunterricht und -vermittlung in der Migrationsgesellschaft, Teil 1: Sich irritieren lassen. http://iae-journal.zhdk.ch/no-6/ (letzter Zugriff: 20.05.2016). Schnurr, Ansgar (2015): »Postmigrantische Kunstpädagogik«, in: Torsten Meyer/ Gila Kolb (Hg.), What’s Next? Art Education. Ein Reader, München: kopaed, S. 301-304.
351
»Kultur öffnet Welten« Interkulturelle Erfahrungen an der Basis Lydia Grün
Zusammenfassung 70 Prozent der deutschen Bevölkerung leben im ländlichen Raum, doch viele der dort stattfindenden Kulturprojekte und -initiativen werden nur selten auch überregional wahrgenommen, da man bisher vor allem auf die »kulturellen Leuchttürme« fokussiert hat. Die von der Staatsministerin für Kultur und Medien, Prof. Monika Grütters, ins Leben gerufene Initiative »Kultur öffnet Welten« zielte in diesem Jahr darauf ab, die bundesweit stattfindenden Projekte für die kulturelle Teilhabe sichtbar zu machen und die unzähligen Akteur_innen und Ehrenamtlichen zu würdigen, die mit ihrer Arbeit und ihrem Engagement diese Projekte erfinden und ermöglichen. In acht verschiedenen Bundesländern hatte das netzwerk junge ohren Workshops zu regional interessanten Themen organisiert, um möglichst alle Akteur_innen der Kultur, der zivilgesellschaftlichen Institutionen, der Kommunen und der Migrant_innen-Selbstorganisationen an einen Tisch zu bringen. Es galt herauszufinden: Wer »macht« die Kultur in den Regionen, Dörfern und Städten? Wie könnten sich die Akteur_innen vor Ort besser miteinander vernetzen, um bereits vorhandene Potentiale gemeinsam zu stärken und auszuschöpfen? Wie können auch Kommunen, Länder und letztlich Stiftungen und der Bund Hilfestellungen leisten? Dies zeigt der Beitrag beispielhaft an den zwei sehr unterschiedlichen Städten Detmold und Weimar. Abstract: Culture Opens Worlds – Intercultural Experiences at the Grass Roots Level 70 percent of the German population lives in rural and regional areas, yet most of the cultural projects and initiatives carried out in those areas rarely receive national attention, owing to the tendency to focus on »cultural centers.« The initiative Kultur öffnet Welten (Culture opens worlds), which was implemented by the Federal Government Commissioner for Culture and the Media, Professor Monika Grütters, aims this year to highlight the projects occurring right across the nation, and to recognize the countless partners and volunteers, who through their work and engagement, create and make them possible. In eight different federal states, the netzwerk junge ohren (network of young ears) set up workshops according to regional interest topics, in order to bring the biggest possible number of cultural partners,
354
Lydia Grün NGOs, communities and migrant-run organizations to the one table. The aim was to find out who ›creates‹ the culture in these regions, towns and cities? How can the stakeholders in these areas network more effectively in order to collectively tap and strengthen existing potential? Additionally, how can communities, regions, foundations and also the federal government assist? The two contrasting cities of Detmold and Weimar are used in this paper to illustrate these questions.
Im Laufe des Jahres 2015 sind über 1 Million geflüchtete Menschen aus den verschiedensten Ländern in die Bundesrepublik Deutschland gekommen. Diese Menschen sind ein Teil unserer Gesellschaft, und nicht zuletzt der Kultur kommt hierbei eine große, integrative Aufgabe zu. Die von der Staatsministerin für Kultur und Medien, Prof. Monika Grütters, ins Leben gerufene Initiative »Kultur öffnet Welten« zielt darauf ab, die in ganz Deutschland stattfindenden, unterschiedlichsten Kulturprojekte für kulturelle Teilhabe sichtbar zu machen. Erstmalig unter einem Dach und als gemeinsames Vorhaben würdigen damit Bund, Länder, Städte und Gemeinden gemeinsam mit den künstlerischen Dachverbänden und Vertreter_innen der Zivilgesellschaft die unzähligen Akteur_innen und Ehrenamtlichen, die mit ihrem Engagement diese Arbeit vor Ort erst ermöglichen. Die Reaktionen auf die Initiative waren überzeugend: Bei einer ersten bundesweiten Aktionswoche im Mai 2016 beteiligten sich über 400 Akteur_innen mit über 500 Veranstaltungen. Am 21. Mai 2016 wurden von Kulturstaatsministerin Monika Grütters drei herausragende, beispielgebende Projekte mit einem Sonderpreis ausgezeichnet, die auf vorbildliche Weise kulturelle Teilhabe geflüchteter Menschen ermöglichen. Doch zurück zum Anfang: Wer »macht« die Kultur in den Regionen, Dörfern und Städten? Was funktioniert gut und was weniger gut? Was braucht man für eine funktionierende Kulturarbeit jenseits der »kulturellen Leuchttürme« mit deren medialer Aufmerksamkeit? Wie könnten sich die Akteur_innen vor Ort besser miteinander vernetzen, um bereits vorhandene Potentiale gemeinsam zu stärken und auszuschöpfen? Wie können auch Kommunen, Länder und letztlich Stiftungen und der Bund Hilfestellungen leisten? Um dies in Erfahrung zu bringen, wurde ein Schulterschluss von Institutionen gebraucht, die jahrelange Erfahrung mit der kulturpolitischen Vernetzung unterschiedlichster Häuser und Interessent_innen haben, eine ausgewiesene Expertise in transkultureller Arbeit und Verbindungen in alle Bundesländer vorweisen konnten und zudem unabhängig von verschiedensten kulturpolitischen Interessen agieren. Der Verbund von netzwerk junge ohren als ein etabliertes europäisches Netzwerk für Musikvermittler_innen und das Haus der Kulturen der Welt in Berlin lösten dies ein: Während das netzwerk junge ohren mit seiner über zehnjährigen Expertise als Plattform der Musikvermittlung vor allem die Vernetzung und Mobilisierung in den Regionen und den Kontakt zu den Akteur_innen übernahm, stellte das Haus der Kulturen der Welt die Internetplattform www.kultur-oeffnet-welten.de bereit, auf der die
»Kultur öffnet Welten«
Akteur_innen nicht nur ihr interkulturelles Profil, sondern auch ihre Projekte, Aktionen und Initiativen präsentieren konnten – flankiert von einer Diskurs ebene, die vor allem selbstkritische Beiträge zum Thema transkulturellen Arbeitens bereit hält. Die Integration von geflüchteten Menschen stellt auch Kulturinstitutionen landauf, landab vor gewaltige Herausforderungen – diese sichtbar zu machen, war Teil der Aufgabe von »Kultur öffnet Welten«. Denn über 70 Prozent der Bevölkerung in Deutschland leben im ländlichen Raum und viele der dort stattfindenden Kulturprojekte werden bislang kaum wahrgenommen, weil sie jenseits der sogenannten »kulturellen Leuchttürme« stattfinden. Für uns galt es nun zunächst, in verschiedene Bundesländer zu reisen und dort – spartenübergreifend – möglichst viele Akteur_innen einer Region, wie zum Beispiel aus den Museen und Theatern, von Verbänden und sozialen Trägern wie etwa vom Deutschen Roten Kreuz oder der Arbeiterwohlfahrt, Migrant_innen-Selbstorganisationen, Vertreter_innen von Hochschulen, Kommunen, Bibliotheken und Volkshochschulen an einen Tisch zu bringen. Dort wollten wir erfahren, unter welchen Bedingungen Kultur-Arbeit stattfindet, welche Netzwerke initiiert oder verstetiget werden können, welche Bedürfnisse und Voraussetzungen annähernd erfüllt sein müssen, um (weiterhin) gut arbeiten zu können. Es ging auch darum, zu erfahren, wie auf kommunaler und Länder- oder gar Bundesebene langfristig strukturell geholfen werden kann. Jedwedes Kunst- oder Kulturprojekt ist immer auch abhängig von den es umgebenden Strukturen. Und hier gibt es ganz gewaltige Unterschiede, zum Beispiel was die Größe der Häuser, die finanzielle Ausstattung, das Personal oder auch das eigene Selbstverständnis betrifft. Dieser Artikel kann nur einen kleinen Einblick in die bisherigen Erfahrungen geben, da die Auswertung der insgesamt 15 regionalen Workshops noch läuft. Doch möchte ich für diesen Text zwei ganz unterschiedliche Städte heraus greifen, nämlich Detmold und Weimar. Beide Städte können auf eine bedeutende Geschichte als Residenzstädte und Orte des kulturellen Reichtums zurückblicken. Weimar ist mit seiner Fülle von Kultureinrichtungen bis heute der Inbegriff der sogenannten deutschen Klassik und eines Deutschlands der Dichter und Denker. Detmold wiederum ist seit der Regierungszeit des Fürsten Leopold III., der Clara Schumann und Johannes Brahms an seinen Hof holte, ein Zentrum der Musik. Die dortige Hochschule für Musik gilt international als herausragende Ausbildungseinrichtung. Jeder unserer regionalen Workshops im Rahmen von »Kultur öffnet Welten« hatte ein spezifisches, der Region angepasstes und mit den Akteur_innen vor Ort entwickeltes Thema, das zur Diskussion und zum Austausch anregen sollte. In Weimar fanden sich die Akteur_innen zu dem Thema »Chancen und Herausforderungen der Kulturarbeit durch Zuwanderung« und in Detmold zu »Kulturarbeit und zivilgesellschaftliches Engagement« zusammen. Bedenkt man, dass sowohl Detmold als auch Weimar weniger als 80.000 Einwohner_innen haben, überraschte es auf den ersten Blick, dass sich zwar viele Akteur_innen lose vom Sehen persönlich kannten, sich aber fachlich oder in
355
356
Lydia Grün
konkreten Vorhaben bisher noch nicht oder wenig ausgetauscht hatten. Grundsätzlich wurde bei allen Workshops sehr deutlich, dass es noch immer eine deutliche Ehrfurcht vor den sogenannten großen Häusern, die für die »Hochkultur« stehen, gibt. Die Trennung von Laien und Profis manifestiert sich letztlich auch in dieser fehlenden Kommunikation, sich mit Laien und damit der Stadtbevölkerung, also ihrem Publikum, auseinanderzusetzen. Hier kristallisierte sich zunehmend die Notwendigkeit einer Selbstreflexion vieler Kultur-Akteur_innen und ihrer Häuser heraus. Denn Partizipation heißt: Kultur-Institutionen und Akteur_innen müssen sich auch nach Innen verändern. Dies ist ein mitunter lange Zeit andauernder und nicht wenig herausfordernder Prozess, für den das eigene künstlerische Selbstverständnis auf dem Prüfstand steht: »Ich sehe die Geflüchteten als großen Katalysator für eine längst überfällige Selbstreflexion der großen Institutionen«, so Folker Metzger von der Klassik Stiftung Weimar (Metzger, Weimar 2016). Dabei liegen praktische Lösungen schnell und unkompliziert auf der Hand. Direktes Miteinandersprechen ermöglicht vieles: In Detmold gibt es zum Beispiel die private Musikschule »Das Glashaus«, die vor dem Problem steht, bei weitem nicht über genügend Instrumente zu verfügen, um jedem interessiertem Kind ein Übe-Instrument nach Hause mitgeben zu können. Hier offerierte der Rektor der Hochschule für Musik, Prof. Dr. Grosse, spontan die Schätze seines Instrumentenkellers. Des Weiteren wurden auch Ideen der Zusammenarbeit entwickelt, die man bisher gar nicht als Möglichkeit bedacht oder als solche nicht wahrgenommen hatte, zum Beispiel die Einbindung der Öffentlichen Bibliotheken: Sie bringen seit jeher Menschen zusammen, die wegen ihrer unterschiedlichen sozialen Herkunft, ihrer finanziellen Lebensumstände und ihres Bildungs- und Berufsstandes im sonstigen Alltag kaum Berührungspunkte haben. Dabei ist der große Vorteil von Bibliotheken, dass das »Konzept Bibliothek« als Begegnungsund Bildungsort weltbekannt ist, auch in Aleppo und Faludscha, und nicht erst mühselig vermittelt werden muss (Kusber o.D.: 2). In Leipzig, in der weltberühmten Nationalbibliothek, werden die Lesesäle jetzt auch von geflüchteten jungen Erwachsenen genutzt, die sonst in ihren beengten provisorischen Unterkünften keinen Ort der Ruhe und Konzentration haben, um zu lernen. Diese Öffnung sei auch für andere Bibliotheken denkbar. Auch die Volkshochschulen sind ein wichtiger Knotenpunkt der Bildung und Begegnung im kommunalen Leben. In Weimar wurde spontan angeboten, die Räume der VHS für Kulturprojekte usw. zu nutzen. Die Kultur eines Landes ist ganz entscheidend für die eigene Identitätsbildung und auch für das Zugehörigkeitsgefühl der Menschen zu einer Region, zu einer Stadt. »Die Kunst ist eine Vermittlerin des Unaussprechlichen« (Goethe 1960: 529), demzufolge kann Kultur unserem Verständnis nach aber auch ein entscheidender Faktor des transkulturellen Austauschs sein. Hier gilt es, die Wertschätzung und den gegenseitigen Respekt zu fördern und anzuerkennen: Die Geflüchteten bringen einen großen, bereichernden Schatz ihrer Kultur mit.
»Kultur öffnet Welten«
Im Moment gilt die Kulturelle Bildung als ein Garant für die Vermittlung demokratischer Grundwerte und für ein friedliches Miteinander. Doch muss man sich bewusst sein, dass im Gegensatz zu den Ballungszentren in vielen der ländlichen Räume Deutschlands bisher nur sehr wenige Menschen mit Migrationserfahrung gelebt haben, es also kaum Erfahrungen im Umgang miteinander gibt. Hier fehlen nicht nur die Dolmetscher_innen für die Sprache, sondern vielmehr Dolmetscher_innen für soziale und kulturelle Codes. Der französische Soziologe Pierre Bourdieu prägte den Begriff des »inkorportierten kulturellen Kapitals« (Bourdieu 1992: 55f.) und meinte damit die spezifische Sozialisation eines jeden einzelnen Menschen. Denn auch die Rezeption von Kultur und Kunst ist davon beeinflusst, welche Prägungen wir erfahren haben, welcher Sprache wir uns bedienen, wie wir uns im öffentlichen Raum bewegen, kurzum: welche Regeln allgemeiner, gesellschaftlicher Konsens sind. Hierzu ein praktisches Beispiel aus Detmold: Die Hochschule für Musik hatte ein Benefiz-Konzert organisiert, zu dem auch geflüchtete Menschen aus der Stadt eingeladen waren. Diese nahmen die Einladung gerne an, gingen jedoch in der Pause. Das Publikum war irritiert. Jedoch: Es fehlte schlicht die Information, dass das Konzert eine Pause hatte und noch nicht beendet war. Dies ist gemeint, wenn von kulturellen Dolmetscher_innen gesprochen wird, was im Übrigen für alle neuen Besucher_innen von Formaten der sogenannten Hochkultur gilt. Die gegenseitige Zurückhaltung bei vielen guten Ideen wie Straßen- und Willkommensfeste geht unter anderem auf fehlende »Übersetzung« zurück: Für viele geflüchtete Menschen aus Syrien, Afghanistan oder anderen Ländern ist der öffentliche Raum angstbesetzt und erinnert an erlebte Repressionen. Wir sind bei unserer Rundreise sehr engagierten Bürgermeister_innen, Museumsdirektor_innen, Sozialarbeiter_innen, Künstler_innen, Lehrer_innen und vielen Menschen begegnet, die für ihre Institution und die Menschen in ihrer Region das Beste wollen und weit über normale Maße für ihre Stadt engagiert arbeiten. Doch ungeachtet aller zuerkannten Bedeutung von Kultureller Bildung treffen diese Akteur_innen nicht selten auf eine Ablehnung seitens der Bevölkerung vor Ort. Die Geflüchteten werden von dieser nicht als kulturelle Bereicherung, oft maximal als Problemlösung mit Blick auf die demografische oder wirtschaftliche Entwicklung begriffen. Es herrscht eine konfuse Angst vor der vermeintlich destruktiven Dominanz einer kulturellen Minderheit, die letztlich zu einer Bedrohung einer sogenannten deutschen Mehrheitsgesellschaft wird. Diese oft rein emotional konnotierten Befürchtungen zu negieren, hieße, die verantwortlichen Kulturschaffenden vor Ort allein zu lassen und Parteien und Strömungen wie der AfD noch mehr Akzeptanz und Wähler_innen zu verschaffen. Immer wieder wurde daher vor Ort die Bitte geäußert, Kulturelle Bildung enger mit politischer Bildung zu verzahnen. Dabei haben größere wie kleinere Städte vielerorts eines gemeinsam: Es gibt nur selten eine Einbindung der bereits vorhandenen Migrant_innen-Selbstorganisationen. Oftmals werden diese lediglich als Pool von kostengünstigen Überset-
357
358
Lydia Grün
zer_innen wahrgenommen – ihr Potential, auch als kulturelle Vermittler_innen zu agieren, Konflikte zu lösen und zu vermeiden, Vertrauen aufzubauen und Hilfeleistungen in beide Richtungen vermitteln zu können, wird bisher nicht ausreichend genutzt. Einen über jahrelange Auf bauarbeit etablierten Weg zeigt das Haus der Vielfalt in Dortmund, das eng mit den Communities der Migrant_innen zusammenarbeitet und selbst zwei Flüchtlingsunterkünfte erfolgreich managt. Erfolgsrezept ist hier, dass es keines gibt: »Alle Projekte funktionieren nur durch persönliche Beziehungen«, so Kati Stüdemann, Projektkoordinatorin im Haus der Vielfalt, und fordert: »Man muss mit den Menschen von Anfang an gemeinsam denken, gemeinsam gestalten. Fertige Projekte, die den Menschen vorgegeben werden, funktionieren einfach nicht mehr – das muss man sich klar machen!« (Stüdemann, Weimar, 2016) Damit hinterfragt sie vehement Funktion und Wirkung von sogenannten Modellprojekten, was auch direkte Konsequenzen bei der Beurteilung von Förderkriterien nach sogenannten übergreifenden Gelingensbedingungen nach sich ziehen dürfte. »Best Practice« ist in dieser Lesart maximal ein Impuls, die Adaption von Modellen bundesweit quasi ausgeschlossen. Ein weiteres, grundsätzliches Problem, das wir bei fast allen regionalen Workshops haben ausmachen können, ist die fehlende Vernetzung und Informationsvermittlung untereinander. Dies beginnt bei den wirklich zuständigen Ansprechpartner_innen aus Kultur, Sozialem und Zivilgesellschaft, deren Telefonnummern und Mail-Adressen, und endet bei der Information, wer was bieten kann. Hier sind die kommunalen Strukturen gefordert, die jedoch vielerorts selbst mit diversen strukturellen, personellen und damit auch finanziellen Herausforderungen zu kämpfen haben. Es ist erstaunlich, wie viele gute Projekte zur Inklusion und Integration stattfinden können, wenn die Kommunen eng und im gegenseitigen großen Vertrauen und Respekt mit den Projektträger_innen zusammenarbeiten. Und hier liegt das nächste noch zu lösende Problem: Nur allzu oft steht die Kultur in kommunalen Haushalten unter dem Begriff »freiwillig« und wird rigoros zusammengespart – gleichsam wird jedoch erwartet, dass die Kultureinrichtungen ihrer definierten Bildungsaufgabe nachkommen. Die Umstellung auf das Finanzierungssystem via Projektförderung hat viel Dynamik – vielerorts zu viel Dynamik, nämlich Hektik hervorgebracht: Auch beim Thema Integration von Geflüchteten verfällt so mancher in einen wilden Aktionismus, der vielleicht kurzfristig zu einem veritablen Presse-Echo führen mag, langfristig jedoch einmal geöffnete Türen verschließt. Auch in den Kultur-Institutionen ist bekannt, dass, wenn bestimmte Projekte enden, auch gute und mühsam aufgebaute Kommunikations- und Vernetzungsstrukturen – zum Beispiel mit Schulen und anderen Jugendeinrichtungen – verloren gehen. Dabei wissen wir allein schon aus der musikalischen Praxis: Übung macht den Meister! Bedeutet: Wiederholung verbessert das »Produkt«. Dem Prinzip der Serie steht allerdings die Projektförderung mit punktueller Innovation als Grundprinzip signifikant entgegen. Dass in vielen Regionen oft gut ausgebildetes Personal fehlt, liegt letztlich auch an diesen unattraktiven Strukturen und Arbeitsbedingungen.
»Kultur öffnet Welten«
Eine weitere Herausforderung, die sich zunehmend zu einer massiven Schieflage auswachsen wird, ist die fehlende Betreuung der ehrenamtlichen Kräfte. Sich ehrenamtlich engagierende Menschen sind deutschlandweit das Fundament vieler kultureller Projekte, vor allem im Bereich der Kinder-und Jugendarbeit und der Betreuung von Geflüchteten. Auch hier fehlen oft verlässliche und qualifizierte hauptamtliche Ansprechpartner_innen: Denn in vielen Fällen geht es nicht nur um fehlende Dolmetscher_innen, sondern auch um psychologische Nach-Betreuung. »Deutschkenntnisse reichen nicht aus, wenn die betreffenden Geflüchteten schwer und schwerst traumatisiert sind. Dann funktionieren diese Projekte schon gar nicht nur mit Ehrenamtlichen. Hier brauchen wir eine professionelle Begleitung und Unterstützung«, so Bernhard Starcke vom Zimmertheater Detmold (Starcke, Detmold, 2016). Ehrenamtliche sind nicht selten völlig überfordert, wenn sie mit zum Teil schwer traumatisierten Menschen zusammenkommen, die in ihnen eine Vertrauensperson sehen und von ihren Erfahrungen auf der Flucht berichten. Schlussendlich lässt sich sagen, dass wir in den Regionen viele hoch engagierte, interessierte und kreative Akteur_innen getroffen haben, die ein großes Interesse daran haben, sich miteinander zu vernetzen, sich auszutauschen und von den Erfahrungen aus anderen Bundesländern zu profitieren. Es gilt in Zukunft, diesen vertrauensvollen Austausch auf Augenhöhe zu verfestigen und die dadurch sichtbar gewordenen Potentiale zu nutzen. Hierzu braucht man nicht nur Zeit und Geduld auf allen Seiten, sondern auch eine Offenheit seitens der Geldgeber gegenüber der professionellen Gestaltung partizipativer Prozesse.
L iter atur Bourdieu, Pierre (1992): Die verborgenen Mechanismen der Macht, hg. von Margareta Steinrücke, (= Schriften zu Politik & Kultur, Band 1), Hamburg: VSAVerlag. Kusber, Eberhard (o.D., noch nicht veröffentlicht): »Wozu noch Bibliotheken? Ein Plädoyer«. Statement Folker Metzger, Klassik Stiftung Weimar, in: Dokumentation des regionalen Workshops »Chancen und Herausforderungen der Kulturarbeit durch Zuwanderung« am 10.05.2016 in Weimar im Rahmen der Initiative »Kultur öffnet Welten«. Statement Bernhard Starcke, Zimmertheater Detmold, in: Dokumentation des regionalen Workshops »Kulturarbeit und zivilgesellschaftliches Engagement« am 02.05.2016 in Detmold im Rahmen der Initiative »Kultur öffnet Welten«. Statement Kati Stüdemann, Haus der Vielfalt, in: Dokumentation des regionalen Workshops »Chancen und Herausforderungen der Kulturarbeit durch Zuwanderung« am 10.05.2016 in Weimar im Rahmen der Initiative »Kultur öffnet Welten«.
359
360
Lydia Grün
von Goethe, Johann Wolfgang (1960): Aufsätze zur Weltliteratur. Maximen und Reflexionen, hg. von Siegfried Seidel (= Berliner Ausgabe. Kunsttheoretische Schriften und Übersetzungen, Band 18), Berlin: Auf bau-Verlag.
Multaka: Treffpunkt Museum Geflüchtete als Guides in Berliner Museen Razan Nassreddine in Zusammenarbeit mit dem Projektleitungsteam von Multaka 1 Zusammenfassung »Multaka: Treffpunkt Museum – Geflüchtete als Guides in Berliner Museen« bildet syrische und irakische Geflüchtete zu Museums-Guides fort, um weitere Geflüchtete in ihrer Muttersprache durch das Museum zu führen. »Multaka« (arabisch: »Treffpunkt«) steht dabei für den Austausch verschiedener kultureller und historischer Erfahrungen. Die Führungen finden im Museum für Islamische Kunst, im Vorderasiatischen Museum, in der Skulpturensammlung und Museum für Byzantinische Kunst, sowie dem Deutschen Historischen Museum in Berlin statt. Abstract: Multaqa: Museum as Meeting Point – Refugees as Guides in Berlin Museums Multaqa: Museum as Meeting Point – Refugees as Guides in Berlin Museums trains Syrian and Iraqi refugees as museum guides, so that they can show other refugees through the museum in their native language. Multaqa (Arabic for »meeting point«) also aims to facilitate the exchange of diverse cultural and historical experiences. The tours take place in the Museum für Islamische Kunst (Museum for Islamic Art), the Vorderasiatisches Museum (Museum of the Ancient Near East), the Skulpturensammlung und Museum für Byzantinische Kunst (Sculpture Collection and Museum for Byzantine Art), and the Deutsches Historisches Museum (German Historical Museum) in Berlin.
Im Rahmen des Projekts »Multaka: Treffpunkt Museum – Geflüchtete als Guides in Berliner Museen« werden primär syrische und irakische Geflüchtete mit verschiedensten Bildungshintergründen zu Museums-Guides fortgebildet, um in ihrer Muttersprache durch Museen zu führen und als Multiplikatoren andere Geflüchtete zu erreichen. Multaka (arabisch: »Treffpunkt«) steht dabei auch für den
1 | Projektleitung: Robert Winkler, Razan Nassreddine, Stefan Weber.
362
Razan Nassreddine
Austausch verschiedener kultureller und historischer Erfahrungen. Das Projekt wurde mit Geflüchteten entwickelt, geplant und durchgeführt. Die Führungen finden im Museum für Islamische Kunst, im Vorderasiatischen Museum, in der Skulpturensammlung und Museum für Byzantinische Kunst sowie dem Deutschen Historischen Museum statt, die in Zusammenarbeit mit den Abteilungen für Bildung und Vermittlung ein inhaltliches und methodisch-didaktisches Training und Programm ausgearbeitet haben. Ziel des Projektes ist es, öffentliche Institutionen in der Mitte Berlins für Geflüchtete sinnvoll zu öffnen und durch den Dialog unterschiedlicher historischer Erfahrungen (alter Orient, islamische Welt, deutsche Geschichte) eine konstruktive Auseinandersetzung zwischen der alten und neuen Heimat zu ermöglichen. Die Begegnung mit dem eigenen archäologischen Erbe im Pergamonmuseum bejaht die individuelle kulturelle Wertigkeit des Geflüchteten durch eine öffentliche Einrichtung. Das ist ein erster Schritt partizipativer Prozesse. Teilhabe als Grundvoraussetzung der Identifikation mit unserem Land. Das Deutsche Historische Museum dient dabei als Reflektionsraum, um eigene Biografien mit der deutschen Geschichte abzugleichen. Migrationsgeschichte, Kriege und Wiederauf bau werden in dialogische Führungen mit der eigenen Wirklichkeit verbunden. Einzelne Ereignisse, z.B. die Rolle der Frau beim Wiederauf bau nach 1945, werden so sinnstiftend für die heutige Lebenswirklichkeit. Aus dem Projekt zum syrischen Kulturerbes (Syrian Heritage Archive Project) des Museums für Islamische Kunst, aus dem die Projektidee stammt, wissen wir, dass es Geflüchteten oft sehr schwer fällt, soziale und kulturelle Anknüpfungspunkte zu finden. Zehntausende geflüchtete Syrer_innen und Iraker_innen leben in Berlin, aber die aktive Teilhabe am öffentlichen Raum ist, allein aufgrund der Sprachbarriere, sehr gering. Besonders die Schwellenangst vor der »Institution Museum« ist groß, so dass nur die wenigsten von ihnen den Weg in die Museen finden. Übliche Kommunikationskanäle erreichen sie nicht oder erweisen sich als wenig effektiv, da sie mündliche, direkte Ansprache brauchen, um ein Museum im Aufnahmeland zu besuchen. Daher kontaktieren wir unsere Zielgruppe niedrigschwellig, hauptsächlich über soziale Medien durch Peer-to-Peer-Ansprache auf Arabisch und machen gezielt und vor Ort, beispielsweise in Aufnahmelagern, Notunterkünften, Wohnheimen und über selbstorganisierte Netzwerke von Geflüchteten auf unser Projekt aufmerksam. Der Zulauf von 40 bis 50 Teilnehmenden pro Führung ist überwältigend, die Reaktion aus den Gruppen extrem positiv. Viele Teilnehmer_innen schätzen die Museumsrundgänge, während denen sie ihren subjektiven Erfahrungsschatz reflektieren können. Eine Reihe der Ausstellungstücke wirkt auf sie als Erinnerungsorte: Sie erinnern sie an ihr verlorenes Zuhause, denn ihnen sind ähnliche Objekte aus historischen Gebäuden, aus den heimatlichen Museen und von Ausgrabungsstätten her bekannt. Bestimmte andere Ausstellungsstücke führen die Auswirkungen von Kriegshandlungen ins Bewusstsein: Die Beschädigungen der historischen Mschatta Fassade zum Beispiel regten mehrere Teilnehmende der
Multaka: Treffpunkt Museum
Führungen zur Frage an, ob Risse und Löcher auf frühere Kampfhandlungen zurückzuführen seien. Und hinsichtlich der Sammlertätigkeit des Museums wurde nachgefragt, ob in den vergangenen Jahren der Zerstörungen und Anschläge kulturelles syrisches oder irakisches Erbe in Berlin in Sicherheit gebracht werden konnte. Im Anblick gold-und silbertauschierter Luxusgegenstände aus der Sammlung des Museums für Islamische Kunst fragte ein Teilnehmer: »Wie kam unser Kulturerbe nach Berlin? Warum? Ist es seit dem aktuellen Krieg oder schon lange hier?« Fragen, die an den postkolonialen Diskurs erinnern, doch meist wertneutrale Fragen einer überraschenden Begegnung sind. Dies in Berlin zu sehen, hatte man nicht vermutet. Im Gegenteil, man freut sich, Teile eigener Geschichte und Kultur hier zu sehen und Schlüssel in die Hand zu bekommen, das neue Land sinnvoll für sich zu erschließen. Im Museum für Islamische Kunst und im Vorderasiatischen Museum sind zu großen Teilen Objekte aus Syrien und dem Irak ausgestellt – oftmals Zeugnisse religiös und ethnisch pluraler Gesellschaften. So zum Beispiel vor der ältesten erhaltenen Wohnhausnische aus Damaskus aus dem 15./16. Jahrhundert mit alt-testamentarischen samaritischen Inschriften. Der Besitzer gehörte einer dem Judentum verwandten Religionsgemeinschaft an – einer von vielen in islamischen Städten der Zeit. Eine Teilnehmende rief beim Anblick der Wohnhausnische aus Damaskus aus: »Wir waren wirklich tolerant!« Die Erfahrung der Wertschätzung, welche diesen Kulturgütern seitens der Museen entgegengebracht wird, aber auch die Einbindung in die große kulturhistorische Narrative über die Epochen hinweg, festigt das Selbstwertgefühl und erleichtert es, sich selbstbewusst-konstruktiv in unserer Gesellschaft einzubringen. Ein weiteres Beispiel für vielfältige interkulturelle Verknüpfungen ist das berühmte »Aleppo-Zimmer« im Museum für Islamische Kunst. Es gehörte einem syrischen Kaufmann um 1600, der sich im Stil islamischer Buchmalerei christliche Szenen malerisch darstellen ließ. Der Anblick dieser tradierten Form eines Repräsentationsraumes rührte einen Besucher zu Tränen. Er selbst hätte 30 Jahre lang so ähnliche Holzbemalungen angefertigt. Zu allen Details der sogenannten Ajami-Bemalung konnte er Auskunft geben. Er würde gerne den Restauratoren des Museums zur Verfügung stehen. Zahlreiche Besucher entwickeln bei seinem Anblick Gefühle des Respekts für die eigene Hochkultur und sehen hier wie auch bei der gesamten Sammlung einen mehrgleisigen Austausch: »Wir sind überrascht, wie viele große und kleine Objekte es aus Syrien und dem Irak im Museum für islamische Kunst gibt! Wir fühlen uns stolz, weil diese Ausstellungsobjekte aus unseren Ländern stammen, wo die frühen Zivilisationen sich entwickelt haben. Wir freuen uns darüber, dass die Deutschen unser Kulturerbe in Sicherheit gebracht haben, und wir fühlen uns geehrt zu sehen, mit welch großer Liebe diese Dinge konserviert wurden und welch große schöne Museen dafür gebaut worden sind. Das ist ein beeindruckender Dialog zwischen den Zivilisationen!«
363
364
Razan Nassreddine
In der Skulpturensammlung und im Museum für Byzantinische Kunst sowie durch die Zusammenarbeit mit dem Deutschen Historischen Museum wird eine weitere Reflexionsebene angeboten, um ihnen nicht nur ihre eigene kulturelle Vielfalt näherzubringen, sondern auch eine Annäherung an die deutsche Geschichte und Kultur mitsamt ihrer Krisen und Erneuerungen zu ermöglichen. Das Anliegen der 21-jährigen Asmaa Ghanems aus Damaskus teilen viele Multaka-Besucher: »Ich bin hier, um etwas über die deutsche Geschichte zu erfahren.« Dabei steht die deutsche Nachkriegsgeschichte mit dem Wiederauf bau im Zentrum des Interesses: Viele Teilnehmer sehen hier Hoffnung, dass es weitergehen kann und die Geschichte nicht mit den Zerstörungen endet. Deshalb fokussieren die Führungen auf historische und kulturelle Zusammenhänge zwischen Deutschland, Syrien und dem Irak. Museen haben durch das Aufzeigen von kulturhistorischen Gemeinsamkeiten und Verknüpfungen eine große Chance, als ein Verbindungsglied zwischen der Geschichte der alten und neuen Heimat und der eigenen Lebenswirklichkeit Geflüchteter zu fungieren und so einen Sinnzusammenhang für ihr Leben hier herzustellen. Wir legen bei den Führungen sehr großen Wert auf die Herstellung eines Bezugs zwischen Vergangenheit und Gegenwart, Fragestellungen zu historischen Objekten werden auf aktuelle Debatten übertragen. Dabei sollen die Besucher_innen nicht passiv rezipieren und die Guides nicht die Museumsführer auswendig lernen. Für eine solche mehrschichtige inhaltliche Auseinandersetzung bieten die Guides eine ungezwungene und gleichzeitig fachlich versierte Dialogplattform. Sie ordnen die jeweiligen Objekte der Führungen kulturhistorisch ein und bieten außerdem die Möglichkeit der spontan assoziativen oder hinterfragenden Auseinandersetzung an. Die Guides suchen sich ihr Museum und ihre Objekte aus, um ihre eigenen Interessen und Fragen zu reflektieren. Die Verbindung zur eigenen Lebenswirklichkeit ist wichtig. Mit den Besucher_innen betrachten und interpretieren sie die verschiedenen Museumsobjekte durch lebendigen und wechselseitigen Dialog und in Auseinandersetzung mit und unter Berücksichtigung ihrer eigenen Geschichte. Immer wieder stehen dabei die Auswirkungen von Kriegshandlungen im Vordergrund: Besonders junge Besucher von 14-15 Jahren sehen in den historischen Beschädigungen der Objekte Ursachen in den kriegerischen Auseinandersetzungen im Nahen und Mittleren Osten. Sie fragten: »Sind diese Objekte Opfer der Zerstörungen aus dem syrischen/irakischen Krieg? Warum haben die Objekte Löcher? Sind sie bombardiert worden?« Die Besucher_innen werden dabei in den Erkenntnisprozess der Objektbetrachtung und dessen Interpretation mit einbezogen und so zu aktiven Teilnehmer_innen. Obwohl die Besucher_innen heterogen sind und die Ansichten unterschiedlich, kam es in den vergangenen Wochen ausschließlich zu lebendigen, konstruktiven und sogar fröhlichen Gesprächen. Menschen, die zuvor nie im Museum waren, hörten gespannt weit über die Regelführungszeit zu und diskutierten mit.
Multaka: Treffpunkt Museum
Das Projekt soll Menschen bewegen und sie fordern: Wer bin ich? Was ist das, was ich »eigen« nenne? Jedes Objekt im Museum hat als kulturelles Produkt einen transkulturellen und migrationsgeschichtlichen Hintergrund. Durch die Diskussion der Erfahrung der interkulturellen Vernetzung von Objekten können bei der Bewertung eigener kultureller Identität offene Selbstbilder entstehen. In Zeiten gesellschaftlicher Verunsicherung und zunehmend kulturalistischer Selbst- und Fremdwahrnehmung eröffnen Objekte aus der Vergangenheit Reflektionsräume zur Aushandlung kollektiver Identitätsbilder. Wie war der Austausch in Kunst, Musik, Wissenschaft und Ideengeschichte über die Jahrhunderte hinweg? Wo sind unsere Ursprünge? Es ist faszinierend, welche Bedeutung die mediterrane Spätantike sowohl für Europa als auch für die islamische Welt hatte, und meist unbekannt, wie der Kulturkontakt unsere Musik, Kleidung und wissenschaftlichen Leistungen prägte oder wie die Moderne als globaler Prozess kulturellen Wandel in islamisch geprägten Ländern hervorbrachte. Für die Multaka-Besucher_innen sind dabei Gemälde und Objekte besonders interessant, die mit gesellschaftlichen Umbrüchen zu tun haben, wie beispielsweise das Porträt Martin Luthers. Diese bisher in der arabischen Welt kaum bekannte Persönlichkeit beeindruckt viele Teilnehmer_innen durch seinen trotz enormer politischer Widerstände ungebrochenen Willen zu Reformen. Der anschließende 30-jährige Krieg erscheint als Folge nachvollziehbar, denn ein »Muster« von gesellschaftlichen Veränderungen und kriegerischen Auseinandersetzungen wird im Arabischen Frühling und seinen politischen Folgen gesehen. So wird es für Syrer_ innen und Iraker_innen interessant, trotz vieler unterschiedlicher historischer Erfahrungen über den Dreißigjährigen Krieg zu diskutieren. Welche Interessen liegen hinter den konfessionellen Auseinandersetzungen? Geht es nur um Religion? Auch die Geschichte anderer wird zur Kontrastfolie für Fragen von heute. Bei solchen Diskussionen an Objekten treffen immer wieder Menschen sehr unterschiedlicher politischer und religiöser Überzeugung aufeinander und kommen ins Gespräch. Das Museum wird somit nicht nur zu einem Raum neuer gesellschaftlicher Kreise, sondern auch zu einem positiven Bezugspunkt und Verhandlungsort interkultureller Verfasstheit unserer Gesellschaft. Einer der Guides im Vorderasiatischen Museum, Hussam Zahim Mohamed, ein Archäologe aus Bagdad, reflektierte hierzu: »Man lernt auf der einen Seite seine eigene Kultur unter neuen Aspekten kennen, und man lernt andere Kulturen ebenfalls intensiv kennen. Das alles geschieht im multikulturellen Berlin.« Im Zentrum dieses Formats sowie der generellen Ausrichtung des Projekts »Multaka« steht vor allem, dass die Beschäftigung mit Kultur und Geschichte Freude macht. Durch die richtige Ansprache, spannende und aktuelle Inhalte sowie kreative Arbeitsweisen können wir Geflüchtete motivieren, die Museen zu entdecken und sich aktiv neue städtische Räume zu erschließen. Über Einladungen zur regelmäßigen Teilnahme an zukünftigen Events, wie Workshops, Vorträgen oder Sonderführungen bieten wir einen Kontext, der die Geflüchteten langfristig in unser Projekt mit einbindet – und in der Tat, viele Geflüchtete kommen
365
366
Razan Nassreddine
mehrmals wieder. Das Museum ist ihr Raum. »Das ist ein wenig wie zu Hause«, sagte der Besucher Saleh Abo Ghaloun aus Aleppo. So wird von Anfang an eine Perspektive eröffnet, die Beschäftigung mit Kultur und Geschichte als Element einer sinnvollen Freizeitgestaltung in die eigene Lebensrealität zu integrieren und so den – vielleicht allzu monotonen – Alltag zu durchbrechen und eigenmächtig zu gestalten. Um eine verstärkte Sensibilisierung für die unterschiedlichen kulturellen Hintergründe der Geflüchteten zu erwirken, wird ab März 2016 auch das einheimische Publikum mit in das Projekt einbezogen. So werden auch auf deren Seite interkulturelle Kompetenzen gestärkt und interkulturelle Dialoge ermöglicht. Wir möchten »Multaka« als Chance begreifen, neue Strukturen für Verständigung und Akzeptanz in einer heterogenen und ethnisch vielfältigen Gesellschaft entstehen zu lassen. Das Projekt stößt auf ein sehr großes Medien-Interesse. Sowohl in zahlreichen internationalen Online-Medien (BBC, Deutsche Welle, NTV, NBC, Al-Jazeera, Die Welt etc.), mehreren nationalen Fernseh-Beiträgen (ARD, ZDF, 3Sat, RBB, WDR etc.) sowie Radio-Beiträgen (Deutschlandfunk, Deutschlandradio Kultur etc.) als auch in Dutzenden Artikeln der deutschen (Tagesspiegel, taz, Berliner Zeitung, Neues Deutschland etc.) und internationalen Tagespresse (The New York Times, The Guardian etc.) wurde über das Projekt berichtet. Die internationale Berichterstattung reicht von Indonesien über den arabischen Raum bis nach Mexiko, Moskau und in die USA (z.B. CNN, New York Times). Organisatorische Unterstützung erhält das Projekt durch die Freunde des Museums für Islamische Kunst und des Syrian Heritage Archive Projects am Museum für Islamische Kunst. Finanziert wird es durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, die Schering Stiftung, die Stiftung Deutsches Historisches Museum, private Spenden und durch das Bundesprogramm »Demokratie leben!« des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.
Ehrenamt und Geflüchtete als Beteiligte in kulturellen Projekten Kritik an Selbstverständnis und Positionen Misun Han-Broich Zusammenfassung Die im Rahmen einer Dissertationsstudie durchgeführten Untersuchungen zeigen, dass ehrenamtliche Akteure einen ganz eigenen und unverzichtbaren Beitrag zur Integration von Geflüchteten leisten. Dieser Beitrag dient nicht nur der sozial-strukturellen und kognitiv-kulturellen Integration, sondern auch der seelisch-emotionalen Stabilisierung häufig traumatisierter Flüchtlinge. Diese sind für Bildungsprojekte, die sich – z.B. im musischen oder künstlerischen Bereich – Mitteln der nonverbalen Kommunikation bedienen, besonders empfänglich. Es empfiehlt sich, ehrenamtliche Bildungsprojekte immer an die aktuellen Bedürfnisse der Geflüchteten anzupassen und diese aktiv in die Gestaltung mit einzubeziehen. Um dem Hauptwunsch der Geflüchteten nach einer sinnvollen Beschäftigung nachzukommen, sollten den Flüchtlingen vermehrt niedrigschwellige Angebote für eigene ehrenamtliche Tätigkeiten gemacht werden. – Der Artikel endet mit drei Vorschlägen für die Aufrechterhaltung und Verbesserung der Ehrenamtskultur in Deutschland.
Abstract: Volunteer Work and Refugees as Participants in Cultural Projects – a Critique of Self-Conceptions and Positions These investigations, carried out as part of a PhD project, show that volunteers play a unique and indispensible role in the integration of refugees. This contribution does not just support their socio-structural and cognitive-cultural integration, but also the psychological and emotional stabilization of often traumatized refugees, who are particularly receptive to education projects which – for example in the fields of music and art – activate non-verbal means of communication. It is advisable to always customize volunteer-run education projects to the current needs of the refugee groups, and to actively involve them in the designing of the projects. In order to meet the number one wish expressed by refugees of engaging in meaningful activities, refugees should be offered multiple, low-threshold opportunities to engage in voluntary activities of their own. The article concludes with three suggestions for the maintenance and improvement of Germany’s volunteer culture.
368
Misun Han-Broich
1. Einleitung Bei der Bewältigung der sogenannten Flüchtlingskrise erweist sich das Ehrenamt in vielen Bereichen als eine schnelle und wirkungsvolle Maßnahme, welche in Politik und Gesellschaft auf breite Anerkennung stößt. Die Ehrenamtlichen gelten mittlerweile als bedeutende Integrationsakteure in der Gesellschaft. Es scheint inzwischen ein breiter gesellschaftlicher Konsens zu herrschen, dass ohne Ehrenamtliche die Integration der massenhaft zugezogenen Flüchtlinge schier unmöglich wäre. In vielen Städten und Gemeinden wurden Willkommensbündnisse gegründet und andere Initiativen ergriffen, in denen sich zahlreiche freiwillige Helferinnen und Helfer in Sammelunterkünften, Wohlfahrtseinrichtungen, Kirchen, Schulen u.a. engagieren und eine außergewöhnlich große Hilfe für geflüchtete Menschen leisten. Das Spektrum ehrenamtlicher Hilfsleistungen reicht von der schnellen, kurzfristigen Akuthilfe in Bereichen, wo staatliche Maßnahmen noch nicht oder zu langsam greifen (Nahrung, Kleidung, Unterkunft, Sprache, Behördengänge), über mittelfristige Integrationshilfen bis zur langfristigen Inklusion (vgl. PHINEO 2016). Es sind vor allem persönliche Kontakte zu und Begegnungen mit Ehrenamtlichen, die den Geflüchteten auf Dauer und vielfältige Art und Weise Orientierung und Halt in der Aufnahmegesellschaft vermitteln und die sich deshalb als ein unverzichtbarer Erfolgsfaktor für die Integration erweisen. Nun ist Integration ein langwieriger komplexer Prozess, der in verschiedenen Dimensionen erfolgt, so dass sich die Frage stellt, welche Integrationsprojekte mit Geflüchteten besonders erfolgversprechend und ggf. förderungswürdig sind. Dies gilt insbesondere für den sensiblen Bereich der kulturellen Integration und die hierfür zu vermittelnde interkulturelle Bildung. Die Geflüchteten werden durch Ehrenamtliche direkt in vielfältige (ambitionierte) kulturelle Projekte mit einbezogen. Als kulturelle Projekte können im engeren Sinne kreative, künstlerische, kulturelle, bildungspolitische Projekte (Tanz, Sprache, Literatur, Theater, Museum) verstanden werden. Im weitesten Sinne können aber auch fast alle ehrenamtlichen Projekte einschließlich der Freizeit aktivitäten und Begegnungsprojekte so verstanden werden, wenn insbesondere Kultur als »Lebensweise« und Kulturelle Bildung als ›Projekt des guten Lebens‹ definiert wird (vgl. Deutscher KulturRat 2009: 11). Es wird dabei von »Lebenskompetenzen oder von Lebenskunst« (ebd.) gesprochen. Wenn Geflüchteten durch Ehrenamtsprojekte bei der aktiven Lebensbewältigung geholfen werden kann, sind solche m.E. im weitesten Sinne als kulturelle Projekte zu begreifen. Kulturelle Bildung ist »ein weites Feld. Von subtilen Theoriefragen rund um die Künste und den Menschen über Fragen der gesellschaftlichen Entwicklung bis hin zu Problemen der Politik, der Finanzierung, des Managements und nicht zuletzt zu Fragen des Arbeitsmarktes Kulturpädagogik/ Kulturvermittlung reicht das Spektrum.« (Ebd.: 13)
Ehrenamt und Geflüchtete als Beteiligte in kulturellen Projekten
In diesem Beitrag soll zunächst die generelle Bedeutung des Ehrenamts in der Flüchtlingshilfe und dann ihr potentieller Beitrag für die Kulturelle Bildung und Integration der Geflüchteten erläutert werden. Hierbei wird insbesondere die Perspektive der Geflüchteten als Beteiligte bzw. Zielgruppe (inter-)kultureller Bildung und das bestehende Selbstverständnis und die Positionen der Geflüchteten und Ehrenamtlichen kritisch hinterfragt, um Ansatzpunkte für gelingende Ehrenamtsprojekte im Bereich der (inter-)kulturellen Bildung von Geflüchteten aufzuzeigen.
2. Bedeutung des Ehrenamts in der Flüchtlingsarbeit Die Untersuchungsergebnisse meiner empirischen Dissertationsstudie 1 über Ehrenamtlichkeit in der Flüchtlingssozialarbeit zeigen, dass das Ehrenamt in besonderer Weise eine integrierende Wirkung sowohl auf die Ehrenamts-Adressaten (hier die Flüchtlinge) als auch auf die (an ehrenamtlichen Prozessen beteiligten) Akteure selbst und auf die Gesellschaft ausübt. Bürgerschaftliches Engagement erweist sich dabei insbesondere als ein unverzichtbarer Baustein zur Migrantenintegration und Kulturellen Bildung. Der Zusammenhang wird deutlich im Rahmen einer in meiner Dissertationsstudie vertretenen ganzheitlichen dreidimensionalen Integrationstheorie, die nicht nur eine kognitiv-kulturelle und eine sozial-strukturelle, also das Denken und Handeln betreffende Dimension, sondern vielmehr auch eine seelisch-emotionale, nämlich das Fühlen betreffende Dimension mit erheblichem Einfluss auf die Fähigkeit zur Gesamtintegration umfasst (vgl. Han-Broich 2012: 122ff.): »Seelisch-emotionale Integration ist ein Ausdruck positiver oder negativer Gefühle gegenüber sich selbst und der Umwelt und bemisst die gefühlte Nähe oder Distanz zur Aufnahmegesellschaft. Kognitiv-kulturelle Integration bemisst insbesondere die Sprachkompetenz, aber auch die Angleichung in Wissen, Fertigkeiten, Normenk enntnissen und schließlich die Fähigkeit zu situationsadäquatem Verhalten. Sozial-strukturelle Integration bemisst die Angleichung in den Beziehungsmustern in Form interethnischer Kontakte und institutioneller Partizipation wie Freund- und Partnerschaften oder Vereinsmitgliedschaften (soziale Integration). Die strukturelle Integration bemisst auch den Zugang zu und die Besetzung von Positionen und den erreichten Status, beispielsweise im Wohnumfeld, im Beruf auf dem Arbeitsmarkt oder im Bildungssystem.«
Die seelisch-emotionale Integration ist hierbei eine unsichtbare, subjektiv empfundene Integration, während die kognitiv-kulturelle und sozial-strukturelle In1 | Diese Studie ging aus meiner lang jährigen sozialarbeiterischen Praxis in der Flüchtlingsbetreuung der Stadt Münster hervor, wofür 44 Interviews mit Ehrenamtlichen, Geflüchteten(-familien), hauptamtlich tätigenden Sozialarbeitenden und Vertretenden von Flüchtlingsorganisationen und Ämtern geführt wurden (vgl. Han-Broich 2012).
369
370
Misun Han-Broich
tegration einer sichtbaren, objektiven Integration entsprechen. Die seelisch-emotionale Integration ist zwar eine äußerlich nicht erkennbare Form der Integration, die sich aber – falls nicht erreicht – wie eine Blockade für die anderen sichtbaren (kognitiv-kulturellen und sozial-strukturellen) Integrationsdimensionen auswirkt. Die seelisch-emotionale Integration ist deshalb als eine Vorstufe oder Voraussetzung zur weiteren Integration zu verstehen. Sie stellt gleichzeitig eine Form der ›Ich-Integration‹ dar, die als ein ausgewogener innerer Zustand beschreibbar ist, wie er sich im Fall der Flüchtlinge erst nach der Überwindung ihrer traumatischen und seelischen Schäden und der Bewältigung ihrer Vergangenheits- und Gegenwartsprobleme einstellen kann. Ganzheitliche Integration wird als ein ausgewogener Zustand des Gleichgewichts eines Migranten in seelisch-emotionalen, kognitiv-kulturellen und sozial-strukturellen Integrationsdimensionen definiert. Die empirische Untersuchung zeigt, dass ehrenamtliche Hilfestellung bei der Integration von Geflüchteten nicht wie ursprünglich erwartet am meisten zur sozialen, sondern vielmehr zur seelisch-emotionalen Integration beiträgt. Die ehrenamtliche Hilfe verhilft zwar Geflüchteten auch zur objektiven (kognitivkulturellen und sozial-strukturellen) Integration, ihre wesentliche Leistung lag jedoch in der Stärkung der seelisch-emotionalen Integration. Durch den Auf bau persönlicher Beziehungen stehen die Ehrenamtlichen den Geflüchteten insbesondere bei der Überwindung ihrer seelisch belastenden Vergangenheits- und Gegenwartsprobleme zur Seite. Obwohl Ehrenamtliche nach ursprünglicher Aufgabenvereinbarung keine therapeutische bzw. psychosoziale Arbeit explizit zu leisten haben, sondern eher konkrete Hilfestellungen (z.B. Bildungs- und Betreuungsarbeit, Begegnung und praktische Lebenshilfe etc.) geben sollen, zeigt sich die größte Wirkung ihrer Arbeit gerade nicht in diesen die praktische Integration betreffenden Bereichen (z.B. im kognitiv-kulturellen und sozial-strukturellen Bereich), sondern vielmehr im seelisch-emotionalen Bereich. Dieses zunächst nicht beabsichtigte Integrationsziel ehrenamtlicher, therapeutischer Hilfestellung erweist sich als ihre besondere Leistung, die ganz wesentlich mit den dem Ehrenamt zugrunde liegenden intrinsischen Motiven2 und Beziehungsfähigkeiten der Ehrenamtlichen selbst zusammenhängt. Intrinsisch motivierte Ehrenamtliche können durch die persönliche Art ihrer Kontakte eine einzigartige Beziehung zu Flüchtlingen auf bauen, indem sie gezielt auf Menschen zugehen, persönliche Berührungspunkte herstellen und mit den Flüchtlingen eine ganzheitliche Begegnung erleben. Im Sinne von Buber begegnen sich Menschen dann ganzheitlich, wenn sie gegenseitig den anderen die Qualität eines 2 | Die in der Studie hinterfragten Motive der Ehrenamtlichen sind entweder extrinsischen oder intrinsischen Ursprungs. Die extrinsische Motivation hat ihren Ursprung in einer (veränderten) biografischen oder gesellschaftlichen (Lebens-)Situation. Dahingegen liegt die intrinsische Motivation in der Erfüllung religiöser oder ethischer Ansprüche sowie in einer empathischen Persönlichkeitsstruktur der Ehrenamtlichen begründet (vgl. Han-Broich 2012, S. 82-88).
Ehrenamt und Geflüchtete als Beteiligte in kulturellen Projekten
Subjektes (›Ich-Du-Verhältnis‹ statt ›Ich-Es-Verhältnis‹) zuerkennen (vgl. Buber 1983). Wenn sich Menschen als Personen ganzheitlich begegnen, findet in der Beziehung ein Berühren und Berührt-Werden statt. Es ist nach Buber diese ontologische Begegnung, die das Herz öffnet und Kraft ausschüttet (vgl. Buber 1962). In der Ehrenamtsbeziehung kann eine solche Begegnung stattfinden, in der sich Ich und Du als gleichberechtigte Subjekte begegnen und keiner dem anderen bewertend gegenübersteht. In einer solchen Beziehung wächst die Fähigkeit, sich dem Anderen zu öffnen. Von daher ist es möglich, dass in den Ehrenamtsbeziehungen (menschlich-familiäre) Nähe und Wärme entstehen können (vgl. HanBroich 2012: 193ff.). So werden Geflüchtete, die aufgrund ihrer extrem schwierigen seelischen und strukturellen Ausgangssituation und negativer Erfahrungen mit der Aufnahmegesellschaft eine geringere oder gar keine Motivation zur Integration hatten oder sogar negativ voreingestellt oder blockiert waren, erst durch die mit ehrenamtlicher Hilfe überwundenen seelisch-emotionalen Blockaden weiterführenden Integrationsschritten in den beiden anderen Dimensionen gegenüber aufgeschlossen. Damit leistet das Ehrenamt einen entscheidenden, seelisch-emotional vorbereitenden ersten Schritt zur kognitiv-kulturellen und sozial-strukturellen Integration. In diesem Sinne ist das Ehrenamt als ein unverzichtbarer Baustein zur Integration zu verstehen. Die Ehrenamtlichen tragen so zur seelisch-emotionalen Stabilisierung und Integration insbesondere auch der traumatisierten Flüchtlinge bei. Etwa ein Viertel der Flüchtlinge in Deutschland hat mehr oder weniger schwere traumatische Erlebnisse im Herkunftsland, auf der Flucht und sogar noch in der Aufnahmegesellschaft erlitten, deren Verarbeitung und Bewältigung erfolgreichen Integrations bemühungen vorausgehen oder hierzu parallel verlaufen (sollten). Stark traumatisierte Flüchtlinge zeigen Verhaltensauffälligkeiten wie Schlaflosigkeit, Müdigkeit und Depressionen und sind zunächst auch nicht lernund arbeitsfähig. Traumatisierte Flüchtlinge brauchen Ruhe oder wollen zunächst nur in Ruhe gelassen werden. Oder sie kapseln sich in ihrer ›dunklen Gedankenwelt‹ ein und isolieren sich von der Außenwelt. Als erste Hilfsmaßnahme könnte daher zunächst Ruhe gewährt werden. Dann kann man versuchen, sie sensibel durch geeignete kreativ-therapeutische Maßnahmen seelisch-emotional zu stabilisieren, bevor man zur konfrontierenden Phase (durch das Sprechen) übergeht. Im Umgang mit Traumata der Flüchtlinge besteht derzeit noch eine große Lücke. Den durch Kriegs- und Fluchterlebnisse traumatisierten Flüchtlingen wird in der Aufnahmegesellschaft kaum die Möglichkeit für eine angemessene Verarbeitung ihrer Erfahrungen gegeben, zumal sie aufgrund der sprachlichen Barriere ihre Probleme nicht adäquat beschreiben können. Für die Trauma-Bewältigung können jedoch Ehrenamtliche eine große Hilfe leisten, indem sie Flüchtlinge in niedrigschwellige Tätigkeitsbereiche, insbesondere (zunächst nonverbaler) kultureller und künstlerischer Art wie Spaziergänge, Museums-, Konzertbesuche, sportliche, musische, künstlerische Betätigungen
371
372
Misun Han-Broich
begleiten. Diese Aufgaben können die Ehrenamtlichen gut leisten, weil sie zu Geflüchteten eine Vertrauensbeziehung auf bauen können, eine Art von Basisbeziehung, in der sich die Geflüchteten öffnen und unter Umständen ihnen ihre Geschichte anvertrauen können, sodass ihnen eine Möglichkeit eingeräumt wird, ihre leidvolle Vergangenheit zu bewältigen und sich auf das Neue einzustellen. Die Ehrenamtlichen können durch ihre persönliche Begleitung3 ›quasi‹ als Therapeut(inn)en zu den Geflüchteten in Beziehung stehen. Aus diesem Grunde könnten mehr musische, künstlerische, kreative-therapeutische Ehrenamtsprojekte für traumatisierte Geflüchtete (z.B. Musik-, Kunstund Tanztherapie, Singen im Chor, Gymnastik als Bewegungstherapie, Mal- und Massagekurse als Entspannungstherapie) (vgl. Han-Broich 2015: 44) eingerichtet werden, wofür mehr befähigte Lehrer(innen), Künstler(innen) oder Kunsttherapeut(inn)en als Ehrenamtliche gewonnen werden sollten. Da kreativ-künstlerische Projekte vor allem von denjenigen angeregt bzw. durchgeführt werden können, die selbst über eine entsprechende Kulturelle Bildung verfügen, ist die Durchführung solcher Projekte stark von mitgebrachten Talenten und Fähigkeiten der Ehrenamtlichen abhängig, was eine stärkere (personelle und finanzielle) Förderung derselben notwendig macht.
3. Geflüchtete als Adressaten oder Akteure des Ehrenamts? Kulturelle Bildungsarbeit, insbesondere interkulturelle Kulturarbeit, fördert die »Begegnung von Menschen unterschiedlicher Herkunft und verschiedenen Alters und bewirkt Offenheit für Neues und Fremdes« (BKJ 2016: 1). In der Kulturellen Bildung kann man sich die Tatsache zunutze machen, dass auf künstlerischem Wege etwas zum Ausdruck gebracht werden kann, wofür Worte fehlen. »In einer noch fremden Umgebung, in der sprachliche Verständigung schwerfällt, können künstlerische Ausdrucksformen Wege der Auseinandersetzung mit dem Unbekannten sein, aber auch mit dem Erlebten, eigenen Gedanken und Gefühlen.« (BKJ 2015: 2) Aus diesem Grunde können vielfältige Projekte der Kulturellen Bildung für Geflüchtete entwickelt und umgesetzt werden. Die bisher häufig beobachtbare Haltung in kulturellen Projekten war jedoch, dass die Geflüchteten eher als passiv rezipierende Teilnehmer(innen) sowohl bei der Planung als auch bei der Gestaltung solcher Projekte und weniger als aktiv gestaltende Subjekte wahrgenommen wurden, so dass Bedürfnisse und Fähigkeiten von teilnehmenden Migranten und Geflüchteten nicht voll aufgegriffen wurden.
3 | Vgl. auch die ›Soteria-Bewegung‹ ab Ende 1960er Jahren, wobei der Heilungseffekt für psychisch Kranken mehr bei einer persönlichen Begleitung durch Laienhelfer als bei Medikation oder Therapieaufenthalt in Kliniken begründet und daher deren Umsetzung postuliert wurde.
Ehrenamt und Geflüchtete als Beteiligte in kulturellen Projekten
Empfehlenswert wäre es jedoch, die Erfahrungen und das Wissen von Migrant(inn)en und Geflüchteten stärker zu nutzen und sie aktiv an der inhaltlichen Planung und Durchführung von Projekten zur interkulturellen Bildung vor allem auch als ehrenamtliche Akteure gemäß ihrer Talente und Fähigkeiten zu beteiligen. Wenn man Ehrenamtsprojekte partizipativ konzipieren will, sollte dem Projekt zunächst eine Bedarfsermittlung bei den Geflüchteten vorausgehen. Projekte können so an die jeweilige Situation und die tatsächlichen Bedürfnisse der Geflüchteten angepasst werden, damit sie nicht ins Leere laufen. Dies erfordert die Mitwirkung der Geflüchteten und eine entsprechende Koordination der Abstimmungsprozesse zwischen allen Beteiligten, z.B. durch einen Flüchtlings- und Ehrenamtsmanager. Das Ergebnis dieses Prozesses ist ein von allen Beteiligten akzeptiertes und für gut befundenes Projekt mit freiwilliger Beteiligung. In einer von mir im Jahr 2015 durchgeführten Erhebung wurde von den Geflüchteten am häufigsten der Wunsch nach einer sinnvollen Beschäftigung ohne Wartezeit geäußert, bei der sie ihre mitgebrachten Fähigkeiten und Fertigkeiten zum Einsatz bringen können. Da die adäquaten Beschäftigungsangebote für Geflüchtete nicht schnell geschaffen werden können, empfiehlt sich die Heranführung der Geflüchteten an unkonventionelle, ehrenamtliche Beschäftigungsmöglichkeiten gerade auch in interkulturellen Bildungsprojekten. So müssen die Geflüchteten bis zur Entscheidung ihrer Asylanträge nicht untätig bleiben und können sich auf eine eventuelle spätere Berufstätigkeit vorbereiten. Durch frühe ehrenamtlich ausgeübte Tätigkeiten können Geflüchtete erste zwanglose Kontakte mit der Aufnahmegesellschaft knüpfen, die hiesigen Gepflogenheiten kennenlernen und sich auch sprachlich verbessern. Von daher sollten Geflüchtete möglichst frühzeitig auch über Möglichkeiten zur Aufnahme einer (ehrenamtlichen) Beschäftigung informiert und unkomplizierte Zugangsstrukturen geschaffen werden. Beispielhaft ist die vom Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend gestartete Initiative zur Einrichtung von 10.000 Bundesfreiwilligendiensten für und von Flüchtlingen (Sonderprogramm ›BFD mit Flüchtlingsbezug‹ für den Zeitraum vom 01.12.2015 bis 31.12.2018). Ehrenamt und Freiwilligendienste sind für die Integration und den Bestand unserer Zivilgesellschaft von entscheidender Bedeutung und können den Geflüchteten als kultureller Bildungsanspruch nicht früh genug vermittelt werden. Flüchtlinge könnten – zumindest in der Anfangsphase ihres Aufenthaltes in dem fremden Land – auch durch einheimische Ehrenamtliche einfühlsam in Möglichkeiten zu eigenem Engagement eingeführt werden. Denn sie sind noch nicht in der Lage, sich am Geschehen der Gesellschaft selbständig zu beteiligen, weil ihnen unsere Kultur und gesellschaftlichen Strukturen fremd sind, auch haben sie noch keinen Zugang zu Netzwerken. Gemäß Gesemann und Roth (2015) bedürfen die Menschen, die sich in einer schwierigen Situation befinden oder einen unsicheren Aufenthaltsstatus haben,
373
374
Misun Han-Broich
einer langfristigen Begleitung und eines »Vorschusses an Unterstützung« (ebd.: 41). Auch nach Klatt haben sozial Benachteiligte »das geringe Zutrauen in die eigene, selbst angeregte Handlungsfähigkeit« (Klatt 2011: 1) und wagen somit den ersten Schritt häufig nicht, für sie neue Orte von sich aus zu ›erobern‹. »Ein Gefragt- oder Mitgenommenwerden zu bürgerschaftlichen Aktivitäten« (ebd.) ist daher unentbehrlich. Hervorzuheben ist auch die Tatsache, dass ehrenamtliche Beziehungen nicht nur eine positive Wirkung auf die Geflüchteten, sondern ebenso auf die ehrenamtlich tätigen Einheimischen ausüben, indem sie vorgefasste Meinungen und Vorurteile abbauen, die Begegnungen selbst als Bereicherung empfinden, als positive Meinungsmultiplikatoren in die Bevölkerung hineinwirken und so zur gesellschaftlichen Integration und Kulturellen Bildung beitragen.
4. Fazit Niedrigschwellige, ehrenamtliche kulturelle Projekte mit und für Geflüchtete sind ein geeignetes und willkommenes Format, geflüchtete und häufig traumatisierte Menschen behutsam in die hiesige Gesellschaft und ihre Gepflogenheiten einzuführen und sich dabei auch künstlerischer Methoden nonverbaler Kommunikation zu bedienen. Damit gutgemeinte Projekte nicht ins Leere laufen, sollte ihnen eine Bedarfsermittlung vorausgehen. Es sind vor allem die von Menschen aus verschiedenen Kulturen gemeinsam gestalteten Projekte, die wechselseitig zum (interkulturellen) Lernen und zur Akzeptanz und Anerkennung beitragen und so die gesellschaftliche Integration vorantreiben. Ehrenamtliches und bürgerschaftliches Engagement leisten durch positive Kontakte zu den Geflüchteten einen ganz eigenen und unverzichtbaren Beitrag zur Integration, nicht nur für die Geflüchteten als Ehrenamtsadressaten, sondern auch für die Gesamtgesellschaft. Aufgrund ihrer besonderen Fähigkeiten und Ressourcen sind Ehrenamtliche für die Bewältigung der Integration von Geflüchteten unverzichtbar. In der derzeitigen Krisensituation mit den hohen Flüchtlingszahlen zeigt sich, dass der Staat und die Kommunen den Herausforderungen alleine nicht gerecht werden können. So ist die Zivilgesellschaft gleichermaßen aufgefordert, ihren Beitrag zur Krisenbewältigung zu leisten. Gleichwohl darf das Ehrenamt seitens des Staates nicht auf ein nur zweckorientiertes Mittel zur Lösung überbordender gesellschaftlicher Probleme reduziert werden. Die Bedeutung und Sinnhaftigkeit, der Eigensinn des Ehrenamts muss dabei ›richtig‹ erkannt und dementsprechend wertgeschätzt und gefördert werden. Für die weitere Ausgestaltung des Ehrenamts für die Flüchtlingsintegration sind m.E. folgende drei Punkte besonders wichtig:
Ehrenamt und Geflüchtete als Beteiligte in kulturellen Projekten
(1) Aufrechterhaltung der hohen Engagementbereitschaft in der Bevölkerung durch Anerkennung, Förderung und Kommunikation ehrenamtlichen Engagements durch Staat und Politik. (2) Koordination und bessere Kommunikation ehrenamtlicher Projekte durch Hauptamtliche in Verbindung mit einem professionellen Freiwilligen-Management. (3) Schaffung und Förderung niedrigschwelliger Ehrenamtsangebote für und mit Geflüchteten insbesondere auch im Bereich der Kulturellen Bildung. Insbesondere für die kreativ-künstlerischen Projekte, die ohne künstlerische Fertigkeiten und Fähigkeiten der ehrenamtlichen Akteure nicht zu gestalten sind, aber doch für die Verarbeitung der Traumatisierungserlebnisse der Geflüchteten ideale Möglichkeiten darbieten, könnte der Staat mit finanziellen Mitteln eintreten und innovative und neuartige Projekte initiieren bzw. nachhaltig fördern.
L iter atur BKJ – Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung (2015): Recht auf Bildung und kulturelle Teilhabe geflüchteter Kinder und Jugendlicher umsetzen!: Kulturelle Bildung in einer vielfältigen Einwanderungsgesellschaft. https://www.bkj.de/fileadmin/user_upload/documents/Downloads/2015 _10_06_BKJ_Stellungnahme_Kulturelle_Teilhabe_Gefluechteter.pdf (letzter Zugriff: 19.03.2016). BKJ – Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung e.V. (2016): Argumente für kulturelle Bildung. Warum kulturelle Bildung wichtig ist- Sechs Argumente. Siehe: https://www.bkj.de/kulturelle-bildung-dossiers/theoriebildung-und-grundlagen/argumente- fuer-kulturelle-bildung.html (letzter Zugriff: 18.04.2016). Buber, Martin (1962): Das Dialogische Prinzip. Neuausgabe, Heidelberg: Schneider. Buber, Martin (1983): Ich und Du, 11. durchgesehene Aufl., Heidelberg: Schneider. Deutscher KulturRat (Hg.) (2009): Kulturelle Bildung: Aufgaben im Wandel. www.kulturrat.de/dokumente/studien/kulturelle-bildung-aufgaben-im-wan del.pdf (letzter Zugriff: 18.03.2016). Gesemann, Frank/Roth, Roland (2015): »Engagement im Quartier«, in: APuZ – Aus Politik und Zeitgeschichte, 65. Jg. 14-15/2015, S. 35-42. Han-Broich, Misun (2012): Ehrenamt und Integration. Die Bedeutung sozialen Engagements in der (Flüchtlings-)Sozialarbeit, Wiesbaden: Springer VS. Han-Broich, Misun (2015): »Engagement in der Flüchtlingshilfe – eine Erfolg versprechende Integrationshilfe«, in: APuZ – Aus Politik und Zeitgeschichte, 65. Jg. 14-15/2015, S. 43-49.
375
376
Misun Han-Broich
Klatt, Johanna (2011): »Individualisierte Zivilgesellschaft und die Beteiligung sozial Benachteiligter. Verliert die Bürgergesellschaft diejenigen, die über wenig Einkommen und wenig Bildung verfügen?«, in: betrifft: Bürgergesellschaft 37, Dezember 2011, Friedrich-Ebert-Stiftung. http://library.fes.de/pdf-files/do/ 08892.pdf (letzter Zugriff: 15.09.2015). PHINEO (Hg.) (2016): Vom Willkommen zum Ankommen. Ratgeber für wirksames Engagement für Flüchtlinge in Deutschland. https://www.bertelsmann stiftung.de/fileadmin/files/user_upload/PHINEO_Ratgeber_Engagement_ fuer_Fluechtlinge.pdf (letzter Zugriff: 25.03.2016).
Interkulturelle Öffnung – notwendiger denn je? Ein Veränderungsmodell am Beispiel der Arbeiterwohlfahrt Talibe Süzen Zusammenfassung Interkulturelle Öffnung ist heute notwendiger denn je geworden. Mit dem Konzept der interkulturellen Öffnung verknüpft sich der Anspruch, die gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Gestaltungsprozess für alle hier im Lande lebenden Menschen zu ermöglichen. Interkulturelle Öffnung ist die sozialpolitische Haltung von Einrichtungen und Institutionen samt ihrer Mitarbeiterschaft, die die Realität der Einwanderungsgesellschaft anerkennt und sich mit Zugangsbarrieren zur Regelversorgung, Vorurteilen, Rassismus, struktureller Diskriminierung und mit Irritationen und Konflikten in interkulturellen Begegnungen auseinandersetzt. Im Beitrag werden der Zugang zum Thema interkulturelle Öffnung und die strukturellen Rahmenbedingungen mit Blick auf dem Weg zu einer interkulturell geöffneten Einrichtung sowie die Herausforderungen, vor denen die sozialen Dienste stehen, reflektiert und diskutiert. Anschließend werden Strategien zur interkulturellen Öffnung mit Blick auf die aktuellen migrationspolitischen Entwicklungen erörtert. Abstract: Intercultural Opening – More Necessary than Ever Before? A Model for Change using the Example of the Workers’ Welfare Association Intercultural opening has become more necessary than ever before. The concept of intercultural opening is intertwined with the premise of enabling equal participation in the shaping of society for everyone who lives in this country. Intercultural opening refers to a socio-political approach on the part of organizations and institutions – together with their staff – which recognizes the reality of an immigrant society, and which works at redressing prejudice, racism, difficulties in accessing basic healthcare, structural discrimination and tensions and conflicts in intercultural encounters. This paper discusses and reflects upon the issue of intercultural opening and its structural parameters, with a focus on the path toward creating interculturally open institutions, as well as addressing the challenges faced by social services. The author continues by discussing strategies for intercultural opening in light of the current developments in migration policy.
378
Talibe Süzen
Die aktuelle Einwanderungssituation in Deutschland stellt die sozialen Dienste vor große Veränderungsprozesse: Im Jahr 2014 hatten 16,4 Millionen (20,3 %) der insgesamt 81,1 Millionen Menschen in Deutschland einen Migrationshintergrund.1 Seit 2014 steigt die Anzahl der Flüchtlinge in Deutschland kontinuierlich. Im Jahr 2015 gab es 442.000 Erstanträge und damit stieg die Asylerstantragszahl im Vergleich zum Vorjahr um 155 Prozent (vgl. Pro Asyl o.D.). Die Hauptherkunftsländer der Asylantragstellenden (Syrien, Albanien und Kosovo, Irak und Serbien) machen es deutlich, dass sich nicht nur die Herkunft von Einwanderer_innen nach Deutschland mehrfach verändert hat, sondern auch deren Migrationsgründe sowie -wege (vgl. Süzen, 2016: 12). Die interkulturelle Öffnung ist in diesem Kontext ein Veränderungsmodell für Organisationen als Ganzes, um allen Menschen gesellschaftliche Teilhabechancen und Partizipation zu ermöglichen. Dabei berührt die interkulturelle Öffnung alle Handlungsebenen einer Einrichtung und beschränkt sich nicht nur auf die Entwicklung und Anpassung von Angeboten und Maßnahmen (vgl. ebd.).
Interkulturelle Öffnung systematisch, strategisch und politisch Im Spiegel der aktuellen Einwanderungsdaten und -fakten ist die interkulturelle Öffnung die politische Anforderung an die Einwanderungsgesellschaft, allen Menschen mit Migrationshintergrund 2 und ihren Kindern mit und ohne Fluchterfahrung »[…] eine umfassende Teilhabe an und den ungehinderten Zugang zu den sozialen, ökonomischen, ökologischen und kulturellen Ressourcen der Gesellschaft zu ermöglichen, insbesondere den Zugang zu Bildung, zu Erwerbsarbeit, zu den sozialen Sicherungssystemen, zu den Sozial- und Gesundheitseinrichtungen, zur sozialen Infrastruktur« (Filsinger 2007: 10). Interkulturelle Öffnung ist in diesem Zusammenhang die Strukturmaxime der Sozialen Arbeit in einer Einwanderungsgesellschaft. Getreu dieser Maxime hat sich die Arbeiterwohlfahrt im Jahr 2000 auf ihrer Bundeskonferenz als erster Wohlfahrtsverband selbst verpflichtet, all ihre bestehenden und neuen Dienste und Einrichtungen interkulturell zu öffnen sowie ihre Dienstleistungsangebote entsprechend des Bedarfs der Einwanderungsgesellschaft zu entwickeln und umzusetzen. Damit sind Migrantinnen und Migranten ihrem Bevölkerungsanteil entsprechend in den Angeboten repräsentiert und somit wird konzeptionell, organisatorisch und personell ihren Bedürfnissen in den Einrichtungen und Maßnahmen entsprochen. 1 | Zu Menschen mit »Migrationshintergrund« zählen nach der Definition des Mikrozensus (2005) alle, die nach 1949 in das heutige Gebiet der Bundesrepublik Deutschland eingewandert sind, sowie alle in Deutschland geborenen Ausländer und alle in Deutschland als Deutsche geborene mit zumindest einem eingewanderten oder als Ausländer oder Ausländerin in Deutschland geborenen Elternteil (vgl. Statistisches Bundesamt 2014). 2 | Die Begriffe Einwanderer_innen, Migrant_innen, Menschen mit Migrationshintergrund und Migrationsbiografie werden hier synonym verwendet.
Interkulturelle Öffnung – notwendiger denn je?
Dieser Beschluss wurde bei der Bundeskonferenz 2008 mit zwei weiteren Beschlüssen erweitert: 1. Die AWO-Standards werden im Hinblick auf die interkulturelle Öffnung der Einrichtungen und Dienste der AWO-Gliederungen weiterentwickelt. 2. Interkulturelle Öffnung als durchgängiges Handlungsprinzip und Qualitätsmerkmal wird im Leitbild und in den Leitsätzen der Arbeiterwohlfahrt verankert. Aus der Umsetzung und Realisierung der Beschlüsse lassen sich folgende Bausteine für die Interkulturelle Öffnung identifizieren, für deren Umsetzung Strategieentwicklungen notwendig sind: • • • • •
Interkulturelle Öffnung ist eine Leitungsaufgabe Interkulturelle Öffnung erfordert eine gezielte Personalentwicklung Interkulturelle Öffnung verlangt Kundenorientierung Interkulturelle Öffnung ist Teil des Qualitätsmanagements Interkulturelle Öffnung ist die Gestaltung eines sozialpolitischen Handlungsauftrags
Verbandsstrategien zur Umsetzung dieser Bausteine zur interkulturellen Öffnung sind: • Bestandsaufnahme in dem jeweiligen Arbeitsfeld • Dokumentation und Analyse vorhandener und modellhaft erprobter Praxisbeispiele • Entwicklung und Umsetzung von Fortbildungen, Stellungnahmen sowie Positionspapieren • Entwicklung von Konzepten/Praxishilfen und Modellversuchen Als erster Schritt werden mit einer Bestandsanalyse je nach Arbeitsfeld der IstZustand erhoben und hierbei insbesondere die strukturellen Zugangsbarrieren zu den Diensten und Angeboten der Sozialen Arbeit identifiziert. Zwei Fragen sind in diesem Kontext bindend: »Müssen sich die Kunden dem Versorgungssystem anpassen?« oder »Müssen sich die Versorgungssysteme den Kunden anpassen?« (Vgl. Barth 2006) Ziele der interkulturellen Öffnung bei der Arbeiterwohlfahrt sind: • Abbau von Zugangsbarrieren • Weiterentwicklung und Qualifizierung aller Angebote der sozialen Dienste • Erwerb interkultureller Kompetenz (Fach- und Führungskräfte) und Gewinnung von Mitarbeiter_innen mit Migrationsbiografie (auch auf Führungsebene)
379
380
Talibe Süzen
• positiver Umgang mit Vielfalt (Anerkennung von Gleichheit und Verschiedenheit nach innen und außen) • Entwicklung von sozialraumorientierten Angeboten mit dem Ziel, Ratsuchende mit Migrationsbiografie im gleichen Verhältnis wie in der Bevölkerung des Umfeldes zu erreichen • gezielte Planung und Umsetzung der Öffentlichkeitsarbeit (mehrsprachige Werbung, Bilder spiegeln Vielfalt wieder) • Auseinandersetzung mit und Bekämpfung von Rassismus Auf der Grundlage der Bestandserhebung werden die weiteren Schritte im Öffnungsprozess entwickelt. Dazu gehören in erster Linie die Zielformulierung, die Umsetzungsschritte zur Zielerreichung, ein Arbeitsplan und die Festlegung zeitlicher und finanzieller Ressourcen. Der AWO Bundesverband unterstützt die Umsetzung der interkulturellen Öffnung seiner Gliederungen nach der o.g. Verbandsstrategie seit über 15 Jahren. Dies wird in den verschiedenen Arbeitsfeldern durch die Entwicklung von Arbeitshilfen, Musterhandbüchern, Leitfäden sowie die Initiierung und Durchführung von Modelprojekten schrittweise realisiert. Die bearbeiteten und dokumentierten Arbeitsfelder bislang sind: • • • • • • •
Elementarerziehung Altenhilfe (stationär und ambulant) Suchthilfe Kinder- und Jugendhilfe (Hilfe zur Erziehung) Familienbildung Jugendberufshilfe Schuldnerberatung
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass es bei interkultureller Öffnung nicht darum geht, mit Differenzen umzugehen, sondern es geht um die Denkweise, um die Haltung der Einrichtung bzw. Organisation, um die Bekämpfung von (strukturellem) Rassismus, um die Ermöglichung von Chancengerechtigkeit und Teilhabe für alle Menschen hier im Lande. Dabei ist der strategische Abbau von Zugangsbarrieren zu sozialen Dienstleistungen die Grundvoraussetzung, um die Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen und Angeboten voranzutreiben, die die konkreten Bedürfnisse der Menschen mit Migrationsbiografie und/oder mit Fluchterfahrung berücksichtigen. Es geht darum, für Menschen in der Region bzw. im Sozialraum, die sich für ein Angebot interessieren, dieses auch zugänglich zu machen. Das wäre der Anspruch der Arbeiterwohlfahrt an eine interkulturell orientierte oder geöffnete Einrichtung und/oder Organisation (vgl. AWO 2015: 49). Interkulturelle Öffnung wird im Fachdiskurs (vgl. z.B. Gaitanides 2006, Handschuck/Schröer 2012, AWO 2015 u.a.) als eine sozialpolitische Forderung,
Interkulturelle Öffnung – notwendiger denn je?
als gesellschaftliche Aufgabe in einer Einwanderungsgesellschaft samt ihrer Einrichtungen und Institutionen diskutiert (vgl. AWO 2015: 26). Die Experten sind sich darin einig, dass in einer Einwanderungsgesellschaft Soziale Arbeit entweder interkulturell oder nicht professionell ist (Handschuck/Schröer 2012). Die jahrzehntelange Forderung nach interkultureller Öffnung als Strukturmaxime der Sozialen Arbeit in einer Einwanderungsgesellschaft hat sich insbesondere durch die aktuellen Einwanderungsentwicklungen noch einmal bestätigt, da der Bedarf sowie die Systemlücken sichtbarer denn je geworden sind. Die gesellschaftlichen Entwicklungen und Veränderungen in Deutschland stellten die sozialen Dienste immer wieder vor neue Herausforderungen. Was heute aber anders ist als in den letzten Jahrzehnten, ist, dass diese Herausforderungen sowohl von Leitungskräften sozialer Einrichtungen und Organisationen als auch von deren Mitarbeiterschaft erkannt werden und die dafür notwendige strukturelle Veränderung, sprich interkulturelle Öffnung, Akzeptanz findet. Es kann heute also von einem »Paradigmenwechsel« die Rede sein, da Einrichtungen, die sich heute eher auf den Prozess der interkulturellen Öffnung einlassen, bis vor ein paar Jahren dieselben waren, die von sich behaupteten, offen für alle zu sein. Diese Behauptung, offen für alle zu sein, war in der Regel die Ablehnung der Einwanderungsrealität und Ignoranz gegenüber der sich weiterentwickelnden Einwanderungsgesellschaft. Heute erkennen diese Einrichtungen und Organisationen die Chance und sind bereit, diese auch zu nutzen, um zukunfts- und konkurrenzfähig zu bleiben sowie die Mitarbeiterschaft durch die mit der interkulturellen Öffnung einhergehende Qualifizierung ihrer Einrichtung zu entlasten. Das heißt, die Implementierung der interkulturellen Öffnung, mit Blick auf die sich permanent verändernde Einwanderungsgesellschaft, wird heute sowohl von der Politik als auch von den öffentlichen und freien Trägern der sozialen Dienste für notwendiger denn je gehalten.
Interkulturelle Öffnung – Grundlage einer Willkommensstruktur Mit Blick auf die aktuelle Situation mit geflüchteten Menschen kommt in diesem Zusammenhang auf die bestehenden »Regeleinrichtungen« (wie Kitas, Schulen, Nachmittagsbetreuungen, Stadtteil- und Familienzentren, Angebote für Jugendliche) eine besondere Aufgabe zu. Die Einrichtungen sind Anlaufpunkte für geflüchtete Menschen: Eltern und Kinder kommen in den Familienbildungsstätten und Kitas in Kontakt mit den Akteuren und Einrichtungen im Sozialraum, Beratungsstellen werden aufgesucht bei Fragen und Problemlagen etc. Alle haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter_innen sind die direkten Kontaktpersonen und Ansprechpartner_innen, gestalten Kommunikation und bieten passgenaue Dienstleistungen an. Zudem sind sie auch wichtige Multiplikator_innen, die eine Stimmung in der Gesellschaft mitprägen.
381
382
Talibe Süzen
Das Zusammenleben in Deutschland ist einem Wandel unterworfen. Vielfalt und Diversität wird an Orten, wie beispielsweise in sehr ländlichen Regionen, durch die Verteilung der geflüchteten Menschen ein Thema, wo es bisher kaum ein Thema war. Bei aller Unterschiedlichkeit von Prägungen wird oft in Begegnungen die Erfahrung gemacht, dass »uns mehr verbindet, als uns trennt«. Diese Begegnungen zu organisieren und zu ermöglichen, ist eine wichtige Aufgabe, auch für die Arbeiterwohlfahrt. Die Arbeiterwohlfahrt ist flächendeckend in Deutschland vertreten – vom ländlichen Bereich bis hin zur Großstadt. Sie hat ein breites Spektrum an Angeboten und sie hat Engagierte, die in allen Feldern in ganz Deutschland tätig sind. Darin liegen eine große Chance und eine große Verantwortung. Um ihre haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter_innen noch besser auf die aktuellen Herausforderungen vorzubereiten, führt die AWO flächendeckend Fachtage durch. Das Ziel dieser Fachtage ist, Teilnehmende in die Lage zu versetzen, mehr Sensibilität für die Lebenswirklichkeit der Menschen mit Fluchterfahrung zu entwickeln und diese in ihre tägliche Arbeit einfließen zu lassen. Die Themen und Fragestellungen sind z.B.: • Was bedeutet Fluchterfahrung? • Welche Erfahrungen haben insbesondere Kinder, Jugendliche und Frauen auf der Flucht? • Wie sehen Lebensrealitäten von Menschen aus, die geflüchtet sind und hier ankommen? • Was bedeutet »Trauma«? • Vielfalt in der Gesellschaft – Was bedeutet dies ganz konkret? • Was bedeutet Religionsfreiheit? Was bedeutet Laizismus? • Welche Haltung habe ich? • Was bedeutet Integration und Inklusion nach Ansicht der AWO? • Wie entstehen Werte und Normen? Worauf basieren unsere kulturellen Wertvorstellungen? • Was sind die üblichen »Stammtischparolen« – wie kann darauf geantwortet werden? Welche Werte prägen mich und sind mir wichtig? • Welche Vorurteile habe ich? • Welche Kommunikationshemmnisse gibt es und worauf beruhen diese? • Wie kann ich dem entgegenwirken? Wie können Toleranz und Wertschätzung »gelebt« werden? Angesprochen werden alle haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter_innen. Dabei wird besonders Wert darauf gelegt, dass nicht nur Fachkräfte sich mit diesen Fragen auseinandersetzen. Auch und gerade Mitarbeiter_innen in der hauswirtschaftlichen, verwaltungs- und organisatorischen Arbeit sollen einbezogen werden. So können z.B. der Koch bzw. die Köchin einer Kita, der Empfangsdienst, der/die Hausmeister_in und der/die Verwaltungsangestellte eine sehr bedeuten-
Interkulturelle Öffnung – notwendiger denn je?
de Rolle spielen bei der gesellschaftlichen Eingliederung von geflüchteten Menschen. Durch die Teilnahme an diesen Fachtagen werden soziale Kompetenzen erweitert und der ressourcenorientierte Blick der Fachkräfte gestärkt. Es wird vor allem Raum für Reflexion des subjektiven Erlebens, der Ängste und Vorurteile geschaffen und Kompetenzen in Bezug auf interkulturelle Öffnung erweitert. Abschließend wird konstatiert, dass es bei Fragen zu Flucht und Migration nicht mit einfachen Antworten getan ist; der Blick in die einzelnen Arbeitsbereiche zeigt, wie vielfältig Lösungen je nach Bedarf und Bedürfnissen der Ratsuchenden mit Fluchterfahrung sein müssen. Geflüchtete Menschen bringen ihre eigene Geschichte und Individualität mit. Sie sind nicht Vertreter_in einer bestimmten Nation, Kultur oder Gruppe, sie bringen verschiedene Prägungen ihrer Sozialisation, ihrer ethnischen und sozialen Herkunft mit. Sie können selbst innerhalb eines Herkunftslandes ganz andere Geschichten und Beweggründe für eine Flucht haben. All dies zeigt, wie differenziert derzeit Lösungsansätze gefunden werden müssen, um Chancengerechtigkeit und Teilhabe aller in Deutschland lebenden Menschen im Sinne der interkulturellen Öffnung zu organisieren.
L iter atur AWO – Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e.V. (Hg.) (2006): Die Umsetzung der interkulturellen Öffnung in unterschiedlichen Handlungsfeldern der Sozialen Arbeit. Eine Arbeitshilfe für die Praxis, Bonn: Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e.V. AWO – Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e.V. (Hg.) (2015): Interkulturelle Öffnung der Bundesprogramme Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer und Jugendmigrationsdienste. Eine Praxishilfe. Schriftenreihe Theorie und Praxis, Berlin: Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e.V. Barth, Wolfgang (2006): »Aktueller Stand und Strategien des Bundesverbandes im interkulturellen Prozess«, in: AWO, Umsetzung der interkulturellen Öffnung, S. 9-12. Filsinger, Dieter (2007): »Was macht IKÖ unabdingbar in den Handlungsfeldern der Sozialen Arbeit«, in: Theorie und Praxis der interkulturellen Öffnung. Einstieg in Theorie und Praxis mit einem Training für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der sozialen Handlungsfelder, Bonn: Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e. V., S. 9-10. Gaitanides, Stefan (2006): »Stolpersteine auf dem Weg zur interkulturellen Öffnung der Sozialen Dienst.«, in: AWO, Umsetzung der interkulturellen Öffnung, S. 22-26. Handschuck, Sabine/Schröer, Hubertus (2012): Interkulturelle Orientierung und Öffnung. Theoretische Grundlagen und 50 Aktivitäten zur Umsetzung, Augsburg: Ziel.
383
384
Talibe Süzen
Pro Asyl (o.D.): Fakten, Zahlen und Argumente. https://www.proasyl.de/thema/ fakten-zahlen-argumente (letzter Zugriff: 30.03.2016). Statistisches Bundesamt (2015): Bevölkerung mit Migrationshintergrund – Ergebnisse des Mikrozensus 2014. https://www.destatis.de/DE/Publikationen/ Thematisch/Bevoelkerung/MigrationIntegration/Migrationshintergrund 2010220147004.pdf?__blob=publicationFile. (letzter Zugriff: 19.05.2015). Süzen, Talibe (2016): »Interkulturelle Öffnung Hilfen zur Erziehung«, in: unsere jugend. Die Zeitschrift für Studium und Praxis der Sozialpädagogik. 68. Jahrgang, 1/2016, S. 11-21. Begleitmaterial zum Text findet sich in den Abschnitten 2.4 und 2.5 der Materialien im Anhang des Buches.
Einander begegnen und voneinander lernen Kultur als Türöffner Mohammad Alhamwi im Interview mit Caroline Gritschke
Zusammenfassung Der syrische Politologe Mohammad Alhamwi betont die Bedeutung von Kultureinrichtungen als Orte der Begegnung von Menschen mit und ohne Fluchterfahrung. In seiner Teilnahme an einer szenischen Lesung zu Brechts »Flüchtlingsgesprächen« in Senftenberg hat er seine Perspektiven auf den Text eingebracht und dramaturgisch mit den angestellten Schauspieler_innen gemeinsam an der Lesung gearbeitet. Dabei war diese Form der Begegnung für ihn eine entscheidende Motivation zur Teilnahme. In gemeinsamen Kulturprojekten lernen Menschen mit und ohne Fluchterfahrung seiner Auffassung nach voneinander und teilen unterschiedliche kulturelle Erfahrungen. Alhamwi hält das für die beste Form von Integration.
Abstract: Coming Together and Learning from One Another – Opening Doors with Culture The Syrian political scientist Mohammad Alhamwi emphasizes the significance of cultural institutions as sites of encounter between refugees and non-refugees. In his participation in the staged reading of Brecht’s Refugee Conversations in Senftenberg, he incorporated his personal perspectives into the text and worked dramaturgically with the actors who performed it. This form of encounter was a crucial motivation behind his participation in the event. In collaborative cultural projects, he believes that refugees and non-refugees learn from one another and share their diverse cultural experiences. Alhamwi considers this to be the best form of integration.
386
Mohammad Alhamwi im Inter view mit Caroline Gritschke
Sie haben im letzten Herbst in Senftenberg in Brandenburg an einem Theaterprojekt teilgenommen, obwohl sie eigentlich Politologe sind. Wie kam es dazu? Ich bin tatsächlich kein Schauspieler, sondern habe in Damaskus Politologie studiert. Ich habe auch kein Stück aufgeführt in Senftenberg, sondern einen Text von Bertold Brecht gelesen. Allerdings habe ich den Text auch dargestellt, präsentiert und nicht nur abgelesen. Was hat Sie motiviert, sich auf eine Bühne zu stellen? Ich bin seit sieben Monaten hier. Deutsch habe ich nicht in der Schule gelernt, sondern auf der Straße in dem kleinen Ort Schipkau, in dem ich untergebracht war. Dort wohnen nicht so viele Menschen. Es gibt sehr viele ältere Menschen und es war für mich als jungen Mann schwer, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Sehr schwer sogar, Südbrandenburg ist nicht wie Berlin. Aber dann habe ich in der Unterkunft einen Schauspieler kennengelernt, der in Senftenberg ein Theaterprojekt machen wollte. Es ging um die »Flüchtlingsgespräche« von Bertold Brecht. Brecht war ja auch Flüchtling und da passte das gut zusammen. Mit einem Freund, der als Schauspieler am Theater arbeitet, habe ich den Text einstudiert und auch die Vortragsweise geprobt. Aber ich war ein wenig skeptisch: Ich spreche auf Deutsch einen bekannten deutschen Text von Brecht. Warum sollte das deutsche Publikum das hören wollen? Was ist das Neue daran? Sie wollten also Ihre eigene Perspektive auf den Brecht-Text sichtbar machen? Damit das Publikum erfährt, was es bedeutet, wenn Sie den Text lesen? Ja, das Publikum braucht ja keinen syrischen Vorleser eines Brecht-Textes. Daher kam ich auf die Idee, den Text ins Arabische zu übersetzen. Da ist dann der Brecht-Text und das wird dann zum Text eines Flüchtlings, der seit drei Monaten in Deutschland ist. Die Leute im Theater haben das poetische Werk mit mir genau und geduldig besprochen. Wir haben den Text gekürzt, damit ich ihn sprechen kann. Es sind nur etwa 30 bis 40 Sätze. Meine Idee mit der Arabisch-Übersetzung haben wir dann gemeinsam weiter entwickelt. Den gesamten Text zunächst auf Deutsch und dann auf Arabisch vorzutragen, die anfängliche Idee der Theaterleute, war aus meiner Sicht nicht so eindrucksvoll. Ich habe dann vorgeschlagen, nach jedem deutschen Satz einen arabischen einzufügen. Das war auch klanglich interessant. Ich habe zunächst versucht, ganz wörtlich zu übersetzen. Das Arabische ist sehr lyrisch und hat eine Melodie. Einige Wörter hören sich auch gleich an. Was waren für Sie die wichtigsten Aspekte der Zusammenarbeit mit dem Theater in Senftenberg? Zum einen der Kontakt, die Begegnung. Dabei konnte ich auch meine Sprachkenntnisse verbessern. Ich kann ja nicht einfach jemanden auf der Straße ansprechen und sagen: »Bitte, ich möchte mit dir reden!«
Einander begegnen und voneinander lernen
Man hat mich im Theater anerkannt, meine Idee von der Arabisch-Übersetzung wurde sofort akzeptiert. Die Aufführung am Theater hat dann auch dazu geführt, dass ich eine Arbeit in Senftenberg bekommen habe für drei Monate. Danach bin ich dann nach Berlin gezogen, um mehr Möglichkeiten zu haben. In Berlin suche ich auch nach kultureller Unterstützung. Ich möchte die deutsche Kultur kennenlernen, insbesondere die Theater. Die Menschen, die am Theater arbeiten, sind sehr offen. Die Kultur ist ein Türöffner. Was würden Sie Künstler*innen und Kulturschaffenden mit auf den Weg geben, wenn sie mit Menschen mit Fluchterfahrung arbeiten wollen? Worauf sollten sie achten? Was würden Sie sich wünschen für ein gemeinsames Projekt? Ein gemeinsames Kulturprojekt, ein Theaterstück, eine Lesung oder etwas im Bereich Kunst – das ist eine gute Orientierung für beide, Deutsche und Flüchtlinge, um einander kennenzulernen. Das ist genau die richtige Integration. Man kann Kulturen gegenseitig entdecken und Vorurteile über die Mentalitäten des Anderen abbauen. Bislang weiß man zu wenig voneinander. Oft wird die Verschiedenheit zu sehr betont, der unterschiedliche Glauben zum Beispiel. Aber in der gemeinsamen Arbeit in Kunst und Theater kann man sich miteinander verbinden und voneinander lernen. Die meisten Dinge brauchen viel Zeit. Wenn man hier studieren möchte, benötigt man z.B. Zeugnisse, Bescheinigungen und Sprachzertifikate. Kulturprojekte kann man aber sofort miteinander machen, und man kann sich in den Kultureinrichtungen treffen und sich austauschen.
387
7. Projektsteckbriefe — Project Profiles
boat people projekt, Göttingen
Was war oder ist das Ziel des Projektes? Seit 2009 sind die Themen Flucht und Migration Schwerpunkte unseres Theaterschaffens. In unseren Stücken suchen wir die Schnittstellen von Politik und Poesie, persönliche Berührungspunkte, die wir fiktional verdichten. Wir begegnen uns auf und hinter der Bühne mit unseren Vorstellungen vom Leben und unseren Ansprüchen an Theaterformen. Dadurch entsteht Austausch auf vielen Ebenen. Wir lernen andere Theaterformen kennen und entwickeln uns mit den Spielerinnen und Spielern weiter, die unser Projekt prägen.
Haben sich Ihre ursprünglichen Planungen und Fragestellungen im Verlauf des Projekts verändert? Wenn ja – inwiefern? Erfahrungen werden vertieft. Unser Team hat sich vergrößert. Dadurch entstehen mehrere Projekte parallel und verschiedene Ansätze werden ausprobiert. Nachhaltigkeit in Bezug auf die Menschen, mit denen wir arbeiten, ist weiterhin unsere Voraussetzung beim Theaterproben.
Wie ist das Verhältnis von Ihrer Institution oder Ihrem Verein zu den Geflüchteten? Wie sehen Sie einander an? Was bringt das für Ihr Haus? Unser Theater ist direkt in einer Unterkunft für Geflüchtete. Neben dem Probenraum wird gekocht. Dadurch sind wir dem Alltag der Menschen dort nah, sind ihm mitunter auch ausgesetzt, denn viele der Bewohner*innen gucken bei Theaterproben zu, kommen in Aufführungen. Wir geben Workshops (Tanz, Theater, Film) für die Bewohner*innen, bei denen auch Göttinger*innen willkommen sind. Unsere Zuschauer*innen kommen gerne in das (in diesem Jahr bezogene) Theater, auch weil sie in Kontakt mit Geflüchteten kommen.
Was würden Sie Kolleg*innen rückblickend raten, die ein Kulturprojekt mit Geflüchteten beginnen wollen? Zur Zeit ist auch ein Hype um partizipative Projekte entstanden. Man muss genau hinschauen und herausfinden, ob man die Geduld hat, ein Theater aufzu-
392
Projektsteckbriefe
bauen mit Menschen, die gerade aus Kriegsgebieten kommen. Wir dürfen uns nicht mit ihnen schmücken, sondern gemeinsam einen Raum öffnen und ihn gestalten. Viel Empathie und Vertrauen sind erforderlich.
Kontakt: boat people projekt www.boatpeopleprojekt.de Luise Rist [email protected] Tel.: 0049 (0) 179 9198051 Nina de la Chevallerie Tel.: 0049 (0) 176 22732901 [email protected]
KINO ASYL, München
Was war oder ist das Ziel des Projektes? KINO ASYL ist ein Festival mit Filmen aus den Herkunftsländern in München lebender, geflüchteter junger Menschen. Das Festival wird von den Kurator_innen mit Fluchterfahrung mit Unterstützung von Fachleuten selbst gestaltet. Es soll Einblicke in andere Teile der Welt ermöglichen – und zwar aus der Perspektive derjenigen, die erst vor kurzem nach Deutschland gekommen sind. Menschen, die aus ihren Heimatländern geflohen sind, bringen einen großen kulturellen Erfahrungsschatz mit. Dazu gehört insbesondere auch der Bereich Film und Fernsehen. Hierzulande kursieren allerdings sehr einseitige Bilder über die Herkunftsländer geflüchteter Menschen, Flucht und die Menschen selbst. Hier setzt KINO ASYL an: Das Filmfestival zeigt neue Sichtweisen und erzählt andere Geschichten aus unterschiedlichsten Ländern. Perspektivwechsel ist folglich ein zentrales Moment von KINO ASYL. Die jungen Kurator_innen sind in alle Aufgabenbereiche der Festivalplanung aktiv eingebunden. Sie treffen somit nicht nur die Filmauswahl. Mit Unterstützung von Fachleuten kümmern sie sich um die Öffentlichkeitsarbeit des Festivals: Sie entwerfen Flyer und Poster, stellen das Programmheft zusammen, gestalten dieses und produzieren Trailer. Des Weiteren liegt auch die Untertitelung der Filme in ihrem Wirkungsbereich und selbstverständlich sind Rahmenprogramm, Filmpräsentation und -gespräch ebenfalls Aufgabe der Jugendlichen. Ein Festival zu organisieren, gibt den jungen Kurator_innen somit ein Stück des Handlungsspielraums zurück, der ihnen mit der Ankunft in Deutschland genommen wurde. Der kreative Spielraum und die Mitgestaltung des kulturellen Lebens sind dabei zwei zentrale Elemente. Durch den aktiven und kreativen Umgang mit Medien wird zudem die Medienkompetenz der Teilnehmer_innen gefördert und mediale Ausdrucksmöglichkeiten werden erlernt. Auch Sprachkompetenz sowie Selbstwirksamkeitsgefühle werden durch das Mitwirken bei KINO ASYL begünstigt.
394
Projektsteckbriefe
Haben sich Ihre ursprünglichen Planungen und Fragestellungen im Verlauf des Projekts verändert? Wenn ja – inwiefern? Am Grundgedanken, den Zielsetzungen und dem Verlauf von KINO ASYL hat sich im Verlauf des Projekts nichts geändert. 2016 wird das Festival jedoch einen größeren Rahmen einnehmen. Konkret bedeutet dies: KINO ASYL wird fünf Tage dauern und in größeren Spielorten stattfinden. Die Kurator_innen fühlen sich durch diesen Umstand stark motiviert und gleichermaßen auch in ihrer Professionalität gefordert. Besonders spannend sind im zweiten Jahr des Projekts die gruppendynamischen Prozesse unter den Kurator_innen. Einige der letztjährigen Kurator_innen begleiten das Festival erneut. Das gesamte Team befindet sich folglich in einem Weiterentwicklungsprozess, bei dem es darum geht, Rollen neu zu definieren. Erfahrene Kurator_innen werden verstärkt als Mentor_innen und Coaches fungieren, ihr Wissen weitergeben und dabei helfen, KINO ASYL weiterzuentwickeln. Gleichmaßen sehen sie sich aber auch vor der Aufgabe, den neu dazugekommenen Kurator_innen genügend Raum zu geben, um eigene Erfahrungen zu machen.
Wie ist das Verhältnis von Ihrer Institution oder Ihrem Verein zu den Geflüchteten? Wie sehen Sie einander an? Was bringt das für Ihr Haus? Unser Verhältnis lässt sich am treffendsten mit ›auf Augenhöhe‹ beschreiben. Das Medienzentrum München des JFF und Refugio München bieten den Kurator_innen einen Rahmen, in dem sie ihr eigenes Filmfestival gestalten können. Dazu gehört auch professionelle Unterstützung in diversen Aufgabenbereichen. Die eigentliche Arbeit wird von allen gemeinsam gestemmt, Entscheidungen werden im gemeinsamen Diskurs ausgehandelt. Die Neugierde an der (Film- und Fernseh-)Kultur des jeweils anderen verbindet alle Beteiligten bei KINO ASYL. Denn nicht nur wir als Institution und die Besucher_innen des Festivals erhalten intensive und individuelle Einblicke in eine für sie sonst unzugängliche Lebenswelt anderer – den Kurator_innen geht es selbstverständlich genauso.
Was würden Sie Kolleg _innen rückblickend raten, die ein Kulturprojekt mit Geflüchteten beginnen wollen? Viele Projekte verfolgen den Ansatz, dass geflohenen Menschen geholfen werden muss. Das ist durchaus richtig, kann Menschen mit Fluchterfahrung aber auch noch stärker in eine Opferrolle zwängen. Um gelingende Kulturprojekte zu gestalten, ist es ausgesprochen wichtig, die Teilnehmenden mit ihren kulturellen Hintergründen, Kompetenzen und Erfahrungen ernstzunehmen und Handlungsräume zu schaffen, in denen sie souverän agieren können. Der dadurch entstehende Handlungsspielraum bietet große Potentiale für Kulturarbeit mit Geflüchteten. Zweitens darf der organisatorische und zeitliche Aufwand solcher Projekte nicht unterschätzt werden. Manche Dinge brauchen viel Zeit und Sorgfalt sowie
KINO ASYL, München
den Blick für jeden einzelnen – und sei es nur der Umstand, dass jeder Teilnehmende zumindest zu Beginn einzeln für ein Arbeitstreffen eingeladen werden sollte. Kulturprojekte bedürfen also – gemäß den Erfahrungen von KINO ASYL – eines großen Maßes an Beziehungsarbeit.
Kontakt: Medienzentrum München des JFF www.medienzentrum-muc.de Mareike Schemmerling Tel.: 0049 (0)89 689890 [email protected]
395
KUNSTASYL Was war oder ist das Ziel des Projektes? Kunst lässt sich von Fragen leiten, schnüffelt neugierig herum und stochert im Gelände. Ziele sind alltags-, aber nicht kunsttauglich. KUNSTASYL ist mit der Fragestellung angetreten, wie es Ansässigen und Menschen, die fliehen mussten, gelingen kann, physischen und sozialen Raum gemeinsam zu nutzen und damit der Ist-Situation von Isolation und Ausgrenzung entgegenzuwirken. In seiner Phase I von Februar 2015 bis Januar 2016 war der primäre Anspruch des Projektes, die Lebensbedingungen von Menschen, die fliehen mussten und, im konkreten Falle von KUNSTASYL, in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Staakener Straße in Berlin-Spandau temporär und provisorisch untergekommen sind, begreifen und verstehen zu lernen. Zwölf Monaten lang erprobte und erforschte KUNSTASYL, wie diese Lebensbedingungen innerhalb der engen Grenzen der vorgegebenen Strukturen verändert werden können und wie der abgeschottete Raum des Heimes für Kommunikation zwischen Bewohner_innen und der »Außenwelt« durchlässig gemacht werden kann.
»Giving somebody the right to be a human is the first step to develop an idea.« (Dachil S ado)
Wer handelt, nimmt teil. In den vergangenen Monaten wurden über den Katalysator der künstlerischen Arbeit unterschiedliche Handlungsstrategien entwickelt und ausprobiert, um die »flüchtige« Situation der Betroffenen in eine »optionale« zu verwandeln. »Optional« bedeutet, dass der Mensch sichtbar wird durch autonome Handlung und die Artikulation seiner selbst. Das Fundament von KUNSTASYL sind Beziehungen, freundschaftliche, berührende, kritische. Die Auseinandersetzung mit dem Gegenüber basiert auf Anerkennung seiner Einzigartigkeit und der Akzeptanz von Differenz.
KUNSTASYL
Haben sich Ihre ursprünglichen Planungen und Fragestellungen im Verlauf des Projekts verändert? Wenn ja – inwiefern? Partizipatorische Projekte, die gemeinsames Tun und Handeln von Menschen anstreben, die sich zu Projektbeginn nicht kennen, können vorbereitet, aber in ihrer Entwicklung nicht geplant werden. Sie sind mit höchstem Risiko behaftet. Keine Erfahrung garantiert, dass es gelingt, eine gemeinsame Plattform herzustellen. Passiert es, ist es immer auch ein Wunder. Oder eben genau die KUNST partizipatorischen Arbeitens. Solche Projekte erfordern die permanente Bereitschaft, die eigenen Handlungsweisen zu überprüfen, Gedachtes neu zu denken und Gewolltes zu Gunsten von Unvorhergesehenem aufzugeben. Die größte Herausforderung ist es, die Verantwortung für das Geschaffene zu übergeben und die Idee zu emanzipieren. KUNSTASYL ist innerhalb von eineinhalb Jahren für eine offene Gemeinschaft von Künstler_innen, Kreativen und Menschen, die fliehen mussten, identitätsstiftend geworden. Diese gemeinsame Identität formuliert sich in dem oft und öffentlich postulierten Statement: »Wir sind KUNSTASYL!«
Wie ist das Verhältnis von Ihnen oder dem Museum zu den Geflüchteten? Wie sehen Sie einander an? Was bringt das für das Museum und für Sie? »Ich bin ein Mensch«, schrie 2012 ein Mann aus Syrien in das Mikrofon eines Reporters in einem Lager an der türkischen Grenze. Wer Flucht als Erfahrung mit einer Charaktereigenschaft verwechselt oder gar denkt, »geflüchtet« sei ein Beruf und der »Flüchtling« eine eigene Gattung, hat ein Problem. Wir kreieren zusammen und nutzen dabei jedwede Skills, die der Einzelne einbringen kann oder möchte. Also eigentlich so wie im ganz normalen Leben. Die Frage, »ob das was bringt«, dürfen gerne andere beantworten. KUNSTASYL forscht und handelt. Seit März 2016 eignet sich KUNSTASYL einige hundert Quadratmeter repräsentativen Raumes eines Staatlichen Museeums Preussischer Kulturbesitz an. Das Museum Europäischer Kulturen Berlin hat KUNSTASYL diesen Raum überlassen und uns zur Handlung ermächtigt. Es ist dies keine paternalistische Geste zur Teilhabe, sondern ein radikaler Akt. Ein Museumsraum wird zum performativen Ort von Geschehen und Verwandlung. Differenz wird nicht aufgehoben, sie darf sein. In diesem Museum zeigt sich Europa souverän.
Was würden Sie Kolleg _innen rückblickend raten, die ein Kulturprojekt mit Geflüchteten beginnen wollen? Ich würde raten, das Projekt mit Menschen zu entwickeln und nicht mit »Geflüchteten« und dabei sehr viel Zeit, Energie und Neugier einzubringen. Ein sehr gutes Standing halte ich für unabdingbar. Und … man braucht eine solide Finanzierung.
397
398
Projektsteckbriefe Kontakt: KUNSTASYL www.kunstasyl.net [email protected] Tel.: 0049 (0)171 7560028 c/o barbara caveng www.caveng.net [email protected]
Lokstoff: »Pass.Worte. Wie Belal nach Deutschland kam«, Stuttgart
Was war oder ist das Ziel des Projektes? »Pass.Worte. Wie Belal nach Deutschland kam« basiert auf einer wahren Geschichte, dem authentischen, individuellen Fluchtschicksal eines jugendlichen Afghanen, den wir durch unseren kulturellen Sprachkurs kennengelernt haben. Es ist das Zeugnis eines Jugendlichen, der binnen Monaten notgedrungen zum Mann reift und dennoch den kindlichen Wunsch auf eine glückliche Zukunft in seinem Herzen nährt. »Pass.Worte.« soll daran erinnern, dass hinter jedem Fluchtschicksal eine individuelle Geschichte und ein Name stehen. Das Stück, das in der Form einer asylrechtlichen Anhörung eines minderjährigen, unbegleiteten Flüchtlings zusammen mit einem »Übersetzer« gestaltet ist, soll einen Perspektivwechsel ermöglichen, um sich empathisch in die Situation und Geschichte eines jungen Menschen, der aus seiner Heimat fliehen musste, hineinversetzen zu können. Wir möchten dabei nicht interpretierend in eine aktuelle Debatte eingreifen, sondern aufzeigend um Aufmerksamkeit werben, damit eine öffentliche Meinungsbildung – auch und gerade bei jungen Menschen – intensiver und vorurteilsfreier möglich wird. »Pass.Worte. Wie Belal nach Deutschland kam« ist ein Theaterstück von 45 Minuten Dauer, da wir es speziell für Schüler_innen konzipiert und deshalb der Länge einer Schulstunde angepasst haben. Es findet in einem großen, zum Theaterraum umgebauten Schiffscontainer statt, mit dem wir für die Vorstellungen zu den jeweiligen Schulen kommen. Dieser Container evoziert ebenso konkret wie symbolisch das Thema der Flucht und der gefährlichen Fluchtrouten und vermittelt in seinem Inneren eine Idee der Beklemmung und der damit verbundenen Ängste.
Haben sich Ihre ursprünglichen Planungen und Fragestellungen im Verlauf des Projekts verändert? Wenn ja – inwiefern? Unsere Ursprungsidee war, eine Flüchtlingsgeschichte in einem umgebauten Container für Schüler_innen zu erzählen. Dafür wollten wir eigentlich das Buch
400
Projektsteckbriefe
von Fabio Geda »Im Meer schwimmen Krokodile« adaptieren. Rückwirkend müssen wir sagen, dass es ein Glücksfall war, dafür die Rechte nicht bekommen zu haben, denn so haben wir selber eine Geschichte geschrieben, basierend auf den Erlebnissen von Shah J. Es ist letztlich für unsere Umsetzung, für uns Schauspieler und die jugendlichen Flüchtlinge, die darin mitwirken, viel authentischer und näher geworden, als die Buchadaption es jemals für uns hätte werden können. Obwohl wir Shahs »Geschichte« natürlich in Teilen verändert und ihr letztlich eine Bühnenfassung gegeben haben, wurde uns immer klarer, dass wir sie Shah unter keinen Umständen selber erzählen lassen dürfen. Alle Flüchtlinge, die wir im Zuge unserer Arbeit und auch in anderen Kontexten kennengelernt haben, sind traumatisiert und erfahren hier weiterhin Unsicherheiten und Ängste, ihre Situation und die Situation ihrer Angehörigen betreffend. Wir wussten nicht, wie die Schüler_innen auf unser Stück reagieren würden, wollten Shah aber unter keinen Umständen einerseits immer wieder der Erzählung seiner Odyssee und andererseits der womöglich nicht absehbaren Reaktionen der Zuschauer_innen aussetzen. Auch wurde uns eigentlich erst im Entstehungsprozess klar, dass wir die Geschichte auf jeden Fall in ihrer Ursprungssprache Dari erzählen möchten. So wandelte sich die Rolle des Schauspielers in die eines Übersetzers, der gemeinsam mit einem jugendlichen Flüchtling auf der Bühne erst die Geschichte übersetzt und dann in Zügen teilweise dessen Erzählung übernimmt. Alternierend haben wir sechs jugendliche Flüchtlinge als Darsteller der Rolle des Belal und jeweils drei Schauspieler, die abwechselnd den Übersetzer spielen, da wir sonst die vielen Schulvorstellungen nicht bewältigen könnten. Eigentlich war geplant, »Pass.Worte.« nur für Schüler_innen zu spielen. Doch die Nachfrage nach unserem Stück hat uns davon überzeugt, auch Abendveranstaltungen anzubieten, die glücklicherweise immer restlos ausverkauft sind.
Wie ist das Verhältnis von Ihrer Institution oder Ihrem Verein zu den Geflüchteten? Wie sehen Sie einander an? Was bringt das für Ihr Haus? Alle Flüchtlinge, mit denen wir durch unsere Arbeit in den »Revolutionskindern« und »Pass.Worte.« zusammengekommen sind, sind uns sehr ans Herz gewachsen. Wir unterstützen sie bei Schulproblemen, der Suche nach Praktika- und Ausbildungsplätzen und versuchen, einfach da zu sein, wenn sie sich allein und einsam fühlen oder mit den vielen neuen Anforderungen in Deutschland überfordert sind. Dabei stehen wir natürlich auch mit ihren jeweiligen Betreuern in Kontakt. Wir versuchen einfach, eine Hilfe zu sein, menschliche Wärme zu geben, all das zu tun, was wir uns selber wünschen würden, sollten wir jemals in eine solche Situation der Not geraten. Dabei werden wir zunehmend von Freunden, Bekannten, von Mitgliedern unseres Theaters und anderen Institutionen unterstützt. Wir haben erleben dürfen, dass »Pass.Worte.« die Herzen berührt. Oft werden wir nach der Vorstellung von Zuschauern gefragt, ob sie uns helfen können, einen Beitrag zu leisten in unserem Bemühen für Integration und gegenseitiges Verständnis.
Lokstoff: »Pass.Wor te.«
Was würden Sie Kolleg _innen rückblickend raten, die ein Kulturprojekt mit Geflüchteten beginnen wollen? Geduld und großes Vertrauen, das sind sicher die wichtigsten Grundpfeiler für ein gemeinsames Kulturprojekt, generell für den Umgang miteinander. Wir können sagen, dass unsere Arbeit mit Geflüchteten diesen sicher geholfen hat, ihre Deutschkenntnisse zu verbessern, Kontakte zu knüpfen, Freude und Verständnis zu erleben, vielleicht ein wenig besser und schneller Fuß zu fassen. Aber auch wir fühlen uns als Beschenkte dieser gemeinsamen Arbeit. Die Realisierung unsers Stückes ist auch für uns eine enorme Bereicherung und wir sind sehr dankbar für das uns entgegengebrachte Vertrauen und den Mut unserer Jugendlichen, ohne die »Pass.Worte.« nie das geworden wäre, was es für uns alle ist.
Kontakt: LOKSTOFF! Theater im öffentlichen Raum e.V. Reinsburgstraße 82 70178 Stuttgart www.lokstoff.com Tel.: 0049 (0)711 88899922
401
Refugees’ Kitchen, Oberhausen
Was war oder ist das Ziel des Projektes? Gut zu essen. Und wir wollten neue Menschen kennenlernen. Neugierige, engagierte Menschen, die Lust haben, gemeinsam etwas zu entwickeln, gemeinsam Neues zu erschaffen. Geflüchtete sind ja nicht nur Schrecklichem entronnen, sie kommen hierher auch mit Hoffnung und Kraft und mit dem Wunsch, aktiver Teil ihrer neuen Gesellschaft zu werden. Das Ruhrgebiet braucht dringend solche Menschen, es gibt hier sehr viele Probleme und Aufgaben, die nur gemeinschaftlich zu lösen sind. So gesehen, birgt die Hoffnung der neu hier lebenden geflüchteten Menschen auch ein enormes gesellschaftliches Potential. Ihr Neuanfang in Oberhausen kann auch ein Neuanfang für Oberhausen werden. Das aber muss erkannt und gewollt werden und bedarf seitens der länger schon hier lebenden Menschen und bestehenden gesellschaftlichen Gruppen sowie auch von den politisch verantwortlichen Personen und Institutionen Neugier, Offenheit, Erprobungslust und Einladungen. »Refugees’ Kitchen« war und ist so eine Einladung und eine ebenso konkrete wie exemplarische gemeinsame Erprobung. Wir legen unsere Projekte immer so an, dass wir engagierte Menschen darin involvieren. ’ob vier deutsche, »weiße« Diplom-Künstler_innen eine Werkstatt benötigen oder eine Gruppe mit sehr unterschiedlich ausgebildeten Geflüchteten. Auch die praktische Arbeit hatte einen besonderen, für uns neuen Takt. Abstrakt hatten wir dies erwartet, konkret haben wir es in der gemeinsamen Arbeit gelernt. In einer Gruppe von einander anfangs unbekannten Menschen mit vielen unterschiedlichen Talenten, Fähigkeiten und zudem verschiedenen Sprachen ist der Rhythmus der Zusammenarbeit ein anderer als in einem Team, das sich untereinander bereits kennt oder nach Professionen zusammengesetzt ist. Man muss anders planen und anders, sehr viel kommunikativer arbeiten: die eigene Arbeit transparenter machen, offener gestalten, damit andere daran aktiv und eigenverantwortlich teilnehmen und sie mit ihren eigenen Ideen und Fähigkeiten – die sich beide oft erst in der gemeinsamen Praxis zeigen – sinnvoll ergänzen, bereichern, verändern können. Dies zu lernen, den dieser Zusammenarbeit angemessenen Rhythmus zu finden und dann so zu arbeiten, braucht mehr Zeit als die Arbeit in bereits erprobter Routine. Sinnvolle Arbeits- und Lebenszeit.
Refugees’ Kitchen, Oberhausen
Wie ist das Verhältnis von Ihrer Institution oder Ihrem Verein zu den Geflüchteten? Wie sehen Sie einander an? Was bringt das für Ihr Haus? Das Verhältnis gründet in gegenseitigem Respekt und Neugier aufeinander. Unsere Neugier bezieht sich auf die Menschen, die unsere neuen Mitbürger_innen sind, ihre Interessen, Gedanken, Eigenschaften, Fähigkeiten, Wünsche, Ideen. Wir fragen nicht nach ihrer Vergangenheit, nach dem Erlebten, dem Erlittenen. Manchmal erzählt jemand etwas, dann ist dies aber ein privater Moment. Viele künstlerische Projekte mit Geflüchteten haben ja Biografiearbeit zur Voraussetzung. Das hat seine Berechtigung, v.a. weil sie aufklären und Empathie erzeugen. Es steckt darin aber auch ein Moment der Reduktion: des Menschen auf seine Vergangenheit. Unsere Arbeit bestand und besteht aus Bauen und Kochen, sie hat ihren Schwerpunkt also in der Jetztzeit und – entwerfend, planend – in der nahen Zukunft. Gefragt sind von allen Beteiligten ihre jetzt vorhandenen Fähigkeiten, ihre heute bestehende Kraft und Lust, gemeinsam etwas zu erschaffen, und ihre in die Zukunft reichenden Ideen darüber, wie dieses Erschaffene – hier konkret: eine gemeinsam entworfene und gebaute mobile Küche und ihr Betrieb – aussieht und funktioniert. Es geht also ums gemeinschaftliche Arbeiten, entwerfend und umsetzend, im Hier und Jetzt und für die Erschaffung von etwas daraus entstehendem Neuen. In diesem Prozess ist die gemeinsame und hierfür je auch geteilte Verantwortung wesentlich. Jeder Mensch hat ein Recht auf Anerkennung. Wenn sie von außen erfolgt, wie in unserem Projekt durch Lob und Auszeichnungen, ist dies schön für alle Beteiligten. Intern, in der gemeinsamen Arbeit, erfolgt die gegenseitige Anerkennung als geteilte und gemeinsame Verantwortung. Dies reicht von den eigenständigen Verantwortlichkeiten für einzelne Arbeitsabschnitte über je individuelle Verantwortung für ganz konkrete Tätigkeiten bis zu einzelnen Handgriffen in diesen und weiter bis zur Wahl der hierfür benötigten Werkzeuge und dafür, dass diese Werkzeuge nach ihrem Gebrauch wieder an den Ort zurückkommen, wo die in ihren Bereichen selbstverantwortlich Mitwirkenden sie in ihrem Bedarfsfall suchen. Die gemeinschaftliche Verantwortung für das große Ganze basiert auf diesen je einzelnen Verantwortlichkeiten. Dies hat auch eine gesellschaftliche, politische Dimension: Die in Oberhausen (im Ruhrgebiet, in Deutschland) neu lebenden Geflüchteten wollen nicht nur geduldet, nicht nur toleriert, nicht nur respektiert werden, sondern sie wollen verantwortlich mitwirken in ihrer gesellschaftlichen Umgebung und an deren Entwicklung. Ihre tatsächliche Anerkennung – und damit auch die Realisierung der zuvor genannten Potentiale – misst sich an den ihnen gegebenen Möglichkeiten zu solcher Mitwirkung. »Refugees’ Kitchen« will hierfür Erprobung und Beispiel sein. Auch wir haben neue Verantwortungen übernommen. Rein privates Kunstschaffen war auch zuvor nicht unser Programm. Das menschliche Miteinander –
403
404
Projektsteckbriefe
dazu gehört für uns immer schon auch das gemeinsame Kochen und Essen – war immer schon wichtig in unseren Projekten. In »Refugees’ Kitchen« wurde das Zwischenmenschliche basaler Teil der Arbeit, mit Menschen, die wir in der gemeinsamen Arbeit erst kennenlernten und mit denen wir über diese Arbeit hinaus verbunden sind. Das Arbeits- und das Lebensverhältnis sind nicht zu trennen, die Verantwortung reicht weiter, sie kennt keinen Feierabend. Für unser Haus hat die Arbeit an »Refugees’ Kitchen« zu einer Öffnung geführt. Insbesondere die oben beschriebene, von der Struktur des Projekts geforderte größere Transparenz und Kommunikation der eigenen Arbeiten wird dauerhafte Veränderungen erzeugen – für kommende Projekte sowie für unseren alltäglichen Betrieb.
Was würden Sie Kolleg _innen rückblickend raten, die ein Kulturprojekt mit Geflüchteten beginnen wollen? Nehmt Euch Zeit! Arbeitszeit und Lebenszeit. Denkt nicht in Projekten, sondern an Menschen und an ein langfristiges Miteinander. Für den Arbeitsprozess bedenkt vor allem anderen: Wie kann ich andere an meiner Arbeit teilhaben lassen? Nicht als in ihrer Praxis kontrollierte Ausführende Eurer Ideen und Pläne, sondern als gedanklich wie praktisch gleichberechtigt Mitverantwortliche. Und stellt Euch die Frage: »Wie lang kann man mal etwas Neues, bisher Unbekanntes ausprobieren?« Und beantwortet sie in Euren Plänen und Konzepten und praktisch stets mit: So lange wie nötig.
Kontakt: kitev – Kultur im Turm e.V. Willy-Brandt-Platz 1 46045 Oberhausen www.kitev.de [email protected]
reisegruppe heim-weh! (2014/15), Leipzig Eine performative Stadtrundfahrt von und mit Asylsuchenden in Leipzig
reisegruppe heim-weh! war eine performative Stadtrundfahrt, die den alltäglichen Umfeldern und Wahrnehmungen von Geflüchteten in Leipzig nachspürte. Asylsuchende selbst wurden dabei zu Reiseleiter*innen und Bürger*innen zu Besucher*innen in der eigenen Stadt. In den Erzählungen der Performer*innen und den Begebenheiten entlang des Weges erlebte die Reisegruppe eine Fahrt ins »Unbekannte«, die mit eigenen Vorstellungen konfrontierte und vielleicht ungeahnte Gemeinsamkeiten entdecken ließ. Hintergrund für das Projekt, das über mehrere Monate gemeinsam mit Asylsuchenden erarbeitet wurde, bildete die teils hitzig geführte Debatte zum Thema Flüchtlingsunterbringung in Leipzig seit 2012. Anwohner und rechte politische Strömungen formierten sich in mehreren Stadtteilen zum Protest gegen neue Unterkünfte. Von den hier lebenden Geflüchteten, ihren Erfahrungen bekam man hingegen so gut wie nichts mit. Was sind Ängste und Hoffnungen, die ihren Alltag prägen? Das Projekt des Cammerspiele Leipzig e.V. unter der Leitung von Clara Minck witz und Julia Lehmann wird gefördert vom Fonds Soziokultur, der Robert Bosch Stiftung, durch die Aktion Mensch, im Rahmen des Landesprogramms »Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz« und vom Kulturamt Leipzig, mit freundlicher Unterstützung von Spritztour-Reisen GmbH.
Was war oder ist das Ziel des Projektes? reisegruppe heim-weh! wollte einen künstlerischen Beitrag zum Dialog zwischen Leipziger Bürger*innen und Leipziger Asylbewerber*innen leisten. Wichtig war dabei die Schaffung eines neuen Zugangs zum Thema auf der Ebene des praktischen Lebens, der vom politischen und medialen Diskurs nicht bedient wird. Dabei setzte das Projekt auf das gegenseitige Kennenlernen von Mensch zu Mensch im gemeinsamen Erlebnis der Performance.
406
Projektsteckbriefe
reisegruppe heim-weh! wurde zudem als Chance gesehen, bei den Zuschauer*innen Fragen aufzuwerfen, an Gewissheiten zu kratzen und Ängste abzubauen, die häufig durch Unwissenheit und Unkenntnis ausgelöst werden. Ausgangspunkt waren Fragen wie: Welche Vorurteile gibt es überhaupt? Was sind Ängste, Hoffnungen und Erlebnisse, die das (Zusammen-)Leben von Ankömmlingen und Anwohnern prägen? Im Rahmen der Performance war dabei das stilistische Element der temporären Wahrnehmungsverschiebung einer vermeintlich vertrauten Umgebung zentral: Alteingesessene Bürger*innen sollten die Rolle von Tourist*innen in der eigenen Stadt und Asylbewerber*innen die von Reiseleiter*innen einnehmen, die ihre Sicht auf Leipzig vermitteln. In besonderem Maße zielte reisegruppe heim-weh! darüber hinaus auf die Partizipation der Asylbewerber*innen am Leben in der Stadt. Bisher kamen sie in der medialen und politischen Debatte kaum zu Wort. Das Projekt wollte eine offene Möglichkeit für sie bieten, einen neuen Zugang zu ihrem derzeitigen Lebensort zu bekommen und selbst (künstlerisch) aktiv in Erscheinung zu treten. Zudem war es den Projektleiterinnen sehr wichtig, dass alle Teilnehmer*innen das Projekt als ihr eigenes betrachten und nicht als etwas, das mit ihnen gemacht wird.
Haben sich Ihre ursprünglichen Planungen und Fragestellungen im Verlauf des Projekts verändert? Wenn ja – inwiefern? Durch die Form der performativen Busreise war die Struktur vorgegeben und wurde auch im Laufe des Projektes nicht verändert. Aufgrund der inhaltlichen Offenheit des Projektes haben sich die konkreten Inhalte, angefahrenen Orte, Geschichten und Elemente in Zusammenarbeit mit den Geflüchteten allerdings erst im Laufe des Projektes entwickelt. Die Projektleiterinnen waren darauf eingestellt, dass Teilnehmer*innen aufgrund der Umstände und Unwägbarkeiten häufig nicht durchgehend am Projekt beteiligt sind. Dies ist allerdings nicht eingetreten, da das Projekt schnell von allen Teilnehmer*innen als fester Bestandteil ihres Lebens begriffen wurde. Anfängliche Unsicherheiten auf Seiten der Teilnehmer*innen (vor allem die Frage, was auf sie zukommen wird), aber auch auf Seiten der Projektleitung (»Gelingt es uns, Teilnehmer*innen für das Projekt zu gewinnen, die wirklich Lust darauf haben?«), verschwanden und es entwickelte sich ein sehr gutes und kontinuierliches Zusammenspiel im Team. Dazu trugen maßgeblich das große Engagement und die empathische Arbeitsweise der Helfer*innen, der Assistenz, der Übersetzer*innen und natürlich der Teilnehmer*innen bei.
Wie ist das Verhältnis von Ihrer Institution oder Ihrem Verein zu den Geflüchteten? Wie sehen Sie einander an? Was bringt das für Ihr Haus? Die Cammerspiele Leipzig sehen sich als Plattform und Möglichkeitsraum für Nachwuchskünstler*innen und innovative Projekte im Bereich Darstellende Kunst. Es war das erste Projekt, das in Zusammenarbeit mit Geflüchteten ent-
reisegruppe heim-weh! (2014/15), Leipzig
stand. Insbesondere für die Teilnehmer*innen des Projektes waren das Kennenlernen aller Beteiligten der Produktion und die Vernetzung auch über das Projekt hinaus wichtig. Auch war der Ort an sich sehr bedeutsam als feste Anlaufstelle, um etwas außerhalb des Heimes und des »Alltags« zu tun. Von Seiten des Theaters waren die Teilnehmer*innen des Projektes in erster Linie Mitwirkende einer Theaterperformance, unabhängig von ihrer Herkunft. Zu der Zeit, als die Performance geplant und durchgeführt wurde, wurde die Frage, was das dem Haus bringt, nicht gestellt. Es ging in erster Linie um das Anliegen des Projektes an sich. Um langfristig oder dauerhaft Theaterprojekte mit Geflüchteten anbieten zu können, müsste jedoch eine feste Personalstruktur aufgebaut werden, da dies einen erhöhten Betreuungsbedarf verursacht.
Was würden Sie Kolleg*innen rückblickend raten, die ein Kulturprojekt mit Geflüchteten beginnen wollen? Es geht darum, die Geflüchteten vordergründig als einzelne Menschen zu sehen und nicht als Teil einer Masse. Dabei sollte man sensibel für die Erlebnisse und die Geschichten von Menschen sein, die ihre Heimat verlassen mussten, aber niemanden als Opfer stilisieren oder auf einen Teil der Lebensgeschichte reduzieren. Das Vorhaben sollte gemeinsam mit den teilnehmenden Menschen realisiert werden. Zudem ist es sehr hilfreich, mit Menschen, Institutionen, Initiativen und Vereinen zu arbeiten, die durch ihre tägliche (und oft langjährige) Arbeit Erfahrung mit der Materie haben und die nötigen Kompetenzen mitbringen. Als wichtig haben wir in diesem Zusammenhang auch die Zusammenarbeit mit Kulturmittler*innen und Übersetzer*innen angesehen.
Kontakt: Cammerspiele in der Kulturfabrik Leipzig Kochstraße 132 04277 Leipzig Geschäftsführung: Sophie Renz [email protected] Tel.: 0049 (0)341 3067606 www.cammerspiele.de | www.kulturfabrik-leipzig.de www.facebook.com/CammerspieleLeipzig
407
»Stadt-Spaziergang«, Ludwigshafen
Was war oder ist das Ziel des Projektes? Das Projekt »Stadt-Spaziergang« will geflohene Menschen beim Ankommen in der deutschen Gesellschaft unterstützten. Bei begleiteten Spaziergängen und Besuchen von Bibliotheken, Museen, Konzerthäusern, Kirchen u.a. werden sie mit der sozialen, politischen und gesellschaftlichen Verfasstheit Deutschlands vertraut. Die »Stadt-Spaziergänge« werden von einer (ehrenamtlichen) Koordinationsstelle in Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kommunalpolitischen Partnern vorbereitet. An jedem Spaziergang nehmen bis zu 15 Flüchtlinge und zwischen zwei und zehn ehrenamtliche Begleiter_innen teil.
Haben sich Ihre ursprünglichen Planungen und Fragestellungen im Verlauf des Projekts verändert? Wenn ja – inwiefern? In einer (offenen) Organisationsgruppe aus Begleiter_innen und Flüchtlingen werden die Spaziergänge bei regelmäßigen Jours fixes vorbereitet und das Konzept ständig weiter entwickelt und versucht, den Bedürfnissen anzupassen. U.a. haben wir begonnen, regelmäßig Schulen zu besuchen.
Wie ist das Verhältnis von Ihrer Institution oder Ihrem Verein zu den Geflüchteten? Wie sehen Sie einander an? Was bringt das für Ihr Haus? Als Kulturverein haben wir und auch die anderen teilnehmenden ehrenamtlichen Engagierten viel Freude an den Stadt-Spaziergängen. Auch die Einheimischen entdecken Neues in der Stadt!
Was würden Sie Kolleg _innen rückblickend raten, die ein Kulturprojekt mit Geflüchteten beginnen wollen? Unbedingt nicht für, sondern mit den Geflüchteten planen. Achtsam sein, bereit sein, zu lernen. Ansonsten: Ehrenamt braucht Hauptamt – das stellen wir auch bei diesem Projekt fest!
»Stadt-Spaziergang«, Ludwigshafen Kontakt: Kultur-Rhein-Neckar e.V. www.KulturRheinNeckar.de https://stadt-spaziergang.de/ Tel.: 0049 (0)621 5296602 mobil: 0049 (0)151 59178838 [email protected]
409
Völkerwanderung Ein lebendiges Archiv für Geschichten von Kommen, Gehen und Bleiben, Freiburg
Was war das Ziel des Projekts? Die Weltgeschichte ist eine Geschichte von Ein- und Auswanderungen, von Flucht, Krieg, Auf bruch, Sehnsucht und Ankunft. Anknüpfend an das Theaterprojekt »Wir sind Deutschland« vom Sommer 2013 im Flüchtlingswohnheim im Stadtteil Littenweiler stellte sich das Theaterkollektiv Turbo Pascal, der Verein Element 3 und das Theater Freiburg die Frage, wie Stadtteilgeschichte als kollektive Migrationsgeschichte erzählt werden kann. Das Flüchtlingswohnheim befindet sich seit 1996 in dem gutbürgerlichen Stadtteil mit 7800 Einwohnern, es liegt abgegrenzt hinter einer Autobahntrasse. Auf der anderen Seite sind Einfamilienhäuser und ein Seniorenwohnheim. Der Begriff Migration mit der Folge der Integration wird meist als Problem diskutiert: Angst vor Überfremdung, religiösen und sozialpolitischen Konflikten, Verlust des Wohlstandes, Sicherheitsverlust. Dabei hat beispielsweise in Freiburg jede*r vierte Bürger*in einen migrantischen Bezug. Menschen sind aus unterschiedlichsten Gründen im Laufe ihres Lebens in Bewegung. Unser Ziel war es daher, über Migration als Verbindendes und nicht als etwas Trennendes zu sprechen. Migration als etwas zu begreifen, das immer stattfindet, das als soziales und kulturelles Potential gesehen und aus vielen Blickwinkeln erzählt werden kann. Daraus gründete sich ein Littenweiler Archiv für Geschichten vom Kommen, Gehen und Bleiben, in das potentiell jede und jeder aus dem Stadtteil eine Geschichte, ein biografisches Fragment einspeisen kann. Der Migrationshintergrund Littenweilers, die Migrationsgeschichten möglichst vieler Bewohner*innen wurden recherchiert und neu zusammengesetzt.
Haben sich Ihre ursprünglichen Planungen und Fragestellungen im Verlauf des Projektes verändert? Es war klar, dass wir uns als Initiator*innen für dieses Vorhaben selbst in Bewegung setzen müssen, dass wir eine ›mobile Sammelstrategie‹ brauchen. Wir haben ab März 2015 mehrere Wochen ein mobiles Archiv in Form eines Holzplan-
Völker wanderung
wagens durch den Stadtteil gezogen und an unterschiedlichen Plätzen Station gemacht: in Seniorenwohnheimen, im Sprachenkolleg der Universität, in einer internationalen Hauptschule, auf dem Bauernmarkt, im Flüchtlingswohnheim, vor dem Bahnhof etc. Vor Ort waren Interessierte eingeladen, Geschichten in einen von zwölf Ordnern des Archivs einzuspeisen: zum Beispiel den »Ordner für Auf bruchsstimmungen und Fluchtmotive«, den »Ordner für enttäuschte Erwartungen« oder den »Ordner für Neuanfänge«. So sammelten wir über 150 biografische Fragmente (in einer Textfassung von 140 Seiten), in den Ordnern vermischten sich Migrationsgeschichten aus unterschiedlichen Perspektiven. Gleichzeitig waren alle Interessierten eingeladen, ›Datenträger*innen‹ des Archivs zu werden: Das heißt, die Verantwortung für eine fremde Geschichte aus dem Archiv zu übernehmen, sie zu ›speichern‹ und weiterzuerzählen. Über dieses Tauschprinzip wurden die Geschichten mündlich in 1:1 Situationen an Besucher*innen weitererzählt. Dabei entstand eine hohe Komplexität: In wie vielen Sprachen spricht das Archiv? Wer kann und will überhaupt wessen Geschichte übernehmen? Wie kann ein Deutscher die Geschichte eines Kosovo-Albaners wiedergeben? Wie jemand aus Ghana die Geschichte eines Afghanen? Es entstand nach und nach ein Pool aus 70 ›Datenträger*innen‹. Trotz immenser organisatorischen Planungen, der Suche nach Übersetzer*innen, immer wieder neuen Fragen nach Verantwortlichkeiten auch jenseits des künstlerischen Prozesses, Missverständnissen über Theaterbegriffe etc. fanden schließlich beeindruckende Präsentationen im Foyer des Theaters Freiburg und Aufführungen rund um das Flüchtlingswohnheim statt.
Wie ist das Verhältnis von Ihrer Institution oder Ihrem Verein zu den Geflüchteten? Wie sehen Sie einander an? Was bringt das für Ihr Haus? Element 3 leistet seit dem Jahr 2000 Kulturarbeit mit Menschen unterschiedlicher Herkunftskulturen, auch mit geflüchteten Menschen. Im Mittelpunkt der Arbeit stehen Kreativität, Neugierde auf Unbekanntes sowie das kulturelle und gesellschaftliche Miteinander. Turbo Pascal ist ein Berliner Performancekollektiv, das bereits zwei Jahre im Rahmen der Doppelpass-Förderung-KSB am Theater Freiburg gearbeitet hat. Durch die Einbettung des Vereins Element 3 in den Stadtteil sowie die kontinuierliche Stadtteilarbeit ist dieses Projekt möglich gewesen. Was Turbo Pascal eingebracht hat, ist das inhaltliche Interesse an kollektiven Fragestellungen und der Erfahrung im Gestalten von kollektiven Prozessen und interaktiven Aufführungsformaten.
411
412
Projektsteckbriefe
Was würden Sie Kolleg*innen rückblickend raten, die ein Kulturprojekt mit Geflüchteten beginnen wollen? Fragen an die Geflüchteten, ob und in welcher Form sie eingebunden werden wollen. Geflüchtete sind in erster Linie Menschen mit verschiedenen Identitäten, sie stammen aus unterschiedlichen Herkunftskulturen: Bildung, Armut, Religion, politische Einflussnahme bilden unterschiedliche Kulturhintergründe und Ausdrucksweisen aus. Entscheidend sind auf jeden Fall der Stellenwert und das Selbstverständnis ihrer Kultur, die sie geprägt hat. Dies beeinflusst das jeweilige kulturelle Projekt. Wichtig ist, Fragen nach Projekthaftigkeit und Nachhaltigkeit zu stellen. In Projekten mit Geflüchteten ist es erforderlich, sich diese Frage früh zu stellen, sich zu positionieren und dies eindeutig zu kommunizieren: Verantwortung, Formen der Begleitung, Hilfe, Freundschaft oder politisches Engagement entstehen dann aus persönlichen Verbindungen – ein Geben und Nehmen – der beteiligten Menschen.
Das Projekt: Stadtteilprojekt in Freiburg-Littenweiler im Breisgau von Element 3 und Turbo Pascal in Kooperation mit dem Theater Freiburg Konzeption, Recherche, Regie: Kathrin Feldhaus, Frank Oberhäußer, Eva Plischke, Margarethe Mehring-Fuchs, Veit Merkle, Tobias Gralke Ausstattung: Nina Hofmann Komposition und Live-Musik: Friedrich Greiling und Ro Kuijpers mit dem Heim und Flucht Orchester Teilnehmer*innen: 75 Bürger*innen aus dem Stadtteil (international, alteingesessene, zugezogene, geflohene verschiedener Generationen) und 25 Musiker*innen vom Musikverein Littenweiler sowie 50 Bewohner*innen aus dem Flüchtlingswohnheim mit ihren Kindern
Kontakt: Element 3 www.element3.de Margarethe Mehring-Fuchs Tel.: 0049 (0) 761 6966755 mobil: 0049 (0)179 4612716 [email protected]
»Zugvögel«, Heinersdorf (Brandenburg)
Was war oder ist das Ziel des Projektes? Der Workshop »Zugvögel« fand im ländlichen Brandenburg im Dorf Heinersdorf (ca. 870 Einwohner, ca. 130 Geflüchtete) im Oktober 2015 statt. Wir wollten den Kindern aus Syrien, Afghanistan und Albanien, die seit Anfang September im Dorf lebten, zusammen mit ortsansässigen deutschen Kindern eine gemeinsame, kreative ›Spielwiese‹ jenseits von Sprachbarrieren öffnen. Die Kinder probierten zunächst ihre Ausdrucksmöglichkeiten in kinästhetischen und akustischen Übungen. Dann wurde ein Dorfspaziergang gemacht, bei dem auf Klänge und Geräusche von Tieren, Menschen und Maschinen gehorcht wurde. Der Klangkünstler Knut Remond zeichnete alles auf. Anschließend haben die Kinder aus der Erinnerung Sound Maps des Ortes aufgezeichnet. Am zweiten Tag kamen die Eltern der Kinder dazu, gemeinsam wurden wieder spielerische Übungen ›zum Aufwärmen‹ gemacht. Dann wurden in den verschiedenen Sprachen Geschichten und Lieder vorgetragen und gleichfalls aufgezeichnet. Kinder und Eltern erlebten das Zusammensein fröhlich und entspannt. Es entstand eine Atmosphäre der Offenheit füreinander und wir spürten, wieviel uns jenseits der sprachlichen Verschiedenheit verbindet, und wie ähnlich wir uns im Grunde sind, wenn wir aufhören, uns aufs Nichtverstehen von Sprache einzuschießen. Der gemeinsam erlebte ›Ausflug‹ in den eignen Ausdruck vermittelte den Wert und praktizierte die Wertschätzung der kulturellen Vielfalt. All diese Klänge wurden später vom Klangkünstler collagiert und zusammen mit Fotos der Aktion in Heinersdorf und in einer Berliner Klanggalerie präsentiert.
Haben sich Ihre ursprünglichen Planungen und Fragestellungen im Verlauf des Projekts verändert? Wenn ja – inwiefern? Eigentlich nicht. Allerdings mussten wir zur Ankündigung der Aktion in der Flüchtlingsunterkunft (in einer Art Performance des Workshopleiters Dionysis Anemogiannis und seiner Assistentin Mareile Keßler bei einem Sprachkurs) quasi illegal intervenieren, denn es hätte langwieriger Voranmeldung und Genehmigung bedurft, um dort Verbindung zu den Bewohnern aufzunehmen.
414
Projektsteckbriefe
Wie ist das Verhältnis von Ihrer Institution oder Ihrem Verein zu den Geflüchteten? Wie sehen Sie einander an? Was bringt das für Ihr Haus? In unserem Projekt »landkunstleben« treffen seit jeher unterschiedlichste Menschen aufeinander und arbeiten und gestalten miteinander. Jeder ist aufgefordert, sich mit dem, was sie/er kann, weiß und will, einzubringen. Wir haben erlebt, dass Geflüchtete gerne mittun, weil unser Projekt einen Raum bietet, miteinander etwas zu entwickeln, zu schaffen und auch zu genießen. Wir sehen das als eine Art von Arbeit an der Gestaltung von Wirklichkeit. Hier auf dem Dorf ist die Situiertheit der Geflüchteten ›am Rand‹ deutlich wahrnehmbar. Von dort holen wir sie hinein in unseren kulturellen Arbeitszusammenhang. Wir beziehen uns aufeinander durch den Beitrag, den jeder einbringt, und da schwinden dann Barrieren. Wenn das Zusammen-Tun gelingt, wächst auch die Akzeptanz von Außen. Denn es gibt hier in den Dörfern den Geflüchteten gegenüber noch viel Misstrauen und Ablehnung. Solche Haltungen sind uns als ›Machern‹ eines kulturellen Projekts auf einem Dorf im östlichen Brandenburg nicht fremd. Erst der längerfristige und beständige Einsatz ließ die Vorbehalte schwinden. Teil zu werden, ohne sich selbst fremd zu werden: Das sollte auch für die Geflüchteten möglich sein.
Was würden Sie Kolleg _innen rückblickend raten, die ein Kulturprojekt mit Geflüchteten beginnen wollen? Ich denke, es braucht einiges Feingefühl, um vernünftig miteinander umzugehen. Wir sollten versuchen, einander als Individuen zu begegnen. Die Geflüchteten sind viele, ganz verschiedene Einzelne, ganz unterschiedliche Familien, mit verschiedenen Lebensweisen und -zielen. Ein Kulturprojekt kann sich so formieren, dass es Aufgaben, Rollen und Freiräume bietet für den komplizierten Übergangsprozess, als Geflüchteter hier kurz- oder längerfristig ein Zuhause zu finden.
Kontakt: Kunstverein landkunstleben e.V. Christine Hoffmann Steinhöfeler Str. 22 15518 Buchholz (Brandenburg) Tel.: 0049 (0)33636 27015 mobil: 0049 (0)173 234 381 8 [email protected]
Materialien — Materials
Materialien: Positionen, Tipps und Links Materials: Positions, Tipps and Links Caroline Gritschke und Maren Ziese Die folgenden Dokumente und kommentierten Links erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es handelt sich auch nicht um Schlüsseldokumente, sondern wir haben Materialien ausgewählt, die uns bei unserer Arbeit in der Kulturvermittlung geholfen oder die unsere Autor_innen für nützlich befunden haben.
1. Haltung – Stance 1.1 Die australische Flüchtlingsselbstorganisation »RISE. Refugees, Survivors and Ex-Detainees« mit ihrer künstlerischen Leiterin Tania Canas hat im Oktober 2015 zehn Punkte aufgelistet, die Künstler_innen und Kulturschaffende beachten sollten, wenn sie Projekte mit Geflüchtete machen wollen: http://riserefugee.org/10things-you-need-to-consider-if-you-are-an-artist-not-of-the-refugee-and-asylumseeker-community-looking-to-work-with-our-community/ 10 things you need to consider if you are an artist – not of the refugee and asylum seeker community – looking to work with our community There has been a huge influx of artists approaching us in order to find participants for their next project. The artist often claims to want to show ›the human side of the story‹ through a false sense of neutrality and limited understanding of their own bias, privilege and frameworks. 1. Process not product We are not a resource to feed into your next artistic project. You may be talented at your particular craft but do not assume that this automatically translates to an ethical, responsible and self-determining process. Understand community cultural development methodology but also understand that it is not a full-proof methodology. Who and what institutions are benefiting from the exchange? 2. Critically interrogate your intention Our struggle is not an opportunity, or our bodies’ a currency, by which to build your career. Rather than merely focusing on the ›other‹ (›where do I find refugees‹ etc) subject your own
418
Caroline Gritschke und Maren Ziese intention to critical, reflexive analysis. What is your motivation to work with this particular subject matter? Why at this particular time? 3. Realise your own privilege What biases and intentions, even if you consider these ›good‹ intentions, do you carry with you? What social positionality (and power) do you bring to the space? Know how much space you take up. Know when to step back. 4. Participation is not always progressive or empowering Your project may have elements of participation but know how this can just as easily be limiting, tokenistic and condescending. Your demands on our community sharing our stories may be just as easily disempowering. What frameworks have you already imposed on participation? What power dynamics are you reinforcing with such a framework? What relationships are you creating (e.g. informant vs expert, enunciated vs enunciator) 5. Presentation vs representation Know the difference! 6. It is not a safe-space just because you say it is This requires long term grass-roots work, solidarity and commitment. 7. Do not expect us to be grateful We are not your next interesting arts project. Our community are not sitting waiting for our struggle to be acknowledged by your individual consciousness nor highlighted through your art practice. 8. Do not reduce us to an issue We are whole humans with various experiences, knowledge and skills. We can speak on many things; do not reduce us to one narrative. 9. Do your research Know the solidarity work already being done. Know the nuanced differences between organisations and projects. Just because we may work with the same community doesn’t mean we work in the same way. 10. Art is not neutral Our community has been politicised and any art work done with/by us is inherently political. If you wish to build with our community know that your artistic practice cannot be neutral.
1.2 Zu Selbstorganisation, Sichtbarsein und Teilhabe von Geflüchteten hat der tamilische Aktivist Sinthujan Varatharajah am 3. Juni.2016 anlässlich des Festivals »Refugees in Art and Education« in Berlin gesprochen: »Selbstorganisation
Materialien: Positionen, Tipps und Links
– what’s up with that?« http://interventionen-berlin.de/wp-content/uploads/DE_ Selbstorganisation-whats-up-with-that-2.pdf
1.3 Pädagog_innen, Sozialarbeiter_innen und andere Expert_innen aus dem Bildungsbereich haben im Herbst 2015 einen Aufruf »für solidarische Bildung in der globalen Migrationsgesellschaft gestartet, in dem sie sich für die Bildungsteilhabe von Geflüchteten einsetzen und globale Perspektiven in der Bildungsarbeit einfordern: www.aufruf-fuer-solidarische-bildung.de/
2. Diversität, Antirassismus-Arbeit und Interkulturelle Öffnung – Diversity, Anti-Racism Work and Intercultural Opening 2.1 Die Antonio Amadeu Stiftung und das Deutsche Kinderhilfswerk haben praktische Handlungsempfehlungen für eine nachhaltige Willkommenskultur in Jugendhilfeeinrichtungen erarbeitet, die auch Antirassismusarbeit mit bedenkt: www.amadeu-antonio-stiftung.de/w/files/juan/15-punkte-plan_web.pdf 2.2 Mit einer Intervention auf einer Kultur-Tagung machte das »Bündnis kritischer Kulturpraktiker_innen«, ein Zusammenschluss von zumeist von Diskriminierung(en) betroffenen Kulturschaffenden, den Ausschluss von Menschen und ihren Erfahrungen und Perspektiven sichtbar. Mit weiteren Partner_innen veranstaltete die Gruppe, die sich vor allem mit Rassismus im Kulturbereich beschäftigt, eine eigene Tagung: »Vernetzt Euch!« Zum Ablauf der Konferenz, die mit partizipativen Methoden arbeitete, gibt es eine Video-Dokumentation: www.vernetzt-euch.org/doku/video/ Die Konferenz erarbeitete ausgehend von fünf Leitfragen »Strategien für eine kritische Kulturpraxis«, die Themenfelder identifizierte und konkrete vernetzte Handlungsstrategien entwickelte. Die in der Dokumentation enthaltene Karte zeigt Vernetzungslinien auf, ist aber in der Bildschirmdarstellung schwer zu lesen: www.vernetzt-euch.org/wp-content/uploads/2016/02/Vernetzt-euch_doku_ bildschirm.pdf Daher seien die Vernetzungsvorschläge hier als nicht-hierarchische Auflistung wiedergegeben: Themenfelder: Netzwerke bilden; Ausbildung; unabhängige nachhaltige Kulturarbeit; Strukturen verändern; verantwortungsvolle Kulturarbeit/Solidarität
Strategien Selbstrepräsentation statt Paternalismus Nichts über uns ohne uns! Nutzt eure Privilegien um eure Ressourcen und Zugänge mit anderen zu teilen, die darüber sonst nicht verfügen. Von Ausschlüssen Betroffene sollten
419
420
Caroline Gritschke und Maren Ziese Raum bekommen, um ihre Perspektiven sichtund hörbar zu machen. Betroffene sollten von Anfang an als Expert_innen in die Konzeption von Veranstaltungen eingebunden sein (idealerweise vergütet). Zusammen arbeiten, nicht aneinander vorbei Wer beschäftigt sich jetzt gerade mit ähnlichen Ansätzen? An welchen Punkten können wir zusammen arbeiten? Respektiert die Arbeit von anderen: überlegt, wie sich eure Handlungen auf deren Arbeit auswirken. Widerständige, interaktive Wissensarchive aufbauen Eigene Erfahrungen aus Projekten dokumentieren und Zugänge dazu schaffen, damit andere darauf aufbauen können. Auf andere kritische Projekte verweisen, um Sichtbarkeit und alternative Referenzrahmen zu erzeugen. Eigene Arbeit als Quelle von Stärke und Energie nutzen Achtet darauf, dass ihr Spaß habt, an dem was ihr macht und darauf, dass es euch und den anderen in der Gruppe gut geht. Lasst euch von Rückschlägen nicht entmutigen. Unterstützt euch gegenseitig. Habt auch mal den Mut, ein Projekt zu beenden, wenn ihr merkt, dass es sich zu weit von dem entfernt hat, was ihr euch wünscht. Krisen meistern, dazulernen Notfallpläne: wer kann helfen, wenn das Projekt zu scheitern droht? Plan B für die Finanzierung entwerfen. Was tun, wenn die Gruppe sich nicht versteht? Wer kann vermitteln, ist eine Mediation möglich von einer Person, der alle vertrauen? Holt euch Hilfe, ihr müsst das nicht alleine schaffen. Kritik im Team mit Bedacht üben Bleibt konstruktiv. Individualisierte Anschuldigungen spielen diskriminierenden Strukturen zu. Sich dessen bewusst sein, dass manchmal auch Menschen innerhalb privilegierender Strukturen Formen von Ausgrenzung erfahren. Einzelne im Kollektiv wahrnehmen Individuen in der Gruppe haben möglicherweise unterschiedliche Bedürfnisse. Arbeitsprozesse erfordern individuelles Coaching (Begleitung, Mentor_innenschaft) und anderweitige Unterstützung (z.B. finanzielle, materielle, praktische) von Einzelnen. Geld ist nicht alles Denkt über alternative Methoden und Ökonomien (Tauschbörsen, Crowdfunding) nach, um euer Projekt zu finanzieren/verwirklichen. Sucht euch Beratung um eine Finanzierung zu bekommen. Welches Thema behandelt ihr in eurem Projekt und welche Finanzierungsmöglichkeiten stehen damit in Verbindung, an die ihr vielleicht bisher nicht gedacht habt?
Materialien: Positionen, Tipps und Links Erfahrungswissen als Expertise wertschätzen Alltagserfahrungen, sowohl emotional als auch körperlich, bilden die Grundlage von Machtkritik und Widerstand. Erfahrungswissen ist die Basis von akademischem Wissen, nicht umgekehrt. Gleichberechtigte Arbeitsstrukturen schaffen Machtstrukturen in der Gruppe erkennen. Immer wieder selbstkritisch überprüfen, ob sich Hierarchien untereinander gebildet haben und was das bewirkt. Entscheidungen transparent machen: Wer trifft welche Entscheidungen und warum? Offen über Geld sprechen: Gibt es Geld? Wieviel? Wofür? Wer wird für was wie bezahlt? Empowerment-Werkzeugkisten zusammenstellen Bündelt Methoden und Strategien, die gut funktioniert haben, und teilt sie mit anderen (z.B. bezüglich Projektförderung, Zeitmanagement, Gruppenarbeit, Arbeit mit Institutionen) Das Rad nicht neu erfinden Informiert euch, wer zu eurem Thema bereits länger arbeitet/gearbeitet hat. Nutzt vorhandenes Wissen, recherchiert historische Hintergründe der Prozesse, die ihr kritisiert, und der emanzipatorischen Kämpfe, die es schon gab. Benennt eure Quellen! Selbstorganisation und Repräsentation in etablierten Institutionen Seid selbstbewusst gegenüber Institutionen! Überlegt euch, warum ihr gerade mit dieser Institution zusammenarbeiten wollt. Habt ihr inhaltliche und politische Überschneidungspunkte zu eurem Thema, oder liegen die Einstellungen zu weit auseinander? Wie könnt ihr auf Augenhöhe mit der Institution arbeiten und die Entscheidungshoheit über euer Projekt behalten? Vereinbart eventuell eine dritte Stelle (Beirat, Berater_innen, die als Instanz wahrgenommen werden), die bei inhaltlichen Schwierigkeiten vermitteln kann und euch unterstützt. Befragt eure Motivation Warum möchte ich zu diesem Thema arbeiten? Wem nützt mein Engagement? Welche Fähigkeiten besitze ich und wie kann ich diese sinnvoll einbringen? Was kann ich nicht leisten? Nehmt euch Zeit für die Konzeption Findet eine gute Methode, um euer Problemfeld einzugrenzen, was ist euch als Gruppe wichtig? Holt euch Feedback von Leuten, die schon länger zu dem Thema arbeiten (möglichst Selbstorganisationen). Plant genug Zeit ein, um Kritik und Veränderungsvorschläge einzubauen. Schafft Zugänge, beseitigt Barrieren Sucht von Anfang an das Gespräch mit anderen Gruppen die zu verschiedenen Diskriminierungsformen arbeiten, um eventuelle Ausschlüsse rechtzeitig zu erkennen. Barrieren
421
422
Caroline Gritschke und Maren Ziese nachträglich zu reduzieren ist schwierig. Plant zusätzliche (finanzielle) Ressourcen dafür ein. Entlohnt Leute angemessen für ihre Beratung. Vielleicht könnt ihr nicht alle Barrieren vollständig beseitigen. Trotzdem ist es gut, mit dem Anspruch zu arbeiten, dies aber so weit wie möglich zu tun. Orientiert euch an ähnlichen Projekten, die (kreative) Lösungen gefunden haben. Bildet euch anhaltend und gründlich fort Die Auseinandersetzung mit Machtkritik erfordert ein fortwährendes Lernen. Lernt von betroffenen Communities über die jeweiligen Ausschlüsse. Fangt in eurem Alltag an Welche lokalen Kämpfe werden in eurem Umfeld geführt und wie könnt ihr euch dort einbringen? Wie könnt ihr eure Kulturarbeit sinnvoll mit diesen Kämpfen verknüpfen und sie für Betroffene zugänglich machen? Welchen Nutzen hat eure Arbeit für die Betroffenen? Stimmt mit ihnen ab, welche Ideen und Themen für sie Sinn machen. Die Form dem Inhalt anpassen Welche Form eignet sich (nicht) für eure Themen? Welche Mittel sind für euren Zweck die richtigen und welche nicht? Gilt es vielleicht, etwas ganz Neues auszuprobieren, eine eigene Form zu finden? Flexibel bleiben, Feedback umsetzen Seid offen für Kritik! Geht von Anfang an mit Expert_innen ins Gespräch. Geht nicht davon aus, dass ihr schon alles wisst. Nutzt konstruktive Kritik um etwas zu lernen und euer Projekt zu verbessern. Verwendet verständliche Sprache Findet eine Sprache, die für möglichst viele Menschen gut zu verstehen ist (oder mehrere Sprachen). Vermeidet akademische Sprache, Fremdwörter und zu komplizierte Sätze. Fragt euch immer: können wir es noch einfacher erklären? Oft macht es Sinn, Übersetzung(en) zu organisieren in verschiedene Sprachen: Gebärdensprache, Englisch, Arabisch etc.
2.3 Im Projekt »Berlin Mondiale« werden Projektpartnerschaften zwischen Kulturinstitutionen und Unterkünften für Geflüchtete gebildet. Am Ende der Evaluierung des ersten Projektabschnitts von Azadeh Sharifi wurden 10 Empfehlungen formuliert, die sich aus der Praxiserfahrung ergeben. Die Empfehlungen sind auch hilfreich für Kulturprojekte, die nicht mit einem Tandem-Ansatz arbeiten: www.kubinaut.de/media/downloads/berlin_mondiale_evaluation_public.pdf
Zehn Empfehlungen 1. Es wird empfohlen, dass die Einbindung von Geflüchteten und Asylsuchenden in die Steuerungsgruppe sowie die Projektleitung stärker forciert wird. Es ist wichtig, dass bei der
Materialien: Positionen, Tipps und Links Steuerung, der Konzeption und Organisationsgestaltung die Perspektiven und Positionen der Menschen, um die es gehen soll, involviert sind. 2. Es wird empfohlen, dass mehr Künstler*innen mit eigenen Flucht- und Asylerfahrungen in das Projekt eingebunden werden. Denn in den meisten Projekten sind die Organisator*innen in erster Linie weiße Künstler*innen und weiße Mitarbeiter*innen von Kulturinstitutionen. Es fehlen also die Geflüchteten und Asylsuchenden bzw. Menschen mit eigenen Erfahrungen von Flucht und Asyl, aber auch People of Color und Künstler*innen of Color als gestaltender Teil des Projektes. Dies ist manchmal als fehlende Perspektive in der Organisation und damit Sensibilisierung in der Umsetzung sichtbar und spürbar. 3. Es wird empfohlen, dass die erwachsenen Geflüchteten und Asylsuchenden aus den Unterkünften stärker in die Projekte eingebunden werden. Denn diese können als Vermittler*innen zu anderen Bewohner*innen hilfreich sein. Sie können aber auch die Dichotomie zwischen den als Geflüchtete und Asylsuchende Gelabelten und den Künstler*innen aufbrechen. 4. Es wird empfohlen, dass die beteiligen Geflüchteten und Asylsuchenden von Anfang an in die künstlerischen Überlegungen der Projekte involviert sind, um die Gewährleistung von Augenhöhe, d.h. die Zusammenarbeit als das gemeinsame Gestalten von künstlerischen Räumen – die in mehrerer Hinsicht eine Herausforderung ist – bewerkstelligen zu können. Generell muss die Trennung zwischen Geflüchteten und Künstler*innen viel stärker thematisiert werden, weil ein ungewolltes Machtgefälle entsteht, in dem die Menschen, um die es eigentlich gehen soll, nicht in die Organisation und Gestaltung der Projekte involviert sind. 5. Es wird empfohlen, dass auch die Geflüchteten und Asylsuchenden für ihre Mitarbeit und Zusammenarbeit honoriert werden. Wer wie bezahlt wird, ist eine zentrale Frage, denn darin perpetuiert sich auch das Asylregime mit seinen hegemonialen und postkolonialen Bedingungen. Dieser ökonomische Aspekt ist gravierender, als es aus dem Wunsch etwas Gutes zu tun heraus erscheinen mag. In den meisten Projekten werden die Menschen gar nicht honoriert. Es besteht die anscheinend nicht überwindbare Vorstellung, dass den Menschen durch die reine Zeit und künstlerische Aufmerksamkeit, die ihnen gewidmet wird, genug Gutes getan werde. 6. Es wird empfohlen, dass die Kulturinstitutionen stärker eingebunden werden. Es besteht immer noch die Frage, inwieweit die Projekte es schaffen, das Thema Flucht und Asyl außerhalb einer puren Viktimisierung und Bagatellisierung in die Institutionen hereinzutragen. Eine stärkere Mitwirkung der Vertreter*innen/Leiter*innen der Institutionen würde eine nachhaltige Reflexion und eine Verankerung des künstlerischen und politischen Diskurses in den Strukturen – Personal, Programm und Publikum – mit sich führen. 7. Es wird empfohlen, dass auch (feste) Räumlichkeiten in den Kulturinstitutionen für die Zusammenarbeit geschaffen werden. Bei den einzelnen Projekten, in denen Räume in den
423
424
Caroline Gritschke und Maren Ziese Kulturinstitutionen für die gemeinsame Arbeit zur Verfügung gestellt wurden, konnte eine positive und nachhaltige Entwicklung gesehen werden. Die beteiligten Menschen, sowohl Kinder und Jugendliche als auch Erwachsene, haben die Kulturinstitution als tatsächlichen Ort und als Raum, an denen sie willkommen sind, angesehen. 8. Es wird empfohlen, dass das Asylsystem in den Strukturen der Projekte stärker reflektiert und mitgedacht wird. Die Lebensbedingungen der geflüchteten und asylsuchenden Menschen werden gänzlich durch das Asylregime bestimmt. Diese nicht nur anzuerkennen, sondern möglicherweise über die reine künstlerische Arbeit hinaus auch einzubeziehen bzw. aufzubrechen, ist für die Ermächtigung und Selbstermächtigung der Menschen wichtig. 9. Es wird empfohlen, dass mehr therapeutische Begleitung – unabhängig von den Sozialarbeiter*innen – vorhanden ist. Generell ist auch die Frage, inwieweit die Künstler*innen mit den traumatischen Erlebnissen, die Menschen während der Flucht und im Prozess des »Asylverfahrens« widerfahren sind, angemessen umgehen können. Hier wäre es sinnvoll, wenn Menschen mit therapeutischen Ausbildungen und Menschen, die lang jährige Erfahrung mit Geflüchteten und Asylsuchenden haben, dabei wären. Eine möglicherweise interdisziplinäre Perspektive ist auch für die künstlerische Arbeit hilfreich. 10. Es wird empfohlen, dass die künstlerischen Prozesse, das Austarieren und Aushandeln von Verwebungen und Verflechtungen kultureller Kontexte, als Ergebnisse der Projekte aufgefasst und stärker in den Mittelpunkt gestellt werden. In den Beobachtungen der Startphase der Berlin Mondiale war der Prozess nicht immer nur der Weg, sondern auch das Ziel. Es bedarf einer Anerkennung der Tatsache, dass die Diversität von künstlerischen Konzepten auch von den beteiligen Geflüchteten mitgebracht wird und diese im künstlerischen Arbeiten nicht immer zu einem gemeinsamen Ergebnis oder möglichen Vorgaben entsprechenden Resultaten führt.
2.4 Die AWO Berlin hat einen Fragebogen entwickelt als Einstieg in die interkulturelle Öffnung von Institutionen im Allgemeinen, die auch im Kontext von Flucht arbeiten, der sich auch für Kulturinstitutionen nutzen lässt (vgl. den Beitrag von Talibe Süzen in diesem Band).
Fragebogen für Einrichtungen zum Einstieg in den Prozess »Interkulturelle Öffnung« Dieser Fragebogen dient zur Bestandsaufnahme der interkulturellen Öffnung, der selbstverständlich ergänzt und erweitert werden könnte. Er ist nicht als Checkliste gedacht, die abgearbeitet werden soll, sondern als Such- und Strukturierungshilfe für das Team, um zu erfahren, welche Erfahrungen und Kenntnisse das Team mitbringt, die zur Umsetzung der interkulturellen Öffnung nützlich sein könnten. Für die gemeinsame Bestandsaufnahme können diese und auch andere (bspw. einrichtungsspezifische) Fragen diskutiert werden. Anschließend könnte das Team die nächsten Handlungsschritte zur Umsetzung der interkulturellen Öffnung festhalten.
Materialien: Positionen, Tipps und Links Angaben zur bisherigen Arbeit mit Familien mit Migrationshintergrund Wie hoch ist der Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund, die an den Angeboten/ Maßnahmen Ihrer Einrichtung partizipieren? (geschätzt in %) Welche Einwanderergruppen werden bisher hauptsächlich erreicht? Welche Einwanderergruppen werden bisher wenig erreicht, und warum? Wie hoch ist der Anteil der Hilfesuchenden, mit denen z.B. ein Beratungs-/Erstgespräch in deutscher Sprache nicht möglich ist? (geschätzt in %) Angaben zu Ihrer Einrichtung Ist die interkulturelle Öffnung im Leitbild oder in der Konzeption Ihrer Einrichtung/Organisation verankert? Wie ist derzeit die sprachliche Kommunikation mit nicht-deutschsprachigen Hilfesuchenden organisiert? (noch gar nicht/durch Begleitperson der Betroffene/zweisprachige pädagogische Mitarbeiter/-innen/sonstiges zweisprachiges Personal/Professionelle/r Dolmetscher/in/Migrationsfachdienst/sonstige) Gibt es in Ihrer Einrichtung Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Migrationsbiografie? a) im pädagogischen Team (geschätzt in %) b) ohne pädagogische Funktion (geschätzt in %) Welche Fremdsprachkompetenzen des Personals stehen im Bedarfsfall zur Verfügung? Gibt es Ihrer Meinung nach Zugangsbarrieren für Menschen mit Migrationsbiografie in Ihrer Einrichtung/Ihrem Dienst? (z.B. Kommunikationsprobleme, fehlende Informationen über das Hilfesystem, Vorbehalte/Ängste der Hilfesuchenden mit Fluchterfahrung/Migrationshintergrund gegenüber Institutionen/staatlichen Behörden/Jugendamt etc.) Wenn ja, welche? Wo besteht Ihrer Meinung nach Handlungsbedarf für die interkulturelle Öffnung in Ihrer Einrichtung/Ihrem Dienst? Angaben zur Vernetzung Existiert eine tragfähige Zusammenarbeit oder Kooperation mit Institutionen und/oder Fachkräften, die im Bedarfsfall hinzugezogen oder an die Hilfesuchenden weitergeleitet werden können? (z.B. Migrationsfachdienste, Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer, Jugendmigrationsdienst, Flüchtlingssozialarbeit, Selbsthilfegruppen, Migrantenorganisationen, Selbsthilfeinitiativen, Dolmetscherdienste etc.) Wenn ja, welche Kontakte bestehen derzeit? Für welche Bereiche besteht weiterer Kooperationsbedarf? Angaben zur Bedarfserhebung und Zielgruppenorientierung Wie hoch ist der Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund (Migranten/-innen, Flüchtlinge usw.) in der Region, der Kommune, im Sozialräumen, in denen Sie aktiv sind? (geschätzt in %)
425
426
Caroline Gritschke und Maren Ziese Angaben zur Umsetzung der Ziele Welche SMART-Ziele haben Sie zum Thema »Interkulturelle Öffnung Ihrer Einrichtung/Organisation« allgemein? Was sind unsere Ziele? Was sind dafür die nächsten Schritte – kurzfristig, mittelfristig, langfristig?
2.5 Ebenfalls von der AWO Berlin stammt die Zusammenstellung von Modulen für einen Fachtag zur Sensibilisierung von Haupt- und Ehrenamtlichen für die Lebenswirklichkeit von Menschen mit Fluchterfahrung. Module zur Durchführung von Fachtagen Das Format des Fachtags ist in vier verschiedene thematische Schwerpunkte gegliedert, die auch unabhängig voneinander umgesetzt werden können: • Baustein »Wissen über Herkunftsländer, Asylverfahren, Fluchtgründe und Grundlagen des Asylrechts und Schutzstatus erwerben«. • Baustein »Einblick in Lebenswelten und Fluchterfahrung bekommen«. • Baustein »Meinungen austauschen und AWO-Position kennenlernen«. • Baustein »Eigene Prägung und Vorurteilsstrukturen erkennen und gesellschaftliche Ausgrenzungsmechanismen thematisieren«. Jeder Baustein ist mit Inhalten und einer zeitlichen Empfehlung beschrieben. Die Bausteine sollen Anregungen für die inhaltliche Ausgestaltung geben und können an den jeweiligen Bedarf vor Ort angepasst werden. Baustein »Wissen« Zeitliche Empfehlung: 2 Stunden, Methoden: Vortrag und Diskussion Inhalte: • • • • • • •
Zur Situation in den (Haupt-)Herkunftsländern. Wege und Stationen der Flucht nach Deutschland. Sichere Herkunftsländer – Politische Dimension und Realität. Was passiert nach dem Ankommen in Deutschland? Wo melden sich Flüchtlinge, wo werden sie hingeschickt? Wo müssen sie wohnen? Was bekommen sie in dieser Zeit? Wie läuft das Verfahren zur Beantragung von Asyl? Wer macht was? Welche Bleibemöglichkeiten gibt es (Aufenthaltsgründe und Titel)? Welche Rechte und Pflichten haben Menschen, die geflüchtet sind: Wohnen, Arbeiten, Ausbildung, Sprachkurse, Integrationskurse, Beratung, Schule, Gesundheit etc. Gibt es gesetzliche Diskriminierung von geflüchteten Menschen? (Asylbewerberleistungsgesetz, Residenzpflicht etc.)
Baustein »Lebenswelten und Fluchterfahrung« Zeitliche Empfehlung: 2 Stunden, Methoden: Vortrag, Arbeitsgruppen, Diskussion Inhalte:
Materialien: Positionen, Tipps und Links • • • •
Was bedeutet Fluchterfahrung? Welche Erfahrungen haben insbesondere Kinder, Jugendliche und Frauen auf der Flucht? Wie sehen Lebensrealitäten von Menschen aus, die geflüchtet sind und hier ankommen? Was bedeutet »Trauma«? Wo gibt es professionelle Hilfe? Habe ich selbst Erfahrungen mit geflüchteten Menschen? Habe ich Interesse daran?
Baustein »Wie steht die AWO dazu?« Zeitliche Empfehlung 3 Stunden, Methoden: Vortrag, moderierte Arbeitsgruppen, Diskussion Inhalte: • • •
Vielfalt in der Gesellschaft – Was sollte dies nach Ansicht der AWO konkret bedeuten? Was bedeutet Religionsfreiheit? Was bedeutet Laizismus? Welche Haltung hat die AWO dazu? Was bedeutet Integration und Inklusion nach Ansicht der AWO?
Baustein »Eigene Prägung und Vorurteilsstrukturen erkennen und gesellschaftliche Ausgrenzungsmechanismen thematisieren« Zeitliche Empfehlung: 8 Stunden/Verteilung auf zwei halbe Tage möglich Methoden: Training mit Selbsterfahrungselementen, TN-Anzahl: begrenzt, höchstens 18 Inhalte: • • • • • •
Wie entstehen Werte und Normen? Worauf basieren unsere kulturellen Wertvorstellungen? Was sind die üblichen »Stammtischparolen« – wie kann darauf geantwortet werden? Welche Werte prägen mich und sind mir wichtig? Welche Vorurteile habe ich? Welche Kommunikationshemmnisse gibt es und worauf beruhen diese? Wie kann ich dem entgegenwirken? Wie kann Toleranz und Wertschätzung »gelebt« werden?
2.6 Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien hat an das Wiener Institut EDUCULT im März 2016 den Auftrag vergeben, systematische Handlungsempfehlungen für die »kulturelle Integration von geflüchteten Menschen« zu erarbeiten: http://educult.at/wp-content/uploads/2016/03/EDUCULT_ Ma%C3%9Fnahmen-zur-kult_Integr-von-gefl_Menschen_Vers-April16.pdf
3. Didaktische Materialien – Educational Materials Die didaktischen Materialien sind für die Arbeit mit Geflüchteten und für Menschen ohne Fluchterfahrung gedacht, die sich über das Thema Flucht informieren wollen.
427
428
Caroline Gritschke und Maren Ziese
3.1 Bücher – Books • »Bücher sagen Willkommen«: Die Initiative der Buchbranche hat Buchempfehlungen für Sprachlernende aller Altersgruppen herausgegeben: www.litcam.de/images/phocadownload/BsW_Empfehlungsliste_gesamt_ Juni30.pdf • Die »Stiftung Lesen« hat Buchempfehlungen für Leseaktionen mit geflüchteten Kindern zusammengestellt: https://www.stiftunglesen.de/download.php? type=documentpdf&id=1615 • Als Einstieg in die didaktische Arbeit zum Thema Flucht für Schulklassen und Jugendgruppen eignet sich besonders: Janne Teller, »Krieg: Stell dir vor, er wäre hier«, München: Carl Hanser Verlag 2011 • Zum Buch gibt es kostenloses Unterrichtsmaterial des dtv-Verlags: www.dtv.de/_pdf/lehrermodell/62557.pdf?download=true • Bücher für unterschiedliche Altersstufen zum Thema Flucht für Kinder und Jugendliche ohne Fluchthintergrund hat der Deutschlandfunk zusammengestellt: www.deutschlandfunk.de/fern-der-heimat-buecherliste-thema-flucht.1202. de.html?dram:article_id=325834 • Das Online-Magazin »Alliteratus« stellt unter dem Titel »Flucht und Vertreibung in der Kinder- und Jugendliteratur« eine ausführliche kommentierte Liste zum Thema Flucht zur Verfügung: www.alliteratus.com/pdf/gesch_flucht.pdf • Einen Überblick über die inzwischen zahlreichen Unterrichtsmaterialien zum Thema Flucht und Asyl gibt das Portal »Globales Lernen«: www.globaleslernen.de/de/aktuelles/fokus-flucht-und-asyl/materialien-undbildungsangebote • Multimediale didaktische Hilfen zum Thema Flucht und Asyl, Flüchtlinge schützen und statistisches Material zu Flucht und Geflüchteten weltweit bietet das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR): www.unhcr. de/service/bildungsmaterialien.html 3.2 Spiele – Games Die Akademie Remscheid hat Spiele für und mit Kindern vorgestellt, die mit wenig Sprache auskommen. Sie eignen sich für Kinder ab 8 Jahren ab einer Gruppengröße von 8 Kindern und können schnell und fast ohne Requisiten umgesetzt werden: www.spielmarkt.de/materialien/ 3.3 Video/Film • Einen Perspektivwechsel für die Arbeit mit Jugendlichen ohne Fluchterfahrung bietet Amnesty International mit dem Video-Clip »When you don’t exist«: https://www.youtube.com/watch?v=fUlskP1zDzg
Materialien: Positionen, Tipps und Links
• Das Goethe-Institut stellt mit »Cinemanya« Filmkoffer zur Verfügung. Die Filme sind für die medienpädagogische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen geeignet. Die deutschen Filme sind mit arabischen Untertiteln versehen oder arbeiten ohne Sprache. Der Koffer ist mit pädagogischem Begleitmaterial ausgestattet: https://www.goethe.de/de/uun/akt/20678932.html
4. Arbeit und Praktika – Work and Internships Die rechtlichen Bestimmungen für die Möglichkeiten, Geflüchtete in Kultureinrichtungen zu beschäftigen, ein Praktikum oder einen sozialen Freiwilligendienst anzubieten, ändern sich wegen der schnellen Abfolge der Änderungen der Asylgesetzgebung momentan häufig. Einige gesetzliche Regularien sind zudem regional oder lokal unterschiedlich bzw. werden verschieden ausgeführt. Daher geben die aufgeführten aus den ersten Monaten des Jahres 2016 stammenden Dokumente u.U. nicht in allen Details den aktuellen Stand wieder. Es empfiehlt sich in jedem Fall, Kontakt zur lokalen Ausländerbehörde und zur Agentur für Arbeit aufzunehmen.
4.1 Die Arbeitsagentur hat unter dem Titel »Potenziale nutzen – geflüchtete Menschen beschäftigen« die gesetzlichen Möglichkeiten einer Beschäftigung für Geflüchtete mit unterschiedlichen Aufenthaltstiteln zusammengefasst: https://www. arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/ mdu5/~edisp/l6019022dstbai771709.pdf?_ba.sid=L6019022DSTBAI771708 4.2 Auch zu den Regularien für Praktika informiert die Arbeitsagentur: https: //www.arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/md aw/mdqw/~edisp/l6019022dstbai772426.pdf ?_ba.sid=L6019022DSTBAI 772429 4.3 Ausgestattet mit Tipps und Hinweisen gibt der Caritas-Verband für die Diözese Osnabrück einen Leitfaden über Praktika und ähnliche Tätigkeiten für Asylbewerber_innen und Geduldete heraus: http://esf-netwin.de/medien/Arbeitshilfe%20Praktika.pdf 4.4 Bundesweit ist ein Sonderprogramm »Bundesfreiwilligendienst mit Flüchtlingsbezug« aufgelegt worden. Geflüchtete können an diesen Programmen teilnehmen, Menschen, die aus den sog. »sicheren Herkunftsstaaten« stammen, sind allerdings von dieser Arbeitsmöglichkeit ausgeschlossen: https://www.bun desfreiwilligendienst.de/fileadmin/de.bundesfreiwilligendienst/content.de/Ser vice/Downloads/Downloads2/Merkblatt_SK.pdf 4.5 Umfassend über Arbeits- und Aufenthaltsrecht informiert die vom »Informationsverbund Asyl&Migration« herausgegebene Handreichung »Die Rechte und
429
430
Caroline Gritschke und Maren Ziese
Pflichten von Asylsuchenden. Aufenthalt, soziale Rechte und Arbeitsmarktzugang während des Asylverfahrens« www.asyl.net/fileadmin/user_upload/redaktion/Dokumente/Publikationen/Basisinformationen/Basisinf_3_160415fin.pdf
4.6 Der »Informationsverbund Asyl & Migration« bietet zudem auch einen allgemeinverständlichen Überblick über das Asylverfahren: www.asyl.net/fileadmin/ user_upload/redaktion/Dokumente/Publikationen/Basisinformationen/Basisinf1.pdf … und viele Details zu einzelnen Fragen des Asyl-, Aufenthalts-, Arbeitsund Sozialrechts: www.asyl.net
5. Verständigung – Communication 5.1 Für einen achtsamen Sprachgebrauch zum Themenbereich Migration und Flucht plädieren die Neuen Deutschen Medienmacher e.V. und geben Formulierungshilfen in einer Handreichung: www.neuemedienmacher.de/download/ NdM_Glossar_www.pdf 5.2 Das AntiDiskriminierungsBüro (ADB) Köln des Vereins Öffentlichkeit gegen Gewalt e.V. hat unter dem Titel »Sprache schafft Wirklichkeit« einen Leitfaden zum rassismuskritischen Sprachgebrauch herausgegeben: www.adb-sachsen.de/ tl_files/adb/pdf/Leitfaden_ADB_Koeln_disfreie_Sprache.pdf 5.3 Für das Erlernen der deutschen Sprache im professionellen Rahmen hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge eine Liste der zugelassenen Lehrwerke für Integrationskurse veröffentlicht, darunter auch Lehrwerke für die Alphabetisierung: www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Integra tionskurse/Lehrkraefte/liste-zugelassener-lehrwerke.pdf?__blob=publicationFile 5.4 Ehrenamtliche Sprachlehrer_innen suchen häufig nach niederschwelligerem Material, das sie auch ohne didaktische und linguistische Kenntnisse nutzen können. Von Ehrenamtlichen entwickelt wurden Materialien nach dem Thannhauser Modell. Die Webseite enthält auch Materialien und Arbeitsblätter für den kostenlosen Download: www.deutschkurs-asylbewerber.de/tipps-und-downloads/ 5.5 Zum Selbstlernen gibt es zahlreiche kostenlose Deutschlern-Apps. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat eine App konzipiert, die nicht nur einen Selbstlernkurs enthält, sondern auch Informationen über das Asylverfahren, über den Bereich »Arbeit« und über »Ausbildung«. Die App »Ankommen« kann in den Sprachen Arabisch, Deutsch, Englisch, Französisch und Persisch/Farsi abgerufen werden: https://www.ankommenapp.de/ 5.6 Das Goethe-Institut hat ein kostenloses Deutsch-Lernspiel »Stadt der Wörter« entwickelt: https://www.goethe.de/de/spr/ueb/led.html
Materialien: Positionen, Tipps und Links
5.7 Als europaweites Konzept zum selbstständigen Erlernen von Sprachen für Geflüchtete ist die »hallo-App Europa« konzipiert. Eine Initiative von VISION EDUCATION: http://visioneducation.net/hallo-europa/ 5.8 Auf der Grundlage der Sprachen Arabisch, Persisch und Russisch hat die Pädagogische Hochschule Oberösterreich eine kostenlose Sprachlern-App bereit gestellt: www.link2brain.at/deutsch_fuer_fluechtlinge
6. Projekte: Übersichten und Datenbanken – Projects: Synopses and Databases 6.1 Die Internet-Plattform »Kultur öffnet Welten« bietet eine Vorstellung von Kulturprojekten mit, für und von Geflüchteten mit dem Ziel, Kultur für alle zugänglich zu machen. In Artikeln werden einige Projekte ausführlicher präsentiert. Unter der Rubrik »Programm« findet sich ein Veranstaltungskalender mit einem Zugang zu einer Fülle von bundesweiten Projekten, Programmen, Tagungen und Workshops aus dem Bereich der Kulturellen Bildung mit Kontaktadressen zu den Akteur_innen. Hier kann man nicht nur die ambitionierten und ausgezeichneten Projekte der Metropolen finden, sondern auch niederschwellige Angebote in ländlichen Regionen oder mittleren Kreisstädten in ganz Deutschland: www.kulturoeffnet-welten.de/programm/kalender.html 6.2 Die Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung e.V. hat auf ihrer Homepage einen thematischen Schwerpunkt zum Bereich »Kulturelle Bildung in der Einwanderungsgesellschaft – Kulturelle Bildung von, mit und für geflüchtete junge Menschen« erarbeitet. Auch hier werden konkrete Praxisprojekte näher vorgestellt: https://www.bkj.de/kulturelle-bildung-dossiers/fluechtlinge-und-kulturelle-bildung/praxis-und-projekte.html 6.3 Eine internationale Perspektive auf Kulturprojekte mit Geflüchteten bietet eine Präsentation des UNHCR von sieben Kunstprojekten, die nach Auffassung der Organisation das Leben von Geflüchteten verändert haben. Die Projekte fanden in Camps in Jordanien, Irak, Libanon und in Kenia statt: http://innovation. unhcr.org/7-art-initiatives-that-are-transforming-the-lives-of-refugees/
431
Autor_innen — Authors
Alhamwi, Mohammad; Politologe aus Damaskus; Mitarbeit bei »Brecht auf! Das Fest« am Theater in Senftenberg (Brandenburg) im September 2015: Lesung und Performance zu den »Flüchtlingsgesprächen« von Bertold Brecht mit freier arabischer Übersetzung; lebt derzeit in Berlin; [email protected] Boemke, Katrin; Dipl. Kulturwissenschaftlerin, Geschäftsführerin Jugend im Museum e.V.; Arbeitsschwerpunkte: kulturelle Bildung in und für Berliner Museen, Teilhabegerechtigkeit in einer diversen Gesellschaft; Vorstandstätigkeit für die Landesvereinigung kulturelle Jugendbildung Berlin e.V.; [email protected] Büro trafo.K; Wiener Büro für Kunstvermittlung und kritische Wissensproduktion; Schwerpunkte: kollektive, emanzipatorische Forschungs- und Vermittlungsprojekte an der Schnittstelle von Bildung und kritischer Wissensproduktion zu zeitgenössischer Kunst, Wissenschaftsvermittlung und Zeitgeschichte. Büro trafo.K sind Ines Garnitschnig, Renate Höllwart, Elke Smodics und Nora Sternfeld; www.trafo-k.at Castro Varela, María do Mar; Professorin für Allgemeine Pädagogik und Soziale Arbeit an der Alice Salomon Hochschule Berlin, Diplom-Psychologin, Diplom-Pädagogin, promovierte Politikwissenschaftlerin; Arbeitsschwerpunkte: Kritische Migrations- und Fluchtforschung, Postkoloniale Theorie und Critical Education; zur Zeit Senior Fellow am Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM) in Wien; [email protected] Costa Carneiro, Julia; Dipl. Sozialpädagogin, stud. MA Friedens- und Konfliktforschung; Initiatorin und Prozessbegleiterin des Dokumentationsprojekts »Gepäckbeförderung« im Grandhotel Cosmopolis, Augsburg; Arbeitsschwerpunkte: Performative Forschung, Trauma und Dialog, dekoloniale Optionen und urbane Gestaltung; [email protected]
434
Geflüchtete und Kulturelle Bildung
Deuflhard, Amelie; M. A., Kuratorin; Intendantin und Künstlerische Leiterin von Kampnagel, internationales Zentrum für schönere Künste Hamburg; Arbeitsschwerpunkte: Realisierung von Kunstprojekten an den Schnittstellen von Theater, Performance, Tanz, Musik, bildender Kunst und Architektur; Mitglied in diversen Gremien und Jurys, Lehraufträge u.a. an der HfMT Hamburg, ZU Friedrichshafen, KU Graz, HfS Ernst Busch, Berlin; [email protected] Fereidooni, Karim; Prof. Dr.; Juniorprofessor für Didaktik der Sozialwissenschaftlichen Bildung an der Ruhr-Universität Bochum; Schwerpunkte: Diskriminierungs- und Rassismuserfahrungen im Schulwesen, Rassismuskritik und Widerstand; [email protected] Gritschke, Caroline; Dr. phil., Historikerin; wissenschaftliche Mitarbeiterin Bildung und Vermittlung im Haus der Geschichte Baden-Württemberg in Stuttgart; Arbeitsschwerpunkte: Migrationsgeschichte, Bildung in der Migrationsgesellschaft, Flucht und Asyl in Vergangenheit und Gegenwart; Landesbeauftragte Asyl bei amnesty international; [email protected] Grün, Lydia; Geschäftsführerin des netzwerk junge ohren und seit 2016 Vertretungsprofessorin im Masterstudiengang Musikvermittlung/Musikmanagement an der Hochschule für Musik in Detmold. Sie arbeitete als stellv. Referatsleiterin im Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur, begleitete die Gründung der Musikland Niedersachsen gGmbH und gilt als Expertin für kulturpolitische Strategiebildung; [email protected] Hagenberg, Julia; seit 2009 Leiterin der Abteilung Bildung in der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen; 2004-2009 Leiterin der Kunstvermittlung, Kunstmuseum Stuttgart, 2002-2003 wissenschaftliche Mitarbeiterin, Kunstmuseum Bonn; Arbeitsschwerpunkte: Schnittstellen kuratorischer und museumspädagogischer Arbeitsfelder, partizipative Projekte im Museum; Lehraufträge an der PH Ludwigsburg und der HHU Düsseldorf; [email protected] Han-Broich, Misun; Dr. phil., Sozialarbeiterin; Lehrbeauftragte für den Studiengang Soziale Arbeit an der ev. Hochschule Berlin, Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft in Berlin, Coach für Ehrenamtsentwicklung in der Flüchtlingshilfe; Arbeitsschwerpunkte: Migration, Integration, Ehrenamt, Freiwilligenmanagement, Flüchtlings- und Migrationssozialarbeit; misun@t-online. de Heinemann, Alisha M.B.; Dr. phil; Universitätsassistentin am Institut für Germanistik der Universität Wien im Arbeitsbereich Deutsch als Zweitsprache; Forschungsschwerpunkte: Deutsch als Zweitsprache in Schule und Erwachsenen-
Autor_innen
bildung, Literalitäts- und Adressatenforschung, Kritische Migrationsforschung; [email protected] Heller, Maria; Dipl.-Kunsttherapeutin (FH); Traumatherapeutin bei REFUGIO München, Beratungs- und Behandlungszentrum für Flüchtlinge und Folteropfer in München; Vorstandsmitglied im Trauma Hilfe Zentrum München; Dozentin an verschiedenen Bildungseinrichtungen mit den Schwerpunkten Trauma und Flucht; [email protected] Helling, Marlene; BA-Studentin an der Universität Hildesheim, Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis mit Hauptfach Theater; im Rahmen des Seminars »Zwischen Kunst und Politik: Kulturprojekte mit Flüchtlingen« intensive Beschäftigung mit dem Stück »Die Schutzbefohlenen«; marlene [email protected] Huber, Marty; Dr. phil., Performance in Theorie und Praxis, Lektor_in an der Akademie der Bildenden Künste Wien, Kulturarbeiter_in; Arbeitsschwerpunkte: Queere Theorien mit Ungleichheitserfahrungen verschränken; Lecture Performances und Wissensvermittlung; Mitbegründer_in von Queer Base (asylum@ queerbase.at), queer-feministische Aktivist_in in der Türkis Rosa Lila Villa; [email protected] Jouni, Mohammed; Krankenpfleger, Student der Sozialen Arbeit (zunächst Medizin), Stipendiat der Rosa-Luxemburg-Stiftung, Sprecher von »Jugendliche ohne Grenzen«, Vorstand des Bundesfachverbands unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge und Vertreter des Berliner Flüchtlingsrats im Migrations- und Integrationsbeirat; [email protected] Linnemann, Tobias; Erziehungswissenschaftler, freiberuflicher Bildungsreferent und Theaterpädagoge; Bremen; Arbeitsschwerpunkte: kritische Reflexion von Rassismus und Weißsein, politisch-historische Bildung; Bildungswerkstatt Migration und Gesellschaft, reflACT – rassismuskritische Praxisreflexion; [email protected] Massumi, Mona; abgeordnete Studienrätin am Zentrum für LehrerInnenbildung der Universität zu Köln, Koordination des Arbeitsbereichs »Diversity« mit dem Fokus Migration und Flucht; Arbeitsschwerpunkte: Rassismuskritik in der LehrerInnenbildung, Bildungsarbeit für geflüchtete Menschen; promoviert zu Schulerfahrungen von neu zugewanderten Jugendlichen in Deutschland; [email protected] Mecheril, Paul; Prof. Dr.; lehrt am Institut für Pädagogik der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg und ist Direktor des Center for Migration, Education and Cultural Studies; Lehr- und Forschungsschwerpunkte: Migration und Bildung,
435
436
Geflüchtete und Kulturelle Bildung
Interkulturelle Pädagogik, Pädagogische Professionalität, Rassismusforschung; [email protected] Micossé-Aikins, Sandrine; Kuratorin und Kunstwissenschaftlerin, Leiterin der Geschäftsstelle des Berliner Projektfonds Kulturelle Bildung; Arbeitsschwerpunkte: Kolonialität, Rassismus und Empowerment in der Kulturarbeit; Mitbegründerin der Initiativen Bühnenwatch, des Bündnisses Kritischer Kulturpraktiker_innen, Mitglied der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland e.V.; [email protected] Mörsch, Carmen; Prof., Leitung des Institute for Art Education der Zürcher Hochschule der Künste; Arbeitsschwerpunkte: Geschichte und Gegenwart von Kunstvermittlung und kultureller Bildung als hegemoniekritischer Praxis, queere, antirassistische und dekoloniale Perspektiven in Kunstvermittlung und kultureller Bildung; iae.zhdk.ch Mousa, Leila; M.A., Geographin; Doktorandin am Geographischen Institut der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Projektleitung »Druckerei in der Blumenhalle«/Schlesische27 (Internationales JugendKunst- und Kulturhaus, Berlin); Arbeitsschwerpunkte: Verstetigung von Flucht, Kulturarbeit und Geflüchtete, Flüchtlingslager im Libanon, Flüchtlingslager als Ausnahmeraum, Governance in humanitären Kontexten; [email protected] Nassreddine, Razan; M.A., Kulturmanagerin; Koordinatorin von interkulturellen Projekten in Syrien; Co-Kuratorin einer internationalen Plattform für Kunstforschung in Berlin mit Schwerpunkt zeitgenössische syrische Künstler; Museumsführungen im Museum für Islamische Kunst; seit November 2015 im Projektleitungs-Team von »Multaka: Treffpunkt Museum«; razan-nassreddine@hotmail. com Natarajan, Radhika; Germanistin, Ausbilderin für Deutsch als Fremdsprache; wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt LeibnizWerkstatt zur Sprachlernunterstützung von Geflüchteten; promoviert zur Schnittstelle Fluchtmigration, Alltagsbewältigung, Sprachenkenntnis und Gender an der Leibniz Universität Hannover; Lehrbeauftragte Mehrsprachigkeit und DaF/DaZ; radhika.natarajan@ lehrerbildung.uni-hannover.de Pfau, Monika; M.A., Kunsthistorikerin; Sales- und Marketing-Managerin für den Berliner Verlag AMBERPRESS; Arbeitsschwerpunkte: Wechselwirkungen zwischen Kunst, Design und Markt; [email protected] Polanía, Felipe; MA Art Education; Projekte und Spezialprogramm im Alternativen Lokalradio LoRa in Zürich; Mitgründer und Mitwirkender bei der Autono-
Autor_innen
men Schule Zürich (2009-2012) und der politischen und künstlerischen Gruppe AntikultiAtelier (2010-2014); Kunstvermittler im Kunstraum Shedhalle Zürich (2014-2015); [email protected] Ronacher, Kim Annakathrin; Kulturwissenschaftlerin; Systemische Coach, freiberufliche Referentin, Trainerin für politische Bildung, Beraterin für diversitysensible Team- und Organisationsentwicklung; inhaltliche Schwerpunkte: Rassismuskritik/Critical Whiteness, Diversity und Antidiskriminierung, Gender; [email protected] Salgado, Rubia; Erwachsenenbildner_in, Kulturarbeiter_in und Autor_in; Arbeitsschwerpunkte im Feld der kritischen Bildungsarbeit in der Migrationsgesellschaft; Mitgründer_in und Mitarbeiter_in der Selbstorganisation maiz (www.maiz.at), seit 2015 auch im neuen Verein das kollektiv. kritische bildungs-, beratungs- und kulturarbeit von und für migrantinnen; [email protected] Seukwa, Louis Henri; Dr. phil.; Professor für Erziehungswissenschaften an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg; Arbeitsschwerpunkte: erziehungswissenschaftliche Migrationsforschung, Postkoloniale Theorien, Resilienz- und Bildungsforschung unter Bedingungen von Flucht und Asyl, interkulturelle Bildungsforschung, Bildungsprozesse im non-formalen und informellen Sektor; [email protected] Sharifi, Bahareh; M.A. Germanistik und Soziologie; Diversitätsbeauftragte beim Fonds kultureller Bildung; Arbeitsschwerpunkte: Diskriminierungskritik, Intersektionalität und Allianzen; kuratorische Tätigkeiten u.a. für das Maxim Gorki Theater und die Kulturprojekte Berlin; Mitglied beim Bündnis kritischer Kulturpraktiker_innen; [email protected] Sheleff, Maayan; Dozentin und freie Kuratorin, lebt und arbeitet in Tel Aviv, Israel; künstlerische Beraterin des Art Cube Künstler-Ateliers in Jerusalem; unterrichtet u.a. an der Bezalel Academy of Art and Design und an der Sam Spiegel Film and Television School in Jerusalem; kuratorische Projekte zur Erkundung von partizipatorischer Praxis durch neue Medien, Moving images und Performances, die die Grenze zwischen Kunst und Aktivismus untersuchen; maayansheleff@ gmail.com Sternal, Uta; Dipl. Sozialpädagogin, Bereichsleiterin beim Internationalen Bund Berlin-Brandenburg gGmbH, Betrieb Berlin Südwest; Arbeitsschwerpunkt: Unterbringung und Unterstützung von geflüchteten und wohnungslosen Menschen; [email protected]
437
438
Geflüchtete und Kulturelle Bildung
Stoffers, Nina; Kulturwissenschaftlerin und Médiatrice Culturelle; Doktorandin an der HU Berlin; wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Kulturpolitik im Bereich Kulturelle Bildung mit dem Schwerpunkt »Diversität«, Universität Hildesheim; Schwerpunkte: Fragen der Teilhabe, der kulturellen Repräsentation und des »Sprechens Über« vor dem Hintergrund der Diversität; [email protected] Süngün, Ülkü; Künstlerin; Studium der Bildhauerei an der ABK Stuttgart; Einweihung der Gedenkstätte für deportierte Juden am Killesberg Park in Stuttgart, 2013; Debut-Ausstellung, Villa Merkel, Esslingen 2015; künstlerische Arbeiten zu Migration, Flucht, Erinnerung und Identitätskonstruktionen; Lehrbeauftragte an der Akademie der Bildenden Künste Stuttgart 2015-2017; [email protected] Süzen, Talibe; Dr. phil., Dipl. Sozialarbeiterin/-pädagogin, Referentin für interkulturelle Kinder- und Jugendhilfe im Bundesverband der Arbeiterwohlfahrt; Arbeitsschwerpunkte: Migrationssozialarbeit, interkulturelle Öffnung, interkulturelle Kompetenz, Bildung in der Einwanderungsgesellschaft; Talibe.Suezen@ awo.org Warrink, Gosia; Linguistin, Designerin und Autorin der Bildwörterbuchreihe ICOON; Gründerin der Designagentur AMBERDESIGN und des Verlages AMBERPRESS in Berlin; Dozentin für Gestaltung an der Universität der Künste (Berlin); Arbeitsschwerpunkte: Corporate und Editorial Design, freie Designprojekte im Bereich Tapeten und Lichtobjekte; [email protected] Wiechell, Wybke; M.A., Kunsthistorikerin; Leiterin für Bildung und Vermittlung an der Hamburger Kunsthalle; Arbeitsschwerpunkte: Beauftragte für Inklusion an der Hamburger Kunsthalle, Projekte für psychisch erkrankte Kinder und Jugendliche sowie demenziell Erkrankte, Vermittlung für erwachsene Einzelbesucher in Sammlung und Sonderausstellungen; wiechell@hamburger-kunsthalle. de Wienand, Kea; Dr. phil., Kunstwissenschaftlerin, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Kunst und visuelle Kultur der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg; Redakteurin der online-Zeitschrift FKW//Zeitschrift für Geschlechterforschung und visuelle Kultur, www.fkw-journal.de; Forschungsschwerpunkte: Kunst und visuelle Kultur des 20. und 21. Jahrhunderts, postkoloniale Studien, kulturwissenschaftliche Geschlechterforschung, Künstlermythen, Erinnerungskulturen, verwobene Geschichten, [email protected]
Autor_innen
Ziese, Maren; Dr. phil., Kunsthistorikerin; Leiterin für Bildung und Vermittlung beim Freundeskreis Willy-Brandt-Haus; Arbeitsschwerpunkte: Flucht und Bildung, Kritische Kunstvermittlung, Diversität; Vorstandstätigkeit für den Länderverband Museumspädagogik Ost und das Haus am Lützowplatz; Lehrbeauftragte für Kulturvermittlung an der Europa-Universität Viadrina (Frankfurt/Oder); [email protected]
439
Kultur und soziale Praxis Daniel Kofahl, Sebastian Schellhaas (Hg.) Kulinarische Ethnologie Beiträge zur Wissenschaft von eigenen, fremden und globalisierten Ernährungskulturen Januar 2017, ca. 180 Seiten, kart., zahlr. Abb., ca. 29,99 €, ISBN 978-3-8376-3539-3
Christian Lahusen, Stephanie Schneider (Hg.) Asyl verwalten Zur bürokratischen Bearbeitung eines gesellschaftlichen Problems Januar 2017, ca. 300 Seiten, kart., ca. 29,99 €, ISBN 978-3-8376-3332-0
Christian Lahusen, Karin Schittenhelm, Stephanie Schneider Europäische Asylpolitik und lokales Verwaltungshandeln Zur Behördenpraxis in Deutschland und Schweden Dezember 2016, ca. 300 Seiten, kart., ca. 29,99 €, ISBN 978-3-8376-3330-6
Leseproben, weitere Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie unter www.transcript-verlag.de
![Kulturmanagement und Europäische Kulturarbeit: Tendenzen - Förderungen - Innovationen. Leitfaden für ein neues Praxisfeld [1. Aufl.]
9783839417812](https://ebin.pub/img/200x200/kulturmanagement-und-europische-kulturarbeit-tendenzen-frderungen-innovationen-leitfaden-fr-ein-neues-praxisfeld-1-aufl-9783839417812.jpg)




![Bildung / Transformation: Kulturelle und gesellschaftliche Umbrüche aus bildungstheoretischer Perspektive [1. Aufl.]
9783839400944](https://ebin.pub/img/200x200/bildung-transformation-kulturelle-und-gesellschaftliche-umbrche-aus-bildungstheoretischer-perspektive-1-aufl-9783839400944.jpg)

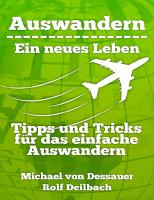
![Interdisziplinarität und Transdisziplinarität als Herausforderung akademischer Bildung: Innovative Konzepte für die Lehre an Hochschulen und Universitäten [1. Aufl.]
9783839427842](https://ebin.pub/img/200x200/interdisziplinaritt-und-transdisziplinaritt-als-herausforderung-akademischer-bildung-innovative-konzepte-fr-die-lehre-an-hochschulen-und-universitten-1-aufl-9783839427842.jpg)
