Weltmodelle : Griechische Weltbilder von Thales bis Ptolemäus 3805310927
Der Autor liefert die erste zusammenhängende Darstellung (seit 1913) der Entwicklung griechischer Weltbilder über 800 Ja
127 7 6MB
German Pages [192] Year 1989
Recommend Papers

- Author / Uploaded
- Werner Ekschmitt
File loading please wait...
Citation preview
Werner Ekschmitt
WeltmodeUe Griechische Weltbilder von Thales bis Ptolemäus
Philipp von Zabern
KULTURGESCHICHTE DER ANTIKEN WELT
BAND 43
VERLAG PHILIPP VON ZABERN • MAINZ AM RHEIN
WERNER EKSCHMITT
WELTMODELLE GRIECHISCHE WELTBILDER VON THALES BIS PTOLEMÄUS
VERLAG PHILIPP VON ZABERN • MAINZ AM RHEIN
192 Seiten mit 26 Schwarzweißabbildungen
Umschlag: Das Weltsystem des Ptolemäus nach Cellarius, 1708. Vorsatz: Globus des Atlas Farnese (Mus. Naz. Neapel Inv. 6374), Nachzeichnung einer Abrollung aus dem 18. Jh., aus: »G. Thiele, Antike Himmelsbilder, Berlin 1898, S. 27«.
CIP-Titelaufnahme der Deutschen Bibliothek Ekschmitt, Werner: Weltmodelle : Griechische Weltbilder von Thales bis Ptolemäus / Werner Ekschmitt. — Mainz am Rhein: von Zabern, 1989 (Kulturgeschichte der antiken Welt; Bd. 43) ISBN 3-8053-1092-7 NE: GT
© 1989 by Verlag Philipp von Zabern, Mainz am Rhein ISBN 3-8053-1092-7 Satz: Typo-Service Mainz Alle Rechte, insbesondere das der Übersetzung in fremde Sprachen, vorbehalten. Ohne ausdrückliche Genehmigung des Verlages ist es auch nicht gestattet, dieses Buch oder Teile daraus auf photomechanischem Wege (Photokopie, Mikrokopie) zu vervielfältigen. Printed in West Germany by Philipp von Zabern Printed on fade resistant and archival quality (PH 7 neutral)
Inhalt
Vorwort
7 Thales von Milet
9 Anaximander von Milet 20 Anaximenes von Milet 29
Pythagoras von Samos 33
Heraklit von Ephesus
38 Parmenides von Elea
53
Empedokles von Agrigent
65 Anaxagoras von Klazomenai
76 Sokrates 82 Demokrit von Abdera
87
Philolaos von Kroton 95
Die Kosmologie des Timaios ioo
Die Epinomis
115
Eudoxos
von
Knidos
119 Aristoteles 125
Heraklides Ponticus 143 Aristarch von Samos 148
Hipparch von Nikäa
155 Claudius Ptolemäus
167 Quellen der Textabbildungen 182
Bibliographie 183 Register 188
Vorwort An ihrem Anfang ist die Kosmologie eine stets erneute Bestreitung des Augenscheins. Der Augenschein täuscht, aber er ist die höchste Autorität der naiven Weltansicht. Der Augenschein zeigt uns eine flache, kreisför mige Erde, über der sich der Himmel als Halbkugel wölbt, die man sich aus Metall oder Kristall bestehend vorstellte, das sog. Firmament, die Feste des Himmels. Daran sind die Sterne geheftet. Von diesem Bild des Augenscheins bis zu den astronomischen Tatsachen ist es ein weiter Weg. Die Griechen sind überraschend früh darauf gekom men, daß die Erde sich freischwebend im Raum befindet, aber es hat ziemlich lange gedauert, bis die Erkenntnis sich durchsetzte, daß sie Kugelgestalt besitzt. Erst relativ spät kommt der Gedanke auf, daß sie nicht im Zentrum der Welt ruht, sondern um die Sonne kreist. Die Kugelgestalt übertrug sich von der Erde zwangsläufig auf Sonne und Mond. Da beide denselben scheinbaren Durchmesser besitzen (ca. i/z°), so stellte sich unmittelbar auch die Frage nach ihrer wirklichen Größe, d. h. nach ihrer Entfernung, von der die Größe direkt abhängig ist. So ver folgen wir, wie man sich Sonne und Mond zunehmend größer vorstellt. Man muß sich dabei immer bewußt bleiben, daß die Antike keinerlei optische Hilfsmittel besaß. Was man sah, war immer dasselbe. Nur die Bewegungen der Gestirne konnte man mit der Zeit zunehmend genauer erfassen, die Himmelskörper selbst nicht. Alles, was die Griechen hier ermittelt haben, ist reine Gedankenarbeit. Und so sind denn die Anfänge der griechischen Kosmologie unmittelbar mit denen der griechischen Philosophie verbunden. Aber auch heute noch ist die Beschäftigung mit der Kosmologie eine philosophische Beschäftigung. Die Welt ist begriff lich definiert als die umfassendste Totalität, d. h. als dasjenige Ganze, das selbst nicht wieder Teil eines anderen ist. Dieses Ganze ist kein Gegen stand möglicher Erfahrung, sondern immer nur Gegenstand des Den kens. Ob dieses Ganze endlich oder unendlich oder beides ist, ist und bleibt eine rein spekulative Frage. Auch hier sind einige griechische Philo sophen schon sehr früh zu der Überzeugung gelangt, daß die Welt nicht nur unendlich sei, sondern, daß es sogar unendlich viele Welten gebe. Für den modernen Leser sind diese Spekulationen natürlich von besonderer Spannung. Die Frage nach der Welt als ganzer ist zugleich auch die Frage nach der Einheit des Seins gegenüber der Vielheit des Seienden und bildet auch in dieser Hinsicht eine nie überholte Grundfrage der Philosophie, auf 7
die die griechischen Philosophen sehr verschiedene Antworten gegeben haben. Das Buch verfolgt also die griechischen Weltvorstellungen von den man nigfachen Versuchen der Vorsokratiker bis zu den großen Systemen Pla tons und des Aristoteles, mit denen die philosophische Spekulation zum Abschluß kommt. Gleichzeitig aber beginnt in diesen Jahren die mathe matische Astronomie, die, von Eudoxos von Knidos begründet, von Aristarch und Hipparch fortentwickelt, bei Ptolemäus ihre definitive Ausformung findet, bei dem sich Mathematik und Kosmologie zu dem jenigen System verbinden, das dann für 1400 Jahre in der europäischen Sternkunde verbindlich blieb und erst durch Kopernikus 1543 aufgelöst wurde. Für die meisten Leser wird es überraschend sein zu erfahren, daß es zwar mehrere Geschichten der griechischen Astronomie, aber in unserem Jahr hundert noch keine monographische Darstellung der griechischen Kos mologie gegeben hat, in keiner europäischen Sprache. Das große, gründ liche, auch heute immer noch sehr nützliche Werk von Sir Thomas Heath, Aristarchus of Samos, stammt schon aus dem Jahre 1913 und ist nicht nur in vielen Einzelheiten überholt, sondern reicht auch, wie der Titel besagt, nur bis Aristarch. Es ist Wert darauf gelegt, möglichst viele Basistexte im Wortlaut vorzu führen, damit der Leser nicht nur auf die Darstellung des Verfassers ange wiesen ist, sondern authentischen Zugang zu den Quellen selbst hat, sein eigenes Nachdenken daran zu wenden. Staufen i. Br., Sept. 1989
8
W. E.
‘Alles ist voll von Göttern.
Thales von Milet (um 600 v. Chr.)
Der Name des Thales, ein griechischer Name aus dem 6. Jahrhundert v. Chr., klingt bis heute zu uns herüber in alle höheren Schulstuben Euro pas. Mit Pythagoras, Euklid und Archimedes gehört er sozusagen zu den griechischen Schulheiligen und erweckt dem Gymnasiasten eine weit deutlichere Vorstellung als die Namen des Parmenides und Heraklit oder selbst die des Platon oder Aristoteles. Jeder weiß, daß Thales das Wasser für den Ursprung der Welt erklärte, und im Geometrieunterricht lernt man die Tatsache, daß alle einem Halbkreis eingeschriebenen Dreiecke rechtwinklig sind, als den »Lehrsatz des Thales« kennen. Mit Thales be ginnt die griechische Kosmologie, Geometrie und Philosophie, Grund genug, uns näher mit ihm zu beschäftigen.
DER URSPRUNG VON ALLEM IST DAS WASSER Die ältesten Nachrichten über Thales enthält das große Geschichtswerk des Herodot, aber seine »Philosophie« finden wir zum erstenmal darge stellt bei Aristoteles. In Buch A der Metaphysik gibt Aristoteles einen historischen Überblick über die »Lehren« seiner Vorgänger, wie er sie ver steht. Der ziemlich ausführliche Abschnitt über Thales lautet wie folgt: Von denen aber, die mit dem Philosophieren begannen, waren die meisten der Ansicht, die Ursprünge (archai) von der Art der Materie seien die ein zigen Ursprünge von allem. Denn woraus alles Seiende besteht, aus dem es zuerst entstanden ist und in das es zuletzt vergeht, wo also die (zugrun deliegende) Substanz (ousta) fortbesteht, während die Modifikationen (päthe) wechseln, dies, sagen sie, sei das Element (stoicheion) und der Ur sprung von allem. Und deshalb glauben sie auch, daß nichts weder ent steht noch vergeht, da die jeweilige Substanz (physis) immer erhalten bleibt. . . Denn es muß irgendeine Substanz (physis) geben, sei es eine, seien es mehr als eine, aus der alles andere entsteht, während sie selbst 9
immer erhalten bleibt. Über die Zahl und die Art eines solchen Ursprungs sind sie freilich nicht alle derselben Ansicht. So sagt Thales, der Initiator (archegos) dieser Art Philosophie, es sei das Wasser. Deshalb läßt er auch die Erde auf dem Wasser ruhen. Vielleicht gewann er seine Ansicht aus der Beobachtung, daß die Nahrung aller Lebewesen feucht ist und daß auch die Wärme aus dem Feuchten entsteht und daraus lebt. (Woraus nämlich etwas entsteht, das ist sein Ursprung.) Daher also gewann er diese Ansicht, und weil auch alle Samen eine feuchte Natur haben. Das Wasser aber ist der natürliche Ursprung von allem Feuchten. (Arist. Met. A 3, 983b 6—27) Wenn Thales je ein Buch über seine Hydrologie geschrieben haben sollte, was ganz unwahrscheinlich ist, so war es jedenfalls zur Zeit des Aristote les nicht mehr erhalten. Alles, was Aristoteles über Thales und seine Lehre weiß, hat er vom Hörensagen. Und er hat es sich — verständlicher weise — nach seiner eigenen Erkenntnis zurechtgelegt, daß es kein wirk liches Entstehen und Vergehen gibt, sondern nur Veränderungen einer zu grundeliegenden, sich überall durchhaltenden Substanz. Wenn man also gewöhnlich leichthin sagt, Thales habe gelehrt, das Wasser sei der Ur sprung von allem, so muß man sich historisch dabei über zwei Dinge klar sein: 1. daß Thales selbst die aristotelischen Termini arche und physis nie mals gebraucht hat, und 2. daß man unter arche und physis nicht, wie es Aristoteles tut, so etwas wie Urstoff zu verstehen hat. Die Meinung, daß alles Wasser ist, d. h., daß alles Seiende im Grunde aus Wasser be stehe, ist ganz sicher nicht die Meinung des Thales gewesen. Diese mate rialistisch-physikalische Frage taucht erst bei Anaximenes auf. Dagegen kann man durchaus zu Recht die schöne alte Formulierung gebrauchen, das Wasser sei der Ursprung von allem. Die von Aristoteles angeführten Beobachtungen, daß alle Nahrung und alle Samen feucht seien und auch die Wärme sich aus dem Feuchten nähre, sind sehr wahrscheinlich erst Erkenntnisse der späteren Medizin. Thales selbst aber konnte sich ohne weiteres bereits auf die allgemeine Erfahrung berufen, daß alle Pflanzen und Tiere zum Leben auf Wasser angewiesen sind, daß ohne Wasser kein Leben möglich ist, und das heißt letztlich, daß Wasser der Ursprung allen Lebens ist. Weiter kann die Beobachtung eine Rolle gespielt haben, daß in unserer alltäglichen Erfahrung Wasser die einzige Substanz ist, die in allen drei Aggregatzuständen vorkommt: als Dampf, Wasser und Eis. Aber die Vorstellung, daß alles aus Wasser be steht, daß alle Dinge Abwandlungen der drei Aggregate des Wassers sind, muß man ganz fernhalten. 10
Interessant ist nun, was Aristoteles von der Erdvorstellung des Thales be richtet, nämlich daß die Erde auf dem Wasser schwimme, in De caelo B 13 fügt er hinzu, wie ein Stück Holz, wie ein Brett auf dem Wasser. Das ist nun zwar eine primitive, aber doch auch eine originelle und jedenfalls ganz ungriechische Vorstellung. Denn mit der alten Überlieferung vom Okeanos, der die Erde »umfließt« und die Menschen vom Jenseits trennt, hat sie nichts zu tun. Man nimmt mit einigem Recht an, daß Thales die Vorstellung von der schwimmenden Erde in Ägypten kennengelernt und von dort mitgebracht hat. Ein Naturphänomen, das — wie die Blitzschläge — die Griechen seit alters beschäftigte, waren die Erdbeben. Die mythische Erklärung hatte sich auf den »Erderschütterer« Poseidon berufen. Thales versuchte zum erstenmal eine rationale Erklärung. Erdbeben entstünden durch Turbu lenzen des Meeres unter der Erde. Und zum Beweis führte er die Tatsache an, daß bei Erdbeben Wasser und Quellen aus der Erde hervorbrächen. Es sei so, sagte er, wie wenn ein Schiff in einen Sturm gerate, der den Schiffsrumpf anschlage, so daß nun das Meerwasser in das Schiff ein dringe. Ob Thales wirklich in Ägypten war, wie wir schon andeuteten, läßt sich nicht beweisen, aber es ist doch sehr wahrscheinlich, um so mehr, als seine Mutterstadt Milet in Naukratis im Delta eine bedeutende Handels niederlassung besaß. Es wäre sonst schwer zu verstehen, wie es zu der Überlieferung kommen konnte, er habe auch in Ägypten versucht, ein rät selhaftes Naturphänomen zu erklären, nämlich den Eintritt der Nil schwelle. Der Nil war für die Alten ein sehr merkwürdiger Fluß, der ein zige, von dem man wußte, daß er im Unterschied zu allen anderen im Sommer anschwoll und im Winter abnahm. Die Nilschwelle trat mit fast unwandelbarer Sicherheit um den 20. Juli ein, um den Tag, auf den die Ägypter deshalb den Beginn des neuen Jahres gelegt hatten. Thales machte nun die Beobachtung, daß um die gleiche Zeit die Etesien, die jährlichen Nordwinde wehten. Seine Erklärung war, sie drückten das Meerwasser in den Nil hinein, so daß der Fluß sich staue und nicht aus laufen könne. Das Argument beweist, daß er sich eigentlich nur im Delta aufgehalten haben kann, denn es wäre nicht glaubhaft gewesen, daß die Etesien den Nil bis Oberägypten gestaut hätten. Von diesem Gegenargu ment macht Herodot, der die Nilschwelle ausführlich diskutiert (2, 20—25), keinen Gebrauch, aber er führt sehr geschickt ein anderes gegen Thales an, nämlich, wenn seine Erklärung stimme, so müßte bei allen an deren Flüssen, die nach Norden strömten, derselbe Stau eintreten, was nicht der Fall sei. ii
THALES ALS GEOMETER Mit einem anderen Unternehmen in Ägypten hatte Thales indessen vollen Erfolg, nämlich mit dem Versuch, die Höhe der Pyramiden zu bestim men. Er hatte den durch seine Einfachheit genialen Gedanken, zu schlie ßen, daß in dem Augenblick, wo sein eigener Schatten seiner Körperlänge gleich sei, auch der Schatten der Pyramiden ihrer Höhe gleich sein müsse. Das einzige, was auf diese Weise erforderlich blieb, war, die Strecke von der markierten Spitze des Schattens bis zur Kante der Pyramide zu messen und noch einmal die halbe Kantenlänge hinzuzufügen. Eigentlich, möchte man sagen, hätte es »der Schatten des Thales« verdient, genauso berühmt zu sein wie das Ei des Kolumbus. Freilich standen die Pyramiden zur Zeit des Thales schon seit zweitausend Jahren, und es ist sehr die Frage, ob nicht in dieser langen Zeit schon einer der alten Ägypter auf den Analogieschluß verfallen war, der dem Thales als Erfindung zuge schrieben wurde, während er ihn in Wirklichkeit von den Ägyptern gelernt hatte. Herodot, der 2,127 angibt, die Chephren-Pyramide selbst gemessen zu haben, hat damit offenbar nur ihre Seitenlänge gemeint. Denn wenn er gewußt hätte, auf wie einfache Weise auch ihre Höhe zu ermitteln war, er hätte nicht verfehlt, sie anzugeben. Was sonst noch dem Thales an geometrischen Entdeckungen zugeschrie ben wurde, war: daß der Durchmesser den Kreis in zwei gleiche Hälften teilt, daß bei sich schneidenden Geraden die gegenüberliegenden Scheitel winkel gleich sind, daß Dreiecke, die eine Linie und die beiden anliegen den Winkel gemeinsam haben, deckungsgleich sind. Lauter ziemlich unschuldige Dinge, bei denen sich die Mathematikhisto riker trotzdem nicht sicher sind, ob sie wirklich dem Thales schon zuge traut werden können. Überliefert wird auch, daß er in der Lage war, die Entfernung von Schiffen zu bestimmen, und sich überhaupt um die Seefahrt verdient gemacht habe, z. B. durch den Nachweis und die Anregung, daß der Kleine Wagen für die Navigation in der Nacht eine viel bessere Hilfe biete als der Große.
THALES ALS PRAKTIKER Auch sonst beruhte sein Ruhm viel mehr auf seinen praktischen Leistungen als auf seinen spekulativen, und es ist ernsthaft die Frage, ob er überhaupt unter den griechischen Philosophen rangieren würde, wenn ihn nicht Aristoteles in dem oben zitierten Bericht an deren Spitze gesetzt hätte. 12
Der lydische König Krösus nahm Thales auf einen Feldzug mit, bei dem es galt, den Halys zu überschreiten. Der Fluß war ohne Furt zu tief, als daß man ihn durchwaten konnte. Da teilte Thales den Fluß oberhalb des Feldlagers durch Anlage eines Kanals in zwei Arme, von denen jeder nur noch das halbe Wasser führte, das leicht zu durchqueren war. Herodot, der die Geschichte berichtet (i, 75), hält sie selbst nicht für historisch, weil es dort Brücken über den Halys gegeben habe. Die Frage bleibt, ob diese Brücken für eine ganze Armee, mit einer berühmten Kavallerie, aus reichten. Von allen frühen Philosophen war Thales der einzige, der zu den Sieben Weltweisen gezählt wurde. (Ein Teil der Überlieferung schreibt ihm sogar den berühmten Spruch zu, der am Tempel von Delphi angebracht war: Erkenne dich selbst!) Diesen Ehrentitel erhielten gewöhnlich Männer, die sich auch in politischen Dingen um ihre Stadt verdient gemacht hatten. Und auch darin hat Thales sich ausgezeichnet. Als die Eroberung der griechischen Küstenstädte durch die Lyder drohte, riet er den Griechen zur Einigkeit und schlug ihnen vor, einen Städtebund mit Sitz des Rates in Teos, das in der Mitte Ioniens gelegen war, zu gründen. In diesem Bund sollten die einzelnen Städte ihre Selbständigkeit bewahren, aber gegen über der Bundeshauptstadt nur noch den Rang von Landstädten ein nehmen.
DIE SONNENFINSTERNIS VOM 28. MAI 585 V. CHR. Totale Sonnenfinsternisse sind außerordentlich selten. Eine ringförmige Sonnenfinsternis gab es in Deutschland am 17. April 1912, die einzige totale in diesem Jahrhundert, die aber auch nur den Südrand Deutsch lands berühren wird, ist für den 11. August 1999 zu erwarten. Eine zen trale Mondfinsternis dauert über eineinhalb Stunden, eine totale Sonnen finsternis maximal sieben Minuten, in den meisten Fällen ist sie aber viel kürzer. Und doch gehört eine Sonnenfinsternis zu den größten und ein drucksvollsten Schauspielen, die die Natur dem Menschen bietet. In der deutschen Literatur gibt es eine berühmte Schilderung einer solchen Fin sternis. In den frühen Morgenstunden des 8. Juli 1842 trat in Wien eine totale Sonnenfinsternis ein, die Adalbert Stifter von dem über seinem Haus sich erhebenden Kornhäusel-Turm beobachtete und von der er eine ausführliche Schilderung gab, aus der wir einen kurzen Abschnitt her setzen:
13
Endlich wurden auch auf Erden die Wirkungen sichtbar und immer mehr, je schmaler die am Himmel glühende Sichel wurde. Der Fluß schimmerte nicht mehr, sondern war ein taftgraues Band. Matte Schatten lagen umher. Die Schwalben wurden unruhig. Der schöne sanfte Glanz des Himmels erlosch, als liefe er von einem Hauche matt an. Eine kühle Luft erhob sich und wehte gegen uns. Über den Auen starrte ein unbe schreiblich seltsames, bleischweres Licht. . . Die Schatten unserer Gestal ten legten sich leer und inhaltslos gegen das Gemäuer, die Gesichter wur den aschgrau — erschütternd war dieses allmähliche Sterben in der noch vor wenigen Minuten herrschenden Frische des Morgens. . . . Dann Totenstille. Es war der Moment, da Gott redete und die Menschen horchten.
Die älteste Erwähnung einer Sonnenfinsternis in der europäischen Litera tur findet sich beim parischen Dichter Archilochos, dem ersten griechi schen Lyriker:
Unvorstellbares Ereignis. Ganz unmöglich, wunderbar ist hinfort nichts mehr auf Erden, seit der Göttervater Zeus Mittagszeit in Nacht verwandelt und der hellen Sonne Licht sich verbergen ließ. Die Menschen spürten plötzlich kalte Angst. Seither ist nichts mehr verläßlich. (Tr. 74 D) Es handelt sich wahrscheinlich um die Sonnenfinsternis vom 6. April 648 v. Chr. Dann folgt der Bericht Herodots über die Finsternis vom 28. Mai 585 v. Chr.
Darauf kam es zwischen den Lydern und Medern zum Krieg. . . . Der Krieg dauerte fünf jahre, und oft siegten die Meder über die Lyder, oft auch die Lyder über die Meder. Einmal hatten sie auch einen nächtlichen Kampf. Als sie den Krieg auch im sechsten Jahr fortsetzten, begab es sich während einer Schlacht, daß der Tag sich plötzlich in Nacht verwandelte. Diese Vertauschung von Tag und Nacht hatte Thales von Milet den Ioniern vorausgesagt und hatte genau das Jahr angegeben, in dem diese Verwandlung dann auch stattfand. Als die Lyder und Meder sahen, daß es nicht mehr Tag, sondern plötzlich Nacht war, ließen sie ab vom Kampf und beeilten sich, Frieden zu schließen. (x> 74)
Die Voraussage dieser Finsternis war der größte Ruhm des Thales. Ihr Zusammenfall mit der Schlacht und der durch sie herbeigeführte Frie14
densschluß haben ihr eine für die Überlieferung überaus günstige Drama tik verliehen. Für uns ist die interessanteste Frage aber die, wie Thales diese Sonnenfinsternis voraussehen konnte. Natürlich hat er sie nicht für den betreffenden Tag vorausgesagt, sondern, wie Herodot ausdrücklich angibt, nur für das betreffende Jahr. Die Frist eines ganzen Jahres ist freilich einigen als zu unbestimmt und vielleicht auch als zu unrühmlich erschienen. Sie weisen darauf hin, daß das Wort für Jahr — eniautos — ursprünglich und in alter Zeit die Sommersonnenwende bezeichne. Da nach wäre also die Voraussage des Thales bis auf die Frist eines Monats genau eingetroffen. Wie war dem Thales eine solche Voraussage möglich? Wie eine Sonnenfinsternis zustande kommt, nämlich durch den Schatten des Mondes, davon hatte er auf Grund seines Weltbildes, wo die Sonne am Tag über den Himmel und in der Nacht über das Meer läuft, nicht den geringsten Begriff und hatten ihn auch, wie wir sehen werden, noch lange seine Nachfolger nicht. Und wenn er ihn gehabt hätte, so hätte er den Vorgang nicht berechnen können. Nirgendwo, auch in Ägypten und Babylonien nicht, war zu Beginn des 6. Jhs. ein Astronom imstande, Fin sternisse vorauszuberechnen. Das einzige, was zu jener Zeit existierte, war ein babylonischer Erfahrungszyklus von 223 Monaten, d. h. von c • 0 0 • 0 c. > •
0
• 0 0
0 •
0
• 0
0
0
()
0
_
0
«rf
0
U V Juni Juli \rfug
Ian Ftbn März April Md!
1969
*
.. 0
• c
• 0c
■967
• 0 •
0
0
•
c • 0
« — ■963
V
0 11
- ■957
0 •
«V
•
- ■953 ■955
'(Z
•
0
'•
1951
Set*
M>v
'973 Pez.
■975
Abb. i Periodik der Sonnenfinsternisse (O) und Mondfinsternisse (• ) von 1951—1975
15
18 Jahren und io Tagen. Abb. i gibt eine moderne Aufstellung dieses Zyklus. Man sieht, daß sich die Finsternisse alle 18 Jahre in gleicher Art und Reihenfolge wiederholen, mit einer Verzögerung von n Tagen. Man sieht auch, daß Sonnenfinsternisse häufiger sind als Mondfinsternisse, theoretisch, denn in Wirklichkeit ist es umgekehrt. Da der Mondschat ten, wie Abb. 2 zeigt, nur ganz begrenzte Gebiete überläuft, sind selbst
Abb. 2
Schema einer Sonnenfinsternis
partielle Sonnenfinsternisse sehr selten. Im übrigen ist die Tabelle von Abb. i natürlich nicht beobachtet, sondern modern berechnet. Die Baby lonier besaßen aber nur einen Erfahrungszyklus. Für die Voraussage von Mondfinsternissen konnte ihnen der eine Hilfe sein, für die von Sonnen finsternissen nicht. Sie machten aus der Not eine Tugend, beobachteten in der fraglichen Zeit die Sonne, und wenn die Finsternis nicht eintrat oder nicht sichtbar wurde, verkündigten sie das als ein gutes Omen. Selbst wenn Thales also der babylonische Zyklus wirklich bekannt gewesen wäre, hätte er ihm nicht die Voraussage einer Sonnenfinsternis ermög licht. — M. a. W. die Annahme, daß Thales die von ihm vorausgesagte Finsternis auch nur annähernd hätte berechnen können, scheidet gänzlich aus. Die günstigste Voraussetzung, die gemacht werden kann, ist die, daß ihm der babylonische Zyklus auf irgendeine Weise bekannt geworden war und daß er auf Grund dieser Kenntnis die Voraussage wagte. Sie war also die reine Lotterie, und die meisten Interpreten nehmen deshalb auch ohne Zögern an, daß Thales einfach Glück gehabt, einen glücklichen Zufalls treffer getan habe, innerhalb der Frist eines Jahres. Eine noch zurückhaltendere Erklärung hat der große deutsche Altphilo loge Kurt von Fritz gegeben. Er nimmt an, daß Thales eine Voraussage in Wirklichkeit gar nicht ausgesprochen habe, sondern daß sie ihm auf grund seiner vielen anderen Verdienste und Ruhmestitel nachträglich zu geschrieben wurde. Auch wenn es vermutlich viele Leser enttäuscht: Dies
i6
ist die Erklärung, die die größte Wahrscheinlichkeit für sich hat. Solche nachträglichen Zuschreibungen hat es in der antiken Literatur massen haft gegeben. Sie haben nicht das geringste Verwunderliche an sich. Was aber den besonderen Fall des Thales angeht, so befinden wir uns im Besitz eines Parallelbeispiels, das auch den widerstrebendsten Parteigänger unse res Philosophen überzeugen muß. Anaxagoras von Klazomenai, ein kleinasiatischer Philosoph des 5. Jahrhunderts (gest. 428 v. Chr.), ein spä ter Nachfahre des Thales also, erklärte, die Sonne und die übrigen Sterne seien nichts als glühende Steine, und wurde dafür von den Athenern wegen Gottlosigkeit vor Gericht gezogen. Nun ging i. J. 456 bei Aigös potamoi auf der Thrakischen Halbinsel ein großer Meteorit nieder, dessen Einschlag weithin Aufsehen erregte. Von diesem Meteoriteneinschlag be richtet nicht nur Plinius in seiner Naturgeschichte, sondern es berichtet von ihm schon Jahrhunderte früher das sog. Marmor Parium. Diese »Parische Chronik« ist wahrscheinlich i. J. 264 v. Chr. verfaßt und berich tet von der Urzeit des attischen Königs Kekrops bis zum Jahr 298 v. Chr. teils über politische Ereignisse, besonders aber auch über wichtige Daten der griechischen Kult- und Literaturgeschichte. In dieser Chronik also wird unter dem Jahr 456 der erwähnte Meteoriteneinschlag angeführt. Im 3. Jh. n. Chr. aber berichtet Diogenes Laertius in seinem Werk »Über Leben und Meinungen berühmter Philosophen« in dem Abschnitt über Anaxagoras, Anaxagoras habe diesen Meteoriteneinschlag vorausgesagt (Diog. Laert. II10). Man stellt sich die Frage, ob der Meteoriteneinschlag dem Anaxagoras für seine Lehre, die Gestirne seien glühende Steine, eine glänzende Bestätigung bildete oder ob er vielleicht durch diesen Meteori ten allererst auf seine Theorie gekommen ist. Auf jeden Fall aber kam der Einschlag unerwartet. Kein Mensch kann einen Meteoriteneinschlag vor aussehen, auch heute nicht. Die Voraussage des Anaxagoras ist eine rein literarische Fiktion. Mit der historischen Wirklichkeit hat sie nichts zu tun. Ganz dasselbe wird es auch mit der Sonnenfinsternis des Thales ge wesen sein. Diese negative Lösung überhebt uns zugleich der schwierigen Frage, wie Thales denn seine Voraussage überhaupt publik gemacht hat. Denn ohne daß seine Voraussage allgemein bekannt war, hätte deren Erfüllung ihm ja gar keinen Ruhm einbringen können. Dagegen wird die Frage der Pu blizität sehr einfach, wenn man annimmt, daß Voraussage und Erfüllung nachträglich erfunden sind. Auf die Frage, wie Thales zu seiner Voraussage gekommen wäre, hätte es allerdings bei seinen Zeitgenossen noch eine ganz andere Auskunft gege ben. Es wäre für sie durchaus naheliegend gewesen, wenn sie angenom17
men hätten, es sei ihm ein Orakel zuteil geworden. Auch in Babylonien war es nichts Ungewohntes, daß Finsternisse durch Leberschau vorausge sagt wurden. Ein großes historisches Verdienst bleibt der Sonnenfinsternis von 585 aber auf jeden Fall. Sie liefert uns den einzigen Anhalt für die Lebenszeit des Thales, die sonst ganz unbestimmt bleiben müßte.
DIE GRÖSSE DER SONNE Eine Frage, die die Menschen zu allen Zeiten beschäftigt haben wird, ist die, wie groß Sonne und Mond, die scheinbar nur die Größe eines menschlichen Fußes haben, in Wirklichkeit sind. Ein großer Schritt auf dem Weg zur Antwort wäre, wenn man ermitteln könnte, in welchem Ver hältnis der Durchmesser der Sonnenscheibe zum ganzen Himmelsrund steht. Diese Proportion durch Winkelmessung zu ermitteln war damals und noch lange danach nicht möglich. In alexandrinischer Zeit maß man die Sonnenbreite mit der Wasseruhr, eine Methode, die den Ägyptern zu geschrieben wurde, die aber Ptolemäus, der sich lieber auf die Mathema tik verlassen wollte, noch im 2. Jh. n. Chr. für wenig verläßlich hielt. Man verglich die Wassermenge, die einlief, bis die Sonnenscheibe ganz über dem Horizont stand, mit der Wassermenge, die im Verlauf eines ganzen Tages einlief. Überliefert wird das Verhältnis 1: 750. Zur Zeit des Thales gab es noch keine, oder jedenfalls noch keine halbwegs genaue Wasseruhr. Trotzdem wird für Thales ein außerordentlich genaues Ergebnis berich tet, die Proportion 1 : 720 d. h. I/x° = 30' (Diog. Laert. I 24), was der Wirklichkeit sehr nahekommt. Der mittlere Sonnendurchmesser beträgt 31'59 Daraus ging zunächst schon einmal ganz allgemein hervor, daß die Sonne ziemlich groß sein mußte. Je nach dem, welche Entfernung von der Erde man annahm, ergaben sich entsprechende Schätzungen, über die wir aber leider nichts wissen. Interessant wäre für uns auch, wie man sich das Größenverhältnis zwischen Sonne und Mond vorgestellt hat. Die scheinbare Größe des Mondes ist der der Sonne fast gleich: 31' 5 Die Größenrelation entsprach den angenommenen Entfernungen von der Erde. Aber auch darüber erfahren wir leider nichts. Es bleibt noch die Frage, wie Thales zu der Verhältniszahl 1: 720 gekom men ist. Sie ist ohne Zweifel eine Zahl innerhalb des Sexagesimalsystems. 360 0 ist der Umfang des ganzen Himmelskreises. ist also, wie schon bemerkt I/i°. Man kann mit einiger Sicherheit annehmen, daß dies das Winkelmaß war, das die babylonischen Astronomen dem Sonnen18
durchmesser zuschrieben und das Thales auf irgendeinem Wege von ihnen übernahm, wenn diese Überlieferung überhaupt zutrifft. Archimedes jedenfalls hat die genaue Bestimmung des scheinbaren Sonnendurch messers erst Hipparch im 2. Jh. v. Chr. zugeschrieben, und diese Nach richt wird wohl die historisch glaubwürdigere sein.
ALLES IST VOLL VON GÖTTERN
Wir haben noch den Satz zu erörtern, der diesem Kapitel als Motto vor gesetzt ist und der in gewisser Weise als wörtliches, als das einzige wört liche Zitat von Thales überliefert wird (Arist. De anima A 5,411 a 7). Man hat in diesem Wort ein Zeugnis für einen Überrest von primitivem Ani mismus bei Thales sehen wollen, eine Auslegung, die ihn sicher unter schätzt. Aristoteles fügt seiner Zitation die Erklärung an, Thales habe damit »vielleicht« die Weltseele gemeint. Die hat er ganz sicher nicht ge meint. Am ehesten gibt eine Anekdote Auskunft, die von Heraklit überlie fert wird. Als einige Besucher die Bekanntschaft des berühmten Philoso phen machen wollten, fanden sie ihn zu ihrem großen Befremden in der alltäglichen Pose, wie er sich am Ofen die Hände wärmte. Den erstaunten Gästen rief indessen Heraklit zu: Auch hier sind Götter anwesend. Der Satz des Thales will vermutlich einfach sagen, daß es überall in der Welt Göttliches zu finden gibt, und das heißt, in indirekter Konsequenz, daß wir von allem, was ist, nicht das eine für göttlicher halten sollen als das andere. Die beiden bekannten Anekdoten über Thales, die eine, daß er bei der Sternbetrachtung in den Brunnen gefallen sei und sich lächerlich gemacht habe, und die andere, daß er durch Voraussicht einer großen Ölernte und durch frühzeitige Pachtung aller Ölmühlen ein Vermögen gemacht habe, wollen wir hier übergehen, denn beide sind Erfindungen, die eine, um die Weltfremdheit, die andere, um die Weltklugheit des Philosophen zu illu strieren.
19
»Sie zahlen einander Buße und Strafe nach der Notwendigkeit.«
Anaximander von Milet (ca. 610—545 v. Chr.)
Anaximander, Mitbürger und »Schüler« des Thales, soll 547 v. Chr. 64 Jahre alt gewesen und kurz darauf gestorben sein, so lauten die antiken Nachrichten. In Anaximander begegnen wir dem ersten wirklichen Philo sophen, d. h. »einem Mann, der spekulierte«. Wir haben schon gesagt, daß Thales wohl kaum in den Rang eines Philosophen aufgestiegen wäre, hätte ihn nicht Aristoteles in seinem geschichtlichen Rückblick dazu gemacht. Diogenes Laertius im 3. Jh. n. Chr. hat sich durch die Autorität des Aristoteles nicht irremachen lassen. Er rechnet Thales zu den Sieben Weltweisen und zählt Anaximander als den ersten Philosophen. Platon weiß noch nichts davon, daß Thales Philosoph ist. Er erwähnt ihn im 10. Buch des Staates (600 A), und zwar im Zusammenhang mit seiner Dichterkritik. Er tadelt Homer, der über Gott und die Welt schreibt, ohne von all dem, worüber er berichtet, wirklich etwas zu verstehen, und stellt ihm Thales als einen Mann mit handfesten Kenntnissen gegenüber. Er nennt ihn dort einen Mann vieler kunstreicher Erfindungen. Thales war einer der Sieben Weisen, d. h. ein Experte des politischen Rates. Daneben war er Ingenieur und Geometer. Aber das, was wir in einem besonderen Sinne Philosophie nennen, nämlich das Spekulative, tritt uns zuerst bei Anaximander entgegen, und zwar in geradezu spektakulärer Form. Das Kühne, Wagende, oft auch Gewagte, das den griechischen Geist vor allen antiken Völkern auszeichnet, den es zu Fragestellungen, Gedanken und Antworten trieb, die weder die orientalischen Völker noch die nachfol genden Römer zu fassen vermochten, tritt uns bei Anaximander gleich zu Anfang der griechischen Philosophie mit staunenswerter Ausprägung entgegen.
DAS APEIRON Seine Hauptlehre ist in einem einzigen Wort beschlossen, dem Apeiron. A-peiron heißt wörtlich un-begrenzt, grenzen-los. Mit ihm schlägt Anaxi-
20
mander ein großes Thema an, das Thema von Grenze und Unbegrenz tem, von Endlichem und Unendlichem, das, wie wir sehen werden, das Denken der Eleaten, Pythagoreer und Atomisten aufs stärkste beschäf tigte und das noch in der Kosmologie des Aristoteles ein zentrales Pro blem bildet, wo es die merkwürdig zwiespältige Lösung erfährt, die Welt sei der Zeit nach unendlich, dem Raum nach aber endlich. Thales hatte das Wasser als den Ursprung von allem erklärt. Anaximander hat sich offenbar gefragt, ob sich wirklich aus dem Wasser, so wandel bar es ist, die ganze Fülle und Vielfalt des Seienden herleiten läßt. Es er schien ihm dafür zu bestimmt. Er nahm den von ihm erdachten Ursprung aus der Bestimmtheit zurück und nannte ihn das Unbestimmte, denn apeiron bedeutet nicht nur das Grenzenlose, Unendliche, sondern auch das qualitativ Unbestimmte. Das Spekulative tritt u. a. dadurch provoka tiv hervor, daß dieses Apeiron, obwohl es allem Seienden zugrunde liegt und überall anzutreffen ist, doch nicht faßbar, ja überhaupt unsichtbar ist. Es ist eine rein spekulative Größe. Gleichzeitig ist das Apeiron aber nicht nur qualitativ unbestimmt, sondern wirklich auch grenzenlos, un endlich, und zwar sowohl der Zeit wie dem Raume nach. Anaximander nennt es unvergänglich und alterslos, er hat es wohl auch ewig und gött lich genannt. Gleichzeitig ist das Apeiron aber auch das räumlich Unend liche, was allem Seienden zugrunde liegt und was alles Seiende umschließt (periéchon). Wenn man sagen wollte, daß es alles Seiende »durchdringt«, so wäre diese Formulierung für Anaximander zu dynamisch. Als Motiv, warum Anaximander das Apeiron, das Unendliche zum Prin zip alles Seienden gemacht hat, führt Aristoteles in der Physik die Inten tion an, damit das Werden nicht aufhört (Phys. T 8, 208a 8; T 4, 203b 18). Das Apeiron ist sozusagen das unerschöpfliche Reservoir, aus dem die un ausgesetzte Verschwendung von Sein bestritten wird. Wie aus dem Apei ron »alles wird«, darüber hat Anaximander vermutlich keine detaillierte Erklärung abgegeben. Aristoteles und seine Schule konnten sich von ihrer Elementenlehre her die Sache nicht anders erklären, als daß das Apeiron die vier Grundqualitäten aus sich heraussetze: warm und kalt, feucht und trocken, die sich dann zu der ganzen Vielfalt der Welt verbinden, und man hat neuerdings, angesteckt durch diesen Gedanken, ein Fragment, das für Heraklit überliefert ist (Fr. 126), dem Anaximander zuschreiben wollen:
Kaltes erwärmt sich, Warmes kühlt sich ab, Feuchtes trocknet, Dürres wird benetzt. Aber es ist sehr die Frage, ob Anaximander dieses System der Qualitäten schon ausgebildet hat. Eigentlich findet sich nur ein Verb, das man 21
authentisch für ihn in Anspruch nehmen kann: sich abscheiden (apokrinesthai), nicht sich ausscheiden (aus einem Gemisch: ekkrinesthai), sondern sich absondem, heruortreten, sich bestimmen aus dem Unbestimmten.
BUSSE UND STRAFE Wahrscheinlich hat Anaximander das nie aussetzende Werden als eine un aufhörliche Fluktuation verstanden, die immer wieder neue Formen und Ausformungen hervortreibt, ohne deshalb anzunehmen, daß sich alles mit allem verbindet. Das unendliche Werden hat er aber nicht wie Hera klit als eine Einheit, als Einheit der Gegensätze, angesehen, sondern als einen Antagonismus und Daseinskampf. Alles, was ist und lebt, ist und lebt auf Kosten von anderem: Die Nacht lebt auf Kosten des Tages und umgekehrt, der Winter auf Kosten des Sommers, das Meer auf Kosten des Landes, die Menschen auf Kosten der Tiere und der Mitmenschen, und — vielleicht auch — die Götter auf Kosten der Menschen. Leben und Sein ist eine unaufhörliche Folge von Übergriffen. Für diese Übergriffe hat er ein berühmtes Gesetz formuliert. Es ist das älteste Zitat griechischer Phi losophie, das wir besitzen. Wir wollen es uns im Zusammenhang verge genwärtigen. Erhalten ist es im Kommentar des Neuplatonikers Simplizius zur Physik des Aristoteles, einem Kommentar, der von dem ursprüng lichen Buch des Anaximander durch einen Abstand von mehr als tausend Jahren getrennt ist und aus großer gedanklicher und sprachlicher Ferne darauf zurückblickt: Anaximander von Milet, Sohn des Praxiades, Schüler und Nachfolger des Thales, erklärte das Apeiron für Ursprung (archi) und Element (stoicheion) des Seienden und war der erste, der diese Bezeichnung für den Ur sprung aufbrachte. Er sagt aber, daß dieser Ursprung weder das Wasser sei, noch ein anderes der sog. Elemente, sondern eine andere unendliche Natur (physis), aus der alle Himmel entstehen mit den in ihnen befindli chen Welten. Woheraus aber das Seiende (wörtl.: die Seienden) sein Ent stehen hat, dahinein hat es auch sein Vergehen nach der Notwendigkeit. Denn sie zahlen einander Buße (dike) und Strafe (tisis) für die Ungerech tigkeit nach der Ordnung der Zeit, wie er dies (Letzte) mit etwas poeti scheren Worten ausdrückt. (Simpl. Phys. 24, 13ff.) Der Schlußpassus weist darauf hin, daß es sich um ein Zitat handelt. Doch sind die Worte »nach der Ordnung der Zeit« ein später Zusatz. Als
22
ursprünglich kann nur das Unterstrichene gelten. Es ist ein Ausdruck des vielberufenen griechischen Pessimismus: alles Sein und Leben steht unter der Ungerechtigkeit, und alles Seiende und Lebende muß dafür — einan der — Buße und Strafe zahlen nach der Notwendigkeit (kata to chreön). Damit ist wohl Dike, die Göttin der Gerechtigkeit, gemeint, wie sie später bei Heraklit ausdrücklich und namentlich auftritt.
UNENDLICH VIELE WELTEN
Die Formel vom Woher und Wohin des Entstehens und Vergehens (genesis kai phthöra) ist natürlich auch aristotelisch, ist aber zu allgemein, um an dieser Stelle etwas geradezu Verfälschendes zu besitzen. Dagegen horcht jeder unvermeidlich auf, wenn es im vorhergehenden Satz vom Apeiron heißt, daß aus ihm alle Himmel hervorgehen mit den in ihnen enthaltenen Welten. Um den Satz richtig zu verstehen, muß man zunächst wissen, daß die beiden Schlüsselwörter hier gerade das Gegenteil meinen wie im späte ren Gebrauch: Himmel (ouranös) bedeutet hier gerade nicht den oberen Teil der Welt, sondern diese selbst als ganze. Und das ist nun zugleich etwas ganz Außerordentliches. Bei Anaximander begegnen wir zum er stenmal einer zusammenfassenden Bezeichnung und damit auch einer einheitlichen Vorstellung für die Welt als ganze. Homer besitzt kein Wort für »Welt«, und sie bleibt ihm aufgeteilt in die einzelnen Bereiche der Göt ter: den Himmel (Zeus), das Meer (Poseidon), das nebelige Dunkel (Hades), während Olymp und Erde gemeinsam sind. Auch Hesiod besitzt kein Wort für »Welt«. Er muß sich einer Aufzählung bedienen, um sie zu bezeichnen: Götter, Erde, Flüsse, Meer, Sterne und Himmel (Theog. io8ff.). Auch Thales, soviel wir wissen, hat das Ganze der Welt noch nicht zusammenfassend benennen können. Das kann erst Anaximander. Er gebraucht dafür das Wort ouranos — Himmel, und gebraucht es, zur gründlichen Überraschung des Lesers, im Plural. Nach der Überlieferung hat Anaximander die Existenz unendlich vieler Welten angenommen. Wir wollen gleich hinzufügen: Wenn er es getan hat, so muß ihm ein völlig anderes Welt- und Lebensgefühl zu eigen gewesen sein als allen Menschen bis dahin. Ob er es getan hat, darüber gehen die Meinungen hart ausein ander und werden sich vermutlich auch in Zukunft nicht leicht vereinigen lassen. Die Lehre von der Existenz unendlich vieler Welten im 6. Jh. v. Chr., zu einer Zeit, als man nicht einmal wußte, was Sonne und Mond, geschweige, was die Sterne sind, erscheint vielen so völlig außerhalb aller Denkbarkeit, daß sie sie für ganz indiskutabel halten. Der englische Phi23
losophiehistoriker F. M. Cornford hat gefragt, worauf Anaximander seine Behauptung hätte stützen können, und darauf hingeweisen, daß die Naturerscheinungen schlechterdings nichts umfassen, was eine solche Annahme hätte evozieren können. Es handelt sich auch nicht darum, daß Anaximander die Fixsterne für so viele separate Welten erklärt hätte. Er rechnet sie zu unserer Welt, und zwar — überraschenderweise — zum in nersten Kreis. Die von ihm angenommenen unendlichen Welten sind un sichtbar und rein spekulativ. Ist es glaubhaft? Um den Anstoß zu mildern, hat man vorgebracht, es handele sich nicht um eine unendliche Anzahl koexistenter Welten, sondern um eine unend liche Abfolge sukzessiver Welten. Unsere Welt werde ihr Ende finden und durch eine neue abgelöst werden. Aber die Überlieferung ist ganz unzwei deutig. Anaximander war nur der erste, aber nicht der einzige, der unend lich viele simultane Welten annahm. Das taten auch die Atomisten und das tat auch Epikur. Aber während diese eine ungleiche Verteilung der Welten im All annahmen, lehrte Anaximander, daß die Abstände zwi schen den einzelnen Welten, daß die Intermundien überall gleich seien. Und da, wie wir noch sehen werden, Anaximander sowohl seine Erdkarte wie auch unser Weltsystem ganz symmetrisch konstruierte, so wird die Nachricht über die Intermundien kaum erfunden sein. Sie paßt vielmehr ausgezeichnet zu allem übrigen. Aber wir brauchen hier gar keine Ent scheidung zu fällen und können die Antwort getrost dem Scharfsinn und der Vorliebe unserer Leser überlassen. Es ist ein schöner Anlaß des Nach denkens und bringt vielleicht den einen oder anderen auf noch unent deckte Fährten. Wir möchten nur die Bemerkung anfügen: Wenn Anaxi mander den Gedanken des Unendlichen konsequent dachte, des unend lichen (erfüllten) Raumes und der unendlichen (erfüllten) Zeit, dann ist die Annahme unendlich vieler simultaner Welten eigentlich unvermeid lich. Und daß es Anaximanders Eigenart war, abstrakte Konsequenzen zu ziehen, gegen den Augenschein, das beweist allein schon seine Lehre vom unsichtbaren, nirgends greifbaren und doch allgegenwärtigen Apeiron.
DAS WELTMODELL ANAXIMANDERS Wenn man die Annahme unendlicher Welt kühn findet, so wird man Anaximanders Vorstellung von der Erde nicht weniger kühn finden. Er stellte sich die Erde als eine zylindrische Säulentrommel vor mit einem Durchmesser vom Dreifachen der Höhe. Auf der oberen Fläche leben die
2-4
1
I
Menschen. Dieser Erdzylinder befindet sich ohne Unterstützung frei schwebend in der Mitte unseres Systems. Da er von allem gleich weit ent fernt ist und es daher für ihn keinen Anlaß gibt, sich nach dieser oder jener Seite zu wenden — und da er, wie Aristoteles der Sicherheit halber hinzufügt, keine Möglichkeit hat, sich gleichzeitig nach zwei Seiten zu wenden —, so bleibt er, wo er ist, unverrückt in der Mitte der Welt. Ein kühner, revolutionärer Gedanke, ebenfalls gefaßt gegen allen Augen schein. Er sollte Generationen brauchen, bis er neue Anhänger fand. Un mittelbare Nachfolge fand er nicht. Um diese frei schwebende Erde bewegen sich im Kreise die Gestirne, die Planeten und Fixsterne zuerst, dann der Mond, zuletzt die Sonne. Diese Anordnung ist sehr merkwürdig und eigentlich unverständlich. Haben denn Anaximander und seine Gefolgsleute niemals bemerkt, daß der
t
Abb. j
27fache Erdbreite 18 fache Erdbreite 9fache Erdbreite
i
Das Weltmodell Anaximanders
2-5
Mond bei seiner Wanderung am Himmel Fixsterne bedeckt und nicht umgekehrt? W. Burkert hat 1963 in einem langen Aufsatz im Rheinischen Museum nachzuweisen versucht, daß diese merkwürdige Gestirnfolge auf persischen Einfluß zurückgeht. Der belgische Iranist J. Duchesne-Guillemin begnügt sich mit dem kurzen Hinweis: Asa ist das Lichtprinzip, das sich dort befindet, wo die anderen Texte die »unendlichen Lichter« anset zen, auch Aufenthaltsort der artävan, d. h. der Seligen, oberster Himmel, unterhalb dessen sich staffeln die Himmel des rechten Tuns, des rechten Redens und des rechten Denkens, die — in dieser Folge — mit der Sonne, dem Mond und den Fixsternen identifiziert werden, eine Anordnung, die sich auch bei Anaximander wiederfindet. (Op. Min. III, S. 29) Nur sieht man nicht, wie die historische Verbindung zwischen Anaximander und der persischen Religion zustande gekommen ist. Schwer verständlich ist für uns auch, wie sich nach Anaximanders Ansicht und Lehre die Gestirne gebildet haben und auf welche Weise sie leuchten. Um die zylindrische Erde bildete sich zunächst ein Luftreifen, und um diesen legte sich wie eine Rinde ein Feuerreifen. Luft-und Feuerreifen zer rissen, und es bildete sich eine Anzahl von Ringen, von Feuerringen, ein gehüllt von dichter Luft, so daß das Feuer unsichtbar bleibt. Nur an einer Stelle sieht es heraus, wie aus der Düse eines Blasebalgs. Sonne und Mond haben große Öffnungen, die Sterne, die durch eine Unzahl von Ringen vertreten sind, nur kleine. Wenn sich die Düsen von Sonne und Mond ver stopfen, so gibt es Finsternisse. Im übrigen verändert sich die Düse des Mondes so regelmäßig, daß seine Phasen entstehen. Der Sonnenring hat einen Abstand von der Erde, der das 27 fache des Erd durchmessers beträgt, der Mondring nur einen von 18 Erddurchmessern. Für die Fixsterne und Planeten ist nichts überliefert, außer, daß sie sich innerhalb des Mondrings befinden. Man kann mit einem gewissen Recht annehmen, daß sie einen Abstand von neun Erddurchmessern halten, so daß die für die antike Astronomie wichtige Neunzahl erhalten bleibt. Die Abstände bilden das Ein-, Zwei- und Dreifache von neun. Wir haben in dem oben S. 22 zitierten Satz, daß aus dem Apeiron alle Himmel und die in ihnen befindlichen Welten entstehen, bis jetzt erst Himmel = Welt erklärt. Was aber bedeutet hier Welt (kosmos)? Während Himmel hier die ganze Welt meint, bedeutet Kosmos, im Gegensatz zum späteren Gebrauch, regionale Teilbereiche. Noch Platon und Aristoteles sprechen von den Kosmoi der Elemente. Erde, Wasser, Luft und Feuer haben ihre speziellen Bereiche, die Kosmoi genannt werden. So bezeich nen bei Anaximander die Kosmoi in den Himmeln wahrscheinlich die Teilbereiche für Sonne, Mond und Sterne, genauer, ihre Ringe.
26
So sieht also das Weltmodell des Anaximander aus, für uns ein merkwür diges Gemisch von Rationalität und Irrationalität. Rational die frei schwebende Erde in der Mitte und die arithmetischen Abstände der Gestirnkreise, irrational die Gestalt der Erde und die Entstehung, Struk tur und Funktionsweise der Gestirne. Wie auch immer: die Gedanken von der frei schwebenden Erde und den unendlich vielen Welten waren so kühn, daß Anaximander mit ihnen seiner Zeit weit vorauseilte. Es brauchte viele Generationen, bis er darin Nachfolge fand.
GEOGRAPHIE UND DESZENDENZTHEORIE Anaximander soll sich, wie Thales, auch politisch engagiert haben. Seine Heimatstadt Milet trug den Ehrennamen »Mutter des Pontus«, weil sie — außer vielen Kolonien im Mittelmeer — allein fünfzig an den Küsten des Schwarzen Meeres gegründet haben sollte. Eine von diesen, Apollo nia, wird dem Anaximander zugeschrieben. Der Städtegründer, der sog. Oikist, führte nicht nur die Kolonisten in ihre neue Heimat, verteilte nicht nur das Land und bestimmte den Stadtplan, sondern pflegte der Kolonie auch die Gesetze zu geben. Berühmt bis in späte Zeit war Anaximander als Verfertiger der ersten grie chischen Erdkarte. Detailkarten zur praktischen Verwendung für die Kü stenschiffahrt hatte es auf jeden Fall schon früher gegeben, und seine Karte steht nicht im Zusammenhang etwa mit den unmittelbaren Bedürf nissen für seine Koloniegründung, vielmehr trägt auch sie den unverkenn baren Zug spekulativer Kühnheit. Zum erstenmal versucht es Anaximan der, ein zusammenfassendes Bild von der damals bekannten Erde als gan zer zu geben. Es ist der Entwurf des Anaximander, auf den die nachfol genden Karten des Geographen Hekataios, auch eines Milesiers, und des Geschichtsschreibers Herodot von Halikarnaß zurückgehen. Wir deute ten schon an, daß diese Karte in hohem Grade konstruktiv war und eine weitgehend symmetrische Verteilung von Erdteilen, Flüssen und Meeren annahm. Ganz erstaunlich ist, was Anaximander sich über den Ursprung der Men schen ausgedacht hat. Ursprünglich war die ganze Erde mit Wasser be deckt. Dann ist die Sonne entstanden und hat einen großen Teil dieses Wassers verdunstet. Die Erde trat hervor, und das verbliebene Wasser bil dete das Meer. Am Ende unseres Erdalters wird die Sonne auch das Meer verdampfen, und dann wird »die Notwendigkeit« den ganzen Prozeß wie der umkehren. Da wir nun sehen, daß die kleinen Menschenwesen hilflos
2-7
sind, sich ohne Beistand weder schützen noch ernähren können, sondern eine lange Aufzucht brauchen, so ist klar, daß sie unter solchen Bedingun gen niemals die Urzeit hätten überleben können. Anaximander nimmt daher an, daß die Menschen von den Fischen abstammen und ursprüng lich als Fische aufgewachsen sind, ja, es wird sogar eine ganz bestimmte Fischart genannt, von der er gewußt haben soll, daß sie ihre Jungen ein holt und birgt. Auf diese Einzelheit ist vielleicht nicht viel Verlaß. Aber das Ganze bleibt erstaunlich in höchstem Grade. Diesmal liegt eine wirk liche Beobachtung zugrunde, und aus ihr wird konsequent ein revolutio närer Schluß gezogen, ohne jede Rücksicht darauf, ob er innerhalb der menschlichen Lebenserfahrung vorstellbar und seinen Mitbürgern an nehmbar sein konnte. Wenn man bedenkt, daß Aristoteles alle Tierarten für konstant und auch den Menschen für unvergänglich hielt — »ein Mensch zeugt einen Menschen« —, so kommen uns die über zweihun dert Jahre älteren Ansichten Anaximanders überraschend modern vor. Wir schließen mit einer astronomischen Notiz. Anaximander soll den Gnomon, den Sonnenzeiger, die Sonnensäule, eine Erfindung der Babylo nier, in Griechenland eingeführt haben und darüber hinaus derjenige gewesen sein, der den ersten Gnomon in Sparta aufstellte.
28
Anaximenes von Milet (ca. 585—525 v. Chr.)
Anaximenes, der Mitbürger und Nachfolger des Anaximander, hat sich bei Mit- und Nachwelt durch den Satz unsterblich gemacht: Alles ist Luft. Die wenigen Bibelleser, die es in unseren Tagen noch gibt, werden sich un mittelbar an den Anfang des Buches Kohelet, des Predigers Salomo, erin nert fühlen, wo es heißt: Nichtigkeit der Nichtigkeiten. Es ist alles vergeb lich. Alle Flüsse fließen ins Meer, aber das Meer wird nicht voller davon. Es ist alles vergeblich. Aber eine solche biblische oder moderne Assozia tion ist natürlich anachronistisch. Es ist keine pessimistische Philosophie, die Anaximenes verkündet, sondern eine Kosmologie wie die seiner Vor gänger. Dabei hat er, wie es scheint, zum erstenmal versucht, eine physi kalische, sozusagen naturwissenschaftliche Erklärung zu geben. Das wäre der Punkt, in dem er über Anaximander hinausgelangte. Freilich, wenn man hört, an die Stelle des Apeiron sei bei Anaximenes die Luft ge treten, so will einem das zunächst als ein großer Rückschritt erscheinen. An die Stelle des »philosophischen« Apeiron in seiner ganzen Elastizität und spekulativen Versalität ist wieder, wie bei Thales, ein einzelnes Ele ment getreten, noch dazu eines, dessen Brauchbarkeit nicht von vorn herein einleuchtet. Im ganzen läßt sich nicht bestreiten, daß die milesische Philosophie mit Anaximander ihren Höhepunkt überschritten hat. Ana ximenes hat sogar den Gedanken seines Vorgängers von der frei schwe benden Erde wieder aufgegeben. Die Erde ist bei ihm wieder eine Scheibe, und zwar eine solche, die auf der Luft ruht, von der Luft getragen wird. Dabei stellt er sich das Ganze nun freilich nicht so vor, wie es Aristoteles einmal darstellt, daß die Erde bis an den Rand des Himmelsgewölbes rei che und wie ein Deckel auf der unter ihr eingeschlossenen Luft sitze, die nicht entweichen könne. Es ist vielmehr die unendliche Luftmasse, auf der die Erde ruht. Wenigstens hat er das Prädikat des Apeiron für seine Luft übernommen, und auch göttlich hat er sein Element genannt. Die wichtigste Notiz über Anaximenes ist bei Simplizius erhalten:
Anaximenes von Milet, der Sohn des Eurystratos, Gefährte des Anaxi mander, setzte wie dieser auch seinerseits eine Substanz (Natur: physis) als zugrundeliegend an, und zwar eine unendliche (apeiron), nichtjedoch als unbestimmt (aoriston) wie dieser, sondern als bestimmt, denn er iden tifizierte sie mit der Luft. In ihren Formen aber (katä täs ousias) unter
z9
scheidet sie sich durch Dünnheit und Dichte (manotes kai pyknötes). Ver dünnt werde die Luft Feuer, verdichtet aber Wind, dann Wolke, noch mehr verdichtet Wasser, dann Erde, dann Steine. Alles übrige aber ent stehe aus diesen. Die Bewegung aber setzt auch er als ewig an, durch die auch die Wandlung (der Umschlag: katabole) geschehe. (Simpl. Phys. 24, 26)
Der Bericht nimmt uns etwas das Befremden über die Wahl des Anaximenes. Denn so einleuchtend man das Wasser des Thales und das Apeiron Anaximanders als Ursubstanz finden kann, die beide sozusagen in der Mitte der Aggregate angesiedelt sind, so befremdlich ist die Luft, die sich mit ihrer Leichtigkeit am einen Ende der Skala befindet. Aber der Bericht belehrt uns, daß nicht alles unmittelbar aus Luft besteht, sondern daß sich aus der Luft zuerst die »Elemente« bilden und dann aus diesen die Ein zeldinge. Auch Anaximenes stellt nicht die Frage, woher die Bewegung kommt, auch er setzt sie einfach als ewig an. Ebensowenig fragt er, warum sie im einzelnen Fall zu dieser und jener Formung führt. So ist aus Luft und der ewigen Bewegung auch die Erde entstanden. Anaximenes stellt sie sich als runde flache Scheibe vor, oder genauer, als flache Scheibe mit erhöh tem Rand. Aufgrund ihrer breiten Fläche schwebt sie, mitsamt ihren Mee ren, von denen Anaximenes nicht näher spricht, auf dem unendlichen Luftmeer. Er hat also die ErdvorStellung seines »Lehrers« Anaximander ganz wieder aufgegeben und ist zu der des Thales zurückgekehrt. Uber die Entstehung und Bewegung der Sterne lesen wir:
Die Erde sei flach und schwebe auf der Luft, ebenso aber schwebten auch Sonne, Mond und die übrigen Sterne, die alle aus Feuer bestünden, auf der Luft infolge ihrer Breite. Entstanden aber seien die Sterne aus der Erde, und zwar aus der Feuchtigkeit, die von ihr aufsteige und aus der durch Verdünnung das Feuer entstehe. Aus dem Feuer aber, das in die Höhe steige, bildeten sich die Sterne. (Hippol. Refut. I 7, 4L)
Auffällig ist zunächst, daß hier von der Luft ausschließlich als Medium der Ruhe und Bewegung die Rede ist, aber überhaupt nicht als Stoff und Substanz. Bei der Bildung der Sterne tritt die Luft gar nicht auf. Wir haben die Folge Erde — Ausdünstung (des Meeres) — (himmlisches) Feuer — Sterne. Daß aus der Verdunstung des Meeres Feuer entstehe und sich daraus die Sterne »nähren«, ist eine Vorstellung, der wir noch oft in der frühen Kosmologie begegnen werden. Aus der Beobachtung, daß die 30
Sonne das Wasser zum Verdunsten bringt, schloß man, daß die Sonne — und in Analogie zu ihr auch die Sterne — sich von diesem Dunst nähre. Auch in unseren modernen Sprachen sagen wir ja noch, daß die Sonne »Wasser zieht«. Sonne, Mond und Sterne hat sich Anaximenes ebenso wie die Erde als flache Scheiben vorgestellt, die wie Blätter von der Luft getragen werden. Von der Sonne heißt es einmal ausdrücklich, sie sei flach wie ein Blatt (petalon). Es ist für uns kein überzeugendes Bild und Gleichnis, die ehernen Sterne als in der Luft schwebende Blätter vorgestellt zu sehen. War für die Lands leute des Anaximenes der Vergleich einleuchtender, wenn sie die regel mäßigen Bahnen der Gestirne und die unveränderliche Position der Fix sterne bedachten? Es gibt freilich noch ein ganz anderes, sehr viel ange messeneres Himmelsbild in der doxographischen Überlieferung. Danach soll sich Anaximenes den (blauen) Himmel als eine große Kristallschale aus Eis vorgestellt haben und die Fixsterne als güldene Nägel, an diese Schale geheftet. Ein majestätisches, großartiges Bild, das dem Wunder des Himmels so viel mehr gerecht wird. Aber es ist sehr die Frage, ob wir die ses Himmelsbild, das auch dem Empedokles zugeschrieben wird, schon für Anaximenes in Anspruch nehmen dürfen. Jedenfalls ist es mit dem verläßlich überlieferten Blattgleichnis unvereinbar. Auch bleibt natürlich die physikalische Frage, wie die feurigen Nägel und die Eisschale sich auf die Dauer miteinander vertragen könnten. Anaximenes stellt sich den Himmel nicht wie Anaximander als eine Kugel, sondern nach alter Weise als eine über der Erde gewölbte Halbku gel vor. Das bedeutet zugleich, daß die Sterne keine Kreisbahnen vollzie hen, sondern nach Vollendung ihrer Himmelsbahn horizontal zu ihrem Ausgangspunkt im Osten zurückkehren. Daß es nachts dunkel ist und wir die Sonne nicht sehen, kommt daher, daß der Rand der Erdschale im Nor den zu hohen Gebirgen aufgetürmt ist, hinter denen die Sonne während ihrer Horizontalwanderung für uns verborgen bleibt. Daß wir aber über diesen Bergen nicht einmal einen Schimmer der Sonne bemerken, rührt daher, weil wir so weit von ihnen entfernt sind. Wie Anaximenes die Entstehung der Mondphasen erklärt hat, darüber ist uns nichts überliefert, und auch nichts Definitives über die Abfolge von Sonne, Mond und Sternen. Aber indirekt macht es den Eindruck, als ob er im Unterschied zu Anaximander die richtige Folge Mond — Sonne — Sterne vertreten hat. Wenigstens dies! möchte man ausrufen. So sehr also die Lehre des Anaximenes von pyknösis und araiösis, von Verdichtung und Verdünnung, physikalisch gesehen, einen bedeutenden 3i
Fortschritt in der Welterklärung darstellte, indem sie ein verständliches Prinzip einführte, wo bei seinen Vorgängern nur Unbestimmtheit herrschte, so sehr fällt er in der Kosmologie hinter seinen genialen »Leh rer« Anaximander astronomisch und philosophisch zurück. »Modern« bleibt er vor allem darin, daß er sich nicht mehr auf die Götter beruft. Wenn Anaximenes erklärt, daß sich durch Verdichtung und Verdünnung nicht nur die Qualitäten hart und weich, schwer und leicht, sondern auch kalt und warm ergeben und dafür als Beweis anführt, daß beim Ausatmen mit offenem Mund unser Atem warm, beim Ausatmen mit gespitzten Lip pen der Atem aber kalt ist, so ist auch dies eine so einfache Demonstra tion, daß sie durch die Gegenbeispiele heißer Steine und kalter Luft sofort in Verlegenheit gerät. Anaximenes, von dem wir sonst persönlich überhaupt nichts wissen, soll zur Zeit der Eroberung von Sardes (546) vierzig Jahre alt gewesen und in der 63. Olympiade (528—525) gestorben sein. Als einziges von Anaximenes erhaltenes Zitat wird öfter der Satz an geführt: Wie unsere Seele, die Luft (Atem, Hauch) ist, uns zusammenhält, so schließen Atem (Wind) und Luft die ganze Welt ein. (Aetius I 3, 4) In Wirklichkeit ist die Lehre, daß die Seele den Leib zusammenhält, spät und erst bei den Stoikern zu finden, während der Vergleich zwischen Seele und Welt, also zwischen Mikro- und Makrokosmos erst in der medizini schen Literatur der zweiten Hälfte des 5. Jhs. auftritt. Um ein echtes Zitat kann es sich deshalb auf keinen Fall handeln.
32
•Alles ist Harmonie und Zahl.«
Pythagoras
von
Samos
(ca. 570—500 v. Chr.)
Pythagoras wurde wahrscheinlich um 570 auf Samos geboren. Als 542 Polykrates seine Gewaltherrschaft über die Insel aufrichtete, verließ er aus Pro test gegen die Tyrannis seine Heimat und begab sich nach Unteritalien. Dort gründete er in der Stadt Kroton eine vegetarische Sekte, mit der er eine ernste, religiöse, eben die pythagoreische Lebensweise (pythagöreios btos) führte, deren Grundlage der Glaube an die Seelenwanderung bil dete, eine der wenigen Lehren, die sich mit Sicherheit auf Pythagoras selbst zurückführen lassen. Es war eine Gemeinschaft übrigens, der nicht nur Männer, sondern auch Frauen angehörten. Die Gruppe zog sich schließlich den Unwillen ihrer Mitbürger zu. Als sie mit Gewalt vertrieben wurde, floh Pythagoras in die Nachbarstadt Metapont, wo er seine letzten Lebensjahre verbrachte und wo er auch starb und begraben wurde. Sein Grab war dort noch in später Zeit ein geweihter Ort. Pythagoras wurden für die Zeit vor seiner Niederlassung in Kroton weite Reisen angedichtet. Daß er wenigstens, wie Thales und Solon, in Ägypten gewesen ist, ist zwar möglich, verbürgt ist es nicht. So groß der Name des Pythagoras bei den Griechen der Spätzeit figuriert, so schlecht steht es um die Überlieferung seiner Lehren. Von Pythagoras gibt es keine Fragmente wie von Heraklit, kein Lehrgedicht wie von Parmenides. Nur mündlich hat er sich seinen Anhängern mitgeteilt. Akoúsmata — Hörstücke heißen die von ihm verkündeten Lehren. Schriftlich hat er nichts verfaßt. Außerdem waren seine Anhänger über alles zur Geheimhaltung verpflichtet. Das älteste über ihn erhaltene Zeugnis, das bis in seine eigene Lebenszeit zurückgeht, sind einige Verse des Xenophanes (Fr. 7): Als Pythagoras einmal dazu kam, wie ein kleiner Hund mißhandelt wurde, Habe er Mitleid empfunden und die Wort gesprochen: »Hör’ auf zu schlagen, denn es ist die Seele eines Freundes, Die ich erkannte, als ich ihre Stimme hörte.« 33
Diese kleine Verserzählung, von Xenophanes natürlich satirisch gemeint, ist ein ziemlich wertvolles, nämlich unzweifelhaftes Zeugnis für den See lenwanderungsglauben, auf dessen Verkündigung das Ansehen des Pythagoras vor allem beruht zu haben scheint. In der folgenden Generation spricht Heraklit mehrmals von ihm, und zwar mit großer Verachtung:
Vielwisserei (polymathie) macht nicht vernünftig, sonst hätte sie Hesiod und Pythagoras belehrt und auch Xenophanes und Hekataios. (Fr. 40)
Pythagoras ist der Anführer der Schwindler.
(Fr. 81)
Pythagoras, der Sohn des Mnesarchos, hat am meisten von allen Men schen Erkundung (historie) getrieben, und indem er sich diese Schriften auswählte, schuf er sich daraus eine eigene Weisheit: Vielwisserei und Schwindel. (Fr. 129)
Keine so schmeichelhaften Zeugnisse. Immerhin ist aus dem Vorwurf der Vielwisserei zu entnehmen, daß Pythagoras nicht nur als religiöser Führer auftrat, sondern auch vielfältige Erkundung, modern gesagt: Wissen schaft trieb. Leider wird in keiner Weise angedeutet, welche. Von den Männern des Fragments 40 war nur der Geograph Hekataios ein Mann wirklicher Erkundung, Hesiod und Xenophanes waren Dichter. Was also war Pythagoras? Herodot, um die Mitte des 5. Jhs., erwähnt ihn nur ein einziges Mal und nennt ihn sehr zurückhaltend nicht den schwächsten unter den Weisen (sophistai) der Griechen (Hdt. 4, 95). Platon hatte das größte Interesse an den Lehren der Pythagoreer, aber be fremdlicherweise erwähnt er Pythagoras selbst in den fast drei Dutzend seiner Werke nur ein einziges Mal. Es ist derselbe Anlaß, bei dem auch Thales vorkommt (s. o. S. 20), seine Homerkritik im letzten Buch des Staates (600 B): Wenn Homer schon kein Held im Kriegs- und Staatsleben war, so hat er vielleicht wenigstens eine besondere »homerische Lebens weise« gestiftet, wie z. B. Pythagoras aus diesem Grunde schon zu seinen Lebzeiten ausgezeichnete Anhänger hatte und wie auch jetzt noch seine Nachfolger durch ihre sog. Pythagoreische Lebensordnung hoch angese hen sind. Hier findet also die religiös-praktische Seite seiner Wirksamkeit und die Existenz seines Ordens eine Bestätigung, aber über seine »wissenschaftli chen« Errungenschaften erfahren wir von Platon sowenig ein Wort wie
34
bei Aristoteles. Aristoteles berichtet wiederholt und z. T. relativ ausführ lich von den Pythagoreern und ist für sie überhaupt unsere wichtigste Quelle. Verschiedentlich spricht er von den sogenannten Pythagoreern und setzt damit ihren Titel in Anführungszeichen. Aber nur höchst selten erwähnt er den Namen eines einzelnen Mannes. Pythagoras selbst wird nur zweimal von ihm erwähnt, aber nicht im Zusammenhang mit Fragen »der Wissenschaft«. Andererseits hatte Aristoteles sogar ein eigenes Buch »Über die Pythagoreer« verfaßt, das uns leider nicht erhalten ist. Aber das wenige, was daraus überliefert wird, klingt höchst merkwürdig: Pythago ras tötet eine giftige Schlange durch einen Biß; beim Überqueren des Flus ses Kasas auf der Flucht nach Metapont wird ihm eine himmlische Stimme zuteil; er hat die Fähigkeit, gleichzeitig an zwei Orten zu sein, wurde in Kroton und in Metapont zur gleichen Zeit gesehen; die Krotoniaten halten ihn für den Hyperboreischen Apollon. Also alles Geschich ten, die ihn als Gottesmann und Wundertäter beschreiben. Ja, Aristoteles berichtet, die Pythagoreer hätten drei Arten von vernünftigen Wesen un terschieden: Götter, Menschen und Wesen von der Art des Pythagoras. Es scheint sich bei diesem Buch des Aristoteles um so etwas wie eine Ten denzschrift gehandelt zu haben. Gegen den Versuch der damaligen Pytha goreer, den Stifter zu einem Gründer und Heros der Philosophie hochzu stilisieren, wollte er, scheint es, in Erinnerung bringen, daß er in der ur sprünglichen Überlieferung nur als Wundermann und homo religiosus (theios aner) figurierte. Zweihundert Jahre lang, bis in die Zeit des Aristoteles, ist also von Pytha goras als einem Heros der Wissenschaft, als dem Gründer von Zahlen-, Musik- und Himmelslehre nirgends die Rede. Und es sollte weitere Jahr hunderte dauern, bis (für Numenios von Apamea in der zweiten Hälfte des 2. Jhs. n. Chr.) der »große Pythagoras« die gleiche Bedeutung wie Pla ton annimmt. Doch schon um die Mitte des 2. Jhs. v. Chr. werden in einer anonymen Pythagoras-Biographie Platon und Aristoteles geradezu in die Sukzession der Pythagoreer eingereiht: Platon ist der neunte, Aristoteles der zehnte Nachfolger des Pythagoras. Bleibt nun von den »wissenschaftlichen« Verdiensten des Pythagoras gar nichts? Was ist, wird man vor allem fragen, mit seinem berühmten Lehr satz, der bis heute den europäischen Geometrieunterricht ziert? 1928 hat Otto Neugebauer, einer der ganz wenigen Spezialisten für die Wissen schaftsgeschichte der Keilschriftkultur, zum erstenmal die Vermutung ge äußert, der sog. Lehrsatz des Pythagoras könne in Wirklichkeit eine baby lonische Entdeckung sein, eine Annahme, die sich in der Tat bestätigte: der Lehrsatz war in Babylonien seit Jahrhunderten in praktischem Ge35
brauch. Dem Pythagoras kann also höchstens das Verdienst zukommen, ihn nach Griechenland vermittelt zu haben. Ist ihm denn nicht wenigstens das Verdienst zuzuschreiben, den Beweis dazu geliefert zu haben? Aber was den Babyloniern unerreichbar war, war auch dem Pythagoras un möglich. Der bekannte »Windmühlen«-Beweis, der im Geometrieunter richt so großes ästhetisches und logisches Vergnügen bereitet, stammt erst von Euklid. Es hätte einfachere Beweise gegeben, aber auch sie sind dem Pythagoras nicht wirklich zuzutrauen. Historisch ist nur ein rein fakti scher Umgang mit dem Verhältnissatz anzunehmen. Dabei erhielt natür lich das Dreieck mit den Seitenlängen 3,4 und 5 eine ganz besondere Dig nität. Es war das einzige, bei dem sich das rechtwinklige Dreieck in gan zen Zahlen darstellen ließ. Eine echte Entdeckung des Pythagoras scheint dagegen die Feststellung gewesen zu sein, daß sich harmonische Töne durch Saiten mit Längen im Verhältnis ganzer Zahlen erzeugen lassen. Wenn wir die harmonische Proportion 12 : 8 : 6 nehmen, so ergibt das Verhältnis 12 : 6 oder 2 : 1 die Oktave, 12 : 8 oder 3 : 2 die Quint und 8 : 6 oder 4 : 3 die Quart. (Die Terz ist von den Pythagoreern nicht bestimmt worden.) Es läßt sich unschwer vorstellen, daß die Entdeckung rationaler Zahlenverhältnisse als Gesetze auf einem Gebiet, wo nichts sichtbar, sondern alles nur hörbar ist, wo sich aber die Rationalität des Hörbaren an den Saitenlängen in sichtbaren Proportionen demonstrieren ließ, auf Pythagoras und seine Anhänger den größten Eindruck gemacht haben muß. Man wird sich ohne weiteres zu dem Analogieschluß berechtigt gefühlt haben, was für das Reich der Töne gelte, gelte auch sonst, und konnte so zu dem Glauben kommen: alles sei Harmonie und Zahl. Es kommt hinzu, daß im Griechi schen die Worte Harmonie (harmonía) und Zahl (arithmós) auf ver wandte Wortstämme zurückgehen. Man darf vielleicht sogar annehmen, daß auch die berühmte »Sphären harmonie«, die eine so lange Geschichte in der Entwicklung des europäi schen Geistes haben sollte, schon von Pythagoras selbst gelehrt wurde. Es ist denkbar, daß er das Weltmodell des Anaximander (s. o. S. 25 Abb. 1), der gleiche Abstände zwischen den Ringen von Sternen, Mond und Sonne angenommen hatte, dahin abänderte, daß er die von ihm in der Akustik entdeckten harmonischen Proportionen dafür einsetzte. Der Frage, warum wir die Sphärenmusik nicht wahrnehmen, begegnete man später mit zwei Argumenten. Das eine sagte, dafür sei die mensch liche Natur zu inferior, das andere: Wir hörten die Sphärenmusik nicht, weil wir sie vom ersten Augenblick unseres Lebens an vernähmen. Was man aber dauernd höre, nehme man nicht mehr wahr.
36
Und schließlich wird man auch die berühmte Tetraktys auf Pythagoras selbst zurückführen dürfen. Bei der Tetraktys pflegten die Pythagoreer zu schwören, und da dieser Schwur sprachlich sehr altertümlich ist, so wird auch die Tetraktys selbst ein sehr hohes Alter haben. Die Tetraktys bildet ein gleichseitiges, d. h. beliebig drehbares Zahlendreieck aus den Zahlen 1—4, d. h. mit der Summe 10:
•
• • •
• •
•
•
•
•
Die Zehn galt als eine besondere, vielleicht gar als heilige Zahl, als die Zahl der Vollkommenheit. (Wie bei den Juden zehn erwachsene Männer erforderlich waren, um das synagogale Gebet zu verrichten, so sollten sich auch bei den Pythagoreern zur abendlichen Hauptmahlzeit nach Möglichkeit jeweils zehn Genossen versammeln.) Es wurde darauf hinge wiesen, daß alle Völker bis zehn zählen und dann von neuem beginnen. (In der Tat ist auffällig, daß das Deutsche und Englische bis zwölf zählen und erst dann in die Dezimalzählung einlenken.) Die andere Feststellung war, daß die Zehn die erste Zahl sei, die gleich viele teilbare und unteil bare, Prim- und Normalzahlen umfasse: 4, 6, 8, 9, 10 und 1, 2, 3, 5, 7. Die teilbaren und unteilbaren Zahlen stehen aber in unmittelbarem Zu sammenhang mit den geraden und ungeraden. Nun könnte man es sich vielleicht als eine überraschende und bald in weitere Feststellungen und zu besonderen, u. U. sogar magischen Konsequenzen entwickelte Ent deckung vorstellen, daß im Zahlenreich eine fundamentale Trennung herrsche in Teilbarkeit und Unteilbarkeit. In Wirklichkeit konnte es keine arithmetische Entdeckung des Pythagoras sein, da die alltägliche Praxis seit eh und je mit diesem Phänomen vertraut war. Überall, wo eine Anzahl in zwei Hälften zu teilen war, stellte sich alsbald heraus, ob die Teilung aufging oder nicht. Ungerade heißt auf Griechisch perittos — überzählig, überschüssig, das, wo bei der Teilung eins übrigbleibt. Eine Entdeckung war hier nicht nötig. Aber der Unterschied zwischen gerade und ungerade gewann doch ein Gewicht, das über das Praktische hinausging. Aber das führt uns bereits zu Theoremen, die einer viel späteren Zeit angehören. 37
»Aus Allem Eines und aus Einem Alles.
Heraklit von Ephesus (ca. 540—476 v. Chr.)
Heraklit von Ephesus, eine der größten Gestalten nicht nur der griechi schen Philosophie, sondern der europäischen überhaupt, wurde wahr scheinlich um 540 v. Chr. geboren und ist mit großer Sicherheit erst nach 478 gestorben, da er die Befreiung der kleinasiatischen Griechenstädte von der Perserherrschaft in diesem Jahr noch erlebt zu haben scheint (Fr. 121: Hermodor wurde 478 vertrieben). Im Jahre 546 hatte Kyros d. Gr. das Lyderreich mit der Hauptstadt Sardes erobert und anschließend auch die griechischen Küstenstädte unterworfen. Heraklit verbrachte also Jugendzeit und Mannesalter unter persischer Herrschaft, und zwar unter dem bedeutendsten Herrscher, den die Perser jemals besaßen, unter Darius I. (522—486).
KULTKRITIK Heraklit entstammte einem der ältesten Priestergeschlechter der Stadt, und obwohl die Überlieferung berichtet, er habe das aktive Priesteramt an seinen Bruder abgetreten, so geht doch aus den erhaltenen Fragmenten deutlich hervor, daß Kultfragen sein besonderes Interesse besaßen, ja, es ist stark damit zu rechnen, daß dieses Interesse noch viel reicher bezeugt wäre, wäre uns von seinem Werk mehr erhalten. Für die überlieferten ist jedenfalls bezeichnend, daß sie alle kritisch sind. So lautet z. B. Fragment 5:
Umsonst suchen sie Sühnung (von Blutschuld), indem sie sich mit Blut besudeln, wie wenn einer, der in Schmutz getreten ist, sich mit Schmutz abwaschen wollte. Für verrückt wird man ihn halten, wenn man sieht, daß er dies tut. — Auch zu den Götterbildern dort beten sie, als ob einer mit Mauern redete [wörtl.: mit Häusern] und wüßte nicht, was Götter und Heroen in Wirlichkeit sind.
38
Wir beschäftigen uns zuerst mit dem zweiten Teil dieses Fragments, der Kritik an der Verehrung der leblosen Kultstatuen übt. Es ist damit, wie wenn einer »gegen die Wand redete«, würden wir Deutsch am drastisch sten übersetzen. Menschen, die solchen Kult treiben, wissen gar nicht, was Götter und Heroen eigentlich sind. Es ist nicht auszuschließen, daß diese Kritik am griechischen Kult durch das Erlebnis der persischen Reli gion ausgelöst wurde. Daß die persische Herrschaft, persische Denk- und Lebensweise, Äußerungen einer großen Kulturnation, auf die unterworfe nen Griechen nicht verfehlen konnte, Eindruck zu machen, versteht sich von selbst. Es ist aber in dieser Frage sogar möglich, über eine bloß plau sible Vermutung zu wirklicher Sicherheit zu gelangen, und zwar durch das Zeugnis Herodots, des ersten großen Geschichtsschreibers der Grie chen. Herodot ist etwa zwei Generationen jünger als Heraklit, aber er ist ebenfalls in Kleinasien geboren und aufgewachsen, und zwar in Halikarnaß in Karien, das unter der Herrschaft der Lygdamiden stand, die persi sche Vasallen waren. Einer der meistzitierten Sätze aus dem umfangrei chen Geschichtswerk des Herodot lautet: Homer und Hesiod hätten den Griechen ihre Götter geschaffen (2, 53). Diese Aussage wird gewöhnlich als Kompliment an die beiden Dichter verstanden, die Herodot als die maßgebenden Religionsstifter würdige. In Wirklichkeit meint Herodot das Gegenteil. Nicht nur hat er den allgemeinen Satz formuliert: Non den Göttern wissen — meiner Meinung nach — alle Menschen gleich wenig, sondern es ist seine entschiedene Meinung, daß Homer und Hesiod den Griechen diese ganze blamable anthropomorphe Göttervor stellung und Göttergesellschaft aufgeladen haben. Später ließ die Satire Homer und Hesiod in der Unterwelt für das büßen, was sie über die Göt ter geschrieben hatten. Als großes Vorbild hält er ihnen die Götterver ehrung und Kultpraxis der Perser entgegen: Es ist nicht Sitte bei ihnen, Götterbilder, Tempel und Altäre zu errichten. Wer das tue, sei töricht, sagen sie. Offenbar stellen sie sich die Götter nicht wie die Hellenen als menschenähnliche Wesen vor. Dem Zeus pflegen sie oben auf den Gipfeln der Berge zu opfern, und zwar bezeichnen sie mit dem Namen Zeus das ganze Himmelsgewölbe. Sie opfern auch der Sonne, dem Mond, der Erde, dem Feuer, dem Wasser und den Winden. Das sind ursprünglich die einzigen göttlichen Wesen, denen sie opfern. (1, 131)
Berühmte Sätze eines berühmten Abschnitts. Ausdrücklich wird der Un terschied zu den anthropomorphen Gottesvorstellungen der Griechen hervorgehoben und dann ausgeführt, welche Naturmächte die Perser 39
bildlos verehren. Es ist kein Zweifel, daß Herodot die persische Religion der griechischen für überlegen hält, wie auch aus seiner Äußerung über den ursprünglichen Kult in Dodona hervorgeht (z, 5z). Wir haben hier ein frühes, ausdrückliches und unbezweifelbares Zeugnis über den gro ßen Eindruck, den die persische Religion auf aufgeschlossene Griechen machte. Es ist daher alles andere als abenteuerlich anzunehmen, daß auch Heraklit unter diesem Einfluß stand. Der erste Teil von Fragment 5 kritisiert das blutige Sühneopfer. Wer sich mit Blutschuld beladen hatte, für den war es Brauch, daß er sich mit weite rem Blut, nämlich dem von geopferten Ferkeln, von ihr zu reinigen suchte. Das kommt Heraklit so absurd vor, wie wenn einer, der mit Schlamm be deckt ist, versuchen wollte, sich mit weiterem Schlamm reinzuwaschen. Es wird in Fr. 5 nicht ausgesprochen, aber es liegt durchaus in seiner Kon sequenz, daß Heraklit nicht nur das blutige Sühneopfer, sondern das blu tige Opfer überhaupt als barbarisch abgelehnt hat. Dies aber war eines der entschiedensten Anliegen des persischen Religionsstifters Zarathu stra, die blutigen Opfer abzuschaffen, und seine Gemeinde hat dieses Ver bot immer mit besonderer Strenge eingehalten. Zarathustra stand in ganz der gleichen Front wie die alttestamentlichen Schriftpropheten: Ich habe keine Lust zum Blut der Stiere, Lämmer und Böcke. (Jes. 1, iz) Ich habe Wohlgefallen an der Erkenntnis Gottes und nicht am Opfer. (Jes. 6, 6)
Auch die von Herodot (1, 131) berichtete Ablehnung des Tempelbaus durch die Perser hat eine alttestamentliche Parallele, wo Tritojesaja gegen den Salomonischen Tempel einwendet: Der Himmel ist mein Thron, und die Erde ist meiner Füße Schemel. Was wollt ihr mir denn für ein Haus bauen? (Jes. 66, 1)
Worte, die Stephanus in seiner großen Rede vor dem Hohen Rat wieder holt und sich damit die Steinigung zuzieht (Apg. 7, 47—50). Jahrzehntelang war es eine hart umstrittene Frage, ob die achämenidischen Könige Zarathustra-Anhänger gewesen seien oder nicht. Ganze Ketten von Beweisen und Gegenbeweisen wurden ins Feld geführt. Große Iranisten haben in dieser schwierigen Frage mehr als einmal ihre Position gewechselt. Die Einzelheit, die uns hier besonders betrifft, ist der Wider spruch, daß Zarathustra blutige Opfer strengstens verboten hatte, daß Herodot aber mehrmals berichtet, Xerxes habe Tiere opfern lassen. In40
zwischen konnte die Frage, deren Beantwortung weitgehend Ansichts sache war, definitiv geklärt werden. 1933 und 1934 wurden bei den Ausgrabungen in Persepolis an der Nord ostecke der Palastterrasse mehrere tausend Tontäfelchen gefunden, Doku mente der Palastverwaltung. Sie sind in Elamisch geschrieben, der Muttersprache der persischen Palastschreiber, und genau datiert: 509—494 v. Chr., stammen also aus der Regierungszeit des Darius, der Heraklits Landesherr war. Wegen der Schwierigkeiten der elamischen Sprache wurden die ersten zweitausend Täfelchen erst 1969 veröffentlicht. Sie geben vielfältigen Aufschluß über die achämenidische Hofhaltung. Den religionsgeschichtlichen Ertrag veröffentlichte acht Jahre später Hei demarie Koch, Die religiösen Verhältnisse der Dareioszeit, Wiesbaden 1977. Und zwar geben die Täfelchen über unsere spezielle Frage unzwei deutig Auskunft. Daß die frühen Achämeniden-Könige ausschließlich Verehrer des Ahura Mazda und insofern Anhänger der monotheistischen Verkündigung Zarathustras waren, wußte man schon aus den Königsin schriften. Aus den gefundenen Hofkammertäfelchen geht nun hervor, 1. daß das Opfer für Ahura Mazda das einzige war, für das von der Palast verwaltung regelmäßig Zuteilungen erfolgten, und 2. daß von der Palast verwaltung keine Tiere für das Opfer zugeteilt wurden, sondern aus schließlich Gerste, Früchte, Wein und gelegentlich Bier. Geopfert wurden außer Trankspenden nur Brote und Fladen. Das gilt nun also nachweislich für ein halbes Menschenalter der Regierungszeit des Darius. Es ist zwar damit zu rechnen, daß sich unter Xerxes die strenge Befolgung der Opfer vorschriften Zarathustras lockerte und in einzelnen Fällen, in fremdem Land vielleicht fremder Sitte folgend, wieder Tieropfer vollzogen wurden. Aber für die Regierungszeit des Darius ist die Lage eindeutig und daher unsere Vermutung historisch vollkommen gerechtfertigt, Heraklits Ver dikt gegen blutige Opfer könne durch die Opfervorschriften Zarathustras angeregt sein.
DAS EINE WEISE
Vielleicht das wichtigste und überzeugendste Testimonium für persisches Gedankengut bei Heraklit ist seine Gottesbezeichnung »Das Weise« (tö sophön): Eines, das allein Weise, will nicht und will (doch) mit dem Namen »Zeus« benannt sein. (Fr. 32) 4i
Einsicht ist es, das eine Weise zu verstehen, wie es alles durch und durch lenkt. (Fr. 41, Übers. J. Kerschensteiner)
Wie kommt Heraklit dazu, die Gottheit als das eine (einzige) Weise zu bezeichnen? »Weise« ist kein Epitheton der homerischen Götter. Es wäre sozusagen das Letzte, worauf sie Anspruch machen könnten. (Philolo gisch muß man freilich hinzufügen, daß sophós in früher Zeit weniger »lebensklug« als vielmehr »sachkundig« bedeutet.) Erst bei Platon wer den die Götter als weise bezeichnet (Phaid. 63 B 7). Bei keinem der moder nen Interpreten ist eine Erklärung zu finden. In Wirklichkeit ist sie sehr einfach. Ahura Mazda, die Bezeichnung des höchsten Gottes der Meder und Perser, ist nicht, wie man leicht glauben könnte, ein Name, sondern ein Titel und bedeutet Herr (der) Weisheit. Die persische Religion bot also eine Gottesbezeichnung, die den Philosophen stark ansprechen mußte. Und so ergibt sich auch die ungezwungenste Erklärung, warum das Eine Weise nicht und doch mit dem Namen des höchsten griechischen Gottes benannt sein will.1
DER STEUERNDE BLITZ
In Fr. 32 wird die Gottheit als dasjenige bezeichnet, was alles durch alles (hindurch)steuert (kyberna). Es gibt noch ein zweites Fragment, in dem vom Steuern die Rede ist: Das All aber steuert (oiakizei) der Blitz (Fr. 64). Man versteht hier Blitz als Synonym für Feuer, das nach Heraklit der Ur sprung von allem ist, und bringt als Erklärung vor, Heraklit habe dieses »Bild« der Volksreligion entnommen. Der Blitz sei das Symbol des höch sten Gottes Zeus. Aber das Wort vom steuernden Blitz ist keine Bildrede. Ein großer Teil der Sätze Heraklits läßt sich (nicht immer) klar unterschei den in Gleichnisse und (Lehr)aussagen. Gleichnisse sind z. B. Gegenge spannte Harmonie wie bei Bogen und Leier (Fr. 51); Die Zeit ist ein spie lendes Kind (Fr. 52); Der Weg hinauf und hinab ist ein und derselbe (Fr. 60); Gemeinsam sind Anfang und Ende auf der Kreislinie (Fr. 103); Auch der Mischtrank zersetzt sich, wird er nicht umgerührt (Fr. 125). Aussagen sind z. B. Derselbe ist Hades und Dionysos(Er. 15); Unsichtbare Harmonie ist stärker als sichtbare (Fr. 54); Die Wachenden haben eine ge meinsame Welt. Im Schlaf wendet sich jeder der eigenen zu (Fr. 89); Der Charakter ist dem Menschen sein Schicksal (Fr. 119). Es kann nun kein Zweifel sein, daß es sich bei Fr. 64 um eine Aussage
42
handelt. Dann aber ist der Satz unverständlich, denn Subjekt und Prädi kat, Blitz und steuern gehen nicht zusammen, sondern widersprechen ein ander. Der Blitz ist eine Sache von Sekunden oder Bruchteilen davon, steuern aber eine langdauernde Praxis aufgrund von Geschick und Erfah rung Der Widerspruch wird deutlicher, wenn wir übersetzen Der Blitz führt das Steuer des Alls und vielleicht mit dem Dichter hinzufügen: durch Nacht und Klippen. Das geht nicht zusammen. Im Epos zertrümmert der Blitz das Schiff des Odysseus und das Schiff des Ajax. Er hindert Odysseus nach errungenem Sieg, seine Gegner weiter zu verfolgen (Od. 24,539). Der homerische Blitz trifft Berggipfel, Baumwipfel und Menschen und riecht nach Schwefel (Od. 12, 417), aber er steuert nicht das All. Bei Herodot heißt es an einer berühmten Stelle, die vom Neid der Gottheit redet: Du siehst, wie der Gott seine Blitze immer gegen die höchsten Bauten und die höchsten Bäume richtet. Alles Große pflegt die Gottheit in den Staub zu werfen. Ebenso erliegt auch ein großes Heer einem kleinen, wenn die neidische Gottheit Schrecken im Heer verbreitet oder Blitze schleudert, so daß es elend zugrunde geht. Denn Gott duldet nicht, daß ein Wesen stolz ist, außer ihm selber. (7, 10).
Aristophanes prangert in den Wolken die Absurdität an, daß der Blitz zwar Tempel zertrümmert, aber darauf verzichtet, Bösewichter zu verfol gen. Wir finden also bei den Griechen den Blitz als Symbol des höchsten Gottes und als Instrument des Verderbens, aber die Idee vom steuernden Blitz ist keine griechische Vorstellung. Bei den Persern dagegen ist der Blitz kein momentanes Naturereignis, auch kein Symbol, sondern dasje nige, was (dem Herrscher z. B.) die Feuernatur verleiht. Nur mit dieser Idee als Schlüssel werden Inhalt und Herkunft des Fragments verständ lich. Im griechischen Kontext bleibt es unverständlich.
EWIG LEBENDES FEUER Der Blitz hat uns nun zu einer der Hauptlehren Heraklits geführt, der vom Feuer:
Diese (unsere) Welt(ordnung) hat weder einer der Götter noch einer der Menschen geschaffen, sondern sie war, ist und wird immer sein: ewig lebendes Feuer, in Maßen erglimmend und in Maßen erlöschend. (Fr. 30) 43
Woher nimmt Heraklit seine Lehre oder Idee vom Feuer? Bei W. Brocker, Die Geschichte der Philosophie vor Sokrates (Frankfurt 1965) beginnt das Heraklit-Kapitel mit der schlichten Anknüpfung: Wie bei Thales das Wasser, bei Anaximänder das Unendliche, bei Anaximenes die Luft der Ursprung von allem war, so lehrt auch Heraklit einen solchen elementa ren Weltursprung. Diesmal ist es das Feuer (S.25). Bei U. Hölscher, An fängliches Fragen. Studien zur frühen griechischen Philosophie (Göttg. 1968) lesen wir im Heraklit-Kapitel: Aber wie ist Heraklit darauf gekom men, daß die Welt »Feuer« ist? Das Wasser des Thales, die Luft des Anaxi menes, das Unbegrenzte des Anaximander ließen sich begreifen: als Variationen einer nicht mythologischen Vorstellung vom Ursprung. Aber das Feuer hat unter diesen keinen Platz (S. 158 f.). Da es ihm unmöglich erscheint, die Feuerlehre aus der ionischen Spekulation über den Urstoff herzuleiten, so versucht er eine ganz andere Erklärung und nimmt an, Heraklits Feuerlehre habe ihren Ursprung in seiner »Psychologie«. Er habe die »Feuernatur« der Seele erkannt und diesen Charakter später, also sekundär, auf die Welt übertragen. Das erscheint uns sehr gesucht und als eine Vertauschung des Primären mit dem Sekundären. Viel einfacher und ungezwungener läßt sich Heraklits Feuerlehre aus der persischen Feu erverehrung herleiten. Bei Indern wie Persern spielte das Feuer seit uralten Zeiten die größte kultische Rolle. Der Tag begann mit der Reinigung des Feuers. Allen Heerzügen wurde das heilige Feuer vorausgetragen. Das Staatsfeuer wurde in besonderen Feuertürmen unterhalten, von denen zwei sogar aus achämenidischer Zeit erhalten geblieben sind, ebenso wie einige Altäre. Wir halten es für das Natürlichste und Naheliegendste, den Anstoß Heraklits zu seiner Feuerlehre aus dem Feuerkult und dem Feuer glauben der Perser herzuleiten. Es ist dazu noch einiges nachzutragen, wenn wir Fr. 31 besprechen. Doch zunächst Fr. 30, das wichtigste von allen für unser kosmologisches Thema. Einige wichtige kosmologische Ansichten Heraklits sind ihm unmittelbar zu entnehmen: erstens, daß es nur eine einzige Welt gibt; zweitens, daß diese Welt ohne Anfang und ohne Ende, ungeworden und unvergänglich, ewig ist; drittens, daß ihr Ur sprung ewig lebendes Feuer ist (pyr aeizöon), und zwar viertens Feuer, das in festen Maßen und Proportionen erglimmt und erlischt. Die Frage ist nun: Was haben wir unter diesem heraklitischen Weltfeuer zu verstehen? Hölscher hat natürlich vollkommen recht, wenn er sagt: Das Wasser des Thales, die Luft des Anaximenes und auch das Apeiron Anaximanders bereiten unserem Verstehen keine Schwierigkeit, aber das Feuer ist für uns kein Stoff, »aus dem« etwas be- oder entstehen könnte. Wie können wir dem näherkommen, was Heraklit darunter verstand? Die 44
Interpreten des 20. Jhs. pflegen sich darüber auszuschweigen. Die des 19. haben die materielle Vorstellung entschlossen zurückgedrängt und spre chen ohne Zögern vom Feuer als dem »unmittelbaren Substrat der Bewe gung« oder vom Feuer, das unter verschiedenen Formen die ganze Natur »treibt und belebt«, vom Feuer als der »höchsten und vollkommensten Lebenskraft« oder selbst, ganz zurückhaltend, vom Feuer als einem (nur) »darstellenden Bild« (Schleiermacher). Das letzte ist nun sicher ungenü gend, ja unzutreffend, denn ohne Zweifel ist ja das Feuer bei Heraklit der eigentliche Träger der kosmologischen Prozesse. Ohne Zweifel ist aber auch der Begriff der »Kraft« modern und von Heraklit femzuhalten. Es ist überhaupt keine vernünftige Einrede möglich, daß Heraklit das Feuer stofflich versteht, wie Fr. 31 unzweideutig bezeugt. Weitere Beweise sind, daß bei Empedokles das Feuer neben Erde, Wasser, Luft als viertes Ele ment natürlich stofflich verstanden ist, ja daß noch Platon im Timaios das Feuer als den feinsten und am leichtesten durchdringenden Stoff aus den einfachsten Körpern, den dreiseitigen Pyramiden, konstruiert. Es geht nicht zuletzt daraus unbestreitbar hervor, daß die griechische Philosophie frühestens bei Anaxagoras, endgültig erst bei Platon zum Begriff des un stofflichen Geistes vordrang, während die Begriffe aller Früheren der Vor stellung des Stofflichen und der räumlichen Ausdehnung verhaftet blei ben. Unbestreitbar ist für Heraklit ebenso wie für Empedokles und noch für Platon, Aristoteles und die Stoiker Feuer »eine Art Stoff«. Schwierigkeiten hat den Interpreten von Fr. 30 die Formulierung gemacht, daß diese Welt weder von einem der Götter, noch von einem der Men schen geschaffen sei, denn wer hätte jemals die Idee vertreten, die Welt sei von Menschen geschaffen? Man hat vorgeschlagen, mit der von den Göttern geschaffenen Welt sei der Kosmos, mit der von den Menschen geschaffenen die menschliche Gesellschaft gemeint. Aber abgesehen davon, ob man die Gesellschaft — und vollends in frühgriechischer Zeit — als von Menschen geschaffen bezeichnen würde, krankt diese Aus legung an der Unverträglichkeit, daß das Wort Kosmos in einer einzigen Verwendung zwei ganz verschiedene Bedeutungen annehmen soll. Man kann der ganzen Schwierigkeit durch die Übersetzung aus dem Wege gehen: Diese Welt hat einer der Götter so wenig wie einer der Menschen ge schaffen. Aber auch dann bleibt immer noch die Frage, warum Heraklit den Ge danken der Schöpfung so nachdrücklich abwehrt. Er sagt ja nicht (wie Parmenides), die Welt ist ungeworden und unvergänglich, er sagt aus drücklich, sie ist ungeschaffen. Nach der griechischen Götterlehre hat 45
aber kein Gott die Welt geschaffen, so daß hier die Abwehr des Schöp fungsgedankens gegenstandslos wäre. In charakteristischem Unterschied zum griechischen Weltverständnis war aber der Schöpfungsglaube ein alter und allgemeiner Gedanke der persischen Religion. Ein großer Gott ist Ahura Mazda, der diese Erde hier schuf, der diesen Himmel dort schuf, der den Menschen schuf, der die Glückseligkeit des Menschen schuf,
so beginnt die erste Inschrift von Darius I., dem Landesherm Heraklits, in Naqsh i Rustam. So unverständlich es wäre, Fr. 30 als gegen griechische Religionsvorstellungen gerichtet zu sehen, so einleuchtend ist es, anzu nehmen, daß Heraklit gegenüber dem persischen Schöpfungsglauben die Ewigkeit der Welt betont. Wir sehen damit zugleich, daß Heraklit die per sischen Vorstellungen nicht einfach en bloc übernommen hat, sondern daß wir es mit einer eigenen, originären Lehre zu tun haben.
DER STEHENDE FLUSS
An Fr. 30 schließt Fr. 31 an:
Wendungen des Feuers (pyrös tropai): zuerst Meer, des Meeres eine Hälfte Erde, die andere Glutwind (prest&f . . . Das Meer zerfließt und erfüllt sein Maß nach demselben Verhältnis (lögos), das auch galt, bevor es Erde wurde. Um das kosmische Universalfeuer von der regionalen Feuerzone zu unter scheiden, verwendet Heraklit für die letztere das nicht ganz sicher deut bare Wort prest&c. Fr. 31 erklärt, was in Fr. 30 mit den Worten in Maßen erglimmend und in Maßen erlöschend bezeichnet war: In demselben Maße, in dem sich die »Elemente« in der einen Richtung verwandeln, ver wandeln sie sich auch in der anderen, so daß nicht nur ein stetiger, son dern geradezu ein stehender Fluß sich ergibt. Man könnte den Schluß von C. F. Meyers bekanntem Gedicht »Der römische Brunnen« darauf be ziehen:
46
Und jedes nimmt und gibt zugleich Und strömt und ruht.
Fr. 60 Der Weg hinauf und hinab ist ein und derselbe
wird gewöhnlich auf diese »Wandlung der Elemente« bezogen, obwohl er natürlich auch ein heraklitisches Paradox aus dem alltäglichen Leben meinen kann. Wir haben also nach Heraklit eine dreigestufte Welt: Erde — Wasser — Feuer (prestSrf zwischen deren Stufen ein ständiger Austausch stattfin det. Das Element des Anaximenes, die Luft, fehlt bei Heraklit. Man kann die Frage, ob es sich auch hier um persischen Einfluß handelt, nicht von vornherein abweisen. Ahura Mazda, der höchste persische Gott, war von sechs dienstbaren Geistern umgeben, mit denen zusammen er die heilige Siebenzahl bildet. Diese sechs Amesha Spentas, die Heiligen Unsterblichen, waren nicht aus altüberlieferten Göttergestalten entwickelt, sondern von Zarathustra systematisiert worden. Zugleich waren diesen »abstrakten Mächten« Seinsbereiche und Lebewesen der realen Welt zugeordnet. Zur Raumersparnis setzen wir die Korrespondenz gleich geschlossen her:
Vohu Manu Asha Chshathra Aramati Haurvatat Ameretat
Frommer Sinn Recht, Ordnung, Wahrheit Herrschaft Fromme Gesinnung Gesundheit Unsterblichkeit
Rind Feuer Metall Erde Wasser Pflanzen
Man sieht gleich, daß hier Luft (Wind) fehlt und nur die drei »Elemente« vertreten sind, die auch Heraklit kennt: Feuer, Wasser, Erde. Ob auch die drei restlichen Entsprechungen als systematische Stufen der realen Welt zu verstehen sind: Mineralien (Metall) — Pflanzen — Tiere (Rind), diese Frage ist zu verneinen, denn mit Metall sind nicht Erze, sondern Geräte, Werkzeuge gemeint. Wichtig und bedeutsam ist aber ganz sicher, daß dem Feuer die großen Ordnungsmächte Recht, Ordnung, Wahrheit zuge teilt sind. Dies erinnert unmittelbar an Heraklit, bei dem das Feuer ja nicht nur das All-Element ist, sondern zugleich auch Gesetz (lógos) und Recht (dtke), das für den einzelnen gilt, für die Gesellschaft (den Staat) und die ganze Welt. Die Dike, als Hüterin der Ordnung, wird in mehreren Fragmenten ausdrücklich erwähnt. Hat nun Heraklit die drei »Elemente« als ein geschichtetes Weltgebäude vorgestellt? Darüber ist nichts überliefert, aber man muß es wohl so 47
annehmen, weil sie. ja sonst ohne Zusammenhang blieben und keinen Kosmos bildeten. So hätten wir dann zuunterst die Erde, wahrscheinlich als Scheibe vorgestellt, die das ganze Weltgebäude trägt. Darüber das Meer, das also hier auf der Erde ruht, nicht umgekehrt wie bei Thales, und schließlich das himmlische Feuer, das mit dem Äther gleichzusetzen ist.2 Nicht leicht ist für uns der Widerspruch auszugleichen, daß einerseits »alles« Feuer sein soll, andererseits aber das Feuer auf eine bestimmte Weltregion beschränkt ist. Das gleiche ergibt sich aber auch aus einem anderen wichtigen Fragment über das Feuer, aus Fr. 90:
Alles ist Austausch für Feuer, und Feuer ist Austausch für alles, wie Waren für Gold und Gold für Waren. Es ist natürlich kein Zufall, daß Heraklit als Gleichnis für das Feuer das Gold wählt. Man denkt dabei auch daran, daß die Amtstracht der persi schen Könige reich mit Gold geschmückt war, weil im Herrscher zugleich das göttliche Feuer repräsentiert war. Nach Fr. 90 gibt es also eine konstante Menge Gold, d. h. Feuer, und diese befindet sich in ständigem Austausch gegen Waren, d. h. Wasser und Erde, so daß hier auf andere Weise noch einmal das Bild vom »stehenden Fluß« bestätigt wird. Das ist deswegen von einiger Konsequenz, weil die Stoiker behaupteten, Heraklit habe (wie sie) den Weltenbrand gelehrt, die Ekpyrosis, und weil sich diese Behauptung auch in neueren Heraklit-Dar stellungen immer wieder einmal findet. Die Stoiker faßten das »in Maßen erglimmend und in Maßen erlöschend« zeitlich auf und unterstellten Heraklit die Lehre, daß sich am Ende alles in Feuer auflöse und der Kos mos in einem ungeheuren Weltenbrand untergehe, um sich dann neu zu bilden. Demgegenüber sind die Fragmente 30, 31 und 90 ohne jede Zwei deutigkeit: Heraklit lehrt die Einzigkeit und Ewigkeit der Welt. Wir wer den die Lehre von der Ewigkeit der Welt später bei Aristoteles kennenler nen, der sie mit aller Entschiedenheit vertritt. Sie steht nicht nur im Gegensatz zur persischen, jüdischen und christlichen Schöpfungslehre, sondern vielleicht auch im Gegensatz zu den Voraussetzungen des Philo sophierens. Aber die Erörterung darüber ist erst sinnvoll, wenn wir die Argumentation des Aristoteles im einzelnen kennengelernt haben.
DIE GESTIRNSCHALEN Es ist schon gesagt, daß von Heraklit keine Äußerung über die Gestalt und Suspension der Erde erhalten ist'und daß er sie vermutlich als eine 48
Scheibe angesehen hat, die den Himmel unten abschloß. Daß jedenfalls seine kosmologischen Vorstellungen noch sehr primitiv waren, bezeugt seine Ansicht von den Gestirnen, die in einem Sekundärbericht bei Dioge nes Laertius (IX 9—10) erhalten ist:
Über das Himmelsgewölbe (tö periechon), wie es beschaffen ist, sagt er nichts Genaueres. Doch befinden sich an ihm Schalen (skäphai), die ihre Höhlungen uns zuwenden, in den sich die hellen Ausdünstungen sam meln und Flammen nähren, die die Gestirne darstellen. (10) Am hellsten und wärmsten ist die Flamme der Sonne . . . Verfinsterungen der Sonne und des Mondes treten ein, wenn sich ihre Schalen nach oben wenden. Die monatlichen Phasen des Mondes aber entstehen dadurch, daß sich seine Schale langsam dreht. Die meisten Leser werden verwundert sein, den großen Philosophen eine so primitive Sternkunde vertreten zu sehen. Die Vorstellung von den Gestirnschalen ist in der Tat weder philosophisch noch astronomisch noch kosmologisch, sondern eigentlich poetisch. So hatte schon der Dich ter Mimnermos vorgetragen, daß die Sonne des Nachts in einer von
Abb. 4
Fahrt des Herakles im Sonnenbecher, Rotfig. Vasenbild
49
Hephaistos kunstvoll verfertigten goldenen Barke von den Hesperiden im Westen zu den Äthiopen im Osten über das Wasser getragen werde, wo sie dann erneut ihren Wagen besteige und die nächste Fahrt über den Him mel antrete.za — Merkwürdig ist für uns auch die Vorstellung, daß die Flammen der Gestirne sich von feuchten Ausdünstungen nähren, eine Vorstellung, die wir bereits bei Anaximenes angetroffen haben und die nicht bildlich, sondern als physikalische Erklärung zu verstehen ist. Man würde wohl zuerst an die Öllampe denken, bei der sich die Flamme aus dem aufsteigenden Feuchten nährt. In Wirklichkeit liegt der Vorstellung die meteorologische Beobachtung zugrunde, daß die Sonne stehendes Wasser zum Verdunsten bringt. So glaubte man, die Sonne, und auch die anderen Sterne, nährten sich von diesen Ausdünstungen (vgl. Herodot 2,25). Einige Fragmente sprechen speziell von der Sonne.
Die Sonne ist jeden Tag neu . . . sie entzündet sich und erlischt.
(Fr. 6)
Die Sonne wird ihre Maße nicht überschreiten. Wenn aber doch, werden die Erinyen, die Schergen der Dike, sie aufspüren. (Fr. 94)
Die Sonne hat die Breite eines menschlichen Fußes.
(Fr. 3)
Fr. 94 scheint noch keine eherne Himmelsmechanik vorauszusetzen, son dern damit zu rechnen, daß die Sonne in der Tat einmal die Länge der Tages- oder Jahreszeiten oder auch ihren Abstand von der Erde verändern könnte. Vermutlich ist es aber ein Beispiel für die Allgewalt der Dike, der Rechtsordnung, der sich selbst die Sonne nicht entziehen könnte. Wir schließen mit Fr. 99:
Wenn die Sonne nicht wäre, trotz der übrigen Sterne wäre es Nacht.
»ALLES FLIESST«
Damit sind die kosmologischen Fragmente Heraklits erschöpft. Von den wichtigen, z. T. sehr schwierigen Logos-Fragmenten zu sprechen würde für unser Thema eine allzu große Digression bedeuten. Zu seiner berühm ten Lehre von der Einheit der Gegensätze und der »gegengespannten Har monie« wollen wir hier nur bemerken, daß Heraklit sich auch mit ihr wie
5°
mit seiner Lehre von der Ewigkeit der Welt in direkten Gegensatz zur per sischen Religion setzte. Sie lehrte bekanntlich einen emphatischen Dualis mus, einen fundamentalen Gegensatz von Gut und Böse. Heraklit lehrte die Einheit der Gegensätze. Tag und Nacht, Winter und Sommer, Krieg und Frieden, Sattheit und Hunger, Wohlbefinden und Schmerz sind eins (Fr. 57, 58, 67, 88). Das heißt natürlich nicht, sie sind dasselbe, wie Aristoteles dem Heraklit Ver stöße gegen den Satz vom Widerspruch zur Last legen wollte, sondern das eine ist nicht ohne das andere. Nimmt man die Nacht fort, so ist auch der Tag nicht mehr Tag, und umgekehrt. Das eine ist nur mit und durch das andere. Vollkommen überzeugend sagt Heraklit:
Gäbe es keine Ungerechtigkeit, für die Gerechtigkeit würden wir nicht einmal einen Namen haben. (Fr. 23) Das war seine wichtigste und wirkungsreichste3 Entdeckung, mit der er sich von seinen Vorgängern, aber auch, wir betonen es noch einmal, vom persischen Denken grundlegend unterschied. Wir schließen, obwohl auch dies eine Digression ist, mit einer Anekdote über die sog. Herakliteer, die angeblichen (Schul)nachfolger des Heraklit. Und zwar sind die beiden bekanntesten Sprüche Heraklits, Der Kriegs ist der Vater und König aller Dinge (Fr. 53) und Alles fließt und nichts bleibt,
bisher unerwähnt geblieben. Aber das berühmte Pänta rhei kai ouden menei ist in Wirklichkeit gar kein echtes Heraklitwort, sondern eine nach trägliche späte Zuschreibung. Der Satz findet sich im platonischen Dialog Kratylos (402 A). Daß die Ansicht, daß alles fließt und nichts bleibt, in Wirklichkeit nicht die Lehre Heraklits ist, haben wir zur Genüge gesehen. Es ist zwar alles in Fluß, aber deswegen ist doch nirgends die Stetigkeit aufgehoben. Wir haben zur Verdeutlichung das Bild vom »stehenden Fluß« gebraucht. Es fließt zwar alles, aber so, daß es im ganzen ruht, und es ruht alles, obwohl es immerzu fließt. Das echte Fragment lautet:
Denen, die in dieselben Flüsse steigen, fließt immerzu anderes Wasser entgegen. (Fr. 12) Es ist ein und derselbe Fluß, und die Watenden stehen an ein und dersel ben Stelle, und doch ist es ständig neues Wasser, das sie umfließt. Das 51
Fragment redet nicht von den Watenden, sondern vom Fluß. Es ist ein un zweideutiges Zeugnis für Heraklits Lehre vom »stehenden Fluß«. Erst sekundär hat man das Bild nicht auf den Fluß, sondern auf die Menschen bezogen und damit einen von Heraklit gar nicht gemeinten Perspektiven wechsel vollzogen. In der Sammlung seiner Fragmente wird unter Nr. 49a der Spruch geführt: 'Wir steigen in dieselben Flüsse und steigen (auch wieder) nicht (in diesel ben Flüsse). Wir sind es und sind es nicht.
Das Fragment ist unecht. Doch ist hier immer noch von einer bestehenden Selbigkeit die Rede. Der nächste Schritt ist dann: Man kann nicht zweimal in denselben Fluß steigen, weil nun bereits alles, Fluß und Watende, fließt. Und die anschließende Konsequenz ist natürlich: Man kann nicht einmal e i n m a 1 in denselben Fluß steigen, denn unter dem Steigen ändert sich ja bereits sowohl der Fluß als auch der Badende. Hier heißt es nun also definitiv: Alles fließt und nichts bleibt. Dies war die Lehre des »Herakliteers« Kratylos, der eine Zeitlang der Lehrer Platons gewesen sein soll, von dem er im Dialog Kratylos vorgeführt wird. Aristoteles aber berichtet in der Metaphysik, die Erkenntnis, daß alles fließt, habe schließlich dazu geführt, daß Kratylos am Ende nur noch dagesessen, den Kopf gewiegt und den erhobenen Zeigefinger hin und her bewegt habe. Das sei am Ende seine ganze Philosophie gewesen, anzudeuten, daß sich schlechter dings nichts Bestimmtes aussagen lasse, da alles fließt (Met. T 5, ioioa iz, vgl. auch Kratyl. 429D). So wird also dem Heraklit das berühmte Alles fließt genauso zu Unrecht zugeschrieben wie dem Sokrates das vielzitierte Ich weiß, daß ich nichts weiß. Übrigens nennt Platon die Anhänger des Kratylos nicht etwa »Vertreter der Flußlehre«, sondern ironisch einfach die Fließenden (hoi rhéontes), und in der Tat, es floß ja nicht nur alles um sie herum, sondern es flössen, ihrer eigenen Meinung nach, ja auch sie selbst.
52-
■Dasselbe ist Gedacht-werden und Sein.
Parmenides
von
Elea
(ca. 515-445 v. Chr.)
Von Kleinasien wechseln wir hinüber in den einen der beiden großen griechischen Siedlungsräume im Westen, nach Unteritalien. Die Stadt Elea lag an der Westküste, etwa 40 km südlich von Pästum (beim heutigen Marina di Ascea). Ursprünglich war sie eine Gründung der Kampaner. Als aber nach der Eroberung des Lyderreiches durch die Perser 546 und der anschließenden Unterwerfung der griechischen Küstenstädte ganze Scharen von Griechen ihre Heimat verließen und ihre Freiheit jenseits des Meeres im Westen suchten, wurde sie von den Einwohnern der Stadt Phokäa besetzt und neu gegründet. Das war um 540. Die Stadt erlebte einen außerordentlich schnellen und außerordentlich großen Aufstieg. Man rechnet, daß sie im 5. Jh. die größte und volkreichste griechische Stadt ganz Süditaliens war und nicht weniger als 50 000 Einwohner zählte. Die Stadt ist neuerdings ausgegraben worden, und die teils freigelegten, teils erst sondierten Wohnviertel haben zu dieser Berechnung den Anhalt gege ben. Bei diesen Ausgrabungen sind auch vier Hermen mit griechischen In schriften gefunden worden. Drei trugen die Büsten von Ärzten, die vierte trägt die Inschrift: PA[R]MENEIDES PYRETOS OYLIADES PHYSIKOS
Parmenides, Sohn des Pyres, aus dem Geschlecht der Ouliaden, Physiker. Zwar stammen die Büsten alle erst aus dem 1. Jh. n. Chr. Trotzdem ist die Annahme nicht leichtfertig, daß es sich um eine Ehrensäule für den berühmtesten Bürger der Stadt handelt. Damit würde sich ergeben, daß der große Philosoph mit einer unteritalischen Ärzteschule in Verbindung stand und dem Geschlecht der Ouliaden angehörte, das sich nach dem Heilgott Apollon Oulios benannte. Dieser Zusammenhang ist über raschend, aber zugleich auch erhellend und erklärend für diejenigen Überlieferungen, die Parmenides spezielle medizinische Lehren, ja sogar
53
solche der Embryologie zuschreiben. So soll er über den Ursprung des Menschen gelehrt haben, die Urzeugung, die die ersten Menschen hervor brachte, sei ein Zusammenwirken von Sonne und Schleim gewesen, d. h., aufs Prinzipielle gebracht, ein Zusammenwirken der beiden Parmenideischen Urprinzipien Hitze und Kälte. — Das weibliche Geschlecht hielt Parmenides dem männlichen für überlegen, denn er fand die Frauen hitzi ger als die Männer, und die Hitze hat höheren Rang als die Kälte. Schließ lich wird von ihm eine spezifische Lehre über die Geschlechtsdetermina tion bei der Empfängnis überliefert. Wenn der männliche Same in den rechten Eileiter gelange, so werde es ein Junge, wenn in den linken, ein Mädchen. Offenbar hat Parmenides »nicht nur Begriffe seziert«, bemerkt Ph. Merlan als Fazit so vieler Merkwürdigkeiten. Über die Lebenszeit des Parmenides gab es zwei Überlieferungen. Apollo dor läßt ihn um 540 geboren sein, womit er aber offenbar nur seinen Ein fall vorträgt, die Geburt des Philosophen mit der Geburt seiner Vaterstadt zusammenzulegen. Platon läßt Parmenides um 515—10 geboren sein, aber diese Angabe ist ganz indirekt und ebenfalls fiktiv. Mit größerer Sicherheit ist der Bemerkung Platons zu entnehmen, daß Parmenides ziemlich alt geworden ist, so daß er vielleicht noch nach 450 gelebt hat.
DAS LEHRGEDICHT
Mit dem Übertritt von Ionien nach Unteritalien wechseln wir nicht nur die Weltgegend, sondern finden eine völlig neue »Schule« der Philosophie, eben die eleatische. Die ionischen Naturphilosophen hatten den Ur sprung und die Einheit der Welt in der Hyle, dem Stoff, gesucht: im Was ser, im Unbegrenzten, in Luft und Feuer. Parmenides findet die Einheit des Seins im Logos. Es ist die Philosophie des reinen Gedankens, die Philosophie, die Dialektik und Metaphysik aus sich entlassen sollte. Das Überraschende und für uns in gewisser Weise Ungemäße ist nun, daß der Philosoph, der zum erstenmal die reine Kraft des Denkens praktiziert, seine Wahrheit nicht im eigenen Namen ausspricht, auszusprechen wagt, sondern sie einer Göttin in den Mund legt, die ihm ihre Belehrung, ja, wenn wir so wollen, ihre Einweihung schenkt. Ohne Zweifel spricht sich darin aus, daß Parmenides seine Erkenntnis als eine überwältigende Er fahrung, ja vielleicht geradezu als Erleuchtung empfunden hat. So verläßt er die von den ionischen Philosophen seit Generationen angewandte Form der Prosa und kehrt zurück zur alten Form des Epos, schafft ein Lehrge dicht in Hexametern, unter teilweiser Nachahmung Hesiods. 54
Der Grundgedanke des Parmenides ist wie viele große, revolutionäre Ge danken sehr einfach. Er erkannte, daß im Unterschied zu Qualitätsbe stimmungen wie warm und kalt, hell und dunkel, leicht und schwer die Bestimmung Sein kein Mehr oder Weniger zuläßt. Es kann etwas mehr oder weniger warm oder kalt, hell oder dunkel, leicht oder schwer sein, aber es kann nicht mehr oder weniger seiend sein. Entweder es ist, oder es ist nicht. Sein ist immer volles Sein, oder es ist Nichts. Parmenides for dert nichts weiter von uns, als den Gedanken des Seins konsequent festzu halten, d. h., den Gedanken des Nichts konsequent von ihm fernzuhalten. Dann ergeben sich seine Bestimmungen ganz von selbst. Das Sein ist Eines, ungeteilt und unteilbar, es ist ungegliedert, ein Kontinuum, es ist nicht hier schwächer oder dort stärker, sondern es ist homogen, überall ganz und gleich mit Sein erfüllt, einheitlich. Es war auch nicht, noch wird es sein, denn das schlösse ein Nichts ein: nicht mehr und noch nicht, son dern es ist immer ganz beisammen, ungeworden und ohne Anfang, ohne Ende und unzerstörbar. Und das alles heißt auch und vor allem, das Sein ist unbewegt, d. h. überhaupt unveränderlich, denn jede Veränderung, jedes Anderswerden schlösse die Negation des nicht mehr und noch nicht ein. Melissos hat später die anschauliche Formulierung gefunden:
Wenn es sich, das Sein, in zehntausend Jahren auch nur um ein Haar ver änderte, so würde es in der ganzen Zeit ganz zugrunde gehen (Fr. 7,2).4 Hören wir die Worte des Parmenides selbst. Am Weg der (Seins jerkenntnis stehen viele (Kenn)zeichen, sagt er. Das Sein ist ungeworden und unvergänglich, ganz und einheitlich, unerschütterlich und vollendet. Und es war nicht irgendwann und wird nicht sein, da es jetzt zugleich ganz ist, eins und zusammenhängend. Denn welches Entstehen könntes du für es erfinden? Also muß es entweder ganz und gar sein oder nicht (sein). Entweder es ist, oder es ist nicht. Auch ist es nicht geteilt, denn es ist ein Ganzes, gleichmäßig, nicht hier mehr, was es hindern würde, zusammenzuhängen, oder dort weniger, sondern ist als Ganzes voll von Sein. Darum ist es ein Ganzes, das zusammenhängt: Sein stößt an Sein. Weil aber nun eine Grenze zuäußerst ist, ist es vollkommen von allen Seiten her, wie die Masse eines wohlgerundeten Balles. (Fr. 8, 3—6. ii. 16. 22—25. 43^-)5 55
Parmenides vergleicht zuletzt das Sein mit einer wohlgerundeten Kugel. In Wirklichkeit muß es, so, wie es unzeitlich ist, auch unräumlich sein, denn sonst wäre es ja teilbar. Aber er stellt das Sein unter der Gestalt eines vollkommenen Seienden vor. Sein und Seiendes sind ihm noch nicht ge trennt. Die sog. ontologische Differenz, die Unterscheidung zwischen Sein und Seiendem, ist noch nicht vollzogen, hat sich, wenn man es seinsgeschichtlich formulieren wollte, noch nicht ereignet. Selbst bei Aristote les, wo sie sich inzwischen ereignet hat, wird das Sein noch am Beispiel oder Vorbild des höchsten Seienden exemplifiziert. Ein Mißverständnis ist es, wenn man in der Geschichte der Kosmologie die Seinskugel des Parmenides als Weltkugel versteht oder gar glaubt, ihre Form auch für Parmenides’ Erdvorstellung reklamieren zu können. Die Seinskugel ist ein ontologisches, kein kosmologisches Bild. Mit der Weltkugel hat sie unmittelbar nichts zu tun, und überhaupt nichts mit der Erdkugel. Wir fassen noch einmal zusammen: Das Sein ist Eines, immerseiend, ungeworden und unvergänglich, unveränderlich und unbewegt. Und so kommt es zu dem berühmten Skandalon: Parmenides leugnet die Vielheit der Welt, leugnet Entstehen und Vergehen, leugnet jede Bewegung. Die Philosophie tritt in den striktesten Gegensatz zu unserer täglichen Erfah rung. Zenon hat schließlich seine bekannten Paradoxien erfunden von Achill und der Schildkröte, vom ruhenden Pfeil usw., um die Unmöglich keit der Bewegung zu erweisen. Die Frage lautet, was heißt hier »leug nen«? Schon Simplizius, der große Aristoteles-Kommentator, dem wir die Erhaltung der meisten Parmenides-Fragmente verdanken, hat im 6. Jh. die Bemerkung gerrtacht, es sei dem Parmenides, wenn er das Sein für Eines erklärte, dabei ohne Zweifel bewußt gewesen, daß er selbst entstan den war und daß er zwei Füße besaß. Auch daß sein Lehrgedicht zwei Teile hatte, ist ihm schwerlich verborgen geblieben. Wenn er Vielheit und Be wegung »leugnete«, so erklärte er sie natürlich nicht für überhaupt nicht existent, sonst hätte er ja, wie W. Brocker in seiner direkten Art einmal sagt, wahnsinnig sein müssen.6 Sondern er erklärte sie für Doxa, für Schein und Meinung, für das, was den Menschen nur so vorkommt, was sie nur vermeinen. Wenn man aber dem Denken (noein, noema) folgt, so ergibt sich mit eiserner Notwendigkeit, daß das Sein Eines ist, unverwandt voll gegenwärtig. Das ist die Wahrheit und unverrückbare Wirklichkeit, wie sehr Schein und Meinung auch dagegen streiten. Es ist ganz einfach die Konsequenz des Gedankens, der Parmenides sich anvertraut, aller Gegenschein ficht ihn nicht an, oder genauer, es ist die Göttin, die ihn zu der Entscheidung veranlaßt. In gewisser Weise sagt das deutlich: Es ist eine göttliche, keine menschliche Entscheidung.
56
DIE DOXA Zweimal im Lehrgedicht führt die Göttin Parmenides an den Scheideweg. Beim ersten Mal heißt es: Alles sollst du erfahren, sowohl der glaubwürdigen Wahrheit unerschütterlich Herz, als auch die Meinungen der Sterblichen, denen keine wahre Beglaubigung eignet. Doch sollst du eben auch das erfahren, wie das, was ihnen nur so vorkommt, gültig sein muß, alles ganz und gar durchdringend. (Fr. 8, 28—32) Beim zweiten Mal, am Ende des ersten Teils und zum Abschluß des Erkenntnisweges, verkündet die Göttin: Hier beschließe ich für dich die verläßliche Rede und Einsicht über die Wahrheit. Von hier ab lerne die menschlichen Leermeinungen kennen, wenn du den trügerischen Kranz (kosmos) meiner Worte hörst. (Fr. 8, 50-52)
Die Göttin, die natürlich nicht meint, daß ihre Worte, sondern daß die Phantastereien der Sterblichen trügerisch sind, setzt dann auseinander, unter welcher Konvention die Menschen übereingekommen sind, die Welt zu betrachten. Es sind, schärft die Göttin ein, nichts weiter als Benennun gen. Und zwar ist es der Gegensatz zwischen dem ätherischen Feuer, mild, leicht, sich selbst überall gleich, auf der einen Seite und der finsteren Nacht, dicht und schwer, auf der anderen. Aus diesem Gegensatz sind sie übereingekommen, alles zu erklären: Feuer und Nacht. In Fr. 9 heißt es: Licht und Nacht (phäos kai nyx). Die Göttin sagt nicht: Licht und Fin sternis, oder Tag und Nacht, sondern mit merkwürdiger Verschiebung: Licht (Feuer) und Nacht. Und sie schickt sich nun an, dem Parmenides diese ganze Weltkonstruktion (diäkosmos) menschlichen Wähnens zu erklären, damit niemals eine Aussage von Sterblichen dir überlegen ist. (Fr. 8,61) Hier beginnt nun das Paradox des Parmenides, das in Wahrheit noch viel größer ist als seine Leugnung von Vielheit und Werden, ein Paradox, das wirklich und eigentlich bis heute unverstanden geblieben ist, soviel Scharfsinn Generationen von Philosophen und Philologen auch an seine Auflösung gewandt haben. Das Lehrgedicht des Parmenides umfaßt zwei 57
Teile. Der erste, mit relativer Vollständigkeit erhaltene Teil gibt die grund sätzliche Lehre vom Sein und die Abweisung der Doxa, des menschlichen Meinens und Wähnens. Der zweite, nur in sporadischen Fragmenten er haltene Teil hat die Aufgabe, die Doxa, die der erste Teil verworfen hat, systematisch darzustellen. Wie ist der Widerspruch zu verstehen, daß der Philosoph, der mit eiserner Konsequenz den Wahrheitsanspruch des Seins verkündet hat, sich nun dazu herbeiläßt, systematisch und in ganzem Umfang den Schein darzustellen? Wenn der Schein falsch und überhaupt unwirklich ist, welchen Sinn kann es haben, ihn zu thematisieren, ja ihm, was er von Hause aus nicht hat, sogar die Form eines Systems zu geben? Man hat die verschiedensten Erklärungen vorgebracht. Es sei Doxographie, Bericht über ein fremdes Weltmodell; es sei Polemik, z. B. gegen die Kosmologie der Pythagoreer; es sei Hypothese: wenn man den Schein der Welt diskussionsweise einmal gelten lassen und die Welt als bewegte Viel falt zulassen wollte, so müßte man sie am einleuchtendsten so erklären, mit Licht und Nacht; es sei die Darstellung vom »Sündenfall der Erkennt nis«, oder es sei die Eingliederung des Scheins in das Sein, nicht nach dem pragmatischen Grundsatz: men must obviously come to terms with appearances, sondern als eine umfassende Philosophie des Ganzen, des Umgreifenden. Es ist auch das Licht mit dem Sein, die Nacht mit dem Nichtsein gleichgesetzt worden, um auf diese Weise eine Verbindung zwi schen dem ersten und zweiten Teil herzustellen. Aber das würde die Mei nung des zweiten Teils verfälschen, der zweifellos einen echten Antagonis mus, einen elementaren Gegensatz zwischen Licht und Nacht gemeint hat. Aber das alles müssen wir hier auf sich beruhen lassen und uns dem speziellen Thema unseres Buches zuwenden.
DIE LEHRE VON DEN KRÄNZEN Der große zweite Teil des Lehrgedichts, von dem, wie gesagt, wenig erhal ten ist, war, quantitativ gesehen, der Hauptteil und enthielt eine ausge führte Kosmologie. In der doxographischen Überlieferung stand Parmenides in außerordentlich hohem Ansehen. Man schrieb ihm eine Reihe wichtiger Entdeckungen zu. Er sollte als erster die Kugelgestalt der Erde gelehrt haben, ein Ruhmestitel, den er allerdings mit Pythagoras teilte. Er sollte als erster erkannt haben, daß der Mond kein eigenes Licht besitzt, sondern das der Sonne zurückstrahlt (Fr. 14, 15), eine Entdeckung, die dem Anaxagoras vorbehalten blieb. Ja, er sollte sogar die raffinierte Ent deckung gemacht haben, daß Morgen- und Abendstern identisch sind
58
(Test. 40), eine Erkenntnis, die ein schwer erworbenes Verdienst der Baby lonier war und wahrscheinlich erst um 430 v. Chr. in Griechenland be kannt wurde. Wie sieht die Wirklichkeit aus? Simplizius berichtet, Parmenides habe in seiner Kosmologie die Entstehung des dem Werden und Vergehen Unter worfenen bis herab zu den Einzelteilen der Lebewesen gelehrt (De caelo 559), und in der Tat hatte die Göttin dem Parmenides und damit zugleich seinen Lesern große Versprechungen gemacht:
(Bescheid) wissen sollst du über die Ätherbildung und alle Zeichen (Sternbilder) im Äther und über der reinen klaren Sonnenfackel versengendes Wirken, und woher sie entstanden. Erfahren sollst du den Umlauf des rundäugigen Mondes und seine Bildung. Und wissen sollst du auch, woraus der rings umgebende Himmel sich gebildet und wie Notwendigkeit ihn führt und gebunden hat, die Grenzen der Gestirne zu halten. (Fr. 10) Aber was uns an Fragmenten und Testimonien erhalten ist, führt zu keiner Klarheit. Der ausführlichste Bericht stammt von Aetius.
Parmenides lehrt, es seien Ringe (Kränze, stephänai) einer um den ande ren heruntgelegt, einer aus dem Dünnen, einer aus dem Dichten, und andere, aus Licht und Dunkel gemischt, zwischen diesen. Das alle Um schließende (periechon) aber sei fest wie eine Mauer, und darunter liege ein Feuerring. Fest sei auch die innerste Mitte von allen, und um sie liege ebenfalls ein Feuerring. Und von den gemischten sei der mittlere für alle übrigen Anfang und Ursache der Bewegung und des Werdens, die er auch Göttin Lenkerin und Herrin der Lose nennt, auch Dike und Ananke (Recht und Notwendigkeit). — Eine Abscheidung der Erde sei die Luft, die durch deren kräftigere Pressung herausgeblasen wurde. Dagegen eine Aufhäufung des Feuers seien die Sonne und die Milchstraße. Gemischt aus beiden, Feuer und Luft, sei der Mond. Zu alleroberst liege im Kreise herum der Äther, und unter ihm angeordnet das Feurige, das wir Himmel nennen. Darunter schließlich der irdische Bereich. (Test. 37)
Der Bericht des Aetius umfaßt zwei Teile, die sich, wie man auf den ersten Blick sieht, kaum miteinander vereinbaren lassen. Es kommt hinzu, daß 59
Äther
FIRMAMENT
HIMMEL
^ZZZZZ SONNE
t
T
---------------- MILCH---------------- STRASSE ____ 1____ I Feuer
4-
Feuer u. Luft MOND Luft
t
M
M
ERDE
ERDE
b)
a)
Feuer und Nacht GÖTTIN
Feuer ERDE
c)
Abb. 5 a—c Die Kränze des Parmenides nach den antiken Berichten
60
auch in sich keine der beiden Darstellungen wirklich durchsichtig ist, ja, der erste Teil scheint teils Doppelungen, teils Auslassungen zu enthalten. Eindeutig ist zunächst der Rahmen des Modells. Außen wird es um schlossen von einem Ring, fest wie eine Mauer. Dieses Umschließende (periechon) kann nur das kristallene Firmament sein, das wir aus Anaximenes oder Empedokles kennen, mit dem Unterschied, daß es hier keine Schale, sondern nur ein Reifen ist. Fest ist auch die innerste Mitte, das Zentrum des Modells, das eigentlich mit der Erde identisch sein müßte. Es werden aber in diesem ganzen ersten Teil Himmelskörper überhaupt nicht erwähnt. Unter dem Firmament und über dem Zentrum liegt je ein Feuerring. Irgendwo dazwischen ist ein Ring aus Dunkel (Nacht). Und zwischen diesen Ringen aus Feuer und Nacht sind mehrere, nehmen wir an drei, Ringe aus Feuer und Nacht gemischt (die, zur besseren Übersicht, in der Zeichnung ohne Abstände wiedergegeben sind). Die Frage ist, lie gen die gemischten Kränze oberhalb oder unterhalb des Nachtrings oder — wenn der Bericht flüchtig ist — symmetrisch zu beiden Seiten. Wäre das Modell symmetrisch, so läge der Sitz der herrschenden Göttin, der Dike oder Ananke, im Nachtring, was keine so befremdliche Vorstellung ist, denn im Proömium des Lehrgedichts führt die Wagenfahrt des Parmenides ja zunächst ins Haus der Nacht, wo Dike an der Schwelle von Tag und Nacht die Schlüsselgewalt ausübt. Ist das Modell unsymmetrisch, so residiert die Göttin im mittleren der gemischten Ringe oberhalb oder un terhalb des Nachtkranzes, je nach dem. Daß die Göttin den ganzen Ring ausfüllt, ist nicht anzunehmen. Wird sie also mit ihm herumgeführt? Von Bewegung ist nirgends die Rede. Der zweite Teil des Berichts spricht von der Erde. Ist es ein Parallelbericht oder eine Ergänzung? Man kann ihn nur als Parallelbericht verstehen, denn er spricht ja z. B. auch wieder von der Begrenzung, die das Ganze außen einschließt. Diesmal ist es der Äther, und unter ihm ein Feuerring, der den Himmel darstellen soll und also die Sterne umfassen muß. Das scheint dem Firmament und dem darunter befindlichen Feuerkreis der ersten Darstellung zu entsprechen. In der Mitte ruht die Erde, aber der zweite Feuerkreis kann nicht, wie im ersten Modell, unmittelbar um das Zentrum liegen, denn wir hören, daß die Erde Luft ausscheidet und der Mond ein Gemenge aus Feuer und Luft sei. Zwischen die Erde und den Feuerring kommen also Luft und Mond zu liegen. Der Feuerring seinerseits scheidet Sonne und Milchstraße aus. Man würde dabei natürlich, von der Erde aus gesehen, zuerst die Sonne, dann die Milchstraße ansetzen. Wenn es hier umgekehrt geschieht, so des halb, weil Aetius an einer anderen Stelle berichtet: 61
Parmenides lehrt, daß die Sonne und der Mond aus dem Kreis der Milch straße sich abgeschieden haben, die Sonne aus der dünneren Mischung als dem Heißen, der Mond aus der dichteren als dem Kalten. (Test. 45) Hier geht die Entstehung von Sonne und Mond von der Milchstraße aus. Der Feuerkranz gerät dadurch in eine unsichere Stellung. Aber es ist hier kaum eine andere Lösung denkbar, als daß die heiße Sonne nach oben und der kalte Mond nach unten strebt7. Nun haben wir aber außer den Berichten des Aetius auch noch ein ein schlägiges Fragment, das wie gewöhnlich bei Simplizius überliefert ist: Denn die engeren (Ringe) füllten sich mit ungemischtem Feuer, die folgen den mit Nacht, doch hinein schießt ein Teil Flamme. Inmitten von diesen aber ist die Göttin, die alles lenkt. (Fr. 12)
Die engeren Ringe aus reinem Feuer müssen näher zur Erde liegen. Darauf folgen gemischte Ringe, in deren Mitte die Göttin thront. Es ist eine ganz rudimentäre Darstellung, aus der höchstens so viel zu entnehmen wäre, daß in Abb. 5 a, wenn wir ein asymmetrisches Modell annehmen, die ge mischten Kränze mit der Göttin unterhalb, nicht oberhalb des Nacht kranzes liegen. Interessant ist, was er über das Wirken der Göttin verlauten läßt:
Inmitten von diesen aber ist die Göttin, die alles lenkt. Denn allenthalben führt sie die abscheuliche Geburt und Mischung herbei, indem sie zum Männlichen das Weibliche schickt, daß es sich mische, und umgekehrt zum Weiblichen das Männliche. (Fr. 12) Sie auch, sagt er, sende die Seelen einmal aus dem Sichtbaren ins Unsicht bare, dann wieder den umgekehrten Weg. (Fr. 13) Der englische Philologe J. S. Morrison hat im Journal ofHellenic Studies 75 (1955) eine Kombination aus den verschiedenen Berichten des Aetius zu gewinnen versucht, deren Zeichnung wir hier wiedergeben (a. a. O. S. 63). Er nimmt ein symmetrisches Weltmodell für Parmenides an (vgl. Abb. 6), aber er ordnet die Kränze nicht alle in einer Ebene, sondern in zwei Hemisphären an. Der Reifen des Firmaments bildet den äußeren Ab schluß, den unteren das kleine Firmament, was mit der Angabe die inner ste Mitte nicht harmoniert und wo ja nun auch ein korrespondierender
62
TTVpcbSriS CTTECf
OTEpeOV
Abb. 6 Die Kränze des Parmenides nach J. S. Morrison
Abschluß der oberen Hemisphäre fehlt. Erde (und Luft) bilden nicht das Zentrum, sondern die Mitte der unteren Hemisphäre, eine Anordnung, die keinen astronomischen Sinn ergibt. Aber wir überlassen es dem Leser selbst, sich einen Reim darauf zu machen. Man kann ja auch einmal, statt Schach zu spielen, sich einen Abend in die Kränze des Parmenides ver tiefen. Wir brechen hier ab. Aus den Kränzen des Parmenides ist weder diesseits noch jenseits des Ärmelkanals für die Geschichte der griechischen Kos mologie etwas Einleuchtendes herauszuholen. Wir erfahren nichts von den Umläufen der Gestirne, nichts von ihren Abständen. Von der Eigen art und Zahl der Planeten hatte damals in der ganzen Griechenwelt noch niemand eine Ahnung. Die Überlieferung, er habe eine so vorausset zungsreiche Entdeckung wie die der Identität von Morgen- und Abend-
Stern gemacht, ist völlig anachronistisch. Seine Lehre von Sitz und Wirken der Göttin verharrt in Mythologemen. Wir hätten die »Kosmologie« des Parmenides übergangen wie die des Xenophanes, wenn der »Vater Parme nides«, wie Platon ihn halb ironisch, halb respektvoll nennt, nicht eine so überragende Gestalt und von so außerordentlicher Wirkung in der vor platonischen Philosophie gewesen wäre. Wenn seine Kosmologie etwas lehrt, dann dies, daß der »Fortschritt« der Wissenschaft nicht geradlinig verläuft, daß er nicht nur Umwege, sondern selbst Rückschritte macht, daß geniale Ideen wie die des Anaximander verkannt oder wieder verges sen werden. Im ganzen darf man — wir haben es schon bei Herklit gese hen, — die Weltvorstellungen der frühen Philosophen nicht über schätzen.
64
•Alles hat Bewußtsein und Anteil am Denken.
Empedokles von Agrigent (492—432 v. Chr.)
In der Kultur- und Religionsgeschichte kommt der Zahl Vier eine beson dere Bedeutung zu, die die der anderen »magischen« Zahlen Drei, Sieben, Zwölf, vielleicht sogar noch übertrifft. Der natürliche Ausgang liegt bei den vier Himmelsrichtungen, dem Schema der elementaren Orientierung, bei den vier Phasen des Mondes mit der zugehörigen Wocheneinteilung und bei den vier Jahreszeiten. Als nächstes denkt man wohl an die vier Elemente: Erde, Wasser, Luft und Feuer, die in Poetik und Metaphorik bis heute als die Repräsentanten alles Materiellen gelten. Die vier Ele mente sind Kombinationen der vier Grundqualitäten warm und kalt, feucht und trocken. Wie sie Zusammenhängen, zeigt das Schema auf S. 127. Es folgen die vier Temperamente: Choleriker und Phlegmatiker, Sanguiniker und Melancholiker, die durch die Säftelehre der antiken Medizin systematisiert sind. Weiter denkt man an die vier Ursachen des Aristoteles: Stoff-, Form-, Zweck- und Bewegungsursache, obwohl der aristotelischen Ursachenlehre natürlich Sachanalyse, keine Zahlenspeku lation zugrunde liegt. Und reiner historischer Zufall ist es, daß es in hellenistischer Zeit vier große Philosophenschulen gab: Platoniker, Aristoteliker, Stoiker und Epikuräer. Der Sophist Hippias hatte eine Folge von vier Wissenschaften aufgestellt: Arithmetik, Geometrie, Astronomie und Musiklehre, die als Propädeutik zur Philosophie in die platonische Akademie eingingen und noch im Quadrivium des Mittelalters fortlebten. Von großer Wirkungsgeschichte war auch die Lehre von den vier Kardinaltugenden: Einsicht, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Mäßigung. Wir sehen schon an den bisherigen Beispielen, daß die Zahl Vier jeweils ein elementares Ordnungsschema aufstellt, dem gleichzeitig Vollständig keit zukommt. Und in dieser Funktion hat die Vier große Bedeutung auch für das Urchristentum und die frühe Kirche erlangt. So ist es alles andere als Zufall, daß der neutestamentliche Kanon gerade vier Evangelien um faßt. Ihnen entsprechen die vier Evangelistensymbole: Mensch, Löwe, 65
Stier und Adler, die bekanntlich aus der Berufungsvision des Propheten Ezechiel stammen (Ez. i) und von den christlichen Kirchenvätern, zum erstenmal wahrscheinlich von Tertullian, auf die Evangelisten übertragen wurden. Die vier apokalyptischen Wesen der Ezechiel-Vision finden einen Nachklang in den vier apokalyptischen Reitern der Offenbarung Johan nis, und mit der alttestamentlichen Engellehre hängt es zusammen, daß die christliche Angelologie vier Erzengel kennt: Michael, Gabriel, Raphael und Uriel, alle mit einer der alttestamentlichen Gottesbezeich nungen im Namen. Historische Entwicklungen und Zusammenhänge haben dazu geführt, daß es in der Kirchengeschichte vier ursprüngliche Patriarchate gibt: Jeru salem, Antiochia, Alexandria und Rom. Alle anderen sind später und nicht von gleichem Ansehen. Ohne Zweifel hat das Viererschema auch eine wichtige Rolle dabei gespielt, daß sowohl die griechische wie die lateinische Kirche je vier Kirchenväter kennt, die in besonderer Weise als Lehrer der Kirche (Doctores ecclesiae) gelten: Athanasius, Basilius d. Gr., Chrysostomus und Gregor von Nazianz in der griechischen, Ambrosius, Augustin, Gregor d. Gr. und Hieronymus in der römischen Kirche. Auch in der antiken Geschichtskonstruktion spielt die Zahl Vier ihre Rolle. Hesiod kennt ursprünglich vier Weltalter: das goldene, silberne, eherne und eiserne. Das Heroenzeitalter ist nachträglich eingefügt. Die selbe Folge findet sich im Buch des Propheten Daniel (Dan. 2), die die An regung zur Geschichtskonstruktion Augustins gegeben hat. Im Leben des einzelnen entspricht der Lehre von den vier Weltaltern das Schema von den vier Lebensaltern. Die Bedeutung der Ordnungszahl Vier für sehr verschiedene, weit ge streute Bereiche ist mit den obigen Beispielen ausreichend, wenn auch sicher nicht vollständig belegt, und mancher Leser wird weitere Zeugnisse kennen oder finden. Wir müssen uns nach dieser Vorerinnerung unserem eigentlichen Thema zuwenden. Empedokles von Agrigent ist es gewesen, der zuerst die folgenreiche Lehre von den vier Elementen aufgestellt hat. Von zwei Schriften des Empedokles sind Reste auf uns gekommen, von seinen Reinigungen (Katharmoi) und von seiner Schrift Über die Natur. Das sachliche und zeitliche Verhältnis dieser beiden Werke zueinander, die sehr disparat sind, ist umstritten. Von den erhaltenen 153 Fragmenten läßt sich nur ungefähr ein Sechstel sicher zu weisen, die meisten bleiben in ihrer Herkunft unbestimmt. Empedokles schrieb wie Parmenides in Hexametern, aber im Unterschied zu ihm stand er noch in einer lebendi gen epischen Tradition. In seiner Jugend soll er auch Tragödien verfaßt haben. Aristoteles schrieb ihm die Erfindung der Rhetorik zu, und Gor-
66
gias, der berühmte sophistische Redner, der ebenfalls aus Sizilien stammte, galt als sein Schüler. Die beiden überlieferten Schriften sollen ursprünglich 5oooVerse umfaßt haben, was wahrscheinlich aus 3000 verschrieben ist, von denen ca. 2000 auf die Naturlehre in zwei Büchern und 1000 auf die Reinigungen in einem Buch entfielen. Erhalten geblieben sind im ganzen ca. 450 Verse, mehr Text als von jedem anderen Vorsokratiker. Die Reinigungen handelten von der Wiederverkörperung und von den Weisen, wie man den Strafen und dem Abstieg entgeht. Empedokles lehrte wie Pythagoras die Seelenwanderung, und zwar gehen die gefalle nen Seelen oder Dämonen nicht nur in Menschen, sondern auch in Tiere und Pflanzen ein. Von sich selbst sagt er: Denn ich wurde schon einmal als Junge und Mädchen, als Strauch und Vogel und als stummer, aus dem Meer auftauchender Fisch geboren. (Fr. 117) (Bei der Geburt) weinte und jammerte ich, den unbekannten Ort er blickend, den freudlosen Ort, wo Mord und Hader und Scharen anderer Unglücksgeister und ausdörrende Krankheiten und Fäulnisse und das Wirken des Rheumas auf der Wiese des Unheils im Düster hin und her schweifen. (Fr. 118 und 12,1) Dieser Klage über das Jammertal tritt als Kontrastprogramm die Beschrei bung des Goldenen Zeitalters gegenüber (Fr. 128,130), von dem es im ein zelnen heißt: und der Altar dampfte nicht vom heiligen Stierblut. Dies war den Men schen vielmehr der schlimmste Greuel, das Leben zu rauben und die gött lichen Glieder zu verspeisen. Eine der obersten Regeln, um dem Abstieg zu entgehen, ist, sich des Fleischgenusses zu enthalten und damit die Gefahr zu vermeiden, eine eingekörperte Seele zu töten und zu essen, Anthropophagie zu üben. Mit makabren Versen hat Empedokles diese Gefahr seinen Zeitgenossen zu Bewußtsein gebracht: Wollt ihr nicht (endlich) ablassen von dem mißtönenden Schlachten! Be greift ihr denn nicht, daß ihr euch gegenseitig verschlingt in der Gedan kenlosigkeit eures Sinnes! (Fr. 136)
Den eigenen Sohn in verwandelter Gestalt hebt der Vater (zum Opfer) empor und schlachtet ihn unter Gebeten. Verblendeter Tor!. . . Ebenso ergreift der Sohn seinen Vater, die Kinder ihre Mutter, entreißen ihnen das Leben und verzehren das verwandte Fleisch. (Fr. 137) 67
Es ist auch der Anfang des Gedichts erhalten. Er lautet so: Freunde, die ihr die große Stadt am gelben Fluß Akragas bewohnt, oben auf ihrer Höhe, ihr geschäftigen Vollbringer trefflicher Werke, ehrenvolle Zuflucht für Fremde, unerfahren in Bosheit, seid gegrüßt. Ich wandle unter euch als unsterblicher Gott, nicht als Sterblicher mehr, von allen gebührend geehrt, mit Tänien gekrönt und grünenden Kränzen. Wo immer ich mit meinen Anhängern, Männern und Frauen, in die blühen den Städte komme, werde ich verehrt. Sie folgen mir, unendliche Scharen, fragen, was der Weg einbringt. Die einen suchen Orakel, die anderen ein heilbringendes Wort in vielfacher Krankheit, lange schon von schweren Schmerzen gequält. (Fr. 112) Wir bekommen eine Anschauung davon, wie Empedokles auftrat: als Orakelpriester und Wunderheiler mit großem Gefolge. Als Kleidung soll er ein purpurnes Gewand mit goldenem Gürtel und bronzene Sandalen getragen haben. Ja, er ließ sich, wie auch andere Fragmente bezeugen, von seinen Anhängern als Gott verehren, was keine Prahlerei, sondern bei den alten Griechen im Ernst möglich war, ungewöhnlich nur in so früher Zeit. Das ist also der thaumaturgische Heiligenschein des Empedokles. Aber er hat sich auch politisch betätigt. Geboren ist er wahrscheinlich 462 v. Chr. als Bürger der bedeutenden, durch ihre vielen Tempel noch heute berühmten sizilischen Stadt Akragas (Agrigent), und zwar entstammte er einer wohlhabenden, einflußreichen Familie. Sein Großvater, nach dem er benannt war, hatte in der 71. Olym piade (496 v. Chr.) den ruhmvollen Sieg im Wagenrennen davongetragen. Aber seine politischen Unternehmungen, demokratische, wie es heißt, trafen auf harten Widerstand. Empedokles mußte die Heimat verlassen. Er verbrachte seine letzte Lebenszeit im Exil auf dem Peloponnes, wo er auch starb. Aristoteles schreibt ihm eine Lebenszeit von sechzig Jahren zu. Von seinen Anhängern wurde sein Tod glorifiziert. Die eine, bekanntere Version besagt, er sei in den Krater des Ätna gesprungen, um sich zu ver gotten, die andere, er sei in der Nacht durch eine göttliche Stimme und eine überirdische Lichterscheinung in den Himmel aufgenommen wor den.
LIEBE UND STREIT Empedokles’ Gedicht Über die Natur steht in Auseinandersetzung mit dem Lehrgedicht des Parmenides. Es erkennt die Ewigkeit, Unentstan-
68
denheit und Unvergänglichkeit des Seienden an, aber es will nicht die Vielfalt und Wandelbarkeit der Welt bestreiten. An die Stelle des eleatischen unverwandten Seins treten die vier Elemente, die zwar eine Vielzahl bilden, aber jedes für sich ungeworden und unvergänglich UND unwan delbar sind. Sie können sich auch nicht ineinander verwandeln, sie kön nen sich nur miteinander mischen, um dadurch den ganzen Reichtum der Welt hervorzubringen. Den Ausdruck Elemente (stoicheia) kennt Empe dokles noch nicht, er gebraucht das Wort rhizömata — Wurzelstämme: Die vier Wurzeln aller Dinge höre zuerst: den strahlenden Zeus und die lebenspendende Hera, dann Aidoneus (Hades) und Nestis, deren Tränen den Menschen Quellwasser spenden. (Fr. 6) Sicher zu identifizieren sind zunächst nur Zeus als Feuer und Nestis, eine sizilische Lokalgöttin, als Wasser. Aber man wird die lebenspendende Hera nicht als Luft bezeichnen können, und so bleibt diese dem finsteren Hades, wie es auch homerischer und hesiodeischer Auffassung entspricht (s. o. S. 23). Nicht ohne Bedeutung ist natürlich, daß Empedokles seine Elemente in mythologischem Gewand einführt: sie sind göttlich. Der naturwissenschaftliche Grundgedanke ist aber klar: Es gibt zwar Verän derung, aber Entstehen und Vergehen sind nur scheinbar, sie sind in Wirklichkeit nur Mischung und Entmischung der unwandelbaren Elemente. Gegen Parmenides verteidigt Empedokles die Wirklichkeit der Bewegung, aber er hält an dessen These fest, daß das Leere undenkbar und nicht seiend ist, ein sinn- und bestandloses Nichts. Die Bewegung geschieht also nicht im Leeren, sondern im Vollen, durch Verdrängung. Eines tritt an die Stelle des anderen. Der spätere Fachausdruck dafür heißt antiperistasis, was soviel heißt wie fortlaufende Erhaltung des Ausgleichs. Das Musterbeispiel ist das Schwimmen des Fisches im Wasser. Was setzt nun die Mischung und Entmischung der Elemente in Gang? Auch hier gibt Empedokles eine mythologische Antwort: Es sind die bei den Mächte Philotes (Harmonia, Aphrodite) — Liebe und Neikos — Streit. Die Liebe führt zueinander, vereinigt, der Streit spaltet und trennt. Aristoteles bemerkt ausdrücklich, Empedokles sei nicht nur der erste ge wesen, der die vier Elemente als Materialursachen angegeben habe, son dern auch der erste, der nach der Bewegungsursache fragte, während seine Vorgänger (die Eleaten natürlich ausgenommen) die Bewegung immer als mit dem Urstoff unmittelbar mitgegeben ansahen. 69
Aber es wäre ganz anachronistisch, wenn wir uns Liebe und Streit nun als »Kräfte« vorstellen würden, oder vielleicht als »Beweggründe«, die die Elemente »motivierten«. Von der Zeit, wo auch unkörperliches Seiendes denkbar wird, sind wir noch um einige Jahrzehnte entfernt. Seiend sein heißt für Empedokles noch körperlich, ausgedehnt sein. Liebe und Streit können nur wirken, indem sie die Elemente durchdringen, also wo sie körperlich anwesend sind, so daß es einmal geradezu heißt, die Liebe sei mit den Elementen gleich an Länge und Breite. Aristoteles gibt mit den Begriffen seiner Ursachenlehre die Erklärung, Empedokles habe in der Philia Bewegungs- und Materialursache miteinander vermengt: Er macht sie zur Bewegungsursache, denn sie führt zusammen, und zur Stoff ursache, denn sie ist ein Teil des Gemischs (Met. A io, 1075b 3E). Wir haben im ganzen also eigentlich sechs materielle Faktoren, vier passive und zwei aktive. Denn obwohl Liebe und Streit im Unterschied zu den Elementen unsichtbar sind, so sind sie in Wirklichkeit doch nur unend lich fein, bleiben aber körperlich. Ohne räumliche Ausdehnung ist noch kein Seiendes vorstellbar.
DIE WELTENTSTEHUNG Die Elemente sind ungeworden, die Welt ist es nicht. Empedokles läßt sie entstehen aus einem Anfangszustand, in dem die Liebe die Alleinherr schaft führt, wo die Elemente vollständig miteinander vermischt sind. Dieser Urzustand mit seiner völligen Durchmischung gleicht zwar nicht dem Chaos, aber doch unverkennbar dem Apeiron des Anaximander und dem Homoü pän, dem Alles zusammen des Anaxagoras. Empedokles selbst nennt ihn Sphairos — Ball, Kugel, ohne Zweifel im Anklang an die Seinskugel des Parmenides. Die Elemente sind völlig miteinander vermischt. Eine solch totale Durch dringung legt natürlich den Gedanken an eine sehr weitgehende Kleintei lung nahe, und in der Tat gibt es Zeugnisse, die darauf hindeuten, daß die Atomtheorie sich ankündigt. Aber dieser Gedanke wurde abgedrängt durch die ganz andere Erklärung, die Empedokles der Mischung gab. Er verstand darunter nicht ein Gemenge kleiner und kleinster Teile bis herab vielleicht zur Konstitution der Pulverisierung, sondern eine wirkliche Durchdringung, und zwar mit Hilfe von Öffnungen, Durchgängen: poroi, Poren. Und die einzelnen Stoffe haben jeweils spezifische, ganz ver schiedene Poren, solche, die zueinander passen, und solche, die das nicht tun. Daß Wasser sich mit Wein vermischt, mit Öl aber nicht, rührt daher,
70
daß die Poren von Wasser und Wein miteinander harmonieren, die von Wasser und Öl dagegen nicht. Empedokles suchte die Mischung auch quantitativ zu beschreiben, zu bestimmen, wenn wir wollen. So sind z. B. Knochen gemischt aus 4 Teilen Feuer und je 2 Teilen Wasser und Erde (Fr. 96), während Blut aus allen vier Elementen gleichmäßig gemischt ist i: i : i : i (Fr. 98). Die Gedankenkonstruktion des Empedokles sucht also auch die quantitativen Verhältnisse zu beschreiben, was die Atom theorie des Demokrit z. B. nicht tut. Im Sphairos sind also alle Elemente vollkommen gleichmäßig miteinan der vermischt, und zwar dadurch, daß das Ganze vollkommen gleichmä ßig von der Liebe durchdrungen ist, die eben diese totale Vermengung be wirkt. Neikos, der Streit, ist ganz nach außen abgedrängt an die Periphe rie. Und nun beginnt der Neikos ins Innere vorzudringen und die Philia zurückzudrängen. Dabei werden die Elemente getrennt. Schon Aristoteles hat bemerkt, daß dieses Trennen des Neikos gleichzeitig ein Sammeln ist. Denn indem es die Mischung trennt, vereint es zugleich die einzelnen Ele mente. Und wenn der Streit die Oberhand gewonnen und die Liebe ganz ins Zentrum zurückgedrängt hat, so besteht statt einer völligen Durch mischung nun eine vollkommen gleichmäßige Schichtung der Elemente. In der Mitte ruht die Erde, darum schließt sich das Wasser, es folgt die Schale des Feuers und zuletzt die der Luft. Nun beginnt die Liebe wieder vorzudringen und den Streit zu verdrängen. Die Liebe verbindet nun die Elemente zu organischen Formen, und es entstehen Pflanzen, Tiere und Menschen, unsere belebte Welt. Rückt die Vermischung weiter vor, so nimmt sie, umschlagend, die Wirkung der Trennung an, die organischen Gestaltungen werden aufgelöst zugunsten einer gleichförmigen Mischung aller Teile, bis am Ende der Urzustand des Sphairos wieder erreicht ist. Es scheint also, daß wir vier Phasen vor uns haben: eine Phase der voll ständigen Durchmischung unter Oberherrschaft der Liebe, eine Phase die stationär ist. Dann eine Phase der Entmischung, eine Phase des Kampfes zwischen Liebe und Streit. Diese Phase endet mit dem Sieg des Streites und einer völligen Entmischung und konzentrischen Schichtung der Ele mente. Sie steht unter der uneingeschränkten Vorherrschaft des Streites. Es erfolgt eine neue Phase des Kampfes. Die Liebe dringt vor und bildet aus den getrennten Elementen organische Gestaltungen, bis diese durch immer weitere Vermischung der Elemente aufgelöst werden. Am Ende steht wieder der Sphairos mit der alles vermengenden Vorherrschaft der Liebe. Es sind im ganzen vier Phasen, zwei stationäre und zwei gegenläu fige. Oder auch nur drei, wenn man Bedenken hat, der Vorherrschaft des
7i
Streites Dauer zuzuschreiben und sie lieber nur als ein kurzlebiges Durch gangsstadium ansieht, nach dessen Erreichung sofort die Gegenbewe gung einsetzt. Der Streit, sozusagen mit sich selbst uneins, kann nicht dauern. Wie auch immer, in diesen drei oder vier Phasen nimmt die Ge stalt unserer Welt nur eine sehr begrenzte Dauer ein, höchstens die Hälfte einer Periode, d. h. nur ein Sechstel oder ein Achtel des Ganzen, je nach dem. Dann kehrt das Ganze an seinen Anfang zurück und beginnt, in ewigem Kreislauf, den nächsten Zyklus. Aber stellen diese vier Phasen und ihre ewige Wiederholung wirklich die empedokleische Weltordnung dar? Die englischen Standardwerke Kirk/Raven, The Presocratic Philosophen und W. K. C. Guthrie, A History ofGreek Philosophy Bd. II halten daran fest und berufen sich vor allem auf Fr. 17 und 26. Aber auf deutscher Seite hatte schon 1912 H. v. Arnim in der Festschrift für Th. Gomperz gegen diese Konstruktion Stel lung genommen, und neuerdings haben zwei große deutsche Philologen die Frage kritisch wiederaufgenommen, beide im gleichen Jahr (1965), Fr. Solmsen in der Zeitschrift Phronesis, U. Hölscher im Hermes. Sie erken nen keine vier Phasen, die sich unendlich wiederholen, sondern nur eine einmalige, zusammenhängende Weltbildung an. Hölscher möchte die Entstehung der Lebewesen in die Phase des vordringenden Streites setzen, aber die erhaltenen Texte lassen keinen Zweifel, daß Empedokles die Ent stehung der Lebewesen ausschließlich dem Wirken der Liebe zuschreibt, wie es auch biologisch allein einleuchtend ist. Wir können also mit gutem Recht bei unserer oben gegebenen Beschreibung bleiben, die mit Solmsens Ansicht übereinstimmt. Aus der uranfänglichen Mischung sondert der Streit die Elemente, und aus einem Teil von ihnen bildet die Liebe die Lebewesen. W. Brocker hat versucht, auch die Lehre vom Goldenen Zeit alter (Fr. 128 und 130), die wir o. S. 67 schon erwähnten, in diese Entwick lung einzuordnen. Im Goldenen Zeitalter erreichte die Herrschaft der Liebe ihren Höhepunkt, danach beginnt das Vordringen des Streites, und es entsteht unsere Welt mit Hader und Totschlag, Unglück und Krankheit, wie sie in Fr. 121 drastisch beschrieben ist (s. o. S. 67). Es ist also unhistorisch, bei Empedokles eine zyklische Weltvorstellung anzunehmen, eine periodische Wiederkehr des Entstehens und Vergehens unserer Welt, obwohl er schon von Aristoteles und dessen Kommentato ren und von den antiken Doxographen immer so verstanden wurde. Empe dokles beschreibt nur einen Weltprozeß, die Entstehung aus dem gleich förmigen Urzustand, die Sonderung und Gliederung durch Liebe und Streit, die sich bis zu unserer jetzigen Welt fortgesetzt hat und unvermeid lich unter den schlimmen Auspizien des Verfalls und Untergangs steht. 72-
Die Beschreibung einer Kreisbewegung in den problematischen Fragmen ten 17 und 26 meint nach Ansicht der genannten deutschen Interpreten keinen Kreislauf der Welt selbst, sondern das periodische Geschehen — Entstehen und Vergehen, Geburt und Tod — innerhalb der Welt. Im übrigen hat das Welt- und Erdmodell des Empedokles keinen Raum mehr für den Hades. Seine Antwort lautet: Der Hades, das ist diese unsere Welt.
DAS WELTMODELL Wie sieht nun das kosmologische Modell des Empedokles aus? Wir haben schon gehört, daß in der Mitte die Erde ruht, die vom Wasser um geben ist, darüber folgt die Schicht des Feuers, dann die der Luft. Die Rei henfolge der beiden äußeren Elemente hat Empedokles also umgekehrt. Offenbar nahm er an, daß Luft leichter ist als Feuer. Er stellt sich nun vor, daß die Welt von einer festen kristallinen Kugelschale eingeschlossen ist, deren Entstehung er damit erklärt, daß das Feuer die äußerste Luft schicht zum Erstarren gebracht habe. Um diese befremdliche Erklärung, die dem, was die Erfahrung über die Wirkung von Feuer auf Luft lehrt, direkt entgegengesetzt ist, plausibel zu machen, hat man darauf verwie sen, daß nicht kalte, aber heiße Quellen Sinterschichten ablagern und daß Empedokles vielleicht hiervon einen Analogieschluß auf die Luft gemacht habe. Überzeugend klingt das nicht. Wir wissen nicht, was und woran Empedokles wirklich gedacht hat. Die Fixsterne sind an diese äußere Himmelsschale geheftet, die Planeten bewegen sich frei. Innerhalb des Firmaments haben sich nun zwei Hemi sphären gebildet, indem Luft und Feuer ihre Schichtung aufgegeben haben. Vielmehr hat sich in der einen Hälfte, die nun warm und hell leuchtend ist, fast das ganze Feuer angesammelt, während in der kalten, dunklen Hälfte die Masse der Luft mit nur wenig Feuer vermischt ist. Diese Ver lagerung hebt das Gleichgewicht auf, und die beiden Hemisphären begin nen, sich zu drehen. Die Rotation war zuerst sehr langsam, jetzt vollendet sie sich innerhalb eines Tages, m. a. W., die Umdrehung der beiden Hemi sphären liefert die Erklärung für den Wechsel von Tag und Nacht. Steht die Feuerhalbkugel über der Erde, so ist es Tag, kommt die Lufthalbkugel, so wird es Nacht. Dabei ist die Abgrenzung der beiden Hemisphären nicht fix und konstant, vielmehr dehnt sich in periodischem Wechsel die Feuerhalbkugel auf einen Teil der Lufthalbkugel aus und umgekehrt. Wächst der Bereich des Feuers, so werden die Tage länger, und der Som
73
mer tritt ein, wächst der Bereich der Luft, so werden die Tage kürzer, und der Winter übernimmt das Regiment. Und die Sonne? — wird jeder stau nend fragen. Ja, die wäre nun in der Tat sehr viel unwichtiger als der Mond, da sie am Tage scheint, wo es ohnedies hell ist. Die Nachrichten über Empedokles’ Vorstellung von der Sonne sind, wie es infolge seiner Hemisphärenlehre gar nicht anders sein kann, teils konfus, teils wider sprüchlich. Es gibt eine Überlieferung, die erklärt, die Sonne sei kein wirkliches Gestirn mit eigenem Licht und Wärme, sie sei nichts anderes als ein Reflex der Erde, die das auf sie strahlende Himmelslicht gebündelt an den Himmel zurückwerfe. Wenn Empedokles das wirklich gelehrt hat, so ist es kaum anders zu verstehen, als daß er die Erkenntnis von den Lichtverhältnissen des Mondes auf die Sonne übertrug. Nun ist zwar die Entdeckung vom indirekten Licht des Mondes unstreitig dem Anaxagoras zuzuschreiben, aber da er ca. zehn Jahre älter war als Empedokles, hätte dieser seine Entdeckung wohl übernehmen und auf die Sonne über tragen können. Ein Bericht des Aetius spricht davon, Empedokles habe die Existenz zweier Sonnen gelehrt, aber seine Darstellung ist so konfus und undurch sichtig, daß noch niemand etwas Vernünftiges daraus hat machen kön nen. Wahrscheinlich hat Aetius in der Überlieferung zwei einander wider sprechende Sonnenbilder vorgefunden, die er dann, statt sich zu entschei den, ungeschickt und erfolglos versuchte, miteinander zu vereinigen. Die andere Überlieferung war die, daß Empedokles die Sonne ganz normal als einen selbständigen und selbstleuchtenden Himmelskörper ansah. Nur diese Annahme ist eigentlich möglich, und sie hat ihre stärkste Stütze in Empedokles’ Weltmodell. Er erklärte, die Sonne sei doppelt so groß wie der Mond und sie halte auch einen Abstand, der doppelt so groß sei wie der des Mondes von der Erde. Diese Symmetrie im Verhältnis i : z macht nur Sinn, wenn die Sonne nicht ein Reflex, sondern ein wirklicher Himmelskörper ist. Sonne, Mond und Sterne werden von dem Wirbel, der aus der Ungleich heit der Hemisphären entstanden ist und die ganze Welt um die Erde krei sen läßt, mitgeführt, und zwar um so langsamer, je näher sie zur Erde ste hen. Dadurch kommt es, daß der Mond gegenüber der Sonne und die Sonne gegenüber den Sternen am Himmel (relativ zu den Zeichen des Tierkreises) zurückbleibt. Die Frage, was die Erde im Mittelpunkt der Welt festhalte, so daß sie nicht aus der Mitte herausfalle, beantwortet Empedokles nicht mit der genialen Auskunft Anaximanders: das nach allen Seiten bestehende Gleichge wicht, sondern durch Hinweis auf den Wirbel. Der Wirbel hält die Erde 74
in ihrer Mittellage fest. Da die Erde aber selbst ruht, so ist nicht recht zu verstehen wie, und auch Aristoteles’ Beispiel vom Wasser, das in einer Schale geschleudert wird, ohne dabei herauszufallen, hilft nicht weiter, da die Erde ja gerade nicht geschleudert wird. So finden wir im einzelnen viele Unklarheiten in der Überlieferung über das Weltmodell des Empedokles, die die Befremdlichkeiten z. T. noch steigern. — Von großer naturphilosophischer Bedeutung ist seine Er kenntnis vom ambivalenten, widersprüchlichen Charakter der Natur. Den Gegensatz von Hervorbringen und Vernichten, von Schenken und Berauben, von Schönheit und Grausamkeit hat er mit Philia und Neikos zum erstenmal formuliert. Die größte Wirkung aber hat er mit seiner Lehre von den vier Elementen erzielt, die durch Aristoteles für viele Jahr hunderte kanonisch wurde und die uns noch heute als poetische oder emblematische Chiffre für alles Materielle, vielfach aber auch als übergrei fendes Ordnungsschema für die großen Bereiche der Natur vertraut ist.
75
•Auch ins Verborgene geben die Phänomene Einblick.
Anaxagoras
von
Klazomenai
(um 500—428 v. Chr.) Angeklagt, die Jugend zu verführen, nicht an die Staatsgötter zu glauben und zu versuchen, die himmlischen Dinge zu erforschen, verteidigt sich Sokrates gegen den letzten Vorwurf mit der Versicherung, er glaube an die Göttlichkeit von Sonne und Mond. Daß die Sonne ein glühender Stein sei und der Mond Erde, das hätten die jungen Leute nicht von ihm, son dern von Anaxagoras, dessen Buch sich jeder für eine Drachme auf dem Markt kaufen könne (Plat. Apol. 26D). — Die Stelle liefert die erste Notiz über antiken Buchhandel, die uns erhalten ist. Die Rolle des Anaxa goras war in keiner Weise billig, im Gegensatz zur Meinung vieler Erklä rer, die bei einem so geringen Preis annehmen, das Buch müsse ziemlich klein gewesen sein. Eine Drachme war damals der Tagelohn eines Stein metzen, und zu der Zeit, als Platon den Dialog Gorgias schrieb, um 390, zehn Jahre nach der Verurteilung des Sokrates, konnte man für zwei Drachmen von Athen nach Ägypten oder ins Schwarze Meer segeln (Gorg. 511E). Man kann also nicht ohne weiteres sagen, das Buch sei bil lig gewesen. Es begann mit dem vielzitierten Satz: Alle Dinge waren (am Anfang) zusammen, unendlich sowohl an Menge wie Kleinheit, denn auch das Kleine war unendlich. Und solange alles zu sammen war, war nichts unterscheidbar (endelon) infolge seiner Klein heit. Denn Luft und Äther hielten alles nieder, die beide unendlich sind. Denn sie sind das Größte, was in der Mischung aller Dinge enthalten ist, sowohl an Menge wie an Größe. (Fr. 1)
Ein Urbild von der Urmischung, die am Anfang war. Man denkt an die Urflut, von der der erste Vers der Genesis spricht. Der moderne Mensch denkt an die kosmischen Gaswolken, in denen es noch keine getrennten Elemente gibt. Die Philologen erinnern an den Vers des Parmenides, wo es von dem Einen einzigen Seienden heißt:
Es war nicht irgendwann und wird nicht irgendwann sein, da es jetzt ganz zusammen ist, Eines, zusammenhängend (ungetrennt). (Fr. 8, 5) 76
In beiden Fragmenten hat das »zusammen« (homoü) großen Nachdruck. Aber in allen übrigen Bestimmungen gehen die Lehren kraß auseinander. Parmenides spricht von dem EINEN und betont seine Endlichkeit und Homogenität. Anaxagoras spricht von den VIELEN SEIENDEN und betont ihre Unendlichkeit und vollkommene Mischung. Parmenides be tont die bleibende, unverwandte GEGENWÄRTIGKEIT des Seins. Anaxagoras spricht vom ANFANG, da alles zusammen war, was es nicht immer bleiben wird. Parmenides spricht vom SEIN, Anaxagoras vom WERDEN. Man kann nicht gut daran zweifeln, daß Anaxagoras mit dem ersten Satz die Gegenposition eröffnet. Bevor sich aber irgendetwas abschied von dem allen, was da zusammen war, war nicht einmal irgendeine Farbe wahrnehmbar (éndelon). Das ver hinderte ja die Mischung alles Seienden, des Feuchten und des Trockenen, des Warmen und des Kalten, des Hellen und des Dunklen und die viele Erde, die darin war, und die Menge der Samen, unendlich an Zahl und keiner dem anderen gleich. Denn auch von den anderen Seienden glich keines dem anderen in irgendetwas. Da es sich hiermit so verhält, so müs sen wir annehmen, daß, in dem Ganzen (sympan) alles Seiende darin ist. (Fr. 4, 2. Hälfte)
Dieser unendlichen, ungeschiedenen Urmischung steht nun der Nous, der Geist, gegenüber, der seinerseits rein, von allem ungemischt bleibt. Es ist das erste Mal in der griechischen Philosophiegeschichte, daß der Geist als eigenes Prinzip auftritt. Der Logos des Heraklit war noch mit dem ewig-lebenden Feuer identisch. Empedokles hatte Liebe und Streit, Philia und Neikos, aus der menschlichen Motivation übernommen und als Bewegungsprinzip eingesetzt. Bei Anaxagoras ist es zum ersten Mal der Geist selbst, der genannt wird. Alles übrige hat Anteil an allem, der Geist aber ist unendlich und be stimmt sich selbst und ist mit gar nichts gemischt, sondern ist allein, ganz für sich. Denn wenn er nichtfür sich wäre, sondern mit irgendetwas ande rem gemischt, so hätte er an allen Dingen teil, wenn er mit irgendetwas gemischt wäre. Denn in allem ist ein Teil von allem enthalten, wie wir schon sagten. Auch würde ihn das Beigemischte hindern, über irgend etwas die Herrschaft so auszuüben, wie wenn er allein, bei sich selbst ist. Denn er ist das Feinste und Reinste von allem Seienden und hat jegliche Kenntnis von allem und besitzt die größte Kraft. Und alles, was Seele hat, das Große wie das Kleine, über alles führt der Geist die Herrschaft. Auch 77
über die gesamte Umdrehung (perichöresis) hat der Geist die Herrschaft ergriffen, so daß er dieser Umdrehung den Anstoß gab. Und zuerst be gann es von einem kleinen (Punkt') aus sich zu drehen, und greift weiter aus, und wird weiter ausgreifen. Und das Gemischte und das sich Abson dernde und Trennende, alles erkannte der Geist. Und wie es werden sollte und wie es war, was jetzt nicht (mehr) ist, und alles, was jetzt ist und wie es sein wird, alles ordnete der Geist, auch die Umdrehung, die jetzt die Sterne, die Sonne und der Mond vollziehen und die Luft und der Äther, die sich absondern. Eben diese Umdrehung aber bewirkte die Sonderung. Und es sondert sich vom Dünnen das Dicke, vom Kalten das Warme, vom Dunklen das Helle, vom Feuchten das Trockene. Dabei gibt es von allem fwörtl.: von vielem) viele Teile. Vollständig aber sondert und trennt sich nichts voneinander, außer dem Geist. Der Geist aber ganz von gleicher Art, der große wie der kleine. Von allem anderen aber ist nichts dem ande ren gleich, sondern wovon (in einem Seienden) das meiste darin ist, als solches ist und war es jeweils unterschieden und wahrnehmbar (endelötataj. (Fr. 12.) Das Fragment formuliert eine eindrucksvolle kosmogonische Vorstel lung, durchaus der vergleichbar, mit der die Genesis beginnt: Der Geist Gottes schwebt über der Urflut und scheidet dann Licht und Finsternis, Wasser und Wasser, Meer und Land. So ist es auch der Geist des Anaxagoras, der die gleichförmige Mischung des Alls in Bewegung setzt, an einer einzelnen Stelle beginnend und dann immer weiter ausgreifend. Und im Laufe und infolge der Umdrehung sondern sich dann die Dinge und arti kuliert sich die Welt. Am großartigsten aber manifestiert sich die bewe gende, umwälzende Macht des Geistes in den Kreisbahnen der Gestirne. Aus welchem Grunde aber der Geist sein Antriebswerk beginnt, das be antwortet Anaxagoras nicht. Wir erfahren nur, daß der Geist der große Motor ist, das Warum und Wie bleibt unerklärt. Der Geist gibt eigentlich nur einen Anstoß. Einmal in Gang gesetzt, nehmen der Umschwung und die Weltbildung ihren automatischen Fortgang. So sehr Anaxagoras versucht, den Nous als reines Bewegungsprinzip — von aller Mischung — zu isolieren, sowenig ist er doch noch imstande, ihn rein geistig aufzufassen. Der Nous ist zwar allgegenwärtig und allwis send, aber er ist doch nur das Feinste und Reinste von allem Körperlichen. Ohne körperliche Ausdehnung ist ihm noch kein Seiendes denkbar. Einmal in Gang gesetzt, wird die Weltbildung durch zwei Gesetze zur Vollendung gebracht. Das eine besagt, daß sich in allem, soweit man es auch teilt, immer etwas von allem befindet. Das andere ist, daß sich Glei ches zu Gleichem gesellt.
78
Zu dem Satz »In allem ein Teil von allem« scheint Anaxagoras speziell durch das Phänomen der Ernährung inspiriert worden zu sein. Unsere Nahrung kann höchst einfach sein, Wasser und Brot, aber daraus bilden sich Haare, Adern, Nerven, Fleisch und Knochen und alles übrige. Und das erscheint ihm nur möglich und verständlich, wenn das, was sich da bildet, in der Nahrung schon vorhanden war. Das besagt seine Lehre von den Homoiomerien, der Gleichartigkeit aller Teile. Wie weit man auch teilt, es bleibt in allem immer etwas von allem. Man hat zur Illustration das Beispiel der Mischung von Zucker und Sand herangezogen, aber es trifft nicht wirklich zu, denn man gelangt bei der Trennung ja schließlich zu dem einzelnen Sand- und Zuckerkörn. Etwas besser ist schon die Mischung von Wasser und Wein. Der springende Punkt aber ist, auch wenn man die Teilung ins Unendliche fortsetzt, bleibt immer ein Anteil von Allem, nicht nur von Wasser und Wein, sondern von allen organi schen und anorganischen Stoffen insgesamt. Die einzige Verlagerung, die geschieht, ist, daß sich durch die Absonderung in einzelnen Stoffmengen besondere Anteile akkumulieren. Solche Anhäufungen nennt Anaxagoras Samen — spérmata (vgl. Fr. i). Sie werden unterscheid- und wahrnehm bar und benannt nach ihrem Hauptanteil. Es ist also nirgends in der Welt, wie Anaxagoras in Fr. 8 sagt, das Warme vom Kalten oder das Kalte vom Warmen mit der Axt abgetrennt. Aber wo sich das Dichte, Feuchte, Kalte und Dunkle akkumulieren, da entsteht Erde, und wo sich das Lockere, Warme, Trockene (und Helle) konzentrieren, da bildet sich Äther (Fr. 15). Aristoteles bemerkt ausdrücklich, daß Anaxagoras mit dem Äther das Feuer bezeichnete. Die beiden folgenden Fragmente lauten: Vom diesen (den genannten vier Qualitäten), wenn sie sich absondern, verfestigt sich die Erde. Denn aus den Wolken sondert sich Wasser ab, aus dem Wasser aber Erde, aus der Erde aber verfestigen sich Steine infolge des Kalten. (Fr. 16)
Vom Entstehen und Vergehen aber haben die Griechen keine richtige An sicht. Denn kein Seiendes (chrema) entsteht oder vergeht, sondern aus Seiendem mischt es sich und sondert es sich. So sollten sie Entstehen rich tiger Sich-mischen und Vergehen richtiger Sich-sondern nennen. (Fr. 17)
Über das Weltbild des Anaxagoras ist ein anschaulicher Bericht beim Kir chenvater Hippolyt erhalten: Die Erde, meint er, sei von flacher Gestalt und bleibe freischwebend wegen ihrer Größe, und weil es kein Leeres gebe, und weil die Luft, die 79
sehr stark sei, die auf ihr treibende Erde trage. (4) Von den Gewässern auf der Erde stamme das Meer aus dem Wasser in der Erde, aus dem, als es verdunstete, das Seiende entstanden sei, und aus den ins Meer strömen den Flüssen. (5) Die Flüsse aber verdankten ihr Dasein sowohl dem Regen als auch dem Wasser in der Erde. Denn sie sei hohl und habe in den Höh lungen Wasser. . . (6) Sonne aber und Mond und alle Sterne seien feurige Steine, die der Umlauf des Äthers mit sich führe. Unterhalb der Sterne gebe es von Sonne und Mond mitgeführte Himmelskörper, die uns un sichtbar seien. (7) Die Hitze der Sterne aber sei uns nicht wahrnehmbar, weil sie so weit von der Erde entfernt seien. Auch seien sie nicht so heiß wie die Sonne, weil sie einer kälteren Region angehörten. Der Mond aber befinde sich unterhalb der Sonne, näher zu uns. (8) Die Sonne aber über treffe an Größe den Peloponnes. Der Mond aber habe kein eigenes Licht, sondern (empfange es) von der Sonne. Der Umlauf der Sterne führe unter der Erde durch. (9) Die Mondfinsternisse aber träten infolge Beschattung (des Mondes) durch die Erde ein, aber manchmal auch durch die Him melskörper unterhalb des Mondes. Sonnenfinsternisse träten ein durch Schattenwurf des Neumonds. . . . (10) Er war der Ansicht, daß der Mond aus Erde bestehe und daß es Ebenen und Schluchten auf ihm gebe. (Hippol. Refut. I 8, 3—10) Ein auffälliger Zug dieses mit so dankenswerter Ausführlichkeit berichte ten Weltmodells ist der starke, in gewisser Weise unverständliche Wider spruch zwischen der primitiven Erdvorstellung und der richtigen Erklä rung der Verfinsterungen. Daß der Mond nicht selbst leuchte, sondern sein Licht von der Sonne empfange, sollen vor Anaxagoras schon mehrere andere Philosophen entdeckt haben, aber erst bei ihm ist diese Erkenntnis wirklich glaubhaft. Ob die Behauptung, daß die Sonne größer sei als der Peloponnes, seinen Zeitgenossen günstigen oder ungünstigen Eindruck gemacht hat, ist nicht überliefert, für seine Erklärung aber, die Sonne sei ein glühender Stein und der Mond Erde, klagten die Athener ihn der Gottlosigkeit an, so daß er es vorzog, nach Kleinasien zurückzukehren. Anaxagoras stammte aus Klazömenai, das an der Südküste des Golfs von Smyrna gelegen war und neuerdings von türkischen Archäologen freige legt wird. Dort ist er wahrscheinlich um 500 v. Chr. geboren. Schon mit zwanzig Jahren soll er nach Athen gekommen und dann dreißig Jahre dort geblieben sein. 428 sei er in Lampsakos gestorben, wohin er sich nach sei ner Flucht aus Athen zurückgezogen hatte. Der Asebieprozeß scheint um 450 gegen ihn angestrengt worden zu sein. Es gab darüber zwei Versionen. Nach der einen klagte Kleon ihn der Gottlosigkeit an. Nachdem aber
80
Perikies, sein Freund und Schüler, ihn vor Gericht verteidigt habe, sei er zu einer Geldstrafe von fünf Talenten (= 130 kg Silber) verurteilt und exi liert worden. Nach der anderen wurde der Prozeß von Thukydides ange strengt, der damit indirekt seinen politischen Gegner Perikies treffen wollte. Die Anklage erfolgte nicht nur wegen Gottlosigkeit, sondern auch wegen Medismus, d. h. wegen Parteinahme und Agitation für die Perser. Anaxagoras sei in Abwesenheit zum Tode verurteilt worden. Ein glimpf lich abgelaufenes Vorspiel zur Verurteilung des Sokrates 399. Wir haben im Kapitel über Thales (o. S. 17) schon davon berichtet, daß i. J. 456 v. Chr. bei Aigös potamoi auf der Thrakischen Halbinsel ein gro ßer Meteorit niederging, dessen Einschlag großes Aufsehen erregte und weit bekannt wurde. Wie Thales die Vorhersage der Sonnenfinsternis von 585, so wurde Anaxagoras die Vorhersage dieses Meteoriteneinschlags zu geschrieben. Diese Überlieferung ist natürlich völlig unsinnig. Historisch berechtigt ist nur die Frage, ob Anaxagoras seine These, die Sterne seien glühende Steine, durch den Meteoriten bestätigt fand oder ob er allererst aufgrund dieses Ereignisses zu seiner Lehre gekommen ist. Die Frage ist kaum überzeugend zu entscheiden, aber die erste Möglichkeit vielleicht doch die wahrscheinlichere. Anaxagoras war nicht nur der Freund und Lehrer des Perikies, sondern auch des Euripides. In der Philosophie selbst war er der Lehrer des Arche laos und dieser wieder der des Sokrates. Wir schließen mit einem Wort des Anaxagoras, das eigentlich als Motto auf dem Titelblatt unseres Buches stehen könnte. Das Beste ist, nicht ge boren zu sein, und das Zweitbeste, gleich nach der Geburt zu sterben, in diesem Satz hat der griechische Pessimismus seinen krassesten Ausdruck gefunden. Aristoteles berichtet in der Eudemischen Ethik, als die Frage aufgeworfen wurde, wozu, zu welchem Zweck es wohl einer vorziehen könnte, lieber geboren statt nicht geboren zu sein, da habe Anaxagoras die Antwort gegeben: Um das Himmelsgebäude zu betrachten und die Ordnung des Weltalls l.Eth. Eud. A 5, 1216a 11—15).
81
»Das ungeprüfte Leben ist für den Menschen gar nicht lebenswert.«
Sokrates (470-399)
Hat auch Sokrates Anspruch auf einen Platz in der Geschichte der griechi schen Kosmologie, werden viele Leser befremdet fragen und diese Frage großenteils verneinen. Sokrates hat, nach dem bekannten Wort Ciceros, die Philosophie vom Himmel auf die Erde herabgeholt und an die Stelle der Naturphilosophie die Ethik gesetzt. »Felder und Bäume wollen mich nichts lehren, wohl aber die Menschen in der Stadt«, läßt Platon ihn im Dialog Phaidros sagen. Selbst Walter Burkert urteilt einmal: »So schob denn Sokrates alle bisher geleistete Arbeit beiseite. Und doch blieb die Naturphilosophie vor allem im Platonismus lebendig« (Rhein. Mus. 106/1963, 134). Aber diese Feindschaft oder Indifferenz des Sokrates gegen die Naturphilosophie ist sowenig historisch wie sein vielzitierter angeblicher Ausspruch: Ich weiß, daß ich nichts weiß. Sokrates wußte eine ganze Menge, und über sehr verschiedene Dinge. Sein wirklicher Ausspruch lautet: »Wenn ich etwas nicht weiß, so glaube ich auch nicht, es zu wissen« (Plat. Apol. 21D), im Unterschied zu den meisten anderen Menschen, die sich keine Rechenschaft über ihre Erkenntnis ablegen und auch dort zu wissen glauben, wo alles ungewiß ist. Daß Sokrates kein Interesse für Naturphilosophie besaß, ist eine Tendenzbehauptung, die sich zuerst bei Aristoteles findet, der von Sokrates berichtet, er habe sich mit den Fragen der Ethik beschäftigt, nicht mit denen der Natur, und er habe (in den Tugenden) das Allgemeine zu bestimmen gesucht und sei daher als erster an die Kunst des Definierens geraten {Met. A 6, 987 b 1—4). Bei Platon und Xenophon lesen wir es zum Glück noch anders. Auch ist die Nachricht, daß Sokrates Schüler des Archelaos gewesen sei, viel zu gut verbürgt, als daß man sie achtlos beiseite schieben dürfte. Gewiß, Archelaos war kein origineller Philosoph. Er war Schüler des Anaxagoras und schloß sich im allgemeinen seinem Lehrer an, nur daß er gegenüber den Spermata des Anaxagoras versuchte, die vier Elemente des Empedokles zur Geltung zu bringen. Auch berief er sich für den An stoß zur Weltentstehung nicht auf den Nous als Bewegungsursache, son82
dem auf den Gegensatz des Warmen und Kalten, die für ihn die Prinzipien der Bewegung und Ruhe darstellten. Daß die Erde eine flache Scheibe sei, bestritt er mit dem Argument, dann müsse die Sonne für alle Menschen zur gleichen Zeit aufgehen, was nicht der Fall sei. Also stellte er sie als in der Mitte vertieft und an den Rändern erhöht vor. Dies wenige ist hin reichend, um zu zeigen, daß Sokrates durch seinen Lehrer mit den alten Fragestellungen der ionischen Naturphilosophie selbstverständlich ver traut war. Daß aber die Lehrzeit bei Archelaos nicht eine später verklungene Jugend erinnerung war, das beweist die meist übersehene enge Verbindung des Sokrates mit den Pythagoreern. Den Bericht über die Abschiedsgespräche des Sokrates am Abend vor seinem Tode erstattet Phaidon von Elis vor dem Synhedrion der Pythagoreer in Phlius, und die Hauptmitunterredner des Sokrates an jenem Abend waren die beiden Pythagoreer Simmias und Kebes aus Theben, Schüler des Philolaos. Und daß sie sich an jenem letz ten Abend nicht nur über ethische und religiöse Fragen unterhielten, das werden wir bald sehen. Aus dem Dialog Kriton erfahren wir, daß die thebanischen Pythagoreer sich nicht nur erboten, Sokrates die Geldsumme zur Verfügung zu stellen, die erforderlich war, seine Wächter zu bestechen und ihn aus dem Gefängnis zu befreien, sondern daß Simmias diese Summe bereits mitgebracht hatte (Krit. 45B). Es ist auch noch einmal nachdrücklich daran zu erinnern, daß die An klage gegen Sokrates drei Punkte umfaßt: 1. daß er die Jugend verführe; 2. daß er neue Götter einführe, und 3. daß er zu erforschen suche, was unter der Erde und was am Himmel vorgehe (Plat. Apol. 18B 7,19B 5). Im Jahre 423 hatte Aristophanes in seiner Komödie »Die Wolken« den So krates als überspannten und windigen Sterngucker auf die Bühne ge bracht, und gelegentlich wird der dritte Punkt der Anklage so verstanden, als gehe er auf den Eindruck zurück, den die Komödie — vierundzwan zig Jahre zuvor — bei den Athenern von Sokrates hinterlassen habe. In Wirklichkeit hätte Aristophanes den Sokrates nicht in dieser Rolle auf die Bühne bringen können, wenn ihr gar nichts Reales entsprochen hätte. Statt gespannt und belustigt, wären die Zuschauer nur befremdet gewe sen. Aber wenden wir uns den Abschiedsgesprächen des Sokrates selbst zu, wie sie im Phaidon berichtet sind. Dort findet sich eine längere Erin nerung des Sokrates, die ohne Zweifel autobiographisch ist. Nach der Bitte um Aufmerksamkeit fährt Sokrates fort: In meiner Jugend hatte ich ein überaus großes Verlangen nach jener Weis heit, die man die Naturkunde nennt. Denn es erschien mir als etwas
83
Großartiges, die Ursachen von allem zu wissen, wodurch ein jedes ent steht und wodurch es vergeht und wodurch es besteht, und hundertmal wendete ich mich bald hier-, bald dorthin, indem ich selbst überlegte und mich als erstes fragte, ob, wenn das Warme und Kalte in Fäulnis gerät, wie einige gesagt haben, dann Tiere entstünden. Und ob es wohl das Blut ist, womit wir denken, oder die Luft, oder das Feuer. Oder ob vielleicht keins von diesen, sondern das Gehirn es ist, das in uns die Wahrnehmun gen hervorbringt. . . . Und wenn ich wiederum das Vergehen von all die sem betrachtete und die Veränderungen am Himmel und auf der Erde, so kam ich mir am Ende zu dieser ganzen Untersuchung vollkommen un tauglich vor. . . . Als ich aber einmal jemanden aus einem Buch des Anaxagoras, wie er sagte, vorlesen hörte, daß die Vernunft das Anordnende ist und aller Dinge Ursache, da fand ich Gefallen an dieser Ursache, und es erschien mir in gewisser Weise sehr richtig, daß die Vernunft von allem die Ursache sei, und ich dachte, wenn es sich so verhalte, so werde die ordnende Vernunft auch alles einrichten und ein jedes so stellen, wie es sich am besten befindet. . . . Dies bedenkend freute ich mich also, über die Ursachen der Dinge einen Lehrer gefunden zu haben, der recht nach meinem Sinn war, nämlich den Anaxagoras, der mir nun auch sagen würde, zuerst, ob die Erde flach ist oder rund, und wenn er es mir gesagt, mir dann auch die Notwendigkeit der Sache und ihre Ursache dazu erklä ren werde, indem er auf das Beste zurückginge und mir zeigte, daß es für sie besser wäre, so zu sein. Und wenn er behauptete, sie stünde in der Mitte, werde er mir dabei erklären, daß es für sie besser sei, in der Mitte zu stehen. Und wenn er mir dies klar machte, war ich schon fest ent schlossen, nie mehr eine andere Art Ursache begehren zu wollen. Ebenso war ich entschlossen, mich nach der Sonne zu erkundigen und nach dem Mond und den übrigen Gestirnen wegen ihrer jeweiligen Geschwindig keit und ihren Umläufen und was ihnen sonst begegnet, warum es denn für jedes besser ist, das zu verrichten und zu erleiden, was es erleidet. . . . Aber von dieser wunderbaren Hoffnung fiel ich ganz herunter, als ich fortfuhr und las und sah, wie der Mann mit der Vernunft gar nichts an fängt und auch sonst gar keine Gründe anführt, die sich auf die Ordnung der Dinge beziehen, wohl aber allerlei Luft und Äther und Wasser vor schiebt und sonst noch vieles zum Teil sehr Wunderliche. (Phaid. 96 A 6 — 98 C 2.)
Den Ausdruck befremdlich, wunderlich (ätopon) gebraucht Sokrates auch in der Apologie zur Charakterisierung einzelner Lehren des Anaxa goras (26 E 2). — Aus Enttäuschung über die Naturphilosophie des Ana84
xagoras habe er sich dann zu einem ganz anderen Erkenntnisweg ent schlossen, den er anschließend auseinandersetzt. Dieser Zweite Weg (deú teros ploüs) ist — die Ideenlehre. Erst zehn Seiten später erfolgt dann die nähere Darstellung von Form und Lage der Erde: Zunächst bin ich also überzeugt, daß sie, wenn sie als Kugel in der Mitte der Welt (ouranös) ruht, weder die Luft nötig hat, um nicht zu fallen, noch irgendeine andere solche Hilfe. Sondern um sie zu halten, ist hinrei chend die durchgehende Gleichförmigkeit der Welt und das Gleich gewicht der Erde selbst. Denn ein gleichförmiges Seiendes, in der Mitte eines anderen gleichförmigen gesetzt, wird keinen Grund haben, sich mehr oder weniger hier- oder dorthin zu neigen, sondern wird in seiner Gleichförmigkeit ohne Neigung (an seiner Stelle) bleiben. Als erstes also bin ich hiervon überzeugt. Dann aber auch davon, daß sie sehr groß ist und daß wir, die wir das Gebiet zwischen dem Phasis (im Osten) und den Säulen des Herakles (im Westen) bewohnen, nur einen kleinen Teil von ihr innehaben und um das (Mittel)meer wohnen wie Ameisen oder Frösche um einen Teich, wäh rend noch viele andere an vielen anderen Orten ähnlich wohnen. (Phaid. 108 E 4 - 109 B 4)
Hier finden wir also die Erde als Kugel frei schwebend in der Mitte der Welt dargestellt, und zwar mit einer Argumentation, die schon Anaximander anwandte (s. o. S. 25) die ohne Zweifel von ihm übernommen ist. Man wird vernünftigerweise nicht bestreiten können, daß die Fragen nach Gestalt und Lage der Erde, nach der Natur von Sonne und Mond und ihren Bahnen und denen der Sterne wirkliche Fragen des historischen So krates gewesen sind, so wie kosmologische Fragen jederzeit philosophi sches Interesse haben. Festzuhalten ist aber auch, daß die Kugelgestalt der Erde an dieser berühmten Stelle des Phaidon zum erstenmal in der grie chischen Philosophie unzweifelhaft ausgesprochen ist und sich von hier aus schließlich endgültig durchgesetzt hat. Auch Xenophon läßt in seinen Memorabilien Sokrates zweimal kosmolo gische Themen erörtern (I 4 und IV 7). Die längeren Ausführungen der zweiten Stelle sind ganz aus den Argumenten der platonischen Apologie herausgesponnen, wie es auch sonst problematisch ist, Xenophon in Ein zelheiten als Zeugen für den historischen Sokrates anzurufen. Aber bewei send ist es doch, daß auch bei Xenophon die Beschäftigung des Sokrates mit kosmologischen Fragen eine ganz geläufige Sache ist. Als sicher ver85
bürgt aber muß auf jeden Fall gelten, was die platonischen Dialoge uns lehren. Danach sind die Beschäftigung mit der Naturphilosophie des Anaxagoras und die dabei eingetretene Enttäuschung und anschließende Kritik und besonders die Ablösung der primitiven Vorstellung von der Erde als Schale durch die Lehre von ihrer Kugelgestalt ohne Zweifel Erfahrungen und Erkenntnisse des historischen Sokrates gewesen.
86
Um nichts ist das Sein mehr seiend als das Nichts.
Demokrit von Abdera (ca. 460—400 v. Chr.)
Für den modernen Leser ist der Name Demokrits vor allem mit der Be gründung der Atomtheorie verbunden. Im Altertum aber ging sein Ruhm weit darüber hinaus. Während seine Vorgänger und Zeitgenossen alle nur mit vereinzelten Schriften hervorgetreten waren, war Demokrit der frucht barste und vielseitigste philosophische Schriftsteller bis auf Aristoteles. Aus alexandrinischer Zeit ist eine Liste seiner Werke mit über sechzig Titeln erhalten, angeordnet in Vierergruppen (Tetralogien) wie die Dia loge Platons. Und wenn ihm auch ein Teil davon fälschlich zugeschrieben wurde — auch die unter dem Namen Platons erhaltenen Dialoge sind nicht alle echt —, so bleiben auf jeden Fall genug, um seine außerordent liche Produktivität und Vielseitigkeit zu bezeugen. Er schrieb über Astro nomie, Kosmologie und Mathematik, über Geographie, Botanik und Landwirtschaft, über Physiologie und Medizin, Sinneswahrnehmung und Erkenntnistheorie, über Sprache, Musik und Malerei. Eine seiner Haupt interessen galt der Ethik. Er verfaßte spezielle Schriften über Pythagoras und über die Planeten. Sein bekanntestes Werk war das Kleine Weltsystem (Mikros diäkosmos), im Unterschied zum Großen Weltsystem seines Leh rers Leukipp, das wahrscheinlich dessen Kosmologie enthielt, während Demokrits Schrift vermutlich Ursprung und Entstehung des Menschen und der Kultur zum Gegenstand hatte. Jedenfalls ist Demokrit der erste gewesen, der den Menschen als Mikrokosmos bezeichnete. Demokrit war sozusagen der erste Systematiker, und Aristoteles stellt ihm das ausdrückliche Zeugnis aus, er sei unter den Vorsokratikern der ein zige gewesen, der sich über alles Gedanken gemacht habe (De gen. et corr. A 2, 315 a 35), und Aristoteles hat von ihm auch den programmatischen Spruch überliefert: Die Bildung (paideia) ist im Glück ein Schmuck (kosmos), im Unglück eine Zufluchtsstätte (kataphygion). (Fr. 180) Auffällig ist, daß Platon ihn kein einziges Mal erwähnt, sooft er sonst auf seine großen Vorgänger zu sprechen kommt. Den Materialisten hat er, wie es scheint, nicht unter sie rechnen wollen8. Denn daß die Werke Demo krits in der Akademie unbekannt blieben, ist kaum anzunehmen. Aristo teles verfaßte eine eigene Schrift über Demokrit, und Cicero rühmte noch Jahrhunderte später den Glanz des demokritischen Stils. 87
Leider ist von allen seinen Werken kein einziges erhalten geblieben. Wir besitzen zwar an die dreihundert Fragmente, aber nach dem vorwiegen den Interesse der Hauptquelle (Stobaios) entstammen die weitaus meisten der Ethik. Über die übrigen Lehren Demokrits besitzen wir nur — teils widersprechende — Sekundärberichte. Demokrit wurde um 460 in Abdera in Thrakien geboren. Abdera war das Schilda der Alten, und seine Einwohner galten als Muster der Einfalt, wie es Wieland in seinem großen Roman Geschichte der Abderiten ausgiebig dargestellt hat. Aber es gab, wie wir sehen, auch Ausnahmen, und Demo krit war nicht die einzige. Auch der berühmte Sophist Protagoras, dessen Person und Lehren Platon einen seiner glänzendsten und geistreichsten Dialoge gewidmet hat, stammte aus Abdera. Die Tradition schrieb Demo krit Aufenthalte in Ägypten, Babylonien und Persien zu, wo er von der jeweiligen Priesterschaft allerhand spezielle Weisheit erlernte. Ja, er soll auf seinen Reisen bis nach Äthiopien und Indien gelangt sein. Aber solche Zuschreibungen waren nur allzusehr Mode. Ob er jemals in Athen gewe sen ist, bleibt ungewiß. Doch wurde ihm die selbstironische Äußerung zu geschrieben, er sei zwar einmal in Athen gewesen, aber dort habe ihn nie mand gekannt (Fr. 116). Das hätte dann in großem Kontrast gestanden zum Auftreten seines Landsmanns Protagoras, der es glänzend verstand, sich in Szene zu setzen, wie es Platon in dem genannten Dialog großartig inszeniert. Demokrits Sterbejahr ist unbekannt. Späte Überlieferung schreibt ihm eine Lebenszeit von über hundert Jahren zu. Dann hätte noch Aristoteles sein Schüler sein können. Die Angabe ist sehr unwahrscheinlich.
DIE ATOMTHEORIE
Demokrits Atomtheorie war die naturwissenschaftliche Antwort auf die Forderung des Parmenides, daß das wahrhaft Seiende ewig, unentstanden und unvergänglich sein müsse. Auch für Demokrit war der erste aller Grundsätze der Erhaltungssatz, daß aus Nichts nichts entstehen und nichts in Nichts vergehen kann (Diog. Laert. IX 44). Aber er verwarf die These, daß das wahrhaft Seiende auch Eines sei, sondern hielt ihr den Satz entgegen, es sei unmöglich, daß aus Zweien Eines und aus Einem Zweie würden (Arist. Met. Z 13,1039 a 3—10). Er ging nicht von den abstrak ten Konsequenzen des Gedankens, sondern von der alltäglichen Erfah rung aus, und die Aufgabe der Philosophie sah er nicht darin, die Vielfalt der Welt zu negieren, sondern sie zu erklären. Das Verhältnis muß, wie 88
es Aristoteles in der Schrift Über den Himmel einmal formuliert, wechsel seitig sein: Der Logos muß den Phänomenen, und die Phänomene müssen dem Logos zu Hilfe kommen (martyrein. De caelo A 3, 270 b 5). Und da die Mannigfaltigkeit der Welt unendlich ist, so setzte er den Eleaten die direkte Antithese entgegen: Das Sein ist nicht Eines, sondern unendlich Vieles. Die Zahl der Atome ist unendlich. Auch dem parmenideischen Satz, daß das Sein unbewegt sei, setzte er die direkte Antithese entgegen: Die Atome sind immer in Bewegung, in Ruhe sind sie niemals von Natur, sondern immer nur durch Zwang. Die Natur als prinzipiell bewegt anzusehen, darin stimmen Demokrit, Platon und Aristoteles überein, und darin sah Aristoteles den großen methodischen Vorzug der Atomtheorie gegenüber der Lehre der Eleaten. Die Bewegung ist ewig. Die Lehre, daß die Atome grundsätzlich und von Ewigkeit her bewegt sind, überhob Demokrit einer Erklärung über die Herkunft der Bewegung, ja er konnte die Forderung nach Begründung mit dem Sophisma ablehnen, daß es für das, was ohne Anfang sei, auch keinen Grund gebe. Bewegung ist aber nicht denkbar ohne das Leere. Und so setzt Demokrit dem Parmenides, der das Leere für das Nichts erklärt hatte, für nicht sei end und nicht denkbar, die weitere Antithese entgegen: Das Leere ist, und zwar als notwendige Voraussetzung jeder Bewegung. Und noch einmal mit Front gegen Parmenides: alles miteinander ist unendlich: In dem un endlichen Leeren bewegen sich die unendlich vielen Atome durch unend liche Zeit — en apeirö tö kenö tä apeira ätoma ep’ äpeiron chronon kineisthai. (Simpl. De caelo 591, 15) Die Atome sind, wie ihr Name sagt, unteilbar und die letzten, unvergäng lichen Bestandteile der Wirklichkeit, durch deren Zusammentritt und Auflösung alles entsteht und vergeht. Als unteilbares Element ist aber nicht nur jedes einzelne Atom in sich homogen, sondern sie sind der Materie nach alle miteinander homogen und unterscheiden sich vonein ander nur durch Form und Größe, Anordnung und Lage, nicht durch sub stantielle Qualitäten. Der Veranschaulichung dient ein Buchstabengleich nis: A und N unterscheiden sich in der Form (schema), AN und NA in der Anordnung (täxis), Z und N in der Lage (thesis. Arist. Met. A 4,985 b 14). Das sind die üblichen griechischen Berichtswörter. Demokrit selbst benutzt die Termini rhysmös, tropS und diathige, von denen er die beiden ersten in neuer Bedeutung verwendet, den dritten überhaupt neu gebildet hat. Seine Ausdrücke betonen das Kinetische der ganzen Theorie, also etwa bei Form den Duktus, bei Anordnung die Hinwendung und bei Lage den Kontakt des Sichhindurchdrängens. 89
Man darf sich also die demokritischen Atome nicht in Analogie zu unse ren chemischen Elementen oder auch nur zu den Elementen des Empedokles vorstellen. Es gibt keine speziellen Gold (Au)- oder Eisen (Fe)- oder Schwefel (S)-Atome, die die Qualitäten der betr. Elemente besäßen. Zwar sagt Aristoteles einmal: Sie unterscheiden sich durch ihre Form, aber der Substanz (physis) nach sind sie gleich, ganz als ob jedes von ihnen ein ein zelnes Quantum Gold wäre. Aber in Wirklichkeit ist der Vergleich mit dem Gold irreführend, denn die Atome sind ja gerade qualitätslos (äpoia), zumindest ohne wahrnehm bare Qualitäten9. Das, was allem anderen zugrunde liegt, muß selbst un bestimmt sein. So treten die Atome Demokrits in ihrer Weise die Nach folge von Anaximanders Apeiron an. Die Verschiedenheit der Atome und Elemente (= gleicher Atome) ist allein in ihrer räumlichen Bestimmtheit begründet, ihre Stofflichkeit hat daran keinerlei Anteil, denn in der Stofflichkeit sind sie alle gleich. Es fin det sich bei Demokrit nicht einmal der Versuch, die traditionellen vier Elemente zu charakterisieren. Einzig das Feuer wird konkretisiert. Seine Atome seien rund und glatt, womit ihre Leichtigkeit und Beweglichkeit erklärt werden soll. Der konkrete Versuch, den ganzen Reichtum der Welt ohne weitere qualitative Differenzierung auf die Unterschiede zweier indi vidueller (Form und Größe) und zweier relativer Bestimmtheiten (Anord nung und Lage) und auf Unterschiede der Bewegung zurückzuführen, wäre sehr schnell an seine Grenze gekommen. Die Verlegenheit war indes für die Alten bei weitem nicht so dramatisch wie für uns, z. T. deswegen, weil sie den Unterschied zwischen Belebtem und Unbelebtem viel weniger scharf empfanden als wir.
BEWEGUNG
Die Bewegung der Atome ist ewig. Parmenides hatte jedes Entstehen mit dem Argument abgelehnt: Warum sollte es zu einer bestimmten Zeit eher begonnen haben als zu einer anderen (Fr. 8, 9h)? Demokrit kehrt das Argument um und bestätigt es, indem er sagt: In der Tat, die Bewegung hat nicht irgendwann begonnen, sie war immer schon. Epikur, der die Lehren der Atomisten, mit geringen Veränderungen, über nahm, ließ die Atome wegen ihres Gewichts durch die unendliche Leere senkrecht in die Tiefe fallen, wie ein Regen. Einige kommen dann von ihrer Bahn ab, verwickeln sich miteinander, es entstehen Strudel und Wir bel und aus diesen die Welt. 90
Bei Demokrit findet sich keine solche Fallbewegung. Die Urbewegung der Atome ist vielmehr eine unregelmäßige konfuse Bewegung nach allen Sei ten. Simplizius gebrauchte für sie das Verb stasiäzein, das eigentlich sich entzweien, hadern, streiten bedeutet und vom Substantiv stäsis — Auf ruhr, Zwietracht, Parteikampf, dem so häufigen Vorkommnis griechi scher Geschichte, gebildet ist. Aetius verwendet das Wort palmos — Schütteln, wie auch Platon im Timaios die Urbewegung ähnlich be schreibt (s. u. S. 103). Bei dieser ziel- und regellosen Bewegung treffen die Atome aufeinander, prallen voneinander ab oder verhaken sich. So entste hen Zusammenballungen, und es entstehen Strudel und Wirbel, und immer größere Wirbel, und aus einem ganz großen schließlich die Welt. Die Wirbel (dtnai) bringen zugleich die erste Ordnung in die Unendlich keit zerstreuter Atome. Demokrit beruft sich dabei auf die Erfahrung, daß sich bei solcher Bewegung Gleiches zu Gleichem gesellt, wie man es auch bei den Tieren sieht.
Denn die Lebewesen gesellen sich zu gleichartigen Lebewesen wie Tauben zu Tauben, Kraniche zu Kranichen und bei den übrigen Tieren ebenso. So ist es aber auch bei den Dingen, wie man sehen kann beim Durchsie ben der Samenkörner und bei den Steinen in der Brandung. Denn dort ordnen sich beim Schütteln des Siebes gesondert Linsen zu Linsen, Gerste zu Gerste, Weizen zu Weizen, hier aber werden beim Wogenschlag die länglichen Steine an dieselbe Stelle wie die länglichen gestoßen, die run den zu den runden, als ob die in den Dingen liegende Ähnlichkeit eine Art Vereinigungskraft auf sie ausübe. (Fr. 164) Bei der Wirbelbewegung wird das Leichte nach außen gedrängt, und das Schwere sammelt sich in der Mitte. Von dort bis zur Entstehung von Meer und Land, von Gesteinen, Pflanzen, Tieren und Menschen ist es freilich ziemlich weit, aber für die Entstehung von Spiralnebeln bildet es ein erstaunlich vorausschauendes Modell.
UNENDLICHE WELTEN
Den bündigsten Bericht über Demokrits Kosmologie finden wir beim Kir chenvater Hippolyt: Es bestehen unzählig viele Welten und von ganz verschiedener Größe. In einigen gibt es weder Sonne noch Mond, in anderen sind sie größer als bei uns, und wieder andere haben mehr als eines (dieser Gestirne). Diese
9i
Welten befinden sich in unregelmäßigen Abständen voneinander, in der einen Richtung mehr, weniger in der anderen. Und die einen entwickeln sich, die anderen sind in Verfall. Hier entstehen, dort sterben sie. Und sie finden ihren Untergang, indem sie aufeinanderprallen. Einige der Welten haben keine Tiere, auch kein Pflanzenleben, nicht einmal Wasser. (Hippol. Refut. i, 13, 2)
Der Gedanke der unzählig vielen Welten und daß sie entstehen und ver gehen, gehört für den modernen Leser ganz gewiß zu den interessantesten Seiten der demokritischen Kosmologie. Und man darf nicht übersehen, wie außerordentlich kühn er damals war. Dem modernen Menschen ist es ganz geläufig — allerdings auch ihm erst seit den dreißiger Jahren unseres Jahrhunderts —, daß es Milliarden, nicht nur Sonnen, sondern Galaxien gibt. Aber damals widersprach ein solcher Gedanke völlig dem Augenschein wie dem Lebensgefühl. Er war rein spekulativ, allein aus der Idee der Unendlichkeit herausgesponnen und ein glänzendes Beispiel für den spekulativen Wagemut der Griechen. Wenn es, müssen wir noch hin zufügen, unendlich viele Welten gibt, so sind natürlich auch solche darun ter, die der unseren völlig gleich sind. Dies wieder war für einen Griechen vermutlich kein besonders bestürzender Gedanke, ganz anders als für einen Christen, dem sich sofort die Frage stellte, ob es denkbar ist, daß sich die Oeconomia salutis, das Heilsgeschehen, Leben, Tod und Aufer stehung Jesu mehrmals wiederholen können. Das Weltbild des Demokrit hätte keinerlei Chance gehabt, von der Kirche und ihren Lehrern an erkannt zu werden, während das aristotelisch-ptolemäische System zum Dogma erhoben wurde. Eine Merkwürdigkeit wird noch überliefert, die für uns befremdlich ist. Nach der Lehre Demokrits war jede Welt von einer Membrane, einem Häutchen (hymSn) umschlossen. Die Idee sollte vermutlich die Einheit und Geschlossenheit jeder Welt betonen, aber sie erinnert natürlich stark an die alte orphisch-mythische Vorstellung vom Weltei, das ja unter der Schale ein Häutchen trägt. Aber vielleicht dachte Demokrit mehr an die Bedeutung von Band, Fügung des Wortes Hymen und wollte damit aus drücken, daß eine äußere Schale wie bei uns der Fixsternhimmel das Ganze Zusammenhalte. ERDE UND PLANETEN Wenn wir nun von dem staunenswerten Gedanken der unendlich vielen Welten und ihres ewigen Entstehens und Vergehens, der die Kosmologie
92
des Demokrit dem modernen Leser so vertraut macht, zu seiner Vorstel lung von der Erde übergehen, so tritt ein großes Befremden ein, denn hier fällt der große Philosoph, der so kühn spekulierte, zurück in primitive, eigentlich längst überholte Vorstellungen. Er stellte sich die Erde als Scheibe vor, oder genauer als Schale mit erhöhtem Rand und vertieftem Boden, eineinhalb mal so lang wie breit, die, wie bei Anaximenes und Anaxagoras, von der Luft getragen wird. Der große Gedanke des Anaxi mander von der frei im Raum schwebenden Erde findet in ihm keinen Anhänger. Der Widerspruch ist groß, fast unbegreiflich, und mit weiteren kuriosen Einzelheiten verbunden. Die Erdschale mit erhöhtem Rand, eine vielleicht aus Babylonien über nommene Vorstellung, sollte, wie schon bei Anaxagoras, die Tatsache er klären, daß die Sonne nicht für alle Orte der Erde zugleich aufgeht. Weiter stellte sich Demokrit vor, daß der Himmelspol, um den sich die Fixsterne drehen, sich ursprünglich im Zenit befunden hatte. Aber dann hatte die Erde sich nach Süden geneigt und dadurch der Pol sich verschoben. Zu dieser Neigung sei es gekommen, weil im Süden die Luft wärmer sei und dadurch die Erde dort mehr Pflanzen und Früchte hervorbringe, wodurch sie im Süden schwerer werde. Ob man diese Erklärung wirklich als authentisch annehmen darf, ist doch sehr fraglich, denn eigentlich hätte schon dem Demokrit selbst oder einem seiner Kritiker der Einwand auf stoßen müssen, den man in unserer Zeit dagegen erhob: Bei einer solchen Neigung der Erde infolge ungleichen Gewichts hätte sich eigentlich alles Wasser im Süden sammeln und dort ein ungeheures Meer bilden müssen. Demokrit hat angeblich auch gelehrt, daß die Erde anfangs umhergeirrt, später — dicht und schwer geworden — zur Ruhe gekommen sei. Demokrit hat ein eigenes Buch Über die Planeten geschrieben, eine erstaunliche Nachricht. Woher nahm ein Grieche den Stoff zu einem solchen Buch? Wenn Demokrit als erster eine solche Monographie vorle gen konnte, dann hat das eigentlich zur Voraussetzung, daß damals die Erkenntnisse der babylonischen Astronomie zum erstenmal in größerem Umfang in Griechenland bekannt wurden. Und es findet sich sogar eine Einzelheit, die das zu bestätigen scheint. Demokrit nimmt nicht die übliche Reihenfolge Mond, Sonne, Planeten an, sondern setzt die Venus zwischen Mond und Sonne. Auf die letztere folgen die Planeten in verschiedenen Abständen, dann der Fixsternhim mel. Die erdnäheren Gestirne werden vom Wirbel langsamer als die äuße ren herumgeführt, dadurch bleiben sie gegenüber dem Tierkreis stärker als die anderen zurück. Daß die Venus unterhalb, nicht oberhalb der Sonne angenommen wird, ist wahrscheinlich eine babylonische Lehre. 93
W. Burkert vermutet, daß die Vermittlung der babylonischen Kenntnisse erst durch den athenischen Astronomen Meton erfolgte, einen namhaften Kalenderreformer, der nach der Überlieferung 332 die Sommersonnen wende beobachtete und sie auf den 28. Juni festsetzte und der den Welt untergang vorhersagte, wenn die sieben Planeten ihre Bahnen vollendeten und gleichzeitig ins Sternbild des Wassermanns einträten, was die Vorstel lung vom großen Planetenzyklus einschließt. Ob aber Demokrit auch die Namen der übrigen Planeten oder auch nur ihre Fünfzahl bekannt waren, das ist historisch ziemlich unwahrscheinlich (s. u. S. 117). Das ganze angebliche Planetenbuch ist vielleicht nichts weiter als eine Fiktion. Wichtig für die Geschichte der griechischen Kosmologie und Astronomie aber war, daß hier zum erstenmal zwischen Fixsternen und Planeten definitiv unterschieden wurde und das hinfort gültige Modell von Mond, Sonne, Planeten und Fixsternen zum erstenmal auf gestellt war. Daß Demokrits Kenntnis der Planeten nicht wirklich gegründet gewesen sein kann, beweist nicht nur sein merkwürdiges Erdbild, sondern auch seine Erklärung der Kometen. Sie seien, wird überliefert, das Zusammen treffen zweier selten oder gar nicht sichtbarer Planeten. Wir wollen nicht schließen, ohne erwähnt zu haben, daß Demokrit ein bedeutender Mathematiker war. Er hat als erster den Rauminhalt von Kegel und Pyramide bestimmt: x/3 Grundfläche x Höhe. Und er hat ein sehr interessantes Dilemma aufgestellt mit der Frage: Wenn man einen Kegel waagerecht durchschneidet, sind die beiden Schnittflä chen gleich oder ungleich? Sind sie gleich, so ergibt sich, unendlich viele Schnitte aufeinander gelegt, kein Kegel, sondern ein Zylinder. Sind sie un gleich, so ergibt sich wiederum kein Kegel, sondern eine Stufenfolge. Mit diesem Dilemma war er auf dem Weg zur Infinitesimalrechnung. Um so mehr befremdet immer wieder die Primitivität seines Erdbildes.
94
Philolaos von Kroton (um 400 v. Chr.)
Das Weltmodell des Philolaos ist zu großer Berühmtheit gelangt, weil sich hier zum erstenmal die Idee ausgesprochen fand, die Erde aus dem Mittel punkt der Welt zu rücken und sie wie die anderen Himmelkörper kreisen zu lassen. Die Erde ist nicht der Mittelpunkt der Welt, sondern eines der Gestirne. Philolaos nahm ein zehnteiliges Weltsystem an. In der Mitte befindet sich das Zentralfeuer, das verschiedene Benennungen trug: Hestia — Herd der Welt, Olymp, Wachtturm des Zeus, Bezeichnungen, die deutlich genug die religiös-mythische Bedeutung dieser Weltmitte zum Ausdruck bringen. Um das Zentralfeuer kreist zunächst die Gegenerde, dann die Erde, dann Mond und Sonne, dann die Planeten, zuletzt der Fixsternhim mel. Die unvermeidliche Frage, wie es kommt, daß wir Zentralfeuer und Gegenerde nicht sehen, beantwortet Philolaos mit der Auskunft, daß wir auf der Erdhälfte wohnen, die ihnen immer abgekehrt ist. Das schließt die Voraussetzung ein, daß die Erde sich bei einem Umlauf um das Zen tralfeuer zugleich einmal um sich selbst dreht. Sowohl die Annahme, daß Umlaufs- und Umdrehungszeit der Erde gleich seien, als auch die andere, daß nur die eine Hälfte der Erde bewohnt sei, war natürlich so künstlich und willkürlich, daß sie auch im Altertum keine Chance hatte, sich län gere Zeit zu halten. Die Frage, warum Philolaos als zusätzlichen Himmelskörper die Gegen erde einführte, hat zwei Antworten gefunden. Sie habe dazu dienen sol len, die Überzahl der Mondfinsternisse über die Sonnenfinsternisse zu er klären, denn nun werde der Mond nicht nur durch den Erdschatten, son dern auch durch den der Gegenerde verfinstert. Wenn dies wirklich ein Motiv gewesen sein sollte, so hat es mit wissenschaftlicher Astronomie natürlich nichts zu tun. Die andere Erklärung, die Aristoteles gibt, ist die, daß dadurch die Zahl der Himmelskörper auf die heilige Zahl zehn ge bracht werden sollte. Und obwohl die Erklärung des Aristoteles ironisch gemeint ist, kann sie durchaus zutreffen. Die spekulative, dem Augenschein widersprechende Idee, die Erde an den Himmel zu versetzen und dort wie die anderen Gestirne kreisen zu lassen, mußte Philolaos natürlich als eine Art antiken Kopernikus erscheinen las sen, um so mehr, als Kopernikus die Anregung zu seinem umstürzenden System aus antiken Quellen gewonnen und unter diesen Philolaos zwei95
Abb. 7 Das Weltmodell des Philolaos
mal namentlich erwähnt hatte. Unwillkürlich setzte man beide Systeme in Parallele und verstand auch das Modell des Philolaos als einen Versuch, die Unregelmäßigkeiten der Planetenbewegungen zu erklären. So findet man in älteren Darstellungen klassischer Philologen das System des Philo laos als eine Vorwegnahme des kopernikanischen dargestellt, in dem die Planetenbahnen schon ganz in derselben Weise erklärt würden, wie es in unserem heutigen heliozentrischen System geschehe. Davon könnte allen falls die Rede sein, wenn sich wenigstens Merkur und Venus um die Sonne drehten. Aber das Modell des Philolaos ist ein völlig symmetrisches Sy stem, in dem alle Gestirne konzentrisch um das Zentralfeuer kreisen. Und
96
dieses System ist nicht einmal tauglich, auch nur die Entstehung von Tag und Nacht korrekt zu erklären. Die einzige Angabe über die Umlaufbah nen der Gestirne, die uns überhaupt überliefert ist, besagt, daß die Erde durch ihren Umlauf um die Mitte Tag und Nacht erzeuge (Arist. De caelo B13, 2.93 a 22—24). Die Umlaufzeit im Verhältnis zur Sonne beträgt also, wie es nicht anders sein kann, einen Tag. Aber wie sich dieser Tag inner halb des Systems ergibt, das ist ganz unerfindlich. Nimmt man an, wie es naheliegt, daß die Erde innerhalb eines Tages einmal um das Zentral feuer läuft, so ergeben sich Tag und Nacht nur, wenn die Sonne in dieser Zeit stillsteht. Sobald sich aber die Sonne bewegt — und sie kann sich dem System nach nur in Richtung der Erdbahn bewegen —, würde sich der Tag um die Frist verlängern, die die Erde braucht, um die vom Aus gangspunkt gerechnet weitergelaufene Sonne einzuholen. Die Umlaufsbe wegungen von Sonne und Erde geraten also in ein indefinites Verhältnis zueinander. Natürlich kann man die Läufe so abstimmen, daß ein regulä rer Tag herauskommt, aber die Erde, ständig mit der Gegenerde gegen über, muß immer wesentlich schneller laufen als die Sonne. Es ist eine ganz unsinnige Komplikation, die vor allem mit der Wirklichkeit gar nichts zu tun hat9A. — Auch die Ungleichheit der Jahreszeiten ist mit den von Philolaos angenommenen konzentrischen Kreisen nicht zu erklären. — Man braucht also gar nicht erst die komplizierten Planetenbewegun gen zu bemühen, um zu begreifen, daß das System des Philolaos mit wis senschaftlicher Astronomie nichts zu tun hat. Im Gegensatz zu den er wähnten Philologen sind daher die Astronomen nicht so gut auf ihn zu sprechen. Van der Waerden schreibt in seiner neuesten Darstellung Die Astronomie der Griechen (Darmstadt 1988) nicht nur: »Die Einzelheiten des Systems sind ganz unklar. Eine mathematisch sinnvolle Beschreibung des Systems ist nicht erhalten« (S. 72), sondern findet sich zu der persön lichen Bemerkung gedrängt, »daß Philolaos in mathematischen Dingen nicht klar denken konnte. Meiner Meinung nach war er ein Wirrkopf« (S. 74). Das schwere Verdikt beruht aller Wahrscheinlichkeit nach auf einem Mißverständnis. Es war gar nicht die Absicht des Philolaos, mit sei nem Modell eine astronomisch-mathematische Erklärung oder auch nur Erklärungsmöglichkeit der Himmelsbewegungen zu geben. Sein wirk liches Anliegen war ein ganz anderes. Wir haben die mythischen Bezeichnungen des Zentralfeuers bereits er wähnt. Er setzte es in die Mitte der Welt mit der Begründung, daß dem Würdigsten auch der würdigste Platz gebühre. Bewohnt ist nicht nur die Erde, sondern auch die Gegenerde und der Mond. Vom Mond behauptet Philolaos (A 20), wie die Erde nur auf der von uns bewohnten Halbkugel,
97
so sei er im ganzen bewohnt von Lebewesen und Pflanzen, und zwar von solchen, die größer und schöner seien als bei uns. Sie seien den unseren an Größe fünfzehnfach überlegen, sonderten aber keine Ausscheidungen ab. Auch der Tag habe dort die fünfzehnfache Länge. Die Bemerkung von den fehlenden Ausscheidungen soll den Mond als einen paradiesischen Ort charakterisieren, und in der Tat bezeichnet ein pythagoreisches Akusma Sonne und Mond als die Inseln der Seligen. (Ein anderes Akusma, d. h. angeblich von Pythagoras selbst stammendes Wort, be zeichnet die Planeten als die Hunde der Persephone.) Ist die Sonne Aufent halt der Seligen, so kann sie kein Gestirn sein, das glüht. Philolaos über trägt daher die Erkenntnis vom indirekten Licht des Mondes auf die Sonne. Die Sonne leuchtet nicht selbst, sondern erhält ihr Licht und ihre Wärme vom Firmament. Die Sonne sei »glasartig« und »seihe« das vom »Ätherfeuer« empfangene Licht und die Wärme durch »enge Zwischen räume«, Poren, hindurch und strahle sie weiter auf die Erde. Die Sonne wirkt also wie eine Art Brennglas, das eben damals erfunden zu sein scheint, und konzentriert das Himmelslicht auf die Erde. Dies alles stellt außer Zweifel, daß es ein Mißverständnis ist, das Weltmo dell des Philolaos für ein astronomisch-mathematisches System zu halten. Sein Anliegen war vielmehr mythisch-religiös. Er gibt eine Schilderung der Welt mit Diesseits und Jenseits. Die Erde ist aus der Mitte gerückt und kreist nun, entthront und destatuiert, zwischen dem lebenspendenden Zentralfeuer und Sonne und Mond als den Inseln der Seligen. Im Hinter grund stehen Weltflucht und Himmelsreise der Seele. Die Pythagoreer waren es, die das Wortspiel vom Leib (söma) als Grab (sema) der Seele aufgebracht hatten. Man ist versucht, das Weltmodell des Philolaos als einen Vorläufer der späteren Gnosis zu verstehen, die auch die Erde als einen Ort der Verbannung ansah. Die Seelen als in das irdische Leben ver senkte Funken des göttlichen Lichts suchen sich aus ihrer Gefangenschaft zu befreien und in die himmlische Heimat zurückzukehren. Ein Vorläufer der heliozentrischen Idee Aristarchs und des Kopernikus ist das System des Philolaos nur auf ganz sekundäre Weise. Merkwürdig im Zusammenhang mit Philolaos sind zwei Nachrichten über Platon bei Plutarch, der überliefert, Platon habe es im Alter bereut, der Erde den Platz im Zentrum der Welt eingeräumt zu haben, während er in Wirklichkeit doch einem würdigeren Gestirn gebühre. In seinen Pla tonischen Untersuchungen beruft er sich für diese Nachricht auf Theo phrast, den Nachfolger des Aristoteles, also eine sehr zuverlässige Quelle (Quaest. Plat. 1006 C). In seiner Biographie des römischen Königs Numa bezieht Plutarch die Sinnesänderung Platons ausdrücklich auf das System
98
des Philolaos. Er spricht dort vom Weltall, in dessen Mitte nach dem Glauben der Pythagoreer das Feuer ruht, . . . Die Erde, meinen sie, ver harre nicht unbewegt in der Mitte des Himmelsumschwungs, sondern sie schwebe im Kreis um das Feuer und gehöre nicht zu den würdigsten und ersten Teilen des Weltalls. Auch Platon soll im Alter zu der Auffassung gelangt sein, daß die Erde an zweiter Stelle rangiere und daß der zentrale und würdigste Platz einem Höheren zukomme. (Numa c. n) Die Nachricht macht natürlich aufhorchen. Daß wir aus Platons Werk selbst nichts darüber erfahren, hat nicht so viel zu besagen, aber ganz un denkbar ist, daß Aristoteles nicht davon berichtet hätte, wenn Platon zum System des Philolaos übergetreten wäre. Auch hätte Platon sich damit einem Modell verschrieben, daß seinen wissenschaftlichen Ansprüchen in keiner Weise genügen konnte.
99
»Die Welt ist das Schönste von allem Gewordenen und der Schöpfer der beste aller Urheber.«
Die Kosmologie
des
Timaios
Unter den nahezu eintausendvierhundert Seiten, die uns von Platon über liefert sind, ist keine einzige, die in seinem eigenen Namen spricht. Der Fall ist singulär in der ganzen Philosophiegeschichte. Die Werke Platons sind fingierte Gespräche, Lesedramen. Alles, was er sagt, hat er den Gesprächsführem und ihren Mitunterrednern in den Mund gelegt, in den frühen und mittleren Dialogen Sokrates, im Spätwerk vorwiegend Frem den. Man kann sich nicht auf Platon berufen, wie man sich auf Aristote les, Thomas, Spinoza oder Kant beruft. Man kann sich auch nicht auf Äschylus oder Sophokles berufen. Man kann nur anführen, was Aschylus und Sophokles diesen oder jenen sagen läßt. Ebenso bei Platon. Eine so vollständige Indirektheit der Mitteilung erscheint ganz unglaublich bei einem Philosophen, und doch ist sie wirklich und gilt besonders bei dem Dialog, mit dem wir uns hier zu beschäftigen haben, beim Timaios. In einer Weise ist er von allen Dialogen derjenige mit der größten Wirkungs geschichte gewesen. Kein anderer hat so viele und so umfangreiche Kom mentare hervorgerufen wie er. Das gilt für unser Jahrhundert so gut wie für die Epoche des Neuplatonismus. Im Mittelalter war bis in die zweite Hälfte des 12. Jhs. hinein der Timaios die einzige Schrift Platons, von der man wenigstens Teile in lateinischer Übersetzung besaß: die Auszüge mit dem Kommentar des Chalzidius. Erst dann wurden die beiden Dialoge Phaidon und Menon ins Lateinische übersetzt, und zwar auf Sizilien, am Hof des Normannenkönigs Wilhelm I. (1154—1166), durch Aristipp (f 1162), einen Vertäuten der königlichen Familie. Für die Phaidon-Übersetzung ist als genaue Datierung das Jahr 1156 überliefert. Aber diese bei den neuen Platon-Texte blieben ohne größere Wirkung. Erst im 15. Jh. kam es zu einer wirklichen Platon-Rezeption. Der Timaios gehört in die Gruppe der Spätdialoge und ist verfaßt in den fünfziger Jahren des 4. Jhs., im letzten Lebensjahrzehnt Platons, der 347 mit 80 Jahren starb. Wie in den meisten Spätdialogen ist auch im Timaios nicht mehr Sokrates der Gesprächsführer, sondern ein Fremder, in diesem Fall Timaios von Lokri in Unteritalien, ein Pythagoreer, über dessen Per son wir nichts weiter wissen als das, was, wenig genug, aus dem Dialog
100
selbst hervorgeht. Timaios führt auch nicht wirklich ein Gespräch mit den anderen Teilnehmern der Runde: Sokrates, Hermokrates und Kritias, sondern liefert in langen, zusammenhängenden Ausführungen eine Dar stellung von der Erschaffung der Welt und des Menschen. Daß Platon diese Lehren einem Pythagoreer in den Mund legt, hat bei einem Teil der Interpreten zu der Ansicht geführt, sie seien auch pythagoreischen Ur sprungs. Daß Platon, der mit dem Pythagoreer Archytas von Tarent per sönlich befreundet war, durch die Wahl des Gesprächsführers den Pytha goreern eine Reverenz erweisen wollte, wird man nicht bezweifeln kön nen, aber daß auch der Inhalt der Lehren vorwiegend oder gar samt und sonders, wie einige meinen, pythagoreisch ist, läßt sich nicht halten. Die »Wissenschaft der Pythagoreer« in klassischer Zeit ist so gering bezeugt, daß eine solche Annahme ohne jede Rechtfertigung ist. Dem entspricht auf der anderen Seite der Versuch der Pythagoreer, Platon und sein Werk für sich zu reklamieren. Wir haben schon gehört, daß Platon in die Suk zession der pythagoreischen Schule einbezogen und zum neunten Nach folger des Pythagoras erklärt wurde (s. o. S. 35) und daß der Dialog Ti maios für ein Plagiat ausgegeben wurde, für die Ausbeutung einer Schrift des Philolaos, die Platon an sich gebracht haben sollte. Im 2. Jh. v. Chr. wurden Teile des Timaios exzerpiert und kontaminiert und unter dem Namen des Timaios von Lokri auf den Markt gebracht, ein Machwerk, das vorgab, die Urschrift des Timaios von Lokri zu sein, die dem Werk Platons zugrunde gelegen habe. Alle diese Machenschaften beweisen in Wirklichkeit nur, daß man Platon streitig zu machen suchte, was sein und seiner Schule Eigentum war. Auf die nähere Unterscheidung, was im Dia log platonisch und was pythagoreisch ist, können und brauchen wir hier nicht einzugehen. Wir haben daher für den Titel dieses Kapitels die Über schrift »Die Kosmologie des (Dialogs) Timaios« gewählt, die die strittige Frage ganz offenläßt. Es genügt, mit der Kosmologie vertraut zu werden, die gegenüber der aristotelischen eine Gegenposition bedeutete und spä ter von den Anti-Aristotelikern wiederum als Autorität angerufen werden konnte. Den zeitlichen Rahmen des Dialogs bildet die Fiktion, das Gespräch über die Weltschöpfung finde zwei Tage nach dem großen Gespräch über die Natur des »Staates« statt, eine der Mystifikationen, von denen das Werk eine ziemliche Reihe enthält. Es gibt auch viele sprachliche Schwierigkei ten, teils sachlicher Art, teils Entstellungen durch schlechte Überliefe rung, die längst nicht alle geklärt und immer noch unverstanden oder kontrovers sind, ein Fest für Kommentatoren. Inhaltlich, auch das ist etwas Besonderes, gliedert sich der Dialog in drei 101
Teile. Zuerst gibt Sokrates ein kurzes Resümee über die im Staat verhan delte Erziehung der Wächter. Dann trägt Kritias in Form historischer Überlieferung die Sage von der Insel Atlantis vor, deren Ursprung bis heute ungeklärt ist und die nicht wenig zum Ruhm und zur Faszination des Timaios beigetragen hat. Erst an dritter Stelle folgt dann der Haupt teil, der Bericht über die Erschaffung der Welt und des Menschen.
DER RAUM, DIE ZISTERNE DES WERDENS
Den Schöpfergott nennt Platon vielfach Demiourgos — Schöpfer, Urhe ber, wobei jedoch immer die ursprüngliche Bedeutung von Künstler, Werkmeister u. ä. mitklingt. Er nennt ihn aber auch einfach Gott. Man darf sich durch den Titel Demiurg nicht verführen lassen, darunter wie bei den Gnostikern nur eine untergeordnete Gottheit zu verstehen, die die verächtliche Aufgabe hat, sich mit der Materie einzulassen, während der ewige Gott hoch über der materiellen Schöpfung in seiner reinen unwan delbaren Lichtwelt thront. Der Text läßt wenig Zweifel, daß der Demiurg die oberste Gottheit ist, so unbestimmt deren Wesen sonst auch bleiben mag. Die naheliegende Frage, warum der Demiurg die Welt erschafft, wird im Timaios sowenig beantwortet wie im Schöpfungsbericht der Genesis. Wir erfahren nur, daß der Demiurg, der selbst gut und ohne Neid ist, die Ab sicht hat, auch die Welt so gut und so vollkommen wie möglich zu ma chen. Sehr im Unterschied zum Schöpfungsbericht des Alten Testaments wird die Welt des Timaios aber nicht aus dem Nichts geschaffen, vielmehr findet der Demiurg zwei fundamentale Konstituentien bereits vor. Das eine ist die Welt der Urbilder (paradeigmata), der unwandelbaren, ungeworde nen und unvergänglichen, immer selbigen Ideen, die nur dem Denken zu gänglich und faßbar sind (noStä). Von dieser Welt des Seins wird der Demiurg ein Abbild (mimSma) schaffen, die Welt des Werdens, in der es Entstehen und Vergehen gibt und die auch wahrnehmbar und sichtbar ist. Mit einer berühmten Formulierung nennt er sie ein bewegtes Abbild der Ewigkeit. Die Ewigkeit ist das urbildliche Zugleich, durch die Bewegung wird das Abbild in die Zeit auseinandergelegt. Dieses Abbild also, und nur dieses, wird vom Demiurgen geschaffen. Dasjenige aber, wohinein der Demiurg die Welt des Werdens erschafft, das findet er auch bereits vor wie das Sein der Urbilder. Es ist der Raum (chöra). Damit ist aber nicht der leere Raum, die reine Dreidimensionalität gemeint. Sondern dieser Raum ist bereits mit Bewegung und mit Spuren der Elemente erfüllt.
102
Diese Urelemente bewegen sich ungeordnet und regellos durcheinander, sie werden vom Raum geschüttelt wie von einem Sieb, das Spreu und Wei zen trennt — und häuft, so daß bereits eine Urordnung eintritt: Das Leichte gesellt sich zum Leichten, das Schwere zum Schweren. Dieser mit Urelementen und Urbewegung erfüllte Raum, dem Apeiron vergleichbar, ist weder dem Denken noch der Wahrnehmung zugänglich — wir sehen nur Räumliches, nicht den Raum selbst —, sondern nur durch einen ille gitimen Bastardschluß faßbar (logismos tis nothos), kaum glaublich, einem Traum vergleichbar (52 B). Dieser Raum nun ist das Material der Schöpfung, ist dasjenige, in dessen regellose Bewegung der Demiurg Regel und Ordnung bringen wird und aus dessen amorphen Urelementen er die vier Elemente schaffen wird. Das ist der Sinn des Raumes, die vier Ele mente zu ermöglichen. Der Raum ist also alles andere als ein bloßes Receptaculum rerum, er ist vielmehr das, was man Deutsch das Einräu mende, Aufnehmende, Raum Gewährende nennen könnte. Und so ge braucht denn auch Platon selbst eine Vielfalt von Ausdrücken, von denen das formale chöra — Raum der unwichtigste ist. Er nennt es Aufnahme, Bergungsort (hypodochß) und Amme (tithSne) des Werdens. Er kann es auch Mutter nennen, oder er nennt es Sitz (hedra) des Werdens, was allem Werdenden Wohnung und Stätte gewährt. Er nennt es auch einmal Zisterne (dexamenS 53 A). Wir sehen, daß nicht nur bildliche Anschauung das ganze offenhält, sondern daß Platon auch eine terminologische Fixie rung vermeidet, in direktem Gegensatz zu Aristoteles. Durch eine Vielfalt von Vergleichen versucht er die Sache eher zu umschreiben als zu bezeich nen. Einmal nennt er das Aufnehmende auch ekmageion — Matrize oder Knetmasse. Und als solche, die alle Formen annehmen kann, muß sie selbst formlos (ämorphon), allaufnehmend (pandeches) und unsichtbar sein. Und dadurch eben ist sie weder dem Nous, noch der Wahrnehmung faßbar. Wir betonen noch einmal: Die Schöpfung des Timaios ist keine Schöp fung von Anfang, sondern der Demiurg findet sowohl die Urbilder als auch ungeordnete Materie und Bewegung vor, und sein Schöpfungswerk besteht darin, Materie und Bewegung nach dem Muster der Urbilder zu ordnen.
DIE KONSTRUKTION DER ELEMENTE In der Lehre von der Materie übernimmt Platon, wie auch Aristoteles, die vier Elemente des Empedokles, aber die Elementenlehre des Timaios ist i°3
eines der wichtigsten und interessantesten Stücke des ganzen Dialogs. Denn Platon hat es unternommen, die Elemente mathematisch zu definie ren. Wir sagen Platon, denn diese Lehre scheint wirklich nicht das Verdienst der Pythagoreer gewesen zu sein. Er erreicht damit eine Ratio nalität, die ausgesprochen modern wirkt und jedenfalls sowohl die Elementenlehre der Atomisten als auch die des Aristoteles weit hinter sich läßt. Charakteristisch ist, daß Platon die Elemente weder durch Volumen, noch durch Masse definiert, sondern allein durch ihre Oberfläche. Für den modernen Leser und Betrachter mit der modernen Physik und Che mie als Basis ist das eine ebenso überraschende wie unbefriedigende Lösung. Innerhalb der platonischen Philosophie ist sie jedoch ganz natür lich und konsequent. Das eigentliche Sein, die Idee des Menschen oder Pferdes oder Tisches oder Hauses, was deren Charakteristisches aus macht, das ist ihr Aussehen (eidos). Und so ist es auch bei den Elementen10. Ihnen entsprechen die regelmäßigen, sog. Platonischen Körper. Aufgebaut, d. h. umschlossen sind diese Körper von Flächen der elementarsten Form, von Dreiecken. Das Dreieck ist die einfachste Fläche. Dreiecke besonderer Art, nämlich regelmäßige Dreiecke sind das gleich seitige Dreieck mit drei Winkeln von 60° und das rechtwinklige Dreieck. Die regelmäßigste Form dieses letzteren ist das gleichschenklige Dreieck mit einem Spitzenwinkel von ?o° und zwei Hypothenusenwinkeln von je 450. Von den ungleichschenkligen rechtwinkligen Dreiecken gibt es unendlich viele Varianten. Eine besondere Form ist jedoch die, die sich ergibt, wenn wir ein gleichseitiges Dreieck durch eine Senkrechte teilen. Dann erhalten wir zwei rechtwinklige ungleichschenklige Dreiecke mit Winkeln von 30°, 6o° und 90° und mit Seitenlängen von 1, 2 und y^. Dieses Dreieck bezeichnet Platon wegen seiner regelmäßigen Steigerung
Abb. 8/9
104
Das Elementardreieck in zwei Kombinationen
von Winkeln und Seitenlängen als das schönste. Wir werden es im folgen den zur einfacheren Verständigung das Elementardreieck nennen.
Ist das Dreieck die einfachste Fläche, so ist die dreiseitige Pyramide der einfachste Körper, denn die regelmäßige Pyramide besteht aus vier glei chen Dreiecken, so daß sie, wie immer man sie auch stellt, immer auf
105
einem ihrer vier Dreiecke ruht und immer dasselbe Aussehen hat. Der nächste platonische Körper ist das Oktaeder, der Acht-Flächner. Es be steht aus zwei gegeneinandergestellten vierseitigen Pyramiden und wird eingeschlossen von acht gleichseitigen Dreiecken. Es folgt das Ikosaeder, der Zwanzig-Flächner, eingeschlossen von einem Gürtel aus zehn gegen ständigen Dreiecken, oben und unten gedeckt durch zwei Pyramiden aus je fünf gleichseitigen Dreiecken. Diese drei stereometrischen Formen weist Platon den Elementen Feuer, Luft und Wasser zu. Das Feuer als das leichteste und durchdringendste Element hat die spitzeste, schneidendste Form, das Wasser als das schwerste die kompakteste, die Luft als das mitt lere Element die mittlere. 106
Da diese Elemente aus lauter gleich großen Elementardreiecken bestehen, so können sie sich, wenn sie z. B. durch Druck aufgelöst werden, ineinan der umwandeln. Ein Oktaeder (Luft) besteht aus 2 x 8 = 16 Elementar dreiecken, ein Tetraeder (Feuer) aus 2x4 = 8 Elementardreiecken. So kann sich ein Luft-Oktaeder in zwei Feuer-Tetraeder verwandeln und um gekehrt. Ein Ikosaeder (Wasser) besteht aus 2 x 20 = 40 Elementardrei ecken. So kann sich ein Wasser-Ikosaeder z. B. in fünf Feuer-Tetraeder oder in drei Feuer-Tetraeder plus zwei Luft-Oktaeder oder in ein FeuerTetraeder plus zwei Luft-Oktaeder verwandeln. Auf diese Weise sind also die Elemente ineinander umwandelbar. Platon hat aber auch eine zwang los sich anschließende Erklärung dafür, daß es von jedem Element viele Arten gibt. Die Elementardreiecke haben verschiedene Größen, und durch diese Größenunterschiede ergeben sich die verschiedenen Modifi kationen der Elemente. Es wird nicht ausdrücklich gesagt, versteht sich aber von selbst, daß diese Größenunterschiede nicht regellos sind, son dern in festen Verhältnissen zueinander stehen — wenigstens teilweise —, so daß sich auch die Modifikationen der Elemente ineinander umwandeln können. Andere Modifikationen kommen durch Mischung zustande. Ein amüsantes Beispiel bilden die mit Feuer vermischten Wässer (hydata empyra 60A). Es gibt zahlreiche solcher Mischungen. Die meisten sind namenlos, aber vier von ihnen haben eine Bezeichnung erhalten. So heißt diejenige, die die Seele mitsamt dem Körper erwärmt, Wein. Andere sind nicht nur durch Wärme-, sondern auch durch Lichteffekte, die ebenfalls vom Feuer herrühren, differenziert: das 01, der Honig, die Pflanzensäfte. So kann man, wie Platon mit charakteristischer Selbstironie einfügt, wenn einem die schwierigen Untersuchungen über das ewig Seiende einmal zu anstrengend werden, sich zur Erholung ein harmloses Vergnügen und sinnvolles Spiel mit der Betrachtung des Werdens bereiten (59 C). Eine besondere Bewandnis hat es jedoch mit der Erde, die aus Würfeln besteht. Die quadratischen Seitenflächen ergeben, diagonal geteilt, gleich schenklige rechtwinklige Dreiecke. Wenn man von der Spitze das Lot fällt, so ergeben sich auch wieder gleichschenklige rechtwinklige Dreiecke. Niemals ergeben sich Elementardreiecke. Das bedeutet, daß sich Erde nicht in die anderen Elemente umwandeln läßt und umgekehrt. Der »Kreislauf« der Natur beginnt sozusagen erst oberhalb der Erde. Es gibt zwar, wie die Abbildungen 14—16 zeigen, eine Exhaustionsmethode, mit der man Elementardreiecke erzielen kann, aber es bleibt in der Mitte immer ein unaufgelöstes Quadrat übrig11. Zwar kann man diese Restquadrate immer weiter bis ins unendlich Kleine auflösen, aber damit erhält man nur immer weitere disparate Größen, die nicht ineinan107
der aufgehen. Die Rationalität der Elementardreiecke, wie sie die anderen Elemente auszeichnet und ihre Konvertibilität begründet, fällt beim Element Erde aus. Es gibt noch einen fünften regelmäßigen Körper, das Pentagondodekae der, den Zwölf-Flächner, der wie ein Ball aus zwölf Fünfecken zusammen gesetzt ist. Die Fünfecke lassen sich auch nicht in Elementardreiecke auf lösen. Außerdem sind alle Elemente schon untergebracht. Es ist das Pen tagondodekaeder die »Kugel«, die die Welt als ganze umschließt.
G
108
Abb. 14-16 Das Quadrat läßt sich nicht rational in Elementardreiecke zerlegen
DIE ERSCHAFFUNG DER WELT UND DER ZEIT
So hat der Demiurg aus der ungeordneten Urmasse, die eine Art Apeiron darstellte, das aus isolierten Dreiecken wie aus lauter Scherben bestand, die Ordnung der Elemente geschaffen, und aus diesen Elementen schafft er nun die Welt. Die Gestirne schafft er selbst, als sichtbare Götter. Aber daneben schafft er eine zweite Art Götter, die sich nur zeigen, wenn sie wollen. Es sind die Götter der traditionellen Staatsreligion, und durch diese läßt er, als Schöpfungsmittler, die Lebewesen, Pflanzen, Tiere, Men schen schaffen. Nun soll die Welt nach dem Muster ihres Vorbildes ein vollkommenes Lebewesen sein. Dazu braucht sie eine Seele, denn der Ur sprung des Lebens und der Bewegung ist das sich selbst Bewegende, die Seele. Wenn die Seele erst jetzt erwähnt wird, so hat in Wirklichkeit der Demiurg sie als das Edlere und Würdigere vor der Welt geschaffen. Übri gens ist der Ausdruck »Weltseele« erst später aufgekommen, Platon selbst gebraucht ihn nicht. Die Weltseele wird nach harmonischen Verhältnissen geschaffen, in Potenzen von 2 und 3, die in Form eines Lambda angeord net werden können: i
2 4 8
3 9
27
Diese Progression wird nun noch weiter unterteilt durch mystifizierende Verhältnisangaben, die nicht im ersten und auch nicht im zweiten Zugriff aufgelöst werden können und eine Reihe z. T. sehr komplizierter Kon struktionen hervorgerufen haben. Man vermutet darin Tonfolgen, so daß die Welt nach harmonischen Verhältnissen eingerichtet ist. Das ganze scheint zunächst an die Idee der pythagoreischen Sphärenharmonie zu erinnern. Es ist jedoch überaus auffällig, daß Tim. 37 B 5 ausdrücklich betont, die Gestirne vollzögen ihre Umläufe ohne Laut und Schall. Das steht in direktem Gegensatz zur pythagoreischen Lehre. Die musikalische Skala, vermutlich in der Länge von vier ein Sechstel Oktaven, ist in Form eines Bandes vorgestellt, das der Demiurg der Länge nach in zwei Bänder trennte. Jedes bog er zu einem Kreis zusammen, von denen der eine etwas größer war als der andere. Diese beiden Kreise brachte er nun so miteinander in Verbindung, daß sie einen gemeinsam 110
den Mittelpunkt hatten, aber gegeneinander geneigt waren. Den äußeren Kreis bestimmte er als den Kreis des Selben, den inneren als den des Ver schiedenen. Den Kreis des Selben führte er rechts herum, von Osten nach Westen, und gab ihm die größere Kraft, da er ihn ungeteilt ließ. Den ande ren führte er links herum und teilte ihn sechsmal ab, so daß sieben unglei che Kreise entstanden mit Abständen des Doppelten und Dreifachen, von denen es jeweils dreie gab. Nachdem Gott der Sonne, dem Mond und den fünf Planeten die Leiber geschaffen hatte, setzte er sie auf den sieben Bahnen im Kreis des Verschie denen in ihre Umläufe ein: den Mond zuerst, dann die Sonne, danach den Morgenstern (heösphoros, Venus) und den Stern, der dem Hermes heilig ist (Merkur)12. Diese beiden Planeten erhielten dieselbe Geschwindigkeit wie die Sonne, aber mit einer ihr entgegengesetzten Richtung. Daraus er gibt sich, daß die Sonne Venus und Merkur teils überholt, teils von ihnen überholt wird. Was aber die Bahnen der übrigen Planeten, die namenlos bleiben, betrifft, so würde die Untersuchung, wohin Gott sie gesetzt habe und warum gerade dorthin, so schwierig und zeitraubend sein, daß Timaios vorschlägt, sie auf ein anderes Mal zu vertagen. Mit dem größeren Kreis des Selben ist also der gleichförmige tägliche Um schwung des Himmels gemeint, mit dem kleineren Kreis des Verschiede nen die Ekliptik, in der die Planeten, einschließlich Sonne und Mond, in ent gegengesetzter Richtung den Tierkreis durchlaufen, die inneren mit größerer Geschwindigkeit als die äußeren. Der Mond durchläuft den Tierkreis in einem Monat, die Sonne in einem Jahr, der Saturn in 29 Jahren. Mit der Einsetzung der Gestirne aber hat Gott zugleich die Zeit gesetzt: Denn Tage und Nächte, Monate und Jahre gab es nicht, bevor der Him mel entstanden war. Aber nun schuf er gleichzeitig mit dem Himmel auch diese. Denn diese alle sind Teile der Zeit. . . . Die Zeit ist also zusammen mit dem Himmel entstanden. (37 E 1—3; 38 B 6)
Es folgt schließlich noch eine Bemerkung über das Große Weltjahr. Die vollkommene Zahl der Zeit bringt das vollkommene Jahr zur Voll endung, wenn die acht Umläufe zur Übereinstimmung gekommen und wieder an ihren Ausgangspunkt zurückgekehrt sind (39 D). Die Aussage, daß die Zeit geschaffen und zugleich mit dem Himmel ent standen sei, muß zunächst irritieren. Denn nicht nur stellt sich sofort die Frage, was war vor der Erschaffung des Himmels und der Zeit, sondern diese Frage wird vom Timaios ja auch ganz konkret beantwortet. Vor der Erschaffung der Welt war die Unordnung und regellose Bewegung der Ur in
elemente. Bewegung außerhalb der Zeit ist für uns generell nicht vorstell bar. Aber Platon unterscheidet scharf zwischen zwei verschiedenen For men der Bewegung, geordneter und ungeordneter Bewegung. Und Zeit ist definiert als Zahl der Bewegung. Zeit bedeutet meßbare Zeit. Sein heißt Bestimmtsein. Darin hat die klassische griechische Philosophie eine ihrer Grundvoraussetzungen. Meßbar aber ist nur die geordnete, periodische Zeit. Platon hätte sicher nicht bestritten, daß vor der Erschaffung der Welt auch eine Art Zeit war. Aber er hätte sie mit dem unfaßbaren Raum verglichen. So wie dieser unbestimmt bleibt, weder dem Denken noch der Wahrnehmung zugänglich ist, sondern nur einem träumerischen Bastard schlußverfahren erscheint, so wäre auch die Zeit vor der Zeit nur etwas unbestimmbar Vages.
DREHUNG DER ERDE UND EINZIGKEIT DER WELT Lange und heftige Diskussionen hat es über die Frage gegeben, ob Platon (der Timaios) eine Drehung der Erde lehre. In 40 B 8 findet sich die For mulierung, daß die Erde sich um die Weltachse winde (illomenen peri ton diä pantös polon tetamenon). Diejenigen, die es für ausgeschlossen hal ten, daß Platon eine Drehung der Erde gelehrt habe, übersetzen das frag liche Verb mit sich ballen. Die sich um die Weltachse ballende Erde ruht natürlich. Nun läßt sich aber nicht gut darum herumkommen, daß illetai eine Bewegung bedeutet. So hat man eine Oszillation, eine Pendelbewe gung daraus gemacht, die folgenden Sinn gehabt haben soll. Wenn der Timaios die Voraussetzung macht, daß Sonne, Mond und Erde sich in einer Ebene befinden, so würde daraus folgen, daß bei jedem Vollmond eine Mond- und bei jedem Neumond eine Sonnenfinsternis eintritt. Da das nicht der Fall ist, so habe die angenommene Pendelbewegung die Erde aus dem Zentrum ausschwingen lassen und dadurch die Linie zwischen Sonne und Mond freigegeben. Aber eine Pendelbewegung der Erde im Zentrum der Welt ist eine ganz unmögliche Vorstellung. Timaios nennt an der betreffenden Stelle die Erde die erste und älteste aller Gottheiten, die innerhalb des Himmels entstanden sind. Für die Erde kommt wie für alle anderen Gestirne, wenn überhaupt, nur die vollkommene Bewegung, die Kreisbewegung in Frage. Entscheidend aber ist, daß Aristoteles in De caelo ausdrücklich überliefert, daß Platon die Erde rotieren ließ, wie es das Verb illetai in Wirklichkeit auch besagt {De caelo B 13, 293 b 30 ff., vgl. B 14, 296a 26). Und der englische Philosophiehistoriker F. M. Cornford hat auch eine recht einleuchtende Erklärung dafür gefunden, jeden-
112
falls die einzige, die etwas Annehmbares ergibt. Cornford nimmt für den Timaios die Vorstellung an, daß der Umschwung des Himmels, der Kreis des Selben, auch die Erde im Zentrum mitnehme. Damit wäre aber für die Erde der Kreislauf des Sternenhimmels als Phänomen aufgehoben, denn beide drehen sich gleich schnell. Damit der Himmel sich für die Betrachter auf der Erde dreht, muß die Erde eine gleich schnelle Gegen bewegung vollziehen. Das Ergebnis ist dasselbe, als ob sie ruhte. Ein Gedanke, den der Timaios mit großem Nachdruck betont und der ihn ausnahmsweise einmal mit Aristoteles verbindet, ist der, daß es nicht viele Welten, sondern nur eine einzige gibt (s. u. S. 130). Aber wenn Aristo teles argumentiert: da die Welt allen vorhandenen Stoff umfasse, könne es außer ihr keine weitere geben, ist Platons Begründung allgemeiner. Da die Welt nach einem einzigen Vorbild geschaffen sei, so müsse sie selbst auch einheitlich sein. Gäbe es aber mehrere Welten, so könnten sie nur Teile eines Ganzen sein, und eben das sie Umfassende (periechon) wäre dann die Welt (31 A/B). Der Dialog schließt mit den nachdrücklichen Worten: So hat denn diese Welt sterbliche und unsterbliche Wesen in sich auf genommen und ist von ihnen erfüllt, als ein sichtbares lebendiges Wesen, das selbst wieder das Sichtbare umfaßt, ein Abbild des Geistigen, ein sichtbarer Gott, und ist zu der größten und besten, schönsten und voll kommensten Welt geworden, diese eine, einzig entstandene Welt (heis ouranos hode monogenes ön).
Mit der Weltschöpfungslehre des Timaios erreicht die griechische Kosmo logie einen ersten Abschluß, vielleicht ihren nie wieder erreichten philoso phischen Höhepunkt, denn sie liefert eine erstaunliche Synthese aller vor aufgegangenen Ideen und Tendenzen. Der unüberbrückbare eleatische Gegensatz von Sein und Werden ist zum Ausgleich gebracht durch die Ver bindung der materiellen mit der intelligiblen Welt. Die Frage nach dem Ursprung der Bewegung ist beantwortet durch die Berufung auf die Seele. Die Seele als das sich selbst Bewegende ist der Urheber aller geordneten Bewegung. Die Frage nach dem Stoff war schon durch Empedokles’ Lehre von den vier Elementen zu einer ersten Synthese gebracht worden, um nun bei Platon ihre perfekte Systematik zu finden. Die Elemente werden aus standardisierten Grundflächen konstruiert und gehen nach festen Verhältnissen ineinander über. Die amorphen Partikelschwärme der Atomisten sind durch eine mathematische Ordnung abgelöst, in der die alt pythagoreischen Seinsbestimmungen von Harmonie und Zahl ihre Erfül-
113
lung finden. Zufall und Wirbel, die die mechanistische Welterklärung der Atomisten bestimmen, sind durch den Gedanken eines sinnvollen Plans nach geistigen Urbildern ersetzt. Der nur tastend eingeführte Nous des Anaxagoras findet im Demiurgen seine abschließende Verkörperung. Er ist der Garant nicht nur des Bestandes der Welt, sondern auch ihrer Ord nung und Schönheit, oder genauer: Aufgrund ihrer vom Demiurgen gewirkten Ordnung und Schönheit wird die Welt Bestand haben, da er keinen Anlaß sieht, sein vollkommenes Werk zu widerrufen. Man hat ge sagt, das ganze literarische Werk Platons sei eine einzige Auseinanderset zung mit Demokrit — den er namentlich niemals erwähnt. Das ist zwar deutlich, aber eben zu diesem Zweck weit übertrieben. Der Kontrast jedoch trifft vollkommen zu. Einem mechanistischen Zufallssystem ist programmatisch ein planvoller, sinnvoll gegliederter, vielfach in sich bezo gener Kosmos gegenübergestellt, nicht als strukturiertes »Weltgebäude«, sondern als beseeltes, lebendiges Wesen. Ein so organisches, harmoni sches, auch optimistisches Weltbild wie das des Timaios hat es in der grie chischen Kosmologie nie wieder gegeben. Schon bei Aristoteles sind entscheidende Vorzüge des platonischen Kosmos aufgegeben, nicht auf grund umfassenderer Realkenntnis, sondern zugunsten einer physika lisch-kinetischen Konstruktion.
114
»Was aber am Himmel regelmäßig seine Bahn zieht, gibt damit ein hohes Zeugnis, daß es Vernunft besitzt, da es immer dasselbe und auf dieselbe Weise vollbringt.«
Die Epinomis Die Epinomis ist der Anhang, sozusagen das 13. Buch der Gesetze, des großen Alterswerks, das Platon im letzten Jahrzehnt oder Jahrzwölft sei nes Lebens schuf. Es ist nicht ganz sicher, ob Platon selbst oder sein Schü ler Philippus von Opus der Verfasser ist. Der Unterschied ist nicht sehr groß. Auf jeden Fall handelt es sich um ein echt platonisches Werk, und eher stammt es sogar von Platon selbst. Die Epinomis stellt die wichtige Frage, die in den Gesetzen nicht zum Ab schluß kam: Was ist es, was zur Weisheit führt? Was muß der sterbliche Mensch erlernen, um weise zu werden? Nach Durchmusterung der übli chen Wissenschaften und Künste ergibt sich, daß sie zwar das Notwen dige und Annehmliche des Lebens bereitstellen, aber nicht zur Weisheit führen. Diesen Vorzug und dieses Vermögen hat allein die Zahl. Sie ist das größte Geschenk der Götter an die Menschen, denn die Erkenntnis der Zahl führt zur Erkenntnis der Ordnung, und Befolgung der Ordnung ist Weisheit. Die Bedeutung der Zahl wird an zwei großen Beispielen illustriert, an der Fünfzahl der Elemente und an der Achtzahl der Gestirnsphären. Im Unterschied zum Timaios nennt die Epinomis nicht vier, sondern fünf Elemente: Feuer, Wasser, Luft, Erde und Äther (in dieser Reihenfolge, 981 C), so daß nun auch dem Dodekaeder ein Element zugeordnet ist, das fünfte (Quinta essentia). Aber der Äther ist hier nicht wie bei Aristo teles das oberste Element, aus dem die Sterne bestehen und das er deshalb nicht das Fünfte, sondern das Erste Element nennt, sondern die obere, klare Region der Luft. Luft und Äther bilden zusammen die mittlere Region. Sie sind der Aufenthaltsort der Dämonen, göttlicher Mittel wesen, die von dort aus teils zur Erde hinab-, teils zu den Gestirnen auf steigen. Die Dämonen sind unsichtbar. Sichtbare Lebewesen befinden sich dagegen in den beiden äußersten Regionen, auf der Erde Menschen, Tiere, Pflanzen, am Himmel die Gestirne. Aber während die Erdregion der Veränderlichkeit und Unordnung unterworfen ist, ziehen die Sterne immer dieselbe Bahn, auf immer dieselbe Weise, unaufhörlich, seit unvor denklichen Zeiten. Daß die Sterne niemals ihre Bahn verlassen, beweist, daß sie Seele und Vernunft besitzen, denn nur ein vernünftiger Wille ver 115
mag diese Ordnung einzuhalten, vermag, bei dem einmal gefaßten Ent schluß zu bleiben. Die Epinomis läßt es ausdrücklich offen, ob die Gestirnseelen bei ihrem jeweiligen Körper oder in ihm sind, jedenfalls sind die Gestirne die sicht baren Götter. Sie werden durch die Epinomis nachdrücklich als solche propagiert. Mit den traditionellen Göttern, mit Zeus und Hera und all den anderen, die sich bald zeigen, bald verbergen, mag ein jeder es halten, wie er will, aber daß die Gestirne sichtbare Götter sind, deren Verehrung die Griechen bisher vernachlässigt haben, ist die erklärte Lehre der Epino mis. Und ausdrücklich wird hinzugefügt, daß es keinen Unterschied der Dignität zwischen ihnen gebe, sondern daß sie alle gleich göttlich seien. Mit dieser Lehre von der Göttlichkeit der Gestirne wird das Fundament gelegt für die Entwicklung der Astrologie in hellenistischer Zeit, die ohne diese Voraussetzung unmöglich gewesen wäre und die bis dahin in Grie chenland nicht bestand. Über die Zusammensetzung der Gestirne gibt die Epinomis die erstaun liche Erklärung, daß sie nicht nur aus Feuer bestünden, sondern daß ihnen auch Erde und Luft und kleine Bestandteile der beiden übrigen Ele mente beigemischt seien, so daß aus der verschiedenen Mischung dieser Bestandteile verschiedenartige Wesen dieser Gattung hervorgehen, alle aber sichtbar (981 D/E). Und neu ist auch, was von der Größe der Ge stirne gesagt wird, daß nämlich jedes von ihnen einen erstaunlichen Um fang habe, daß die Sonne größer sei als die ganze Erde, ja, daß überhaupt die Größe aller am Himmel einherwandelnden Sterne unsere Vorstellung weit übersteige (983 A). Von den acht Gestirnen werden zuerst die Sonne, der Mond und die Fix sternsphäre genannt, einfach, weil sie allgemein sichtbar und jedem be kannt sind. Zugleich scheinen aber doch Sonne und Mond auch als die erdnächsten Gestirne betrachtet zu werden. Die Planeten folgen erst dar über: Merkur und Venus mit ungefähr gleicher Umlaufszeit wie die Sonne, dann Mars, Jupiter, Saturn mit immer längeren. Die Epinomis hat also noch keine Vorstellung davon, daß sich Merkur und Venus, die sog. inneren Planeten, unterhalb der Sonne befinden. Über die Zahl und Namen der Planeten lesen wir:
Diese drei (gleich schnell laufenden) sind die Sonne, der Morgenstern (Heösphoros) und ein dritter Planet, dessen Name sich nicht angeben läßt, weil es keinen für ihn gibt. Die Ursache davon ist, daß derjenige, der ihn zuerst beobachtete, ein Nichtgrieche (Barbar) war. Denn Gegen den wie (As)syrien (Babylonien) und Ägypten mit klarem Sommer und
116
wolkenlosem Himmel.. . nährten jene Menschen, die zuerst den Himmel beobachteten. Von dort aus hat sich (dann) das, was sie Jahrtausende hin durch . . . immer wieder beobachtet haben, unter allen Völkern und so auch bei uns verbreitet. . . Auch haben die Gestirne von ihnen Bezeich nungen erhalten, durch die sie bestimmten Göttern als Eigentum zugeteilt werden. Denn der Morgenstern (Heösphoros), der mit dem Abendstern (Hésperos) identisch ist, heißt der Stern der Aphrodite (Venus). . . Der jenige Stern aber, der mit ihm und mit der Sonne die gleiche Umlaufszeit hat, heißt gewöhnlich der des Hermes (Merkur). (986 E — 987 B)
Es folgen dann, nach dem Grad ihrer Langsamkeit angeordnet, die drei oberen Planeten Kronos (Saturn), Zeus (Jupiter) und Ares (Mars). Es ist das erste Mal in der griechischen Literatur, daß die fünf Planeten mit Namen genannt werden. Einzig der Merkur war schon im Timaios vor ausgegangen (38 D). Die Stelle ist von einiger historischer Bedeutung. Die Tatsache, daß es außer für Morgen- und Abendstern (= Venus) keine grie chischen Namen gab, was die Epinomis ausdrücklich betont, läßt keinen Zweifel, daß die Planeten den Griechen bis ins 4. Jh. unbekannt waren und ihnen deren Kenntnis erst durch die Babylonier vermittelt wurde, wie die Epinomis ebenfalls ausdrücklich betont. Da es unwahrscheinlich ist, daß der Timaios nur den Merkur zitiert hätte, wenn ihm auch die anderen Planetennamen schon bekannt gewesen wären, so läßt sich die Vermitt lung der babylonischen Planetenkenntnis mit großer Sicherheit zwischen Timaios und Epinomis, d. h. um die Mitte des 4. Jhs., setzen. Alle Ver mutungen über frühe, und besonders pythagoreische Planetenkenntnisse sind anachronistisch. An anderer Stelle sagt der Athener: Wisset, daß es im ganzen Weltraum acht miteinander verschwisterte Mächte (dynämeis) gibt, wie ich beobachtet habe. Und ich habe damit nichts Großes vollbracht, denn leicht kann dies auch ein anderer. (986 A)
Wenn diese Selbstaussage des »Atheners« auch nicht wörtlich zu nehmen ist, so bestätigt sie doch noch einmal ausdrücklich, daß die Kenntnis der fünf Planeten erst vor kurzer Zeit erworben wurde. Gegen Ende wird dann noch einmal die zu Anfang gestellte Frage aufge nommen, was zur Weisheit führe. Es ist die Astronomie als die Beschäfti gung mit den sichtbaren Göttern. Es werden dabei auch die Wissenschaf ten genannt, die der Astronomie vorhergehen und mit ihr das Quadri117
vium bilden: Arithmetik, Geometrie und Harmonielehre. In der Harmo nik aber werden nur die Zahlen 6, 8, 9 und 12 erwähnt, d. h. die Zahlen, in deren Verhältnissen die Oktave, Quart und Quint eingeschlossen sind. (Es fehlt auch hier die Terz.) Das bedeutet historisch, daß keine anderen harmonischen Verhältnisse thematisiert werden als die vor alters von den Pythagoreern entdeckten. Es ist keine Rede davon, daß die Kenntnis der fünf Planeten sofort eine ihnen korrespondierende »Sphärenharmonie« evoziert hätte. Und so kann demnach auch keine Rede davon sein, daß dem Weltsystem des Philolaos mit seinen zehn Gestirnen auch bereits eine pythagoreische Sphärenharmonie zugeordnet gewesen wäre. Das histori sche Zeugnis der Epinomis erscheint in zwei wichtigen Punkten als ganz eindeutig. Die Kenntnis der fünf Planeten gehört erst der Mitte des 4. Jhs. an, und eine frühe, dem Planetensystem entsprechende pythagoreische Sphärenharmonie hat es niemals gegeben. Die unter dem Namen des Phi lolaos überlieferten Nachrichten, die von der Sphärenharmonie sprechen, sind spätere Rückprojektionen. Wir schließen mit der Erinnerung, daß es die Epinomis ist, in der jener charakteristische Satz griechischer Selbsteinschätzung steht: Was immer die Griechen von den Barbaren übernommen haben, sie haben Schöneres und Vollkommeneres daraus hervorgebracht. (917 D)
118
Eudoxos von Knidos (395-342. V. Chr.)
Eudoxos von Knidos war nach Aristoteles der vielseitigste Gelehrte des 4. Jhs. Als er mit 23 Jahren nach Athen kam, hatte er bereits in Unter italien bei Archytas von Tarent Mathematik und bei Philistion von Lokri Medizin studiert. In Athen wurde er Schüler Platons. Seine Heimat war die dorische Stadt Knidos auf der gleichnamigen Halbinsel an der West küste Kleinasiens. Das Jahr seiner Geburt ist nur unsicher überliefert und hat unterschiedliche Ansätze gefunden. Fest steht, daß er ein Lebensalter von 53 Jahren erreichte und daß seine Lebenszeit in die erste Hälfte des 4. Jhs. fällt. Sein erster Aufenthalt in Athen dauerte nur wenige Monate. Er kehrte in seine Heimat zurück und begab sich von dort mit Unterstüt zung knidischer Freunde und mit einem Empfehlungsschreiben des spar tanischen Königs Agesilaos nach Ägypten an den Hof Nektanebos. Hier blieb er eineinhalb Jahre, ließ sich von den Priestern in den ägyptischen Traditionen und Wissenschaften unterweisen und errichtete bei Heliopo lis eine eigene Sternwarte. Es ist die erste griechische Sternwarte, von der wir wissen. Sie wurde, wie der Geograph Strabon im 1. Jh. n. Chr. berich tet, damals den griechischen und römischen Reisenden noch als Sehens würdigkeit gezeigt. Von Ägypten kehrte Eudoxos nach Kleinasien zurück und eröffnete in Kyzikos am Marmarameer seine erste Lehrtätigkeit. Spä ter wirkte er eine Zeitlang am Hof des Mausollos in Halikamaß, um sich dann in Athen niederzulassen. Hier wurde er ein enger Freund und Mit arbeiter Platons, ja, als Platon 361 seine dritte Sizilienreise antrat, soll er ihm für die Zeit seiner Abwesenheit die Leitung der Akademie übertragen haben. Über ihrem Eingang stand, nach einer freilich nicht allzu verläß lichen Überlieferung, der Satz: Wer nichts von Geometrie versteht, hat hier keinen Zutritt. Auch wird von Platon das Diktum überliefert, daß Gott allezeit Geometrie treibe. Die außerordentliche Wertschätzung, die Platon den mathematischen Wissenschaften und besonders auch der Astronomie entgegenbrachte, fand nun ihre Erfüllung durch die Zusam menarbeit mit dem bedeutendsten Mathematiker der Zeit. Die besondere Aufgabe, die sich ergab oder die vielleicht Platon dem Eudoxos geradezu stellte, war, die Planetenbahnen zu berechnen, d. h., ein Himmelsmodell, eine Himmelsmechanik zu entwickeln, die eine solche Berechnung ermöglichte. 119
Von den vielen Schriften des Eudoxos über zahlreiche und vielfältige Themen ist keine einzige erhalten geblieben. Aber indirekt ist seine Wirk samkeit reich bezeugt. So enthält das 5. Buch der Elemente Euklids die Proportionenlehre des Eudoxos, während in Buch 6 seine Ähnlichkeits und in Buch 12 seine Kreis- und Kugellehre eingegangen sind. Er hatte eine exakte Exhaustionsmethode entwickelt, um den Inhalt nicht gerad linig begrenzter Flächen und Körper zu bestimmen. Zahlreich sind die Fragmente und Erwähnungen seiner Erdbeschreibung (Ges pertodos), die beweisen, welch außerordentliche Verbreitung und Benutzung dieses Werk bis in römische Zeit, wo es mehrere lateinische Übersetzungen erfuhr, gefunden hat. Seine geologischen Nachrichten, soweit die Phänomene bis heute erhalten geblieben und überprüfbar sind, erweisen sich alle als zuverlässig. Aber das Buch umfaßte nicht nur Geolo gisches und Geographisches, sondern auch Kulturgeschichtliches und Literarisches zu den einzelnen Landschaften. Viele singuläre Nachrichten sind nur bei Eudoxos erhalten. Besonders instruktiv war natürlich sein Kapitel über Ägypten, wo er aus seiner reichen eigenen Anschauung schöpfen konnte. In der Philosophie hat besonders die Ethik des Eudoxos Nachhall gefunden. Er lehrte, das höchste Gut sei die Lust, hedone, mit der Begründung, 1. daß alle Wesen, hohe und niedrige, vernünftige und unvernünftige, nach ihr strebten, und 2. daß sie um ihrer selbst willen erstrebt werde und die Frage »Wozu?« in ihr eine abschließende Antwort finde und nicht mehr auf etwas weiteres darüber hinaus gewiesen werde. Platon soll als Antwort darauf den Dialog Philebus geschrieben haben mit seiner differenzierten Unterscheidung der vielfältigen sinnlichen und geistigen Genüsse. Aristoteles hat die Lehre des Eudoxos unter Nennung seines Namens zweimal in der Nikomachischen Ethik thematisiert, im 12. Kapitel des 1. Buches im Zusammenhang seiner Erörterung über die Eudämonie und im 2. Kapitel des 10. Buches innerhalb seiner Analyse der Lust. Um Eudoxos gegen Mißverständnisse in Schutz zu nehmen, fügt er die persönliche Bemerkung ein: Diese seine Lehre fand aber mehr durch die Lauterkeit seines Charakters Glauben als durch ihren Inhalt. Denn er war bekanntlich ein Mann von außerordentlicher Besonnenheit. Den größten Nachhall aber fand seine naturwissenschaftliche Schrift über die Phänomene, die zwar auch nicht erhalten ist, die aber vom Dich ter Aratos von Soli am Hof des makedonischen Königs Antigonos Gonatäs in Hexameter übertragen wurde und der in dieser Form ein ganz außerordentlicher, bis heute nachwirkender Erfolg beschieden war. Der große Astronom Aristarch von Samos hat einen eigenen Kommentar dazu verfaßt.
120
Was nun unser eigenes Interesse angeht, so gilt es vor allem seiner Astro nomie, seiner Lehre von den konzentrischen Kugelschalen. Sie ist uns im wesentlichen bei zwei Autoren erhalten, bei Aristoteles im 8. Kapitel des i2. Buches der Metaphysik und bei Simplizius in zwei Referaten seines Kommentars zu Aristoteles’ Schrift Über den Himmel. Das Hauptpro blem war, wie schon gesagt, die Unregelmäßigkeiten der Planetenbahnen mathematisch zu erfassen und zu berechnen. Die Planeten kreisen ja nicht wie der Fixsternhimmel oder die Sonne gleichmäßig um die Erde, sondern
Abb. 18
Scheinbare Bahn der Venus von November 1957 bis April 1958
sie verändern ständig ihre Position relativ zur Sonne, eilen ihr voraus, ste hen still, werden rückläufig, stehen wieder still, rücken aufs neue vor, und dies noch dazu in individuell abgewandelter Weise. Die Erklärung stand nun für Platon, Eudoxos und Aristoteles unter einer ganz strikten Voraus setzung, nämlich daß für die Gestirne als göttliche Wesen nur die voll kommene Bewegung denkbar sei, und das ist die Kreisbewegung. Diese Voraussetzung blieb für die ganze antike und mittelalterliche Astronomie gültig, aber es kam für die platonische und aristotelische Welterklärung die weitere, sehr spezielle und einschränkende Voraussetzung hinzu, daß die kombinierten Kreisbewegungen alle konzentrisch verliefen. So kam es also für jeden Planeten zu der Annahme einer Reihe konzentrischer Kugelschalen, durch deren unterschiedliche, teils gegeneinander ver121
setzte, teils direkt entgegengesetzte Bewegung sich eine Kombination ergab, die den scheinbaren Planetenbahnen wenigstens nahekam. Man nahm dabei nicht Ringe oder Reifen an, wie Anaximander oder Parmenides, sondern Sphären, Kugelschalen. Im ganzen nahm Eudoxos innerhalb des Fixsternhimmels 26 solcher Kugelschalen an, je drei für Sonne und Mond, je vier für die fünf Planeten. Das Gestirn selbst befand sich und kreiste jeweils auf dem Äquator der innersten Kugelschale. Die äußerste Schale vollführte den täglichen Umschwung innerhalb von 24 Stunden, konform mit dem Umschwung des Fixsternhimmels. Daß Eudoxos die sen nicht einfach alle Planeten mitnehmen ließ, sondern jedem von ihnen einen eigenen Tagesumlauf zuschrieb, beweist deutlich, daß es sich um kein physisch-mechanisches, sondern um ein reines Rechenmodell han delte, denn sonst wären die sieben äußeren Kugelschalen überflüssig gewesen. Das mathematische Modell sollte die Planetenbewegungen geometrisch erklären und ihre Berechnung ermöglichen. Ein Realitätsan spruch war damit nicht verbunden. Die Fragen, woraus die Kugelschalen bestünden, wie sie ineinander befestigt seien, wodurch sie in Bewegung gehalten würden, blieben gänzlich offen. Die zweite Kugelschale vollführte den Umlauf innerhalb der Ekliptik, für den Mond innerhalb eines Monats, für die Sonne innerhalb eines Jahres, für die Planeten nach ihren Umlaufszeiten. Dje dritte Schale des Mondes sollte wahrscheinlich seiner Breitenschwankung innerhalb der Ekliptik Rechnung tragen. Was die dritte Schale der Sonne zu bedeuten hat, ist un klar. Die dritten und vierten Schalen der Planeten sollten die Anomalien der Planetenbahnen erklären und ergaben die sog. Hippopede, den Pfer dezügel, d. h. die Schleife, Lemniskate, auf der sich der Planet innerhalb
Abb. 19
122
Die Hippopede des Eudoxos
eines schmalen Zylinders bewegte (Abb. 19). Mit Hilfe der zweiten Kugel schale wird die Lemniskate die Ekliptik entlanggeführt. Der Planet voll führt also auf dem Hintergrund des Fixsternhimmels eine komposite Be wegung. Die Hälfte der Periode wird sein Lauf auf der Lemniskate entlang der Ekliptik beschleunigt, die andere Hälfte verzögert. Wenn die Rück wärtsbewegung auf der Lemniskate größer ist als die Vorwärtsbewegung auf der Ekliptik, wird der Planet rückläufig, wenn beide gleich sind, kommt er zum Stillstand. Die Breite der Lemniskate gibt die Breitenabwei chung von der Ekliptik an. Das Kugelschalensystem des Eudoxos ist zum erstenmal analysiert und durchgerechnet worden von dem italienischen Astronomen G. V. Schiaparelli (1875). Schiaparelli konnte zeigen, daß das System für Jupiter und Saturn, in gewissem Umfang auch noch für Merkur brauchbare Ergeb nisse lieferte, daß es für Venus unzureichend war und beim Mars gänzlich versagte. Schiaparelli nahm an, daß Eudoxos für seine Berechnungen sorgfältige Bahnbeobachtungen vorgelegen haben, die er, da in Griechen land solche Planetenbeobachtungen damals und noch lange danach gar keine Tradition hatten, aus Babylonien oder Ägypten erhalten habe. Man darf solche Informationsquellen füglich bezweifeln. Es lag in der Natur des konzentrischen Systems, daß es grundsätzlich nicht imstande war, die Anomalien zu erklären, die durch wechselnde Entfernungen der Planeten von der Erde eintraten, und dieses Unvermö gen hat ihm dann auch nach wenigen Jahrzehnten den Kredit entzogen. Es war seit langem bekannt, daß die Jahreszeiten verschiedene Länge hat ten, daß die Sonne also nicht gleichförmig um die Erde läuft. Schon zur Zeit des Perikies hatte Euktemon um 430 die Länge der Jahreszeiten — mit dem Frühling beginnend — zu 93,90,90 und 92 Tagen angegeben. Solcher Anomalie konnte Eudoxos mit seinem konzentrischen System nicht Rechnung tragen. Er suchte dieser Schwierigkeit aus dem Wege zu gehen, indem er sie ignorierte. Er nahm einfach möglichst gleich lange Jahreszeiten an, drei zu 91 und eine zu 92 Tagen. Viel auffälliger noch waren die Entfernungsschwankungen von Venus und Mars, wo Erdferne und Erdnähe sich so stark unterscheiden, daß es zu großen Veränderungen in der Lichtstärke kommt (Abb. 20). Diesem Phänomen gegenüber war das konzentrische System ziemlich hilflos. Und dabei stand die Venus, als das hellste aller Gestirne nach dem Mond, auf besonders vordringliche Weise im Zentrum des astronomischen Interes ses. Sie hatte sogar eine Art Sprichwörtlichkeit angenommen. Aristoteles, der im Fünften Buch der Nikomachischen Ethik die Gerechtigkeit als die vollkommenste aller Tugenden aufweist, rühmt sie, indem er unter Ver-
123
Vollvenus
Abb. 20
Größen- und Helligkeitsveränderung der Venus
wendung eines Verses von Euripides sagt, weder der Morgen- noch der Abendstern sei so herrlich wie sie (E 3). Dennoch nimmt Eudoxos in der Geschichte der griechischen Sternkunde einen überaus ruhmvollen Platz ein, denn mit Recht kann er als der erste wissenschaftliche Astronom Europas gelten. Hier war das Jahrhunderte währende Stadium kosmologischer Spekulation und Konstruktion über schritten zugunsten mathematischer Berechnung. Zum erstenmal gingen Beobachtung und Berechnung die Verbindung ein, die von da an allein als wissenschaftlich gelten konnte. Wenn man aber daraus schließen wollte, daß von nun an philosophische oder zahlenmystische Konstruk tion, die nicht durch Beobachtung gestützt war, unhaltbar geworden wäre, so wäre das unhistorisch. Wir werden sehen, daß der berühmte Ptolemäus, der größte Mathematiker unter den antiken Astronomen, mas senhaft Beobachtungsergebnisse beiseite setzte und selbst abänderte, um seine mathematischen Formeln und spekulativen Zahlen nicht zu gefähr den. Wenn wir nach alledem zum Schluß noch nach den Realien fragen, so ist zu berichten, daß Eudoxos die Sonne für neunmal größer hielt als den Mond. Da beide praktisch denselben scheinbaren Durchmesser haben, so bedeutet das, daß er die Entfernung der Sonne wohl für neunmal so groß gehalten hat wie die des Mondes. Wir finden darin eine charakteristische, für das ganze Altertum gültige Diskrepanz zwischen großer mathemati scher Versiertheit und ganz ungenügender Realeinschätzung.
124
»Es bewegt, wie das Geliebte bewegt, und durch ein Bewegtes bewegt es alles andere.
Aristoteles (384—322 v. Chr.)
Nikomachos, der Vater des Aristoteles, war Leibarzt des makedonischen Königs. Aristoteles war also von Jugend auf mit medizinischen und natur wissenschaftlichen Fragestellungen und Tatbeständen vertraut. Außer dem wuchs er in der Nähe des makedonischen Königshofes auf und war Altersgenosse Philipps II. (359—336), der ihn 343 zum Erzieher seines Sohnes Alexander berief. Aristoteles war damals 41, der Kronprinz 13 Jahre alt. Vier Jahre dauerte die Unterweisung des künftigen Weltherr schers, bis Alexander, bereits mit 17 Jahren, die Reichsverweserschaft für seinen im Kriege stehenden Vater übernahm. Als Aristoteles mit 41 Jahren als Prinzenerzieher an den makedonischen Königshof von Pella ging, hatte er zuvor zwanzig Jahre lang, von seinem 17. bis zu seinem 37. Lebensjahr, der platonischen Akademie in Athen an gehört, wo er gleichzeitig Lehrer der Rhetorik war. Als Platon 347 starb, wurde nicht Aristoteles, sein bei weitem begabtester und bedeutendster Schüler, sein Nachfolger, sondern Speusipp, ein Neffe Platons. Aristoteles ging damals mit einigen anderen Platonikern auf Einladung des dortigen Herrschers nach Assos an der kleinasiatischen Westküste. Ab 345 weilte er für ungefähr zwei Jahre auf der Insel Lesbos. Hier und in Kleinasien trug er wichtiges Material für seine spätere Zoologie zusammen. 335 kehrte Aristoteles nach Athen zurück und gründete dort mit 49 Jahren seine eigene Schule. Zu ihrer Stätte wählte er ein im Osten der Stadt gele genes Gymnasium, das er schon früher benutzt hatte. Es war dem lykischen Apollon geweiht, und daher trägt die aristotelische Schule den Namen Lykeion, lat. Lyceum. Sie heißt aber noch häufiger Peripatos, ent weder von der Allee, in der Aristoteles gewöhnlich lehrte, oder, wie die meisten antiken Autoren annehmen, weil er nicht stehend oder sitzend, sondern im Umhergehen (peripatein) zu lehren pflegte. 323 starb Alexander d. Gr., und in Athen gewann die antimakedonische Partei die Oberhand, und Aristoteles, als einem der prominentesten Ver treter Makedoniens, wurde der Prozeß gemacht. Um das politische Motiv
125
zu verschleiern, klagte man ihn der Gottlosigkeit an, wegen einer alten, Jahrzehnte zurückliegenden Hymne, die er seinem verstorbenen Freund Hermias gewidmet hatte. Aristoteles verließ daraufhin Athen, um — wie er mit Anspielung auf das Schicksal des Sokrates sagte, — die Athener davor zu bewahren, sich ein zweites Mal an der Philosophie zu vergreifen. Er begab sich nach Chalkis auf Euböa, woher die Familie seiner Mutter stammte. Dort ist er schon ein Jahr später, 322, im Alter von 62 Jahren gestorben. Die Arbeitsleistung des Aristoteles, seine Bedeutung für die Grundlegung der Philosophie und seine Wirkung bei der Nachwelt grenzen geradezu ans Übermenschliche. Während bei Platon die Philosophie weitgehend noch in der einen Übung der Phronesis und der Dialektik beschlossen ist, begegnet uns in Aristoteles der Schöpfer der philosophischen Disziplinen, die er z. T. in exemplarischer Ausführung präsentierte. Er ist der Schöpfer der Logik mit der Lehre vom Urteil, vom Schluß und von der Beweisfüh rung, in einer Vollständigkeit, daß Kant 1765 in seiner eigenen Logikvor lesung bemerken konnte, seit den Tagen des Aristoteles habe die Logik, wie die Geometrie seit der Zeit Euklids, keine nennenswerten Fortschritte gemacht. Aristoteles schuf die Ethik, Ontologie und Metaphysik. Er be gründete die Physik, die Lehre von Raum und Zeit und von der Bewegung, die Staatsphilosophie, die Seelenlehre, die Lehre von der Dichtung und die Rhetorik. Leistungen großer Organisationsbegabung waren seine Samm lung von nicht weniger als 158 griechischen Verfassungen, die er als Mate rialsammlung für seine Staatsphilosophie anlegte, und die unendlichen Materialien, die er für seine zahlreichen Werke zur Zoologie zusam mentrug. Aristoteles war auch der erste Europäer, der eine große Bibliothek zusam menbrachte. Von Platon erhielt er den halb ironischen, halb bewundern den Beinamen »der Leser«. Im Mittelalter erübrigte sich die Nennung seines Namens. In der aristotelischen Tradition der Scholastik hieß er ein fach »der Philosoph«. — Wir beschäftigen uns hier nur mit seiner Him melslehre.
NATÜRLICHER ORT UND NATÜRLICHE BEWEGUNG Aristoteles hat von Empedokles die Lehre von den vier Elementen über nommen, die durch ihn bis in das Mittelalter kanonisch wurde. Die vier Elemente sind Kombinationen der vier Grundqualitäten warm und kalt, feucht und trocken:
126
FEUER |
warm
—
trocken |
LUFT feucht
—
| ERDE
kalt
¡WASSER
Die mathematische Konstruktion der Elemente aus Dreiecken, wie sie der Tbnaios lehrte, hat er aufgegeben, er nimmt statt dessen eine gemeinsame Urmaterie (pröte hyls) an, die sich in die einzelnen Elemente ausformt. Die Elemente können also ineinander übergehen, und zwar alle, während bei Platon die Erde wegen ihrer Konstruktion aus speziellen Dreiecken in konvertibel war. Es gibt Elemente, die keine Qualitäten gemeinsam haben wie Feuer und Wasser oder Luft und Erde, und andere, die eine Qualität gemeinsam haben wie Feuer und Luft, Luft und Wasser, Wasser und Erde oder Erde und Feuer und die sich daher leichter ineinander verwandeln. Die Elemente sind in der Welt in konzentrischen Sphären angeordnet. In der Mitte ruht die Erdkugel, darauf das Wasser, darüber erheben sich die Sphären der Luft und des Feuers. Das Feuer muß man sich als heiße, trockene Ausdünstung vorstellen, nicht als Flamme. Es ist ein leichtent zündlicher Stoff, der schon durch eine geringe Bewegung entflammt wer den kann. Die genannten Sphären sind die vier Regionen, die den Elementen von Natur zukommen, ihre sog. natürlichen Örter (oikeioi topoi). Aristoteles schreibt den Elementen eine innewohnende Tendenz zu, sich an ihren natürlichen Ort zu begeben. Wasser und Erde streben nach unten, dem Zentrum zu, Luft und Feuer nach oben, der Peripherie zu. Und je größer die Masse des jeweiligen Elements ist und je mehr es sich seinem natür lichen Ort nähert, desto größer ist seine Geschwindigkeit, desto schneller seine Bewegung (oikeia kinesis/. Da aber jedes Element an seinem natür lichen Ort zur Ruhe kommt, so muß — nach der angenommenen Be schleunigung — der Übergang von Bewegung zur Ruhe mit großer Abruptheit, bei Wasser und Erde sogar mit heftigem Aufschlag erfolgen. Wasser und Erde streben nach unten, d. h., sie sind schwer, Luft und Feuer streben nach oben, d. h., sie sind leicht. Hier ist natürlich ein sanfterer
12-7
Stillstand vorstellbar. Die leichten Elemente schlagen nicht, sondern tau chen in ihre Sphäre ein. Wir finden also bei den Elementen zwei entgegen gesetzte Bewegungstendenzen, nach oben und nach unten, und da Feuer und Erde hierbei die Extreme bilden, so spricht Aristoteles häufig nur von ihnen als den beiden Exponenten und nennt die beiden anderen die Zwischenelemente (tä metaxy toütön). Wir wollen ausdrücklich noch einmal betonen, daß es in diesem Modell keines Anstoßes von außen, keiner äußeren Bewegungsursache bedarf. Die Elemente streben von Natur zu dem ihnen zugehörigen Ort. Es gibt nur äußere Hindernisse und Gegenbewegungen, die sie davon abhalten, der ihnen innewohnenden Bewegungstendenz zu folgen.
DAS FÜNFTE ELEMENT Nun finden wir aber in der sichtbaren Welt noch eine ganz andere Bewe gung, nämlich die Kreisbewegung des Himmels und der Sterne. Aristote les nimmt daher an, wie es den vier kanonischen Elementen innewohne, sich nach unten oder oben zu bewegen, so müsse es ein weiteres Element geben, dessen natürliche Tendenz es sei, sich im Kreise zu bewegen. Es gibt also im ganzen drei einfache Bewegungen: von der Mitte fort, auf die Mitte zu und um die Mitte herum (apo toü mesou, epi tö meson, peri to meson. De caelo A 2). Das Element mit der Kreisbewegung nennt er Äther. Der Äther als Element verdankt seine Existenz einem reinen Ana logieschluß des Aristoteles und hat doch selbst in der Physik des 19. Jhs. noch die größte Rolle gespielt. Sein hypothetischer Charakter war weitge hend vergessen, bis 1887 die beiden amerikanischen Physiker Michelson und Morley durch ihr berühmtes Experiment nachwiesen, daß der Äther als gleichmäßig den Weltraum durchziehende Materie gar nicht existiert. Als Nachtrag zu den vier kanonischen Elementen heißt der Äther im Westen gewöhnlich das Fünfte Element (Quinta essentia). Aristoteles selbst nennt ihn dagegen das Erste Element ipröte ousia, pröton söma), und zwar deswegen, weil er als himmlisches Element gegenüber den vier irdischen eine viel höhere Dignität besitzt. Sie rührt her aus der größeren Dignität der Kreisbewegung. Die gradlinige Bewegung der kanonischen Elemente ist endlich, sie findet ihre Grenze am jeweiligen natürlichen Ort und kann, wenn sie fortgesetzt werden soll, nur — unter Zwang — in ent gegengesetzter Richtung erfolgen. Die Kreisbewegung dagegen verbin det den Anfang mit dem Ende, kehrt in sich selbst zurück, ist ewig. Ja,
128
Aristoteles behauptet sogar, die Kreisbewegung habe im Unterschied zur linearen keine Entgegensetzung, da sie, gleichviel in welcher Richtung sie erfolge, immer an ihren Ausgangspunkt zurückkehre, sich schließe und erneuere. Zugleich mit seiner Bewegung ist auch der Äther selbst unver gänglich und unveränderlich. Aus ihm bestehen der Himmel und die Sterne. Als weiteres Argument für die Unveränderlichkeit des Himmels bringt Aristoteles vor, daß seit Menschengedenken, daß in der ganzen Zeit, deren Menschen sich erinnern können, niemals irgendeine Veränderung des Fixsternhimmels beobachtet worden sei (De caelo A 3,270b 14—17). Das Weltall ist also aufgeteilt in zwei Zonen, eine ewige und unveränder liche des Äthers, reichend vom äußersten Fixsternhimmel bis herunter zum Mond, und eine sublunare der vier Elemente, ständiger Verände rung, Vergänglichkeit und Unordnung unterworfen. Diese Zweiteilung der Welt hat für zwei Jahrtausende alle Ansätze zu einer einheitlichen Welterklärung immer wieder verhindert. Erst durch Newtons Gravita tionslehre wurde sie endgültig aufgehoben. Da der Äther sich nicht vertikal, sondern horizontal bewegt, so ist er weder schwer noch leicht. Schwere und Leichtigkeit sind Qualitäten, die bei ihm keinen Sinn haben. Aber auch sonst kommen dem Äther keine Gegensätze zu. Denn wo es Gegensätze gibt, da gibt es auch Übergang aus dem einen in den anderen, d. h. Veränderung. Das Erste Element ist aber ewig und unveränderlich. So kommen dem Äther also auch die Qua litäten warm und kalt nicht zu, und es wäre ganz falsch, ihn sich, wie es unwillkürlich wohl leicht geschieht, als feurig vorzustellen. Daß die Sterne weder aus Feuer bestehen, noch sich in Feuer bewegen, ist das aus drückliche Fazit von De caelo B 7. Wenn die Gestirne trotzdem leuchten und die Sonne sogar Wärme spendet, so kommt das von ihrer Reibung mit der Luft, unverständlicherweise, da ja die Region der Luft gar nicht bis in die der Sterne hinaufreicht. So hat schon Theophrast, der Nachfol ger des Aristoteles, in seiner Schrift Über das Feuer Kritik an dieser Erklä rung geübt, aber erst Straton, der zweite Nachfolger des Aristoteles, hat entschlossen die Konsequenz daraus gezogen und die Sterne für feurig erklärt. Am Ende des Altertums hat der christliche Philosoph Johannes Philoponos von den Voraussetzungen der jüdisch-christlichen Schöp fungslehre her die aristotelische Kosmologie energisch und mit großem Scharfsinn kritisiert, vor allem natürlich die Lehre von der Ewigkeit und Unerschaffenheit der Welt, aber nachdrücklich auch den Äther als deren Träger und Garanten.
DIE EINZIGKEIT UND ENDLICHKEIT DER WELT Das All ist der Inbegriff aller fünf Elemente, d. h. zugleich, daß es nicht mehrere, geschweige denn unendlich viele Welten geben kann, sondern nur eine einzige. Denn befände sich Materie außerhalb der Welt, so würde sie aufgrund ihrer natürlichen Bewegung zu ihrem natürlichen Ort stre ben und sich mit ihr vereinigen. Als nächste folgt die Frage: Ist die Welt endlich oder unendlich? Nach Ari stoteles sind zwar Bewegung und Zeit ewig, ohne Anfang und ohne Ende, Raum und Materie aber sind endlich. Wäre die Materie unendlich, so könnte der Fall eintreten, daß ein Element über die anderen das Überge wicht erhielte und damit die Ordnung und Harmonie der Welt auflöste. Ist aber die Materie endlich, so ist auch der Raum endlich, denn die Vor stellung eines leeren Raumes ist für Aristoteles ohne Sinn. Er bringt aber auch zwei Argumente vor, die sich auf den Raum allein beziehen. Wäre der Raum unendlich, so wäre auch die Linie vom Zentrum zur Peripherie unendlich, d. h., sie wäre eine Strecke, die niemals durchmessen werden kann. Ebensowenig könnte diese unendliche Strecke in endlicher Zeit eine Kreisbewegung ausführen. In Wirklichkeit sehen wir aber, daß der Him mel seinen Kreislauf innerhalb eines Tages vollendet. Also ist die Welt endlich. Für Aristoteles ergibt sich die weitere Konsequenz, daß sich das Unend liche (äpeiron) überhaupt nicht bewegen kann, da die kleinste Bewegung des Unendlichen bereits eine unendliche Zeit erfordern würde (De caelo A 5). Was aber eine unendliche (Welt)kugel betrifft, so ist eine unendliche Figur (von bestimmter Form), sei es Quadrat, Kreis oder Kugel ebenso un denkbar wie ein unendlicher Fuß (als Größenmaß von ca. 30 cm, ebd.). Eine »unendliche Figur« ist eine contradictio in adiecto. Das andere Argument lautet: Wenn der Raum unendlich wäre, so gäbe es in der Welt weder Zentrum noch Peripherie. In Wirklichkeit sehen wir, daß die Erde das Zentrum und der Fixsternhimmel die Peripherie bildet. Wenn die Welt aber nun endlich ist, so ergibt sich unvermeidlich die Frage: Was befindet sich außer ihr? Darauf antwortet Aristoteles: Außer ihr befindet sich weder Zeit noch Volles noch Leeres. Das klingt zunächst wie eine Umschreibung oder gar mystische Formel für das Nichts. Nichts Vol les, nichts Leeres, ein Drittes gibt es nicht, also Nichts. Aber das Argu ment, in seinen Zusammenhang gestellt, ist ganz konkret. Die Welt um schließt alle Materie. Materie befindet sich nur innerhalb ihrer, nicht außerhalb. Ohne Materie gibt es aber keine Bewegung, (denn Bewegung ist immer Bewegung von etwas,) und ohne Bewegung keine Zeit. Ohne
130
Materie gibt es nichts Volles, d. h. Raum, der mit Materie gefüllt ist, und nichts Leeres, d. h. Raum, der mit Materie erfüllt werden könnte. Wie nachdrücklich Aristoteles die Einzigkeit und Endlichkeit der Welt be tont, mag die Stelle in der Schrift Über den Himmel verdeutlichen, mit der er die ganze Diskussion abschließt und in der er sogar zu einer empha tischen Wiederholung greift:
Die Welt als ganze besteht also aus der gesamten vorhandenen Materie, so daß es eine Vielzahl von Welten weder jetzt gibt, noch jemals gegeben hat, noch in Zukunft geben wird. Sondern diese Welt ist Eine, einzig und vollkommen. Zugleich ist aber auch klar, daß es weder Raum, noch Leere, noch Zeit außerhalb der Welt gibt foude töpos, oude kenön, oude chrönos). Denn in jedem Raum kann ein Körper sein, Leere aber nennen wir das, in dem sich zwar kein Körper befindet, in das er aber eintreten kann. Zeit aber ist die Zahl der Bewegung, und ohne materiellen Körper gibt es keine Bewegung. Außerhalb der Welt aber, haben wir gezeigt, gibt es weder Körper, noch kann es solche geben. Es ist also klar, daß es weder Raum, noch Leere, noch Zeit außerhalb gibt. Deshalb sind dort weder Dinge im Raum entstanden, noch läßt die Zeit sie altern, noch gibt es Ver änderung für das, was jenseits des äußeren Umschwungs (des Fixstern himmels) eingeteilt (tetagmena) ist, sondern unveränderlich und unwan delbar (analloiöta kai apathe) genießen sie die ganze Zeit ein Leben reiner Vollkommenheit und Unabhängigkeit1^. . . . Vom Unendlichen und Göttlichen hängt auch für alle anderen Seienden, teils unmittelbarer (akribesteron), teils dunkler (amaurös), Sein und Leben ab. (De caelo A 9, 279a 8—30). Mißverständlich in der deutschen Übersetzung ist, daß das jenseits des Fixsternhimmels Befindliche im Griechischen Plural des Neutrums ist: die jenseits des Fixsternhimmels befindlichen göttlichen Wesen. Man denkt unwillkürlich an den überhimmlischen Ort (hyperouränios töpos) des platonischen Dialogs Phaidros, an dem sich die Ideen befinden. Über raschend ist am Aristoteles-Zitat sowohl der Plural als auch das Neutrum der göttlichen Wesen — wer sind sie? —, vor allem aber, daß sie, obwohl unräumlich, doch einen besonderen Bereich zugeteilt, »zugedacht« be kommen. Da sie unräumlich sind, könnten sie sich, vom Raum ganz un abhängig, überall in ihm befinden. Aber die Vorstellung des Aristoteles ist in gewisser Weise präziser, eingeschränkter, d. h. zugleich traditionel ler: Die Unräumlichen (Wesen) befinden sich eben nicht irgendwo im Raum, sondern im Unräumlichen, jenseits des Raumes. Daß dieses »jen-
131
seits« selbst eine räumliche Bestimmung ist, scheint ihn nicht gestört zu haben. Diese merkwürdige, paradoxe, eigentlich unphilosophische Fixie rung des Unräumlichen wird für uns erneut aktuell werden bei der Lehre vom Unbewegten Beweger. Die Lehre von der räumlichen Endlichkeit der Welt hat natürlich schon früh philosophischen Widerspruch hervorgerufen. Der Pythagoreer Archytas von Tarent, ein Zeitgenosse des Aristoteles, hat das Gedanken experiment angestellt: Wenn ich mich im Geist an den Fixsternhimmel versetze, so, daß mein Scheitel die Grenze des Weltalls berührt, und wenn ich dann meinen Arm hebe, wohinein erhebe ich ihn? Die Vexierfrage des Archytas führt aber automatisch zur Unendlichkeit des Weltalls, denn nun setzen wir die Gedankenreise fort, rücken mit unserem Scheitel bis in die Höhe des erhobenen Armes, der Fingerspitzen vor, heben dann aufs neue den Arm, und so fort ins Unendliche (Test. 24). In anderer, allgemeinerer Form hatte dies Argument eigentlich schon Melissos vorweggenommen. Parmenides hatte das Sein für endlich erklärt und unter dem Bild einer wohlgerundeten Kugel gefaßt. Das rief unver meidlich die Frage hervor: Was ist außerhalb dieser Kugel? Das Leere, war die einzig mögliche Antwort. Aber das Leere ist nach Parmenides Nichts, nicht denkbar, nicht seiend. Aus der Vorstellung von der Seinskugel ergibt sich aber, daß das Nichts — außerhalb der Kugel — ist. Um dieser Konsequenz zu entgehen, zog Melissos, in direktem Widerspruch zu sei nem Lehrer, den Schluß: das Sein ist nicht endlich, sondern unendlich. Ein Außerhalb, gleichviel ob mit etwas oder Nichts, gibt es gar nicht. Man könnte also den Satz des Aristoteles, außerhalb sei weder Volles noch Lee res, auch auf Melissos beziehen.
DIE KUGELGESTALT UND RECHTSDREHUNG DER WELT Daß für Aristoteles das Weltall kugelförmig ist, bedarf keines besonderen Aufweises. Wie der Kreis die vollkommene Flächengestalt ist, einge schlossen von einer einzigen, ungebrochenen Linie, so ist die Kugel die vollkommene Raumfigur, eingeschlossen von einer einzigen, ungebroche nen Fläche. Und wie die ewigen, unveränderlichen Gestirne sich auf Kreisbahnen bewegen, so dreht sich die ewige und unveränderliche Welt in einer Kugel. Die Kugel ist die einzige Figur, die sich allseits drehen kann, ohne dabei ihren Raum zu verändern. Jeder eckige Körper würde bei seiner Umdrehung ins Leere hinausgreifen, was es nach Aristoteles nicht gibt. 132
Er schließt dann die für uns überraschende Frage an, ob die Welt bei ihrer Umdrehung eine bestimmte Richtung hat. Seine Antwort lautet: Die Welt dreht sich rechtsherum, denn die Bewegung beginnt von rechts, und rechts ist die gute, die glückverheißende Seite, und so waren auch schon im System des Philolaos die Gestirne rechts um das Zentralfeuer gelaufen. Und in der Tat drehen sich ja der Himmel und die Sterne von Osten über Süden nach Westen, d. h. für uns, rechtsherum. Rechts und links gibt es aber nur, wenn es auch oben und unten gibt. Nun findet sich bei Aristote les die überraschende Auskunft, oben im Weltall sei nicht Norden, son dern Süden. Wir Europäer bewohnten nicht die obere, sondern die untere Hemisphäre. Nach Aristoteles müßten wir also alle unsere Landkarten umdrehen und auf den Kopf stellen. Die Konsequenz dieser Annahme ist aber, daß sich — für unser Verständnis — die Welt dann gerade nicht mehr rechts-, sondern linksherum dreht. Wieso für Aristoteles rechts herum? Diese Frage, die zum Glück nicht besonders wichtig ist, hat weder bei antiken noch modernen Kommentatoren eine wirklich befriedigende und einleuchtende Antwort gefunden. Die beste Lösung, die man nicht im Ergebnis, aber wenigstens im Ansatz nachvollziehen kann, bietet Sir Thomas Heath in seiner nichts übergehenden griechischen Astronomie geschichte Aristarchus of Samos, Oxford 1913, S. 231 f., vgl. auch S. 160 ff. Die Voraussetzung des Aristoteles lautet: Bewegung beginnt von rechts. Die Sterne gehen im Osten auf, also ist Osten rechts und Westen links. Stellen wir uns so auf, daß unsere rechte Seite nach Osten, unsere linke nach Westen zeigt. Dann stehen wir mit dem Kopf nach Norden, mit den Füßen nach Süden. Die Sterne gehen dann auf unserer rechten Seite auf und laufen über unseren Rücken nach links, nach Westen. Für uns ist das eine Rechtsdrehung. Für Aristoteles ist sie das deswegen nicht, weil sie nach hinten führt. Für ihn wird die Richtung durch die Bewegung be-
N W--------------- O
s 133
stimmt, die nach vorne führt. So herrscht also auf der nördlichen Hemis phäre Linksdrehung, und um daraus eine Rechtsdrehung zu machen, muß das Weltall umgepolt werden. Merkwürdig und befremdlich bleibt es für uns auf alle Fälle {De caelo B 2). Aber Aristoteles und Platon glaub ten z. B. auch, daß die Wurzeln einer Pflanze eigentlich ihr Kopf seien (Arist. De anima B 4, 416a 4; Plat. Tim. 90 A).
DER UNBEWEGTE BEWEGER Die Kosmologie, wie Aristoteles sie in der Schrift Über den Himmel konzi piert hat, kommt ohne eine erste Bewegungsursache aus. Zeit und Bewegung sind ewig. Allen fünf Elementen kommt eine ihnen spezifische Bewegungs tendenz zu. So vollzieht sich der Kreislauf der Welt in sich selbst. Aber damit begeht Aristoteles selbst eben jenes Versäumnis, das er den frühen Naturphi losophen zum Vorwurf macht, daß sie — außer Empedokles — nicht eigens nach der Bewegungsursache gefragt, sondern die Bewegung einfach mit dem Urstoff, dem Wasser, der Luft, dem Feuer, dem Apeiron und den Atomen mitgesetzt haben. Im 8. Buch der Physik und im 12. der Metaphysik stellt Aristoteles ausdrücklich die Frage nach dem Ursprung der Bewegung. Die Metaphysik ist nicht, wie die Physik, ein zusammenhängendes Buch, son dern eine lose Sammlung von nur wenigen ausgeführten Partien, in der Hauptsache vielmehr von Vortragsmanuskripten, deren Inhalt nur skizziert ist. In dieser relativ umfangreichen Sammlung bildet das 12. Buch (A) die Ausname eines zusammenhängenden Traktats. Da er in seiner zweiten Hälfte die Gotteslehre des Philosophen enthält, so nennt man ihn häufig auch die »Theologie« des Aristoteles. Die ersten fünf Kapitel enthalten allgemeine Erörterungen über Fragen der Ursachen und Prinzipien, die letzten fünf die Lehre vom Unbewegten Bewe ger. Der Ausgangspunkt ist, daß es drei Arten von Sein gibt, nämlich das sinnlich Wahrnehmbare, von dem das eine vergänglich und Gegenstand der Physik, das andere unvergänglich und Gegenstand der Astronomie ist, und ein ewiges, aber unsichtbares Sein, das Gegenstand der Theologie ist. Dane ben gibt es noch das mathematische Sein der Zahlen und geometrischen Figuren, die zwar auch ewig und unveränderlich sind, aber sie sind nicht selbständig, nicht vom Seienden abtrennbar, es kommt ihnen kein Fürsich-sein zu. Das erste von allem ist aber das selbständige Sein, und wenn dieses insgesamt vergänglich wäre, so könnte der Fall eintreten, daß alles, was ist, vergeht. Das aber ist undenkbar. Denn die Bewegung ist ewig und ebenso die Zeit, denn die Zeit ist entweder mit der Bewegung identisch oder
134
wesentlich mit ihr verbunden. Die Zeit aber ist die Folge des Früher und Spä ter, und es gibt keinen ersten oder letzten Augenblick, früher oder später als der keiner gedacht werden könnte. Also ist mit der Zeit auch die Bewegung ewig. Kontinuierlich aber ist allein die Kreisbewegung. Was, ist nun die Frage, garantiert die ewige Fortdauer der Bewegung? Wie muß es beschaffen sein? Da ergibt sich als erstes, daß es selbst nicht bewegt sein darf, denn wäre es bewegt, so wäre es veränderlich. Ist es aber veränderlich, so ist es auch vergänglich und das Sein ständig von der Möglichkeit bedroht, in sich zu sammenzufallen. Es muß also unbewegt, und das heißt zugleich, unkörper lich sein. Die weitere Frage ist dann, auf welche Weise bewegt das Unbewegte das Bewegte? Das Erste Bewegte ist der Fixstemhimmel, der in ewiger Gleichförmigkeit kreist. Aristoteles nennt ihn auch den Ersten Himmel. Da der Unbewegte Beweger unkörperlich und unräumlich, d. h. geistig ist, so kann er nicht körperlich, sondern nur geistig bewegen. Er bewegt wie das Begehrte oder das Gedachte. Die berühmteste Formulierung lautet: Er be wegt, wie das Geliebte bewegt — kinei bös erömenon (A 7,1072 b 3). So wie das Geliebte durch seine Schönheit anzieht, so setzt der Unbewegte Beweger allein durch seine Vollkommenheit den obersten Himmel in Bewegung. Und durch ihn bewegt er alles andere (ebd.). Aristoteles führt das nur ganz kurz aus. Der Erste Himmel setzt die Sonne in Bewegung. Teils führt er sie selbst mit und erzeugt dadurch Tag und Nacht, teils wird sie in der Ekliptik mitge führt, und dadurch entstehen die Jahreszeiten. Der Wechsel von Tag und Nacht und der Wechsel der Jahreszeiten aber sind, so sollen wir vestehen, der Ursprung des Lebens. An einem solchen Ursprung also hängt der Him mel und die Natur. Für den modernen Leser ist natürlich die Vorstellung befremdend, daß das Geliebte in die Liebesbeziehung gar nicht einbezogen ist, sondern seinerseits ganz ungerührt bleibt. Aber das ist ein spezielles Liebesverständnis, das sich nicht nur hier, sondern auch in der Endemischen Ethik findet und das ohne Zweifel eine griechische Sonderform formuliert. Auf das Ganze angewendet, besagt dieser Vergleich jedoch, daß zwischen Gott und der Welt keine gegen seitige Beziehung besteht, sondern allein das Verhältnis einer einseitigen Attraktion. Das Göttliche bewegt allein durch seine Gegenwart, weiter nichts. Wilamowitz hat einmal bemerkt, ein Gott, der nicht zu den Men schen komme, sei gar keiner. Der Unbewegte Beweger kommt wirklich nicht zu den Menschen, auch gar nicht erst zur Welt. Er ist strikt extramundan und steht damit außerhalb aller kultischen Religionsvorstellungen, welchen Kulturkreis auch immer man wählt. Im übrigen ist die Übersetzung Erster oder Unbewegter Beweger, so sehr sie in allen Sprachen üblich ist (Primus motor, Unmoved Mover), in Wirklich-
135
keit verfälscht und irreführend. Die griechische Formulierung lautet pröton kinoün akineton und steht im Neutrum. Es ist also in Wirklichkeit kein Un bewegter Beweger, sondern, um unser Befremden voll zu machen, das erste unbewegte Bewegende. W. Brocker hat sich nicht gescheut, die Theologie des Aristoteles eine atheistische Theologie zu nennen, und diese forcierte Be zeichnung hat zumindest das Verdienst, das moderne Befremden unbeschö nigt zum Ausdruck zu bringen. Wir wollen auch hier wenigstens kurz die Frage streifen, was das unbewegt Bewegende außer der Bewegung sonst noch leistet. Es ist Geist, Nous, und als solches denkt es. Und was denkt es? Es denkt sich selbst. Der Geist ist Denken des Denkens — nöesis noeseös. Die Scholastiker, in der Annahme, es müsse dem Nous auf die Länge monoton werden in seiner strengen Isola tion, haben ihm den ganzen Reichtum der Welt zum Denkinhalt geben wol len, und ein moderner Interpret hat ihm wenigstens die 47 oder 55 Sphären geister der Planeten zugedacht. Beides ist ein Mißverständnis. Es ist vollkom men deutlich und außer jedem Zweifel, daß Aristoteles das Denken des Denkens strikt auf sich selbst beschränkt. Darin ist er ganz konsequent, so wenig wir imstande sind, dieses Denken nach modernen Begriffen mit Inhalt zu füllen. Und dabei ist denn auch nicht zu verkennen, daß dieses System des Aristote les in seiner gedanklichen Strenge und Konsequenz von großer Imposanz ist. Es lehrt einen vielfach gestaffelten hierarchischen Aufbau und gipfelt in einem vollkommenen, ewigen, unveränderlichen Sein als Garanten des un verbrüchlichen Fortbestandes der Welt. Buch A schließt emphatisch mit dem Iliasvers: Niemals ist gut die Herrschaft von vielen — EIN Herrscher gebiete. Er erinnert unmittelbar an den Schluß des Timaios, wo auch im letzten Satz zwar nicht die Einheit des Ursprungs, aber die Einheit der Welt mit emphati scher Formel proklamiert wird (s. o. S. 113). In nacharistotelischer Zeit, im 1. Jh. v. Chr., vielleicht auch erst im 1. Jh. n. Chr., wurde von einem unbekannten Autor eine kosmologische Schrift verfaßt, die den Titel trug Über die Welt (Peri kosmou) und sich für ein an Alexander gerichtetes Werk des Aristoteles ausgab. Die Schrift stammt auf keinen Fall von Aristoteles, aber sie propagiert mit einigem Geschick viele seiner kosmologischen Gedanken. Besonders eindrucksvoll ist, wie der Ver fasser die Lehre vom Unbewegten Beweger zu illustrieren sucht. Er vergleicht ihn mit dem persischen Großkönig in Susa. Unsichtbar thront er in seinem kostbaren Palast, der umgeben ist von einer ganzen Folge gestaffelter und bewehrter Eingänge. Dem König dient eine ganze Hierarchie von Würden trägern und Funktionären, so daß sein Wille auch in dem letzten Winkel des Reiches gegenwärtig ist. Umgekehrt ermöglicht es das persische Signal
136
System der Feuerzeichen, daß der König alles, was selbst am Ende des Rei ches vorgeht, umgehend erfährt (De mundo 398 a). An anderer Stelle ver gleicht er die Wirkung des Unbewegten Bewegers mit einem militärischen Trompetenstoß, der zum Aufbruch ruft: Sie gleicht sehr stark dem, was passiert, besonders im Kriegsfall, wenn in einem Militärlager ein Trompetensignal ertönt. Jeder hört das Signal. Der eine nimmt seinen Schild auf, ein anderer legt seinen Panzer an, ein dritter seine Beinschienen oder seinen Helm. Der eine zäumt sein Pferd, der andere besteigt sein Zweigespann, der dritte gibt das Losungswort weiter. Der Kompagnie führer eilt zu seiner Kompagnie, der Befehlshaber zu seiner Abteilung, der Rei ter zu seiner Schwadron und der Bogenschütze auf seinen Posten. All das wird durch einen einzigen Trompeter ausgelöst auf Anordnung des Oberkomman dierenden. So müssen wir uns auch das Universum vorstellen, denn durch einen Anstoß werden alle Dinge angetrieben, ihre spezielle Aufgabe zu erfüllen. (De mundo 399 b)
Es folgen noch weitere Vergleiche: mit dem Steuermann eines Schiffes, mit dem Leiter eines Chors, mit dem Gesetzgeber einer Stadt. Wie der ..., so ist Gott in der Welt. Die vielfältige Wirkung eines einheitlichen Willens wird dadurch anschau lich vor Augen gestellt. Schief an den Beispielen ist aber natürlich der Ver gleich mit Willen, Befehl, Anordnung überhaupt. Denn das trifft ja gerade nicht auf das unbewegt Bewegende zu, daß es »anstößt«, da es ja in Wirk lichkeit nur »anzieht«. Es ist in den Beispielen sozusagen die Aktionsrich tung vertauscht. Schief im Vergleich des Großkönigs ist auch, daß der Herr scher ständig auf dem laufenden ist, alles, was vorfällt, erfährt. Das steht in striktem Gegensatz zur Eigenart des unbewegt Bewegenden, das am Gesche hen der Welt gar nicht teilhat. Es wäre zu voluntaristisch ausgedrückt, woll ten wir sagen: gar nicht teilnimmt, gar kein Interesse hat. Denn die Voraus setzung ist, daß es mit der Welt in gar keiner Verbindung steht, sondern gänzlich von ihr isoliert ist. Ob dies wirklich das letzte Wort des Aristoteles in theologicis gewesen ist? Wichtig und beherzigenswert ist aber, daß der an tike Autor des Aristoteles Lehre vom unbewegt Bewegenden monarchisch verstanden hat, daß sich bei ihm auch nicht die Spur eines Gedankens findet, es könnte mehrere oder gar Dutzende von Unbewegten Bewegern gegeben haben. FÜNFUNDFÜNFZIG UNBEWEGTE BEWEGER
Eine solche Lehre findet sich aber, zur großen Verblüffung jedes unbefange nen Lesers, in Kap. 8 des Buches A, das mit den Worten beginnt: 137
Ob aber dieses Sein (das unbewegt Bewegende) als eines oder mehreres und (wenn mehreres) als wie vieles anzusehen ist, darf nicht im unklaren bleiben. Der Leser von Kap. 7 und 9 findet nicht den allergeringsten Anlaß zu dem Gedanken, es könnte mehrere Unbewegte Beweger geben. Ein solcher Ge danke würde nicht nur der Beweisführung des Aristoteles, sondern manifest auch dem Inhalt des Buches widersprechen. Zwischen Kap. 7 und 9 ist aber nun, an recht ungeschickter Stelle, ein Kapitel eingeschaltet, das sich sowohl im Stil als vor allem auch im Inhalt von seinen Nachbarkapiteln auffällig unterscheidet. Unabhängig davon, wo Kap. 8 herstammt und wer es an seine Stelle gesetzt hat, ist keinerlei Sinn und Grund gegeben, die Differenz zu bestreiten. Kap. 8 führt aus:
Wir sehen aber neben der einfachen Bewegung des Alls (d. h. dem Um schwung des Fixstemhimmels), von der wir sagen, daß sie von dem ersten und unbewegten Sein verursacht ist, noch andere Umschwünge, (ebenfalls) ewige, die der Planeten . . . Dann ist es aber notwendig (anzunehmen), daß auch von diesen Umschwüngen ein jeder von einem selbst unbewegten und ewigen Sein bewegt wird. Später heißt es: Die Anzahl der Umschwünge aber muß man schon der mathematischen Wis senschaft entnehmen, die der Philosophie am nächsten steht, der Astronomie. . . . Daß aber die Zahl der Umschwünge größer ist als die Zahl der kreisenden (Gestirne), ist jedem klar, der sich auch nur halbwegs damit beschäftigt hat, denn jeder der Planeten wird von mehr als einem Umschwung mitgeführt.
Es folgt dann ein Referat über die Theorie der konzentrischen Sphären und wie viele von ihnen die führenden Astronomen glaubten ansetzen zu müssen, um die Phänomene zu retten, die Planetenbahnen zu erklären. Es wird zuerst das System des Eudoxos mit 26 Kugelschalen vorgestellt und dann das ver besserte des Kallippos mit 33 Schalen. Kallippos aus Kyzikos, der um 330 v. Chr. blühte, hatte bei Polemarch, einem Freund des Eudoxos, studiert und soll sich in Athen bei Aristoteles aufgehalten haben, um zusammen mit ihm das System des Eudoxos »zu verbessern und zu vervollständigen«. Er ließ bei Jupiter und Saturn die Zahl der Kugelschalen unverändert, fügte aber bei den übrigen Planeten je eine, bei Sonne und Mond je zwei neue hinzu. Da durch sollte natürlich die Erfassung der Umlaufbahnen verfeinert werden. Bei Venus und Merkur scheint eine wirkliche Verbesserung der Berechnung 138
erreicht worden zu sein, während die Darstellung der Marsbahn weiterhin problematisch blieb. Ein besonderes Anliegen des Kallippos war es, bei der Sonne der Ungleichheit der Jahreszeiten Rechnung zu tragen, die Eudoxos einfach übergangen hatte. Er bestimmte zunächst ihre Länge — mit dem Frühling beginnend — auf 94, 92, 89 und 90 Tage, womit er die Werte, die Euktemon hundert Jahre früher ermittelt hatte (93, 90, 90, 92), wesentlich verbesserte, und suchte sie mit den für die Sonne angenommenen fünf Kugel schalen darzustellen. Ebenso dienten beim Mond die beiden zusätzlichen Kugelschalen zur besseren Darstellung seiner von vielen Schwankungen be stimmten Bahn. Darauf folgt das System des Aristoteles selbst, das nicht weniger als 22 neue Kugelschalen einführt und es auf eine Gesamtzahl von 55 bringt. Nur beim untersten Gestirn, beim Mond, bleibt ihre Zahl unverändert, während bei Jupiter und Saturn je drei, bei den übrigen Planeten und bei der Sonne je vier neue Kugelschalen hinzukommen.
Saturn Jupiter Mars Venus Merkur Sonne Mond
Eudoxos
Kallippos
Aristoteles
4 4 4 4 4 3 3 26
4 4 5 5 5 5 5
7 7 9 9 9 9 5
33 Zahl der Kugelschalen nach Arist. Metaph. A 8
55
Dieser außerordentliche Zuwachs hat aber keine mathematische Bedeutung, sondern erklärt sich ganz anders. Die konzentrischen Systeme des Eudoxos und Kallippos waren reine Rechenmodelle ohne jeden Realitätsanspruch. Wie diese Kugelschalen angetrieben wurden, ineinander befestigt waren und aufeinander einwirkten, das blieb völlig offen. Sie sollten nur ermöglichen, die Planetenbahnen zu berechnen. Jetzt aber wurde daraus ein mechanisches System. Der Verfasser von A 8 verstand die Kugelschalen materiell, in Analo gie zum Fixstemhimmel. Und das bedeutete, daß alle Schalen aufeinander einwirkten. Vielleicht nahm er sogar an, daß sie sich berührten, wo er ihnen dann auch eine Dicke zuschreiben mußte. Um nun das Mitgenommenwer139
den durch die äußeren Kugelschalen aufzuheben, wurde in dem neuen System jedem Gestirn außer dem Mond eine zusätzliche Zahl von Kugel schalen zugeschrieben in Höhe des bisherigen Ansatzes weniger eins. Die neuen Kugelschalen bewegten sich in der Gegenrichtung und hoben dadurch das Mitgenommenwerden auf. Der Verfasser von A 8 hat sich auf die Zahl 55 nicht endgültig festgelegt, son dern hält auch 47 Kugelschalen für möglich. Es ist aber unklar, wie die Dif ferenz von 8 zustande kommt. Man hat einen Rechenfehler des Aristoteles oder das Versehen eines Schreibers angenommen. Eine andere Erklärung ist, er sei bei den Zahlen von Sonne und Mond zum Ansatz des Eudoxos zu rückgekehrt. Aber auch das ist nur eine ganz unverbindliche, wenig wahr scheinliche Vermutung. Die Zahl 47 bleibt unaufgeklärt. Während in dem mathematischen Rechensystem des Eudoxos und Kallippos die Frage des Antriebs der Kugelschalen ganz auf sich beruhen bleiben konnte, wurde sie nun in dem mechanischen Modell von A 8 aktuell und zwang den Verfasser, 55 Unbewegte Beweger anzunehmen, eine philosophi sche Monstrosität. Zugleich setzt deren Annahme natürlich voraus, daß die einzelnen Kugelschalen beseelt sind, wie es auch der Fixstemhimmel ist. Denn um nach dem unbewegt Bewegenden als dem Geliebten, Begehrten, Gedachten streben zu können, müssen sie natürlich Seele haben. Nicht leicht zu beantworten war dabei die Frage, wieso die Attraktion durch den Unbe wegten Beweger bei den einen Schalen in diese, bei den anderen in die ent gegengesetzte Richtung führte. Daß aber die 55 Unbewegten Beweger nicht alle von gleicher Dignität, son dern notwendig hierarchisch unterschieden sind, ergibt sich aus dem Welt bau selbst. So ist z. B. der Erste Himmel, der allein schon durch seinen Namen ausgezeichnet wird, die einzige von allen Kugelschalen, die alle an deren mitnimmt. Er ist dadurch an Macht und Würde allen anderen über legen. Das findet sich im Text auch unzweideutig formuliert: Daß es nun Wesenheiten (wie die unbewegt Bewegenden) gibt und daß von diesen eine die erste und (eine andere die) zweite ist nach derselben Ordnung wie die Umschwünge der Sterne, ist klar. (A 8, 1073 b 1—3)
Wie viele Unbewegte Beweger von A 8 auch vorgeschlagen werden, es bleibt wenigstens so weit beim alten, daß einer der erste und vorzüglichste ist. Den Verfasser der Schrift Über die Welt hätte es in der Tat hart ankommen müs sen, sich vorzustellen, daß 55 persische Großkönige gleichzeitig regierten oder daß 55 Trompeter gleichzeitig zum Aufbruch geblasen hätten. Wie die anderen Unbewegten Beweger aber dem Ersten nachgeordnet und wie sie 140
weiter unter sich gegliedert sind, darüber läßt sich der Text nicht aus. Es hätte ihn auch nur in Widersprüche verwickelt, und es erscheint wenig wahr scheinlich, daß er wirklich von Aristoteles selbst stammt. Dem Versuch von Ph. Merlan, die 55 Unbewegten Beweger gar als die ur sprüngliche Ansicht des Aristoteles auszugeben, fehlt jede Beweiskraft.
ZWEIERLEI PERSPEKTIVE Werfen wir abschließend noch einen Blick auf das aristotelische Weltbild im ganzen. Moderne Antiaristoteliker haben ihm seine große Monotonie zum Vorwurf gemacht. Und in der Tat, sie läßt sich nicht gut leugnen. In der sublunaren Welt streben Erde und Wasser unentwegt zum Zentrum, Luft und Feuer un entwegt zur Peripherie. Tiere und Pflanzen bringen uniform eine Generation nach der anderen hervor, und auch vom Menschen gilt: Der Mensch zeugt einen Menschen. In der translunaren Welt ziehen die Planeten ewig ihre vorgeschriebene Bahn. Der Fixstemhimmel kreist in vollkommener Einförmigkeit, ohne sich im geringsten zu verändern. Der Unbewegte Beweger bewegt, wie das Geliebte bewegt, und denkt sich selbst im Denken des Denkens. Es ist eine Welt, in der im Grunde nichts passiert, sondern sich alles nur im Kreise bewegt, eine Welt, in der vor allem nichts entschieden wird. Im Welt bild der Epinomis gab es wenigstens noch Luft und Äther als Reich der Dämonen, die die Guten bestärkten und die Bösen verfolgten. Im Weltbild des Aristoteles gibt es keine Gottheit, die sich der Menschen annimmt, so wenig es bei ihm noch Götter gibt, die die Menschen durch Verblendung ins Verhängnis führen. Der einzige Trost ist, daß Gott und die Natur nichts sinnlos und nichts vergeblich tun und daß der vernünftige Seelenteil den Tod überdauert. Ein ganz undramatisches, auch ganz unverbindliches Weltbild, wie es scheint, ohne Fall und Erlösung, ohne Himmelsreise der Seele, ohne alle Eschatologie, wie sie bei Platon so geläufig ist. Wenn man an die gleichzeitige persische Religion denkt mit ihrem ethischen und metaphysischen Dualismus, wo jeder sich zu entscheiden und Partei zu ergreifen hat, mit Bewährung und Erlösung, mit persönlichem und mit Weltund Endgericht, so tritt uns darin eine ganz andere, kämpferische Religiosi tät entgegen. Aber eines ist eine prophetische Religion, ein anderes eine kos mologische Theologie. Und diese letztere gewinnt ein anderes Ansehen, wenn wir sie im Zusammenhang der griechischen Philosophiegeschichte be trachten. Dann erweist sich nämlich, daß die Gedanken des Aristoteles einen
141
Höhepunkt darstellen in der Wirkungsgeschichte des parmenideischen Den kens. Das eine, ganz erfüllte Sein des Parmenides finden wir exemplarisch gegenwärtig im Sein des unbewegt Bewegenden. Denn dessen Sein ist reine Wirklichkeit, unter Ausschluß auch der geringsten Spur von Möglichkeit. Wäre es auch nur im geringsten charakterisiert durch Möglichkeit, dann wäre es veränderlich, und als veränderlich vergänglich, und könnte nicht den ewigen Fortbestand der Welt garantieren. Wir erinnern uns an das Wort des Melissos: Wfeww es sich in 10000 Jahren auch nur um ein Haar veränderte, so würde es in der ganzen Zeit ganz zugrunde gehen. Das unbewegt Bewe gende ist das volle, untrügliche Sein des Parmenides, ungeworden und unver gänglich, ewig und unveränderlich. Und darum kann es auch nichts anderes denken als sich selbst, denn dächte es anderes, so wäre es bereits veränder lich. Auch darin wirkt das Denken des Parmenides fort, daß das Sein als ein vollkommen Seiendes gedacht wird. Und auch der Gedanke hält sich durch, daß Sein und Gedachtwerden oder Sein und Sich-selbst-denken eines sind. Eines ist aber zuerst und vor allem das Sein selbst, und so erscheint es auch von hier aus ganz undenkbar, daß das höchste Seiende, in dem das Sein ge genwärtig ist, vieles sein soll. Das unbewegt Bewegende kann nur eines sein.
142
Heraklides Ponticus (ca. 385—310 v. Chr.)
Die im Timaios vertretene Lehre von der Achsendrehung der Erde (s. o. S. 112) wurde von Heraklides Ponticus übernommen, einem philosophi schen Schriftsteller, der später bald zur Platonischen Akademie, bald zum Peripatos gerechnet wurde. Der Beiname bezeichnet seine Heimat. Er wurde nach 388 v. Chr. in Herakleia am Pontus, d. h. am Schwarzen Meer, geboren, in der Stadt, deren Ruinen im heutigen Eregli noch zahlreich er halten sind, wo sie von deutschen Archäologen aufgenommen wurden. Um 364 kam er nach Athen, lernte dort Speusipp, den Neffen und späte ren Nachfolger Platons, kennen und wurde von ihm in die Akademie ein geführt. Wenn die Überlieferung zutrifft, muß seine Verbindung mit Pla ton ziemlich eng gewesen sein. Es heißt, daß er mit einer Reise nach Kolo phon, einer bedeutenden ionischen Handelsstadt in der Nähe von Ephesus, beauftragt wurde, um die Werke des dort heimischen Dichters Antimachos zu beschaffen. Das byzantinische Lexikon der Suda gibt an, Platon habe ihm auf seiner dritten sizilischen Reise (361/360), auf der er von Speusipp begleitet wurde, für die Zeit seiner Abwesenheit die Leitung der Akademie übertragen, eine Ehre, die freilich auch Eudoxos zuteil ge worden sein soll (s. o. S. 119). Als Platon 347 starb, übernahm Speusipp das Amt des Scholarchen, das er acht Jahre führte. Bei seinem Tode 338 war Heraklides einer der drei Kandidaten für die Nachfolge und wurde angeblich von Xenokrates nur um wenige Stimmen übertroffen. Er kehrte danach in seine Heimat zurück, wo er seine eigene Schule eröffnete. Diogenes Laertius überliefert von ihm ein Schriftenverzeichnis von nicht weniger als 47 Titeln der unterschiedlichsten Thematik. Es sind darunter eine ganze Reihe von Dialogen über die Tugenden, weiter auffallend viele Schriften über ältere Philosophen: vier Bücher mit Erläuterungen zu Heraklit, eine Schrift gegen Zenon, zwei gegen Demokrit, je eine über Protagoras und über die Pythagoreer. Er schrieb nicht nur über Dicht kunst im allgemeinen, sondern speziell auch über Homer, Hesiod und Archilochos, über Sophokles und Euripides. Von einzelnen Titeln wollen wir hier nur noch anführen seine zwei Bücher über Musik und die Schrif ten Über die Natur, Über die Dinge am Himmel und Über die Dinge im Hades. Von all diesen Werken, die z. T. noch bis in späte Zeit viel gelesen wurden, sind nur ganz geringe Reste auf uns gekommen. Sie sind gesam 143
melt und kommentiert von Fr. Wehrli, Die Schule des Aristoteles. Heft 8. 2. verb. Aufl. Bern 1969. Von den verschiedenen Zeugnissen über seine Lehre von der Erdrotation führen wir hier nur ein kurzes aus Simplizius an:
Heraklides Pontikus nahm an, daß die Erde sich im Zentrum befindet und rotiert, während der Himmel in Ruhe ist, und dachte, durch diese Annahme die Phänomene zu retten. (Simpl. De caelo 519, 9—11; Fr. 106 Wehrli) Die Idee, daß die Erde sich im Zentrum der Welt täglich einmal um ihre Achse dreht, fanden wir zum erstenmal im Timaios ausgesprochen (s. o. S. 112), und es ist naheliegend anzunehmen, daß Heraklides sie von dort übernommen hat — allerdings mit einem wesentlichen Unterschied. Bei Platon dreht sich sowohl die Erde wie der Fixsternhimmel, und die Drehung der Erde in entgegengesetzter Richtung zum Fixsternhimmel diente nur dazu, das Mitgenommenwerden der Erde durch die Umdre hung des Himmels aufzuheben. Bei Heraklides finden wir zum erstenmal die moderne Vorstellung, daß die Erde sich dreht und durch ihre Umdre hung im Verlauf eines Tages Tag und Nacht hervorruft und die scheinbare Umdrehung des Himmels, der selbst ruht. Dieser Perspektivenwechsel ist um so erstaunlicher und selbst auch ruhmvoller dadurch, daß er sich nicht durchsetzen konnte, keine Nachfolge fand. Argumente, die der Hypo these des Heraklides zugrunde liegen, sind uns nicht überliefert, aber einer seiner Hauptgründe ist sicher der gewesen, daß man auf diese Weise der Annahme entging, daß das ausgedehnte All sich an seiner Grenze mit unvorstellbarer Geschwindigkeit um sich selbst drehe, und ebenso konnte er es mit Recht befremdlich finden, daß in der traditionellen Vorstellung die Welt nicht durch eine ruhende Kugelschale begrenzt und abgeschlos sen wurde, sondern durch eine solche, die sich in rasendem Umschwung befand. Heraklides selbst scheint freilich die Vorstellung einer geschlosse nen Kugelschale überhaupt aufgegeben und die Welt für unendlich gehal ten zu haben (Fr. 112), ja, jeder Stern ist eine Welt für sich, frei im un endlichen Äther schwebend, jeweils mit eigener Erde und Atmosphäre (Fr. 113). Der Mond ist eine von Nebel umgebene Erde (Fr. 114). Die Kometen sind hoch in der Luft befindliche Wolken, die vom Feuer in der Höhe entzündet werden, wie es auch für die Meteore gilt (Fr. 116). Es hat nichts Überraschendes, wenn Heraklides in der Nachfolge Platons und des Aristoteles das ganze Universum, aber auch Planeten, Erde und Him mel für göttlich hält (Fr. in).
144
Heraklides ist noch mit einer zweiten revolutionären Annahme hervorge treten, die die Planeten betrifft. Er nahm an, daß zwar die äußeren Plane ten Mars, Jupiter und Saturn mit der Sonne um die Erde kreisten, daß aber die inneren Planeten Merkur und Venus um die Sonne und mit dieser um die Erde liefen. Wir wollen auch hier nur ein einziges Zeugnis anführen:
Obgleich Venus und Merkur, wie wir sehen, täglich auf- und untergehen, so kreisen sie mit ihren Umläufen doch in keiner Weise um die Erde, son dern umkreisen in einer freien Bewegung die Sonne. Sie haben in der Tat die Sonne zum 'Zentrum ihrer Umläufe, so daß sie zeitweise über, zeit weise unter sie, näher an die Erde heran, geführt werden. Und die Venus entfernt sich von der Sonne um die Breite von eineinhalb (Tierkreis)zeichen [= 45°]. (Mart. Capella, De nupt. VIII 880) In diesem Referat, wie in einigen anderen, wird der Name des Heraklides zwar nicht erwähnt, aber die sonstige Überlieferung berechtigt dazu, auch diese Zeugnisse auf ihn zu beziehen. Zwei Erscheinungen zeichnen Merkur und Venus vor den anderen Planeten aus: 1. daß sich ihre Größe und Lichtstärke deutlich ändert (s. o. S. 12.4, Abb. 20), woraus hervorgeht, daß sie einmal näher, einmal entfernter zur Erde stehen, und 2. daß sie sich nie über einen gewissen Grad hinaus von der Sonne entfernen, Phä nomene, die mit den konzentrischen Sphären des Eudoxos nicht zu erklä ren waren. Aber die Annahme, daß sie um die Sonne kreisten, machte
Abb. zi
Merkur und Venus als Trabanten der Sonne
145
diese Erscheinung leicht verständlich. Mit der Sonne bleiben sie stets auf der einen Seite der Erde, stehen ihr bei ihren Umläufen abwechselnd nah und fern und bleiben auch von der Erde aus gesehen immer in der Nähe der Sonne. Durch diese einfache Annahme war für das Planetensystem eine bedeutende Verbesserung erreicht. Schwierig blieb freilich die »Ret tung der Phänomene« beim Mars, der zwar auch die Lichtstärke wechselt, d. h. sich der Erde abwechselnd nähert und entfernt, aber dabei nicht immer jenseits von ihr bleibt, sondern sie umkreist. Daß Heraklides Merkur und Venus nicht um die Erde, sondern um die Sonne kreisen ließ, ist zwar von zwei Gelehrten, G. Evans in Classical Quarterly 20 (1970) und O. Neugebauer im American Journal of Philology 93 (1972) bestritten worden. Die Bezeugung ist aber verläßlich genug, um solcher Bestreitung zu widerstehen. Statt die Verdienste des Heraklides zu schmälern, haben andere Gelehrte den Versuch gemacht, sie außerordentlich auszudehnen. Der italienische Astronom G. V. Schiaparelli hat nachzuweisen versucht, daß Heraklides nicht nur Merkur und Venus, sondern schließlich alle fünf Planeten um die Sonne kreisen ließ, d. h., er versucht ihm ein System zuzuschreiben, wie es nach Kopernikus, um zwischen geozentrischem und heliozen trischem System zu vermitteln, Tycho Brahe aufgestellt hatte, das sog. Tychonische Weltsystem. Ja, Schiaparelli ging am Ende sogar so weit, Heraklides geradezu ein heliozentrisches System zuzuschreiben und ihn zum Vorläufer des Aristarch zu machen14. Diese letzte Ausweitung wurde von Tannery durch den Nachweis widerlegt, daß an der Stelle, auf die Schiaparelli sich berief, ein Interpolator den Namen des Heraklides irrtümlich für den des Aristarch eingefügt hatte. Die andere Ausweitung, daß Heraklides auch die äußeren Planeten habe um die Sonne kreisen las sen, wurde ausführlich von Th. Heath widerlegt. Noch ausgreifender ist der Versuch gewesen, mit dem van der Waerden Heraklides hat zu Ehren bringen wollen. Er will ihm nicht nur eine Ach sendrehung der Erde (Rotation), sondern auch eine Umlaufbahn um das Weltzentrum (Revolution) zuschreiben. Dieses Weltzentrum ist dabei un besetzt. Denn die Sonne befindet sich nicht in ihm, sondern kreist viel mehr ihrerseits wie die Erde und die Planeten um diese freie Mitte. Gegen solche Konstruktionen hatte Sir Th. Heath schon 1913 die, wie man nicht zweifeln kann, historisch zutreffende Bemerkung gemacht:
Es ist unzulässig anzunehmen, daß z. 7a. des Heraklides irgend jemand die Idee hervorgebracht hätte, der Platz in der Mitte der Welt werde von Nichts eingenommen und daß sowohl die Sonne wie die Erde um einen 146
idealen Punkt kreisten. Die Idee eines Umlaufs um einen immateriellen Punkt erschien erst später, in der verallgemeinernden Theorie von Epizykeln und Ekzentern. Wir finden keine Erwähnung dieser Ansicht (der Epizykeltheorie) vor Apollonius. (Th. Heath, Aristarchus of Samos. Oxf. 1913. S. 278) Es besteht weder historisches Recht noch sachliche Notwendigkeit, die sichere Überlieferung zu überschreiten. Die Lehre von der täglichen Ach sendrehung der Erde und vom Umlauf der beiden inneren Planeten Mer kur und Venus um die Sonne waren so revolutionäre Neuerungen, daß sie vollkommen ausreichen, Heraklides in der Geschichte der griechi schen Kosmologie und Astronomie einen ruhmvollen Platz zu sichern.
147
Aristarch von Samos (ca. 310—230 v. Chr.)
Die hellenistische Zeit besaß zwei große Gelehrte mit dem Namen Ari starch. Der eine war Aristarch von Samos (ca. 310—230 v. Chr.), der an dere Aristarch von Samothrake (etwa 215—145 v. Chr.). Aristarch von Samothrake war der sechste Vorsteher der Alexandrinischen Bibliothek und nicht nur einer ihrer größten Philologen, sondern der bedeutendste Homerforscher, den der Hellenismus überhaupt hervorgebracht hat. Er reinigte die überlieferten Gesänge von den im Laufe der Zeit eingedrunge nen fremden Zusätzen und etablierte den maßgebenden Text. Er schuf auch das Vorbild der künftigen Exegese, einer Exegese ohne Allegorie, sondern aus dem Text selbst entwickelt. Seine Autorität verdunkelte z. T. die Leistungen seiner Vorgänger. Aristarch von Samos, der Astronom, der Mathematiker, wie sein unter scheidender Beiname lautete, ist für alle Zeiten berühmt durch die Tat sache, daß er als erster das heliozentrische Weltsystem aufstellte. Aber wir wissen leider über ihn sehr wenig. Eudoxos wirkte in Kyzikos, Athen und Knidos, Heraklides in Athen und Herakleia am Pontus, Hipparch in Rho dos und Byzanz, Ptolemäus in Alexandria. Aber wo Aristarch seine Wirk stätte hatte, ist unbekannt. Zwar galt er als Schüler des Straton, des zwei ten Nachfolgers des Aristoteles in der Leitung der Peripatetischen Schule, was bedeutet, daß er längere Zeit in Athen geweilt haben muß. Aber wo er sich endgültig niederließ, wissen wir nicht. Ebensowenig sind die Zahl und die Titel seiner Schriften überliefert. Und nur von einer einzigen ist der Text erhalten. Es ist seine Abhandlung Über die Größe und Entfer nung von Sonne und Mond. In dieser Schrift kommt die heliozentrische These nicht zur Sprache. Sie wird daher vermutlich aus früherer Zeit stammen, als Aristarch seine revolutionäre Idee noch nicht entwickelt hatte. Über diese sind wir also nur indirekt unterrichtet. Das älteste Zeug nis stammt von Archimedes (287—212 v. Chr.), der Zeitgenosse Aristarchs war und dessen Zeugnis daher als unanfechtbar gelten kann. In seiner dem König Gelon gewidmeten Abhandlung Psammites — Sand rechner, in der er ein Notationssystem entwickelt, mit dem man auf ein fache Weise beliebig große Zahlen schreiben kann, daher der Name, be richtet er: 148
Aristarch hat eine Schrift mit gewissen Hypothesen herausgebracht, aus denen als Konsequenz der gemachten Annahmen hervorgeht, daß das Universum viele Male größer ist als das gerade erwähnte (traditionell an genommene) Universum. Seine Annahmen lauten, daß die Fixsterne und die Sonne unbewegt sind, daß die Erde in einer Kreisbahn um die Sonne läuft, daß die Sonne in der Mitte der Umlaufbahn ruht und daß die Fix sternschale, deren Zentrum mit dem der Sonne zusammenfällt, so groß ist, daß die Kreisbahn, die er für die Erde annimmt, sich zur Entfernung der Fixsterne verhält wie der Mittelpunkt einer Kugel zu ihrer Ober fläche. (Archim. Opera Bd. II S. 244 ed. Heiberg) Der Text enthält folgende Aussagen: 1. Im Zentrum der Welt ruht nicht die Erde, sondern die Sonne. 2. Die Erde bewegt sich vielmehr (wie die Planeten) in einer Kreisbahn um die Sonne. 3. Der Fixsternhimmel dreht sich nicht, sondern ruht. 4. Seine Entfernung ist im Verhältnis zum Umfang oder zum Durchmes ser der Erdbahn unvergleichlich groß. Nicht eigens erwähnt wird, daß der Mond sich um die Erde und die Erde sich um ihre eigene Achse dreht. Das letztere versteht sich aber von selbst, denn bei ruhender Sonne und ruhendem Fixstemhimmel würde sonst Tag und Nacht und die tägliche Umdrehung des Himmels nicht zustande kommen. An zwei Stellen bereitet der Text Schwierigkeiten. Wo hier übersetzt ist, Aristarch hat »eine Schrift« herausgebracht, steht in Wirklichkeit der Plu ral graphai — Schriften. Aber damit ist vermutlich nicht gemeint, daß Aristarch mehrere Bücher über seine heliozentrische These veröffentlicht hat, sondern daß diese Schrift außer den Hypothesen auch deren Begrün dung und Erläuterung enthielt. Aber von diesen Einzelheiten, die für uns von dem größten Interesse wären, ist keine einzige überliefert. Einer der Hauptgründe für die neue Hypothese muß u. a. auf jeden Fall der gewesen sein, daß Aristarch glaubte, mit ihr die Anomalien der Planetenbahnen einfacher als bisher erklären zu können. Wir wissen nicht, wie seine Er klärungen lauteten, und können sie uns nicht einmal selbst ausdenken, denn bei der Annahme konzentrischer Umlaufbahnen, die man wohl auch für Aristarch voraussetzen muß, sind »die Phänomene nicht zu ret ten«. Daß er die Sonne in die Mitte der Welt setzte, dazu könnte ihn das alte Argument veranlaßt haben, daß dem Würdigeren auch der würdigere Platz gebühre, vor allem aber auch die gewonnene Erkenntnis, daß die Sonne so viele Male größer ist als die Erde. In der überlieferten Abhand 149
lung über Größe und Entfernung von Sonne und Mond ermittelt Aristarch für das Verhältnis der Durchmesser von Sonne und Erde zwei Grenzwerte, zwischen denen der wahre Wert eingeschlossen ist. Die eine Relation lautet 19 : 3 = 6V3, die andere 43 : 6 = 7V6. Daraus ergibt sich, daß das Volumen der Sonne rund dreihundertmal größer ist als das der Erde. Es mußte widersinnig erscheinen, einen so viel größeren Körper um den kleineren kreisen zu lassen. Wenn Aristarch die Entfernung des Fixsternhimmels gegenüber den bis herigen Vorstellungen außerordentlich vergrößerte, so daß der Durch messer der Erdbahn im Verhältnis dazu verschwindend wurde, so war diese Annahme dadurch erzwungen, daß sich sonst die Sterne im Laufe des Jahres für den irdischen Betrachter gegeneinander hätten verschieben müssen, was der antiken Beobachtung widersprach. Noch Tycho Brahe (1546—1601), der große dänische Astronom, dessen Assistent Kepler war, lehnte das Kopernikanische System ab, weil er mit seinen Instrumen ten keine Verschiebung der Fixsterne feststellen konnte. Er entwarf das nach ihm benannte Tychonische System, bei dem die Planeten zwar um die Sonne kreisen, diese aber mit ihnen um die feststehende Erde. Erst Fr. W. Bessel aus Minden gelang es 1838 zum erstenmal, mit Hilfe eines speziellen Fernrohrs, dessen Objektivlinse in zwei Hälften zerschnitten war, eine Fixsternparallaxe festzustellen. Aber Aristarch nahm das Weltall nicht als unendlich an. Der letzte Satz des obigen Archimedes-Zitats, daß sich die Erdbahn zur Entfernung der Fixsterne verhalte wie der Mittelpunkt einer Kugel zu ihrer Oberfläche, ist sehr merkwürdig formuliert. In unmittelbarem Anschluß daran be merkt Archimedes selbst, daß das Verhältnis zweier Strecken nicht ver glichen werden könne mit dem Verhältnis zwischen einem Punkt und einer Fläche, wo die Proportion 1: 00 ist. Der Vergleich ist in Wirklichkeit nur bildlich zu nehmen und soll nichts weiter besagen, als daß die Erd bahn im Verhältnis zum Umfang des Himmels verschwindend ist. Kleanthes, der zweite Vorsteher der Stoa nach dem Gründer Zenon, ver öffentlichte eine Streitschrift Gegen Aristarch, in der er die Griechen dazu aufrief, Aristarch der Gottlosigkeit anzuklagen, weil er die Erde, den Herd der Welt, aus der Mitte und in Bewegung gesetzt habe. Der Angriff ist nicht ganz verständlich, da Kleanthes in Fr. 499 die Sonne als das Hegemonikón, den führenden Teil des Weltalls, bezeichnet. Wie auch immer, da Kleanthes 232 starb, ist sein Angriff jedenfalls zu Aristarchs Lebzeiten erfolgt. Auf ihn spielt eine Stelle bei Plutarch an, wo es heißt: Nur daß du, lieber Freund, mich nicht der Gottlosigkeit zeihst im Stil des Kleanthes, der glaubte, daß es die Pflicht der Griechen sei, Aristarch von Samos der Gottlosigkeit anzuklagen, weil er den Herd des Universums 150
in Bewegung setzte aufgrund seines Versuchs, die Phänomene dadurch zu retten, daß er annahm, der Himmel befinde sich in Ruhe und die Erde bewege sich in einem geneigten Kreis, während sie sich gleichzeitig um ihre eigene Achse dreht. (Plut. De fade in orbe lunae c. 6, 922 F — 923 A) Wir erfahren aus diesem Zeugnis nichts Neues. Daß die Erde sich auf ge neigter Bahn in der Ebene der Ekliptik bewegte, war durch die Phäno mene ebenso erzwungen wie die Drehung um ihre eigene Achse. Zwei weitere Zeugnisse, bei Plutarch noch einmal und bei Vitruv, sind ebenso unergiebig. So sind die Nachrichten über den »antiken Kopernikus« enttäuschend dürftig und unbefriedigend. Wir erfahren Näheres weder darüber, was ihn zu seiner revolutionären Hypothese veranlaßte, noch wie er sie ausführte und zur Erklärung der Planetenbahnen an wandte. Die defekte Überlieferung ist natürlich in erster Linie dadurch verursacht, daß das heliozentrische Weltmodell nicht Schule machte und keine Nachfolge fand. So hatte niemand Interesse, es zu erörtern und zu tradieren. Hipparch, der große Astronom des folgenden Jahrhunderts, schloß sich dem geozentrischen System an, und seine erdrückende Autori tät schlug alle heliozentrischen Spekulationen nieder. Ein einziger Astro nom etwa hundert Jahre nach Aristarch wird genannt, Seleukos, von dem nicht einmal feststeht, ob er aus Seleukia am Tigris oder aus Babylon stammt, was freilich nicht weit voneinander entfernt lag. Wir wissen eini ges darüber, wie er die Entstehung der Gezeiten erklärte, aber von seiner Kosmologie nur, daß er die Welt für unendlich hielt und wie Aristarch die Erde um die Sonne kreisen ließ. Über seine Weltvorstellung im einzelnen und seine Erklärung der Planetenbahnen erfahren wir nichts, geschweige denn, daß sich zusätzliche Nachrichten oder auch nur Rückschlüsse für Aristarch ergäben. Nach Seleukos verzeichnet die Überlieferung niemanden mehr, der sich der heliozentrischen Hypothese angeschlossen hätte. Wird sie irgendwo noch einmal erwähnt, so nur, um sie zu bekämpfen. Allein bei Seneca fin det sich ein später, schöner Nachklang:
Es wird angemessen sein, dies zu diskutieren, damit wir wissen, ob das Universum sich dreht und die Erde stillsteht oder das Universum stillsteht und die Erde sich dreht. Denn einige haben behauptet, daß wir es sind, die die Natur sich bewegen läßt, ohne daß wir dessen gewahr werden, daß Auf- und Untergänge nicht durch die Bewegung des Himmels erfolgen, sondern daß wir selbst auf- und untergehen. Die Frage verdient unsere Betrachtung, damit wir wissen, unter welcher Bedingung wir leben, ob
I51
die Wohnstätte, die uns zugeteilt ist, sich sehr langsam oder sehr schnell bewegt, ob Gott alles um uns her bewegt oder vielmehr uns selbst. (Sen. Quaest. nat. VIII 2, 3)
Damit ist der heliozentrische Gedanke in der Antike erloschen. Von der erhaltenen Schrift des Aristarch Über die Größe und Entfernung von Sonne und Mond wollen wir hier nur zwei Einzelheiten anführen. Archimedes berichtet, Aristarch habe die Beobachtung (Entdeckung) ge macht, daß die Breite der Sonne 1/° betrage. In seiner Abhandlung dage gen bestimmt Aristarch ihre Breite als V15 eines Tierkreiszeichens, d. h. zu 2°, das ist das Vierfache der wirklichen Größe. Man hat verschiedene Versuche gemacht, diesen Widerspruch zu beseitigen und den großen Astronomen vor einer so argen Ungenauigkeit zu bewahren. Aber der Text ist klar, und nichts berechtigt, die Zahlenangabe zu ändern. Man sieht darin ein weiteres Argument, die Schrift für ein Frühwerk zu halten, in dem Aristarch sich noch nicht auf der späteren Höhe befand. Eine an dere Erklärung lautet, Aristarch habe die Breite von 20 gewählt, weil sie ihm eine bequemere Rechnung ermöglichte. In Wirklichkeit ist es un denkbar, daß der große Astronom bei einer so elementaren Größe wie dem scheinbaren Sonnendurchmesser sich eines Beobachtungsfehlers von 300% schuldig gemacht oder sich einen willkürlichen Rechnungsansatz von derselben Abweichung erlaubt hätte. Realistisch ist allein die Ent scheidung, der Angabe des Archimedes zu vertrauen. Und dessen Nach richt ist für uns auch deswegen von besonderem Interesse, weil eine andere Überlieferung diese Entdeckung oder Berechnung bereits dem Thales zuschreibt (s. o. S. 18). Wie die Dinge liegen, muß man wohl auch in diesem Fall der frühen Zuschreibung gegenüber mißtrauisch sein und eher der Nachricht des Archimedes vertrauen: Erst Aristarch hat den scheinbaren Sonnendurchmesser genau ermittelt. Allerdings gibt es noch ein weiteres Beispiel, wo Aristarch ebenfalls mit einer stark abweichenden Zahl operiert. Aber hier könnte ein wirklicher Beobachtungsfehler vorliegen. Er hatte eine mathematisch glänzende Idee, die Entfernung von Sonne und Mond in ihrer Relation zu bestim men. Wenn der Mond im Viertel steht, so ist die Konstellation so, daß Erde, Mond und Sonne sich im rechten Winkel zueinander befinden. Wenn man dann den Winkel W bei der Erde mißt, so kann man mit seiner Hilfe das entsprechende Dreieck zeichnen oder berechnen. Mathematisch ist die Idee glänzend durch ihre große Einfachheit. Astronomisch aber ist sie weniger glücklich. Zwar läßt sich der genaue Zeitpunkt des Mondvier-
152.
Abb. 22
Messung der Sonnenentfernung nach Aristarch
tels relativ genau bestimmen, wenn auch nicht durch Beobachtung, in folge der zerklüfteten Oberfläche des Mondes, so doch durch Berech nung. Aber nur sehr schwer ist der Winkel W genau zu messen. Aristarch nahm für ihn mit runder Zahl einen Wert von 900 — 3° = 87° an und kam damit für die Entfernung des Mondes von der Erde und der Sonne von der Erde auf ein Verhältnis von 1 : 19. In Wirklichkeit beträgt der Winkel 90° — 9' = 89° 51', und das tatsächliche Verhältnis ist 1 : 380. Wir ersehen daraus, daß Aristarch eine ganz unzureichende Vorstellung von der Ausdehnung des Planetensystems auch nur in der Relation hatte. Aber das war im ganzen Altertum niemals besser. Die nachstehende Tabelle zeigt seine Ergebnisse im Vergleich zu denen der anderen großen Astronomen. Die Tabelle belegt, daß die Resultate nicht nur von der Wirklichkeit, sondern auch voneinander ziemlich stark abwichen.
Gemessen in Erddurchmessern
Mittl. Entfernung des Mondes
Durchmesser des Mondes
von der Erde
nach Aristarch nach Hipparch nach Poseidonios nach Ptolemäus in Wirklichkeit
91/1 33 V, 26 75 29 Vz 30,2
9/z5
= 0,36
V = 0,33 V19 = 0,157 5/17 = 0,29
0,27
Mittl. Entfernung
der Sonne von der Erde
Durchmesser der Sonne
6V4
180 1245
12 7,
6945 605 II 726
39 Vt 5x/z 108,9
(nach Fr. Hultsch, Hipparchos über die Größe und Entfernung der Sonne. S. 199)
T53
Wir haben oben angeführt, daß Kopernikus zu seinem heliozentrischen Weltsystem durch antike Autoren die ersten Anregungen erhielt und daß er in seinem Hauptwerk zweimal den Namen des Philolaos erwähnt (s. o. S. 95). Merkwürdig ist, daß er ursprünglich auch einen Hinweis auf Aristarch formuliert hatte, den er aber bei der endgültigen Drucklegung tilgte.
154
Hipparch von Nikäa (ca. 190—i2o v. Chr.)
Plinius hat Hipparch den Mitwisser der Naturgeheimnisse genannt, und in der Tat war er nicht nur der bedeutendste und sozusagen fleißigste aller antiken Sternbeobachter, sondern auch ein großer Geograph. Als seinen Geburtsort gibt die Überlieferung übereinstimmend die Stadt Nikäa in Bithynien an, das heutige Iznik. Dreimal im Verlauf seiner Geschichte ist Nikäa zu großem Ruhm gelangt. Im Jahre 325 n. Chr. rief Kaiser Konstan tin in seinen Mauern das Erste Ökumenische Konzil zusammen, das er persönlich eröffnete. Das Konzil hatte die Streitfrage zu entscheiden, ob Christus in der Göttlichkeit dem Vater untergeordnet oder gleichgestellt sei, und das Nikänische Glaubensbekenntnis mit seinen feierlichen For mulierungen ist noch heute in allen rechtgläubigen Kirchen das Bekennt nis besonderer Festtage. — Im Jahre 1204 eroberte auf dem sog. Lateini schen Kreuzzug das Kreuzfahrerheer auf Anstiften des Dogen von Vene dig statt Jerusalem Konstantinopel. Der Kaiser zog sich mit seinem Hof nach Nikäa zurück, das nun zwei Menschenalter lang die Hauptstadt des Byzantinischen Reiches war, bis von ihm aus 1261 die Rückeroberung Konstantinopels gelang. — In osmanischer Zeit befanden sich in Iznik die berühmten Manufakturen der klassischen türkischen Keramik, die heute außerordentlichen Seltenheitswert besitzt. — Heute ist Iznik eine idyllische und wohlhabende türkische Landstadt mit gut erhaltenen Befe stigungsanlagen, aber nur noch sehr kläglichen Resten der einst berühm ten Sophienkirche. Wann Hipparch in Nikäa geboren wurde, ist nicht überliefert, ja wir wür den von seiner Lebenszeit nicht einmal das Jahrhundert wissen, hätte nicht Ptolemäus im Abnagest von den Sternbeobachtungen berichtet, die Hipparch zwischen den Jahren 161 und 127 v. Chr. durchführte, und daß seit Hipparchs Zeit bis zum Regierungsantritt des Kaisers Antoninus Pius 135 n. Chr. 265 Jahre verflossen seien. Von den zahlreichen Werken Hipparchs ist nur ein einziges, in gewisser Weise das unwichtigste, erhalten geblieben, nämlich sein Kommentar zu den Phänomenen, dem Sternkatalog des Aratos. Hipparch führt zunächst an einer Reihe von Beispielen den Nachweis, das die Hexameter des Aratos inhaltlich ganz von den Sternbeobachtungen des Eudoxos abhän gig sind (s. o. S. 120), und geht anschließend zur Kritik über. Er berichtigt
155
zahlreiche Ungenauigkeiten in ihrer, Arats und Eudoxos’, Beschreibung der Sternbilder. Er legt seiner Korrektur den Horizont von Athen zu grunde, wo der längste Tag eine Dauer von 14^/5 Std. hat und die Pol höhe etwa 37° beträgt (Comm. I 3, 12), und gibt dann am Anfang von Kap. 4 das erste Beispiel:
Was den nördlichen Pol betrifft, so befindet sich Eudoxos im Irrtum, wenn er sagt: >Es gibt einen Stern, der immer an derselben Stelle bleibt. Dieser Stern ist der Pol der Welt Hydriae). 2. Eine durch den Schwanz des Löwen (ß Denebola) und durch den Stern am Ende des Schwanzes des Großen Bären (rj Benetnasch) gezogene Linie läßt den hellen Stern unter dem Schwanz des Großen Bären einen Finger westlich liegen. 3. Eine durch den Stern unter dem Schwanz des Großen Bären und durch den Schwanz des Löwen gezogene Linie geht genau durch die vorangehen den Sterne im Haupthaar (der Berenike). (Almag. VII 1, 4/5 Hei.; Übers. II S. 5 Manit.)
Es folgt die Beschreibung der Jungfrau. Das Verfahren besteht also in der Hauptsache darin anzugeben, welche Sterne durch eine gerade Linie oder auch durch ein Dreieck miteinander verbunden sind. Es werden dabei Winkelabstände von dieser Linie ver zeichnet, nicht aber die Winkelabstände der Sterne voneinander. Ein wei teres Bestimmungsmittel ist die unterscheidende Angabe der Helligkeit: hell, glänzend usw. Für die modernen Astronomen war es nicht immer leicht und in einigen Fällen bis heute unmöglich, die Sterne nach der Be schreibung Hipparchs zu identifizieren, während Ptolemäus sich auf der voraufgehenden, einleitenden Seite zu der Feststellung berechtigt fühlte: Daß nun bis auf den heutigen Tag keinerlei Veränderung (metäptösis) in der Stellung der Fixsterne zueinander eingetreten ist, sondern die zu Hip parchs Zeiten beobachteten Figurationen (schSmatismoi) auch heute 160
noch unverändert als dieselben sich zeigen, . . . wird jedem klar werden, der Lust hat, nachzuprüfen. (a. a. O. S. 3) Das klingt ganz aristotelisch. — In dem hier fortgelassenen langen und umständlichen Mittelteil des ungefügen Satzes kommt Ptolemäus — nur in Parenthese sozusagen — auf die von Hipparch entdeckte Präzession der Tag- und Nachtgleichen zu sprechen. Es habe zuerst so scheinen können, als betreffe die Präzession nur die Tierkreiszeichen, wodurch sich in der Tat eine Veränderung des Fixsternhimmels ergeben hätte. Es habe sich aber gezeigt, daß die Fixsterne des nördlichen und südlichen Himmels ihre Stellung zu den Tierkreiszeichen nicht verändert hätten, so daß die Präzession den Himmel im ganzen betreffe. In der Tat brauchte die Präzes sion seine aristotelische Konzeption von der Ewigkeit und Unveränder lichkeit des Fixsternhimmels seinem Verständnis nach nicht zu stören. Aber die Entdeckung einer Nova durch Hipparch war ein sehr deutliches, eigentlich nicht zu übergehendes Signal. Offenbar hat er sie aus dem Spiel gebracht, indem er sie für eine ausgefallene Singularität erklärte, die das Modell als solches nicht betraf. Im ganzen hat der Katalog Hipparchs 1080 Fixsterne in 49 Sternbildern aufgelistet, während der des Ptolemäus nur 1022 Sterne umfaßte.
DIE ENTFERNUNG VON SONNE UND MOND Wir wollen noch zwei Ergebnisse Hipparchs anfügen, die über sein Welt modell Auskunft geben. Die seit langem bekannte Ungleichheit der Jah reszeiten besagte, daß die Sonne sich nicht konzentrisch um die Erde be wegte, sondern auf einem Ekzenter. Hipparch bestimmte die Länge des Frühlings (von der Frühlings-Tag- und Nachtgleiche bis zur Sommerson nenwende) auf 94J/Z Tage und die Länge des Sommers (von der Sommer sonnenwende bis zur Herbst-Tag- und Nachtgleiche) auf 92VZ Tage. (Die Dauer der anderen Jahreszeiten gibt das Referat des Ptolemäus nicht an.) Aufgrund dieser Zeitdifferenz kam Hipparch zu dem Ergebnis, daß die Ekzentrizität Vz4 des Ekzenterradius betragen müsse. Die uns hier inter essierende Frage lautet: Was bedeutet das kosmologisch? In der Mitte der Welt ruht unbeweglich die Erde. Hat Hipparch angenommen, daß die Sonne sie auf einer ekzentrischen Bahn umkreist? Die Frage wiederholt sich später bei Ptolemäus, und dort ist sie eindeutig zu verneinen. Bei Pto lemäus ist es nichts weiter als ein Rechenverfahren, und zwar eines unter mehreren. Für uns ist es ein irritierender Widerspruch. Der Übergang
161
vom Rechenmodell zum kosmologischen Modell, den ja doch unvermeid lich jeder für sich vollziehen mußte, wird auf so vielen hundert Seiten nie mals erörtert und thematisiert. Das gilt für Ptolemäus’ eigene Darlegun gen ebenso wie für seinen Bericht über Hipparch. Wie Aristarch so hat auch Hipparch eine heute verlorene Schrift Über Entfernung und Größe der Sonne und des Mondes verfaßt. Im 2. Buch dieser Abhandlung kam er zu dem Ergebnis, daß die kleinste Entfernung des Mondes 62 Erdradien betrage, die mittlere 67V3 Erdradien (und also die weiteste yiAlf, die Entfernung der Sonne aber 490 Erdradien. Hier erweist sich also, daß Hipparch sowenig wie Aristarch von den wah ren Größen der Sonne und des Planetensystems eine auch nur annähernd zutreffende Vorstellung besaß. Es wäre unbillig, das von ihm zu erwarten. Unverständlich ist aber die jedes reelle Maß überschreitende Ekzentrizität der Mondbahn und auf der anderen Seite das völlige Übergehen der Ekzentrizität der Sonnenbahn, die er doch mit VZ4 berechnet hatte. Aber nun erfahren wir gar nicht, ob 490 Erdradien die Erdnähe oder Erdferne oder den Mittelwert der Sonnenentfernung bedeuten soll. Vollends merkwürdig ist, daß Hipparch im 1. Buch der genannten Schrift ganz andere Mondabstände gefunden hatte, nämlich für die Erdnähe 71 und für die Erdferne 83, also im Mittel 77 Erdradien. Offenbar hatte Hipparch diese beiden widersprechenden Ergebnisse nicht zum Ausgleich gebracht, denn Ptolemäus nimmt ausdrücklich auf diesen Widerspruch Bezug, freilich ohne sich, zu unserer ziemlichen Ver blüffung, groß darüber zu befremden. Er bemerkt lediglich lakonisch, es seien ihm die Verhältnisse der Mondentfernung je nach den gemachten Voraussetzungen verschieden ausgefallen, und zwar deswegen, weil er die Entfernung des Mondes mit Hilfe der Entfernung der Sonne zu ermitteln versucht habe, diese aber ganz ungewiß sei {Almag. V Kap. 11 Ende). Im übrigen scheint Hipparch grundsätzlich darauf verzichtet zu haben, Planetenbahnen zu berechnen, wohl, weil er den Versuch für zu vage hielt. Er beschränkte sich auf die Katalogisierung des Fixsternhimmels und die Berechnung der Mond- und Sonnenbahn. Bedeutend war er aber auch als Geograph. Und zwar vertrat er den methodischen Grundsatz, daß die geographische Lage der Schlüsselorte nur mit Hilfe der Astronomie sicher zu bestimmen sei. Für die Arbeiten und Ergebnisse des großen Eratosthenes hatte er nichts als Tadel, weitgehend zu Unrecht.
ASTRONOMIE UND KOSMOLOGIE Seit Eudoxos und vollends dann seit Aristarch war die Beschäftigung mit der Sternenwelt in eine doppelte Bahn getreten: Die eine war die mathe
162
matische Astronomie, die andere die alte spekulative Kosmologie. Die beiden Forschungswege konnten bei ein und demselben Forscher neben einander laufen, ohne zum Ausgleich zu kommen. Man kann sie daher auch nur getrennt würdigen. Als Astronom war Hipparch, wir sagten es schon zu Anfang, der größte und fleißigste Sternbeobachter, den das Altertum aufzuweisen hat. Ptolemäus rühmt einmal ausdrücklich seine Wahrheitsliebe und seine keine Mühe scheuende Gewissenhaftigkeit {Almag. III i Anfang). Mit seinem Sternkatalog hat er für das große Werk des Ptolemäus eine überaus wich tige Vorarbeit geleistet. Das eingehende Studium der Ergebnisse seiner Vorgänger ermöglichte ihm die genaue Bestimmung der Länge des Son nenjahres: 365 + V4 — V300 Tage, und die Entdeckung der Präzession der Tag- und Nachtgleiche. Und seiner scharfen Himmelsbeobachtung gelang auch zum erstenmal, soviel wir wissen, die Entdeckung eines ver änderlichen Fixsterns, einer Nova. In der Gesamtkonzeption seiner Weltvorstellung kehrte er zum geozentri schen System des Aristoteles zurück. Wir wissen nicht, ob er die Über nahme von Aristarchs heliozentrischem Entwurf jemals erwogen hat. Es mußte für jeden antiken Menschen wie noch für jeden mittelalterlichen etwas Gewaltsames haben, die fest gegründete Erde aus dem Zentrum des Alls zu entfernen und unter die Planeten zu versetzen. Aller Augenschein sprach dagegen. Für Hipparch persönlich aber wird ausschlaggebend ge wesen sein, daß die rechnerischen Vorteile des neuen Modells nicht ohne weiteres manifest waren. Und Aristarch hatte, wie es scheint, selbst wenig getan, sie vorzuführen. So wurde alles, was an heliozentrischer Tendenz und heliozentrischer Überlieferung bestand, durch die unangefochtene Autorität Hipparchs sistiert und abgeschnitten. Das System ist in der anti ken Astronomie niemals wieder erwogen worden. Was aber die kosmologischen Ergebnisse Hipparchs betrifft, so sind sie zwar ziemlich eingreifend, scheinen aber mehr für den Historiker als für den Betroffenen selbst spektakulär zu sein. Hipparch war vor allem Beob achter und Empiriker, er verfolgte, verglich und stellte fest. Aber aus sei nen Entdeckungen ideologische Konsequenzen zu ziehen scheint ihn weniger verlockt zu haben. In Wirklichkeit war durch seine Entdeckun gen das ideale, symmetrische, angeblich ewige und unveränderliche Ge füge des aristotelischen Weltmodells gehörig angeschlagen. Schon die Annahme ekzentrischer Umläufe für Mond und Sonne hob die schöne Symmetrie der göttlichen Gestirne und ihrer vollkommenen Kreisbahnen auf. Ebenso widersprach die Präzession, auch wenn sie nur eine winzige Verschiebung im ganzen war, der Voraussetzung eines ewigen, unwandel-
163
baren Himmels. Vollends die Nova. Sie machte handgreiflich, daß die Vorstellung vom unveränderlichen Himmelsgewölbe eine Illusion war. Und hätte man nicht eigentlich von Anfang an mißtrauisch gegen sie sein müssen durch die naheliegende Frage, wieso eigentlich die offenbare Unordnung in der Verteilung der Sterne und der Milchstraße göttlich und ewig sein sollte. Auf welche Weise waren sie so offenkundig regellos zu sammengewürfelt und hingestreut worden? Es waren harte Gegenläufe, die aus Hipparchs Arbeit hervorgingen. Aber man gestand sie sich nicht ein.
GEMINUS
Zwischen Hipparch und Ptolemäus liegt ein Intervall von fast dreihundert Jahren. Hipparch hatte das zunächst Erreichbare erreicht. Seine Nachfol ger konnten sich darauf beschränken, das Erreichte zu tradieren und nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, bis Ptolemäus es noch einmal im gan zen wiederaufnahm, mit außerordentlichem Zugriff systematisierte und mathematisierte und der Nachwelt als definitive Summe hinterließ, als Kanon für ganze Jahrhunderte. Einer dieser Tradenten der Zwischenzeit war Geminus. Man weiß so gut wie nichts über ihn, nicht ob er im i. Jahrhundert vor oder nach Christus gelebt hat, nicht einmal sicher, ob sein Name eigentlich griechisch oder lateinisch ist. Auf Lateinisch bedeutet er Zwilling, auf Griechisch bedeu tet er das nicht. Eher ist wahrscheinlich, daß seine Lebenszeit ins letzte Jahrhundert vor Christus fällt und sein Name griechisch ist, denn er schreibt auf Griechisch. Aber Heimat und Herkunft sind gänzlich unbe kannt. Sein kleines Buch trägt den Titel Einführung in die (Himmels-)Erscheinungen — EisagögS eis tä phainömena. Es ist ein tüchtiges, erfreuli ches Buch, konzis und klar, alles, was man damals wußte, geschickt und übersichtlich auseinandersetzend. Karl Manitius, der den deutschen Almagest geschaffen hat, hat auch eine sehr dankenswerte zweisprachige Ausgabe von Geminus geschaffen. Der Autor beginnt seine Erörterungen mit der Frage, wie sich bei der (tra ditionellen) Annahme kreisförmiger Umlaufbahnen und gleichförmiger Bewegungen die Unregelmäßigkeiten der Himmelserscheinungen erklä ren lassen, und bringt für die Sonnenbahn ein einfaches Schema, wie sich durch die Annahme ihrer Ekzentrizität die Ungleichheit der Jahreszeiten ohne weiteres ergibt. Wie man sich das in der Realität vorzustellen hat mit der ekzentrischen Sonnenbahn, das überläßt freilich auch er lieber 164
Sommerpunkt
Frühlings punkt
Herbstpunkt
\O
Winterpunkt
Widder 'Y1 Stier SJ Zwillinge H
Krebs Löwe Jungfrau
Abb. 2.4
Q w
SL Waage Skorpion Schütze
m. z
Ö
Steinbock Wassermann Fische X
Ekzenter der Sonnenbahn nach Geminus
dem Leser selbst zur Entscheidung. Aber schon eine Seite vorher spricht er einen Gedanken aus, der wahrhaft neu und aufregend ist und um dessentwillen wir ihn hier zitieren. Er spricht dort von der Weltkugel im gan zen und sagt:
Zu alleroberst befindet sich die sog. Kugelschale der Fixsterne, die sämt liche zu bestimmten Bildern zusammengefaßten Sterne enthält. Daß aber diese Sterne alle auf derselben Fläche liegen, ist nicht anzunehmen, son dern eher werden sie sich in teils größerer, teils geringerer Entfernung (von ihr) befinden. (Kap. 1, 23) 165
Seit Anaximenes klebten die Fixsterne (eingeschlagen wie Nägel) an der Himmelsschale. Hier wird zum erstenmal, soviel wir wissen, diese starre Vorstellung aufgelöst. Zum erstenmal lockert die Fixsternschale sich auf und nimmt Volumen an. Die Idee braucht natürlich nicht von Geminus selbst zu stammen. Sie kann älter sein als er, muß aber wohl auf jeden Fall jünger sein als Hipparch. Es kommt hier ein befreiender, geradezu lösender realistischer Zug in die Himmelsvorstellung. Die sog. Feste des Himmels, das Firmament, wird dissoziiert. Es ist ein großer Ruhm des Geminus, daß er diesen Gedanken nicht bloß hypothetisch, sondern ent schieden und ohne Einschränkung ausgesprochen hat. Aber vor dieser Folie wird nur um so deutlicher, wie restaurativ das Weltmodell des gro ßen Ptolemäus war.
166
Staub nur bin ich, ich weiß es, ein Sterblicher. Aber betracht’ ich, Sterne, den kreisenden Lauf eurer gewundenen Bahn, Dann so glaub’ ich die Erde nicht mehr mit dem Fuß zu berühren, Sondern am Tisch des Zeus teil’ ich göttliches Mahl.
Claudius Ptolemäus (ca. 100—178 n. Chr.)
Im Jahre 1158 wurde zwischen dem Normannenkönig Wilhelm I. von Sizi lien und dem byzantinischen Kaiser Manuel I. Komnenos Frieden ge schlossen. Die normannische Gesandtschaft leitete der Archidiakon der sizilischen Stadt Katania Henricus Aristippus. Als kaiserliches Geschenk an den Normannenkönig brachte er eine griechische Handschrift mit dem Hauptwerk des Ptolemäus aus Konstantinopel mit nach Palermo. Bis dahin gab es in Europa nur arabische Übersetzungen des griechischen Textes und mehr oder weniger schwerfällige und unzuverlässige lateini sche aus dem Arabischen. Wir haben Aristipp schon als Platon-Überset zer kennengelernt (s. o. S. 100). So wie Europa ihm die ersten lateinischen Übersetzungen platonischer Dialoge verdankte, so brachte er ihm jetzt den ersten griechischen Text des Almagest. Die Handschrift ist bis heute erhalten geblieben, es ist der Kodex 313 der Markus-Bibliothek in Vene dig. Von großer Wirkung war der griechische Text damals freilich nicht, und fast vierhundert Jahre sollte es dauern, bis er zum erstenmal im Druck erschien, 1538 in Basel, in der Offizin des Johannes Walder. Und als der Originaltext nun endlich vorlag, da war er nicht mehr aktuell, denn in zwischen hatte Kopernikus sein neues, umstürzendes System entwickelt. Bereits fünf Jahre später, 1543, erschien es im Druck. In Kopernikus’ Nachlaß hat sich ein Exemplar der Baseler Ausgabe gefunden, unaufge schnitten. Der Text war für ihn nicht mehr von Wichtigkeit. Sehr wahr scheinlich las er auch kein Griechisch. Die erste und bisher einzige kriti sche Ausgabe, um das bibliographische Thema abzuschließen, erschien in zwei Bänden 1898 und 1903, herausgegeben von dem dänischen Gräzi sten J. L. Heiberg. Aufgrund dieser Ausgabe schuf Karl Manitius in jahre langer entsagungsvoller Arbeit seine deutsche Übersetzung, mit mathe matischen Formeln und Gleichungen statt der oft langwierigen und um167
ständlichen Erklärungen des Originaltextes und mit zahlreichen neuen Zeichnungen zur Veranschaulichung schwieriger Stellen (Bd. i 1912, Bd. 2 1913). Ein Neudruck dieser Ausgabe mit Korrekturen und Anmer kungen des führenden Mathematikhistorikers O. Neugebauer erschien 1963. Die neueste Ausgabe ist die englische Übersetzung von G. J. Toomer, London 1984. Die näheren Lebensumstände des Ptolemäus sind uns sowenig bekannt wie die seiner großen Vorgänger Aristarch und Hipparch. Fest steht nur, daß er in Alexandria gewirkt und bis in die Regierungszeit Kaiser Marc Aurels (168—180) gelebt hat. Wann er geboren wurde, ist unbekannt. Seine Heimat soll die bedeutende Stadt Ptolémaïs in Mittelägypten gewe sen sein, die hellenistische Hauptstadt des Thinitischen Gaues. Aber diese Angabe basiert wahrscheinlich auf nichts anderem als dem Gleichklang der Namen. So hat Isidor von Sevilla, der gelehrte spanische Bischof des 7. Jahrhunderts, sogar behauptet, Ptolemäus sei ein Nachfahre des grie chisch-ägyptischen Königshauses gewesen, eine Angabe, die allein aus dem falsch verstandenen Namen des Ptolemäus herausgesponnen ist. Eine andere Überlieferung nennt Pelusium als seinen Geburtsort, die be kannte ägyptische Grenzstadt in der Nähe der Mündung des östlichen Nilarms. Chronologisch gesichert ist, daß die Sternbeobachtungen, die in sein Hauptwerk eingegangen sind, in der Zeit von März 127 bis Februar 141 vorgenommen wurden. Das Buch selbst scheint vor 146 vollendet und veröffentlicht worden zu sein, denn in diesem Jahr, dem 10. Regierungs jahr des Kaisers Antoninus Pius, wurde die Kanobusinschrift aufgestellt, die den Abschluß des Almagest zur Voraussetzung hat.
MATHEMATIKÉ SŸNTAXIS Der griechische Titel von Ptolemäus’ Hauptwerk lautete ursprünglich ein fach M athèmatikë syntaxis — Mathematische Zusammenstellung. Spä ter fügte man ein megàlë — große Zusammenstellung hinzu. Und die Araber, denen das noch nicht genug war, machten daraus megistë — größte Zusammenstellung, und indem sie noch den Artikel davorsetzten, wurde daraus Al-magest, ein Titel, der dem astronomischen Handbuch des Ptolemäus den Nimbus eines orientalischen Zauberbuches verlieh. Es ist in Wirklichkeit alles andere. Im 11. Jahrhundert machte der berühmte arabische Astronom Geber ben Afflah aus Sevilla Ptolemäus den Vor wurf, daß er unklar, schwer verständlich und ohne Not weitschweifig sei, daß er andererseits manches Wichtige gar nicht oder zu kurz behandele,
168
dazu auch mehreres Unrichtige enthalte. In der Tat sind lästige Weit schweifigkeit und schwerverständliche Kürze zwei widersprechende Eigenheiten, die die Lektüre des Handbuchs oft erschweren. Was aber sei nen Inhalt, das astronomische System angeht, so hat König Alfons der Weise von Kastilien (125z—1282), der größeres Interesse für Astronomie als für Eroberungen und Gebietserweiterungen zeigte, der astronomische Schriften der Araber ins Spanische übersetzen und mit großzügigem Auf wand die nach ihm benannten Alfonsinischen Planetentafeln erstellen ließ, den vielzitierten Ausspruch getan: Wenn Gott ihn bei der Weltschöpfung zu Rate gezogen hätte, er würde Ihm ein einfacheres System vorgeschlagen haben. Das leichthin tradierte Bon mot war in Wirklichkeit für seinen Urheber von verheerenden Folgen. Er wurde von den fanatischen Mönchen seines Landes, denen es widerstrebte, daß er jüdische und arabische Astrono men an seinen Hof zog, der Gotteslästerung angeklagt und nach dreißig jähriger segensreicher Herrschaft 1282 abgesetzt und aller seiner Güter beraubt. Arm und vereinsamt starb er zwei Jahre später in Sevilla. Wie der griechische Titel zu verstehen gibt, ist das Handbuch vor allem ein mathematisches Werk, und daß Ptolemäus an Tabellen und an mathe matischen Berechnungen und Beweisen viel mehr Interesse hatte als an Beobachtungen, werden wir noch genauer sehen. Zu Beginn aber gibt sich das Buch geradezu philosophisch. Es ist, wie z. B. auch das LukasEvangelium, einem einzelnen, uns unbekannten Adressaten gewidmet, und der erste Satz lautet: Mit Fug und Recht, lieber Syros, haben m. E. die echten Philosophen den theoretischen Teil der Philosophie von dem praktischen geschieden. Und einen Abschnitt weiter wird Aristoteles ge radezu und namentlich zitiert, der den theoretischen Zweig der Erkennt nis eingeteilt habe in Physik, Mathematik und Theologie, weil alles Seien de auf Materie, Form und Bewegung beruhe. Die Anwendung dieser Ein teilung führt natürlich zu dem Nachweis, daß die Astronomie sowohl eine physikalische und mathematische, wie auch eine theologische Kompo nente besitze. Wir werden also von vornherein darauf hingewiesen, daß die physikalisch-mathematischen Erörterungen sozusagen nur der Vor dergrund sind, der auf einem hier nicht thematisierten Hintergrund ruht. Und die Erwähnung des Aristoteles ist in der Tat insofern ohne jede Über raschung, als das Weltmodell des Ptolemäus ja in Wirklichkeit das aristo telische ist. Wenn man es aufgrund seiner erdrückenden astronomischen Autorität in der Folge das ptolemäische nannte, so ist das nur ein anderer Name für dasselbe System. Ihm gilt auch hier wieder unser Interesse. Was aber das Handbuch alles an Tabellen, Berechnungen und Beweisen, also 169
an mathematischer Astronomie enthält, das müssen und können wir ge trost den Spezialisten, Mathematikern, Astronomen und Astronomie historikern, überlassen. Es würde nicht nur unser Interesse, sondern auch unsere Fähigkeiten weit übersteigen. Nur zwei kleine geometrische Erörterungen möchten wir dem Leser doch zumuten, und zwar, weil ihr Verständnis von elementarer Bedeutung für das Ganze ist.
EPIZYKEL UND EKZENTER
Das 3. Kapitel des 3. Buches handelt Von den Hypothesen der gleichför migen Bewegungen auf Kreisen. Sein Anliegen ist, zu erklären, daß die Unregelmäßigkeiten des Sonnenlaufs, manifest in den ungleichen Längen der Jahreszeiten, nur scheinbar sind, daß die Sonne in Wirklichkeit doch auf einem Kreis, und zwar gleichförmig, ihre Bahn zieht. Dazu gibt es aber zwei Erklärungsmöglichkeiten, die Ptolemäus beide vorführt, und zwar deshalb, weil er sie grundsätzlich für gleichwertig hält. Das eine ist die Ekzenter-, das andere die Epizykeltheorie. Die Ekzentertheorie haben wir schon bei Geminus kennengelernt (s. o. S. 165). Ptolemäus leitet die Erörterung mit der aristotelischen Bemerkung ein, Unregelmäßigkeiten in der Bewegung der Sterne, die mit ihrer ewigen Dauer unvereinbar sind, könnten nur in der Vorstellung des Betrachters bestehen, nicht aber in Wirklichkeit. Zu ihrer Erklärung sind zwei Annahmen möglich: Entweder vollziehen die Gestirne ihre Bewegungen auf Kreisen, die mit dem Weltall nicht konzentrisch sind, oder auf Kreisen, die mit dem Welt all konzentrisch sind, dann aber nicht direkt auf diesen selbst, sondern auf anderen, von diesen getragenen Kreisen, den sogenannten Epizyklen. Nach jeder dieser beiden Hypothesen wird sich die Möglichkeit heraus stellen, daß die Planeten in gleichen 'Leiten für unser Auge ungleiche Bogen der mit dem Weltall konzentrischen Ekliptik durchlaufen. A. Denken wir uns zunächst nach der exzentrischen Hypothese als den Exzenter, auf welchem das Gestirn sich gleichförmig bewegt, den Kreis ABrA um das Zentrum E und den Durchmesser AEA, ferner auf letzte rem den Punkt Z als unser Auge, so daß A der erdfernste, und A der erd nächste Punkt (des Exzenters) wird. Ziehen wir alsdann nach Abtragung der gleich großen Bogen AB und Ar die Verbindungslinien BE, BZ, rE, HZ, so wird ohne weiteres klar sein, daß das Gestirn, nachdem es jeden der beiden Bogen in gleicher Zeit zurückgelegt hat, auf dem um Z be schriebenen Kreise (d.i. in der Ekliptik) scheinbar ungleiche Bogen
170
Abb. 25
Ekzenter nach Ptolemäus
durchlaufen haben wird; denn BZA wird kleiner, ^rZA dagegen grö ßer sein (nach Eukl. I.16) als jeder der als gleich angenommenen Winkel BEA und rEA. B. Denken wir uns nach der epizyklischen Hypothese ABFA als den mit der Ekliptik konzentrischen Kreis um das Zentrum E und den Durchmes ser AEr und als den auf ihm laufenden Epizykel, auf welchem sich das Gestirn bewegt, den Kreis ZH0K um den Mittelpunkt A, so wird auch
hier ohne weiteres folgendes einleuchten. Wenn der Epizykel den Kreis ABZ2I z. B. in der Richtung von A nach B mit gleichförmiger Geschwin digkeit durchläuft, und ebenso das Gestirn den Epizykel, so wird das Ge stirn, wenn es in den Punkten Z und 0 steht, mit dem Mittelpunkt A des Epizykels scheinbar zusammenfallen; steht es dagegen in anderen Punk ten, so wird dies nicht mehr der Fall sein. So wird es z. B., in Punkt H angelangt, scheinbar eine um den Bogen AH größere Bewegung als die
171
gleichförmige ausgeführt haben, dagegen in Punkt K angelangt, ganz ent sprechend eine um den Bogen AK kleinere. (Manit. I, S. 152 f.) Beide Hypothesen, obwohl in der Struktur sehr verschieden, sind rechne risch vollkommen gleichwertig, unter drei Voraussetzungen: 1. daß die Ekzentrizität in beiden Fällen dieselbe ist. Wie sich beim Ekzenter EZ : EA verhält, so muß sich beim Epizykel ZA : EA verhalten. 2. daß sich das Gestirn auf dem Ekzenter in Richtung der Buchstabenfolge (d. h. nach rechts, ostwärts) bewegt, während das Gestirn auf dem Epizykel sich westwärts bewegen muß. 3. daß die Zeiten aller Umläufe gleich lang sind. Bei Einhaltung dieser Bedingungen ergibt sich, daß nach beiden Hypo thesen die Erscheinungen den gleichen Verlauf nehmen. Daß dies wirk lich so ist, wird anschließend mathematisch bewiesen, eine Erörterung, an der unsere Leser kein so großes Vergnügen finden würden. Wir können dem Ptolemäus seine Beweise auch ohne weiteres glauben und gleich zu der Frage übergehen: Wenn beide Hypothesen rechnerisch gleich sind, welche von ihnen ist dann vorzuziehen? Darauf antwortet Ptolemäus im 4. Kapitel: Es wird logisch richtiger sein, sich an die Ekzenter-Hypothese zu halten, weil sie einfacher ist und mit einer Bewegung statt zweien ans Tdel kommt. Schon im 1. Kapitel des 3. Buches hatte Ptolemäus die Forderung aufge stellt, die Phänomene mit möglichst einfachen Hypothesen zu erklären (Übers. Bd. 1 S. 140, 3 Manit.). Wir finden also hier ganz im aristotelischen Sinne die sog. Lex parsimoniae ausgesprochen, das Sparsamkeitsprinzip, ohne Not die Vorausset zungen nicht zu vermehren. Es ist ein rein logisches Prinzip, das mit der empirischen Wirklichkeit unmittelbar nichts zu tun hat. Uns drängt sich unvermeidlich die Frage auf: Ja bewegt sich die Sonne nun auf einem Ekzenter oder einem Epizykel um die Erde? Für den Mathematiker ist das eine naive Frage. Er wird einfach antworten: Der Effekt ist derselbe. Dabei bleibt aber unbestreitbar doch der Unterschied, daß der Astronom nicht einfach nur Mathematiker ist, er ist gleichzeitig immer auch Kosmo loge. Und da macht es nun nicht nur einen Real-, sondern auch einen Dignitätsunterschied, ob die Gestirne sich auf konzentrischen oder ekzentrischen Bahnen bewegen. Platon, Aristoteles und Eudoxos, vielleicht auch noch Aristarch, haben nur konzentrische Kreise der Göttlichkeit der Gestirne für angemessen gehalten. Eine hinkende Ekzenterbewegung wäre für sie unannehmbar gewesen, denn sie hätte die vorausgesetzte Symmetrie aufgehoben. Für Ptolemäus ist, wie es scheint, diese metaphy172
sische Wertfrage zumindest sehr zurückgetreten. Er entscheidet sich ohne Zögern nach der logischen Einfachheit. Allerdings besteht die Freiheit der Wahl nur bei den Gestirnen mit einer Anomalie. Bei Planeten mit zwei Anomalien ergibt sich die Notwendig keit, die beiden Hypothesen zu kombinieren. Da läuft dann der Epizykel nicht, wie in unserem obigen Beispiel, auf einem konzentrischen Kreis, sondern auf einem Ekzenter. Damit ergeben sich rechnerisch sehr ver wickelte Kombinationen, wie Ptolemäus sie in Kap. 5 und 6 des 9. Buches durchführt und wie sie eben das zitierte Diktum Alfons des Weisen von Kastilien herausgefordert haben. Eine erhebliche zusätzliche Komplika tion ergab sich aus dem Glauben des Ptolemäus, daß die Ebenen der Planetenbahnen nicht fest lägen, sondern schwankten, sich leicht höben und senkten. Um diese Schwankungen zu berechnen, führte er kleine senkrechte Kreise ein, senkrecht zum Ekzenter, die die Umlaufbahnen periodisch hoben und senkten. Bei der Ekzenter-Epizykel-Kombination kommt es ganz unzweideutig zum Vorschein, daß es sich nicht um eine Realerklärung, sondern nur um Rechenoperationen handelt. Und vollends beweist das die Einführung der gerade erwähnten Hebekreise. Man liest gelegentlich selbst in Fachdarstellungen, Ptolemäus habe die Epizykeltheorie eingeführt. In Wirklichkeit ist die Epizykeltheorie alt und war schon dem Hipparch geläufig. Ptolemäus hat die Kombination von Epizykel- und Ekzentertheorie eingeführt und dadurch die Berechnung der Planetenbahnen zwar verbessert, aber auch außerordentlich kompli ziert. Noch Kepler hat an den ptolemäischen Berechnungen endlos her umstudiert, bis er endlich seine eigenen einfachen Gesetze fand.
FÄLSCHUNGEN Während aber Kepler gegenüber seinem großen Vorgänger und seiner Arbeit noch mit außerordentlichem Respekt erfüllt war, ist seit 1817 das Ansehen des Ptolemäus schwer angeschlagen. Damals veröffentlichte der französische Astronom J. Delambre eine zweibändige Geschichte der an tiken Astronomie, in der er dem Ptolemäus gefälschte und fingierte Beob achtungen, vorgefaßte Meinungen, Lügen und Plagiat vorwarf. Diese massiven Anschuldigungen verloren natürlich mit der Zeit an Gewicht, und man konnte sie um so mehr für maßlose Übertreibungen halten, als niemand bereit war, sie nachzuprüfen. Aber damit war der Angriff Delambres keineswegs überstanden, vielmehr erneuerte er sich 160 Jahre 173
später auf das härteste. 1977 veröffentlichte der englische Astronom R. R. Newton ein Enthüllungsbuch mit dem thrillerhaften Titel Das Ver brechen des Claudius Ptolemäus — The Crime of Claudius Ptolemy, in dem die Anschuldigungen Delambres in vollem Umfang bestätigt werden. Die ganze Masse der von Ptolemäus berichteten Beobachtungen ist bis auf wenige Ausnahmen fiktiv. Entweder sind sie direkt gefälscht, oder sie sind von Hipparch übernommen, nur daß Ptolemäus dessen Längenangaben jeweils 2° 40' hinzugefügt hat, um der seit damals eingetretenen Präzes sion Rechnung zu tragen. Die ganze empirische Basis der ptolemäischen Rechnungen ist nur vorgetäuscht. Newton zieht am Ende das Fazit, es wäre für die Geschichte der Astronomie besser gewesen, wenn die Ver öffentlichung des Almagest unterblieben wäre. Nach den detaillierten Nachweisen Newtons bleibt offenbar nicht viel zu beschönigen, um so weniger, als er 1985 in seinem Buch The Origins ofPtolemy’s Astronomical Tables neues, zusätzliches Material vorgelegt hat. Und so finden sich denn auch in dem letzten Buch von B. L. van der Waerden Die Astronomie der Griechen (Darmstadt 1988) Äußerungen und Urteile, die an Schärfe nichts zu wünschen übriglassen: Daß Ptolemäus systematisch und absichtlich Beobachtungen gefälscht hat, um die Beobachtungsergebnisse mit seiner Theorie in Übereinstim mung zu bringen, das haben Delambre und Newton überzeugend bewie sen. Auch darin hat Newton recht, daß die Theorie des Ptolemäus auf ganz anderen empirischen Grundlagen beruht, als er behauptet. Ium Bei spiel sagt Ptolemäus, sein Sternkatalog beruhe auf Beobachtungen, die er selbst mit einem von ihm ausführlich beschriebenen Instrument gemacht habe, während er in Wahrheit einfach z°40' zu den von Hipparch gemes senen Längen addiert hat. . . . Ähnliche bewußte Unwahrheiten finden sich in seinem ganzen Werk. (S. 253)
In Buch I Kap. 12 beschreibt Ptolemäus zwei Beobachtungsinstrumente, mit denen er behauptet, die Mittagshöhe der Sonne zur Zeit der Sonnen wenden gemessen zu haben. Van der Waerden bemerkt dazu: Er behauptet, bei mehreren Messungen jedesmal Werte zwischen 47° 40' und 47° 45' gefunden zu haben. Er hätte also, wenn er wirklich mehrere Male gemessen hätte, jedesmal Fehler zwischen iß1/! und z^/z Bogen minuten gemacht. Das ist sehr unwahrscheinlich, denn zo' sind rund 2/j des scheinbaren Sonnendurchmessers. Mit Newton meine ich, daß Ptole mäus gar nicht gemessen, sondern den Wert des (Geographen) Eratosthenes übernommen hat. (S. 261) 174
Ptolemäus beschreibt seine Beobachtungsinstrumente und betont, er habe seine Messungen »mit größter Zuverlässigkeit« ausgeführt. Das ist, wie Newton mit Recht sagt, ein absichtlicher Betrug. (S. 261) Die ganze trigonometrische Rechnung, die in der Edition Heiberg neun Seiten in Anspruch nimmt, ist ein ungeheurer Schwindel. Mathematisch ist die Rechnung richtig, aber ihr Ausgangspunkt war eine von vornherein fertige Mondtheorie. (S. 368) Über die Beobachtung von Mondfinsternissen bemerkt van der Waerden: Was man direkt beobachten kann, ist nicht die Mitte der Finsternis, son dern nur ihr Anfang und ihr Ende. Ptolemäus gibt sich aber bei seinen eigenen angeblichen Finsternisbeobachtungen gar nicht die Mühe, An fang oder Ende der Finsternis anzugeben, sondern er gibt nur die Zeit der Finsternismitte an, die aus seinen Tafeln leicht zu berechnen war. (S. 269)
Über die Art und Weise, wie Ptolemäus den Betrag, die Größe der Präzes sion bestimmte, schreibt van der Waerden:
Das Motiv der Fälschung scheint mir auch in diesem Fall ganz klar. Hätte Ptolemäus gemessen und die von ihm gemessenen Deklinationen ehrlich wiedergegeben, so hätte er einen viel größeren Betrag der Präzession der Äquinoktien erhalten. Er hätte dann alle Planetenperioden, die er in der Kanobosinschrift schon vorher angekündigt hatte, revidieren und seine Tafeln neu berechnen müssen. Auch hätte er die von Hipparch übernom mene Dauer des tropischen Jahres revidieren müssen und seine Sonnenund Mondtafeln neu berechnen. Diese riesige Rechenarbeit wollte er offenbar vermeiden. Er fälschte lieber seine Beobachtungen und erhielt so ein System ohne innere Widersprüche. (S. 279 f.) Genug, und wahrscheinlich schon übergenug. Zu beschönigen ist da offenbar wenig. So bleibt nur die Frage: Wie erklärt es sich? Der von van der Waerden angeführte Grund, sich weitläufige Rechenarbeit zu erspa ren, nennt eher nur ein Symptom als die Ursache, denn solche Manipula tionen wären ja gar nicht denkbar gewesen, wenn die empirischen Fakten für Ptolemäus das oberste Kriterium gebildet hätten. Er war aber in erster Linie Mathematiker, in direktem Gegensatz zu Hipparch. Die beobachte ten empirischen Daten waren für ihn nur das Material, an dem sich die Rechnung entzündete. Seine Einstellung erinnert stark an die ähnliche, die Jacob Burckhardt auf historischem Gebiet vertrat, wo sie freilich eine 175
ganz andere Berechtigung hat. In einem langen Brief an den jungen Bern hard Kugler vom 30. März 1870 äußert er sich über die richtige Darstel lung historischer Stoffe:
Ich rathe ferner zum einfachen Weglassen des blossen Tatsachenschuttes — nicht aus dem Studium, wohl aber aus der Darstellung. . . . Unsere Nervenkraft, unser Augenlicht sind zu gut dazu, um nur zur Erkundung äußerer vergangener Fakten zu dienen. . . . Lange bevor die Schuttschlep per nur von ihrem Karren aufgestanden sind, um uns Unangenehmes nachzurufen, sind wir schon über alle Berge. So werden auch dem Ptolemäus die »äußeren Fakten« der Beobachtung — man bedauert fast den Schuttschlepper Hipparch, der sie herbeige schafft, — keine verbindliche Instanz gewesen sein, sondern nur das Material, um zum Allgemeinen der mathematischen Regel vorzudringen. Im Unterschied zu Burckhardt ist ihm allerdings das Mißgeschick wider fahren, von späteren Schuttschleppem eingeholt zu werden, die ihm nun weithallend Unangenehmes nachrufen. Im übrigen ist dieser üble Nachruf wesentlich älter als der durch Delambre erfolgte. Der englische Astronom Edmund Hailey (1656—1742), allgemein bekannt durch den nach ihm benannten Kometen, stellte 1718 fest, daß die von ihm bestimmten Örter heller Fixsterne (Sirius, Arktur, Aldebaran) wesentlich von denen abwichen, die sich im Almagest angege ben fanden. Nur wußte er damals noch nicht, ob diese Unstimmigkeiten von der Unzuverlässigkeit der Angaben des Ptolemäus herrührten oder ob die betreffenden Sterne wirklich ihre Position verändert hatten. Vielleicht darf man die Einstellung des Ptolemäus mit derjenigen Hegels vergleichen. Als man Hegel vorhielt, daß die von ihm gemachten natur philosophischen Aufstellungen in der Natur gar kein Korrelat besäßen, gab er zur Antwort: Um so schlimmer für die Natur! und sprach von der Unfähigkeit der Natur, dem Begriff zu folgen. Wie sehr Ptolemäus noch in dem Konstruktionsdenken des Aristoteles be fangen war, wird uns eine spezielle Angabe der Kanobus-Inschrift gera dezu erschreckend klarmachen. Doch betrachten wir zunächst noch ein ganz anderes Zeugnis.
KARTOGRAPHIE Der Widerspruch zwischen Konstruktion und Datenverarbeitung kann mit einem gewissen Recht deshalb als charakteristisch für Ptolemäus an176
gesehen werden, weil er sich auch bei anderen Werken findet, z. B. bei sei ner Kartographie. Wir zitieren zum Beleg einfach das Urteil des Fach manns. H. v. M2ik hat 1938 das 1. Buch von Ptolemäus’ sog. Geographie, die in Wirklichkeit eine Anweisung für die Kartographie ist, ins Deutsche übersetzt (Klotho 5) und schreibt dazu im Vorwort: Schließlich treten die Konstruktions-Probleme, die die Herstellung einer Weltkarte bietet, neben den theoretischen Erörterungen immer mehr in den Vordergrund, um in den letzten Kapiteln des I. Buches ihre mathema tische und zeichnerische Lösung in zwei Kartenprojektionen zu finden, die weit alles überragen, was uns bis zum Beginn der Neuzeit über Projek tionsarten überliefert ist. Wenn dann die Karten, die auf Grund der Projektionslehre im I. Buch und der Tabellen in den Büchern II— VII gezeichnet werden sollen, die eige nen Forderungen des Ptolemaios nur zum Teil erfüllen und weit hinter dem Zurückbleiben, was wir heute von Landkarten verlangen, so ist dies hauptsächlich auf zwei Gründe zurückzuführen: Auf die Unmöglichkeit, die für das ganze Altertum bestand, genaue Längenbestimmungen zu er halten, und auf die Befangenheit des Ptolemaios in gewissen theoreti schen Voraussetzungen, die z. T. in der ganzen damaligen wissenschaftli chen Welt Geltung hatten, z. T aber von ihm selbst aufgestellt sein dürf ten. Derartiges war z. B. die Annahme betreffend die Länge des Mittel meeres (Kalpe-Issos 62.°, statt richtig43 °z8') und die Annahme betreffend die Länge (180°) und Breite (63° + i6z/ß) der Oikumene, der zuliebe er im Süden und Osten seiner Weltkarte mit den Berichten, die er von diesen Gegenden zur Verfügung hatte, in mehr als freier Weise umging. Daß das »Angleichsverfahren«, zu dem er nur zu oft greifen mußte, und das in ge wissem Sinne unserer »Netzausgleichung« entspricht, aus den oben ge nannten Gründen keine befriedigenden Ergebnisse bringen konnte, son dern vorhandene Fehler oft noch unterstrich und vergrößerte, ist beinahe selbstverständlich. Trotz aller Mängel seiner Karten aber bleibt Ptolemaios unser Altmeister in der Kartenwissenschaft. . . . Auf ihn geht die mathematische Basis un serer Karten (das Gradnetz), die Projektionslehre, die Nordorientierung und die kartographische Zeichensprache unmittelbar zurück. Durch ihre Methode und durch das von ihr gebrachte topographische Material ist seine »Darstellende Erdkunde« die Spitzenleistung des Altertums auf dem Gebiete der Kartenwissenschaft, nicht anders wie Strabons »Geographie« den gleichen Rang auf dem Gebiete der beschreibenden Erdkunde für sich in Anspruch nehmen kann. (S. 6f.) 177
Wir finden also auch beim Beispiel der Kartographie eine merkwürdige Verflechtung von Verdiensten und Fehlleistung. Und auch hier entspringt sie aus dem Widerstreit von Konstruktion und Faktizität, von Theorie und Empirie.
DIE KANOBUS-INSCHRIFT Kanobus, ursprünglich eine wichtige Hafenstadt an der Mündung des westlichsten Nilarms, die durch die Gründung Alexandrias ihre Bedeu tung verlor, war später eine Art Erholungs- und Ausflugsort für die Alexan driner, über einen Kanal leicht zu erreichen. Aus dem alten Osiristempel war unter den Ptolemäern ein bedeutendes Serapisheiligtum geworden. Hier scheint Ptolemäus Jahre, vielleicht Jahrzehnte hindurch gewirkt zu haben, und hier stellte er auch eine Inschrift auf, deren Text erhalten ist. Die Inschrift ist datiert durch ihren Schlußsatz Aufgestellt in Kanobus im io. Jahr des Antoninos (= 146 n. Chr.) und dadurch von besonderer chro nologischer Wichtigkeit, weil durch sie indirekt auch der Almagest mitda tiert wird. Man hat bisher den Almagest für älter als die Inschrift gehal ten, weil sie ihm gegenüber Verbesserungen zu enthalten schien. Neuer dings hat N. T. Hamilton die Ansicht vertreten, die Inschrift müsse jünger sein, eine Annahme, der sich van der Waerden angeschlossen hat. Die Inschrift verzeichnet in der Hauptsache Zahlenangaben, die meist mit dem Almagest übereinstimmen, teils aber auch von ihm abweichen: die Schiefe der Ekliptik, die Ekzentrizität der Bahnen von Sonne, Mond und den fünf Planeten, die Radien der Epizykel, die tägliche Bewegung der Planeten usw. Die Theorie der senkrechten Epizykel, mit denen die Schwankung, Hebung und Senkung, der Ebenen der Planetenbahnen er faßt werden sollte, scheint vereinfacht zu sein. Uns interessieren hier vor allem zwei Angaben. In auffälligem Unterschied zum Almagest werden hier die Entfernungen von Sonne und Mond mit ganz anderen Zahlen an gegeben, und zwar die letztere mit 64 und die erste mit 729 Erdradien und mit dem erklärenden Zusatz: Das sind die ersten Zahlen, die sowohl Kuben wie Quadrate sind. 64 = 4x4x4 = 8x8 und 729 = 9x9x9 = 27 x 27. Hier werden also Zahlen angegeben, die mit Beobachtung und Rechnung gar nichts zu tun haben, sondern der Zahlenmystik entnom men sind, die ersten Kombinationen von Kubik- und Quadratzahlen in der Zahlenreihe. Wie vertragen sich diese »magischen« Zahlen mit den oben aufgeführten astronomischen? Unwillkürlich fragt man sich, ob wohl die dritte Kombinationszahl für die Entfernung des Fixsternhim
178
mels in Anspruch genommen wurde. Irgendwie fühlt man sich in die Zei ten Anaximanders zurückversetzt, nur daß die Konstruktion der Entfer nungen nun etwas raffinierter geworden ist. Und da Ptolemäus diese Zah lenspielerei hat in Stein einmeißeln lassen, muß es ihm wohl Ernst damit gewesen sein. Aber wie es sich mit seiner Wissenschaft verträgt, das sehen wir auf keine Weise. Der Schlußabsatz der Inschrift handelt von der Sphärenharmonie und ordnet den einzelnen Planeten die Saiten einer Lyra zu. Ptolemäus legt der Berechnung die Zahl 36 als Einheit einer Tonleiter zugrunde, wie er es auch in seiner Harmonielehre tut. Im einzelnen bleibt es jedoch offen, wie die Analogien zwischen dem Tonsystem und den Planetenabständen be schaffen sein sollen. Aber es war ein Gedanke, der bis in die Neuzeit fort wirkte. Noch das 6. Kapitel des 5. Buches von Keplers Harmonices mundi trägt die Überschrift: In den Grenzwerten der Umlaufgeschwindigkeiten der Planeten treten in gewisser Weise musikalische Tonfolgen auf. Nicht ganz klar ist, was Ptolemäus mit der Aufstellung der Kanobus inschrift bezweckte. Man hat angenommen, er habe sich mit ihr für eine Reihe von ihm zuerst ermittelter Werte die Priorität sichern wollen. Olympiodor, ein später Platoniker des 6. Jhs., hat in seinem Phaidon-Kommentar überliefert, daß Ptolemäus vierzig Jahre in Kanobus gewirkt habe und deshalb auch dort die Inschrift mit den von ihm gefundenen astronomi schen Erkenntnissen aufgestellt habe, zum Ruhm, so sollen wir wohl ver stehen, nicht nur seiner selbst, sondern auch seiner Wissenschaft, die in ihm die größte Höhe erreichte, die ihr in der Antike bestimmt war.
179
1
Da Heraklit in Fr. 32 als Genitiv von Zeus nicht die übliche Form Dios, sondern Zenos gebraucht, so hat man hierin eine Anspielung auf das Verb zen — leben und auf Zeus als den »Gott des Lebens« erblicken wollen. Ahura Mazda, der »weise Herr« ist eher
der Gott der Gerechtigkeit. Auffällig als philosophische Umformung ist die Neutralisierung des persischen Gottes begriffs in »Das Weise«. Ähnlich spricht Herodot, um von den menschengestaltigen Göttern fortzukommen, gern von »dem Göttlichen« (to theion). Aristoteles schließlich nennt die höchste Gottheit »das erste Bewegende« (tö pröton kinoün), was gewöhnlich ungenau und irreführend personal mit »primus motor« und »der erste Beweger« über 2
setzt wird. In Heraklits Seelenlehre entsprechen den drei Elementen Feuer — Wasser — Erde die drei menschlichen Zustände Wachen — Schlafen — Tod.
2A Wahrlich, ein mühevoll Amt muß Helios täglich verwalten;
Auch kein einziges Mal ist ja den Rossen und ihm Innezuhalten vergönnt, sobald zur Höhe des Himmels Aus des Okeanos Flut Eos, die rosige, stieg. Aber ihn trägt bei Nacht durch die Woge das wonnige Lager, Das aus lauterem Gold künstlich Hephästos gewölbt; Über den Spiegel des Meeres auf eiligen Fittichen schwebend, Trägt es den Schlummernden sanft fort von Hesperiens Strand Zum Äthiopengestad, wo sein Gespann und der Wagen Harrt, bis wieder des Tags dämmernde Frühe sich naht.
3
Mimneros (um 600 v. Chr.). Deutsch von E. Geibel Vgl. z. B. den Eingangssatz von Hegels Dissertation: »Wahrheit ist nur im Widerspruch.
4
Was sich nicht widerspricht, ist nicht wahr.« Die Zahl 10000 ist im Altgriechischen die Symbolzahl für unendlich.
5
Die Übersetzung im Anschluß an U. Hölscher, Parmenides. Vom Wesen des Seienden.
6
Frankf. 1986. Schon Aristoteles hat gesagt, daß man diejenigen, die heiß und kalt für dasselbe erklär
7
ten, des Wahnsinns anklagen müsse. Ganz irritierend ist ein dritter Bericht des Aetius, wo es heißt: Parmenides ordnet zu oberst, im Äther, den Morgenstern an, den er für denselben wie den Abendstern hält;
nach diesem die Sonne, und unter ihr die Sterne in dem Feurigen, das er Himmel nennt (Test. 40a). Hier schwebt der Planet Venus im obersten Äther. Dann folgt die Sonne
und erst unter ihr der Sternhimmel. Es ist eine groteske Mischüng aus Babylonischem 8
und Anaximandrischem. Aristoxenos von Tarent, ein Schüler des Aristoteles, der sich eine Zeitlang der Hoffnung hingab, sein Nachfolger zu werden, ein Mann, der es auch sonst darauf anlegte, Platon am Zeug zu flicken, hat die Erklärung vorgebracht, Platon habe die Lehren Demokrits deshalb verschwiegen, weil er sich bewußt gewesen sei, gegen den Besten der Philoso phen im Feld zu stehen (Diog. Laert. IX 40), ein Zeugnis jedenfalls für die außerordent
’
liche Wertschätzung Demokrits im Peripatos. Um diese Eigenart recht handgreiflich zu machen, hat man argumentiert: selbst wenn es ein Atom gäbe, so groß wie die ganze Welt, so müßte es doch unsichtbar bleiben, da es keine wahrnehmbaren Qualitäten besitzt. Die Idee von einem weltgroßen Atom war evoziert durch Demokrits Lehre, daß die Atome von verschiedener Größe seien. In Wirklichkeit bleiben diese Größenunterschiede alle unterhalb der Sichtbarkeit infolge ihrer Kleinheit.
180
,A Ein astronomisches Hauptargument gegen das System des Philolaos wäre auch, daß
innerhalb jedes Tages eine ungeheure Differenz zwischen Sonnennähe und Sonnenferne 10
eintritt. Als eine weitere Analogie könnte man heranziehen, daß der griechische Tempel keinen
Raum gestaltet, sondern ihn nur umschließt, ein Schrein, ein Gehäuse ist. So auch die 11 IX 13
Elementformen. Nach A. Ahlvers, Zahl und Klang bei Platon. Bern 1952. S. 57. Es ist die früheste Erwähnung eines Planetennamens in der griechischen Literatur. Aristoteles gibt hier sozusagen eine entmythologisierte Darstellung der göttlichen Exi
14
stenz im Elysium. G. V. Schiaparelli, Die Vorläufer des Copernicus im Alterthum. Übers, v. M. Curtze
15
16
1876. Vgl. auch die Bemerkung von Sir Th. Heath über die Unmöglichkeit der Vorstellung eines immateriellen Weltmittelpunktes bei den Alten o. S. 146 f. Ein Finger (däktylos), was Manitius in seiner Almagest-Übersetzung mit »Zoll« wiedergibt, entspricht fünf Bogenminuten (5').
181
Quellen der Textabbildungen 1.
J. J. v. Littrow, Die Wunder des Himmels, n. Aufl., Bonn 1963. S. 85, Abb. 40.
2.
ebd. S. 88, Abb. 44.
18.
ebd. S. 96, Abb. 49.
19.
ebd. S. 339, Abb. 182.
21.
ebd. S. 108, Abb. 56.
22.
ebd. S. 79, Abb. 36.
23.
ebd. S. 191, Abb. 102.
24.
ebd. S. 66, Abb. 32.
3. + 6.
Journ. of Hell. Stud. 75 (1955), p. 63.
4. Fr. Boll, Die Sonne im Glauben und in der Weltanschauung der alten Völker. Stuttg. 1922. S. 17, Bild 12. 5 a—c. 7.
Eigene Zeichnung.
D. R. Dicks, Early Greek Astronomy. London 1970. S. 69 Fig. 9.
8. —13. + 17. W. Schadewaldt, Das Weltmodell der Griechen. Hellas und Hesperien I. 2. Aufl. Stgt. 1970. S. 610-615. 14.—16. 20.
A. Ahlvers, Zahl und Klang bei Platon. Bern 1952, S. 57.
Th. Heath, Aristarchus of Samos. Oxf. 1913. S. 203 Fig. 7.
25. + 26. CI. Ptolemäus, Handbuch der Astronomie. Übers, v. K. Manitius. Bd. 1, Lpz. 1912, S. 152E
182
Bibliographie ASTRONOMIE
Th. Heath, Aristarchus of Samos. A History of Greek Astronomy to Aristarchus. Oxf. 1913 D. R. Dicks, Early Greek Astronomy to Aristotle. Lond. 1970 O. Neugebauer, Exact Science in Antiquity. 2. Aufl. Providence 1957 D. G. Kendall u. a. (Hg.), The Place of Astronomy in the Ancient World. A Sym posium. Lond. 1974 O. Neugebauer, A History of Ancient Mathematical Astronomy. In 3 parts. Springer 1975 ders., Astronomy and History. Selected Essays. Springer 1983 B. L. van der Waerden, Die Astronomie der Griechen. Darmstadt r988
VORSOKRATIKER
J. Burnet, Early Greek Philosophy. 4. Aufl. Lond. 1930 H. Diels/W. Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker. 6. Aufl. 3 Bde. Berl. 1951/52 H. Fränkel, Wege und Formen frühgriechischen Denkens. 2. Aufl. Münch, i960 G. S. Kirk/J. E. Raven, The Presocratic Philosophers. 3. Aufl. Cambr. 1961 W. K. C. Guthrie, A History of Greek Philosophy. Bd. I u. II. Cambr. 1962/65 J. Kerschensteiner, Kosmos. Quellenkritische Untersuchungen zu den Vorsokratikern. Zetemata 30. Münch. 1962 O. Gigon, Der Ursprung der griechischen Philosophie. 2. Aufl. Basel/Stuttg. 1968 U. Hölscher, Anfängliches Fragen. Studien zur frühen griechischen Philosophie. Göttg. 1968 Fr. Solmsen, Aristotle and Presocratic Cosmogony. Kl. Schriften I (Hildesh. 1968), S. 356-373 M. L. West, Early Greek Philosophy and the Orient. Oxf. 1971 J. Mansfield, Die Vorsokratiker. Griech.-Dt. 2 Bde. Stuttg. 1986. Reclam
THALES D. R. Dicks, Thales. Class. Quart. 9 (1959), 294-309 Br. Snell, Die Nachrichten über die Lehren des Thales. Ges. Schriften (Göttg. 1966), S. 119-127 A. Wasserstein, Thales and the Determination of the Diameters of Sun and Moon. Journ. of Hell. Stud. 75 (1955), 114-116; 76 (1956), 105 183
ANAXIMANDER
Fr. Dirlmeier, Der Satz des Anaximandros von Milet. Rhein. Mus. 87 (1938), 376-382* W. Brocker, Heraklit zitiert Anaximander. Hermes 84 (1965), 382-384* Ch. H. Kahn, Anaximander and the Origins of Greek Cosmology. New York i960 P. Seligman, The Apeiron of Anaximander. Lond. 1962 W. Burkert, Iranisches bei Anaximandros. Rhein. Mus. 106 (1963), 97-134
PYTHAGORAS UND PYTHAGOREER W. Burkert, Weisheit und Wissenschaft. Nürnbg. 1962 J. Kerschensteiner, Kosmos. Kap. 7: Pythagoras und Pythagoreer. Münch. 1962. S. 192-232 C. J. de Vogel, Pythagoras and Early Pythagoreanism. Assen 1966 K. v. Fritz, Pythagorean Politics in Southern Italy. New York 1940 ders., Mathematiker und Akusmatiker bei den alten Pythagoreern. Bayer. AW, Phil.-hist. Kl. SB i960, Heft 11
HERAKLIT G. S. Kirk, Heraclitus. The Cosmic Fragments. Cambr. 1954 Br. Snell, Die Sprache Heraklits. Ges. Schriften (Göttg. 1966), S. 129-151
PARMENIDES H. Schwabl, Sein und Doxa bei Parmenides. Wien. Stud. 66 (1953), 50-75* J. S. Morrison, Parmenides and Er. Journ. of Hell. Stud. 55 (1975), 60-68 Ph. Merlan, Neues Licht auf Parmenides. Kl. Philos. Schriften (Hildesh./New York), S. 8-17 U. Hölscher, Parmenides. Vom Wesen des Seienden. Suhrkamp tb wiss. 624. Frkf. 1986
EMPEDOKLES
Fr. Solmsen, Love and Strife in Empedocles’ Cosmology. Kl. Schriften I (Hildesh. 1968), S. 274-313
* Wieder abgedruckt in: H.-G. Gadamer (Hg.), Um die Begriffswelt der Vorsokratiker. Wege der Forschung, Bd. 9. Darmstadt 1968
184
ANAXAGORAS
R. Mathewson, Aristotle and Anaxagoras. Class. Quart. 8 (1958), 67-81 H. Diller, Opsis adelon td phainomena. Kl. Schriften (Münch. r97i), S. 119-143
SOKRATES Plato’s Phaedo. Ed. with introduction and notes by J. Burnet. 5. Aufl. Oxf. 1949 Gr. Vlastos (Hg.), The Philosophy of Socrates. A Collection of Critical Essays. Anchor AP 11. New York 1971 A. Patzer (Hg.), Der historische Sokrates. Wege der Forschung, Bd. 585. Darm stadt 1987
DEMOKRIT
R. Löbl, Demokrits Atomphysik. Darmstadt 1987
PLATON, TIMAIOS
A. E. Taylor, Plato. The Man and his Work. 6. Aufl. Lond. 1952 ders., A Commentary on Plato’s Timaeus. Oxf. 1928 Fr. M. Cornford, Plato’s Cosmology. Lond. 1937 A. Ahivers, Zahl und Klang bei Platon. Bern 1952 R. Hackforth, Plato’s Cosmology. Class. Quart. 9 (1959), 17-22 W. Burkert, Platon und Pythagoras. Hermes 88 (i960), 159 ff. P. Friedländer, Platon als Atomphysiker. In: Platon Bd. I. 3. Aufl. Berl. 1964, Kap. XIV R. D. Mohr, The Platonic Cosmology. Leiden 1985
EUDOXOS G. V. Schiaparelli, Die homozentrischen Sphären des Eudoxos, des Kallippos und des Aristoteles. Abh. z. Gesch. d. Mathem. I. 1877 Fr. Gisinger, Die Erdbeschreibung des Eudoxos von Knidos. Stoicheia VI. Lpz. u. Berl. 1921 W. Schadewaldt, Eudoxos von Knidos und die Lehre vom unbewegten Beweger. Hellas und Hesperien I. 2. Aufl. Zürich/Stuttg. 1970. S. 635-655
ARISTOTELES W. Brocker, Aristoteles. 3. Aufl. Frkf. 1964 H. Strohm, Studien zur Schrift von der Welt. Mus. Helv. 9 (1952), 137-175 185
Fr. Solmsen, Aristotle’s System of the Physical World. Ithaca, N. Y. i960 A. P. Bos, On the Elements. Aristotle’s Early Cosmology. Assen 1973 Ph. Merlan, Aristotle’s Unmoved Movers. KI. Philos. Schriften (Hildesh./New York), S. 195-224 R. Sorabji (Hg.), Philoponus and the Rejection of Aristotelian Science. Ithaca, N. Y. 1987
HERAKLIDES PONTICUS A. Pannekoek, The Astronomical System of Herakleides. Proceed. Nederl. Aka demie Amsterdam B 55 (1952), 373-381 Fr. Wehrli, Herakleides Pontikos. Die Schule des Aristoteles, Heft 8. 2. Aufl. Bern 1969 W. Saltzer, "Lum Problem der inneren Planeten in der vorptolemäischen Theorie. Sudhoffs Archiv 54 (1970), 141-172
ARISTARCH
Th. Heath, Aristarchus of Samos. With Aristarchus’s Treatise on the Sizes and Distances of the Sun and Moon. Oxf. 1913
HIPPARCH H. Berger, Die geographischen Fragmente des Hipparch. Lpz. 1869 Hipparchi in Arati et Eudoxi Phaenomena Commentaria. Griech.-Dt. hrsg. v. K. Manitius. Lpz. 1894 Fr. Hultsch, Hipparchos über die Größe und Entfernung der Sonne. Berr. üb. Verhh. d. Sächs. Ges. d. Wiss. zu Lpz. 52 (1900), 169-200 D. R. Dicks, The Geographical Fragments of Hipparch. Lond. i960 N. Swerlow, Hipparchus on the Distance of the Sun. Centaurus 14 (1969), 287-305
GEMINUS Gemini Elementa Astronómica. Griech.-Dt. hrsg. v. K. Manitius. Lpz. 1898
PTOLEMÄUS Cl. Ptolemäus, Syntaxis mathematica. Griech. Opera omnia Bd. I. Teil I Lpz. 1898, Teil II Lpz. 1903. Hrsg. v. J. L. Heiberg ders., Opera astronómica minora. Opera omnia Bd. II. Lpz. 1907. Hrsg. v. J. L. Heiberg 186
ders., Handbuch der Astronomie. Dt. Übers, v. K. Manitius. i. Bd. Lpz. 1912, 2. Bd. Lpz. 1913 Mit Berichtigungen und Erläuterungen neu hrsg. v. O. Neugebauer, Lpz. 1962 G. J. Tommer, Ptolemy’s Almagest. Engi. Übers, mit Erläutergg. Lond. 1984 Olaf Pedersen, A Survey of the Almagest. Odense UP 1974 Fr. Boll, Studien über Claudius Ptolemäus. Jbb. f. Klass. Philol. Suppl. 21. 1894 R. R. Newton, The Crime of Claudius Ptolemy. Baltimore 1977 ders., The Origins of Ptolemy’s Astronomical Tablets. Univ, of Maryld. 1985 Ptolemaios, Harmonikâ. Griech. Hrsg. v. I. Düring. Göteborgs Högskolas Arsskrift 36 (1930) Ptolemaios u. Porphyrios, Über die Musik. Dt. Übers, u. Komm. v. I. Düring. Göteborgs Högskolas Arsskrift 40 (1934) H. v. Mzik (Hg.), Des Klaudios Ptolemaios Einführung in die darstellende Erd kunde. Dt. Übers, u. Komm. Klotho 5. Wien 1938 CI. Ptolemaeus, Tetrabibios. Dt. Übers, v. M. E. Winkel. Berl. 1923 Ptolemy, Tetrabibios. Greek-Engl. by F. E. Robbins. The Loeb Class. Library 1956 Cl. Tolomeo, Le previsioni astrologiche (Tetrabiblos). Griech.-Ital. mit Komm. v. Simonetta Feraboli. Scrittori greci e latini. Mailand 1985 W. J. Tucker, LAstrologie de Ptolémée. Paris 1981
SPEZIELLES C. v. Jahn, Die Harmonie der Sphären. Philol. 52 (1894), 13-36 Th. Reinach, La musique des sphères. Rev. des étud. grecques. 13 (1900), 432-449 H. Diels, Elementum. Lpz. 1899 B. L. van dér Waerden, Das große fahr und die ewige Wiederkehr. Hermes 80 (1952), 129-155 W. Härtner, Mediaeval Views on Cosmic Dimensions and Ptolemy’s Kitab Al-Manshurat. EAventure de la science. Mélanges Al. Koyré I. Paris 1964. S. 254-282 C. D. Hellman, The Gradual Abandonment of the Aristotelian Universe, ebd. S. 283-293 A. Szabö, Astronomische Messungen bei den Griechen im 5. Jh. v. Chr. und ihr Instrument. Historia scientiarum 21 (1981), 1-26
187
Personenregister I. ANTIKE Alexander d. Gr. 125, 136 Anaxagoras 17, 45, 58, 70, 74, 76ff., 84, 86, 93 Anaximander 20ff., 70, 85, 93, 122 Anaximenes 29ff., 50, 61, 93, 166 Apollodor 54 Aratos 120, 155 f. Archelaos 81, 82 f. Archilochos 14 Archimedes 19, 148 f., 152 Archytas 101, 119, 132 Aristarch von Samos 120, 146, 148 ff., 163 Aristarch von Samothrake 148 Aristophanes 43, 83 Aristoteles 10, 12, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 35, 48, 51, 52, 66, 68ff., 75, 8l, 82, 87, 89, 99, IO3, II2Í, 114, 120 f., 123, 125 ff., 159, 169
Hekataios 27, 34 Heraklides Pont. 143 ff. Heraklit 19, 34, 38 ff. Herodot 11-14, 27, 34, 39, 43 Hesiod 23, 39, 66 Hipparch 19, 151, 155 ff. Hippias 65 Homer 20, 23, 34, 39, 43, 136
Johannes Philop.
Kallippos 138 f. Kleanthes 150 Kratylos 51 f. Melissos 55, 132, 142 Meton 94 Mimnermos 49
Numenios
Chalzidius 100 Cicero 82, 87
Darius I. 38, 41, 46 Demokrit 87 ff., 114 Diogenes Laert. 17, 20, 143 Empedokles 45, 61, 65ff., 113, 126, 134 Epikur 24, 90 Eudoxos ii9ff., 138 ff., 143, 155 f. Euklid 36 Euktemon 123 Euripides 81, 123 Geminus 164 ff. Gorgias 77 188
129
35
Parmenides 53 ff., 66, 70, 76f., 88 ff., 122, 132, 143 Perikies 81 Philippus von Opus 115 Philistion von Lokri 119 Philolaos 83, 95 ff., 101, 118, 133 Platon 20, 26, 34 f., 42, 45, 52, 54, 64, 76, 87f., 89, 91, 98, 100ff., 115, H9ff., 126f., 134, 143f. Plinius 155 Plutarch 98, 150 f. Protagoras 88 Ptolemäus 124, 155, 157, i6if., 167 ff. Pythagoras 33 ff., 58, 67 Pythagoreer 35, 83, 98, 101, 118
Seleukos von Seleukia 151 Seneca 151 f. Simmias 83 Simplizius 22, 56, 59, 91 Sokrates 52, 77, 82 f., 100, 125 Speusipp 125, 143 Stobaios 88 Stoiker 32, 45, 48 Strabon 119, 177 Straton 129, 148
Thales 9ff., 20, 23, 34, 152 Theophrast 98, 129
Xenokrates 143 Xenophanes 34, 64 Xenophon 85 Xerxes 40 f.
Zarathustra Zenon 96
40 f.
II. NACHANTIKE/NEUZEIT
Alfons d. Weise 169 Aristippus, Henr. 100, 167 v. Arnim, H. 72 Bessel, Fr. W. 150 Brahe, Tycho 146, 150, 159 Brocker, W. 21, 44, 56, 72, 136 Burckhardt, J. 175 f. Burkert, W. 26, 83, 94
Cornford, F. M.
24, 112E
Delambre, J. 173 Duchesne-Guillemin, J.
Evans, G.
146
v. Fritz, K.
16
Geber ben Afflah 168 Guthrie, W. K. C. 72
Halley, E. 176 Hamilton, N. T. 178 Heath, Th. 133, 146 f. Hegel, G. W. Fr. 176 Heiberg, J. L. 167 Hölscher, U. 44, 72 Isidor von Sevilla
168
Kant, I. 126 Kepler, Joh. 173, 179
26
Kerschensteiner, J. 42 Kirk, G. S./Raven, J. E. 72 Koch, H. 41 Kopernikus, Nik. 95, 154, 167
Manitius, K. 164, 167 Merlan, Ph. 54, 141 Meyer, C. F. 46 Michelson/Morley 128 Morrison, J. S. 62 f. v. Mzik, H. 177 Neugebauer, O. 35, 146, 168 Newton, I. 123 Newton, R. R. 174 Schiaparelli, G. V. 123, 146 Schleiermacher, Fr. D. E. 45 Solmsen, Fr. 72 Stifter, A. 13 Tannery, P. 146 Tommer, G. J. 168
v. d. Waerden, B. L. 146, 174 f., 178 Wehrli, Fr. 143 Wieland, Chr. M. 88 v. Wilamowitz-Moellendorff, U. 135 189
Sachregister Äther 48, 59ff., 76, 78, 115, 128 ff., 141, 144 Ahura Mazda 41 f., 47 Akusmata 33, 98 Amesha Spentas 47 Almagest 168 ff. Apeiron 20ff., 26, 29, 70, 90, 103, no, 130 Asebieprozesse 80 f., 83, 125 f. Astrologie 116 Atlantis 102 Atome 89 f.
Babylonier 15 f., 35, 59, 93, 117, 123 Bewegung(sursache) 30, 69f., 78, 89ff., 103, ii2f., 128, 134 Blitz 42 f.
Demiurg 102 f., 114 Dike 23, 47, 50, 61
Ekliptik in, i22f., 151, I57Í. Ekpyrosis 48 Ekzenter 164 f., 170 ff. Elea 53 Elemente 26, 30, 47, 69ff., 90, 103 ff., 126 ff. Embryologie 54 Entstehen u. Vergehen 69, 89 Epizykel 170 ff. Erde Beben 11 Element 107 f. Entstehung 27, 30 f. = Hades 73 Kugel 58, 85 Revolution 95, 99, 149 Rotation ii2f., 143 f. 190
Scheibe 11, 24, 29E, 79E, 83, 93 Suspension 25, 29 h, 74, 79, 85 Erdkarte 27
Feuer 30, 43ff., 59ff., 90, 106f., 127 Fixsternhimmel, Unveränderlich keit 129, 135, i4if., 158 f., 160, 164 Fixsternkatalog 160 f. Gegenerde 95, 97 Gestirne Bahnen 25, 31, 74, 78 Entstehung 26, 30 Gestalt (Blätter) 31 Göttlichkeit 76, ri2f., 116, 144, 172 Materie 80, 116, 129 Reihenfolge 25, 26, 31, 59ff., 8°, 93, 95, m, 116 Gleiches zu Gleichem 91, 103 Gnomon (Sonnenzeiger) 28 Gnosis 98, 102 Gold 48, 90
Halys 13 Harmonie, tonale 36, 118 Homoiomerien 79 Jahreslänge 163 Jahreszeitenlänge
97, 123, 139, 161
Kanobus 178 Kometen 94, 144 Kosmos 26 Kreisbewegung 121, 128 f., 132, 134
Leeres 55, 79, 89f., 130ff. Lehrsatz des Pythagoras 35 f. des Thales 9 Luft 29ff., 80, 106f.
Mars n6f., 123, 139, 146 Menschen, Abstammung 27 f. Merkur in, 116L, 138, 145 f. Meteore, Meteoriten 17, 81, 144 Milet 27 Mond Finsternisse 26, 49 indir. Licht 58, 80 Materie 80 Phasen 26, 31, 49
SeelenWanderung 33, 67 Seinskugel 70 Skaphai (Gestirnschalen) 49 f. Sonne u. Mond Bahnen 25, 50, 123, 138f., 164 f. Entfernung 26, 124, 153, 162 Finsternisse 13ff., 26, 49, 80, 95 Gestalt (Blätter) 31 Größe 18, 50, 74, 80, 116, 124, 150, 153 = Inseln der Seligen 98 Materie 30, 49, 62, 80 Sphärenharmonie 36, no, 118, 179
Naukratis 11 Nilschwelle 11 Nous 77f., 84, 114, 136 Nova 158 f.
Tag u. Nacht, Entstehung 97, 144 Tetraktys 37
Okeanos n Ouranos = Welt 23
Venus 116 f., 121, 123 f., 138, 145 f. Vier 65 f.
Parische Chronik 17 Periechon 21, 49, 61, 113 Persische Religion 26, 39ff-, 51, 141 Planeten Bahnen 95f., in, 116, i2iff., 145 f. Morgen- u. Abendstern 58, 63, in, 116, 121 ff., 145 f. Namen 94, in, 117 Zahl 94, 116 ff. Präzession 157 f. Pyramidenhöhe 12
Raum
102 f., 130
Saros-Zyklus 15 Schlachtopfer 38ff., 67 Seele no, 113
31, 73,
Wasser 9ff., 80, 106f. Welt Begriff 23 Einzigkeit 49, 113, 130 ff. Endlichkeit 130 ff., 150 Entstehung 70ff., no Ewigkeit 49, 51, vgl. Fixstern himmel Kugelgestalt 56, 132 Unendlichkeit 144 Welten, unendlich viele 23f., 91 f. Weltei 92 Weltjahr, großes 94, in Weltseele no Wirbel 74, 78, 90f., 93, 114
Zehn 37, 95 Zeit nif., 130, 134 f. Zentralfeuer 95, 133 191
Der Autor liefert die erste zusammenhängende Darstellung (seit 1913) der Entwicklung grie chischer Weltbilder über 800 fahre, angefangen von den tastenden Versuchen der Vorsokratiker bis zu den großen Systemen Platons, Aristoteles’ und Ptolemäus’. 186 Seiten mit 26 Schwarzweißabbildungen
VERLAG PHILIPP VON ZABERN • MAINZ/RHEIN
ISBN 3-8053-1092-7




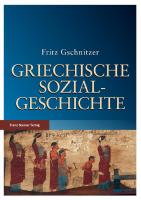



![Die Griechische Geschichtsschreibung: Band 1 Von den Anfängen bis Thukydides. Anmerkungen [Reprint 2020 ed.]
9783112318188, 9783112306994](https://ebin.pub/img/200x200/die-griechische-geschichtsschreibung-band-1-von-den-anfngen-bis-thukydides-anmerkungen-reprint-2020nbsped-9783112318188-9783112306994.jpg)
