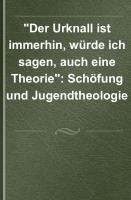Jahrbuch für Jugendtheologie Band 4: 'Jedes Mal in der Kirche kam ich zum Nachdenken': Jugendliche und Kirche 9783766843647
Das Verhältnis von Jugend und Kirche kann als wechselseitig (an)gespannt und als spannungsreich bezeichnet werden - so n
133 81 3MB
German Pages 200 [239] Year 2016
Cover
Title Page
Copyright Page
Inhalt
Kirche und kirchliche Praxis in jugendtheologischer Perspektive
»Ordinary Theology« und Jugend1
Jugendtheologie und Spiritualität
Was heutige Jugendliche an Gemeinschaft schätzen, an Individualität brauchen und an Orientierung suchen
Religiöse Erfahrungen nehmen zu! Längsschnittanalysen zur Religiosität junger Erwachsener in den westeuropäischen Daten des Reli
Identitätsentwicklung und Konfirmationsarbeit in jugendtheologischer Perspektive
Persönlicher Glaube1
Gibt es ›Anfängerglück‹ im Christentum? – Weshalb ›Fresh expressions von Kirche‹ für die junge Generation hilfreich zu sein sche
Jugend und religiöse Gemeinschaften: Zwei getrennte Welten? Inspiration für Jugendliche und von Jugendlichen und die Herausforde
»Nur wenn man einen Jugendgottesdienst macht mit Lichtershow, begeistert das niemand für Jesus« – Warum Kirche und Gemeinde aus
Muslimische Jugendliche und ihre Erfahrungen mit ›Kirche‹ – Empirische Ergebnisse und Ansatzpunkte für jugendtheologische Gesprä
Bedingungen eines gelingenden theologischen Diskurses mit jungen Freiwilligen
Jugendkirchen – Antwort auf die Entfremdung von Gemeinde und Jugend? Eine Stichprobe und jugendtheologische Folgerungen
Gottesdienste als Herausforderung der Konfirmationsarbeit – Partizipation als jugendtheologischer Lösungsansatz
Kirche und Gemeinde bei Jugendlichen an Berufsschulen
Theologisieren mit »bildungsfernen Jugendlichen« – eine Praxisreflektion
Theologisieren mit Jugendlichen im Horizont gegenwärtiger Inklusionsaufgaben
Rüstzeiten und Junge Gemeinde – Theologisieren mit Jugendlichen 14plus in kirchengemeindlicher Jugendarbeit in Sachsen
Schöpfung oder Evolution – Komplementäres Denken im Religionsunterricht
Die Autorinnen und Autoren
Recommend Papers

- Author / Uploaded
- Thomas Schlag (editor)
- Bert Roebben (editor)
File loading please wait...
Citation preview
Theologisieren mit Kindern und Jugendlichen Herausgegeben von Anton A. Bucher, Gerhard Büttner, Veit-Jakobus Dieterich, Petra Freudenberger-Lötz, Christina Kalloch, Friedhelm Kraft, Bert Roebben, Hanna Roose, Martin Rothgangel, Thomas Schlag, Martin Schreiner und Elisabeth E. Schwarz
»Jedes Mal in der Kirche kam ich zum Nachdenken« Jugendliche und Kirche Jahrbuch für Jugendtheologie Band 4 Herausgegeben von Thomas Schlag und Bert Roebben
Calwer Verlag Stuttgart
eBook (pdf) ISBN: 978–3–7668–4372–2 ISBN 978–3–7668–4364–7 © 2016 by Calwer Verlag GmbH Bücher und Medien, Stuttgart Alle Rechte vorbehalten. Wiedergabe, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Verlags. Umschlaggestaltung: Karin Sauerbier, Stuttgart Satz und Herstellung: Karin Class, Calwer Verlag Druck und Verarbeitung: Mazowieckie Centrum Poligrafii – 05-270 Marki (Polen) – ul. Słoneczna 3C – www.buecherdrucken24.de E-Mail: [email protected] Internet: www.calwer.com
Öhler Jugend und Schöpfung – historische und neutestamentliche Anmerkungen
5
Inhalt
Vorwort. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
I. Theoretische Grundlagen
Thomas Schlag Kirche und kirchliche Praxis in jugendtheologischer Perspektive. . . . . . . . . . . . . . . 13 Jeff Astley »Ordinary Theology« und Jugend. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Anton A. Bucher Jugendtheologie und Spiritualität. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 II. Empirische Aspekte
Emanuela Chiapparini Was heutige Jugendliche an Gemeinschaft schätzen, an Individualität brauchen und an Orientierung suchen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Stefan Huber Religiöse Erfahrungen nehmen zu! Längsschnittanalysen zur Religiosität junger Erwachsener in den westeuropäischen Daten des Religionsmonitors 2008 und 2013. . . . . . . . . . . . . 64 Thomas Schlag / Muriel Koch Identitätsentwicklung und Konfirmationsarbeit in jugendtheologischer Perspektive . . 78 Pete Ward Persönlicher Glaube. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Nick Shepherd Gibt es ›Anfängerglück‹ im Christentum? – Weshalb ›Fresh expressions von Kirche‹ für die junge Generation hilfreich zu sein scheint . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Monique van Dijk-Groeneboer Jugend und religiöse Gemeinschaften: Zwei getrennte Welten? Inspiration für Jugendliche und von Jugendlichen und die Herausforderungen für die Kirche und religiöse Gemeinschaften in den Niederlanden . . . . . . . . . . . . 120
6 Janieta Bartz / Bert Roebben »Nur wenn man einen Jugendgottesdienst macht mit Lichtershow, begeistert das niemand für Jesus« – Warum Kirche und Gemeinde aus ekklesiologischen Gründen jugendtheologische Forschung brauchen. . . . . . . 134 Joachim Willems Muslimische Jugendliche und ihre Erfahrungen mit ›Kirche‹ – Empirische Ergebnisse und Ansatzpunkte für jugendtheologische Gespräche. . . 145 III. Religionspädagogische Anregungen
Sabrina Müller Bedingungen eines gelingenden theologischen Diskurses mit jungen Freiwilligen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Patrik C. Höring Jugendkirchen – Antwort auf die Entfremdung von Gemeinde und Jugend? Eine Stichprobe und jugendtheologische Folgerungen. . . . . . . . . . . . . 171 Lilli Hochuli-Wegmüller Gottesdienste als Herausforderung der Konfirmationsarbeit – Partizipation als jugendtheologischer Lösungsansatz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 Markus Mürle Kirche und Gemeinde bei Jugendlichen an Berufsschulen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Marcus Götz-Guerlin Theologisieren mit »bildungsfernen Jugendlichen« – eine Praxisreflektion. . . . . . 205 Britta Hemshorn de Sánchez Theologisieren mit Jugendlichen im Horizont gegenwärtiger Inklusionsaufgaben. . . . 216 Tobias Petzoldt Rüstzeiten und Junge Gemeinde – Theologisieren mit Jugendlichen 14plus in kirchengemeindlicher Jugendarbeit in Sachsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 Susanne Bürig-Heinze Schöpfung oder Evolution – Komplementäres Denken im Religionsunterricht. . . . 228 Die Autorinnen und Autoren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
7 Vorwort
In der jugendtheologischen Forschung ist die Thematik »Kirche« bisher eher nur am Rande behandelt worden. Dies mag, wie es sich auch schon für den Bereich der längst etablierten Kindertheologie rückblickend feststellen lässt, ursächlich damit zusammenhängen, dass sich die Aufmerksamkeit in den Anfangsjahren beider Forschungsrichtungen stark auf religionspädagogische Grundfragen sowie Kommunikationsvollzüge und Unterrichtspraktiken im Bereich vorschulischen und schulischen Lernens konzentriert hat. Gerade hier wurde der stärkste Handlungsbedarf hinsichtlich einer neu zu gestaltenden Wahrnehmungs- und Kommunikationspraxis ausgemacht, so dass Fragen des kirchlichen Bildungskontextes sowohl in der kinderwie in der jugendtheologischen Reflexion anfänglich erst einmal zurücktraten. Ein weiterer, damit zusammenhängender Grund für die bisher vergleichsweise zurückhaltende Beschäftigung der Jugendtheologie mit dem Thema Kirche sowie der Verankerung in der kirchlichen Praxis mag auch darin liegen, dass in diesem Bereich im Vergleich zu schulischen Lernprozessen noch lange Zeit eine vermeintlich klare Selbstverständlichkeit des gelingenden Dialogs zwischen Erwachsenen und Jugendlichen angenommen wurde. Die Plausibilisierung religiöser Rede und theologischer Reflexion schien auf dem Feld kirchlicher Bildung
lange Zeit weniger dringlich zu sein als im schulischen Kontext. Tatsächlich zeigt sich aber bei näherer Betrachtung, sei es im Rahmen empirischer Studien oder anhand der Erfahrungen kirchlicher Akteure, dass in diesem Praxisfeld aufgrund mancher Verständnisschwierigkeiten und auch Distanzierungen der Bildungsklientel ebenfalls schon längst mit sehr ähnlichen und erheblichen Herausforderungen zu rechnen ist, die die alten Selbstverständlichkeiten und damit auch die etablierten Formen kirchlicher Bildung intensiver denn je auf den Prüfstand stellen. Schließlich ist nicht zu unterschätzen, dass gerade im Bereich kirchlicher Bildung eine mögliche Vereinnahmung Jugendlicher durch die Jugendtheologie für bestimmte Interessen der Institution Kirche als Problemanzeige mitschwingt. Gelegentlich wird gar der Vorwurf der »Verzweckung« und »Verkirchlichung« von Bildung zu Ungunsten der Jugendlichen geäußert, was – trotz aller Problematik solcher Vorwürfe – ebenfalls die bisherige Zurückhaltung jugendtheologischer Forschung zu dieser Thematik mit erklären mag. Angesichts einer Vielzahl aktueller Herausforderungen, die sich allesamt um die Grundfrage des spannungsreichen Verhältnisses von Kirche und Jugend drehen, kann sich die religionspädagogische Forschung, Praxisreflexion und Pra-
8
Vorwort
xis dem Thema »Kirche« – verstanden einerseits als Bildungsgegenstand, andererseits als Kontext religiöser Kommunikation, Sozialisation und Partizipation – nun aber schlechterdings nicht mehr entziehen. Zugleich ist angesichts der generellen Entwicklungstendenzen und Herausforderungen für die Kirche klar, dass eine solche jugendtheologische Perspektive auch zukünftig nur ökumenisch und auch sinnvollerweise im internationalen Zusammenhang zu denken ist. Und schließlich ist darüber noch hinausgehend zu fragen, wie sich das Themenfeld Kirche angesichts zunehmender interreligiöser Vielfalt in Bildungsprozessen mit Jugendlichen sehr unterschiedlicher religiöser und kultureller Herkunft zukünftig überhaupt sinnvoll und religionspädagogisch sachgemäß bearbeiten lässt. Vor dem Hintergrund der genannten Problemanzeigen fand deshalb im April 2014 die vierte Tagung des Netzwerks Jugendtheologie unter der Überschrift »Jugendtheologie und Kirche/Gemeinde« an der Universität Zürich statt: Nach den bisherigen Tagungen und Jahrbüchern für Jugendtheologie zu den Grundlagen (2011), zur Schöpfung (2012) und zur Anthropologie (2013) wird im vorliegenden Band präsentiert und diskutiert, wie die Generation der Jugendlichen Kirche und Gemeinde als prägende Räume religiöser Erfahrung wahrnimmt, was sie daran interessiert und fasziniert, was sie irritiert und abschreckt und was sie sich von kirchlichen und gemeindlichen Akteuren und deren Botschaft kommunikativ erwarten. Die in diesem Band versammelten Beiträge spiegeln dabei einerseits unterschiedliche soziologische und religionssoziologische, theologische und re-
ligionspädagogische sowie unmittelbar praxisbezogene Annäherungen an diese Fragen wider. Zugleich greifen zusätzliche Beiträge über die damaligen Tagungsdiskussionen hinaus, indem weitere Aspekte der Thematik ergänzend und weiterführend aufgenommen werden. Im I. Abschnitt der theoretischen Grundlagen setzt Thomas Schlag mit grundsätzlichen Überlegungen zur Kirche und kirchlichen Praxis in jugendtheologischer Perspektive ein, indem er die wesentlichen Herausforderungen für eine sachgemäße Verhältnisbestimmung von Kirche und Jugend benennt und von dort aus in religionspädagogischer Hinsicht einerseits auf den Aspekt von Kirche als Bildungsraum Jugendlicher zu sprechen kommt, andererseits Kirche als eigenes jugendtheologisches Thema entfaltet. Der englische Theologe Jeff Astley liefert durch den von ihm geprägten Begriff der »Ordinary Theology« ein sowohl historisch grundiertes wie systematischtheologisch reflektiertes Verständnis von Theologie als gleichsam alltäglicher, nicht-akademischer Praxis religiöser Selbstreflexion, die auch für eine Jugendtheologie im kirchlichen Kontext ausgesprochen inspirierend ist. Unter der Überschrift »Jugendtheologie und Spiritualität« erweitert Anton A. Bucher die Dimension religiöser Sinnsuche Jugendlicher um eben jenen Begriff der Spiritualität und gelangt von dort her zu einer Ausweitung bisheriger klassischer Themen der Jugendtheologie wie »Gott«, »Theodizee« oder »Leben nach dem Tod« hin zur auch jugendtheologisch relevanten Erfahrungsdimension der »Verbundenheit mit allem«.
9 Im II. Abschnitt des Bandes werden aktuelle empirische Erträge zur Thematik präsentiert, um so für die zukünftige jugendtheologische Arbeit von möglichst gut gesicherten Grundlagen ausgehen zu können: Die Schweizer Soziologin Emanuela Chiapparini fragt danach, was heutige Jugendliche an Gemeinschaft schätzen, an Individualität brauchen und an Orientierung suchen, und plädiert von aktuellen quantitativen und qualitativen Untersuchungen aus für eine auch durch die Kirchen mögliche Förderung von Elternbildung und Peergroups als entscheidenden Orientierungsinstanzen jugendlicher Lebensgestaltung. Der Berner Religionsforscher Stefan Huber macht von den Längsschnittanalysen zur Religiosität junger Erwachsener im Bertelsmann-Religionsmonitor die Erkenntnis stark, dass – im Unterschied zu säkularisierungstheoretischen Annahmen – religiöse Erfahrungen bei jungen Erwachsenen deutlich zunehmen, und zwar gleichermaßen bei Konfessionslosen wie auch bei Angehörigen von Religionsgemeinschaften. Thomas Schlag und Muriel Koch nehmen einige zentrale Ergebnisse der Zweiten Europäischen Studie zur Konfirmationsarbeit zum Anlass, um nach dem Zusammenhang von Identitätsentwicklung, Glaubensfragen und diesem kirchlichen Bildungsangebot in dezidiert jugendtheologischer Perspektive zu fragen, und zeigen dabei auf, dass Kirche und kirchliche Akteure durchaus nach wie vor mit einem Orientierungsinteresse bei Jugendlichen rechnen können – vorausgesetzt, dass sie sich als relevant und glaubwürdig erweisen.
Der englische praktische Theologe Pete Ward betont auf der Basis religionsethnographischer Studien und von der Leitdifferenz zwischen einer dogmatisch schon formulierten und einer immer wieder neu wirksamen Theologie die Notwendigkeit theologischer Innovation und Imagination, da erst diese dem jugendlichen, postmodernen Bedürfnis nach persönlicher Glaubenspraxis zu entsprechen vermag. Ebenfalls mit Bezug auf die gegenwärtigen englischen Debatten sowie durch die Interpretation jugendlicher Selbstaussagen zeigt Nicholas Shepherd auf, inwiefern und in welchem Sinn die aktuelle Bewegung der sogenannten ›Fresh expressions of Church‹ mit ihren Prinzipien der Inkarnation und Inkulturation für die junge Generation und deren Glaubensfragen hilfreich zu sein verspricht. Mithilfe einer Typologie zu unterschiedlichen Verhältnisbestimmungen von Jugend und Religion, unter Bezugnahme auf aktuelle empirische Ergebnisse insbesondere aus den Niederlanden sowie mit Verweis auf bestehende katholische Initiativen zeigt Monique van Dijk-Groeneboer die Herausforderungen für die dortige Kirche und die religiösen Gemeinschaften in den Niederlanden sowie deren Gegenstrategien auf, was auch für andere Kontexte ausgesprochen inspirierend ist. Janieta Bartz und Bert Roebben stellen am Beispiel des 28. Weltjugendtages 2013 in Rio de Janeiro sowohl quantitativ wie qualitativ gewonnene Einsichten zu den zentralen Fragen junger Menschen im Blick auf Kirche und Gemeinde vor und entwickeln von dort aus neue Perspektiven einer jugendlichen Ekklesiologie im
10
Vorwort
Sinne einer sich dynamisch immer wieder erneuernden Wegtheologie. Um auch aktuelle Herausforderungen in einem weiteren Sinn über die evangelische und katholische Praxis hinaus zu erfassen, präsentiert Joachim Willems Ergebnisse einer qualitativen Studie zu muslimischen Jugendlichen und ihren Erfahrungen mit »Kirche« und entfaltet von dort aus im Fragemodus Ansatzpunkte für eine erhöhte interreligiöse Sensibilität und die dafür hilfreiche jugendtheologische Gesprächskultur. Im III. Abschnitt dieses Jahrbuches erfolgen schließlich aus der Perspektive der Praxis kirchlicher Jugendarbeit sowie des schulischen Unterrichts religionspädagogische Anregungen, die ihrerseits – und dies ebenfalls immer mit starkem Bezug auf empirisch gewonnene Einsichten – auch an die aktuellen jugendtheologischen Diskussionen anschließen: Die Zürcher Theologin und Pfarrerin Sabrina Müller stellt von einer Befragung junger Freiwilliger im Bereich kirchlicher Jugendarbeit her Reflexionen über die Bedingungen des gelingenden theologischen Diskurses mit jungen Menschen an und betont dafür die Notwendigkeit einer dialogischen Grundhaltung sowie der Bereitschaft zur Teamarbeit, die Jugendlichen überhaupt erst Eigenverantwortung, Partizipation und Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet. Patrik C. Höring wirft als Referent für jugendpastorale Grundlagenarbeit der katholischen Kirche die Frage auf, inwiefern Jugendkirchen eine Antwort auf die Entfremdung von Gemeinde und Jugend sein können, und kommt ebenfalls von empirisch gewonnenen Einsichten zur Überzeugung, dass es stärker denn
je der Rückbindung des Gemeindelebens an die Interessen und Bedürfnisse junger Menschen bedarf, damit diese tatsächlich Subjekte einer Glaubenskommunikation auf Augenhöhe werden können. Die Zürcher Theologin und Pfarrerin Lilli Hochuli-Wegmüller widmet sich vor dem Hintergrund aktueller Ergebnisse zur schweizerischen Konfirmationsarbeit der Frage, inwiefern Gottesdienste als Grundherausforderung dieses Bildungsangebots zu begreifen sind und plädiert für eine gesteigerte, jugendtheologisch sensible und gestaltungsoffene Partizipationskultur des gottesdienstlichen Geschehens. Der Religionspädagoge Markus Mürle fragt auf der Grundlage einer breit angelegten Befragung von Berufschuljugendlichen danach, welche Bilder von Kirche und Gemeinde diese traditionellerweise eher kirchendistante Gruppe zeichnet, und gelangt von den Ergebnissen her zu der ebenfalls jugendtheologisch relevanten Folgerung, dass sich Gemeinden angesichts mancher Schwellenängste und Unsicherheiten Jugendlicher nicht nur als Ort religiöser Beheimatung und theologischer Vergewisserung verstehen sollten, sondern deliberativer Beweglichkeit und Offenheit bedürfen. Marcus Götz-Guerlin beschreibt als Leiter in der Evangelischen Bildungsarbeit ein konkretes Seminarangebot des Theologisierens mit »bildungsfernen Jugendlichen« der Jugendbildungsstätte Haus Kreisau und wirft angesichts der gemachten Erfahrungen die zentrale Frage auf, welche Bedingungen es eigentlich braucht, damit ein solches Theologisieren überhaupt eine Chance auf Gelingen hat bzw. wie damit umzugehen ist, dass unter immer mehr Jugendlichen kaum
11 jugendtheologische Anknüpfungspunkte bestehen. In Bezugnahme auf die aktuelle Inklusionsdebatte entwickelt die Studienleiterin für Globales Lernen und Inklusion am PTI der Nordkirche Britta Hemshorn de Sánchez ihre religionspädagogischen Überlegungen und kommt dezidiert auf die Notwendigkeit der wertschätzenden Haltung der Lehrpersonen zu sprechen, ohne die jegliche inklusive Lernprozesse und auch Formen des Theologisierens schlechterdings nicht denkbar sind. Wie sich ein Theologisieren mit Jugendlichen im Rahmen kirchengemeindlicher Jugendarbeit und unter den spezifischen Bedingungen ostdeutscher Religionspraxis denken lässt, entfaltet der Moritzburger Dozent für Gemeindepädagogik Tobias Petzoldt, indem er vor problematischen Verengungen innerhalb bestimmter kirchlicher Gruppen warnt und demgegenüber dafür plädiert, in diesen Bildungsbereichen Tendenzen der Einseitigkeit entgegenzutreten und die Pluralität von Deutungsmöglichkeiten zu erhalten. Mit dem Beitrag der Religionspädagogin Susanne Bürig-Heinze zum Thema Schöpfung oder Evolution wird der thematische Bereich des Bandes in gewisser Weise verlassen, zugleich aber die Ver-
knüpfung mit der Schöpfungsthematik, wie sie im zweiten Jahrbuch für Jugendtheologie (2012) vorgenommen wurde, hergestellt. Indem hier für ein komplementäres Denken im Religionsunterricht eingetreten und die Notwendigkeit der individuellen jugendlichen Meinungsbildung auch hinsichtlich tradierter theologischer Themen betont wird, eröffnet dieser letzte Beitrag gemeinsam mit den in diesem Band versammelten Beiträgen vielfältige und anregende Perspektiven für eine jugendtheologische Arbeit und Sensibilität, die sich der eigenen Verwurzelung bewusst ist, und durch die zugleich Bildungsprozesse eröffnet werden, bei denen diese Wurzeln immer wieder auf ihre Gegenwart- und Lebensrelevanz sowie ihr Potenzial zur Horizonterweiterung geprüft werden. In diesem Sinn kann das hier immer wieder angesprochene spannungsreiche Verhältnis von Jugend, Glaube und Kirche seine produktive Bearbeitung erfahren – und dies nicht in erster Linie um der Zukunftsperspektive von Kirche willen, sondern vielmehr um der Zukunft der Jugendlichen und ihrer Potenziale des eigenen Nachdenkens, Glaubens und ihrer je individuellen Lebensführung willen. Thomas Schlag und Bert Roebben
Schlag Kirche und kirchliche Praxis in jugendtheologischer Perspektive
13
Thomas Schlag Kirche und kirchliche Praxis in jugendtheologischer Perspektive
1. Jugend und Kirche – Grundund Verhältnisbestimmungen
Wie weit sind Kirche und Jugend voneinander entfernt – wie eng können sie miteinander verbunden sein – sind sie gar wechselseitig aufeinander angewiesen? Diese im Rahmen kirchlicher Reformprojekte immer wieder gestellten Fragen gewinnen durch eine jugendtheologische Perspektive einen erweiterten und in gewissem Sinn sogar neuen Richtungssinn. Denn eine solche, auf die theologische Bildung und Kommunikation mit Jugendlichen ausgerichtete, kirchliche Praxis lässt sowohl die Herausforderungen wie die Chancen im Verhältnis von Kirche und Jugend klarer hervortreten. Über den Zusammenhang von Jugendtheologie und Kirche nachzudenken, stellt aber nun in verschiedener Hinsicht ein herausforderndes und komplexes Unterfangen dar. Insofern sind dafür eine Reihe grundsätzlicher Bestimmungen an den Anfang zu stellen: Grundlegend – und zugegebenermaßen sehr elementar formuliert – macht es das Selbstverständnis von Kirche aus, sich als Gemeinschaft aller Getauften zu verstehen und zugleich für alle Menschen unabhängig von deren Herkunft, Bildung oder Alter offen zu sein. Kirche lebt in ihrer biblischen Verwurzelung und theologischen Deutung von der göttlichen Verheißung gelingender Gemeinschaft,
die sich ihres Glaubens immer wieder durch eben jene, an alle Menschen ausgerichtete Praxis der Verkündigung und des Handelns vergewissert.1 In der klassischen Formulierung des Apostolischen Glaubensbekenntnisses von der »einen, heiligen, katholischen und apostolischen« Kirche kommt zum Ausdruck, dass es weder für eine bestimmte Gruppe noch irgendeine Generation Zutrittsschranken oder Zutrittsbedingungen zur Teilhabe an kirchlicher Verkündigungspraxis geben darf – ja mehr noch: Kirche ist im Sinn von Mt 28 dazu beauftragt, die Verkündigung des Evangeliums in einem möglichst weiten Horizont zu denken und sich demzufolge so breit wie nur möglich auf die je individuellen, konkreten Lebensvollzüge auszurichten. Nun trifft allerdings dieser kirchlicher Auftrag und Anspruch auf die Realität der Lebensvollzüge, Existenzfragen und Artikulationsformen der Jugendgeneration selbst. Begegnen sich im kirchlichen Kontext Jugendliche und Erwachsene, prallen nicht selten ausgesprochen unterschiedliche Lebenslagen und Interessen aufeinander. Dann trifft etwa eine bestimmte jugendliche Form 1 Vgl. Christiane Tietz, Systematisch-Theologische Perspektiven. In: Thomas Schlag / Ralph Kunz (Hg.), Handbuch für Kirchen- und Gemeindeentwicklung, Neukirchen-Vluyn 2014, 49–56.
14
Theoretische Grundlagen
der Selbstartikulation auf institutionelle Vertreter und deren ganz eigene Sprachspiele. Das Interesse Adoleszenter an spontaner, gegenwartsorientierter Expression kann mit einem absichtsvollen strategischen Handeln auf Seiten der Kirche kollidieren, das Jugendliche vor allem als – gleichsam zu rekrutierende – zukünftige Mitglieder in den Blick nimmt. Bestimmte Vorstellungen jugendlich-freiheitlicher, individueller Religiosität, die wesentlich vom Gedanken des Patchworks und Experimentellen geprägt sind, können mit längst etablierten institutionellen Ordnungsprinzipien und normativen Ansprüchen in Konflikt geraten. Kurz gefasst: Der theologische Deutungsanspruch von Kirche als creatura verbi – als der von Gottes Wort her existierenden Kirche – kann mit einer Lebenskultur in Widerstreit geraten, für die ganz andere Faktoren und Bestimmungsgrößen existentielle und orientierende Bedeutung haben. Dies ist ein keineswegs ganz neues oder gar überraschendes Phänomen: Historisch gesehen war das Verhältnis von Kirche und Jugend durch die Zeiten hindurch immer von erheblichen Spannungen und Asymmetrien gekennzeichnet. Jugendliche wurden über Jahrhunderte hinweg als katechetisch-normativ zu belehrende und moralisch zu erziehende Objekte angesehen, die es auf ihre Pflichten als Erwachsene in Kirche, Staat, Gesellschaft und Arbeitswelt vorzubereiten galt. Bis weit in das 20. Jahrhundert hinein sind die kirchlichen Bestrebungen glaubenskonformistischer Erziehung und autoritätshöriger Prägung unverkennbar. Insofern ist von einem langen und mühevollen Weg der Kirche mit der jeweiligen Jugend ihrer Zeit zu sprechen, der nicht
selten durch erhebliche Funktionalisierungen, Vorurteilshaltungen, Aversionen oder schlichtweg durch bloßes Unverständnis und schiere Ignoranz gekennzeichnet war. Erst seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde Jugendlichen von Seiten der Kirche aus mehr und mehr das Eigenrecht selbstständiger religiöser Lebens- und Willensäußerung zugestanden. Man kann sogar sagen, dass entscheidende Veränderungen des klassischen kirchlichen Selbstverständnisses aufgrund der geradezu verzweifelten Befürchtung, die Jugend endgültig zu verlieren, motiviert waren. Die Etablierung und der Ausbau kirchlicher Verbandsarbeit seit den 1960er Jahren ist nicht zuletzt auf genau diese kirchliche Grundsorge zurückzuführen. Insofern ist das aktuelle kirchliche Bemühen um die Jugendgeneration unbestreitbar auch aus der Ambivalenz von Interesse am Individuum bei gleichzeitiger Sorge um den Bestand der Institution geprägt. Dass es erst vor wenigen Jahren auf Seiten der katholischen Kirche zu einem eigenen Jugendkatechismus gekommen ist, stellt einen Beleg dieses programmatischen Aufmerksamkeitsaufbruchs auf die Generation der Jugendlichen dar.2 Gleichwohl spiegelt sich die lange tradierte und gepflegte kirchliche Grundhaltung der Fundamentalskepsis gegenüber der nachkommenden Generation offenbar bis zum heutigen Tag in den Haltungen vieler Jugendlicher gegenüber der Kirche, ihren Repräsentantinnen und Representanten sowie Ange2 Vgl. Youcat, Jugendkatechismus der Katholischen Kirche, mit einem Vorwort von Papst Benedikt XVI., München 2011.
Schlag Kirche und kirchliche Praxis in jugendtheologischer Perspektive
botsstrukturen wider. Von der Seite der allermeisten Jugendlichen her wird der Kirche kaum wesentliche Bedeutung für die eigene Lebensführung beigemessen. Jugendliche erwarten sich von der Kirche keine wesentlichen Antworten auf ihre lebensbedeutsamen Fragen und empfinden deren klassisches Veranstaltungsangebot in der Regel als wenig attraktiv und verheißungsvoll.3 Die jüngste V. Kirchenmitgliedschaftsstudie, aber auch die aktuellen Studien zur Konfirmationsarbeit, sowohl im deutschsprachigen wie im europäischen Zusammenhang bestätigen diese Tendenzen sehr klar.4 Die konkrete Identifikations- und Bindungsbereitschaft Jugendlicher mit der Institution Kirche und gar mit deren dogmatischem Regelwerk ist gering oder zeigt sich bestenfalls sehr zurückhaltend und wenn überhaupt, dann selektiv.5 So vollziehen diese gewissermaßen am Ort der eigenen Person längst die Unterscheidung zwischen individueller und institutioneller Religion6 bzw. legen das Schwergewicht ganz auf Formen privater religiöser Praxis jenseits ihrer kirchlichen Formationen und Verfasstheit. Ganz offensichtlich kann »die Jugend« die eigenen Lebensvollzüge und ethischen Orientierungen bis hin zur Frage des Transzendenzbezugs gut ohne Kirche für sich denken und entwerfen. Und offenkundig tun sich die Kirchen schwer, ihre eigenen Deutungsangebote so plausibel und attraktiv in die Lebenswelten der Jugendlichen einzuspielen, dass dort die erwünschte Aufmerksamkeit erregt werden kann – erstaunlicherweise abgesehen von denjenigen geradezu popkulturellen Jugend- und Freikirchen, denen offenbar ausgesprochen anziehende Mischungen von Inszenierung, Orientie-
15
rungsangebot, Gemeinschaftserlebnis und spiritueller Praxis gelingen.7 So muss bis in die Gegenwart hinein – und dies trotz aller guten kirchlichen Zukunftsabsichten im Blick auf die kommende Generation – der Anspruch auf die Integration und Partizipation Jugendlicher an den kirchlichen Handlungsund Gestaltungsformen als uneingelöst gelten. Die innerkirchlichen Sprach- und Kommunikationskulturen, Entscheidungsmechanismen und Symbolhaushalte liegen in aller Regel immer noch und vielleicht mehr denn je in weiter Ferne zu den jugendlichen Alltagserfahrungen. 3 Vgl. Wolfgang Ilg / Friedrich Schweitzer / Volker Elsenbast, Konfirmandenarbeit in Deutschland. Empirische Einblicke – Herausforderungen – Perspektiven. Mit Beiträgen aus den Landeskirchen, Gütersloh 2009; Thomas Schlag / Rudi Neuberth / Ralph Kunz (Hg.), Konfirmandenarbeit in der pluralistischen Gesellschaft. Orientierungen – Deutungen – Perspektiven, Zürich 2009. 4 Vgl. Heinrich Bedford-Strohm / Volker Jung (Hg.), Vernetzte Vielfalt. Kirche angesichts von Individualisierung und Säkularisierung. Die fünfte EKD-Erhebung über Kirchenmitgliedschaft, Gütersloh 2015; Friedrich Schweitzer u.a. (Hg.), Konfirmandenarbeit im Wandel – Neue Herausforderungen und Chancen Perspektiven aus der zweiten bundesweiten Studie, Gütersloh 2015; Friedrich Schweitzer u.a. (Eds.), Youth, Religion and Confirmation Work in Europe: The Second Study, Gütersloh 2015. 5 Vgl. Carsten Gennerich, Empirische Dogmatik des Jugendalters. Werte und Einstellungen Heranwachsender als Bezugsgrößen für religionsdidaktische Reflexionen, Stuttgart 2010. 6 Vgl. Thomas Luckmann, Die unsichtbare Religion, Frankfurt a.M. 1991; Roland J. Campiche, Die zwei Gesichter der Religion. Faszination und Entzauberung, Zürich 2004. 7 Vgl. Thomas Schlag, Emotionen im Gottesdienst – wie Jugendliche für Kirche begeistert werden. In: Hans Schmidt (Hg.), Angebot der Volkskirchen und Nachfrage des Kirchenvolks, Zürich / Berlin 2009, 119–133.
16
Theoretische Grundlagen
Jugendlichen selbst wird zwar in einzelnen Kirchengemeinden durchaus ein eigenes Biotop-Refugium zugestanden. Aber die Offenheit der Gemeinden, sich wirklich in ein produktives Verhältnis zu »ihren eigenen« Jugendlichen zu setzen und sich gar von diesen für die eigene Praxis inspirieren oder womöglich sogar korrigieren zu lassen, ist nach wie vor ausgesprochen gering. Mit den gegenwärtigen, auch in der Kirche zu konstatierenden demographischen Verschiebungen und der damit verbundenen zunehmenden Aufmerksamkeit auf die »ältere Generation« drohen aber Jugendliche sowohl im Blick auf finanzielle Ressourcen als auch auf kirchliche Angebots- und Entscheidungsstrukturen zukünftig noch stärker aus dem Blick zu geraten. Diese Prognose erhält aktuell noch schärfere Konturen dadurch, dass verschiedene religionssoziologisch ausgemalte Szenarien das Schreckensbild einer »kleiner, ärmer und älter«8 werdenden evangelischen Kirche an die Wand malen. So erstaunt es kaum, dass angesichts solcher Kollisionen und kognitiven Dissonanzen wechselseitige Entfremdungs- und Distanzierungserfahrungen zwischen Jugend und Kirche die unübersehbare Folge sind. Damit ist natürlich die Frage aufgeworfen, ob denn hier tatsächlich auf eine auch zukünftig noch erkennbare Identifikations- und Zugehörigkeitspraxis der kommenden Generation in und mit der Kirche gehofft werden kann. Gesagt sei aber hier ausdrücklich: Es wäre in jugendtheologischer Hinsicht kurzschlüssig, würde man angesichts der aufgezeigten Tendenzen in einseitiger Weise von einer Kirchenverdrossenheit Jugendlicher ausgehen,
und nicht auch Phänomene einer Jugendverdrossenheit von Seiten der Kirche in den Blick nehmen. Ein massenhafter innerer oder äußerer Exodus Jugendlicher stellt tatsächlich für die Kirche und deren immer noch vorhandene Teilhabe- und Engagementstrukturen eine existentielle Gefährdung par excellence dar. Aber ein solcher Schwund hätte über die Frage der »Zukunft der Kirche« hinaus noch ganz andere Folgewirkungen – nämlich hinsichtlich der Möglichkeit, die »Zukunft der Jugendlichen« selbst zu begleiten: Denn die Kirche steht Jugendlichen gegenüber nicht nur hinsichtlich ihres eigenen institutionellen Fortbestandes in der Pflicht, sondern auch aufgrund grundlegender gesellschaftlicher Phänomene, die die Jugendgeneration massiv betreffen: Genannt seien exemplarisch das tiefe Bewusstsein Jugendlicher über die Gefährdungen der eigenen Zukunft in ökonomischer und ökologischer Hinsicht oder der als hoch empfundene spürbare Leistungs-, Konformitäts- und Zeitdruck in Schule und Arbeitswelt. Hinzu kommt die weitgreifende Digitalisierung des Alltags Jugendlicher im Blick auf die Informationsbeschaffung, aber auch die Informations- und Reizüberflutung bis hin zu Phänomenen einer Informationsglobalisierung, in der mit einer Vielzahl neuer kultur- und religionsprägender Bezugsgrößen umzugehen ist. Die Kirche steht vor diesem Hintergrund in der Verantwortung, die Phänomene des Jugendalters möglichst genau und sensibel wahrzunehmen und 8 Vgl. Jörg Stolz / Edmée Ballif, Die Zukunft der Reformierten. Gesellschaftliche Megatrends – Kirchliche Reaktionen, Zürich 2010.
Schlag Kirche und kirchliche Praxis in jugendtheologischer Perspektive
zugleich nach Möglichkeiten zu suchen, dies gemeinsam mit den betroffenen Jugendlichen in produktive Zukunftsstrategien umzusetzen. Von dort aus hat sich in jüngster Zeit die Rede und Forderung nach einer jugendsensiblen Kirche entwickelt, die nun tatsächlich, wie gleich zu zeigen sein wird, eine Reihe von jugendtheologischen Implikationen mit sich bringt. In diesem Zusammenhang seien deshalb nun hoffnungsvolle Aspekte benannt: 2. Berührungspunkte von Jugend und Kirche
Nach wie vor weist die kirchliche Realität ein keineswegs gering einzuschätzendes Potential für eine konstruktive und zukunftsträchtige Beziehung zwischen Jugendlichen und der Kirche auf: In der Bundesrepublik Deutschland und in der Schweiz gehören immer noch etwa zwei Drittel der Bevölkerung einer der beiden großen Volkskirchen an. Auch wenn in der breiteren, v.a. medial imprägnierten Öffentlichkeit gerne der Eindruck eines massenhaften Mitgliederverlusts erweckt wird, ist nach wie vor von einer nicht zu unterschätzenden breiten volkskirchlichen Basis auszugehen. Man kann dies sowohl an der immer noch hohen Zahl von Konfirmandinnen und Konfirmanden, an den vielfältigen Aktivitäten im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit und nicht zuletzt an einer erstaunlich hohen Zahl ehrenamtlich und freiwillig Tätiger im Bereich kirchlicher Arbeit ablesen9 – ganz zu schweigen von den nach wie vor vorhandenen intensiven kirchlichen Bildungsangeboten im Bereich der Kindertagesstätten sowie den öffentli-
17
chen staatlichen und privaten Schulen, die auch zukünftig wichtige Einflussfaktoren für die religiöse Sozialisation darstellen werden. Allerdings muss zugleich darauf hingewiesen werden, dass insbesondere in urbanen Kontexten die Zahl von Taufen in den vergangenen Jahrzehnten dramatisch gesunken und damit die konfessionelle Zugehörigkeit von Kindern und Jugendlichen je nach örtlichen Gegebenheiten schon jetzt auf ein kaum noch relevantes Minimum abgesunken ist. Die Potentiale für eine stärkere Partizipation und Integration Jugendlicher sind aber auch auf deren Seite selbst unverkennbar – vorausgesetzt ihnen leuchtet ein, dass sich der Kontakt mit Kirche lohnen könnte. Dies zeigt sich immer dort, wo bestimmte Angebote tatsächlich auch von Jugendlichen genutzt werden. Und diese können von attraktiven Formen in einzelnen Gemeinden und Gruppen bis hin zur Teilnahme an nationalen und gleichsam globalen Events wie den Kirchentagen oder den Weltjugendtagen reichen. Offenkundig sind Jugendliche sehr wohl begeisterungsfähig für kirchliche Kontaktaufnahme, sei es in Form gruppenförmiger Angebote, des Austausches über religiöse Fragen oder selbst ritueller Praxis und multimedialer Inszenierung. Die eigenständige und damit natürlich auch kritikfähige und kritikbereite Auseinandersetzung Jugendlicher mit der Kirche als Institution und auch ihren Repräsentantinnen und Repräsen9 Vgl. Katrin Fauser / Arthur Fischer / Richard Münchmeier (Hg.), Jugendliche als Akteure im Verband. Ergebnisse einer empirischen Untersuchung der Evangelischen Jugend. Jugend im Verband Bd. 1, Opladen 2006.
18
Theoretische Grundlagen
tanten ist insofern selbst eine wichtige kirchliche Gestaltungsressource, ebenso wie die oben angedeuteten Nöte und Zukunftsängste Jugendlicher ein wichtiges Bedürfnis- und Hoffnungspotential für die kirchliche Arbeit darstellen. Ein bisher von Seiten der Kirchen eher unbeachteter Bereich kommt hinzu: Erstmals seit vielen Jahren konstatiert die Shell-Studie eine steigende politische Aufmerksamkeit Jugendlicher und deren Bereitschaft zum politischen Engagement.10 Bekanntermaßen stellt es für viele nach der Schulzeit auch eine attraktive Option dar, Erfahrungen etwa im Rahmen eines Freiwilligen Jahres zu machen. Hier werden die Kirchen zukünftig immer stärker gefragt sein, mit eigenen profilierten Angeboten auf diesen Markt zu gehen und somit mit Jugendlichen in Verbindung zu kommen bzw. sie für die jeweiligen Motive eines politischen Engagements zu sensibilisieren und mit ihnen darüber in den Austausch zu kommen. 3. Grundlegende Herausforderungen
Vor dem Hintergrund der vorgenommenen Grund- und Verhältnisbestimmungen sowie der benannten hoffnungsvollen Potentiale ist zu fragen, wie sich die Erwartungshaltung der traditionellen Volkskirchen mit ihrer spezifischen Wort-Kultur und ihren institutions-, regel- und ritusgeleiteten Gemeinschaftsansprüchen mit spontanen und hochgradig flexiblen Erlebnis-Kulturen Jugendlicher in ein produktives Verhältnis zueinander bringen lässt. Die grundlegende Herausforderung besteht folglich darin, das institutionell-normative Ori-
entierungsangebot der Kirche mit dem Individualitäts- und Freiheitsbedürfnis Jugendlicher zusammenzudenken. Grundsätzlich gilt, dass sich »die Jugend« aufgrund ihrer sozialisations- und kulturbedingten Pluralitätsoffenheit, aber eben auch aufgrund ihrer inneren Orientierungsdynamik mitsamt den permanenten Neujustierungen einer eindeutigen Bestimmung entzieht, die für kirchliches Handeln eine ein für alle Mal eindeutige Ausgangs- und Arbeitsgrundlage darbieten könnte. Eine einlinige oder uniforme Annäherungs- oder Kommunikationsstrategie wird insofern angesichts der faktischen Pluralitäten und Fluiditäten des Jugendalters bis hin zu einer kaum noch überschaubaren Heterogenität jugendkultureller Ausdrucksformen und Präferenzen schlichtweg ins Leere laufen. Insofern besteht eine Kernaufgabe kirchlichen Handelns darin, diese Dynamik und Prozesshaftigkeit jugendlichen Selbst- und Welterlebens bzw. jugendlicher Selbst- und Welterschließung selbst erst einmal möglichst vorurteilsfrei und in aller Offenheit wahrzunehmen. In diesem Sinn wird seit einigen Jahren die Forderung nach einer jugendsensiblen Kirche aufgeworfen.11 Zu vermeiden ist
10 Vgl. Mathias Albert / Klaus Hurrelmann / Gudrun Quenzel, 17. Shell Jugendstudie. Jugend 2015, Frankfurt a.M. 2015. 11 Vgl. Kirchenamt der EKD (Hg.), Kirche und Bildung. Herausforderungen, Grundsätze und Perspektiven evangelischer Bildungsverantwortung und kirchlichen Bildungshandelns. Eine Orientierungshilfe des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Gütersloh 2009; Kirchenamt der EKD (Hg.), Kirche und Jugend. Lebenslagen – Begegnungsfelder – Perspektiven. Eine Handrei-
Schlag Kirche und kirchliche Praxis in jugendtheologischer Perspektive
in jedem Fall jegliche kirchliche Funktionalisierungsabsicht im Sinne einer institutionellen Verzweckung unter der Maßgabe, vor allem die eigene Organisation in die Zukunft führen zu wollen. Umgekehrt ist aber auch kirchliche Profillosigkeit kontraproduktiv, da eine solche Unklarheit der Repräsentantinnen und Repräsentanten bei Jugendlichen bestenfalls Irritationen auslöst und zu Recht die Frage nach deren Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit auslöst. Das spannungsvolle Verhältnis zwischen Kirche und Jugend ist folglich nur mit einer erheblichen Wahrnehmungssensibilität sinnvoll und sachgemäß aufzunehmen. Insofern kann auch die gewünschte Bindung und Nähe und gar die Identifizierung Jugendlicher mit Kirche nicht hergestellt, sondern allenfalls ermöglicht und eröffnet werden. Der Ausgangspunkt kirchlicher Arbeit liegt folglich im erkennbaren Vertrauen auf die Potentiale Jugendlicher selbst. Insofern bedarf es hier einer Ressourcen- und gerade nicht einer Defizitorientierung. Und von hier aus kann nun gerade eine jugendtheologische Perspektive mitsamt der entsprechenden Wahrnehmungs- und Kommunikationsarbeit an diese Potentiale anknüpfen und die notwendige ressourcenorientierte Grundhaltung erheblich befördern. 4. Kirche und Jugendtheologie
In den bisherigen jugendtheologischen Studien ist die Perspektive auf die Kirche eher am Rand thematisiert wirden, was nicht zuletzt darauf zurückzuführen sein dürfte, dass die bildungs- und kommunikationstheoretischen Überlegungen
19
stark von den didaktischen Herausforderungen am Ort der Schule und des Religionsunterrichts geprägt wurden. Zudem herrschte hier bisher gleichsam eine Art programmatische Zurückhaltung, um eben den Gefahren und verschiedentlich geäußerten Vermutungen einer schleichenden Klerikalisierung der Jugendtheologie keinen Vorschub zu leisten. Wenn nun im Folgenden von »Kirche und Jugendtheologie« die Rede ist, so sind diese kritischen Stimmen selbstverständlich mit im Blick. Gleichwohl soll mit dieser Verhältnisbestimmung nicht nur der kirchliche Bildungsraum im engeren Sinn angesprochen werden, sondern auch die Schule und der Religionsunterricht. Denn dort kommt natürlich zum einen ebenfalls kirchliche Mitverantwortung zum Tragen und zum anderen ist »Kirche« selbst Unterrichtsthema. Insofern wäre es eine sachlich nicht angemessene Verkürzung, wenn man die jugendtheologische Perspektive lediglich auf den Bereich gleichsam innerkirchlicher Bildungsarbeit beziehen würde. Natürlich ist hinsichtlich der konkreten jugendtheologischen Wahrnehmungs-, Deutungs- und Kommunikationspraxis in Kirche und Schule von unterschiedlichen Voraussetzungen und Zielsetzungen auszugehen, aber gleichwohl kann diese jugendtheologische als eine prinzipiell theologische Perspektive für die beiden Bereiche Kirche und Schule fruchtbar gemacht werden.
chung des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Gütersloh 2010; vgl. auch Thomas Schlag, Jugend und Kirche, in: Yvonne Kaiser u.a. (Hg.), Handbuch Jugend. Evangelische Perspektiven, Opladen 2013, 290–295.
20
Theoretische Grundlagen
4.1 Kirche als Bildungsraum für jugendtheologische Praxis
Wie schon zu Beginn angedeutet, steht kirchliche Praxis vor der theologischen Daueraufgabe, die eigene Bedeutung und ihr Handeln von der Orientierungskraft des Evangeliums her einsichtig zu machen. Als Institution der Freiheit macht Kirche ihren Anspruch dadurch deutlich, dass sie einer auf Theologie bezogenen Gedanken- und Reflexionsfreiheit Raum zur kommunikativen Entfaltung und zum Experimentieren gibt. In den Überlegungen zu einer Jugendtheologie reflektiert sich diese Grundaufgabe theologischer Deutung und Kommunikation. Diese Kommunikationspraxis beinhaltet selbst verschiedene Dimensionen, die klassischerweise durch die Unterscheidung zwischen einer Theologie von Jugendlichen, mit Jugendlichen und für Jugendliche markiert werden.12 Ausgangspunkt jugendtheologischer Praxis ist dabei die unbedingte Anerkennung der Jugendlichen als Subjekte gemeinsamer Gestaltungsprozesse und die Bereitschaft der Lehrenden zur Kommunikation – wie man heutzutage sagt – »auf Augenhöhe«. Durch diese in sich ausdifferenzierte Perspektive ist eine spezifische, auf die Zielgruppe jugendlicher Subjekte hin ausgerichtete Möglichkeit theologischer Kommunikation im kirchlichen Kontext angesprochen: Im Blick auf die Generation der Jugendlichen sowie deren Potentiale und Bedürfnisse zeigt sich Kirche als institutioneller Bildungsraum, indem ihre konkreten Angebote einen partizipativen jugendtheologischen Gestaltungsraum eröffnen. Dies bedeutet für den Bildungsraum Kirche und seine
Akteure, diese Differenzierung innerhalb der eigenen Angebotspraxis immer als konstitutive Gestaltungsgröße zu berücksichtigen. Allerdings darf, wie erwähnt, Jugendtheologie nicht dafür funktionalisiert werden, hier gleichsam um der Zukunft der Institution Kirche willen bestimmte Identifikations- und Bindungswirkungen in funktionalistischer Weise erzeugen zu wollen. Zugleich hat die Kirche aufgrund ihres Anspruchs, Kirche »für und mit allen« zu sein, die Aufgabe, in diesen theologischen Suchbewegungen Exklusionen zu vermeiden, sei es durch eine kirchliche Binnensprache, sei es durch die mehr oder weniger bewusste Ignoranz gegenüber Einzelpersonen und Personengruppen, die mit solchen Sprachbewegungen nicht vertraut sind. Für all dies bedarf es erfahrbarer, gelingender Formen des Kennenlernens von Kirche in ihren kommunikativen und rituellen Vollzügen – kurz gesagt: einer Begegnungs-, Begleitungs- und Beheimatungskultur, bei der die Jugendlichen tatsächlich mit ihren eigenen Welt- und Lebensdeutungen zur Sprache kommen können und in ihrem Eigensinn angesprochen werden. Die Möglichkeiten und Formen einer solchen jugendsensiblen, jugendtheologischen Wechselseitigkeit sind dabei denkbar vielfältig und umfassen sowohl Aspekte des informellen und non-formalen wie auch des formalen Lernens. Insofern findet jugendtheologische Kommunikation keineswegs nur in den 12 Vgl. Thomas Schlag / Friedrich Schweitzer, Brauchen Jugendliche Theologie? Jugendtheologie als Herausforderung und didaktische Perspektive, Neukirchen-Vluyn 2011.
Schlag Kirche und kirchliche Praxis in jugendtheologischer Perspektive
klassischen Formen der Konfirmationsarbeit oder des Jugendleiterkreises statt. Vielmehr ist hier gemeint, dass schon jede einzelne Begegnung, ja jedes Gespräch mit Jugendlichen die Möglichkeit theologischer Anschlussfähigkeit eröffnet – und dies, weil Jugendliche mit ihren Fragen und Expressionen zu religiösen und existentiellen Fragen eben jene Anschlussfähigkeit selbst immer schon herstellen können. Auch konkrete Partizipation an kirchlicher Praxis und ehrenamtliche Erfahrung vermögen Jugendlichen Möglichkeiten zu eröffnen, um die Sinndimension kirchlichen Selbstverständnisses zu entdecken und ihrerseits mitzugestalten. Hier ist, wie die neueren Studien zur Konfirmationsarbeit verdeutlichen, die Bedeutung von jugendlichen Peers eben nicht nur für ein bestimmtes Gemeinschaftserleben bedeutsam, sondern auch für den inhaltlichen Austausch – gleichsam als ein Theologisieren »auf Augenhöhe« mit Menschen des mehr oder weniger gleichen Lebensalters. Kirchliche Praxis muss darüber hinaus vielfältige Möglichkeiten von nicht sprachlich gebundenen jugendtheologischer Suchbewegungen eröffnen: D.h., die Herausforderung besteht darin, dass auch solche Erfahrungen mit Theologie ermöglicht werden, die jenseits profiliert verbaler Ausdrucksformen liegen. Die jugendtheologischen Austauschformen müssen insofern viel vielfältiger gedacht werden als dies bisher der Fall ist. Es ist hier beispielsweise nicht zu unterschätzen, dass im Sinn einer Theologie für Jugendliche schon allein die Teilnahme am gottesdienstlichen Wortgeschehen und den Ritualen eine bestimmte Form des Vertrautwerdens erzeugen kann –
21
vorausgesetzt, man ermöglicht es den Jugendlichen, wirklich in diese Praxis mit ihren eigenen Frage-, Antwort- und kreativen Gestaltungspotentialen im wahrsten Sinn des Wortes mit hineinzufinden. Anders gesagt: Das kirchliche Selbstverständnis als Gemeinschaft der Heiligen kann sowohl auf explizite wie auf implizite Weise zum Ausdruck und zum Austausch gebracht werden. Im Sinn einer Theologie für Jugendliche braucht es hier natürlich hochkompetente Gesprächspartner, die in der Lage sind, diese Potentiale überhaupt erst einmal wahrzunehmen, gemeinsam mit den Jugendlichen zu deuten und dadurch inhaltliche Orientierung anzubahnen. Hierbei ist die Dimension des Vertrauens, das überhaupt erst einmal gebildet werden muss, überhaupt nicht zu überschätzen. Kirchliche Bildung kann aber auch für die individuelle Lebensführung Jugendlicher orientierenden Charakter gewinnen, indem Jugendlichen ein vertieftes Verständnis der eigenen »Zeitlichkeit« nahe gebracht wird, für die eben nicht nur die jetzige Gegenwart, sondern auch die eigene Vergangenheit und Zukunft, Erinnerungen, Visionen und Zukunftsängste relevant sind. Gefragt ist jugendtheologisch und ekklesiologisch gesprochen eine kirchliche Wahrnehmungskultur, die ihrerseits von einer möglichst starken und klaren Präsenz von Kirche »bei Gelegenheit« lebt. Deshalb sind übrigens gerade in diesem Bereich Angebote der offenen Jugendarbeit ebenfalls kaum zu überschätzen. Zugleich – dies kann nicht stark genug betont werden – kann und sollte Kirche im Umkehrschluss auch von den kompetenten Selbstdeutungen Jugendlicher und deren Fähigkeiten, mit den Kom-
22
Theoretische Grundlagen
plexitäten der Gegenwart umzugehen, in erheblichem Sinn lernen. Mit anderen Worten ermöglicht eine jugendtheologische Perspektive die Chance und Herausforderung, dass sich die verantwortlichen kirchlichen Akteure selbst zum theologischen Nachdenken und über die Zeitlichkeit ihrer je eigenen Existenz herausgefordert fühlen. Als ein weiteres, noch konkreteres und plastisch anschauliches Beispiel der jugendtheologischen Ermutigung zu individueller Freiheit sei auf die erschließende Bedeutung des Kirchenraums verwiesen. Dieser kann im Sinn einer Theologie für Jugendliche im wortwörtlichen Sinne eines persönlichen Zugangs hochbedeutsam werden. So berichtet die 15-jährige Esther, die sonst weder mit dem Religions- noch ihrem Konfirmandenunterricht positive Erfahrungen gemacht hat, davon, dass sie auch immer wieder außerhalb des Gottesdienstes alleine in eine Kirche geht und so den Kirchenraum für sich erschließt: »War dann da alleine für mich, das hat mir gut getan in dem Moment. … Man kriegt halt im Kirchenraum sehr viel Wärme raus, finde ich. … Also wenn zum Beispiel wenn viele Kerzen da sind und wenn es warm wird, dann denke ich, ich bin geborgen.«13 Und auf die Frage, was sie denn jedes Mal mache, wenn sie in eine Kirche gehe, antwortet sie: »Für mich mit Gott reden, – – – Kerze anmachen, da sitzen und nachdenken«14. Der implizite Charakter theologischen Denkens wird hier in der schönen und eindrücklichen Formulierung der Jugendlichen »Für mich mit Gott reden … da sitzen und nachdenken« überaus deutlich. Offenbar braucht es im gelingenden Fall nicht viel, dass Jugendliche
sich gleichsam selbstredend den Kirchenraum zu ihrem eigenen Raum machen und diesen für sich im besten Sinn in Anspruch nehmen. 4.2 Kirche als jugendtheologisches Thema
»Kirche« ist natürlich auch Gegenstand und Thema konkreter Bildungsprozesse, seien diese nun im kirchlichen oder im schulischen Bereich angesiedelt. Dass im Rahmen kirchlicher Bildungsangebote auch »Kirche« zum Thema wird, ist so selbstverständlich wie notwendig. Aber auch Schule und Religionsunterricht sind legitime Orte, um über das Thema Kirche zu theologisieren bzw. in eine entsprechende Gesprächskultur einzutreten. Entsprechende thematische Einheiten finden sich in den aktuellen Lehrund Bildungsplänen für die diversen Schularten und Schulstufen. Schulische Bildung kann hier in allgemeinbildendem Sinn darauf abzielen, die Bedeutung von Kirche in ihrer Prägekraft für die Gesellschaft und das Individuum zu verdeutlichen – konkret gesprochen eröffnet beispielsweise das anstehende Reformationsjubiläum vielfältige Möglichkeiten, über die bloße historisierende Erinnerung hinaus auch die Frage nach den möglichen aktuellen Folgewirkungen mit den Blick zu nehmen. Auf katholischer Seite sind fraglos die jüngsten Entwicklungen des Papstamtes bestens 13 Barbara Husmann, Das Eigene finden. Eine qualitative Studie zur Religiosität Jugendlicher, Göttingen 2008, 77. 14 Ebd.; von dieser Formulierung her leitet sich auch das leicht umformulierte Titelzitat dieses 4. Jahrbuchs für Jugendtheologie ab.
Schlag Kirche und kirchliche Praxis in jugendtheologischer Perspektive
dazu geeignet, das spezifisch katholische Verständnis von Amt und Kirche und dessen gesellschaftspolitisch relevante Ausgestaltung durch Papst Franziskus zu thematisieren und zu diskutieren. In diesem Zusammenhang vermag die Form des konfessionell-kooperativen Religionsunterrichts auch die ökumenischen Aspekte gegenwärtigen Kirche- und Christseins in das notwendige Licht zu stellen. In jugendtheologischer Perspektive heisst dies für die unterrichtliche Thematisierung, dass »Kirche« neben ihren historischen und kulturellen Bedeutungsgehalten auch in ihrem theologischen Tiefensinn zur Sprache gebracht werden kann: Konkret bedeutet dies, Jugendliche sowohl für die gleichsam geistige und geistliche Grundlage von Kirche zu sensibilisieren, sie zugleich aber auch in den produktiven Diskurs über die gegenwärtigen (vorhandenen, fehlenden oder missbräuchlich verzweckten) Orientierungsansprüche von Kirche zu integrieren. Die didaktische Herausforderung liegt zudem darin, die theologischen »Begründungsgehalte« von Kirche eben nicht in einem exklusiv konfessionalistischen Sinn schlicht vermitteln zu wollen, sondern diese bewusst in die diskursive Erörterung einzubringen und diese damit auch der notwendigen subjektiven Kritik auszusetzen. Hier sind Erwachsene und Jugendliche gleichermaßen zur Teilhabe befähigt und auch aufgerufen. Dies bedeutet zugleich, dass sich Religionslehrpersonen selbst in ein Verhältnis zum Thema Kirche setzen und dieses im Gespräch mit den Jugendlichen ihrerseits transparent machen sollten. Insbesondere am Ort der Schule ist natürlich bei solchen diskursiven Thema-
23
tisierungen die weitergehende Grundfrage, wie man Jugendliche ohne kirchliche Prägung oder auch ohne ein Interesse an Kirche in eine solche Gesprächskultur hineinnimmt, wie man überhaupt mit der Heterogenität der jugendlichen Verstehens- und Sprachvoraussetzungen umgeht und wie das Faktum zunehmender Interreligiosität – das ja keineswegs nur im schulischen Bereich relevant ist! – gerade bei der Thematisierung von Kirche angemessene Berücksichtigung findet. Dies kann im vorliegenden Beitrag zwar nicht im Einzelnen entfaltet werden. Aber hingewiesen sei zumindest auf die unhintergehbare Notwendigkeit, hier für möglichst niedrige Zugangsschwellen zur thematischen und persönlichen Auseinandersetzung zu sorgen – übrigens eine didaktische Figur, die auch in ekklesiologischer Hinsicht ihren wahren Kern hat. 5. Fazit
In einer solchen jugendtheologisch-diskursiven Arbeit »von Kirche«, »mit Kirche« und »über Kirche« ergeben sich über die genannten Kommunikationsformen und Thematisierungen hinaus weitere ganz konkrete Anknüpfungsmöglichkeiten für kirchliches Handeln vor, während und nach der Jugendzeit: Jugendtheologie verweist auf die Notwendigkeit einer möglichst früh einsetzenden und dann kontinuierlichen Begegnungs- und Begleitungskultur: Angesichts der immer stärker ausfallenden religiösen Sozialisation in Elternhaus und Familie ist es notwendig, dass Kirche, will sie für Jugendliche attraktiv sein, in möglichst frühem Kindesalter in ihrem Angebotsprofil er-
24
Theoretische Grundlagen
kennbar wird. Insofern sind Angebote zu begrüßen, mit deren Hilfe Kinder solche jugendtheologischen Zugänge einüben und dann ein solches Reflexionsgeschehen in seiner biographiebezogenen und lebensbegleitenden Relevanz erkennbar wird. Die kirchliche Jugendarbeit – gerade auch in ihrer notwendigen Vernetzung mit der Kommunions- und Konfirmationsarbeit! – in den Gemeinden, regionalen Kirchenverbünden und überregionalen Kirchenstrukturen sollte auch in jugendtheologischer Hinsicht weiter gefördert und ausgebaut werden, selbst wenn die demographischen Gegebenheiten höhere kirchliche Investitionen in das »höhere Alter« nahe zu legen scheinen. Die Schaffung spezifischer Gottesdienstangebote für und vor allem mit Jugendlichen bis hin zur Etablierung von möglichst eigenständig verantwortlichen Jugendkirchen ist nicht zuletzt in jugendtheologischer Perspektive ebenso weiter zu profilieren wie die Etablierung von spezifischen Glaubenskursen für Jugendliche – vorausgesetzt, dass diese Angebote tatsächlich den Charakter konzeptioneller kommunikativer Offenheit tragen. Jedenfalls sollte man auch in diesem Bereich die theologische Kommunikation im Jugendalter nicht den missionarischen Initiativen oder evangelikalen Gruppierungen als Alleinstellungsmerkmal überlassen! Zugleich sind Möglichkeiten des Experimentierens und Einübens in gottesdienstliche und spirituelle Vollzüge zu eröffnen, in denen es zum Austausch über die plausibelsten theologischen Argumente und tragfähigsten Deutungsformen kommen kann. Im Blick auf die gegenwärtig weit reichenden und teilwei-
se sehr dynamischen Entwicklungen im Bereich der Kirchen- und Gemeindeentwicklung sind insofern Jugendliche mit ihren Interessen und Ideen auch im Sinn jugendtheologischer Diskurse deutlich stärker in diese Prozesse einzubeziehen als dies bisher der Fall ist. Eine kirchliche Mitverantwortung für das gelingende Aufwachsen Jugendlicher besteht, wie oben angedeutet, nicht nur im Blick auf die eigene konfessionelle Klientel, sondern hinsichtlich der Jugendgeneration überhaupt. Fragen der Teilhabe- und Bildungsgerechtigkeit, die ja ihrerseits von eminent theologischer Tragweite sind, machen nicht vor den kirchlichen Mauern Halt. Kirchliche Praxis steht vor der Herausforderung, sich auch als gesellschaftlich relevante, intermediäre Institution mit lebensdienlichem Potential – folglich als eine öffentliche Kirche15 im wahrsten Sinn des Wortes – zu zeigen. Sie wird von Jugendlichen nur dann als glaubwürdig und gerechtigkeitsorientiert und damit bedeutsam erlebt, wenn sie sich für deren individuellen Bedürfnisse und zugleich für die Gesellschaft als Ganze sichtbar einsetzt. Dies bringt für eine kirchliche jugendtheologische Bildungspraxis zugleich Herausforderungen für eine erhöhte Wahrnehmungsund Begegnungskultur auch mit denjenigen Milieus mit sich, die ansonsten eher am Rande von Kirche stehen. Insofern bestehen auch von dieser Seite her besondere Herausforderungen für eine jugendsensible Kirche und deren sach- und
15 Vgl. Thomas Schlag, Öffentliche Kirche. Grunddimensionen einer praktisch-theologischen Kirchentheorie, Zürich 2012.
Schlag Kirche und kirchliche Praxis in jugendtheologischer Perspektive
jugendgemäße theologische Kommunikations- und Deutungskultur. Die Überzeugungskraft kirchlicher Praxis und ihrer Akteure wird davon abhängen, ob Jugendliche sich darin selbst als unverzichtbarer Bestandteil der ›Gemeinschaft der Heiligen‹ entdecken und sich darin als ein »starkes Stück Protestantismus«16 erleben können. Dies schließt die personale Dimension notwendigerweise mit ein: Im Sinn einer nachhaltig bedeutsamen Vertrauens- und Beziehungsbildung kann die Institution Kirche nur durch ihre Repräsentantinnen und Repräsentanten plausible und glaubwürdige Gestalt gewinnen. Letztlich hängt ein konstruktives Verhältnis von »Kirche und Jugend« maßgeblich davon ab, ob es gelingt, Jugendlichen eigene Einsichten in denjenigen
25
Glaubensgrund von Kirche zu ermöglichen, der diese ausmacht und in der sich die Bedeutsamkeit der evangelischen Botschaft selbst manifestiert. Anders gesagt: Kirchliche Gemeinschaft muss subjektiv erlebbar sein und individuelle Verantwortungsmöglichkeiten sollten für Jugendliche in jedem einzelnen Fall sichtbar und im wahrsten Sinn des Wortes miteinander vollziehbar werden.
16 Vgl. Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Deutschland e.V. (aej) (Hg.), Ein starkes Stück Protestantismus – Zeitansagen zur Evangelischen Jugend und zur evangelischen Kinder- und Jugendarbeit (2011) http:// www.evangelische-jugend.de/fileadmin/user_ upload/aej/Die_aej/Downloads/Mitgliederver sammlung/MV_2010/B2_2010_Ein_starkes_ Stueck_Protestantismus.pdf.
26
Theoretische Grundlagen
Jeff Astley »Ordinary Theology« und Jugend1
1. Ausgangsbestimmungen
Ich verwende den Begriff »Ordinary theology«2 seit mehr als zehn Jahren. Ich definiere diesen als »die Theologie und das Theologisieren von Christen, die wenig oder keine theologische Bildung gelehrter, akademischer oder systematischer Art empfangen haben« (oder genereller: als Inhalt, Muster und Prozesse der Artikulation des religiösen Verstehens »ganz gewöhnlicher« Menschen). Dies ist die primäre Verortung des Begriffs: seine Heimat ist inmitten derer, die in keinerlei Hinsicht Theologie studiert haben. Ich bin durchaus auch der Ansicht, dass der Begriff »Theologie« nicht einfach auf jede Art des Gebrauchs des Gottesnamens (»Gott-Talk«) angewendet werden darf. In Ihrer Sprache wie in meiner, mag es sein, dass wir den Namen Gottes, Jesu oder Marias aussprechen, wenn wir uns den Zeh anstoßen oder den Zug verpassen. Aber dies ist nicht Theologie. Um es als Theologie zu bezeichnen, muss »Gott-Talk« ein Element und einen bestimmten Grad der Reflexion beinhalten. Und ich beharre darauf, dass »ganz gewöhnliche« Theologen und nicht nur akademische Theologen, über das nachdenken und reflektieren, was sie glauben, obwohl solche Reflexionen selten so präzise, kohärent, systematisch oder leidenschaftslos sind, wie es die akademischen Experten erwarten.3
Ich benutze das englische Adjektiv »ordinary« in seinem nicht-abwertenden Sinn: ich meine es nicht als eine Beleidigung. In meinem Gebrauch ist es ein Wort, das für das »Gewöhnliche«, »Übliche«, »Reguläre« und deshalb »Alltägliche« verwendet wird. »Ordinary« ist, was statistisch normal ist, ob es nun mit der vorgeschriebenen Norm mancher lehrmäßiger oder gelehrter Regeln, Standards oder einem moralischen Ideal zusammenpasst oder nicht. »Ordinary« ist das Wort, das Personen, die man in Großbritannien interviewte, als Beschreibung 1 Übersetzt aus dem Englischen von Thomas Schlag (T.S.). 2 Für die vorliegende Übersetzung wird in der Regel der von Jeff Astley verwendete Begriff »Ordinary theology« beibehalten; inhaltlich trägt bei Astley das »ordinary« vor allem den Sinn dessen, was wir als das »Gewöhnliche« im Sinn des »Alltäglichen« bzw. des »ganz Normalen«, geradezu »Selbstverständlichen« bezeichnen würden. In der deutschen Übersetzung wird die Bedeutung »gewöhnlich« verwendet. Dort, wo es um personenbezogene Zuschreibungen – etwa »ordinary« people – geht, wird für die Übersetzung deshalb von »gewöhnlichen« Menschen gesprochen; wo Astley von den »ordinary« theologians spricht, wird dies mit »gewöhnlichen« Theologen übersetzt. Kursiv, in Klammern oder mit Anführungszeichen werden einzelne Worte oder Sequenzen gesetzt, die auch im Originaltext kursiv, in Klammer oder mit Anführungszeichen gesetzt sind (T.S.). 3 Vgl. Jeff Astley, Ordinary Theology. Looking, Listening and Learning in Theology, Aldershot / Burlington 2002.
Astley »Ordinary Theology« und Jugend
über sich selbst und ihre Theologie verwenden: »Warum fragen Sie nach mir und meinen Glaubensüberzeugungen4 und Werten?« Sie sagen: »Ich bin kein Universitätsprofessor oder ein Bischof. Ich bin einfach ganz gewöhnlich.« Aber, um es im Paradox auszudrücken (und dabei die andere Konnotation von Gewöhnlichkeit, nämlich das Uninteressante, Nicht-Exzellente, Unbedeutende aufzunehmen): Diejenigen, die solche sich selbst geringschätzenden Behauptungen zum Ausdruck bringen, zeigen damit oft eine ziemlich außergewöhnliche, gewöhnliche Theologie. Denn »ordinary theology« kann erfrischend lebendig, glänzend, ursprünglich und spirituell überaus fundiert sein. Sie ist es natürlich nicht immer; aber sie ist es häufiger, als manche, vor allem der Klerus5, dies zu denken scheint. Natürlich habe ich meine eigene theologische Agenda und meine theologischen Überzeugungen, die mich dazu motivieren, für eine »ordinary theology« zu plädieren. Diese enthält den Anspruch, dass unsere alltägliche Welt und das gewöhnliche Leben – was diejenigen, die noch Latein sprechen, den Aspekt des »quotidian« nennen mögen – den primären Ort unserer spirituellen Gesundheit repräsentieren. Deshalb stimme ich mit Gelehrten wie Charles Taylor überein, dass unsere Würde und selbst unser Verstehen dessen, was »menschlich« meint, ultimativ hierin gegründet ist, eben im »Gewöhnlichen«. Aus der Perspektive christlicher Spiritualität ist dies nicht nur legitim, sondern essentiell.6 Gewöhnlichkeit, so wurde gesagt, ist »unser unaufgebbarer Anker: Ohne ihn sind wir nichts und nirgendwo. Die Wahrnehmung des religiösen Gewichts
27
der Gewöhnlichkeit kann Menschen von der Tyrannei unterschiedlicher Formen eines spirituellen Elitismus befreien.«7 Ich habe versucht, dieses Thema in zwei populären Büchern über die Theologie des Alltäglichen zu entwickeln.8 Die »ordinary theology« der Menschen ist zum Teil schon deshalb bedeutsam, weil sie für gewöhnliche Christen selbst wichtig ist: Die eigenen Glaubensüberzeugungen und Werte sind für Menschen tatsächlich sehr häufig sehr bedeutsam. Sie sind immer bedeutsamer als die Glaubensüberzeugungen und Werte anderer Personen, eingeschlossen akademischer Theologen. Dies überrascht kaum und sollte auch nicht infrage gestellt werden. Schon strittiger ist allerdings die Behauptung, dass Menschen diese Glaubensüberzeugungen und Werte vor allem deshalb für sich in Anspruch nehmen, weil sie für sie »funktionieren«. Ich meine damit vielmehr, dass sie für die Ressourcen von Sinn und spiritueller Stärke sorgen, damit Menschen in 4 So wird im folgenden Text der Begriff »beliefs« übersetzt, während »faith« mit Glaube übersetzt wird (T.S.). 5 Das an dieser Stelle und im weiteren Text vielfach verwendete »clergy« wird hier durchgängig mit Klerus übersetzt, wobei es bei Astley sowohl auf den geistlichen Stand der Kleriker wie auch auf ein bestimmtes klerikales Selbstverständnis innerhalb der Kirche und ihres Personals selbst verweist (T.S). 6 Vgl. Charles Taylor, Clericalism, in: The Downside Review 78/252 (1960), 167–180; ders., Sources of the Self. The Making of the Modern Identity, Cambridge 1989. 7 Don Cupitt, Life, Life, Santa Rosa 2003, 50. 8 Vgl. Jeff Astley / David Day, Beyond the Here and Now, Oxford / Sutherland 1996; Jeff Astley / David Day, Die leichte Unverständlichkeit des Seins. Vom großen Konzept hinter den kleinen Dingen, übersetzt von Wolfgang Schrödter, Wuppertal / Kassel 1998.
28
Theoretische Grundlagen
der Lage sind, sich mit den schwierigen Herausforderungen ihres Lebens auseinanderzusetzen. Es ist sehr oft gerade deren »ordinary theology«, die Menschen befähigt und sogar aufblühen lässt, Tag für Tag, während sie ihr Leben vor sich sehen und es leben – und eventuell ihren Tod. Obwohl sie oft unvollständig, unsystematisch und sogar wirr ist, ist die »ordinary theology« für die meisten Menschen praktisch fokussiert und spirituell geerdet; es ist eine Theologie, um damit zu leben. In meinen Schriften rede ich von »ordinary theology« im »gewöhnlichen« Sinn (als allgemein, weitverbreitet, nicht unüblich) vor allem im Kontrast zur unüblichen, außerhalb des Gewöhnlichen befindlichen, spezialisierteren Theologie, die an den Universitäten entwickelt und gelehrt wird. Insofern habe ich »ordinary theology« weitgehend im Sinn ihrer relativen Einfalt gegenüber einer solchen akademisch theologischen Bildung definiert. Aber in der Tat lege ich mehr Gewicht auf die Darstellung dieses Phänomens. Ich muss von Beginn an betonen, dass ich ein Bild male, das sich nur im Grad, aber nicht in der Art von gelehrten, akademischen – und sehr oft kirchlichen – Typen von Theologie unterscheidet (dieser Satz funktioniert übrigens im Englischen aufgrund der Doppeldeutigkeit des Wortes »degree« [als Grad oder akademischer Rang] auch als ein Wortspiel). Bert Roebben hat dieselbe Unterscheidung durch die englische Phrase «not substantial, but gradual« zum Ausdruck gebracht. Dies trifft es ganz genau – wenn auch das Wortspiel nicht mehr funktioniert! Ich behaupte, dass »ordinary theology« einer akademischen Theologie der an der
Universität geschulten Theologen vorangeht und oft in ihnen selbst weitergeht. Wie der Kern eines Baumes beeinflusst diese »von innen« heraus, »vom Herz her« ihre spätere Theologie: »Ordinary theology« umfasst für diese akademischen Theologen ein Bündel von tief verankerten und schwer zu verändernden theologischen Grundüberzeugungen und damit verbundenen religiösen Werten, die sie früh gelernt haben, sehr oft auf den Knien der ersten Person, die für sie gesorgt hat (in der Regel die Mutter) – oder auch aufgrund des eher gewalttätigen Kontakts mit ihrer disziplinierenden Hand (»Ordinary theology« kann wie akademische Theologie in ihrem Ursprung und in ihrem Inhalt gut oder schlecht sein). Im Innersten der meisten akademischen Theologen liegt deshalb sehr oft eine »ordinary theology« verborgen und wird manchmal ganz absichtsvoll versteckt. Ich habe immer wieder bemerkt, dass akademische Theologie speziell dann spirituell und auf mitmenschliche Weise lebendig wird, wenn diese innere »ordinary theology« sich in einer Sekunde, mit ganz anderer Stimme, durch die wohl überlegte Sprache und Argumente des Gelehrten hindurch, Geltung verschafft. »Ordinary theology« und akademische Theologie können wie Idealtypen im Sinn von Konstrukten behandelt werden – als Konstrukte, die bestimmte, für die meisten Fälle eines Phänomens die üblichen Elemente betonen –, ohne dass dabei behauptet sein soll, dass diese mit allen Charakteristika eines bestimmten Falles übereinstimmen. In diesem Sinne besetzen diese beiden Typen die beiden Enden eines durchlaufenden Spektrums. Sie besitzen unterschiedliche Vorteile und unterschiedlich starke Punkte.
Astley »Ordinary Theology« und Jugend
Im Blick auf die Form oder den Stil ist »ordinary theology« eher aphoristisch und anekdotisch, autobiografisch und unsystematisch; reich an Geschichten und Metaphern, die Emotionen auslösen. Ihr Sprachmodell wurde bisher noch in keinem intensiveren Maß qualifiziert, profiliert oder geklärt – also rein gewaschen oder aufpoliert. Es liegen hier also keine gereinigten oder sauberen Konzepte vor, von denen aus wir mit Klarheit Rückschlüsse ziehen oder gar Systeme kreieren könnten, wie es in der präziseren akademischen Form von Theologie der Fall ist.9 Theologie hat außerdem mit einer Haltung zu tun. In Hinsicht auf diese Haltung befindet sich »ordinary theology« nahe bei dem, was der katholische Theologe von Balthasar »Theologie beim Gebet« benannte; wie auch immer: sie ist dem Gebet jedenfalls näher als die mehr abwägende und leidenschaftslose »Theologie am Schreibtisch«.10 Vielleicht können wir uns diese Haltung als halb über dem Knien vorstellen; jedenfalls ist es nicht die sitzende Theologie des Theologen in seinem Arbeitszimmer, der aufgeschlagene Bücher befragt, in denen er oder sie die akademische Theologie anderer liest, mit einem Stift in der Hand, um die eigene Theologie zu formulieren und zu kommunizieren. Mit Sicherheit ist »ordinary theology« keine Theologie, die eine umfassende, unbegrenzte Glaubenskritik auf Armlänge hält. Vielmehr besitzt »ordinary theology« ihre eigene Art des Fragens und insofern ihre eigene selbstkritische Dimension. Die Stimme der »ordinary theology« liegt näher am Erdgebundenen, Heimatgebundenen der Muttersprache der Gespräche innerhalb von Beziehungen, um eine Metapher Ur-
29
sula Le Guins11 zu übernehmen – und damit ist diese weiter entfernt von dem, was sie die Vatersprache einer einseitigen Kommunikation und offenkundig desinteressierten Analyse und Evaluation nennt. »Ordinary theology« und akademische Theologie unterscheiden sich außerdem hinsichtlich ihres Arbeitsplatzes: »Ordinary theology« wird oftmals zu Hause und auf der Straße, am Arbeitsplatz, in der Bar und auf dem Spielplatz sowie innerhalb kirchlicher Gemeinschaften und Gebäude gelernt und re9 Qualifizierung und Klärung sind sicherlich von Vorteil, wenn man über Gott nachdenkt. Unausweichlich sind wir weniger sicher, was gemeint ist, wenn wir Gott einen »Fels« oder »Vater« nennen, als wenn wir ausgearbeitete theologische Konzepte wie das der allgemeinen Vorsehung oder die Rede von der »Sub stanz« verwenden. Aber die Gefahr des zuletzt genannten Stils von Theologie ist, dass wir dabei die dahinterliegenden figurativen und anbetungsbezogenen Ursprünge dieser Konzepte vergessen und diese in einem hölzernen, verdünnten und wortwörtlichen Sinn nutzen, um so das majestätische Geheimnis göttlicher Liebe zu beschreiben, vgl. Jeff Astley, Exploring God-talk. Using Language in Religion, London 2004, Kap. 2–5; ders., Jeff Astley, SCM Studyguide to Christian Doctrine, London 2010, 58–60, 122f; Wahrheit innerhalb der Religion ist in ihrer Essenz persönlicher und heilsamer als dies, vgl. ders., Christ of the Everyday, London 2007; ders., A Theological Reflection on the Nature of Religious Truth, in: Ders. et al. (Eds.), Teaching Religion, Teaching Truth. Theoretical and Empirical Perspectives, Bern 2012, 241–262. 10 Vgl. Hans Urs von Balthasar, Verbum Caro. Skizzen zur Theologie I, Einsiedeln 1960. 11 Ursula K. Le Guin, Dancing at the Edge of the World. Thoughts on Words, Women, Places, New York 1989; Anthony Lees-Smith, Ordinary Theology as ›Mother Tongue‹, in: Jeff Astley / Leslie J. Francis (Eds.), Exploring Ordinary Theology. Everyday Christian Believing and the Church, Farnham / Burlington 2013, 23–31.
30
Theoretische Grundlagen
flektiert. Gleichwohl wird sie vor allem unter Nordeuropäern eher selten ausdrücklich artikuliert. Und dies oft nur dann, wenn Gespräche in solchen alltäglichen Settings eine tiefere persönlichere und ernsthaftere Wendung nehmen. »Ordinary theology« ist nichtsdestotrotz sehr üblich, sowohl innerhalb wie auch außerhalb der Kirche, und dies in dem Sinn, dass sie sehr weit verbreitet ist. Ihr Territorium ist nicht auf diejenigen mit einer akademisch theologischen Bildung begrenzt. Für Edward Farley drückt der Begriff Theologie – in seinem Wesen und seinem Ursprung – aus, dass der christliche Glaube im Leben des Christen reflexiv geworden ist. Theologie war seit ihrer frühesten Geschichte nicht einfach der Besitz des Gelehrten oder das Handwerk des Lehrers, sondern vielmehr die Weisheit, die dem Leben des Gläubigen angemessen war – dem Leben aller Gläubigen. Theologie gehörte allen Christen, war ein Teil der Orientierung ihrer Seelen und ihrer Fähigkeit, von Gott zu wissen. Vor der Institutionalisierung und Professionalisierung der Theologie als einer Lehrdisziplin oder Untersuchungsmethode in späteren Jahrhunderten war es – und ist es immer noch für die größere Mehrheit in der Kirche – eine fundamentale Dimension der Frömmigkeit eines jeden Christen und seiner Berufung: als reflexive Weisheit des Gläubigen und als Teil der christlichen Existenz als solcher. So erfasst, repräsentiert Theologie viel mehr und grundlegend eine existenzielle und praktische als eine abstrakte oder theoretische Kenntnis und Wissen von Gott.12 Trotz der Tatsache, dass »ordinary theology« überall gefunden werden kann,
legt es sich nahe, sich nun auf »ordinary theology« innerhalb der Kirche zu konzentrieren, insofern dieser Begriff den reflexiven Gott-Talk gewöhnlicher Kirchgänger und anderer gläubiger Christen markiert. Von diesem Verständnis aus kann man zu der Übereinstimmung gelangen, dass diese Form von Theologie eine »Aufgabe ist, die auf jedem Christen liegt«.13 Gleichzeitig ist es richtig, dass, mindestens bis zu einem gewissen Ausmaß, »alle Christen schon Theologen sind«, und dass »der einzige Platz, an dem authentische Theologie beginnen kann, die realen Glaubensüberzeugungen realer Christen«14 sind. Auch für Stanley Grenz und Richard Olson ist »Theologie für alle denkenden und reflektierenden Christen unausweichlich und der Unterschied zwischen Laientheologen und professionellen Theologen ein gradueller und kein grundsätzlicher.«15 12 Edward Farley, Theologia. The fragmentation and unity of theological education, Philadelphia 1983, 31–37, 47, 156; ders., The Fragility of Knowledge. Theological Education in the Church and the University, Philadelphia 1988, 81, 88. 13 Jürgen Moltmann, The Source of Life. The Holy Spirit and the Theology of Life, übersetzt von Margaret Kohl, London 1997, ix. 14 John B. Cobb, Jr., Becoming a Thinking Christian, Nashville 1993, 17, 41. 15 Stanley J. Grenz / Roger E. Olson, Who Needs Theology? An Invitation to the Study of God, Downers Grove / Leicester 1996: sie identifizieren dabei ein ganzes Spektrum ansteigender theologischer Reflexionsebenen, von der einer unreflektierten »Volkstheologie«, über mittlere Kategorien einer »Laientheologie«, »Geistlichentheologie« und »professionellen Theologie« bis hin zu einer »hochspekulativen, künstlich philosophischen« Form akademischer Theologie, die »oft mit der Kirche unverbunden ist und wenig mit dem konkreten christlichen Leben zu tun hat« – diese ist dann (wie die »Volkstheologie«) von »nur geringem
Astley »Ordinary Theology« und Jugend
Ich habe schon zu Beginn darauf hingewiesen, dass der Begriff »ordinary theology« im Prinzip sogar noch weiter gefasst werden kann: Vor fast 20 Jahren habe ich in ziemlich allgemeinen Begriffen über das geschrieben, was ich »Schultheologie« von Kindern und Teenagern nannte. Dabei behauptete ich, dass diese Phrase in angemessenem Sinn selbst auf die theologischen Reflexionen derer angewendet werden könnte, die agnostisch oder atheistisch sind.16 Thomas Schlag würde, denke ich, den Vorschlag wohl begrüßen, den ich in diesem Papier gemacht hatte, nämlich eine größere Konzentration religiöser Bildung in Fragen der Glaubensüberzeugungen und speziell im Blick auf das Konzept von Gott sowie im Blick auf ein studentisches Theologisieren selbst im säkularen Klassenzimmer. Damit könnte aktiviert werden, was er »persönliche Annäherungen an systematische Themen« nennt, und dies in einem Kontext des »offenen Dialogs« und einer offenen sowie zugleich persönlich sensiblen Suche nach theologischer Wahrheit.17 Der britische Gelehrte Andrew Wright hat ähnliche Ideen in detaillierterem Sinne als ich entwickelt, obwohl seine Interpretation religiöser Wahrheit für meinen Geschmack ein wenig zu kognitiv ist.18 Ich habe in meinem Papier von 1996 dargelegt, dass, falls Theologie in einem nicht-restriktiven Sinne hinsichtlich unserer Reflexion über das Ultimative verstanden wird, dann von jedermann gesagt werden kann, dass er oder sie eine bestimmte Art von Theologie sowie jedermann eine bestimmte Art von Glaube hat. Jeder glaubt an etwas oder jemanden; und alles, was es braucht, um menschlichen Glauben in Theologie zu wenden,
31
ist ein bestimmter Grad von Reflexion, etwas, das selbst Kinder und Jugendliche tun können. Diejenigen, die darauf insistieren, dass »ordinary theology« eine bestimmte Form der Referenz an Gott beinhalten muss, würde ich antworten, das Ungläubige ebenfalls eigene Überzeugungen über Gott für sich besitzen. Grenz und Olson argumentieren, dass Theologie jede Reflexion über die letzten Fragen des Lebens, die auf Gott hin abzielen, ist. Sie erweitern ihre Definition sogar noch, indem sie jeden integrieren, der über die großen ›Warum-Fragen‹ des Lebens reflektiert.19 2. Jugendtheologie?
Soweit ich es verstehe und es sich mir erschließt, lässt sich das Konzept der Jugendtheologie leicht mit meinem Verständnis der »ordinary theology« verbinden, wobei diese einen Unterbereich
Wert« und kann »für die Herausforderung des Untersuchens, Verstehens und Artikulierens des christlichen Glaubens sogar gefährlich sein«. Diese Unterscheidungen sind allerdings eher spezifisch für den besonderen Kontext des US-amerikanischen Erziehungssystems und der US-Kirchen und stellen vermutlich die eigene theologische Perspektive der Autoren dar. 16 Vgl. Jeff Astley, Theology for the Untheological? Theology, Philosophy and the Classroom, in: Jeff Astley / Leslie J. Francis (Eds.), Christian Theology and Religious Education. Connections and Contradictions, London 1996, 60–77. 17 Vgl. Thomas Schlag, Systematic topics, in: Martin Rothgangel / Thomas Schlag / Friedrich Schweitzer (Eds.), Basics of Religious Education, Göttingen 2014, 371–383. 18 Vgl. Jeff Astley, A Theological Reflection on the Nature of Religious Truth (wie Anm. 9). 19 Vgl. Grenz / Olson (wie Anm. 15).
32
Theoretische Grundlagen
markiert. Ich beobachte insbesondere die folgenden Parallelen und gleichgearteten geäußerten Bedenken: 1. Wie Thomas Schlag, Friedrich Schweitzer und andere möchte ich die Frage der – um Bert Roebbens Worte aufzunehmen – »theologischen Dignität« und des »theologischen Wertes« der Ideen und Praktiken junger Menschen (ebenso wie der der Erwachsenen) aufwerfen. Und dies, um ganz grundsätzlich dafür zu argumentieren, dass wir sehr viel positiver als wir es oft tun, über diese ungeschulten Formen von Theologie nachdenken sollten. Ein großes Thema in meinem Buch Ordinary Theology war, dass selbst akademische Theologie etwas lernen könnte, wenn sie diese Art gewöhnlicher, gelebter Theologie erforscht: Weil genau dies uns eine Menge darüber sagen kann, wie es um eine Theologie bestellt ist, die für Menschen in spiritueller religiöser und humaner Weise »funktioniert«. 2. Thomas Schlag hat über die »inzwischen beinahe klassische Unterscheidung zwischen der Theologie von Kindern und Jugendlichen, der Theologie mit Kindern und Jugendlichen und der Theologie für Kinder und Jugendliche«20 geschrieben. Meine Kategorie der »ordinary theology« bezieht sich auf die weniger artikulierte, persönliche Theologie derer, die keine akademische theologische Bildung erfahren haben. Es handelt sich deshalb um eine »Theologie von« bzw. um die Theologie einer bestimmten Gruppe: im Sinne der Theologie, die sie selbst haben, für die sie eintreten und die sie zum Ausdruck bringen. Im Englischen wird der Ausdruck »theology
of« unglücklicherweise meist für eine akademische Theologie verwendet, die sich mit einer bestimmten Gruppe befasst. Aus diesem Grund stellt der Begriff »Theologie von Jugendlichen« – und selbst »Jugendtheologie« – eine eher uneindeutige Übersetzung dar, die als Themen oder Buchtitel im Bereich der Praktischen oder auch der Systematischen Theologie erscheinen könnten, insofern Autoren hier ihre akademischen theologischen Reflexionen über junge Menschen entwickeln. Der Ausdruck »die ordinary theology junger Menschen« (oder von Kindern) hat diese Uneindeutigkeit nicht (einen ähnlichen semantischen Punkt werde ich später im Blick auf die Laientheologie machen). 3. Meine eigenen Veröffentlichungen beinhalten nun tatsächlich einige (akademische) theologische Überlegungen über »ordinary theology«: Eine Art Theologie der »ordinary theology«. Und ich habe immer darauf insistiert, dass eine umfängliche Beschäftigung mit der »ordinary theology« nicht nur eine empirische, deskriptive Theologie individueller Glaubensüberzeugungen, sondern auch eine Analyse und Evaluation der Glaubensüberzeugungen gemäss der Kriterien akademischer und kirchlicher Theologie umfassen muss21 – obwohl diese beiden Aufgaben voneinander getrennt bleiben müssen. In 20 Vgl. Schlag, Systematic topics (wie Anm. 17), 375. 21 Vgl. Astley, Ordinary Theology (wie Anm. 3), 103–105; ders., The Analysis, Investigation and Application of Ordinary Theology, in: Ders., / Leslie J. Francis (Eds.), Exploring Ordinary Theology. Everyday Christian Believing and the Church, Farnham / Burlington 2013, 1–9.
Astley »Ordinary Theology« und Jugend
jüngerer Zeit habe ich detaillierter auszuarbeiten versucht, wie Christen, die unausweichlich ihre Entwicklung als ganz und gar »gewöhnliche Theologen« beginnen, akademische Theologie lernen können. Akademische Theologen werden nicht überrascht sein zu hören, dass das Muster wesentlich eines des impliziten Dialogs oder der Konversation zwischen diesen beiden theologischen Stimmen ist.22 Beide Stimmen haben etwas zu sagen, und beide haben das Recht, gehört zu werden. Die »ordinary theology« einer Person verändert sich in diesem Prozess natürlich. Aber auf persönlicher Ebene verändert sich auch die akademische oder kirchliche Theologie, die jemand lernt. Lernende sind niemals leere Tafeln, die nur darauf warten würden, dass man von außen Worte auf sie schreibt. In echten Konversationen sprechen beide Partner miteinander und jeder trägt etwas für den anderen bei. 4. Dies wirft das wichtige Thema der Normativität der »ordinary theology« bzw. Jugendtheologie auf. Um nochmals Bert Roebben zu zitieren: »Jungen Menschen sollte eine Stimme gegeben werden – eine theologische Stimme«. Dies ist ein Sonderfall seiner Forderung, dass »Theologie eine demokratische Entdeckungsreise sein sollte. Es darf kein Privileg religiöser Erzieher, Pfarrer, Theologen (das meint, akademische Theologen!) oder von Bischöfen sein.« Ganz richtig. Meine eigene Randbemerkung dazu ist, dass dieses »es darf kein« sowohl einen gültigen Sachverhalt wie auch eine Aufforderung darstellt. Die Frage der Normativität ist entscheidend. Ich
33
werde sie später wieder aufnehmen und dies, indem ich auf die provokative Frage »Wem gehört die kirchliche Theologie?« antworte. Aber zuerst zu einem damit verwandten Thema: 3. Laientheologie?
Um zum christlichen Kontext im engeren Sinne zurückzukehren, will ich versuchen, meine eigentümliche englische Begriffsverwendung von »ordinary theology« mit einem anderen Begriff zu verbinden, der sich unter den Forschern des kontinentalen Europa vielfach auffinden lässt: Laientheologie. 1. Im Englischen kann der Ausdruck »Laientheologie« in sehr unterschiedlicher Weise interpretiert werden – so wie wir es zuvor schon beim Begriff der »Jugendtheologie« festgestellt haben. Insbesondere kann dieser Begriff thematisch gebraucht werden – im Sinne von Ausdrücken wie »sakramentale Theologie«, »liturgische Theologie« oder »pädagogische Theologie«, um so eine akademische Theologie von, über oder bezogen auf ein bestimmtes Objekt, Phänomen oder eine Praxis zu kennzeichnen. In diesem Falle würde es also um eine Theologie gehen, die sich mit Laien befasst – unglücklicherweise ein negativ konnotierter Begriff und deshalb einer 22 Vgl. Astley, SCM Studyguide (wie Anm. 9), 9–13; ders., Ordinary Theology and the Learning Conversation with Academic Theology, in: Ders. / Leslie J. Francis (Eds.), Exploring Ordinary Theology. Everyday Christian Believing and the Church, Farnham / Burlington 2013, 45–54; ders., Studying God. Doing Theology, London 2014, Kap. 1–4.
34
Theoretische Grundlagen
der Gründe, weshalb ich diese Ausdrucksweise nicht mag – als derjenige Teil des ganzen Gottesvolkes, die etwas nicht sind, nämlich nicht geweihte Priester bzw. ordinierte Pfarrer.23 In diesem ersten Sinne bezeichnet der Begriff »Laientheologie« einen Teil der Ekklesiologie als Beschäftigung mit dem Wesen von Kirche.24 Eine Reihe von Dingen, die ich über »ordinary theology« geschrieben habe, fallen unter diese Rubrik, insofern sie theologische Überlegungen über den Status und die Rolle der Glaubensüberzeugungen gewöhnlicher Kirchenmitglieder beinhalten – d.h. des überwiegenden Teils der Kirche. Aber das Hauptargument, dass ich herangezogen habe, um den Klerus dazu zu ermutigen, die »ordinary theology« ihrer Gemeinde ebenso wie die der im weiteren geographischen Feld der Gemeinde, der Mission oder der Gemeindearbeit Tätigen ernst zu nehmen, basiert nicht in erster Linie auf einer »Theologie über Laien«. Was ich damit vielmehr meinte, ist, dass die Wahrnehmung der Glaubensüberzeugungen und Werte ihrer Gemeinden wesentlich für ihre Arbeit als Geistliche ist. Um ihr Amt sachgemäß auszuüben, und dies meint das Priesteramt ebenso wie die christliche Erziehung, das Predigen, die Apologetik und Evangelisierung, und ebenso die Seelsorge, bedarf es des sehr viel besseren Hörens und des sehr viel besseren Wissens über die Glaubensüberzeugungen und Werte der Menschen, für die jene dieses Amt der Kommunikation und Sorge ausüben25 – seien es nun Kinder, Jugendliche oder Erwachsene. Ganz
offenkundig ist dies nun eine pragmatische Rechtfertigung für die Beschäftigung mit »ordinary theology«. Ich vertraue darauf, dass diese Begründung eine ist, die der ganze Klerus als bedeutsam ansieht, obwohl ich darüber verzweifle, dass in England das Curriculum für die Pfarramtsausbildung wenig Aufmerksamkeit dafür aufbringt, was die meisten Kirchgänger tatsächlich glauben. Ich vermute, dies liegt daran, dass viele Geistliche oder deren Mentoren keine angemessen hohe Einschätzung des Status und der Bedeutung der Laien in der Kirche haben und damit auch davon, was diese denken – was zugleich auf eine ziemlich geringe Theologie schließen lässt. Dies ist insbesondere für die sinkende Zahl junger Menschen in den Gemeinden relevant. 2. Aber so, wie ich nun bisher argumentiert habe, ist es klar, dass wir von »Laientheologie« noch in einem zweiten Sinne zu sprechen haben: und zwar schlicht als angemessener Begriff, um die Theologie von Laien als eine solche zu markieren, die sich von der »klerikalen Theologie« oder »Amtstheologie« unterscheidet – um 23 Vgl. Hendrik Kraemer, A Theology of the Laity, London 1958; Mark Gibbs / T. Ralph Morton, God’s Frozen People. A Book For – and About – Ordinary Christians, London 1964; Mark Gibbs / T. Ralph Morton, God’s Lively People. Christians in Tomorrow’s World, London 1971; Hans Küng, The Church, übersetzt von Ray Ockenden / Rosaleen Ockenden, London 1971, 363–387. 24 Die Gegenstände der Eklesiologie sind in den verschiedenen christlichen Lehren unterschieden, gemeint ist aber durchgehend die kirchliche normative Lehre über sich selbst. 25 Vgl. Astley, Ordinary Theology (wie Anm. 3), 145–148.
Astley »Ordinary Theology« und Jugend
einmal diese Begriffe in der deskriptiven Art und Weise zu verwenden, in der sich die theologischen und ethischen Ansichten der Geistlichen manifestieren. Natürlich können diese beiden »Gruppentheologien« (in diesem zweiten Sinn von »Laientheologie« und »Kleriker-Theologie«) eine Theologie des Laientums (im oben genannten ersten Sinn) als Teil von deren theologischen Reflexionen einschließen. Diese normativen Theologien in Hinsicht auf den theologischen Status der Laien innerhalb der ganzen Kirche mögen über die beiden Gruppen hinweg identisch sein, sowie eben auch zwischen Klerikern und Laien. Aber sie sind es oft nicht; denn in der Theologie wie auch sonst trifft Bernhard Shaws wahres Wort zu oft zu: »Alle Professionen sind Verschwörungen gegen die Laien.« (Zugegebenermaßen: er schrieb über Mediziner). Wie auch immer, meine »ordinary theology« ist zweifellos sehr oft eine Laientheologie in diesem zweiten Sinn, gemeint als Theologie der (allermeisten) Laien – oder besser gesagt, der Theologien – von denen es natürlich viele gibt. Wir können davon ausgehen, dass »ordinary theology« genauso vielfältig ist wie akademische Theologie. Und wie es eben üblicherweise verstanden wird: Jugendtheologie und Kindertheologie sind beide Laientheologien in diesem zweiten Sinn der (zu oft bestrittenen) Unterkategorien von Laientheologie. 3. Aber Laientheologie ist eine Bezeichnung, die nun auch für eine dritte Interpretation offen ist: als eine Theologie, die in weitem Sinn in den Laien verortet ist – wie im zweiten
35
Sinn – aber in diesem Fall nur, weil sie nicht Expertentheologie ist. Dies ist die Theologie, über die diejenigen verfügen, die im Sinn der akademischen Ausbildung in Theologie nicht »professionell qualifiziert« sind. Hier mögen insofern diejenigen miteingeschlossen sein, die nicht Kirchenmitglieder sind. Dieses dritte Verständnis von »Laie« ist im Englischen sehr gebräuchlich, und deckt viel von dem ab, was ich vermitteln wollte, indem ich ursprünglich das Adjektiv »ordinary« übernahm. In diesem Sinn ist »ordinary theology« per definitionem »laien-haft«26. In diesem Fall ist das Kontrastobjekt nicht die theologische Reflexion der Kleriker, sondern die akademische Theologie der Akademiker – und in gewissem Ausmaß die konzeptuelle und systematische Theologie kirchlicher Lehre und Lehrer. »Ordinary theology« ist insofern unterschieden von der »außergewöhnlichen« Theologie der Gelehrten. Das Concise Oxford English Dictionary bietet zwei Bedeutungen für das Wort »lay« als Adjektiv an: 1. »nicht ordiniert oder dem geistlichen Amt angehörend«, 2. »über keine professionellen Qualifikationen oder Expertenwissen verfügend«. Im Englischen wird »professional« nicht allein im Blick auf die Professionen (»the professions«) verwendet, sondern genereller im Blick auf »bezahlte Beschäftigung« und jede »fachkundige oder kompetente« Aktivität oder Haltung. Beide Bedeutungen werden üblicherweise vom amateurhaften Sein oder Verhalten unterschieden. Unglücklicherweise führte der Begriff »Amateur« irgendwann ein26 Ebd., 64.
36
Theoretische Grundlagen
mal dazu, Menschen, Zugänge und Aktivitäten als »unbeholfen oder ungeschickt« zu charakterisieren. Einige englischsprachige Philosophen vergangener Zeiten sind sogar so weit gegangen, dieses viel mehr als ein »Buhwort« denn als ein »Hurra-Wort« zu beschreiben. Es drückt Missbilligung aus. Natürlich liegt mir nicht daran, den Begriff »ordinary theology« mit dieser Konnotation zu belegen. Ich sollte an diesem Punkt wiederholen, dass ich davon überzeugt bin, dass ein überwiegender Teil der Theologie, die ich von Klerikern in Predigten und pastoralen Konversationen höre, sehr gut in meine Darstellung von »ordinary theology« passt, denn diese ist ebenfalls spiritualitätsorientiert und affektiv, anekdotisch, reich an erfindungsreichen Geschichten und Metaphern, persönlich bis hin zum Autobiografischen usw. Es ist nicht – oder jedenfalls nicht offensichtlich – das hochgradig rationale, systematisierte und abstrakte Theologisieren der akademischen Welt, trotz der Tatsache, dass die Kleriker in solcher akademischer Theologie ausgebildet sind. Und dies ist es, wie es sein sollte, denke ich. Der amerikanische Philosoph Paul Holmer betont die Bedeutung des Erlernens religiöser Theorien als ein Teil des Glaubenslebens, aber er legt dar, dass das, was gelernt werden muss, nicht die abstrakten und spezialisierten Theorien akademischer Theologie einschließt. Die meisten Christen benötigen diese nicht, insistiert er, genauso wie es nicht nötig ist, dass der Automechaniker die Theorie der Atomgewichte kennt oder gebraucht. Zu essen, Autos zu fahren und alltägliche Dinge zu gebrauchen, setzt keine Kenntnis der Theorien über Vitamine, Atomgewichte oder andere durch Spe-
zialisten beschriebene Theoriebausteine voraus. Genauso sind Vorstellungen theistischer Metaphysik keine Bestandteile der meisten Vorstellungen von Gott, die für uns durch die Schrift, Gebete und Liturgie – vielleicht auch durch die meisten Predigten – ausgearbeitet werden.27 Es sind die reichen, praktikablen und lebbaren Konzepte des religiösen Glaubens, die wir für unsere religiöse Anbetung und andere Praktiken benötigen – inklusive der Kommunikation von Religion. Im Gegensatz dazu bedeuten die technischen Konzepte einer akademischen oder dogmatischen Theologie weniger und haben im Glaubensleben »wenig Arbeit zu tun«. Religiöse Experten (Heilige, spirituelle Lehrer und Berater, Priester, Pastoren, Prediger, Heiler, Bekenner, Evangelisten) müssen nicht notwendigerweise theologische Experten in irgendeinem akademischen Sinne sein. Wie ich an anderer Stelle argumentiert habe, gibt es bedeutsame Vorteile für Geistliche, wenn sie akademische Theologie lernen28, aber dies meint nicht, dass sie diese Form von Theologie in ihrer Kommunikation mit »gewöhnlichen« Theologinnen und Theologen oft direkt gebrauchen sollten. Dies ist ein Fehler, den manche englischen Geistlichen immer noch machen. Ich kann mir vorstellen, dass die längere und intensivere Bildung in akademischer Theologie, die Pfarrer in Kontinentaleuropa erfahren, dies auch hier noch üblicher werden lassen wird. Deshalb sollten Priester und Pfarrer, obwohl sie technisch gesehen keine »ge27 Vgl. Paul L. Holmer, The Grammar of Faith, San Francisco 1978, 174. 28 Vgl. Astley, Ordinary Theology (wie Anm. 3), 47 n.2.
Astley »Ordinary Theology« und Jugend
wöhnlichen« Theologen nach meiner Definition sind, die Form, den Stil, die Haltung und die Stimme der »ordinary theology« kommunizieren und zum Ausdruck bringen. Ich habe behauptet, dass sie immer noch diese »ordinary theology« in sich selbst besitzen. Falls sie nicht mehr fähig dazu sind, auf diese tiefe Ressource zuzugreifen, so müssen sie doch immer noch einige ihrer wertvollsten Eigenschaften in sich nachbilden. Ein anderes Problem mit dem Begriff Laientheologie in Großbritannien besteht darin, dass eine steigende Anzahl von Laien – im Sinn der »nicht ordinierten« – Mitglieder der Kirche gegenwärtig die erfahrensten akademischen Theologen sind. Es ist tatsächlich so, dass in vielen Gemeinden und selbst in den Konfessionen solche Theologen sehr stark die Gruppe der tatsächlich akademisch gebildeten Theologen innerhalb der Kleriker übertreffen und dies sowohl hinsichtlich der Zahl als auch im Blick auf die akademische Auszeichnung. Insofern ist das Verhältnis zwischen »ordinary theology« und Laientheologie komplizierter als man zu hoffen wagt! 4. Wem gehört Theologie? Wer ist die Kirche?
Mir liegt schließlich in diesem letzten Teil daran, zwei Fragen anzusprechen, die von zeichenhafter Bedeutung sowohl für die »ordinary theology« als auch für die Jugendtheologie sind: wem gehört Theologie und wer ist die Kirche? Der lateinische Ausdruck sensus (oder consensus) fidei (oder fidelium) ist bestimmt als Anerkennung oder Zustimmung zu demjenigen Glauben, der grundsätzlich
37
von den Gläubigen geteilt wird. Dies ist eine Kategorie, die insbesondere für die römischen Katholiken relevant ist. Der Anspruch, dass dies eine Quelle oder ein Prüfstein oder ein Test des theologischen Glaubens ist, ist nun allerdings natürlich eher umstritten. Selbst seine Verfechter sind zurückhaltend. Insofern hat die römisch-katholische Internationale Theologische Kommission29 behauptet, dass obwohl dies »ein Kriterium für katholische Theologie« ist, der sensus fidelium nicht einfach die Mehrheitsmeinung in einer bestimmten Zeit oder Kultur darstellt – und ebenso wenig ist es einfach das Echo darauf, was das Lehramt lehrt. Vielmehr gilt, dass es sich dabei um den »Sinn des Glaubens handelt, der tief im Gottesvolk innerhalb der Kirche verwurzelt ist«. Die Kommission fügt hinzu, dass dieser sensus fidelium der Klärung und Artikulation durch »Theologen« darüber bedarf, was Katholiken tatsächlich glauben. Die Idee des Empfangens, die in der akademischen und kirchlichen Theologie verwendet wird, und hier wiederum insbesondere in der katholischen Theologie, ist auch der Schlüssel für unsere Diskussion. Ursprünglich ist »reception« ein ziemlich gewöhnlicher Begriff. Wir sprechen etwa davon, ein Paket in Empfang zu nehmen, indem wir dessen Aushändigung annehmen; und davon, für andere Ideen und andere Menschen aufnahmefähig zu sein, was beinhaltet 29 International Theological Commission, Theology Today. Perspectives, Principles and Criteria, Vatican City 2011 (http://www.vatican.va/ roman_curia/congregations/cfaith/cti_docum ents/rc_cti_doc_20111129_teologia-oggi_en.h tml), 3 §34.
38
Theoretische Grundlagen
– jedenfalls teilweise – dazu bereit zu sein, von diesen zu lernen. Innerhalb der Theologie bezieht sich der Begriff immer auf das Empfangen der Lehren und der anderen Traditionen der Kirche, indem man diese aufnimmt und auf sie antwortet. Dies wird oft als die Antwort der lokalen Gemeinde auf dasjenige begriffen, das »aus der Höhe« herabkommt oder mindestens »von außerhalb« ihrer selbst. Dies wurde aber als eine zu enge Sicht kritisiert (zum Beispiel durch den französischen Gelehrten Yves Congar). Denn das, was eine Gemeinde empfängt, kann niemals total fremd für sie sein. Der amerikanische katholische Theologe Richard Gaillardetz legt dar, und dies mit Bezug auf Studien zur Alten Kirche, »dass das, was durch die Bischöfe gelehrt wurde, in einem gewissen Sinne immer als etwas verstanden wurde, dass bereits im Besitz der Kirche ist«.30 In den folgenden Jahrhunderten wurde dieser demokratische Prozess dadurch ersetzt, dass diejenigen in Autoritätsposition die gehorsame Aufnahme von fremden Gesetzen und Regeln durch diejenigen forderten, die ihnen untertan waren und an die sie diese Gesetze und Regeln in förmlicher, unpersönlicher Weise weiterreichten. Was allerdings dabei verloren ging, war die Idee, dass die Gläubigen etwas empfangen, das sie – in einem gewissen, wenn auch nur impliziten Sinn – längst wussten und als ihren eigenen Glauben begreifen konnten. Denn alle sind Empfänger und Diener von Gottes Wort. Gaillardetz vermerkt, dass das, was er »popular religion« und was ich »ordinary theology« nenne, dieser engeren, autoritären Ausdrucksform kirchlicher Lehren sowohl vorausgeht als auch folgt. Dies alles beginnt »nicht mit Gesetzen und Leh-
ren, sondern mit gelebter Erfahrung und dem Zeugnis der christlichen Gemeinde«, und diese Gesetze und Lehren müssen durch gelebten Glauben der ganzen Kirche geprüft – oder wieder-geprüft – werden. Nur dann werden diese Dinge auf angemessene Weise angeeignet und für das menschliche Leben relevant und so Teil ihres Glaubenslebens und Teil ihrer (geänderten, herausgeforderten) revidierten »ordinary theology« werden. Und »erst das authentische Empfangen des Lehrens durch die Gemeinschaft, und dies durch den Akt der Interpretation, macht es möglich, dass Lehren effektiv wird. Interpretation ist das Herzstück theologischen Lernens und auch von erheblicher Bedeutung für jedes andere Lernen. Pädagogische Studien und pädagogische Praxis zeigen, dass sich, ob wir es nun mögen oder nicht, der Lernende – als Kind, junge Person oder Erwachsener – im Zentrum und Herz dieses Prozesses befindet. Ich kann jeden Tag lehren, aber lernen geschieht nur, wenn sich jemand ändert, wenn jemand lernt. Was auch immer die Experten denken mögen, die Nicht-Experten, die sie lehren, werden nur glauben, was sie selbst glauben können. Mit Sicherheit zeigen uns die meisten unserer eigenen Erfahrungen die Wahrheit dieser Maxime.31 30 Vgl. Richard R. Gaillardetz, The Reception of Doctrine. New Perspectives, in: Bernard Hoose (Ed.), Authority in the Roman Catholic Church. Theory and Practice, Aldershot / Burlington 2002, 95–114. 31 Ich habe mir niemals große Sorgen über die mögliche Indoktrination durch religiöse Bildung gemacht, denn ich habe selbst nur sehr wenige Lernende erlebt, die sogleich und radikal ihre eigenen Überzeugungen in dem Moment änderten, als sie die erste Brise meiner Theologie in ihren formbaren Gemütern und
Astley »Ordinary Theology« und Jugend
Auch in der Kirche dreht sich christliche Kommunikation nicht wirklich um Pfarrer oder Lehrer, und es geht in ihr auch nicht primär um den Inhalt (Einstellung, Glaube, Wert, Fähigkeit, Anlage), der gelehrt wird. Es geht um eine Veränderung im Lernenden selbst. Man mag sagen, dass es in Wirklichkeit um Gott geht, wenn man es so meint, dass Gott die Interaktionen seiner menschlichen Schöpfung so geschaffen hat und nun erhält, dass eine solche Veränderung überhaupt zu einer Möglichkeit werden kann. Denn wir wurden geschaffen und entwickelt, um Lernende zu sein – und wurden zu Gottes Ebenbild geschaffen, um für Gott und Gottes Wort empfänglich zu sein. Die Aufnahme, Interpretation von und das Empfangen der Worte, Bilder und Praktiken des Glaubens machen den Lernenden in ihrem bzw. seinem Kontext und Leben zu einer Person des Glaubens, und dies auf seinem bzw. ihrem eigenen Weg. Wie ich bereits betont habe, geschieht dies in implizitem Dialog oder in der Konversation zwischen dem Glauben, der »story« und meinem Glauben, meiner »story«. Wir beide müssen sprechen. Die Bibel, die Lehren, die Geschichte und die Kirche müssen sprechen – und so müssen es auch wir … Wir müssen etwas zu sagen haben; wir müssen »zurück antworten«, andernfalls werden wir nicht wirklich lernen. Jesus scheint jedenfalls so gedacht zu haben. Und deshalb muss auch das Hören auf beiden Seiten stattfinden. Ohne diese Bedingungen werden wir weder ein Teil der Kirche werden noch bleiben, als Männer und Frauen des Glaubens, die den Weg Christi auf unserem je eigenen Weg beschreiten.32
39
Unterstreicht dies nicht die Bedeutung, unsere, Ihre und jedermanns »ordinary theology« ernst zu nehmen? Wenn junge Menschen in jedem Fall Teil von Gottes Kirche sind, muss deren »ordinary theology« ebenfalls ernst genommen werden. Dies ist die einzige Art und Weise, in der christliche Erziehung funktionieren kann. Und noch mehr: dies ist der einzige Weg, auf dem christliche Evangelisierung und Apologetik funktionieren kann. Jeder von uns – und speziell junge Menschen – fordern allezeit – wenn auch nicht immer laut – ernst genommen zu werden. Die Glaubensüberzeugungen und Werte junger Menschen ebenso ernst zu nehmen wie unsere eigenen, wäre eine sehr gute Gelegenheit, um damit zu beginnen. Ein anderer katholischer Theologe, Nicholas Healy, schreibt auf positive, wenn auch vorsichtige Weise über die Bedeutung der »ordinary theology« Folgendes: »Empfangen ist … nicht ausschließlich passive Annahme, die vielleicht einige Zeit braucht, um erfüllt zu werden. Viel eher ist es ein echter Test, um die Wahrhaftigkeit des Lehrens und dessen Lebensfähigkeit zu prüfen. Dies kann nur dann gelingen, wenn Gnade am Werk ist – um der Kirche willen unter den ›gewöhnlichen‹ Theologen. Ich sollte darauf hinweisen, dass ich nicht vorschlage, ›ordinary theology‹ solle notwendigerweise zu einer formalen Größe in den Abwä
Herzen spürten. In den allermeisten Fällen war ich ziemlich unfähig, jemanden von dem zu überzeugen, woran ich glaube, wie stichhaltig auch immer dies schien. Und sicherlich nicht meine eigenen Kinder … 32 Vgl. Jeff Astley, Christ of the Everyday (wie Anm. 9), 106–111, 117.
40
Theoretische Grundlagen
gungsprozessen der Kirche werden. Ich plädiere auch nicht für eine demokratische Kirche oder dafür, das Volk in einer Art antielitärem Sinne zu ›feiern‹. Mein primärer Punkt ist, mit Karl Barth, dass menschliche Verwirrung die Gnade nicht daran hindert, Gottes VorsehungsWillen in und durch unsere wirren Bemühungen hindurch durchzusetzen (Dei providentia et hominum confusione). Viel eher gilt, dass die Verwirrung in theologischem Sinn angenommen und benannt werden muss. Von dieser Grundlage aus kann die Beschreibung der konkreten Kirche mit der Christlichkeit eines jeden rechnen, vom unbekümmertsten bis hin zum besorgtesten Mitglied der Kirche. Die Kirche kommt niemals ohne Leitung aus und dies, würde ich sagen, bedarf sowohl aus praktischen wie auch aus dogmatischen Gründen des offiziellen Lehramts. Wir brauchen wahrscheinlich auch akademische Theologie. Aber all dies reicht nicht aus, um die Kirche Kirche werden zu lassen, wenn wir die Kirche so betrachten wie sie wirklich ist, in ihrer Beziehung zu Gott.«33 Meiner Meinung nach sollte »ordinary theology« von uns, die wir eine solche Möglichkeit zu denken bereit sind, als Teil der sich entwickelnden christlichen Tradition und als Ort der kontinuierlichen göttlichen Offenbarung angesehen werden.34 Und wenn Gott damit fortfährt, Wahrheiten über Gott selbst durch unsere menschlichen Reflexionen und Antworten zu offenbaren, wer wäre bereit zu sagen, dass solche Aufdeckung nur auf die Mitglieder des Klerus oder der akademischen Professionen begrenzt sein könnten – und nicht ebenso zu jemandem kommen könnte, den sie »von der Straße her kennen und der sie mit seiner
oder ihrer Auffassung beschämt«. Denn »Theologie wird oft von denen getan, denen man es am wenigsten zutraut«, und »Gottes Wege werden immer noch durch seine Freunde entdeckt und nicht durch technische Fähigkeiten und Machtagenturen.35 Sollte allerdings die Kirche ihre eigene »ordinary theology« ignorieren, könnte es passieren, dass sie sich selbst von der reichen Quelle religiöser und moralischer Einsichten abschneidet. Im Schlusskapitel meiner Ordinary Theology stelle ich deshalb verschiedene gewagte Forderungen auf, inklusive der folgenden:36 Erstens behaupte ich, dass – trotz der wichtigen Unterscheidung zwischen einer deskriptiven Darstellung dessen, was wir glauben und einer normativen Darstellung dessen, was wir glauben sollten – »mit Sicherheit eine Spannung, wenn nicht sogar ein Paradox entsteht, wenn Theologie Glaubensüberzeugungen als ›christliche Lehre‹ oder als ›Lehre der Kirche‹ kennzeichnet, die viele gewöhnliche Christen nicht teilen.« Insofern »gibt es etwas Instabiles in jeder Beschreibung der christlichen Lehre, die substantielle Minderheitenmeinungen (und in manchen Bereichen auch Mehrheitsmeinungen) der Laien ignoriert, insbesondere 33 Nicholas M. Healy, Ordinary Theology, Theological Method and Constructive Ecclesiology, in: Jeff Astley / Leslie J. Francis (Eds.), Exploring Ordinary Theology. Everyday Christian Believing and the Church, Farnham / Burlington 2013, 19f. 34 Vgl. David Brown, Tradition and Imagination. Revelation and Change, Oxford 1999. 35 Holmer, The grammar of faith (wie Anm. 27), 21. 36 Astley, Ordinary Theology (wie Anm. 3), 158– 159, 162.
Astley »Ordinary Theology« und Jugend
dann, wenn solche Meinungen unter den theologisch sprachlich Kompetenten gemeinsam vorhanden sind.« Und zweitens: alle Christen haben die Verantwortung, christliche moralische und spirituelle Urteile über solche Glaubensüberzeugungen, Haltungen, Werte und Praktiken abzugeben, die innerhalb der gegenwärtigen Gesellschaft existieren. Sie haben außerdem die Verantwortung, auf der Grundlage eigener Urteilsbildung zu entscheiden, ob wir einen solchen wachsenden gesellschaftlichen Einfluss innerhalb der Kirche willkommen heißen oder ihm widerstehen sollten. Was niemand von uns tun kann, ist so zu tun, als ob diese Sachverhalte nicht bereits innerhalb unserer Kirchenmauern blühten. Sie gedeihen bereits, und dies ist unvermeidlich, sie werden weiter gedeihen. Denn seit die Kirche in der Welt ist, gehört es dazu, dass sie den Veränderungen der Welt gegenüber offen ist. »Ordinary theology« ist die Art der christlichen Theologie, die dies am besten reflektieren kann und die die beste Gelegenheit bietet, auf diese Entwicklungen zu antworten. Dies ist die Frontlinie der Kirche.
41
Kirche muss ihre »gewöhnlichen« Theologen ernst nehmen. Sie muss ihnen zuhören und von ihnen lernen. Will sie überleben, muss sie insbesondere auf die Jugend innerhalb der Kirche hören und von ihr lernen. Sie muss aber auch von der »ordinary theology« derjenigen jungen Menschen lernen, die dort gelegentlich in Erscheinung treten oder eine andere Form des Kontakts mit ihr haben. Und natürlich muss sie die Kritik und spirituellen Einsichten innerhalb der »ordinary theology« derjenigen ernst nehmen, die darin fortfahren, sich in einer großen Distanz zu ihr aufzuhalten. Was junge Menschen glauben, was ihnen wertvoll ist und worauf sie hoffen – worüber sie in unterschiedlicher Tiefendimension besorgt sind – was sie »anbeten«, im Sinne dessen, wem sie einen ultimativen Wert zuschreiben: alle diese Elemente konstituieren ihre »ordinary theology«. Keines von diesen Elementen – weder der Jugendlichen noch ihrer Glaubensüberzeugungen – ist »zu gewöhnlich«, um nicht für uns bedeutsam zu sein. Aber ich fürchte, die meisten jungen Menschen glauben nicht, dass wir so denken.
42
Theoretische Grundlagen
Anton A. Bucher Jugendtheologie und Spiritualität
Was bewegt den Menschen, auch im Jugendalter, dazu, zu theologisieren? Anregungen Erwachsener, etwa von der Kanzel oder im Religionsunterricht? Sicherlich auch! Aber ein ursprünglicheres Motiv beschrieb William James1, einer der Gründerväter der Psychologie, bereits vor mehr als hundert Jahren. »Religion in dem Sinn, in dem wir sie auffassen, Theologien, Philosophien und kirchliche Organisationen« sei »sekundär«. Was ist dann das Primäre? James zufolge »die unmittelbaren persönlichen Erfahrungen«, die Menschen mit jener Wirklichkeit machen, »die sie in irgendeinem Sinne als das Göttliche betrachten«. War es nicht so bei Jesus von Nazareth? Er erfuhr die Nähe zu Gott, den er »Abba« (Väterchen) nannte (Mk 14,36), in einer Innigkeit, die ihn befähigte, die Schranken der damaligen Religion zu überschreiten, hin zu den Unreinen, Sündern, Heiden. Erst später ›theologisierten‹ Christen darüber, wer dieser Gottmensch war, und dies in einer Institution (Kirche), die vor allem danach strebt(e), sich zu erhalten – und missionarisch zu erweitern. Genau das gleiche geschah und geschieht in vielen religiösen Sondergruppen: Charismatische Personen machen tiefe Erfahrungen, teilen diese anderen mit, scharen im besten Falle Gefolgsleute um sich, die Strukturen schaffen und ihren Offenbarer und seine Botschaft systematisch reflektieren.
Die persönliche Erfahrung des Göttlichen würde William James heute weniger als »religiös«, sondern vielmehr als »spirituell« charakterisieren – so der renommierte Religionspsychologe Ralph Hood jr.2 Denn für »Spiritualität« sei konstitutiv, dass sie sich weniger an Vorgaben der Tradition oder an Dogmen orientiere, sondern viel mehr an der persönlichen Erfahrung, zu deren Wesen es gehört, dass sie nicht delegiert und niemandem abgenommen werden kann.3 Was aber ist Spiritualität? Für James, wie skizziert, als persönliche Erfahrung des Heiligen die eigentliche Quelle des – sekundären – Theologisierens. Freilich, Traditionalisten würden anders gewichten: Primär sei die Schrift, die Offenbarung, die Überlieferung der Religionsgemeinschaften – und Spiritualität bestenfalls eine Frucht davon. Wie immer dem sei – Tradition ist erst dann wirklich angeeignet, wenn sie erfahren wurde, und Erfahrung zehrt immer von Traditionen: im ausufernden 1 William James, Die Vielfalt religiöser Erfahrung. Eine Studie über die menschliche Natur, Frankfurt a.M. 1997, 40f. 2 Ralph W. Hood, The relationship between religion and spirituality, in: Arthur L. Greil/ David G. Bromley (Eds.), Defining religion: Investigating the boundary between the sacred and the secular; Vol. 10. Religion and the Social Order, Amsterdam 2003, 244. 3 Vgl. Ralph W. Hood / Peter C. Hill / Bernhard Spilka, The psychology of religion. An empirical approach, New York 42009, 290.
Bucher Jugendtheologie und Spiritualität
Diskurs über »Spiritualität« ist wohl am wenigsten umstritten, dass dieser Begriff eine geradezu atemberaubende Erfolgsgeschichte hinter sich hat, enorm populär und in seinen (möglichen) Bedeutungen erweitert wurde (bis hin zur Spiritualität des Mountainbikens)4, aber auch, dass er alles andere als konsensfähig definiert ist, sondern an die Sprachverwirrung beim Turmbau zu Babel gemahnt.5 Ziel dieses Beitrages ist es, »Spiritualität« auf der Basis empirischer Studien, eher qualitativen denn quantitativen, einer Klärung näherzubringen, indem als ihr Kern »Verbundenheit« (connectedness) identifiziert wird.6 Sodann wird von einer der bisher größten Studien zu Jugend und Spiritualität – auch und gerade im Sinn von Allverbundenheit – berichtet, die vom Center for Spiritual Development in Childhood and Adolescence in Minneapolis mit knapp 7.000 Jugendlichen durchgeführt wurde.7 Daraus sich ergebende Implikationen und Desiderate für »Jugendtheologie« runden den Beitrag ab. 1. Spiritualität als Verbundenheit
Noch in den 1980er Jahren fand man in Buchhandlungen, deren »Regale« mit »Spiritualität« beschriftet waren, Bücher über die Exerzitien nach Ignatius von Loyola, Askese, Betrachtungen des Leidens und Sterbens Jesu etc. Spiritualität ließ an Nonnen denken, die in abgeschiedenen Klöstern den Rosenkranz beten, oder an Priesterseminare, in denen sich die Alumnen kopfnickend ihrem »Spiritual« unterordnen – und überhaupt nicht an eine vegane Lebensweise oder an die Wellness-Szene, in der zusehends mehr
43
Menschen ihre Spiritualität suchen8, und schon gar nicht an Sexualität.9 »Spiritualität«, etymologisch im lateinischen »spiritus« wurzelnd, was gleichermaßen »Atem« und Geist« bedeutete10, war bis vor wenigen Jahren ein binnenkirchlicher Begriff und wurde zumeist mit »Frömmigkeit« übersetzt. Wie kam es, dass sich seine Bedeutung dermaßen verbreiterte? Dazu trug sicherlich die englische Sprache bei, in der »spiritual« im ausgehenden Mittelalter noch »kirchliche Person« bedeutete, aber schon im 18. Jahrhundert als »essenzielles Prinzip« aufgefasst wurde und fortan für »seelisch, ideell, nichtmateriell, übernatürlich« stand.11 Besonders attraktiv ist dies für Personen, denen eine materielle Weltsicht nicht genügt, speziell in der New-Age-Bewegung, die 4 Vgl. Bernhard Grom, Spiritualität – die Karriere eines Begriffs: Eine religionspsychologische Perspektive, in: Eckhard Frick / Traugott Roser (Hg.), Spiritualität und Medizin, Stuttgart 22011, 12–17. 5 Vgl. David O. Moberg (2011), Expanding horizons for spirituality research, in: http:// www.hartfordinstitute.org/sociology/Expanding%20Horizons%20for%20Spirituality%20 Research%202011.pdf. 6 Anton A. Bucher, Psychologie der Spiritualität. Handbuch, Weinheim 22014. 7 Eugene C. Roehlkepartain et al. (2008), With their own voices: A global exploration of how today’s young people experience and think about spiritual development. Center for Spiritual Development in Childhood and Adolescence, Minneapolis: http://www.search-institute.org/system/ files/with_their_own_voices_report.pdf 8 Franz Höllinger / Thomas Tripold, Ganzheitliches Leben. Das holistische Milieu zwischen neuer Spiritualität und postmoderner Wellness-Kultur, Bielefeld 2012. 9 Jenny Wade, Transcendent sex. When lovemaking opens the veil, New York 2004. 10 Philip Sheldrake, Spirituality and history. Questions of interpretation and method, New York 1992. 11 Grom (wie Anm. 4), 14.
44
Theoretische Grundlagen
enorm zur Popularisierung von »Spiritualität« beitrug.12 Als ursächlich für die Popularisierung von Spiritualität kann auch die Krise institutioneller Religion gelten, erkennbar an dem mittlerweile geflügelten Akronym »SBNR« (»Spiritual but not religious«13), zwischenzeitlich auch an deutschsprachigen Stichproben nachgewiesen14, was insofern höchst bemerkenswert ist, als ein ursprünglich kirchlicher Schlüsselbegriff eine auch antikirchliche Stoßrichtung bekommen hat. Viele Zeitgenossen dichothomisieren15: Aspekt
Religiosität
Spiritualität
Organisationsform
Institution
Individuum
Wahrheitskriterium
Dogmen, Lehre, Lehramt
Authentizität der Erfahrung
Wahrheitsanspruch
Exklusiv
Pluralistisch; viele Traditionen integrierend
Kontrolle
External
Interne Verantwortung
Quelle des Wissens
Schrift, Offenbarung
Erfahrung und Mystik
Gottesvorstellung
Transzendent
Immanent
Geschlecht
Stärker patriarchalistisch
Eher androgyn
Bezugswissenschaft
Theologien
U.a. Quantenphysik
Kommunikation
Stärker hierarchisch
Informelle Netzwerke
Denkweisen
Systematisch, analytisch
Holistisch, ganzheitlich
Typische Praxis
Gottesdienstbesuch
Meditation
Diese Differenzierung ist freilich heuristisch und trifft zumal auf jene Zeitgenossen zu, die sich primär als »spirituell« und nicht (mehr) als »religiös« begreifen
– eine im Steigen begriffene Quote.16 »Spiritualität« und »Religiosität« werden auch als sich überlappende Konstrukte aufgefasst, zumal dann, wenn letztere intrinsisch motiviert ist, um ihrer selbst willen vollzogen wird.17 Es ist möglich, sich religiös zu verhalten, beispielsweise einen Gottesdienst zu besuchen, ohne spirituell zu sein – etwa wenn man vor allem gesehen werden will –, aber ebenso, spirituell zu empfinden und zu leben, ohne einer Religion anzugehören und sich auf spezifisch religiöse Semantik zu beziehen, beispielhaft die auch empirisch nachgewiesene »Spiritualität von Atheisten«.18 Ein weiterer Grund für die gestiegene Popularität von Spiritualität sind ihre vielfältig dokumentierten wünschenswerte Effekte, speziell auf Gesundheitsvariablen, physische wie psychische.19 Spirituell eingestellte Menschen, die 12 Vgl. Hubert Knoblauch, Vom New-Age zur populären Spiritualität, in: Dorothea Lüddeckens / Rafael Walthert (Hg.), Fluide Religion. Neue religiöse Bewegungen im Wandel. Theoretische und empirische Systematisierungen, Bielefeld 2010, 149–174. 13 Vgl. Robert Fuller, Spiritual but not religious: Understanding unchurched America, Oxford 2001. 14 Vgl. Heinz Streib / Ralph W. Hood, »Spirituality« as privatized experience-oriented religion: Empirical and conceptual perspectives, in: Implicit Religion 14 (2011), 433–453. 15 Vgl. Knoblauch (wie Anm. 12). 16 Vgl. Paul L. Heelas et al., The spiritual revolution: Why religion is giving way to spirituality, Oxford 2005; Streib / Hood (wie Anm. 14). 17 Vgl. Harold G. Koenig / Dana King / Verna B. Carson, Handbook of religion and health, New York 22012. 18 Vgl. Elaine A. Ecklund / Elizabeth Long, Scientists and spirituality, in: Sociology of Religion 72 (2011), 253–274. 19 Vgl. Koenig / King / Carson (wie Anm. 17).
Bucher Jugendtheologie und Spiritualität
auch entsprechend leben, achtsam und meditierend, haben in aller Regel weniger vom Stresshormon Cortisol in ihrem Blut, bessere kardiovaskuläre Werte, sie sind weniger anfällig für Erkrankungen und haben eine nachweislich längere Lebenserwartung, dies auch mitverursacht durch einen gesünderen Lebensstil, wozu die unterschiedlichsten spirituellen (und religiösen) Traditionen raten. Beeindruckend sind auch die Effekte auf psychische Variablen: Weniger Depressivität und Ängstlichkeit, ein höheres Wohlbefinden, mehr Stressresistenz und adaptivere Copingstile. Und nicht zuletzt war der Popularität von Spiritualität auch förderlich, dass sie in den harten Wissenschaften vermehrt thematisiert wird, etwa in der Quantenphysik, so von Hans Peter Dürr20, für den es – quantenphysikalisch betrachtet – letztlich »keine Materie« gibt: »Das Fundament unserer Wirklichkeit ist nicht die Materie, sondern etwas Spirituelles«21. Sodann in der Gehirnforschung, etwa beim Neuropsychologen Mario Beauregard, für den das Gehirn letztlich »spiritual« ist, begründet unter anderem damit, dass der Mensch kraft seines Geistes neurologische Strukturen verändern kann, etwa durch Meditation, und aufgrund von faszinierenden Phänomenen wie den Nahtoderfahrungen.22 Freilich: nicht alle, die Spiritualität quantenphysikalisch deuteln, haben die Physik nach Einstein wirklich begriffen. Kontrovers diskutiert wurde, ob »Spiritualität« oder »Religiosität« umfassender ist. Mehr und mehr Autoren votieren diesbezüglich für erstere, obschon sie lange Zeit ein Teil von Religion bzw. Kirche war. Autoren wie Gollnick23 oder Johnston24 verweisen darauf, Spiritualität könne auch von Menschen gelebt wer-
45
den, die keiner Religionsgemeinschaft angehören. Vor allem sei Spiritualität – als performative Erfahrung – ursprünglicher und der Nährboden unterschiedlichster Religionssysteme. Konsensuell ist zusehends, Spiritualität als multidimensionales Phänomen aufzufassen.25 Aber auch, ihr Herzstück in Verbundenheit zu bestimmen.26 Und dies auf der Basis zahlreicher qualitativer Studien27, in denen Männer und Frauen ihre Spiritualität schilderten, oft Erfahrungen wie folgende: »Wir alle sind miteinander verbunden und ein Teil der gleichen Schöpfung. Der verlässlichste Weg, um aus der Isolation herauszutreten, ist der, in diese Verbundenheit mit allem, was ist, hineinzugehen«.28 Diese Verbundenheit kann ausdifferenziert werden in eine horizontale – hin zu Natur / Kosmos und sozialer Mitwelt – sowie eine vertikale, bezogen auf Transzendenz: 20 Vgl. Hans Peter Dürr, Geist – Kosmos – Physik. Gedanken über die Einheit des Lebens, Amerang 2010. 21 Ebd., 45. 22 Vgl. Mario Beauregard / Denise O’Leary, The spiritual brain. A neuroscientist’s case for the existence of the soul, New York 2007. 23 Vgl. James Gollnick, Religion and spirituality in the life cycle, New York et al. 2005. 24 Vgl. Margret P. Johnston, Faith beyond belief: Stories of good people who left their church behind, Wheaton 2012. 25 Vgl. James A. Neff, Exploring the dimensionality of »Religiosity« and »Spirituality« in the Fetzer Multidimensional Measure, in: Journal for the Scientific Study of Religion 45 (2006), 449–459. 26 Vgl. Margaret Burkhardt / Mary G. NagaiJacobson, Spirituality. Living our connectedness, Albani 2002. 27 Bucher (wie Anm. 6), 30–40. 28 Robin D. Moremen, What is the meaning of life? Women’s spirituality at the end of life span, in: Omega 50 (2005), 51.
46
Theoretische Grundlagen
Verbundenheit mit der Natur ist der Kern der Spiritualität von Michael Gorbatschow: »Gut, ich glaube an den Kosmos. Wir alle sind mit dem Kosmos verbunden … Für mich ist die Natur heilig, Bäume sind meine Tempel.«29 Mit der Natur verbunden zu sein, in sie eingebettet, ist nicht nur der physischen Gesundheit förderlich, sondern auch dem Wohlbefinden.30 Es ist ein fundamental anderes Lebensgefühl, sich in der Natur geborgen zu fühlen, als ihr ausgesetzt und von ihr bedroht zu sein. Blaise Pascal erschauderte in Angst, als er in die eisigen Tiefen des Alls schaute; anders ein Meditationsmeister: »Ich lag auf dem Rücken unter den Sternen und den unsichtbaren Galaxien, und ich ließ ihre Grösse in mich gehen … und ich war mit allem eins, und das berührte mich zärtlich wie ein Gregorianischer Choral«.31 Für spirituelle Erfahrungen besonders prädestiniert ist die Wildnis, speziell die Berge32, aber auch Wälder: »Manchmal spüre ich eine spirituelle Tiefe an den Waldplätzen, so als ob ich zuhause angelangt wäre … es ist ein Gefühl des Dazugehörens, der Verbundenheit, ich werde ein Teil
davon«.33 Auch Kindern sind solche spirituellen Intensiverfahrungen in der Natur zugänglich, zumal an Orten, an denen sie sich sicher fühlen.34 Als spirituell charakterisiert wird auch die Verbundenheit mit der sozialen Mitwelt. Ein Angehöriger der israelischen Kultusgemeinde: »Spiritualität bedeutet, dass ich in Gemeinschaft bin. Ich habe eine Gruppe von Leuten, die 29 Bron Taylor, Earth and nature based spirituality (Part 1): From deep ecology to radical environmentalism, in: Religion 31 (2001), 175. 30 Vgl. Colin A. Capaldi / Raelyne L. Dopko / John M. Zelenski (2014), The relationship between nature connectedness and happiness: A meta-analysis, in: http://journal.frontiersin.org/ article/10.3389/fpsyg.2014.00976/full 31 Vgl. Tom W. Clark, Spirituality without faith, in: The Humanist 62 (2002), 30–35. 32 Vgl. Shahar Arzy et al., Why revelations have occurred on mountains? Linking mystical experiences and cognitive neuroscience, in: Medical Hypotheses 65 (2005), 841–845. 33 Terry L. Terhaar, Evolutionary advantages of intense spiritual experiences in nature, in: Journal for the Study of Religion, Culture and Nature 3 (2009), 314. 34 Vgl. Tobin Hart, Die spirituelle Welt der Kinder. Wie Sie ihre verborgenen Fähigkeiten verstehen und fördern, Kreuzlingen / München 2007.
Bucher Jugendtheologie und Spiritualität
mit mir verbunden und für mich ebenso verantwortlich sind wie ich für sie«.35 Im Sanskrit steht dafür das geflügelte Wort: »Tat twam asi«: Der andere, der bist auch du: Ein Wesen mit gleichen Gefühlen, Sehnsüchten, Ängsten. Diese Verbundenheit kann von spirituellen Personen auch über den Tod hinaus empfunden werden.36 Vertikal ist die Verbindung mit der Transzendenz, in unserem Kulturkreis zumeist »Gott«. Eine Krankenschwester, gefragt, was Spiritualität für sie bedeute: Sie »hat ihre Wurzeln in Gott. Je tiefer sie wächst, desto mehr können wir mit Gott eins werden.« Von spirituellen Personen werden vor allem entgrenzte Gottesbilder favorisiert, die pantheistisch anmuten: »Gott ist alles, durchdringt alles«.37 Wünschenswert ist, wenn vertikale und horizontale Verbundenheit im Gleichgewicht sind. Mitunter versteifen sich Menschen ganz und gar auf Transzendenz, vernachlässigen die soziale Mitwelt und schätzen das Irdische gering, etwa als Reich der Finsternis, so in diversen weltflüchtigen Strömungen, etwa der Gnosis. Unausgewogen wäre auch Spiritualität, die Transzendenz ausblendet; Verbundenheit mit der Natur kann viel tiefer sein, wenn in dieser Heiliges und Göttliches wahrgenommen wird. Verbundenheit kann schwerlich eingehen, wer zu sehr auf sich selbst fixiert ist, ein Hypochonder auf seine Gesundheit, ein raffgieriger Broker auf die Aktien, oder eine Person in der Midlife-Krise auf Selbst-Verwirklichung, die geradezu erzwungen werden will. Verbundenheit fällt umso leichter, je mehr Menschen zur Selbsttranszendenz fähig sind, d.h. vom Ego auch absehen und sich voll und ganz anderem und anderen zuwenden kön-
47
nen.38 Selbsttranszendenz, wofür neuerdings Messskalen entwickelt wurden39 – mit Items wie: »Ich fühle, dass mein Leben Teil eines größeren Ganzen ist« –, gilt als weitere Kernkomponente von Spiritualität. Klinische Studien wiesen sie als eine der stärksten Prophylaxen depressiver Verstimmungen aus.40 2. »Mit ihren eigenen Stimmen« – Empirische Einblicke in die Spiritualität Jugendlicher
Das Zitat im Zwischentitel ist der Titel der Publikation des Center for Spiritual Development in Childhood and Adolescence, in der die Ergebnisse einer der bisher aufwändigsten Studien zur Spi35 Kevin S. Reimer et al., Developing spiritual identity: Retrospective accounts from Muslim, Jewish, and Christian exemplars, in: Marian de Souza et al. (Eds.), International handbook of religion and education 3, New York 2009, 517. 36 Vgl. Susan Cadell / Linda Janzen / Dennis J. Haubrich (2006), Engaging with spirituality: A qualitative study of grief and HIV/AIDS, in: Critical Social Work 7/1: http://www1. uwindsor.ca/criticalsocialwork/engaging-with -spirituality-a-qualitative-study-of-grief-andhivaids. 37 Vgl. David Tacey, D., Environmental spirituality (2009), in: International Journal of New Perspectives in Christianity 1, Article 3: http:// research.avondale.edu.au/npc/vol1/iss1/3. 38 Vgl. Alfried Längle, Geist und Existenz. Zur inhärenten Spiritualität der Existenzanalyse, in: Existenzanalyse 28/2 (2011), 18–31. 39 Vgl. bspw. Gørill Haugan et al., The Self-Transcendence scale – An investigation of the factor structure among nursing home patients, in: Journal of Holistic Nursing 30 (2012), 147–159. 40 Vgl. Gørill Haugan / Siw Innstrand (2012), The effect of self-transcendence on depression in cognitively intact nursing patients, in: International Scholarly Research Network ISRN Psychiatry. Article ID 301325, doi:10.5402/2012/301325.
48
Theoretische Grundlagen
ritualität Jugendlicher präsentiert wurden.41 Der Titel ist programmatisch: Jugendliche sollen frei schildern können, wie sie Spiritualität erfahren haben, und dies in immerhin 77 Gruppendiskussionen, die in 13 Nationen durchgeführt wurden. Zusätzlich füllten, in acht Nationen (Australien, Kamerun, Kanada, Indien, Thailand, Ukraine, Großbritannien, USA), 6.853 Jugendliche zwischen dem zwölften und 25. Lebensjahr umfangreiche Fragebögen aus. Und nicht zuletzt wurden mit 32 Jungen und Mädchen Tiefeninterviews geführt. Obschon Jugendliche immer wieder mit dem Stereotyp konfrontiert waren und nach wie vor sind, oberflächlich und primär auf Fun aus zu sein, beteuerten diese mehrheitlich, das Leben habe eine spirituelle Dimension; gerade einmal sieben Prozent lehnten dies ab. Freilich, nicht alle Befragten wussten mit dem Begriff »spiritual« etwas anzufangen, aber diejenigen, die ihn angeeignet hatten, konkretisierten die spirituelle Lebensdimension als Sinn, Verbundenheit mit Natur und Mitmenschen, sowie innerer
41 Vgl. Roehlkepartain et al. (wie Anm. 7). 42 Ebd., 12.
Friede. Eine Dreizehnjährige in China: »Spiritualität ist wichtig. Wenn du sie verlierst, verlierst du die Anziehungskraft, und du wärst bloß Fleisch.«42 Erfragt wurde auch spirituelle Selbsteinschätzung: 39% deklarierten sich als »sehr oder ziemlich spirituell«, 37% als »irgendwie spirituell«, und weniger als ein Viertel (24%) gar nicht. Allerdings bestehen erhebliche Differenzen zwischen den einzelnen Nationen: Am spirituellsten sind, den eigenen Angaben zufolge, die jungen Amerikaner (52%), sodann die Kanadier (50%), und am wenigsten die jungen Australier (23%), von denen knapp die Hälfte meinte, überhaupt nicht spirituell zu sein. Unter dem Durchschnitt liegen die jungen Briten und Ukrainer (36%). Mehrheitlich beteuerten die Befragten, ihre Spiritualität bekomme ihnen gut, in der Gesamtstichprobe 45% »sehr«, 16% »nicht«. Konstitutiv für Spiritualität sind entsprechende Erlebnisse, die an die Gipfelerfahrungen von Maslow43 erinnern. Solche scheinen überraschend vielen Jugendlichen zuteil geworden zu sein:
43 Vgl. Abraham H. Maslow, Religions, values, and peak experiences, New York 1970.
Bucher Jugendtheologie und Spiritualität
49
Mehrheitlich werden solche Erfahrungen als der subjektiven Spiritualität förderlich gewürdigt. Erfragt wurden
zusätzlich spirituelle Überzeugungen, auch die, alles sei miteinander verbunden:
Mehr als zwei Drittel rechnen grundsätzlich damit, alles Leben sei miteinander verbunden, was als spirituell gedeutet wird, und sechs von zehn halten ein Leben nach dem Tod – in welcher Form auch immer – zumindest für wahrscheinlich. Mehr als jeder zweite schließt nicht aus, es gäbe eine »spirituelle Welt«. Eine der in der jüngeren Religionspsychologie am intensivsten diskutierten Fragen ist die, wie sich »Religiosität« und »Spiritualität« zueinander verhalten.44 Am ehesten konsensfähig ist, sie als distinkte, aber zugleich aufeinander bezogene und sich teils überlappende Konzepte aufzufassen. So sehen es auch viele der befragten Jugendlichen45: »Du musst nicht religiös sein, um spirituell zu sein, aber du musst spirituell sein, um religiös zu sein«, so ein 15jähriger Kanadier. Spiritualität sei – so eine junge Britin – »die Suche nach Antworten, und Religion bietet solche an«. Eine 17jährige Amerikanerin: »Religion ist eher ein Platz, und Spiritualität ist eher ein Weg«. Das Freiheitspotenzial von Spiritualität akzentuierte eine junge Südafrikanerin
besonders anschaulich: »Spiritualität ist etwas, das einer erfahren haben muss. Religion, da ist das meiste aufgezwungen: Tue es oder tue es nicht! Spirituell sein, das ist wie auf einem Berg zu stehen, wenn der Wind durchs Haar weht, und das Gefühl, frei zu sein.« Mehrheitlich (34%) verstehen sich die Befragten sowohl als »religiös« wie auch als »spirituell«, knapp ein Viertel (23%) deklariert sich als ausschließlich als »spirituell«, und mit 15% sind es deutlich weniger, die sich primär für »religiös« halten. »Weder-noch« kreuzten gerade einmal 10% an – ein weiteres Indiz dafür, dass Heranwachsende religiöser und spiritueller sind als ihr Ruf. Jede/r Fünfte ist sich diesbezüglich nicht sicher, mit steigendem Alter allerdings deutlich seltener werdend. Zu wiederholten Malen wurde nachgewiesen, dass im Jugendalter der Gottesdienstbesuch seltener wird und die Zustimmung zu christlichen Glaubens44 Vgl. Bucher (wie Anm. 6). 45 Roehlkepartain et al. (wie Anm. 7), 27f.
50
Theoretische Grundlagen
inhalten zurückgeht46, etwa dass Christus der wahre Sohn Gottes sei, von 80% bei den Zehnjährigen auf 45% bei den Achtzehnjährigen.47 Damit kontrastiert, wie Jugendliche die Entwicklung ihrer Spiritualität deuten: Zu 55% als intensiver geworden, jede/r Vierte meinte, sich diesbezüglich in den letzten Jahren nicht verändert zu haben, während bloß 20% angaben, sie seien nun weniger spirituell. Dieser Trend wurde mehr-
fach bestätigt, so von Denton, Pearce & Smith48, die 2350 amerikanische Jugendliche im Abstand von drei Jahren befragten: Die Quote der seltenen Gottesdienstbesucher stieg von 45% auf 65%, aber auch die der ausschließlich spirituellen Sucher. Aber welche Faktoren begünstigen die mehrheitlich registrierte spirituelle Weiterentwicklung? Auch darauf antworteten die jungen Männer und Frauen:
Besonders spiritualitätsfreundlich sei, sich oft draußen, in der Natur aufzuhalten – ein weiteres Indiz dafür, Spiritualität auch als Naturverbundenheit zu konzeptualisieren. Musik galt ursprünglich als etwas Sakrales; vier von fünf Jugendlichen würdigen sie als ihrer Spiritualität förderlich. Dem gegenüber erheblich geringer ist der Effekt religiöser Texte sowie der Schule. Zu Recht wird bilanziert, die Jugend sei spiritueller, als sie vielfach nach außen erscheine.49 Abschließend wird hier gewünscht, dass für heranwachsende Männer und Frauen Gesprächsforen bestehen oder entstehen, in denen sie sich zu ihrer Spiritualität äußern können, vertrauensvoll und ohne zu fürchten, dass persönli-
che Sichtweisen für unangemessen oder gar falsch gehalten werden. Dies umso mehr, als viele der Befragten auch angaben, sie könnten mit ihren Eltern und Freunden nur selten über so zentrale Fra46 Vgl. Hans-Georg Ziebertz u.a., Religiöse Signaturen heute. Ein religionspädagogischer Beitrag zur empirischen Jugendforschung, Freiburg i.Br. 2003. 47 Anton A. Bucher, Religionsunterricht zwischen Lernfach und Lebenshilfe. Eine empirische Untersuchung zum katholischen Religionsunterricht in der Bundesrepublik Deutschland, Stuttgart 2001, 131. 48 Melinda L. Denton / Lisa D. Pearce / Christian Smith, Religion and spirituality on the path through adolescence. A Research Report of the National Study of Youth and Religion, No. 8, 2008. 49 Vgl. Roehlkepartain et al. (wie Anm. 7).
Bucher Jugendtheologie und Spiritualität
gen reden wie die, warum wir auf Erden seien und welchen Sinn dies habe. Eine 17jährige US-Amerikanerin: »Ich weiß, viele Leute in meinem Leben sind tief spirituell. Aber ich fühle, dass dies etwas sehr Privates ist und komme nicht an diese Seiten der Personen heran.« Könnte Jugendtheologie hier ansetzen? 3. Implikationen von Spiritualität für Jugendtheologie
Ob sich der Topos Jugendliche als Theologen, wie seit längerem im Anschluss an die Kindertheologie propagiert50, etabliert, wird sich zeigen. Heranwachsende selber meinen mehrheitlich, sie seien keine Theologen, weil sie Theologie nicht studiert hätten, nicht als Pfarrer arbeiten und keine Religion unterrichten.51 Aber eines steht außer Streit: Jugendliche sind zu spirituellen Erfahrungen fähig, die mitunter sehr intensiv sein können, und die ihnen bald in der Gemeinschaft zuteil werden, aber besonders häufig in der freien Natur. Dies bestätigen mittlerweile zahlreiche Studien, speziell qualitative, unter anderem Mason52, der von einer Sechzehnjährigen hörte: »Plötzlich war ich überwältigt von einer Gegenwart, von Licht, von Liebe überall um mich herum … Es blieb ein unbeschreibliches Gefühl des Friedens und der Freude.« Entscheidend ist, wie Jugendliche anthropologisch gesehen werden, ob als aufsässig, ausschweifend, triebgelenkt, spirituell seicht bzw. – so Martin Luther – als »gärender Most«53. Oder ob als geistbegabte, spirituelle Wesen, als welche nicht nur Kinder zu würdigen sind.54 Jugendtheologie könnte denn auch vermehrt Intensiverfahrungen von Jun-
51
gen und Mädchen thematisieren, die gegebenenfalls theologische Reflexionen evozieren können. Allerdings hat man sich davor zu hüten, solche Erfahrungen gleich als spirituell oder religiös zu vereinnahmen – dies zumal dann, wenn solche Attribuierungen dem subjektiven Selbstverständnis Jugendlicher entgegengesetzt sind.55 Dennoch könnten mögliche Gesprächsimpulse wie »Mit wem / was fühle ich mich sehr verbunden?« aufschlussreiche Einblicke in das existenzielle Selbstverständnis Jugendlicher ermöglichen, und damit auch in ihre Spiritualität, sofern diese primär als Verbundenheit aufgefasst wird. Dies führte zu einer enormen Erweiterung von Jugendtheologie: nicht nur Themen wie Gott, Theodizee, Leben nach dem Tod, sondern auch der Erfahrungsaspekt, und dies in der Verbundenheit mit allem. 50 Vgl. Friedrich Schweitzer, Auch Jugendliche als Theologen? Zur Notwendigkeit, die Kindertheologie zu erweitern, in: Zeitschrift für Pädagogik und Theologie 57 (2005), 46–53. 51 Vgl. Anton A. Bucher, Sind Jugendliche auch für Jugendliche Theologen. Eine Pilotstudie und konzeptionelle Überlegungen, in: Thomas Schlag / Friedrich Schweitzer (Hg.), Jugendtheologie. Grundlagen – Beispiele – kritische Diskussion, Neukirchen 2012, 102–110. 52 Vgl. Michael Mason (2004), Methods for exploring primordial elements of youth spirituality. Paper presented at the annual meeting of the Association for the Sociology of Religion, San Francisco, August 14, 2004. hirr.hartsem.edu/sociology/sociology_online_articles_mason.html 53 Friedrich Schweitzer, Die Religion des Kindes. Zur Problemgeschichte einer religionspädagogischen Grundfrage, Gütersloh 1992, 5. 54 Vgl. Anton A. Bucher, Spiritualität von Kindern. Was sie ausmacht und wie sie gefördert werden kann, in: Praxis Gemeindepädagogik 68 (2015), 39–41. 55 Vgl. Bernhard Porzelt, Jugendliche Intensiverfahrungen. Qualitativ-empirischer Zugang und religionspädagogische Relevanz, Graz 1999.
52
Empirische Aspekte
Emanuela Chiapparini Was heutige Jugendliche an Gemeinschaft schätzen, an Individualität brauchen und an Orientierung suchen
Im digitalen Zeitalter geben Jugendliche in Deutschland das »sich treffen mit Leuten« als wichtigste Freizeitbeschäftigung neben dem Surfen im Internet1 an. Ebenso gewichten Heranwachsende in der Schweiz »Freunde treffen« mit 92% als wichtigste Freizeitaktivität2 und wichtigsten Wert im Leben.3 Die Befunde belegen die zentrale Bedeutung von Vergemeinschaftung bei Heranwachsenden in ihrer gegenwärtige Lebens- und Freizeitgestaltung. Gleichzeitig ermöglichen mediale Technologien neue Gestaltungsformen der Vergemeinschaftung, wobei diese bislang als Verlängerungsarm der realen Freundschaftsbeziehungen betrachtet werden.4 Aufgrund des relevanten Vergemeinschaftungsphänomens haben sich in der deutschsprachigen Jugendforschung die englischen Begriffe Peer und Peergroups etabliert.5 Mit Peers werden gleichaltrige und sozial gleichgestellte junge Menschen bezeichnet, deren Beziehungsintensitäten unterschiedliche Ausprägungen annehmen.6 Sie reichen von losen Bekanntschaften bis zu festen Freundschaften, die sich als Peergroups in den Vergemeinschaftungsformen von losen »Kollegen«kreisen (was schweizerdeutsch auch Bezeichnung für eine Kategorie von eher lockeren Freunden bzw. Schulkameraden ist) – bis zu geschlossenen Cliquen oder Banden abbilden.
1 Shell Deutschland Holding (Hg.), Jugend 2010. Eine pragmatische Generation behauptet sich. 16. Shell Jugendstudie. Unter Mitarbeit von Mathias Albert, Klaus Hurrelmann und Gudrun Quenzel, Frankfurt a.M. 2010, 96. 2 Jugendbarometer, Anpacken, solange die Work-Life-Balance stimmt. Beruf als bedeutende, nicht aber zentrale Orientierung für die Schweizer Jugend. Drittes Credit Suisse Jugendbarometer, hg. v. Credit Suisse, unter Mitarbeit von Claude Longchamp et al., Bern 2012 (https://infocus.credit-suisse.com/app/ topic/index.cfm?fuseaction=OpenTopic&coid =371616&lang=DE), 39. 3 Jugendbarometer, WhatsApp und News-Apps auf dem Vormarsch bei digital bewusster Jugend. Abnehmende Sorge um Arbeit, zunehmende Sorge um Verhältnis zur EU und zwischen den Generationen. Fünftes Credit Suisse Jugendbarometer. Schlussbericht, hg. v. Lukas Golder et al., Bern 2014 (http://www. gfsbern.ch/de-ch/Detail/jugendbarometer-20 14-the-fast-and-the-smart-generation-y-im-wa ndel), 25. 4 Vgl. Klaus Neumann-Braun / Ulla P. Autenrieth (Hg.), Freundschaft und Gemeinschaft im Social Web. Bildbezogenes Handeln und Peergroup-Kommunikation auf Facebook & Co., Baden-Baden 2011. 5 Vgl. Jutta Ecarius / Marcel Eulenbach (Hg.), Jugend und Differenz. Aktuelle Debatten der Jugendforschung, Wiesbaden 2012; Lothar Beinke, Der Einfluss von Peer Groups auf das Berufswahlverfahren von Jugendlichen, in: Nikolaus Bley / Marit Rullmann (Hg.), Übergang Schule und Beruf. Aus der Praxis für die Praxis – Region Emscher-Lippe. Wissenswertes für Lehrkräfte und Eltern, Recklinghausen 2006, 249–265. 6 Hans Peter Kuhn / Daniela Wagner, Jugend und Peers, in: Thomas Rauschenbach u.a. (Hg.), Handbuch Jugend. Evangelische Perspektiven, Opladen 2013, 66.
Chiapparini Was heutige Jugendliche an Gemeinschaft schätzen
Im Rahmen der Thematik dieses Bandes, die sich zentral der Frage widmet, wie kommende Generationen Kirche und Gemeinde als prägende Räume der eigenen religiösen Erfahrung wahrnehmen, ist vorerst die jugendsoziologische Frage zu klären, was heutige Jugendliche an Gemeinschaft schätzen, an Individualität brauchen und an Orientierung suchen. Diese dreifache Frage ist umso brisanter vor den kontextuellen und gesellschaftlichen Herausforderungen, denen sich Heranwachsende zu stellen haben, sowie vor den Entwicklungs- und Identitätsprozessen in Familie, Ausbildung und Freizeit, womit die Jugendphase charakterisiert ist.7 Heranwachsende sind beispielsweise schulischen Leistungserwartungen oder elterlichen Zukunftserwartungen ausgesetzt, wodurch sie sich immer mehr zwischen Selbst- und Fremdbestimmung zu orientieren haben. Insbesondere mit dem Berufseinstieg werden Jugendliche mit sozialen und kontextuellen Herausforderungen wie beispielsweise dem Wechsel von der lokalen obligatorischen Schule zur zentralisierten Berufsschule (Mobilität), der generationenübergreifenden Personalbesetzung am Arbeitsplatz oder der veränderten Alltagsstruktur konfrontiert. Anders als in öffentlichen Debatten, in denen der Fokus allzu oft einseitig auf die gesellschaftliche Desintegration von Jugendlichen gerichtet wird, nimmt der vorliegende jugendsoziologische Beitrag Heranwachsende als Akteure in den Blick, die sowohl Probleme machen als auch Probleme haben.8 Deshalb werden aus ihrer Sicht Antworten auf die im Titel enthaltene dreifache Frage nach Gemeinschaft, Individualität und Orientierung bei Jugendlichen in ihrer
53
Freizeitgestaltung gegeben. Die empirische Grundlage der Ausführungen sind Befunde aus der repräsentativen Jugendstudie SoYouth, die Engagement- und Partizipationsformen von Jugendlichen im Kanton Zürich der Sekundarstufe II, sprich der 15- bis 19-Jährigen, untersucht hat.9 Der Beitrag fokussiert vorerst die Orientierungen von Jugendlichen, indem der Frage nachgegangen wird, bei welchen Personen sie Orientierung suchen, wenn sie Probleme haben. Dabei werden zentrale Problembereiche von Jugendlichen und ihre subjektive Gewichtung aufgezeigt. Der zweite Teil widmet sich der ersten Titelfrage: Was Jugendliche an Gemeinschaft schätzen und untersucht den bedeutsamen Einfluss des Elternhauses gegenüber dem Einfluss von Peergroups. Gefragt wird danach, inwiefern Jugendliche grundsätzlich und spezifisch in ihrer Freizeitgestaltung durch Elternhaus und Peergroups beeinflusst werden. Daraufhin werden im dritten Teil des Beitrages Freizeitaktivitäten mit Blick auf institutionelle gegenüber informelle Gemeinschaftsformen aus der Sicht der 7 Vgl. Klaus Hurrelmann / Gudrun Quenzel, Gudrun, Lebensphase Jugend. Eine Einführung in die sozialwissenschaftliche Jugendforschung, Weinheim 112012; Wilfried Ferchhoff, Jugend und Jugendkulturen im 21. Jahrhundert. Lebensformen und Lebensstile, Wiesbaden 22011. 8 Vgl. Axel Groenemeyer (Hg.), Jugend als soziales Problem – Probleme der Jugend? Diagnosen, Diskurse und Herausforderungen, Weinheim 2014. 9 Vgl. zur methodischen Anlage der Studie Emanuela Chiapparini / Verena Kuglstatter / Jan Skrobanek, Jugenddelinquenz im Kanton Zürich. Handreichung Nr. 3 der Forschungsgruppe SoYouth, Zürich 2013, 5–6.
54
Empirische Aspekte
Heranwachsenden erkundet. Am Beispiel von Vereinsaktivitäten, die in der Schweiz traditionsreich und weit verbreitet sind10, ist zu klären, welche Jugendlichen sich an diesen institutionalisierten Freizeitaktivitäten beteiligen und welche Motive sie für die Teilnahme in informellen Peergroups haben, die weniger strukturiert sowie verbindlich sind und sich außerhalb pädagogischer Aufsicht verorten.11 Ausgehend von den gewonnenen Erkenntnissen aus den vorgestellten Befunden und Überlegungen werden abschließend zusammenfassende Antworten auf die dreifache Titelfrage gegeben und mögliche Anknüpfungspunkte für die kirchliche Gemeindearbeit formuliert.
1. Orientierung und wichtige Vertrauenspersonen: Mutter und Peers
Die subjektive Problembewältigung von Jugendlichen muss sich nicht mit derjenigen der Erwachsenen decken. Deshalb ist es umso relevanter, aus der Perspektive der Jugendlichen zu verstehen, bei wem sie Orientierung suchen, wenn sie Probleme haben. Die befragten Jugendlichen konnten auf folgende Fragestellung mit sieben Antwortkategorien und vier Gewichtungen (»oft«, »manchmal«, »selten«, »nie«) Stellung nehmen: »Nun geht es um verschiedene persönliche Probleme, die man haben kann. In den letzten 24 Monaten hatte ich Probleme mit Eltern, Geld, Leben, Lehrpersonen, Freunden, Drogen und Polizei«. Tabelle 1: Subjektive Problemwahrnehmung (N= 2327). Quelle: SoYouthDat 2012.
10 Vgl. Marc Bühlmann / Markus Freitag, Individuelle und kontextuelle Determinanten der Teilhabe an Sozialkapital. Eine Mehrebenenanalyse zu den Bedingungen des Engagements in Freiwilligenorganisationen, in: KZfSS 56/2 (2004), 327. 11 Vgl. Marius Harring, Freizeit, Bildung und Peers – informelle Bildungsprozesse im Kontext heterogener Freizeitwelten und Peer-Interaktionen Jugendlicher, in: Marius Harring u.a. (Hg.), Freundschaften, Cliquen und Jugendkulturen. Peers als Bildungs- und Sozialisationsinstanzen, Wiesbaden 2010, 22–23.
Chiapparini Was heutige Jugendliche an Gemeinschaft schätzen
Die meisten Probleme zeichnen sich mit Eltern, Geld, dem Leben generell und mit Lehrpersonen ab, wobei die 15- bis 19-jährigen Teilnehmenden der SoYouthStudie tendenziell eine geringe subjektive Problemwahrnehmung präsentieren. Die Antwortmöglichkeit »oft« gaben 12.2% der Jugendliche bei Problemen mit Eltern und 10.8% bei Problemen mit Geld an. Wesentlich geringer fallen die Probleme mit dem Leben generell (6.1%) und mit Lehrpersonen (6.1%) aus. Die Angaben für Probleme mit Drogen betrugen nur 3% und Probleme mit Freunden oder mit der Polizei gar nur knapp 1.8% und 1.7%. Obwohl die Problemwahrnehmung eher gering ausfällt, liegen dennoch konkrete Problemfälle vor. So stellt sich die
55
Folgefrage, bei welchen Personen Jugendliche in persönlichen Problemsituationen Orientierung suchen, was mit der Frage erkundet wurde: »Wenn Sie ein ganz persönliches Problem haben und sich einmal richtig aussprechen wollen oder Hilfe brauchen, an wen wenden Sie sich?« Während Jugendliche der Sekundarstufe I, sprich 12- bis 15-Jährige aus einem ländlichen Bezirk des Kantons Schwyz als zentrale Vertrauensperson die Mutter (60%) und darauf folgend die Geschwister und den Kollegenkreis (37%) angeben,12 nehmen bei 15- bis 19-Jährigen im Kanton Zürich neben der zentralen Orientierungsrolle der Mutter (56%) ebenfalls die besten Freunde (56.8%) eine zentrale Rolle ein.
Tabelle 2: Vertrauenspersonen (N= 2371), Mehrfachantworten möglich. Quelle: SoYouthDat 2012.
Der Freundeskreis ist für 43.9% der Jugendlichen als Orientierungsort bedeutsam und auch die Geschwister und der Vater nehmen mit je 34% eine diesbezüglich zentrale Rolle ein. Damit geben 15- bis 19-Jährige im Kanton Zürich an, dass neben der Mutter der beste Freund
und der Freundeskreis als Vertrauenspersonen sehr wichtig sind. Gleichzeitig 12 Emanuela Chiapparini / Jan Skrobanek, Engagement- und Partizipationsformen von Jugendlichen. Eine Vollerhebung unter Oberstufenschülerinnen und -schülern in der March. Forschungsbericht, Zürich 2012.
56
Empirische Aspekte
spiegelt sich in den Antworten der Jugendlichen ein breites Band an Vertrauenspersonen wieder, die bei Problemen beigezogen werden und eine wichtige Funktion einnehmen. So sind Großeltern über die Kategorie »andere Personen in meiner Familie« erfasst, die einen gleich großen Wert wie die Kategorie »spreche mit niemanden darüber« (7.7%) aufweist. Aufgrund des theologischen Kontextes dieses Beitrages ist ergänzend festzuhalten, dass in den Antwortkategorien nicht die Seelsorgerinnen und Seelsorger oder Pfarrerinnen und Pfarrer erfasst wurden. Allerdings haben in den offenen Antwortkategorien sechs Jugendliche von sich aus angegeben, dass sie ihre Probleme mit Gott besprechen oder in der Bibel Rat finden. Nun stellt sich die Frage, wie die Problemtypen die Auswahl der Vertrauenspersonen erklären. Signifikante Zusammenhänge bestehen bei denjenigen Jugendlichen, die die Mutter als zentrale Vertrauensperson angeben und denjenigen, die gleichzeitig Probleme mit Geld (47%), mit Lehrpersonen (45%), mit dem Leben (45%), mit den Eltern (44%) und der Polizei (40%) nannten.13 Ebenso besteht ein signifikanter Zusammenhang zwischen denjenigen Jugendlichen, die die Peergroups als zentrale Vertrauenspersonen deklarieren und gleichzeitig Probleme mit Eltern (59%) nennen.14 Schließlich fällt auf, dass Jugendliche, die Probleme mit Lehrpersonen (11%) und mit dem Leben (13%) angeben, gleichzeitig mit niemanden darüber sprechen.15 Kurz: Die Befunde verweisen auf die zentrale Orientierungsrolle, welche grundsätzlich sowohl die Peers als auch die Mutter einnehmen. Gleichzeitig zeichnen sich problemspezifische Diffe-
renzierungen bei der Auswahl der Vertrauenspersonen ab: In der Peergroup werden eher Probleme mit den Eltern, hingegen werden mit der Mutter eher Probleme mit dem Geld, mit Lehrpersonen, mit dem Leben, mit den Eltern und der Polizei besprochen. Schließlich zeichnet sich ab, dass es Jugendliche gibt, die Probleme mit dem Leben oder mit Lehrpersonen haben, aber keine Unterstützung bei einer Vertrauensperson suchen und damit sich selber überlassen sind. Für Präventionsprogramme ist gerade diese Gruppe im Blick zu behalten. 2. Familie und Peergroup als Gemeinschafts- und Orientierungsorte: Differenzierte Beeinflussung durch Eltern und Peers in Abhängigkeit von Lebensbereichen
Peers und Familie als Gemeinschafts- und Orientierungsorte nehmen, wie aus dem ersten Kapitel hervorging, eine wichtige Vertrauensfunktion ein und gelten darüber hinaus in der Jugendforschung neben der Schule als zentrale Sozialisationsinstanzen. Gleichzeitig wird eine kontroverse Debatte zur positiven und negativen Beeinflussung durch Peers geführt. Zum einen gelten Peergroups seit den Klassikern der Jugendsoziologie als schulische und außerschulische Orte der Normabwei13 Mit Geld: Chi2 =29.2***, Cramer-V = .11***; mit Lehrpersonen: Chi2 = 30.1***, Cramer-V = .11***; mit dem Leben: Chi2 =34.5***, CramerV = .12***; mit Eltern: Chi2 = 92.2***, CramerV = .20***; mit Polizei: Chi2 =15.3***, CramerV = .08***. 14 Mit Eltern: Chi2 = 21.6***, Cramer-V = .10***. 15 Mit Lehrpersonen: Chi2 =12.1**, Cramer-V = .07**; mit dem Leben: Chi2 =36.7***, CramerV = .12***.
Chiapparini Was heutige Jugendliche an Gemeinschaft schätzen
chung und der gesellschaftlichen Desintegration.16 Auf negative Beeinflussungen von Peergroups weisen ebenso aktuelle schulspezifische Untersuchungen hin.17 Zum anderen erkennen Vertreter des positiven Verständnisses von Peergroups diese als wichtige Sozialisationsorte an, die sich sowohl als Potential18 als auch als Freiraum für die Bildung sozialer Kompetenzen und Identität der Jugendlichen19 und als Lernort20 präsentieren. Weiterführend stellt sich die Frage, inwiefern die Peers und die Familie Einfluss auf die Freizeitgestaltung von Jugendlichen haben. Aktuelle Jugendstudien belegen, dass Peers auf die Freizeitgestaltung, auf gegenwartsrelevante Lebensgestaltung und auf das Wohlbefinden einen zentralen Einfluss nehmen.21 Ergänzend dazu besagen weitere Forschungsbefunde, dass die Familie und darin insbesondere die Mutter eine zentrale Rolle in den Lebensbereichen Schule, Ausbildung und Berufsfindung spielt.22 Ebenfalls bestimmt die Familie die politische Werthaltung (und weniger das politische Interesse) der Heranwachsenden wesentlich mit.23 Vor dem Hintergrund, dass Heranwachsende Peers mit ähnlichen Interessen, familiären Hintergründen und Status auswählen24, beeinflusst die Sozialisation in der Familie die Art der ausgewählten Peers mit. Ebenfalls belegt Rieker25 in seiner Studie, dass Probleme innerhalb der Familie und der Peergroup in ähnlicher Art und Weise gelöst werden. Er kommt zum Schluss, dass die Herangehensweisen sowie die Strategien, mit Schwierigkeiten umzugehen, in der Familie gelernt werden und nahezu identisch auch in der Peergroup angewandt werden. Hingegen sind Unterschiede inhaltlicher Art festzustellen: Familie und Peers vertreten beide bei-
57
16 Vgl. Frederic M. Thrasher, The gang. A study of 1,313 gangs in Chicago. Abridged and with a new introduction, Chicago 1967; Hermann Tertilt, Turkish Power Boys. Ethnographie einer Jugendbande, Frankfurt a.M. 1996. 17 Vgl. Heinz-Hermann Krüger u.a., Peer group, educational distinction and educational biographies, in: Childhood 18/4 (2011), 477–490. 18 Vgl. Albert Scherr, Cliquen/informelle Gruppen: Strukturmerkmale, Funktionen und Potentiale, in: Marius Harring u.a. (Hg.), Freundschaften, Cliquen und Jugendkulturen. Peers als Bildungs- und Sozialisationsinstanzen, Wiesbaden 2010, 73–90. 19 Vgl. Roland Eckert, Die Dynamik jugendlicher Gruppen. Über Zugehörigkeit, Identitätsbildung und Konflikt, Weinheim 2012; Hans-Jürgen von Wensierski, Junge Muslime in Deutschland. Lebenslagen, Aufwachsprozesse und Jugendkulturen, Opladen 2007. 20 Vgl. Achim Schröder, Cliquen und Peers als Lernort im Jugendalter, in: Thomas Rauschenbach / Wiebken Düx / Erich Sass (Hg.), Informelles Lernen im Jugendalter. Vernachlässigte Dimensionen der Bildungsdebatte, Weinheim 2006, 173–202; Werner Helsper / Jeanette Böhme, Handbuch der Schulforschung, Wiesbaden 22008; Robert Heyer / Christian Palentien / Aydin Gürlevik, Peers, in: Ullrich Bauer / Uwe H. Bittlingmayer / Albert Scherr (Hg.), Handbuch Bildungs- und Erziehungssoziologie, Wiesbaden 2012, 983–999. 21 Vgl. Heinz Reinders, Jugendtypen zwischen Bildung und Freizeit. Theoretische Präzisierung und empirische Prüfung einer differenziellen Theorie der Adoleszenz, Münster 2006, 262; Helmut Fend, Entwicklungspsychologie des Jugendalters. Ein Lehrbuch für pädagogische und psychologische Berufe, Opladen 3 2003. 22 Bspw. Beinke (wie Anm. 5). 23 Vgl. Johann Bacher, In welchen Lebensbereichen lernen Jugendliche Ausländerfeindlichkeit? Ergebnisse einer Befragung bei Berufsschülerinnen und Berufsschülern, in: KZFSS 58/2 (2001), 334–349. 24 Vgl. Hans Oswald, Sozialisation in Netzwerken Gleichaltriger, in: Klaus Hurrelmann / Matthias Grundmann / Sabine Walper (Hg.), Handbuch Sozialisationsforschung, Weinheim 7 2008, 321–332. 25 Peter Rieker, Problemlösung in Familien und Peergroup, in: Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation 27/3 (2007), 304–319.
58
Empirische Aspekte
spielsweise die Meinung, dass gehandelt werden muss, jedoch nicht wie gehandelt werden soll. Dennoch bleibt festzuhalten, dass die Untersuchung von Rieker26 aufzeigt, dass der Umgang mit Problemen eindeutig innerhalb der Familie erlernt wird. Damit ist aber nicht von vornherein ein positiver Einfluss von Peergroups auf Peers zu prognostizieren, denn ob Peergroups einen möglichen unerwünschten Einfluss nehmen, hängt ebenso von der formalen Gruppenstruktur und deren Geschlossenheit ab. Wenn diese sehr verbindlich und geschlossen ist, haben Eltern einen geringeren Einfluss.27 Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Eltern und Peers als Vertrauenspersonen und die Familie sowie die Peergroup als zentrale Gemeinschaftsorte und Sozialisationsinstanzen eine differenzierte Beeinflussung auf Heranwachsende ausüben, die von den einzelnen Lebensbereichen abhängig ist. Gleichzeitig übernehmen sowohl die Familie als auch die Peergroup eine sich gegenseitig ergänzende Sozialisationsfunktion, indem die Familie primär vermehrt für die Orientierung in die Zukunft (Schule / Ausbildung) zuständig ist und für die Orientierung bezüglich Freizeitgestaltung, gegenwartsrelevante Lebensgestaltung und Wohlbefinden primär die Peers zum Zuge kommen. 3. Institutionelle und informelle Gemeinschaftsformen am Beispiel von Jugendvereinen und informellen Peergroups
Institutionelle Freizeitangebote wie Jugendvereine geben Heranwachsenden einen sozialen Rahmen, um gleichen In-
teressen mit anderen Peers und dies in einer eher verbindlichen und organisierten Form nachzugehen. Die Vereinstätigkeit in der Schweiz hat eine lange Tradition.28 So mag es nicht erstaunen, dass 65% der 12- bis 15-Jährigen im ländlichen Bezirk der March (Kanton Schwyz) angeben, in einem Verein tätig zu sein.29 Hingegen liegt bei den 15- bis 19-Jährigen im Kanton Zürich der Durchschnitt der Vereinsteilnahme bei 47%.30 Dies entspricht den Befunden der Shell-Studie in Deutschland, in denen 12- bis 25-Jährige befragt wurden.31 Die Vereinsangebote sind regionsabhängig und sehr vielfältig. 36% der 15bis 19-Jährigen im Kanton Zürich geben an, dass sie in einem oder mehreren Sportvereinen aktiv sind. Damit kommt dem Sportverein der weitaus höchste Beliebtheitsgrad im institutionellen Freizeitengagement zu. Aber auch in Musikvereinen (5%), Freizeitvereinen (5%) oder kirchlichen sowie religiösen Vereinen (4%) sind die Jugendlichen aktiv. Damit sind die Vereinsarten erwähnt, welche die Jugendlichen am meisten genannt haben. Befunde zu Vereinsaktivitäten von Jugendlichen belegen, dass insbesondere männliche Jugendliche unter 16 Jahren, 26 Ebd., 315. 27 Vgl. Kurt Möller / Nils Schuhmacher, (Hg.), Rechte Glatzen. Rechtsextreme Orientierungsund Szenezusammenhänge: Einstiegs-, Verbleibs- und Ausstiegsprozesse von Skinheads, Wiesbaden 2007. 28 Vgl. Bühlmann / Freitag (wie Anm. 10). 29 Vgl. Emanuela Chiapparini / Jan Skrobanek (wie Anm. 12). 30 SoYouthDat, Datensatz der Jugenduntersuchung im Kanton Zürich (SoYouth), Jan Skrobanek / Emanuela Chiapparini / Vera Kuglstatter, Zürich 2012. 31 Shell Deutschland Holding (wie Anm. 1), 156.
Chiapparini Was heutige Jugendliche an Gemeinschaft schätzen
die keinen Migrationshintergrund haben und deren Eltern über hohe Bildungsabschlüsse verfügen, in Vereinen aktiv sind.32 Das heißt, dass weibliche Jugendliche, Jugendliche über 16 und Jugendliche mit Migrationshintergrund eine geringere Einbindung in Vereinsaktivitäten finden. Zudem zeichnet sich in der Forschung zur Vereinsteilnahme ab, dass mit zunehmendem Alter das Bedürfnis nach unverbindlichen Aktivitäten, offenen Gestaltungsräumen und Aktivitäten steigt, die
59
frei von pädagogischer Aufsicht sind.33 Dabei spielt die Attraktivität der Angebote oder die Vertrautheit mit den Personen eine nachrangige Rolle.34 Wenn Jugendliche gefragt werden, mit wem sie ihre Freizeit am häufigsten verbringen, geben sie abgrenzend zu allen anderen Personengruppen ihren Kollegenkreis an (58.7%). Demgegenüber nimmt das Zusammensein mit Freundin/Freund (19.3%), mit der Familie (14.9%), und in einer
Tabelle 3: Personen, mit denen am häufigsten die Freizeit verbracht wird (N= 2371). Quelle: So YouthDat 2012. 32 Vgl. Emanuela Chiapparini/ Jan Skrobanek, Alles eine Frage der Lebenslage? – Vereinsaktivitäten von Jugendlichen im Kanton Zürich. Schweizerische Zeitschrift für Soziologie 41 (2015); Thomas Gensicke, Freiwilligensurvey, in: Thomas Olk / Birger Hartnuss (Hg.), Handbuch bürgerschaftliches Engagement, Weinheim 2001, 691–704; Sigrid Meinhold-Henschel (Hg.), Kinder- und Jugendbeteiligung in Deutschland. Entwicklungsstand und Handlungsansätze, Gütersloh 2007; Wolfgang Gaiser / Martina Gille, Soziale und politische Partizipation. Trends, Differenzierungen, Herausforderungen, in: Thomas Rauschenbach / Walter Bien (Hg.), Aufwachsen in Deutschland. AID:A – der neue DJI-Survey, Weinheim 2012, 136–159; Wolfgang Gaiser Jo-
hann de Rijke, Gesellschaftliche Beteiligung der Jugend. Handlungsfelder, Entwicklungstendenzen, Hintergründe, in: aus politik und zeitgeschichte 44 (2001), 8–16. 33 Bspw. Scherr (wie Anm. 17); Klaus Farin, Jugendkulturen als Sozialisationsinstanzen, in: Imbke Behnken / Jana Mikota (Hg.),Sozialisation, Biografie und Lebenslauf. Eine Einführung. Weinheim 2009, 110–120. 34 Bspw. Chiapparini / Skrobanek (wie Anm. 28); Barbara Hölscher, Sozialisation, Sozialisationskontexte, schichtspezifische Sozialisation, in: Herbert Willems (Hg.), Lehr(er)buch Soziologie. Für die pädagogischen und soziologischen Studiengänge, Wiesbaden 2008, 747–771.
60
Empirische Aspekte
Gang (3.3%) einen viel geringeren zeitlichen Stellenwert ein. Ebenso verbringen nur wenige Jugendliche (3.4%) häufig Zeit alleine. Die Kollegenkreise treffen sich teilweise in den Vereinsangeboten oder in den Ausbildungsstätten und in Form von informellen Peergroups und zu nicht institutionalisierten Freizeitbeschäftigungen. Aus selbstgeführten Gruppendiskussionen mit vier urbanen Peergroups im Rahmen der SoYouth-Studie35 zeichnen sich zentrale Aktivitäten ab, wie beispielsweise Autoausflüge, Shoppen, Chillen am See / im Park, Ferien, Club, Konzerte / Musik, Sport. Die Vereinstätigkeit wird nicht thematisiert, ebenso ist keiner der 16- bis 21-jährigen Peers gegenwärtig in einem Verein aktiv. Als Hauptmotiv des Zusammenseins in den Peergroups präsentiert sich aus den Gesprächen das »Spaß haben«. Zudem betonen Jugendliche aus zwei bezüglich sozialem Hintergrund36 unterschiedlich »belasteten« Gruppen (Gruppe Motor37 und Gruppe Ferien) weitere Motive. Die Gruppe Motor mit einem sozial belasteten Hintergrund präsentiert kollektive Motive, was folgender Gesprächsausschnitt besonders gut verdeutlicht: Am: Also, je nach dem. Cm: Es geht darum – Bm: Spass haben. Am: Den Spass haben, und etwas erleben. Cm: Jaa. Bm: Ich möchte einmal meinen Kindern etwas erzählen können. Am: Ja etwas spät – Am: Also, nicht unbedingt von Drogen und so einfach Cm: (Lachen) Am: Das man hät können, »Crème de la Crème« vom Leben sehen, oder. Cm: (Lachen)
An den gemeinsamen Aktivitäten in der Peergroup schätzen die drei Mitglieder der geschlossenen Gruppe Motor, dass sie miteinander Spaß haben und etwas erleben wollen. Dazu unternehmen sie Autoausflüge im Kanton Zürich bis nach Luzern, wie sie in anderen Gesprächsabschnitten ausführen. Ihnen ist wichtig, etwas Neues kennenzulernen. Um Besonderes im Sinne von »Crème de la Crème« zu erleben, haben sie sich zudem eine Reise nach London geleistet und planen eine Reise nach Dubai. Die Schilderungen und Gesprächsinhalte der Jugendlichen geben Indizien, wie sie aus ihrem eher langweiligen Alltag und Quartier ausbrechen wollen, um dann später den eigenen Kindern etwas erzählen zu können. Ein angepasstes Leben mit Familie, was sie explizit als elterliche Erwartungen beschreiben, planen sie unumstritten, aber zu einem späteren Zeitpunkt als ihre Eltern es sich wünschen. Demgegenüber betont die Gruppe Ferien mit einem sozial unbelasteten Hintergrund, wie sie den Gesprächsaustausch und den Spaß am Zusammensein schätzen. An folgender Passage wird dies explizit und unterstützend diskutiert:
35 Vgl. Emanuela Chiapparini / Anastasiya Kovalova, Konfliktlinien zwischen berufstätigen Jugendlichen und elterlichen Erwartungen bezüglich Freizeitgestaltung, in: Sabine Stövesand / Dieter Röh (Hg.), Konflikte – theoretische und praktische Herausforderungen für die Soziale Arbeit, Opladen, Berlin / Toronto 2015, 140–151. 36 Die soziale Belastung ist aufgrund der Sozialhilfeleistungen der jeweiligen Wohnorte bestimmt. 37 Bei den Namen der Gruppen handelt es sich um Decknamen.
Chiapparini Was heutige Jugendliche an Gemeinschaft schätzen
Ew: Also vor allem eben was mir sehr wichtig ist, ist einfach das man ein bisschen (»chli«) miteinander reden kann, dass man einfach Zeit zum reden hat, und über alles reden kann, mit den be- also mit den nächsten Freunden und einfach auch Spass haben. Aw: Das ist bei mir auch so, also vor allem einfach auch so der Austausch, weil ich meine, wir haben vielmals einen völlig anderen Alltag jetzt mittlerweile und dann finde ich es schön zu hören, wie geht es ihr bei der Arbeit (»bim schaffe«) und sie fragt mich: »Wie geht es dir in der Schule?«, und einfach so ein bisschen das Interesse gegenseitig zeigen, so. Cm: Ja bei mir ist es eigentlich auch meistens, also ich habe eben auch, eigentlich sehr gerne ab und zu auch ein bisschen so kulturelle Sachen, mal ein bisschen in ein Museum gehen, bin so eher an Kunst interessiert, ins Museum gehen, einmal vielleicht auch
Die kommunikative Funktion der Peergroup und der Ausbruch über den Schulund Arbeitsalltag dokumentieren sich als kollektive Orientierung. Zudem zeichnet sich an den geordneten und nicht gleichzeitigen Wortmeldungen – kontrastierend zur Gruppe Motor – wie die Gruppe Ferien tatsächlich eine respektvolle Kommunikationskultur pflegt. Darüber hinaus verweisen die Hinweise von »Cm« auf die hochkulturellen Interessen, die an anderen Stellen nicht von allen Peers geteilt werden. Zusammenfassend und vor dem Hintergrund der verschulten Jugendphase und den vielfältigen kommerziellen und nicht-kommerziellen Freizeitangeboten zeichnet sich eine hohe Vereinstätigkeit bei den Jugendlichen im Kanton Zürich ab. Gleichzeitig kommt den informellen
61
Peergroups als Vergemeinschaftungsform eine wichtige Funktion zu, indem Jugendliche zusammen aus ihrem Herkunfts-, Schul- und Arbeitsalltag ausbrechen können und ihren Interessen kollegial und ohne pädagogische Aufsicht nachgehen können. 4. Fazit
Ausgehend von den Befunden der Jugendstudie SoYouth und Verweisen auf weitere jugendsoziologische Studien konnten zentrale Erkenntnisse zu Vertrauenspersonen, Einflussgrößen und institutionellen sowie informellen Freizeitbeschäftigungen gewonnen werden. Damit sind wichtige Anhaltspunkte gegeben, um zusammenfassende Antworten auf die Fragen zu geben: Was schätzen heutige Jugendliche an Gemeinschaft? Was brauchen sie an Individualität? Was suchen sie an Orientierung? Aus den vorgestellten empirischen Befunden geht hervor, dass Jugendliche gleichzeitig unterschiedliche Vertrauenspersonen bei Problemen angeben. Darin sprechen sie den Peers und der Mutter eine zentrale Orientierungsrolle zu, deren Bedeutung allerdings in den einzelnen Problembereichen unterschiedlich gewichtet ist. Gleichzeitig kommt der Peergroup eine ergänzende Sozialisationsfunktion zur Familie zu und beide fungieren als Orientierungsorte für die Unterstützung der Jugendlichen in differenzierten Lebensbereichen. Jugendliche schätzen sowohl die Gemeinschaft in institutionellen Freizeitangeboten wie beispielsweise Jugendvereinen als auch die Gemeinschaft in informellen Peergroups außerhalb von pädagogischer
62
Empirische Aspekte
Aufsicht und institutionellen Instanzen. Damit wäre ein integrativer Ansatz von institutionellen Freizeitangeboten und informellen Aktivitäten von Peergroups zu empfehlen, denn einerseits profitieren die Peers und die Peergroups unter sich von einem Vertrauensvorschuss, der als solcher nicht immer gegenüber Erwachsenen gegeben ist, aber gleichzeitig gilt bei auf die Zukunft ausgerichteten Lebensbelangen insbesondere die Mutter als zentrale Vertrauensperson. Andererseits ist in der Jugendphase die zunehmende Selbstbestimmung gegenüber der Fremdbestimmung ausschlaggebend, sodass das Bedürfnis nach dem Zusammensein mit Peers in einer offenen sowie unverbindlichen Form und ohne pädagogische Aufsicht in der Jugendphase ausgeprägter ist als in anderen Lebensphasen.38 Zudem gilt gerade die Peergroup als Ort der impliziten oder expliziten Bewältigung von Problemen und als Gestaltungsraum. In der gegenwärtigen verschulten Jugendzeit und in Zeiten des gesellschaftlichen Wandels hin zu einer stärkeren Leistungsorientierung stellen Peergroups geschätzte und unverbindliche Freiräume für Jugendliche dar, deren Bedeutung bezüglich gesellschaftlich integrativer Funktion noch ungenügend erkundet ist. Zudem erlauben neue Kommunikationstechnologien wie Facebook oder Whatsapp individuellere und kreativere Formen der freundschaftlichen und kollegialen Austauschorganisation. Darin werden reale Freundschaftsbeziehungen mit Umgangsformen mit Peers im Netz verknüpft, wobei letzteres als erweiterter Handlungsbereich zu verstehen ist, in dem die realen Freundschaften in der medialen Welt weitergeführt werden.39 An dieser Schnittstelle besteht noch
weiterer Forschungsbedarf, damit digitale Handlungsprozesse von Peergroups für Außenstehende wie Erziehungsverantwortliche zugänglich gemacht werden können. Kirchliche Gemeinden bieten unterschiedliche Räume, in denen sowohl institutionelle als auch informelle Freizeitgestaltungen von Jugendlichen stattfinden. Mit Blick auf die vorgenommenen jugendsoziologischen Reflexionen zu Gemeinschaft, Individualität und Orientierung ist eine Förderung von Elternzusammenarbeit sowie Elternbildung, als auch von Peergroups weiterhin zu stärken. Denn gerade Eltern und Peers nehmen entscheidende Orientierungsfunktionen ein. Vor dem Hintergrund der Vereinsaktivitäten und der intensiv geführten Freizeitaktivität in Kollegen- und Freundeskreisen lohnt es sich, verstärkt informelle Angebote zu entwickeln, die ebenfalls für Jugendliche über 17 Jahren, weibliche Jugendliche und Jugendliche mit Migrationshintergrund attraktiv sind, die sich für eine Vereinstätigkeit weniger angesprochen fühlen. In diesem Zusammenhang bestehen Ansätze von Peer-Education40, in denen Gleichaltrige als Leiter eingesetzt werden und auf einer Peer-Ebene die Jugendlichen wirkungsvoll erreicht werden. Diese Ansätze werden bezüglich Kirchgemeinden 38 Vgl. Hurrelmann und Quenzel (wie Anm. 7). 39 Vgl. Wilfried Ferchhoff, Mediensozialisation in Gleichaltrigengruppen, in: Ralf Vollbrecht / Claudia Wegener (Hg.), Handbuch Mediensozialisation. Wiesbaden 2010, 192–200. 40 Vgl. Robert Heyer, Peer-Education – Ziele, Möglichkeiten und Grenzen, in: Marius Harring u.a. (Hg.), Freundschaften, Cliquen und Jugendkulturen. Peers als Bildungs- und Sozialisationsinstanzen, Wiesbaden 2010, 407–421.
Chiapparini Was heutige Jugendliche an Gemeinschaft schätzen
differenziert diskutiert41 und haben vereinzelt beispielsweise in der Konfirmanden- und Firmarbeit Eingang gefunden, indem etwa ehemalige Konfirmanden und Gefirmte als Leiter eingesetzt werden. Solche Entwicklungen sind weiter voranzubringen, um vorhandene Kompetenzen der neuen Generationen ernst zu
63
nehmen und um vermehrt aus ihrer Sicht Kirchgemeindearbeit zu leisten. 41 Vgl. Arne Schäfer, Peerbeziehungen zwischen Tradition und Moderne – Gleichaltrigengruppen und Jugendkultur in evangelikalen Aussiedlergemeinden, in: Harring (wie Anm. 17), 339–363.
64
Empirische Aspekte
Stefan Huber Religiöse Erfahrungen nehmen zu! Längsschnittanalysen zur Religiosität junger Erwachsener in den westeuropäischen Daten des Religionsmonitors 2008 und 2013 In meinem Beitrag interessiere ich mich für die Frage, ob die Religiosität junger Erwachsener in den letzten Jahren eher zu- oder eher abgenommen hat, in welchen Bahnen derartige Dynamiken ablaufen und ob dabei unterschiedliche Gestalten von religiösen Konstrukt räumen beobachtbar sind. Empirische Basis sind die westeuropäischen Daten (Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Schweiz) von jungen Erwachsenen (bis einschließlich 25 Jahren) im Religionsmonitor 2008 und 2013. Wie der Titel bereits andeutet, besteht der wichtigste empirische Befund in einer deutlichen Zunahme von religiösen Erfahrungen in den letzten fünf Jahren. Dieser Befund wird detailliert analysiert sowie religionssoziologisch und empirisch-theologisch diskutiert.1 1. Theoretische Hintergründe
Der religionssoziologische Hintergrund meines Beitrags ist die Debatte zwischen säkularisierungs- und individualisierungstheoretischen Ansätzen über die Zukunft von Religion, Religiosität und Spiritualität. Säkularisierungstheoretische Ansätze2 verbindet die Grundthese, dass Religion im Prozess der Modernisierung an sozialer und individueller Bedeutung verliert. Das müsse nicht zwangsläufig zu einem restlosen Verschwinden
religiöser Institutionen, Praktiken und Vorstellungen führen. Doch ein fortschreitender Bedeutungsverlust des Religiösen auf allen Ebenen der Gesellschaft und in allen Dimensionen der Religiosität ist in dieser Perspektive unvermeidbar. Daneben ist diesen Ansätzen eine makrosoziologische Perspektive gemeinsam. Deshalb wird der Fokus oft auf religiöse Institutionen und Prozesse der Tradierung und der Sozialisation religiöser Inhalte und Praktiken gerichtet. Dementsprechend kommen in empirischen Untersuchungen säkularisierungstheoretischer Provenienz vor allem Indikatoren institutioneller Religiosität wie Kirchenmitgliedschaft, Gottesdienstteilnahme, Glaube an traditionelle religiöse Vorstellungen und die Befolgung religiöser Vorschriften im Alltag sowie Indikatoren 1 Diese Analysen stellen zum Teil eine Fortsetzung meiner nur auf die deutschen Daten des Religionsmonitors bezogenen Analysen dar. Vgl. dazu: Stefan Huber, Anzeichen einer Trendwende? Längsschnittanalysen zum Religionsmonitor 2008 und 2013, in: Birgit Weyel/ Peter Bubmann (Hg.), Kirchentheorie. Praktisch-theologische Perspektiven auf die Kirche, Leipzig 2014, 94–114. 2 Vgl. Detlef Pollack, Säkularisierungstheorie, in: https://docupedia.de/zg/Saekularisierungs theorie?oldid=85955; Gert Pickel, Säkularisierung, Individualisierung oder Marktmodell? Religiosität und ihre Erklärungsfaktoren im europäischen Vergleich, in: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 62 (2010), 219–245.
Huber Religiöse Erfahrungen nehmen zu!
zur religiösen Sozialisation zur Anwendung. Unterschiede zwischen diesen Ansätzen ergeben sich vor allem aufgrund verschiedener Schwerpunktsetzungen in Bezug auf Merkmale und Prozesse der Moderne, die zu einem Bedeutungsverlust des Religiösen führen. Beispiele für derartige Prozesse sind die Rationalisierung, funktionale Differenzierung und kulturelle Pluralisierung der Gesellschaft, sowie die durch das ökonomische Wachstum fortschreitende Sicherung der materiellen Existenz breiter Bevölkerungsschichten. In Bezug auf junge Erwachsene erwarten säkularisierungstheoretische Ansätze einen kontinuierlichen und deutlichen Rückgang der Religiosität in allen Dimensionen. Dafür sind zwei Faktoren maßgeblich: Junge Erwachsene sind im Zeitverlauf immer stärker durch Modernisierungsprozesse geprägt und zugleich immer weniger in Prozesse religiöser Sozialisation integriert. Demgegenüber verbindet individualisierungstheoretische Ansätze3 die Grundthese, dass Religiosität in der Moderne nicht verschwindet, sondern lediglich ihre inhaltliche Gestalt verändert. Dabei wird von anthropologischen Reflexionen ausgegangen, die meist zum Postulat der Unausweichlichkeit religiöser Erfahrungen führen. Sie gehören zum Menschsein und bilden eine unversiegbare Quelle religiösen Erlebens und Verhaltens. Ergänzend wird – wie bei säkularisierungstheoretischen Ansätzen – auf soziologische Individualisierungstheorien zurückgegriffen, in denen die Modernisierung als Prozess zunehmender Selbstbestimmung des Individuums thematisiert wird. In religiöser Hinsicht führe dies zur »Abnabelung« von religiösen Institutionen und begünstige den
65
Aufbau »hybrider« religiöser Identitäten, die sich unabhängig von institutionellen Normierungsversuchen entwickeln. Der Individualisierung der Religiosität wohnt somit auch eine Tendenz zu ihrer Pluralisierung inne. Der entscheidende Unterschied zu säkularisierungstheoretischen Ansätzen ist somit die Berücksichtigung einer anthropologischen Quelle von Religiosität. In der Forschung wird eine mikrosoziologische Perspektive bevorzugt, die oft mit qualitativen Methoden rekonstruktiv nach neuen Gestalten und Konfigurationen des Religiösen fragt. In Bezug auf junge Erwachsene rechnen individualisierungstheoretische Ansätze insgesamt mit einer Konstanz des Religiösen, wobei sich jedoch ihr Schwerpunkt von institutionellen Dimensionen auf personale Dimensionen verschieben und eine zunehmend autonome Gestalt gewinnen sollte. Daher sollten die Dimensionen der religiösen Erfahrung und Intellektualität zumindest relativ im Vergleich zu anderen Dimensionen an Gewicht gewinnen. In empirisch-theologischer Perspektive orientiert sich mein Beitrag an einem Selbstverständnis Empirischer Theologie, die sich nicht primär normativ versteht, sondern rekonstruktiv, spiegelnd und dialogisch agiert. In ihrer Forschung rekonstruiert Empirische Theologie Gestalten subjektiv-theologischer Sinnkonstruktionen in personalen und sozialen Lebenswirklichkeiten. Die Ergebnisse ihrer Forschung macht sie insbesonde3 Vgl. Paul L. Heelas / Linda Woodhead, The spiritual revolution: why religions giving way to spirituality, Malden MA 2005; Hubert Knoblauch, Populäre Religion. Auf dem Weg in eine spirituelle Gesellschaft, Frankfurt a.M. 2009.
66
Empirische Aspekte
re einer kirchlichen Öffentlichkeit zugänglich. Damit spiegelt sie der Kirche und Öffentlichkeit Aspekte der von ihr gelebten Religiosität. Dadurch erfüllt die Empirische Theologie eine zutiefst kirchliche Funktion. Denn sie tritt mit dem Kollektiv der Glaubenden in einen Dialog über die Zukunft von Kirche, Theologie und Gesellschaft ein. Ein zentraler Begriff für ein derartiges Konzept Empirischer Theologie ist »religiöser Konstruktraum«. Darunter verstehe ich einen Wahrnehmungs-, Erfahrungs- und Handlungsraum, der sich einem Individuum öffnet, wenn es etwas mittels seiner religiösen Konstrukte wahrnimmt und konstruiert. Für die empirische Untersuchung religiöser Konstrukträume bietet sich das in Tabelle 1 schematisch dargestellte Modell der Religiosität4 an. Die darin definierten Kerndimensionen können als Hauptachsen religiöser Konstrukträume verstanden werden. In dem Modell unterscheide ich zwischen sozialen und personalen Kerndimensionen der Religiosität. Das Hauptmerkmal sozialer Dimensionen ist, dass sie nur in der Interaktion mit Anderen realisiert werden können. Daher sind in ihnen Angebote und Normen religiöser Institutionen besonders stark wirksam. Sie führen zum Aufbau einer sozialen, religiösen Identität und dem Gefühl einer bestimmten, sozial abgrenzbaren, religiösen Gruppe anzugehören. Demgegenüber kann Religiosität in personalen Dimensionen ohne soziale Interaktionen gelebt werden. Extrembeispiele sind religiöse Einsiedler. Dies bedeutet nicht, dass personale Dimensionen immer oder auch nur hauptsächlich allein ausgeführt werden. Gleichwohl beinhalten sie Potentiale, eine personale
religiöse Identität aufzubauen, die sich der Kontrolle durch religiöse Institution entziehen kann. Von sozialen und personalen Kerndimensionen unterscheidet das Modell weiterhin allgemeine Religiositätsmaße. Dabei unterscheide ich zwischen einem objektiven Maß zur Zentralität der Religiosität und ihrer subjektiven Selbstwahrnehmung. Im Zentralitätsmaß werden die Auskunftspersonen nicht direkt danach gefragt, wie religiös sie sind, sondern sie werden gefragt, wie oft sie bestimmte Dinge tun (über religiöse Fragen nachdenken, beten, meditieren, an Gottesdiensten teilnehmen) wie oft sie bestimmte religiöse Erfahrungen machen und wie plausibel für sie die Existenz einer höheren Macht ist. Aus der Summe der Antworten wird auf die Präsenz religiöser Inhalte im personalen Lebenshorizont geschlossen. Daher kann von einem objektiven Maß der Religiosität gesprochen werden, das über Erlebens- und Verhaltensbeschreibungen sowie Plausibilitätsschätzungen das religiöse Sein abzubilden versucht. Demgegenüber bilden direkte Fragen nach der Stärke der eigenen Religiosität oder Spiritualität eher das religiöse Bewusstsein ab. In Tabelle 1 ist das Modell schematisch dargestellt. Zu jeder Kerndimension ist der Modus ihrer psychologischen Funktionsweise benannt. Darüber hin4 Vgl. Stefan Huber, Zentralität und Inhalt. Ein neues multidimensionales Messmodell der Religiosität, Opladen 2003; Ders., Der Religiositäts-Struktur-Test (R-S-T). Kernkonzepte und Anwendungsperspektiven, in: Prävention. Zeitschrift für Gesundheitsförderung 31 (2008), 38f.; Stefan Huber / Odilo Huber, The Centrality of Religiosity Scale (CRS), in: Religions 3 (2012), 710–724, Online: http://www. mdpi.com/2077-1444/3/3/710.
Huber Religiöse Erfahrungen nehmen zu!
aus sind zu allen Kerndimensionen und den Maßen der allgemeinen Religiosität Grundfragen formuliert. Auf diese Wei-
67
se soll die relative Eigenständigkeit und Eigenlogik jeder Kerndimension veranschaulicht werden.
Tabelle 1: Modell der Religiosität Kerndimensionen der Religiosität Sozial
Psychologische Grundfrage Funktionsweise
Institution
dazugehören
Gehöre ich zu einer religiösen Gemeinschaft?
Ritual
sich beteiligen
Beteilige ich mich an religiösen Ritualen?
Verhalten (Alltag)
orientieren
Orientiere ich mich im Alltag an religiösen Konzepten?
soziale religiöse Identität Personal
Ideologie
glauben
Glaube ich an irgendeine Art von Transzendenz?
Intellekt
denken
Denke ich über religiöse Fragen nach?
Devotion
sich hingeben
Übe ich irgendeine Frömmigkeitspraxis aus?
Erfahrung
wahrnehmen
Nehme ich irgendeine Art von Transzendenz wahr?
personale religiöse Identität Allgemeine Masse der Religiosität Zentralität der Religiosität (»objektiv«)
Wie oft und stark sind religiöse und spirituelle Inhalte in meinem Lebenshorizont präsent?
Religiöses Selbstbild
Wie religiös bin ich?
Spirituelles Selbstbild
Wie spirituell bin ich?
Religiös-spirituelles Selbstbild
Wie religiös oder spirituell bin ich?
2. Methode
Die Operationalisierung von sechs Kerndimensionen und der allgemeinen Religiosität ist in Tabelle 2 dargestellt. Die meisten Indikatoren erklären sich von selbst. Drei Indizes werden durch inklusiv disjunktive Verknüpfungen (inklusives ODER)
von zwei Indikatoren gebildet (Devotion [ODER], Erfahrung [ODER] und religiös-spirituelles Selbstbild [ODER]). Dabei wird nicht der Durchschnitt der beiden Indikatoren berechnet, sondern der höhere Wert gezählt. Auf diese Weise wird ermittelt, wie stark die jeweilige Dimension im Allgemeinen ausgeprägt ist.
68
Empirische Aspekte
Tabelle 2: Operationalisierung des Modells der Religiosität Kerndimensionen der Religiosität Sozial
Personal
Operationalisierung
Institution
Zweistufiger Index aus den Fragen zur religiösen und konfessionellen Zugehörigkeit. (0 = ohne Konfession, 1 = gehört einer Konfession an)
Ritual
Wie oft nehmen Sie an Gottesdienten teil? (1 = nie, 5 = sehr oft)
Verhalten (Alltag)
–
Ideologie
Wie stark glauben Sie daran, dass Gott oder etwas Göttliches existiert? (1 = gar nicht, 5 = sehr)
Intellekt
a) Allgemein
Wie oft denken Sie über religiöse Fragen nach? (1 = nie, 5 = sehr oft)
b) Reflexivität Devotion
Erfahrung
a) Gebet
Wie oft beten Sie? (1 = nie, 5 = sehr oft)
b) Meditation
Wie oft meditieren Sie? (1 = nie, 5 = sehr oft)
Devotion (ODER)
Index aus dem höheren Wert des Gebets und der Meditation
a) Du-Erfahrung
Wie oft erleben Sie Situationen, in denen Sie das Gefühl haben, dass Gott oder etwas Göttliches in Ihr Leben eingreift? (1 = nie, 5 = sehr oft)
b) All-Erfahrung
Wie oft erleben Sie Situationen, in denen Sie das Gefühl haben, mit Allem Eins zu sein? (1 = nie, 5 = sehr oft)
Erfahrung (ODER)
Index aus dem höheren Wert der Du- und All-Erfahrungen
Allgemeine Masse der Religiosität Zentralität der Religiosität (»objektiv«)
Fünfstufiger Index aus den Fragen zum Ritual und den personalen Kerndimensionen (1 = niedrig, 5 = hoch)
Religiöses Selbstbild
Alles in Allem: Als wie religiös würden Sie sich selbst bezeichnen? (1 = gar nicht, 5 = sehr)
Spirituelles Selbstbild
Einmal abgesehen davon, ob Sie sich selbst als religiöse Person bezeichnen oder nicht, als wie spirituell würden Sie sich selbst bezeichnen? (1 = gar nicht, 5 = sehr)
Religiös-spirituelles Selbstbild (ODER)
Index aus dem höheren Wert des religiösen und spirituellen Selbstbilds
Alle Längsschnittanalysen basieren auf den gewichteten Daten des Religionsmonitors 2008 (N ≈ 470) und des Religionsmonitors 2013 (N ≈ 736) aus vier westeuropäischen Staaten (Deutschland, Frankreich, Großbritannien und der Schweiz). Dabei wird auf die in Tabelle 2 benannten Indikatoren zu-
rückgegriffen. Nach dem Verhalten im Alltag wurde nur im Religionsmonitor 2008 gefragt. Daher sind in Bezug auf diese Kerndimension keine Längsschnittanalysen möglich. Bei allen Dimensionen werden Veränderungen von 2008 zu 2013 durch einfaktorielle ANOVAs untersucht.
Huber Religiöse Erfahrungen nehmen zu!
3. Befunde
Die Befunde der Längsschnittvergleiche werden in drei Tabellen dargestellt. Darauf aufbauend hebe ich jeweils die wichtigsten Ergebnisse stichpunktartig hervor. Als Ausgangspunkt dient die Gesamtstichprobe der jungen Erwachsenen bis 25 Jahre Deutschland, Frankreich, Großbritannien und der Schweiz (Tabelle 3), darauf aufbauend werden die Befunde der Teilstichproben der jungen Erwachse-
69
nen ohne Religionszugehörigkeit (Tabelle 4) und der jungen Erwachsenen mit Religionszugehörigkeit (Tabelle 5) dargestellt. Die Ergebnistabellen sind analog zu den Tabellen 1 und 2 zur Systematik des Modells der Religiosität und seiner Operationalisierung aufgebaut. Zu jedem Merkmal ist bei beiden Untersuchungsjahren jeweils der Mittelwert angegeben. Signifikante Veränderungen sind durch Fettdruck und Angabe des Signifikanzniveaus hervorgehoben.
Tabelle 3: Veränderung der Religiosität in Westeuropa (Deutschland, Frankreich, Großbritannien und der Schweiz) bei jungen Erwachsenen bis 25 Jahre (Mittelwerte) Kerndimensionen der Religiosität
Befragungszeitpunkt 2008 (N≈470)
2013 (N≈736)
Mittelwert
Mittelwert
0,67
0,65
Sozial
Institution Ritual
2,29
2,28
Personal
Ideologie
3,19
3,18
Intellekt Devotion
Erfahrung
a) Allgemein
2,84
2,85
b) Reflexivität
2,66
2,79*
a) Gebet
2,29
2,35
b) Meditation
1,73
1,82
Devotion(ODER)
2,58
2,60
a) Du-Erfahrung
2,10
2,39**
Höhe der signifikanten Veränderung
+0,13
+0,30
b) All-Erfahrung
2,05
2,35**
+0,30
Erfahrung (ODER)
2,48
2,80**
+0.32
Zentralität der Religiosität (CRSi-7)
2,68
2,73
Religiöses Selbstbild
2,30
2,43+
Spirituelles Selbstbild
2,47
2,42
Religiös-spirituelles Selbstbild (ODER)
2,76
2,85
Allgemeine Masse der Religiosität
** p < 0,01, * p < 0,05, + p < 0,1
+0,13
70
Empirische Aspekte
Bei der Gesamtstichprobe der in Westeuropa in den Jahren 2008 und 2013 befragten jungen Erwachsenen (bis 25 Jahre) sind folgende Grundtendenzen erkennbar (vgl. Tabelle 3): In Bezug auf die sozialen Kerndimensionen ist Stabilität der Religiosität beobachtbar. Dies gilt sowohl für die Zugehörigkeit zu religiösen Institutionen als auch für die Häufigkeit der Teilnahme an religiösen Ritualen. Der Rückgang der Zugehörigkeit von 67 Prozent auf 65 Prozent im Jahr 2013 ist statistisch nicht signifikant. Daher kann es sich auch um einen zufälligen Effekt handeln. Im Jahr 2013 nahmen etwa 18 Prozent der befragten jungen Erwachsenen mindestens einmal im Monat an einem Gottesdienst teil. Demgegenüber ist in Bezug auf die personalen Kerndimensionen der Religiosität nicht nur Stabilität, sondern ein Anwachsen der Religiosität feststellbar: Die Dimensionen der religiösen Ideologie und der Devotion bleiben stabil. Im Jahr 2013 gaben 41 Prozent der Befragten an, »ziemlich« oder »sehr« an Gott zu glauben, 30 Prozent praktizierten mindestens mehrmals in der Woche Gebet oder Meditation. Bei der religiösen Intellektualität zeigen sich unterschiedliche Tendenzen. Das allgemeine Maß bleibt konstant, 2013 dachten etwa 31 Prozent »oft« oder »sehr oft« über religiöse Fragen nach. In Bezug auf die religiöse Reflexivität ist jedoch ein signifikanter Anstieg um 0,12 Skalenpunkte feststellbar. Dies bedeutet, dass die Bereitschaft, selbstkritisch über religiöse Fragen nachzudenken, zugenommen hat. Im Jahr 2013 ist diese Bereitschaft bei 26 Prozent der Befragten hoch ausgeprägt.
Ein deutlicher, hochsignifikanter Anstieg ist bei der religiösen Erfahrung beobachtbar – und zwar bei beiden Grundformen. Die Mittelwerte nahmen um mindestens 0,3 Skalenpunkte zu. 2013 geben 21 % aller Befragten an, dass sie »oft« oder »sehr oft« ein göttliches Eingreifen erleben, bei Einheitserfahrungen beträgt dieser Anteil 14%. Wird bei jedem Befragten der höhere Wert der beiden religiösen Grunderfahrungen gezählt (inklusives ODER), dann zeigt sich, dass rund 28 Prozent der jungen Erwachsenen in Westeuropa »oft« oder »sehr oft« religiöse Erfahrungen machen. Bei 87 Prozent ist dies zumindest »selten« der Fall. In Bezug auf die allgemeinen Maße der Religiosität zeigen sich ebenfalls sowohl Stabilität als auch Zunahme: Der Mittelwert der Zentralitätsskala bleibt stabil. 2013 können etwa 16 Prozent der jungen Erwachsenen als »hochreligiös« charakterisiert werden. In dieser Gruppe sind religiöse Inhalte im persönlichen Lebenshorizont deutlich und differenziert präsent. Dadurch üben sie auch auf das allgemeine Erleben und Verhalten einen starken Einfluss aus. Demgegenüber ist die eigene Religiosität in der subjektiven Selbstwahrnehmung signifikant angestiegen. Dies gilt jedoch nur für das religiöse Selbstbild. 2013 gaben 21 Prozent aller Befragten an, dass sie »ziemlich« oder »sehr« religiös seien. Beim spirituellen Selbstbild beträgt dieser Anteil 19 Prozent. Wird bei jedem Befragten der höhere Wert bei der religiösen oder spirituellen Selbsteinschätzung gezählt (inklusives ODER), dann ist das religiös-spirituelle Selbstbild sogar bei 31 Prozent der Befragten hoch ausgeprägt.
Huber Religiöse Erfahrungen nehmen zu!
71
Tabelle 4: Veränderung der Religiosität in Westeuropa (Deutschland, Frankreich, Großbritannien und der Schweiz) bei jungen Erwachsenen bis 25 Jahre ohne Religionszugehörigkeit (Mittelwerte) Kerndimensionen der Religiosität
Sozial Personal
Befragungszeitpunkt 2008 (N≈157)
2013 (N≈255)
Mittelwert
Mittelwert
Institution
0,00
0,00
Ritual
1,27
1,48**
Ideologie
2,19
2,02
2,29
2,46
Intellekt
a) Allgemein b) Reflexivität
2,17
2,39*
Devotion
a) Gebet
1,29
1,26
Erfahrung
b) Meditation
1,54
1,55
Devotion(ODER)
1,69
1,68
Höhe der signifikanten Veränderung
+0,21
+0,22
a) Du-Erfahrung
1,47
1,72**
+0,25
b) All-Erfahrung
1,61
2,06**
+0,45
Erfahrung (ODER) 1,87
2,26**
+0,39
Allgemeine Masse der Religiosität Zentralität der Religiosität (CRSi-7)
1,86
1,96
Religiöses Selbstbild
1,46
1,50
Spirituelles Selbstbild
2,16
1,98
Religiös-spirituelles Selbstbild (ODER)
2,22
2,12
** p < 0,01, * p < 0,05, + p < 0,1
Bei der Teilstichprobe der in Westeuropa in den Jahren 2008 und 2013 befragten jungen Erwachsenen bis 25 Jahre, die keiner Religionsgemeinschaft angehören (vgl. Tabelle 4), sind vor allem bei der Dimension der religiösen Erfahrung die gleichen Grundtendenzen wie bei der Gesamtstichprobe beobachtbar. Daneben werden jedoch andere Akzente in der Dynamik der Religiosität sichtbar: Bei den sozialen Kerndimensionen zeigt sich im Gegensatz zur Gesamtstichprobe eine hoch signifikante Zunahme der Häufigkeit der Teilnahme an religiösen Ritualen. Der Mittelwert steigt um 0,21
Skalenpunkte an. Die Veränderungen betreffen jedoch vor allem den unteren Bereich der Skala. Im 2007 gaben fast 83 Prozent der Konfessionslosen bis 25 an, »nie« an Gottesdiensten teilzunehmen. Im Jahr 2013 ist dieser Anteil auf etwa 62 Prozent gesunken. Bei den personalen Kerndimensionen der Religiosität sind im Prinzip die gleichen Dynamiken wie bei der Gesamtstichprobe beobachtbar. Die Dimensionen der religiösen Ideologie und der Devotion bleiben auf niedrigem Niveau stabil. Im Jahr 2013
72
Empirische Aspekte
gaben 12 Prozent der jungen Konfessionslosen an, »ziemlich« oder »sehr« an Gott zu glauben – etwa 46 Prozent antworten auf diese Frage mit »gar nicht«. 8 Prozent praktizierten mindestens mehrmals in der Woche Gebet oder Meditation – bei 59 Prozent war dies »nie« der Fall. Das allgemeine Maß der religiösen Intellektualität bleibt ebenfalls auf niedrigem Niveau konstant. 2013 dachten etwa 19 Prozent »oft« oder »sehr oft« über religiöse Fragen nach – bei 23 Prozent kam dies »nie« vor. Bei der religiösen Reflexivität ist der signifikante Anstieg mit 0,22 Skalenpunkten wesentlich deutlicher als in der Gesamtstichprobe. Im Jahr 2013 ist diese Bereitschaft bei 16 Prozent der jungen Konfessionslosen hoch ausgeprägt. Die untersuchten Facetten der religiösen Erfahrung steigen bei den jungen Konfessionslosen ebenfalls deutlich und hochsignifikant. Die Mittelwerte nahmen bis zu 0,45 Skalenpunkte zu. 2013 gaben 5 Prozent der jungen Konfessionslosen an, dass sie »oft« oder »sehr oft« ein göttliches Eingreifen erleben – bei 53 Prozent war das »nie« der Fall. Einheitserfahrungen kamen bei 11 Prozent »oft« oder »sehr oft« vor – 34 Prozent hatten »nie« derartige Erfahrungen. Werden die Antwor-
ten zu den beiden religiösen Grunderfahrungen durch das inklusive ODER verknüpft, dann zeigt sich, dass rund 13 Prozent der jungen Konfessionslosen in Westeuropa »oft« oder »sehr oft« religiöse Erfahrungen machten. Bei 72 Prozent war dies zumindest »selten« der Fall. In Bezug auf die allgemeinen Maße kann im Gegensatz zur Gesamtstichprobe keine signifikante Zunahme der Religiosität festgestellt werden: Der Mittelwert der Zentralitätsskala blieb stabil. 2013 können knapp 1 Prozent der jungen Konfessionslosen als »hochreligiös« charakterisiert werden. Auch bei der subjektiven Selbstwahrnehmung der Religiosität und Spiritualität zeigen sich keine signifikanten Veränderungen. 2013 sagten 3 Prozent der jungen Konfessionslosen, dass sie »ziemlich« oder »sehr« religiös seien. Bei der Spiritualität beträgt dieser Wert 10 Prozent. Werden die Antworten zu beiden Selbstbilder durch das inklusive ODER verknüpft, dann ist bei 13 Prozent der jungen Konfessionslosen eine hohe Ausprägung der religiösen oder spirituellen Identität beobachtbar – auf der anderen Seite der Skala bezeichnen sich 27 Prozent als »gar nicht« religiös und spirituell.
Huber Religiöse Erfahrungen nehmen zu!
73
Tabelle 5: Veränderung der Religiosität in Westeuropa (Deutschland, Frankreich, Großbritannien und der Schweiz) bei jungen Erwachsenen bis 25 Jahre mit Religionszugehörigkeit (Mittelwerte) Kerndimensionen der Religiosität
Sozial Personal
Befragungszeitpunkt 2008 (N≈317)
2013 (N≈470)
Mittelwert
Mittelwert
Institution
1,00
1,00
Ritual
2,80
2,72
Ideologie
3,68
3,73
Intellekt
Höhe der signifikanten Veränderung
a) Allgemein
3,11
3,06
b) Reflexivität
2,89
2,99
a) Gebet
2,79
2,93
b) Meditation
1,83
1,96
Devotion(ODER)
3,01
3,11
a) Du-Erfahrung
2,41
2,76**
+0,35
b) All-Erfahrung
2,28
2,52**
+0,24
Erfahrung (ODER)
2,77
3,09**
+0,31
Zentralität der Religiosität (CRSi-7)
3,08
3,14
Religiöses Selbstbild
2,71
2,94**
Spirituelles Selbstbild
2,62
2,66
Religiös-spirituelles Selbstbild (ODER)
3,02
3,24**
Devotion
Erfahrung
Allgemeine Masse der Religiosität +0,24 +0,22
** p < 0,01, * p < 0,05, + p < 0,1
Bei der Teilstichprobe der in Westeuropa in den Jahren 2008 und 2013 befragten jungen Erwachsenen, die einer Religionsgemeinschaft angehören (vgl. Tabelle 5), sind bei der Dimension der religiösen Erfahrung die gleichen Grundtendenzen wie bei den Konfessionslosen beobachtbar. In Bezug auf andere Dimensionen zeigen sich jedoch andere Dynamiken: Bei den sozialen Kerndimensionen tritt im Gegensatz zu den Konfessionslosen (und auch der Gesamtstichprobe) keine signifikante Veränderung der Häufigkeit der Teilnahme an religiösen Ritualen auf – sie bleibt stabil. Im Jahr 2013 nahmen
etwa 27 Prozent der befragten jungen Erwachsenen, die einer Religionsgemeinschaft angehören, mindestens einmal im Monat an einem Gottesdienst teil. Bei den personalen Kerndimensionen sind Unterschiede zu den Konfessionslosen vor allem bei religiösen Dynamiken im Bereich der religiösen Intellektualität beobachtbar. Die Dimensionen der religiösen Ideologie und der Devotion bleiben auf mittlerem bis hohen Niveau stabil. Im Jahr 2013 gaben 58 Prozent der Befragten an, »ziemlich« oder »sehr« an Gott zu glauben – etwa 8 Prozent
74
Empirische Aspekte
antworteten auf diese Frage mit »gar nicht«. 36 Prozent praktizierten mindestens mehrmals in der Woche Gebet oder Meditation – bei 16 Prozent war dies »nie« der Fall. Das allgemeine Maß der religiösen Intellektualität bleibt auch bei den jungen Mitgliedern von Religionsgemeinschaften auf mittlerem Niveau konstant. 2013 dachten etwa 33 Prozent »oft« oder »sehr oft« über religiösen Fragen nach – bei 4 Prozent kam dies »nie« vor. Im Gegensatz zu den Konfessionslosen ist jedoch kein signifikanter Anstieg der religiösen Reflexivität feststellbar. Im Jahr 2013 ist diese Bereitschaft bei 24 Prozent der jungen Konfessionslosen hoch ausgeprägt. Die untersuchten Facetten der religiösen Erfahrung steigen bei den jungen Mitgliedern von Religionsgemeinschaften ebenfalls deutlich und hochsignifikant. Die Mittelwerte nehmen bis zu 0,35 Skalenpunkte zu. 2013 gaben 20 Prozent an, dass sie »oft« oder »sehr oft« ein göttliches Eingreifen erleben – bei 29 Prozent war das »nie« der Fall. Einheitserfahrungen kamen bei 13 Prozent »oft« oder »sehr oft« vor – 26 Prozent berichten »nie« über derartige Erfahrungen. Werden die Antworten zu den beiden religiösen Grunderfahrungen durch das inklusive ODER verknüpft, dann zeigt sich, dass rund 26 Prozent der jungen Mitglieder von Religionsgemeinschaften in Westeuropa »oft« oder »sehr oft« religiöse Erfahrungen machen. Bei 85 Prozent ist dies zumindest »selten« der Fall. In Bezug auf die allgemeinen Maße ist im Gegensatz zu den Konfessionslosen eine
signifikante Zunahme der Religiosität feststellbar: Der Mittelwert der Zentralitätsskala blieb stabil. 2013 können rund 23 Prozent der jungen Konfessionslosen als »hochreligiös« charakterisiert werden. Demgegenüber zeigen sich bei der subjektiven Selbstwahrnehmung der Religiosität signifikante Veränderungen. Sowohl beim religiösen Selbstbild als auch beim religiösspirituellen Selbstbild ist ein hoch signifikanter Zuwachs um 0,22 und 0,24 Skalenpunkte beobachtbar. 2013 sagten 20 Prozent der jungen Mitglieder von Religionsgemeinschaften, dass sie »ziemlich« oder »sehr« religiös seien. Bei der Spiritualität beträgt dieser Wert ebenfalls 20 Prozent. Werden die Antworten zu beiden Selbstbildern durch das inklusive ODER verknüpft, dann ist bei 30 Prozent eine hohe Ausprägung beobachtbar – auf der anderen Seite der Skala bezeichnen sich 7 Prozent als »gar nicht« religiös und spirituell. 4. Diskussion
Zusammenfassend können folgende Befunde hervorgehoben werden: Bei keiner der untersuchten Dimensionen der Religiosität ist ein signifikanter Rückgang der Religiosität beobachtbar – und zwar weder bei jungen Konfessionslosen noch bei jungen Angehörigen von Religionsgemeinschaften. Religiöse Erfahrungen nehmen bei jungen Erwachsenen deutlich zu – wobei dies gleichermaßen für die Konfessionslosen als auch für die Angehörigen von Religionsgemeinschaften gilt.
Huber Religiöse Erfahrungen nehmen zu!
Die Zunahme der religiösen Erfahrung ist bei Konfessionslosen und Angehörigen von Religionsgemeinschaften in unterschiedliche Muster eingebettet: Bei den konfessionslosen jungen Erwachsenen geht der Anstieg der religiösen Erfahrungen mit einer erhöhten religiösen Reflexivität und einer erhöhten Bereitschaft, an Gottesdiensten teilzunehmen, einher. Demgegenüber ist bei den jungen Mitgliedern von Religionsgemeinschaften die Zunahme der religiösen Erfahrungen mit einem Anstieg des religiösen Selbstbildes verknüpft. In der Debatte zwischen säkularisierungstheoretischen und individualisierungstheoretischen Ansätzen zur Erklärung der Gegenwartsreligiosität können aus den Befunden folgende Schlüsse gezogen werden: Die säkularisierungstheoretische Grund annahme einer kontinuierlichen Abnahme der Religiosität auf allen Ebenen wird durch die Daten widerlegt. Bei keinem der 15 berücksichtigten Maße der Religiosität ist ein signifikanter Rückgang beobachtbar – und zwar weder bei den jungen Konfessionslosen noch bei den jungen Mitgliedern von Religionsgemeinschaften. Dagegen kann eingewendet werden, dass der Beobachtungszeitraum von fünf Jahren zu kurz sei, und auch zeitlich beschränkte »Erholungsphasen« durchaus theoriekompatibel seien. Dieser Einwand hat eine gewisse Berechtigung. Allerdings bringen die gleichzeitig beobachtete deutliche Zunahme von religiösen Erfahrungen und der Anstieg der Religiosität in weiteren Dimensionen säkularisierungstheoretische Ansätze in beträchtliche Erklä-
75
rungsnöte. Umso mehr als diese Zunahme mit hoher Konsistenz nicht nur bei Konfessionslosen und Konfessionellen sondern auch in jedem einzelnen der vier untersuchten Länder beobachtet werden kann. Auf der anderen Seite wird die individualisierungstheoretische Grundannahme, dass Transzendenzerfahrung eine unversiegbare Quelle für die immer wieder neue Entstehung religiösen Erlebens und Verhaltens darstellen, durch die Daten eindrücklich bestätigt. Wie bereits erwähnt, ist die Zunahme religiöser Erfahrungen mit hoher Konsistenz beobachtbar. Besonders eindrücklich ist, dass diese Zunahme bei den jungen Konfessionslosen, von denen 2013 nur noch 30 Prozent religiös erzogen wurden, am stärksten ist. Dies spricht für anthropologisch begründete Transzendenzerfahrungen, die auch unabhängig von religiöser Sozialisation ihre Wirksamkeit entfalten. Empirisch-theologische Forschung beschäftigt sich mit der religiösen (Re-) Produktivität der Subjekte und richtet dabei den Fokus auf semantische Eigenstrukturen und Dynamiken des Religiösen in personalen und sozialen Systemen. Diese Forschung wird genau dann theologisch, wenn es ihr gelingt, die theologische Gestalt personaler und sozialer religiöser Sinnkonstruktionen zu rekonstruieren. Darauf aufbauend sollte eine Empirische Theologie die »Beforschten« als theologische Subjekte anerkennen und mit ihnen in einen theologischen Dialog treten. Für diesen Typ empirischer Religionsforschung ist die religiöse Produktivität der jungen Erwachsenen ein besonders ertragreicher Forschungsgegenstand. Daher gehe ich abschließend
76
Empirische Aspekte
auf die unterschiedlichen Bahnen ein, in denen der Aufschwung der Religiosität bei Konfessionslosen und Konfessionellen verläuft. Bei den konfessionslosen jungen Erwachsenen ist Religiosität in allen Dimensionen und Maßen der Religiosität meist nur schwach ausgeprägt. Die höchsten Mittelwerte sind bei der intellektuellen Dimension (M = 2,46) und der religiösen Erfahrung (M = 2,26) beobachtbar. Damit korrespondiert, dass 70 Prozent zumindest »selten« über religiöse Fragen nachdenken und 72 Prozent zumindest »selten« religiöse Erfahrungen machen. Daher kann angenommen werden, dass die persönlichen religiösen Konstrukträume durch diese beiden Dimensionen dominiert und vermutlich auch strukturiert werden. Die Religiosität ist wesentlich erfahrungsförmig und muss sich vor der eigenen Rationalität als kritischer Instanz bewähren. Sie gewinnt eine hochgradig autonome Gestalt. Aus den Befunden folgt weiter, dass die Dimensionen der Erfahrung und Intellektualität als Hauptachsen funktionieren, auf denen sich individuelle religiöse Dynamiken entfalten. Wer sich für eine Stimulation derartiger Dynamiken interessiert, wäre daher gut beraten, Angebote zu entwickeln, die auf diese beiden Dimensionen bezogen sind und dabei die Autonomie der religiösen Subjektivität stärken. Der gleichzeitig beobachtbare deutliche Zuwachs bei der sozialen Kerndimension der Teilnahme an religiösen Ritualen steht nicht im Widerspruch zu dieser Interpretation. Es handelt sich um einen Zuwachs, der auf das niedrigste Ausgangsniveau bei allen untersuchten Religiositätsmaßen bezogen ist (M = 1,27; 85 Prozent nahmen 2008 »nie«
an Gottesdiensten teil). Die statistische Zunahme der Gottesdienstbesuche ist daher nicht auf die Erhöhung eines regelmäßigen Gottesdienstbesuchs zurückzuführen, sondern auf den Rückgang der kategorischen Ablehnung, überhaupt an einem Gottesdienst teilzunehmen. Auch dies ist jedoch für religiöse Institutionen eine Chance. Bei den jungen Mitgliedern von Religionsgemeinschaften ist Religiosität in den meisten Dimensionen und Maßen mittel bis hoch ausgeprägt. Der mit Abstand höchste Mittelwerte findet sich bei der religiösen Ideologie (M = 3,73), dementsprechend glauben 58 Prozent »ziemlich« oder »sehr« an Gott oder etwas Göttliches. An zweiter Stelle, jedoch bereits mit einem halben Skalenpunkt Abstand, steht das religiös-spirituelle Selbstbild (M = 3,24). Daher kann vermutet werden, dass die persönlichen religiösen Konstrukträume durch das religiöse Bewusstsein bestimmt und strukturiert werden. Man glaubt an eine bestimmte Gestalt der Transzendenz und versteht sich selbst als religiös oder spirituell. Die Religiosität gewinnt dadurch eine glaubensförmige Gestalt. Dies hat zur Folge, dass Fragen nach dem Inhalt des Glaubens, insbesondere der Transzendenz, und der Bedeutung von religiösen Praktiken, Symbolen und Institutionen in den Vordergrund rücken. Vermutlich entfalten sich auch individuelle religiöse Dynamiken entlang derartiger Fragen und können durch Angebote zur religiösen Selbstreflexion stimuliert werden. Angesichts der bewusstseins- und glaubensförmigen Grundstruktur der religiösen Konstrukträume junger Mitglieder von Religionsgemeinschaften ist es schließlich auch plausibel, dass sich die Zunah-
Huber Religiöse Erfahrungen nehmen zu!
me der religiösen Erfahrungen in einem Anstieg des religiösen Selbstbildes spiegelt. Dass primär das religiöse Selbstbild ansteigt und nicht das spirituelle, verweist vermutlich auf die Dominanz traditioneller religiöser Semantiken in den religiösen Konstrukträumen der jungen Mitglieder von Religionsgemeinschaften in Westeuropa.
77
Danksagung
Ich danke der Bertelsmann Stiftung dafür, dass sie mir die Daten des Religionsmonitors 2008 und 2013 für diese wissenschaftliche Publikation zur Verfügung gestellt hat.
78
Empirische Aspekte
Thomas Schlag / Muriel Koch Identitätsentwicklung und Konfirmationsarbeit in jugendtheologischer Perspektive
1. Religiöse Identitätsentwicklung als jugendtheologische Herausforderung
Jugendtheologische Arbeit orientiert sich an Menschen in der komplexen und je individuellen Entwicklungsphase der Adoleszenz. Bei allen unterschiedlichen Verlaufsdynamiken und Suchbewegungen im Einzelnen ist ein wesentliches Merkmal dieser Phase die jugendliche Frage und Entwicklung nach dem eigenen Selbst und damit auch die mehr und mehr bewusste Konstruktion der eigenen Identität. Sich als Selbst – und dabei zugleich sich selbst in Gemeinsamkeit und Unterscheidung zu Anderen – wahrzunehmen und zu positionieren, stellt eine reflexive Tätigkeit dar, die im Kindesalter noch nicht vergleichbar ausgeprägt ist.1 Das Jugendalter ist dabei maßgeblich durch zunehmende Komplexität und Instabilität, der Suche nach letzten Gewissheiten, mancher Unsicherheit – kurz gesagt durch vielfältige Übergangssituationen und -erfahrungen geprägt, die die eigene Persönlichkeit und ihre Ausrichtung betreffen und prägen. Sich in diesem Suchprozess der eigenen Identitätsbildung zu befinden, beinhaltet Fragen wie: »Wer bin ich?«, »Wer sind die anderen?«, »Was will ich für mich?«. Im Verlauf der Adoleszenz werden die Antworten auf solche Fragen zunehmend komplexer und deshalb auch die Fragen interessanter und nicht selten brisanter.
Zugleich wird erfahrbar, dass die je eigenen Antwortversuche auf solche Fragen des Selbst immer wieder auf den Prüfstand kommen und neue, weitere Fragen aus sich heraus erzeugen. Diese Fragen nach der eigenen Identität und Selbstpositionierung stellen sich natürlich nicht exklusiv im Lauf des Jugendalters, sondern gehören zu einem Prozess der Entwicklung eines Selbstbildes, der durch das Leben hindurch anhält. Darum ist das Thema Identität zwar nicht ausschließlich bei Jugendlichen zu verorten. Allerdings stellt es sich dort – sowohl für die Jugendlichen selbst wie auch für die sie begleitenden erwachsenen Akteure – als besonders zentral dar, weil sich ihnen eben diese Fragen in der Regel erstmalig in dieser existentiellen Tiefe aufwerfen und auch in den ihnen entsprechenden Formen – die von der expliziten Expression bis hin zu mehr oder weniger »stummen« Ausdrucksweisen reichen können – zum Vorschein kommen. Die Auffassung, dass Identität das Resultat eines erfolgreichen Entwicklungsprozesses darstellt, wie sie mit Erikson2 1 Vgl. Carsten Gennerich, Empirische Dogmatik des Jugendalters. Werte und Einstellungen Heranwachsender als Bezugsgrößen für religionsdidaktische Reflexionen, Stuttgart 2010. 2 Vgl. Erik H. Erikson, Jugend und Krise, Stuttgart 31980.
Schlag / Koch Identitätsentwicklung und Konfirmationsarbeit in jugendtheologischer Perspektive
noch vertreten wurde, hat inzwischen allerdings seine vielfältige kritische relecture erfahren: Ausgehend von der Annahme, dass Identität keine abgeschlossene Wesenseigenschaft des Menschen ist, sondern gerade reflektiert, wie der Mensch sich durch sein Leben hindurch verändert und immer wieder neu sucht, manifestiert sich bei Keupp3 Identität im Wechsel der Reflexion von bereits gemachten Erfahrungen und der Antizipation zukünftiger Erfahrungen eine (vorübergehende) Form von Identität. Damit stellt die Identitätsbildung zum einen einen Prozess dar, der durch das ganze Leben hindurch anhält, zum anderen wird die Kontextbedingtheit dieser Prozesse offenkundig: »So artikuliert sich Identität im Spannungsfeld von Selbst und Anderem, Eigenem und Fremden, Identität und Differenz, Identität und Nicht-Identität. Die Änderung des Kontextes ändert immer auch den Text.«4 Für die jeweilige individuelle Prägekraft durch die äußeren Kontexte wird nun zurecht darauf hingewiesen, dass auch Religion eines der Systeme für Jugendliche darstellt, das ihnen die nötige Struktur vermittelt, um nicht nur Fragen nach einer möglichen religiösen Identität, sondern nach ihrem Gesamtverhältnis zur Welt zu bearbeiten.5 Im komplexen Prozess dieser Identitätskonstruktion kann insofern auch die Frage nach dem persönlichen Glauben eine wichtige Rolle spielen – und dies abhängig davon, wie stark und prägend die bis dahin erfahrende religiöse Sozialisation war oder immer noch ist. Möglicherweise wird dann nun der eigene »Kinderglaube« kritisch hinterfragt und erfährt eine Form der Entmythologisierung, durch die das bis-
79
her wie selbstverständlich Geglaubte in Frage gestellt oder in aller Freiheit ganz ad acta gelegt wird. Aber auch hier gilt bei aller individuellen und freien Suchbewegung: Ob sich der bisherige eigene Glaube bzw. die damit verbundenen Glaubensüberzeugungen zu einem für das individuelle Erleben »passenden« Glauben hin verändert, ist wiederum nicht nur je individuell, sondern auch durch den maßgeblichen Einfluss des jeweiligen Kontextes (z.B. familieninterne religiöse Sozialisierung, Bildungsangebote der Kirchen) mitbedingt. Weil somit Überzeugungs-, Werteund Orientierungssysteme in diesem Alter nicht mehr einfach übernommen, sondern – gerade in intensiver Auseinandersetzung mit der Vielfalt der äußeren Orientierungsangebote – hinterfragt, adaptiert und kritisiert werden, muss eine jugendtheologische Praxis den Jugendlichen dazu verhelfen, sich selbst als Subjekte ihrer religiösen Orientierung und ihres Glaubens erleben und erfahren zu können. Im Fokus steht hier also die Frage, wie sich angesichts der angedeuteten Prozesse kontextuell mitbedingter religiöser Identitätsentwicklung der Beitrag jugendtheologische Praxis näher konturieren lässt. 3 Heiner Keupp u.a.: Identitätskonstruktionen. Das Patchwork der Identitäten in der Spätmoderne, Reinbek b. Hamburg 1999. 4 Hans Waldenfels, Zur gebrochenen Identität des abendländischen Christentums, in: Werner Gephart und Hans Waldenfels (Hg.), Religion und Identität. Im Horizont des Pluralismus, Frankfurt a.M. 1999, 105–124. 5 Vgl. Vassilis Saroglu, Adolescents’ Social Development and the Role of Religion: in: Gisela Trommsdorff / Xinyin Chen (Eds.), Values, Religion, and Culture in Adolescent Development, Cambridge 2012, 391–423.
80
Empirische Aspekte
Für eine solche Annäherung kann nun die Konfirmationszeit als eine der zentralen und prägenden Erfahrungsangebote und Angebotserfahrungen in den Blick genommen werden, weil sich hier die angedeuteten komplexen Erfahrungs- und damit Beschreibungszusammenhänge besonders deutlich manifestieren: Im Rahmen der Konfirmationszeit werden Jugendliche auf das ErwachsenSein in der Kirche vorbereitet und feiern nach evangelischem Verständnis im Konfirmationsgottesdienst zum einen den Übergang vom Konfirmand zum Gemeindemitglied, zum anderen in biographischer und familienbiographischer Hinsicht den Übergang vom Jugendlichen zum Erwachsenen. Insofern illustrieren die Konfirmationszeit als Ganzes und der Schlussgottesdienst in besonderer Weise nicht nur die existentielle Orientierungssituation, in der sich Jugendliche in der Phase der Adoleszenz befinden, sondern in ihnen manifestiert sich auch das von kirchlicher Seite aus in Hinsicht auf die Glaubensfrage hin eröffnete Kommunikationsangebot sowie die damit verbundene institutionell eröffnete Teilhabestruktur. Um den möglichen Beitrag der Konfirmationszeit zur Identitätsentwicklung in glaubensbezogener Hinsicht näher in Augenschein zu nehmen, ist zuvor eine Differenzierung der Verwendung des Glaubensbegriffs notwendig: Es lassen sich hier zwei unterschiedliche Glaubensdimensionen ins Spiel bringen, die ihrerseits auf je spezifische Weise in Verbindung zur oben angedeuteten individuellen Orientierungssuche stehen: 1. Der persönliche Glaube (»believing«): Hierbei handelt es sich um persönliche Erfahrungen, die der Lebensorientie-
rung dienen, da aus diesen ein religiöses Selbstbild abgeleitet werden kann. Solche Erfahrungen können etwa das individuelle Gebet, der persönliche Glaube an Gott oder auch die religiöse Selbstwahrnehmung und -reflexion sein. Für die Herausbildung und auch die Überprüfung eines solchen persönlichen Glaubens sind insbesondere solche Personen bedeutsam, die ihre je eigene Glaubenshaltung glaubhaft und authentisch verkörpern – neben den Familienmitgliedern und Peers können dies im Zusammenhang der Konfirmationsarbeit Pfarrerinnen und Pfarrer oder andere Mitarbeitende oder Gemeindeglieder sein. 2. Der institutionalisierte Glaube (»belonging«): Hierbei handelt es sich, wie schon durch die Signatur deutlich wird, um eine solche glaubensorientierende Praxis, in der und durch die die Institution Kirche selbst für Jugendliche wahrnehmbar und erfahrbar in Erscheinung tritt. Hier ist etwa zu denken an den Bereich der Kasualien oder anderer Gottesdienste, an denen Jugendliche teilnehmen bzw. die sie (z.B. auch medial) wahrnehmen. Diese Form des institutionalisierten Glaubens wird aber für Jugendliche auch durch eine eigene aktive Gottesdienstpraxis im Zusammenhang der Konfirmationszeit oder der bevorstehendem Konfirmation erfahrbar, so dass sie von Beginn an nicht gänzlich von persönlicher Bezugnahme getrennt werden kann. Auch hier gilt, dass eine positive Wahrnehmung durch konkrete Erfahrungen mit einzelnen Repräsentantinnen und Repräsentanten die Identifikation bzw. das Zugehörig-
Schlag / Koch Identitätsentwicklung und Konfirmationsarbeit in jugendtheologischer Perspektive
keitsgefühl mit Kirche wesentlich prägt und oftmals überhaupt erst ermöglicht. Entscheidend ist nun, dass zumindest für Erwachsene – so die These der englischen Religionssziologin Grace Davie – persönlicher Glaube ohne Verbundenheit zur Institution (»believing without belonging«) oder eine institutionelle Bindung ohne persönliche Identifikation mit spezifischen Glaubensinhalten (»belonging without believing«) die zwei wesentlichen Konstruktionsmuster der Postmoderne sind, wenn es um die religiöse Dimension der je eigenen Lebensorientierung geht.6 Dabei geht ihre säkularisierungstheoretisch geprägte These dahin, dass Religiosität sich in der Gegenwart häufig dergestalt ausdifferenziert, dass »believing« und »belonging«, also persönlicher Glaube und institutionalisierter Glaube häufig eben gerade nicht mehr in Verbindung zueinander stehen, sondern einer primär individualisierten Patch-work-Religiosität weichen, für die eine Orientierung an institutionellen Vorgaben bestenfalls sekundäre Bedeutsamkeit hat. Nun stellt sich angesichts dieser These die Frage, inwiefern sich an den Einstellungen der Konfirmandinnen und Konfirmanden diese Trennung zwischen individueller und institutioneller Glaubensorientierung ebenfalls ablesen lässt – bzw. weiter gefragt, ob möglicherweise aufgrund der hier zu gewinnenden Erkenntnisse die Grundthese Davies relativiert werden muss. Zur Annäherung an diese Frage sollen im Folgenden konkrete empirische Daten aus dem Bereich der Konfirmationsarbeit herangezogen werden.
81
2. Empirische Ergebnisse der Zweiten Europäischen Studie zur Konfirmationsarbeit
Im Rahmen der breit angelegten sogenannten Zweiten Europäischen Studie zur Konfirmationsarbeit wurden Jugendliche und Mitarbeitende des Konfirmandenjahres 2012/2013 mit Hilfe eines umfangreichen Fragebogenverfahrens sowohl zu Beginn wie am Ende des letzten Konfirmandenjahres zu ihren Erwartungen, Interessen, Erfahrungen und Gesamtwahrnehmungen befragt. Im Folgenden sollen einige thematisch einschlägige europäische Ergebnisse7 – beteiligt waren Dänemark, Deutschland, Finnland, Norwegen, Schweden, Österreich, Polen, Schweiz und Ungarn – vorgestellt werden, die für die hier im Fokus stehende jugendtheologische Fragestellung nach dem Zusammenhang von Identitätsbildung, Glaubensorientierung und den jugendtheologischen Herausforderungen aufschlussreich sind: Grundsätzlich zeigt sich, dass sowohl die Konfirmanden und Konfirmanden wie auch die Mitarbeitenden – fasst man die Länderergebnisse zusammen, die Konfirmationszeit als Ganze ausgesprochen positiv beurteilen: 78% der Jugendlichen sind mit dieser Zeit und dem Angebot insgesamt zufrieden, der allerüberwiegende Anteil auch mit den durchführenden Personen. 89% der 6 Vgl. Grace Davie, Religion in Britain Since 1945. Believing Without Belonging, Oxford 1994. 7 Vgl. dazu ausführlicher Thomas Schlag / Muriel Koch / Christoph Maaß, Developing a (Religious) Identity during Confirmation Time, in: Friedrich Schweitzer u.a. (Eds.), Youth, Religion and Confirmation Work in Europe, Gütersloh 2015, 135–145.
82
Empirische Aspekte
Hauptverantwortlichen machen die Konfirmationsarbeit gerne und nur wenige würden diese lieber heute als morgen aufgeben. Die Berücksichtigung der thematischen und persönlichen Interessen der Jugendlichen durch das jeweils konkrete Angebot wird als hoch erlebt, die Gemeinschaftserfahrungen werden ebenso positiv von der allermeisten Zahl der befragten Jugendlichen bewertet wie die Möglichkeiten der aktiven Teilhabe und Mitgestaltung am Gesamtangebot.8 Von diesem positiven Gesamteindruck auf Seiten beider Akteursgruppen schließt sich die Frage an, inwiefern Konfirmationsarbeit einen positiven Einfluss auf die Entwicklung der persönlichen religiösen Identität Jugendlicher haben
kann und welche jugendtheologischen Folgerungen von dort aus getroffen werden können. Ziel ist es, dafür die oben genannte These Davies’ zu überprüfen, wonach persönlicher Glaube ohne Verbundenheit zur Institution oder eine institutionelle Bindung ohne persönliche Identifikation mit spezifischen Glaubensinhalten nun nicht nur für Erwachsene, sondern auch für Jugendliche eine gängige Konstruktion darstellt, wenn es um die religiöse Dimension ihrer eigenen Lebensorientierung geht: Anhand der drei Frageitems »Ich glaube an Gott« (CE/KE09), »Es ist mir wichtig, zur Kirche zu gehören« (CG/ KG01) und dem »Interesse an der Frage nach dem Sinn des Lebens« (CL/KL11)
belonging and believing believing without belonging belonging without believing explizites Interesse an Fragen der Lebensorientierung kein explizites Interesse an Fragen der Lebensorientierung
Anteil der Konfirmand/innen (in %)
N = 16065. Berücksichtigt wurden hier nur diejenigen Jugendlichen, die sowohl zum ersten Befragungszeitpunkt t1 wie zum zweiten Befragungszeitpunkt t2 geantwortet haben. Lesehilfe: 32% der Konfirmandinnen und Konfirmanden zeigen eine klare religiöse Identität (»belonging and believing«) bei t1 und 36% bei t2. 8 Vgl. dazu die tabellarische Aufstellung in Friedrich Schweitzer u.a. (Eds.), Youth, Religion and Confirmation Work in Europe, Gütersloh 2015, 364–394.
Schlag / Koch Identitätsentwicklung und Konfirmationsarbeit in jugendtheologischer Perspektive
lassen sich fünf mögliche Formen von Einstellung definieren: 1) belonging and believing 2) believing without belonging 3) belonging without believing sowie zwei, gleichsam säkulare Formen ohne expliziten religiösen Bezug, die aber 4) ein explizites Interesse an Fragen der Lebensorientierung aufweisen oder 5) kein explizites Interesse an Fragen der Lebensorientierung zeigen. Wie die Grafik aufzeigt, erhalten die höchsten Zustimmungswerte die klar umrissenen Formen, also »belonging and believing« (1) und ein »explizites Interesse an Fragen der Lebensorientierung« (4). Die ›säkularen‹ Haltungen, die sich in (4) und (5) zeigen, sind verhältnismässig beliebt, jedoch drückt sich nur in (4) ein erhöhtes Interesse an Lebensorientierung und damit auch an Fragen, die die eigene Identität betreffen aus. Rund ein Viertel aller KonfirmandInnen zeigt kein explizites Interesse an Fragen der Lebensorientierung (5). Am wenigsten Anklang findet die Möglichkeit der formalen Zugehörigkeit ohne persönliches Glaubensinteresse (3). Aus diesen Ergebnissen kann geschlossen werden, dass Jugendliche in Bezug auf Fragen des Lebens und des Glaubens im Zusammenhang mit ihrer Identitätsentwicklung nicht nur explorativ Interesse an Deutungsangeboten aufweisen, sondern auch nach Orten und Möglichkeiten der Zugehörigkeit suchen und damit durchaus offen dafür sind, sich auf eine Religion, Konfession oder Weltanschauung in gleichsam institutionellem Gewand einzulassen. Untersucht wurde auch, von welchen der genannten fünf Formen sich welche Verschiebungen zwischen t1 und t2 er-
83
geben – wie es gleichsam um Wechselwanderungen zwischen den einzelnen Formen bestellt ist. Interessanterweise weisen die KonfirmandInnen, die bei t1 zur Form 1 gezählt werden können, die höchste Stabilität auf, d.h. die Verbindung von persönlich-individuellem und institutionellem Glauben bleibt bei der überwiegenden Mehrheit dieser Gruppe erhalten. Aber auch die Wechselwanderungen in den anderen Formen sind insgesamt gering. Dieses Phänomen dürfte darauf verweisen, dass einerseits die Einflüsse dieses kirchlichen und in der Regel nur einjährigen Bildungsangebots hinsichtlich der Veränderungen der eigenen Glaubenseinstellungen eher gering ist, zum anderen offenbar andere Präge- und Kontextfaktoren von viel weitreichenderer und nachhaltiger Bedeutsamkeit sind. Um diese Vermutung breiter fundieren und interpretieren zu können, wurde untersucht, welche Rolle die religiöse Sozialisierung durch das Elternhaus bei der (religiösen) Orientierung der Jugendlichen spielt. Dafür werden im Folgenden die Antworten zur Einschätzung der Religiosität des Elternhauses durch die Jugendlichen (CJ01), auf die Frage, ob ein Abendgebet gesprochen wurde (CJ02) und nach der Kontaktintensität der Jugendlichen mit kirchlichen Angeboten vor der Konfirmationszeit (CM11/CM12) ausgewertet. Die erste Frage hatte im (hier deutschsprachigen) Fragebogen die Überschrift: »Welche Bedeutung hat die Religion in deinem Elternhaus?«, wozu vier verschiedene Antwortmöglichkeiten angeboten wurden: »Ich komme aus einem … sehr religiösen / ziemlich religiösen / weniger religiösen / überhaupt nicht religiösen Elternhaus«.
84
Empirische Aspekte
Die zweite Frage hatte im Fragebogen die Überschrift: »Haben deine Mutter oder dein Vater in deiner Kindheit ein Abendgebet mit dir gesprochen?«, wozu wiederum vier Antwortmöglichkeiten angeboten wurden: »Ja, jeden oder fast jeden Abend. / Manchmal. / Nie. / Weiss nicht«. Die dritte Frage, die sich allerdings im abschließenden Fragebogenteil »Jetzt noch ein paar persönliche Informatio-
nen zu dir« findet, lautet: »hast du schon (mehr als dreimal) in einer christlichen Gruppe oder Veranstaltung der Kirche teilgenommen (Kindergottesdienst, Lager, Kindertreff, Sonntagsschule etc.) …, worauf zwei Optionen, nämlich »im Alter von 5–9 Jahren?« und »im Alter von zehn Jahren bis heute?« zur Verfügung standen, auf die jeweils mit »Ja / Nein / Weiss nicht« geantwortet werden konnte.
belonging and believing believing without belonging belonging without believing explizites Interesse an Fragen der Lebensorientierung kein explizites Interesse an Fragen der Lebensorientierung alle Konfirmand/innen t1 (100%) alle Konfirmand/innen t2 (100%) religiöses Elternhaus JA t1 (22%) religiöses Elternhaus JA t2 (22%) religiöses Elternhaus NEIN t1 (75%) religiöses Elternhaus NEIN t2 (75%) Abendgebet JA t1 (36%) Abendgebet JA t2 (36%) Abendgebet NEIN t1 (33%) Abendgebet NEIN t2 (33%) Kirchenkontakt JA t1 (57%) Kirchenkontakt JA t2 (57%) Kirchenkontakt NEIN t1 (42%) Kirchenkontakt NEIN t2 (42%) Merkmalsüberlagerungen JA t1 (11%) Merkmalsüberlagerungen JA t2 (11%) Merkmalsüberlagerungen NEIN t1 (15%) Merkmalsüberlagerungen NEIN t2 (15%)
Anteil der Konfirmand/innen (in %)
N = 16065. Wiederum wurden nur diejenigen Konfirmanden und Konfirmanden für diese Grafik berücksichtigt, die eines der fünf Identitätsmuster sowohl zum Zeitpunkt t1 wie zum Zeitpunkt t2 zeigten.
Schlag / Koch Identitätsentwicklung und Konfirmationsarbeit in jugendtheologischer Perspektive
Die in der Grafik vorgenommen Zuordnungen zu den verschiedenen Antworten sind dabei wie folgt zu lesen: Als positive Antwort »JA« auf die Frage nach der Religiosität des Elternhauses (CJ01) gilt, wenn hier »sehr« oder »ziemlich « angekreuzt wurde; als negative Antwort NEIN gilt, wenn »weniger« oder »überhaupt nicht« angekreuzt wurde. Als positive Antwort JA auf die Frage des Abendgebets (CJ02) gilt, wenn dieses laut Erinnerung der Jugendlichen »Ja, jeden oder fast jeden Abend« oder »manchmal« stattgefunden hat. Ein JA zur Frage der Vorerfahrungen mit kirchlichen Gruppen oder Angeboten (CM11 oder CM12) wird angenommen, wenn die Jugendlichen laut Selbstauskunft Kontakt (»Ja«) vor ihrer Konfirmationszeit hatten; ein NEIN meint hier, dass die Jugendlichen entweder keinen Kontakt zur Kirche hatten oder sich an einen solchen nicht erinnern. Die Grafik ist nun wie folgt zu lesen (beispielhaft für den dritten und vierten Balken der Grafik): 22% derjenigen Konfirmanden und Konfirmanden, die sowohl an der Umfrage t1 wie a t2 teilgenommen haben, kommen aus einem religiösen Elternhaus. Von diesen haben in t1 54% eine religiöse Identität, 56% von diesen in t2. Oder um ein anderes Beispiel (Balken 13 und 14) zu nehmen: Dass sie über keinen Kirchenkontakt vor der Konfirmationszeit verfügten oder sich daran erinnern, sagen bei t1 und bei t2 jeweils 42%; von diesen haben zu t1 30%, zu t2 37% ein explizites Interesse an Fragen der Lebensorientierung, ohne dies aber mit Formen des individuellen oder Glaubens in Verbindung zu setzen.
85
Das Stichwort der Merkmalsüberlagerung meint (wiederum beispielhaft im Blick auf den viertletzten Balken der Grafik): Unter den befragten Konfirmanden und Konfirmanden gibt es 11%, die aus einem religiösen Elternhaus kommen (CJ01), Abendgebete mit ihren Eltern erlebt haben oder sich daran erinnern (CJ02) und Kontakt mit der Kirche vor der Konfirmationszeit hatten. Von diesen 11% haben 63%, also fast zwei Drittel eine klare religiöse Identität («belonging and believing”) zum Zeitpunkt t1 und 65% eine solche starke religiöse Identität zum Befragungszeitpunkt t2. Und dort, wo sich eine Merkmalsüberlagerung in negativer Hinsicht zeigt (letzte und vorletzte Balken der Grafik), wo also bei 15% der Jugendlichen wieder ein religiöses Elternhaus, ein Abendgebet, oder der Kontakt zur Kirche konstatiert wird, finden sich zu t1 nur 14%, zu t2 19% in der Form »belonging and believing« wieder. Es fällt also auf, dass Jugendlichen, die durch das Elternhaus religiös sozialisiert wurden und die zudem noch an kirchlichen Angeboten vor der Konfirmationszeit teilgenommen haben, häufiger eine religiöse Identität zugeschrieben werden kann als anderen. Für Jugendliche hingegen, die über geringe oder keine religiösen oder institutionellen Vorerfahrungen verfügen, zeigt sich einerseits eine sehr viel geringere Nähe zum Glaubensaspekt, andererseits aber auch ein geringes explizites Interesse an Fragen der Lebensorientierung. Interessanterweise ist nun aber festzustellen, dass sich im Fall der nicht oder kaum religiös sozialisierten Jugendlichen – bei aller Stabilität innerhalb der fünf Orientierungsformen – relative starke
86
Empirische Aspekte
Entwicklungen von t1 zu t2 abzeichnen. Offenbar gelingt es der Konfirmationsarbeit, bei dieser Gruppe der Jugendlichen das vorhandene Entwicklungspotential abzurufen, was faktisch zu größeren Veränderungsschritten hinsichtlich des individuellen und institutionellen Glaubens führt als dies selbst bei den schon religiös Sozialisierten der Fall ist. 3. Fazit und Konsequenzen für die jugendtheologische Arbeit
Ob die Konfirmationszeit insgesamt zu einem gesteigerten Interesse an der Entwicklung einer religiösen Identität beiträgt, kann zwar aus den hier herangezogenen Daten nicht zweifelsfrei geschlossen werden. Denn diese Daten geben keinen Aufschluss darüber, inwiefern es gerade dieses kirchliche Angebot war, das zu diesen Veränderungen geführt hat. Manches mag, wie angedeutet, viel eher auf die generellen Entwicklungsdynamiken in dieser Altersphase und langfristige Präge- und Kontextfaktoren zurückzuführen sein als die Erfahrungen dieses einen Jahres. Allerdings zeigt sich, dass die Jugendlichen auf dieser Altersstufe ein keineswegs geringes Interesse an Fragen der religiösen Identifikation haben und – fast noch wichtiger –, dass in der Zeit der Konfirmation Jugendliche, die kaum oder wenig Interesse mitgebracht haben, einen deutlichen Interessenszuwachs aufweisen. Alleine diese Feststellung, kombiniert mit der Beobachtung, dass ein nicht geringer Anteil der Jugendlichen der Form eines »believing und belonging« zugeordnet werden können und »believing« und
»belonging« überhaupt am häufigsten zusammenfallen, zeigt das breit durch die einzelnen Gruppen hindurch vorhandene Interessen- und Entwicklungspotential im Blick auf existentielle Fragen im Sinn persönlicher Glaubensfragen. Im Unterschied zu den Deutungen Davies’ und der recht strikten Trennung zwischen dem, was sie als »believing« und »belonging« bezeichnet, ist somit festzuhalten, dass das Phänomen einer Patch-work-Religiosität, für die individuelle von institutionellen Bindungen eher separiert werden, so für die befragten europäischen Konfirmandinnen und Konfirmanden nicht bestätigt werden kann. Gerade weil diese aufgrund ihrer je individuellen entwicklungsbedingten Herausforderungen das Bedürfnis haben, sich nicht nur in individueller, sondern eben auch in institutioneller Hinsicht an einzelnen Repräsentanten und Repräsentanten von Religion zu orientieren oder mindestens abarbeiten zu wollen, kann nicht davon gesprochen werden, dass sich bei Jugendlichen hier so etwas wie ein antiinstitutioneller Grundreflex oder das Bedürfnis nach einer prinzipiellen Abtrennung von der Kirche zeigt. Natürlich verwundert es nicht, wenn Konfirmandinnen und Konfirmanden sich überhaupt relativ stark in Hinsicht auf die Form des institutionellen Glaubens äußern – immerhin nehmen sie gerade an einem solchen Angebot teil und insofern antworten sie natürlich auch in dieser Hinsicht kontextgemäß. Allerdings ist die positive Einschätzung des institutionellen Orientierungsfaktors eben doch eigens zu vermerken – denn denkbar wäre ja auch gewesen, dass sie diesen Faktor gerade aufgrund ihrer konkreten Erfahrungen als unbedeutend ablehnen,
Schlag / Koch Identitätsentwicklung und Konfirmationsarbeit in jugendtheologischer Perspektive
was aber ganz offenkundig nicht der Fall ist. Dem entsprechen im Übrigen auch zwei weitere Ergebnisse der europäischen Studie, wonach am Ende der Konfirmationszeit lediglich 6% der befragen Jugendlichen »den christlichen Glauben insgesamt« als »sehr negativ« oder »eher negativ« bezeichnen, und »die evangelische Kirche insgesamt« nur von 5% als »sehr negativ« oder »eher negativ« angesehen wird. Jugendliche befinden sich jedenfalls in einer Lebensphase, in der die Orientierung und der Einfluss von erwachsenen Personen des privaten, aber auch des öffentlichen Umfeldes – und somit auch und gerade, wenn diese bestimmte Institutionen repräsentieren – wichtig ist und von deren persönlichen Einstellungen sie sich durchaus erheblich beeinflussen lassen. Gerade weil die Jugendlichen herausfinden möchten, weshalb und wozu es sich lohnen soll, dazuzugehören bzw. wovon man sich im Einzelfall notwendigerweise auch unbedingt abgrenzen muss, sind sie auch gegenüber den Glaubensorientierungsangeboten der Kirche mindestens als aufmerksame und wahrnehmende Jugendliche auf der Suche nach dem eigenen Glauben9 zu charakterisieren. In jugendtheologischer Perspektive lassen sich die aufgezeigten Ergebnisse schon ganz grundsätzlich so interpretieren, dass jedenfalls auf Seiten der Jugendlichen nicht mit einer dezidiert institutionenkritischen Haltung hinsichtlich des kirchlichen Bildungsangebots zu rechnen ist. Ganz im Gegenteil kann davon ausgegangen werden, dass Jugendliche sich von den erwachsenen Repräsentanten und Repräsentanten im
87
Zusammenhang theologischer Kommunikations- und Bildungsprozesse durchaus einiges versprechen bzw. für gerade solche Deutungsangebote offen sind, die ihnen für ihre eigene Orientierungssuche als anregend oder weiterführend erscheinen. Insofern sollte man von Seiten der verantwortlichen Akteure keine Angst vor institutioneller Erkennbarkeit haben. Gleichzeitig weisen die empirischen Erkenntnisse aber auch darauf hin, dass es keinesfalls genügt, in der konkreten Kommunikation mit Jugendlichen lediglich auf so etwas wie die tradierten kirchlichen Selbstverständlichkeiten oder bestimmte dogmatische Normen zu setzen. Es ist vielmehr davon auszugehen, dass insbesondere derjenige Teil der Jugendlichen, die über wenig oder keine religiöse Sozialisation verfügen, nicht durch eine solche innerkirchliche Binnensprache oder die entsprechenden Bild- und Vorstellungswelten erreicht werden können, die ihnen aus ihren eigenen Lebenskontexten bisher unvertraut geblieben sind. Angesichts der, wie angedeutet, in der Regel sehr langfristig erfolgten religiösen oder eben nichtreligiösen Prägung, insbesondere durch das Elternhaus, aufgrund derer oft schon eine Vielzahl von positiven oder problematischen Erfahrungen vorliegt, bedeutet dies für die jugendtheologische Arbeit zuallererst die jeweiligen individuellen Voraussetzungen inklusive der damit verbundenen sprachlichen und bildungsmäßigen Bedingungen bei den Jugendlichen selbst 9 So schon Friedrich Schweitzer, Die Suche nach eigenem Glauben. Einführung in die Religionspädagogik des Jugendalters, Gütersloh 1996.
88
Empirische Aspekte
so genau wie möglich in den Blick zu nehmen und für das eigene professionelle Handeln zu berücksichtigen. Oder um es in die klassische Trias der Theologie von Jugendlichen, für Jugendliche und mit Jugendliche zu fassen: gerade weil ein nicht geringer Teil dieser Generation zwar keine grundsätzliche Ablehnung gegenüber Kirche mitbringt, zugleich aber oftmals von einer regelmäßigen kirchlichen Praxis eher weiter entfernt ist, ist hier zu aller erst jugendtheologische Sensibilität gefragt. Konkret gesprochen macht dies auf Seiten der Erwachsenen zum ersten die möglichst aufmerksame Wahrnehmung individueller Orientierungs-, Gestaltungs-, und Sprachversuche Jugendlicher im Blick auf deren eigene Glaubensäußerungen – also der Theologie von Jugendlichen – notwendig. Zum zweiten sind die Orientierungsangebote der Erwachsenen so zu kommunizieren und verständlich zu machen, dass sie für die Jugendlichen selbst nicht als Elemente einer fremden Welt erscheinen, sondern
in ihrem Lebensweltbezug als Theologie für Jugendliche erkennbar werden. So ist beispielsweise die bei Jugendlichen durchaus auf Interesse stoßende Taufthematik ihrerseits überhaupt nicht ohne den sofortigen und unmittelbaren lebensbiografischen Bezug auf das Leben der je Einzelnen thematisierbar. Schließlich, und darin könnte gerade die jugendtheologische Pointe der Form eines »believing and belonging« liegen, sind die existenziell bedeutsamen, auf den Glauben bezogenen Kommunikationsakte, letztlich überhaupt nur im Modus eines gemeinsamen Theologisierens mit Jugendlichen denkbar und planbar. Um es noch einmal grundsätzlich zu betonen: nur wenn sich die jeweilige theologische Kommunikation selbst als Ausdruck und Äußerung der zugesagten »herrlichen Freiheit der Kinder Gottes« (Röm 8,21) zeigt, kann Konfirmationsarbeit zu Recht als zeitgemäßer und relevanter Beitrag zur freien Identitäts-Bildung eines jeden Jugendlichen bezeichnet werden.
Ward Persönlicher Glaube
89
Pete Ward Persönlicher Glaube1
1. Feurige Interaktion
Der Leiter des Alphakurses Nicky Gumbel wird im nationalen Fernsehen interviewt. Es ist kurz vor Weihnachten und dies ist nun der religiöse Teil einer normalerweise sehr oberflächlichen und schnell getakteten Vorabendtalkshow. Der Interviewer beginnt damit, nach der sinkenden Mitgliederzahl in den Kirchen zu fragen. Gumbel antwortet, indem er sagt, dass er tatsächlich vielmehr einen »steigenden spirituellen Hunger unter den jungen Leuten« wahrnimmt. Er erklärt, dass in seiner Kirche zu jedem Treffen mehr als 1000 Menschen erscheinen, wenn der Alphakurs durchgeführt wird. »Also warum kommen die Leute?«, fragt der Interviewer. Nicky führt aus, dass Menschen hier eine Erfahrung mit Gott machen, die ihr Leben verändert. Zugleich laden sie andere ein, ebenfalls zu kommen und dies zu erfahren: »Menschen realisieren, dass es hier tatsächlich nicht um Regeln und Religion geht, sondern die Beziehung mit Gott der Kern des Ganzen ist.« Daraufhin erzählt er, wie er selbst eine Begegnung mit Jesus hatte, die sein Leben verändert hat. »Als ich das Neue Testament las«, sagt er, »war es, als ob Jesus lebendig wurde und man tatsächlich diese Person kennen konnte.«2 Nicky Gumbel ist ein höchst versierter Verfechter der Sache. Seine Darstellung des Glaubens ist sowohl leicht zugänglich
wie auch tiefgründig: In dieser feurigen Interaktion muss er notwendigerweise spontan reagieren. Denn dies hier ist »live«. Hier ist nicht viel Zeit für theologische Erwägung, sondern er muss einfach das aussprechen, was seiner Überzeugung nach in diesem Moment Wirkung verspricht. Er versucht, sich mit den Zuschauern zu verbinden und den Glauben möglichst verständlich zum Ausdruck zu bringen. In diesem Kontext bringt Gumbel diejenige Theologie zum Vorschein, die innerhalb der gegenwärtigen evangelikalen3 Kirche am häufigsten in Verwendung ist. Seine spezifische Terminologie und Begriffsverwendung offenbart diese Theologie: Jesus, sagt er, ist jemand, den du ›kennen‹ kannst. Die Erfahrung mit Jesus verändert Leben. Wir haben ›Begegnungen‹ mit Jesus und der Kern des christlichen Glaubens ist die ›Beziehung‹ mit Gott. In diesem Fernsehinterview versucht Gumbel, eine gewisse Distanz zwi1 Übersetzt von Thomas Schlag. 2 https://www.youtube.com/watch?v=TfgwkN_JUg. 3 Im englischen Text findet sich hier und an weiteren Stellen das Wort »evangelical«; dieses trifft nicht genau den Sinn dessen, was im Deutschen mit »evangelikal« übersetzt wird; im englischen Selbstverständnis und im kirchlichen wie im theologischen Wortgebrauch bezeichnet es zum einen eine bestimmte Glaubenshaltung jenseits der konfessionellen Zugehörigkeitsfrage, beinhaltet zugleich aber auch die evangelische Verortung (T.S.).
90
Empirische Aspekte
schen dem, worüber er spricht, und einer Religion, die auf Regeln beruht, herzustellen. Aber interessanterweise verzichtet er zugleich darauf, solche Aspekte zu erwähnen, die man üblicherweise als ›die Botschaft‹ der evangelikalen Kirchen ansehen kann. So spricht er beispielsweise weder über Sünde noch die Notwendigkeit des Kreuzestodes Jesu; er spricht nicht über die Liebe Gottes, oder Gnade oder über Buße oder die Notwendigkeit, zu glauben. Das Interview findet in der Weihnachtszeit statt, aber Gumbel erwähnt nicht einmal die Inkarnation. Worauf er sich hingegen konzentriert, ist eine Darstellung des christlichen Glaubens als Erfahrung der Begegnung: Glaube ist persönliche Beziehung mit Jesus Christus. Die nähere Betrachtung dieses kurzen Interviews ist nicht als ›Kritik‹ an Nicky Gumbel gemeint. Ganz im Gegenteil. Tatsächlich habe ich in ähnlichen Situationen mehr oder weniger dasselbe gesagt. Der Punkt ist vielmehr, dass in seinen Predigten und Vorträgen eine komplexe, vielschichtige Interaktion zwischen einer mehr persönlichen und subjektiven Form von Theologie einerseits und einer mehr ›objektiven‹4 und dogmatisch-propositionalen Theologie andererseits offenkundig wird. Diese zwei Formen existieren miteinander und sind im Blick auf die Erscheinungsweise und den gelebten Glauben der gegenwärtigen Kirche zu einer engen Beziehung verbunden. In verschiedenen Schriften macht Gumbel längere Ausführungen über das Evangelium: in Materialien des Alphakurses entfaltet er beispielsweise ein evangelikales Verständnis von Heil in dogmatischer Begrifflichkeit. Insofern ist er nicht nur sehr klar, sondern tatsächlich auch sehr vertraut mit den ob-
jektiven Spielarten evangelikaler Theologie. Der Punkt hier ist aber, dass wir in diesem Interview einen Eindruck von dem bekommen, was man als seine ›wirksame‹5 Theologie bezeichnen könnte. Es ist wichtig, von einem solchen isolierten Interview nicht zu viel abzuleiten, aber das Thema der persönlichen Beziehung mit Christus zeigt sich doch als eindrückliches gemeinsames Thema: Es ist tatsächlich die dominierende Ausdrucksgestalt der gegenwärtigen Kirche – nicht nur unter Evangelikalen, sondern auch in der Kirche in einem viel weiteren Sinn. 2. Subjektivierung – die Wende zum Selbst
In den USA wurde in den Jahren 2002– 2003 die National Study on Youth and Religion durchgeführt, die auf mehr als 3000 Telefoninterviews und etwa 300 detaillierteren Follow-up-Interviews basierte.6 4 Im englischen Text steht meist »more personal« bzw. »more objective«. Der Komparativ wird aber im Folgenden sowohl aus sprachlichen wie auch aus inhaltlichen Gründen nicht übersetzt, da es Ward streng genommen um zwei kategorial deutlich voneinander unterschiedene Formen von Theologie geht (T.S.). 5 Ward verwendet und im Englischen den für diesen Beitrag zentralen Begriff »operant« – und dies im Unterschied zu einer »espoused« theology, was im Folgenden mit »wirksamer« und »formulierter« Theologie übersetzt wird. Der Unterschied liegt in Folgendem: »espoused theology« meint: »What we say we believe / what motivates our practice«, während »operant theology« meint: »What the practices themselves actually disclose as our lived out theology« (T.S.). 6 Christian Smith / Melinda Lundquist Denton, Soul Searching. The Religious and Spiritual Lives of American Teenagers, Oxford 2005, 292–307.
Ward Persönlicher Glaube
Die Untersuchung förderte insbesondere zur Frage von ›Jugend und Religion‹ einige recht erstaunliche Dinge zu Tage: gemäß eines der führenden akademischen Experten im Bereich kirchlicher Jugendarbeit der USA zeigt die Untersuchung, dass Kirchen in ihrer Kommunikation ausgesprochen effektiv sind. Tatsächlich haben die Kirchen einige sehr gute Wege gefunden, um mit Menschen zu kommunizieren, und sind insofern von diesen keineswegs weit entfernt. Was sie nun aber kommunizieren, sind eher wolkige und problematische Versionen des Glaubens. Christian Smith und Melinda Denton nennen diese Glaubensversion ›Moralistisch-therapeutischen Deismus‹. Sie fassen diese Glaubensäußerung in fünf einfachen Sätzen zusammen: 1. Es existiert ein Gott, der die Welt geschaffen hat und ordnet und über das Leben wacht. 2. Gott möchte, dass Menschen gut, nett und zueinander fair sind, so wie es in der Bibel und in den meisten Weltreligionen gelehrt wird. 3. Das zentrale Lebensziel ist es, glücklich zu sein und sich selbst gut zu fühlen. 4. Gott ist in mein Leben nicht involviert, außer wenn ich ihn benötige, um ein Problem zu lösen. 5. Gute Menschen kommen in den Himmel, wenn sie sterben.7 Was hier genannt wird, sind weder die formalen theologischen Verpflichtungen der einzelnen Konfessionen noch tatsächlich die dogmatischen Formeln, die von den Pfarrern und Kirchen autorisiert und akzeptiert sind. Die Untersuchung basiert auf den persönlichen Überzeugungen junger Gläubiger. Es ist nun wichtig,
91
darauf hinzuweisen, dass diese individuellen Überzeugungen zusammen mit den formalen Lehren der religiösen Gemeinschaften existieren. Diese Koexistenz ist Bestandteil der komplexen kulturellen Formen, die den Glauben ausmachen. Smith und Denton verstehen Moralischtherapeutischen Deismus jedenfalls als eine Form der Glaubensüberzeugung, die quer durch die amerikanischen religiösen Traditionen hindurch verbreitet ist: »Ein solcher de-facto-Glaube zeigt sich insbesondere unter den Jugendlichen der protestantischen und katholischen Mainline-Kirchen, wird aber auch unter farbigen und konservativen Protestanten erkennbar, jüdischen Jugendlichen, anderen religiösen Teenagern und selbst unter den vielen nichtreligiösen Teenagern in den Vereinigten Staaten.«8 Dieser Einblick macht jedenfalls deutlich, dass es fluide Formen des Glaubens gibt, die sich offenkundig zwischen und innerhalb formaler Traditionen hin und her bewegen. Dies bedeutet, dass trotz der unterschiedlichen Arten des Predigens und der Liturgie der Kirchen sowie anderer religiöser Gruppen in persönlicher Hinsicht der Glaube offenkundig in einer gemeinsam üblichen Form zu existieren scheint. Eine Ausnahme stellen lediglich die konservativeren evangelikalen Christen dar. Aber selbst in diesem Fall zeigen sich Erscheinungsformen, die ebenfalls diesen generellen Trend hin zum Persönlichen widerspiegeln. Die Themen, die Smith und Denton identifi7 Kenda Creasy Dean, Almost Christian. What the Faith of Our Teenagers is Telling the American Church, Oxford 2010, 14. 8 Christian Smith / Melinda Lundquist Denton, Soul Searching (wie Anm. 6), 163.
92
Empirische Aspekte
ziert haben, sind insofern Ausdruck eines sehr viel weiteren und generellen Wechsels hin zum »Selbst« in Gesellschaft und Religion. Die Soziologen Paul Heelas und Linda Woodhead beziehen sich darauf im Sinn der Subjektivierungsthese. Diese geht davon aus, dass eine »spirituelle Revolution« stattgefunden hat, die die Form der Rückorientierung zum Persönlichen im religiösen Leben angenommen hat. Die gegenwärtige religiöse Umwelt, sagt Heelas, ist durch eine Veränderung des religiösen Empfindens hin zu einem ›expressiven Individualismus‹ charakterisiert. Dieser Fokus auf das Individuelle, so argumentiert er, führt dazu, dass die Art und Weise, in der religiöse Traditionen als unterscheidbare und ›unterschiedliche‹ Formen des Glaubens entfaltet wurden, kollabiert.9 Dies bedeutet, dass dogmatisch orientierte religiöse Traditionen auf schleichende Weise durch den Einschluss solcher Perspektiven verändert werden, die das Individuelle und den Sinn des Selbst in den Vordergrund stellen.10 Diese Rückorientierung um das Persönliche herum zeigt die »Wende zum Subjekt«11. Diese ›Wende ist eine Bewegung, die sich von einem Leben abwendet, »das im Sinne äußerer, objektiver Rollen, Pflichten und Verpflichtungen besteht, hin zu einem Leben, das sich auf die eigenen subjektiven Erfahrungen (sowohl beziehungsorientiert wie auch individualistisch)«12 bezieht. Insofern ist die Wende zum Subjekt ein Wechsel vom ›So leben wie‹ hin zum ›subjektiven Leben‹. ›So leben wie‹ ist dabei durch einen Sinn für die Pflicht der Rollenübernahme charakterisiert, sei es als Elternteil, Ehefrau, Leiter, Schüler etc., während ein ›subjektives Leben‹ um ein solches Leben herum ausgerichtet ist, das »in tiefer Ver-
bindung mit den einmaligen Erfahrungen des Mit-sich-selbst-in-Beziehung-Seins gelebt wird.«13 Diese Veränderungen der religiösen Traditionen ereignen sich ohne größere Bezugnahme auf die formalen Auffassungen von Glaube oder Dogma. Die Orientierung hin zum Selbst wird schlichtweg zu einem theologischen Mix hinzugefügt – und dies in »nichtregulierter und unkontrollierter«14 Art und Weise. Entscheidend ist Woodheads Hinweis, dass dieses Selbst insbesondere aus einem marktorientierten, unternehmerischen Verständnis von Religion hervorgeht. Da nun also die organisierten und formalen Formen von Religion im Niedergang sind, steigt der subjektive, persönliche Glaube, wie er von den evangelikalen Kirchen vertreten wird, in bedeutender Weise: »Die neuen Teilnehmer auf dem spirituellen Marktplatz«, sagt Woodhead, »konzentrieren sich mehr darauf, Individuen im alltäglichen Leben zu unterstützen, neue Formen der Identität und des Lifestyles zu pflegen, sowie die Ähnlich-Denkenden und Ähnlich-Fühlenden inmitten der weiten Vielfalt unterschiedlicher Formen religiöser Bündnisse miteinander zu verbinden.«15 Für diese Entwick9 Paul Heelas, The New Age Movement. The Celebration of the Self and the Sacralization of Modernity, Oxford 1996, 3. 10 Ebd. 11 Paul Heelas / Linda Woodhead, The Spiritual Revolution. Why Religion is Giving Way to Spirituality, Oxford 2005, 2. 12 Ebd. 13 Ebd., 3. 14 Paul Heelas, The New Age Movement (wie Anm. 9), 4. 15 Linda Woodhead, Introduction, in: Dies./Rebecca Catto (Eds.), Religion and Change in Modern Britain, London 2012, 27.
Ward Persönlicher Glaube
lungen ist die neue Entstehung von Festivals, Netzwerken und Events zentral, da dadurch solche persönlichen Formen des Glaubens erzeugt und weiterverbreitet werden. 3. Selfation
Der holländische Soziologe Johan Roe land hat untersucht, in welcher Weise energisch aufbrechende evangelikale Gruppen solche Formen des Glaubens aufnehmen, die diese Wende zum Selbst verkörpern. Auf den Arbeiten von Heelas und Woodhead aufbauend, hat er den Begriff »Selfation« geprägt. Selfation, so sagt er, ist eine Mischung aus Heil (salvation) und Selbst (self), und dies bezieht sich auf die Art und Weise, wie die subjektive Perspektive Bedeutung über die objektiven Dogmen der Kirche hinaus gewonnen hat. Diese Beobachtung stellt in vielfacher Hinsicht eine Umkehrung oder mindestens einen Einschnitt im Blick auf die Säkularisierungsthese dar. In der Subjektivierungsthese findet Berücksichtigung, dass entlang des Niedergangs (bzw. der Säkularisierung) bestimmte Formen persönlicher Religion zu blühen beginnen.16 Subjektivierung bezieht sich auf die moderne Idee, dass Sinn, inklusive des religiösen Sinns, immer »auf das Individuum bezogen« ist. Religion beschäftigt sich deshalb immer mehr mit »individueller Erfahrung, Gefühlen und Emotionen.«17 Roeland findet in seiner Forschung Aspekte der Subjektivierung innerhalb der evangelikalen Kirche. Aber interessanterweise findet er ebenso eine starke Verpflichtung gegenüber dem, was er »religiösen Realismus« nennt. Er stimmt also in anderen Worten
93
nicht komplett mit der Theorie von Heelas und Woodhead überein, wonach Religion gleichsam durch die Wende zum Selbst überformt worden sei. Was Roeland vielmehr beobachtet, ist eine komplexe Mischung aus einerseits objektiven Formen, in denen das Evangelium und der Glaube ausgedrückt werden, und andererseits einer höchst persönlich ausgerichteten Art und Weise, wie das Individuum über diese formalen dogmatischen Ausdrucksformen orientiert wird. Diese Mischung führt ihn zum Begriff »Selfation«. Roelands Arbeiten basieren auf einer ausgedehnten ethnografischen Studie über zwei Kirchen, die über eine aktive evangelikale Jugendarbeit verfügen. Er findet hier Smiths und Dentons Auffassung des Moralistisch-therapeutischen Deismus bestätigt. »Evangelikalismus«, so sagt er, »umfasst nicht nur ein subjektives Verständnis des guten Lebens, das in Begriffen des Wohlbefindens bestimmt wird, sondern er liefert auch die Bausteine und die therapeutischen Mittel, durch die dieses gute Leben erreicht werden kann. In der Konsequenz kann ein solches evangelikales moralisches Leben sich so zeigen, dass es die Vorstellung des Subjektseins auf den Willen Gottes hin wendet, und dies unter Hinzufügung von Elementen heutiger Subjektivitätskultur, die diesem göttlichen Willen angeglichen werden.«18 Er veranschaulicht diese Wende zum Selbst anhand der Beschreibung der Erfahrung eines Gottesdienstes mit 16 Johan Roeland, Selfation. Dutch Evangelical Youth Between Subjectivization and Subjection, Amsterdam 2009, 45. 17 Ebd., 57. 18 Ebd., 209.
94
Empirische Aspekte
jungen Menschen. Dieser fand an einem Samstagabend des Jahres 2006 in einem umgebauten Heuschober statt, der der Niederländisch-reformierten Kirche der Stadt Houten gehörte. Der Raum selbst war mit Tischen und Stühlen ausgestattet, die diesen eher wie ein Café erscheinen ließen. Die Bühne war mit Scheinwerfern ausgeleuchtet. Die gesamte Örtlichkeit mit ihrem abgedimmten Licht, ihrer Bühne und der Hintergrundmusik wirkte wie ein Pop- oder Partytreffpunkt. Das eigentliche Treffen startet damit, dass ein junges Mädchen ans Mikrofon tritt und sagt: »Bitte sei Du selbst und tue, was immer Du willst.«19 Eine Rockband beginnt damit, charismatische Lobpreislieder zu spielen: »One way, Jesus. You’re the only one that I could live for. You are always, always there. Every how and everywhere. Your grace abounds so deeply within me.«20 Einige der jungen Menschen fangen an, ihre Hände zu erheben, andere beginnen zu tanzen. Nach gewisser Zeit steht ein junger Mann auf und hebt mit einer Botschaft an. Sie basiert auf der Stiftshüttenüberlieferung des Alten Testaments: Gott selbst ist ein »Camper«, denn er lebt in einem Zelt. Er führt dies aus und bittet dann die Versammelten, für sich selbst diesen Platz der Anbetung Gottes zu entdecken. Jeder sucht nach Gott, aber es macht keinen Sinn, auf- und hoch zu springen, um über die Wand des Zeltes blicken zu können. Erst indem durch Jesus die Verhüllung des Tempels zerrissen worden ist, können wir nun Gott treffen. Der Sprecher lädt die Versammelten ein, an den heiligen Ort zu kommen, um »auf Gottes Schoß zu steigen«, denn Gott möchte einfach mit den Menschen zusammen sein, die ihn lieben.21 Nach der
Predigt beginnt die Band erneut zu spielen, dieses Mal sehr viel ruhiger: »This is my desire, to honor you. Lord with all my heart I worship you.« Die weiteren Verszeilen handeln davon, Gott jeden Atemzug, sein Herz und seine Seele zu geben. An einer Stelle beobachtet Roeland, wie zwei Mädchen auf deren Bitte hin für ein anderes Mädchen beten. Während sie dies tun, legen sie ihre Hände auf ihre Schulter. Das Mädchen hat seine Augen geschlossen, dann beginnt es zu zittern und schließlich zu weinen.22 Dieser Gottesdienst-Event vermittelt ein anschauliches Bild gelebter Ausdruckskraft eines ganz normalen Jugendevents. Was aber Roelands Beschreibung herausstreicht, ist die Art und Weise, wie durch Songs, das Predigen und eine spirituelle Praxis wie das Gebet, charismatische Christen eine hochgradig persönliche und subjektive Form des Glaubens entwickelt haben. Gleichzeitig nimmt er das Ausmaß wahr, in dem diese konservative Gemeinschaft bedeutende Elemente der eigenen kirchlichen Tradition beibehält: Da ist zum Beispiel die Predigt mit biblischer Beleuchtung. Der Gesamtton des Gottesdienstes verbindet die Gelegenheit, einerseits du selbst zu sein und tun zu können, was du willst, mit dem realen Gefühl, dass dort ein Gott ist und es klare Wege gibt, diesem Gott zu antworten. Insofern folgt charismatisches Christentum nicht vollständig der »Wende zum Selbst«, die Heelas und Woodhead beschreiben. Vielmehr zeigt sich eine Art Anpassung einer konserva19 20 21 22
Ebd., 136. Ebd., 136f. Ebd., 137. Ebd., 138.
Ward Persönlicher Glaube
tiven christlichen Tradition an bestimmte Aspekte der Subjektivierung. Roelands Arbeit bringt die komplexe Beziehung zwischen einer ›formulierten‹ und einer ›wirksamen‹ Theologie innerhalb der evangelischen Kirche zum Vorschein. Es ist jedenfalls nicht der Fall, dass zum Beispiel Theologie einfach hinter sich gelassen oder gewissermaßen dem Individualismus preisgegeben würde. Was hier passiert, ist viel nuancierter und vielschichtiger. Eine formale und objektive dogmatischtheologische Ausdrucksweise existiert nicht nur gemeinsam mit persönlichem Glauben, sondern diese scheint sogar ein Umfeld zu kreieren und zu erhalten, in dem subjektive Formen des Glaubens sich überhaupt erst entfalten können. Diese Beobachtung ist wiederum komplexer als das, was Woodhead und Heelas unterstellen. Roelands Arbeiten erlauben die Folgerung, dass dasjenige, was durch die Führungspersonen innerhalb der Kirche als objektive Voraussetzung mithilfe theologisch realistischer Begriffe benannt wird, von jungen Menschen in sehr persönlicher Art und Weise angeeignet wird. Das Gleiche kann auch für Gumbels Präsentation des Evangeliums gesagt werden, insofern dort sowohl objektive dogmatische Ausdrucksformen erkennbar werden wie auch persönliche Ausdrucksweisen dessen, was es bedeutet, Christ zu sein. Das traditionelle Verständnis dieser beiden, also des Persönlichen und des Dogmatischen, ist, dass diese in einer engen Beziehung zueinander stehen. Roelands Forschung legt nun nahe, dass in der Praxis die dogmatische Ausdrucksweise des Glaubens bei den Predigenden und Lehrenden
95
erhalten bleibt. Demgegenüber nutzen gewöhnliche Gläubige diese Glaubensvorstellungen dazu, subjektive Formen des persönlichen Glaubens daraus zu entwickeln. Diese Dynamik jedoch bildet zugleich die Basis für die wachsende Unverbundenheit zwischen dem Evangelium und der wirksamen Theologien, mit denen Individuen leben. 4. Die »Vier geistlichen Gesetze« und der Wechsel zum Persönlichen
Die Wende zum Selbst wird auf Seiten evangelikalen Predigens längst mit einbezogen. Die Absicht, ein dogmatisches und theologisches Verstehen des Evangeliums miteinander zu verbinden und zum Ausdruck zu bringen, wurde immer wieder in sehr persönlichen Begriffen präsentiert. Dies kann anhand der sogenannten »Vier geistlichen Gesetze«23 veranschaulicht werden: Diese sind ein Beispiel für die Art und Weise, wie dogmatische Formen verkürzt und somit in einer stilisierten Form fixiert werden. Neben diesem Aspekt kommt allerdings auch Dynamik mit ins Spiel. Die objektiven theologischen Elemente des Evangeliums werden im Leben der jungen Menschen und Erwachsenen aufgrund deren subjektiver Orientierung relevant. Der Wunsch nach »Verbindung« mit dem gegenwärtigen kulturellen Kontext meint, dass die theologische Ausdrucksweise die persönliche zum Mittel macht, um die Wichtigkeit des Glaubens zu vermitteln:
23 Http://www.campuscrusade.com/fourlawseng. htm.
96
Empirische Aspekte
1. Gott liebt dich und hat einen Plan für dein Leben. 2. Der Mensch ist sündig, er ist von Gott getrennt. Deshalb kann er die Liebe und den Plan Gottes für sein Leben weder erkennen noch erfahren. 3. Jesus Christus ist Gottes einziger Ausweg aus der Sünde des Menschen. Durch ihn kannst du die Liebe Gottes und seinen Plan für dein Leben kennenlernen und erfahren. 4. Wir müssen Jesus Christus durch persönliche Einladung als Erlöser und Herrn aufnehmen. Dann können wir die Liebe Gottes und seinen Plan für unser Leben erfahren. In diesen Vier geistlichen Gesetzen wird die Beziehung zwischen objektivem theologischen Dogma und persönlicher bzw. subjektiver Orientierung sehr deutlich. Jedes dieser Gesetze beginnt mit einem dogmatischen Satz, zu dem dann aber die Wendung »Plan für unser Leben« hinzugefügt wird. Dies gibt dem, was nach einer eher abstrakten theologischen Formulierung aussieht, eine sehr viel persönlichere Verortung. Die Idee eines Lebensplans führt das Evangelium in eine persönliche Erzählung über. Es wird damit persönlich und nimmt den Hörenden in Anspruch. Gottes Liebe wird persönlich, weil sie im Plan, den Gott für das Leben jeder Person hat, verortet wird. Sünde wird ebenso sehr viel realer, insofern durch sie der Plan, den Gott für das Leben hat, verhindert wird. Jedes geistliche Gesetz hat insofern zwei Teile. Der erste Teil ist das, was man als eine objektive theologische Aussage bezeichnen könnte, der zweite Teil der Aussage ist in seinem Gesamtton persönlich und subjektiv. Ursprünglich wurden
diese Vier geistlichen Gesetze durch eine kleine Zahl biblischer Zitate unterstützt und im Schlussabschnitt wird der Leser dazu eingeladen, ein Gebet des Einverständnisses zu beten. Das Gebet wiederholt im Wesentlichen die theologische Reise, die in diesen vier Gesetzen enthalten ist. In der Konsequenz ist dies die Anerkennung der Wahrheit dieser Gesetze, wobei im Gebet selbst erneut eine persönliche Orientierung vermittelt wird: »Herr Jesus Christus, ich brauche Dich. Ich habe gegen Dich gesündigt. Ich öffne Dir mein Leben und bitte Dich, mein Herr und Erlöser zu sein. Vergib meine Schuld. Übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie Du mich haben willst.«24. Das Gebet des Einverständnisses baut auf das vierte geistliche Gesetz auf. Jesus Christus muss ›individuell‹ empfangen werden. Die Tür des Lebens jeder einzelnen Person muss geöffnet werden, denn nur dann kann Gottes Liebe und der ›Plan‹, den Gott für das Leben hat, erfahren werden. In einer späteren Broschüre unter dem Titel »Möchtest du Gott persönlich kennenlernen?« arbeitet der Gründer von Campus Crusade, Bill Bright, diese vier geistlichen Gesetze um das Thema Beziehung herum aus. Er führt diese evangelistische Broschüre mit der folgenden Botschaft an den Leser ein: »Lieber Freund, ja, du kannst Gott persönlich kennenlernen, so anmaßend dies auch klingen mag. Gott liegt es so sehr daran, eine persönliche, lebendige Beziehung mit dir aufzurichten, dass er bereits alle Vorkehrungen dafür getroffen hat. Er wartet geduldig und liebend 24 Ebd.
Ward Persönlicher Glaube
darauf, dass du auf seine Einladung antwortest. Du kannst durch den Glauben an seinen einzigen Sohn, den Herrn Jesus Christus die Vergebung deiner Sünden und die Zusage des ewigen Lebens empfangen. Die höchste Grenze, die uns davor abhält, Gott persönlich kennen zu lernen, ist die Ignoranz, wer Gott ist und was er für uns getan hat. Lese und entdecke für dich selbst die freudige Realität, Gott persönlich zu kennen.«25 In dieser Version der vier geistlichen Gesetze wird die Vorstellung des »Plans für unser Leben« in eine noch persönlichere und vertraulichere Begrifflichkeit umgewandelt. Die Betonung der liebenden Beziehung als Herzstück der christlichen Erfahrung reflektiert die kulturellen Schwerpunktsetzungen der 1960er Jahre. Dass Bright diese Sprache aufnimmt, ist vor allem durch sein Bestreben motiviert, das Evangelium wirksam zu verknüpfen und zum Ausdruck zu bringen. Die Hinwendung zum Persönlichen ermöglicht die Realisierung dieses Ziels und findet zugleich seinen Nachhall in den Menschen, weil es die relevanten Trends in der Gesellschaft artikuliert. Dieser Ausschnitt aus »Möchtest du Gott persönlich kennenlernen?« macht deutlich, wie formale dogmatische Elemente, etwa die Vergebung der Sünden oder die Heilsverheißung mit dem aktuellen Thema liebend-vertraulicher Beziehung verknüpft werden. Diese Beobachtung soll nun nicht suggerieren, dass die Idee der Beziehung mit Gott nicht auch in der christlichen Tradition präsent wäre. Der Punkt ist aber, dass diese theologischen Perspektiven nun in den Kontext und in ein Korrespondenzverhältnis mit der Gegenwart gebracht werden, indem die Vorstellung der vertraut-liebenden Be-
97
ziehung aufgenommen wird. Sie werden in ihrer Bedeutsamkeit herausgestellt, indem sie mit dem alltäglichen Verständnis des Selbst und seiner Vorstellung von Vertrautheit verknüpft werden, wie sie die bis zum heutigen Tag anhaltende kulturelle Bewegung der 1960er Jahre auszeichnet. Die Ausdrucksweise und die Rede von Verbindung bringen insofern zwei sehr unterschiedliche theologische Dynamiken in die evangelikale Präsentation des Evangeliums ein. Auf der einen Seite wird das formale Dogma, das mit dem Evangelium verbunden ist, verkürzt und fixiert. Daneben aber wird das so verkürzte Evangelium als eine subjektive und persönliche Art der Theologie artikuliert, die sich nun zu entwickeln beginnt. Diese persönliche Theologie führt dazu, dass das Formulierte im Leben der jungen Christen wirksam und zum entscheidenden Rahmen für das Selbstverstehen und insbesondere für den gemeinsamen Gottesdienst wird. Die verschiedenen Beispiele und Praktiken, die mit evangelikalem Christentum verbunden sind, haben ihren Ursprung im allmählichen Wechsel hin zum Selbst, der in der evangelistischen Botschaft von Campus Crusade und anderen identifiziert werden kann. Aber zugleich ist das formale Dogma im alltäglichen Leben der Christen wenig offenkundig. In Traktaten wie dem der Vier geistlichen Gesetze gibt es eine notwendige Beziehung zwischen der objektiven dogmatischen Satzwahrheit und der subjektiven Annahme des Evangeliums. Das
25 Bill Bright, Would you Like to Know God personally?, Orlando 1965 (2007).
98
Empirische Aspekte
eine führt zum anderen. Im Alphakurs und in Nicki Gumbels Schriften sowie in seinen Lehren wird diese Beziehung zwischen Dogma und Erfahrung durchgehend betont. Beide koexistieren, auch wenn diese Koexistenz, würde ich sagen, auf der Ebene der Praxis ungleich ist. Während also Führungspersonen wie Gumbel damit fortfahren, die Verbindungen explizit zu machen, wie es Roeland gezeigt hat, scheinen Gläubige die objektiven dogmatischen Elemente auf eine subjektive gelebte Theologie hin anzupassen. Die formulierte dogmatische Theologie verschwindet dabei nicht. Sie erscheint lediglich als so etwas wie eine Nebenhandlung oder als ein weit entfernter Hintergrund des alltäglichen Glaubens. Während also in der gegenwärtigen Kirche das objektive Verstehen des Evangeliums nicht aufgegeben wurde, sondern vielmehr regelmäßig formuliert wird, ist es faktisch längst unwirksam geworden. Es stellt inzwischen weniger eine Quelle für den Glauben dar als vielmehr eine Art theoretischer Untermauerung bestimmter Glaubensüberzeugungen. In der alltäglich gelebten Ausdrucksform evangelikaler Christen haben jedenfalls persönliche und beziehungsorientierte Aspekte den Platz des Dogmatischen eingenommen. Das Subjektive ist die wirksame Theologie der Gemeinschaft.
Gottesdienst am Pfingstsonntag. Während dieses Gottesdienstes wurde eine kleine Gruppe von sechs Studierenden und jungen Menschen getauft. Tatsächlich wurden drei im eigentlichen Sinne nicht getauft, weil sie bereits als Kinder die Taufe empfangen hatten. So wurde im Gottesdienst erklärt, dass diejenigen, die als Kinder getauft wurden, nun das Jawort zur Taufe erneuern würden, was durch das Untertauchen im Wasser symbolisiert wurde. Am entscheidenden Punkt des Gottesdienstes kam jeder der Kandidaten auf das Podium und nahm eine kurze Darstellung des eigenen Glaubens vor. Danach gingen sie jeweils zum Baptisterium, wo sie untergetaucht wurden, während ihre Freunde und ihre Familie darum standen und mit ihnen beteten. Während dieses geistlichen Aktes kam jeweils der nächste Kandidat auf die Bühne und legte sein Zeugnis ab.27 Eine bestimmte Anzahl von Schlüsselthemen charakterisieren diese Zeugnisse und ermöglichen einen Einblick in die ›wirksame‹ Theologie, die diese Gruppe teilte. Beinahe alle Kandidaten kamen tatsächlich aus christlichen Familien. In der Tat trat nur eine Person auf, die von einem nicht-kirchlichen Hintergrund her zum Glauben gekommen war. Die meisten Studierenden sprachen sehr warmherzig darüber, wie sie in gläubigen Familien aufgewachsen seien. Sie zeigten ihre tiefe Dankbarkeit für die christliche Gesinnung, die sie in ihren
5. Themen und Zeugnisse
Im Sommer 2009 haben Paul Fiddes und ich im kleinen Maßstab ein Forschungsprojekt über einen Gottesdienst in einer lokalen Kirche durchgeführt.26 Die Studie bezog sich auf einen einzigen
26 Pete Ward / Paul S. Fiddes, Affirming Faith at a Service of Baptism in St. Aldates Church, Oxford, in: Christian B. Scharen (Ed.), Explorations in Ecclesiology and Ethnography, Grand Rapids / Cambridge 2012, 51–70. 27 Ebd., 54.
Ward Persönlicher Glaube
Familien erlebt hatten. Einige von ihnen benutzten den Begriff »Privileg« dafür, dass sie christlich erzogen worden waren. Die Idee des Glaubens als »Privileg« ist sehr interessant und verbindet sich mit einem anderen sehr wichtigen Thema innerhalb der Zeugnisse. Drei der Kandidaten sprachen sehr enthusiastisch über die kirchliche Gemeinschaft und wie christliche Freunde aus der Kirche ihre Reise des Glaubens beeinflusst hätten. Sie sprachen ebenfalls über den Alphakurs. Aber die Wirkung, die diese evangelistischen Erlebnisse hatten, wurde in den Kontext von Freundschaft sowie in den Zusammenhang der für sie entscheidenden Beziehungen gestellt. Es war die Wärme und Freundschaft anderer Christen und der kirchlichen Gemeinschaft, die ihnen geholfen habe, zum Glauben zu kommen. Eines der Charakteristika, die wir in dieser Kirche beobachteten, war die hohe Bedeutung, die man einer warmherzigen Willkommenskultur und der Pflege der Kirche als Sozialraum beimaß.28 Die Absicht, die Kirche zu einer Willkommen heißenden Gemeinschaft zu machen, spiegelte sich in den Zeugnissen wider. Wie man es von einem Zeugnis vor der Taufe erwarten kann, sprachen alle Kandidaten über den Glauben als eine Änderung in ihrem Leben oder als Erfahrung der Umkehr. Beinahe alle von ihnen rahmten diese Idee so ein, dass sie davon sprachen, ihr »altes Leben« zurückzulassen und eine neue Reise mit Gott zu beginnen. Sie sprachen über das christliche Leben als »Vertrauen in Gott.« Drei der Kandidaten beschrieben ihr neues Leben so, dass sie auf Gott als denjenigen, der »einen Plan für ihr Leben« hat, vertrauen. Sie teilten die
99
Überzeugung, dass dieser Plan bedeute, unterwegs auf einer aufregenden Reise des Christwerdens zu sein. Einige von ihnen betonten Gottes Glaubwürdigkeit als eine tiefe Sicherheit für ihr christliches Leben. Sie betonten, dass Gott ein verlässlicher Gott sei, der auch dann mit ihnen sein würde, wenn sie Risiken eingingen und »Christen werden würden«. Über all dies hinaus vermittelten die Kandidaten das Gefühl höchster Erregtheit über ein gemeinsames Leben mit Gott und betonten zugleich die Herausforderungen und in manchen Fällen die Opfer, die dies mit sich bringen könne. Durch diese Zeugnisse hindurch wurde die sehr persönliche Natur des christlichen Glaubens betont. Christus zu folgen, wurde grundsätzlich in das Narrativ der je eigenen individuellen Lebensreise übertragen. Interessanterweise unternahm, abgesehen von einer Ausnahme, keiner der Studierenden eine spezielle Bezugnahme auf irgendeine Art objektiver theologischer Begrifflichkeit des Evangeliums. Das Kreuz Christi wurde kaum erwähnt und es erfolgten keine Bezugnahmen auf Sünde, Buße oder Heil im Sinn formaler theologischer Begrifflichkeiten. Vielmehr wurden diese Kategorien in narrativer Begrifflichkeit im Sinn der persönlichem Beziehung und anhand des Plans, den Gott für ihr Leben hat, formuliert. Durch diese evangelikalen Zeugnisse wurde offenkundig, dass die wirksame Theologie des Selbst in Beziehung zu Gott die primäre Bedeutung für das Selbstverstehen und für die Kommunikation des christlichen Glaubens gegenüber anderen darstellt. 28 Ebd., 67.
100
Empirische Aspekte
6. Die Zeugnisse
Die Zeugnisse in dieser Kirche erfolgten im Kontext eines anglikanischen Lobpreis-Gottesdienstes. Teil des Gottesdienstes waren Elemente der anglikanischen Liturgie und längere Phasen des gesungenen Lobpreises. Zudem erfolgte eine recht ausführliche Predigt.29 In der Predigt selbst fand insbesondere eine kontinuierliche Bezugnahme auf das evangelistische Verständnis des Evangeliums statt. Prediger an diesem Tag war der Leiter der Kirche und die Predigt selbst war Teil einer fortlaufenden Serie von Auslegungen des Philipperbriefs. Die Perikope für jenen Sonntag war Phil 2,1–13.30 Die Intention dieses Pfingstgottesdienstes war evangelistisch. Die Freunde und die Familien der Kandidaten, die getauft werden sollten, wurden gemeinsam mit anderen eingeladen, die sich möglicherweise eher am Rand von Kirche befinden. Die ›Zeugnisse‹ der Studierenden waren insofern darauf ausgerichtet, Zeuge zu sein – aber dies nicht einfach nur als Zeugen ihres Glaubens, sondern ebenso mit der Intention, diejenigen Gäste zu erreichen, die an diesem Abend zur Kirche kamen. Mit dieser grundsätzlichen Absicht nahm die Predigt als Erläuterung der Guten Nachricht die Form einer Verteidigungsrede für Christus an. Der erste Teil der Predigt fokussierte auf Jesus Christus. Der Prediger bezog sich auf eine Anzahl verschiedener Personen aus Geschichte und Philosophie und sprach darüber, wie Christus sowohl anziehend wie auch zutiefst bedeutsam war. Darüber hinaus wurde die Gemeinde dazu herausgefordert, den christlichen Glauben als Reise des
opfernden und wertvollen Dienstes für die Gesellschaft und Welt aufzufassen. Die Basis für diese Art der Jüngerschaft werde, so wurde erläutert, im Kreuz Jesu Christi gefunden. Herzstück der Predigt war die Erläuterung des Kreuzes als Opfer aufgrund der Sünde und für das Heil der ganzen Menschheit. Seine Ausführungen zum Kreuz illus trierte der Prediger durch das Bild, dass die Bibel von einer Hand in die andere übergeben wird, was die Weitergabe der Sünde der Menschheit auf Christus am Kreuz symbolisiere. Insofern wurde in der Predigt das »unveränderliche« Evangelium gepredigt – tatsächlich so unveränderlich, dass genau die gleiche Abbildung, die mehr als 100 Jahre lang durch die Prediger benutzt worden war, erneut zur grafischen Vermittlung dieser Botschaft eingesetzt wurde. Die Präsenz der evangelischen Botschaft im Gottesdienst ist zentral. Daran wird deutlich, dass, auch wenn die Studierenden nicht das Bedürfnis gefühlt haben, direkt über einen objektiv dogmatisch gegründeten Glauben zu sprechen und ihre Zeugnisse in persönliche Begrifflichkeiten gefasst haben, diese Ausdrucksweise doch nicht vollständig den objektiven theologischen Ausdruck 29 Ebd., 52–56. 30 In dieser Passage wird Christus den Philippern als höchstes Beispiel für ein opferbereites Leben durch den christlichen Dienst vor Augen gestellt: »Seid so gesinnt, wie es eurem Stand in Christus Jesus entspricht: Er, der doch von göttlichem Wesen war, hielt nicht wie an einer Beute daran fest, Gott gleich zu sein, sondern gab es preis und nahm auf sich das Dasein eines Sklaven, wurde den Menschen ähnlich, in seiner Erscheinung wie ein Mensch. Er erniedrigte sich und wurde gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz.« (Phil 2,5–8)
Ward Persönlicher Glaube
ersetzt hat. Die ›formulierte‹ und die ›wirksame‹ Theologie koexistieren in lebendiger Weise. Dies kommt nun dem sehr nahe, was Roelands Forschungen herausgestellt haben: Die evangelikale Kirche besteht ganz offensichtlich aus einer komplexen Mischung unterschiedlicher theologischer Stimmen. Die objektive und theologische Stimme wurde gerade nicht in der Weise durch die subjektive Stimme ersetzt, wie dies Heelas und Woodhead annehmen. Vielmehr hat sie von ihrer ›wirksamen‹ hin zu ihrer ›formulierten‹ Form gewechselt, oder vielleicht präziser ausgedrückt: Das Objektive wirkt weiter als Wirksames im Sinne einer Wurzel zur Umkehr, selbst wenn es nicht mehr als eine alltägliche »lebendige Theologie« fungiert. Sie wird weiterhin gepredigt, wenn es um Umkehr geht, aber als solche scheint sie schlichtweg den Kontext oder die Grundlage für eine persönliche Form des Glaubens bereitzustellen. Insofern sind die jungen Christen in einem Kontext zum Glauben gekommen, in dem diese Botschaft gepredigt wird – und gleichwohl haben sie offenkundig selektiv die individuellen Ausdrucksformen intern realisiert und für ihr Leben wirksam gemacht. Dies sind die Aspekte des Glaubens, die als eine alltägliche Basis in ihrem Leben »funktionieren«. Die Gruppe bestand offenkundig aus intelligenten und artikulationsfähigen Studierenden. Hätte man sie gefragt, wären sie sicherlich in der Lage gewesen, die formulierte Theologie der evangelischen Botschaft zu wiederholen. Was sie hingegen nicht taten, oder was wenigstens nicht aus diesen Zeugnissen abgeleitet werden kann, ist, dass sie eine direkte Verbindung zwischen diesen theologi-
101
schen Aussagen und ihrem alltäglichen Leben hergestellt hätten. Dafür gibt es einen Grund. Dies ist nicht nötig, weil der Gott, den sie erfahren haben, sich als so klar und kümmernd gezeigt hat. Sie sind in Gottes Leben und seine Energie aufgenommen und solange dies der Fall ist – also so lange das Evangelium in einer Form kollektiver Erinnerung bewahrt wird –, entstehen keine wirklichen Probleme. Fragen werfen sich allerdings dann auf, wenn der gelebte Glaube nicht länger trägt oder sich nicht mehr als förderlich erweist. Wenn dies geschieht, kann die Unverbundenheit von formalem Dogma und wirksamer Theologie problematisch und sogar weniger plausibel werden. Was passiert zum Beispiel, wenn der Gott, mit dem man eine persönliche Beziehung hat, offenkundig ins Schweigen übergeht, oder wenn der Plan, den Gott für das Leben hat, auf einmal Tragödie und Leiden beinhaltet, oder was passiert, wenn die willkommen heißende Familie der Kirche als eine missbrauchende erfahren wird? Unter solchen Umständen wird die Unverbundenheit zwischen einem vereinfachten Evangelium und dem sich schnell entwickelnden, persönlich wirksamen Glauben eines aufbrechenden Evangelikalismus zu einem schwerwiegenden Thema. Aber lediglich darauf hinzuweisen, dass hier ein Problem besteht, ist nicht genug. Vielmehr erfordert dies große Aufmerksamkeit für die Art und Weise, in der Theologie und Glaube in den gelebten Ausdrucksformen von Kirche präsent sind. Nur wenn der vielschichtigen Natur des Glaubens größte Aufmerksamkeit gewidmet wird, kann eine konstruktive Theologie entwickelt werden.
102
Empirische Aspekte
7. Inwiefern das Persönliche in Glaubensfragen Sinn macht
Evangelistischer Glaube ist komplex und nuancenreich. Die Wende zum Selbst kann in Ausdrucksformen von Kirche entdeckt werden, in denen sie primär als ›wirksame‹ Theologie in Erscheinung tritt. Als solche hat sie die traditionale objektive Theologie nicht ersetzt. Vielmehr ist das »Evangelium« hier zum spezifischen und formelhaften Muster theologischer Satzwahrheiten geworden. Diese Satzwahrheiten in dieser gekürzten Form sind »fixiert«. Als solche sichern sie zugleich die Glaubwürdigkeit und Verwurzelung in der Tradition. Zugleich ist diese persönlich wirksame Theologie hochgradig anpassungsfähig und offen für kontinuierliche Reformulierungen und neue Artikulationen. Diese Entwicklungen ereignen sich immer dann, wenn Kirche und ihre Führungspersonen danach suchen, den Glauben zu kommunizieren und insbesondere, wenn sie versuchen, von dort aus eine Verbindung zur kulturellen Welt junger Menschen herzustellen. Die Beziehung zwischen der unveränderlichen ›formulierten‹ Theologie und der ›wirksamen‹ Theologie der Evangelikalen ist insofern hochkomplex. Im Kern dieser Komplexität bestehen Spannungen und selbst Widersprüche. Einer der bedeutsamsten Aspekte gegenwärtiger Kirche ist, dass sie in einem Umfeld stattfindet, in dem Veränderung zum Teil des Lebens der Kirche geworden ist. Nicky Gumble argumentiert sowohl für die Aufmerksamkeit hinsichtlich angemessener kultureller Ausdrucksformen
des Glaubens wie er auch darauf beharrt, dass das Evangelium selbst unveränderlich ist. In »Questions of Life« spricht er über die Notwendigkeit für die Kirche, die Anbetung und das Zeugnisgeben ewiger Wahrheiten durch den Gebrauch zeitgemäßer Ausdrucksformen vorzunehmen: »Gott ändert sich nicht« sagt Gumbel, »noch ändert sich das Evangelium.« Die Kirche sollte deshalb nicht anfällig dafür werden, einfach jeder »vorbeikommenden Mode« zu folgen. Aber zugleich sagt er: »Die Art und Weise, in der wir anbeten und die Art und Weise, in der wir das Evangelium kommunizieren, muss für Menschen der Moderne stimmig sein.« Um so zu kommunizieren, wird es oftmals notwendig sein, etwa in der Art der Musik in Gottesdiensten, und auch in Hinsicht auf die Sprache, Anpassungen vorzunehmen.31 Dies ist grundsätzlich ein Balanceakt. Gumbel ist nicht unaufrichtig, aber ich denke, er unterschätzt das Ausmaß dessen, wie viel Veränderung die Bereitschaft zur Kommunikation des Evangeliums in Begriffen und Kategorien gegenwärtiger populärer Kultur auslösen wird. Wichtig wird in jedem Falle sein, dass die Erzählungen persönlicher Begegnungen fluide bleiben. In anderen Worten: Sie unterliegen in einem bedeutsamen Ausmaß der theologischen Innovation. Diese Fluidität meint, dass sich über die Zeit hinweg die theologische Imagination der Kirchen verändert – und dies in manchmal fast unmerklicher und doch bedeutsamer Weise. 31 Nicky Gumbel, Questions of Life, Eastbourne 1993, 216.
Shepherd Gibt es ›Anfängerglück‹ im Christentum?
103
Nick Shepherd Gibt es ›Anfängerglück‹ im Christentum? – Weshalb ›Fresh expressions von Kirche‹ für die junge Generation hilfreich zu sein scheint1 »The Church of England … professes the faith uniquely revealed in the Holy Scriptures and set forth in the catholic creeds, which faith the Church is called upon to proclaim afresh in each generation« (Zustimmungserklärung des anglikanischen Ordinationsgelübdes für Diakone und Pfarrer) 1. Fresh Expressions of Church: Aufbrechen2 und bewahren
Fresh Expressions of Church (FxC)3 ist der Name der offiziell zugelassenen Kirchenpflanzungsbewegung in der Anglikanischen ›Church of England‹ und der Methodistischen Kirche. Die FxCBewegung folgt ähnlichen Strategien und Mustern wie andere gegenwärtige Kirchenpflanzungsinitiativen. Aber diese formale Anerkennung ist einer der wesentlichen Unterschiede zwischen den FxC und anderen Kirchenpflanzungsinitiativen in Großbritannien. Eine Kirchenpflanzung kann als ein Weg verstanden werden, auf dem die Kirche sich auf Menschen einlässt, die sich nicht ›selbstverständlich‹ mit einer gängigen Kirchengemeinde oder Konfession verbinden. Solche Initiativen suchen nach kontextsensiblen Formen einer ›neuen Kirche‹, um so ein missiologisches Engagement in der gegenwärtigen westlichen Kultur zu ermöglichen.4 Diese Intention wird durch fünf Werte einer missionalen
Kirche erfasst: Trinität Gottes, inkarnatorisch sein, transformatorisch sein, Jüngernachfolge ermöglichen, beziehungsorientiert sein.5 Diese Werte liegen hinter dieser Bewegung und markieren zugleich die entscheidenden Begriffe in der Debatte über die formale Bestimmung dessen, was die Arbeit der Fresh Expressions – als ein Netzwerk, das durch die Anglikanische Kirche und die Methodistische Kirche im Jahr 2006 aufgerichtet wurde, um FxC zu fördern6 – ausmacht. Die Arbeitsdefinition lautet: – eine fresh expression ist eine Form von Kirche für unsere sich verändernde Kultur, die vor allem zugunsten der Menschen etabliert wird, die bis1 Übersetzt aus dem Englischen von Thomas Schlag. 2 Der hier im englischen Text verwendete und für die FxC-Bewegung zentrale Begriff des Pioneering wird durchgängig entweder mit Aufbrechen oder Aufbruch übersetzt. (T.S.) 3 Dies ist die geläufige Abkürzung, die auch im Folgenden hier Verwendung findet, vgl. George Lings, Report on Strand 3b: An analysis of fresh expressions of Church and church plants begun in the period 1992–2012, Sheffield 2013. 4 Vgl. Martin Robinson / Stuart Christine, Planting tomorrow’s churches today, Speldhurst / Kent 1992, 30ff. 5 Vgl. Mission-shaped church. Church planting and fresh expressions of church in a changing context, London 2004, 81f. 6 Vgl. Steven J. L. Croft, Fresh expressions in a mixed economy church, in: Ders. (Ed.), Mission-shaped questions. Defining issues for today’s Church, London 2008, 9.
104
Empirische Aspekte
her noch keine Mitglieder irgendeiner Kirche sind; – sie wird Wirklichkeit durch die Prinzipien des Hörens, Dienens, inkarnatorischer Mission und des Rufs in die Jüngernachfolge; – sie hat das Potenzial, zur mündigen Ausdrucksform einer Kirche, die durch das Evangelium und ihre bleibenden Kennzeichen profiliert ist, für ihren jeweiligen kulturellen Kontext zu werden. Wie man sich vorstellen kann, trifft diese Definition auf eine breite Vielfalt von Initiativen zu. Dieser Aufbruch hin zu neuen Formen von Kirche steht zugleich in Spannung zu der Forderung, dass FxC in einer bestimmten Verbindung zur etablierten Kirche bleiben soll.7 Diese Verbindung kann im Einzelfall von einer schwachen bis hin zu einer hochstrukturierten Form reichen. Einige FxC beginnen zu existieren und schließen sich der Bewegung an, andere werden zum Teil der Missionsstrategie in der jeweiligen Diözese.8 Die Rhetorik im Zusammenhang der fresh expressions ist die des Aufbruchs. Diese fresh expressions sind keine »Mittel, um die Institution um ihrer selbst willen einfach fortzuführen«, sondern stellen eine Aktivität für »den Geist dar, damit dieser die Kirche befähige, zu predigen und das Evangelium so zu verkörpern, dass es dem jeweiligen kulturellen Kontext entspricht.«9 Das Profil einer FxC bildet sich insofern weitgehend entlang der kulturellen und sozialen Welt derjenigen Menschen, die sich gegenwärtig nicht in der Kirche engagieren. Wie gesagt, dies kann entweder zu kleineren Neuerungen führen wie dem Angebot eines Gottesdienstes unter der
Woche, eines ›Messy Church‹-Angebots oder eines Kirchencafés. Es kann aber auch bis hin zu eher weiter entfernten Ausdrucksformen reichen, die danach streben, christliche Gemeinschaften unter Skatern, Surfern Clubbern, PartyPeople oder in neu geschaffenen modernen Wohnanlagen (sei es für Reiche oder für Menschen in Not) zu schaffen, wo komplexe Netzwerke und Nachbarschaftsgemeinden sich verbinden oder gegebenenfalls auch aufeinanderprallen. Von hier aus gesehen sind die FxC für das anglikanische Verständnis von Kirche und Mission zum kreativen wie auch zum streitbaren Ort geworden.10 Und dies insbesondere aufgrund des institutionellen Gewichts, das den fresh expressions durch die Erlaubnis gegeben wurde, aufzubrechen und ›Kirche neu zu denken‹. Für einige Verantwortliche innerhalb der FxC ist dies keineswegs willkommen, da dies die Notwendigkeit einer De-Institutionalisierung der Kirche ver-
7 Vgl. Fresh expressions in the mission of the church. Report of an Anglican-Methodist Working Party, London 2012; Mission-shaped church (wie Anm. 5). 8 Vgl. George Lings, Report on Strand 3b (wie Anm. 3). 9 Mission-shaped church (wie Anm. 5), 84.86. 10 Vgl. Steven J.L. Croft / Ian Mobsby (Eds.), Ancient faith, future mission. Fresh expressions in the sacramental tradition, Norwich 2009; Andrew Davison / Alison Milbank, For the Parish. A critique of Fresh Expressions, London 2010; John M. Hull, Mission-shaped church. A theological response, London 2006; Michael Moynagh / Philip Harrold, Church for every context. An introduction to theology and practice, London 2012; Louise Nelstrop / Martyn Percy (Eds.), Evaluating fresh expressions: Explorations in emerging church. Responses to the changing face of ecclesiology in the Church of England, Norwich 2008.
Shepherd Gibt es ›Anfängerglück‹ im Christentum?
neine und die vielen durch Laien geführten christlichen Gemeinschaften, die aus dieser Bewegung heraus entstanden sind, entwerte.11 Für andere jedoch stärkt es einen Geist der Kooperation zwischen den ›traditionellen‹12 Formen von Kirche und den fresh expressions von Kirche – und dies im Sinne einer sogenannten mixed economy – ein Begriff, der durch den früheren Erzbischof von Canterbury Rowan Williams geprägt wurde. Viele FxC bringen ihre feste Überzeugung zum Ausdruck, dass sie mit den historisch gewachsenen Ausdrucksformen der Kirche verbunden bleiben wollen, nutzen aber die Tradition in dieser Hinsicht als reiche Palette von Theologie und Praktiken, mit denen gleichsam ›gespielt‹ werden kann.13 Dies wird natürlich von manchen als ein grundsätzlicher Widerspruch zur kirchlichen Aufgabe angesehen, ihren missionarischen Auftrag zu erfüllen. In dieser Linie gelten die FxC als eine Bedrohung der Katholizität und der Ordnung der Kirche. Sie werden zudem dafür kritisiert, und dies in einigen Fällen ganz zu Recht, dass sie manche Menschen ignorieren, für die die Kirche eigentlich da sein sollte, die aber nicht genau in die digital kompetenten, jungen und hippen Café-Kultur-Netzwerke hineinpassen, um die herum sich die FxC gesellen.14 Für die Gegner der FxC bleibt die Gemeinde eine feste Notwendigkeit innerhalb einer fluiden Kultur – und zwar sowohl als Gewährleistung des Gemeinschaftslebens als auch der christlichen Tradition. Diese Kritik könnte nun durch das Aufkommen von mixed-economy-Gemeinden etwas abgemildert werden, in denen traditionelle Gemeinden und fresh expressions koexistieren und sich
105
miteinander verbinden. So gibt es starke Verbindungslinien zwischen kirchlicher, missionarischer Jugendarbeit und den FxC.15 Jugendmission und kirchliche Jugendarbeit haben ihren besonderen Ort in der Wachstumsgeschichte der fresh expressions. Der ›Mission-shaped church‹-Report – der gemeinhin als Begründungsschlüssel für fresh expressions gilt – widmet dem Thema der Jugendgemeinden als Beispielen von FxC einen eigenen Abschnitt.16 Viele der Hauptakteure innerhalb der Fresh expressions haben ihre persönliche Geschichte mit der Profilierung kirchlicher Jugendarbeit und Mission in Großbritannien. Viele der missionarischen und ekklesiologischen Experimente innerhalb der FxC lassen sich innerhalb der Entwicklung kirchlicher Jugendarbeit 11 Vgl. Pete Rollins, Biting the hand that feeds. An apology for encouraging tension between the established church and emerging collectives, in: Louise Nelstrop / Martyn Percy (Eds.), Evaluating fresh expressions: Explorations in emerging church. Responses to the changing face of ecclesiology in the Church of England, Norwich 2008, 71–84. 12 Das in diesem Beitrag und in der ganzen FxCDebatte für die »klassischen Formen von Kirche« vielfach gebrauchte »inherited« wird hier mit »traditionell« übersetzt, um so den Bezug auf die spezifischen kirchlichen, dogmatischen sowie institutionellen Formen und Traditionen der Anglikanischen Kirche deutlich zu machen (T.S.). 13 Vgl. Johnny Baker, Curating worship, London 2010. 14 Vgl. Andrew Davison / Alison Milbank, For the Parish (wie Anm. 10). 15 Gleiches gilt für die Emergent Church-Bewegung in den USA, vgl. Tony Jones, Postmodern youth ministry. Exploring cultural shift, cultivating authentic community, creating holistic connections, Grand Rapids 2001. 16 Vgl. Mission-shaped church (wie Anm. 5), 75–80.
106
Empirische Aspekte
und Mission identifizieren und beobachten – seien dies nun Experimente und Erkundungen in inkarnatorischer Mission17, Zell-Kirchen18, kulturell engagierten Gottesdienstgemeinden19, der Wiederentdeckung von ›Tradition‹ und spirituellen Praktiken20 sowie Kirchenpflanzungen in urbanen oder ländlichen Gegenden in Not.21 Von dieser Verbindung aus gibt es insofern eine Vielfalt von FxC, die eine spezifische Konzentration darauf legen, missionale Kirchen für Jugendliche und junge Erwachsene zu etablieren. Insofern ist es wenig überraschend, dass viele FxC so agieren, dass sie Jugendliche oder junge Erwachsene in Netzwerkkirchen versammeln – insbesondere in urbanen Zentren. Es bedarf kaum der Erwähnung, dass solche Modelle ausgesprochen gut mit den sozialen und kulturellen Lebenspraktiken dieser jungen Menschen zusammenpassen.22 In einer aktuellen empirischen Studie über solche FxC, die einen sehr viel deutlicheren und messbaren ›Nachbarschaft‹Fokus haben, zeigt sich ein signifikant höherer Anteil junger Menschen und Kinder als in den ›traditionellen‹ Formen von Kirche – und dies selbst dann, wenn man die Gemeinschaftsangebote ›für alle Lebensalter‹ (wie die Messy Church) bewusst herausnimmt.23 Wenn also nun die FxC offenkundig funktionieren, was könnten dann die Gründe für diesen Erfolg sein? Diese Frage kann versuchsweise beantwortet werden, indem man die missionale und ekklesiale Theologie der FxC in den Blick nimmt und diese mit der Art und Weise verbindet, in der Jugendliche ihre Glaubensidentität formen und zum Ausdruck bringen.
2. Fresh Expressions: Missionale Theologie, kirchliche Praktiken und Glaubensidentität
Die Schriften, die für Fresh expressions werben, konzentrieren sich darauf, eine ›missionale Theologie‹ oder eine ›missionale Ekklesiologie‹ als Handlungsgrundlage für die Bewegung und als Reflexionsrahmen für zukünftige Entwicklungen zu entfalten. Diese theologische Aktivität hat sowohl ihre tiefgreifend praktische wie auch ihre intellektuelle Dimension. Tatsächlich ist das theologische Verstehen, dass aus der Reflexion über die FxC hervorgeht, oftmals nachlaufend oder entsteht gleichsam im Moment der Aufgabe, sich missionarisch zu engagieren. Dies wird oft als Haupt17 Vgl. Andrew Root, Revisiting Relational Youth Ministry. From strategy of influence to a theology of incarnation, Downers Grove 2007; Pete Ward, Youthwork and the Mission of God, London 1997. 18 Vgl. Laurence Singlehurst et al., Cell-it. How to start youth cells, Harpenden 1997; Liz West / Paul Hopkins, The D factor. Youth discipleship – the hole in our thinking?, London 2002. 19 Vgl. Steve Adams / Ruth Adams, Music to move the soul. 100 group sessions using today’s music, Milton Keynes 2003; Patrick Angier, Changing youth worship, London 1997; Pete Ward, Worship and youth culture, London 1993. 20 Vgl. Jenny Baker / Moya Ratnayake, Tune in, chill out. Using contemplative prayer in youth work, Birmingham 2004, 204; Mark Yaconelli, Contemplative youth ministry. Practicing the presence of Jesus, Grand Rapids 2006. 21 Vgl. Richard Passmore / Lorimer J. Passmore / James G. Ballantyne, Here be Dragons. Youth Work and Mission off the Map, Birmingham 2013; Jo Pimlott / Nigel Pimlott, Youth Work After Christendom, Milton Keynes / Colorado Springs 2008. 22 Vgl. George Lings, Report on Strand 3b (wie Anm. 3), 45–47. 23 Vgl. ebd., 45.
Shepherd Gibt es ›Anfängerglück‹ im Christentum?
kritik an der Bewegung markiert – dass sie nämlich auf einer ›Theologie light‹ basiere und zu einer ›Kirche light‹ führe.24 Die Ursprungsargumentation zugunsten von fresh expressions, wie sie durch ›Mission-shaped church‹ präsentiert wurde, soll nun erweitert werden, um weiterreichende Fragen über Mission und Ekklesiologie aufzunehmen, die durch Hunderte von Projekten, die sich als fresh expressions bezeichnen, aufgeworfen werden. Innerhalb dieser Studien gibt es allerdings nur eine begrenzte Anzahl von solchen, die Jugendliche genauer in den Blick nehmen.25 Hier handelt es sich insbesondere um Fallstudien darüber, wie sich Jugendliche organisieren und wie diese Formen von Projekten an anderen Orten übernommen werden könnten. Dies beinhaltet zwar durchaus eine kritische Evaluation dessen, warum die Beteiligung im Einzelnen gelingt oder eben nicht, aber dies wird normalerweise nicht unter Bezugnahme auf weiterreichende Theorien zum Glauben und zur Glaubenspraxis junger Menschen unternommen – weder in soziologischer noch in theologischer Hinsicht. Um nun den ›Erfolg‹ der FxC näher zu untersuchen, beziehe ich mich auf eine theoretische Orientierung, die ich aus eigenen früheren Arbeiten über die Wirksamkeit von Jugendprojekten gewonnen habe, in deren Rahmen jungen Menschen geholfen werden sollte, ihre christliche Identität zu formen und auszudrücken. Dieses Modell wurde anhand einer fallbasierten ethnografischen Studie entwickelt. In dieser sollte die spezifische Befähigung dieser Jugendgruppen identifiziert werden, christliche Gemeinschaften zu schaffen, in denen (junge) Menschen Identitätsarbeit im
107
Blick auf den ihnen innewohnenden und jeweils neu entstehenden christlichen Glauben vornehmen können. Zu Beginn versuche ich aufzuzeigen, wie gegenwärtige Zugänge der FxC mit dieser Aktivität zusammenstimmen, danach werde ich betonen, weshalb ein solcher Zugang im Blick auf Jugendliche und junge Erwachsene entscheidend ist. Diese missionale Theologie konzentriert sich auf zwei Schlüsselfelder: Inkarnation und Inkulturation als Grundierung für sich etablierende FxC sowie Reifung und Transformation als Markenzeichen für die Entwicklung dieser Gemeinschaften als Kirche. 3. Inkarnation und Inkulturation
Inkarnation und Inkulturation bilden Schlüsselelemente der missionalen Theologie der FxC. Inkarnatorische Mission ist ein Begriff, der eine Vielzahl von Bedeutungen beinhaltet. Während die Basis für diesen Zugang auf der theologischen Rede von der Inkarnation Christi beruht, leitet sich aus dem Gebrauch des Begriffs inkarnatorisch innerhalb der FxC sowohl ein bestimmter ›Stil‹ wie auch eine ›Substanz‹ ab. Dazu ein Beispiel: ›No.5‹ ist an den meisten Wochentagen des Jahres geöffnet: die hauptsächlichen Öffnungszeiten sind nach der Schule am Nachmittag zwischen 3:30 und 5:30. Während der Schulferien variieren diese Zeiten und zugleich finden dann spezielle Aktivitäten statt. Die Anlaufstelle ermöglicht ein Gefühl 24 Vgl. Andrew Davison / Alison Milbank, For the Parish (wie Anm. 10). 25 Vgl. etwa www.churcharmyresearchunit.org und www.freshexpressions.org.uk.
108
Empirische Aspekte
von ›Zuhause‹; sie befindet sich in einem umgebauten mehrstöckigen Haus in einer normalen Anwohnerstraße. Es gibt Sessel, Tische und Stühle, Musik und eine Playstation. Jedem, der durch die Tür eintritt, wird Tee, Kaffee oder ein kaltes Getränk durch einen der Jugendleiter angeboten. Das Team, das die Anlaufstelle betreibt, besteht aus bezahlten Angestellten, jungen Erwachsenen eines Überbrückungsjahr-Programms sowie lokalen Freiwilligen in Vollzeit und Teilzeit. Im ersten Stock können die Jugendlichen das PC-Netzwerk als Zugang zum Internet benutzen. Direkt daneben befindet sich das JugendarbeiterBüro. ›No.5‹ hat kein Programm oder ein bestimmtes festes Muster von Treffen. Gleichwohl bedeutet dies nicht, dass es sich hier um ein unstrukturiertes Setting handelt. Vielmehr sind die Jugendleiter höchst einflussreich dadurch, dass sie den ›Ton‹ und manchmal das ›Thema‹ bestimmter Treffen setzen. In der Vergangenheit wurde ein Gruppenangebot für junge Männer gemacht, ein Alphakurs (als Entdeckung und Einführung in den christlichen Glauben) sowie Filmnächte. In dieser Hinsicht ist ›No.5‹ ein Raum, der durch die zielsetzenden Aktivitäten der Jugendleiter ›konstruiert‹ wird und in dem die Jugendlichen sich zugleich in fluidem Sinn bzw. flexibel einbringen können – sowohl im Blick darauf, wie oft sie erscheinen als auch, wie stark sie sich innerhalb der strukturierten und informellen Aktivitäten, die von den Leitenden angeboten werden, engagieren möchten. Vor und nach jedem Treffen setzen sich die Leitenden zusammen, um darüber zu diskutieren und dafür zu beten, was sie an Interessen oder Sorgen der Jugendlichen miterlebt haben,
mit denen sie im Austausch waren. In Erweiterung einer offenen Jugendarbeit gibt es hier auch deutlich und ausdrücklich glaubensbasierte Aktivitäten für Jugendliche. Diese beinhalten spontane ›Einfach-interessiert‹-Gruppen, die die Jugendleiter bilden. Im Ergebnis dieser Angebote wurden von den insgesamt 20 Kernmitgliedern zehn von den Mitarbeitenden als Personen wahrgenommen, die ›aktiv danach strebten, Christen zu werden‹. Die Mitarbeiter der Organisation regten zudem an, diese Jugendlichen in der Entwicklung ihres Glaubens durch eine ›eins zu eins-Jüngernachfolge-Beziehung‹ innerhalb der Anlaufstelle sowie durch die Verbindung zu einer Zell-Gemeinde zu unterstützen. Die christliche Dimension dieses Angebots von Jugendarbeit bleibt für die Jugendlichen (und, wenn es zu einem Kontakt kommt oder dieser notwendig ist, auch für deren Familien) keinesfalls verborgen. Über dem Eingang und der Glastür der Anlaufstelle ist ein großes Zeichen angebracht, dass die Organisation als eine christliche erkennbar macht. Wann immer ich Jugendlichen auf ihrem Weg zur Anlaufstelle begegnete, bezogen sie sich darauf als ›den christlichen Ort‹. Der Name ›No.5‹ wird gelegentlich wahlweise auch als Name für die Organisation verwendet, um so die Anlaufstelle damit zu identifizieren. Zusätzlich zur Signalsetzung christlicher Identität mithilfe der eingerichteten einzelnen Räumlichkeiten (mit christlichen Poster, Informationen über bevorstehende Events, Fotos von Aktivitäten, Pressemitteilungen) bestehen zusätzlich Gelegenheiten, um den Austausch über Glaubensfragen durch bestimmte Aktivitäten zu erleichtern, insbesondere durch per-
Shepherd Gibt es ›Anfängerglück‹ im Christentum?
sönliche Geschichten und Zeugnisse. In einigen der Treffen wurde allerdings ein deutlicher Widerstand dagegen erkennbar, in solchen Fragestunden ›sitzen und zuhören‹ zu müssen. Wie auch immer, Unterhaltungen im Rahmen täglicher Treffen sind die vorrangige Gelegenheit, um sich über Glaubensanschauungen auszutauschen und die Jugendarbeiter erweisen sich als sehr proaktiv darin, nach den Meinungen der Jugendlichen zu fragen. Es besteht eine generelle Haltung der Teilhabe: es gibt einen Kasten für Vorschläge und eine Graffitiwand, die beide von den Jugendlichen benutzt werden, weil sie sie als eine besondere Form wahrnehmen, durch die ihnen ›zugehört wird‹. Die Leitenden von ›No.5‹ haben versucht, die Beteiligung der Jugendlichen in anderen Jugendgruppen und Netzwerken zu unterstützen und am Ende meiner Feldstudie haben sie begonnen, ein Netzwerk kleiner Gruppen einzurichten, dass auch Jugendliche sowohl von ›No.5‹ als auch von anderen lokalen Gemeinden einschloss. ›No.5‹ veranschaulicht den Stil und die Substanz von Inkarnation und Inkulturation sehr gut: Das Projekt beginnt mit Dienstleistungen und Gastfreundschaft, von wo aus zielgerichtete Versuche hervorgehen können, das Evangelium zu verkörpern und zu entdecken.26 Jede FxC stellt den Versuch dar, einen ›Ort des Engagements‹ zu konstruieren – und dies mit der ausdrücklichen Zielsetzung, zu einem dauerhaften Engagement der Entdeckung und der Expression des christlichen Glaubens einzuladen. Der Antrieb der fresh expressions besteht darin, dass die Institution Kirche oft als eine Barriere im Blick auf ihren missionarischen Auftrag angesehen wird – im
109
Sinn der Falle zwischen ›Luther und Weber‹ – also zwischen der babylonischen Gefangenschaft der Kirche und dem stahlharten Gehäuse der Bürokratie gefangen zu sein! Ein hoher Grad an Energie innerhalb der fresh expressions wird dafür aufgewendet, unterschiedlichste ›Orte des Engagements‹ für die verschiedenen Praxisformen zu schaffen, die dazu dienen, Glaube zu entdecken und Anbetung zum Ausdruck zu bringen. Dies stellt die wesentliche Verbindung zur Rede vom ›Aufbrechen‹ (pioneering) dar – als Aufgabe, neue Orte und neue Verbindungen zu konstruieren, durch die die Kirche innerhalb der sozialen Räume und Strukturen innerhalb der gegenwärtigen Kultur präsent ist. Nichtsdestotrotz ist es ein wesentlicher Aspekt der FxC ist es, dass sie institutionell verbunden und zugleich gebunden durch die Beziehung zu den ›traditionellen Formen von Kirche‹ sind und somit zugleich Appetit auf die Wiederentdeckung und Wiedervergegenwärtigung der unterschiedlichen Merkmale und Praktiken der christlichen Tradition machen. Ein solcher Zugang passt gut mit dem zusammen, was in der kirchlichen Jugendarbeit und Mission während der letzten Jahrzehnte eindrücklich deutlich geworden und in unterschiedlichen missiologischen Reflexionen verwurzelt ist27: Neue Orte und eine neue Sprache des Engagements müssen innerhalb der 26 Vgl. Steven J. L. Croft, Fresh expressions in a mixed economy church (wie Anm. 6), 10. 27 Vgl. etwa Vincent J. Donovan, Christianity rediscovered. An epistle from the Masai, London 1982; Stephen B. Bevans, Models of contextual theology, Maryknoll 22002; Robert J. Schreiter, Constructing local theologies, London 1985.
110
Empirische Aspekte
kulturellen Räume gesucht werden, in denen Menschen leben und arbeiten – Gott ist gegenwärtig an diesen Orten und kann hier erkannt werden. Ein solcher Zugang bleibt nicht ohne Kritik. Zum ersten wird hier die vehemente Kritik geäußert, dass es unvernünftig sei, anzunehmen, ›traditionelle Formen von Kirche‹ wären etwa unfähig dazu, Engagementformen innerhalb der Gemeinschaften, denen sie dienen wollen, zu entwickeln. Zudem sei kaum aufrecht zu erhalten, sich vorzustellen, dass angesichts der vielfältigsten Schichten kultureller Verbindungen des modernen Lebens bestimmte passgenaue Ausdrucksformen von Kirche in ebenso vielfältiger Weise geschaffen werden könnten.28 Für die Kritiker gibt es deutliche Hinweise darauf, dass sich auch die ›traditionelle Kirche‹ als ›lokale Theologie‹ missionarisch organisiert: die starke Tradition der Gemeinde (oder des Dekanenamtes) kann sehr wohl als strukturermöglichende Gemeinschaft eigenen Rechts in Erscheinung treten – als eine Gemeinschaft, die in besonderer Weise Aufmerksamkeit auf diejenigen richtet, an denen die Begrenztheit der regulären sozialen Strukturen allzu offensichtlich wird.29 Was viele fresh expressions mit diesen Formen von Kirche, seien diese nun evangelisch oder katholisch, teilen, sind die konkreten Praxisangebote: diese erfolgen sowohl absichtsvoll aufgrund der Zielsetzung, christliche Identität zum Ausdruck zu bringen wie auch reflexiv in der Hinsicht, dass sie je nach Gemeinde, in der sie vollzogen werden, in einem mehr oder einem weniger ausdrücklichen Sinn angepasst werden.30 Insofern ist das vermutlich hervorstechendste Argument gegen FxC nicht die Notwen-
digkeit, neue Aspekte des Engagements zu entwickeln, sondern zu gewährleisten, dass diese Aspekte sowohl die ›Dichte‹ wie die Tiefe haben, um wirklich fresh expression der Kirche zu werden – es ist nicht die Ekklesiologie der FxC und nicht die Missiologie, die scharfe Unterschiede hervorbringt. Insofern müssen FxC nicht nur Orte des Engagements, sondern ebenso sich untereinander unterstützende sowie sich erneuernde Glaubensgemeinschaften sein, in denen der Veränderung der Verhältnisse durch Gott selbst begegnet werden kann und sich christliche Mündigkeit entwickelt. 4. Reifung und Transformation
Die Frage danach, ›was Kirche ist‹, ist natürlich sowohl für die ›traditionellen‹ Formen wie auch für die fresh expressions von dauerhafter Bedeutung.31 Das vermutlich kritischste Thema für die 28 Vgl. Martyn Percy, Old tricks for new dogs? A critique of fresh expressions, in: Louise Nelstrop / Martyn Percy (Eds.), Evaluating fresh expressions: Explorations in emerging church. Responses to the changing face of ecclesiology in the Church of England, Norwich 2008, 27–39. Hier besteht im Übrigen eine mitlaufende Spannung innerhalb der anglikanischen Kirche darüber, ob FxC die Kirche womöglich in eine mehr reformierte Position und Ekklesiologie führen könnte; dazu siehe Steven J. L. Croft / Ian Mobsby (Eds.), Ancient faith, future mission (wie Anm. 10). 29 Vgl. Andrew Davison / Alison Milbank, For the Parish (wie Anm. 10). 30 Vgl. Christopher R. Baker, The hybrid church in the city. Third space thinking, London 2 2009, 126. 31 Vgl. Martyn Atkins, What is the essence of church?, in: Steven J. L. Croft (Ed.), Missionshaped questions. Defining issues for today’s Church, London 2008, 16–28.
Shepherd Gibt es ›Anfängerglück‹ im Christentum?
FxC ist, dass diese Fragen die Verantwortlichen durchgehend beschäftigen müssen und zugleich in gewissem Ausmaß auch mit denjenigen zu verhandeln sind, die jeweils partizipieren. Die kirchliche Natur der FxC kann ›von oben‹ wie auch ›von unten‹ her kritisiert werden, und dies ist nicht unbedeutend. Davisons und Milbanks Kritik ist ein exzellentes Beispiel der Kritik ›von oben‹: Ihre Polemik gegen FxC baut das Argument gegen die Ausbreitung der FxC darauf auf, dass in ihnen Diversität und Tiefe fehle: Kirche auf nur einem Segment kultureller Verbindung aufzubauen, sei mit dem biblischen und historischen Zeugnis der Kirche unvereinbar. Mit den Bezugspunkten gegenwärtiger Kultur als Bausteinen der Ritualpraxis zu beginnen hieße, die Weisheit zu verneinen, die innerhalb der Kulturen und Traditionen der Kirchen über lange Zeiten hinweg aufgebaut worden sei. Percy, der ebenfalls diese Haltung einnimmt, vermutet, dass FxC lediglich eine Form der babylonischen Gefangenschaft gegen eine andere vertauschen – Kirchenkultur gegen Konsumkultur.32 Kann FxC eine ›Hermeneutik für das Evangelium‹ darstellen, wenn sie nicht das Gewicht von Diversität und Tiefe haben? Sara Savage weist diese Kritik zurück, indem sie von ihrer Position als Psychologin aus argumentiert, dass »FxC in größerer Übereinstimmung zur postmodernen Weltanschauung steht und viel besser verortet ist, um neue, sinnstiftende Rahmungen zu entwickeln, die es ermöglichen, das Evangelium in einer Vielfalt unterschiedlicher Wege, sowie dem je unterschiedlichen sozialen Terrain angemessen, zu verstehen.«33 Nichtsdestotrotz macht der Vorwurf, bei den FxC handle
111
es sich um eine ›Kirche light‹, eine Antwort notwendig. Eine mögliche Antwort lässt sich im Begriff des Entwickelns (›emerging‹) fassen. FxC wird nicht zur ›Kirche‹, weil sie irgendein Set ekklesialer Kriterien erfüllt, sondern durch ihre Zielsetzung, Kirche zu sein und als Kirche zu handeln. In diesem Zusammenhang ist die Auffassung der ›Bishops Mission Orders‹ für die FxC hilfreich: diese anerkennt und autorisiert, wenn religiöse Gemeinschaften – sei es unter der Leitung von Laien oder von Ordinierten – nach einer reifen Ausdrucksform von Kirchesein streben. In einer empirischen Studie der FxC illustriert die Church Army dies anhand eines Ablaufplans theologischer Reflexion – um so die fortlaufenden Konversationen, die solche Gemeinschaften über ihre eigene Identität führen, zu erfassen. Während die Fallstudien über FxC anwachsen, gibt es bisher nur wenige Arbeiten, die versuchen, die Ekklesiologie der FxC ›von unten‹ zu erfassen. Eine dieser Studien zeigt, dass FxC tatsächlich Orte sind, an denen frische Beteiligung vermittelt wird, um so diese Gemeinschaften zu befähigen, sich zu Orten der Transformation und Reifung zu entwickeln, was allerdings in der Praxis durchaus schwierig ist. In ihrer ethnografischen Studie der Messy Church haben Watkins und Shepherd entdeckt, dass viele der Teilnehmer Messy Church 32 Vgl. Martyn Percy, Old tricks for new dogs? (wie Anm. 28). 33 Sara Savage, Fresh expressions. The psychological gains and the risks, in: Louise Nelstrop / Martyn Percy (Eds.), Evaluating fresh expressions: Explorations in emerging church. Responses to the changing face of ecclesiology in the Church of England, Norwich 2008, 55–70.
112
Empirische Aspekte
als ›Kirche light‹ ansehen34 – dies wurde durchaus als positive Identifikation verstanden, weil sie fühlten, dass sie auf niedrigschwelliger Ebene Glaubensfragen entdecken und sich damit beschäftigen können. Tatsächlich entdeckte das Forschungsteam, das viele Teilnehmenden insbesondere über die Wirkung, die die Gemeinschaft um die Messy Church herum hatte, sprachen – sich dabei aber nicht auf Gott innerhalb dieser Gemeinschaft bezogen. Dies könnte natürlich ein Problem der Methodologie der Fragen sein – nichtsdestotrotz wirft dies eine offenkundige Herausforderung für die FxC auf. Messy Church ist in diesem Zusammenhang jedenfalls eine Versammlung einer Gemeindekirche, die ihrerseits in einer physischen und fühlbaren Verbindung zu dieser sich entwickelnden Gruppe bleibt. Die Schlüsselherausforderung der FxC im Blick auf ihre Reifung beinhaltet die Fähigkeit, sich zu, wenn man so will, »charaktervollen Gemeinschaften« zu entwickeln.35 Dies bringt die Aufgabe mit sich, den ethischen Sinn des christlichen Glaubens in sich zu verkörpern und aus sich heraus zu erzeugen – Jüngernachfolge als Praxis der Glaubensüberzeugung, eine sichtbare Gemeinschaft zu sein, die ein tragfähiges Leben vor Gott beispielhaft modelliert – um so zu zeigen, was Gott ermöglicht. Genau darin besteht die fortwährende Verbindung und Aufrechterhaltung der fresh expressions als Teil von Kirche, selbst wenn sie damit der Institutionalisierung widersteht. Die Anziehungskraft der ekklesialen Gemeinschaft, deren Teil die FxC bleiben, hält diesen ›Druck‹ aufrecht – wie auch im Umkehrschluss die Kreativität der FxC die traditionellen Formen von
Kirche dazu stimuliert, ihre eigenen frischen Einsatzpunkte zu entwickeln. Dies ist möglicherweise der Kerninhalt einer ›mixed-economy‹-Sicht – eben nicht nur, dass hier ein Spektrum verschiedenster Formen von Kirche besteht, sondern dass diese sich jeweils darin helfen, sich im Blick auf den gemeinsamen Auftrag des Kircheseins zu stimulieren.36 Aber auch ohne solche festen ekklesiologischen Bestimmungen sind FxC Orte, an denen Transformation erkannt und von den ›gewöhnlichen‹ Personen, die daran partizipieren, artikuliert wird. Zentren der Praxis und Rituale innerhalb der FxC und ebenso die Beziehungen innerhalb der Gruppen können als Schlüsselstelle dafür verstanden werden, dass sich Gottes Gegenwart hier zu erkennen gibt und erschließt.37 Rollins argumentiert, dass anstelle des propositionalen theologischen Diskurses innerhalb der FxC eine Vielfalt von beweglichen und poetischen Wegen von Erkenntnis aufge-
34 Vgl. Clare Watkins / Bridget Shepherd, The Challenge of ›Fresh Expressions‹ to Ecclesiology. Reflections from the Practice of Messy Church, in: Ecclesial Practices 1/1 (2014), 92– 110. 35 Vgl. Mark Mason, Living in the distance between a ›community of character‹ and a ›community of the question‹, in: Louise Nelstrop / Martyn Percy (Eds.), Evaluating fresh expressions: Explorations in emerging church. Responses to the changing face of ecclesiology in the Church of England, Norwich 2008, 85–104. 36 Vgl. Stephen Cottrell, Letting your actions do the talking, in: Steven J. L. Croft / Ian Mobsby (Eds.), Ancient faith, future mission. Fresh expressions in the sacramental tradition, Norwich 2009, 66–80. 37 Vgl. Mark Mason, Living in the distance (wie Anm. 35); Sara Savage, Fresh expressions (wie Anm. 33).
Shepherd Gibt es ›Anfängerglück‹ im Christentum?
funden werden können. Wie er eindringlich herausstellt, ist dies nicht neu, aber die Fähigkeit, solche Rituale zu ›spielen‹, ist ein wesentlicher Weg, der neue theologische Einsichten ermöglicht. Für Rollins sprechen solche Erlebnisse für sich selbst und haben in sich selbst die Kapazität, individuelle Subjektivität zu transformieren. Dies kann dann dazu führen, dass die schon gewussten oder noch unbekannten Erfahrungen und Transformationen diskutiert werden können und ihr damit eine sprachliche Ausdrucksgestalt gegeben werden kann.38 Insofern können gerade die Praktiken innerhalb der FxC positive Transformationsprozesse ermöglichen. Dykstra und Bass schreiben über christliche Praktiken als »Dinge, die Christen machen, um so fundamentale menschliche Bedürfnisse in Antwort auf und im Licht von Gottes aktiver Gegenwart in der Welt (in Jesus Christus) zu adressieren.«39 Für Dykstra und Bass sind solche Praktiken nicht einfach Aktivitäten, die in solchen Gemeinschaften irgendwie stattfinden, sondern die Art und Weise, in der ein normatives Verstehen des Glaubens gesucht und erwogen wird; die Art und Weise, in der die transformierende Hoffnung und Kraft Gottes vermittelt und von Menschen erfahren werden kann.40 Menschliche Sünde mag nun solche Praktiken selbsttrügerisch und selbstbezogen werden lassen, sodass Aktivitäten, die das Ziel zu haben scheinen, sich dem Leben Gottes zu öffnen und daran teilzuhaben, im Effekt gerade das Gegenteil erreichen, wenn sie nicht auf die »aktive Gegenwart Gottes« bezogen bleiben.41 In diesem Sinn wird die Teilhabe an Praktiken als die Art und Weise angesehen, in der Normativität
113
innerhalb christlicher Gemeinschaften gesichert wird. Wie Swinton und Mowat deutlich machen, sind christliche Praktiken normativ und mit theologischem Inhalt geladen. An solchen Praktiken zu partizipieren ist insofern der Versuch, glaubwürdig an den fortlaufenden Aktivitäten Gottes selbst teilzuhaben.42 Eine alternative Wertschätzung des Ortes christlicher Praktiken wird von Tanner vorgenommen43, die Praktiken nicht als »von Natur aus christlich« ansieht, sondern als Art und Weise, in der Glaubensgemeinschaften die Basis ihres Christseins festsetzen: und dies sowohl durch historisch gewachsene christliche Praktiken wie auch durch neue Praktiken, gleichsam »neu geboren zu einem neuen Zweck.«44 Darüber hinaus sind christliche Gemeinschaften für Tanner, indem sie Gottes Praxis folgen, offener dafür, zu interpretieren, wie Dinge sein sollten, als abhängig davon, sich durch bestimmte Aktionen auf eine ganz bestimmte Art und Weise zu engagieren.
38 Vgl. Pete Rollins, Biting the hand that feeds (wie Anm. 11). 39 Craig Dykstra / Dorothy C. Bass, A Theological Understanding of Christian Practices, in: Miroslav Volf / Dorothy C. Bass (Eds.), Practicing theology. Beliefs and practices in Christian life, Grand Rapids / Cambridge 2002, 18. 40 Vgl. ebd., 22. 41 Ebd., 25. 42 Vgl. John Swinton / Harriet Mowat, Practical Theology and Qualitative Research, London 2005, 21.24. 43 Vgl. Kathryn Tanner, Theological Reflection and Christian Practices, in: Miroslav Volf / Dorothy C. Bass (Eds.), Practicing theology. Beliefs and practices in Christian life, Grand Rapids / Cambridge 2002, 228–242. 44 Ebd., 230 sowie Kathrin Tanner, Theories of culture. A new agenda for theology, Minneapolis 1997.
114
Empirische Aspekte
Für Tanner sind christliche Praktiken fluide und flexibel: sie passen sich sowohl der Realität des organisierten sozialen Lebens an wie sie sich auch auf ihre historischen Sinnstiftungen beziehen.45 All dies lässt theologische Reflexion zum zentralen Vorgang innerhalb der Gemeinschaft werden. Tanner argumentiert, dass genau diese Art und Weise, wie Christen handeln und ihre Aktivität als eine besondere verstehen, den sinnstiftenden und in seiner Bedeutung zu erfassenden Wert christlicher Praxis ausmachen – jedenfalls sehr viel stärker als das interne »Besitzen« solcher Praktiken.46 Innerhalb beider Zugänge geht es nicht nur darum, wie bestimmte Praktiken Menschen dazu befähigen könnten, ein normatives Verstehen des Glaubens auszuformen, sondern wie die Praktiken selbst ein Mittel der Teilhabe an der fortwährenden Aktivität Gottes werden können. 5. Fresh expressions: Zur Schaffung von Orten und Wegen zielgerichteter christlicher Gemeinschaft und individueller christliche Identität
Savage u.a. entwickeln einen Interpretationsrahmen, um Spiritualität in ihrer konstruktiven Bedeutung für die Entwicklung einer Selbst-Identität zu verstehen, die sich aus den Erzählungen und der Teilhabe am Konsum- und Media-Lifestyle der Gegenwart aufbaut.47 Sie argumentieren, dass ihre Feldforschung die Anschauung unterstützt, dass Jugendliche sich selbst als Autoren der eigenen Persönlichkeit verstehen.48 Im Sinn einer theologischen Kritik bezeichnen sie je-
doch eine solche Suchbewegung ohne Bezugnahme auf Gott als häretische Sichtweise.49 Um dies neu zu fassen, ermutigen sie zu einer Sichtweise, wonach Mission festeren Grund bieten muss, damit Identität innerhalb der Erzählungen und Praxis der jeweiligen Glaubensgemeinschaft konstruiert werden kann.50 Dies kann durch die Feldforschung, die ich bei ›No 5‹ durchgeführt habe, veranschaulicht werden. Im Sinne eines ›konstruierten Porträts‹, dass sich aus Fragen und Antworten der von mir geführten Interviews zusammensetzt, zeige ich auf, wie diese Transformation geschah: Marilyn: Wann hast du angefangen, über Gott nachzudenken? Bryony: Nun, die Dinge zu Hause wurden wirklich schlecht und etwas, worüber ich wirklich nicht stolz bin, begann: Ich fing damit an, meinen Körper zu benutzen, ich schnitt mich selbst und trank viel zu viel, was mich krank werden ließ. Ich habe dies vielleicht einmal, zweimal die Woche gemacht. Marilyn: Wie kam es dazu, dass du aufgehört hast? Bryony: Es war nach der Segnung von Janes’ Baby, als ich realisierte, dass, … nun …, ich war blöd. Dieser Tag des Gottesdienstes war großartig, extrem viele Menschen waren dort, um ihn in die Kirche zu bringen. Jeder war so glücklich und ich dachte nur, dass ich es toll fände, wenn mir dies 45 Vgl. ebd., 230f. 46 Ebd., 233. 47 Vgl. Sara Savage et al., Making sense of Generation Y. The world view of 15- to 25-year-olds, London 2006, 31 sowie Abby Day, Believing in belonging. Belief and social identity in the modern world, Oxford 1997. 48 Vgl. Savage, Making sense, 52ff. 49 Vgl. ebd., 152f. 50 Vgl. ebd., 156–158.
Shepherd Gibt es ›Anfängerglück‹ im Christentum?
auch geschehen würde. Aber dann schaute ich auf all die schlechten Dinge, die ich getan hatte und ich begann zu denken, warum sollte dieser Gott mich wollen? Marilyn: Hast du das rausgekriegt? Bryony: Yeah. Irgendwann. Ich entschied an diesem Tag, alles zu ändern und meinen Körper gut zu nutzen, um so zu versuchen, ein gutes Beispiel für andere Jugendliche, die herkommen, zu werden. Ich habe auch versucht, mehr über Gott zu lernen. Marilyn: Das kann ich bestätigen! Bryony: Bevor ich Christ war, bin ich andauernd in Schwierigkeiten geraten. Hab mich geprügelt, Menschen verletzt, richtig schlimm. Aber jetzt als Christ, seit drei Jahren, hat es mich dazu geführt, dass ich aufgehört habe, mich zu schlagen, in Schwierigkeiten zu geraten, und es hat mir geholfen, um nun sehr viel ruhiger zu sein. Marilyn: Ich mag dich ruhiger. Bryony: Ich auch. Es verändert die Art und Weise, wie ich über mich denke, denn ich habe mich nie für irgendwie bedeutsam gehalten. Ich war es gewohnt, mich einfach selbst zu hassen, jeden Teil von mir zu hassen, aber jetzt akzeptiere ich einfach die Tatsache, dass ich bin, wer ich bin und das tue ich auch, denn das bin ich. Marilyn: Amen, Schwester! Bryony: Das ist natürlich hart, weil, ich geh immer noch manchmal aus und fange an, herum zu rotzen, aber das ist keine gute Sache. Marilyn: Was denkt deine Familie über deinen Glauben? Bryony: Mein Dad – er versteht es und er weiß, dass ich Christ bin und er ist für mich da, er war für mich da, als ich im Krankenhaus war und so und all das, aber meiner Mum, ist einfach alles egal, komplett … Sie will sich nicht damit beschäftigen, was ich glaube und so. Marilyn: Und deine Freunde?
115
Bryony: Ich spreche zu meinen Freunden darüber, wie es ist, ein Christ zu sein und so, wenn sie Probleme haben … Dann sage ich zu ihnen: ›Nun, ich erzähl euch jetzt was als Christ, so, hört einfach zu, ihr müsst mir nicht zustimmen, ich werde nicht versuchen, euch zu bekehren, ich will euch nur was sagen‹. Und dann sitzen sie da und hören mir zu und so. Marilyn: Das ist ziemlich gut. Das ist besser als bei mir! Bryony: Gibt es ›Anfängerglück‹ im Christentum?
Ein Einblick in den Erfolg der FxC kann gewonnen werden, wenn man die Art und Weise, in der Teilhabe in ›No.5‹ mit der Identitätsarbeit, mit der die Jugendlichen beschäftigt sind, verbunden wird. Für diese Jugendlichen ist diese aktive Identitätsarbeit besser zu beschreiben als eine ›Identitätsarbeit durch Glauben‹. Wie bereits zuvor erwähnt, ziehen Savage u.a., unterstützt durch ihre Feldforschung über die Spiritualität und den Glauben der Generation Y, den Schluss, dass kirchliche Jugendarbeit als Mission den Fokus darauf legen sollte, Gelegenheiten zu eröffnen, damit Jugendliche ihre Identität innerhalb der Erzählungen und der Praxis der Glaubensgemeinschaft konstruieren können.51 Dies geschieht offensichtlich tatsächlich in 51 Die Tatsache, dass Jugendliche sich tatsächlich mit ›Identitätsarbeit‹ befassen – im Sinn der Konstruktion der Selbstidentität durch einen bestimmten Lebensstil – ist durch die Jugendforschung gut belegt; vgl. Johnson, Chambers, Raghuram, & Tincknell, 2004), was Graham für ihre Studie zum Habitus ebenfalls heranzieht (1996, 109); vgl. Richard Johnson et al., The Practice of Cultural Studies, London 2004; Elaine L. Graham, Transforming practice. Pastoral theology in an age of uncertainty, London 1996.
116
Empirische Aspekte
diesem Zusammenhang. Aufgrund der Erfahrungen in dieser Aufnahmestelle beschreiben die Jugendlichen die Art und Weise, in der tief verankerte Kämpfe über den Sinn des Selbst nun neu geschrieben werden, anhand der Teilhabe in der Glaubensgemeinschaft, die in dieser Aufnahmestelle präsent ist und sich von dort aus ausweitet. Es wird zugleich deutlich, dass diese Teilhabe sich als sich als dem »reflexiven« Glauben ähnlich ausformt, wie er seinerseits in der Jugendgruppe geformt wurde. Hier nun von einem bewusst kon struktivistischen Zugang zur Glaubensformation auszugehen, ist dabei durchaus zu bezweifeln. Dean argumentiert beispielsweise, dass es aus pastoraler Sicht nicht wünschenswert ist, zur »zeitaufwändigen Pflicht« zu ermutigen, eine Patchwork- oder konstruierte Identität integrieren zu wollen.52 Die Aufmerksamkeit sollte vielmehr darauf ausgerichtet werden, Identität als ein ›Geschenk‹ von Gott zu realisieren. Im Unterschied dazu plädiert Anderson dafür, dass die aktive Konstruktion eines »glaubenden Selbst« ein durchaus wünschenswertes Ziel christlicher Erziehung darstellt. Das Glaubensleben sucht ein Gefühl der »Stabilität des Selbst« durch die Beziehung mit Gott, unterstützt durch die Teilhabe an der Glaubensgemeinschaft.53 Ich bevorzuge, von einem vom Habitus beeinflussten Identifizieren zu sprechen. Gemäß Farley meint Habitus hier »die Ausrichtung der Seele und das denkfähige Bewusstsein von Gott«. Geht man vom Habitus als Produkt menschlicher Arbeit aus, dann kann theologisch gesprochen Glaube sowohl als Geschenk wie auch als Arbeit angesehen werden.54 Es geht folglich um die Balance zwi-
schen der angenommenen Individualität als einem Geschenk Gottes, das man empfängt und als Produkt menschlichen Strebens nach gottebenbildlicher Identität. Das Gefühl für den Aspekt des Geschenks wie für den der Arbeit ist in den reflektierenden Kommentaren der Jugendlichen in diesem Porträt gegenwärtig. Das Projekt selbst ist der Ort, an dem Jugendliche dieses Geschenk erfahren können – an dem sie aber zugleich auch ermutigt werden, die christliche Identität mithilfe einer gesteigerten Teilhabe an der zielsetzenden christlichen Gemeinschaft, zu der diese Anlaufstelle Zugang eröffnet, aktiv zu verfolgen. Das nächste Porträt verdeutlicht nun, wovon diese Identitätsbildung beeinflusst wird. Wiederum wird ein Dialog zwischen zwei Jugendlichen in der Annahmestelle konstruiert, nun darüber, inwiefern die Erfahrungen in dieser Anlaufstelle für das Glaubensverständnis und für die christliche Identitätsentwicklung bedeutsam sind: Tess: Mann, ich hab mir echt ins Hemd gemacht, als ich hier reingekommen bin. Ich dachte, das wird echt blöd. Ellen: So ging’s mir auch. Es ist ›der christliche Ort‹. Tess: Yeah, ich dachte, dass es echt blöd wird und schräg. Ellen: Ich hab mich echt zu Tod gefürchtet, weil ich allein war, und es war das erste 52 Kenda C. Dean, Practicing passion. Youth and the quest for a passionate church, Grand Rapids 2004, 62. 53 Vgl. E. Byron Anderson, A Constructive Task in Religious Education. Making Christian Selves, in: Religious Education 93/2 (1998), 188. 54 Vgl. Edward Farley, Theologia. The fragmentation and unity of theological education, Philadelphia 1983, 44.
Shepherd Gibt es ›Anfängerglück‹ im Christentum?
Mal, dass ich da reinging, ich hab mich nach Leuten umgeschaut, die ich kenne und eine Person kam beiläufig auf mich zu und sagte ›Hi, bist du neu?‹ Tess: Das brachte uns drei sozusagen als Freunde zusammen, nicht wahr? Und es machte mir klar, weißt du, Gott kann einen Ort wie diesen zusammenbauen und, das habe ich damals nicht gesehen, aber die Veränderung, die ich in einigen Leuten gesehen habe, du weißt, wenn er das tun kann, dann ist er … Ellen: Ich habe jetzt schon zwei Alphakurse gemacht, und obwohl ich jetzt klarer sehe, wie das mit Gott ist, weiß ich persönlich noch nicht genug, um diesen Schritt zu machen und mein Leben tatsächlich Gott zu übergeben. Tess: Einmal beim Alpha, da hatten wir diesen Ausflug, wir gingen ins Kino und waren bei McDonald’s und so, wir kamen zurück und wir unterhielten uns alle, im Raum, wo die Playstation ist, und wir sagten Gebete und es war echt nett, fühlte sich nett an. Ellen: Ich mag es, wenn sie einen Fragen über den eigenen Glauben fragen, dann können sie sehen, woher du kommst, die verstehen das sozusagen. Wenn du es ihnen ein wenig klar machst. Aber dann verstehst du auch, wo sie herkommen. Und die Tatsache, dass alle einige Stücke des eigenen Lebens mit den anderen teilen können, hilft wirklich. Tess: Yeah. Zum Beispiel, wenn mein Dad Gott als einen echt furchtbaren Namen bezeichnet und er mich die ganze Zeit aufzieht und schlimme Dinge sagt. Ellen: Was tust du dagegen? Tess: Ich ignoriere ihn, und so. Ich bete zu Gott, dass er mir hilft, ihn zu ignorieren. Meine Mum, sie ist keine Christin, aber sie weiß, dass ein Gott existiert, sie glaubt, dass da ein Gott ist, und deshalb hilft sie mir, wenn ich irgendeine Hilfe brauche. Aber im Grunde ist es gerade hier, wo es mir am meisten hilft, definitiv, yeah.
117
Ellen: Wenn ich nicht hierhergekommen wäre, hätte ich meinen Glauben wohl ziemlich verloren, weil, da ist niemand in meiner Familie, der Christ ist. Tess: Vor einem Monat etwa oder vielleicht vor drei Wochen, betete ich zu Gott, dass ich ein bisschen näher an diesen Ort rücken kann und ein bisschen mehr helfen kann. Und ich hab damit angefangen, die Tische abzuwischen, und dann, ich glaube, es war ein Montag, kam Duncan und sprach so mit mir und sagte sowas wie ›Hast du Lust, ein paar Verantwortlichkeiten zu übernehmen?‹ Ich sagte sowas wie ›Yes! Das würd’ ich sehr gerne.‹
Graham geht von den Argumenten Farleys aus und führt dies weiter, indem sie sagt, dass die Konstruktion des Habitus eine persönliche und gemeinschaftliche Dimension hat. Der Habitus fokussiert nicht in erster Linie darauf, wie Glaubensüberzeugungen verkörpert werden, sondern darauf, wie durch gemeinsame Aktion »christliche Präsenz in der Welt«55 etabliert wird. Das oben genannte Projekt zeichnet sich folglich durch die Formation und Teilhabe an der »zielführenden christlichen Gemeinschaft« aus, in der diese Praktiken Gott erschließen und Transformation sowohl auf persönlicher wie auf gemeinschaftlicher Ebene vermitteln.56 55 Elaine L. Graham, Transforming practice (wie Anm. 51), 98. 56 Vgl. Ebd., 111. Insofern sehe ich bei Graham, dass sie sich eine transformationale Perspektive aneignet, um die Beziehungen zwischen der soziologischen und der theologischen Interpretation der Realitätsstrukturen verstehen zu können – dass also soziale und entwicklungsbezogene Prozesse Gottes fortwährende Aktivität ›offenbaren‹ können, und nicht ›lediglich‹ menschliche Prozesse beschreiben, die eine Korrelation mit alternativen theolog-
118
Empirische Aspekte
Dieses Interview-Porträt identifiziert zwei Schlüsselfunktionen der Teilhabe an zielführenden christlichen Gemeinschaften: Aktivitäten, die »erweiterte neue Kenntnis ermöglichen«57 und dazu dienen, sich der eigenen Identität zu vergewissern.58 Graham verwendet den Begriff Habitus nicht als ein »bestimmendes Objekt« für den Glauben einer Person, sondern als ein Konstrukt, das die dynamische Beziehung zwischen dem Glauben einer Person und ihrer Identität sowie der Glaubenspraktiken, an denen diese teilhat, verdeutlicht.59 Für Graham strukturiert Habitus nicht nur bestimmte habitualisierte Antworten, Werte und das Verstehen, sondern dieser agiert zugleich als das »Rohmaterial« für »regulierte Improvisationen« in der Hinsicht, wie Individuen sich ihr Glaubensverständnis aneignen und es anpassen.60 Dies führt zu Grahams Argument, dass praktische Weisheit über den Glauben einem Individuum »innewohnt und konstruiert« ist: Habitus wird jeweils immer wieder neu für jede Generation übertragen und wird von dieser jeweils reinterpretiert.61 Die Aufgabe dieses ›innewohnenden und konstruierenden‹ Habitus für diese Jugendlichen ist grundsätzlich durch einen schroffen Gegensatz zwischen ihrem Familienkontext und der kirchlichen Jugendgruppe beeinflusst. Die Hauptsorge Jugendlicher ist es, wie sie die Wirkung des Gefühls, selbst Christ zu sein, mit dem eher ambivalenten oder ablehnenden Familienleben im Blick auf ihr Christsein vereinbaren können. Wie schon im vorherigen Fall, ist es die Teilhabe an dieser Anlaufstelle, die diese Jugendlichen als den Weg bezeichnen, um mit diesen einander sich durchkreuzenden
Erfahrungen umgehen zu können. Noch schärfer gesagt: Es sind die Anerkennung der Anlaufstelle als ein ›christlicher Ort‹ sowie die Eindrücke und Erwartungen der Jugendlichen darüber, was es angesichts dieser spannungsvollen Erfahrungen bedeuten könnte, Christ zu sein. So empfehlen Savage u.a., dass christliche Jugendarbeit darauf abzielen sollte, genau solche Begegnungen zu ermöglichen. Allerdings ist auch zu erwähnen, dass viele der jungen Menschen, die die Anlaufstelle besuchen, auf diese Begegnung nicht im Sinn einer Transformation reagieren, sondern eher durch eine starke Reaktion der Loslösung von diesem ›Ort‹. Eine FxC kann als zielorientierte christliche Gemeinschaft agieren, innerhalb derer Jugendliche ohne Hintergrunderfahrungen oder Verbindung zur
57 58 59
60 61
ischen Beschreibungen dieser Realität erfordern würden; vgl. Ray S. Anderson, The shape of practical theology. Empowering ministry with theological praxis, Downers Grove 2001; James E. Loder, Normativity and Context in Practical Theology. The Interdisciplinary Issue, in: Friedrich Schweitzer / Johannes A. van der Ven (Eds.), Practical Theology – International Perspectives, Frankfurt am Main / New York 1999, 359–381. Elaine L. Graham, Transforming practice (wie Anm. 51), 99. Vgl. ebd., 166. Vgl. ebd., 109. Brittain argumentiert, dass Habitus als eine Kurzbezeichnung für eine theologische Reflexion dienen kann, die sich mit der Konstellation der Empfindsamkeit für die körperliche Natur aller Praxis sowie der Bedeutung des sozialen Kontextes für die individuelle Subjektivität und teilhabeorientierte Lernstile beschäftigt, vgl. Christopher C. Brittain, Can a theology student be an evil genius? On the concept of habitus in theological education, in: Scottish Journal of Theology 60 (2007), 427. Elaine L. Graham, Transforming practice (wie Anm. 51), 103. Vgl. Ebd., 95.
Shepherd Gibt es ›Anfängerglück‹ im Christentum?
Kirche zur glaubensbezogenen Identitätsarbeit ermutigt werden können. Dies bestätigt die zentrale Prämisse meiner fallbasierten Praxistheologie – dass nämlich kirchliche Jugendarbeit zu einer zielorientierten christlichen Gemeinschaft führen kann, innerhalb derer Jugendliche sich mit ihrer Glaubensidentitätsarbeit beschäftigen können, indem sie einen Habitus des Glaubens für sich annehmen und konstruieren. Fresh expressions der Kirche sind nicht die einzige Möglichkeit, durch die sich ein solcher Prozess ereignen kann.
119
Die anwachsende Forschung in diesem Bereich macht deutlich, dass Teilhabe an der ›traditionellen Kirche‹ ähnlich kraftvoll sein kann.62 Nichtsdestotrotz: Die missionale Theologie der FxC hat eine besondere Triebkraft, um sich mit jungen Menschen zu verbinden und die ekklesiale Theologie gibt deren Glaubensverständnis und Glaubensausdruck eine Stimme, pflegt diese und stärkt sie. 62 George Lings, Report on Strand 3b (wie Anm. 3).
120
Empirische Aspekte
Monique van Dijk-Groeneboer Jugend und religiöse Gemeinschaften: Zwei getrennte Welten? Inspiration für Jugendliche und von Jugendlichen und die Herausforderungen für die Kirche und religiöse Gemeinschaften in den Niederlanden1 Zielsetzung dieses Artikels ist es, das Verhältnis von Jugend, Kirche und Gemeinschaft in den Niederlanden in den Blick zu nehmen. Genauer gesagt, konzentrieren sich diese Ausführungen auf das Thema »Jugendliche und ihre Suche nach Religion, Glaube und Inspiration«. Diskutiert wird, ob die großen Religionen und Religionsgemeinschaften für diese Suchbewegungen eine Bedeutung haben können. Ich werde wesentliche Charakteristika dieser Generation, inklusive deren Religion, religiöse Aktivitäten sowie die sie inspirierenden Themen und Personen benennen. Sind Jugendliche wirklich so individuell wie jedermann es annimmt? Welche berühmten Personen inspirieren sie, und welche Ängste haben sie in der Gegenwart? Im ersten Teil dieses Artikels werde ich einige wesentliche Forschungsergebnisse aus unterschiedlichen Studien präsentieren, die sich mit dem Thema Jugend und Religion befassen. Im zweiten Teil werde ich erläutern, was uns die Resultate über die Jugend in den Niederlanden sagen. Vor allem werde ich hier Forschungsergebnisse einer Studie aus dem Jahr 2013 präsentieren, an der 1400 Schülerinnen und Schüler beteiligt waren. Diese ist Teil einer Langzeitstudie an unserer Fakultät, der Catholic School of Theology der Universität Tilburg, an der seit 1997 alle fünf Jahre ein solcher
Survey durchgeführt wird. Der dritte Teil des Artikels konzentriert sich auf die katholische Kirche als Beispiel einer religiösen Institution, die versucht, Jugendliche zu erreichen. Schließlich werde ich im vierten Teil Herausforderungen konkretisieren, die sich aus den Ergebnissen meiner Untersuchung unter Schülerinnen und Schülern für die Kirche und die (religiösen) Gemeinschaften aktuell ergeben.2 1. Forschung über »Jugend und Religion«
Die gegenwärtige »Generation« oder »Kohorte« Jugend wird in den meisten Fällen auf die Altersspanne der 15- bis 25-jährigen bezogen. Während dieser Jahre des Erwachsenwerdens entwickeln und erleben Jugendliche erhebliche Veränderungen. Sie müssen viele Entscheidungen vornehmen und als ein Resultat der Globalisierung und des Internet steht ihnen nun die gesamte Welt zur Verfügung, um daraus auszuwählen. Im Sinn eines ersten Beschreibungsversuches stütze ich mich auf einige jüngst
1 Übersetzt aus dem Englischen von Thomas Schlag. 2 Ich möchte Herrn A. Latour für die kritische Lektüre meines Textes danken.
van Dijk-Groeneboer Jugend und religiöse Gemeinschaften
erschienene Veröffentlichungen3, anhand derer die »heutige Jugend« charakterisiert wird; eine Generation, die manchmal »Generation Y«, »Generation Einstein«, die »Millennials« oder »bindungslose Generation« genannt wird. Hier werde ich selbst kurz vier unterschiedliche »Typen« von Jugendlichen beschreiben (Fortissimos, Tranquillos, Legatos, Spirituosos), wie ich diese schon in früheren eigenen Forschungen aufgeführt habe.4 1.1 Grundbestimmungen von Jugend
Seit 1984 hat »Motivaction«5 über 10.000 Jugendliche und Eltern interviewt. Aus den Ergebnissen dieser Forschung lassen sich einige zentrale Aspekte ablesen, die für die heutige Jugend in den Niederlanden spezifisch zu sein scheinen: Über die Jahre hinweg haben die Autoren eine tief greifende Veränderung hinsichtlich der sogenannten »sozialen Sensibilität« entdeckt – im Übrigen ein Phänomen, das für das gesamte westliche Europa als gültig angenommen wird. Sie gehen davon aus, dass in der heutigen, aktuellen Generation ein größerer Teil der Antwortenden als pragmatisch anzusehen ist. Diese so genannten Pragmatischen macht es aus, dass sie durchsetzungsfähig sind, gerne reisen, gut gebildet sind und selbstbewusst auf ihre eigenen Fähigkeiten vertrauen. Zugleich scheint die Idee vom »survival of the fittest« unter diesen immer gängiger zu werden, während Empathie verschwindet. Dies ist der Grund, weshalb die Autoren hier die Bezeichnung »bindungslose Generation« verwenden, um die gegenwärtige Generation der
121
Jugendlichen zu charakterisieren. Es ist ein neues Label, das das vorherige der »Generation Einstein« ersetzen soll, die stärker sozial involviert und im Ergebnis stärker dazu bereit gewesen sei, mit anderen Menschen zu interagieren sowie mit den Problemen des Aufwachsens aktiv umzugehen. Als zweitgrößte Gruppe werden von dieser Forschung die sogenannten »Outsider« bezeichnet. Diese Jugendlichen zeigten beispielsweise gegenüber höheren Positionen wenig Respekt, seien in ihrem Kaufverhalten impulsiv sowie auf Struktur, Ordnung und Disziplin ausgerichtet. Zum Beispiel träumen sie von einem glücklichen Familienleben, in dem der Vater der Boss ist. Diese zwei großen Gruppen wachsen laut diesen Forschungen zahlenmäßig weiter und die Unterschiede zwischen ihnen nehmen zu. Darüber hinaus fühlen sich beide Gruppen in Opposition zu denjenigen, die sich entweder verantwortlich oder pflichtbewusst fühlen. Die beiden letztgenannten Gruppen nehmen hingegen 3 Frits Spangenberg / Martijn Lampert, De grenzeloze generatie, Amsterdam 2009; Jeroen Boschma / Inez Groen, Generatie Einstein: slimmer, sneller en socialer. Communiceren met jongeren van de 21e eeuw, 2006; Silvia Collins-Mayo et al., The Faith of Generation Y. London 2010; Monique Dijk-Groeneboer (ed.), Handboek Jongeren en Religie. Katholieke, protestantse en islamitische jongeren in Nederland, Almere 2010; William V. D’Antonio / Michele Dillon / Mary L. Gautier, American Catholics in Transition, New York 2013. 4 Monique Dijk-Groeneboer, Reaching out beyond the Fortissimo’s, in: Staf Hellemans / Jozef Wissink (eds.), Towards a New Catholic Church in Advanced modernity, Zürich / Berlin 2012. 5 Spangenberg / Lampert (wie Anm. 3).
122
Empirische Aspekte
zahlenmäßig ab, was, gemäß der Autoren, für die Gesellschaft als Ganze eine Gefahr darstellt. Die geschilderte Entwicklung dieser vier unterschiedlichen Gruppen führt zu der Annahme, dass stetig mehr junge Menschen weniger sozial aktiv sind bzw. sich für die Gesellschaft einsetzen, sondern mehr und mehr auf sich selbst und ihre individuellen Erlebnisse bezogen sind. Sie kümmern sich weniger um andere und sind es – aufgrund einer bestimmten bindungslosen Erziehung durch ihre Eltern – gewöhnt, ohne Grenzen oder Begrenzungen ihr Leben zu führen. Sie könnten in der Welt auf sich alleine gestellt zurechtkommen.6 Ich will nun schon an dieser Stelle darauf hinweisen, dass ich selbst in meinen Untersuchungen keine große Gruppe von »anti-sozialen« Jugendlichen gefunden habe, die so extrem individuell sind, wie in den genannten Untersuchungen beschrieben. Vielmehr denke ich, dass auch diese nach Gemeinschaft suchen – aber vermutlich in einem sehr anderen Sinne als wir es anzunehmen und wahrzunehmen gewohnt sind. 1.2 Religiös analphabetische Jugend
Nachdem diese grundlegende Skizze über die gegenwärtige Jugend angestellt wurde, soll im Folgenden darauf eingegangen werden, was über deren Religion festgestellt wird: In ihrem Buch »The Faith of Generation Y« präsentieren Collins-Mayo et al.7 eine Studie aus England mit über 300 jungen Menschen zwischen 18 und 23 Jahren. Zwei hauptsächliche Folgerungen werden dabei über die Religion der heutigen Jugend
gezogen: Offenkundig haben junge Menschen die rebellische Feindschaft gegenüber Religion und Kirche, wie sie noch in ihrer eigenen Elterngeneration vorhanden war, nicht geerbt. Vielmehr scheint für viele Jugendliche zu gelten, dass Religion schlichtweg irrelevant für ihr alltägliches Leben ist. Zum anderen verweisen die Ergebnisse dieser Studie darauf, dass für die meisten jungen Menschen der Glaube vor allem in Bezug auf ihre Familie, Freunde und sich selbst als Individuen – im Sinn eines »immanent faith« zum Thema wird. Die jungen Leute suchen nicht nach Antworten auf letzte Fragen und zeigen auch wenig Anzeichen einer »Pick and mix«-Spiritualität. Collins-Mayo formuliert: »In den seltenen Fällen, in denen eine religiöse Perspektive gefragt war (zum Beispiel im Falle familiärer Krankheiten oder Trauerfälle), kamen sie mit sehr dünnen übernommenen kulturellen Erinnerungen an das Christentum bei gleichzeitiger Abwesenheit von irgendetwas Weiterem zu Recht. In diesen Fällen haben sie manchmal in ihren eigenen privaten Zimmern gebetet«8. Hier wird also angenommen, dass Religion eine Art Copingfunktion für junge Menschen haben könnte. Glaubenswissen oder der Kirchenbesuch wird nicht vermisst. Wir nennen diese jungen Menschen oftmals religiöse Analphabeten: Sie wissen nichts über Religion oder die Kirche und haben deshalb auch keine 6 Jozef Wissink, Mission and Modernity, in: S. Hellemans / Ders. (wie Anm. 4), Towards a New Catholic Church in Advanced modernity, Zürich / Berlin 2012, 257–274. 7 Collins-Mayo et al. (wie Anm. 3). 8 Ebd., 32.
van Dijk-Groeneboer Jugend und religiöse Gemeinschaften
Vorstellung davon, was dies für ihre eigene Entwicklung bedeuten könnte. 1.3 Eine Typologie »Religion und Jugend«
Zur genaueren Annäherung an das Thema ist eine typologische Unterscheidung in vier Gruppen hilfreich9: Diese Gruppen lassen sich entlang zweier Dimensionen unterscheiden: auf der einen Seite im Blick auf die Verbindung oder das commitment zu einer religiösen Institution – man könnte es die Dimension des »belonging« nennen; auf der anderen Seite im Blick auf die Bedeutung von Religion für die Bildung von Identität – vergleichbar mit der Dimension des »believing«. Die erste Dimension kann als derjenige Weg angesehen werden, wie Jugendliche sich selbst auf eine religiöse Institution wie etwa eine Kirche oder eine Moschee beziehen, etwa dadurch, dass sie diese Institution regelmäßig aufsuchen (z.B. Kir-
123
chen- oder Moscheenbesuche), mit der sie etwa durch Gruppenaktivitäten verbunden sind, und so weiter. Die zweite Dimension bezieht sich auf die Art und Weise, in der Religion eine Rolle für Lebenspräferenzen spielt, zum Beispiel für die Bewältigung von Problemen oder große Lebensentscheidungen, aber auch für den Zusammenhang des Freundeskreises, sich im alltäglichen Leben zurechtzufinden oder eigene Lebensziele zu wählen. Die faktische Komplexität dieser Orientierungsnotwendigkeiten bleibt hinter diesem zweidimensionalen Denken natürlich etwas abgeblendet, um so eine Ja-nein-Skala für jede Dimension erstellen zu können: entweder ist jemand mit einer religiösen Institution verbunden oder nicht, und entweder misst jemand der Religion einen Platz für die Bildung der eigenen Identität bei oder nicht. Von dort aus kann eine vierfache Unterscheidung im Blick auf das Verhältnis von Jugend und Religion angestellt werden:
Aktiv, mit Religion im Blick auf Nicht aktiv mit Religion im Blick die Identitätsbildung befasst auf die Identitätsbildung befasst Believing Non-believing Mit einer religiösen Insti- Fortissimos tution verbunden Belonging
Legatos
Nicht mit einer religiösen Spirituosos Institution verbunden Non-belonging
Tranquillos
Die erste Gruppe umfasst sehr engagierte und sich selbst verpflichtende junge Menschen, die zum allergrößten Teil in einer religiösen Familie aufgewachsen sind, von frühem Kindesalter an mit Religion in Verbindung waren und sich selbst sehr stark mit einer religiösen Institution wie der Kirche oder der Moschee verbun-
den wissen. Diese Gruppe ist sehr aktiv im Blick auf ihre eigene Religionspraxis, nicht zuletzt auch in ihrem Versuch, andere Personen von ihrer eigenen Religion 9 Dies wird entfaltet und illustriert in den von mir bereits genannten eigenen Studien (vgl. Anm. 3 und 4).
124
Empirische Aspekte
zu überzeugen. Zugleich machen sie sich das gesamte Programm ihrer Religion für ihre eigene religiöse Identität zueigen. Die meisten Personen dieser Gruppe sind orthodox im Blick auf ihre Religion und in der Art und Weise, wie sie sich zur jeweiligen hierarchischen Organisation in Beziehung setzen. Sie sind gehorsam und nicht kritisch, ein wenig engstirnig, aber zugleich fest gegründet. Innerhalb der Forschung werden sie als »Tough core« bezeichnet, die etwa 10–15% der gesamten Jugend ausmachen. Für meine Zwecke bezeichne ich sie als die Fortissimos. Die zweite Gruppe besteht aus Jugendlichen, die nichts mit Religion zu tun haben wollen. Manchmal sind sie aggressiv gegenüber Religion – hier finden wir bindungslose, hedonistische und materialistische Jugendliche – in anderen Fällen sind sie schlichtweg nicht interessiert. Sie sind weder in irgendeiner Kirche oder Moschee aktiv, noch in irgendeiner Hinsicht mit religiösen Institutionen verbunden. Sie sind in keiner Form mit spirituellen oder religiösen Fragen befasst. Ich nenne diese Gruppe junger Menschen Tranquillos. Die dritte Gruppe ist religiösen Organisationen wie Kirchen oder Moscheen wohl vertraut. Personen dieser Gruppe besuchen manchmal religiöse Versammlungen, meistens zu besonderen festlichen Anlässen. Sie kennen Religion aus ihrem Familienleben, obwohl vornehmlich aus der Distanz, d.h. sie sind den »alten Zeiten« ihrer Großeltern verbunden. Sie verbinden sich mit religiösen Organisationen, wenn es für sie persönlich wichtig ist, zum Beispiel, wenn sie kirchlich heiraten wollen. Sie sind gleichwohl nicht aktiv mit der jeweiligen religiösen Institution verbunden und Religion oder
Spiritualität hat keinen großen Einfluss auf ihr Leben. Ich nenne diese Gruppe die Legatos. Schließlich ist die vierte Gruppe in dem Material meiner Forschung sowie in den Forschungen anderer gut erkennbar. Diese Gruppe umfasst ebenfalls ungefähr 20–25% aller Jugendlichen. Personen dieser Gruppe sind nicht mit einer bestimmten Religion verbunden. Vielmehr erfinden sie eine »Religion« für sich selbst, in der Teile unterschiedlicher Religionen und spiritueller Bewegungen kombiniert sind. Zum Beispiel gehen sie gerne in eine Kirche, um eine Kerze anzuzünden, wenn sie Stärke benötigen; sie fahren nach Taizé, um sich eine Auszeit zu nehmen oder ihre Energiebatterie neu aufzuladen, sie lieben es, in der Natur spazieren zu gehen und dabei spirituelle Erfahrungen zu machen. Dies ist die Gruppe, die zwischen allen möglichen Formen religiöser und spiritueller Angebote »umher shoppt«, sich von hier und dort bestimmte Teile herauspickt und auswählt, um sie zu einer Religion zu kombinieren, die für sie passt. Ich nenne diese Gruppe die Spirituosos. 1.4 Neue Wege, um nach realistischen Antworten zu suchen
Um es zusammenzufassen: Unter der Vielzahl von Wahlmöglichkeiten, mit denen Jugendliche in ihrem Erwachsenwerden konfrontiert sind, gehört die Religion nicht zu den zentralen Punkten: »Viele suchen überhaupt nicht nach Antworten auf letzte Fragen.«10 10 Collins-Mayo et al. (wie Anm. 3), 31.
van Dijk-Groeneboer Jugend und religiöse Gemeinschaften
Dies ist nun der Punkt, an dem ich Collins-Mayo nicht zustimme und mich von ihr unterscheide. Ich will insofern vielmehr argumentieren, dass die heutige Jugend tatsächlich nach Antworten auf die großen Fragen sucht. Sie unternehmen dies lediglich auf sehr viel weniger traditionellen Wegen und in anderen Formen. Ich glaube, dass Forscher auf junge Menschen und deren religiöse Fragen in einem altertümlichen Sinn blicken, etwa wenn sie in Kirchen gehen und dort nach jungen Menschen suchen oder eruieren wollen, was junge Leute über Religion denken, indem sie fragen: »Gehen sie in die Kirche oder lesen sie die Bibel?« Wenn man hingegen die Glaubensüberzeugungen heutiger junger Menschen studiert, passen diese traditionellen Forschungszugänge nicht mehr. Denn in diesen Fällen nimmt man faktisch nur die Fortissimos in den Blick. Die Art und Weise, wie junge Menschen ihre Identität bilden und Antworten auf die großen Fragen des Lebens finden, unterscheidet sich jedenfalls sehr stark vom Bisherigen und macht deshalb neue Formen wissenschaftlicher Annäherung notwendig. Wir können Jugendliche »religiös analphabetisch« nennen, aber vielleicht müssen wir als Forscher uns selbst als realitätsfern betrachten, wenn wir bei den alten typischen Zugängen und Antworten bleiben. In der Forschung von »Motivaction« haben wir gesehen, dass es einen Teil von Jugendlichen gibt, der Schwierigkeiten damit hat, mit all den Wahloptionen der globalen Welt zurecht zu kommen. Dies ist die Gruppe der Jugendlichen, für die das Leben sehr schwierig werden kann. Die Antwor-
125
ten, die die Gesellschaft darauf anbietet, sind nun allerdings sehr fadenscheinig und flüchtig. So ermöglichen etwa kommerzielle Angebote und Festivals sofortige Befriedigung, bieten aber keinerlei Transzendenz, Verbindung oder nachhaltigen Lebenssinn an. Deshalb könnte durch die Kirchen und Religionsgemeinschaften ein sorgfältigeres Lösungsangebot bereitgestellt werden, um mit den Fragen des Lebens zurechtzukommen. Aber dafür ist zuerst auf die Lebenserfahrungen Jugendlicher selbst zu blicken, um zu sehen, ob diese Suche nach dem Sinn des Lebens wirklich beeinflusst werden kann. 2. Schüler in den Niederlanden, deren religiöse Aktivitäten und Inspiration
Seit 1997 führt unsere Fakultät alle fünf Jahre einen Survey unter niederländischen Schülerinnen und Schülern an katholischen Sekundarschulen durch, worin es um deren Religion, Glaube und Werte im Leben geht.11 Im Jahr 2012/13 haben wir 1450 Schüler in 15 Sekundarschulen vor allem in katholischen und auch in einigen protestantischen Schulen erreicht. Die Ergebnisse dieser Untersuchung wurden 2013 in Holland 11 Frühere Publikationen dazu sind: Monique van Dijk-Groeneboer / Jacques Maas, Op zoektocht; levenslang 2001; dies., Geloof? ff checke! Utrecht 2005 sowie Dies. / Hans van den Bosch, Godsdienst? Lekker belangrijk! Utrecht 2008, worin Daten der Umfragen aus den Jahren 1997, 2002 und 2007/2008 berücksichtigt sind; im letzten Bericht stammen die Daten aus der Umfrage von 2012/2013.
126
Empirische Aspekte
veröffentlicht.12 Das Alter der Beteiligten variierte von 15–18 Jahren. 16% bezeichneten sich selbst als Katholiken, 6% als Protestanten, 14% als Christen und 3% als Muslime. 14% bezeichneten sich als Atheisten und 38% sagten, dass sie keiner Kirche oder Religion angehören. In einem Teil des Fragebogens wurden die Schülerinnen und Schüler direkt gefragt, ob sie irgendetwas mit Religion, Glaube oder Gott zu tun hätten. 59% bezeichneten sich selbst als nicht religiös; nur 34% bezeichneten sich als religiös; die übrigen 7% beantworteten diese Frage nicht. Nur 17% sagten, dass sie gerne glauben würden, es aber nicht könnten. 41% sagten, dass sie genau wüssten, woran sie glauben, während 34% Religion als altmodisch und überholt bezeichneten. Die höchsten Werte (aus einer Liste von 23 mit den Antwortmöglichkeiten auf einer 5-er Skala »sehr wichtig«, »wichtig«, »unentschieden«, »nicht wichtig«, »sehr unwichtig«) waren: Das Leben genießen
93%
Für sich selbst glücklich sein
93%
Frei und unabhängig sein
91%
Über die Jahre haben zwei andere wichtige Werte, nämlich »eine glückliche Beziehung haben« und »ein guter Mensch sein«, in dieser Übersicht abgenommen, während »das Leben genießen« und« für sich selbst glücklich sein« zugenommen haben. Werden junge Menschen also tatsächlich hedonistischer und bindungsloser? Alle Werte, die mit Glaube oder Glaubensüberzeugungen verbunden sind, sind niedrig ausgefallen:
Ein Leben führen, das von Gott, Allah 15% oder einer höheren Macht geleitet ist Gott, Allah oder einer höheren Macht 19% vertrauen Glauben haben
22%
Die Jugendlichen wurden darum gebeten, in eigenen Worten zu beschreiben, was für sie in den Bereichen von Religion, Glaube und Sinn des Lebens wichtig ist. Wichtige Themen bei diesen Antworten waren, dass Glaube seine Grenzen hat (»jemand kann glauben, solange es andere Menschen nicht verletzt«) und dass Glaube auch zu tun hat mit anderen Dingen wie »weltliche Dinge wichtig finden« und »zu versuchen, die Balance zwischen Glauben und Leben zu halten«. Viele Antworten haben die Bedeutung der Balance hervorgehoben, zum Beispiel »jeder kann glauben, was er oder sie will, solange dieser Glaube nicht jemand anderem aufgedrängt wird«. Zudem wurde Glaubenstoleranz sehr häufig erwähnt und auch betont, dass man gegenüber Glaubensexzessen wachsam sein müsse. Ob sich die Jugendlichen nun selbst als religiös, gläubig oder mit der Kirche verbunden bezeichnen, ist sehr schwierig zu beantworten. Dazu unterscheiden sie sich zu sehr in ihren Antworten. Und die offensichtlichste Folgerung ist, dass diese Konzepte in ihrem täglichen Leben nicht funktionieren, vielleicht abgesehen von der Gruppe der Fortissimos. Nichtsdestotrotz haben wir sie gefragt, ob sie sich vorstellen könnten, sich mit anderen über den Glauben zu unterhalten:
12 Monique van Dijk-Groeneboer / Bernice Brijan, Kerk uit zicht? Jongeren inspireren!, Utrecht 2013.
van Dijk-Groeneboer Jugend und religiöse Gemeinschaften
127
Ablehnung
Neutral
Zustimmung
Ich möchte andere Gleichaltrige treffen, die glauben
49%
38%
13%
Ich möchte meinen Glauben mit anderen ausprobieren
61%
27%
12%
Ich möchte mich über meinen Glauben mit anderen unterhalten
55%
28%
17%
Ich wage es immer und überall, meinen Glauben zum Vorschein zu bringen
24%
34%
42%
Mehr als die Hälfte dieser Jugendlichen möchte nicht mit anderen über ihren Glauben sprechen (es ist zu bemerken: wir haben diese Fragen an alle Jugendlichen gestellt, nicht nur an diejenigen, die sich selbst als religiös bezeichnen). Nur eine kleine Anzahl von Jugendlichen möchte andere, die glauben, treffen, während dies die Hälfte der Gruppe ablehnt. Interessant ist auch, dass beinahe die Hälfte der Jugendlichen zugibt, es nicht zu wagen, den eigenen Glauben immer und überall zum Vorschein zu bringen. Es ist für junge Menschen schwer, öffentlich über Religion zu sprechen und sie scheinen einer sicheren, vertrauensvollen Umgebung zu bedürfen, um dies zu tun. Dazu haben wir sie genauer gefragt, ob sie gerne in solchen sicheren Umgebungen wären, in denen sie eine bestimmte sichere religiöse Atmosphäre spüren, um sich intensiv glücklich oder wohl fühlen oder religiöse und heilige Erfahrungen machen zu können. Vor allem anderen ist für junge Menschen die Musik der bedeutendste Bereich für Inspiration: Musik ist wichtig, weil sie mir hilft, 63% wenn ich traurig bin. Sport ist wichtig. Wenn ich Sport treibe, kann ich mich manchmal richtig 37% glücklich fühlen. Ich bin gerne in der Natur, dort fühle 20% ich mich wohl und ich erlebe Ganzheit.
Gleichwohl fühlen sich 8% der Jugendlichen an einem religiösen Platz wie einer Kapelle, Kirche oder Moschee zu Hause, und 9% sagen, dass sie bereits einmal eine religiöse oder mystische Erfahrung hatten, die sie selbst als heilig bezeichnen würden. Wer sind nun die inspirierenden Personen für diese jungen Menschen? Wo finden sie ihre Leidenschaft, was inspiriert sie grundsätzlich? Wir haben verschiedene Fragen zu diesem Thema gestellt und die interessantesten Antworten werden im Folgenden genannt: Vor allem Personen der eigenen Umgebung, d.h. der Familie oder Freunde, werden am häufigsten (von 58%) als inspirierende Personen genannt. Filmstars und Musiker kommen an zweiter Stelle (genannt von 55%). Die darüber hinaus gehenden Kommentare zu dieser Frage machen es offensichtlich, dass es für junge Leute ganz besonders bestimmte Zeilen in einzelnen Liedern oder bestimmte Szenen in Filmen sind, die darüber bestimmen, welchen Star sie inspirierend finden. Auch Sportlerinnen und Sportler werden in hohem Maße wertgeschätzt: 48% nennen sie als inspirierende Figuren. Diese Resultate zeigen sehr deutlich, dass es von vielen Variablen abhängt, welche »Celebrities« junge Menschen inspirieren – oder welche Umgebung als heilig
128
Empirische Aspekte
empfunden wird. D.h., nicht jeder Jugendliche, der sich selbst als religiös bezeichnet, hält sich gerne in einer Kirche oder in anderen religiösen Räumen auf. Alles ist auswechselbar, so scheint es, und hängt vom Moment, der Stimmung, und so weiter ab. Dies macht alles in allem klar, dass von diesen Ergebnissen aus keine einfachen Folgerungen gezogen werden können; junge Menschen »wählen«, wie wir sagen, und variieren in diesen Wahlentscheidungen während ihres Aufwachsens. 3. Die katholische Kirche und die Jugend
In diesem Abschnitt werde ich auf einige Grundmerkmale der katholischen Kirche im Blick auf das Thema »Jugend und Religion« zu sprechen kommen, um von dort her beispielhaft zu zeigen, wie eine weit verbreitete Religion versucht, junge Menschen weltweit, im nationalen Zusammenhang und lokal zu erreichen. Auch wenn sich die katholische Kirche als eine weltweite Gemeinschaft versteht, was durch die zentrale Rolle des Papstes und die gemeinsame Feier der Eucharistie sichtbar wird, können aus meiner Sicht unter den Initiativen der katholischen Kirche nur die lokalen Gemeinschaften als echte Gemeinschaft angesehen werden, insofern hier Menschen ihre Zugehörigkeit spüren können und mit anderen verbunden sind. Die katholische Kirche – in einem soziologischen Sinn nicht als Gemeinschaft, sondern als Institution verstanden – hat eine klare Vorstellung von der Wichtigkeit, junge Menschen zu erreichen, um so als Institution zu über-
leben. Wie Peter Jonkers notiert, muss die katholische Kirche ihre Selbstpositionierung im Licht neuer sozialer Verhältnisse innerhalb der fortgeschrittenen Moderne neu bestimmen.13 Diese »Neubestimmung« ist auch für das Bestreben, junge Menschen zu erreichen, relevant, da eben auch diese Kinder ihrer Zeit sind und, wie wir vorher gesehen haben, den kirchlichen Sprachgebrauch nicht mehr gewohnt sind. Bischof Samuel Jacobs beschreibt den Ruf nach einer »neuen Evangelisation« als eines der größten Erbstücke Johannes Pauls II. und dessen Papstamtes.14 In seiner Enzyklika Redemptoris Missio (1990) betonte Johannes Paul II. die große Bedeutung für jeden christlichen Gläubigen, alle Energie zugunsten einer neuen Evangelisation einzubringen. Er gibt zu, dass dies keine einfache Aufgabe in einer Gesellschaft ist, die sich über die letzten Jahrzehnte hinweg so stark verändert hat. Er wandte sich speziell an die Jugend, indem er ihnen sagte: »In euch ist Hoffnung, denn ihr gehört der Zukunft, genauso wie die Zukunft euch gehört. Denn Hoffnung ist immer mit Zukunft verbunden; es ist die Erwartung von ›zukünftigen guten Dingen‹. Als eine christliche Tugend ist diese Erwartung verbunden mit der Erwartung derjenigen ewigen guten Dinge, die Gott in Jesus Christus dem Menschen verheißen hat. Und zur gleichen Zeit ist diese Hoffnung, sowohl als christliche wie als menschli13 Peter Jonkers, A Purifying Force for Reason, in: Hellemans / Wissink (wie Anm. 4), 79–102. 14 Einführung von Bishop Samuel Jacobs, in: Ralph Martin and Peter Williamson (eds.): John Paul II and the new evangelization, San Francisco 2006, xvii–xx.
van Dijk-Groeneboer Jugend und religiöse Gemeinschaften
che Tugend, die Erwartung der guten Dinge, die der Mensch schaffen wird, indem er die Talente, die im durch die Verheißung gegeben sind, gebraucht.«15 Dazu betonte er, dass neue Wege der Kommunikation notwendig sind, um diese neue Evangelisation der Jugend zu realisieren. Eine Kultur selbst muss durch einen christlichen Geist durchtränkt werden, und dies in der Form von Musik, Literatur, Poesie und anderen Formen. Deshalb ist dieser neue Weg der Kommunikation und der Transformation kultureller Ausdruckskraft wesentlich, um junge Menschen zu erreichen. In weltweitem Maßstab wurde die Jugend erfolgreich durch den Weltjugendtag erreicht, der durch Johannes Paul II. initiiert und als Antwort auf seinen Ruf im Jahr 1984 gestartet wurde: Alle zwei bis drei Jahre treffen sich junge Menschen aus aller Welt, um ihren Glauben zu teilen, zu feiern und den Papst zu treffen. Dies ist ein moderner Weg der Evangelisation, der mit der Welt der jungen Menschen in Einklang kommen kann. 3.1 Nationale Initiativen
In den Niederlanden gibt es unterschiedliche Initiativen der katholischen Kirche, die darauf abzielen, Jugendliche zu erreichen. Beispiele sind große Events, spezielle Jugendbeauftragte, das Internet und katholische Jugendgruppen.16 Diese Initiativen haben ihren Ausgangspunkt in Entscheidungen, die von der Bischofskonferenz getroffen wurden und in schriftlicher Form dokumentiert sind.17 In ihrem Report folgern die Bischöfe, dass es eine positive Erreichbarkeit junger Menschen gibt, da diese in authen-
129
tischem Sinne nach religiösen Erfahrungen suchen. Eine gute stimulierende und konstruktive Beziehung zwischen Gemeinden und Schulen wird dabei für bedeutsam gehalten, um die Möglichkeiten, Jugendliche zu erreichen, auszuweiten. Gemeinden sollten keine Orte sein, an denen junge Menschen sich ausgeschlossen fühlen und ältere Gemeindeglieder sich von den Jugendlichen selbst mehr und mehr entfremden. Trotzdem ist die Anzahl von Jugendpriestern sowie die Anzahl von Gemeinden, die Aktivitäten für junge Menschen anbieten, in den letzten zehn Jahren von 50% auf 30% gesunken. Zudem ist die Kooperation zwischen Gemeinden und Schulen in keiner Hinsicht befriedigend. An Aktivitäten ist u.a. zu nennen: Die katholische Kirche in den Niederlanden organisiert einen jährlichen nationalen Event: den niederländischen katholischen Jugendtag; seit 1997 existiert eine nationale Jugendplattform. Hier können junge Menschen zwischen 18 und 30 Jahren einmal im Monat ihre Erfahrungen über den Weltjugendtag teilen und sozusagen das Wort an andere junge Menschen weitergeben. Sie feiern gemeinsam Messe, essen zusammen und diskutieren miteinander. Seit 1978 existiert eine katholische Jugendstiftung (Werkgroep Katholieke Jongeren), die junge Katholiken darin unterstützt, Aktivitäten für
15 Johannes Paul II., 1990. Redemptoris Missio Encyclical Letter, Rome Libreria Editrice Italia Kerkelijke Documentatie 21 (1993) nr 1, 3–25. 16 Dijk-Groeneboer (wie Anm. 4). 17 Vgl. Ad Limina reports from the Dutch bishops, in: »Kerkelijke documentatie« 21 (1993), nr 1 und 26 (1998), nr 6.
130
Empirische Aspekte
andere junge Menschen anzubieten. Diese Aktivitäten beinhalten etwa Filmabende oder Sommerfreizeiten. Die Website »Young Catholic« (Website) stellt einen modernen Kommunikationskanal dar, an dem sich alle Diözesen beteiligen. Das Internet ist zu einem Ort geworden, an dem sich junge Katholiken begegnen können, um über wichtige Glaubensthemen zu sprechen und diese in ihre tägliche Lebenspraxis zu integrieren. Gerade weil die Anwesenheit junger Menschen in lokalen Gemeinden niedrig ist, ist das Internet von Nutzen, um hier andere junge Menschen oder Gläubige zu treffen und so eine alternative Begegnungskultur zu schaffen. Zudem organisieren Diözesen Events, um junge Menschen zusammenzubringen, die ihre Firmung empfangen haben. In diesen Events werden außerdem diakonische Aktivitäten für junge Menschen präsentiert und es wird Jugendseelsorge diskutiert. Der Bischof ist immer anwesend und leitet die Messe am Ende des Tages. 3.2 Lokale Gemeinschaften
Wie bereits erwähnt, sind religiöse Gemeinschaften in der katholischen Kirche heutzutage insbesondere in den lokalen Gemeinden zu finden. Überall in den Niederlanden gibt es kleinere Aktivitäten in Gemeinden, die erfolgreich zu sein scheinen: Viele Jugendchöre bestehen, kleine Gruppen von Jugendlichen treffen sich zu wöchentlichen Gebeten und Mahlzeiten, Jugendbibel-Lesegruppen treffen sich, ebenso wie Lifeteen-Gruppen, in denen gebetet und die Messe miteinander gefeiert wird. Darüber hinaus gibt es in diversen Gemeinden Wohltä-
tigkeitsgruppen. Diese Gruppen erfüllen die diakonische Aufgabe der Kirche, eine Aufgabe, die sehr häufig junge Menschen gerade deshalb anzieht, weil sie ein Tun für jemand anderen beinhaltet. Darüber hinaus existieren weitere religiöse Gemeinschaften, die sich darauf konzentrieren, Jugendliche zu erreichen. So gibt es zum Beispiel verschiedene neue charismatische Bewegungen in den Niederlanden, die eigene Aktivitäten für junge Menschen anbieten. Zudem bieten klösterliche Orden und Gemeinschaften spezielle Programme für junge Menschen an. Sie offerieren Wochenenden und Sommerfreizeiten, um dort Gott entdecken zu können. Andere Gemeinschaften laden Schulklassen ein, um mit ihnen für ein Wochenende oder eine bestimmte Zeit unter der Woche zusammenzuleben. Diese »Komm-und-leb-mituns«-Programme sind sehr populär und durch das ganze Jahr hindurch nachgefragt. Zudem treten neue Initiativen ans Tageslicht, vor allem importiert aus den USA. Als kleine christliche Gemeinschaften treffen sie sich in Gruppen von 8–12 Personen regelmäßig, v.a. in häuslichen Kreisen. Die Anzahl dieser Gruppen in den Niederlanden ist schwer einzuschätzen, aber sie stellen in jedem Fall eine lebendige Form religiöser Gemeinschaft dar, die auch für junge Menschen anziehend sein könnte. 3.3 Erreicht die Kirche wirklich alle?
In den bisherigen Abschnitten habe ich Wege beschrieben, auf denen die katholische Kirche versucht, junge Menschen weltweit, im nationalen Kontext
van Dijk-Groeneboer Jugend und religiöse Gemeinschaften
und lokal in den Niederlanden zu erreichen. Indem sie dies tut, fokussiert sich die Kirche allerdings vor allem auf die Fortissimos, d.h. auf diejenigen, die bereits die Kirche besuchen, sich mit ihr und ihren Glaubenstraditionen hoch verbunden fühlen und ein hohes Maß an Aktivität und Partizipation zeigen. In anderen Worten: der Fokus richtet sich auf die »glücklichen Wenigen«, den heiligen Rest oder den harten Kern.18 Obwohl sich die religiösen Gemeinschaften auch über die Fortissimos hinaus ausrichten, müssen auch in diesem Fall immer noch die Jugendlichen zu ihnen kommen, um so einen Weg zu Gott zu finden. Jedenfalls ist es mit großer Wahrscheinlichkeit nicht klug für die Kirche, wenn sie ihre evangelisierenden Energien auf die Fortissimos begrenzt. Vielmehr sollte die Kirche moderne Wege der Evangelisation nutzen, um so eben die drei anderen, vernachlässigten Gruppen zu erreichen. Obwohl Jugendliche aus diesen Gruppen mit der Kirche nicht verbunden sind, sind doch mindestens zwei von ihnen einer Interaktion mit Religion nicht komplett abgeneigt. Jugendliche aus diesen Gruppen mögen nicht notwendigerweise die gesamte Identität der Kirche mit all ihren Forderungen und dogmatischen Bestimmungen akzeptieren. Sie gehören nicht in einer Weise zur Kirche, wie diese es für sie hofft oder es gewohnt war. Aber es besteht nach wie vor die Möglichkeit für die Kirche, eine ad-hoc-Beziehung mit diesen Gruppen zu pflegen, was etwa Formen kurzzeitiger Partizipation oder kleinerer Formen des Involviertseins beinhaltet: Die Legatos bewahren sich immer noch in einem gewissen Umfang die Zugehörigkeit zur Kirche aufgrund ihrer
131
alten Wurzeln der Verbundenheit, die innerhalb der Familie existieren. Wenn sie zu einer Bestattung oder zum Weihnachtsgottesdienst gehen, erneuern sie ihre Verbindung zur Kirche, was zugleich zu weiterem Interesse führen könnte. Die Spirituosos suchen aktiv nach religiöser Inspiration. Sie sind leidenschaftliche Gläubige, aber in einem modernen Sinn, d.h. frei von den Grundregeln religiöser Institutionen. Insbesondere für diese Gruppe ist es wichtig, durch das Internet als Kirche zugänglich zu sein und so Teil der Social Media Realität zu werden, in deren Zusammenhang die Spirituosos Antworten auf ihre Suche nach dem Sinn des Lebens suchen. Die Tranquillos sind an Religion überhaupt nicht interessiert und doch sind viele von ihnen nicht komplett antireligiös oder atheistisch. Auch sie sind mit den großen Fragen des Lebens konfrontiert und es ist keineswegs umfassend klar, wo sie dafür Antworten suchen. Hier könnten Gelegenheiten für die Kirche sein, sich mit diesen ebenfalls zu verbinden, auch wenn es sich hier sicherlich um diejenige Gruppe handelt, die am schwierigsten zu erreichen ist. Alle beschriebenen Gruppen suchen kontinuierlich nach Antworten für die entscheidenden Lebensthemen. Deshalb ist es wichtig, dort präsent zu sein, wo diese Suche stattfindet. Aber diese Form der Evangelisierung bedarf einer Kirche, die weniger traditionell ist. Wie S. Hellemanns notiert: »Wie kann die Kirche diejenigen erreichen und eine größere Zuhörerschaft an sich binden, die doch
18 Joris Kregting / José Sanders, ›Waar moeten ze het zoeken?‹ Vindplaatsen van religie en zingeving bij jongvolwassenen, Nijmegen 2003.
132
Empirische Aspekte
unberechenbar und zunehmend bereiter dazu geworden ist, zu anderen interessanten religiösen Angeboten zu switchen«.19 Ich schlage vor, dass die Kirche sich nicht dadurch verängstigen lässt, dass junge Menschen die Fähigkeit haben, aus der Vielfalt unterschiedlichster religiöser Angebote auszuwählen – solange die Kirche selbst sich darüber im Klaren ist, was sie in ihren einzelnen Teilen konstituiert und wie diese einzelnen Teile miteinander zusammenhängen. Die Kirche als Organisation sollte gedacht werden im Sinne eines Networks20 von religiösen Orten, an denen Menschen sich treffen können, um ihre Kenntnisse zu erweitern – ein Netzwerk von kleinen Gemeinschaften, zu denen Menschen sich versammeln und mit denen sie ihre großen Fragen teilen können. Zugleich sollte sie eine Ermöglichungsinstanz großer Events sein, in denen Menschen ihre Religion leben und sie mit größeren Gruppen teilend erfahren können. Kleine christliche Gemeinschaften oder Hauskreise könnten gegenwärtig die beste Form für Jugendliche sein, sich von der Kirche inspirieren zu lassen. Darüber hinaus müssen aber pastorale Leitende besser ausgebildet werden, um sich auf solche neuen Wege zu konzentrieren, auf denen junge Menschen inspiriert werden können.
während sie »zu sich selbst finden«: Wenn sie Probleme haben, gehen sie zu ihren Eltern und natürlich zu ihren Freunden. In dieser Hinsicht sind junge Menschen nicht einfach individualistisch ausgerichtet, sondern wollen zu einer Gemeinschaft gehören; oder mindestens suchen sie nach anderen Personen, um Antworten auf die großen Fragen des Lebens zu finden. Religion kann dabei eine Rolle spielen. Es stellt eine Herausforderung dar, junge Menschen dort zu erreichen, wo sie bereits für sich sind und nicht darauf zu warten oder darauf zu hoffen, dass sie von sich aus zur Kirche kommen. Im Blick auf die Herausforderung gelingender Kommunikation ist es entscheidend, authentisch zu sein und keinen Druck auszuüben. Junge Menschen bedürfen des Gefühls, in ihren eigenen Wahlentscheidungen frei zu sein und ihre eigenen Antworten zu finden. Aber sie benötigen dazu auch andere, mit denen sie in Gespräche eintreten können. Die Kirche, und insbesondere die Mitarbeitenden von Kirche, können zu Gesprächspartnern werden, wenn sie sich Zeit nehmen und ihnen wirklich zuhören. Dazu die richtige Sprache zu gebrauchen und dadurch die eigenen Glaubensüberzeugungen zu erhellen, stellt eine der größten Herausforderungen für kirchliche Mitarbeitende dar, um sich mit jungen Menschen zu verbinden. Die Antworten, die ich in meiner Forschung gefunden
4. Jugend und religiöse Gemeinschaften: Zwei getrennte Welten?
Wenn wir uns klarmachen, von welchen Personen Jugendliche sich inspiriert fühlen, dann sehen wir, dass es jene Erwachsenen sind, zu denen sie aufschauen können und denen sie nacheifern möchten,
19 Vgl. Staf Hellemans, Tracking the Shape of the Catholic Church in the West, in: Ders. / Wissink (wie Anm. 4), 19–50. 20 Kees de Groot, How the Roman Catholic Church Maneuvers through Liquid Modernity, in: Hellemans / Wissink (wie Anm. 4), 195–216.
van Dijk-Groeneboer Jugend und religiöse Gemeinschaften
habe, weisen nachdrücklich darauf hin, dass junge Menschen tatsächlich nach Antworten auf ernsthafte Lebensfragen suchen und dass sie selbst andere mit ihren »nicht-religiösen« Antworten auf das, was ihnen in ihrem Leben wichtig ist, inspirieren können. Der Schlüssel ist jedenfalls die Fähigkeit, den Wert der eigenen Botschaft vom Herzen aus zum Ausdruck zu brin-
133
gen: Zwinge niemandem deinen Glauben auf und strebe nicht danach, in einer Art und Weise »dazuzugehören«, die du gewohnt bist – sondern vertraue auf den Heiligen Geist. Wenn du deine eigene Inspiration teilen kannst – also den Weg, auf dem dich der Heilige Geist bewegt – werden junge Menschen dasselbe mit dir tun. Aber pass auf: ihr könntet am Ende beide inspiriert werden!
134
Empirische Aspekte
Janieta Bartz1 / Bert Roebben »Nur wenn man einen Jugendgottesdienst macht mit Lichtershow, begeistert das niemand für Jesus« – Warum Kirche und Gemeinde aus ekklesiologischen Gründen jugendtheologische Forschung brauchen Wenn sich Kirche in der Welt von heute als Kommunikations- und Suchgemeinschaft begreift2, zählen auch Jugendliche zu dieser Gemeinschaft. Angesichts der Herausforderungen unserer Zeit erfolgen bei ihnen und anderen ernsthafte und neue Suchprozesse, welche jugendtheologische Theorie und Forschung für die Praxis fundieren möchte (Abschnitt 1). Am Beispiel des XXVIII. Weltjugendtages 2013 in Rio de Janeiro wird in diesem Beitrag ein empirischer Einblick in alte und neue Fragen junger Menschen mit Blick auf Kirche und Gemeinde gegeben (Abschnitt 2 und 3). Anhand der Reflexion dieser empirischen Befunde ergeben sich neue Perspektiven einer jugendlichen Ekklesiologie (Abschnitt 4). 1. Jugendtheologische Forschung zur katholischen Jugendpastoral: eine Bestandsaufnahme
Jugendliche haben heute im Vergleich zu ihren Eltern und Großeltern deutlich mehr Freiheiten und Möglichkeiten, ihr Leben individuell zu gestalten.3 Sie können sich zur Gestaltung von Freizeit, Kommunikation, Partnerschaft, Karriere, Spiritualität u.v.m. aus einem großen ›Markt der Möglichkeiten‹ bedienen.4 Als Teil einer globalisierten Welt mit vielfältigen Angeboten und eng verzweigten, schnellen Netzwerken mit großen
Reichweiten werden junge Menschen durch globale Trends bei der Suche nach Identität und in ihrer Sicht auf die Welt beeinflusst. Angesichts der gesellschaftlichen Veränderungen weist Karl Ernst Nipkow schon 1990 Jahre auf folgende Problematik hin: Wir präsentieren eine Welt, die schnell und laut, technifiziert und geschichtslos, anscheinend selbstsicher und doch unterschwellig angstbesetzt ist. Wir tauchen die Kinder von früh an in diese Umgebung ein, dass sie von den herrschenden oberflächlichen Überzeugungen ganz »durchtränkt« werden, denen zufolge fast alles prinzipiell relativierbar und im Fluss ist sowie aufklärbar und machbar.
1 Geb. Jesuthasan. 2 Vgl. Thomas Schlag, Brauchen Jugendliche die Bibel?, in: Nadja Troi-Boeck / Isabele Noth / Andreas Kessler (Hg.), Wenn Jugendliche Bibel lesen. Jugendtheologie und Bibeldidaktik, Zürich 2015, 13–22; Gaudium et spes. Pastoralkonstitution über die Kirche in der Welt von heute »Gaudium et spes«. Zitiert nach: Karl Rahner / Herbert Vorgrimler, Kleines Konzilskompendium. Sämtliche Texte des Zweiten Vatikanums, Freiburg i.Br. / Basel / Wien 2008, 449–552. 3 Norbert Mette, Religionspädagogik, Düsseldorf 2006, 32; Friedrich Schweitzer, Globalization, Youth, and Religion. Theoretical, Empirical, and Practical Perspectives from Germany, in: Richard R. Osmer / Kenda Creasy Dean (Eds.), Youth, Religion and Globalization. New Research in Practical Theology, Berlin 2006, 20. 4 Vgl. ebd., 17f.
Bartz / Roebben Warum Kirche und Gemeinde aus ekklesiologischen Gründen …
In dieser Umgebung fällt es den Kindern schwer, zu innerer Ruhe zu kommen und Stille zu finden, Ehrfurcht zu lernen und das Staunen zu üben, die Symbole der Religion zu verstehen und aufzuhorchen, wenn von Gott die Rede ist.5
Empirische Studien aus jüngster Zeit6 zeigen hingegen immer mehr, dass junge Menschen spirituelles Potential und Interesse an theologischen Fragestellungen haben, um mit existentieller Ambiguität umzugehen, dies jedoch immer weniger mit Kirche als Institution in Verbindung bringen. Spiritualität scheint demzufolge in erster Linie eine individuelle und private Angelegenheit zu sein. Jugendliche, die kirchennah sozialisiert sind, verbinden allerdings Spiritualität durchaus mit Kirche und deren Aktivitäten.7 Das spirituelle Denken und Erleben von Menschen im Kontext jugendpastoraler Events, insbesondere des Weltjugendtages, steht in starkem Kontrast zu der allgemeinen Kirchendistanziertheit und -fremdheit. Seit 1985 machen sich im Abstand von zwei bis drei Jahren junge Menschen aus der ganzen Welt auf den Weg, um am Weltjugendtag teilzunehmen.8 Gemeinsam mit anderen wird der christliche Glaube öffentlich gefeiert und der katholischen Kirche ein lebendiges, junges Gesicht verliehen. Unsere Forschung setzt bei dieser besonderen Faszination jugendspiritueller Events an und untersucht die Motivationen und Erfahrungen der teilnehmenden Personen. Betrachtet man die Tatsache, dass der Weltjugendtag in seiner eventorientierten Form von Papst Johannes Paul II. als Anreiz für nicht katholische, aber interessierte Jugendliche konzipiert wurde,9 ist es umso interessanter, zu beobachten, dass die Hauptklientel über
135
eine katholische Sozialisation verfügt, die oftmals durch das Engagement und die Mitgliedschaft in kirchlichen Jugendverbänden verstärkt ist. Die erste quantitativ ausgerichtete Studie konnte diese zunächst populärwissenschaftliche These für den deutschsprachigen Raum im Jahr 2002 wissenschaftlich untermauern.10 Die Erkenntnis, dass Jugendliche bereits als Teil der katholischen Kirche zum Weltjugendtag fahren und nicht erst dort zu aktiven Mitgliedern werden, wurde in späteren qualitativen sowie quantitativen 5 Karl Ernst Nipkow, Bildung als Lebensbegleitung und Erneuerung. Kirchliche Bildungsverantwortung in Gemeinde, Schule und Gesellschaft, Gütersloh 1990, 305. 6 Vgl. Andreas Prokopf, Religiosität Jugendlicher. Eine qualitativ-empirische Untersuchung auf den Spuren korrelativer Konzeptionen, Stuttgart 2008; Eva Stögbauer, Die Frage nach Gott und dem Leid bei Jugendlichen wahrnehmen. Eine qualitativ-empirische Spurensuche, Bad Heilbrunn 2011; Mathias Albert / Klaus Hurrelmann / Gudrun Quenzel, Jugend 2010. Eine pragmatische Generation behauptet sich, Frankfurt a.M. 2010. 7 Schweitzer (wie Anm. 3), 21; Bert Roebben, Seeking Sense in the City. European Perspectives on Religious Education, Berlin 2013 (second enlarged edition), 213–257. 8 Vgl. Werner Simon, Weltjugendtage. Orte der Präsenz von Religiosität Jugendlicher, in: Christlich-pädagogische Blätter 120 (2007), 105–108. 9 Vgl. Papst Johannes Paul II. (1984), An die Jugendlichen. Der Heilige Vater an die Jugendlichen. Ansprachen. Online: http://www. vatican.va/gmg/hf_youth/index_spe_ge.html# 1984. 10 Vgl. Christian Scharnberg / Hans-Georg Ziebertz, Weltjugendtag 2002. Forschungsbericht zur Fragenbogenuntersuchung, Würzburg / Düsseldorf 2004; Christian Scharnberg, Event-Jugend-Pastoral. Eine quantitativ-empirisch gestützte Theorie des religiösen Jugendevents am Beispiel des Weltjugendtages 2002, Berlin 2010.
136
Empirische Aspekte
Studien zu Weltjugendtagen weiter bestätigt.11 Eine wesentliche Erkenntnis der bisherigen internationalen Forschungsarbeiten besteht darin, dass junge Menschen aus der ganzen Welt begeistert am internationalen Treffen junger Katholiken teilnehmen und durch intensive spirituelle wie soziale Erfahrungen gestärkt in ihre Heimatgemeinden vor Ort zurückkehren. Die australische Forschungsgruppe zeigte im Jahr 2011 mit Blick auf die Nachhaltigkeit dieser Erfahrungen, dass diese bei den Pilgern nicht sehr lange anhalten. Im Gegenteil wird die oftmals vom Weltjugendtag verschiedene Situation in der Heimatgemeinde als ernüchternd, bisweilen entmutigend wahrgenommen.12 Diese Erfahrung von Isolation, welche nicht nur mit Blick auf eine peer-orientierte Glaubenspraxis, sondern v.a. hinsichtlich der ausbleibenden Begeisterung für den eigenen Glauben besteht, dient vielen jungen Menschen als Ansporn, bei zukünftigen Weltjugendtagen erneut teilzunehmen. Qualitativen Studien zufolge hat sich eine ›pilgernde Weltjugendtagsgeneration‹ etabliert, welche sich beginnend bei einem Weltjugendtag kontinuierlich an weiteren internationalen Treffen junger Katholiken beteiligt. Es stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, ob und inwiefern Jugendliche – dem Konzept der Jugendtheologie entsprechend13 – bei diesem Event auch eigene theologische Perspektiven auf Kirche und Gemeinde gewinnen, die sie in eine Ekklesiologie einbringen können, die sich im Sinne einer »theologia viatorum« als eine dynamisch stets zu erneuernde versteht.14 Dieser Frage soll im Folgenden anhand ausgewählter empirischer Daten aus dem Projekt »Rio 2013:
Faszination Weltjugendtag?!«15 nachgegangen werden. 2. Implementierung der Studie
Das Forschungsprojekt »Rio 2013: Faszination Weltjugendtag?!« untersucht aus jugendtheologischer Perspektive Motivationen vor, spirituelle Erfahrungen während und Konzepte von Mission und Nachfolge Jesu nach dem XXVIII. Weltjugendtag in Rio de Janeiro bei Jugendlichen aus unterschiedlichen Ländern und Kulturen. Motivation für das Projekt sind zwei Forschungsdesiderate: 1. Was macht die Faszination einer situa tiven Vergemeinschaftung bei einem spirituellen Event aus? 2. Welche Konsequenzen lassen sich datenbasiert für eine jugendtheologische und pastorale Praxis ableiten? Um bei der prozessorientierten Beobachtung und Befragung zum spirituellen Denken und Erleben junger Menschen 11 Vgl. Forschungskonsortium WJT, Megaparty – Glaubensfest – Weltjugendtag: Ergebnis – Medien Organisation, Wiesbaden 2007; Richard Rymarz, Who goes to World Youth Day? Some data on under 18 Australian participants, in: Journal of Beliefs and Values 2007, 33–43; Michael Mason, World Youth Day 2008: What did we gain? What did we learn? Australasian Catholic Record 87/3 (2010), 334–348; Andrew Singleton, The Impact of World Youth Day on Religious Practice, in: Journal of Beliefs and Values 32/1 (2011), 57–68. 12 Vgl. Singleton (wie Anm. 11). 13 Vgl. Thomas Schlag / Friedrich Schweitzer, Brauchen Jugendliche Theologie? Jugendtheologie als Herausforderung und didaktische Perspektive. Neukirchen-Vluyn 2011. 14 Ebd., 187. 15 Projektinformationen online unter: http:// www.wyd2013-research.de.
Bartz / Roebben Warum Kirche und Gemeinde aus ekklesiologischen Gründen …
signifikante Ergebnisse erhalten, aber gleichzeitig möglichst auch jeden Pilger in seiner Individualität wahrnehmen zu können, war ein differenziertes Forschungssetting (Kombination von quantitativen und qualitativen Methoden der Sozialforschung) notwendig.16 Konkret wurde eine ethnographisch ausgerichtete Herangehensweise17 gewählt, die zu interessanten Einblicken führte. Um individuelle wie globale Entwicklungen genauer beschreiben zu können, ist die empirische Studie zum Weltjugendtag 2013 als Längsschnittstudie konzipiert worden. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Weltjugendtages wurden zu drei Erhebungszeitpunkten durch quantitativ ausgerichtete (Online-) Fragebögen und qualitative Interviews über ihre Erwartungen vor, Erfahrungen bei und Einstellungen nach dem XXVIII. Weltjugendtag befragt. Die viersprachig verfügbaren Fragebögen (Deutsch, Englisch, Spanisch, brasilianisches Portugiesisch) bauen auf bereits bekannten Erkenntnissen vorangegangener Studien auf18 und erweitern diese dahingehend, dass junge Menschen über die Angabe ihrer Einstellungen hinaus zum theologischen Reflektieren eingeladen wurden. Interviews wurden auf freiwilliger Basis persönlich wie auch in sozialen Netzwerken durchgeführt.19 Im Juli 2013 nahm eine dreiköpfige Forschergruppe der TU Dortmund außerdem selbst am Weltjugendtag in Rio de Janeiro teil und interviewte und beobachtete die teilnehmenden Personen vor Ort. Die Interviews wurden abhängig vom Erhebungskontext als strukturierte, semi-strukturierte sowie narrative Interviews durchgeführt.20 Ergänzend hierzu hatten Jugendliche die Möglichkeit, ihre Gedanken in soge-
137
nannten ›Pilgertagebüchern‹ zu notieren, indem sie sich auf Fragen zu Papst, Nachfolge Jesu oder Mission äußern konnten. Neben der direkten Befragung wurden auch systematische Beobachtungen zu verschiedenen Situationen (z.B. Verhalten und Gefühle während der Gottesdienste, Begegnung mit dem Papst, Situationen am Strand der Copacabana etc.) durchgeführt.21 Für die in diesem Beitrag behandelte Fragestellung wurde nur ein kleiner Ausschnitt des erhobenen vielfältigen und umfangreichen Datenmaterials analysiert. Ausgewählt wurden die Antworten von Teilnehmerinnen und Teilnehmern des deutschsprachigen Raums im Alter von 18–34 Jahren (insgesamt 79 Personen) zu den folgenden Fragen des Fragebogens nach dem Weltjugendtag: 16 Vgl. Ulrike Loch, Geschichte(n) (de)konstruieren – Geschichte rekonstruieren, in: Peter Cloos / Werner Thole (Hg.), Ethnografische Zugänge. Professions- und adressatInnenbezogene Forschung im Kontext von Pädagogik, München 2006, 219–231; Philipp Mayring, Mixed Methods – ein Plädoyer für gemeinsame Forschungsstandards qualitativer und quantitativer Methoden, in: Michael GläserZikuda u.a. (Hg.), Mixed Methods in der empirischen Bildungsforschung, Münster 2012, 287–300; Rymarz (wie Anmerkung 11). 17 Vgl. Uwe Flick, Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung, Hamburg 2009. 18 Vgl. Scharnberg (wie Anm. 10); zur Methodik vgl. Rolf Porst, Fragebogen. Ein Arbeitsbuch, Wiesbaden 2014. 19 Vgl. Heinz Reinders, Qualitative Interviews mit Jugendlichen führen. Ein Leitfaden, München 2012. 20 Vgl. Christian Thiele, Interviews führen, Konstanz 2009. 21 Vgl. Christopher Blake, Eye-Tracking: Grundlagen und Anwendungsfelder, in: Wiebke Möhring / Daniela Schlütz (Hg.), Handbuch standardisierte Erhebungsverfahren in der Kommunikationswissenschaft, Wiesbaden 2013.
138
Empirische Aspekte
1. Was fällt dir spontan ein, wenn du an den Weltjugendtag zurückdenkst? Nenne mindestens ein, maximal fünf Schlagworte. 2. Was macht für dich persönlich eine gute Kirche aus? 3. Formuliere konkrete Empfehlungen: Wie sollte eine Kirche für Jugendliche gestaltet werden?
4. Hat sich durch die Teilnahme am WJT deine Sichtweise auf Kirche als internationale Glaubensgemeinschaft verändert? 5. Wie nah fühlst du dich Gott / Jesus Christus / Papst Franziskus / Papst Benedikt XVI / der Kirche jetzt / in 15 Jahren? Die folgende Abbildung zeigt Eckdaten zur Beschreibung der Stichprobe
Abb. 1: Zusammensetzung der Stichprobe: Staatsangehörigkeit, Geschlecht, Religion
Abb. 2: Alter
Abb. 3: Empfangene Sakramente
Die Stichprobe ist in Bezug auf die Merkmale Geschlecht und Alter in akzeptablem Maße ausgewogen. Mit Blick auf Staatsangehörigkeit, Religion und empfangene Sakramente der Befragten
muss festgehalten werden, dass es sich bei dem gewählten Datenausschnitt im Wesentlichen um eine deutsche Gruppe katholischer Jugendlicher aus einem kirchennahen Milieu handelt. Für die
Bartz / Roebben Warum Kirche und Gemeinde aus ekklesiologischen Gründen …
Zusammensetzung der tatsächlichen Teilnehmergruppe des Weltjugendtags ist dies aber offensichtlich repräsentativ: Auch in den vorangegangenen, in Abschnitt 1 genannten Studien zeigten sich ähnliche Stichprobenzusammensetzungen. Die Daten wurden im Sinne eines Mixed-Methods-Ansatzes quantitativ und qualitativ analysiert. Bei den offenen Fragen (1–4) fokussiert sich die quantitative Analyse allerdings auf die Ermittlung der Häufigkeiten der in den Antworten vorkommenden Inhaltswörter und deren Visualisierung in Form von Wortwolken22. Diese ermöglichen einen schnellen, explorativen Einblick in auffällige Tendenzen. Für einen quantifi-
139
der Antworten adäquates Kategoriensystem zur Verfügung steht. 3. Ergebnisse
Im Folgenden werden die Ergebnisse der Auswertung für die einzelnen Fragen dargestellt. Wortwolken, bei denen die Vorkommenshäufigkeiten der Inhaltswörter in den Antworten der Jugendlichen durch die Darstellungsgröße repräsentiert werden, sollen jeweils einen ersten Eindruck zur Datenlage bilden helfen. Nenne fünf Begriffe, die dir einfallen, wenn du an den Weltjugendtag 2013 in Rio de Janeiro zurückdenkst.
Abb. 4: Wortwolke zum Thema »Was fällt Dir spontan ein, wenn Du an den Weltjugendtag zurückdenkst? Nenne mindestens ein, maximal fünf Schlagworte.«
zierbaren Teil von Frage 4 und für Frage 5 (geschlossene Frage) wurden relative Häufigkeiten und Mittelwerte errechnet. An die quantitative Analyse wurde eine qualitative Inhaltsanalyse mit induktiver Codierung (angelehnt an die Grounded Theory23) angeschlossen. Bei diesem Verfahren werden die Antworten der einzelnen Befragten (›Codes‹) in mehreren rekursiven Durchgängen Kategorien zugeordnet, die unmittelbar aus dem Datenmaterial gewonnen werden. Die Analyse ist jeweils in dem Moment abgeschlossen, in dem ein für die Gesamtheit
Abbildung 4 zeigt, welche Erinnerungen die deutschsprachigen Jugendlichen bei der Befragung nach dem Weltjugendtag in Worte fassen. Vor allem die brasilianische Gastfreundschaft hat bei den befragten Teilnehmenden aus Deutschland einen dominanten bleibenden Eindruck hinterlassen. Ein Schlüsselerlebnis war jedoch offensichtlich auch das lebendi22 Dazu wurde die Webanwendung ›Wordle‹ genutzt: http://www.wordle.net/. 23 Vgl. Barney Glaser / Anselm Strauss, Grounded Theory. Strategien qualitativer Forschung, Bern 2008.
140
Empirische Aspekte
ge Erleben von Kirche als einer großen internationalen Gemeinschaft Gleichgesinnter. Dieser Aspekt scheint auch in den Antworten zu den anderen untersuchten Fragen immer wieder auf (s. unten). Ähnlich verhält es sich mit der beim Weltjugendtag in Rio de Janeiro wahrgenommenen Freude und Offenheit der Kirche. Dass auch touristische Aspekte zur Anziehungskraft der Weltjugendtage beitragen (die Schlagworte »Copacabana«, »Zuckerhut«, »Strand«), ist bereits aus vorangegangenen Studien bekannt (s. Abschnitt 1). Doch der XXVIII. Weltjugendtag scheint ebenso als spirituelles Erlebnis in Erinnerung geblieben zu sein: »Glaube«, »Gebet«, »Spiritualität« unterscheiden sich in ihrer Salienz (Auffälligkeit) kaum von den touristischen Schlüsselbegriffen. Was macht für dich persönlich eine gute Kirche aus?
muss der Mensch stehen«, fordert ein jugendlicher Teilnehmer und gibt gleichzeitig zu erkennen, was seiner Meinung nach nicht dazu passt: »nicht das Machtgehabe eines Pfarrers«. Viele Befragte sind zudem der Reform- und Strukturdebatte in Deutschland (im Sinne von pastoral crisis technology)24 überdrüssig: »Eine gute Kirche macht für mich aus, dass sie [dem] Geist Raum lässt und nicht in Strukturdiskussionen erstirbt«. »Allzu oft wird in Deutschland zu sehr in Reformen oder irgendwelche Pfarreizusammenlegungen investiert, anstatt wirklich für heiligmäßige Priester und Familien [zu beten]«. Die Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, bedeutet konkret, ihnen »in schwierigen Lebenssituationen [beizustehen]«, »Not [zu bekämpfen]« und sie »auf dem Weg und im Alltag [zu begleiten]«, insbesondere die »Benachteiligten,
Abb. 5: Wortwolke zum Thema »Was macht für dich persönlich eine gute Kirche aus?«
Eine gute Kirche ist aus Sicht der Jugendlichen vor allem an den Menschen orientiert. Einige treffen in ihren Antworten sogar den Wortlaut der Pastoralkonstitution Gaudium et spes: »Eine gute Kirche muss die Freude und Hoffnung, Angst, Sorgen und Trauer der Menschen ernst nehmen«. »Im Mittelpunkt
[…] Armen, Schwachen, Behinderten und Ausgegrenzten«. Dies gilt auch für das ›ungeborene Leben‹ ‒ »die Kirche 24 Vgl. Bert Roebben, Internationale Entwicklungen in der Erforschung der Jugendseelsorge. Kontexte, Themen und Tiefenstrukturen, in: Jahrbuch für Jugendtheologie 1 (2013), 82–83.
Bartz / Roebben Warum Kirche und Gemeinde aus ekklesiologischen Gründen …
ist z.B. die einzige, die wirklich für die Schwächsten eintritt: Das ungeborene Leben«. Die meisten Teilnehmer setzen das Engagement für die Menschen mit dem Gottesdienst gleich, eine Teilnehmerin versteht es sogar als den einzigen und wahren Gottesdienst: Kennzeichen einer guten Kirche sei es, Menschen in ihrem Leben zu unterstützen und Kraft / Lebensstärke und Vertrauen in sich selbst zu schenken. Mir ist vor allem die Gemeinschaft und Liebe der Menschen untereinander wichtig, ich versuche täglich mir ein Beispiel an Jesu Leben zu nehmen. Aber jemanden anzubeten wie Gott, empfinde ich persönlich als nichtig, da man persönlich dafür verantwortlich ist, die Welt ein Stück besser zu machen.
Eine gute Kirche ist aus Sicht der meisten Jugendlichen authentisch und barmherzig, offen und tolerant, sucht die »Vereinigung von unterschiedlichsten Menschen«, »egal ob geschieden, schwul, lesbisch oder allein erziehend«. Dazu sollte sie auch »bereit [sein], Regeln zu ›beugen‹«. Das bedeutet allerdings nicht, dass sich die Kirche um jeden Preis aktuellen Trends anpassen muss: »[Ich] möchte […] keine Kirche, die sich dem Zeitgeist
141
beugt«. Ihren Idealen sollte sie treu bleiben, »auf Jesus Christus [gegründet], […] beständig […] in ihren Regeln und Wertvorstellungen«. »Eine gute Kirche bleibt vor allem ihren Grundsätzen stets treu und wackelt nicht bei jedem kleinen ›Gewitter‹«, sie »[steht] zu ihren Werten«, »aber ganz klar immer Jesus und Maria [im] […] Zentrum«, genauso wie die Heilige Schrift. Ein Jugendlicher ist überzeugt: »So wie sie [die Kirche] ist, ist sie gut, komm in meine Heimatgemeinde und schau sie dir an«. Eine Jugendliche bemüht sich um einen energischen Ton und gibt zu bedenken: »Mensch, wir haben eine so tolle Botschaft und keiner will sie hören!«. Nichts desto trotz spielt Offenheit für die meisten Jugendlichen eine zentrale Rolle. Jeder soll in der Kirche Platz haben, »aktuelle Themen«, »die heutigen Dinge« müssen frei und ernsthaft angesprochen werden dürfen. Auch der »modernen Musikkunst« sollte sich die Kirche weiter öffnen. Gleichzeitig wird sie ermahnt, jedem »dieselben Möglichkeiten einzuräumen, sich einzubringen«, auch den »Laien« und »Fremden«. Formuliere konkrete Empfehlungen: Wie sollte eine Kirche für Jugendliche gestaltet werden?
Abb. 6: Wortwolke zum Thema »Formuliere konkrete Empfehlungen: Wie sollte eine Kirche für Jugendliche gestaltet werden?«
142
Empirische Aspekte
Das auffällig groß gesetzte »mehr« zeigt die wichtigste Tendenz in den Antworten der Jugendlichen an: In der Kirche muss nicht alles anders gemacht werden. Vielmehr sollte die theologische Substanz fokussiert und auf die Themen der Zeit (»Themen, die Jugendliche beschäftigen«) bezogen werden. Kirche für Jugendliche sollte sich nicht extra an die Jugendlichen anpassen, sondern sollte versuchen, ihre Grundsätze und Lehren für die Jugendlichen verständlich und überzeugend zu formulieren. Nur wenn man einen Jugendgottesdienst macht mit Lichtershow, begeistert das niemand für Jesus. Jesus als dem Auferstandenen, Gekreuzigten begegnen, das verändert Menschen egal welchen Alters. Wir wollen ernst genommen werden und spüren sehr wohl, welcher Geist in einer Pfarrei herrscht, ob der Priester wirklich seine Berufung lebt oder ob er es nur als einen »Job« ansieht.
Mit der letzten Aussage ist ein wichtiger, weil vielleicht überraschender Aspekt angesprochen, der sich in vielen Antworten der Befragten zeigt. Jugendliche sehnen sich nach überzeugenden Persönlichkeiten, »die den Jugendlichen mehr Zuneigung und Verständnis entgegenbringen«; ausdrücklich werden vor allem Priester benannt: »Das wichtigste ist der Pfarrer, der die Jugendlichen betreut. Einer der motiviert und nah zu den Jugendlichen steht«. Die Jugendlichen trauen Priestern in hohem Maße eine Art von place sharing25 zu, die Kompetenz, ihre Fragen und Sorgen zu verstehen und vor einer bisweilen komplexen und herausfordernden Gesellschaft mutig artikulieren zu können. Deshalb sollte die Seelsorge auch »persönlicher werden«, einige wünschen sich explizit persönliche Beziehungen:
Wie es beim WJT war. Man isst mit Priestern und Ordensleuten, lacht, betet, redet, feiert die Messe. Man teilt das Leben miteinander.
Wer Jugendliche gewinnen will, muss Priester gewinnen – das ist ein überraschender Schluss, zu dem viele Befragte kommen. Damit das gelingt, empfehlen einige die Abschaffung der Zölibatspflicht: Priester, die zölibatär leben möchten, können das ja auch, aber es muss endlich auch möglich sein, dass Priester Familien gründen können und somit Liebe auf ihre direkteste Art und Weise erleben dürfen. Somit können auch in Deutschland wieder Persönlichkeiten für die Kirche gewonnen werden, die die Kirche wieder in eine Rolle in der Gesellschaft bringen können, die sie verdient!
Der Kirchenmusik messen die meisten Befragten eine zentrale Bedeutung bei, wenn es darum geht, von der Botschaft des Evangeliums berührt zu werden. Dies gelingt aus ihrer Sicht besser mit neuem, den jugendlichen Hörgewohnheiten stärker entsprechendem Liedgut und modernen Arrangements mit verschiedenen Instrumenten und Vorsängern, bei denen der Liedtext besser verständlich ist. »Schnellere und schönere Lieder«, »neue Lieder«, »moderne Lieder«, »mehr Musik«, »verschiedene Instrumente« ist der einhellige Tenor. Neuerungen – im Bereich der Kirchenmusik, aber auch in anderen Bereichen der Gestaltung von Gottesdiensten – sollten jedoch flächendeckend umge-
25 So der amerikanische Jugendseelsorge-Forscher Andrew Root, in: Roebben (wie Anm. 7), 81–82
Bartz / Roebben Warum Kirche und Gemeinde aus ekklesiologischen Gründen …
setzt werden. Gegenüber Leuchtturmprojekten sind einige Befragte skeptisch: Es gibt mittlerweile schon tolle Jugendgottesdienste. Sie sollten an vielen Orten sein und nicht die Jugendlichen zwingen, 30 km zu fahren, um einen Jugendgottesdienst zu erleben.
Hat sich durch die Teilnahme am WJT deine Sichtweise auf Kirche als internationale Glaubensgemeinschaft verändert?
143
Als positiv empfunden wurde das Gefühl, »Teil von etwas größerem zu sein«. Vielen wurde die »Universalität der Kirche« noch mehr bewusst. »Es ist egal, in welches Land man schaut, es gibt überall Christen«. Die Atmosphäre beim Abschlussgottesdienst führte bei einigen zu einem Pfingsterlebnis: Wenn beim Abschlussgottesdienst Menschen so vieler Nationen ohne die eigentlich vorgesehene Organisation so friedlich miteinander leben und feiern, wird man von dieser Gemeinschaft überzeugt.
Abb. 7: Verteilung der Antworten »ja« und »nein« auf die Frage: »Hat Diejenigen Probansich durch die Teilnahme am WJT deine Sichtweise auf Kirche als den, die introspektiv internationale Glaubensgemeinschaft verändert?«
Für gut zwei Drittel der Befragten hatte der Weltjugendtag 2013 Auswirkungen auf ihre Sichtweise auf Kirche als internationale Glaubensgemeinschaft. Die Glaubensgemeinschaft sei »näher zusammengerückt«, betonen viele, »mir ist bewusster geworden, dass es trotz vieler Unterschiede eine internationale Glaubensgemeinschaft gibt«. Angesichts der Erfahrung von Weltkirche und ihrer Dynamik erscheinen die Probleme der Menschen und der Kirche in Deutschland einigen Befragten weniger bedeutend: Ich habe Menschen gesehen, die nichts außer ihren Glauben hatten. Trotzdem waren sie glücklich. In Deutschland ging es vielen Menschen noch nie wirklich schlecht. Dadurch brauchen sie Gott nicht. Auch wenn es mir gut geht will ich versuchen, Gott nicht aus den Augen zu verlieren, denn ich habe gesehen, was der Glaube bewirken kann. Unser kleines Land ist nicht das Zentrum. Wir sind eine Kirche. Es geht um das Wohl aller. Nicht nur um »meine Gemeinde«.
keine Änderung ihrer Sichtweise auf Kirche als internationale Glaubensgemeinschaft festgestellt haben, begründen dies im Wesentlichen damit, dass ihnen dieser Aspekt von Kirche bereits bekannt sei – meistens von der Teilnahme an vorangegangenen Weltjugendtagen. Wie nah fühlst du dich …? Mithilfe der Fragen »Wie nah fühlst du dich Gott / Jesus Christus / Papst Franziskus / Papst Benedikt XVI. / der Kirche?« und »Wie nah wirst du dich diesen in 15 Jahren fühlen« wurden die Jugendlichen um eine Einschätzung zur Entwicklung ihrer Einstellungen gebeten. Abbildung 8 zeigt die Ergebnisse im Durchschnitt. Fünf Monate nach dem Weltjugendtag scheinen die Jugendlichen verhalten optimistisch zu sein, dass ihre Nähe zu Gott, Jesus und der Kirche noch zunehmen wird. Lediglich in Bezug auf ihre Einstellungen gegenüber dem am-
144
Empirische Aspekte
um ein ›Mehr‹ an Theologie, an Beziehungen und Authentizität, an Freude und Bewegtheit, aber auch an eigenem Einsatz und Solidarität scheint es den Jugendlichen vor allem zu gehen. Dieses ›Mehr‹ fordern Abb. 8: Bewertung auf einer Skala von 1 (ganz fern) bis 6 (ganz sie nicht aus einer Konsumnah) im Durchschnitt: »Wie nah fühlst du dich Gott / Jesus haltung heraus. Schon gar Christus / Papst Franziskus / Papst Benedikt XVI. / der Kirche nicht stellen sie fundamenjetzt / in 15 Jahren?« tale Inhalte des Glaubens, tierenden und dem emeritierten Papst den Priesterberuf oder die Institution vermuten sie eine negative Entwicklung Kirche als solche in Frage. Was sie anüber die Zeit. Der Grund dafür ist nach prangern, ist eine gewisse Lauheit und Auskunft der Befragten aber keineswegs Bequemlichkeit, die sie der Kirche in ein schlechtes Bild, das die Päpste im Zu- Westeuropa attestieren, und das Fehlen sammenhang mit Weltjugendtagen abge- von überzeugenden Persönlichkeiten. geben haben. Das Gegenteil ist der Fall. Sie sehen sich selbst als Teil der Kirche Viele Befragten waren positiv überrascht und machen sich auch deren Sorgen zu über das Auftreten und die Botschaften eigen: »Eine so tolle Botschaft und keivon Papst Franziskus während des Welt- ner will sie hören!« Wenn eine Befragte jugendtages und befürchten, dass ein so zu verstehen gibt, Beten sei »nichtig«, positives Bild über die Zeit nur getrübt dann in dem Sinne, dass zuerst die im werden könne. Glauben erkannte richtige Tat hilft. Jugendliche wollen etwas tun, sie zeigen auch in der oben vorgestellten Befragung den sprichwörtlichen ›jugendli4. Diskussion und Fazit chen Tatendrang‹, den auch andere (z.B. Bereits die in diesem Beitrag vorge- soziologische) Jugendstudien bestätigen. stellte Fallstudie, in der nur ein kleiner Was Kirche und Theologie von dieAusschnitt der beim XXVIII. Weltju- sen Jugendlichen lernen können, ist, bei gendtag 2013 in Rio de Janeiro erhobe- allen Reform-, Rationalisierungs- und nen Daten vorgestellt wurde, zeigt, dass Strukturzwängen dieser Tage die theodie befragten Jugendlichen durch ihre logische und spirituelle WeiterentwickVorstellungen und Anfragen an Kirche lung nicht aus den Augen zu verlieren. ekklesiologisch Wesentliches zu sagen Eine Entwicklung, bei der es nicht um haben, wenn man die von Jugendlichen weniger, sondern nur um mehr gehen reflektierte Kirchenerfahrung im Sinne kann; darum, mehr vom Evangelium zu einer sich dynamisch immer wieder er- verwirklichen. neuernden Wegtheologie versteht. Denn
Willems Muslimische Jugendliche und ihre Erfahrungen mit ›Kirche‹
145
Joachim Willems Muslimische Jugendliche und ihre Erfahrungen mit ›Kirche‹ – Empirische Ergebnisse und Ansatzpunkte für jugendtheologische Gespräche1 1. Vorbemerkungen
Muslimische Jugendliche und Kirche? Viele Religionslehrer und Pfarrerinnen wären ja schon froh, wenn die christlichen, getauften Jugendlichen eine Vorstellung von Kirche hätten, die über Klischees hinausgeht – von Erfahrungen mit kirchlichem Leben ganz zu schweigen. Hier soll trotzdem gefragt werden: Welche Erfahrungen mit, welche Bilder von Kirche haben muslimische Jugendliche? Mit Blick auf Jugendtheologie ist diese Frage deshalb von Bedeutung, weil in vielen Fällen auch muslimische Schülerinnen und Schüler am christlichen Religionsunterricht teilnehmen und die Lehrkräfte deshalb Wissen darüber benötigen, wie diese Jugendlichen auf das Thema ›Kirche‹ schauen. Darüber hinaus kann der folgende Artikel dabei helfen, eine differenziertere Sicht auf muslimische Jugendliche in Deutschland zu bekommen. Zu diesem Zweck werden Interviews eines aktuellen Forschungsprojekts mit dem Titel REVIER ausgewertet. REVIER steht für Religiöse Vielfalt erleben – deuten – bewerten. Religionspädagogische Untersuchungen zum Umgang Jugendlicher mit religiös pluralen Situationen. In diesem Forschungsprojekt wird erhoben, unter welchen Umständen, in welchen Situationen Jugendliche eigentlich die Kategorie religiöser Differenz zur Anwendung
bringen: In welchen Alltagssituationen ist Religion im Allgemeinen und religiöse Differenz im Besonderen von Bedeutung? Welche Deutungsmuster aktivieren Jugendliche, also: Wie beurteilen sie bestimmte andere Religionen oder religiöse Vielfalt an sich? Welche Emotionen verbinden sie damit und welche Werturteile? Welche Eigenschaften werden bestimmten Religionen oder Situationen religiöser Vielfalt zugeschrieben? Um diese Fragen zumindest im Ansatz zu beantworten, werden Jugendliche in Berlin zwischen 14 und 18 Jahren untersucht, die unterschiedliche religiös-weltanschauliche Überzeugungen haben (christlich, v.a. evangelisch; muslimisch; nicht-religiös) und aus unterschiedlichen Regionen der Stadt kommen (sowohl aus dem säkularisierten Osten der Stadt, als auch aus den ›Multi-Kulti-Kiezen‹ in der Mitte und dem eher ›bürgerlichen‹ Berliner Südwesten mit teils volkskirchlichen Milieus). Das hauptsächliche Untersuchungsinstru1 Dieser Beitrag ist entstanden im Rahmen des Forschungsprojekts REVIER, gefördert durch ein Heisenberg-Stipendium und eine Sachbeihilfe der DFG, GZ: WI 2715/1–1 und WI 2715/2–1; vgl. auch die Projektdarstellung im Internet unter http://zope.theologie.hu-berlin. de/relpaedagogik/mitarbeiter/revier. Im Projekt angestellt sind außerdem die Studentinnen Juliane Behrndt (evang. Theologie) und Friederike Schulze-Marmeling (Islamwissenschaft).
146
Empirische Aspekte
ment sind problemzentrierte LeitfadenInterviews. Die transkribierten Interviews werden im Verlauf des Projekts vor allem mit Methoden der rekonstruktiven Sozialforschung analysiert. Bei der Analyse geht es darum, neben den bewussten und reflektierten Einschätzungen der Jugendlichen deren nichtbewusste und nicht-reflektierte Deutungen zu explizieren (vgl. unten 3.). Vom REVIER-Projekt ausgehend, sollen im Folgenden einige Anmerkungen zu der Frage gemacht werden, welche Erfahrungen muslimische Jugendliche mit ›Kirche‹ machen. 2. Muslimische Jugendliche und ›Kirche‹ – einige theoretische Vorüberlegungen
Wer im Zusammenhang mit Jugendtheologie fragt, welche Erfahrungen muslimische Jugendliche mit ›Kirche‹ machen, sollte zunächst klären, was unter ›Kirche‹ zu verstehen ist, und zwar aus zwei Gründen: Zum einen ist der Begriff ›Kirche‹ im Deutschen ja mehrdeutig, und gerade auch ein Blick darauf, welche der Bedeutungen von muslimischen Jugendlichen überhaupt nicht verwendet werden, gibt deshalb Aufschluss über ihre Konzepte von ›Kirche‹. Zum anderen ist zu fragen, welche äquivalenten Begriffe es in der islamischen Theologie und Tradition gibt. Denn dies ist die Voraussetzung dafür, zu klären, wie ggf. in interreligiösen jugendtheologischen Gesprächen Vorstellungen von ›Kirche‹ kontextualisiert werden (können). Der Einfachheit halber sollen hier die folgenden Bedeutungen unterschieden werden:
1. ›Kirche‹ als ›Gemeinschaft der Heiligen‹. Kirche ist nach christlichem Verständnis, bei allen konfessionsbedingten Unterschieden im Verständnis von Kirche, der Ämter und der Bedeutung der kirchlichen Tradition, zunächst die Gemeinschaft der Heiligen. Merkmale von Kirche sind, den altkirchlichen Bekenntnissen entsprechend, vor allem nach dem Nicäno-Konstantinopolitanum, dass die Kirche eine ist, heilig, katholisch bzw. allgemein und apostolisch. Ein islamisches Äquivalent dazu wäre am ehesten die islamische Umma als religiöse Gemeinschaft der Muslime, in der Muslime über nationale, kulturelle, soziale oder Geschlechtsgrenzen hinweg zusammengehören. Allerdings gibt es charakteristische Unterschiede zwischen dem, was ›Umma‹ im Islam und was Kirche im Christentum bedeutet: So kann der Begriff ›Umma‹ ursprünglich auch für nicht-muslimische Glaubensgemeinschaften verwendet werden, und er kann auf die Gemeinschaft aller Menschen verweisen. Im Koran heißt es, die Menschen seien einst nur eine Gemeinschaft (›Umma‹) gewesen, sich dann aber uneinig geworden (Sure 10, 19). Von Ibn Madscha wird ein Hadith überliefert, demzufolge ein Drittel der Bewohnerschaft im Paradies aus der muslimischen Umma sein werde, der Rest aus den anderen Ummas.2 2. ›Kirche‹ als Gebäude. Ein islamisches Äquivalent dazu wäre zunächst einmal ›Moschee‹, wobei natürlich zu berücksichtigen ist, dass eine Moschee nicht genau die gleichen Funktionen 2 Vgl. Frederick M. Denny, Art. ›Umma‹. In: Encyclopedia of Islam, 2nd ed., Vol. 10, 1960, 859–863, hier 862.
Willems Muslimische Jugendliche und ihre Erfahrungen mit ›Kirche‹
erfüllt wie eine Kirche, und dass auch die theologischen Zuschreibungen zum Gebäude ›Kirche‹, je nach konfessioneller Prägung, andere sind als die Zuschreibungen zum Gebäude ›Moschee‹. Das wird vor allem deutlich mit Blick auf das Verständnis von ›Heiligkeit‹ des Kirchenraums in katholischer oder orthodoxer Tradition. 3. Kirche als (Orts-)Gemeinde – und andere Formen der zeitlich und räumlich definierten Gemeinschaft. In der Orts-Gemeinde wird, im Idealfall zumindest, die kirchliche Gemeinschaft erfahrbar, die die ›Heiligen‹ aller Zeiten und Orte umfasst. Denn in der Orts-Gemeinde ist die Bezugsgruppe der exemplarischen Gläubigen überschaubar, können spirituelle Erfahrungen gemacht und religiöse Kenntnisse erworben werden. Wo dies außerhalb der Orts-Gemeinde geschieht, kann dennoch von Gemeinde und Kirche gesprochen werden, und vielleicht sind solche anderen Formen von Gemeinde ja für Jugendliche tendenziell attraktiver: Kirchentage, Weltjugendtage, Jugendcamps und ähnliche zielgruppenorientierte Angebote von Kirche. Islamische Äquivalente wären dann, zumindest in der europäischen Diaspora, einerseits die Moschee-Gemeinde, die in sich ähnlich differenziert sein kann wie eine christliche Gemeinde, so dass für Jugendliche in beiden Fällen möglicherweise eine Jugendgruppe innerhalb der Gemeinde die primäre Bezugsgruppe ist. Andererseits gibt es islamische Angebote für Jugendliche in Deutschland, in denen religiöse Gemeinschaft jenseits von Moschee-Gemeinden gelebt werden kann, sei es in speziellen Organisationen von und für Jugendliche oder bei Veranstaltungen mit Event-Charakter.
147
4. Kirche als Institution im Sinne einer Landeskirche. Die Unterscheidung zwischen der Kirche als Gemeinschaft der Heiligen und der Kirche als Institution mag eine sehr protestantische Angelegenheit sein (im Sinne der Unterscheidung von sichtbarer und unsichtbarer Kirche). Dennoch begegnet im allgemeinen Sprachgebrauch auch diese Begriffsverwendung: Kirche z.B. als die Evangelische Kirche in Deutschland (oder eine ihrer Gliedkirchen) bzw. als Römisch-Katholische Kirche (mit ihren Bistümern). Das islamische Äquivalent dazu wären in Deutschland die Islamischen Verbände wie der Zentralrat der Muslime in Deutschland, der Islamrat für die Bundesrepublik Deutschland, die DITIB, der Verband der Islamischen Kulturzentren. 3. Ein Blick in das empirische Material
Nach diesen Vorüberlegungen sollen nun einige Ergebnisse von Auswertungen der REVIER-Interviews vorgestellt werden. Dabei sind die Fragen leitend, welche Konzepte von ›Kirche‹ bzw. der genannten islamischen Äquivalente die muslimischen Jugendlichen haben und wo zwar nicht explizit von ›Kirche‹, ›Moschee‹ oder ›Umma‹ geredet wird, es aber der Sache nach darum geht. Denn eine erste interessante Beobachtung ist: Die Begriffe ›Kirche‹ und ›Umma‹ sind für die Jugendlichen kein Thema, wohl aber die Frage, wer zur Gruppe der Gläubigen dazugehört und wer nicht. Hier sei kurz erläutert, wie die folgenden Einsichten gewonnen wurden: Grundlage der Analyse sind die dreizehn Interviews aus dem REVIER-Sam-
148
Empirische Aspekte
ple, die mit muslimischen Jugendlichen in und aus Berlin geführt wurden. Im Sample repräsentiert sind Jugendliche mit migrantischer Familiengeschichte, aber auch ethnisch deutsche Konvertiten bzw. deren Kinder sowie Kinder aus ethnisch gemischten Familien. Ausgewählt wurden die meisten der Jugendlichen nach dem Kriterium, dass sie sich selbst als religiös verstehen. Deshalb wurden Kontakte geknüpft über verschiedene islamische Organisationen im muslimischen ›Mainstream‹ und über Personen, die in diesen Organisationen engagiert sind.3 Dies ist zu berücksichtigen bei jedem Versuch, Ergebnisse über den Einzelfall hinaus zu generalisieren: Die hier vorgestellten Jugendlichen sind nicht repräsentativ für ›die‹ muslimischen Jugendlichen in Berlin, sondern sie sind im Schnitt von ihrem Selbstverständnis und ihrer religiösen Praxis nach überdurchschnittlich religiös. Insofern fragt das Projekt REVIER, was für diese Gruppe der sich selbst als (religiös) muslimisch verstehenden und nicht radikalen Jugendlichen als exemplarisch gelten könne. Dahinter steht die Vorannahme, dass eine Person zum einen individuelle Erfahrungen im Kontext der je eigenen Biographie und in Wechselwirkung mit je individuellen vorausgegangenen Erfahrungen sowie mit ihrer biologisch oder psychologisch beschreibbaren spezifischen Konstitution macht. Zum anderen aber werden individuelle Erfahrungen in einem gesellschaftlichen und kulturellen Kontext gemacht: Menschen lernen und internalisieren Deutungsmuster in Auseinandersetzung mit gesellschaftlich objektivierten Deutungsmustern, durch die hindurch sie etwas erfahren; sie handeln im Rahmen von Handlungsmustern, die
ebenfalls auf objektivierte Handlungsmuster bezogen sind und die ihrerseits gesellschaftlich bzw. kulturell in unterschiedlichen Maßen verbreitet sind.4 Soll es hier darum gehen, Aussagen über muslimische Jugendliche zu machen, so steht man vor der Schwierigkeit, über den Einzelfall hinaus generalisierte Aussagen treffen zu müssen, obwohl jeder Einzelfall jeweils besonders ist. Dennoch sind Generalisierungen, so die Vorannahme, deshalb möglich, weil Menschen jeweils unterschiedlichen ›Gruppen‹ und Diskurs-Zusammenhängen angehören, in denen bestimmte Handlungs- und Deutungsmuster kulturell objektiviert werden. Durch den Einzelfall hindurch können darum entsprechende Muster beschrieben werden. Die Analysen, auf denen der hier vorliegende Beitrag fußt, beziehen sich auf diese theoretischen und methodologischen Überlegungen. Die Analyse ge3 Als organisierter (religiöser) muslimischer Mainstream gelten hier die großen islamischen Verbände, Unterorganisationen sowie Organisationen in ihrem Umfeld bzw. mit ihrer Beteiligung. Zum Zweck der Kontaktaufnahmen wurden keine Organisationen ausgewählt, die aus religiösen oder theologischen Gründen ›am Rande‹ stehen und die man sich scheut, angesichts ihrer Unterschiedlichkeit und Unvereinbarkeit miteinander in einer Klammer zu nennen (Ahmadiyya, alevitische Organisationen, salafistische Gruppen, ›säkulare‹ Muslime). Selbstverständlich ist mit dem Begriff ›Mainstream‹ keine Wertung verbunden und auch nicht die Behauptung, die hier als Organisationen ›am Rande‹ bezeichneten Gruppen seien nicht relevant oder für die Forschung uninteressant. 4 Vgl. dazu und zum Folgenden ausführlicher den theoretischen Teil in Joachim Willems, Interreligiöse Kompetenz. Theoretische Grundlagen – Konzeptualisierungen – Unterrichtsmethoden, Wiesbaden 2011, 25–90.
Willems Muslimische Jugendliche und ihre Erfahrungen mit ›Kirche‹
schieht wie folgt: Innerhalb der Interviews wurden zunächst die Abschnitte identifiziert, die mit Blick auf diesen Artikel von Relevanz sind. Ausgewählt wurden 1. Abschnitte, in denen der Begriff ›Kirche‹ oder ein islamisches Äquivalent vorkommen; 2. Abschnitte, in denen Jugendliche von Erfahrungen mit ›Kirche‹ oder den islamischen Äquivalenten berichten (als von den Jugendlichen selbst verwendetes Konzept oder als von außen herangetragenes Konzept); 3. Abschnitte, in denen die Jugendlichen von Erfahrungen mit Christinnen und Christen bzw. mit Christentum im Allgemeinen berichten. Diese Abschnitte werden dann daraufhin befragt, um welche Bedeutungen von ›Kirche‹ bzw. um welches islamische Äquivalent es hier geht (vgl. oben 2.). Innerhalb der oben unterschiedenen Bedeutungen von ›Kirche‹ bzw. ihren islamischen Äquivalenten werden dann weitere Unterscheidungen vorgenommen, wobei sich das Vorgehen lose am offenen Kodieren im Sinne vom Strauss und Corbin orientiert.5 Auf diese Art entstehen Subkategorien, die deutlich machen, in welchen Kontexten die unterschiedlichen Bedeutungen von ›Kirche‹ sowie ihre Äquivalente eine Rolle spielen, welche Eigenschaften ihnen zugeschrieben und welche Erfahrungen mit ihnen verbunden werden. So wird ansatzweise das Konzept von ›Kirche‹ beschreibbar.6 Nun kann eine vertiefende Analyse beginnen, die im Sinne rekonstruktiver Sozialforschung die ausgewählten Abschnitte im Blick auf die darin vorgenommenen Rahmungen und auf nicht reflektierte Selbstverständlichkeitsannahmen untersucht.7 Schon die ersten Schritte zeigen, dass die interviewten Jugendlichen den
149
Begriff ›Kirche‹ vor allem, ja fast ausschließlich als Bezeichnung für KirchenGebäude verwenden und damit (bei allen Unterschieden) in Parallelität zur Moschee, nicht als Begriff für die ›Gemeinschaft der Heiligen‹ (also, bei allen Unterschieden, in Parallelität zur Umma). In zwei von dreizehn Interviews verwenden die Jugendlichen den Begriff ›Kirche‹ überhaupt nicht. Kirche als Kirchengemeinde und Kirche als Institution (etwa als evangelische Landeskirchen oder als Evangelische Kirche in Deutschland) ist für die interviewten muslimischen Jugendlichen, so kann man sagen, kein Thema.8 Von diesem ersten Ergebnis ausgehend, ergibt sich die folgende Gliederung. 3.1 ›Kirche‹ als Gebäude
Im Blick auf ›Kirche‹ als Gebäude lassen sich in den Interviews mit muslimischen Jugendlichen drei Aspekte unterscheiden: 1. Der Begriff Kirche wird verwendet, wenn es auch um Moschee geht, und beides wird parallel gesetzt – und zwar ohne dass die funktionalen und theologischen Unterschiede zum Thema würden. 5 Anselm Strauss / Juliet Corbin, Grounded Theory: Grundlagen Qualitativer Sozialforschung, Weinheim 1996, 43–55. 6 Vgl. ebd., 75–93. 7 Vgl. Arnd-Michael Nohl, Interview und dokumentarische Methode. Anleitungen für die Forschungspraxis, Wiesbaden 32009, 11f. 8 Die Mengenangaben sind hier und im Folgenden aus Gründen der Transparenz im Blick auf das Sample angegeben.
150
Empirische Aspekte
2. Kirchen-Gebäude erscheinen als Orte der praktizierten christlichen Religion. 3. Kirchen-Gebäude kommen als Orte interreligiöser Begegnung in den Blick. In Kontakt kommen die interviewten Jugendlichen mit Kirche als Gebäude durch die Schule (vier der dreizehn interviewten muslimischen Jugendlichen berichten von Exkursionen mit der Schule zu Kirchen und teilweise auch zu buddhistischen Tempeln und Synagogen, niemand jedoch von Moschee-Exkursionen mit der Schule), durch ihnen nahestehende nicht-muslimische Personen (Familienmitglieder; Partner) oder durch institutionelle Kontakte über ihre Moschee-Gemeinde. 3.1.1 Parallelität von Kirche und Moschee
In den Interviews wird der Begriff ›Kirche‹ parallel gesetzt zum Begriff ›Moschee‹. Damit wird zum einen eine gewisse Nähe ausgedrückt: Kirche und Moschee gleichen sich darin, dass sie religiöse Gebäude sind, in denen Gott angebetet wird. Zum anderen beinhaltet die Parallelität von Kirche und Moschee ihre Unterscheidung und damit auch die Unterscheidung der Religionen Christentum und Islam: Beide Religionen haben zwar Gotteshäuser, aber nicht dieselben. Im Interview mit ›Sarah‹9 wird die Parallelität von Kirche und Moschee besonders deutlich, wenn ›Sarah‹ die Begriffe Kirche und Moschee offensichtlich verwechselt und synonym gebraucht: Auf die Frage, ob sie nach einem erwähnten Kirchenbesuch noch einmal in einer Kirche gewesen sei, antwortet sie: »Ja so – paar Mal hier in dieser arabischen Kirche am Görlitzer Bahnhof, sonst gar nicht mehr.«
Im Folgenden stellt sich heraus, dass die ›arabische Kirche‹ in Wirklichkeit eine Moschee ist, und wenige Zeilen im Transkript später nennt sie das Gebäude dann auch »arabische Moschee«. Ihr Augenmerk liegt dabei auf der Frage der ethnischen Zuordnung: »Araber, libanesische, Kurden, Türken, Kurden, so. Äh ob – also, sagen wir mal es whier – diese arabisch Kirch da gehört jeder rein. Das heißt nur so – türkische Kirche, arabische Kirche. Da kommen Araber rein, da kommen Türken rein, da kommen Frauen rein, so. … Und äh ich war ja auch mal drinnen.«
Daraus könnte man den Schluss ziehen, dass für Sarah ethnische Differenz(ierung) wichtiger ist als religiöse Differenz(ierung), wobei in ihrer Schilderung die Trennung der genannten ethnischen Gruppen gleich wieder relativiert wird: Die Moscheen sind nicht exklusiv für eine ethnische Gruppe, auch wenn sie vorrangig von nur einer Gruppe genutzt und entsprechend bezeichnet werden. Vergleicht man diesen Interview-Ausschnitt mit anderen, so wird deutlich, dass Sarah hier Binnendifferenzierungen innerhalb der für sie ›eigenen‹ Gruppe der Muslime anhand des Kriteriums Ethnizität vornimmt und die Gruppe der Deutschen und Christen nicht in den Fokus kommt. Auch ›Peter‹ setzt die Begriffe Moschee und Kirche parallel. Er äußert den 9 Alle Namen sind Pseudonyme, die in der Regel von den Interviewten selbst gewählt wurden. Auffällig ist, dass die meisten Pseudonyme, anders als die richtigen Namen der Interviewten, nicht auf die Familiengeschichte der Interviewten und die Herkunft ihrer Vorfahren verweisen (meist aus der Türkei und arabischen Staaten).
Willems Muslimische Jugendliche und ihre Erfahrungen mit ›Kirche‹
Wunsch nach einer »richtigen Moschee« und erläutert diesen Begriff mit Verweis auf das Christentum: In der Kirche würden die Glocken zum Gebet rufen, und das sei gut so. Er selbst wolle auch zum Gebet gerufen werden, und deshalb wünsche er sich eine »Moschee mit Minarett«. An einer anderen Stelle des Interviews erläutert er, welchen hohen Stellenwert seiner Ansicht nach der Beruf des Lehrers hat und vergleicht dessen Autorität mit der von religiösen Amtsträgern: »der Imam in der Moschee […], wie der Priester im Christentum in der Kirche«. Das Gebäude wird damit auch zum Symbol für die jeweilige Religion. 3.1.2. Kirchen-Gebäude als Ort des Gottesdienstes und als Chiffre für praktiziertes Christentum
In mehreren Interviews kommt das Kirchgebäude als Ort des Gottesdienstes in den Blick und wird dann zu einer Chiffre für praktiziertes Christentum. Die interviewten Jugendlichen verbinden den Kirchgang in der Regel mit positiven Bewertungen, wie sie überhaupt denjenigen Christen, die ihre Religion praktizieren, mit Hochachtung begegnen. Die Hochschätzung von religiöser Praxis kann vor dem Hintergrund der eigenen Frömmigkeit der muslimischen Jugendlichen gesehen werden, für die ihre Religion in der Regel vorrangig Orthopraxie ist, also Regelobservanz in ritueller und moralischer Hinsicht. Die positive Bewertung des Gottesdienstes kann auch außerreligiöse Gründe haben, wie im Falle von ›Sarah‹. Sie berichtet, dass sie mit ihrer Schulklasse einen Gottesdienst besucht hat. Diesen Besuch schildert sie äußerst positiv; sie hebt die Ruhe und Aufmerksamkeit der Menschen hervor:
151
»Und ja, das war, das war so ruhig, das war so voll schön so. [lacht] Das war auch ein sehr, sehr schönes Eindruck. Also, das hat mir auf jeden Fall gefallen.« Es sei »nicht schlimm« gewesen, dass die Menschen »kein Kopftuch« getragen haben.
Zum positiven Eindruck hat für Sarah beigetragen, dass sie eine gewisse Form von Anerkennung erfahren hat und sich nicht ausgegrenzt gefühlt hat, hier symbolisiert im gemeinsamen Essen und Trinken: Nach dem Gottesdienst hätten sie »Kuchen, Tee, Kaffee« bekommen. Dies widersprach ihrer Normalitätserwartung: Das Kopftuch ist hier ein Symbol der Trennung. Frauen ohne Kopftuch erscheinen Sarah zunächst als ›die Anderen‹, denen gegenüber sie unsicher ist. Ihre Erleichterung (es sei »nicht schlimm« gewesen) zeigt dabei, dass sie selbst, die ein Kopftuch trägt, diese Trennung von Menschen in KopftuchTrägerinnen und Nicht-Kopftuch-Trägerinnen überwinden möchte. ›Timo‹, der auch schon einmal in einem Gottesdienst war, beschreibt seine Erfahrungen dagegen, ohne seine Gefühle dabei zu schildern und auch ohne das Gesehene zu bewerten. Er sagt selbst: »Ich wollte mir Wissen darüber aneignen, ich wollte gucken, wie ist das …« Nach seiner Schilderung des Gottesdienstes erläutert er das noch einmal: »Und ähm, wie gesagt, also es ist, es ist, es ist notwendig so etwas zu machen meines Erachtens. Es ist notwendig. Man muss wissen: Wie ist der andere? Worauf muss ich achten? Wenn ich als Muslim nicht weiß, worauf ich achten soll, dann kann ich auch irgendetwas machen, was ihm vielleicht nicht gefällt, ohne es zu wissen. Aber wenn ich weiß, das würde ihm nicht passen, oder wenn ich nicht, wenn, wenn ich nicht weiß, wie ich mich zu beneh-
152
Empirische Aspekte
men habe, dann mache ich vielleicht etwas, was ihn nicht erfreut. Und dies ist nicht Ziel meiner ganzen Sache sondern mein Sinn ist halt, Ziel ist es halt entgegen zu kommen, gegenseitig entgegenzuwirken, sich zu helfen.«
Timos Schilderung wird hier so gerahmt, dass es als (zumindest ein) Ziel seines Gottesdienst-Besuchs erscheint, Wissen zum Zwecke der Toleranz und des respektvollen Miteinanders zu erwerben. Das ist insofern interessant, weil er hier bei einer Beerdigung innerhalb der eigenen Familie war. (Später erwähnt er, er habe »natürlich auch Beistand geleistet bei ihrer Trauer«.) Ähnlich sachlich und nüchtern ist seine Schilderung der Veranstaltung: »Es war zuallererst interessant, weil es war was vollkommen anderes. Es war ähm, interessant zu sehen, dass sie, dass man eben auch direkt vom Buch beispielsweise gesprochen hat, dass man da seine Gebete zusammen gesagt hat. Also es war ja relativ mit der Orgel, soweit ich weiß, wenn ich mich recht daran erinnere. Dann mit dem Buch, ähm, ich zitiere kurz: Oh Herr, vergib uns! Oder: Oh Herr, lasse sie in ihrem Himmel aufgehen! Oder: Wie eine Blüte, oder et cetera. Also es war jetzt ein anderes Erlebnis. Es war ähm, weil wenn wir hier unsere Bittgebete sprechen, machen wir nat- machen, machen wir es teils laut, aber teils auch jeder für sich selbst. Weil jeder hat seine eigenen Bedürfnisse. Da sagt jeder selbst, was er von Gott möchte, was er gerne von Gott haben will.«
In dieser vom Ton her sehr sachlichen Schilderung fokussiert Timo die Andersartigkeit, die er, ohne sie explizit zu bewerten, im Stile eines neutralen, neugierigen Beobachters als »interessant« kennzeichnet. Als »vollkommen« anders bezeichnet er dabei religiöse Handlungen,
die im Islam wie im Christentum eine Rolle spielen (Lesungen aus der Heiligen Schrift bzw. Predigt, Gebet). Es geht also um die Differenz unter der Voraussetzung der Gemeinsamkeit. Die Kirche als Ort des Gottesdienstes erscheint dann als ein ›andersartiger‹, aber gleichwohl interessanter und nicht negativ zu bewertender Ort. Ähnlich wie mit Blick auf die Parallelität von Kirche und Moschee impliziert die Parallelität der christlichen und der islamischen religiösen Praxis, dass es sowohl Gemeinsamkeiten zwischen den Religionen gibt, als auch Differenzen bzw. Binnendifferenzierungen innerhalb der monotheistischen Religion. Diese Differenzen bearbeitet Timo, indem er sie ›erforscht‹, um so das interreligiöse Miteinander zu verbessern. Die religiösen Differenzen werden auch in anderen Interviews thematisiert. ›Sarah‹ und ›Hajar‹ berichten von ihrer Angst, einen christlichen Gottesdienst zu besuchen. Sarah war in der 5. oder 6. Klasse mit ihrer Grundschul-Klasse in einer Kirche: »Ey ich dachte erstmal: Ey du musst hier raus! Das ist nicht okay! Ja damals so. Ich hatte so damals diese Kindgedanken. Aber jetzt, wenn ich mir so heute vorstelle – natürlich bin ich immer noch ein Kind, aber, ich denk immer so nach. W- egal wo ich bin, man sollte sich leise verhalten, und, das war eigentlich nicht so schlimm. Ich dachte mir nur eher, ob es richtig ist, dass ein Moslem hier reintreten sollte. … Ich dachte mir so: Ey, Gott wird – Allah wird voll sauer auf mich sein, es [sic] sieht mich grade. Aber ich glaub nicht, dass das eine Sünde ist. Glaube ich nicht.«
Für Sarah ist der Besuch einer Kirche gerahmt durch die Angst vor Sünde und göttlichem Zorn, weil die Kirche ein
Willems Muslimische Jugendliche und ihre Erfahrungen mit ›Kirche‹
Ort anderer, nicht-islamischer religiöser Praxis ist. Diese Angst vor religiöser Differenz wird von Sarah übertragen auf die Ebene zwischenmenschlicher Beziehungen und auf die christlichen Gottesdienst-Besucher projiziert: Sie berichtet, die Leute im Gottesdienst hätten nicht negativ auf sie reagiert und erklärt das damit, dass »wir noch jung waren, da ich noch kein Kopftuch hatte, da ich noch sehr, sehr, sehr jung war«. Hier wird ihre selbstverständliche Erwartung sichtbar, dass Christen einer Kopftuchträgerin gegenüber negativ eingestellt sein müssten, das Kopftuch wird zum Symbol für die Trennung der Menschen entlang religiöser und kultureller Grenzen (vgl. oben). Der Gedanke, dass »Allah … voll sauer« sein könnte, wenn ein muslimisches Mädchen in eine Kirche geht, begegnet auch im Interview mit Hajar. Als Grundschülerin habe sie sich deshalb geweigert, das zu tun: Früher, ich kann mich erinnern in der Grundschule, sind wir zum Mosch-, äh zum äh Kirch ge-, gegangen, wir Moslems alle. Wir gehen da nicht rein. Wir hatten kein Wissen, wir hatten, wir haben gedacht, wenn wir jetzt da rein gehen kriegen wir Sünden und so was. Nur ein Mädchen ist da rein gegangen und hat gesagt, ne ich guck’s mir an. Also wir beten da ja nicht. Wir gucken uns das mal an. Kamen wir alle nach Hause. Und so [seufzt]: Unsere Lehrer, die schicken uns zu einer Kirche und uns so unsre. Ja, das fand, da kann ich mich voll gut daran erinnern. So lustig. Nee, nicht lustig. Früher war das für mich so Schock. Oh Gott, was sind das für Lehrer, die wollen mich zwingen und so.
Die Grenzziehung, die sich für Sarah am Kopftuch manifestiert, wird hier sichtbar anhand der Haltung zur Kirche. In
153
beiden Fällen gilt das religiös differente als gefährlich, weil der Kontakt damit »Sünde« sei. Deshalb liegt es nahe, dass Hajar hier die Gruppe der Muslime den Christen gegenüberstellt. Allerdings könnte dies bereits eine Überinterpretation sein: Deutlich wird lediglich die in dieser Situation besondere Bedeutung einer kollektiven Identität, die sich in der häufigen Verwendung von Personalpronomina in der ersten Person Plural zeigt. Neben der religiösen Differenz könnte hier allerdings auch eine ethnische Differenz mitklingen, denn es ist unwahrscheinlich, dass die Berliner Lehrkräfte und nicht-muslimischen Mitschüler/in nen alle (oder auch nur eine deutliche Mehrheit) religiös christlich sind. Wichtig ist dabei, dass Hajar und Sarah hier Begebenheiten der Vergangenheit beschreiben und sich von ihren damaligen Sichtweisen explizit distanzieren. Hajar erzählt, ihre Eltern hätten ihr damals gesagt, dass es keine Sünde sei, eine Kirche zu betreten, und so sieht sie selbst das heute auch: »die haben mir dann erklärt, ne man kann da reingehen. Du betest da nicht, du gehst dahin, guckst dir das an und so. Und dann, aber ich hab wirklich ich auch so, früher hab ich mich auch gar nicht für andere Religionen interessiert, war mir voll egal. Islam auch, aber ich wusste auch nicht viel über meine Religion. Weißt du?«
Trotzdem geht Hajar nicht in die evangelische Kirche in der Nachbarschaft, obwohl sie das eigentlich interessieren würde. Hier ist vor allem ihre Begründung bemerkenswert: »Weil, weil ich seh immer diese, die Simpsons und so. Du weißt doch, wo die dann im-
154
Empirische Aspekte
mer in der Kirche sitzen und dann zuhören und so. Aber so, ich wollte mal gucken. Nee wirklich, wie das so ist was die sagen und so. Würde mich voll interessieren.«
Aber an der Kirche habe »nur für Mitglieder« gestanden. Da Gottesdienste ja in der Regel öffentliche Veranstaltungen sind, spricht einiges dafür, dass Hajars Interesse doch nur begrenzt ist und sie sich nicht ernsthaft um die Möglichkeit kümmert, an einem Gottesdienst teilzunehmen, oder dass die Hemmschwelle aus anderen Gründen zu hoch ist. 3.1.3 Kirchen (und Synagogen) als Orte interreligiöser Begegnungen
Kirche als Ort anderer, ›fremder‹, nichtmuslimischer Religion kann zum Ort für interreligiöse Begegnungen werden. Dieser Aspekt kommt immerhin in zwei der Interviews vor: ›Hajar‹ berichtet von positiven Erfahrungen in einer Synagoge und einer Kirche, die sie mit ihrer Schulklasse während einer Klassenfahrt nach Polen besucht habe. Während sie dort auf der Straße wegen ihres Kopftuchs geschubst, beschimpft und abfällig angesehen worden sei, sei sie von den religiösen Menschen, Christen und Juden, gut behandelt worden. Dies widersprach Hajars Normalitätserwartung. Denn zuvor sei sie davon ausgegangen, dass »die« »uns … Frauen mit Kopftuch« »hassen« würden, und sie habe deshalb mit »denen … nicht so wirklich was zu tun haben« wollen. ›Hajar‹ erlebt also eine Kirche und eine Synagoge als Orte geglückter interreligiöser Begegnung, und zwar wider Erwarten. Dies unterscheidet sie von ›Inge‹, die offensichtlich sehr viel bessere Erfahrungen mit religiöser und kultureller Pluralität gemacht hat:
»Dieses Multikulti finde ich eigentlich voll schön, weil – äh – man lernt ja von diesen verschiedenen Kulturen, irgendwie bringt ja jeder irgendwas mit, seinen Beitrag – positiv als auch negativ, je-je-jeder hat so seinen positiven und negativen Beitrag. Und, man sollte das Positive sehen. Ich meine, jeder Mensch hat was Negatives, Positives. Wenn man immer das Negative sieht, und das Negative groß macht, dann wird man selbst dabei nicht glücklich, und daher dass jede Kultur auch ihre positiven Sachen bringt, und auch leckeres Essen und, so weiter, sollte man einfach das Positive sehen – und ja.«
In diesem Zusammenhang kommt Inge auf ein geplantes interreligiöses Bethaus in Berlin zu sprechen, in dem unter einem Dach eine Moschee und eine Kirche sein sollen und in der Mitte ein »Raum, wo man sich trifft«. Inges Einschätzung ist, dass diese Planung sowohl den Gemeinsamkeiten, als auch den Unterschieden zwischen den Religionen gerecht werden würde: »Und ich finde das Projekt eigentlich sehr gut, weil ich meine, es sind ja beides Religionen, wo man an Gott glaubt, und man betet, und trotzdem hat jede so ihre eigenen Rituale, und dann kann ja jeder in seiner eigenen Moschee, Kirche seinen Gottesdienst verrichten, und im Hauptraum trifft man sich dann, und kann sich austauschen.«
Indem Inge hier religiöse Pluralität in den Kontext kultureller Pluralität stellt, rahmt sie die Frage nach möglichen wechselseitigen Exklusivitätsansprüchen der Religionen Christentum und Islam auf eine bestimmte Weise: Offen bleibt, ob Inge auch im Blick auf diese beiden Religionen jeweils Positives und
Willems Muslimische Jugendliche und ihre Erfahrungen mit ›Kirche‹
Negatives sehen würde, und wenn ja, ob sie dann entsprechend sagen würde, dass man das Positive einer anderen Religion so übernehmen kann, wie das Positive einer anderen kulinarischen Tradition. Zumindest liegt diese Möglichkeit angesichts der Rahmung in Inges Horizont, und Inge würde dann eine prinzipielle Bereitschaft mitbringen, auch von anderen Religionen zu lernen.10 3.2 ›Kirche‹ als Religionsgemeinschaft
Die Aspekte von ›Kirche‹ als ›Gemeinschaft der Heiligen‹, als Kirchengemeinde und als Institution lassen sich im Blick auf die Interviews nicht immer trennscharf unterscheiden. Deshalb sollen sie hier unter der Überschrift »›Kirche‹ als Religionsgemeinschaft« zusammengefasst werden. Dabei ist zweierlei zu unterscheiden: Zum einen begegnen in den Interviews nur vereinzelt Aussagen über das kirchliche Leben in Deutschland, und diese Aussagen sind aus biographischen Gründen und angesichts der Zusammensetzung des Samples nicht exemplarisch oder gar repräsentativ für muslimische Jugendliche in Berlin. Zum anderen ist ein Motiv, das in allen (!) der dreizehn Interviews auftaucht, dass zwischen einerseits ›wirklichen‹ oder ›richtigen‹ und andererseits ›nicht-wirklichen‹ Christen unterschieden wird. Entsprechend unterscheiden einige Interviewte dann auch zwischen ›wirklichen‹ und ›nicht-wirklichen‹ Anhängern innerhalb ihrer eigenen Religion und eröffnen so Möglichkeiten zur Dekonstruktion von Grenzziehungen zwischen den Religionen.
155
3.2.1 Die Unterscheidung zwischen ›wirklichen‹ und ›nicht-wirklichen‹ Christen
Die wichtigste Art und Weise, wie das Christentum als Religionsgemeinschaft in den Blick kommt, ist die Unterscheidung zwischen ›wirklichen‹ und ›nichtwirklichen‹ Christen. Geht man diese Frage nicht ausschließlich theoretisch dogmatisch an, sondern schaut auf empirisch beschreibbare Fälle, wird die Grenzziehung zwischen Kirchengliedern und ›Außenstehenden‹ oft schwierig. Hier ist nicht der Ort, solche Fragen theologisch zu bearbeiten. Vielmehr geht es darum, die spezifischen Formen der Grenzziehung zu beschreiben, die in Interviews mit muslimischen Jugendlichen begegnen. Dabei fällt auf, zusammenfassend gesagt, dass die interviewten muslimischen Jugendlichen durchgehend eine Kluft zwischen christlichem Anspruch und christlicher Wirklichkeit bemerken. Den interviewten Jugendlichen erscheint es als selbstverständlich, dass ›wirkliche‹ Christen die große Ausnahme sind, wenn man solchen überhaupt begegnet. In mehreren Interviews wird von nur einem einzigen Mitschüler oder einer einzigen Mitschülerin berichtet, die ›wirklich‹ christlich sei. Die Kriterien für ›wirkliches‹ Christentum sind dabei auffällig stark von einem islamischen Verständnis religiösen 10 Vgl. zur Dimension des ›learning from religions‹ ausführlich Joachim Willems, Die Bearbeitung interreligiöser Überschneidungssituationen als Aufgabe eines interreligiös orientierten Religionsunterrichts, in: Herbert Stettberger / Max Bernlochner (Hg.), Interreligiöse Empathie lernen. Impulse für den trialogisch orientierten Religionsunterricht, Berlin 2013, 115f.
156
Empirische Aspekte
Lebens abhängig: Als ›wirklich‹ christlich gilt, wer nicht nur an Gott glaubt, sondern auch einem islamisch geprägten Ideal von Orthopraxie und Regelobservanz entspricht. So berichtet Jerome: »Und das ist das Komische. Viele, viel mehr Atheisten, viel mehr Ungläubige. Oder deren Eltern irgendwie vielleicht Christen sind und sie selber sind dann atheistisch. Das ist das Komische, Interessante, aber selber mit dem Christentum schon, ja. Weil wir haben da welche, die glauben schon, ähm jetzt nicht so stark, wie ich eben beschreiben habe. Die meisten sind nicht so stark christlich, sag ich mal. Und mit denen eigentlich, generell, vor einer Woche hatte ich ein Gespräch. Da ging es darum, dass er einem anderen, einem Atheisten erklärt hat warum das Rauschgift verboten ist, in der Bibel, aber Alkohol erlaubt. Und wir sind ins Gespräch gekommen, weil bei uns ist auch Rauschgift verboten, aber Alkohol auch. Da haben wir so gesprochen, ja Rauschgift hast du mir grade erklärt, wieso, warum dann nicht auch Alkohol und so? Da haben wir ein bisschen gesprochen.«
Wie der christliche Mitschüler von Jerome auf die Idee kommt, es gebe in der Bibel ein ›Rauschgift-Verbot‹, lässt sich natürlich schon aus methodischen Gründen nicht erheben. Setzt man voraus, dass das Gespräch in etwa so verlaufen ist, wie es Jerome hier darstellt, dann wäre folgendes möglich: der christliche Mitschüler könnte unreflektiert davon ausgehen, dass gesetzliche Regelungen in Deutschland und die Moralvorstellungen in seinem sozialen Umfeld (z.B. Familie, Kirchengemeinde) christlich fundiert seien. Möglicherweise bezieht er sich auch auf Interpretationen der Bibel, die aus den Warnungen vor ›pharmakeia‹ (z.B. Gal 5,20) ein Drogenverbot ableiten.11 Wichtig ist im Kontext
dieses Artikels allerdings etwas anderes: Für viele Muslime, auch im REVIERSample, ist das islamische Alkoholverbot ein Identitätsmarker. Für die meisten Christen dagegen ist ein Verbot von Rauschgift, wenn überhaupt, nicht von zentraler Bedeutung für ihre religiöse Identität. Im weiteren Verlauf des Interviews mit Jerome zeigt sich, dass Jerome das (vermeintlich) christliche ›RauschgiftVerbot‹ nun aber in genau einer solchen Analogie zum islamischen Alkoholverbot interpretiert: Er bezeichnet den erwähnten Mitschüler als ›wirklichen Christen‹, und nicht als jemanden, der sich zwar Christ nenne, dabei aber »einfach alle Regeln [missachtet]«. Dies begründet Jerome mit dessen Regelobservanz: »Und äh der praktiziert das auch wirklich richtig, also Rausch-, raucht gar nicht.« Aufgrund eines solchen Religionsverständnisses, das stark geprägt ist von der Vorstellung, Religion bestehe vorrangig aus Regeln, Geboten und Verboten, verstehen die interviewten muslimischen Jugendlichen eine große Zahl von Mitschülern und Mitbürgern als ›nicht-wirkliche‹ Christen. 3.2.2 Dekonstruktion von Grenzziehungen zwischen Religionen
Die Unterscheidung von jeweils mehr oder weniger ›richtigen‹ Gläubigen eröffnet die Möglichkeit, Grenzziehungen zwischen den Religionen zu dekonstruieren: Was, wenn die Gemeinsamkeiten 11 Diese Interpretation ist im Internet auf christlichen (evangelikalen) Seiten verbreitet. Vgl. z.B. http://www.livenet.de/themen/gesellschaft/soziales_lebenshilfe_diakonie/sucht_u nd_rehabilitation/132670-sagt_die_bibel_etw as_ueber_drogen.html, http://www.no-hopein-dope.de/content/view/52/25/ oder http:// www.truthmagazine.com/archives/volume15/ TM015091.html.
Willems Muslimische Jugendliche und ihre Erfahrungen mit ›Kirche‹
zwischen praktizierenden, überzeugten Gläubigen verschiedener Religionen größer sind als diejenigen zwischen den praktizierenden und den nicht-praktizierenden Anhängern innerhalb einer Religion? Die Grenze zwischen den Religionen wird in solchen Interviews nicht für obsolet erklärt, aber zumindest relativiert. Besonders deutlich wird die Relativierung der Grenzziehung zwischen den Religionen im Interview mit Jerome. Jerome berichtet von einem Mitschüler, der ihn im Musikunterricht zu provozieren versucht, als die Klasse gerade ein Weihnachtslied singt: »Hat ein nicht wirklich Freund, er war neu in der Klasse, auch eigentlich nicht religiös und hat mich angesehen und hat gesagt, Jesus Christus ist geboren, also provozierend. Also nach dem Motto, Jesus Christus ist im Christentum. Siehst du? Und ich erst mal, ich fand’s erstmal lustig. Häh. Wenn der wüsste, dass Jesus Christus ein wichtiger Prophet bei uns ist und so. Da habe ich es ihm ein bisschen näher gebracht und gesagt: Hey, na klar, finde ich sogar super, dass wir darüber singen und das singen und alles. Das ist ein Prophet und der hat vieles gebracht. Mh die Bibel selber gehört ja zu den Büchern Gottes. Also im Islam jetzt.«
Anstatt also Jesus zu benutzen, um die beiden Religionen zu unterscheiden und zu trennen, deutet Jerome Jesus als Integrationsfigur. Hier könnte man freilich darauf hinweisen, dass Jerome die Unterschiede zwischen den Religionen ausblendet. Zugleich sollte man aber das Potential solcher Deutungen nicht unterschätzen, um zunächst einmal eine gemeinsame religiöse Basis zu begründen und die Möglichkeit für eine vertiefte Auseinandersetzung auch mit den Unterschieden zwischen den Religionen zu schaffen.12
157
Eine Konsequenz der Überzeugung, dass Christentum und Islam in der Tiefe miteinander verbunden sind, kann dann sein, die christlichen Freunde nicht zum Islam bekehren zu wollen, sondern – zum Christentum. Davon berichtet Ahmed: »… ich bringe sie dann sozusagen zu ihre Religion … Na weil … das Christentum hat sehr viele gute Werte, die auch im Islam sind, sozusagen. Und ich versuch einfach diese Werte … rüber zu bringen, sozusagen. Und das versuch ich dann, denn wenn ich einen Christ sehe, dann, dann, äh, dann sprech ich mit ihm über die Bibel, dann zeig ich ihm auch wie die Bibel da das so steht, genau.«
Hier könnte man sagen: Weil Christentum und Islam eine Schnittmenge haben, setzt es sich Ahmed zur Aufgabe, Christen mit Verweis auf die Bibel zu dieser Schnittmenge hinzuführen. 3.3 Moschee-Gemeinden
Wie erwähnt, ist das kirchliche Leben in Kirchen-Gemeinden für die interviewten muslimischen Jugendlichen kein Thema. Dies könnte damit zusammenhängen, dass sie nur wenige ›praktizierende‹ Christen in ihrem Umfeld wahrnehmen. Dort, wo das geschieht, können kirchengemeindliche Aktivitäten in den Blick kommen. Tobias beschreibt die 12 Eine nähere Auseinandersetzung mit ›Jerome‹ und daraus resultierende Ideen für den Unterricht finden sich in Joachim Willems, Interreligiöse Kompetenz fördern. Lernen an einer interreligiösen Begegnungssituation, in: Zeitsprung 2 (Islam im Unterricht. Begegnungssituationen gestalten können), Berlin 2014, 4–6, online unter http://www.akd-ekbo. de/files/2_2014.pdf.
158
Empirische Aspekte
wenigen ›aktiven‹ Christen, die er kennt, wie folgt: »Und dann gibt’s noch Leute die sind Katholen aus meiner Klasse. Die gehen jeden Sonntag in die Kirche. Und singen auch im Chor, und die machen auch immer was mit ihrer, mit ihrer Gemeinde.«13
Dass die interviewten Jugendlichen christliches Gemeindeleben zur Kenntnis nehmen, ist aber die Ausnahme, nicht die Regel. Dies verwundert insofern ein wenig, als fast allen das Konzept ›Gemeindeleben‹ aus eigener Erfahrung bekannt ist. Mehrere Interviewte antworten auf die Frage, wann ihnen besonders deutlich bewusst werde, dass sie Muslime sind, dies sei in der Moschee der Fall. ›Peter‹ hat darüber hinaus ein Amt, »eine vertretende Rolle in der Moschee-Gemeinde«. Und sogar ›Sarah‹, die berichtet, nicht zur Moschee zu gehen, versteht den MoscheeBesuch als das, »was von einem Moslem erwartet wird«. Anscheinend ist die Moschee in der Diaspora ein wichtiger Rückzugsraum, wo die eigene religiöse Praxis bestärkt und Geborgenheit erlebt wird. Hajar berichtet in diesem Sinne: »Wirklich ohne die Moschee-Gemeinde könnte ich gar nichts. Weil halt auch immer wenn ich dahin gehe ist es so, so ’n äh, man lernt einfach was. Du gehst da hin, … du bist immer du, du erfährst neue Sachen. Das ist immer das Schöne. So was mir gefällt auch, du lernst Leute kennen, … du hörst was Hübsches …«
Im Unterschied zu einem Stereotyp, das in den deutschen Medien immer wieder begegnet, ist Moschee hier nicht die ›Koranschule in der Hinterhof-Moschee‹ und damit der Ort der Heteronomie,
wo Heranwachsende indoktrinierend in die Religion ihrer Vorfahren eingeführt werden, ohne dass es einen Bezug zu ihrem Leben außerhalb der Moschee gebe. Hajar erlebt die Moschee-Gemeinde im Gegenteil als positiv konnotierten Ort des Lernens und der Gemeinschaft sowie als Ort, an dem sie sich selbst als authentisch erleben kann (»du bist immer du«). Das scheint zu implizieren, dass ihr dies außerhalb der Moschee nicht (oder weniger gut) gelingt. Die Leitkategorien sind dabei nicht normativ (es geht nicht um richtig oder falsch, gut oder böse), sondern vielmehr ästhetisch (schön, hübsch). 4. Jugendtheologische Konsequenzen
Welche Konsequenzen könnten sich aus dieser Darstellung von Interviews mit muslimischen Jugendlichen für jugendtheologische Gespräche ergeben? Abschließend sollen im Fragemodus einige theologisch relevante Themen benannt werden, die im Horizont der Interviewten sind oder die durch die Verwendung von Interview-Ausschnitten ins Gespräch mit auch nicht-muslimischen Jugendlichen gebracht werden könnten: 1. Dürfen Muslime in eine Kirche gehen – dürfen Christen in eine Moschee gehen? Was darf man in einem Gebäude 13 Bemerkenswert ist, dass die aktiven Christen hier ausgerechnet als Katholiken identifiziert werden. In Berlin beträgt der Anteil von Katholiken an der Gesamtbevölkerung weniger als 10%, der Anteil der Mitglieder der evangelischen Landeskirche ist fast doppelt so hoch; vgl. Statistisches Jahrbuch Berlin 2013. Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Potsdam 2013, 35 und 162.
Willems Muslimische Jugendliche und ihre Erfahrungen mit ›Kirche‹
einer anderen Religionsgemeinschaft? Wo beginnen religiöse Loyalitätskonflikte? Was ist in diesem Zusammenhang Sünde? Sind gemeinsame Gebete von Angehörigen verschiedener Religionen möglich, und wenn ja, in welcher Form (interreligiös, multireligiös; gemeinsam, nacheinander, simultan)? Haben religiöse Gebäude eine bestimmte ›Heiligkeit‹, die man verletzen kann, oder eine religionsspezifische ›Aura‹? Und falls ja: Haben sie das nur für die Angehörigen einer Religion, oder auch für andere Gläubige? 2. Wer gehört zur Gemeinschaft der Gläubigen? Können Christen zur Umma gehören, Muslime zur Kirche? Welche Grenze, welche Unterscheidung ist wichtiger: diejenige zwischen unterschiedlichen Religionen, diejenige zwischen Gläubigen und zwischen Nicht-Gläubigen – oder sind andere Unterscheidungen und Grenzziehungen in bestimmten Situationen angemessener? Brauchen wir
159
überhaupt Grenzziehungen zwischen Gruppen von Menschen? Wozu? Wann können Grenzziehungen schädlich oder gar gefährlich sein? 3. Wie schätzen wir die religiöse Praxis von anderen Menschen ein? Soll man eher die Gemeinsamkeiten betonen – gar versuchen, Angehörige einer anderen Religion in ihrer eigenen Religion zu bestärken und zu einer entsprechenden religiösen Praxis zu motivieren? Oder darf, soll man Angehörige einer anderen Religion zu seiner eigenen Religion zu bekehren versuchen? Warum bzw. warum nicht? Ist religiöse Praxis eine Gefahr für das multireligiöse Zusammenleben (zumindest innerhalb einer Familie)? Wo könnte es in einer multireligiösen Familie zu Spannungen kommen, und wie könnte man damit (in möglichst konkret zu beschreibenden Fällen) umgehen? Was kann man von der religiösen Praxis in anderen Religionen lernen?
160
Religionspädagogische Anregungen
Sabrina Müller Bedingungen eines gelingenden theologischen Diskurses mit jungen Freiwilligen
1. Rahmenbedingungen des Konfirmandenunterrichtes und methodologisches Vorgehen
Ernüchternd stellte Christian Möller 2004 in seiner »Einführung in die Praktische Theologie« fest, dass so, wie Kirche heute erlebt werde, kaum Hoffnung bestehe, dass sich junge Menschen in ihr integrieren können.1 Weiter plädiert er dafür, dass »Übungsfelder religiöser Erfahrung im Raum der Kirche« mit jungen Menschen erfunden werden müssen.2 Ob neue religiöse Erfahrungsräume erfunden werden müssen, ist fraglich. Dass diese Erinnerungs- und Erfahrungsräume der religiösen Selbst- und Fremdbegegnung als Teil lebendiger Tradition für Jugendliche jedoch wieder eröffnet und zugänglich gemacht werden müssen, steht außer Frage. Während meiner 17-jährigen Tätigkeit in der Jugend- und Konfirmandenarbeit war es meist spürbar, wo der theologische Dialog geglückt und wo er missglückt war. Um die dialogfördernden Bedingungen innerhalb der Erfahrungs- und Wahrnehmungswelt der Jugendlichen zu analysieren, wurde hierfür eine kleine qualitative Studie durchgeführt.3 Eine ethnographische Annäherung an die Thematik wurde anhand halbstandardisierter WhatsAppInterviews durchgeführt, da diese Form der Kommunikation den Jugendlichen entspricht. Der Einsatz eines Leitfadens4
kam zur Anwendung, trotzdem wurde ein natürlicher WhatsApp-Gesprächsverlauf angestrebt5, zudem gewährt diese Kommunikationsform den interviewten Personen eine gewisse Anonymität. Die Interviews dauerten im Schnitt 30–40 Minuten. Insgesamt wurden fünf Jugendliche im Alter zwischen 16 und 18, die freiwillig im Konfirmandenunterricht engagiert sind, befragt. Ein sechster Jugendlicher, der auch im Bereich des kirchlichen Unterrichtes, jedoch bei den 12-, 13- und 14-Jährigen freiwillig tätig ist, wurde zur 1 Vgl. Christian Möller, Einführung in die Praktische Theologie, Tübingen 2004, 230. 2 Ebd., 230. 3 Qualitative Forschung orientiert sich am interpretativen Paradigma, bei dem sich soziale Wirklichkeit prozesshaft konstituiert und wiederum als Interpretationsprozess angesehen werden muss, vgl. Peter Atteslander, Methoden der Empirischen Sozialforschung, Berlin 2010, 77. 4 Der Leitfaden stellte sicher, dass trotz der begrenzten Zeit alle wichtigen Themen angesprochen wurden. Er wurde mit dem von Helfferich beschriebenen Prinzip SPSS, welches in einem Vier-Schritte-Modell von Sammeln, Prüfen, Sortieren, Subsumieren (SPSS) immer auch zur Reflexion über das eigene Vorwissen und die Beweggründe der Fragen anleitet, erarbeitet. Vgl. Cornelia Helfferich, Die Qualität Qualitativer Daten: Manual für die Durchführung qualitativer Interviews, Wiesbaden 42011, 162ff. 5 Christel Hopf, Qualitative Interviews – ein Überblick, in: Uwe Flick / Ernst von Kardorff / Ines Steinke (Hg.), Qualitative Forschung: Ein Handbuch, Hamburg 92005, 351.
Müller Bedingungen eines gelingenden theologischen Diskurses mit jungen Freiwilligen
Überprüfung der zuvor vorgenommenen Codierungen in einem weiteren Interview hinzugezogen. Die jungen Freiwilligen wählten selber, ob sie lieber Mundart (schweizerdeutsch) oder Schriftsprache schreiben. Alle interviewten Personen arbeiten in einem ähnlichen Team- und Unterrichtssetting, in vier evangelischreformierten Kirchgemeinden der deutschsprachigen Schweiz, mit.6 Allen Unterrichts-Settings ist gemeinsam, dass sie die Jugendlichen als theologisches Gegenüber ernst nehmen und in die Unterrichtsplanung und -gestaltung miteinbeziehen.7 Die Freiwilligen engagieren sich seit mindestens sieben und maximal 30 Monaten in den Teams. Drei der befragten Jugendlichen sind weiblich, drei männlich. Die Interviewpartnerinnen und -partner gelten als Fachpersonen über die zu erforschenden sozialen und theologischen Sachverhalte und als Quelle von Spezialwissen.8 Die Interviews wurden in Anlehnung an die Grounded Theory9 und auf dem Hintergrund der Forschungsfrage einem mehrstufigen computergestützten Codierungsprozess unterzogen. Als deduktive Codes wurde die dreifache Entfaltung von Theologie der, mit und für Jugendliche(n) von Schlag / Schweitzer verwendet.10 Die restlichen 52 Codes wurden induktiv gesetzt. Im ersten Schritt wurden die ersten zwei Interviews offen codiert, danach wurden diese Codes auf die weiteren Interviews angewendet, wobei sich gleichzeitig das Kategorienschema sukzessive weiterentwickelte und angepasst wurde, die schon codierten Interviews wurden wiederum mit den neuen Codes überarbeitet.11 Ein weiteres Interview folgte auf den Codierungs- und Kategorienbildungsprozess,
161
das zur Überprüfung des Schemas fungierte. 2. Dialogische Grundhaltung
Bei der Analyse der sechs Interviews ist eine häufige Verwendung von Verben augenfällig. Die Jugendlichen begreifen ihre ehrenamtliche Tätigkeit als engagiertes, fragendes, aktives und partizipatives Beziehungsgeschehen, wie in der Word-Cloud ersichtlich ist. Die WordCloud wurde anhand der in den Interviews am häufigsten verwendeten Wörter, mit Ausschluss der Partikel, erstellt.12 Auffällig dabei ist der Wort-Komplex aus: eigene Meinung, fragen, fühlen, glauben, 6 Die Jugendlichen stammen aus den Kantonen Basel Stadt, St. Gallen und Zürich. 7 In allen Kirchgemeinden wird ein Konfirmandenunterrichtskonzept verwendet, welches vor einigen Jahren entwickelt wurde und seither in unterschiedlichen Kirchgemeinden in Deutschland und der Schweiz Anwendung findet. Viele ähnliche Konzepte sind jedoch ebenfalls in Umlauf. Allen gemeinsam ist, dass ehemalige Konfirmandinnen und Konfirmanden als Jugendleitende im Konfirmandenunterricht integriert werden. Das Ziel des Unterrichtes ist eine beziehungs- und erfahrungsorientierte, vernetzte und nachhaltige Gestaltung. 8 Vgl. Jochen Gläser / Grit Laudel, Experteninterviews und Qualitative Inhaltsanalyse als Instrument rekonstruierender Untersuchungen, Wiesbaden 42010, 12. 9 Barney G. Glaser / Anselm L. Strauss, Grounded Theory: Strategien qualitativer Forschung, Bern 32010. 10 Vgl. Thomas Schlag / Friedrich Schweitzer, Brauchen Jugendliche Theologie? Jugendtheologie als Herausforderung und didaktische Perspektive, Neukirchen-Vluyn 2011. 11 Vgl. Glaser / Strauss (wie Anm. 9), 79. 12 Zur Erstellung der Word-Cloud, wie auch zur ganzen Analyse wurde die Computersoftware maxqda verwendet, www.maxqda.de.
162
Religionspädagogische Anregungen
Gott, Kirche, können, Menschen, Religion, Team, Thema und verändern.
Bei der Analyse entstanden 55 Codes, welche sich durch die eben genannten Zusammenhänge und im Laufe des Analyseprozesses zu einer Kategorie zusammenfassen ließen. Die Hauptbedingung für einen gelingenden theologischen Diskurs mit jungen Freiwilligen ist demnach eine dialogische Grundhaltung. Dadurch wird ein Teamsetting ermöglicht, das den Jugendlichen sowohl emotionale und körperliche13, kognitive14, spirituelle15 und ekklesiale Erfahrung zugänglich macht und zudem als Lern-, Beziehungsund Selbstentdeckungsort beschrieben wird. So beschreiben die jungen Freiwilligen ihr Engagement als ständigen Ich-Du-Begegnungsprozess. Anhand der Analyse sind so folgende drei Begegnungsformen, basierend auf der dialogischen Grundhaltung, auszumachen16: Selbstbegegnung
Dialogische Grundhaltung Beziehungsnetzwerk und ekklesiale Gemeinschaft
Individuelle Spititualität und personales Gottesbild
2.1 Selbstbegegnung
Die jungen Freiwilligen befinden sich zunächst in einer ungewohnten Rolle. Sie sind plötzlich Teammitglieder, für die inhaltliche Gestaltung des Konfirmandenunterrichts mitverantwortlich und sie nehmen Leitungs- und Lehrverantwortung für nur wenig jüngere Menschen wahr. Wie sich bei der Analyse, nicht zuletzt anhand der Häufigkeit der gesetzten Codes, gezeigt hat, eröffnet dieser Rollenwechsel den jungen Freiwilligen einen neuen Erfahrungsraum intensiver Selbstbegegnung. So sind sie durch das Teamsetting in der Lage, ihren eigenen Sinn-, Glaubens- und Religionsfragen nachzugehen. Wie sich gezeigt hat, sind diese vielfältiger Natur: »Ob es Gott gibt, ob Gott wirklich etwas ändern kann? Welche Glaubensformen es alles 13 Interview A, 50: »Mein Herz geht auf und ich bekomme hühnerhaut. Es ist eine unwahrscheinliche wärme in meinem Körper.« 14 Interview E, 51–52: »Ich versuche ihnen vor allem weiterzugeben, dass sie sich nicht schämen müssen und es nichts verwerfliches ist zu glauben. Außerdem ist es mir wichtig ihnen mitzuteilen, dass Gott und der Glaube nicht nur das ist, was in der Bibel steht, sondern was wir daraus machen. Jeder muss seinen eigenen Weg finden sich mit Gott zu verstehen und zu vertrauen.« 15 Interview B, 27: »Ich denke es ist immer spannend mit Leuten zu reden, die Gott schon einmal hautnah erlebt haben (wie z.B. XY) und im Konfunti hat man die Chance solche kennen zu lernen und deren Geschichten zu hören.« 16 Was sich hier in den sechs Interviews zeigt, weist große Parallelen zu Kunstmanns Definition einer guten Didaktik auf. Sie versucht den »Erfahrungsbezug zu beachten und vor allem einen Entdeckungsweg zu eröffnen, weil so Neugier stimuliert und das Lernen als bedeutsam erfahren wird.«, Joachim Kunstmann, Religionspädagogik, Tübingen 2004, 223.
Müller Bedingungen eines gelingenden theologischen Diskurses mit jungen Freiwilligen
163
gibt, wie sich diese auf die heutige Zeit auswirken (z.B. Kriege)?« Des weiteren: »Wieso sieht Gott auch in Mördern, Kinderschändern etc. das Gute? Wieso vergibt er auch diesen Menschen wenn sie ihn darum bitten? Woher weiss ich überhaupt dass es Gott wirklich gibt? Kann ich Gott anzweifeln? Wieso lässt Gott es zu dass junge Menschen schon so früh sterben müssen? Kann Gott seine Meinung ändern? … mir würde wahrscheinlich noch mehr einfallen wenn ich länger darüber nachdenken würde.« Zudem: »Wie man den Kontakt zu Gott verstärken kann und ihn erleben kann? Eines was ich mich häufig frage ist, warum Menschen sehr früh aus dem leben genommen werden.«17
den mithilfe meiner Aussagen und den Aussagen der Anderen evt. ihr eigenes Bild vom Glauben machen können.« Zudem: »Ich bin jedoch ein Mensch der sehr gerne und sehr viel für mich selber in Frage stellt. Ich denke sehr gerne über diese Fragen in ruhigen Minuten im Bus, bei der Arbeit, im Bett etc. nach. Ich mag es aber auch andere Meinungen zu hören und so meine Meinung zu stärken oder anzupassen […] Das ist das, was ich vor allem am Konfunterricht sehr schätze. Meine Meinung, und die aller anderen, werden respektiert und zur Kenntnis genommen. Man kann sich frei fühlen anderen mitzuteilen. Das macht für mich einen wichtigen Teil des Glaubens aus.«24
Das stabile Umfeld des Teams und des Unterrichtes bietet einen Ort der Geborgenheit und Sicherheit, in dem Lernerfahrungen18 gemacht werden können und persönliche Entwicklung möglich ist. In der Analyse zeigt sich Sicherheit als entscheidendes Themenfeld, dies vor allem in Bezug auf die Auseinandersetzung mit sich selbst. Sicherheit fungiert so auch als Katalysator für das eigene Interesse19, die Beziehungen untereinander20, Motivation, Freude21, den Einsatz der persönlichen Stärken22, die religiöse Sprachfähigkeit23 und die Bereitschaft für einen theologischen Diskurs:
2.2 Personales Gottesbild und individuelle Spiritualität
I: »Wie würdest du deinen Glauben beschreiben? Und an was glaubst du?« A: Als sehr offen! Ich liebe Gott und widme mein Leben Gott. Ich glaube an die Bibel, nicht wirklich an jede Geschichte, aber an den Inhalt der Geschichten […] In der heutigen Welt brauchen wir Gott um zu leben. Gott bedeutet Glück und das sollte jeder und jede erfahren.« Oder: »Nein, wichtig ist es mit verschiedenen Ansichten / Personen in Kontakt zu treten, um sich sein eigenes Bild vom Glauben / Gott zu bauen […] Ich denke, dass sich die Konfirman-
Der erste Kontakt der jungen Freiwilligen zur evangelisch-reformierten Kirche kam vorwiegend durch den kirchlichen Religi17 Interview A, 23, 26–27; Interview B, 20; Interview E, 28–33; Interview F, 26.32. 18 Z.B. Interview A, 61–62, I: »Was hast du durch dein ehrenamtliches Engagement gelernt?« A: »Ich kann besser mit Menschen umgehen, habe ein besseres Gefühl für Personen entwickelt. Ich weiss wie man eine Gruppe führt und richtig diskutiert. Natürlich noch vieles, vieles mehr!« 19 Z.B. Interview F, 37: » Ich habe mehr Interesse bekommen an jungen Leuten und an der Gemeinschaft mit Gott und diesen Personen.« 20 Vgl. 2.3. 21 Interview D, 22: »Es macht Spass und ich erfahre auch viel, meine Motivation ist den Kindern was beizubringen.« 22 Interview B, 39: »Ich höre gerne zu und rede auch gerne mit den Konfirmanden. Deshalb denke ich, kann ich mich am besten in die Gesprächsteile einbringen.« 23 Interview F, 24: » Ich spreche immer lieber mit anderen Personen über Gott und Religionen. Früher habe ich mich bei diesem Thema immer zurück gezogen.« 24 Interview A, 70.64; Interview B, 37.49; Interview E, 35–36.38.
164
Religionspädagogische Anregungen
onsunterricht zu Stande. Nur eine Person besuchte 4–6 Mal pro Jahr mit der Mutter die Ortsgemeinde. Fünf der interviewten Personen geben an, dass sie vor dem Konfirmandenunterricht wenige Berührungspunkte mit der Kirche hatten. Durch den kirchlichen Unterricht in der Adoleszenz konnten religiöse und spirituelle Inhalte und Fragen überhaupt erstmals thematisiert werden. Bedeutungsvoll scheinen für einen Erstkontakt auch die Beziehung zu gleichaltrigen Personen und älteren Geschwistern zu sein.25 Alle sechs Jugendlichen sprechen von einem erhöhten spirituellen Interesse seit sie den kirchlichen Unterricht mitgestalten. Fünf der befragten Personen geben an, dass sie sich fast täglich mit religiösen Themen oder Praktiken befassen. So antwortet jemand auf die Frage, ob er sich häufig mit Fragen nach Gott und Religion auseinandersetze, folgendermaßen: »Ja, praktisch jeden Tag […] ich bin viel interessierter geworden, lerne mehr über den Glauben.«26 Und eine andere Person bemerkt: »Ich spreche immer lieber mit anderen Personen über Gott und Religionen, früher habe ich mich bei diesem Thema immer zurück gezogen.«27
Bei der Beschreibung der persönlichen Spiritualität zeigt sich bei den jugendlichen Freiwilligen eine enge Verknüpfung von Emotionen und Wissen: »Ich finde es nur schwierig, wenn ich das Gefühl habe, dass mich jemand nicht ernst nimmt bzw. meinen Glauben und meine Meinung nicht respektiert. Es hilft, sich viel damit zu befassen und so das Vertrauen zu erlangen. Hat man Vertrauen in Gott und den Glauben hilft er einem auch, die richtigen Worte zu finden […] Gott ist für mich ein Gefühl, eine Sicherheit.«28
Wie in der vorherigen Aussage ersichtlich, ist das spirituelle Erleben stark von einem personalen Gottesbild geprägt. Gott wird als Gegenüber begriffen, welches erfahrbar und im Alltag präsent sein sollte. Gleichzeitig bewegt die interviewten Personen die Frage, wie denn Präsenz Gottes im Alltag erkannt und erlebt werden kann. Die Sehnsucht nach dem Transzendenten ist nicht nur Teil des Individuellen, sondern auch des Team-Kollektivs. Ihren persönlichen Glauben beschreiben vier der Freiwilligen mit dem Wort stark und auch die Adjektive offen und heilsam werden verwendet. Dies möchten die jungen Ehrenamtlichen auch den Konfirmandinnen und Konfirmanden weitergeben: »Den Bezug auf das Leben zu nehmen und den Konfis zu zeigen dass Gott im Alltag eine grosse Rolle spielen kann.«29
Bei der Analyse stellt sich zudem heraus, dass sich durch die intensive Lernerfahrung im Konf-Team und im Konfirmandenunterricht für die jungen Leitungspersonen ein Zugang zu religiösen Praktiken wie Gebet, Gottesdienst und Lektüre von Bibeltexten eröffnet.30 2.3 Beziehungsnetzwerk und ekklesiale Gemeinschaft
Das Miteinander im Team, die einzelnen Beziehungen, Freundschaften und das gegenseitige Vertrauen sind entscheiden25 26 27 28 29 30
Interview C, 12. Interview A, 16. 21. Interview F, 24. Interview E, 55–56, 59–60. Interview B, 67. Z.B. Interview C, 25.
Müller Bedingungen eines gelingenden theologischen Diskurses mit jungen Freiwilligen
de Voraussetzungen, damit sich die jungen Freiwilligen auf einen theologischen Diskurs einlassen können. So zeigt sich, dass das Team für die Jugendlichen ein Ort des Vertrauens ist, in dem ein Dialog über Gottes-, Sinn- und Glaubensfragen ermöglicht wird. Dabei stellte sich der induktive Code der Offenheit als wesentlich heraus. Offenheit fungiert als Grundlage des gegenseitigen Verständnisses. Für alle Jugendlichen ist so auch die gegenseitige Bereitschaft zum Zuhören und sich mitteilen können wichtig: »[…] wichtig ist es mit verschiedenen Ansichten / Personen in Kontakt zu treten, um sich sein eigenes Bild vom Glauben / Gott zu bauen.«31 Ein anderer Jugendlicher wiederum bekräftigt, wie das Gefühl, ernst genommen zu werden, wiederum zur eigenen Offenheit beiträgt: »Ernst genommen dan gibts au andere Meinung die ich au akzeptiere.«32
Den Jugendlichen ist es wichtig, sich mit unterschiedlichen Ansichten auseinandersetzen zu können, dann jedoch ihren eigenen religiösen Weg zu finden. So fördert ein Klima der Offenheit und die Möglichkeit zur Meinungsfreiheit wiederum das Interesse an religiösen Themen und die Offenheit gegenüber dem Du. Darin kommt auch den Jugendarbeitenden und Pfarrpersonen eine zentrale Rolle zu. Sie sind sowohl Respektpersonen, als auch sichere Beziehungsorte.33 Zudem eröffnen sie neben der Informationsvermittlung einen Weg, der individuelle Nachfolge ermöglicht: »I: Wie erlebst du die Pfarrperson oder die Hauptleitung? F: Natürlich als eh Respektsperson und als guete Fründ wo da isch bi Frage.«34 Oder: »Als Stereotyp habe ich Pfarrer als stur, langweilig, eingeschränkt und monoton
165
im Kopf. Dies vor allem weil die Pfarrer die ich kannte alles ältere Menschen waren, die sehr strikt mit dem Glauben waren und keinen Freiraum für eigene Interpretationen und Meinungen liessen. Erlebt habe ich Pfarrer und Hauptleiter, in meiner Gemeinde, genau im Gegenteil. Ich finde es gut, dass sie nicht versuchen uns den Glauben aufzuzwängen und uns die Freiheit lassen ein eigenes Bild von Gott und dem Glauben zu bilden.«35
Es stellt sich heraus, dass durch das Klima im Team und die Beziehungen untereinander das Interesse an Spiritualität und an anderen Personen gefördert wird.36 Gerade im Themenkreis christlicher Nachfolge zeigt sich bei den Jugendlichen nicht nur spirituelle Individualität, sondern es werden auch religiöse kollektive Praktiken erkennbar. Dabei verweisen die interviewten Personen beispielsweise eigenständig auf ihre Gebetspraxis. Diese war nicht schon gegeben, sondern entwickelte sich im Laufe der Mitarbeit weiter oder entstand erstmals: »I: Wie würdest du deinen Glauben beschreiben? D: Mein Glaube ist stark, aber ich bete nicht immer, aber öfters. I: Hat dir XY darin geholfen? […] D: Ja er hat immer am Anfang gebetet, dann musste ich und ich wusste nicht wie, er hat mir dann geholfen. I: Seit welchem Alter betest du? D: 17«37 31 Interview B, 37. 32 Interview D, 54. 33 Der Pfarrperson oder den Jugendarbeitenden kommt ähnlich wie den Eltern im Kindesalter orientierende, stabilisierende und erfahrungsermöglichende Funktion zu, vgl. Remo Largo, Kinderjahre, München 142007, 156ff. 34 Interview F, 44. 35 Interview E, 45–46. 36 Interview F, 37: »Ich habe mehr Interesse bekommen an jungen Leuten und an der Gemeinschaft mit Gott und diesen Personen.« 37 Interview D, 84–90.
166
Religionspädagogische Anregungen
Die Jugendlichen bekommen voneinander und den Pfarrpersonen positive Rückmeldungen auf ihre Ideen und Vorschläge. Sie erleben, dass sie wertgeschätzt werden und ihre Verknüpfungen von Glaube, Alltag und den Themen des Konfirmandenunterrichts wichtig sind. So ist es für die jungen Leitungspersonen entscheidend, dass sie auch in theologischen Belangen und der inhaltlichen Gestaltung des Unterrichts ernst genommen werden. Im Sinne der Jugendtheologie zeigt sich hier eine explizite Theologie der Jugendlichen38: »Die Meinung jedes Teammitgliedes ist sehr wichtig und gefragt. So funktioniert die Zusammenarbeit am besten und wir können unser Programm immer optimieren.«39
Gleichzeitig weisen die interviewten Personen ein ausgeprägtes Bewusstsein auf, dass sie zu einer Theologie für Jugendliche40, in diesem Fall für die Konfirmanden und Konfirmandinnen, viel beizutragen haben.41 Sie erachten dabei die Verknüpfung von persönlicher Spiritualität, christlicher Praxis und Alltag als essenziell.42 So zeichnet sich christlicher Glaube für die jungen Ehrenamtlichen als individuelle Ausübung und Ausprägung im Alltag aus.43 Dadurch eröffnet sich eine Spannung zwischen dem kollektiven Erleben von christlichem Glauben und praktizierter Theologie im Team sowie der persönlichen Spiritualität, die höchst individualistische Züge aufweist. Das Teamsetting ist für die jungen Leitungspersonen jedoch ein Ort der Freundschaft und Geborgenheit, in dem auch über persönliche Probleme, Sorgen und Nöte gesprochen werden kann. So ist der Umgang und die Basis der Zusam-
menarbeit Freundschaft, Sicherheit und Interesse aneinander.44 In der Analyse stellte sich des Weiteren heraus, dass die Jugendlichen über ein großes Auftragsbewusstsein verfügen, in welchem auch ein Teil der Eigenmotivation für die ehrenamtliche Tätigkeit gründet. Die jungen Leiterinnen und 38 Vgl. Thomas Schlag / Friedrich Schweitzer, Jugendtheologie. Grundlagen – Beispiele – kritische Diskussion, Neukirchen-Vluyn 2012, 9ff. 39 Interview E, 40. 40 Vgl. Schlag / Schweitzer (wie Anm. 38), 9ff. 41 Interview A, 34–35, I: »Wo im Rahmen des Teams hattest du das Gefühl du konntest dich am ehesten einbringen?« A: »Bei theologischen Teilen, bei denen ich von mir erzählen kann. Ich motiviere gerne die Jugendlichen und mein Team. Ich stehe gerne vor Leuten und erzähle.« Oder Interview F, 77–78, I: »F, was ist dir inhaltlich wichtig?« F: »Die Leute aufzumuntern und ihnen mehr von Gott erzählen zu können.« Interview B, 48–49, I: »Hast du das Gefühl, dass du etwas verändern kannst im Hinblick auf den Konf?« B: »Ich denke, dass sich die Konfirmanden mithilfe meiner Aussagen und der Aussagen der Anderen evt. ihr eigenes Bild vom Glauben machen können.« 42 Interview E, 67, I: »Was ist dir inhaltlich selber wichtig?« B: »Den Bezug auf das Leben zu nehmen und den Konfis zu zeigen dass Gott im Alltag eine grosse Rolle spielen kann.« 43 Interview E, 50–52, I: »Was versuchst du den Könfis an Theologie weiterzugeben?« E: »Ich versuche ihnen vor allem weiterzugeben, dass sie sich nicht schämen müssen und es nichts verwerfliches ist zu glauben. Ausserdem ist es mir wichtig ihnen mitzuteilen, dass Gott und der Glaube nicht nur das ist was in der Bibel steht, sondern was wir daraus machen. Jeder muss seinen eigenen Weg finden sich mit Gott zu verstehen und zu vertrauen.« 44 Interview C, 51: »Im Team höre alli zue, do kahn ich immr mini Problem los werde.« Oder Interview E, 22: »Ich sehe Probleme und Sorgen als nicht mehr so schlimm an, weil ich weiss, ich habe jemanden der mir damit hilft. Nicht nur Gott sondern auch die Leute in meiner Glaubensgemeinde. Ich denke im Moment auch viel über den Tod nach, weil meine Grossmutter letzten Samstag verstorben ist.«
Müller Bedingungen eines gelingenden theologischen Diskurses mit jungen Freiwilligen
Leiter möchten anhand von Beispielen aus ihrem Leben aufzeigen, wie sich eine christliche Glaubenshaltung im Alltag auswirkt und wie persönliche Spiritualität im Alltag integriert werden kann. So betonen fünf der sechs interviewten Personen, dass sie die Konfirmandinnen und Konfirmanden darin begleiten möchten, ihren eigenen Glauben zu entdecken und Gott als personales Gegenüber im Alltag erleben zu können. 3. Reflexion
Die drei soeben skizierten relationalen Dynamiken basieren auf einer dialogischen Grundhaltung.45 Dabei ist bei dieser Gesinnung nicht primär an eine Gesprächstechnik zu denken, sondern vielmehr an eine »[…] Einstellung zum Umgang mit sich selbst und den eigenen persönlichen Wahrheiten, zum Umgang mit anderen Menschen und deren persönlichen Wahrheiten.«46 So ist die dialogische Grundhaltung auch nicht an einem Gesprächsverlauf festzumachen, sondern vollzieht sich permanent innerhalb der Teamstruktur in den Beziehungen, in narrativ-biographischen Vollzügen, in religiösen Praktiken und semiotischen Handlungen und Deutungen. Sie »intendiert keine Vereinnahmung von Jugendlichen, sondern ein Wahrnehmen und Ernstnehmen ihrer Fähigkeiten, ihrer Ansprüche sowie ihrer reflexiven Orientierungsbedürfnisse und – das ist besonders wichtig – ihrer Kompetenzen.«47 Ebenfalls wird die gesprächsoffene gegenseitige Haltung im Team zum Gegenstand der Erfahrung von Freiwilligen. Der von den Jugendlichen beschriebene transzendente und immanente Erfah-
167
rungsraum konstituiert sich vorwiegend aus einem Ich-Du-Geschehen48, was Analogien zu Bubers dialogischem Prinzip aufweist.49 So erweist sich die dialogische Grundhaltung als Voraussetzung für den gelingenden theologischen Diskurs mit jungen Freiwilligen und wird zu dessen Leitparadigma. Im theologischen Diskurs mit den Freiwilligen zeigt sich so auch eine explizite und teilweise höchst differenzierte Theologie der Jugendlichen.50 In dieser nehmen persönlicher Glaube und Glaubensprozesse, Meinungsfreiheit und gegenseitiger Respekt eine wichtige Rolle ein. Der Lernprozess spielt sich neben den thematischen Teilen des Konfirmandenunterrichts stark im emotionalen Beziehungsgeschehen der Einzelnen51 ab. Die Theologie der Jugendlichen steht so in einem reflektierenden Bezugsystem untereinander und mit Expertenwissen. Diese Dynamik dialogischer Grundhaltung zielt auf die direkte »[…] Förderung religiöser Urteils- und Partizipationskompetenz«52 ab, welche daseinshermeneutische Funktion in der Lebenswelt der Jugend45 Vgl. Kap. 2. 46 Michael Benesch, Psychologie des Dialogs, Wien 2011, 11. 47 Schlag / Schweitzer (wie Anm. 38), 169. 48 »Alles wirkliche Leben ist Begegnung.«, Martin Buber, Das dialogische Prinzip, Gütersloh 2014, 15. 49 Vgl. ebd. 50 Vgl. Schlag / Schweitzer (wie Anm. 38), 9ff. 51 Interview F, 71–74: » I: »Was hast du durch dein ehrenamtliches Engagement gelernt?« F: »Mit jungen Leute umzgah und dankbar s zi was mer bechunt.« I: »Was ist das, was du bekommst?« F: »Vertrauen, Dankbarkeit und Mitgefühl.« 52 Bernhard Dressler, Zur Kritik der »Kinderund Jugendtheologe«, in: Zeitschrift für Theologie und Kirche 111 (2014), 333.
168
Religionspädagogische Anregungen
lichen übernimmt. Diese ist Grundlage der Befähigung von gebildeten Laien, allerdings nicht nur wie Dressler vorschlägt, zur Kommunikation mit Experten53, sondern zuerst für die existenzielle Klärung des eigenen religiösen Symbolhorizontes. Des Weiteren zielt die dialogische Grundhaltung im Setting des kirchlichen Unterrichts auf die religiöse Sprachfähig-Werdung der Jugendlichen ab.54 Erst dadurch kann ein gleichberechtigter Dialog untereinander, mit Expertinnen und Experten, Glaubenssystemen und anderen religiösen Traditionen entstehen.55 Das Erlangen religiöser Sprachfähigkeit entwickelt sich parallel innerhalb der drei beschriebenen Dynamiken. Dies zeigt sich sowohl in der »ekklesialen Gemeinschaft«56, wie auch in der »Selbstbegegnung«57 anhand positiver Rückmeldungen auf Ideen und Vorschläge und an der erfahrenen Wertschätzung auf die kontextuelle Verknüpfung von Glaube, Alltag und den Themen des Konfirmandenunterrichts. Es ist für die jungen Leitungspersonen entscheidend, dass sie auch in theologischen Belangen und der inhaltlicher Gestaltung des Unterrichts ernst genommen werden.58 So ist es zwingend notwendig, dass ein theologischer Diskurs mit jungen Freiwilligen »[…] erst im Kommunikationsprozess generiert [wird und] grundsätzlich ergebnisoffen bis hin zur Erschließung neuer Wirklichkeit [ist].«59 Die anhand der qualitativen Daten generierte Kategorie der »dialogischen Grundhaltung« weist große Ähnlichkeiten zu Grethleins Definition von Kommunikation auf und lässt sich in dessen Theoriehorizont, dass die Praktische Theologie über kommunikative Modi erkennbar werden soll, einordnen.60
Die partizipative Gesinnung des Dialoges ermöglicht es den Jugendlichen, sich ekklesial zu verorten und christlichreligiöse Praktiken zu erlernen.61 Bei der Beschreibung der persönlichen Spiritualität zeigt sich eine Verbindung zwischen erfahren, fragen, glauben und wissen. Im Erfahrungshorizont der jungen Freiwilligen findet dadurch eine enge Verknüpfung von Emotionen und Verstand statt. Persönliche Fragen und eigenes Interesse dienen als Katalysator. Religiöses und biblisches Wissen verhilft den Jugendlichen zu Glaubenssicherheit, spirituelle Erfahrungen62 zur Glaubensgewissheit. Glaubenssicherheit und Glaubensge53 Vgl. ebd., 335. 54 Vgl. ebd., 333. 55 Vgl. dazu auch Schlag / Schweitzer (wie Anm. 38), 170. 56 Vgl. Kap. 2.3. 57 Vgl. Kap. 2.1. 58 Wiederum zeigt sich hier eine explizite Theologie der Jugendlichen, vgl. Schlag / Schweitzer (wie Anm. 38), 9ff. 59 Christian Grethlein, Praktische Theologie, Berlin / Boston, 2012, 157. 60 Ebd., 8–11. 61 Hier zeigt sich im Gegensatz zum von Davie geprägten Begriff des believing without belonging (Grace Davie, Religion in Britain Since 1945: Believing Without Belonging, Oxford 1994) eine klare Sehnsucht nach Zugehörigkeit und in dem Sinne auch eine Verortungstendenz. Dies wiederum würde der religiössäkularen Konkurrenztheorie entsprechen, in welcher die Individuen als Subjekte gewürdigt werden und sich durch persönliche Entscheidung positionieren, vgl. Jörg Stolz et. al., Religion und Spiritualität in der Ich-Gesellschaft, Zürich 2014. 62 Religiöse Emotionen und Erfahrungen sind integraler Bestandteil in der Beschreibung der persönlichen Spiritualität aller interviewten Personen. Erst dadurch zeigt sich die Bildung eines Gefühls von Glaubensgewissheit. Dieses Phänomen zeigt sich weltweit, vgl. Ole Riis / Linda Woodhead, A Sociology of Religious Emotion, Oxford 2012, 1.
Müller Bedingungen eines gelingenden theologischen Diskurses mit jungen Freiwilligen
wissheit bilden gleichzeitig aber auch die Spannung zwischen der ekklesialen Verortung und ihrer Tradition und der individualistisch geprägten Beschreibung der eigenen Spiritualität und des »personalen Gottesbildes«63 ab. So wird gerade in der persönlichen Spiritualität der Jugendlichen der gesellschaftliche Trend von Konsum-Orientierung, Wahlfreiheit und individueller Wahrheit offensichtlich.64 Augenfällig dabei ist der starke Alltagsbezug, den die persönliche Spiritualität der Jugendlichen aufweist. So interessiert sich der angehende Zimmermann in Interview D dafür, wie Gott die Welt gebaut habe. Den Gärtnerlehrling in Interview F bewegt im Gegensatz dazu die Sinn-Frage, warum es Mücken gibt. Daraus könnte die These, dass bei tieferem Bildungsstand die Verknüpfung von Lebensrealität und religiösen Inhalten verstärkt gewährleistet werden muss, aufgestellt werden. Anhand der geringen Datenmenge lässt sich dies jedoch weder verifizieren noch falsifizieren. Grundsätzlich kann aber gerade der Alltagsbezug als Ressource von jugendlichen Freiwilligen im Konfirmandenunterricht betrachtet werden.65 Unabhängig vom Bildungsstand bildet sich »Sicherheit« als weiterer funktionaler Teil einer dialogischen Grundhaltung heraus.66 Gerade in der Unstetigkeit und Ungewissheit der Adoleszenz sehnen sich die jungen Freiwilligen nach Sicherheit. In jeder der drei beschriebenen Dynamiken67 lässt sich so auch die Entwicklung von persönlicher Sicherheit beobachten. So wird Gott beispielsweise in aller Unverfügbarkeit dennoch zum personalen und zu jeder Zeit verfügbaren Gegenüber. Zusätzlich dazu wird durch die Verortung, die Gemeinschaft und die Ausbildung von persönlichen Kom-
169
petenzen und religiöser Sprachfähigkeit die Selbstsicherheit gestärkt. In diesem Horizont kann sowohl Sicherheit, als auch »urteilsfähige Partizipation an der Religionskultur«68 als großer Gewinn des freiwilligen Engagements betrachtet werden. Ein klarer Bezugsrahmen für die theologische Reflexion ist dabei grundlegend. Erst wenn ein biblischer und christlicher Bezugsrahmen des Unterrichtssettings geschaffen wird, kann sich die junge Person dazu verhalten und religiös sprachfähig werden. Gerade darin zeigt sich jedoch auch eine Schwäche dialogisch-partizipativer Ansätze. Denn in den Interviews sind sowohl biblische Referenzen, als auch christliche Traditionsbezüge eher marginal. So kann gefragt werden, worauf die persönliche Spiritualität und die kollektiven Glaubenserfahrungen denn gründen? Gerade hierbei sind Pfarrpersonen und Jugendarbeitende an ihre theologische Anleitungs- und Reflexionsfunktion zu erinnern, nicht um religiöse Emotionen und spirituelle Erfahrungen zu verhindern, sondern um diese einzuordnen.69 Dennoch ist in einer dialogischen Teamstruktur ein Entwicklungsprozess feststellbar, bei dem die jungen Freiwilligen immer weniger Objekte der kirch63 Vgl. Kap. 2.2. 64 Vgl. Stolz (wie Anm. 61). 65 Der Alltagsbezug gilt als generelle Ressource von Freiwilligen für Expertinnen und Experten, vgl. Grethlein (wie Anm. 59), 461. 66 Vgl. Kap. 2.1. 67 Vgl. Kap. 2.1, 2.2, 2.3. 68 Vgl. Dressler (wie Anm. 52), 355. 69 Grethlein (wie Anm. 59), 169: »Evangelium ereignet sich in kommunikativen Vollzügen verbaler und nonverbaler Art. Deren Inhalt erschließt sich durch den Rückbezug auf Jesu Wirken und Geschick.«
170
Religionspädagogische Anregungen
lichen Lehre, sondern Subjekte der Kommunikation des Evangeliums werden.70 Im Horizont der neutestamentlichen Exegese zeigt sich die Subjektwerdung gerade in ihrer verkündigenden Funktion: »›Die »Zwölf‹ werden hier also zu einer öffentlichen Verkündigung dessen aufgefordert, was sie von Jesus heimlich oder privatim gehört haben. Es herrscht ein Gegensatz zwischen heimlicher Erfahrung und öffentlicher Verkündigung des Erfahrenen. Das Subjekt des heimlichen Redens ist Jesus, das Subjekt der öffentlichen Verkündigung sind die Jünger (Zwölf).«71 So muss im Umgang mit jungen Freiwilligen nicht nur der dialogische Prozess, sondern immer auch dessen Ziel, verkündigendes Subjekt zu sein und zu werden, im Auge behalten werden. 4. Impulse für den jugendtheologischen Praxisbezug mit jungen Freiwilligen
Ausgehend von der Fragestellung nach den Bedingungen eines gelingenden theologischen Diskurses mit jungen Freiwilligen können einige Implikationen für die Praxis gemacht werden. Eine dialogische Grundhaltung und die Bereitschaft zur Teamarbeit, welche Eigenverantwortung, Partizipation und Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet, sind Voraussetzung für einen gelingenden theologischen Diskurs. Darin ist die Pfarrperson oder die Jugendarbeitende vor allem in theologieund unterrichtsermöglichender Funktion entscheidend. Sie ist primus/a inter pares. Ziel ist die Schaffung eines sicheren Umfeldes, in dem sich die Jugendlichen von Objekten hin zu Subjekten der Verkündigung entwickeln können. Dafür sind
sowohl persönliche spirituelle Erfahrungen, eine kollektive religiöse Praxis, als auch die Einbindung in eine ekklesiale Gemeinschaft wichtig. Eine zugängliche und erfahrbare Theologie ermöglicht den jungen Freiwilligen einen Bezug zu ihrer Lebenswelt herzustellen, was wiederum Auswirkungen auf die Gestaltung des Konfirmandenunterrichtes hat. Die Pfarrperson fungiert als Brücke zwischen biblischer Überlieferung, christlicher Tradition und dem Bezugsrahmen der Jugendleitenden. Die jungen Freiwilligen wiederum können die Übersetzungsleistung ihrer theologischen Reflexion und religiösen Erfahrung in den Konfirmandenunterricht einbringen. Nachfolge ereignet sich so prozessual in der Verkündigungsfunktion der jungen Freiwilligen. Die Voten der jungen Freiwilligen stimmen zuversichtlich und stellen die eingangs erwähnten Hypothese, dass kaum Hoffnung bestehe, dass sich junge Menschen in der Kirche, wie sie heute erlebt werde, integrieren können, in Frage.72 Gleichzeitig bekräftigt die Analyse jedoch auch die These, dass religiöse Erfahrungsräume für junge Menschen zugänglich gemacht werden müssen. Jedoch weniger als Theologie für Jugendliche im Sinne einer bloßen Angebotsorientierung, sondern als Theologie mit und von Jugendlichen, im Sinne der Partizipation und des gleichberechtigten Dialoges. 70 Vgl. ebd., 451–461; Schlag / Schweitzer (wie Anm. 38), 173: Gerade die Subjektorientierung zeigt sich als großes Anliegen der Jugendtheologie. Mit dieser eher kleinen qualitativen Auswertung induktiv generierter Daten lassen sich diese Denkansätze empirisch stützen. 71 Wolfgang Stegemann, Zwischen Synagoge und Obrigkeit, Göttingen 1991, 47. 72 Vgl. Kap. 1.
Höring Jugendkirchen – Antwort auf die Entfremdung von Gemeinde und Jugend?
171
Patrik C. Höring Jugendkirchen – Antwort auf die Entfremdung von Gemeinde und Jugend? Eine Stichprobe und jugendtheologische Folgerungen Das Verhältnis von Kirche/Gemeinde und Jugend gilt traditionell, d.h. zumindest seit den 1960er Jahren und der Entstehung einer Pop- und Jugendkultur, wenn nicht gar seit den Anfängen der Jugendbewegung zu Beginn des 20. Jahrhunderts, als belastet. An den Wendepunkten des Lebens kommen junge Menschen mit der christlichen Gemeinde in Kontakt, eine Beheimatung jedoch ereignet sich nur (noch) bei den wenigsten. Zu groß erscheinen die Divergenzen, nicht nur hinsichtlich Ästhetik oder Sprache, sondern auch angesichts der starken zentripetalen, homogenisierend wirkenden Kräfte, die eine mit Jugendlichen unweigerlich verbundene Heterogenität nicht in die bestehenden Gemeindestrukturen einsickern lassen will. Jugendkirchen erscheinen da als möglicher Ausweg. Was kennzeichnet sie? Und was können sie bewirken? Da Jugendkirchen bislang eher aus einem pastoral- bzw. gemeindetheologischen denn aus religionspädagogischem Interesse reflektiert werden, soll auch der Frage nachgegangen werden: Welche Chancen bieten Jugendkirchen aus jugendtheologischer Perspektive? Eine Stichprobe am Jugendpastoralen Zentrum CRUX in Köln gewährt Einblicke.
1. Jugendkirchen: Vom Experiment zur Zielgruppengemeinde
Etwa seit dem Jahr 2000 (Gründung der Jugendkirche TABGHA in Oberhausen) gehören Jugendkirchen zu den vielfach hoch gelobten und als zentraler Beitrag zu einer innovativen Pastoral gewürdigten Einrichtungen. Zunächst ein »Experiment«1 oder ein »Versuch«2, sind sie heute in den großen christlichen Kirchen im deutschsprachigen Raum eine feste Größe. Das Internet-Lexikon Wikipedia gibt ihre Zahl mit über 180 an.3 Ihre Lage, ihre konzeptionelle Ausrichtung und ihre konkrete Gestalt sind erwartungsgemäß unterschiedlich. Zumeist stehen hinter ihnen überregionale Träger (Diözesen, Landeskirchen u.a.), mitunter sind sie aber auch ein Angebot einer lokalen Pfarrei oder Initiative. Man findet sie in den Zentren der Großstädte 1 Vgl. Elisa Stams, Das Experiment Jugendkirche. Die ersten Jahre der Jugendkirche TABGHA in Oberhausen. Eine exemplarische Fallstudie zur Problematik jugendpastoraler Neuorientierung, Stuttgart 2008; Hans Hobelsberger / Elisa Stams / Oliver Heck (Hg.), Experiment Jugendkirche. Event und Spiritualität, Kevelaer 2003. 2 Franz-Josef Bode, Geleitwort, in: Michael Freitag / Christian Scharnberg (Hg.), Innovation Jugendkirche. Konzepte und Know-how, Hannover / Kevelaer 2006, 14f; ders., Mit Jugendlichen »auf Sendung« bleiben. Grußwort, in: Hobelsberger u.a. (wie Anm. 1), 10. 3 http://de.wikipedia.org/wiki/Jugendkirche.
172
Religionspädagogische Anregungen
und Mittelzentren ebenso wie als Kristallisationspunkt eines Stadtviertels oder Seelsorgebereiches, in Form einer Zeltkirche sogar als der Versuch, eine mobile Jugendkirche zeitlich befristet an einem Ort zu errichten.4 1.1 Kennzeichen
Jugendkirchen haben sich damit als eine weitere Säule von Jugendpastoral bzw. kirchlicher Jugendarbeit etabliert, neben und idealerweise in Kooperation mit den bereits bestehenden lokalen Angeboten in Form Offener Kinder- und Jugendeinrichtungen, pfarreilich orientierter Gruppen- oder Projektarbeit und den alle Ebenen kirchlichen Lebens umfassenden Jugendverbänden.5 Im Mittelpunkt der verschiedenartigen Konzepte steht primär die Bereitstellung eines sakralen Raumes für jugendkulturelle Ausdrucksformen.6 Den Hintergrund bildet die hinlänglich bekannte und mit den Sinus-Milieustudien ab 2005 auch empirisch dokumentierte Diastase zwischen zeitgenössischen Jugendkulturen und kirchlicher Ästhetik.7 Inkulturation und Partizipation können damit als zwei weitere Zielbereiche dieser Entwicklung identifiziert werden.8 Auf dem Hintergrund der Auseinandersetzung mit der Milieuforschung können Jugendkirchen aber ebenso verstanden werden als ein Versuch der Milieuüberschreitung: Durch neue Angebotsformen soll ein Zugang zu bisher durch das übliche Instrumentarium kirchlicher Jugendarbeit nicht erreichten Zielgruppen möglich werden.9
1.2 Fragestellungen
Vor diesem Hintergrund lassen sich an eine ›jugendkirchliche Pastoral‹ folgende jugendtheologisch besonders relevante Fragestellungen anlegen: Inwiefern gelingt Inkulturation? Wird die Jugendkirche bzw. der Sakralraum selbst als ein (moderner, ansprechender) Ort wahrgenommen, an dem junge Menschen jugendkulturelle Elemente vorfinden bzw. an dem diese auf innovative Weise eine spannungsvolle Beziehung mit traditionellen Ausdrucksformen christlichen Glaubens und kirchlichen Tradition eingehen? Wie geschieht Partizipation? Ist die Jugendkirche ein Ort, an dem junge Menschen mitwirken, sich einbringen, mitentscheiden können und so kirchliches Leben neu ausprägen? Ferner ist zu fragen, ob Milieuüberschreitung gelingt, d.h. welche Jugendlichen nehmen das Angebot der Jugendkirche wahr und gelingt es, neue Zielgruppen zu erschließen?
4 Vgl. Hobelsberger u.a. (wie Anm. 1), 165–167. 5 Vgl. Stams (wie Anm. 1), 371–418. 6 Vgl. Hans Hobelsberger, Experiment Jugendkirche – pädagogische und jugendpastorale Ansätze, in: ders. u.a. (wie Anm. 1), 24f. 7 Vgl. ebd., 18–24, wobei die zu dieser Zeit (und im Kontext des Weltjugendtages in Deutschland 2005) häufig diskutierte Eventkultur im Vordergrund stand. 8 Vgl. Stams (wie Anm. 1), 267–369. 9 Vgl. ebd., 185–266.423–425.431–434.
Höring Jugendkirchen – Antwort auf die Entfremdung von Gemeinde und Jugend?
2. »Glauben.Katholisch.Leben«: Das »Jugendpastorale Zentrum CRUX« in Köln
Diese Fragestellungen bilden den Hintergrund einer Untersuchung des »Jugendpastoralen Zentrums CRUX« in Köln. Eine fünfjährige Praxis war Anlass, Zielsetzungen, wie sie 2008 formuliert wurden10, hinsichtlich Erscheinungs- und Arbeitsweise sowie Angebotsformen zu überprüfen. Als Einrichtung der Katholischen Jugendagentur für das Stadtdekanat Köln und das Kreisdekanat RheinErft-Kreis, nutzt das CRUX die Kirche St. Johann Baptist der katholischen Kirchengemeinde St. Severin in der Kölner Südstadt. Sowohl der Kirchenraum wie der angeschlossene Kirchturm wurden für den Zweck des jugendpastoralen Zentrums renoviert und umgestaltet.11 Die personelle Ausstattung umfasst drei volle hauptamtliche Stellen (u.a. ein Priester) sowie Küster, einen FSDler und eine Gruppe von drei Schwestern einer Geistlichen Gemeinschaft. Damit entspricht das CRUX weitgehend dem von Michael Freitag als »Grundform« einer Jugendkirche bezeichneten Konzept, das in erster Linie Räumlichkeiten, verbunden mit einem spezifischen Programmangebot, für junge Menschen vorsieht.12 2.1 Zielsetzungen
Unter dem Titel »Glauben.Katholisch. Leben« versucht das CRUX, auf eine jugendgemäße Weise Vollzüge von katholischer Kirche erlebbar zu machen und Ort von Jugendkultur, Begegnung und Glaubensbildung zu sein. Folgende Zielbereiche wurden auf Basis des »Kurzkonzepts (2008)« identifiziert13:
173
Zielbereich 1 (Kooperation und Subsidia rität): Das CRUX als »Ergänzung zu den bestehenden pastoralen Angeboten in den Seelsorgebereichen« (Konzept 2008, 3) verfolgt folgende Ziele: – »Unterstützung für das örtliche Angebot« (3) – »Nutzung von Synergieeffekten« (3) – »zentrale Verortung der überregionalen jugendpastoralen Angebote der katholischen Kirche in Köln« (3) – »vernetzt mit den wichtigsten Institutionen« im Bereich Seelsorge und Jugendhilfe »in der Region und im Veedel« (6) – »von jungen Menschen, von Trägern der Jugendhilfe und von der Öffentlichkeit anerkanntes Zentrum der katholischen Kirche und der Jugendkultur in Köln« (6). Zielbereich 2 (Katholizität): Das CRUX als »Heimat kirchlichen Lebens mit klarem katholischem Profil« (4) bietet bzw. ist: 10 Vgl. http://jugend.erzbistum-koeln.de/export/ sites/kjw/koeln/crux/.Anmeldungen_und_PD Fs/pdf/cruxkurzkonzept.pdf 11 Vgl. Dominik Meiering / Joachim Oepen (Hg.), Aufbruch statt Abbruch. St. Johann Baptist in Köln, Köln 2009. 12 Vgl. Michael Freitag, Immer anders: Evangelische Jugendkirchen – Ein Überblick über die evangelische Landschaft und ihre Jugendkirchen, in: Ders. / Scharnberg (wie Anm. 2), Innovation Jugendkirche. Konzepte und Know-how, Hannover / Kevelaer 2006; Freitag unterscheidet »Die ›klassischen Jugendkirchen‹ – Jugendkirchen als räumliches Angebot«, »Jugend-Kultur-Kirchen«, »Jugendgemeinden – Jugendkirche als personales Angebot«, »Jugendkirchen als Tochtergemeinden«, »Church planting – Jugendkirchen als Gemeindegründungen« und »Mobile Jugendkirchen«, vgl. 62–68. 13 Vgl. Anm. 10; in Klammern angefügte Seitenzahlen beziehen sich auf dieses Konzept.
174
Religionspädagogische Anregungen
– Erlebnis von »Beheimatung und Geborgenheit« (4) – »Begegnungsort mit Gott und untereinander« (4) – Kennenlernen und Einüben der pastoralen Grundvollzüge »Liturgie, Verkündigung und Diakonie« (4). Zielbereich 3 (Partizipation): Das CRUX als Ort der Mitwirkung und Mitgestaltung (4): – Jugendliche haben die Möglichkeit als »Berater, Mitarbeiter und Verantwortungsträger« sich zu beteiligen (4) – Jugendliche entscheiden selbst über »die Intensität und die Dauer ihres Verweilens oder ihrer Mitarbeit« (4). Zielbereich 4 (Inkulturation): Das CRUX als jugendkulturelles und lebensrelevantes Angebot (5): – Jugendliche erleben das CRUX als einen Ort, an dem sie Antworten auf ihre Fragen finden – Mitarbeiter sind ansprechbar und »stehen zur Hilfestellung bei allen möglichen Fragen … zur Verfügung« (5) – Das CRUX ist »Trendsetter« (5) – Das CRUX ist offen für alle Nationalitäten und Kulturen und – trägt zum interreligiösen Dialog »vor allem mit … dem Judentum und dem Islam« bei (5). Im Unterschied zu den Kennzeichen anderer Jugendkirchen wird der Aspekt der Milieuüberschreitung, der eine missionarische Grundausrichtung erkennen ließe, weniger deutlich. Inwieweit nun löst das CRUX mit seiner Praxis die im »Kurzkonzept« formulierten Zielsetzungen ein, und welche
Entwicklungsmöglichkeiten lassen sich ableiten? 2.2 Befragungsgruppen und Instrumente
Für die Untersuchung kamen zwei Befragungsgruppen in Betracht: Jugendliche Besucher des CRUX sowie Multiplikatoren im Einzugsgebiet. Denn erstere sind als Nutzer der Einrichtung die primäre Zielgruppe des CRUX, Hauptamtliche können hingegen Auskunft über die Einlösung des subsidiären Auftrages und die Vernetzung in der Stadt- bzw. Viertelskultur Auskunft geben. Während sich für die erste Befragungsgruppe aufgrund einer großen Zahl von in Frage kommenden Teilnehmern ein weitgehend standardisierter Fragebogen anbot, sollte es sich bei der Befragung von zehn Multiplikatoren um ein halboffenes Leitfadeninterview handeln. Bei diesen handelte es sich um drei pastorale Mitarbeiter/innen aus dem Kölner Stadtgebiet, den Referenten für Schulpastoral des Stadtdekanates, den Stadtdechanten, eine Jugendreferentin und einen Jugendreferenten der dem CRUX räumlich angeschlossenen und organisatorisch zugeordneten Katholischen Jugendagentur, ein Mitglied des Kirchenvorstands der örtlichen Kirchengemeinde sowie den Leiter des benachbarten Gymnasiums. Auf der Basis dreier denkbarer Selbstkonzepte, wie sie Hans-Georg Ziebertz entworfen hat14, wurden Fragen formuliert, um herauszufinden, wie die Besu14 Vgl. Hans-Georg Ziebertz / Boris Kalbheim/ Ulrich Riegel, Religiöse Signaturen heute. Ein religionspädagogischer Beitrag zur empirischen Jugendforschung, Gütersloh / Freiburg i.Br. 2003, 146.
Höring Jugendkirchen – Antwort auf die Entfremdung von Gemeinde und Jugend?
cher/innen das Verhältnis von persönlichem Glauben und Kirche bestimmen. Ist Glauben eher eine dem Einzelnen je individuell zukommende Aufgabe (Selbstkonstruktion von Glauben)? Ist Glauben eine untrennbar mit der Kirche verbundene Angelegenheit (Identität von Glaube und Kirche) oder besteht hier eine Differenz? Verteilung und Rücklauf erfolgten im Umfeld von Veranstaltungen im CRUX. Die Erfassung geschah im Zeitraum Februar-April 2014. Die Grundgesamtheit betrug N = 239. 3. So geht »Glauben. Katholisch. Leben«: Beobachtungen und Wahrnehmungen 3.1 Ausstattung und Erscheinungsweise
Das CRUX besteht räumlich aus zwei der Öffentlichkeit zugänglichen Teilen, dem Kirchenraum und dem im Erdgeschoss des Turms gelegenen Café. Die meisten Befragten empfinden den Kirchenraum – in der Fachliteratur ein wesentliches Kennzeichen für eine Jugendkirche15 – als wenig spektakulär, gleichwohl nicht als unattraktiv. Häufig werden die aus Flightcases hergestellten Kirchenbänke erwähnt. Sie scheinen für viele der befragten Multiplikatoren aber auch das einzige Merkmal einer ›jugendgemäßen‹ Gestaltung des Kirchenraumes. Verglichen mit anderen Jugendkirchen, scheinen Elemente, die am ehesten als jugendgemäß assoziiert werden, wie Installationen, Lichttraversen oder eine Kletterwand, zu fehlen. Das Café wiederum beschreiben die meisten als offen und einladend, hell und modern.
175
Noch deutlicheres Merkmal der Ausstattung ist nicht das räumliche, sondern – ganz im Sinne der Würzburger Synode – das »personale Angebot«16. Dies bestätigt sich etwa darin, dass viele Besucher auf die Frage, wie das CRUX auf sie wirke, häufig einen Bezug zu den anwesenden Personen – und weniger zu den Räumlichkeiten – erkennen ließen. Zugleich ist dieser Faktor auch ein Grund für eine mögliche oder tatsächlich realisierte Rückkehr ins CRUX. Dies kann freilich Segen und Fluch zugleich sein, da die Attraktivität der Angebote im Wesentlichen von der Wirkung der sie verkörpernden Personen abhängt (so wird der Jugendpfarrer auffallend oft namentlich erwähnt). Wird auf der einen Seite die Atmosphäre in den meisten Fällen (und im Einzelfall auch überschwänglich) als familiär, herzlich und einladend beschrieben, gibt es dennoch Einzelstimmen, die eine »geschlossene Gemeinschaft« erlebten und sich ausgeschlossen fühlten. 15 Vgl. Hans Hobelsberger, Fokus Kirchenraum: »Räume aneignen«, in: Michael Freitag / Ursula Hamachers-Zuba / Ders. (Hg.): Lebensraum Jugendkirche, 100–107; ders.: Jugendkirche in der Diskussion – Anmerkungen zu zentralen Aspekten, in: Freitag / Scharnberg (wie Anm. 2), 102; Herbert Fendrich, Was macht einen geeigneten Jugendkirchenraum aus?, in: ebd., 108–110; Ulrich Schwab, Innovation Jugendkirche, in: ebd., 38f. Aufschlussreich ist auch die Aussage von Hans-Jürgen Vogel: »Zweite Bedingung: Kirchenraum – ›Die Bänke müssen raus!‹«, in: Ders., Welche Bedingungen müssen für ein gelingendes Verhältnis zwischen Jugendkirche und Territorialgemeinde gegeben sein?, in: ebd., 161]. 16 Vgl. Ziele und Aufgaben kirchlicher Jugendarbeit, Beschluss, in: Ludwig Bertsch u.a. (Hg.): Gemeinsame Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland. Beschlüsse der Vollversammlung [Offizielle Gesamtausgabe I], Freiburg i. Br. 21976, 298–301.
176
Religionspädagogische Anregungen
3.2 Angebote und Veranstaltungen
Problemanzeige: Gefahr der Verengung auf liturgische Feiern und Bildungsangebote Der Schwerpunkt im CRUX liegt auf den liturgischen Feiern und Angeboten der religiösen und kulturellen Jugendbildung. Weniger offenkundig sind soziale Aktionen und Angebote, die im Stadtgebiet Kölns auch bereits durch eine Vielzahl anderer Träger durchgeführt werden.17 Die Angebotspalette war allen Befragten weitgehend bekannt, nur 6 % der Besucher fühlten sich nicht ausreichend informiert. Bei den Multiplikatoren erschien vor allem die sonntägliche Stadtjugendmesse als Wiedererkennungsmerkmal, wurde sie doch in vielen Fällen als erstes genannt. Offensichtlich ist die Liturgie nach wie vor eine Art Aushängeschild der Kirche. Sie prägt ihre Außenwahrnehmung, zugleich ist sie eine der wenigen Möglichkeiten der Teilhabe am kirchlichen Leben ohne gleich ein Ehrenamt übernehmen zu müssen.18 3.3 Wer ist denn da? Was glauben die wohl? – Details aus der Besucherbefragung
Wie so häufig, bildet die Mehrheit der Besucher sich nicht aus der Kirche fernstehenden Jugendlichen, sondern aus kirchlich engagierten jungen Erwachsenen.19 Nur 30 % waren jünger als 18 Jahre, 47 % waren zwischen 18 und 30 Jahre alt. 62 % der Befragten waren weiblich, 38 % männlich, 86 % katholisch. Zehn Personen gaben an, Muslim (2) oder Jude (1) zu sein bzw. keiner Religion anzugehören (7).
Fast 80 % sind regelmäßige Kirchgänger (46,4 % sogar ein- bis mehrmals in der Woche!). Über 40 % gaben an, täglich zu beten. Glaube und Kirche sowie das Nachdenken und Austauschen darüber sind 85 % wichtig oder sehr wichtig. Noch wichtiger ist der Wunsch nach Gemeinschaft und Zugehörigkeit. Knapp die Hälfte der Befragten (44,8 %) hat am CRUX schon einmal in irgendeiner Form mitgewirkt. In Bezug auf die entworfene Typologie religiöser Einstellungen ergibt sich eine deutliche Ablehnung einer traditionellen Identifikation von kirchlicher Institution und persönlichem Glauben, was sich mit den Ergebnissen anderer Untersuchungen20, auch unter kirchlich orientierten Freiwilligen21, deckt. Glauben kann man 17 Dementsprechend zurückhaltend waren auch die Einschätzungen der Multiplikatoren hinsichtlich der Aussage, im CRUX würden die kirchlichen Grundvollzüge Liturgie, Verkündigung und Diakonie erlebt. 18 Ähnliches gilt allenfalls noch für die punktuellen Angebote der Katechese im Kindesund Jugendalter (Erstkommunion / Firmung/ Konfirmation), vgl. zu dieser Frage auch Hansjörg Kopp u.a., Nur mitarbeiten? Ein Plädoyer für mehr Teilnahmeangebote in der Evangelischen Jugendarbeit, in: Ders. u.a. (Hg.), Brücken und Barrieren. Jugendliche auf dem Weg in die Evangelische Jugendarbeit, Stuttgart / Neukirchen-Vluyn 2013, 263–274. 19 Dahinter steckt die Erfahrung, dass bei vermeintlich innovativen pastoralen Projekten dann doch letztlich die bekannten Gesichter auftauchen, vgl. zu den Hintergründen Stams (wie Anm. 1), 253–266. 20 Vgl. Marc Calmbach u.a., Wie ticken Jugendliche 2012? Lebenswelten von Jugendlichen im Alter von 14 bis 17 Jahren in Deutschland, Düsseldorf 2012, 77f; Ziebertz u.a. (wie Anm. 14), 145–152. 21 Vgl. Patrik C. Höring, Junge Menschen auf dem Weg zum Weltjugendtag, in: Pastoralblatt für die Diözesen Aachen, Berlin, Essen, Hildesheim, Köln, Osnabrück 57 (2005), 236–243.
Höring Jugendkirchen – Antwort auf die Entfremdung von Gemeinde und Jugend?
aus Sicht der Befragten auch »ohne Papst und Kirche«. Für den eigenen Glauben hingegen ist ihnen die Kirche gleichwohl wichtig! Die Befragten lassen sich somit nicht eindeutig einem der drei möglichen Typen zuordnen, sondern bilden eher ein Beispiel für einen einzigartigen, postmodernen Wertemix: Kirche und Glauben sind wichtig, im persönlichen Erleben auch aufeinander bezogen, im Blick auf andere aber folgen die Befragtem keinem christlichen Exklusivismus, sondern empfinden Christ-Sein als eine mögliche religiöse Orientierung unter vielen anderen. Problemanzeige: Schwerpunkt in den gesellschaftlichen Leitmilieus Die große Mehrheit (82 %) sind Studierende oder verfügen über ein Abitur bzw. streben dieses an. Hauptschüler kommen mit nur 5,4 % als Besucher kaum vor. Dies mag auch Folge eines – wie oben dargestellten – Angebotsprofils mit einem Schwerpunkt in der Liturgie und der Bildungsarbeit sein. Die große Mehrheit ist bereits in einer Kirchengemeinde und in Feldern der kirchlichen Jugendarbeit aktiv. Immerhin ein Drittel (32 %) ist nicht in der Kirche freiwillig engagiert, hat aber den Weg ins CRUX gefunden. Das CRUX könnte also zum Ort werden, an dem neue Möglichkeiten der Mitwirkung entdeckt werden. 4. Ergebnisse zu den Kennzeichen einer Jugendkirche 4.1 Inkulturation
Jugendkirchen wollen junge Menschen einladen, sich mit ihren Kulturtechniken in der Kirche, konkret: im Kirchenraum,
177
zu verwurzeln, um eine Beheimatung der jungen Menschen, möglicherweise aber auch eine Erneuerung und Verlebendigung der Kirche anzubahnen. Am Beispiel des Kirchenraumes wird deutlich, dass es mehr noch als um Inkulturation um Interkulturation geht.22 Wie steht es um diese Prozesse innerhalb des CRUX? Ist es ein Ort, an dem junge Menschen mit ihren Lebensweisen und Lebensfragen in einen konstruktiven Dialog mit dem Evangelium geraten? Von den Multiplikatoren wird das CRUX mehrheitlich als ein Ort wahrgenommen, an dem junge Menschen »Antworten auf ihre Fragen finden«. Die Besucher sehen dies nicht ganz so eindeutig: Nur 22 % stimmten dieser Aussage voll, immerhin 49 % teilweise zu, wobei rund ein Fünftel hierzu gar keine Angabe machte. Als ein »Trendsetter« jedoch oder als ein profilierter Ort des interreligiösen Dialogs erscheint das CRUX weniger. Auch die reklamierte Offenheit für alle Nationalitäten und Kulturen ist konzeptionell zwar gewollt, wird aber faktisch nur wenig realisiert oder zumindest nicht wahrgenommen.23 Demgegenüber scheint es aber zu gelingen, jungen Menschen »Beheimatung und Geborgenheit« zu vermitteln bzw. Möglichkeiten der Gottesbegegnung zu eröffnen. Zumindest trauen die meisten 22 Zur Frage von In- bzw. Interkulturation im Kontext von Jugendpastoral und kirchlicher Jugendarbeit vgl. Patrik C. Höring, Katholische Perspektiven einer missionarischen Jugendarbeit, in: Florian Karcher / Germo Zimmermann (Hg.), Handbuch missionarische Jugendarbeit, Neukirchen-Vluyn 2016 (im Erscheinen). 23 Außer zum religiösen Bekenntnis wurden jedoch keine weiteren Fragen zur kulturellen oder ethnischen Herkunft gestellt.
178
Religionspädagogische Anregungen
Multiplikatoren dies dem CRUX zu. Der Frage nach der Beheimatung stimmten 38 % der Besucher voll und 37,6 % teilweise zu, noch übertroffen von der Frage nach der Möglichkeit, »Gott nahe zu kommen«: 47,3 % stimmten dieser Aussage voll, 31,4 % teilweise zu. Damit bestätigt sich das schon vom Programm und der Außenansicht angedeutete Profil des CRUX als einer wirklichen Jugendkirche im Sinne eines geistlichen und liturgisch geprägten Ortes. Daran wird deutlich: Das CRUX ist ein Ort, der Begegnungen zwischen Jugendlichen und Kirche, zwischen jugendlichen Kulturformen und dem Evangelium ermöglicht. Prozesse der Begegnung, der Auseinandersetzung und möglicherweise der Aneignung des Raumes entstehen dort, wo junge Menschen den Kirchenraum aufsuchen und besetzen, mitgestalten und für diesen Raum charakteristische Umgangsformen und Kulturtechniken kennenlernen, mitvollziehen, einüben, adaptieren und weiterentwickeln, sodass Lern- und wechselseitige Interkulturationsprozesse stattfinden können.24 Diese werden zum einen möglich, wo Passanten einzeln die Kirche aufsuchen und in ihr verweilen, was häufig insbesondere während der Öffnungszeiten des Cafés zu beobachten ist. Auch die positiven Rückmeldungen hinsichtlich der Atmosphäre deuten darauf hin, dass sich solche Prozesse zu ereignen scheinen. Noch deutlicher geschieht Raumaneignung, wenn Jugendliche an der Realisierung von Ausstellungen und Installationen beteiligt sind, die eine Auseinandersetzung mit dem Raum (und seinen Möglichkeiten und Grenzen) erforderlich machen oder im Raum unmittelbare Begegnungen mit dem Evangelium ermögli-
chen (z.B. im Rahmen einer interaktiven Ausstellung zum Thema Bibel). Eigene Verstehenszugänge der jungen Menschen verbinden sich mit theologischen, vor allem exegetischen und bibeltheologischen Impulsen der theologischen Mitarbeiter. 4.2 Partizipation und Mitwirkung
Voraussetzung für In- und Interkulturationsprozesse ist Begegnung, ist Partizipation. Damit klingt nicht nur ein Grundprinzip kirchlicher Jugendarbeit, wenn nicht gar des kirchlichen Selbstverständnisses insgesamt25, an, sondern auch eine zentrale Voraussetzung jugendtheologischer Prozesse. Das CRUX hat das Ziel, Ort der Mitwirkung und Mitgestaltung zu sein, an dem eine gestufte Weise der Mitwirkung in Form von spontanem Genießen, temporärem Mitmachen und dauerhaftem Engagement möglich ist, etwa als »Berater, Mitarbeiter und Verantwortungsträger«.26 Die befragten Multiplikatoren stimmten unisono zu, dass diese Zielsetzung auch realisiert wird. Die Besucherbefragung ergab ebenfalls eine große Zustimmung (67 %) zur Aussage, dass man im 24 Zum Aneignungskonzept in der Sozialen Arbeit vgl. Ulrich Deinet, Das Aneignungskonzept als Praxistheorie für die Soziale Arbeit, in: sozialraum.de (6) Ausgabe 1/2014 (http:// www.sozialraum.de/das-aneignungskonzeptals-praxistheorie-fuer-die-soziale-arbeit.php); Andreas Oehme, Der Aneignungsansatz in der Jugendarbeit, in: sozialraum.de (2) Ausgabe 1/2010 (http://www.sozialraum.de/deraneignungsansatz-in-der-jugendarbeit.php) 25 Vgl. Patrik C. Höring, Jugendlichen begegnen. Jugendpastorales Handeln in einer Kirche als Gemeinschaft, Stuttgart 2000. 26 CRUX-Kurzkonzept (wie Anm. 10), 4.
Höring Jugendkirchen – Antwort auf die Entfremdung von Gemeinde und Jugend?
CRUX seine Ideen und Anliegen einbringen könne. Mitwirkung scheint also möglich zu sein, und der Mehrheit aller Befragten (57%) sind die jeweiligen Ansprechpartner bekannt. Allerdings fällt erneut auf, dass etwa ein Fünftel keine Angaben machte. Dies bestätigt eine für freiwilliges Engagement mögliche Vermutung, dass für Engagierte das eigene, freiwillige Handeln plausibel und die Rahmenbedingungen klar sind, für Außenstehende beides jedoch nicht immer hinreichend transparent ist, um selbst zur Mitwirkung animiert zu werden.27 Die konkret genannten Tätigkeitsfelder umfassen alle Angebotsformen des CRUX, angefangen von der Teilnahme an Einzelprojekten und geselligen Anlässen bis hin zur Mitwirkung in der Liturgie. Da in der gottesdienstlichen Versammlung der eigentliche Zweck eines Kirchenraumes liegt und auch das CRUX hier einen Schwerpunkt setzt, kommt der Feier und Mitgestaltung von Gottesdiensten eine besondere Rolle zu. Jugendtheologisch relevant werden diese vor allem dann, wenn es nicht nur um äußere Teilnahme, sondern um inneren Mitvollzug, eine wirkliche Partizipation, eine »participatio plena« (Zweites Vatikanisches Konzil: Sacrosanctum Concilium 14) geht. Liturgische Bildung muss daher noch nicht einmal explizit intendiert sein, wenn eine (partizipatorische, mystagogische) Liturgie es von allein leisten kann, Teilnehmende tiefer in das Glaubensgeheimnis zu führen.28 In Jugendkirchen lädt man junge Menschen darüber hinaus auch zur Mitgestaltung und Vorbereitung der Gottesdienste ein. Im CRUX wirken Jugendliche nicht nur als Ministranten, Lektoren oder im Chor mit, sondern fallweise auch
179
bei der inhaltlichen Vorbereitung der Gottesdienste, etwa zum Patrozinium oder am Karfreitag. Solche Vorbereitung umfasst dabei am wenigsten die praktische Planung als vielmehr die inhaltliche Auseinandersetzung, zuerst und vor allem mit den vorgesehenen Schriftlesungen und ihrer Auslegung. Demgegenüber stoßen die zahlreichen offenen Gesprächsangebote zum Thema »Glaube und Leben« sowie explizite Kursangebote der Glaubensbildung und Glaubenskommunikation auf ein deutlich geringeres Interesse bei den Besuchern. Jugendtheologische Diskurse in jugendkirchlichem Rahmen werden daher noch stärker erkennbar non-formale und informelle Settings nutzen bzw. entwickeln müssen, um nicht irrtümlicherweise als eine Form von Unterricht wahrgenommen oder assoziiert und damit abgelehnt zu werden. 4.3 Milieuüberschreitung
Zunächst bestätigt sich das auch andernorts29 wahrgenommene Bild: Die Mehrheit der Besucher im CRUX gehört zu 27 Zur Kultur der Mitbestimmung, gerade auch im Verhältnis von Haupt- und Ehrenamt vgl. Freiwilligensurvey 2009, 30.188–193, bes. 191f. Zur Frage der Einstellung gegenüber freiwilligem Engagement auch Calmbach u.a. (wie Anm. 20), 83–87 und v.a. Kopp (wie Anm. 18). 28 Vgl. etwa Patrik C. Höring, Partizipation – Schlüssel zur liturgischen Bildung junger Menschen, in: ders.: Jugendpastoral heute. Aufgaben und Chancen, Kevelaer / Düsseldorf 2004, 171–184. 29 Vgl. Hans Hobelsberger / Lothar Kuld / Ursula Hamachers-Zuba, Evaluation Katholischer Jugendkirchen am Beispiel der Jugendkirchen Oberhausen, Ravensburg und Wien, in: Freitag (wie Anm. 15), 163–182.
180
Religionspädagogische Anregungen
den gut ausgebildeten und weiten teils ambitionierten Personenkreisen der gesellschaftlichen Leitmilieus, die bereits an verschiedenen (anderen) Orten (der Kirche) engagiert sind. Noch nicht oder nicht mehr kirchlich engagierte Personenkreise zu erschließen, gelingt auch dem CRUX nur zu einem geringen Teil. Nun gehört eine ausgesprochen missionarisch ausgerichtete Pastoral auch nicht zu den eingangs formulierten Zielsetzungen des CRUX. Der Typologie von Michael Freitag folgend30, gehört das CRUX nicht zu den Formen einer neuen Gemeindegründung (bzw. einer »Fresh Expression of Church«, um den beispielhaften Prozess neuer Gemeindeformen für sogenannte »nonchurched« oder »dechurched people« in den anglikanischen Kirchen als Vergleich heranzuziehen). Milieuüberschreitung gelingt also nur bedingt. Immerhin: 10 % der Besucher gehen gar nicht oder nur »alle paar Jahre« einmal in die Kirche. Gut 30 % sind nicht (in der Kirche freiwillig) engagiert. Dennoch ist die Rolle der zahlreichen im CRUX anzutreffenden kirchlich Engagierten nicht gering zu schätzen. Problemanzeige: Verschworene Gemeinschaft? Der größte Teil (61 %) der Befragten gab an, mehr als zehnmal bereits das CRUX besucht zu haben. Nur 10 % waren Erstbesucher. Knapp die Hälfte aller Befragten hat bereits einmal aktiv mitgewirkt. Zu fragen wäre, ob dies Anzeichen einer relativ geringen Durchlässigkeit sind und ob das CRUX auf dem Weg ist, eine ›verschworene Gemeinschaft‹ zu werden. Das CRUX ist offensichtlich mehr ein Ort zum längeren Verweilen und Sichbeheimaten als ein Stopover auf der
Durchreise. Der Aussage: »Im CRUX erfahre ich Heimat und Geborgenheit«, stimmten immerhin über 75 % zu. Die Ergebnisse insgesamt sprechen für eine gewisse Attraktivität von Ort, Angebot und Personal für eine bestimmte Zielgruppe. 5. Austragungsort, Instrument oder Ausdrucksform: Ein Resümee aus jugendtheologischer Perspektive
Aus jugendtheologischer Perspektive erscheinen die klassischen Jugendkirchen wie das CRUX in mehrfacher Hinsicht relevant. Anknüpfend an die aus der Kindertheologie geläufigen Unterscheidung einer Jugendtheologie für, von und mit Jugendlichen, ließe sich zusammenfassen: Die Jugendkirche ist zunächst Austragungsort jugendtheologischer Diskurse, wenn Jugendliche Adressaten einer für sie stimmigen Verkündigung sind. So wird auch im CRUX u.a. in Gottesdienst und Glaubenskursen der Versuch unternommen, die Essentials des Evangeliums auf eine jugendgemäße Weise anzubieten und zu einem Leben aus dem Evangelium einzuladen. Im Sinne einer Kirchen(raum)pädagogik ist die Jugendkirche zugleich Instrument der Glaubenskommunikation mit jungen Menschen, indem sie als steingewordenes Zeugnis einer bestimmten Glaubenskultur zur Auseinandersetzung anregt. Auch in diesem Sinne ist der Raum Element einer Theologie für Jugendliche, wenn er zur eigenen Entdeckungsreise, etwa im Rahmen von Kirchenführungen, animiert. In der Weise jedoch wie sich Jugendliche 30 Freitag (wie Anm. 12), 62–68.
Höring Jugendkirchen – Antwort auf die Entfremdung von Gemeinde und Jugend?
diesen Raum aneignen und wie sie ihre individuellen Glaubensvorstellungen in einen partizipativ angelegten Gestaltungsprozess einbringen und Ausdruck verleihen, zeigen sich Züge einer Theologie von Jugendlichen bzw. einer Theologie mit Jugendlichen im Sinne eines symmetrischen Dialogs zwischen überlieferter Glaubenskultur und jugendlichen Lebensweisen. Die Befragung im CRUX liefert für die letztgenannten Dimensionen einer Jugendtheologie auf den ersten Blick wenig Anhaltspunkte, was auf eine doch letztlich von der Kirchen- bzw. Gemeindeleitung ausgehende Konzeption und eine von ihr maßgeblich beeinflusste Raumgestaltung schließen lässt. Es mag mit dem in der Befragung ermittelten, eher kirchennahen, möglicherweise auch tendenziell eher familienorientierten und wenig lifestyleaffinen Besucherprofil – wie es (inzwischen) für die Mehrheit der in der (gemeindenahen) kirchlichen Jugendarbeit Engagierten kennzeichnend ist – konvergieren. Um eine Jugendkirche in diesem Sinne als Personalgemeinde zu entwickeln, müssten noch bessere Rahmenbedingungen geschaffen werden, die eine wirkliche Partizipation, angefangen von der Konzeption und Gründung bis hin zur regelmäßigen Rückbindung des Gemeindelebens an Interessen und Be-
181
dürfnisse junger Menschen, gewährleisten31, sodass Jugendliche tatsächlich Subjekte einer Glaubenskommunikation auf Augenhöhe werden. Eine den Ideen und Ansprüchen heutiger Jugendtheologie Rechnung tragende Konzeption einer Jugendkirche wird daher die Adressaten nicht nur als potentielle Teilnehmende oder Mitwirkende betrachten können, sondern diese auch in ihrer eigenen theologischen Kompetenz (Jugendliche als Theologen), d.h. als Mitgestalter und Mitentscheider stärker wahr- und ernstnehmen wollen. Besondere Anstrengungen und spezielle Instrumente müssten dazu dienen, vorreflexive Formen einer jugendlichen Religiosität zu einer wirklichen, reflektierten eigenen Theologie von Jugendlichen weiterzuentwickeln, um junge Menschen auch zu Motoren einer lebendigen Gemeinde- und Kirchenentwicklung zu befähigen. Jugendtheologie hätte damit nicht nur Relevanz im Blick auf die Glaubensentwicklung und Glaubensbiographie des jeweiligen Jugendlichen, sondern auch Rückwirkungen auf Prozesse der Gemeinde- und Kirchenentwicklung.
31 Vgl. dazu Stams (wie Anm. 1), 338–369.
182
Religionspädagogische Anregungen
Lilli Hochuli-Wegmüller Gottesdienste als Herausforderung der Konfirmationsarbeit – Partizipation als jugendtheologischer Lösungsansatz Die reformierten Jugendlichen in der Schweiz erleben ihre Konfirmationszeit und die Konfirmation grundsätzlich positiv. Trotzdem tun sie sich schwer mit den Gottesdiensten. Aktuelle empirische Untersuchungen zeigen: Eine Mehrheit der Konfirmandinnen und Konfirmanden findet Gottesdienste meistens langweilig – nicht nur am Anfang des Konfirmationsjahres, sondern auch und sogar noch verstärkt gegen das Ende hin. Was braucht es also, damit Konfirmandinnen und Konfirmanden Gottesdienste positiv erleben können? Die folgenden Thesen skizzieren Lösungsansätze und reflektieren die jugendtheologischen Konsequenzen. Dabei ist zu beachten, dass Konfirmandinnen und Konfirmanden in den meisten reformierten Landeskirchen der Schweiz zum Zeitpunkt der Konfirmation 15 bis 16 Jahre alt sind. 1. Zum Stellenwert von Gottesdiensten
Ergebnissen der Jugendforschung denkbar schlecht: Die Mehrheit der Jugendlichen in der Schweiz ist wenig religiös. Religiosität erweist sich in ihrem Alltag als nicht relevant. Rituelle Vollzüge wie der Gottesdienstbesuch sind ihnen sogar am wenigsten wichtig.1 Konfirmandinnen und Konfirmanden suchen und definieren ihre Identität heutzutage weder aufgrund der Religion noch der Tradition. Sie orientieren sich vielmehr an Werten wie Hedonismus, Selbstbestimmung und Benevolenz.2 Jugendliche wollen Spaß erleben und ihre Ziele selber festlegen. Sie bevorzugen, was die Beziehungen unter Individuen fördert. Diese Wertorientierungen gilt es in der Konfirmationsarbeit und der Planung sowie Durchführung von Gottesdiensten zu berücksichtigen. Gottesdienste haben bei Konfirmandinnen und Konfirmanden eine Chance, wenn sie Spaß machen, Kreativität zulassen und Beziehungen fördern. Die
Der Stellenwert von Gottesdiensten muss durch die Konfirmationsarbeit erhöht werden. Die Ergebnisse der Jugendforschung geben dafür die Stossrichtung an: Es braucht mehr Spaß, Selbstbestimmung und Spannung in der Planung und Durchführung von Gottesdiensten, um Konfirmandinnen und Konfirmanden dafür zu begeistern. Die Ausgangslage für positive Erfahrungen mit Gottesdiensten ist gemäß den
1 Vgl. Sabine Zehnder Grob, Jugendliche in der Deutschschweiz und ihre Religiosität, in: Christoph Käppler / Christoph Morgenthaler (Hg.), Werteorientierung, Religiosität, Identität und die psychische Gesundheit Jugendlicher, Stuttgart 2013, 76f. 2 Aristide Peng, Wertorientierungen und Einstellungen zur Akkulturation bei Jugendlichen, in: Christoph Käppler / Christoph Morgenthaler (Hg.), Werteorientierung, Religiosität, Identität und die psychische Gesundheit Jugendlicher, Stuttgart 2013, 113.
Hochuli-Wegmüller Gottesdienste als Herausforderung der Konfirmationsarbeit
Subjektorientierung muss in der Konfirmationsarbeit Ausgangspunkt und Zentrum sein. Sie zielt darauf ab, dass Jugendliche mit ihrer Persönlichkeit und ihren Ansichten ernst genommen werden, ein Mitbestimmungsrecht erhalten und Verantwortung mittragen können. Die Mitarbeitenden sind zum gemeinsamen theologischen Nachdenken mit den Jugendlichen herausgefordert. Sie haben insofern eine Vorbild-Funktion, als Jugendliche Orientierung suchen und diese am ehesten finden »durch die Auseinandersetzung mit Positionen, die einem erlebbaren Menschen zugeordnet werden können«3. Insofern kommt den Familien eine bedeutende Rolle ebenso zu wie Gleichaltrigen, die dazu bereit sind, sich mit Glaubensthemen auseinander zu setzen und an die eigene Lebenspraxis anzuknüpfen. »Begegnung und Gemeinschaft« sind für Konfirmandinnen und Konfirmanden die wichtigsten Grundformen des Glaubens.4 Entscheidend ist, dass die Jugendlichen sich angesprochen fühlen, ihre Lebenswelt wahrgenommen wird und sie mit dem jeweiligen Inhalt in eine Beziehung kommen. Gottesdienste können Konfirmandinnen und Konfirmanden begeistern, sofern sie ihnen etwas bringen und andere Angebote für sie nicht attraktiver sind.5 2. Zum Sinn von Gottesdiensten
Der Sinn von Gottesdiensten muss in der Konfirmationsarbeit erklärt werden. Konfirmandinnen und Konfirmanden sollen Gottesdienste kennen lernen und erleben, wie diese mit Freude und als »Mitte der Gemeinde« gefeiert werden. Stimmt die Beziehung unter den Feiernden und passt die »Kom-
183
munikation des Evangeliums« zum Leben der Jugendlichen, kann der Funke überspringen. Die »Zürcher Studie«6 und die »Schweizer Studie«7 zur Konfirmationsarbeit decken verschiedene Defizite auf, die insbesondere die Qualität und Ausgestaltung von Gottesdiensten betreffen. Die Ergebnisse hierzu stimmen im Wesentlichen überein und lassen sich aus Sicht der Konfirmandinnen und Konfirmanden wie folgt zusammenfassen: Nur wenige interessieren sich zu Beginn des Konfirmationsjahres für den Ablauf und Sinn von Gottesdiensten. Eine Mehrheit findet Gottesdienste meistens langweilig – sowohl vor als auch nach der 3 Wolfgang Ilg, Ich nehm’ dich ernst, ich stell’ dir Fragen. Jugendarbeit als jugendtheologischer Experimentierraum, in: Thomas Schlag/ Friedrich Schweitzer u.a., Jugendtheologie. Grundlagen – Beispiele – kritische Diskussion, Neukirchen-Vluyn 2012, 100. 4 Rahel Voirol-Sturzenegger / Frieder Furler, Das Religionspädagogische Gesamtkonzept der Evangelisch-reformierten Landeskirche des Kantons Zürich, in: Thomas Schlag / Rudi Neuberth / Ralph Kunz (Hg.), Konfirmandenarbeit in der pluralistischen Gesellschaft, Orientierungen – Deutungen – Perspektiven, Zürich 2009, 129. 5 Friedrich Schweitzer, Individuelle Bildungsbedürfnisse und kirchliche Bildungsangebote im Wandel der Zeit am Beispiel des Konfirmandenunterrichts, in: Peter Bubmann u.a. (Hg.), Gemeindepädagogik, Berlin / Boston 2012, 189. 6 Thomas Schlag / Rahel Voirol-Sturzenegger (Hg.), Konfirmationsarbeit im Kanton Zürich. Erkenntnisse – Herausforderungen – Perspektiven, Zürich 2010. 7 Vgl. Thomas Schlag, Aus der Konfirmationsforschung. Erkenntnisse der 2. Europäischen Studie zur Konfirmandenarbeit, in: Evangelisch-reformierte Landeskirche des Kantons Zürich (Hg.), Konf. Wir leben in Beziehungen. Arbeitshilfe für die Konfirmationsarbeit mit 2 Begleit-DVDs und 103 Karten [Eure Wahl!], Zürich 2014, 377–381.
184
Religionspädagogische Anregungen
Konfirmation. Weniger als die Hälfte erlebt während des Konfirmationsjahres jugendgemäße Gottesdienste. Und weniger als ein Drittel hat während dieser Zeit die Möglichkeit, mit eigenen Ideen zu den Gottesdiensten beizutragen. Dass Jugendliche zu Beginn ihres Konfirmationsjahres nur ein geringes Interesse am Ablauf und Sinn der Gottesdienste zeigen, erscheint in Anbetracht ihrer Lebenssituation nachvollziehbar. Dass aber eine Mehrheit der Jugendlichen Gottesdienste nach der Konfirmation noch langweiliger findet als zuvor und diese jeweils möglichst schnell hinter sich bringen will, muss ebenso nachdenklich stimmen wie die Tatsache, dass nicht einmal die Hälfte der befragten Konfirmandinnen und Konfirmanden jugendgemäße Gottesdienste erlebt, obwohl solche laut Studie ein erklärtes Ziel der Mitarbeitenden sind. Die Gründe dafür, dass Konfirmandinnen und Konfirmanden Gottesdienste langweilig finden, sind vielfältig. Sie sind wohl insbesondere darauf zurückzuführen, dass die Jugendlichen andere Interessen haben sowie mit den Inhalten, Personen und Rahmenbedingungen Mühe bekunden. Damit ihr Interesse für Gottesdienste geweckt und / oder gesteigert werden kann, braucht es zusätzliche Anstrengungen. Zunächst sind den Konfirmandinnen und Konfirmanden Gelegenheiten zu eröffnen, Gottesdienste auf eine ansprechende, jugendgemäße Art kennen zu lernen. Die Jugendlichen wollen nicht nur erfahren, »dass und inwiefern sich der christliche Glaube für sie als lebensrelevant erweist«8, sondern gleichzeitig auch eine Gemeinschaft erleben, in der sie sich sicher fühlen und die ihnen eine positive Stimmung und gute Ge-
fühle vermittelt.9 Um diesen hohen Ansprüchen der Jugendlichen zu genügen, müssen verschiedene Bedingungen erfüllt sein. In Bezug auf die Inhalte ist eine sorgfältige Auswahl der Themen notwendig, in welche die Konfirmandinnen und Konfirmanden miteinbezogen sind. Wichtig sind weiter die Bezugspersonen, die am Gottesdienst mitwirken und die Methoden, die zum Einsatz gelangen. Der Ablauf sollte kurzweilig und spannend gestaltet sein und den Jugendlichen Mitwirkungsmöglichkeiten einräumen. Auch jugendgerechte Musik ist von großer Bedeutung und es sind Kommunikationsformen einzusetzen, die zielgerichtet und kreativ sind. Wichtig sind zudem die Art der Werbung und die Ästhetik des Raums, welche dazu beitragen, dass die Konfirmandinnen und Konfirmanden überhaupt in die Gottesdienste kommen und sich dort wohlfühlen. Insofern sollten möglichst viele Gottesdienste – nicht nur Jugendgottesdienste und Gottesdienste in Jugendkirchen – »jugendsensibel«10 sein und die Erwartungen und Erfahrungen der Konfirmandinnen und Konfirmanden aufnehmen. Angesichts
8 Uta Pohl-Patalong / Friedrich Schweitzer, Konfirmandinnen und Konfirmanden, in: Thomas Böhme-Lischewski u.a. (Hg.), Konfirmandenarbeit gestalten. Perspektiven und Impulse für die Praxis aus der Bundesweiten Studie zur Konfirmandenarbeit in Deutschland, Gütersloh 2010, 26. 9 Karlo Meyer, Gottesdienst in der Konfirmandenarbeit. Der kritische Punkt, in: KU-Praxis 57, Gottesdienst von, für und mit Konfis, Gütersloh 2012, 11. 10 Vgl. Kirchenamt der EKD (Hg.), Kirche und Jugend. Lebenslagen, Begegnungsfelder, Perspektiven. Eine Handreichung des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Gütersloh 2010, 17ff.
Hochuli-Wegmüller Gottesdienste als Herausforderung der Konfirmationsarbeit
der Heterogenität der Jugendlichen stellt dies für alle Beteiligten eine große Herausforderung dar. Die Erfahrung von Gottesdiensten ist ein wichtiger Bestandteil der Konfirmationsarbeit. Die Konfirmandinnen und Konfirmanden sind daher in geeigneter Weise an Gottesdienste heranzuführen. Die in Deutschland durchgeführte Studie macht deutlich, dass diejenigen mit Gottesdiensten deutlich zufriedener sind, die jugendgemäße Gottesdienste selber erlebt und Gottesdienste selbst mit vorbereitet haben.11 Weiter steht fest, dass der Erfolg von Gottesdiensten zu einem wesentlichen Teil von gelingender Beziehungsarbeit abhängt. Beziehungsarbeit beginnt auf der Ebene raum-leiblicher Arrangements und setzt sich fort in der Achtsamkeit, mit der Inhalte und Musik getragen sind von einer Gruppe, die den Jugendlichen nahe steht.12 Die empirischen Daten belegen, dass Gottesdienste, die für Jugendliche attraktiv sind und an denen sie aktiv partizipieren, einen positiven Effekt auf ihre Wahrnehmung haben. Allerdings geben die Daten allein keinen Aufschluss darüber, wie die Partizipation konkret ausschauen soll und wie genau Gottesdienste für Konfirmandinnen und Konfirmanden attraktiv werden können.13 Hier besteht noch Klärungsbedarf. Obwohl die Mitarbeitenden es mehrheitlich befürworten, dass Konfirmandinnen und Konfirmanden immer wieder selbst Gottesdienste mitgestalten bzw. eigene Ideen in die Gottesdienstvorbereitung einbringen, hat dies offenbar weniger als ein Drittel der Jugendlichen erlebt.14 In der Praxis ist die Partizipation meistens auf die Mitwirkung und Mitgestaltung von Konfirmationsgottesdiensten ausge-
185
richtet. In der vorliegenden Betrachtung stehen allerdings nicht die Konfirmationsgottesdienste im Fokus, sondern vielmehr die breite Vielfalt des Gottesdienstangebots. 3. Zur Partizipation in Gottesdiensten
Die Partizipation in Gottesdiensten muss durch die Konfirmationsarbeit gefördert werden. Konfirmandinnen und Konfirmanden verfügen über ein großes Potenzial an Fähigkeiten und Kompetenzen. Die Gemeinden nutzen dieses Potenzial und eröffnen den Jugendlichen Mitwirkungs- und Mitgestaltungsmöglichkeiten. Daraus ergeben sich lebendige Gottesdienste und ein fruchtbarer Austausch der Generationen. Der Begriff »Partizipation« wird in den Schweizer Fragebögen für die Konfirmandinnen und Konfirmanden nicht explizit erwähnt. Es finden sich aber in den Fragen zu den Gottesdiensten verschiedene Hinweise darauf. So wird beispielsweise in der »Zürcher Studie« nach der Wichtigkeit bzw. dem Stellenwert gefragt, die Sonntagsgottesdienste
11 Vgl. Christoph Urban, Ansprechen, Mitarbeiten, Aktivieren. Beteiligung von Konfirmandinnen und Konfirmanden am Gottesdienst, in: KU-Praxis 57, Gottesdienst von, für und mit Konfis, Gütersloh 2012, 49–53. 12 Vgl. Karlo Meyer, Wie die Konfis zur Kirche kommen. Fragen, Erfahrungen, Konzepte, Göttingen 2012, 125f. 13 Wolfgang Ilg / Friedrich Schweitzer, Methodology, in: Friedrich Schweitzer / Wolfgang Ilg / Henrik Simojoki (Eds.), Confirmation Work in Europe: Empirical Results, Experiences and Challenges. A Comparative Study in Seven Countries, Gütersloh 2010, 35. 14 Vgl. Thomas Schlag / Rahel Voirol-Sturzenegger (wie Anm. 6), 212f, 201.
186
Religionspädagogische Anregungen
regelmäßig zu besuchen sowie die Frage gestellt, ob Gottesdienste mit vorbereitet wurden. In der »Schweizer Studie« werden die Konfirmandinnen und Konfirmanden danach gefragt, ob sie gerne mit eigenen Ideen zu den Gottesdiensten beitragen oder Aufgaben im Gottesdienst übernehmen würden, ob sie jugendgemäße Gottesdienste erlebt haben und ob es ihnen gefallen hat, alte und moderne Kirchenlieder zu singen. Damit sind verschiedene Ebenen von Partizipation angesprochen, die sich in drei Formen einteilen lassen: eine »formale Teilnahme«, eine »erhöhte Beteiligungsaktivität« und »erfahrungsorientierte, kreative Teilhabeprozesse«.15 Hier sind insbesondere die erfahrungsorientierten, kreativen Teilhabeprozesse als stärkste der drei Formen im Sinne von echter »aktiver Partizipation«16 im Blick. In der Konfirmationsarbeit ist grundsätzlich die »aktive Partizipation« der Jugendlichen anzustreben. Gottesdienste sind für Konfirmandinnen und Konfirmanden dann interessant, wenn ihre Themen zur Sprache kommen und sie bei der Vorbereitung, Durchführung und Gestaltung selber aktiv beteiligt sind.17 Je eigenständiger die Jugendlichen ihre Mitwirkung erleben, desto stärker sind ihre Eindrücke.18 Dabei müssen sich die Jugendlichen auch auf der emotionalen Ebene angesprochen fühlen.19 Im Rahmen von Gottesdiensten sollen sich ihnen »Möglichkeiten des Experimentierens und Einübens in gottesdienstliche und spirituelle Vollzüge« eröffnen, wobei ihre Interessen und Ideen noch stärker zu berücksichtigen sind.20 Die Eröffnung von Partizipationsmöglichkeiten ist auch deshalb wichtig, weil dadurch nachhaltiges Lernen
gefördert wird und »die Erschliessung christlicher Überlieferung in christlicher Tradition immer ein partizipativer Prozess ist«.21 In vielen Gemeinden ist eine breite Beteiligungskultur fester Bestandteil der Konfirmationsarbeit.22 Die Partizipationsmöglichkeiten von Konfirmandinnen und Konfirmanden im Zusammenhang mit Gottesdiensten sind vielfältig und können in den folgenden drei Perspektiven betrachtet werden: Partizipation vor, in und nach Gottesdiensten. Diese Perspektiven, die nun eben auch jugendtheologisch eminent anschlussfähig sind, schaffen zusammen ein Bewusstsein dafür, dass »Gottesdienst«-Lernen auf vielen verschränkten Ebenen stattfindet und der ganzheitliche Prozess der 15 Vgl. Thomas Schlag / Rahel Voirol-Sturzenegger (wie Anm. 6), 117–127. 16 Vgl. Thomas Schlag, Partizipation, in: Thomas Böhme-Lischewski u.a. (Hg.), Konfirmandenarbeit gestalten. Perspektiven und Impulse für die Praxis aus der Bundesweiten Studie zur Konfirmandenarbeit in Deutschland, Gütersloh 2010, 118ff. 17 Friedrich Schweitzer / Volker Elsenbast / Herbert Kolb, Inhalte und Themen, in: Thomas Böhme-Lischewski u.a. (Hg.), Konfirmandenarbeit gestalten. Perspektiven und Impulse für die Praxis aus der Bundesweiten Studie zur Konfirmandenarbeit in Deutschland, Gütersloh 2010, 131. 18 Karlo Meyer (wie Anm. 12), 37. 19 Ebd., 52. 20 Vgl. Thomas Schlag, Jugend und Kirche, in: Yvonne Kaiser u.a. (Hg.), Handbuch Jugend. Evangelische Perspektiven, Opladen, Berlin und Toronto 2013, 294. 21 Rahel Voirol-Sturzenegger, Kirchliche Religionspädagogik in der Schweiz. Reformierte Perspektiven am Beispiel des Zürcher Religionspädagogischen Gesamtkonzepts (rpg), Zürich 2014, 420. 22 Vgl. Thomas Schlag / Rahel Voirol-Sturzenegger (wie Anm. 6), 117.
Hochuli-Wegmüller Gottesdienste als Herausforderung der Konfirmationsarbeit
Gottesdienste dadurch vertieft werden kann.23 Durch persönliche Assoziationen und Gruppenbeziehungen vor Gottesdiensten eröffnen sich den Konfirmandinnen und Konfirmanden Möglichkeiten, Unbekanntes kennen zu lernen, mit verschiedenen Sinnen zu entdecken und Vorurteile sowie Fremdheitsgefühle abzubauen. Kirchenpädagogische Übungen erscheinen zu Beginn des Konfirmationsjahrs besonders wichtig, um die Jugendlichen mit den Orten, Angeboten und Menschen der Gemeinde vertraut(er) zu machen. Sind Konfirmandinnen und Konfirmanden bereit, sich darauf einzulassen, können sie eigene Zugänge zum christlichen Glauben entdecken sowie Gelegenheiten erhalten, über ihre Religiosität nachzudenken und dafür Sprache zu finden. Die zum Einsatz gelangende Methodenvielfalt kann die Jugendlichen zum »Theologisieren«24 anregen und bewirken, dass sie mit einer anderen Haltung an Gottesdiensten teilnehmen.25 Unterschiedliche Begegnungen fördern die Vernetzung der Konfirmandinnen und Konfirmanden und dienen damit auch dem Gemeindeaufbau.26 Im Hinblick auf die Perspektive in Gottesdiensten ist von Bedeutung, dass die Konfirmandinnen und Konfirmanden ihre Fragen und Ergebnisse aus der Konfirmationsarbeit in die Gottesdienste einbringen, mit Interesse bei den Vorbereitungen dabei sind und die Gottesdienste engagiert mitgestalten.27 Die Vorzeichen dafür sind günstig: Social Media wie Facebook und YouTube animieren Jugendliche zur Kreativität und Gemeinschaft. In Bezug auf Gottesdienste besteht die Herausforderung darin, bei den Konfirmandinnen und
187
Konfirmanden die Bereitschaft zu wecken, ihre Fähigkeiten an dieser Stelle kreativ einzubringen. Dies dürfte am ehesten gelingen, wenn der sog. »Spaß«Faktor stimmt. »Spaß« meint hier nicht einfach »Unterhaltung« oder »Fun«, sondern »Selbstwirksamkeit, Lebensfreude, Humor, Lockerheit und das spielerische Einüben von Fertigkeiten, die das eigene Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl heben«.28 Im Blick sind damit gleichzeitig Erfolgserlebnisse und positive Lernerfahrungen. 23 Karlo Meyer, Was hat dir am letzten Gottesdienst gefallen? »… dass ich mitmachen konnte«. Lerndimensionen beim Thema »Gottesdienst« in der Arbeit mit Konfirmandinnen und Konfirmanden, in: Thomas Schlag / Rudi Neuberth / Ralph Kunz (Hg.), Konfirmandenarbeit in der pluralistischen Gesellschaft. Orientierungen – Deutungen – Perspektiven, Zürich 2009, 231. 24 Vgl. Veit-Jakobus Dieterich, Theologisieren mit Jugendlichen als religionsdidaktisches Programm für die Sekundarstufe I und II, in: Petra Freudenberger-Lötz / Friedhelm Kraft / Thomas Schlag (Hg.), »Wenn man daran noch so glauben kann, ist das gut«. Grundlagen und Impulse für eine Jugendtheologie, Jahrbuch für Jugendtheologie, Band 1, Stuttgart 2013, 36f. 25 Vgl. Martin Hinderer, Gestaltungs- und Spielräume des Glaubens entdecken. Kirchenpädagogische Übungen mit Konfirmandinnen und Konfirmanden, in: Thomas Schlag / Rudi Neuberth / Ralph Kunz (Hg.), Konfirmandenarbeit in der pluralistischen Gesellschaft. Orientierungen – Deutungen – Perspektiven, Zürich 2009, 205f. 26 Elisabeth Wyss-Jenny, Begegnung der Generationen, in: Thomas Schlag / Rudi Neuberth / Ralph Kunz (Hg.), Konfirmandenarbeit in der pluralistischen Gesellschaft. Orientierungen – Deutungen – Perspektiven, Zürich 2009, 220. 27 Hans-Martin Lübking, Kursbuch Konfirmation. Das neue Programm. Ein Praxisbuch für Unterrichtende in der Konfirmandenarbeit, Düsseldorf 2006, 10. 28 Kirchenamt der EKD (wie Anm. 10), 40.
188
Religionspädagogische Anregungen
Diese Erkenntnis kann nicht nur während eines Gottesdienstes Geltung beanspruchen, sondern auch im Anschluss daran. In der Perspektive nach Gottesdiensten geht es darum, dass die Beteiligten miteinander ins Gespräch kommen und sich über das zuvor gemeinsam Erlebte austauschen können. Für die partizipierenden Konfirmandinnen und Konfirmanden sind die Rückmeldungen der Besucherinnen und Besucher sehr wichtig und letztlich wohl ausschlaggebend für die Motivation zur weiteren Mitwirkung und Mitgestaltung von Gottesdiensten. Trotz der zahlreichen, positiv zu wertenden Partizipationsmöglichkeiten ist darauf hinzuweisen, dass die Mitgestaltung durch Konfirmandinnen und Konfirmanden in Gottesdiensten auf einige (wenige) Stellen beschränkt sein sollte – und dies auch darf.29 Die Gottesdienste sollten nicht überladen sein und sind wohl dann am besten gelungen, wenn sie als Teamwork aller Mitwirkenden sozusagen als stimmig erlebt werden. Damit ist wiederum die Beziehungsarbeit angesprochen: »Gute Stimmung und Gemeinschaft sind nicht alles, aber ohne gute Stimmung und Gemeinschaft ist alles nichts.«30 »Aktive Partizipation« ist nicht allein Aufgabe der Jugendlichen. Sie erfordert vielmehr die Bereitschaft aller Beteiligten zur intensiven Auseinandersetzung. Die Mitarbeitenden müssen bereit sein, den Konfirmandinnen und Konfirmanden »Gestaltungsraum in der Kirche zu überlassen und Verantwortung zu übertragen«.31 Sie dürfen den Jugendlichen etwas zutrauen und ihnen auch etwas zumuten. Und die Jugendlichen müssen sich trauen, zu partizipieren und selber Verantwortung zu übernehmen. Dabei ist die Mitbestimmung der Konfirman-
dinnen und Konfirmanden bei Inhalten und Themen, Musik und Liedern sowie Methoden zentral. Das gemeinschaftliche Zusammenspiel zwischen Mitarbeitenden und Jugendlichen kann wichtige Möglichkeiten und positive Erlebnisse nicht nur für die Gegenwart eröffnen, sondern die Identifikation mit der Kirche auch langfristig stärken. Freiwilliges Engagement von Jugendlichen dürfte sich aber nur dort entfalten, wo diese »mit ihren ganz persönlichen Fähigkeiten gefragt und willkommen sind«.32 Im Rahmen gelingender Beziehungsarbeit ist nicht nur die Offenheit der Mitarbeitenden und Konfirmandinnen und Konfirmanden Voraussetzung. Vielmehr muss auch die Gemeinde zur Unterstützung der Jugendlichen bereit sein und ihnen vermitteln können, dass sie in den Gottesdiensten willkommen sind und in der »Mitte der Gemeinde« ihren Platz haben. Wenn verschiedene Akteure einer Gemeinde gemeinsam für die Konfirmandinnen und Konfirmanden verantwortlich sind, zeigt dies »Auswirkungen auf die gesamte Gemeindearbeit und insbesondere auf die Gottesdienste in dieser Gemeinde«.33 29 Markus Beile, Reise durch die Welt des Glaubens. Ein Konfi-Kurskonzept für 9 Samstage und ein Wochenende, Gütersloh 2012, 39. 30 Karlo Meyer (wie Anm. 12), 79. 31 Evangelisch-reformierte Landeskirche des Kantons Zürich (Hg.), Konf. Wir leben in Beziehungen. Arbeitshilfe für die Konfirmationsarbeit mit 2 Begleit-DVDs und 103 Karten [Eure Wahl!], Zürich 2014, 343. 32 Thomas Schlag / Rahel Voirol-Sturzenegger (wie Anm. 6), 97. 33 Vgl. Sönke von Stemm / Karlo Meyer, Gottesdienste, in: Thomas Böhme-Lischewski u.a. (Hg.), Konfirmandenarbeit gestalten. Perspektiven und Impulse für die Praxis aus der Bundesweiten Studie zur Konfirmandenarbeit in Deutschland, Gütersloh 2010, 84f.
Hochuli-Wegmüller Gottesdienste als Herausforderung der Konfirmationsarbeit
Die Feier jugendgemäßer Gottesdienste ist folglich nicht nur für die Konfirmandinnen und Konfirmanden ein Gewinn, sondern inspiriert die ganze Gemeinde. Die Jugendlichen können als Teil der Gemeinde eine neue Sicht auf Glaubens- und Lebensfragen einbringen und bereichernde Denkanstöße liefern. So kann es zu einem fruchtbaren Austausch zwischen den Generationen kommen und dazu, dass Gemeinden zusammenwachsen oder der Zusammenhalt zumindest gefördert wird.34 In diesem Sinne machen jugendgemäße Gottesdienste die Gemeinden attraktiver und leisten einen wertvollen Beitrag zur Gemeindeentwicklung. 4. Jugendtheologische Konsequenzen
Welche Konsequenzen ergeben sich daraus in jugendtheologischer Perspektive für die Kommunikation von und mit Jugendlichen vor, in und nach Gottesdiensten? Ausgehend von der Tatsache, dass in der Konfirmationsarbeit und auch im Hinblick auf Gottesdienste in der Schweiz eine hohe inhaltliche und formale Gestaltungsfreiheit besteht, sind die Jugendlichen, Mitarbeitenden und Gemeinden dazu aufgefordert, »auf einem gemeinsamen Weg der Glaubenssuche« ihre Erfahrungen, Fragen und Antworten miteinander auszutauschen.35 Hierfür braucht es verschiedene »Formen authentischer und offener inhaltsbezogener Kommunikation«, welche auch die Komplexität biblischer Überlieferung und theologischer Interpretation einbeziehen.36 Im Sinne der Theologie von Jugendlichen sind die Vorstellungen der Konfirmandinnen und Konfirman-
189
den von sich selbst, der Welt und Gott zentral. Diese Vorstellungen müssen die Jugendlichen im Zusammenhang mit der Planung von Gottesdiensten sich selbst bewusst machen und zusammen entfalten. Darauf aufbauend stehen im Rahmen der Theologie mit Jugendlichen das gemeinsame theologische Nachdenken und der partnerschaftliche Dialog von Jugendlichen und Mitarbeitenden im Fokus. Dabei soll es zu einer wechselseitigen Durchdringung der je eigenen Positionen und der christlichen Tradition kommen mit dem Ziel, dass beide für die Jugendlichen klarer werden und ihre Deutungs-, Entscheidungs- und Handlungskompetenz zunimmt.37 Entsprechend sind auch die Konfirmandinnen und Konfirmanden in der Pflicht, bei den in Gottesdiensten zur Sprache kommenden Themen mitzubestimmen.38 Bei der Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Gottesdiensten sind die Mitarbeitenden also dazu herausgefordert, die Konfirmandinnen und Konfirmanden mit ihren Fragen und Antworten sowie ihren Fähigkeiten und 34 Gabriele Persch, Gottesdienste mit Jugendlichen, Göttingen 2009, 12. 35 Vgl. Thomas Schlag / Friedrich Schweitzer, Jugendtheologie in der Praxis von Schule und Gemeinde: Religionsunterricht, Konfirmandenarbeit und Jugendarbeit, in: Thomas Schlag / Friedrich Schweitzer u.a., Jugendtheologie. Grundlagen – Beispiele – kritische Diskussion, Neukirchen-Vluyn 2012, 28f. 36 Thomas Schlag / Rahel Voirol-Sturzenegger (wie Anm. 6), 109. 37 Vgl. Jörg Conrad, Theologie mit Jugendlichen, in: Thomas Böhme-Lischewski u.a. (Hg.), Konfirmandenarbeit gestalten. Perspektiven und Impulse für die Praxis aus der Bundesweiten Studie zur Konfirmandenarbeit in Deutschland, Gütersloh 2010, 160ff. 38 Ebd., 163.
190
Religionspädagogische Anregungen
Kompetenzen ernst zu nehmen. Weiter sehen sie sich mit der Herausforderung konfrontiert, sich auf die Wahrnehmungen und Vorstellungen der Konfirmandinnen und Konfirmanden einzulassen, ohne dabei die eigene Kompetenz auszublenden.39 Konkret geht es nicht nur um die Reflexion und Kommunikation von religiösen Vorstellungen, sondern auch um den Versuch, die Vernetzung dieser Reflexions- und Kommunikationsformen mit Gefühlen, Einstellungen, Handlungsweisen und unterschiedlichen Ausdrucksformen aufzuzeigen.40 Die Jugendlichen sind als Theologen anzuerkennen und ihre Deutungen wertzuschätzen.41 Damit rückt der Lebensbezug der Jugendlichen ins Zentrum und für Gottesdienste werden diejenigen Themen relevant, die den jungen Menschen am Herzen liegen. Die Mitarbeitenden können weiterführende Antworten anbieten und schlüpfen in verschiedene Rollen: Sie begleiten die Jugendlichen als Expertinnen und Experten, sind aufmerksame Beobachterinnen und Beobachter sowie stimulierende Gesprächspartner.42 Letztlich muss aber gemeinsam um Antworten gerungen werden, welche dann von den Konfirmandinnen und Konfirmanden sowie den Mitarbeitenden authentisch und überzeugend vor, in und nach Gottesdiensten kommuniziert werden.43 Dies kann es zudem ermöglichen, im Austausch mit der Gemeinde den Prozess des gemeinsamen theologischen Nachdenkens auszuweiten und fortzusetzen.44 In Bezug auf Gottesdienste geht es somit nicht um noch attraktivere Ausgestaltungen oder noch intensivere Er-
lebnisproduktionen.45 Vielmehr braucht es eine »theologische Kommunikationsund Deutungspraxis«, bei der die Theologie der Jugendlichen und das Theologisieren mit Jugendlichen von Seiten der Konfirmandinnen und Konfirmanden aus auf wesentliche Anknüpfungspunkte bauen und vertrauen kann. Daher ist für eine »theologische Perspektivenverdichtung im Sinn einer intensiveren Berücksichtigung der theologischen Faktoren« zu plädieren.46 Wenn die theologischen Vorstellungen und Gedanken der Jugendlichen ernst genommen werden, kommen ihre Fragen und Antworten tatsächlich zum Zug. Konfirmandinnen und Konfirmanden können dann auch erleben, dass »die Gehalte der christlichen Tradition durchaus etwas mit ihnen und ihrem Leben zu tun haben, wenn sie sie selbst damit verknüpfen können«.47 Damit kann sich der christliche Glaube für sie als unmittelbar lebensrelevant erweisen und für die ganze Gemeinde ein Gewinn sein. 39 Thomas Schlag / Friedrich Schweitzer, Rückfragen – Klärungen – Perspektiven, in: Thomas Schlag / Friedrich Schweitzer u.a., Jugendtheologie. Grundlagen – Beispiele – kritische Diskussion, Neukirchen-Vluyn 2012, 179. 40 Ebd., 174. 41 Ebd., 167. 42 Jörg Conrad (wie Anm. 37), 167. 43 Vgl. Thomas Schlag / Friedrich Schweitzer (wie Anm. 39), 170f. 44 Jörg Conrad (wie Anm. 37), 171. 45 Thomas Schlag / Rahel Voirol-Sturzenegger (wie Anm. 6), 111. 46 Ebd., 109f. 47 Vgl. Uta Pohl-Patalong / Friedrich Schweitzer (wie Anm. 8), 28f.
Mürle Kirche und Gemeinde bei Jugendlichen an Berufsschulen
191
Markus Mürle Kirche und Gemeinde bei Jugendlichen an Berufsschulen
1. Forschungshintergrund und Datenbasis
Im Folgenden wird auf Äußerungen von 309 Jugendlichen und jungen Erwachsenen Bezug genommen, die einer 2012 durchgeführten Befragung an zwölf Beruflichen Schulen in Baden-Württemberg entnommen sind. Um die gewonnenen Daten einordnen zu können, werden leitende Fragestellung und Methodik des Forschungsprojekts vorweg kurz skizziert: Ausgangspunkt bildet der nachhaltige Impuls, den die religionspädagogische Diskussion durch die 1984 von Robert Schuster1 unkommentiert veröffentlichten 1236 Texte von Schülerinnen und Schülern zur Gottesfrage an Beruflichen Schulen2 in Württemberg erhalten hat. Bekanntlich stellte Nipkows Auswertung der Textsammlung3 eine markante Initialzündung für die genannte Diskussion dar. Seine aus den Texten erhobenen vier »Einbruchsstellen« des Gottesglaubens bilden hierfür bis heute eine grundlegende Matrix. Auch das Kirchenverhältnis zählt dazu, allerdings wurde die von Nipkow hervorgehobene Theodizeefrage in der Fachliteratur am stärksten rezipiert4. Knapp 30 Jahre nach der Veröffentlichung der genannten Texte lassen sich so zwei Forschungsfragen formulieren: 1. Welche Themen induziert eine ähnlich angelegte Befragung bei Berufsschüle-
rinnen und -schülern (BS) heute? 2. Welche Erkenntnisse ergeben sich damit im Blick auf die erwähnten Diskussionslinien bezüglich der Schuster-Texte? Um dies beantworten zu können, wurde eine offene Befragung in Anlehnung an Schuster entworfen. Die BS sollten schriftlich mindestens einen Satzanfang oder eine Frage nach Wahl beantworten: 1 Robert Schuster, Was sie glauben, Texte von Jugendlichen, Stuttgart 1984. 2 Die im Folgenden verwendete Abkürzung BS für Schülerinnen und Schüler an Beruflichen Schulen schließt alle dort vertretenen und untersuchten Schularten wie Berufliches Gymnasium, Fachschule und Berufskolleg ein. 3 Karl Ernst Nipkow, Erwachsenwerden ohne Gott? Gotteserfahrung im Lebenslauf, München 1987. 4 Die »Einbruchstellen« lauten: Gott – Garant des Guten? (Theodizee, emotionale Ebene); – Erklärung von Welt, Leben und Tod? (Weltbild, kognitive und pragmatische Ebene); – bloßes Symbol? (Fiktion, semantische Ebene); – kirchlich verbürgt? (Kirche und Christentum, soziale Ebene). Die beiden positiven Aufnahmen des Gottesglaubens bei den BS (Gott als Freund und unbedingte Liebe) haben keine vergleichbare Resonanz in der Diskussion von Nipkows Thesen erfahren – möglicherweise liegt das daran, dass Nipkow diese selbst auch mit einer gewissen Skepsis bewertet. Zur anhaltenden Debatte um Begriff, Inhalte und Bewertung der »Einbruchstellen« sei exemplarisch verwiesen auf die 2013 erschienenen Beiträge von Eva-Maria Stögbauer und Petra FreudenbergerLötz im Jahrbuch für Jugendtheologie, Band 1, sowie auf Gerhard Büttner / Veit-Jakobus Dieterich, Entwicklungspsychologie in der Religionspädagogik, Stuttgart 2013.
192
Religionspädagogische Anregungen
Satzanfänge: – Gott ist … – Ich glaube an Gott, weil … – Ich glaube nicht an Gott, weil … – Ich habe Mühe mit dem Glauben, weil … Fragen: – Woran denken Sie bei dem Wort »Gott«? – Worauf verweist das Wort »Gott«? Die generierten Beiträge werden, entsprechend der Forschungsfragen, folgendermaßen ausgewertet: Mittels eines an der »Grounded Theory« angelehnten induktiven Verfahrens werden zentrale Kategorien entwickelt5, um die wesentlichen Themen der BS zu erfassen. Eine inhaltsanalytische Untersuchung ausgewählter Texte6 dient dazu, die zentralen Themen exemplarisch darzustellen und einzelne Schülerarbeiten zu würdigen. Gleichzeitig können die so erfassten Themen als Vergleichsschnittstellen genutzt werden, um das gesamte Sample im Blick auf die genannten theoretischen Diskussionslinien im Gefolge der Schuster-Texte auszuwerten. In Bezug auf das hier interessierende Thema »Kirche und Gemeinde« sollen dementsprechend sowohl ein Einzeltext als auch Grundlinien des gesamten Samples vorgestellt werden. 2. Schwerpunkte der Jugendforschung
Doch zunächst: Welche Erkenntnisse liefert die Forschung seit Veröffentlichung der Schuster-Texte? Obwohl das Verhältnis von BS zu Kirche bzw. Gemeinde nicht den Hauptgegenstand bisheriger
Befragungen an Beruflichen Schulen darstellt, zeichnen sich einige Konturen ab: In der genannten Auswertung von 1987 ordnet Nipkow dieses Verhältnis ein unter die Gesamttendenz einer »lapidare[n] Verabschiedung Gottes« (49). Die Frage »Gott – glaubhaft verbürgt in der Kirche?« (76–78) zählt er zu den »vier Entscheidungsfelder[n] bzw. Einbruchstellen für den Verlust des Gottesglaubens« (49, kursiv im Original). Der stark rezipierte Begriff der »Einbruchstelle« hat demnach schon bei Nipkow ein deutliches Übergewicht gegenüber der neutraleren Formulierung »Entscheidungsfeld«. Dem neutraleren Begriff lassen sich noch Äußerungen zuordnen, die auf eine personale Vermittlung von Glauben bezogen sind: den BS ist wichtig, wer aus ihrem Umfeld glaubt und wie viele Menschen glauben. Doch schon hier, wie bei dem Argumentieren mit der historischen Wirksamkeit des Christentums, spricht Nipkow von einem »schwankenden Boden«, auf dem die »religiöse Bindung« der Jugendlichen stehe. »Am wichtigsten ist jedoch offensichtlich, wie an Gott geglaubt wird, und hier spielt fast nur ein Punkt eine Rolle: die Übereinstimmung zwischen Reden und Handeln.« Die »Kritik an der mangelnden Glaub5 Ausgehend von einem »offenen Kodieren« entspricht der Grad der hier angestrebten Kategorienbildung (Software: MAXQDA) dem Niveau der »axialen« Ebene; vgl. Anselm L. Strauss / Juliet Corbin, Grounded Theory. Grundlagen qualitativer Sozialforschung, Weinheim 1996. 6 Mit Mitteln der Qualitativen Inhaltsanalyse nach Philipp Mayring, Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken, Weinheim 2010.
Mürle Kirche und Gemeinde bei Jugendlichen an Berufsschulen
würdigkeit christlicher Lebensführung« (77, kursiv im Original) beziehe sich auf Gegenwart, Kirchengeschichte sowie die Zuverlässigkeit biblischer Überlieferungen. Auffällig ist der Kontrast, den Nipkow aufbaut: Passt die lapidare, nachchristliche Verabschiedung Gottes zur Massivität und Ernsthaftigkeit der Vorwürfe? Wollen die BS tatsächlich eine christliche Lebensführung einklagen? Oder erleichtert die oft vehemente Kritik lediglich besagten Abschied? 1989 markiert H. Schmid in seiner Untersuchung von »Cliquen« in einer fränkischen Kleinstadt7 eine Spannung, die auch in der Jugendforschung außerhalb des Beruflichen Schulsystems immer wieder eine Rolle spielt.8 Er stellt fest, dass alle Gruppen einen schwer artikulierbaren und kaum kommunizierten »IrgendwieGlauben« an einen »Irgendwie-Gott« aufwiesen (201f). Dieser zeige sich z.B. in einer »lebensweltliche[n] Verankerung des Gebets« (195). Andererseits werden »negative Gegenhorizonte« etabliert: »Vieles, ja das Meiste an der überkommen Religiosität von Kirche und Glaube wird gleichsam zum Gegenbild dessen, was die Jugendlichen selbst wollen, worin sie sich und ihresgleichen verorten« (202). Die Härte der Urteile differiere in den Gruppen, was den unterschiedlichen Motiven für die vorgenommene Abgrenzung entspreche. Zwei Beispiele (202ff): Bei einer Lehrlingsgruppe (Jungen) wird das Bedürfnis nach rationalem »Theoretisieren und Philosophieren« (inkl. Theodizee und Illusionsverdacht) ausgemacht – bei gleichzeitiger »eigener potentiell bejahte[r] Religi-
193
osität« (Gebet in Krisensituationen). Bei einer Lehrlingsgruppe (Mädchen) spielt die Abgrenzung von der »eigenen repressiven religiösen Erziehung« und einem unmündigen Kinderglauben eine maßgebliche Rolle. Beide Gruppen »setzen sich […] zentral mit der sozialen Gestalt der überkommenen Religiösität [sic] auseinander: mit der traditionellen Kirchlichkeit in der Perspektive eines negativen Gegenhorizontes« (205). Im Unterschied zu Nipkows Diagnose stehen dabei Fremdheit und Zwang kirchlicher Vollzüge im Vordergrund. 1990 hat Nipkow die Schuster-Texte erneut gesichtet. Diesmal unter der Frage, inwiefern Ökumene – vom konfessionellen Verhältnis bis hin zum weltweiten Prozess – »ein Thema von Jugendlichen« darstellt9. Ernüchtert konstatiert er, dass diesbezüglich 7 Hans Schmid, Religiosität der Schüler und Religionsunterricht. Empirischer Zugang und religionspädagogische Konsequenzen für die Berufsschule, Bad Heilbrunn 1989. 8 Exemplarisch: Trotz hohen konfessionellen Anteils der Befragten sehen diese keinen Zusammenhang von Glaube und Kirche: Hans-Georg Ziebertz / Boris Kalbheim / Ulrich Riegel, Religiöse Signaturen heute. Ein religionspädagogischer Beitrag zur empirischen Jugendforschung, Gütersloh 2003; Kirche als Gegenpol aktueller Selbstund Umweltkonzeption: Holger Oertel, »Gesucht wird: Gott?« Jugend, Identität und Religion in der Spätmoderne, Gütersloh 2004; Abgrenzung individueller Religiosität mittels traditioneller Semantik (Tradition als notwendiger Katalysator): Andreas Prokopf, Religiosität Jugendlicher. Eine qualitativ-empirische Untersuchung auf den Spuren korrelativer Konzeptionen, Stuttgart 2008. 9 Karl Ernst Nipkow, Ökumene – Ein Thema von Jugendlichen? Empirische Annäherungen, in: Friedrich Johannsen / Ulrich Becker (Hg.), Lernen für eine bewohnbare Erde, Gütersloh 1990, 137–147.
194
Religionspädagogische Anregungen
kaum Interesse bestehe und wenig Kenntnisse greifbar würden.10 Zwei beschreibbare Zugänge zeichnen sich ab: 1. Dem häufig von den BS erhobenen Vorwurf kirchlicher bzw. religiöser Intoleranz entsprechen »Unverständnis und Ablehnung gegenüber bestehenden Unterschieden zwischen den christlichen Konfessionen sowie darüber hinaus Gleichgültigkeit gegenüber den Unterschieden zwischen den Religionen« (140). 2. Religiöse Pluralität scheint zu irritieren, weil hier eine Spannung bestehe zwischen religiösen Wahrheitsansprüchen und einer Sicht von Religion als menschlichem Erzeugnis. Nahezu resigniert spricht Nipkow von einem »zweistufigen Zerfallsprozess«, der sich in einer »nachkonfessionellen« bzw. »nachchristlichen« Bewusstseinslage manifestiere (145f): Aufgrund einer von vorne herein eingenommenen relativistischen und Differenzen nivellierenden Grundposition würde neben einem ökumenischen auch ein interreligiöser Dialog unterlaufen. Anders als Nipkow könnte man in dieser Konstellation zumindest Ansätze einer von den Jugendlichen als notwendig erachteten »Theologie der Religionen« erkennen. Unabhängig davon kann aufgrund derartiger Befunde das Kirchen- bzw. Gemeindeverhältnis von BS ohne Einbeziehung einer globalen und interreligiösen Perspektive offenbar nicht mehr angemessen bearbeitet werden. Interessant für unseren Zusammenhang sind die religionssoziologischen Bezüge, die A. Bucher für das auf BS bezogene Teilsample (563 BS, Raum Mainz/Frankfurt) herstellt11. Hier
sind »6 % … religiös stark sozialisiert, 31 % mittelmäßig, 63% schwach.« »Bezeichnend ist, dass die Befragten ihren Großeltern signifikant mehr Kirchlichkeit attestieren. […] Im Vergleich dazu ist die Kirchenpraxis der jungen Generation dramatisch eingebrochen.« (117). 71% charakterisieren sich als kirchenfern, 14% als der Kirche nah (135). In ihrer Auffassung von Kirche sind die BS im Vergleich mit anderen Schularten deutlich distanzierter: »Während … Grundschüler/ innen [Kirche] zu 88% attestieren, den richtigen Glauben zu verbürgen, sind es die Berufsschüler/innen zu zehn Prozent. 97% streiten ihr ›das Recht‹ ab, ›den Menschen zu sagen, wie sie leben sollen‹.«12 (137). Indes macht Bucher auf eine bemerkenswerte Korrelation aufmerksam: Einerseits binden die Befragten vor diesem Hintergrund »ihre Identität nur mehr wenig an ihrer Religions- bzw. Konfessionszugehörigkeit fest« (120). Andererseits würden die zur Selbsteinschätzung angebotenen Merkmale »gläubig« – »religiös« – »kirchennah« signifikant interkorrelieren: »Subjektiv eingeschätzte Religiosität und Gläubigkeit sind von Kirchlichkeit doch nicht so massiv und unwiderruflich abgekoppelt, wie oft behauptet wird. […] Eher 10 Noch einmal muss betont werden, dass Kirche/Ökumene nicht das explizite Thema der Befragung darstellt. 11 Anton A. Bucher, Religionsunterricht zwischen Lernfach und Lebenshilfe. Eine empirische Untersuchung zum katholischen Religionsunterricht in der Bundesrepublik Deutschland, Stuttgart 2001. 12 Diese klare Haltung entspricht dem von Schmid festgestelltenBedürfnis, gegen kirchlichen Zwang zu opponieren.
Mürle Kirche und Gemeinde bei Jugendlichen an Berufsschulen
zieht der Rückgang an Kirchlichkeit auch einen Schwund von Religiosität und Gläubigkeit nach sich« (136). Damit dürfte die religionssoziologische Perspektive einen wichtigen Beitrag zur Bewertung der bei Schmid u.v.a. erwähnten Spannung von »eigener« und »kirchlicher« Religiosität bzw. Religion liefern. Unter rezeptionsästhetischem Vorzeichen wurden in der umfangreichen Studie mit 8000 BS von Feige / Gennerich13 »Gefühlsassoziationen« zum Wort »Kirche« bzw. »Moschee« erhoben. Die Befragungs-Variablen luden wie folgt auf drei Faktoren (182): Variablen in Reihenfolge der Gewichtung (stark schwächer) innerhalb des jeweiligen Faktors
Faktor: Gefühlswahrnehmung …
Heiliger Ort – Ruhe, Stille – Würde – Geheimnis – Erhabenheit
1. … eines bedrohungsfreien, dem Individuum verdeckt zugewandten und zugleich letztlich unfassbaren ›Gegenübers‹
Sehnsucht nach mehr – zu Haus sein – Freude – Erinnerung an die Kindheit
2. … einer das Individuum umhüllend-schützenden Beheimatung
Beklemmung – nicht dazu gehören – Moder, Muffigkeit
3. … einer das Individuum ausschließenden, altersgruppenfernen Fremdheit
Bei allen Abweichungen durch konfessionslose und muslimische BS erzeugten im Gesamten die Variablen »Ruhe, Stille«, »Heiliger Ort« und »Würde« die stärkste Resonanz. »›Moder, Muffigkeit‹ und ›Beklemmung‹ gehören mehrheitlich nicht zu den Gefühls-›Echos‹: Das
195
Image von ›unmodern‹ für ›Kirche‹ / ›das Kirchliche‹ scheint sich stillschweigend erledigt zu haben.« (33) Weiter wird festgestellt, dass »Gemeinschaft« als »Tatbestand des Sozialen und nicht des Religiös-Institutionellen« wahrgenommen werde und positiv eher mit Beheimatung als mit sozialer Kontrolle konnotiert sei (189ff ). Um unter diesem Vorzeichen entstehende Kirchenverhältnisse zu charakterisieren, verwenden die Vf. den Begriff des »religiösen Flaneurs«. Dieser lasse sich, permanent oszillierend zwischen »Gemeinschaftssehnsucht« und »Verbot, sich substantiell festzulegen«, »institutionell kaum einfangen« (363). Fundamentalistische Tendenzen scheinen demgegenüber insgesamt marginal. Über ihren Zugang gewinnen die Autoren positivere Interpretationsmöglichkeiten für Phänomene der Kirchen- und Gemeindeferne, als die bisher hierzu aufgeführten Befunde es nahelegen könnten. Die in allen Forschungsarbeiten festgestellte Distanz, die BS mit ihrer eigenen, mehr oder weniger religiösen Welt zur kirchlichen Welt einnehmen, findet also eine unterschiedliche Beurteilung: Für Nipkow kann die Ernsthaftigkeit des ethischen Vorwurfs den Abschied von Glauben überhaupt einleiten. Geschichtlich gewachsene, differente Formen »positiver Religion« werden angesichts einer Glo13 Andreas Feige / Carsten Gennerich, Lebensorientierungen Jugendlicher: Alltagsethik, Moral und Religion in der Wahrnehmung von Berufsschülerinnen und -schülern in Deutschland; eine Umfrage unter 8.000 Christen, Nicht-Christen und Muslimen, Münster 2008. (Kursive Seitenangaben nach der Online-Ausgabe: comenius.de/biblioinfothek/open_access_pdfs/feige/textband.pdf, Zugriff: 201601-08).
196
Religionspädagogische Anregungen
balperspektive auf Religion(en) relativiert und spielen lebenspraktisch kaum noch eine Rolle. Während Bucher auf die bleibende Wirksamkeit soziologischer Faktoren aufmerksam macht und damit auf den Einfluss von tatsächlich er- und gelebter kirchlicher »positiver Religion«, löst sich der von Nipkow markierte ethische und theologische Problemdruck bei Feige / Gennerich durch eine vornehmlich ästhetische Betrachtungsweise (»Image« von Kirche) teilweise auf: Kirchliche Statik könnte sich verflüssigen, Gemeinde sich auf fluide Gemeinschaftsformen einstellen. Schmids Beobachtungen unterstreichen die bleibende Berechtigung entwicklungspsychologischer Erklärungsbeiträge (Abgrenzungsbedürfnisse). 3. Ein exemplarischer Einzeltext
Wieder gilt es zu berücksichtigen, dass auch in der Untersuchung von 2012 die Äußerungen zum Thema Kirche/Gemeinde nicht direkt abgefragt, sondern indirekt über die Gottesfrage ausgelöst wurden. Der ausgewählte und in Auszügen wiedergegebene Einzeltext stammt von einer 18-jährigen evangelisch-freikirchlichen Schülerin eines Ernährungswissenschaftlichen Gymnasiums, JS 114: Ich glaube an Gott, weil ich schon als kleines Kind von meinen Eltern mit in die Gemeinde genommen wurde. Als Kind war ich jeden Sonntag in der Sonntagsschule, was mich sozusagen schon in diese Richtung gelenkt hat. Mit ca. 10 Jahren habe ich mich dann »bekehrt«. Als Kind ist es einfach an Gott zu glauben und an ihm festzuhalten, als ich jedoch ins Teenageralter kam #fing ich an vieles zu hinterfragen# hatte ich nicht mehr so gro-
ße Lust in der Gemeinde oder in der Teengruppe mitzuwirken, jedoch ging ich weiterhin regelmäßig hin, zum einen weil es eine Art Gewohnheit war, zum anderen weil ich keine Diskussion mit meinen Eltern wollte. Irgendwann [oben eingefügt:] mit ca. 16 Jahren [Einfügung Ende] fing ich an mich bewusst mit der Gottesfrage auseinander zusetzen, alles zu hinterfragen und das geht bis zum heutigen Zeitpunkt so. Ich weiß, dass es Gott gibt auch wenn ich öfters mal daran zweifle nur fällt es mir sehr schwer Ihn in meinen Alltag einzubeziehen. Ein Großteil meiner Freunde sind auch »Christen«, meine Familie, meine Verwandtschaft auch. Somit werde ich immer von diesem Thema umgeben sein. Ich wünschte ich könnte ein echter Christ sein, jedoch scheitere ich im Alltag an diesem Vorhaben. Bsp.weise in der Schule: Den größten Teil meiner Zeit verbringe ich in der Schule mit meinen »nichtchristlichen« Freunden und auch das beeinflusst mich. […] Was mich an Gott zweifeln lässt, ist zum einen, dass ich nicht glauben kann, dass er wirklich in meinen Leben wirksam werden kann. Manchmal funktionieren Dinge im Leben und manchmal nicht. Christen sagen, dass die Dinge, die positiv sind von Gott kommen, sie nennen es Wunder, Gottesführung etc. Nichtchristen sehen eher die negativen Dinge und verwenden diese als Begründung dafür, dass es keinen Gott gibt, und die positiven Dinge werden als Glück oder Selbstverdient bezeichnet. Man könnte also sagen, dass alles nur Interpretationssache ist […] Ein anderer Grund, durch den es mir schwer fällt an Gott zu glauben, ist, denke ich, der Selbstzweifel der an mir nagt. Es heißt, dass Gott jeden liebt und jeden annimmt so wie er ist. Jedoch scheint mir diese Vorstellung 14 Die Transkriptionen geben die Texte ohne Korrekturen wieder. Mit #…# gekennzeichnet sind durchgestrichene Satzteile, Anmerkungen zur Transkription sind in […] gesetzt.
Mürle Kirche und Gemeinde bei Jugendlichen an Berufsschulen
von einem liebenden Gott einfach zu unrealistisch und zu perfekt. […] ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie mich jmd. genau so wie ich bin annimmt, geschweige denn lieben kann. #Ich weiß# Mit meiner Meinung sitze ich also zwischen zwei Stühlen und ich weiß, dass ich mich entscheiden muss. Für oder gegen Gott!? Noch schiebe ich diese Entscheidung vor mir her. […] Zurzeit bin ich also irgendwie Teil-ZeitChrist, ich spiele Klavier in unserer Lobpreis-Band, wenn ich mitsinge, weiß ich jedoch nicht ob ich es auch so meine. Ich fühle mich innerlich zerrissen und hoffe, dass dieses Gefühl irgendwann weg geht. […]
Das Verhältnis der Vf. zur Gemeinde lässt sich aus ihrer gegenwärtigen Sicht in drei Etappen nachvollziehen. Für das Kindesalter wird eine grundsätzliche, »alternativlose« Einbettung in Religion beschrieben: räumlich-sozial durch Eltern und Gemeinde, temporal durch die regelmäßige Sonntagsschule. Diese »Mitgift« spielt für die dargestellte gesamte Entwicklung eine maßgebliche Rolle. Dabei lassen sich zwei Kräfte ausmachen. Die religiösen Vorgaben wirken gleichsam zentripetal und haben schon das Kind in eine bestimmte Richtung gelenkt. Die gleichzeitige Eigenaktivität der Vf. ließe sich als zentrifugaler Impuls beschreiben. Dieser ist durch eine Doppelung charakterisiert: Zwar wurden die Vorgaben in wachsender Eigenbeteiligung vertrauensvoll und aktiv übernommen (Ich glaube an Gott, habe mich […] »bekehrt«), doch gleichzeitig schwingt in der rückblickenden Schilderung ein deutlich distanzierendes Moment mit15.
Eltern jeden Sonntag Sonntagsschule
197
Gemeinde
(schon) als (kleines) Kind
In diese Richtung gelenkt
mit ca. 10 Jahren »bekehrt«
Während es als Kind noch einfach ist, an Gott zu glauben und an ihm festzuhalten, beginnt mit dem Teenageralter jedoch eine neue Phase. Als religiös einbettende oder einkreisende Größen16 werden für diese Phase wie bisher Gemeinde und Eltern genannt, die Sonntagsschule wird durch die Teengruppe abgelöst. Für die zentrifugale Richtung bleibt die beobachtete Doppelung erhalten: Als distanzierendes Moment wird eine schwindende Motivation für die Teilnahme am gemeindlichen Leben erwähnt. Dennoch wird sie aufrecht erhalten, wofür die Vf. zwei Gründe nennt (die eigene Gewohnheit und das Vermeiden einer Diskussion mit meinen Eltern). Andere Kompromisslösungen, etwa das Einschränken der Häufigkeit des regelmäßig[en] »Hingehens« oder eine Erweiterung von Kontakten bzw. Aktivi15 Nur ein Beleg: Die im Umfeld offensichtlich gängige Vokabel der »[B]ekehr[ung]« wird mit Anführungszeichen versehen und somit als spezifisches Sprachspiel des religiösen (hier freikirchlichen) Raumes von außen markiert. 16 Wieder ist das Umfeld nicht nur in seiner sozialen sondern auch temporalen Dimension (regelmäßig) gefasst.
198
Religionspädagogische Anregungen
täten über das Feld der Gemeinde hinaus oder ein Gespräch mit den Eltern über die Gemeinde, das neben der Binnensicht auch mögliche andere Perspektiven zum Zuge kommen lässt, scheinen nicht den Horizont möglicher Handlungsspielräume darzustellen.
Eltern
Teengruppe
Gemeinde
Teenageralter: – nicht mehr so große Lust Dennoch: regelmäßig hingehen – Gewohnheit – keine Diskussion
Gegenwärtig bedeutsam ist die Phase, aus deren Perspektive die Vf. jetzt
Großteil meiner Freunde
schreibt und die mit ca. 16 Jahren beginnt. Hierzu gehört die reflexive Auseinandersetzung mit der Gottesfrage. Theologische Grundhaltungen und Argumente sind sozial verknüpft: Die bestimmenden familialen und freundschaftlichen Größen des religiösen Raumes werden nun als »Christen«17 bezeichnet; mit der LobpreisBand wird der Gemeindebezug später noch einmal hergestellt. Diesem bisherigen Raum gegenüber hat sich an der Schule inzwischen eine weitere Gruppe gebildet, zu der die »nichtchristlichen« Freunde zählen. Die neue Konstellation lässt sich so beschreiben: Das unausweichliche Immer der gegebenen Gottesund Glaubensthematik spiegelt die Welt der Herkunft, der neue Lebenskreis stellt den verstärkenden Resonanzraum des grundsätzlich Alles Hinterfragens dar. Dadurch, dass beide »Kreise« (allein) in der Person der Vf. miteinander verknüpft erscheinen, entsteht für die Vf. eine derzeit nicht auflösbare Spannung:
»Christen« »Nichtchristliche« Freunde
meine Familie meine Verwandschaft (LobpreisBand)
mit ca. 16 Jahren: – bewusstes Auseinandersetzen mit Gottesfrage – alles hinterfragen – immer von diesem Thema umgeben
Schule
17 Die religiösen Zuschreibungen werden hier zunächst wieder mit Apostroph versehen, vgl. Anm. 15.
Mürle Kirche und Gemeinde bei Jugendlichen an Berufsschulen
Spannend ist dementsprechend die darauf bezogene theologische und existentielle Argumentation, die oben gekürzt wiedergegeben wurde. Dazu kann hier nur auf den zentralen Kern hingewiesen werden, der auch für das Gemeindeverhältnis von Bedeutung ist: Die existentielle Frage der Vf., wie mich jmd. genau so wie ich bin annimmt, geschweige denn lieben kann, bezieht sich auf Gott, schließt aber die Sozialbeziehungen des »christlichen« wie »nichtchristlichen« Lebenskreises erkennbar mit ein. Aufgrund der Argumentation der Vf. könnte man sagen, dass die Christen wie die Nichtchristen Gott und die negativen Dinge nicht zusammen bringen: die Christen blenden die negativen Dinge aus, die Nichtchristen Gott. Genau hier möchte die Vf. aber einen Zusammenhang herstellen. Die mit der religiösen »Mitgift« initiierte Linie religiöser Eigenaktivität überschreitet in existentieller und intellektueller Hinsicht also sowohl den von der Vf. dargestellten familialen und gemeindlichen Horizont als auch die erweiternde Alternative des nichtchristlichen Freundeskreises. Dessen Auffassung, dass es keinen Gott gibt … und alles aus dem Nichts kommt, kann sie zum derzeitigen Zeitpunkt einfach nicht teilen. Theologisch spitzt sich damit die Frage für die Vf. auf das Verhältnis von Gott und Nichts zu. Bei ihrer Teilhabe am Gemeindeleben besteht entsprechend ein Gefühl der Zerrissenheit. Aus Perspektive des christlichen Herkunfts-Kreises kann sie ihr Mitwirken nicht mehr als voll gültig anerkennen. Das gilt hinsichtlich des mehrfach thematisierten zeitlichen Engagements (Teil-Zeit-Christ) als auch für das Musizieren in der LobpreisBand. Beim mitsinge[n]den Loben Gottes ist die beschriebene Außenperspektive
199
präsent, mitsamt geschildertem (Selbst-) Zweifel. Auch der Lobpreis löst das Dilemma nicht. 4. Kirche und Gemeinde im gesamten Sample
Der Begriff Gemeinde wurde von 13, Kirche von 118 BS verwendet18. Am obigen Beispiel wird deutlich, wie der Gemeindebegriff vornehmlich gebraucht wird: Charakteristisch ist die Verknüpfung mit einer christlichen Erziehung von klein auf. Die erfahrene Beheimatung stellt ein prägendes Grundgefühl dar, das durch weitere aktive Teilnahme am Gemeindeleben erhalten werden kann. Dies schließt, wie gesehen, Distanzierungen nicht aus. Entweder wird nach Horizonterweiterungen gesucht, oder der eigene Glauben wird konfessorisch betont, weil dieser nicht nur äußerlich auf die beschriebene christliche Prägung zurückgeführt werden soll. In Einzelfällen können deutliche Kontraste entstehen: Erratisch wirkt z.B. die Formulierung [Gott] konnte mich zu sich rufen und ich darf ihm als ein lebendiger Stein in seiner Gemeinde dienen und folgen. Es gibt wirklich nichts schöneres als das! (Fachschülerin Sozial18 Der Gebrauch des Begriffs Gemeinde nach Konfessionen: ev 7x; k 2x; rk, evfreik, adv, morm jeweils 1x. Muslimische BS verwenden den Begriff Gemeinde nicht, Kirche dient ihnen in zwei Dokumenten als Entsprechung zu Moschee. 63 BS verwenden den Begriff Religion, teilweise in Ergänzung zu Kirche. Um dem Feld gerecht zu werden, wird es in diesem Beitrag mit »Religion / Kirche / Gemeinde« bezeichnet. Die vereinzelten Zahlenangaben bieten keine Grundlage für quantitative Extrapolationen, sondern veranschaulichen lediglich Verteilungen innerhalb des Samples.
200 Religionspädagogische Anregungen pädagogik, 18, k). Demgegenüber wirkt folgende Überlegung recht vage: Warum aber […] gehe ich dann regelmäßig in die Kirche? Ist es die Gemeinschaft? Oder ein Gefühl? Ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich fühle mich wohl, kann mir meine Meinung bilden wie ich will und werde warmherzig akzeptiert, so wie ich bin und wie ich denke (Kauffrau Bürokommunikation, 21, morm). Der Gebrauch des Begriffs Kirche muss personale Beziehungen und Bindungen nicht ausschließen, verweist aber, im Unterschied zur Gemeinde, auch auf eine institutionelle übergemeindliche Größe. Anhand der vorgenommenen Kodierungen lassen sich für das Verhältnis zu Gemeinde bzw. Kirche folgenden Linien aufzeigen: Kirche wird schlicht als gegebener Hintergrund und Ort von Religionsausübung wahrgenommen. Dies geschieht z.T. recht nüchtern. Wertungen können teilweise mit einfließen, wie bei den oft positiven Beschreibungen von Gemeinde: Mich verbindet mit Gott eine enge Beziehung, an der ich ständig arbeiten muss. Ich habe das Glück in einer Gemeinde zuhause zu sein, wo ich in ständigem austausch mit andern Christen sein kann und auch mit Fragen gut aufgehoben bin (TG, 18, m, ev). Eine 17-jährige Industriemechanikerin (rk) schreibt: Ansonsten gehen meine Mutter und ich, #mach# manchmal in die Kirche und brennen Kerzen an. Einfach so. #M# Ein Licht gibt ein Zeichen, dass man an jemanden denkt. Unterscheidungen und gezielte Distanzierungen sind klar und deutlich vertreten. Bei den Unterscheidungen wird Kirche bzw. religiöse Praxis auf einen eigenen Glauben bzw. eine eigene Glaubenspraxis bezogen.
Eine Einzelhändlerin / Verkäuferin (18, ev) reflektiert im Blick auf ihre Ausbildungssituation: Jeder lebt seinen Glauben anders. Manche beten täglich und gehen jeden Sonntag in die Kirche. So bin ich nicht. Ich bete selten und die Kirche #sieht# sah mich zuletzt beim Konfirmationsunterricht. Kirche gehört für mich zwar zum Glauben, aber es ist schwer vereinbar mit dem Beruf. Wenn ich die Woche über 40 Stunden oder mehr arbeite, schlafe ich am Sonntag gerne aus. Aber ich denke es ist nicht so sehr wichtig. Gott liebt uns, auch wenn wir nicht in die Kirche gehen. Es ist allein das, dass wir an ihn denken und #ihm# uns zu ihm gehörig fühlen. Gott ist für mich überall. Ich denke auch oft über ihn nach. Die etwas häufiger vorgenommenen Distanzierungen sind demgegenüber deutlicher auf Abgrenzung bedacht und lassen positive Bezüge oft kaum noch erkennen. Sie reichen von zaghaften Versuchen (s. Einzeltext) über konstatierte Grenzziehungen (Ich habe Mühe mit dem Glauben, da ich nicht den Glauben der Kirche und dessen Verhalten vertretten kann! – Berufsfachschülerin Wirtschaft, 19, ev), bis hin zur Auflistung von »Lasterkatalogen« über die Kirche und v.a. ihre angemaßte Macht: Meiner Meinung nach ist das die Kirche die älteste Sekte ist die es gibt. Sie erzählt uns was von Himmel und Hölle mordeten frühre [früher?] 100 Tausende im Namen Gottes Lächerlich!! […] Wenn ich schon sehe der Papst ein Mann Gottes etc. Lebt auf Staats kosten etc. (Möbel-Küchen-Umzug, 20, m, k). Einzelstimmen können Facetten des Verhältnisses zur eigenen Religion / Kirche / Gemeinde genauer beleuchten. Dazu gehören:
Mürle Kirche und Gemeinde bei Jugendlichen an Berufsschulen
– über die obigen, positiven Grundschilderungen hinausgehende, explizit wertschätzende Äußerungen zur Bedeutung der eigenen Religion / Kirche / Gemeinde19; – oft kurze Verhältnisbeschreibungen, die von »Kirche bei Gelegenheit« (M. Nüchtern) bis zum Ver(b) lassen von Kirche reichen; – Reflexionen über die eigene religiöse Biographie (vgl. Einzeltext); – konkrete Enttäuschungen, die als Begründung von Distanzierungen angeführt werden: Ich #/# glaube nicht an Gott, weil er doch nur noch geldmacherei ist! Unsere Kirche im [XY-]Kreis will #nur# nur noch Geld machen früher habe ich geglaubt bis die Kirche nur noch #Geld# Geld von #un# uns wollte. Als mein Vater verstarb war ich #egat egalt egalt# egal. #Gott = Geld Geld und# (Möbel-Küchen-Umzug, 18, m, ev) Über familiär prägende Bezugspersonen hinaus kommen 20 Passagen auf offizielle »Religionsvertreter« zu sprechen, d.h. auf Personen, die für die Jugendlichen Religion / Kirche / Gemeinde repräsentieren (v.a. Pfarrer, Priester, Papst)20. Negative Schilderungen sind etwas häufiger als positive. Im Unterschied zu den Negativbeispielen werden bei hervorgehobenen positiven Schilderungen die »Religionsvertreter« namentlich erwähnt: Meine Auffassung von Gott wurde durch den Pfarrer [NN] am stärksten geprägt. Er begleitete mich durch meine Konfirmandenzeit und unter seiner Hand begann ich mit der Kinder- und Jugendarbeit. Ich ließ mich weiterbilden zum Jugendleiter und #überna[?]# übernahm eine eigene Gruppe. […] Leider geht #her#Herr [N]
201
nun und ich habe auf Grund meines Abitures im nächsten Jahr mit der Jugendarbeit aufhören aber trotzdessen war es eine tolle und lehrreiche Zeit für mich. Diese Zeit hat mich geprägt und meinen Charakter gebildet (TG, 18, w, ev). Ein weniger ausgeführtes Beispiel stammt von einem Schüler aus derselben Klasse (18, ev): Ich selbst bin keine häufiger Kirchengänger, aber jedes mal in der Kirche kam ich zum nachdenken, da ich glaube das unsere Pfarrerin doch oft die richtigen Worte fand. Teilweise wird an als hilfreiche oder anstößig empfundene Aussagen erinnert. Mit 31 Äußerungen spielt das Bewusstsein für Pluralität von »Religionen, Konfessionen, Kulturen« zwar eine deutliche21, aber nicht ganz so gewichtige Rolle wie die Distanzierungen. Selten sind Versuche, Fremdes durch Abwertung oder parodistische Versuche abzuwehren. Inhaltlich beschäftigen sich die Beiträge v.a. mit Fragen nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden sowie mit Konflikten22: Zudem denke ich, dass sich die großen Weltreligionen in großem Umfang überschneiden. Der monotheistische 19 Im Sample: Einige muslimische und eine griechisch-orthodoxe Schülerin über ihre Religion; eine mormonische Schülerin zu Kirche und Gemeinde. 20 Hierzu gehören auch Religionslehrkräfte. Der RU wird als Bestandteil kirchlicher Arbeit wahrgenommen. Zum Thema wird er v.a. bei inhaltlichen Fragen und bezüglich religiöser Prägung. 21 Was durch das Abfragen der Sozialvariablen mit induziert sein kann. 22 Auffällig ist, dass die Begriffe »In/Toleranz« bzw. »in/tolerant« nicht verwendet werden. Äußerungen hierzu betonen die eigene »Liberalität« gegenüber (Anders-)Glaubenden sowie die Ablehnung von Zwang in Glaubensdingen.
202
Religionspädagogische Anregungen
Ansatz, Aufstellen von Regeln, Normen, Werte, #sind# welche #ein# sich zudem #ähneln# ähnlich sind, sind einige Punkte. (Winzer, 19, m, rk). Interessant ist eine Handvoll von Beiträgen, die auf eigenständige, auch auf gemeindlicher Ebene angesiedelte religiöse Erkundungen hinweist (s.u.). Hierzu passen Aussagen, die mit »Religion aus / ein-üben, erlernen, Nachdenken« kodiert wurden. Sie dokumentieren ein Bewusstsein dafür, dass Glauben sich nicht von selbst versteht, sondern auf Einweisung, (Selbst-)Bildung und Einübung durch Familie und Religion(sgemeinschaft) angewiesen ist. Diese Perspektive schlägt sich selbst in dem quasi »religionsethnographischen« Blick nieder, den eine aus Ostdeutschland stammende Schülerin (Winzerin, 24, w, k) auf württembergisches Brauchtum wirft: Vor einem Jahr zog ich nach Württemberg und erlebte auf meiner Arbeitsstelle zum ersten Mal ein Tischgebet. Das war eine sehr komische, aber auch interessante Situation. Jetzt ist es → [Nächste Seite:] Normalität. Ich meine damit allerdings nicht, dass ich einem Tischgebet beipflichte und Gott fürs Essen danke. 5. Resümee
Zum Schluss sollen diese Beobachtungen vor dem skizzierten Forschungshintergrund profiliert werden: 1. Bei den befragten BS bildet die Perspektive der eigenen Lebenswelt und Biographie einen zentralen Ausgangspunkt für die Wahrnehmung und Bewertung von Gemeinde / Kirche / Religion. Dies entspricht der in anderen Studien
festgestellten hohen Bedeutung, die von Jugendlichen dem sozialen Nahbereich zugemessen wird23. Weder neu noch überraschend ist daher die Rolle, die Personen bzw. personalen Beziehungen bei den gezeichneten Bildern von Kirche und Gemeinde zukommt. Positive Resonanz erzeugt dementsprechend in konkreten kirchengemeindlichen Vollzügen das Gefühl, individuell wahr- und angenommen zu werden sowie die Möglichkeit, Impulse selbststeuernd aufgreifen – oder abwehren zu können. Auch die Aussagen zum Thema Pluralität lassen sich unter dem Vorzeichen der Prävalenz des Nahbereichs lesen. Religiöse Pluralität scheint demnach seltener grundsätzlich oder funktional relativiert werden zu müssen, als sich dies nach Nipkows Auswertung von 1990 erwarten lässt. Wichtiger, als Toleranz abstrakt und allgemein von Kirche einzufordern, scheint es für viele der Befragten, die eigene »Toleranz« in religiösen Dingen zu betonen und sich gleichzeitig von religiösen Zwängen und Zumutungen abzugrenzen. Ein Grund hierfür könnte in einer (latent) vorhandenen Unsicherheit oder Unabgeschlossenheit in Glaubensdingen liegen, die sich dann noch verstärkt, wenn religiöser Pluralismus registriert wird und im eigenen Umfeld an Relevanz gewinnt (Bsp. Freunde, Partner). 2. Das Moment von Unsicherheit könnte zum Teil auch die Vehemenz ver23 In Bezug auf Wertebildung etwa: Joachim Ruopp / Friedrich Schweitzer / Georg Wagensommer, Wertebildung im Religionsunterricht. Unterrichtsforschung am Evangelischen Institut für Berufsorientierte Religionspädagogik (EIBOR) in Tübingen. Loccumer Pelikan. Religionspädagogisches Magazin für Schule und Gemeinde, Heft 1 (2013), 11–14.
Mürle Kirche und Gemeinde bei Jugendlichen an Berufsschulen
ständlich machen, mit der Distanzierungen zu Kirche mitunter vorgenommen werden. Die bereits erwähnten soziologischen und entwicklungspsychologischen Hintergründe dürften diesbezüglich weiterhin erhellend sein. Zu betonen ist, dass es unterschiedliche Ebenen und Grade von Distanzierungen gibt. Wie dargestellt, reichen sie von unterscheidenden Differenzierungen über konstatierte Abgrenzungen bis hin zu radikal klingenden Verdikten. Letztere werden durch die Übernahme gängiger Muster von Kirchenkritik leicht ermöglicht. Vor diesem Hintergrund ist es nachvollziehbar, wenn eigene positive Erfahrungen auf Gemeindeebene teilweise wie eine nicht erwartete Ausnahme dargestellt werden. Der oben zitierte Einzeltext stammt aus einem freikirchlichen Kontext. Ein vergleichbarer Beitrag findet sich auch bei einer evangelisch-landeskirchlichen BS derselben Klasse. Dennoch wurde der Text mit Bedacht ausgewählt: Zum einen wird daran deutlich, dass sich die mit den strukturgenetischen Entwicklungsmodellen der 1980er Jahre gestellte Frage nach religiöser Entwicklung und Reife nicht durch ein »poststrukturalistisches« Aufschäumen von selbst erledigt (»styles« statt »stages«). Zum anderen zeigt sich daran, dass auch freikirchliche bzw. »freie« Gemeinden nicht der Aufgabe religiöser Bildung enthoben sind. Es mag sein, dass dem BRU theologische und konfessorische Kenntlichkeit gut tut; umgekehrt sollten sich Gemeinden nicht nur als Ort religiöser Beheimatung und theologischer Vergewisserung verstehen, sondern bedürfen deliberativer Beweglichkeit und Offenheit. Die Befunde legen nahe: Kirchen und Gemeinden müs-
203
sen die Distanzierungen Jugendlicher auf Dauer aushalten und sich ihnen ohne Anbiederung stellen. Wollten sie auf die damit gestellten Anfragen wirklich verzichten? Frei nach Arno Schmidt ließe sich auch sagen: Nichts fataler als ein junger Mensch, der sich allzufrüh schon gut in der Kirche zurechtfindet …24 3. Damit zum letzten Punkt: Die Befragung zeigt, dass expliziter »God-talk« (J. Astley u.a.) mit Kirche und Gemeinde assoziiert wird. Das bedeutet, dass dieses Feld immer noch als genuiner Bereich für »god-talk« wahrgenommen und bewertet wird. Mit anderen Worten: der kirchliche Anspruch diesbezüglich wird ernst genommen, auch wenn er zurückgewiesen wird. Dieser Eindruck verstärkt sich, wenn man die Aussagen der Jugendlichen und jungen Erwachsenen hinzunimmt, die ihre religiöse Biografie reflektieren und die vereinzelt erstaunliche Erkundungsleistungen erkennen lassen25: 24 »Nichts fataler als ein junger Mensch, der sich allzufrüh schon gut in der Welt zurechtfindet!«, Arno Schmidt Das essayistische Werk zur deutschen Literatur. Sämtliche Nachtprogramme und Aufsätze, Band 4, Zürich 1988, 107. 25 Dies gilt im Sample eindeutig auch für konfessionslose Jugendliche. Gerber et al. halten für außerschulische Gesprächsthemen von BS fest: »Dieses kaum erwartbare Votum der Konfessionslosen für religiöse Themen untermauert die Einsicht, dass eine diesbezügliche Kommunikation nicht primär an konfessionellen Zugehörigkeiten festgemacht werden kann. Offenbar enthalten die weltanschaulichen und moralischen Suchbewegungen der Heranwachsenden ein unleugbar ›religiöses‹ Potential.« Uwe Gerber / Peter Hohmann / Reiner Jungnitsch, Religion und Religionsunterricht. Eine Untersuchung zur Religiosität Jugendlicher an berufsbildenden Schulen, Frankfurt a.M. 2002, 82.
204
Religionspädagogische Anregungen
In den letzten Jahren habe ich auf verschiedene Arten versucht dieses »Märchen« zu meiner Wahrheit zu machen. Ich habe Orte wie die Kirche #ver#, verschiedene Gemeinden, christliche Organisationen und Veranstaltungen besucht, ich habe die Bibel gelesen, mich mit Christen ausgetauscht und jeden Tag zu Gott gebetet. Und doch konnte und kann ich nicht finden, was all die Menschen an diesen
Orten #um mich herum# gefunden zu haben scheinen. Diese Menschen scheinen von einer Überzeugung beherrscht zu sein, die ich noch nicht einmal in Ansätzen vorweisen kann (Schülerin EG, 19, ev). Wie verantworten Gemeinden ihren »God-talk« und wie ist Kirche auf derartige »Visitationen« Jugendlicher und junger Erwachsener eingestellt?
Götz-Guerlin Theologisieren mit »bildungsfernen Jugendlichen« – eine Praxisreflektion
205
Marcus Götz-Guerlin Theologisieren mit »bildungsfernen Jugendlichen« – eine Praxisreflektion
1. Vorüberlegungen
Ein Nachdenken über praktische Erfahrungen im Theologisieren mit bildungsfernen Jugendlichen kann sich einem kurzen Rekurs auf die hier verwendeten Begriffe nur schwer entziehen. Was meint »Theologisieren« und wer sind die »bildungsfernen Jugendlichen«? Theologisieren mit Jugendlichen soll verstanden werden als »Reflexion und Kommunikation religiöser Vorstellungen durch Jugendliche«1. Es ist ein religionspädagogisches Modell und zugleich ein »didaktisches Konzept, … bei dem biblische bzw. theologische Traditionen und die theologischen Auffassungen der Schüler/innen in einen grundsätzlich gleichberechtigten und ergebnisoffenen Dialog eintreten«2. Betrachtet man die unterschiedlichen Dimensionen einer Jugendtheologie3, dann stellt sich daneben die Frage, in welcher Dimension sich ein ausgewähltes und reflektiertes Praxisbeispiel bewegt. Wird ein Austausch über implizite Theologie geführt? Wird persönliche Theologie zum Gegenstand? Oder wird, für alle erkennbar und einsichtig, Religion zum Gegenstand der Diskussion; bewegt sich der Diskurs also in der Dimension expliziter Theologie? Dies ist bei der Analyse des Praxisbeispiels in den Blick zu nehmen, wobei bereits hier darauf hingewiesen sei, dass ein Einbringen theologischer Dogmatik und
ausdrückliche theologische Argumentation im Sinne von Schlag / Schweitzer angesichts des pädagogischen Settings und der Zielgruppe keine Rolle spielen werden. Theologisieren mit Jugendlichen bzw. Theologie mit Jugendlichen basiert auf einem bestimmten Verständnis von Theologie. Demnach ist davon auszugehen, dass Jugendliche – theologische Fragen mit sich »herumtragen«. Sei es implizit in Form einer »diffusen« Suche nach Orientierung oder explizit in Form einer Auseinandersetzung mit konkretem Glauben4; – in der Lage sind, theologische Fragen zu bedenken und zu kommunizieren, wenn auch nicht zwangsläufig im Sprachduktus und den geprägten For1 Thomas Schlag / Friedrich Schweitzer, Jugendtheologie in der Praxis von Schule und Gemeinde: Religionsunterricht, Konfirmandenarbeit und Jugendarbeit, in: Dies. (Hg.), Jugendtheologie. Grundlagen – Beispiele – kritische Diskussion, Neukirchen-Vluyn 2012, 180. 2 Veit-Jakobus Dieterich, Theologisieren mit Jugendlichen – Ein Programm, in: Ders., Theologisieren mit Jugendlichen – Ein Programm für Schule und Kirche, Stuttgart 2012, 36. Vgl. auch Schlag / Schweitzer (wie Anm. 1), 9, die hier den Terminus »Theologie mit Jugendlichen« verwenden. 3 Kurz in Schlag / Schweitzer (wie Anm. 1), 10f. Ausführlich in: Thomas Schlag / Friedrich Schweitzer, Brauchen Jugendliche Theologie? Jugendtheologie als Herausforderung und didaktische Perspektive, Neukirchen-Vluyn 2011. 4 Ebd., 19f.
206
Religionspädagogische Anregungen
men »erwachsener« Rede und Frömmigkeit; – als »Laien« im evangelischen Verständnis grundsätzlich befähigt, aufgerufen und ermuntert sind, Theologie als das kritisch-reflexive Nachdenken über den Glauben zu treiben und ergo in Bildungsprozessen dazu befähigt werden sollen. Indem Jugendtheologie sich zunächst daran orientiert, »dass Jugendliche für ihre Orientierung im Leben und Glauben davon profitieren«5 und ihnen die Entscheidung, welche Theologie sie brauchen, in erster Linie selber überlässt, rücken lebensweltliche Themen und Fragen von Jugendlichen sowie deren eigene Zugänge zu Religion und Glauben ins Zentrum. Nicht was die religiösen Profis für wichtig und relevant halten, bestimmt die theologische Agenda, sondern die Jugendlichen selber. Nicht traditionelle dogmatische Inhalte haben das »Prae«, sondern sie müssen sich in ihrer Relevanz für die Fragen der Jugendlichen erst je bewähren. Für die (religions-)pädagogische Praxis stellen sich dann umgehend spezifische Herausforderungen durch die jeweiligen Jugendlichen, die im konkreten pädagogischen Kontext zusammen sind. Wie sieht z.B. ein Theologisieren mit Jugendlichen aus, wenn »kaum noch Erfahrung, Wissen oder schon nur Interesse bzw. Sensibilität im Blick auf … religiöse Themen und Fragen vorausgesetzt werden kann«?6 Welche »biblisch-christlichkonfessionelle[n] Traditionen« können auf welche Art und Weise in den Dialog unter und mit Jugendlichen eingetragen werden7, wenn die Mehrheit derselben weder christlich ist, noch zuvor grundlegende religiöse Bildung genossen hat?
Wer oder was sich hinter dem Begriff der sogenannten bildungsfernen Jugendlichen verbirgt, bedarf ebenfalls einer kurzen Betrachtung. Die Herausforderungen, vor denen die Initiatoren von Bildungsprozessen mit den so umrissenen Zielgruppen stehen, sind für die politische Bildung in den zurückliegenden Jahren intensiv diskutiert worden. Es lohnt also, den Blick auf die Erkenntnisse zu werfen, die an dieser Stelle, gleichsam bei der Zwillingsschwester religiöser Bildung8, gewonnen wurden. Bildungsferne Jugendliche »verfügen in der Regel über niedrige Bildungsabschlüsse. … Sie sind politisch uninformiert, sozial wenig engagiert, partizipatorisch passiv und … fallen durch Sprachbarrieren, Lernschwierigkeiten, schlechte Schulleistungen und häufig durch abweichende Verhaltensweisen auf«9. Jugendliche aus bildungsfernen Milieus haben eine vergleichsweise hohe Konsumorientierung und einen spaßund freizeitorientierten Lebensstil. Ihre Bereitschaft, sich Anstrengungen und 5 Ebd., 12. 6 Ebd., 17. 7 Dieterich (wie Anm. 2), 44. 8 Es gibt weitgehende Strukturanalogien zwischen Politik- und Religionsdidaktik und sehr ähnliche Herausforderungen: beide sind diskursiv angelegt, streben eine reflexive Auseinandersetzung mit komplexen Themen an, setzen voraus, dass eigene Positionen relativiert werden können, arbeiten mit sprachlich anspruchsvollen Texten und ihre Lerngegenstände entziehen sich in besonderer Weise einer unmittelbaren alltagsbezogenen Verwertung. Ausführlich dazu Thomas Schlag, Horizonte demokratischer Bildung. Evangelische Religionspädagogik in politischer Perspektive, Freiburg i.Br. / Basel / Wien 2010. 9 Joachim Detjen, Politische Bildung für bildungsferne Milieus, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 32–33 (2007), 3.
Götz-Guerlin Theologisieren mit »bildungsfernen Jugendlichen« – eine Praxisreflektion
Mühen zum Erreichen von Zielen auszusetzen, ist eher gering. Für Bildungsprozesse besonders relevant ist, dass die subjektiven Anforderungen an Bildung dadurch gekennzeichnet sind, dass diese einen »unmittelbar praktischen Nutzen« haben muss.10 Bildung als Selbstzweck oder zum Ziel der Persönlichkeitsentwicklung ist aus Sicht dieser Jugendlichen kaum relevant. Zugleich ist eine intrinsische Motivation im Blick auf Bildung schwach ausgeprägt.11 Für die politische Bildung ist deutlich geworden, dass sie die Voraussetzungen für gesellschaftlich-politische Partizipation und Teilhabe an Prozessen politischer Bildung häufig erst selber schaffen muss. Solche sind z.B.12 – sprachliche Kompetenzen und die Fähigkeit zur Gewinnung und Bewertung von Informationen. Argumentationsfähigkeit, um Argumente und Positionen in Diskursen verstehen und einbringen zu können; – Wissen um politische Prozesse und die Funktionsweise von Politik sowie die Fähigkeit der kategorialen Unterscheidung unterschiedlicher Ebenen und Dimensionen von Politik; – Selbst- und Sozialkompetenzen, um diskursive Prozesse mit anderen eingehen zu können. Fähigkeit zum Kompromiss und dazu, andere Positionen auszuhalten sowie Frustrationstoleranz im Blick auf die Durchsetzung eigener Vorstellungen. Was hier die politische Bildung als »Eintrittsbedingungen« für erfolgreiche Prozesse politischer Bildung beschreibt und häufig genug eine noch unbewältigte Herausforderung ist, lässt sich auf religiöse Bildung, zumindest in ihrem protes-
207
tantischen Selbstverständnis, mehr oder weniger direkt übertragen. Eine geringe sprachliche Kompetenz und Schwierigkeiten beim Umgang mit Texten, ein konsum- und freizeitorientierter Lebensstil sowie insgesamt eine geringe Bereitschaft, sich Anstrengungen und reflexivem Nachdenken auszusetzen, weisen mit dem protestantisch gefärbten Verständnis von (Selbst-)Bildung wenig Deckung auf. Die Anforderung, dass Bildung einen unmittelbaren verwertbaren Nutzen aufweisen muss, macht die Sache nicht einfacher. Vor diesem Hintergrund lässt sich vermuten, dass die empirischen Erkenntnisse für politische Bildung auch für den Bereich der religiösen gelten: Es gibt »einen engen Zusammenhang zwischen Bildungsniveau und politischem Interesse … Nach wie vor ist es besser gebildeten Jugendlichen vorbehalten, sich als politisch interessiert zu charakterisieren. … Typischerweise sind die für politisch interessierte Jugendliche charakteristischen wichtigsten Freizeitbeschäftigungen ›Bücher lesen‹, sich ›in Projekten, Initiativen und Vereinen engagieren‹ und sich ›künstlerisch betätigen‹. Das niedrige Bildungsniveau der Bildungsfernen korreliert demgegenüber mit Sprach- und Gesprächsarmut sowie einer eher niedrigen politischen Urteilskompetenz. … Charakteristisch für desinteressierte Jugendliche ist weiterhin die Aussage, dass politische Betätigung eher langweilig sei.«13 Vor dem Hintergrund solcher Überlegungen muss ein Theologisieren mit »bildungsfernen« Jugendlichen also bedenken und berücksichtigen 10 Ebd., 5. 11 Ebd. 12 Ebd., 6f. 13 Ebd., 3.
208
Religionspädagogische Anregungen
– dass Texte und Sprache ein besonderes Hindernis darstellen. Das gilt in besonderer Weise, wenn sie elaboriert oder alltagsenthoben sind, was für religiöse Texte und Sprache in vielerlei Hinsicht zutreffen dürfte; – dass diskursive Fähigkeiten eher schwach ausgeprägt sind und folglich die Bereitschaft zu Diskussionen im Blick auf die Motivation und Fähigkeiten rasch an Grenzen stoßen kann; – die Bereitschaft, sich auf ein Nachdenken über komplexe Fragen und differenziertes Urteilen einzulassen, gering ist; – dass besonders hohe Anforderungen an alltagspraktischen Nutzen und unmittelbare »Nützlichkeit« der Bildungsinhalte gestellt werden, damit sie überhaupt als relevant eingeschätzt werden. 2. Religionspädagogik in besonderer Form: Haus Kreisau
Die Evangelische Berufsschularbeit in Berlin ist zuständig für den Evangelischen Religionsunterricht und Angebote politischer Bildung in Trägerschaft der Evangelischen Kirche an beruflichen Schulen in ganz Berlin. Beides wird in einem besonderen Organisationsmodell, als eintägige Seminartage oder mehrtägige Seminare mit Übernachtung, in der Jugendbildungsstätte »Haus Kreisau« angeboten. Das Angebot richtet sich an alle Bildungsgänge in den beruflichen Schulen, von Berufsvorbereitung über Duale Ausbildung und Fachschulen bis zu den beruflichen Gymnasien.14 Die Teilnahme an diesen Veranstaltungen ist freiwillig. Sofern die Schul-
leitung und Lehrkräfte einer Teilnahme der Klasse an einem Angebote dieser Art zustimmen, entscheidet die Klasse, ob sie das Angebot wahrnehmen will oder stattdessen regulären schulischen Unterricht haben möchte. Entscheidet sich die Klasse für einen Besuch von »Haus Kreisau«, wird das Thema des Tages bzw. Seminars mit den Schülerinnen und Schülern gemeinsam festgelegt. Es nehmen dann in er Regel (fast) alle Schülerinnen und Schüler der Klasse teil. Einen regulär im Stundenplan verankerten Religions-, Ethik-, Philosophieunterricht oder ein vergleichbares Fach gibt es an beruflichen Schulen in Berlin nicht. Die Angebote von »Haus Kreisau« konkurrieren mit ähnlichen projektförmigen Angeboten von Bildungsträgern, z.B. der Gewerkschaften oder Parteien, sowie nicht selten auch mit der Möglichkeit, alternativ eine Klassenfahrt zu machen. Andere religiöse oder weltanschauliche Anbieter, z.B. die katholischen Kirche oder der Humanistische Verband, sind in Berlin an den beruflichen Schulen nicht tätig. 3. Ein Seminartag im April 2013: »Wer bestimmt, was ich denke und tue?«
Der Seminartag im April 2013 findet mit einer Klasse aus dem OSZ (Oberstufenzentrum) Handel 1 statt. Die Teilnehmenden befinden sich alle am Ende des ersten Ausbildungsjahres und lernen Einzelhandelskaufmann/-kauffrau im Bereich Medien und Elektronik. In die14 Eine ausführlichere Selbstdarstellung unter: www.hauskreisau.de.
Götz-Guerlin Theologisieren mit »bildungsfernen Jugendlichen« – eine Praxisreflektion
sem Fall machen alle ihre Ausbildung in Handy-Shops. Der Seminartag wird vom Verfasser des Artikels und einer Kollegin gemeinsam vorbereitet und durchgeführt. Von den 18 Schülerinnen und Schülern der Klasse sind 14 gekommen. Das stellt einen normalen Schnitt dar, denn auch in der Berufsschule erreicht die jeweils real vorfindliche Klassenstärke nur selten den »Soll-Wert«. Sebastian, Jennifer, Philip, Joane, Merve, Robert, Christian, Sebastian, Osman, Ahmed, Reza, Baris, Murat und Cagdas sind zwischen 17 und 26 Jahren alt. Von den 4 Frauen und 10 Männern haben 2/3 einen »Migrationshintergrund«. Auch das bewegt sich im Durchschnitt der Klassen dieser Berufssparte. Wie sich im Lauf des Tages herausstellt, sind in der Klasse sechs muslimisch, zwei christlich und sechs konfessionslos sozialisierte Schülerinnen und Schüler. Im Laufe ihres unterschiedlich langen Weges in allgemeinbildenden Schulen haben drei der 14 Anwesenden an Religions- Ethik oder Lebenskundeunterricht teilgenommen. Die übrigen haben bislang keine eigenen Erfahrungen mit Angeboten religiöser, weltanschaulicher oder philosophischer Bildung gemacht; zumindest nicht im schulischen Kontext. Auch dies ist ein durchschnittlicher Wert. In Berlin ist Religion kein ordentliches Unterrichtsfach und der Religionsunterricht an Haupt-, Real- und Sekundarschulen unterrepräsentiert. Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund werden vom konfessionell-christlichen RU nur zögerlich erreicht und »Ethik« als allgemeinverbindliches Unterrichtsfach ist zu Zeiten der Schullaufbahn der meisten Teilnehmende dieses Tages noch nicht eingeführt gewesen.
209
Thema des Tages ist die Frage, wie jemand zu seiner eigenen Meinung kommt bzw. wie sich eine solche bildet. Im Vorgespräch mit den Teilnehmenden wurde deutlich, dass deren Interesse vor allem auf Fragen zur Manipulation durch Medien, wie Sozialisation und Erziehung sich auf die eigene Meinungsbildung auswirken und wer öffentlich wahrhaftig ist, betrifft. Der Seminartag beginnt mit einer Einstiegsrunde im Plenum. Diese Einheit ist auf ca. 45 Minuten angelegt und wird noch ausführlicher analysiert. Es folgt im weiteren Verlauf des Tages eine Gruppenarbeit an Texten, die an ausgewählten Beispielen deutlich macht, dass Meinung und Überzeugung durch familiäre Sozialisation, Austauschs in Peergroups, gesellschaftliche Grundstimmungen und Entwicklungen, durch Religion und Kultur sowie Lebenserfahrungen beeinflusst werden. In Text A geht es um das Phänomen, dass sich bei Markteinführung eines neuen i-Phones bereits in der Nacht vor dem Verkaufsstart lange Schlangen von Kaufwilligen vor den Geschäften bilden, dass also Menschen erhebliche Strapazen auf sich nehmen, um zu den allerersten Besitzern des neuen Handymodells zu gehören. Text B berichtet die Sitte der sehr konservativen und moderne Lebensweisen ablehnenden Gemeinschaft der Amish-People. Dort wird Jugendlichen bei Eintritt ins Erwachsenenalter ein Jahr des freien Lebens außerhalb der Gemeinschaft zugebilligt. Nach diesem Jahr der Selbstprüfung kehren in den besonders konservativen Gemeinden deutlich weniger Jugendliche der Gemeinschaft den Rücken als in den liberaleren AmishGemeinden.
210
Religionspädagogische Anregungen
Text C thematisiert die Frage eines Zusammenhangs von ethnischer Herkunft bzw. kulturellem Hintergrund und der Kriminalitätsrate unter jugendlichen und heranwachsenden Männern. Die Teilnehmenden sollen die Texte bearbeiten und anhand von vorgegebenen Fragen für die übrigen Teilnehmenden aufbereiten. Nachdem die unterschiedlichen Faktoren, die eigene Meinungen und Überzeugungen beeinflussen können, zusammengetragen und an der Tafel visualisiert wurden, sind die Teilnehmenden aufgefordert, in Einzelarbeit solche Faktoren entlang ihres eigenen Lebenslaufes zu identifizieren. Ein kurzer Austausch im Plenum beendet diese Einheit, die insgesamt auf ca. 120 Minuten angelegt ist. Die letzte Arbeitseinheit thematisiert die Frage von Freiheit angesichts der Gewordenheit und Beeinflussbarkeit von Meinungen und Überzeugungen. Mit der Methode des Posterchats / Schreibgesprächs und einer Übung, die die Dynamik von Gruppendruck und MehrheitsMinderheiten-Problemen verdeutlicht (ca. 60 Minuten), wird hier gearbeitet. Eine auswertende Schlussrunde und ein »Blitzlicht-Feedback« schließen den Tag ab. 4. Wer ist glaubwürdig?
Für die Frage des Theologisierens mit bildungsfernen Jugendlichen soll hier die Einstiegseinheit analysiert werden. Der Einstieg in den Seminartag hat eine doppelte Aufgabe. Es geht zum einen um ein »warm up« und Kennenlernen. Die Teilnehmenden und die Seminarleitung kennen sich bislang lediglich von einem kurzen, ca. 60minütigen Be-
such in der Schule, bei dem Haus Kreisau und das Angebot eines Seminartages vorgestellt sowie das Thema des Tages und die dahinter liegenden Fragen der Teilnehmenden ausgelotet wurden. Zum anderen geht es um eine Hinführung zum Thema des Tages. Dabei soll das Thema für die Anwesenden klarer umrissen werden, indem diejenigen Aspekte und Fragestellungen, die im Lauf des Tages noch bearbeitet werden sollen, bereits hier einmal anklingen. Verdeutlicht werden soll dabei, dass die Voten und Beiträge der Teilnehmenden im Zentrum stehen, da kein »Unterrichtsstoff« bearbeitet oder bewältigt werden muss. Die Aussagen der Teilnehmenden sind gleichsam eine wesentliche »Material-Quelle«, mit der gearbeitet wird. Auf dem Boden des Seminarraumes werden Portraitfotos von unterschiedlichen Menschen ausgelegt, denen die Seminarleitung eine meinungsbildende Kraft bzw. Funktion zuspricht. Das Spektrum reicht von Politikerinnen und Politikern (Barack Obama, Wladimir Putin, George W. Bush, Willy Brandt, Silvio Berlusconi, Angela Merkel, ….) über bekannte historische Persönlichkeiten (Kemal Attatürk, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela, Osama Bin-Laden, Sophie Scholl …) und Prominente aus dem Musik- und Showgeschäft (Madonna, Joachim Löw, Bushido, Heidi Klum, Günther Jauch, ….) bis hin zu Persönlichkeiten aus dem religiösen Bereich (Jesus, Mohammed, Mutter Theresa, Franz v. Assisi, Papst, Dalai Lama, …). Um Religion als Thema explizit einzuspielen, werden zusätzlich noch ein Foto einer Bibel und des Koran zugefügt. Einige leere Blätter liegen ebenfalls dort, für den Fall, dass ein Teil-
Götz-Guerlin Theologisieren mit »bildungsfernen Jugendlichen« – eine Praxisreflektion
nehmender eine für ihn äußert wichtige Person ergänzen möchte. Die Teilnehmende werden aufgefordert, jeweils ein Bild auszuwählen, auf dem jemand abgebildet ist, dem sie ein besonders hohes Maß an Glaubwürdigkeit zusprechen. Danach stellen sich die Teilnehmenden jeweils vor, indem sie ihre Auswahl begründen. Die Seminarleitung steuert zurückhaltend durch kurze Nachfragen, wo Dinge zu unklar bleiben oder die Begründungen zu oberflächlich erscheinen. In einem zweiten Schritt werden die Teilnehmende aufgefordert, gemeinsam alle ausgelegten Bilder in eine Reihenfolge zu bringen, die dem Maß an Glaubwürdigkeit der jeweils Abgebildeten entspricht. Die Gruppe muss sich dabei auf eine Reihenfolge einigen, mit der alle in der Gruppe »einigermaßen leben können«. Nach einer ersten Runde, in der an manchen Stellen Bilder nebeneinander liegen, erhöht die Seminarleitung den Zwang zur Diskussion untereinander, indem die Anordnung ergeht, dass eine Reihenfolge gefunden werden muss, die eindeutig ist und keine Doppelplatzierungen zulässt. Nach einer ganzen Weile, in der sich die Teilnehmenden – unterschiedlich intensiv – an den Diskussionen und am Hin- und Herlegen beteiligen, kommt folgende Reihenfolge zustande: An der Spitze liegen der Dalai Lama, Gandhi, Mandela, Mohammed, Jesus, gefolgt von einigen Prominenten, dahinter die unterschiedlichen Politiker und am Ende Bushido. Bibel und Koran liegen irgendwo im Mittelfeld. Die Schülerinnen und Schüler setzen sich wieder auf ihre Plätze und es macht sich Erleichterung breit. Vor allem dar-
211
über, dass die Aufgabe bewältigt wurde, weniger über ein im Diskurs gefundenes Ergebnis. Es folgen eine kurze Betrachtung des Gruppenergebnisses und gezielte Nachfragen der Seminarleitung an einzelne Teilnehmende, wie sie selber zu diesem Ergebnis stehen und warum sie dieses Ergebnis der Gruppe mit tragen können. Nun zeigt sich schnell, dass die gefundene Reihenfolge der Bilder lediglich in Teilen einen Konsens wiederspiegelt. Klar wird, dass einige sich durchgesetzt haben, andere keine Lust mehr auf Diskussionen hatten und daher allem zustimmen u.ä. Neben der Frage, ob einige Politiker nicht doch bessere Plätze verdient hätten (Obama, Attatürk), scheiden sich die Geister besonders an der Frage der Positionierung der religiösen Persönlichkeiten bzw. der Bibel und des Koran. Zum Thema wird das, als sich der bislang zurückhaltende Omer positioniert15: »Eigentlich ist das alles nicht meine Meinung. Es geht nicht, dass Koran oder die Bibel da liegen. Die müssen ganz nach oben – meine Meinung. Gott kann nicht weniger glaubwürdig sein als ein Mensch. Also für mich ist das so; ich bin Moslem.« Dieses Votum ist der Anstoß zu einer Diskussion über die Frage, wie weit die Glaubensaussage, »Gott kann nicht weniger glaubwürdig sein als ein Mensch«, Geltung beanspruchen kann. Die konfessionslosen Schülerinnen und Schüler halten sich zunächst zurück, geben aber 15 Die folgenden Zitate entstammen einer Mitschrift, die im Verlauf des Seminars vom Verfasser angefertigt wurde. Es wurden dabei Stichpunkte gemacht und einige besonders zentrale Zitate möglichst wörtlich notiert. Dieses Verfahren ist naturgemäß unpräziser als ein wörtliches Transkript.
212
Religionspädagogische Anregungen
doch zu bedenken, dass sie die Bibel und den Koran ans Ende der Reihe legen würden. Robert, der älteste in der Gruppe, sagt: »Ich kann mit dem ganzen Religions-Kram nichts anfangen. Ich meine, Bibel und Koran gehören da ganz raus. Das muss jeder für sich entscheiden. Da kann man nicht diskutieren.« Im Folgenden dreht sich die Diskussion eine Weile um die Frage, ob religiöse Fragen und Themen überhaupt einem Diskurs zugänglich sind und fährt sich an diesem Punkt fest. An dieser Diskussion beteiligen sich relativ viele Teilnehmende. Lediglich zwei sagen nichts dazu und bleiben still. Die Diskussion ist sachlich und fair, aber über die Bedeutung und Glaubwürdigkeit von Heiligen Schriften ist offenbar kein Konsens zu erzielen. Bewegung kommt in die Debatte als die Seminarleitung aus der bislang lediglich moderierenden und kurze Nachfragen stellenden Rolle heraustritt und gezielt fragt, was denn mit Jesus und Mohammed sei. Ermuntert durch diese Frage bemängeln die muslimischen Teilnehmenden (erwartungsgemäß) die bislang gefundene Reihenfolge: Mohammed gehöre weiter nach oben und Jesus mindestens doch vor Nelson Mandela, denn letzterer habe keine Religion gegründet. »Und ein Prophet ist er auch nicht, also Mandela«, pflichtet Murat bei. Erstaunlich ist, dass die Diskussion hier nun deutlich entspannter ist. Robert, der sich unter den religionsfernen Teilnehmenden am deutlichsten exponiert hat, bringt die Sache auf den Punkt: »Ich kann mit Religion nichts anfangen. Wie schon gesagt. Aber Jesus oder Mohammed, die sind o.k.« Nachfrage von Joane: »Wieso o.k. Was meinst du damit?« Robert: »Na ja, so wie die waren und was die
gemacht haben. Ihr Leben.« Philip: »Also Bibel und Koran – das hat jemand aufgeschrieben; ist halt ein Buch. Aber Jesus, zum Beispiel. Den hat es echt gegeben.« Nachfrage der Seminarleitung: »Denken Sie also, dass Jesus und Mohammed wirklich gelebt haben? Oder sind es doch eher eine Art Sagen-Figuren?« Philip: »Nein. Die muss es gegeben haben. Das denkt man sich nicht einfach aus. Ich meine, die ganzen Geschichten. Und dass es so viele gleich glauben. Die sind echt.« Die Diskussion geht in der Gruppe eine kurze Weile weiter, ist aber nicht besonders kontrovers. Recht schnell können sich die Schülerinnen und Schüler auf einen Konsens einigen, der sich ungefähr wie folgt zusammenfassen lässt: Unabhängig von der eigenen religiösen Überzeugung gibt es einen großen Respekt vor der »Lebensleistung« Jesu und auch Mohammeds. Die Kenntnisse über beide Gestalten sind nicht sonderlich tief, aber sie werden ähnlich respektvoll behandelt wie z.B. der Dalai-Lama, der ja auf Platz eins der Glaubwürdigkeitsskala stand. Die religiöse und theologische (Be-)Deutung von Jesus und Mohammed tritt dabei zugunsten des Gruppenkonsenses zurück. Sebastian bringt es auf den Punkt: »Ist halt Toleranz. Über die Bibel oder den Koran kann ich nichts sagen. Ich glaub einfach nicht dran. Für Ahmed und Omer und für euch andere ist das total wichtig. Eigentlich muss es daneben gelegt werden. Aber Jesus und Mohammed – an die muss man nicht glauben. Ob Prophet oder nicht, die waren gut.« Es folgen weitere zustimmende Voten und Jesus und Mohammed rücken direkt hinter den Dalai Lama vor. Kurz wird noch dessen Spitzen-Position diskutiert, aber die Diskussionsfreudigkeit ist nun
Götz-Guerlin Theologisieren mit »bildungsfernen Jugendlichen« – eine Praxisreflektion
deutlich erlahmt. Nicht zuletzt weil sich abzeichnet, dass in der Gruppenkonstellation und vor dem Hintergrund des oben geschilderten Konsenses, die Entscheidung, ob Jesus oder Mohammed nun der erste Platz gebührt, kaum zu fällen sein dürfte, bleibt der Dalai Lama an Platz eins. Als Symbolfigur für Gewaltlosigkeit und Friedfertigkeit ist das für alle akzeptabel. Bibel und Koran werden gesondert betrachtet – ihre Bedeutung erschließt sich nur den jeweils Glaubenden und ist im Diskurs nicht zugänglich. Nach über 70 Minuten, und mithin nach deutlich längerer Diskussion als geplant, geht die Gruppe in die Pause. 5. Reflektionen auf die Praxis
Die erste Frage, die sich in der Reflektion dieses Seminartages stellt, ist, ob sich diese Auszubildenden als »bildungsfern« im o.g. Sinne bezeichnen lassen. Sie besitzen alle einen Schulabschluss, wenn sie auch z.T. recht lange dafür benötigt haben, wie das hohe Lebensalter in der Erstausbildung vermuten lässt. Alle haben einen Ausbildungsplatz in der Dualen Berufsausbildung gefunden. Wenn auch in einem eher unattraktiven Segment, nämlich dem schlecht bezahlten Dienstleistungssektor mit wenig attraktiven Arbeitsbedingungen (Arbeitszeiten, Entlohnung, Leistungsdruck). Trotz ihrer häufig gebrochenen Bildungsbiographien gehören die Teilnehmenden des Seminars also nicht zum »chancenlosen Prekariat« oder zur »Unterschicht«.16 Sie sind eher im Bereich der unteren Mittelschicht anzusiedeln und haben relativ gute Chancen, sich im Blick auf gesellschaftliche und ökonomi-
213
sche Teilhabe zu etablieren. Gerade der Einzelhandel bietet Menschen ohne hohe formale Bildung, aber mit Aufstiegswillen und Leistungsbereitschaft nach wie vor vergleichsweise gute Chancen zur beruflichen Entwicklung. Trotzdem treffen einige der Merkmale für »Bildungsferne« auf die Gruppe zu. In besonderem Maß gilt das für religiöse oder insgesamt geisteswissenschaftliche Bildung: – hinter dem hohen Alter vieler Teilnehmender stehen problematische Schulkarrieren, Abbruch von Ausbildungen, Arbeitslosigkeit, »Rumhängen« und, wie sich im Verlauf des Tages herausstellt, in einem Fall auch eine Jugendstrafe; – im Blick auf Religion sind die meisten Schülerinnen und Schüler wenig informiert – das gilt auch für die Muslime – wenig engagiert und »partizipatorisch passiv«; – eine relativ hohe Konsumorientierung und ein spaß- und freizeitorientierter Lebensstil ist ebenfalls weitgehender Konsens, findet seine Grenzen aber in den real bestehenden finanziellen Möglichkeiten17; – die Anforderung, Bildung müsse einen unmittelbar praktischen Nutzen haben, war bereits beim Besuch in der Schule ein Thema. Es bedurfte einiger Überzeugungsarbeit, bis die Gruppe bereit war, einen Projekttag in Haus Kreisau zu wagen. Dass sie 16 Vgl. Sinus Institut Heidelberg, Sinus-Milieumodell, http://www.sinus-institut.de/de/loe sungen/sinus-milieus.html und Dirk Loerwald, Ökonomische Bildung für bildungsferne Milieus, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 32–33 (2007), 27–33. 17 Ebd., 29.
214
Religionspädagogische Anregungen
dann ein »philosophisch« konnotiertes Thema ausgewählt hat, war überraschend; – sprachliche Kompetenzen und Argumentationsfähigkeit der Teilnehmenden waren hingegen relativ ausgeprägt. Das zeigt nicht zuletzt das hohe Niveau der Diskussion – nicht so sehr auf formal-sprachlicher aber auf argumentativer Ebene; – die Grenzen der Teilnehmenden wurden in der Textarbeit rasch deutlich. Die Arbeit an den Texten war für viele eine überfordernde Aufgabe, obwohl die aus Zeitungen und anderen journalistischen Zusammenhängen stammenden Texte stark gekürzt und sprachlich vereinfacht sowie mit erschließenden Fragen flankiert waren. In der Präsentation wurden die Texte gekürzt nacherzählt. Eine Verbindung zu den diskutierten Fragestellungen gelang nur in Ansätzen und mit großer Unterstützung durch die Seminarleitung. Zusammenfassend erlaubt dies, die Gruppe trotz aller Einschränkungen als »bildungsfern«, mindestens aber in hohem Maße als »bildungsungewohnt« zu bezeichnen. Das gilt in besonderem Maß im Blick auf Themen und Zugangsweisen, die sich mit dem Gegenstand und Programm des Theologisierens verbinden. Die zweite Frage, die zu stellen ist, ist die, wie weit in dem geschilderten Praxisbeispiel mit Recht von einem »Theologisieren« gesprochen werden kann. In jedem Fall werden hier in der beschriebenen Eingangssequenz religiöse Vorstellungen und Themen von und durch die jugendlichen Teilnehmenden diskutiert. Theologisch ausgedrückt geht es um die Frage des Geltungsanspruchs
religiöser Texte und Überzeugungen in einem über die jeweilige Religionsgemeinschaft hinausreichenden Raum sowie um die Frage religiöser Toleranz. Die Schülerinnen und Schüler bringen ihre eigenen Ansichten und Meinungen zum Ausdruck, sie positionieren sich und begründen ihre Haltungen voreinander. »Schüler-Positionen«18 werden also ins Gespräch gebracht. Die Seminarleitung greift dabei so gut wie nicht ein, bittet allenfalls um eine die jeweilige Position verdeutlichende Erklärung. Eine Auseinandersetzung mit »Fremdpositionen«, die nicht aus der Gruppe kommen, sondern wie z.B. von Dieterich vorgeschlagen der »biblischchristlich-konfessionellen Tradition«19 entstammen, fehlt in dem geschilderten Projekttag; zumindest in der beschriebenen Einstiegseinheit. Legt man die Matrix von Schlag / Schweitzer20 an die Sequenz an, lässt sich feststellen, dass sich die Diskussion wesentlich im Feld der persönlichen Theologie und der expliziten Theologie bewegt. Eine »Deutung mit Hilfe der theologischen Dogmatik«, welche eine weitere Dimension darstellen würde, ist allenfalls in Ansätzen zu finden. Und das nur, wenn man z.B. die Behauptung einer grundlegenden qualitativen Überlegenheit göttlicher Offenbarung vor menschlichem Handeln (»Ein Mensch kann nicht höher sein als Bibel oder Koran«) bereits als dogmatisch-theologische Aussage bezeichnen will. Die Vermutung, der Tag verharre dadurch beim ersten Schritt des Theo18 Vgl. Dieterich (wie Anm. 2), 44. 19 Ebd. 20 Schlag / Schweitzer (wie Anm. 3), 11.
Götz-Guerlin Theologisieren mit »bildungsfernen Jugendlichen« – eine Praxisreflektion
logisierens mit Jugendlichen – als religionspädagogischem oder didaktischem Programm – lässt sich daher nicht entkräften. Es bleibt dabei, dass hier vor allem das thematisiert wird, was Jugendliche als theologische Fragen und impliziter Religiosität21 im weiteren Sinne mit sich »herumtragen«. Die Schüler/innen bringen ihre eigenen Ansichten und Meinungen zum Ausdruck, sie positionieren sich und begründen ihre Haltungen voreinander. Weiter geht es an diesem Tag aber nicht. Angesichts der Rahmenbedingungen eines solchen Projekttages muss gefragt werden, ob »mehr drin« gewesen ist. Das betrifft zum einen die pädagogischen Rahmenbedingungen: Eine unbekannte Gruppe trifft auf ihnen unbekannte Pädagogen in einem fremden Rahmen. Zur Verfügung steht ein Tag mit 3 x 90 Minuten »Unterricht«. Die meisten TN haben kaum religiöse Vorbildung und kaum Erfahrungen mit einem Diskurs über philosophische oder religiöse Themen. Zum anderen sind die religionspolitischen Rahmenbedingungen in den Blick zu nehmen: Die Auszubildenden kommen zu einem Projekttag, nicht aber zum Religionsunterricht; es fehlt also die grundsätzliche bewusste Entscheidung, sich über Religion bzw. das was dafür gehalten wird, auszutauschen. Im Blick auf das religionspädagogische Konzept eines Theologisierens mit Jugendlichen ist m.E. ungeklärt, wie dieses auszugestalten ist, wenn 85% der Teilnehmende keinen christlichen Hintergrund haben. Welche »biblischchristlich-konfessionelle Traditionen« können und sollen dann auf welche Art und Weise in den Dialog eingetragen werden? Wie sieht ein Theologisieren
215
mit Jugendlichen aus, wenn »kaum Erfahrung, Wissen oder nur schon Interesse bzw. Sensibilität im Blick auf … religiöse Themen und Fragen vorausgesetzt werden« kann?22 Und nicht zuletzt: Wie wird ein solches Konzept angesichts einer freiwilligen Teilnahme umgesetzt, wenn Religion für mehr als die Hälfte der Schülerinnen und Schüler ein negativ besetztes Feld ist, mit dem man nichts zu tun haben will? Die skizzierten Bedingungen sind für weite Teile des Religionsunterrichts in beruflichen Schulen auch dort, wo dieser an anderen Orten ein reguläres Unterrichtsfach ist, anzunehmen. Es wäre sicherlich lohnend, in der Auseinandersetzung mit den wenigen aktuelleren Betrachtungen zu einer Religionspädagogik in diesem Bereich die Frage eines Theologisierens mit Berufsschülerinnen und Auszubildenden – ob bildungsferner oder bildungsaffiner – einmal intensiv zu reflektieren. Für die Praxisreflektion, die dieser Artikel leisten soll, lässt sich abschließend – und in der naturgemäß subjektiver Wertung eigenen pädagogischen Handelns – sagen, dass unter den aufgezeigten Bedingungen an diesem Projekttag schon einiges an Theologisieren realisiert werden konnte. Ob mehr »drin« war, ob Chancen vergeben wurden oder der religionspädagogische Mut fehlte, lässt sich aus der Binnenperspektive wohl nicht endgültig klären.
21 Andreas Obermann, Im Beruf Leben finden. Allgemeine Bildung in der Berufsbildung – didaktische Leitlinien für einen integrativen Bildungsbegriff im Berufsschulreligionsunterricht (ARP 55), Göttingen 2013, 195. 22 Schlag / Schweitzer (wie Anm. 3), 17.
216
Religionspädagogische Anregungen
Britta Hemshorn de Sánchez Theologisieren mit Jugendlichen im Horizont gegenwärtiger Inklusionsaufgaben
1. Einleitung
Inklusion als Menschenrecht ist eine nicht hintergehbare Herausforderung an die gesamte Gesellschaft und damit auch an die Religionspädagogik. Seit 2009 ist sie in Deutschland rechtsverbindlich. Im Spannungsfeld unterschiedlicher gesellschaftlicher Anforderungen an schulische Bildung, nämlich Anpassung an gesellschaftliche Normen und Bildungsstandards einerseits und Inklusion als Recht auf Verschieden-Sein andererseits1, beschäftigt sich der vorliegende Aufsatz allgemein mit dem Ansatz des Theologisierens mit Jugendlichen als einer geeigneten religionspädagogische Antwort auf diese Herausforderungen und im Besonderen mit der professionellen Haltung der Lehrpersonen, die sich für inklusiven Unterricht und besonders für das Theologisieren mit Lernenden als wesentlich erweist. Zunächst möchte ich deutlich machen, dass ich von einem weiten Inklusionsverständnis ausgehe, das Inklusion als Ergebnis fortschreitender Differenzierung in der Menschenrechtstradition versteht und an Andreas Hinz anschließt. Danach ist Inklusion der »allgemeinpädagogische Ansatz, der auf der Basis von Bürgerrechten argumentiert, sich gegen jede gesellschaftliche Marginalisierung wendet und somit allen Menschen das gleiche volle Recht auf individuelle
Entwicklung und soziale Teilhabe ungeachtet ihrer persönlichen Unterstützungsbedürfnisse zugesichert sehen will. Für den Bildungsbereich bedeutet dies einen uneingeschränkten Zugang und die unbedingte Zugehörigkeit zu allgemeinen Kindergärten und Schulen des sozialen Umfeldes, die vor der Aufgabe stehen, den individuellen Bedürfnissen aller zu entsprechen – damit wird, dem Verständnis der Inklusion entsprechend, jeder Mensch als selbstverständliches Mitglied der Gemeinschaft anerkannt«.2 Inklusion bedeutet folglich die Anerkennung von Verschiedenheit als Normalität. Der Begriff »Inklusion« grenzt sich von anderen Begriffen ab, die den Umgang mit Verschiedenheit in Bezug auf Bildung kennzeichnen (Exklusion, Separation, Extinktion, Integration). Für den schulischen Kontext heißt Inklusion dann, Verschiedenheit aller Lernenden zum Ausgangspunkt aller Konzeptionierung und Planung für Schulleben und Unterricht zu machen und daraus resultierende strukturelle und inhaltli1 Annedore Prengel, Kann inklusive Pädagogik die Sehnsucht nach Gerechtigkeit erfüllen? – Paradoxien eines demokratischen Bildungskonzepts, in: Simone Seitz u.a. (Hg.), Inklusiv gleich gerecht? Inklusion und Bildungsgerechtigkeit, Bad Heilbrunn 2012, 16–31. 2 Andreas Hinz, Inklusion, in: Georg Antor / Ulrich Bleidick (Hg.), Handlexikon der Behindertenpädagogik, Stuttgart 2006, 97f.
Hemshorn de Sánchez Theologisieren mit Jugendlichen im Horizont gegenwärtiger Inklusionsaufgaben
che Anpassungen zu gewährleisten und individuell angemessene Vorkehrungen auf allen Ebenen des Bildungswesens zu treffen.3 Die Menschenrechte verweisen auf die Menschenwürde als Ausgangs- und Zielpunkt. In einer pluralen Gesellschaft ist aber die Begründung und inhaltliche Füllung dessen, was genau Menschenwürde ausmacht, nicht automatisch gegeben, sondern muss immer wieder mit den verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen ausgehandelt werden. Daraus ergibt sich für Bildung allgemein und besonders für die Religionspädagogik die Aufgabe, neben didaktisch-methodisch vielfältigen Zugängen zu ihren Themen, Dialogfähigkeit zu fördern.4 Die Kompetenz zum Übersetzen zwischen verschiedenen Diskursen und zum Aushandeln zwischen verschiedenen Positionen, Perspektiven, Interessen und Bedürfnissen ist entscheidend für Lernsettings, in denen Inklusion konsequent Beachtung finden soll. Diese Kompetenzen können meines Erachtens unter den verschiedenen Ansätzen der Religionsdidaktik in besonderer Weise beim Theologisieren mit Jugendlichen eingeübt werden. Denn das Theologisieren kommt den menschenrechtlich orientierten Prinzipien einer Pädagogik der Vielfalt5 bzw. der Religionspädagogik der Vielfalt besonders entgegen: Selbstachtung und Anerkennung der Anderen in egalitärer Differenz, Subjektorientierung und Offenheit. Sinnvoll ergänzt wird der Ansatz des Theologisierens durch konstruktivistische religionspädagogische Prinzipien, da sie in besonderer Weise der Anerkennung der Anderen entsprechen, indem sie Konstruktionen und Ko-Konstruktio-
217
nen der Lernenden bzw. der Anderen ernst nehmen und von verabsolutierenden Wahrheitsansprüchen absehen.
3 Vgl. Saskia Flake / Ina Schröder, Inklusive Pädagogik – Eine Herausforderung für die Religionspädagogik?!, in: Katharina Kammeyer / Erna Zonne / Annebelle Pithan (Hg.), Inklusion und Kindertheologie, Münster 2014, 30– 64. Der Index für Inklusion wurde für die konkrete Umsetzung von Inklusion im schulischen Bereich entwickelt, vgl. Ines Boban / Andreas Hinz, Index für Inklusion. Lernen und Teilhaben in der Schule der Vielfalt entwickeln, Halle 2003. Im Vorwort des Index wird ausdrücklich an die Pädagogik der Vielfalt und ihren nicht-hierarchischen, demokratischen Umgang mit Heterogenität angeknüpft, so dass die Sinnhaftigkeit der Nutzung dieser Systematik für die schulische Praxis explizit gegeben ist. Der »Index Inklusion für Bildungseinrichtungen der EKD« versteht sich in Anlehnung an diesen Index für Inklusion, als Leitfaden für die Institute, um Grundhaltungen, Strukturen ihrer Organisation, Aktionsformen und Angebote so zu verändern, dass sie sich der Vision von Teilhabe- und Chancengerechtigkeit für alle immer weiter annähern, vgl. Kirchenamt der EKD (Hg.), Index Inklusion für Bildungseinrichtungen in der EKD (http://www.ekir. de/pti/arbeitsbereiche/index-inklusion-fuer-bi ldungseinrichtungen-in-der-ekd-373.php). Die »zehn Grundsätze für inklusiven Religionsunterricht« des Comenius-Instituts greifen ebenfalls die Anregungen des Index für Inklusion auf und spezifizieren sie in stark gekürzter Form für den Religionsunterricht, vgl. Comenius-Institut (Hg.), Inklusive Religionslehrer/ innenbildung. Module und Bausteine, Münster 2014. 4 Heiner Bielefeldt, Menschenwürde. Der Grund der Menschenrechte. Berlin 2008. (htt p://www.institut-fuer-menschenrechte.de/upl oads/tx_commerce/studie_menschenwuerde_ 2008.pdf ; ders., Zum Innovationspotenzial der UN-Behindertenrechtskonvention. Berlin 2009. 5 Vgl. Annedore Prengel, Pädagogik der Vielfalt. Verschiedenheit und Gleichberechtigung in interkultureller, feministischer und integrativer Pädagogik, Opladen 2006.
218
Religionspädagogische Anregungen
2. Ansätze des Theologisierens mit Jugendliche(n) als gelungene Umsetzung einer Religionspädagogik der Vielfalt6
Beim Theologisieren mit Kindern und Jugendlichen geht es explizit nicht um den fragend-entwickelnden Stil, bei dem die Lehrperson die Lernenden zu dem ihr selbst bekannten Ergebnis hinzuführen versucht, sondern Ziel der Kindertheologie ist es, Kinder zur Entwicklung eigener Fragestellungen anzuregen, sie zum eigenständigen Nachdenken über Religion und Glauben zu motivieren und sie bei der Reflexion ihres Nachdenkens zu begleiten.7 Jugendtheologisch relevant ist in diesem Zusammenhang Hans-Jürgen Röhrigs Forderung nach einem erweiterten Reflexionsbegriff, der über den rein kognitiven hinausgeht: »Ein rein kognitiver Reflexionsbegriff birgt die theologischanthropologisch nicht akzeptable Gefahr, zum Beispiel jüngeren Mädchen und Jungen oder Schülerinnen und Schülern mit individuellem Förderbedarf, die Möglichkeit des Theologisierens abzusprechen. Es geht um einen breiten, mehrdimensionalen ästhetischen Reflexionsbegriff, der allen Mädchen und Jungen die Kompetenz des Theologisierens zuspricht. Über kreative Zugänge – wie das Bilder malen und zeichnen, Puzzeln, Tonarbeiten, über Standbilder, Rollenspiele etc. – haben sie die Möglichkeit, das Wahrgenommene und Erfahrene auszudrücken und auf einer zweiten Ebene zu ›reflektieren‹«8. Röhrig sieht in den kreativen Formen der Auseinandersetzung nicht nur reine Ausdrucksformen, sondern Formen des Reflektierens, die dazu anregen, Erfah-
rungen und Wahrnehmungen in eine bestimmte Form zu bringen und damit auch zu systematisieren.9 Grundlage für ein solches Vorgehen ist ein vielfältiges Angebot von Zugangs- und Aneignungsformen.10 Entscheidend ist dabei die Beachtung der vier Zugangsweisen: basal-perzeptziv, konkret-handelnd, anschaulich-modellhaft 6 Ich benutze im Folgenden die Begriffe, Kinder- bzw. Jugendtheologie, Theologisieren mit Kindern oder Jugendlichen synonym, weil es mir an dieser Stelle um das TeilhabePrinzip insgesamt, und nicht um einzelne Differenzierungen unter den Altersstufen geht. 7 Vgl. Hanna Roose, Kindertheologie und schulische Alltagspraxis: eine Explorative Studie zum Verhältnis von kindertheologischen Normen und eingeschliffenen Routinen im Religionsunterricht, in: Theo-Web. Zeitschrift für Religionspädagogik 13/1 (2014), 140f. Dabei werden alle Beiträge »von Sinnsuche, die einen Bezug auf Gott vornehmen, als Theologie gewürdigt« (Katharina Kammeyer, Kinder-und Jugendtheologie auf dem Weg zur Inklusion – Kontextuelle und emanzipatorische Beispiele, in: Katharina Kammeyer / Erna Zonne / Annebelle Pithan [Hg.], Inklusion und Kindertheologie, Münster 2014, 10); Kraft und Schreiner betonen ebenfalls einen weiten Theologiebegriff, vgl. Friedhelm Kraft / Martin Schreiner, Zehn Thesen zum didaktischmethodischen Ansatz der Kindertheologie, in: Theo-Web. Zeitschrift für Religionspädagogik 6/1 (2007), 21. 8 Zitiert nach Flake / Schröder (wie Anm. 3), 54. 9 Ebd. 10 Diese Formen finden sich z.B. bei: Wolfhard Schweiker, Arbeitshilfe Religion inklusiv. Grundstufe und Sekundarstufe I: Basisband: Einführung, Grundlagen und Methoden, Stuttgart 2012; Anita Müller-Friese / Wolfhard Schweiker, Inklusives Lernen im Religionsunterricht, in: Volker Elsenbast / Matthias Otte / Annebelle Pithan (Hg.), Inklusive Bildung als evangelische Verantwortung. Dokumentation einer Fachtagung vom 31. Januar bis 1. Februar 2013 in Hofgeismar, Münster 2013, 38–48 sowie Katharina Kammeyer / Erna Zonne / Annebelle Pithan (Hg.), Inklusion und Kindertheologie, Münster 2014.
Hemshorn de Sánchez Theologisieren mit Jugendlichen im Horizont gegenwärtiger Inklusionsaufgaben
und abstrakt-begrifflich.11 Dies kann Lernen am gemeinsamen Gegenstand in binnendifferenzierter Weise ermöglichen.12 Für die Lehrperson wiederum bedeutet dies, sie muss in der Lage sein, die Differenz zwischen ihrem theologischen Wissen und den theologischen Äußerungen der Jugendlichen auszuhalten. Sie braucht außerdem Einfühlungsvermögen, kommunikative Kompetenz und Fachwissen. Je umfangreicher das Fachwissen, desto spontaner und sicherer kann sie mit ungewöhnlichen Antworten umgehen. Darüber hinaus ist sie dann in der Lage, Bezüge zu verwandten theologischen Thesen oder Fragestellungen herzustellen, und damit die Relevanz der Fragen und Aussagen der Jugendlichen zu heben. Die Vorbereitung auf einen solchen Unterricht erfordert eine breit angelegte Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Thema und weiteren Unterthemen, die zur Sprache kommen könnten.13 Entscheidend ist des Weiteren die Art des Fragens, denn sie soll Lernende motivieren und Raum für eigenes Nachdenken öffnen.14 Martin Schreiner hat Fragen nach unterschiedlichen Funktionen kategorisiert und Beispielfragen zusammengestellt, die sich als Impuls eignen, um das Nachdenken der Kinder anzuregen. Er unterscheidet dabei Fragen, die klären helfen, die Voraussetzungen aufspüren, die nach Begründungen und Wahrheit suchen, die den Horizont für verschiedene Meinungen öffnen, die Konsequenzen aufspüren und schließlich Fragen, die das Fragen reflektieren. Neben der fachlichen Vorbereitung und der Auswahl geeigneter Fragen ist immer wieder von der angemessenen Haltung der Lehrpersonen die Rede.
219
Denn ob und in wieweit das Theologisieren mit Jugendlichen den Elementen einer Religionspädagogik der Vielfalt entspricht, hängt jeweils von der Art der Gesprächsgestaltung und von der Haltung der Lehrperson ab.15 Aber auch die sich durch die unterschiedlichen Lehrpläne in den Bundesländern ergebenden Rahmenbedingungen haben einen Einfluss darauf. Je nachdem, ob das Setting im Religionsunterricht monokonfessionell, interkonfessionell oder interreligiös ist, muss das Theologisieren modifiziert werden. Die Anforderungen an die fachliche Vorbereitung und die Wahl der Themen fallen dementsprechend unterschiedlich aus. Da sich aber ohnehin keine klare Grenze zwischen Theologisieren und Philosophieren mit Kindern ziehen lässt, ist der Ansatz in jedem Fall auch für religiös heterogen zusammengesetzte Gruppen fruchtbar zu machen.16 11 Vgl. Müller-Friese / Schweiker (wie Anm. 10) 42–45. 12 Vgl. Georg Feuser, Entwicklungslogische Didaktik, in: Astrid Kaiser u.a. (Hg.), Didaktik und Unterricht, Stuttgart 2011, 89. 13 Vgl. Erna Zonne, Thesen zur Kindertheologie in einem von Lehrplänen beeinflussten Kontext, in: Katharina Kammeyer / Erna Zonne / Annebelle Pithan, Inklusion und Kindertheologie, Münster 2014, 77f; Kraft / Schreiner (wie Anm. 7), 23. 14 Vgl. auch Manfred Hilkert, Theologisieren mit Kindern, Stuttgart 2013, 5 (http://www. calwer.com/media/39/ZM_4150_Theologisieren_mit_Kindern.pdf) 15 Vgl. Roose (wie Anm. 7); Henning Schluß, Kindertheologische Differenzierungen – Zwei Fragen zur Kindertheologie, in: A.A. Bucher u.a. (Hg.), »Sehen kann man ihn ja, aber anfassen …? Zugänge zur Christologie von Kindern, Stuttgart 2008, 21f). 16 Vgl. Philipp Klutz, Philosophisch und theologisch denken. Ein Beitrag zur Entwicklung eines Curriculums, Kassel 2010.
220
Religionspädagogische Anregungen
3. Bedeutung einer professionellen Haltung für das Theologisieren im inklusiven Religionsunterricht17
Die herausragende Bedeutung der Lehrperson im Unterricht hat Hattie in seiner Meta-Analyse der Meta-Analysen herausgestellt.18 Auch in den »zehn Grundsätzen für inklusiven Religionsunterricht« des Comenius-Instituts werden in den ersten beiden Grundsätzen verschiedene Kompetenzen und eine wertschätzende Haltung der Lehrpersonen explizit genannt. In den anderen Grundsätzen finden sie sich implizit, wie z.B. im sechsten Grundsatz, wo »Prinzipien und Regeln der dialogischen Kommunikation« genannt werden, für die wiederum eine bestimmte Haltung grundlegend ist. Auch Prengel betont die Bedeutung einer »Halt gebenden und responsiven Lehrer-Schüler-Beziehung«19 sowie eine Haltung der Anerkennung.20 Außerdem sollte das Selbstkonzept der Lehrperson im Hinblick auf verschiedene Differenzlinien und die Bestimmung ihrer Rolle fortlaufend reflektiert werden. Reich betont für den konstruktivistischen Ansatz, dass Lehrpersonen die »wichtigste Lernumgebung« für die Lernenden sind21, und stellt die Bedeutsamkeit eines didaktischen Menschenbildes für Lehrende heraus.22 Daher soll im Folgenden reflektiert werden, was hinsichtlich einer angemessenen Haltung der Lehrpersonen in inklusiven Lernprozessen beachtet werden muss.
17 Was eine (gute) Religionslehrperson ausmacht, welche Kompetenzen sie benötigt, wurde auf vielfältige Weise dokumentiert, z.B. Gottfried Adam, Religionslehrerin / Religionslehrer: Beruf – Person – Kompetenz, in: Martin Rothgangel / Gottfried Adam / Rainer Lachmann (Hg.), Religionspädagogisches Kompendium, Göttingen 7 2012, 292–309. Vieles davon gilt auch für den inklusiven Religionsunterricht, denn letztlich sollte guter Religionsunterricht immer inklusiv sein. Adam nennt z.B. die Kompetenzen aus dem von der KMK verfassten Anforderungsprofil »Evangelische Religionslehre«: Fachwissenschaftliche Kompetenz, Rollen- bzw. Selbstreflexionskompetenz, Wahrnehmungs- und Diagnosekompetenz, theologisch-didaktische Erschließungskompetenz, Gestaltungskompetenz, Dialog- und Diskurskompetenz sowie Entwicklungskompetenz (vgl. ebd. 296); vgl. auch Kirchenamt der EKD (Hg.), Theologisch-Religionspädagogische Kompetenz. Professionelle Kompetenzen und Standards für die Religionslehrerausbildung. Hannover 2008 sowie Renate Hofmann, Wie werden Religionslehrer/innen zu guten Religionslehrer/innen? In Theo-Web. Zeitschrift für Religionspädagogik 6/2 (2007), 33–41. 18 Vgl. John Hattie, Visible Learning. A Synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement, London 2009. 19 Vgl. Annedore Prengel, Humane entwicklungs- und leistungsförderliche Strukturen im inklusiven Unterricht, in: Vera Moser (Hg.), Die inklusive Schule. Standards für die Umsetzung, Stuttgart 2012, 176f. 20 Vgl. Annedore Prengel, Inklusion pädagogisch – Grundverständnisse, Voraussetzungen und Konzeptionen, in: Volker Elsenbast / Matthias Otte / Annebelle Pithan (Hg.), Inklusive Bildung als evangelische Verantwortung. Dokumentation einer Fachtagung vom 31. Januar bis 1. Februar 2013 in Hofgeismar, Münster 2013, 6–14; dies., Pädagogische Beziehungen zwischen Anerkennung, Verletzung und Ambivalenz, Opladen 2013; dies., »Ohne Angst verschieden sein« – Mehrperspektivische Anerkennung von Schulleistungen in einer Pädagogik der Vielfalt, in: Benno Hafeneger / Peter Henkenborg / Albert Scherr (Hg.), Pädagogik der Anerkennung. Grundlagen, Konzepte, Praxisfelder, Schwalbach/Ts. 2013, 203–221. 21 Kersten Reich, Konstruktivistische Didaktik. Das Lehr- und Studienbuch mit Online-Methodenpool, Weinheim 52012, 17. 22 Ebd., 21f; vgl. auch Rudolf Englert, Braucht,
Hemshorn de Sánchez Theologisieren mit Jugendlichen im Horizont gegenwärtiger Inklusionsaufgaben
4. Halt und Haltung der Lehrperson – Zur Entwicklung eines professionellen Habitus
Die Anforderungen an die Haltung von Lehrpersonen im inklusiven Unterricht sind hoch. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, ohne sich selbst zu überfordern, benötigen Lehrpersonen Halt, der eine solche Haltung ermöglicht. Aus reformatorischer Perspektive gilt auch für Lehrpersonen, dass sie sich als anerkannt »vor jeder Leistung« wahrnehmen dürfen. Damit kommt eine spirituelle Dimension in den Blick, die in der Aus-, Fort- und Weiterbildung von Religionslehrpersonen sowie im Aufgabenfeld von Schulseelsorge vermehrt Aufmerksamkeit erhalten muss. Dabei spielt ebenfalls das Menschenbild der Lehrpersonen eine wesentliche Rolle für den Halt, weil es sich z.B. auf den Umgang mit Unvollkommenheit bei sich selbst und anderen auswirkt. Die Auseinandersetzung mit Henning Luthers fragmentarischer Identität23 und der theologischen Anthropologie von Ulf Liedke24 ist hier richtungsweisend. Büttner fordert, dass die Auseinandersetzung der Lehrpersonen mit der Theologie, den theologischen Aussagen zu Gottes- und Menschenbild und zu Fragen von Leistung und Anerkennung zu einem relevanten theologischen Wissen führen muss, das argumentativ spontan einsetzbar ist, ohne dies im Gestus der unhinterfragbaren Richtigkeit einzubringen.25 Dazu sollen Büttners Gedanken zum Habituskonzept für eine Jugendtheologie kurz skizziert werden. Denn mit dem Habituskonzept wird der wichtigen Frage nach Macht Raum gege-
221
ben, die bei inklusiven Forderungen nach Teilhabegerechtigkeit allgemein, aber auch im Religionsunterricht und beim Theologisieren in besonderer Weise von Bedeutung ist. Angeregt durch die Frage, ob auch Lernende aus bildungsferneren Milieus zum Theologisieren motiviert werden können, hat Büttner das Theologisieren zunächst als ein Habituselement im Bourdieu’schen Sinn identifiziert, d.h. als Ausdruck gesellschaftlicher Ungleichheit.26 Er charakterisiert diese Art des Theologisierens als »Gespräche mit Professorenkindern und deren Freund/innen«27. Büttner stellt die These auf, dass sich sowohl Lehrende als auch Lernende gemeinsam, aber auch jede Person für sich, einen Habitus aneignen müssen. Ihm zufolge ist das Ziel einerseits, allen Lernenden gesellschaftlich verbesserte Partizipationsmöglichkeiten zu eröffnen. Dies geschieht dadurch, dass sie sich durch das Theologisieren den Habitus einer »gebildeten Religion« aneignen, der wiederum gesellschaftlich positiv konnotiert ist, weil er für die Fähigkeit steht, reflektiert argumentieren
wer von Bildung redet, ein Menschenbild? Ein Blick auf die EKD Denkschrift »Maße des Menschlichen«, in: Christoph Bizer u.a. (Hg.), Menschen Bilder im Umbruch – Didaktische Impulse, Neukirchen-Vluyn 2014, 147–154. 23 Vgl. Henning Luther, Religion und Alltag. Bausteine zu einer Praktischen Theologie des Subjekts, Stuttgart 1992. 24 Ulf Liedke, Beziehungsreiches Leben. Studien zu einer inklusiven theologischen Anthropologie für Menschen mit und ohne Behinderung, Göttingen 2009. 25 Gerhard Büttner, Theologisieren: Einübung in einen Habitus, in: Katechetische Blätter 138/2 (2013), 142. 26 Ebd., 140. 27 Ebd.
222
Religionspädagogische Anregungen
zu können. Andererseits sollte durch die inhaltliche Auseinandersetzung und durch die Diskurskultur im Religionsunterricht, besonders durch das gemeinsame Theologisieren, ein demokratiefreundlicher Habitus entwickelt werden. Zwischen diesen sich teilweise widersprechenden Zielen Büttners – Chancengleichheit durch Anpassung oder gleiche Rechte für alle in ihrer Verschiedenheit – begegnet uns die Machtfrage in aller Deutlichkeit. Für eine Religionspädagogik der Vielfalt stellt sich die Frage, ob der inklusive Religionsunterricht darauf zielen soll, dass Lernende sich einen Habitus aneignen, der ihnen zu Chancengleichheit in einer zurzeit noch nicht-inklusiven Gesellschaft verhilft, oder ob er Lernende stärken soll, ihre Potenziale in die Gestaltung von inklusiver Gesellschaft einzubringen. Letzteres entspräche eher der »Selbstachtung und der intersubjektiven Anerkennung der Anderen«.28 Um das Theologisieren als einen religionspädagogischen Ansatz für alle Lernenden, auch die aus bildungsferneren Milieus, zu öffnen, bedarf es seitens der Lehrpersonen eines besonderen Stils, der dies ermöglicht. Inger Herrmann hat Beispiele dafür angeführt, dass auch bildungsfernere Lernende durchaus zu relevanten theologischen Äußerungen motiviert werden können.29 Es ist also seitens der Lehrenden ein Habitus gefragt, der Zugang zu allen Lernenden verschafft. Ein solcher inklusiver Habitus verleiht »Macht«, um andere zu »ermächtigen«, d.h. andere zur Teilhabe zu befähigen. In diesem Zusammenhang erscheinen mir zwei Ansätze weiterführend:
Erstens der Vorschlag, mehrsprachig zu werden und hin- und herübersetzen zu können, um Dialog mit Verschiedenen kompetent und zielgerichtet führen zu können.30 Der angestrebte inklusive Habitus im Religionsunterricht wäre dann ein für alle Beteiligten, Lehrende und Lernende, durch Mehrsprachigkeit gekennzeichneter. Dabei ist Mehrsprachigkeit hier weit zu fassen, d.h. auf Religionen, Milieus, Kulturen, Begabungen und Jargons bezogen. Zweitens kann für einen spielerischen Umgang mit dem Habitus ein Ansatz aus dem Improvisationstheaters bedeutsam sein, der das verbale und körpersprachliche Spiel mit Status einübt.31 Durch den spielerischen Umgang wird eine bestimmte (Körper-)Sprache eingeübt, so dass sie zur Verfügung steht, allerdings ohne ab
28 Prengel (wie Anm. 5), 185ff. 29 Vgl. Inger Hermann, Halt’s Maul, jetzt kommt der Segen …«: Kinder auf der Schattenseite des Lebens fragen nach Gott, Stuttgart 1999. 30 Vgl. Heinrich Bedford-Strohm, Menschenrechte und Menschenwürde in der Perspektive Öffentlicher Theologie, in: International Journal of Orthodox Theology 2/3 (2011), 5–20; Manfred Pirner, Protestantismus und Menschenrechtsbildung: Das Beispiel Religionsunterricht, in: Ralf Koerrenz (Hg.), Bildung als protestantisches Modell, Paderborn 2013, 149–167. 31 Keith Johnstone, Improvisation und Theater, Berlin 112013, 51–125; Plath greift die Statuslehre von Johnstone als Instrument auf, um Konflikte in der Kommunikation zwischen Lehrenden und Lernenden zu lösen, aber auch um schwächeren Lernenden zu mehr Standing zu verhelfen. Sie zeigt, wie durch Mehrsprachigkeit bzw. wechselnden Ausdruck von Status im Körperausdruck beim jeweiligen Gegenüber viel bewirkt werden kann, vgl. Maike Plath, Status im Schulalltag (2013) (http:// www.sek-muellheim.ch/documents/Plath_Sta tus_im_Schulalltag.pdf).
Hemshorn de Sánchez Theologisieren mit Jugendlichen im Horizont gegenwärtiger Inklusionsaufgaben
jetzt die einzig gültige sein zu müssen. Um Missverständnissen vorzubeugen, möchte ich betonen, dass ein Habitus nicht hergestellt werden kann. Methoden und Übungen sind immer nur Hilfestellungen, die einen Lern- bzw. Entwicklungsprozess befördern können. So entsteht keine Norm, an die sich alle anpassen müssen, sondern ein freies Spiel mit Möglichkeiten. Weiterhin kann die Offenheit, Selbstreflexivität und Geistesgegenwart, die Lehrpersonen für den diskursiven Unterrichtsstil benötigen, durch Trainings befördert werden, wie Petra Freudenberger-Lötz betont. Sie sieht insbesondere bei den angehenden Religionslehrpersonen Chancen, mit Trainings einen solchen Habitus zu entwickeln, den das Theologisieren erfordert.32
223
32 Vgl. Petra Freudenberger-Lötz, Lernstände wahrnehmen und fördern in strukturierten theologischen Gesprächen, in: Dietlind Fischer (Hg.), Lernen beobachten – Leistung beurteilen im Religionsunterricht der Grundschule, Seelze-Velber 2010, 74–83; dies., Petra Freudenberger-Lötz, Theologische Gespräche mit Kindern. Untersuchungen zur Professionalisierung Studierender und Anstöße zu forschendem Lernen im Religionsunterricht, Stuttgart 2007. Hier seien zudem noch einige mögliche Trainingsansätze beispielhaft erwähnt: Uwe Sielert u.a., Kompetenztraining »Pädagogik der Vielfalt«. Grundlagen und Praxismaterialien zu Differenzverhältnissen, Selbstreflexion und Anerkennung, Weinheim 2009; Marshall B. Rosenberg, Gewaltfreie Kommunikation. Eine Sprache des Lebens. Paderborn 2009 sowie Übungen aus dem Improvisationstheater, Britta Hemshorn de Sánchez, Improvisationstheater – Flexibilität im Umgang mit Irritationen und Differenz. Anregungen für die Fortbildung von Religionslehrpersonen, in: Annebelle Pithan / Agnes Wuckelt (Hg.), Krise und Kreativität – Eine Suchbewegung zwischen Behinderung, Bildung und Theologie, Münster 2015, 82–91.
224
Religionspädagogische Anregungen
Tobias Petzoldt Rüstzeiten und Junge Gemeinde – Theologisieren mit Jugendlichen 14plus in kirchengemeindlicher Jugendarbeit in Sachsen 1. Kirche und Jugend in Ostdeutschland am Beispiel des Bundeslandes Sachsen
Wie in vielen einst sozialistischen Ländern hat das atheistische System der DDR die Entkirchlichung seiner Bewohnerinnen und Bewohner massiv vorangetrieben. Folgen dieser Entwicklung reichen bis in unsere Zeit und zeigen sich deutlich an den Mitgliederzahlen der Kirchen. So sind nur ca. 19% der sächsischen Jugendlichen Mitglieder einer Religionsgemeinschaft. Der Übergang zum Erwachsensein wird am häufigsten mit der Jugendweihe begangen (72%), etwa 17% nehmen an der evangelischen Konfirmation teil.1 Die Bedeutung von Kirche / Gemeinde ist also in den östlichen Bundesländern in der Folge dieses Traditionsabbruches für die Mehrzahl junger Menschen eher gering. Bundesweit signifikante Trends wie Institutionsverdrossenheit bei jungen Menschen (vgl. Shell-Jugendstudie 2010) und Individualisierung lassen ebenso wie konfessionsinhomogene Partnerschaften und eine zunehmend zu beobachtende Zurückhaltung bei der traditionellen Praxis der Kindertaufe die Wahrscheinlichkeit sinken, dass Kinder und Jugendliche christlich erzogen und im gemeindlichen Kontext beheimatet werden. Weitere Herausforderungen finden sich insbesondere im ländlichen
Raum in einer oft dramatischen demographischen Entwicklung. Im Blick auf die Milieus ist die Zugehörigkeit zu einer Kirche auch in Sachsen sehr unterschiedlich. Bei Jugendlichen wird die häufigste Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft mit 31% von Schülern am Gymnasium angegeben, am wenigsten vorhanden sind konfessionelle Bindungen bei Jugendlichen in Berufsausbildung (13%).2 Die Konfessionszugehörigkeit der religiös gebundenen Jugendlichen ist überwiegend evangelisch. Daraus resultierend ist eine schwierige Erreichbarkeit weiter Teile junger Bevölkerungsgruppen mit klassischen kirchengemeindlichen Angeboten festzustellen. Kirche wendet sich – wohl auch bedingt durch eine oft festzustellende inhaltliche Hochschwelligkeit – de facto nur an gebildete, engagierte und sozial unauffällige junge Menschen. Regional unterschiedlich verortete Angebote kirchlicher Jugendsozialarbeit bilden hier eine Ausnahme.
1 Freistaat Sachsen. Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz: Jugend 2013 in Sachsen. Eine vergleichende Untersuchung zu Orientierungsproblemen junger Menschen, Dresden 2014, 10. 2 Ebd.
Petzoldt Theologisieren mit Jugendlichen 14plus in kirchengemeindlicher Jugendarbeit
2. Beobachtungen zu Jugend und Kirche in Sachsen
Grundsätzlich ist im Bereich der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens mit regionalen Abstufungen bei den Teilnehmenden ein zumeist ausgeprägtes Interesse an Glaubensthemen wahrzunehmen (»hoher Jesus-Faktor«). Die Quantität der Mitgliedschaft zu Kirche und Gemeinden (vgl. oben) entspricht also nicht der Qualität der Teilhabe durch die Teilnehmenden und deren Interesse an Glaubensbildung. Vielmehr bestehen oft ein traditionell hoher Bekenntnishintergrund und die Sehnsucht nach individueller Gottesbegegnung. Dabei sind besonders jugendgemäße Ausdrucksformen des Glaubens gefragt. Hierzu zählen Zielgruppengottesdienste, Lobpreiszeiten, Gebetsnächte in Kirchen und Gemeinden ebenso wie der Schülerbibelkreis in der großen Pause. Daneben gehören erlebnispädagogische und sportliche Angebote ebenso wie musisch-kulturelle zu den Lebensäußerungen evangelischer Jugendarbeit in Sachsen. In den meisten Kirchengemeinden auf dem Gebiet der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens besteht das Format Junge Gemeinde als ein Basisangebot kirchengemeindlicher Jugendarbeit. Junge Gemeinde meint ein i.d.R. wöchentlich stattfindendes themenorientiertes Gruppentreffen nach der Konfirmation mit der Kernzielgruppe 14–18 Jahre.3 Dort finden soziale Begegnungen, gemeinsame Aktivitäten und Auseinandersetzungen mit biblischen/ ethischen und lebensweltlichen Themen statt. Weitere Merkmale der Junge-Gemeinde-Gruppen sind die Möglichkeit zu Teilhabe und Mitgestaltung, der An-
225
spruch auf Bildung und Kompetenzerwerb im non-formalen Kontext4 und das Erleben jugendverbandlicher Strukturen der Evangelischen Jugend mit demokratischen Einflussmöglichkeiten. Daneben besteht auf dem Gebiet der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens traditionell eine große Nachfrage nach Freizeitfahrten (Rüstzeiten). Der Begriff Rüstzeit bezeichnet geistlich profilierte Fahrtenangebote der Kirchengemeinden, Regionen oder Verbände, bei dem eine bestehende oder spezifisch zusammenkommende Gruppe miteinander unterwegs ist und sich dabei unter anderem mit biblischen Themen zur geistlichen Zurüstung – daher der Begriff – beschäftigt. Viele junge Christinnen und Christen sind an Wochenenden oder in Ferienzeiten bei derlei Maßnahmen dabei. Trotz anderer bundesweiter Trends und der beschriebenen gesellschaftlichen Herausforderungen kann im Bereich der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens vielerorts von einer stabilen und in den Ausdrucksformen vielfältigen Jugendarbeit die Rede sein. Dies zeigt sich vor allem in den regelmäßigen Gruppentreffen der Jungen Gemeinden. Wer sich also im »religiös unmusikalischen« (Habermas) Umfeld Sachsens zum christ3 2015 gab es nach internen Zählungen der Ev. Luth. Landeskirche Sachsens etwa 750 Jugendkreise, die insgesamt etwa 7000 junge Menschen erreichen. 4 Vgl. Deutsches Jugendinstitut (Hg.), Kompetenzen von Jugendlichen sowie Bildungsangebote der Jugendarbeit stärken – Die EUJugendstrategie unterstützt die Anerkennung und Sichtbarmachung der nicht formalen und informellen Lernangebote in der Jugendarbeit. München, Diskussionsstand 23. September 2011, www.dji.de
226
Religionspädagogische Anregungen
lichen Glauben bekennt, tut dies i.d.R. bewusst und mit nötiger Konsequenz. Mitunter ist bei Prozessen der Meinungsbildungen in sächsischen Jugendgruppen oder sozialen Netzwerken eine Tendenz zu weltanschaulichem Relativismus auf der einen und fundamentalistischen Tendenzen auf der anderen Seite zu beobachten. Auch ist bei manchen Teilnehmenden kirchlicher Angebote der Jugendarbeit wenig kirchliches Identitätsbewusstsein, sondern eine Nähe zu freien christlichen Strukturen wahrnehmbar. So lässt sich die These ableiten, dass sich Kirche im Bereich evangelischer Jugendarbeit in Sachsen von zwei Seiten hinterfragt sieht: Auf der einen Seite von einer Gleichgültigkeit weiter Teile der Bevölkerung gegenüber christlichem Glauben und der mit ihm verbundenen traditionellen Institutionen, auf der anderen Seite durch die Artikulation normativer Positionen und der Feststellung deren Allgemeingültigkeit. 3. Konsequenzen für das Theologisieren mit Jugendlichen in Kirche und Gemeinden
In der »reflexiven Moderne« (Beck) mit ihren vielfältigen Möglichkeiten der Lebensgestaltung, wenigen Korrektiven und fast undurchschaubaren Orientierungsangeboten kann das Wissen um den Gehalt biblischer Geschichten gerade für junge Menschen eine wichtige sinn- und wertstiftende Bezugsgröße für ein gelingendes Leben in einer bewussten Beziehung zwischen Mensch und Gott bieten. Zielgruppenorientierte kirchliche Angebote, die zum Theologisieren einladen, können und sollen Prozesse der Glau-
bensbildung ermöglichen. Die Auseinandersetzung mit biblischen Überlieferungen in der Jungen Gemeinde und bei Rüstzeiten ist darum keine distanzierte Beschäftigung mit geistesgeschichtlichen Kulturgütern, sondern dient der Vergewisserung und Vertiefung spiritueller Fundamente. Dabei findet – i.d.R. angeleitet von Hauptberuflichen oder qualifizierten Ehrenamtlichen – eine oft diskursive Beschäftigung mit Glaubensthemen mit dem Ziel der Meinungsbildung und Glaubensvertiefung statt. In geistlich stärker geprägten Gemeindejugendkreisen (vgl. 2.) besteht dabei die Herausforderung, die Sehnsucht nach verbindlichem, »richtigem« Glauben wertzuschätzen und durch zielführende Impulse geistliche Fundierungen und individuelle Glaubensentwicklungen zu ermöglichen. Daneben gilt es, problematischen Verengungen Aspekte von Weite und Offenheit gegenüberzustellen. Auch ist es insbesondere im Blick auf die geistlichen Überzeugungen scheinbar homogen denkender Gruppen wichtig, Tendenzen der Einseitigkeit entgegenzutreten und durch asymmetrische Diskussionsbeiträge die Pluralität von Deutungsmöglichkeiten zu erhalten.5 In der Fowlerschen Logik der Glaubensstufe6 sind dabei vor allem beim im Jugendalter festzustellenden »Syn5 Vgl. Gerhard Büttner, Theologisieren als Grundfigur der Praktischen Theologie – Grundüberlegungen für das Theologisieren mit Jugendlichen, in: Veit-Jakobus Dieterich (Hg.), Theologisieren mit Jugendlichen, Stuttgart 2012, 64. 6 Vgl. James W. Fowler, Stufen des Glaubens. Die Psychologie der menschlichen Entwicklung und die Suche nach Sinn, Gütersloh 1991.
Petzoldt Theologisieren mit Jugendlichen 14plus in kirchengemeindlicher Jugendarbeit
thetisch-konventionellen Glauben« der Stufe III erwachsene Begleiter als »significant others« gefragt, ihre Glaubensüberzeugungen einzubringen und zur Debatte zu stellen. Denn professionelle Gemeindepädagogik lebt nicht allein von Begleitung, Ermöglichung und Moderation, sondern im Blick auf Glaubensbildung ganz wesentlich von Impulsen des Leiters bzw. der Leiterin.7 Daneben dienen die Grundsätze einer u.a. auf Subjektorientierung, Partizipation und Ganzheitlichkeit ausgerichteten konfessionellen Jugendverbandsarbeit8 zur Einübung einer Haltung, die fehlerfreundlich theologische Bildungserfahrungen ermöglicht und dabei spirituelle Deutungsmöglichkeiten eröffnet. Die »Jugendordnung« der Evangelischen Jugend in Sachsen beschreibt das Ziel kirchlicher Jugendarbeit damit, »… als mündige und tätige Gemeinde Jesu Christi das Evangelium von Jesus Christus, wie es im Alten und Neuen Testament beschrieben ist, den jungen Menschen in ihrer Lebenswirklichkeit zu bezeugen …« sowie »… Gottes Wirken auch in der Begabung Jugendlicher zu sehen, frühzeitig gesellschaftliche und geistliche Bewegungen anzuzeigen …«.9 Hier zeigt sich bereits in der Zielsetzung für den Arbeitszweig eine theologische Grundhaltung. »Theologisieren« hat also nicht allein mit dem Zusammenkommen von theologisch relevanten Themen mit spezifischen Zielgruppen zu tun, sondern wird geprägt durch Traditionen vor Ort, durch verantwortlich agierende Bezugspersonen sowie durch die Kultur und Leitsätze der Organisation. Für die konfessionelle Jugendarbeit in Sachsen geht es auch künftig darum, den Schatz des hohen Interesses an Glau-
227
bensthemen bei den Teilnehmenden von Angeboten evangelischer Jugendarbeit zu hüten und zu mehren. Gleichzeitig besteht im Blick auf eine weitgehend entkirchlichte Gesellschaft die Herausforderung, sich nicht allein in Binnenorientierung zu erschöpfen. Darum wird ein rechtes Maß an Tiefe und Weite, Fundament und Öffnung, Verortung und Einladung die Prozesse des Theologisierens mit Jugendlichen zu bestimmen haben. Fangfrage (nach Mk 1,17)10 Von nun an sollst du Menschen fischen, spricht der Herr. Hurtig bei der Arbeit, müssen wir leider feststellen: Die Fangquoten sind niedrig. Sie schwimmen auf anderen Wegen, sie gehen uns durch die Netze, sie leben an uns und wir an ihnen vorbei. Meist fischen wir nun in eignen Gewässern, denn in fremden fischen wir allzu oft im Trüben. Ob das der Herr so gemeint hat?
7 Vgl. Kompetenzprofil für zukünftiges professionelles Handeln von Fachkräften in der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit und zukünftige Anforderungen an die Aus- und Fortbildung, beschlossen vom Vorstand der Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Deutschland e.V. (aej), Hannover 2010. 8 Vgl. ebd. 9 http://www.evlks.de/landeskirche/kirchenrec ht/rechtssammlung/doc/2.3.6_Evangelische_ J ugendO.pdf. 10 Tobias Petzoldt, Ein für alle Mal. Heiter bis kritisch durch das Kirchenjahr, Düsseldorf 2012.
228
Religionspädagogische Anregungen
Susanne Bürig-Heinze Schöpfung oder Evolution – Komplementäres Denken im Religionsunterricht
1. Sich eine eigene Meinung bilden
Sich eine eigene Meinung zu bilden – das ist eine der zentralen, aber auch der spannendsten Aufgaben im Jugendalter. Grundsätzlich haben Jugendliche Interesse daran. Sie wollen das eigene Verhältnis zur Welt klären, sich in der Fülle von Angeboten orientieren sowie eine Auswahl für das eigene Lebenskonzept treffen. Und sie merken, dass sie sich für diese Mündigkeit auskennen und das Wahrgenommene bewerten können müssen. Es geht aber auch darum, sich eine eigene Meinung zu bilden. Dieser Prozess ist offen.1 Eine Meinung habe ich nicht auf Dauer, sie ist nicht abgeschlossen, starr, sondern muss weiterentwickelt werden. Bildung ist ein Prozess ständig neugierigen Aufnehmens und Hinterfragens, Vertiefens und Neubewertens. Das ist sicher auch anstrengend und führt an mancherlei Irritationen nicht vorbei, es führt aber auch zu einem differenzierten sowie vertieften und damit erwachsenen Verhältnis zu sich und der Welt. Im Religionsunterricht ab dem achten oder neunten Jahrgang gewinnt die Meinungsbildung der Jugendlichen zunehmend Relevanz. Neben der Aufforderung zur eigenen Positionierung ist deshalb dieser Prozess auch auf der Metaebene zu reflektieren: Wie entsteht eine Meinung? Wie werden Begründungszu-
sammenhänge plausibel? Wie wird die Auseinandersetzung mit anderen Positionen fruchtbar? Es ist wichtig, einen Standpunkt einzunehmen, ich muss mir aber auch dessen Vorläufigkeit bewusst sein.2 Die Verhältnisbestimmung von Schöp fung und Evolution gehört zu den Themen, die sich für das Erreichen dieser Fähigkeiten besonders eignen.3 Objektiv betrachtet ist eine abschließende Antwort nicht möglich.4 Vielmehr muss jeder für sich die Zusammenhänge prüfen und im Laufe des Lebens immer wieder neu bewerten: Spielen die Schöpfungserzählungen in meinem Denken gar keine Rolle? Werden sie mit zunehmenden Jahren von 1 Auf die Notwendigkeit prozessorientierten Unterrichts im Rahmen der Jugendtheologie weist auch Freudenberger-Lötz hin. Petra Freudenberger-Lötz, Theologische Gespräche mit Jugendlichen. Erfahrungen – Beispiele – Anleitungen, München 2012, 12f. 2 Ebd., 13. 3 Es stehen gut aufbereitete Unterrichtsmaterialien zu diesem Thema zur Verfügung. Als Beispiel sei hier auf folgende Arbeitshilfe hingewiesen: Matthias Roser, Gott vs. Darwin. Umfassende Materialien zur Kontroverse »Evolution und Schöpfung«, Donauwörth, 2 2010. 4 Schweitzer diskutiert verschiedene Haltungen zum Atheismus und Kreationismus und weist Reaktionsmöglichkeiten auf. Friedrich Schweitzer, Schöpfungsglaube – Nur für Kinder? Zum Streit zwischen Schöpfungsglaube, Evolutionstheorie und Kreationismus, Neukirchen-Vluyn 2012, 15ff.
Bürig-Heinze Schöpfung oder Evolution – Komplementäres Denken im Religionsunterricht
den naturwissenschaftlichen Erkenntnissen abgelöst oder sogar erst dann für das eigene Leben entdeckt? Bleibt die religiöse Deutungsebene sinnstiftend trotz der Erkenntnisse aus dem Biologieunterricht? Oder werden die naturwissenschaftlichen Forschungen zwar zur Kenntnis genommen, in ihrem Wahrheitsgehalt aber abgelehnt? Besonders bei den Übergängen vom Kindes- zum Jugend- und dann zum Erwachsenenalter gerät auf diesem Gebiet vieles in Bewegung. Die Jugendlichen verlassen mit der zunehmenden Entwicklung ihres Abstraktionsvermögens ein vorwiegend narratives Denken. Zudem vergrößert sich das Abgrenzungsbedürfnis von der Deutungshoheit der Erwachsenen, bevor auch integrative Momente wieder denkbar werden und damit komplementäre Wahrheiten Anerkennung finden können.5 Christina Kalloch hat sich mit den Fragen nach Schöpfung und Evolution mit Kindern im Grundschulalter genauer beschäftigt.6 In einem Artikel im »Jahrbuch der Kindertheologie« 2012 weist sie auf der Grundlage mit Viertklässlern geführter Gespräche nach, dass die Kinder sowohl biblische als auch naturwissenschaftliche Welterklärungsmodelle zur Kenntnis nehmen und versuchen, sie in ein Verhältnis zueinander zu bringen. Sie deuteten diese beiden Zugänge aber als einen kognitiven Konflikt, den sie für sich auflösen müssten. Dabei entwickelten sie verschiedene Lösungsstrategien. Während einige Kinder meinten, sich eindeutig für das eine und damit gegen das andere Erklärungsmodell entscheiden zu müssen, konstruierten andere ihre Lösung so, dass Urknall und Evolution zwar stimmten, Gott aber als Allmächtiger im Hintergrund die Prozesse
229
initiieren und begleiten würde. Kalloch konnte aber auch erste Versuche erkennen, die Schöpfungserzählungen nicht als faktische Darstellung zu verstehen, sondern auf die Aussagen zu der Beziehung zwischen Gott und Mensch hin zu lesen.7 Insgesamt bedeute dieses Thema für die Kinder eine Verunsicherung gewohnter Denkweisen, die auf die Konstruktion neuer Lösungen dränge. Da ein komplementäres Denken in diesem Alter jedoch noch nicht möglich sei, gehöre die explizite Anerkennung beider Wahrheiten noch nicht zum Lösungsrepertoire dieser Altersstufe.8 Wie gesagt: Diese Gespräche sind im Rahmen der Kindertheologie geführt worden, also mit einem sehr offenen und die Beiträge der Teilnehmerinnen und Teilnehmer wertschätzenden Verfahren. 2. Ein Unterrichtsversuch
Ich möchte diese im Rahmen der Kindertheologie erworbenen Ergebnisse für die Jugendtheologie aufgreifen. Konkret habe ich Jugendliche einer neunten und 5 Zum Abschied vom Kinderglaube ebd., 79ff. 6 Christina Kalloch, »Gott hat die Welt erschaffen – aber eigentlich ist sie so entstanden …«. Biblische Schöpfungsgeschichten und naturwissenschaftliche Erklärungsmodelle – ein Dilemma für Grundschulkinder? In: »Gott hat das in Auftrag gegeben«. Mit Kindern über Schöpfung und Weltentstehung nachdenken, JaBuKi 11, Stuttgart 2012, 53ff. 7 Kalloch weist in diesem Zusammenhang auf die Nähe zwischen der Schöpfungstheologie und der Frage nach der Theodizee hin. Diese Beobachtung ist im Kontext der Ergebnisse dieses Unterrichtsprojektes interessant. Ebd., 54, 61. 8 Zum komplementären Denken vgl. Schweitzer, Schöpfungsglaube (wie Anm. 4), 73f.
230
Religionspädagogische Anregungen
einer elften Klasse eines Gymnasiums um die Äußerung ihrer Meinung zur Verhältnisbestimmung von Evolution und Schöpfung gebeten. Der Unterrichtsversuch war nicht eingebettet in eine größere Unterrichtssequenz. Die neunte Klasse hatte das Thema »Naturwissenschaft und Religion« noch nicht auf dem Lehrplan, in der elften Klasse war es eineinhalb Jahre zuvor behandelt. Bei der Planung habe ich mich an der Jugendtheologie orientiert: Dabei geht es nicht um die Vermittlung dogmatisch festgelegter Antworten oder um eine Bewertung der Beiträge. Vielmehr sollen sich die Jugendlichen ihrer Position bewusst werden, Begründungszusammenhänge reflektieren, Denkstrukturen durchschauen, zuhören, argumentieren, analysieren. Offene Fragen und Irritationen sind bei diesem Verfahren erwünscht, es zielt auf eine größere Durchdringung der eigenen Haltung. Die Planung für den Ablauf der Doppelstunde in dem neunten Jahrgang war identisch mit der in dem elften Jahrgang. Ich habe den Schülerinnen und Schülern 16 Kärtchen mit Aussagen über Evolution und Schöpfung vorgelegt (vgl. Anlage 1). Die Formulierungen waren so gewählt, dass sie entweder Aussagen über die Evolutionstheorie enthielten oder aber über den Wahrheitsgehalt der Schöpfung. Einige waren emotionaler gehalten, andere rationaler. Einige forderten stärker zur Positionierung auf, andere weniger. Zudem variierte das Gottesbild zwischen einem dem Menschen nahen Gott und einem von Mensch und Welt distanzierten. Die Schülerinnen und Schüler sollten zunächst in Einzelarbeit (vgl. Anlage 2) aus diesen Kärtchen solange diejenigen auswählen, die zusammen für sie ein
sinnvolles Gefüge ergeben. Die Anzahl der Kärtchen war dabei nicht vorgegeben. Eine Leerkarte ermöglichte Ergänzungen. Im Anschluss galt es, die getroffene Auswahl zu begründen und – sollte noch Zeit bleiben – Überlegungen zur biografischen Entwicklung der eigenen Haltung anzustellen. Nach dieser Einzelarbeit wurden die Ergebnisse zunächst in kleinen Gruppen vorgestellt und diskutiert. Dabei hatten einzelne Schülerinnen bzw. Schüler zunächst ausreichend Zeit, ihre eigene Position vorzustellen und zu begründen. Für die anschließende Diskussion bekamen die Gruppenmitglieder den Auftrag, die Rolle des Nachfragers, Zweiflers, Kritikers einzunehmen, um so über ein bestätigendes Feedback hinaus in eine echte Diskussion oder sogar Disputation zu kommen. Ich selbst habe mich in dieser Phase zurückgehalten und den Prozess beobachtet. Die Gesprächsführung lag bei den Jugendlichen. Anders jedoch im folgenden Plenumsgespräch: Nach einem eher offenen Impuls zum Verlauf der Gruppendiskussionen bestand meine Aufgabe hier darin, genannte Aspekte kategorisieren und in Beziehung setzen zu lassen, Fragen weiterzugeben und die Aussagen in Verbindung zu großen theologischen Themen zu setzen.9 Ähnlich der Kindertheologie stand dabei die Meinungsfindung der Jugendlichen im Vordergrund und nicht die Vermittlung vorgegebener Sachverhalte.
9 Freudenberger-Lötz, (wie Anm. 1), 81f. Thomas Schlag / Friedrich Schweitzer, Brauchen Jugendliche Theologie? Jugendtheologie als Herausforderung und didaktische Perspektive, Neukirchen-Vluyn 2011, 32f.
Bürig-Heinze Schöpfung oder Evolution – Komplementäres Denken im Religionsunterricht
3. »Wir würden gerne länger darüber diskutieren!«
Sowohl das Thema als auch die Vorgehensweise haben die Schülerinnen und Schüler beider Lerngruppen aktiviert. Die Konzentration war hoch, die Diskussion ehrlich und kontrovers, sie hätten sich gerne über die Unterrichtszeit hinaus mit dem Thema beschäftigt. Während in der neunten Klasse vehement für die eigene Wahrheit gestritten wurde, war der Ablauf bei den Älteren moderater. Das Respektieren einer anderen Haltung schien kein Problem. Zudem war die Bereitschaft, mit einem offenen Problem umzugehen, sehr viel höher. Insgesamt ließen sich folgende Tendenzen ausmachen: Grundsätzlich war es den meisten Jugendlichen möglich, naturwissenschaftliches und religiöses Denken miteinander zu verknüpfen. Allerdings gab es im neunten Jahrgang durchaus eine größere Gruppe, die die religiösen Vorstellungen für sich ablehnte. Diese Position wurde im elften Jahrgang verhältnismäßig seltener formuliert, zudem wurde hier häufiger der Respekt vor anderen Haltungen explizit zum Ausdruck gebracht. In jeder Gruppe gab es eine Schülerin, die eine ablehnende Haltung zur Evolution vertrat. Ihr Hauptargument war, dass die Perfektion von Mensch und Welt kein Zufall sein könne. Aber auch bei denen, die Schöpfung und Evolution für sich miteinander verbinden konnten, zeigten die Begründungen erhebliche Unterschiede. Ausgehend von einem eher wortgetreuen Bibelverständnis lösten vor allem viele Neuntklässler das Problem durch ein Nacheinander der Vorgänge: Gott habe zunächst so, wie es in der Bibel stünde, die Welt
231
geschaffen und anschließend die Evolution angestoßen. Zudem sei Gott in dem zu finden, was wir uns nicht erklären können. In der elften Klasse wurde hingegen eine andere Lesart verstärkt vertreten: Die Schöpfungserzählungen seien nicht wörtlich zu verstehen, sondern zielten auf Sinnstiftung sowie Wertevermittlung und intendierten die Verantwortungsübernahme durch den Menschen. Erst in dieser Form der Verbindung von Naturwissenschaft und Religion ist eine komplementäre Denkstruktur auszumachen. Bezüglich des Gottesbildes ließen sich folgende Beobachtungen machen: Viele Schülerinnen und Schüler beider Jahrgänge gingen davon aus, dass es einen Gott gibt. Auf die Frage, wo sie sich Gott vorstellen würden, gab es in beiden Gruppen ähnliche Antworten: Teilweise verorteten sie ihn weit weg von der Welt im Universum oder auch in der Vorzeit, teilweise ganz nah in jedem Lebewesen, teilweise machten sie seine Existenz vom Glauben der Menschen abhängig. Hierin unterschieden sich die Gruppen genau so wenig wie bei der Frage, die sie – ohne einen entsprechenden Impuls meinerseits – in den Mittelpunkt stellten: Wie lässt sich angesichts des Leids in der Welt von einer guten Schöpfung sprechen? Während die Neuntklässler diese Theodizeeproblematik eher auf Krankheit und Behinderung, also auf persönliches Erleben bezogen, stellten die Elftklässler sie in einen größeren gesellschaftlichen Horizont und bezogen sie v.a. auf die Grausamkeiten im Nationalsozialismus. Aber auch die Antwortversuche differierten zwischen den Jahrgängen: In der neunten Klasse war die Gruppe deutlich größer, die im Leid einen Beweis gegen
232
Religionspädagogische Anregungen
die Allmacht Gottes und damit gegen Gott insgesamt ausmachten. Diejenigen, die trotzdem an ihrem Glauben festhalten wollten, suchten nach einem Sinn in dem Leid: So könne z.B. angesichts der Krankheit die Gesundheit besser wertgeschätzt werden. In der elften Klasse waren die Schülerinnen und Schüler hingegen weniger bereit, die Gottesfrage insgesamt aufgrund des Leides für sich negativ zu beantworten. Überlegungen zur Freiheit des Menschen oder auch zur Grenze der eigenen Erkenntnis wurden in diesem Zusammenhang genauso diskutiert wie die interreligiöse Perspektive oder der Geltungsbereich christlicher Antworten. Beim Blick auf die eigene Biografie konnten viele Jugendliche sehr genau Auskunft darüber geben, wie sich ihre Haltung zu den Schöpfungserzählungen verändert hatte: Durch eine oftmals christliche Sozialisation hätten zunächst die Schöpfungserzählungen uneingeschränkte Gültigkeit gehabt. Die Begegnung mit naturwissenschaftlichen Erkenntnissen bedeutete dann eine massive Anfrage an das eigene Denken. Mit zunehmendem Alter wich nicht nur die Konkretion aus dem Gottesbild, sondern auch die Relevanz der Schöpfungserzählungen für die Erklärung der Weltentstehung. Während in der neunten Klasse darüber hinaus schon erste Anfragen daran formuliert wurden, dass das naturwissenschaftliche Weltbild bei Trauer und zur Orientierung nicht ausreichen könne, wurden diese Überlegungen in der elften Klasse klarer formuliert: Nachdem man zunächst den Konflikten aus dem Weg gegangen sei, würde man jetzt merken, dass das Hinterfragen den Glauben sogar stärken würde. Zudem stießen auch
die Naturwissenschaften an ihre Grenzen. In beiden Gruppen äußerten wenige Schülerinnen und Schüler, dass sie sich nicht als religiös sozialisiert bezeichneten und sich erst jetzt im Jugendalter verstärkt religiösen Themen zuwenden würden.10 Die abschließende Reflexion auf der Metaebene zu Inhalt und Verfahren der Doppelstunde fiel in beiden Jahrgängen unterschiedlich aus. Während die Neuntklässler noch stark mit ihren unterschiedlichen Positionen beschäftigt waren, stellten die Elftklässler die Lebensrelevanz dieser Fragen heraus, beurteilten das Verfahren als konstruktiv und nachdenklich stimmend und zeigten großes Interesse, in dieser Form weiterzuarbeiten. 4. Man kann nicht nicht theologisieren
Insgesamt bestätigt dieses kleine Projekt: Sowohl die Methode des Theologisierens mit Jugendlichen als auch das Thema »Evolution und Schöpfung« führen zu einer engagierten Diskussion über elementare theologische Problemstellungen. Die Offenheit gegenüber den verschiedenen Positionen der Schülerinnen und Schüler ermöglicht, sehr verschiedene Haltungen miteinander ins Gespräch zu bringen und vertiefend zu reflektieren. Ebenso zeigten sich – insbesondere zusammen mit den Untersuchungen von Christina Kalloch – eindeutige Entwicklungstendenzen in Bezug auf die Möglichkeit des 10 Auf die Bedeutung des Schöpfungsglaubens in der Kindheit weist Schweitzer ausführlicher hin. Schweitzer, Schöpfungsglaube (wie Anm. 4), 65ff.
Bürig-Heinze Schöpfung oder Evolution – Komplementäres Denken im Religionsunterricht
komplementären Denkens. So ist es den älteren Schülerinnen und Schülern häufiger möglich, zwei sich zunächst widersprechende Wahrheiten nebeneinander stehen, bzw. andere Haltungen respektvoll gelten zu lassen. Zunächst ein genauerer Blick auf das Inhaltliche: Die Frage nach dem Verhältnis von Evolution und Schöpfung bewegt die Jugendlichen. Sie birgt ein hohes Konfliktpotenzial, eine deutliche Alltagsrelevanz und drängt immer wieder neu nach Lösungen. Durch ihre prinzipielle Offenheit löst sie zudem kontroverse Diskussionen und damit die Notwendigkeit der präziseren Begründung der eigenen Haltung aus. Zudem bildet sie theologisch einen Kristallisationspunkt: Aspekte der Anthropologie, Theologie, Christologie sowie der Ethik wurden von den Jugendlichen zur Klärung herangezogen. Insbesondere ist hier die Theodizeefrage hervorzuheben, die beide Gruppen in den Mittelpunkt stellten.11 Die Diskussion des Verhältnisses von Evolution und Schöpfung sensibilisiert zudem für die eigene Biografie und greift damit einen zentralen Zugang zur Religion auf. Aber auch das Verfahren führt zunächst zu überzeugenden Ergebnissen: Die offene, wertfreie Form des Theologisierens eröffnet eine authentische Auseinandersetzung, die die Anliegen der Schülerinnen und Schüler zur Sprache bringt und sie ernst nimmt. Letztlich bestimmen die Jugendlichen, welchen Verlauf das Gespräch nimmt und welche Aspekte sie vertiefen wollen. Die Lehrerin bzw. der Lehrer greift eher strukturierend ein und lenkt inhaltlich nur vorsichtig. Sicher war es auch dieses hohe Maß an Selbstbestimmung, das bei
233
den Jugendlichen zu einer breiten Akzeptanz dieser beiden Stunden geführt hat. In dem Zusammenhang eines kontrovers diskutierten Themas muss sogar grundsätzlicher überlegt werden, ob wir überhaupt anders als theologisierend vorgehen können, wenn der Unterricht auf eine Meinungsbildung zielen soll. Zu Recht verweist Büttner darauf, dass es beim Theologisieren eher um eine Haltung als um eine Methode geht.12 Grundlagen der Aneignungspädagogik, eine Wertschätzung des einzelnen Jugendlichen und eine als Begleiter definierte Lehrerrolle führen eindeutig in diese offenen Verfahrensweisen. Zunächst also die positive Bilanz: Die Grundlagen der Jugendtheologie fördern in besonderer Weise den Prozess der Meinungsbildung. Die generelle Wertschätzung der Beiträge, die Offenheit der möglichen Positionen und das hohe Maß an Selbststeuerung geben Raum, sich der eigenen impliziten Theologie bewusst zu werden und sie zu überdenken.13 So kann 11 In der Religionspädagogik wird kontrovers diskutiert, ob sich Zweifel an Gott derzeit bei Jugendlichen eher an der Theodizeefrage oder verstärkt an den naturwissenschaftlichen Erkenntnissen entzünden. Vgl. dazu Herbert Rommel, Mensch – Leid – Gott. Eine Einführung in die Theodizee-Frage und ihre Didaktik, Paderborn 2011; Friedrich Schweitzer, Gott im Religionsunterricht. Bestandsauf-nahme – neue Herausforderungen – weiterführende Perspektiven zu einer Didaktik der Gottesfrage, in: Rudolf Englert / Helga Kohler-Spiegel / Norbert Mette u.a. (Hg.), Gott im Religionsunterricht, Neukirchen-Vluyn 2009, 241ff. 12 Gerhard Büttner, Die Kindertheologie und die Theologie, in: »Gott hat das in Auftrag gegeben«. Mit Kindern über Schöpfung und Weltentstehung nachdenken, JaBuKi 11, Stuttgart 2012, 12. 13 Darauf weist Schweitzer (wie Anm. 9), 109ff hin.
234
Religionspädagogische Anregungen
das Theologisieren zum Modellfall für den Umgang mit religiösen Fragen für die Jugendlichen werden.14 Zudem wird ein Theologisieren besonders kontrovers zu diskutierenden Themen gerecht. So eignen sich auch weitere Themen wie z.B. die Sterbehilfe, Organtransplantation, PID sowie die globalen Zusammenhänge des eigenen Konsumverhaltens oder der Umgang mit dem Kirchenasyl für dieses Verfahren. Gerade durch die unterschiedlichen Positionierungen kann das Begründen der eigenen Haltung, aber auch das Tolerieren ganz anderer Meinungen und damit das für eine erwachsene Bildung zentrale komplementäre Denken geschult werden.15 Trotz dieser positiven Aspekte möchte ich aber auf einige Grenzen des Theologisierens mit Jugendlichen hinweisen, an die ich in diesem Projekt gestoßen bin und die mir grundlegender Natur zu sein scheinen. Dabei gehe ich auf die methodische Einseitigkeit des Verfahrens, den verengten Zugriff auf religiöse Fragen und die hervorgehobene Lehrerrolle ein. Beide Doppelstunden hatten einen vorrangig diskursiven und kognitiven Charakter. Die meisten Beteiligten haben das geschätzt und den Verlauf effektiv mitgestaltet und für sich genutzt. Trotz der breiten Beteiligung war diese Arbeitsweise aber einseitig. Es war nach einiger Zeit kaum noch möglich, zurückhaltende Schülerinnen bzw. Schüler einzubinden, die andere Zugänge bräuchten, um sich einzubringen. Erneute vorbereitende Stillarbeitsphasen, konkretere Bezüge zur Lebenswelt, Arbeit mit Fallbeispielen, Biografien, aber auch Bilder und andere ästhetische Ausdrucksformen sowie gestaltende Arbeitsweisen sprechen
vielfältige Lernwege und damit auch unterschiedliche Lerntypen an. Angesichts dieser Möglichkeiten bleibt das Theologisieren zunächst sehr einseitig. Andererseits bringt es eine Fülle von inhaltlichen Aspekten hervor, die nicht weiter vertieft werden können. Die thematische Offenheit bezüglich der Meinungsbildung ist interessant und unbedingt zu wahren. Die Sachklärung von Wissensfragen im Sinne des Ernstnehmens der Jugendlichen kann darüber aber nicht zu kurz kommen. Vielfältige Zugänge zu verschiedenen Fragestellungen sind aber nicht nur wegen der verschiedenen Schülerpersönlichkeiten geboten, sondern auch wegen des Religionsverständnisses, das dem Unterricht zugrunde liegt. Das Theologisieren führt zu einem eher kognitiven Umgang mit Religion und stellt damit m. E. eine starke Verkürzung dar. Auch wenn analytische Phasen im Unterricht unabdingbar sind, lässt sich nicht alles im Diskurs klären. In dem hier vorgestellten Beispiel wird dies m. E. besonders bei der Theodizeefrage deutlich. Um die existenzielle Tiefe dieses Zweifelns zu durchdringen, sind biografische oder ästhetische Formen zunächst sogar vorrangig einzubringen, bevor mögliche Antworten systematisierend und diskutierend betrachtet werden. Und noch einige Anmerkungen zur Rolle des Lehrers bzw. der Lehrerin: Zunächst ist es natürlich eine Entlastung, 14 Zur Abgrenzung vom fragend-entwickelnden Unterricht vgl. Freudenberger-Lötz (wie Anm. 1), 14f. 15 Zu der Bedeutung des komplementären Denkens für die Bildung allgemein vgl. Schweitzer, Schöpfungsglaube (wie Anm. 4), 82.
Bürig-Heinze Schöpfung oder Evolution – Komplementäres Denken im Religionsunterricht
nicht bewerten zu müssen, sondern eher katalysieren zu sollen. So dürfen die Schüleräußerungen unkommentiert stehen bleiben und als Ausdruck eines Stadiums im Meinungsbildungsprozess gesehen werden. Auch steuern die Schülerinnen und Schüler den Gesprächsverlauf in weiten Teilen selbst. Es wird aber auch einiges von der Lehrkraft gefordert: Neben der wohl bedachten Auswahl der Themen ist v.a. während des Plenumsgesprächs eine hohe Analysefähigkeit auf der Seite des Unterrichtenden notwendig. Lasse ich das Gespräch laufen oder gebe ich einen Impuls zur Vertiefung? Kristallisieren sich hier Themen, die ich benenne oder wäre dies an dieser Stelle für die Schülerinnen und Schüler noch nicht nachvollziehbar? Lassen sich zwei unterschiedliche Schülerantworten unterschiedlichen theologischen Positionen zuordnen, die ich aufzeigen sollte? Wäre der gerade genannte Aspekt geeignet, über mögliche Konsequenzen oder sogar über einen neuen thematischen Schwerpunkt nachzudenken? Eine hohe Sachkompetenz und ein sicheres Einschätzungsvermögen sind hier unbedingt notwendig. In dem hier vorgelegten Beispiel waren ähnliche Abwägungen z.B. bei der Systematisierung der Gottesbilder, der Theodizeefrage oder auch bei dem Umgang mit kreationistischen Positionen16 notwendig. Besonders in diesem Bereich ist der schmale Grad zwischen Wertschätzung und Hinterfragen zu wahren, ohne die Jugendlichen zu isolieren und damit eher zu radikalisieren (vgl. Anlage 3). Es sind also vielfältige Kompetenzen von Seiten der Lehrerinnen und Lehrer nötig. Darüber hinaus ergibt sich aber noch eine grundlegendere Anfrage: Auch
235
wenn das Gespräch beim Theologisieren nicht durchweg über den Lehrer läuft und die Schülerinnen und Schüler auch direkt aufeinander eingehen, übernimmt dieser doch einen Teil der Regie, den er nicht an die anderen Gesprächsteilnehmer abgeben kann. Das passiert zwar im herkömmlichen Unterricht auch, jedoch nicht in so langen Phasen und immer im Wechsel mit anderen Sozialformen. So können das selbstständige Arbeiten und die Arbeitsergebnisse der Jugendlichen sowie die Unabhängigkeit vom Lehrer bzw. der Lehrerin gefördert werden. Beim Theologisieren habe ich nur eingeschränkte Möglichkeiten gesehen, dieses Ziel zu verfolgen. Um die positiven Effekte des Theologisierens zu bewahren und gleichzeitig die hier beschriebenen Einwände ernst zu nehmen, erscheint mir als Ausweg nur ein Wechsel der Verfahrensweisen möglich. Wird das Theologisieren z.B. als Sequenzeinstieg genutzt und werden die genannten Aspekte auf Kärtchen gesammelt, ergibt sich aus einem Gespräch hinreichend Potenzial für eine längere Unterrichtsphase, in der weitere Methoden und Sozialformen ergänzt und die Inhalte sukzessive geklärt werden können. 5. Wie könnte es weitergehen?
Die hier geführten Gespräche geben die Möglichkeit, in verschiedene Richtungen weiterzugehen. Das Anknüpfen an curriculare Vorgaben ist dabei problem16 Einen ersten Überblick über die Positionen gibt Schweitzer, Schöpfungsglaube (wie Anm. 4), 23ff.
236
Religionspädagogische Anregungen
los möglich: Alle sechs inhaltbezogenen Kompetenzbereiche der Kerncurricula (Mensch, Gott, Jesus Christus, Ethik, Kirche und Kirchen, Religion und Religionen) könnten vertieft werden. Auch werden prozessbezogene Kompetenzen fast aller Bereiche geschult (Wahrnehmung und Darstellung, Deutung, Urteil, Dialog). Wie schon aufgezeigt, bleibt lediglich die Gestaltungskompetenz zunächst unberücksichtigt.17 Konkrete Themen für den neunten Jahrgang sind: verschiedene Modelle der Verhältnisbestimmung von Religion und Naturwissenschaft, die Theodizeeproblematik, Gottesbilder, Aspekte der Kreuzestheologie, Grundlagen der Schöpfungstheologie oder auch des Kreationismus. Hier wäre im Sinne eines Fächerübergriffs auch die Klärung evolutiver Grundlagen notwendig. Im elften Jahrgang liegen die Themen ähnlich, sie haben aber eine zunehmende Durchdringungstiefe: Theodizee und weitere religionskritische Anfragen, theologische Deutungen der Shoah, unterschiedliche Methoden der Bibelauslegung. In beiden Jahrgängen führt die Problematik auch in eine Reflexion der Sprachformen. Besonders die Unterscheidung zwischen Mythos und Logos unterstützt die Fähigkeit, komplementäre Denkstrukturen aufzubauen, zu präzisieren und zu verbalisieren.18 Diese vielfältigen Möglichkeiten der Weiterarbeit verdeutlicht also noch einmal die hohe Relevanz des Themas »Schöpfung und Evolution« für den Religionsunterricht.
Anlage 1: Aussagen auf den Karten
1. Das Festhalten an der Schöpfungslehre ist ein Hindernis für die Entwicklung der modernen Naturwissenschaften. 2. Der Mensch ist angesichts der Größe des Weltalls und der Vielfalt der Lebewesen absolut unbedeutend. 3. Wir fühlen, dass selbst wenn alle möglichen wissenschaftlichen Fragen beantwortet sind, unsere Lebensprobleme noch gar nicht berührt sind. 4. Einen Schöpfergott gibt es nicht. 5. Gott hat die Welt erschaffen. 6. Es stimmen nur diejenigen Erkenntnisse der Evolutionstheorie, die nicht im Widerspruch zu den Schöpfungsberichten stehen. 7. Gott hat die Welt erschaffen und sich dann von ihr zurückgezogen. 8. Die Evolutionstheorie kann nicht stimmen, da sie mit Experimenten nicht beweisbar ist. 9. Die Schöpfung ist kein einmaliges Geschehen in der Vergangenheit gewesen, sondern zeigt, dass sich Gott den Menschen immer wieder zuwendet. 10. Glaube und Naturwissenschaft sind zwei getrennt Bereiche, einmal wird etwas über Gott ausgesagt und einmal über die Welt und die Natur. 17 Vgl. z.B. die Kerncurricula im Fach Evangelische Religion für das Land Niedersachsen: Niedersächsische Kultusministerium (Hg.), Kerncurriculum für das Gymnasium Schuljahrgänge 5–10, Hannover 2009 und Kerncurriculum für das Gymnasium, gymnasiale Oberstufe, die Gesamtschule, das berufliche Gymnasium, das Abendgymnasium, das Kolleg, Hannover 2011. Zur Verbindung zwischen der Jugendtheologie und dem Kompetenzaufbau vgl. ausführlicher Schweitzer 2011, 135ff. 18 Vgl. z.B. Hubertus Halbfas, Religiöse Sprachlehre. Theorie und Praxis, Ostfildern 2012.
Bürig-Heinze Schöpfung oder Evolution – Komplementäres Denken im Religionsunterricht
11. In der Schöpfung zeigt sich, wie mächtig Gott ist. 12. Schöpfungsvorstellungen sind heute nicht mehr notwendig. 13. Schöpfungserzählungen sind keine Augenzeugenberichte. 14. In den Schöpfungserzählungen wird die Frage der Menschen nach ihrem Sinn beantwortet. 15. Die Schöpfungserzählungen weisen den Menschen darauf hin, dass er Verantwortung für die Welt übernehmen soll. 16. Die modernen Naturwissenschaften können die Entstehung der Welt und der Lebewesen schlüssig erklären. 17. Eine leere Karte. Anlage 2: Schöpfung oder Evolution: Wer hat Recht? Ihre Meinung ist gefragt!
Zu dem Thema, ob die Schöpfungsberichte stimmen oder die Evolutionsbiologen Recht haben, gibt es ganz unterschiedliche Auffassungen. Heute soll Ihre Meinung dazu im Zentrum stehen und auch die Begründung, die Sie für diese haben. 1. Lesen Sie sich die Aussagen auf den einzelnen Karten gründlich durch. Stellen Sie die Aussagen zusammen, die für Sie zusammengenommen eine schlüssige Antwort ergeben. Die Anzahl der Karten können Sie selbst bestimmen. Wenn Ihnen eine wichtige Aussage fehlt, können Sie diese auf das leere Kärtchen schreiben. 2. Notieren Sie die Nummern der Karten, die Sie ausgesucht haben. 3. Jetzt geht es um die Begründung: Erläutern Sie, warum Sie die Auswahl so getroffen haben und die Aussagen auf
237
den Karten in dieser Zusammenstellung für Sie am schlüssigsten sind. 4. Falls noch Zeit bleibt: Haben Sie diese Meinung schon immer so vertreten? Können Sie sich daran erinnern, ob das einmal anders war, wann sich etwas geändert hat und woran das lag? Anlage 3: Ein kleines Training für die eigene Analysefähigkeit
Die Notwendigkeit der Analysefähigkeit wird z.B. an folgenden Aussagen aus einem Kurs eines 12. Jahrgangs deutlich. Sie sollen dazu anregen zu überlegen, wie Sie a) spontan bzw. b) im weiteren Unterrichtsverlauf nach vorbereitender Planung reagieren würde: A »Die Lehre von der Evolution des Lebens lässt sich für mich nicht mit der Schöpfung vereinbaren: Gott hat jedes einzelne Lebewesen mit seinen Eigenarten und seiner einzigartigen symbolischen Bedeutung selbst geschaffen und hätte die gesamte Struktur und Ordnung der Erde nicht dem Zufall überlassen. Gott hat sich den Menschen zum Ebenbild geschaffen und damit ist für mich die Hypothese, der Mensch stamme vom Tier ab, völlig ausgeschlossen. Die christliche Religion zeigt, dass Gottes Handlungsfähigkeit unergründlich ist und den menschlichen Verstand bei weitem übersteigt. Wer die Bibel aufmerksam liest, findet Antworten auf alle Fragen unseres Lebens.« B »Evolution und Schöpfung lassen sich nicht verbinden. Für mich steht die wissenschaftliche Erkenntnis im Fokus. Demnach ist die Schöpfungserzählung der Bibel eine hübsche Geschichte.«
238
Religionspädagogische Anregungen
C »Ich finde grundsätzlich, dass die Evolution logische Erklärungen dafür gibt, wie sich die Lebewesen verändern. Ebenso glaube ich, dass die Schöpfungsgeschichte die Wahrheit erzählt. Ich denke jedoch, dass die Schöpfungsgeschichte nicht den genauen Ablauf der Entstehung des Lebens beschreiben soll, sondern uns klarmachen soll, dass Gott hinter dem Leben auf der Erde steht. Das bedeutet also nicht, dass sich Schöpfung und Evolution widersprechen, sondern sich im Gegenteil sogar ergänzen.«
D »Dabei darf man aber nicht außer Acht lassen, dass der Mensch ein empfindendes, nicht vollkommen po sitivistisch-rationales Wesen ist. Er strebt besonders nach Halt, Kontinuität, Tradition, festen Werten, die ihm in einer undurchsichtigen, globalisierenden Welt Orientierung vermittelt. Dies wird v.a. durch die Religion gewährleistet, womit auch eine biologistische, unmoralische Weltsicht verhindert werden kann.«
Die Autorinnen und Autoren
239
Die Autorinnen und Autoren
Dr. Jeff Astley ist Honorary Professorial Fellow für Praktische Theologie und Christliche Erziehung sowie Honorarprofessor am Department für Theologie und Religion an der Durham University.
Marcus Götz-Guerlin, Evangelischer Theologe und Politikwissenschaftler, leitet die Evangelische Berufsschularbeit und die Jugendbildungsstätte »Haus Kreisau« in Berlin.
Janieta Bartz ist Referentin für Pastoraltheologische Grundsatzfragen im Bischöflichen Generalvikariat Münster und Lehrbeauftragte für Religionspädagogik und Religionsdidaktik an der Universität Paderborn.
Britta Hemshorn de Sánchez, Magistra der Theologie, Master of Arts in inklusiver Pädagogik und Kommunikation ist Studienleiterin für Globales Lernen und Inklusion im Pädagogisch-Theologischen Institut der Nordkirche
Dr. Anton A. Bucher ist Professor für Religionspädagogik an der Universität Salzburg.
Lili Hochuli-Wegmüller ist Master of Theology UZH, Juristin (lic. iur.) und Sozialversicherungsfachfrau. Zur Zeit absolviert sie das Lernvikariat in der Reformierten Kirche Stadt Luzern.
Susanne Bürig-Heinze ist Lehrerin für Biologie und Religion am Gymnasium in Burgdorf und Fachberaterin für Evangelische Religion. Dr. Emanuela Chiapparini ist Jugendsoziologin und Dozentin am Institut Kindheit, Jugend und Familie der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), Soziale Arbeit. Dr. Monique van Dijk-Groeneboer ist Dozentin für Religionssoziologie und Koordinatorin der Akademischen Religionslehrerausbildung an der Fakultät für Katholische Theologie, Universität Tilburg.
Dr. Stefan Huber ist Professor für Empirische Religionsforschung und Theorie der interreligiösen Kommunikation an der Theologischen Fakultät der Universität Bern. Dr. Patrik C. Höring ist Professor für Katechetik und Didaktik des Religionsunterrichts an der Philosophisch-Theologischen Hochschule der Steyler Missionare in Sankt Augustin. Muriel Koch ist Wissenschaftliche Assistentin im Bereich Praktische Theologie an der Theologischen Fakultät der Universität Zürich.
240
Die Autorinnen und Autoren
Dr. Sabrina Müller ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Kirchenentwicklung (ZKE) der Theologischen Fakultät der Universität Zürich. Markus Mürle ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Evangelische Theologie und ihre Didaktik an der Universität Hohenheim. Tobias Petzoldt ist Dozent für Evangelische Bildungsarbeit mit Jugendlichen und Leiter des Instituts für berufsbegleitende Studien an der Evangelischen Hochschule Moritzburg bei Dresden. Dr. Bert Roebben ist Professor für Religionsdidaktik am Institut für Katholische Theologie der TU Dortmund und VizeVorsitzender der »Religious Education Association« in den USA.
Dr. Thomas Schlag ist Professor für Praktische Theologie an der Theologischen Fakultät der Universität Zürich. Dr. Nicholas Shepherd ist Assistant Director of Discipleship and Ministry, Diocese of Southwark (Church of England). Dr. Pete Ward ist Professor am St John’s College/Department of Theology and Religion, Durham University, Professor für Praktische Theologie MF, The Norwegian School of Theology, Oslo sowie Professor für Praktische Theologie, NLA University College, Bergen. Dr. Dr. Joachim Willems ist Professor für Religionspädagogik am Institut für Evangelische Theologie der Technischen Universität Dortmund.