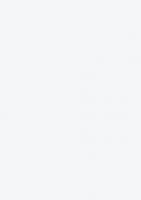Religion in der Moderne: Religionsphilosophische Beiträge zu einer aktuellen Debatte 9783737002004, 9783847102007, 9783847002000
134 70 1MB
German Pages [162] Year 2013
Recommend Papers

- Author / Uploaded
- Kurt Appel
- Rudolf Langthaler
- Christopher Meiller
File loading please wait...
Citation preview
Religion and Transformation in Contemporary European Society
Band 6
Herausgegeben von Kurt Appel, Christian Danz, Richard Potz, Sieglinde Rosenberger und Angelika Walser
Die Bände dieser Reihe sind peer-reviewed.
Rudolf Langthaler / Christopher Meiller / Kurt Appel (Hg.)
Religion in der Moderne Religionsphilosophische Beiträge zu einer aktuellen Debatte
Mit einer Abbildung
V& R unipress Vienna University Press
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. ISBN 978-3-8471-0200-7 ISBN 978-3-8470-0200-0 (E-Book) Veröffentlichungen der Vienna University Press erscheinen im Verlag V& R unipress GmbH. Gedruckt mit freundlicher Unterstützung des Rektorats der Universität Wien und der Forschungsplattform »Religion and Transformation in Contemporary European Society«. Ó 2013, V& R unipress in Göttingen / www.vr-unipress.de Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages. Printed in Germany. Titelbild: RaT-Logo (Gerfried Kabas, Wien). Druck und Bindung: CPI Buch Bücher.de GmbH, Birkach Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier.
Inhalt
Vorwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
Peter Strasser Religiosität ohne Glauben? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
Jakob Deibl Jenseits zielloser Suchbewegung? Zu Peter Strassers Vortrag »Religiosität ohne Glauben?« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
Herbert Schnädelbach Religion in der Moderne – Aspekte und Perspektiven . . . . . . . . . . .
47
Hans Schelkshorn Der schmale Grat einer Versöhnung von kritischer Vernunft und Religion. Überlegungen zu Herbert Schnädelbachs Thesen über »Religion in der Moderne« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63
Bernd Dörflinger Eine neuere Religionsauffassung im Licht einer älteren. Habermas und Kant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85
Rudolf Langthaler Zu Bernd Dörflingers Kritik an Habermas’ Religionskonzeption . . . . . 103 Hans-Joachim Höhn Säkularisierungsresistent? Struktur und Relevanz eines religiösen Daseinsverhältnisses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
6
Inhalt
Christopher Meiller »Religiöses Daseinsverhältnis« – Anmerkungen und Rückfragen zu Hans-Joachim Höhns »existentialpragmatischer« Religionsphilosophie
. 151
Autorenverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Vorwort
Im Rahmen der an der Universität Wien eingerichteten Forschungsplattform »Religion and Transformation in Contemporary European Society« fanden im Studienjahr 2011/12 auch einige Gastvorlesungen und Workshops zu religionsphilosophischen Fragen statt, die mit dem Generalthema der Forschungsplattform in engem Zusammenhang stehen. Sie ließen sich dabei naheliegenderweise von der Absicht leiten, in durchaus unterschiedlichen Akzentuierungen an aktuelle einschlägige religionsphilosophische Debatten anzuschließen: »Religion und Moderne«, »Religion in der Öffentlichkeit moderner Gesellschaften« und die daran geknüpften Problematisierungen und Herausforderungen rückten dabei naturgemäß in den Vordergrund des Interesses. Die lebhaften und auch kontroversiellen Diskussionen ließen es als sinnvoll erscheinen, die Gastvorträge gemeinsam mit Repliken zu veröffentlichen, die jeweils von Angehörigen der Wiener Forschungsplattform verfasst wurden. Peter Strasser skizziert in einem Streifzug durch die Philosophie der Neuzeit zunächst einige markante Positionen einer Verabschiedung der Metaphysik und auch der Religion in Gestalt bekannter religionskritischer Positionen. Daran knüpft sich sein gegenwartsbezogener Befund: Ebenso wie die Religion, gedacht als Institution mit Ritualen, Dogmen und Beamten, anfangs aus diffus religiösen Einstellungen und Affekten der Welt gegenüber erwächst, so bleibt nach dem Zerfall der hochreligiösen Bindungskräfte in Neuzeit und Moderne eine flottierende Religiosität zurück, die nach neuer Form und Anbindung sucht. Diese »Religiosität ohne Religion« wird einerseits vielfältig ausgebeutet – Stichwort: Spiritualitätsmarkt –, andererseits gewinnt durch sie der profane Alltag wieder stärker »liturgische« Züge, das heißt: Praxis und Erleben des einst bloß Weltlichen werden als Verkörperung des Absoluten, Göttlichen, ernstgenommen und gewürdigt. Hier, so Strasser, bricht sich dann der metaphysische Ursprungssinn der ethischen Idee des guten Lebens Bahn. Als Kern dieses Beitrages des Grazer Philosophen identifiziert Jakob Deibl in seiner Replik die Frage, was eine »Religiosität ohne Glauben«, wie sie laut Strasser ein neues Phänomen jenseits klassischer Religiosität und Unglauben
8
Vorwort
ist, bedeuten könne. An die Erörterung dieser Frage knüpft sich sodann die von Deibl in Gestalt einer Rückfrage an den Beitrag Strassers geäußerte Vermutung: Muss sie zwangsläufig in eine ziellose Suchbewegung münden, die sich schließlich kaum mehr von einem Konsumverhalten unterscheiden lässt, oder wird sie sich – worin gerade die vermittelnde Aufgabe von Theologie und Philosophie heute läge – auch wieder ein neues Verhältnis zu den »Mythen« und Narrativen, die unabweisbar zur abendländischen Tradition gehören, erschließen können? Bernd Dörflinger, seines Zeichens Vorsitzender der Internationalen KantGesellschaft, legt in seinem Beitrag die Gründe dafür dar, weshalb er in Habermas’ Religionsauffassung einen Rückfall hinter das Anspruchsniveau der kantischen Religionsphilosophie erkennt: Dörflinger sieht in der Habermas’schen Stellungnahme zur Religion das »säkulare Konzept der Vernunft« gemessen an den Ansprüchen der Kantischen Vernunftreligion verfehlt. Ebenso verkenne das an Habermas’ Stellungnahmen zur »Religion in der Öffentlichkeit« vorgeschlagene »Friedensprojekt« die in den Ansprüchen der geschichtlichen Glaubensarten liegenden fundamentalen Schwierigkeiten. Dörflinger setzt dagegen das von ihm bei Kant wesentlich nüchterner und konsequenter wahrgenommene Projekt der »wahren Aufklärung«. Rudolf Langthaler konfrontiert diese – an Kants Religionstheorie orientierte – sehr entschiedene Kritik an Habermas mit der Anfrage, ob bzw. wie weit sich Kants Konzeption einer »autonomen Vernunft« in der Tat berechtigterweise gegen Habermas in Stellung bringen lässt, und ob das von Dörflinger in Bezugnahme auf Kant geltend gemachte Programm der »wahren Aufklärung« im vernünftigen und gesellschaftlich vertretbaren Umgang mit den gegenwärtigen Ansprüchen der historischen Glaubensarten nicht genau jene Forderungen und Herausforderungen berücksichtigen muss, die in Habermas’ Kennzeichnung eines »postsäkularen Bewusstseins« angesprochen sind. Herbert Schnädelbach, der sich als »frommer Atheist« versteht, zeichnet in seinem Beitrag die für die Entwicklung der Moderne maßgebenden »Strukturmerkmale«: »Dezentrierung, Pluralisierung und vollständige Reflexivität« und die damit verbundenen Wandlungen des gesellschaftlichen Stellenwerts der Religion nach. Am Ende dieser Entwicklung sieht er, als Konsequenz des abgeschlossenen »Reflexiv-Werdens« der Religion eine vollständige »Subjektivierung« bzw. »Individualisierung« (»Privatisierung«) des »Glaubens« der Religion; dieser Entwicklung entsprechen bezeichnenderweise fundamentalistische Tendenzen auf der einen Seite sowie der Reduktion der Theologie auf Religionsbzw. Kulturwissenschaft andererseits. In seiner Replik legt Hans Schelkshorn zunächst ein besonderes Gewicht auf notwendige Differenzierungen im Begriff bzw. im Verständnis der »Moderne«, die er in Schnädelbachs Moderne-Konzeption vermisst, die er jedoch für eine
Vorwort
9
Beantwortung der Frage nach der »Zukunft der Religion« als unverzichtbar ansieht; auf dieser Basis erfolgt Schelkshorns Auseinandersetzung mit der zentralen These Schnädelbachs, wonach die von ihm angezeigten Strukturmerkmale der Moderne eine völlige Privatisierung und letztlich eine Selbstauflösung der Theologie in eine Art Kulturwissenschaft zur Folge haben. Hans-Joachim Höhn verfolgt in seinem Beitrag »Säkularisierungsresistent? Struktur und Relevanz eines religiösen Daseinsverhältnisses« – ausgehend von einer »postsäkularen Bewusstseinslagen« Rechnung tragenden Problemskizze – eine sich am Projekt einer Existenzialpragmatik orientierende religionsphilosophische Perspektive. Vor diesem Hintergrund sind »auf ebenso zeit- wie sachgemäße Weise Vernunft und Religion in Beziehung« zu setzen und »die möglichen Säkularisierungstendenz eines religiösen Weltverhältnisses zu rekonstruieren«. In existentialpragmatischer Sicht soll darin »Religion als eine spezifische Bezugnahme auf die existentiale Grundkonstellation menschlicher Lebenspraxis« ausgewiesen und im Blick auf eine durch sie eröffnete »Daseinsakzeptanz« legitimiert werden. In seiner Replik darauf diskutiert Christopher Meiller einige Charakteristika sowie die Reichweite der von Hans-Joachim Höhn dargelegten Bestimmung des »Religiösen« (bzw. der Kategorie des »religiösen Daseinsverhältnisses«). Vor dem Hintergrund diverser systematischer Kontextualisierungen wird dessen spezifische »existentialpragmatische« Verortung kommentiert und Anfragen hinsichtlich Eigenart, (möglicher) Kritikanfälligkeit und Sachadäquatheit desselben artikuliert. Die Herausgeber danken Rudolf Kaisler, Simone Pesendorfer und Angelika Walser für die redaktionelle Bearbeitung der Texte. Wien, im Mai 2013
Rudolf Langthaler und Kurt Appel
Peter Strasser
Religiosität ohne Glauben?
1.
Das Ende der Metaphysik – eine Endlosgeschichte?
Ernst Topitsch veröffentlicht sein Buch Vom Ursprung und Ende der Metaphysik erstmals 1958. Es basiert auf einer Überzeugung, die sich seit den Tagen der Aufklärung immer mehr verstärkte. Im neopositivistischen Wiener Kreis, in dessen gedanklichem Umfeld sich auch das Buch von Topitsch bewegt, galt als ausgemacht, dass das Zeitalter der Moderne zugleich zwei Tendenzen befördere: Erstens, die Verankerung des inhaltlichen Erkenntnisbegriffes im Methodenbegriff der Naturwissenschaften, und zweitens die zunehmende Verdrängung der Metaphysik aus der Philosophie. Denn die Metaphysik galt den Neopositivisten, Empiristen und Kritischen Rationalisten als die Rationalisierung mythologischer und religiöser Altbestände. Für diese Diagnose sprach tatsächlich vieles, und bezogen auf bedeutende Philosophenschulen der Neuzeit und Moderne hatte sie offensichtlich Recht. Man denke an Fichte, Hegel, Schelling, kurz: an den deutschen Idealismus, welcher zwar einerseits der großangelegte Versuch gewesen war, die Aufklärung zu beerben, indem er in den Mittelpunkt der philosophischen Spekulation das autonome Subjekt – das pathetisch getönte Ich – rückte. Doch andererseits trug eben die spekulative Selbstentfaltung des Ich deutlich Züge eines heilsgeschichtlichen, namentlich des christlichen Erlösungsprozesses. Am Ende sollte die Einsicht in das Absolute, Göttliche stehen, was in gewissem Sinne einer Selbstvergöttlichung des Subjekts gleichkam. Das waren natürlich hochfliegende Phantasien unter der ausschweifenden Produktion heftigen Begriffsgeklappers. Und so ist es nicht verwunderlich, dass die Romantik, als Trägerin und Erbin des Idealismus, zuletzt viele ihrer Vertreter – in einer Art Pendelbewegung – zur Kirche, ja zu Rom und zum Papismus zurückführte. Dort konnte man der dünnen Luft der Ich-Dialektiken und Geistspekulationen entkommen, dort durfte man wieder zu einer das sehnsüchtige Herz ausfüllenden Gewissheit finden, und zwar am Gegenpol der autonomen Vernunft, nämlich im Schoß der Offenbarung.
12
Peter Strasser
Als Topitsch sein Buch veröffentlichte, stand die deutsche Philosophie noch immer im Bann Heideggers. Dessen Denkstil, Vokabular und Problemstellung waren zwar ausdrücklich als Abkehr sowohl vom Humanismus als auch vom rationalisierend Theologischen konzipiert. Doch jeder, der Heideggers Werke konsultierte, musste die religiöse Atmosphäre gleichsam riechen. Indem Heidegger gegen die Dominanz des autonomen Subjekts in der Philosophie der Neuzeit anging, installierte er das besorgte menschliche Dasein wieder als eine Art Medium. In ihm sollte das Sein zur Sprache kommen. Auf diese Weise wird das Subjekt, über alle technischen Verstellungen der Zivilisation hinweg, wieder ursprünglich. Im Rückgang auf die vorsokratische Philosophie verkündete Heidegger, der Mensch sei dazu berufen, Hüter des Seins zu sein, aber nicht, indem er sich selbst als Gott aufspreize, sondern sich offen halte für die – exemplarisch gesprochen – Lehre des Feldwegs. Der Feldweg, so nannte Heidegger eine kleine, nachhaltig wirksame Schrift über den Weg, der seit Heideggers Kindheitstagen vom Elternhaus ein Stück weit in die Landschaft um Meßkirch, Heideggers Heimatort, hineinführte: »Ob das Alpengebirge über den Wäldern in die Abenddämmerung wegsinkt, ob dort, wo der Feldweg sich über eine Hügelwelle schwingt, die Lerche in den Sommermorgen steigt, ob aus der Gegend, wo das Heimatdorf der Mutter liegt, der Ostluft herüberströmt, ob ein Holzhauer beim Zunachten sein Reisigbündel zum Herd schleppt, ob ein Erntewagen in den Fuhren des Feldweges heimwärtsschwankt, ob Kinder die ersten Schlüsselblumen am Wiesenrain pflücken, ob der Nebel tagelang seine Düsternis und Last über die Fluren schiebt, immer und von überall her steht um den Feldweg der Zuspruch des Selben: // Das Einfache verwahrt das Rätsel des Bleibenden und des Großen. Unvermittelt kehrt es bei den Menschen ein und braucht doch ein langes Gedeihen. Im Unscheinbaren des immer Selben verbirgt es seinen Segen. Die Weite aller gewachsenen Dinge, die um den Feldweg verweilen, spendet Welt.«
Aber der Zuspruch des Feldwegs wird nur denen zuteil, die ihn hören können, weil sie »in seiner Luft geboren« sind. Wir Heutigen, so Heidegger, sind schwerhörig geworden für den Zuspruch des Feldwegs, denn wir hören bloß den Lärm der Apparate, die wir »fast für die Stimme Gottes halten«. Auf diese Weise werden wir zerstreut und weglos. Das Einfache erscheint uns als einförmig. Es macht uns überdrüssig. Wir werden verdrießlich, »finden nur noch das Einerlei«. Der Feldweg hingegen spricht, so Heidegger, mit der Stimme des Einfachen; und diese Stimme spricht, paradox genug, im »Ungesprochenen der Sprache«, so, wie sie von den Dingen rund um den Feldweg »gesprochen« wird; nur dort ist, wie Heidegger schreibt, »Gott erst Gott«.1 1 Der Feldweg ist bei Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, als kleines Heftchen erschienen, sicherlich der meistverbreitete Sonderdruck der deutschen Literatur; ich zitiere aus der 10. Aufl. (56.–65. Tausend), 1998. Die zitierten Stellen finden sich auf den Seiten 4 ff. (Wiederabgedruckt zusammen mit einigen anderen kleinen Werken findet sich Der Feldweg in:
Religiosität ohne Glauben?
13
Hier braucht der Leser nicht weiter nach einer religiösen Grundierung Ausschau zu halten. Sie wird expressis verbis vorgetragen, indem einer grundsätzlichen Kritik der lärmenden Apparatewelt, also all dessen, was bei Heidegger »das Gestell« heißt, ein Lob der einfachen Dinge gegenübersteht – der Dinge, wie sie sich besonders in der Natur finden, deren beredtes Schweigen erst die Anwesenheit Gottes oder des Göttlichen offenbart. Heideggers Denken, dessen Einfluss auf die Theologie des 20. Jahrhunderts nicht überschätzt werden kann, traf sich zumindest in einem Punkt mit dem seiner philosophischen Erzfeinde, den Vertretern der neomarxistisch orientierten Frankfurter Schule. Die beiden Schulhäupter, Max Horkheimer und Theodor W. Adorno, besonders Letzterer zusammen mit seinem Schüler Jürgen Habermas, betrieben ebenfalls Aufklärungskritik, die sich am naturwissenschaftlichen Denkstil und der aus ihm resultierenden technischen Weltsicht entzündete. Man sprach von der instrumentellen Vernunft, deren Herrschaft es zu brechen galt. Während jedoch Adorno der Metaphysik im »Augenblick ihres Sturzes« beistehen wollte, das heißt, darauf setzte, die religiösen Gehalte des einst Bekämpften gegen die neuen Gewalten der reinen Innerweltlichkeit denkend in Schutz zu nehmen, schwebte dem jungen Habermas ein Denken vor, das sich politisch umsetzen ließ. Die Formel hieß »emanzipatorisches Interesse«, worin sich eine Grundeinstellung des Menschen zur Welt widerspiegeln sollte. Im Konzept des transzendentalpragmatischen »Interesses« wirkte der Strom jener Philosophie von Hegel bis Marx weiter, der um die geschichtliche Aufhebung der Entfremdung des Menschen – der Selbstverfehlung seines Wesens – bemüht war. Wie der in den späten 1960er-Jahren ausbrechende Positivismusstreit dann zeigte, wurde den Emanzipationsdenkern von ihren Verächtern, namentlich Karl Popper, Hans Albert, aber eben auch Ernst Topitsch, vorgeworfen, trotz Metaphysikund Religionskritik immer noch heilsgeschichtliche Motive zu transportieren. Unübersehbar war deren Präsenz vom deutschen Idealismus bis zum Historischen Materialismus. Der »Histomat« prophezeite das Ende des Kapitalismus und des Staates, kurz: der Ausbeutung des Menschen durch den Menschen. Damit sollte die letzte Menschheitsepoche beginnen, die – in der Diktion ihrer Gegner, der Antimarxisten – nichts Geringeres als das Paradies auf Erden verwirklichen hätte wollen. Derart hätte sich die Menschheit, nach dem Tod Gottes und dem Sturz der Klassenherrschaft, endlich selbst erlöst.
Heidegger, Martin: Zum 80. Geburtstag von seiner Heimatstadt Meßkirch. Frankfurt a. M. 1969. S. 11 ff.)
14
2.
Peter Strasser
Glück ohne Transzendenz: Nietzsches letzter Mensch
Die Vermutung, welche die religionskritisch eingestellten Weltanschauungskritiker hegten, lautete: Das Erstarken der Metaphysik seit dem 18. Jahrhundert war gleichzeitig ein Indiz für das Schwächerwerden der hochreligiösen Bindungskräfte im Westen, der sich zunehmend säkularisierte. Zugleich wanderte die religiöse Substanz aus dem kircheninternen Bereich aus, weil dort noch immer das Dogma und der Mythos den Ton angaben. Ihr neuer Ort: die Metaphysik. Doch die philosophische Ummantelung des religiösen Erbes konnte nur solange anhalten, als die Metaphysik nicht selbst als eine Endgestalt des Mythos, der sich bereits überlebt hatte, durchschaut wurde. Diesem Prozess des Durchschauens kräftig nachzuhelfen, war das zentrale Anliegen des Buches Vom Ursprung und Ende der Metaphysik. Damit sollte zugleich eine Dynamik des Unwirksamwerdens der religiösen Metamorphosen in der Gestalt transzendentalistischer, fundamentalontologischer oder geschichtsphilosophischer Systeme in Gang gesetzt werden. Der dahinterstehende psychologische Ansatz war relativ schlicht, weil ausgesprochen rationalistisch: Habe man nämlich – so die Behauptung – einmal verstanden, dass, erstens, Religionen samt und sonders sinnstiftende Illusionen seien, denen die Vernunft entsagen müsse; dass, zweitens, daher auch die Metaphysik in jedweder Form als Sinnstiftungsagentur aufgegeben werden müsse, sobald ihr kryptoreligiöser Charakter durchschaut sei: dann werde sich, drittens, das menschliche Gefühlsleben, nach anfänglichen Phantomschmerzen (man spürt noch die Gegenwart dessen, woran man nicht mehr glaubt), an die objektive Sinnlosigkeit der Welt, ihrer Gesetze und Dynamiken, anpassen. Mit anderen Worten: Der Übergang zur Moderne und Postmoderne hätte eine bisher unbekannte Intensität der Säkularisierung mit sich bringen müssen, nämlich die innere Säkularisierung des Menschen. Der innerlich säkularisierte Mensch würde seine Bedürfnisstruktur ganz darauf abgestellt haben, dass keine übernatürliche Welt existiert. Alles was ist, ist gleichsam von hier. Der Sinn des Lebens wäre demgemäß eine bloße Chimäre oder aber ergäbe sich innerweltlich daraus, dass man seinem eigenen Dasein und dem der anderen eine Bedeutung zuschreibe, die aus letztlich subjektiven Wertungen resultiere. Ferner : Der berühmte Satz des katholischen Schriftstellers L¦on Bloy, Dieu se retire, »Gott zieht sich zurück«, würde – nach Abklingen des religiösen Phantomschmerzes – dahingehend interpretiert werden, dass es niemals etwas Transzendentes gab, das sich hätte zurückziehen können. Und was die Vermutung Dostojewskijs betrifft, dass nämlich unter der Bedingung der Nichtexistenz Gottes alles erlaubt sei, so zeige gerade der Humanismus die Entstehung einer universalen Moral und die Durchsetzung der Menschenrechte: Es bedarf keines
Religiosität ohne Glauben?
15
religiösen Fundaments, um plausibel zu machen, dass nicht alles erlaubt sei. Wäre nämlich alles erlaubt, dann würde die Menschheit in den Naturzustand zurücksinken, das heißt, in ein elendes Leben, worin, nach der Formulierung des Thomas Hobbes, jeder gegen jeden Krieg führen müsste. Um eine derartige Konsequenz zu vermeiden, sei es das oberste Gebot der Vernunft, Institutionen und Regeln zu schaffen, unter denen zumindest eine gewisse Wahrscheinlichkeit bestehe, dass möglichst viele Menschen ihre Grundbedürfnisse einigermaßen befriedigen können. Das Ende der religiösen Ethik und des Naturrechts sei also keineswegs das Ende der Moral, im Gegenteil. Erst wenn die hierarchischen, dogmatischen und abergläubischen Formen des Zusammenlebens, die sich auf Blut, Herkunft und Charisma gründen, ihre Wirkkraft verloren hätten, erst dann werde der Einzelne instand gesetzt, angstlos darüber nachzudenken, was seine ureigensten Interessen und Präferenzen seien, um diese dann mit den Wünschen der anderen rechtsförmig abzustimmen. Dann werde sich auch der Gedanke einer prinzipiellen Gleichheit aller Menschen auf längere Sicht praktisch durchsetzen lassen. Dieser optimistischen Hoffnung stand seit Nietzsche eine andere Sicht der Dinge gegenüber, die bestimmte Phänomene unserer Gegenwart mit scharfem Vorausblick einfing. In seinem Spätwerk Also sprach Zarathustra, welches den Tod Gottes zelebriert, ist auch von den »letzten Menschen« die Rede, vor denen Nietzsche alias Zarathustra graute: »Die Erde ist dann klein geworden, und auf ihr hüpft der letzte Mensch, der Alles klein macht. Sein Geschlecht ist unaustilgbar, wie der Erdfloh; der letzte Mensch lebt am längsten. / ›Wir haben das Glück erfunden‹ – sagen die letzten Menschen und blinzeln. / Sie haben die Gegenden verlassen, wo es hart war zu leben: denn man braucht Wärme. Man liebt noch den Nachbar und reibt sich an ihm: denn man braucht Wärme. / Krankwerden und Misstrauen-haben gilt ihnen sündhaft: man geht achtsam einher. Ein Thor, der noch über Steine oder Menschen stolpert! / Ein wenig Gift ab und zu: das macht angenehme Träume. Und viel Gift zuletzt, zu einem angenehmen Sterben.«2
Was hier vorausgeahnt wird, bis hin zur Forderung nach aktiver Sterbehilfe, das ist eine postreligiöse, postmetaphysische Gesellschaft, deren Friede und Glück ebenso rundgeschlossen sind wie sie, von außen betrachtet, defizitär anmuten. Die letzten Menschen, könnte man sagen, sind verachtenswert nachsichtig gegen sich selbst. Zu den alten Fragen, die über den Menschen hinausführen, den aufwühlenden Fragen nach dem Sinn des Daseins und der Welt, hat der letzte Mensch nichts mehr zu sagen. Derlei Fragen ermüden ihn. Er blinzelt, sobald sie ihm in den Sinn kommen, und wenn sie beginnen, in ihm zu rumoren, dann 2 Nietzsche, Friedrich: Sämtliche Werke. Kritische Gesamtausgabe in 15 Einzelbänden. Also sprach Zarathustra I – IV. Hrsg. von Giorgio Colli und Mazzino Montinari. Neuausgabe Band 4. München 1999. S. 19 f.
16
Peter Strasser
nimmt er ein bisschen Gift oder er geht zum Psychiater. Kurz, das Glück des letzten Menschen hat dies an sich: Es ist ein lebloses, ein irgendwie totes Glück. Und wir Heutigen müssten schon blind sein, wenn wir nicht erkennen würden, dass eine tiefe Missgestimmtheit, die mit dem Hedonismus der Postmoderne einhergeht, eben darin besteht, im Glückskonsum unserer Tage die Leblosigkeit zu spüren. Es wird uns zwar immer leichter gemacht, glücklich zu sein, zugleich jedoch wird unser Glück – so empfinden es jedenfalls viele – immer sinnloser. Auch wenn es auf den ersten Blick paradox klingen mag: Unser Glück ist sich selbst nicht genug.
3.
Defizit an Spiritualität und Spiritualität als Defizit
Nietzsches letzter Mensch ist eine existenzielle Negativgestalt, deren reale Ausformung ziemlich genau dem Endzustand dessen entspräche, was eine vollständige, bruchlose Anpassung an die »Wertirrationalität des Weltlaufs« la Topitsch hervorbringen müsste. Tatsächlich jedoch hat eine solche Anpassung niemals stattgefunden. Ihr scheint die menschliche Natur entgegenzustehen. Diese kann nicht aufhören, sich Fragen zu stellen, die über das Innerweltliche hinausreichen. Oder anders gesagt: Schon dass der Mensch dazu befähigt oder verdammt ist, den Begriff des Innerweltlichen, der »Immanenz«, zu denken, konstituiert nicht nur den Fragenkreis der Transzendenz. Darüber hinaus entsteht ein Komplex an Transzendenzgefühlen, die von der Sehnsucht nach einer Urheimat, über die Hoffnung auf Erlösung und das Bedürfnis nach absoluter Geborgenheit, bis zur schwärzesten Verzweiflung über die Abwesenheit Gottes reichen. Am Schluss, nachdem die Entmythologisierung aller jenseitsweltlichen Überschüsse vollzogen ist, bleiben womöglich nur noch die gleichsam leeren, begriffslosen Formen des religiösen Erlebens übrig. Aber sie bleiben und treiben die Menschen um. Nennen wir dieses Phänomen »Religiosität ohne Glauben« oder »Religiosität ohne Religion«. Das Phänomen ist wohlbekannt, in einzelnen Gestalten unserer Kultur hat es stets eine produktive Funktion gehabt. Nicht nur Wittgenstein bemerkte gelegentlich, dass sich ihm jedes philosophische Problem nur aus einer religiösen Warte erschließe (was vermutlich eine Übertreibung war). Ausführlicher dazu äußert sich beispielsweise John Bayley, wenn er über seine Gattin, Iris Murdoch, die große Oxforder Literatin und Philosophin, gelegentlich schreibt: »Religiöse Menschen – wie ihre Studentinnen – fanden sie auf Anhieb und ganz instinktiv sympathisch. Aber sie schien nie mit ihnen über Religion oder den Glauben
Religiosität ohne Glauben?
17
gesprochen zu haben. In gewisser Weise hing das ›Spirituelle‹, wie man es wohl nennen muss, in der Luft, und sein Vorhandensein wurde als selbstverständlich betrachtet. So sagte sie mir einmal lächelnd nach einem Zusammentreffen mit W. H. Auden […]: ›Er spricht gerne übers Beten.‹ Ich fragte, ob sie beide sich darüber ausgetauscht hätten, wie man beten solle. ›Aber nein‹, meinte Iris, ›wir beten ja beide nicht. Aber er macht Scherze darüber, wie er beten würde, wenn er es täte.‹ […] Iris ist und war eine anima naturaliter Christiana, war religiös ohne Religion.«3
Religiosität ohne Religion kann zur Quelle künstlerischer und anderweitig geistvoller Kreativität werden. Wohl deshalb auch legte Graham Greene Wert darauf, kein katholischer Schriftsteller zu sein, sondern einer, der katholisch ist. Denn worum es hier geht – bis hin zum Werk von Peter Handke –, scheint ja immer wieder zu sein, das Defizit des Glaubens, der dogmatisch und rituell bindet, einzubinden in die Energie einer künstlerischen Produktion, die zweierlei zugleich ist: frei genug, um der genialen Formkraft des Künstlers genügend Spielraum zu lassen, und doch, in ihrer Aussage und Strahlkraft, getragen von einem Transzendenzgefühl, demzufolge die Dinge der Welt objektiv Bedeutung und Wert haben, sich also sub specie aeternitatis, als lebendige Teile einer zeitlosen Schöpfung, anschauen und darstellen lassen. Religiosität ohne Glauben kann aber auch zu einer gleichsam frei flottierenden Lebensunruhe führen, die sich umso quälender bemerkbar macht, je weniger nach außen hin noch ein triftiger Grund besteht, nicht glücklich zu sein. Die Entwicklung der westlichen Demokratien mit hohem Wohlstandsniveau lässt gerade im breiten Feld der Mittelschichten, die ihre Freiheitsspielräume auf vielerlei Weise nützen, eine Form des »unglücklichen Bewusstseins« erkennen, die der säkularen Wohlfühlprogrammatik hartnäckig widersteht. Gewiss, dafür ist zu einem Teil der ständig wachsende Leistungsdruck verantwortlich, vor allem in Zeiten ökonomischer Krise (und Krise ist im Kapitalismus immer). Zu einem gewichtigen anderen Teil jedoch resultiert das unglückliche Bewusstsein der typischen Wellness-Schichten aus einem Mangel an »Spiritualität«. Dieses Wort, welches John Bayley auf Iris Murdoch noch so zögerlich anwendet, ist zu einem Schlüsselbegriff dafür geworden, wie man, ohne sich als einigermaßen gebildeter Mensch etwas zu vergeben, seinen religiösen Neigungen nachgeben darf. Spiritualität ist das Code-Wort für eine verschämte Religiosität ohne Glauben. In einer Kultur nach Voltaire und Kant sollte es gelungen sein, alles Abergläubische hinter sich zu lassen. Und ist die traditionelle Religion nicht voller abergläubischer Einschlüsse, voll von dem, was Kant »Afterglauben« und »Fetischdienst« nannte, also Bestandteilen einer Lebensform, die sich mit Aufklärung und Säkularisierung nicht verträgt? So fragt der gebildete Westeuropäer, dem es dennoch nach Höherem verlangt, das er immer weniger in der 3 Bayley, John: Elegie für Iris. München 2000. S. 162 f.
18
Peter Strasser
Kunst findet, also dort, wo Goethes Auge der Anschauung beheimatet war, für das noch galt, dass es die Sonne nie erblicken könnte, wäre es nicht selber »sonnenhaft«, das heißt, dem Lichte innerlich verwandt. Also bieten sich die verschiedenen Spielarten der »Spiritualität« an, allerlei fernöstliche Religionsverschnitte, die als Weisheitslehren in Umlauf und Mode kommen, ebenso die verschiedensten Körper- und Heilpraktiken, die das Leben des Einzelnen mit den energetischen Potenzen und Prozessen verbinden, die alles Leben durchdringen und noch den toten Stein lebendig sein lassen. Überhaupt ist das Spiritualitätsdenken wesentlich ein Energetik-Konzept, weil dieses an die wissenschaftliche Theorie des Universums anschlussfähig zu sein scheint. Obwohl man billige Leichtgläubigkeit verabscheut, widmet man sich in seiner Freizeit nicht nur gerne der Hauben-Küche, sondern auch, mutatis mutandum, der Drei-Hauben-Esoterik, die mit Steinen, Sternen, Stille, mit Pflanzen, Wässerchen und Tinkturen hantiert, wobei sich das alles auf ästhetisch hohem Niveau abspielen sollte, also wenn möglich in Vier-Sterne-Hotels, deren Räumlichkeiten und Personal den praktizierten Aktivitäten eine liturgische Qualität verleihen.
4.
Ethik statt Religion?
Wie aber verhält es sich im westlichen Kulturraum mit dem prognostizierten Unwirksamwerden religiöser Bindungskräfte? Erhebungen aus den letzten zehn Jahren zeigen ein deutlich differenziertes Bild. In der Zeitschrift The Atlantic Monthly vom Dezember 2005 umriss Paul Bloom, Psychologe und Linguist an der Yale University, die amerikanische Glaubenssituation. Demnach zeigen Umfragen, dass 96 Prozent der US-Amerikaner an Gott glauben, wobei mehr als die Hälfte zugleich an Wunder, Engel und den Teufel glaubt. Die meisten glauben an ein Leben nach dem Tod, und zwar in dem handfesten Sinn, dass man sich post mortem mit seinen Verwandten wiedervereinigen wird, um gemeinsam Gott zu begegnen. Dabei ist die oft behauptete Mentalitätskluft zwischen Amerikanern und Europäern in Sachen Religiosität offensichtlich, wenn auch vermutlich nicht immer so groß, wie es auf den ersten Blick scheint. Außerdem sind die innereuropäischen Besonderheiten erheblich. 2006 zeigten Umfragedaten in Österreich, dass hierzulande mehr Menschen an Wunder als an den Urknall glaubten (48 zu 35 Prozent). Zur selben Zeit gaben nur 47 Prozent der Befragten an, die Existenz Gottes eindeutig zu bejahen, und dies in einem Land, wo noch immer über 80 Prozent der Bevölkerung monotheistischen Religionsgemeinschaften angehören! Freilich, das alles gilt nicht, wenn man den Blick auf das katholische Polen lenkt. Dort nämlich glaubten im Befragungszeitraum 94 Prozent der
Religiosität ohne Glauben?
19
Menschen an den christlichen Gott und nicht viel weniger daran, dass Jesus der Sohn Gottes ist.4 Was Westeuropa insgesamt betrifft, so sticht ein Unterschied zu den USA besonders ins Auge: der Kirchenbesuch, der in den Vereinigten Staaten breitflächig floriert, während bei uns die Kirchen vor allem dann aufgesucht werden, wenn es um den feierlichen Aufputz großer Lebenszeremonien, namentlich Hochzeiten und Taufen, geht. Diese Situation ergibt sich daraus, dass die USreligiösen Sitten durch einen rigoros freien Markt geprägt werden. Die verschiedenen Denominationen (churches) werben mangels staatlicher Unterstützung aktiv und aggressiv um Mitglieder. Dabei verbessern sie ständig die Attraktivität ihres religiösen »Angebots«. Man handelt sozusagen mit heiliger Ware. Vergleichbares findet in Europa kaum statt. Trotz solcher Befunde, lässt sich der Zusammenhang zwischen Säkularisierung, Bildung und der Zunahme gleichsam frei flottierender religiöser Bedürfnisse nicht leugnen. Nicht religiöses Desinteresse an sich, sondern Religiosität ohne Einbindung in eine religiöse Lebensform wird als kultureller, ökonomischer und psychosozialer Faktor immer wichtiger, zumal es sich um ein Phänomen handelt, das sich seit langer Zeit anbahnt. Kants Spätwerk aus dem Jahr 1793, Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, machte sich anheischig zu demonstrieren, dass im Christentum wesentliche Elemente einer religiösen Einstellung enthalten sind, die sich vor der aufgeklärten Vernunft rechtfertigen lassen. Kant wollte den universalistischen Kern des christlichen Glaubens rund um die Gestalt des Jesus freilegen. Sieht man von Kants Theorie des radikal Bösen ab, dann wird sofort klar, dass es dem Aufklärungsphilosophen darum geht, am jesuanischen Christentum das Ideal einer Pflichtethik herauszuarbeiten, die für alle Menschen guten Willens als verbindlich einsehbar sein müsste. Lassen wir beiseite, ob die kantische Deutung des Urchristentums haltbar ist, und achten wir bloß auf die Konsequenzen. Nach Kant bedarf die wahre Religion keiner Vorsteherkirche, keiner irrationalen Glaubenssätze und keiner abergläubischen Rituale. Kants Kirche ist, wie er selber betont, eine unsichtbare, weil sie aus nichts weiter – aber auch aus nichts weniger – als all den Menschen besteht, die entschlossen sind, die Tugendgesetze der Moral, die allein die Vernunft wollen kann, über die Maximen der Selbstsucht zu stellen. Das klingt einnehmend, muss aber, von einem authentisch religiösen Standpunkt aus, mit dem Einwand rechnen, dass die Ersetzung des alten Glaubens durch eine Vernunft-Ethik noch keinen neuen Glauben ergibt – also nichts, was eine Antwort auf die in Bedrängnis geratenen metaphysischen Bedürfnisse wäre. 4 Prüller, Michael: »Woran glauben die Österreicher? Bericht über die neueste Studie des Imas-Instituts«, in: Die Presse, 11. März 2006. S. 1.
20
Peter Strasser
Charles Taylor, der katholische Großtheoretiker unserer Tage, hat in seiner Marianist Award Lecture, die er 1996 an der Dayton University, Ohio, hielt, unausgesprochen, aber deutlich auf Kant reagiert, indem er sich Gedanken darüber machte, worin katholische Modernität denn nun eigentlich bestehe oder bestehen sollte: »Der Standpunkt, den ich gerne verteidigen möchte, lautet – auf eine kurze Formel gebracht –, dass sich in unserer modernen, säkularisierten Kultur authentische Entwicklungen des Evangeliums, d. h. einer christlich inspirierten Lebensweise, vermischen mit einer Tendenz zur Gottlosigkeit, durch die das Evangelium negiert wird. Mein Punkt ist dabei Folgender : Indem die moderne Kultur mit den Strukturen und Glaubensinhalten des Christentums bricht, führt sie doch gewisse Facetten des christlichen Lebens weiter, und zwar in einer Art und Weise, wie das innerhalb der Kirche selbst unmöglich gewesen wäre. Im Vergleich mit früheren Formen der christlichen Kultur müssen wir bescheiden anerkennen, dass der Ausbruch aus dem Christentum eine notwendige Bedingung seiner Entwicklung war.«5
Mit anderen Worten: Das, was wir heute als universalistische Moral unter dem Vorzeichen der strikten Gleichheit und Würde aller Menschen kennen, einschließlich der Menschenrechte und ihrer unbedingten Geltung, ist – ganz im Sinne Kants – zwar im Christentum seit jeher enthalten gewesen. Doch hätte sich dieser Nukleus innerhalb der Kirche niemals voll entfalten können. Dazu bedurfte es einer »Tendenz zur Gottlosigkeit«, das heißt, zum agnostischen, ja sogar atheistischen Humanismus, der seinen Blick energisch von der geistigen Beengtheit religiöser Lehrtraditionen und ihrer kirchlichen Hüter befreite. Die Pointe der Überlegung von Taylor besteht nun aber in Folgendem: Ist der Humanismus erst einmal religiös entkernt, dann kann er seine eigenen Prinzipien nicht mehr legitimieren. Taylor verwendet den Ausdruck »lofty humanism«, um anzudeuten, dass diese Position letzten Endes in der Luft hängt, worüber ihre Anhänger, ob sie sich nun auf Kants Ethik oder eine Spielform des Utilitarismus berufen, gerne hochmütig hinwegsehen. Was also bleibt noch? Taylors Antwort: »Hier gibt es keine Garantie, es handelt sich um eine Sache des Glaubens. Doch klar ist, dass die christliche Spiritualität einen Ausweg weist. Er kann auf zweierlei Weise charakterisiert werden: entweder als eine Form der Liebe oder Zuwendung, die bedingungslos ist – das heißt, unabhängig vom Gebaren des Empfängers –, oder als der Umstand, dass jeder Mensch grundlegend ein Wesen nach dem Bild Gottes ist. […] Unser gottesebenbildliches Sein ist auch unser Mitsein mit anderen im Strom der Liebe, die jene Facette des göttlichen Lebens repräsentiert, welche wir, sehr unangemessen, zu erfassen versuchen, indem wir von der Dreieinigkeit reden.«6 5 Heft, James Lewis (Hg.): A Catholic Modernity? Charles Taylor’s Marianist Award Lecture, with responses by William M. Shea, Rosemary Luling Haughton, George Marsden, Jean Bethke Elshtain. New York/Oxford 1999. S. 16. [Übersetzung des Autors] 6 Heft: A Catholic Modernity?. S. 35. [Übersetzung des Autors]
Religiosität ohne Glauben?
21
Doch warum sollte irgendein Mensch, der nicht schon die »Sache des Glaubens« zu seiner gemacht hat, sich auf die Glaubenssätze der Gottesebenbildlichkeit und Dreieinigkeit verpflichten, um so eine Legitimationsbasis für den »lofty humanism« zu gewinnen? Es überrascht daher wenig, dass jene, die ihre religiöse Bedrängnis nicht im Schoß einer Hochreligion, aber auch nicht durch eine universalistische Ethik zu lindern vermögen, dann für Weisheitslehren anfällig werden, die mit dem Anspruch auftreten, einen neuen, zeitgemäßen, sogar wissenschaftlich beweisbaren Glauben zu bieten.
5.
Täglich Schöpfung, durchgehend geöffnet: Religiöse Verwilderung
2011 wurde des 150. Geburtstags von Rudolf Steiner gedacht. Das mediale Echo ist fast ausschließlich wohlwollend. Kein Wunder : Eine der hierzulande erfolgreichsten parareligiösen Bewegungen ist die Anthroposophie, also jene Spiritualitätsoffensive, die von Steiner in den ersten Jahrzehnten des vergangenen Jahrhunderts ins Leben gerufen wurde. Werfen wir einen unbeeindruckten Blick auf das vom Meister selbst »geschaute« fünfte Evangelium, dann fällt die religiöse Verwilderung ins Auge. Diese ist einerseits die Folge einer bemühten Überwindung der großen christlichen, aber als unbefriedigend empfundenen Glaubenstradition; andererseits das phantastische Produkt des Zusammenraffens heterogener Glaubensbestände mit dem Ziel, die religiöse Weltformel zu präsentieren. Eckpunkte des Steiner’schen Evangeliums sind die Folgenden: Ein salomonischer Jesus, der früh stirbt, bildet – nach Rudolf Steiners »Schauung« – für den unsterblichen Christus die niedrigen Wesensglieder aus. Im salomonischen Jesus wirkt das geistige Ich Zarathustras. Demgegenüber wirkt der Geist Buddhas im nathanischen Jesus, der für Christus den Astralleib bereitzustellen hat. Christus selbst, der Welterlöser, ist ein rein geistiges Wesen, das sich nach der Trennung von Sonne und Erde zunächst in den Sonnenstrahlen verbirgt. Bei der Kreuzigung stirbt – darf man sagen: konsequenterweise? – der Mensch Jesus, während Christus in die unkörperlichen Sphären aufsteigt. Das Blut des Gekreuzigten sickert in die Erde und leitet eine spirituelle Menschheitsevolution ein, an deren Ende – konsequenterweise – die Anthroposophie steht.7 Ohne die Verdienste der Waldorf-Schulen oder des biologisch-dynamischen Landbaus nach Steiners Ideen schmälern zu wollen, muss doch festgehalten werden, dass die Faszination der Anthroposophie von Anfang an gerade darin 7 Vgl. dazu Ullrich, Heiner : Rudolf Steiner. Leben und Lehre. München 2011. S. 54 ff. Ausführlicher noch Zander, Helmut: Rudolf Steiner. Eine Biografie. München 2011. S. 221 ff.
22
Peter Strasser
lag, dass sie es – gleich anderen, weniger erfolgreichen Unternehmungen – verstand, existenzielle Bereiche einer »alternativen« Patchwork-Esoterik zuzuführen, und zwar unter Benützung durchaus angestammter Requisiten, ob Astralwesen, Auren, Wiedergeburten oder kosmischer Energiefelder. Auf die Frage, in welcher Form die frei flottierenden, meist frustrierten religiösen Bedürfnisse dennoch befriedigt oder befriedet werden können, gibt es also unterschiedliche Antworten. Charakteristisch für sie alle scheint zu sein, dass sie nicht wirklich befriedigen. Glaubensausdünnung bis an den Rand metaphysischer Homöopathie ist ebenso wenig eine Lösung wie eine vernünftelnde Rückkehr in den Schoß der Kirche oder das Bekenntnis zu einer synkretistischen Weisheitslehre ohne innere Stimmigkeit, weil ohne den Rückhalt einer formgebenden Tradition. Und was die diversen Offerte der Wellness-Religiosität betrifft, so sind sie eben nur wohlstandsbasierte, hedonistische Surrogate dafür, dass man angesichts der drängenden existenziellen Fragen und metaphysischen Rätsel vor den verschlossenen Türen des Mythos steht, sehnsüchtig, aber trostlos. Ist also eine Religiosität ohne Glauben die moderne Form des unglücklichen Bewusstseins par excellence, dazu verurteilt, in einer ziellosen Suchbewegung zu verharren? Wer darauf eine Antwort weiß, der möge sie geben. Ich kenne sie nicht. Doch scheint mir immerhin die Richtung, in welcher die Antwort liegen müsste, exemplarisch erhellbar. In meinem Buch Die einfachen Dinge des Lebens habe ich eines Menschen namens Hans gedacht, an dessen Grab der Trauerredner sich in der peinsamen Lage befindet, einige aufrichtige Worte über die Religiosität des Dahingeschiedenen – einer Religiosität ohne Glauben – zu verlieren. Hier, zum Abschluss, ein Auszug aus dieser Rede: »Hans war nicht religiös im konventionellen Sinne des Wortes. Er war katholisch getauft, aber schon in jungen Jahren aus der Kirche, deren Kultus, Dogma und Mythos ihn ebenso geprägt wie abgestoßen hatten, ausgetreten. Die Frage, ob Hans an Gott glaubte, ließ sich schon deshalb nicht mit ›Ja‹ beantworten, weil Hans in den seltenen Gesprächen, in denen er darüber sprach, mit einem gewissen Unterton behauptete, er sei sich dessen gewiss, dass Gott existiere, bloß wüsste er nicht, was das bedeute. Auch glaubte Hans nicht an ein persönliches Überleben nach dem Tod, weil er, wie er sagte, nicht wisse, wie er – und wieder dieser gewisse Unterton – ohne Körper seinen Tod überleben können sollte. So einfach war das. Oder sollten wir besser sagen, so einfach schien das zu sein? Immerhin wusste der Trauerredner zu berichten, dass Hans eine ›Art religiöser Haltung‹ für sich gelten ließ, ja, in Anspruch nahm. Hans, so der Trauerredner, habe immer das Mysterium verehrt, das in der Existenz und Ordnung der Dinge lag. Dabei war Hans stets neugierig auf die Erklärungen, welche die Wissenschaft fand, denn für ihn verflachten sie das Mysterium nicht; sie vertieften es. Der Urknall und das Genom waren
Religiosität ohne Glauben?
23
für Hans weniger Ursachen als Wunder, die bewiesen, dass die Welt eine Schöpfung war. Hans hätte allzu gerne gewusst, was der neueste Teilchenbeschleuniger, der sagenhafte Large Hadron Collider, dem Menschen Neues über Aufbau und Ursprung des Universums lehren wird – seines Universums. Aber Hans durfte immerhin noch darüber lachen, dass die Maschine, gleich nachdem sie gestartet worden war, wieder abgeschaltet werden musste. Der Weg zum Urknall ist mit defekten Stromkabeln, klappernden Ventilen, leckenden Abdichtungen und ähnlichen Ärgernissen der menschlichen Gottesanmaßung gepflastert. Man konnte – das war Hansens feste Überzeugung – sich die Welt und das Leben gar nicht anders denn als Schöpfung denken. Fragte man Hans allerdings, was er damit meine, dann freilich wich er aus. Einmal, so schloss der Trauerredner, habe Hans augenzwinkernd doziert, man solle den Alltag, ob Schuhputzen, Liebemachen oder Gedichteschreiben, als eine Art Liturgie feiern. Und dabei habe er ein heißes Bügeleisen geschwungen, aus dem der Dampf aufstieg wie der Rauch aus einem Weihrauchkessel. Denn nur selten, so Hansens geistiges Vermächtnis (wenn hier von ›geistig‹ und gar von ›Vermächtnis‹ die Rede sein darf), gelinge es, die Anwesenheit Gottes im Mitvollzug der Schöpfung beim Hemdenbügeln zu beschwören. Meistens war Hemdenbügeln nichts weiter als Hemdenbügeln. Aber, so Hans, der sich gerne ein bisschen als Liturgiekenner aufspielte, meistens war auch Weihrauchkesselschwingen nichts weiter als Weihrauchkesselschwingen. Man durfte, so Hans – und das Augenzwinkern reicherte sich mit Lachfältchen an –, vom Mitvollzug der Schöpfung eben nicht erwarten, dass über der alltagsliturgischen Szenerie des Hemdenbügelns eine Reklametafel blinkte, die weithin leuchtend annoncierte: ›Täglich Schöpfung, durchgehend geöffnet‹.«8
8 Strasser, Peter : Die einfachen Dinge des Lebens. München 2009. S. 86 f.
24
Peter Strasser
Literaturverzeichnis Bayley, John: Elegie für Iris. München 2000. Heft, James Lewis (Hg.): A Catholic Modernity? Charles Taylor’s Marianist Award Lecture, with responses by William M. Shea, Rosemary Luling Haughton, George Marsden, Jean Bethke Elshtain. New York/Oxford 1999. Heidegger, Martin: Zum 80. Geburtstag von seiner Heimatstadt Meßkirch. Frankfurt a. M. 1969. Nietzsche, Friedrich: Sämtliche Werke. Kritische Gesamtausgabe in 15 Einzelbänden. Also sprach Zarathustra I – IV. Hrsg. von Giorgio Colli und Mazzino Montinari. Neuausgabe Band 4. München 1999. Prüller, Michael: »Woran glauben die Österreicher? Bericht über die neueste Studie des Imas-Instituts«, in: Die Presse, 11. März 2006. S. 1. Strasser, Peter : Die einfachen Dinge des Lebens. München 2009. Ullrich, Heiner : Rudolf Steiner. Leben und Lehre. München 2011. Zander, Helmut: Rudolf Steiner. Eine Biografie. München 2011.
Jakob Deibl
Jenseits zielloser Suchbewegung? Zu Peter Strassers Vortrag »Religiosität ohne Glauben?«
Der von Peter Strasser im Juni 2011 auf Einladung der Forschungsplattform »Religion and Transformation in Contemporary European Society« an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien gehaltene Vortrag Religiosität ohne Glauben?1 stellt den Bezugspunkt des folgenden Textes dar. Meine Überlegungen, die sich in sechs Abschnitte gliedern, nehmen ihren Ausgang beim paradox anmutenden Titel des Vortrags (I) und versuchen dann in drei Schritten den Duktus der Ausführungen Strassers nachzuzeichnen: Deren erster Teil reicht bis zu jenem Punkt, an dem im Vortrag der Titel auftaucht, und stellt eine Vorbereitung der Frage nach der Religion dar (II). Der zweite Abschnitt ist dann eine explizite Auseinandersetzung mit dem Phänomen heutiger Religiosität (III). Beendet wird der Vortrag mit einem Nachwort, das aufgrund seiner literarischen Gestalt außerhalb oder am Rande philosophischen Diskurses steht (IV). Ausgehend von diesem ungewöhnlichen Ende des Vortrags möchte ich die Frage stellen, ob man die literarische Gestalt bestimmter Texte Strassers als ein Bemühen um eine Öffnung des Mythos interpretieren kann (V). Das letzte Kapitel bezieht sich auf Strassers Auseinandersetzung mit der Gestalt einer ziellosen Sehnsucht, wie er sie für gegenwärtige Formen der Religiosität als charakteristisch ansieht (VI).
I.
Vom Urteil über die Antwort zum Gespräch – zum Titel des Vortrags
Ausgehend vom Titel des Vortrags möchte ich in zwei Vorbemerkungen den Charakter einer möglichen Antwort an Strassers Ausführungen thematisieren. 1 Vgl. Strasser, Peter : »Religiosität ohne Glauben?«, in: Langthaler, Rudolf/Meiller, Christopher/Appel, Kurt (Hg.): Religion in der Moderne. Religionsphilosophische Beiträge zu einer aktuellen Debatte. Göttingen 2013. S. 11 – 24.
26 (1)
Jakob Deibl
Vom Urteil zur Antwort
Der Titel gibt einen klaren Einstiegspunkt für eine theologische Kritik an Strassers Vortrag an die Hand. Er mutet paradox an, weil in ihm ein fundamentaler Mangel ausgedrückt ist, der bis in eine Unvereinbarkeit zu führen scheint: Kann es eine Religiosität geben, der das fundamentale Element des Glaubens fehlt? Bedeutet dieses Fehlen nicht geradewegs die Auflösung jeglicher Gestalt von Religiosität? Wird hier nicht eine Betrachtungsweise angezielt, die von vornherein zum Scheitern verurteilt ist, weil sie das Phänomen der Religion verfehlen muss? Oder mit anderen Worten: Was haben die Überlegungen des Philosophen noch mit Religion zu tun? Strassers Vortrag ist eine unter zahlreichen Publikationen des Philosophen zum Thema Religion. Seine Texte dazu haben einen ganz unterschiedlichen Charakter : Aphoristisch ist das Journal der letzten Dinge und systematisch Der Weg nach draußen; eine Archäologie des Mythos findet sich in Unschuld. Das verfolgte Ideal, eine humoristische Betrachtung hingegen stellt der Text Eine schöne Päpstin für den Ungehorsam dar ; Strasser schreibt in Buchform (Warum überhaupt Religion? Der Gott, der Richard Dawkins schuf), veröffentlicht darüber hinaus im Feuilleton (Neulich bei Gott) und auch in theologischen Fachzeitschriften (Zu viel Gerede über Gott).2 Mit dieser Thematisierung der Religion befindet sich Strasser in einem Umfeld zeitgenössischer Philosophie, welches Gianni Vattimos Einschätzung zu bestätigen scheint, dass es (mit dem Ende der großen Metaerzählungen) zu einem »Wegfall der gegen die Religion gerichteten philosophischen Denkverbote«3 gekommen sei: Zu nennen sind in diesem Zusammenhang etwa Arbeiten von Jean-Luc Nancy, Slavoj Zˇizˇek, Giorgio Agamben und Vattimo selbst.4 An dieser Stelle sei nicht weiter auf mögliche Gründe für diese Entwicklung 2 Vgl. Strasser, Peter : Journal der letzten Dinge. Frankfurt a. M. 1998; ders.: Der Weg nach draußen. Frankfurt a. M. 2000; ders.: Unschuld. Das verfolgte Ideal. München 2012; ders.: »Eine schöne Päpstin für den Ungehorsam?«, in: Diakonia (43) 2012/3. S. 194 – 196; ders.: Warum überhaupt Religion? Der Gott, der Richard Dawkins schuf. München 2008; ders.: »Neulich bei Gott«, in: Die Presse. Spectrum, 15. April 2006. S. 1 – 2; ders.: »Zu viel Gerede über Gott«, in: ThPQ (158) 2010. S. 50 – 57. Darüber hinaus gibt es noch zahlreiche andere Publikationen Strassers zum Thema Religion. 3 Vattimo, Gianni: »Die Spur der Spur«, in: Derrida, Jaques/Vattimo, Gianni (Hg.): Die Religion. Frankfurt a. M. 2001. S. 109. 4 Vgl. Nancy, Jean-Luc: Dekonstruktion des Christentums. Zürich/Berlin 2008; ders.: Noli me tangere. Zürich/Berlin 2008; Zˇizˇek, Slavoj: Das fragile Absolute. Warum es sich lohnt, das christliche Erbe zu verteidigen. Berlin 2000; Agamben, Giorgio: Die Zeit, die bleibt. Ein Kommentar zum Römerbrief. Frankfurt a. M. 2006; Vattimo, Gianni: Glauben – Philosophieren. Stuttgart 1997; ders.: Jenseits des Christentums. Gibt es eine Welt ohne Gott?. München/Wien 2004; ders.: Jenseits der Interpretation. Die Bedeutung der Hermeneutik für die Philosophie. Frankfurt a. M./New York 1997.
Jenseits zielloser Suchbewegung?
27
eingegangen, sondern lediglich ein Zug nachgezeichnet, der meines Erachtens in den theologischen Reaktionen auf jene philosophischen Arbeiten zur Religion immer wieder begegnet. Nach einer (neutralen) Darstellung der theologischen Bezüge, die von philosophischer Seite aufgegriffen werden, erfolgt nicht selten deren Taxierung hinsichtlich der Kategorie des Mangels: Hingewiesen wird von theologischer Seite auf das, was in den philosophischen Darstellungen zu einem adäquaten religiösen Verständnis und zu einem vollständigen Ausdruck der Religion fehle. Detektorisch werden Motive aufgespürt, die in jenen Texten nicht vorkommen, um dann darauf hinzuweisen, dass mangels dieser Elemente nicht von Christentum oder allgemeiner von Religion die Rede sein könne. Um ein Beispiel zu nennen: Gianni Vattimo hat (durchaus in Anlehnung an Hegel) den Versuch unternommen, das Motiv der kenosis des Logos als treibendes Moment seiner Geschichtsphilosophie aufzunehmen, und sieht darin auch die Tiefendimension einer Auflösung metaphysischer Fundamente in eine hermeneutischinterpretative Welterfahrung. Von theologischer Seite wurden die christologischen Implikationen dieser originellen postmodernen Position kaum aufgegriffen und weiterentwickelt, sondern wurde vielmehr eine selektive Engführung der christlichen Tradition festgestellt: Christologie erschöpfe sich nicht in kenosis, Christentum sei mehr als Interpretation, es könne nicht gedacht werden, ohne dass auch auf seine sakramentale Verfasstheit Bezug genommen und der Glaubensakt hervorgekehrt werde, es fehle überdies die Dimension der Transzendenz etc.5 Als Maßstab des Urteils wird dabei ein Ideal der Vollständigkeit angelegt, auch wenn weder Vattimo noch einer der oben genannten Philosophen selbst Interesse daran hat, eine geschlossene Dogmatik vorzulegen. Diese Weise der Beurteilung stellt freilich ein zumeist risikofreies Unterfangen dar – ein Mangel, etwas Fehlendes lässt sich angesichts der reichen Tradition und verzweigten Architektonik theologischer Aussagen wohl immer finden. Allerdings müsste, gemessen an demselben Maßstab, auch jeder »orthodoxe« theologische Text scheitern, denn keiner behandelt das Gesamt des Glaubens. Über dem beurteilenden Gestus wird nicht selten vergessen, den Formen philosophischer Bezugnahme auf theologische Motive auch tatsächlich eine Antwort zu geben. Es ist daher die Frage zu stellen, ob heutige Theologie überhaupt noch fähig ist, Anstöße, die sie von außen erreichen, in produktiver Weise aufzunehmen und zu verarbeiten. Der Titel von Strassers Vortrag, der nach einer Religiosität ohne Glauben fragt, könnte nun geradewegs dieser Logik der Beurteilung hinsichtlich eines Mangels in die Hände fallen: Einer Religiosität ohne Glauben fehle eben ein konstitutives Element, weshalb es sich hierbei gar nicht um ein genuin religiöses 5 Vgl. etwa Depoortere, Frederic: Christ in Postmodern Philosophy. Gianni Vattimo, Ren¦ Girard and Slavoj Zˇizˇek. London/New York 2008.
28
Jakob Deibl
Phänomen handeln könne. Allerdings wäre mit dieser Beurteilung die massive Anfrage an heutige Theologie, Religion und Kirche, die sich darin verbirgt, nicht ans Licht gebracht, von einer Antwort gar nicht zu sprechen.
(2)
Von der Antwort zum Gespräch
Im Falle von Strassers Vortrag führt aber auch der Versuch, anstatt eines Urteils eine Antwort zu geben, in eine prekäre Situation. Der Vortrag selbst läuft auf eine offene Frage zu, die am Ende den paradoxen Titel noch einmal aufgreift und zu einer Antwort geradezu herausfordert: »Ist also eine Religiosität ohne Glauben die moderne Form des unglücklichen Bewusstseins par excellence, dazu verurteilt, in einer ziellosen Suchbewegung zu verharren? Wer darauf eine Antwort weiß, der möge sie geben. Ich kenne sie nicht.«6 Wer aber könnte von sich behaupten, sie zu kennen? Wer kann ohne Selbstüberschätzung da noch antworten? Will man der fundamentalen Frage, die der Vortrag hinterlässt, dennoch nicht ausweichen, bleibt allein die Möglichkeit, sie wenigstens genauer zu Gehör zu bringen. Es ist der Titel des Vortrags, der in dieser Frage erneut auftaucht. Das Fragezeichen, das der Überschrift Religiosität ohne Glauben? eine grundsätzliche Fraglichkeit eingeschrieben hatte, erscheint demnach auch am Ende der Überlegungen nicht als aufgelöst. Die Frage nach einer Religiosität ohne Glauben bleibt zuletzt offen, auch wenn es bei der ersten Nennung des Titels im Text in optimistischem Ton noch geheißen hatte: »Nennen wir dieses Phänomen ›Religiosität ohne Glauben‹ oder ›Religiosität ohne Religion‹. Das Phänomen ist wohlbekannt, in einzelnen Gestalten unserer Kultur hat es stets eine produktive Funktion gehabt.«7 Die Gewissheit, aus dem wohl Bekannten unserer Kultur und aus dem, was darin bisher schöpferisch war, ableiten zu können, was heute »Religion« bedeute, erfährt im weiteren Verlauf des Textes eine Erschütterung. Strassers Reflexion über die Wendung »Religion ohne Glauben«, mit der er versucht hat, die religiöse Situation heute in den Blick zu bekommen (»Nennen wir dieses Phänomen …«), verläuft sich aber dennoch nicht ins Nebulose, sondern kann eine Frage freilegen – und das ist keinesfalls zu unterschätzen: »Ist also eine Religiosität ohne Glauben die moderne Form des unglücklichen Bewusstseins par excellence, dazu verurteilt, in einer ziellosen Suchbewegung zu verharren?« Die Kategorie des »unglücklichen Bewusstseins« ist eine aus Hegels Phänomenologie des Geistes bekannte Gestalt, die ein Sehnen nach der Vereinigung mit dem Unwandelbaren, d. h. dem Absoluten, zum Ausdruck bringt, das 6 Strasser: »Religiosität ohne Glauben?«. S. 22. 7 Strasser: »Religiosität ohne Glauben?«. S. 16.
Jenseits zielloser Suchbewegung?
29
sich nie erfüllt (bzw. nie erfüllen darf), also stets in ein Jenseits ausgelagert bleibt.8 Vermag das unglückliche Bewusstsein als eine Kategorie zu fungieren, die bei der Deutung heutiger Religiosität helfen kann? An eine Theologie, die offensichtlich damit zu rechnen beginnt, dass innerhalb gegenwärtiger Veränderungsprozesse auch die Gottesrede (und nicht etwa bloß die Organisation kirchlicher Vollzüge) einem tiefgreifenden Wandel unterliegt, gibt Strasser mithin die Frage weiter, ob sich heutige Religiosität in einem unendlichen Sehnen und einer ziellosen Suchbewegung erschöpfen müsse. Niemand kann darauf heute eine Antwort wissen, denn wir haben keine Ahnung, wie sich die religiöse Landschaft weiterentwickeln wird. Indem Strasser auf Hegel anspielt, gibt er jedoch einen wichtigen Hinweis. Für Hegel ist das unglückliche Bewusstsein nicht die letzte Gestalt der Religion – die eigentliche In-Blick-Nahme der Religion wird im Fortgang der Stufen der Phänomenologie des Geistes erst viel später beginnen und setzt einen fundamentalen Blickwechsel voraus. Strasser fordert die Theologie heraus, an dieser Stelle, bei jener sehnsüchtigen, ziellosen Suchbewegung, die Diskussion aufzunehmen, um die Frage zu stellen, ob es (im Sinne Hegels) gelingen kann, Potenziale der (christlichen) Tradition für heute zu öffnen, um über diese Bewegung hinauszugelangen und sie selbst zu verwandeln. Der folgende Text versucht die fundamentale Anfrage Strassers in Erinnerung zu halten, sich aber weder Urteil noch Antwort anzumaßen. Vielmehr möchte er mit dem Vortrag selbst in ein engeres Gespräch treten, was vor allem bedeutet, seiner inneren Logik zu folgen.9 In der Bewegung vom Urteil zur Antwort zum Gespräch ist eine Abrüstung angezeigt, die ich heute für theologisch unerlässlich halte: weniger Beurteilungen und Produktion großer Antworten, dafür mehr Bemühen, überhaupt in ein Gespräch zu kommen.
II.
Metaphysik, Ethik und Nietzsches »letzte Menschen«
Der Vortrag Strassers stürzt nicht sofort in eine Erklärung seines paradoxen Titels, um damit eine Darstellung heutiger Religiosität zu geben – gleichsam nach dem Motto: Religion heute stelle sich dar als Religiosität ohne Glauben. Stattdessen nähert er sich dem Titel und damit auch der Frage nach heutiger 8 Vgl. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Phänomenologie des Geistes (=Hegel Werke Band 3). Frankfurt a. M. 1970. S. 495. 9 Strasser bezieht sich in seinem Vortrag auf eine Fülle von philosophischen Positionen, ohne aber diese Bezüge breiter zu entfalten. Ich möchte versuchen, den Duktus des Vortrags herauszuarbeiten, und die Frage stellen, in welcher Hinsicht Strasser einen bestimmten Autor aufgreift. Keinesfalls kann jedoch auf die von Strasser erwähnten Positionen selbst im Detail eingegangen werden.
30
Jakob Deibl
Religiosität in drei Reflexionsgängen an, von denen der erste und längste die Metaphysik10, der zweite den Bereich der Ethik11 und der dritte Nietzsches Gestalt der »letzten Menschen«12 betrifft.
(1)
Entlarvung der Metaphysik
Der erste Gang der Überlegungen nimmt die Geschichte der Metaphysik seit dem 18. Jahrhundert in den Blick, wobei Strasser zwei Gesichtspunkte geltend macht: zum einen die Verdrängung der Metaphysik aus der Philosophie, wie sie von Neopositivisten, Empiristen und Kritischen Rationalisten betrieben wird (wobei sich Strasser immer wieder auf seinen Lehrer Ernst Topitsch bezieht), zum anderen ihre untergründige Verflochtenheit mit der Religion. Beide Blickwinkel erweisen sich als verbunden: Strasser referiert, dass die Metaphysik ihren philosophischen Kritikern »als die Rationalisierung mythologischer und religiöser Altbestände«13 gegolten habe und nicht zuletzt deshalb aus dem Raum des kritischen Denkens verdrängt werden sollte. Mit einem »Schwächerwerden der hochreligiösen Bindungskräfte« sei die »religiöse Substanz aus dem kircheninternen Bereich«14 ausgewandert und habe in der Metaphysik Zuflucht gefunden. Um diese Ansicht zu illustrieren, verweist Strasser auf die Züge heilsgeschichtlichen Erlösungsprozesses im deutschen Idealismus15, auf die Einschätzung, der historische Materialismus wolle »nichts Geringeres als das Paradies auf Erden verwirklichen«16, auf die »religiöse Atmosphäre«17 im Werk Heideggers18, auf Adornos Bestreben, »der Metaphysik ›im Augenblick ihres Sturzes‹« beizustehen und die »religiösen Gehalte des einst Bekämpften gegen die neuen Gewalten der reinen Innerweltlichkeit denkend in Schutz zu nehmen«19, sowie auf den gegenüber Habermas und den »Emanzipationsdenkern« erhobenen Vorwurf, »trotz Metaphysik- und Religionskritik immer noch heilsgeschichtliche Motive zu transportieren«20. Diese »philosophische Ummantelung des religiösen Erbes«21, dieser kryptoreligiöse Charakter22 der Me10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Strasser: »Religiosität ohne Glauben?«. S. 11 – 14. Strasser: »Religiosität ohne Glauben?«. S. 14 – 15. Strasser: »Religiosität ohne Glauben?«. S. 15 – 16. Strasser: »Religiosität ohne Glauben?«. S. 11. Strasser: »Religiosität ohne Glauben?«. S. 14. Vgl. Strasser: »Religiosität ohne Glauben?«. S. 11. Strasser: »Religiosität ohne Glauben?«. S. 13. Strasser: »Religiosität ohne Glauben?«. S. 12. Vgl. dazu Strasser : Der Weg nach draußen. S. 205 – 221. Strasser: »Religiosität ohne Glauben?«. S. 13. Strasser: »Religiosität ohne Glauben?«. S. 13. Strasser: »Religiosität ohne Glauben?«. S. 14.
Jenseits zielloser Suchbewegung?
31
taphysik müsse dem Programm jener Kritiker der Metaphysik zufolge selbst als Mythos durchschaut werden, was zu anfänglichen Verlustgefühlen und danach zu einer Anpassung »an die objektive Sinnlosigkeit der Welt, ihrer Gesetze und Dynamiken«23 führen werde. Metaphysikkritik wäre demnach eine zu Ende geführte Religionskritik, welche religiöse Restbestände auch noch im Bereich der Philosophie aufzuspüren und zu beseitigen sucht. Diese von Strasser nachgezeichnete kritische Entlarvungsgeschichte der Metaphysik als Mythos oder verborgene Religion, die ein skeptisches Denken einem metaphysischen und religiösen Denken entgegenstellt, entspricht jedoch nicht dem Verständnis von Philosophie, das er selbst anderswo entwickelt. Strasser geht vielmehr von ihrer wesenhaften Verbindung aus und spricht so in Der Weg nach draußen von einem unauflösbaren Gefüge, das skeptisches, metaphysisches und religiöses Denken umfasse: »Skeptisches, metaphysisches und religiöses Denken gehören innerlich zusammen.«24 Ein skeptisches Denken, wie es etwa Neopositivismus, Empirismus und Kritischer Rationalismus für sich veranschlagen, müsse ohne Metaphysik in sich zusammenfallen: »Es ist kaum zu übersehen, dass der Skeptiker am Schluss Begriffe und Argumente verwenden muss, von denen er, als Skeptiker, nicht mehr sagen kann, ob sie überhaupt noch sinnvoll sind. In diesem Moment verstummt er oder er betritt das Gebiet der Metaphysik – nicht um es aufzulösen, sondern um Boden zu gewinnen. Das tiefe Paradox der philosophischen Skepsis besteht darin, dass sie ohne Metaphysik nicht existieren kann.«25
Weiters führe die Metaphysik bis an die Schwelle eines religiösen Denkens: »Die Grenze zwischen Skepsis und Metaphysik ist ebenso durchscheinend wie die zwischen Metaphysik und Religion. Einzig solange der Schein des Absoluten hindurchzudringen vermag bis in den Kerker unserer Immanenz, wird die Philosophie erfüllt bleiben vom Leben des Geistes.«26
Philosophie sei ausgespannt »zwischen den Polen des Fraglichen und des Absoluten«27. Ausgehend davon sucht Strasser in Der Weg nach draußen eine systematische Grundlegung von Metaphysik und Religionsphilosophie zu geben. Im Vortrag hingegen tauchen lediglich Stationen von deren Niedergang auf. Ich möchte später versuchen, auf diesen unterschiedlichen Blickwinkel noch einzugehen. 22 23 24 25 26 27
Vgl. Strasser: »Religiosität ohne Glauben?«. S. 14. Strasser: »Religiosität ohne Glauben?«. S. 14. Strasser: Der Weg nach draußen. S. 10. Strasser: Der Weg nach draußen. S. 72. Strasser: Der Weg nach draußen. S. 12. Strasser: Der Weg nach draußen. S. 10.
32
Jakob Deibl
(2)
Ethik
Nachdem Strasser im Vortrag den Abgesang der Metaphysik referiert hat, weist er in einem zweiten Gang der Überlegungen darauf hin, dass auch der Gedanke einer theologischen Begründung von Ethik und Moral seine Plausibilität verloren habe, mithin künftig weder Metaphysik noch Ethik eine religiöse Haltung zu stützen vermögen. Der Humanismus, die Entstehung einer universalen Moral und die Durchsetzung der Menschenrechte würden, wie Strasser darlegt, dem bekannten Diktum, dass »unter der Bedingung der Nichtexistenz Gottes alles erlaubt sei«28, widersprechen. Auch dies scheint nicht ganz mit der Position Strassers übereinzustimmen. Im Journal der letzten Dinge findet sich ein ganzes Kapitel, das dieses Diktum aufgreift und, wie es scheint, zu ganz anderen Ergebnissen kommt29 : Der Begriff der Moral komme nicht ohne den Gedanken eines Unbedingten aus, und dieses könne nie das Produkt evolutionärer Entwicklung oder menschlicher Willenstätigkeit sein: »Unser Begriff von Moral schließt ein, dass Gott existiert. Dass Gott existiert, bedeutet unter anderem, es existiert eine Bindungskraft, die stärker wirkt als jeder Akt der menschlichen Selbstbindung.«30 Dabei geht es aber nicht um die Installierung einer regressiven Form von Heteronomie, sondern um das, was der Gedanke des Ichs als eines moralischen Subjektes impliziere. In der moralischen Selbstbestimmung bestimme sich der Mensch, »Teil des Göttlichen«31 zu sein. Dies hat Strasser in der genannten Passage des Vortrags jedoch nicht im Blick. Wenn er sich dort gegen das Diktum, dass ohne Gott alles erlaubt sei, wendet, tritt er dagegen auf, Gott selbst als einen Faktor in moralische Begründungsfiguren einzubeziehen, ihn mithin zu einem kontingenten Element zu machen. Dies geschieht gerade immer dort, wo die Ethik, der man bescheinigt ohne einen Gottesgedanken nicht auskommen zu können, dazu verwendet werden soll, die Plausibilität der Religion zu sichern. Allerdings wird dies im Vortrag nicht weiter ausgeführt. Zu beachten ist, dass dieser Abschnitt wie auch jener über die Metaphysik im Konjunktiv steht, was die Wiedergabe von etwas allgemein Plausiblem ausdrückt, das jedoch nicht (in allen Belangen) mit der Ansicht Strassers selbst übereinstimmen muss.
28 29 30 31
Strasser: »Religiosität ohne Glauben?«. S. 14. Vgl. Strasser: Journal der letzten Dinge. S. 226 – 232 (Nr. 260 – 263). Strasser: Journal der letzten Dinge. S. 229 (Nr. 261). Strasser: Journal der letzten Dinge. S. 232 (Nr. 263).
Jenseits zielloser Suchbewegung?
(3)
33
Nietzsches Gestalt der letzten Menschen
Der »optimistischen Hoffnung« auf eine emanzipierte Menschheit, die sich (in ethischen Belangen) vom »Gedanke[n] einer prinzipiellen Gleichheit aller Menschen«32 werde leiten lassen und auf metaphysische oder religiöse Begründungen verzichten könne, stellt Strasser danach im dritten Reflexionsgang ein anderes Bild postreligiöser und postmetaphysischer Gesellschaft gegenüber, Nietzsches anti-eschatologische Gestalt der »letzten Menschen«, die gänzlich aufgehoben in einem »rundgeschlossen[en]«33 Glück sind, das keinerlei Transzendenz mehr kennt. Dies wäre die Gestalt des vollendeten Konsumenten und der vollständigen, bruchlosen Anpassung – eine »existentielle Negativgestalt« (7), korrespondierend dem, was Strasser auf treffliche Weise im Journal der letzten Dinge immer wieder als sich gänzlich schließende Immanenz beschreibt.34 Nicht allein die Religion, auch die Kunst werde im Horizont der »letzten Menschen« verschwinden. Vor diesem Hintergrund kann jene überraschende Bestimmung der Philosophie gelesen werden, die Strasser am Ende von Der Weg nach draußen gibt: »Die Philosophie ist weder Religion noch Kunst. Sie sichert aber die Spuren der Transzendenz und ist so eine Wächterin des Religiösen im Zeitalter der Immanenz.«35 Mit dieser Bewegung der Spurensicherung beginnt Strasser in seinem Vortrag nach den Überlegungen zu Nietzsches »letzten Menschen«. Eine gänzliche Anpassung im Sinne der »letzten Menschen« habe bis heute nicht stattgefunden, ihr scheint die »menschliche Natur entgegenzustehen. Diese kann nicht aufhören, sich Fragen zu stellen, die über das Innerweltliche hinausreichen.«36 Was hier mit »menschlicher Natur« gemeint sein kann, lässt sich vielleicht präzisieren, wenn man ein anderes Wort Strassers hinzunimmt: »Unser Wesen ist es, keines zu haben.«37 Dies bedeutet nicht, dass das Wesen des Menschen in einer vagen Unbestimmtheit bestünde, sondern in der Negativität, d. h. in der Transzendierung jeder Positivierung und unmittelbaren Zuschreibung, was dieses Wesen sei. Jeder empirischen Ausgestaltung eines Lebens, so könnte man die Gedanken Strassers weiterführen, haftet eine Vorläufigkeit an, die sie niemals als dauerhafte Verkörperung des menschlichen Wesens erscheinen lässt. Auch in der faktischen gänzlichen Eingepasstheit in die Immanenz und im vollständigen Konsumentendasein gibt es eine bleibende Differenz 32 Strasser: »Religiosität ohne Glauben?«. S. 15. 33 Strasser: »Religiosität ohne Glauben?«. S. 15. 34 Vgl. Strasser: Journal der letzten Dinge. S. 32 (Nr. 42), S. 45 (Nr. 68), S. 49 f. (Nr. 76 – 78), S. 52 f. (Nr. 83), S. 236 – 239 (Nr. 269 f.), S. 247 – 251 (Nr. 274). 35 Strasser: Der Weg nach draußen. S. 253. 36 Strasser: »Religiosität ohne Glauben?«. S. 16. 37 Strasser: Der Weg nach draußen. S. 153.
34
Jakob Deibl
zum menschlichen Wesen: »Was immer unser Leben mit all seinen empirischen Eigenschaften und Möglichkeiten sein mag, stets sind wir auch noch etwas darüber hinaus. Etwas an uns hat keinen Ort in der Welt.«38 Mit Hinblick auf die Erzählung von der Vertreibung aus dem Paradies bestimmt Strasser die ontologische Verfasstheit des Menschen auch als »Wesen des Exils«, d. h. einer NichtVerortbarkeit, die fundamentaler ist als die Bestimmung des Menschen als »Wesen des Mangels«39, stünde hinter dieser doch erneut das Ideal einer vollkommenen Erfüllung und Eingepasstheit. Strasser gibt im Vortrag dem Begriff der Transzendenz eine zweifache Ausrichtung: Sie zeigt sich als »Fragenkreis der Transzendenz« (d. h. jener Fragen, »die über das Innerweltliche hinausreichen«) und als »Komplex an Transzendenzgefühlen«40. Von hier aus könne sich wieder ein neuer Blick auf Religion eröffnen. Diese Richtung schlägt Strasser auch in seinem Buch Warum überhaupt Religion? ein, wo er den Ausgangspunkt religiösen Denkens darin sieht, dass »in allen menschlichen Erfahrungen semantische/ontologische/metaphysische Überschüsse enthalten sind, deren Nichtanerkennung zur Folge hätte, Begriff und Erfahrung der Welt selbst zu zerstören«41. Davon ausgehend darf jedoch der Weg zurück zur Religion oder genauer zu heutiger Religiosität nicht zu schnell eingeschlagen werden. Im Vortrag geht es Strasser (anders als in Der Weg nach draußen und in Warum überhaupt Religion?) nicht um die Erkundung der Intelligibilität eines religiösen Denkens, d. h. eines philosophischen Denkens, das die Frage nach Existenz, Wesen und Wirken Gottes stellt, sondern darum, was Religiosität in unserer Gesellschaft heute bedeuten kann. Wofür steht Religiosität in einer Gesellschaft, in der die Metaphysik, die bislang Seite an Seite mit der Religion gegangen war, selbst ihre Plausibilität verloren hat? Hier zeigt sich der Grund, warum die Metaphysik im Vortrag einzig unter dem Geschichtspunkt ihrer »Entlarvung« und ihres Bedeutungsverlustes referiert wurde. Strasser möchte bis an einen Punkt heranführen, an dem Religiosität nur mehr als etwas gänzlich Diffuses, Unbestimmtes, Ungeschütztes, nicht mehr argumentativ durch eine Metaphysik Abgesichertes erscheint, das eigentlich hätte verschwinden müssen, aber dennoch irgendwie eine Präsenz bewahrt hat. So endet der erste Teil des Vortrages mit der Ungewissheit, ob jenem Fragenkreis der Transzendenz und jenen Transzendenzgefühlen noch eine inhaltliche Ausgestaltung und ein kommunizierbarer Sinn entspricht, ob es noch einen Anspruch auf allgemeine Verständlichkeit gibt, oder ob, »nachdem die Entmythologisierung aller jenseitsweltlichen Überschüsse vollzogen ist, […] 38 39 40 41
Strasser: Journal der letzten Dinge. S. 44 (Nr. 64). Strasser: Journal der letzten Dinge. S. 244 (Nr. 272). Strasser: »Religiosität ohne Glauben?«. S. 16. Strasser: Warum überhaupt Religion?. S. 17.
Jenseits zielloser Suchbewegung?
35
nur noch die gleichsam leeren, begriffslosen Formen des religiösen Erlebens«42 übrig bleiben.
III.
Wie von Religiosität sprechen?
Ausgehend von diesem Gedanken einer gänzlichen Entleerung, die bloß Fragestrukturen und unbestimmte Gefühle zurücklässt, nimmt Strasser – im zweiten Teil seines Vortrags – die Frage nach der Religion neu auf. Dafür muss er einen neuen Begriff ins Spiel bringen: »Nennen wir dieses Phänomen ›Religiosität ohne Glauben‹ oder ›Religiosität ohne Religion‹. Das Phänomen ist wohlbekannt, in einzelnen Gestalten unserer Kultur hat es stets eine produktive Funktion gehabt.«43 Hier ist der Angelpunkt des Textes erreicht, nach einem langen Anweg taucht nun zum ersten Mal im Verlauf des Textes der Titel auf. Das »wir« (»Nennen wir […]«) bringt zum Ausdruck, dass nun der Vortrag in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft angelangt ist. Was vermag das Wort von der Religiosität ohne Glauben aber über unsere Kultur zum Ausdruck zu bringen?
(1)
Religion und Kunst
Strasser rückt einen neuen Begriff in den Blick: »Nennen wir dieses Phänomen […]«. Es zeigt sich jedoch sofort, dass es sich dabei um keine »Erfindung« Strassers handelt, sondern um ein Zitat, etwas, das er bereits von anderswoher aufgegriffen hat. Diese Zugangsweise ist aus dem Bereich der Religion selbst bekannt und bleibt ihr mithin nicht äußerlich, bedenkt man, dass die Geschichte wenigstens der biblischen Tradition (aber vielleicht der Religionen überhaupt) zutiefst von einem Gestus der Wiederaufnahme und der Reinterpretation, des Zitates und der Neukonfiguration alter Motive, Muster, Narrative geprägt ist. Um eine erste Verdeutlichung des Begriffs zu geben, bezieht sich Strasser (neben Wittgenstein) auf Beispiele aus der Literatur : John Bayley, Iris Murdoch, Graham Greene und Peter Handke werden genannt und ein Text von John Bayley auch zitiert. Der erste Versuch der Darstellung des Phänomens einer Religion ohne Glauben oder einer Religion ohne Religion weist somit in das Feld einer Kunst, die nicht gänzlich von der Religion geschieden ist. Deren Verbindung erachtet Strasser, wie aus einem anderen Text hervorgeht, als wesentlich: »Kunst, wie wir sie bisher kannten, war ein Medium der Wahrheit: nicht der wissenschaftlichen, aber einer dennoch fundamentalen – einer existentiellen und ontologi42 Strasser: »Religiosität ohne Glauben?«. S. 16. 43 Strasser: »Religiosität ohne Glauben?«. S. 16.
36
Jakob Deibl
schen Wahrheit. Daher die Nähe der Kunst zur Religion auch noch dort, wo sie anscheinend schon ganz auf die Seite der Welt übergegangen war : sie verlieh den Dingen einen Glanz, der unmöglich nur aus ihnen selbst stammen konnte, sie tauchte sie in ein Schweigen, das sie von den innerweltlichen Diskursen ›erlöste‹.«44
Die Kunst findet ihre Mitte im Glanz, der unmöglich nur aus den Dingen selbst stammen kann, dem Glanz, als einem nicht herstellbaren Zusatz; er ist in den Worten Hans-Dieter Bahrs die »vorbehaltlose, ungezielte Veraus-Gabung, die keinen Weg mehr einschlägt« und sich »ohne Kalkül auf irgendwelche Ziele, Resonanzen und Erwiderungen«45 verströmt. Die Kunst kann in ihren Werken dem Übersteigenden des Transzendenzgefühls einen sinnenhaften Ausdruck geben, der es in eine Form bindet und nicht bloß ins Unbestimmte oder Schwärmerische gleiten lässt. Gleichwohl hat sie nicht die starre institutionelle und dogmatische Verfasstheit der Religion. Kunst wird somit als ein Äquilibrium aus Freiheit und Bindung, freier Veraus-Gabung und Formgebung des Transzendenzgefühls gefasst. Vielleicht kann gerade der Verlust dieses in der Kunst noch aufrechterhaltenen Äquilibriums als ein wesentliches Problem heutiger Religiosität angesehen werden: In den Religionen und Kirchen droht das Transzendenzgefühl erstickt zu werden, die frei sich bewegenden Spiritualitätsangebote finden hingegen kaum einen Haftpunkt dafür, d. h. nicht den »Rückhalt einer formgebenden Tradition«46. Religiosität ohne Religion meint in ihrem ersten Auftreten im Umkreis der Kunst eine Form freien Umgangs mit einer Tradition, der nicht institutionell und dogmatisch fixiert ist, dabei aber einer Gestalt existentieller und ontologischer Wahrheit verpflichtet ist, die sich nicht auf bloße Subjektivität reduzieren lässt.
(2)
Formen der Religiosität heute
Mit einem »aber« leitet Strasser auf eine zweite Ausdrucksweise heutiger Religiosität über, die er nun in leichter Abwandlung zu vorher nicht Religiosität ohne Religion, sondern ohne Glauben nennt (»Religiosität ohne Glauben kann aber auch […]«). Anders als für die künstlerisch geprägte Form scheint es dafür keine literarischen Referenzpunkte, keine literarischen Sedimentierungen, die schon zur Gestalt geworden wären, zu geben, weshalb Strasser eine andere Weise der Thematisierung wählen muss. Er unternimmt vier Anläufe, um sich diesem diffusen gesellschaftlichen Phänomen zu nähern: Zunächst wagt er sich über den Begriff der Spiritualität einige Schritte in die Charakterisierung dieses un44 Strasser: Journal der letzten Dinge. S. 251 (Nr. 274). 45 Bahr, Hans-Dieter : Zeit der Muße – Zeit der Musen. Tübingen 2008. S. 41 f., vgl. 38 – 45. 46 Strasser: »Religiosität ohne Glauben?«. S. 22.
Jenseits zielloser Suchbewegung?
37
sicheren Feldes47, dann zieht er empirische Untersuchungen hinzu48 und fragt anschließend, inwieweit Charles Taylors philosophische Rekonstruktion von Moderne und Christentum für die Thematik hilfreich sein kann49. Die vierte Überlegung bezieht sich aus aktuellem Anlass auf die Anthroposophie Rudolf Steiners, dessen 150. Geburtstag 2011 begangen wurde50. Unter Spiritualität, dem »Code-Wort« einer Religiosität ohne Glauben, ließen sich unzählige Ausdrucksweisen zusammenfassen, doch bleibt Strasser nicht bloß bei deren Aufzählung, sondern versucht wenigstens eine allgemeine Charakterisierung der Verwendung des Begriffs zu geben: Er sei unbefangen, nicht korrumpiert, allgemein akzeptiert. Auch der, dem der religiöse »Mythos« nicht mehr glaubwürdig und allzu rückständig erscheint, könne ohne weiteres von Spiritualität sprechen, ohne seine aufgeklärte Gesinnung preisgeben zu müssen. Der Begriff der Spiritualität ist völlig anpassungsfähig: Als ein »EnergetikKonzept« scheint er mit wissenschaftlichen Theorien nicht unvereinbar, er gibt aber auch den Bezug zu den alten religiösen Traditionen nicht auf und kann sogar als wichtiger Faktor in gegenwärtigem Konsumverhalten auftreten. Darüber hinaus legt er inhaltlich auf nichts fest, seine Kommunikabilität besteht lediglich in seiner Flexibilität; eine allgemeine, eröffnende Bedeutung scheint er darüber hinaus aber nicht zu haben. Religiosität ohne Glauben tritt hier auf als eine Spiritualität ohne jede Form der Bindung, sie ist bloß äußeres Merkmal, das man sich gibt, wechselbar und gleichsam Design. Dieser Entleerung korrespondiert dann meines Erachtens auch die von Strasser in einem zweiten Anlauf hinzugezogene empirische Analyse, die den Glauben an irgendwelche vereinzelte Versatzstücke einer Religion abfragt: Glauben Sie an Gott? Glauben Sie an Wunder und Engel? Diese Fragen erhalten als empirisch zu messende nur dann annähernd einen Sinn, wenn schon eine Entkoppelung von jeder inhaltlichen Substanz stattgefunden hat. Sie setzen eine völlige Disponibilität sämtlicher Elemente voraus, die dann von Fall zu Fall bejaht oder verneint werden können, aber keinen ihnen vorgeordneten Zusammenhang mehr haben, von dem sie ihre Bedeutung erst erhielten. Wer noch irgendwie in der Treue zu einer religiösen Erzählung steht, fühlt ob dieser Fragen ein Befremden und weiß nicht, wie er ihnen antworten soll. Strasser stellt dann die Frage, ob eine Religiosität ohne Glauben im Rahmen von Charles Taylors Theorie der Moderne noch einmal in die »christliche Spiritualität«51 zurückgeführt werden könne. Es gäbe einen Humanismus, der sich aus dem Christentum entwickelt habe, allerdings in Form einer Abhebung von 47 48 49 50 51
Vgl. Strasser: »Religiosität ohne Glauben?«. S. 17 – 18. Vgl. Strasser: »Religiosität ohne Glauben?«. S. 18 – 19. Vgl. Strasser: »Religiosität ohne Glauben?«. S. 19 – 21. Vgl. Strasser: »Religiosität ohne Glauben?«. S. 21 – 22. Strasser: »Religiosität ohne Glauben?«. S. 20.
38
Jakob Deibl
ihm. Wenn er jedoch »erst einmal religiös entkernt« sei, d. h. seine Anbindung an die Religion gänzlich verloren habe, könne er »seine eigenen Prinzipien nicht mehr legitimieren«52. Glaube und christliche Spiritualität könnten einen Ausweg in dieser Situation der Entwurzelung weisen. Strasser sieht darin jedoch, ohne Taylor inhaltlich oder in der Struktur der Argumentation zu widersprechen, wenig Möglichkeit, das Christentum wieder als eine formgebende Tradition plausibel zu machen. Eher als in die vernünftig plausible Rekonstruktion eines Christentums der Moderne, wie es Taylor vorschwebe, führe die metaphysisch religiöse Entleerung, die lediglich einen Fragebereich der Transzendenz und Transzendenzgefühle zurücklasse, in synkretistische »Weisheitslehren« oder Formen der Spiritualität, wofür Rudolf Steiners Anthroposophie ein Beispiel darstelle. Strasser beklagt allerdings die mangelnde innere Stimmigkeit derartiger Weisheitslehren und Formen der Spiritualität und führt dies auf das Fehlen des Rückhaltes »einer formgebenden Tradition«53 zurück, womit sich ein typisch aufklärerisches Argument umkehrt. Ansinnen der Aufklärung war es, die Tradition dort zu durchbrechen, wo sie zur Stütze eines Systems wurde, das seine Kommunikabilität und Plausibilität verloren hatte und der Prüfung durch die Vernunft nicht mehr standhalten konnte. Wo aber sämtliche Traditionen zerbrochen sind und jeder auch in der Wahl seiner religiösen Haltung mehr und mehr auf sich gestellt ist, erhebt sich die Frage nach »Tradition« in einer neuen Weise: Wo gibt es Orte einer nicht abgerissenen Bezeugung von Religion (oder religiöser Motive und Narrative), welche die Möglichkeit eröffnen, in der persönlichen Zustimmung dazu nicht bloß auf die eigene Subjektivität zurückgeworfen zu werden und letztlich darin nichts anderes zu finden als die Leere der Sehnsucht des eigenen Ichs? Wo gibt es Spuren einer lebendigen Tradition, an die man anknüpfen kann und die einen Gehalt haben, dessen innerer Zusammenhalt nicht bloß temporär von unserer Kompetenz, synkretistisch das Heterogene in uns zu vereinen, abhängt? Wo gibt es eine Tradition, die auf einer Geschichte der Bezeugung ruht, und dadurch etwas anderes begegnen lässt als die gänzliche Flexibilität und bruchlose Anpassung an alle Verhältnisse, wie sie bloß Spiegel eines kapitalistischen Konsumentendaseins ist? Die Entwicklung der Moderne hat gezeigt, dass den Kirchen diese Traditions-Kompetenz nicht mehr ohne weiteres zugetraut wird. Wenn aber gerade (zumindest nach katholischem Verständnis) in dieser Kompetenz das Proprium von Kirche liegt, dann müsste man die Frage stellen, wo die Orte sind, an denen »Kirche« sich heute ereignen kann. Die Erkundungen des Feldes einer Religiosität ohne Glauben schließt Strasser 52 Strasser: »Religiosität ohne Glauben?«. S. 20. 53 Strasser: »Religiosität ohne Glauben?«. S. 22.
Jenseits zielloser Suchbewegung?
39
mit der Feststellung, wir stünden »angesichts der drängenden existentiellen Fragen und metaphysischen Rätsel vor den verschlossenen Türen des Mythos […], sehnsüchtig, aber trostlos«54. Der Vortrag mündet daraufhin in die bereits erwähnte Frage: »Ist also eine Religiosität ohne Glauben die moderne Form des unglücklichen Bewusstseins par excellence, dazu verurteilt, in einer ziellosen Suchbewegung zu verharren? Wer darauf eine Antwort weiß, der möge sie geben. Ich kenne sie nicht.«55
IV.
Nachwort – Wahrnehmung der Welt als Schöpfung
An dieser Stelle ist der zweite große Teil des Vortrags abgeschlossen, ohne eine Antwort zu geben; es folgt jedoch noch eine Art Nachwort als Darstellung einer »Richtung, in welcher die Antwort liegen müsste«56. Diese Richtung erhält keine begriffliche Ausarbeitung mehr, zu ihrer Illustration gibt Strasser aus seinem Buch Die einfachen Dinge des Lebens die Grabrede für einen Verstorbenen, der gleichsam eine Religiosität ohne Glauben hatte, wieder. Die Gestalt des Textes ist für einen philosophischen Vortrag ungewöhnlich und stellt vor die Frage, warum Strasser auf diese Form der Rede zurückgreift. In welcher Weise wird nun im Nachwort des Vortrags Religiosität thematisch? Strasser greift erneut zu einer anderen Annäherungsweise. Als Grabrede evoziert der Epilog einen öffentlichen Ort, an dem von der Religiosität eines Menschen erzählt wird. Sie spricht dabei aber nicht im Modus des Bekenntnisses, was in heutigem Kontext leicht in eine Form der Selbstdarstellung umschlagen könnte. Die Rede von der Religiosität würde dann zum bloßen Ausdruck unserer Egoität. Erzählt wird in Strassers Rede von jemandem, der selbst nicht mehr sprechen kann, dem keine Sprache, keine Worte mehr eignen, um von sich und seiner Religiosität zu reden. Das scheint vielfach auch unsere Situation zu sein. Das Feld der Religion kann heute nicht mehr unmittelbar zur Sprache gebracht werden, auch und gerade weil es zu viel Gerede über Gott57 gibt. Die Grabrede hingegen ist allem Gerede gegenüber das vorsichtig, pietätvoll geliehene Wort für einen, der keine Sprache hat – gesprochen in der Scheu, dass jedes Wort zu viel sein könnte. Sie ist durchzogen von einer Distanz, weil sie Worte sprechen will, die dem Verstorbenen nicht äußerlich bleiben, sondern ihn in seinem Wesen vor Augen stellen, und doch schmerzlicher als jede andere Beschreibung einer Person um seine Entzogenheit weiß. 54 55 56 57
Strasser: »Religiosität ohne Glauben?«. S. 22. Strasser: »Religiosität ohne Glauben?«. S. 22. Strasser: »Religiosität ohne Glauben?«. S. 22. Vgl. Strasser: »Zu viel Gerede über Gott«.
40
Jakob Deibl
Die im Vortrag wiedergegebene Trauerrede gibt keinen direkten Bezug auf Gott und die Frage seiner Existenz. Zugänglich, d. h. kommunikabel, wird diese Frage erst über die Idee der Schöpfung, genauer : über eine Wahrnehmung der Welt als Schöpfung: »Man konnte […] sich die Welt und das Leben gar nicht anders denn als Schöpfung denken.«58 Was das bedeutet, wird nicht festgelegt, sondern erzählerisch zum Ausdruck gebracht als Einstimmung in eine bestimmte Weise der Wahrnehmung der Welt: der Wahrnehmung des Mysteriums, »das in der Existenz und Ordnung der Dinge«59 liegt und der Feier des Alltags »als eine Art Liturgie«60. »Alltag« ist hier jedoch nicht gleichzusetzen mit dem Täglichen, auf das man jederzeit zugreifen könnte nach dem Motto: »›Täglich Schöpfung, durchgehend geöffnet‹«61, sondern ist das, was bisweilen eine Verwandlung erfahren kann – wie es etwa Hölderlin in der 7. Strophe von Brot und Wein zum Ausdruck bringt: »Nur zu Zeiten erträgt göttliche Fülle der Mensch. / Traum von ihnen ist drauf das Leben […]«62 Religiosität ohne Glauben steht hier nicht für eine ziellose Suchbewegung, sondern für eine »Art religiöser Haltung«63, die nicht zu viel der Worte um Gott und seine Existenz oder Nicht-Existenz macht. Sie kann keine Unmittelbarkeit Gottes für sich veranschlagen, sondern möchte allenfalls in eine Wahrnehmung der Welt als Schöpfung einstimmen und offen für die festliche Verwandlung des Alltäglichen werden. Damit ist eine Haltung ausgesprochen, aus der auch Strassers Journal der letzten Dinge verfasst ist. Das Zentrum dieses Buches sei, wie Strasser im Vorwort anmerkt, die »paradox anmutende Frage, was es unter der Voraussetzung des Unglaubens bedeutet, zu den Tatsachen des Lebens eine religiöse Haltung einzunehmen«64. Dies ist die letzte der von Strasser in seinem Vortrag verhandelten Lesarten des paradoxen Titels Religiosität ohne Glauben: die ästhetische Haltung an der Schwelle von Kunst und Religion, die vage bleibende Spiritualität, die Strasser eher in synkretistische Weisheitslehren wandern sieht (Rudolf Steiner), als dass sie zurück in eine christliche Religiosität der Moderne geführt werden könnte (Charles Taylor), und schließlich die religiöse Haltung dem Leben gegenüber, die auch dem Ungläubigen möglich sein muss. Die ästhetische Haltung wird es in einem kleinen Ausmaß weiterhin geben. Entscheidender für eine Charakterisierung der europäischen Gesellschaft heute sind jedoch die beiden anderen Formen. Hinsichtlich der vagen Spiritualität Strasser: »Religiosität ohne Glauben?«. S. 23. Strasser: »Religiosität ohne Glauben?«. S. 22. Strasser: »Religiosität ohne Glauben?«. S. 23. Strasser: »Religiosität ohne Glauben?«. S. 23. Hölderlin, Friedrich: Sämtliche Gedichte. Hrsg. von J. Schmidt. Frankfurt a. M. 2005. S. 289. 63 Strasser: »Religiosität ohne Glauben?«. S. 22. 64 Strasser: Journal der letzten Dinge. S. 9. 58 59 60 61 62
Jenseits zielloser Suchbewegung?
41
sieht Strasser die Problematik, dass sie zu einer ziellosen Suchbewegung zu werden droht, die sich letztlich wenig von einem Konsumverhalten unterscheiden lässt. Eine entscheidende Frage wird sein, wie sich die dritte Form, die religiöse Haltung der Ungläubigen, und die angestammten religiösen Traditionen selbst zueinander verhalten werden. Ich denke, beide werden letztlich nur überleben können, wenn es ihnen gelingt, in ein Gespräch zu treten: Die religiöse Haltung des Ungläubigen zehrt davon, dass es die Kontinuität einer Tradition gibt. Diejenigen, die sich bewusst in diese Tradition stellen, sind umgekehrt zunehmend darauf angewiesen, von außen zu lernen, was die Allgemeinheit und Universalität ihrer Botschaft überhaupt bedeuten kann, würden sie doch sonst selbst zur sektoiden Gemeinschaft werden. Ich möchte nun abschließend versuchen, zwei mögliche Punkte eines derartigen Gespräches anzudeuten, die Öffnung des Mythos und die Wahrnehmung des Menschlichen.
V.
Öffnung des Mythos
Abgesehen von diesem Vortrag, der mit einer Grabrede endet, gibt es zahlreiche andere Texte Strassers, deren Gestalt sich nicht dem akademischen Diskurs anpasst. Ich denke, dieser Umstand kann ausgehend von jenem Wort, dass wir »vor den verschlossenen Türen des Mythos« stünden, »sehnsüchtig, aber trostlos«65, eine Deutung erfahren. Ein nicht unerheblicher Teil der Arbeit Strassers besteht in einer Archäologie der Mythen, aus denen die abendländische Kultur gewoben ist, d. h. im Versuch, jene Erzählungen davor zu bewahren, gänzlich unzugänglich zu werden.66 Es handelt sich dabei um Erzählungen eines Primärtextes, deren Sich-Verschließen unabsehbare Folgen für eine Kultur hätte: »Alle anderen Bedeutungen hängen von diesem Text und seinem Sinn ab. Beide können verfinstert sein, aber sie bleiben das Zentrum, solange die Kultur nicht abstirbt und ein lebendiges Gedächtnis behält.«67 Jene »Quellen, aus denen sich das tiefere Leben der Kultur speist«, bleiben »am Rande ihres rationalisierenden Betriebs«, folgen »wie Träume ihrem eigenen ›Gesetz‹«68 und widersetzen sich einer historisierenden Logik. Wie kann man sich diesen Texten heute, wo ihre Selbst-Verständlichkeit gefährdet ist, noch annähern, wenn Rationalisierung und Historisierung, die beiden Methoden, die von unserer Kultur ausgeprägt wurden, um »sich verfinsternde« Traditionsbestände aufzuhellen, versagen? 65 66 67 68
Strasser: »Religiosität ohne Glauben?«. S. 22. Vgl. etwa Strasser: Unschuld. Strasser: Journal der letzten Dinge. S. 255 (Nr. 277). Strasser: Journal der letzten Dinge. S. 254 (Nr. 277).
42
Jakob Deibl
Strasser zufolge bedarf die Annäherung einer Verschiebung in der Sprache, d. h. eines Versetzungsschrittes, der dem gewohnten Diskurs eine Fremdheit einschreibt und ihm damit seinen sicheren Gang nimmt. In einer Sammlung mehrerer Aphorismen mit dem Titel Der Augenblick der Philosophie zeigt er diese Verfremdung in der Sprache am Werk Heideggers. In Bezug auf dessen extensive etymologische Betrachtungen und die eigentümliche Gestalt zahlreicher seiner Texte, etwa der »Winke«, spricht Strasser von einer »Deformationsarbeit«, von einem Wissen, das »sich nur mittels einer Deformation des begrifflichen Rahmens darstellen lässt«69. Es gehe dabei um eine Weise indirekter Kommunikation, die davon Abstand nimmt, die Dinge unmittelbar, d. h. ohne Übergänge, auf den Punkt zu bringen – statt dessen sollen sie in ein neues Licht gerückt und eine neue Wahrnehmung von ihnen möglich werden. Es lässt sich nicht entscheiden, ob es sich bei diesen Texten um Dichtung oder Philosophie handelt: Die literarisch-metaphorische Gestalt lasse sich nicht auflösen – wie ein Gedicht kann sie nicht einfachhin zwecks Wiedergabe des Inhalts in Prosa überführt werden. Der Gestus der Deformation führt jedoch nicht zu einer neuen Sprache, die danach verfügbar wäre, sondern muss je neu vollzogen werden und lebt selber nur aus dem Übergang und der Abstoßung von einer anderen Sprachgestalt.70 Was Strasser hier zu Heidegger ausführt, kann vielleicht auch eine Deutung der nicht einordenbaren Gestalt vieler seiner eigenen kleineren Texte (oder gewisser Textpassagen) ermöglichen. Wo es darum geht, den Quellen, die unsere Kultur untergründig prägen, und den Fragen, die sich unsere Kultur selbst verbirgt, nachzuspüren, scheint auch Strasser zu einer Gestalt »nicht-kontingenter Literarizität«71, d. h. zu einer literarischen Ausdrucksweise, die nicht durch andere Formen ersetzt werden könnte, zu greifen. Es handelt sich um eine Sprachform, die nach einem Zwischen von Literatur, philosophischer Argumentation, religiösen Narrativen, mythischen Elementen und Alltagsbeobachtungen sucht und sich immer wieder von einem etablierten philosophischen Duktus abstößt. Vielleicht können gerade an diesen Übergängen Motive eines bereits verschlossen geglaubten Mythos auftauchen, für die wir keine Sprache mehr zur Verfügung zu haben scheinen. Es treten in diesen Text-Miniaturen Strassers immer wieder dieselben Personen und Szenen auf: die Betrachtungen aus der Frühstücksecke, bevor der Betrieb des Alltags einsetzt, das Läuten unerwarteter Gäste an der Haustüre, die Beschreibungen des Spazierengehens, die Erfahrungen des Universitätslehrers etc. Alles hat gewissermaßen einen ironischen Charakter, und in die gewohnten Settings brechen meist überraschende 69 Strasser: Journal der letzten Dinge. S. 192 (Nr. 235). 70 Vgl. Strasser: Journal der letzten Dinge. S. 192 – 197 (Nr. 235 – 237). 71 Strasser: Journal der letzten Dinge. S. 195 (Nr. 236).
Jenseits zielloser Suchbewegung?
43
Wendungen ein, die sich nie völlig auflösen lassen. Bisweilen beschreibt Strasser auch einen Zustand, der sich an der Grenze zwischen Wachen und Schlaf bewegt, und es scheint, als wolle er damit einfangen, was an der Schwelle zum Traum nicht aufhört, sich zu entziehen, was in Versunkenheit und Dämmerzustand assoziativ begegnet.72 Den Texten eignet stets das Moment eines Bruches, der etwas zum Ausdruck bringt, was in der geschlossenen Relationalität der Kategorien unserer Weltdeutung keinen Ort hat. Strasser hat einen »Stil« kreiert, der es ihm ermöglicht, Motive anzusprechen, die im Versuch ihrer gänzlichen Rationalisierung verschwinden würden, die er aber dem Diskurs noch zugänglich machen möchte. Von Seiten einer religiösen Haltung des Ungläubigen könnte in einem Gespräch mit Theologie, Religion und Kirche die Frage gestellt werden, warum sie selbst denn so wenig Kompetenz hinsichtlich der Öffnung des Mythos haben. Wäre darin nicht eine ihrer wesentlichen Aufgaben zu sehen?73
VI.
Wahrnehmung des Menschlichen
Worin aber gründet, so könnte die Gegenfrage lauten, Strassers Zugang zum Mythos? Vermag sich in der nicht selten ironisierenden Sprachgestalt tatsächlich etwas zu eröffnen? Könnte man nicht auch annehmen, dass sich in jenem Zwischen von Literatur, Philosophie, Mythos, Religion und Alltagsbeobachtung nichts anderes zeigt als eine beliebig variierbare Zusammensetzung irgendwo aufgegriffener Versatzstücke? Weder die Einbindung in eine religiöse Gemeinschaft noch die Ursprünglichkeit des Glaubensaktes können nämlich in einer Religiosität ohne Religion und Glauben für die Authentizität eines Sich-Öffnens von mythischer und religiöser Erzählung einstehen. Einen Ausgangspunkt seiner Rekonstruktionen mythischer und religiöser Motive scheint Strasser in der überragenden Bedeutung des Primärtextes, die noch bis in all unsere Erzählungen nachzuwirken vermag, zu sehen. Darüber hinaus spricht er aber auch von einem Ausgangspunkt der Philosophie, der eine Art von visio darstellt. Es ist dies eine »Art des Welterlebens, bei dem die 72 Vgl. Strasser: »Eine schöne Päpstin für den Ungehorsam?«. S. 194 – 197. 73 Die Kompetenz der Theologie, »jenseits kindischer (Pseudo)Naivität und abgeklärter, letztlich ungläubiger Rationalität« einen Begriff des Mythos auszubilden, scheint gering, wie Kurt Appel in seiner Habilitationsschrift Zeit und Gott konstatiert: »Tatsächlich scheint es heute so zu sein, dass gerade die Theologie weit von einem freien Zugang zum Mythos entfernt ist (was schon Bonhoeffer gegen Bultmann kritisiert hat) und es philosophischer Denker wie Pareyson, Vattimo oder sogar Zˇizˇek (alle drei nicht zufällig Erben Schellings und Hegels) bedarf, um der Theologie ihre genuine Sprachform zurückzugeben.« (Appel, Kurt: Zeit und Gott. Mythos und Logos der Zeit im Anschluss an Hegel und Schelling. Paderborn 2008. S. 446; vgl. besonders die Kapitel VIII und IX.)
44
Jakob Deibl
Deutungsaktivitäten des Subjekts stillgelegt sind«74. Der Aufgang von Welt wird als so massiv erfahren, dass jede Form begrifflicher oder handelnder Weltbewältigung zerbricht. Das Subjekt steht dem tremendum et fascinans ungeschützt gegenüber und ist von seiner Auslöschung bedroht. Doch das Schwinden aller möglichen Situationsdeutungen kann auch als Durchbruch und »Eröffnungsmoment«75 erfahren werden: »Im Augenblick der Philosophie fällt das Subjekt aus dem Netzwerk der Begriffe, Deutungen und Perspektiven heraus, ohne aber deswegen vernichtet zu werden […], und es wird für die Dauer des Herausfallens ontologisch unschuldig. Dieses Herausfallen ist wie ein Auftauchen aus der Blindheit.«76
Philosophie wäre dann der Versuch, »die vorbegrifflich erlebte Wahrheit der Dinge in das Reich der Begriffe, in die Welt des Diskurses herüberzuholen«77. Dies gibt der Philosophie ihr Gepräge als Übersetzerin (verschlossener) mythischer Gehalte, arkaner Fragen der Gesellschaft und vorbewusster Motive. Die Erfahrung des Augenblicks der Philosophie münde Strasser zufolge nicht notwendig in das Schweigen am Ende von Wittgensteins Tractatus, sondern verleihe der philosophischen Begrifflichkeit eine ironische Tinktur. Das Verhältnis zu den Begriffen nehme ein »›ironisches‹ Gepräge« an, das einem »unheilbaren Bruch zwischen Gesagtem und Gemeintem«78, d. h. zwischen philosophischem Ausdruck und dem, was Strasser die vorbegrifflich erlebte Wahrheit der Dinge nennt, geschuldet ist: »Denn stets ist das, was gesagt wird, nicht das, was gemeint wird, und eben dadurch soll das Gemeinte bemerkbar werden – und nur auf diese Weise kann es in der Sprache überhaupt zum Ausdruck kommen.«79 Die ironische Ausdrucksweise hält diesen Bruch in Erinnerung, der die Sprache davor bewahrt, ihren Verweischarakter (ihre Transzendenz) zu verlieren, indem das »Gesagte« mit dem »Gemeinten« zusammenfiele. Sprache würde sonst zu einer Gestalt der Immanenz, in ihr müsste die Differenz erlöschen, die ihre Offenheit bedeutet. Die Legitimation der Philosophie (nicht zuletzt als Übersetzerin mythischer Gehalte) erwächst für Strasser aus jenem Augenblick, der die Erfahrung des Zerbrechens aller Kategorien der Deutung und eines Aufgangs der Dinge der Welt darstellt. Philosophie wird daraufhin notwendig einen ironischen Gestus annehmen. Dieser Gedanke, der hier nicht weiter besprochen werden kann, führt zurück zu einigen Fragen, die mit dem Gegenstand des Vortrags von 74 75 76 77 78 79
Strasser: Journal der letzten Dinge. S. 186 (Nr. 231). Strasser: Journal der letzten Dinge. S. 189 (Nr. 233). Strasser: Journal der letzten Dinge. S. 189 (Nr. 233). Strasser: Journal der letzten Dinge. S. 189 f. (Nr. 233). Strasser: Journal der letzten Dinge. S. 193 (Nr. 235). Strasser: Journal der letzten Dinge. S. 193 (Nr. 235).
Jenseits zielloser Suchbewegung?
45
Strasser eng verbunden sind, nämlich zur Problematik, ob moderne Religiosität dazu verurteilt ist, in einer ziellosen Suchbewegung zu verharren. Könnte man, so möchte ich fragen, die Ironie auch als ein Bekenntnis zu einer Gestalt von Endlichkeit deuten, die sich einerseits nicht in ihrer Immanenz schließt, sondern Verweis auf Transzendenz ist (das »Gesagte« verweist immer auf das »Gemeinte«), und andererseits nicht in eine ziellose Suchbewegung mündet, die von einem beständig sich erneuernden Mangel ausgeht, der unausgesetzt seine Erfüllung sucht? Der Bruch, der Gesagtes und Gemeintes nie zusammenfallen lässt, hält eine Distanz offen – und zwar die Erinnerung oder den Traum vom Augenblick der Erfahrung des tremendum et fascinans, den Strasser den Augenblick der Philosophie nennt. Treten diese Erinnerung und dieser Traum nicht einer ziellosen Suchbewegung scharf entgegen, weil sie gerade nicht von einem sich ständig erneuernden Mangel ausgehen, der je neu seine Erfüllung sucht? In jenem Augenblick der Philosophie zerbricht auch die Logik von Mangel und Erfüllung und ist jede Suche, die immer noch nach etwas anderem fragt, stillgestellt. Strasser gibt über die Reflexion auf den Augenblick der Philosophie als Gestalt einer visio und den daraus resultierenden Gestus der Ironie hinaus noch einen weiteren, für die christliche Tradition wichtigen Hinweis auf das Überschreiten einer ziellosen Suchbewegung, der mit einer neuen Wahrnehmung des Menschlichen in seiner Schwäche, wie sie der biblischen Tradition entstammt, verbunden ist: »Der christliche Gott hingegen tötet [im Gegensatz zu den heidnischen Göttern] das Unerlöste nicht ab; er lässt es als Wunde in sich zu, und das heißt, er bejaht das endliche Leben. Um den Menschen zu trösten, muss er selbst einsam werden. Fortan hat er mit dem Menschen etwas gemeinsam, das über beide hinausreicht: jenes aus den Dingen herströmende Zehren, durch das die Liebe möglich und das Heimweh unstillbar wird.«80
Das aus den Dingen strömende Zehren, das dem Aufgang der Dinge im Augenblick der Philosophie entspricht, eröffnet hier nicht allein die ironischen (Anti-)Diskurse der Philosophie, sondern schlägt auch in eine neue Form der Menschlichkeit um: Es ermöglicht die Liebe, die nun als eine Bejahung des Endlichen in seiner Verletzlichkeit und Fragilität (»Wunde«) gedacht werden kann. Das Heimweh als Chiffre für die Ausgesetztheit und Unheimlichkeit des Menschen schlechthin wird unstillbar, es zerbricht damit jede Ökonomie kontinuierlich sich erneuernder Annäherung an das ewig Unerreichbare und wird aus der Logik von Mangel und Erfüllung erlöst. Die ziellose Sehnsucht und ihr Pendant der gänzlich erfüllten Beheimatung können sich dann vielleicht ver80 Strasser: Journal der letzten Dinge. S. 257 f. (Nr. 278).
46
Jakob Deibl
wandeln in eine tiefere Wahrnehmung des Menschlichen. Religiosität ohne Glauben, wenn sie als eine Art religiöser Haltung des Ungläubigen gedacht werden kann, und Religiosität als Ausdruck eines Glaubens stehen vor der gemeinsamen Frage, ob ihnen diese Wandlung wenigstens in Augenblicken gelingen kann.
Literaturverzeichnis Agamben, Giorgio: Die Zeit, die bleibt. Ein Kommentar zum Römerbrief. Frankfurt a. M. 2006. Appel, Kurt: Zeit und Gott. Mythos und Logos der Zeit im Anschluss an Hegel und Schelling. Paderborn 2008. Bahr, Hans-Dieter : Zeit der Muße – Zeit der Musen. Tübingen 2008. Depoortere, Frederic: Christ in Postmodern Philosophy. Gianni Vattimo, Ren¦ Girard and Slavoj Zˇizˇek. London/New York 2008. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Phänomenologie des Geistes (=Hegel Werke Band 3). Frankfurt a. M. 1970. Hölderlin, Friedrich: Sämtliche Gedichte. Hrsg. von J. Schmidt. Frankfurt a. M. 2005. Nancy, Jean-Luc: Dekonstruktion des Christentums. Zürich/Berlin 2008. Nancy, Jean-Luc: Noli me tangere. Zürich/Berlin 2008. Strasser, Peter : Journal der letzten Dinge. Frankfurt a. M. 1998. Strasser, Peter : Der Weg nach draußen. Frankfurt a. M. 2000. Strasser, Peter : »Eine schöne Päpstin für den Ungehorsam?«, in: Diakonia (43) 2012/3. S. 194 – 196. Strasser, Peter : »Neulich bei Gott«, in: Die Presse. Spectrum, 15. April 2006. S. 1 – 2. Strasser, Peter : »Religiosität ohne Glauben?«, in: Langthaler, Rudolf/Meiller, Christopher/Appel, Kurt (Hg.): Religion in der Moderne. Religionsphilosophische Beiträge zu einer aktuellen Debatte. Göttingen 2013. S. 11 – 24. Strasser, Peter : Unschuld. Das verfolgte Ideal. München 2012. Strasser, Peter : Warum überhaupt Religion? Der Gott, der Richard Dawkins schuf. München 2008. Strasser, Peter : »Zu viel Gerede über Gott«, in: ThPQ (158) 2010. S. 50 – 57. Vattimo, Gianni: Glauben – Philosophieren. Stuttgart 1997. Vattimo, Gianni: »Die Spur der Spur«, in: Derrida, Jaques/Vattimo, Gianni (Hg.): Die Religion. Frankfurt a. M. 2001. S. 107 – 124. Vattimo, Gianni: Jenseits des Christentums. Gibt es eine Welt ohne Gott?. München/Wien 2004. Vattimo, Gianni: Jenseits der Interpretation. Die Bedeutung der Hermeneutik für die Philosophie. Frankfurt a. M./New York 1997. Zˇizˇek, Slavoj: Das fragile Absolute. Warum es sich lohnt, das christliche Erbe zu verteidigen. Berlin 2000.
Herbert Schnädelbach
Religion in der Moderne – Aspekte und Perspektiven1
1. Wenn wir über Religion sprechen, können wir den Begriff mindestens in zweifacher Weise verwenden – in objektiver oder in subjektiver Hinsicht. Mit dem objektiven Religionsbegriff meinen wir eine kulturelle Tatsache, und dies entweder in soziologischer oder in historischer Perspektive. Die Soziologen behaupten, dass Religion als kulturelles Teilsystem in allen Gesellschaften vorkomme und darin in höchst unterschiedlicher Weise bestimmte Bestandsbedingungen des Ganzen erfülle. Wenn wir stattdessen auf die einzelnen Religionen zu sprechen kommen – auf das Christentum, den Islam oder den Buddhismus – dann beziehen wir uns auf einzelne, geschichtlich gewordene religiöse Systeme, von deren Entstehung und Struktur man nur berichten kann – im Sinn des griechischen historen. Religion als subjektives Phänomen betrachtet ist hingegen das, was man glaubt und lebt, was freilich nicht ausschließt, dass man dies wiederum zum objektiven Untersuchungsgegenstand macht, wie in der Religionspsychologie oder der empirischen Sozialforschung.
2. Religion in der Moderne ist somit ein ziemlich komplexes Thema, wobei freilich zuvor zu klären ist, was hier mit ›Moderne‹ gemeint sein könnte. Sicher nicht all das, was gerade modern ist, und auch nicht einfach eine historische Epoche. Im Französischen und Angelsächsischen ist das Wort gleichbedeutend mit unserem deutschen ›Neuzeit‹ (vgl. les temps modernes und modern times), während wir in der Regel die Moderne erst nach der politischen und industriellen Revolution beginnen lassen. Im Folgenden soll von Moderne als einem bestimmten Zustand 1 Dieser Vortragstext variiert Grundgedanken meines Buches: Religion in der modernen Welt. Frankfurt a. M. 2009. insbes. S. 11 – 52.
48
Herbert Schnädelbach
die Rede sein, in dem sich eine Kultur befindet, den sie aber auch wieder verlieren kann, wenn sie in die Prämoderne zurückfällt. Die Soziologen und Kulturwissenschaftler haben verschiedene Modernisierungstheorien vorgeschlagen, die den Übergang von der Prämoderne in die Moderne erklären sollten, aber ein allgemeiner Konsens wurde hier nicht erreicht; deswegen soll mit dem Verhältnis ›Moderne – Prämoderne‹ auch kein allgemeines Fortschrittsmodell impliziert sein. Man sollte sich hier lieber an Karl Marx und sein Diktum erinnern, dass wir die Anatomie des Affen aus der des Menschen zu erklären pflegen und nicht umgekehrt, und deswegen von der Struktur unserer modernen Kultur ausgehen, deren Entstehung aus dem Vorhergegangenen – also der Prämoderne – man nicht deduzieren, sondern nur erzählend rekonstruieren kann. In diesem Sinn hat Max Weber die Strukturen unserer gegenwärtigen Gesellschaft als das Resultat der spezifisch abendländischen Rationalisierung dargestellt, deren Verlauf zwar durchgehende Merkmale aufweist, aber nicht irgendeinem abstrakten Schema wie der »Dialektik der Produktivkräfte und Produktionsverhältnisse« folgte. Was man hier als die alles bestimmende Tendenz hervorheben kann, ist die »Ausdifferenzierung und Autonomisierung der Weltbilder und Lebensformen«, und überall dort, wo dies geschichtlich stattgefunden hat, soll von Moderne die Rede sein; wo dies alles wieder zu verschwinden beginnt, droht der Rückfall in die Prämoderne.
3. Eine in diesem Sinn von ›Moderne‹ moderne Kultur weist vor allem drei Strukturmerkmale auf: Dezentrierung (3.1), Pluralisierung (3.2) und vollständige Reflexivität (3.3).
3.1 In allen Kulturen lassen sich Differenzen zwischen Weltbildern und Lebensformen unterschiedlicher sozialer Gruppen unterscheiden – etwa der Priester, Krieger und Bauern, aber in modernen Kulturen ist diese Ausdifferenzierung so weit fortgeschritten, dass die verschiedenen Weltbilder und Lebensformen autonom wurden, also mit gleichem Recht nebeneinander existieren. Das Ergebnis ist die Dezentrierung der Kultur, was bedeutet, dass es in ihr kein alle kulturellen Teilbereiche steuerndes Zentrum mehr gibt wie im christlichen Mittelalter oder in der islamischen Welt die Religion – zumindest im Prinzip. Die totalitären politischen Programme des letzten Jahrhunderts versuchten, diesen Prozess rückgängig zu machen und einer Partei und ihrer Ideologie die Funktion zu-
Religion in der Moderne – Aspekte und Perspektiven
49
zuweisen, die in prämodernen Kulturen in der Regel das religiöse System wahrnehmen sollte.
3.2 Die erstaunlich breite Zustimmung, auf die die Marxisten ebenso wie die Nationalsozialisten in ihren jeweiligen Bevölkerungen dabei stießen, verweist neben anderen lokalen Bedingungen vor allem auf den Preis der kulturellen Dezentrierung, den die Moderne zu entrichten hat: Die unhintergehbare Pluralität aller kulturellen Teilbereiche, die dem Einzelnen das kulturelle Ganze als vollkommen unübersichtlich erscheinen lässt und ihn vor kaum lösbare Orientierungsprobleme stellt. Für Menschen, die in festgefügten Strukturen mit eindeutiger Ausrichtung auf die herkömmlichen Autoritäten ›Gott-Kaiser-Vaterland‹ oder ›Thron und Altar‹ aufgewachsen waren – hier denke ich vor allem an die Deutschen des 19. und 20. Jahrhunderts – musste diese Pluralisierung als Erschütterung der meisten lebensweltlichen Selbstverständlichkeiten erscheinen, die Angst und die Sehnsucht nach eindeutigen Verhältnissen erzeugt. Dies äußert sich in der Regel als ein nachdrückliches Streben nach Einheit, nach Versöhnung der auseinanderstrebenden Kräfte, nach Aufhebung der Klassengegensätze und der parlamentarischen Machtkämpfe ebenso wie der privatwirtschaftlichen Konkurrenz, und dies möglichst unter der Ägide eines politischen Machtzentrum, sei es ein Politbüro oder der Apparat eines väterlichen und fürsorglichen Führers. Bemerkenswert ist, dass solche Beschwörungen der Prämoderne stets als das Modernste auftraten, was auf dem Markt ist, und dies gilt auch für den Islamismus unserer Tage, der ebenfalls aus dem letzten Jahrhundert stammt und als moderne, aber eben antimoderne Intellektuellenbewegung die westliche Dezentrierung und Pluralisierung, die längst auch die islamische Welt erfasst hat, zurückzudrehen trachtet. In prämodernen Kulturen existiert ebenfalls Pluralität, aber eben nicht in dem Maße, dass sie den Menschen als ängstigende Unübersichtlichkeit erscheinen muss. Für diesen Zustand fand Hegel als ein wichtiger Theoretiker der Moderne den Ausdruck ›Entfremdung‹, der den Zustand des einander Fremdgewordenseins der kulturellen Teilbereiche sehr glücklich bezeichnet; dies schließt notwendig die subjektiven Fremdheitserfahrungen der modernen Menschen mit ein. Hegel spricht hier von der »Welt des sich entfremdeten Geistes«, wobei man seinen Geistbegriff getrost mit ›Kultur‹ übersetzen kann, denn er bezeichnet nicht nur das menschliche Bewusstsein, sondern auch seine geschichtlichen und sozialen Existenzbedingungen; Hegel ist kein Spiritualist. Arnold Gehlen sprach einmal von der »Geburt der Freiheit aus der Entfremdung« und erwies sich dabei anders als seine hegelmarxistischen Kritiker als
50
Herbert Schnädelbach
getreuer Hegelianer. Schon für Hegel war evident, dass Entfremdung der Preis der individuellen Freiheit ist, denn nur dort, wo die kulturellen Ausdifferenzierungen und Autonomisierungen stattgefunden und sich in subjektiven Fremdheitserfahrungen bemerkbar gemacht haben, entstehen Handlungsräume für ein selbstbestimmtes persönliches Leben. Alle unsere modernen Freiheiten sind das Resultat der relativen Unabhängigkeit der kulturellen Teilbereiche voneinander. Die Grundrechte beschränken den legitimen Zugriff des politischen Systems, und so sind Meinungs-, Religions-, Wissenschaftsfreiheit oder Freiheit der Kunst zunächst einmal nur negative Freiheiten, also Schutzrechte gegenüber der staatlichen Macht. Ähnliches gilt aber von den Machtansprüchen der anderen gesellschaftlichen Teilsysteme. Die Väter des deutschen Grundgesetzes hatten sich mit Vorschlägen auseinanderzusetzen, nach den Erfahrungen des Nationalsozialismus nun einen christlichen Staat zu errichten, und ich denke, zu unserem Glück sind sie dem nicht gefolgt; denn wir können nicht zurückwollen in ein Gemeinwesen, in dem wieder das religiöse System über das Entscheidungsmonopol für ›richtig‹ oder ›falsch‹ verfügt. In demselben Sinn sind auch die Verrechtlichung, Moralisierung, Ökonomisierung, Verwissenschaftlichung oder Technisierung all unserer Lebensverhältnisse Projekte, die uns Albträume zu bescheren geeignet sind. Die Frage nach dem, was ein auf diese moderne Weise pluralisiertes Gemeinwesen noch zusammenhalten könnte, lässt sich nur mit dem Verweis auf ein fest institutionalisiertes, aber formales Rechtssystem beantworten, wie es die modernen westlichen Verfassungen nach langen Kämpfen mit den prämodernen Autoritäten bereitstellen. Den Nostalgikern der Prämoderne ist das freilich nicht genug, und sie sprechen dann verächtlich von ›Formalismus‹, und zwar so lange, wie ihre ideologischen Machtansprüche hinsichtlich des gesellschaftlichen Ganzen nicht befriedigt sind; in demselben Sinn geißelt der gegenwärtige Papst den modernen »Relativismus«, der für ihn wohl nur in einem katholischen Staat überwunden wäre.
3.3 Das dritte Merkmal der Modernität von Kulturen, die vollständige Reflexivität, kann man erläutern anhand der Tatsache, dass die Menschen, so lange es sie gibt, immer in Kulturen gelebt haben, denn der Mensch »ist von Natur ein Kulturwesen«, so Arnold Gehlen. Die Bibel notiert dies im Mythos des Sündenfalls und der Vertreibung aus dem Paradies, die wohl die eigentliche Menschwerdung bedeutet, denn im Paradies waren nach einem apokryphen Hegelwort nur Gott und die Tiere. Dieser Exodus stellte die Menschen vor die Aufgabe, nun arbeitend für sich selbst zu sorgen und ihre sozialen Probleme eigenständig zu lösen,
Religion in der Moderne – Aspekte und Perspektiven
51
denn die Natur nahm ihnen dies nicht mehr ab. Dass sie immer schon in Kulturen gelebt haben, bedeutet freilich nicht, dass sie dies stets auch gewusst hätten, sondern erst als sie lernten, ihre eigene Lebenswelt von der natürlichen Umgebung zu unterscheiden, nahmen sie sich selbst wahr und zugleich ihr Gegenüber als ein anderes. Diesen Selbstbezug nennen die Philosophen ›Reflexion‹, hier freilich auf eine ganze Kultur bezogen, und dieses Reflexivwerden war die elementare Bedingung für die Unterscheidung von Natur und Kultur. Sie geschah zuerst in mythischer Form. Für die Griechen waren die Naturgewalten, über die die Menschen nicht verfügen konnten, ganz real in der Gestalt von Naturgottheiten. Überhaupt kann man die Naturreligionen als den kulturellen Teilbereich verstehen, in dem es gilt, den Umgang mit dem unverfügbaren Göttlichen zu pflegen, ja zu kultivieren. Es waren dann die Griechen, die die Differenz zwischen dem vertrauten Eigenen und dem »Draußen« auf den Begriff brachten. Das Wort ›phy´sis‹, das wir mit Natur übersetzen, bedeutete jetzt nicht mehr nur die Instanz des Werden und Wachsens im Lebendigen, sondern den Wirklichkeitsbereich, der das Prinzip der Bewegung und Veränderung in sich selbst hat und zu dem man nur eine theoretische Einstellung unterhalten kann. Der Gegenbegriff war dann t anthrûpina (die menschlichen Angelegenheiten), und hier war der Ort der Praxis, des Herstellens und Handelns. Während in der lateinischen Tradition der Ausdruck ›natura‹ mindestens seit Cicero ständig präsent war, verzögerte sich der Auftritt des uns vertrauten Kontrastterminus ›Kultur‹ bis ins 18. Jahrhundert. Die Reflexivität von Kulturen weist Grade auf; sie ist umso höher, je mehr von dem angeblich Natürlichen als ein kulturell Erzeugtes einsichtig wird. Dieser Prozess ist der Kern dessen, was wir ›Aufklärung‹ nennen; Aufklärung ist nichts anderes als die intellektuelle Außenseite des kulturellen Reflexivwerdens. Deutlich greifbar wird dies in der griechischen Sophistik, die damit begann zu fragen, ob wirklich alles, was wir für naturgegeben halten (phy´sei), nicht in Wahrheit auf menschliche Satzung zurückgehe, also nûmo oder th¦sei sei. Die Sophisten bezogen dies nicht nur auf die politischen und rechtlichen Verhältnisse, sondern auch auf die Wissenschaft, die Sprache und nicht zuletzt auf die Religion. Vor allem dadurch galten sie als politisch gefährlich, denn sie griffen damit ja unmittelbar die Legitimitätsgrundlagen der herrschenden Verhältnisse an. Die neuzeitliche Aufklärung in Europa brauchte die von ihren sophistischen Ahnen bereits aufgeworfenen Fragen nur aufzunehmen und zu radikalisieren, um den Prozess des Reflexivwerdens unserer Kultur kräftig voranzutreiben. Das wohl folgenreichste Programm der Aufklärer war die Abkehr vom klassischen und später christianisierten Naturrecht und der Versuch, die Maßstäbe des Gerechten nun im Wesen und in der Natur des Menschen aufzusuchen; nur diejenige Herrschaftsordnung konnte demzufolge als gerecht gelten, die im Prinzip die Zustimmung der Betroffenen im Sinn ihres vernünftigen Selbstin-
52
Herbert Schnädelbach
teresses zu gewinnen und zu erhalten vermag. (Dies ist der rationale Kern der Staatsvertragstheorien, die bis heute als mythisch und unhistorisch kritisiert werden.) Dieser Übergang kann als Modell dafür gelten, was vollständige Reflexivität bedeutet: Jetzt kann eine Kultur nicht länger ihre Grundlagen in einem Bereich aufsuchen, der nicht mehr zur Kultur gehörte, sondern sie muss sie in sich selbst auffinden, ganz auf sich gestellt. Was das für Recht, Moral und Politik bedeuten musste, wurde sehr bald deutlich: Nicht nur der herkömmlichen, mit christlicher Theologie verschränkten Metaphysik, sondern vor allem der Religion wurde die Rolle der Legitimierung der herrschenden normativen Verhältnisse streitig gemacht; hier entstanden die Ideen des Vernunftrechts, der Eigenständigkeit des Moralischen und des säkularen Staates. Diese Dezentrierung der Religion wurde kräftig verstärkt durch die aufklärerische Religionskritik, die ständig vermeintlich unverzichtbare Elemente der Offenbarungsreligion als menschliche Machwerke entlarvte und schließlich bei Ludwig Feuerbach ihren ersten Höhepunkt erreichte mit der These, dass nicht der Mensch das Geschöpf Gottes sei, sondern Gott ein Geschöpf des Menschen.
4. Das vollständig-Reflexivwerden unserer Kultur setzte sich auch in den Beziehungen der anderen kulturellen Teilbereiche untereinander fort, denn keiner von ihnen konnte danach noch auf eine besondere, transzendente Legitimitätsgrundlage verweisen. Wenn für Recht, Moral und Politik ausschließlich kulturimmanente Kriterien gelten, besteht kein vernünftiger Grund mehr, diese Bereiche der Autorität der Religion zu unterstellen; die Konsequenz ist die Idee der Religionsfreiheit im doppelten Sinn: der Freiheit des Politischen von religiöser Bevormundung, aber auch umgekehrt der Religion von politischer Bevormundung. Dasselbe gilt für die Freiheit von Wissenschaft und Kunst, ja sogar für die Meinungs- und Redefreiheit, die der moderne Staat nicht kassieren kann, ohne seine Legitimation im vernünftigen Eigeninteresse seiner Bürger zu verlieren. Wenn in keinem der kulturellen Teilbereiche noch etwas bestimmend ist, was nicht selbst kulturell wäre, dann hat das vollständig-Reflexivwerden der Kultur die unhintergehbare Pluralität herbeigeführt, die oben als zweites Merkmal kultureller Modernität illustriert wurde. Jetzt entsteht die Aufgabe, eine umfassende Ordnung zu finden, die den Zusammenhalt des kulturellen Ganzen sichert, ohne die Eigenrechte der Teilbereiche wesentlich zu beeinträchtigen, und die hat der moderne Verfassungsstaat in einer säkularen, aber formalen Rechtsordnung gelöst – im Prinzip jedenfalls. Die Verfassungsordnung und die Gesetze, die von ihr ihre Legitimität beziehen, schränken die Grundfreiheiten nur innerhalb des Rechtsgehorsams ein, und tatsächlich können un-
Religion in der Moderne – Aspekte und Perspektiven
53
sere Grundrechte nur auf der Grundlage verfassungskonformer Gesetze eingeschränkt werden. Die Meinungsfreiheit endet dort, wo das Strafrecht beginnt; die Wissenschaftsfreiheit entbindet nicht von der Verfassungstreue, oder die Religionsfreiheit rechtfertigt nicht die Weigerung, Kinder in öffentliche Schulen zu schicken. In soziologischer Hinsicht führt das vollständig-Reflexivwerden einer Kultur auch zu einer Veränderung ihrer sozialen Struktur. Prämoderne Gesellschaften sind wesentlich hierarchisch gegliedert, und sie folgen dabei in der Regel der normativen Rangordnung ihrer Klassen und Schichten. (Als Kinder sagten wir : »Kaiser, König, Edelmann, Bürger, Bauer, Bettelmann«.) Dezentrierung, Pluralisierung und vollständige Reflexivität tendieren zusammengenommen dazu, der hierarchischen Gesellschaftsordnung nicht nur ihre Legitimität, sondern vor allem ihren Nutzen für das soziale Ganze zu bestreiten; sie passt einfach nicht mehr in die Moderne. Die Alternative ist die moderne, funktional differenzierte Gesellschaft (Luhmann), in der die sozialen Teilsysteme nicht nur relativ autonome Funktionen wahrnehmen, sondern genau dadurch zum Funktionieren des sozialen Ganzen beitragen.
5. Dezentrierung, Pluralisierung und vollständige Reflexivität der modernen Kultur konnten die Religion als eines ihrer Teilsysteme nicht unberührt lassen; die gesamtkulturelle Modernisierung musste sich somit auch in ihrem eigenen Bereich durchsetzen.
5.1 In der Moderne fand sich die Religion schließlich als Teilsystem innerhalb einer säkularen Rechtsordnung wieder. Gegen diese Dezentrierung leistete die Religion in Europa hinhaltenden Widerstand, und damit gegen die Einsicht, nun nicht länger über das Definitionsmonopol der für alle verbindlichen normativen Ordnung zu verfügen; hier halten die Rückzugsgefechte bis in unsere Tage an. Zugleich musste sich die Religion in der Moderne damit abfinden, dass es auch andere Formen des religiösen Lebens gibt, die sie nicht mehr wie das Christentum bis ins späte Mittelalter oder der Islam bis heute als Götzendienst oder Gottlosigkeit abtun kann. Erst im 14. Jahrhundert bürgerte sich die Rede von Religionen im Plural ein, was begriffsgeschichtlich dokumentiert, dass man im Abendland bereit geworden war, die anderen Glaubenssysteme – vor allem den
54
Herbert Schnädelbach
Islam – ebenfalls als Religionen zu akzeptieren, wenn auch nicht als gleichberechtigte Alternativen. In der Moderne muss sich die Religion damit abfinden, in der funktional differenzierten Gesellschaft ein Funktionsträger unter anderen zu sein. Dies bedeutet nicht notwendig ihr Verschwinden, das ihr von bestimmten Modernisierungstheoretikern nachgesagt wurde, wohl aber den Zwang, sich auf das ihr Eigene zu besinnen und von ihren traditionellen Totalitätsansprüchen abzulassen. Hier ist Friedrich Schleiermacher zu erwähnen, der als der wohl erste moderne Theologe auf der Eigenart des Religiösen bestand und in diesem Bereich den Verzicht auf metaphysische und moralische Geltungsansprüche forderte. Die Theologie als die denkende Beschäftigung mit dem Glauben hat demzufolge nichts mehr beizutragen zur theoretischen Welterklärung und auch nicht zur Moralbegründung, denn Wissenschaft und Moral stehen auf eigenen Füßen und bedürfen des Religiösen nicht als Fundament. Diese Autonomisierung der Religion ist auch bei uns längst nicht allgemein akzeptiert. Nicht wenige Christen, vor allem in den USA, sehen in der Schöpfungstheologie eine Alternative zur Evolutionslehre, die ja längst auch die Evolution des Universums einschließt. Noch weiter verbreitet ist die Meinung, ohne Gott sei alles erlaubt, weil es ohne seine Gebote keine Moral geben könne.
5.2 Diese externe Pluralisierung des Religiösen blieb nicht folgenlos für die innere Struktur des Christentums als des bis dahin verbindlichen religiösen Systems, und die damit verbundene interne Pluralisierung war ein mühsamer und opferreicher Prozess. Der setzte ein, als es der katholischen Kirche nicht mehr gelang, die von ihr als ketzerisch angesehenen Reformbewegungen institutionell zu integrieren oder gewaltsam zu vernichten; die konfessionelle Spaltung durch die Reformation war die Folge, und die sollte sich dann innerhalb der reformatorischen Bewegung selbst fortsetzen. Erst das Ende der schrecklichen konfessionellen Bürgerkriege schaffte Raum für die Religionsfreiheit – zuerst im Sinn der Befugnis der Monarchen, die Konfession der Untertanen festzusetzen (cuius regio eius religio), dann aber auch als Toleranz unterschiedlicher Konfessionen im jeweiligen Territorium, was schließlich nach vielen Rückschlägen dazu führte, die Gewährung der Bürgerrechte nicht länger von der konfessionellen Bindung des Einzelnen abhängen zu lassen. Zudem fiel es den einzelnen Konfessionen schwer, die jeweils Andersgläubigen als wahre Christen zu respektieren; die Grenzen der christlichen Ökumene wurden erneut sichtbar, als Papst Benedikt XVI. dekretierte, es gebe nur eine wahre Kirche, nämlich seine, und alles Übrige seien nur christliche Religionsgemeinschaften.
Religion in der Moderne – Aspekte und Perspektiven
55
5.3 Nicht nur die externe und interne Pluralisierung, sondern auch der Prozess des Reflexivwerdens der Kultur schließlich, an dessen Ende die vollendete Modernität steht, setzte sich notwendig auch innerhalb des kulturellen Teilsystems ›Religion‹ durch. Angelegt war dieser Vorgang bereits in den Anfängen des Christentums, das sich in der hellenistischen Vielfalt der Religionsangebote nur dann durchsetzen konnte, wenn es sich auf diesem Markt der Konkurrenz gewachsen zeigte. Dies zwang zur Ausbildung einer Theologie im Sinn einer rationalen Beschäftigung mit dem Geglaubten, und dies sowohl zum Zweck der Selbstverständigung wie zur Apologie nach außen. Diese Kultur der kritischen Reflexion hat unter den Offenbarungsreligionen nur das Christentum ausgebildet, und der Preis dafür war der Import der gängigen Philosophie – vor allem des Stoizismus und des Neuplatonismus – der schließlich bei Augustinus zu einer engen Verklammerung von Theologie und Metaphysik in einer allumfassenden scientia christiana führte. Erst im Hochmittelalter traten beide Diskurse so weit auseinander, dass die Differenz zwischen Theologie und Philosophie auch terminologisch fassbar wurde. Zugleich entstand dadurch mit der Philosophie der Theologie eine Gegenmacht, die im Aufklärungszeitalter die Tradition der rationalen Religionskritik vorantrieb. Dass die wissenschaftliche Theologie des 19. Jahrhunderts dieses Programm schließlich zu ihrer eigenen Sache machte, kann man nicht als einen Import der Aufklärung in einen bis dahin gehegten Raum verstehen, sondern die christliche Theologie als die Reflexionsform des Glaubens war ja seit den Anfängen Aufklärung gewesen, und dadurch wurde sie gegen alle institutionellen Beharrungskräfte selbst zu einem Motor des gesamten abendländischen Aufklärungsprozesses. Es war nicht zuletzt die spezifisch christliche Festlegung des Glaubens auf Freiheit und Wahrheit, die es nicht erlaubte, diesen Vorgang aus Gründen kirchlicher Machterhaltung auf Dauer stillzustellen. Im Zeitalter des Historismus konnte es nicht ausbleiben, die textliche und dogmatische Überlieferung des Christentums mit den modernen historischen und hermeneutischen Verfahren zu untersuchen, und zwar mit Ergebnissen, die das naive fromme Gemüt notwendig als Zerstörung seines Glaubens fürchten musste. Dieses Reflexivwerden des Christentums tendiert seitdem dazu, vollständig zu werden, weil es hier immer schwieriger wird, das proprium des Glaubens gegenüber der wissenschaftlichen Reduktion auf rein innerkulturelle Bedingungen zu isolieren. Wo dies nicht mehr gelingt, vermag die Theologie nicht mehr von Gott zu reden, sondern nur vom faktischen Glauben an ihn, wie sie ihn in der kulturellen Umwelt vorfindet. Diesen Rückzug in die Religionswissenschaft hat die protestantische Theologie schon weitgehend vollzogen, und dies nicht deswegen, weil sie durch äußere Faktoren dazu genötigt worden wäre; eine solche
56
Herbert Schnädelbach
Theologie ohne Gott ist der Preis für die sich vollbringende Aufklärung im religiösen Bereich. So hat Friedrich Nietzsche schlicht recht, wenn er behauptet, »der unbedingte redliche Atheismus« sei »ein endlich und schwer errungener Sieg des europäischen Gewissens, […] der folgenreichste Akt einer zweitausendjährigen Zucht zur Wahrheit, welche am Schlusse sich die Lüge im Glauben an Gott verbietet […] Man sieht, was eigentlich über den christlichen Gott gesiegt hat: die christliche Moralität selbst, der immer strenger genommene Begriff der Wahrhaftigkeit, die Beichtväter-Feinheit des christlichen Gewissens, übersetzt und sublimiert zum wissenschaftlichen Gewissen, zur intellektuellen Sauberkeit um jeden Preis.«2
6. Es bleibt anzumerken, welche Folgen die Dezentrierung, Pluralisierung und Reflexivität der Religion nicht nur in deren eigenem Umfeld, sondern auch am Orte des religiösen Individuums hervorbrachte.
6.1 Unsere Tradition ist gekennzeichnet durch einen ständigen Trend zur Subjektivierung des Religiösen, der sich anhand des geschichtlichen Wandels des Religionsbegriffs aufweisen lässt. Bei Cicero und den Kirchenvätern steht ›religio‹ durchweg für den objektiven religiösen Bestand, sei es des Kultus oder der Lehre; das subjektive Gegenstück vertreten die Begriffe ›pietas‹ und ›fides‹; erst in der Scholastik erscheint ›religio‹ auch als die Tugend des gläubigen Individuums. Zwar spricht Luther immer wieder vom Christentum als »unserer Religion«, aber in Wahrheit setzt er die vollständige Subjektivierung der Religion mit seiner Lehre durch, dass nicht mehr die Kirche, sondern der einzelne Glaubende der Ort ist, an dem das spezifisch Religiöse stattfindet – oder eben nicht stattfindet. Das bezeugt Martin Luthers Erklärung der zweiten Bitte des Vater Unser : »Dein Reich komme. Was ist das? Gottes Reich kommt wohl ohne unser Gebet von sich selbst; aber wir bitten in diesem Gebet, dass es auch zu uns komme.« Angelus Silesius dichtet: »Wär’ Christus tausendmal zu Bethlehem geboren, / doch nicht in dir : du bliebst noch ewiglich verloren.« Diese Subjektivierung des christlichen Glaubens bedeutet freilich nicht, dass in den Kirchen der Reformation die objektiven Elemente der Religion – Institution, Tradition sowie Dogmen- und 2 Nietzsche, Friedrich: Idyllen aus Messina. Die fröhliche Wissenschaft. Nachgelassene Fragmente. Frühjahr 1881 bis Sommer 1882 (=KGW V/2). Berlin/New York 1973. § 357.
Religion in der Moderne – Aspekte und Perspektiven
57
Lehrbestand – ganz verschwunden wären, aber sie mussten sich daran messen lassen, ob sie den wahren Glauben ermöglichen oder behindern, und demgemäß wollte man den kirchlichen Reformbedarf feststellen. Dieses Subjekt der reformatorischen Frömmigkeit war freilich zunächst noch sehr gleichförmig und ließ wenig Spielraum für persönliche Unterscheidung. Die Erfordernisse einer institutionellen Sicherung des reformatorischen Erbes hatten unvermeidlich zu einer Kollektivierung der gläubigen Subjektivierung geführt, und dies nicht nur durch die katechetische Lehre, sondern auch durch die Kirchenlieder, die zwar ständig das Ich-Sagen einüben, aber eben doch in einer standardisierten Weise; Beispiele dafür findet man vor allem in den Bachschen Passionen. So versteht man, warum es in den Kirchen der Reformation so leicht war, auf einer solchen kollektiven Ich-Identität eine neue Orthodoxie aufzubauen; das Prinzip ›sola scriptura‹, das in der Ablösung vom Katholizismus die subjektive Befreiung von der Übermacht der Tradition und der historisch gewachsenen Hierarchie voranzutreiben vermochte, erwies sich bald als problematische Stütze einer wiederkehrenden repressiven Kirchlichkeit.
6.2 Die reformatorische Subjektivierung, die sich in einer objektivistischen Sackgasse zu verlieren drohte, wurde im 18. Jahrhundert überboten durch das, was man die Individualisierung der Religion nennen sollte, und zwar vor allem durch den Pietismus. Hier erst wird der Glaube zu einer wirklich persönlichen Angelegenheit mit individuellen, von den Amtskirchen nicht länger normierten Glaubenserfahrungen. Das Extrem bildeten hier die Quäker aus, deren Gottesdienste auf alles Rituelle verzichten und nur von den jeweiligen Glaubenszeugnissen der Gemeindeglieder leben. Auch die pietistische Frömmigkeit war nicht davor gefeit, orthodox zu werden; wer in diesem Umfeld groß geworden ist, weiß von den geradezu unglaublichen konformistischen Zwängen zu berichten, die sich dort zuweilen bemerkbar machten. Im Prinzip galt dann: Der pietistisch Gläubige soll schon Individuum sein und eine ganz persönliche Beziehung zu Gott unterhalten, aber die hat so auszusehen wie die aller anderen Individuen. Bekehrungen hatten nach dem Schema »Sünde – Buße – Wiedergeburt« zu erfolgen, oder sie hatten eben nicht stattgefunden. Die Erweckungsbewegung seit der Mitte des 19. Jahrhunderts machte daraus eine wahre Industrie, die als revivalism auch heute noch weltweit tätig ist; der in jüngster Zeit bekannteste Unternehmer in diesem Marktsektor war Billy Graham und das prominenteste Produkt George W. Bush.
58
Herbert Schnädelbach
6.3 Die Individualisierung der Religion ist eine Tatsache, an der sich die Folgen der Modernisierung für die individuelle Lebensgestaltung genau ablesen lassen. Die gesellschaftliche Dezentrierung der Religion und das plurale Nebeneinander der verschiedenen kulturellen Teilbereiche stellt für den Einzelnen eine erhebliche Anforderung dar, denn als modernes Kulturwesen muss er sich in diesem unübersichtlichen Gelände orientieren und in sehr verschiedenen Rollen tätig sein, um am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können; von den damit verbundenen subjektiven Belastungen war schon die Rede. Was die Religion betrifft, so wird es in der Moderne immer unwahrscheinlicher, dass der Einzelne ein im Religiösen zentriertes Leben führen kann; nur exklusiven Minderheiten wie Priestern oder Ordensleuten mag dies noch offenstehen. Zugleich hat sich die kulturelle Pluralisierung im religiösen Bereich selbst durchgesetzt, so dass sich der Glaubensbereite einem breiten Angebot gegenübersieht, aus dem er sich bedienen kann. Die individualisierte Religion wird dadurch zu einer privaten Baustelle, auf der Patchwork-Religionen entstehen, ganz nach den persönlichen Bedürfnissen des Einzelnen. Dabei werden häufig nicht nur christliche Konfessionsgrenzen, sondern auch interreligiöse Barrieren überschritten. Erst an dieser Stelle sollte man von Privatisierung der Religion sprechen; sie ist eine Steigerungsform der religiösen Individualisierung.
6.4 Begriffsgeschichtlich ist dieser Prozess greifbar in der Konjunktur des Begriffs ›Religiosität‹ seit dem 19. Jahrhundert. Nicht die Eigenschaft ist hier gemeint, die Kunst, Literatur oder Philosophie zu etwas Religiösem macht, sondern eine subjektive Empfänglichkeit oder Sensibilität für die religiösen Gehalte; seit Max Weber und Jürgen Habermas spricht man hier auch von »Musikalität«. Religiosität in diesem ganz unbestimmten Sinn wird in unserer Kultur immer noch positiv bewertet, während den »religiös Unmusikalischen« droht, in die Nähe der kulturlosen Atheisten gerückt zu werden. Die Ausflucht, an dieser Stelle Agnostiker zu sein, ist da kein Ausweg, denn die Verteidiger der Religiosität sind in der Regel davon überzeugt, dass diese Eigenschaft zu den anthropologischen Konstanten gehöre, was bedeutet, dass den Nichtreligiösen etwas fehle, was in Wahrheit zu ihrem vollständigen Menschsein gehöre. Dann wird meist auch behauptet, alle Menschen seien religiös, aber nicht allen sei dies bewusst. In der Religiosität, die häufig auch als Spiritualität angesprochen wird, sind alle konkreten Inhalte wirklich gelebter Religion zu einem abstrakten Begriffsnebel verdampft, dessen Undurchsichtigkeit über die Befürchtung hinwegzuhelfen
Religion in der Moderne – Aspekte und Perspektiven
59
geeignet sind, es könnte in der Moderne doch einmal mit der Religion zu Ende gehen. Ein weiterer Vorteil ist, dass von niemandem, der sich in diesem Sinn als religiös outet, erwartet wird, dass er über die Inhalte seines persönlichen Glaubens Auskunft gibt, und in der Tat meinen wir, dass uns jemand zu nahe tritt, wenn er uns danach fragt; die Privatisierung der Religion ist hier so weit gesteigert, dass sie nun als etwas Intimes gilt. Roland Werneck sagt dazu: »Wir sind es […] nicht gewohnt, offen über Religion zu reden. Für manche ist dieses Thema noch intimer als Sexualität oder die Frage nach der Höhe des Gehaltes. Es gibt sicher gute Gründe über Religion nicht öffentlich sprechen zu wollen. Niemand will sich gerne in den Fragen des Glaubens etwas dreinreden lassen.«3 Hinter diesem Vorhang vor dem Privaten können wir auch ohne Einzelnachweise am allgemeinen Sozialprestige des Religiösseins teilhaben.
7. Ich hatte versprochen, auch etwas über die Perspektiven der Religion in der Moderne zu sagen, und dem möchte ich wenigstens in einem Schlussabschnitt nachkommen. Alles was über Religion in der Moderne gesagt wurde, gilt nur für Westeuropa und mit starken Einschränkungen für die USA und Canada, aber keineswegs weltweit. Wir leben hierzulande auf einer Insel, umgeben von einem Meer intensiver und ständig zunehmender Religiosität, wobei die Ablehnung der westlichen Moderne eine bedeutende Antriebskraft ist. Darum sollten wir uns hier an Max Weber erinnern, der sich darauf beschränkte, den Prozess der abendländischen Rationalisierung und Modernisierung zu rekonstruieren; eine universale Modernisierungstheorie wollte er nicht formulieren. Wenn wir auf dieser Basis ein idealtypisches Modell von kultureller Modernität entwerfen, dürfen wir nicht vergessen, dass es sich um unser Modell handelt, das seine Plausibilität aus unseren westeuropäischen Erfahrungen bezieht. Modernisierungsprozesse können auch ganz andere Wege einschlagen, wie uns die Beispiele Japan oder China demonstrieren, und deswegen werden sich auch die Fragen nach der Religion anders stellen. Also: Was wird bei uns aus der Religion? Sie wird immer mehr zu dem werden, was sie jetzt schon weitgehend ist – Privatsache. Die Privatisierung der Religion, die dazu führt, das sie dazu wird, ist aber »aufs Ganze gesehen, keine Privatsache«, sondern »eine der Konsequenzen des Umbaus der Gesellschaft in Richtung auf ein primär funktional differenziertes System […] Für den Religi3 Werneck, Roland: »Meine Religion ist Privatsache!«, in: ORF Regionalradios: Morgengedanken, 12. Juni 2006. (Text verfügbar unter http://religionv1.orf.at/projekt03/tvradio/ra_ morgen/ra_mor060611.htm [12. 12. 2012])
60
Herbert Schnädelbach
onsbereich bedeutet Privatisierung, dass die Beteiligung an geistlicher Kommunikation (Kirche) ebenso wie das Glauben des Glaubens zur Sache individueller Entscheidung wird, dass Religiosität nur noch auf der Grundlage individueller Entscheidungen erwartet werden kann, und dass dies bewusst wird. Während vordem Unglaube Privatsache war, wird jetzt Glaube zur Privatsache.«4 Darum ist zu erwarten, dass sich der Ort wirklich gelebter Religion immer stärker von den Institutionen des verfassten Christentums hin zur individuellen Lebenspraxis verlagern wird, wo sie freilich nur einen immer begrenzteren Lebensbereich abdecken kann. Die katholische Ekklesiologie steht dem freilich hartnäckig entgegen, aber ich meine, dass sie im europäischen und nordamerikanischen Katholizismus auf die Dauer den Trend zur Privatisierung der Religion bestenfalls verlangsamen, aber nicht definitiv stoppen kann. Der Protestantismus ist da schon viel weiter, weil moderner, denn er hatte ja selbst als ein starker Motor der westlichen Modernisierung gewirkt. Auch seine Kirchenstruktur ist modern, während die katholische Kirche mit ihrer strikt hierarchischen Verfassung in der Prämoderne verharrt. Ich glaube, man irrt sich nicht vollständig, wenn man erwartet, dass der Katholizismus immer protestantischer wird, und dies vor allem in der Lehre; hier ist die theologische Aufklärung bereits so weit fortgeschritten, dass höchstens noch auf der dogmatischen Ebene wirkliche Kontroversen zwischen katholisch und protestantisch stattfinden. Die werden sich freilich in dem Maße weiter abschwächen, in dem im Zuge der internen Pluralisierung des Protestantismus sich seine traditionellen Lehrbestände immer weiter auflösen, was zur Folge hat, dass die dogmatischen Konturen und damit die Profile dessen, was eigentlich genuin protestantisch sei, ständig an Deutlichkeit verlieren. Hinzu kommt, dass hierdurch die Renaissance der liberalen Theologie die Grenzen zwischen Theologie und Religionswissenschaft sich als immer durchlässiger erweisen, und sich die Frage stellt, welchen Sinn es noch macht, wissenschaftlich von Gott zu reden und nicht bloß über den vorhandenen Glauben an ihn. »Theologie als Kulturwissenschaft des Christentums« (Rendtorff) – ist das die Wissenschaft, die der Religion den Weg in die Zukunft weist? Dies alles ist nicht ohne Risiko. Es ist nicht zu sehen, wie ohne eine Theologie im Sinn einer wissenschaftlichen Rede von Gott die institutionellen Bedürfnisse der noch vorhandenen Kirchlichkeit befriedigt werden sollen. Was soll ein ausschließlich religionswissenschaftlich gebildeter Pfarrer denn predigen? Kann er ohne sacrificium intellectus noch beten? Nach meiner Kenntnis leben die meisten protestantischen Pfarrer mit einem oft schmerzlichen Spagat zwischen ihrer theologischen Bildung und dem, was sie mit gutem Gewissen ihren Gemeinden zumuten können. Die junge Generation der Theologiestudenten 4 Luhmann, Niklas: Funktion der Religion. Frankfurt a. M. 1982. S. 238.
Religion in der Moderne – Aspekte und Perspektiven
61
scheint sich vielfach schon darauf einzustellen; sie werden anscheinend immer frommer, konzentrieren sich auf den Pfarrerberuf, der es mit Frommen zu tun hat, und nehmen die wissenschaftliche Ausbildung als unvermeidliches Übel in Kauf. Wirklich bedenklich wird es freilich, wenn Menschen mit religiösen Bedürfnissen die Flucht aus der Moderne ergreifen, wie es in Nordamerika ständig geschieht und was sich auch bei uns ereignet; der theologische Fundamentalismus ist keine akzeptable Antwort auf die Herausforderungen der Religion in der Moderne, sondern deren Zerstörung.
8. An dieser Stelle bin ich dankbar, dass für mich als einem Philosophierenden dies alles nicht mein Problem ist. Als frommer Atheist, der mit der Religion sympathisiert und ihren Weg in der Moderne aufmerksam begleitet, kann ich nur wünschen, dass meine geäußerten Befürchtungen sich letztlich als unberechtigt erweisen.
Literaturverzeichnis Luhmann, Niklas: Funktion der Religion. Frankfurt a. M. 1982. Nietzsche, Friedrich: Idyllen aus Messina. Die fröhliche Wissenschaft. Nachgelassene Fragmente. Frühjahr 1881 bis Sommer 1882 (=KGW V/2). Berlin/New York 1973. Schnädelbach, Herbert:Religion in der modernen Welt. Frankfurt a. M. 2009. Werneck, Roland: »Meine Religion ist Privatsache!«, in: ORF Regionalradios: Morgengedanken, 12. Juni 2006, verfügbar unter : http://religionv1.orf.at/projekt03/tvradio/ ra_morgen/ra_mor060611.htm [12. 12. 2012].
Hans Schelkshorn
Der schmale Grat einer Versöhnung von kritischer Vernunft und Religion. Überlegungen zu Herbert Schnädelbachs Thesen über »Religion in der Moderne«
In den letzten Jahren hat sich Herbert Schnädelbach mit mehreren Essays gegen den Mainstream der aktuellen Religions-Debatte gestellt.1 So sieht Schnädelbach in der zuweilen lautstark verkündeten These von der »Wiederkehr der Religion« primär ein Phänomen der modernen Erlebniskultur, das durch einige spirituelle Angebote bloß erweitert wird.2 Umgekehrt fühlt sich Schnädelbach durch den kämpferischen Atheismus Dawkins oder der Giordano-Bruno-Stiftung »ins 19. Jahrhundert zurückversetzt.«3 Gegenüber den dominanten Strömungen der aktuellen Religionssoziologie, in denen nach der Abkehr von der evolutiven Fortschrittsidee religiös fundierte Gesellschaften plötzlich als Normalfall der Menschheitsgeschichte qualifiziert werden, verteidigt Schnädelbach das säkulare Europa als einen positiven Sonderfall. Mehr noch: Angesichts des Anwachsens fundamentalistischer Bewegungen in und außerhalb Europas stünden die »Verteidiger der Aufklärung« wie im 17. und 18. Jahrhundert »einer Front gegenüber, die sich im Zeichen ›wahrer‹ Religion ihrem Projekt entgegenstellt; das Thema ›Religionskritik‹ gewinnt so eine neue und zunächst ganz unerwartete Aktualität.«4 Schließlich grenzt sich Schnädelbach auch von den religionstheoretischen Arbeiten des späten Habermas deutlich ab. »Habermas’ Befürchtung, unsere Sinnressourcen könnten im Zuge der Aufklärung versiegen, teile ich nicht; die Quellen unserer religiösen Vergangenheit sprudeln nicht mehr.«5 Darüber hinaus liegen, wie Schnädelbach in der vieldiskutierten Streitschrift »Der Fluch des Christentums« herausgestellt hat, in der christlichen 1 Vgl. dazu vor allem Schnädelbachs Aufsatzsammlung: Religion in der modernen Welt. Vorträge, Abhandlungen, Streitschriften. Frankfurt a. M. 32005 (im Folgenden abgekürzt RW). 2 Vgl. dazu Schnädelbach: RW. S. 132: »Wiederkehr der Religion ist bestenfalls die Wiederkehr eines religiösen Bedürfnisses. Nicht die Religion kehrt zurück und ergreift die Menschen, sondern die Menschen greifen nach etwas, was sie für das Religiöse halten; sie spüren ein Vakuum und möchten es aufgefüllt sehen.« 3 Schnädelbach: RW. S. 53. 4 Schnädelbach: RW. S. 12. 5 Schnädelbach: RW. S. 127.
64
Hans Schelkshorn
Tradition äußerst problematische Sinnhorizonte bereit, die keinesfalls zu übersetzen oder zu beerben, sondern endlich abzustreifen seien. Der Abschied vom Christentum sollte nicht allzu schwer fallen, da nach Schnädelbach »das verfasste Christentum sein tatsächliches Ende längst hinter sich hat, aber ohne dies bemerkt zu haben.«6 Die Gründe für das Ende institutionell verfasster Religion und das Versiegen religiöser Quellen liegen, wie Schnädelbach in dem vorliegenden Beitrag »Religion in der Moderne« nochmals zusammenfassend klarstellt7, in der aktuellen Konstellation der Moderne. Die christliche Religion war zwar nach Schnädelbach in Europa über lange Zeit hinweg ein Promotor von Aufklärungsprozessen; seit Kant und der historischen Wende der Aufklärung ist jedoch – darin sehe ich die zentrale Pointe von Schnädelbachs religionsphilosophischen Reflexionen – eine Situation entstanden, in der zumindest nicht mehr ersichtlich ist, wie Vernunft und Religion noch organisch miteinander verbunden werden können. Schnädelbach legt ohne Zweifel den Finger auf offene Wunden im Verhältnis zwischen Religion und säkularer Moderne. Auch wenn es in diesem sensiblen Feld keine einfachen Antworten gibt, möchte ich im Folgenden zumindest den Versuch wagen, einen zwar schmalen, aber doch tragfähigen Grat einer Versöhnung zwischen neuzeitlicher Vernunft und Religion grob zu skizzieren. Dabei werde ich in zwei Schritten vorgehen. In einer ersten Überlegung sollen gegenüber Schnädelbachs Theorie der Moderne einige Differenzierungen eingebracht werden, die mir im Hinblick auf die Zukunft von Religion bedeutsam zu sein scheinen. In einem zweiten Schritt möchte ich auf Schnädelbachs These näher eingehen, wonach neuzeitliche Rationalisierungsprozesse zu einer Privatisierung und letztlich zu einer religionswissenschaftlichen Selbstauflösung von Religion führen.
6 Schnädelbach: RW. S. 173. 7 In diesem Beitrag, der im Folgenden ohne bibliografischen Hinweis zitiert wird, fasst Schnädelbach die zentralen Thesen der ersten beiden Aufsätze des Sammelbandes RW zusammen, nämlich »Aufklärung und Religionskritik« (S. 11– 34) und »Religion und kritische Vernunft« (S. 35 – 51). In beide Texte fließen wiederum frühere Studien zur Moderne und ihren spezifischen Rationalitätsformen ein.
Der schmale Grat einer Versöhnung von kritischer Vernunft und Religion
1.
Vollständige Reflexivität als Idealtypus »vollendeter Modernität«?
1.1
Zum Begriff der »Moderne«
65
Eine philosophische Theorie der Moderne kann sich – so Schnädelbach in sachlicher Nähe zu Habermas8 – nicht auf soziologische Deskriptionen oder narrative Rekonstruktionen beschränken, sondern muss auf der Basis einer bestimmten Rationalitätstheorie einen normativen Begriff der Moderne ausarbeiten, in dessen Licht geschichtliche Prozesse überhaupt erst »als Modernisierungen identifizierbar« werden. Mit dem Begriff der »Moderne« soll folglich weder die jeweilige Gegenwart noch eine bestimmte Epoche, sondern ein idealtypischer »Zustand« beschrieben werden, »in dem sich eine Kultur befindet, aber den sie auch wieder verlieren kann, wenn sie in die Prämoderne zurückfällt.« Dies bedeutet: »Der geschichtliche Epochenbegriff der Moderne setzt einen kulturtheoretischen Strukturbegriff voraus – und nicht umgekehrt.«9 In inhaltlicher Hinsicht bestimmt Schnädelbach das Wesen der »Moderne« mit Max Weber als einen Prozess der »Ausdifferenzierung und Autonomisierung der Weltbilder und Lebensformen«, die nicht mehr durch die Religion, sondern durch eine säkulare Rechtsordnung zusammengehalten werden. »Dezentrierung« und »Pluralität« sind folglich konstitutive Merkmale des normativen Begriffs der Moderne. Die humanitätsverbürgende Balance funktional differenzierter Gesellschaften ruht nach Schnädelbach im Wesentlichen auf zwei Säulen, die sowohl gegenüber einem religiösen als auch einem säkularen Integralismus zu verteidigen sind, nämlich der relativen Autonomie der Teilsysteme und der Substitution transzendenter Sinnhorizonte durch kulturimmanente Codes. Das Gleichgewicht zwischen den Teilsystemen ist, wie Schnädelbach selbst andeutet, im postreligiösen Europa heute wohl weniger durch die Religion als durch »imperialistische« Dynamiken des ökonomischen und wissenschaftlich-technischen Systems gefährdet. In einer globalen Perspektive stellt allerdings das Erstarken autoritärer und fundamentalistischer Gestalten von Religion tatsächlich ein nicht zu unterschätzendes Bedrohungspotential dar. Vor diesem Hintergrund ergeben sich für Schnädelbach die drei zentralen Merkmale der Moderne: Dezentrierung, Pluralität, vollständige Reflexivität. 8 Zum philosophischen Begriff der »Moderne« vgl. dazu vor allem Schnädelbach, Herbert: »Gescheiterte Moderne?«, in: ders.: Zur Rehabilitierung des animal rationale. Vorträge und Abhandlungen 2. Frankfurt a. M. 1992. S. 431 – 446; ders.: Philosophie in der modernen Kultur. Abhandlungen und Vorträge 3. Frankfurt a. M. 2000; hier ist im Besonderen auf die Beiträge »Philosophie in der modernen Kultur« (S. 9 – 27) und »Kant – der Philosoph der Moderne« (S. 28 – 42) zu verweisen. 9 Schnädelbach: Philosophie in der modernen Kultur. S. 33.
66
Hans Schelkshorn
Gewiss: »Dezentrierung« und »Pluralität« sind in sachlogischer Form mit der funktionalen Differenzierung moderner Gesellschaften verbunden. Kritische Rückfragen provoziert hingegen das Merkmal der »vollständigen Reflexivität«, mit dem Schnädelbach den Begriff der Moderne mit einer einlinigen Rationalisierungsidee zu belasten droht, in der trotz aller Abgrenzungen noch die evolutive Fortschrittsidee der Aufklärung in problematischer Weise nachwirkt. Denn das Modell der vollständigen Reflexivität stellt die Theorie der funktionalen Differenzierung, die in der Gegenwartsphilosophie beinahe zu einem Shiboleth geworden ist, mit dem gleichsam mit einem Schlag die Komplexität moderner Gesellschaften überblickt werden kann, von vornherein in den Horizont fortschreitender Rationalisierung. Die Ausdifferenzierung und Konstitution moderner Wissenschaft, Politik, Wirtschaft oder Kunst folgt jedoch keineswegs der simplen Logik der Ersetzung transzendenter durch kulturimmanente Kriterien. Vielmehr sind bereits in den frühneuzeitlichen theoretischen Grundlegungen der einzelnen Teilbereiche moderner Gesellschaften jeweils rationale Momente mit kulturbedingten, zuweilen sogar irrationalen Motiven amalgamiert.10 So verbindet etwa Francis Bacon die Idee einer experimentellen Naturwissenschaft, die ohne Zweifel einen epochalen Fortschritt in der rationalen Erschließung der Natur eröffnete, mit der Vision einer restlosen Entfesselung der produktiven Potenziale von Natur und Mensch: »the enlarging of Human Empire, to the effecting of all (sic!) things possible.«11 Die Idee der Verwirklichung aller (!) möglichen Werke der Natur, die Bacon religiös als Offenbarung der Herrlichkeit Gottes überhöht, ist, wie die Entwicklungen der Atomtechnik oder der Humangenetik zeigen, bis heute in moderner Wissenschaft und Technik wirksam. Kurz: Die Leitideen der Subsysteme moderner Gesellschaften lassen sich nur um den Preis bedenklicher Gewaltsamkeiten oder, wie bei Schnädelbach, einer abstrakten idealtypischen Konstruktion, pauschal als Rationalisierungsprozesse deuten. In Aufklärungsprozessen sind vielmehr, wie im Folgenden am Beispiel der Moral und der Religion aufgewiesen werden soll, jeweils Prozesse der Entund Resakralisierung miteinander verwoben. Die Verschiebung des »sakralen Kerns« ist allerdings nicht beliebig, sondern ergibt sich jeweils aus den Selbsterfahrungen menschlicher Vernunft, deren Sinn selbst wiederum Gegenstand von Kontroversen ist.
10 Vgl. dazu Schelkshorn, Hans: Entgrenzungen. Ein europäischer Beitrag zum philosophischen Diskurs über die Moderne. Weilerswist 2009, vor allem Teil C (Bacon, Hobbes, Locke). 11 Bacon, Francis: »New Atlantis«, in: ders.: The Works of Francis Bacon. Faksimile Neudruck der Ausgabe von James Spedding, Robert Leslie Ellis, Douglas Denon Heath 1857 – 74. Band III. Stuttgart/Bad Cannstatt 1963. S. 156.
Der schmale Grat einer Versöhnung von kritischer Vernunft und Religion
1.2
67
Die Moral der Moderne – die Grenzen der Selbstreflexivität
In der Idee von Aufklärung als »vollständigem Reflexivwerden« von Kulturen sind zwei Dimensionen zu unterscheiden, nämlich die allgemeine Bedeutung von Aufklärung als Zurückgeworfensein auf die Vernunft und Aufklärung im Sinne einer bestimmten Selbstauslegung der Vernunft. Die allgemeine Erfahrung von Aufklärung, die jeweils mit tiefgreifenden gesellschaftlichen Umwälzungen verbunden ist, hat Schnädelbach an anderer Stelle treffend beschrieben. »Eine Voraussetzung von Modernität in diesem Sinne ist die spürbare Schwächung der zuvor mit Selbstverständlichkeit geltenden Traditionsmächte«12, sei es des antiken Mythos oder der theologischmetaphysischen Fundamente des mittelalterlichen Christentums. Der Geltungsverlust umfassender Sinnhorizonte schafft zwar »neue Handlungsmöglichkeiten«, aber auch schwerwiegende »Orientierungsprobleme«, die einerseits durch die Kreation neuer Perspektiven, andererseits durch einen Rückgriff auf das Tradierte behandelt werden können, wobei im zweiten Fall Tradition »im doppelten Sinn zum Gegenstand« wird, nämlich als Ressource von praktischen Optionen und Dauerthema des Nachdenkens, ja der Kontroverse.«13 Doch wie immer wir uns zu einzelnen Inhalten der Tradition stellen, wir bewegen uns stets in einem Raum der Fraglichkeit und des Zwangs zur kritischen Prüfung bzw. Auslegung. Die Modernität im Sinne der conditio humana in posttraditionalen Gesellschaften kann folglich mit Schnädelbach »als die gesellschaftliche Situation einer Kultur« umschrieben werden, »in der die Menschen in selbst zu verantwortenden kognitiven und normativen Ordnungen leben müssen.«14 Die Moderne als geschichtliches Apriori unseres Daseins verweist von selbst auf die zweite Dimension von Aufklärung, in deren Zentrum die Frage steht, mit welcher Vernunft die kognitiven und normativen Ordnungen jeweils zu rechtfertigen sind. Die allgemeine Erfahrung von Aufklärung bringt, wie Jaspers in der Theorie der Achsenzeit gezeigt hat, bereits in der Antike eine Pluralität von Selbstauslegungen der Vernunft hervor. In China wird daher der achsenzeitliche Aufbruch treffend als die »Zeit der 100 Schulen« bezeichnet, in der wie in Europa ein breites Spektrum an moralphilosophischen Konzeptionen aufbricht.15 Modernität im Sinn von Aufklärung impliziert daher, wie auch Schnädelbach bewusst ist, stets einen Streit zwischen unterschiedlichen Selbstauslegungen der Vernunft. »So ist nicht nur die Moderne, sondern auch der Streit über sie ein
12 13 14 15
Schnädelbach: »Gescheiterte Moderne?«. S. 442. Ebd. Ebd. S. 443. Vgl. dazu Roetz, Heiner: Die chinesische Ethik der Achsenzeit. Frankfurt a. M. 1992.
68
Hans Schelkshorn
Schicksal in dem Sinne, dass wir ihm nicht ausweichen oder ihn auf sich beruhen lassen können.«16 Im Disput über eine angemessene Selbstauslegung der Vernunft nimmt nun Schnädelbach eine pointierte Position ein. »Die Reflexivität von Kulturen weist Grade auf; sie ist umso höher, je mehr von dem angeblich Natürlichen als ein kulturell Erzeugtes einsichtig wird. Dieser Prozess ist der Kern dessen, was wir ›Aufklärung‹ nennen«. In historischer Perspektive ist in Europa der Prozess der Aufklärung für Schnädelbach vor allem durch die Sophisten zum Durchbruch gekommen. Denn die Sophistik »begann zu fragen, ob wirklich alles, was wir für naturgegeben halten (phy´sei), nicht in Wahrheit auf menschliche Satzung zurückgehe, also nûmo oder th¦sei sei«. Die Radikalität der sophistischen Aufklärung löste nicht nur in den griechischen Poleis, sondern auch im Inneren der Philosophie Gegenreaktionen aus. Die griechische Philosophie ist daher nach Schnädelbach vor allem durch den Konflikt zwischen spekulativer Vernunft (Vorsokratik, Platon, Neuplatonismus, Stoa) und kritischer Vernunft (Sophistik, Sokrates, antike Skepsis) bestimmt.17 Nachdem die von Augustinus grundgelegte Synthese von antiker Metaphysik und christlichem Glauben von der spätmittelalterlichen Theologie selbst aufgebrochen worden ist, nehmen schließlich die Gründerväter des neuzeitlichen Denkens (Bacon, Descartes) die antiken Ansätze kritischer Vernunft auf und transformieren sie für die Begründung der neuzeitlichen Wissenschaft18 und einer säkularen Moral. Der Übergang vom christlichen Naturrecht zu den frühneuzeitlichen Vertragstheorien kann daher »als Modell dafür gelten, was vollständige Reflexivität bedeutet: Jetzt kann eine Kultur nicht länger ihre Grundlagen in einem Bereich aufsuchen, der nicht mehr zur Kultur gehörte, sondern sie muss sie in sich selbst auffinden, ganz auf sich gestellt.« Die neuzeitliche Überführung von »Natur« in »Kultur« wird nach Schnädelbach in gewisser Hinsicht durch Kant abgeschlossen. Seit Platon habe es zwar immer wieder Versuche gegeben, »die Reflexivität von Kultur zu begrenzen und die in ihr gültigen kognitiven und normativen Ordnungen in einer objektiven, der menschlichen Verfügung entzogenen ›Hyperphysis‹ zu fundieren: im Sein, in der Idee, der lex naturalis, der göttlichen Schöpfungsordnung, im mundus intelligibilis. Der Philosoph der vollständigen Reflexivität hingegen ist Kant. Er unternimmt den halsbrecherischen Versuch, kognitive 16 Schnädelbach: »Gescheiterte Moderne?«. S. 442 f. 17 Vgl. dazu Schnädelbach, Herbert: Vernunft. Stuttgart 2007. S. 15 – 43. 18 Angesichts der Aporien spekulativer Vernunft in der traditionellen Metaphysik und der scholastischen Tradition musste nach Schnädelbach in der frühen Neuzeit »das reiche, durch Sextus Empiricus überlieferte Instrumentarium der antiken Skeptiker genutzt werden […] Die Philosophie der Neuzeit musste zwar durchwegs skeptisch verfahren. So wurde die skeptische Methode zu ihrem Kennzeichen, aber im Unterschied zur antiken Skepsis in kritischer Absicht und mit dem Ziel, den Zweifel zu überwinden.« Ebd. S. 78.
Der schmale Grat einer Versöhnung von kritischer Vernunft und Religion
69
und normative Objektivität genau auf der Instanz zu begründen, die bisher alle Objektivität kritisiert, ja destruiert hatte – auf der Vernunft selber.«19
Auch wenn zugestanden werden kann, dass für den Bereich der Moral »die Abkehr vom klassischen und später christianisierten Naturrecht« und die Begründung einer Vernunftmoral das »folgenreichste Programm der Aufklärer« war, so bleibt dennoch Schnädelbachs Geschichtskonstruktion, die von Parmenides bis Kant bloß eine fortschreitende Überführung des Natürlichen ins Kulturelle sieht, die bedauerlicherweise durch das Naturrecht und die spekulative Vernunft unterbrochen worden ist, trotz aller Distanzierung von deterministischen Fortschrittstheorien einem Evolutionismus verhaftet, der die Heterogenität und Instabilität achsenzeitlicher und auch moderner Moral in problematischer Weise überspielt. Bereits in der Antike lässt sich der Übergang von mythischen zu rationalen Begründungskontexten nicht gemäß der Logik eines einlinigen Entsakralisierungsprozesses rekonstruieren. Vielmehr kommt es in der griechischen und römischen Philosophie zu mannigfachen Verschiebungen des sakralen Kerns von Weltbildern bzw. Lebensformen. So sind zwar in der sophistischen Aufklärung zentrale Instanzen für eine menschliche Grundorientierung wie Moral, Sprache und Religion als menschliche Setzungen entlarvt worden. Da die Entwertung der überlieferten Moral als menschlicher Konvention die Gesellschaft in eine tiefe Krise bzw. in einen moralischen Nihilismus stürzt, bricht nicht zufällig bereits in der Sophistik – und nicht erst bei Sokrates – die Frage nach einem Unverfügbaren bzw. einem physei diakaion auf, das unsere menschlichen Setzungen (nomoi) orientieren könnte. Im Medium kritischer Vernunft droht allerdings, wie ebenfalls bereits in der Sophistik sichtbar wird, jeder Appell an ein unverfügbares Maß selbst wieder in den Sog divergierender Auslegungen zu geraten. So sieht Antiphon das »von Natur aus Gerechte« in der Gleichheit aller Menschen, Kallikles hingegen im Recht des Stärkeren.20 Angesichts des Geltungsverlusts mythischer Religion und der Aporien der sophistischen Naturrechtsethik bestimmt Sokrates in Analogie zu Kant das Unbedingte der Moral in der endlichen Vernunft, genauer in der Forderung, sämtliche Fragen der Lebensführung argumentativ zu prüfen. Obwohl die Entmythologisierung von Natur und Politik in der sokratischen Selbstsorge einen vorläufigen Abschluss findet, wird das Transzendente nicht einfach restlos im Kulturellen aufgelöst, sondern kehrt gleichsam an einer anderen Stelle, nämlich an der Quelle der Forderung nach einer rationalen Lebensführung, wieder. Sokrates ruft daher den Athenern zu: »Denn, so wisst nur, befiehlt es der Gott.«21 19 Schnädelbach: Philosophie in der modernen Kultur. S. 22. 20 Zu Antiphon vgl. DK 87 B44; zu Kallikles Platon: Gorgias. 483a–484b. 21 Platon: Apologie. 30a.
70
Hans Schelkshorn
Unter dem Schock des Todes des Sokrates ist in der Antike von Platon bis zur Stoa versucht worden, die Fragilität der Ethik der Selbstsorge in eine umfassende Kosmologie einzubetten, der wie zuvor in mythischen Weltbildern wieder eine legitimatorische Funktion für die moralisch-politische Ordnung zuwächst. Die philosophisch motivierte Resakralisierung der Natur vollzieht gegenüber Sokrates eine weitere Verschiebung des sakralen Kerns auf die Achse zwischen menschlicher Vernunft und dem Logos als Prinzip des Universums. Die Dialektik zwischen Artikulation und interpretatorischer Auflösung des Unbedingten in der Moral setzt sich auch in der Neuzeit fort. Aus diesem Grund führt von der Krise des »traditionellen« Naturrechts keineswegs, wie Schnädelbach zu suggerieren scheint, ein direkter Weg zu den »Ideen des Vernunftrechts, der Eigenständigkeit des Moralischen und des säkularen Staates.« Bereits in den frühneuzeitlichen Naturzustands- bzw. Vertragstheorien (Hobbes, Locke), die Schnädelbach als Modell für seinen Begriff von »Aufklärung« in Anschlag bringt, bleiben an entscheidenden Stellen naturrechtliche Momente präsent.22 Bei Kant rückt zwar, worauf Schnädelbach zu Recht hinweist, die kritische endliche Vernunft selbst zur einzigen Instanz für die Objektivität der Moral auf. Dennoch ist auch Kants Ethik wie zuvor die verschiedenen Varianten der Naturrechtsethik in den Verdacht einer metaphysischen Überhöhung des Moralprinzips geraten. Denn das in endlicher Vernunft gegebene Moralprinzip steht, wie Kant am Beispiel des Fürsten veranschaulicht, der unter Androhung der Todesstrafe einen Menschen zwingen will, einen Unschuldigen durch ein falsches Zeugnis zu Tode zu bringen, letztlich auch über dem elementaren Überlebenstrieb des Menschen.23 Der kategorische Anspruch der Kantschen Vernunftmoral ist denn auch in der Folge von Durkheim, Schopenhauer über den Utilitarismus bis hin zu Sartre und selbst von der Diskursethik als metaphysischer Restbestand kritisiert worden. Spätestens an dieser Stelle dürfte jedoch deutlich werden, dass die Überführung des Unbedingten bzw. »von Natur aus Gerechten« in ein von Menschen Gesetztes nicht per se einen Fortschritt von Aufklärung impliziert. Albert Camus, der wie Schnädelbach mit äußerster Konsequenz sämtliche Fragen auf dem Boden endlicher Vernunft verhandelt und jeden »Sprung«, sei es ins Religiöse oder in eine objektive Vernunft zurückweist, hat denn auch gegenüber Sartre das »metaphysische« Moment der Kantschen Ethik verteidigt. In der moralischen Empörung beziehen wir uns nach Camus auf einen »Wert« bzw. eine »menschliche Natur«, die unsere weltimmanenten Setzungen übersteigt. Denn wenn »das Individuum tatsächlich im
22 Vgl. dazu Schelkshorn: Entgrenzungen. S. 490 – 516, S. 533 – 548. 23 Kant, Immanuel: Kritik der praktischen Vernunft. AA V. S. 30.
Der schmale Grat einer Versöhnung von kritischer Vernunft und Religion
71
Lauf der Revolte den Tod auf sich nimmt«, so opfert es sich »zugunsten eines Gutes, von dem es glaubt, daß es über sein eigenes Geschick hinausreicht.«24 Kurz: Auch wenn sich der moderne demokratische Rechtsstaat in normativer Hinsicht primär auf das Kantsche Vernunftrecht stützt, so kann dennoch nicht darüber hinweggesehen werden, dass die »moralische Landkarte« der Moderne in einem hohen Maß zerklüftet und fragil ist. In der Moral der Moderne sind, wie Charles Taylor aufgewiesen hat, mehrere »Hypergüter« geschichtsmächtig, die, wie ich ergänzen würde, jeweils auf einem »sakralen Kern« aufruhen. Auf welchen starken Wertungen moderne demokratische Rechtsstaaten genauerhin aufruhen, ist, wie die kontroversen Debatten über die Idee »unantastbarer Menschenwürde«, Abtreibung, Euthanasie, Humangenetik u. a. zeigen, selbst kontrovers. Der Vorzug moderner demokratischer Rechtsstaaten besteht gerade darin, einen öffentlichen Diskursraum selbst noch für die Klärung der vorpolitischen Grundlagen der Rechtsordnung offen zu halten, in dem bekanntlich utilitaristische, kantische, naturalistische und traditionell metaphysische Begründungsstrategien zuweilen unvermittelt aufeinanderprallen. Die Hinweise auf die Instabilitäten einer säkularen Moral dürfen jedoch – dies möchte ich eigens hervorheben – nicht als Vorwand verstanden werden, dass die moderne Ethik letztlich doch nicht auf eigenen Füßen stehen könne und, da ohne Gott alles erlaubt sei (Dostojewskij), in unvermittelter Weise durch religiöse Quellen gestützt werden müsse. Ich stimme daher auch Schnädelbachs Kritik an der Idee einer gegenseitigen Korrektur von »Vernunft« und »Religion«, wie sie Kardinal Ratzinger gegenüber Habermas vorgetragen hat, in einem entscheidenden Punkt zu. Da auch religiöse Quellen auslegungsbedürftig sind, bleibt als Medium rationaler Selbstorientierung allein die kritische Vernunft; in den Worten von Schnädelbach: »tatsächlich brauchen wir für die Vernunftkritik nichts anderes als unsere Vernunft selber, denn nur selbstkritische Vernunft ist vernünftig.«25 Dies bedeutet: So wie »die« säkulare Moral so steht auch »die« Religion auf unsicheren Füßen und kann daher nicht unvermittelt als Remedium für die Relativismen neuzeitlicher Kultur ins Spiel gebracht werden.
2.
Selbstauflösung der Religion in der »vollendeten Modernität«?
Im Unterschied zur säkularen Moral steht nach Schnädelbach die Religion nicht bloß auf unsicheren Füßen, sondern vermag bei nüchterner Betrachtung letzt24 Vgl. dazu Camus, Albert: Der Mensch in der Revolte. Essays. Reinbek b. Hamburg 1997. S. 23. 25 Schnädelbach: RW. S. 134.
72
Hans Schelkshorn
lich überhaupt keinen Fuß mehr auf den profanen Boden der Moderne zu setzen. Die Folgen für die Religion durch neuzeitliche Aufklärungsbewegungen werden von Schnädelbach auf zwei Ebenen analysiert, einerseits im Blick auf die Religion als gesellschaftliche Realität, andererseits im Blick auf die religiöse Existenz des Einzelnen.
2.1
Privatisierung und Subjektivierung von Religion
Infolge der neuzeitlichen Aufklärungsbewegungen findet sich nach Schnädelbach die Religion heute »als Teilsystem innerhalb einer säkularen Rechtsordnung wieder.« Diese These wird zwar in westlichen Gesellschaften nur mehr von extremen Fundamentalisten offen bekämpft, doch die Frage, wie sich Religion als Teilsystem in einer pluralistischen Gesellschaft genauerhin situieren soll, ist sowohl bei säkularen als auch religiösen Bürgern höchst umstritten. Die These von der Religion als Privatsache bedarf daher sorgfältiger Klärungen. Auch wenn die Trennung von Staat und Religion in der Menschheitsgeschichte ein Novum darstellt, impliziert die Ablösung vom staatlichen Gewaltmonopol nicht nur für das Christentum, sondern für alle achsenzeitlichen Religionen eine mehr als heilsame Katharsis. Denn Buddhismus und Christentum waren wie der Konfuzianismus und die Philosophenschulen ursprünglich Widerstandsbewegungen gegenüber den mythischen Legitimationen der alten sakralen Monarchien, die sich zunächst auf freiwilliger Basis in kleinen Gesellschaften organisierten und erst Jahrhunderte später zum religiösen Fundament von Weltreichen wurden. So rückten unter Ashoka der Buddhismus, in der HanDynastie eine sakralisierte Form des Konfuzianismus und unter Konstantin das Christentum zur Staatsreligion auf. Auch wenn sowohl katholische als auch protestantische Kirchen in den modernen Nationalstaaten staatskirchliche Strukturen bis in die jüngste Vergangenheit und zuweilen sogar noch in die Gegenwart hinein zu bewahren suchen26, so sollte eine vom staatlichen Machtapparat radikal abgekoppelte Religion – in Schnädelbachs Terminologie die »externe Pluralisierung« – für Christen keine existenzbedrohende Bedeutung haben. Ein weitaus schwierigeres Problem stellt in der Tat die »interne Pluralisierung« dar, d. h. die Anerkennung anderer Konfessionen oder Religionen. Bereits in den ersten beiden Jahrhunderten n. Chr. brachen innerhalb der christlichen 26 Ähnliche Prozesse sind auch im Buddhismus zu beobachten, wie vor allem die politische Macht des Theravada-Buddhismus in Sri Lanka eindrücklich vor Augen stellt. Umgekehrt haben buddhistische Lebensformen, die sich auf die ursprüngliche Form der Mönchsgemeinschaft beschränken, keine Probleme, sich in westlichen Gesellschaften zu situieren.
Der schmale Grat einer Versöhnung von kritischer Vernunft und Religion
73
Gemeinden schwere Konflikte über Glaubensfragen aus, die nach der Konstantinischen Wende mit den Mitteln staatlicher Gewalt ausgetragen wurden. Eine nachhaltige Lösung innerreligiöser Konflikte bedarf letztlich zweier Reflexionsebenen, einerseits der sokratischen Idee kritischer Vernunft, andererseits der religionsphilosophischen Einsicht in die Grenzen menschlicher Rede vom Absoluten bzw. von Gott, eine Einsicht, die z. B. in Indien bereits in früher Zeit systematisch ausgebildet worden ist. Das frühe Christentum hat hingegen primär eine Synthese mit der neuplatonischen und stoischen Philosophie gesucht; so rechtfertigt z. B. Eusebius die konstantinische Wende durch einen christlich überformten Neuplatonismus. Die Gewaltexzesse gegen Häretiker und Ungläubige bilden daher ein reiches Anschauungsmaterial für die »praktische Aporie spekulativer Vernunft«, die Schnädelbach paradigmatisch an Platons Staatslehre vorführt.27 Da religionsphilosophische Ansätze für eine Eindämmung religiöser Konflikte etwa bei Nikolaus von Kues, der die sokratische Einsicht in die Grenzen menschlicher Vernunft ins Zentrum seiner philosophischen Theologie stellt28, nicht geschichtsmächtig geworden sind, mussten in der Moderne religiöse Toleranz und Religionsfreiheit tatsächlich gegen den erbitterten Widerstand christlicher Kirchen erkämpft werden. »Erst das Ende der schrecklichen konfessionellen Bürgerkriege schaffte« – so Schnädelbach – »Raum für die Religionsfreiheit«. Nicht ohne Grund moniert Schnädelbach, dass es den einzelnen Konfessionen, insbesondere der katholischen Kirche, noch immer schwer falle, »die jeweils Andersgläubigen als wahre Christen zu respektieren.« Der tiefere Grund für die Defizite der Anerkennung Andersgläubiger liegt in verschiedenen Abwehrhaltungen gegenüber endlicher, kritischer Vernunft. Im Katholizismus hält gegenwärtig das Lehramt, wie Schnädelbach klarsichtig analysiert29, mit aller Vehemenz an der von Augustinus grundgelegten christlichen Gestalt spekulativer Vernunft fest; im Protestantismus flüchten sich hingegen evangelikale Gruppen in pietistisch gefärbte religiöse Sonderwelten. Der Privatisierung korrespondiert nach Schnädelbach eine zunehmende Subjektivierung von Religion in der Geschichte der Neuzeit, die sich in schematischer Vereinfachung in vier Phasen vollzieht. Während sich die Reformation gegen den Objektivismus der mittelalterlichen Kirche wandte, lässt der Pietismus wie z. B. bei den Quäkern sämtliche Rituale hinter sich. Reformation und Pietismus bewegen sich allerdings nach Schnädelbach noch auf einem weithin unhinterfragten religiösen Fundament, mit der Konsequenz, dass innerhalb der 27 Vgl. dazu Schnädelbach: Vernunft. S. 45 – 53. 28 Vgl. dazu Riedenauer, Markus: Pluralität und Rationalität. Die Herausforderung der Vernunft durch religiöse und kulturelle Vielfalt nach Nikolaus von Kues. Stuttgart 2007. 29 Schnädelbach: RW. S. 37 – 40.
74
Hans Schelkshorn
protestantischen Gemeinden die Subjektivierungen jeweils mit neuen Formen zwanghafter Homogenisierung einhergehen. Seit dem 19. Jahrhundert erfasst der kulturelle Pluralismus der Moderne auch religiöse Milieus mit voller Wucht. Angesichts der Vielfalt an Lebensformen sieht sich der Einzelne gezwungen, religiöse Orientierungen nicht mehr bloß auf der Basis eines religiösen Berufungserlebnisses, sondern auch rationaler Einsicht zu suchen. »Die individualisierte Religion wird dadurch zu einer privaten Baustelle, auf der PatchworkReligionen entstehen, ganz nach den persönlichen Bedürfnissen des Einzelnen. Dabei werden häufig nicht nur christliche Konfessionsgrenzen, sondern auch interreligiöse Barrieren überschritten.« Dieser Prozess kann – so Schnädelbach mit Luhmann – Privatisierung der Religion genannt werden, die durch die »Konjunktur von Religiosität« noch eine Steigerung erfahren hat. Religion wird hier auf einen intimen Bereich des Religiösen bzw. Spirituellen beschränkt, in dem »alle konkreten Inhalte wirklich gelebter Religion zu einem abstrakten Begriffsnebel verdampft« sind, so dass selbst Fragen nach den leitenden Inhalten als Verletzung der religiösen Intimsphäre zurückgewiesen werden. An dieser Stelle nimmt Schnädelbach einen überraschenden Schwenk vor. Gegenstand der Kritik sind nicht mehr integralistische Machtansprüche, sondern die privatistische Selbstdepotenzierung von Religion. Mehr noch: In einer merkwürdigen Nähe zu Vertretern der »Amtskirche« nimmt Schnädelbach die zentralen Achsen neuzeitlicher Subjektivierung von Religion, nämlich die aufklärerische Idee eines rationalen Subjekts und das romantische Ideal expressiver Freiheit, jeweils in einseitiger Weise von ihren subjektivistischen Verzerrungen her in den Blick. So enthält der Vorwurf einer Patchwork-Religion die Unterstellung, dass in der kritischen Prüfung religiöser Traditionen nicht Gründe und Argumente, sondern primär subjektive Neigungen bzw. Bedürfnisse leitend sind. Abgesehen von der Tatsache, dass auch die geschichtsmächtig gewordenen Religionen jeweils »Patchworkcharakter« haben, insofern in ihnen unterschiedliche Traditionen verarbeitet werden, so muss in der entwickelten Moderne aus immanenten Gründen eine patchworkartige Orientierung geradezu der Normalfall sein. Denn als rationales Subjekt kann sich der Mensch nicht blind einer Religion verschreiben, ohne andere Traditionen zu prüfen oder zumindest die Beziehungen zwischen dem Eigenen und dem Fremden zu klären. Auch die Formen einer inhaltslosen Religiosität, die sich monologisch in sich selbst verschließt, sind, wie Charles Taylor in seinen Studien zum Viktorianischen Zeitalter gezeigt hat, letztlich reduktionistische Varianten der romantischen Vorstellung von Religion, in der der Vollzug authentischer Freiheit nicht bloß als individualistischer Selbstausdruck, sondern primär als Re-sonanz einer Transzendenzer-
Der schmale Grat einer Versöhnung von kritischer Vernunft und Religion
75
fahrung verstanden worden ist.30 Sowohl in den aufklärerischen als auch romantischen Subjektivierungen bleibt im Übrigen Religion als Privatsache stets ein Politikum. So wie das »stahlharte Gehäuse« (Max Weber) der technokratischen Moderne durch romantische Formen des Religiösen aufgebrochen worden ist, so haben sich der Aufklärung verpflichtete Theologen von Bonhoeffer und Martin Luther King bis hin zu den Befreiungstheologen in Lateinamerika, Afrika und Asien den Totalitarismen des 20. Jahrhunderts entgegengestellt.
2.2
Selbstauflösung von Religion im Raum kritischer Vernunft?
Wie bereits anhand der Kritik an den subjektivistischen Verzerrungen des religiösen Bewusstseins deutlich geworden ist, zieht sich Schnädelbach nicht auf eine religionssoziologische Diagnose zurück, sondern wirft in aller Offenheit die Probleme auf, die sich für Religionen durch die neuzeitliche Aufklärung ergeben. An dieser Stelle stößt die Analyse über das Verhältnis von Religion und Moderne an eine entscheidende Wegkreuzung. Denn die uneingeschränkte Öffnung von Religion auf die kritische Vernunft droht nach Schnädelbach letztlich in eine Selbstdestruktion religiöser Existenz zu münden. Während im vorliegenden Text »Religion in der Moderne« die Problematik einer möglichen Selbstauflösung der Religion noch als philosophisch aufbereitete Frage höflich an TheologInnen weitergereicht wird, hat Schnädelbach an anderer Stelle seine eigene Sicht nicht zurückgehalten. »Das jüdisch-christliche und antike Erbe ist« – so Schnädelbach – »im aufgeklärten Humanismus unserer Tage angetreten und abgegolten. Das hat nichts mit Undankbarkeit oder gar Respektlosigkeit zu tun: Die profane Moderne ist unser Schicksal. Wir leben jenseits des Christentums.«31 Mehr noch: Für Schnädelbach ist das »Bild der Wurzel« letztlich »irreführend, ja tendenziös, denn es legt die Befürchtung nahe, der Baum unserer modernen Kultur könnte verdorren, wenn wir seine Wurzeln kappen. Der Vergleich mit der Nabelschnur ist viel besser ; die muss durchtrennt und dann abgestoßen werden, damit ein neuer Mensch weiterleben kann.«32 Aus diesem Grund kommt Habermas’ Aufforderung an religiöse Bürger, die Quellen ihrer Sinnressourcen für die säkulare Welt zu »übersetzen«, nicht nur zu spät, sie beruht darüber hinaus, wie Schnädelbach zu Recht hervorhebt, auf Voraussetzungen, die keineswegs selbstverständlich sind. Denn vor der »Übersetzung« für atheistische oder agnostische Mitbürger müssen sich religiöse 30 Vgl. dazu Taylor, Charles: Quellen des Selbst. Frankfurt a. M. 1996. S. 683 – 728; ders.: Das säkulare Zeitalter. Frankfurt a. M. 2009. S. 788 – 842. 31 Schnädelbach: RW. S. 127. 32 Schnädelbach: RW. S. 126 f.
76
Hans Schelkshorn
Menschen, die sich der Aufklärung verpflichtet fühlen, zunächst die Quellen ihrer jeweiligen religiösen Tradition selbst »übersetzen«. An dieser Stelle tauchen jedoch, wie Schnädelbach ohne triumphalistische Überheblichkeit zu bedenken gibt, Barrieren auf, von denen zumindest nicht absehbar ist, wie und ob sie überhaupt noch überwunden werden können. In diesem Kontext steht das harte Urteil: »die Quellen unserer religiösen Vergangenheit sprudeln nicht mehr.«33 Das Ende des Christentums im Kontext neuzeitlicher Aufklärung ist allerdings, wie Schnädelbach in sachlicher Konvergenz mit Charles Taylor betont, nicht das Resultat einer Subtraktionsgeschichte, wonach die Errungenschaften der Moderne erst hervortreten konnten, nachdem die Nebel der religiös-metaphysischen Weltbilder endgültig abgezogen waren. Das Christentum, das sich bereits in früher Zeit auf die griechische Philosophie eingelassen hat, war vielmehr, wie Schnädelbach anerkennt, über viele Jahrhunderte hinweg Träger und Akteur europäischer Aufklärungsprozesse. Wer sich jedoch auf Vernunft einlässt, bewegt sich – darin stimme ich mit Schnädelbach völlig überein – unweigerlich in einer unabschließbaren Erfahrungsgeschichte der Vernunft mit sich selbst. Ohne auf die rationalitätstheoretischen Diskussionen in der gegenwärtigen Philosophie näher eingehen zu können, möchte ich vorweg festhalten, dass ich Schnädelbachs Verteidigung einer endlichen bzw. kritischen Vernunft im Prinzip zustimme, auch wenn ich in manchen Bereichen, wie in der Frage der Moral bereits angedeutet worden ist, die Akzente anders setze. Dies bedeutet: Die Frage nach der Religion muss auf dem Boden endlicher Vernunft, und nicht durch einen Rekurs auf vormoderne oder hegelsche Varianten einer spekulativen Vernunft verhandelt werden. Neben den philosophischen Bürden sprechen auch religiöse Gründe gegen die Fundierung eines rationalen Weltbildes und einer verbindlichen Moral in einer affirmativen Philosophie des Absoluten. Denn achsenzeitliche Religionen wie der Buddhismus und das frühe Christentum stellen epistemologische Ansprüche einer spekulativen Vernunft explizit zugunsten einer bestimmten Lebenspraxis zurück.34 Die geschichtliche Selbstvergewisserung und die Bestimmung der Möglichkeiten und Grenzen kritischer Vernunft scheinen mir jedoch nicht, wie Schnädelbach vermutet, notwendigerweise auf eine Selbstauflösung der Religion hinauszulaufen. Die Suche nach religiösen Wasseradern ist auch auf dem harten Boden der profanen Moderne nicht aussichtslos. Denn manche Barrieren liegen weniger in der »Sache« selbst, sondern in problematischen Selbstdeutungen der 33 Schnädelbach: RW. S. 127. 34 In dieser Perspektive würde ich auch das berühmte Diktum von Paulus über die »Torheit des Kreuzes« in 1 Kor 1,18 ff. deuten.
Der schmale Grat einer Versöhnung von kritischer Vernunft und Religion
77
Moderne. In diesem Sinn scheint mir auch Schnädelbachs Leitidee einer vollständigen Reflexivität der Kultur nicht nur im Bereich der Moral, sondern auch der Religion mögliche Optionen vorschnell abzublenden. Ich muss mich an dieser Stelle wieder auf wenige Skizzen beschränken. »Der neuzeitliche Aufklärungsprozess, der das Christentum schließlich auflöste, folgte dabei« – so Schnädelbach – »selbst einem christlichen Gebot – dem der Wahrhaftigkeit – und damit einer ›zweitausendjährigen Zucht zur Wahrheit, welche am Schlusse sich die Lüge im Glauben an Gott verbietet.‹ (Nietzsche, Die fröhliche Wissenschaft, § 357).« Der Rekurs auf Nietzsche führt jedoch in mehrfacher Hinsicht auf falsche Pfade. Erstens ist die Wahrhaftigkeit nicht bloß Ergebnis christlicher Zucht, sondern eine ethische Voraussetzung kritischer Vernunft, die Schnädelbach in anderen Zusammenhängen denn auch entschieden gegen eine nietzscheanische Vernunftskepsis verteidigt. Zweitens dürfte Nietzsches Diktum vom Tod Gottes primär die Synthese von Platonismus und Christentum im Blick haben. Da die frühneuzeitlichen Aufklärungsprozesse – Schnädelbach selbst verweist auf Duns Scotus und Ockham35 – noch von christlichen Theologien in Gang gebracht worden sind, kann in gewisser Hinsicht mit Nietzsche von einer Selbstauflösung des platonischen Christentums gesprochen werden. Die sachlichen Gründe für Schnädelbachs Vorbehalt gegenüber der Möglichkeit einer authentischen Versöhnung zwischen Religion und kritischer Vernunft liegen tatsächlich weniger in Nietzsches Religionskritik, sondern in einer bestimmten Sicht der Folgen der historischen Vernunft für Religionen und in der These einer kategorialen Differenz zwischen Religion, im Speziellen der Offenbarungsreligion, und Metaphysik. Die geschichtsphilosophische Wende der Philosophie der Aufklärung, in der seit Vico sämtliche Bereiche menschlichen Lebens, einschließlich der Moral und der Religion, in den Sog der Historisierung geraten sind, stellt für Religionen, insbesondere für Offenbarungsreligionen, tatsächlich eine existenzbedrohende Herausforderung dar. Denn die historisch-kritische Textexegese vollzieht durch ihren methodischen Atheismus eine radikale Entsakralisierung religiöser Offenbarungsschriften. In den christlichen Kirchen lassen sich, wie Schnädelbach hellsichtig diagnostiziert, bislang zwei konträre Reaktionsmuster gegenüber der historischen Kritik der Religion erkennen, nämlich fundamentalistische Verhärtungen und Tendenzen zu einer Selbstauflösung in Religionswissenschaft. Da einmal fraglich gewordene Sinnhorizonte nur mehr durch einen Mehraufwand an autoritärem Druck bewahrt werden können, werden gegenwärtig sowohl im katholischen als auch protestantischen Raum vormoderne Offenbarungsverständnisse zementiert. Auf diese Weise muten Kirchen ihren Gläubigen 35 Schnädelbach: Vernunft. S. 60 ff.
78
Hans Schelkshorn
entweder durch den Gehorsam gegenüber lehramtlich festgelegten Dogmen oder dem als Verbalinspiration verstandenen Text der Bibel ein sacrificium intellectus zu. Umgekehrt hat nach Schnädelbach die liberale Theologie in der uneingeschränkten Affirmation historischer Vernunft die Grenzen zwischen Theologie und Religionswissenschaft verwischt, was nicht weniger als eine Selbstauflösung der Religion impliziert. »›Theologie als Kulturwissenschaft des Christentums‹ (Rendtorff) – ist das die Wissenschaft, die der Religion den Weg in die Zukunft weist?« Da die Bibel entsakralisiert ist, konnte bereits die alte liberale Theologie nicht einsehen, »warum man nicht auch Buddha-, Kant- oder Goethezitate als Predigttext verwenden könne.«36 Doch abseits der epistemischen Aporien muss nach Schnädelbach eine Versöhnung zwischen kritischer Vernunft und Religion bereits an der »›Logik‹ religiöser Rede« scheitern. Denn »Religion artikuliert sich nicht in kognitiver, sondern in performativer Rede, und zwar in der Perspektive der 1. Person Singular oder Plural. Religion sagt: ›ich bekenne…/wir bekennen…‹, ›ich glaube/wir glauben…‹«37. Der Logik religiöser Rede korrespondieren nach Schnädelbach Glaubenswahrheiten, die auf Evidenzen beruhen, bei denen »sich die Frage nach Wahrheit oder Irrtum gar nicht stellt, weil sie, wenn es sie gibt, das Falschsein gewissermaßen grammatisch aus sich ausschließen. So sind sie die Basis aller Offenbarungsreligionen.«38 Sogenannte »Glaubenswahrheiten« seien de facto »Glaubensgewissheiten«39. »Urteilswahrheiten hingegen sind« – so Schnädelbach – »der Gehalt dessen, was wir Wissen nennen und mit guten Gründen als wahre, gerechtfertigte Überzeugung verstehen.«40 Im Gegensatz zu Glaubensgewissheiten sei Wissen »etwas Transsubjektives« und »fehlbar, während man nicht sagen kann, was eine fehlbare Gewissheit sein könnte.«41 Aus der Dichotomie von Glaubensgewissheit und Urteilswahrheit zieht Schnädelbach die Konsequenz einer prinzipiellen Divergenz von kritischer Vernunft und Religion: »Ich denke, dass alle echten Glaubenswahrheiten von dieser Art sind, und deswegen kennt der religiöse Glaube, wie ich ihn verstehe, keine Grade, keine Wahrscheinlichkeiten: Niemand verlässt sich im Leben und im Sterben auf etwas, dessen er nur zu 51 % gewiss ist. Deswegen ist dieser Glaube auch keine defizitäre Form des Wissens, wie wir ihn etwa bei Kant definiert finden – als ein ›subjektiv zureichendes, aber 36 Schnädelbach: RW. S. 28. 37 Schnädelbach, Herbert: »Metaphysik und Religion heute«, in: ders.: Zur Rehabilitierung des animal rationale. Vorträge und Abhandlungen 2. Frankfurt a. M. 1992. S. 155. 38 Schnädelbach: RW. S. 46. 39 Ebd. 40 Schnädelbach: RW. S. 47. 41 Ebd.
Der schmale Grat einer Versöhnung von kritischer Vernunft und Religion
79
objektiv unzureichendes Für-wahr-Halten‹[KrV B 850]. Die Glaubensgewissheit kann man durch Argumente weder erzeugen noch widerlegen, wie es im Bereich des Wissens möglich ist; man kann sie nur als Ganze verlieren – z. B. durch mit dem Geglaubten unvereinbare Evidenzen, die jemanden am Glauben nicht nur zweifeln, sondern verzweifeln lassen.«42
Gewiss: Der Glaube kann angemessen nicht als defizitäre Form des Wissens bestimmt werden. Dennoch scheint mir Schnädelbachs dichotomische Gegenüberstellung von Urteilswahrheit und Glaubensgewissheit unvollständig zu sein. Allerdings bleibt, wenn sowohl einem Offenbarungspositivismus als auch Aktualisierungen spekulativer Vernunft eine Absage erteilt wird, für eine Versöhnung von Religion und kritischer Vernunft tatsächlich nur ein schmaler Grat, der denn auch wegen der bereits sichtbaren Absturzgefahren von den institutionell verfassten Religionen bis heute zumeist gemieden worden ist. Auf welchem Grat sich auch für eine endliche kritische Vernunft in der hügeligen Landschaft der gegenwärtigen Religionsdebatten ein gangbarer Weg eröffnen könnte, soll abschließend zumindest grob angedeutet werden. Die Versöhnung von kritischer Vernunft und Religion bewegt sich, wie bereits mehrfach angesprochen, zwischen der Charybdis der übermenschlichen Bürden spekulativer Vernunft und der Skylla eines objektivistischen Offenbarungsverständnisses, in dem Glaubensfragen in undifferenzierter Weise auf die Ebene der Urteilswahrheit transponiert werden.43 Der Verzicht auf eine teleologische Kosmologie und ein autoritatives Offenbarungsverständnis stellen daher die Eckpfeiler für eine angemessene Transformation von Religion im Kontext der Moderne dar. In dieser Perspektive ist vor allem durch Friedrich Schleiermacher, wie Schnädelbach selbst anerkennt44, mit dem »Gefühl der schlechthinnigen Abhängigkeit« eine wichtige Grundlage für eine modernitätskompatible Reinterpretation von Religion freigelegt worden. Da vor den Herausforderungen neuzeitlicher Aufklärung la longue sämtliche Religionen stehen, sollte es nicht überraschen, dass sich nicht nur in der christlichen Theologie Europas, sondern auch im Buddhismus und im Hinduismus bereits bedeutsame Beiträge zu neuzeitlichen Reinterpretationen religiöser Traditionen finden. Ein beeindruckendes Beispiel für die Absage an einen dogmatischen Offenbarungsbegriff findet sich z. B. bei Mahatma Gandhi, der auf dem Boden endlicher Vernunft zentrale Quellen des Hinduismus reinterpretiert 42 Schnädelbach: RW. S. 47. 43 Vgl. dazu Schnädelbach: RW. S. 156 f.: »Es ist unsinnig, Sätze wie ›Gott ist der Schöpfer des Himmels und der Erde‹ oder ›Gott ist die Liebe‹ daraufhin zu befragen, ob sie wahr oder falsch seien. Es ist sinnlos, aus dem Schöpfungsglauben eine Theorie zu machen, die als ›creationism‹ in Konkurrenz zur Evolutionstheorie treten könnte.« Doch dies scheint mir bereits ein systematisches Missverständnis der biblischen Texte selbst zu sein. 44 Vgl. Schnädelbach: RW. S. 20 u. S. 85.
80
Hans Schelkshorn
und auf diese Weise sogar zu einem der bedeutendsten Erneuerer des Hinduismus geworden ist. »Ich fälle mein Urteil über jede Schrift, einschließlich der Gita. Kein geschriebener Text kann an die Stelle meiner Vernunft treten. Auch wenn ich die bedeutendsten Bücher als Offenbarungen anerkenne, so weiß ich doch, dass sie unter dem Vorgang doppelter Destillierung leiden. Als erstes werden sie durch einen menschlichen Propheten übermittelt und dann von Exegeten kommentiert. Nichts kommt direkt von Gott.«45
Da sich achsenzeitliche Religionen stets in unterschiedlichen Schulen entfalten, eröffnen sich für moderne Reinterpretationen auch Möglichkeiten für eine selektive Anknüpfung an vormoderne Theologien. Im europäischen Denken kommt an dieser Stelle der negativen Theologie, in der einerseits die spezifische Erfahrungsdimension des Absoluten wachgehalten wird, das Absolute selbst zugleich jedoch menschlicher Verfügung entzogen bleibt, eine wichtige Bedeutung zu. In einer ähnlichen Perspektive hat Keji Nishitani, einer der bedeutendsten Vertreter der Kyoto-Schule, das spezifisch moderne Feld von Religion durch die buddhistische Su¯nyata¯-Lehre freigelegt. Religiöse Erfahrung wird von Nishitani als das Gewahrwerden des Nichts bzw. der Leere am Grunde unserer Existenz bestimmt, womit sich zugleich eine sachliche Brücke zum europäischen Nihilismus auftut.46 Im Ausgang von religionsphilosophischen Ansätzen, die explizit den Ansprüchen spekulativer Vernunft entsagen und im Rekurs auf die Erfahrung des nihilum absolutum in konstruktiver Weise an den modernen Nihilismus anknüpfen47, können im Blick auf Schnädelbach zwei Klarstellungen vorgenommen werden. Mit der Bestimmung der conditio humana als einem »Hineingehaltensein in das Nichts« (Heidegger) möchte ich keineswegs ein religiöses Apriori einführen, mit dem atheistische oder agnostische Lebensformen vorweg als defizitäre Formen des Menschseins disqualifiziert werden. Gegenüber allen Formen eines religiösen Inklusivismus, den Schnädelbach zu Recht entrüstet zurückweist48, ist 45 Gandhi, Mahatma: Was ist Hinduismus?. Frankfurt a. M. 2006. S. 46. 46 Vgl. dazu Nishitani, Keji: Was ist Religion?. Frankfurt a. M. 21986. insbes. Kap. 1: Was ist Religion? u. Kap. 3: Nihilismus und su¯nyata¯. 47 Ohne die Sache hier näher entfalten zu können, sei zumindest auf einige Autoren verwiesen, die diesen Weg, wenn auch in unterschiedlicher Weise, beschritten haben: Nancy, Jean-Luc: Dekonstruktion des Christentums. Zürich/Berlin 2008; Welte, Bernhard: Das Licht des Nichts. Von der Möglichkeit religiöser Erfahrung. Düsseldorf 1980; Wucherer-Huldenfeld, Augustinus: »Das Nichts als ›Ort‹ der religiösen Erfahrung. Das Phänomen des Nichts und der Aufweis des Daseins Gottes«, in: ders.: Ursprüngliche Erfahrung und personales Sein. Ausgewählte philosophische Studien II. Wien u. a. 1997. S. 305 – 344. 48 Schnädelbach: RW. S. 59 ff. An dieser Stelle sei allerdings auch die Rückfrage erlaubt, ob die These von der faktisch bereits vollzogenen Selbstauflösung des Christentums, die bloß den ChristInnen noch nicht bewusst geworden sei, nicht einem atheistischen Inklusivismus bedenklich nahe kommt.
Der schmale Grat einer Versöhnung von kritischer Vernunft und Religion
81
vielmehr eigens hervorzuheben, dass die Erfahrung des Nichts am Grunde unserer Existenz sowohl für religiöse als auch atheistische oder agnostische Deutungen offen ist. Zweitens zielt die Erfahrung des Nichts keineswegs, wie Schnädelbach gegenüber neuen Gestalten liberaler Theologie einwendet, auf eine nebulose »Religiosität«, der es abseits aller Inhalte primär um eine individuelle Selbstvergewisserung geht: »Wenn die Individualisierung der Religion so weit fortgeschritten ist, dass es nur noch darauf ankommt, welchen Sinn man seinem Leben selbst gibt, dann ist die Privatisierung der Religion so weit fortgeschritten, dass sie sich dadurch selbst aufhebt: Was soll denn das sein – ein Glaube an sich selbst? Das Christentum war einmal eine Offenbarungsreligion.«49
Das Hineingehaltensein in das Nichts unserer Existenz ist vielmehr im eminenten Sinn Er-fahrung, d. h. Widerfahrnis, auch wenn das Erfahrene gedeutet werden muss, um überhaupt zur Erfahrung werden zu können. Die Haltung einer souveränen Sinngebung ist vor diesem Hintergrund eher Zeichen für eine Verweigerung des Anspruchs des Nichts am Grund unserer Existenz. Eine solche Verweigerung, die gleichsam die Flucht nach vorne antritt, kann im Übrigen sowohl im Gewand einer selbstsicheren Proklamation der eigenen »Offenbarungsreligion« auftreten, als auch in der Gestalt eines dogmatischen Atheismus. Schnädelbachs Kritik narzisstischer Formen von Religiosität, in der überraschenderweise an den Begriff der »Offenbarung« erinnert wird, kann nur dadurch entsprochen werden, dass religiöse Quellentexte selbst als Deutungen der Er-fahrung des nihilum absolutum verstanden werden. Die hermeneutische Reformulierung des Offenbarungsbegriffs mündet keineswegs, wie Kirchenund Religionsführer zumeist einwenden, in eine subjektivistische Selbstauflösung der Religion. Im Gegenteil, ein von autoritären Offenbarungsverständnissen entschlackter Umgang mit religiösen Quellentexten, der bereits in vormodernen Traditionen der Mystik erprobt worden ist, dürfte der »Sache« sakraler Texte näherkommen als so manche Übersetzungen religiöser Themen im Rahmen der traditionellen Metaphysik. Vor diesem Hintergrund kann nun Schnädelbachs Alternative »Glaubensgewissheit versus gerechtfertigte Überzeugung« vorsichtig erweitert werden. Gewiss, in der Frage, ob der Anspruch des Nichts am Grunde unserer Existenz als eine Quelle des Guten oder als dunkler Abgrund zu deuten ist, gibt es keine schlagenden Argumente. Insofern betont Schnädelbach zu Recht, dass man »Ungläubigen Gott nicht andemonstrieren« kann; »noch nie ist jemand durch
49 Schnädelbach: RW. S. 66 f.
82
Hans Schelkshorn
Argumente allein fromm geworden.«50 Dennoch sind Fragen des Glaubens oder Unglaubens transsubjektiver Argumentation nicht einfach enthoben, sondern mit vielfältigen Reflexionsformen verbunden, in denen sich für die kritische Vernunft ein weites Betätigungsfeld eröffnet. Zunächst gilt es den jeweiligen Erfahrungsraum der Religion oder, wie bei Camus, des Absurden, im Kontext der Vernunftgeschichte der eigenen Kultur aufzuschließen. Dazu kommen die schwierigen Fragen der Hermeneutik religiöser Quellen. Trotz der Autonomisierung von Moral stehen religiöse und atheistische Traditionen nicht zuletzt vor der Frage, welche Lebensformen ihren Deutungen des nihilum absolutum in der aktuellen Gestalt der Moderne in adäquater Weise entsprechen. Kurz: Die Frage nach Gott ist, wie Sartre in aller Klarheit herausgestellt hat, »ein totales Problem, dem jeder durch sein ganzes Leben eine Lösung gibt, und die Lösung, die er ihm gibt, spiegelt die Haltung, die man den andren Menschen und sich selbst gegenüber gewählt hat.«51 An dieser Stelle stoßen die theoretischen Reflexionen über das Verhältnis von Religion und Moderne auf die existenziellen Fragen individueller Lebensführung, denen Schnädelbach keineswegs ausweicht. Abseits der Privatisierung des religiösen Feldes hat Schnädelbach seine eigene Haltung öffentlich mit der paradox anmutenden Formel eines »frommen Atheisten« umschrieben, der offen eingesteht, dass ihm »die offenbar alles verändernde Erfahrung, die die Gläubigen ›Offenbarung‹ nennen und als die unabweisbare Evidenz von etwas Göttlichem verstehen«52, fehlt. Im Bewusstsein, dass Gott fehlt, artikuliert sich die »Frömmigkeit« von Schnädelbachs Atheismus, der, wie er selbst bekennt, »nicht anders kann, als das, was er nicht hat, ernst zu nehmen und seinen Verlust zu bedauern.«53 Ich selbst würde mich als skeptischen Christen bezeichnen, der sich, getragen von einem zerbrechlichen Vertrauen auf die Hoffnung, die aus den biblischen Texten spricht, die zentralen Gehalte christlichen Glaubens im Medium endlicher Vernunft, d. h. in unermüdlicher (Selbst-)Prüfung, verständlich zu machen versucht. Ein skeptischer Christ setzt sich ohne Zweifel dem Verdacht aus, nur mehr die von Schnädelbach scharfsinnig diagnostizierte Schwundstufe einer religiösen Existenz, nämlich die bloße Bereitschaft zum Glauben oder gar eine nebulöse, intellektuell eingefärbte Religiosität, zur Sprache zu bringen. Ein solcher Verdacht kann nicht mehr theoretisch, sondern letztlich nur durch die Lebenspraxis selbst entkräftet werden. Auf reflexiver Ebene kann ich an dieser Stelle nur zwei Überlegungen vorbringen. Erstens erfahre ich – wie Schnädelbach – das Medium endlicher kritischer Vernunft als kulturelle conditio hu50 Schnädelbach: RW. S. 77. 51 Sartre, Jean-Paul: »Lebendiger Gide«, in: ders.: Schriften zur Literatur. Band 4: Schwarze und weiße Literatur. Reinbek b. Hamburg 1994. S. 120 f. 52 Schnädelbach: RW. S. 85. 53 Schnädelbach: RW. S. 55.
Der schmale Grat einer Versöhnung von kritischer Vernunft und Religion
83
mana, in die wir eingelassen sind und die wir folglich nicht voluntaristisch durch einen Sprung in »den« Glauben überwinden können, da der Sinn eines solchen Glaubens selbst wieder durch die endliche Vernunft geklärt werden müsste. So bleibt ein skeptischer Christ auf den Spagat verwiesen, sich einerseits der Erfahrung des Hineingehaltenseins in das Nichts zu öffnen, das im Neuen Testament in emphatischer Weise als Quelle einer nicht versiegenden Liebe gedeutet wird, und zugleich die vielfältigen Motive und Geltungsansprüche, die konkrete religiöse Traditionen mit sich führen, im Blick auf den aktuellen Stand der Selbstauslegung menschlicher Vernunft geduldig und nüchtern zu prüfen. »Was wir hier für glaubwürdig halten, hängt« – wie Schnädelbach zu Recht hervorhebt – »von uns ab, d. h. von unserer Vorstellung von dem Gott, dem zu vertrauen und zu folgen wir bereit wären.«54 Zweitens ist ein Christ, wie Schnädelbach selbst weiß, vom eigenen Selbstverständnis her gar nicht in der Lage, einem Atheisten den »Besitz« des Glaubens entgegenzuhalten. Denn der christliche Glaube und die verschwenderische Praxis der Agape sind kein Besitz, sondern Gabe, damit wir uns, wie Paulus betont, nicht rühmen können vor Gott (1 Kor 1,29). Wie ein wahrer Buddhist so trägt auch ein Christ seine Frömmigkeit nicht vor sich her. In der Schilderung des Endgerichts in Mt 25,31 – 46 sind sich daher die Gerechten nicht einmal bewusst, in ihrem selbstlosen Dienst an den Armen Christus begegnet zu sein. Gleichwohl ergeht von Mt 25 an uns der Appell, ein Leben im Sinne des selbstlosen Dienstes an den Armen zu wählen – diese Selbstwahl kann allerdings die Möglichkeit einer Gottesbegegnung nur offenhalten, keineswegs erzwingen. Vor dem Problem der Selbstwahl stehen auch säkulare Bürger der Moderne. An dieser Stelle macht Schnädelbach einen überraschenden Vorschlag. Angesichts der Gewaltgeschichte der Religionen läge es zwar nahe, »Gott ganz aus dem Verkehr zu ziehen«, doch »nicht nur weil das nicht zu erwarten ist, sondern auch wegen des dann fälligen Verzichts der Hoffnung auf den Gott der Liebe (!) empfiehlt sich« – so Schnädelbach – »ein dritter Weg zwischen Gottesglauben und Atheismus: Wir sollten so leben, dass wir die Existenz eines gerechten und gütigen Gottes durch unser Tun glaubwürdig machen und erhalten, und im Übrigen diese Frage auf sich beruhen lassen; von einer Antwort hängt dann nichts weiter ab.«55 Aus diesem Grund dürften sich fromme Atheisten und skeptische Christen trotz aller Differenzen letztlich auf demselben schmalen Grat, der der Religion in der gegenwärtigen Moderne durch die endliche Vernunft vorgezeichnet wird, bewegen, auch wenn die Blicke vermutlich in unterschiedliche Richtungen schweifen.
54 Schnädelbach: RW. S. 122. 55 Schnädelbach: RW. S. 122.
84
Hans Schelkshorn
Literaturverzeichnis Bacon, Francis: The Works of Francis Bacon. Faksimile Neudruck der Ausgabe von James Spedding, Robert Leslie Ellis, Douglas Denon Heath 1857 – 74. Band III. Stuttgart/Bad Cannstatt 1963. Camus, Albert: Der Mensch in der Revolte. Essays. Reinbek b. Hamburg 1997. Diehls, Hermann/Kranz, Walter: Die Fragmente der Vorsokratiker. griechisch/ deutsch. 3 Bände (=DK). Zürich/Hildesheim 181989. Gandhi, Mahatma: Was ist Hinduismus?. Frankfurt a. M. 2006. Kant, Immanuel: Gesammelte Schriften. Hg.: Band 1 – 22 Preussische Akademie der Wissenschaften, Band 23 Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin, ab Band 24 Akademie der Wissenschaften zu Göttingen. Berlin 1900 ff. Nancy, Jean-Luc: Dekonstruktion des Christentums. Zürich/Berlin 2008. Nishitani, Keji: Was ist Religion?. Frankfurt a. M. 21986. Platon: Sämtliche Werke. Nach der Übersetzung von Friedrich Schleiermacher. Hrsg. von Walter Friedrich Otto u. a. Reinbek b. Hamburg 1988. Riedenauer, Markus: Pluralität und Rationalität. Die Herausforderung der Vernunft durch religiöse und kulturelle Vielfalt nach Nikolaus von Kues. Stuttgart 2007. Roetz, Heiner : Die chinesische Ethik der Achsenzeit. Frankfurt a. M. 1992. Sartre, Jean-Paul: Schriften zur Literatur. Band 4: Schwarze und weiße Literatur. Reinbek b. Hamburg 1994. Schelkshorn, Hans: Entgrenzungen. Ein europäischer Beitrag zum philosophischen Diskurs über die Moderne. Weilerswist 2009. Schnädelbach, Herbert: »Gescheiterte Moderne?«, in: ders.: Zur Rehabilitierung des animal rationale. Vorträge und Abhandlungen 2. Frankfurt a. M. 1992. S. 431 – 446. Schnädelbach, Herbert: »Metaphysik und Religion heute«, in: ders.: Zur Rehabilitierung des animal rationale. Vorträge und Abhandlungen 2. Frankfurt a. M. 1992. S. 137 – 157. Schnädelbach, Herbert: Philosophie in der modernen Kultur. Abhandlungen und Vorträge 3. Frankfurt a. M. 2000. Schnädelbach, Herbert: Religion in der modernen Welt. Vorträge, Abhandlungen, Streitschriften. Frankfurt a. M. 32005. Schnädelbach, Herbert: Vernunft. Stuttgart 2007. Taylor, Charles: Quellen des Selbst. Frankfurt a. M. 1996. Taylor, Charles: Das säkulare Zeitalter. Frankfurt a. M. 2009. Welte, Bernhard: Das Licht des Nichts. Von der Möglichkeit religiöser Erfahrung. Düsseldorf 1980. Wucherer-Huldenfeld, Augustinus: »Das Nichts als ›Ort‹ der religiösen Erfahrung. Das Phänomen des Nichts und der Aufweis des Daseins Gottes«, in: ders.: Ursprüngliche Erfahrung und personales Sein. Ausgewählte philosophische Studien II. Wien u. a. 1997. S. 305 – 344.
Bernd Dörflinger
Eine neuere Religionsauffassung im Licht einer älteren. Habermas und Kant1
Unsere Zeit bietet wieder verstärkt Anlass, über Religion nachzudenken. Dass diese Einschätzung von nicht wenigen geteilt wird, zeigt sich auch am Anwachsen religionsphilosophischer Literatur speziell im letzten Jahrzehnt. Zu den am aufmerksamsten wahrgenommenen Diskussionsteilnehmern gehört zweifellos Jürgen Habermas. Im Ausgang von einer, wie ich meine, weitgehend zutreffenden deskriptiven Charakteristik des gegenwärtigen weltweiten Religionszustandes hat er in zahlreichen Schriften eine erwägenswerte Deutung des Wiederauflebens religiöser Erscheinungen und eine normative Theorie zu ihrer systematischen Verortung vorgelegt. Zusammengefasst, lautet sein Befund zur Situation: »Es sind vor allem drei, einander überlappende Phänomene, die sich zum Eindruck einer weltweiten resurgence of religion verdichten: die missionarische Ausbreitung großer Weltreligionen (a), deren fundamentalistische Zuspitzung (b) und die politische Instrumentalisierung ihrer Gewaltpotentiale (c).«2 Obwohl Habermas erkennbar nicht blind gegenüber den pathologischen Zügen der Religionen ist – übrigens auch nicht gegenüber deren Auswüchsen in der Geschichte –, beinhaltet seine intellektuelle Reaktion auf die skizzierte Situation doch vor allem eine Apologie des Religiösen. Er entwirft in seinen Schriften in bester friedensstiftender Absicht ein Modell gesellschaftlichen Zusammenlebens, in dem Religion ihren Platz hat und haben soll, selbstverständlich ohne jene fundamentalistische Zuspitzung und ohne Gewaltpotential. Es ist das Modell einer Balance zwischen den Ansprüchen säkularer Bürger einerseits, zu denen Habermas sich selbst zählt, und religiöser Bürger andererseits; zudem soll es auch Modell für friedliche Verhältnisse der Religionen untereinander sein. Neben den religiösen Fundamentalisten gilt Habermas’ 1 Dieser Beitrag ist zuerst in den Akten des Internationalen Kant-Kongresses (Pisa 22.–26. 5. 2010) Berlin 2013 erschienen. 2 Habermas, Jürgen: Kritik der Vernunft. Philosophische Texte: Band 5. Frankfurt a. M. 2009. S. 388.
86
Bernd Dörflinger
Kritik in gleichem Maße den sogenannten Säkularisten, die er von den gemäßigteren Säkularen dadurch unterscheidet, dass sie das Verschwinden der Religionen nicht bloß voraussagen, sondern sogar propagieren.3 Für Säkularisten, so seine Kritik, sei Religion, »kognitiv betrachtet, eine historisch überwundene ›Gestalt des Geistes‹«4, ein »aus vormodernen Gesellschaften in die Gegenwart hineinreichendes Relikt«5 ohne innere Berechtigung. Die Einstellung von Säkularisten gegenüber der Religion könne so – die Trennung von Kirche und Staat und das Recht auf Religionsfreiheit vorausgesetzt – allenfalls die Einstellung eines »schonenden Indifferentismus«6 sein und »nicht mehr als einen modus vivendi gewährleisten«7. Den die positiven Gehalte der Religionen verfehlenden Säkularismus sieht Habermas auf zweifache Weise ausgeprägt: zum einen auf die Weise eines Naturalismus, der das naturwissenschaftliche Denken verabsolutiert und es derart zu schlechter Metaphysik werden lässt8, zum anderen aber auch durch das aufklärerische Konzept der »Autonomie der Vernunft«, das besage, »daß der Glaube zum Weltwissen nichts mehr beitragen kann«9, und das speziell praktische Vernunft als »konstruktive Vernunft« begreife, »die alle normativen Gehalte aus sich selbst schöpft«10. Mit dieser Position identifiziert Habermas – und das nicht zu Unrecht – Kant. Ihm hält er entgegen, dass die autonome Vernunft dem durch die historischen Religionen dargebotenen »fremden Anderen nicht auf Augenhöhe«11 begegne, was näherhin heißt, dass sie über die moralischen Intuitionen und normativen Gehalte »aus erlösungsreligiösen Offenbarungswahrheiten«12 hinwegsehe und überhaupt verkenne, dass die geschichtlichen Religionen Bedingungen der Genese der Vernunft selbst seien.13 Auch wenn Habermas, wie noch näher zu sehen sein wird, in Absicht auf einen gelingenden gesellschaftlichen Diskurs dafür plädiert, jene moralischen Intuitionen und normativen Gehalte aus Offenbarungswahrheiten von der Ebene der religiösen Sprache auf die Vernunftebene öffentlich zugänglicher 3 Vgl. ebd. S. 392. 4 Habermas, Jürgen: »Die Dialektik der Säkularisierung«, in: Blätter für deutsche und internationale Politik (53) 2008/4. S. 43. 5 Habermas, Jürgen: Zwischen Naturalismus und Religion. Philosophische Aufsätze. Frankfurt a. M. 2005. S. 145. 6 Ebd. 7 Habermas: Kritik der Vernunft. S. 402. 8 Vgl. Habermas: »Die Dialektik der Säkularisierung«. S. 44. 9 Habermas: Kritik der Vernunft. S. 403. 10 Ebd. S. 404. 11 Ebd. 12 Ebd. S. 406; vgl. auch Habermas: Zwischen Naturalismus und Religion. S. 137 u. ö. 13 Vgl. Habermas, Jürgen: The Holberg Prize Seminar 2005. Holberg Prize laureate professor Jürgen Habermas: Religion in the Public Sphere. Hrsg. vom Holberg Prize Seminar 2005. Bergen 2005. S. 17.
Eine neuere Religionsauffassung im Licht einer älteren
87
Sprache zu heben, wird doch deutlich, dass er der religiösen Ebene nicht bloß den Charakter des Anlasses für vernünftige Reflexion zuschreibt, sondern dass er historische Religion, die sich auf Offenbarung beruft, als Quelle sui generis für Normativität und moralische Wahrheit betrachtet, als Quelle also, die durch Vernunft nicht zu ersetzen sei. Entsprechend gilt seine Skepsis einer Vernunft, die eigenmächtig und mittels eines allein aus sich erzeugten normativen Wissens an die historischen Religionen herantritt, um zu entscheiden, was an ihnen als vernunftkonform bestehen bleiben kann und was als unvernünftig zu verwerfen ist. Dass Kant als ein Hauptadressat solcher Skepsis wird gelten müssen, lässt sich leicht durch die Erinnerung an dessen oberste Autorität in der Auslegung aller Offenbarungsschriften vergegenwärtigen. Diese ist keine andere als reine praktische, d. h. moralischpraktische Vernunft beziehungsweise der rein rationale Religionsglaube. Dass durch diesen letzten Ausdruck Vernunftreligion, also immerhin Religion, als Auslegerin von Offenbarungsreligion bezeichnet ist, mildert den hier herausgestellten Gegensatz nicht. Denn Vernunftreligion ist von Kant allein aus moralischem Bewusstsein entwickelt und von etwaigen geoffenbarten Wahrheiten historischer Religionen, d. h. von dem von Habermas verteidigten fremden Anderen dieser Religionen, ganz unabhängig. Wenn nun ein Säkularist ein solcher ist, der keine vernunftexterne, in positiver Religion begründete moralische Normativität anerkennt und darüber hinaus die Zielvorstellung des Verschwindens solcher Religion hegt, dann ist Kant nach den Maßstäben von Habermas inklusive seines Lehrstücks von der Vernunftreligion ein Säkularist – ein nicht-naturalistischer selbstverständlich. Denn Vernunftreligion ist rein immanente ideelle Religion, die sich dem Inhalt nach, so Kant, »nicht […] in irgend einem Stücke von der Moral [unterscheidet]«14, nur der Form nach, nämlich in dem Punkt, dass autonome Vernunft den moralischen Gesetzen noch die zusätzliche Beziehung auf »die Id e e von Gott« gibt, das ist eine Idee, welche die Vernunft, so wieder Kant, »sich selber macht«15. Den positiven historischen Religionen, die sich auf empirische Faktizität des Göttlichen berufen, versagt Kant sogar die Bezeichnung ›Religion‹; er nennt sie durchgängig bloß kirchliche Glaubensarten. Habermas selbst ordnet Kant übrigens nicht den Säkularisten zu, doch mit der bezweifelbaren Begründung, bei Kant finde sich der uneingestandene Beleg der Schwäche der Vernunftmoral, etwa in der Lehre vom Postulat der Verwirklichung des ethischen Gemeinwesens, das aus reiner praktischer Vernunft nicht zu entwickeln sei.16 Auch gehe sein Konzept der Vernunftreligion in Wahrheit nicht aus reiner praktischer Vernunft hervor, wie an dem darin zen14 Kant: SF. AA 07: 036.22 f. 15 Kant: MS. AA 06: 487.10 f. 16 Vgl. Habermas: Zwischen Naturalismus und Religion. S. 230 f.
88
Bernd Dörflinger
tralen Begriff des höchsten Guts zu sehen sei.17 Beide Lehrstücke hätten eine außerhalb der Menschenvernunft gelegene »epistemische Anregung« zur notwendigen Bedingung, nämlich den »historischen Vorschuss, den die positive Religion mit ihrem unsere Einbildungskraft stimulierenden Bilderschatz liefert«; so sei der Begriff des ethischen Gemeinwesens von Kant nur aus der christlichen »Metapher einer Gottesherrschaft auf Erden philosophisch ausbuchstabiert«18. Die Argumente und Gegenargumente zu diesen Lehrstücken, ihre Vernunftimmanenz oder ihre Abhängigkeit von positiver Religion, gar von ihrem Bilderschatz, betreffend, sollen hier nicht im Einzelnen erwogen werden, auch weil Habermas von anderen in diesen Punkten bereits überzeugend widersprochen wurde, an erster Stelle von Rudolf Langthaler19 und Herta NaglDocekal20. Es soll aber doch gesagt sein, dass es der kantischen Vernunftkonzeption völlig entgegenliefe, wenn eine außermenschliche anonyme, quasi naturwüchsige und ursprünglich unbekannte Vernunft waltete, ob in einem Bilderschatz versteckt oder nicht, der gegenüber die menschliche Vernunft bloß passiv sein könnte und von der her sie durch Ablernen und Ausbuchstabieren mit normativen Gehalten und moralischen Anforderungen erst bekannt würde. Bei einer solchen Nachträglichkeit der menschlichen Vernunft zum sittlich Gebotenen könnte dieses nie zur ureigenen inneren Angelegenheit der Menschenvernunft werden. Mag auch der Inhalt der fremden Aufforderung ein objektiv moralischer sein, wie z. B. ein auf einer Gebotstafel vorgefundenes Lügenverbot, ohne inneren, d. h. bei nur äußerem Geltungsgrund könnte das Gebot nur den Charakter eines statutarischen Gesetzes haben, einen zufälligen und willkürlichen Charakter also, so dass kraft eigener Einsicht nicht vollzogen werden könnte, warum etwa nicht gelogen werden sollte. Nach Kant zeigt sich an demjenigen, an dem sich das Bedürfnis nach einem äußeren Ursprung der Moral vorfindet, nicht bloß ein relatives Defizit, sondern ein völliges moralisches Vakuum, das Kant diesem Bedürftigen sogar als dessen »eigene Schuld« zurechnet, nämlich als die Schuld, sich nicht »selbst durch seine Vernunft an unbedingte Gesetze« zu binden. Diesem Mangel autonomer Selbstverpflichtung kann ihm zufolge durch »nichts anders abgeholfen werden«, das heißt: »was nicht aus ihm [dem Menschen] selbst und seiner Freiheit ent-
17 Vgl. ebd. S. 223 ff. 18 Ebd. S. 231. 19 Vgl. Langthaler, Rudolf: »Zur Interpretation und Kritik der Kantischen Religionsphilosophie bei Jürgen Habermas«, in: Langthaler, Rudolf/Nagl-Docekal, Herta (Hg.): Glauben und Wissen. Ein Symposium mit Jürgen Habermas. Wien 2007. S. 32 – 92. 20 Vgl. Nagl-Docekal, Herta: »Eine rettende Übersetzung? Jürgen Habermas interpretiert Kants Religionsphilosophie«, in: Langthaler, Rudolf/Nagl-Docekal, Herta (Hg.): Glauben und Wissen. Ein Symposium mit Jürgen Habermas. Wien 2007. S. 93 – 119.
Eine neuere Religionsauffassung im Licht einer älteren
89
springt, [gibt] keinen Ersatz für den Mangel seiner Moralität«.21 Allein durch autonome Selbstverpflichtung ist Moral die Angelegenheit des Menschen selbst; d. h. nur so kann er im Selbstverständnis stehen, in Erfüllung seiner Pflichten keinen fremden und also im Grunde gleichgültigen Befehl auszuführen oder für keine anonymen Natur- oder Geschichtskräfte bloß als Werkzeug ihrer Planerfüllung zu agieren, wodurch er gleichermaßen in einem distanzierten Verhältnis zur Pflichterfüllung stünde. Dass Habermas der Selbstständigkeit und Selbstgesetzgebung der Vernunft prinzipiell misstraut und sie sogar in die Nähe der Hybris rückt, zeigt sich neben der Priorisierung der positiven Religionen in der von ihm als geschichtliches Werden verstandenen Genese der Vernunft auch an seiner Bewertung nachkantischer Religionsphilosophie. Habermas bewertet es erkennbar als Fortschritt, dass etwa Schleiermacher und Kierkegaard wieder die Abhängigkeit und Unterworfenheit des Menschen hinsichtlich eines fremden Anderen betonen. Er formuliert in diesem Zusammenhang den seines Erachtens fortschrittlichen Gedanken so: »Die auf ihren tiefsten Grund reflektierende Vernunft entdeckt ihren Ursprung aus einem Anderen, dessen schicksalhafte Macht sie anerkennen muss, soll sie nicht in der Sackgasse hybrider Selbstbemächtigung ihre vernünftige Orientierung verlieren.«22 Aus der Perspektive Kants muss eher eine solche Vernunft mit dem Anspruch der Entdeckung ihres transzendenten Ursprungs als anmaßend erscheinen. Die Entdeckung des Ursprungs der Vernunft müsste auch die für Kant widersinnige Entdeckung des Grundes der Freiheit enthalten. Im Folgenden möchte ich mich nun einem anderen Aspekt des Themas zuwenden, wie nämlich nach Habermas der wohlverstandene Säkulare – nicht der Säkularist also – den historischen Religionen und ihren Repräsentanten in der Gesellschaft begegnen sollte, um auch die Ergebnisse dieser Darstellung mit Kant zu konfrontieren. Dabei soll eine akzentuierte Rolle spielen, ob die Friedensintention, die Habermas zweifellos verfolgt, durch sein Konzept tatsächlich zu erfüllen ist, und zwar mehr als durch das kantische, das auf den ersten Blick eher provokativ und konfrontativ zu sein scheint, indem »vermöge der überhand genommenen wahren Aufklärung«23 die letztliche Auflösung der historischen Religionen anvisiert ist. Zu den Merkmalen der Habermasschen Normgestalt des Säkularen, dem eine entsprechende Normgestalt eines nicht-fundamentalistischen Religiösen beigeordnet wird, gehört die Festlegung auf die diskursive Rede der Vernunft24, das
21 Kant: RGV. AA 06: 003.04 f., 003.08 – 11. 22 Habermas, Jürgen/Ratzinger, Joseph: Dialektik der Säkularisierung. Über Vernunft und Religion. Mit einem Vorwort hrsg. von Florian Schuller. Freiburg 2005. S. 29. 23 Kant: RGV. AA 06: 123.14 (Anm.). 24 Vgl. Habermas, Jürgen: »Eine Replik«, in: Reder, Michael/Schmidt, Josef (Hg.): Ein Be-
90
Bernd Dörflinger
ist die allgemeine und öffentlich zugängliche Rede des Begründens und Rechtfertigens. Zugleich gehört aber auch die Einstellung dazu, aus der religiösen Offenbarungsrede mit dem ihr zuzugestehenden Wahrheitspotential einen Gewinn schöpfen zu können, was ersichtlich voraussetzt, ihre potentiell erkenntniserweiternden Gehalte in jene diskursive Rede der Vernunft zu übertragen. Habermas nennt diese Übertragung »rettende Übersetzung«25. Die Übersetzungsarbeit ist ihm zufolge eine Aufgabe, die beiden beteiligten Seiten zukommt, der säkularen als eine Art Holschuld und der religiösen als Bringschuld. Es seien die besagten lehrreichen religiösen »semantischen Gehalte […] in einen vo[n] […] Offenbarungswahrheiten entriegelten Diskurs [zu] übersetzen«26, bzw. sei den in religiöser Sprache artikulierten Erfahrungen ein »profane[r] Sinn«27 zu geben; sie seien, so ein anderer Ausdruck, zu neutralisieren28, um universell akzeptabel werden zu können. Ersichtlich setzt Habermas tatsächliche religiöse Erfahrungen hier voraus, obwohl er sie durch sein bekanntes Diktum, religiös unmusikalisch zu sein, nicht für sich selbst beansprucht. Dass er sie voraussetzt, geht auch aus seiner an den Säkularen gerichteten Mahnung hervor, bei seiner Übersetzungsarbeit keinen bloß metaphorischen Gebrauch religiöser Vokabeln zu unterstellen bzw. die religiöse Rede bloß als literarische zu verstehen.29 Das Verhältnis zwischen dem Säkularen und dem Religiösen im Zuge ihrer gemeinsamen Übersetzungsbemühung bezeichnet er als das einer kooperativen Wahrheitssuche,30 als ein symmetrisches und komplementäres, als das reziproker Perspektivübernahmen mit der Einstellung auf beiden Seiten, vom andern etwas lernen zu können.31 Das Gelingen der kooperativen Wahrheitssuche ist nach Habermas schon vorgezeichnet, wenn der Dialog überhaupt nur aufgenommen wird. Dafür sorge die »Normativität der Sprache«32, d. h. die jedem Sprechakt als solchem schon innewohnende Rationalität. Ein solcher Akt kommunikativen Handelns bzw. diskursiver Rede enthalte nämlich die idealisierende Unterstellung, dass Geltungsansprüche, Ansprüche auf Wahrheit oder moralische Richtigkeit, im Medium des Begründens und Rechtfertigens zur Diskussion gestellt bzw. der Kritik
25 26 27 28 29 30 31 32
wusstsein von dem, was fehlt. Eine Diskussion mit Jürgen Habermas. Frankfurt a. M. 2008. S. 105 und Habermas: The Holberg Prize Seminar 2005. S. 14 u. ö. Habermas/Ratzinger: Dialektik der Säkularisierung. S. 32. Habermas: Zwischen Naturalismus und Religion. S. 255. Habermas, Jürgen: Zeit der Übergänge. Frankfurt a. M. 2001. S. 192. Vgl. Habermas: Kritik der Vernunft. S. 428. Vgl. Habermas: Kritik der Vernunft. S. 428. Vgl. Habermas: Zwischen Naturalismus und Religion. S. 145. Vgl. Habermas, Jürgen: Vom sinnlichen Eindruck zum symbolischen Ausdruck. Frankfurt a. M. 1997. S. 45, 58. Habermas: Zwischen Naturalismus und Religion. S. 79.
Eine neuere Religionsauffassung im Licht einer älteren
91
dargeboten werden.33 Dabei ist Zustimmung auf der Basis überzeugender Gründe intendiert, aber auch Ablehnung, ebenfalls mittels Begründungen, erwartet. Den Fall letztlichen Scheiterns eines solchen diskursiven kommunikativen Handelns hält Habermas für ausgeschlossen; er hält es für falsch, partikulare und geschlossene Universen von Bedeutungen anzunehmen, die inkommensurabel sind.34 – Allerdings gibt es doch Arten sprachlicher Äußerung, die nach Habermas’ eigenen Maßstäben keine Fälle kommunikativen Handelns sind und die demnach auch nicht die Rationalität beanspruchen können, die diesem innewohnen mag. Eine Äußerung als bloße Mitteilung sieht nicht die Möglichkeit vor, »daß deren Geltung von anderen Aktoren bestritten wird«; sie fordert kein »Gegenüber zu einer rational motivierten Stellungnahme«35 auf. Auf forcierte Weise muss das für eine vermeinte Selbstmitteilung Gottes, d. h. für die Offenbarungsrede, gelten: Mit dem autoritativen Anspruch einer faktischen göttlichen Mitteilung kann nicht verbunden sein, dass Geltungsansprüche zur Diskussion gestellt oder der Kritik dargeboten werden. Es ist ja auch nach Habermas, wie gehört, eine Übersetzungsarbeit nötig, um die religiöse Rede auf die Ebene des begründenden Diskurses zu heben. Trotz der offensichtlichen Wichtigkeit der Übersetzungsproblematik findet sich bei Habermas kein explizites Lehrstück dazu, das etwa der kantischen hermeneutica sacra mit ihren ausformulierten Auslegungsregeln entspräche. Es finden sich auch nur wenige Beispiele, aus denen ein solches Theoriestück rekonstruiert werden könnte. Eines davon – ein mehrfach wiederholtes – ist, dass es als rettende Übersetzung verstanden werden könne, wenn die religiöse Vorstellung von der »Gottesebenbildlichkeit des Menschen in die gleiche und unbedingt zu achtende Würde aller Menschen«36 transformiert werde; es zeige sich daran, dass das Vernunftrecht, so Habermas, »vom egalitären Universalismus der Gottesebenbildlichkeit »des« Menschen zehren»37 könne. Die nähere Betrachtung dieses Beispiels führt allerdings eher in Probleme, als dass es das Gelingen des zuvor skizzierten Übersetzungsgedankens belegen könnte. Was nämlich lernen die beiden an der Übersetzungsarbeit Beteiligten in diesem Fall voneinander? Der säkulare Vernunftrechtler kann zur Kenntnis nehmen, dass es eine religiöse Vorstellung gibt, die zu der auch von ihm gebilligten Konsequenz des rechtlichen Schutzes von Personen führt. Seine Begründung dieses Schutzes stützt sich aber auf die Würde, die der Mensch sui generis hat – auf dessen 33 Vgl. ebd. S. 31. 34 Vgl. Habermas, Jürgen/Derrida, Jacques: Philosophie in Zeiten des Terrors. Berlin/Wien 2004. S. 62. 35 Habermas, Jürgen: Theorie des kommunikativen Handelns. Frankfurt a. M. 1995 (1. Aufl. 1981). S. 148. 36 Habermas/Ratzinger: Dialektik der Säkularisierung. S. 32. 37 Habermas: Kritik der Vernunft. S. 404.
92
Bernd Dörflinger
Selbstzweckcharakter, kantisch gesprochen. Seine Begründung allein durch die Berufung auf das Selbstverständnis des Menschen ist unabhängig davon, von der Vorstellung der Gottesebenbildlichkeit zu lernen oder zu zehren. Er muss dieser Vorstellung sogar mit Skepsis begegnen, denn nach ihr hat der Mensch bloß eine geliehene Würde, die sekundäre und derivative Würde eines Abbilds, die zudem von der unsicheren Bedingung abhängig ist, dass die gläubige Vorstellung der Gottesebenbildlichkeit sich erhält. Diese Bedingung ist deshalb unsicher, weil nach ursprünglich religiöser Voraussetzung diese Vorstellung keine selbstgemachte und keine in der Immanenz des menschlichen Selbstverständnisses verifizierbare ist, sondern auf der Gunst fremder Mitteilung beruht, die überdies auf direkte Art in historisch ausgezeichneter Zeit nur an wenige ergangen ist. Auch könnte eine Kritik der religiösen Erfahrung verunsichernd wirken, die die Erfahrbarkeit göttlicher Mitteilungen problematisierte oder auch nur auf den Irrtumsvorbehalt bei jeder empirischen Erkenntnis hinwiese, womit im speziellen Fall nicht weniger als die Grundlage für die Überzeugung von der unverletzlichen Würde der Person verunsichert wäre. Es mag darauf geantwortet werden, dass Habermas’ Übersetzungspostulat eben Ausdruck solcher Skepsis gegenüber offenbarungsreligiösen Begründungen ist und gerade aufgrund der Fragilität und Partikularität solcher Begründungen in die säkulare Sprache der Vernunft übersetzt werden soll. Doch mit der Aufgabe der Vorstellung der Gottesebenbildlichkeit zur Begründung der unverletzlichen Würde der Person und mit ihrer Ersetzung durch die Vorstellung eigenursprünglicher personaler Würde hätte die Transformation ein solches Ausmaß angenommen, dass sie kaum noch ein Übersetzen genannt werden könnte. Denn sie verlangte vom religiösen Partner nicht weniger als die Aufgabe seines spezifisch religiösen Selbstverständnisses, d. h. die Aufgabe seiner Art des Begründens mittels geoffenbarter Wahrheit. Es wäre so kaum noch von einem symmetrischen Verhältnis, von gleichberechtigter Kooperation, von Komplementarität oder reziproker Perspektivenübernahme zu sprechen. Der unübersetzten, originär religiösen Rede als dem Reservoir für potentielle Übersetzungen weist Habermas die geschlossene Sphäre der jeweiligen Religionsgemeinschaft zu, verlangt jene Übersetzungen also nur für den Fall des Hinaustretens in den öffentlichen Raum. Auch hinsichtlich dieser Grenzziehung erscheint es fraglich, ob sie mit dem Selbstverständnis positiver Religionen verträglich sein kann, die doch keine geringeren Ansprüche erheben, als über göttliche Wahrheiten zu verfügen, die also die Tendenz zu allgemeiner und ganzheitlicher Wirksamkeit haben müssen und sich nicht mit dem Dasein in einer Art Reservat begnügen können, das sie nur verlassen dürfen, wenn sie sich auf Übersetzungen ins säkular Vernünftige einlassen und damit ihr religiöses Proprium aufgeben. All das weist auf Inkommensurabilitäten, die durch das Habermassche Harmonievokabular bloß verdeckt werden.
Eine neuere Religionsauffassung im Licht einer älteren
93
Kants Blick auf diese Unverträglichkeiten ist schärfer. Sein Auslegen von Texten eines »empirischen Glauben[s], den uns dem Ansehen nach ein Ungefähr in die Hände gespielt hat«38, ist nicht als ein Übersetzen im Ausgang von der Autorität der Texte konzipiert, das sich bei näherem Hinsehen dann doch als ein essentielles Verändern herausstellt, sondern es ist von vornherein ein Verändern, sowohl im Fall der moralischen Lehren dieser Texte, deren Anspruch auf einen heteronomen Ursprung durch den Anspruch autonomen Vernunftursprungs ersetzt wird, als auch im Fall ihrer sonstigen Lehren. In diesem zweiten Fall verfolgt die Auslegerin, nämlich reine praktische Vernunft, die Intention des Hineinlegens von moralischem Sinn in die Texte. Dabei scheut Kant die offene Opposition gegen den Text nicht, d. h. das Hineinlegen darf ihm zufolge gegen das Buchstäbliche des Textes und gegen eine als wahrscheinlich anzunehmende Autorenintention auch »gezwungen«39 sein, was durch Ausnutzung von textlichen Ambiguitäten oder durch symbolische Interpretation möglich ist. Als letzte Möglichkeit bleibt schließlich auch das Verwerfen von eindeutig amoralischem Textsinn. Die Legitimation zum Zwang im Zuge des Hineinlegens von moralischem Sinn in religiöse Texte zieht Kant aus dem Anspruch dieser Texte, heilige Texte zu sein. Sie als solche ernst zu nehmen, bedeutet nicht, wie es bei Habermas zu sein scheint, ihnen aufgrund ihrer historischen Faktizität einen Ehrwürdigkeitsvorschuss zu geben, sondern sie auf ihre Heiligkeit hin zu prüfen und sie gegebenenfalls in dieser Hinsicht zu verbessern, eben durch das Hineinlegen von moralischem Sinn. Es ist dies bei Kant ein ganz bewusstes Verändern gegebenen Sinns von der Autorität reiner praktischer Vernunft her, die er auch den »Gott in uns […] selbst«40 nennt, allerdings ohne die Illusion, dass es darüber mit dem offenbarungsreligiösen Ausleger der Texte, den er den ›biblischen Theologen‹ nennt, einen Konsens geben könnte. Dieser bleibt, indem er aus der für ihn nicht diskutablen Faktizität der Texte und aus der Faktizität der durch sie gesetzten Lehren schöpft, der Antipode des philosophischen Auslegers. Käme er, wie Habermas es offensichtlich verlangt, dem rationalen Ausleger auf halbem Weg entgegen, d. h. ließe er sich auf ein diskursives Deliberieren nach Maßstäben der Vernunft ein, dann verliefe er sich, wie Kant es ausdrückt, »in das offene, freie Feld der eigenen Beurtheilung«41, wodurch unsicher würde, ob die Lehren des Textes, der doch nicht weniger als Gottes Wort ausdrücken soll, der Prüfung standhalten können. Der biblische Theologe hätte durch sein Entgegenkommen den Geltungsgrund seiner Lehren – sein: Der Herr hat’s gesagt – relativiert und die Möglichkeit eröffnet, dass diese Lehren im Licht des nun 38 39 40 41
Kant: RGV. AA 06: 110.01 f. Kant: RGV. AA 06: 110.11. Kant: SF. AA 07: 048.05. Kant: SF. AA 07: 024.23.
94
Bernd Dörflinger
anerkannten neuen Geltungsgrundes, der Vernunft, modifiziert oder sogar verworfen werden könnten. Demgegenüber besteht Kant auf der strikten gedanklichen Trennung dessen, was nicht versöhnt werden kann, nämlich die Orientierungen an der äußeren Autorität des sich historisch mitteilenden Gottes einerseits und an der inneren Autorität der reinen praktischen Vernunft andererseits. »Denn so bald wir zwei Geschäfte von verschiedener Art vermengen und in einander laufen lassen, können wir uns von der Eigenthümlichkeit jedes einzelnen derselben keinen bestimmten Begriff machen.«42 Auch Habermas gesteht ein verbleibendes Problem im Verhältnis zwischen »Glaubensgewissheiten und öffentlich kritisierbaren Geltungsansprüchen«43 zu, hält also offenbar seinen eigenen Übersetzungsgedanken nicht für vollständig problemlösend. Wenn Glaubensgewissheiten sich allein auf die »dogmatische Autorität […] von infalliblen Offenbarungswahrheiten« stützten, seien sie »vorbehaltloser diskursiver Erörterung«44 entzogen. Bei der Beanspruchung solcher Wahrheit handelt es sich dann ersichtlich um jene bloße Mitteilung, die kein Fall kommunikativen Handelns ist. Bei Kant heißen die für Vernunft gar nicht einsichtigen, sich allem Hineinlegen von moralischem Sinn entziehenden Lehren und Gesetze die statutarischen, wovon es in den historischen Religionen unzählige gibt, die nicht selten konkurrieren und das Leben der jeweiligen Glaubensgemeinschaften bis ins Einzelne regeln. Sie alle sind, weil eben jeweils auf Gott zurückgeführt, zugleich strikt verbindlich und nicht diskutabel. Aus der Sicht der Philosophie hält Habermas solche »diskursive Exterritorialität«45 für eine »kognitiv unannehmbare Zumutung«46, und er formuliert im Blick auf die hier nicht durch Übersetzung zu mildernde Konfrontation zwischen Philosophie und Offenbarung: »Die Perspektiven, die entweder in Gott oder im Menschen zentriert sind, lassen sich nicht ineinander überführen.«47 Doch trotz dieser zugestandenen Unversöhnlichkeit »auf der kognitiven Ebene« hält er den Konsens auf »der sozialen Ebene«48 doch für möglich. Hier ließe sich der »Dissens zwischen Gläubigen, Andersgläubigen und Ungläubigen« so handhaben, dass die »Interaktionen zwischen Bürgern des politischen Gemeinwesens nicht berührt«49 werden müssten. Was von der religiösen Seite dazu zu verlangen
42 43 44 45 46 47 48 49
Kant: SF. AA 07: 024.28 – 30. Habermas: Zwischen Naturalismus und Religion. S. 149. Ebd. S. 135. Ebd. S. 135. Ebd. S. 252. Ebd. S. 252. Ebd. S. 319. Ebd. S. 319.
Eine neuere Religionsauffassung im Licht einer älteren
95
sei, nennt er »reflexive[s] Bewußtsein«50 bzw. ein »reflexives Verhältnis zur Partikularität des eigenen Glaubens«51. Mit dem reflexiven Bewusstsein ist von den religiösen Traditionen eine »Distanzierung von sich selbst« verlangt, wenn sie sich nämlich »des Umstandes inne werden, daß sie mit anderen Glaubensmächten dasselbe Universum von Geltungsansprüchen teilen«52. Verlangt ist, anders gesagt, das Bewusstsein der »nicht-exklusiven Stellung«, dies als Voraussetzung dafür, »sich mit den Augen der anderen zu betrachten.«53 Durch die Unfähigkeit oder mangelnde Bereitschaft zu solch reflexivem Bewusstsein definiert Habermas den Fundamentalismus.54 Das verlangte reflexive Bewusstsein soll dennoch seines Erachtens »keine Relativierung der Glaubenswahrheiten selbst zur Folge haben«55. Da Wahrheiten als solche einen universellen Anspruch haben, muss hier offensichtlich, um den Widerspruch mit der doch auch geforderten Einsicht in die eigene Partikularität zu vermeiden, von der eingeführten Unterscheidung zwischen der gedanklichen Ebene, der kognitiven, und der faktischen, der sozialen Ebene, Gebrauch gemacht werden. Wenn universalistische Wahrheitsansprüche bloß noch in Gedanken gehegt werden, wenn aber im Faktischen des sozialen Lebens eine partikulare Rolle akzeptiert wird, dann ist durch die Trennung der Hinsichten ein formeller Widerspruch in der Tat vermieden. Es resultieren, so Habermas, keine »Relativierung[en] eigener Überzeugungen«, sondern es ergeben sich bloß »Einschränkung[en] ihrer praktischen Wirksamkeit«, nämlich »das eigene Ethos nur begrenzt ausleben zu dürfen und die praktischen Folgen des Ethos der anderen hinnehmen zu müssen«56. An dieser Stelle muss gefragt werden, ob das skizzierte Modell dem Selbstverständnis positiver Religionen entsprechen und tatsächlich einen Konsens tragen kann, der ja nach Habermas kein brüchiger modus vivendi sein soll. Es muss gefragt werden, ob ein solcher Schnitt durch das religiöse Bewusstsein, der die Innerlichkeit der Überzeugungen von ihrer praktischen Wirksamkeit trennt, nicht die völlige Preisgabe des Selbstverständnisses verlangt und für sie also mehr sein muss als die akzeptable Zumutung, für die Habermas sie hält.57 Denn es handelt sich bei diesen Überzeugungen um normative Überzeugungen vom richtigen Leben, die als moralische und außermoralisch-statutarische auf keinen geringeren als Gott zurückgeführt werden. Schon für nicht theonom fundierte 50 51 52 53 54 55 56 57
Habermas: Zeit der Übergänge. S. 177. Habermas: Kritik der Vernunft. S. 421. Habermas: Vom sinnlichen Eindruck zum symbolischen Ausdruck. S. 56. Habermas: Zeit der Übergänge. S. 177. Vgl. ebd. S. 177. Ebd. S. 177. Habermas: Zwischen Naturalismus und Religion. S. 320 f. Vgl. ebd. S. 320.
96
Bernd Dörflinger
normative Überzeugungen, deren Intentionen doch nur durch praktische Wirksamkeit zu erfüllen sind, muss es unmöglich erscheinen, ohne ein Widerstreben an der Grenze zum Faktischen des sozialen Lebens innezuhalten. Erst recht muss für theonom begründete Normen gelten, und zwar inklusive der unübersetzbaren und mit keinem moralischen Sinn unterlegbaren statutarischen Vorschriften, dass sie ihre mit einem absoluten und nicht verhandelbaren Anspruch verbundene Tendenz zur Wirksamkeit nicht aus freien Stücken an der Grenze zum Faktischen werden aufhalten können. Das verlangte die Unmöglichkeit, mit Überzeugung, gewonnen aus dem propagierten reflexiven Bewusstsein, von der Verwirklichung dessen abzusehen, wovon eine gegenläufige Überzeugung sagt, dass es nach dem Willen Gottes verwirklicht werden sollte. Habermas selbst bringt an einer Stelle das Argument zum Ausdruck, ohne allerdings die entsprechende Konsequenz daraus zu ziehen, das gegen sein Harmoniemodell des Zusammenlebens verschiedener positiver Religionen spricht. Es lautet: Aus den jeweils beanspruchten »göttliche[n] Perspektive[n]« müssen »andere Lebensweisen nicht nur als anders, sondern als verfehlt erscheinen«58. Solchen als verfehlt betrachteten anderen Lebensweisen kann weder indifferent noch gar mit wirklichem Respekt begegnet werden, so dass also von den jeweiligen göttlichen Perspektiven her der Konflikt nicht zu vermeiden sein wird. Diesen strikten Zusammenhang hat Kant klar gesehen. Ihm zufolge kann über historische Glaubenslehren der Streit nie vermieden werden59. Ein etwaiger Versuch, die anderen Lebensweisen nicht als verfehlt, sondern bloß als anders zu betrachten, bedeutete die Preisgabe der göttlichen Perspektive und also die Preisgabe des religiösen Selbstverständnisses. Die Zwischenlösung, die Habermas vorschwebt, nämlich die freiwillige Begrenzung der Wirksamkeit auf der sozialen Ebene, lässt von dieser Perspektive nicht etwa einen Teil übrig, sondern hebt sie, die als göttliche keine Relativierung zulässt, ganz auf. Wenn demnach mit der Beanspruchung einer göttlichen Perspektive schon dem Begriff nach ein Exklusivitätsanspruch verbunden ist und ebenso der Anspruch auf Universalisierung der praktischen Lehren bis hin zum letzten statutarischen Gesetz, das durch Vernunft nicht eingesehen werden kann, dann ist, die Habermassche Charakteristik des Fundamentalismus zugrunde legend, der Fundamentalist der eigentlich adäquate und unvermeidliche Typus der historischen Religionen. Dieser wird zwar außer in Gottesstaaten in der Wirklichkeit des sozialen Lebens oft notgedrungen eine partikulare Rolle spielen müssen, weil die faktischen Kräfteverhältnisse in einer Gesellschaft dazu zwingen und das säkulare staatliche Recht mit der gleichmäßig auf die konkurrierenden Religionen ver58 Ebd. S. 321. 59 Vgl. Kant: RGV. AA 06: 115.
Eine neuere Religionsauffassung im Licht einer älteren
97
teilten Religionsfreiheit keine andere Rolle zulässt. Doch in sein Selbstverständnis wird der Fundamentalist diese ihm abgenötigte oder ihm durch das Recht zugewiesene Rolle nicht integrieren können. Wenn er sie demnach nicht mit innerer Überzeugung übernehmen kann, dann ist unter der Voraussetzung der Fortexistenz der – kantisch gesprochen – kirchlichen Glaubensarten nur jener modus vivendi in ihrem Verhältnis möglich, den Habermas mit einigem Recht »unzureichend« nennt, den er als ein »prekäres Nebeneinander«60 beschreibt, der aber durch seinen Vorschlag auch nicht zu überwinden ist. In seiner faktisch oder rechtlich erzwungenen partikularen Rolle wird der doch innerlich ungebrochen Exklusivitäts- und Universalitätsansprüche hegende religiös Überzeugte dazu tendieren müssen, seine Rolle offensiv und zu Lasten der konkurrierenden Glaubensarten zu erweitern und auch die durch das säkulare Recht gesetzten Grenzen zu überschreiten. Diese Tendenz zur Rechtsverletzung und zur Theokratie ist – in Kants Worten – die Tendenz hin auf »ein Volk Gottes n a c h s t at u t a r i s c h e n G e s e t z e n « bzw. »ein juridisches gemeines Wesen […], von welchem […] Gott der Gesetzgeber […] sein würde« und »Priester, welche seine Befehle unmittelbar von ihm empfangen, eine aristokratische Re g i e r u n g führten«61. Der wesentliche Grund dafür, dass »über historische Glaubenslehren der Streit nie vermieden werden«62 kann, liegt nach Kant in der Eigenart des religiösen statutarischen Gesetzes. Für diesen Gesetzestypus ist die fatale Verbindung von Irrationalität und absolutem Geltungsanspruch wesentlich. Das religiöse statutarische Gesetz ist, weil kein moralisches Gesetz, für reine praktische Vernunft nicht einsichtig, muss dieser demnach als zufällig und willkürlich erscheinen; es kann, wie Kant sagt, »nicht verbindend sein«, »ohne daß ein Befehl vorher ergangen«63, verlangt also auf der Seite des Adressaten eine Befehlsempfänger-mentalität, die offen ist für die Ausführung unverständlicher Anweisungen. Verlangt ist, mit einer Wendung Kants ausgedrückt, der Geist »passiven Gehorsam[s]«64. Insofern als der äußere Gesetzgeber Gott behauptet ist, muss dem Adressaten, der das nicht in Zweifel zieht, jeder Widerspruch, aber auch schon jeder Versuch der Modifikation, als frevelhaft erscheinen. Für deliberative Erörterungen, also für den Habermasschen Diskurs, kann er nicht zur Verfügung stehen. Während auf dem Gebiet des staatlichen positiven Rechts, dem Analogon religiöser statutarischer Gesetzgebung, das auch Züge von Willkür und Zufall aufweist, aufgrund des als fehlbar vorausgesetzten menschlichen Gesetzgebers das Deliberieren, Modifizieren und Verwerfen ein60 61 62 63 64
Habermas: »Die Dialektik der Säkularisierung«. S. 39. Kant: RGV. AA 06: 099.21 – 100.02. Kant: RGV. AA 06: 115.22 f. Kant: RGV. AA 06: 099.07 f. Kant: RGV. AA 06: 103.19.
98
Bernd Dörflinger
mal ergangener Gesetze keine Probleme aufwirft, müssen religiöse statutarische Gesetze trotz ihrer für Vernunft nicht einsehbaren Gehalte, so wieder Kant, »allen Menschen auf alle künftige Zeiten unverfälscht […] mitgetheilt werden«65. Ohne die Möglichkeit, über religiöse statutarische Gesetze unter Menschen zu verhandeln, muss der »alle Einwürfe niederschlagende […] Machtspruch« des statutarischen Kirchenglaubens lauten: »d a s t e ht s g e s c h r i e b e n «66. Wenn nun im Fall konkurrierender positiver Religionen mit konkurrierenden statutarischen Gesetzgebungen ihre zivile Begegnung an solchen Machtsprüchen ihre Grenze und das Sprechen also ein Ende hat und wenn zugleich jede von ihnen ihren Totalitätsanspruch aufrecht erhält, was angesichts der göttlichen Beauftragung, in der sie sich wähnen, unvermeidlich erscheint, dann liegt der Schritt in die Sphäre der gewaltsamen Auseinandersetzung in der Konsequenz ihres fortbestehenden Dissenses. Kants Diagnose, dass »die sogenannten Religionsstreitigkeiten, welche die Welt so oft erschüttert und mit Blut besprützt haben, nie etwas anders als Zänkereien um den [statutarischen] Kirchenglauben gewesen«67 seien, kann somit nicht bloß als Aussage über den faktisch zufälligen Verlauf der Geschichte der statutarischen Religionen gelten. Sie beschreibt eine Notwendigkeit, die in diesen Religionen angelegt ist. Angesichts dieser Tendenz zum Religionskrieg ist nach Kant eine moralische Forderung die »nothwendige Folge«, nämlich dass Religion »endlich […] von allen Statuten […] losgemacht werde«68, dass die positiven statutarischen Religionen also letztlich verschwinden. Was dann noch verbleiben kann, ist reine Vernunftreligion, die aber nichts anderes lehrt als die Moral reiner praktischer Vernunft. Das Gegenmittel gegen die friedensgefährdenden positiven Religionen ist nach Kant, allgemein gesprochen, die überhandnehmende wahre Aufklärung69. Im Einzelnen ist darunter neben dem Hineinlegen moralischen Sinns in die »heiligen« Texte, das ein Umdeuten ist und kein herauslesendes Übersetzen wie bei Habermas, und neben der Entschärfung dieser Lehren durch Symbolisierung auch die Entwicklung eines kritischen theoretischen Bewusstseins zu verstehen. Da die historischen statutarischen Glaubensarten von empirischen Fakten ausgehen müssen, kann zu ihrer Aufklärung auch die über sich selbst belehrte theoretische Vernunft beitragen. In diesem Sinne formuliert Kant vor dem Hintergrund der erfahrungskritischen Ergebnisse seiner ersten Kritik: »[…] wenn Gott zum Menschen wirklich spräche, so kann dieser doch niemals w i s s e n , daß es Gott sei, der zu ihm spricht. Es ist schlechterdings unmöglich, daß der Mensch durch seine Sinne den Unendlichen fassen, ihn von Sinnen65 66 67 68 69
Kant: RGV. AA 06: 163.12 f. Kant: RGV. AA 06: 107.09 f. Kant: RGV. AA 06: 108.16 – 18. Kant: RGV. AA 06: 121.11 – 16. Vgl. Kant: RGV. AA 06: 123 (Anm.).
Eine neuere Religionsauffassung im Licht einer älteren
99
wesen unterscheiden und ihn woran ke n n e n solle.«70 Wie für den äußeren Sinn, gilt das Gesagte auch für den inneren: »Gefühl der unmittelbaren Gegenwart des höchsten Wesens […] wäre eine Empfänglichkeit einer Anschauung, für die in der menschlichen Natur kein Sinn ist«71; »Himmlische Einflüsse in sich w a h r n e h m e n zu wollen, ist eine Art Wahnsinn […]«72. Kant unterstellt, dass sich im Grunde auch jeder dieser Erkenntnisrestriktionen bewusst ist, so dass, wie er sagt, selbst »der kühnste Glaubenslehrer« statutarischer Lehren »zittern« müsste, wenn er gefragt würde: Traust du dich, »mit Verzichtthuung auf alles, was dir werth und heilig ist, dieser Sätze Wahrheit zu betheuren?«73 Die moralischen Qualifikationen, mit denen Kant den dogmatischen Glauben, »der sich als ein Wi s s e n ankündigt«74, belegt, die Bekundung von Wahrheit also, wo sich innerer Einsicht nach Wahrheit nicht beanspruchen lässt, lauten: Unaufrichtigkeit, Heuchelei also, Vermessenheit75, Anmaßung76. Die vermeinte innere Gotteserfahrung nennt er »S c hw ä r m e r e i «, die angebliche äußere »Ab e rg l au b e «77. Die moralischen Qualifikationen erwecken zunächst den Anschein von Härte und Unerbittlichkeit, vielleicht sogar von Aggressivität. Auch die begrifflichen Bestimmungen zur Charakteristik der statutarischen historischen Religionen sind strikt grenzziehend und nicht vermittelnd. Sie betonen den Widerspruch zwischen einer wahrhaft universellen Vernunft und einer Pluralität von partikularen Absolutheitsansprüchen, die sich durch Machtspruch für universell erklären und so die Tendenz zum Unfrieden in sich tragen. Auch die von Kant daraus gezogene Konsequenz ist eine radikale, eben jene Forderung nach dem Ende der historischen Religionen. – Verglichen damit ist Habermas’ Sprache der Versöhnung unmittelbar einnehmend. Seinen Appellen an die säkularen und religiösen Bürger, einander aufgeschlossen zuzuhören und voneinander zu lernen, ist die menschenfreundliche Intention auf Anhieb anzumerken. Sie rufen in Absicht auf ein ausbalanciert harmonisches Verhältnis die säkularen Bürger dazu auf, die Religionen als vernunftexterne Wahrheitsquellen, speziell in Hinsicht auf Normen, anzuerkennen, und umgekehrt die religiösen, in Distanz zu sich selbst zu gehen, um die Priorität der Vernunft im öffentlichen Raum und die Gleichberechtigung anderer Religionen anzuerkennen; der eigene Wahrheitsanspruch könne innerlich weiter gehegt werden. – Bei allem Respekt vor der 70 71 72 73 74 75 76 77
Kant: SF. AA 07: 063.09 – 12. Kant: RGV. AA 06: 175.04 – 07. Kant: RGV. AA 06: 174.17 f. Kant: RGV. AA 06: 189.23 f., 189.27. Kant: RGV. AA 06: 052.32 f. Kant: Vgl. RGV. AA 06: 052.33. Kant: Vgl. RGV. AA 06: 201. Kant: RGV. AA 06: 053.03 f.
100
Bernd Dörflinger
Versöhnungsabsicht muss das aus dem Gesichtspunkt der von Kant her entwickelten Begriffe doch als verundeutlichend und verharmlosend bewertet werden. Das Habermassche Modell verfehlt zum einen das säkulare Konzept der autonomen Vernunft, indem es eine äußerlich gesetzte Normativität unterstellt, und zum anderen das Selbstverständnis geoffenbarter Religion, die ihrem Wesen nach die Selbstdistanzierung abweisen muss, die also nicht pluralistisch sein kann, sondern im Gegenteil ihren Absolutheitsanspruch faktisch zu realisieren suchen muss. Sie kann ihn nicht bloß innerlich im Medium der Überzeugungen halten. Die Friedensperspektive des Modells ist somit illusionär. Während die Aussicht auf einen dauerhaften Religionsfrieden unter der Bedingung der Existenz statutarischer Religion nicht zu begründen ist, ist sie durch Kants Projekt ihrer Auflösung und ihrer Ersetzung durch reine Vernunftreligion doch gegeben, denn diese lehrt nichts als die Moral, die ihren Ursprung in reiner praktischer Vernunft hat. Dass das kantische Projekt im Verhältnis zu den positiven Religionen trotz der Radikalität des Auflösungspostulats doch nicht aggressiv ist und es auch nicht sein kann, leitet sich aus seinem Zweck ab, nichts als Moral zur Geltung zu bringen. Denn das erfordert die Ausbildung von Überzeugungen, die nur durch Selbstdenken und unmöglich durch Zwang entstehen können. Kants Aussage, das Ende statutarischer Religion sei »nicht von einer äußeren Revolution zu erwarten«, sondern werde »durch allmählig fortgehende Reform zur Ausführung gebracht«78, ist Ausdruck dieser Notwendigkeit des Verzichts auf Zwang, entspringt also keinem Klugheitskalkül angesichts realer Kräfteverhältnisse. Die überhandnehmende wahre Aufklärung kann sich nach Kant nur »mit jedermanns Einstimmung«79 durchsetzen. Die militanteste Art, diese zu gewinnen, ist die Verbreitung von Gedanken.
Literaturverzeichnis Habermas, Jürgen: »Die Dialektik der Säkularisierung«, in: Blätter für deutsche und internationale Politik (53) 2008/4. S. 33 – 46. Habermas, Jürgen/Ratzinger, Joseph: Dialektik der Säkularisierung. Über Vernunft und Religion. Mit einem Vorwort hrsg. von Florian Schuller. Freiburg 2005. Habermas, Jürgen: »Eine Replik«, in: Reder, Michael/Schmidt, Josef (Hg.): Ein Bewusstsein von dem, was fehlt. Eine Diskussion mit Jürgen Habermas. Frankfurt a. M. 2008. S. 94 – 107. Habermas, Jürgen: Kritik der Vernunft. Philosophische Texte: Band 5. Frankfurt a. M. 2009. 78 Kant: RGV. AA 06: 122.11, 122.20 f. 79 Kant: RGV. AA 06: 123.15 (Anm.).
Eine neuere Religionsauffassung im Licht einer älteren
101
Habermas, Jürgen/Derrida, Jacques: Philosophie in Zeiten des Terrors. Berlin/Wien 2004. Habermas, Jürgen: The Holberg Prize Seminar 2005. Holberg Prize laureate professor Jürgen Habermas: Religion in the Public Sphere. Hrsg. vom Holberg Prize Seminar Bergen 2005. Bergen 2005. Habermas, Jürgen: Theorie des kommunikativen Handelns. Frankfurt a. M. 1995 (1. Aufl. 1981). Habermas, Jürgen: Vom sinnlichen Eindruck zum symbolischen Ausdruck. Frankfurt a. M. 1997. Habermas, Jürgen: Zeit der Übergänge. Frankfurt a. M. 2001. Habermas, Jürgen: Zwischen Naturalismus und Religion. Philosophische Aufsätze. Frankfurt a. M. 2005. Kant, Immanuel: Gesammelte Schriften. Hg.: Band 1 – 22 Preussische Akademie der Wissenschaften, Band 23 Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin, ab Band 24 Akademie der Wissenschaften zu Göttingen. Berlin 1900 ff. Langthaler, Rudolf: »Zur Interpretation und Kritik der Kantischen Religionsphilosophie bei Jürgen Habermas«, in: Langthaler, Rudolf/Nagl-Docekal, Herta (Hg.): Glauben und Wissen. Ein Symposium mit Jürgen Habermas. Wien 2007. S. 32 – 92. Nagl-Docekal, Herta: »Eine rettende Übersetzung? Jürgen Habermas interpretiert Kants Religionsphilosophie«, in: Langthaler, Rudolf/Nagl-Docekal, Herta (Hg.): Glauben und Wissen. Ein Symposium mit Jürgen Habermas. Wien 2007. S. 93 – 119.
Siglenverzeichnis AA MS RGV SF
Akademie-Ausgabe Die Metaphysik der Sitten Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft Der Streit der Fakultäten
Rudolf Langthaler
Zu Bernd Dörflingers Kritik an Habermas’ Religionskonzeption
Vorbemerkung Dörflingers kritisches Vorhaben, die in Habermas’ jüngeren Arbeiten dargelegte Religionsauffassung in kritischer Absicht mit derjenigen Kants zu konfrontieren, orientiert sich vornehmlich an Themen, die in Kants Religionsschrift bzw. im »Streit der Fakultäten« (dem Streit der »philosophischen« mit der »theologischen Fakultät«) im Vordergrund stehen. Mit der Würdigung von Habermas’ »systematische(r) Deutung des Wiederauflebens religiöser Erscheinungen« und seiner »normativen Theorie zu ihrer systematischen Verortung« verbindet Dörflinger indes die kritische Diagnose, dass in Habermas’ Religions-Konzeption eine zweifache Verfehlung nicht zu übersehen sei: Habermas’ Position laufe (1) de facto nicht nur auf »eine Apologie des Religiösen« hinaus, die »zum einen das säkulare Konzept der autonomen Vernunft« verfehle, »indem es eine äußerlich gesetzte Normativität unterstellt«. Dass Habermas’ Problemsicht mit den kritischen Ansprüchen Kants in vielerlei Bezügen unvereinbar sei, verrate schon sein gegen Kant geäußerter Vorwurf, »dass die autonome Vernunft dem durch die historischen Religionen dargebotenen ›fremden Anderen‹ nicht auf Augenhöhe«1 begegne. Schon darin wie auch in der von Habermas gegen Kant gerichteten Kritik, dass Letzterer »über die moralischen Intuitionen und normativen Gehalte ›aus erlösungsreligiösen Offenbarungswahrheiten‹«2 hinwegsehe und überhaupt verkenne, »dass die geschicht1 Dörflinger, Bernd: »Eine neuere Religionsauffassung im Licht einer älteren. Habermas und Kant«, in: Langthaler, Rudolf/Meiller, Christopher/Appel, Kurt (Hg.): Religion in der Moderne. Religionsphilosophische Beiträge zu einer aktuellen Debatte. Göttingen 2013. S. 85, 100, 86. 2 Habermas, Jürgen: »Ein Bewusstsein von dem, was fehlt«, in: ders.: Kritik der Vernunft. Philosophische Texte. Band 5. Frankfurt a. M. 2009. S. 406; vgl. auch Habermas, Jürgen: »Religion in der Öffentlichkeit. Kognitive Voraussetzungen für den ›öffentlichen Vernunftgebrauch‹ religiöser und säkularer Bürger«, in: ders.: Zwischen Naturalismus und Religion. Philosophische Aufsätze. Frankfurt a. M. 2005. S. 137 u. ö.
104
Rudolf Langthaler
lichen Religionen Bedingungen der Genese der Vernunft selbst seien«, erkennt Dörflinger hingegen eine Preisgabe der »Autonomie der Vernunft bzw. der Moralität«. Vornehmlich daran entzündet sich seine diesbezügliche Kritik an Habermas’ Kantverständnis, die im ersten Teil seines Aufsatzes im Vordergrund steht. Ebenso verkenne Habermas (2) jedoch die konkreten gesellschaftlichen Herausforderungen, die aus den von den Religionsgemeinschaften erhobenen Ansprüchen resultieren. Infolgedessen sieht Dörflinger bei Habermas auch die erheblichen Schwierigkeiten verharmlost, die das Verhältnis der Philosophie bzw. der »säkularen Vernunft« zu den Ansprüchen der geschichtlichen Glaubensarten bzw. Religionsgemeinschaften betreffen. Denn das »Selbstverständnis geoffenbarter Religion« impliziere doch geradewegs die Abweisung der ihr von Habermas zugemuteten »Selbstdistanzierung«, weshalb, so Dörflingers Folgerung, solche Religion »also nicht pluralistisch sein kann, sondern im Gegenteil ihren Absolutheitsanspruch faktisch zu realisieren suchen muss.«3 Demnach sieht Dörflinger jedenfalls in beiden Fällen – in direktem Rekurs auf Kant – die Ansprüche der »wahren Aufklärung« unterboten: Einerseits sei damit die Habermas’sche Problemsicht unvereinbar ; andererseits bringe sich die »wahre Aufklärung« gegenüber dem von Habermas favorisierten Vorhaben einer »kooperativen Übersetzung« zur Geltung als eine notwendige »Entschärfung dieser Lehren durch Symbolisierung« und gleichermaßen als »die Entwicklung eines kritischen theoretischen Bewusstseins«4. Bevor im Folgenden diese beiden zentralen Einwände Dörflingers kommentiert und auch kritisch beurteilt werden sollen, ist für die Prüfung der Stichhaltigkeit derselben jedoch ein Rekurs auf einige klärende Stellungnahmen von Habermas aus jüngerer Zeit zweckmäßig. Manche der jüngsten einschlägigen Äußerungen Habermas’ zu diesen Themenfeldern implizieren ohnedies zugleich eine indirekte Antwort auf Dörflingers Bedenken.5
1.
»Postsäkular«: Eine »soziologische Beschreibung eines tendenziellen Bewusstseinswandels« (J. Habermas)
Vorweg ist die in Habermas’ jüngeren Publikationen in den Vordergrund getretene – von Dörflinger jedoch nicht erwähnte – Konzeption des »Postsäkula3 Dörflinger: »Eine neuere Religionsauffassung im Licht einer älteren«. S. 100. 4 Dörflinger: »Eine neuere Religionsauffassung im Licht einer älteren«. S. 98. 5 Um den mit den einschlägigen Texten von Habermas weniger vertrauten Lesern das Verständnis seiner diesbezüglichen Grundanliegen zu diesem Leitthema »Religion in der Öffentlichkeit« zu erleichtern, sollen im Folgenden auch einige Stellungnahmen angeführt werden, in denen er sich in jüngster Zeit auch an eine breitere Öffentlichkeit gewendet hat.
Zu Bernd Dörflingers Kritik an Habermas’ Religionskonzeption
105
ren« anzuführen, zumal sie auch in der nachfolgenden Stellungnahme zu den strittigen Themen im Hintergrund steht: Als eine »soziologische Beschreibung eines tendenziellen Bewusstseinswandels« zielt sie ja nicht lediglich auf die Konstatierung des faktischen Fortbestands der Religionen ab;6 ihre eigentliche Pointe liegt freilich in der Provokation, dass damit eine – ein laizistisches Verständnis des Verhältnisses von Politik und Religion distanzierende – Sichtweise von »Säkularisierung« ins Blickfeld rückt, die sich am Leitbild eines »komplementären Lernprozesses« zwischen beiden orientiert und auf die hierfür unumgänglichen Bedingungen abzielt. Unter »postsäkularen« Vorzeichen als Signatur der Gegenwart besagt dies laut Habermas näherhin: »In dieser Rolle müssen wir uns an einen undogmatischen und lernbereiten Umgang mit Zivilisationen gewöhnen, die auf ganz anderen Entwicklungspfaden zu Zeitgenossen einer von multiple modernities geprägten Weltgesellschaft geworden sind. Aber nur auf der Grundlage einer selbstbewussten Verteidigung universalistischer Ansprüche können wir uns von den Argumenten der anderen über unsere blinden Flecken im Verständnis und in der Anwendung der eigenen Prinzipien belehren lassen«.7
Aus der von Habermas gegenüber laizistischen Engführungen und den damit einhergehenden Aporien geltend gemachten »postsäkularen« Perspektive resultiert konsequenterweise die Frage – die freilich auch schon den in Dörflingers Habermas-Kritik angesprochenen zweite Hauptpunkt berührt (s. u. 3.): Wie ist unter den Vorzeichen des Fortbestehens und der noch vorhandenen »vitalen Kraft« der Religionen mit den damit verbundenen Konsequenzen vernünftig umzugehen? Diesbezüglich verweist Habermas zunächst auf die »gemeinsame Genealogie des nachmetaphysischen Denkens und der Weltreligionen«, die eine Anerkennung der Religion nicht nur als Teil der »Geschichte der Vernunft« und als Gestalt des Bewusstseins von gestern, sondern auch als einer »zeitgenössischen 6 Habermas’ Charakterisierung des Ausdrucks »postsäkular« bezieht sich auf eine »mentalitätsgeschichtliche Zäsur«; sie versteht sich näherhin lediglich als eine »soziologische Beschreibung eines tendenziellen Bewusstseinswandels in weitgehend säkularisierten oder ›entkirchlichten‹ Gesellschaften, die sich inzwischen auf das Fortbestehen religiöser Gemeinschaften eingestellt haben und mit dem Einfluss religiöser Stimmen sowohl in der nationalen Öffentlichkeit wie auf der weltpolitischen Bühne rechnen.« (Habermas, Jürgen: »Religion und nachmetaphysisches Denken. Eine Replik«, in: ders.: Nachmetaphysisches Denken II. Aufsätze und Repliken. Frankfurt a. M. 2012. S. 121). 7 Habermas, Jürgen: »Wie viel Religion verträgt der liberale Staat?«, in: Neue Zürcher Zeitung, 4. August 2012. S. 63. – Dörflinger konnte diese präzisierende Stellungnahme Habermas’ zur Frage: »Wie viel Religion verträgt der liberale Staat?« noch nicht kennen; sie enthält freilich auch eine indirekte Antwort an ihn – so wenn es wenig später heißt: »Aus dem Rückblick des ernüchterten nachmetaphysischen Denkens auf diese Erbschaftsverhältnisse können wir für ein säkulares Selbstverständnis eine gewisse Zurückhaltung lernen: Wir können nicht wissen, ob sich der bis heute – bis zu Jacques Derridas Begriffsschöpfungen – andauernde Prozess einer Übersetzung unabgegoltener religiöser Bedeutungspotenziale erschöpft hat.«
106
Rudolf Langthaler
Gestalt des Geistes« begründet. In solcher Hinsicht richtet sich seine Bestimmung des »Postsäkularen« nicht nur gegen religiöse »Fundamentalisten«, sondern – eben im Sinne einer »Säkularisierung, die nicht vernichtet«8 – gleichermaßen gegen die Position der »sogenannten Säkularisten«, die in der Religion nicht mehr als eine inzwischen obsolet gewordene und somit »überwundene Gestalt des Geistes« erkennen wollen. Einer solchen »säkularistischen« Auffassung zufolge sei Religion also lediglich als ein noch rudimentär vorhandenes »Relikt« anzusehen, das allenfalls – im Sinne eines bloßen Koexistenz-orientierten »modus vivendi« – in der Haltung der Duldung bzw. eines »schonenden Indifferentismus« hinzunehmen sei; keineswegs erlaube bzw. erfordere dies jedoch einen darüber hinausgehenden Austausch von Motiven und lebendigen Überzeugungen.9 Mit einer derartigen, d. h. aus einem reduktionistischen Verständnis von »Säkularität« gespeisten Einstellung, der offenbar ein schiefes Verständnis von »Toleranz« zugrunde liegt10 und deren Konzeption des – angeblich eingeräumten und als große Errungenschaft der Aufklärung gepriesenen – »Rechts auf Religionsfreiheit« genauer besehen gewissermaßen auf eine Art dauerhaften »Quarantäne-« bzw. bestenfalls auf einen beschränkten »Zulassungs-Status« hinausläuft, sieht Habermas zuletzt die »Anerkennungsbasis der gemeinsamen Staatsbürgerschaft« überhaupt gefährdet, zumal dies das positive Freiheitsrecht individueller Überzeugungen beschneide und im Grunde religiöse Mitbürger 8 Habermas, Jürgen: Glauben und Wissen. Friedenspreis des deutschen Buchhandels 2001. Frankfurt a. M. 2001. S. 26. Mit Recht betont Hans Joas, dies besage »nicht eine Bedeutungszunahme der Religion oder eine neuerliche Aufmerksamkeit auf sie«, sondern »eine veränderte Haltung des säkularen Staats oder der Öffentlichkeit zum Fortbestehen religiöser Gemeinschaften und den aus ihnen kommenden Impulsen.« (Joas, Hans: Braucht der Mensch Religion? Über Erfahrungen der Selbsttranszendenz. Freiburg i. Br. 2004. S. 124 f.) Damit impliziert dieser als »postsäkular« bezeichnete »Bewusstseinswandel« die – im zweiten Teil näher thematisierte – gesellschaftliche Herausforderung bzw. die Aufgabe, das Verhältnis der zivilen Gesellschaft und dem Selbstverständnis der religiösen Bürger, damit auch dasjenige des politischen Diskurses und den leitenden religiösen Überzeugungen neu zu bedenken. 9 Damit widerspricht Habermas indirekt sowohl Richard Rortys entschiedenem Plädoyer für das längst fällige Verschwinden der »institutionalisierten Religion […] von der Bildfläche« (zit. n. Große Kracht, Hermann-Josef: »Offene Fragen im Universum öffentlicher Gründe. Jürgen Habermas und die Öffentlichkeit der Religionen«, in: Wenzel, Knut/Schmidt, Thomas M. (Hg.): Moderne Religion? Theologische und religionsphilosophische Reaktionen auf Jürgen Habermas. Freiburg i. Br. 2009. S. 76) wie auch, der Sache nach, dem allerdings anders akzentuierten Befund von Herbert Schnädelbach (s. dazu den Beitrag v. Hans Schelkshorn in diesem Band). 10 Hier ist auch an Kants Kritik an einem falschen – weil anmaßenden – Toleranz-Verständnis zu erinnern: »Ein Fürst, der es seiner nicht unwürdig findet, zu sagen: dass er es für Pflicht halte, in Religionsdingen den Menschen nichts vorzuschreiben, sondern ihnen darin volle Freiheit zu lassen, der also selbst den hochmütigen Namen der Toleranz von sich ablehnt: ist selbst aufgeklärt« (KANT: VI. S. 59 f.).
Zu Bernd Dörflingers Kritik an Habermas’ Religionskonzeption
107
aus dem Kreis ernstzunehmender »moderner Zeitgenossen« ausschließt11. Demgegenüber ergibt sich die in jener Kennzeichnung des »Postsäkularen« implizierte – gegen die reduktionistische Perspektive eines bloßen »modus vivendi« und ein damit verbundenes schiefes Toleranzverständnis gerichtete – Forderung einer reziproken Anerkennung nach Habermas schon daraus, dass der moderne Staat auf die »in Überzeugungen verwurzelte Legitimation«12 nicht verzichten kann; schon deshalb könne sich diese »Anerkennung« nicht auf einen Umgang mit den Religionsgemeinschaften nach dem Modell des »Artenschutzes« reduzieren (s. u. Anm. 64),13 in dem andernfalls in der Tat eine »paradoxe« Situation der modernen Verfassungen zutage tritt (s. u. 3.3). Gegenüber jenen säkularistischen bzw. laizistischen Missverständnissen bzw. Engführungen (der nicht selten mit szientistischen Reduktionismen einhergeht) richtet sich Habermas’ – durchaus selbst dem Programm der Aufklärung als einem »unvollendetem Projekt« verpflichtetes – Bestreben, »das säkulare Denken über das säkularistische Selbstmissverständnis einer bornierten Aufklärung aufzuklären«14. In der Folge macht er auch mit Nachdruck geltend, dass wir »unter Prämissen nachmetaphysischen Denkens keinen Grund haben, die Möglichkeit eines fortgesetzten ›Einwanderns theologischer Gehalte ins Säkulare‹« auszuschließen, und »dass es von unseren […] Gegenwartsdiagnosen abhängt, ob wir eine solche transformierende Aneignung oder Übersetzung für wünschenswert halten«15. Freilich, gelingen kann solches Vorhaben doch allein 11 Habermas, Jürgen: »Religion in der Öffentlichkeit der ›postsäkularen‹ Gesellschaft«, in: ders.: Nachmetaphysisches Denken II. Aufsätze und Repliken. Frankfurt a. M. 2012. S. 327. – Besonders deutlich wird seine Abwehr eines auf bloße »Duldung« herabgestuften »Toleranz«-Verständnisses in der Bemerkung: »Daher muss der liberale Staat den säkularen Bürgern nicht nur zumuten, religiöse Mitbürger, die ihnen in der politischen Öffentlichkeit begegnen, als Personen ernst zu nehmen. Er darf von ihnen sogar erwarten, dass sie nicht ausschließen, in den artikulierten Inhalten religiöser Stellungnahmen und Äußerungen gegebenenfalls eigene verdrängte Intuitionen wiederzuerkennen – also potenzielle Wahrheitsgehalte, die sich in eine öffentliche, religiös ungebundene Argumentation einbringen lassen.« (Habermas: »Wie viel Religion verträgt der liberale Staat?«. S. 63) 12 Habermas: Kritik der Vernunft. S. 413. 13 »In concreto« bedeutet dies freilich auch: »Tatsächlich können die muslimischen Einwanderer nicht gegen ihre Religion, sondern nur mit dieser in eine westliche Gesellschaft integriert werden.« Vgl. Habermas: Nachmetaphysisches Denken II. S. 320. 14 Habermas: »Religion und nachmetaphysisches Denken«. S. 142. Schon in einem früheren Aufsatz verweist Habermas auf die Notwendigkeit, ein »säkularistisch verhärtete(s) und exklusive(s) Selbstverständnis der Moderne« zu überwinden. Vgl. Habermas: »Religion in der Öffentlichkeit«. S. 145. – Von einer »szientistisch« verkürzten Aufklärung kann bei Dörflinger freilich nicht nur nicht die Rede sein; vielmehr bekämpft er einen solchen »Reduktionismus« stets auf der Seite der kantischen »Vernunftkritik« und knüpft daran sein kritisches Plädoyer für Kants »Vernunftglauben« als einen »Zweifelglauben«. 15 Habermas: »Religion und nachmetaphysisches Denken«. S. 128. Derart will sich Habermas freilich nicht damit begnügen, was Dörflinger im Rekurs auf Kants »reformerische« Absicht« einräumen möchte: »Der erkennbare Grund für seine [Kants] moderate reformerische re-
108
Rudolf Langthaler
unter der Voraussetzung des »allen gleichermaßen offenstehenden Universum der vorbehaltlos begründenden Rede«. Habermas selbst wirft in diesem Problemkontext die – auch von Dörflinger berührte – Frage auf: »Aber unter welchen Bedingungen können religiöse Bürger, deren normative Einsichten letztlich in fundamentalen Glaubensüberzeugungen wurzeln, die Konsequenz eines solchen Übersetzungsvorbehalts überhaupt akzeptieren? Gerade in vitalen Religionen schlummert oft ein Gewaltpotenzial; dieses darf sich nicht an den Funken einer Weltanschauungsdynamik entzünden, die in der Zivilgesellschaft freigesetzt wird. Wenn die liberale Verfassungsordnung über einen bloßen modus vivendi hinaus Legitimität soll beanspruchen können, müssen sich grundsätzlich alle Bürger, auch die religiösen, von der Vernünftigkeit der Verfassungsprinzipien überzeugen können. Religionskonflikte werden diese gemeinsame Basis nur dann nicht angreifen, wenn die Glaubensüberzeugungen mit der Loyalität zu Verfassungsgrundsätzen nicht in Widerspruch geraten«.16 Damit ist offenkundig die Frage berührt, was der notwendigerweise säkulare Staat den Religionsgemeinschaften bzw. ihren »Gläubigen« einerseits – und zwar durchaus auch im eigenen Interesse! – einräumen muss – und was andererseits von ihnen als unverzichtbar gefordert werden darf und muss, wenn, wie Dörflinger mahnt, »das Konfliktpotential der statutarischen Glaubensarten nicht zum Ausbruch kommen«17 und auch nicht unterschätzt werden soll. Auf diese in den jüngeren einschlägigen Äußerungen in den Vordergrund tretenden Aspekte ist später noch zurückzukommen. Stellen diese der Bestimmung des »Postsäkularen« zugrunde liegenden Motive doch auch die Basis für die Stellungnahme zum zweiten Hauptpunkt von Dörflingers Habermas-Kritik dar. (s. u. bes. 3.2 u. 3.3). Zunächst ist nun, in gebotener Rücksicht auf diese in jüngeren Veröffentlichungen präzisierten Motive, in Konzentration auf die beiden genannten Kernpunkte jedoch zu fragen, ob Dörflinger die eigentliche Intention von Habermas nicht doch verkürzt wahrnimmt. An die diesbezüglichen Einwände gegen Dörflingers Kritik an Habermas schließen sich einige
ligionspolitische Position ist, dass doch auch im Prozess des Übergangs ›für öffentliche Eintracht und Frieden Sorge‹ zu tragen sei. Den Prozess selbst aber sofort zu beginnen, d. h. zu dem einen durch die herabgeminderten Offenbarungslehren ›eingeleiteten Religionsglauben‹ doch ›ohne Verzug… überzugehen‹, fordert er ebenso unmissverständlich« (Dörflinger, Bernd: »Über den aufgeklärten Umgang mit Gottes Wort. Kant zur Auslegung ›heiliger‹ Schriften«, in: Bermes, Christian/Orth, Ernst W./Welsen, Peter (Hg.): Die Kultur des Textes. Studien zur Textualität. Würzburg 2009. S. 136). 16 Habermas: »Wie viel Religion verträgt der liberale Staat?«. S. 63. 17 Dörflinger, Bernd: »Kant über moralische, juridische und religiöse Gesetze«, in: Zager, Werner (Hg.): Die Macht der Religion. Wie die Religionen die Politik beeinflussen. Neukirchen-Vluyn 2008. S. 114.
Zu Bernd Dörflingers Kritik an Habermas’ Religionskonzeption
109
kritische Rückfragen an seine eigene Position an. Zunächst sei jedoch der erste Kritikpunkt näher verfolgt.
2.
Zu Dörflingers Einspruch: Verkennt Habermas das säkulare Konzept der »autonomen Vernunft«? (2.1) Eine kurze Erinnerung an Kants Unterscheidung zwischen »rational« und »historisch« (2.2)
2.1. Dörflingers Vorwurf, dass Habermas’ Religionsauffassung »zum einen das säkulare Konzept der autonomen Vernunft« verfehle, d. h. den mit dem »reinen Religionsglauben« verbundenen Anspruch verkenne bzw. aufweiche und somit das kritische Anliegen Kants unterbiete, beruht vermutlich doch auf einem Missverständnis der Intention, von der Habermas sich diesbezüglich leiten lässt. Zum Einwand, dass Habermas »der religiösen Ebene nicht bloß den Charakter des Anlasses für vernünftige Reflexion zuschreibt«, sondern überdies die »historische Religion, die sich auf Offenbarung beruft, als Quelle sui generis für Normativität und moralische Wahrheit betrachtet, als Quelle also, die durch Vernunft nicht zu ersetzen sei«18, sei zunächst dies angemerkt: Selbstverständlich hält Habermas an dem Grundprinzip der Moderne fest, sofern auch das »nachmetaphysische Denken […] die Bausteine seines ›Geltungsbodens‹ aus eigenen Ressourcen erzeugt und nicht irgend einer Überlieferungsautorität entlehnt«19 – und auch gar keiner anderen Begründung bedarf. Dies impliziert natürlich auch, »dass die praktische Vernunft der politischen Philosophie in der Sache der Rechtfertigung säkularer Verfassungsprinzipien gegenüber den von Religionsgemeinschaften reklamierten ›Wahrheiten‹ das letzte Wort behalten muss«20. Ebenso ist darauf hinzuweisen, dass Habermas eigentlich nicht der »religiösen Ebene« (der »religiösen Erfahrung«) als solcher, sondern den tradierten »geschichtlich-positiven« Religionen – eben im Sinne ihrer geschichtlichen Priorität und in Rücksicht auf jene gemeinsame »Genealogie« – die Rolle eines »Anstoßes« zuerkennt. Und allein in Bezug auf diese geschichtliche Faktizität 18 Dörflinger : »Eine neuere Religionsauffassung im Licht einer älteren«. S. 87. 19 Habermas: »Religion und nachmetaphysisches Denken«. S. 142 f. Ausdrücklich betont er gegenüber einschlägigen Befürchtungen, dass ihm damit natürlich keinesfalls »etwa eine Rückkehr zur Einheit einer substantiellen, durch die Geschichte hindurchgreifenden oder im Kosmos verkörperten Vernunft« (Habermas: Nachmetaphysisches Denken II. S. 134) vorschwebt. 20 Habermas: »Religion und nachmetaphysisches Denken«. S. 148.
110
Rudolf Langthaler
setzt er – im Sinne eines hinreichend sensiblen »geschichtlichen Bewusstseins« – auch tatsächliche religiöse Erfahrungen der religiösen Gemeindemitglieder voraus, die sich aus ihren Traditionen speisen, ohne dass dadurch jedoch der autonome Geltungsanspruch der Vernunft relativiert wäre.21 Mit einer solchen Vergegenwärtigung des Sachverhaltes, dass »Philosophie und Religion« sich als »komplementäre Gestalten« ausgebildet haben, könnte sich Habermas wohl durchaus auf Kants Hinweis auf die »durch hergebrachte fromme Lehren erleuchtete Vernunft«22 berufen, der sich auch in einer solchen »genealogischen Hinsicht« verstehen lässt, ohne damit die »Autonomie der Vernunft« zu gefährden. Eben im Sinne des diesbezüglich gebotenen »geschichtlichen Bewusstseins« ist sodann wohl Habermas’ Rekurs auf die »säkulare Übersetzung des universalistischen Gehalts jüdisch-christlicher Heilsvorstellungen« zu verstehen, die er als eine Voraussetzung des »egalitär-universalistischen Vernunftrechtes der Moderne« würdigt. Beschreibt Habermas demzufolge mit dem Verweis auf die »Genese« lediglich das faktische Verhältnis von Religion und Philosophie als »komplementäre Gestalten des Geistes«, so ist diese Darlegung der historischen Konstellation jedoch nicht mit einer »normativen Aussage« zu verwechseln. Dörflinger scheint hier also zu verkennen, dass Habermas lediglich einen – auch auf Äußerungen Kants zu stützenden – historischen Sachverhalt beschreibt, der jedoch nicht als ein von ihm geltend gemachtes bzw. wenigstens eingeräumtes »Bedürfnis nach einem äußeren Ursprung der Moral« missverstanden werden darf, wie Dörflingers Kritik suggeriert. Dieser lediglich dem geschichtlichen Denken und dem darin geschärften Kontextbewusstsein geschuldete bloße Hinweis auf die genealogische Herkunft moralischer Prinzipien und Einsichten relativiert demzufolge keineswegs deren Geltungsanspruch. Auch bezüglich der rechtlich-politischen Prinzipien ist im Blick auf die unhintergehbaren Prinzipien des mo21 Insofern ist es nicht unproblematisch (und beruht wohl auf einem Missverständnis), wenn Dörflinger gegen Habermas einwendet: »Wo Weltbilder und Lebensweisen auf historische Art religiös fundiert sind, werden sie alle auf verschiedene Ursprünge zurückgeführt, mit denen jeweils der Anspruch verbunden ist, dass mit zufällig Faktischem, nämlich mit bestimmten in Raum und Zeit situierten Erfahrungen, doch absolute Geltungsansprüche verbunden werden können, weil nichts Geringeres als göttliche Mitteilung erfahren worden sein will. Solchen vermeinten religiösen Erfahrungen, die ihrem Wesen nach dogmatisch autoritativ sind, steht eine sich selbstkritisch in den Grenzen ihres restringierten Erfahrungsbegriffs haltende Vernunft verständnislos gegenüber, so dass sie sich also auch nicht als Übersetzerin für dieses Unverstandene eignet, das für sie nicht als Erfahrung gelten kann.« (Dörflinger, Bernd: »Kants Projekt der unsichtbaren Kirche als Aufgabe zukünftiger Aufklärung«, in: Klemme, Heiner F. (Hg.): Kant und die Zukunft der europäischen Aufklärung. Berlin 2009. S. 172, Anm. 1) 22 Kant: VI. S. 186. Eine andere Frage ist es freilich, ob nicht gerade auch dieser kantische Verweis den von Habermas gegen Kant gerichteten Einwand relativiert, dass dieser die philosophisch uneinholbare Priorität der »geschichtlichen Religionen« verkenne.
Zu Bernd Dörflingers Kritik an Habermas’ Religionskonzeption
111
dernen demokratischen Rechtsstaates nach Habermas natürlich daran nicht zu rütteln: Nichts anderes als die »Annahme einer gemeinsamen Menschenvernunft ist die epistemische Grundlage für die Rechtfertigung einer säkularen Staatsgewalt, die nicht länger von religiösen Legitimationen abhängt. Und das wiederum ermöglicht auf institutioneller Ebene die Trennung von Staat und Kirche«23. Auch damit ist gesagt, dass die Standards der säkularen Vernunft den unhintergehbaren Prüfstein gegenüber den Ansprüchen der Religionsgemeinschaften darstellen. Vor diesem Hintergrund ist wohl auch den Bedenken Dörflingers zu begegnen: »Dass Habermas der Selbstständigkeit und Selbstgesetzgebung der Vernunft prinzipiell misstraut und sie sogar in die Nähe der Hybris rückt, zeigt sich neben der Priorisierung der positiven Religionen in der von ihm als geschichtliches Werden verstandenen Genese der Vernunft auch an seiner Bewertung nachkantischer Religionsphilosophie.«24 Auch laufe es »der kantischen Vernunftkonzeption völlig entgegen«, »wenn eine außermenschliche anonyme, quasi naturwüchsige und ursprünglich unbekannte Vernunft waltete, ob in einem Bilderschatz versteckt oder nicht, der gegenüber die menschliche Vernunft bloß passiv sein könnte und von der her sie durch Ablernen und Ausbuchstabieren mit normativen Gehalten und moralischen Anforderungen erst bekannt würde. Bei einer solchen Nachträglichkeit der menschlichen Vernunft zum sittlich Gebotenen könnte dieses nie zur ureigenen inneren Angelegenheit der Menschenvernunft werden.«25 Diesbezüglich sei noch einmal betont: Jene »Priorisierung der positiven Religionen« bezieht sich bei Habermas lediglich auf den von ihm beschriebenen geschichtlichen Prozess in Sinne der Entstehungsbedingungen; dies besagt jedoch keinesfalls eine Aufweichung des normativen Geltungsanspruches einer autonomen Moral – auch nicht einen ihrer historischen Faktizität zugebilligten »Ehrwürdigkeitsvorschuss«26. Zudem dürfte Dörflingers kritische Bezugnahme auf eine bloße »Nachträglichkeit der menschlichen Vernunft zum sittlich Gebotenen« ein Missverständnis begünstigen und wohl auch der von Kant diesbezüglich besonders akzentuierten Differenzierung von »Autonomie« und »Heteronomie« nicht ganz gerecht werden (s. u. 2.2). Demzufolge ist mit jenem »genealogisch« orientierten Aufweis, dass die »philosophische« Vernunft selbst in einem Prozess der kritischen Auseinandersetzung und Aneignung von den religiösen Traditionen Impulse, aber auch Gehalte angeeignet habe, in diesem Sinne also von Religion »gelernt« hat, die von Dörflinger für die »wahre Auf23 24 25 26
Habermas: »Religion in der Öffentlichkeit«. S. 125. Dörflinger : »Eine neuere Religionsauffassung im Licht einer älteren«. S. 89. Dörflinger : »Eine neuere Religionsauffassung im Licht einer älteren«. S. 88. Dörflinger : »Eine neuere Religionsauffassung im Licht einer älteren«. S. 93.
112
Rudolf Langthaler
klärung« reklamierte Wahrung der »Autonomie der Vernunft« keineswegs in Frage gestellt – auch und erst recht nicht durch den von Habermas unter »postsäkularen« Vorzeichen in Aussicht genommenen bzw. geltend gemachten »komplementären Lernprozess«, der sich jenem Hinweis auf »Philosophie und Religion« als »komplementäre Gestalten des Geistes« verdankt.
2.1.1. Eine Erwiderung verlangt ebenso Dörflingers Bezugnahme auf das von Habermas bestimmte Verhältnis »zwischen dem Säkularen und dem Religiösen« im Sinne einer »kooperativen Wahrheitssuche« und die diesbezüglich von Dörflinger unterstellte Auffassung, wonach laut Habermas der »Fall letztlichen Scheiterns eines solchen diskursiven kommunikativen Handelns ausgeschlossen« sei, denn »er hält es für falsch, partikulare und geschlossene Universen von Bedeutungen anzunehmen, die inkommensurabel sind«27. Gegenüber solcher Einschätzung sei darauf hingewiesen, dass das Gelingen der kooperativen Wahrheitssuche nach Habermas offenbar keineswegs schon insofern »vorgezeichnet« ist, »wenn der Dialog überhaupt nur aufgenommen wird«28 ; denn selbstverständlich kann der zwar zustande gekommene Dialog auch scheitern, was freilich letztlich nur von den eine Verständigung ernsthaft suchenden Parteien selbst zureichend beurteilt werden kann. Ebendies führe die Notwendigkeit vor Augen, ein bloßes »Übereinander-Reden« durch ein »Miteinander-Reden« »auf Augenhöhe« zu ersetzen.29 Natürlich insistiert Habermas, im Blick auf die nur so ermöglichte sachorientierte Auseinandersetzung, darauf, dass die säkulare Vernunft in ihren Maßstäben keinen anderen, ihr fremden Autoritäten untersteht – denn nur unter dieser Voraussetzung ist ja auch ein Dialog mit den Religionen vernünftigerweise zu führen. Indes, auch in Vermeidung einer »falschen«, weil vordergründigen »Versöhnung« von Religion und Philosophie will sich der von Habermas diesbezüglich der Philosophie zugedachte – weil allein den Eigensinn des »Religiösen« zu wahrende bzw. respektierende – Anspruch offenbar schon damit zufrieden geben: Nicht über die Wahrheit und Falschheit religiöser Lehren eine Ent27 Dörflinger : »Eine neuere Religionsauffassung im Licht einer älteren«. S. 90, 91. So Dörflinger in Bezugnahme auf Habermas, Jürgen/Derrida, Jacques: Philosophie in Zeiten des Terrors. Berlin/Wien 2004. S. 62. 28 Dörflinger : »Eine neuere Religionsauffassung im Licht einer älteren«. S. 90. 29 Vgl. Habermas, Jürgen: »Die Revitalisierung der Weltreligionen – Herausforderung für ein säkulares Selbstverständnis der Moderne?«, in: ders.: Kritik der Vernunft. Philosophische Texte. Band 5. Frankfurt a. M. 2009. S. 409: »Es geht nicht um einen schwiemeligen Kompromiss zwischen Unvereinbarem […]. Aber es macht einen Unterschied, ob man miteinander spricht oder nur übereinander.«
Zu Bernd Dörflingers Kritik an Habermas’ Religionskonzeption
113
scheidung zu fällen, ist nach Habermas’ behutsamer Auskunft die vornehmliche und angemessene Aufgabe der Philosophie; Letztere sollte sich ihm zufolge vielmehr mit der kritischen Prüfung begnügen bzw. darauf beschränken, welche tradierten Glaubensinhalte »innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft«30 integriert bzw. so übersetzt werden können, dass diese auch »aus Vernunft allein« zu begründen sind. Solche Intention lässt sich wiederum durchaus auch im Sinne des kantischen Vorhabens »innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft« verstehen.31 Und nur in solch gemeinsamen hermeneutischen Bemühungen könnte sich auch herausstellen, ob dies, wie Dörflinger geltend macht, de facto auf eine Verkennung des Selbstverständnisses und des absoluten Wahrheitsanspruchs geoffenbarter Religion hinauslaufe, die »ihrem Wesen nach die [ihr zugemutete] Selbstdistanzierung abweisen muss«32. Indes muss es als unzutreffend erscheinen, jener von Habermas vertretenen Position, die sich auf den in reziproken Anerkennungsverhältnissen verankerten »komplementären Lernprozesse« stützt, eine »Skepsis« gegenüber einer »Vernunft« zuzuschreiben, »die eigenmächtig und mittels eines allein aus sich erzeugten normativen Wissens an die historischen Religionen herantritt, um zu entscheiden, was an ihnen als vernunftkonform bestehen bleiben kann und was als unvernünftig zu verwerfen ist«33.
30 In einem durchaus ähnlichen Sinne erklärte bekanntlich auch Kant, dass der im Titel der Religionsschrift formulierte Anspruch »innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft« ja keineswegs auf den Anspruch »aus bloßer Vernunft« hinauslaufe, sondern lediglich darauf abziele, »dasjenige, was im Text der für geoffenbart geglaubten Religion, der Bibel, auch durch bloße Vernunft erkannt werden kann, hier in einem Zusammenhang vorstellig« zu machen (Kant: VI. S. 268, Anm.). Davon sieht Kant die darüber hinausgehenden Ansprüche des »biblischen Theologen« noch ganz unberührt, der deshalb auch nicht besorgt sein muss, dass »alle Lehren, die als eigentliche Offenbarungslehren und also buchstäblich angenommen werden müssten«, »wegphilosophiert« werden und ihnen ein »beliebiger Sinn« unterschoben werde (Kant: VI. S. 303). 31 Gleichwohl scheint hier die Antwort Habermas’ tatsächlich nicht ganz eindeutig zu sein. Denn ebenso erläutert er diese Zurücknahme des Anspruchs einer Entscheidung darüber, was an religiösen Lehren wahr oder falsch sei, mit der Selbstbeschneidung des Agnostikers: »Der Agnostiker behauptet nur die Unzugänglichkeit dieser semantischen Gehalte und lässt den Wahrheitsanspruch, den der Gläubige mit ihnen verbindet, auf sich beruhen. Wenn der Agnostiker einen Geltungsanspruch dahingestellt sein lässt, drückt er sein Unverständnis gegenüber einem Redegenre aus; denn aus seiner Sich werden religiöse ›Wahrheiten‹ in einer Begrifflichkeit formuliert, die der üblichen Differenzierung in deskriptive, evaluative und normative Aussagen vorausliegt.« (Habermas: »Religion und nachmetaphysisches Denken«. S. 148; vgl. dazu auch das in diesem Aufsatz-Band enthaltene Interview: 102; 111). 32 Dörflinger : »Eine neuere Religionsauffassung im Licht einer älteren«. S. 100. 33 Dörflinger : »Eine neuere Religionsauffassung im Licht einer älteren«. S. 87. Vielmehr scheint diese von Habermas empfohlene – und auch für jenen »komplementären Lernprozess« vorauszusetzende – Einstellung doch selbst jener von Kant gerühmten (ein »hochmütiges« Verständnis von »Toleranz« ablehnenden) »Aufklärung« verpflichtet zu sein, die
114
Rudolf Langthaler
Daraus mag deutlich werden: Jener von Habermas im Sinne dieses »historischen Bewusstseins« unternommene Nachweis beabsichtigt weder eine Infragestellung bzw. eine Negation der »Autonomie« noch läuft er de facto darauf hinaus, zumal eine rationale Aneignung dieser Gehalte ohne diese auch gar nicht möglich ist. Letztere hat auch Kant bekanntlich als eine vorrangige Aufgabe einer Religionsphilosophie angesehen, wenn ein autoritatives »da stehts geschrieben« jeden vernünftigen Umgang mit diesen Traditionen nicht ohnedies überhaupt verhindern soll. Bekanntlich hatte Kant die – von Habermas zweifellos geteilte – »aufklärungs«-orientierte Zuversicht, dass »eine Religion, die der Vernunft unbedenklich den Krieg ankündigt, […] es auf die Dauer gegen sie nicht aushalten« werde34 ; in solcher Hinsicht hoffte er gleichermaßen auf einen Konsens mit dem »biblischen Theologen« in der Klärung von »Offenbarungsthemen« berührenden Angelegenheiten, zumal ja auch dieser, wie Kant ausdrücklich betont,35 nur auf Vernunft sich berufen könne, wenn er nicht lediglich Gewalt anwenden wolle. So wie Kant setzt offenbar auch Habermas derart auf die Bemühungen einer theologischen Hermeneutik, die Kant ja selbst immer wieder beispielhaft in der »authentischen« Auslegung positiver Glaubensinhalte vor Augen führt.
2.2. Dörflinger sieht sich auch dazu veranlasst, auf der Seite des »Säkularisten« Kant gegen Habermas, der Kant selbst nur mit einer »bezweifelbaren Begründung« nicht den »Säkularisten« zuordnet, zu betonen: »Denn Vernunftreligion ist von Kant allein aus moralischem Bewusstsein entwickelt und von etwaigen geoffenbarten Wahrheiten historischer Religionen, d. h. von dem von Habermas verteidigten fremden Anderen dieser Religionen, ganz unabhängig.«36 Jedoch Kant durch eine »vorurteilsfreie«, »erweiterte« und »konsequente Denkungsart« (Kant: III. S. 391 f.) ausgezeichnet sah. 34 Kant: IV. S. 657. 35 Ein Passus aus einem Brief Kants verdient hier Beachtung: »Der biblische Theolog kann doch der Vernunft nichts Anderes entgegensetzen, als wiederum Vernunft, oder Gewalt, und will er sich den Vorwurf der letzteren nicht zu Schulden kommen lassen, (welches in der jetzigen Krisis der allgemeinen Einschränkung der Freiheit im öffentlichen Gebrauch sehr zu fürchten ist), so muss er jene Vernunftgründe, wenn er sie sich für nachteilig hält, durch andere Vernunftgründe unkräftig machen und nicht durch Bannstrahlen, die er aus dem Gewölke der Hofluft auf sie fallen lässt« (Brief Kants an Stäudlin, 4. Mai 1793, in: Kant: AkademieAusgabe XI. S. 429). 36 Dörflinger : »Eine neuere Religionsauffassung im Licht einer älteren«. S. 87. Schon hier ist auch zu fragen, ob Dörflingers Urteil sich nicht doch zu rasch über Kants Hinweis hinwegsetzt, dass eine »größere Bearbeitung sittlicher Ideen, die durch das äußerst reine Sittengesetz unserer Religion notwendig gemacht wurde, […] die Vernunft auf den Gegen-
Zu Bernd Dörflingers Kritik an Habermas’ Religionskonzeption
115
spricht einiges dafür – schon im Hinblick auf seinen Rekurs auf »die durch hergebrachte fromme Lehren erleuchtete Vernunft«37 –, dass Kants Position sich auch diesbezüglich als recht differenziert erweist und so auch schiefe Alternativen vermeiden lässt. Im Blick auf Dörflingers einschlägige Kritik an Habermas besagt dies auch: Dass nach Kant allein »durch autonome Selbstverpflichtung […] Moral die Angelegenheit des Menschen« ist, wird ja durch Habermas’ Bestimmung des Verhältnisses von »Religion und Vernunft« keineswegs infrage gestellt, wie auch seine – dem genau entsprechende – ausdrückliche Unterscheidung zwischen »rational« und »historisch« zeigt, die, wie sich sogleich zeigen soll, einen schiefen Gegensatz beider vermeiden lässt. Darin wird auch die – das Verhältnis von »Religion und Philosophie« betreffende – Intention Kants erkennbar (die auch in jenem Hinweis auf die »größere Bearbeitung der sittlichen Ideen« entgegentritt): Auch wenn in diesem Sinne die immer schon in die »Geschichte der menschlichen Vernunft« »eingebettete« Philosophie durch die Religion einen geschichtlichen »Anstoß« erfährt, so läuft dies, ihrer »Geltung« nach, dennoch keineswegs auf eine Relativierung der der »Autonomie der Vernunft« innewohnenden »rationalen« Maßstäbe hinaus. Schon die (in Anm. 30 angeführte) Erklärung Kants zum genauen Titel seiner Religionsschrift enthält bzw. indiziert zugleich eine behutsame Selbstbeschränkung desselben. Gleichwohl hält auch Habermas in diesem Sinne mit Kant daran fest: Es bleibt dabei freilich notwendigerweise »dem philosophischen Denken vorbehalten zu bestimmen, was an den Gehalten der religiösen Überlieferung vernünftig und was unvernünftig ist.«38 stand« schärfte, »durch das Interesse, das sie an demselben zu nehmen nötigte« Vgl. Kant: II. S. 685. 37 Kant: VI. S. 186. – Die Einschätzung Dörflingers trifft wohl in mehrfacher Hinsicht zu: »Seine [Kants] Aussagen zur Rolle der Offenbarungsreligionen, speziell der christlichen mit dem über ihren Vernunftkern hinausgehenden Offenbarungsanteil, im geschichtlichen Prozess fortgesetzter Rationalisierung im Sinne der moralischen Religion des bloßen guten Lebenswandels dokumentieren ein Spannungsverhältnis.« (Dörflinger, Bernd: »Offenbarung – nicht jedermanns Sache. Kants Kritik der historischen Religionen«, in: Dörflinger, Bernd/Krieger, Gerhard/Scheuer, Manfred (Hg.): Wozu Offenbarung. Zur philosophischen und theologischen Begründung von Religion. Paderborn 2006. S. 160). 38 Habermas: Kritik der Vernunft. S. 404. In einer weiterführenden Auseinandersetzung wäre vornehmlich dies zu thematisieren: Der von Habermas wiederholt benannte »opake« Charakter des Glaubens – »für das Wissen etwas Opakes, das weder verleugnet noch bloß hingenommen werden darf« (Habermas: Kritik der Vernunft. S. 411) – verlangt eine genauere Klärung. Besagt es einerseits offenbar etwas der Philosophie prinzipiell nicht Zugängliches bzw. verweist es auf das von ihr nicht einholbare »überschießende mehr« der Religion, so ist andererseits mit dieser Kennzeichnung wiederum eher die Unentscheidbarkeit »religiöser Wahrheiten« angezeigt; sodann will Habermas diesem »opaken« Charakter offenbar durch den Hinweis Rechnung tragen, dass »aus seiner Sicht […] religiöse ›Wahrheiten‹ in einer Begrifflichkeit formuliert« werden, »die der üblichen Differenzierung
116
Rudolf Langthaler
Auch im Blick auf diese Kritikpunkte mag eine knappe Vergegenwärtigung von Kants einschlägigen Auffassungen hilfreich sein, die so auch zur Klärung beitragen mag, wie weit Dörflingers Einspruch, der in bzw. durch Habermas’ Religionsauffassung das »aufgeklärte Konzept der Autonomie der Vernunft« in Frage gestellt sieht, sich diesbezüglich zu Recht auf Kant berufen kann. Kants Anmerkung zur Unterscheidung zwischen »Vernunfterkenntnissen« und »historischen Erkenntnissen« (»ex principiis« und »ex datis«) erlaubt und verlangt ebenso eine – geradezu programmatische – Umkehrung39, die somit eine Verwechslung bzw. eine Einebnung der »subjektiv« oder »objektiv historisch« erworbenen Erkenntnis geradewegs verbietet: »Eine Erkenntnis kann aber aus der Vernunft entstanden und demohngeachtet historisch sein«. Denn nicht zuletzt in religionsphilosophischem Kontext bleibt in programmatischer Hinsicht zu erwägen, dass zwar »eine Erkenntnis historisch entstanden« und dennoch »rational« sein mag; dies betrifft eben den »subjektiven Ursprung«, d. h. die »Art, wie eine Erkenntnis von den Menschen kann erworben werden. Aus diesem letzteren Gesichtspunkte betrachtet sind die Erkenntnisse entweder rational oder historisch, sie mögen an sich entstanden sein, wie sie wollen. Es kann also objektiv etwas ein Vernunfterkenntnis sein, was subjektiv doch nur historisch ist«40. Die hier angezeigten Unterscheidungen finden bekanntlich in Kants »Religionsschrift« eine konkrete Anwendung. Zu fragen bleibt in diesem engeren Kontext aber auch, ob Dörflinger nicht den von Kant ausdrücklich erhobenen Anspruch des »negativen« Richtmaßes unterbelichtet, dem zufolge Offenbarungsansprüche der Vernunft lediglich nicht in deskriptive, evaluative und normative Aussagen vorausliegt« (Habermas: »Religion und nachmetaphysisches Denken«. S. 148), weshalb religiöse Aussagen auch nicht am Maßstab »propositionaler Aussagen« gemessen werden dürfen. – Von der notwendigen genauen Klärung dessen, worin nun dieses »Opake« genauer besteht, hängt nun freilich nicht nur ab, was die intendierte »kooperative Übersetzung« zu leisten vermag, sondern auch die Bestimmung der unverzichtbaren Aufgabe bzw. Rolle der Religionsphilosophie. Passt Habermas’ Rühmung der Intentionen der kantischen Religionsphilosophie als »beispiellos« begründetermaßen damit zusammen, dass er selbst bezüglich der von der Philosophie zu leistenden Aufgaben jedoch für Zurückhaltung plädiert, ja gelegentlich sogar ausdrücklich die Möglichkeit bzw. Notwendigkeit einer Religionsphilosophie in Frage stellt: »Aber das nachmetaphysische Denken, für das die religiöse Erfahrung und der religiöse Glaubensmodus einen undurchsichtigen Kern behalten, muss auf Religionsphilosophie verzichten« (Habermas: Kritik der Vernunft. S. 31); s. dazu die kritischen Einwände von Thomas M. Schmidt in seinem Artikel: Schmidt, Thomas M.: »Nachmetaphysische Religionsphilosophie. Religion und Philosophie unter den Bedingungen diskursiver Vernunft«, in: Wenzel, Knut/Schmidt, Thomas M. (Hg.): Moderne Religion? Theologische und religionsphilosophische Reaktionen auf Jürgen Habermas. Freiburg i. Br. 2009. S. 10 – 32. 39 »Eine Erkenntnis, sofern ihre Erwerbung empirisch ist, ist subjektiv historisch; objektiv historisch, wenn ihre Erwerbung nur empirisch sein kann« (Refl. 1629, in: Kant: AkademieAusgabe XVI. S. 49); vgl. Kant: III. S. 444 f. 40 Kant: III. S. 444 f.
Zu Bernd Dörflingers Kritik an Habermas’ Religionskonzeption
117
widerstreiten dürfen: »Es kann zwar von einer ›Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft‹, die aber nicht aus bloßer Vernunft abgeleitet, sondern zugleich auf Geschichts- und Offenbarungslehren gegründet [!] ist und die nur die Übereinstimmung der reinen praktischen Vernunft mit denselben (dass sie jener nicht widerstreite) enthält, die Rede sein. Aber alsdann ist sie auch nicht reine, sondern auf eine vorliegende Geschichte angewandte Religionslehre, für welche in einer Ethik, als reiner praktischen Philosophie, kein Platz ist«41.
3.
Das von Dörflinger – gegenüber der zum Scheitern verurteilten Habermas’schen Friedensperspektive – geltend gemachte Programm der »wahren Aufklärung«
In seinen Ausführungen zu dem von Habermas vorgeschlagenen Weg, wie »der wohlverstandene Säkulare – nicht der Säkularist also – den historischen Religionen und ihren Repräsentanten in der Gesellschaft begegnen sollte«, will Dörflinger in kritischer Absicht – darauf zielt der zweite Hauptpunkt seiner Habermas-Kritik – »auch die Ergebnisse dieser Darstellung mit Kant […] konfrontieren«42. Die von Habermas favorisierte – von Dörflinger jedoch im Grunde als bloß »illusionär« eingeschätzte – »Friedensperspektive« sieht Dörflinger, wiederum im Blick auf Kant und das Programm der »wahren Aufklärung«, deshalb auch zum Scheitern verurteilt, zumal die ihr innewohnenden »Inkommensurabilitäten« »durch das Habermas’sche Harmonievokabular bloß verdeckt« würden und die Habermas’sche Intention die bestehenden faktischen Schwierigkeiten hinsichtlich »einer kooperativen Wahrheitssuche« unterschätze.43 Vornehmlich richten sich seine diesbezüglichen Bedenken gegen Habermas
41 Kant: IV. S. 629. In der Vorrede zur 2. Auflage der »Religionsschrift« betont Kant ganz ausdrücklich: »Aus diesem Standpunkte kann ich nun auch den zweiten Versuch machen, nämlich von irgend einer dafür gehaltenen Offenbarung auszugehen, und, indem ich von der reinen Vernunftreligion (sofern sie ein für sich bestehendes System ausmacht) abstrahiere, die Offenbarung, als historisches System, an moralische Begriffe bloß fragmentarisch [!] halten und sehen, ob dieses nicht zu demselben reinen Vernunftsystem der Religion zurück führe, welches zwar nicht in theoretischer Absicht […], aber doch in moralisch-praktischer Absicht selbständig und für eigentliche Religion, die als Vernunftbegriff apriori (der nach Weglassung alles Empirischen übrig bleibt), nur in dieser Beziehung statt findet, hinreichend sei.« (Kant: IV. S. 659) 42 Dörflinger : »Eine neuere Religionsauffassung im Licht einer älteren«. S. 89. 43 Wohl auch in diesem Sinne hat Dörflinger andernorts betont: »Es ist nicht zu erkennen, dass eine der partikularen historischen Glaubensarten den absoluten Anspruch aufgegeben hätte, die einzig wahre zu sein. Verlangt wäre allerdings noch mehr als dies, nämlich das Ziel der letztlichen Selbstaufhebung um der Universalität der moralisch-praktischen Vernunft willen ins Selbstverständnis aufzunehmen«. Erst so wären die Ansprüche der geschichtlichen
118
Rudolf Langthaler
darauf, »ob das [von Habermas] skizzierte Modell dem Selbstverständnis positiver Religionen entsprechen und tatsächlich einen Konsens tragen kann«44, zumal solche Forderung, wie schon erwähnt, doch »vom religiösen Partner nicht weniger als die Aufgabe seines spezifisch religiösen Selbstverständnisses« verlange, »d. h. die Aufgabe seiner Art des Begründens mittels geoffenbarter Wahrheit.«45 Dieser kritische Befund Dörflingers und die daran von ihm geknüpften Befürchtungen sollen im Folgenden ebenfalls kritisch kommentiert werden. Dazu sei vorab dies angemerkt:
3.1. Habermas’ Bestimmung des »Postsäkularen« wäre zweifellos missverstanden, wenn die darin implizierte Aufgabenteilung zwischen dem Säkularen und dem Religiösen dahingehend aufgenommen wird, dass dabei etwa in der geforderten »Übersetzungsarbeit« der säkularen Seite »eine Art Holschuld« und der »religiösen« Seite eine Art »Bringschuld« als Aufgabe zugewiesen werde. Derart wäre jenes von Habermas geforderte »kooperative Übersetzungsverhältnis« gerade nicht gewahrt, liefe dies doch vielmehr geradewegs darauf hinaus, das unumgängliche »reziproke Verhältnis« beider Parteien zueinander einseitig abzuspannen. Habermas selbst sieht nüchternerweise das Zustandekommen bzw. Gelingen jenes »komplementären Lernprozesses« und der darin anvisierten »kooperativen Übersetzung« und die darin begründete »gesellschaftliche« und »politische« Aufgabe bzw. Zielsetzung an eine Reihe von wechselseitigen Erwartungen und Zumutungen geknüpft. Zunächst besagt es die an die religiöse Seite gerichtete elementare Erwartung, die Prinzipien des modernen Rechtsstaates anzuerkennen, zumal auch die Anerkennung der öffentlichen Relevanz der Religion »die säkular ›freistehenden‹ Legitimationsgrundlagen von Politik und Recht« nicht beeinträchtigen dürfe46. Dies impliziert, dass der moderne Staat mit »Besonderheit« mit dem »Allgemeinen« vereint. (Dörflinger: »Kants Projekt der unsichtbaren Kirche als Aufgabe zukünftiger Aufklärung«. S. 178) 44 Dörflinger : »Eine neuere Religionsauffassung im Licht einer älteren«. S. 100, 92, 90, 95. 45 Dörflinger : »Eine neuere Religionsauffassung im Licht einer älteren«. S. 92. 46 Habermas: Kritik der Vernunft. S. 399. »In einem säkularen Staat müssen sie freilich auch akzeptieren, dass der politisch relevante Gehalt ihrer Beiträge in einen allgemein zugänglichen, von Glaubensautoritäten unabhängigen Diskurs übersetzt werden muss, bevor er in die Agenden staatlicher Entscheidungsorgane Eingang finden kann. Es muss gewissermaßen ein Filter zwischen die wilden Kommunikationsströme der Öffentlichkeit einerseits und die formalen Beratungen, die zu kollektiv bindenden Entscheidungen führen, andererseits eingezogen werden. Denn staatlich sanktionierte Entscheidungen müssen in einer allen
Zu Bernd Dörflingers Kritik an Habermas’ Religionskonzeption
119
religiösen Lehren verbundene politische Ansprüche abweisen muss, die den Grundsätzen des modernen demokratischen Verfassungsstaates widersprechen, denn gegenüber diesen auf »normativen Prinzipien« basierenden Ansprüchen des weltanschaulich notwendigerweise neutralen Staates können sich auch die Religionsgemeinschaften nicht verschließen.47 Des Weiteren bedeutet dies freilich auch die unverzichtbare Forderung der Bereitschaft, »das eigene Ethos nur begrenzt ausleben zu dürfen, und die praktischen Folgen des Ethos der anderen hin[zu]nehmen«48. Ebenso wird von Habermas den Religionen der unverzichtbare Maßstab zugemutet und angelegt, ob bzw. wie weit sie sich selbst in ihrer Partikularität gegenüber anderen religiösen Traditionen und Konfessionen begreifen. Mit dieser impliziten Forderung eines reflexiven Verhältnisses zur Partikularität des eigenen Glaubens und der damit an die religiösen Bürger auch herangetragenen Erwartung der Selbstkritik (somit der reflexiven Haltung auch gegenüber der eigenen religiösen Tradition) ist engstens der für ein säkulares Selbstverständnis unabdingbare Verzicht auf »Prämissen« verbunden, »die aus göttlichen Offenbarungen und prophetischen Lehren schöpfen«49. An diese prinzipiellen Erwartungen ist die weitere »Zumutung« geknüpft, »im Hinblick auf unser Weltwissen [zu] respektieren, was sich in den Grenzen eines falliblen, aber wissenschaftlich gefilterten Argumentationshaushaltes a fortiori nicht mehr behaupten lässt«50. Die motivliche Nähe seiner ausdrücklichen Forderung an die Religionsgemeinschaften, »sich auf die richtige reflexive Verarbeitung von Grundtatsachen der Moderne ein[zu]lassen«51, zu jener schon erwähnten kantischen
47
48 49 50 51
Bürgern gleichermaßen zugänglichen Sprache formuliert und gerechtfertigt werden können.« S. dazu u. Anm. 62. Anders könnte auch von einem »reziproken« Anerkennungsverhältnis auch nicht die Rede sein, das eben an solche Bedingungen geknüpft ist und somit auch die Bereitschaft zur diskursiven Reflexion im öffentlichen Raum voraussetzt. Vgl. Habermas: Kritik der Vernunft. S. 414. Schon in seiner Friedenspreis-Rede betonte Habermas, im Blick auf die für den demokratischen Meinungsbildungsprozess unverzichtbaren basalen Überzeugungen sei die Forderung unabweislich, dass »aus der Sicht des liberalen Staates […] nur die Religionsgemeinschaften das Prädikat ›vernünftig‹ [verdienen], die aus eigener Einsicht auf eine gewaltsame Durchsetzung ihrer Glaubenswahrheiten und auf den militanten Gewissenszwang gegen die eigenen Mitglieder, erst recht auf eine Manipulation zu Selbstmordattentaten Verzicht leisten.« (Habermas: Glauben und Wissen. S. 13 f.). Habermas nimmt damit einschlägige Forderungen von John Rawls auf, mit denen er zwar im Ergebnis, nicht jedoch in der Begründung übereinstimmt. Habermas, Jürgen: »Kulturelle Gleichbehandlung – und die Grenzen des Postmodernen Liberalismus«, in: ders.: Zwischen Naturalismus und Religion. Philosophische Aufsätze. Frankfurt a. M. 2005. S. 321. Habermas: Kritik der Vernunft. S. 402 f. Habermas: »Religion und nachmetaphysisches Denken«. S. 122. Habermas: Kritik der Vernunft. S. 402. Eine Zusammenschau der einschlägigen Motive und ihrer Entwicklung bei Habermas bietet Hermann-Josef Große Kracht in: Wenzel/Schmidt: Moderne Religion?. S. 55 – 91.
120
Rudolf Langthaler
Diagnose, dass eine den Prinzipien der Moderne sich verweigernde Religion es gegen »die Vernunft nicht auf die Dauer wird aushalten« (s. o. Anm. 34), ist wohl nicht zu übersehen. Indes, auch die »säkulare Seite« ist – eben buchstäblich »prinzipiell« anders als es das säkularistisch-laizistische Modell vorsieht – mit unverzichtbaren Erwartungen und Zumutungen als jenen Bedingungen zu konfrontieren, ohne die jener zwar als möglich angesehene Konsens auf der »sozialen Ebene« sowie der erstrebte »kooperative Lernprozess« nicht gelingen kann. Gegenüber laizistischen »Kurzschlüssen« bringt Habermas diesbezüglich vor allem die unverzichtbare Basis der demokratischen Willens- und Urteilsbildung der Bürger zur Geltung, deren »Wurzel« er durch die »Einäugigkeit« laizistischer Positionen als gefährdet ansieht und dagegen deshalb seine eigene Perspektive einer »Säkularisierung«, »die nicht vernichtet«, in Stellung bringt. Dieses für eine »postsäkular« sensibilisierte Mentalität zentrale Anliegen, den religiösen Bürgern und Religionsgemeinschaften auf dieser elementaren Ebene eine Partizipation im öffentlichen Diskurs einzuräumen und ihnen somit in gebührender Weise Gehör zu verschaffen, ist von der jenes Habermas’sche genealogische Interesse leitenden Absicht und von der auch der »säkularen Bürgern« zugemuteten »Selbstaufklärung« inspiriert, um solcherart für den »unfairen Ausschluss der Religion aus der Öffentlichkeit« zu sensibilisieren52. Demnach müssen nach Habermas zunächst also »zwei Voraussetzungen« erfüllt sein, die sich einerseits aus der Unverzichtbarkeit des SäkularisierungsAnliegens und andererseits aus der Ablehnung seiner »laizistischen« Fehlform bzw. aus seiner Bestimmung des »Säkularen« ergeben53 : »Die religiöse Seite muss die Autorität der ›natürlichen Vernunft‹ als die fehlbaren Ergebnisse der institutionalisierten Wissenschaften und die Grundsätze eines universalistischen Egalitarismus in Recht und Moral anerkennen. Umgekehrt darf sich die säkulare Vernunft nicht zum Richter über Glaubenswahrheiten aufwerfen, auch wenn sie im Ergebnis nur das, was sie in ihre eigenen, im Prinzip allgemein zugänglichen Diskurse übersetzen kann, als vernünftig akzeptiert«.54 Mit dem 52 Habermas: Glauben und Wissen. S. 22. 53 Bezüglich dieser von Habermas an das Gelingen dieses Dialoges notwendigerweise geknüpften Erwartungen an beide Seiten ist vorweg an seine Bestimmung des »Säkularen« zu erinnern: Als »säkular« bezeichnet er die Vernunft als Vermögen, das »begriffliche und empirische, wissenschaftliche, moralische und rechtliche Argumente« auszubilden und anzuerkennen vermag, »die – vor dem Erfahrungshintergrund moderner Lebensbedingungen – über weltanschauliche Gegensätze hinweg allen Parteien eingeleuchtet haben würden«. Vgl. Habermas: Kritik der Vernunft. S. 400. 54 Habermas: Kritik der Vernunft. S. 409. – Dies hätte Habermas wohl auch gegen Dörflinger geltend gemacht, der andernorts die Frage, wie der Staat den spezifischen statutarischen Gesetzgebungen« begegnen soll, in Berufung auf Kant auf folgende Weise beantwortet und damit wohl auch seinen eigenen »Aufklärungs-Standpunkt« verdeutlicht: »1. Der Staat muss,
Zu Bernd Dörflingers Kritik an Habermas’ Religionskonzeption
121
letztgenannten Aspekt ist freilich nicht mehr als die kritische Beschränkung darauf benannt, welche tradierten Glaubensinhalte einer kritischen Prüfung »innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft« bzw. einer entsprechenden – »gefilterten« – »Übersetzung« standhalten können. Der diesbezüglich von Habermas geltend gemachte »Übersetzungsvorbehalt« für »religiöse Beiträge« im Kontext der »politischen Öffentlichkeit« verweist somit die von religiöser Seite erhobenen Ansprüche auf politische Einflussnahmen jedenfalls unnachgiebig an die säkulare Vernunft als unumgängliche Prüfungsinstanz. In einer der jüngsten öffentlichen Stellungnahmen zu diesem Themenfeld »Religion in der Öffentlichkeit« hat Habermas dieses in beide Richtungen verfolgte differenzierte Anliegen besonders deutlich formuliert: »Der liberale Staat ist also mit religiösem Fundamentalismus unvereinbar. In diesem Konflikt tritt eine Gestalt der Moderne einer anderen, als Reaktion auf entwurzelnde Modernisierungsprozesse entstandenen Gestalt der Moderne entgegen. Der liberale Staat kann seinen Bürgern gleiche Religionsfreiheiten – und ganz allgemein gleiche kulturelle Rechte – nur unter der Bedingung garantieren, dass diese gewissermaßen aus den integralen Lebenswelten ihrer Religionsgemeinschaften und Subkulturen ins Offene der gemeinsamen Zivilgesellschaft heraustreten. Gleichzeitig darf auch die Mehrheitskultur ihre Mitglieder nicht in der bornierten Vorstellung einer Leitkultur gefangen halten, die sich eine ausschließende Definitionsgewalt über die politische Kultur des Landes anmaßt […] In der Rolle von demokratischen ›Mitgesetzgebern‹ gewähren sich alle Staatsbürger gegenseitig den grundrechtlichen Schutz, unter dem sie als Gesellschaftsbürger ihre kulturelle und weltanschauliche Identität wahren und öffentlich zum Ausdruck bringen können. Dieses Verhältnis von demokratischem Staat, Zivilgesellschaft und subkultureller Eigenständigkeit ist der Schlüssel zum Verständnis der beiden einander ergänzenden Motive, die Säkularisten und Multikulturalisten fälschlich für unvereinbar halten. Das universalistische Anliegen der politischen Aufklärung erfüllt sich erst in der fairen Anerkennung der partikularistischen Selbstbehauptungsansprüche religiöser und kultureller Minderheiten.«55 obwohl er, wie gesehen, um seiner selbst und seines Rechtsprinzips willen eine rein moralische und nichtstatutarische Vernunftreligion favorisieren muss, die außerrationalen Gestalten von Religion, also etwa das Judentum und den Islam ihren vielfältigen statutarischen Anteilen nach, doch dulden und schützen. 2. Der Staat sollte eben diesen statutarischen Anteilen gegenüber, die das Spezifische, sozusagen das Antiuniversalistische der Religionsgemeinschaften ausmachen, zugleich höchst wachsam sein, weil in ihnen nicht bloß zufällig, sondern notwendigerweise ein Potential für Streit und Gewalt enthalten ist und sie demgemäß eine mögliche Gefahr für das Staatsziel der Wahrung der Rechtsordnung und für das der Friedenserhaltung darstellen […] Über ein solches Zulassen des außerrational Religiösen und über die Gewährung von Schutz hinaus, wenn es sich im Rahmen der vernunftrechtlichen Ordnung hält, kann der Staat sich den historischen Religionen allerdings nicht annähern.« (Dörflinger, Bernd: »Kant zum Verhältnis von Staat und Religion«, in: Hoffmann, Bernd von (Hg.): Universalität der Menschenrechte. Kulturelle Pluralität. Frankfurt a. M. 2009. S. 75 f.) 55 Habermas: »Wie viel Religion verträgt der liberale Staat?«. S. 63.
122
Rudolf Langthaler
Dass Habermas hier eine »Übersetzung« religiöser Gehalte und Leitbilder »nur für den Fall des Hinaustretens in den öffentlichen Raum« verlangt, mag zwar in der Tat dem Selbstverständnis und den Ansprüchen mancher »historischer Glaubensarten« widerstreiten; jedoch ändert dies nichts an der Unverzichtbarkeit bzw. Berechtigung der Zumutung, dass doch nur unter dieser Bedingung religiöse Traditionen auch Anerkennung im säkularen Raum verdienen, jedoch auch zur öffentlichen Diskussion Inhaltliches beitragen können. Überdies will Habermas im Sinne jenes »komplementären Lernprozesses« freilich auch bezweifeln, »dass säkulare Bürger irgendetwas lernen können aus fundamentalistischen Lehren, die mit dem Faktum des Pluralismus, mit der öffentlichen Autorität der Wissenschaften und dem Egalitarismus unserer Verfassungsgrundsätze nicht zurechtkommen.«56 Falls solche an sie herangetragene »Zumutungen«, wie Dörflinger befürchtet bzw. diagnostiziert, jedoch dem »Selbstverständnis der positiven Religionen« widersprechen, so ist dies gegebenenfalls eben umso schlechter für diese – zumal doch die Akzeptanz der daran geknüpften inhaltlichen Ansprüche und deren öffentliche Anerkennung daran gebunden ist. Ob also – wie Dörflingers Vorwurf der diesbezüglichen »Realitätsferne« und sein dagegen gesetztes Plädoyer für die »wahre Aufklärung« besagt – diesbezügliche Maßstäbe bzw. Forderungen mit dem Selbstverständnis und den Ansprüchen der geschichtlich-»positiven« Religion in der Tat unverträglich ist, ist demnach eine andere Frage – gleichwohl bleibt dies ein unverzichtbarer Prüfstein seitens des liberalen Staates. Auch hier bleibt nochmals daran zu erinnern: Die angeführten Punkte benennen lediglich einige – nur von den Religionsgemeinschaften selbst zu beurteilende – Erwartungen und Zumutungen, die Habermas aus seiner philosophischen und gesellschaftstheoretischen Perspektive begründet und an das Selbstverständnis von Religionsgemeinschaften im säkularen Staat bzw. in modernen – »pluralistischen« und »verwissenschaftlichten« – Gesellschaften herangetragen hat. Zwar hat Habermas mit den angeführten Forderungen in der Tat allen Formen eines Fundamentalismus, der »Grundüberzeugungen der Moderne« negiert, eine eindeutige Absage erteilt. Die daran von ihm geknüpften »Erwartungen und Zumutungen« bedeuten jedoch nicht (wie Dörflinger unterstellt), dass damit etwa den Religionen abverlangt werde, »sich auf Übersetzungen ins säkular Vernünftige ein[zu]lassen und damit ihr religiöses Proprium auf[zu]geben«57; vielmehr erscheint dies doch lediglich als eine Konsequenz aus jenem eingeräumten »komplementären Lernprozess« und der schon »an der Wurzel« unverzichtbaren Einbindung der religiösen Seite in die demokatischen 56 Habermas, Jürgen: »Ein neues Interesse der Philosophie an der Religion? Ein Gespräch«, in: ders.: Nachmetaphysisches Denken II. Aufsätze und Repliken. Frankfurt a. M. 2012. S. 112. 57 Dörflinger : »Eine neuere Religionsauffassung im Licht einer älteren«. S. 92.
Zu Bernd Dörflingers Kritik an Habermas’ Religionskonzeption
123
Urteils- und Willensbildungsprozesse58. Es ist eben dieses Anliegen, das Habermas in diesen jüngeren einschlägigen Stellungnahmen besonders hervorhebt und gegenüber »laizistischen« Verengungen und »Einäugigkeiten« zur Geltung bringt. Im Blick darauf stellt sich nun auch die Frage nach einer möglichen Alternative, die Dörflingers – gegen die Realitätsferne des Habermas’schen Friedensprojekts erhobenes – Plädoyer für die »wahre Aufklärung« als aussichtsreich erweisen und deshalb auch gegenüber dem Habermas’schen Konzept den Vorzug verdienen könnte. Indes, deren Realisierbarkeit scheint – in der gebotenen nüchternen Beachtung der gesellschaftlichen und politischen Realitäten –, selbst just an diejenigen Bedingungen geknüpft zu sein, die in Habermas’ – aus einer philosophisch verankerten gesellschaftstheoretischen Perspektive gespeisten – Erwartungen zum Ausdruck gebracht sind und an die Religionsgemeinschaften und ihre gläubigen Mitglieder herangetragen werden; sie sind es doch, die auch diesbezüglich, ganz im Sinne jener »reziproken Anerkennung« und des angestrebten »komplementären Lernprozesses«, zur Stellungnahme im Sinne des »allen gleichermaßen offenstehenden Universums der vorbehaltlos begründenden Rede« auffordern. Es hat den Anschein, dass Dörflinger vor allem das Habermas leitende – alternativlose – Anliegen unterschätzt bzw. zentrale Aspekte desselben ohnedies auch für das von ihm alternativ geltend gemachte »aufgeklärte« Projekt voraussetzen bzw. akzeptieren muss. Klärungsbedürftig ist, wie gesagt, wohl vor allem dies: Wie sollte anders überhaupt aussichtsreich sein, was Dörflinger mit Kant als Anliegen und Vorgangsweise der »wahren Aufklärung« geltend macht – wie sollen die mit ihr selbst untrennbar verbundenen Maßnahmen bzw. Einstellungen ohne die von Habermas benannten Bedingungen erreichbar sein – zumal doch Dörflinger in Berufung auf Kant (und zweifellos auch in Übereinstimmung mit Habermas) ausdrücklich betont: »Der Friedenszweck aber ist ein Hauptzweck des vernunftrechtlich verfassten Staates«59 ? Wie soll ohne die von Habermas als »postsäkular« charakterisierte Realität bzw. »Denkungsart«, welche laizistische Engführungen und dadurch bedingte Verhärtungen gerade vermeiden will, dasjenige – mit Rücksicht auf die gesellschaftlichen und politischen Realitäten 58 Natürlich darf in einem demokratischen Verfassungsstaat auch eine Staatsgewalt nicht »zum Agenten einer religiösen Mehrheit« werden, »die ihren Willen unter Verletzung des demokratischen Verfahrens durchsetzt«. Sehr entschieden betont Habermas auch, dass die »Mehrheitsherrschaft« sich »in Repression« verwandelt, »wenn eine religiös argumentierende Mehrheit im Verfahren der politischen Meinungs- und Willensbildung der unterlegenen säkularen oder andersgläubigen Minderheit den diskursiven Nachvollzug der ihr geschuldeten Rechtfertigung verweigert« (Habermas: Zwischen Naturalismus und Religion. S. 140). 59 Dörflinger : »Kant zum Verhältnis von Staat und Religion«. S. 79.
124
Rudolf Langthaler
und einer notwendigen »Logik der kleinen Schritte« gemäß – einlösbar sein,60 was Dörflinger für eine »wahre Aufklärung« als maßgebend ansieht? Der von ihm selbst im Blick auf Kant bejahte »Reformprozess, der auf fortschreitender Aufklärung beruht«61 setzt offenbar die von Habermas benannten Bedingungen bzw. Maßnahmen notwendigerweise voraus; wie anders könnte die von ihm gesuchte bzw. allein akzeptierte »rein gedankliche Auseinandersetzung« mit den »rationalen Defiziten« der historischen Glaubensarten«, die eben selbst »auf gut aufklärerische Art auf die Kraft der Überzeugung […] setzen« will, selbst als aussichtsreich erscheinen? Und setzt solche vernunft-geleitete Orientierung an der »Kraft der Überzeugung« nicht auch ein Verständnis von »Religionsfreiheit« voraus, das sich gerade nicht in einer laizistischen Engführung erschöpfen darf ? Daran anknüpfend seien abschließend noch einige besondere Akzentuierungen in Habermas’ jüngsten einschlägigen Äußerungen erwähnt, die auch Dörflingers Anfragen zu dem zweiten Punkt betreffen.
3.2. Im Vorblick auf die von Dörflinger diesbezüglich erhobenen Einwände ist vor allem der von Habermas in jüngerer Zeit wiederholt geäußerte bedeutsame Hinweis auf den »Hauch von Paradoxie« besonders bedeutsam, der »liberalen Verfassungen« innezuwohnen scheint – darauf hat Dörflinger in seiner Kritik 60 Demgemäß geht auch nach Dörflinger der »Rat des an der Vernunft orientierten Philosophen […] nun zwar so weit«, den gegenüber dem »Vernunftglauben« »defizitären Glaubensgestalten« »die ausdrückliche Zustimmung zu verweigern […] doch geht dieser Rat nicht so weit, sie etwa zu bekämpfen und staatlichen Zwangsmaßnahmen zu unterwerfen. Solange seine eigene Rechtsordnung durch sie nicht verletzt wird, ist es sogar Aufgabe des Staates, sie trotz der erkannten rationalen Defizite zu schützen […] Auch für die Ausprägungen der Religionsausübung, die aus dem Gesichtspunkt reiner praktischer Vernunft als defizitär und als zu überwinden nötig beurteilt werden, gilt also Religionsfreiheit«. Indes bleibt zu bedenken: »[…]wenn andererseits das Vorkommen dieser Glaubensarten zu tolerieren und vor Zwang zu schützen ist, dann folgt daraus, dass die Auseinandersetzung mit ihren rationalen Defiziten eine rein gedankliche sein muss, d. h. es folgt daraus, auf gut aufklärerische Art auf die Kraft der Überzeugung zu setzen. Schutz vor Zwangsmaßnahmen bedeutet also nicht Schutz vor geistiger Auseinandersetzung; ebenso bedeutet Toleranz nicht, dass irrationale Ansprüche unangetastet bleiben und mit allgemeiner Nachsicht rechnen können, was von der Vernunft die Unmöglichkeit verlangte, die Erreichung ihres moralischen Endzwecks für gleichgültig zu halten […] Schutz und Toleranz bedeuten nur, dass der in der Sache unvermeidliche Konflikt auf rationale und nicht auf gewaltsame Art ausgetragen wird, es sei denn die historischen Glaubensarten verletzen ihrerseits, wozu sie aufgrund ihrer Verabsolutierungstendenz in der Tat neigen, die Rechtsordnung, wodurch staatlicher Zwang gegen sie legitimiert wäre.« (Dörflinger: »Kant über moralische, juridische und religiöse Gesetze«. S. 117 f.). 61 Dörflinger : »Kant über moralische, juridische und religiöse Gesetze«. S. 119.
Zu Bernd Dörflingers Kritik an Habermas’ Religionskonzeption
125
allerdings nicht mehr Bezug genommen. Indes berühren die darin geäußerten Bedenken durchaus auch Dörflingers Einwände, ebenso sein gegen Habermas’ Friedensprojekt gerichtetes Plädoyer für »wahre Aufklärung« und die damit verbundene Frage ihrer Realisierungsbedingungen: »Die Religionsgemeinschaften dürfen, solange sie in der Bürgergesellschaft eine vitale Rolle spielen, nicht aus der politischen Öffentlichkeit in die Privatsphäre verbannt werden, weil eine deliberative Politik vom öffentlichen Vernunftgebrauch ebenso der religiösen wie der nichtreligiösen Bürger abhängt. Wenn die schrille Polyfonie aufrichtiger Meinungen nicht unterdrückt werden soll, dürfen die religiösen Beiträge zu moralisch komplexen Fragen wie Abtreibung, Sterbehilfe, vorgeburtliche Eingriffe in das Erbgut usw. nicht schon an der Wurzel der demokratischen Willensbildung abgeschnitten werden.«62 62 Habermas: »Wie viel Religion verträgt der liberale Staat?«. S. 63. – Wohl am eindringlichsten hat Habermas auf die durch die »laizistische« Konzeption bedrohte »Wurzel der demokratischen Willensbildung«, die auf der – auch für ein differenziertes Verständnis von »Säkularisierung« unentbehrlichen – Unterscheidung zwischen der »Säkularisierung des Staates« und der »Säkularisierung der Bürgergesellschaft« basiert und die »Neutralisierung der Staatsgewalt nicht mit dem Ausschluss religiöser Äußerungen aus der politischen Öffentlichkeit verwechseln« will (Habermas: »Religion in der Öffentlichkeit der ›postsäkularen‹ Gesellschaft«. S. 326), in einem Interview hingewiesen: »Solange religiöse Überlieferungen und Organisationen innerhalb der Gesellschaft eine vitale Kraft bleiben, kann sich im Rahmen einer liberalen Verfassung aus der Trennung von Staat und Kirche keine vollständige Eliminierung des Einflusses religiöser Gemeinschaften auf die demokratische Politik ergeben. Die Säkularisierung der Staatsgewalt verlangt gewiss eine weltanschaulich neutrale Verfassung sowie die Unparteilichkeit der in ihrem Rahmen gefassten kollektiv verbindlichen Beschlüsse gegenüber konkurrierenden Weltanschauungs- und Religionsgemeinschaften. Aber die rechtsstaatliche Demokratie darf Bürger, die sie ausdrücklich zu einer religiösen Lebensführung ermächtigt, nicht gleichzeitig in ihrer Rolle als demokratische Mitgesetzgeber diskriminieren. Dieser Hauch von Paradoxie schürt seit langem ein Ressentiment gegen den Liberalismus – zu Unrecht, es sei denn man setzt den Politischen Liberalismus mit dessen laizistischer Deutung gleich. Der liberale Staat darf nicht schon in der politischen Öffentlichkeit, also an der Wurzel des demokratischen Prozesses, die Äußerungen seiner religiösen Bürger zensieren; noch kann er deren Motive an der Wahlurne kontrollieren […] Gewiss, der Gehalt religiöser Äußerungen muss in eine allgemein zugängliche Sprache übersetzt werden, bevor er auf die offiziellen Agenden gelangen und in die Beratungen der beschlussfassenden Gremien einfließen kann. Aber religiöse Bürger und Religionsgemeinschaften behalten dort Einfluss, wo der demokratische Prozess der Begegnung zwischen religiösen und nichtreligiösen Teilen der Bevölkerung entspringt. Solange sich politisch relevante öffentliche Meinungen aus diesem Reservoir des öffentlichen Vernunftgebrauchs speisen, muss es zum kollektiven Selbstverständnis aller Bürger gehören, dass eine deliberativ gebildete demokratische Legitimation auch von religiösen Stimmen und religiös stimulierten Auseinandersetzungen zehrt. In diesem Sinne wahrt der vom Staat auf die Zivilgesellschaft verschobene Begriff des ›Politischen‹ auch innerhalb des säkularen Verfassungsstaates einen Bezug zur Religion« (Habermas: »Ein neues Interesse der Philosophie an der Religion?«. S. 117 f.). In diesem Sinn betonte der Vizepräsident des Deutschen Bundestages kürzlich: »Der Staat ist säkular, ja. Aber er verlangt deshalb nicht, dass die Bürger, die ihn tragen, säkular sein müssen« (»Ohne Glauben ist kein Staat zu machen. Warum wir auf Religion als Wertreservoir nicht verzichten können. Ein Streitgespräch mit
126
Rudolf Langthaler
Andernfalls wäre nach Habermas genau jene »paradoxe Situation« geradezu unvermeidlich, die sich ihm zufolge vermutlich auch in Dörflingers kritischen Äußerungen widerspiegelt: »Liberale Verfassungen gewährleisten allen Religionsgemeinschaften (unter Berücksichtigung der negativen Religionsfreiheit) den gleichen Freiraum und schirmen gleichzeitig die staatlichen Körperschaften, die kollektiv verbindliche Beschlüsse fassen, gegen die politische Einflussnahme vonseiten einzelner mächtiger Religionsgemeinschaften ab. Daraus folgt aber, dass sich dieselben Personen, die ausdrücklich dazu ermächtigt werden, ihre Religion zu praktizieren und ein frommes Leben zu führen, in ihrer Rolle als Staatsbürger an einem demokratischen Prozess beteiligen sollen, dessen Ergebnis von allen religiösen Beimengungen freigehalten werden muss«.63 Eine besondere Pointe dieser erwähnten »Paradoxie« dürfte nicht zuletzt darin zu erkennen sein, dass eine solche Einstellung bzw. Vorgangsweise zuletzt doch darauf hinausliefe, dass auch das zunächst angeblich (nicht selten wohl in Berufung auf unveräußerliche Menschenrechte) eingeräumte Recht auf »Religionsfreiheit« und die darin notwendig implizierte Anerkennung Glaubens- und Gewissensüberzeugungen in Wahrheit gerade nicht als solche anerkannt wären – denn was wäre eine »anerkannte« Religionsfreiheit ohne die daran geknüpfte Anerkennung der Überzeugungen der sich daran orientierenden Staatsbürger? Eine solche Einstellung liefe letztendlich auf den Widerspruch hinaus, den »religiösen Bürgern« »Religionsfreiheit« zuzusichern – und ihnen zugleich das Einverständnis dazu zuzumuten, diese dennoch nicht als Glaubens- und Gewissens-Überzeugungen im öffentlichen Raum der gemeinsamen Urteils- und Willensbildung geltend zu machen: Ebendies wäre (auch nach Habermas) offenbar mit fundamentalen Ansprüchen der Aufklärung unvereinbar, die stets gleichermaßen Zuerkennung und Zumutung in sich vereinen und nur so die »Existenz der Vernunft« gewährleistet sehen. Wohl auch im direkten Blick auf gesellschaftliche und politische Konsequenzen gibt Habermas – und wohl auch angesichts des von Dörflinger betonten »Friedenszwecks« (s. o. Anm. 59) – gegenüber einem »laizistischen Kurzschluss« jedenfalls zu bedenken, dass dies »sowohl innerhalb derselben Kultur wie weltweit zu einem Konflikt zwischen Gläubigen und Säkularisten führen« müsse, »der genauso tief reicht wie der zwischen Weltanschauungsparteien. Wenn die säkulare Seite die religiösen Mitbürger aus dem Kreis moderner Zeitgenossen ausschließt und als Exemplare betrachtet, die gleichsam unter Artenschutz stehen, greift sie an die Substanz der gleichberechtigten Mitglieddem Bundestagsvizepräsidenten Wolfgang Thierse«, in: Die Zeit (49), 29. November 2012. S. 68). Den Titel dieses Interviews hätten Habermas und Thierse jedoch wohl als höchst irreführend zurückgewiesen. 63 Habermas: »Wie viel Religion verträgt der liberale Staat?«. S. 63.
Zu Bernd Dörflingers Kritik an Habermas’ Religionskonzeption
127
schaft im Universum vernünftiger Personen. Ohne eine reziproke Anerkennung kann die formal gesicherte rechtliche Gleichstellung von Staats- oder Weltbürgern nicht mehr als einen modus vivendi gewährleisten«64.
3.3. Diese voranstehend vergegenwärtigten Motive, die für Habermas’ Bestimmung des Verhältnisses von Religion und Politik grundlegend sind, implizieren nun noch weitere kritische Bezugnahmen auf Dörflingers Plädoyer für die »wahre Aufklärung«. Vornehmlich die in jener benannten »Paradoxie« anklingende Kritik an einem bornierten Säkularismus bzw. Laizismus enthält auch einige nähere Rückfragen an Dörflingers Plädoyer für eine »wahre Aufklärung«. Er selbst weist ausdrücklich darauf hin, dass dies »die Ausbildung von Überzeugungen, die nur durch Selbstdenken und unmöglich durch Zwang entstehen können«, verlangt65, und beruft sich dabei auf die von Kant in Aussicht genommene »allmählig fortgehende Reform zur Ausführung«66. Solche Hoffnung teilt freilich auch Habermas – und gewiss setzt auch er auf die mit der »wahren Aufklärung« verbundene Hoffnung auf die damit einhergehende »Entwicklung eines kritischen theoretischen Bewusstseins«. Und auch Habermas hätte kaum in Zweifel gezogen: »Da die historischen statutarischen Glaubensarten von empirischen Fakten ausgehen müssen, kann zu ihrer Aufklärung auch die über sich selbst belehrte theoretische Vernunft beitragen«67. Ebendies sieht Habermas jedoch an die oben benannten – als »postsäkular« gekennzeichneten – Bedingungen geknüpft, die im Grunde ohnedies die »Ma64 Habermas: Kritik der Vernunft. S. 402. Auch hier wird noch einmal deutlich, dass die Kennzeichnung der modernen Gesellschaft (und deren Verhältnis zur Religion) als »postsäkular« sich nicht in einem deskriptiven Sinn erschöpft, sondern eben auch normative Implikationen hat. – Die von Dörflinger geäußerten Bedenken sind freilich auch so zu verstehen, dass der Erforschung der kulturellen, sozialen und institutionellen Barrieren, die jenen »komplementären Lernprozessen« – die notwendigerweise »soziale Lernprozesse« sind – im Wege stehen bzw. diese erschweren, und den entsprechenden Maßnahmen eine vorrangige Bedeutung zukommt; auch diese Aspekte sind in jener Kennzeichnung »postsäkular« mitzuhören. 65 Dörflinger : »Eine neuere Religionsauffassung im Licht einer älteren«. S. 100. 66 Kant: IV. S. 786. 67 Dörflinger : »Eine neuere Religionsauffassung im Licht einer älteren«. S. 98. Für den Anspruch der »wahren Aufklärung« macht Dörflinger jedenfalls geltend: »Aufklärung, ihrem entfalteten Begriff nach, ist nicht bloß in dienender Funktion Korrektiv der geschichtlichen Religionen, sondern selbstbewusst provokativ, auf den Kern ihres Selbstverständnisses und ihrer Legitimität zielend« (Dörflinger : »Über den aufgeklärten Umgang mit Gottes Wort«. S. 124).
128
Rudolf Langthaler
ximen« der von Kant so genannten »aufgeklärten Denkungsart« widerspiegeln.68 Was Dörflinger hier mit Bezug auf Kant als selbstverständliche Forderung der »wahren Aufklärung« zur Geltung bringt, setzt also just diejenigen »Maximen« voraus, deren Zumutung er andererseits wiederum als mit dem Selbstverständnis der Gestalten des »Geschichtsglaubens« unverträglich ansieht. Freilich, dann ist auch die im Sinne der »wahren Aufklärung« erhoffte theoretische Auseinandersetzung nicht weniger unrealistisch, zumal doch auch die Bereitschaft dazu genau jene von Habermas geforderte Haltung schon voraussetzt. Dafür ist also jener von Habermas geltend gemachte Dialog die unumgängliche Bedingung, die Dörflinger gleichwohl als unrealistisch distanziert. Infolgedessen wäre aber auch genau jene darauf verwiesene »wahre Aufklärung« selbst unmöglich – was aber wäre dann die Konsequenz daraus? Gerade auch in gebotener Beachtung jener von Habermas erwähnten – durch säkularistische Kurzschlüsse »sowohl innerhalb derselben Kultur wie weltweit« geradewegs begünstigten – Konflikte zwischen »Gläubigen und Säkularisten« bleibt auch noch zu fragen, ob Dörflingers programmatische »Forderung nach dem Ende der historischen Religionen« nicht nur diese ungeahnten politischen und sozialen Konsequenzen unterschätzt, sondern auch übersieht, dass wohl allein auf dem von Habermas angezeigten – langen und mühsamen, von Rückschlägen geprägten und doch »alternativlosen« – Weg jene »allmählige fortgehende Reform zur Ausführung [!] gebracht werden kann«, obgleich auch hier – gut kantisch – von der »Errichtung« die »Erreichung« illusionslos unterschieden bleiben muss.69 Auch Dörflinger versteht freilich das von ihm gegen Habermas ins Treffen geführte Programm der »wahren Aufklärung«, worin »die letztliche Auflösung der historischen Religionen anvisiert ist« – d. i. die Forderung nach dem Ende der Religionen als »historischen Glaubensarten« – im Blick auf die realen Gegebenheiten und Probleme als eine »regulative Idee«. Indes, diese Auskunft Dörflingers über das von der »wahren Aufklärung« verfolgte »wahre Ziel« geht vermutlich auch insofern zu weit, als bei Kant doch behutsamerweise lediglich davon die Rede ist, dass sie ohne »Positivität« aus68 Kant nennt sie: »1. Selbstdenken; 2. An der Stelle jedes andern denken; 3. Jederzeit mit sich selbst einstimmig denken«. Vgl. Kant: III. S. 390; Kant: III. S. 283 (Anm.). 69 Wohl in diesem Sinne betont Habermas: »Wir stellen uns das Reflexivwerden des religiösen Bewusstseins nach dem Vorbild jenes Wandels epistemischer Einstellungen vor, wie er sich seit der Reformation in den christlichen Kirchen des Westens vollzogen hat. Eine solche Mentalitätsänderung lässt sich nicht verordnen, nicht politisch steuern und rechtlich erzwingen, sie ist bestenfalls das Ergebnis eines Lernprozesses. Und als ›Lernprozess‹ erscheint sie auch nur aus der Sicht eines säkularen Selbstverständnisses der Moderne. Bei solchen kognitiven Voraussetzungen für ein demokratisches Staatsbürgerethos stoßen wir an die Grenzen einer normativen politischen Theorie, die Pflichten und Rechte begründet. Lernprozesse können gefördert, nicht moralisch oder rechtlich gefordert werden« (Habermas: »Religion in der Öffentlichkeit der ›postsäkularen‹ Gesellschaft«. S. 325).
Zu Bernd Dörflingers Kritik an Habermas’ Religionskonzeption
129
kommen könnten. Sehr bemerkenswert ist, dass Kant in der 2. Auflage der »Religionsschrift« ausdrücklich präzisiert, besser wohl: vorsichtig korrigiert – auch hier bleiben wohl unaufgelöste Spannungen: »Nicht dass er [d. i. der »Geschichtsglaube« als »Kirchenglaube«] aufhöre (denn vielleicht mag er als Vehikel immer nützlich und nötig sein), sondern aufhören könne; womit nur die innere Festigkeit des reinen moralischen Glaubens gemeint ist«.70 In diesem Sinne darf wohl auch Kants Hinweis auf die »wahre erste Absicht« verstanden werden, die »keine andere als die gewesen sei, einen reinen Religionsglauben, über welchen es keine streitenden Meinungen geben kann, einzuführen, alles jenes Gewühl aber, wodurch das menschliche Geschlecht zerrüttet ward und noch entzweiet wird, bloß davon herrühre, dass durch einen schlimmen Hang der menschlichen Natur, was beim Anfange zur Introduktion des letzteren dienen sollte, nämlich die an den alten Geschichtsglauben gewöhnte Nation durch ihre eigenen Vorurteile für die neue zu gewinnen, in der Folge zum Fundament einer allgemeinen Weltreligion gemacht worden«71. Dass Gott »sei alles in allem« (wie Kant in diesem Kontext anmerkt), besagt also zunächst, dass die »historischen Glaubensarten« in ihrer Partikularität sich begreifen und sich, »sich miteinander verständigend«, gemeinsam den fundamentalen Ansprüchen der »Vernunftreligion« nicht mehr verschließen – obgleich Kant tatsächlich an der »eschatologischen« (?) Perspektive festhält, dass »zu guter Letzt« vollends »die Form einer Kirche selbst aufgelöset wird«72 und jene Formen des »Geschichtsglaubens« darin zugleich auch ihre »Erfüllung« finden.
Literaturverzeichnis Dörflinger, Bernd: »Eine neuere Religionsauffassung im Licht einer älteren. Habermas und Kant«, in: Langthaler, Rudolf/Meiller, Christopher/Appel, Kurt (Hg.): Religion in der Moderne. Religionsphilosophische Beiträge zu einer aktuellen Debatte. 70 Kant: IV. S. 802 (Anm.) (Hervorhebung v. Verf.). In diesem Sinne ist auch Kants Anregung bzw. Ermutigung zu verstehen, »dass der Geschichtsglaube, der als Kirchenglaube ein heiliges Buch zum Leitbande der Menschen bedarf, aber eben dadurch die Einheit und Allgemeinheit der Kirche verhindert, selbst aufhören und in einen reinen, für alle Welt gleich einleuchtenden Religionsglauben übergehen werde; wohin wir dann jetzt, durch anhaltende Entwickelung der reinen Vernunftreligion aus jener gegenwärtig noch nicht entbehrlichen Hülle, fleißig arbeiten sollen« (Kant: IV. S. 802, Anm.). 71 Kant: IV. S. 797. Solches »Gewühl« hatte Kant offenbar mit der programmatischen Ansage vor Augen, dass die »Religion endlich von allen empirischen Bestimmungsgründen, von allen Statuten, welche auf Geschichte beruhen, […] allmählich losgemacht werde, und so reine Vernunftreligion zuletzt über alle herrsche, ›damit Gott sei alles in allem‹« (Kant: IV. S. 785). 72 Kant: IV. S. 802.
130
Rudolf Langthaler
Göttingen 2013. S. 85 – 101 (Erstveröffentlichung in: Akten des XI. Internationalen Kant-Kongresses in Pisa, 22.–26. Mai 2010). Dörflinger, Bernd: »Kant zum Verhältnis von Staat und Religion«, in: Hoffmann, Bernd von (Hg.): Universalität der Menschenrechte. Kulturelle Pluralität. Frankfurt a. M. 2009. S. 69 – 82. Dörflinger, Bernd: »Kants Projekt der unsichtbaren Kirche als Aufgabe zukünftiger Aufklärung«, in: Klemme, Heiner F. (Hg.): Kant und die Zukunft der europäischen Aufklärung. Berlin 2009. S. 165 – 180. Dörflinger, Bernd: »Kant über moralische, juridische und religiöse Gesetze«, in: Zager, Werner (Hg.): Die Macht der Religion. Wie die Religionen die Politik beeinflussen. Neukirchen-Vluyn 2008. S. 99 – 119. Dörflinger, Bernd: »Offenbarung – nicht jedermanns Sache. Kants Kritik der historischen Religionen«, in: Dörflinger, Bernd/Krieger, Gerhard/Scheuer, Manfred (Hg.): Wozu Offenbarung. Zur philosophischen und theologischen Begründung von Religion. Paderborn 2006. S. 141 – 164. Dörflinger, Bernd: »Über den aufgeklärten Umgang mit Gottes Wort. Kant zur Auslegung ›heiliger‹ Schriften«, in: Bermes, Christian/Orth, Ernst W./Welsen, Peter (Hg.): Die Kultur des Textes. Studien zur Textualität. Würzburg 2009. S. 123 – 141. Finger, Evelyn/Polke-Majewski, Karsten (Red.): »Ohne Glauben ist kein Staat zu machen. Warum wir auf Religion als Wertreservoir nicht verzichten können. Ein Streitgespräch mit dem Bundestagsvizepräsidenten Wolfgang Thierse«, in: Die Zeit (49), 29. November 2012. S. 68. Große Kracht, Hermann-Josef: »Offene Fragen im Universum öffentlicher Gründe. Jürgen Habermas und die Öffentlichkeit der Religionen«, in: Wenzel, Knut/Schmidt, Thomas M. (Hg.): Moderne Religion? Theologische und religionsphilosophische Reaktionen auf Jürgen Habermas. Freiburg i. Br. 2009. S. 55 – 91. Habermas, Jürgen: »Ein neues Interesse der Philosophie an der Religion? Ein Gespräch«, in: ders.: Nachmetaphysisches Denken II. Aufsätze und Repliken. Frankfurt a. M. 2012. S. 96 – 119. Habermas, Jürgen: »Religion und nachmetaphysisches Denken. Eine Replik«, in: ders.: Nachmetaphysisches Denken II. Aufsätze und Repliken. Frankfurt a. M. 2012. S. 120 – 182. Habermas, Jürgen: »Religion in der Öffentlichkeit der ›postsäkularen‹ Gesellschaft«, in: ders.: Nachmetaphysisches Denken II. Aufsätze und Repliken. Frankfurt a. M. 2012. S. 308 – 327. Habermas, Jürgen: »Wie viel Religion verträgt der liberale Staat?«, in: Neue Zürcher Zeitung, 4. August 2012. S. 63, verfügbar unter : http://www.nzz.ch/aktuell/feuilleton/ literatur-und-kunst/wie-viel-religion-vertraegt-der-liberale-staat-1.17432314 [20. 12. 2012]. Habermas, Jürgen: »Die Revitalisierung der Weltreligionen – Herausforderung für ein säkulares Selbstverständnis der Moderne?«, in: ders.: Kritik der Vernunft. Philosophische Texte. Band 5. Frankfurt a. M. 2009. S. 387 – 407. Habermas, Jürgen: »Ein Bewusstsein von dem, was fehlt«, in: ders.: Kritik der Vernunft. Philosophische Texte. Band 5. Frankfurt a. M. 2009. S. 408 – 416. Habermas, Jürgen: »Religion in der Öffentlichkeit. Kognitive Voraussetzungen für den
Zu Bernd Dörflingers Kritik an Habermas’ Religionskonzeption
131
›öffentlichen Vernunftgebrauch‹ religiöser und säkularer Bürger«, in: ders.: Zwischen Naturalismus und Religion. Philosophische Aufsätze. Frankfurt a. M. 2005. S. 119 – 154. Habermas, Jürgen: »Kulturelle Gleichbehandlung – und die Grenzen des Postmodernen Liberalismus«, in: ders.: Zwischen Naturalismus und Religion. Philosophische Aufsätze. Frankfurt a. M. 2005. S. 279 – 323. Habermas, Jürgen/Derrida, Jacques: Philosophie in Zeiten des Terrors. Berlin/Wien 2004. Habermas, Jürgen: Glauben und Wissen. Friedenspreis des deutschen Buchhandels 2001. Frankfurt a. M. 2001. Joas, Hans: Braucht der Mensch Religion? Über Erfahrungen der Selbsttranszendenz. Freiburg i. Br. 2004. Kant, Immanuel: Gesammelte Schriften. Hg.: Band 1 – 22 Preußische Akademie der Wissenschaften, Band 23 Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin, ab Band 24 Akademie der Wissenschaften zu Göttingen. Berlin 1900 ff. Kant, Immanuel: Werke in sechs Bänden. Hrsg. von Wilhelm Weischedel. Wiesbaden 1956 ff. Schmidt, Thomas M.: »Nachmetaphysische Religionsphilosophie. Religion und Philosophie unter den Bedingungen diskursiver Vernunft«, in: Wenzel, Knut/Schmidt, Thomas M. (Hg.): Moderne Religion? Theologische und religionsphilosophische Reaktionen auf Jürgen Habermas. Freiburg i. Br. 2009. S. 10 – 32.
Hans-Joachim Höhn
Säkularisierungsresistent? Struktur und Relevanz eines religiösen Daseinsverhältnisses
Für die Frage, was Religion und Glaube der Vernunft und den Wissenschaften zu denken aufgeben, liefert die Gegenwart reichlich Material – sowohl hinsichtlich des Verschwindens als auch hinsichtlich des Fortbestandes des Religiösen in der Gesellschaft. Religion gehört einerseits zu jenen Beständen des Daseins, über die die Zeit hinweggeht. Andererseits scheint sie zu jenen Größen zu gehören, auf die man auf dem Weg in die Zukunft immer wieder Bezug nehmen muss. Zu dieser vermehrten Aufmerksamkeit nötigen keineswegs allein die aggressiven Formen des Fundamentalismus. Belangvoll für eine kritische Analyse der soziokulturellen Antreffbarkeit des Religiösen sind vielmehr auch Konstellationen, in denen gesellschaftlich produktive Momente vermutet werden. Unter dieser Rücksicht interessiert sich die Politik(wissenschaft) für die religiösen Quellen von Werten, die gegen die Fliehkräfte eines liberalistischen Individualismus aufzubieten sind. In der Ökonomie begegnet Religion als eine Ressource zur Bildung jenes Vertrauens, ohne das wirtschaftlicher Handel und Wandel nicht funktionieren können. Historiker entdecken neu, dass das kulturelle Gedächtnis einer Gesellschaft religiöse Erinnerungsarbeit nicht bloß als Sediment, sondern auch als Ferment betrachten kann. Soziobiologen machen darauf aufmerksam, dass Religiosität keine späte, kulturbedingte Pathologie darstellt, sondern sich in einem evolutiv erfolgreichen Anpassungs- und Selektionsvorgang als »fitnessmaximierend« erwiesen hat. Von vielen Soziologen ist die Kategorie der »Säkularisierung« als Schlüsselbegriff einer Gesellschaftstheorie der Moderne verabschiedet worden. Weder hat sich die Prognose eines modernisierungsbedingten Endes der Religion erfüllt noch scheint die in vielen westlichen Ländern beobachtbare Verdrängung der Religion ins soziale Abseits unumkehrbar zu sein. Offensichtlich muss die Annahme korrigiert werden, dass Modernisierungsprozesse unweigerlich mit einer Verabschiedung des Religiösen einhergehen. Vielmehr offenbaren sie eine eigene Ambivalenz und Dialektik, welche
134
Hans-Joachim Höhn
die Gleichsetzung von Moderne und Säkularisierung als kurzschlüssig erweisen.1
I.
Problemskizze: Religionsphilosophie postsäkular
Die Nachfrage nach dem religiösen »Anderen« der Vernunft nimmt zwar ab in dem Maße, wie die Vernunft (in Wissenschaft, Technik, Medizin) Modernisierungserfolge verzeichnen kann. Zugleich nimmt sie fast proportional zur Verunsicherung zu, welche die fortschrittsbedingten »Entgleisungen« (Jürgen Habermas) der Moderne auslösen.2 Sich solchermaßen »postsäkularen« Konstellationen verdankend, ist Religiosität vielfach kein Überbleibsel einer unaufgeklärten Vorzeit, »vielmehr, genau im Gegenteil, Produkt avancierter, sich selbst in Frage stellender Modernisierungen«.3 Aber reicht dieser Befund bereits aus, um eine Neukalibrierung des Verhältnisses zur Vernunft ins Spiel zu bringen? Lässt sich sogar eine modernisierungsbedingte Säkularisierungsresistenz des Religiösen konstatieren? Mit diesen Fragen rückt der Komplex »Religion« nicht bloß in den Horizont sozial- und kulturwissenschaftlicher Disziplinen. Auch die Philosophie ist gefragt, wenn es um die Überlegung geht, ob die Moderne tatsächlich Probleme erzeugt, mit denen vernunftgemäß umzugehen Thema und Rechtfertigung einer religiösen Einstellung zur Welt sein könnte. Ist deswegen die Vernunft aus rationalen Gründen dazu zu motivieren, sich für die Sache der Religion zu interessieren? Oder kann angesichts der ebenso unabweisbaren sozio-kulturellen Schadensbilanz der Religion ein philosophisches Interesse an ihr nur in die radikale Religionskritik führen? Ob man sich nun affirmativ oder kritisch zur Religion verhält, so wird in jedem Fall ein genuin philosophisches Verhältnis nur möglich sein, wenn man die Sache der Religion vom Standpunkt des Denkens her rekonstruiert. Wie man vor diesem Hintergrund auf ebenso zeit- wie sachgemäße Weise Vernunft und Religion in Beziehung setzen kann und auf welchem Weg die mögliche Säkularisierungsresistenz eines religiösen Weltverhältnisses rekonstruierbar wird, 1 Vgl. Bernius, Volker u. a. (Hg.): Religion und Gesellschaft. Zur Aktualität einer unbequemen Beziehung. Berlin 2010; Kemper, Peter u. a. (Hg.): Wozu Gott? Religion zwischen Fundamentalismus und Fortschritt. Frankfurt/Leipzig 2009. 2 Vgl. Höhn, Hans-Joachim: Postsäkular. Gesellschaft im Umbruch – Religion im Wandel. Paderborn/München/Wien/Zürich 2007. Der einleitend verwandte Religionsbegriff wird sukzessive präzisiert. Zunächst dient er als Indikator für die Spannweite von Thema und Gegenstand: von einer kulturellen Sphäre (»das Religiöse«) über die individuelle Disposition zur Einnahme einer spezifischen Einstellung zur Wirklichkeit (»Religiosität«) bis hin zur institutionellen Ausprägung bestimmter Traditionen und Glaubensgemeinschaften. 3 Beck, Ulrich: Der eigene Gott. Friedensfähigkeit und Gewaltpotential der Religionen. Frankfurt 2008. S. 114.
Säkularisierungsresistent?
135
markiert die zentrale Fragestellung der folgenden Überlegungen. Sie rühren auch an eine Kernaufgabe der Religionsphilosophie: die Vernunft daran zu erinnern, dass sie im Interesse ihrer eigenen Sache ein Interesse an der Sache der Religion entwickeln sollte. Allerdings bedarf es dazu eines Denkansatzes, von dem aus sowohl die Sache bewussten, rationalen Seins als auch Struktur und existenzielle Relevanz religiöser Vollzüge rekonstruiert werden können. Auf vernunftgemäße Weise sich für die Sache der Religion zu interessieren, schließt aus, dem Denken die Position und Perspektive des Glaubens zuzumuten. Ob das Religiöse ein möglicher Kandidat für das vernunftgemäße Andere der Vernunft sein kann, lässt sich nur vom Standpunkt der Vernunft aus entscheiden. Methodisch setzt hier das Projekt einer Existentialpragmatischen Religionsphilosophie ein, das eine Verklammerung von existentialen und transzendentalen Formbestimmungen menschlichen Daseins nach dem »linguistic turn« vornimmt.4 Zu diesem Zweck nimmt es Intentionen und Prinzipien der Transzendentalpragmatik Karl-Otto Apels auf, erinnert an die Anliegen der Existentialanalytik Martin Heideggers und lässt dabei Korrelationen zwischen den existentialen Konstellationen vernunftorientierter Welterschließung und den Parametern sprachvermittelter Handlungskoordination sichtbar werden. Seine Vorgehensweise richtet sich dabei nicht auf Voraussetzungen, die ein als einsam vorstellbares Vernunftsubjekt für seine Erkenntnis und Weltbegegnung unterstellen muss, sondern bezieht sie grundlegend und primär auf die transsubjektiven Konstitutionsbedingungen für das Zustandekommen sinnhafter Handlungen. Dabei wird nicht nur in Umrissen erkennbar, was die Sache der Vernunft ausmacht (II.). Freigelegt wird dabei auch das existenzielle Bezugsproblem einer religiösen Einstellung zu den von der Vernunft konfigurierten Daseinsverhältnissen: Religion kann verstanden werden als eine besondere Umgangsform mit den ebenso unvermeidlichen wie unverfügbaren »Umständen« menschlichen Daseins, die gerade von vernunftbasierten Umgangsformen mit den Limitationen des Daseins erhoben werden (III.). Diese Limitationen brechen auf in den Fragen: Ist ein Dasein letztlich zustimmungsfähig, das angesichts der Befristung menschlicher Lebenszeit, der Erschöpfbarkeit der Lebensressourcen, der Konkurrenz um ihre Nutzung und der Ungewissheit künftiger Lebenslagen keinen letzten Grund zum Ja-Sagen erkennen lässt? Kann man rational verantwortbar ein Dasein akzeptieren, wenn mit den Mitteln der Vernunft weder dem schicksalhaften Unglück beizukommen ist noch das machbare Glück befördert werden kann – und wenn die Vernunft um ihrer Rationalität und Moralität willen dennoch nicht davon ablassen darf, sich um die Herstellung von Daseinsakzeptanz zu mühen? Gibt es »transpragmatische« 4 Zu Grundlegung und Entfaltung dieses Ansatzes vgl. ausführlich Höhn, Hans-Joachim: Zeit und Sinn. Religionsphilosophie postsäkular. Paderborn/München/Wien/Zürich 2010.
136
Hans-Joachim Höhn
Gelingensbedingungen für die Akzeptanz des Daseins, die religiös codiert und dennoch rational rekonstruierbar sind (IV.)?
II.
Lebensverhältnisse: Existentialpragmatik als philosophische Basistheorie
Das Ziel einer »existential« angelegten Reflexion ist die Konstitutionsanalyse der unhintergehbaren Formen, Situationen und Konstellationen menschlichen Daseins, seiner Weltorientierung und Selbstverständigung, ohne die keine Sinnund Handlungsorientierung im Dasein möglich ist. »Pragmatisch« kann dieser Ansatz aufgrund seines Leitprinzips genannt werden, diese Konstitutiva zugleich als Parameter vernunftgeleiteter Welterschließung und sprachvermittelter Handlungskoordination zu identifizieren und sie als Existentiale eines via Sprache »vergesellschafteten«, relationalen Daseins auszuweisen. Fragt man derart nach den elementaren Strukturen und Vollzugsformen des Menschseins, so zeigt sich: Dasein heißt für den Menschen stets, ein sprachvermitteltes Verhältnis haben zu dem, was in der objektiven Gegenstandswelt bzw. Außenwelt (Natur) der Fall sein kann, was der Innenwelt, die einem Individuum bevorzugt zugänglich ist, zuzurechnen ist (Subjekt), was in der personalen Mitwelt zur Interaktion fähig ist (Gesellschaft) und was zeitlich datierbar ist, d. h. Ereignischarakter in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft besitzt (Zeit). Zwischen diesen Bezügen besteht ein Verhältnis der wechselseitigen Implikation. Sie sind voneinander nicht ableitbar und aufeinander nicht rückführbar ; sie sind miteinander unlösbar verknüpft und unverzichtbar füreinander. Relationalität ist hierbei nicht nur eine in methodischer Hinsicht zentrale Kategorie, sondern benennt auch die ontologische Struktur der Grundsituation menschlichen Daseins. Das Bei-sich-Sein eines Subjekts ist nicht ablösbar von seinem Bezogensein auf naturale und personale bzw. soziale Andersheit innerhalb eines bestimmten Zeithorizontes. In seinen praktischen Lebensvollzügen setzt sich der Mensch jeweils neu in ein spezifisches Verhältnis zu diesen elementaren Lebensbezügen. Dieses Verhältnis wird nach Maßgabe bestimmter Parameter gedeutet und gestaltet, die sich aus der limitativen Verfassung menschlicher Daseinsbezüge ergeben und jeweils die Endlichkeit menschlichen Daseins spiegeln: Die psycho-physisch-mentale Einmaligkeit, Unersetzbarkeit und Verletzlichkeit des Subjekts wird manifest im Gebundensein an einen Körper, dessen Zerfall das Ende des bewussten Lebens ankündigt und erzwingt. An ihm wird ablesbar, was ebenso für den Bezug zur naturalen Umwelt gilt: die Erschöpfbarkeit der Lebensressourcen. Um deren Nutzung entbrennt soziale
Säkularisierungsresistent?
137
Konkurrenz, deren Schärfe durch das Wissen um die Befristung der (Lebens) Zeit bzw. die Ungewissheit ihres Endes gesteigert wird. (siehe Abbildung 1)
Das Projekt der Vernunft ergibt sich aus dem Umstand, dass die Existentiale relationalen Daseins den Weltbezügen des Menschen Konturen geben, aber auch Grenzen setzen. Dasein heißt nämlich auch: sich am Limit bewegen, d. h. Umgehen mit den Grenzbestimmungen bewussten Seins (Verletzbarkeit, Ungewissheit, Konkurrenz, Knappheit). Die Sache der Vernunft besteht darin zu zeigen, wie man bestmöglich ans Limit geht. Dabei muss sie eine Kriteriologie entwickeln, welche das jeweilige Optimum bestimmbar macht, d. h. sie sucht nach der optimalen Formatierung von rationalen Umgangsformen mit den Limitationen des Daseins. Darauf drängen auch die elementaren handlungsleitenden Interessen des Vernunftsubjektes, das Grenzen nicht einfach hinzunehmen bereit ist, sondern nach Möglichkeiten sucht, ihren Charakter der Einschränkung weitest möglich aufzuheben. Sache der Vernunft ist es, diese Interessen jeweils für sich und ebenso als Ensemble so zu koordinieren, dass ein optimaler Umgang mit diesen Beschränkungen des Daseins möglich wird, und Vorkehrungen zu treffen, dass dieses Optimum auch rational ausweisbar ist. Dabei nimmt die Vernunft Maß am Nichtwiderspruchsprinzip, das den Grundsatz jeder Selbstgesetzgebung der Vernunft markiert.5 Ausgehend von seiner Elementarlogik lassen sich jene Rationalitätstypen und »Faustregeln« 5 Vgl. hierzu Schick, Stefan: Contradictio est regula veri. Die Grundsätze des Denkens in der formalen, transzendentalen und spekulativen Logik. Hamburg 2010.
138
Hans-Joachim Höhn
bestimmen, welche jeweils ein Muster des vernunftgeleiteten Ans-Limit-Gehens darstellen: (1) Prinzip der Non-Kontraproduktivität im Umgang mit der Knappheit von Ressourcen der sachhaften Umwelt (! Zweck/Mittel-Rationalität): »Handle so, dass auf Dauer der Aufwand nicht höher ist als der erwartete Nutzen, und achte darauf, dass die eingesetzten Mittel auf Dauer und im ganzen jene Zwecke nicht zerstören, zu deren Realisierung sie eingesetzt werden!« (2) Prinzip der Selbstreflexivität beim strategischen Verfolgen von Eigeninteressen angesichts begrenzter individueller Einflussmöglichkeiten (! strategisch-reflexive Rationalität): »Suche nach Deinem Vorteil, aber kalkuliere dabei ein, dass Du auch den Kürzeren ziehen kannst. Halte eine mögliche Niederlage in Grenzen, so dass Du Dich mit ihr abfinden kannst!« (3) Prinzip der Gegenseitigkeit beim Umgang mit knappen sozialen Gütern (! kommunikative Rationalität): »Wandle Konkurrenz in Kooperation um! Suche nach Arrangements der Interessenverfolgung, die zum allseitigen Vorteil der Beteiligten führen bzw. eine gerechte Teilhabe und Teilgabe ermöglichen!« (4) Prinzip der Nachhaltigkeit im Umgang mit den Limitationen und Modi der Zeit, d. h. im Blick auf a) die Unwiederholbarkeit des Vergangenen (! anamnetische Rationalität): »Lerne aus der Vergangenheit, begehe keinen Fehler doppelt!«; b) die Ungewissheit des Künftigen (! futurische Rationalität): »Versuche eine Abschätzung der Konsequenzen, Neben- und Fernwirkungen Deines Tuns und achte darauf, den Wert, den Du gerade realisieren willst, nicht auf Dauer und im Ganzen zu zerstören! Treibe keinen Raubbau!«; c) die Flüchtigkeit des Gegenwärtigen (! kairologische Rationalität): »Tue an jedem Tag, der Dir bleibt, wofür gerade dieser Tag hinsichtlich Deiner Pläne (die den Kriterien 1 bis 3 entsprechen) günstig ist! Erfasse die Gunst der Stunde und verschiebe die Realisierung Deiner Vorhaben nicht auf einen Tag, von dem Du nicht weißt, ob oder wann er kommt!« Den vernunftgemäßen Umgang mit diesen Rationalitätsformen eigens nachzuweisen ist Aufgabe und Funktion des diskursiven Rationalitätstyps. Hier wird die Faustregel ausgegeben: »Weise durch den zwanglosen Zwang des besseren Argumentes die Rationalität der jeweiligen Umgangsform mit den Limitationen des Daseins nach!« Da sich die vernunftgeleitete Optimierung von Daseinsverhältnissen und deren diskursive Legitimation stets innerhalb der existentialen Grundkonstellation menschlichen Daseins bewegt, ist sie selbst wiederum limitiert. Sie kommt an ihre Grenze in einem doppelten Sinn: zum einen hinsichtlich dessen, was man nicht hintergehen kann, und zum anderen hinsichtlich
Säkularisierungsresistent?
139
dessen, worüber man nicht hinauskommt. Eine »Horizonterweiterung« menschlichen Daseins ist zwar prinzipiell derart möglich, dass man die bis dato unverfügbaren Voraussetzungen menschlichen Handelns in Folgen menschlichen Tuns verwandelt. Aber auch diesem Bestreben ist ein Limit gesetzt. Die existentiale Grundkonstellation steht selbst nicht zur Disposition. Sie ist selbst nicht veränderbar oder erweiterbar. Veränderungen und Erweiterungen gibt es nur innerhalb dieser Konstellation.
III.
»Einstellungssache«: Religion in existentialpragmatischer Sicht
In religionsphilosophischer Hinsicht erweist sich die existentialpragmatische Reflexion auf den ersten Blick als wenig ergiebig. Denn im Kontext der rationalen Bezugnahme auf die Limitationen des Daseins wird nicht erkennbar, wo hier ein religiöser Vollzug geortet werden könnte oder welcher Gegenstandsbereich hierfür in Frage kommen könnte. Weder lässt sich auf der Ebene der Weltbezüge ein eigenes »Woraufhin« für einen religiösen Vollzug identifizieren, noch ist erkennbar, welche Funktion eine religiöse Bezugnahme auf diese Bezüge erfüllen könnte. Weder gibt es eine spezifische Limitation, auf die sich ein religiöser Bezug richten könnte, noch ist begründbar, dass oder warum er eine der anderen vernunftbestimmten Bezugnahmen ersetzen oder ergänzen könnte. Im Gegenteil: Wegen der Unüberbietbarkeit des NWS-Prinzips ist logisch ausgeschlossen, dass religiöse Vollzüge die Autonomie vernunftbasierter Weltdeutung und Weltgestaltung relativieren können. Somit ist auch nicht ersichtlich, wo in diesem Kontext für das Projekt der Religion ein existentielles Bezugsproblem identifiziert werden kann. Ebenfalls ist nicht erkennbar, wie hier ein heuristisch brauchbarer Religionsbegriff formuliert werden könnte. Denn für die definitorische Erfassung des Phänomens »Religion« bedarf es eines Zugangs, der sich im Blick auf seinen Gegenstandsbereich durch maximale Reichweite und durch maximale Trennschärfe auszeichnet. Was ein Phänomen als »religiös« qualifizierbar macht, muss derart bestimmt werden, dass dabei zumindest ein »Alleinstellungsmerkmal« der Bezugnahme auf ein existenzielles Bezugsproblem menschlicher Lebenspraxis benannt wird (d. h. Religion muss mit einem Spezifikum menschlicher Existenz zu tun haben, das der Selbstvergewisserung eines jeden Menschen zugänglich ist) und ebenso eine reflexive Einstellung zu diesem Problem auch für die Kritiker einer religiösen Lebenseinstellung ermöglicht
140
Hans-Joachim Höhn
wird.6 Die phänomenologisch ausgrenzbare Größe ›Religion‹ muss derart im Horizont menschlicher Weltorientierung und Lebensführung thematisiert werden können, dass sie von anderen Formen der Daseinsorientierung und -gestaltung hinreichend deutlich unterschieden werden kann (ohne dass nichtreligiöse Lebenseinstellungen als anthropologisch defizitär gekennzeichnet werden). Daher darf der Religionsbegriff nicht so ins Unbestimmte ausgedehnt werden, dass auch eine bewusst gewählte nicht-religiöse Lebensorientierung gleichwohl als »religiös« vereinnahmt wird. Wie jedes andere kulturelle Medium der Orientierung und Gestaltung des Daseins darf Religion zudem nicht mit dem Charakter des Zwingenden ausgestattet sein. Erfüllbar sind diese Bedingungen dann, wenn das Bezugsproblem religiöser Vollzüge anthropologisch basal ist, der religiösen Bezugnahme auf dieses Problem ein Proprium zukommt, diese Bezugnahme aber hinsichtlich ihrer Modalität nicht durch »Notwendigkeit«, sondern durch »Möglichkeit« bestimmt ist: Man muss religiös sein können, aber nicht religiös sein müssen. Dass man nicht religiös sein muss, hat bereits die existentialpragmatische Fehlanzeige hinsichtlich Gegenstandsbezug und Funktion religiöser Vollzüge ergeben. Aus einer Fehlanzeige wird aber unversehens ein Fehlschluss, wenn aus der Nicht-Notwendigkeit eines religiösen Vollzuges seine Unmöglichkeit oder Unverantwortbarkeit gefolgert wird. Denn es besteht die Möglichkeit, Funktion und Objektbereich religiöser Praktiken auf der Ebene der reflexiven Bezugnahme auf das Integral der menschlichen Lebensverhältnisse zu orten. Zwar ist unter den elementaren Daseinsbestimmungen des Menschen kein Bezugspunkt religiöser Vollzüge auszumachen. Kehrt man aber die Fragerichtung um, lässt sich durchaus eine Ortsbestimmung des »Religiösen« im Ganzen menschlicher Lebenspraxis vornehmen. Es bezieht sich nicht auf »etwas« oder »alles« im Leben, sondern auf das Leben in seiner Ganzheit. Anders formuliert: Religion zeigt sich als eine spezifische Einstellung zu Lebenseinstellungen, als eine besondere Umgangsform mit den Formen, mit den Limitationen des Daseins umzugehen. Religion erscheint in dieser Perspektive als eine spezifische Bezugnahme auf die existentiale Grundkonstellation menschlicher Lebenspraxis, ohne selbst zu den Bestimmungsmomenten dieser Grundsituation zu gehören. Sie hat mit existentialen Charakteristika menschlichen Daseins zu tun, ohne selbst ein solches Charakteristikum zu sein. Im Unterschied zu den vernunftbasierten Lebenseinstellungen, deren Maß das Integral der weltimmanenten Lebensbedingungen und ihrer Limitationen 6 Zu den Anforderungen an einen religionsphilosophisch plausiblen und interreligiös einsetzbaren Religionsbegriff vgl. auch Schrödter, Hermann/Ebeling, Klaus: »Nach-Denken über ›Religion‹«, in: Ebeling, Klaus (Hg.): Orientierung Weltreligionen. Stuttgart 22011. S. 193 – 204.
Säkularisierungsresistent?
141
bildet, lässt sich als »religiös« näherhin eine solche Einstellung zu den menschlichen Lebensverhältnissen bezeichnen, welche diese Lebensverhältnisse auf das bezieht, was den Menschen unausweichlich betrifft, und die sich zugleich über dieses Unausweichliche »hinwegsetzt« bzw. dieses Unausweichliche »transzendiert«. Zu diesem Unausweichlichen gehört zunächst die Relationalität der existentialen Grundsituation selbst. Sie ist für jeden menschlichen Vollzug unabstreifbar. Jedes Ereignis, jedes Wollen und Tun kann nur innerhalb dieses Gefüges realisiert werden. Unabstreifbar sind ebenfalls die »limitativen« Merkmale dieser Grundsituation, d. h. die psycho-physische Endlichkeit und Bedingtheit des Subjekts, die Erschöpfbarkeit der Lebensressourcen, die Konkurrenz um deren Nutzung sowie die Befristung der (Lebens)Zeit bzw. die Ungewissheit ihres Endes. Dieses Unausweichliche zu transzendieren kann jedoch nicht heißen, diese Grundsituation auf eine »jenseits« von ihr zu ortende Wirklichkeit zu überschreiten. Die Unhintergehbarkeit und Unüberschreitbarkeit der existentialen Grundsituation lässt nicht zu, jenseits ihrer selbst einen weiteren »Wirklichkeitsbereich« anzunehmen, auf den sich der religiöse Mensch bezieht. Angesichts der Unhintergehbarkeit der existentialen Grundsituation wäre dies ein »vorhandenheitsontologisches« Missverständnis des Gegenstandes und der Bedeutung religiöser Vollzüge. »Transzendieren« kann in existentialpragmatischer Sicht für ein Subjekt lediglich bedeuten, sich zu dem Unausweichlichen seiner Existenz in ein Verhältnis zu setzen, das es ermöglicht, im Modus der Bestreitung mit seinen Limitationen zu leben und sich widerständig gegen sie zu behaupten. Sie werden anerkannt als etwas, das unausweichlich über alles im Leben verhängt ist, das nicht zu umgehen und dem nicht zu entrinnen ist. Und zugleich wird bestritten, dass sie in ihrer Unabwendbarkeit für alles, was im Leben geschieht, auch darüber bestimmen, was es letztlich mit dem Leben auf sich hat. Soll dieses Überschreiten etwas genuin Religiöses darstellen, muss gezeigt werden können, dass das, was als Gegenstand und Thema religiösen Transzendierens behauptet wird, einer Aufhebung in die zweckrationalen, strategischen, kommunikativen, temporalen und diskursiven Umgangsformen mit Daseinslimitationen widerstreitet. Weder kann eine religiöse Einstellung von ihnen ersetzt noch überboten werden. Es müsste somit deutlich werden, dass sich das, was als »religiöse« Einstellung zu Daseinsverhältnissen und zu anderen Bezugnahmen auf diese Verhältnisse behauptet wird, nicht unverkürzt in instrumentelle, strategische, kommunikative, temporale oder diskursive Einstellungen überführen lässt. Diese Bedingungen erfüllt ein (religiöses) Verhältnis zu menschlichen Lebensverhältnissen (und deren Deutung), sofern es dabei nicht Bezug nimmt auf etwas im Leben, zu dem man ein Verhältnis aufbauen kann, sondern nach einem Verhältnis zum Leben in seiner Ganzheit sucht. Genuin religiös ist die Thema-
142
Hans-Joachim Höhn
tisierung dieser Ganzheit, wenn sie sich im Format der auch in der Moderne unabgegoltenen »ersten« und »letzten« Fragen nach den Möglichkeiten einer Welt- und Daseinsakzeptanz angesichts des Inakzeptablen artikuliert: Ist ein Dasein letztlich zustimmungsfähig, das angesichts der Befristung menschlicher Lebenszeit, der Erschöpfbarkeit der Lebensressourcen, der Konkurrenz um ihre Nutzung und der Ungewissheit künftiger Lebenslagen keinen letzten Grund zum Ja-Sagen erkennen lässt? Ist ein Leben letztlich akzeptabel, wenn alle (daseinsimmanenten) Versuche zur Herstellung dieser Akzeptanz am Ende nur deren Fraglichkeit hervortreiben? Denn wie ist eine Welt zu bejahen, in der man sich nur insoweit die Chance sichert, etwas vom Leben zu haben, dass man sich als Konkurrent gegenüber anderen durchsetzt und sich am Ende doch nur den Tod holen wird? Wie kann jemand zu sich selbst stehen, wenn es in einer endlichen und vergänglichen Welt nichts Beständiges gibt, auf das letztlich Verlass ist und einen Menschen Stand im Unbeständigen gewinnen lässt? Kann man sich selbst annehmen in einem Kontext, der seinerseits unannehmbar ist? Diese Fragen beziehen sich nicht auf etwas in der Welt, sondern auf das Inder-Welt-Sein des Fragenden und auf die Verhältnisse, in denen er bisher sein Leben geführt hat. Die Beschäftigung mit diesen Fragen markiert aber noch nicht hinreichend deutlich das gesuchte Alleinstellungsmerkmal religiöser Vollzüge. Zusätzlich müssen Genese und Geltungsanspruch ihrer Thematisierung von Daseinsakzeptanz bedacht werden. Auf diese Momente stößt man, wenn man jene Umstände und Ereignisse im Leben betrachtet, die in einer säkularen Welt »befremden«, weil sie sich die autonome Vernunft mit ihren eigenen Mitteln nicht verstehbar und handhabbar machen kann. Dazu gehört jenes, was sich gegen das Kalkül der Zweck/Mittel-Rationalität als unverzweckbar oder als untauglich für jede Form der Instrumentalisierung behauptet (weil es ein Malum ist und seine Verwendung nur negative Konsequenzen hat), was indifferent gegenüber einer Optimierungs- und Maximierungsstrategie bleibt (weil es ein Bonum ist, das weder verbessert noch jemals wieder schlecht gemacht werden kann), was sich nicht mit der Logik des aufgeklärten Selbstinteresses oder des gegenseitigen Vorteils vereinbaren lässt (weil es etwas schicksalhaft Unvermeidliches, Tragisches, Kontraintentionales ist, das man sich selbst als Auslöser solchen Geschehens nicht verzeihen kann und wofür man von anderen keine Vergebung zu erlangen vermag), was temporal nicht datierbar ist (weil es ein »Verhängnis« ist, das niemals anfing und nie aufhört, d. h. so alt ist wie die Welt). Das solchermaßen Befremdliche zeigt sich nicht zuletzt dort, wo die Moral am Ende ist und die Grenzen der Moral sichtbar werden: Wie steht es um Schuld, die nicht getilgt werden kann? Darf man sich mit Unrecht abfinden, für das es keine Abfindung, keine Schadensregulierung, keine Wiedergutmachung gibt? Wo die Vernunft mit dem solchermaßen Unbegreiflichen, Unverfügbaren und
Säkularisierungsresistent?
143
Unheimlichen zu tun bekommt, wofür sie selbst keine zureichenden vernunftgemäßen Umgangsformen entwickeln kann, wird sie nicht nur verstehen wollen, was das Unverständliche, weil rational Unübersetzbare am derart »Befremdlichen« ausmacht.7 Vielmehr muss sie auch an der Frage interessiert sein, ob es »diesseits« und »jenseits« der Vernunft sinnvolle und zumutbare Einstellungen zum Befremdlichen zu entdecken gibt. Zur Sache der Religion gehört genau dies: sinnvolle Bezugnahmen auf das in Vernunftverhältnisse Unübersetzbare auszubilden. Unübersetzbar in Vernunftverhältnisse ist nicht nur, was jeweils für sich das Unannehmbare am Inakzeptablen (d. h. das Bösartige des Bösen, das Leidvolle am Leiden) und die Annehmbarkeit des Akzeptablen (d. h. das Beglückende des Glücks) ausmacht, sondern auch das angesichts des Widerstreits zwischen Unannehmbaren und Akzeptablen, zwischen dem Bösartigem und Beglückendem gesuchte Verhältnis zum Dasein, in dem trotz des kategorisch Inakzeptablen eine Zustimmung zum Dasein erfolgt.8 In der Thematisierung dieses Widerstreites geht es dem religiösen Denken um die Gelingensbedingungen, Mittel und Wege einer kontrafaktischen Selbst- und Weltakzeptanz. Der religiöse Grundvollzug artikuliert demnach den fragenden und hoffenden Ausgriff nach Gründen, das Leben allen Limitationen und allem Befremdlichen zum Trotz für letztlich zustimmungsfähig zu halten. Als säkularisierungsresistent erscheinen in existentialpragmatischer Sicht somit allein das Bezugsproblem der Daseinsakzeptanz angesichts des Inakzeptablen, nicht aber die historisch kontingenten und kulturell variablen Formen seiner Bearbeitung. Von Entmythologisierungs- und Säkularisierungsprozessen sind die materialen Formatierungen von Religiosität betroffen, nicht aber das sie konstituierende Problem der Daseinsakzeptanz. Dass in der Moderne die strukturellen Bedingungen für das Entstehen von Fragen, die traditionell religiös beantwortet wurden, unvermindert erhalten bleiben, schließt somit weder das Verschwinden bestimmter materialer religiöser Formatierungen eines existenziellen Verhältnisses zu diesen Fragen aus, noch verhindert es die Wiederkehr anachronistischer religiöser Antworten (z. B. in Gestalt kreationistischer Welterklärungen).
7 Vgl. Waldenfels, Bernhard: Grundmotive einer Phänomenologie des Fremden. Frankfurt 2006. 8 Zur näheren Kennzeichnung dieses Widerstreits siehe auch Wolf, Jean-Claude: Das Böse. Berlin/Boston 2011.
144
IV.
Hans-Joachim Höhn
Grundlosigkeit und Zweckfreiheit: Bedingungen religiöser Sinnkonstitution
Religiöses Denken steht insofern kritisch zur säkularen Vernunft, als es bestreitet, dass Daseinsakzeptanz alleiniges Ergebnis vernunftbasierter Daseinsgestaltung sein kann und im Kosten/Nutzen-Kalkül, in Strategien der Interessendurchsetzung, im Modell wechselseitigen Vorteils oder im Leitbild des befristeten Glücks bzw. der seriellen Anordnung von Glücksepisoden abbildbar ist. Der Modus der Bestreitung definiert aber auch vielfach das Verhältnis zur Religion in der Moderne. So unstrittig das Problem der Daseinsakzeptanz angesichts des Inakzeptablen sein mag, so strittig ist wiederum die behauptete Zuständigkeit der Religion für ihre Bearbeitung. Welche Bedingungen erfüllt sein müssen, um das Dasein akzeptieren zu können, kann auch ein religionsloser oder »religiös unmusikalischer« Mensch fragen. Ein solcher Zeitgenosse kommt schnell dahinter, dass es zum Zweck der Daseinsakzeptanz vor allem der energischen Weltverbesserung bedarf. Seine Devise lautet: Wenn die Welt von sich aus noch nicht akzeptabel ist, so kann man diesem Mangel abhelfen durch menschliches Zutun. Es ist eine Frage der richtigen Praxis, ob und dass entsprechende Weltverbesserungen zu Weltakzeptanzsteigerungen führen. Daseinsakzeptanz ist hier eine noch ausstehende Folge menschlichen Handelns, mit der das Dasein zu einem guten Ende kommt. Ob die als Frage nach Daseinsakzeptanz verstandene existenzielle »Sinnfrage« eine Antwort erhält, ist demnach auch nur eine Frage der Zeit: Sinn hat, was gut ausgeht und ein gutes Ende findet – zumindest ein Ende, mit dem der Mensch einverstanden sein kann. Und dieser gute Ausgang muss letztlich eine Folge menschlicher Praxis sein: »Handle so, dass Du angesichts des Todes sagen kannst, das Beste aus Deinem Leben gemacht zu haben!« Dieser Imperativ passt zum säkularen Projekt der Moderne, aus den Umständen des Daseins, die dem Menschen bisher unverfügbar waren, Folgen seines Tuns zu machen, die er steuern und beherrschen kann. Im Rahmen des Verfügbaren kann er sein Dasein dann so gestalten, dass es ihm am Ende derart zusagt, dass er es gut findet. Allerdings weist diese Zuordnung von Zeit und Sinn eine prekäre Zuordnung von Sinn und Handeln auf. Die Bedingungen der Daseinsakzeptanz finden sich nicht allein und exklusiv bei den positiven Konsequenzen menschlicher Praxis. Sie sind ebenso auf Seiten der unverfügbaren Vorgaben menschlichen Tuns zu suchen. Vernünftigerweise ist das Verbesserungsbedürftige auf Dauer nur zustimmungsfähig, wenn Grund zu der Annahme besteht, durch eigenes Engagement lasse sich die Kluft zwischen dem Akzeptablen und dem Unannehmbaren verringern. Dies gilt auch für die Frage der Welt- und Daseinsakzeptanz. Hier muss jeder Wille, durch Veränderung der
Säkularisierungsresistent?
145
Weltverhältnisse die Welt akzeptabler zu machen, davon ausgehen, dass die Welt nicht von vornherein etwas unaufhebbar Misslungenes darstellt. Denn wer etwas zum Besseren verändern möchte, wird es für besser halten, etwas zum Besseren zu verändern, als es bleiben zu lassen. Es kommt hierbei aber nicht alles auf das Tun des Menschen an. Die Welt muss von sich aus wenigstens Akzeptanzsteigerungen ermöglichen und einen Anhalt dafür bieten, sie annehmbar zu machen. Daseinsakzeptanz bemisst sich darum auch nach den Ausgangsbedingungen des Daseins: »Fang nur mit dem etwas an, dessen Start- bzw. Ausgangsbedingungen ein gutes Ende nicht a priori verhindern!« Verbesserbar ist somit nur dasjenige, das bereits »im Ansatz« unterscheidbar ist von einem Fehlschlag. Aber das reicht noch nicht. Im Fall der Daseinsakzeptanz müsste die Welt auch die Überzeugung als berechtigt erweisen, es sei besser sie zu verbessern, als es zu unterlassen. Nur dann zeigt sich, dass sie nicht nur Verbesserungen braucht und ermöglicht, sondern dieses Aufhebens auch wert ist. Es könnte ja auch sein, dass sie letztlich »unverbesserlich« bleibt. Die Welt muss per se wenigstens so »gut« sein, dass sie es wert ist verbessert zu werden. Wenn die Welt etwas unaufhebbar Misslungenes darstellt, kann man sich jede Mühe der Weltverbesserung sparen. Wer an der Möglichkeit der Daseinsakzeptanz festhält, muss dafür eine »transpragmatische« Voraussetzung unterstellen: Das Ziel menschlichen Bemühens um ein sinnvolles Dasein muss von dessen Ursprung her ermöglicht sein und verweist insofern auf eine Bedingung bzw. »Umstandsbestimmung« von Sein und Handeln, die allem menschlichen Tun vorausgeht. Nur ein Dasein, das nicht per se absurd ist, sondern zustimmungsfähig und zustimmungswürdig, macht das Projekt der (kontrafaktischen) Daseinsannahme und Daseinsoptimierung vertretbar. Wie aber steht es um die Berechtigung, von dieser Voraussetzung auszugehen? Weist nicht jeder Versuch, etwas über den Sinn und Wert des Lebens im Ganzen zu sagen, eine »Deckungslücke« auf ? Wenn das Gesuchte am Leben als dasjenige aufscheint, was in ihm fehlt, dann ist am und im Leben nichts ablesbar, das diese Lücke schließen könnte. In dieser Situation darauf zu verzichten, über die Problematik der Daseinsakzeptanz weiter nachzudenken, stellt keine Lösung, sondern einen Beweis beträchtlicher Denkfaulheit dar. Es mag sein, dass von einem szientistischen Naturalismus, der die neueren Ergebnisse der Bio- und Neurowissenschaften in einem naturalistischen Weltbild aufbereitet, die Berechtigung jener »metaphysischen« Aussagen kategorisch bestritten wird, die für Mensch und Welt ein letztes, sinnstiftendes »Woher« oder »Wohin« ihres Daseins vorsahen.9 Vielleicht trifft sogar die gegenteilige Annahme zu: »Das Universum, das wir be9 Vgl. etwa Wuketits, Franz Manfred: Darwins Kosmos. Sinnvolles Leben in einer sinnlosen Welt. Aschaffenburg 2009.
146
Hans-Joachim Höhn
obachten, hat genau die Eigenschaften, die man erwarten kann, wenn dahinter kein Plan, keine Absicht, kein Gut oder Böse steht, sondern nichts als blinde, erbarmungslose Gleichgültigkeit.«10 Es kann aber ebenso sein, dass gerade mit der Beschreibung der Grundlosigkeit und Zweckfreiheit menschlichen Daseins die Bestimmung zweier elementarer Bedingungen von Daseinsakzeptanz verknüpft ist. Dies ist dann der Fall, wenn sich zeigen lässt, dass anders nicht eine Kompatibilität zwischen der Welt der Handlungsziele und der Welt der Handlungsvoraussetzungen gedacht werden kann: Die Herstellung von Daseinsakzeptanz (auf dem Wege der Verbesserung menschlicher Lebensverhältnisse) ist eine unabweisliche Aufgabe der Vernunft.11 An dieser Aufgabe droht sie jedoch unvermeidlich zu scheitern, wenn die kontrafaktischen Bedingungen und Umstände dieser Praxis nicht in die beabsichtigten Folgen der »Weltverbesserung« überführt werden können. Ist aber das Kontrafaktische ein zureichender Grund, sich nicht um Daseinsakzeptanz zu bemühen? Oder ist es eher ein Ansporn, nach einer Neukalibrierung der Vernunft zu suchen, die sie davor bewahrt vor der Erfüllung der von ihr selbst gestellten Aufgabe zu resignieren?12 Wenn etwas allein mit der Vernunft nicht möglich ist, aber auch nicht ohne sie, dann bleibt nur die Möglichkeit – im Blick auf ein vernunftgemäßes Anderes der Vernunft – die Vernunft in ein Verhältnis zu ihrer eigenen Sache zu setzen, das ihr ermöglicht kontrafaktisch bei ihrer Sache zu bleiben. Vor diesem Hintergrund kann der religiöse Grundvollzug als vernunftkompatibler Ausgriff nach einem »Sinnapriori« der Daseinsakzeptanz betrachtet werden. Dieser Ausgriff versucht im Modus der Frage, das Vorfindliche zu »übersteigen« und
10 Dawkins, Richard: River out of Eden. A Darwinian View of Life. New York 1995. S. 113. (dt. Übersetzung nach Becker, Patrick: Kein Platz für Gott? Theologie im Zeitalter der Naturwissenschaften. Regensburg 2009. S. 51.) 11 Vernunftgemäß und zustimmungsfähig ist nach den Forderungen der praktischen Vernunft (im Sinne Immanuel Kants) ein Dasein, in dem alle Menschen als Wesen existieren, die ihre eigenen Zwecke frei und vernünftig setzen können. Im Handeln gemäß dem »moralischen Gesetz« muss daher ein weiterer Handlungszweck darin liegen, ein »Reich der Zwecke« zu gründen, d. h. »ein Ganzes aller Zwecke (sowohl der vernünftigen Wesen als Zwecke an sich, als auch der eigenen Zwecke, die ein jeder sich selbst setzen mag) in systematischer Verknüpfung« (GMS 433; BA 75). Dieses »Reich der Zwecke« ist letztlich der Rahmen für das Streben nach der Herstellung von Lebensverhältnissen, mit denen für alle Vernunftsubjekte auf best- und größtmögliche Weise das Ziel der Daseinsakzeptanz verbunden ist. Innerhalb dieses Rahmens ist es möglich, dass sowohl jedes Vernunftwesen als Zweck an sich selbst behandelt wird als auch, dass jedes Vernunftsubjekt eigene vernunftgemäße Zwecke jeweils für sich verfolgt. Hört der Mensch auf, lediglich Mittel zum Erreichen von Zwecken zu sein, wozu auch die Zwecke der Evolution gehören, ist erst ein unverzwecktes Dasein möglich, das weitaus annehmbarer ist als ein Leben, das von Zwecken bestimmt wird, die sich der Mensch nicht selbst gesetzt hat. Auf ein solches Ziel hin zu wirken, ist Sache der (praktischen) Vernunft. 12 Vgl. hierzu ausführlicher Höhn: Zeit und Sinn. S. 47 – 54, S. 198 – 210.
Säkularisierungsresistent?
147
dabei »zurückzusteigen« zu den Bedingungen der Möglichkeit eines zustimmungsfähigen Daseins. Wer derart nach einem »Sinnapriori« d. h. dem Rechtfertigungs- und Ermöglichungsgrund für die Zustimmungsfähigkeit des Daseins angesichts des Inakzeptablen fragt, setzt keinen Akt, der der Vernunft widerspricht. Vielmehr stellt er sich einem Konsistenzproblem zwischen dem theoretischen und praktischen Vernunftgebrauch: Die praktische Vernunft insistiert auf Maßnahmen der Weltverbesserung als Bedingung der Daseinsakzeptanz. Angesichts einer unaufhebbar inakzeptablen Welt müsste der kategorische Imperativ zur Herstellung einer ›menschlichen Welt‹ bereits im Ansatz kollabieren. Die theoretische Vernunft dementiert, dass ersichtlich ist, ob und warum die Welt es wert ist verbessert zu werden. Sie stützt damit die Position, die in der Tatsache, dass mit der Vernunft nachweislich nicht erhoben werden kann, ob es etwas mit der Welt (an Sinn und Wert) auf sich hat, ein starkes Indiz sieht, dass es mit der Welt nichts auf sich hat. Wählt man für die Deutung dieser »Grundlosigkeit« menschlichen Daseins eine derart »nihilistische« Perspektive, bleibt die Vernunft gefangen in einer Zerreißprobe: Weder darf aus Vernunftgründen im Interesse des Menschen an einer Welt- und Selbstakzeptanz das Gebot der Weltverbesserung relativiert werden, noch darf aus Vernunftgründen das Faktum der Nichtausweisbarkeit des Sinnaprioris eines solchen Unternehmens ignoriert werden. Eine Neukalibrierung der Vernunft, welche diesen Widerstreit überwindet, wird hingegen möglich, wenn sie mit guten Gründen das religiöse Sinnapriori einer »wohltuenden«, weil existenz-, identitäts- und autonomiekonstitutiven Grundlosigkeit menschlichen Daseins als ein Vernunftpostulat aufnehmen kann. Vernunftpostulate benennen, was nötig ist, wenn eine Zerreißprobe des theoretischen und praktischen Vernunftgebrauchs aufgehoben werden soll, weil andernfalls die Sache der Vernunft im Ganzen konterkariert wird. Aber die Vernunft kann sich der Realität dessen, was sie einfordert, nicht anders vergewissern als durch den Aufweis, dass dieses Postulat die Bedingung benennt, unter der die Sache der Vernunft auf Dauer auch unter widrigsten Umständen verfolgt werden kann.13 13 Postulate stellen nach Kant für ein endliches Vernunftwesen praktisch-notwendige, unbedingte, d. h. kategorische Forderungen aus dem Sittengesetz dar, das sich in der Form eines Sollensanspruchs auf den freien Willen des Vernunftsubjekts bezieht. Sie basieren somit auf dem Grundsatz der Moralität, der selbst kein Postulat, sondern ein normatives Faktum der Vernunft ist. Ein Postulat hat die Form eines Satzes der theoretischen Vernunft, ist seinem Inhalt nach aber nicht als ein solcher erweislich, sofern dieser »einem a priori unbedingt geltenden praktischen Gesetze unzertrennlich anhängt« (KpV A 220). Er ist der Form nach objektiv notwendig und enthält der Sache nach die (Voraus)Setzung einer Wirklichkeit, die als Bedingung der Möglichkeit zur Verwirklichung eines »höchsten Gutes« und zur Befolgung des »Sittengesetzes« überhaupt (KpVA 244) anzusehen ist. Die Basis dieser Überlegung
148
Hans-Joachim Höhn
Die Wortverbindung »wohltuende Grundlosigkeit« erscheint auf den ersten Blick widersprüchlich. Wer bei der Frage nach dem Grund des Daseins auf den Sachverhalt der Grundlosigkeit stößt und diesen als »wohltuend« ausgibt, löst meist Protest aus. Hier wird anscheinend zusammengebracht, was nicht zusammengehört. Mit »Grundlosigkeit« assoziiert man zunächst Willkür und Beliebigkeit – also jenes, was Wert und Sinn untergräbt, anstatt beides zu ermöglichen. Wer sich aber von dieser Fixierung befreit, dem geht eine Alternative auf. Aus einer Akteursperspektive heißt etwas grundlos zu tun auch: keine Hintergedanken und Nebenabsichten zu hegen, sondern etwas um seiner selbst willen zu wollen. Nicht immer ist das Vorhandensein von Gründen und Zwecken eine notwendige Sinnbedingung menschlichen Tuns und oder Qualitätsausweis seines Wollens. Das Gut-Sein des Daseins muss nicht darin liegen, dass es ein geeignetes Mittel für das Erreichen weiterer Ziele ist. Wenn das Dasein seinen Zweck in sich selbst trägt, ist diese Art der Zweckfreiheit sogar eine Voraussetzung für die freie Akzeptanz des In-der-Welt-Seins. Das eigene Dasein lässt sich für den Menschen gerade dann als akzeptabel erscheinen, wenn und weil es allen Zweckund Nutzenbestimmungen enthoben ist. Ein Leben, das man führen muss, um Zwecke zu erfüllen, die andere gesetzt haben, widerstreitet dem Autonomiegedanken, d. h. dem Anspruch der Selbstverwirklichung, Selbstgesetzgebung und Selbstverantwortung. Und ein Leben, das im Zeichen der Heteronomie steht, ist schwerlich aus freien Stücken akzeptabel. Anders verhält es sich, wenn der Mensch das voraussetzungs- und bedingungslose Freigelassensein ins eigene Dasein als Freiheit und Identität konstituierendes Unterschiedensein vom Nichtsein erleben und deuten kann. Die existenzielle Grunderfahrung, dass sich das Dasein einer Unterscheidung zwischen Sein und Nichts zugunsten des Seins verdankt, widerspricht der Auffassung, dass der Mensch die Vorzugswürdigkeit seines Daseins (gegenüber dem Nichtsein) und Zustimmungsfähigkeit dieses Daseins immer erst »nachträglich« ist bei Kant die Evidenz des Sittengesetzes (KpVA 81 f.). Der Anspruch dieses Sollens bezieht sich indessen auf ein Wirklichsein: Das Gute soll in Raum und Zeit realisiert werden. Diese Realisierung des Guten soll wiederum ein Vollzug von Vernunft und Freiheit sein. Es sollen ja nicht einfachhin bestimmte Fakten geschaffen werden, sondern bestimmte Taten als Verwirklichung eines vom Sittengesetz bestimmten Wollens. Gleichwohl ist dies nicht eine alleinige Angelegenheit der praktischen Vernunft. Um das Gute zu tun, genügt es nicht dieses Gute zu wollen, man muss auch wissen, was und wie jeweils in Raum und Zeit zu agieren ist, um das Gute zu realisieren. Wie nun die »Gesetzgebungen« der theoretischen und praktischen Vernunft zusammenstimmen können, wenn die äußeren Umstände dies zunächst prinzipiell und faktisch als unmöglich erscheinen lassen, ist eine Leitfrage der Postulatenlehre. Zu ihrer Deutung vgl. eingehender Langthaler, Rudolf: »›Gott ist doch kein Wahn‹ (Kant)«, in: Wasmeier-Sailer, Margit/Göcke, Benedikt Paul (Hg.): Idealismus und natürliche Theologie. Freiburg/München 2011. S. 49 – 80. (Lit.)
Säkularisierungsresistent?
149
durch eigene Anstrengungen nachweisen müsse. An ihre Stelle tritt die ebenso grundlose wie wohltuende Unterscheidung von Sein und Nichts, die gerade keine Zweck-, Nutzen- und Zielbestimmungen aufweist. Wer dagegen nach anderen Bedingungen, Gründen und Zweckbestimmungen für ein frei akzeptables Dasein fragt, verkennt, dass dessen »Grundlosigkeit« gerade die Grundlage seiner Autonomie und seines Eigenwertes ist. Die religiöse Rede von einer »creatio ex nihilo« bildet eben jenen Sachverhalt ab und leitet daraus eine materiale Akzeptanzbestimmung des Daseins ab: Jemanden aus dem Nichts und »wegen nichts«, d. h. grundlos ins Leben zu rufen und am Leben zu erhalten, ist identisch mit dem Vollzug einer unbedingten Bejahung. Wer jemanden unbedingt bejaht, will nichts von ihm oder ihr, sondern für ihn und sie: dass er und sie ist, dass er/sie frei ist und sich selbst zu eigen ist. Ein de facto objektiv richtungs-, funktions-, zweck- und bedeutungsloses Dasein ist dann kontrafaktisch bejahbar im Horizont eines unbedingten Bejahtseins – als Folge eines »grundlosen« Unterschiedenseins vom eigenen Nichtsein. Zwar ist es der Vernunft nicht möglich darüber zu befinden, ob die Voraussetzung dieser materialen Akzeptanzbestimmung tatsächlich erfüllt ist, und sie wird diesen Gedanken wiederum als Sinnpostulat einstufen. Interessant aber ist die Logik und Struktur dieses Postulates: Die schöpfungstheologische Verknüpfung des existenziellen Bezugsproblems eines religiösen Verhältnisses zu den Lebensverhältnissen und -einstellungen des Menschen mit einer materialen Formatierung dieses Verhältnisses läuft darauf hinaus, dass sie ebenso wie naturalistische Positionen die Letztbestimmung menschlicher Existenz in der Grundlosigkeit des Daseins sieht, aber dieser Grundlosigkeit eine anti-nihilistische Lesart geben kann. In einem christlich-religiösen Verhältnis zu den Daseinsverhältnissen wird die Grundlosigkeit des Daseins als Sinnbedingung von Freiheit und Würde bzw. als prä-funktionale Voraussetzung aller zweckorientierten, funktionalen Gestaltungen menschlicher Lebensverhältnisse bestimmt. Aus existentialpragmatischer Sicht entspricht dies einer »transpragmatischen« Akzeptanzbedingung des Daseins: Grundlos am Leben (gelassen) zu sein bedeutet, dass das menschliche Dasein bedeutungslos ist, d. h. es hat keine Bedeutung in dem Sinne, dass es etwas abbildet, an- oder bedeutet und für etwas steht, das es nicht selbst ist. Es ist als grundloses zugleich zwecklos in dem Sinne, dass es nicht als Mittel zum Erreichen eines Zwecks herhalten kann. Aber gerade diese Grundlosigkeit erweist sich in einem zweiten Hinblick als »wohltuend«. Allein ein Dasein, das allen Zweck- und Nutzenbestimmungen enthoben ist, an dessen Seinkönnen keine Vor- oder Nachbedingungen gestellt werden, das nicht als Emanation, Funktion oder Platzhalter einer anderen Größe begegnet, ist sich wirklich selbst ganz gegeben, frei überantwortet und kann Zweck an sich selbst sein, sich als Zweck an sich selbst anerkennen und in Freiheit selbstgesetzte
150
Hans-Joachim Höhn
Zwecke verfolgen. Grundlos und zweckfrei existieren zu können, ist mithin das Erste und Beste, was dem Menschen widerfahren kann.
Literaturverzeichnis Beck, Ulrich: Der eigene Gott. Friedensfähigkeit und Gewaltpotential der Religionen. Frankfurt 2008. Becker, Patrick: Kein Platz für Gott? Theologie im Zeitalter der Naturwissenschaften. Regensburg 2009. Bernius, Volker u. a. (Hg.): Religion und Gesellschaft. Zur Aktualität einer unbequemen Beziehung. Berlin 2010. Dawkins, Richard: River out of Eden. A Darwinian View of Life. New York 1995. Höhn, Hans-Joachim: Postsäkular. Gesellschaft im Umbruch – Religion im Wandel. Paderborn/München/Wien/Zürich 2007. Höhn, Hans-Joachim: Zeit und Sinn. Religionsphilosophie postsäkular. Paderborn/ München/Wien/Zürich 2010. Kant, Immanuel: Gesammelte Schriften. Hg.: Band 1 – 22 Preussische Akademie der Wissenschaften, Band 23 Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin, ab Band 24 Akademie der Wissenschaften zu Göttingen. Berlin 1900 ff. Kant, Immanuel: Kritik der praktischen Vernunft. Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (=Immanuel Kant Werkausgabe 7). Hrsg. von Wilhelm Weischedel. Frankfurt a. M. 141998. Kemper, Peter u. a. (Hg.): Wozu Gott? Religion zwischen Fundamentalismus und Fortschritt. Frankfurt/Leipzig 2009. Langthaler, Rudolf: »›Gott ist doch kein Wahn‹ (Kant)«, in: Wasmeier-Sailer, Margit/ Göcke, Benedikt Paul (Hg.): Idealismus und natürliche Theologie. Freiburg/München 2011. S. 49 – 80. Schick, Stefan: Contradictio est regula veri. Die Grundsätze des Denkens in der formalen, transzendentalen und spekulativen Logik. Hamburg 2010. Schrödter, Hermann/Ebeling, Klaus: »Nach-Denken über ›Religion‹«, in: Ebeling, Klaus (Hg.): Orientierung Weltreligionen. Stuttgart 22011. S. 193 – 204. Waldenfels, Bernhard: Grundmotive einer Phänomenologie des Fremden. Frankfurt 2006. Wolf, Jean-Claude: Das Böse. Berlin/Boston 2011. Wuketits, Franz Manfred: Darwins Kosmos. Sinnvolles Leben in einer sinnlosen Welt. Aschaffenburg 2009.
Christopher Meiller
»Religiöses Daseinsverhältnis« – Anmerkungen und Rückfragen zu Hans-Joachim Höhns »existentialpragmatischer« Religionsphilosophie
Hans-Joachim Höhn hat in den voranstehenden Überlegungen zur »Struktur und Relevanz eines religiösen Daseinsverhältnisses« bzw. den entsprechenden Ausführungen der Monographie »Zeit und Sinn« (2010)1 ein programmatisch anspruchsvolles und argumentativ aufwendiges religionsphilosophisches Basismodell konzipiert: Angezielt ist dabei nicht weniger als eine dem zeitgenössischen philosophischen Reflexionsniveau adäquate, von religiös-parteiischen Einfärbungen bzw. Blickverzerrungen frei gehaltene sowie der Eigenart beider Instanzen genügende (»zeit- wie sachgemäße«) Klärung des Verhältnisses von Religion und Vernunft2, vorgetragen mit kontextualisierendem Blick auf religiös-säkulare Gegenwartskonstellationen – namentlich den Umstand, dass Religion auch im Horizont der Moderne keineswegs als pauschal desavouiert erscheinen muss bzw. sich gerade ein moderne-spezifisch akzentuiertes Interesse am Religiösen behaupten lässt3. Im Folgenden soll und kann aufgrund der gebotenen Knappheit keine umfassende Rekonstruktion bzw. durchgehende Besprechung dieses höhnschen
1 Höhn, Hans-Joachim: Zeit und Sinn. Religionsphilosophie postsäkular. Paderborn 2010 (im Folgenden ZuS); vgl. hierzu ergänzend auch die Besprechung von Hoff, Gregor Maria: »Rezension zu Höhn, Hans-Joachim: Zeit und Sinn. Religionsphilosophie postsäkular«, in: Theologische Revue (108) 2012/2. Sp. 137 f. Ähnliche Überlegungen zur »Religion in existentialpragmatischer Sicht« finden sich u. a. auch schon in: Höhn, Hans-Joachim: Postsäkular. Gesellschaft im Umbruch – Religion im Wandel. Paderborn 2007. S. 64 – 80; einige der maßgeblichen Themen werden außerdem – unter theologischen Vorzeichen – bereits erörtert in: Höhn, Hans-Joachim: Der fremde Gott. Glaube in postsäkularer Kultur. Würzburg 2008, sowie wieder aufgegriffen in: Höhn, Hans-Joachim: Gott – Offenbarung – Heilswege. Fundamentaltheologie. Würzburg 2011. 2 Höhn, Hans-Joachim: »Säkularisierungsresistent? Struktur und Relevanz eines religiösen Daseinsverhältnisses«, in: Langthaler, Rudolf/Meiller, Christopher/Appel, Kurt (Hg.): Religion in der Moderne. Religionsphilosophische Beiträge zu einer aktuellen Debatte. Göttingen 2013. vgl. S. 134 f., hier 134. 3 Vgl. Höhn: »Säkularisierungsresistent?«. S. 133 f.; ausführlich dazu: Höhn: ZuS. v. a. S. 15 – 72.
152
Christopher Meiller
Entwurfs, der eine spezifische Profilierung des »Projekt[s] der Vernunft«4 wie der Religion involviert, geleistet werden; stattdessen sollen – im Ausgang von voranstehendem Beitrag, wiewohl teils auch mit Blick auf die mitunter breiteren Ausführungen Hans-Joachim Höhns in thematisch verwandten Arbeiten – einige grundlegende Aspekte eines ausgewählten Kernstücks des höhnschen Entwurfs, nämlich: der spezifischen Verortung und Konturierung des Religiösen in »existentialpragmatischem« Bezugsrahmen, analysiert bzw. an-diskutiert, näherhin v. a.: diesbezügliche Deutungsvarianten vorgeschlagen, einige systematisch lohnend scheinende Kontextualisierungen vorgenommen sowie sich hieraus ergebende Rückfragen artikuliert werden.
(1)
Zur nicht-existentialen Charakterisierung des Religiösen
Die höhnsche Verortung und Kennzeichnung des Religiösen ist als mehrstufiges und komplex verzahntes systematisch-definitorisches Gefüge organisiert; eine erste diesbezügliche Verständigung und sachliche Würdigung soll entsprechend bei einer grob rekapitulierenden Vergewisserung hinsichtlich einiger, für alles Folgende maßgeblichen Bestimmungen des bei Höhn entfalteten Religionsbegriffs (bzw. des »Religiösen«, »religiöser Vollzüge« u. Ä.) ansetzen. Vorab in seiner Bedeutungsvielfalt bezeichnet5, wird die eigentliche Einführung eines spezifischen Religionsbegriffs zunächst durch zwischengeschaltete Klärungen zum definitorischen Profil der Religionsbestimmung6 vorbereitet, ehe eine erste Verortung des Religiösen im »existentialpragmatischen« Bezugsrahmen erfolgt: Religion soll dabei näherhin nicht selbst als »existentiale[s] […] Charakteristikum«7 gefasst werden, sondern wird in einem ersten Schritt »als eine besondere Umgangsform mit den Formen, mit den Limitationen des Daseins umzugehen«8, bestimmt – und soll als solche augenscheinlich einen legitimen Ort im Horizont des »existentialpragmatisch« ans Licht gebrachten Aufrisses beanspruchen können. Jene (Meta-)«Einstellung»/«Umgangsform»9 wird (über einige Zwischenstufen) in der Weise weiter spezifiziert, dass sie als »Verhältnis zum Leben in seiner Ganzheit« zu stehen kommt, das sich in den »›ersten‹ und ›letzten‹ Fragen nach den Möglichkeiten einer Welt- und Daseinsakzeptanz angesichts des Inakzeptablen« ausbuchstabiert, die vielfältige, mit dem »In-der-Welt-Sein« des Fragenden mit-gesetzte Grenz-Erfahrungen 4 5 6 7 8 9
Höhn: »Säkularisierungsresistent?«. S. 137. Vgl. Höhn: »Säkularisierungsresistent?«. S. 134 (Anmerkung). Vgl. Höhn: »Säkularisierungsresistent?«. S. 139 f. Höhn: »Säkularisierungsresistent?«. S. 140. Höhn: »Säkularisierungsresistent?«. S. 140. Höhn: »Säkularisierungsresistent?«. S. 140.
»Religiöses Daseinsverhältnis«
153
sinnkritisch zur Sprache bringen, bzw. als Parteinahme (als »fragende[r] und hoffende[r] Ausgriff«) für eine akzeptanz-affirmierende Antwort auf jene Fragen bestimmt werden kann10. Mit diesen Basisbestimmungen ist nicht nur eine erste differenzierte Orientierung in der titelgebenden Frage der »Säkularisierungsresistenz« gewonnen11, sondern gleichfalls der Boden für eine weitere Bestimmung des Verhältnisses von Religion und Vernunft bereitet, die auch eine vertiefte Klärung des Religiösen mit sich bringt, indem hierbei die Kategorie des »Sinnaprioris« als zentraler Bezugspunkt desselben identifiziert wird – der »religiöse Grundvollzug [kann] als vernunftkompatibler Ausgriff nach einem ›Sinnapriori‹ der Daseinsakzeptanz betrachtet werden«12 –, die schließlich über das abschließend explizierte Motiv der »›wohltuende[n] Grundlosigkeit‹«13 weiter konturiert wird. Was am Grundriss dieser höhnschen Bestimmung des Religiösen, vor allem vor dem Hintergrund einschlägiger theologischer religionstheoretischer Alternativen, systematisch hervorragt, ist gerade dessen explizit nicht-existentiale Typisierung, wie sie in der Durchführung der »existentialpragmatischen« Sichtung des Religiösen zutage tritt: Gerade kein »existentiales Charakteristikum« ist (wie gesehen) dieses Religiöse – und damit offenkundig engstens verknüpft: Kein »Religiös-sein-Müssen« ist hier angezielt bzw. wird als Resultat »existentialpragmatischer« Analyse präsentiert14. Genau schon mit der Einräumung dieser Leerstelle bzw. dieser Negativbestimmungen (gewissermaßen noch vor der genauen positiven Ausfüllung seiner Religionsbestimmung) ist offenbar eine Eigenart des höhnschen Modells fassbar, die dieses von all jenen Alternativmodellen abstechen lässt, die in der ein oder anderen Art auf der Linie einer Bestimmung des Religiösen gerade als eigentlich »wesentlich« angesiedelt sind: die eben gerade an einem »existentialen« Begriff des Religiösen ansetzen, oder – in einer alternativen Spezifizierung – die vom Gedanken geleitet sind, dass »diese Eigenschaft [die Religiosität; Anm. CM] zu den anthropologischen Konstanten gehöre« (was Herbert Schnädelbach im vorliegenden Band geradezu als »Regel«-Position der »Verteidiger der Religiosität« bestimmen will)15. Dass solchen Modellen grundsätzliche Schwierigkeiten anhaften – Höhn selbst beispielsweise bringt in diesem Zusammenhang das in dieser Frage zentrale Höhn: »Säkularisierungsresistent?«. S. 141 ff. Vgl. Höhn: »Säkularisierungsresistent?«. S. 143. Höhn: »Säkularisierungsresistent?«. S. 146. Höhn: »Säkularisierungsresistent?«. vgl. S. 147 ff., hier 148. »Man muss religiös sein können, aber nicht religiös sein müssen« (Höhn: »Säkularisierungsresistent?«. S. 140). 15 Vgl. Schnädelbach, Herbert: »Religion in der Moderne – Aspekte und Perspektiven«, in: Langthaler, Rudolf/Meiller, Christopher/Appel, Kurt (Hg.): Religion in der Moderne. Religionsphilosophische Beiträge zu einer aktuellen Debatte. Göttingen 2013. S. 47 – 61, hier 58. (Abschnitt 6.4).
10 11 12 13 14
154
Christopher Meiller
Stichwort des »[V]ereinnahm[ens]« von »bewusst gewählte[n] nicht-religiöse[n] Lebensorientierung[en]«16 –, ist kein Geheimnis und vielfach diskutiert. Der skizzierte Grundriss des höhnschen Modells bzw. eben die erklärte Absage an eine Bestimmung des Religiösen als »existentiales Charakteristikum« ist, vor jenem Hintergrund, nicht zuletzt also dazu angetan, dasselbe aus genau dieser Schusslinie zu halten.17
(2)
Zur prekären Funktionalität des Religiösen
Möglicherweise schon prekärer könnte die Stellung des höhnschen religionsphilosophischen Entwurfs, sofern er augenscheinlich auf eine differenziert affirmierende Einschätzung des Religiösen zusteuert und hierbei das Religiöse entscheidend in den Horizont der Frage der »Daseinsakzeptanz angesichts des Inakzeptablen« rückt, dagegen erscheinen, wo er in seinem Verhältnis zu solchen religionsphilosophischen bzw. -kritischen Ansätzen in den Blick genommen wird, die jede Tauglichkeit des Religiösen in Sachen »Daseinsbewältigung« zu dessen Lasten auslegen bzw., schärfer gesagt, in denen jede in solchem Sinne lesbare Eignung als Indiz für dessen »illusorischen« bzw. fiktionalen Status gewertet wird: Gerade eine behauptete Funktionalität des Religiösen (im Umgang mit bzw. hinsichtlich einer weltanschaulichen »Bewältigung« von Kontingenzerlebnissen, Sinn-Skepsis o. Ä.)18, so ließe sich ein solches religionskri16 Höhn: »Säkularisierungsresistent?«. S. 140. Vgl. zu dieser Debatte bzw. zu diesbezüglich einschlägigen Modellen, Autoren sowie dem obigen und weiteren Motiven der Kritik (aber auch zu Versuchen der Antikritik) – in verschiedensten theologischen und religionsphilosophischen Settings – v. a. die Aufsätze in Stolz, Fritz (Hg.): Homo naturaliter religiosus? Gehört Religion notwendig zum Mensch-Sein?. [Studia religiosa Helvetica. Jahrbuch. Vol. 3.] Bern 1997; Honecker, Martin: Religion: Naturanlage oder Illusion?. [Gerda Henkel Vorlesung.] Münster 2000 (genau etwa mit einer Zusammenziehung solcher verschiedener Spezifizierungen einer solchen alternativen Religionsbestimmung: siehe v. a. S. 5 f.); Schrödter, Hermann: »Religion – eine anthropologische Komponente?«, in: Nordhofen, Eckhard/Höfler, Arnold (Hg.): Homo sapienter educandus. Festschrift für Hans-Michael Elzer. Frankfurt a. M./Bern 1982. S. 63 – 79; Schmidt-Leukel, Perry : Theologie der Religionen. Probleme, Optionen, Argumente. [Beiträge zur Fundamentaltheologie und Religionsphilosophie 1.] Neuried 1997. bes. S. 171 – 191; Eberlein, Karl: Christsein im Pluralismus. Ein Orientierungsversuch in der religiösen Gegenwart. [Theologische Orientierungen. Band 1.] Berlin 2006. bes. S. 102 ff.; Metz, Johann Baptist: Memoria passionis. Ein provozierendes Gedächtnis in pluralistischer Gesellschaft. In Zusammenarbeit mit Johann Reikerstorfer. Freiburg i. Br. 2006 (bes. S. 108 – 117) u.v.m. 17 Allerdings ließe sich fragen, ob nicht möglicherweise strukturell teils ähnliche Bedenken auch schon an Entwürfe adressiert werden (könnten), die lediglich nach einem »Vernunftinteresse« am Religiösen fragen. Vgl. Höhn: »Säkularisierungsresistent?«. S. 134 f.; auch Höhn: ZuS. S. 28, 117. 18 Diese psychologische bzw. existentielle Tauglichkeit ist im vorliegenden Kontext – nämlich
»Religiöses Daseinsverhältnis«
155
tisches Standardmotiv knapp konturieren, wird hierbei tendenziell als skeptisch-entlarvender Einwand in Richtung religiöser Wahrheitsansprüche in Stellung gebracht, das Religiöse soll entscheidend als entlastende oder dem Umgang des Menschen mit seinem fortwährend bedrohten, endlichen etc. Dasein sonstwie zuträgliche Geistes- bzw. Kulturschöpfung/-fiktion begriffen werden.19 Nun wird hiergegen bekanntermaßen standardmäßig u. a. eingewandt, dass eine Kopplung der Diagnose psychisch-existentieller Funktionalität des Religiösen und der Behauptung der (bloßen) Fiktionalität desselben in der Form: funktional ergo fiktional, schlicht unzulässig weil fehlschlüssig werde; zugleich aber überdauert jenes Motiv offenkundig, in diversen Gestaltungsvarianten und mehr oder minder explizit, nach Art eines die Religionsskepsis befeuernden Verdachtsmoments bis hinein in gegenwärtige Diskussionen um die Plausibilität des Religiösen und findet sich entsprechend in zeitgenössischen religionskritischen bzw. neu-atheistischen Wortmeldungen nicht selten als Glied einer religionskritischen Indizienkette, gewissermaßen als psychologiim Horizont der höhnschen Religionsbestimmung – naheliegenderweise eher relevant als andere Varianten religiöser Funktionalität, z. B. Funktionen des Religiösen in politischen Kontexten, die an dieser Stelle entsprechend übergangen werden können, wiewohl bekanntlich auch auf diese gerade in religionskritischen Zusammenhängen regelmäßig hingewiesen wird (vgl. für eine solche Bezugnahme auf eine Funktion des Religiösen im Politischen in zeitgenössischem religionskritischem Kontext etwa Onfray, Michel: Wir brauchen keinen Gott. Warum man jetzt Atheist sein muss. München/Zürich 2007. S. 45 f.). 19 Ein Überblick zu argumentativen Grundzügen der besagten religionskritischen Schiene (und zu entsprechenden Strategien der Antikritik) findet sich üblicherweise in jeder besseren Einführung in die Religionsphilosophie/-kritik, vgl. etwa Löffler, Winfried: Einführung in die Religionsphilosophie. [Einführungen Philosophie.] Darmstadt 2006. bes. S. 140 – 143. Eine ideengeschichtlich prominente und außerordentlich luzide Variante derselben bieten bekanntermaßen Freuds Überlegungen eben zum »illusorischen« Charakter der Religion (»Die Zukunft einer Illusion«, in: Freud, Sigmund: Massenpsychologie und IchAnalyse. Die Zukunft einer Illusion. Frankfurt a. M. 82007. S. 107 – 158), wobei eben gilt: Gerade »[d]ass die Religion Trost und Hilfe spendet, wird zum entscheidenden Einwand gegen sie« (so kompakt in einer frühen Analyse bei Leo Strauss: »›Die Zukunft einer Illusion‹«, in: Strauss, Leo: Die Religionskritik Spinozas und zugehörige Schriften (=Gesammelte Schriften 1). Unter Mitwirkung von Wiebke Meier hrsg. von Heinrich Meier. Stuttgart/ Weimar 22001. S. 431 – 439, hier 437; Hervorhebung übernommen). Zu zeitgenössischen Ausformungen dieser Variante einer Religionskritik vgl. nochmals etwa Michel Onfray mit seinen einschlägigen Bemerkungen zum Religiösen bzw. Gottesglauben als Reflex auf Sterblichkeitserfahrungen bzw. -erwartungen (etwa: » […] Gott existiert nur, um trotz der Tatsache, dass der Weg für jeden ins Nichts führt, ein Alltagsleben zu ermöglichen«; und: »Die Angst vor dem Tod oder vor der Leere nach dem Tod erzeugt trostspendende Legenden und Fiktionen«. Onfray : Wir brauchen keinen Gott. S. 34, 270 – das Onfray’sche Motiv ist augenscheinlich nach dem skizzierten Muster lesbar, bei dem eben die Zuschreibung einer psychologischen bzw. existentiellen Funktionalität mit einer Entwertung der Glaubwürdigkeit des Religiösen zusammengespannt wird); für eine explizite und im Grundsatz affirmative Bezugnahme auf Freuds »Zukunft einer Illusion« im Rahmen der zeitgenössischen Religionskritik schließlich vgl. etwa Hitchens, Christopher: Der Herr ist kein Hirte. Wie Religion die Welt vergiftet. München 2007. S. 129 f., 298 u. ö.
156
Christopher Meiller
scher Baustein im Rahmen argumentativ breit aufgestellter religionskritischer Gedankengebäude. Dessen materiale Ausgestaltungen mögen vielfältig sein, die Grundstruktur folgt doch regelmäßig dem klassischen Muster : Auch wenn streng genommen mit dem Aufweis einer (psychologischen, existentiellen usf.) Funktionalität des Religiösen über dessen »Wahrheitswert« nicht negativ entschieden sein mag, so ist es jedenfalls »doch sehr auffällig[!], dass dies alles so ist, wie wir es uns wünschen müssen«20, bzw. wie passgenau Grundzüge des Religiösen im Umgang mit menschlichen Defiziterfahrungen, Sinn-Bedürfnissen u. Ä. tauglich scheinen; eine Beschaffenheit nun gerade eben von der Art, wie man sie von einem eigens hierzu erfundenen, oder defensiver gesagt: einem im Zuge der menschlichen Entwicklungsgeschichte zur Bewältigung solcher Defiziterlebnisse u. Ä. sich ausbildenden und bewährenden kulturell-ideologischen Werkzeug erwarten könnte. Nähert man sich unter solchen Vorzeichen, eben: einer klassischen, dabei zeitgenössisch weiterhin virulenten fundamentalen religionskritischen Verdächtigung religiöser Funktionalität, der »existentialpragmatischen« Rekonstruktion des Religiösen, scheinen entsprechende Rückfragen naheliegend: Unnötig zu sagen, dass es eine grobe Verzerrung und Banalisierung der höhnschen Bestimmungen des Religiösen bedeuten müsste, wollte man sie mit den angesprochenen üblichen religionskritischen Labels – Religion als Angstbewältigungs-, Trost-Vehikel o. Ä. – einfachhin in eins setzen; und gleichwohl: Lassen sich nicht doch maßgebliche Charakteristika des »existentialpragmatisch« konstruierten Religiösen letztlich gerade nach dem Muster einer subtil gefassten existentiellen Funktionalität des Religiösen buchstabieren – wenn eben etwa, angesichts der Fraglichkeit von »Daseinsakzeptanz«, der »hoffende[] Ausgriff nach Gründen, das Leben allen Limitationen und allem Befremdlichen zum Trotz für letztlich zustimmungsfähig zu halten«, als »religiöse[r] Grundvollzug«21 (!) markiert wird? Ließe sich mit Blick auf Obiges vielleicht sogar sagen, dass, was eben als eine Funktionalität des Religiösen typischerweise im Zuge einer religionskritischen Gegenlesung desselben erst (re)konstruiert (und als religionsskeptisches Indiz verwertet) wird, in der höhnschen Religionsbestimmung gewissermaßen offensiv angegangen wird, in der Weise eben, dass eine entsprechende Tauglichkeit des Religiösen in »existentialpragmatischem« Kontext im definitorischen Aufriss selbst bereits deutlich begrifflich greifbar wird? Aber dann eben auch: Muss man nicht annehmen (und dann gegebenenfalls systematisch mitkalkulieren), dass sich ein solches religionsphiloso20 Freud: »Die Zukunft einer Illusion«. S. 136; so mit Blick auf zentrale jüdisch-christliche Religionsbestände (»Gott […] als Weltenschöpfer und gütige Vorsehung, eine sittliche Weltordnung und ein jenseitiges Leben«. ebd.). 21 Höhn: »Säkularisierungsresistent?«. S. 143.
»Religiöses Daseinsverhältnis«
157
phisches Modell – eben durch die definitorische Verklammerung des Religiösen mit dem »Ausgriff« auf »[Z]ustimmungsfähig«-keit des »Leben[s]«, die (unter affirmierenden Vorzeichen erfolgende, wenn auch im Einzelnen zurückhaltend formulierte) Einspannung des Religiösen in den Problemhorizont »Daseinsakzeptanz« – in Richtung der besagten weiterhin aktuellen religionskritischen Denkmuster in markanter Weise (und jedenfalls markanter als andere gegenwärtig verbreitete Religionsdefinitionen) exponiert?22 – Freilich, die zuletzt erörterte Charakterisierung des Religiösen, also: die im vorliegenden Modell so dominante Zuordnung desselben in den Motivkomplex »Zustimmungsfähigkeit«, »Daseinsakzeptanz« etc., lässt – abgelöst von der eben durchgespielten religionskritischen Kontextualisierung und den diesbezüglichen Provokationen – Anfragen in Sachen religionstheoretischer Eignung auch noch in anderer Richtung zu, die auf die sachliche Adäquanz einer solcherart gepolten religionstheoretischen Rekonstruktion des Religiösen vor dem Hintergrund möglicherweise gegenläufiger religiöser Selbst- und Daseinsdeutungen abhebt – eine Problemdimension, die im Weiteren kurz beleuchtet werden soll.
(3)
Religiös affirmierte »Zustimmungs«-Verweigerung? Zu Gegenbegriffen des Religiösen
Zu Rückfragen kann die skizzierte Bestimmung des Religiösen hierbei näherhin auch hinsichtlich ihrer Reichweite Anlass geben: nämlich, sofern sich Verknüpfungen der hier maßgeblichen Kategorien – »Religiöses«, »Zustimmungsfähigkeit« etc. – plausibel machen lassen, die gerade quer zur höhnschen Zuordnung derselben zu stehen scheinen und entsprechend Fragen nach dem Applikationsradius von letzterer provozieren. Anders gewendet: Auch wenn vorausgesetzt wird, dass mit den vorgelegten definitorischen Bestimmungen eine überzeugende Verortung des (in der oben rekapitulierten Weise spezifizierten) Religiösen im »existentialpragmatischen« Bezugsrahmen geglückt ist, so ist damit klarerweise noch nicht ausgemacht, ob hierbei durchgängig mit einer eigentlich bzw. vollsinnig sach-adäquaten Bestimmung des Religiösen operiert wird; gefragt werden kann also: (inwiefern) können die bezeichneten Bestimmungen als sach-adäquate religionstheoretische Rekonstruktion angesprochen werden bzw. lassen sich hiergegen begründete Zweifel artikulieren, die in Richtung einer diesbezüglichen Perspektivenverkürzung weisen? Konkreter : Wie steht es, vor dem Hintergrund der ange22 Und dann auch: Was können in dieser Problemsicht die angeschlossenen Bestimmungen bezüglich des Verhältnisses von Vernunft und Religion eigentlich leisten?
158
Christopher Meiller
führten definitorischen Zuschreibungen, etwa um (extrem-)dualistische bzw. eskapistische Varianten des Religiösen und deren tendenziell prekäres Verhältnis zu »Welt« und »In-der-Welt-Sein«? Wie ist das Verhältnis etwa der schon angeführten Charakterisierung des »religiösen Grundvollzugs«, als »hoffender Ausgriff nach Gründen, das Leben […] für letztlich zustimmungsfähig zu halten«, zu jenen (Sonder-)23Formen des Religiösen zu denken, die, zugeschärft gesagt, vom »In-der-Welt-Sein« letztlich nicht mehr, nichts anderes er-hoffen, als dass es – etwa zugunsten eines (wie immer näher ausgestalteten) eschatologisch-»jenseitigen« Idealzustandes – aufhören möge? Wird man nicht etwa, in Anlehnung an Hans-Joachim Höhns Begrifflichkeit gesagt, auch mit »materialen« Ausgestaltungen des Religiösen rechnen müssen, die die »Welt« als so grundsätzlich »im Argen«24 befindlich begreifen, dass ihr »hoffender Ausgriff« nicht eigentlich auf die »Zustimmungsfähig«-keit des »In-der-Welt-Seins« geht, sondern eher auf dessen Aufhebung: sodass aber entsprechend möglicherweise kaum auf den ersten Blick einsichtig scheint, dass bzw. wie sie unter die geltend gemachte »existentialpragmatisch«-formale Charakterisierung des Religiösen fallen? Und weiter : Wird dann, angesichts solcher tendenziell gegenläufigen religiösen Daseinsdeutungen, in den höhnschen Ausführungen nicht vielleicht allzu selbstverständlich davon ausgegangen, dass das Religiöse (den »Ausgriff« auf) ein »Sinnapriori«, als »Rechtfertigungs- und Ermöglichungsgrund für die Zustimmungsfähigkeit des Daseins angesichts des Inakzeptablen«25, vertritt – wenn eben auch mit solchen Varianten des Religiösen zu rechnen ist, die augenscheinlich ein so gänzlich anders geartetes, ja gegenteiliges Profil eines »hoffenden Ausgriffs« aufweisen und für die man entsprechend geradezu eine Antithese zu einem höhnschen »Sinnapriori« reklamieren könnte? Wenn es sich aber so verhält, kann sich immerhin der Verdacht nahelegen, dass an dieser Stelle gewissermaßen eine strukturelle Analogie zu jener Schwierigkeit vorliegt, die Hans-Joachim Höhn andernorts26 als Problem 23 Dass solche Positionen nicht repräsentativ für (zeitgenössische) Ausgestaltungen des Religiösen sein mögen und entsprechend tatsächlich tendenziell als Sonder-/Extremformen desselben angesprochen werden müssen (gegen die außerdem u. a. unter theologischen Vorzeichen viel einzuwenden sein mag), sei zugestanden – was die daran geknüpften Rückfragen freilich nicht gegenstandslos macht; die obigen Charakterisierungen verfolgen an dieser Stelle lediglich die heuristische Intention, etwaige Schwierigkeiten der »existentialpragmatischen« Religionsbestimmung zu markieren. 24 Die Formulierung ist angelehnt an die prägnante – und assoziativ wohl nicht unpassende – Wendung in 1 Joh 5,19 – in der Lutherübersetzung eben: »Wir wissen, dass wir von Gott sind, und die ganze Welt liegt im Argen« (Die Bibel. Nach der Übersetzung Martin Luthers. Mit Apokryphen. Revid. Fassung 1984. Stuttgart 1999); ein von Kierkegaard gern referenziertes Motiv übrigens. 25 Höhn: »Säkularisierungsresistent?«. S. 146 f. 26 Nämlich im Kontext seiner instruktiven Diskussion der Eigenarten und Defizite unterschiedlicher Religionsbestimmungen: vgl. Höhn: ZuS. S. 149 – 155, hier bes. 153.
»Religiöses Daseinsverhältnis«
159
»substantialistischer« Fassungen des Religionsbegriffs selbst im Grundsatz angesprochen hat, nämlich: einer der faktisch-phänomenalen Vielfalt des Religiösen (bzw. religiöser Selbstzuschreibungen) unangemessenen bzw. nur eine Teilmenge desselben erfassenden Engführung in der Bestimmung des Religiösen; metatheoretisch gesprochen, scheint an dieser Stelle demnach auch mit Blick auf das höhnsche Modell die altbekannte Spannung aufzubrechen zwischen Versuchen, systematisch eindeutige religionstheoretische Charakterisierungen und Zuordnungen zu konstruieren, und der phänomenalen Vielgestaltigkeit und Uneindeutigkeit, wie sie im Bereich der Selbstzuschreibungen des Religiösen typischerweise antreffbar ist. Zusammenfassend gesagt: Sein ambitionierter Aufriss, und hierbei nicht zuletzt eben die betont nicht-existentiale Verortung des Religiösen, erwirbt dem höhnschen Modell eine grundlegende systematische Trittsicherheit – dessen weitere Spezifizierung lässt freilich gleichwohl auch Räume für Rückfragen und Folgediskussionen betreffend die Konzeption des Religiösen bestehen.
Literaturverzeichnis Die Bibel. Nach der Übersetzung Martin Luthers. Mit Apokryphen. Revid. Fassung 1984. Stuttgart 1999. Eberlein, Karl: Christsein im Pluralismus. Ein Orientierungsversuch in der religiösen Gegenwart. [Theologische Orientierungen. Band 1.] Berlin 2006. Freud, Sigmund: »Die Zukunft einer Illusion«, in: ders.: Massenpsychologie und IchAnalyse. Die Zukunft einer Illusion. Frankfurt a. M. 82007. S. 107 – 158. Hitchens, Christopher : Der Herr ist kein Hirte. Wie Religion die Welt vergiftet. München 2007. Höhn, Hans-Joachim: Der fremde Gott. Glaube in postsäkularer Kultur. Würzburg 2008. Höhn, Hans-Joachim: Gott – Offenbarung – Heilswege. Fundamentaltheologie. Würzburg 2011. Höhn, Hans-Joachim: Postsäkular. Gesellschaft im Umbruch – Religion im Wandel. Paderborn 2007. Höhn, Hans-Joachim: »Säkularisierungsresistent? Struktur und Relevanz eines religiösen Daseinsverhältnisses«, in: Langthaler, Rudolf/Meiller, Christopher/Appel, Kurt (Hg.): Religion in der Moderne. Religionsphilosophische Beiträge zu einer aktuellen Debatte. Göttingen 2013. S. 133 – 150. Höhn, Hans-Joachim: Zeit und Sinn. Religionsphilosophie postsäkular. Paderborn 2010. Hoff, Gregor Maria: »Rezension zu Höhn, Hans-Joachim: Zeit und Sinn. Religionsphilosophie postsäkular«, in: Theologische Revue (108) 2012/2. Sp. 137 f. Honecker, Martin: Religion: Naturanlage oder Illusion?. [Gerda Henkel Vorlesung.] Münster 2000. Löffler, Winfried: Einführung in die Religionsphilosophie. [Einführungen Philosophie.] Darmstadt 2006.
160
Christopher Meiller
Metz, Johann Baptist: Memoria passionis. Ein provozierendes Gedächtnis in pluralistischer Gesellschaft. In Zusammenarbeit mit Johann Reikerstorfer. Freiburg i. Br. 2006. Onfray, Michel: Wir brauchen keinen Gott. Warum man jetzt Atheist sein muss. München/Zürich 2007. Schmidt-Leukel, Perry : Theologie der Religionen. Probleme, Optionen, Argumente. [Beiträge zur Fundamentaltheologie und Religionsphilosophie 1.] Neuried 1997. Schnädelbach, Herbert: »Religion in der Moderne – Aspekte und Perspektiven«, in: Langthaler, Rudolf/Meiller, Christopher/Appel, Kurt (Hg.): Religion in der Moderne. Religionsphilosophische Beiträge zu einer aktuellen Debatte. Göttingen 2013. S. 47 – 61. Schrödter, Hermann: »Religion – eine anthropologische Komponente?«, in: Nordhofen, Eckhard/Höfler, Arnold (Hg.): Homo sapienter educandus. Festschrift für HansMichael Elzer. Frankfurt a. M./Bern 1982. S. 63 – 79. Stolz, Fritz (Hg.): Homo naturaliter religiosus? Gehört Religion notwendig zum MenschSein?. [Studia religiosa Helvetica. Jahrbuch. Vol. 3.] Bern 1997. Strauss, Leo: »›Die Zukunft einer Illusion‹«, in: ders.: Die Religionskritik Spinozas und zugehörige Schriften (=Gesammelte Schriften 1). Unter Mitwirkung von Wiebke Meier hrsg. von Heinrich Meier. Stuttgart/Weimar 22001. S. 431 – 439.
Autorenverzeichnis
Jakob Deibl, MMag. Dr., ist Post-Doc im Fachbereich Theologische Grundlagenforschung (Fundamentaltheologie) des Instituts für Systematische Theologie der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien. Bernd Dörflinger, Prof. Dr., ist Professor für Philosophie an der Universität Trier und Erster Vorsitzender der Internationalen Kant-Gesellschaft. Hans-Joachim Höhn, Prof. Dr., ist Professor für Systematische Theologie und Religionsphilosophie am Institut für Katholische Theologie der Philosophischen Fakultät der Universität zu Köln. Rudolf Langthaler, Prof. Dr., ist Professor für Philosophie am Institut für Christliche Philosophie der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien. Christopher Meiller, MMag. Dr., ist Post-Doc am Institut für Christliche Philosophie der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien. Hans Schelkshorn, Prof. DDr., ist Professor für Philosophie am Institut für Christliche Philosophie der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien. Herbert Schnädelbach, Prof. Dr., ist emeritierter Professor für Philosophie der Humboldt Universität zu Berlin. Peter Strasser, Prof. Dr., ist Professor für Philosophie am Institut für Rechtsphilosophie, Rechtssoziologie und Rechtsinformatik an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Karl-Franzens-Universität Graz.