Kollektivierung der Phantasie?: Künstlergruppen in der DDR zwischen Vereinnahmung und Erfindungsgabe [1. Aufl.] 9783839406274
Kunst sollte im Staatssozialismus der DDR den Herrschaftsanspruch durch ästhetische Präsentation der beabsichtigten gese
208 45 97MB
German Pages 276 [275] Year 2015
Inhalt
Prolog
Einleitung
Kultur und Wandel: Kann Kunst sozial wirksam sein?
Symbolische Vermittlung- eine kunstsoziologische Betrachtungsweise
Exkurs: Das Geheime im Sozialen
Gegenkultur und sozialer Wandel
Phasen und Zäsuren in der SBZ und DDR
Die sozialen Phantasien der Künstlergruppen-Generation
Aktionsfelder und Vorstellungen in der Weimarer Republik
Exkurs: Das Gruppenselbstbildnis »Dresdner Sezession 33«
Aufbruch in den Sozialismus (1945-1947)
Künstlergruppen im Prozess der Transformation
Von der Gruppe ins Kollektiv (1948-1950)
Exkurs: Wider die Doktrin des Realismus oder
Das Künstlerindividuum in der DDR
Diffusion der Ideale (1951-1953)
Kollektivierung des künstlerischen Feldes
Prinzipien staatlicher Kollektivbildung
Exkurs: Der Popularisierungsgedanke und seine Symbolische Vermittlung
Legitimationsstrategien
Literatur
Abkürzungen
Recommend Papers
![Kollektivierung der Phantasie?: Künstlergruppen in der DDR zwischen Vereinnahmung und Erfindungsgabe [1. Aufl.]
9783839406274](https://ebin.pub/img/200x200/kollektivierung-der-phantasie-knstlergruppen-in-der-ddr-zwischen-vereinnahmung-und-erfindungsgabe-1-aufl-9783839406274.jpg)
- Author / Uploaded
- Petra Jacoby
File loading please wait...
Citation preview
Petra Jacoby Kollektivierung der Phantasie?
Petra Jacoby (M.A.) hat Soziologie, Kunstgeschichte und Neuere deutsche Literaturgeschichte studiert. Ihre Arbeit über Künstlergruppen ist aus der Mitarbeit an einem soziologischen Forschungsprojekt über Kunstpolitik in der DDR entstanden.
PETRA J ACOBY
KoLLektivierung der Phantasie? Künstlergruppen in der DDR zwischen Vereinnahmung und Erfindungsgabe
[transcript]
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
© 2007 transcript Verlag, Bielefeld Zugl.: Freiburg i. Br., Univ., Diss., 2005
Die Verwertung der Texte und Bilder ist ohne Zustimmung des Verlages urheberrechtswidrig und strafbar. Das gilt auch für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Verarbeitung mit elektronischen Systemen. Umschlaggestaltung & Innenlayout Kordula Röckenhaus, Bielefeld Lektorat & Satz: Petra Jacoby Druck: Majuskel Medienproduktion GmbH. Wetzlar ISBN 3-89942-627-4 Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier mit chlorfrei gebleichtem Zellstoff. Besuchen Sie uns im Internet: http://www. transcript-verlag. de Bitte fordern Sie unser Gesamtverzeichnis und andere Broschüren an unter: [email protected]
INHALT Prolog 7 Einleitung 9 Kultur und Wandel: Kann Kunst sozial wirksam sein? 11
Symbolische Vermittlung- eine kunstsoziologische Betrachtungsweise 11
Exkurs: Das Geheime im Sozialen 25 Gegenkultur und sozialer Wandel
33 Phasen und Zäsuren in der SBZ und DDR
44 Die sozialen Phantasien der Künstlergruppen-Generation 67 Aktionsfelder und Vorstellungen in der Weimarer Republik
68 Exkurs: Das Gruppenselbstbildnis »Dresdner Sezession 33« 99 Aufbruch in den Sozialismus (1945-1947) 115
Künstlergruppen im Prozess der Transformation 131 Von der Gruppe ins Kollektiv (1948-1950) 131 Exkurs: Wider die Doktrin des Realismus oder Das Künstlerindividuum in der DDR
146 Diffusion der Ideale (1951-1953)
163 Kollektivierung des künstlerischen Feldes
175 Prinzipien staatlicher Kollektivbildung
176 Exkurs: Der Popularisierungsgedanke und seine Symbolische Vermittlung 198 Legitimationsstrategien
214 Literatur
233 Abkürzungen
271
PROLOG
Dresden an einem Abend im Jahr der nationalsozialistischen Machtübernahme. Die Maler und Bildhauer der Dresdner Künstlergruppen versammeln sich ein letztes Mal und tauschen Auffassungen und Wünsche über die Zukunft ihres künstlerischen Wirkens aus. Festgemacht an der Person und den Werken von Otto Dix 1, kommt es bei dieser Zusammenkunft zu heftigen politischen Diskussionen, in deren Verlauf sich die vier Malerfreunde Otto Griebe!, Erich Fraaß, Kar! Krönerund Johannes Beutner an einen Tisch zurückziehen und ein Bündnis vereinbaren. Dem Freundeskreis schließen sich Hans Jüchser, Paul Wilhelm und Fritz Winkler an.Z Fortan nennen sie sich Die aufrechten Sieben3: »An jenem Abend kam [... ] die Vereinbarung zustande, daß wir Gleichgesinnten uns ab und zu treffen [ ... ],um gemeinsame Ausflüge in die Umgebung der Stadt zu unternehmen[ ... ].« (Griebe! 1986: 346) Der Rückzug in den Vertrautenkreis geschah in einer Zeit ärgster Bedrängnis: Gruppierungen wurden aufgelöst, Arbeits- und Ausstellungsverbote durch die Reichskulturkammer4 verhängt und die Leerstellen mit kontrollierten Zusammenschlüssen5 überlagert. Die Dresdner
2 3
4 5
Am 8. April 1933 wurde Dix aus seinem Lehramt an der Dresdener Kunstakademie enthoben. Die Argumentation: Seine Bilder verletzten das »sittliche Geftihl des deutschen Volkes aufs schwerste« und beeinträchtigten den »Wehrwillen des deutschen Volkes«. (Fischer 1981: 97f.) Lose beteiligten sich Josef Hegenba1th und Theodor Rosenhauer. Der Freundeskreis blieb über die Naziherrschaft hinaus konstant und exklusiv bestehen. Variationen der Namensgebung sind: Die getreuen Sieben, Die aufrechten Sieben, die Sieben Spaziergänger. (V gl. Die Sieben 1997) In der weiteren Literatur wird Fraaß nicht angeführt und die Übereinkunft auf die Jahre 1932 (Jähner 1980: 28ff.) und 1931 gelegt (Löffler 1987: 29). Eingerichtet am 15. November 1933 zur Kontrolle aller Künstlerverbände. Eine von den Nationalsozialisten veranlasste Ausnahme war die Ateliergemeinschaft Klosterstrasse in Berlin mit rund 30 Mitgliedern und Gästen. Darunter ftir die spätere DDR von Bedeutung sind Fritz Duda, Carl Hofer und Käthe Kollwitz. Kurt Tucholsky resümiert über die Struktur: »Unter den 40 Atelierinhabern waren 10% unbestechliche Antifaschisten, 10% waren gefährliche Nazis.« (Vgl. Wilhelmi 1996: 79) Beispielsweise seien bei
7
KOLLEKTIVIERUNG DER PHANTASIE?
Künstler wählten die Form des Spazierganges, um ihre Vorstellungen auszutauschen, gemeinsam Ideen zu entwickeln und Zeichenstudien in der Natur anzufertigen. Der naturverbundene Austausch, in Adaption romantischer Kontemplation, und das zwanglose nicht ortsgebundene Zusammensein hatten entlastende Funktion. 6 Eingebunden in alltägliche und gesellige Verhaltensweisen konnte ein den Bedingungen angepasstes, festes soziales und aufVertrauen aufgebautes Beziehungsgefüge beibehalten werden. Etliche Jahre später schreibt Karl Kröner über seine Motivation: »Man braucht ab und zu die Bestätigung dessen, was man als wahr und echt empfindet, [... ] !« (Kröner 1967: 4) Die Ausgangsbasis für das Bündnis bildete die freundschaftliche und lokale Verbundenheit, die während der Ausbildungszeiten in Dresden an der Kunstgewerbeschule geschaffen und an der Königlichen Kunstakademie vertieft worden war. Auch orientierten sich die um 1890 Geborenen künstlerisch an realistischen Darstellungsweisen. Mit ihrem Freundeskreis knüpften Die Aufrechten Sieben an die ab Ende der lOer Jahre im künstlerischen Feld massenhaft hervor tretenden Zusammenschlüsse an, in denen sich nahezu jeder Künstler - zumeist in mehreren gleichzeitig - präsentiert hatte. 7 Hierin konnten künstlerische Vorstellungen und gesellschaftliches Interesse ausgeprägt und neue Handlungsmuster gemeinschaftlich gefonnt werden. Mit Manifesten, öffentlich wirksamen Aktionen, Gruppenabspaltungen, internen Zerwürfnissen und je eigenen, avantgardistischen Kunstformen gewann das Phänomen an gesteigerter Bedeutung. Jäh unterbrochen von der Machtübernahme der Nationalsozialisten, wird das Prinzip der Künstlerbewegung von eben dieser Künstlergeneration nach dem Zweiten Weltkrieg und insbesondere in der SBZ mit der Hoffnung weiter getragen, an die biografischen Erfahrungen und Konzeptionen der Weimarer Zeit anknüpfen zu können. 8 Die Vorstellungen trafen jedoch auf Bedingungen, die gesellschaftliche Prämissen kultureller Gegenbewegungen durchscheinen lassen.
6
7
8
einer improvisietten Weihnachtsausstellung im Treppenhaus der Ateliergemeinschaft Plastiken von Käthe Kollwitz entfernt worden. (Ibid.) Eine Form des Spaziergangs, das Flanieren in städtischem Ambiente, wurde in der Mitte des 19. Jahrhunderts bewusst mit antibürgerlichem Habitus verbunden. Walter Benjamin bewertet das Spazieren führen von Schildkröten in Paris, als gegenkritische Manifestation großstädtischer Dynamisierung. (Vgl. Benjamin 1983) Insbesondere in der Künstler-Vereinigung Dresden und in der Dresdner Sezession 1932. Weitere Mitgliedschafren in sozialistisch sowie landesund auch europaweit ausgerichteten Gruppierungen spiegeln das gesellschaftliche Engagement dieser Epoche wider. Nicht so die Mitglieder des Freundeskreises. Lediglich Griebe! und Fraaß beteiligten sich in der Anfangsphase der DDR an der Gruppe Das Ufer.
8
EINLEITUNG
Der Kunst war im Staatssozialismus die Aufgabe zugedacht, den Herrschaftsanspruch durch ästhetische Präsentation der beabsichtigten gesellschaftlichen Wirklichkeit zu vergegenwärtigen. Die Mittel dazu waren der Austausch von Handlungsfonnen zwischen Künstler- und Arbeiterschaft, soziale Kollektivbildungen und die vehemente diskursive Vermittlung der vorgestellten Gesellschaftsordnung. Hingegen die Mehrheit der Künstler zuvörderst mit Mitteln der Kunst zu einer neuen sozialen Gemeinschaft gelangen wollte und das Wirken in sozialen Zusammenschlüssen als Multiplikator ihrer künstlerischen Auffassungen und als Ausdruck ihrer Lebensformen verstanden hat. Trotz gegenseitiger Bemühungen konnten die staatlichen Bestrebungen der Kollektivierung und die sozialen Phantasien der Künstler nie wirklich in Einklang gebracht werden und bedingten auf beiden Seiten je besondere Strategien der Verständigung. Diese Nahtstellen sozialer Gegenbeziehungen ermöglichen es, die Bedingungen gegenkultureUer Bewegungen aufzuspüren. Sie markieren die Wege, die gesellschaftliche Strukturen aufzubrechen vermögen. Denn Nahtstellen sind zweigesichtige Orte, von denen aus das jeweils Andere bestimmbar und erreichbar wird. Die Hauptthese lautet, dass Utopie, als kritische Vorstellung und das Geheime, als Regulator des sozialen Austauschs, sowie Kunst, als Art und Weise sowie als Ort des Ausdrucks, mit ihren Zuständen der phantasiemäßigen Vorwegnahme des Selbst, der Isolation und der ästhetisierten Lebensführung, Wege der Wunscherfüllung sind. Diese können unter bestimmten Bedingungen und mit den ihnen eigenen Möglichkeiten der Verknüpfung sozialer Bereiche zu Motoren für gesellschaftliche Transformationen geraten. Da sich Gruppenzusammenschlüsse stets gegen übergeordnete, sozial bedeutsame Zusammenhänge richten, kann im Prinzip jede Form von Vergemeinschaftung zur Verankerung gegenkultureHer Vorstellungen geraten. Aber erst durch die besondere Besitznahme des sozialen Gefüges im Ganzen können Bewegungen eine okkupierende Position einnehmen und selbst zu Gesellschaften generieren. Oder pragmatisch formuliert: Gruppen gewinnen Einfluss, wenn sie sich aus einer zunächst eige-
9
KOLLEKTIVIERUNG DER PHANTASIE?
nen und besonderen Interessenlage in Abgrenzung zur Gesamtgesellschaft ausbilden und schließlich in Kenntnis ihrer Mechanismen deren Wirkungsfelder besetzen. Das künstlerische Feld in der SBZ und DDR hat Bedeutung innerhalb eines Gesellschaftsganzen erlangen können, weil den Künsten in diesem gesellschaftlichen System eine Wirkungsmacht zugesprochen wurde. Insofern als die soziale Eingebundenheit der bildenden Künste per se einen hohen Stellenwert erhielt und Kunst wie Künstler seit der Konstitution des Staates mit sämtlichen Lebensbereichen instrumentell verflochten wurden. Dem Artefakt Kunst kam als Trägermedium die Rolle zu, soziale Identität herzustellen. Kunstwerke sollten Emotionen transportieren und damit unbewusst den idealisierten Vorstellungen gesellschaftstragende Geltung verschaffen. Das methodische Konzept dieser Arbeit liegt darin, Positionen und Reaktionen zu Wort kommen zu lassen und ihnen einen strukturierten Rahmen zu geben. Dieser Rahmen besteht aus der systematischen Darlegung historischer und zeithistorischer Verläufe künstlerischer Zusammenschlüsse, aus methodischen Überlegungen zur Interpretation von Bewegungen, aus bildkünstlerischer Interpretation kunsthistorischer Provenienz und aus diskursanalytischen Interpretationen. Herausgekommen ist schließlich eine grundständige kunstsoziologische Betrachtungsweise. Für die Analyse konnten unterschiedliche Materialsorten - insbesondere Originaldokumente aus Archivbeständen - ausgewertet werden, die einen Perspektivenwechsel ermöglichten und einen umfassenden und atmosphärischen Einblick boten. Darunter sind Manifeste, Ausstellungshefte und Kataloge aus den Anfangsjahren, Briefe an befreundete Künstler und künstlerisch gestaltete Postkarten, Fotografien, Anträge an behördliche Stellen sowie Mitschriften von Künstlerversammlungen. Die staatlichen Maßnahmen der Kollektivierung konnten direkt aus dem Archivbestand der DDR-Behörden entnommen werden oder ließen sich über die zentralen Veröffentlichungsorgane, wie die »Bildende Kunst« und die »Mitteilungen des Künstlerverbandes«, erschließen. Besonders erwähnen möchte ich die »Stiftung Archiv der Akademie der Künste Berlin« (SAdK) mit ihrem umfangreichen Aktenbestand des »Verbandes Bildender Künstler« (VBK-Archiv) und die Handschriftensammlung der »Sächsischen Landes- und Universitätsbibliothek Dresden« (SLUB), deren Schriftstücke und Fotografien ein besonders atmosphärisches Bild vennitteln konnten. Im »Sächsischen Staatsarchiv, Regierungsstelle Dresden« fanden sich Dokumente, die dokumentarische Lücken schließen und damit den organisatorischen Zusammenhang der Ereignisse nachzuvollziehen halfen.
10
KULTUR UND WANDEL: KANN KUNST SOZIAL WIRKSAM SEIN?
Die inhaltliche Folie der Betrachtungen über das künstlerische Feld in der SBZ und DDR bilden drei epochale, historisch unterschiedlich gelagerte und kulturell ausgeprägte Formationen. Sie zeigen Möglichkeiten auf, wie sich Sicht- und Lebensweisen als Handlungsmuster in übergeordneten gesellschaftlichen Systemen durchsetzen, und woran sie scheitern können. Ausgangslage bildet die Analyse des Geheimen, das sozial ausgeprägt in Fonn von Geheimgesellschaften in der Epoche der Aufklärung erscheint. Im Anschluss an die künstlerischen Lebensbewegungen um die Wende zum 20. Jahrhundert, mit denen den bürgerlichen Kultureinrichtungen des 19. Jahrhunderts entgegengetreten werden sollte, konnte sich dann eine Generation von Künstlern für eine relativ kurze Zeitspanne in der Weimarer Republik eigene Ausdrucksräume schaffen und Möglichkeiten kollektiver Ausdrucksmittel aufzeigen. Diese Künstlergruppen-Generation der historischen Avantgarde ist es, die in der SBZ und in der Anfangsphase der DDR an ihre Leitsterne anzuknüpfen versuchte, deren Vorstellungen jedoch von den staatlichen Kollektivierungsbestrebungen aufgefangen wurden. Erst der dritten Generation der Kunstschaffenden in der DDR wird es in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts gelingen, eigene Netzwege der Verständigung aufzubauen und die gesellschaftlichen Bedingungen zu konterkarieren.
Symbolische Vermittlung eine kunstsoziologische Betrachtungsweise In sozialen Gruppen finden sich gleichgerichtete Interessen von Individuen gebündelt wieder. Hier werden je besondere Beziehungen transportiert und entsprechende Ordnungsprinzipien generiert. Das Interpretationsmodell der Symbolischen Vermittlung filtert Grundsätze von Gemeinschaftsprozessen und lässt diese greifbar werden. Drei Ebenen kultureller Manifestationen werden dabei unterschieden: Ausgehend von den Absichten, die zu einem Gruppenzusammenschluss
11
KOLLEKTIVIERUNG DER PHANTASIE?
führen, werden die Handlungsweisen, mit denen die Gründungsmotive umgesetzt werden sollen und die aus beiden geschaffene und hiennit verbundene Dingwelt erschlossen. Die drei Betrachtungsebenen der Vorstellung, des Austauschs und des Ausdrucks stellen nicht reduzierbare Extrakte der Symbolischen Vermittlung dar und tragen zur Unterscheidbarkeit sozialer Gruppenbildungen bei. Diese Bestimmungen erleichtern den interpretatorischen Zugang zu den mannigfaltigen Gruppenbildungsprozessen der Künstlergruppen-Generation 1 und werden zur Darstellung und Interpretation ihrer Vorstellungen und Aktionsfelder herangezogen. Die Annahme lautet, dass jedes soziale Beziehungsgeflecht symbolisch ausgedrückt wird und daher jegliche Ausdrucksformen, im Sinne von Transformationen des sozialen Lebens, bestimmt werden können. Symbole strukturieren die Wirklichkeit und generieren die Weltbezüglichkeit des Menschen sowohl auf der Vorstellungs- als auch auf der Handlungsebene.2 Sie wirken als Transformatoren in die soziale Welt hinein und markieren gleichsam Prozesse der Vergesellschaftung, die es ermöglichen, den Mechanismen sozialer Wirkungszusammenhänge nachzugehen. Mit Symbolischer Vermittlung werden also Vorgänge bezeichnet, mit denen durch kulturelle Leistungen sichtbare soziale Ordnungsgefüge hergestellt werden und sich in diesen, wie generell in Ausdrucks-, Mitteilungs- und Kommunikationsformen, manifestieren. 3 Zur Konkretisierung des Symbolbegriffes werden die Überlegungen von Ernst Cassirer übernommen. Er erkennt das Prinzip des Symbolischen als immanenten Bestandteil menschlicher Kultur. Der Mensch lebe nicht mehr in einem bloß physikalischen, sondern in einem symbolischen Universum: »Sprache, Mythos, Kunst und Religion sind Bestandteile dieses Universums. Sie sind die vielgestaltigen Fäden, aus denen das Symbolnetz, das Gespinst menschlicher Erfahnmg gewebt ist.« (Cassirer 1990: 50)
2
3
Es handelt es um ein Modell, dem beliebig andere soziale Austauschverhältnisse zum Inhalt gereichen können. Die Erweiterung des Symbolbegriffs durch die Komponente der Handlungsebene ermöglicht es, die Stabilisierung kultureller Lebensformen und die unbewusste Automatisierung des Verhaltens zu erkennen. Den Überlegungen von Hans Paul Bahrdt folgend, werden Symbole von Zeichen unterschieden. Zeichen sind alltägliche Vetmittlungsleistungen, die über eine bloße Abfolge von Bedeutungen gebildet werden. Hingegen Symbole fiir Sachverhalte stehen, die Sinnprovinzen angehören und sich von der alltäglichen Lebenswelt abheben. (Bahrdt 1996: 106). Cassirer unterscheidet zwischen Signalen und Symbolen, in Anlehnung an die Zeichentheorie von Charles W. Morris. (Vgl. Morris 1972) Für Morris sind Signale »Operatoren« und Symbole »Designatoren«. (Cassirer 1990: 58)
12
KULTUR UND WANDEL
Der strukturalen Vorgehensweise liegen primär die Überlegungen von Pierre Bourdieu zugrunde, der die Bedeutung symbolischer Ordnungen fur die Reproduktion von Machtverhältnissen in ausgewählten Wirkungsfeldern heraus gearbeitet hat. Seine Analysen speisen sich aus der Frage, aus welchen Bedingungen heraus sich Machtpositionen erklären lassen und wie sich diese äußern. (Bourdieu 1994) An welchen Orten sich das gesamte kulturelle Wissen in symbolischen Formen verkörpert, konkretisiert Jürgen Habermas anschaulich an historischen Beispielen: in Sitten und Gebräuchen, Verboten, Überzeugungen, Motiven, Einstellungen, in sichtbaren Kulturprodukten. Oder, wie Habennas selbst fonnuliert: »Kulturelles Wissen ist in symbolischen Formen verkörpert - in Gebrauchsgegenständen und Technologien, in Worten und Theorien, in Büchern und Dokumenten nicht weniger als in Handlungen.« (Habermas 1988b: 98)
Vorstellungen, Austausch, Ausdruck Eine Analyse von Gruppenbildungsprozessen ist immer anspruchsvoll, da kulturelle Leistungen zu vielgestaltig in ihrer Erscheinung sind, als dass sie in all ihren Merkmalsausprägungen erfasst werden können (Tenbruck 1989: 51). Typisierungen stellen eine Möglichkeit dar, soziale Ausprägungen in gruppierende Unterscheidung zu bringen. Sie bergen jedoch die Gefahr, dass Mischfonnen generiert werden, in die nicht zuweisbare Merkmalsträger eingebracht werden. Auch lassen sich bei mangelnder oder fehlender Konzeption unzählige Ordnungsmuster konstruieren - je nach Erscheinen und Anzahl der als bedeutend erachteten Ausprägungen. Es kann also nicht darum gehen, sämtliche beobachtbare Erscheinungen nachzuzeichnen, wie auch umgekehrt auf einer gewissen Abstraktionsstufe4 kaum mehr Strukturen erkennbar werden, die losgelöst vom ursprünglichen Betrachtungsfeld einen Zugang zu ähnlich gelagerten Phänomenen eröffnen können. Denn je größer die sozialen Wirkungskreise gezogen werden, desto unwahrscheinlicher erscheinen gesellschaftliche Unterschiede und Übereinstimmungen der einzelnen Subjekte.5 Um Symbolisierungsleistungen einfangen zu können, kommt es also weniger darauf an, nach den Bestandteilen, als vielmehr nach deren
4 5
Vgl. die Konzeption von Raymond Boudon, die in dem Kapitel »Gegenkultur und sozialer Wandel« dargestellt wird. Auch erweist sich eine vergleichende Analyse als unmöglich, werden Ausprägungen verschiedener Couleur zur Kategorisierung herangezogen.
13
KOLLEKTIVIERUNG DER PHANTASIE?
Beziehungen zu fragen, die als Abweichungen im sozialen Beziehungsgeflecht erkennbar werden. Die spärlichen und zuvörderst von kunstwissenschaftlicher Seite aus vorgenommenen typisierten Analysen von Künstlergruppen zielen u.a. auf eine Gleichsetzung von Inhalt und Form: So wird beispielsweise ein Vertrautenkreis als Modus einer Gruppendifferenzierung und nicht als eine mögliche Ausgangslage fur sich anschließende, je unterschiedlich ausgerichtete Gruppenformen genommen. Dadurch werden soziale Entwicklungen durch Zuweisung unterbrochen, und die prozessualen Vorgänge des originären Betrachtungsgegenstandes gehen verloren. Anschauliches Material liefern die Mitte des 19. Jahrhunderts aus Kritik an den bürgerlich dominierten Künstlergenossenschaften abgespaltenen, sezessionistischen Zusammenschlüsse. Die Zuweisungen, wie »pragmatische Ausrichtung« und »lokaler Wirkungskreis«, sind historisch fixierte und greifen als unterscheidende Kriterien bei der KünstlergruppenGeneration der historischen Avantgarde nicht mehr. Diese Gruppenbildungen müssen in ihrem Verlauf betrachtet und Bruchstellen" markieti werden, an diesen lassen sich Verschiebungen und Kontinuitäten erkennen und klären, weshalb etwas nicht funktioniert. Den umfassendsten Versuch, die Bedingungen und Ausfonnungen von Künstlergruppen zu untersuchen, hat Hans Peter Thurn unternommen. Er legt dem Selbstverständnis des individualisierten Künstlers der Modeme vier Prämissen zugrunde: Individualität, Originalität, Virtuosität und Universalität. Aus diesen haben sich, so schlussfolgert Thurn, drei Professionstypen ausgebildet. Der im Geniebegriff verewigte »Malerfurst«; der »Peintre Maudite«, der konventionelle Verhaltensmuster und Lebensformen aufkündigt; und der Typus des »Normalkünstlers«, zu dem er den »Entbehrlichen« zurechnet. (Thurn 1991: 101f.) Diese drei Künstlertypen werden von Thurn als Grundlagen für Künstlergruppen herangezogen. Die Motivation zur Bildung von Künstlergruppen sieht Thurn im »Prozesses des Solitarismus«7 des 19. Jahrhundert begründet. Eine theoriengeleitete und nicht historisch angebundene Zugangsweise fur die Interpretation sozialer Ausdifferenzierung in Beziehung zum Gesamtsystem und die Abhängigkeitsverhältnisse in diesem, hat Pi-
6 7
Durch das Aufzeigen fehlender Elemente werden Transformationsgesetze markiert und Verschleiemngen aufgelöst. (Bourdieu 1987: 39) Eine ähnliche Argumentationslinie verfolgt Florian Rötzer: Weil der Individualismus der Künste und der Künstler durch Gemeinschaftlichkeit überschritten werden sollte, wurden die Bauhütten für die Romantik und auch fiir Gmppen oder Institutionen wie de Stijl, Der blaue Reiter oder das Bauhaus zum Vorbild ihrer Suche nach Einheit. (Rötzer 1991: 77)
14
KULTUR UND WANDEL
erre Bourdieu mit seiner Habituskonzeption8 eröffnet. (Bourdieu 1994: 7ff.) In Anlehnung an diese Konzeption und- entsprechend der übergeordneten Fragestellung nach den Möglichkeiten und Wirkungsmechanismen gegenkultureHer Vorstellungen und Handlungsweisen - wurde die Methode der Symbolischen Vermittlung entworfen, mit der die sozialen Wirkungsprozesse über Differenzierung im gewichteten Wechselspiel von Vermittlungsfunktionen vergleichbar gemacht werden können. Soziale Gruppen, so die Prämisse, differenzieren sich über gemeinsame Ideen, die jeweils bestimmte Handlungen und jeweils bestimmte Produkte entstehen lassen, die nicht subsumiert werden können. Dabei bedingen sich die drei Symbolisierungsleistungen der Vorstellung, des Austauschs und des Ausdruck~. Diese lassen jeweils unterschiedliche Medien der Vermittlung sichtbar werden: Gefragt werden kann nach dem Grund, weshalb sich ein sozialer Zusammenschluss formiert, nach der Struktur, wie die Mitglieder ihre Umwelt gestalten, nach ihrem Verhältnis zum Gesamtsystem und nach den Dingen, die in diesem Zusammenhang geschaffen werden. Die Vermittlungsfunktionen im Einzelnen: Die Motivation zu einer Gruppengründung lässt sich direkt aus den Proklamationen, dem Konglomerat von Absichten ablesen - beispielsweise in Form von Manifestationen und Programmen- oder interpretierend aus dem gemeinschaftlichen Handeln der Mitglieder erschließen. Die Gründungsmotivation ist von Interesse, weil sich hieraus die sozialen Bedürfnislagen und die als problematisch angesehenen gesellschaftlichen Bedingungen erkennen lassen - in unserem Fall zudem ersichtlich an Gruppentransformationen und Neudefinitionen. Dazu gehören nach außen getragene Willensbekundungen, zur Abgrenzung der eigenen Interessen, und Bekräftigung dieser im Inneren. Manifeste werden mit dem Zweck erstellt, Identität nach außen wie nach innen zu sichern, durch Sichtbarmachung auf einer appellativen Ebene. Allgemein gesprochen sind Proklamationen immer polarisierende Muster der Argumentation gemein: V ergangenes und Zukünftiges werden voneinander geschieden und der Wunsch nach kollektiver Selbstvergewisserung und Positionierung in der Gesamtgesellschaft verdeutlicht. Die Prinzipien sozialer Vemetzung werden über Austausch im Innenund im Außenverhältnis hergestellt. Im Innenverhältnis werden die Mechanismen des Austauschs sichtbar an Regeln, Ritualen, Sondersprachen und Transfonnationen. Im Außenverhältnis erscheinen sie in den Medien 8
Bedingungen und Anschlüsse stellen die Vermittlung dar, zwischen dem System der objektiven Möglichkeiten und dem System der direkt wahrnehmbaren Verhaltensfonnen. (Bourdieu 1987: 40)
15
KOLLEKTIVIERUNG DER PHANTASIE?
der Darstellung und werden durch Aktionen fixiert. Interaktionsrituale, als wiederkehrende Handlungen, verfestigen die Binnenstrukturen der Gruppen. Sie dienen zunächst als Mittel der Selbstkonstruktion und werden als symbolisches Handeln zur Grundlage der Verständigung. 9 Merkmale im Innen- resp. Außenverhältnis betreffen vor allem die Inklusions- und Exklusionsbestrebungen. Diese zeigen an, wie die Vorstellungsweiten einer Gruppe in Handlungen umgesetzt werden. Im Innenverhältnis schlagen sich die Vorstellungen unmittelbar in der Organisation ihrer Mitglieder nieder, beispielsweise als Freundschaftsbund, als Massenorganisation oder als exklusiver Kreis, und spiegeln die Beziehungen wider, die im Außenverhältnis aufgebaut werden sollen: zu Mentoren, zu einem ausgewählten Publikum oder in der Absage an alle diese. Dementsprechend werden innerhalb der Gruppe hierarchisch-funktionale Bindungsmuster oder Kreisstrukturen aufgebaut. Gruppen stabilisierende Elemente, wie programmatische Leitideen, die die sozialen Beziehungen regeln, sind ein bestimmendes Zeichen bei Künstlerzusammenschlüssen mit exklusivem Impetus, deren Leitideen über Referenzbildung und über Selbst- resp. Fremdbildkonstruktionen gesichert werden sollen. Ein weiteres Merkmal des Austauschs sind Zerwürfnisse. Diese führen zu Um- und Neuorganisationen, markieren Transformationen innerhalb der Gruppe und zeigen vor allem die mitgeführten gesellschaftlichen Bedingungen an. So werden je nach Ausrichtung der Gruppe Handlungsmuster gewählt, die eher innen geleitet sind oder, beispielsweise durch Provokation, nach Außen geleitete Wirkungen beabsichtigen. Die Medien des Ausdrucks speichern und festigen die Identität der Gruppe im Inneren und fonnen ihr Außenbild. In diesen Bereich fallen artifiziell hergestellte Objekte, wie Kunstwerke, Schriftbanner, Postkarten, Erkennungszeichen und Geheimsprachen oder andere Formen der Verdinglichung sozialer Vorstellungen, wie beispielsweise die Pläne zur Landschaftsgestaltung von Geheimbünden (vgl. Hajos 1989; Reinhardt 1988). Die Orte der Mitgliederversammlungen 10 werden meist von den Initiatoren selbst bestimmt und richten sich nach den Zielen, Möglichkeiten und automatisierten Handlungsabläufen der Gruppe.
9
Vgl. die Bedeutung von Handlungsanweisungen für die gesteigerte Hierarchienbildung und die zunehmende Bedeutung von Ritualen bei den Geheimbünden des 18. Jahrhunderts in dem Exkurs »Das Geheime im Sozialen«. 10 Die Orte der Gründungen waren beispielsweise ein Kaffeetisch in einer Gartenlaube in Sindelfingen, das »Cafe de Flore« in Paris, Ateliers oder eine Moorwanderung, die zur Initiation der Warpsweder Künstlerkolonie wnrde.
16
KULTUR UND WANDEL
Vorab bemerkt: In der biografischen Erinnerung bleibt die Gruppenzugehörigkeit ein primäres Ereignis, gerade wegen der Bestätigung der eigenen Ideenwelt und Handlungen durch Anhindung an andere. Künstlergemeinschaften formieren sich meist im kleinen Kreis, der selten mehr als vier oder fünf Personen umfasst. Diese bilden den künstlerischen und organisatorischen Kern. Das Alter der Gruppengründer liegt zwischen den entscheidenden Phasen der Ausbildung und des individuellen Engagements. In diesem Abschnitt des biografischen Werdegangs empfinden sich die Künstler verstärkt als nachrückende Generation, weshalb Gruppengründungen den Verdrängungsprozess der Generationen strategisch beschleunigen. (Thurn 1991: 112ff.) In der DDR geschah dies nicht so, wie in dem Kapitel »Phasen und Zäsuren in der SBZ und DDR« ausgeführt wird.
Historische Transformationen des künstlerischen Feldes Ausgangsbasis und Kennzeichen der modernen Gesellschaft - seit der Französischen Revolution - ist das Auftauchen des Individuums als neuem gesellschaftlichem Agenten, dessen Konstituierung erst durch den Grad der Gestaltungschancen ennöglicht worden war. Der Individualisierungsschub, der im Kunstbereich im 19. Jahrhundert einsetzte, ließ die Künstler aus den bestehenden Organisationsmedien heraustreten und eigene Zentren der Verarbeitung schaffen. Aus dieser Außenseiterposition heraus, schuf der Künstler sich eine Gemeinde, mit all der Pluralität und mit all der übersteigerten Erwartung, die sich notwendig aus dem Anspruch ergibt, dass die eigene Schaffensform und Schaffensbotschaft die wahre sei. (Gadamer 1977: 8) Es bildeten sich zwei grundlegende Stränge von Künstlerzusammenschlüssen heraus. Bürgerliches Verständnis schlug sich im Vereinswesen nieder. Ihre Institutionen der Vermittlung im kulturellen Bereich waren Kunstvereine, Museumsgesellschaften und Kunstgenossenschaften. In der Gegenbewegung zur bürgerlichen Aneignung des kulturellen Lebens als Kulturbetrieb, fanden sich Künstler zunächst massenhaft in Künstlerkolonien und später in Sezessionen zusammen. Neu waren überdies kunststilistisch motivierte Zusammenschlüsse, wie beispielsweise die des Impressionismus gegen Ende des Jahrhunderts. Getragen und vorbereitet von den Lebensrefonnbewegungen um 1900, eröffnete dann die Künstlerschaft der historischen Avantgarde mit Elementen vormals vereinzelter Anschauungen und Lebensweisen ein Sammelsurium je differenter Vorstellungs-, Austausch- und Ausdrucksformen. Im Zuge der gesellschaftlichen Bedingungen geriet die Avantgarde so zu einer sozialen
17
KOLLEKTIVIERUNG DER PHANTASIE?
Bewegung, ohne aber letztlich Einfluss zu gewinnen. 11 Die gemeinsame Geisteshaltung lag nicht mehr nur in der Flucht aus dem Gefüge der Gesellschaft oder der teilausgerichteten, ökonomischen Kritik begründet, sondern in dem Willen zur Umgestaltung der Gesellschaft und kristallisierte sich im Gemeinschaftserlebnis und in der Forderung nach der Verbindung zwischen Kunst und Leben 12 aus. Im Übergang zu diesen selbstbestimmbaren Lebens- und Kunstformen hatten sich während der Zeit der Aufklärung gesellschaftlich motivierte Zusammenschlüsse in Debattierklubs und Lesegesellschaften gebildet. Diese bürgerlichen Emanzipationsbestrebungen waren gekennzeichnet von einer Durchmischung von Rezipienten und Produzenten. Die Assoziation 13 als freier organisatorischer Zusammenschluss, mit den Merkmalen des selbst gewählten Beitritts, des selbst gewählten Austritts und der selbst gewählten Auflösung, lockerte die durch Geburt und Stand bestimmte und auf das Ganze des Lebens unspezifisch ausgerichtete Organisation der Korporation, die für ihre Mitglieder noch rechtsbestimmenden Charakter hatte. (Nipperdey 1972: 1) 14 Man orientierte sich jetzt an Abstrakta wie Menschheit, Nation, Aufgeklärten und Gemeinschaft. (Ibid.: 10) Es bildeten sich Kaffeehausgesellschaften, Salongesellschaften und Tischgesellschaften. Deren konstitutives Merkmal bestand in der Ablösung der repräsentativen Öffentlichkeit der Höfe durch Institutionen ei-
11 Vgl. das Kapitel über die Künstlergruppen-Generation »Aktionsfelder und Vorstellungen in der Weimarer Republik«. 12 Das Bedürfnis nach Annäherung von Kunst und Leben richtete sich gegen den Historismus (Ruppert 1998: 176) und war in Reaktion auf die Zuschreibung des Geistigen der Kunst und der Abspaltung dieser vom Alltagsleben entstanden (ibid.: 578). 13 Die ersten Assoziationen hatten ideale Zwecke, die aus dem Selbstverständnis der Aufklärung und den neuen kulturellen Ansprüchen entstanden waren. Im zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts gewannen ökonomische Faktoren für die Vereinsbildung an Bedeutung; in den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts organisierten sich kirchliche, konservative und proletarische Gruppen. (Nipperdey 1972: 12) 14 Das Vereinswesen wurde »zu einer die sozialen Beziehungen der Menschen organisierenden und prägenden Macht«. Ab Ende des 18. Jahrhunderts waren es zunächst landwirtschaftliche, patriotische und bildungsorientierte Gesellschaften und Musiziergesellschaften. Es folgten die ersten rein geselligen Vereinigungen wie der Club der Freundschaft oder die Harmoniegesellschaft. In Großstädten bildeten sich philanthropische Wohlfahrtsvereine und pietistische Vereine. Schließlich organisierten sich politisch motivierte und unzählige informelle Gruppen in Salons, in Kreisen und in Kaffeehäusern. In den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts verbreiteten sich dann Kunst-, Konzert- und Gesangvereine. (Nipperdey 1972: 2)
18
KULTUR UND WANDEL
ner bürgerlichen. Zunächst als Zentren der literarischen, dann der politischen Kritik/ 5 entstanden diese Diskursgemeinschaften 16 als Medien für den gedanklichen Austausch unter Privatleuten. 17 Denn soziale Gleichheit war nur als eine Gleichheit außerhalb des Staates möglich, in der Exklusivität gegenüber dem absolutistischen Bereich. (Habermas 1975: 51f.) Der Zusammenschluss der Privatleute erfolgte als Arkandisziplin, da nur in der Abgeschlossenheit die Fesseln des Absolutismus abgestreift und gemeinsame Ideale bestätigt werden konnten: Die moderne Gesellschaft konstituierte sich über diese freien Zusammenschlüsse und bewirkte die »Selbstmobilisierung gesellschaftlicher Kräfte«. (Tenbruck 1989: 221 f.) Nach der Emanzipation weiter Teile der Gesellschaft transformierten sich die Geheimgesellschaften in bürgerliche Öffentlichkeiten, und die Arkanpraxis verfiel in dem Maße, in dem sich bürgerliche Öffentlichkeit gegen die obrigkeitlich reglementierte Herrschaft durchsetzen konnte. Transformiert wurden der Umgangsstil, die Intimität und die Moral, die nun »nicht mehr der Veranstaltung zeremonieller Brüderlichkeit« bedurften. (Habennas 1975: 51) Die Verbürgerlichung von Kultur, und parallel dazu deren Autonomisierung vom bestehenden System, setzte im 19. Jahrhundert mit dem Vereinswesen ein. Dieses war ein neues Prinzip der Vergesellschaftung, in Form frei wählbarer und abwählbarer Zusammenschlüsse. Die kulturell geprägten Werte drangen in das Lebensgefühl ein und motivierten das Bürgertum, die den Alltag überstrahlende Wirkung von Kunst für sich zu vereinnahmen. 18 (Nipperdey 1972: 26) Im ausgehenden 18. Jahr15 Sprachgesellschaften hatten ihre Blütezeit im 17. Jahrhundert, Salons zwischen Regentschaft und Revolution und Kaffeehäuser zwischen 1680 und 1730. Während in diesen ausschließlich Männer zugelassen waren, wurden Salongesellschaften wesentlich von Frauen, in Reaktion auf die Männerbündnisse, gebildet. (Habermas 1975: 48f.) 16 Gegen das Zeremoniell der Ränge setzte sich der Takt der Ebenbürtigkeit durch Selbstverständnis des Menschlichen durch. Es bildete sich ein Publikum von Privatleuten, das Bereiche problematisierte, die bis dahin nicht als fragwürdig galten. (Habermas 1975: 52) 17 Die höfische Aristokratie des 17. Jahrhunderts war noch kein Lesepublikum und unterhielt Literaten wie Bedienstete, deren mäzenatisch begründete Produktion entsprach einer Art conspicious consumption. (Habermas 1975: 54) 18 In den Vereinen fanden Beamte, akademisch Gebildete und der Adel zusammen. Diese neue Oberschicht wurde für den bürokratisch-monarchischen Staat des frühen 19. Jahrhunderts charakteristisch. Das Vereinswesen trug entscheidend dazu bei, dass der Adel in die bürgerlich-staatsbürgerliche Gesellschaft eingebürgert wurde und sich verbürgerlichte. (Nipperdey 1972: 15)
19
KOLLEKTIVIERUNG DER PHANTASIE?
hundert hatte sich hierfür ein spezifisch sozialer Raum mit eigenen Institutionen soweit konstituiert, dass der Künstlerhabitus in die bürgerliche Gesellschaft integriert werden konnte. Mit der veränderten Rolle des Künstlers und der Rezeption der Werke ging auch die Verstaatlichung des Bildungswesens einher. Es wurden neue Fom1en der Kunstvermittlung, wie Kunstkritik und Kunstausstellungen, als Institutionen der bürgerlichen Öffentlichkeit, geschaffen. Diese waren ökonomisch motiviert und für die Künstler die Bühne der Präsentation ihrer Werke und nicht ihrer Person. (Ruppert 1998: 579) Den Künstlern wurden nun die geistige Artikulation der bürgerlichen Gesellschaft und die ästhetische Gestaltung der individuellen Lebenswelt übertragen. Von besonderem Interesse in unserem Zusammenhang ist, dass Vereine zur Vertretung gesellschaftlich bedeutender Interessen beigetragen haben, wohingegen bei ständisch geprägten Korporationen Gruppeninteressen im Vordergrund gestanden hatten. 19 Im Verein konnte sich Privatheit, als Voraussetzung der bürgerlichen Öffentlichkeit, in einer differenzierten und individualisierten Welt ausbilden und der Mensch gewann »[ ... ] sein Leben innengeleitet als >persönlicher Stand< aus Bildung und Leistung«. 20 (Nipperdey 1972: 10) Im Verein konnte - im Unterschied zur Zweitwelt der Geheimbünde - die ganze Persönlichkeit zur Geltung gebracht werden. Hierin wurde sich die Gesellschaft ihrer selbst bewusst. Aufgebaut auf Eigeninitiative und Selbstorganisation, war das Vereinswesen zunächst ein Faktor der Mobilisierung im Übergang von der ständischen zur bürgerlichen Gesellschaft. Im Unterschied zur Kunstproduktion von Höfen und Adel, wurde das Postulat der Selbstständigkeit des Künstlers als gesellschaftlichem Akteur nun zu einer der zentralen Zuschreibungen. Kunstvereine als bürgerliche Assoziationen schufen außerhalb des Hofes und der Akademien einen Ort für Künstler und Werke und förderten deren Rezeption durch Organisation einer bürgerlichen Kunstöffentlichkeit Sie setzten sich die Aufgabe, Kunst einem breiten Publikum zu vem1itteln. Das Mittel dazu waren Kunstreproduktionen, die als Jahresgaben an alle Mitglieder verteilt wurden. Kultur trat damit einen unpolitisch-ästhetischen Rückzug an, die im Vereinswesen organisierten kulturellen Aktivitäten sonderten sich von anderen menschlichen Aktivitäten ab und differenzierten sich in 19 »Die Korporation ist ein polyfunktionales, unspezifizierte Interessen bündelndes Gebilde, das den ganzen Lebenskreis des Menschen außerhalb von Haus und Kirche umspannt; die Wettorientierung der Korporation ist partikularistisch auf die Gruppe, nicht auf die ganze Gesellschaft bezogen.« (Nipperdey 1972: 7f.) 20 Die Vereinstätigkeit hatte wiederum Einfluss auf den sozialen Rang, den Bürger im öffentlichen Leben einnahmen. (Nipperdey 1972: 17f.)
20
KULTUR UND WANDEL
Gruppen aus. (Ibid.: 26ff.) Schließlich organisierten die Künstler ihren Berufsstand in den Künstlergenossenschaften, um den ökonomischen Problemen des freien Arbeitens und der drohenden Isolation entgegenzuwirken.21 Parallel zu der vom Bürgertum bestimmten und im Vereinswesen organisierten Kunstrezeption, traten selbst gewählte und örtlich begrenzte Lebens- und Kunstgemeinschaften hervor. Diese verband - im Unterschied zu Kunstinteressierten bürgerlicher Couleur - eine Sehnsucht nach volkstümlicher Wirkung (Haus 1971: 8). Den Beginn dieser Gruppenbewegungen zeigt der »Künstlerorden« der Nazarener22 an. Mit den erstarrten Ausbildungsriten in Wien unzufrieden, lag ihr Interesse zunächst in einem freundschaftlichen Austausch von Gleichgesinnten.Z3 Bereits ein Jahr später fonnten die Künstler in einem verlassenen Kloster nahe Rom24 eine Gemeinschaft auf der Grundlage asketischer Lebensweise. Sie schwören einander Treue in Kunst und Leben und besiegelten ihren Bund mit Riten und Symbolen. Ihre Aufgabe sah der Freundeskreis darin, die Kunst auf der Grundlage einer volkstümlich-religiösen Lebens- und Kunstgemeinde, geprägt von moralischen und religiösen Idealen, zu emeuem25 (Blazek 1999: 81f.). Die Nazarener verstanden sich als missionarischer Künstlerorden, der um eine rege Jüngerschaft bemüht war und Gleichgesinnte feierlich aufnahm, wogegen Abtrünnige nachdrücklich ausgestoßen wurden (Thum 1991: 103).
21 Anlässlich eines Treffens in Koblenz wurde 1836 die Standesorganisation, die Allgemeine Deutsche Kunstgenossenschaft, gegründet. (Ruppert 1998: 173) 22 Die Lukasbruderschaft wurde 1809 in Wien von den Freunden und Schülern der Wiener Akademie Johann Friedrich Overbeck, Franz Pforr, Johann K. Hottinger, JosefWintergerst, Ludwig Vogel und Joseph Suttner gegründet (der Heilige Lukas war Schutzpatron der spätmittelalterlichen Malerzünfte). Ein Jahr nach der Konstituierung nannte sich die Bruderschaft in Lukasbund um. (Blazek 1999: 80) In Rom erhielt die Gmppe die Bezeichnung Nazarener, der zunächst als Spottname gedacht war, in Anlehnung an das Gemälde »Christus« von Raffael, wegen der langen Haartracht »alla nazarena« (nach Art des Nazareners Jesu). Später wurde die Bezeichnung als Stilbegriff in der Kunst verwandt. 23 Am 10. Juli 1809 in Wien besiegelten die Nazarener beim Abendessen ihre Gemeinschaft: »Wir gaben uns die Hände, und der Bund war geschlossen [... ]«. (Zit. n. Thurn 1991: 109) 24 Zunächst in der Villa Malta, später im Kloster Sant' Isidoro am Pincio. 25 1813 zum katholischen Glauben konvertiert, wirkte Overbeck im 19. Jahrhundert stark auf die religiöse Kunst ein und prägte den Christus-Typus der Zeit, der durch Reproduktionen weite Verbreitung fand. Nach dem Vorbild Overbecks traten alle Mitglieder der Nazarener zum Katholizismus über.
21
KOLLEKTIVIERUNG DER PHANTASIE?
Das mönchische Gemeinschaftsleben erscheint als rituelle Fortführung der Geheimgesellschaften der AufkJärung. 26 Die Künstler bekräftigten ihren Zusammenschluss und ihre gemeinsame Lebens- und Kunstkonzeption durch den abgeschlossenen Raum einer Kolonie. Sie trugen eine eigene Tracht und bedienten sich u.a. bei der Aufnahme neuer Mitglieder spezieller Initiationsriten. 27 Die romantisch überhöhte Vorstellung des eigenen Wirkensund Lebens war mit den Tugenden der Aufrichtigkeit, des Mutes, der Treue, der Glaubensfestigkeit und der Reinheit verbunden. 28 Die Beziehungsform wurde gestützt durch Treuegelöbnisse, den Versprechen der gegenseitigen Hilfe und Unterstützung sowie IiteraJen Techniken der Distanzüberwindung (Thurn 1991: 116). Beispielsweise entwickelten die Nazarener eine Zeichenkette, bei der Radierungen und Künstlerzeichen mit persönlichen Eintragungen weiter getragen wurden und den Freundschaftskult verfestigen helfen sollten. Die Mitglieder nannten sich gegenseitig >»KlosterbrüderStandardXL Kunstausstellung< 1988) 142 Sowohl Mitgliederzahl als auch personelle Besetzung der Arbeitsgruppe waren nicht konstant. Zu den ursprünglich vom Zentralvorstand berufenen Mitgliedern der Arbeitsgruppe kamen bereits zur 1. Beratung weitere Mitarbeiter hinzu. Darüber hinaus hat sich Dr. Bemd Linder, wie er sich im Februar 1998 auf Anfrage erinnerte, in Eigeninitiative um die Teilnahme bemüht. Durchschnittlich nahmen 13 bis 17 Mitglieder - in stark wechselnder Besetzung - an den ersten Sitzungen teil: »Für die Beratung am 16. September möchte ich mich auf Grund objektiver Gründe entschuldigen.« (Peuker 1988) Zu einem jähen Einbruch kam es bei der 5. Beratung Mitte Dezember 1988, bei der zudem der Leiter der »Abteilung Bildende Kunst« des Ministeriums für Kultur der DDR, Dr. Joachim Alt, anwesend war. Diese Sitzung schloss sich dem »X. Kongreß des Verbands Bildender Künstler der DDR« an, bei dem der Leiter der Arbeitsgruppe, Dieter Rex, die Ideenkonzeption der Arbeitsgruppe vorgestellt hatte. 143 Dies könnte m.E. auch damit zusammenhängen, dass das vorliegende Aktenmaterial über die Planungen der 11. Kunstausstellung von Dr. Peter Michel stammt und dieser bei der 5. Beratung der Arbeitsgruppe nicht anwesend war. (Vgl. Michel 1989) 144 Vgl. die Protokollmitschrift einer Tagung der ZSL. (ZSL 1987)
63
KOLLEKTIVIERUNG DER PHANTASIE?
stellen. In der »Ideenkonzeption« wurde um jede Formulierung gerungen und das Handeln auf vermeintliche Reaktionen buchstäblich abgestimmt.145 Es bestand aber weit mehr Unzufriedenheit über die starren Formen und die tradierten Inhalte, als diese hätten institutionell umgesetzt werden können. Bestätigt wird diese Annahme von dem Beschluss des Zentralvorstandes, die monatelang diskutierte und mehrmals überdachte Ideenkonzeption der Arbeitsgruppe letztlich zu verwerfen 146: »[ ... ] generelle Regie wird nicht akzeptiert [... ] die Malerei/Grafik und Plastik sollte alles beim alten lassen [ ... ] alle augewandten Bereiche müßten regiemäßig aufbereitet werden[ ... ).« (Zusammenfassung ZV [1990]) Im Verlauf der Diskussion scheinen immer mehr Problemstellen auf und deutlich auch als solche benannt. Mit Proklamationen und Versprechungen147 wollte man sich nicht mehr begnügen. Die Verweigerungshaltung junger Künstler und Künstlerinnen sahen die Mitglieder der Arbeitsgruppe in der Unzufriedenheit der jüngeren Generation begründet: »Wir leben in einer Phase hochgetrimmter Unzufriedenheit, besonders in der Jugend.« (Gerlach 1988) Mit den »Zentralen Kunstausstellungen« und dem statTen Festhalten an Organisation und inhaltlicher Konzeption könne der reale Kunstprozess in der DDR nicht mehr eingefangen werden. Andererseits hätten, bedingt durch die wachsende Anzahl der Verbandsmitglieder, immer weniger Künstler eine Möglichkeit, ihre Werke auszustellen. 148 Die bisherige Strategie der Personalveränderung in den eigenen Reihen des Verbandes hätte keine Wirkung mehr gezeigt. 149 Als Konsequenz dieser Einstellung würden die auf ihre Art eigentlich nonna145 Während man in früheren Zeiten daraufbedacht war, den Erwartungen zu entsprechen, ging es nun darum, eigene Wege zu markieren. »Es ist unerlässlich, dass wir sehr grosse Vorsicht walten lassen, damit keine berechtigten Vorwürfe gemacht werden können.« (Rudloff-Hille 1951) 146 Die im VBK-Archiv der SAdK Berlin vorliegende Akte 5251 stammt aus den Unterlagen des Kunstwissenschaftlers Dr. Peter Michel. Michel war Chefredakteur der Zeitschrift Bildende Kunst, von 1978 bis 1989 im Sekretariat des Zentralvorstandes des VBK-DDR und Mitglied der »Fachjury Malerei« ftir die Auswahl der Werke zur »X. Kunstausstellung der DDR«. Darüber hinaus stellte ein ehemaliges Mitglied der AG, Dr. Bemd Linder, seine Dokumente zur Verfiigung. 147 »Von der >Wende< wird viel gesprochen, das Wort Demokratie als Ziel allein genügt nicht, auch im Verband.« ( Gerlach 1988) 148 Jene, die schon immer bestimmt haben, was Kunst ist, hätten auch diesmal ihre subjektiven Anschauungen durchsetzen können. (Griebe [1988]) 149 Nur in einem Fall- bei der Ablösung des Kollegen Bonzin -habe sich diese Strategie bewährt. »So ist auch ein Wechsel in der Präsidentschaft nur ein schnell vergehendes Aufflackern.« Auch könne es sich der Künstlerverband nicht leisten, von den Bezirken vorgeschlagene Mitglieder abzulehnen und durch andere zu ersetzen. (Gerlach 1988)
64
KULTUR UND WANDEL
Jen, etwas schrägen Dinge, die nicht von Leuten aus dem »Abseits« stammten - »was wäre das auch bei uns?« - nicht gezeigt werden. 150 (Peuker 1988) Auf einer Anwesenheitsliste zu einer der zahlreichen Sitzungen der Arbeitsgruppe zur Planung der 11. Kunstausstellung vermerkt der Architekt Prof. Dr. Wolf-Rüdiger Eisentraut unter der Rubrik Wohnort als Einziger: »DDR«. (Anwesenheitsliste [1988])
150 Im Vorfeld einer Ausstellung in der Dresdner Galerie West sei ein kritischer Faltblatt-Text des jungen Kunstwissenschaftlers Christoph Tannert zusammengestrichen und ihm die Rede zur Eröffnung verboten worden auf Anweisung des Stadtbezirksrates ftir Kultur. Daraufhin habe Tannert, Absolvent der Dresdner Hochschule und VBK-Mitglied, seine erste Personalausstellung zurückgezogen: »Frustration ringsum. « (Griebe [1988])
65
DIE SOZIALEN PHANTASIEN DER KÜNSTLERGRUPPEN-GENERATION
Nur jenseits der vom Bürgertum etablierten Ordnungsmuster und gegen diese konnte der Schaffende der künstlerischen Moderne die Stabilisierung seines Daseins erreichen. 1 Um das frei gelassene Künstlerselbst aufzufangen und den bürgerlichen Maßgaben entgegen zu treten, schlossen sich die Künstler in der Weimarer Zeit massenhaft in selbst gewählten Organisationsmedien zusammen. Hierin konnten gemeinsam Vorstellungen entwickelt, Ideen ausgetauscht und mit Ausdrucksformen experimentiert werden. Geleitet war das gemeinschaftliche Engagement der Akteure der Künstlergruppen-Generation von dem kollektiven Wunsch, zu einer veränderten sozialen Ordnung zu gelangen. Gemeinschaftliches Handeln wurde zur alles beherrschenden Vorstellung und kristallisierte sich in mannigfaltigen Schattierungen aus. Man wollte Grenzen jeglicher Ausfonnung überwinden, auch um sich selbst Geltung zu verschaffen. Eine der wenigen künstlerischen Auseinandersetzung der Künstlergruppen-Generation mit ihren eigenen Gruppenaktivitäten ist mit der Zeichnung »Dresdner Sezession 33« von Bemhard Kretzschmar überliefert. Aus dem Vergleich mit weiteren Selbstbildnissen dieser Zeit ergibt sich die These, dass Gruppenselbstbilder entstehen, wenn Transformationen emotional dazu drängen, den Moment des Erlebten festzuhalten. Gruppenselbstbildnisse sind deshalb immer auch eine künstlerische Auseinandersetzung mit sich selbst im sozialen Gefüge. In der SBZ wurden die ersten staatlich kontrollierten Organisationsformen im kulturellen Bereich kurze Zeit nach Ende des Zweiten Weltkriegs eingerichtet. Diese vorläufig erste und den Kulturbetrieb konstituierende Gründungswelle war wenige Monate später abgeschlossen. Im gleichen Zeitabschnitt schlossen sich die ersten, nicht mehr oder nicht in den Kriegsverlauf eingebundenen Künstler zu Gruppen zusammen. Nahezu jeder Künstler der Weimarer Generation beteiligte sich an den Zusammenschlüssen dieser Anfangsjahre, trotz des mittlerweile fortgeDie sich in der Transformation des Berufsstandes (vgl. Ruppert 1998) und in veränderten künstlerischen Ausdrucksformen niederschlug.
67
KOLLEKTIVIERUNG DER PHANTASIE?
schrittenen Lebensalters. Die persönlichen Erfahrungen und die besondere Situation des Neubeginns erneuerten die wesenhaft in jüngeren Lebensabschnitten ausgeprägte Orientierung an bestätigender Gemeinschaft.
Aktionsfelder und Vorstellungen in der Weimarer Republik Geprägt von den Erlebnissen im Ersten Weltkrieg schlossen sich die um 1890 geborenen bildenden Künstler massenhaft in frei gewählten sozialen Kreisen zusammen. Hierin konnten gemeinsam Vorstellungen entwickelt, Ideen ausgetauscht und mit Ausdrucksformen experimentiert werden. Geleitet war das gemeinschaftliche Engagement von dem Willen die soziale Ordnung zu verändern. Dieses sollte durch Politisierung mit Mitteln der Kunst oder durch die Verbindung von Lebensweise und ästhetischem Ausdruck erreicht werden. Die Akteure der Künstlergrupp en-Generation begannen bereits während des Ersten Weltkriegs - in der Phase prägender Jugendzeit - selbst gewählte Organisationsmedien in Form von Zusammenschlüssen zu bilden. Massiv ausgeweitet wurden die Bestrebungen in den 20er Jahren2 des 20. Jahrhunderts, gespeist von dem Bedürfuis nach sozialer Umgestaltung durch gemeinschaftliches Engagement. Die Elemente, aus denen sich die Vorstellungswelten erhoben, bestanden aus mystisch-kosmischen, proletarisch-revolutionären sowie anarchistischen und christlichen Theoremen und können beschrieben werden als Umgestaltung des Habitus, Umgestaltung der Gesellschaft und Umgestaltung des Lebens. Mit der Ästhetisierung der Lebensweise konnte sich die künstlerische Avantgarde zwar im Prozess ihrer Ablösung aus den übergeordneten sozialen Strukturen in Gegenbewegungen konstituieren. Die zahllosen Teilkulturen vermochten es aber nicht einheitliche und verbindende Netzstrukturen aufzubauen und dadurch letztlich Einfluss zu erreichen. Die sozialen Umgestaltungen wurden von allen Künstlergruppen in je spezifischer Weise radikal eingefordert, wie dies Bruno Taut exemplarisch mit seiner Vision für den Korrespondentenkreis Die gläserne Kette3 formuliert: »Sei dies ein Magnet, das Schneekorn einer Lawine!« (Taut 1919a: 10) 2 3
Die Gründungswellen der Zusammenschlüsse lagen in den Jahren von 1918 bis 1920, um das Jahr 1925 und Ende der 20er Jahre. Die gläserne Kette (1919-1920) wurde um den Architekten Bruno Taut (1880-1938) initiiert.
68
SOZIALE PHANTASIEN
Der von den Künstlern in Wechselbeziehung zur Gesellschaft aufgebaute Entscheidungsdruck spiegelte sich in mannigfaltigen Gruppenbewegungen und Aktionen wider und äußerte sich in einer verstärkt gesellschaftlich-thematischen Ausrichtung des künstlerischen Schaffens. Dem Medium Zeitschrift kam dabei eine bedeutende Rolle zu, als Gruppenorgan oder als eigenständiger sozialer Zusammenschluss. Vermehrt wurden Stellungnahmen in Form von Manifesten und Gegenschriften sowie Plakaten, Flugblättern und illustrierter Agitationswerbung vorgebracht und je gruppeneigene Handlungsmuster entwickelt, mit denen die Binnenstruktur stabilisiert und die Unterscheidung gegenüber anderen sozialen Formierungen verdeutlicht werden konnten. Mehrheitlich wurde mit missionarischem Eifer der Wunsch nach Außenbestätigung verfochten, der sich in Verlautbanmgen und Aktionen ausdrückte. Zu bemerken sind außerdem national wie auch international ausgerichtete rege Ausstellungstätigkeiten sowie Bündnisse der Künstlergruppen untereinander. Daneben traten Zusammenschlüsse auf, die explizit keine Anhindung suchten und in ihrer Außendarstellung jegliche Gruppen- und Programmbildung negierten. Durch die strikte Abgrenzung und die geregelten Binnenstrukturen gaben sie sich aber umso mehr als Gemeinschaft zu erkennen. Die konträr angelegten Prinzipien der Gruppenbildung zeichneten sich gleichfalls in den Binnenorganisationen aller Zusammenschlüsse dieser Epoche ab. Definierte Regelhaftigkeit wiesen in erster Linie gesellschaftlich-revolutionär und lebensweltlich ausgerichtete Gruppierungen auf, während Habitus- orientierte Künstlerverbindungen zwar jeglicher Binnenanweisungen und Wiederholungsmuster entsagten, diese aber dennoch in angepasster Übereinkunft praktizierten, um die Gruppenstabilität zu gewährleisten. Eine gemeinsame Position bezog die in Gruppen organisierte Künstlerschaft der Weimarer Epoche gegenüber dem herrschenden Bürgertum. Dieses hatte die Bedingungen für die Autonomisierung des künstlerischen Feldes geschaffen und gereichte nunmehr zum verinnerlichten Feindbild: »ABC KÄMPFT GEGEN DAS BÜRGERLICHE ZEITALTER!« (ABC 1927/28:
12t
4
Die ABC-Beiträge erschienen von 1924 bis 1925 in sechs Heften und von 1926 bis 1928 in vier Ausgaben. Neben Mart Stam und Hans Schmidt bestand das Autorenkollektiv aus Paul Artaria, Emil Roth und EI Lissitzky. Die Architekten verfochten die Idee, eine neue Gesellschaft durch neues Bauen einer neuen Generation von Architekten, Künstlern und Ingenieuren zu errichten. Allerdings lassen die Beiträge eine eindeutige Konzeption vermissen, sieht man von dem Gedanken der architektonischen Normierung ab. Hierin wird die Rationalisierung aller Lebensbereiche verfochten (durch das »Exakte der Normierung«, »reine und klare Aussagen« und
69
KOLLEKTIVIERUNG DER PHANTASIE?
Generell gesprochen führt die Ablösung aus bekannten Strukturen dazu, dass neue Sichtweisen erst entwickelt werden können. Die Bestrebungen dieser Künstlergeneration trafen jedoch zusätzlich auf soziale Bedingungen, die neue Vorstellungs-, Handlungs- und Ausdrucksmuster geradezu herausforderten und in deren Konsequenzen bildhaft radikale Formbrüche und veränderte inhaltliche Bezugnahmen ausgestaltet sowie je besondere Handlungsmuster geschaffen wurden. Die Gruppenbewegungen der Künstlergruppen-Generation erscheinen zuvörderst als Reaktion auf eine fragmentarische Konstitution der Gesellschaft5 und sind historisch betrachtet das Ergebnis ihrer Komplexitätssteigerung, in deren sozialer Konsequenz das Individuum mehrere Rollen aufbauen und partielle Beziehungen in wechselnden Interaktionen unterhalten musste. Da nur über die eigene Ausgestaltung des Lebensraums die Einheitlichkeit des Individuums hergestellt werden kann. (Tenbruck 1989: 238) Um seine Ansprüche weit reichend anbinden zu können, war nahezu jeder Künstler dieser Zeit gemeinschaftlich organisiert und hielt durchschnittlich drei bis fünf Gruppenmitgliedschaften inne, was den Anhindungsbedarf abermals steigerte. Denn, mit Tenbruck argumentiert, je mehr Gruppen sich konstituieren, desto mehr werden sich dieser Entwicklung anschließen. Nicht nur wegen des Konkurrenzdrucks, auch weil der Einzelne ansonsten in die Bedeutungslosigkeit der Privatheit versinken würde: »Je stärker die Gesellschaft alle wesentlichen Funktionen institutionell organisiert, um so beliebiger werden die übrigen Bereiche für sie.« (Ibid.: 76) So waren beispielsweise Conrad Felixmüller6 und John Heartfield7 an über zehn Gruppen und Zeitschriftenpro-
5
6
7
»klares Denken«). (Stam 1924/1) In der Anfangsphase der DDR wirkte Stam dann als Drehpunktperson weiter. Die aus der Differenzierung der Sozialstruktur entstandenen Verhaltensunsicherheiten waren in den Jahren von 1750 bis 1850 in gesteigerter Form durch persönliche Beziehungen in Freundeskreisen aufgefangen geworden. (Tenbruck 1989: 238) Conrad Felixmüller (recte Conrad Felix Müller, 1997-1977) gründete u.a. mit Felix Stiemer die Zeitschrift Menschen und war Mitbegründer der Dresdner Sezession 1919. In der DDR hielt Felixmüller, bis zu seiner Ausreise im Jahr 1967, den Vorsitz des langjährigen und staatlich geförderten Zusammenschlusses Sorbisch Bildender Künstler. John Heartfield (recte Helmut Herzfelde, 1891-1968) gründete die Berliner Dada-Gruppe, die Rote Gruppe. Vereinigung kommunistischer Künstler und den Malik-Verlag mit. Er war u.a. in der Novembergruppe und in der ASSO Berlin. Bei illustrierten Zeitungen (u.a. AIZ) entwickelte er mit der Technik der Fotomontage die Grundlage fiir die Gestaltung von Wahlkampfplakaten.
70
SOZIALE PHANTASIEN
jekten beteiligt; Otto Griebd engagierte sich in acht Zusammenschlüssen. Bei der Analyse der Aktionsfelder und Vorstellungen der Künstlergruppen-Generation vor 1945 werden zuvörderst Zusammenschlüsse betrachtet, und diese stellen die einflussreichsten dieser Zeit dar, in denen Akteure mitgewirkt haben, die in der DDR als Referenzen herangezogen wurden, als Funktionäre und als Gruppenmitglieder gewirkt oder sich nach anfänglichem Engagement zurückgezogen haben. Zur Erinnerung sei nochmals auf die Bestandteile des Interpretationsmodells der Symbolischen Vermittlung für die Analyse sozialer Gruppenprozesse hingewiesen: Die Motivation zu einer Gruppengründung lässt sich direkt aus den Proklamationen, dem Konglomerat von Absichten, ablesen oder aus dem gemeinschaftlichen Handeln erschließen. Die Gründungsmotivation ist von Interesse, weil sich hieraus die sozialen Bedürfnislagen und die als problematisch angesehenen gesellschaftlichen Bedingungen erkennen lassen - in unserem Fall zudem ersichtlich an Transformationen und Neudefinitionen. Handlungen und Aktionen verweisen auf die Austauschmechanismen der Gruppe. Im Innenverhältnis werden diese sichtbar an Regeln, Rin1alen, Sondersprachen, Versammlungsorten und Zerwürfnissen. Im Außenverhältnis werden die Mechanismen des Austauschs in den Medien der Darstellung und in Aktionen fixiert. In den Bereich des Ausdrucks fallen artifiziell hergestellte Objekte, wie Kunstwerke, Schriftbanner oder Postkarten. Selbst die Requisiten eines Versanm1lungsraumes lassen Muster erkennbar werden. Das Soziale der Kunst Zusammenschlüsse mit dem Ziel und der Ausprägung der Umgestaltung des Habitus wurden vornehmlich bis 1920 gegründet und waren von meist kurzer Dauer. Auflösungen traten gehäuft auf in den Jahren 1919, nach ein bis drei Jahren; 1920, nach ein bis vier Jahren und 1922, nach zwei bis vier Jahren. Merkmale dieser Bewegungen sind die transzendentale Ausrichtung der Vorstellungen oder die prestiziöse Selbstdarstellung als Künstler, wie auch als Gruppe. In Opposition zu den gesellschaftlichen Verhältnissen wurden gesellschaftliche Themen vereinnahmt, deren Umsetzungen jedoch uneindeutig blieben. Exemplarischer Vertreter ist
8
Otto Griebe! (1895-1972) beteiligte sich u.a. an der Novembergruppe, an der Dresdner Sezession 1919, am Komet, am jungen Rheinland, an der Dresdner Dada-Gruppe und war Mitbegründer der Roten Gruppe in Berlin sowie der ASSO Dresden. Griebe! war zudem einer der 7 Spaziergänger und in der DDR Mitglied der Ufer-Gruppe.
71
KOLLEKTIVIERUNG DER PHANTASIE?
die Bewegung der Dadaisten 9 . Diese stellte, trotz ihres kurzlebigen geschlossenen Auftretens, mit ihren provokativ ausgerichteten und unter der Parole »epater Je bourgeois« betont satirisch angelegten Darstellungen und Darbietungen eine der, über ihr Bestehen hinaus, künstlerisch einflussreichsten Gruppierungen dar, abgesehen von den beiden Großbewegungen der Weimarer Republik, der ASS0 10 und dem von Herwarth Walden 11 geleiteten Der Sturm. Die Gruppen der Umgestaltung des Habitus wandten sich gegen Traditionen und soziale Muster und bezogen hierin ihre Position. Dazu gehörte, dass der überwiegende Teil keine verbindenden Kunstrichtungen schaffen oder Gruppenprogramme entwerfen wollte. 12 So stellten beispielsweise die Künstler der K.ommune 13 in ihrer ersten Programmschrift klar: »Ästhetische Vorschriften machen wir uns nicht, und wir haben nicht die Absicht, sie irgend jemand zu machen. [...] Wir werben nicht um Anhänger und 9
I0
II
12
13
Die Dada-Anhänger in Berlin (d.i. Berlin Dada oder Club der Blauen Milchstrasse) fonni erten sich zwei Jahre nach der Züricher Initialzündung. Mitglieder waren u.v.a. John Heartfield, George Grosz, Raoul Hausmann, Harrnah Höch und Kurt Schwitters. Hinzu bestand in Berlin bis 1920 der Club Dada. D.i. die Assoziation [Association] Revolutionärer Bildender Künstler (ARBKD). Um die Anliegen zu verdeutlichen, nannte sich die Gruppe am 1. November 1931 beim »Berliner Kongreß« in Bund revolutionärer Bildender Künstler Deutschlands (BRBKD) um. Sie begann 1928 in Berlin (nach dem Versuch der Initiatoren 1927/28 die Arbeitsgemeinschaft kommunistischer Künstler Deutschlands zu gründen) - weitere Ortsgruppen außerhalb Berlins folgten. Bis 1933 waren mehrere hundert Künstler beteiligt; 1931 trat u.a. die Gruppe die Abstrakten resp. Die Zeitgernässen bei. Herwarth Walden (recte Georg Levin, 1878-1941) machte durch seine Stunn-Bewegung ab 1910 einen Großteil der europäischen Künstleravantgarde in Deutschland bekannt. In der gleichnamigen Zeitschrift, die von 1912 bis 1929 wöchentlich und folgend bis 1932 in unregelmäßigen Abständen erschien, wurden richtungsweisende Aufsätze zu Kunst und Theater veröffentlicht. Bereits 1904 hatte er den literarischen Verein ftir Kunst ins Leben gerufen und 1913 den Ersten Deutschen Herbstsalon nach französischem Vorbild organisiert. Der Aktivistenbund 1919 dazu: »Wir vertreten keine Kunstrichtung, sondern jedes starke, junge Wollen, das diesem Ziel in rücksichtsloser Aktivität entgegensteht.« (Aktivistenbund 1919 1919: 501) Die 1922 in Berlin gegründete Die Kommune richtete im gleichen Jahr die »Internationale Ausstellung revolutionärer Künstler« aus. Diese war gedacht als Gegenentwurf zur »Ersten Internationalen Kunstausstellung« von 1922 in Düsseldorf (veranstaltet von den Kunsthändlern Flechtheim und Nierendorf) aus Kritik an der Vermengung von Kunst und Kommerz. (Schneede 1979: 102)
72
SOZIALE PHANTASIEN
um keine Anerkennung. Wir sind gewiß, daß das Fluidum einer starken Willensgemeinschaft durch alle Poren dringen wird, jede räumliche und zeitliche Feme überwindet.« (Die Kommune 1922) Man erklärte sich als unabhängig und unliterarisch, wie der Komee 4 , und negierte sich selbst, »wir sind keine Künstlergruppe« (Ungers/Taut [1963]: 8), um jegliche Standortbestimrnungen, inhaltlicher oder struktureller Art, zu vermeiden:»[ ... ] er [der Komet] begann im Jahre 1917 in kleinstem Umfang durch das gesprochene Wort unter dem Zeichen der weißen Chrysanthemen. Im Oktober 1918 veröffentlichte Dietrich sein erstes Flugblatt.« (Dietrich 1964: 83) Entsprechend unbefangen beschrieb sich der Kreis um die Zeitschrift Komet als »Gemeinschaft des Geistes« (ibid.). Erkenntnis sollte durch Intuition, nicht durch Reflexion erreicht werden. 15 Im Unterschied dazu setzen Zusammenschlüsse mit dem Ziel der Umgestaltung der Gesellschaft, Rationalität vor Intuition und wollten, wie die Novembergruppe 16, als »Revolutionäre des Geistes« und als »Vereinigung der radikalen bildenden Künstler« verstanden werden, in der sich Expressionisten, Kubisten und Futuristen versammelten (vgl. Schneede 1979: 92). Von den Bedingungen und Auswirkungen des Weltkrieges geprägt, sahen die Künstler der Kugel 17 die Rolle der Kunst darin, die durch Grenzpfähle getrennten Völker einander näher zu bringen, um dem »größten Zukunftsgedanken, dem der geeinten Menschheit«, den Weg zu ebnen. In ihrem Manifest, für das mit der Magdeburger Tageszeitung ein bis dahin ungewöhnlicher Ort der Veröffentlichung gewählt worden war, kündigten die Mitglieder der Kugel an, Kunst solle »von neuem Religi14 Der Kreis um die Zeitschrift der Komet ( 1917-1919) in Dresden verstand sich als das »einzig prägnante, unabhängige und unliterarische Flugblatt Europas im Kriege und während der Revolution«. (Dietrich 1964: 83) Die Beteiligten hatten eine gemeinsame kosmisch-idealistische Haltung mit kunststilistisch unterschiedlicher Couleur. (Kutschera 1994: 48) 15 Ein ähnliches Selbstbild gab sich der Aktivistenbund 1919. Dieser wollte eine Vereinigung derer sein, denen die geistigen Energien der Menschheit das allein Wertvolle des Lebens bedeuten. (Wilhelmi 1996: 53) 16 Die Novembergruppe (1918-1933) wurde von Max Pechstein, Cesar Klein, Georg Tappert, Heinrich Richter und Moriz Melzer in Berlin gegründet. 17 Die Kugel, um 1920 in Magdeburg gegründet, war ähnlich wie die Novembergruppe strukturiert, aber regional ausgerichtet und bestand bis ca. 1923. Mit einer Ausstellung im Jahr 1929 versuchten die ehemaligen Mitglieder die Gruppe wieder zu beleben, ein zweiter erfolgloser Versuch erfolgte 1948. Als Medium fungierte die Zeitschrift Die Kugel. Zeitschrift flir neue Kunst und Dichtung, die in zwei Ausgaben erschien. In Reaktion zur Kugel bildeten sich in Magdeburg zwei weitere Künstlergruppen: die Nichtorganisierten freien Magdeburger und Wir aber 1919.
73
KOLLEKTIVIERUNG DER PHANTASIE?
on« werden, nicht aber interessante Abendunterhaltung oder gesellschaftliche Frage. (Die Kugel 1919) Etwa zur gleichen Zeit und mit ähnlichem Pathos trat die Gruppe 1917 18 an, auf der Suche nach der Wahrheit, den Künstlern zu helfen, die Welt zu gestalten und das gesellschaftliche Interesse für neue Kunst zu erwecken (Schmidt [1964]: 199). Überzeugt davon, dass jeder Äußerung - sei diese Wort, Ton, Farbe oder Lebensform - innere Notwendigkeit zugrunde liege, die zum Handeln dränge, trafen sich etwa 40 Menschen im Atelier von Felixmüller und verfassten eine expressionistische, emotional gehaltene Programmschrift Erwachsen sei diese, so reflektierten die Künstler, aus der Empörung, die geistige Kämpfer schaffe: »Heute soll alles Erlebnis zum Protest gegen das, was außen geschieht, drängen. Protest wird gemalt, gemeißelt, geschrieben, geschrieen.« (Programm der expressionistischen Abende 1917: 39) Bei Gruppen mit der Ausrichtung der Umgestaltung der Gesellschaft19 kann eine gleichmäßige Verteilung von ein bis zwei Gründungen pro Jahr, mit einer dreijährigen Lücke von 1921 bis einschließlich 1923, ausgemacht werden. Diese Verbindungen lösten sich etwa zur Hälfte nach einem bzw. zwei Jahren auf oder aber bestanden über zehn Jahre bis zur Machtübernahme der Nationalsozialisten?0 Gegen Ende der 20er Jahre gerieten diese Zusammenschlüsse in eine Phase heftiger Bewegung: Gründungen wie auch Zerwürfnisse und Abspaltungen häuften sich; es wurden Bündnisse mit anderen Gruppen eingegangen und übergeordnete Dachorganisationen gebildet. So beispielsweise das Kartell Fortschrittlicher Künstlergruppen, zu dem sich sieben Gruppen aus allen Teilen Deutschland zusammenschlossen21 und das Kartell der vereinigten 18 Die Mitglieder der Dresdner Gruppe 1917 (1917-1919) drückten in ihrer
Programmschrift der expressionistischen Abende (Ideensammlung von Mitte September bis Anfang Oktober 1917) die Hoffnung nach einem kollektiven, expressionistischen Lebensgefühl durch »Kunst als Tat« aus. (Programm der expressionistischen Abende 1917: 38f.) Eine weitere kunststilistisch motivierte Gruppe war die AGDE (d.i. die Arbeitgemeinschaft der Expressionisten) in Berlin um 1925. 19 Beispielsweise 1916 der Spartakusbund in Berlin mit u.a. Johannes R. Becher, Erich Fraaß, Curt Großpietsch und Willy Illmer; der Aktionsausschuss revolutionärer Künstler 1919 in München und der Aktivistenbund 1919 in Düsseldorf oder der von dem Schriftsteller Kurt Hiller 1918 in Berlin gegründete Aktivistenbund und der von ihm am 9. November 1918 im Reichstag ausgerufene Rat der geistigen Arbeiter. 20 Weitere langjährige Verbindungen waren die Hallische Künstlergruppe (1919-1933) und der Künstlerbund Schlesien ( 1908-1933), worin sich rund 50 Künstler versammelten. 21 Im März 1922 initiierte Das junge Rheinland, zusammen mit der Dresdner Sezession 1919 und der Novembergruppe, das Kartell Fortschrittlicher
74
SOZIALE PHANTASIEN
Verbände Bildender Künstler Berlins im Jahr 1926 mit zehn Künstlergruppen. Bereits mit der Benennung der Zusammenschlüsse als Kartelle wurde die angestrebte Positionierung im herrschenden Kunstbetrieb angezeigt.22 Es wurden übergeordnete Anhindungen geschaffen und verstärkt Referenzen23 zu lebenden Personen, zu zeitgleichen und ähnlich ausgerichteten Gruppen oder zu Gesellschaftstheorien24 gebildet, um die eigenen Standpunkte zu bekräftigen. Außerdem gerieten diese Gruppen zu mitgliederstarken Organisationen mit ausgeprägt geregelten Binnenstrukturen, wie beispielsweise der 1919 in München gegründete Aktionsausschuss revolutionärer Künstler mit rund 200 Mitgliedern oder die ASSO mit ausgesprochen funktionaler Positionierung ihrer Mitglieder. Zu den Stammgruppen wurden häufig Ortsgruppen in den Kunstzentren Deutschlands aufgebaut und Austauschbeziehungen mit Gruppen in anderen Städten gepflegt, wodurch der Anspruch der gesellschaftlichen Veränderung organisatorisch gefestigt und das politische Wirken begünstigt werden sollten. So bildete die ASSO neben Dresden und Leipzig in acht weiteren deutschen Städten Zweigstellen25 aus. Auch die Novem-
22 23
24
25
Künstlergruppen. Gemeinsame Aktion war die Bildung von Redaktionsgruppen fiir die Zeitschrift Das junge Rhein1and, die ab Oktober 1922 von der Zeitschrift Union der internationalen fortschrittlichen Künstler abgelöst wurde. Dem Kartell schlossen sich später die 1922 in Dresden gegründete Gruppe Die Schaffenden (mit u.a. Erich Fraaß, Fritz Winkler, Wilhelm Lachnit, Willy Illmer, Fritz Skade und Curt Großpietsch und der linkspolitisch motivierten Ausstellung »Wir schaffen für Euch« von 1923), die Dam1städter Sezession sowie die Künstlergruppe Halle an der Saale und die Künstlergruppe München an. Dem Berliner Kartell sei es besser gelungen, von den außerordentlich zähen Behörden der Weimarer Republik Gelder für Ausstellungen zu erhalten. (Nerlinger 1959: 26) Bei Lebensutopien wurden - aufgrund ihrer ganzheitlichen Ausrichtung dezidiert viele Bezüge hergestellt. Heinrich Vogel er berief sich auf Charles Fourier und dessen Schüler Victor Considerant. Seine Barkenhoff-SiedJung sollte, wie in den frühsozialistischen Schriften von Petr Kropotkin und Gustav Landauer propagiert, als Kampf- und Aufbauzelle die Zukunft vorwegnehmen. (Kutschera 1994: 170) Mangels ausreichender Marxistischer Lehrzirkel habe man sich gegenseitig geschult. (Grundig, Hans 1957: 468) Als Referenzen für die ASSO benennt Lea Grundig die Abhandlungen von Lu Märten über marxistische Ästhetik und »Die goldne Kette oder die Sage von der Freiheit der Kunst« von Upton Sinclair. Vorbildfunktion hätten sowjetische Romane, wie »Zement« von Gladkow, und Agitpropgruppen, wie Die blauen Blusen, übernommen (Grundig, Lea 1977: 592). Außerdem habe man an die Ideen von Hermann Dunckerangeknüpft. (Grundig, Hans 1957: 471) Weitere Ortsgruppen der Berliner ASSO wurden in Düsseldorf, Essen, Köln, Halle, Hamburg, Magdeburg, München und Stuttgart gebildet. Das
75
KOLLEKTIVIERUNG DER PHANTASIE?
bergruppe schrieb zunächst das Ortsgruppenprinzip in den ersten Satzungen von 1919 fest: »Zur Förderung der Vereinsziele werden in den Kunstzentren Ortsgruppen gebildet.«26 Umgesetzt wurde das Vorhaben der Novembergruppe durch enge freundschaftliche Verbindungen zu Künstlergruppen in anderen Städten. Die »Quasi«-0rtsgruppen 27 und die verstärkte Anhindung einzelner Künstler aus allen Teilen Deutschlands als Mitglieder sowie als Gäste28 und das Anwerben passiver Mitglieder29 sollten den Einflusskreis der Künstlergruppe vergrößern helfen. Diese vielgestaltigen Verbundsysteme der Künstlergruppen untereinander waren ein gesteigertes Mittel, die geforderte Umgestaltung durchzusetzen. Die Forderungen nach der Umgestaltung der Gesellschaft zielten anfangs auf eine Umstrukturierung der Kultureinrichtungen und formten sich im Laufe der Jahre zu einem Konzept der Revolutionierung der gesellschaftlichen Verhältnisse aus 30 - angezeigt in erster Linie mit Gruppengründungen, programmatischer Radikalisierung und pragmatischer Umsetzung. Ähnlich den Forderungen der Novembergruppe31 nach
26
27
28 29
30
31
Ortsgruppen-Prinzip wandten auch die Mitglieder der Abstrakten an, die sich 1932 der ASSO anschlossen. Das Ortsgruppen-Prinzip der Novembergruppe ist in den Satzungen vom 16. Dezember 1918 unter§ 6 aufgeführt (Novembergruppe 1918), taucht aber in späteren Fassungen nicht mehr auf. Weil die Gruppen »entweder ihre Selbständigkeit bewahren wollten oder gar nicht mehr existierten.« (Kliemann 1969: 12) Im Katalog der »Großen Kunstausstellung Berlin« von 1919 sind Ortsgruppen in Magdeburg, Karlsruhe, Hamburg, Stuttgart, Halle und Kiel aufgeftihrt. (Vgl. Kutschera 1994: 28) Zu den Gruppen, die eng mit der Novembergruppe zusammengearbeitet haben, gehörten die Dresdner Sezession 1919, Das junge Rheinland in Düsseldorf, die Gruppe Rih in Karlsruhe, die Kugel in Magdeburg, die Hallische Künstlergruppe, die Zeitschrift Kräfte in Harnburg sowie die De Stijl-Gruppe um Theo van Doesburg. (Vgl. Kliemann 1969: 12) Mindestens 120 Künstler durchliefen die Novembergruppe. (Vgl. Kliemann 1969: 50ff.) Passive Mitglieder konnten - analog zu den Gepflogenheiten von Kunstvereinen - ftir einen jährlichen Betrag von 500 Mark eine Plastik oder ein Bild entleihen. (Vgl. Kliemann 1969: 74) Viele Novembristen waren Mitglieder der intemationalen Künstlergemeinschaft Porza, deren Bezeichnung auf ein kleines Dorf in der Nähe von Lugano zurückgeht. Die Porza gab eine Zeitschrift heraus und unterhielt Häuser in der Schweiz, in Deutschland und in Frankreich, wo die Mitglieder gegen geringes Entgelt wohnen und arbeiten konnten. (Kliemann 1969: 83) In ihren »Richtlinien« forderte die Novembergruppe die institutionelle Gleichberechtigung der Künstler sowie die Beseitigung von Vorrechten und von kapitalistischen Einflüssen im Kunstbereich. Sie wandte sich gegen einseitig geführte Sammlertätigkeit und gegen die Streichung von Stipendien. Museen sollten zu »vorurteilslosen Vermittlern zeitloser Gesetze«
76
SOZIALE PHANTASIEN
Gleichberechtigung durch Refonnen, drängte die Hallische Künstlergruppe32 darauf, die eigenen Arbeitsbedingungen zu verbessern und die Anerkennung der modernen Kunst voran zu treiben. Ihren eigenen Beitrag sahen die Künstler darin, ein reifes und geistig vollwertiges Volk erziehen zu helfen: »Wir wollen den Staat, in Gemeinschaft mit gleichem Zeitgeist durchdrungener Intelligenz, zu kultureller Blüte bringen! Wir wollen das Gesicht des Staates formen, das äußere und innere Ansehen heben!« (Hallische Künstlergruppe [o.J.]: 59) Die Mitglieder des Arbeitsrates fur Kunse 3 beabsichtigten akademische Ausbildungsstätten und künstlerisch wertlose Denkmäler zu beseitigen. Als Leitsätze wurden aufgestellt34 , dass »Kunst und Volk« eine Einheit bilden und Kunst zum »Glück und Leben der Masse« werde (Schlösser 1989: [o.S.]). Denn nur eine politische Umwälzung, so die Überzeugung, könnte von jahrzehntelanger Bevormundung befreien. (Ein neues künstlerisches Programm 1980: 87) Wie andere Künstler in dieser anfänglichen Phase der Gruppengründungen, hegte der Initiator des Arbeitsrates, Bruno Taut, die Hoffnung, als Künstler in einer dezentralisierten, aus Arbeiter- und Soldatenräten zusammengesetzten staatlichen Regierung Einfluss gewinnen zu können. 35 Kämpferischer und ohne politische Zugeständnisse artikulierten einige Jahre später die Mitglieder der Progressiven36 ihre Standpunkte. Ein guter Kommunist sei in erster Linie Kommunist und dann erst Facharbeiter oder Künstler, wie auch künstle-
32 33
34
35
36
und zu »Volkskunststätten« werden sowie Künstler bei der Wahl ihrer Lehrer mitwirken können. (Schmidt [ 1964]: 159) Die Hallische Künstlergruppe (1919-1933) war kooperativ zur Novembergruppe gebildet worden. (Schulze 1974: 598) Der Arbeitsrat fiir Kunst (1918-1921) in Berlin, dem rund 100 Architekten, Maler, Bildhauer und Kunstkritiker angehörten, wurde nach dem Muster der Arbeiter- und Soldatenräte von Adolf Behne, Cesar Klein, Max Pechstein, Georg Tappert und Bruno Taut gegründet und unterhielt engen Kontakt zur Novembergruppe. (Schneede 1979: 72) Otto Bartning, Walter Gropius und Bnmo Taut trafen sich am 9. November 1918 in der Wohnung von Adolf Behne in Berlin-Charlottenburg und arbeiteten das Programm des Arbeitsrats aus. Der Aufruf, »Ein neues künstlerisches Programm«, erschien ab dem 18. Dezember 1918 in verschiedenen Zeitschriften. Die Entscheidung der Räte, eine parlamentarische Regierungsform zu errichten, hätten Tauts Pläne durchkreuzt, weshalb er den Vorsitz an Walter Gropius weitergegeben habe. (Whyte 1996: 7) D.i. die Gruppe der progressiven Künstler oder Rheinische Gruppe Progressiver Künstler (1920-1933) in Köln, die sich erst ab 1929 einen Namen gab. (Vgl. Kutschera 1994: 62). Als Gruppenorgan fungierte die Zeitschrift a bis z. Vgl. Franz W. Seiwert über das Kunstverständnis des vergangeneu Jahrzehnts »Es ist noch nicht aller Tage Abend«. (Seiwert 1929)
77
KOLLEKTIVIERUNG DER PHANTASIE?
rische Kenntnisse und Fähigkeiten lediglich als Werkzeuge im Dienst des Klassenkampfes zu betrachten seien. (Die Rote Gruppe 1924: 2) Mit der Gründung der ASSO im Jahr 1928 wurden die Standpunkte bekräftigt, die Konzeptionen fur eine Umgestaltung der Gesellschaft organisatorisch gefestigt und agitatorisch umgesetzt. Die Mitglieder der ASSO verorteten sich eindeutig als marxistische Künstler, verbunden mit der »Bruderorganisation« der ACHRR in Russland. (ARBKD [o.J.a]: 385ff.) Als Gegenparts wurden, über die gesellschaftlichen Bedingungen hinaus, andere Gruppierungen und als l'art-pour-l'art charakterisierte Kunstrichtungen und deren Vertreter erkannt. 37 Eine weitere Ausprägung der Künstlergruppen-Generation bildete sich in Ansätzen in den Architekten-Bewegungen3g, hauptsächlich aber in Künstlerkolonien, heraus. Hier blieb die Umgestaltung des Lebens nicht Forderung, sondern wurde zur täglichen Übung. Die Grundformel von Heinrich Vogeler, einem ihrer engagierten Verfechter, lautet: Das Anderssein sollte gelebt, nicht durch intellektuelle Kritik erreicht werden. Mit dem Ziel, zu »höherem Leben« zu gelangen begann Vogeler ab 1918 (er war außerdem in zahlreichen Bewegungen aktiv) eine geldfreie Gemeinschaftskultur mit seiner Arbeitsgemeinschaft auf dem Barkenhoff39 auf der Basis von Landarbeit aufzubauen. (Vogeler [1919]: 145f.). Seinem religiös motivierten und nach kommunistischen Idealen begründeten Lebensmodell40 zufolge, müsse ein jeder Siedler »innerlich völlig Sozialist sein, d.h. Träger, Aufbauer fur den Neubau der klassenlosen Gesellschaft« (Pforte/Sontag 1973: 126).41 Die Barkenhoff-Kommune 37 Die Gruppe Das Manifest schreibt im Entwurf des Griindungsaufrufs von 1931: »Wir glauben[ ... ], daß die drohenden Anzeichen, Kriegshetze, Klassenhaß und Verbitterung jeden Menschen verpflichten, sein Möglichstes zu einer Tat der Sammlung aller aufbauenden Kräfte beizutragen.« (Hiepe 1980: 27, 32) 38 Vgl. die Schriften und Entwürfe von Bruno Taut und der Gläsernen Kette. Taut entwarf Modelle, in denen architektonische Gestaltung und soziales Zusammenleben verschmelzen. Er spricht sich, ähnlich wie Heinrich Vogeler (Vogeler [1919]: 145ff.), flir sozial geregeltes Leben in Künstlerkolonien und in Volkshäusern aus. (Taut, Bruno 1919: 100) 39 Vogelerkaufte 1895 eine Bauernkate in Worpswede, die er umbauen und vergrößern ließ. Zuerst nannte er die Siedlung Kommune, später entwickelte sich das Modell zu einer Arbeitsschule und wurde 1921 als Verein eingetragen. 40 Die Siedlung wurde als Aufbauzelle der klassenlosen Gesellschaft verstanden, als gewaltfreier Weg zu einer neuen Gesellschaftsform. (Vgl. Kutschera 1994: 171) 41 Vogelers emotional geprägte Vorstellungswelt zeigt sich an einem Aufruf, dem Siedlerleben zu folgen: »Werdet Aufbauende fiir die große kommende
78
SOZIALE PHANTASIEN
umfasste eine Gärtnerei, Handwerksstätten und landwirtschaftlich genutzte Flächen. 42 Hier suchten die Siedler ihr persönliches Lebensglück in der Einheit von Natur, Kunst und Arbeit. Ihre Ideen waren getragen von der Vorstellung durch Arbeit und Liebe im Schutzraum der Kolonie der von Besitzgier, Klassenhass und Machtdünkel gezeichneten Weltordnung zu entkommen: »Zeigt durch die Tat, daß ihr den bestialischen Menschen überwunden habt, daß ihr gewillt seid, die Fackel der Liebe zu erheben und der gesamten Menschheit voranzutragen.« (Vogeler [1919]: 145) Das Modell der Umgestaltung des Lebens begleitete Vogel er - selbst nach einigen anderen gescheiterten Gemeinschaftsprojekten - in zahlreichen Variationen ein Leben lang. In einem verschriftlichten »FunkAbhör-Bericht« der BBC ist von einer Ansprache im Moskauer Rundfunk im Jahr 1941 überliefert: »Ich lebe in Sowjetrussland und habe hier die Möglichkeit, meine Kunst [... ] auszuüben, denn in der Sowjetunion ist die Möglichkeit zu einer Verbindung zwischen Kunst und Leben und zwischen Kunst und Arbeit vorhanden.«43 (Hoffmeister 1985: 148) Lebensweltlich orientierte Programme wurden auch von Architekten entworfen, die zu dieser Zeit vornehmlich bestrebt waren, Wohnformen durch neue Baugesinnungen zu revolutionieren und verstärkt Pläne für geregeltes soziales Zusammenleben entwarfen. 44 Deutlich zeichneten sich auch hier die Differenz zu den als bürgerlich bestimmten gesellschaftlichen Bedingungen und der Wille zu radikalen Reformen ab: »Wir zeigen den Riß auf in der bürgerlichen Gesellschaft und gleichzeitig bilden sich die Ansätze zu Neuem, das die bessere Zukunft ahnen läßt, die wir aber noch nicht vollendet formen können.« (Arntz 1930: 293) Betrachtet man die Beweggründe, die zur Bildung der Künstlergruppen in der Weimarer Republik geführt haben und deren Entwicklung, treten mannigfaltige Prozesse der Transfonnation hervor, die sich insbesondere bei gesellschaftspolitischen Gruppierungen aufzeigen lassen. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs schlossen sich die Künstler aufgrund Friedenswelt der arbeitenden Bruderschaften!« (Vogeler 1921: 59) Das Leben in der Siedlung stellte er unter das Motto: »Der besitzlose Künstler [... ]ist der Traumjeder echten Künstlerseele.« (Vogeler [1919]: 155) 42 An Wochenenden kamen Massen an Besuchern, geladene Gäste habe Vogeler in einem weißen Biedermeierfrack vor einem Bild des Grabes von Jean-Jacques Rousseau empfangen. (Wietek 1976: 6f.) 43 Vogeler siedelte 1931 in die Sowjetunion über und starb 1942 im Krankenhaus des Kolchos Budjonny bei Kornejewka. 44 Vgl. u.a. die Berliner Zeitschrift G- Material zur elementaren Gestaltung (1922-1926) und die Berliner Architektenvereinigung Der Zehnerring (1921-1923). Die Mitglieder der Monatszeitschrift Das neue Berlin planten die Umgestaltung Berlins zu einer Welt- und Ausstellungsstadt
79
KOLLEKTIVIERUNG DER PHANTASIE?
aktueller Ereignisse zusammen. Das Potenzial zur organisatorischen Bindung war vorhanden und bedurfte nur mehr eines emotional besetzten Auslösers. Die Initialzündung für den Aktionsausschuss Revolutionärer Künstler, dem sich etwa 2000 Personen anschlossen, stellte die Ermordung des sozialdemokratischen Politikers und Publizisten Kurt Eisner dar; der Matrosenaufstand in Kiel war für die Mitglieder der Zeitschrift Der schwarze Turm der Grund zu gemeinschaftlich orientiertem Handeln.45 Diese Nachkriegsgruppierungen mit gesellschaftskritischem Impetus, wie beispielsweise der Arbeitsrat für Kunst, richteten ihr Innengefüge nach dem Muster der Arbeiter- und Soldatenräte aus. 46 Ein weiteres Motiv für Gründungen in diesen Anfangsjahren war das Bestreben, »gleichgesinnte schöpferische Kräfte« zu vereinen, wie dies u.a. die Novembergruppe proklamierte. 47 Mit Beginn der 20er Jahre traten verstärkt Zusammenschlüsse auf, die meist von kurzer Dauer waren und zuvörderst Verbindungen schaffen wollten aufinternationaler Ebene, zwischen Ost und West48 oder den nationalen Austausch in den Mittelpunkt ihrer Anliegen rückten. Die Vorhaben speisten sich aus den trennenden Erfahrungen in den Weltkriegsjahren und dienten nicht zuletzt der Bestätigung des eigenen Wirkens. Manifestiert wurden die Bestrebungen u.a. 1922 auf dem » 1. Kongreß internationaler fortschrittlicher Künstler«49 , der unter dem Motto »Künstler aller Länder vereinigt Euch!« stand. Gegen Mitte der 20er Jahre verdichtete sich allmählich der Wille zur Umgestaltung der Gesellschaft. Im Gründungsmanifest der Roten Gruppe. Vereinigung kommunistischer Künstler 50 wurde ausdrücklich die Re45 Der schwarze Turm wurde von 1918 bis 1920 in Kiel herausgegeben und
stand in Verbindung mit der Berliner Novembergruppe. 46 Weitere sind der im November 191 8 von Walter Gasch gegründete Provi-
47 48
49 50
sorische Revolutionäre Künstlerrat, der radikale Reformen aller Kunstinstitutionen und die staatliche Unterstützung der Künstler einforderte oder die von Paul Adler in Hellerau 1918 gegründete Sozialistische Gruppe der Geistesarbeiter Dresdens sowie der Politische Rat Geistiger Arbeiter, der am 9. November 1918 aus Hillers Bund zum Ziel gegründet worden war. Die »Novemberrevolution« stand Pate ftir die Namensgebung der Novembergruppe. Die Zeitschrift Gegenstand - Internationale Rundschau der Kunst der Gegenwart erschien in Berlin ab 1922 in drei Sprachen (Deutsch, Französisch, Russisch)- allerdings auch nur in drei Ausgaben. Bei diesem Projekt beteiligt waren u.a. Charlie Chaplin, Boris Pasternak, Pablo Picasso, Carl Einstein, Raoul Hausmann und Kasimir Malewitsch. Der Kongress wurde im Mai 1922 in Düsseldorf von der Gruppe Das junge Rheinland ( 1919-1929) initiiert. Die Rote Gruppe. Vereinigung kommunistischer Künstler ( 1924-1926[27]) wurde in Berlin von George Grosz, John Heartfield und Erwin Piscator ge-
80
SOZIALE PHANTASIEN
alisierung des kommunistischen Modells angestrebt. Anstelle der anarchistischen Produktionsweise der kommunistischen Künstler müsse ein planmäßiges Zusammenarbeiten treten. (Die Rote Gruppe 1924: 2) Gegen Ende der 20er Jahre - mittletweile war nahezu die gesamte Künstlerschaft in Zusammenschlüssen jedweder Art organisiert - wurden nicht mehr nur Forderungen aufgestellt, sondern gleichfalls Instrumente zu deren Umsetzung geschaffen. Zum Vorbild geriet die 1928 in Berlin angetretene ASSO-Bewegung. Problemlagen wurden nun personifiziert, 51 Kunst war Kampfmittel: »Die Kunst eine Waffe, der Künstler ein Kämpfer im Befreiungskampf des Volkes gegen ein bankrottes System!« (Vgl. Schmidt [1964]: 385)52 Gruppengründungen nach 1930 waren darin motiviert, gegen etablierte Organisationen und Patronage anzugehen: 53 Die Generation der 30jährigen strebte den Machtwechsel an. Als kleinster gemeinsamer Nenner kristallisierten sich die ökonomische Notlage und die starren staatlichen Strukturen heraus. (Cassel 1932: [o.S.]) Die Gruppen traten jetzt geschlossen nach Außen hin auf und richteten eigene Ausstellungsreihen und Präsentationsveranstaltungen, in Reaktion auf zurückgewiesene Werke bei etablierten Kunstschauen, aus. 54 Eine weitere Fonn des kritischen nach Außentretens und Durchbrechens von Reglements waren »En-bloc-Beteiligungen«- wie dies bei der »2. Großen Leipziger Kunstausstellung« geschah: Um den Kollektivcharakter herauszustellen und die Gruppenstabilität zu dokumentieren, versahen die Künstler der Leip-
51
52
53
54
gründet und war der erste dezidierte Zusammenschluss kommunistischer Künstler in Deutschland. Lea Grundig äußert rückblickend über ihre und Hans Grundigs Motivation 1926 der KPD beizutreten, dass beide sich als Künstler in der kapitalistischen Gesellschaft überflüssig gefühlt hätten. (Grundig, Lea 1977: 592) »Nur durch den Sturz des kapitalistischen Systems und Aufrichtung der sozialistischen Gesellschaftsordnung kann die Menschheit aus den Fesseln der Not und Unterdrückung befreit werden.« (ARBKD [o.J.a]: 386) So die 1932 in Berlin gegründete Selection, der Oskar Schlemmer, Wassilij Kandinsky, Willi Baumeister jedoch nicht beitreten wollten. Schlemmer begründete in einem Brief an Baumeister vom 17. November 1932, dass ihm deren Forderung nach Ablösung vom Kunsthandel zu weit gehe, er plädiere vielmehr fiir einen Verbund kunstpolitisch besonders gefährdeter und innerlich zusammengehörender Künstler. (Wilhelmi 1996: 326) Der »Kongreß internationaler fortschrittlicher Künstler« wurde 1922 in Düsseldorf ausgerichtet. Weitere waren die von der ASSO organisierte Ausstellungen »Kapital und Arbeit« ( 1929), »Sozialistische Internationale Kunst« (1930), die Ausstellung im Europa-Hans (1932) und die »Internationale Ausstellung revolutionärer Künstler«. Die Novembergruppe organisierte 1922 eine eigene Wanderkunstausstellung, die in Moskau und Japan gezeigt wurde.
81
KOLLEKTIVIERUNG DER PHANTASIE?
ziger ASSO ihre Bilder bei dieser Ausstellung zwar mit Titel, ließen aber die jeweilige Autorenschaft im Ungewissen. (Wilhelmi 1996: 77) Das gleiche Prinzip verfolgten die ASSO-Künstler mit der Zeitschrift stoss von links, die in Dresden in zehn Heften von 1930 bis 1932 erschien, und die in dieser Zeit zum Organ der sozialistischen Linken wurde. Die darin abgedruckten grafischen Arbeiten, in denen sich die Künstler kritisch zu kulturpolitischen Themen äußerten, sind sämtlich unsigniert. 55 Andere Gruppen festigten ihr Gefüge über kollektives künstlerisches Arbeiten56 oder wechselnde Herausgeberschaftell bei Zeitschriften57 Betrachtet man Gründungen und Transfonnationen der Künstlergruppen aller Ausprägungen, so häuften sich diese um das Jahr 1920, um 1925 und nach 1930. Die Veränderungen prägten sich aus in generellen Auflösungen und in Neugründungen, in der Bildung von Kollektiven innerhalb von Gruppen und als Austritte einzelner oder mehrerer Künstler. Weiterhin charakteristisch waren Umbenennungen, aufgrund von Abspaltungen mit Neugründungen oder Gruppenbündnisse. Die Gründe für die Transformationen im Innenverhältnis der Gruppen lagen vornehmlich darin, dass die ursprünglichen Motive für deren Bildung wegfielen, keine Impulse mehr in die Gruppe getragen werden konnten oder sich die Vorstellungen nicht mehr bündeln ließen. Bereits in den Anfangsjahren häuften sich die Zerwürfuisse in Gestalt von Abspaltungen und Austritten aus Protest über die jeweiligen Gruppenziele58 . So spaltete sich ein Jahr nach der Gründung der Dresdner Sezession 1919 der linke Flügel mit Conrad Felixmüller, Peter August Böckstiegel und Otto Schubert vor der 3. Sezessionsausstellung ab. 59 Zwei Jahre später löste sich die Gruppe auf, da 55 Die ASSO-Künstler waren zugleich Herausgeber und Autoren der Hefte des stoss von links. Es zeichneten u.a. Otto Griebe!, Eugen Hoffmann, Wilhelm Lachnit und Eva Schulze-Knabe. 56 Vogeler begann 1920 mit der Wandbemalung des Barkenhofs. Nachdem die Rote Hilfe (zu den Gründungsmitgliedern im Jahr 1924 zählten Vogeler, Zetkin und Pieck) hier ein Kinderheim eingerichtet hatte, sollten die Fresken entfernt werden, worauf es zum Protest kam. Vgl. der »Aufmf an die deutschen Künstler« von Vogeler und die »Protestschreiben« unterstützender Künstler. (Protesterklärung [1927]: 371 f.) 57 Bei der Berliner Zeitschrift Freie Strasse (1916-1918) wurde jedes Heft von einem anderen Herausgeber verantwortet. 58 Bereits in ihrer Gründungsschrift hatten die Sezessionisten ein Zerwürfnis einkalkuliert: »Der Elan der Zeit hat die Gruppe hervorgebracht, und der kommende kann sie vernichten: Wir werden dazu beitragen, indem wir dem kommenden den Weg bereiten, der wir eben schon sind.« (Dresdner Sezession 19191919: 47) 59 Hugo Zehnder hatte im August 1919 die Gruppe aus prinzipiellen und persönlichen Gründen die Gruppe verlassen und Felixmüller als Anhänger eines radikalen Rätekommunismus, den Otto Rühle in Dresden vertrat, in der
82
SOZIALE PHANTASIEN
die meisten Mitglieder den Expressionismus in ihren Werken stilistisch überwunden hatten60 (Löffler [1977]: [o.S.]). Zwar traten 1920 weitere Künstler61 der Sezession bei, trotzdem zerfiel die alte Struktur allmählich, auch weil sich einige der Mitglieder anderweitig orientiert hatten. 62 Nach außen getragene Zerwürfnisse schlossen sich dieser Entwicklung an. So verließen tragende Mitglieder 1921, zum Teil vorübergehend, als »Opposition der Novembergruppe« 63 die Novembergruppe und prangerten in einem Aufruf, den sie im KPD-Kunstorgan Der Gegner veröffentlichten, deren Verbürgerlichung an. Ihr Handeln sahen die Künstler als Ausdruck der revolutionären Kräfte, als Instrument der Notwendigkeit der Zeit und als Verpflichtung gegenüber den Massen: »[ ... ] wir leugnen jede Verwandtschaft mit den ästhetischen Schiebern und Akademikern von morgen ab.«64 (Opposition der Novembergruppe 1920/21: 297ff.) Neben Liquidationen wegen Zahlungsunfähigkeit und verordneten Gruppenauflösungen65 , zerfielen die meisten der Zusammenschlüsse ob nicht erfüllter Hoffnungen. So endete im Dezember 1920 die Korrespondenz der Gläsernen Kette, nachdem sich schon ab April 1920 ein Wandel zu einer rationalistischen Auffassung abgezeichnet hatte. (Kutschera 1994: 34) Das Motiv zur Gruppengründung war hinfällig geworden und die »geheimbündlerische« Bindung hatte ihren Reiz verloren.
60
61
62 63 64 65
Gruppe keine Anhänger gefunden, »am wenigsten wohl bei dem malbesessenen Nietzscheaner Otto Dix« (Löffler [1 977]: o.S.). Zwar habe die Sezession 1919 »nominell« bis 1925 bestanden, das Auftreten der Neuen Gruppe 1925 mit Schülern von Richard Müller habe jedoch angezeigt, dass die provokative Tendenz der Sezessionisten bereits harmloser Idylle gewichen sei. (Heusinger [1977]: o.S.) 1920 traten der Sezession 1919 Walter Jacob und die Bildhauer Eugen Hoffmann, Christoph Voll und Ludwig Godenschweg bei. Im Umkreis bewegten sich Otto Griebe!, Bemhard Kretzschmar, Edmund Kesting und Wilhelm Rudolph. Gela Forster heiratete Alexandr Archipenko und zog nach Berlin, Otto Dix siedelte nach Düsseldorf und Lasar Segall nach Brasilien. Vorübergehend traten Otto Dix (er verließ 1924 endgültig die Gruppe), Max Dungert, John Heartfield, George Grosz, Hannah Höch, Ernst Krantz, Franz Mutzenbecher, Rudolf Schlichter und Georg Scholz aus. Die Unterzeichner des Briefes waren u.a. Otto Dix, Max Dungert, George Grosz, Raoul Hausmann und Hannah Höch. Eine solche traf die satirische, von der KPD unterstützte Arbeiterzeitschrift Der Knüppel (1923-1927) in Berlin, die von Grosz und Heartfield herausgegeben wurde. Ab Sommer 1925 kritisierte die KPD das eigenwillige Vorgehen der Künstler und entzog der Zeitschrift zwei Jahre die Gelder, nach zweitägiger Diskussion bei einem Parteitag. (Wilhelmi 1996: 205)
83
KOLLEKTIVIERUNG DER PHANTASIE?
Aus eigener Motivation löste sich der Arbeitsrat für Kunst am 30. Mai 1921 auf, überzeugt davon, dass eine »menschliche Gemeinschaft« und die Voraussetzungen für Kunst fehlten (Schlösser 1980: 114). Zu Spannungen war es bereits im Dezember 1918 wegen des »Architekturprogramms« von Bruno Taut gekommen, in dem er die soziale Rolle der Kunst festgeschrieben hatte.66 Großorganisationen unter Künstlern seien ein Unding, kommentiert Walter Gropius seine Erfahrungen beim Arbeitsrat als Nachfolger von Bruno Taut. (Gropius 1919b) Andere Künstler kündigten ihre Verbindung auf, weil sie keine in die Zukunft gerichtete gemeinschaftlich angebundene Aussicht mehr hatten. 67 Enttäuscht von den gescheiterten Erwartungen an das gemeinschaftliche Engagement begründen die Mitglieder der Kommune bereits kurz nach der Gtiindung 1922 das Ende: »Wir hatten unserer Vereinigung den Namen >Die Kommune< gegeben. Wir nehmen uns diese Bezeichnung wieder von der Stirn und sagen: Diese Gruppe besteht nicht mehr. Unsere Verbindung wird bestehen auch ohne Namen, wenn wir als Menschen wirklich verbunden sind.« (Die Kommune [1922]) 68 Das bereits zu Beginn der Gruppenaktivitäten polarisierte Kunstverständnis zeigt sich exemplarisch an der »Kunstlumpdebatte«, die Oskar Kokoschka, zu dieser Zeit Professor an der Kunstakademie Dresden, im März 1920 ins Rollen brachte. Anlässlich der Dresdner Straßenkämpfe gegen den »Kapp-Putsch«, in deren Verlauf ein Gemälde von Rubens durch eine Kugel beschädigt wurde, fordert Kokoschka in dem Aufruf »An alle Einwohner Dresdens«, dass Kunst bei politischen Auseinandersetzungen nicht gefährdet werden und »solche kriegerischen Übungen« nicht vor der Gemäldegalerie stattfinden sollten. (Kunst im Aufbruch 1980: 339) Daraufhin verfassten John Heartfield und George Grosz die Gegenschrift »Der Kunstlump«; Otto W. Seiwert veröffentlichte in der Aktion seine Sicht über »Das Loch in Rubens Schinken«69 und Otto Dix 66 Marcks und Poelzig traten wegen Unstinunigkeiten mit Taut aus; die Neuauflage des Manifests des Arbeitsrats vom April 1920 trugen Käthe Kollwitz u.a. nicht mit. (Kutschera 1994: 27) 67 So geschehen bei der Architektenverbindung der Zehnerring, die sich umorientierte, nachdem die Ziele erreicht worden waren: Das Ziel der Anerkennung neuer Architektur sei erreicht worden, nachdem dieser zu Beginn noch als eine Vereinigung von nicht ernstzunehmenden Phantasten und Wirrköpfen verlacht und bekämpft worden sei. (Max Taut [1963]: 6) 68 Die Kritik richtete sich gegen die Novembergruppe, Das junge Rhein land, den Sturm und die Dresdner Sezession - mit der Schlussbemerkung: »Lebt wohl, ihr Frösche! - « (Die Kommune [ 1922]) 69 »Fort mit der Achtung vor dieser ganzen bürgerlichen Kultur! Schmeißt die alten Götzenbilder um! Im Namen der konunenden proletarischen Kultur!« (Seiwert 1920: 16)
84
SOZIALE PHANTASIEN
klebte einen Teil des Kokoschka-Artikels in den Rinnstein seines Gemäldes »Streichholzhändler 1«. 70 Zunehmend wurden Kunstaktionen von allen Zusammenschlüssen und auch von einzelnen Künstlern in die Öffentlichkeit getragen: Die Mitglieder der Dada-Bewegung beteiligten sich an gesellschaftspolitisch motivierten Straßenhappenings. Otto Dix schnitt aus Protest seine Leinwände aus den Dresdner Ladenmarkisen heraus (Schmidt 1987: 19), und Otto Griebe! wirkte bei einer, später als »Heringsschlacht« bezeichneten Protestaktion gegen Arbeitslosigkeit mit: Aus Wut über die verwunnten Heringe, die vom Fischhändler Paschky in Dresden als Almosen verteilt worden waren, hätten die Anwesenden eine regelrechte Fischschlacht begonnen und die Fische selbst in die offenen Fenster der Cafes in der Prager Straße geschmissen, worauf das wohlhabende Publikum entsetzt geflüchtet sei. 71 (Griebell986: 123) Vermehrte Transformationen in Form von Richtungswechseln und Umbenennungen erfolgten in den Jahren 1924, 1928 und 1932. Hierfür exemplarisch steht die Künstlergruppe Die Abstrakten. Internationale Vereinigung der Expressionisten, Kubisten, Futmisten und Konstruktivisten72. Diese war 1924 gegründet worden und verfasste 1928 ein neues, politisch orientiertes Statut. 73 Weitere vier Jahre später schlossen sich die Abstrakten der ASSO an und benannte sich in Die Zeitgemässen74 um, 70 Vgl. Griebe!, der selbst teilgenommen hatte. (Griebe! 1986) 71 Griebe! berichtet von dem »Sturm auf das Versorgungsamt«: Man habe Aktenbündel aus dem Fenster geworfen, bis das Militär angerückt sei. Dieses habe sich erst nach Verhandlungen mit dem revolutionären Erwerbslosenrat zurückgezogen. (Griebe! 1986: 124) 72 Die Abstrakten (1924/25-1932) hatten sich aus der Sturm-Bewegung abgelöst (später mit dem Untertitel Landesgruppe Deutschland) und bestanden als Gruppe und als Kollektiv. Mit der Gruppenbezeichnung lehnte man sich an Waldens Verein Intemationale Vereinigung der Expressionisten, Futuristen, Kubisten und Konstruktivisten e.V. (1919-1925) in Berlin an. Jedem Aussteller war auch die Möglichkeit gegeben, Mitglied in der SturmGalerie sein. Bis 1931 wurden regelmäßige Gruppensitzungen abgehalten, die von einem vierköpfigen Arbeitsausschuss geleitet wurden, und Themenausstellungen veranstaltet. 73 Die Veränderungen betrafen auch Ausstellungen: Bei den »Großen Berliner Kunstausstellungen« habe man ein fiir jedes Mitglied verbindliches Thema ausgewählt und die Entwürfe mit Vertretern der Arbeiterpresse [d.s. Durus und Fritz Schiff] besprochen. (Nerlinger 1959: 30) 74 Die Zeitgernässen beteiligten sich als Ausstellungsgruppe Die Abstrakten bei der zwei Mal im Jahr ausgerichteten »Großen Berliner Kunstausstellung«. Zu dem Kollektiv innerhalb der Gruppe schlossen sich Ernst Oskar Albrecht, Karl [Carl Paul] Haacker, Adolf Köglsperger, Alice LexNerlinger, Laszlo Peri, Anne Reibstein-Albrecht und Fritz Wolff zusammen; als Kopf fungierte Oskar Nerlinger, neben Gert Caden und William
85
KOLLEKTIVIERUNG DER PHANTASIE?
um deutlich zu machen, dass die Mitglieder »mit abstrakter Kunst nichts mehr zu tun haben« (Nerlinger 1959: 30). Dank der Zusammenarbeit mit der ASSO habe man eine eindeutige Zielsetzung für die künstlerische Arbeit entwickeln können. Aus den bisher lose nebeneinander arbeitenden Künstlern sei ein Kollektiv geworden, erinnert sich Oskar Nerlinger (alias Nilgreen), einer der fuhrenden Köpfe der Abstrakten. (lbid.: 26) Weitere Merkmale der Unterscheidung können an den Mechanismen des Austausches ausgemacht werden: an den nach innen und nach außen gerichteten Ritualen und Aktionen, an dem Wirken und der Bedeutung der Drehpunktpersonen und an der Wahl der Versammlungsorte. Bei den Gruppen, die zur Umgestaltung des Habitus drängten, wurde überwiegend auf Positionierungen der Mitglieder im Gruppeninneren verzichtet und desto mehr die Aufmerksamkeit auf innen orientierte ritualisierte Interaktionen gerichtet. So wählten die Mitglieder des Club Dada Beinamen, mit denen die gegenseitige Verbundenheit auf spielerische Weise angezeigt und- ähnlich einer Maskerade- eine, als markant erachtete persönliche Eigenschaft hervorgehoben werden konnte. 75 Eine bedeutende Rolle spielten über Geheimhaltung organisierte Abgrenzungs- und Einbindungsmechanismen. Mit mystischem Einschlag wollte der Kreis um die Zeitschrift der Komet eine Innenbindung »nach den Gesetzen der unsichtbaren Kirche« schaffen (Dietrich 1964: 83). Es bildete sich auch der Trend heraus, unter Pseudonym zu veröffentlichen, um u.a. Repressionen, gleich welcher Couleur, aus dem Weg zu gehen. Beim Korrespondentenkreis Die Gläsernen Kette76, in dem Bruno Taut ab Ende 1919 eine kleine, auf Verschwiegenheit eingeschworene Gruppe um sich sammelte, gab man sich als Zeichen der Exklusivität und aus Gründen der Geheimhaltung ebenfalls Decknamen77 . Zudem sollte das Verständ-
Wauer; Schriftftihrer war Paul Fuhnnann. Medien waren die Ausstellungszeitung Die Blätter der Zeitgernässen sowie die Arbeiterpressen Rote Fahne und Rote Post. 75 George Grosz wurde »Politdada«, Raoul Hausmann schlicht »Dadaraoul«, »Dadasoph« oder »Direktor des Cirkus Dada« und John Heartfield, gemäß seiner Montagetechnik, »Monteurdada«. Ritualisierte Interaktionen spielten bei den Dadaisten eine hervorgehobene Rolle. So suchte sichjeder ein ausgefallenes Steckenpferd aus: Hannah Höch kreierte Puppen, Kurt Schwitters entwickelte eine Klangsprache und geheime Wohnbauten. 76 Am 24. November 1919 leitete Bruno Taut mit dem ersten Rundbrief, der an vierzehn Personen gerichtet war, den Korrespondentenzirkel Die Gläserne Kette ein. (Whyte/Schneider 1996: 8) 77 Walter Gropius wählte das Pseudonym »Mass«, Hans Scharoun »Hannes« und Bruno Taut »Glas«. Andere waren »Antischmitz« für Hans Hansen, »Stellarius« fiir Jakobus Götte1 und »Angkor« für Hans Luckhardt. (Bruno Taut [1963]: 11)
86
SOZIALE PHANTASIEN
nis der Texte für Außenstehende durch die Knappheit des Ausdrucks der sich selbstverständlich aus der inneren Übereinstimmung der Kreismitglieder ergebe- erschwert werden. Jeder Mitwirkende vermerkte seinen Decknamen auf dem oberen Rand eines Stück Papiers, zeichnete und schrieb seine Gedanken darauf und versendete Kopien davon an jedes Mitglied des Kreises: »Jeder von uns zeichnet oder schreibt in kurzen Zeiträumen je nach Neigung und zwanglos auf einem handlichen Blatt Pauspapier (Aktenfonnat) seine Ideen auf, die er unsenn Kreise mitteilen will und schickt j e d e m eine Lichtpause. So entsteht Austausch, Frage, Antwort, Kritik.« (Bruno Taut 1919,1: 10) Um die Abgeschlossenheit der Gruppe zu gewährleisten, wurde als weitere Regel eingeführt, dass jeder Ausscheidende sich verpflichtet, alle Beiträge an Taut oder ein verbleibendes Mitglied zu schicken oder aber zu vernichten. Ihr Streben nach einer fest gefügten Gemeinschaft drückten die Korrespondenten der Gläsernen Kette in der gegenseitigen Benennung als »Brüder« oder »Mitstreiter« aus, der Kreis selbst wurde gelegentlich- in Anlehnung an die verschwiegene Gemeinschaft der Logenbrüder - als »Bund« tituliert. (Bruno Taut 1920: 23). Mit der Einbindung der Mitglieder in Abgrenzung zur Außenwelt wollten die Künstler zu einer verschworenen Gemeinschaft werden und ihre Differenz zur sozialen Umwelt für sich anzeigen. Mit einem Zusammenschluss in der Art einer Geheimloge sympathisierte auch Walter Gropius, der im März 1919 den Vorsitz des Arbeitsrates für Kunst von Bruno Taut übernommen hatte und in einer Rede vor der Mitgliederversammlung seine Vision präzisierte: »Dieser Arbeitsrat ist eine Art Verschwörerbund, der durch Zusammenschluß einer kleinen Minorität einem radikalen künstlerischen Bekenntnis zum Siege verhelfen will.« (Vgl. Schlösser 1989: [o.S.]) In einem Brief an Adolf Behne führt Gropius aus, er werde weiter radikalisieren und alle Elemente, die nicht in den Arbeitsrat hineinpassten, mehr oder weniger zart vor die Tür setzen. (Ibid.) Denn eine Großorganisation unter Künstlern, von einer Stelle aus geführt, werde wohl niemals gelingen und erfülle auch keinen Zweck: »[ ... ], kleine logenartige Zusammenschlüsse, das ist es, was wir brauchen.« (Whyte/Schneider 1996: 9) Das Anliegen, den Arbeitsrat für Kunst in der Tradition eines Geheimbundes auszurichten, wurde nicht wirklich umgesetzt, blieb aber virulent. Beleg hierfür ist die im März 1919 eröffnete Ausstellung »Für unbekannte Architekten«, deren vierseitiger Prospekt mit einem Bauhüttenzeichen versehen ist. 78 (Vgl. Schlösser 1989: [o.S.]) 78 Eine verschworene Gemeinschaft zu bilden, hatte zunächst auch die Architektenvereinigung Der Ring im Sinn. Wie Max Taut beschreibt, hätte dieser lose Zusammenschluss von zunächst zehn Berliner Architekten von
87
KOLLEKTIVIERUNG DER PHANTASIE?
Eine andere Möglichkeit, die Gruppenverbundenheit zu festigen, exerzierten die Zusammenschlüsse der Umgestaltung der Gesellschaft. Hier dominierten Organisationsprinzipien, durch die eine Basis für die Expansionsbestrebungen geschaffen wurde. Die Zuteilung von Ämtern79 erleichterte die Eingliederung der Mitglieder, zudem konnten Großorganisationen mit arbeitsteiliger Aufgabenstellung gebildet werden. 80 Obwohl in den Richtlinien der Novembergruppe vom Januar 1919 niedergelegt wurde, dass keine ausschließlich pragmatischen Aufgaben übernommen werden sollen, war diese Großgruppe in Sektionen unterteilt und wurde mit Ämtern geführt. Die Ausnahme bildeten Kunstausstellungen. Hier erhielt jedes Vereinsmitglied eine gleich große Fläche, wie auch die Werke juryfrei ausgewählt wurden. 8 1 Zudem sollten mit fortlaufenden Veröffentlichungen und einer jährlich im November stattfindenden Ausstellung die Geschlossenheit der Novembergruppe bewiesen und die Leistungen in der Außendarstellung dokumentiert werden. (Novembergruppe 1919) Mit Kunstausstellungen wollte die Dresdner Sezession 1919 ihre Ziele verwirklichen und das Rezensions-, Ausstellungs- und Ausbildungswesen in die Hand bekommen. Das Prinzip der Gruppenexklusivität sah die Gruppe als Möglichkeit, die Vorstellungen ohne Kompromisse voranzutreiben. Im Gründungsdokument ist fixiert: »Dresdner Künstlervereinigungen anzugehören, ist nicht erlaubt, auswärtigen nur nach gemein-
echter Kameradschaft beseelt und ohne materielle Absichten, beinahe logenhaften Charakter angenommen. (Max Taut [1963]: 6) Hieraufverweist auch Bruno Taut in der Zeitschrift Frühlicht, dem Sprachrohr der Gruppe, in dem er allerlei mystische Schriften von Meister Eckhart und Jakob Böhme abdrucken ließ. 79 Das Ämterprinzip wurde auch von der Roten Gruppe angewandt: Vorsitzender war George Grosz, Sekretär John Heartfield und Schriftftihrer Rudolf Schlichter. Der Arbeitsrat ftir Kunst, dem 127 Mitglieder und ein kleiner Kreis von Sponsoren angehö1ten, organisierte sich ebenso (Geschäftsausschuss, Arbeitsausschuss, Geschäftsführer und Vorsitzender). 80 An der Spitze der ASSO stand ein von der Vollversammlung gewählter fiinfköpfiger Ausschuss. Dieser entschied kollektiv über alle Angelegenheiten, aber jederzeit durch Mehrheitsbeschluss einer Versammlung absetzbar. Der Ausschuss beauftragte ein Mitglied mit der verantwortlichen Geschäftsftihrung und entschied über Mitgliederaufnahmen. Mindestens ein Mal pro Monat sollten alle Mitglieder zusammentreten. Der Mitgliedsbeitrag berechnete sich über einen festgelegten Prozentsatz aller Arbeiten, die durch die ASSO vermittelt werden konnten. (ARBKD [o.J., 2]: 388) 81 Die Organisation von Ausstellungen und Veröffentlichungen besorgte der zentrale Arbeitsausschuss; neben dem Vorstand und dem Vorsitzfuhrenden gab es einen Geschäftsfiihrer.
88
SOZIALE PHANTASIEN
samem Beschluß«. (Dresdner Sezession 1919 1919: 47)~2 Im Unterschied dazu beabsichtigte die Rote Gruppe, wie die meisten ähnlich ausgerichteten Gruppierungen, über die ständige Aufnahme neuer Mitglieder Außenanbindung und gewünschte Außenwirksamkeit herzustellen. Der Gruppenzusammenhalt sollte durch die Dynamik des Ausstrebens gewährleistet werden.
Versammlungsorte und Künstlerfeste Weitere unterscheidende Gruppenmerkmale stellten die Versammlungsorte der Künstler dar, die nach den jeweiligen Bedürfuissen und Möglichkeiten ausgerichtet waren. Kleinere und lose geftihrte Zusammenschlüsse trafen sich meist an öffentlichen Orten, bevorzugt in Kaffeehäusern. Beispielsweise verabredeten sich Die Progressiven in der Bücherstube am Wallraf-Richartz-Museum oder im Cafe Monopol. Die Mitarbeiter der Zeitschrift Gegenstand - Internationale Rundschau der Kunst der Gegenwart trafen sich im Berliner Cafe Prag, dem Treffj.mnkt russischer Künstler. Bevorzugte Orte ftir Zirkeltreffen stellten private Orte dar. Diese waren Wohnräume, insbesondere aber Ateliers der Künstler83 oder Räumlichkeiten in Kunstakademien, die den Künstlern zur VerfUgung gestellt wurden 84 . Die Expressionistische Arbeitsgemeinschaft Dresden, die sich später zur Gruppe 1917 erweiterte, hielt im Atelier von Conrad Felixmüller mit Künstlern und Freunden ihre »Expressionistensoireen« ab, zu deren Höhepunkten die Lesungen von Walter Rheiner85
82 Neue Mitglieder konnten bei der Sezession 1919 nur durch einstimmigen
Beschluss sämtlicher Mitglieder aufgenommen werden; Kriterien waren »Mut und die innere notwendige Überzeugung«. 83 Die späteren ASSO-Aktivisten, Dresdner Sezessionisten und zu dieser Zeit bei der Roten Gruppe engagierten Künstler Eugen Hoffmann, Otto Griebe] und Wilhelm Lachnit hatten von 1924 bis 1925 ein gemeinsames Atelier in der Zirkusstraße in Dresden. 84 So diskutierten die Mitglieder der Architektenverbindung Der Ring im Atelier von Mies van der Rohe, wie auch der Zehnerring seine Treffen im Arbeitsraum von Hugo Häring im Atelier von Mies van der Rohe veranstaltete. Der exklusive Freundeskreis Die Brücke traf sich im Dresdner Cafe Central. Eine verbreitete, formlose Weise, Kontakte zu knüpfen, waren Treffen bei Veranstaltungen, wie Vorträgen oder Vernissagen. 85 Der Schriftsteller Walter Rheiner (recte W. Heinrich Schnorrenberg, 1895 Köln - 1925 Berlin) gilt wegen seiner Lesungen als Schlüsselfigur der Gruppe 1917. Er hielt zudem die Redaktion der von Felixmüller gegtündeten Zeitschrift Menschen inne. Nach seiner Musterung 1914 flir den Wehrdienst lernte er Robert R. Becher und dessen Kreis kennen, »der mit Hilfe von Narkotika agitatorische Kriegsdienstverweigerung praktizierte.« (AdK Berlin (Hg.) [1969]: 7). Rheinernahm sich 1925 mit einer Überdosis Mor-
89
KOLLEKTIVIERUNG DER PHANTASIE?
gehörten. Die Mitarbeiter der Zeitschrift G - Material zur elementaren Gestaltung changierten zwischen privater und öffentlicher Sphäre. Zu Beginn traf man sich im Atelier von Gert Caden, später in einem Cafe in der Herrenstraße. Um pädagogisch wirken zu können und Stellungnahmen zu ihrem künstlerischen Schaffen zu erhalten, setzten die Künstler der ASSO von Anfang an auf öffentlich wirksame Versammlungen. In einer ehemaligen Werkstatt eines Schlossers fanden in Dresden regelmäßig und in kurzen Zeitabständen Mitgliederversammlungen statt. Hinzu kamen offene Zusammenkünfte, bei denen Kunstwerke vor Laienschaffenden und Arbeitern zur Diskussion gestellt oder aber Schulungsabende veranstaltet wurden. Diese hatten das Ziel, den Künstlern die Weltanschauung der Arbeiterklasse zu erläutern (Gärtner 1970: 252). Die freundschaftlich verbundene Atmosphäre setzte sich mit gemeinsamen Ausflügen fort. Man sei zu Ausstellungen gefahren oder ins Theater gegangen, meist aber hätten die Künstler im »Kaffeekeller« der Witwe Zuntz gesessen, debattiert, etwas getrunken und gewartet, »bis Otto Dix kam, uns auslöste und noch einen spendierte«. (Naumann 1985: 9) Eine tradierte Form der Geselligkeit unter Künstlern waren Künstlerresp. Gauklerfesteg6 , als je unter ein anderes Motto gestellte Kostümbälle. Die kunstvollen Grotesken trugen als farbige Scheinwelten zur Stilisierung der Lebenswelt bei. Historisch erschienen die Feste im 19. Jahrhunderts mit dem Auftreten einer eigenständigen und selbstbewussten Künstlerschaftg7 • Vormals den politisch herrschenden Kreise vorbehalten, nahmen die Künstler im bürgerlichen Zeitalter die Möglichkeit selbst wahr, ihr Leben durch Feste zu erhöhen88 . Die Feste waren Mittel der Selbstdarstellung und spontane, exzessive Darstellung der künstlerischen
phium in Berlin das Leben. In Erinnerung fertigte Conrad Felixmüller das Gemälde »Der Tod des Dichters Walter Rh einer« (Öl, 185x 130 cm) an. 86 Gauklerfeste waren das »Waldfest« in München mit etwa 400 Kostümierten und Darstellungen der Bauernkriegszeit im Sommer 1879. Es folgten wiederkehrende »Winter- und Sommerfeste«; Mottos hier waren beispielsweise »Kneipe auf dem Meeresgrund«, »Kneipe in der Unterwelt« oder »Märchen und Sage«. 87 Der erste Münchner »Künstler-Maskenzug« wurde 1835 im königlichen Nationaltheater abgehalten. Zu dieser Phantasiefeier unter dem Thema »Wallensteins Lager« versammelte sich die gesamte Künstlerschaft zu einer prachtvoll aufgemachten Maskerade. (Haus 1971: 13) Weitere Formen waren Künstlerbälle, ähnlich den Bürgerredouten, oder Stifterfeste. 88 Daneben gab es immer auch intime Formen der Geselligkeit, im Atelier, als Trinkgelage- jedoch unter weitgehendem Ausschluss der Öffentlichkeitwie die »fröhlichen Künstlerabende« der Renaissance in Florenz und in Rom. (Vgl. die Schriften von Vasari, Benvenuto und Cellini)
90
SOZIALE PHANTASIEN
Lebensweise. (Ruppert 1998: 191) Hier konnten die Künstler Alltagsund Kunstwelt verbinden und sich Geltung89 verschaffen. (Haus 1971: 3) Im 20. Jahrhundert wurden die Künstlerfeste vornehmlich in Akademien, in Philharmonien, gelegentlich in Zoos oder in Kasinos ausgerichtet. Meist in einer Nacht dekorierten die Künstler Orte und Räumlichkeiten selbst (Kliemann 1969: 30ff.) und bewarben diese mit humoristisch gestalteten Einladungsschriften. 90 Die Feste, die meist zweimal jährlich stattfanden, schufen - neben der Geselligkeit und Darstellungskraft - eine materielle Grundlage. So konnte sich die Novembergruppe aus den Erlösen ein ganzes Jahr finanzieren und kleine Geldsummen an einzelne Künstler verteilen. (Butting 1955)
Drehpunktpersonen Drehpunktpersonen erfüllten für die Künstlergruppen-Generation eme ökonomisch, wie mental unterstützende Funktion. Sie waren Kunstfreunde und Kunstsammler und hielten keine - wie später in der Anfangsphase der DDR - staatlichen Entscheidungspositionen inne. Ihre mäzenatische Rolle führten sie neben den beruflichen Tätigkeiten als Unternehmer, Arzt oder Rechtsanwalt aus. Von Bedeutung flir die Künstler waren, neben den Aspekten der Geselligkeit, insbesondere die ökonomischen Vorteile und die Anerkennung ihres Schaffens91 • In einer Zeit problematischer finanzieller Lage und ablehnender Haltungen etablierter Kunstvermittler und Kunstkonsumenten gegenüber experimentellen Ausdrucksformen boten Drehpunktpersonen einen Existenzrahmen.92 So habe der
89 In den Aufzeichnungen über den Dresdner Künstlerfasching 1856 bezeichnen sich die Künstler als »Stand« oder »Bund«. (Vgl. Haus 1971: 5) 90 Die Novembergruppe richtete im Dezember 1922 ihr Kostümfest im Gartensaal des Berliner Zoo mit einer »grossen Tombola und Dadaistischem Kabarett« aus. Für die Kostümierung wurden Krepppapier und bunte Lappen verwendet werden, Utensilien zum Färben der Haut waren an der Garderobe ausgelegt. (Vgl. Novembergruppe [ 1922]) 91 Dass ein »derart anspruchsvoller Kunstfreund« seine Arbeiten beachtet, hätte ihn riesig gefreut, kommentiert Griebe! die Werkankäufe von Dr. Fritz Glaser. (Griebel1986: 120) 92 In Düsseldorf war Johanna Ey mit ihrem Geschäft flir Kunsthandel, »das Ey«, Anlaufstation ftir Künstler aus allen Teilen Deutschlands. »Du bist ein rettender Engel Mutzli«, bedankte sich Otto Dix für die Abnahme einiger Radierungen mit einer Zeichnung, auf der er Johanna Ey als lächelnden Engel mit einem 2000 Markschein winkend darstellt. (Vgl. Barth 1987: 54, 57) Das Ey wurde außerdem zur Bezeichnung ftir eine Künstlergruppe im Düsseldorfer Umkreis und zum Titel für eine von Wollheim und Pankok herausgegebenen Zeitschrift.
91
KOLLEKTIVIERUNG DER PHANTASIE?
Rechtsanwalt und Förderer Dr. Fritz Glaser93 , im Tausch gegen ein Ölbild, Griebe! bei seiner Ehescheidung vertreten, ein anderes Mal Esskörbe an befreundete Künstler verteilt oder aber einen Hundertmarkschein auf Griebels Bett mit den Worten geworfen, er suche sich später ein Bild dafür aus. Häufig hätten sich Künstler und Kunstfreunde auch in Glasers Wohnung getroffen. Oder auch, wie Otto Griebe! lapidar formuliert: Gönner und Schnorrer. 94 Neben der für die Künstler faszinierenden Unabhängigkeit und der ökonomischen Lebensgrundlage boten Drehpunktpersonen - in Krisensituationen - immer auch je tatkräftige Unterstützung an. 95 Ihre Rolle veränderte sich jedoch mit dem Wandel der Bedingungen, wie dies in der Anfangsphase der DDR geschehen ist. 96 Der Gemeinschaftsgedanke Gemeinschaftliches Handeln wurde - wie bereits durch die vennehrten Gruppengründung und Bündnisse angezeigt - zur alles beherrschenden Vorstellung der Künstlergruppen-Generation und kristallisierte sich in mannigfaltigen Ausfonnungen. Man wollte Grenzen jeglicher Ausformung überwinden, auch um sich selbst Geltung zu verschaffen. Dabei schälten sich drei Strömungen heraus. Die einen zogen ihr Selbstbild aus der Massenwirksamkeit von Kunst (Kunst vereint in der Gemeinschaft), andere sympathisierten mit einer geistig-künstlerischen Verbindung von Gleichgesinnten (Kunst verbindet die Gemeinschaft) oder aber die Gemeinschaftsphantasie durchdrang alle Lebensbereiche und verschmolz selbst auf der semantischen Ebene (Kunst lässt in der Gemeinschaft aufgehen). Wie letzteres in der Wortschöpfung »kommunieren« von Hein93 Fritz Glaser beteiligte sich an der »Hungerhilfe fiir Russland« Anfang der 20er Jahre, an der »Internationalen Roten Hilfe« und an der «Deutschen Roten Hilfe« und wurde dadurch als »Rote-Hilfe-Anwalt« bekannt. Glaser war zudem Mitglied der Gesellschaft der Freunde des neuen Russland, zusammen mit u.a. Pol Cassel, Eugen Hoffmann, Georg Kind und Wilhelm Lachnit. Diese bildete die Basis fiir die »Erste Deutsche Kunstausstellung« 1924 in Moskau, Leningrad und Saratow, an der sich u.a. Otto Nagel, Otto Dix, Otto Griebe!, Wilhelm Lachnit und Edmund Kesting beteiligten. 94 Vgl. Griebels autobiografische Beschreibungen. (Griebe! 1986: 163, 197, 220, 263f.) 95 So bot der Psychiater Dr. Fritz Neuherger Weltkriegsverweigerern im Sanatorium Dr. Teuscher eine Ausweichmöglichkeit. Vermittelt über den Schriftsteller Albert Ehrenstein, hielt sich Kokoschka ab 1916 im Sanatorium »Weißer Hirsch« in Dresden auf und konnte so einen Kriegseinsatz verhindern. (Schmidt 1987: 13) Der Düsseldorfer Arzt und Kunsthändler Dr. Hans Koch förderte u.a. Conrad Felixmüller, Otto Pankak und Otto Dix. (Ibid.: 54) In Bischoffswerda nahm eine Unternehmerfamilie mittellose Künstler aufund bot ein Austauschforum an (vgl. Barth 1987: 52). 96 In dem Kapitel »Phasen und Zäsuren in der SBZ und DDR« erörtert.
92
SOZIALE PHANTASIEN
rich Vogeler sichtbar wird. 97 Die Mitglieder der Monatszeitschrift Das neue Berlin beschworen den »Weltbürgergeist«. Die »geeinte Menschheit« fassten die Künstler der Kugel als größten Zukunftsgedanken und sahen künstlerischen Ausdruck als das »gewaltigste Mittel«, die durch Grenzpfähle getrennten Völker einander näher zu bringen (vgl. Wilhelmi 1996: 234). Bestärkt durch das »Fluidum einer starken Willensgemeinschaft«, bekräftigte die Gruppe in ihrem Manifest das Ziel, eine große internationale Gemeinschaft zu erreichen. (Die Kommune 1922) Max Pechstein fonnulierte in seinem viel beachteten Aufruf »An alle Künstler« zur konstituierenden Sitzung der Novembergruppe seine Vorstellung, eine künstlerische Idealgemeinschaft in einer sozialistischen Republik zu schaffen, um eine einheitliche Kunstepoche entstehen und »Volk und Kunst« in der »Morgemöte der Einheit« erglänzen zu lassen.98 (Schmidt [1964]: 243) In einem Rundschreiben der Novembergruppe wurde der Zusammenhalt ein weiteres Mal mit der Argumentation beschworen, dass die Zukunft der Kunst und der Ernst der Stunde zur Einigung und zu einem engen Zusammenschluss zwängten: »Schon vor Jahren einte uns der schöpferische Instinkt als Brüder.« (V gl. Schneede 1979: 92) Die von der Novembergruppe abgelöste »Opposition der Novembergruppe« kritisierte ebenfalls die Gemeinschaftsidee und wollte Ernst machen mit dem Bekenntnis zur Revolution und dem »Aufbau der neuen menschlichen Gemeinschaft« der Werktätigen!«. (Opposition der Novembergruppe 1920/21: 297ff.)
Umfrage: »Ja! Stimmen des Arbeitsrates für Kunst« Eine neue Fonn, künstlerische Standpunkte vorzustellen, unternahm der Arbeitsrat für Kunst im Frühjahr 1919 mit der Umfrage »JA! Stimmen des Arbeitsrates für Kunst«99 • Mit der Umfrage unter den Mitgliedern sollte die »Stellung der Künstler zu den Bewegungen der Zeit« geklärt und eine einheitliche Basis für ein gemeinsames Werk von Künstlern verschiedener Art aufgebaut werden. Die Gruppe, so das Selbstbild, sei bestrebt, alle Künstler und zerrissenen Künste zusammenzuschließen. (Ja! Stimmen des Arbeitsrates für Kunst in Berlin 1919: 5) Die Fragen, 97 Abdr. in (Schmidt [1964]: 153). Die Künstler der Barkenhoff-Kommune wollten die Masse über die Verbindung von Arbeit und Kunst individualisieren. 98 Pechstein bezieht sich in seinem Aufruf auf Lenin: »Damm ist kein leerer Ruf der Schrei: >Die Kunst dem Volke!>Dresdner Sezession 33« Eine der wenigen künstlerischen Auseinandersetzungen der Künstlergruppen-Generation mit ihren eigenen Gruppenaktivitäten ist mit der Zeichnung »Dresdner Sezession 33« von Bemhard Kretzschmar aus dem Jahr 1933 überliefert. Hierauf hat Kretzschmar sich selbst und 32 seiner Mitstreiter der Dresdner Sezession 1932 abgebildet. Konzipiert als Titelblatt für den Sezessionsteil des Katalogs zur zweiten Ausstellung der Gruppe, die 1933 in Dresden zusammen mit der Künstlervereinigung und dem Deutschen Künstlerverband 11 7 ausgerichtet
116 Dabei waren die Dresdner Sezession, die Vereinigung der Schaffenden Künstler (1920-1922) mit expressionistisch orientierten Künstlern wie Fraaß, Großpietsch und Illmer, die Unkorporierten Künstler Dresden und die Arbeitsgemeinschaft Lausitzer Künstler. (Vgl. Sächsische Kunstausstellung Dresden [1934]) 117 Die »Gemeinsame Ausstellung. Drei Künstlergruppen« fand in den Dresdner Ausstellungshallen an der Lennestraße statt. (Vgl. Gemeinsame Ausstellung 1933)
99
KOLLEKTIVIERUNG DER PHANTASIE?
wurde, war das Blatt kurzerhand aus einer Teilauflage des Gesamtkatalogs entfernt worden. 118
Die Dresdner Sezessionisten 1933 an einem Tisch
DRESDNER SEZESSION33
Bernhard Kretzschmar ))Dresdner Sezession 33«, 1933, Zeichnung (Abb. aus: GemeinsameAusstellung 1933: [o.S.]) 118 Die Auswahl für die Sezession sei vorsichtig in Form und Thema erfolgt, aber ohne Konzession an die neuen Machthaber. Zur gleichen Zeit habe der dritte große Verband, die Künstlergenossenschaft Dresden, am gleichen Ort, aber in getrennten Räumen und unter eigener Regie, eme Werkauswahl seiner Mitglieder vorgestellt. (Löffler 1985: 36)
100
SOZIALE PHANTASIEN
Der Betrachter wird in das Bildgeschehen über die Rückenansicht des Verfassers und Leiters der Sezessionsgruppe, Bernhard Kretzschmar, gefuhrt. Dieser sitzt an der vorderen Breitseite des langen, rechteckigen Versammlungstisches; vor sich ein Tintenfass, in der rechten Hand ein Füllfederhalter, daneben drei Schriftstücke. Die darauf geschriebenen Satzfragmente 119 lassen vermuten, dass es sich um den Briefwechsel zur Ausrichtung der Ausstellung mit den Behördenstellen handelt. Die meisten Sezessionisten sitzen entlang des Tisches, vor sich ein Wein-, Sekt-, Schnaps- oder Bierglas sowie Tassen mit Kaffee oder Tee. Einige wenige stehen, etwas abseits gerückt. Kretzschmar neigt sich seinem linken Tischnachbarn und Schriftführer der Sezession, Erich Fraaß 120, zu. Gestik und Mimik lassen ihn als Vortragenden erkennen. Manche der Anwesenden hören aufmerksam zu, die Stirn in Falten gelegt, andere erscheinen gedanklich abwesend oder beschäftigen sich mit GitarrenspieL Das Szenario stellt eine Versammlung der Sezessionisten dar, ohne weitere Angaben über den Ort des Geschehens. Zu vermuten ist, dass sich die Künstler in einem Gasthaus trafen, wie dies als Gepflogenheit vieler Künstlergruppen aus der Weimarer Zeit überliefert ist, und es die reichhaltige Auswahl an Getränken erwarten lässt. 121
Der Hintergrund Der von der Sezession konzipierte Katalog der gemeinsamen Ausstellung122 dreier Künstlergruppen zeigt eine klare Trennung der drei Zusammenschlüsse. Farblieh markiert, ist dem Künstlerverband der erste, schwarz umrandete, der Künstler-Vereinigung der zweite, weiß umrandete, und der Sezession der letzte, rot umrandete Teil zugetragen und auf diesem das Motto in weißer Schrift vermerkt: »Das Leben ist immer ein
119 Rekonstruiert werden kann: »An das Ministerium[ ...] [Seite wird] [...] [vom] Rat zu [ ...] [vor]genannt B. Kretzschmar«. 120 Fraaß hatte sich in der Gruppe Die Schaffenden und im Spartakusbund engagiert und wird neben Kretzschmar und Kesting auch als Mitbegründer der Sezession 1932 angefiihrt (vgl. Edmund Kesting [1989]: 26). Das freundschaftliche Verhältnis zwischen Kretzschmar und Fraaß intensiviertenbeidein den folgenden Jahren mit gemeinsamen Studienreisen. 121 Daneben versammelten sich die Künstler dieser Zeit- je nach Gruppenausrichtung und Anlass - u.a. in den Ateliers der Kunstakademien, in privaten Räumen oder in eigenen Klubhäusem. 122 Mit der Gestaltung des gemeinsamen Katalogs war die Sezession betraut. Die Gesamtkonzeption trugen Erich Fraaß, Edmund Kesting, Bemhard Kretzschmar und der Kunsthistoriker Dr. Fritz Löffler; die Gestaltung des Haupttitelblattes übernahm Kesting.
101
KOLLEKTIVIERUNG DER PHANTASIE?
Plagiat der Kunst.« 123 (Gemeinsame Ausstellung 1933: [o.S.]) Indessen sich der Deutsche Künstlerverband, angeglichen an die ideologischen Forderungen der Zeit, mit einem Aufruf vorstellt, dessen appellativer Charakter zwar durch die Wortstellung relativiert wird, aber bereits erahnen lässt, mit welcher Aufgabe die Künstlerschaft in den folgenden Jahren konfrontiert werden sollte: 124 »Was dient dem Volke!« (Ibid.) Da der Katalog den politischen Vorgaben in seiner Form, wie in den Aussagen und Wünschen entgegenstand, sich aber in der Eile kein neuer beschaffen ließ, habe die Leitung des bereits mit NSDAP-Leuten besetzen Künstlerverbandes125 kurzerhand das »übelste Delikt« - das Titelblatt der Sezession - aus dessen Teil der Auflage entfernt und den Katalog ohne dieses verkauft. (Löffler 1986: 36) Als Beweggründe für die Reaktion des Deutschen Künstlerverbandes können die betonte Herausstellung der Sezession als Gruppe, die stilistische Überzeichnung der Künstler sowie die personale Abbildung >>Unerwünschter>Unsere Linie gehalten« werde (Kesting 1945). 94 Grohmann sei ja noch von 1946 her im Besitz der Bilder und des Textes gewesen, sodass die Drucklegung dann sehr schnell erfolgen konnte. (Kesting 1955) 95 Die Briefe an Liebmann, deren Inhalt sich überwiegend um die politische Situation künstlerischen Wirkens gruppiert, wurden abwechselnd von Gerda oder Edmund Kesting geschrieben. Die Grußformeln enden fast durchgängig mit der Unterschrift »die drei Kestings«.
158
PROZESS DER TRANSFORMATION
»Er konnte eine diskriminierende Ungerechtigkeit nicht verwinden, und hat sich deswegen abgewendet. Man bedauert es sehr, er soll doch der beste Kameramann gewesen sein!!!! Alles hat man versucht, um ihn wieder auszusöhnen, aber er hatte sofort eine neue Position gefunden in der er wie er meint: >geschätzt und gewürdigt wird und wo man seine Leistung auch offiziell anerkennen darf1 Kunstwerk< versagen mußte«. (Abschlußbericht 1953) 97 Laux werde es nicht gelingen, sich hinter einem »formalistischen Mäntelchen« zu verstecken. Denn »auch der primitivste Student in Weissensee« habe nun gesehen, dass der »Direktor jener Hochschule [... ] gar keine Ahnung von Malerei hat und ein erbärmlicher Dilettant ist.« (Kesting 1954)
159
KOLLEKTIVIERUNG DER PHANTASIE?
ben [... ] kurz gesagt, jeder schlug etwas anderes vor. Aber nicht um der Sache zu dienen, sondern um sich dabei durch Wort laut werden zu lassen, um Anspruch auf ein Sonnenplätzchen zu erheben. Die Vorschläge konnte man manchmal beinah als provozierend bezeichnen, und ich fragte mich oft, ob die wohl echt gemeint waren?« (Ders. 1955) Nicht nur fur Edmund Kesting war das Briefeschreiben ein Medium sozialer Vemetzung. Gerade in der Phase der staatlichen Konstitution hatte sich das Schreiben von Briefen zu einer regelrechten GrußpostkartenKultur entwickelt. Mit dieser Form der persönlichen Kommunikation konnten Beziehungen aufrechterhalten oder geschaffen werden. Der oder die Absender schufen die Möglichkeit, sich unverfänglich distanziert in Erinnerung zu halten. Ein Brief, so führt Georg Simmel aus, ist immer persönlich, trägt aber zur Objektivierung des Subjektiven durch seine schriftliche Form bei und verleiht so momentanen Stimmungen, wie auch Gedanken Dauerhaftigkeit. 98 Betrachte man den vermittelten persönlichen Ausdruck,99 veranschaulicht der Brief die Vielheit des scheinbar so einfachen, gegenseitigen Verstehens. Der Brief befindet sich in einem Bereich zwischen der »naiven Einheitlichkeit« der Rede, bei der durch Gestik und Mimik mehr gegeben wird, als der bloße Inhalt der Worte, und einer distanziert schriftlichen Abhandlung. (Simmel 1999: 433) In der durch die Umstrukturierungsprozesse unsicheren Anfangsphase der DDR verschickten die Künstler systematisch, auch als Gruppe, auf Postkarten und Kurzbriefen insbesondere Wünsche und Grüße zu jährlich wiederkehrenden Ereignissen, wie Geburtstagen oder zu anderen Festanlässen, wie Ostern, Weihnachten und Sylvester. Diese sind häufig mit malerischen Statements, zeichnerisch illustrierten Karikaturen oder mit poetischen Erläuterungen versehen 100 und künstlerischer Ausdruck Simmel geht vom EmpHinger aus, nicht vom Sender. Das Verständnis des Empfangenden sei schriftlich auf den logischen Kern hin gebundener als bei der Rede, aber freier in Bezug auf den tieferen und persönlichen Sinn. Der Brief erscheine »deutlicher, wo es auf das Geheimnis des anderen nicht ankommt, undeutlicher und vieldeutiger aber, wo dies der Fall ist.« (Simmel 1999: 432) 99 Die literarische Gattung des Briefes hatte sich in der bürgerlichen Kultur des 18. Jahrhunderts als ein Medium der Subjektivierung entwickelt und konnte sich als Ausdrucksform der individuellen Geftihlswahmehmung etablieren. In der Romantik gerieten Briefe zu Kunstwerken und zum Ausdruck des bürgerlichen Selbstverständnisses. Als >Künstlerbriefeexklusiv< d. h. ich male sehr viel, fast ununterbrochen und wir zählen nur eine bandvoll außergewöhnlich verständnisvoller Menschen zu unserem Kreis, [.. .].« (Ders. 1962) Das Verständnis der Freunde, die allesamt Künstler waren, ergab sich aus der geistesverwandten künstlerischen Einstellung. Selbst deren Kinder wollten nur »>abstrakte< Bilder in ihre Zimmer aufgehängt haben«. Hingegen könne man zur laufenden Bezirkskunststellung in Berlin nur sagen: »Vater vergib ihnen. Es ist wohl das Letzte !! !!« (Ibid.) Zunächst versuchte Kesting, wie auch andere Künstler, die Konfrontationen durch Drehpunktpersonen abzufangen. Andere Möglichkeiten, wie die Positionienmg durch gesellschaftliches Wirken oder die Betätigung im institutionellen Rahmen, kamen für Kesting wegen seiner freiheitlichen und auch eigenwilligen Auffassungen, nicht in Frage. Nachdem die Möglichkeiten erschöpft waren, wandte er sich ab. Dies geschah durch den Rückzug in die Provinz. Dort lebte er ein beschauliches Alltagsleben. Er unternahm, wie dies auch von den Mitgliedern der UferGruppe überliefert ist, Besichtigungen und Wanderausflüge und favorisierte überschaubare Geselligkeit104 • In einem Brief an Fritz Löffler beschreibt er die Tage zwischen Weihnachten und Silvester als recht turbulent: »Ständig das Haus voller Gäste, gebetene und ungebetene. Das hält der stärkste Mann nicht aus.« (Ders. 1961) Ab 1948 begann Kesting mit seinen »jährlichen Domizilwechseln«, die ihm, auch wegen seiner freien und phasenweise unterbrochenen Lehrtätigkeiten, ermöglicht waren.
104 In Ahrenshoop betätigte sich Kesting im Ahrenshooper Kreis und im Rubenow-Club der Greifswalder Universität. (Kesting 1968)
162
PROZESS DER TRANSFORMATION
Diffusion der Ideale (1951-1953) Die dritte Phase der Formierung des künstlerischen Feldes in der Anfangsphase ist gekennzeichnet von einer grundlegenden Umstrukturierung des Kulturbereichs und hier vor allem von der Ausgliederung des Künstlerverbandes aus dem Kulturbund. Mit Geltungsdauer bis zum Zusammenbruch des Staates stellte die Einrichtung des Verbandes den Abschluss des institutionellen Prozesses der kulturellen Vergesellschaftung der DDR dar. Anfang der 50er Jahre hatten bereits einige der gesellschaftlich ins Abseits gerückten Künstler und Drehpunktpersonen der Künstlergruppen-Generation die DDR verlassen, wie beispielsweise Will Grobmann 1948 in Richtung Westberlin. Oder kapselten sich zusehends in ihrem eigenen Weltverständnis ab, meist verbunden mit örtlicher Abschließung, wie dies Edmund Kesting und Hennann Glöckner oder auch Curt Quemer wählten. Die Künstlergruppen waren bereits in ihrem Wirken eingeschränkt und verschwanunen zusehends als soziales Gebilde. Am Ende der Diffusionsphase wird es keine soziale Formation mehr geben, die sich als solche zu erkennen gibt. Am Beispiel der Künstlergruppe Das Ufer, die 1952 in den VBKD eingegliedert worden war, können die Mechanismen der Vergesellschaftung, deren konkreten Auswirkungen und die Gegenstrategien der Künstler aufgezeigt werden.
Umstrukturierung des Kulturbereichs Die Initialzündung für die institutionelle Festigung des Staates der DDR wurde politisch am 10. März 1952 mit der »Stalin-Note« eingeläutet, in der die Aufhebung der Teilung Deutschlands anvisiert worden war. 105 Kurz darauf riefen die Verantwortlichen der SED während der »2. Parteikonferenz« 1952 den Aufbau der »Sozialistischen Nation« aus. Hieran schlossen sich weitere Umstrukturienmgen im Kulturbereich an, die ab Anfang 1953 in wenigen Monaten durch »Instrukteure« der vorübergehend eingerichteten »Kommissionen« umgesetzt werden konnten. Um die »neue Linie« bildhaft werden zu lassen, wurde die dritte große Kunstschau um ein halbes Jahr von Herbst 1952 auf das Frühjahr 1953 verschoben und konkrete Richtlinien für die Künstler ausgegeben. An der Forderung nach der Vereinigung der beiden Staaten hielt man aber, 105 Die Stalin-Bekundung, auch als »sowjetische Deutschland-Note« bezeichnet, galt in der BRD dagegen als machtstrategische Offerte der sowjetischen Führung. (Vgl. u.a. Steininger 1985)
163
KOLLEKTIVIERUNG DER PHANTASIE?
auch im kulturellen Bereich, weiterhin fest. Dieser Topos bildete, zusammen mit dem des »Aufbaus der Sozialistischen Nation«, begrifflich eingefangen als »der neue Weg«, denn auch den Schwerpunkt der dritten Kunstausstellung, sowohl in thematischer und stilistischer als auch in organisatorischer Hinsicht und wurde in den folgenden Jahren ideologisch und konzeptionell weitergeführt. Die institutionellen Konturen waren 1950 mit der Zusammenlegung aller Künstlerorganisationen, resp. mit der Gründung des Künstlerverbandes im Kulturbund, und der Ernennung des Verbands im April 1951 zur eigenständigen Organisation innerhalb des Kulturbundes, vorbereitet worden. Auf den Tag genau ein Jahr später erfolgte dann die Ausgliederung des Künstlerverbandes aus der Dachorganisation und die Umbenennung in Verband Bildender Künstler Deutschlands (VBKD). 106 Begründet wurden diese Veränderungen mit der Verwaltungsreform von 1952, bei der die föderalistische Einteilung der DDR in fünf Länder durch eine zentralistische Ordnungsform mit Bezirken und Ortseinteilungen ersetzt worden war. Zur gleichen Zeit löste man Einrichtungen wie die Deutsche Zentralverwaltung für Volksbildung nach der allmählichen Ausgliederung ihrer Aufgabenbereiche auf. Im Vorfeld der Umstrukturierung waren historisch gewachsene Organisationsfonnen aus dem 19. Jahrhundert- ausdrücklich Kunstvereine und Sezessionen - als »bürgerliche Einrichtungen« abgelehnt worden. Dennoch wurden ihre organisatorischen Muster, beispielsweise bei den ab 1953 eingerichteten Verkaufsgenossenschaften, übernommen. 107 Die eigens ftir die Umstrukturierung eingesetzten »Instrukteure« übernahmen die Überwachung über den Abschluss hinaus, der nach der dritten Kunstausstellung im Frühjahr 1953 erfolgte. 108 Geplant wurde die
106 Beim »Tl. Verbandskongreß« vom 7. bis 9. Juni 1952 wurde der VBKD als eigenständige Organisation konstituiert; 120 Teilnehmer bestätigten die Loslösung vom Kulturbund. Vorausgegangen war eine herbe Parteikritik an der Arbeit des Verbandes. In der Konsequenz wurde Otto Nagel von Fritz Dähn abgelöst. Von den Kritisierten kamen nur noch Nagel und Schwimmer in den neuen Vorstand. (Heider 1993: 159f.) Aus den Landesverbänden wurden 15 Bezirksverbände des VBKD (vgl. die von der Volkskammer beschlossene Verwaltungsreform der DDR vom 23. Juli 1952) und 1954 an Kunstgenre angebundene Sektionen mit »Zentralen Sektionsleitungen« eingerichtet. 107 Vgl. die Ausfühnmgen über die Übemahme der ehemals vom Bürgertum im 19. Jahrhundert eingerichteten, organisatorischen F01m der Kunstvereine als Verkaufsgenossenschaften in der DDR in dem Kapitel »Zwischen Tradition und Revolution«. 108 Beispielsweise wurde Dresden in acht und Berlin in neun Arbeitsgebiete aufgeteilt, die jeweils einem »Instrukteur« zugeordnet waren.
164
PROZESS DER TRANSFORMATION
Umstrukturierung innerhalb des Kulturbundes mit eigens auf Landes-, Kreis- und Stadtebene geschaffenen »Kommissionen«. Diese hatten Sichtungsaufgaben, d.h., sie bereiteten die Ausgangsbasis fur die Sammlung der Künstler vor, bevor die eigentliche zentrale Künstlerorganisation gebildet wurde. 109 Eine bedeutende Rolle bei der Umstrukturierung hatte die Staatliche Kommission fur Kunstangelegenheiten 11 0 , kurz KuKo oder Kunstkommission genannt. 111 Sie fungierte als Zensurbehörde, übte Kontroll- und Anleitungsfunktionen aus und war beauftragt, auf allen Gebieten der Kunst den Formalismus überwinden und eine realistische Kunst durch Anknüpfen an die Meister der Klassik entwickeln zu helfen (Heider 1993: 130f.). Die Kommission war direkt dem Ministerrat unterstellt, was die Auflösung der »Hauptabteilung Kunst und Literatur« des Ministeriums zur Folge hatte. Der Einfluss der Kunstkommission lässt sich auch daran ermessen, dass diese Anfang 1954 in das höchste Entscheidungsgremium der DDR- in das Ministerium fur Kultur, mit Johannes R. Becher an der Spitze - umgewandelt wurde. Die Auflösung der Kommission im Jahr 1954 markierte dann auch den Abschluss der institutionellen Umstrukturierung des kulturellen Bereichs. In der Folgezeit wurden lediglich zwei weitere und ständige Kommissionen im Politbüro des ZK der SED eingerichtet: die Kommission fur Fragen der Kultur im Politbüro des ZK der SED im Jahr 1957 und die Ideologische Kommission im Jahr 1963. 112 109 Die »Kommissionen fiir bildende Kunst« innerhalb des Kulturbundes waren zuständig fiir »die Entwicklung des Kunstlebens, den geistigen Austausch unter den Kunstschaffenden, das Kunstgespräch mit dem interessierten Publikum, Ausstellungen und Fachvorträge« (VBK der DDR 1983: 23). 110 Die KuKo wurde vom 5. Plenum des ZK in den Grundzügen beschlossen und am 12. Juli 1951 eingerichtet. Den Vorsitz erhielt Helmut Holtzhauer (1912-1973), der von 1948 bis 1951 Minister des Ministeriums ftir Volksbildung in Sachsen und Mitglied des Ehrenpräsidiums der dritten Kunstausstellung 1953 war. 111 Gemeinsam mit dem VBKD war die KuKo Veranstalter der »III. Deutschen Kunstausstellung« und maßgeblich beteiligt am Abhängen von Werken kurz vor der Ausstellungseröffnung und der Beeinflussung der Juryentscheidung bezüglich der WerkauswahL Vgl. hierzu die Notizen über ein Ferngespräch (Staatliche Kunstkommission 1953), die Diskussionen nach der Kunstausstellung (VBKD [1953]: 59, 78, 86, 98ff.) sowie den Abschlussbericht (Abschlußbericht 1953). 112 Bei beiden hatte Kurt Hager (1912-1989) die leitende Funktion bis zum Ende der DDR. Hager war in diesem Zeitraum u.a. tätig als Leiter der Abteilung Propaganda des ZK der SED, Leiter der Abteilung Wissenschaft und Hochschulen des ZK der SED, Professor ftir Philosophie an der Humboldt-Universität zu Berlin, Sekretär des ZK der SED Abteilung Wissenschaft, Sekretär fiir Volksbildung und Kultur, Mitglied der
165
KOLLEKTIVIERUNG DER PHANTASIE?
Mit der Ausgliederung des Künstlerverbandes aus dem Kulturbund wurde die Aufgabenverteilung im Kulturbereich abgestimmt und die Organisationsstruktur an das staatspolitische Ordnungsgefüge angeglichen. Dadurch konnte der Kulturbund seine Arbeit fokussieren und sich »auf die Sammlung der Intelligenz, die Verstärkung der gesamtdeutschen Arbeit und die Verbreitung der populärwissenschaftlichen Kenntnisse konzentrieren« 113 • Zur Strukturänderung des Verbandes merkt Magdalena Heider an: »Üb es zu dieser Trennung tatsächlich eine Alternative gegeben hatte, und ob sie diskutiert wurde, war nicht zu ermitteln.« (Heider 1993: 159) Wie jedoch aus der Quellenlage und den folgenden Ausfiihrungen deutlich wird, gab es keine Alternative zu dieser institutionellen Form. Zunächst wählten die Verbandsdelegierten die Mitglieder des Vorstands114. Der Vorstand wählte wiederum das Sekretariat und dessen 1. Vorsitzenden 115 . Mit der Begründung der praktischen Koordinationsunfähigkeit und des mangelnden Engagements wurde Otto Nagel als Präsident des Künstlerverbandes abgelöst und Fritz Dähn als erster Vorsitzender bestimmt. Zu dessen Unterstützung erhielt Herbert Gute das neu geschaffene Amt des Generalsekretärs. 116
113 114
115 116
»Kommission für Fragen der Kultur beim Politbüro«, Mitglied des Politbüros, Mitglied in der Volkskammer, Leiter der Ideologischen Kommission beim Politbüro des ZK der SED, Vorsitzender des Volkskammerausschusses Volksbildung. Die meisten dieser Positionen hielt Hager bis 1989 inne. Die Zeit der »Allesbetreuer-Organisation« sei vorbei, es werde sich ein Organisationstypus bilden, der auf einem Gebiet Spezielles und Konkretes leiste. (Becher 1952: 10) In den Vorstand gewählt wurden Walter Arnold, Hans Baltschun, Rudolf Bergander, Fritz Cremer, Fritz Dähn, Walter Funkat, Eberhard Frey, Lea Grundig, Herbert Gute, Bert Heller, Bernhard Kretzschmar, Fritz Kühn, Heinz Mansfeld, Otto Nagel, Marcien Novack-Neumann, Herbert Sandberg, Ernemann Sander, Herbett Schmidt-Walter, Eva Schulze-Knabe, Max Schwimmer, Gustav Seitz, Tilk Senf, Willi Wolfgramm und Kurt Zimmermann. »Amo Mohr, der es gewagt hatte, die gegen seine Bilder vorgebrachten Einwände zurückzuweisen, bekam in diesem Leitungsgremium überhaupt kein Amt mehr.« (Heider 1993: 161) Weiterhin gehörten dem Sekretariat Gustav Seitz, Rudolf Bergander, Kurt Zimmermann, Herbert Sandberg, Willi Wolfgramm und als geschäftsführender Sekretär Arno Krewetth an. (VBKD 1952b: 2) Dähn hielt das Präsidentenamt bis 1954 inne, unterstützt von Herbert Gute als Generalsekretär, wobei diese Funktion danach aufgehoben wurde. Gute wurde von 1955 bis 1959 zum Präsidenten gewählt und ihm zu seiner Entlastung Willi Wolfgramm zur Seite gestellt. Geschäftsführende Sekretäre waren Herbert Scheffel (1952-1953) und Gottlieb Rese (19531958).
166
PROZESS DER TRANSFORMATION
Die zweite Stufe der Umstrukturierung des künstlerischen Feldes war die Bildung von Ausschüssen und Kommissionen, um die Kontrolle und Lenkung des Kulturbereichs effektiver zu gestaltet. Beispielsweise die »Gutachterkommission« 117 , die über die Qualifikation der Mitglieder entscheiden, bei der Auftragslenkung und Auftragsberatung mitwirken sowie an den Sitzungen und Atelierbegehungen der Kommission für Kunstangelegenheiten teilnehmen sollte. (VBKD 1952a: 3) Als Erklärung für die Einrichtung der zahlreichen Untergruppierungen wurden spezielle Aufgabenstellungen angeführt, die zentral nicht mehr bewältigt werden könnten.m Die Kritik innerhalb des Verbandes machte sich an der als mangelhaft bewerteten Koordination zwischen den Institutionen fest. So bestünden zwischen der Kunstkommission und der Akademie der Künste keinerlei Arbeitsabsprachen. (Scheffel 1952: 6) Weshalb in der Vorstandssitzung vom 3. und 4. September 1952 beschlossen wurde, eine außerordentliche Delegiertenkonferenz für den 8. und 9. Oktober einzuberufen und als Begründung von Verbandsseite angeführt 119 : »Die Konferenz ist nötig im Zusammenhang mit den Maßnahmen der Regierung, die sich aus den Beschlüssen der Il. Parteikonferenz der SED ergeben, da die Aufgabenstellung des Verbandes [...] und seine Struktur der Situation angepaßt werden muß.« (VBKD 1952d: 10) Der Abschluss der Umstrukturierung des Verbandes erfolgte schließlich Ende März 1953 120, die Realisierung der Vorstellungen übernahm federführend die Staatliche Kommission für Kunstangelegenheiten121 (vgl. VBKD 1953: 17). In der zweiten Arbeitstagung mit den Kommissionen wurde dann eine härtere Gangart beschlossen: »Entsprechend den Satzungen sind Mitglieder, die sich durch ihr Verhalten als unverbesser-
117 Die »Gutachterkommission« wurde von den Vorstandsmitgliedern und die »Landesgutachterkommissionen« von den Landesdelegierten gewählt und vom ZV bestätigt. 118 Im Sekretariatsbeschluß vom 24. Juni 1952 werden benannt: »ideologischer Ausschuß«, »Auftragsausschuß«, »Gutachterausschuß«, »Ausstellungsausschuß«, »Redaktionsausschuß«, »Förderungsausschuß« und »Materialausschuß«. Die Bildung einer »Zentralen Auftragskommission« wurde verschoben bis zur Einrichtung einer »Staatlichen Auftrags- und Prämienkommission«. (VBKD 1952c: 17) 119 Über diese Vorstandssitzungen liegen keine Primärquellen vor. 120 Verantwortlicher der Umstrukturierung war Wemer Scheffel, der kurz darauf plötzlich ausschied. 121 Die KuKo wurde im darauf folgenden Jahr grundlegend vom Vorstand des VBKD kritisiert. Sie hätte es nicht verstanden, wie viele andere Kommissionen auch, die entscheidende Aufgabe zu lösen und »ein enges, schöpferisches, unbürokratisches Verhältnis zu unseren fuhrenden Künstlern herzustellen« (VBKD [1953]: 14).
167
KOLLEKTIVIERUNG DER PHANTASIE?
liehe Formalisten erweisen, aus dem Verband auszuschließen.« (1953 ein Jahr der großen Aufgaben 1953: 3) Von der Vorstandsebene wurde kritisiert, dass einige Mitglieder des Vorstandes wiederholt und ohne Entschuldigung den Sitzungen ferngeblieben seien, die Arbeit im Vorstand und in den Kommissionen dadurch hemmten und ihrer Vorstandspflicht nicht genügen würden. Bis zum 15. Mai 1953 wurden deshalb sämtliche Bezirksleitungen neu gewählt. Durch die Strukturänderung erfuhr der Zentralvorstand nochmals eine Veränderung. Nach der Auflösung der Landesvorstände schieden die bisherigen Landesvorsitzenden aus dem Vorstand aus, soweit sie nicht dem auf dem »II. Kongreß« gewählten Vorstand angehört hatten. 122 Die Zentralisierung des Kulturbereichs war mit der Umstrukturierung Mitte 1953 abgeschlossen. Seit dieser Zeit wurden die Verbindung zwischen der politischen und der kulturellen Ebene nur mehr intensiviert und parallel dazu Kontrollmechanismen ausgebaut.
Scheitern der Gemeinschaftsidee Spätestens ab Anfang der 50er Jahre hatte sich die Mehrzahl der Künstler mit den vorgegebenen Bedingungen arrangiert oder hielt für eine kurze Zeitspanne eine Doppelidentität als Gruppe und als Kollektiv aus. Als Alternativen für den je einzelnen Künstler boten sich Funktionärspositionen und pädagogisch-akademische Tätigkeiten an. Einige Künstler verließen die DDR oder wandten sich in innerer Emigration ab, was meist einer örtlichen Abschließung gleichkam. Diese Entwicklung wurde begünstigt durch die staatlichen Bemühungen, das künstlerische Feld ab 1952 forciert zu bündeln. Aus der anfänglichen Euphorie der Künstler erwuchsen mehrheitlich Strategien der Anpassung mit der Anhindung der künstlerischen Tätigkeit an die staatlichen Vorstellungen, bis auch dieses Engagement nach und nach in eine Phase der Diffusion eintrat und verschwand. Die faschistische Verfolgung blieb jedoch als gemeinsamer Kerngedanke im Gedächtnis eingeschrieben und wurde in der Erinnerung von dieser Funktionärs- und Künstlergeneration bis Anfang der 70er Jah-
122 Zudem schieden Herbert Gute, Arno Krewerth, Fritz Kühn, Ernemann Sander, Gustav Seitz und Tilk Senf aus dem Vorstand sowie Rudolf Bergander aus dem Sekretariat des VBKD aus. Seitz tmd Krewerth, geschäftsführender Sekretär, waren zugleich Mitglieder des Sekretariates. Hinzu gewählt wurde, sieht man von den Bezirksleitern ab, lediglich Tom Beyer, der eine mitbestimmende Rolle bei den Atelierbesuchen in Westdeutschland für die Werkauswahl zur III. DKA hatte.
168
PROZESS DER TRANSFORMATION
re und der Ausbildung einer staatlichen Eigengeschichte stets präsent gehalten. Die pädagogischen und gesellschaftlich ausgerichteten Aktionen der Ufer-Künstler waren zwar gemeinschaftlich motiviert, aber aus strategischem Kalkül entstanden. Insbesondere Siegfried Donndorf, der die Gruppe immer wieder zu motivieren wusste, verstand die Anhindung an die staatlichen Entscheidungsinstanzen als Möglichkeit, das Überleben als Gruppe zu sichern. Dem staatlichen Programm der »Wissenschaftlichen Popularisierung« folgend - und damit den gesellschaftlichen Auftrag von Kunst in die Tat umsetzen zu helfen- wurden, neben den Vertragsverpflichtungen aus »Freundschaftsverträgen« und »Patenschaften«, ideologische Unterstützung mit populärwissenschaftlichen Vorträgen gegeben, Diskussionsabende geführt, speziell zugeschnittene Führungen zu Ausstellungen ausgerichtet und »Laienzirkel« gebildet. Die Beweggründe der Ufer-Gruppe vor Augen, bemerkt die Direktorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, Gertrud Rudloff-Hille, dass die Ausdrucksmerkmale der zu einer Ausstellung eingereichten Werke den geforderten nicht genüge leisten und »manche Ufer-Leute meinen, durch Diskussion werde ein Bild besser und zur Ausstellung noch reif!«: »Denn ob ein Künstler in dieser oder jener Beziehung ausserkünstlerisch tüchtig ist, sagt noch nichts über die Qualität seiner Bilder aus.« (Rudloff-Hille 195lb) Bei der Auswahl der Werke für die Ausstellungen gingen die UferKünstler Konzessionen ein, wie auch den Vorgaben zur Art der Darstellung und der Themenwahl nachgekommen wurde. So übermittelte Gruppenleiter Siegfried Donndorf 1951 Hainz Harnisch die Anweisung von Rudloff-Hille, dass für die bevorstehende Ausstellung nur Bilder ausgewählt werden sollten, die noch nicht gezeigt worden seien. Die Werke müssten einer »eifrigen >Kritik< standhalten können«. (Das Ufer 1951a) Bezüglich der Auswahlkriterien bemerkt die Direktorin offen in einem Brief an Donndorf: »Es ist unerlässlich, dass wir grosse Vorsicht walten lassen, damit keine berechtigten Vorwürfe gemacht werden können.« (Rudloff-Hille 1951a) Als Ausschlusskriterien nennt sie Arbeiten, die bekannt oder zu bekannt seien und somit den »neuen Kurs« nicht wirklich unterstreichen helfen würden. Andere Kriterien für Ausstellungen waren das immer wieder von staatlicher Seite aus für immens wichtig erachtete Hängen der Werke und der bildlich darzustellende gesellschaftliche Auftrag. Mit diesen eingehenden Hilfestellungen bewahrte sich die Leiterin der Kunstsammlungen auch selbst vor Konsequenzen, was Gertrud RudloffHille in einem Brief deutlich zum Ausdruck bringt: Sie sei gegenüber
169
KOLLEKTIVIERUNG DER PHANTASIE?
dem Ministerium und der Öffentlichkeit verantwortlich fiir die gezeigten Werke bei der Wechselausstellung. (Vgl. u.a. Das Ufer 1951a) Das Jahr 1951 sollte denn auch das gesellschaftlich aktivste Jahr der Gruppe sein und läutete eine Wendemarke im Gruppengefiige ein. Die zu diesem Zeitpunkt 30 Mitglieder umfassende Gtuppe und insbesondere deren Leiter, Siegfried Donndorf, ftihlten sich immer mehr unter Druck gesetzt. Ab nun häuften sich die Schreiben der Rechtfertigung und die Bekundungen über die gesellschaftliche Bedeutung der Künstlergruppe. Es zirkulierten mehrere Listen über die gesellschaftsrelevanten Tätigkeiten und ihre Funktion für die Vennittlung von Kunst, hingegen wurden die eigenen Kunstwerke in den Schreiben völlig ausgeblendet. Mit den schriftlichen Klarstellungen sollte »jeder Vorwurf beseitigt« werden, das Ufer »würde in einem Gegensatz zum VBK stehen«. Vielmehr sei ein hoher Prozentsatz eng mit der Verbandsarbeit verknüpft. In der Gruppe hätten sich fortschrittliche und aktive Künstler zusammengefunden, um in ernster, kollektiver und künstlerischer Arbeit am Aufbau der DDR mitzuhelfen. (Das Ufer 1951d) Um als Gtuppe weiter zu bestehen, wurden von den Ufer-Mitgliedern nun ausschließlich Aktivitäten vorgenommen, von denen sie glaubten, den gesellschaftlichen Auftrag erfüllen zu können. Ab 1951 wurden deshalb das soziale Engagement verstärkt und vermehrt Aufträge im Sinne der Verbandsvorstellungen übernommen. Das Ufer schloss im Juli und im September 1951 zwei Freundschaftsverträge mit der Landesdruckerei Sachsen und mit der MAS Barnitz »Thomas Müntzer« ab und betreute mittlerweile drei Patenschulen. Fernerhin leistete die Gruppe Sichtwerbung, gestaltete die Feiern zum 1. Mai, die Erntefeste, Betriebskunstausstellungen, Wanderausstellungen, Ausstellungen in Ferienheimen, hielt beispielsweise im »Üfenwerk Fortschritt« Referate, führte Diskussionen und halfbei den Vorbereitungen der »Weltfestspiele der Jugend und Studenten«. Weiterhin wurden Vortragsreihen und Zirkelleitungen in Betrieben veranstaltet sowie Lehrtätigkeiten in Schulen und Hochschulen, im VBK und im Kulturbund übernommen. 123 Um die künstlerische Arbeit effektiver gestalten zu können und den kunstpolitischen Auffassungen auch organisatorisch näher zu kommen, gründeten die Ufer-Künstler innerhalb der Gruppe drei Arbeitskollektive,124 so u.a. das Kollektiv Kulturarbeit, das 1951 mit Vorträgen in den beiden Freundschaftsbetrieben betraut war. 125
123 Vgl. die Darstellung der Ausstellungstätigkeiten (Das Ufer 195lc). 124 Ein Kollektiv war flir die »Kulturarbeit in der Industrie und auf dem Lande« zuständig, ein weiteres erarbeitete die »ideologischen und künstlerischen Voraussetzungen in ständigem Austausch« und ein drittes Kol-
170
PROZESS DER TRANSFORMATION
Den vorläufig letzten Schritt als eigenständige Gruppe und ein Mittel, das Gruppengefuge nochmals nach innen durch Abgrenzung zu erhärten, stellte der Ausschließlichkeitsanspruch dar. Dieser wurde am 15. Oktober 1952 für alle Mitglieder definiert und in dieser Phase der unsicheren Gruppenexistenz als stabilisierender Eingriff wahrgenommen. Der Anlass für diese Anweisung stellte die Bildung eines eigenen Kollektivs von Hans Kinder mit der Bezeichnung »Brigade« außerhalb der Ufer-Gruppe dar, ohne dies mit den Künstlerkollegen vorher abgesprochen zu haben (Das Ufer 1952a). Bei einem »Aussprache-Abend« der Gruppenmitglieder forderten diese Hans Kinder auf, eindeutig zu erklären, ob er weiterhin als Mitglied gelistet werden wolle oder nicht. Wie auch von staatlicher Seite die Bildung von Künstlergruppen als bedrohlich empfunden wurde, sahen nun die Ufer-Künstler selbst ihre Identität als Gruppe vehement gefährdet. Nachdem die Künstlergruppe bereits mehrere interne Kollektive gebildet hatte und die »Eingliederung« in den Künstlerverband unausweichlich erschien, löste sie sich formell am 5. März 1952 aufund ging als so bezeichnetes »Arbeits-Kollektiv« unter dem Namen »Kollektiv >Das Ufer< im Verband Bildender Künstler« in den VBKD ein: »Das Kollektiv >Das Ufer< im Verband Bildender Künstler übernimmt mit der Uebernahme des Namens der liquidierten Gruppe die Verbindlichkeiten dieser Gruppe.« (Das Ufer 1952b) Das Ufer stellte die letzte Künstlergruppe dar, die als vormals frei gewählter Zusammenschluss vergesellschaftet wurde. In der Schlusserklärung wird die Auflösung als eigen motiviert dargestellt und den Mitgliedern empfohlen, sich tatkräftig in die Verbandsarbeit einzugliedern und ihre reichen Erfahrungen auf dem Gebiet der gesellschaftlichen Arbeit nutzbringend zu verwerten. In einem letzten Rundschreiben begründet Danndorf die drastisch als »Liquidierung« bezeichnete Auflösung. Die Liquidierung dieser Gruppe erfolgte unter der Erklärung, dass Gruppen innerhalb des Verbandes Bildender Künstler nicht mehr notwendig seien und die Verbandsarbeit evtl. sogar stören könnten. (Ibid.) In Art einer Rechenschaftslegung wurden mit diesem Schreiben nochmals alle gesellschaftlichen Aktionen der Gruppenmitglieder bis zur Eingliederung aufgeführt. So habe Das Ufer insgesamt elf Ausstellungen in Museen, 43 Kunstausstellungen in Betrieben und Schulen ausgerichtet sowie 35 po-
125
lektiv kümmerte sich um die Organisation der Gruppe und war als Jury für Ausstellungen tätig. (Das Ufer l95lc) »Praktische Abende« waren diesen Vermittlungsaktionen angeschlossen, auf denen die gleichenVorträgegehalten wurden. (Das Ufer 1951 b)
171
KOLLEKTIVIERUNG DER PHANTASIE?
pulärwissenschaftliche Vorträge, 328 Führungen und Diskussionen mit Werktätigen übernommen. (Ibid.) Ab diesem Zeitpunkt sind zwar die Aktionen der Gruppe verloren gegangen, nicht jedoch ihre Treffen und die Identifikation mit dieser. Als Kollektiv innerhalb des Verbandes blieb der Zusanunenschluss weiterhin auf enger freundschaftlicher Basis bestehen, die Basis des Zusammenhalts war nicht durch die Einbindung in den Künstlerverband entzogen oder überflüssig geworden. Dokumentiert ist auch eine letzte Ausstellung von 1955 in Hamburg, indessen löste sich Das Ufer als Gruppe vollständig 1957 mit dem Tod von Siegfried Danndorf auf. 126 Zwar bergen widersprüchliche Selbstbilder einen hohen Grad an Instabilität, dass sich die Gruppe aber nach ihrer staatlichen Einbindung nicht auflöste und eine Doppelexistenz führte, lag an dem innen gerichteten und stabilisierenden Moment der Freundschaft. Gäste waren immer willkommen und das Atelier in der Loschwitzer Strasse 21 stand jedem Mitglied zu jeder Zeit offen. 127 Auch hatten die Treffen der Künstler nicht den strengen Ablauf, wie dieser in den Rundschreiben und den Verbandsschreiben und Rundschreiben vermerkt wurde. Beleg hierfür sind in den Sitzungsprotokollen vennerkte gesellige Momente. 128 Die D!ffitsionsphase des Ufers ist durch folgende Aspekte gekennzeichnet: Keinen Einfluss hatte die Einbindung der Gruppe in den VBKD als Kollektiv. Nach kurzer Irritation arrangierten sich die Ufer-Leute dahingehend, dass sie zwei Identitäten ausbildeten, als Gruppe und als Arbeitskollektiv im Verband. Neben dem freundschaftlichen Verhältnis der Gruppenmitglieder untereinander bestimmten wechselnde Treffpunkte den fortwährenden Zusammenhalt. Mit den Ortswechseln verschleierten die Künstler die zweite Existenz der Gruppe in der Diffusionsphase und ließen sie nicht greifbar werden. Dynamisierungen können so auch integrierende Funktion übernehmen, indem sie das Gefüge fortwährend verändern und Problemstellen überdecken helfen, ohne destabilisierend zu wirken. Veränderungen schaffen immer auch ein egalitäres Gruppengefüge, da die Verantwortungen changieren und sich keine Handlungs- und Vorstellungsschleifen einspielen. Ein Weg aus den begrenzten Möglichkeiten und der Bedeutungslosigkeit der Gruppe im VBKD, wurde in der Gründung von Verkaufsge126 Nach dem Tod von Siegfried Danndorf im Jahre 1957 habe sich Das Ufer auch formal aufgelöst. (Harnisch [o.J.]) 127 So wird in einem Schriftstück vermerkt, dass der Schlüssel zum Atelierwie immer- im Ofen liege. (Das Ufer 1953) 128 Wie beispielsweise nach der »offiziellen« Auflösung der Gruppe im Protokoll vom 5. Januar 1954 vermerkt ist: »21.15 Uhr alle besoffen« (Das Ufer 1954).
172
PROZESS DER TRANSFORMATION
nossensehaften gesehen. Durch das Engagement in diesen, im Jahr 1953 von Verbandsseite eingerichteten und verwalteten Verkaufsstellen schufen sich die Künstler in der Gemeinschaft eine weitere Motivationsgrundlage. Sie hatten nun bessere Wirkungsmöglichkeiten und konnten relativ eigenverantwortlich ihr Handeln bestimmen. In den Folgejahren verlagerten die Künstler des Ufers ihre Aktivitäten in diese Präsentations- und Verkaufsform und arrangierten sich mit den Verhältnissen, ohne ihre eigenen Vorstellungen aus den Augen zu verlieren. Auf Anregung von Otto Gratewohl gründeten die Ufer-Mitglieder 1953 die ersten beiden Verkaufsgenossenschaften in Dresden und in Meißen. Als bedeutsam wurden vor allem die organisatorische Anhindung und der Verkaufseffekt erachtet. Rückblickend begründet Hainz Hamisch in einer vermutlich Anfang der 70er Jahre von Verbandsseite eingeforderten Stellungnahme die Auflösung der Ufer-Gruppe mit der Einrichtung der staatlich verwalteten Verkaufsgenossenschaften, die praktisch die Tätigkeiten der Künstlergruppe übernommen hätten. 129 (Hamisch [o.J.]) Erinnert werden die Geschlossenheit der Gruppe, ihre Vorbildfunktion und ihre Bedeutung als Vorläufer des »Bitterfelder Weges«, die staatliche Lenkung wurde jedoch ausgeblendet. Angebunden an das frühere Wirken in den Künstlergruppen wurde nun das Selbstbild als Gruppe im Sinne des neuen von staatlicher Seite aus aufgebauten, gesellschaftlich orientierten Eigenbildes rekonstruiert. Dadurch wurde in erster Linie die eigene Biografie bestätigt und es konnte die eigene Person in einem dauerhaften Gefüge verortet werden. Letztlich hatte die Anhindung der individuellen Tätigkeit an eine übergeordnete Einheit überhöhenden Effekt: Zur Selbstverständlichkeit konnte gelangen, was durch Proklamation an die Oberfläche gednmgen war und als Sinn gebend in das Selbstbild im Modus der Rechtfertigung eingebaut werden konnte. Die Veränderungen spiegelten sich ab diesem Zeitpunkt auch in den Kunstwerken der Künstler wider. Insbesondere die Bildmotive erfuhren eine deutliche thematische Hinwendung zu Abbildungen des Arbeitsprozesses. Weiterhin versuchten die Künstler dem stilistischen Gebot des Sozialistischen Realismus zu folgen, was sich künstlerisch in der bunten Farbgebung, dem mimischen Optimismus und der thematischen Lebensnähe der Bildwerke ausdrückte.
129 Hilfreich seien hierbei nicht nur die Erfahrungen in der Gruppe gewesen, sondern auch das Ufer-Mitglied Ema Lincke, damals Vorsitzende des Arbeitsgebietes Dresden des VBK im Kulturbund z.d.E.D. (Harnisch [o.J.])
173
KOLLEKTIVIERUNG DER PHANTASIE?
In der Diffusionsphase der Anfangszeit der DDR fand sich, außer einer reinen Ausstellungsgruppe, dem Dresdener Künstleraktiv 1957 130, keine Künstlergruppe mehr zusammen, die nach Außen hin aktiv war. Zwar läutete zu dieser Zeit der Freundeskreis erste phalanx nedserd bereits den zweiten großen Umbruch im künstlerischen Feld der DDR, die »Phase der Verweigerung« 131 , ein. Diese Künstler entwickelten j edoch in der Abgeschiedenheit ein eigenständiges künstlerisch-soziales Programm. Im Unterschied dazu waren die Künstler in der Anfangsphase bemüht, den gesellschaftlichen Anforderungen durch Anpassung gerecht zu werden. Dadurch konnten sie sich für kurze Zeit Freiräume resp. Vorteile verschaffen.
130 Im Katalog des Dresdner Künstleraktivs 1957 begründet Marianne Bruns den Zusammenschluss als Kampf gegen den Faschismus. (Dresdner Künstleraktiv 1957 [1960]: o.S.) Beteiligt waren Eugen Hoffmann, Hans Grundig, Lea Grundig, Fritz Schulze, Eva Schulze-Knabe, Gerhard David, Gabriele Meyer-Dennewitz, Hans Mroczinski, Nicolaus Manoussis, Horst Jokusch, Margret Häusler und Günther Maubach. 131 Vgl. das Kapitel »Phasen und Zäsuren in der SBZ und DDR«.
174
KOLLEKTIVIERUNG DES KÜNSTLERISCHEN FELDES
Der Kunst war in der DDR die Wirksammachung sozialer Zusammenhänge zugeschrieben, weshalb die Bildung von Kollektiven, gerade in der Phase der staatlichen Konstitution zwischen 1949 und 1953, forciert als Mittel zur Vergegenwärtigung des politisch Gewünschten durch ästhetisierte Vermittlung eingesetzt wurde. Die Grundlage bildete die Zentralisierung des kulturellen Bereichs, für deren organisatorische Ausgestaltung1 auch bürgerliche Muster der ökonomischen und der Geselligkeit stiftenden Selbstorganisation übernommen wurden. In dieser Phase wurde unter dem Begriff der »wissenschaftlichen Popularisierung« ein Programm geschaffen, mit dem die Vorstellungen der »sozialistischen Erneuerung der Gesellschaft« durch Austausch von Handlungsfonneu etabliert werden sollten. Ziel der inszenierten, teils Ereignis bezogenen, teils vereinbarten und teils ständigen, sozialen Tauschbeziehungen war es, Vorstellungen durch Rituale in alltäglichen Handlungsmustern zwischen Arbeiterschaft und Intelligenz zu verfestigen. Die vehementen diskursiven Auseinandersetzungen, in eben dieser Zeit der Verändenmgen, zeigen den hohen Legitimationsbedarf der sozialen Ordnung an, die mit strategischen Mitteln durchzusetzen versucht und mit denen immer auch Rezipienten, wie Schaffende im Blickfeld gehalten wurden. Die Instrumente der Legitimation waren u.a. die Konstitution der Gesellschaft als Erinnerungsgesellschaji und die Inszenierung des Wahrheitsdiskurses. Mit diesem sollte der gesellschaftlichsoziale Anspruch sich mit dem wirklichen Leben verbinden und durch die Kunstform des Sozialistischen Realismus repräsentiert werden. Die unausgesprochene Formel »Kunst ist Leben« geriet denn auch zum zentralen Bereich der politischen Einflussnahme in den künstlerischen Bereich.
Die organisatorischen Eckpfeiler des Kulturbereichs wurden in der Folgezeit weitestgehend beibehalten.
175
KOLLEKTIVIERUNG DER PHANTASIE?
Prinzipien staatlicher Kollektivbildung Zunächst sollten staatlich eingefangene künstlerische Schaffensgruppen, die so bezeichneten Künstlerbrigaden 2, zeitnahe und thematisch vorgegebene Werke in großen Bildfom1aten anfertigen, um bildhaft soziale Identifikationsnahmen zu ennöglichen. Diese Form der Kollektivbildung wurde als alsbald verworfen, da sich deren ersonnenen Besonderheiten den Leistungsanreiz innerhalb einer Gruppe und die Wettbewerbssituation unter den beteiligten Gruppen zu steigern - nicht, wie erwartet, in den Bildwerken ausdrückten. Zu einem durchgängigen Instrumentarium staatlicher Kontrolle und Lenkung künstlerischer Produktion entwickelte sich die öffentliche Präsentation von Kunst - zunächst in der klassischen Form von zusammengestellten Werken vieler Künstler in Ausstellungen3 , später verstärkt durch Präsentation von Kunst im öffentlichen Raum. Um die Kontrolle und Lenkung im Kunstbereich zu intensivieren, wurden spezielle Schulungen für Künstler, die so genannten Künstlerseminare, eingerichtet und Künstler in ihren Ateliers für die Anleitung und die Auswahl der Werke besucht sowie, speziell in der Anfangsphase, Kunstwettbewerbe zur ästhetischen Kollektivierung ausgerichtet. 4
Kontrolle und Lenkung Die zentralen Kunstausstellungen in Dresden waren ein weit reichendes Instrument der ästhetischen Vermittlung erwarteter gesellschaftlicher Wirklichkeit und zugleich deren Kontrollinstrument Für diese galt, in Umkehrung des wesenhaften Kennzeichens von Ausstellungen, das der Ausdifferenzierung des Kunstgeschmacks, dass dieser Dynamisierungseffekt bedingt festgehalten wurde, da keine von außen herangetragenen 2
3
4
Mit der Bezeichnung als Künstlerbrigaden sollte die W esensverwandtschaft zu den Arbeiterbrigaden, als Kollektive von Werktätigen, verdeutlicht werden. Diese waren nach sozialistischem Prinzip auf den Produktionsprozess ausgerichtete soziale Einheiten, die angewiesen wurden sich kameradschaftliche Hilfe und Unterstützung zu geben. Insbesondere in den zentralen Kunstausstellungen und in diesen vorgelagerten Bezirkskunstausstellungen sowie als popularisierte Form der Präsentation in Betriebs-, Wander-und Laienkunstausstellungen. Mit Kunstwettbewerben sollten die politischen Vorgaben in das kollektive Bewusstsein eingehen. Die unerwünschte Begleiterscheinung von Wettbewerben, die Herstellung von Unsicherheit durch soziale Differenzierung, wurde kompensiert durch konsensorientiertes Handeln, durch kanonisierte Feindbildkonstruktion, durch Markierung des zu Erreichenden sowie durch Themenvorgaben und Kontrollen bereits bei der Auswahl der Künstler.
176
KOLLEKTIVIERUNG
Veränderungen zugelassen werden konnten, ohne eigene Macht- und Geltungsansprüche in Frage zu stellen.
Die Präsentation der Werke Im ausgehenden 18. Jahrhundert konstituiert, dokumentiert das Ausstellungswesen die Transformation des künstlerischen Feldes. 5 Mit diesem historisch neuen, nach außen gerichteten Wirkungsbereich ästhetisierte das aufkommende Bürgertum sein Selbstbild und bereitete das Feld flir die Ausdifferenzierung des Kunstgeschmacks, der sich kunsthistorisch in der Ablösung von Epochen zur schnellen Abfolge von Stilen bemerkbar macht hat. Die öffentliche Präsentation von Kunstwerken geriet zu einem Faktor der Beschleunigung der kulturellen Modeme, da der jeweils herrschende Kunstgeschmack in geronnener Fonn zum Ausdruck gebracht werden konnte: 6 »Mit der Institution Kunstausstellung stabilisierte sich das Prinzip des >NeuenKünstler schaffen flir den Frieden< bereits ein wesentlicher Durchbruch in der Thematik erzielt worden war.« (Däbritz 1953: 3) 10 Die Ausstellung sollte Zeugnis ablegen von dem »nationalen Einigungswillen« und den »tiefen und entscheidenden Veränderungen« des gesellschaftlichen Lebens und die »Weiterentwicklung des Realismus in der deutschen Kunst« (Grotewohll953: lf.). ll Ursprünglich bezeichnet als »Allgemeine Deutsche Kunstausstellung«. Die Initiative flir diese Ausstellung ging von der Zentralverwaltung flir Volksbildung aus, die zu diesem Zweck im Februar 1946 in Berlin eine Konferenz mit bildenden Künstlern und Kulturdezernenten einberufen hatte.
178
KOLLEKTIVIERUNG
pen-Generation noch selbst mit der Organisation betraut, vieles musste improvisiert werden. So berichtet der Kunstmaler Herbert Volwahsen, er habe von der Sächsischen Landesverwaltung den Auftrag erhalten, eine gesamtdeutsche Kunstausstellung vorzubereiten und als verantwortlicher Leiter tätig zu sein. Zusammen mit dem Künstlerkollegen Will Grohmann12 habe er das Konzept der Ausstellung erarbeitet. (Winkler 1989: 355f.) Im Auftrag der Landesverwaltung beschafften Will Grobmann und Hans Grundig dann das BildmateriaL »Von Stadt zu Stadt sind wir mit zwei von der Landesverwaltung gestellten Wagen, schnellen Lastkraftwagen, losgefahren. [... ] Alles das mußte in ganz kurzer Zeit geschafft werden, nur drei Wochen hatten wir zur Verfügung vom Datum der Abreise bis zur Eröffnung der Ausstellung.« (Wächter 1966: 107) Viele organisatorische Aspekte dieser ersten, zwar improvisierten, aber mit Anleitung der SMAD ausgerichteten zentralen Ausstellung, bei der man auf etabliert bürgerliche Muster zurückgegriffen hatte, wurden in der Folge weiter getragen. Bis einschließlich der dritten Kunstausstellung wurden Künstlerateliers zur Werkauswahl, Motivation und Anleitung besucht sowie die Rezeption der vorgestellten Werke u.a. durch Befragungen, Besucherzählungen und Resonanzen aus geführten Gruppen bei Ausstellungen sondiert. Gleichfalls forcierte man von Beginn an den Verkauf von Kunstwerken, um einen Multiplikatoreffekt zu erreichen, weshalb auch die Verkaufspreise moderat gestaltet und insbesondere die Betriebe zu Ankäufen motiviert werden sollten. Allerdings konnte dieser Wunsch mit den Vorstellungen der Künstler nicht immer in Einklang gebracht werden, da den Betrieben vielfach nicht die von den Künstlern geforderten Geldbeträge zum Ankauf zur Verfügung standen.13 Um dennoch die gewünschte Massenrezeption zu erreichen, sollte bei der dritten zentralen Präsentationsschau geprüft werden, ob die Preise gerechtfertigt seien und gegebenenfalls auch hier korrigierend eingegriffen werden. 14 Gemeinsamkeiten bei der konzeptuellen Gestaltung der zentralen Kunstausstellungen bis zum Ende der DDR bildeten Besucherführungen 12 Grobmann und Volwahsen hätten aus eigener Initiative die Jury zusammengestellt, der u.a. die Avantgardekünstler Karl Hafer und Max Pechstein angehört hatten. 13 »Vor dem Kaufabschluß über die reservierten Kunstwerke wird sich die Ausstellungsleitung auf Wunsch der Interessenten noch mit einigen Ausstellern hinsichtlich Preisforderung in Verbindung setzen müssen.« (Rese [1953]: 3) 14 Kritisiert wurde weiterhin, dass nicht alle besonders materiell geförderten Künstler auch bei dieser Ausstellung vertreten, oder aber kaum Werke von Museen, Verwaltungen, Organisationen und Großbetriebe reserviert worden waren. In den ersten 14 Tagen der Ausstellung seien 5% verkauft und etwa 20% Werke reserviert worden.
179
KOLLEKTIVIERUNG DER PHANTASIE?
und Künstlerkongresse, wie auch an Dresden, als Ort der Ausstellungen, konzise festgehalten wurde. Ebenfalls behielt man das Eröffnungszeremoniell mit kunstprogrammatischen Redebeiträgen und den Modus der Verlängerung des Ausstellungszeitraums bei, die stets mit dem unerwartet hohen Besucherandrang begründet wurde. Als wiederkehrende Ereignisse kristallisierten sich die heftig debattierten Juryentscheidungen und Mythen umworbenen »Ausjurienmgen in letzter Minute« heraus. 15 Einzig bei der letzten, der »X. Kunstausstellung der DDR«, die vom 3. Oktober 1987 bis zum 4. April 1988 stattfand, wurde das fortdauernd mit Kritik bedachte Muster der Werkauswahl mittels Jurienmg durchbrachen und die Methode der Regieausstellung gewählt. Die Funktionäre der SMAD beteiligten sich in den Anfangsjahren der kulturpolitischen Festigung - mehr oder weniger sichtbar - an der organisatorischen Planung, der kunstwissenschaftliehen Betreuung und der Bewertung der Werke. 16 Die unmittelbare Hilfe, so ein zeitgenössischer Kommentar, habe in der Entwicklung der Kunstkritik, in der Entsendung von Künstlern und Kunstwissenschaftlern zur Erfahrungsvermittlung, in der Ausrichtung von sowjetischen Kunstausstellungen sowie in der Übermittlung von Lehr- und Studienmaterial bestanden. (Hoffmann 1953: 13) Der dokumentierte Einfluss der sowjetischen Führung bei der ersten zentralen Ausstellung 1946 reichte von der Hilfestellung beim Transport der Werke bis zum Halten kommentierender Reden bei der Eröffnungs-
15 Für die erste Ausstellung« ist anekdotisch der Fall Erhard Hippold überliefert. Als seine, von der Jury abgelehnten Werke aus dem Saal gebracht werden sollten, habe Carl Hoferden Raum betreten, nach dem Namen des Malers gefragt, sich dessen Bilder vorfuhren lassen und verfügt, dass diese neben seine eigenen Arbeiten gehängt werden: »Das sind ausgezeichnete Arbeiten, und die wollen Sie wegstellen?« (Vgl. Kober 1989: 462f. ). Im Eilverfahren ordnete die Staatliche Kunstkommission kurz vor Ausstellungsbeginn der dritten Ausstellung von 1953 an, dass unverzüglich eine Liste erstellt werden sollte mit eingereichten Kunstwerken, u.a. von Otto Dix (er lebte mittlerweile am Bodensee) und von Arthur von Hüls, Künstler und »Vertrauensmann« der Atelierbesucher in Westdeutschland. Hüls war wegen vermuteter Beziehungen zu »Bohemienkreisen« in Misskredit gefallenen: »[... ]überprüfen, welche Werke zur Ausstellung gelangten und welche abgelehnt worden sind. Diese Arbeiten sofm1 heraussuchen und Koll. Holtzhauer vorfUhren.« (Staatliche Kunstkommission 1953) 16 Aus einem Schreiben des Leiters der »Abteilung Kultur beim ZK der SED« an den ersten Bundessekretär beim Kulturbund, Alexander Abusch, von 1949 wird ersichtlich, dass sich die kulturpolitisch Verantwortlichen gewissenhaft an die sowjetischen Vorgaben hielten und diese insbesondere von den Institutionen eindeutig in ihrem Erscheinungsbild wiedergeben werden sollten. (Heymann 1949)
180
KOLLEKTIVIERUNG
feier. 17 Bei der dritten zentralen Ausstellung wurden diese Kontakte in der Außendarstellung merklich zurückgenommen. Bei dieser Ausstellung von 1953 besprachen Kulturvertreter der Sowjetunion abwägend und sachbezogen die vorgestellten Bildwerke. 18 Sie wurden umgekehrt als »sowjetische Freunde« oder als »Delegation der künstlerischen Öffentlichkeit der Sowjetunion« (Stellungnahme 1953) tituliert. Außerdem waren im Vorfeld dieser Ausstellung vehemente Kampagnen in schriftlicher Form - als Zitate von sowjetischen Kunstwissenschaftlern, als Erfahrungsberichte sowjetischer Künstler und als analytische Beschreibungen der sowjetischen Kunsttradition- lanciert worden. Kurz vor der Strukturreform des künstlerischen Bereiches im Jahr 1952 war eine »Delegation Bildender Künstler« 19 in die Sowjetunion gereist, um Einblicke in die dortigen Praktiken zu erhalten. Zudem fanden nach der Ausstellung einige Sitzungen mit sowjetischen Funktionären und Wissenschaftlern und Kulturvertretern der DDR statt. 20 Aufgrund der konkreter werdenden institutionellen Bedingungen waren bis einschließlich der dritten Kunstausstellung die Träger der Veranstaltung, die Räumlichkeiten der Präsentation sowie die Zusammensetzung und Form der organisatorischen Leitung verändert worden. 21 Unter17 Herbert Volwahsen berichtet über die Rolle der SMAD bei der Vorbereitung der ersten Ausstellung: »Die Sowjetische Militäradministration gewährte uns jede Hilfe, um die Ausstellung durchführen zu können, besonders hinsichtlich der Transpolte von Bildern und Plastiken.« (Winkler 1989: 355f.) 18 Die sowjetischen Funktionäre bewerteten den Verlauf und die Ergebnisse der Kunstschau von 1953 ausnahmslos positiv. Herausgestellt wurden die vom Verband zuvor beworbene realistische Darstellungsweise und die erweiterten Themenkreise: »Die bedeutenden Erfolge, die die deutschen Künstler auf dem Wege der Überwindung der abstrakten und lebensfernen Kunst, auf dem Wege einer wahrheitsgetreuen realistischen Widerspiegelung der Lebenserscheinungen erreichten, fallen in die Augen.« Schlüsselbegriffe waren »f01tschrittliche Künstler«, »glückliches und neues Leben«, »friedliche Aufbau«, »Kampf um den Frieden«. (Stellungnahme 1953) 19 Die Reise dauerte von Anfang März bis Ende April. Ihre Ankunft auf dem Berliner Ostbahnhof ist mit einem Foto auf der Titelseite des Mitteilungsblattes des Künstlerverbandes dokumentiert. (Vgl. Delegation Bildender Künstler 1952) 20 So traf sich der Zentralvorstand des VBKD mit sowjetischen Kollegen am 14. November 1953 im Haus der Kultur in Berlin zu einer außerordentlichen Sitzung. Die Besprechung hätte sich hauptsächlich um sowjetrussische Kunst gedreht, hierzu das Bildmaterial der Ausstellung herangezogen worden sei. (VBKD [1953]: 112) 21 Die »Erste Allgemeine Deutsche Kunstausstellung« fand im dritten Stock der Stadthalle am Nordplatz im ehemaligen Sächsischen Armeemuseum statt. Als Veranstalter traten die Landesverwaltung Sachsen, der Kultur-
181
KOLLEKTIVIERUNG DER PHANTASIE?
schiede lassen sich insbesondere bei den ausgestellten Kunstwerken ausmachen. Wie überhaupt sich die politisch angepassten Vorgaben des Künstlerverbandes alle vier Jahre bei den zentralen Präsentationen bildkünstlerisch ablesen ließen, da bei der Werkauswahl immer auf diese geachtet worden war. Bereits zur ersten Kunstausstellung wurden deshalb Atelierbesuche vorgenommen und diese bis einschließlich der dritten auch in Westdeutschland beibehalten. 22 Die konkrete Produktion für eine Ausstellung und die Forderung nach zeitnahen Bildwerken setzten vehement zur dritten Kunstausstellung ein. Da die Vorstellungen nicht fristgerecht umzusetzen waren, wurde die Ausstellung um ein halbes Jahr, auf den ersten März 1953, verschoben. 23 Den Ausschlag für die kurzfristige Verlegung gab die bevorstehende Umstrukturierung des Verbandes und der Anspruch der Führungselite eine umfassende und eindrucksvolle Manifestation des bildkünstlerischen Schaffens zu leisten. In Vorbereitung dieser Kunstausstellung übersandte der Vorsitzende der Staatlichen Kunstkommission, Helmut Holtzhauer, an Hauptmann Beburow von der »Sowjetischen Kontrollkommission« eine Liste der Themen, an denen die Künstler für eben diese Ausstellung arbeiteten obund z.d.E.D. sowie die Stadt Dresden auf. Betreut wurde die Ausstellung von Herber! Gute, Staatssekretär für Kulturfragen des Landes Sachsen und Leiter des sächsischen Volksbildungswesens, in Absprache mit der SMAD. Veranstalter der zweiten Kunstausstellung waren die Landesregierung Sachsen und die Stadt Dresden. Bei der dritten Ausstellung traten die Staatliche Kommission für Kunstangelegenheiten der DDR und der neu formierte VBKD auf. Bei der ersten Kunstausstellung von 1946 wurde neben den beiden Organisatoren, Will Grohmann und Hans Grundig, ein Arbeitsausschuss mit Künstlern gebildet. Die künstlerische Leitung der zweiten Ausstellung übernahm ein Team, darin u.a. Gert Caden, Lea Grundig und Joachim Uhlitzsch. Die Gestaltung übernahmen Mart Stam und E.A. Mühler. Bei der dritten Ausstellung wurden organisatorische Gruppen mit differenzierten Aufgaben gebildet. 22 Andere Möglichkeiten der Kontrolle und Lenkung waren Beurteilungen. So veranlasste die Parteileitung der SED-Parteiorganisation die Professorenkünstler Hans und Lea Grundig, Bewertungen über ihre Studenten abzugeben. Darin sollten Schwächen, Stärken, soziales Umfeld und moralisches Verhalten überprüft werden, um zu gewähren, »daß der Student nach Abschluß des Studiums der Gesellschaft eine wertvolle Hilfe sein wird«. (Parteileitung der SED-Parteiorganisation 1952) Vgl. ebenfalls die Berichte über Horst Stempel. (SED Landesleitung Gross-Berlin 1951) 23 Fritz Dähn hatte auf dem »ll. Verbandskongreß« auf die Verschiebung der im Herbst 1952 angesetzten Ausstellung hingewiesen und diese im Namen der Künstlerschaft begründet. (VBKD 1952: 27) Nach der 2. Parteikonferenz der SED vom 9. bis 12. Juli erschien in der Juliausgabe des Verbandsmitteilungsblattes der neue Termin.
182
KOLLEKTIVIERUNG
der die zu diesem Zeitpunkt bereits vorlagen. In Diskussionen mit Künstlern wurden ausdrücklich patriotische und arbeitsnahe Bildmotive vorgeschlagen und entsprechende Aufträge vergeben.Z4 (Vgl. Holtzhauer 1952)
Die Auswahl der Werke Atelierbesuche stellten in der Anfangsphase ein vermitteltes Instrument der Einflussnahme und Kollektivbildung dar. Sie dienten der konkreten Handlungsanweisung und sollten die Künstler zur Beschickung motivieren.25 Die Besuche wurden als beste Möglichkeit gesehen, zu einer Einschätzung der Künstler durch »systematische Beobachtung der Entwicklung im Verlauf der Arbeit«26 zu gelangen: »Die Vorteilhafte oder nachteilige Entwicklung und Auswirkung auf die Tätigkeit kann am klarsten durch die persönliche Aussprache bei einem Atelierbesuch festgestellt werden.« (VBKD 1953) Vor der dritten zentralen Ausstellung, die ideologisch u.a. unter dem Motto der Vereinigung der beiden deutschen Staaten stand, wurden in der DDR mehr als 600 Ateliers besucht, in der BRD fanden über 200 Besuche statt. 27 Die Atelierbesucher erhielten konkrete Vorgaben zur Beurteilung: Auszuwählen waren je vier Werke eines Künstlers. Dabei wurde neben den bildkünstlerischen Kriterien, die der Darstellung realistischer und sozialistischer Kunstprogrammatik, vor allem Wert auf außerkünstlerische Besonderheiten gelegt. Diese waren die ideologische und persönliche Integrität sowie der Bekanntheitsgrad und die gesellschaftliche Stellung der westdeutschen Künstler. 28 24 Thematische Kategorien bildeten »Führende Staatsmänner der Sowjetunion
25
26 27
28
und der DDR«, »Helden der Arbeit, Aktivisten, Verdiente Erfinder, Nationalpreisträger«, »Verteidigung der Heimat«, »Kampf um Einheit, Frieden und Demokratie«, »Aufbau des Sozialismus«, »Produktionsgenossenschaften«, »Freundschaft mit der Sowjetunion«, »Aus dem Kulturleben«, »Unsere Jugend«, Historische Themen und Werke über Befreiungskämpfe in kapitalistischen Ländern. (Holtzhauer 1952) Die Atelierbesuche im Kreis Meissen hätten dazu geführt, dass sich von 24 Künstlern insgesamt 21 an der Einlieferung zur Ausstellung beteiligten. (Däbritz 1953: 2) Die an die »Auftragskommission« weiter geleitet wurden. (Vgl. Kießling 1952; Däbritz 1953: 2) Um die Einheit Deutschlands vorantreiben und »die Unteilbarkeit unseres nationalen Kunstschaffens« sichtbar werden zu lassen (Dähn 1953: 26). In den Berichten der Atelierbesucher wird angedeutet, dass es geplant war, Werkaufträge auch an westdeutsche Künstler zu vergeben. Linker SPD-Mann; aber sehr aufgeschlossen und ernst zu nehmen. Er ist aktiv in der Arbeit des Kulturbundes. Jüngere brauchbare Landschaftsmalerin, scheint aktiv im Kulturbund zu sein; uns gegenüber aufgeschlossen; sympathisierend, wenn nicht sogar Mitglied der KP; gesellschaftliche Tä-
183
KOLLEKTIVIERUNG DER PHANTASIE?
Es sollten - so das vornehmliehe Ziel dieser Atelierbesuche - möglichst viele Künstler aus Westdeutschland zur Beschickung gewonnen und nur wenige Bilder, es sei denn abstrakte Arbeiten, aber keine Künstler, dezidiert abgelehnt werden. 29 Da viele Kriterien30 - auch divergierende und außerkünstlerische - gewichtet werden mussten, für die Annahme einer Arbeit aber lediglich eines zu erfüllen war, gestaltete sich die Entscheidungstindung als äußerst diffizil. Späterhin wurde als großer Fehler erkannt, dass zahlreiche minder bewertete Kunstwerke zur Ausstellung gelangt waren: »Nachträglich bekamen wir ja doch wegen der schlechten Qualität ernste Bedenken«. (Hahne/Lade/Sandberg [1952]) In einem schriftlichen Atelierbericht wurde gar ausdrücklich erwähnt, dass eine Reihe von Arbeiten nicht ausgesucht worden wären, wenn die Künstler in der DDR leben würden. In einigen Fällen habe man Rücksicht nehmen müssen auf den gesellschaftlichen Einsatz in Gewerkschaft, Kulturbund und Berufsverband. Bei anderen habe es sich um besonders angesehene westdeutsche Künstler gehandelt, deren Beteiligung an der Dresdner Ausstellung für absolut notwendig erachtet worden sei. (Vgl. Mansfeld 1952) Die Besichtigungen dauerten je eine Woche und waren im November 1952 mit ein bis drei Personen umfassenden Gruppen 31 gestartet worden. In den fünf markierten Gebieten32 wurden je zwischen 50 und 70 Ateliers
29
30
31 32
tigkeit im Sinne der Arbeiterklasse. (Vgl. u.a. Hahne!Lade/Sandberg [1952]) Von den Atelierbesuchern wurde bemängelt, dass bei den vorausgegangenen Künstlerbesprechungen die Frage der Gegenständlichkeit zu weit gefasst worden sei und deshalb viele abstrahiert gegenständliche Bilder vorgelegt worden seien, die aufgrund der sehr bunten Farbgebung und des formalen Experimentierens befremdet hätten. Eine fortschrittliche Thematik habe man kaum feststellen können, in fast in allen Ateliers hätte deshalb erneut diskutiert werden müssen. Beurteilungen waren u.v.a.: Sehr befahigt, hat aber noch abstrakte Tendenzen. Es würde sich lohnen, sich mit ihm zu befassen, gute Entwicklung, hat noch leichte fmmalistische Tendenzen. Alter Künstler mit stark formalistischen Tendenzen; in Westdeutschland nicht unbekannt - ist in einer Mappe mit Dix und anderen namhaften Leuten abgebildet. (Hahne!Lade/Sandberg [1952]) Gruppenanzahl und -größe hatten sich u.a. wegen fehlender Aufenthaltserlaubnisse reduziert. Mit den Gebieten: »Wasserkante« (Franz Nolde und Willy Wolf), »Niedersachsen« (Oskar Nerlinger und Werner Nerlich, diese Reise fiel wegen Krankheit von Nerlinger und der verweigetten Einreisegenehmigung von Nerlich aus), »Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Hessen« (Tom Beyer und Erich Fraaß, der keine Aufenthaltsgenehmigung erhielt, »Baden-Württemberg« (Heinz Mansfeld und Ingeborg Franck) und »Bayern« (Ruthild Hahne, Curt Lade und Herbert Sandberg). Die Besucherliste war
184
KOLLEKTIVIERUNG
besucht, für größere Touren standen Kraftfahrzeuge zur Verfügung, in Städten griff man auf öffentliche Verkehrsmittel zurück.33 Die Pläne für die Besichtigungstouren hatten westdeutsche »Vertrauensleute« ausgearbeitet. Diese stellten die Besucherlisten zusammen, entwarfen die Besichtigungspläne, organisierten die Besuche vor Ort und begleiteten die Auswahl-»Kommissionen«. Allerdings waren die »Vertrauensleute« zu jedem Zeitpunkt mit besonderem Misstrauen34 bedacht: »Da diesen Vertrauensleuten die Organisierung der Sammelstellen übertragen wurde, besteht die Möglichkeit, daß die westdeutschen Behörden leichten Einblick in den organisatorischen Ablauf [... ] erhalten können.« (Hahne/Lade/Sandberg [1952]) Jede Besuchergruppe erstellte nach Abschluss ihrer Westreisen detaillierte Erfahnmgs- und Hintergnmdberichte. In diesen wurde die zeitgenössische Kunstentwicklung in Westdeutschland einvernehmlich als »Desaster« beurteilt. So hätte sich kaum ein westdeutscher Künstler mit der Gestaltung aktueller Themen beschäftigt und viele Künstler von sich aus immer wieder hervorgehoben, dass sie nicht anders malen könnten, weil bei staatlichen Ankäufen die Abstrakten bevorzugt werden würden. (Wolff/Nolde 1952: 2) Die Begründungen für Absagen 35 an Künstlern zur Beschickung der Ausstellung, der bereits mit Bedacht ausgewählten Künstler, waren vielgestaltig. So hätten sich diese aus der Falschinformation ergeben, dass die Ankäufe aus der Ausstellung in Westmark bezahlt werden würden. von Vertretern westdeutscher Künstlerverbände zusammengestellt worden, mit denen Schwimmer und Lohmar zuvor Gespräche geftihrt hätten. 33 Zu den Abläufen ist vermerkt, dass die Besuche wegen der kurzen Tageszeit ohne Unterbrechung in der Mittagszeit durchgeführt wurden. An den Abenden habe man zumeist kurz und gesellig zusammen sein und mit Erfolg über Fragen des sozialistischen Realismus diskutieren können. (Mansfeld 1952) 34 Die »Vertrauensleute« hätten zu den schwächsten Kräften gehött. So wurde Arthur von Hüls aus München als »obskure Persönlichkeit« bezeichnet, da er überwiegend in bürgerlichen Bohemienkreisen verkehre: »Der schlimmste Mißgriff ist charakteristisch ftir das Gesamt-Niveau und besteht in der Ernennung des [... ] Malers Arthur von Hüls als Mitglied des Ausstellungs-Komites. Dieser Name hat unsere Arbeit in Süddeutschland diskreditiert. Die Versuche, in Westdeutschland weitere Verbindungen anzuknüpfen, wurden anHinglich unterlassen, weil die Zugeständnisse an das Westkomite eingehalten werden sollten, später waren sie erfolglos, weil unsere offizielle Vertretung bekannt war und namhafte Leute zur Distanzierung veranlasste (Briefwechsel Nagel).« (Abschlußbericht 1953: 3) 35 Über die Kunst in der DDR seien die Westkünstler meist nicht informiert und erstaunt gewesen, dass man auch mal auf einen Akt zurückgreife (Wolff/Nolde 1952).
185
KOLLEKTIVIERUNG DER PHANTASIE?
(Hahne/Lade/Sandberg [1952]: 11) Einige westdeutsche Künstler hätten auch zu Recht beklagt, dass der Rücktransport ihrer Arbeiten aus früheren Ausstellungen ausstehe und sie immer noch kein Geld von Verkäufen aus der Ausstellung »Künstler schaffen für den Frieden« erhalten hätten. (Wolff/Nolde 1952: 5) Vor allem an Kunsthochschulen angestellte Künstler wollten ihre berufliche Existenz durch eine Einsendung nach Dresden nicht in Gefahr bringen: »Ein Teil [... ] hat sehr wenig Rückgrat und erwartet[ ... ] Repressalien seitens der Kunstämter.« (Beyer 1953). Von den Atelierbesuchern selbst wurden der mangelnde Kontakt der westdeutschen Künstler untereinander und das Festhalten an abstraktem Bildgestalten beklagt. Nach Ansicht von Tom Beyer seien viele Künstler »sozusagen verwirrt«. So sei vorgekommen, dass ein Maler in vier bis fünf Räumen 80 bis 90 bedeutende gegenständliche Arbeiten ausgestellt habe und plötzlich am Ende der Räume 10 »völlig abstrakte Arbeiten« mit der Begründung zeige, dass alle das so machen. Auch habe man in den seltensten Fällen die erste Garnitur für Dresden gewinnen können, da gerade diese von Institutionen korrumpiert seien. (Beyer 1953) Eine große Gruppe der Künstler, die zur gegenständlichen Malerei hielten, scheinen in der Luft zu schweben: »Wenn wir Verständnis für deren Situation aufbringen[ ... ] können wir viele Freunde gewinnen.« (Wegehaupt 1952) Die eigene kritische Auseinandersetzung machte sich hauptsächlich an Fehlern im Organisationsaufbau fest. 36 Als Schwäche wurde erkannt, dass aus zeitlichen Gründen kaum wirklich politische Diskussionen gefuhrt werden konnten. (Hahne/Lade/Sandberg [1952]) Außerdem ergaben sich Verschiebungen bei Zuständigkeiten und Entscheidungsvollmachten.37 Ein Problemfeld betraf die offiziell ausgeschriebene Jury-
36 Im Abschlußbericht über die »Westarbeit« wurde kritisiert, dass das selbständige westliche Zentrum die politische Sicherheit der Maßnahmen ständig gefahrdet habe und das Gesamtkomitee von Berlin aus nur mit ungewöhnlichem Aufwand seine Ziele durchsetzen konnte. (Abschlußbericht 1953: 3) 37 In den Besprechungen zwischen Kunstkommission und Kulturbund war festgelegt worden, dass der »Koordinierungsausschuß ftir gesamtdeutsche Zusammenarbeit« unter der Leitung von Gerhard Schröter und Wise das zentrale Organ darstellen sollte. Tatsächlich hätte der Hamburger Kulturbundvorsitzende Wilhelm Bauche auf eigene Faust eine »Zentrale Kommission« resp. ein westdeutsches Komitee gebildet, vermutlich in Übereinkunft mit dem »DDR-Arbeitsausschuß«. Dieses System sei in der Praxis auf eine Generalvollmacht für Bauche und Schröter hinaus gelaufen und der »Ausschuß ftir gesamtdeutsche Arbeit« nur auf dem Papier gestanden. (Abschlußbericht 1953: 2) Zudem sei erst vor der Eröffnung bekannt geworden, dass die Kunstkommission eine besondere westdeutsche Abteilung unterhalten habe und die Forderung nach Beteiligung an den Atelierbesu-
186
KOLLEKTIVIERUNG
gruppe, die unmittelbar vor ihrem Zusammentreten entscheidend verändert worden sei. 38 Dies wurde als Versuch gewertet, »eine Reihe Werke durchzupeitschen, denen die Mehrheit das Prädikat >Kunstwerk< versagen mußte«39 : »Gen. Hoffmann setzte seine Richtung unter brutalster Anwendung des Fraktionszwanges gegenüber den Genossen Juroren durch und schreckte nicht davor zurück, nach Abschluß der Jury ausjurierte Werke wieder in die Ausstellung aufnehmen zu lassen und angenommene Bilder zu entfernen.« (Abschlußbericht 1953: 4) Vor allem aber habe man nicht sorgfältig genug ausgewählt und nicht qualitativ gute Künstler und einigermaßen qualifizierte Kreise angesprochen. Für die nächste zentrale Ausstellung - bei der es jedoch nicht mehr, aufgrund der politischen Entwicklung, zu einer Beteiligung westdeutscher Künstler kommen sollte - beabsichtigte man politische und künstlerisch bessere Kräfte aufzufinden. Empfohlen wurde deshalb, zahlreiche und vielseitige Verbindungen zu schaffen und die persönlichen Beziehungen der Künstler aus der DDR zu ihren westdeutschen Kollegen fur unmittelbare Kontakte heranzuziehen. Außerdem sollte die Auswahl nicht ausschließlich dem westdeutschen Kulturbund oder dem »Koordinierungsausschuß« überlassen und »ernst zu nehmende Stützpunkte in den westdeutschen Städten« geschaffen werden. 40
Die Motivation der Künstler Weitere Instrumente der Kollektivbildung und des schrittweisen Einschränkens von gemeinschaftlichem und freiem Engagement betraf das Einbinden der Künstler in staatlich dirigierte Organisationsfonnen. Zunächst wurde den Künstlern nahe gelegt, sich als Mitglieder in der Gewerkschaft Sparte 17 und später im VBK zu organisieren. Diesen nicht zugehörigen Künstler wurden in zunehmendem Maße von Auftragsangeboten und Möglichkeiten der Präsentation ausgeschlossen. Ab 1950 wurchen von Kulturfunktionären und Arbeitem nicht umgesetzt worden sei. (Hahne/Lade/Sandberg [ 1952]) 38 Anstelle der »Nicht-Künstler« Alexander Abusch, Egon Rentsch und Martin Läuter, habe man den Leiter der Abteilung Bildende Kunst, Ernst Hoffmann, und die Professoren Maßloff aus Leipzig und Laux aus Weißensee berufen. 39 Die Jury war mehrfach bedroht, auseinander zu fallen. Nur durch die Autorität und Geschicklichkeit von Otto Nagel (zu dieser Zeit Präsident des VBKD) habe ein Skandal vermieden werden können. (Abschlussbericht 1953: 4) 40 Vorgesehen war eine gemeinsame Organisation der Atelierbesuche von Künstlerverband und Kulturbund in Ost- und Westdeutschland. Die Stellen des westdeutschen Kulturbunds sollten als Stützpunkte dienen.
187
KOLLEKTIVIERUNG DER PHANTASIE?
den ausgewählte Künstler in zentralen Künstlerseminaren41 unterwiesen. Die Schulungen waren vom Künstlerverband, unterstützt durch das Ministerium für Volksbildung der DDR, ausgerichtet und sollten das kommunikative Missverhältnis zwischen Vorstellung und Ergebnis ebnen: »Die besten Absichten unserer bildenden Künstler scheitern sehr oft, weil über die grundsätzlichen Probleme keine Verständigung erreicht ist.« Weshalb zunächst die »Verpflichtung« gegenüber dem neuen gesellschaftlichen Auftraggeber zu klären sei. (Nagel 1951) Eine bedeutende Rolle erhielt die Auftragsvergabe42 in der Anfangs- und Aufbauphase der DDR zugewiesen. Mit den staatlichen Ankäufen sollten die Künstler, die die sozialistische Gesellschaft darstellen, und die Menschen, die die neue Gesellschaft aufbauen, zusammen gebracht werden: »Das wichtigste Mittel für diese künstlerische Produktion ist der Auftrag. Es bringt uns nicht weiter, wenn wir sagen Auftraggeber ist das Volk. [... ]Die Parteien, die Gewerkschaften, alle Massenorganisationen, die Wirtschaftsorgane, die staatliche Verwaltung, sie alle müssen dem Künstler konkrete und bestimmte Aufträge geben. Sie müssen Ratschläge geben, ihre Erwartungen und ihre Wünsche aussprechen, um so in einer engen und kameradschaftlichen und demokratischen Zusammenarbeit das Wort zu verwirklichen: Kunst, Künstler und Volk gehören zusammen! (Beifall).« (Grotewohl 1953a: 13) Die Kunstwettbewerbe der Anfangszeit sollten die Künstler motivieren und eine gewünschte thematische Ausrichtung sowie das Bündnis zwischen Werktätigen und Künstlern forcieren. So waren in der Auswahlkommission43 des Kunstwettbewerbs »Unsere neue Wirklichkeit«44 ne41 Den Anfang machte das Künstlerseminar in Petzow bei Potsdam unter der Leitung von Herbert Gute. Gute leitete daraufhin ein weiteres Seminar in Bad Saarow (14. Januar bis 3. Februar 1952). Wegen guter Resonanz wurde auch hier vorgeschlagen, die Seminare zu verlängem. (Vgl. Der Bildende Künstler 1952: 11) Seitens der Künstler war dieses Seminar hochrangig besetzt, u.a. mit Lea und Hans Grundig, Alice Lex-Nerlinger und Siegfried Danndorf Zwei zentrale theoretische Seminare mit je 30 Teilnehmem wurden 1952 und im darauf folgenden Jahr nochmals vier weitere ausgerichtet. (VBK der DDR 1983: 30) 42 An der Auftragsvergabe hielt man bis zum Ende des DDR-Staates fest. Auf einer Tagung der »Zentralen Sektionsleitung« 1987 beurteilten fast alle Vertreter der Bezirke einzig die Auftragssituation als gut, entgegen den in dieser Zeit kritischen Auseinandersetzungen. (ZSL 1987) 43 In der Kommission waren u.a. Heinrich Ehmsen, Herbert Gute, Carl Hafer, Alice Lex-Nerlinger, Amo Mohr, Oskar Nerlinger, Gerhard PommeranzLiedtke und Horst Strempel. 44 Der Wettbewerb »Unsere neue Wirklichkeit« wurde vom Bundesvorstand des FDGB und dem Verlag sowie der Redaktion der Zeitschrift »bildende
188
KOLLEKTIVIERUNG
ben Künstlern und Journalisten auch Werktätige beteiligt. Als preiswürdig galten Werke, »in denen die gesellschaftliche Wahrheit ihre adäquate Form gefunden« habe. 45 Um die Werktätigen verstärkt mit bildender Kunst vertraut zu machen, wurde im Jahr 1952 der »Wettbewerb der deutschen Volkskunst auf dem Gebiete der bildenden Kunst«46 ausgeschrieben. Mit der so bezeichneten »Laienkunst« glaubte man, Rezeptionsschwellen leichter überwinden zu können. Wie sehr jedoch dieses Vorhaben eine Gratwanderung darstellte, zeigt der im gleichen Jahr veranstaltete und von der Staatlichen Kommission für Kunstangelegenheiten vorgeschlagene »Wettbewerb gegen den Kitsch bei Ansichtspostkarten«, der sofort wirksam werden sollte47 .
Künstlerbrigaden Die Kollektivierung im künstlerischen Feld wurde zunächst nach sowjetischem Vorbild48 gestaltet. Insbesondere die kollektive Kunstproduktion mit »künstlerischen Arbeitsbrigaden« wurde schnell als gescheitert betrachtet und verworfen. Andere Kollektivformen wurden in das Vermitt-
45
46 47
48
kunst« zusammen mit der Gruppe Arbeitsgemeinschaft sozialistischer Künstler im Januar 1949 initiiert. Eine Auswahl der Werke wurde im Juni 1949 in der Ausstellung »Mensch und Arbeit« gezeigt. Kunst, so das Motto, müsse den Menschen Auftrieb und Zuversicht geben, bejahend zum Leben stehen und das neue gesellschaftliche Werden die soziale Verpflichtung bewusst werden lassen. (Unsere neue Wirklichkeit 1949) Es wurden zwölf Geldpreise vergeben: Der I. Preis war mit 6000 Mark dotiert, der 2. mit 4000 Mark, der zwei mal vergebene 3. mit je 2000 DM, der vier mal vergebene 4. mit je 1000 Mark und der ebenfalls vier mal vergebene 5. Preis mit je 500 Mark dotiert. Die Ausstellung fand in den Ausstellungsräumen der Verkaufsgenossenschaft »Bild der Zeit« in Berlin statt; die Ehrung am 3. August 1952. Die Ergebnisse sollten sich bereits bei der Leipziger Herbstmesse zeigen. (VBKD 1952: 19) Für die Ausgestaltung der Westfassade des Dresdner Altmarkts war im September 1953 ein Ideenwettbewerb als Preisausschreiben initiiert und die Teilnahme an eine Mitgliedschaft im VBKD gebunden worden. Ein »Preisgericht« bewe1tete die Ergebnisse. (Ausgestaltung der Westfassade des Dresdner Altmarktes 1953) Hingegen der 1952 ausgeschriebene »Piakatwettbewerb der Sportvereinigung Rotation und der IG Druck und Papier« gerügt und fiir ungültig erklärt wurde, da »ein künstlerischer Wettbewerb nur auf der Basis der vom VBKD herausgegebenen Wettbewerbsbestimmungen durchgefiihrt werden« dürfe. (lbid.: 20) Die künstlerische Kollektivbildung in der SU wurde im Mitteilungsblatt des Verbandes mit Erfahrungsberichten vorgestellt. (Vgl. Gegen die Entstellung der Prinzipien der Kollektivmethode 1953: 12f.; Nalbandjan 1953: 15f.; Jefanow 1952: 16f.)
189
KOLLEKTIVIERUNG DER PHANTASIE?
lungsprogramm der »wissenschaftlichen Popularisierung« eingebunden und über die Jahre hin modifiziert, wie beispielsweise Freundschaftsund Patenschaftsverträge, Laienkunstzirkel und schließlich Verkaufsgenossenschaften49 . Künstlerbrigaden, als soziale Schaffensgruppen kollektiver Kunstproduktion, wurden primär in den ersten Jahren eingesetzt. Mit diesen kurzfristig zusammenstellbaren und örtlich angebundenen Kleingruppen, die vorgegebene Themen mit zeitlicher Begrenzung in Wettbewerbssituation zu bearbeitet hatten, glaubte man einen Multiplikatoreffekt bei der Vennittlung von Kunst zu bewirken. Die Künstlerbrigaden sollten zum Vorbild für die Bildung von Arbeitskreisen werden und die schnelle Umsetzung großflächiger Bildproduktionen ermöglichen. 5° Zudem konnten durch die Themenvorgabe aktuelle soziale Brennpunkte aufgegriffen und diese mit der vorgegebenen Wettbewerbssituation qualitativ fokussiert werden. So entstanden zu Beginn des »Zweijahresplanes« großflächige Wandbilder in Bahnhöfen, an Fabriken und öffentlichen Einrichtungen.51 Die erste Wandbildaktion der DDR in großem Maßstab startete zur zweiten zentralen Kunstausstellung 1949 in Dresden mit 12 K.ollektiven.52 Die Idee, programmatische Wandbilder zu schaffen und diese bei der zentralen Schau zu präsentieren, kam von Gert Caden. Dieser hatte Erfahrungen mit Wandgemälden im mexikanischen Exil gemacht und 49 Verkaufsgenossenschaften ermöglichten Künstlern die Selbstvermarktung ihrer Werke unter staatlicher Obhut. Im Vordergrund standen aber der Multiplikatoreffekt und die ökonomischen Zwecke. Diese Form wurde später durch den Devisen orientierten Staatlichen Kunsthandel abgelöst. 50 Oskar Nerlinger berichtet auf einem außerordentlichen Kongress Mitte des Jahres 1953, er habe mit Kollegen am vorherigen Abend die sowjetische Kunstausstellung in Berlin besucht und festgestellt, dass noch immer das Missverständnis bestehe, kollektives Arbeiten sei eine bessere Methode. Ein sowjetischer Kollege habe aber klar gestellt, dass man in der SU zur Kollektivarbeit gekommen sei, da man in relativ kurzer Zeit große Bilder für die großen Flächen Hochhäuser gebraucht hätte. (VBKD [ 1953]: 31) 51 Horst Strempel hatte bereits im Oktober und November 1948 in der Schalterhalle des Bahnhofs Friedrichstraße in Berlin ein Wandbild angefertigt, das aber als formalistisch kritisiert wurde. (Schönfeld 1996: 447) Kurze Zeit nach der Wandbildaktion zur 2. DKA verließ Strempel die DDR. 52 Diese unterstanden der »Künstlerischen Leitung« der Ausstellung. Die Maler des Ufers bildeten vier Kollektive. Für Berlin waren Horst Strempel, Arno Mohr, Bruse und Rene Graetz tätig. In der Ausstellung wurden 13 Wandbildentwürfe gezeigt, das vierzehnte Bild »Textil Chemnitz« des Kollektivs Rudi Gruner, Willy Wittig und Hans Rudolph sei von der Ausstellungsleitung zurückgezogen worden und »konnte, obwohl malerisch und kompositionell interessant, nicht in der Ausstellung montiert werden, da es ideologische Fehler in der Darstellung aufwies.« (Caden 1949b)
190
KOLLEKTIVIERUNG
dachte mit der Aktion an die legendären Wandbildmalereien von Siquero und Rivera an knüpfen zu können. (Vgl. Caden 1949a: 269) In Zusammenarbeit mit 14 Großbetrieben wurden 28 Maler ausgewählt, die die Aufgabenbereiche »Arbeit« und »Zweijahresplan« auf großen Hartfaserplatten ausgestalteten.53 Die Künstler, so fuhrt Caden aus, hätten sich selbst ihre Themen aus den Vorschlägen der Ausstellungsleitung ausgewählt und die Vorstudien - gemäß des populärwissenschaftlichen Programms - an Ort und Stelle in den Betrieben angefertigt. Die Ausarbeitung sei ohne Einflussnahme und unter alleiniger Verantwortung der Kollektive erfolgt. Die »Künstlerische Leitung«, die mit der Begutachtung der Entwürfe betraut war, habe diese zum Teil nochmals eingehend diskutiert. Caden, der für die Wandbildaktion selbst ein Kollektiv gegründet hatte, beschreibt das Zusammenwirken der Künstler euphorisch, »wir saßen im Atelier zusammen und planten«. In den geräumigen Ateliers der Staatlichen Kunstakademie bei der Brühlsehen Terrasse habe ein fieberhaftes Treiben begonnen, es seien die Platten montiert und die Kollektive verteilt worden: »[ ... ] Wände und Fußböden bedeckten sich mit Skizzen und Entwürfen in allen Techniken. An jeder der großen Ateliertüren erschien nach und nach das Pappschild, das mit Kohle oder Tusche die Namen der dem jeweiligen Kollektiv angehörigen aller, die aus den Betrieben zurückgekehrt waren, anzeigte.« (Caden 1949a: 270) Nach dem Ende der zentralen Ausstellung wurden die Wandbildentwürfe, bis auf zwei Ausnahmen54, magaziniert und Mitte der funfziger Jahre als provisorische Ausstellungswände überstrichen, dienten als Malgrund für neue Bilder oder wurden schließlich zersägt. (Schönfeld 1996: 45li5 Die Kritik an den Ergebnissen der Wandbildaktion zur zweiten deutschen Kunstausstellung machte sich insbesondere an der venneintlichen formalistischen Darstellungsweise fest, trotz der sorgfaltigen Auswahl der Bildwerke und der ideologischen Betreuung der Künstler durch den Auftraggeber. Herbert Gute verurteilte die Aktion als eine »Konfektion 53 Vorgegeben waren Themen des im Vorjahr verkündeten ZweijahresWirtschaftsplanes. Nach Studien in verschiedenen Industriebetrieben arbeiteten im August 1949 zehn Kollektive und vier einzelne Künstler an der Ausarbeitung ihrer Entwürfe. (Schönfeld 1996: 449) 54 Anerkennung erhielt lediglich das Bild »Berufsschulung« von Erich Gerlach und Kurt Schütze, wegen des positiven Inhalts und der guten kompositorischen Gliedenmg. Von der Sächsischen Landesregierung angekauft, blieb das Werk als einziges des Auftragsprojekts erhalten. (Schönfeld 1996:451) 55 Diesen Hinweis erhielt Martin Schönfeld von Diether Schmidt (vgl. Schönfeld 1996).
191
KOLLEKTIVIERUNG DER PHANTASIE?
von Wandbildern zur Verwendung bei passenden Gelegenheiten« und interpretierte sie als den »anachronistischen Versuch, aktionistische Kunsttendenzen aus der Weimarer Zeit zu übernehmen« (Gute 1949). Dennoch glaubte man zunächst mit Aufklärungsarbeit über die Möglichkeiten kollektiven Schaffens eine höhere Resonanz und bessere Ergebnisse zu erreichen und hielt an den künstlerischen Arbeitsbrigaden, auch für Wanderausstellungen, fest. 56 Zwei Jahre nach dieser Wandbildaktion wurde die Idee der kollektiven Kunstgestaltung mit dem in dieser Größenordnung singulären Projekt der» 1. Sozialistischen Straße« resp. der »Stalinallee« in Berlin weitergeführt. Für dieses Aufbauprogramm waren Künstler in die Bauarbeiten eingebunden und führten zahlreiche Bildtafeln aus. 57 (Vgl. Thiel 1996) Die letzte große Kollektivaktion war die vom Verband initiierte » 1. Sozialistische Künstlerbrigade« resp. »Aktion Rammenau«. Diese war kurzfristig im Herbst 1952 in Form eines prämierten Wettbewerbs auf den Weg gebracht worden, um Bildwerke des »neuen Weges« für die verschobene dritte zentrale Kunstausstellung zu schaffen: »Diese neuen Aufgaben sind nicht in künstlerischer Einzelarbeit allein zu bewältigen, sondern erfordern das gemeinsam lernende, helfende, beratende, kritisch richtende Künstlerkollektiv, eine neue gesellschaftliche Triebkraft auf dem Gebiete der kulturellen Arbeit.« (Unsere Künstler bilden eine sozialistische Brigade 1952: 1) Der Beschluss zur Bildung der Rammenauer Brigade war auf der »Theoretischen Konferenz«58 gefasst und daraufhin als offener, von Künstlern unterzeichneter Briet9 publiziert worden. Mit diesem sollte 56 Zusätzlich erteilten der Kulturfonds der DDR und die Staatliche Kanunission für Kunstangelegenheiten über 60 Förderungsaufträge an bildende Künstler, wie auch die Arbeiten der Künstlerbrigaden in den Bezirken Dresden, Halle, Erfurt und die Arbeit des Künstlerkollektivs in der Stalinallee sichergestellt wurden. (Vgl. Däbritz 1953: 2) 57 Die Wohnbauten der Stalinallee- »im Flair der Riviera« - waren für diese Zeit mit beispielloser Innenausstattung ausgerichtet: Müllschlucker, Fahrstühle, Innentoiletten, geflieste Bäder, Fernheizung, Parkettfußböden, Innentüren mit Glas und eingerichtete Küchen. 58 Die »Theoretische Konferenz« fand in Dresden am 26. und 27. September 1952 statt. 59 Hauptunterzeichnet von vier Künstlern und 27 weiteren Künstlern aus dem gesamten DDR-Gebiet. Zwei Wochen später trafen sich 27 Künstler zum »Arbeitsseminar der 1. Sozialistischen Künstlerbrigade« im Ostseebad Heiligendarrun und am Abend des 21. Oktober 1952 wurde offiziell die Gründung der I. Sozialistischen Künstlerbrigade vollzogen. Am 14. November 1952 kündigte das Ausstellungssekretariat der »III. Deutschen Kunstausstellung« den Teilnehmern der Sozialistischen Künstlerbrigade den Beginn der Arbeit für den 20. des Monats an. (Lindner [1999])
192
KOLLEKTIVIERUNG
der Eindruck erweckt werden, die Künstler selbst hätten die Initiative zur Brigadebildung ergriffen. Der VBKD gründete daraufhin fünf Kollektive und brachte die Künstler sieben Wochen im Schloss Rammenau bei Bischofswerda unter - mit reichlich Lebensmitteln und politischer Schulung versorgt. In schriftlichen Arbeitsrichtlinien wurden die Verpflichtungen der Künstler umrissen: Die Künstler sollten sich kameradschaftliche Hilfeleistung in ideologischer sowie fachlicher Hinsicht geben und selbstkritische Haltung in Fonnen und Farbe einnehmen. Andere Mitglieder und deren Arbeiten sollten kritisiert werden, aber nur wenn dies erwünscht werde. Weiterhin könnten die Mitglieder einer Brigade auf gemeinsamen Beschluss ein Mitglied ausschließen, wenn dieses trotz ausreichender Hilfestellung mit der Entwicklung nicht Schritt halte. (Verpflichtung der Mitglieder der 1. Sozialistischen Künstlerbrigade 1952) Da die Ergebnisse der »Aktion Rammenau«, deren Werke für die jeweilige Gruppe prämiert worden waren, 60 den Ansprüchen nicht standhalten konnten, verwarf man die Form der künstlerischen Kollektivbildung mittels Künstlerbrigaden.6 1 In den Archivquellen lassen sich deshalb kaum Angaben über den Ablauf, die Zusammensetzung oder die entstandenen Bildwerke finden. 62 Zu vennuten ist, dass die Gruppen mit Bezug zu den fünf Ländern der DDR ausgerichtet waren, die ja zu Beginn des Jahres mit der politischen Strukturreform gebildet worden waren und die Umstrukturierung des Künstlerverbandes erst begründet hatten.63 Aufgrund der Materiallage können folgende Gruppen ermittelt werden: Lukas-Cranach-Brigade« aus Sachsen-Anhalt, die Hochschulbrigade der Dresdner Hochschule für bildende Künste, die Wartburgbrigade aus Thüringen, die Brigade Rammenau resp. die Vorzeigebrigade
60 Der I. und der 3. Preis gingen an die Lukas-Cranach-Brigade; der 2. Preis
an die Hochschulbrigade und der 4. und 5. Preis an die Brigade Rammenau. (Die 3. Deutsche Kunstausstellung im Spiegel der Presse 1953: 8) 61 Im Ausstellungskatalog befinden sich acht Bilder. Auf die Entstehungsgeschichte werde aber nicht hingewiesen. (Lindner [1999]) 62 In der Literatur bleibt unklar, welche die 5. Brigade war. Die 15 bis 24 beteiligten Künstlern hätten zwischen 13 und 15 Bilder angefertigt. Außer von David und Klünder (wegen Lasurschaden) seien alle Bilder fiir die Ausstellung angenommen worden. (Lindner [1999]) 63 In einem Rechenschaftsbericht wird vermerkt, dass die fünf Brigaden 74 Werke eingesandt hätten, wovon 51 angenommen worden seien. Vergleichsweise hätten die einzeln schaffenden Künstler aus der DDR 2876 Werke eingesandt, von denen nur knapp 372 Werke angenommen worden seien. Bei der Brigade Hochschule Dresden sei das Ergebnis besser ausgefallen: Hier hätten 18 Brigademitglieder 22 Arbeiten geschaffen, zur Ausstellung seien dann 20 Werke gelangt. (Däbritz 1953: 2)
193
KOLLEKTIVIERUNG DER PHANTASIE?
des Verbandes und die Brigade Chemnitz resp. die 1. Sozialistische Künstlerbrigade. (Vgl. VBKD [1953]: 23; Die 3. Deutsche Kunstausstellung im Spiegel der Presse 1953: 8) Verbandsintern wurde das Gruppenergebnis zunächst positiv dargestellt.64 Herbert Gute, der die Aktion ins Leben gerufen hatte, resümiert in seinem Abschlußbericht »Die vom VBKD angewendete Methode der Brigaden hat sich bewährt. Sie erzog die Künstler zur Kritik und zur gegenseitigen Hilfe. Sie erhöhte den Leistungsstand der durch die Brigaden erfassten Künstler.« (Gute [1953]: 9) An anderer Stelle wird geschlussfolgert, dass die Brigadearbeit unter allen Künstlern eine bedeutende Initiative ausgelöst hätte. (Däbritz 1953: 6628) Der Erfolg stellte sich jedoch nicht wirklich ein und die Aktion, außer als singuläres Negativbeispiel, nicht mehr erwähnt: »Die Praktiken und Arbeitsergebnisse der Rammenauer Brigade sind ausreichendes Beispiel dafür, wie schlecht sich das in unserem Schaffen auswirkte.«(VBKD [1953]: 23) Zwar wurden die beiden Großprojekte mit Künstlerbrigaden als gescheitert angesehen, die Idee in kleinem Maßstab unter der Bezeichnung Studiengruppen65 aber fortgeschrieben. Nach über 30 Jahren resümiert der VBK der DDR, dass sich die Unterteilung des Verbandes in Sektionen als fruchtbarer erwiesen hätte, als die Kollektivbildungen der Anfangsjahre. Diese seien »mancherlei Versuche« gewesen, neue Möglichkeiten des Zusammenfindens der Künstler zu erproben und an die damalige Auffassung gebunden gewesen, das Kunstschaffen müsse im Sozialismus ausgeprägt kollektiven Charakter tragen und kollektiv ausgeübt werden: »Diese zeitweiligen Zusammenschlüsse vermochten freilich den erwarteten Effekt nicht zu bringen.« (VBK der DDR 1983: 37)
Kulturinstitutionelle Ordnungsvorstellungen Andere Fonnen der Kollektivbildungen der Anfangsjahre waren eng mit den staatlichen Organisationsfonnen verbunden und vergleichsweise dauerhafter Natur. Dazu wurden auch vom Bürgertum im 19. Jahrhundert geschaffene kulturinstitutionelle Ordnungsmuster übernommen und auf 64 »Die Bildung der Künstlerbrigaden ist eine bedeutende Errungenschaft in
der Methode des künstlerischen Schaffens. Es erzogen sich hiermit die Künstler viel besser als bisher zur sachlichen und offenen Kritik und Selbstkritik und zur gegenseitigen Hilfe.« (Däbritz 1953 : 2) 65 »Die erste dieser Studiengruppen hat in der MTS Isseroda im Landkreis Weimar ihre Arbeit aufgenommen. Der Studienauftrag lautet: Studium der Frühjahrsbestellung der landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften.« (Künstler studieren die Frühjahrsbestellung 1953: 17)
194
KOLLEKTIVIERUNG
diese Weise eine Rekonstruktion des Historischen vollzogen: in Gestalt der Habitus führenden Rolle der Bourgeoisie oder in Form der Prinzipien der Vergemeinschaftung in bürgerlich dominierten Gesellschaften. Für den Kunstbereich wurden die Präsentationsform Kunstausstellung sowie die Organisations- und Vermittlungsformen Kunstverein66 und Kunstgenossenschaft übernommen. Kunstvereine, so urteilt Herbert Gute, seien historisch das Ergebnis einer schlechter werdenden ökonomischen Lage der Künstler, in deren Konsequenz ausgeklügelte Binnenregelungen geschaffen werden mussten. In Kunstvereinen waren diese das Verlosen von Kunstwerken oder das Angebot von Ratenzahlungen. Bei bürgerlich motivierten Zusammenschlüssen, wie Genossenschaften oder Sezessionen, würden künstlerische Ziele mit sozialen Forderungen vermengt, was Spaltungen und Umgruppierungen der Künstlerorganisationen nach sich gezogen hätten. In der Konsequenz hätten die Künstler »Verfahrens-Rituale« entwickelt und »das ganze kopflose Durcheinander für Demokratie« gehalten. (Gute 1952: 2) Zwei Jahre nach dieser Einschätzung wurde innerhalb des VBKD von der Zentralebene angeregt, die Organisationsfenn der Kunstvereine für örtliche Ausstellungsgruppen zu übernehmen: »Es soll angestrebt werden, analog der ehemaligen Kunstvereine örtliche Ausstellungsgruppen (vielleicht innerhalb des Kulturbundes) zu bilden, die das Ausstellungswesen der bildenden Kunst in die Hand nehmen.« (VBKD 1954: 4) Benannt als Verkaufsgenossenschaften67 wurde das neue Organisationssystem in der DDR im Jahr 1953 etabliert und mit der Sicherung der wirtschaftlichen Grundlage der Künstler begründet, wie dies als Beweggrund für die Gründungen im 19. Jahrhundert erkannt worden war. Die Verkaufsgenossenschaften der DDR hatten gleichfalls den historischen Kunstvereinen analoge Binnenregelungen: Jedes Mitglied erhielt jährlich eine originale Grafik, außerdem sollte die Möglichkeit zur Auslosung von Kunstwerken geben werden. Die Mitglieder einer örtlichen Verkaufsgenossenschaft konnten auch kostenlos alle laufenden Ausstellungen besuchen, die von diesem Verein in der DDR veranstaltet wurden. (VBKD 1954: 5) Ausdrücklich sollten die Genossenschaften in Eigeninitiative der Künstler eingerichtet werden. Begeistert von den neuen Wirkungsmöglichkeiten gründeten Mitglieder des Ufers nach der Eingliederung der Gruppe in den Künstlerverband die beiden ersten Ver-
66 Entgegen den Angaben von Ruppett wurden die ersten Kunstvereine bereits 1792 und nicht 1824 gegründet (Hinweis von Dr. Manuela Vergoossen, TU Dresden). 67 Genossenschaftlich organisierte Zusanunenschlüsse von Künstlern waren im 19. Jahrhundert als Dachverbände der Kunstvereine etabliert worden.
195
KOLLEKTIVIERUNG DER PHANTASIE?
kaufsgenossenschaften der DDR in Meißen" und in Dresden. In Berlin übernahm der Künstlerverband im Jahr 1950 die Ausstellungssäle »Unter den Linden« in Berlin69 , die bereits in den vierziger Jahren von der Arbeitsgemeinschaft sozialistischer Künstler geschaffen worden war, und stellte sie unter dem Namen »Bild der Zeit« für Ausstellungen und als Verkaufsstellen zur Verfügung. (VBK der DDR 1983: 30) Diese Verkaufsform wurde von allen Seiten als Möglichkeit der Künstlerselbsthilfe gesehen, sie war finanziell unabhängig, basisdemokratisch organisiert und ein Ersatz fur den privaten Kunsthandel. 70 Tatsächlich aber gab es auch hier- und zwar bei der Auswahl der Kunstwerke - staatliche Reglementierungen71: »Die Werke, die durch die Verkaufsgenossenschaft zum Verkauf angeboten werden, unterliegen einer Jury, die durch die Vollversammlung fur jeweils ein Jahr gewählt wird.« (Verkaufsgenossenschaft Meissen [1953]) Der Ufer-Künstler Franz Nolde, mittlerweile auch Vorsitzender der Verbandsbezirksleitung Dresden, begründet sein Engagement entsprechend der Argumentation der Verbandsseite als Eigeninitiative, die die noch unbefriedigende Lage der Künstler verbessern würde. Diese hätten sich eine eigene finanzielle Grundlage geschaffen und würden sich bereits gegenseitig Hilfe geben. Nach kurzer Zeit habe die Genossenschaft 68 In dem Entwurf des Statuts der VK »Bildender Künstler« in Meißen werden die staatlichen Vorgaben gebündelt: »Hebung unseres fachlichen Wissens durch Aneignung des nationalen Kulturerbes und Anwendung der Erfahrungen sowjetischen und volksdemokratischen Volksschaffens, Aneignung und Anwendung der Methode des sozialistischen Realismus. Im festen Bündnis zur Arbeiterklasse, zu den werktätigen Bauern und zur schaffenden Intelligenz wollen wir den sozialistischen Realismus in der bildenden Kunst verwirklichen.« (Verkaufsgenossenschaft Meissen [1953]) 69 Am 18. Mai 1954 wurden die neuen Verkaufs- und Ausstellungsräume der Berliner Verkaufsgenossenschaft eröffnet. Ihr gehörten 75 Künstler an. Es sollte eine große Anzahl fördemder Mitglieder geworben werden. Die VK in Jena wurde Anfang Juni des Jahres eröffnet. Zu diesem Zeitpunkt in Vorbereitung waren die Verkaufsgenossenschaften in den Bezirken KarlMarx-Stadt, Magdeburg und Rostock. (Vgl. Das Blatt 1954: 4) 70 Ab Anfang der 60er Jahre erweiterten sich die Ausstellungsmöglichkeiten. Mit den »Kleinen Galerien« (Galerien des Kulturbundes) schufman weitere lokale Ausstellungsorte in öffentlichen Einrichtungen und in betrieblichen Kulturhäusem. 1983 waren 364 »Kleine Galerien« eingerichtet. Weitere Ausstellungsmöglichkeiten boten ab den 70er Jahren die »Werksgalerien« in Industriebetrieben und die kommunalen Galerien der lokalen Verwaltungen. (Schönfeld 1999: 71) Im Oktober 1974 wurde dann der Staatliche Kunsthandel der DDR für sämtliche Kunstsparten (auch Antiquitäten) eingerichtet und die erste Verkaufsgalerie in Rostock eröffnet. 71 Ankäufer war die Bezirksauftragskommission, die Preise wurden entsprechend der Honorarordnung des VBK gestaltet. (VBKD [Bitterlich]1953)
196
KOLLEKTIVIERUNG
der Künstler einen schönen mietfreien Verkaufsraum mit drei Schaufenstern sowie Einrichtungsgegenstände vom örtlichen Bürgenneister erhalten: »Wir gingen also zum Kreisrat und haben[ ... ] ihn gefragt, ob[ ... ] die Entwicklung der Kunst nur eine Sache der Künstler wäre. Nein, sagte er, das geht alle an. Wir sagten ihm: Wir werden eine Verkaufsstelle schaffen, gib uns einen Laden dafür!« (VBKD [1953]: 36) Um eine ständige Käuferschicht zu sichern, wurde neben einer aktiven Mitgliedschaft auch eine fördernde Mitgliedschaft für Privatpersonen oder Betriebe eingeführt. 72 Diese zahlten, gleich dem aktiven Mitglied, ein Eintrittsgeld von fünf Mark und monatlich eine selbst festgesetzte Summe, die für den Ankauf von Kunstwerken gutgeschrieben wurde. Die Kollegen in den Betrieben, so Nolde, hätten sich bereits begeistert an ihn gewandt: »Da können wir ja vielleicht, statt für einen Kollegen, den wir ehren wollen, ein Radio in der HO zu kaufen, ihm einen Scheck ausschreiben, der in eurer Verkaufsstelle eingelöst werden kann.« (Ibid.: 36) Die bereits von der Künstlergruppe eingeübten Prinzipien wurden mit den beiden Verkaufsgenossenschaften »Bildender Künstler« in Meißen und Dresden fortgeführt und das Prinzip gegenseitiger Abhängigkeit positiv besetzt als gegenseitiges Verständnis und Beihilfe. Die staatlich eingeforderte Massenanhindung von Kunst erhielt so eine praktische Handlungsebene, die sich mit dem Motiv der ökonomischen Sicherung und dem eigenen Wirken durch Verkauf der Werke verbinden ließ. Die im Staatssozialismus übernommenen kulturinstitutionellen Ordnungsmuster des Bürgertums wurden in dieser Phase der institutionellen Festigung nach marxistischen Prinzipien bewe1iet und die argumentativen Spannungen mit begrifflichen Umbenennungen und Ausblendung tariert. Dahinter steht, dass die kommunistischen Ideale aus der Ablehnung bürgerlicher Strukturierungsprinzipien entstanden, diese aber mitgedacht und versatzweise weiter getragen wurden. In der Anfangszeit der DDR wurde die diskursive Alterität gegenüber dem Kleinbürgertum aufgespannt und dieses gegen die Masse der Arbeiterschaft gesetzt. Hingegen die Habitus führende Rolle der Bourgeoisie mit der Maxime der Umwälzung von unten übernommen und das anfangs gemeinschaftliche Engagement der Künstler in ein gesellschaftliches transformiert.
72 Ein Aquarell kostete ab 150 Mark, eine Lithographie ab 65 Mark. Über die Motive privater Käufer berichtet Nolde anekdotisch: »Ein junger Mann, vielleicht von 22 bis 24 Jahren, kriecht jetzt schon das ftinfte oder sechste Mal in unserem Laden herum und nimmt immer wieder eine kleine Plastik, die 280 DM kostet, in die Hand und sagt: Ich will nur sehen, ob sie schon verkauft ist, das Geld habe ich noch nicht zusammen.« (VBKD [1953]: 37)
197
KOLLEKTIVIERUNG DER PHANTASIE?
Exkurs: Der Popularisierungsgedanke und sei n e Sy m b o I i s c h e Vermit t I u n g 73 Der Gedanke, Kultur zu popularisieren, fand im 20. Jahrhundert seine paradigmatische Entsprechung in der bildprogrammatischen Vermittlung der Kunstform des »Sozialistischen Realismus«. Kunst wurde hierin zum Medium symbolischer Vermittlung, mit dem die Inhalte der angestrebten gesellschaftlichen Transformation im Kollektivbewusstsein verankert werden sollten. Jedes Artefakt, so die Idee, verändere die Wahrnehmung und eigne sich dazu, Vorstellung und Wirklichkeit zusammenzuführen und auf Dauer zu stellen. 74 Weshalb Kunst gerade in Phasen staatlicher Konstituierungen helfen sollte, idealisierte Vorstellungen in Handlungsweisen umzusetzen.
Symbolische Vermittlung In der Anfangsphase der DDR wurde künstlerischen Ausdrucksformen über die beabsichtigte Konstituierung staatlicher Identität hinaus - die Rolle zuteil, gesellschaftliche Wirklichkeit erstmals zu erzeugen. Kunst gereichte durch ihre Verbildlichung des Kollektivs zum Instrumentarium außergesellschaftlicher Abgrenzung des je Besonderen und zum Instrumentarium der Ästhetisierung der Lebenswelt des je Einzelnen. Mit der folgenden, begrifflich als Symbolische Vermittlung gefassten Betrachterperspektive, schließe ich mich den Überlegungen von Pierre Bourdieu (Bourdieu 1994), Ernst Cassirer (Cassirer 1990) und Jürgen Habennas (Habermas 1988) über symbolische Ordnungen, Prinzipien und Formen an. Mit symbolischer Vermittlung werden Vorgänge bezeichnet, mit denen durch kulturelle Leistungen sichtbare soziale Ordnungsgefüge hergestellt werden und sich in diesen, wie generell in Ausdrucks-, Mitteilungsund Kommunikationsformen, manifestieren. Symbole wirken als Transformatoren in die soziale Welt hinein, sie markieren gleichsam Prozesse der Vergesellschaftung und ermöglichen, Mechanismen sozialer Wirkungszusammenhänge nachzugehen - wie diese den Bestrebungen der Popularisierung in der Anfangsphase der DDR zugrunde liegen. 75
73 In ähnlicher Fonn als Aufsatz veröffentlicht (vgl. Jacoby 2004). 74 Gefolgt wurde dabei der Marxschen Modellvorstellung, dass die Produktion nicht nur einen Gegenstand fiir das Subjekt schaffe, sondern auch ein Subjekt fiir den Gegenstand: »Der Kunstgegenstand - ebenso jedes andre Produkt - schafft ein kunstsinniges und schönheitsgenußfahiges Publikum.« (Marx 1947: 247) 75 Vgl. die methodische Darstellung in dem Kapitel »Symbolische Vennittlung- eine kunstsoziologische Betrachtungsweise«.
198
KOLLEKTIVIERUNG
Der Popularisierungsgedanke In der Phase staatlicher Konstitution wurde in der DDR unter dem Begriff der »wissenschaftlichen Popularisierung« ein Programm geschaffen, mit dem die Vorstellungen der »sozialistischen Erneuerung der Gesellschaft« durch Austausch von Handlungsfonnen etabliert werden sollten.76 Die Protagonisten des Programms waren die Künstlerschaft als »Teil der Intelligenz« und die Werktätigen als »Träger der Gesellschaft«. Eingefordert wurden insbesondere Bildnisse von Arbeitern sowie Darstellungen von Arbeitsabläufen und die Maxime erstellt, dass »die beste bildende Kunst umsonst ist, wenn sie nicht unter die Werktätigen kommt.« (Grotewohl 1954: 4) Die einprägsame Leuinsehe Formel »Die Kunst gehört dem Volke!«77 geriet dabei zu einem omnipräsenten Schlüsselzitat, sei es auf Schriftbändern bei zentralen Kunstereignissen oder in der diskursiven Auseinandersetzung über Kunst. Mit diesem Konzept der Massenvennittlung wurde, neben den wirkungsmächtigen Instrumentarien der Lenkung durch Auftrags- 78 und Themenvergabe79 sowie Kollektiv- resp. Brigadebildung, eine vennittelnde Einflussnahme verfolgt. Eingesetzt in bestehende organisatorische Formen oder als geregelte Beziehungsmuster, beispielsweise mit »Freundschaftsverträgen« zwischen Künstlergruppen und Betrieben, konnten so neue Wirkungskreise aufgetan werden. Auf der semantischen Ebene wurde das angestrebte Bündnis durch Kettung tradierter Begriffs- und sozialer Gegensatzpaare bekräftigt, beispielsweise durch Wortbildungen wie »werktätige Kunstschaffende« und »künstlerisches Volksschaffen« oder durch »Künstlerbrigaden« resp. »künstlerische Arbeitsbrigaden«.Ro 76 Zu der vorgestellten Transformation von Vorstellungen in Lebensweisen stellte Vladimir Iljitsch Lenin fest: Der Sozialismus könne erst dann als gesichert gelten, wenn er »in das Alltagsleben, in die Kultur, in die Gewohnheit« eingegangen sei. (Lenin 1965: 475) 77 Der Ausspruch wird Lenin um 1920 zugeschrieben und ist von Clara Zetkin überliefert. (Zetkin 1961: 17) Vgl. u. v.a. den Schriftzug am Eingangsportal der »IIL Deutschen Kunstausstellung 1953« in Dresden. (Photodolmmentation 1953) 78 Das Prinzip der Auftragsvergabe wurde ab Mai 1950 mit dem im September 1949 gegründeten Kulturfonds forciert. Der Institution oblag die Entscheidungsgewalt über die Auswahl zu fördernder Künstler. 79 Die Künstler wurden in pädagogisch ausgerichtete Wettbewerbe und gesellschaftsstiftende Aufbauprogramme eingebunden. Zu Beginn der 50er Jahre in das »Nationale Aufbauprogramm Stalinallee« in Berlin [d.i. die »1. Sozialistische Straße Deutschlands«] und in Kunstwettbewerbe u.a. »Unsere neue Wirklichkeit« im Januar 1949 mit der anschließenden Ausstellung einiger der Werke unter dem Titel »Mensch und Arbeit«. 80 Die Verschmelzung tradierter Differenzierungsmuster in der DDR lässt sich anschaulich an der prominent werdenden Rolle der Baukunst aufzei-
199
KOLLEKTIVIERUNG DER PHANTASIE?
Im Fortgang der Erörterung der Ausgangsfrage, weshalb künstlerischen Ausdrucksformen eine Ausnahmestellung im gesellschaftlich-ideologischen Lenkungsprozess zugesprochen wurde, soll das Potenzial artifizieller Alterität für die Bildung kollektiver Identität anband der jeweils konkreten Umsetzung des Programms erschlossen werden. Eine vorläufige These lautet, dass Vorstellungen als symbolische Setzungen politischer Herrschaft nur annähernd künstlerisch umgesetzt werden können, da das Medium selbst im Ungewissen verbleiben muss, um als solches zu bestehen. Weshalb sich im Staatssozialismus der DDR die kritische Auseinandersetzung mit Kunst als DiskussionskulturR1 institutionalisiert hat.
Die »Wissenschaftliche Popularisierung« Im Anschluss an die kulturkritisch ausgelegte, diskursive Vennittlung der gesellschaftspolitischen Vorgaben, die zunächst sporadisch initiiert und 1951 mit dem »Fonnalismusbeschluß«s2 zielgerichtet aufgegriffen wurden, sowie der organisatorischen Umstrukturierung des gesamten Kulturbereichs, war die Konzeption der »wissenschaftlichen Popularisierung« als Motor der Massenvermittlung gedacht. Die Grundlage wurde am 16. März 1950 mit der »Kulturverordnung« 83 gelegt und hierin als zentrale Aussage formuliert, dass das kulturelle Niveau der Werktätigen durch die Bildung einer fortschrittlichen Intelligenz aus deren eigenen Reihen angehoben werden solle. Im Gegenzug versprach man die Lebens- und Arbeitsbedingungen, der für den demokratischen Aufbau gen. Ihr wurde in den beiden Folgejahrzehnten eine aktive Bildfunktion zur Synthese von bildender Kunst und Architektur zugewiesen. 81 Die staatlichen Methoden der Lenkung mittels diskursiver Vermittlung haben sich später in der DDR als Umgangsmodi flir Problemlösungen etabliert. 82 Der »Formalismusbeschluß« wurde auf der 5. Tagung des ZK der SED vom 15. bis 17. März 1951 unter dem Titel »Der Kampf gegen den Formalismus in Kunst und Literatur für eine fortschrittliche deutsche Kultur« verabschiedet. Initiiert wurde die Auseinandersetzung zwischen den künstlerischen Darstellungspolen der Abstraktion und des Realismus bereits Ende 1948 in der so genannten »Dymschitz-Debatte« von dem sowjetischen Kulturfunktionär Major Alexander Dymschitz. (Dymschitz 1948) 83 D.i. die »Verordnung des Ministerrates der DDR zur Entwicklung einer fortschrittlichen demokratischen Kultur des deutschen Volkes und zur weiteren Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen der Intelligenz«. Mit dieser angeknüpft wurde an die Vorordnung »Über die Erhaltung und Entwicklung der deutschen Wissenschaft und Kultur, die weitere Verbesserung der Lage der Intelligenz und die Steigerung ihrer Rolle in der Produktion und im öffentlichen Leben« der Deutschen Wirtschaftskommission vom 31. März 1949. (Zentralverordnungsblatt 1949: 227ff.)
200
KOLLEKTIVIERUNG
schaffenden Intelligenz zu verbessern. Die Akzeptanz durch die Künstler war in dieser Zeit zu weiten Teilen gewährleistet, da über deren ökonomische Sicherung hinaus, die Umsetzung des Künstlertraums vor Augen geführt wurde, Kunst und Leben 84 zu vereinen. Auch griffen die Instrumente des Tauschprogramms in sämtliche Lebens- und Wirkungsbereiche ein. Den Vorgaben der »Il. Parteikonferenz der SED« folgend, bei der am 12. Juli 1952 beschlossen wurde, die Grundlagen des Sozialismus planmäßig aufzubauen und das Kulturleben durch Pflege des klassischen Erbes sowie der Entwicklung eines realistischen Kunstschaffens zu entfalten, wurden die Popularisierungsbestrebungen vom Künstlerverband programmatisch umgesetzt und die gesamte Künstlerschaft als »Rufer zur Aktion« eingebunden. (SED 1952; VBKD 1952) In dieser Phase gründete das kulturelle Selbstbild der DDR hinsichtlich der Massenwirksamkeit von Kunst auf sowjetrussischen nachrevolutionären Ideen, die in den 30er Jahren von Kulturwissenschaftlern und Kulturfunktionären präzisiert worden waren und ab Mitte 1945 durch die SMAD weitergereicht wurden. 85 Somit stellte das Vermittlungsprogramm der »wissenschaftlichen Popularisienmg« keine originäre Positionierung dar. Vehement vennieden wurde allerdings eine direkte Referenz auf die bereits während der Weimarer Republik von sozialistisch motivierten Künstlerzusammenschlüssen86 erprobte »Politisierung der Massen« 87 • Diese Bewegung hatte ab Ende der 20er Jahre unter der Bezeichnung »Proletkult« mit phantasiereichen Aktionen der Agitprop 88 -Gruppen auf sich aufmerksam gemacht und, bis zu ihrem jähen Ende mit der Machtübernahme der 84 Die Aufhebung, des als vom Leben getrennt wahrgenommenen Kulturbetriebs, beschäftigt die Künstler spätestens seit Beginn der Moderne und war während der Zeit der Weimarer Republik von eben dieser Generation mit Nachdruck eingefordert worden. 85 Kunstwissenschaftliche Referenzträger waren in der Anfangsphase der DDR Andrej A. Shdanow, er führte 1948 mit der »Shdanowstschina« die Debatte gegen den »Kosmopolitismus« ein, und Georgij M. Malenkow, Generalsekretär des ZK der KPdSU, sowie Nikolaj N. Shukow, Major Alexander Dymschitz und der Kunstwissenschaftler German Nedoschiwin. 86 Die KPD hatte die »Politisierung der Massen« ab Mitte der 20er Jahre zu ihrem zentralen Arbeitsfeld erhoben (Grune 1977: 434) und insbesondere mit auf Spontaneität gründenden Wandertheatem umgesetzt. Vgl. Das rote Sprachrohr in Berlin und die Roten Raketen in Dresden sowie die von der Künstlergruppe ASSO als Vorbild genommene mssische Gruppe Die blauen Blusen, die auch in Deutschland Auftritte gab. 87 Weshalb nur wenige Stellungnahmen vorliegen. U.a. die Bewertung des »Proletkults« als »vulgären« (Döderlin 1953: 29) oder als »Kollektivismus der proletarischen >PsychoideologieErich Wirth< sieht, so wird er wie ich, ebenfalls davon gepackt sein. Diese Gestalten nehme ich mir gern zum Vorbild.« (Stimmen 1953) Speziell auf das Vermittlungsprogramm zugeschnittene Orte der Präsentation von Kunst wurden mit den »Betriebskunstausstellungen« geschaffen und verstärkt Wanderausstellungen 103, insbesondere in kleineren Städten und Dörfern, ausgerichtet. Diese boten den Künstlern willkommene Gelegenheiten, ihre Werke einem größeren Rezipientenkreis vorzustellen. Ein weiteres Instrument der Vermittlung war die Verbreitung der Leitideen mittels Sichtwerbung. Mit einprägsamen Leitsätzen auf Schriftbändern, bevorzugt von sowjetrussischen Kulturwissenschaftlem, die Anfang der 50er Jahre kaum anderweitig in Übersetzungen vorlagen, aber auch von Literaten der deutschen Klassik, um mit letzteren eine der 100 Auf dem nicht anonymisierten Umfragebogen sollten die persönlichen Präferenzen angegeben und Vorschläge für Werkankäufe für Betriebe und Museen gemacht sowie die am besten dem »Sozialistischen Realismus« entsprechenden Werke genannt werden. (Besucherftagebogen 1953) 101 An erster Stelle seien »Nationalpreisträger Erich Wirth mit seinem Kollektiv« von Erich Hering genannt worden, an zweiter Stelle »Freundschaft« von Rudolf und Fritz Wemer, an dritter »Streikposten in Harnburg« von Willy Colberg, gefolgt von »Die Schlosserlehrlinge Zinna und Glasenapp im März 1948« von Heinz Wagner und »Die erste Furche für die Produktionsgenossenschaft« von Walter Cordes. (Däbritz 1953b: 8) 102 Von sieben Eintragungen seien sechs positiv formuliert, urteilt der Leiter der »Abteilung Kunst und kulturelle Massenarbeit« des Rats des Bezirkes Dresden. Über das Bild »Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft bei der Ernte« von Siegfried Donndorf zitiert Däbritz eine Bewertung mit dem Wortlaut »Dieses Bild gefallt mir, nur das Getreide im Vordergrund ist stumpf und sieht lehmig aus. Was für einen schönen Glanz hat sommerlich reifes Getreide! Daran habe ich bei der Emte immer meine Freude!« und fügt dem hinzu: »Die Künstler sollten eine so treffende und wohlgemeinte Kritik nicht überhören.« (Däbritz 1953b: 8f.) 103 Nach dem Vorbild der russischen Künstlerbewegung der Wanderer, die um 1900 die Methode des Realismus in der Tradition russischer Malerei des 19. Jahrhunderts propagiert hatten.
207
KOLLEKTIVIERUNG DER PHANTASIE?
damaligen Leitideen, die der deutschen Einheit, zu bekräftigen. 104 Zu lesen war: »Die Kraft der Kunst liegt in ihrer engen Verbindung mit dem Volke« und »Der Marxismus ist allmächtig, weil er richtig ist« oder die Anfang der 50er Jahre favorisierte Formel von Malenkow »Das Problem des Typischen ist stets ein politisches Problem«. 105 (Photodokumentation 1953) Ein eigenständiges Prinzip - auf dem Höhepunkt der Popularisierungsbestrebungen eingerichtet - stellten die »Freundschaftsverträge« zwischen Künstlern und Volkseigenen Betrieben (VEB) sowie zwischen Künstlern und Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften (LPG) dar. 106 Beworben wurde das Austauschprogramm, mit dem verbindlich geregelte Handlungsanweisungen gegeben werden konnten, u.a. mit Aufrufen in der Verbandszeitung, die als Absichtserklärung abgefasst waren: »Künstler wollen Freundschaftsverträge mit Betrieben abschließen.« (Künstler wollen Freundschaftsverträge 1952: 11) Die Regelungen, in Form und Inhalt einer Urkunde gleich, hatten bindende Wirkung für beide Seiten, die bei Bedarf auch eingefordert wurden. So erinnert die Kulturabteilung der Landesdruckerei Sachsen die Künstlergruppe Das Ufer vier Jahre nach der Vertragsunterzeichnung schriftlich daran, ihren Verpflichtungen nachzukommen und populärwissenschaftliche Vorträge über bildende Kunst im Betrieb zu halten sowie eventuell eine Führung durch die Dresdner Kunstsammlungen zu übernehmen. (Kulturabteilung der VEB Landesdruckerei Sachsen 1955) Die Vertragsunterzeichnungen wurden feierlich begangen, um dem Bündnis Geltung zu verschaffen, und der Ereignischarakter - beispielsweise mit einer Dampferfahrt auf der Elbe - hervorgehoben. Die in den »Freundschaftsverträgen« formulierte Zielsetzung war es, »ein enges Bündnis
I 04
Schriftbänder fanden sich bei sämtlichen Kulturveranstaltungen: in den Eingangsbereichen der Ausstellungsgebäude, an Wänden hinter Rednerpulten bei Künstlerkongressen oder an Außenfassaden der Theater- und Konzertgebäude. 105 Indes wurden 1959 drei, aufTafeln zum Verkaufangebotene volkstümliche Sprüche als nicht zeitgemäß empfunden: »Arbeite langsam und gediegen, was nicht fertig wird bleibt liegen«, »Früh auf spät nieder friß schnell schufte wieder« und »Halte stets die Ruhe heilig Nur Verrückte habens eilig.« Solche Sprüche seien nicht dazu angetan, die Arbeitsproduktivität zu steigern. »Unserer Ansicht nach ist das glatte Feindarbeit.« (Abteilung fiir Kultur 1959) 106 Anfang Oktober 1948 wurde die erste Auftragskommission gegründet und auf dem »Sozialistischen Kulturtag Sachsen« als deren Aufgabe festgelegt, Patenschaften bildender Künstler mit volkseigenen Betrieben vorzubereiten. (Schönfeld 1999: 73) Eine verwandte Form waren zwischen Künstlerkollektiven und Schulen vereinbarte »Patenschaftsverträge«.
208
KOLLEKTIVIERUNG
zwischen der Arbeiter- und Bauemsehaft und der künstlerischen Intelligenz zu erstreben«. (Freundschaftsvertrag 1951) Beide Seiten sollten im ständigen Gedankenaustausch stehen und ihre gegenseitige Verbundenheit immer auch öffentlich zum Ausdruck bringen. Weitere Regelungen in den Verträgen betrafen die künstlerische Ausgestaltung der Betriebsfeste und Kantinen sowie die jährliche Ausrichtung der zentralen Kundgebungen anlässlich der beiden Festtage der Werktätigen, dem 1. Mai und dem Erntefest. Außerdem verpflichteten sich die Künstler, Diskussionsveranstaltungen zu leiten, Vorträge über ihre Arbeitsweise zu halten, Führungen zu übernehmen und sich für ihren Freundschaftsbetrieb bei Kulturwettbewerben zu engagieren. Ausgeglichen wurde die kulturelle Betreuung durch eine finanzielle Unterstützung in Fonn von Werkankäufen: zur Ausstattung der betrieblichen Gemeinschaftsräume oder als jährliche Weihnachtsgaben. Hinzu kamen Studienaufenthalte in den Freundschaftsbetrieben, um den Künstlern die Arbeitsmethoden in den Betrieben nahe zu bringen. 107 Bei diesen, meist mehrtägigen Aufenthalten, stellten die Betriebe Übernachtungsmöglichkeiten bereit und übernahmen die Verpflegung vor Ort. 10~ (Freundschaftsvertrag 1951) Diese Form geregelter Beziehungen wurde in den 70er Jahren auf übergeordnete Organisationsebenen ausgeweitet, und »Popularisierung« konkretisiert als »Durchsetzung der Grundsätze der kulturellen Lebensregeln der Arbeiterklasse«. (Freundschaftsvereinbarung 1971: 431) Im Unterschied zu den früheren Bestimmungen wurden keine konkreten Handlungsanweisungen gegeben und nur mehr die Treffen an sich festgeschrieben. Diese sollten regelmäßig erfolgen, um den ständigen Austausch zu unterstützen und die Beziehungen zu intensivieren. Beide Seiten waren aufgefordert, einen langfristigen Plan zu entwerfen und einen eigenständigen Beitrag zu leisten. Die Motivation für die inhaltlich frei bleibenden Vereinbarungen gründete auf der kaum mehr vertraglich regelbaren gesellschaftlichen Komplexitätssteigerung. Weshalb die ursprünglich als »Vertrag« bezeichneten Regelungen des Austauschs in »Vereinbarung« umberrannt wurden und die Beziehungen »entsprechend den gewachsenen Anforderungen durch Rationalisierung, Automatisie-
I 07 Ein ähnliches Prinzip verfolgte der VBKD mit den »Offenen Ateliers«. Hierbei wurden die Künstler aufgefordert, ihre Atelierräume an bestimmten Tagen offen zu halten und die Werktätigen angewiesen, vor Ort zu diskutieren tmd Bewertungen abzugeben. Die Resonanz wurde dann von den Kulturleitern der Betriebe und Gewerkschaften an den VBKD weitergeleitet. (VBKD, Arbeitsgebiet Dresden 1953) 108 Außerdem nahm ein Vertreter des »Freundschaftsbetriebs« bei Ausstellungen der Künstler in der Jury mit beratender Stimme teil.
209
KOLLEKTIVIERUNG DER PHANTASIE?
rung, Umweltfragen und neue Produktionsstätten« selbsttätig geregelt werden sollten. (Freundschaftsvereinbarung 1971: 431 ff.) Einen bedeutenden Stellenwert im Zusammenhang mit der Popularisierung der Kunst erhielten die turnusmäßig veranstalteten zentralen Präsentationsschauen, die »Zentralen Kunstausstellungen« in Dresden, wo Werktätige in die höchst sensiblen Juryentscheidungen fiir die Auswahl der Bildwerke eingebunden und insbesondere massiv zum Besuch der »III. Deutschen Kunstausstellung 1953« mobilisiert wurden. Zur Vorbereitung dieses Ereignisses gaben Künstler Sonderlehrgänge an Volkshochschulen (Däbritz 1953b: 7), hielten Vorträge über Kunst und wiesen auf die Bedeutung der Ausstellung bei Diskussionsabenden in Betrieben, LPGs und Maschinen-Traktoren-Stationen hin. (Abteilung Kunst und Kulturelle Massenarbeit [1953]) In den Großbetrieben wurden »ArbeiterDelegationen« fiir den exemplarischen und pressewirksamen Ausstellungsbesuch gebildet und die Betriebe angewiesen, die »besten Vertreter« zur Ausstellung zu entsenden (Aufruf 1953): »[ ... ] und zwar möglichst mit dem bestimmten Auftrag, ein Bild für den Betrieb zum Kauf auszusuchen, über das bald anschließend eine größere Anzahl Kollegen aus dem Betrieb diskutieren.« (Däbritz 1953a: 6) In Lichtspielhäusern zeigte man Kurzfilme über Kunst und verpflichtete die Betreiber, für den Ausstellungsbesuch zu werben. Desgleichen sollten Landfilmvorführer erreichen, dass Betriebe und Produktionsgenossenschaften Geld zum Ankauf von Kunstwerken bereitstellten. 109 (Abteilung Kunst und kulturelle Massenarbeit [1953]) Zusätzlich wurden als solche benannte Bevölkerungsgruppen angesprochen: »Natürlich ist die Beteiligung der technischen Intelligenz sowie der Frauen zu beachten. Ebenso, wie die Kreisleitungen der Freien Deutschen Jugend ihre Gruppen in den Dörfern und Städten ftir den Besuch mobilisierten, sollten sich auch Hausgemeinschaften zusammenschließen um über die 3. Deutsche Kunstausstellung in Ausspracheabenden zu diskutieren.« (Däbritz 1953a: 5f.)
Um möglichst vielen Besuchern den Ausstellungsbesuch praktisch zu ermöglichen, stellte man für auswärtige Besuchergruppen Sonderzüge bereit; es wurden verbilligte Fahrten mit Omnibussen angeboten und Lastwagen von den Großbetrieben eingefordert, um mit diesen den Be-
109
Sämtliche Kulturbetriebe erhielten die Order, geschlossen die zentrale Ausstellung zu besuchen. In den Foyers der Theater und Konzerthäuser wurden Kunstausstellungen ausgerichtet, in den Bibliotheken Buchausstellungen zum Thema.
210
KOLLEKTIVIERUNG
such von mehreren hundert Werktätigen zu organisieren. 110 Der Kunst wurde selbst heilende Wirkung zugesprochen: »Rücksprache mit Dr. W ohlrabe, Gesundheitswesen, erforderlich, um evtl. den Besuch der 3. DKA durch die Rekonvaleszenten der Krankenhäuser zu ermöglichen.«111 (Vorbereitungsmaßnahmen [1953]) Mit dem Ergebnis der massenwirksamen Mobilisierung, 65 Prozent der Besucher waren Arbeiter und »werktätige Bauern«, gaben sich die Verantwortlichen allerdings bei weitem nicht zufrieden.112 Im Abschlussbericht zur Ausstellung wurde vor allem der geringe Zuspruch aus den Großbetrieben kritisiert und dieser mit dem »Versagen der Verantwortlichen der Betriebe« begründet. (Däbritz 1953b: 6ff.)
Die Grenzen der Massenwirksamkeit von Kunst Ziel der inszenierten, teils ereignisbezogenen, teils vereinbarten und teils ständigen, sozialen Tauschbeziehungen in der Anfangsphase der DDR war es, Vorstellungen durch Rituale in alltäglichen Handlungsmustern zu verfestigen. Gesellschaft konstituiert sich, so legt Georg Simmel dar, gerade erst durch die soziale Wechselwirkung des Tauschs, weshalb der Gabe eine der stärksten sozialen Funktionen zukomme, und Dankbarkeit durch das Folgeprinzip der Wohltat, den Motor für diese Art von Tauschbeziehung darstelle. Soziale Beziehungen geraten so, in der Folge des Tauschs, zu einer Beziehung der Gegenstände. (Simmel 1999: 662) Durch das staatlich inszenierte Wechselspiel sollten der Arbeiter zum Künstler und der Künstler zum Arbeiter werden. Wie Marcel Mauss zeigt, wirkt das Wechselspiel des Geben und Nehmen sozial egalisierend, da in einer Tauschbeziehung immer mehr gegeben als genommen wird. (Mauss 1968: 162) Äquivalent dazu werden die Kunstgaben im Vermittlungsprogramm der »wissenschaftlichen Popularisierung« zu austauschbaren Waren, weshalb sich der Werkleiter eines »Freundschaftsbetriebes« schriftlich veranlasst sah, ein leihweise von Künstlern zur Verfügung gestelltes Bild im Speiseraum durch ein anderes ersetzen zu lassen: »Unsere Kollegen wollen gern einmal etwas anderes sehen, wenn möglich ein Industriebild.« (Kulturleitung der VEB Landesdmckerei Sachsen 1955) 110 Allein im Gebiet um Dresden waren 10 Sonderzüge eingesetzt, mit denen jeweils bis zu 1100 Personen befördert wurden. (Däbritz 1953b: 7) 111 Andere Gruppenbildungen betrafen Kindergärtnerinnen sowie Pionierleiter in Begleitung der Elternbeiräte. 112 Die III. Kunstausstellung sahen 184.836 Besucher, das waren durchschnittlich 1.600 Personen pro Tag mit Spitzenwerten bis zu 6.000. Außerdem konnten über 500 Besuchergruppen mit je bis zu 50 Teilnehmern gebildet werden. (Däbritz 1953b: 8)
211
KOLLEKTIVIERUNG DER PHANTASIE?
In der Phase der staatlichen Konstituierung der DDR kam dem Artefakt Kunst als Trägennedium die Rolle zu, soziale Identität herzustellen. Kunstwerke sollten Emotionen transportieren und damit unbewusst den idealisierten Vorstellungen gesellschaftstragende Geltung verschaffen. Die Absicht, alltagsweltlich erzeugte Bewusstseinslagen einzufangen und diese mit außeralltäglich wirkender Ästhetisierung zu verbinden, konnte allerdings nicht im gewünschten Umfang umgesetzt werden. Eingebunden in eine soziale Wechselbeziehung, lässt das Artefakt die Grenzen seiner sozialen Einbindbarkeit hervortreten. Veralltäglichung von Kunst und Außeralltäglichung durch Kunst bleiben stets widerspenstig. Ebenso wie die unterschiedlichen Bedürfnisse und Erkenntnisse trotz Austauschprogramm und künstlerischen Darstellungsanweisungen nicht in Einklang gebracht und die Reaktionen dieser Konstruktion nicht abgeschätzt werden konnten. Realiter lief das Bündnis zwischen Werktätigen und Künstlern nur schleppend an und verlor nach wenigen Jahren auf beiden Seiten an Attraktivität. Bereits im Frühjahr 1952 wies das Dezernat für Volksbildung die Kulturleiter von insgesamt 25 Betrieben schriftlich auf die angesetzten Kunstdiskussionen und Kunstführungen hin und forderte mit Nachdruck, dass von jedem der nochmals mündlich erinnerten Betriebe mindestens 30 Werktätige an diesen Veranstaltungen teilnehmen sollten. (Künstler wollen Freundschaftsverträge 1952: 12) Das korrektive Eingreifen von staatlicher Seite führte dazu, dass Gegenstände aus dem Tausch ausgeschlossen und soziale Beziehungen unterbrochen wurden. 113 So vereinbarte die Künstlergruppe Das Ufer einen Kunstkalender als Geschenk für ihren Freundschaftsbetrieb zu gestalten, den dieser im Gegenzug kostenlos herstellen sollte. In Übereinstimmung mit den politischen Vorgaben wählten die Mitglieder der Künstlergruppe selbsttätig u.a. die Bildmotive Aufbau, Aktivist, Arbeitsmotiv und Pioniereinsatz aus (Das Ufer 1952) und diskutierten die fertig gestellten Bilder mit den Werktätigen im Betrieb. Schließlich wurde über jede Arbeit abgestimmt''\ die Abstimmungsergebnisse statistisch ausgewertet und an die Kommission für Kunstangelegenheiten weitergeleitet. Da der in den Entscheidungsprozess eingebundene Kunstsachverständige die Auswahl jedoch verwarf, sah sich die Betriebsleitung veranlasst, »auf keinen Fall die HerDie zu vermittelnden Gehalte werden durch die verbundene Absicht ihres eigentlichen Sinnes beraubt und geraten selbst zum Ausdruck der Verdinglichung, gegen deren Wirkung sie sich richtet. (Kracauer 1971: llOf.) 114 Von den 12 vorgelegten Bildwerken befürworteten die Werktätigen ftinf uneingeschränkt, die geringste Bewertung lag bei 80 Prozent erhaltener »Ja-Stimmen«. (Das Ufer [1952]: 2) 113
212
KOLLEKTIVIERUNG
ausgabe dieses innerbetrieblichen Kalenders weiterzubetreiben.« (Das Ufer [1952]: 2) Mit Popularisierung, so die übergeordnete Schlussfolgerung, geht immer auch eine Veralltäglichung einher, die gespeist wird durch Ausblendung und Reduktion. Ästhetischer Ausdruck bedeutet indes maximale Distanznahme von Erfahrungswerten, um das Artefakt nicht zu einem bloßen Dokument geraten zu lassen. Wie dies der, einem Arbeiter zugeschriebene1 15 Vorschlag bildhaft werden lässt, Walter Ulbricht bei einer Rede darzustellen:»[ ... ] Prof. Gute [verlas] den Brief eines Arbeiters, der den Künstlern die Anregung gibt, ein Bild über die Rede von Walter VIbricht auf der JI. Parteikonferenz, als er den Aufbau des Sozialismus verkündete, zu schaffen.« (Gute 1952b: 10) Die Führungselite übernahm die Kulturalisierung des Massenpublikums und entwickelte eine Bildprogrammatik, die dem vorgestellten Ideal der Massen entsprechen sollte, weshalb überwiegend außerkünstlerische Kriterien angestellt wurden: »Zwei Bilder hätten beinahe ausgestellt werden können, wenn der Künstler nicht ganz vergessen hätte, Hände zu malen: er gab statt dessen seinem Modell Gummi-Handschuhe, und das konnte doch wohl nicht ernst gemeint sein.« (Rudloff-Hille 1951) Eine den populärwissenschaftlichen Maximen in den Schlussfolgerungen entgegenstehende Überlegung von Leo Trotzki lässt die Schwierigkeit der Popularisierungsbestrebung an ihrer Nahtstelle hervortreten. Trotzki entwickelt einen gesellschaftlichen Transformationsprozess, den er als »Kulturismus« bezeichnet. Zunächst müsse, in der Übergangsphase zur klassenlosen Gesellschaft, unterschieden werden zwischen dem kulturellen und dem politischen Bereich (Trotzki 1991: 27f., 9f.). Da es keine Vorwärtsbewegung ohne Rückschau auf die wichtigsten Grenzpfähle der Vergangenheit gebe und sich der gesellschaftliche Umgestaltungsprozess in der Phase des Übergangs zu vielgestaltig gestalte, könne auf Stilpluralität nicht verzichtet werden. (Ibid.: 17) Konträr zur populärwissenschaftlichen Position sieht Trotzki - abstrakt gesprochen - die Kluft zwischen Artefakt und Gesellschaft als unüberwindbar an, da die »Methoden des Marxismus [... ] nicht Methoden der Kunst« seien (ibid.: 9). Andernfalls werde Kunst umgeformt und auf »Heimatklänge« reduziert.
115 Zugeschriebene Stellungnahmen und Aufrufe waren zu dieser Zeit ein gängiges Prinzip diskursiver Lenkung. Vgl. den zweiten Vorschlag des Arbeiters: »[...] für dieses schöne bedeutsame Thema einen Wettbewerb auszuschreiben.« Zum gleichen Thema ließ der damalige Präsident des VBKD verlautbaren: »Prof. Dähn, der selbst auf der Parteikonferenz war, hatte ebenfalls die Absicht, ein solches Bild zu gestalten und ist bereits mit der Konzeption beschäftigt.« (Gute 1952b: 10)
213
KOLLEKTIVIERUNG DER PHANTASIE?
Eine »>verschrumpelte< Kunst« sei jedoch keine Kunst und könne infolgedessen von den Werktätigen nicht gebraucht werden 116 (ibid.: 39): »Daraus wäre die allgemeine Folgemng zu ziehen, daß eine proletarische Kultur nicht nur nicht existiert, sondern auch nicht existieren wird, und man hätte wirklich keinen Gnmd, das zu bedauern: das Proletariat ergreift die Macht, um eben ein für allemal den Klassenkulturen ein Ende zu machen und einer Menschheitskultur den Weg zu bahnen. Das vergessen wir bisweilen.-« (Ibid.: 20)
Legitimationsstrategien Mit der Konstitution des Staates der DDR wurden sukzessive frei gewählte soziale Zusammenhänge durch staatlich gelenkte Tätigkeiten in Kollektiven ersetzt. Das Feld flir die Kollektivbildung im künstlerischen Bereich, mit der ein unmittelbar auf die Schaffensprozesse zielendes Instrument der Lenkung geschaffen worden war, bereitete die diskursive Vermittlung der vorgestellten sozialen Ordnungen. Diese sollten vom Leben einverleibt werden und so zum Gegenstand des Wissens geraten und nicht - nota bene - durch Anordnung erfolgen. Die vehementen diskursiven Auseinandersetzungen, in eben dieser Phase der Veränderungen, zeigen den hohen Legitimationsbedarf der vorgestellten sozialen Ordnung an, die mit strategischen Mitteln durchzusetzen versucht und mit denen immer auch Rezipienten, wie Schaffende im Blickfeld gehalten wurden. Dabei waren Diskussionen durchgängige Modi der Legitimation einer vorgestellten demokratischen Mitbestimmung, ein Konsensangebot, das jedoch konterkariert wurde. Neben den direkten Erziehungsmaßnahmen der Künstler, wie beispielsweise durch Schulung, Vorgabe von Themen und Auftragsvergaben geschehen, können indirekt strategische Einflussnahmen ausgemacht werden. Diese erfolgten vennittels initiierter Diskurse, gelenkter egodokumentarischer Schilderungen, eingeforderter Stellungnahmen und Umfragen sowie zugeschriebener Erlebnisberichte und kollektiver Verlautbarungen. Wie diese des Künstlerverbandes in Reaktion auf den Arbeiteraufstand Mitte 1953: Es hätten sich » 10 junge bildende Künstler in Berlin [... ] unter dem Eindruck der faschistischen Provokationen am 17.
116 Der Aufuau einer neuen Kultur scheitere überdies an den Konsequenzen sozialer Revolution, die immer auch Zerstötung mit sich bringe und den Klassencharakter beseitige. (Trotzki 1991: 20)
214
KOLLEKTIVIERUNG
Juni zu einem Kollektiv« zusammengeschlossen und dem VBKD eine Solidaritätserklärung übersandt. (VBKD 1953: 4) Zur Stabilisierung der gesellschaftlichen Bedingungen und zur Durchsetzung der Kollektivierung wurde das soziale Gefiige als Erinnerungsgesellschaft aufgebaut und an dieser Strategie bis zum Zusammenbruch des Staates mit modifizierten Inhalten und Referenz- resp. Abgrenzungsmustern festgehalten. Dabei begründete das Alteritätsmoment des Antifaschismus die gemeinschaftsstiftende Ausgangslage, weitere durchgängige Bestandteile sichernder Identitätsbildung bildeten historische Legitimationsbezüge. Nach einer ersten Phase der Orientierung und des punktuellen Anknüpfens an tradierte, nationale Kulturbilder folgte deren Konkretisierung als Leitlinien im Zeichen des Sozialismus und die kontinuierliche Umsetzung in den 60er Jahren. Mit dem Aufbau einer Eigengeschichte der Gesellschaft der DDR, die eng mit dem anstehenden Generationenwechsel verbunden war, konnte Anfang der 70er Jahre begonnen werden, was schließlich zu einem Prozess der Abkopplung von weiten Teilen der Künstlerschaft führte.
Zwischen Tradition und Revolution Die Leitthemen dieser Anfangszeit waren der Aufbau einer sozialistischen, global friedenssichernden Gesellschaft und die Vereinigung der seit Kriegsende geteilten beiden deutschen Staaten. Die neue Staatsordnung sollte durch die wechselseitige Bezugnahme auf einerseits traditionelle Werte, d.h. Rückgriff auf das »nationale Kulturerbe«, und auf andererseits soziale Veränderung, diese paraphrasiert als der »neue Kurs«, erreicht werden. Neben dem, den ästhetischen Ausdrucksformen zugeschriebenen überhöhenden Effekt, war beabsichtigt, eine neue, durch lmlturelle Rückbesinnung getragene, gesellschaftliche Identität zu schaffen.117 Weshalb der Kunst im Allgemeinen eine zentrale Rolle bei der Kollektivierung der Gesellschaft zugewiesen wurde. Soziale Wirksamkeit von Kunst, so die propagierte Erwartung, konnte durch Massenrezeption erreicht werden, infolgedessen die Arbeiterklasse als »Wahrerin des kulturellen Erbes« eingesetzt wurde. Kunst sollte, getragen vom »kulturellen Erbe« und mit der Methode des sozialistischen Realismus, als Darstellungsform der gewünschten Wirklichkeit, zur »unsterblichen Weltkunst« (Döderlin 1953: 33) geraten: »Die wahr117 Die Aufgabe einer »fortschrittlichen Kunst«, so formuliert Ministerpräsident Grotewohl an prominenter Stelle, bestünde in der Aufnahme des »nationalen Kulturerbes«. (Grotewohl1953: 2)
215
KOLLEKTIVIERUNG DER PHANTASIE?
haftgroße Kunst der Vergangenheit nimmt am Kampf[ ... ] auf der Seite [... ] des Fortschritts teil, und darin liegt gerade das Unterpfand für ihre wirkliche Unsterblichkeit.« (Ibid.: 43) Die aus der deutschen Klassik entlehnten Figuren der Erinnerung versprachen Orientierung und stellten die Basis für die Übernahme neuer Vorstellungs- und Handlungsmuster dar. 118 Gleichsam besetzten die tradierten Muster die Leerstellen, die immer dann erscheinen, wenn Brüche im Leben und dadurch Unterschiede gewahr werden. 119 Die Aufnahme des »kulturellen Erbes« bereitete eine kollektive Gedächtnisgrundlage und legitimierte die beabsichtigten sozialen Veränderungen. Insofern erreichte das ideologische Programm, das inhaltlich und methodisch aus dem sowjetischen Bezug gespeist war, dessen Fortsetzung und ließ sich als geschlossene, national spezifische Kulturgeschichte rekonstruieren.120 Dass für die Modeme in diesem Konzept kein Platz war, bedeutete indes wesentliche kulturelle Leistungen eines ganzen Jahrhunderts auszuklammem.121 Die diskursive Initialzündung :für die Formierung der künstlerischen Produktion stellte die erste »Formalismusdebatte« 122 dar, die 1948 von dem SMAD-Kuln1rfunktionär Major Alexander Dymschitz gestartet worden war. Das künstlerische Feindbild des Fonnalismus, beschrieben 118 Die deutsche Klassik sei geeigneter, die Trennung von geistiger Elite und Konsumenten der Trivialkultur aufzuheben, als die bürgerliche Modeme, wegen des weltanschaulichen Extrakts des aufsteigenden Bürgertums. (Erbe 1988: 660) Gegen die Klassik konnte sich niemand stellen, da erst alles Nachklassische zum Nationalsozialismus geführt habe. (Schütrumpf 1997: 196ff.) 119 In den Anfangsjahren häuften sich die Gedenkfeiern, beispielsweise 1949 das »Goethe-Jahr« und 1950 das »Bach-Jahr«. Im Jahr des institutionellen Umbruchs 1953 wurden Alexander von Humboldt und Richard Wagner als Referenzen angeführt. »Nicht die kritische Aneignung kultureller Traditionen war in diesem Erbekonzept vorgesehen, sondern die Identifikation mit dem Geist einer als vorbildlich deklarierten vergangenen Epoche.« (Erbe 1988: 659) 120 Die besten Errungenschaften der Klassiker sollen zum Gemeingut der Volksmassen und das Kulturerbe zu einerneuen nationalen Kunst generiert werden. (Nedoschiwin 1953a: 42) 121 Die »Tendenzkunst«, so eine weitere Titulierung westlicher Kunstformen, äußere sich in den Stilformen der Ismen, wie Impressionismus, Expressionismus und Surrealismus. 122 Vgl. Dymschitz in der »Täglichen Rundschau« vom 21. März und vom 24. November 1948 mit den Beiträgen »Warum wir gegen Dekadenz sind« und »Über die formalistische Richtung in der deutschen Malerei«. (Dymschitz 1948a: 2) Diese Begriffe waren seit den dreißiger Jahren als zentrale Merkmale des sozialistischen Realismus vorgestellt worden. (Thomas 1980: 13ff.)
216
KOLLEKTIVIERUNG
als »dekadente Spielart westlichen Neuerertums ohne ideellen Gehalt«, gewann diskursiv rasch an sozialer Dimension und erschien als »krank«, >mnlebendig« und »einsam« (Dymschitz 1948b: 2). 123 Metaphern der Gewalt, wie »Zerstörung« und »Zersetzung«, halfen das Bild über die nicht sozialistisch-realistisch orientierten Kunstströmungen zu belegen. Hingegen die Werke des sozialistischen Realismus als »aufbauend« und »friedenssichernd« vorgestellt wurden, erschien im Verlauf der diskursiven Auseinandersetzung mit dem künstlerischen Feindbild, dessen gesellschaftliches Umfeld als »Kulturbarbarei« 124 . Im Jahr 1953 erreichte die Auseinandersetzung um die richtige Kunst ihren vorläufigen Höhepunkt, die Position trat nun unmissverständlich hervor: »Der Fonnalismus ist der Ausdruck des Kosmopolitismus in der Kunst [ ...].« 125 (Hoffmann 1953: 15) Es folgten Theorien geleitete Darlegungen, beispielsweise von KP-Sekretär Malenkow mit seinem als richtungweisend geltenden Vortrag »Über die Prinzipien der sozialistisch-realistischen Kunst«. Weitere Zeugnisse russischer Kunstgeschichte wurden durch ausgewählte Übersetzungen sukzessive erreichbar gemacht. 126 (Vgl. Nikiforow 1953) Als Parameter ftir die Umsetzung des Sozialistischen Realismus galt die Darstellung des »Typischen« 127, zu dessen Bedeutungsträger das Wesentliche, das Wirkliche, die Parteilichkeit sowie Dauerhaftigkeit und
123
124
125
126
127
Der »Fom1alismus« als abstrakter, abstrahierender und nicht im sozialistischen Sinne gegenständlicher künstlerischer Ausdruck galt zudem als »schädlich«, »dekadent« und >>Unsinnig«. Die den »Volksmassen unverständlichen Hieroglyphen« (Magritz 1953: 34) folgten der bürgerlichen Dekadenz und könnten nur durch deren Vernichtung beseitigt werden (Döderlin 1953: 29). »Sie propagierten den >Neoexpressionismus< als >Begegnung mit neuer Stilrichtung für gegenstandslose Kunstdynamischem Rhythmus< und müssen ihn schließlich selbst als >Krippelkrappel nervöser Tupfen und Gedankenstriche< kommentieren, die >an die mikroskopische Vergrößerung von Pullovern erinnertBildende Kunst< ist ein Kampforgan für den sozialistischen Realismus. Sie vertritt die Einheit und Unteilbarkeit der deutschen Kunst. Sie kämpft gegen alle kunst- und menschenfeindlichen Richtungen der Dekadenz: Formalismus, Naturalismus und Kitsch. Die Zeitschrift >Bildende Kunst< wendet sich an Künstler, Kunstwissenschaftler, Kulturpolitiker und an alle werktätigen Menschen. Sie will diesen helfen, am Aufblühen einer wahrhaft fortschrittlichen deutschen Kunst mitzuschaffen.« (Eigenanzeige 1953: I)
In diesen Printmedien, aber- je nach tagesaktueller Bedeutung - auch in Tageszeitungen, wurden die Diskurs leitenden Stellungnahmen lanciert. U.a. beschloss der Vorstand des Künstlerverbandes in Vorbereitung der »III. Deutschen Kunstausstellung 1953«, dass vier Mitglieder desselben je einen Aufsatz fiir die Tageszeitungen »Neues Deutschland«, »Tägliche Rundschau«, »Sonntag« und die Nachrichtenagentur ADN unter dem Titel »Der Künstler meldet sich zu Wort« verfassen. In diesen Beiträgen sollten die, von den Künstlern aufgeworfenen Fragen und kritischen Anmerkungen zur Kunstpolitik aufgegriffen und klarstellt werden. (Beschlüsse der Vorstandsitzung 1952) Dem gleichen Zweck dienten angeforderte kunstästhetische Beiträge: »Es wurde beschlossen, [... ] einen Artikel eines namhaften Kunstkritikers, z.B. Gimus, Rentzsch oder Besenbruch, unter dem Arbeitstitel >Kritische Bemerkungen zur 3. Deutschen Kunstausstellung< zu veröffentlichen.« (1953. Ein Jahr der grossen Aufgaben 1953: 4) Eine der großen Kunstdebatten, die über die Beziehung von Kunst und Politik zwischen den beiden Herausgebern und Chefredakteuren der »bildenden kunst«, Oskar Nerlinger und Carl Hofer, im Jahr 1948 ausgetragen wurde, war eine Inszenierung ohne Hafers Wissen, bei der Nerlinger als Sieger hervorging. 135 (Hofer; Nerlinger 1948: 20ff.) Die beiden, bereits während der Weimarer Republik, unterschiedlich agierenden Künstler vertraten hierin grundlegend differente Positionen. Nerlinger forderte, die Kunst unter die Werktätigen zu bringen, währenddessen Hofer deren Exklusivität verteidigte. Der Beweggrund für diese initiierte Debatte war, neben der Möglichkeit der plastischen, da kontrastierenden Darstellung der kunstästhetischen Programmatik, dass Carl Hofer nicht mehr als Repräsentant erwünscht war. Aus diesem Grunde wurde Anfang 1948 bei einer Bespre-
135 Nerlinger war 1951 von Westberlin in die DDR übergesiedelt. In späteren Jahren wurde die Beurteilung entschärft und Hafer als »progressiver bürgerlicher Künstler« verortet (VBK der DDR 1983: 16)
220
KOLLEKTIVIERUNG
chung im kleineren Kreis 136 zusammen mit einem Vertreter der SMA bei dem Künstler Anton Ackermann, in dieser Zeit Sekretär fur Kultur in der SED, verhandelt, dass Carl Hofer zu einem beruflichen Rücktritt bewogen werden müsse. In der Diskussionsrunde wurden in einem vorliegenden, aber noch nicht veröffentlichten Artikel von Hofer »starke Angriffe« gegenüber der SED und der SMA festgestellt und eingehend dessen Standpunkte diskutiert. Anstoß nahmen die Anwesenden insbesondere an dem Satz: »Die Politiker benutzen die Kunst als Hure.« (Protokoll der Besprechung 1948) Übereinkommend forderten die Anwesenden Oskar Nerlinger auf, »einen scharfen Gegenartikel« zu verfassen und diesen im Redaktionsbeirat der Zeitschrift zur Debatte zu stellen. Verhindert werden sollte unter allen Umständen, so die Essenz, dass lediglich der Artikel von Hofer in der Kunstzeitschrift erscheint: »Entweder erscheinen beide Artikel, oder gar keiner.« (Ibid.) Falls der Hofersehe Artikel in der vorgelegten Form zum Abdruck kommen sollte, werde SMA-Hauptmann Barski, so heißt es im Protokoll weiter, die Verbreitung der gesamten Ausgabe verhindem. 137 Die Hintergründe der »Kunst und Politik« resp. »Politik und Kunst«-Debatte blieben verdeckt, die Debatte selbst aber geriet zu einer der großen Vorzeigeauseinandersetzungen um die richtige Kunst in der DDR. Forciert diskursive Unterstützung erhielt die strukturelle Veränderung des Künstlerverbandes. Beispielsweise veröffentlichte der Vorstand des Verbandes 1952 im Mitteilungsblatt »Der Bildende Künstler« einen Statutenentwurf, der zunächst auf sämtlichen Verbandsebenen diskutiert werden sollte. Tatsächlich aber stellte der Entwurf, bis in die Wortwahl hinein, die Endfassung der Statuten dar. 138 Zudem wurden die Ergebnisse 136 Anwesend waren neben Ackermann, Nerlinger und Barski auch Kulturreferent Grabowski sowie u.a. die Künstler Max Keilson und Alice LexNerlinger. (Vgl. Protokoll der Besprechung 1948) 137 Im September 1955 begann in der »Bildenden Kunst« eine Debatte über Pablo Picasso. Die so bezeichnete »Picasso-Diskussion« dauerte nahezu ein Jahr und wurde von der Diskussion über »Realismus und Abstraktion« abgelöst. (Vgl. Feist 1956: 6; Damus 1991: 142) 138 Die Entwürfe sollten von Ende April bis Mitte Mai in den Arbeitskreisen diskutiert und dazu Stellungnahmen erarbeitet werden. Es wurden Arbeitskonferenzen, an denen jeweils einige Mitglieder der Landesvorstände teilnahmen, und anschließend Landeskonferenzen veranstaltet, in denen über die Erfahrungen in den Kreisen berichtet wurde und bei denen je zwei Mitglieder des Zentralvorstandes teilnahmen. Auf diesen Konferenzen wurden die Delegierten flir den »li. Kongreß des Verbandes« (7. bis 9. Juni 1952) gewählt sowie die Satzung und die »Entschließung über die bisherige Arbeit des Verbandes Bildender Künstler Deutschlands« verabschiedet (VBKD 1952b: 2). Beide Entwürfe wurden in der Maiausgabe des Mitteilungsblattes veröffentlicht (vgl. VBKD 1952d: 2) und als
221
KOLLEKTIVIERUNG DER PHANTASIE?
des zweiten Verbandskongresses vorab klargestellt139 und den Künstlern ihre Möglichkeiten vorgegeben: »Auf diesem Kongreß muß klar zum Ausdruck kommen, daß die bildenden Künstler ihre Aufgaben erkannt und Mittel und Wege gefunden haben, sie zu lösen. Die Aufgabe aber lautet: Für eine realistische Kunst als Waffe im Kampf um ein unabhängiges, friedliebendes, demokratisches Deutschland!« (VBKD 1952c: 1) Weitere Instrumente diskursiver Lenkung in der Anfangsphase waren kollektive Verlautbarungen und Aufrufe, wie beispielsweise durch Künstlermanifeste und Künstlerzusammenschlüsse geschehen. Diese hatten vorbildhaften Charakter und wirkten infolgedessen indirekt erzieherisch. Gemeinsam ist den diskursiven Strategien, dass der eigentliche Verfasser einer Entscheidung im Verbogenen bleiben sollte. Abstrahiert gesprochen, entzieht sich der Initiator seiner Verantwortung, er verdeckt seine eigenen Motive, indem anderen diese zugedacht und Handlungen umgeleitet werden. Die projektiv angelegte Methode wurde ebenso in späteren Jahren angewandt. Beispielsweise bei der Bewertung der Dresdner Künstlergruppe Das Ufer, deren Programm rückblickend als das »vielleicht eindeutigste ideologische Programm« bewertet wurde. Dieses habe »bereits viele Grundsätze kulturpolitischer und künstlerischschöpferischer Orientierung« enthalten, die späterhin »zu den Leitprinzipien« des Verbandes gehört hätten (VBK der DDR 1983: 16f.). 140 Die Spitze des Künstlerverbandes, die stets parteikonforme Arbeit leistete, zeigte sich stets in einer Vorkämpferrolle. Verbandsbeschlüsse wurden anheim gestellt als antizipative Vorstellungen der staatstragenden Verbandssatzung auf dem »ll. Kongreß des VBKD« bestätigt. Die Endfassung und die Diskussionsgrundlage unterscheiden sich lediglich in unbedeutenden Zusätzen, weshalb vermutet werden kann, dass die Arbeitskreis- und Landeskonferenzen der diskursiven Vermittlung der Umstrukturierung dienen sollten. Darüber hinaus diente die gegenseitige Präsenz bei den Sitzungen der unterschiedlichen Verbandsebenen, weniger der anheim gestellten Transparenz, denn der Kontrolle und Ve1mittlung im hierarchisch formierten Verband. Aufgebaut in Form eines Netzwerkes, flächendeckend auf Länder und Orte verteilt, stellte das Vorstandsgremium die Entscheidungsinstanz und das Sekretariat das durchfuhrende Organ dar. Die Basis bildeten die örtlichen Arbeitskreise; die sorbischen Mitglieder erhielten einen eigenen Arbeitskreis zugewiesen. (VBKD 1952f: 114f.) 139 Dabei wurde strengstens auf die Formulierungen geachtet: »[ ... ] die rot angekreuzten Beschlüsse sind zur Veröffentlichung im Mitteilungsblatt [... ]von der Druckerei zurückzufordern.« ([Gute] [ 1952]) 140 Obwohl die Ufer-Gruppe, wie sämtliche frei gewählte Künstlerzusammenschlüsse, peu-a-peu in die staatlichen Strukturen eingebunden wurden. Vgl. das Kapitel »Künstlergruppen im Prozess der Transformation«.
222
KOLLEKTIVIERUNG
Partei. Vorgestellt wurde, dass der Verband aus eigenem Antrieb handelte und eine unabhängige, solidarische Geschlossenheit innerhalb der Künstlerschaft bestünde. Aus den Primärquellen wird jedoch ersichtlich, dass die Führungsfunktionäre des kulturellen Bereiches in ständigem Kontakt mit der Parteispitze der SED standen, stets über deren Vorhaben instruiert waren und diese auch getreu umsetzten. So beispielsweise bei der Verlegung der »III. Deutschen Kunstausstellung« von Herbst 1952 auf März 1953. Diese war im »Namen der Künstlerschaft« begründet worden, wiewohl sich die Entscheidung über die Verlegung aus den Notwendigkeiten der institutionellen Umstrukturierung ergab: »Wie ernst es unseren Künstlern ist, zeigt die Tatsache, daß der allgemeine Wunsch geäußert wurde, ihnen mehr Zeit fur die Vorbereitung der IIJ. Deutschen Kunstausstellung in Dresden zu geben.« (VBKD 1952g: 27) Ein anderes Beispiel fur eine forciert kollektive Verlautbarung ist die Künstlerschrift »Manifest an die deutsche Künstlerschaft«, die am dritten Tag des »li. Kongresses der Deutschen Bildenden Künstler« 1952 in Berlin verfasst 141 und auf der Titelseite des Mitteilungsblatts abgedruckt worden war. Gemäß der damaligen Forderung nach Vereinigung der beiden deutschen Staaten ist der Aufruf an die Künstler »in allen Teilen Deutschlands« gerichtet. Hierin wird die Politik des Westens als kriegshetzerisch bezeichnet und dagegen die zeitkonfonnen Topoi »Frieden« und »Heimat der Kunst« gesetzt. Begründet wird der manifestierte Zusammenschluss mit der gemeinsamen »humanistischen Tradition« 142 : »Die hohen Ideale des Humanismus und die Liebe zum Volke und zum Leben, die die großen Künstler der Vergangenheit erfullten, beseelen auch uns in unserem Schaffen.« (Manifest 1952) Künstler, so im Aufruf weiter, seien nunmehr keine Außenseiter, sondern »Rufer zur Aktion« und könnten sich deshalb ihrer gesellschaftlichen Verantwortung nicht entziehen. In der Schlusspassage des Manifests wird in lyrischer Form pointiert dargelegt: »Hier unsere Hand! Schlagt ein und kämpft mit uns! Für die Blüte der unteilbaren deutschen Kunst! Für das unteilbare deutsche Vaterland! Für den Frieden und das Glück der Menschheit!!« (Ibid.)
141
Kollektive Verlautbamngen finden sich auch bei anderen Verbänden wieder, wie beispielsweise während des kurz zuvor stattgefundenen Kongresses der Schriftsteller. 142 Als künstlerische Vorbilder werden Grünewald, Riemenschneider, Dürer, Holbein, Menzel und Liebermann sowie Käthe Kollwitz genannt.
223
KOLLEKTIVIERUNG DER PHANTASIE?
Zur gleichen Zeit wurde eine weitere Verlautbarung von Verbandsseite ausgegeben. Diese gab vor, dass sich Künstler aus Ost und West beispielhaft zusammengeschlossen hätten, um sich dem gesellschaftlichen Aufbau Verdienst zu machen und :fiir die 2. Parteikonferenz der SED 143 Kunstwerke anzufertigen: »Bildende Künstler aus allen Teilen der Deutschen Demokratischen Republik, darunter auch Parteilose, Maler, Graphiker, Bildhauer haben den Wunsch geäußert, zu Ehren der II. Parteikonferenz der SED, [... ] Kunstwerke zu schaffen und der Konferenz zu widmen, die dem Kampf des deutschen Volkes um einen Friedensvertrag, die nationale Einheit und Unabhängigkeit unseres Vaterlandes, dem wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Aufbau und der Verteidigung unserer demokratischen Errungenschaften dienen.« (ZK der SED, Kulturabteilung 1952: 9) 144 Weitere, die ideologischen Vorstellungen bestätigende Egodokumente waren Erlebnisberichte, auch zugeschriebene sind darunter zu finden, und eingeforderte persönliche Stellungnahmen. Letztere meist als Beantwortung von Fragen oder in Fonn von Umfragen und Bewertungen aus vorgelegten Besucherbüchern bei Ausstellungen. Einige Artikel, Berichte und Stellungnahmen- und diese vor allem 1952, im Zeitraum des Höhepunktes der Popularisierungsbestrebungen - können unschwer als zugeschriebene, fiktive Geschichten angenommen werden. So beispielsweise der, in der »Bildenden Kunst« erschienene Essay mit dem Titel »Westdeutsche Künstler-Delegation in Dresden. Bericht eines Teilnehmers« (vgl. Westdeutsche Künstler-Delegation in Dresden 1952). Anlass :fiir das in Tagebuchform verfasste, ideologisch konforme Statement eines »westdeutschen Delegierten«, der von der »halt-, glaubens- und zukunftslosen Jugend« im Westen berichtet, war die Ausstellung »Künstler schaffen :fiir den Frieden«, die auch von westdeutschen Künstlern beschickt worden war. Andere Formen der erzieherischen Beeinflussung durch Identifikations- und Rückkoppelungseffekte stellten Erlebnisberichte und Selbstbeschreibungen in Form von Lehrbeispielen dar. Ein Stimmungsbild liefert 143 Die 2. Parteikonferenz, bei der beschlossen wurde, den Sozialismus in der DDR planmäßig aufzubauen (SED 1952: 58), war im Februar einbetufen und vom 9. bis 12. Juli 1952 in Berlin ausgerichtet worden. 144 »Die Künstler verpflichteten sich auf dem II. Kongress des Verbandes Bildender Künstler Deutschlands gegenüber den Werktätigen, Kunstwerke zu schaffen, die das Leben, den Kampf unseres Volkes und seine Liebe zur Heimat wahrheitsgetreu widerspiegeln und zur Erziehung der Werktätigen beitragen.« (Hoffmann 1953: 12f.)
224
KOLLEKTIVIERUNG
die Schilderung der Künstlerin und Funktionärin Lea Gnmdig, zu dieser Zeit Professorin an der Hochschule für bildende Künste Dresden und spätere Präsidentin des Künstlerverbandes, über ihre Besucherführung von Angehörigen einer LPG: »Das waren Bauern, die zum ersten Male in ihrem Leben eine Kunstausstellung besichtigten. Sie fingen an die Bilder zu betrachten. Zuerst äußerten sie sich sehr zaghaft. Dann kamen sie zu den Bildern, die ihre Probleme stellen [... ]. Da gingen sie aus sich heraus.« (Grundig, Lea 1953: 30) Auf den Einwand eines kleinen älteren Herren, dass die Ausstellung 30 Jahre zu früh veranstaltet werde, denn erst dann könne man beurteilen, ob man Bilder eines Giorgone oder Tizian betrachte, hätten sich die Besucher heftig gewehrt und ohne zu wissen, wer diese Künstler seien, rundheraus erklärt, dass man ihnen diese Ausstellung nicht nehmen dürfe. (Ibid.) Den Kunstgeschmack der Massen, der für die soziale Wirksamkeit von Interesse war, sondierte man mit schriftlichen Befragungen 145 und Stellungnahmen in Besucherbüchern. Mit den Bewertungen konnte kontrolliert werden, inwieweit die ideologischen Vorgaben aufgenommen wurden und wo sich Schwachstellen ergaben, die weitere Aufklärungsarbeit oder Kunstlenkung erforderten: »Zweck der Tagung war, festzustellen, welche besonderen Wünsche die Organisationen und Verwaltungen hinsichtlich der Reproduktion von Bildern (für den Wandschmuck), Bildmappen und Kunstpostkarten haben, aber auch welche Größen, Mengen usw. von ihnen benötigt werden.« (Dähnhardt 1953: 9) Diese Kunst bewertenden Stellungnahmen wurden nach eindeutigen Kriterien ausgewählt und bevorzugt an prominenten Stellen veröffentlicht oder in Redebeiträge eingeflochten. Die Stellungnahmen hatten meist appellativen Charakter. Sie dienten der Bestätigung und wirkten als Aufrufe zur Selbstdisziplinierung. Mit den Statements der Besucher in den Besucherbüchern der Ausstellungen, konnten sowohl die Rezeption der Bildproduktion kontrolliert, als auch auf eine reichhaltige Zitatensammlung zurückgegriffen werden, bei deren Veröffentlichung auf unterschiedliche Vorstellungen, als auch auf Personengruppen geachtet 145 Bereits bei der ersten DKA von 1946 wurden Fragebogen von der Ausstellungsleitung verteilt und in der Zeitschrift »Der Aufbau« im Jahr 1946 ausgewertet Die Umfrage zur III. DKA, bei der die Teilnehmer um die Angaben von Name, Beruf, Geburtsjahr und Anschrift gebeten wurden, bestand aus vier Fragen, mit jeweils sieben Leerzeilen ftir Antwortmöglichkeiten. Gefragt wurde, welche Werke sich die Besucher selbst als farbige Kunstblätter für das persönliche Ambiente, für ihren Betrieb oder für Museen aussuchen würden und welche Werke am besten dem Sozialistischen Realismus entsprächen. Begründet wurde die Umfrage mit der Hilfestellung fiir die Künstler und fiir kommende Ausstellungen. (Vgl. Besucherumfrage [1953])
225
KOLLEKTIVIERUNG DER PHANTASIE?
wurde. Hauptsächlich jedoch wurden Statements ausgewählt, die die kunstprogrammatischen Vorstellungen verbal verdeutlichen. Dabei ergaben sich manche ernst gemeinte Köstlichkeiten. So schrieb der Schriftsteller Ludwig Renn 146 in das Gästebuch der dritten zentralen Kunstausstellung: »Dass diese Kunstausstellung so besucht wird, wie früher Blumen- und Hundeausstellungen, finde ich sehr erfreulich. Ein solches lebendiges Interesse für Dinge unserer Kulturentwicklung hatte ich bis heute nur in der SU gesehen.« (Vgl. Däbritz 1953: 2)
Der Wahrheitsdiskurs Um das neue Gesellschaftsbild als realisiert erscheinen zu lassen und insofern den Herrschaftsanspruch zu begründen, wurde in der Phase der staatlichen Konstitution der DDR auf das kulturelle und stets diskursiv gesetzte Konstrukt des Wahrheitsanspruchs zurückgegriffen. Kennzeichen für diesen Diskusmechanismus ist nicht die Suche nach Wahrheit oder die Diskussion über diese, sondern der Diskurs der Wahrheit als Diskurs. Eingebettet in die Diskursgesellschaft der DDR tritt der Wahrheitsdiskurs hier als Zustandserklärung auf. Der Kunst kam die Rolle der bildhaften Vermittlerirr zu, sie wurde als Wegbereiterin der Erkenntnis gesellschaftlicher Wahrheit gesehen, um mit ihr - und im Besonderen mit der Kunstform des Sozialistischen Realismus - den gesellschaftlichsozialen Anspruch mit dem wirklichen Leben in Einklang zu bringen. Diskurse sind immer auch mit Machtansprüchen verbunden, die eigene Position wird dargelegt und verteidigt. Insofern stellt die Bezugnahme auf die Wahrheit eine der stärksten Begründungen dar, als sie selbst nur diskursiv vermittelt werden kann und stets argumentativ ausschließenden Charakter, 147 in Form dualistisch veranschaulichter Weltbildentwürfe, annimmt. Weiterhin zeichnen sich Wahrheitspostulate durch ihre Universalistische Art, ihre Dauerhaftigkeit und ihren missionarischen Charakter aus. Dabei wird die Darstellung der Wahrheit stets als unhinterfragbare Referenz mitgedacht und ihr somit der Charakter einer Letztbegründung beigemessen. Friedrich H. Tenbruck macht drei epochale Typen der Vermittlung von Wahrheitsansprüchen aus, die er durch das Christentum, die Wissen-
146 Recte Amold Friedrich Vieth von Golßenau (1889-1979). 147 Der Anspruch auf Wahrheit wird immer auch mit dem Anspruch nach Ausschließlichkeit verbunden und gegen Unechtheit und Unrichtigkeit gesetzt. (Vgl. Heidegger 1985: 9)
226
KOLLEKTIVIERUNG
schaft und den Kommunismus verkörpert sieht. Diese unterscheiden sich in der inhaltlichen und methodischen Handhabung: So setzt das Christentum den subjektiv geprägten, persönlichen Besitz und den Glauben an die Wahrheit in den Vordergrund ihrer Mission. Die Wahrheitssuche in der Wissenschaft zeichnet sich durch den Anspruch eines genauen mit letzter Gewissheit begründbarem Wissen für alle aus; es werden Ordnungen mittels der Vernunft geschaffen und eine gewisse Rücksichtslosigkeit gegenüber Vorgängern artikuliert. Der Kommunismus stellt über den Wahrheitsanspruch die soziale Reorganisation in den Vordergrund im Kampf um Geltungsansprüche; die alte Ordnung wird gegen die neue Ordnung gesetzt und die Aufhebung der Klassenherrschaft als entscheidendes Heilsgeschehen propagiert. (Tenbruck 1989: 93 ff. , 109) In der Anfangsphase der DDR war die sprachliche und handlungsanweisende Vermittlung der gewünschten Gesellschaftsform zentraler Mechanismus der Herrschaftsausübung. Daneben sollte in dieser Phase der staatlichen Konstitution mit dem Wahrheitsdiskurs ein kollektiver Wertkonsens hergestellt werden. 148 Der Kunst kam dabei die Rolle der bildhaften Vermittlung zu. Jede »echte realistische Kunst«, so die Argumentation, müsse die Wahrheit aussprechen, die im Westen gefürchtet werde (Grundig, Lea 1953: 29). Um den Anspruch zu bekräftigen, wurden Schwachstellen in der künstlerischen Darstellung wiederholt problematisiert und den Künstlern Hilfestellungen gegeben in Form von Exempeln und erklärenden Stellungnahmen. Als diskursive Gegensatzpaare dienten die Topoi »wirklich« und »barbarisch« 149 , die über die Kunstanschauungen des Realismus, in Abgrenzung zur Abstraktion objektiviert wurden. Denn, - so die aus anderen Bereichen übernommene Argumentation - aus Barbarei könne niemals eine wahre Kunst entstehen. (Gratewohl 1953: 5) »Ich bin der Ansicht, daß die Wahrheit der beste Freund der realistischen Kunst ist und sie ist auch der erste Feind des Fonnalismus.« (Dähn 1952: 9) Beabsichtigt waren der Gesellschaft als Besitzerin der »wahren Kunst« einen höchst zu erreichenden Zustand zuzusprechen und ihre Einzigartigkeit durch den universellen Geltungsanspruch aufzuzeigen. Zwei Auslegungen spielten dabei eine Rolle: die Erfüllung der Zukunft, die Seelenheil beschwört und die Vorstellung der Wirklichkeit, die das Leben erscheinen lässt. Wahrheit verspreche, so die stereotype Auslegung, >>Unvergängliche Werte« und »wirkliche Unsterblichkeit«: »Die 148 Im Kampfuniversalistischer Ideen gehe es um die Tauglichkeit der Ideen zur Fundierung eines gesellschaftlichen Konsensus in einer öffentlichen Wahrheit. (Tenbruck 1989: 118f.) 149 Im Christentum fungieren als Gegensatzpaare gut und böse; in der Wissenschaft beweisbar und spekulativ.
227
KOLLEKTIVIERUNG DER PHANTASIE?
wahrhaft große Kunst der Vergangenheit nimmt am Kampf unserer Zeit auf der Seite der Kräfte des Fortschritts teil, und darin liegt gerade das Unterpfand für ihre wirkliche Unsterblichkeit.« (Nedoschiwin 1953a: 43) Als Maxime galt das authentische Leben: So war den Künstlern die Aufgabe zugetan, die konkret-historische Wirklichkeit in ihrer ganzen Fülle zu erfassen und die Wirklichkeit im Bewusstsein der Menschen widerzuspiegeln (vgl. Mausfeld 1953: 21). Die Kunst als das »Lehrbuch der Wahrheit des Lebens« (Magritz 1953: 39) sollte ihre privilegierte Position als bildhaft gewordene Idee dem Leben vorstellen. Die Wahrheit, so wird resümiert, drücke den höchsten Wert sozialer Ordnung aus und biete soziale Orientierung. 150 Gerade die Arbeiterklasse sei daran interessiert, dass das »Leben so umfassend und wahrheitsgetreu wie möglich« gezeigt werde (Nedoschiwin 1953a: 43). Mit der Gleichsetzung des künstlerischen Ausdrucks und der lebensweltlichen Zustandsbeschreibung wollte man eine Handlungsanweisung zur lebensweltlichen Gestaltung vorbereiten: »In tief realistischen Kunstwerken [... ] verbindet sich der Ideengehalt mit der Lebenswahrheit der Darstellung.« (Ders. 1953b: 44) Der Wahrheitsdiskurs in der Anfangsphase der DDR diente der Legitimation des Herrschaftsanspruchs. Um aber eine uneingeschränkte Machtposition generieren zu können, musste der Staat alle Geheimnisse auflösen. Gruppenbildung innerhalb eines zielorientierten Systems, so die Befürchtung, steigern das Wissen, schaffen neue Handlungsformen und nähren Verschwörungen, weshalb auch bevorzugt Offenlegungsdiskurse zur Kontrolle durch Ungewissheit initiiert wurden. Methodisch wurde der Wahrheitsanspruch deutlich gemacht, durch die Übereinstimmung des in der Aussage Gemeinten mit der Sache: Es sollte suggeriert werden, dass Wahrheit gleich dem Leben sei und Kunst deshalb zur Wirklichkeit werde. 151 Die Formel »Kunst ist Leben« geriet denn auch zum zentralen Bereich der politischen Einflussnahme im künstlerischen Bereich - diese Verschmelzung sollte sich jedoch nur in der Darstellung und nicht im Habitus zeigen.
150 Das Konstrukt des Wahrheitsanspruches ist nicht überptüfbar und tritt deshalb als verschleierter Paradigmenwechsel auf. 151 Wie sich auch Unwahrheit und Wahrheit bedingen und das Andere jeweils mitgedacht wird. (Heidegger 1985: 18) Die Wahrheit entspreche, im Gegensatz zur Lüge und zur Unaufrichtigkeit, den Ausprägungen des Wirklichen. (Ibid.: 7)
228
KOLLEKTIVIERUNG
Die Erinnerungsgesellschaft Von Anfang an wurde in der DDR die Idee der Erinnerungsgesellschaß152 als »Stabilitätsmechanismus in Szene gesetzt« (Münkler 1997: 458ff.) und an dieser Strategie bis zum Zusammenbruch des Staates mit modifizierten Inhalten und Referenz- resp. Abgrenzungsmustern festgehalten. Dabei übernahm der Prozess der Erinnerung pragmatische Funktion, als Vorbild gebender Inhalt, der Stabilität gewährte und eine Verortung ermöglichte. Die Erinnerungsgesellschaft setzte sich aus dem Gründungsmythos des Antifaschismus, der Erberezeption und dem Aufbau einer Eigengeschichte zusammen. In der Anfangsphase bis zur Gründung der DDR diente der Widerstand gegen den Faschismus als Legitimationsgrundlage. Mit dem institutionellen Umbau des Staates wurden dezidierte, kunstprogrammatische Leitlinien aufgestellt. Die Parole lautete nunmehr: Aufbau der sozialistischen Gesellschaft. Dafür griff man im Kunstbereich auf tradierte Bildungsideale, auch in Abgrenzung zur »dekadenten Kulturbarbarei« der westlichen Gesellschaften, zurück. Nach rund 25 Jahren - dem Generationenbruch entsprechend - bildeten Rückgriffe auf die Eigengeschichte dann die gesellschaftsstiftende Grundlage. Die Gedächtniskultur in der DDR gründete vornehmlich auf einem Personenkult, beispielsweise um Martin Luther, Thomas Müntzer oder Wolfgang von Goethe. Ein Personenkult kann idealiter angepasst werden und erleichtert es, ein überschaubares, geschlossenes und gewesenes Bild zu zeichnen. Hinzu entlasten personale Identifikationen die Nachvollziehbarkeit des Gewollten und ermöglichen ein punktuell herausgestelltes Anknüpfen an konkrete Leitbilder. Insgesamt betrachtet waren die Bezüge aber stets territorial angebunden. Alterität wurde vor allem in der Orientierungs- und der Konkretisierungsphase aufgebaut. Topoi im Anschluss an den Gründungsmythos waren u.a. »Formalismus« und »Kosmopolitismus« sowie »Dekadenz« und »Kulturbarbarei«. Diesen entgegengestellt wurden das »Typischen«, die »Wahrhaftigkeit« sowie die »Sozialistischen Nation« und stabilisiert über das identifikatorische Moment der Erberezeption mit deren übernommenen bürgerlichen Leitbildern. Die Kontinuitätsphase der 60er Jahre zeichnet sich durch die Annäherung an die biografischen Entwicklungen der Künstler aus, mit diesen der »neue Kurs« zusätzlich abgesichert werden sollte und konnte. Es 152 Vgl. den von Herfried Münkler geprägten Terminus der »Erinnerungs-
gemeinschaft«, den er im Zusammenhang mit der Ausbildung des »Kollektiven Gedächtnisses« der DDR entworfen hat. (Münkler 1997: 459)
229
KOLLEKTIVIERUNG DER PHANTASIE?
kristallisiert sich heraus, dass die Begründungsbezüge im Verlauf sowohl historisch ausgedehnt als auch zunehmend verdichtet wurden. In den ersten beiden Jahrzehnten waren die 10er und insbesondere die 20er Jahre kunsthistorisch ausgeblendet und später tabuisiert worden. Dies änderte sich dann vor der Phase der Eigenreferenzausbildung und dem Aufbau einer Eigengeschichte. Bezug genommen wurde jetzt auf die personale Eigengeschichte der DDR-Künstler, die ihre künstlerische Hochphase während der Weimarer Republik ausgebildet hatten. Das Anknüpfen an die Nachkriegsphase sollte ein Selbstverständnis für das Eigene herstellen. Im Vordergrund stand nun die Entwicklung des Staates ab 1945, die zuvörderst sprachlich mit der Umbenennung der Kulturinstitutionen markiert wurde. 153 Herfried Münkler unterscheidet im Zusammenhang mit der Ausbildung des »Kollektiven Gedächtnisses« in dem politischen System der DDR zwischen Gründungs- und Additionsmythen. Seiner Ansicht nach hätten letztere im Vergleich zum Antifaschismus, als durchgängiger Legitimationsquelle, lediglich schwach identitätsbildend gewirkt. (Münkler 1998: 17) Weshalb schließlich auch der Abnutzungseffekt dieses DDRMythos zum Zerfall des politischen Systems geführt habe. (Ibid.) Dem entgegen kann festgestellt werden, dass die Phasen der Erberezeptionen durchgängige Legitimationsquellen darstellten, die nicht als Supplement in Form von Additionsmythen bestanden. Das Alteritätsmoment des Antifaschismus begründete zwar die gemeinschaftsstiftende Ausgangslage, historische Referenzbildungen resp. Begründungsakte durch geschichtliche Legitimationsbezüge bildeten aber immer auch notwendige Bestandteile sichernder Identitätsbildung. 154 Unbeachtet lässt Herfried Münkler die Selbstreferenzphase in den 70er Jahren mit schwindenden Fremdpolarisierungen. Der Ausbau der staatlichen Eigengeschichte ab dieser Zeit ist dabei eng an die personelle Form der Erinnerung gebunden und deren sinnstiftenden kontinuierlichen Rekonstruktion. Markiert wurde der Umbruch mit der »VII. Kunstausstellung der DDR«, die von Oktober 1972 bis März 1973 ausgerichtet worden war. Die Gründungsmythen werden nun personal angebunden rekapituliert, der Aufbau einer Eigengeschichte beginnt. Der Rekurs auf die Eigengeschichte bedingt, dass eine geschlossene Geschichte erzählt und damit die beteiligte Generation gemeinschaftlich und mental angebunden werden kann. 153 Diese Zäsur Anfang der 70er Jahre mit einem Wechsel zur Selbstreferenz, wurde u.a. durch die Umbenennung staatlicher Institutionen angezeigt und das Suffix »deutsch« durch »der DDR« ersetzt. 154 Vgl. die Überlegungen von Hans Paul Bahrdt zur biographischen Rekonstruktion. (Bahrdt 1996: 205ff.)
230
KOLLEKTIVIERUNG
Die wechselhaften Bezugnahmen zeigen an, dass das gesellschaftliche Ordnungsgefüge als brüchig empfunden worden war und verdeutlichen, dass auch soziale Identitätsbildungen einem zeitlichen Verlauf unterliegen (Bahrdt 1996: 67). 155 Den Abkoppelungsprozess (durch Aneignung und Umdeutung der staatlichen Vorgaben für den Kunstbereich) in den 80er Jahren bewirkte der Generationenumbruch auf natürliche Weise. Die Vermutung liegt nahe, dass dieser gegenkultureHe Wandel eng verbunden ist mit dem Aufbau der Eigengeschichte. Die Eigengeschichte stellte nun nicht mehr nur eine konstruierte dar, sondern war eine vorgelebte.
155 Vgl. zum Prozess der AbkappeJung das Kapitel »Phasen und Zäsuren in der SBZ und DDR«.
231
LITERATUR
Prolog und Einleitung Benjamin, Walter (1983): Das Passagenwerk, 2 Bde., Frankfurt/M. Die Sieben. Beutner · Fraass · Griebe! · Jüchser · Kröner · Wilhelm · Winkler. Werke einer Künstlergmppe (1997): Kultur im Dresdner Umland e.V. Meißen/Reichenberg (Hg.), [Ausstellung vom 7. Juni bis 17. August 1997, Albrechtsburg Meißen], Reichenberg, OT Boxdorf. Fischer, Lothar (1981): Otto Dix - ein Malerleben in Deutschland, Berlin. Griebe!, Otto (1986): Ich war ein Mann der Straße. Lebenserinnemngen eines Dresdner Malers, Halle/Leipzig. Jähner, Brigitte (1980): Hans Jüchser. Maler und Werk, Dresden. Kröner, Karl (1967): »Brief an Erich Fraaß vom 8. Juli« [Faksimile]. In: Kultur im Dresdner Umland e.V. (Hg.), 1997, Die Sieben. Beutner· Fraass · Griebe! · Jüchser · Krön er · Wilhelm · Wink! er. Werke einer Künstlergmppe, [Ausstellung vom 7. Juni bis 17. August 1997, Albrechtsburg Meißen], Meißen/Reichenberg. Leventman, Seymour (1982): Counterculture and Social Transformation: Essays on negativistic Themes in Sociological Theory, Springfield/Ill. Löffler, Fritz (1987): Johannes Beutner, Maler und Werk, Dresden. Simmel, Georg C1999): Soziologie. Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung. Otthein Rammstedt (Hg.), [Gesamtausg. Bd. 11], Frankfurt/M., [Erstv. 1908]. Wilhelmi, Christoph (1996): Künstlergmppen in Deutschland, Österreich und der Schweiz seit 1900. Ein Handbuch, Stuttgart. Zetkin, Clara CZ1961): Erinnemngen an Lenin, Berlin/DDR, [Erstv. 1929]. Symbolische Vermittlung eine kunstsoziologische Betrachtungsweise Bahrdt, Hans Paul (1996): Gmndformen sozialer Situationen. Eine kleine Grammatik des Alltagslebens, München.
233
KOLLEKTIVIERUNG DER PHANTASIE?
Blazek, Helmut (1999): Männerbünde. Eine Geschichte von Faszination und Macht, Berlin. Bourdieu, Pierre e1994): Zur Soziologie der symbolischen Fonnen, Frankfurt/M., [Erstv. 1970]. Ders. (1987): Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft, Frankfurt/M., [Erstv. 1979]. Cassirer, Ernst (1990): Versuch über den Menschen. Einfiihrung in eine Philosophie der Kultur, Frankfurt/M., [Erstv. 1944]. Deleuze, Gilles (1992): Woran erkennt man den Strukturalismus?, Berlin, [Erstv. 1973]. Gadamer, Hans-Georg (1977): Die Aktualität des Schönen. Kunst als Spiel, Symbol und Fest, Stuttgart. Habermas, Jürgen (1975): Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft, Neuwied und Berlin, [Erstv. 1962]. Ders. (1988a): Theorie des kommunikativen Handelns, Bd. 2, Frankfurt/M., [Erstv. 1981]. Ders. (1988b): Nachmetaphysisches Denken, Frankfurt/M. Hajos, Geza (1989): »Die Freimaurer und der englische Garten in Wien«. In: Romantische Gärten der Aufklärung, [Studien zu Denkmalschutz und Denkmalpflege 14], Wien, S. 44-59. Haus, Andreas [Staat!. Museen Preuß. Kulturbesitz] (1971): Ernst ist das Leben Heiter ist die Kunst! Künstlerfeste des 19. Jahrhunderts, Berlin. Hepp, Corona e1992): Avantgarde. Modeme Kunst, Kulturkritik und Reformbewegungen nach der Jahrhundertwende, München, [Erstv. 1987]. Morris, Charles W. (1972): Grundlagen der Zeichentheorie: Ästhetik und Zeichentheorie, München. Nipperdey, Thomas (1972): »Verein als soziale Struktur in Deutschland im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert«. In: Hartmut Boockmann/u.a. (Hg.), Geschichtswissenschaft und Vereinswesen im 19. Jahrhundert. Beiträge zur Geschichte historischer Forschung in Deutschland, Göttingen, S. 1-44. Reinhardt, Helmut (1988): »Der Einfluß der Freimaurer auf die Anlage und Gestaltung der Gärten im 18. Jahrhundert«. In: ICOMOSNationalkomitee d. Bundesrepublik Deutschland (Hg.), Gartenkunst und Denkmalpflege, [Kolloquiwn vom 25. bis 29. Mai 1987, Brühl], Brühl, S. 109-119. Rötzer, Florian (mit Sara Rogenhofer) (1991): »Künstlergruppen: Von der Utopie einer Kollektiven Kunst«. In: Kunstforum international, Bd. 116, Köln, S. 71-77.
234
LITERATUR
Ruppert, Wolfgang (1998): Der moderne Künstler. Zur Sozial- und Kulturgeschichte der kreativen Individualität in der kulturellen Moderne im 19. und frühen 20. Jahrhundert, Frankfurt/M. Schütz, Alfred (1971): Gesammelte Aufsätze, Bd. I, Das Problem der sozialen Wirklichkeit, Den Haag. Tenbruck, Friedrich H. (1989): Die kulturellen Grundlagen der Gesellschaft. Der Fall der Moderne, Opladen. Thurn, Hans Peter (1991): »Die Sozialität des Solitären. Gruppen und Netzwerke in der Bildenden Kunst«. In: Kunstforum international, Bd. 116, Köln, S. 100-129. Uhde-Bernays, Hennann (Hg.) (1957): Künstlerbriefe über Kunst, Dresden. Wietek, Gerhard (1976): Deutsche Künstlerkolonien und Künstlerorte, München.
Das Geheime im Sozialen Dülmen, Richard van (1986): Die Gesellschaft der Aufklärer. Zur bürgerlichen Emanzipation und aufklärerischen Kultur in Deutschland, Frankfurt/M. Hobsbawn, Eric J. (1962): Sozialrebellen. Archaische Sozialbewegungen im 19. und 20. Jahrhundert, Neuwied/Rhein, Berlin-Spandau, [Erstv. 1959]. Koselleck, Reinhart C1997): Kritik und Krise. Eine Studie zur Pathogenese der bürgerlichen Welt, Frankfurt/M., [Erstv. 1959]. Möller, Horst (1983): »Die Bruderschaft der Gold- und Rosenkreuzer. Struktur, Zielsetzung und Wirkung einer anti-aufklärerischen Geheimgesellschaft«. In: Helmut Reinalter (Hg.), Freimaurer und Geheimbünde im 18. Jahrhundert in Mitteleuropa, Frankfurt!M., S. 199239. Neidhardt, Friedhelm (1994): »Innere Prozesse und Außenweltbedingungen sozialer Gruppen«. In: Bemhard Schäfers (Hg.), Einführung in die Gruppensoziologie. Geschichte. Theorien. Analysen, [2. erw. u. akt. Auflage von 1980, überarb. »Das innere System sozialer Gruppen«. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie. 1979, H. 4, S. 639-660], Heidelberg, Wiesbaden, S. 135-156. Nipperdey, Thomas (1972): »Verein als soziale Struktur in Deutschland im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert«. In: Hartmut Boockmann/u.a. (Hg.), Geschichtswissenschaft und Vereinswesen im 19. Jahrhundert. Beiträge zur Geschichte historischer Forschung in Deutschland, Göttingen, S. 1-44. Oesterle, Günter (1998): »Aufklärung und Geheimnis oder die Kunst als Rätsel«. In: Albert Spitznagel (Hg.), Geheimnis und Geheimhaltung.
235
KOLLEKTIVIERUNG DER PHANTASIE?
Erscheinungsfonneu - Funktionen - Konsequenzen, Göttingen, Bem, Toronto, Seattle, S. 97-105. Popitz, Heinrich ( 1997): Wege der Kreativität, Tübingen. Schindler, Norbert (1983): »Der Geheimbund der Illuminaten - Aufklärung, Geheinmis und Politik«. In: Helmut Reinalter (Hg.), Freimaurer und Geheimbünde im 18. Jahrhundert in Mitteleuropa, Frankfurt!M., S. 284-318. Siberski, Elias (1967): Untergrund und offene Gesellschaft. Zur Frage der strukturellen Deutung des sozialen Phänomens, [Diss. Univ. Göttingen, 1965], Stuttgart. Simmel, Georg C1999): Soziologie. Untersuchungen über die Fonnen der Vergesellschaftung, Otthein Rammstedt (Hg.), [Gesamtausg. Bd. 11], Frankfurt/M., [Erstv. 1908]. Tenbruck, Friedrich H. (1989): Die kulturellen Grundlagen der Gesellschaft. Der Fall der Modeme, Opladen. Weishaupt, Adam (1983): »Das verbesserte System der Illuminaten«. [Zit. Norbert Schindler: Der Geheimbund der Illuminaten - Aufklärung, Geheinmis und Politik. In: Helmut Reinalter (Hg.), Freimaurer und Geheimbünde im 18. Jahrhundert in Mitteleuropa, Frankfurt/M., S. 294.
Gegenkultur und sozialer Wandel Bachtin, Michail (1987): Rabelais und seine Welt. Volkskultur und Gegenkultur, Renate Lachmann (Hg.), Frankfurt/M. Bloch, Ernst (1970): Das Prinzip Hoffnung, 3 Bde, Frankfurt/M. Boudon, Raymond (1991): Theories ofsocial change: A Critical Appraisal, Cambridge, [Erstv. 1984]. Duerr, Hans Peter (1978): Traumzeit über die Grenze zwischen Wildnis und Zivilisation, Frankfurt/M. Erikson, Erik H. (1997): Identität und Lebenszyklus: drei Aufsätze, Frankfurt/M. Gasset, Jose Ortegay (1959): Man and Crisis, London. Girtler, Roland (1995): Randkulturen - Theorie der Unanständigkeit, Wien. Habermas, Jürgen (1975): Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft, Neuwied und Berlin, [Erstv. 1962]. Ders. (1988a): Theorie des kommunikativen Handelns, Bd. 2, Frankfurt!M., [Erstv. 1981]. Ders. (1988b): Nachmetaphysisches Denken, Frankfurt/M. Holert, Tom/Terkessidis, Mark (1996): Mainstream der Minderheiten. Pop in der Kontrollgesellschaft, Berlin.
236
LITERATUR
Hollstein, Walter (1969): Der Untergrund. Zur Soziologie jugendlicher Protestbewegungen, N euwied. Ders. (1979): Die Gegengesellschaft Alternative Lebensformen, Bonn. Inglehart, Ronald (1989): Kultureller Umbruch: Wertwandel in der westlichen Welt, Frankfurt/M., New York. Koselleck, Reinhart (8 1997): Kritik und Krise. Eine Studie zur Pathogenese der bürgerlichen Welt, Frankfurt/M., [Erstv. 1959]. Kubicek, Herbert/Wagner, Heiderose (1999): Drei Generationen Community Networks: der Wandel eines elektronischen Mediums in 25 Jahren, Bremen. Kreuzer, Helmut (1968/71 ): Die Boheme. Analyse und Dokumentation der intellektuellen Subkultur vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart, Stuttgart. Marcuse, Herbert (1973): Konterrevolution und Revolte, Frankfurt/M. Mauss, Marcel (1968): Die Gabe. Form und Funktion des Austauschs in archaischen Gesellschaften, Frankfurt/M., [Erstv. 1925]. Negt, Oskar/Kiuge, Alexander (1972): Öffentlichkeit und Erfahrung. Zur Organisationsanalyse von bürgerlicher und proletarischer Öffentlichkeit, Frankfurt/M. Neidhardt, Friedhelm (1979): »Das innere System sozialer Gruppen«. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, H. 4, Köln, S. 639-660. Nisbet, Robert A. (1969): Social Change and History: Aspects of the Western Theory ofDevelopment, London u.a. Ogbum, William Fielding (1969): Kultur und sozialer Wandel. Ausgewählte Schriften, Neuwied. Rheingold, Howard (1994): Virtuelle Gemeinschaft: soziale Beziehungen im Zeitalter des Computers, Bonn. Roszak, Theodore (1971): Gegenkultur. Gedanken über die technokratische Gesellschaft und die Opposition der Jugend, Düsseldorf, Wien, [Erstv. 1968/1969]. Ders. (1972): Where the Wasteland Ends: politics and transcendence in postindustrial society, Garden City, New York. Schwendter, Rolf (1977): »Alternativen zu einem Vierteljahrmarkt, oder: GegenkulturHineingeborenen«XI. Kunstausstellung< (1988): [Sitzung am 4. Mai 1988], SAdK Berlin, VBK-Archiv, vorl. Sign. 5251/Berlin. Rudloff-Hille, Gertrud [Staatliche Kunstsammlungen Dresden] (1951): Schreiben an Siegfried Donndorf vom 27. Juni, SLUB, Handschriftensammlung, Mscr. Dresd. App. 2099, 128. Schmidt, Wemer [1992]: >»UNTERGRundLÜCKE«Arbeitsgemeinschaft der in der SED organisierten bildenden Künstler«AssoASSO< in Dresden« [Vorabdr. aus: Zwischen Karneval und Aschermittwoch. Erinnerungen eines Malers, Berlin]. Bildende Kunst, H. 7, S. 468-4 71. Gnmdig, Lea (1977): »Zeit sich zu erinnern. Anläßlich des 50. Jahrestages der Gründung der ASSO«. Bildende Kunst, H. 12, S. 587-592. Hänisch, Martin (1985): »Interview« [Notizen aus dem Protokoll eines Gespräches am 25. Oktober 1984] von Manfred Heirler, Künstlerische Arbeiten gegen politische Abstinenz. Besuch bei vier Mitgliedern der Dresdner ASSO. Bildende Kunst, H. 2, S. 61-62. Hallische Künstlergruppe [o.J.]: Manifest. In: Helga Kliemann, 1969, Die Novembergruppe, Berlin, S. 59. Haus, Andreas [Staatl. Museen Preuß. Kulturbesitz] ( 1971 ): Ernst ist das Leben Heiter ist die Kunst! Künstlerfeste des 19. Jahrhunderts, Berlin. Heartfield, John (1926): »Grün oder Rot?« [im Auftrag der Roten Gruppe. Vereinigung kommunistischer Künstler]. Die Weltbühne, Nr. 11, S. 434-435. Heusinger v. Waldegg, Joachim [1977]: »Wie sie einander sahen - die Dresdner Sezession Gruppe 1919 in Bildnissen ihrer Mitglieder«. In: Fritz Löffler/Emilio Bertonati/u.a. (Hg.), Dresdner Sezession 1919-
244
LITERATUR
1923, [Ausstellung vom 10. Februar bis 31. März 1977, Galleria del Levante München], Milano, München, S. [O.S]. Hiepe, Richard (1980): »Zu den antifaschistischen Positionen in der deutschen Kunst bis 1933«. In: Badischer Kunstverein Karlsruhe (Hg.), Widerstand statt Anpassung. Deutsche Kunst im Widerstand gegen den Faschismus 1933-1945, Berlin/BRD. Hoffmeister, Christirre (1985): »Heinrich Vogelers Reden im Moskauer Rundfunk. 1941«. Bildende Kunst, H. 4, S. 146-149. Keil, Alex [recte Sändor Ek] (1933): »Fünf Jahre Kampf um die revolutionäre bildende Kunst in Deutschland«. In: Diether Schmidt (Hg.), [1964], Manifeste Manifeste 1905-1933. Schriften deutscher Künstler des zwanzigsten Jahrhunderts, Bd. I, Dresden, S. 414-429. Kliemann, Helga (1969): Die Novembergruppe, Berlin. Kubin, Alfred (1918): »Reaktion auf die Einladung der Novembergruppe vom 23. Dezember 1918«. In: Diether Schmidt (Hg.), [1964], Manifeste Manifeste 1905-1933. Schriften deutscher Künstler des zwanzigsten Jahrhunderts, Bd. I, Dresden, S. 158. Kuhirt, UHrich (1978): »Einige Thesen zur ersten Phase der Geschichte der Kunst der DDR 1945-1949/50«. In: Rektor der Karl-MarxUniversität Leipzig (Hg.), Zur Bildenden Kunst zwischen 1945 und 1950 auf dem Territorium der Deutschen Demokratischen Republik. Wissenschaftliches Kolloquium am 15. und 16. November 1976 in Leipzig, Leipzig, S. 37-44. Kunst im Aufbruch. Dresden 1918-1933 (1980): Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Hg.), [Ausstellung vom 30. September 1980 bis 25. Februar 1981, Albertinum Dresden], Dresden. Kutschera, Johanna (1994): Aufbruch und Engagement. Aspekte deutscher Kunst nach dem Ersten Weltkrieg 1918-1920, Frankfurt/M., u.a. Ludewig, Peter (Hg.) (1988): Schrei in die Welt. Expressionismus in Dresden, Berlin. Nagel, Otto (1927): »Die Krisis der bildenden Kunst und das Volk«. In: Uwe M. Sehrreede (Hg.), 1979, Die zwanziger Jahre: Manifeste und Dokumente deutscher Künstler, Köln, S. 150. Naumann, Horst (1985): »Interview von Manfred HeirlerNovembergruppe< vom Januar 1919« [Faksimile]. In: Helga Kliemann, 1969, Die Novembergruppe, Berlin, S. 57.
245
KOLLEKTIVIERUNG DER PHANTASIE?
Dies. [1922]. »Kostümfest: Die Kubische Kiste« [Faksimile]. In Helga Kliemann, 1969, Die Novembergruppe, Berlin, S. 32]. Opposition der Novembergruppe (1920/21 ): »Offener Brief an die Novembergruppe«. Der Gegner, H. 8/9, S. 297ff. »Programm der expressionistischen Abende Dresden« (1917): In: Peter Ludewig (Hg.), 1988, Schrei in die Welt. Expressionismus in Dresden, Berlin, S. 38f. »Protesterklärung« [1927]: In: Diether Schmidt (Hg.), [1964]. Manifeste Manifeste 1905-1933. Schriften deutscher Künstler des zwanzigsten Jahrhunderts, Bd. I, Dresden, S. 371-372. »Protestschreiben des Düsseldorfer Aktivistenbundes« (1920): Gegen Kokoschka! Aktion, H. 35/36 vom 4. September, Sp. 487. Ruppert, Wolfgang (1998): Der moderne Künstler. Zur Sozial- und Kulturgeschichte der kreativen Individualität in der kulturellen Modeme im 19. und frühen 20. Jahrhundert, Frankfurt/M. Sächsische Kunstausstellung Dresden 1934 [1934]: Katalog und Führer, Dresden. Schlösser, Manfred (Hg.) (1980): Arbeitsrat für Kunst: Berlin 1918 1921, [Ausstellung vom 29. Juni bis 3. August 1980, AdK Berlin], Berlin. Ders. (1989): Der Arbeitsrat für Kunst- Eine Dokumentation. In: Anneliese Sehröder (Hg.), Freiheit · Gleichheit · Brüderlichkeit. Künstlergruppen in Deutschland 1918-1923, [Ausstellung vom 3. Mai bis 18. Juni 1989, Städtische Kunsthalle Recklinghausen], [Recklinghausen], S. [o.S.]. Schmidt, Diether (Hg.) [1964]: Manifeste Manifeste 1905-1933. Schriften deutscher Künstler des zwanzigsten Jahrhunderts, Bd. I, Dresden. Ders. (1987): »Zwischen >Brücke< und >Roter Gruppe«Hallische KünstlergruppeFreunde, Prometh! Zacken! Angkor! Antischmitz! ... ExpressionismusNO!wort«. In: Sächsische Kunstausstellung Dresden 1934, [1934], Katalog und Führer, Dresden, S. [o.S.]. Winkler, Kurt (4 1989): »Allgemeine Deutsche Kunstausstellung, Dresden 1946«. In: Michael Bolle (Hg.), Stationen der Modeme. Die bedeutenden Kunstausstellungen des 20. Jahrhunderts in Deutschland, Berlin/BRD, S. 353-363, [Erstv. 1988].
Aufbruch in den Sozialismus (1945-1947) Augst, Gerhard (1946): Programmatische Chronik »Der Ruf« vom 4. August 1946, [Original bei G. Augst, Fotothek]. Das Ufer (1947a): »Entwurf Gründungsmanifest«, [Abdr. in: Büro für Bildende Kunst des Rates des Bezirkes Dresden (Hg.), 1984, Das Ufer. Malerei. Grafik. Plastik 1947-52, S. 13]. Dies. (1947b): Faltblatt der ersten Ausstellung im Staatlichen Kunstgewerbemuseum Dresden vom 26. April bis 27. Mai 1947, [Dresden].
250
LITERATUR
Dies. (1948): Faltblatt zur Ausstellung in der Oberlausitzer Kunsthandlung Görlitz von März bis April 1948, SLUB, Handschriftensammlung, Mscr. Dresd. App. 2099, 143. Dies. [1949]: Gründungsstatuten, SLUB, Handschriftensammlung, Mscr. Dresd. App. 2099, 3. Dies. (1951): Anwesenheitsliste vom 11. April 1951, SLUB, Handschriftensammlung, Mscr. Dresd. App. 2099,31. Dresdner Künstler-Kollektiv (1946): Erste Kunstausstellung. Ernst Busche · Konstantin Franz · Hans Grundig · Wilhelm Lachnit · Max Möbius · Eva Schulze-Knabe · Kurt Schütze · Otto Dix · Kurt Querner, [Ausstellung 2. Juni bis 30. Juni 1946, Haus der Kunst Radeheul], [Radebeul]. Edmund Kesting 1892-1970 (1992): Zum 100. Geburtstag. Gemälde · Arbeiten auf Papier· Fotografien, [Ausstellung vom 3. September bis 24. Oktober 1992, Galerie Döbele Stuttgart], Stuttgart. Grundig, Hans (1957): »Über die >ASSO< in Dresden«. [Vorabdr. aus: Zwischen Karneval und Aschennittwoch. Erinnerungen eines Malers, Berlin]. Bildende Kunst, H. 7, S. 468-471. Hallesche Künstlervereinigung 1947 bis 1949 (1989): Galerie Marktschlösschen des VBK-DDR (Hg.), [Ausstellung vom 17. Oktober bis 19. November 1989, Galerie Marktschlößchen Halle], Halle. Heider, Magdalena (1993): Politik-Kultur-Kulturbund. Zur Gründungsund Frühgeschichte des Kulturbundes zur demokratischen Erneuerung Deutschlands 1945-1954 in der SBZ/DDR, Köln. Kirsch, Günter (1985): »Die Gründung des Kulturbundes in DresdenEin Beitrag zur antifaschistisch-demokratischen Kunstentwicklung und zum Bündnis zwischen Arbeiterklasse und Intelligenz«. In: Rat des Bezirkes Dresden, Abt!. Kultur/Kulturakademie des Bezirkes Dresden (Hg.), Vom kulturellen Anfang im Raum Dresden. Nach der Befreiung vom Hitlerfaschismus, [Dresdner Hefte. Beiträge zur Kulturgeschichte], H. 6, Dresden, S. 14-23. Kober, Kar! Max (1989): Malen, als wäre nichts passiert? Auch in der Kunst ganz von vorn beginnen? Malerei, Zeichnungen, Grafiken aus der sowjetischen Besatzungszone, Leipzig. Kramer, Hermann (1946): »Vorwort«. In: Dresdner Künstler-Kollektiv. Erste Kunstausstellung. Ernst Busche · Konstantin Franz · Hans Grundig · Wilhelm Lachnit · Max Möbius · Eva Schulze-Knabe · Kurt Schütze · Otto Dix · Kurt Querner [Ausstellung 2. Juni bis 30. Juni 1946, Haus der Kunst Radebeul], S. [o.S.]. Kuhirt, UHrich (1977): »Parteilich, streitbar, poesievoll, heiter. Der Berliner Maler Fritz Duda«. Bildende Kunst, H. 2, S. 66-69.
251
KOLLEKTIVIERUNG DER PHANTASIE?
Ders. (1978): »Einige Thesen zur ersten Phase der Geschichte der Kunst der DDR 1945-1949/50«. In: Rektor der Karl-Marx-Universität Leipzig (Hg.), Zur Bildenden Kunst zwischen 1945 und 1950 auf dem Territorium der Deutschen Demokratischen Republik, Wissenschaftliches Kolloquium am 15. und 16. November 1976 in Leipzig, Leipzig, S. 37-44. Landesregierung Sachsen, Ministerium für Volksbildung, Abteilung für Kunst und Literatur (1947): Schreiben an das Volksbildungsamt der Stadt Zittau, Abteilung Kulturamt vom 28. Februar [i.A. Prof. Reinhold Langner], Sächsisches Staatsarchiv, Regierungsstelle Dresden, Ministerium für Volksbildung, Nr. 2355. Liebmann, Kurt (1947): Ansprache zur Eröffnung der Ausstellung (Malerei, Graphik, Plastik) »Das Ufer« Gruppe 1947 Dresdner Künstler am 26. April 1947 im Staatlichen Kunstgewerbemuseum, SLUB, Handschriftensammlung, Mscr. Dresd. App. 2404 f, 6. Lühr, Hans-Peter (Hg.) (1996): Curt Querner. Tag der starken Farben. Aus den Tagebüchern 1937 bis 1976. [Dresdner Hefte, Beiträge zur Kulturgeschichte, Sonderausg.], Dresden. Nerlinger, Oskar (1947): Schreiben an die Vorsitzenden des Zentralvorstandes der SED Wilhelm Pieck und Otto Grotewohl vom 18. März. SAPMO-BArch, ZPA, IV/2/906/170, BI. 125, 126. Schumacher, Karl-Heinz (1965): Zur Entstehung und Gründung des Kulturbundes zur Demokratischen Erneuerung Deutschlands, Berlin/DDR. Semrau, Jens (1996): »Keine ASSO ! Fritz Duda und die >Arbeitsgemeinschaft der in der SED organisierten bildenden Künstler«Dilemma< der festen Wandmalerei. Die Folgen der Formalismus-Debatte für die Wandbildbewegung in der SBZ/DDR 1945-1955«. In: Günter Feist/Eckhart Gillen/Beatrice Viemeisel (Hg.), Kunstdokumentation SBZ/DDR 1945-1989. Aufsätze ·Berichte · Materialien, Köln, S. 444-465. Ders. (1999): »Vom Auftrag zur Vergesellschaftung des Künstlers. Strategien zu einer Neubestimmung der gesellschaftlichen Rolle des Künstlers in der DDR«. In: Dokumentationszentrum der DDR (Hg.), Volks Eigene Bilder: Kunstbesitz der Parteien und Massenorganisationen der DDR, Berlin S. 67-89. Schulze, Ingrid (1974): »Karl Völker und die >Hallische KünstlergruppeArbeitsgemeinschaft der in der SED organisierten bildenden Künstler«Die Kaue«


![Zwischen Sprachspiel und Methode: Perspektiven der Diskursanalyse [1. Aufl.]
9783839414293](https://ebin.pub/img/200x200/zwischen-sprachspiel-und-methode-perspektiven-der-diskursanalyse-1-aufl-9783839414293.jpg)
![Der Surrealismus in der Mediengesellschaft - zwischen Kunst und Kommerz [1. Aufl.]
9783839412381](https://ebin.pub/img/200x200/der-surrealismus-in-der-mediengesellschaft-zwischen-kunst-und-kommerz-1-aufl-9783839412381.jpg)
![Gundlagen der Privaterbfolge in der Bundesrepublik Deutschland und in der DDR [1 ed.]
9783428468898, 9783428068890](https://ebin.pub/img/200x200/gundlagen-der-privaterbfolge-in-der-bundesrepublik-deutschland-und-in-der-ddr-1nbsped-9783428468898-9783428068890.jpg)

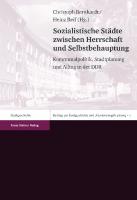
![Transstaatliche Räume: Politik, Wirtschaft und Kultur in und zwischen Deutschland und der Türkei [1. Aufl.]
9783839400548](https://ebin.pub/img/200x200/transstaatliche-rume-politik-wirtschaft-und-kultur-in-und-zwischen-deutschland-und-der-trkei-1-aufl-9783839400548.jpg)
![Die andere Hälfte der Erinnerung: Die DDR in der deutschen Geschichtspolitik nach 1989 [1. Aufl.]
9783839417737](https://ebin.pub/img/200x200/die-andere-hlfte-der-erinnerung-die-ddr-in-der-deutschen-geschichtspolitik-nach-1989-1-aufl-9783839417737.jpg)
![New York und Tokio in der Medienkunst: Urbane Mythen zwischen Musealisierung und Mediatisierung [1. Aufl.]
9783839405918](https://ebin.pub/img/200x200/new-york-und-tokio-in-der-medienkunst-urbane-mythen-zwischen-musealisierung-und-mediatisierung-1-aufl-9783839405918.jpg)