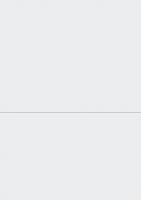Würde und Autonomie: Fachtagung der Schweizerischen Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie, 24.–25. April 2013, Landgut Castelen, Augst 3515109498, 9783515109499
Die Würde des Menschen wird oft in einen direkten Zusammenhang mit Autonomie gestellt: Würde werde geachtet und geschütz
120 54 3MB
German Pages 216 [218] Year 2014
InhaltsverzeIchnIs
Vorwort
Erster Teil: Das Verhältnis von „Menschenwürde und Autonomie“
Was umfasst die „neue“ Menschenwürde in den internationalen Menschenrechtsdokumenten?
Die Würde von Freien und Gleichen.
Recht – Selbst – Bestimmung
Worin liegen Menschenwürde-Verletzungen? Eine Fallgruppenanalyse
Umfang und Grenzen einer Bestrafung wegen Organhandels bei der Lebendorganspende.
Zweiter Teil: Alternative Bedeutungs- und Begründungsbestimmungen von Menschenwürde
Autonomie als notwendige aber nicht hinreichende Bestimmung der Menschenwürde
Die „Sakralität“ des Menschen
Die Bedeutung von Instrumentalisierung und Demütigung als Würdeverletzung
Menschenwürde als Bremse
Dritter Teil: Ein erweitertes Würdeverständnis über Menschenwürde hinaus: Die Würde nichtmenschlicher Lebewesen
Menschenwürde und Speziesismus
Würde der Tiere?
Autorinnen und Autoren sowie Herausgeberin und Herausgeber
Recommend Papers

- Author / Uploaded
- Daniela Demko
- Kurt Seelmann
- Paolo Becchi (eds.)
File loading please wait...
Citation preview
Daniela Demko / Kurt Seelmann / Paolo Becchi (Hg.)
Würde und Autonomie Fachtagung der Schweizerischen Vereinigung für Rechtsund Sozialphilosophie, 24.–25. April 2013, Landgut Castelen, Augst
ARSP Beiheft 142 Franz Steiner Verlag
Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie
Daniela Demko / Kurt Seelmann / Paolo Becchi (Hg.) Würde und Autonomie
archiv für rechts- und sozialphilosophie archives for philosophy of law and social philosophy archives de philosophie du droit et de philosophie sociale archivo de filosofía jurídica y social Herausgegeben von der Internationalen Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie (IVR) Redaktion: Dr. Annette Brockmöller, LL. M. Beiheft 142
Daniela Demko / Kurt Seelmann / Paolo Becchi (Hg.)
Würde und Autonomie Fachtagung der Schweizerischen Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie, 24.–25. April 2013, Landgut Castelen, Augst
Franz Steiner Verlag
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über abrufbar. Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar. © Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2015 Druck: Druckhaus Nomos, Sinzheim Gedruckt auf säurefreiem, alterungsbeständigem Papier. Printed in Germany. Franz Steiner Verlag: ISBN 978-3-515-10949-9 (Print) Franz Steiner Verlag: ISBN 978-3-515-10952-9 (E-Book) Nomos Verlag: ISBN 978-3-8487-1971-6
InhaltsverzeIchnIs Vorwort ...................................................................................................................... 7 erster teIl: Das verhältnIs
von
„MenschenwürDe
unD
autonoMIe“
Georg Lohmann, Magdeburg Was umfasst die „neue“ Menschenwürde in den internationalen Menschenrechtsdokumenten? ....................................................... 15 Tilo Wesche, Basel/Gießen Die Würde von Freien und Gleichen. Zur Begründung der menschlichen Würdeidee ...................................................... 41 Stephan Kirste, Salzburg Recht – Selbst – Bestimmung .................................................................................. 65 Ralf Stoecker, Bielefeld Worin liegen Menschenwürde-Verletzungen? Eine Fallgruppenanalyse ................ 91 Ulrich Schroth, München Umfang und Grenzen einer Bestrafung wegen Organhandels bei der Lebendorganspende. Zur Kritik der deutschen Lösung – ein Alternativvorschlag........................................................................................... 107 zweIter teIl: alternatIve BeDeutungsvon MenschenwürDe
unD
BegrünDungsBestIMMungen
Sabrina Zucca-Soest, Hamburg Autonomie als Notwendige aber nicht hinreichende Bestimmung der Menschenwürde ............................................................................................... 117 Gunnar Duttge, Göttingen Die „Sakralität“ des Menschen............................................................................... 145 Peter Schaber, Zürich Die Bedeutung von Instrumentalisierung und Demütigung als Würdeverletzung 159 Paolo Becchi, Genua/Luzern Menschenwürde als Bremse ................................................................................... 169
6
Inhaltsverzeichnis
DrItter teIl: eIn erweItertes würDeverstänDnIs üBer MenschenwürDe DIe würDe nIchtMenschlIcher leBewesen
hInaus:
Tatjana Hörnle, Berlin Menschenwürde und Speziesismus ....................................................................... 183 Jean-Claude Wolf, Fribourg Würde der Tiere? .................................................................................................... 195 Autorinnen und Autoren sowie Herausgeberin und Herausgeber....................... 216
vorwort Am 24. und 25. April 2013 fand auf dem Landgut Castelen der „Römerstiftung Dr. René Clavel“ in Augst (dem ehemals römischen Augusta Raurica) bei Basel ein internationales Forschungskolloquium zum Thema „Würde und Autonomie“ statt, aus welchem die Beiträge in diesem Band hervorgegangen sind. Die überarbeiteten Referate werden hierbei ergänzt durch Beiträge von Teilnehmenden, die als Diskutanten eingeladen waren. Die Ausgangsüberlegung der Veranstaltenden war, dass in der modernen Ethik ebenso wie im modernen Recht (Menschen-)Würde und Autonomie zentrale Fundierungsbegriffe sind. Der Mensch soll nicht in seiner Würde missachtet, insbesondere nicht wie eine Sache instrumentalisiert, nicht „zum Objekt“ gemacht werden und er soll als verantwortlich Handelnder in seinen Freiheits- und Selbstbestimmungsrechten und damit in seiner Autonomie anerkannt und geschützt werden: Autonomie erweist sich insoweit als ein tragender Grund für die Bestimmung von Würde. Aber ist es hinreichend, Würde allein und ausschliesslich von der Autonomie her bestimmen zu wollen? Nicht nur der Ausübung ihres Selbstbestimmungsrechts fähige und in diesem Sinne autonome Menschen, sondern vielmehr alle Menschen sollen in ihrer Menschenwürde geachtet und geschützt werden: Auch (etwa) Kleinkinder und in schwerster Weise geistig behinderte Menschen sind nach den entsprechenden rechtlichen Regelungen Träger von Menschenwürde – ja sie sind, was ihre Bewahrung vor Verletzungen der Menschenwürde angeht, sogar mehr noch als alle anderen (autonomen) Menschen einer solchen Achtung und eines solchen Schutzes ihrer Würde bedürftig. Die Würde dieser besonders schutzbedürftigen Menschen mit der Achtung und dem Schutz ihrer Autonomie zu erklären, ist hierbei ein zumindest schwieriges Unterfangen. Überhaupt stellt sich des Weiteren für alle, also für autonome und nicht-autonome Menschen die Frage, ob es jenseits von Autonomieverletzungen nicht auch andere Anknüpfungspunkte für Menschenwürdeverletzungen gibt. Dies hat schon lange zu Überlegungen darüber geführt, ob die Bestimmung von Menschenwürde nicht doch eines anderen – oder doch zumindest eines weiteren, zusätzlichen – tragenden Grundes jenseits der Autonomie bedürfe und welche Gründe (etwa Empathie, Sakralität oder Schutz vor Demütigung) hierfür im Einzelnen in Betracht kommen könnten. Kann bereits die Menschenwürde, die in der Schweizerischen Bundesverfassung in Art. 7 an der Spitze des Grundrechtekatalogs und im deutschen Grundgesetz sogar ganz am Anfang in Art. 1 Abs. 1 garantiert ist, nicht allein mit einem Autonomieschutz begründet werden, so gilt dies noch viel mehr für Überlegungen zur Achtung und zum Schutz von Würde im ausserhumanen Bereich: Die Erweiterung eines Würdeverständnisses über den Menschen hinaus und dessen Bezugnahme auch auf nicht-menschliche Lebewesen stellen sich mit Blick auf unser traditionelles Würdeverständnis gerade als eines Menschenwürdeverständnisses als neue und in Zukunft weitere Relevanz gewinnende Herausforderung für die Entwicklung und genaue Ausformung eines menschliche und nicht-menschliche Lebewesen einbeziehenden Würdeverständnisses dar. In den letzten Jahren ist die Würde auch von nicht-menschlichen Lebewesen, etwa in Gestalt einer Tierwürde oder einer Pflanzenwürde, in zunehmendem Masse zum Gegenstand philosophischer und rechtlicher Diskussionen ge-
8
Vorwort
worden, wobei gerade hierfür Überlegungen zu einem Würdeverständnis unvermeidlich sind, das sich nicht an den auf den Menschen bezogenen Autonomiebegriff bindet. In kontroverser Weise wird für nicht-menschliche Lebewesen etwa über die Verwendung des „Würde“-Begriffs an sich, über die massgeblichen Anknüpfungspunkte für eine Bestimmung ihrer sog. kreatürlichen Würde und über Unterschiede zwischen einer Würde für menschliche und nicht-menschliche Lebewesen gestritten. Speziell in der Schweiz besteht hier für solche philosophischen und rechtlichen Diskussionen ein grundlegendes Klärungsbedürfnis, ist hier doch ein erweiterter Würde-Begriff sogar positiv-rechtlich in der Bundesverfassung (Art. 120 BV: „Würde der Kreatur“) auch auf nichtmenschliche Lebewesen bezogen. Diese unterschiedlichen Begründungsdimensionen des Würdebegriffs, der sich teilweise über das Prinzip der Autonomie fundiert und teilweise zu seiner Begründung anderer Erwägungen bedarf, gilt es mit Hilfe der hier veröffentlichten Beiträge nun in der Weise auszuleuchten, dass sich der erste und zweite Teil des Bandes der Bedeutungs- und Begründungsbestimmung von Menschenwürde widmen und sich der dritte Teil des Bandes der Frage nach einer Erweiterung des Würdeverständnisses über den Menschen hinaus auf nicht-menschliche Lebewesen öffnet: Im ersten Teil des Bandes soll mit Blick auf das Menschenwürdeverständnis der hier traditionell vorrangig betonte Aspekt der Autonomie ins Zentrum gerückt und das spezielle Verhältnis von Menschenwürde und Autonomie aufgegriffen werden. Der zweite Teil des Bandes sucht sodann für das Menschenwürdeverständnis nach alternativen Fundierungen jenseits von Autonomie. Der dritte Teil des Bandes fragt schliesslich nach Begründungsund Bedeutungsaspekten eines erweiterten, über den Menschen hinausgehenden und auch nicht-menschliche Lebewesen (wie etwa Tiere) einbeziehenden Würdeverständnisses und führt hier (etwa) auch zur Frage, ob eine Ausdehnung des Würdebegriffs unter Anknüpfung an die Menschenwürde oder an ein von vornherein originäres weiteres Konzept von Würde an sich erfolgen könnte. Im ersten Teil des vorliegenden Bandes zum Verhältnis von Menschenwürde und Autonomie wird die enge und spezielle Verbindung zwischen diesen beiden Begriffen der Menschenwürde und der Autonomie erforscht. Hierbei interessiert zunächst der Umstand, dass der moderne Begriff der Menschenwürde trotz seiner vielen älteren Wurzeln in der heutigen Debatte stark durch Immanuel Kant bestimmt ist, der aus der Autonomie – verstanden als Selbstgesetzgebung ausgehend von der durch Verallgemeinerbarkeit bestimmten Vernunft – das Selbstzweck-Sein und das SelbstGesetzgeber-Sein und daraus die Würde des Menschen herleitet. Diese „Würde“ setzt Kant in einen Gegensatz zum „Preis“, den eine Sache hat. Inhaltlich besteht ein deutlicher Bezug der Würde zu einem solchen Verständnis von Autonomie dann, wenn die Verletzung von Menschenwürde in der vollständigen Instrumentalisierung gesehen wird. Es ist jedoch davon auszugehen, dass noch eine andere enge Verbindung von Würde und Autonomie über eine insbesondere von Adam Smith über John Stuart Mill bis zur heutigen Verwendung des Autonomiebegriffs fortgesetzte pragmatischere Linie verläuft, wonach aber die Autonomie keinen objektivierten, sondern einen individualistischen Charakter zugesprochen bekommt und daher auch eine Selbstbestimmung des aus der Sicht anderer „unvernünftig“ Handelnden einschliesst. Dieser Begriff von Autonomie wird ebenfalls in der Nachkriegsgeschichte als wichtiger Gegenstand des Schutzes der Menschenwürde angesehen. Auch die in der derzeitigen philosophischen Diskussion häufig als Schutzgrund der
Vorwort
9
Menschenwürdegarantie genannte Selbstachtung steht in einer engen Beziehung zu diesem eher auf Mill zurückzuführenden Verständnis von Autonomie. Von der grundsätzlichen Auswahl des für die Menschenwürde verwendeten Autonomiebegriffs hängt zudem ab, wie man das Verhältnis zwischen der Menschenwürde und den Menschenrechten versteht. Diesen und weiteren der soeben angesprochenen Themenaspekte(n) zum Verhältnis von Menschenwürde und Autonomie widmen sich die Beiträge im ersten Teil des Bandes: Insbesondere mit dem Verhältnis der Menschenwürdegarantie zu den Menschenrechten, also mit einem seit Mitte des 20. Jahrhunderts an Rechte geknüpften und in der Autonomie-Tradition stehenden Menschenwürdebegriff befassen sich die Beiträge von georg lohmann (Magdeburg) und tilo wesche (Basel/gießen). Durch die Aufnahme u. a. relationaler (Autonomie als Resultat der Beziehung zu anderen Menschen), prozeduraler (Autonomie als Willensprüfung auf einer Metaebene) und substanzieller (inhaltsbezogener) Aspekte haben sich die Konzeptionen von Kant und Mill inzwischen in verschiedene Richtungen ausdifferenziert. Auch ist zentral für moderne Autonomie-Begriffe, welches Verständnis von AutonomieSchutz gerade das Recht zugrunde legt. Über die Bandbreite des heutigen Autonomiebegriffs und die sich daraus ergebenden Fragen gerade für das Recht, das an das Fehlen von Autonomie Eingriffsbefugnisse knüpft, schreibt stephan kirste (salzburg). In einer Fallgruppenanalyse fragt sodann ralf stoecker (Bielefeld) nach möglichen Verletzungen der Menschenwürde. Anschliessend gilt es weitere, vor allem praktische Fragen im Verhältnis zwischen Menschenwürde und Autonomie zu beantworten: Lässt sich Autonomie, in Bereichen wie etwa der Organtransplantation, durch den Gedanken der Menschenwürde, mit dem sie doch so eng verbunden ist, gar beschränken? Und wie steht es generell um die Vereinbarkeit bestimmter Formen eines (beispielsweise sanften) Paternalismus mit dem Autonomiegedanken? Dies ist die Thematik des Beitrages von ulrich schroth (München), der an Einzelheiten der Regelung der Organtransplantation aufzeigen kann, wie der Gedanke der Würde hier herangezogen wird gerade zur Begrenzung der Autonomie. Dies leitet bereits über zu einer anderen Sicht auf die Verhältnisbestimmung von Würde und Autonomie – und hier zu möglichen Alternativen zu einer nur oder vorrangig aus der Autonomie begründeten Würde: Solchen alternativen Bedeutungs- und Begründungsbestimmungen der Würde widmen sich nunmehr der zweite und dritte Teil des Bandes. Mögliche Alternativen zu einem von der Autonomie her verstandenen Menschenwürdeverständnis können sich, so erweist es sich im zweiten Teil des Bandes, aus ganz unterschiedlichen weiteren Zugängen eröffnen. Eine Möglichkeit, so zeigt sabrina zucca-soest (hamburg), besteht darin, der Autonomie die Empathie zur Würdebestimmung an die Seite zu stellen. gunnar Duttge (göttingen) sucht unter Rückgriff auf Hans Joas den Grund der Würde mit Hilfe der Sakralität der Person zu bestimmen. peter schaber (zürich) zählt neben der Instrumentalisierung, die als Autonomie-Beeinträchtigung verstanden werden kann, auch jenen Typ von Demütigung unter die Würdeverletzungen, durch die dem Einzelnen klar gemacht wird, dass er „nicht zählt“. Schliesslich fragt paolo Becchi (genua/luzern) in seinem der Würdeproblematik in den Biowissenschaften gewidmeten Beitrag, ob Würde in diesem Bereich nicht vielleicht – von der jeweiligen Lebensphase des Menschen abhängig – Unterschiedliches bedeuten könne, so dass sich auch hier der Schutz der Autono-
10
Vorwort
mie nur als einer der möglichen Aspekte für eine Begründung von Menschenwürde erweist. Der dritte Teil des Bandes wendet sich dann der Thematik zu, ob und ggf. wie ein Würdeschutz – wenn er schon beim Menschen nicht zwingend und ausschliesslich an die Autonomie gebunden ist – moralisch auch für nichtmenschliche Lebewesen begründet werden kann und was eine solche sog. kreatürliche Würde (z. B. in Gestalt einer Tierwürde) im Einzelnen bedeuten könnte. Dies betrifft zum einen die Frage, was aus dem Arsenal der Begründungen des Menschenwürdeschutzes auch für die Begründung des Würdeschutzes bei nichtmenschlichen Lebewesen herangezogen werden könnte (und was nicht). Betroffen ist aber auch die in die umgekehrte Richtung weisende Frage, was ein Würdebegriff für nichtmenschliche Lebewesen an fruchtbaren Erkenntnissen für den Menschenwürdebegriff bereithalten könnte – also inwieweit und in welcher Weise sich etwa ein nicht (nur) die Autonomie wahrender Menschenwürdeschutz begründen liesse. Mit Blick auf die zwischen Menschen und nichtmenschlichen Lebewesen bestehenden Unterschiede im Schutzniveau von Würde ist auf der Suche nach einer tragfähigen Begründung für einen solchen höheren bzw. niedrigeren Schutz danach zu fragen, ob ein hier bestehender „Speziesismus“ tadelnswert erscheint oder es für eine Besserstellung von Menschen beim Würdeschutz gute Argumente, und wenn ja, welche guten Argumente es für eine solche Besserstellung gibt. Diese Speziesismus-Problematik behandelt tatjana hörnle (Berlin) und begegnet einer Ausweitung des Würdebegriffs auf nichtmenschliche Lebewesen mit grosser Skepsis. Was es als konkretisierte Ausprägung einer kreatürlichen Würde nicht-menschlicher Lebewesen insbesondere bedeuten kann, von einer „Würde der Tiere“ auszugehen, kann sich offenbar nur teilweise aus Elementen der bisherigen Menschenwürde-Debatte ergeben und es gilt daher im Folgenden zu untersuchen, was die speziellen Anknüpfungs- und Begründungspunkte für eine Würde gerade des Tieres sein könnten. Mit Blick auf den dazu häufig angeführten Gesichtspunkt einer Menschenähnlichkeit und/oder einer emotionalen Verbundenheit des Menschen mit Tieren stellt sich hier etwa die Frage, ob die – kontrovers debattierten – hierarchischen Differenzierungen innerhalb des Tierreichs (z. B. höherer Schutz für nichtmenschliche Primaten im Unterschied zu anderen Tieren) tatsächlich für Fragen der Würde relevant erscheinen dürfen. Über diese und weitere Fragen der Tierwürde und ihre Begründbarkeit und inhaltliche Ausgestaltung schreibt Jean-claude wolf (freiburg i. ue.) und geht dabei grundsätzlich von einer Theorie eigenständiger Tierrechte aus, welche er zudem in verschiedenen Hinsichten kritisch hinterfragt. Wir sind allen Referierenden und Diskutierenden des Forschungskolloquiums für ihre inspirierenden Anregungen und den fruchtbaren wissenschaftlichen Gedankenaustausch anlässlich des Kolloquiums und für das Zur-Verfügung-Stellen ihrer Beiträge für die Veröffentlichung in diesem Band sehr dankbar. Eine grosse Freude wird es sein, diesen unseren Gedankenaustausch in weiteren zukünftigen Forschungskolloquien fortzusetzen. Zu Dank verpflichtet für die grosszügige finanzielle Förderung des Anlasses sind wir dem Schweizerischen Nationalfonds, der Freiwilligen Akademischen Gesellschaft Basel und der Max-Geldner-Stiftung in Basel. Die Schweizerische Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie (SVRSP) – die nationale Sektion der Internationalen Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie (IVR) – hat uns ideell unterstützt und das Kolloquium als Fachtagung der
11
Vorwort
SVRSP auch ihren Mitgliedern zugänglich gemacht. Für die redaktionelle Arbeit danken wir insbesondere Frau Sabrina Keller MLaw, Basel. Daniela Demko
Kurt Seelmann
Paolo Becchi
erster teIl: Das verhältnIs
von
„MenschenwürDe
unD
autonoMIe“
GeorG Lohmann, maGdeburG was uMfasst DIe „neue“ MenschenwürDe MenschenrechtsDokuMente?1
Der InternatIonalen
1. eInleItung Obwohl der Begriff der Menschenwürde gegenwärtig im Fokus einer großen Zahl von wissenschaftlichen Arbeiten steht, und obwohl seine politische Bedeutung und Verwendung beeindruckend zugenommen hat, sind Klagen über seine Vagheit und Unbestimmtheit beinahe ebenso häufig wie die Versuche, dafür eine theoretische Erklärung zu finden oder doch eine begriffliche Bestimmung zu versuchen. So zeigt bieri in seinem Buch „Eine Art zu leben“ im Untertitel zugleich den Tenor an, mit dem er „Über die Vielfalt menschlicher Würde“ „begriffliche Geschichten“2 erzählt. Allerdings vermitteln diese Geschichten eher den Eindruck einer konservativen Kulturkritik und ihr begrifflicher Ertrag ist in der Tat sehr gering, weil bieri, der ja auch Philosoph ist, zwar immer wieder rhetorisch seminarhaft fragt, was „genau“ die „vertrauten Worte“ „bedeuten“, mit denen wir Erfahrung würdevollen Lebens oder dessen Verletzungen beschreiben, aber explizit darauf verzichtet, sie auch begrifflichtheoretisch zu ordnen und systematisch zu deuten. Auch begriffsgeschichtliche Arbeiten verdeutlichen eher die Komplexität und Vielfalt der Würdebegriffe oder legen sich auf einen Autor, häufig Kant, fest,3 als dass sie versuchen, die gegenwärtige Verwendungen der Würdebegriffe in einen klärenden und systematischen Zusammenhang zu stellen. Anspruchsvoller sind schon Versuche, die eine bestimmte Auffassung von Würde explizieren und gegenüber den aktuellen Herausforderungen verteidigen. Hier kann man Ansätze unterscheiden, die „ihren“ Würdebegriff vornehmlich oder manchmal auch ausschließlich als moralischen Begriff verstehen4, und solche, die ihn ebenso einseitig oder aber dominierend als rechtlichen Begriff behandeln5. Meines Erachtens ist es, aus gleich anzugebenen Gründen, angemessener und auch erfolgsversprechender, nicht von einem, sondern von einer Mehrzahl unterschiedlicher Würdebegriffe auszugehen und dabei alle Dimensionen (die his1 2 3 4
5
Vorfassungen habe ich an den Universitäten in Dresden und Bochum vorgetragen; für kritische Hinweise danke ich Hans Vorländer, Corinna Mieth, Stefan Kirste, Henning Hahn, Jörn Müller und Stefan Huster. bieri, Peter, Eine Art zu leben, München 2013, 16. rosen, michaeL, Dignity, Its History and Meaning, Harvard 2012. Das triff zum Beispiel auf die Arbeiten von schaber und stoecKer zu: schaber, Peter, Menschenwürde, Stuttgart 2012; ders., Instrumentalisierung und Würde, Paderborn 2010; stoecKer, raLf, Die philosophischen Schwierigkeiten mit der Menschenwürde, in: Information Philosophie, 1 (2011), 8–19; ders., 2004 Selbstachtung und Menschenwürde, in: Studia Philosophica, 63 (2004), 107–119; auch bieLefeLdt, heiner, Auslaufmodell Menschenwürde?, Freiburg 2011, versteht seinen eigenen (kantianischen) Vorschlag vornehmlich moralisch. mccrudden, christoPher, Human Dignity and Juridical Interpretation of Human Rights, in: European Journal of International Law, 19 (2008), 655–724. Wesentlich bezogen auf das deutsche Grundgesetz: enders, christoPh, Die Menschenwürde in der Verfassungsordnung, Tübingen 1997; tiedemann, PauL, Menschenwürde als Rechtsbegriff. Eine philosophische Klärung, Berlin 2007.
16
Georg Lohmann
torische, politische, moralische und rechtliche) der Würdebegriffe zu beachten. In den Reigen dieser Ansätze will ich auch den hier skizzierten Versuch einordnen. Dabei gehe ich von dem historischen Befund aus, dass die gegenwärtige Relevanz von „Würde“ sich dem Umstand verdankt, dass erst seit 1945, seit Gründung der Vereinten Nationen, „Würde“ im Kontext der Menschenrechte gebraucht wird und erst aus der Verbindung zu den Menschenrechten der Begriff seine gegenwärtige erstaunliche Kariere gewinnt. Nun ist der Begriff der Menschenrechte ebenso umstritten und komplex wie der der Würde, sodass zu beiden Begriffen Vorklärungen sinnvoll sind (2). In einer insgesamt hermeneutisch sich verstehenden Weise will ich, ausgehend von den rechtlichen Menschenrechtsdokumenten, den (formalen) Wert- und Statuscharakter des „neuen“ Begriffs der „Menschenwürde“ in einer ersten Vorverständigung bestimmen (3), um dann das umfassende „Menschenbild“ dieses Begriffs zu skizzieren (4). Vor dem Hintergrund dieser Vorverständigungen gehe ich von der Vermutung aus, dass der (begrifflich notwendige) inhaltliche Gehalt von „Menschenwürde“ nicht durch eine inhaltliche Bestimmung erfasst werden kann, sondern dass hier inhaltliche Aspekte von „Menschenwürde“ unterschieden werden können,6 die der neue Begriff umfasst und die jedem Menschen ein „Bewusstsein seiner Würde“7 erlauben. In diesem Sinne bezieht sich „Menschenwürde“ grundlegend auf die basale wertmäßige Gleichheit und rechtliche Gleichstellung aller Menschen und erlaubt jedem Menschen die gleiche Selbstachtung als anerkannter Träger von Menschenrechten (5). „Menschenwürde“ bezieht sich ferner auf die prinzipiellen Fähigkeiten des Menschen, sein Leben in überlegender Weise selbst zu bestimmen und erlaubt jedem Menschen ein hochgeschätztes Bewusstsein seiner individualisierenden Freiheit (6). „Menschenwürde“ bezieht sich schließlich auf die Ansprüche eines „angemessenen Lebensstandards“ oder Leben-könnens und erlaubt jedem Einzelnen eine selbstverantwortliche Sorge, sein „Leben in Würde“ zu führen (7). Wie diese inhaltlichen Aspekte des Gehaltes der „Menschenwürde“ zusammenhängen, kann in diesem Beitrag nur skizziert werden. In einem Ausblick werden daher die weiterhin offenen Fragen dieses Verständnisvorschlages genannt (8). 2. vorklärungen: konzeptIonen
Der
Menschenrechte
unD
würDeBegrIffe
„Menschenrechte“ sind keine ewige platonische Idee, sondern sie sind Rechtskonstruktionen, die in historisch besonderen Situationen politisch erkämpft und gesetzt worden sind8 und zumeist (und zu Recht) den Anspruch erhoben haben, moralisch 6 7
8
Damit korrigiere ich einen ersten Versuch, siehe Lohmann, GeorG, „Menschenwürde“ – formale und inhaltliche Bestimmungen, in: Joerden, Jan C. / Hilgendorf, Eric / Petrillo, Natalia / Thiele, Felix (Hrsg.), Menschenwürde und moderne Medizintechnik, Baden-Baden 2011, 151–160. In den neueren Menschenrechtskonventionen wird diese Formulierung benutzt. Die Kinderrechtskonvention (CRC) spricht z. B. davon, dass „das Gefühl des Kindes für die eigene Würde und den eigenen Wert“ gefördert werden soll, (Artikel 40, CRC, in: Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.), Menschenrechte, Bonn 1999, 200.) Und auch das Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen vom 13. Dezember 2006 formuliert die Verpflichtung der Vertragsstaaten, „das Bewusstsein der Würde und das Selbstwertgefühl des Menschen voll zur Entfaltung zu bringen“ (Art. 24, zit. nach Bundesgesetzblatt (BGBL) 2008 II, 1419). menKe, christoPh / raimondi, francesca (Hrsg.), Die Revolution der Menschenrechte, Frank-
Was umfasst die „neue“ Menschenwürde der internationalen Menschenrechtsdokumente?
17
begründbar zu sein.9 Ihnen sind nicht aufeinander reduzierbare, politisch-historische, rechtliche und moralische Dimensionen eigen.10 Aus den geschichtlichen Vorkommnissen können wir ein begriffliches Konzept der Menschenrechte versuchen zu bestimmen, nach dem Menschenrechte, formal gesehen, universelle, egalitäre, individuelle und kategorische „subjektive“ Rechte sind, und von geschichtlich und systematisch unterschiedlichen Konzeptionen von Menschenrechten unterscheiden: nationale Menschenrechtskonzeptionen des 18. Jahrhunderts (Erklärungen der Menschenund Bürgerrechte in Amerika und Frankreich), die internationale Konzeption nach dem Zweiten Weltkrieg (Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, AEMR, und nachfolgende internationale Menschenrechtspakte), und vielleicht, gegenwärtig entstehende oder zu fordernde, transnationale (z. B. Europäische Menschenrechtskonvention) und globale Konzeptionen („Konstitutionalisierung des Völkerrechts“)11. Würdebegriffe werden in den Deklarationen des 18. Jahrhunderts nicht erwähnt und spielen auch indirekt in den entsprechenden nationalen Menschenrechtskonzeptionen keine Rolle.12 Von „Würde“ im Kontext von Menschenrechten wird erstmals in der internationalen Konzeption nach 1945 gesprochen.13 Um diese historisch und systematisch neue Rede von „Würde“ zu klären, ist es auch hier sinnvoll, Konzeptionen der vielfältigen unterschiedlichen Verwendungsweisen von „Würde“ begrifflich zu unterscheiden.14 Dabei stütze ich mich auf die komplexe Begriffsgeschichte dieses Wortes,15 beschränke mich aber auf Würdekonzepti-
9
10 11 12
13
14 15
furt am Main 2011 Zu diesem Verständnis von Menschenrechten, was hier nicht weiter erläutert werden kann, siehe menKe, christoPh / PoLLmann, arnd, Philosophie der Menschenrechte: Zur Einführung, Hamburg 2007; zu meiner eigenen Auffassung siehe Lohmann, GeorG, Menschenrechte, in: Hartmann, Martin / Offe, Claus (Hrsg.), Politische Theorie und Politische Philosophie: Ein Handbuch, München 2011, 255–260. Lohmann, GeorG, Zur moralischen, juridischen und politischen Dimension der Menschenrechte, in: Sandkühler, Hans Jörg (Hrsg.), Recht und Moral, Hamburg 2010, 135–150. Zu diesen Konzeptionen siehe ausführlicher Lohmann, GeorG, Menschenrechte und transnationale Demokratisierungen: Überforderungen oder Erweiterungen der Demokratie?, in: Reder, Michael / Cojocaru, Mara-Daria (Hrsg.), Zukunft der Demokratie, Stuttgart 2014, 64–77. Von „Würde“ ist freilich in nationalen Verfassungen (seit 1919 etwa) mit unterschiedlicher Bedeutung und Stellenwert die Rede; die gleich zu erläuternden neue internationale Bedeutung der „Menschenwürde“ bestimmt das deutsche Grundgesetz von 1949 und dann auch nachfolgende neue nationale Verfassungen. Natürlich gibt es auch vorher historisch vorgreifende und deshalb so beeindruckende Versuche, Menschenwürde und Menschenrechte zusammen zu bringen, siehe z. B. troeLtsch, ernst, Naturrecht und Humanität in der Weltpolitik, in: ders. (Hrsg.), Schriften zur Politik und Kulturphilosophie, 1918–23 (= Kritische Gesamtausgabe Bd. 15), Berlin 2002, 493–512; und insbesondere Hermann Brochs „Völkerbund-Resolution“ von 1937, siehe broch, hermann, Menschenrechte und Demokratie, Frankfurt am Main 1978, 31–73; dazu PoLLmann, arnd, Heimkehr aus der Sklaverei: Der Schriftsteller Herrmann Broch als vergessener Vordenker des völkerrechtlichen Zusammenhangs von Menschenrechten und Menschenwürde, in: Breuer, Marten et al. (Hrsg.), Der Staat im Recht, Berlin 2013, 1235–1252. Im Folgenden verwende ich auch überarbeitete Passagen aus Lohmann, GeorG, Menschenwürde als „Basis“ von Menschenrechten, in: Joerden, Jan C. / Hilgendorf, Eric / Thiele, Felix (Hrsg.), Menschenwürde und Medizin: Ein interdisziplinäres Handbuch, Berlin 2013, 179–194. Panajotis, KondyLis, Artikel „Würde“, in: Brunner, Otto / Conze, Werner / Koselleck, Reinhart (Hrsg.), Geschichtliche Grundbegriffe, Bd. 7, Stuttgart 1992, 645–677; PöschL, ViKtor, Artikel „Würde“, in: Brunner/Conze/Koselleck (Fn 15), 637–645; siehe auch rosen 2012, (Fn 3).
18
Georg Lohmann
onen, die jeweils von der Würde eines einzelnen Menschen sprechen.16 Grob vereinfachend kann man dabei die Geschichten allgemeiner Würdebegriffe des Menschen qua Menschen (von der Stoa bis zu Kant), in denen von der „Würde“ aller Menschen geredet wird, von den Geschichten sozialer, ständischer oder ehrbegründeter besonderer (manche sprechen hier auch von kontingenter) Würdebegriffe unterscheiden, in denen „Würde“ nur einigen Menschen zukommt.17 In beiden Geschichtstraditionen ist mit ‚Würde‘ eine besonders hochgeschätzte Wertung eines Modus von Freiheit gemeint, die dem Würdigen einen besonderen Rang (bei den allgemeinen Würdebegriffen in Bezug auf Tiere, bei den besonderen Würdebegriffen in Bezug auf andere Menschen) zuspricht und vom Würdigen selbst wie auch von anderen eine besondere Referenz und Achtung erheischt.18 Unabhängig von den jeweils unterschiedlichen Begründungen für die allgemeinen Würdekonzeptionen des Menschen (Stellung im Kosmos, Vernunftfähigkeit, Kreativität, Gottesebenbildlichkeit) sind hier mit der Würde entsprechende Pflichten gegen sich und gegen andere oder gegenüber der Instanz, die die Würde verleiht, verbunden, aber keine Rechte (!). Die ebenfalls unterschiedlich begründeten besonderen Würdekonzeptionen (z. B. durch eigene Leistung, durch Standesgeburt oder Gruppenzugehörigkeit), die vielfach auch als Ehre verstanden werden, begründen einen besonderen Status und Rang innerhalb besonderer Gruppen. Sie sind ebenfalls durch Pflichten gegen sich und standes- bzw. würdegemäße Verhaltenskodizes charakterisiert, aber auch mit Privilegien gegen andere versehen. Häufig können Konzeptionen aus beiden Begriffstraditionen nebeneinander bestehen, ohne dass die allgemeine Würde des Menschen Auswirkungen auf die jeweils besonderen Standeskonzeptionen hat.19 Insbesondere sind beide Arten von Würdebegriffe vereinbar mit sozialen, rechtlichen oder politischen Ungleichheiten. In dem Maße aber, wie seit der Aufklärung die allgemeine, nun zunehmend moralisch sich artikulierende Wertschätzung der Freiheit des Menschen an sozialer Geltung gewinnt, geraten auch die besonderen, sozialen Würdekonzeptionen, die unterschiedliche soziale Ränge, Stände und Privilegien zu begründen versuchen, unter Rechtfertigungsdruck. Dass alle Menschen in bestimmten Hinsichten als gleich gelten, dass jedem einzelnen unabhängig von seiner besonderen sozialen Stellung die gleiche fundamentale Wertschätzung schlicht als Mensch zusteht, das wird nun moralisch artikuliert, und naturrechtliche oder vernunftrechtliche Grundlage von Recht und Politik. Die Ideen von Freiheit und Gleichheit werden aufeinander 16
17 18 19
Damit sehe ich im Folgenden von Würdebegriffen ab, die sich auf das Ganze eine Population beziehen, insbesondere von der Rede einer „Gattungswürde“ oder „Würde des Menschlichen“. Diese gattungsbezogenen Würdebegriffe folgen insgesamt eher den Strukturen besonderer oder konventioneller Würdebegriffe. Sie spielen aber in einigen Hinsichten für personale Würdebegriffe sicherlich eine wichtige Rolle; siehe z. B. habermas Unterscheidung zwischen personaler Würde und „Würde des menschlichen Lebens“, habermas, jürGen, Die Zukunft der menschlichen Natur, Frankfurt am Main 2001, 67 ff.; dazu Lohmann, GeorG, Unantastbare Menschenwürde und unverfügbare menschliche Natur, in: Menschenwürde. La Dignité de l’ etre humain, Studia Philosophica Vol. 63/2004, Jahrbuch der schweizerischen philosophischen Gesellschaft, Basel 2004, 55–75. Natürlich sind auch andere Unterscheidungen möglich, siehe z. B. rosen (Fn 3), 15 ff. Das entspricht auch dem Ansatz von WaLdron, jeremy, Dignity, Rank, and Rights, Berkeley 2009. vgl. KondyLis (Fn 15), 651.
Was umfasst die „neue“ Menschenwürde der internationalen Menschenrechtsdokumente?
19
bezogen und werden nun, freilich abstrakt und mit charakteristischer Inkonsistenz z. B. gegenüber Frauen, Farbigen und Arbeitern, für alle Menschen beansprucht. Aber auch hier – auch noch bei Kant, soweit diese aufklärerischen Ideen sich in seinem Würdebegriff niederschlagen – sind mit dem Würdebegriff unmittelbar Pflichten gegen sich und andere, aber nicht die Trägerschaft von Rechten verbunden. Seit der Französischen Revolution wird im 19. Jahrhundert im Kontext der Arbeiterbewegung die Rede von der allgemeinen Würde des Menschen noch um soziale Forderungen nach einem ‚menschenwürdigen Leben‘ erweitert, wenn auch zumeist nur via negationis als Protest gegen menschenunwürdige Lebensverhältnisse20. Auf diese komplexen Vorgeschichten unterschiedlicher Würdebegriffe, ergänzt noch durch ähnliche Würdekonzeptionen in nicht-europäischen Kulturen21, greifen Autoren, die an der völkerrechtlichen Neubestimmung der Menschenrechte im Ausgang des Zweiten Weltkrieges engagiert sind, zurück und verwenden22 nun, im völkerrechtlichen Kontext der Vereinten Nationen, den Würdebegriff in einer dritten Art, die ich, um sie begrifflich von den beiden anderen Arten (besondere und allgemeine Würdebegriffe) leichter unterscheiden zu können nun: Menschenwürde nenne. Sie wird im reaktiven Entsetzen über die „Verbrechen gegen die Menschheit“ der NaziZeit, aber auch anderer totalitärer Diktaturen und der Barbarei der Kolonialmächte als eine neugefasste, axiomatische normative Grundlage deklariert und so zunehmend in den dann folgenden Menschenrechtskonventionen und Rechtsverfassungen „eingebaut“.23 Der Menschenwürdebegriff erscheint so zum ersten Mal im Kontext der internationalen Konzeption der Menschenrechte, prominent 1948 in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (AEMR). Zunächst wird er nur miterwähnt (‚Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren‘, Art.1 AEMR), dann aber, wie im Deutschen Grundgesetz24, als begründende und motivierende Basis für 20 21 22
23 24
Siehe dazu Lohmann, GeorG, Marxens Kapitalismuskritik als Kritik an menschenunwürdigen Verhältnissen, in: Jaeggi, Rahel / Loick, Daniel (Hrsg.), Karl Marx – Perspektiven der Gesellschaftskritik, Reihe: Deutsche Zeitschrift für Philosophie, Sonderband 34, Berlin 2013, 67–78. Siehe z. B. sieGetsLeitner, anne / KnoePffLer, niKoLaus (Hrsg.), Menschenwürde im interkulturellen Dialog, Freiburg [u. a.] 2005. Die Geschichte der Verwendung des Würdebegriffs in den Diskussionen während und nach dem Zweiten Weltkrieg ist noch nicht vollständig und überzeugend erforscht; siehe für eine Übersicht beitz, charLes r., Human Dignity in the Theory of Human Rights: Nothing But a Phrase?, in: Philosophy & Public Affairs, 3 (2013), 259–290. Ich schlage daher hier eine retrospektive Interpretation vor, weil der „neue“ Charakter der „Menschenwürde“ zunächst in begrifflich tradierten Bedeutungen sich gewissermassen „verkleidet“, und erst rückblickend deutlich wird; siehe auch Lohmann, GeorG, Menschenwürde als „soziale Imagination“. Über den geschichtlichen Sinn der Deklaration der Menschenrechte und Menschenwürde nach 1945, in: Knoepffler, Nikolaus / Kunzmann, Peter / O’Malley, Martin (Hrsg.), Facetten der Menschenwürde, Freiburg [u. a.] 2011, 54–74. Siehe menKe/PoLLmann (Fn 9), 129 ff.; Lohmann (Fn 14), 179–194. Das deutsche Grundgesetz ist insofern ein Sonderfall, als die verfassungssystematische Stellung des Art. 1 mit der statuierten Unantastbarkeit der Würde des Menschen das ganze Grundgesetz und alle Grundrechte als oberste Verfassungsnorm bestimmt, siehe enders (Fn 5), tiedemann (Fn 5). In vielen anderen Staaten und auch international ist das aber entweder explizit nicht so oder eben umstritten, siehe Kirste, stePhan, Menschenwürde im internationalen Vergleich der Rechtsprechungen, in: Gröschner, Rolf / Lembcke, Oliver W. (Hrsg.), Das Dogma der Unantast-
20
Georg Lohmann
das Haben von Menschenrechten weiterbestimmt. Seit den Internationalen Menschenrechtspakten über bürgerliche und freiheitliche Rechte (IPbfR) und wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (IPwskR) von 1966 wird nun explizit dieser Würdebegriff als Begründung für das Haben von Menschenrechten statuiert. So formulieren die Vertragsstaaten in den Präambeln der beiden Pakte des Jahres 1966 jeweils die „Erkenntnis, dass sich diese Rechte aus der dem Menschen innewohnenden Würde herleiten“. Dieser Würdebegriff fungiert jetzt als ein außerverfassungsmäßiges Prinzip zur Begründung für die Trägerschaft von Menschenrechten, und in einem interpretationsbedürftigen Sinne kann er auch zur inhaltlichen Bestimmung der Menschenrechte dienen. Es geht mir im Folgenden um die Bedeutung und den Status dieses, in den internationalen Menschenrechtsdokumenten nun neu bestimmten Begriffs von „Menschenwürde“. Er ist nun ein in rechtlichen Kontexten gebrauchter Begriff, der in politischen Erklärungen gesetzt wird, aber hinsichtlich seiner normativen Behauptungen (selbstverständlich) moralischer Begründungen bedarf. Weil er und insofern er die Menschenrechte fundiert, ist er, formal gesehen, wie die Menschenrechte zu bestimmen: universell, egalitär, individuell und kategorisch. D. h. allen Menschen kommt individuell und in der gleichen Weise „Menschenwürde“ zu, nur weil sie Menschen sind. Man kann, ohne auf den besonderen „Inhalt“ der „Menschenwürde“ einzugehen, noch einige weitere, eher formale Charakteristika nennen. Vermittelt über die Trägerschaft von Menschenrechten entsprechen seiner Achtung Rechtspflichten, deren direkte Adressaten die Staaten (und Vertreter der Staaten) und vermittels einer Drittwirkung in indirekter Weise auch die Bürger untereinander sind. Ihm entsprechen aber keine Pflichten gegen sich, da Rechtspflichten (also äußerlich erzwingbare Pflichten) gegen sich nicht möglich sind.25 Neben dieser menschenrechtlichen Verwendung von „Menschenwürde“ bleiben natürlich die anderen Arten von Würdebegriffe, die (moralisch) allgemeinen und die (kulturell und sozial) besonderen Würdebegriffe in Gebrauch. In Fällen konkreter Würdeverletzungen werden diese nicht nur nach der menschenrechtlichen Würdekonzeption, sondern eben auch im Lichte moralisch allgemeiner und sozial besonderer Würdevorstellungen gedeutet und erfahren.26 Und in vielen Hinsichten über-
25
26
barkeit, Tübingen 2007, 175–214; schWeizer, rainer j. / sPrecher, franzisKa, Menschenwürde im Völkerrecht, in: Seelmann, Kurt (Hrsg.), Menschenwürde als Rechtsbegriff, Stuttgart 2004, 127–161. Man kann daher die deutschen Verhältnisse nicht einfach auf internationale übertragen, auch wenn sie, normativ gesehen, oft sehr schlüssig sind. Das ist einer der auffälligsten Unterschiede zu Auffassungen, die „Würde“ wesentlich (oder nur) moralisch verstehen. Wie sich an den letztinstanzlichen Urteilen in Fragen des rechtlichen Verbots einer Peepshow (BVerwGE 45, 187 (229) = NJW 1977 m 1525 und BVerwG NVwZ 1990, 668) oder des sogenannten „Zwergenweitwurfs“ (VG Neustadt, NVwZ 1993, 98) zeigte, ist im Recht diese Auffassung zwar nicht unumstritten, aber doch letztlich anerkannte Meinung, Siehe auch dreier, horst, Art 1., in: ders. (Hrsg.), Grundgesetz-Kommentar, Band 1, 2. Aufl., Tübingen 2004. Ich habe das an zwei Fallbeispielen versucht, deutlich zu machen: Lohmann, GeorG, Die Achtung der Würde des Menschen in der Geriatrie, in: Joerden, Jan C. / Hilgendorf, Eric / Petrillo, Natalia / Thiele Felix (Hrsg.), Menschenwürde in der Medizin: Quo vadis?, Baden-Baden 2012, 125–132; Lohmann, GeorG, Menschenrechte- und Menschenwürdeverletzungen in der Zuwanderungsgesellschaft, in: Lohmann, GeorG / foLLmar, otto Petra, Menschenrechte in der Zuwanderungsgesellschaft, Potsdam 2014, 7–20.
Was umfasst die „neue“ Menschenwürde der internationalen Menschenrechtsdokumente?
21
lagern, verstärken, aber auch verkomplizieren die Bezugnahmen auf die unterschiedlichen Würdekonzeptionen ein angemessenes Verständnis konkreter Würdeerfahrungen. Zumal aus der Erfahrungsperspektive des konkret Betroffenen sich die begrifflich-analytisch trennbaren Konzeptionen mehr oder weniger verbinden zur Verletzung oder Achtung „seiner“ Würde. Insbesondere auch nehmen die Gehalte des menschenrechtlichen Würdebegriffs Bedeutungsinhalte auf, die auch für die anderen Würdekonzeptionen charakteristisch sind oder in ihnen eine Rolle spielen. Das Folgende ist daher ein Versuch, zunächst analytisch den für den menschenrechtlichen Begriff der „Menschenwürde“ charakteristischen inhaltlichen Gehalt zu bestimmen, um auf diesem Wege die einzelnen Konzeptionen deutlicher ordnen zu können und auch systematisch besser begreifen und rechtfertigen zu können. 3. zuM (forMalen) wert unD status
BegrIfflIchen
charakter
Der
„MenschenwürDe“:
Methodisch ist der „neue“ Menschenwürdebegriff aus der Perspektive seines rechtlichen Verwendungskontextes hermeneutisch zu bestimmen,27 d. h. es wird zunächst versucht, aus den in den rechtlichen Menschenrechts-Dokumenten vorgenommenen Verwendungen einen Vorbegriff zu gewinnen, der dann im weiteren Verlauf expliziert, auf seine Stimmigkeit und seinen Gehalt hin überprüft werden kann und zu einem genaueren Begriff gefasst werden kann. Gemäß der hermeneutischen Methode ist freilich nicht zu erwarten, dass hier eine ein-für-alle-Mal abschließende Begriffsbestimmung gelingen kann. Zunächst ist zu fragen, welchen begrifflichen Charakter und auch Status dieser Menschenwürdebegriff als ein außerlegaler Begriff hat, der zur Begründung der Menschenrechte herangezogen werden kann, aber dann, wenn er rechtlich gefasst ist, durch die rechtliche Bestimmung natürlich auch festgelegt wird, vielleicht zu sehr festgelegt wird.28 Als vorverfassungsmäßiger Begriff ist er (aus der Perspektive des Rechts) zunächst abstrakt und vage, aber doch nicht so, dass er gänzlich leer oder (aus der Perspektive der Philosophie) willkürlich verstanden werden kann. Er fasst, so eine erste Vorverständigung, mit Bezug auf ein Menschenbild eine wertende Sicht des Menschen zusammen, wie die Völkergemeinschaft nach den Erfahrungen der Verbrechen gegen die Menschheit den Menschen sehen, verstehen und wertschätzen wollte. Als eine solche performative Wertsetzung stellt „Menschenwürde“ eine neue, politisch deklarierte axia (ein vorverfassungsmäßiges Prinzip) für legitime, rechtlich verfasste politische Herrschaft dar; sie fungiert als Wertbasis für das Haben von 27
28
So auch müLLer, jörn, Ein Phantombild der Menschenwürde: Begründungstheoretische Überlegungen zum Zusammenhang von Menschenrechten und Menschenwürde, in: Brudermüller, Gerd / Seelmann, Kurt (Hrsg.), 2008, 117–48; stePanians, marKus, Gleiche Würde, gleiche Rechte, in: Stoecker, Ralf (Hrsg.), Menschenwürde. Annäherungen an einen Begriff, Wien 2003, 43–63. Im deutschen Grundgesetz ist „Menschenwürde“ formal „Bestandteil der Verfassung“, zugleich aber nicht vollständig und abschließend definiert; siehe Kirste, stePhan, Menschenwürde in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes, in: Joerden, Jan C. / Hilgendorf, Eric / Thiele, Felix (Hrsg.), Menschenwürde und Medizin: Ein interdisziplinäres Handbuch, Berlin 2013, 245 ff.
22
Georg Lohmann
Menschenrechten. Sie ist deshalb, begrifflich gesehen, eine konstituierende Wertsetzung (mit heGeL gesprochen: „als vorausgesetzt gesetzt“), geht in ihrer rechtlichen Faktizität auf ein gemeinsames Wollen (Deklaration, politische Entscheidungen) zurück, in ihrer normativen Geltung (Anerkennungswürdigkeit und Begründbarkeit) aber auf Gründe (auch moralischer Art) und wertbezogene Motive zurück.29 Ich will versuchen, diese komplexe Entstehungs- und Verwendungssituation etwas genauer zu bestimmen. Zunächst einmal ist „Menschenwürde“, begrifflich gesehen, ein Wert, d. h. formal gesehen etwas, was auf Grund einer Wertschätzung beanspruchen kann, etwas anderem vorgezogen zu werden. Dabei wird man die subjektive und intersubjektive Praxis des Vorziehens und Wertschätzen von den Objektivität beanspruchenden Gründen der Würdigkeit des Vorziehens und Wertschätzens unterscheiden können, d. h. die begrifflich als Wert bestimmte „Menschenwürde“ setzt eine bestimmte motivierende Praxis des Wertschätzens und bestimmte Gründe für diese Wertschätzung voraus oder ist in Bezug auf diese beiden Aspekte zu erläutern. „Werte“ sind nach dieser Auffassung keine schon existierenden „absoluten“ Entitäten, die uns, wie die objektivistische Wertlehre meint, irgendwie ergreifen und zu einer Wertschätzung zwingen.30 Da die Praxis des Wertschätzens ein Vorziehen ist, müssen wir die Alternativen angeben können, relativ zu denen wir vorziehen. Wenn wir Menschen in ihrer Menschenwürde schätzen, ziehen wir eine solche Wertung einer Wertung der Menschen z. B. als beliebig verfügbare Sachen (das hieße unter anderem als Sklaven) oder als grundlegend bestimmt durch die Mitgliedschaft oder Zugehörigkeit zu einer partikularen Gruppe, Gemeinschaft oder Menge (z. B. Familie, Religionsgemeinschaft oder Rasse) oder als mit ungleichem Status und Wert behaftet (z. B. nach Geburt, Geschlecht, sozialem Status etc. unterschieden) vor. Relativ zu solchen Wertungen (und vergleichbaren und ähnlichen weiteren) ziehen wir, wenn wir Menschen Menschenwürde zusprechen, diese bestimmte Wertschätzung des Menschen nicht bloß faktisch vor, sondern wir erheben auch den Anspruch, dass diese Wertung besser begründet oder begründbar ist als die genannten Alternativen. Die Wertschätzung aller Menschen hinsichtlich ihrer Menschenwürde ist daher nicht bloß eine faktische (subjektive oder intersubjektive) Wertsetzung, sondern beansprucht auch vorziehenswürdig zu sein, d. h. begründbar und somit objektiv zu sein. Wie (und ob) dieser Begründungsanspruch eingelöst werden kann, wird uns später beschäftigen. Die Motive dafür, allen Menschen eine Menschenwürde zuzuschreiben, sind Antworten auf gravierende Unrechtserfahrungen. Sie entstehen aus der affektiven 29
30
Deshalb ist die Rede von Würde als „inhärenter Wert“ oder als angeborene „innere“ Würde nicht naturrechtlich zu verstehen; damit kann, wie gleich noch auszuführen ist, kein absoluter, transzendent bestimmter Wert gemeint sein, so dass hier der Eindruck entsteht, dass das historisch Neue, wie in der Geschichte häufiger, zunächst in einer „alten Sprache“ formuliert wird. Informativ über die Probleme der Wertlehre immer noch schnädeLbach, herbert, Philosophie in Deutschland 1831–1933, Frankfurt am Main 1983, 198–234; siehe auch schnädeLbach, herbert, „Wert und Würde“, in: Thies, Christian (Hrsg.), Der Wert der Menschenwürde, Paderborn [u. a.] 2009, 21–32. Zu objektivistischen oder absoluten Auffassungen von „Würde“, wie etwa die von joas, hans, Die Sakralität der Person, Frankfurt am Main 2011, siehe Lohmann, GeorG, Nicht affektive Ergriffenheit, sondern öffentlicher Diskurs: Sakralisierte Person oder säkulare Menschenwürde als Basis der Menschenrechte?, in: Große Kracht, Hermann-Josef (Hrsg.), Der moderne Glaube an die Menschenwürde Philosophie, Soziologie und Theologie im Gespräch mit Hans Joas, Bielefeld 2014, 13–27
Was umfasst die „neue“ Menschenwürde der internationalen Menschenrechtsdokumente?
23
Verarbeitung und Erfahrung von Barbarei und „unsagbarem Leid“ (Charta der Vereinten Nationen); sie sind Antworten auf die Verbrechen gegen die Menschheit durch die Nazis und totalitären Diktaturen, auf die Erfahrungen von Krieg, Kolonialismus und Flüchtlingselend. Sie sind aber auch Reaktionen auf zukünftige Bedrohungen und sind in diesem Sinne offen für historische Erfahrungen. Sie beziehen sich auf gravierende Gefährdungen eines Lebens in Würde. In sozialen und kulturellen Kämpfen, in denen um die Anerkennung dieser Wertschätzung jedes Menschen (auch immer wieder neu) gerungen wird, sind daher die Bezugnahmen auf negative Erfahrungen konstitutiv. Daraus folgt aber nicht ein radikaler Negativismus31. Verletzungserfahrungen und die wertende Abwehr von gravierenden Gefährdungen haben zwar gewissermaßen ein methodisches Prius, benötigen aber begrifflich gesehen einen vagen inhaltlichen Vorbegriff, was denn verletzt worden ist oder was gefährdet werden kann. Motive und Gründe beziehen sich dabei auf den besonderen Gehalt der als Wert geschätzten Menschenwürde. Sie enthalten Forderungen oder bringen Absichten und Ziele zum Ausdruck, dass solche Verbrechen oder Gefährdungen „nie mehr“ geschehen oder ungestraft geschehen können, und deshalb fordern „sie“ (d. h. Menschen mit Bezug auf diese Motive und Gründe) die Etablierung einer internationalen Rechtsordnung und verkünden die Anerkennung „der allen Mitgliedern der menschlichen Familie innewohnenden Würde und ihrer gleichen und unveräußerlichen Rechte“ (AEMR, Präambel). Damit aber alle Menschen in der gleichen Weise als Träger von (Menschen-)Rechten anerkannt werden können, müssen sie, vom Recht ausgesehen, nicht bloß einen vorziehenswürdigen Wert darstellen, sondern sie müssen auch hinsichtlich eines Rechtsstatus anerkannt werden, der ihnen als Trägern von Rechten (begriffsnotwendig) zukommt. Um nämlich Träger eines Rechts sein zu können, muss jemand als anerkanntes Mitglied in einer Rechtsgemeinschaft gelten, rechttechnisch ausgedrückt, er oder sie muss in einem rechtlich relevanten Status anerkannt sein. Der wertgeschätzte Begriff der „Menschenwürde“ ist daher mit der Anerkennung eines Status verbunden, dessen genaue Bestimmung freilich noch offen ist. Hier macht sich nun geltend, dass der „Menschenwürde“ Begriff im Kontext des Rechts (und nicht bloß der Moral) verwendet wird. Er bringt nun eine Begründung für einen Rechtsstatus zum Ausdruck,32 und erhält von daher weitere Begriffsbestimmungen. Begrifflich ist „Status“ eine anerkannte Position innerhalb eines Spiels, einer Lebensweise, einer Institution oder Gesellschaft.33 Ein Status ist immer ein auf 31
Wie er etwa von theunissen vertreten worden ist, siehe dazu anGehrn, emiL / finK-eiteL, hin/ iber, christian / Lohmann, GeorG (Hrsg.) Dialektischer Negativismus, Michael Theunissen zum 60. Geburtstag, Frankfurt am Main 1992. Die bekannte Statustheorie von jeLLineK, GeorG, System der Subjektiven öffentliche Rechte, 2. Aufl. Freiburg 1905, setzt nicht bei der Würde an, sondern bei unterschiedlichen Stellungen des Individuums zum Staat; siehe dazu auch Von der Pfordten, dietmar, Status negativus, status activus, status positivus, in: Pollmann, Arnd / Lohmann, Georg (Hrsg.), Menschenrechte: Ein interdisziplinäres Handbuch, Weimar 2012, 216–219. Auf jeLLineKs Statustheorie bezieht sich in seinen anregenden Ausführungen zum Verhältnis von Menschenwürde und Menschenrechten Kirste (Fn 28), hier 252–260. Siehe zu mehr soziologischen Verwendungsweisen von „status“ abeLs, heinz, Status, in: Ritter, Joachim / Gründer, Karlfried (Hrsg.), Historisches Wörterbuch der Philosophie, Bd. 10, Basel 1998, Sp. 110–115. rich
32
33
24
Georg Lohmann
Grund von Wertschätzungen entweder zugesprochener oder erworbener (ascribed or achieved) Status, kann erhöht oder erniedrigt werden, steht im Vergleich oder in Beziehungen mit anderen, ist (statusgemäß) mit bestimmten legitimen (anerkannten) Kompetenzen (Privilegien oder Rechten) und Verpflichtungen ausgestattet. Insofern „Menschenwürde“ nun als Status begründend verstanden wird, gebührt ihr Achtung. Die Achtung der Menschenwürde umfasst so eine Hochschätzung (esteem) als vorziehungswürdiger Wert und eine Respektierung (respect)34 in Bezug auf den Status, der die Trägerschaft von Menschenrechten „begründet“. Was genau nun der Gehalt (Kompetenzen, Rechte und Verpflichtungen) des durch die Menschenwürde begründeten Rechtsstatus ist, wird des Weiteren in Bezug auf die konkreteren inhaltlichen Bestimmungen der Menschenwürde zu klären sein. 4. zuM „MenschenBIlD“
Der
„MenschenwürDe“
Anders als die besonderen (sozialen) Würdebegriffe, die den Menschen nur in einer bestimmten sozialen Rolle fassen, und anders auch als die allgemeinen (moralischen) Würdebegriffe, die den Menschen durch eine dominierende Eigenschaft (z. B. Vernunftfähigkeit) oder Bestimmung (z. B. Gottesebenbildlichkeit) fassen, umfasst das Bild des Menschen, dem „Menschenwürde“ zugeschrieben wird und der Menschenwürde „hat“, den Menschen in einem umfassenden Sinn. Dazu gehört zunächst, dass der Mensch nicht nur als Vernunftwesen, sondern in seiner leiblichseelischen oder körperlich-geistigen, endlichen Verfasstheit gesehen wird. Verletzbar oder gefährdet ist die Menschenwürde daher nicht nur hinsichtlich der intellektuellen Fähigkeiten des Menschen, sondern auch hinsichtlich seines Körpers.35 Zudem ist der Mensch weder als ein atomistisch reduziertes Individuum ohne soziale Beziehungen, noch als metaphysische Entität angesprochen. Menschen führen und erleben ihr Leben, indem sie sich zugleich auf eine Konzeption, wie sie sich insgesamt verstehen, beziehen. Ein Menschenbild36 fasst die einzelnen Momente solcher Konzeptionen zusammen, bildet sie in einem Zusammenhang und ist deshalb immer Gegenstand von Deutungen und Verstehensprozessen.37 Was Menschen, indem sie leben, aus der Teilnehmerperspektive unter „Mensch“ verstehen, und was sie sich, in einer objektivierenden Beobachterperspektive, als „Bestimmung“ oder Begriff des „Menschen“ explizieren können, ist so historisch sich wandelnden Deutungs- und Verstehensprozessen ausgesetzt. Die Wertschätzung und Respektierung (zusammengenommen: Achtung) des Menschen in
34 35 36 37
Zu diesen beiden Bedeutungskomponenten von Achtung siehe den grundlegenden Aufsatz von darWaLL, steVen L., Two Kinds of Respect, in: Ethics, 88 (1977) 1, 36–49. Siehe dazu den aufschlussreichen Band von Van der WaLt, sibyLLe / menKe, christoPh (Hrsg.), Die Unversehrtheit des Körpers, Frankfurt am Main [u. a.] 2007. Siehe dazu auch hiLGendorf, eric, Konzeptionen des „Menschenbildes“ und das Recht, in: Joerden/Hilgendorf/Thiele (Fn 14), 195–216. Siehe Lohmann, GeorG, Überleben und über Leben: Zur Vielfalt der Verständigungen wie zu leben sei, in: Fischer-Geboers, Miriam / Wirz, Benno (Hrsg.), Leben verstehen, Weilerswist 2014 (im Erscheinen).
Was umfasst die „neue“ Menschenwürde der internationalen Menschenrechtsdokumente?
25
seiner Menschenwürde ist daher intern auf ein solches, historisch artikuliertes Menschenbild bezogen.38 Mit der Deklarierung der „Menschenwürde“ erhebt dieses Bild vom Menschen den Anspruch, universell zu gelten, und das heißt auch, mit der internationalen Neufassung der Menschenrechte nun in alle Kulturen und Gesellschaften der Welt „übersetzbar“, verstehbar und anwendbar zu sein. Der Anspruch ist nicht, dass ein entsprechendes Menschenbild schon in allen Kulturen vorhanden ist und man gewissermaßen nur darauf zurückgreifen muss. Die für die internationale Menschenrechtskonzeption konstitutiven Wertschätzungen des Menschen sind, wie wir betont haben, eine historische Neuinterpretation, die zwar in den europäischen Kulturen eher geeignete Vorbegriffe und Überlegungen finden konnte, aber auch in ihnen sich nur durch komplexe und umstrittene Deutungskämpfe, wie man Menschen verstehen soll, oder besser: wie Menschen sich verstehen wollen, „entwickelt“ oder herausgebildet hat.39 Der universelle Anspruch des für die „Menschenwürde“ relevanten Menschenbildes bezieht sich daher auf den Anspruch, heute in allen Kulturen der Welt „übersetzbar“ und verstehbar zu sein, er wird nicht ohne kritische Anstrengungen und Deutungskämpfen in diesen Kulturen akzeptiert und sein normativer Anspruch ist daher der einer Universalisierbarkeit, nicht einer schon vorhandenen Universalität.40 „Naturgemäß“ erfordert dieser Universalisierbarkeitsanspruch begründende Argumentationen, und eine Weise, wie das geschehen kann, sind z. B. die Überlegungen von nussbaum41, die ein historisch sensibles und in diesem Sinne mit schwachen anthropologischen Annahmen gezeichnetes Bild des Menschen entwickelt. Im Einzelnen aber sind die hier aufzuwerfenden Fragen sehr komplex, und können hier nicht angemessen beantwortet werden. Gemäß des hier verfolgten hermeneutischen Vorgehens belasse ich es bei diesem ersten formalen (Vor-)Verständnis und werde nun versuchen, inhaltliche Aspekte zu unterscheiden, in Hinsicht darauf dem einzelnen Menschen eine „Menschenwürde“, ein mit allen anderen Menschen gleicher Wertstatus, zugeschrieben wird. Dass dem bislang ja nur formal umrissenen Begriff der Menschenwürde auch ein inhaltlicher Gehalt zukommen muss, ergibt sich einmal aus dem begrifflichen Umstand, dass die wertende Perspektive des Vorziehens leer wäre, könnte sie nicht einen Inhalt angeben, und zweitens aus dem Anspruch, mit ihm42 inhaltlich ganz 38 39
40
41 42
Dass damit, aus der Sicht des Verfassungsrechtlers, auch Probleme ins Haus stehen, betont dreier, horst, Bedeutungen und systematische Stellung der Menschenwürde im deutschen Grundgesetz, in: Seelmann (Fn 24), 43 ff. Einschlägig sind hier die Untersuchungen von schneeWind, jerome b., The Invention of Autonomy, Cambridge 1998; tayLor, charLes, Quellen des Selbst, Frankfurt am Main 1996. Siehe zu wesentlichen Änderungen im Verständnis von „Würde“ menKe, christoPh, Von der Würde des Menschen zur Menschenwürde: das Subjekt des Rechts, in: West-End: Neue Zeitschrift für Sozialforschung, 2 (2006), 3–21. Siehe dazu Lohmann, GeorG, Unterschiedliche Kulturen – warum universelle Menschenrechte?, in: Holderegger, Adrian / Weichlein, Siegfried / Zurbuchen, Simone (Hrsg.), Humanismus. Sein kritisches Potential für Gegenwart und Zukunft, Basel 2011, 217–232; Lohmann, GeorG, Interkulturalismus und „cross-culture“, in: Pollmann/Lohmann (Fn 32), 210–215. nussbaum hat ihren Ansatz mehrmals geändert, siehe als eine der letzten Versionen nussbaum, martha c., Die Grenzen der Gerechtigkeit, Frankfurt am Main 2010. „Mit ihm“ bedeutet aber nicht, dass „aus ihm“ alle einzelnen Menschenrechte „abgeleitet“ werden sollen.
26
Georg Lohmann
unterschiedliche Menschenrechte begründen zu können. Aus der inhaltlichen Vielfalt der Menschenrechtskataloge könnte man schon vermuten, dass es nicht nur eine inhaltliche Bestimmung sein kann, die hier relevant werden mag. Versuche, hier nur einen Begriff zu nennen (häufig: Freiheit oder auch „Handlungsfähigkeit“), müssen dann ihren Begriff intern so spreizen, dass er entweder ganz seine Kontur verliert, oder aber sie grenzen die Liste der Menschenrechte auf eine selektive Menge ein, die zu ihrem inhaltlichen Verständnis passt und vernachlässigen andere Menschenrechte. Erfolgversprechender scheint mir eine Auffassung zu sein, die von vornherein mit einer Vielfalt des inhaltlichen Gehaltes von „Menschenwürde“ rechnet, diese begrifflich-analytisch differenziert behandelt und dann versucht, sich über ihren Zusammenhalt zu verständigen. Entsprechend will ich im Folgenden nacheinander den „Inhalt“ von „Menschenwürde“ hinsichtlich der Begriffe „Gleichheit“, „Freiheit“ und „Leben“ untersuchen und so, sicherlich in einer noch nicht abschließenden Weise, die Titelfrage dieses Aufsatzes zu beantworten versuchen. 43 5. „MenschenwürDe“ als grunDlegenDe gleIchheIt aller Menschen: ausschluss „prIMärer DIskrIMInIerung“, rechtsgleIchheIt unD BürgerlIche selBstachtung Wir hatten gesehen, dass der Wertstatus, den die „Menschenwürde“ ausdrückt, einer ist, der allen Menschen in der gleichen Weise, nur weil sie Menschen sind, zugesprochen wird. Hinsichtlich dieser kategorischen Gleichheit aller Menschen lassen sich nun erste inhaltliche Bestimmungen von „Menschenwürde“ explizieren. Zunächst einmal ist „Gleichheit“ eine Qualität der Beziehungen oder Verhältnisse zwischen Menschen. Ein einzelner Mensch für sich kann nicht „gleich“ sein. Wenn daher „Gleichheit“ eine wesentliche (in dieser Interpretation die erste und grundlegende) inhaltliche Bestimmung von „Menschenwürde“ ist, dann bringt „Menschenwürde“ eine Wertschätzung zum Ausdruck, die nicht einem einzelnen Menschen ohne Bezugnahme auf andere Menschen zukommen kann, sondern etwas, was begrifflich schon die Bezugnahme auf andere Menschen impliziert. Nun sind Menschen in ihren jeweils konkreten Gestalten oder von „Natur aus“ nicht untereinander gleich. „Gleichheit“ erfordert immer die Angabe einer Hinsicht, in Bezug darauf Mehreres gleich ist, sie abstrahiert von vielen anderen Hinsichten und es ist daher nötig, zu explizieren, in welchen Hinsichten „Menschenwürde“ Gleichheit impliziert. Die zugeschriebene „Menschenwürde“ ist eine Wertschätzung, die allen Menschen in der gleichen Weise zukommt, d. h. es ist begrifflich (aber nicht faktisch!) ausgeschlossen, dass hinsichtlich dieser Wertschätzung einige Menschen anders als andere gewertet werden. Unter der Bedingung, dass ein Lebewesen (kategorial) zur 43
Teilweise ähnlich entwickelt müLLer in seinem anregenden Aufsatz ein „inhaltliches Profil“ der Menschenwürde, freilich setzt er, mit Kant, sehr dominant mit dem Freiheitsbegriff ein, siehe müLLer, jörn, Ein Phantombild der Menschenwürde: Begründungstheoretische Überlegungen zum Zusammenhang von Menschenrechten und Menschenwürde, in: Brudermüller, Gerd / Seelmann, Kurt (Hrsg.), 2008, 132 ff.; Siehe auch ders., Menschenwürde als Fundament der Menschenrechte: Eine begründungstheoretische Skizze, in: Gesang, Bernward / Schälike, Julius (Hrsg.), Die großen Kontroversen der Rechtsphilosophie, Paderborn 2011.
Was umfasst die „neue“ Menschenwürde der internationalen Menschenrechtsdokumente?
27
Klasse der Menschen gehört, scheint der Völkergemeinschaft nach 1945 keine Argumentation mehr zutreffend und überzeugend zu sein, die ihm oder ihr „Menschenwürde“ absprechen könnte.44 D. h., die Annahme der wertmäßigen Gleichheit aller Menschen ergibt sich negativ, als Resultat des Ausschlusses von Argumentationen, die eine grundlegende ungleiche Wertigkeit behaupten oder begründen wollen,45 sie lässt aber andere Ungleichheiten zu. Bezogen auf den Bereich der Moral hatte tuGendhat in einer ähnlichen Weise von dem Ausschluss einer „primären Diskriminierung“46 gesprochen (freilich mit der Angabe der Bedingung „Kooperationsfähigkeit“, was man diskutieren kann)47, bei dessen Anerkennung dann durchaus „sekundäre Diskriminierungen“ vorstellbar und begründbar sind. Die mit der „Menschenwürde“ ausgesprochene Gleichheit ist zugleich eine für alle Menschen. Da sie sich aber als Resultat der Ablehnung von „primärer Diskriminierung“ ergibt, muss nun angegeben werden können, auf welche Inhalte sich denn diese „primäre Diskriminierung“ in Unterschied zur erlaubten oder möglichen „sekundären Diskriminierungen“ bezieht. Das diskursive Medium, in dem diese Unterscheidung zwischen „primären“ und „sekundären“ Diskriminierungen sich abspielt und festgestellt wird, sind die argumentativen Verständigungen darüber, welche schwerwiegenden Verletzungen und Gefährdungen des Menschen seine „Menschenwürde“ betreffen. Verletzungserfahrungen haben, wie wir oben schon angesprochen haben, so einen gewissen methodischen Vorrang. Der Begriff der „Menschenwürde“ muss aber einen vagen inhaltlichen Gehalt vorgeben, damit verständlich werden kann, worauf sich „primäre Diskriminierungen“ beziehen.48 Dieser inhaltliche Gehalt ist zunächst als Annahme, als Glaube formuliert, dass alle Menschen den gleichen grundlegenden rechtlichen Status haben, d. h. dass sie in der gleichen Weise berechtigt sind, als Träger von Menschenrechten anerkannt zu werden. Die „Völker der Vereinten Nationen“ sprechen deshalb in der Charta der Vereinten Nationen von „unserem Glauben an die Grundrechte des Menschen, an Würde und Wert der menschlichen Persönlichkeit“ (Präambel, Hervorhebung von G. L.), und die Präambel der AEMR geht von der „Anerkennung der allen Mitgliedern der menschlichen Familie innewohnenden Würde und ihrer gleichen und unveräußerlichen Rechte“ (Hervorhebung von G. L.) aus. Was hier geglaubt und öffentlich anerkannt wird, ist die gleiche Rechtsträgerschaft aller Menschen, die, wie es 44
45
46 47 48
Das scheint mir auch der Grund zu sein, warum, noch in der Sprache der Naturrechtstradition und daher auch missverständlich, die AEMR davon spricht, dass „alle Menschen … gleich an Würde … geboren“ (kursiv von G. L.) sind. „Geboren“ werden wir weder mit Rechten noch im wörtlichen Sinne „gleich“. Das scheint mir auch ein wesentlicher Unterschied zu Positionen zu sein, die die Gleichwertigkeit aller Menschen aus einen „absoluten“ Wert des Menschen oder seiner Würde folgern, so z. B. VLastos, GreGory, Justice and Equality, jetzt in: Waldron, Jeremy (Hrsg.), Theories of Rights, Oxford 1994, 41–76. tuGendhat, ernst, Vorlesungen über Ethik, Frankfurt am Main 1993, 375 ff.; siehe auch tuGendhat, ernst, Macht und Antiegalitarismus bei Nietzsche und Hitler, in: ders., Aufsätze 1992–2000, Frankfurt am Main 2001, 225–261. Meine eigene Kritik an tuGendhat zu diesem Punkt siehe Lohmann, GeorG, Menschenrechte zwischen Moral und Recht, in: Gosepath, Stefan / Lohmann, Georg (Hrsg.), Philosophie der Menschenrechte, Frankfurt am Main 1998, 62–95, 80 ff. Das entspricht in etwa den „dignitary harms“, von denen rosen (Fn 3), 57 ff. und 156 ff., spricht.
28
Georg Lohmann
die späteren Internationalen Pakte von 1966 formulieren, „sich … aus der dem Menschen innewohnenden Würde herleiten“. Der begrifflich mit „Menschenwürde“ implizierte Gehalt bezieht sich nach dieser Interpretation daher zunächst auf den Status der Rechtsgleichheit aller Menschen. Man kann auch sagen: mit der deklarierten Anerkennung der „Menschenwürde“ wird mit der grundlegenden wertmäßigen Gleichheit aller Menschen auf ihren grundlegenden gleichen Rechtsstatus als Träger von Rechten geschlossen.49 Was aber beinhaltet dieser mit der „Menschenwürde“ anerkannte gleiche Rechtsstatus? Zunächst einmal, dass ein Mensch, der als Träger von Rechten anerkannt ist, rechtstechnisch gesehen als Subjekt von Rechten und Pflichten, d. h. als freie Person, anerkannt wird.50 Mit Rechtsgleichheit ist aber nicht nur ein status passivus (oder status subjectionis im Sinne von jeLLineK51) als passive und gleiche Herrschaftsunterworfenheit gemeint, und damit auch nicht nur die prinzipielle und ubiquitäre Anerkennung eines jeden Menschen als rechtsfähig („engl: „a person before the law“) wie im Artikel 6 der AEMR52, sondern auch die prinzipielle Anerkennung eines, wie im Artikel 15 der AEMR formulierten „Anspruchs auf eine Staatsangehörigkeit“53 (engl.: „the right to a nationality“). Zwischen diesen Ansprüchen besteht nun ein wesentlicher Zusammenhang, der aber unterschiedlich gedeutet werden kann. Seine Deutung hängt zunächst wesentlich von der Auffassung ab, wie das Verhältnis zwischen „Recht“ (law und right!) und dem Rechtsstatus des Einzelnen verstanden wird (a), dann aber charakterisiert er auch das inhaltliche Verständnis von Menschenwürde (b). Ad a) In naturrechtlichen Ansätzen (prominent in den nationalen Konzeptionen der Menschenrechte des 18. Jahrhunderts) ist der Status der Rechtsträgerschaft gewissermaßen eine vorrechtliche Annahme, die mit der „Natur“ des Menschen (absolut) gegeben ist und im politisch gesetzten Recht (law) nur noch übernommen und beachtet werden muss. Rein moralisch argumentierende Ansätze unterstellen ebenfalls, dass die Menschen als Träger von Rechten (rights) vorausgesetzt werden können, manchmal sogar als schlichter Reflex davon, dass sie moralische Pflichten haben.54 Auch religiöse oder theologisch bestimmte Ansätze, die etwa aus der „Sakralität“ des Menschen als Person oder aus dem absoluten Wert oder der Heiligkeit 49
50 51 52 53 54
So auch habermas, jürGen, Das Konzept der Menschenwürde und die realistische Utopie der Menschenrechte, in: Habermas, jürGen (Hrsg.), Zur Verfassung Europas, Frankfurt am Main 2011, 21 f. Schon 1970 hatte joeL feinberG formuliert: „What is called „human dignity“ may simply be the recognizable capacity to assert claims“, feinberG, joeL, The Natur and Value of Rights, in: Journal of Value Inquiry 4, 1070, 252. „Menschenwürde“ ist daher die gesuchte Begründung für die Forderung von hannah arendt, nach einen „Recht, Rechte zu haben“; siehe dazu Lohmann (Fn 14), 182 ff. Siehe zum Folgenden Kirste (Fn 28), hier 252–260; siehe auch Kirste, stePhan, Das Fundament der Menschenrechte, in: Der Staat, 52 (2013) 1, 123 f. jeLLineK, GeorG, System der Subjektiven öffentliche Rechte, 2. Aufl. Freiburg 1905, 197. „Jederman hat das Recht, überall als rechtsfähig anerkannt zu werden“, Art.6, AEMR, abgedruckt in Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.), Menschenrechte. Dokumente und Deklarationen, 3. Aufl., Bonn 1999, 54. Art. 15 Abs. 1 der AEMR, Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.), Menschenrechte. Dokumente und Deklarationen, 3. Aufl., Bonn 1999, 55. Gegen diese Auffassung habe ich schon mehrmals argumentiert, zuletzt in Lohmann, GeorG, Welchen Status begründet die Menschenwürde?, Ms. 2012, im Erscheinen.
Was umfasst die „neue“ Menschenwürde der internationalen Menschenrechtsdokumente?
29
seiner „Würde“ folgern, dass er Träger von Rechten (rights) ist, greifen auf Annahmen zurück, die dem Recht selbst (law) gegenüber transzendent sind und zumeist mit einem absoluten Anspruch das Haben von Rechten (rights) dekretieren. In diesen Ansätzen ist das Recht selbst in seiner Legitimität von der Beachtung der dem Recht transzendenten Prämissen abhängig. Dass konkrete Rechtssysteme selbst auf Gesetzgebungsprozesse zurückgehen, ist für diese Legitimitätskonzeptionen zweitrangig. Dagegen wendet sich das moderne Rechtsverständnis. Angesichts der prinzipiellen Positivität und Machbarkeit des modernen Rechts (law), „das mit dem Anspruch auf systematische Begründung sowie verbindliche Interpretation und Durchsetzung auftritt“55 und der Tatsache, dass die Menschenrechte in der internationalen Konzeption der Menschenrechte und in den neuen nationalen (und regionalen) Verfassungen nun Bestandteile des positiven Rechts sind, erscheinen solche, dem Recht selbst gegenüber transzendenten und/oder absoluten Bestimmungen der Rechtsträgerschaft problematisch.56 Aus dieser Einsicht folgt nun nicht, dass man einen kruden dezisionistischen Rechtspositivismus57 vertreten muss, sondern es scheint mehrere überzeugende Lösungen für die Selbstbindung der Rechtssetzung an objektivierbar, aber nicht (mehr) absolute Normen zu geben.58 Will man keine absoluten und dem Recht transzendenten Prämissen akzeptieren,59 so muss der Rechtsstatus des Einzelnen zugleich mit der allgemeinen Rechtssetzung begriffen werden können. habermas hat dazu einen Vorschlag gemacht, dem ich mich hier anschließen kann. Der entscheidende Satz für diesen dem Recht immanenten Ansatz ist habermas These, dass die Anerkennung des „Status von Rechtspersonen“ und damit auch das „System der Rechte“ sich genau dann ergibt, wenn die Bürger „ihr Zusammenleben mit Mitteln des positiven Rechts legitim regeln wollen“60. Bestimmend ist hier rousseaus Idee der Selbstgesetzgebung. habermas folgt freilich nicht Rousseaus problematischer Idee eines „allgemeinen Willens“, sondern interpretiert die Idee der „Selbstgesetzgebung von Bürgern“ so um, dass hier „die private und die öffentliche Autonomie der Bürger gleichgewichtig zur Geltung“61 zu bringen sei. Da in den Prozessen der wechselseitigen Anerkennung der Rechtsträgerschaft und in den Prozessen der Rechtssetzung des Rechts niemand der Beteiligten ungleich gewertet wird, da alle hier einen prinzipiell gleichen Wertstatus und gleiche Rechte haben, folgt daraus, dass jeder nicht nur in der gleichen Weise wie alle anderen Adressat des Rechts ist, also als rechtsfähig dem Gesetz unterworfen ist, sondern auch, dass jeder in der gleichen Weise wie alle anderen Autor des Rechts und der Gesetze sein kann. Ad b) Damit haben wir nun auch eine Antwort auf die obige zweite Frage: Der Status, der mit der deklarierten Anerkennung der gleichen Menschenwürde aller 55 56
57 58 59 60 61
Siehe habermas, jürGen, Faktizität und Geltung, Frankfurt am Main 1992, 106 ff. Lehnt man aus grundsätzlichen Überlegungen, die sich auf die Endlichkeit des Menschen beziehen, absolute oder „vertikale“ Bestimmungen von Moral und Recht ab, so müssen Lösungen in einer „horizontalen“ Bestimmung gesucht werden. Siehe dazu vorerst Lohmann, GeorG, Ethik der radikalen Endlichkeit, in: Information Philosophie, 42 (2014) 1, 5–11. Siehe kritisch dazu aLexy, robert, Begriff und Geltung des Rechts, Freiburg [u. a.] 1992. Siehe für die deutsche Diskussion dreier, horst, Gilt das Grundgesetz ewig? Fünf Kapitel zum modernen Verfassungsstaat, München 2009. Siehe dazu auch VorLänder, hans (Hrsg.), Transzendenz und die Konstitution von Ordnungen, Berlin 2013. Siehe habermas (Fn 55), 151, kursiv von G. L. Ebd.
30
Georg Lohmann
Menschen jedem einzelnen Menschen nun zugeschrieben wird, ist nicht nur „Rechtsfähigkeit“ in der Bedeutung eines Status gleicher Rechtsunterworfenheit („a person before the law“), und nicht nur gleiche Rechtsträgerschaft oder Rechtsperson, sondern eben auch mit dem Anspruch62 auf gleiche Autorschaft für das Haben von Rechten, d. h. gleiche Mitwirkung bei der Rechtssetzung, verbunden.63 Letzteres wird traditionell der aktiven Rolle des Staatsangehörigen oder Bürgers (citoyen, nationality) zugeschrieben. Freilich ist, angesichts der Pluralität und Partikularität der vielen Staaten, die Anerkennung einer Staatsbürgerschaft, auf die die Anerkennung der Menschenwürde nun einen Anspruch verleiht, gemessen am universellen Anspruch der Menschenwürde, nur eine defiziente Lösung. Kants Idee der Weltbürgerschaft weist hier in die richtige Richtung, ist aber selbst mit neuen Problemen behaftet, auf die ich hier aber nicht eingehen kann.64 Für unsere Überlegungen muss genügen, dass ein erster Aspekt des inhaltlichen Gehaltes der „Menschenwürde“ gewissermaßen einen republikanischen Anspruch zum Ausdruck bringt, nach dem die Achtung der Menschenwürde jedes Menschen nun sich (auch) auf seine Berechtigung bei der politischen Selbstgesetzgebung mitzuwirken bezieht. Ich will anmerken, dass überraschender Weise Kants erste begriffliche Bestimmung von „Würde“ genau diese republikanische Idee der Selbstgesetzgebung unterstellt. Im Kontext seiner Ausführungen zum „Reich der Zwecke“ spricht Kant zum ersten Mal von „der Idee der Würde eines vernünftigen Wesens, dass keinem Gesetz gehorcht als dem, das es zugleich selbst gibt.“65 Was Kant, in Anknüpfung an rousseau, als moralische Gesetzgebung formuliert, kann und muss nun wieder in den politischen Kontext rückübertragen werden. Die politisch deklarierte „Menschenwürde“ 62 63
64 65
Kirste formuliert hierfür die Unterscheidung zwischen der „Rechtssubjektivität“, die durch die Menschenwürde begründet wird, und der „Rechtsperson“, die die Trägerin konkreter Rechte ist, siehe Kirste (Fn 28), 254. Mit diesem republikanischen Verständnis gehe ich auch über das Verständnis des mit „dignity“ verbundenen „status“ hinaus, wie ihn WaLdron (Fn 18), versteht. WaLdrons These ist, dass dieser Rechtsstatus eine Generalisierung des ehemals priviligierten Status des Adels ist und sich in der Fähigkeit ein „self-directing agent“ zu sein ausdrückt, siehe dazu auch beitz (Fn 22), 288 ff. stoecKer weist darauf hin, dass schon Schiller „Würde“ als „universalisierter Adel“ versteht, stoecKer, raLf, Die Pflicht, dem Menschen seine Würde zu erhalten, in: Zeitschrift für Menschenrechte, (2010) 1, 108 ff. Gegen diese These spricht aber, dass dem adeligen Rang von vorherein eine Höherstellung zu anderen Menschen gemäß ihren sozialen Ständen begrifflich innewohnt, und deshalb diese These in sich widersprüchlich ist. Die mit dem Statusbegriff begrifflich notwenigen Bedeutungselemente der Hochgeschätztheit und Vorziehenswürdigkeit werden im Begriff der „Menschenwürde“, wie auch bei den allgemeinen Würdekonzeptionen, nicht innerhalb der Menge der Menschen verstanden, sondern eben in Bezug auf andere nichtmenschliche Lebewesen. Freilich, Menschen wird nicht eine Würde zugeschrieben, weil sie sich über andere Lebewesen stellen! Siehe dazu auch habermas (Fn 49), 27 f. Siehe dazu Lohmann, GeorG, Menschenwürde und Staatsbürgerschaft, in: MenschenRechtsMagazin, (2012) 2, 155–168, und: Lohmann 2012, (Fn 54). Kant, immanueL, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, Akademie Ausgabe Bd. IV, 434. Siehe zu Kants Würdebegriff seeLmann, Kurt, ‚Menschenwürde‘ als ein Begriff des Rechts?, in: Gander, Hans-Helmuth (Hrsg.), Menschenrechte: Philosophische und juristische Positionen, Freiburg 2009; Von der Pfordten, dietmar, Zur Würde des Menschen bei Kant, in: ders. (Hrsg.), Menschenwürde, Recht und Staat bei Kant, Paderborn 2009, 9–26. Siehe zu meiner Kantinterpretation und der These vom republikanischen Gehalt der Menschenwürde, Lohmann, GeorG (Fn 14), 185 ff.
Was umfasst die „neue“ Menschenwürde der internationalen Menschenrechtsdokumente?
31
meint nun, dass jeder Mensch nicht bloß als Träger von Rechten anerkannt ist, sondern auch, dass er oder sie einen Anspruch hat, als Autor dieser Rechte anerkannt und respektiert zu werden. Weil daher, von normativen Gehalt der „Menschenwürde“ ausgesehen, jedes Menschenrecht, das einem Menschen zugeschrieben wird, dem normativen Anspruch nach von ihm selbst in einer allgemeinen Gesetzgebung mit allen anderen mitgesetzt werden muss, fordert (und vielleicht überfordert)66 der republikanische Gehalt der Menschenwürde eine letztlich globale Demokratisierung aller Rechtsetzungen. Er opponiert damit jeder Art von Paternalismus, sei er moralischer oder politische Art. Dieser republikanische Gehalt der Menschenwürde erlaubt nun jedem Menschen, sich als gleichwertiges und gleichberechtigtes Mitglied der universellen Rechtsgemeinschaft aller Menschen zu verstehen. Er verleiht ihm oder ihr mit der universell anerkannten Rechtsgleichheit den Anspruch auf die gleiche Rechtsstellung als Bürger (Staatsbürger und Weltbürger) und erlaubt ihm so eine Selbstachtung als Bürger, die auf der anerkannten gleicher Wertschätzung und dem zuerkannten gleichen Rechtsstatus beruhen. In dieser Selbstachtung wird er verletzt, wenn er gedemütigt wird, wenn er willkürlich diskriminiert wird, und sein Anspruch auf grundlegend gleiche Wertschätzung und gleichen Rechtsstatus nicht geachtet wird.67 In diesem subjektiven Reflex der deklarierten Menschenwürde, in dem Bewusstsein seiner Würde, verdichten sich nun diese rechtlich begründete Selbstachtung mit den weiteren inhaltlichen Gehalten der „Menschenwürde“. 6. „MenschenwürDe“ als fähIgkeIt unD freIheItsBewusstseIn
zu üBerlegter
selBstBestIMMung
Die mit der „Menschenwürde“ anerkannte grundlegende Wert- und Rechtsgleichheit aller Menschen ist nicht ohne Bezugnahme auf ihre Freiheit, d. h. auf ihre Fähigkeiten, sich selbst in überlegender Weise zu bestimmen, zu verstehen. Traditionell und zumeist wird der Freiheitsbegriff als der entscheidende erste Begriff zu Bestimmung von „Würde“ herangezogen. Gleichheit wird dann als begriffliche Folgerung eines bestimmten Verständnisses von Freiheit gewissermaßen nachgereicht. Richtig an diesem Vorgehen ist, dass der Freiheitsbegriff, radikal verstanden, auch ohne Beziehung auf andere expliziert werden kann, während Gleichheit von vornherein begrifflich eine Beziehung auf andere erfordert. Frei, in einem radikalen Sinne, bin ich gerade auch gegen die gemeinschaftlichen Beziehungen zu anderen, von denen ich zugleich lebensnotwendig abhängen mag. Freiheit kann radikal vereinzeln, muss aber nicht nur in dieser einseitigen Weise verstanden werden. In den oben unterschiedenen Arten von (moralisch) allgemeiner Würde (wie auch in den Begriffen besonderer Würde) sind die Fähigkeiten zur freien Selbstbestimmung entscheidend, auch wenn sie, wie z. B. in der christlichen Annahme der Gottesebenbildlichkeit, nicht allein begründend sind. Freiheit wird in diesen Konzeptionen verstanden als selbst nochmal von etwas anderen abhängig: von der Natur, der Kreatürlichkeit oder Vernunft. Frei ist der Mensch nur, wenn er sich zugleich 66 67
Siehe Lohmann 2014 (Fn 11). Siehe marGaLit, aVishai, Politik der Würde, Berlin 1997.
32
Georg Lohmann
seiner Natur, seiner Kreatürlichkeit oder seiner Vernunft gemäß bestimmt. Das sind mitbestimmende Gründe, warum diese Würdekonzeptionen den Menschen immer auch mit Pflichten gegen sich, gemäß seiner Würde, verstehen. Der nach-45-ziger Begriff der „Menschenwürde“ löst diese Verbindung; er ist nicht „von Haus aus“ oder begrifflich mit Pflichten gegen sich verbunden. Als ein inhaltlich auf Rechtsgleichheit bezogener Begriff bestimmt er aber auch das Vermögen, sich frei bestimmen zu können, in einer gewissermaßen moralisch schwächeren Weise: „Menschenwürde“ kommt einem Menschen schon deshalb zu, weil er Mensch ist, und dazu gehört als Bestimmung seiner Freiheit die prinzipielle Möglichkeit, sich in überlegender Weise, d. h. durch Gründe, zu bestimmen, was nicht gleich bedeutet, dass es nur moralische rechtfertigbare Gründe sein können. Für die Freiheitsvorstellungen kann diese Unterscheidung begrifflich-theoretisch unterschiedlich bestimmt werden. Kant etwa spricht von Willkürfreiheit, die für das Recht vorausgesetzt werden muss, im Unterschied zur „Freiheit“ im Sinne einer vernünftigen (= moralischen) Autonomie, die für die Moral entscheidend ist. habermas unterscheidet die „Willkürfreiheit“ von Rechtspersonen von den „Verpflichtungen kommunikativer Freiheit“, von denen die „rechtlich geschützten subjektiven Freiheiten entbinden.“68 Die Anerkennung der Rechtsgleichheit aller Menschen erfordert nur, dass jedem Menschen im Prinzip seine Handlungen und Unterlassungen zugerechnet werden können, dass er verantwortlich handeln kann und das heißt, dass er frei in dem Sinne ist, dass er die Fähigkeiten (Möglichkeiten) besitzt, Gründe abzuwägen und sich nach Gründen in überlegender Weise zu bestimmen und zu rechtfertigen. Auf diese Freiheitsvorstellung im Sinne einer, nicht schon moralischen Selbstbestimmungsfähigkeit bezieht sich inhaltlich der Begriff der „Menschenwürde“. Dieser Freiheitsbegriff ist nun nicht in dem Sinne zu verstehen, dass ein Einzelner seine Freiheit ohne jede Beziehung auf andere (atomistisch) oder nur auf Kosten der anderen („egoistisch“ im negativen Sinn) realisieren kann. Insofern jemand sich durch Gründe bestimmt, bezieht er sich auf Andere, aber nicht notwendigerweise auf alle Anderen. Rechtfertigende Gründe sind begrifflich etwas, das auch für andere in vergleichbaren Situationen begründend sein kann, und diese Fähigkeiten, Gründe abzuwägen, müssen prinzipiell69 unterstellt werden, wenn jemandem „Menschenwürde“ und damit die Fähigkeit sich frei zu bestimmen, zugeschrieben wird. Das 68 69
habermas (Fn 55), 151 f. D. h. es sind mit seiner Menschlichkeit gegebene Möglichkeiten, nicht faktisch realisierte Fähigkeiten. Ab wann und bis wann einem Menschen diese Fähigkeiten, aus der Perspektive des Rechts, konkret zugeschrieben werden können, ist im engeren Sinne keine moralisch zu entscheidende Frage, sondern eine Frage, die in Kohärenz zu gutbestätigtem empirischen Wissen über Menschen letztlich politisch durch Rechtsetzung entschieden wird, aber auch dann für wissenschaftliche, moralische und weltanschauliche Kritik und Auseinandersetzung offen bleibt. Rechtlich und politisch gibt es hier große nationale Unterschiede; international sind die Fragen weitgehend offen gelassen, und da die moralischen Urteil nicht auf gemeinsame Entscheidungen, sondern sich im Raum der Gründe bewähren müssen, ist es kein Wunder, wenn diese Fragen weitgehend, besonders aus religiös und weltanschaulich unterschiedlichen Auffassungen, umstritten sind. Hier wird nur behauptet, dass prinzipiell jedem Wesen, wenn es als Mensch anerkannt ist, die Möglichkeiten zu diesen Fähigkeiten zugeschrieben wird, nicht schon, dass der Begriff der Menschenwürde entscheidet, ab wann und bis wann diese Fähigkeiten faktisch zugeschrieben werden können.
Was umfasst die „neue“ Menschenwürde der internationalen Menschenrechtsdokumente?
33
enthält freilich auch die Möglichkeiten, sich gegen andere oder sich nicht gemäß den normativen Ausdeutungen der Menschenwürde zu bestimmen, oder auch, sich überhaupt gegen Gründe zu entscheiden. Man kann auch sagen: Die wertmäßige und deklarierte Anerkennung der „Menschenwürde“ verleiht jedem Menschen ein subjektives Recht, sich gemäß seiner Willkürfreiheit zu bestimmen, legt ihn aber begrifflich weder auf negativen Egoismus noch auf moralischen Altruismus fest. Das positive, moderne Recht selbst verlangt, mit Kant zu sprechen, dass diese Willkürfreiheit nur durch die gleiche Willkürfreiheit aller anderen begrenzt werden kann, aber es schreibt dem einzelnen nicht vor, mit welchen Gründen und Motiven er seine Willkürfreiheit im Rahmen des Rechts betätigt. Einschränkungen der mit der Anerkennung der Menschenwürde jedem Menschen zugestandene Willkürfreiheit dürfen, dem Recht gemäß, nur durch äußerlich erzwingbare Rechtspflichten erfolgen und beziehen sich nur auf äußere Verhaltensweisen; innere Einstellungen, Werthaltungen und Überzeugungen sind für das Recht unmittelbar nicht bestimmbar, kontrollierbar oder erzwingbar. Gleichwohl hat diese mit der Anerkennung der Menschenwürde jedem Menschen zugestandene Freiheit für den Gehalt des zugeschriebenen Wertstatus eine entscheidende Bedeutung: Weil nun jedem Menschen die wertgeschätzte und geachtete Fähigkeit zu überlegender Selbstbestimmung zugeschrieben wird, deshalb ist jeder Mensch in seinem Wertstatus, obwohl wertmäßig und rechtlich mit allen anderen gleich, zugleich von allen auch unterscheidbar, er ist selbstverantwortlich und unersetzbar. Das gerade fordert auch der oben erläuterte republikanische Gehalt der „Menschenwürde“. Zwar können einige oder alle sich nach den gleichen Gründen bestimmen, sodass es hinsichtlich der Begründungsqualität keinen Unterschied zwischen ihnen geben könnte, und es egal wäre, ob nun die Gründe von A oder von B in Betracht gezogen werden, die angenommene Freiheit verlangt aber, dass jeder einzelne in seiner individuellen Entscheidung beachtet wird und nicht durch die sachlich gleiche und gleich gut begründete Entscheidung eines anderen ersetzt werden kann.70 Es kommt immer darauf an, dass ein jeder überzeugt worden ist und was er auf Grund seiner (oder ihrer) Überzeugung für richtig hält und entscheidet. Die deklarierte „Menschenwürde“ gibt damit jedem Einzelnen einen nichtersetzbaren Wert und anerkannten Status als selbstverantwortliches Subjekt. Auf Grund dieses individualisierenden Charakters der Freiheit, die mit der „Menschenwürde“ allen in der gleichen Weise zugeschrieben wird, erlaubt die wertgeschätzte Menschenwürde ein individualisierendes Freiheitsbewusstsein. Sie gibt jedem Menschen ein hochgeschätztes Bewusstsein, dass es an ihm liegt, wie er sein Leben führt, dass er sich in seiner Subjektivität als unersetzbar und, soweit er die gleiche Freiheit aller anderen beachtet, respektiert verstehen kann. Wiederum sind 70
Kant greift, um die Unersetzbarkeit des würdigen Menschen zu erläutern, mit der Metapher des „Entspringens“ auf seinen Begriff der Freiheit als Spontanität zurück und fordert deshalb, dass „diese Gesetzgebung (im Reich der Zwecke, G. L.) … in jedem vernünftigen Wesen selbst angetroffen werden und aus seinem Willen entspringen können“ muss (Kant (Fn 65), 434, Hervh. v. G. L.). Er gibt damit eine Erläuterung zur Begründung der Unersetzbarkeit, die vielleicht besser zu seiner zweiten, konkurrierenden Rede von Würde als „innerer Wert“ passt, gegenüber der republikanische Struktur der allgemeinen Gesetzgebung im „Reich der Zwecke“, die republikanisch die Unersetzbarkeit jedes Einzelnen unterstellt, aber eher als Ergänzung wirkt. Siehe zur Kantinterpretation seeLmann (Fn 65).
34
Georg Lohmann
es Verletzungserfahrungen und drohende Gefährdungen, die ihn Einschränkungen, Missachtungen und Demütigungen seiner Freiheit, d. h. seiner prinzipiellen Fähigkeiten sich selbst überlegt zu bestimmen, als Verletzungen und Gefährdungen seiner Menschenwürde verstehen lassen. Verletzungen dieser inhaltlich als Freiheit gedeuteten „Menschenwürde“ können in der Kantianischen Tradition als pure Instrumentalisierung für nicht selbst(-mit-)bestimmte Zwecke, als Nichtanerkennung des Übersich-selbst-Verfügenkönnens, als Nichtgefragtwerden bei wichtigen Lebensentscheidungen, als prinzipielle Leugnung der verantwortlichen Handlungsfähigkeit überhaupt, etc. gedeutet werden. Insbesondere sind es Leugnungen oder Missachtungen der prinzipiellen Möglichkeiten des Einzelnen, sich frei zu bestimmen oder aber Missachtungen seiner je individuellen Entscheidungen, die als Verletzungen seiner Menschenwürde erfahren werden. Auch hier opponieren die inhaltlichen Gehalte der Menschenwürde gegen einen noch so gut gemeinten Paternalismus! Dieses Freiheitsbewusstsein, das jedem Menschen durch die Anerkennung seiner Menschenwürde ermöglicht wird, stockt sich gewissermaßen politisch auf, wenn auf seinen mit der Menschenwürde anerkannten Anspruch auf einen gleichen Rechtsstatus und seine Rechtsträgerschaft Bezug genommen wird. Dann ist es gemäß des Anspruches als Bürger (Staatsangehöriger und Weltbürger) mit allen Menschenrechten anerkannt zu sein, ein Freiheitsbewusstsein als Bürger, in dem sich sein Bewusstsein seiner Würde artikuliert. Leugnungen oder Missachtungen seiner Rechtssubjektivität, seiner Freiheiten, über sein Wohl und seine Rechte selbst zu entscheiden, seines prinzipiellen Anspruchs Träger und Autor von Menschenrechten zu sein, werden daher als Verletzungen seiner Menschenwürde und seiner Freiheit erfahren. Konkretisiert wird dieses Freiheitsverständnis durch die entsprechenden auf den Schutz der Freiheiten bezogenen Menschenrechte. Von hierher kann auch die motivierende Kraft erklärt werden, die im politischen (und kulturellen und sozialen) Kämpfen gegen Verletzungen der Menschenwürde sich zeigt und die wesentlich als Verteidigung oder Erkämpfung der prinzipiell zuerkannten und beanspruchten Freiheiten als Bürger zu verstehen ist. 7. „MenschenwürDe“ als anspruch auf eInen „angeMessenen leBensstanDarD“ unD DIe selBstverantwortlIche sorge uM eIn leBen In würDe Anders als der intellektualistische Würdebegriff in der kantischen Tradition enthält der Begriff der „Menschenwürde“, dank der erweiternden Kritik der sozialistischen Arbeiterbewegung im 19. Jahrhundert an den damaligen Würdebegriffen,71 von Beginn an den Bezug auf den geistigen und körperlichen und entsprechend bedürftigen Menschen. Das Menschenbild der „Menschenwürde“ bezieht sich aber ebenso auch auf die kulturellen und sozialen Beziehungen und Bedingungen menschlichen Lebens, es erfasst den Menschen, wie wir oben gesagt hatten, in einer umfassenden Weise. Damit kommen nun inhaltliche Gehalte in den Blick, die unter den Gesichtspunkten der Rechtsgleichheit und der individualisierenden Freiheit nicht schon eo 71
Siehe dazu Lohmann (Fn 20), 67–78; Lohmann, GeorG, ‚Human dignity and socialism‘, in: Düwell, Marcus / Braavig, Jens / Brownsword, Roger / Mieth, Dietmar (Hrsg.), The Cambridge Handbook of Human Dignity, Cambridge 2014, 126–134.
Was umfasst die „neue“ Menschenwürde der internationalen Menschenrechtsdokumente?
35
ipso erfasst sind. Man kann sie, wie oben geschehen, als Ansprüche auf einen „angemessenen Lebensstandard“ (Art.25.1 AEMR) oder auf ein gesichertes Existenzminimum oder, wie in der sozialistischen Tradition formuliert, auf ein „menschenwürdiges Leben“ verstehen.72 Bevor ich versuche, diese Ansprüche etwas genauer zu umreißen, will ich noch eine Bemerkung zu den theoretisch-methodischen Bestimmungen dieses Gehaltes machen und damit auch zur Frage nach dem Zusammenhang der inhaltlichen Aspekte von Menschenwürde. Konzeptionen von Würde, die diese ausschließlich oder ganz wesentlich als Freiheit verstehen, und entsprechend „Gleichheit“ als begründet durch Freiheit erläutern oder „ableiten“, verstehen die Bestimmungen eines Existenzminimums als Mittel, um der gleichen Freiheit aller auch einen Wert für den Einzelnen zu geben73 oder aber sie bestimmen sie als ermöglichende Bedingungen, um die würdebasierten Freiheiten realisieren zu können.74 Etwas anders setzen Versuche an, die den traditionell negativ verstandenen Freiheitsbegriff durch Konzeptionen von positiver Freiheit erweitern75 und dann, freilich im Horizont eines erweiterten Freiheitsverständnisses, die Bedingungen und Fähigkeiten frei zu sein, mit in den Gehalt des Würdebegriffes (oder in die Liste der Menschenrechte) aufnehmen können. Ferner kann man auch versuchen, indem man die mit den Menschenrechten korrelierten (negativen) Pflichten des Respektes oder der Achtung durch die ebenfalls moralisch gut begründeten (positiven) Pflichten des Schützens und der Gewährleistungen oder Helfens erweitert,76 den durch die Menschenwürde angesprochenen Gehalt um eben diese Ansprüche auf ein gesichertes Existenzminimum zu ergänzen. Viertens schließlich versuchen anthropologische Ansätze aus grundlegenden Interessen, Bedürfnissen oder Fähigkeiten des Menschen unmittelbar auf Bestimmungen eines Existenzminimums zu schließen und verstehen „Würde“ dann als begründenden Anspruch auf die rechtlich gesicherte Befriedigung dieser anthropologisch zu bestimmenden Gehalte.77 Diese (und vielleicht auch noch weitere Ansätze) sind in ihrer Komplexität hier nicht im Einzelnen zu diskutieren. Meine Einschätzung ist, dass sie sich wechselseitig ergänzen und kritisieren, dass, wie auch sonst beim philosophischen Geschäft der Begründungen der Menschenrechte, ein möglicher Pluralismus der Begründungen akzeptiert werden kann78 und dass daher für den hier umrissenen Vorschlag nicht der Anspruch erhoben werden sollte, die einzige mögliche Zugangsweise vorzulegen. Ich tendiere zu der Annahme, dass die Ansprüche auf ein gesichertes Existenzminimums nicht nur als Mittel oder Bedingungen für würdegeschützte Freiheit und Gleichheit bestimmt werden sollten, sondern dass sie für eigenständige Ansprüche ein Leben in Würde führen zu können, stehen. Anzeichen für diese Auffassung sind 72
Dass das im deutschen Verfassungsrecht zunächst geleugnet oder umstritten war, zeigt maihoWerner, Rechtsstaat und menschliche Würde, Frankfurt am Main 1968, 37 ff. So raWLs, john, Eine Theorie der Gerechtigkeit, Frankfurt am Main 1975, 232 f. habermas (Fn 50), 156 f. tuGendhat, ernst, Vorlesungen über Ethik, Frankfurt am Main 1993, 358 ff. Paradigmatisch durch shue, henry, Basic Rights, Princeton 1980. nussbaum, martha, Die Grenzen der Gerechtigkeit, Frankfurt am Main 2010; LadWiG, bernd, Anthropologie und Naturalismus, in: Pollmann/Lohmann (Fn 32), 186–192. Lohmann, GeorG, Zur Verständigung über die Universalität der Menschenrechte. Eine Einführung, in: Nooke, Günter / Lohmann, Georg / Wahlers, Gerhard (Hrsg.), Gelten Menschenrechte universal? Begründungen und Infragestellungen, Freiburg [u. a.] 2008, 55. fer,
73 74 75 76 77 78
36
Georg Lohmann
Erfahrungen von Würdeverletzungen, in denen nicht die Ansprüche auf Freiheit oder Gleichheit betroffen sind, sondern die mit den besonderen Lebensnotwendigkeiten gegebenen Ansprüche sein Leben leben zu können. Zum Beispiel in Fällen großer Not, in denen Menschen (durch Naturkatastrophen oder durch selbst unverschuldete wirtschaftliche oder politische Katastrophen) unter ihr Existenzminimum gedrückt werden, können sehr wohl wesentliche Freiheits- und Gleichheitsrechte erfüllt sein, die lebensnotwendige Befriedigung von Subsistenzmitteln aber nicht. Auch Situationen von absoluter Armut lassen sich besser beurteilen, wenn in ihnen Verletzungen der mit der Menschenwürde anerkannten Ansprüche auf ein „Leben in Würde“ gesehen werden.79 Diese Menschenwürde basierenden Ansprüche begründen die Vielzahl von Subsistenzrechten, zu denen insbesondere die Menschenrechte auf Leben, Ernährung, Wohnen, Gesundheit und z. B. Wasser gehören.80 Ganz allgemein können sie zur Begründung der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte herangezogen werden.81 Für diesen normativen Gehalt der „Menschenwürde“ sind nun eine Reihe von Eigentümlichkeiten charakteristisch, die freilich auch bei den anderen hier unterschiedenen Inhalten eine Rolle spielen, hier aber besonders auffällig sind und entsprechende Probleme hervorrufen. Zunächst einmal erscheint eine genaue, inhaltliche Bestimmung dessen, was mit einem „Leben in Würde“ oder „gesichertes Existenzminimum“ oder auch mit „angemessenen Lebensstandard“ gemeint ist, aus systematischen und kulturellen Gründen schwierig. Der Ausschuss für Wirtschaftliche, Soziale und kulturelle Rechte der VN stellt fest: „Was genau unter „Angemessenheit“ zu verstehen ist, wird in starkem Maße von den vorherrschenden sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen, klimatischen, ökologischen und sonstigen Bedingungen bestimmt“.82 Der inhaltliche Gehalt dieses Aspektes der Menschenwürde kann daher nicht schon eine genaue Liste von Fähigkeiten oder Bedürfnissen enthalten, die zu erfüllen sind, sondern muss notwendig vage bleiben und durch weitere, letztlich politisch zu entscheidende Bestimmungen ergänzt werden. Zudem stehen zweitens die auf ein angemessenes Leben-können bezogenen Inhalte der Menschenwürde für Menschenrechte, die in klarer Weise nicht nur negative Unterlassungspflichten, sondern positive Pflichten des Schutzes und der Hilfe oder Gewährleistung erfordern. Lange Zeit war deshalb die Klasse der sozialen (genauer: der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen) Menschenrechte nicht als mit den Freiheitsrechten gleichwertig anerkannt. Der IPwskR ist durch diese Auffassung 79 80 81
82
Siehe schaber, Peter, Globale Hilfspflichten, in: Bleisch, Barbara / Schaber, Peter (Hrsg.), Weltarmut und Ethik, Paderborn 2007, 139–151. Zu diesen Menschenrechten siehe die entsprechenden Artikel (mit weiteren Literaturangaben) von schmitz, barbara, Subsistenzrechte, in: Pollmann/Lohmann (Fn 32), 233–241. So heißt es in der AEMR: „Jedermann“ hat Anspruch auf die „für seine Würde …unentbehrlichen wirtschaftlichen, sozialen und kulturelle Rechte“, Art. 22 AEMR. Siehe auch eichenhofer, eberhard, Sozialrechtlicher Gehalt der Menschenwürde, in: Gröschner, Rolf / Lembcke, Oliver W. (Hrsg.), Das Dogma der Unantastbarkeit, Tübingen 2007, 215–234; siehe für einen Überblick die entsprechenden Handbuchartikel mit weiterer Literatur: Mahler, Claudia, Wirtschaftliche Rechte, in: Pollmann/Lohmann (Fn 32), 269–279; Wyttenbach, judith, Soziale Rechte, in: Pollmann/Lohmann (Fn 32), 277–281; Weiss, norman, Kulturelle Rechte, in: Pollmann/Lohmann (Fn 32), 286–293. Siehe Deutsches Institut für Menschenrechte (Hrsg.), Die „General Comments“ zu den VNMenschenrechtsverträgen, Baden-Baden 2005, 252 f.
Was umfasst die „neue“ Menschenwürde der internationalen Menschenrechtsdokumente?
37
geprägt und formuliert die entsprechenden Verpflichtungen schwächer als die Verpflichtungen des IPpfR. Diese Auffassung ist heute weitgehend philosophisch83 und auch in der Rechtsauslegung84 wiederlegt, auch wenn sie praktisch im politischen Geschäft des Menschenrechtsschutzes noch vorherrscht. Dahinter steht aber ein systematisches und praktisches Problem. Die Konkretisierungen von positiven Pflichten erfordern politisch zu regelnde Abwägungen zwischen moralischen, rechtlichen und wirtschaftlichen Überlegungen.85 Ihr Problem ist daher, dass sie von den (häufig skandalös unzureichenden) konkreten Strukturen und Entscheidungen der internationalen oder auch nationalen politischen Meinungs- und Willensbildungen abhängig sind. Um sie aber, in Richtung auf eine stärkere (und nicht nur rhetorische) Beachtung der Menschenrechte zu bewegen, erscheinen Argumentationen in den entsprechenden zivilen Öffentlichkeiten, die eine Verletzung und Missachtung der Menschwürde skandalisieren, eine zunehmende und größere Relevanz zu bekommen.86 Abschließend ist noch darauf hinzuweisen, dass auch dieser inhaltliche Aspekt der „Menschenwürde“ sich im subjektiven Bewusstsein der Würde mit einem weiteren Aspekt verdeutlicht. Sich seiner „Menschenwürde“ bewusst sein, so hatten wir gesagt, erlaubt jedem Menschen eine gleiche Selbstachtung und ein damit verbundenes individuierendes Freiheitsbewusstsein. Analytisch hinzufügend können wir nun, als einen weiteren inhaltlichen Aspekt, eine selbstverantwortliche Sorge um ein Leben in Würde unterscheiden. Alle Aspekte sind Weisen eines praktischen Selbstbewusstseins, in dem der Einzelne sich zu sich selbst, zu seinem Zusein oder seinem Leben-können verhält. Der Begriff der „Sorge“ hat mit Heideggers Hochinterpretation als Existential gegenüber seiner antiken und christlichen Begriffsgeschichte eine individualisierende, sich auf das Ganze des Daseins beziehende Bedeutung bekommen. Die „Sorge für anderes“ (engl. care) wird als ein Moment des Um-sich-besorgtseins (engl. worry) gesehen.87 In beiden Bedeutungen von „Sorge“ artikuliert sich für den einzelnen Menschen ein Bewusstsein seiner Würde, das sowohl die sorgende Sicherung seiner Bedürftigkeit wie die auf ein Leben-können bezogene praktische Selbstbestimmung betrifft.88 Dass es sich hier um Weisen eines Bewusstseins von Würde handelt, zeigt sich an den Bewertungen, mit denen wir auf Verletzungen 83 84 85 86
87
88
Seit h. shue, op. cit. Siehe den wichtigen General Comment Nr. 12 des Ausschusses für Wirtschaftliche, Soziale und kulturelle Rechte von 1999, zu finden z. B. in: Deutsches Institut für Menschenrechte (Hrsg.), Die „General Comments“ zu den VN-Menschenrechtsverträgen, Baden-Baden 2005, 255. Siehe Lohmann, GeorG, Über die Zurechnung von Pflichten bei sozialen Grund- und Menschenrechten, in: Kaufmann, Matthias / Renzikowski, Joachim (Hrsg.), Zurechnung als Operationalisierung von Verantwortung, Frankfurt am Main [u. a.] 2004, 123–134. hahn, henninG, Human Rights as the Universal Language of Critique, in: Zeitschrift für Menschenrechte, 2 (2013), 42–58; Lohmann, GeorG, Normative Perspectives on Global Social Rights, in: Möller, Kolja / Fischer-Lescano, Andreas (Hrsg.), „The struggle for transnational social rights. Landgrabbing and the right to food“, Oxford 2014, im Erscheinen. Siehe dazu Kranz, marGarita, Sorge, in: Ritter, Joachim / Gründer, Karlfried (Hrsg.), Historisches Wörterbuch der Philosophie, Basel Bd. 9 1995, Sp. 1086–1090. Und auch die neuerlichen Verwendungen des Sorgebegriffs bei m. foucauLt und h. franKfurt stehen, bei allen Unterschieden, in dieser Tradition; foucauLt, micheL, Die Sorge um sich. Sexualität und Wahrheit 3, Frankfurt am Main 1986; franKfurt, harry, The Importance of What We Care about, Cambridge 1988. In umfassender Weise hat tuGendhat die Strukturen dieser praktischen Selbstbestimmung ana-
38
Georg Lohmann
dieser selbstverantwortlichen Sorge um sich reagieren. Für die subjektiven Verletzungserfahrungen von Menschenwürde bedeutet das, dass nicht nur die faktische Nichtbefriedigung eines „angemessenen Lebensstandards“ eine Verletzung von Menschenwürde ist, sondern auch die Missachtung einer selbstverantwortlichen Sorge um sich, z. B. wenn durch Hilfe in Not zwar eine Befriedigung der Grundbedürfnisse gesichert wird, sie zugleich aber in einer entmündigenden Weise gewährt wird. Auch hier opponiert das Bewusstsein der Menschenwürde gegen Formen von Paternalismus, die die Selbstbestimmung und Selbstverantwortung des Menschen leugnen oder nicht angemessen beachten. 8. ausBlIck Es hat sich nun vielleicht ein etwas konkreteres Verständnis des nach-45-ziger, „neuen“ Begriffs der „Menschenwürde“, wie er in der internationalen Konzeption der Menschenrechte verwendet wird, abgezeichnet. Eine Absicht der vorgehenden Überlegungen war, die innere Komplexität und auch den Bedeutungsreichtum dieses „neuen“ Grundlagenbegriffs zum Verständnis der Menschenrechte gegenüber zu einfachen oder zu einseitigen Verständigungen deutlich zu machen. Dabei habe ich mich auf Fragen nach dem inhaltlichen Gehalt der „Menschenwürde“ beschränkt. In dieser Hinsicht kann man nun sagen, dass, schlagwortartig formuliert, der Begriff der „Menschenwürde“ inhaltlich sich auf jeden einzelnen Menschen in den Hinsichten auf Gleichheit, Freiheit und Leben-können bezieht: Grundlegend drückt die allen Menschen zugeschriebene „Menschenwürde“ die prinzipielle Gleichwertigkeit und den gleichen rechtlichen Status aller Menschen aus und macht deren grundlegende Achtung (Wertschätzung und Respekt) zum normativen Gehalt der Menschenwürde (als Antwort auf die Frage: „Was besagt „Menschenwürde“?“) Sie verdeutlicht zweitens mit der Annahme, dass alle Menschen ihr Leben in überlegender, freier Selbstbestimmung führen können, die normative Erwartung, wie Menschen ihrer Menschenwürde gemäß sollen leben können. Und sie erläutert mit der Bezugnahme auf einen „angemessenen Lebensstandard“ oder die Bedingungen eines gesicherten Leben-könnens, worum es mit der Wertschätzung und deklarierten Anerkennung der „Menschenwürde“ geht: insgesamt um ein Leben in Würde, das jedem Menschen, nur weil er Mensch ist, in der gleichen Weise und selbstverantwortlich zusteht. Diese Erläuterungen zum Gehalt der Menschenwürde erlauben nun auch, Verletzungen von Menschenrechten zu graduieren. Wir sprechen von gravierenden Menschenrechtsverletzungen und von solchen, in denen zwar ein Menschenrecht verletzt wird, aber nicht prinzipiell die Trägerschaft von Menschenrechten geleugnet wird. Wird also die „primäre Nichtdiskriminierung“ und der prinzipiell gleiche Rechtsstatus eines Menschen geleugnet oder nicht beachtet, werden seine Fähigkeiten zu individuierender freier Selbstbestimmung prinzipiell missachtet oder werden seine Ansprüche auf einen „angemessenen Lebensstandard“ prinzipiell nicht erfüllt, so wird nicht nur dieses oder jenes Menschenrecht verletzt, sondern zugleich damit lysiert, siehe tuGendhat, ernst, Selbstbewußtsein und Selbstbestimmung, Frankfurt am Main 1979.
Was umfasst die „neue“ Menschenwürde der internationalen Menschenrechtsdokumente?
39
auch der Anspruch eines jeden Menschen, in seiner Menschenwürde geachtet und anerkannt zu werden. Man kann, um diese Metapher aufzugreifen, auch von einem „Kernbereich“ des Menschenrechtsschutzes sprechen, in dem zugleich die Menschenwürde verletzt wird, und das von Verletzungen eines Menschenrechts unterscheiden, in dem zwar nicht das Haben eines Menschenrechts prinzipiell in Frage gestellt wird, wohl aber berechtigte Pflichten, die sich aus diesem Recht ergeben, unvollkommen oder nicht angemessen erfüllt werden.89 Von dieser einräumbaren Ungleichgewichtigkeit von Menschenrechtsverletzungen muss man die Unteilbarkeit der Menschenrechte unterscheiden.90 Dass den ja historisch offenen Listen der Menschenrechtskataloge ein Anspruch auf Unteilbarkeit innewohnt, dass kann nun ebenfalls mit Bezug auf den Zusammenhang der inhaltlichen Aspekte der Menschenwürde gezeigt werden.91 Diese zusammenfassende Charakterisierung von Was? Wie? und Worum? der „Menschenwürde“ kann für ein erstes, etwas genaueres begriffliches Verständnis des Zusammenhangs der analytisch zu unterscheidenden inhaltlichen Gehalte stehen. Zugleich sind sicherlich eine Reihe von weiteren Fragen deutlich geworden, die nun beantwortet werden müssten: Wie verhält sich diese Interpretation von Menschenwürde zu ihrem kategorischen Anspruch? Wie steht es um die interkulturelle Akzeptanz dieser Deutung? Wie können die normativen Urteile und Forderungen, die mit ihr verbunden sind, moralisch begründet werden? Wie genau ist das Verhältnis zwischen „Menschenwürde“ als vorrechtliche axia und ihrer Verrechtlichung in nationalen und internationalen Rechtssystemen oder Verfassungen zu verstehen? Was bedeutet diese Auffassung von Menschenwürde für das Verständnis konkreter Menschenrechte? Und schließlich: Wenn die „Menschenwürde“ eine geschichtliche „Erfindung“ ist, kann sie dann ihre grundlegenden Aufgaben: einen normativen Maßstab für politische Herrschaft und eine Begründung für das Haben von Menschenrechten zu liefern, überhaupt erfüllen? – Ein Gutes an wissenschaftlichen Aufsätzen ist, dass sie immer mit der Notwendigkeit schließen können, neue Aufsätze zu schreiben; so auch hier.
89 90
91
Siehe dazu auch stePanians (Fn 27), 82. Siehe dazu Lohmann, GeorG, Die Menschenrechte: unteilbar und gleichgewichtig? – Eine Skizze, in: Lohmann, Georg / Gosepath, Stefan / Pollmann, Arnd / Mahler, Claudia / Weiß, Norman (Hrsg.), Die Menschenrechte: unteilbar und gleichgewichtig?, Studien zu Grund- und Menschenrechten 11, Menschen Rechts Zentrum der Universität Potsdam, Potsdam 2005, 5–20. Siehe auch habermas (Fn 49), 20 f.
tiLo Wesche, baseL/Giessen DIe würDe
von
zur BegrünDung
freIen
unD
gleIchen
Der MenschenrechtlIchen
würDeIDee
Das Verständnis der Menschenwürde, das der Politik und Zivilgesellschaft heute zugrunde liegt, entstammt einer Neubestimmung der Würdeidee in der Mitte des 20. Jahrhunderts. Angesichts der Unrechtserfahrungen in der Nazi-, Kriegs- und Kolonisationszeit rückt die Idee der Menschenwürde ins Zentrum der völkerrechtlichen, nationalstaatlichen und zivilgesellschaftlichen Neuordnungen. So sind die Gründungsakte der Vereinten Nationen von 1945 und die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948 aus einer geschichtlichen Unrechtserfahrung hervorgegangen, die als Verletzung einer unbedingt schützenwerten Würde des Menschen gedeutet wird. Trotz der nationalstaatlichen Partikularinteressen einiger Kolonialmächte und Großmächte bildet die Würdeidee das gemeinsame Ziel aller beteiligten Staaten. Die Barbarei der Diktaturen, Weltkriege und Kolonialisierung wird nicht nur als Verstoß gegen ein oder mehrere Menschenrechte betrachtet, sondern als Verletzung dessen, was den Menschen qua Menschsein ausmacht.1 Während bei Menschenrechtsverletzungen gegen Rechte verstoßen wird, auf die ihre Träger einen Anspruch haben, so wird ihre Würde verletzt, wenn ihnen ebendieser Anspruch abgesprochen wird. Die Würde des Menschen wird nicht allein durch den Verstoß gegen Menschenrechte, sondern durch das Vorenthalten von Rechtsansprüchen verletzt. Im Zuge ihrer Neubestimmung wird die Würde in der Präambel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte den konkretisierten Menschenrechten und 1949 im Artikel 1 Absatz 1 des deutschen Grundgesetzes den verfassungsrechtlichen Grundgesetzen im Ganzen vorangestellt. Indem die Würde den Rechten des Menschen zugrunde gelegt und in das politische und zivilgesellschaftliche Selbstverständnis verankert wird, hat sie sich endgültig als Maßstab eines weltweiten Menschenrechtsregimes etabliert. Doch wirft die Neubestimmung der Würde auch Fragen auf. Der Zankapfel in der Debatte um die Menschenwürde ist die Frage, ob und, falls ja, in welchem Sinn sie der ‚Grund‘ der Menschenrechte ist. Weshalb bedürfen die Menschenrechte der Würdeidee? Und wie bewahren die Menschenrechte ihren normativen Eigengehalt, wenn die Würde ihren Grund darstellt? Das Würdeverständnis, das im Folgenden vertreten wird, nimmt eine Position zwischen zwei Extremen ein. Einerseits grenzt es sich von einer deflationären Deutung der Würde ab. Der Würdebegriff könne aus 1
Siehe zur Einbettung des menschenrechtlichen Würdebegriffs in den historischen Kontext der Unrechtserfahrung: zimmermann, roLf, Philosophie nach Ausschwitz: Eine Neubestimmung von Moral und Politik, Reinbeck 2005; Wetz, franz josef, Illusion Menschenwürde: Aufstieg und Fall eines Grundwerts, Stuttgart 2005, 14–124; menKe, christoPh / PoLLmann, arnd, Philosophie der Menschenrechte zur Einführung, Hamburg 2007; Lohmann, GeorG, Die rechtsverbürgende Kraft der Menschenwürde: Zum menschenrechtlichen Würdeverständnis nach 1945, in: Zeitschrift für Menschenrechte 4 (2010) 1, 46–63. Die Partikularinteressen, die dabei im Hintergrund stehen, werden dargelegt in: moyn, samueL, The Last Utopia. Human Rights in History, Cambridge, Mass. / London 2010.
42
Tilo Wesche
dem Selbstverständnis moderner Gesellschaften kurzerhand gestrichen werden, weil er sich durch die Konzeptionen der Menschenrechte oder moralischen Rechte restlos ersetzen ließe und sich damit als „Leerformel“ erwiese.2 Der Preis für diesen Reduktionismus ist, dass die Intuition verloren geht, mit der Würde werde etwas Menschliches verletzt, das mit dem Verstoß gegen ein oder mehrere Menschenrechte nicht aufgeht. Andererseits verhält sich der folgende Vorschlag skeptisch gegenüber Begründungsambitionen, die zu hohe Erwartungen an die Begründungskraft der Würdeidee hegen. Der Anspruch, dass die Würde die Menschenrechte normativ begründe, mutet der Würdeidee zu viel zu. Die Würde des Menschen diente hier als Begründungsquelle der Geltung seiner Rechte. Der Reiz dieser Deutung liegt darin, die Würde als einen absoluten Wert (was sie zweifelsohne ist) zu betrachten und die Begründung der Menschenrechte somit (was bezweifelt werden kann) in das unerschütterliche Fundament der Würde zu verankern. Erkauft wird dieser Vorteil allerdings damit, dass die Würde zu einem Axiom, das sich selbst einer Begründung entzieht, mystifiziert wird und dass die Menschenrechte ihre eigene normative Kraft, die für sich steht, einbüßen. Beide Extrempositionen sollen durch die Auffassung umgangen werden, dass die Menschenwürde die Basis für die Achtung der Menschenrechte darstellt, ohne dass damit ein irgendwie gearteter Anspruch auf die Begründung ihrer normativen Geltung erhoben wird.3 Würde ist die Basis für nicht mehr, aber auch nicht weniger als die Achtung moralischer Ansprüche. Die Unterscheidung zwischen der Geltung der Menschenrechte und der Achtung der Menschenwürde kann als der Unterschied zwischen Norm und Wert konzeptualisiert werden. Die normative Dimension der Menschenrechte setzt sich aus dem moralischen Inhalt und der rechtlichen Form zusammen. Der moralische Inhalt besteht in dem Verletzungsverbot und dem Hilfsgebot von Freien und Gleichen. Dieser Inhalt wird in Gestalt von Menschenrechten verrechtlicht und nimmt die Form von sanktionsbewährten und mit Klagebefugnis ausgestatteten Rechten an. Der durch die Rechtsform gedeckte normative Inhalt besitzt eine willensunabhängige Geltung, die aus einer Theorieperspektive unbeteiligter Beobachter begründet werden kann. Die Würde bedeutet dagegen einen universellen Wert. Sie steht für die Wertschätzung und Achtung ein, die die Menschenrechte aus der Betroffenenperspektive von Beteiligten verdienen. Als Wert ist die Menschenwürde Ausdruck eines Willens, dass Menschenrechte unbedingte Wertschätzung verdienen. Der universelle Wert der Menschenwürde ersetzt somit nicht, sondern ergänzt die normative Dimension der Menschenrechte. Normen und Werte 2
3
Pösche, ViKtor / KondyLis, Panajotis, Würde, in: Brunner, Otto / Conze, Werner / Koselleck, Reinhart (Hrsg.), Geschichtliche Grundbegriffe, Bd. 7, Stuttgart 1992, 637. Den Vorschlag einer deflationären Ersetzung des Würdebegriffs durch den Begriff der Menschenrechte oder der Achtung vertreten franKena, WiLLiam, The Ethics of Respect fo Persons, in: Philosophical Topics 14 (1986) 2, 149–167, hoerster, norbert, Ethik des Embryonenschutzes: Ein rechtsphilosophischer Essay, Stuttgart 2002 und macKLin, ruth, Dignity is a Useless Concept, in: British Medical Journal 327 (2003) 7429, 1419–1420. Den Gedanken der Menschenwürde als einer Basis der Menschenrechte, die keine Begründungsfunktion ausübt, übernehme ich von Georg Lohmann. Im Unterschied zu Lohmann verstehe ich die Würde als Basis nicht für die Menschenrechte tout court, sondern für die Achtung der Menschenrechte. Lohmann, GeorG, Menschenwürde als ‚Basis‘ von Menschenrechten, in: Joerden, Jan C. / Hilgendorf, Eric / Thiele, Felix (Hrsg.), Menschenwürde und Medizin: Ein interdisziplinäres Handbuch, Berlin 2013, 43–56.
Die Würde von Freien und Gleichen
43
erscheinen hier nicht als konkurrierende, sondern als komplementäre Prinzipien. Die Rechte und die Würde des Menschen verhalten sich zueinander wie zwei Perspektiven, die sich miteinander verschränken: Die normative und willensunabhängige Begründungsperspektive der Menschenrechte wird durch die evaluative und willensabhängige Begründungsperspektive der Menschenwürde flankiert. Die menschenrechtliche Würdeidee kann demnach so verstanden werden, dass mit ihr auf einen Mangel des Menschenrechtsregimes reagiert wird, das die unvertretbaren Werteinstellungen der Beteiligten mit einbinden muss. Die Würde begründet nicht die Geltung der Menschenrechte, also die Tatsache, dass Personen überhaupt den moralischen Rechtsstatus von Freien und Gleichen besitzen, sondern, dass die Betroffenen aus einer je unvertretbaren Einstellung ihren moralischen Status wechselseitig wertschätzen. Die Geltung der Menschenrechte garantiert, dass Menschen den moralischen Status von Freien und Gleichen haben. Ihre Geltung wird dabei unabhängig von der Würdeidee und vom Standpunkt unbeteiligter Beobachter begründet. Dass aber Beteiligte sich wechselseitig als Träger solcher Rechte wertschätzen und achten, wird aus der unvertretbaren Teilnehmerperspektive und im Rückgriff auf die Würdeidee begründet. Im Lichte der Würdeidee nehmen sich die Beteiligten einander als Mitglieder einer universellen Gemeinschaft wahr, in der sie sich aus einer Wir-Perspektive als Freie und Gleiche begegnen. Die Würdeidee verbürgt gleichsam ihr ethisches Selbstverständnis als Freie und Gleiche. Auf ihrer Basis verstehen sie sich selbst als Mitglieder einer Gemeinschaft, die voneinander die Achtung der Menschenrechte erwarten dürfen. Als Basis steht die Würdeidee für die Bedingungen ein, unter denen es für Personen möglich sein soll, sich wechselseitig als Freie und Gleiche und damit als Träger von Menschenrechten anzusehen. Der normative Gehalt der Würde erschöpft sich also darin, dass Personen sich als Freie und Gleiche und damit als Mitglieder einer universalen und egalitären Rechtsgemeinschaft wahrnehmen können sollen. Die Menschenrechte gehen über die Würdeidee hinaus, indem sie den moralischen Status von Freien und Gleichen unabhängig von den jeweiligen Einstellungen sichern. Die menschenrechtliche Würdeidee erklärt, weshalb der moralische Status von Freien und Gleichen Achtung in den Augen der Beteiligten verdient, und stellt insofern die Basis für die Achtung der Menschenrechte dar (1.). Die Verknüpfung von Würde und Achtung stammt von Kant. Trotz aller Unterschiede ist deshalb die menschenrechtliche Würdeidee ein Erbe der Würdekonzeption von Kant (2.). Würde bedeutet bei Kant den unbedingten Wert der Freiheit, wobei Freiheit der Grund für die Rücksichtnahme auf fremde Ansprüche ist. Mit der Begründung der Würde wird demnach die Frage beantwortet, warum die moralischen Ansprüche Anderer unbedingt wertgeschätzt werden. Kants Begründung der Würde erfolgt somit über den Freiheitsbegriff und baut auf zwei Begründungsschritten auf. Zuerst wird dargelegt, weshalb Freiheit der Grund dafür ist, Rücksicht auf fremde Ansprüche zu nehmen. Anschließend wird im dritten Kapitel ausgewiesen, dass Freiheit einen unbedingten Wert besitzt (3.). Mit der Begründung der Würde wird also der Grund eingeholt, weshalb Freiheit – als Grund für jene Rücksichtnahme – eine unbedingte Wertschätzung verdient. Die Achtung der Würde bedeutet, den unbedingten Wert, der der Autonomie gebührt, zu achten und ist demnach gleichbedeutend mit der uneingeschränkten Wertschätzung der Autonomie. ‚Achtung der Würde‘ wird deshalb im Folgenden gleichbedeutend mit ‚unbedingte Wertschätzung‘ ver-
44
Tilo Wesche
wendet. Die Würdeidee erhebt den Achtungsanspruch, demzufolge der moralische Status von Freien und Gleichen unbedingte Wertschätzung verdient. Kants Würdebegriff und die menschenrechtliche Würdekonzeption verbindet die Gemeinsamkeit eines säkularen Begründungsprogrammes. Anstatt auf die Vorstellung der Gottesebenbildlichkeit, die Lehre von der Würde als imago dei, zurückzugreifen, wird die Würde hier über die Autonomie begründet. Damit enden auch schon die Gemeinsamkeiten. Der Hauptunterschied liegt in der unterschiedlichen Begründungsweise der Würdeidee. In den Konzeptionen wird jeweils unterschiedlich begründet, weshalb wir zu Recht von der Annahme einer Würde und ihrer Begründungskraft für die Wertschätzung des moralischen Status von Freien und Gleichen ausgehen dürfen. Im vierten Kapitel wird dargelegt, weshalb der Würdebegriff einer anderen Begründung bedarf, als sie von Kant geleistet wird (4.). Während Kant die Würde als eine Tatsache beschreibt, wird sie in der menschenrechtlichen Konzeption als eine Zuschreibung begründet. Es ist wohlgemerkt nicht die Geltung der Menschenrechte, sondern der Achtungsanspruch, der als das Ergebnis eines Willens, dass Menschen eine Würde zukommen soll, hervorgeht. 1. DIe MenschenwürDe als von freIen unD gleIchen
DIe
BasIs
für DIe
achtung
Die menschenrechtliche Würdekonzeption ist die Antwort auf den Erklärungsbedarf, wie es zur Achtung des moralischen Status von Freien und Gleichen kommt. Dieser Status bestimmt Personen als Träger von universellen, egalitären, unveräußerlichen und subjektiven Rechten, deren Durchsetzung rechtlich gesichert sein soll. Der moralische Status umfasst die moralischen Ansprüche einer Person. Diese darf erwarten, dass ihre Ansprüche etwa auf Schutz vor Verletzungen und Hilfe in Not berücksichtigt werden. Ansprüche werden hier an ihre Adressaten als berechtigte Erwartungen gerichtet und besitzen insoweit einen willensunabhängigen Verpflichtungscharakter (siehe unten). Personen schulden einander, dass sie wechselseitig Rücksicht auf ihre Ansprüche nehmen. Diese Ansprüche haben deshalb den Status moralischer Rechte, die im Unterschied zu juridischen Rechten (law) als schwache Rechte (rights) gelten.4 Sie besitzen Rechtscharakter, weil ihre Träger dazu berechtigt sind, Ansprüche zu erheben und ihre Berücksichtigung verlangen zu dürfen. Allerdings treten sie nur als schwache Rechte auf, weil ihre Berücksichtigung nicht erzwungen werden kann, wie es durch das zwangsbewährte und mit Klagebefugnis ausgestattete Recht möglich ist. Menschenrechte nun sind das Ergebnis der Verrechtlichung moralischer Ansprüche und stellen den Sonderfall von universellen Rechten dar, deren Geltung auf die einzelstaatliche Gesetzgebung und zugleich – auf Grund 4
Ich deute den Unterschied zwischen Moral und Recht dahingehend, dass moralische Ansprüche als ‚schwache‘ Rechte und juridische Rechte mit Zwangsbefugnis und Klagebefugnis als ‚starke‘ Rechte auftreten. Siehe zu diesem Unterschied: habermas, jürGen, Faktizität und Geltung: Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts, Frankfurt 1994, 135–151; Lohmann, GeorG, Menschenrechte zwischen Moral und Recht, in: Gosepath, Stefan / Lohmann, Georg (Hrsg.), Philosophie der Menschenrechte, Frankfurt 1998, 62–95; ders., Zur moralischen, juridischen und politischen Dimension der Menschenrechte, in: Sandkühler, Jörg (Hrsg.), Recht und Moral, Hamburg 2010, 135–150.
Die Würde von Freien und Gleichen
45
ihres universellen moralischen Gehalts – über diese hinaus auf eine völkerrechtliche Rechtsgemeinschaft hin ausgerichtet ist. Der moralische Rechtsstatus, von dem im Folgenden die Rede ist, bedeutet demnach die Trägerschaft von Menschenrechten, die aus der Verrechtlichung moralischer Ansprüche hervorgehen. Der Statusgedanke an sich ist ein Erbe des traditionalen Begriffs der Würde.5 Die Würden im Plural verbürgten den Zugehörigkeitsstatus von Personen in den Bereichen der Ökonomie, des Sozialen, der Politik, der Familie etc. und wurden entweder erworben oder verliehen. Mit den Würden erhielten sie die Mitgliedschaft in einer organisierten Standesgemeinschaft, die mit Pflichten und gegebenenfalls mit Privilegien verbunden war. Die Würde wies ihnen also einen partikularen Status im Sinne eines Achtung gebietenden Ranges zu, den sie in einer hierarchisch organisierten Ordnung einnehmen. Dem Würdenträger kommt in dieser Ordnung ein ‚hoher‘ Rang zu und steht damit über anderen. Würde beinhaltet ein Moment der ‚Hoheit‘, weshalb man auch davon spricht, etwas sei unter einer Würde. So deutet Cicero die Würde als die Stellung, die den Menschen über die Triebnatur der Tiere erhebt.6 Mit der menschenrechtlichen Würdekonzeption wird der partikulare Status zu einem universalen Status der Träger von Rechten erweitert, auf die alle Menschen gleichermaßen einen Anspruch haben. Kontingente Würden werden zu der inhärenten, angeborenen Würde. Zwar schloss die ‚dignitas humana‘ spätestens bei Cicero den generellen Anspruch auf eine menschliche Gemeinsamkeit, die ‚humani generis societas‘ mit ein.7 Aber dieser universalistische Kern des Würdebegriffs stand noch problemlos in Einklang mit den verschiedenen Rollen (‚personae‘) in der hierarchischen Ordnung und drückt das Selbstverständnis einer ‚privilegierten‘ Universalität aus. Erst der moderne Würdebegriff macht mit dem universalen Status von egalitären Rechten Ernst, indem dieser Rechtstatus über und nicht neben den anderen Rollen steht.8 Indem die Würde Personen den Status garantiert, Rechte wahrnehmen zu dürfen, übernimmt sie die Funktion einer Grundlage der Menschenrechte. In der Präambel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte wird die „Anerkennung der angeborenen Würde und der gleichen und unveräußerlichen Rechte aller Mitglieder der Gemeinschaft der Menschen“ allen konkreten Menschenrechten vorangestellt.9 Die 5
6 7 8
9
Siehe zum Folgenden: schaede, stePhan, Würde – Eine ideengeschichtliche Annäherung aus theologischer Perspektive, in: Bahr, Petra / Heinig, Hans Michael (Hrsg.), Menschenwürde in der säkularen Verfassungsordnung: Rechtswissenschaftliche und theologische Perspektive, Tübingen 2006. Vgl. cicero, De officiis I, 106. canciK, hubert, ‚Dignity of Man‘ and of ‚Persona‘ in Stoic Anthropology: Some Remarks on Cicero, De officiis I, 105–107, in: Kretzmer, David / Klein, Eckart (Hrsg.), The Concept of Human Dignity in Human Rights Discourse, Den Haag 2002, 19–40. WaLdron stellt die fortschreitende Verallgemeinerung des egalitären Würdestatus als einen Prozess dar, der antizyklisch zur Nivellierung verläuft. Statt einer Gleichmacherei setzt sich der historisch jeweils höchste Status einer Rechtperson durch. Siehe: WaLdron, jeremy, Dignity, Rank, and Rights, Oxford 2012, 47–76. Einen historischen und aktuellen Überblick über die Geschichte des Würdebegriffs in Hinsicht auf dessen Universalisierung gibt: rosen, michaeL, Dignity: Its History and Meaning, Cambridge 2012. Ein Überblick über den Würdebegriff in den einschlägigen Rechtsdokumenten findet sich in: WaLter, christian, Menschenwürde im nationalen Recht: Europarecht und Völkerrecht, in: Bahr/Heinig (Fn 5), 127–248.
46
Tilo Wesche
Würde übt demnach eine Grundlegungsfunktion für die Menschenrechte aus, indem sie die Mitgliedschaft zur Gemeinschaft der Menschen als Rechtsträger garantiert. Das deutsche Grundgesetz hebt die Grundlegungsfunktion der Würde für die Menschenrechte ausdrücklich im Artikel 1 hervor. „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. / Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit der Welt.“ (GG Art. 1, Abs. 1–2, Hervorhebung von T. W.)10 Weil die Menschenwürde unantastbar ist, bekennen sich Staatsbürgerinnen und -bürger zu den Menschenrechten. Die Würde verbürgt somit die Mitgliedschaft in einer Gemeinschaft von Menschen als Träger universaler und egalitärer Rechte. Die angeführten Rechtsdokumente werfen die Frage auf, in welchem Sinn die Würde der Grund oder die Basis der Menschenrechte sei. Welche bestimmte Grundlegungsfunktion übt die Menschenwürde für die Menschenrechte aus? Eine naheliegende, aber unzutreffende Antwort lautet, dass die Würde eine Begründungsinstanz für die Geltung der Rechte der Menschen darstelle. Menschenrechte besitzen demnach eine uneingeschränkte Geltung, weil sie im unerschütterlichen Fundament des absoluten Werts der Würde verankert sind. Sie verdanken ihre Geltung der Würde, die erst den Menschen ihren moralischen Status als Träger von Rechten verleiht. In dieser Lesart spielt die Würde die Rolle einer Begründungsquelle, aus der sich normative Ansprüche auf Menschenrechte herleiten. Eine solche Ableitungsbeziehung wird etwa beschrieben in der Resolution 37/200 der UN-Generalversammlung vom 18.12.1982 über die Förderung und den Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten: „the dignity of man from which all human rights derive their justification.“ Oder auch, aber mehrdeutiger in Art. 14 Abs. 2 der Verfassung des Freistaates Sachsen aus dem Jahr 1992: „Die Unantastbarkeit der Würde des Menschen ist Quelle aller Grundrechte.“ Die Menschenwürde wird hier als ein invariantes Fundament betrachtet, das die Rechtfertigung aller weiteren moralisch und rechtlich einklagbaren Ordnungen ermöglicht. Die Lesart der Würde als eine ‚Wurzel‘ oder ‚Quelle‘ der Begründung zieht sich den Einwand der Redundanz zu.11 Die Auffassung, die Würdeidee begründe den Anspruch auf den moralischen Rechtsstatus, ebnet den Unterschied zwischen der Würde und dem Recht des Menschen ein. Einmal angenommen, der Anspruch, 10
11
Im Unterschied dazu löst die seit 2009 rechtsverbindliche EU-Grundrechtscharta im Art.1 diesen ausdrücklichen Zusammenhang auf: „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie ist zu achten und zu schützen.“ Ebenso wenig wird in der Präambel der Verfassung von BadenWürttemberg dieser Zusammenhang zwischen Würde und dem „feierlichem Bekenntnis zu den unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten“ hergestellt. Ich folge birnbacher in seiner Argumentation, weshalb der Würdebegriff keine Begründungsrelevanz für die Menschenrechte besitzt: birnbacher, dieter, Kann die Menschenwürde die Menschenrechte begründen?, in: Gesang, Bernward / Schälike, Julius (Hrsg.), Die großen Kontroversen der Rechtsphilosophie, Paderborn 2011, 77–98, 93. Zudem steht die vermeintliche Begründungskraft der Würde unter dem Verdacht des naturalistischen Fehlschlusses, aus der Naturbestimmung einer angeborenen Eigenschaft oder Fähigkeit ein Sollen, das heißt die Verbindlichkeit universaler Rechte von Gleichen und Freien abzuleiten. Diesen Einwand führt müLLer aus: müLLer, jörn, Menschenwürde als Fundament der Menschenrechte: Eine begründungstheoretische Skizze, in: Gesang, Bernward / Schälike, Julius (Hrsg.), Die großen Kontroversen der Rechtsphilosophie, Paderborn 2011, 99–122, 105.
Die Würde von Freien und Gleichen
47
dass Personen Träger von Rechten sind, rechtfertige sich aus ihrer Würde. Damit würde dieses Würdeverständnis den Unterschied zwischen der Würde und den Rechten der Menschen verschleifen, weil der Anspruch auf den moralischen Status, Träger von Rechten zu sein, bereits mit der Geltung von Menschenrechten abgedeckt ist. Denn der Begriff des Rechts setzt notwendig die Annahme eines Trägers und eines Adressaten der Rechte voraus. Der moralische Status der Trägerschaft von Rechten ist eine analytische Implikation der Menschenrechte. Die Würde ist demnach weder ein inhaltlicher Grund der Menschenrechte. Denn versteht man unter Menschenrechten grundlegende moralische Ansprüche von Gleichen und Freien, dann geht ihr Inhalt, dass Personen Träger von universalen Ansprüchen sind, im Begriff des Menschenrechts vollständig auf und es wäre unklar, für welchen Inhalt Würde zusätzlich ein Grund wäre. Noch ist die Würde ein formaler Grund der Menschenrechte, aus dem sich die Verrechtlichung des moralischen Gehalts ergebe. Denn dass ein moralischer Gehalt in die Form von sanktionsbewährten Rechten gegossen werden soll, ergibt sich aus dem moralischen Gehalt selbst. Zur Pflicht gehört laut Kant die Verpflichtung zur Verfügbarkeit über die nötigen Mittel, um eine Pflicht erfüllen zu können. Wenn die Ansprüche von Gleichen und Freien Geltung besitzen, dann ist es eben darum auch geboten, für ihre Verwirklichung und die dazu nötigen Mittel, einschließlich der Rechtsform, zu sorgen. Rechte müssen auch wirksam in Anspruch genommen werden können. Der Besitz eines Rechts verleiht deshalb einer Person das Recht zweiter Stufe, ihre Rechte als rechtlich abgesicherte Ansprüche gegenüber Institutionen einzuklagen.12 Auch in formaler Hinsicht auf die Verrechtlichung geht also die Würde nicht über das hinaus, was in dem Begriff der Menschenrechte selbst schon liegt. Die Annahme der Würde als Begründungsquelle hätte nun zur Folge, dass die Würdeidee selbst entbehrlich würde. Falls die Würde den Anspruch auf den moralischen Status begründen sollte, entstünde der berechtigte Eindruck von ihrer Redundanz. Es wäre unklar, wozu die Würdeidee benötigt werde, wenn doch der moralische Status von Rechtsträgern eine analytische Implikation der Menschenrechte ist. Menschenrechte setzten demnach keine Würdeidee voraus. Die konsequente Folge wäre die (anfangs genannte) deflationäre Deutung der Würde als eine Leerformel, auf die getrost verzichtet werden könne, sofern der moralische Rechtsstatus von der Idee der Menschenrechte selbst abgedeckt werde. Allerdings würde damit die Intuition verloren gehen, dass die Würde ein Begriff sui generis ist, der sich mit dem Begriff des Rechts nicht verrechnen lässt. Ihr Eigenwert zeigt sich ja, wie anfangs beschrieben, darin, dass ihre Verletzung über den Verstoß gegen ein oder mehrere Menschenrechte hinausgeht. Das Würdeverständnis als Begründungsquelle führt also zu einem Redundanzproblem. Menschenrechte schließen den moralischen Status ihrer Trägerschaft ein und machen eine Würdeidee entbehrlich, die diesen moralischen Status begründete. Der Eigenwert der Würdeidee besteht vielmehr in einer Grundlegung, die eine andere Funktion als die der normativen Begründung erfüllt. Die Würde begründet nicht die Geltung der Menschenrechte, sondern deren Achtung. Die Menschenwürde besitzt ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber den Menschenrechten, weil sie 12
feinberG, joeL, Rights, Justice, and the Bounds of Liberty: Essays in Social Philosophy, Princeton 1980, 141.
48
Tilo Wesche
die wechselseitige Achtung von Rechtsansprüchen begründet, die sich nicht aus der Geltung dieser Rechte erklärt. Menschenrechte erklären zwar, dass Personen Träger berechtigter Ansprüche sind. Sie erklären jedoch nicht, weshalb Personen wechselseitig ihre Ansprüche auch achten. Zu unterscheiden ist zwischen der Geltung, Achtung und Befolgung von Ansprüchen. Die Geltung eines moralischen Anspruchs bedeutet die willensunabhängige Verbindlichkeit eines Gebots oder Verbots. Moralische Gebote und Verbote besitzen einen willensunabhängigen Verpflichtungscharakter. Moralische Ansprüche werden von ihren Adressaten als Pflichten wahrgenommen und nehmen die Gestalt von (wenn auch schwachen) Rechten an, weil ihnen eine Geltung unabhängig vom Willen der Adressaten zukommt. Moralische Rechte und die ihnen korrespondierenden Pflichten besitzen somit eine willensunabhängige Geltung. Nicht die Akteure entscheiden darüber, ob moralische Gebote und Verbote für sie bindend sind oder nicht. Die Verbindlichkeit etwa der Beistandspflicht und des Tötungsverbots hängt nicht von der Zustimmung der Akteure ab und tritt demnach schon vor deren Willen in Kraft. Die normative Grundlage der Gebote und Verbote ist dabei der moralische Status von Freien und Gleichen. Bestimmte Gebote und Verbote enthalten berechtigte Forderungen, weil sie sich aus den Normen der Freiheit und Gleichheit ergeben. Aus der Geltung des moralischen Status von Freien und Gleichen leiten sich die konkreten Ansprüche ab. Von der Geltung ist die Achtung des moralischen Status von Freien und Gleichen zu unterscheiden. Moralische Rechte und Pflichten berechtigen dazu, dass ihre Zustimmung erwartet und Verstöße gegen sie kritisiert werden dürfen. Deshalb ist ihre Verbindlichkeit äußerst legitimationsbedürftig gegenüber ihren Adressaten. Der Begründungsanspruch unterscheidet ihre autoritative Verbindlichkeit vom autoritären Charakter traditionalistischer Ethiken, die sich auf überlieferte Wertbindungen, religiöse Glaubensgewissheiten oder zeitlose Menschenbilder zu berufen versuchen. Aus der Sicht einer autonomen Ethik muss stattdessen die willensunabhängige Verbindlichkeit gegenüber den Akteuren begründbar sein, damit diese die moralische Autorität anerkennen können. Welchen Grund hat jeweils eine Person, sich bestimmten Geboten und Verboten zu unterwerfen und den moralischen Status von Freien und Gleichen zu achten? Der Achtungsanspruch betrifft demnach den Grund, weshalb dem moralischen Status aus der Sicht der Ersten Person Achtung gebührt. Mit dem Übergang von der Geltung zur Achtung wird ein Perspektivenwechsel vollzogen. Während die Geltung der Rechte vom Standpunkt unbeteiligter Beobachter begründet werden kann, erfolgt die Achtung von Rechtsträgern aus der unvertretbaren Teilnehmerperspektive.13 Welchen Grund, so fragen sich die Akteure, habe ich oder haben wir dafür, den moralischen Status von Freien und Gleichen zu achten? Von der Geltung und Achtung ist schließlich die Befolgung der einzelnen Ansprüche zu unterscheiden. Jemand kann es unterlassen, ein Gebot zu befolgen, und gleichzeitig den, dessen Anspruch durch diese Nichtbefolgung verletzt wird, als Träger von moralischen Ansprüchen grundsätzlich zu achten. Mit dem Verstoß gegen etwa das Menschenrecht auf Meinungsfreiheit wird dem Betroffenen nicht schon 13
Siehe zum Zusammenhang von Würde und Achtung, die auf der Teilnehmerebene verortet ist: habermas, jürGen, Zur Verfassung Europas: Ein Essay, Berlin 2011, bes. 21.
Die Würde von Freien und Gleichen
49
der moralische Rechtstatus im Ganzen vorenthalten. Die Nichtbefolgung eines Anspruchs entspricht dem anfangs geschilderten Fall des partikularen Verstoßes gegen ein oder mehrere Menschenrechte, der nicht schon mit der Verletzung der Menschenwürde aufgeht. Die Frage nach der Befolgung ist demnach nur indirekt relevant für die Würdeidee. Die Unterscheidung zwischen Geltung und Achtung entspricht derjenigen zwischen Menschenrechten und Menschenwürde. Als Freie und Gleiche sind Personen Träger universeller, egalitärer, unveräußerlicher und subjektiver Rechte. Das Konzept des Rechts deckt die Geltung eines moralischen Status der Trägerschaft von solchen Rechten freier und gleicher Personen ab. Während Menschenrechte Normen verkörpern, drückt die Menschenwürde einen Wert aus. Menschenrechte beinhalten die normative Geltung von Freiheit und Gleichheit, Menschenwürde dagegen deren Wert. Die Achtung der Würde drückt eine unbedingte Wertschätzung des moralischen Status von Freien und Gleichen aus. Mit der Würdeidee wird ein Achtungsanspruch erhoben, das heißt ein Anspruch darauf, dass der moralische Status von den Beteiligten unbedingte Achtung verdient. Sie gibt den Grund an, warum sie Freiheit und Gleichheit wichtig nehmen sollten. Geltung und Achtung sind jeweils notwendige, aber nicht für sich hinreichende Bedingungen des moralischen Status von Freien und Gleichen. Erst im Verbund verleihen sie Geboten und Verboten eine handlungsleitende Kraft. In der menschenrechtlichen Würdeidee vereinigen sich somit die Geltung und Achtung des moralischen Status von Freien und Gleichen. Die moralische Achtung besitzt drei Merkmale. Sie wird erstens in der Einstellung der Ersten Person begründet. Die Frage nach dem Grund moralischer Achtung untersucht, wie moralische Forderungen aus der Ich-Perspektive begründet werden. Sie betrifft den Grund, den ich dafür habe, moralische Ansprüche zu achten. Der Grund wird also nicht stellvertretend aus der Theorieperspektive unbeteiligter Beobachter dargelegt, sondern aus der unvertretbaren Teilnehmerperspektive von moralischen Akteuren. Die moralische Achtung besitzt zweitens einen intrinsischen Wert. Im Unterschied zu prudentiellen Tätigkeiten werden moralische Ansprüche nicht aus den selbstbezogenen Gründen einer Vorteilserwartung oder einer Nachteilsvermeidung geachtet. Ihre Achtung darf vielmehr gefordert werden, weil das Wohlergehen oder die Unversehrtheit der anderen Person für sich gut ist. Wir achten den Anspruch auf Hilfe in Not nicht aus Gründen der Gratifikation oder Sanktion, sondern deshalb, weil die Hilfe um des Bedürftigen selbst willen gut ist. Wir achten moralische Ansprüche, indem wir, in Kants Ausdrucksweise, den anderen als Zweck an sich achten oder ihn als Person respektieren.14 Der Grund moralischer Achtung ist drittens ein vormoralisches Prinzip. Das Prinzip, aus dem die moralische Achtung begründet wird, darf keine moralische Eigenschaft sein. Denn ansonsten würde die moralische Achtung aus etwas abgeleitet werden, das bereits moralisch geachtet werden soll. Warum ich die moralischen Ansprüche anderer achten und mich deren Forderungen unterwerfen soll, würde aus der bereits verbindlichen Achtung der Rechte begründet werden. Die Begründung
14
Diese Auffassung wird von tuGendhat vertreten:tuGendhat, ernst, Vorlesungen über Ethik, Frankfurt am Main 1993, 5. Vorlesung.
50
Tilo Wesche
würde sich damit im Kreis bewegen. Damit dieser Zirkel vermieden wird, muss der Grund moralischer Achtung ein vormoralisches Prinzip sein. Im Folgenden wird die Auffassung vertreten, dass die Autonomie ein solcher vormoralischer Grund ist. Die Autonomie ist der Grund dafür, weshalb Personen wechselseitig Rücksicht auf ihre moralischen Ansprüche nehmen. Von dieser Ebene der Begründung moralischer Rücksichtnahme durch Freiheit ist nun die tiefere Ebene der Begründung ebendieser Freiheit als eines obersten Wertes zu unterscheiden. Denn wenn moralische Rücksichtnahme durch Freiheit begründet wird, dann schließt sich wiederum die Frage an, weshalb Freiheit Wertschätzung verdient. Auf dieser tieferen Ebene hat die Würdeidee ihren Ort und erfolgt die Begründung, dass die Freiheit einen unbedingten Wert, das heißt eine Würde hat (bekanntlich stammt ‚Würde‘ von ‚Wert‘). Die Würde stellt somit zwar eine Grundlage für die Begründung moralischer Achtung dar; sie bedarf aber selbst auch einer Begründung.15 Denn wir dürften nicht die Achtung einer unantastbaren Würde von Anderen verlangen, wenn wir nicht angeben könnten, warum wir diese Erwartung zu Recht haben. Mit der Begründung der Würde wird erklärt, weshalb wir zu Recht annehmen dürfen, dass Freiheit ein oberster Wert, ein letztes Ziel oder ein Selbstzweck ist. Moralische Rücksichtnahme wird durch Würde nur indirekt begründet, sofern Würde den unbedingten Wert bezeichnet, der der Freiheit als dem Grund zukommt, weshalb wir moralische Ansprüche achten. Zwei unterschiedliche Begründungsweisen der Würdeidee sind nun möglich. In beiden Konzeptionen der Würde wird jeweils unterschiedlich begründet, weshalb wir zu Recht von der Annahme einer Würde und ihres Achtungsanspruchs ausgehen dürfen. Die Würde kann von zweierlei Art sein. Entweder ist die Würde eine Tatsache, die allenfalls durch Beschreibung ausgewiesen wird, oder sie ist das Ergebnis einer Zuschreibung. Die weitere Möglichkeit, dass Würde selbst eine Verpflichtung ist, kann ausgeschlossen werden.16 Denn damit entstünde der eben aufgezeigte Zirkel, wiederum einen Grund zu benötigen, weshalb nunmehr die Forderung, dass Menschen eine Würde haben sollen, Achtung verdient. Die erste Konzeption der Würde als Tatsache wird von Kant vertreten. Die Würde oder der Wert bezieht sich bei Kant auf die Autonomie als den Grund der Moralität, wobei ihre Wertschätzung als eine Tatsache gilt. Die zweite Konzeption entspricht der menschenrechtlichen Würdeidee, die dem heutigen Selbstverständnis von Politik und Gesellschaft zugrunde liegt. Würde wird hier durch Zuschreibung begründet. Demnach ist sie das
15
16
bieLefeLdt hat zu Recht den Bedeutungsgehalt der Menschenwürde als den „Achtungsanspruch“ bestimmt, der es Personen erlaubt, dass sie sich als Träger von Rechten und Pflichten begegnen. Ein Problem besteht allerdings darin, dass er die Würde mit einer „axiomatischen Qualität“ versieht, die nicht mehr begründet werden kann. bieLefeLdt, heiner, Die Würde des Menschen – Fundament der Menschenrechte, in: Sandkühler, Hans-Jörg (Hrsg.), Recht und Moral, Hamburg 2010, 105–134, 107 (im Original kursiv). Siehe auch: „Die Menschenwürde ist nicht so sehr Gegenstand des Bekennens, sondern fungiert als axiomatische Referenz, das heißt als die ihrerseits voraussetzungslose Voraussetzung möglicher Bekenntnisse.“ bieLefeLdt, heiner, Auslaufmodell Menschenwürde? Warum sie in Frage steht und warum wir sie verteidigen müssen, Freiburg 2011, 97. Zu der gleichen Schlussfolgerung kommt WoLf, ursuLa, Moralische Rechte ohne Würde, in: Bornmüller, Falk / Hoffmann, Thomas / Pollmann, Arnd (Hrsg.), Menschenrechte und Demokratie, Freiburg 2013, 119–133, 131.
51
Die Würde von Freien und Gleichen
Ergebnis des Willens, dass Menschen der moralische Status von Rechtsträgern zukomme. Im vierten Kapitel werden wir hierauf ausführlicher zurückkommen. 2. autonoMIe
als Der
grunD
MoralIscher
rücksIchtnahMe
Kants und der menschenrechtliche Würdebegriff sind verwandt und verschieden gleichermaßen. Beide überschneiden sich darin, dass Würde mit Achtung (anstelle mit Geltung) verknüpft und durch Autonomie begründet wird. Ein Graben klafft zwischen ihnen allerdings in der Hinsicht, dass Würde bei Kant eine Tatsache und im menschenrechtlichen Verständnis eine Zuschreibung ist.17 Um diese Gemeinsamkeiten und Unterschiede genauer in den Blick zu bekommen, soll zunächst an Kants Vorschlag erinnert werden, die Autonomie als einen vormoralischen Grund der moralischen Rücksichtnahme zu begreifen. Autonomie ist ihm zufolge der Seinsgrund, die ‚ratio essendi‘ für das moralische Gesetz. Im berühmten IV. Lehrsatz der Kritik der praktischen Vernunft unterscheidet Kant zwischen negativer und positiver Freiheit. Die Begründung des moralischen Gesetzes durch Freiheit kommt erst dann ins Ziel, wenn beide Seiten unterschieden werden und zugleich zur Deckung kommen. „Die Autonomie des Willens ist das alleinige Prinzip aller moralischen Gesetze und der ihnen gemäßen Pflichten […]. In der Unabhängigkeit nämlich von aller Materie des Gesetzes (nämlich einem begehrten Objekte) und zugleich doch Bestimmung der Willkür durch die bloße allgemeine gesetzgebende Form, deren eine Maxime fähig sein muß, besteht das alleinige Prinzip der Sittlichkeit. Jene Unabhängigkeit aber ist Freiheit im negativen, diese eigene Gesetzgebung aber der reinen, und als solche, praktischen Vernunft, ist Freiheit im positiven Verstande. Also drückt das moralische Gesetz nichts anderes aus als die Autonomie der reinen praktischen Vernunft.“18 An späterer Stelle kommt Kant auf diesen Freiheitsbegriff zurück, in dem sich die Unabhängigkeit von Eigeninteressen und Pflichtethik kreuzen. „Freiheit und das Bewußtsein derselben, als eines Vermögens, mit überwiegender Gesinnung das moralische Gesetz zu befolgen, ist Unabhängigkeit von Neigungen.“19 Kants Begründung der Rücksichtnahme durch Freiheit baut auf zwei Annahmen auf.20 Beiden Annahmen liegt eine Prämisse zugrunde. Um die Argumentationsstruktur von Kants Begründung zu rekonstruieren, müssen also diese Annahmen 17 18 19 20
Weitere Unterschiede werden erläutert in: Luf, Gerhard, Der Grund für den Schutz der Menschenwürde – konsequentialistisch oder deontologisch, in: Brudermüller, Gerd / Seelmann, Kurt (Hrsg.), Menschenwürde: Begründung, Konturen, Geschichte, Würzburg 2012, 43–56. Kant, immanueL, Kritik der praktischen Vernunft, Hamburg 2003, 44, 24–45, 8 (AA V, 33). Die folgenden Ausführungen werden von mir in einem größeren Kontext dargestellt in: Wesche, tiLo, Wahrheit und Werturteil: Eine Theorie der praktischen Rationalität, Tübingen 2011. Kant, immanueL Kritik (Fn 18), 158, 31–34 (AA V, 117); vgl. Kant, immanueL, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, Hamburg 1999, 53, 33–37 (AA IV, 430). Die einzelnen Theorien, die sich Kants Begründung der Pflicht durch Freiheit widmen, und vor allem ihre Unterschiede kann ich hier nicht im Detail diskutieren. Ihr Konvergenzpunkt besteht darin, dass unter „Begründung“ nicht die subjektive Motivation, sondern die objektiven Gründe für die Geltung einer moralischen Lebensform verstanden werden. Vgl. WiLLascheK, marcus, Praktische Vernunft: Handlungstheorie und Moralbegründung bei Kant, Stuttgart 1992; KorsGaard, christine, The Sources of Normativity, Cambridge 1996; forst, rainer, Moralische Autonomie und Autonomie der Moral: Zu einer Theorie der Normativität nach Kant, in: ders.,
52
Tilo Wesche
und die Prämisse erörtert werden. Die beiden Annahmen betreffen Kants Begriffe der negativen und der positiven Freiheit. Kants Argument lautet, dass Freiheit sich in der moralischen Rücksichtnahme realisiert, und ist wie folgt aufgebaut: 1. Freiheit beinhaltet die Einschränkung des Eigeninteresses. Diese erste Annahme wird von Kant mithilfe des Begriffs der negativen Freiheit erklärt. 2. Das Eigeninteresse wird eingeschränkt (und damit Freiheit realisiert) nur durch die Anerkennung der Rechte, die die Interessen anderer Personen schützen.21 Der Erklärung dieser zweiten Annahme dient der Begriff der positiven Freiheit. Kant führt den Begriff der negativen Freiheit ein, um die Annahme zu begründen, dass Freiheit die Einschränkung von Eigeninteressen beinhaltet. Negative Freiheit bedeutet die Fähigkeit, unabhängig von Eigeninteressen zu handeln. Diese Unabhängigkeit von selbstbezogenen Interessen ist zentraler Bestandteil der Freiheit. Denn wenn Freiheit die Unabhängigkeit von notwendigen Faktoren bedeutet, und wenn Eigeninteressen durch Notwendigkeit gekennzeichnet sind, dann erfüllt sich Freiheit als die Unabhängigkeit von solchen Eigeninteressen. Kants Begriff der negativen Freiheit liefert demnach das Argument für die geforderte Einschränkung selbstbezogener Interessen und erklärt, warum wir dies überhaupt sollen. Wir sollen Eigeninteressen einhegen, weil sich dadurch Freiheit realisiert. Das Sollen gründet demnach auf der Freiheit. Kants Begriff der positiven Freiheit dient argumentationsstrategisch dem Ziel, dem Sollen sein moralisches Leben einzuhauchen. Negative Freiheit erklärt zwar, weshalb freie Wesen Eigeninteressen einschränken sollen, nicht aber, warum sich hieraus Konsequenzen für die Moral ergeben. Damit das Sollen ein moralisches Sollen wird, bedarf es der positiven Freiheit. Negative Freiheit allein ist moralisch leer. Sie lässt im Dunkeln, weshalb die Forderung nach Selbstbeschränkung dem sozialen Miteinander zugutekommt und beispielsweise die Pflicht impliziert, andere nicht zu verletzen und Bedürftigen zu helfen. Negative Freiheit lässt den Klärungsbedarf ungedeckt, warum Eigeninteressen dann und nur dann eingeschränkt werden, wenn auf fremde Ansprüche Rücksicht genommen wird. Das Sollen besitzt ein moralisches Gewicht deshalb, weil die geforderte Einhegung von Eigeninteressen nur in der Form eines moralischen Handelns zugunsten Anderer bewerkstelligt wird. Wir schränken unser Eigeninteresse ein, indem wir uns der Geltung moralischer Rechte Anderer unterwerfen. Eigeninteressen werden nur dadurch eingeschränkt, dass sie der Rücksicht auf allgemeine Rechte untergeordnet werden. Denn sofern Eigeninteressen einen notwendigen Antrieb bilden, können wir uns ihrer nicht kurzerhand entledigen. Stattdessen bedarf es einer anderen Größe, der ein Vorrang gebührt und der die Eigeninteressen untergeordnet werden können. Diese Größe ist die Gleichheit mit den Anderen als vernunftbegabte und verletzbare Wesen. Die eigenen Ansprüche etwa auf Hilfe in Not besitzen ein äquivalentes Gegengewicht in dem gleichen Recht, das andere Personen wahrnehmen können. Uneigennütziges Handeln gelingt nicht durch Entsagung oder Unterdrückung von Eigeninteressen, sondern mit deren Einschränkung, indem wir Personen
21
Das Recht auf Rechtfertigung: Elemente einer konstruktivistischen Theorie der Gerechtigkeit, Frankfurt am Main 2007, 74–99. Kants Vorstellung von unvollkommenen Pflichten, also Pflichten, denen keine Rechte korrespondieren, ist in Bezug auf Pflichten gegenüber anderen irreführend und scheint für Kant ohnehin von systematischem Gewicht nur in Bezug auf die Pflichten gegen sich selbst zu sein.
Die Würde von Freien und Gleichen
53
als Rechtsträger achten und ihre Ansprüche respektieren. Der Grund des moralischen Sollens ist also die Freiheit, die wir allein dadurch realisieren, dass wir uns der Autorität moralischer Ansprüche unterwerfen. Kants Verknüpfung von moralischer Achtung und Autonomie setzt eine Prämisse voraus. Die anthropologische Prämisse besteht in der Auffassung, dass Eigeninteressen durch Notwendigkeit gekennzeichnet sind. Die Prämisse notwendiger Eigeninteressen drückt Kant terminologisch durch den Gegensatz zwischen Natur und Freiheit aus. Neigungen und Bedürfnisse werden der Natur und Kausalität zugeordnet, die im Gegensatz zur Freiheit stehen. Kants Ansicht von der Notwendigkeit des Eigeninteresses steht in einer Linie mit Hobbes’ Bild vom notwendigen Antrieb der individuellen Selbsterhaltung und Schopenhauers Idee des unverfügbaren principium individuationis. a) Die Prämisse, dass Eigeninteressen durch Notwendigkeit gekennzeichnet sind, betrifft zunächst die negative Freiheit. Die Prämisse wird vorausgesetzt, weil nur unter ihrer Bedingung der Gedanke stichhaltig ist, dass Freiheit die Unabhängigkeit von Eigeninteressen einschließt. Denn Freiheit erfüllt sich nur dann als Freiheit von selbstbezogenen Interessen, wenn diese Interessen eine Notwendigkeit charakterisiert, die der Freiheit entgegensteht. Zwei Merkmale kennzeichnen die Notwendigkeit des Eigeninteresses: Zwang und Zufall. Eigeninteressen gehören erstens zu einem Begehrungsvermögen, das als Zwang erfahren wird. Die Lebensführung ist unfrei im Hinblick auf den „Zwange selbst wahrer Bedürfnisse“, nach deren Befriedigung gestrebt werden muss.22 Das unausweichliche Streben nach der Befriedigung von Neigungen und Bedürfnissen ist eine Eigenschaft der sinnlichen Natur des Menschen. Eigeninteressen gehören zur menschlichen Natur und sind notwendige Antriebskräfte, die wir nicht kurzerhand ausknipsen können. Das Handeln frei von Eigeninteressen ist deshalb bei Kant keineswegs gleichbedeutend mit einem Rigorismus, ohne Eigeninteressen zu handeln, sondern bedeutet recht verstanden, dass Eigeninteressen eingeschränkt werden können.23 Die Realisierung eines Handlungsziels hängt zweitens von kontingenten „Glücksumständen“ ab.24 Zu solchen Umständen zählen unverfügbare Bedingungen, deren Urheber nicht der Akteur ist; beispielsweise Talente, günstige Zeitumstände und äußere Güter wie ererbter Reichtum. Ob ein Lebensplan glückt oder scheitert, hängt wesentlich von solchen kontingenten Bedingungen des Handelns ab. Die Freiheit, über das eigene Schicksal zu bestimmen, verlangt deshalb nach einer Lebensform, in der Umstände, die nicht in unserer Hand liegen, eine möglichst geringe Rolle spielen. Im Kontrast zu aristoteLes, der die vita contemplativa als effektivste Eindämmung des Zufalls veranschlagt, weist Kant der moralischen Lebensform diese Leistung zu.25 Die moralische Lebensform realisiert sich in der Gesinnung, die moralischen Rechte der Anderen anzuerkennen und dadurch das Eigeninteresse einzuschränken. Dass die moralische Lebensform realisiert wird unab22 23 24 25
Kant, immanueL, (Fn 18), 213, 29–30 (AA V, 160). Den Vorwurf des Rigorismus weist nachdrücklich zurück: enGstrom, stePhen, The Form of Practical Knowledge: A Study of the Categorical Imperative, Cambridge 2009, bes. 25–94. Kant, immanueL, (Fn 18), 214, 15 (AA V, 161); vgl. 25, 12; 25, 32; 33, 7; 34, 3; 83, 28–29 (AA V, 20, 21, 25, 26, 61). aristoteLes, Nikomachische Ethik 1177 a 28–35.
54
Tilo Wesche
hängig von Handlungsfolgen, deren Erfolg von zwangsläufig kontingenten Handlungsbedingungen mit abhängt, macht das Wesensmerkmal der deontologischen Ethik aus. b) Die Prämisse, dass Eigeninteressen durch Notwendigkeit charakterisiert sind, wird auch von der positiven Freiheit vorausgesetzt. Die Annahme, dass das Eigeninteresse allein durch die Achtung der Rechte Anderer eingeschränkt wird, ist zwingend nur unter der Voraussetzung, dass Eigeninteressen unvermeidlich sind und nicht anders – etwa durch Verzicht, Entsagung oder Unterdrückung – als durch die einschränkende Autorität der Rechte eingehegt werden. Wir können zwar einzelne Interessen aufgeben, nicht aber das Eigeninteresse selbst fallen lassen und uns von ihm lösen. Das Eigeninteresse ist ein unausweichliches Verlangen, das man ebenso wenig abstreifen kann wie man aus seiner Haut steigen kann. Wir können unsere sinnliche Natur zwar nicht ablegen, aber uns – so Kants terminus technicus – über sie „erheben“.26 Die Erhabenheit über selbstbezogene Interessen wird allein von der moralischen Rücksichtnahme ermöglicht. Wir erheben uns über unser Eigeninteresse dann und nur dann, wenn es von den anerkannten Rechten anderer eingeschränkt wird. 3. DIe achtung
Der
würDe
als
wertschätzung
Der
autonoMIe
In der Architektonik von Kants Philosophie hat der Begriff der Würde seinen Ort im Begründungsprogramm der Moral. Würde besitzt der Mensch aufgrund seiner Autonomie. Autonomie ist, wie dargelegt, der Grund, weshalb Personen sich wechselseitig als Freie und Gleiche respektieren. Aus Gründen der Freiheit berücksichtigen wir die moralischen Ansprüche Anderer. Kants Begründung der moralischen Rücksichtnahme aus der Freiheit zieht nun die Frage nach sich, wie sich der Wert der Freiheit begründen lässt. Wenn Freiheit moralische Rücksichtnahme begründet, welchen Grund gibt es dann wiederum dafür, Freiheit wertzuschätzen? Diesen grundlegenden Wert der Freiheit nennt Kant Würde. Kants Würdebegriff bedeutet den unbedingten Selbstwert der Freiheit, deren Geltung von nichts anderem als ihr selbst abhängt. Sie ist ein oberstes Ziel und wird um ihrer selbst willen, oder besser: um ihrer Würde willen erstrebt. Die Würde – der Wert der Freiheit, dem unbedingte Achtung gebührt – wird dabei von Kant als eine Tatsache nachgewiesen. Zu diesem Beweisziel führen vier Argumentationsschritte, die anhand folgender Erläuterung der dritten Formel des kategorischen Imperativs, der Autonomie-Formel rekonstruiert werden sollen. „[E]s hat nichts einen Wert, als den, welchen ihm das Gesetz bestimmt. Die Gesetzgebung selbst aber, die allen Wert bestimmt, muß eben darum eine Würde, d. i. unbedingten, unvergleichlichen Wert haben, für welchen das Wort Achtung allein den geziemenden Ausdruck der Schätzung abgibt, die ein vernünftiges Wesen über sie anzustellen hat. Autonomie ist also der Grund der Würde der menschlichen und jeder vernünftigen Natur.“27 26 27
Vgl. Kant, immanueL (Fn 18), 109, 28 (AA V, 80). Kant, immanueL, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten AA IV, 436. Kant verwendet drei Bedeutungen von Achtung, die sich keineswegs gegenseitig ausschließen. Sein einheitlicher Achtungsbegriff kommt auf drei Ebenen vor: Die Achtung der Würde, von der im obigen Zitat die Rede ist, betrifft erstens die Wertschätzung der Freiheit als Grund für Moralität. Moralität hat
Die Würde von Freien und Gleichen
55
Würde besitzt bei Kant erstens den Stellenwert einer Grundlage, der im obigen Zitat im Übergang vom ersten zum zweiten Satz angezeigt wird. Sie stellt das Fundament oder die Basis der moralischen Rücksichtnahme dar. Moralische Rücksichtnahme geht aus der Freiheit hervor, die dem Menschen seine Würde verleiht. Kant stellt damit einen Zusammenhang zwischen Würde und Moral her. „[D]ie Sittlichkeit und die Menschheit, sofern sie derselben fähig ist, [ist] dasjenige, was allein Würde hat.“28 Diese Verknüpfung von Würde und Moral rechtfertigt sich daraus, dass die Würde diejenige Freiheit betrifft, die der Grund der moralischen Rücksichtnahme ist. Das Instrumentalisierungsverbot, andere nicht bloß als Mittel, sondern ‚jederzeit zugleich als Zweck zu gebrauchen‘, erschöpft deshalb nicht den vollen Sinn von Kants Würdebegriff.29 Denn es beschreibt die moralische Rücksichtnahme Anderer, die jedoch als eine Folge aus der Würde hervorgeht, welche sich auf die Autonomie und damit auf den Grund für die moralische Rücksichtnahme bezieht. Zudem greift Kant hier eine Bedeutungskomponente des traditionalen Würdebegriffs auf. Dieser schloss die Hoheit von Würdenträgern ein, deren Rang sie dazu befugte, sich über Konventionen zu erheben. In Kants egalitärem Würdebegriff fließt die Bedeutung der „Erhabenheit“ mit ein, wobei die Würde moralischer Personen darin besteht, sich über selbstbezogene Interessen zugunsten der moralischen Rücksichtnahme Anderer zu erheben (siehe oben).30 Würde ist zweitens ein evaluatives Attribut der Freiheit. Würde kommt Menschen aufgrund ihrer Autonomie zu und bezeichnet den unbedingten Selbstwert der Autonomie, die für sich selbst steht und aus keinem weiteren Zweck abgeleitet werden kann.31 Auf diese Bedeutung der Würde als eines unbedingt schützenswerten Zwecks verweist Kants Unterscheidung zwischen Preis und Wert. „Im Reich der Zwecke hat alles entweder einen Preis oder eine Würde. Was einen Preis hat, an dessen Stelle kann auch etwas anderes, als Äquivalent, gesetzt werden; was dagegen über allen Preis erhaben [!] ist, mithin kein Äquivalent verstattet ist, das hat eine Würde. […] das […], was die Bedingung ausmacht, unter der allein etwas Zweck an sich selbst sein kann, hat nicht bloß einen relativen Wert, d. i. eine Preis, sondern einen
28 29
30 31
zweitens die Form einer Achtung für das moralische Gesetz (vgl. Grundlegung zur Metaphysik der Sitten AA IV, 400, 403, 426), die als moralische Achtung bezeichnet und als die Achtung des moralischen Status von Freien und Gleichen beschrieben werden kann. Aus diesem moralischen Status ergibt sich wiederum drittens die Achtung gegenüber anderen Personen, die Kant vor allem in seiner Tugendlehre erläutert (Metaphysik der Sitten AA VI, 462–468) und als der Respekt gegenüber konkreten Ansprüchen begriffen werden kann. Kant, immanueL, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten AA IV, 435. Kant, immanueL, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten AA IV,429. Die zweite Formel des kategorischen Imperativs wird oftmals – einschlägig, allerdings ohne explizite Bezugnahme von Dürig für seine Objektformel – herangezogen und, entgegen Kants Würdebegriff, mit der Würde des Menschen identifiziert. Obwohl Kant einen solchen Zusammenhang herstellt – die Referenzstellen sind: Metaphysik der Sitten AA VI, 434 f., 462 –, verkürzt dieses Identitätsverhältnis den Zusammenhang bei Kant zwischen Würde und Autonomie als Grund der Moralität. Einen ähnlichen Einwand erhebt: Von der Pfordten, dietmar, Menschenwürde, Recht und Staat bei Kant: Fünf Untersuchungen, Paderborn 2009, 18–19. Kant, immanueL, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten AA IV, 439, 440. Vgl. Metaphysik der Sitten AA VI, 434, 436, 462. Dieser Zusammenhang zwischen Würde und Selbstzweck wird ausführlich dargelegt in: sensen, oLiVer, Kant on Human Dignity, Berlin [u. a.] 2011, 5. Kapitel.
56
Tilo Wesche
inneren Wert, d. i. Würde.“32 Die Würde der Freiheit ist ein „unvergleichlicher“ Wert, der durch keinen anderen aufgewogen oder gemindert werden kann. Die Wertdimension der Würde schließt drittens einen Achtungsanspruch ein. Der unbedingte Wert der Freiheit wird als ein Anspruch auf ihre uneingeschränkte Achtung wahrgenommen. Die Achtung der Würde bedeutet also die unbedingte Wertschätzung der Freiheit. Der Achtungsanspruch stellt sich insbesondere in Gestalt der Selbstachtung. Selbstachtung ist die Achtung vor der eigenen Freiheitsfähigkeit. Sie ist „die Achtung für uns selbst im Bewußtsein unserer Freiheit.“33 Personen achten sich selbst hinsichtlich der Fähigkeit, Eigeninteressen freiwillig durch die Anerkennung der Rechte anderer einschränken zu können. In der Selbstachtung bringt sich ein notwendiges Freiheitsbewusstsein zum Ausdruck. In ihr sind sich Personen zwangsläufig ihrer Freiheit als eines Wertes bewusst, der Achtung verdient. Das Bewusstsein der Freiheit muss nicht erst gefordert werden, weil es jeder absichtsvollen Einstellung schon zuvorkommt. Gefordert werden vielmehr Handlungen, die dem Bewusstsein der Freiheit gerecht werden, also moralische Handlungen, die die Selbstachtung verdienen. Man kann entweder in Übereinstimmung mit dem Freiheitsbewusstsein oder im Widerspruch zu ihm handeln. Unmöglich aber ist es, ein Freiheitsbewusstsein zu wählen oder abzuwählen. Für das praktische Wissen ist Freiheit sozusagen ein Fixpunkt, in dessen Licht dem Akteur seine Überzeugungen und Handlungen zwangsläufig erscheinen. Im Lichte der Freiheit erscheinen sie ihm je entweder als achtenswert oder als verachtungswürdig. Dieses Entweder-Oder ist unhintergehbar. Die Würde wird von Kant viertens auf Wesen beschränkt, die zur Vernunft begabt sind. Er schließt dabei nicht aus, dass es andere Wesen als Menschen gibt, die Vernunft besitzen. Irrtümlich wird Kants Verflechtung von Würde mit Vernunft oftmals damit erklärt, dass Vernunft der Grund sei, dem Menschen ihre Würde verdanken. Demgegenüber lässt das obige Zitat keinen Zweifel daran, dass Menschen ihre Würde der Freiheit verdanken und Vernunft ein zusätzliches Merkmal der würdefähigen Wesen ist. Kants Motiv, Vernunft zusätzlich als Voraussetzung der Würde einzuführen, erklärt sich aus der Argumentationsstrategie, die Notwendigkeit des Achtungsanspruchs im Rückgriff auf die Vernunft zu begründen. Dass der Achtungsanspruch, wie soeben dargelegt wurde, unhintergehbar ist, erklärt Kant mit dem Faktum der Vernunft. Darunter versteht er eine Vernunftfähigkeit, deren Ausübung ihr notwendiges Ziel ist. Als ein Faktum strebt die Vernunftfähigkeit durch sich selbst oder, in Kants Worten, aus Spontaneität zur Ausübung.34 Personen haben demnach nicht die Wahl, ihre Vernunftfähigkeit auszuüben oder nicht auszuüben. Das Freiheitsbewusstsein verschafft sich notwendig Geltung, weil seine Fähigkeit von selbst ausgeübt wird. Das nicht wählbare Freiheitsbewusstsein geht auf die Notwendigkeit zurück, mit der seine Fähigkeit zur Ausübung drängt. Die Achtung der Würde tritt also als Selbstachtung in Erscheinung und bringt ein notwendiges Freiheitsbewusstsein zum Ausdruck. Wenn den Vernunftfähigkeiten ihre Ausübung als ein inneres Ziel eingeschrieben ist, dann kann ihre Ausübung nur durch äußere Umstände gewaltsam blockiert 32 33 34
Kant, immanueL, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten AA IV, 434. Kant (Fn 18), 214, 20–21 (AA V,161). Die Idee der Spontaneität einer Vernunft, die sich selbsttätig und autonom verwirklicht, wird ausgeführt in: rödL, sebastian, Self-Consciousness, Cambridge 2007.
Die Würde von Freien und Gleichen
57
werden. Würdeverletzungen werden deshalb als Defekte einer Fähigkeit begreiflich gemacht, die durch sich selbst zur Ausübung drängt. Nur aufgrund äußerer Umstände des Mangels – beispielsweise des Erlernens – sind Personen imstande, die Würde und ihre Selbstachtung zu verletzen. Solche Würdeverletzungen beschreibt Kant als das ‚radikal Böse‘. Radikal böse Handlungen stehen weder im Einklang mit noch im Widerspruch zur Selbstachtung und bilden einen eigenständigen Handlungstyp des Immoralismus. Personen werden hier als Träger moralischer Rechte nicht anerkannt und stattdessen so behandelt, als besäßen sie keine Würde. Der Immoralist handelt der Selbstachtung nicht bloß zuwider, indem er etwa gegen Pflichten verstößt oder moralische Rechte verletzt. Vielmehr fehlt ihm schlicht eine Selbstachtung, mit der seine Handlung in Konflikt geraten könnte. Das Fehlen der Selbstachtung kann daher nur durch äußere Umstände verursacht werden, die die Vernunftfähigkeit gewaltsam an ihrer Ausübung hindern und den Immoralisten seine Selbstachtung verkennen lassen. Damit ist Kants Beweisziel erreicht. Würde und ihr Achtungsanspruch sind eine Tatsache und müssen nicht normativ gefordert werden. Denn der Anspruch, Freiheit wertzuschätzen und als oberstes Ziel zu achten, besteht unausweichlich. Zwar können Personen durch äußere Umstände daran gehindert werden, diesen Anspruch wahrzunehmen. Ohne hindernde Umstände aber können sie nicht anders, als diese Wertschätzung der Freiheit von sich selbst und von anderen zu verlangen. Notwendig wird die Freiheit nicht der Wirklichkeit, sondern der Möglichkeit nach wertgeschätzt. Selbst wo im konkreten Fall die Würde missachtet wird, ist die Achtung als ein potentieller Anspruch trotzdem gegeben. Er wird hier allerdings durch äußere Umstände gewaltsam blockiert, ohne denen Personen von sich aus verlangen, dass die Würde von Freien und Gleichen geachtet wird. Kants Würdekonzeption zieht sich den Einwand zu, dass sie auf der unzutreffenden Prämisse eines Vernunftfaktums beruht.35 In zahlreichen Positionen der nachkantischen Philosophie wird die Annahme des Faktums der Vernunft, die sich notwendig zu verwirklichen strebt, in Zweifel gezogen.36 Sie entwerfen das ernüchternde Bild einer Vernunft, mit der Menschen nicht fest verdrahtet sind. Zwar gebührt der Vernunft ein Vorrang. Zugleich aber besteht die Freiheit, sich von diesem Vernunftvorrang ohne Not oder Zwang zu entlasten. Dass Vernunftfähigkeiten nicht ausgeübt werden, ist hier keine Frage von Hindernissen, sondern des Willens. Es liegen weder Mängel noch andere Umstände vor, die jemanden daran hinderten, zur Welt ein vernunftgeleitetes Verhältnis einzunehmen und Personen so zu respektieren, wie es der Achtungsanspruch erfordert. Dieser Fall wäre die unaufrichtige Selbstachtung einer Person, die zwar moralische Rechte nicht anerkennt, aber – im Unterschied zum radikal Bösen – ein intaktes Gefühl der Selbstachtung aufrecht erhält, ohne dass diese Unaufrichtigkeit durch äußere Umstände verursacht wird. Mit diesem illusionslosen Blick auf das Vernunftvermögen verändert sich auch das Verständnis der Menschenwürde. Wenn sich der Tatsachenstatus der Würde aus der Notwendigkeit der Vernunft erklärt, und wenn nun diese Vernunftnotwendigkeit 35
36
Einen ähnlichen metaphysikkritischen Einwand, der jedoch in eine andere Kerbe schlägt, erhebt: seeLmann, Kurt, Menschenwürde und die zweite und dritte Formel des Kategorischen Imperativs: Kantischer Befund und aktuelle Funktion, in: brudermüLLer, Gerd / seeLmann, Kurt (Hrsg.), Menschenwürde: Begründung, Konturen, Geschichte, Würzburg 2012, 67–77. Diese Auffassung wird ausführlich dargelegt in: Wesche (Fn 18), 3. Kapitel.
58
Tilo Wesche
fehlt, dann kann die Würde keine Tatsache sein. Entfällt die Prämisse einer Vernunftnotwendigkeit, so wird auch die Folgerung hinfällig, dass die Autonomie von selbst geachtet wird. Der Grund dafür, auf moralische Rechte Rücksicht zu nehmen, wird auch unter günstigen Umständen nicht zwangsläufig geachtet. Der Achtungsanspruch besteht nicht von vornherein, sondern muss stattdessen erst entstehen. Die Würde ist somit keine bestehende Tatsache, sondern das Ergebnis einer politischen und sozialen Zuschreibung. Diese Ansicht soll nun eingeholt werden. 4. DIe
MenschenrechtlIche
würDeIDee
Betrachten wir zunächst ein Fallbeispiel für die Würdeverletzung. Es ist den Tagebüchern von Victor KLemPerer entnommen, die er zu Zeiten der Naziherrschaft führte. Um seine Lebensmittelkarten einzulösen, war KLemPerer 1942 wegen des Verbots der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel gezwungen, den täglichen Weg von seinem ‚Judenhaus‘ in die Dresdner Innenstadt zu Fuß zu gehen. Die Beschränkungen des öffentlichen Aufenthalts auf Stunden bei Tageslicht sowie auf wenige Straßen boten weder den Schutz der Dunkelheit noch den Schutz urbaner Anonymität. Kenntlich durch den gelben Stern war er deshalb leicht sichtbar und der Gestapo ein distinktes Ziel der Demütigung. Eines Tages geschah es, dass eine unbekannte Frau auf ihn zutrat, seine Hand ergriff, ihn freundlich grüßte und ohne ein Erwarten der Erwiderung umkehrte. Ihre vornehme Bekleidung ließ keinen Zweifel, dass es sich um eine ‚Arierin‘ handelte, die sich mit ihrem Gruß über das Verbot des Kontakts zu Juden hinwegsetzte und strafbar machte. Wochen zuvor hatte ihm eine Bekannte ein ähnliches Erlebnis geschildert. In seinem Tagebuch berichtet KLemPerer von dieser Geste der Solidarität mit überschwänglichem Gefühl.37 Ihre volle Bedeutung tritt zutage, wenn man sie in Zusammenhang mit einem Eintrag aus dem Jahr 1938 betrachtet. Nachdem KLemPerer, ein weltweit renommierter Romanist und Vetter des Dirigenten otto KLemPerer, seine Anstellung an der Dresdner Universität verloren hatte, versuchte man von offizieller Seite, ihm auch sein Haus zu nehmen. „Vor einiger Zeit war der Gendarm radKe vom Gemeinderat hier, ich sollte wegen der Kennkarte heraufkommen. Wir unterhielten uns freundschaftlich, der Mann schüttelte mir die Hand, sprach mir Mut zu. Wir wissen von früher, dass er gewiss kein Nazi ist, dass seine Schwester Schwierigkeiten hat, weil ihr Mann, ein Gärtner, eine arische Großmutter zu wenig besitzt. Als ich dann anderntags ‚oben‘ war, kam er gerade durch das Zim37
„Auf dem Wasaplatz zwei grauhaarige Damen, etwa sechzigjährige Lehrerinnen, wie ich sie oft in meinen Vorlesungen und Vorträgen antraf. Sie bleiben stehn, die eine kommt mit ausgestreckter Hand auf mich zu, ich denke: eine alte Hörerin, und lüfte den Hut. Ich kenne sie aber doch nicht, und sie stellt sich auch nicht vor. Sie schüttelt mir nur lächelnd die Hand, sagt: ‚Sie wissen schon, warum!‘ und geht fort, ehe ich ein Wort finde. Solche Demonstrationen (gefährlich für beide Teile!) sollen des öfteren stattfinden. Gegenstück zum neulichen: ‚Warum lebst Du noch, du Lump!‘“ (8. Mai 1942) KLemPerer, Victor, Ich will Zeugnis ablegen bis zum letzten: Tagebücher 1933–1945, Berlin 1995, Bd. 2, 79 f. Die frühere Schilderung der Bekannten stammt vom 24. November 1941: „Frau Reichenbach erzählte […], ein Herr habe sie in der Ladentür gegrüßt. Ob er sich nicht in der Person geirrt habe? – ‚Nein, ich kenne Sie nicht, aber Sie werden jetzt öfter gegrüßt werden. Wir sind eine Gruppe, die den Judenstern grüßt‘.“ Ebd., Bd. 1, 688. Vgl., Bd. 2, 85, 224, 249, 253, 304, 306, 436, 493, 501, 567.
Die Würde von Freien und Gleichen
59
mer; er ging starr in die Luft blickend möglichst fremd an mir vorbei. Der Mann repräsentiert in seinem Verhalten wahrscheinlich 79 Millionen Deutsche, eher eine halbe Million mehr als weniger.“38 Der Unterschied zwischen dem Gruß und dem grußlosen Übersehen mag gemessen am sonstigen Leiden, das KLemPerer als Jude im Nazideutschland widerfährt, verschwindend gering ausfallen. Gerade weil er als geringfügig erscheint und KLemPerer ihn trotzdem als bedeutungsvoll erlebt, wirft er Licht auf eine bestimmte Unrechtserfahrung. Unrecht widerfährt hier in Gestalt einer Würdeverletzung durch Gleichgültigkeit. KLemPerer erfährt die Gleichgültigkeit gegenüber seiner Rechtlosigkeit nicht weniger entwürdigend als die Rechtlosigkeit selbst. Die menschenrechtliche Würdeidee antwortet auf zwei Arten des Unrechts. Die Würde wird erstens durch Rechtlosigkeit verletzt, wenn Personen die Institutionen vorenthalten werden, in deren Licht sie sich wechselseitig als Träger von Ansprüchen achten können. In der Debatte um die Menschenwürde wird häufig übersehen, dass die Gründungsakte der Vereinten Nationen, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und das Grundgesetz auf eine zweite Unrechtserfahrung antworten, die nicht mit der Rechtlosigkeit aufgeht. Ebenso wie durch Rechtlosigkeit wird die Würde durch die Gleichgültigkeit gegenüber solcher Rechtlosigkeit verletzt. Gegen die Würde des Menschen wurde zusätzlich durch das schweigende Wegsehen verstoßen, das nicht minder die Verbrechen der Nazi-, Kriegs- und Kolonisationszeit erst möglich machte. Der Imperativ des ‚Nie wieder‘, in dessen Namen die Menschenrechte erklärt wurden, richtet sich auch gegen die Gleichgültigkeit, mit der Menschenrechtsverletzungen übersehen und geduldet wurden. Die Menschenwürde wird durch Gleichgültigkeit als das zweifache Vorenthalten einer Anerkennung verletzt, indem jemandem Rechtsansprüche vorenthalten und die Wahrnehmung dieser Rechtlosigkeit verwehrt werden. Personen wird hier ihre Achtung als Rechtsträger vorenthalten, wobei dieses Vorenthalten nicht als Vorenthalten eines berechtigten Anspruchs wahrgenommen wird. Rechtlosigkeit verletzt den Anspruch auf Rechte. Gleichgültigkeit tritt hinzu, indem die Verletzung nicht als Verletzung betrachtet wird. Personen, denen Rechtsansprüche abgesprochen werden, wird durch Gleichgültigkeit zusätzlich ihre Wahrnehmung als rechtlose Personen verweigert. Unrecht nimmt hier eine bestimmte Gestalt von Unsichtbarkeit an, die den Opfern widerfährt, indem vor ihrer Entwürdigung und Erniedrigung die Augen verschlossen werden. Gleichgültigkeit verletzt die Würde einer Person, die übergangen und wie Luft behandelt wird, als zähle sie nicht, indem sie nicht einmal wahrgenommen wird als jemand, dem Ansprüche vorenthalten werden. Die historische Unrechtserfahrung der Gleichgültigkeit stellt Anforderungen an ein Würdeverständnis, das sich von demjenigen Kants unterscheidet. Trotz aller Unterschiede teilen sie die gemeinsame Vorstellung von der Würde als ein Achtungsanspruch. Kants Begriff der Würde bedeutet die unbedingte Wertschätzung – nicht die Geltung! – des moralischen Status von Freien und Gleichen. Mit der menschenrechtlichen Würdeidee wird indessen dem Umstand Rechnung getragen, dass, im Unterschied zu Kants Würdeverständnis, der Achtungsanspruch nicht vorausgesetzt werden kann. Die Wertschätzung wird vielmehr kraft eines Akts der Zuschreibung erzeugt. Würde wird Menschen – mittels ihrer öffentlichen Deklaration – in 38
Ebd., Bd. 1, 447.
60
Tilo Wesche
dem Sinne zugesprochen, als die Wertschätzung des moralischen Rechtsstatus erzeugt wird. Die Wertschätzung geht als das Ergebnis eines öffentlich bekundeten Willens erst hervor. Während also bei Kant die Würde als eine Tatsache beschrieben wird, nimmt sie in ihrem menschenrechtlichen Verständnis die Gestalt einer Zuschreibung an. Die menschenrechtliche Würdeidee besitzt fünf Eigenschaften. Sie nimmt eine ethische Form an, besitzt einen performativen Charakter, hat die Struktur der Anerkennung, zeichnet sich durch eine prozessuale Anlage aus und kann als Ermächtigungsnorm beschrieben werden. Die Würde – die Wertschätzung des moralischen Status von Freien und Gleichen – ist erstens das Ergebnis einer ethischen Selbstverständigung darüber, was für uns von unbedingtem Wert ist. Die Achtung als Freie und Gleiche geht als eine Antwort aus der Frage hervor, wie und als was wir uns verstehen wollen. Wir wollen uns als Mitglieder einer universalen Gemeinschaft von Freien und Gleichen verstehen. Zwar besitzen moralische Gebote und Verbote einen willensunabhängigen Verpflichtungscharakter und insoweit eine Geltung, die nicht das Ergebnis eines Willens sein kann.39 Dass Personen sich aber überhaupt als Freie und Gleiche, die Ansprüche einander gegenüber erheben dürfen, wechselseitig wahrnehmen, kann nicht gleichermaßen als eine Pflicht eingefordert werden. Damit Personen überhaupt für Gebote und Verbote empfänglich sind, müssen sie sich zuvor als Mitglieder einer Gemeinschaft von Freien und Gleichen betrachten. Die Achtung des moralischen Status von Freien und Gleichen selbst ist weder eine Verpflichtung noch, wie bei Kant, eine Tatsache, sondern das Resultat einer kollektiven Entscheidung. Die Würde ist die Basis der Rechte des Menschen, weil die Wertschätzung des moralischen Rechtsstatus das Ergebnis einer Willensentscheidung ist, die aus einer generalisierbaren Selbstverständigung hervorgeht.40 Die Würde verbürgt die Zugehörigkeit zur Gemeinschaft von Freien und Gleichen, weil wir uns zu ihr bekennen in einer humanen Selbstverständigung darüber, was für uns als Menschen unbedingt schützenwert sein soll. Der moralische Rechtsstatus verdankt zweitens seine Achtung einem performativen Akt der öffentlichen Willensbekundung.41 Ihm wächst seine Wertschätzung durch einen performativen Akt zu, indem Menschen ihren Willen, sich als Freie und Gleiche betrachten zu wollen, öffentlich erklären oder bekennen. Auch wenn die Geltung des moralischen Status von Freien und Gleichen ohne einen solchen performativen Akt auskommt, bedarf es seiner, damit Beteiligte ihren Rechtsstatus auch 39 40 41
schaber stellt zu Recht fest, dass die willensunabhängige Geltung der Menschenrechte nicht das Ergebnis einer willentlichen Zuschreibung sein kann; schaber, Peter, Sind Menschenrechte zugeschriebene Rechte?, in: Bornmüller/Hoffmann/Pollmann (Fn 16), 89–99. habermas stellt diesen Zusammenhang zwischen Würde und dem ethischen Fundament einer Entscheidung dar in: habermas, jürGen, Die Zukunft der menschlichen Natur. Auf dem Weg zu einer liberalen Eugenik?, Frankfurt am Main 2005, 70–80, 151–156. Den performativen Charakter der Menschenwürde untersucht Lohmann, dem ich in wesentlichen Punkten folge: Lohmann, GeorG, ‚Menschenwürde‘ – Leerformel oder Neuentwurf der Menschenrechte?, in: Ammer, Christian / von Bülow, Vicco / Heimbucher, Martin (Hrsg.), Herausforderung Menschenwürde: Beiträge zum interdisziplinären Gespräch, Neukirchen-Vluyn 2010, 101–128; ders., Menschenwürde als ‚soziale Imagination‘: Über den geschichtlichen Sinn der Deklaration der Menschenrechte und Menschenwürde nach 1945, in: Knoepffler, Niklaus / Kunzmann, Peter / O’Malley, Martin (Hrsg.), Facetten der Menschenwürde, Freiburg 2011, 45–74.
Die Würde von Freien und Gleichen
61
wertschätzen. Der performative Akt der öffentlichen Willensbekundung stiftet eine Wertschätzung des moralischen Rechtsstatus, ohne die sich die Erscheinungsform der Geltung auf ein moralisches Gesetz, das ‚in uns ist‘, auf die bloße Schriftlichkeit eines Rechtsdokuments oder auf ein privates Gewissen zurückzöge. Erst die performative Überführung des Willens in eine öffentliche Erklärung oder ein öffentliches Bekenntnis verleiht der Würde ihren Achtungsanspruch. Das Musterbeispiel für den performativen Akt ist die politische Deklaration, wie sie der Allgemeinen „Erklärung“ der Menschenrechte und den anschließenden Menschenrechtspakten zugrunde gelegt wird. Kraft des performativen Akts der Deklaration wird ihren Adressaten und Autoren Würde zugesprochen.42 Der moralische Rechtsstatus verdient eine kategorische Wertschätzung, indem die Menschengemeinschaft, vertreten durch die Repräsentanten der Völker, ihren Willen erklärt, dass Menschen einen unveräußerlichen und unverlierbaren Achtungsanspruch haben sollen. Der Anspruch, den Schutz der Würde fordern zu dürfen, kommt erst dann zum Zuge, wenn dem Willen, dass sie als schützenswert gelten soll, durch einen öffentlichen Erklärungsakt Ausdruck verliehen wird. Im deutschen Grundgesetz wird der Wille, dass Menschen eine unantastbare Würde zukomme, in einem performativen Akt des Bekenntnisses zu den Menschenrechten erklärt. Mit der Erklärung der Würde als unantastbar, achtens- und schützenwert, wie es in Art. 1 Abs. 2 heißt, „bekennt“ sich ein Kollektivsubjekt, das deutsche Volk, zu den Menschenrechten. Die Würde des Menschen wird als das ‚Bekenntnis‘ zu den Menschenrechten kundgetan, das die Gestalt einer verfassungsrechtlichen Institution annimmt.43 Der performative Akt erfüllt dabei einen reflexiven Sinn. Die performative Kundgebung des Willens schafft die reflexive Voraussetzung, dass sich die Betroffenen als Urheber dieses Willens begreifen. Staatliche Institutionen rufen reflexiv den Würdeanspruch als ihre eigene vorstaatliche Bedingung aus, die es überhaupt erst ermöglicht, dass sich Personen in der Teilnehmereinstellung als Mitglieder einer staatlichen, transnationalen oder völkerrechtlichen Rechtsgemeinschaft wahrnehmen. Dieses grundgesetzliche Bekenntnis zu einer überpositiven Würde verwandelt sich dabei seinerseits nicht in überpositives Recht.44 Ebenfalls reflexiv kommt in der Zivilgesellschaft eine Hintergrundgrundkultur zum Ausdruck, die es Personen in der Perspektive von Beteiligten erlaubt, sich als mit Ansprüchen ausgestattete Mitglieder einer sozialen Gemeinschaft zu betrachten. Die Würde bezieht sich drittens auf das intersubjektive Verhältnis der Anerkennung. Anerkennung ist bereits dem traditionalen Würdebegriff eingeschrieben, dem zufolge Personen als Mitglieder eines organisierten Gemeinwesens anerkannt werden. Auch die menschenrechtliche Würdekonzeption wird als Anerkennungsver42 43
44
Siehe zum performativen Charakter der Deklaration: o’maLLey, martin, A Performative Definition of Human Dignity, in: Knoepffler/Kunzmann/O’Malley (Fn 41), 75–101. Der Charakter eines vorstaatlichen Bekenntnisses, das zugleich in die institutionalisierte Form eines Verfassungsdokuments gegossen wird, wird von Goos anhand der Akten und Protokolle des Parlamentarischen Rates dargelegt. Goos stützt sich dabei vor allem auf Theodor Heuss’ Idee der Würde als ‚nicht interpretierte These‘ und Carlo Schmids Verständnis der Würde als ‚innere Freiheit‘, die der äußeren Freiheit der Grundrechte zugrunde gelegt wird; Goos, christoPh, „Innere Freiheit“: Eine Rekonstruktion des grundgesetzlichen Würdebegriffs, Göttingen 2011. Siehe hierzu: isensee, josef, Würde des Menschen, bes. 21–23.
62
Tilo Wesche
hältnis verstanden, indem in der Präambel zur Allgemeinen Menschenrechtserklärung eigens auf die „Anerkennung der angeborenen Würde“ hingewiesen wird; wobei sich die angeborene Würde nicht auf eine angeborene Propietät, sondern ihre universalistische und unveräußerliche Geltung bezieht, der zufolge jedem Mensch die gleiche Würde zusteht. Kraft des performativen Aktes des öffentlichen Bekenntnisses wird dem Willen Ausdruck verliehen, dass Personen Ansprüche geltend machen dürfen. Zweck des performativen Aktes ist es, dass Personen ausdrücklich als Rechtsträger anerkannt werden. Die ausdrückliche Anerkennung durch Dritte besitzt einen Eigenwert. Sofern die Würde, wie einst bei Kant, keine apriorische Tatsache ist, sondern kraft einer kollektiven Willensbekundung verliehen wird, können sich Personen ihrer Würde nicht durch einen Selbstbezug oder zweite Personen versichern. Politische Ordnungen, Rechtsinstitutionen und zivilgesellschaftliche Praktiken verkörpern den Willen, dass Personen in ihrem Licht als Freie und Gleiche anerkannt werden. Die Gewissheit, einen Anspruch auf die Achtung ihres moralischen Status zu haben, wird Personen durch Institutionen und Praktiken – wie der Gruß gegenüber KLemPerer – garantiert, in deren Licht sie als Träger dieses Status wahrgenommen werden und diese Wahrnehmung wiederum für sie erkennbar ist. Damit sich Personen ihrer Würde versichern können, müssen sie sich in den Augen anderer als Rechtsträger wahrnehmen können. Das Anerkennungsverhältnis gilt auch in Bezug auf die Würdeverletzung eines vorenthaltenen Rechtsanspruchs. In der Würdeverletzung wird der Anspruch verletzt, dass ein vorenthaltenes Recht als das Vorenthalten eines Rechts wahrgenommen werden können muss. In Fällen der Rechtlosigkeit dürfen Personen erwarten, als Träger vorenthaltener Rechte wahrgenommen zu werden. Die menschenrechtliche Würdeidee hat viertens eine prozessuale Struktur. Sie besitzt den historischen Sinn, dass sie aus einer Selbstverständigung hervorgeht, die mit der Unrechtserfahrung der Nazi-, Kriegs- und Kolonisationszeit konfrontiert ist. Der Wille, dass Personen kraft politischer, rechtlicher und sozialer Ordnungen als Freie und Gleiche zu achten sind, ist das Ergebnis einer Selbstverständigung, die ihren Impuls vom Schrecken der Unrechtserfahrungen empfängt.45 Die Einsicht in das, was wir wollen, zehrt von der Empörung über die Erniedrigung und Entwürdigung in der Zeit totalitärer Herrschaft. Zwar sind Unrechtserfahrungen keine notwendige Bedingung für eine fortschreitende Selbstverständigung. Lernprozesse, die nicht aus Krisen und Konflikten erwachsen, sind jedoch ein historisches Privileg. Hingegen ist der moderne Würdebegriff der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und des Grundgesetzes Unrechtserfahrungen abgerungen und damit aus einem historischen Kontext erwachsen. Die Würdeidee eines Achtungsanspruchs, der kraft unseres Willens Menschen zugeschrieben wird, war in den Vierzigerjahren kein bereits geltender Wert, auf den man kurzerhand zurückgreift. Sie ist vielmehr unter den bestimmten Voraussetzungen historischer Unrechtserfahrungen entstanden. Dieser Entstehungsprozess betrifft sowohl die institutionelle Verwirklichung der Menschenrechte als auch die – hier allein interessierende – Genese des Achtungsanspruchs der Würde. Die Leistung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und 45
Mögliche Einwände gegen diese Deutung werden dargelegt in: horn, christoPh, Lässt sich Menschenwürde in Begriffen von Selbstachtung und Demütigung verstehen?, in: Bornmüller/ Hoffmann/Pollmann (Fn 16), 101–118.
Die Würde von Freien und Gleichen
63
des Grundgesetzes besteht nicht zuletzt darin, dass der Würde als universalem Wert Geltung verschafft wurde, anstatt ihre Geltung als gegeben vorauszusetzen. Freilich war die Vorstellung von einer allgemeinen Würde, die dem Menschen gegeben ist, bekannt. Das Neue war vielmehr die selbstermächtigende Idee einer Würde, die wir uns geben wollen. Die Achtung von Freien und Gleichen wurde als ein Anspruch begriffen, den wir uns zuschreiben und institutionell verankern wollen, anstatt ihn transzendental oder naturalistisch als etwas vorauszusetzen, das implizit gegeben sei und nur ausdrücklich gemacht werden müsse. Die Würde ist das Ergebnis eines kollektiven Willens, der erst in einem historischen Kontext sich herausgebildet hat. Dieser Wille, dass Menschen eine unantastbare Würde zukomme, ist nicht zeitlos gegeben, sondern selbst ein Gewordenes. Würde ist kein von vornherein geltender Wert. Vielmehr wurde sie gegen Unrechtserfahrungen geltend gemacht, und erst im Widerstreit mit diesen gewann sie ihre unverwechselbare Strahlkraft. Die menschenrechtliche Deutung der Würdeidee erklärt also die zeitliche Genese ihres unabdingbaren Werts und antwortet auf die Frage, wie es zum Willen kommt, dass Menschen als Freie und Gleiche geachtet werden sollen. Die menschenrechtliche Würdeidee ist den Unrechtserfahrungen totalitärer Herrschaft abgerungen. Sie bezieht ihren unverwechselbaren Gehalt aus dem ‚Nie wieder!‘ und fordert Bedingungen ein, die den ‚Akten der Barbarei‘ zukünftig einen Riegel vorschieben. Diese Bedingungen konkretisieren sich als institutionelle und zivilgesellschaftliche Arrangements, die in der Lage sind, ein Unrecht abzuwehren, das sich nicht wiederholen soll. Diese Abwehrkraft gegen drohendes Unrecht kann als Ermächtigung, ‚empowerment‘ beschrieben werden. Die Würde berechtigt zu einem Anspruch auf politische, rechtliche und soziale Rahmenbedingungen, kraft derer Personen im Widerstreit mit Unrechtserfahrungen zu ihrer Wahrnehmung als Freie und Gleiche ermächtigt werden. Die Würdeidee nimmt deshalb fünftens die Gestalt einer Ermächtigungsnorm an. Damit ist keineswegs behauptet, das Verletzungsverbot oder die Empörung – das Negative – sei ein normativ Erstes oder besäße einen Vorrang gegenüber dem Würdeschutz und Rechtsanspruch – dem Positiven. Von einem logischen Standpunkt aus betrachtet kommt zuerst der Würdebegriff und anschließend folgt der negative Begriff der Verletzung, die es zu vermeiden gilt. Weil Personen Ansprüche erheben dürfen, deshalb sollen sie vor Verletzungen geschützt werden; und nicht umgekehrt. Unrechtserfahrungen sind indes in der Lage, eine Wertschätzung zu mobilisieren. Vor dem Hintergrund der Unrechtserfahrungen verliert die Würdegarantie ihre Selbstverständlichkeit, und es wird offenbar, dass sie eines Willens bedarf, der ausgebildet, institutionalisiert und stets erneuert werden muss. Anstatt darauf zu vertrauen, dass die unantastbare Würde eine unerschütterliche Tatsache ist, gilt es, sich des Werts stets aufs Neue zu vergewissern, der dem moralischen Status von einander als frei und gleich achtender Personen zukommt. Dessen Wertschätzung ist nicht unverlierbar. Ihrer muss man sich deshalb durch öffentliche Bekundung erst versichern. Autonomie nimmt in der menschenrechtlichen Würdeidee somit die Gestalt der Selbstermächtigung an. Der Wille, dass wir uns als Mitglieder einer universalen Gemeinschaft von Freien und Gleichen verstehen wollen, drückt einen Freiheitsakt der Selbstermächtigung aus. Dabei hängt dieser Wille nicht freischwebend in der Luft. Zwar geht die Würdeidee als Ergebnis aus dem Willen hervor, als was wir uns verstehen wollen. Dieser Wille bildet sich aber erst aus und verdankt sich dabei be-
64
Tilo Wesche
stimmten Entstehungsbedingungen. Solche Entstehungsbedingungen besitzen einen geschichtlichen Kern und gehen mitunter in dem Entsetzen über Unrechtserfahrungen auf, das als zivile und politische Kraftquelle für die Willensbildung wirkt. Hier zeigt sich ein grundlegender Unterschied zu Kants Würdekonzeption. Würde steht bei Kant für einen Achtungsanspruch gegenüber der Autonomie, der kraft der Vernunft als Tatsache zum Zuge kommt. Die Bedingungen, die eine Ausübung des Vernunftvermögens ermöglichen, fallen in das Vernunftvermögen selbst. Ohne äußere Blockaden strebt das Vernunftvermögen von sich aus zur Verwirklichung. Dagegen ist der aus einer historischen Erfahrung gewachsene Wille kein solches Vermögen, dessen Bedingungen in ihm selbst gegeben sind. Der freie und öffentlich bekundete Entschluss, den moralischen Rechtsstatus von Freien und Gleichen wichtig zu nehmen, geht stattdessen aus einer historischen Erfahrung hervor. Man fällt deshalb leicht dem Eindruck anheim, der Wille verfestige sich zu einer unverlierbaren Natur. Ebenso aber wie der Wille einst entstanden ist, droht er auch zu vergehen. Den Akteuren einer politischen und zivilen Bürgersellschaft wird deshalb zugemutet, ihren Willen, dass Menschen eine Würde zukommt, durch eine lebendige Praxis der Politik und Zivilgesellschaft stets zu erneuern.
stePhan Kirste, saLzburG recht – selBst – BestIMMung neuere konzepte
Der
autonoMIe
unD Ihr
verhältnIs
zuM
recht
Autonomie, sei sie als Selbstbestimmung, Selbstgesetzgebung, Selbstregierung oder anders verstanden1, ist in der reinen Selbstbezüglichkeit in den letzten Jahren in die Kritik geraten2. Die deontologische Bestimmung des moralischen Selbst durch das Sittengesetz im Sinne immanueL Kants3 wird dabei ebenso bezweifelt, wie die freie Entscheidung des ungebundenen Individuums durch den Utilitarismus john stuart miLLs4. Skepsis und die Suche nach Alternativentwürfen kommen nicht nur aus dem kommunitaristischen Lager5, das das Selbst der „Bestimmung“ als sozial verankert versteht6; postmoderne Autoren zweifeln an dem einheitlichen Selbst7, das sich selbst schaffen und gestalten kann, wie es existentialistische Theorien noch an1
2
3
4 5
6 7
seLLers, mortimer: An Introduction to the Value of Autonomy in Law. In: Autonomy in the Law. Hrsg. v. M. Sellers. Dordrecht/Heidelberg (Ius Gentium, Vol. 1) 2007, 1–9, 1 definiert: „Autonomy, in its simplest and most natural sense, signifies self-rule: the right of states, or of families, or of associations or individuals to make their own laws for themselves“. Vgl. etwa Larmore, charLes: Politischer Liberalismus. In: Kommunitarismus. Eine Debatte über die moralischen Grundlagen moderner Gesellschaften. Hrsg. v. A. Honneth. Frankfurt/ Main 1993, 131–156.1993, 136 f.; anderson, joeL / honneth, axeL (2005): Autonomy, Vulnerability, Recognition, and Justice. In: Autonomy and the Challenges of Liberalism. Cambridge, New York, Melbourne u. a. 2005, 127–149., 127 f. Kant, immanueL: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Hrsg. v. W. Weischedel. Werkausgabe Bd. VII. Frankfurt/Main 1974, 7–102, 66 u. 73 ff.; zur Verteidigung der Kantischen Autonomiekonzeption gegen Kritiker tayLor, robert: Kantian Personal Autonomy. In: Political Theory 33 (2005), 602–628, 606 ff. miLL, john stuart: Über die Freiheit. Stuttgart 1974, Kap. 3. Zu Grundaussagen des Kommunitarismus bruGGer, Winfried: Zur Rationalität des Kommunitarismus und zu seiner Bedeutung für die Verfassung Deutschlands und Europas. In: ders.: Integration, Kommunikation, Konfrontation in Recht und Staat. Hrsg. v. Helen Brugger und Stephan Kirste. Berlin (Schriften zum Öffentlichen Recht Band 1252) 2013, 275–306, 275 ff., bes. 280 u. bruGGer, Winfried: Zum Verhältnis von Neutralitätsliberalismus und liberalem Kommunitarismus. Dargestellt am Streit über das Kreuz in der Schule. In: ders.: Integration, Kommunikation, Konfrontation in Recht und Staat. Hrsg. v. Helen Brugger und Stephan Kirste. Berlin (Schriften zum Öffentlichen Recht Band 1252) 2013, 348–390, 360 ff., bruGGer, Winfried: Kommunitarismus als Verfassungstheorie des Grundgesetzes. In: ders.: Liberalismus, Pluralismus, Kommunitarismus. Studien zur Legitimation des Grundgesetzes. Baden-Baden 1999, 253–284, 259; typisch die Aussage von nisbet, robert a.: Community and Power. Oxford 1962, 279: „The liberal values of autonomy and freedom of personal choice are indispensable to a genuinely free society, but we shall achieve and maintain these only by vesting them in the conditions in which liberal democracy will thrive – diversity of culture, plurality of association, and division of authority.“ sandeL, micheL: Die verfahrensrechtliche Republik und das ungebundene Selbst. In: Kommunitarismus. Eine Debatte über die moralischen Grundlagen moderner Gesellschaften. Hrsg. v. A. Honneth. Frankfurt/Main 1993, 18–35, 22 f. Vgl. etwa tierney, WiLLiam G.: The autonomy of knowledge and the decline of the subject: Postmodernism and the reformulation of the university. In: Higher Education 41 (2001), 353– 372, 354: „I drop the notion of a singular, cohesive identity that acts as an autonomous agent;
66
Stephan Kirste
genommen hatten8. Auch Liberale relativieren ihr Konzept der Autonomie, verstehen Personen als wechselseitig mit anderen verbunden. Es werden ökonomische Zwänge thematisiert, aber auch die Schwierigkeiten langfristiger Entscheidungen akzentuiert. harry franKfurt9 und GeraLd dWorKin10 haben bereits in den 80er Jahren hierarchische Modelle von Autonomie entwickelt. Danach ist eine Person autonom, wenn ihre Willensäußerungen den höherrangigen Wünschen entsprechen. Diese Modelle verlangen ein gewisses Maß an Rationalität als Voraussetzung von Autonomie. Im Autonomieverständnis Mills war dies noch nicht der Fall. Gerade das wird aber als zu weitgehend kritisiert. Nicht alle Fragen und Argumente, die dabei zur Sprache kommen, sind neu; dennoch werden in der Breite der Diskussion besonders im Bereich der Bioethik Fragen der Autonomie sichtbar, die in dieser Differenziertheit zuvor kaum diskutiert wurden11. Ich werde im Folgenden zunächst eine begriffliche Klärung von Autonomie vornehmen, sodann zwei neuere Autonomiekonzeptionen vorstellen und schließlich eine Konzeption von rechtlicher Autonomie skizzieren. I. zur klärung
Des
BegrIffs autonoMIe
Ich verstehe unter „Autonomie“ die Bestimmung des Selbst durch sich anhand von für richtig gehaltenen allgemeinen Prinzipien12. Autonomie enthält also die Momente „Selbst“, „Bestimmung“ und „Prinzip“. „Autonomie“ stammt sprachlich aus dem Griechischen (αὐτονόμος, αὐτονομία) und setzt sich aus „Selbst“ und „Gesetz“ zusammen. Das Lateinische verzichtete auf eine wörtliche Übertragung. Die mittelalterliche Philosophie nutzte den Begriff nicht13, auch wenn der verwandte
8
9 10 11 12
13
instead I develop the idea of a fractured subject that is shaped by, and helps shape, the culture in which identity exists“. Anders noch sartre, jean-PauL: Das Sein und das Nichts. Versuch einer phänomenologischen Ontologie. Hamburg 1967, 560 f.: „Ich bin dazu verurteilt, für immer jenseits meines Wesens zu existieren, jenseits der Antriebe und Anlässe meines Tuns: ich bin dazu verurteilt, frei zu sein. Das bedeutet, daß wir für unsere Freiheit keine anderen Grenzen als sie selbst finden können oder, wenn man lieber will, daß wir nicht die Freiheit haben, aufzuhören, frei zu sein… Also ist die Freiheit nicht ein Sein: Sie ist das Sein des Menschen, das heißt sein Nichts an Sein… Der Mensch kann nicht bald frei und bald Sklave sein: er ist gänzlich und immer frei, oder er ist es nicht.“ franKfurt, harry: Freedom of the Will and the Concept of a Person. In: The Importance of What We Care About, Cambridge 1987, 11 u. 47 ff. dWorKin, GeraLd: The Theory and Practice of Autonomy. Cambridge 1988. Eine Übersicht über einige neuere Publikationen etwa bei Kirste, stePhan: Literaturbericht ARSP: Autonomie und Selbstbestimmung in der Bioethik. In: ARSP 97 (2011), 132–138, 132 f. Ich klammere hier eine andere Bedeutung von Autonomie, die man institutionelle Autonomie nennen könnte, aus. Sie bezieht sich etwa auf die rechtliche Verselbständigung von juristischen Personen des öffentlichen Rechts gegenüber dem Staat, der sich weitgehend auf eine Rechtskontrolle ihres Handelns zurückzieht. Damit klammere ich auch Souveränität als Autonomie des Staates mit ihrer negativen (äußeren oder völkerrechtlichen) und positiven (inneren) Form aus, hierzu etwa seLLers (Fn 1), 4 f. PohLmann, rosemarie: Autonomie. In: J. Ritter / K. Gründer / G. Gabriel (Hrsg.): HWbPh, Bd. 1 (1971), Sp.701–719.
Recht – Selbst – Bestimmung
67
Begriff der Selbstbestimmung durchaus gebräuchlich war14. Vorübergehend büßt der Begriff seine politische Bedeutung ein und erhält sie erst etwa im 16. Jahrhundert wieder zurück15. Seit immanueL Kant ist Autonomie als ein Aspekt von Freiheit zu verstehen: Ohne Freiheit wäre eine Bestimmung des Selbst durch sich nicht möglich. Vielmehr wäre es durch anderes bestimmt. Freiheit kann – nicht erst seit isaiah berLin16 – in positive und negative Freiheit unterschieden werden. Negative Freiheit ist Abwesenheit oder Unabhängigkeit von fremder Beherrschung17 oder von Heteronomie18. Positive Freiheit ist hingegen die Freiheit zu etwas, etwa die Freiheit als „Bei-SichSelbst-Sein“19. Das Selbst setzt sich hier Zwecke, erstrebt Güter und bestimmt sich mit Rücksicht auf diese Güter, wie GeorG WiLheLm friedrich heGeL schreibt20. Autonomie ist danach genauer ein Aspekt positiver Freiheit. Ihre Realisierung setzt negative Freiheit voraus, trägt aber insofern zur Freiheit bei, als das Selbst sich nicht zu allem negativ verhalten, sich aus allem heraushalten und distanzieren kann, sondern positive Handlungsprinzipien entwickeln muß. Ohne diese positive Freiheit würde das Selbst auch seine negative verlieren21. Es würde aufhören, es selbst zu sein und sich fremden Bestimmungsgründen überlassen und damit auch sein Selbst verlieren. Beide Aspekte von Freiheit können als Äußerungen des Selbst verstanden werden, das sich von seiner Geschichte und von sich selbst und seiner Umwelt in Form der negativen Freiheit distanziert, diesen Rückzug aber als Ausgang für eine positive Beziehung auf seine Umwelt versteht und sich hierbei erst realisiert. Wenden wir uns also dem Selbst als erstem Moment der Autonomie neben der Selbstbestimmung und dem gesetzlichen Prinzip zu.
14 15 16
17 18
19 20
21
Gerhardt, VoLKer (1995): Selbstbestimmung. In: J. Ritter / K. Gründer / G. Gabriel (Hrsg.): HWbPh Bd. IX. Basel 1995, Sp. 335–346, Sp. 335 ff., 339, etwa im „ipsa libera voluntate per eam ipsam uti“ Augustins. PohLmann (Fn 13) Sp. 702 f.; oberreuter, heinrich (1995): Autonomie. In: Staatslexikon der Görresgesellschaft, Bd. 1. Freiburg – Basel – Wien 1985 (Nachdruck 1995), Sp. 490–493, Sp. 490 f. Zur Unterscheidung von positiver und negativer Freiheit vgl. böcKenförde, ernst-WoLfGanG: Freiheit und Recht / Freiheit und Staat. In: Staatslexikon der Görresgesellschaft, Bd. 1. Freiburg – Basel – Wien 1985 (Nachdruck 1995), Sp. 696–717, Sp. 696–717 unter Verweis auf die Ideengeschichte; und nicht erst Berlin, Isaiah (1958): Two concepts of liberty: an inaugural lecture delivered before the University of Oxford on 31 October 1958. Oxford 1958. Larmore, charLes (2008): The Autonomy of Morality. Cambridge, Cambridge University Press 2008, S. 175; dazu auch Kirste, stePhan (2010): Literaturbericht ARSP: Autonomie. In: ARSP 96 (2010), 578–586, 578 f. Kant (Fn 3) BA 97, 81: „Freiheit würde diejenige Eigenschaft dieser Kausalität [derjenigen lebender Wesen, SK] sein, da sie unabhängig von fremden sie bestimmenden Ursachen wirkend sein kann“. Diesem negativen Freiheitsbegriff stellt er aber einen positiven entgegen und versteht Freiheit in diesem Sinn als „Kausalität nach unwandelbaren Gesetzen“. böcKenförde (Fn 16), Sp. 705. heGeL, GeorG WiLheLm friedrich (Grundlinien §, S. A=Anmerkung; Z=Zusätze von Gans): Grundlinien der Philosophie des Rechts oder Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse. Mit Hegels eigenhändigen Notizen in seinem Handexemplar und den mündlichen Zusätzen. Hrsg. und eingeleitet v. Helmut Reichelt. Frankfurt/Main – Berlin – Wien 1972, § 6, A, Z. Treffend Goethe, johann WoLfGanG Von: Wilhelm Meisters Wanderjahre – oder Die Entsagenden. Frankfurt/Main 1982: „Alles was unsern Geist befreit, ohne uns die Herrschaft über uns selbst zu geben, ist verderblich“, S. 297.
68
Stephan Kirste
1. das seLbst Mit etwas Vorsicht und einigen Generalisierungen lassen sich ein paar begriffliche Abgrenzungen übergreifend vornehmen. Mit der Bestimmung des Selbst durch das Selbst meint Autonomie so viel wie Selbstbeherrschung22 und auch Selbständigkeit. Während jedoch Selbständigkeit einen Zustand bezeichnet, meinen Selbstbeherrschung und vor allem Selbstbestimmung Prozesse der Realisierung des Selbst23. Auch diese moralischen Formierungsprozesse des Selbst werden früh in der Ideengeschichte in einen engen Zusammenhang mit dem Recht und der Gerechtigkeit gebracht. PLaton schreibt etwa, daß sich diese Selbstbeherrschung auf die „innere Tätigkeit“ des Menschen beziehe, „die ja doch sein wahres Selbst und wahrhaft das Seinige ist“. Dieser innerlich Tätige „duldet nämlich nicht, daß irgend ein Teil seines Inneren Fremdartiges verrichte, noch daß die Vermögen der Seele sich eines in des anderen Geschäft mische, sondern er hat sein Haus im wahren Sinn wohlbestellt, hat die Herrschaft über sich selbst gewonnen (autonom), hat in sich Ordnung geschaffen, sich mit sich selbst innig befreundet und jene drei Seelenvermögen in Einklang gebracht“24.
Die an der Gerechtigkeit orientierte Herrschaft über sich selbst bezeichnet Platon als autonom. Hier wird bereits die Ambivalenz des „Selbst“, das sich beherrscht, deutlich: Einerseits setzt die Selbstherrschaft oder die Selbstbestimmung ein Selbst voraus, das sich beherrscht und bestimmt; andererseits macht sich das Selbst eben zu dem, was es ist, durch die Art und Weise seiner Bestimmung. Diese Ambivalenz könnte in der Differenz zwischen der wirklichen Konstruktion des Selbst und dem Bewußtsein von sich begründet sein. So schreibt etwa auch johann GottLieb fichte: „Das Ich hat … durch freie Reflexion über das Gefühl sich gesetzt als Ich, nach dem Grundsatze: das sich selbst setzende, das, was bestimmend und bestimmt zugleich ist, ist das Ich. – Das Ich hat demnach in dieser Reflexion (welche sich als Selbstgefühl äusserte), sich selbst bestimmt, völlig umschrieben und begrenzt. Es ist in derselben absolut bestimmend“25.
Wenn die Reflexion wesentlich zum Ich gehört, dann setzt sich das Selbst mit der Reflexion. Bewußtsein des Selbst von sich und es selbst hervorbringen, fallen zusammen. Man muß kein Platoniker oder Anhänger Fichtes sein, um dieser Idee des an sich seienden und durch die Ausdifferenzierung am Prinzip der Gerechtigkeit 22
23 24
25
Vgl. hierzu hoLLerbach aLexander (1996): Selbstbestimmung im Recht (Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse 1996,2). Heidelberg; Gerhardt, VoLKer (1999): Selbstbestimmung. In: Enzyklopädie Philosophie. Hrsg. v. H. J. Sandkühler. Hamburg, 1432–1436. hadot, P. (1995): Selbstbeherrschung. In: Historisches Wörterbuch der Philosophie. J. Ritter / K. Gründer / G. Gabriel (Hrsg.): HWbPh, Bd. IX. Basel 1995, Sp. 324–330, Sp. 324 ff. PLaton: Der Staat. Übersetzt und erläutert von Otto Apelt. Hamburg (Sämtliche Dialoge, Bd. V. Nachdr.) 1993, IV, 443d: „ἐντός, ὡς ἀληθῶς περὶ ἑαυτὸν καὶ τὰ ἑαυτοῦ, μὴ ἐάσαντα τἀλλότρια πράττειν ἕκαστον ἐν αὑτῷ μηδὲ πολυπραγμονεῖν πρὸς ἄλληλα τὰ ἐν τῇ ψυχῇ γένη, ἀλλὰ τῷ ὄντι τὰ οἰκεῖα εὖ θέμενον καὶ ἄρξαντα αὐτὸν αὑτοῦ καὶ κοσμήσαντα καὶ φίλον γενόμενον ἑαυτῷ καὶ συναρμόσαντα τρία ὄντα, ὥσπερ ὅρους τρεῖς ἁρμονίας ἀτεχνῶς, νεάτης τε καὶ ὑπάτης καὶ μέσης, καὶ εἰ ἄλλα ἄττα μεταξὺ τυγχάνει ὄντα, πάντα ταῦτα“. fichte, johann GottLieb (Wissenschaftslehre): Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre. Johann Gottlieb Fichte’s sämmtliche Werke. Bd. 1. Berlin 1845, 306–307.
Recht – Selbst – Bestimmung
69
sich für sich und zum Bewußtsein bringenden Selbst etwas abgewinnen zu können. Es könnte nämlich sein, daß hiermit nicht nur ein Prozeß des individuellen Selbstbewußtseins beschrieben wird, sondern daß sich der Prozeß einer am Recht und durch das Recht erfolgenden Selbstbestimmung auch im demokratischen Verfassungsstaat als Ausbildung eines Selbstbewußtseins des Volkes und des entsprechenden Handelns verstehen ließe. Zunächst ist nach dem Begriff des Selbst das zweite Moment der Autonomie zu untersuchen, die Bestimmung dieses Selbst. 2. autonomie und seLbstbestimmunG Autonomie ist eine Form der Selbstbestimmung26, bei der sich das Selbst anhand von Gesetzen bestimmt. Andere Formen der Selbstbestimmung könnten intuitiv, dezisionistisch oder emotional sein. So läßt Pico deLLa mirandoLa in seiner berühmten Rede über die Würde des Menschen Gott zu Adam sprechen: „Die Natur der übrigen Geschöpfe ist fest bestimmt und wird innerhalb von uns vorgeschriebener Gesetze begrenzt. Du sollst deine [Natur] ohne Beschränkung nach deinem freien Ermessen, dem ich dich überlassen habe, selbst bestimmen“27.
In der Gegenüberstellung zu den begrenzenden Gesetzen in der übrigen Natur und dem „freien Ermessen“ wird deutlich, daß die Bestimmung des Selbst bei Pico nicht durch Gesetze erfolgen muß. Versteht man demgegenüber Autonomie als Selbstbestimmung durch Gesetze, so stellt sich die Frage, ob diese Gesetze die Bedingung oder das Ergebnis der Selbstbestimmung sind. Der Neukantianer hermann cohen begreift die ethische Selbstgesetzgebung in dem Sinn, daß dem Selbst das praktische Gesetz durch die Vernunft vorgeschrieben wird28. „Das Selbst ist keineswegs und in keiner noch so idealen Gestalt vorher vorhanden, bevor es sich darlegt, und es hat sich keineswegs nur darzulegen; sondern es hat sich erst zu erzeugen“29.
Anders als in der Existenzphilosophie Sartres30 erzeugt sich das Selbst aber durch seine Handlungen, die nur freie, das Selbst ermöglichende Handlungen sind, wenn sie an Gesetzen orientiert werden31: „Die Gesetzgebung allein erzeugt das Selbst der sittlichen Handlung, des geschichtlichen Daseins“. Die Bestimmung fügt dem sittlichen Gesetz einen konkreten Inhalt hinzu: „in der Beschränkung der Bestimmung hat das Selbst sich zu erzeugen; als Meister zu erproben“, wie cohen im Anschluß an Goethe32 und Kant schreibt. Er meint so26 27 28 29 30 31 32
Dazu Gerhardt (Fn 22), 1432 ff. Pico deLLa mirandoLa: Über die Würde des Menschen. Übers. v. N. Baumgarten. Hrsg. v. A. Buck. Hamburg 1990, 7. Gerhardt (Fn 22), 1436. Die Selbstbestimmung bedeutet dann die Konkretisierung der in der ethischen Gesetzgebung nur generell-abstrakt vorgegebenen Merkmale. hermann cohen, Die Ethik des Reinen Willens, Berlin 1904, 321. Vgl. Fn 8. cohen (Fn 29), 321: „es kann sich nur erzeugen in der Gesetzgebung…Also die Selbstgesetzgebung ist nicht etwa die Gesetzgebung aus dem Selbst, sondern zum Selbst. Auf die Gesetzgebung kommt es an; in ihr erst bezeugt sich das Selbst; in ihr erzeugt es sich“. Ohne ihn freilich zu erwähnen. „Wer Großes will, muß sich zusammenraffen; In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister, Und das Gesetz nur kann uns Freiheit geben“, Goethe, johann
70
Stephan Kirste
mit eine Gesetzgebung für das Selbst. Selbstgesetzgebung des Ich und Selbstbestimmung verhalten sich also wie Gesetzgebung und Verwaltung zueinander. Beide können unter dem Begriff der Selbstbeherrschung zusammengefaßt werden33. Das vorjuridisch zu verstehende Gesetz34 erscheint hier als Bedingung der Möglichkeit des Handelns als Grundlage der Hervorbringung des Selbst. Autonomie kann jedoch auch diejenige Selbstbestimmung bezeichnen, bei der das Selbst die Gesetze seines Handelns bestimmt (Gesetzgebung durch das Selbst). Im ersten Fall ist das Gesetz, das Grundlage des Handelns ist, nicht notwendig selbstgesetzt; im zweiten Fall ist es das Ergebnis der Entscheidung des Selbst. Das wird besonders deutlich in nietzsches Autonomiebegriff35: nietzsche denkt sicher nicht an die Gesetzgebung für das Selbst, wenn er schreibt: „Wir aber wollen die werden, die wir sind – die Neuen, die Einmaligen, die Unvergleichbaren, die Sich-selberGesetzgebenden, die Sich-selber-Schaffenden!“36 Indem es sich eine Bestimmung gibt, schafft sich das Selbst. Es ist, wozu es sich macht. Das kann es nur selbst und dies ist es, wodurch es unverwechselbar wird. In der laufenden Selbstüberwindung seiner Selbstbestimmung ist es ein zukünftiges Selbst37. Das Gesetz dieser Bestimmung geht nur aus ihm selbst hervor, ist Ideal nur für es selbst und verliert sich nicht in dem, was alle tun sollen38. Das Selbst ist danach die Voraussetzung für die Geltung der Gründe als Maximen der Handlung.
33
34
35
36
37 38
WoLfGanG Von: Natur und Geist. In: Goethes Werke. Hrsg. im Auftrag der Großherzogin Sophie von Sachsen. I. Abt., 4. Bd. Weimar 1891. Nachdr. München 1987, 129. Kant, immanueL: Die Metaphysik der Sitten. Metaphysische Anfangsgründe der Tugendlehre. Immanuel Kant Werkausgabe, Bd. VIII. Hrsg. v. W. Weischedel. Frankfurt/Main 1982, 501– 634, A 50, 539: „Zur inneren Freiheit aber werden zwei Stücke erfordert: seiner selbst in einem gegebenen Fall Meister (animus sui compos) und über sich selbst Herr zu sein (imperium in semetipsum), d. i. seine Affekten zu zähmen und seine Leidenschaften zu beherrschen“. cohen (Fn 29), 321: „Gesetzgebung fordert das Recht und den Staat in die Schranken. In ihnen, in der juristischen Person, die durch sie vollzogen wird, erkennt das Selbst sein Urbild einer moralischen Person. So wird die Gesetzgebung zum Monopol der Sittlichkeit. Kein Gott kann sie ersetzen; keine Natur; keine Macht der Geschichte. Das Alles ist Mystik, welche nimmermehr zu einem wahrhaften sittlichen Selbst verhilft“. Gemes, Ken and may, simon, Nietzsche on Freedom and Autonomy, Oxford 2009. Hierzu auch Kirste (Fn 17), 580; Gemes, Ken and janaWay, christoPher: Nietzsche on Free Will, Autonomy and the Sovereign Individual. In: Proceedings of the Aristotelian Society, Supplementary Volumes, Vol. 80 (2006), 321–357, 321 ff. nietzsche, friedrich: Die Fröhliche Wissenschaft. In: Kritische Studienausgabe Bd. 3, Hrsg. v. G. Colli u. M. Montinari. 2. Aufl. Berlin/München 1988, Nr. 335, 563: „Moralisch zu Gericht sitzen, soll uns wider den Geschmack gehen! Überlassen wir dies Geschwätz und diesen üblen Geschmack denen, welche nicht mehr zu tun haben, als die Vergangenheit um ein kleines Stück weiter durch die Zeit zu schleppen, und welche selber niemals Gegenwart sind – den vielen also, den allermeisten! Wir aber wollen die werden, die wir sind – die Neuen, die Einmaligen, die Unvergleichbaren, die Sich-selber-Gesetzgebenden, die Sich-selber-Schaffenden!“. Gemes, may (Fn 35), 33 ff. nietzsche (Fn 36), Nr. 335, S. 561 f.: „Wie? Du bewunderst den kategorischen Imperativ in dir? Diese ‚Festigkeit‘ deines sogenannten moralischen Urteils? Diese ‚Unbedingtheit‘ des Gefühls ‚so wie ich, müssen hierin alle urteilen‘? Bewundere vielmehr deine Selbstsucht darin! Und die Blindheit, Kleinlichkeit und Anspruchslosigkeit deiner Selbstsucht! Selbstsucht nämlich ist es, sein Urteil als Allgemeingesetz zu empfinden; und eine blinde, kleinliche und anspruchslose Selbstsucht hinwiederum, weil sie verrät, daß du dich selber noch nicht entdeckt, dir selber noch kein eigenes, eigenstes Ideal geschaffen hast – dies nämlich könnte niemals das eines anderen sein, geschweige denn aller, aller!“
Recht – Selbst – Bestimmung
71
Die scheinbare Entgegensetzung der Gesetzgebung für das Selbst und der Gesetzgebung durch das Selbst läßt sich wiederum ähnlich wie beim Verständnis der beiden Bedeutungen des Selbst, das sich bestimmt, dialektisch vermitteln. Es gibt „an sich“ vielfältige gute Gründe für das Handeln des Selbst. Einige von ihnen mögen rationaler sein als andere, einige verallgemeinerbar sein und andere nicht; zu Gründen des Selbst werden sie erst durch ihre Anerkennung. Autonomie würde dann bedeuten, daß es an sich eine Reihe von guten Gründen für das Handeln gibt; ihre Geltung als eigene moralische Gründe hängt aber von der Anerkennung des Handelnden ab. Durch diese Anerkennung macht er sie sich zu eigen, transformiert sie von allgemeinen zu eigenen Handlungsmotiven und verschafft ihnen so eine Geltung für sich. Auch darauf wird unter juristischen Vorzeichen zurückzukommen sein. 3. der nomos der seLbstbestimmunG Bei PLaton war der Nomos, der die Selbstbestimmung zur Autonomie werden läßt, die Gerechtigkeit. Im Menschen wie in der Polis ist die Gerechtigkeit, die verlangt, daß jeder das Seine tut, Grundlage der Selbstbestimmung und Bedingung der guten Ordnung. Die Wirklichkeit dieser guten Ordnung beruht darauf, daß der Einzelne oder die Polis diese Gerechtigkeit erkennt, anerkennt und seine Seele oder das Gemeinwesen danach umwandelt. Kant hingegen versteht den Nomos als das Sittengesetz des kategorischen Imperativs39. Die Allgemeinheit der Form des Gesetzes ohne Rücksicht auf einen besonderen Inhalt ist bei ihm derjenige Aspekt, der den Willen gut macht40. Das Sittengesetz wirkt über die Autonomie auf den Willen, d. h. auf das Vermögen, „nach der Vorstellung der Gesetze, d. i. nach Prinzipien, zu handeln“41. Die Gesetzlichkeit sichert als Autonomie dem Willen die Vernünftigkeit42 und bewirkt Freiheit43. Sie ist damit zugleich die Grundlage der Würde des Menschen44. Diejenigen, die das Selbst als Resultat der Bestimmung durch das Gesetz, sowie Autonomie als Gesetzgebung für das Selbst auffassen, verstehen Nomos in der Autonomie so, daß er die notwendige Kohärenz der Motive als Basis der Identität des Selbst als Grundlage seiner Selbstbestimmung herstellen soll. Autoren wie Laura WaddeLL eKstrom betonen etwa, daß Autonomie durch die Kohärenz von Handlungen gesteigert würde45. 39 40 41 42 43 44
45
Kant GMS (Fn 3) BA 52, 51: „Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, daß sie ein allgemeines Gesetz werde“. Kant GMS (Fn 3) BA 14 f., 27. Kant GMS (Fn 3) BA 36, 41. Kant GMS (Fn 3) BA 111, 90. Kant GMS (Fn 3) BA 98, 81. Kant (Fn 3) BA 78, S. 69; vgl. auch bruGGer, Winfried: Die Würde des Menschen im Lichte des anthropologischen Kreuzes der Entscheidung. In: ders.: Integration, Kommunikation, Konfrontation in Recht und Staat. Hrsg. v. Helen Brugger und Stephan Kirste. Berlin (Schriften zum Öffentlichen Recht Band 1252) 2013, 33–60, 41 f. Ekstrom, Laura Waddell (2008): Autonomy and Personal Integration. James Stacey Taylor (ed.): Personal Autonomy: New Essays on Personal Autonomy and its Role in Contemporary Moral Philosophy. Cambridge 2008, 143–162, 143 ff.
72
Stephan Kirste
Aus dem zuvor Ausgeführten ergibt sich mithin folgende Übersicht freiheit Negative Freiheit (Unabhängigkeit)
Positive Freiheit (Selbstbestimmung) Existenzialistische Selbstbestimmung
II. neuere auffassungen
zur
Autonomie = Bestimmung durch Gesetze Bestimmung durch das Selbst
Bestimmung für das Selbst
Selbst ist für seine Bestimmung konstitutiv
Bestimmung ist für das Selbst konstitutiv
autonoMIe
Wie stellt sich nun für neuere Theorien der Zusammenhang der drei Momente der Autonomie – Selbst, Selbstbestimmung und Gesetz – dar? 1. rationaListische und LiberaLe theorien der autonomie Häufig kritisieren gegenwärtige Autonomietheorien gerade im Bereich der angewandten Ethik wie etwa der Medizinethik, daß die klassischen Konzepte der Autonomie von unrealistischen Annahmen ausgingen46. Es wird versucht, anspruchsvolle Autonomiebegriffe zu bilden, indem etwa die Anforderungen an die Fähigkeiten, insbesondere Rationalität und hier etwa die Informiertheit gesteigert werden. Autonom könne nur eine voll informierte Entscheidung sein. So nimmt christman an, daß Autonomie die Fähigkeit des Selbst voraussetzt, ein reflexives Verhältnis zu sich einnehmen zu können47. Es muß in der Lage sein, die Faktoren die es prägen, interpretieren und sich zu ihnen verhalten zu können. Dieses geschichtlich in seinen Selbstverständnissen sich entwickelnde Selbst ist autonom im Sinne einer sich gleichzeitig mit dieser Interpretationspraxis entfaltenden Praxis der Selbstregierung und Selbstbestimmung. Reizvoll an dieser Konzeption ist das Zugestehen einer 46
47
So geht etwa berofsKy, bernard: Liberation from Self: A Theory of Personal Autonomy. Cambridge 2007, 16 ff. (21) davon aus, daß Autonomie auch an natürliche Fähigkeiten gebunden ist. Autonomie setzt voraus: Freiheit aufgrund bestimmter körperlicher und intellektueller Fähigkeiten, Handeln aufgrund von Werten, grundsätzliche – aber nicht anspruchsvolle – Rationalität, Kontingenz, emotionale und charakterliche Entwicklungsfähigkeit. Selbstursprünglichkeit, Hierarchie von Motiven, persönliche Integrität sind hingegen nicht erforderlich. christman, john: „Autonomy in Moral and Political Philosophy“. In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2011 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = http://plato.stanford. edu/archives/spr2011/entries/autonomy-moral/ : „to be autonomous is to be one’s own person, to be directed by considerations, desires, conditions, and characteristics that are not simply imposed externally upon one, but are part of what can somehow be considered one’s authentic self “.
Recht – Selbst – Bestimmung
73
auch narrativen Konstruktion des Selbst, die aber von Bewußtseinsprozessen begleitet ist, die der Selbst-Erzählung erst eine spezifische Form geben; eine Form, die ihrerseits wieder sozial und historisch vermittelt ist. Fehlen diese Fähigkeiten, und insbesondere die Fähigkeit zur Reflexion, ist entsprechend diese Person nicht autonom48. Problematisch sind diese anspruchsvollen Autonomiekonzeptionen jedoch im Recht: Hier erfolgt ja nicht nur ein klassifikatorisches Urteil – Entscheidungen, die ein bestimmtes Maß an Rationalität verfehlen, sind nicht autonom – sondern ein praktisches: nicht hinreichend rationale Entscheidungen sind nicht autonom und verdienen daher keine Anerkennung, ja können die Grundlage von Eingriffen sein, so daß deshalb paternalistische Interventionen gerechtfertigt werden49. 2. der autonomiebeGriff des existentieLLen LiberaLismus Von VoLKer Gerhardt Das Problem solcher liberaler Theorien der Autonomie, die sie an hohe Rationalitätsanforderungen knüpfen, ist also die rechtliche Beschränkung der Autonomie: Je anspruchsvoller ein so begründeter rechtlicher Autonomiebegriff ist, desto leichter sind Beschränkungen des Handelns zu rechtfertigen. Gehört es denn nicht zur Autonomie des Subjekts, selbst darüber entscheiden zu dürfen, wie viel Rationalität es seinen Handlungen zugrunde legen will? Die Gesamtglücksbilanz eines Lebens mag darunter leiden, daß der Einzelne in den Tag hinein lebt und auf Langfristziele keinen Wert legt. Er kann momentane Glücksmomente erleben, die ihn für sein weiteres Leben ruinieren, ihm aber mehr wert sind, als langfristige Glücksoptimierungen. Mit anderen Worten: Er wertet seine first-order volitions höher als seine second-order volitions50. Diese Probleme vermeidet eine Theorie, die die Autonomie des Einzelnen nicht an irgendwelche philosophisch begründeten Autonomieziele bindet, sondern ihm die Autonomie über seine Autonomie zurückgibt. Darauf zielt der Ansatz von VoLKer Gerhardt. In Anlehnung an eine individualistische Interpretation Kants und ein um den Begriff der Freiheit erweitertes Verständnis nietzsches,
48
49
50
christman, john: The Politics of Persons: Individual Autonomy and Socio-historical Selves. Cambridge 2009, 162: „What this implies is that there will be two kinds of people being ruled out here as heteronomous: one is unable to reflect adequately at all and hence should not be counted in collective decisions, at least as a self-representing participant in the usual way; the other is a person who feels trapped or alienated from some central commitment or other but is generally able to reflect. The former might well be open to paternalistic care rather than egalitarian respect in our social dealings with her“. Zum Rechtspaternalismus vgl. anderheiden/bürKLi/heiniG/Kirste/seeLmann (Hrsg.), Paternalismus und Recht, Tübingen 2006; Kirste, stePhan: Harter und Weicher Rechtspaternalismus unter besonderer Berücksichtigung der Medizinethik. In: JZ 2011, 805 ff., 805 ff.; adeodato, joão maurício: Rechtspaternalismus und das Problem des Gesundheitsrechts in der Bioethik. In: Verfassungsvoraussetzungen. Gedächtnisschrift für Winfried Brugger. Hrsg. v. M. Anderheiden, R. Keil, S. Kirste, J. P. Schäfer. Tübingen 2013, 125–141, 125 ff.; christman (Fn 47), 2.2. Zu dieser Unterscheidung bekanntlich franKfurt, harry: Freedom of the Will and the Concept of a Person. In: Journal of Philosophy 68 (1971), 5–20, 5 ff., der aber Freiheit nur bei der Ausrichtung der first order volitions an den second order volitions annimmt.
74
Stephan Kirste
entwickelt er einen Autonomiebegriff, in dessen Zentrum das um Selbstverwirklichung bemühte Ich steht. a) Autonomie als individuelle Selbstbestimmung Gerhardt unterscheidet individuelle und politische Autonomie. Auf der individuellen Ebene ist Autonomie eine qualifizierte Form von Selbstorganisation51. Während zu dieser auch andere Lebewesen fähig sind, gelangt der Mensch kraft seiner Vernunft zu einer selbstbewußten Selbstbestimmung52: „Eine Person nennen wir autonom, wenn sie nach ihren eigenen Einsichten handelt, kurz: wenn sie sich selbst bestimmen kann“53. Frei ist die Person, wenn sie einen Zustand von selbst anfängt54. Diese Spontaneität steht jedoch nicht im Widerspruch zu der gesetzlichen Natur, sondern überformt sie durch einen hinzutretenden Sinn. Die Regelhaftigkeit des Handlungsprinzips sichert dem Individuum das Bewußtsein seiner selbst. Sub specie Sicherung der Identität des Selbst über das Leben hinweg wird aus dieser Regel ein Gesetz55. In dieser Selbstgesetzgebung beantwortet die Vernunft die moralische Grundfrage „was soll ich tun und soll ich überhaupt etwas tun“ unter Rückgriff auf Regeln56. Das Individuum steht vor dem Handlungsproblem; es stellt sich seinen moralischen Anforderungen und es bestimmt die moralischen Anforderungen, vor denen es in seiner Identität bestehen will57. Auf das Selbst ist die moralische Situation zentriert und aus ihm ist die Antwort zu gewinnen (Gesetzgebung durch das Selbst)58. Die Herausforderung des Selbst ist es dabei, sich zu verwirklichen59. Dieses Verwirklichen ist aber die Transformation dessen, was es der Möglichkeit nach schon ist, in eine selbstgeschaffene Realität. Daher lautet diese sich vom Selbst eigenständig aufgegebene Regel: „Sei du selbst! Das ist der kategorische Imperativ einer Moral der Individualität“60. Die moralischen Gesetze, die sich das Selbst in seiner Gesetzgebung gibt, beanspruchen eine individuelle Allgemeinheit, die sich auf gleiche Handlungskriterien in
51 52 53 54 55
56 57 58 59 60
Gerhardt, VoLKer: Selbstbestimmung. Das Prinzip der Individualität. Stuttgart 1999, 178 f.: Selbstorganisation wird als interne Organisation jedes Lebewesens durch es selbst verstanden. Gerhardt (Fn 51), 375, 143: „Selbstbestimmung ist der originäre Akt, in dem sich ein Mensch allererst zu einem moralischen Wesen macht“. Sie ist eine „Manifestation der Selbständigkeit“. Gerhardt, VoLKer: Partizipation – Das Prinzip der Politik. München 2007, 359. „Wann immer jemand von sich aus etwas tut, ist er frei“ (Fn 51), 244. Er muß also der Ursprung seines Handelns sein, damit diese als seine freie Handlung verstanden werden kann. Gerhardt (Fn 51), 408: „Wenn … das Individuum in seiner Antwort auf eine moralische Frage eine es selbst bindende Entscheidung für sein ganzes Dasein sieht, wird aus der Regel, die sich das Individuum in der Selbstbestimmung gibt, ein Gesetz. Selbstbestimmung in der Perspektive des eigenen Lebens wird als Selbstgesetzgebung praktiziert“. Gerhardt (Fn 51), 381 f. „Ethik und Moralphilosophie“ sprechen „davon, wie der Mensch – nach seinem eigenen Verständnis – handeln soll“, Gerhardt (Fn 51), 95. Gerhardt (Fn 51), „Das Gesetz wird nicht nur von einem Individuum, sondern es kann auch nur für ein Individuum gegeben werden“. Gerhardt (Fn 51), 396: „Moralität ist dort, wo ein Individuum wirklich als es selber handeln will“. Gerhardt (Fn 51), 397.
Recht – Selbst – Bestimmung
75
gleichen Handlungssituationen bezieht61. So versichert sich das Selbst darin, daß es in verschiedenen Handlungen doch sich selbst realisiert. Diese Handlungen erheben keinen Anspruch auf interindividuelle Allgemeinheit, weil jeder selbst in der je individuellen Handlungssituation steht und darauf selbstbestimmte Antworten entwickeln muß. Das moralische Gesetz ist also nicht allgemein hinsichtlich der Adressaten, sondern hinsichtlich des Handlungsinhalts. Allenfalls gibt der autonom Handelnde so ein Beispiel, das gewissermaßen einen Fichteschen Aufforderungscharakter besitzt62. Durch ihre Autonomie verfaßt sich die Person63. Sie optimiert sich im Hinblick auf das, was sie sein möchte. Gerhardt nennt diese Optimierung „Steigerung“. In klassischen Begriffen könnte man das dahinter stehende „Werde, der du bist!“ (Pindar), bzw. „Wie man wird, was man ist“64 oder das „Sei du selbst“65 verstehen als Transformation der Potentialität des Selbst in seine Realität als Person. Wir sind nur, was wir sein können, wenn wir uns selbst dazu machen. Die Person ist gekennzeichnet dadurch, daß sie den Anspruch dieser Übersetzung ihrer Möglichkeiten akzeptiert hat, sich vorschreibt und sich von dieser selbstgesetzten Aufgabe her versteht. Das Selbst ist sowohl der Autor als auch der Adressat dieser autonomen Ansprüche: „Vom Selbst geht etwas aus, das primär für das Selbst gültig ist“66. Zugleich ist das Gesetz das Bild dessen, was es sich von sich entwirft. So ist das Gesetz, das sich das Selbst autonom gibt, der seiner Vernunft entspringende Entwurf dessen, was und wie es sich verwirklichen will. Die Autonomie wird so zur souveränen Selbstermächtigung des Individuums hinsichtlich seiner Selbstverwirklichung67. Die Autonomie ist damit die anspruchsvollste Form der vernünftigen Selbstgesetzgebung als einer Form von Selbstbestimmung. Sie ist die Grundlage der freien Verwirklichung des Einzelnen in und durch seine Handlungen. In der autonomen Selbstbestimmung schafft sich das Individuum selbst die Voraussetzungen für seine Verwirklichung als Transformation seiner Möglichkeiten in seine Realität. Im emphatischen Sinn ist es nur als seine Setzung. Das Selbst als kraft seiner Vernunft sich 61 62 63 64
65
66 67
Gerhardt (Fn 51), 399. Aufforderungscharakter hat nach Fichte vor allem das andere Ich, das unser potentielles Ich gewissermaßen wachruft (Fichte: Grundlage des Naturrechts, S. 32 f.), nicht nur Probleme, Gerhardt (Fn 51), 49. Gerhardt (Fn 51), 409, 411. nietzsche Ecce Homo, Vorwort, 293. Gegen Rationalitätsanforderungen an die Selbstwerdung schreibt Nietzsche: „Daß man wird, was man ist, setzt voraus, daß man nicht im entferntesten ahnt, was man ist… Darin kommt eine große Klugheit, sogar die oberste Klugheit zum Ausdruck: wo nosce te ipsum das Rezept zum Untergang wäre, wird Sich-Vergessen, Sich-Mißverstehn!“. Ebenso fallen bei Nietzsche alle externen Ziele weg: „Noch in diesem Augenblick sehe ich auf meine Zukunft – eine weite Zukunft! – wie auf ein glattes Meer hinaus: kein Verlangen kräuselt sich auf ihm. Ich will nicht im geringsten, daß etwas anders wird als es ist; ich selber will nicht anders werden…“. Neben vielen anderen, vor allem Dichtern, e. e. cumminGs: „To be nobody-but-yourself–in a world which is doing its best, night and day, to make you everybody else–means to fight the hardest battle which any human being can fight; and never stop fighting“, cumminGs, edWard e.: A Miscellany. Ed by George James Firmage. New York 1958, 13 oder auch der Ralph Waldo Emerson zugeschriebene aber nicht belegbare Gedanke: „To be yourself in a world that is constantly trying to make you something else, is the greatest accomplishment.“. Gerhardt (Fn 51), 412. Gerhardt (Fn 51), 415.
76
Stephan Kirste
über sich selbst aufklärende Individuum schafft als autonomer Autor selbst die Grundlagen der Verwirklichung seiner selbst. Es geht ihm in dieser Verwirklichung nur um es selbst. Eben deshalb unterstellt sich der Autor dem selbstgegebenen Gesetz als sein Adressat. Autor und Adressat der Autonomie sind derselbe, nur nach verschiedenen Perspektiven betrachtet: Das Selbst realisiert sich bereits als Autor des Gesetzes, indem es sich so zur Geltung bringt. Weil sich das Individuum selbst realisieren will, unterstellt es sich diesem Plan, anerkennt seine Gültigkeit. Der Adressat ist das Individuum, das diese Vorschrift ausführt und sie für diese Ausführung anerkennt als Entwurf seiner selbst. Autor der Selbstgesetzgebung und Adressat der Selbstgesetzgebung sind funktional unterschieden; sie sind jedoch zwei Arten der Erscheinung des Selbst. Alle Kriterien der Autonomie entspringen also dem Selbst des autonom Handelnden. Es werden keine Rationalitätskriterien an das Individuum herangetragen, die Bestand vor seinem eigenen Entwurf hätten. Während die zunächst vorgestellte liberale Theorie die Autonomie des Einzelnen unter externe Anforderungen an die Rationalität stellen, die einer Bewertung der Folgen seines Tuns entspringen oder über die second-order Volitions eine künstliche Äußerlichkeit in seine Handlungsmotive einziehen, sieht Gerhardt nach dem Ursprung der Autonomie im Selbst und untersucht die Grundlagen seiner Autonomie als Selbstbestimmung. Weil Autor und Adressat immer das sich realisieren wollende Individuum bleiben, dringt auch nichts Fremdes in diesen Ursprung ein. Die natürlichen Grundlagen der Selbstbestimmung werden zwar berücksichtigt; sie erscheinen jedoch gewissermaßen das „sinnliche Material der Pflicht“68, wie man wiederum im Anschluß an Fichte sagen könnte: Die Herausforderung ist, auch dieses ohne Zutun des Individuums Gegebene autonom in ein von ihm Gesetzes zu transformieren. Auf der Stufe der individuellen Selbstbestimmung bezieht zwar das Selbstbewußtsein notwendig andere ein; doch nur als Abgrenzung und Affirmation des Selbst69. Andere Menschen geraten primär als Gegenstand der Selbstverwirklichung des Individuums in den Blick. Dabei ist Gerhardt keineswegs ein Solipsist. Er verlegt jedoch die Auseinandersetzung mit den Anderen ebenso in das Selbst wie diejenige mit der Natur und der Leiblichkeit. Altruismus wird zur Selbstbewährung des Ich. Kommunikation spielt keine konstitutive Rolle, weil der Einzelne sein Verhältnis zu anderen mit sich selbst ausmacht. Schon gar nicht, ist das Selbst kommunikativ konstituiert. Einzig als Beispiel wirkt der Einzelne in seiner autonomen Selbstbestimmung auf andere. Dabei ließe sich der Ansatz durchaus zum Anderen hin öffnen. Auch Gerhardt nimmt nämlich an, daß der Einzelne kein Mängelwesen ist70, da ihm die Vernunft hilft, Defizite in der leiblichen Ausstattung nicht nur zu kompensieren, sondern als Nichtfestgelegtheit auf eine ökologische Nische auch zu nutzen. Wenn ferner in der 68
69 70
johann GottLieb fichte: Ueber den Grund unseres Glaubens an eine göttliche Weltregierung (1798). Johann Gottlieb Fichtes sämmtliche Werke. Herausgegeben von Immanuel Hermann Fichte. Zweite Abtheilung (Band III-V). Bd. 5, 177–189, 185: „Unsere Welt ist das versinnlichte Materiale unserer Pflicht; dies ist das eigentliche Reelle in den Dingen, der wahre Grundstoff aller Erscheinung“. Gerhardt (Fn 51), 225 f. „Die Rede vom ‚Mängelwesen‘ ist eine rhetorische Pointe, aber keine ernst zu nehmende anthropologische These“, Gerhardt (Fn 51), 195.
Recht – Selbst – Bestimmung
77
Vernunft, nämlich der Selbstreflexion, die Grundlage der menschlichen Freiheit besteht, dann ist die Unterstützung eines Hilfsbedürftigen keine paternalistische Bevormundung. Sie dient vielmehr der Beseitigung von Defiziten der Ausstattung des Menschen oder Beschränkungen seiner Lebenslage, die er nicht selbst beseitigen und aus der er sich nicht selbst befreien kann. Der Zweck der Hilfe ist also die Ermöglichung der Freiheit des Anderen71. Mehr nicht. Seine Freiheit kann der Andere nur selbst – autonom – realisieren. Ohne die Freiheit des anderen lebe ich aber nicht weniger in einer unfreien Umwelt, als wenn ich unvernünftig mit meinem Leib umgehe. Nur ist der Stoff meiner Pflicht ein anderer: Der Hilfsbedürftige lebt nicht nur ein Leben, das er selbst organisieren könnte, sondern eines, das er sogar autonom bestimmen kann, wenn er durch seine Beschränkung nicht daran gehindert wäre. b) Politische Autonomie als Partizipation „Freiheit ist der grundlegende politische Begriff, der auch der Selbstbestimmung zugrunde liegt“72. In der Politik ermäßigt sich jedoch die Selbstbestimmung des Einzelnen zur Partizipation, da mehr als Einfluß auf die gemeinsamen Angelegenheiten nach Gerhardt nicht möglich sei73. Partizipation ist die bewußte Anteilnahme am gesellschaftlichen Ganzen mit Rücksicht auf gemeinsame Ziele und Aufgaben74. „Die Politik geht aus der vereinigten Selbstbestimmung von Individuen hervor…“75 und zielt auf die Institutionalisierung eines gesellschaftlichen Ganzen76. Partizipation ist ein Recht und zugleich Pflicht. Hier werden allgemeine Verbindlichkeiten erzeugt77. Menschen begeben sich selbstbestimmt in Verhältnisse, in denen sie einander wechselseitig Mittel zu eigenen Zwecken sind78: „Der Mensch kann nur deshalb zu etwas verpflichtet werden, weil er sich selbst verpflichten kann.“79 Diese Verpflichtungen unterscheiden sich von zwangshaften Instrumentalisierungen durch die autonome Begründung. Daher ist die Partizipation bei der Begründung von rechtlichen Verpflichtungen notwendige Bedingung ihrer Legitimi71 72 73 74 75 76 77 78
79
Zur Abgrenzung von Paternalismus als Handeln gegen die Autonomie eines anderen zu seinem Vorteil und Hilfe, als Vorteilsgewährung, nach der der andere verlangt, vgl. Kirste (Fn 49), 808 f. Gerhardt (Fn 53), 320. Gerhardt (Fn 53), 20 f., 24: „Wenn das Prinzip des individuellen Handelns die Selbstbestimmung des Einzelnen ist, dann ist das politische Handeln ganz und gar auf Mitbestimmung gegründet“. Gerhardt (Fn 53), 472 f. Gerhardt (Fn 53), 224. Gerhardt (Fn 53), 293 f. u. 370: „Politik ist das auf Einheit zielende Handeln der sich als Einheit verstehenden gesellschaftlichen Organisation“ oder 373: „Die Politik … ist ein Prozess, in dem sich eine Gesellschaft als Ganze zu steuern sucht.“ Gerhard (Fn 53), 265. Gerhardt (Fn 53), 290 f. Nur über diese Wechselseitigkeit werden würdeverletztende Instrumentalisierung verhindert. Unklar ist es insofern, daß die „Partizipation an staatlichen Gemeinschaften … schon damit an[hebt], dass man bewusst in ihnen lebt“. Hier reicht also schon das Bewußtsein ohne eine Entscheidung oder voluntative Bestimmung des Selbst, um zu partizipieren, ja sogar um „Mitschuld“ an Verbrechen der Herrschenden zu tragen, denen man nicht Widerstand geleistet hat, Gerhardt (Fn 53), 356. Gerhardt (Fn 53), 404.
78
Stephan Kirste
tät. Konsequent nimmt Gerhardt daher an: „Alle Politik… wird durchgängig von der Selbstbestimmung des Individuums getragen. Selbstbestimmung ist somit als erstes und wichtigstes Recht zu sichern… Die Selbstbestimmung des Staates ist nur ein Mittel, um das originäre Recht des Einzelnen durch eine handlungsfähige gesellschaftliche Einheit gegen konkurrierende Einheiten zu sichern.“80 Seine aktive Partizipation am politischen Ganzen kann dann demokratische Selbstherrschaft bedeuten81. Das Recht zur gleichen Partizipation vermittelt dem Einzelnen die Möglichkeit zur Mitwirkung am politischen Ganzen. Diese Partizipation sei prinzipiell gleich und daher stehe dem Menschen nur eine Stimme zu82. Dieser Argumentation fällt es jedoch schwer, Partizipationsformen zu rekonstruieren, die den Grundsatz der Gleichheit durchbrechen. Im Bereich der funktionalen Selbstverwaltung können wegen der unterschiedlichen Betroffenheit durch staatliches Handeln oder zur Steigerung von besonderer Eigenverantwortung asymmetrische Partizipationsformen vorgesehen werden. Auch im internationalen Bereich gibt es über NGOs durchaus gerechtfertigte unterschiedliche Einflußnahmemöglichkeiten83. Recht erscheint bei Gerhardt als eine zwangsbewährte Form der Institutionalisierung von Politik. Seine Aufgabe ist es insbesondere, die Verbindlichkeit politischer Institutionen und ihrer Entscheidungen zu sichern84. Es setzt auf allen seinen Stufen Partizipation voraus: prozedurale Beteiligung bei der Vertragsgestaltung und Streitbeilegung und wegen der Möglichkeit ihrer autoritativen Entscheidung auch bei der Begründung der rechtlichen Grundlagen für diese Beilegung85. Diesen Zwangscharakter des Rechts sieht er auch beim Kantischen Rechtsbegriff als entscheidend an86. Damit tritt bei ihm aber das Recht nur negativ, als Sicherungsinstrument und nicht positiv als Ausdruck von Freiheit auf. Der Zwang ist jedoch nur das Empirische am Recht – wie die Natur. Wesentliches Merkmal des Rechts ist er nicht. Wichtig sind Macht und Recht nur zu seiner faktischen Durchsetzung oder Geltung87. Charakteristisch für das Recht ist vielmehr, daß der Zwang nicht nur der Erhaltung der Freiheit dient, sondern als rechtlich normierter Zwang auch Ausdruck von Freiheit ist. Schon Kant versteht Recht als eine durch „ein Gesetz der Freiheit“ begründete Begrenzung der äußeren Freiheit. Im demokratisch oder privatautonom begründeten Recht herrscht gewiß der Einzelne über sich selbst88, aber doch in einem Medium, das weder durch Zwang 80 81 82 83
84 85 86
87 88
Gerhardt (Fn 53), 322. Gerhardt (Fn 53), 356. Gerhardt (Fn 53), 404 f. Vgl. hierzu Kirste, stePhan: Politische Partizipation und globale Politik – Zur menschenrechtlichen Begründung eines Rechts auf globale Partizipation. In: Jürgen von Ungern-Sternberg / Hansjörg von Reinau: Politische Partizipation. Idee und Wirklichkeit von der Antike bis in die Gegenwart. Berlin (Colloquia Raurica Bd. 13) 2013, 309–337, 309 ff. Gerhard (Fn 53), 286. Gerhardt (Fn 53), 313. Gerhardt, VoLKer: Recht und Herrschaft. Zur gesellschaftlichen Funktion des Rechts in der Philosophie Kants. In: Rechtstheorie 12 (1981), 53–94, 75 f.; Gerhardt (Fn 53), 310 f., 476 u. 334: „Recht ohne Gewalt ist nicht denkbar. Der physische Zwang steht nicht nur am Anfang des Rechts, sondern er bleibt sein unverzichtbarer Begleiter“. Und insoweit zu recht dann auch Gerhardt (Fn 53), 333. Gerhardt (Fn 86), 91 f.
Recht – Selbst – Bestimmung
79
noch von ihm alleine begründet, sondern von der Rechtsgemeinschaft autonom geschaffen wird. Dieses Recht ist von allen gemeinsam autorisiert. Wer ihm folgt, folgt nicht mehr nur sich selbst, sondern der Rationalität dieses verselbständigten Mediums. Das Selbst des Menschen wird hier als Zurechnungssubjekt von Rechten und Pflichten, also als Rechtsperson rekonstruiert. Die rechtliche Autonomie zeigt sich in den verliehenen Rechten und Pflichten. Im Prinzip der Partizipation sieht Gerhardt selbstverständlich das auch rechtlich wirksame Potential positiver Freiheit. Er entfaltet aber nicht die rechtlichen Möglichkeiten dieses Prinzips, sondern beläßt es beim politischen Prinzip. Es ist eben nicht nur Politik ein „Kampf ums Recht“, wie er meint89. Der „Kampf ums Recht“ ist sicherlich ein Ausdruck der rechtlichen Selbstbestimmung des Einzelnen. Diese Selbstbestimmung vollzieht sich aber auf der Grundlage und in den Bahnen und Grenzen des Rechts. Wenn bei Vertragsverhandlungen, in Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren oder schließlich auch in den verfassungs-, europa- und völkerrechtlich gebundenen Gesetzgebungsverfahren um Recht gestritten wird, dann geht es da um die Sicherung aber auch den Ausdruck der Autonomie. Das Recht tritt dieser Partizipation nicht nur äußerlich gegenüber und beschränkt sie, sondern ist selbst ihr Ausdruck. Durch diese rechtlich begründete und geformte Partizipation ist der Mensch in der Tat „… stets bemüht, aus dem Faktum der Gesellschaft, das Produkt seiner eigenen Tätigkeit zu machen“90. 3. axeL honneths aKtuaLisierunG der heGeLschen GrundLinien und sein autonomiebeGriff Die objektive Dimension der Autonomie stellt nun axeL honneth in seinem „Anerkennungsbegriff der Autonomie“ heraus91. Dem „Vorbild der heGeLschen ‚Rechtsphilosophie‘“ folgend, entwickelt axeL honneth aus einer Gesellschaftsanalyse Prinzipien der Gerechtigkeit92. Mit heGeL teilt er die Auffassung von der Zentralstellung des Wertes der Freiheit in der Entwicklung der modernen Gesellschaft und der Gleichheit als eines lediglich nachgeordneten Wertes93. Diese individuelle Freiheit versteht honneth als Autonomie94. Nur diesem Wert sei es gelungen, individuelle 89
90 91
92
93 94
Gerhardt (Fn 53), 477: „Ein auf das gegebene Recht gestütztes Legitimationsmodell erlaubt es auch, die Politik in ihrer eigenen Handlungslogik als ‚Kampf ums Recht‘ zu verstehen“. Soll das bedeuten, daß Politik ausschließlich Kampf ums Recht ist? Wohl kaum, denn sie hat auch gänzlich andere, nicht rechtliche Aufgaben und Formen, wie etwa in der Außenpolitik. Oder soll es bedeuten, daß ausschließlich die Politik ums Recht kämpft? Das wäre ebenso unzutreffend, da sich dieser Kampf ganz wesentlich in Vertragsverhandlungen und vor Gerichten abspielt. Gerhardt (Fn 51), 433. anderson/honneth (Fn 2), 130: „recognitional theory of autonomy“: “The key initial insight of social or relational accounts of autonomy is that full autonomy – the real and effective capacity to develop and pursue one’s own conception of a worthwhile life – is achievable only under socially supportive conditions“. honneth, axeL: Das Recht der Freiheit. Grundriß einer demokratischen Sittlichkeit. Frankfurt Main 2013, 9. Ihm erscheint es „sinnvoll, die Hegelsche Absicht noch einmal aufzugreifen, eine Theorie der Gerechtigkeit aus den Strukturvoraussetzungen der gegenwärtigen Gesellschaften selbst zu entwerfen“. Zum „Recht der Freiheit“ auch Kirste, Stephan: Axel Honneth: Das Recht der Freiheit. Berlin 2013, 628. In: Zeitschrift für Rechtsphilosophie 2013, 105–112, 105 ff. honneth (Fn 92), 35. Quer zu diesem sehr elementaren Autonomiebegriff steht Honneths sehr voraussetzungsvolle
80
Stephan Kirste
Freiheit und objektiven Orientierungsrahmen miteinander zu verbinden. In der individuellen Freiheit wurzele auch der Gerechtigkeitsgedanke95. Autonomie setze Selbstrespekt, Selbstvertrauen, Selbstachtung in persönlichen, gesellschaftlichen und rechtlichen Anerkennungsbeziehungen96. Abzugrenzen ist der Begriff der Autonomie von demjenigen der negativen Freiheit. Die Abgrenzung von Freiräumen ungehinderter Willkür, machte bei hobbes und seinen liberalen Nachfolgern den Kern des Freiheitsbegriffs aus97. Sie ist die Freiheit des egoistischen Bourgeois. Dieser Freiheitsbegriff leidet, wie schon heGeL gezeigt hat, an Defiziten: Ihm fehlt das Moment der Selbstbestimmung und damit die reflexive Ebene, durch die in die Freiheit noch einmal die Überprüfung und Bestimmung der Ziele der Freiheit eingeführt wird98. Dies gilt nun nicht nur für die Bestimmung über die eigenen Ziele des Handelns, sondern auch für die politische Mitwirkung. Von dieser negativen Freiheit grenzt honneth die „reflexive Freiheit“ ab, die es dem Einzelnen ermöglicht, sich bei seinen Handlungen von den eigenen Zielen bestimmen zu lassen99. Sie ist eine Freiheit der Deliberation und der Kooperation als Citoyen. Vor heGeL haben besonders rousseau und auch Kant diesen Freiheitbegriff vertreten. Dabei legt Honneth den Akzent bei der Autonomie auf die interpersonelle Verallgemeinerbarkeit der Handlungsmotive. Erst von aPeL und habermas würde jedoch das intersubjektive Potential dieses bei Kant noch monologisch strukturierten Freiheitsbegriffs entfaltet100. Damit wird die Begründung der reflexiven Freiheit prozedural. Die Gesellschaft bekommt in diesen Diskursen eine andere, geradezu gegenteilige Funktion wie diejenige, die sie bei Gerhardt besitzt: „Das Verfahren der individuellen Selbstbestimmung wird auf die höhere Stufe der gesellschaftlichen Ordnung übertragen, indem es hier als Prozedur einer gemeinsamen
„normative Idee der individuellen Autonomie“. Sie verlangt, daß der Einzelne „Zugleich zur kreativen Bedürfniserschließung, zur ethisch reflektierten Darstellung seines Lebensganzen und zur konstextsensitiven Anwendung universalistischer Normen in der Lage ist“, honneth, axeL: Dezentrierte Autonomie. Moralphilosophische Konsequenzen aus der modernen Subjektkritik. In: Zur Verteidigung der Vernunft gegen ihre Liebhaber und Verächter. Hrsg. v. Chr. Menke u. Martin Seel. Frankfurt/Main 1993, 149–162, 161. 95 honneth (Fn 92), 38. 96 anderson/honneth (Fn 2), 132 ff., 144: „Central to that model of autonomy [recognition model, SK.] is the idea that the acquisition, maintenance, and exercise of the array of competencies comprising autonomy depends on the establishment of particular ways of „relating to oneself practically,“ especially self-respect, self-trust, and self-esteem“. 97 honneth Fn 92, 44 ff., 58: „Die negative Freiheit ist ein originäres und unverzichtbares Element des moralischen Selbstverständnisses der Moderne; in ihr kommt zum Ausdruck, daß der einzelne das Recht genießen soll, ohne äußere Einschränkungen und unabhängig vom Zwang zur Prüfung seiner Motive ‚nach Belieben‘ zu handeln, solange er dabei nicht dasselbe Recht seiner Mitbürger verletzt“. 98 honneth (Fn 92), 57: „Um eine Art von Freiheit konzipieren zu können, die zusätzlich genau das, also ein Element der ‚Selbstbestimmung‘ enthalten würde, wäre es nämlich nötig, auch die Ziele des Handelns noch als eine Ausgeburt von Freiheit zu begreifen“. 99 honneth (Fn 92), 58 f.: „Ihr zufolge ist dasjenige Individuum frei, dem es gelingt, sich auf sich selbst in der Weise zu beziehen, daß es sich in seinem Handeln nur von eigenen Absichten leiten läßt“. 100 honneth (Fn 92), 69.
Recht – Selbst – Bestimmung
81
Willensbildung begriffen wird, in der die gleichgestellten Bürger und Bürgerinnen die Grundsätze einer ihnen ‚gerecht‘ erscheinenden Sozialordnung beschließen“101. Sowohl die individualistisch-substantialistischen Variante dieses Ansatzes reflexiver Freiheit als auch ein kollektivistischer Ansatzes – honneth nennt arendt und sandeL – sind jedoch einseitig und vermögen der Autonomie nicht gerecht zu werden. Schließlich verkennt auch die Diskurstheorie, daß die äußere Wirklichkeit nicht ein heteronomer Gegensatz zu selbstbestimmten Handlungen ist. Soziale Institutionen sollen vielmehr nicht als etwas dieser Freiheit Äußerliches, sondern „Medium und Vollzugsbedingung“ von Freiheit verstanden werden102. Durch diese Konzeption von sozialen Institutionen als Medium der Freiheit führt honneth mit heGeL über habermas und aPeL hinaus. Dies bedeutet keine Abkehr vom Begriff der reflexiven Freiheit. Die von honneth so genannte „soziale Freiheit“ soll vielmehr die Potentiale der Reflexion auch noch auf die äußere Wirklichkeit anwenden und sie als Material autonomer Gestaltung konzipieren. Er versteht diese Institutionen als Kristallisationspunkte der wechselseitigen Anerkennung der Individuen, bei denen die Realisierung der Freiheit des einen von der Realisierung der Freiheit des Anderen abhängt103. Die Individuen sichern sich darin als Rechtssubjekte des demokratischen Rechtsstaats die negativen, positiven und aktiven Rechte zu104. Durch diese komplementären oder wechselseitigen Anerkennungsverhältnisse gestalten die Individuen eine gemeinsame Sphäre der Autonomie. Deren Institutionen sind jedoch nicht nur Ausdruck von Freiheit, sondern auch Bedingungen der Möglichkeit des individuellen Freiheitsverständnisses. Anders als bei Gerhardt soll die Sphäre, in der sich die Menschen aufeinander beziehen und ihre gemeinsame Freiheit ausbilden, vorgängig gegenüber der individuellen Freiheit sein105. honneth kann sich bei dieser Konstruktion der Freiheit jedoch nur eingeschränkt auf heGeL berufen. Zwar kennt heGeL die soziale Freiheit als Dasein der Freiheit in dem von ihr selbst konstituierten Recht106. Hierbei geht es heGeL aber nur um die sich äußernde Freiheit, wie sie im Verhältnis zur Freiheit anderer besteht. honneth orientiert sich jedoch zu sehr an der objektiven Freiheit, wenn er meint, daß heGeL „in der Darlegung der individuellen Freiheit deren institutionelle Verfaßtheit sogleich mitzuerfassen“ versuche107. Das wäre so, also würde die heGeLsche Geistphilosophie nur aus dem objektiven Geist bestehen. Abgesehen von anderen Stellen entwickelt heGeL jedoch seinen Freiheitsbegriff – der bekanntlich eine Grundbestimmung des Geistes ist – in der Philosophie des subjektiven Geistes. Individuelle Freiheit ist zunächst die Freiheit des subjektiven Geistes. Der Wille ist hier in seinem Selbstbewußtsein denkend nur für sich frei108. Der Geist hat darin die 101 102 103 104 105
honneth (Fn 92), 73. honneth (Fn 92), 81 f. honneth (Fn 92), 91 f. honneth (Fn 92), 142 f. „Zunächst müssen wir in derartige Interaktionen verstrickt gewesen sein, bevor wir jene Freiheiten geltend machen können, die uns als individuelle einzelne oder moralische Subjekte zukommen sollen“, Honneth (Fn 92), 114. 106 heGeL, (Fn 20), Einleitung. 107 Honneth (Fn 92), 105. 108 heGeL, Georg Wilhelm Friedrich: Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse 1830. Dritter Teil. Die Philosophie des Geistes. Mit mündlichen Zusätzen. Werke, Bd. 10. Hrsg. v. E. Moldenhauer u. K. M. Michel. Frankfurt/Main 1986, § 481, 300.
82
Stephan Kirste
Stufe des Begriffs, der sich im objektiven Geist zu seiner Realität entäußert und im absoluten Geist zu sich selbst zurückfindet und sich darin nicht nur in seinem Begriff, sondern auch in seiner äußeren Wirksamkeit als Geist weiß und will109. Der subjektive Geist ist am Beginn seiner Verwirklichung tatsächlich in der Situation, die honneth – und zu Recht – an habermas kritisiert, daß er sich nämlich auf eine äußerlich vorgefundene Realität als bloße Faktizität bezieht110. Seine ganze Arbeit ist aber die Befreiung dieser äußeren Objektivität. Hierzu bildet er dann, wie von Honneth gezeigt, das Medium des Rechts als Dasein der Freiheit und transformiert die Sozialbeziehungen in dieses Freiheitsmedium und auf ihrer Grundlage auch die Umwandlung von Dingen der Erfahrungswelt. Daß honneth aber die Sphäre der individuellen Freiheit vernachlässigt, sie in die Sphäre des objektiven Geistes zieht und darauf beschränkt, hat weitreichende Konsequenzen für die Autonomie des Einzelnen. Während Gerhardt das Bewußtsein der Gesellschaft mit in das Selbstbewußtsein des Einzelnen zieht, verschiebt honneth umgekehrt das Selbstbewußtsein in die Gesellschaft. Gerhardt vernachlässigt durch seine Theoriekonstruktion die Sphäre des Rechts als Ort nicht nur individueller, sondern auch kollektiver vernünftiger Selbstbestimmung. Es gerät zum bloßen Sicherungs- und Durchsetzungsinstrument der Politik, in die diese Selbstbestimmung abgewandert ist. honneth kann hingegen die Gesellschaft und ihr Recht als Medium der Autonomie begreifen, vernachlässigt aber, daß die Triebkräfte für die autonome Mitwirkung an diesem Medium aus der individuellen Autonomie des Einzelnen und seinem Denken stammen. Der Einzelne ist bei seiner individuellen Selbstgesetzgebung Autor und Adressat seiner Regeln in einem. So ist er der Ursprung seiner individuellen Freiheit. Darin ist Gerhardt Recht zu geben. Er schließt sich mit anderen zusammen, um auch im Verhältnis zu ihnen eine vernünftige Welt der Freiheit aufzubauen. Die gemeinsame private und politische Autonomie wird so zur Grundlage des Rechts und der hierauf gegründeten Institutionen. Seine soziale Autonomie erhält er vermittelt durch das Recht wieder zurück, wie rousseau dies für den Gesellschaftsvertrag angenommen hat111. In den Institutionen der Sittlichkeit wird ein System relationaler sozialer Handlungspraktiken autonom gestaltet, dessen Vernünftigkeit sich von derjenigen individueller Handlungsvollzüge unterscheidet112. Insofern wird die Position des Einzelnen und die Rationalität seiner Handlungen vom System her begründet. Darin ist honneth Recht zu geben. Es verschwindet damit jedoch weder die soziale Autonomie in der individuellen, noch die individuelle Autonomie in der sozialen; vielmehr erweitert sich die individuelle Autonomie um die soziale Autonomie. Weil Honneth erstens die individuelle Autonomie als sozial begründet ansetzt und weil er zweitens das Recht als eine autonom gestaltete soziale Institution versteht, muß er überrascht Grenzen der Leistungsfähigkeit des Rechts feststellen. Un109 heGeL (Fn 108) § 482, 300 f. 110 heGeL (Fn 108), § 482, 303. 111 „Was der Mensch durch den Gesellschaftsvertrag verliert, ist seine natürliche Freiheit und ein unbegrenztes Recht auf alles, wonach ihn gelüstet und was er erreichen kann; was er erhält, ist die bürgerliche Freiheit und das Eigentum an allem, was er besitzt“, rousseau, jean-jacques, Vom Gesellschaftsvertrag. Übers. v. H. Brockard. Stuttgart 1986, I, 8, 22 f. 112 honneth (Fn 92), 226.
Recht – Selbst – Bestimmung
83
ter dem Schutz negativer Rechte soll die Autonomie den Boden des Rechts wieder verlassen, um eigene Lebensentwürfe zu realisieren113. Obwohl das Recht doch nach honneth gerade ein Medium Gesellschaft bei der Vermittlung von individueller Autonomie sein soll, kann es aufgrund seiner formalen Qualitäten – die honneth nicht wiederum vollständig auf Autonomie zurückführt – diese Freiheit nicht erzeugen114. So sollen ihm zufolge eine „Pathologie rechtlicher Freiheit“ entstehen, wie die „Rigidisierung sozialer Verhaltensweisen“ („Dienst nach Vorschrift“), die Verdrehung des Rechts als Mittel zum Selbstzweck, die Versteinerung des freien Subjekts zur Amtsperson, die Verrechtlichung. Das Recht wird auf Problembereiche ausgedehnt, in denen angemessenere Ordnungen zur Problembewältigung bereitstehen115. Diese Pathologien sollen der strategisch-funktionalen Struktur des Rechts offenbar notwendig innewohnen. Zu fragen ist jedoch, ob sich nicht einerseits diese „Pathologien“ autonom rechtlich bewältigen lassen und ob nicht andererseits die Verrechtlichung gerade auch Ausdruck eines Vertrauens in die Gestaltungskraft des Rechts ist. Gerhardt wie honneth reduzieren das Recht also naturalistisch auf seinen Zwangscharakter und bestreiten die Möglichkeit und Notwendigkeit, daß es Selbstheilungskräfte für seine Pathologien entwickelt und zum wesentlichen Element der autonomen Selbstbestimmung der Bürger wird. Demgegenüber soll nun abschließend die These verteidigt werden, daß das Recht einen besonders ausdifferenzierten Aggregatszustand von Selbstbestimmung bezeichnet. In diesem ist das Recht nicht nur schützendes Medium von Autonomie, sondern auf allen seinen Stufen zugleich ihr Ausdruck. III. autonoMIe
unD
recht
1. rechtLiche autonomie und PoLitische seLbstbestimmunG Ausgangspunkt soll das Verhältnis der drei Momente Nomos, Selbst, Bestimmung und zum Recht sein. Das positive Recht transformiert diese drei Momente in juristische Geltung116. Dabei schützt es nicht nur die Autonomie, sondern wird auf verschiedenen Stufen durch rechtliche Autonomie hervorgebracht. Es bringt auf diese Weise die in der Gesellschaft vorausgesetzten, pluralistisch diskutierten und sich entwickelten Werte zum Bewußtsein und transformiert sie in eine legitimierte, für alle Bürger verbindliche Form. Einleitend war Autonomie als die auf allgemeine Normen bezogene positive Freiheit definiert worden. Sie besitzt die Ambivalenz, daß sich das Selbst auf ein Gesetz hin bestimmt, wie es der kategorische Imperativ in Gestalt des Sittengesetzes enthält (Gesetzgebung für das Selbst), und die Bestimmung des Gesetzes durch das Selbst (Gesetzgebung durch das Selbst). Im ersten Fall wird das Selbst durch das 113 114 115 116
honneth (Fn 92), 151. honneth (Fn 92), 156. Honneth (Fn 92), 208. Zum hier zugrundegelegten Konzept der Tranformation vgl. Kirste, stePhan: Recht als Transformation. In: Rechtsphilosophie im 21. Jahrhundert. Hrsg. v. W. Brugger, U. Neumann und S. Kirste. Frankfurt/Main 2008, 134–156, 134 ff.
84
Stephan Kirste
Gesetz erst zu dem, was es – etwa moralisch – ist. Im zweiten Fall wird das Gesetz durch das Selbst erst zu dem, als was es gilt, z. B. zum juristischen Gesetz. Es ist nun kennzeichnend für die rechtliche Autonomie, daß in ihr beide Momente verbunden sind. 2. der nomos des rechts Recht kann verstanden werden als ein System von Normen, deren Setzung und Durchsetzung Normen unterworfen ist117. Mit moralischen Verhaltensvorschriften teilt das Recht den normativen Charakter. Er besteht darin, daß diese Normen Verpflichtungen in Gestalt von Geboten, Verboten oder Erlaubnissen enthalten. Von diesen und anderen Normen unterscheiden sich jedoch die Rechtsnormen dadurch, daß sie nicht zeitlos gelten, wie das eine vernunftrechtliche Naturrechtstheorie annahm. Ferner entstehen sie weder auf rein natürliche Weise noch aus rein rationalen Begründungen; vielmehr ist ihre Entstehung selbst Normen unterworfen. Solche Normen, die die Entstehung von Recht regeln, finden sich etwa in den zivilrechtlichen Regelungen über den Abschluß von Verträgen, dem Prozeßrecht, das die Voraussetzungen der Entstehung von Normen durch richterliches Handeln festlegt oder in verfassungsrechtlichen Regelungen des Gesetzgebungsverfahrens, der entsprechenden Kompetenzen und der inhaltlichen Grenzen für diese Verfahren. Auch die Durchsetzung dieser Normen ist kein natürlicher oder willkürlicher Vorgang, sondern ist durch die Normen etwa des Vollstreckungsrechts oder des Polizeirechts geregelt. Entscheidend ist deshalb, wie schon oben ausgeführt, nicht, daß die Normen zwangsmäßig durchgesetzt werden, sondern daß der Zwang, wenn er ausgeübt wird, normativen Bindungen unterworfen ist. Weil es in diesem Sinne normierte Normen bezeichnet, ist es ein reflexives Normensystem. Durch diese Struktur bricht das Recht sowohl den Einfluß natürlicher Faktoren, wie gesellschaftliche Interessen, sozialen Druck oder persönliche Leidenschaften, als auch religiöse, moralische oder konventionelle Auffassungen vom richtigen Handeln. Es ermöglicht in normativ gesteuerten Verfahren die Reflektion über diese Einflüsse und läßt sie dann nach Maßgabe gerechter Verfahren zu oder bringt sie zum Ausgleich. In dieser Abwehr und Filterung natürlichen und wertmäßigen Drucks schafft das Recht einen Freiraum für rationales Handeln und sichert somit negative Freiheit gegenüber diesen Einflüssen. Freiraum benötigt es auch selbst, denn seine Normen machen schlicht keinen Sinn, wenn sie sich nicht an Freiheit richten würden: Eine Verpflichtung setzt wenigstens die Möglichkeit der Wahl zwischen Handlungsalternativen voraus und bestimmt diese Wahl mit Rücksicht auf eine als vorzugswürdig angesehene Handlung. Das Recht beruht dabei nicht auf dem freien Willen in einem indeterministischen Sinn118. Vielmehr setzt es ihn, wie 117 Hier soll mithin eine normative Perspektive auf das Recht eingenommen werden. Andere sind selbstverständlich möglich. So kann das Recht als ein Kommunikationssystem, als Diskursform, als eine Zwangsordnung, als Befehl, als Ausfluß der Gerechtigkeit usw. verstanden werden mit jeweils unterschiedlichen Erkenntnisgewinnen, vgl. dazu auch Kirste, stePhan: Einführung in die Rechtsphilosophie. Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Reihe: Einführung Philosophie) 2010, 66 ff. 118 heun, Werner: Die grundrechtliche Autonomie des Einzelnen im Lichte der Neurowissen-
Recht – Selbst – Bestimmung
85
es eduard KohLrausch in Kantischer Tradition annahm, als „staatsnotwendige Fiktion“ voraus119. Willensmängel schließen diese Zurechnung nur dann aus, wenn das Recht sie selbst als relevant anerkennt. In subjektiven Rechten gibt das objektive Recht dem Einzelnen die Erlaubnis, unbeschränkt durch Gebote oder Verbote in rechtlich anzuerkennender Weise zu handeln. Er mag diese rechtliche Erlaubnis zu moralischem oder unmoralischem Verhalten nutzen. Solange er nicht die Grenzen dieser Erlaubnis überschreitet, haben diese Handlungen rechtliche Geltung. Das Recht schafft so erst die Möglichkeit, daß Erklärungen des Einzelnen als rechtlich relevant interpretiert und ihm zugerechnet werden können120. Zugleich zieht es ihn zur Verantwortung und verweist ihn auch auf diese Weise an seine soziale Einbindung. Rechtliche Autonomie muß nicht zugleich tatsächliche Freiheit bedeuten. Das ist vielleicht als erstes bei der sozial Frage und ihrer Herausforderung für den privatautonomen Abschluß von Arbeitsverträgen im 19. Jh. deutlich geworden. Dort wurde die soziale Asymmetrie zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ausgenutzt wurde zum Diktat einseitiger Arbeitsbedingungen und nicht mehr der Leistung der Arbeitskraft des Arbeiters entsprechender Arbeitslöhne. Daher sichert das Recht die Autonomie in tatsächlicher Hinsicht dort, wo mangelnde Freiheit rechtliche Autonomie gefährdet121. Es schafft somit auch einen Freiraum gegenüber sozialen und natürlichen Gefahren für die Autonomie. Schließlich würden diese Freiräume und staatlichen Leistungen zur Freiheitsbefähigung der Freiheit des Einzelnen doch nicht gerecht, wenn ihm die Einflußmöglichkeiten auf die Verfahren zu ihrer Begründung und Interpretation fehlen würden. Er bedarf daher der subjektiven Rechte gerade auch in Gestalt der Verfahrens- und Prozeßrechte, wie sie insbesondere in der englischen Menschenrechtstradition als Anhörungsrechte, Habeas Corpus und anderer Beteiligungsrechte anerkannt wurden122. Zusammengefaßt läßt sich diese freiheitsermöglichende, -ordnende und -sichernde Funktion der subjektiven Rechte mit GeorG jeLLineK in den status negativus, status positivus und status activus gliedern und zuordnen123.
schaften. In: JZ 2005, 853–860, S. 854 f. 119 KohLrausch, eduard: Sollen und Können als Grundlage strafrechtlicher Zurechnung. In: Güterbock-Festschrift. Berlin 1910, 3 ff., 26: „So ist das generelle Können tatsächliche Voraussetzung jedes Zurechnungsurteils, das individuelle Können aber wird zu einer staatsnotwendigen Fiktion“. 120 sinGer, reinhard: Vorbemerkung zu §§ 116 ff. In: Staudinger, BGB – Neubearbeitung Berlin 2011, Rn. 8. 121 So bekanntlich schon Lorenz von Stein: „Der Begriff der Freiheit ist aber ein abstrakter. Die Freiheit ist erst eine wirkliche in Dem, der die Bedingungen derselben, die materiellen und geistigen Güter als die Voraussetzungen der Selbstbestimmung, besitzt… Die Erfüllung der Idee der Freiheit besteht in der freien Selbstbestimmung der Gemeinschaft“, stein, Lorenz Von: Geschichte der socialen Bewegung in Frankreich von 1789 bis auf unsere Tage. In drei Bänden. Dritter Band: Das Königthum, die Republik, und die Souveränität der französischen Gesellschaft seit der Februarrevolution von 1848. Leipzig 1850, 114. 122 Kirste, stePhan: § 204. Die naturrechtliche Idee überstaatlicher Menschenrechte. In: HbStR, Bd. 10. Hrsg. v. P. Kirchhof und J. Isensee. Heidelberg 2012, 1–30, Rn. 25 f. 123 Näher hierzu Kirste, stePhan: Vom Status Subiectionis zum Recht auf Rechtssubjektivität. Die Status-Lehre Georg Jellineks und der normative Individualismus. In: Normativer Individualismus. Hrsg. v. L. Kähler. Tübingen 2014, S. 180 ff.
86
Stephan Kirste
In seiner rechts-, sozialstaatlich und demokratischen Organisation differenziert das Recht die durch die politische Autonomie gebildete öffentliche Gewalt in den bekannten drei Gewalten aus und sichert ihnen Befugnisse, damit sie ihre Aufgaben erfüllen können und verschafft ihnen hier eigenverantwortliche Kernbereiche, in die andere Gewalten nicht hineinwirken können. Schon Kant hatte PLatons Erkenntnis von der Differenzierung als Grundlage der Autonomie auf die Gewaltenteilung angewendet: „Also sind es drei verschiedene Gewalten …, wodurch der Staat …seine Autonomie hat, d. i. sich selbst nach Freiheitsgesetzen bildet und erhält“124. Kraft dieser Struktur differenziert, ordnet und stabilisiert Recht die Gesellschaft. Es ist Grundlage der Autonomie der Bürger. Das positive Recht grenzt die Freiheitssphären der Bürger gegeneinander und gegenüber staatlicher Intervention ab. Durch subjektive Rechte sichert es die Freiheit vor Fremdbestimmung. Rechtliche Autonomie geht somit aus rechtlicher Freiheit – als Freiheit durch subjektive Rechte hervor. Grundrechte schützen insbesondere die Freiheit autonomer Entscheidungen gegenüber staatlicher Beeinflussung. So wird die Privatautonomie durch eine Reihe von Grundrechten garantiert. Die politische Autonomie ist durch die Freiheit der Wahl gesichert. 3. das rechtLiche seLbst Das Recht ist insofern Nomos für das Selbst und seine Autonomie125. Es setzt das individuelle oder kollektive rechtliche Selbst nicht voraus, sondern schafft es erst durch seine Normen. Sicherlich ist der Einzelne dem Recht moralisch und natürlich vorgegeben. Die damit formulierte moralische oder anthropologische Aufgabe wird jedoch zu einer rechtlichen nur dadurch, daß das Recht sie in seiner „Sprache“, also als rechtliche Verpflichtung formuliert. Diese Verpflichtung wird dadurch erfüllt, daß der Einzelne von der Rechtsgemeinschaft als Rechtsperson anerkannt wird126. Durch die Gewährung von Rechten wird der Einzelne im Recht als Subjekt anerkannt. Der Einzelne wird von den subjektiven Rechten als Zurechnungspunkt ihrer Erlaubnisse gesetzt. Je vielseitiger dieser Rechte sind, desto vielseitiger wird der Mensch als Rechtsperson rekonstruiert. So wie andere außerrechtliche Elemente wegen der reflexiven Struktur gezielt in das Recht transformiert werden müssen, so tritt auch der Mensch im Recht nicht als ein natürliches Wesen, sondern als ein konstruiertes Rechtssubjekt, als Rechtsperson in Erscheinung. Das Selbst der rechtlichen Autonomie ist also rechtlich begründet in der Rechtsperson. Ihre Identität wird durch Zurechnung kontrafaktisch gesichert. Die Schattenseite der Notwendigkeit der expliziten Anerkennung des Menschen als Rechtssubjekt ist freilich, daß diese Anerkennung tatsächlich verweigert werden kann und auch verweigert wurde. Die mit der Konstruktivität der Rechtsperson ge124 Kant, immanueL: Die Metaphysik der Sitten. Erster Teil, metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre. Immanuel Kant Werkausgabe, Bd. VIII. Hrsg. v. W. Weischedel. Frankfurt/Main 1982, 305–499, § 49 a. E. 125 seLLers (Fn 1), 2. 126 Im Einzelnen Kirste, stePhan: Die beiden Seiten der Maske – Rechtstheorie und Rechtsethik der Rechtsperson. In: Kirste, S. / Gröschner, R. / Lembcke, O. (Hrsg.): Person und Rechtsperson. Tübingen (Mohr, Reihe Politika) 2014, 26 (im Erscheinen).
Recht – Selbst – Bestimmung
87
gebene Freiheit kann mithin mißbraucht werden. Der Nationalsozialismus hat dies mit der Verweigerung der Anerkennung ganzer Bevölkerungskreise als Rechtssubjekte bedrückend dokumentiert. Juden, Sinti und Roma und Behinderte wurden allenfalls partiell als Rechtssubjekte anerkannt und durften ansonsten als Rechtsobjekte zu Arbeit verpflichtet, gesundheitlich manipuliert, deportiert oder getötet werden. Daher bedarf es einer eigenen rechtlichen Verpflichtung, daß jeder Mensch vom Recht als Subjekt anerkannt und nicht als bloßes Rechtsobjekt behandelt wird. Die als Reaktion auf die Greueltaten totalitärer Regime nach dem II. Weltkrieg in Menschenrechtserklärungen und Verfassungen aufgenommene Menschenwürde gewährt dem Menschen das Recht auf Anerkennung als Rechtssubjekt. Menschen- und grundrechtlich hat mithin jeder Mensch das Recht von der Rechtsordnung als Subjekt von Rechten anerkannt zu werden, in denen er seine Freiheitsfähigkeit ausdrücken kann. Das rechtliche Selbst der Autonomie ist also eine rechtliche Konstruktion, auf die jeder Mensch einen menschen- und seit der Mitte des letzten Jahrhunderts auch einen verfassungsrechtlichen Anspruch besitzt127. Insofern ist das Selbst und seine Autonomie durch das Gesetz bestimmt. 4. die bestimmunG des seLbst Doch bleibt das Recht bei dieser Autonomie als Bestimmung des Selbst durch das Recht nicht stehen. Der Sinn des Rechts ist es gerade, die Autonomie des Einzelnen freizusetzen. Die subjektiven Rechte sind Befugnisse zu rechtlich anzuerkennenden Handlungen128. Wie die Rechte des status activus zeigen, richtet sich die durch das Recht ermöglichte Autonomie gerade auch auf die Begründung und Interpretation des Rechts selbst. Die Autonomie sichert dem Einzelnen, daß die Bindungen, die er eingeht, nicht von außen, heteronom auferlegt werden, sondern diesem grundrechtlich geschützten Selbst entspringen. Die Privatautonomie bezieht sich auf privatrechtliche Rechtsgeschäfte. Sie bedeutet die rechtliche Möglichkeit, sich im Verhältnis zu anderen rechtlich verbindlich gestalten und selbst Recht setzen zu dürfen. Sie bezeichnet das Prinzip „der Selbst-
127 Dieser grund- oder menschenrechtliche Anspruch ist als subjektives Recht ausgestaltet. Wenn Rechtssubjekt ist, wem ein subjektives Recht zusteht, dann kann mithin von Verfassungen, die das Recht auf Anerkennung als Rechtssubjekt enthalten, dieses Recht nicht mehr verletzt werden. Es ist in diesem Sinn performativ. Wenn das Recht auf Anerkennung als Rechtssubjekt die Kernbedeutung der Menschenwürde ist, wie gerade angedeutet (vgl. näher Kirste, stePhan, Human Dignity and the Concept of Person in Law. In:the Depth of the Human Person: A Multidisciplinary Approuch. Hrsg. v. Michael Welker, Cambridge 2014, 274–296, 291 f.; Kirste, stePhan: A Legal Concept of Dignity as a Foundation of Law. In: Human Dignity as a Foundation of Law. Hrsg. gemeinsam mit W. Brugger. Stuttgart (ARSP-Beiheft 137) 2013, 63–83, 78 f.), dann ist die Menschenwürde insoweit rechtlich nicht mehr antastbar: Jedenfalls in bezug auf das menschen- oder verfassungsrechtliche Recht auf Anerkennung als Rechtssubjekt, ist der Mensch mit der verfassungsrechtlichen Kodifizierung dieses Rechts bereits als Rechtssubjekt anerkannt. Daher muß die Würde des Menschen auch als subjektives Recht verstanden werden. 128 Rechtliche Autonomie beruht daher in der Tat auf rechtlichen Anerkennungsbeziehungen Anderson/Honneth (Fn 2), 137 f.
88
Stephan Kirste
gestaltung der Rechtsverhältnisse durch den Einzelnen nach seinem Willen“129. In der Privatautonomie schafft der Einzelne aus dieser rechtlichen Freiheit heraus in entsprechenden Instituten wie Vertrag, Ehe, Eigentum etc. eine Sphäre selbstbestimmter Freiheit. Rechtliche Autonomie stammt aus rechtlicher Freiheit und sie begründet rechtliche Freiheit. Die politische Autonomie gewährt der Rechtsperson das Recht, am gemeinsamen Selbst verbindlich mitgestalten zu können. Aus Sicht des Einzelnen bedeutet politische Autonomie einerseits die gleiche Mitwirkung an der demokratischen Herrschaft durch und über Gesetze, sei es durch die direktdemokratische Selbstgesetzgebung des Volkes oder durch die repräsentative Parlamentsgesetzgebung. Demokratie ist dann die Selbstbestimmung einer Gruppe von Menschen in den sie betreffenden Angelegenheiten. Als verfassunggebende Gewalt erlegt sich etwa ein Volk freiwillig rechtliche Bindungen auf130. Sie sind insofern rechtliche Selbstverpflichtungen der verfassunggebenden Gewalt, auch wenn dabei sonstige normative (moralische, völkerrechtliche) Verbindlichkeiten berücksichtigt werden, da es sich dabei nicht um verfassungsrechtliche Bindungen handelt. Hier liegt ein ursprünglicher Akt der Bestimmung des Volkes vor. Es gewinnt damit gesetzliche Herrschaft über sich selbst und ist nicht nur negativ, sondern auch positiv frei. Im demokratischen Rechtsstaat vollzieht sich dann die politische Autonomie in den Bahnen dieser Verfassung131. Dies geschieht in der rechtlich geordneten Partizipation der Bürger an der öffentlichen Willensbildung. Das Selbst als Rechtsperson ist somit im demokratischen Verfassungsstaat rechtlicher Ausdruck seiner politischen Autonomie. In der verfassunggebenden Gewalt des Volkes und in seiner direktdemokratischen oder repräsentativen Selbstgesetzgebung wirkt der Einzelne mit an der Begründung derjenigen Rechte, die ihn als rechtliches Selbst ausmachen. Das freie, selbstzweckliche Individuum setzt sich durch rechtliche Partizipation im deliberativen Prozeß der Demokratie als ein vermitteltes Subjekt, als Rechtsperson mit ihrer Würde und Freiheit. Die Gesellschaft regelt im Recht nicht nur irgendetwas und beschränkt nicht nur Freiheiten und begründet Herrschaft; vielmehr gibt sie sich im Recht eine prozedural vermittelte und geläuterte Version ihrer selbst. So wie das Ich bei fichte sein vorbewußtes Selbst zum Bewußtsein bringt und sich selbst bestimmt, so bringt die Gesellschaft sich in den Verfahren der Demokratie zum Bewußtsein und bestimmt sich aufgrund dieses Bewußtseins selbst. Das indivi-
129 fLume, Werner (1992): Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts II: Das Rechtsgeschäft, 3. Aufl. Heidelberg (1979, Nachdr 1992), § 1, 1 (2). 130 böcKenförde, ernst-WoLfGanG: Die verfassunggebende Gewalt des Volkes – Ein Grenzbegriff des Verfassungsrechts. In: ders. : Staat, Verfassung, Demokratie. Studien zur Verfassungstheorie und zum Verfassungsrecht, 1991, 90–112, 94: „Verfassunggebende Gewalt ist diejenige (politische) Kraft und Autorität, die in der Lage ist, die Verfassung in ihrem normativen Geltungsanspruch hervorzubringen, zu tragen und aufzuheben.“ 131 Treffend horst dreier, der „Selbstbestimmung als Verfassungsessens“ versteht: „Der Freiheitsgedanke steht am Beginn moderner Verfassunggebung, verbraucht sich aber in diesem Akt nicht. Die Idee gesamtgesellschaftlicher Selbstbestimmung bleibt weiterhin Movens und Motor politischer Einheitsbildung… Sie soll sich nicht nur auf eine freie Entscheidung gründen, sondern auch Freiheit gewährleisten“, Dreier, Horst: Der freiheitliche Verfassungsstaat als riskante Ordnung. In: Rechtswissenschaft 1 (2010), 11–38, 19.
Recht – Selbst – Bestimmung
89
duelle und das soziale Selbst realisiert sich in diesen Gesetzgebungsprozessen. So ist das Recht Bestimmung durch das Selbst. Iv. zusaMMenfassung Auf diese Weise differenziert der demokratische Verfassungsstaat die Dialektik der Autonomie in einem System von aus Freiheit gesetzter, an Freiheit gerichteter Normen aus. Er steht in der ideengeschichtlichen Tradition der Autonomiephilosophie und ist in der Lage, auch ihre Kritik aufzugreifen und zu integrieren. Das Selbst, das sich gesetzlich bestimmen soll, wird durch die Zurechnung von Rechten als Rechtsperson rekonstruiert. Es ist dem Recht also nicht ontologisch vorgegeben, sondern sein Konstrukt, auch wenn die Würde des Menschen, in der das Selbst ruht, das in Rechtsform anerkannte Fundament des Rechts ist. Dieses Selbst schließt sich mit anderen kraft seiner politischen Autonomie zum Verfassungsstaat zusammen, bindet sich freiwillig selbst und die anderen. So ist der Nomos durch das Selbst. Diese Bindung erfolgt aber in Gestalt von formell aufgrund ihrer Allgemeinheit und Gleichheit dem kategorischen Imperativ genügenden Gesetzen. Diese Verfassungsoder einfachen Gesetze sind wiederum Grundlage der privaten und öffentlichen Autonomie des Verfassungsstaates selbst. So entfaltet sich die Selbstbestimmung aufgrund des Nomos. Bei allem braucht man die Bewußtseinsphilosophie nicht aufzugeben. Das so gebildete rechtliche Selbst als Rechtsperson ist nicht der solipsistische Einzige max stirners132. Es ist vielmehr die sozial konstituierte und in die Gesellschaft wirkende Person. Sie mag den Rahmen geben, den der Einzige braucht, um sich seiner selbst bewußt zu werden. Diese Rechtsperson ist der Einzelne in einer Welt rechtlich gestalteter Sozialbeziehungen. Indem das Recht die soziale Anerkennung des Einzelnen als Rechtsperson konstituiert, bringt es sie zu Bewußtsein und ermöglicht ihm in rechtlich verfaßten diskursiven Prozessen, das Bewußtsein seiner Selbständigkeit und seiner sozialen Bindung neueren Erkenntnissen und Überzeugungen gemäß weiterzuentwickeln. Versteht man das Recht durch seine rechtlich geordneten Verfahren nicht nur als Ausdruck des politischen Bewußtseins, sondern auch als seine Ermöglichungsbedingung, dann besteht kein Bedarf, mit habermas die Bewußtseinsphilosophie zu verabschieden. In der Entfaltung der Dialektik der Autonomie ist der demokratische Verfassungsstaat zugleich die Institutionalisierung des politischen Bewußtseins in seiner rechtlichen Form. Insofern kann Gerhardt Recht gegeben werden. Das sich in seiner vernunftgeleiteten individuellen Autonomie realisierende Selbst, von dem Gerhardt spricht, schließt sich im Recht mit anderen Individuen zusammen, um das an sich vernünftige Verhältnis zu ihnen auch vernünftig zu ordnen und damit zu realisieren. Aus dieser politischen Autonomie geht das Recht als Normensystem hervor, das sich an die individuelle Autonomie richtet. Die Zurechnung dieser Normen konstituiert das rechtliche Selbst als diejenige Rechtsperson, von deren sozialer Autonomie Honneth spricht. Gerade die Rechtsform ist jedoch nicht nur Garant der Autonomie, sondern auch ihr Ausdruck. 132 Zu ihm hochhuth, martin: Relativitätstheorie des öffentlichen Rechts. Baden-Baden 2000, 4 u. 422 ff. u. passim.
raLf stoecKer, bieLefeLd worIn
lIegen
MenschenwürDe-verletzungen?
eIne fallgruppenanalyse
Nachrichten aus einer beliebigen Woche im April 2013: Der polnische Präsident Bronislaw Komorowski würdigte am Jahrestag des Aufstands im Warschauer Ghetto den “heroischen Kampf um Menschenwürde und Menschenrecht“ der Aufständischen. In der Bild-Zeitung stand zu lesen, dass in Berlin der mit 1 Million € dotierte „Roland-Berger-Preis für Menschenwürde“ an Menschenrechtsaktivistinnen verliehen wurde. Der Österreichische Rundfunk berichtete, dass im Land Vorarlberg Krankenhäuser oder Heime oft doppelt auf die Einhaltung der Menschenwürde kontrolliert würden. Der FDP-Politiker Jörg-Uwe Hahn schrieb in der FAZ, dass wir in Deutschland stolz auf die Strafprozessordnung sein könnten, weil sie dazu beitrage, die Menschenwürde zu verteidigen, und der scheidende Vorsitzende der Französischen Bischofskonferenz, Kardinal André Vingt-Trois, beklagte laut Radio Vatikan, dass – wie die bevorstehende Einführung der Schwulen-Ehe zeige –, das christliche Konzept der Menschenwürde in Frankreich nicht mehr als ethischer Bezugspunkt anerkannt werde. Diese Liste ließe sich, Google sei Dank, beliebig weiter fortsetzen. Jeder weiß, dass die Menschenwürde einen, wenn nicht den höchsten Wert darstellt, der uns zur moralischen Beurteilung, vor allem aber zur moralischen Verurteilung, zur Verfügung steht. Zugleich fällt es uns jedoch notorisch schwer zu erläutern, was gemeint ist mit diesem Rückgriff auf die Menschenwürde, so dass letztlich der Verdacht sehr nahe liegt, dass eigentlich gar nichts damit gemeint sei, zumindest nichts Bestimmtes, sondern dass der Verweis auf die Menschenwürde lediglich dazu diene, besonders verwerfliche Handlungsweisen zu brandmarken, bzw. diejenigen als Kämpfer für die Menschenwürde zu feiern, die sich entsprechenden Übeltaten in den Weg gestellt haben. Der Ausdruck „Menschenwürde“, könnte man denken, ist passend für Festreden, für Preisverleihungen und Moralpredigten, aber trägt nichts aus für das Anliegen von Ethikern und Rechtswissenschaftlern.1 Aus philosophischer Sicht hat diese minimalistische (vielleicht sogar eliminationistische) Haltung gegenüber der Menschenwürde den großen Vorteil, dass man sich keine Gedanken über das Verhältnis der Menschenwürde zu anderen moralischen Grundbegriffen machen muss, insbesondere dem der Menschenrechte. Der Kernbegriff unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens bekommt nicht nach über zweihundert Jahren plötzlich einen (zumindest) gleichrangigen Begriff zur Seite ge-
1
Besonders prominent ist diese Position in den letzten Jahren durch einen knappen Aufsatz der amerikanischen Bioethikerin macKLin geworden): macKLin, ruth, Dignity is a useless concept, in: BMJ 327 (2003) 7429, 1419–1420. In Deutschland wird sie schon seit langem von hoerster vertreten: hoerster, norbert, Zur Bedeutung des Prinzips der Menschenwürde, in: Juristische Schulung, 23 (1983) 2, 93–96.; ders., Ethik des Embryonenschutzes: Ein rechtsphilosophischer Essay, Stuttgart 2002, Abschnitt 1; Vgl. birnbacher, dieter, Menschenwürde-Skepsis, in: Joerden, Jan C. / Hilgendorf, Eric / Thiele, Felix (Hrsg.), Menschenwürde und Medizin: Ein interdisziplinäres Handbuch, Berlin 2013, 159–175.
92
Ralf Stoecker
stellt.2 Andererseits lässt es sich aber auch nicht ausschließen, dass man etwas versäumt, wenn man die Menschenwürde allzu schnell ad acta legt, sei es, dass sich dahinter vielleicht eine zweites Fundament unserer moralischen Situation verbirgt, sei es, dass sich die Geltung der Menschenrechte auf die Menschenwürde zurückführen ließe. Gegeben also, dass man auf Nummer sicher gehen und nicht vorschnell auf die Menschenwürde verzichten möchte, dann gibt es meines Erachtens zwei verschiedene Strategien, wie man weiter vorgehen könnte. Die erste besteht darin, philosophisch eine Konzeption der Menschenwürde zu entwickeln oder auch eine der schon in der Debatte befindlichen Konzeptionen aufzunehmen, um dann zu zeigen, dass sie tatsächlich trifft, was wir von der Menschenwürde erwarten. Man beginnt also mit der Theorie und trägt sie dann an die Praxis heran.3 Die zweite Strategie geht in umgekehrte Richtung vor. Sie setzt bei unseren Erwartungen an, um daraus Anhaltspunkte für die theoretische Konzeptualisierung zu gewinnen. Ersteres, könnte man auch sagen, ist eine Top Down Strategie, letztere ist Bottom Up, oder: die eine Strategie ist deduktiv, die andere induktiv. Natürlich gilt, so eindrücklich diese Redeweisen auch sind, dass wir uns alle in unseren philosophischen Untersuchungen keineswegs nur in eine Richtung, sondern ständig hin und her bewegen, mal eher konzeptuelle Überlegungen anstellen, um daraus Schlussfolgerungen für die Praxis zu ziehen, mal uns eher die Vielfalt der Anwendungskontexte vor Augen führen. Aber man kann jedenfalls die Schwerpunkte unterschiedlich setzen, und gerade für das Verständnis von Menschenwürde ist es meines Erachtens erhellend, mit der Frage zu beginnen, in welchen verschiedenen Zusammenhängen der Begriff der Menschenwürde eine wesentliche Rolle spielt, um dann zu untersuchen, was es jeweils ist, das den Rekurs auf die Menschenwürde so attraktiv macht. Das ist der Ausgangspunkt für die Fallgruppenanalyse, die ich in meinem Beitrag leisten möchte. Ich werde sie im ersten Teil mit einem Durchgang durch die verschiedenen Anwendungsbereiche, in denen in der ethischen Reflexion häufig von Menschenwürde die Rede ist, beginnen, um dann als zweites zu fragen, welcher Aspekt es jeweils ist, der durch die Rede über Menschenwürde herausgestrichen 2
3
Das problematische Verhältnis zwischen Menschenwürde und Menschenrechten wird in der Literatur häufig thematisiert, z. B. in: Lohmann, Georg, Die rechtsverbürgende Kraft der Menschenwürde: Zum menschenrechtlichen Würdeverständnis nach 1945, in: Zeitschrift für Menschenrechte, 4 (2010) 1, 46–63; Ders., Menschenwürde als „Basis“ von Menschenrechten, in: Joerden/Hilgendorf/Thiele (Fn 1), 179–194. bieLefeLdt, heiner, Auslaufmodell Menschenwürde? Warum sie in Frage steht und warum wir sie verteidigen müssen, Freiburg im Breisgau [u. a.] 2011; düWeLL, marcus, Menschenwürde als Grundlage der Menschenrechte, in: Zeitschrift für Menschenrechte, 4 (2010) 1, 64–79; PoLLmann, arnd, Menschenwürde nach der Barbarei: Zu den Folgen eines gewaltsamen Umbruchs in der Geschichte der Menschenrechte, in: Zeitschrift für Menschenrechte, 4 (2010) 1, 26–45; habermas, jürGen, Das Konzept der Menschenwürde und die realistische Utopie der Menschenrechte, in: Deutsche Zeitschrift für Philosophie, 58 (2010) 3, 343–357; stePanians, marKus, Gleiche Würde, gleiche Recht, in: Stoecker, Ralf (Hrsg.), Menschenwürde – Annäherung an einen Begriff, Wien 2003, 81–101. Das klassische Vorbild ist Kants Konzeption der Menschenwürde, die er in der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten entwickelt und in der Metaphysik der Sitten auf verschiedene Anwendungsbereiche überträgt. Vgl. zur häufig missverstandenen Konzeption Kants: sensen, oLiVer, Kant‘s Conception of Human Dignity, in: Kant-Studien, 100 (2009) 3.
Worin liegen Menschenwürde-Verletzungen?
93
werden soll. Im abschließenden dritten Teil stelle ich ein paar Spekulationen dazu an, welches Menschenwürdeverständnis dieser Vielfalt von Anwendungskontexten besonders gut gerecht werden könnte, und gelange dabei zu einem Verständnis, dem zufolge das Gebot, die Menschenwürde zu achten, auf den besonderen Wert der individuellen, sozialen Würde des Menschen abhebt. Der Darstellung der verschiedenen Anwendungsbereiche, in denen häufig von Menschenwürde die Rede ist, möchte ich allerdings eine generelle Beobachtung voranstellen. Offenkundig wird unser Interesse an der Menschenwürde primär aus unserem Interesse an Menschenwürdeverletzungen gespeist. Was es uns so schwer macht, in moralischen Urteilen auf den Rückgriff auf die Menschenwürde zu verzichten, sind Situationen, in denen die menschliche Würde eklatant missachtet wird. Die induktive Strategie sollte also in diesem Sinn mit einer negativen Strategie verknüpft werden. Wir wollen wissen, in welchen Bereichen der ethischen Debatte es naheliegt Menschenwürdeverletzungen zu konstatieren, um dann zu klären, worin jeweils das Verletzende der beanstandeten Handlungsweise liegt.4 Nun aber zum ersten Teil, einem exemplarischen Durchgang durch verschiedene Anwendungsbereiche, in denen in der ethischen Reflexion häufig von Menschenwürde die Rede ist.5 I. Vor ein paar Jahren erschien in der Zeitschrift Bioethics ein Artikel mit einem Eröffnungssatz von geradezu biblischer Wucht: „In the begining there was bioethics.“6 Dieses Selbstbewusstsein muss man nicht teilen. Wahr ist aber, dass die Transformation der traditionellen medizinischen Standesethik in die moderne Bioethik in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts zu einer deutlichen Umorientierung der Ethik generell geführt hat. Auch die aktuelle philosophische Debatte um die Menschenwürde hat ihren Ausgang in zwei bioethischen Debatten genommen, in der Sterbehilfedebatte und der Debatte über den richtigen Umgang mit frühen Embryonen im Rahmen der Präimplantationsdiagnostik und der Stammzellforschung. Ausgangspunkt der Debatte über die Zulässigkeit aktiver Sterbehilfe war die Einsicht, dass die einseitige Fixierung der Medizin auf den Erhalt des Lebens, wie sie gegen Mitte des 20. Jahrhunderts selbstverständlich war, nicht immer im Interesse der Patienten lag. Sowohl der aggressive Einsatz technologischer Mittel als auch die 4
5
6
Dass es ratsam ist, den Menschenwürdebegriff mit einer induktiven, negativen Strategie zu untersuchen, habe ich in: stoecKer, raLf, Three Crucial Turns on the Road to an Adequate Understanding of Human Dignity, in: Kaufmann, Paulus / Kuch, Hannes / Neuhäuser, Christian / Webster, Elain (Hrsg.), Violations of Human Dignity, Dordrecht 2010, 7–19, erläutert. Es gibt eine Reihe von umfangreichen Sammelbänden zu verschiedenen Bereichen, in denen in der Ethik von der Menschenwürde die Rede ist: düWeLL, marcus / braarViG, jens / broWnsWord, roGer / mieth, dietmar (Hrsg.), The Cambridge Handbook of Human Dignity. Interdisciplinary perspectives, Cambridge 2014; joerden/hiLGendorf/thieLe, (Fn 1) sowie knapper Kaufmann, PauLus / Kuch, hannes / neuhäuser, christian / Webster, eLain (Hrsg.), Humiliation, Degradation, Dehumanisation, Dordrecht [u. a.] 2011; KnoePffLer, niKoLaus / hanieL, anja, Menschenwürde und medizinethische Konfliktfälle, Stuttgart [u. a.] 2000. bayer, ronaLd / fairchiLd, amy L., The Genesis of Public Health Ethics, in: Bioethics, 18 (2004) 6, 473–492, 473.
94
Ralf Stoecker
damals übliche Praxis, den Patienten ihren Zustand zu verschweigen, nahmen ihnen die Möglichkeit, sich gedanklich mit dem Lebensende auseinander zu setzen, ihre Angelegenheiten zu regeln, sich von Angehörigen zu verabschieden usw. Ende der Sechzigerjahre hat in der Medizin allerdings ein Umdenken eingesetzt, maßgeblich angestoßen durch die Hospiz-Bewegung und die Entwicklung der Palliativmedizin. In dem viel beachteten Buch Die Geschichte des Todes des französischen Historikers ariès von 1978 heißt es dazu: „Diese neue Strömung, die aus dem Mitgefühl mit dem sich selbst entfremdeten Sterbenden hervorgegangen war, hat sich für eine Verbesserung der Bedingungen des Sterbens ausgesprochen, die dem Sterbenden seine mit Füßen getretene Würde zurückerstatten sollte.“7 Was ariés zufolge an dem Sterben in den Kliniken der Fünfziger- und Sechzigerjahre auszusetzen war, war die Missachtung der Würde der Sterbenden. Dadurch, dass den Patienten die Möglichkeit vorenthalten wurde, sich mit dem bevorstehenden Tod auseinander zu setzen und auch sonst die ihnen verbleibende Lebensspanne so gut wie möglich zu nutzen, wurde ihre Würde verletzt. In diesem Punkt herrschte schnell Einigkeit, niemand bestreitet heute ernsthaft, dass es eine wichtige medizinische Aufgabe ist, sterbenden Patienten in diesem Sinne einen würdigen Tod zu ermöglichen. Umstritten war und ist hingegen, ob es der Respekt vor der Würde der Sterbenden auch erforderlich machen kann, ihnen die Mittel zur Verfügung zu stellen, sich selbst zu töten, beziehungsweise sie auf ihren Wunsch hin zu töten, oder ob es gerade ein Gebot der Würde ist, dieses Verlangen auszuschlagen. Dass in dieser Debatte der Würde-Begriff eine große Rolle spielt, zeigt sich schon an dem Namen eines der so genannten Sterbehilfe-Vereine, Dignitas, und auch an den offiziellen Bezeichnungen der Gesetze, die in zwei USamerikanischen Bundesstaaten die Suizid-Assistenz regeln: Oregon Death with Dignity Act und Washington Death with Dignity Act. Was diese Debatte allerdings philosophisch besonders interessant macht ist, dass sich beide Seiten explizit auf die Menschenwürde berufen.8 Eine plausible Menschenwürde-Konzeption muss diesem Umstand Rechnung tragen. Sozusagen am anderen Ende des menschlichen Lebens ist die Embryonen-Debatte angesiedelt, die um die Jahrtausendwende herum zu einer heftigen Kontroverse in der deutschen Philosophie geführt hat, was vielleicht auch damit zusammenhing, dass mit nida-rümeLin einer der Meinungsführer dieser Debatte zugleich politisch Karriere machte und Mitglied der Deutschen Bundesregierung wurde.9 7 8
9
ariès, PhiLiPPe, Geschichte des Todes, München 1985, 755. Für die Befürworter von assistiertem Suizid oder Tötung auf Verlangen vgl. beispielsweise: jens, WaLter / KünG, hans, Menschenwürdig sterben: Ein Plädoyer für Selbstverantwortung, München 1995, für die Gegner: Kass, Leon, Life, liberty, and the defense of dignity. the challenge for bioethics, San Francisco 2002, Kapitel 8; VeLLeman, j. daVid, A right of self-termination?, in: Ethics, 109 (1999) 3, 606–628. Vgl. die Dokumentation in Teil 4 von nida-rümeLin, juLian, Ethische Essays, Frankfurt am Main 2002; sowie hoerster, Ethik des Embryonenschutzes (Fn 1), Kapitel 1; merKeL, reinhard, Forschungsobjekt Embryo. Verfassungsrechtliche und ethische Grundlagen der Forschung an menschlichen embryonalen Stammzellen, München 2002, Kapitel 3; stoecKer, raLf, Die Würde des Embryos, in: Groß, Dominik (Hrsg.), Zwischen Theorie und Praxis: Ethik in der Medizin in Lehre und Klinik, Würzburg 2002, 53–71; quante, michaeL, Wessen Würde? Welche Diagnose?: Bemerkungen zur Verträglichkeit von Präimplantationsdiagnostik und Menschenwürde, in: Siep, Ludwig / Quante, Michael (Hrsg.), Der Umgang mit dem beginnenden mensch-
Worin liegen Menschenwürde-Verletzungen?
95
Während nach meinem Eindruck die Menschenwürde in der schon älteren Abtreibungsdebatte keine große Rolle gespielt hatte, stand sie bei der Diskussion um die Zulässigkeit der Präimplantationsdiagnostik, der Stammzellforschung, aber auch des reproduktiven Klonens im Mittelpunkt der Debatte, die vor allem um die so genannten SKIP-Argumente geführt wurde. „SKIP“ ist ein Akronym für „Spezies-, Kontinuitäts-, Identitäts- und Potentialitätsargumente“. Diese Argumente beginnen stets mit der Feststellung, dass erwachsene Menschen eine Würde haben, die sie unter den besonderen Schutz des Tötungsverbots stellt, um dann aus der Beziehung der Embryonen zu den daraus potentiell oder wirklich entstehenden Erwachsenen herzuleiten, dass also auch schon die Embryonen eine Würde haben müssten.10 Im Zusammenhang mit der Embryonenforschung, wie auch im Rahmen der Forschungen zur Xenotransplantation wurde darüber hinaus auch diskutiert, ob die künstliche Überwindung der menschlichen Gattungsgrenze und die Erzeugung von Menschen-Tier-Mischwesen mit der Würde des Menschen vereinbar ist, ja wie stark sich überhaupt Eingriffe in das natürliche Design des Menschen mit dieser Würde vereinbaren ließen.11 Ähnliche Überlegungen betreffen auch die noch futuristischen Ideen von Mensch-Maschine-Mischwesen, so genannten Cyborgs. Wenngleich die heutige Diskussion der Menschenwürde in der Bioethik weitgehend auf die Embryonen- und Sterbehilfe-Debatten zurückgeht, so hat der Rückgriff auf die Menschenwürde schon früher eine wichtige medizinethische Rolle gespielt, in der Kritik an den Zuständen in der psychiatrischen Versorgung und beim Umgang mit behinderten Menschen in den 1960er und Anfang der 1970er Jahre. Auch wenn sich diese Zustände insgesamt radikal geändert haben, ist die Sorge um eine menschenwürdige Behandlung immer noch ein wichtiges Thema in der psychiatrischen Ethik, am prominentesten im Kontext medizinischer Behandlungen gegen den Willen der Patienten.12 Die Zwangsbehandlungen waren aber nicht der einzige Grund, die Umstände in den damaligen psychiatrischen Anstalten für unvereinbar mit der Menschenwürde zu halten, auch die ganze Art des Umgangs mit den Patienten war menschenunwürdig. Dass die Art und Weise, wie in Kliniken mit Patienten umgegangen wird, deren Menschenwürde verletzen kann, betrifft aber nicht nur psychiatrische Krankenhäuser, es ist eine Gefahr, die auch in anderen Krankenhausabteilungen, sowie in Pflegeheimen und Alteneinrichtungen immer wieder auftritt.13 Ein großer Teil der em-
10 11 12
13
lichen Leben: Ethische medizintheoretische und rechtliche Probleme aus niederländischer und deutscher Perspektive, Münster [u. a.] 2003, 133–152. Vgl. damschen, GreGor / schönecKer, dieter, Der moralische Status menschlicher Embryonen: Pro und contra Spezies-, Kontinuums-, Identitäts- und Potentialitätsargument, Berlin [u. a.] 2003. Vgl. joerden, jan, Menschenwürde und Chimären- und Hybridbildung, in: Joerden/Hilgendorf/Thiele (Fn 1), 1033–1044. Vgl. Koch-stoecKer, steffi, Menschenwürde und Psychiatrie. Annäherung an das Thema aus der psychiatrischen Praxis, in: Joerden, Jan C. (Hrsg.), Menschenwürde in der Medizin: Quo vadis?, Baden-Baden 2012, 133–146; seideL, raLf, Von psychischer Krankheit und Menschenwürde, in: Borsi, Gabriele M. (Hrsg.), Die Würde des Menschen im psychiatrischen Alltag, Göttingen 1989, 24–32. Vgl. jacobson, nora, Dignity and health, Nashville 2012; aGich, GeorGe j., Reflections on the Function of Dignity in the Context of Caring for Old Peoplein: Journal of Medicine and Philosophy, 32 (2007) 5, 483–494; chochinoV, harVey max, Dignity and the essence of medicine:
96
Ralf Stoecker
pirischen Forschung zu Würdeverletzungen findet sich deshalb auch in der pflegewissenschaftlichen Literatur. Ein ganz anderer Aspekt der Bedrohung der menschlichen Würde im Gesundheitssystem betrifft die grundsätzliche Frage, wer unter welchen Umständen in den Genuss welcher Gesundheitsleistungen kommt. Von wichtigen medizinischen Leistungen ausgeschlossen zu sein, ist ein guter Grund, eine Bedrohung der Menschenwürde zu diagnostizieren. An dieser Stelle gibt es einen nahtlosen Übergang in einen anderen ethischen Themenbereich, in dem der Rekurs auf die Menschenwürde Gang und Gebe ist, in der politischen und Sozialethik.14 Bekanntlich ist die Menschenwürde ja nicht deshalb in ihre prominente Position in den internationalen Konventionen und beispielsweise im Deutschen Grundgesetz gelangt, um dadurch zur Embryonenforschung oder Chimärenbildung Stellung zu beziehen. Sie bildete eine Reaktion auf das, was man als paradigmatische Menschenwürdeverletzungen bezeichnen kann: all das, was die Nazis, die Schergen Stalins, die japanischen Militaristen und viele andere Akteure den Menschen in den Jahren vor 1945 angetan haben und wovon sie sich auch danach nicht haben abhalten lassen: Folter, Massenmord und -vergewaltigungen, Konzentrationslager, Zwangsarbeit und Sklaverei, Rassismus und Sexismus, politische Unterdrückung, Vertreibung und kulturelle Vernichtung, Kolonialismus, Ausbeutung und Verelendung, Zwangsheiraten und rituelle Verstümmelungen.15 Auch die verbreitete Rede über Menschenwürdeverletzung in Publikationen der 1960er und 70er Jahre bezog sich in aller Regel nicht auf die Bioethik, sondern auf die verheerenden Lebensumstände der allermeisten Menschen beispielsweise in Afrika oder unter den Diktaturen Lateinamerikas. In Deutschland gab es ebenfalls einen sozialen Kontext für die Diskussion der Menschenwürde. Sie stand in der Gewerkschaftsbewegung schon seit dem 19. Jahrhundert als Gegenbegriff für die herrschende Ausbeutung der Arbeiter. Die Forderung nach menschenwürdigen Arbeitsverhältnissen wurde dann in den letzten Jahren zunehmend ergänzt um die Befürchtung, dass auch Arbeitslosigkeit eine Bedrohung für die Menschenwürde bedeuten könne.16 Ein anderes Thema, dessen sich die junge Bundesrepublik zum Glück sehr schnell entledigt hat, das aber global weiterhin aktuell ist, ist die Frage, ob die Todesstrafe mit der menschlichen Würde vereinbar ist.17 Es stellen sich aber andere Fragen zu unserer Praxis des Strafvollzugs, etwa zur Vereinbarung von Menschenwürde
14 15
16
17
the A, B, C, and D of dignity conserving care, in: British Medical Journal, 335 (2007) 7612, 184–187. Vgl. die Beiträge in düWeLL et al., (Fn 5)), Teil V; Kaufmann et al., (Fn 5), Teil II. Zur Geschichte des Menschenwürdebegriffs vgl.: tiedemann, PauL, Menschenwürde als Rechtsbegriff: Eine philosophische Klärung, Berlin 2007; Jaber, dunja, Über den mehrfachen Sinn von Menschenwürde-Garantien: Mit besonderer Berücksichtigung von Art. 1 Abs. 1 Grundgesetz, Frankfurt am Main 2003; VöGeLe, WoLfGanG, Menschenwürde zwischen Recht und Theologie, Gütersloh 2006. Eine Untersuchung des entwürdigenden Charakters von Arbeitslosigkeit findet sich in marGaLit, aVishai, Politik der Würde: Über Achtung und Verachtung, Frankfurt am Main 1999, Kapitel 15. Zu würdigen Arbeitsverhältnissen vgl. sayer, andreW, Würde am Arbeitsplatz, in: Deutsche Zeitschrift für Philosophie, 60 (2012) 4, 557–572. Vgl. stoecKer, raLf, Todesstrafe und Menschenwürde, in: Jacobs, Helmut (Hrsg.), Gegen Folter und Todesstrafe, Frankfurt am Main 2007, 265–304.
Worin liegen Menschenwürde-Verletzungen?
97
mit Sicherungsverwahrung oder generell mit der Existenz von weitgehend rechtsfreien Sozialräumen innerhalb der Gefängnisse. Eine Diskussion, in der sich zumindest die deutsche Haltung zum Strafvollzug radikal von derjenigen in den USA abhebt, betrifft den Einsatz entwürdigender Maßnahmen als Teil der Strafe, innerhalb der Gefängnisse aber auch (als Shame Punishment) anstelle von Haftstrafen.18 Weitere Themen aus dem juristischen Bereich, die unmittelbar die menschliche Würde betreffen, sind der Einsatz von Lügendetektoren, Abhörmaßnahmen, sowie der prophylaktische Einsatz von Überwachungskameras im öffentlichen Raum. Die Möglichkeit, dass staatliches Handeln die Menschenwürde verletzt, wurde in den letzten Jahren in Deutschland anhand von zwei besonderen Szenarien heftig diskutiert, einem realen und einem fiktiven. Real war die Drohung des stellvertretenden Frankfurter Polizeichefs im Jahre 2002, einen Kindesentführer foltern zu lassen, wenn er nicht das Versteck des Kindes preisgibt, fiktiv die Abwägung, ob es zulässig sein könnte, ein Verkehrsflugzeug abzuschießen, wenn die Gefahr besteht, dass es nach dem Vorbild von 9/11 als fliegende Bombe verwendet wird.19 Neben möglichen Würdeverletzungen staatlichen Handelns wurde in den letzten Jahren auch über Bedrohungen der Menschenwürde durch Medien diskutiert. Ein Grund waren Paparazzi, die immer tiefer in das Privatleben von Prominenten eindrangen, ein anderer die zunehmende Tendenz vor allem in privaten Fernsehsendern, Quoten dadurch zu erzielen, dass Menschen gezielt lächerlich gemacht werden, angefangen von Dieter Bohlens „Deutschland sucht den Superstar“, über Stefan Raabs „TV total“ bis hin zum „Dschungelcamp“ und „Germanys next Topmodel“.20 Und noch ein weiterer Bereich unseres Lebens ist in den letzten Jahren stark mit Menschenwürdeverletzungen in Verbindung gebracht worden, die schulische Erziehung, vor allem in Internaten und Kinderheimen. Auch in hoch angesehen Institutionen waren Kinder offensichtlich immer wieder Gewalt und sexuellem Missbrauch ausgeliefert. Was in diesem Kontext bislang allerdings noch nicht so stark debattiert wird, ist die grundsätzliche Frage dahinter, wie es überhaupt mit der Würde des Kindes steht, inwieweit man abgesehen von Missbrauch und Prügelstrafe die Menschenwürde der Kinder achten und missachten kann, in der schulischen Erziehung, in der Öffentlichkeit, vor allem aber auch im häuslichen Umfeld.21 Damit schließe ich meinen Schnelldurchgang durch Themen, in denen in der Debatte der Rekurs auf die Menschenwürde einen großen Anteil hat. Sie ist natürlich längst nicht vollständig, sondern ließe sich noch lange fortsetzen. Was sie aber zeigt ist, wie breit das Feld ist, in dem der ethische Diskurs auf den Rückgriff auf die Menschenwürde verzichten müsste, wenn es sich dabei tatsächlich bloß um eine wohlklingende Leerformel zur Artikulation schärfster moralischer Missbilligung 18 19 20 21
Vgl. nussbaum, martha c., Hiding from Humanity: Disgust, Shame, and the Law, Princeton 2009, Kapitel 5. Zur Folter vgl. die Beiträge in beestermöLLer, Gerhard / brunKhorst, hauKe (Hrsg.), Rückkehr der Folter: Der Rechtsstaat im Zwielicht?, München 2006. Vgl. stoecKer, raLf, Superstars und Menschenwürde, in: Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung Berlin (Hrsg.), Bildung für Berlin, Berlin 2007, 70–75. Vgl. stoecKer, raLf, Kinderrechte und Kinderwürde, in: Bornmüller, Falk / Hoffmann, Thomas / Pollmann, Arnd (Hrsg.), Menschenrechte und Demokratie: Georg Lohmann zum 65. Geburtstag, Freiburg im Breisgau 2013, 387–407.
98
Ralf Stoecker
oder Wertschätzung handeln würde. Entscheidend ist aber nun die Frage, ob sich aus dieser Liste noch weitere Schlussfolgerungen ziehen lassen, die darauf hoffen lassen, von dem Bedauern, dass es schade wäre, auf die Rede über die Menschenwürde verzichten zu müssen, zu einer positiven Charakterisierung der Menschenwürde zu gelangen. II. Eine erste Beobachtung ist, dass die Handlungssituationen, die in den verschiedenen ethischen Diskursen als Bedrohungen der Menschenwürde betrachtet werden, unterschiedlich gewichtig sind. Folter, Vergewaltigung und Sklaverei bewegen sich, moralisch gesehen, in einer ganz anderen Dimension der Verwerflichkeit als die Selektion von Embryonen, die Observation von Straftätern oder der rüde Umgang mit Patienten in einem Krankenhaus. Diese Beobachtung hat in der Menschwürdediskussion immer wieder zu der Warnung geführt, mit dem Vorwurf der Menschenwürdeverletzung sparsam umzugehen, ihn auf die monströsen Fälle zu beschränken, um ihn nicht als Kleingeld für die alltäglichen Unmoralitäten zu verschwenden. Und natürlich macht es einen riesen Unterschied, ob ein Mädchen aus der Gesellschaft ausgestoßen und in die Prostitution getrieben wird, weil sie von einem Mann vergewaltigt wurde, oder ob sie vom Moderator einer Casting-Show vor aller Welt verspottet wird, weil sie keine gute Stimme hat. Die Frage ist nur, ob daraus folgt, dass letzteres gar nichts mit Menschenwürde zu tun hat. Eine angemessene Konzeption der Menschenwürde muss darauf eine Antwort geben. Die Hauptfrage, die sich angesichts der verschiedenen Anwendungskontexte stellt ist aber, worin jeweils das Verwerfliche liegt, das den Rückgriff auf die Menschenwürde nahelegt. Was wird hier jeweils denjenigen angetan, deren Menschenwürde verletzt wird? Wenig überraschend finden sich unter den Antworten alle diejenigen Vorschläge wieder, zwischen denen die moralphilosophische Diskussion über das richtige Verständnis der Menschenwürde geführt wird, daneben aber auch noch weitere. Scheinbar besonders leicht ist es, eine Antwort für die Debatte zu geben, ob der Umgang mit Embryonen im Rahmen einer Präimplantationsdiagnostik menschenwürdeverletzend ist. damschen und schönecKer haben dies in ihrem schon erwähnten einflussreichen Buch Der moralische Status menschlicher Embryonen ganz deutlich gemacht. Sie ersetzen dort die umständliche Rede von Menschenwürde durch einen prosaischen Platzhalter, den griechischen Buchstaben Sigma, der einfach für diejenige Eigenschaft eines Menschen stehen soll, die es verbietet, den Menschen zu töten (vgl. S 190 f.). Etwas anderes kann man einem Embryo durch die PID eben nicht antun als ihn zu vernichten oder nicht zu vernichten. Und die Menschenwürde, das ist dann dasjenige, was ihm den besonderen moralischen Status verleiht, der ihn vor der Vernichtung schützt. Dass es der Menschenwürde wesentlich ist, das Tötungsverbot zu begründen, spielt allerdings auch in anderen Anwendungskontexten eine Rolle: zu allererst bei Massenmorden, daneben aber auch im Fall der Todesstrafe, bei den Gegnern der Sterbehilfe und in der Diskussion, ob es die Menschenwürde der Passagiere verletzt,
Worin liegen Menschenwürde-Verletzungen?
99
wenn man ihr Flugzeug abschießt und sie dadurch umbringt, um eine noch größere Katastrophe zu verhindern. In vier dieser Fälle, bei den Embryonen, der Sterbehilfe, der Todesstrafe und dem Flugzeugabschuss, drängt sich aber noch ein anderer Verdacht auf, ein anderer Vorwurf, der häufig mit Menschenwürdeverletzungen verbunden wird: dass die Opfer durch die Tat instrumentalisiert werden. Besonders prominent erhebt Kant diesen Vorwurf, wenn er in der Grundlegungsschrift den Selbstmördern vorwirft, sich selbst preiszugeben, nur um kein leidvolles Leben zu führen. Aber natürlich beschränkt sich der Vorwurf nicht auf instrumentelle Tötungshandlungen. Auch gegen Folter beispielsweise, gegen Vergewaltigung und Kindesmissbrauch kann man einwenden, dass sie insofern Menschenwürdeverletzungen sind, als sie die Betroffenen zum Mittel ihrer Zwecke machen.22 Allerdings beschleicht einen hier schnell der Verdacht, dass dasselbe auch für die allermeisten anderen Handlungsweisen auf meiner Liste gilt, und ebenso für viele andere Handlungen, die sicher keine Menschenwürdebedrohungen darstellen, ja die sogar moralisch ganz unbedenklich sind. Damit ist der Standardeinwand gegen dieses Menschenwürdeverständnis angesprochen, wie ihn z. B. hoerster vorgebracht hat: Schließlich würden wir auch den Taxifahrer benutzen, um vom Bahnhof ins Hotel zu kommen, ohne ihm Unrecht zu tun.23 Dieser Einwand ist heftig umstritten, ich will ihn hier aber nur als Anhaltspunkt dafür verwenden, um auf eine verwandte, aber vermutlich bessere Auskunft hinzuweisen, worin der Vorwurf der Menschenwürdeverletzung in diesen Fällen liegt: in der Vergegenständlichung der Betroffen. Sie werden insofern in ihrer Menschenwürde verletzt, als sie als Gegenstände statt als Menschen, als Objekte statt als Subjekte, als bloße Mittel, statt auch als Zweck behandelt werden. Diese Objekt-Formel der Menschenwürde hat den Vorteil, dass man problemlos behaupten kann, sich den Taxifahrer durchaus als Mensch zunutze gemacht zu haben, um ins Hotel zu kommen. – Sie hat allerdings auch den Nachteil, dass nicht mehr so klar ist, warum der Folterer nicht dasselbe über sein Opfer behaupten sollte. Viele der Situationen, in denen jemand als Mittel behandelt wird und in denen sich nun die Frage stellt, ob er womöglich ein bloßes Mittel, ein Objekt, dieser Behandlung ist, sind in der Menschenwürde-Diskussion ausführlich diskutiert worden. In meiner Liste findet sich allerdings auch ein Beispiel, das meines Wissens deutlich weniger Aufmerksamkeit geweckt hat, die Instrumentalisierung von Kindern und Jugendlichen zugunsten ihrer eigenen Zukunft. Auch durchaus gutgemeinte Prinzipien und Ratschläge zum richtigen Umgang mit Kindern sehen diese primär mit Blick auf ihr späteres Erwachsenenleben. Natürlich ist grundsätzlich nichts dagegen einzuwenden, dass jemand dafür sorgt, dass es Kindern auch später noch gut geht, wenn sie erwachsen sind – ganz im Gegenteil, alles andere wäre unverantwortlich –, aber auch hier ist es offenbar entscheidend, wie weit man sie trotzdem nicht als bloße Gegenstände zum Zweck der eigenen Zukunft erachtet. Die Redeweise, jemand werde nicht behandelt wie ein Mensch, sondern nur wie ein Ding, verweist auf den Vorschlag marGaLits in seinem Buch Politik der Würde, 22 23
Vgl. die ausführliche Untersuchung in schaber, Peter, Instrumentalisierung und Würde, Paderborn 2010. hoerster, norbert, Ethik des Embryonenschutzes: ein rechtsphilosophischer Essay, Stuttgart 2002.
100
Ralf Stoecker
Menschenwürdeverletzungen darin zu sehen, dass jemand so behandelt wird, als ob er kein Mensch wäre, sondern z. B. ein Gegenstand, wenn etwa Bedienstete in Adelshäusern so vollständig ignoriert wurden wie x-beliebige Möbelstücke, oder auch, wenn in Japan während des Zweiten Weltkriegs Kriegsgefangene als ‚Holzscheite‘ bezeichnet wurden, um sie unbesorgt in medizinischen Experimenten opfern zu können.24 Ungleich vertrauter als diese radikalen Formen, nicht als Mensch behandelt zu werden, sind uns aber die verschiedenen Weisen, nicht als Erwachsene behandelt zu werden. Verblüffender Weise gibt es neben dem Problem zu klären, inwiefern Kinder eine Menschenwürde haben, die es zu achten gilt, auch das Phänomen, dass man die Würde erwachsener Menschen dadurch beschneiden kann, dass man sie wie Kinder behandelt. Das prominenteste Beispiel ist die Verkindlichung von Frauen, die auch als Erwachsene in unserer Gesellschaft lange Zeit so behandelt wurden, als ob sie Kinder wären. Weitere, immer noch sehr aktuelle Beispiele finden sich im Umgang mit alten, kranken und behinderten Menschen. Die Unsitte beispielsweise, zur Erläuterung des Gesundheitszustands geistig behinderter Menschen diese mit kleinen Kindern zu vergleichen („Er ist auf dem geistigen Niveau eines Vierjährigen“), ist eine solche Behandlung als ob ein Erwachsener ein Kind wäre, ebenso die immer noch ziemlich verbreitete Praxis, geistig eingeschränkte Menschen zu duzen, oder die Selbstverständlichkeit, mit der in Alten- und Pflegeheimen für die gemeinschaftlichen Aktivitäten auf Kinderspielzeug, Kinderlieder und Kinderbücher zurückgegriffen wird. So widersprüchlich es zunächst erscheint, dass es sowohl ein Problem ist, Kindern Würde zuzubilligen, als auch, es als Würdeverletzung zu erachten, einen geistig behinderten oder in seinem Denken beeinträchtigten, alten Menschen wie ein Kind zu behandeln, so gibt es doch vielleicht einen gemeinsamen Nenner für beide Themen. Was wir in beiden Fällen häufig als Bedrohungen für die Würde der Betroffenen erachten, ist, dass sie nicht ernst genommen werden. Der Vorwurf, von jemandem nicht ernst genommen zu werden, ist ein typisches Element unserer Alltagsmoral, dem die Moralphilosophie noch nicht genügend Aufmerksamkeit geschenkt hat, vielleicht weil es zur Ethik der Nahbeziehungen gehört. Aber gerade für den Umgang mit Menschen in einer schwächeren, verletzlichen Situation ist es uns sehr wichtig, dass sie trotzdem in ihren Anliegen ernst genommen und nicht übergangen werden.25 marGaLit hat dem Kapitel, in dem er über das Behandeln von Menschen als ob sie keine richtigen, erwachsenen Menschen wären schreibt, die Überschrift gegeben: „Menschen unmenschlich behandeln“. Damit ist eine weitere Antwort auf die Frage angesprochen, worin eigentlich die jeweils konstatierte Menschenwürdeverletzung besteht: die Menschenwürde wird dadurch verletzt, dass jemand unmenschlich behandelt wird. Und auch die Unmenschlichkeit ist, wie schon das Ernstnehmen ein ver24
25
marGaLit (Fn 16), Kapitel 6; aGich, GeorGe j., Reflections on the Function of Dignity in the Context of Caring for Old Peoplein: Journal of Medicine and Philosophy, 32 (2007) 5, 483–494; yudin, boris, Research on humans at the Khabarovsk War Crimes Trial, in: Nie, Jing-Bao / Guo, Nanyan / Selden, Mark / Kleinman, Arthur (Hrsg.), Japans Wartime Medical Atrocities: Comparative Inquiries in Science, History, and Ethics, London 2011, 59–78. Darauf hat jaWorsKa hingewiesen: jaWorsKa, aGniesKa, Respecting the Margins of Agency: Alzheimer’s Patients and the Capacity to Value, in: Philosophy and Public Affairs, 28 (1999) 2, 105–138).
Worin liegen Menschenwürde-Verletzungen?
101
trautes Element unserer moralischen Urteilspraxis, dessen alltägliche Bedeutung sich nicht in einer entsprechenden philosophischen Aufmerksamkeit widerspiegelt. Allerdings wird nach meinem Eindruck in der Menschenwürde-Diskussion der Bogen von der Menschenwürde zur Menschlichkeit nur sehr selten geschlagen. Auch marGaLit stellt die Menschlichkeit nicht ins Zentrum seiner Überlegungen. Sein zentraler Begriff ist der der Demütigung. Das ist es, worauf es für ihn auch herausläuft, wenn man einen Menschen behandelt, als ob er etwas anderes wäre, ein Gegenstand, ein Tier oder ein Kind. Wer so behandelt wird, hat ein Recht, sich gedemütigt, sprich: in seiner Selbstachtung verletzt zu sehen. Auf die Feststellung, dass bestimmte Handlungen oder Umstände demütigend sind, gründen sich viele der von mir aufgelisteten Anwendungskontexte für den Menschenwürdebegriff. Ganz offenkundig ist das dort, wo Demütigungen als Mittel gezielt eingesetzt werden wie beim Shame Punishment oder auch bei der Beschämung als Erziehungsmittel in der Schule und im Elternhaus. Auch Folter zielt in aller Regel nicht nur auf das Zufügen von Schmerzen, sondern auf die Erniedrigung des Opfers ab. Dasselbe gilt für Vergewaltigungen. Als Formen sexualisierter Gewalt geht es den Tätern häufig viel stärker um Unterwerfung als um die Durchsetzung von Geschlechtsverkehr. Neben diesen explizit gewollten Erniedrigungen gibt es aber viele Umstände, die faktisch demütigend für die Betroffenen sind, ob es nun bewusst angestrebt oder nur in Kauf genommen ist. Die Zustände in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und ähnlichen Instituten können auf diese Weise die Menschenwürde der Betroffenen bedrohen. Es ist demütigend, beispielsweise vor Schmerzen, Angst, Durst oder ähnlichem nicht ein noch aus zu wissen, um dann immer wieder mit der Trägheit, Gleichgültigkeit oder Überheblichkeit der Umgebung konfrontiert zu sein. In der damit verbundenen Demütigung liegt aber auch ein Grund, Arbeitslosigkeit als Bedrohung für die Menschenwürde zu sehen. Insbesondere dann, wenn Arbeitslosigkeit sozial als selbst verschuldet und deshalb besonders beschämend gilt, ist sie offenkundig eine Bedrohung für die Selbstachtung der Betroffenen. Und auch die angemahnte Würde des Sterbens hängt eng mit der Gefahr der Demütigung zusammen. Das kann daran liegen, dass die Situation, in der ein Mensch stirbt, besonders erniedrigend für ihn ist, sei es wegen der Krankheit, sei es weil Sterbende lange Jahre in den Krankenhäusern eher ignoriert und abgeschoben wurden. Es kann aber auch daran liegen, dass der besonderen Würdeanforderung des Sterbens nicht Rechnung getragen wird, also nicht darauf geachtet wird, dass das Sterben ein besonderes Stadium im Leben eines Menschen ist. Eine spezielle Form der Demütigung liegt in der Stigmatisierung bestimmter Menschengruppen.26 Stigmata sind Attribute eines Menschen, die geeignet sind, diesen gegenüber anderen Menschen zu diskreditieren. Es sind Anzeichen, an die eine bestimmte negative Erwartung der stigmatisierten Person gegenüber geknüpft ist, auch wenn diese sie nicht verdient. Sie haben zur Folge, dass die betroffene Person besonders große Mühe hat, die von ihrer Selbstachtung geforderte Darstellungsleistung zu erbringen. marGaLit hat im Zusammenhang mit der schon erwähnten These, dass Menschen dadurch gedemütigt werden, dass sie behandelt werden, als ob sie keine Menschen wären, behauptet, dass Stigmata Menschen in gewisser Weise zu ‚Untermenschen‘ abstempeln. Sie tragen ein Kainsmal, das es ihnen sehr schwer 26
Vgl. nussbaum, martha c., (Fn 18), Kapitel 4.VII.
102
Ralf Stoecker
oder unmöglich macht, auf Augenhöhe, in Würde, mit anderen Menschen umzugehen. Eine spezielle Form der Stigmatisierung findet sich in der rassistischen, nationalistischen, sexuellen, religiösen oder in irgendeiner anderen Form chauvinistischen Unterdrückung gesellschaftlicher Gruppen. Wenn man an die Erniedrigung von Menschen denkt, fallen einem aber nicht nur die Patienten in Altenheimen oder unterdrückte Minderheiten ein. Man kann dabei auch an die Bilder verhungernder, von Krankheiten geplagter, heimatloser Flüchtlinge denken. Damit zeigt sich aber noch ein anderer Grund, von Menschenwürdeverletzungen zu reden, dann nämlich, wenn Menschen gezwungen werden, in menschenunwürdigen Verhältnissen zu leben, sprich: in Verhältnissen, die unter der Würde eines Menschen sind. Dieser Aspekt des Menschenwürde-Diskurses, den beispielsweise nussbaum ausgearbeitet hat, schließt ein Stück weit an den allerersten Aspekt an, die Verbindung zwischen Würde und den Grundlagen des Tötungsverbots. Weil Menschen eine Menschenwürde haben, darf man sie nicht unterhalb einer minimalen Grenze des Lebensnotwendigen dahinvegetieren lassen. Der körperliche Aspekt von Menschenwürde und Menschenwürdeverletzungen zeigt sich auch in vielen anderen Beispielen, in denen die inkriminierten Handlungsweisen den Betroffenen Schmerzen und/oder körperliche Schäden zufügen. Der Kranke, der unbehandelt aus dem Krankenhaus verjagt wird, die Steine schleppenden Kinderarbeiter, das Folteropfer, sie alle tragen auch körperliche Folgen aus der Missachtung ihrer Würde davon. Und vielleicht kommt noch hinzu, wie es der ehemalige Chef des AIDS-Programms der WHO, mann, behauptet hat: „the impact on health for people living in an environment characterized by severe, sustained, institutionalized and repetitive violations of individual and collective dignity is likely to be substantial.“27 Nicht nur bestehen Menschenwürdeverletzungen häufig darin, Menschen körperliche Schäden zuzufügen, auch die Tatsache selbst, dass sie Würdeverletzungen sind, hat Auswirkungen auf die Gesundheit der Opfer. Das Bild von hungernden, geknechteten und gepeinigten Menschen legt aber nicht nur deshalb den Rekurs auf die Menschenwürde nahe, weil sie offenkundig körperlich leiden, sondern auch, weil sie in eine Lage gepresst sind, die so wenig unseren Vorstellungen davon entspricht, wie anständige Lebensumstände aussehen sollten. Mit dieser Charakterisierung als „anständig“ ist die expressive Komponente der Menschenwürde angesprochen.28 Der Mensch, der gezwungen ist, im Staub zu liegen, anstatt sich auf Augenhöhe zu bewegen, sich klein zu machen, zu betteln, der befindet sich gezwungenermaßen in einer Situation, die seiner Würde nicht entspricht. Vieles von dem, was schon cicero in seiner berühmten Beschreibung würdigen Verhaltens in De Officiis ausgeführt hat, findet sich bis heute in den Anforderungen an die Menschenwürde. Daran erinnert man sich auch ganz schnell, wenn man sich im Fernsehen das erste Mal eine Folge Dschungelcamp ansieht. Zur expressiven Seite dessen, was wir als Bedrohungen der Menschenwürde ansehen, gehört auch wesentlich die Möglichkeit, nicht alles von sich preiszugeben, eine private, intime Sphäre zu haben, die nach außen hin geschützt ist. Lauschan27 28
mann, jonathan, Dignity and Health: The UDHR‘s Revolutionary First Article, in: Health and Human Rights, 3 (1998) 2, 30–38. Vgl. seeLmann, Kurt, Repräsentation als Element von Menschenwürde, in: Angehrn, Emil / Baertschi, Bernard (Hrsg.), Menschenwürde, Basel 2004, 141–158.
Worin liegen Menschenwürde-Verletzungen?
103
griff, Lügendetektor, Datensammlungen sind aus dieser Perspektive zweifelhafte Maßnahmen.29 Die expressive Seite der Menschenwürde führt aber auch unmittelbar zu einer der wichtigsten Grundlagen unserer Sorge um die Menschenwürde. marGaLit, an dessen differenzierter Phänomenologie der Menschenwürde ich mich vielfach orientiert habe, stellt neben die Behandlung eines Menschen als ob er keiner wäre noch eine zweite Charakterisierung der Menschenwürdeverletzung: den Kontrollverlust. Man kann einen Menschen auch dadurch in seiner Menschenwürde beschneiden, dass man ihn vollständig unter seine Kontrolle bekommt und damit an seiner Selbstbestimmung hindert. Für viele der genannten Situationen ist es charakteristisch, dass die Betroffenen nicht autonom sind. Offenkundig ist dies dort, wo es geradezu das Wesen einer Handlungsweise ist, jemanden in seiner Freiheit einzuschränken wie im Strafvollzug, bei Sklaverei und Zwangsheirat sowie bei der medizinischen Behandlung gegen den Willen der Patienten. Es gilt aber auch für andere Fälle von Bevormundung, typischerweise in den verschiedenen Szenarien von Sterbehilfe und Suizid. Interessanterweise gibt es aber Ausnahmen, die freiwillige Sterbehilfe beispielsweise und den Aufenthalt im Dschungelcamp. Es bleibt noch ein letzter, ganz anderer Aspekt, den birnbacher als den der Gattungswürde bezeichnet hat.30 Die Herstellung von Chimären, die Selektion genetisch unauffälliger Embryonen, aber auch das achselzuckende Akzeptieren von Hunger, Elend und Gewalt sind möglicherweise Verletzungen unserer Menschlichkeit, unvereinbar damit, dass die Betroffenen zur menschlichen Gattung gehören – ganz abgesehen von allen anderen Gründen, die für oder gegen die betreffenden Handlungsweisen sprechen. In diesen Kontext gehört vielleicht auch das generelle Unbehagen, das manche Handlungsweisen auslösen, die Scheu, dass man so etwas nicht mit Menschen machen sollte, und ebenso das religiöse Verdikt, dass Missachtungen der Menschenwürde im Grunde Missachtungen Gottes sind. III. Situationen und Handlungsweisen, die in den Verdacht geraten, die Menschenwürde zu verletzen, können also ganz unterschiedlich aussehen. Die Masterfrage lautet nun, wie man auf diese Vielfalt moralphilosophisch reagieren sollte. – Prinzipiell gibt es hier eine Reihe von sich wechselseitig nicht unbedingt ausschließenden Möglichkeiten, die ich nur kurz andeuten möchte. Erstens kann man die große Bandbreite, in der hier von Menschenwürde die Rede ist, als Indiz nehmen, den Menschenwürde-Begriff für mehrdeutig zu erachten. Sängerinnen zu verspotten, Kleinkinder nicht ernst zu nehmen oder einem Sterbenden eine ehrenvolle letzte Stunde zu verweigern, seien Missachtungen der sozialen Würde der Betroffenen, und das sei eben etwas ganz anderes als die Men29 30
Vgl. stoecKer, raLf, Meine Gedanken von Ferne: Gedankenlesen als neuroethisches Problem, in: Angewandte Philosophie: Eine internationale Zeitschrift (2014) 1, 102–120. birnbacher, dieter, Der künstliche Mensch: ein Angriff auf die menschliche Würde?, in: Birnbacher, Dieter (Hrsg.), Bioethik zwischen Natur und Interesse, Frankfurt am Main 2006, 77–98.
104
Ralf Stoecker
schenwürde. Um es prägnant auszudrücken: die Würde der Menschen ist noch lange nicht ihre menschliche Würde.31 Zweitens kann man nach Reduktionsmöglichkeiten suchen. Stigmatisierungen beispielsweise sind eine besondere Art von Demütigungen, und vielleicht gibt es entsprechend weitere Möglichkeiten, bestimmte Menschenwürdeverletzungen als Spezialfälle anderer zu verstehen, so dass sich am Ende die eine Handlungsweise findet, die allen Menschenwürdeverletzungen gemeinsam ist. Der prominenteste Kandidat ist die Beeinträchtigung der Selbstbestimmung. Man kann dasselbe aber auch mit dem religiös fundierten, herausgehobenen Status des Menschen versuchen, also unsere ausgezeichnete Stellung vor Gott herausstreichen, um dann die verschiedenen Menschenwürdeverletzungen als Frevel anzusehen. Oder man kann es mit der Eigenschaft versuchen, dass man Menschen demütigen kann. Meine Sympathien liegen bei der letzteren Strategie.32 Ich glaube, dass sich der historischen Herkunft der Menschenwürde aus der sozialen Würde, die sich in der Vielfalt dessen zeigt, was wir als Bedrohungen der Menschenwürde anzusehen geneigt sind, der Schlüssel dazu findet, was es heißt, die Würde des Menschen zu achten.33 Alle uns vertrauten Gesellschaften sind Würde-Gesellschaften in dem Sinn, dass es in ihnen ausgeklügelte Strukturen sozialer Würde gibt. Es gibt Ehrungen und Beleidigungen, Scham und Schande, Respekt und Selbstachtung. Diese sozialen Begriffe haben in der Philosophie schon immer eine Rolle gespielt, wenn es darum ging, den Platz des Menschen in der Welt zu klären, vielleicht am grandiosesten in Kants Beschluss der Kritik der praktischen Vernunft über den Ehrfurcht erweckenden bestirnten Himmel über uns und eben auch das moralische Gesetz in uns. „Der erstere Anblick einer zahllosen Weltenmenge“, so Kant, „vernichtet gleichsam meine Wichtigkeit als eines tierischen Geschöpfs […] Der zweite erhebt dagegen meinen Wert als einer Intelligenz unendlich durch meine Persönlichkeit“ (AA V 162). Unsere menschliche Ehre ist damit voll und ganz widerhergestellt und etabliert. Mit dem 18. Jahrhundert war dann die zunehmende Einsicht verbunden, dass es keinen Grund gibt, innerhalb einer Gesellschaft prinzipielle Unterschiede in der sozialen Ehrbarkeit zu akzeptieren. Die Menschenwürde, das war der egalitäre Anspruch jedes rechtschaffenden Bürgers, allen anderen auf Augenhöhe begegnen zu dürfen. Auch wenn dieser Anspruch im 19. Jahrhundert nur sehr unvollkommen verwirklicht wurde, so war es doch eine schockierende Erfahrung der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, wie radikal dieser Anspruch selbst in der Mitte so zivilisiert erscheinender Staaten wie Deutschland vernichtet werden konnte und wie nahe immer noch der Umschwung in Verhältnisse radikaler Ehrlosigkeit liegen konnte, zumindest für einen Teil der Bevölkerung. Wenn diese sehr knappe und vage Geschichte aber in die richtige Richtung geht, dann war die Aufnahme der Menschenwürde in die verschiedenen Dokumente 31 32
33
Dieser Vorwurf ist sehr verbreitet. Besonders sorgfältig ist er ausgeführt in: jaber (Fn 15). Das habe ich an anderer Stelle detaillierter ausgeführt stoecKer, raLf, Menschenwürde und das Paradox der Entwürdigung, in: Stoecker, Ralf (Fn 2), 133–151; ders., Selbstachtung und Menschenwurde. (Series: Menschenwürde / La dignite de l‘etre humain), in: Studia Philosophica: Jahrbuch der Schweizerischen Philosophischen Gesellschaft, Basel 2004; ders., Die Pflicht, dem Menschen seine Würde zu erhalten, in: Zeitschrift für Menschenrechte, 4 (2010) 1, 98–117. Damit widerspreche ich Lohmann, GeorG, Die rechtsverbürgende Kraft der Menschenwürde (Fn 2); PoLLmann, arnd, (Fn 2).
Worin liegen Menschenwürde-Verletzungen?
105
Ende der 40er Jahre ein Plädoyer für dieses Ideal einer Gesellschaft, in der die traditionalen Mechanismen egalitär verstandener individueller Ehrbarkeit Bestand haben. „Die Würde des Menschen ist unantastbar“ bedeutet dann: jeder Eingriff des Staates (letztlich aber auch der Menschen untereinander) in die soziale Ehre des Menschen ist hoch begründungsbedürftig und es gibt Grenzen, bis zu denen ein solcher Eingriff überhaupt nur erlaubt sein kann, nämlich dort, wo das staatliche Handeln seine individuelle Würde irreparabel bedroht. Die Würde des Menschen ist zwar nicht in dem Sinne unantastbar, dass man ihn nicht demütigen und beleidigen darf, wohl aber in dem Sinn, dass es ein grundsätzliches Recht jedes Menschen auf ein gewisses Maß an Achtbarkeit gibt. Diese Lesart lässt es offenkundig zu, von unterschiedlich starken Bedrohungen der menschlichen Würde zu sprechen. Und sie schließt auch nicht aus, dass sich die herrschenden Konzeptionen dessen, was zur Würde des einzelnen gehört, verändern und dass wir uns darüber auseinandersetzen, wie dies am besten geschehen sollte. Haben wir Verpflichtungen uns selbst gegenüber, oder können wir kriechen und schleimen soviel wir wollen, ohne dass daran moralisch etwas auszusetzen wäre? Markiert bei vernünftigen, handlungsfähigen Menschen die Autonomie die Grenzen dessen, was mit der Würde vereinbar ist, d. h. kann man uns beliebig behandeln, solange wir nur einverstanden sind? Dürfen wir beispielsweise unsere Niere verkaufen oder an Fremde verschenken? Ich bin skeptisch, ob sich diese Fragen allein aus der Reflexion dessen beantworten lassen, was es heißt, die Würde zu achten. Viel eher muss man sich fragen, in welche Richtung wir unser Würdeverständnis weiterentwickeln wollen. Wohinein wollen wir in Zukunft unsere Ehre legen?34 Die verschiedenen Handlungsweisen, die Anlass geben, eine Bedrohung der Menschenwürde zu konstatieren, zeigen jedenfalls, was uns bislang an unserer Würde lieb und teuer ist.
34
Vgl. stoecKer, raLf, Eine Frage der Ehre: Der Mord an Hatin S. als Herausforderung für die moderne Moralphilosophie, in: Berliner Debatte Initial, 17 (2006), 147–155.
uLrich schroth, münchen uMfang unD grenzen eIner Bestrafung BeI Der leBenDorganspenDe zur krItIk
an Der Deutschen
regelung –
eIn
wegen
organhanDels
alternatIvvorschlag
I. DerzeItIge gesetzeslage Der deutsche Gesetzgeber hat den Organhandel umfassend verboten. § 17 I TPG verbietet es, mit Organen, die einer Heilbehandlung zu dienen bestimmt sind, Handel zu treiben. § 18 I TPG bedroht denjenigen mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe, der dieses Verbot verletzt. Weiter verbietet § 18 I i. V. m. § 17 II TPG strafbewehrt, ein Organ zu entnehmen oder zu übertragen, das Gegenstand verbotenen Handeltreibens war. Wer sich als Organempfänger ein Organ, das Gegenstand verbotenen Handeltreibens war, übertragen lässt, wird schließlich von § 18 I i. V. m. § 17 II TPG mit Strafe bedroht. Bei Organspendern und Organempfängern, die sich strafbar machen, kann nach § 18 IV TPG das Gericht von einer Strafe absehen oder diese nach seinem Ermessen mildern. Wer gewerbsmäßig Organhandel betreibt, begeht ein Verbrechen, § 18 II TPG sieht eine Mindeststrafe von einem Jahr vor. Der Durchsetzung des Organhandelsverbots soll auch die strafbewehrte Begrenzung des Spenderkreises bei der Lebendspende dienen. Die Entnahme von Organen, die sich nicht wieder bilden können (zumeist die Niere) ist nur zulässig zum Zwecke der Übertragung auf Verwandte 1. und 2. Grades, Ehegatten, Verlobte, eingetragene Lebenspartner und andere Personen, die dem Spender in besonderer persönlicher Verbundenheit offenkundig nahe stehen. Diese Vorschrift ist gemäß § 19 I Nr. 2 TPG strafbewehrt, verboten ist der vorsätzliche Verstoß gegen diese Norm. II. zur krItIk
aM Deutschen
organhanDelsverBot
1. orGane, die einer heiLbehandLunG zu dienen bestimmt sind Der Gesetzgeber hat es in Deutschland verboten, mit Organen, „die einer Heilbehandlung (…) zu dienen bestimmt sind“, Handel zu treiben, da er die negativen Auswirkungen von Organhandel verhindern wollte. Problematisch ist es aber, den Organhandel nur bei Organen, die einer Heilbehandlung zu dienen bestimmt sind, zu verbieten. Es ist nach deutschem Recht nicht verboten, mit Organen Handel zu treiben, die der Kosmetikindustrie zugeführt werden sollen. Genauso ist es erlaubt, mit Organen Handel zu treiben, die der Forschung dienen sollen. Schließlich ist es nicht verboten, mit Arzneien Handel zu treiben, die aus oder unter Verwendung von Organen hergestellt sind. Damit erscheint das deutsche Organhandelsverbot als nicht konsistent. Wenn es strafbares Unrecht sein soll, mit Organen zu handeln, die einer Heilbehandlung zu dienen bestimmt sind, so ist es auch strafwürdiges Unrecht, mit Organen zu handeln, die
108
Ulrich Schroth
der Kosmetikindustrie zugeführt werden oder Forschungszwecken dienen sollen. Auch die Arzneimittelklausel ist wenig überzeugend. Wenn es strafbares Unrecht sein soll, für Organe Geld zu nehmen, so ist nicht einsichtig, warum man dieselben Organe verkaufen darf, sobald sie nach Aufbereitung und Konservierung sauber verpackt bereitstehen. 2. beGriff des handeLtreibens Die zentrale unrechtsbegründende Handlung des Organhandelsverbots ist das „Handeltreiben“. Dieser Begriff knüpft an den analogen Begriff des Betäubungsmittelrechts an, der bereits dort viel zu weit ist. „Handeltreiben“ ist hiernach eine auf Umsatz gerichtete Tätigkeit auf Übertragung eines Organs, die eigennützig ist.1 Damit benützt der Gesetzgeber einen Begriff, der das Organhandelsverbot zu einem unechten Unternehmensdelikt macht. Ein Unternehmensdelikt zeichnet sich dadurch aus, dass Versuch und Vollendung zusammengefasst werden. Das deutsche Organhandelsverbot bestraft aber auch den Versuch noch besonders. Geht man davon aus, dass § 18 TPG ein unechtes Unternehmensdelikt ist, so ist es unangemessen, auch noch den Versuch zu bestrafen. Das Verständnis des Handeltreibens als jede eigennützige, auf Umsatz gerichtete Tätigkeit umfasst auch schon jede Vorbereitungshandlung. Bestraft man die Vorbereitungshandlung bereits, so ist es dogmatisch absurd, den Versuch unter Strafe zu stellen. Im Übrigen verstößt der Begriff des Handeltreibens als „jede eigennützige, auf Umsatz gerichtete Tätigkeit“, wie roxin ausgeführt hat,2 auch gegen Art. 103 II GG. Wer ein Buch kauft oder eine Mahlzeit einnimmt, betreibt noch keinen Handel. Man wird wohl auch nicht sagen können, dass derjenige, der ein Organ einkauft oder ein Organ anbietet, bereits deshalb in einem sprachlogischen Sinne Handel treibt. Damit verstößt diese Definition des Handeltreibens-Begriffs gegen die Wortlautgrenze im Strafrecht. 3. bestrafunG Von orGansPender und -emPfänGer Es ist falsch, dass das strafbewehrte Organhandelsverbot Organspender und -empfänger miterfasst. Man soll nicht denjenigen, den man schützen will, bestrafen. Klar ist, dass Zweck des deutschen Organhandelsverbots der Schutz des Organempfängers bzw. des -spenders ist. Das deutsche Strafrecht hat sich jedenfalls bisher an diesen Grundsatz, dass diejenigen, die geschützt werden sollen, nicht bestraft werden können, gehalten (Bsp. Nichtbestrafung der notwendigen Teilnahme des Teilnehmers, dessen Schutz beabsichtigt ist). Organspender und -empfänger sind nur dann strafwürdig, wenn sie sich bewuchern. Dann verwirklichen sie jeweils strafwürdiges Unrecht, indem sie die Notlage des anderen ausnutzen. Sie verwirklichen dagegen kein strafbares Unrecht, wenn der Organempfänger nur sein Leben retten 1 2
Vgl. schroth, uLrich / KöniG, Peter / Gutmann, thomas / oduncu, fuat (Hrsg.), Transplantationsgesetz, Kommentar München 2005, §§ 17, 18 Rz 16 ff. Vgl. roxin, cLaus, Anmerkung zu den Urteilen des BGH vom 20.8.1991–1 StR 273/91 und vom 15.1.1992–2 StR 267/91, in: Strafverteidiger 12 (1992), 517–520, 518 ff.
Umfang und Grenzen einer Bestrafung wegen Organhandels bei der Lebendorganspende
109
oder seine Gesundheit verbessern will und der Organspender nur die Chance sieht, Geld zu verdienen. Dass der Gesetzgeber es nicht für unproblematisch hielt, Organspender und -empfänger zu bestrafen, zeigt sich daran, dass er eine Regel für erforderlich hielt, die es erlaubt, Organempfänger und -spender von Strafe frei zu stellen. § 18 IV TPG gestattet dies. Diese Norm sagt aber nicht, unter welchen Voraussetzungen von Strafe freigestellt werden kann. § 18 IV TPG ist damit eindeutig verfassungswidrig, da diese Regel gegen das strafrechtliche Bestimmtheitsgebot, das in Art. 103 II GG verfassungsrechtlich garantiert ist, verstößt. Es gibt in dieser gesetzlichen Regelung keinen Wertmaßstab, der die Gesichtspunkte festschreibt, unter denen der Richter bei Spender und Empfänger die Strafe mildern bzw. von einer Bestrafung absehen kann. Damit ist aber die Entscheidung, ob eine Bestrafung in einem konkreten Einzelfall erfolgen soll oder nicht, allein in die Allmacht des Richters gelegt. Eine Wertmaxime, die den Richter bindet, ist nicht erkennbar. Derartige Regelungen sollen über Art. 103 II GG ausgeschlossen werden. Der Gesetzgeber des GG war von der Vorstellung getragen, dass die Wertentscheidungen über die Frage, was als strafwürdiges Unrecht anzusehen ist und was nicht, der Gesetzgeber zu treffen hat. Der Gesetzgeber muss auch bestimmen, wann eine Sanktion erfolgen soll und wann nicht. III. Das strafwürDIge
IM
kontext
Der
leBenDtransplantatIon
Was ist nun strafwürdig im Zusammenhang mit der Lebendtransplantation? Die Organlebendspende ist ein Eingriff in die körperliche Integrität des Lebendspenders. Dieser ist nur legitim, wenn die Einwilligung in die Lebendspende autonom erfolgt ist. Strafwürdig ist die Verletzung des Selbstbestimmungsrechtes des Lebendspenders. Der Gesetzgeber hat dieses über § 19 II TPG besonders geschützt. Ob dies sinnvoll war, mag dahinstehen. Die Integrität des Lebendspenders ist nämlich bereits umfangreich über § 223 StGB geschützt. Es ist aber eine technische Frage, ob man die autonome Entscheidung des Lebendspenders über § 19 II TPG schützen soll oder ob man hierfür die §§ 223 ff. StGB heranziehen will. Die Nötigung des Organlebendspenders zu einer Organlebendspende stellt einen gravierenden Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht des Lebendspenders dar. Die Nötigung zur Organlebendspende sollte nicht als einfache Nötigung angesehen werden, vielmehr sollte symbolisch zum Ausdruck gebracht werden, dass dies ein Fall der besonders schweren Nötigung ist. Es sollte daher ein zusätzliches Regelbeispiel in § 240 IV StGB aufgenommen werden. Wer eine Schwangere zum Schwangerschaftsabbruch nötigt, begeht nicht nur eine einfache Nötigung, sondern eine Nötigung in einem besonders schweren Fall. Analog könnte man sagen: § A „Wer einen anderen nötigt, sich ein Organ entnehmen zu lassen oder einen anderen nötigt, ihm oder einem Dritten für die Hingabe eines Organs einen Vorteil zu versprechen oder zu gewähren, begeht eine Nötigung in einem besonders schweren Fall.“
110
Ulrich Schroth
Sinnvoll wäre sicherlich auch, in analoger Weise zum Werbungsverbot für den Abbruch der Schwangerschaft ein Werbungsverbot im Hinblick auf den Organhandel zu erlassen. KöniG hat den Vorschlag gemacht, folgenden Tatbestand zu formulieren:3 § B „Wer öffentlich in einer Versammlung oder durch Verbreiten von Schriften in grob anstößiger Weise Personen sucht oder nachzuweisen verspricht, die zur Hingabe eines Organs gegen Entgelt bereit sind, wird mit … bestraft.“ Es muss darauf hingewiesen werden, dass ein Werbungsverbot auch europarechtlich geboten ist. So ist im Entwurf eines Zusatzprotokolls zur Bioethikkonvention des Europarats ein Werbeverbot für Organhandel enthalten4. Verhindert werden muss sicherlich auch, dass Organspender und -empfänger bewuchert werden. Das heißt, es muss verboten werden, dass der Einzelne auf Grund einer Schwächelage krass übervorteilt wird. § 291 StGB ist ein Paradigma für eine solche Vorschrift. Ein solcher Tatbestand könnte lauten (so der Vorschlag KöniGs)5: § C „(1) Wer einen anderen unter Ausnutzung einer Zwangslage dazu bestimmt, sich ein nicht regenerierungsfähiges Organ entnehmen zu lassen, oder wer einer solchen Handlung durch seine Vermittlung Vorschub leistet, wird mit … bestraft. (2) Ebenso wird bestraft, wer einen anderen unter Ausbeutung einer gesundheitlichen Notlage dazu bestimmt, ihm oder einem Dritten für ein Organ einen Vorteil zu versprechen oder zu gewähren, oder wer einer solchen Handlung durch seine Vermittlung Vorschub leistet. (3) Der Versuch ist strafbar. (4) Wer die Tat gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande begeht, die sich zur fortgesetzten Begehung einer solchen Tat zusammengeschlossen hat, wird mit … bestraft.“ Mit einer solchen Strafrechtsnorm würden Organspender und -empfänger vor der Ausnutzung von Notlagen sinnvoll geschützt. Organspender und -empfänger wären auch strafbar, soweit sie die Notlagen des jeweils anderen ausnutzen würden. Die Frage ist aber, ob ein darüber hinausgehendes, generell strafbewehrtes Organhandelsverbot nötig ist. Strafrechtsnormen sind dann legitimiert, wenn sie in sinnvoller Weise Rechtsgüter schützen. Fraglich ist, was ein generelles Organhandelsverbot schützen kann. 1. schutz der menschenWürde? Ein umfassendes, strafbewehrtes Organhandelsverbot – so wird argumentiert – finde seine Berechtigung in dem notwendigen Schutz der Menschenwürde. Die These, dass der Verkauf von Körperteilen generell als Verletzung der Menschenwürde zu 3 4
5
Vgl. KöniG, Peter, Strafbarer Organhandel, Frankfurt am Main [u. a.] 1999, 251. Council of Europe, Steering Committee on Bioethics (CDBI), Additional Protocol to the Convention of Human Rights and Biomedicine, on Transplantation of Organs and Tissues of Human Origin, in der von dem CDBI am 5.–8. Juni 2000 verabschiedeten Fassung, Strassburg 2002, Art. 21. Vgl. KöniG (Fn 3), 249.
Umfang und Grenzen einer Bestrafung wegen Organhandels bei der Lebendorganspende
111
bewerten sei, hat in der deutschen Diskussion sasse zu begründen versucht.6 Nach seiner Auffassung lasse sich der Behauptung, die Degradierung menschlicher Körperteile zum Kaufobjekt sei menschenunwürdig, vor dem Hintergrund der erheblichen Erfahrungen der Würdeverletzungen wie Sklaverei, Folter und Zwangsarbeit ein gewisses Maß an unmittelbarer Evidenz nicht absprechen.7 sasse kommt zu dem Ergebnis, dass die Kommerzialisierung des menschlichen Körpers zu einer Korrumpierung der Gesellschaft führe, ähnlich, wie es der Fall wäre, wenn sich reiche und mächtige Personen ihr Recht erkaufen könnten.8 Mit einer solchen Argumentation ist freilich eine Begründung der Menschenwürdeverletzung nicht erbracht.9 Im entscheidenden Punkt, warum eine Kommerzialisierung des menschlichen Körpers unter dem Aspekt der Menschwürde schlecht und unerträglich sein soll, findet sich nur der Verweis auf die Folgen des freien Marktes. Warum Handlungen, die darauf gerichtet sind, ein Organ zu verkaufen oder zu kaufen, als solche einen Würdeverstoß begründen sollen, wird nicht dargelegt. Formulierungen, dass man den menschlichen Körper nicht für Zwecke nutzbar machen dürfe, die außerhalb seiner selbst liegen,10 spiegeln eine Begründung vor, die sie nicht erbringen.11 Mit der Menschenwürdegarantie ist der soziale Wert- und Achtungsanspruch gemeint, der jedem Menschen wegen seines Menschseins zukommt.12 Die Menschenwürde fordert zentral, dass der Mensch nicht als Instrument für andere genutzt werden darf. Dementsprechend verbietet es dieser Grundsatz, den Menschen zum bloßen Objekt des Staates zu machen oder ihn einer Behandlung auszusetzen, die seine Subjektqualität prinzipiell in Frage stellt. Versteht man die Menschenwürde in diesem Sinne, so lässt sich daraus nicht ableiten, dass ein Organhandelsverbot generell bestraft werden muss. Wenn ein Spender sich freiwillig nach Aufklärung bereiterklärt, für eine bestimmte Summe ein Organ zu spenden und ihm ein Rücktrittsrecht bis zum Zeitpunkt der Narkotisierung eingeräumt wird, wird dadurch seine Subjektqualität nicht in Frage gestellt. Etwas anderes gilt nur dann, wenn Organhandel mit Organen betrieben wird, die gegen den Willen des Spenders gewonnen wurden. Dann ist in der Tat seine Subjektqualität in Frage gestellt und seine Menschwürde verletzt. Zweifelhaft erscheint auch, ob man die Würde eines konkreten Spenders als einen höheren Wert als seine Selbstbestimmung ansehen kann. Von dieser Unterstellung geht die Argumentation aus, die den Organhandel als solchen grundsätzlich als Angriff auf die Menschenwürde ansieht. Eine derartige Argumentation stellt der empirischen Würde des Einzelnen die Würde im Sinne eines spezifischen Menschenbildes gegenüber und schränkt die Autonomie des Individuums mit dem Argument ein, sie verletze die Würde im Sinne dieses Bildes. Das Prinzip der Menschenwürde wendet sich dann gegen die Freiheitsrechte des Einzelnen, indem ein 6
7 8 9 10 11 12
Vgl. sasse, raLf, Zivil- und strafrechtliche Aspekte der Veräußerung von Organen Verstorbener und Lebender, Frankfurt am Main [u. a.] 1996, 93 ff.; zur Diskussion des Schutzrechts vgl. ausführlich meinen Aufsatz: schroth, uLrich, Das Organhandelsverbot, in: Schünemann, Bernd / Achenbach, Hans / Bottke, Wilfried /Haffke, Bernhard / Rudolphi, Hans-Joachim (Hrsg.), Festschrift für Claus Roxin zum 70. Geburtstag am 15. Mai 2001, Berlin 2001, 869 ff. Vgl. sasse (Fn 6), 93. Vgl. sasse (Fn 6), 101. Vgl. KöniG (Fn 3), 111. Vgl. sasse (Fn 6), 100. Vgl. KöniG (Fn 3), 111. Vgl. BVerfG 87, 209.
112
Ulrich Schroth
spezifischer metaphysischer Menschenwürdebegriff benutzt wird. Besonders problematisch wird dieser Gedanke, wenn man gleichzeitig denjenigen, den man in seiner Menschenwürde schützen will, zentral also den Organspender, auch noch bestraft. Ein generelles Organhandelsverbot kann sich auch nicht darauf berufen, dass Ausbeutung zu verhindern wäre. Der Ausbeutungsschutz verlangt einen Wuchertatbestand im oben gekennzeichneten Sinne, aber kein generelles Organhandelsverbot. 2. sicherunG einer autonomen entscheidunG Ein Zweck eines Organhandelsverbotes könnte darin liegen, dass der Gesetzgeber sich in der Pflicht sieht, die autonome Entscheidung von Organspender und -empfänger zu sichern. Organe sind ein knappes Gut. Es steht nicht nur zu befürchten, dass dies noch einige Zeit so bleiben wird, sondern sogar, dass die Organknappheit weiter zunimmt. Organe werden aber für Schwerkranke dringend benötigt. Sie helfen nicht nur, den Gesundheitszustand von Schwerkranken wesentlich zu verbessern, sondern auch, Leben zu retten. In einer derartigen Situation Organhandel zuzulassen, hätte deshalb erhebliche Folgewirkungen. Der Druck des potentiellen Organempfängers, jeden Preis zu zahlen, wäre groß. Es bestünde die aktuelle Gefahr, dass er Entscheidungen trifft, die nicht in seiner Person wurzeln, sondern in seinem Leidenszustand. Potentielle Organspender erhielten, wenn man einen Markt zuließe, die Möglichkeit, sich in kurzer Zeit mit wenig Aufwand erhebliche finanzielle Mittel zu beschaffen. Sie könnten nämlich aller Wahrscheinlichkeit nach exorbitante Summen verlangen. Ließe man Organhandel zu, so könnte es dazu kommen, dass potentielle Organspender sich kurzfristig für einen Eingriff in ihren Körper entscheiden, den sie ohne die finanzielle Erwartung nicht getroffen hätten. Ein Organhandelsverbot kann dies ausschließen. Es könnte den Gefahren für den Organspender und -empfänger, sich selbst zu korrumpieren, entgegenwirken. Ein Organhandelsverbot hat dann die Aufgabe, die Rahmenbedingungen der Möglichkeit zur autonomen Entscheidung zu garantieren. Iv. reforMvorschläge Wie kann nun ein Organhandelsverbot aussehen? Geht man davon aus, dass ein Organhandelsverbot nicht nur Organe umfassen soll, die einer Heilbehandlung zu dienen bestimmt sind, sondern alle Organe umfassen muss, so kann man formulieren: § D I „Es ist verboten, mit Organen Handel zu treiben. Wer hiergegen verstößt, wird mit … bestraft.“ Meines Erachtens muss aber der Handeltreiben-Begriff explizit definiert werden. Handeltreiben kann eben nicht nur jede auf Umsatz gerichtete Tätigkeit sein, die eigennützig ist. Der Begriff muss erfolgsorientiert verstanden werden. So könnte man formulieren: § D II „Ein Handeltreiben im Sinne dieses Gesetzes ist jede eigennützige Förderung des tatsächlichen Umsatzes von Organen, um sich oder einen Dritten zu bereichern.“
Umfang und Grenzen einer Bestrafung wegen Organhandels bei der Lebendorganspende
113
Damit hätte man gesetzgeberisch klargestellt, dass nur der tatsächliche Umsatz von Organen als vollendeter Organhandel angesehen werden kann und dass unter diesen Begriff nur Handlungen subsumiert werden können, die als tatsächliche Förderungen anzusehen sind. Der Begriff der „Förderung“ lässt sich hinreichend konkretisieren, da er im Strafrechtssystem eingeführt ist. Förderungshandlungen sind nämlich die Handlungen, die im Strafrecht eine Beihilfe begründen können. Dass nur eigennützige Handlungen Organhandel begründen können, versteht sich von selbst und war als Merkmal bisher unumstritten. Des Weiteren sollen nur Handlungen, die von Bereicherungsabsicht getragen sind, als Organhandel angesehen werden. Dies stellt klar, dass jedenfalls die Crossover-Spende nicht als Organhandel anzusehen ist. Weiter ist damit eindeutig, dass die Absicherung des Lebendspenders und der Ausgleich seiner finanziellen Einbußen kein Handeltreiben ist. Ausgenommen aus dem Begriff des Organhandels sollte auch jede Entgelterzielung für die Heilbehandlung sein. Man könnte dann formulieren: § D III „Das Verbot des Organhandels gilt nicht für die Annahme eines Entgelts für die Heilbehandlung sowie für die Annahme eines Entgelts für die zur Erreichung des Ziels der Heilbehandlung gebotenen Maßnahmen, insbesondere für die Entnahme, die Konservierung und die weitere Aufbereitung der Organe einschließlich der Maßnahmen zum Infektionsschutz, die Aufbewahrung und die Beförderung der Organe. Das Verbot des Organhandels gilt auch nicht, wenn Krankenkassen oder staatliche Stellen als Ausgleich für körperliche Beeinträchtigungen dem Organspender ein billiges Schmerzensgeld gewähren.“ Die derzeitige Regelung des Organhandelsverbots schränkt das Organhandelsverbot nur für die Gewährung oder die Annahme eines angemessenen Entgelts ein. Dies ist unangemessen, da ansonsten bei unangemessenem Entgelt für die Heilbehandlung auch der Arzt kriminalisiert werden würde. Das Verbot des Organhandels soll jedoch nicht vor Preistreiberei schützen. Es gibt im deutschen Strafrecht auch sonst keine Delikte, die Preistreiberei unter Strafe stellen. Es sollte weiter von Strafe ausgenommen werden, dass Krankenkassen dem Spender eine billige Entschädigung gewähren. Eine gewisse Kommerzialisierung für erlittene Schmerzen ist bereits im Zivilrecht allgemein anerkannt. Es ist nicht einzusehen, weshalb Geldleistungen, die dem Organspender eine gewisse Kompensation für körperliche Beeinträchtigungen bieten, kriminalisiert werden müssen. Um unkontrollierbare Anreize auszuschließen und um zu verhindern, dass Transplantationen ausschließlich denjenigen zu Gute kommen, die sie sich leisten können, sollten billige Schmerzensgeldzahlungen jedoch nur Krankenkassen oder staatlichen Stellen gestattet sein. Nachdem nur der tatsächliche Umsatz unter Strafe gestellt ist, ist es angemessen, auch den Versuch zu bestrafen. Man kann formulieren: § D IV „Der Versuch ist strafbar.“ Es fallen dann aber nur Handlungen, die als unmittelbares Ansetzen zum Umsatz von Organen gesehen werden können, unter die Versuchsstrafbarkeit. Vorbereitungshandlungen fallen dagegen nicht unter die Versuchsstrafbarkeit. Dies ist zudem angemessen, da auch sonst im Regelfall im Strafrecht Vorbereitungshandlun-
114
Ulrich Schroth
gen nicht kriminalisiert werden. Die Notwendigkeit, Vorbereitungshandlungen zu kriminalisieren, müsste besonders begründet werden. Ich sehe die Notwendigkeit der Kriminalisierung von Vorbereitungshandlungen nicht. Da mit einer derartigen Vorschrift ausschließlich Organspender und -empfänger in ihrer Autonomie geschützt werden sollen, ist es nicht angemessen, Organspender und -empfänger unter diese Vorschrift fallen zu lassen. Derjenige, der geschützt werden soll, kann nicht bestraft werden. Man kann dies dadurch zum Ausdruck bringen, dass man analog § 258 StGB formuliert: § D V „Wegen Organhandels werden der Organspender und der Organempfänger nicht bestraft.“ Soweit beide Notlagen ausnutzen, werden sie nach dem Wuchertatbestand sanktioniert. Umgekehrt ist auch eine Bestrafung möglich, wenn Organempfänger und -spender Organhandel betreiben, der von einem Dritten gefördert wird, da im Hinblick auf Organspender und -empfänger nur ein persönlicher Strafaufhebungsgrund besteht. Ein Verbot dahingehend, dass die Organe, die Gegenstand verbotenen Handeltreibens waren, nicht übertragen werden dürfen, und auch das Verbot für den Empfänger, sich diese übertragen zu lassen, ist unangemessen. Ein derartiges Verbot kann seine Legitimität allein aus der Tatsache beziehen, dass hier die Integrität der Transplantationsmedizin geschützt werden soll. Diese mag über Standesrichtlinien geschützt werden, ist aber kein Rechtsgut, das für strafrechtliche Normen taugt. Dies hätte im Übrigen zur Konsequenz, dass Organe nicht übertragen werden dürften, die einem anderen helfen könnten, nur um gewissermaßen „den Sumpf auszutrocknen“. Dies erscheint kaum sinnvoll. Es muss darauf hingewiesen werden, dass sich derjenige, der am Organhandel beteiligt war, sowieso strafbar macht. Wenn aber weder Arzt noch Empfänger am Organhandel beteiligt waren, erscheint es nicht sinnvoll, ein Übertragungsverbot zu verhängen. Mit diesen Vorschlägen wäre das Unrecht, das durch die Verletzung bzw. Gefährdung der Autonomie von Organspender und Organempfänger begangen wird, angemessen sanktioniert. Denn sicherlich sollte Organhandel strafrechtlich verhindert werden – dabei müssen aber stets das Schutzgut sowie die Tatsache beachtet werden, dass strafrechtliche Reaktion als ultima ratio nur maßvoll und verhältnismäßig erfolgen darf. Außerdem muss der Tatsache Rechnung getragen werden, dass diejenigen, die geschützt werden sollen (Organspender und Organempfänger), nicht als Täter des Organhandels in Betracht kommen. Sie verhalten sich erst dann strafwürdig, wenn sie den jeweils anderen in seiner sozialen Notlage ausnutzen. Ein entsprechender Tatbestand muss hierfür geschaffen werden.
zweIter teIl: alternatIve BeDeutungsvon MenschenwürDe
unD
BegrünDungsBestIMMungen
sabrina zucca-soest, hamburG autonoMIe als notwenDIge aBer nIcht BestIMMung Der MenschenwürDe
hInreIchenDe
I. aBstract Um die verzweigten Linien des Würdebegriffs zu systematisieren, wird hier eine Betrachtungsweise vorgeschlagen, die neue Begründungsimpulse ermöglichen soll. Sämtliche Zugänge zum Würdebegriff lassen sich hiernach bildlich gesprochen mit den Schwingungsbreich eines Pendels vorstellen. Vier Umkehrpunkte können dabei als Schwerpunkte ausgemacht werden. Diese Umkehrpunkte liegen inhaltlich am weitesten voneinander entfernt bzw. stehen sich gegenüber. Den einen Umkehrpunkt bildet die verengte naturalistische Perspektive, mit der jeder Mensch qua Menschsein Inhaber von Würde ist. Sie kann dem Menschen weder zu- noch abgesprochen werden. Dem gegenüber liegt die vorrangig vernunftbasierte Perspektive, mit der insbesondere auf das Vernunftvermögen des autonomen Ichs abgestellt wird. Ebenso liegen sich die vereinseitigte soziale Perspektive, nach der Würde das reine Ergebnis von sozialer Interaktion ist und als solch soziales Produkt immer zuund absprechbar ist und die vereinseitigte individualistische Perspektive gegenüber, nach der auf das vereinzelte menschliche Individuum als Würdeträger abgestellt wird. Alle vier Grundpositionen, als Extrempunkte gedacht, inkludieren Voraussetzungen und Konsequenzen, die der moralischen Intuition wie auch der Zielsetzung der Ausformulierung des Würdebegriffs zuwider laufen. Diese Paradoxien machen den Würdebegriff in seiner theoretischen wie empirischen Bestimmung so komplex. Hier wird der Versuch unternommen, die Ruheposition (ausbalancierte Moment) des Pendelbildes zu finden, um den Schwächen der begründungstheoretischen Extrempunkte zu entgehen und ihre Stärken auf der theoretischen Ebene kondensieren zu können. Dafür wird insbesondere der Autonomiebegriff als Basis für Würde in seinen Facetten kritisch beleuchtet. Nimmt Autonomie doch eine besonders gewichtige Stellung bei fast allen Begründungslinien im gesamten Pendelspektrum ein, wenn sie nicht sogar zu der Begründungsressource schlechthin avanciert ist. Im Folgenden wird aufgezeigt, dass aber gerade dieses Fundament nicht tragfähig ist. Es wird entgegen der allgemeinen Gewichtung des Autonomiebegriffs, Empathie als Schlüsselkategorie eingeführt. Dadurch soll ein Würdeverständnis verdeutlicht werden, dass jedem Menschen qua Menschsein unter allen Bedingungen und in ihrem sozialen Dasein zukommt. II. zur systeMatIk
Des
würDeBegrIffs
Wie so viele gesellschaftstheoretische Grundbegriffe erweist sich auch der Begriff der menschlichen Würde als schillernde Kategorie. So facettenreich er ist, so vielfältig sind auch die Zugänge. Dabei handelt es sich nicht nur um unterschiedliche Wissen-
118
Sabrina Zucca-Soest
schaftsperspektiven1, denn bereits innerhalb der jeweiligen Disziplin sind unterschiedlichste Begründungspfade und Definitionsversuche unternommen worden. Würde wird zm Allgemeinplatz. Trotzdem können markante Diskussionscluster ausfindig gemacht und dabei Grundzüge einer allgemeinen Systematik gewonnen werden. Die entscheidenden Aspekte werden hier mit der Frage nach ihrer Trägerschaft, ihrer Grundlage, ihrem Inhalt wie auch nach ihrem Bezug zu anderen Grundwerten wie Gerechtigkeit herausgearbeitet.2 Mit dem diesen Zusammenhang erfassenden Systematisierungsvorschlag soll nicht nur das „weite Wortfeld der Würde“3 umfasst, sondern vielmehr ein neuer Anstoß gegeben werden, der es ermöglicht, die unterschiedlichen Begründungslinien neu zu durchdenken. Dafür aber müssen zunächst die dem Würdebegriff inhärenten Paradoxien entschlüsselt werden. Denn erst mit der Freilegung der Stärken und Schwächen der verschiedenen Ansätze lässt sich eine hiervon abstrahierende Systematik entwickeln. 1. die Paradoxien Menschenwürde beschreibt zunächst ganz allgemein etwas Menschliches – es wird als Kerngehalt des Menschseins wie auch als Ergebnis sozialer Interaktion begründet. „Human dignity can be a concept that refers to the specificity of human beings.“4 Dieses Menschliche begreifen wir aber immer als schützenswert und als Fundamentalprinzip unseres Zusammenlebens5. Eine Verletzung der Menschenwürde löst in uns die Intuition aus, dass ein Mensch etwas so Furchtbares erleidet, dass wir der Meinung sind, es solle keinem Menschen widerfahren. Daher fällt unser Blick insbesondere auf diejenigen Mitmenschen, die „sich nicht wehren“ können und eben besonderen Schutz benötigen. Es ist also der Schwierigkeit zu begegnen, einen solchen Menschenwürdebegriff zu konstituieren, der die Grundzusammenhänge von geistig und körperlich unbeeinträchtigten, Freiheit und Selbstbestimmung einfordernden erwachsenen Menschen – und diese als Sinneswesen wie auch als Vernunftwesen – ebenso berücksichtigt wie die Grundbedürfnisse von denjenigen, die diese Attribute nicht erfüllen, wie z. B. Komapatienten, Demenzkranke, Behinderte oder je nach Auslegung auch Kinder. Gerade aber diese Inklusion scheint in den Begründungsdiskursen nicht befriedigend herzustellen zu sein. Denn geht man von Würdeträgern als Individuen und Vernunftwesen aus, die sich selbst Gesetze 1
2 3 4 5
Vgl. exemplarisch herms, eiLert, Politik und Recht im Pluralismus, Tübingen 2008, insbesondere 61 ff.; römeLt, josef, Menschenwürde und Freiheit: Rechtsethik und Theologie des Rechts jenseits von Naturrecht und Positivismus, Freiburg im Breisgau 2006, Wetz, franz josef, Illusion Menschenwürde: Aufstieg und Fall eines Grundwerts, Stuttgart 2005. Vgl. seeLmann, Kurt, Einführung, in: Seelmann, Kurt (Hrsg.), Menschenwürde als Rechtsbegriff, Stuttgart 2004, 8. Gröschner, roLf / KaPust, antje / LembcKe, oLiVer W., Wörterbuch der Würde, München 2013, Vorwort. düWeLL, marcus, Human dignity: concepts, discussions, philosophical perspectives, in: Düwell, Marcus / Braarvig, Jens / Brownsword, Roger / Mieth, Dietmar (Hrsg.), The Cambridge Handbook of Human Dignity, Cambridge 2014, 23–49, 26. Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass es Teil unser aller Intuitionen und Bestrebungen ist, Menschenwürdeverletzungen zu verhindern und allen Menschen zu jeder Zeit ihres Lebens ein würdiges Dasein zu ermöglichen.
Autonomie als notwendige aber nicht hinreichende Bestimmung der Menschenwürde
119
geben und Zwecke setzen, stellt man auf Eigenschaften und Fähigkeiten ab, die beispielsweise geistig behinderte Menschen aus dem Kreis der Würdeinnehabenden ausschließt (Paradoxie I).6 Gehen wir naturalistisch-faktisch von dem „Dasein des Menschen“ aus, und schließen damit auch behinderte Menschen mit ein, schneiden wir die soziale Dimension des Menschseins heraus; wobei ein Abstellen auf Würde als reinem sozialen Produkt zu einer Beliebigkeit und dem Verlust der Unverfügbarkeit von Würde führt (Paradoxie II).7 Diese grundlegenden Paradoxien des Würdebegriffs8 schleifen sich mit der Zeit dabei nicht ab, sondern scheinen immer detaillierter und verworrener zu werden. Während in den verschiedenen Diskursen immer wieder unterschiedliche Autonomiekonzepte herangezogen werden, um das zu schützende Menschsein einzufangen, gibt uns der Hinweis auf die zeitliche Endlichkeit des Ichs9 neue Schwierigkeiten auf. Denn die Spannung zwischen der früheren Identität eines Demenzkranken und dem aktuellen Ich des Erkrankten10 kann durch einen momentanen Blick auf den Würdeinnehabenden nicht eingefangen werden. Vor ähnlich grundlegenden Schwierigkeiten stehen die Diskurse im Bereich der Verfassungstheorie11, der Bioethik12, der embryonalen Stammzellenforschung, der Pränataldiagnostik13 oder etwa auch der staatlichen Rettungsfolter.14 Diese Aufzählung macht dabei nur einen kleinen Teil der fallbezogenen Grundfragen sichtbar. Es ist von diesen konkreten Anwendungsfällen insofern zu abstrahieren, als eine allgemeine Begründungslinie gesucht werden soll, die dennoch aber nicht die konkreten Fälle aus dem Blick verliert und die empirische zum Teil dramatische Situa6 7 8
9 10 11
12 13 14
Vgl. seeLmann (Fn 2), 8. ähnlich siehe seeLmann (Fn 2), 8 f. Vgl. bayertz, Kurt, Die Idee der Menschenwürde: Probleme und Paradoxien, in: ARSP 1995, 465 ff.; seeLmann, Kurt, Menschenwürde als ein Begriff des Rechts?, in: Gander, Hans-Helmuth (Hrsg.), Menschenrechte, Freiburg/München 2009, 166–180, hier 166; zucca-soest, sabrina, Das Recht der Menschenwürde, in: Seelmann, Kurt / Zabel, Benno, Autonomie und Normativität, Tübingen 2014, 99–125; Systematisch unterliegt der Würdediskurs insbesondere diesen beiden Paradoxien (I&II). Anstatt vieler KLie, thomas; Die Zeitlichkeit des Ichs – Die Würde des Menschen, in: Tiesing, Martin (Hrsg.), Alt und psychisch krank: Diagnostik, Therapie und Versorgungsstrukturen im Spannungsfeld von Ethik und Ressourcen, Stuttgart 2007, 79. Siehe ausführlich KLie (Fn 9), 79; vgl. auch neumann, VoLKer, Menschenwürde und psychische Krankheit, in: Kritische Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft 76 (1993), 276–288. Vgl. beispielsweise enders, christoPh, Menschenrechtsidee und staatliche Grundrechtsgewährleistung – ein unauflöslicher Widerspruch?, in: Bohnert, Joachim (Hrsg.), Verfassung-Philosophie-Kirche, Berlin 2001, 533–561, sowie hoffmann, hasso, Die versprochene Menschenwürde, in: Anstalt des öffentlichen Rechts 1993, 353–377, häberLe, Peter, Menschenwürde, in: Isensee, Josef / Kirchof, Paul (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts, Bd. II, 3. Aufl. Heidelberg 2004, § 22. Vgl. beispielsweise KnoePffLer, niKoLaus, Menschenwürde in der Bioethik, Berlin 2009; ein Überblick siehe joerden, jan / hiLGendorf, eric / thieLe, feLix (Hrsg.), Menschenwürde und Medizin: Ein interdisziplinäres Handbuch, Berlin 2013. schWarz, michaeL, Die Menschenwürde als Ende der europäischen Wertegemeinschaft? Eine realistische Perspektive auf das Schutzdefizit nach Art. 1 der Grundrechtscharta, in: Der Staat 2011, 533–566, hier 533. Siehe enders, christoPh, Die Würde des Rechtsstaats liegt in der Würde des Menschen – Das absolute Verbot staatlicher Folter, in: Nitschke, Peter (Hrsg.), Rettungsfolter im modernen Rechtsstaat?: Eine Verortung, Bochum 2005, 133–148.
120
Sabrina Zucca-Soest
tion von Menschenwürdeverletzungen übergeht. Menschenwürde, so ist also festzuhalten, kann und muss in ihrer empirischen wie auch normativen Dimension diskutiert werden. Dabei stehen wir vor der Aufgabe, Würde bestimmbar zu machen, ohne auf theologische, metaphysische oder axiomatische Vorannahmen zu rekurrieren.15 An diese Grundüberlegungen über den Kerngehalt des Menschseins, seine Normativität und Faktizität schließt sich ein komplexer Diskurs an, den es zu klären gilt. 2. das PendeLbiLd Bereits der antike Würdebegriff umfasst die Weite der Sphären, die heute noch die Grundlage der aktuellen Systematik bilden. So enthält der Begriff schon in der römischen Antike eine anthropologisch allgemeine und eine politische Dimension.16 Zum einen wurde er als Gattungsmerkmal im Sinne einer Vorrangstellung (excellentia et dignitas) der menschlichen Natur gegenüber dem Tier gebraucht und zum anderen beschrieb der politische Begriff der dignitas die Abstufungen des zu erreichenden gesellschaftlichen Ranges und Ansehens.17 Dies spiegelt sich ebenso im alltäglichen Sprachgebrauch wieder, in dem beispielsweise ein würdevolles Auftreten etwas ganz anderes meint als die Würdeverletzung eines Folteropfers. Grundsätzlich muss also zwischen der Würde als dem erreichten Rang oder der Leistung innerhalb einer jeweiligen Gesellschaft und Würde als innerem Wert, also als einem auszeichnenden Merkmal des Menschseins18 überhaupt unterschieden werden.19 Bei Bestimmung eines allgemeinen Werts des Menschseins muss notwendigerweise auch der historisch-konkrete Status des Menschen als solchen in den Blick genommen werden. In diesem Sinne beschreibt die Idee des Menschen als Innehabenden von Würde den Brückenschlag zwischen Vernunft und Natur, zwischen würdigem Subjekt und konkretem endlichen Individuum; sie umfasst damit zugleich den sozialen, Verantwortung einfordernden Aspekt unseres Menschseins.20 Eben diese Spannweite der zu fassenden Systematik lässt sich seit den Anfängen der überlieferten Begrifflichkeit bis in die gegenwärtige Diskussion verfolgen. Es lässt sich also feststellen, dass der Würdebegriff insbesondere ab der Neuzeit mit Blick auf vier Begründungsperspektiven bestimmt wird: zum einen wird er vorrangig als etwas Vorgesellschaftliches, insbesondere Vorrechtliches akzentuiert (Würde an sich qua Menschsein), zum anderen als sozialen Interaktionen, Sprachzusammenhängen oder Rechtsverhältnissen innerweltlich kontingent Enstehdendes. Dahinter steht grob vereinfacht die Frage, ob Würde qua Menschsein und im Sinne naturrechtlicher Argumentationen (naturalistische Perspektive) besteht oder 15 16 17 18 19 20
burKhard, franz-Peter, siehe: Würde, in: Prechtl, Peter / Burkhard, Franz (Hrsg.), Metzler Philosophie Lexikon: Begriffe und Definitionen, Stuttgart 1996. Grossmann, andreas, siehe: Würde, in: Ritter, Joachim / Gründer, Karlfried / Gottfried, Gabriel, (Hrsg.), Historisches Wörterbuch der Philosophie, Bd. 12, 1088. Anstatt vieler vgl. Grossmann (Fn 16), 1088. Die Diskussion des Würdebegriffs im Hinblick auf die Tier- und Pflanzenwelt wird an dieser Stelle nicht geführt. Ebenso wenig wie theologische Begründungslinien. horstmann, roLf Peter, siehe: Menschenwürde, in: Ritter, Joachim / Gründer, Karlfried (Hrsg.), Historisches Wörterbuch der Philosophie, Bd. 5, 1127. seeLmann (Fn 8), 170.
Autonomie als notwendige aber nicht hinreichende Bestimmung der Menschenwürde
121
das Ergebnis gesellschaftlichen Erkennens, Denkens und Handelns ist (vernunftbasierte Perspektive). Ebenso wird Würde jedem Menschen als Vollzug einer einzigartiger Identität (individualistische Perspektive) zugeschrieben, zugleich aber auch gerade nur als Teilhaber an sozialen Anerkennungsverhältnissen (soziale Perspektive). Zwischen diesen Extrempunkten bewegen sich die gegenwärtigen Versuche, die Stärken der jeweiligen Positionen in der Bestimmung neuer Verhältnisse21 zu bündeln. Das Pendelbild schafft nun einen, alle Zugänge inkludierenden Überblick und verdeutlicht so die jeweiligen Defizite der einzelnen Positionen wie auch die Verhältnisse der Aspekte zueinander. So lassen sich sämtliche Begründungslinien bildlich gesprochen in den Schwingungsbereich eines Pendels einordnen. Die genannten Grundparameter wie Trägerschaft, Grundlage, Inhalt und Bezug zu anderen Grundwerten bilden in diesem Bild den Pendelkörper, der zwischen den Umkehrpunkten in seinem Schwingungsbereich die verschiedenen Begründungslinien umfasst. Die sich gegenseitig ausschließenden Grundannahmen (naturalistische, vernunftbasierte, individualistische und soziale Perspektive) beschreiben die Umkehrpunkte als äußerste Extrempositionen. Alle Extrempositionen inkludieren dabei Voraussetzungen und Konsequenzen, die neben ihren zunächst gewonnenen Stärken jedoch der moralischen Intuition von Würde wie auch der Zielsetzung der Ausformulierung des Würdebegriffs zum Teil konträr zuwider laufen, wie der kurze Blick auf die Paradoxien gezeigt hat. Um die bereits eingenommenen Perspektiven kontrastieren zu können, werden im Folgenden sozusagen die Umkehrpunkte in ihren Reinformen betrachtet. Selbstredend bestehen viele abgeschwächte Versionen und Mischformen dieser jeweils veranschlagten Grundannahmen. 2.1. Die vereinseitigte individualistische Perspektive Das Würdeverständnis mit Blick auf das vereinzelte menschliche Individuum inkludiert weit mehr als der klassische Personenbegriff, wie wir ihn beispielsweise aus den Rechtswissenschaften kennen. Hier sollen die „natürlichen und kulturellen Unterschiede, ja das jeweilige Schicksal des Einzelnen“22 mit umfasst werden. Die sozialen Notwendigkeiten zur Ausbildung und Umsetzung einer einzigartigen Identität müssen im konkreten Fall gewährleistet sein. Der Mensch soll hier in seiner Würde so geschützt werden, wie er sich selbst in seiner Individualität verwirklicht und seiner selbst bewusst wird.23 Das konkrete Individuum wird also als Einzelnes in seiner Einzigartigkeit wahrgenommen und „verschwindet“ nicht als beliebiges soziales Wesen. Diese Perspektive bietet eine Begründungslinie, nach der sich dann eine individuelle Schutzwürdigkeit erklären lässt, die das Recht auf Entwicklung und Identität umschließt. Gerade diese „Stärke“ kann aber auch als ins Gegenteil umgeschlagen betrachtet werden. Denn eben dieser Blick auf die einzigartige Identität eines Menschen müsste ihn doch zugleich auch als Teilnehmer sozialer Interaktionen in Betracht ziehen. Menschen sind ja nicht nur immer schon soziale Wesen, sondern gerade ihre Indivi21 22 23
Für einen sehr kompakten Überblick über die neueren Theorien siehe Gröschner / KaPust, antje / LembcKe, oLiVer W. (Fn 3). seeLmann (Fn 8), 173. seeLmann (Fn 8), 173.
122
Sabrina Zucca-Soest
dualität erwächst auf der Grundlage wie auch dem Vollzug von intersubjektiven Anerkennungsverhältnissen24. Identitäten, gerade in dem hier angenommenen schützenswerten Sinne – und dies auf empirisch-psychologischer wie auch verallgemeinerter theoretisch-philosophischer Ebene – sind Ergebnis und Teil von Vergemeinschaftungsprozessen. Mit dem Ausgangspunkt beim vereinzelten Individuum aber wird der Mensch primär nicht als ein Teil einer Gemeinschaft gesehen, sondern als isolierter einzigartiger Mensch mit Rechten, die ihm als Mensch in der Gemeinschaft, nicht aber als Mitglied der Gemeinschaft zustehen.25 Die soziale Sphäre als Voraussetzung für das (Bewusst-)Werden von Individuen wird an diesem äußersten Umkehrpunkt bei der Betrachtung der Würde eines vereinzelten Ich ausgeblendet und führt so zu einer dezisionistisch zugeschriebenen, nicht ableitbaren Idee von menschlicher Würde des vereinzelten Ich. 2.2. Die vereinseitigte soziale Perspektive Würde kann nun aber auch als reines Ergebnis sozialer Interaktion bestimmt werden. Sie muss hier erst als gesellschaftliche Leistung hervorgebracht werden und bleibt somit auch immer von der jeweiligen Gesellschaft abhängig. Ein solches soziales Produkt bleibt immer zu- und absprechbar. Daher wird in diesem Zusammenhang auch von einer kontingenten Würde26 gesprochen. Würde kann – muss aber nicht – hervorgebracht werden. Hier wird der Mensch gerade auch in seiner sozialen, gesellschaftliche Verhältnisse gestaltenden Dimension wahrgenommen. Gerade das bei den anderen Perspektiven zu bemängelnde Fehlen von Identitätsbildungsund Anerkennungsprozessen als Perpetuierung sozialer Vergemeinschaftungsprozesse ist hier als eingebunden gedacht. So kann auch Intersubjektivität als Ressource für Würde fruchtbar gemacht werden. Und selbst das Individuum mit einzigartiger Identität im Gesamtzusammenhang sich aufbauender gesellschaftlicher Wirklichkeit nicht verloren gehen. Würde kann hier als Voraussetzung eines intersubjektiven Beziehungsnetzes wie auch als innerweltliche Konkretisierung eines historisch/zeitlichen Ergebnisses in konkret werdenden Anerkennungsakten27 innerhalb sozialer Ordnungen begriffen werden. Eine Engführung der Perspektive auf Würde als sozialem Ergebnis führt allerdings zu einer schwerwiegenden Schwächung ihres normativen, Allgemeinheit beanspruchenden Sinngehaltes. Denn durch die Zu- und Absprechbarkeit wird Würde zu einer relativen Größe. Sie kann ja erbracht oder aber eben auch nicht erbracht werden. Sie ist „gradualisierbar, ja sogar verlierbar“28. Entscheidet sich eine Gesellschaft nun Menschenwürde nur einigen bestimmten Menschen (Problematik der Minderheiten, Ethnien, anderen diskriminierten Gruppen) zuzusprechen und die anderen als „unwürdig“ zu kategorisieren, stünde dies auch legitimatorisch im 24 25 26 27 28
Zur detaillierten Diskussion von dieser Position siehe zucca-soest (Fn 8), 99–125. KLie (Fn 9), 77. müLLer, jörn, Ein Phantombild der Menschenwürde: Begründungstheoretische Überlegungen zum Zusammenhang von Menschenrechten und Menschenwürde, in: Brudermüller, Gerd / Seelmann, Kurt (Hrsg.), Menschenwürde, Würzburg 2008, 121. seeLmann (Fn 2), 8. siehe auch KLie (Fn 9), 78.
Autonomie als notwendige aber nicht hinreichende Bestimmung der Menschenwürde
123
Einklag mit einer solchen Würdebegründung. Darüber hinaus birgt die Idee von Würde als nachgeordnetem Ergebnis sozialer Leistung oder auch Anerkennung weitere Schwierigkeiten in sich. Denn als Resultat von wechselseitiger oder gar wechselseitig bedingter Anerkennung haben wir große Mühe mit der Begründung des Anerkanntseins von Menschen, die ihrerseits eines Anerkennungsaktes nicht fähig sind, wie etwa geistig schwer Behinderte.29 Schließlich ist beispielsweise ein dementer Mensch als nicht entscheidungsfähiges Subjekt nicht in der Lage, an den beschriebenen sozialen/kommunikativen Prozessen im Sinne einer Konstituierungsleistung teilzunehmen. 2.3. Die naturalistisch verengte Perspektive Den anderen entscheidenden Umkehrpunkt stellt die naturrechtlich bzw. naturalistische Position dar, nach der jeder Mensch qua Menschsein Inhaber von Würde ist. Sie kann dem Menschen weder zu- noch abgesprochen werden. Sie ist auch nicht abhängig von Eigenschaften oder Leistungen wie Vernunftbegabung, Kommunikationsfähigkeit, Selbstbestimmung oder das Ergebnis sozialer Interaktion. Würde wird hier in keiner Weise hervorgebracht oder konstituiert, sondern besteht als Menschenwürde von Natur aus. Sie wird hier als etwas gegebenenfalls naturrechtlich Aufzuweisendes bzw. als etwas „Angeborenes“ verstanden und ist deshalb unabhängig von ihren eigenen systemimmanenten Erfordernissen zu achten und zu schützen.30 Als vorrechtliche Institution bildet Würde hier also die faktische Grundlage von Rechtsordnungen und anderen sozialen Normsystemen. In eben diesem Sinne wird Würde als inhärent beschrieben.31 Als faktisch-naturalistische Entität fokussiert sie schließlich alles Menschliche. Demnach sind alle Menschen32 – eben auch Menschen mit Behinderungen, Demente oder Kleinkinder33 – in gleichem Maße Würdeträger. Die Stärke dieser Position ist evident: gerade die nach unseren moralischen Intuitionen besonders schützenswerten Menschen sind nicht nur überhaupt Würdeträger, sondern gar in gleichem Maße und unter allen Umständen wie alle anderen. Darüber hinaus kommt Würde dem einzelnen Individuum unabhängig von seiner sozialen Einbindung zu. Defizitär hingegen wirkt die tiefere Begründungslosigkeit insbesondere dieser letztgenannten Perspektive. Denn hier wird die notwendige Eigenschaft der Vernunft ausgeschlossen und postuliertes auf ein bloßes Vorliegen von Menschenwürde. Diese Perspektive setzt sich in ihrer Reinform also dem Vorwurf eines „begründungslosen Speziezismus, eines Schutzes der Gattung Mensch letztlich ohne Begründung“34 aus.
29 30 31 32 33 34
seeLmann (Fn 2), 8. seeLmann (Fn 2), 8. müLLer (Fn 26), 121. Hier wird von dem geborenen Menschen ausgegangen, inwiefern die hier zu Grunde gelegte Perspektive auf noch nicht geborene Menschen oder Tiere übertragbar ist, muss an anderer Stelle erfolgen. Gemeint sind hier Babies wie auch Kleinkinder. seeLmann (Fn 8), 167.
124
Sabrina Zucca-Soest
2.4. Die vorrangig vernunftbasierte Perspektive Wohl vertraut ist uns die Vorstellung vom Menschen als Vernunftwesen, die, kantisch gesprochen, als intelligible Wesen sich selber Gesetze geben und Zwecke setzen. Nun unterscheiden sich die Vernunftbegriffe im Verlauf des innerphilosophischen Diskurses durch die Jahrhunderte hindurch sehr und ziehen dementsprechend auch ganz andere Folgen nach sich. Und dennoch kann der hier aufgezeigte Kritikpunkt mit keinem Konzept völlig überwunden werden. Denn ob Vernunft nun im klassischen Sinne seinstheoretisch verstanden wird oder im neuzeitlichen Sinne subjekttheoretisch oder im Sinne des 20./21. Jahrhunderts in mannigfachen sprachphilosophischen Varianten entweder als „ermäßigter Vernunftbegriff “ gerettet oder als unzeitgemäß metaphysisch aufgelöst, destruiert, dekonstruiert wird; immer bleibt der „Mensch als Komapatient“ hinter den nicht erkrankten Menschen als Träger oder auch Teilhaber an Prozessen der „Konkretisierung von Würde“ zurück. So beschreibt die seinsphilosophische Perspektive Vernunft als Logos, der unser Denken bestimmt – der Demenzkranke kann in diesem Sinne aber nicht qua Seele zum Denken bestimmt werden; der Logos kommt bei ihm nicht an. Vernunft als Vernunftvermögen des „Ich denke/Ich soll“ hingegen, wie wir es aus der kantischen Philosophie kennen, schließt geistig schwer behinderte Menschen insofern aus, da sie dieser Allgemeinheit des Ich denke/Ich soll nicht fähig sind. Und selbst der Versuch, Vernunft als im prozeduralen Sprachzusammenhang sich herstellendes normatives, sinnstiftendes und handlungsorientierendes Moment, wie wir es z. B. aus der universalpragmatischen Variante der Diskursethik kennen, bleibt weit hinter der naturalistischen Bestimmung der Würde eines jeden Menschen unter jedweden Umständen zurück. Denn es handelt sich bei Ihnen doch „nur“ um virtuelle Teilnehmer am Diskurs, den sie selbst nicht zu vollziehen vermögen und somit eines Stellvertreters bedürfen. Hier wird ein Demenzkranker als möglicher Diskursteilnehmer in den Konkretisierungsprozess von Würde (gelungenes, wirkliches kommunikatives Handeln), nur am Rande mitbetrachtet. Da aber Andere „für ihn“ im Perspektivenwechsel der Verständigung und unter Berücksichtigung der „Interessen aller“ Stellung nehmen, kommt ihm eine nur zugeschriebene, nicht in Eigenverantwortung vermittelte Teilhabe an Akzeptabilitätsprüfungen und somit an Würde zu. Selbstredend ist dies weitaus mehr als aus dem Kreis der Würdeträger von vornherein ausgeschlossen zu werden: die notwendige „Autonomie der Ja/Nein-Stellungnahme im gelingenden Sprachvollzug“ einer prozeduralen Verfahrensrationalität aber bleibt ihm unerreichbar. Festzuhalten bleibt, dass die Grundannahme von Menschen als Vernunftwesen, im Sinne einer der „Gattung Mensch als Regelzustand kennzeichnenden Eigenschaft“35, dazu führt, dass die Lebensbedingungen behinderter Menschen „als nicht vernunftfähig aus einem Bild von würdevollem Leben herausfallen“36. Hier kann sich ein auf das vernunftbegabte autonome Subjekt hin angelegtes und akzentuiertes Würdekonzept als Ethik des Stärkeren erweisen, das den Schwachen, an
35 36
seeLmann (Fn 8), 166. vgl. KLie (Fn 9), 80.
Autonomie als notwendige aber nicht hinreichende Bestimmung der Menschenwürde
125
denen sich die Menschenwürde als gesellschaftliche Zusicherung und Gestaltungsaufgabe zu bewähren hat, gefährdet.37 2.5. Die Aufgabe: Die Ruheposition Wir stehen also vor dem Dilemma, dass die Schwächen der einen Perspektive nicht durch die Stärken der anderen überwunden werden können, ohne im Umkehrschluss sich ebenso die Schwächen der anderen einzuhandeln. Scheinbar verlieren wir die positiven Möglichkeiten der jeweiligen Grundpositionen in dem Maße, in dem wir uns auf die jeweils andere zubewegen. Konkret gesprochen stehen sich scheinbar die Allgemeingültigkeit und Unverfügbarkeit der Würdeidee (naturalistische Position), der Erkenntnisfähigkeit oder aktiven Teilnahme an Diskursen (vernunftbasierte Position), die Bedingungen sozialer Anerkennungsverhältnisse (soziale Position) und der Schutz einzigartiger Identitäten (individualistische Position) unversöhnlich gegenüber. Die Aufgabe besteht also darin, durch eine Schlüsselkategorie als verbindendes Moment das Ausschlussverhältnis zu überwinden, um so die jeweiligen Stärken der aufgezeigten Grundannahmen als Erkenntnisgewinn erfolgreich verbinden bzw. neu kondensieren zu können. Das Ziel der hier veranschlagten Betrachtung liegt also in dem Versuch, das als Ruheposition ausbalancierte Moment des Pendelbildes begrifflich-inhaltlich aufzuspüren. Dabei soll Würde auf ein Fundament gestellt werden, das alle Menschen unter jedweden Umständen als emotional und/oder verstandesbasiert miterlebende Wesen in ihrer einzigartigen Identität wie auch als Teilnehmer sozialer Anerkennungsprozesse, eben als soziale Mitglieder der Menschheit, ausmacht.
Über alledem steht die kritische (Nach)Frage der Kulturrelativität38 dieser Überlegungen. Dabei muss die Fokussierung des Menschenwürdekonzeptes auf die Begriffe wie Subjekt, Person und Individuum, und dies unabhängig von ihrer jeweiligen Variante und der sich hieraus ableitenden Position im Pendelbild, per se keine kulturkontingente Variable darstellen. Vielmehr verstellt uns die der westlichen Tradition inhärente Einfärbung, nämlich die Zugrundelegung von Autonomie, den Blick auf ein Würdeverständnis als Kerngehalt der Menschheit. Denn der Ausgangspunkt von einem Menschen (sozialer Gruppen) im Verhältnis zur Gemeinschaft (sozialen Systemen) ist das Ergebnis einer wie auch immer gearteten Autonomievorstellung. So wichtig wie die Möglichkeit der Freiheit und Unabhängigkeit für das Menschsein auch sein mag, so erschöpft sich – wie es im Folgenden aufzuzeigen gilt – der Grundgehalt von Menschenwürde mitnichten aus den möglichen Autonomieverständnissen. Vielmehr gilt es die Perspektive zu öffnen für eine umfassendere Wahrnehmung des Menschseins. Diese wiederum müsste sich dann ebenso in ihren überkulturellen Zusammenhängen bestimmen bzw. aufweisen lassen. Kritisch hinterfragt werden soll im Folgenden also der uns allen spätestens seit der Aufklärung eingebrannte subjektphilosophisch-naturrechtliche Zugang zur Idee der Menschenwürde über ein wie auch immer geartetes Autonomieverständnis. Bildlich gesprochen bildet das dreidimensionale Pendelbild einen Kegel. Die Grundfläche dieses 37 38
KLie (Fn 9), 80. siehe seeLmann (Fn 2), 10.
126
Sabrina Zucca-Soest
Kegels kann als die „Grundannahme der Autonomieidee“ beschrieben werden. Es stellt sich also die Frage, ob diese „Grundannahme der Autonomieidee“ nicht zu den beschriebenen Dilemmata führt. III. autonoMIe
als
grunDlage
von
würDe
Der Autonomiebegriff fungiert in vielen ethischen Diskussionen insbesondere aber im Menschenwürdediskurs als Legitimations- und Begründungsressource. Er steht in seinen unterschiedlichen Schattierungen und Verwendungszusammenhängen zunächst einmal für die Freiheit, Unabhängigkeit und Selbstbestimmtheit von dem/ den Innehabendem/en im Verhältnis von etwas bzw. anderen. Die Relationssphäre des Innehabens also des Autonomen umgreift dabei ein einzelnes Individuum wie auch soziale Gruppen. Die andere Relationssphäre kann unterschiedlichste Dinge wie kulturelle Regeln, autoritäre Strukturen oder andere soziale Einflussgrößen beinhalten. Immer aber besteht ein Wechselverhältnis zwischen den Relationssphären, das um Einfluss, Emanzipation und Selbstbehauptung kämpft. Die starke Wirkkraft solcher sozialer Ideen lässt sich daher auch in den unterschiedlichsten disziplinären und historischen Zusammenhängen aufzeigen. So wurde bereits in der griechischen Antike Autonomie als sozialpolitischer Terminus entwickelt, mit dem die gegen eine Tyrannei geforderte innere und gegen eine Fremdherrschaft geforderte äußere Freiheit programmatisch bezeichnet werden konnte.39 Systematisch besteht diese sozialpolitische Lesart bis heute. So schwankt die Verwendung des Autonomiebegriffs zwischen der gegenüber den bestehenden Gesetzen und Machtverhältnissen kritischen Berufung auf das „eigene Gesetz“ und zwar sowohl des Individuums40 gegenüber der Gruppenmoral oder der gesellschaftlichen Tradition als auch von kleineren Staaten41 bzw. Gemeinwesen gegenüber größeren Vormächten – und der gegenüber übergeordneten Gesetzen affirmativen Betonung des noch verbleibenden Freiraums für die eigene Gesetzgebung.42 Systematisch wendet sich Autonomie gegen bloße Naturtheorie wie auch gegen gesellschaftliche Fremdbestimmung.43 Dies lässt sich unter der Fokussierung der sozialen wie auch individuellen Sphäre nachweisen.
39 40
41 42 43
schWemmer, osWaLd, siehe: Autonomie, in: Mittelstraß, Jürgen (Hrsg.), Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie, Stuttgart [u. a.] 2004. Siehe auch reimann, bruno, siehe: personale Autonomie & siehe: soziale Autonomie, in: Fuchs-Heinritz, Werner / Klimke, Daniela / Lautmann, Rüdiger / Rammstedt, Ottheim / Stäheli, Urs / Weischer, Christoph / Wienold, Hanns (Hrsg.), Lexikon zur Soziologie, 5. Aufl., Wiesbaden 2011. Vgl. schuLtze, rainer-oLaf / WaschKuhn, arno, siehe: Autonomie, in: Nohlen, Dieter / Schultze, Rainer-Olaf, Lexikon der Politikwissenschaft, München 2010. Vgl. schWemmer (Fn 39); PrechtL, Peter, siehe: Autonomie, in: Prechtl/Burkhard (Fn 15). Vgl. PohLmann, rosemarie, siehe: Autonomie, in: Ritter, Joachim (Hrsg.), Historisches Wörterbuch der Philosophie, Bd. 1, 707.
Autonomie als notwendige aber nicht hinreichende Bestimmung der Menschenwürde
127
1. die soziaLe sPhäre – oder die äussere freiheit Im Hinblick auf die Zusammenhänge von sozialen Gruppen scheint diese Problematik als Kampf um Freiheit besonders in der Moderne sehr virulent. So beschreibt Weber die Autonomie des Verbandes als eine nicht durch Außenstehende gesetzte, sondern durch Verbandsgenossen kraft dieser ihrer Qualität bestehende.44 In diesem Sinne unterscheidet auch die gegenwärtige Soziologie zwischen personaler, sozialer und funktionaler Autonomie. Auch hier wird der Grundgedanke lediglich in seinem spezifischen Kontext gewendet. Nach ersterer besteht für das Individuum im Kontext der Bedrohung durch die Gesellschaft die Chance, im Rahmen bestehender kultureller und rechtlicher Schranken bestimmte Orientierungs- und Verhaltensmuster aus einem Repertoire von Werten und Verhaltensmustern auszuwählen45 und somit zwischen Konformität und Nonkonformität frei zu entscheiden.46 Im Sinne der sozialen Autonomie kann die soziale Einheit grundlegende strukturelle Muster selbst definieren und auf Grundlage dieser Muster bestimmte Ziele, Werte, Normen und Inhalte auch eigenständig die Einhaltung dieser Normen kontrollieren.47 Mit Blick auf die funktionale Autonomie wird die Wechselwirkung von gesellschaftlichen Teilbereichen bzw. -systemen, wie Politik, Wirtschaft, Wissenschaft usw., in den hochkomplexen Gesellschaftssystemen diskutiert. Autonomie besteht hier in der Selbstprogrammierung, nach der die Teilsysteme an beiden Zeitgrenzen, sowohl im Hinblick auf die Ursachen als auch im Hinblick auf die Wirkungen ihres Handelns Informationen der Umwelt aufnehmen und selektiv verarbeiten.48 Auch in dem modernen rechtswissenschaftlichen Verständnis von Autonomie, aus staatsrechtlicher und privatrechtlicher Sicht, lässt sich die benannte Systematik belegen. Selbst wenn der rechtswissenschaftliche Autonomiebegriff im Besonderen soziale Zusammenhänge beschreibt, so inkludiert er auch Teile der individuellen Sphäre. Dies geschieht vor allem im Hinblick auf Trägerschaft wie Schutzbereich. Hier begegnet uns der Autonomiebegriff insbesondere als Idee der Privatautonomie49, die sich historisch als Abwehr gegen staatliche Einflüsse etabliert hat und in prominenter Form u. a. bei KeLsen50 zu finden ist. In diesem Sinne hat auch bereits Von hiPPeL den Kampf um Freiheit und Unabhängigkeit im Rechtsleben treffend thematisiert: „Bei der ‚individuellen‘ Privatautonomie handelt es sich um die Gestattung, das eigene rechtlich abgesonderte Leben in dieser oder jener Hinsicht nach eigener Wahl zu führen. […] Bei der ‚sozialen‘ Privatautonomie handelt es sich um die Gestattung, im Verhältnis zu anderen Personen nach eigener Wahl in neue Rechts-
44 45 46 47 48 49 50
Weber, max, Wirtschaft und Gesellschaft, Neu Isenburg 2005, 36 f. siehe u. a. reimann (Fn 40); siehe auch marcuse, herbert, Der eindimensionale Mensch, Neuwied 1967, 255 f.; mitscherLich, aLexander, Das soziale und das persönliche Ich, in: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 1966, 21–36. riesman, daVid / denney, reueL / GLazer, nathan, Die einsame Masse, Hamburg 1958, 254. reimann, bruno, siehe: soziale Autonomie, in: Fuchs-Heinritz/Klimke/Lautmann/Rammstedt/Stäheli/Weischer/Wienold (Fn 40). Luhmann, niKLas, Zweckbegriff und Systemrationalität, Frankfurt am Main 1968, 70 f. rüthers, bernd / fischer, christian / birK, axeL, Rechtstheorie, 7. Aufl., München 2013, N. 361 ff.; PohLmann (Fn 43), 707; schWemmer (Fn 39); radbruch, GustaV, Rechtsphilosophie, 6. Aufl., Stuttgart 1963, 210 ff. KeLsen, hans, Reine Rechtslehre, 2. Aufl. (1960), Nachdruck, Wien 2009, 283 ff.
128
Sabrina Zucca-Soest
und Pflichtverhältnisse einzutreten.“51 Das moderne Recht sieht also die Sicherung der Würde im Wesentlichen als Sicherung der Autonomie des handelnden Subjektes.52 Das deutsche Grundgesetz beispielsweise geht in diesem Zusammenhang von einem Menschenbild aus, das ganz wesentlich auf die Entscheidungsfähigkeit, Selbstständigkeit und individuelle Entfaltung hin ausgelegt ist.53 Garantiert wird das Elementare, die Subjektstellung des Menschen als Person sowie die soziokulturellen Existenzbedingungen des Menschen und seiner sozialen Umwelt.54 Im Bereich der sozialen Sphäre steht also disziplinübergreifend der Kampf um Unabhängigkeit im äußeren Verhältnis zu Gruppen oder Systemen im Mittelpunkt. 2. die indiVidueLLe sPhäre – oder die innere freiheit Ebenso zeigt sich die benannte systematische Struktur mit Blick auf das Individuum. So beschreibt Autonomie in der Sozialpsychologie einen Zustand der Selbstwerdung und Selbstbestimmung im Bereich des ethischen Daseins. fromm beispielsweise beschreibt den Unterschied zwischen einer autoritären und humanistischen bzw. autonomen Ethik, „in welcher der Mensch zugleich Normgeber und Gegenstand der Normen, deren formale Quelle oder regulative Kraft und der ihnen Unterworfene“55 ist. Dies wiederum führt durch die Internalisierung der unterschiedlichen Normen bzw. Normstrukturen beim Kind zu einem „autoritären oder autonomen Gewissen“56. Ähnlich argumentiert PiaGet, wenn er Autonomie als Folge der reduzierten elterlichen Einflussnahme und zugleich – was entscheidender ist – als Konsequenz des Aufbaus erster Sozialbeziehungen unter der Voraussetzung von Gleichheit, Zusammenarbeit, Gegenseitigkeit und wechselseitiger Achtung57 entstehen lässt.58 Der Hinweis auf das Werden des autonomen Individuums als sozialem Wesen und dies von Anfang an, verdeutlicht die Schwierigkeit individueller – autonomer – Moralbegründung in dem Geflecht sozialer Interaktionen. Die Sozialpsychologie fokussiert hier die Prozesse der Bewusstwerdung der Verfügbarkeit und Machbarkeit sozialer Regeln und Satzungen und geht klassischer Weise von einem Lernprozess aus.59 Diese scheinbar disziplinimmanente Perspektive beinhaltet dabei tatsächlich eine weitreichende Vorentscheidung bzw. Anschauung, die es 51 52 53 54 55 56 57 58 59
hiPPeL, fritz, Das Problem der rechtsgeschäftlichen Privatautonomie, Tübingen 1936, 69 f. KLie (Fn 9), 79. KLie (Fn 9), 79. KLie (Fn 9), 78. Exemplarisch fromm, erich, Psychoanalyse und Ethik, Stuttgart 1954, 21 f. fromm (Fn 55), 155 ff. PiaGet, jean, Das moralische Urteil beim Kinde, Zürich 1954, 223 ff. vgl. PohLmann (Fn 43), 707. klassisch siehe hier u. a., PiaGet (Fn 57); KohLberG, LaWrence / coLby, ann, Das moralische Urteil: Der kognitionszentrierte entwicklungspsychologische Ansatz, in: Bertram, Hans (Hrsg.), Gesellschaftlicher Zwang und moralische Autonomie, Frankfurt am Main 1986, 130–162; eriKson, eriK h., Kind und Gesellschaft, Zürich 1957, 69 ff.; als kritische Würdigung von Kohlberg und Piaget siehe erLach, franz, Prosistenz, Frankfurt am Main 2011, 140 ff. – ganz anders die aktuelle Forschung tomaseLLo, michaeL, Kooperation und Kommunikation im zweiten Lebensjahr, in: Gebauer, Gunter / Edler, Markus (Hrsg.), Fankfurt am Main 2014; wie bishofKöhLer, doris, Soziale Entwicklung in Kindheit und Jugend, Stuttgart 2001, 141 ff. Von
Autonomie als notwendige aber nicht hinreichende Bestimmung der Menschenwürde
129
im Folgenden kritisch aufzuspüren und zu hinterfragen gilt. Ganz ähnlich beschreibt die Pädagogik Autonomie im Gegenzug zu autoritärer Erziehung bzw. autoritärer Sozialstruktur.60 Während zunächst die Autonomie der sittlichen Person geradezu in ihrer Behauptung gegenüber bedrohenden gesellschaftlichen Verhältnissen gesehen wurde, wird aktuell auf die Aufgabe der Selbstbestimmung als Forderung nach einer demokratischen Grundstruktur der Gesellschaft hingewiesen.61 3. das KonstitutiVe Verständnis seit der aufKLärunG Der Autonomiebegriff wird aber nicht nur in quasi allen akademisch-gesellschaftstheoretischen Perspektiven als Grundbegriff diskutiert, weil er den Zusammenhang von gemeinschaftlicher Unabhängigkeit und Freiheit (inter- wie intrainstitutionell) beschreibt. Vielmehr hat er sich als eigenständiger normativer Wert und als Fundament für unsere Würdeverständnisse spätestens seit der Aufklärung als Teil unserer sozialpolitischen wie schließlich auch moralischen Intuitionen manifestiert. So ist Autonomie in ihren je unterschiedlichen Nuancen zur oftmals letztbegründenden Ressource für viele gegenwärtige gesellschaftstheoretische Konzepte avanciert. Sie steht als Erbe der Aufklärung nicht zuletzt für Fortschritt im positiven Sinne und wirkt als Legitimationsquelle bis in konkrete aktuelle Gemeinschaftsentwürfe wie z. B. Rechtsordnungen. Wir verbinden in der Regel bereits intuitiv mit Autonomie einen individual-gesellschaftlichen Status, hinter den es nicht zurückzufallen bzw. den es permanent zu beachten und herzustellen gilt. Ganz in diesem Sinne beschrieb bereits Ernst cassirer den positiven Charakter der Aufklärungsphilosophie: „Die Philosophie der Aufklärung […] kämpft auf allen Gebieten gegen die Macht des bloßen Herkommens; gegen Tradition und Autorität. Aber sie glaubt damit keine bloß negative und auflösende Arbeit zu vollziehen. Sie will vielmehr den Schutt der Zeiten abtragen, um die festen Grundmauern des Gebäudes bloßzulegen und sichtbar zu machen. Diese Fundamente selbst gelten ihr als unwandelbar und als unerschütterlich; sie sind so alt wie die Menschheit selbst. Die Philosophie der Aufklärung fasst demgemäß ihre Aufgabe nicht als einen Akt der Vernichtung, sondern als einen Akt der Wiederherstellung. Sie will auch in ihren kühnsten Revolutionen nichts anderes als eine Restitution sein; ein >restitutio in integrum