Medien der Geschichte – Antikes Griechenland und Rom 9783110336351, 9783110336252
Our understanding of past societies is shaped by the media that constitute their cultural practices. The essays in this
211 94 18MB
German Pages 445 Year 2013
Vorwort
Einführung: Historien – Historie – Geschichte: Wohin führen die Medien?
1 Die Herausforderung der Medien für die Geschichte
2 Leistungen und Grenzen der ‚Medien der Geschichte‘
3 Das Spektrum der Medien
4 Aus der Perspektive der Medien: Geschichten oder Geschichte?
Historiographie: Die Gegenwart in der Geschichte
1 Tradition: Geschichte im Medium von Kunst
2 Innovation: Der Einsatz der Historiographie
3 Vergangenheit und Gegenwart in der griechischen Geschichtsschreibung
Das homerische Epos als Quelle, Überrest und Monument
1 Homer als Medium von der Antike bis in die Gegenwart
2 Homer als ‚Quelle‘
3 Homer als ‚Überrest‘
4 Homer als ‚Monument‘
5 Die Spatialität des epischen Erinnerns
Symposion, Kult und frühgriechische Dichtung: Sappho im Kontext
Tragic Myth as Medium of Social and Cultural History: Black Sea Artemis and the Cults of the Roman Empire
Mnemopoetik: Die epigraphische Konstruktion von Erinnerung in den griechischen Poleis
1 Epigraphisch überlieferte Texte als Medium der Erinnerung
2 Epigraphische Texte sind das Ergebnis von Auswahl
3 Epigraphische Texte sind hypomnemata
4 Epigraphische Texte wurden als historische Zeugnisse verstanden
5 Der Ort der epigraphischen Aufstellung ist Ort der Erinnerung
6 Historische Erinnerung in epigraphischen Texten ist (auch) Erinnerung an Protagonisten und Familien
7 Epigraphische Texte vermitteln eine selektive Version der Vergangenheit
8 Epigraphische Texte erwecken Emotionen
9 Ergebnisse
Urgeschichte – Frühgeschichte: Geschichte? Das Beispiel des mykenischen Griechenland
1 Gesellschaften ohne Geschichte?
2 Das unterschätzte sozialgeschichtliche Potential materieller Kultur
3 Die Entstehung der mykenischen Kultur aus der Auseinandersetzung mit dem minoischen Kreta
4 Das Ende der mykenischen Kultur und die Erinnerung an die palatiale Vergangenheit
5 Eine kulturelle Anthropologie der Antike
Bilder lesen ohne Texte
1 Endymion und Luna
2 Dionysos und Ariadne
3 Prospektive Hoffnung und respektive Erinnerung
Mythen- versus Lebensbilder? Vom begrenzten Gebrauchswert einer beliebten Opposition
Two Notes on Greeks Bearing Arms: The Hoplites of the Chigi Jug and Gelon’s Armed Aphrodite
1 The Warriors of the Chigi Jug
2 Arsinoe-Aphrodite at Arms
3 Conclusion: History as (Self-)Image
Das Medium der künstlerischen Form. Medium – künstlerische Form – Geschichte: Drei Begriffe und zugleich drei Problemfelder
1 Medium
2 Kunst
3 Geschichte
4 Subjektives Interesse
5 Form und Stil
6 Form und Zeitgeist
7 Usurpierte Form
Monumente der Geschichte – Geschichte als Monument?
1 Einleitung
2 Denition: Monu-Mentalität
3 Initiatoren, Botschaften und Rezipienten
4 Die Praxis der Setzung öffentlicher Denkmäler
5 Grundthemen der geschichtlichen Repräsentation
6 Monumentale Geschichte
7 Geschichtsbewusstsein?
Historische Dimensionen des gebauten Raumes – Das Forum Romanum als Fallbeispiel
1 Der gebaute Raum als plurimediales Produkt
2 Die historische Interpretierbarkeit des gebauten Raumes
3 Das Forum Romanum – Chancen und Herausforderungen der historischen Interpretation
4 Die Komplexität der Geschichte – Plädoyer für eine differenziertere Sicht auf die historischen Dimensionen des gebauten Raumes
St. Peter in Rom: Medien und Gattungen seit 1506
Raum – Präsenz – Performanz. Prozessionen in politischen Kulturen der Vormoderne – Forschungen und Fortschritte
1 Konzepte und Kategorien
2 Prozession als Performanz I: Botschaft(en) eines Mediums
3 Prozession als Performanz II: Raum, Route und Richtung
4 ‚Performative turn‘ meets ‚spatial turn‘
Im Schatten der Pyramiden
1 Die Dichter sind langlebiger als die Monumente
2 Borges und der Schatten der Mauer
3 Kafka und die Ansichten eines Vorarbeiters
Bilder im Kopf. Archäologen und ihre Medien
1 Archäologen schaffen Bilder
2 Bilder prägen Archäologen
3 Die Rolle der Medien
Recommend Papers

File loading please wait...
Citation preview
Medien der Geschichte – Antikes Griechenland und Rom
III
Medien der Geschichte – Antikes Griechenland und Rom Herausgegeben von Ortwin Dally, Tonio Hölscher, Susanne Muth und Rolf Michael Schneider
Gedruckt mit Unterstützung des Deutschen Archäologischen Instituts, Berlin, und der Gerda Henkel Stiftung, Düsseldorf. Einbandbild: Theater von Leptis Magna, Stifterinschrift des Annobal Tapapius Rufus, © Susanne Muth.
ISBN 978-3-11-033625-2 e-ISBN 978-3-11-033635-1 Library of Congress Cataloging-in-Publication Data A CIP catalogue record for this book has been applied for at the Library of Congress Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter http://dnb.dnb.de abrufbar © 2014 Walter de Gruyter GmbH, 10785 Berlin/Boston Satz: Dörlemann Satz GmbH & Co. KG, Lemförde Druck und Bindung: Hubert & Co. GmbH & Co. KG, Göttingen ? Gedruckt auf säurefreiem Papier Printed in Germany www.degruyter.com
Vorwort Der hier vorgelegte Band wurde mit einem Kolloquium an der Universität Heidelberg vom 7. bis 9. April 2010 vorbereitet. Den Autorinnen und Autoren waren die Themenbereiche und die Fragestellung vorgegeben worden: In den verschiedenen Medien und Gattungen sollten der ‚Eigen-Sinn‘ und die ‚Eigen-Macht‘, das heißt: die spezifischen Möglichkeiten und Grenzen ihrer Strukturen und Gesetze aufgezeigt werden, in und mit denen historische Wirklichkeit konzipiert und rezipiert wird. Dies sollte an Beispielen anschaulich gemacht und analysiert werden. Für die Publikation wurden noch einige weitere Beiträge hinzugefügt – ohne dass damit alle Lücken gefüllt worden wären. Dafür, dass alle Autorinnen und Autoren sich auf diese Themen eingelassen haben, sind wir sehr dankbar. Zum Gelingen dieses Projekts haben viele beigetragen. Das Kolloquium, das in der stimulierenden und gastfreundlichen Atmosphäre des Internationalen Wissenschaftsforums der Universität Heidelberg stattfand, ist von der Gerda Henkel Stiftung, dem Deutschen Archäologischen Institut, dem IWF Heidelberg sowie aus Mitteln des Manfred Lautenschläger Forschungspreises großzügig gefördert worden. Für den Druck des Bandes haben wiederum die Gerda Henkel Stiftung und das Deutsche Archäologische Institut Zuschüsse bewilligt. Die redaktionelle Bearbeitung des Bandes hat Jessica Bartz mit kompetenter Umsicht und unermüdlicher Sorgfalt geleistet. Die vertrauensvolle Betreuung durch den Verlag De Gruyter lag in den Händen von Mirko Vonderstein und Monika Pfleghar. Allen genannten Institutionen und Personen sagen wir unseren herzlichen Dank. Ortwin Dally Tonio Hölscher Susanne Muth Rolf Michael Schneider
Inhaltsverzeichnis
VII
Inhaltsverzeichnis Vorwort fi V Ortwin Dally, Tonio Hölscher, Susanne Muth, Rolf Michael Schneider Einführung: Historien – Historie – Geschichte: Wohin führen die Medien? fi 1 1 Die Herausforderung der Medien für die Geschichte fi 1 2 Leistungen und Grenzen der ‚Medien der Geschichte‘ fi 7 3 Das Spektrum der Medien fi 12 4 Aus der Perspektive der Medien: Geschichten oder Geschichte? fi 31 Hans-Joachim Gehrke Historiographie: Die Gegenwart in der Geschichte fi 37 1 Tradition: Geschichte im Medium von Kunst fi 37 2 Innovation: Der Einsatz der Historiographie fi 43 3 Vergangenheit und Gegenwart in der griechischen Geschichtsschreibung fi 47 Jonas Grethlein Das homerische Epos als Quelle, Überrest und Monument fi 54 1 Homer als Medium von der Antike bis in die Gegenwart fi 54 2 Homer als ‚Quelle‘ fi 56 3 Homer als ‚Überrest‘ fi 59 4 Homer als ‚Monument‘ fi 62 5 Die Spatialität des epischen Erinnerns fi 66 Renate Schlesier Symposion, Kult und frühgriechische Dichtung: Sappho im Kontext fi 74 Edith Hall Tragic Myth as Medium of Social and Cultural History: Black Sea Artemis and the Cults of the Roman Empire fi 107 Angelos Chaniotis Mnemopoetik: Die epigraphische Konstruktion von Erinnerung in den griechischen Poleis fi 132 1 Epigraphisch überlieferte Texte als Medium der Erinnerung fi 132 2 Epigraphische Texte sind das Ergebnis von Auswahl fi 135 3 Epigraphische Texte sind hypomnemata fi 137 4 Epigraphische Texte wurden als historische Zeugnisse verstanden fi 139 5 Der Ort der epigraphischen Aufstellung ist Ort der Erinnerung fi 143 6 Historische Erinnerung in epigraphischen Texten ist (auch) Erinnerung an Protagonisten und Familien fi 147
VIII
7 8 9
Inhaltsverzeichnis
Epigraphische Texte vermitteln eine selektive Version der Vergangenheit fi 151 Epigraphische Texte erwecken Emotionen fi 153 Ergebnisse fi 158
Joseph Maran Urgeschichte – Frühgeschichte: Geschichte? Das Beispiel des mykenischen Griechenland fi 170 1 Gesellschaften ohne Geschichte? fi 170 2 Das unterschätzte sozialgeschichtliche Potential materieller Kultur fi 171 3 Die Entstehung der mykenischen Kultur aus der Auseinandersetzung mit dem minoischen Kreta fi 172 4 Das Ende der mykenischen Kultur und die Erinnerung an die palatiale Vergangenheit fi 176 5 Eine kulturelle Anthropologie der Antike fi 183 Paul Zanker Bilder lesen ohne Texte fi 190 1 Endymion und Luna fi 195 2 Dionysos und Ariadne fi 199 3 Prospektive Hoffnung und respektive Erinnerung fi 201 Luca Giuliani Mythen- versus Lebensbilder? Vom begrenzten Gebrauchswert einer beliebten Opposition fi 204 Andrew Stewart Two Notes on Greeks Bearing Arms: The Hoplites of the Chigi Jug and Gelon’s Armed Aphrodite fi 227 1 The Warriors of the Chigi Jug fi 227 2 Arsinoe-Aphrodite at Arms fi 233 3 Conclusion: History as (Self-)Image fi 240 Adolf H. Borbein Das Medium der künstlerischen Form. Medium – künstlerische Form – Geschichte: Drei Begriffe und zugleich drei Problemfelder fi 244 1 Medium fi 244 2 Kunst fi 244 3 Geschichte fi 246 4 Subjektives Interesse fi 247 5 Form und Stil fi 248
Inhaltsverzeichnis
6 7
IX
Form und Zeitgeist fi 249 Usurpierte Form fi 250
Tonio Hölscher Monumente der Geschichte – Geschichte als Monument? fi 254 1 Einleitung fi 254 2 Definition: Monu-Mentalität fi 256 3 Initiatoren, Botschaften und Rezipienten fi 262 4 Die Praxis der Setzung öffentlicher Denkmäler fi 266 5 Grundthemen der geschichtlichen Repräsentation fi 273 6 Monumentale Geschichte fi 279 7 Geschichtsbewusstsein? fi 281 Susanne Muth Historische Dimensionen des gebauten Raumes – Das Forum Romanum als Fallbeispiel fi 285 1 Der gebaute Raum als plurimediales Produkt fi 285 2 Die historische Interpretierbarkeit des gebauten Raumes fi 290 3 Das Forum Romanum – Chancen und Herausforderungen der historischen Interpretation fi 294 4 Die Komplexität der Geschichte – Plädoyer für eine differenziertere Sicht auf die historischen Dimensionen des gebauten Raumes fi 320 Rudolf Preimesberger St. Peter in Rom: Medien und Gattungen seit 1506 fi 330 Karl-Joachim Hölkeskamp Raum – Präsenz – Performanz. Prozessionen in politischen Kulturen der Vormoderne – Forschungen und Fortschritte fi 359 1 Konzepte und Kategorien fi 359 2 Prozession als Performanz I: Botschaft(en) eines Mediums fi 369 3 Prozession als Performanz II: Raum, Route und Richtung fi 371 4 ‚Performative turn‘ meets ‚spatial turn‘ fi 375 Alain Schnapp Im Schatten der Pyramiden fi 396 1 Die Dichter sind langlebiger als die Monumente fi 396 2 Borges und der Schatten der Mauer fi 400 3 Kafka und die Ansichten eines Vorarbeiters fi404
X
Inhaltsverzeichnis
Ortwin Dally Bilder im Kopf. Archäologen und ihre Medien fi 408 1 Archäologen schaffen Bilder fi 409 2 Bilder prägen Archäologen fi 418 3 Die Rolle der Medien fi 428
Einführung: Historien – Historie – Geschichte: Wohin führen die Medien?
1
Ortwin Dally, Tonio Hölscher, Susanne Muth, Rolf Michael Schneider
Einführung Historien – Historie – Geschichte: Wohin führen die Medien? 1 Die Herausforderung der Medien für die Geschichte Seit jeher haben die Geschichtswissenschaften ein weites Spektrum von Zeugnissen für die Erforschung vergangener Gesellschaften und Kulturen herangezogen. Dies gilt sowohl für die Rekonstruktion der faktischen Ereignisse und Lebensformen dieser Gesellschaften als auch für ihr Verhältnis zu ihrer eigenen Geschichte1. Für das Altertum benutzen wir, neben den Werken der antiken Historiker, die uns ‚Geschichte‘ überliefern, in weitem Maß die Texte der Dichter, Philosophen und anderer Literaten, dazu Inschriften, Bildwerke, Architekturen, materielle Gegenstände der Lebenskultur, und nicht zuletzt die vielfachen Spuren der antiken Lebenswelt, die die Archäologie mit immer feineren Methoden erschließt. Johann Gustav Droysen hat bereits klargestellt, dass wir nicht die Vergangenheit als solche, sondern nur ihre Zeugnisse erforschen können2. In diesem Sinn hat er eine Klassifikation der Zeugnisse vorgenommen, verbunden mit einer Bestimmung dessen, was sie für die Erkenntnis der Geschichte zu leisten imstande sind: 1. „Überreste“, die als absichtslose Hinterlassenschaften und Spuren Zeugnis von der Vergangenheit geben, 2. „Denkmäler“, in denen eine vergangene Zeit etwas Bedeutendes für die Zukunft bezeugen, in der Erinnerung erhalten und in einer bestimmten Auffassung fixieren will, und 3. „Quellen“, in denen vergangene Zeiten Nachrichten von ihrer eigenen Vergangenheit bewahrt und gedeutet haben. Damit hat er grundsätzliche Kategorien (mit vielfältigen Unter-Kategorien) von historischen Zeugnissen aufgestellt, die bis heute für jede wissenschaftliche Auswertung maßgebend sein sollten. Die Strukturen und Intentionen der Zeugnisse sind entscheidend dafür, mit welchen Fragen, Zielen und Perspektiven sie untersucht werden können. Dabei ging es, in einem historistischen Sinn, im Wesentlichen um die Frage der korrekten Erschließung historischer Tatbestände. Die Zeugnisse waren gewissermaßen deren Transportmaterial. In diesem traditionellen Sinn treffen wir als Historiker aus dem heterogenen Spektrum von Zeugnissen bestimmte Selektionen, die von den eigenen Fragestellun-
1 Zur Geschichtskultur in schriftlosen Gesellschaften: Schott (1968); Schott (1990); Müller (1999); Schott (2000); Holtorf (2005); Müller (2005). 2 Droysen (1883/1935/1971) 31–91.
2
Ortwin Dally, Tonio Hölscher, Susanne Muth, Rolf Michael Schneider
gen bestimmt sind, um daraus eine eigene Sicht der ‚Geschichte‘ im modernen Sinn zu konstruieren3. Dabei wissen wir allerdings: Es sind Fragestellungen, die oft oder zumeist nicht den Intentionen der Zeugnisse selbst entsprechen. Aus diesem Grund wird der Umgang mit den Zeugnissen vielfach zu einer Art von Ausschlachten, bei dem das Zeugnis selbst am Ende tatsächlich mehr oder minder geschlachtet ist. Die dem Leichnam entnommenen Einzelteile übersetzen wir dann in einem koordinierenden Transfer in den Diskurs einer entweder narrativen oder systematischen Geschichte. Dabei werden Grenzen verschiedener Art überschritten. Zum einen die Grenzen zwischen den literarischen Gattungen: aus den verschiedenen Textsorten Historische Geschichtsschreibung, Epos, Lyrik, Tragödie, philosophische Abhandlung, politische Rede, Inschriften – in die zeitgenössische Historiographie. Sodann die Grenzen zwischen verschiedenen sensorischen Medien: aus dem visuellen Bereich der Bild- und Bauwerke, der topographischen Räume und der materiellen Kultur, dazu aus dem auditiven Bereich der Musik und Töne – in das Medium der verbalen und schriftlichen wissenschaftlichen Erörterung und Darstellung. Schließlich die diskursive Grenze: aus den verschiedensten sozialen Kontexten und Diskursen, in denen die Medien und Gattungen ihre Funktion hatten, – in den neuen Diskurs-Kontext der kritischen Wissenschaft4. Doch all die für die ‚Geschichte‘ verwendeten Zeugnisse sind zunächst nicht zu dem Zweck entstanden oder geschaffen worden, um damit ‚Geschichte‘ im modernen Sinn zu produzieren. Es sind vielmehr Elemente von spezifischen kulturellen Konstrukten und Diskursen vergangener Gesellschaften für ihre eigenen kulturellen Situationen und Kontexte – aus denen sie von Wissenschaftlern, die nicht diesen Kontexten angehören, herausgenommen und zu einem neuen Konstrukt von ‚Geschichte‘ konfiguriert werden. Methodisch hat es sich dabei natürlich längst durchgesetzt, die ursprünglichen Kontexte, Intentionen und eigenen Gesetze der Zeugnisse zu beachten. Wie wenig selbstverständlich das allerdings gelingt, erfahren wir täglich – freilich jeder vor allem aus seiner eigenen Perspektive5: Archäologen klagen notorisch darüber, dass Historiker und Philologen die Bildwerke als reine Illustration benutzen, ohne nach ihren genuinen Bildaussagen und Bildgesetzen zu fragen, und dass damit der eigentliche geschichtliche Wert der Zeugnisse verkannt oder verfehlt wird. Kritik in der Gegenrichtung, an der Verwendung antiker Schriftquellen durch die Archäologen, ist gewiss eben so häufig und berechtigt. Andererseits werden inzwischen aber auch Stimmen laut, die den Zeugniswert der jeweils anderen Medien in polemischer Weise bestreiten. Methodenbewusste Archäologen gehen mit unterschiedlicher Motivation den Texten aus dem Weg: entweder weil sie dort immer gleich individuelle und
3 Wenn im Folgenden ‚Geschichte‘ z.T. in gnomische Anführungszeichen gesetzt wird, so soll damit der Charakter von ‚Geschichte‘ als Konstrukt hervorgehoben werden, im Unterschied zu Geschichte als dem Geschehenen. 4 Zu Medien und Gattungen s. unten S. 6 und 10. 5 Selbstverständlich sind die folgenden Bemerkungen mit Absicht holzschnittartig vereinfacht.
Einführung: Historien – Historie – Geschichte: Wohin führen die Medien?
3
meist elitäre Sinnstiftungen fürchten, wogegen sie die angebliche ‚Objektivität‘ von Grabung und Survey ins Feld führen. Umgekehrt stellen Historiker zunehmend die genuine Bedeutung von Denkmälern und Bildwerken in Frage, soweit keine erläuternden Schriftzeugnisse vorhanden sind. Dann bleibt nur noch die tautologische Feststellung, sei es als Vorwurf oder als Resignation: „Eine Vase ist eine Vase ist eine Vase …“6. Es bedarf darum möglichst präziser Einsicht in die spezifischen Leistungen der einzelnen Medien und Gattungen, um sie sinnvoll aufeinander zu beziehen. Doch das Problem liegt vielleicht noch tiefer. Denn was wir als Historiker – historisch orientierte Archäologen und Philologen eingeschlossen – eigentlich tun, wenn wir bei der Benutzung von Zeugnissen deren spezifische Kontexte und Gesetzmäßigkeiten berücksichtigen, ist oft mehr oder minder: diese Kontexte kritisch zu ‚hinterfragen‘, sie methodisch ‚heraus-zu-dividieren‘, das heißt: sie so gut wie möglich zu eliminieren, um einen brauchbaren ‚Kern‘ des betreffenden Zeugnisses für die eigene historische Fragestellung zu gewinnen. Dann zieht man aus einem literarischen Text die dichterischen Stilzüge und die rühmenden Intentionen, aus einem Bilddenkmal die Gesetze und Formgebungen der Bildkunst und die Verformungen durch die Absichten des Auftraggebers ab, um zu der dahinter stehenden ‚Wirklichkeit‘ zu gelangen. Man muss sich aber fragen, wie weit das überhaupt möglich ist – und, sofern man davon überzeugt ist, wie direkt man auf dies Ziel eigentlich zusteuern sollte. Denn es ist sicher nicht damit getan, dass man eine gewisse kritische ‚Kennerschaft‘ und Kompetenz in den betreffenden Medien und Gattungen entwickelt, sondern zunächst ist davon auszugehen, dass die Konstitution von Geschichte immer „Mnemopoetik“ (siehe Beitrag Chaniotis) ist und bei den Griechen insbesondere immer ein Akt der „Kunst“ war (siehe Beitrag Gehrke). Die Aufgabe ist daher, grundsätzlich danach zu fragen: welche spezifischen Vorgaben und Gesetze die einzelnen Medien und Gattungen implizieren? welche eigenen Leistungen sie für die Frage nach der ‚Geschichte‘ erbringen können? welche verschiedenen Sichten auf die Welt oder die Geschichte in den Medien und Gattungen konstruiert werden? welche inhaltlichen und strukturellen Vorgaben damit für das Begreifen von Welt und Geschichte gemacht werden? Erst dann kann man wohl wieder die Frage stellen, ob und wie dies alles konzeptuell in eine Relation zueinander gesetzt und für ‚Geschichte‘ in unserem Sinn verwendet werden kann7. Seit langem hat es Ansätze gegeben, auf der Grundlage einzelner Medien und Gattungen ‚Geschichte‘ zu schreiben. Zwei sehr verschiedenartige Beispiele können zeigen, mit welchen Problemen und Möglichkeiten das verbunden ist:
6 Gotter (2000) 399. 7 In der neueren Geschichtswissenschaft sind in letzter Zeit wichtige Arbeiten zur Interferenz von Medien und Geschichte vorgelegt worden: bes. Borsó u. Kann (2004); Crivellari u. a. (2004).
4
–
–
Ortwin Dally, Tonio Hölscher, Susanne Muth, Rolf Michael Schneider
Ernst Buschor hat, beginnend mit seinem Frühwerk Griechische Vasenmalerei von 1913, die Entwicklung der griechischen Kunst als einen Lebensvorgang, als Lebensgeschichte einer „Persönlichkeit“ beschrieben, auf den Spuren Winckelmanns, allerdings weit radikaler8. Griechische Plastik hatte eine Geburtsstunde (um 1000 v. Chr.) und durchlief die Lebensphasen von Blüte, Reife und Auflösung. Mehr noch: Die Lebensgeschichte der griechischen Plastik war eins mit der Lebensgeschichte des griechischen Volkes. Die Körper und Köpfe der Bildwerke werden gewissermaßen zu Lebensstufen eines übergeordneten (Volks-)Körpers; dessen irrationaler Kern wird als ein nicht mehr substantieller „Lebensträger“ angesprochen. Die inhärente Stimmigkeit dieses Konzepts ist erkauft durch Absehen von allen konkreten Funktionen der Bildwerke in den verschiedenen Kontexten des realen Lebens. Wenn man den Ansatz konsequent weiter verfolgte, so würden all die Ereignisse und Vorgänge der griechischen Geschichte, die Kriege und sozialen Konflikte, die Lebensformen, Leistungen und Leiden der Griechen, im wesentlichen als Emanationen dieser immanenten Volks-Persönlichkeit und als Arabesken um die organische Entfaltung dieser Grundformen der Bildenden Kunst erscheinen. Dafür steht Buschors kolportiertes Aperçu, nicht die Perserkriege hätten den ‚Strengen Stil‘ heraufgeführt, sondern umgekehrt hätte der Strenge Stil, das heißt das damals in der Bildkunst entwickelte Menschenbild, die Griechen in den Stand gesetzt, den Angriff der Perser zurückzuschlagen9. Geschichte wird hier zur Stilgeschichte des Körperbildes. Wenngleich man dem schwerlich folgen wird, so liegt doch in den Beobachtungen dieses Ansatzes eine Herausforderung, der sich auch der Historiker nicht entziehen sollte: Denn wenn einerseits die Stilformen der Bildkunst tatsächlich eine gewisse eigene Dynamik der Veränderung besitzen, und wenn man andererseits davon ausgeht, dass der Stil der Bildkunst in irgendeiner (noch genauer zu bestimmenden) Verbindung zu den sozialen und mentalen Verhältnissen der betreffenden Zeit steht, dann ist die Frage nach dem Verhältnis von Stil und Geschichte schwer zu umgehen (siehe dazu Beitrag Borbein). Im Jahr 1966 veröffentlichte der Ägyptologe Erik Hornung eine kleine Schrift Geschichte als Fest, in der er aus altägyptischen Texten und Bildwerken ein ägyptisches Konzept von ‚Geschichte‘ entwickelte, das stark rituellen Charakter hat10. Der Pharao erscheint in dieser Auffassung als eine Gestalt, die die Aufgabe hat, die Ordnung der Welt durch wiederkehrende Handlungen gegen die Feinde dieser Ordnung zu verteidigen und aufrecht zu erhalten. Er tut das durch ständige Kriege gegen die Fremdvölker des Nordens und des Südens, durch regelmäßige
8 Buschor (1914) 7–10; Buschor (1936). 9 Das Dictum wurde von Schülern Ernst Buschors überliefert, in seinen Schriften scheint es sich nicht zu finden. 10 Hornung (1966).
Einführung: Historien – Historie – Geschichte: Wohin führen die Medien?
5
Ausübung des Kultes für die Götter, durch Rituale, die den Lauf der Sonne als Garantie der Weltordnung in Gang halten. Alle Pharaonen sind Träger einer gleichbleibenden Rolle in dem kultischen Drama einer Geschichte, in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in eins fallen. Das Konzept der königlichen Rolle ist so stark, dass Texte und Bildwerke sie auch dann darstellen, wenn sie in Wirklichkeit gar nicht realisiert wurde: Kriege, die nicht stattgefunden haben; Störungen der Ordnung, die nicht eingetreten sind und nicht bewältigt werden mussten; Kulthandlungen, die nicht vom Pharao selbst vollzogen worden sind. Der Pharao ist der Haupt-Akteur in einem sich ewig wiederholenden Schauspiel auf der Bühne der Welt. In diesem Sinn deutet Hornung die altägyptische Auffassung von Geschichte als ein rituelles „Fest“. Wer an Ereignisgeschichte interessiert ist, kann diese Zeugnisse kritisch werten, kann ‚erfundene‘ oder ‚verfälschte‘ Informationen eliminieren und jene Fakten herausfiltern, die trotz dieses Geschichtskonzepts als ‚verlässlich‘ angesehen werden können. Aber natürlich ist das kein produktiver Umgang mit den Zeugnissen. Denn in vielerlei Hinsicht interessanter ist das Phänomen „Geschichte als Fest“ selbst – und vielleicht ist das sogar die stärkere ‚Realität‘. Wenn somit Geschichte sich in den Formen des künstlerischen Stils oder eines Herrscher-‚Rituals‘ manifestieren kann, so wird man darüber hinaus etwa fragen: Wie steht es mit Geschichte als Tragödie? Wie wird Geschichte in der Tragödie aufgefasst und in den Dialogen dieser Gattung strukturiert? Geht von hier aus ein Weg zu der „tragischen Geschichtsschreibung“ des Hellenismus? Können wir heute den Peloponnesischen Krieg als Tragödie verstehen? Was würde man dabei gewinnen, was verlieren? Und weiter: Wie gestaltet sich Geschichte als Epos? als Epigramm bzw. als „epigraphic habit“? als Mythos? als Bild oder Folge von Bildern? als Monument? als Architektur? als Konglomerat von Spuren? Was sind das für Geschichten, die in und von den antiken Medien konstruiert werden? Und welche Art von Geschichte(n) können wir daraus machen? Schließlich auch: Welches ist die Begründung dafür, dass wir bestimmte schriftliche Formen der Darstellung und Erörterung von Geschichte privilegieren, in die wir all die verschiedenen Zeugnisse integrieren11? Gewiss ist es nicht ausreichend, pragmatisch auf einer allgemeinen Offenheit für die Verwendung verschiedener Medien und Gattungen historischer Zeugnisse zu bestehen. In der Regel wird ein solcher Pluralismus damit begründet, dass in den verschiedenen Medien und Gattungen der historischen Überlieferung verschiedene Aspekte der ‚Geschichte‘ transportiert werden, die der wissenschaftliche Autor in den Blick nehmen, erforschen und darstellen will. Damit werden die Medien gewissermaßen als eine Linse betrachtet, deren spezifische Verzerrungen eliminiert werden müssen, um die Geschichte aus der eigenen Perspektive zu sehen und durch eine Verbin-
11 Allgemein zu diesen Fragen s. Trabant (2005).
6
Ortwin Dally, Tonio Hölscher, Susanne Muth, Rolf Michael Schneider
dung von verschiedenartigen Zeugnissen zu rekonstruieren. Die Betrachtung wird aber viel gewinnen, wenn zunächst die Medien und Gattungen als solche genauer in den Blick genommen werden. Denn bereits die antiken Autoren der Texte und die Auftraggeber und Konzipienten der Denkmäler haben in den verschiedenen Medien und Gattungen, nach jeweils spezifischen Vorgaben, Sichtweisen und Strukturen, eine andere ‚Geschichte‘ in den Blick genommen und konstruiert; entsprechend (re-)konstruiert die Forschung mit den verschiedenen Medien jeweils andere ‚Geschichten‘. In diesem Sinn werden im Folgenden die ‚Medien der Geschichte‘ in den Blick genommen, weil der Begriff des Mediums in besonderem Maß auf eine differenzierte Analyse der spezifischen Gestaltungen von Geschichte zu führen vermag, die z.T. durch die sinnlichen Vorgaben von Sprache, Schrift, Bild und materiellen Objekten natürlich vorgegeben, z.T. durch die konzeptuellen Formen der Gattungen und Funktionstypen vorgeprägt sind12. Gegenüber dem Begriff des ‚Zeugnisses‘ werden dadurch der Eigenwert und das eigenständige Potential der Baumaterie hervorgehoben, mit der wir aus der eigenen Perspektive Geschichte konstruieren. Dabei ergeben sich folgende allgemeine Feststellungen: – Medien und Gattungen machen unterschiedliche Themen und Inhalte zum Gegenstand. – Medien und Gattungen unterscheiden sich strukturell in ihren Kapazitäten der Darstellung und der diskursiven Strukturierung ihrer Themen bzw. der Repräsentanz geschichtlicher Phänomene. – Medien und Gattungen werden in spezifischen gesellschaftlichen Bereichen und Situationen für bestimmte Kommunikationen eingesetzt. Dabei können sie mehr oder minder formell in spezifisch politischen, gesellschaftlichen oder religiösen Institutionen verankert sein. – Medien und Gattungen werden von Initiatoren, Konzipienten und Autoren mit bestimmten Intentionen genutzt und eingesetzt. Sie wenden sich an spezifische Rezipienten mit spezifischen Vorstellungen und Erwartungen. Dabei kommen z.T. spezifische gesellschaftliche Normen, Regeln und Gebräuche zur Geltung. – Medien und Gattungen entfalten zunächst eigene medienspezifische Diskurse. Geschichtswerke antworten auf frühere Historiographie, öffentliche Denkmäler auf frühere Monumente, Münzen auf frühere Prägungen. – Medien und Gattungen erfordern spezifische Weisen der Rezeption: des Lesens und Betrachtens, Zuhörens, Zuschauens und Teilnehmens. Sie provozieren bestimmte Arten der Reaktion: politisch, ethisch, religiös, ästhetisch, emotional, und so fort.
12 In ähnlichem Sinn s. auch Crivellari u.a. (2004) bes. 9–45. Zur Definition des Medienbegriffs s. etwa: Kloock u. Spahr (2000); Hickethier (2003); Leschke (2003); Lagaay u. Lauer (2004); Münker u. Roesler (2008).
Einführung: Historien – Historie – Geschichte: Wohin führen die Medien?
7
Die verschiedenen ‚Medien der Geschichte‘ haben zum Teil in der Antike und für die Antike spezifische Historien geschaffen; zum Teil bilden sie die Grundlage für die Konzeption unterschiedlicher Historien in der Geschichtswissenschaft der Neuzeit. Wie weit diese Historien zu einem Bild einer gesamten Historie der Antike zusammengeführt werden können oder sollten, und in welcher Form sie einen Blick auf die Komplexität der geschehenen Geschichte eröffnen, ist eine Frage, die der Historiker kaum endgültig beantworten, aber immer im Blick behalten wird13.
2 Leistungen und Grenzen der ‚Medien der Geschichte‘ Die Frage nach den Medien hat in jüngster Zeit in den historischen Wissenschaften zunehmende Aufmerksamkeit erfahren14. Das gilt auch mehr und mehr für die Forschungen zur griechischen und römischen Antike. Dabei geht es zum einen, ausgelöst durch die ‚Macht der Medien‘ in der heutigen Welt, um die persuasive Kraft antiker Medien, etwa der Rhetorik, der öffentlichen Inschriften, des Theaters oder auch der Bildkunst, in der Lebenspraxis der Antike selbst15. Darüber hinaus ist aber auch, zum anderen, die Bedeutung der antiken Medien für die Methoden und theoretischen Ansätze der modernen Geschichtswissenschaft neu in den Blick getreten. Für die römische Republik hat Uwe Walter dargelegt, dass die Medien der öffentlichen Rede, des Theaters, der Gedächtnisorte und öffentlichen Denkmäler, der religiösen Fest- und Gedenktage, der vor- und nichtliterarischen Aufzeichnungen und schließlich der kohärenten Historiographie „erhebliche Relevanz für die erinnerten Inhalte“ besaßen16. Jonas Grethlein hat die Thematisierung der eigenen Vergangenheit in der griechischen Antike im Vergleich zwischen verschiedenen Gattungen der Literatur untersucht, die er grundsätzlich als gleichrangige Perspektiven auf die Vorzeit betrachtet17. In ähnlichem Sinn hat Susanne Muth für eine medientheoretische Reflexion über die unterschiedlichen Potentiale der verschiedenen historischen Medien und die Konsequenzen für den methodischen Zugriff auf die medialen Zeugnisse als historische Quellen plädiert18. Implizit findet die mediale Eigengesetzlichkeit der historischen Quellen und Zeugnisse in steigendem Maß Beachtung. 13 S. Luca Giuliani in seinem Beitrag in diesem Band. 14 Unter den zahlreichen Einführungen in die Medientheorie seien genannt: Helbig (1998); Merten (1999); Kloock u. Spahr (2000); Hickethier (2003); Leschke (2003); Münker u. Roesler (2008); Engell, Bystricky u. Krtilova (2010). – Medien und Geschichte s. Anm. 7. 15 S. etwa Engell (2003); Hesberg u. Thiel (2003); Peter u. Seidlmayer (2006); Marincola, LlewelynJones u. Maciver (2012), mit ähnlicher Zielsetzung wie der hier vorgelegte Band. 16 Walter (2001). 17 Grethlein (2010). 18 Muth (2011).
8
Ortwin Dally, Tonio Hölscher, Susanne Muth, Rolf Michael Schneider
Für ein positivistisches Interesse an der Geschichte, das auf Rekonstruktion dessen zielt, „wie es eigentlich gewesen“ ist, würde das ideale (antike) Medium sich durch totale Durchsichtigkeit, gewissermaßen durch Inexistenz auszeichnen, indem es einen ‚reinen‘ Inhalt transportiert. Doch das wäre natürlich eine historistische Illusion: Das durchsichtige Medium kann es nicht geben. Vor allem aber: Es wäre eine eklatante Verkürzung des tatsächlichen Potentials der Medien, zeichnen diese sich doch durch einen Überschuss an gestiftetem und vermitteltem Eigen-Sinn aus, der immer im Blick zu behalten ist19. Letzten Endes würde es zu einer fruchtlosen Engführung unserer Fragestellungen führen: Zum einen haben wir Geschichte nur in der Vermittlung durch die Medien in ihrer prägenden Form; dem ist nicht zu entrinnen. Zum anderen wird man sich fragen, wie sinnvoll das Entrinnen eigentlich wäre; denn die Medien machen die transportierten Inhalte erst zu historischen Faktoren. Nicht zuletzt: Wir selbst können die Geschichte auch nur wieder in medialer Form konstruieren20. Die Frage nach den Medien, das heißt nach den konkreten Texten, Bildern und sonstigen Artefakten, kann somit gewiss nicht bedeuten, den Blick durch sie hindurch auf etwas anderes zu richten, was dann ‚die Geschichte‘ wäre. Denn die medialen Ausprägungen kultureller Vorstellungen sind Faktoren und Teil der Geschichte (siehe u.a. Beitrag Chaniotis). Sie sind Elemente von sozialen Praktiken und Diskursen, ohne die sie nicht verständlich sind, die aber auch ohne sie nicht verständlich sind: Ohne die wechselseitige Interferenz würden weder die Praxis noch die ‚Gegenstände‘ überhaupt existieren. Eine Alternative, ob man durch die Medien auf die Geschichte oder von der Geschichte her auf die Medien blickt, kann es gar nicht geben. Die Texte, Bilder und Artefakte, wenn genau betrachtet, bringen daher eben so viel Überraschung und neue Erkenntnisse für die Geschichte wie die Geschichte Überraschungen für das Verständnis der einzelnen Werke der Bildkunst und Literatur. Neuere Ansätze der Sozial- und Kulturwissenschaften haben im Gewebe der kulturellen Praxis den ‚Gegenständen‘, insbesondere den Artefakten, einen neuen Status von eigenständiger Wirkungskraft gegeben. Damit wurden ältere Konzepte der Semiotik und Kommunikationstheorie überwunden, die vor allem die menschlichen Akteure, ‚Sender‘ und ‚Rezipienten‘, in den Vordergrund gestellt und den medialen
19 Prägnant hierzu etwa Münker (2008) 327–328; s. auch u. Luca Giuliani und Susanne Muth in ihren Beiträgen in diesem Band. 20 S. Crivellari u.a. (2004) 20: „ … dass Medien selbst elementare Produktivkräfte des Geschichtlichen sind“. Grundsätzlich Crivellari, Kirchmann u.a. (2004) 32 über „die Medialität des Historischen und damit … die Grundlagen des eigenen Fragens, Verstehens und des Umgangs mit den Quellen. Die medienwissenschaftliche Herausforderung für die Geschichtswissenschaften besteht also in den erkenntnistheoretischen Implikationen der Mediendebatte. Medien erscheinen dann freilich nicht mehr als ein bestimmter, zu isolierender Gegenstandsbereich; Medien strukturieren die Wahrnehmungs- und Kommunikationsmöglichkeiten von Individuen und Gesellschaften in einer umfassenden Weise. Sie sind nicht Vermittlungsinstanzen von Sinn, sondern stellen Bedingungen der Möglichkeit von Sinnbildungsprozessen dar, die sowohl den historischen Gegenstand als auch seine Erkenntnisweisen betreffen.“
Einführung: Historien – Historie – Geschichte: Wohin führen die Medien?
9
Faktoren als ‚Zeichen‘ eine vergleichsweise geringe, konventionelle Bedeutung zugemessen hatten. Der Sozialanthropologe Alfred Gell gibt Artefakten im Rahmen sozialen Handelns eine eigenständige Rolle als Verkörperungen menschlicher Intentionen, der Sozialwissenschaftler Arjun Appadurai erkennt kulturellen Produkten, soweit sie als ‚Ware‘ in Austauschprozesse eingebunden sind, eine Art ‚Biographie‘ wie Lebewesen zu, und der Philosoph Bruno Latour begreift Gegenstände als ‚Aktanten‘ in einem ‚sozialen‘ Netzwerk, das aus lebenden wie unbelebten Teilnehmern besteht. In solchen theoretischen Ansätzen erhalten die ‚Dinge‘ der sozialen Praxis eine kulturelle ‚Bedeutung‘, im Sinn von Signifikanz, die als bedingt eigenständige Wirkmacht begriffen wird. Für die Kunstwissenschaft hat Hans Belting ein anthropologisches Konzept des Mediums begründet, das den „inneren Bildern“, das heißt den bildlichen Vorstellungen einer Gesellschaft ‚lebendige‘ Präsenz als Faktor der sozialen Lebenswelt gibt. In diesem Sinn kann es nicht darum gehen, Texte, Bilder und andere Artefakte der Geschichte ein- und unter-zuordnen, sondern Geschichte kann nur aus und mit diesen Elementen konstituiert werden. Die Medien sind die Gestalt, in der Geschichte uns entgegentritt21. In diesem Sinn bedeutet die Frage nach der Geschichte nicht eine Abwendung von den Medien, Texten wie Bildwerken, als solchen, sondern im Gegenteil eine dichte Betrachtung. Sie bedeutet aber zugleich mit Emphase, den Blick auf die Menschen und Gesellschaften zu richten, die diese kulturellen Manifestationen und Praktiken produziert und genutzt haben. Diese Frage ist kaum zu umgehen, wenn die Beschäftigung mit den historischen Kulturen mehr als ein lebensfernes intellektuelles Spiel sein will: Die Frage, wie die historischen Menschen und Gesellschaften die Texte und Bilder gebrauchten, ist zugleich die Frage, warum sie sie brauchten. Der Begriff des Mediums oszilliert bekanntlich zwischen allgemeiner und konkreter Bedeutung, zwischen generativem Potential und realisiertem Produkt: zwischen Sprache und Text, Bildkunst und Bildwerk, Technik und hergestelltem Gegenstand22. Das Potential ist dabei ganz auf Realisierung angelegt. Das bedeutet nicht nur die Herstellung des Textes, Bildes oder Artefakts als solchen, sondern auch deren Nutzung in kultureller Praxis, in Akten des Hörens, Lesens, Sehens, Tastens, kurzum des Erlebens und Gebrauchs. Damit sind weiterhin die sozialen Situationen und Institutionen impliziert, in denen diese Nutzungen stattfinden. Wenn somit hier die Medien in das Zentrum der kulturellen Praxis und damit auch der historischen Forschung gestellt werden, dann ist dieser Begriff in einem weiten Sinn gemeint. Medien sind Verkörperungen und Übermittler von Bedeutung. Das gilt zunächst für die primären Medien, die im Wesentlichen auf die Grundfähigkeiten
21 Gell (1998); Appadurai (1986); Latour (1991, 1999, 2005, 2007); Belting (2001). 22 Überblick über die verschiedenen Definitionen des Medienbegriffs und ihre Anwendungen in der Forschung s. etwa: Kloock u. Spahr (2000); Hickethier (2003); Leschke (2003); Lagaay u. Lauer (2004); Münker u. Roesler (2008).
10
Ortwin Dally, Tonio Hölscher, Susanne Muth, Rolf Michael Schneider
der Wahrnehmung mit den menschlichen Sinnen ausgerichtet sind: Sprache und Schrift zum Hören und Lesen, Bilder und andere Artefakte zum Sehen und Tasten, schließlich Töne und Gerüche. Mit den verschiedenen sensorischen Medialisierungen sind jeweils grundlegende Bedingungen und Möglichkeiten der Vermittlung von ‚Sinn‘ in der sozialen Kommunikation vorgegeben. Wenn man darüber hinaus die konstruktiven Vorgaben der Medien genauer erfassen will, dann richtet sich die Frage auf weitere mediale Faktoren: zum einen auf materielle Qualitäten, zum anderen auf konventionelle formale Strukturen. – Unter den materiellen Ausprägungen und technischen Möglichkeiten von Medien wären für die Sprache etwa zu nennen: die Sprechakte Rede, Rezitation, Gesang, Dialog, dazu das performative Spiel; für die Schrift: die skripturalen Produkte Buch und Inschrift, später Zeitung und elektronischer Display; für die Bildkunst: die Formen Standbild, Relief, Malerei und Mosaik, mobile Bildträger, später Photographie und Film. Daran schließen sich andere materielle Träger von Bedeutung an: symbolische und funktionale Gegenstände, Architekturen und Gestaltungen der Umwelt. Nicht zuletzt gehören in diesen Zusammenhang menschliche Körper mit Kleidung und Kosmetik, Mimik und Gestik; und schließlich die konkreten Formen kultureller Handlungen, von funktionalen Aktionen bis zu Ritualen und anderen performativen Akten. Dabei stellt sich für vergangene Kulturen z.T. das komplexe Problem, dass Medien wie der menschliche Körper und seine Handlungen nicht mehr unmittelbar zugänglich werden und heute nur noch in der Vermittlung durch andere Medien erhalten sind. Alle diese ‚Medien‘ verkörpern und übermitteln Bedeutung. In der materiellen Realisierung werden die Medien Faktoren der kulturellen Praxis. – Die Vorgabe formaler Grundstrukturen beruht auf traditionellen kulturellen Konventionen. In der Literatur sind es Kategorien wie Epos, Lyrik und Drama mit ihren Sub-Typen, Roman, Historiographie, Ekphrasis, in der Bildkunst Grundtypen wie Kultbild, Votivbild und Ehrenstatue, architektonische Friese, Metopen und Giebel, Grabrelief, Vasenmalerei, in der Lebenswelt etwa Gebet, Grabrede, politische Debatte. Damit kommt der Begriff der Gattung ins Spiel23. Medientheorie und Gattungstheorie sind daher nicht zu trennen. – Die Realisierung und Aktualisierung der medial geformten Produkte und Manifestationen geschieht in spezifischen sozialen Situationen und Institutionen: beim religiösen Fest, in der Volksversammlung, beim Gastmahl und beim Grabritual, zuletzt auch im privaten Leseraum, später in Kirche, Museum und Theater,
23 Zum Zusammenhang von Medien und Gattungen s. Raible (2006) 21–22., der die ‚kommunikativen Gattungen‘ des Alltagslebens und die Text-Gattungen der Schriftkultur zu den „kulturell geschaffenen(n) und kulturell verbindliche(n) symbolische(n) Formen“ der ‚Schönen Künste‘ zählt und als „Beispiele für Mediatisierung“ nennt. Dabei ist allerdings zu beachten, dass es in der Archäologie und Kunstgeschichte kein ausgearbeitetes Äquivalent zu der Gattungstheorie der Literaturwissenschaft gibt.
Einführung: Historien – Historie – Geschichte: Wohin führen die Medien?
–
11
Bibliothek, Radio und Fernsehen. Die jeweiligen Kontexte schaffen spezifische Bedingungen sowohl für die intendierten Aussagen wie für ihre Rezeption. Dem entsprechend können Medien und medial geformte Produkte in unterschiedlichen kulturellen und sozialen Kontexten eine andersartige Bedeutung annehmen. So hat eine Vase aus Athen, die in einem etruskischen Grab, einer iberischen Siedlung oder einem Kurgan auf der Krim gefunden worden ist, nicht notwendigerweise dieselbe Semantik wie in Athen selbst24.
Insgesamt stellen die Phänomene, die damit unter dem Begriff des Mediums zusammengefasst werden, ein Zusammenspiel aus natürlich-sensorischen, konventionellformalen, pragmatisch-funktionalen und performatorischen Praktiken und Faktoren dar. Diese Offenheit wird, in Übereinstimmung mit neueren Ansätzen der Kommunikations- und Medienwissenschaft, um den Preis erkauft, dass damit möglicherweise ein geschlossener Begriff des Mediums in Frage gestellt wird. Da es hier aber nicht um eine systematische Medientheorie, sondern um die Bedeutung der Medien für die Sicht auf die Geschichte geht, schien es sinnvoll, den Rahmen möglichst breit zu ziehen. Eine weitere Unschärfe, vielleicht besser eine Ambivalenz, die zunächst irritieren kann, die aber bewusst in die Fragestellung einbezogen wurde, liegt darin, dass die verschiedenen Medien in sehr unterschiedlichem Sinn und Ausmaß ‚Medien der Geschichte‘ sind. Die Historien des Herodot oder das Denkmal der athenischen Tyrannenmörder sind Medien, die intentional Geschichte in einer bestimmten Deutung darstellen und übermitteln. Dagegen sind ein Gedicht der Sappho oder ein athenisches Vasenbild zwar intentionale Träger von sozialen und kulturellen Sinn-Bedeutungen, aber nicht mit dem Zweck einer Bewahrung von ‚Geschichte‘; dazu werden sie erst von den heutigen Historikern gemacht. Und die Gegenstände, Bauten und Installationen des funktionalen Gebrauchs, die Geräte, Häuser und Opferstellen, die die archäologischen Grabungen als Überreste und Spuren zutage fördern, sind vielfach nicht einmal als Träger von Bedeutungen produziert und hinterlassen worden; hier stellen die Historiker überhaupt erst Bedeutung fest und ‚Geschichte‘ her. Diese Ambivalenz zwischen intentionalen und nicht-intentionalen Trägern von Geschichte ist in der Kunstgeschichte seit langem am Begriff des ‚Denkmals‘ bewusst gemacht worden25: Denkmäler im engeren Sinn des ‚Monuments‘ werden errichtet, um ‚Geschichte‘ zu begründen, Denkmäler im weiten Sinn werden aus historischer Perspektive konserviert, um ‚Geschichte‘ zu bewahren. Diese Ambivalenz hat ihre Begründung darin, dass in der Antike alle Darstellungen von geschichtlicher Vergangenheit in hohem Maß aus der Perspektive der Gegenwart und für die Gegenwart konzipiert sind. Zum einen ging es um Vergegenwärtigung
24 Die Forschung zum kulturellen Transfer ist in neuerer Zeit stark angestiegen. Beispiele bei Fless (2002); Reusser (2002). 25 Riegl (1903/1995). S. u. Beitrag Hölscher.
12
Ortwin Dally, Tonio Hölscher, Susanne Muth, Rolf Michael Schneider
der mythischen Vorzeit als Tradition und Exempel für die aktuelle Situation, zum anderen um die Rühmung der eigenen Zeit als exemplarische Vergangenheit für die antizipierte Zukunft: beides im Sinn einer „intentionalen Geschichte“ (Hans-Joachim Gehrke) für eigene und künftige Gegenwarten. Doch selbst die rationale und kritische Historiographie seit Herodot und Thukydides stellt die Ereignisse und Vorgänge ‚intentional‘ aus der Sicht der Gegenwart und mit dem Anspruch auf nützlichen Besitz für künftige Gegenwarten dar. Insofern sind die Geschichtswerke wie die GeschichtsMonumente nicht nur Quellen zu den darin bewahrten Vergangenheiten, sondern zugleich auch Zeugnisse und Überreste ihrer eigenen Gegenwarten. Darin treffen sie sich mit den übrigen ‚Medien der Geschichte‘, die der Historiker in seine eigenen Konzepte der Geschichte zusammenführt. Die Medien sind die Formen, in denen Geschichte dokumentiert ist, gedacht wird und stattfindet. Diese Zusammenführung der Medien in der Sicht des Historikers wirft aber eine weitere grundsätzliche Frage auf. Die Medien haben ihre eigenen Vorgaben und Gesetze, ihre spezifische Leistungs-Kapazität, ihr Eigen-Gewicht, ihren Eigen-Sinn. Jedes Medium ‚kann‘ das eine, aber nicht oder nur bedingt das andere, und das eine wie das andere auch nur in bestimmter Weise. Daraus entwickeln sich jeweils eigene Rahmen und Regeln, die für die verschiedenen Medien Geltung besitzen. Und das führt weiter dazu, dass es innerhalb einzelner Medien zu einem inner-medialen Diskurs kommt: Ein Werk der Historiographie bezieht sich nicht nur auf eine geschichtliche Realität, eine Tragödie nicht nur auf einen Mythos, ein politisches Denkmal nicht nur auf ein Ereignis oder eine Person, sondern sie beziehen sich zugleich auch auf frühere Geschichtswerke, frühere Tragödien, frühere Denkmäler. Diese medien-internen Diskurse sind Subsysteme mit einer gewissen Eigen-Dynamik, die sich einem homogenisierenden Konzept der ‚Geschichte‘ entgegenstellt. Auf diesen Eigen-Sinn muss man sich erst einmal ganz einlassen: Was leistet ein Text, in Prosa, in Versen, in Dialogen, was leistet ein Bild, ein Ritual, eine Spur für die Erkenntnis und Konstruktion von ‚Geschichte‘? Man könnte das als Experiment auf die Spitze treiben: Welche Geschichte ergäbe sich, wenn wir sie in erster Linie aus den Informationen und nach den Konzepten des Epos, der Tragödie, der Inschriften, der Monumente, der Vasenbilder konstruierten?
3 Das Spektrum der Medien Die folgenden Bemerkungen haben nicht zum Ziel, die Beiträge dieses Bandes zusammenzufassen – womit die vielschichtigen Darstellungen und Überlegungen nur auf dürre Allgemeinheiten reduziert würden. Vielmehr wird versucht, anhand der verschiedenen Ansätze einige allgemeine Linien durch das hier ausgebreitete Spektrum der ‚Medien der Geschichte‘ und ihrer Leistungspotentiale zu ziehen.
Einführung: Historien – Historie – Geschichte: Wohin führen die Medien?
13
Literatur Geschichtsschreibung. Die ‚professionelle‘ Historiographie, die seit der griechischen Antike die Tradierung und Reflexion der geschichtlichen Vergangenheit beherrscht, hat in neuerer Zeit den Status der Alleinvertretung mehr und mehr verloren. HansJoachim Gehrke stellt die Entstehung der Geschichtsforschung des Hekataios, Herodot und Thukydides in den Horizont unterschiedlicher, vor allem älterer Formen der Vergegenwärtigung der Vergangenheit. Die Pluralität der Sichtweisen auf die Geschichte ist zum einen dadurch geprägt, dass „der Blick der Griechen auf und in ihre Geschichte … der Blick des Künstlers“ war. Damit ist hier in erster Linie die Kunst der ästhetischen Variation, Attraktion und Verlebendigung gemeint. Hinzu kommen die spezifischen Strukturen der Medien und Gattungen, in den verschiedenen Situationen ihrer Nutzung und mit ihren jeweiligen impliziten Sichtweisen, nach denen in dem hier vorgelegten Band gefragt wird. Diese Grund-Voraussetzung, dass Geschichte ein Produkt kultureller Konzepte ist, hängt zum zweiten mit der von Gehrke als konstitutiv betonten Sicht der Vergangenheit aus der Gegenwart und für die Gegenwart zusammen. Ein stark „intentionaler“ Gebrauch von ‚mythischer‘ Geschichte wird bei den epischen Sängern der Frühzeit deutlich, die für eine zunehmend tiefe Vorzeit die Sicherung des Nachruhms zur Aufgabe haben und dabei ein komplexes Wechselspiel zwischen Vergangenheit und antizipierter Zukunft schaffen. In den Epen, ebenso wie in anderen Formen der Dichtung und insbesondere in performativen Praktiken wie Chorgesängen und Tänzen, wird die große Vergangenheit von den gegenwärtigen Akteuren nicht nur rezipiert, sondern geradezu inkorporiert. Gegenüber solchen ‚intentionalen‘, auf Exempel und Paränese gerichteten Formen der ‚Geschichte‘ erscheint die neue, nach Regeln des Denken ermittelnde und kritisch prüfende Geschichtsforschung des 5. Jahrhunderts v. Chr. alles andere als selbstverständlich und in hohem Maß erklärungsbedürftig. Zwar blieb die Bewahrung von Ruhm ein entscheidendes Motiv, und entsprechend blieben Traditionen epischer Darstellung in Gebrauch. Aber als Praxis war die neue Geschichtsschreibung nicht mehr in gemeinschaftlichen sozialen Situationen verankert, sondern wurde als individuelle Leistung in einem agonalen Diskurs von ‚modernen‘ elitären Historie-Denkern erbracht. Das Thema war seitdem grundsätzlich die jüngere Vorgeschichte der eigenen Zeit, die allein einer kritischen Erkundung zugänglich war, die jetzt aber auch als Gegenstand einen neuen, gleichgewichtigen Rang neben der Vorzeit des Mythos erhielt: Die ‚Entdeckung der Geschichte‘ im Werk Herodots war insofern weniger eine Entdeckung der Vergangenheit als der Gegenwart. Gegenüber Epos, Lyrik und Tragödie dient die literarische Form der Prosa zum einen der Darlegung von meta-faktischen Aspekten der geschichtlichen Vorgänge und ihrer tieferen Gründe, sowie von kritischen Argumenten und theoretischen Grundannahmen bei der Ermittlung durch den Autor; zum anderen entspringt sie der Erzählform der lehrhaften Fabel. In der weiteren Tradition der Historiographie macht sie die Darstellung von Voraussetzungen der Macht, kollektiver Psychologie und anthropologischen Grundmustern möglich,
14
Ortwin Dally, Tonio Hölscher, Susanne Muth, Rolf Michael Schneider
die in anderen literarischen Formen nicht in den Blick geraten. In dieser Form, den festlichen Situationen der rühmenden Erinnerung entzogen und der individuellen Rezeption im Buch überantwortet, tritt Geschichtsschreibung bei und seit Thukydides mit dem Anspruch des ktêmá te es aieí auf, des ‚Besitzes für immer‘, das heißt für künftige Gegenwarten26. Epos. Die früheste explizit bezeugte Form des Umgangs mit Vergangenheit im antiken Griechenland sind die homerischen Epen. Die grundsätzliche Aufgabe des Epos, ‚großen‘ Gestalten und Vorgängen der Vergangenheit ein ruhmvolles Gedächtnis, kleos, zu sichern, prägt die literarische Form der Gattung: eine auktoriale Erzählung, sanktioniert durch die Eingebung der Musen, im gehobenen, kontinuierlich fließenden Versmaß; darauf ausgerichtet, Kenntnis zu geben von heldenhaften Protagonisten und ihren individuellen Taten und Leiden, vor dem Hintergrund der kollektiven Masse der Gefolgsleute; ohne Reflexion auf die allgemeinen Ursachen, Motivationen und Zusammenhänge der ‚Geschichte‘. Jonas Grethlein zeigt an den Epen Homers paradigmatisch die theoretischen Ebenen auf, auf denen diese primordialen Zeugnisse der griechischen Frühzeit für die Erkenntnis und Konstituierung von Geschichte fruchtbar gemacht werden können: als Quelle, als Überrest und als Monument; letzteres nicht im Sinn eines statischen Dokuments, sondern eines Elements von historischen Praktiken und Diskursen. Die zunächst naheliegende Nutzung als ‚Quelle‘ für die Ereignisgeschichte der erzählten Vorzeit erweist sich im Fall von Ilias und Odyssee als problematisch, weil ihre Verlässlichkeit de facto nicht zu belegen und allgemein eher unwahrscheinlich ist. In späteren Fällen von historischen Epen wäre die Frage zu stellen, wie weit der narrative Stil der Gattung Epos die Auffassung der geschichtlichen Vorgänge prägt. Weit ergiebiger ist die Auswertung als ‚Überrest‘ der Zeit der Entstehung, die zugleich einen Wechsel der Perspektive auf die Sozial- und Kulturgeschichte bedeutet. Die Prägung der homerischen Epen durch die soziale und kulturelle Wirklichkeit ihrer Zeit steht außer Zweifel; sie betrifft die Formen des materiellen Lebens, des sozialen Verhaltens und der gemeinschaftlichen Organisationen ebenso wie die Auffassungen von Menschen, Göttern und der Welt mit ihren religiösen und ethischen Bindungen. Hier bedarf allerdings die Frage nach der ‚Geschichte‘ besonderer methodischer Reflexion, da die Dichtung mit ihren eigenen Formen und Intentionen die tatsächlichen Formen des Lebens transformiert und insofern nicht ohne Reflexion auf diese Transformationen zu deren sachlicher Rekonstruktion genutzt werden kann. Daraus ergibt sich aber umgekehrt die Frage, wie weit die dichterische Formung, auch die in dem Medium Epos vorgegebene Form der Konstitution von Wirklichkeit, eine eigene kulturelle Wirkungsmacht darstellt, die implizit auch die damalige Wahrnehmung der Lebenswelt und die Formen des Verhaltens und Handelns prägte. Die explizite Wirkung von Ilias und Odyssee, als ‚Monumente‘, auf die
26 Thuk. 1, 22, 4. Zu der Bedeutung der Prosa-Form für Herodot s. Kurke (2011) bes. 361–431, die neben der Funktion des kritischen Argumentierens die der ‚popular narrative tradition‘ hervorhebt.
Einführung: Historien – Historie – Geschichte: Wohin führen die Medien?
15
Lebenspraxis zeigt sich insbesondere in der Geschichte ihrer Rezeption: als konstitutive Strukturierung der Wahrnehmung der Wirklichkeit, als Norm des Verhaltens im sozialen Leben und als ‚symbolisches Kapital‘ im Kampf um Macht. Die Erzählungen der Dichtung wie die Bilder der Bildenden Kunst erweisen sich zugleich als Grundmuster der Erschließung von Welt und als prägende Vorgaben der Lebenspraxis in der Welt, des Erkennens und Handelns, in kontinuierlicher Wechselwirkung zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Als Grundvoraussetzung für diese Entzeitlichung, die ohne ein Konzept von Zwischenstufen der ‚Entwicklung‘ direkte Kompatibilität über weite Zeiträume hinweg schafft, führt Grethlein den Begriff der Spatialisierung ein, als Gegensatz zu der Sequenzialität narrativer Geschichtsdarstellung. Lyrik. Im Gegensatz zum Epos steht in der Lyrik ein dichterisches Ich im Zentrum, das nicht über seine geschichtliche Situation ‚informiert‘, sondern eine soziale Situation voraussetzt und in diese Situation hinein wie auch aus dieser Situation heraus spricht. Sprecher und Hörer (imaginiert auch der Leser) sind Teilnehmer derselben Situation ihrer eigenen Lebenswelt, etwa Götterfest oder Symposion, in der der Text sich direkt an alle Beteiligten richtet. Das öffnet ganz andere Perspektiven auf ‚Geschichte‘, indem hier individuelle oder kollektive Stimmen in und zu der vorgegebenen Situation zur Sprache gebracht werden. Renate Schlesier zeigt das Potential, das in der Situierung literarischer Medien und Gattungen in den sozialen Kontexten ihrer Performance liegt, an der archaischen Lyrik auf, indem sie die Gedichte der Sappho auf die poetologische Konstitution des dichterischen Ich, auf die von ihm angesprochenen Adressaten und die dabei vorausgesetzten sozialen Situationen der Interaktion befragt. Die Texte sind damit nicht mehr nur hinterlassene Aussagen über die Zeit ihrer Entstehung, sondern Faktoren von performativen Akten in ihrer Zeit. Das ungewöhnliche Maß an dichterischer und musikalischer Invention wie auch die hohen Register der kulturellen Standards, die die Lebensformen mit dem Vorderen Orient verbinden, lassen bei Sappho auf ein Ambiente im Zentrum der Polis-Gesellschaft schließen. Damit wird aus der Literatur, ohne sie zum platten Zeugnis von ‚biographischer‘ Wirklichkeit zu reduzieren, der Blick für konzeptionelle soziale Rollen als Phänomene spezifischer Epochen frei; umgekehrt gewinnen die Texte auf diesem Weg erst ihre lebensweltliche Prägnanz. Für Sappho ergibt sich, statt des zumeist angenommenen Kontextes der Erziehung junger Mädchen, ein weites Panorama einer Symposion-Kultur, in der unverheiratete Frauen mit hohem Selbstbewusstsein und in sexueller Freizügigkeit hetero- wie homoerotische Beziehungen eingehen, sich ähnlich den vornehmen Männern in Gelage-Gruppen zusammenschließen und an den Angelegenheiten der Polis-Elite teilnehmen konnten. Der pragmatische Ansatz der medialen Textanalyse führt von der Poetologie in die Sozialgeschichte: Mit der Auffassung des lyrischen Ich als konzeptuelle Rolle in zentralen sozialen Situationen wird eine Brücke zwischen poetischer Form und sozialen Strukturen geschaffen. Die Lyrik mit ihren Gattungen tritt damit nicht als eine historische Entwicklungsstufe des ‚griechischen Menschen‘ zwischen Epos und Tragödie auf, sondern als eine mediale Form der poetischen Artikulation, die ein bestimmtes Verhältnis zwischen einem
16
Ortwin Dally, Tonio Hölscher, Susanne Muth, Rolf Michael Schneider
‚Ich‘, seinen gesellschaftlichen Adressaten und seiner Umwelt zum Ausdruck zu bringen erlaubt, die in verschiedenen Epochen teils mehr teils weniger im Vordergrund steht, grundsätzlich aber neben anderen Gattungen mit anderen Qualitäten eingesetzt wird. Tragödie. Wiederum anders ist die mediale Bedeutung des Theaters, in erster Linie der Tragödie. Der Zuschauer wird in eine Welt versetzt, in der Regel aus der mythischen Vorzeit, die nicht die seine ist, an der er aber empathisch teilnimmt. Die dargestellte Handlung ist die Kulmination eines längeren Vorgangs, der nicht ‚informierend‘ berichtet, sondern allenfalls deklamatorisch evoziert, im Übrigen aber als vorgegeben vorausgesetzt wird. In den Mythen werden große ethische, religiöse und politische Themen des individuellen Menschen wie auch der Gesellschaft, und damit der Polis, performativ verhandelt. Dabei geht es nicht um Ruhm und Gedächtnis, sondern um die Kontingenz des Handelns und Schicksals individueller Protagonisten, um die Erweckung von Furcht und Mitleid, und um ‚Reinigung‘ der involvierten Zuschauer. Die (Be-)Deutung wird immanent in Handlung und Dialog zum Ausdruck gebracht, im Chor ist jedoch eine kollektive Person präsent, die das Geschehen aus einer gewissen Distanz betrachtet und ihre Reflexionen auch an die Zuschauer richtet. In der dramatisierenden Geschichtsschreibung des Hellenismus hat diese Sicht auf Protagonisten und die Peripetien ihrer Schicksale auch die Beschreibung der Zeitgeschichte geprägt. Welche enorme Kraft das Medium der theatralischen Form weit über die konkrete Performance hinaus entwickeln konnte, zeigt Edith Hall an der starken Nachwirkung der von Euripides weitgehend neu konzipierten „Iphigenie in Tauris“. Aus dem Plot der Tragödie ließen sich vielfältige Motive extrapolieren, die den Mythos über Jahrhunderte und in weiten Teilen der antiken Welt für Aktualisierungen verschiedenster Art fruchtbar machten. Zum Gründungstext par excellence für Kulte der Artemis/ Diana konnte diese Version nicht nur durch den darin verkündeten Auftrag zur Einrichtung von Heiligtümern in Euboia und Attika werden. Darüber hinaus konnten die in der Handlung ausgelösten Wanderungen der verfolgten Geschwister und Freunde durch weite Teile Griechenlands, Vorderasiens und Italiens geführt werden, um dort die Einrichtung von Kulten zu lokalisieren; dabei erwies die Konstruktion etymologischer Verbindungen zwischen Gottheit, Herkunft und Zielort eine starke legitimierende Kraft. In den allenthalben begründeten Kulten blieben der bei Euripides angelegte blutige Charakter und das Motiv der Sühnung vielfach erhalten. Darüber hinaus war es die literarische Fassung des Mythos, die ein starkes Bedeutungspotential für seine Aktualisierung im Rahmen der späteren griechischen und römischen Grabkunst enthielt: Drohender Tod, Überleben und Weiterleben, soziale und affektive Bindungen in Familie und Freundschaft konnten im Bild evoziert werden. Die Überbrückung der Distanz zwischen mythischer Vergangenheit und Gegenwart wird durch soziale und ethische Wertkonzepte, durch kanonische Bildprägungen und durch unmittelbare psychisch-emotionale Wirkungen erreicht. Dabei kommt eine spezifische reziproke Wechselwirkung zwischen dem Medium des Mythos und der
Einführung: Historien – Historie – Geschichte: Wohin führen die Medien?
17
Lebenswirklichkeit zur Geltung: Der Mythos ist zum einen Spiegelung menschlicher Verhältnisse in der ‚großen‘ Vorzeit, zum anderen aber auch eine wirkende konzeptuelle Kraft, die ihrerseits das Selbstbild und die Verhaltensweisen der Menschen prägt. Und unabhängig davon, ob die ursprüngliche Form als Tragödie noch realisiert wurde, blieb der theatralische Charakter des Mythos ein Faktor von starker ‚medialer‘ Bedeutung. Epos, Lyrik, Tragödie und weitere Gattungen sind, obgleich sukzessiv entstanden, nicht als sich ablösende Stufen literarischer Weltdeutung zu verstehen. Einmal entwickelt, stellten sie im Lauf der weiteren Geschichte nebeneinander unterschiedliche mediale Formen mit je eigenem Potential der Wahrnehmung und Darstellung der Welt dar27. Inschriften. Eine wiederum andere kommunikative Funktion erfüllen die Inschriften, insbesondere die dichte ‚epigraphische Kultur‘ der Antike in den öffentlichen Räumen. In der Materialisierung auf Inschriftträgern, durch die Wort und Schrift in den Kontexten des sozialen Lebens präsent wurden und zur Wirkung kamen, zeigt sich das Potential eines Begriffs des Mediums, das als dynamischer Faktor der kulturellen Praxis verstanden wird. Angelos Chaniotis entfaltet in einem systematischen Spektrum die Kraft der „Mnemopoetik“, der Konstruktion der Erinnerung für die Zukunft, die in den Inschriften körperliche Präsenz gewinnt, oft in Verbindung mit bildlichen ‚Monumenten‘. In einer Art von ‚commemorative turn‘ wurde öffentliches Gedächtnis zu einem zentralen Faktor des städtischen Lebens. Inschriften, im Sinn von ‚epigraphisch überlieferten Texten‘ dienten dem Ziel, den Inhalten von solchen Texten, die konstitutiv für das Leben der Gemeinschaft waren und sein sollten, dauerhafte Geltung im kollektiven Gedächtnis zu schaffen: als Urkunden zur Kontrolle in rechtlichen und politischen Konflikten, als Dokumente historischer Traditionen und Ansprüche, als Rühmung verdienter Personen, Auszeichnung für ihre Verdienste und Vorbild für die Nachwelt. Öffentlicher Raum und öffentliche Zeit waren aneinander gebunden: Kommemoration der Vergangenheit und Adhortation für die Zukunft wurden in den Räumen des öffentlichen Lebens zu größtmöglicher Sichtbarkeit gebracht. Dabei konnte die mnemopoetische Kunst starke multimediale Wirkungen erzielen: mit der Aufstellung der Denkmäler an Orten von großer Sichtbarkeit, mit sprachlicher Bildhaftigkeit und Evozierung emotionaler Anteilnahme wurde kollektive Erinnerung gesteuert und auf Dauer in das kulturelle Gedächtnis eingeprägt. Im Rahmen lebensweltlicher Aktivität immer wieder laut gelesen, wurden die epigraphischen Texte von den Akteuren in die soziale und kulturelle Praxis einverleibt. Für die wissenschaftliche Geschichtsforschung eröffnen die Inschriften jeweils kleinste Blicke auf Personen, Ereignisse und Vorgänge, die erst aus ‚historischer‘ Sicht zu größeren Strukturen und Narrativen zusammengeführt werden können. Die epigraphische ‚Welt‘, die daraus entsteht, ist ein Geflecht von sozialer, politischer, religiöser und kultureller
27 Grethlein (2010).
18
Ortwin Dally, Tonio Hölscher, Susanne Muth, Rolf Michael Schneider
Repräsentation, in dem normative und kompetitive Kräfte ineinander verwoben sind, in dem aber insgesamt strukturelle gegenüber ereignishaften Phänomenen im Vordergrund stehen.
Materielle Kultur und Bilder Gegenüber den Texten stellen die materiellen Überreste und – als eine besondere Gruppe unter ihnen – die Bildwerke der Vergangenheit Medien von ganz anderem Leistungspotential dar. Zunächst sind sie in ihrer materiellen Präsenz Bezeugungen von vergangenen Welten, die einen grundsätzlich höheren, unhintergehbaren Grad von Wirklichkeit besitzen als Texte, die als solche immateriell sind und in der Überlieferung immer wieder neue materielle Formen annehmen. Die Mauern, Geräte oder Bildwerke von vergangenen Gesellschaften, auch die Spuren von Fauna und Flora vergangener Lebenswelten existieren, unabhängig von Interesse und Rezeption späterer Betrachter oder Benutzer. Als Zeugnisse der Geschichte stimulieren sie zunächst die Imagination wie die wissenschaftliche Forschung zur Rekonstruktion der vergangenen Wirklichkeit. Diese Wiederbelebungen haben ihre eigene Suggestionskraft: Sie vermitteln die Vorstellung, intuitiv in eine vergangene Welt einzutauchen und physisch wie psychisch an ihr teilzunehmen. Man soll diese ‚partizipatorische‘ Annäherung an die Geschichte nicht hochmütig als unwissenschaftlich abtun, denn sie vermittelt Aspekte des historischen Verständnisses, ohne die alle weiteren, bewusst reflektierten Einsichten und Erkenntnisse partikulär bleiben. Gleichwohl kann selbst die perfekteste Rekonstruktion vergangener Welten und Verhältnisse kein vollständiges Eintreten in die Vergangenheit gewähren: Der gegenwärtige Betrachter und Forscher bleibt immer präsent mit seinen eigenen Erfahrungen und Erwartungen und seinen Kategorien des Erlebens und Denkens. Nur aus dieser Perspektive der Distanz kann er auch Fragen zum geschichtlichen Verständnis der Phänomene stellen: was die Gegenstände der ‚Kultur‘ bedeuten, aus welchen Motiven sie entstanden sind. Dabei geht es über die rekonstruierten Gegenstände hinaus um die Menschen der Vergangenheit in ihren kulturellen und sozialen Lebensformen. Materielle Überreste. Die Gegenstände der materiellen Kultur und ihre Interpretation als Zeugnisse der Geschichte sind seit längerer Zeit Thema einer differenzierten methodologischen Diskussion im Fach der Ur- und Frühgeschichte, das allein oder zumindest in wesentlicher Hinsicht auf den materiellen Hinterlassenschaften vergangener Gesellschaften begründet ist28. Bei diesen Relikten von früheren Kulturen sind zwei Stufen der Explizierung ihrer Bedeutung zu unterscheiden: zum einen die ‚Überreste‘ und ‚Spuren‘ materieller Art, wie Nutzbauten, Gebrauchsgegenstände, Ver-
28 Auch die Klassische Archäologie als Fachdisziplin mit einer feldarchäologischen und einer kunsthistorischem Seite hat sich in den letzten zehn Jahren verstärkt dieser Debatte geöffnet.
Einführung: Historien – Historie – Geschichte: Wohin führen die Medien?
19
kehrswege, die im Vollzug des Lebens entstanden und für die Praxis des Lebens geschaffen sind, ohne dabei den Handlungen und Gegenständen einen darüber hinaus gehenden Sinn zu geben; zum anderen die ‚Denkmäler‘, wie Repräsentationsbauten, Bildwerke, Ritualgeräte, Feststraßen, die in ihrer Gestaltung und ihrem Gebrauch ihre kulturelle Bedeutung explizit machen. Die Überreste und Spuren bezeugen das inhärente Funktionieren, die ‚Denkmäler‘ die expliziten Sinngebungen der Gesellschaft29. Für die materiellen Relikte der Vergangenheit zeichnet Joseph Maran die Entwicklung der Fragestellungen und Methoden in den letzten Generationen nach, die von einer klassifizierenden Ordnung der archäologischen Objekte in ‚Kulturkreisen‘ zu einer Fokussierung auf die menschlichen Akteure in ihrer sozialen und kulturellen Praxis führt. Dabei wird Kultur nicht mehr als Objekt, sondern als generatives Prinzip verstanden; die Gegenstände der materiellen Kultur werden als Faktoren menschlichen Handelns und Verhaltens unter den Bedingungen ihrer geschichtlichen Verhältnisse gesehen. Dieser Kontext umfasst nicht nur die materiellen Bedürfnisse, sondern vor allem auch die immateriellen Konzepte, mit denen die Gesellschaft sich selbst organisiert und sich in der Welt orientiert. Damit „sind Materielles und Immaterielles untrennbar miteinander verbunden“. Da es in vor-skripturalen Gesellschaften keine unabhängigen Quellen gibt, die auf die Bedeutungen der materiellen Gegenstände hinweisen, kann der methodische Weg zur ‚Geschichte‘ nur in der Aufstellung von begründeten Hypothesen bestehen, deren Plausibilität durch Kontrolle an möglichst vielen und unterschiedlichen Phänomenen erwiesen werden kann. Dabei kann in den seltensten Fällen faktische erzählbare Geschichte von Ereignissen und Personen rekonstruiert, dafür aber ein Netz von sozialen Strukturen und Prozessen aufgezeigt werden. Am Beispiel des mykenischen Griechenland macht Maran deutlich, dass materielle Kultur nicht als ‚objektive‘ Eigenschaft ihrer Gesellschaft, etwa des ‚kriegerischen Mykene‘ gegenüber dem ‚friedlichen‘ Kreta, verstanden werden kann, sondern dass sie eine kulturelle Selbstbeschreibung darstellt, die auch die Wahrnehmung der Umwelt steuert; erst in diesem Sinn zeigt materielle Kultur geschichtliche ‚Wirklichkeit‘ an. In der mykenischen Welt erscheinen die Entstehung wie der Untergang der Palastkultur eng mit der Ausbildung von Identität, sozialer Imagination, Aufstellung von Normen sowie deren Manifestation durch die soziale Praxis in der materiellen Welt der Architektur, Gräber und symbolischen Artefakte verbunden. Dabei werden kulturelle Manifestationen wie die Artikulation von Identitäten und die Konstruktion von autoritativer Erinnerung nicht so sehr als kollektive Stiftung von Gemeinschaft, sondern als Strategien divergierender Gruppen im Kampf um soziale Macht gesehen. In diesem Sinn sind die Objekte der Kultur nicht nur Produkte und Ausdruck der historischen Akteure, sondern verstärken ihrerseits deren Wahrnehmung der Welt und ihr Potential des Handelns.
29 S. Riegl (1903/1995).
20
Ortwin Dally, Tonio Hölscher, Susanne Muth, Rolf Michael Schneider
Bildwerke. Eine wieder andere mediale Welt sind Bildwerke. Da Bilder bei der Erforschung und Rekonstruktion von Geschichte lange Zeit eine sekundäre Rolle gespielt haben und aus diesem Grund vielfach in methodisch problematischer Weise ausgewertet werden, ist es wichtig, ihre grundsätzliche Leistungsfähigkeit richtig einzuschätzen. Zunächst ein Defizit: Bilder können nur sehr begrenzt informieren. Sie können über keinen Vorgang so berichten, keine Geschichte so erzählen, dass ein Betrachter, der diese nicht schon kennt, sie durch das Bild kennen lernt. Allein aus Bildern ist ohne Vorkenntnisse weder der Mythos von Theseus und Minotauros noch die Geburt Christi zu verstehen. Das aufwendige Projekt von Conrad Cichorius, aus der immensen Folge von Reliefs an der Traianssäule die Dakerkriege Traians zu rekonstruieren, hat die Vergeblichkeit solcher Bemühungen demonstriert – und auch dieser Versuch hätte gar nicht erst begonnen werden können, wenn nicht aus schriftlichen Quellen zumindest eine Grundkenntnis vorgelegen hätte30. Mit diesem narrativen Defizit hängt weiter zusammen, dass Bilder keine Relationen zwischen Geschehnissen und Handlungen darstellen können. Nur Texte können Vorgänge in ihren kausalen Vernetzungen und kontingenten Bedingungen, mit den Motivationen und Absichten der beteiligten Gestalten, mit Voraussetzungen und Konsequenzen schildern, sie mit Reflexionen begleiten und mit Bewertungen sich zu eigen machen oder ablehnen. Bilder dagegen können nur Figuren im Raum nebeneinander anordnen und in konkreten Handlungen miteinander verbinden, vermögen in den Konstellationen bestimmte Beziehungen suggerieren, können aber explizit weder kausale oder finale noch konditionale oder adversative Beziehungen zwischen ihnen herstellen. Erst recht können Bilder nicht begründen, argumentieren, urteilen. Darum bieten Bilder nur hilfsweise eine Grundlage, um eine diskursive Ereignisgeschichte zu rekonstruieren. Die eigentliche Leistung von Bildern ist: zu re-präsentieren. Bilder machen Gestalten und Vorgänge über die Distanz von Raum und Zeit an Orten und in Situationen ‚präsent‘, in denen sie realiter nicht sind. Gesellschaften und Individuen schaffen sich mit Bildern die Möglichkeit, ‚absente‘ Gestalten und Vorgänge in die eigene Lebenswelt hereinzuholen, um mit ihnen ‚umgehen‘ zu können. Die Gegenstände der Bilder können die gegenwärtige oder historische Realität betreffen, dann stellen sie geschichtliche ‚Quellen‘ dar, oder sie sind Produkte der Imagination, dann geben sie die handlungsleitenden sozialen, religiösen, ethischen und psychologischen Vorstellungen der geschichtlichen Gesellschaften wieder. In jedem Fall wurden die Bilder in bestimmten sozialen Situationen ‚benutzt‘, im religiösen Kult, im politischen Leben, am Grab, in den öffentlichen oder den privaten Lebensräumen. Davon sind ihre Formen und Funktionen der verschiedenen Bild-Medien mit den Regeln ihres ‚Gebrauchs‘ geprägt: als Kultstatuen, Weihgeschenke, politische Monumente, Grabdenkmäler, Schmuck von Privathäusern, Dekor von Gefäßen und Geräten. Museen und ‚reine‘
30 Cichorius (1896/1900)
Einführung: Historien – Historie – Geschichte: Wohin führen die Medien?
21
Kunst gab es nicht. Darum liegt die Bedeutung von Bildwerken in der Antike immer in der sozialen Praxis, im ‚Leben mit Bildern‘: in verschiedenen Räumen und Situationen des Lebens, in ihren verschiedenen medialen Formen, mit ihren spezifischen Themen und Bildformen31. Die allgemeine Funktion der Bildwerke, Gestalten und Vorgänge zu re-präsentieren, bedeutet nicht, dass sie diese in ihren rein physischen Qualitäten ‚ersetzen‘, sondern schließt ein, dass sie sie in ihrer sozialen und kulturellen Bedeutung für die betreffende Gesellschaft präsent machen. In Formen und Motiven können Bildwerke die Einstellung der Betrachter zu den dargestellten Gegenständen mehr oder minder autoritär lenken oder aber dem Betrachter frei stellen. Gleichwohl aber gehen die Gestalten und Vorgänge im Bild nicht völlig in ihrer intendierten Bedeutung auf, sondern behalten ein gewisses Maß an autonomer Substanz, die über die Intention von Künstler und Auftraggeber hinausgeht. Für die Deutung ergibt sich daraus eine spezifische Offenheit von Bildern: Ein Mythos oder historisches Ereignis, eine Gestalt der Vergangenheit oder Gegenwart kann vom Betrachter im gestalteten Bild reicher oder reduzierter, enthusiastischer oder kritischer, und vor allem in ganz anderen Aspekten gesehen werden, als es in der Absicht der Autoren gelegen hatte. Wie weit dabei das Spektrum ‚legitimer‘ Deutungen ist, kann nicht theoretisch festgelegt, sondern nur durch historische Forschung plausibel gemacht werden. Bilder. Diese „Unschärfe“ von Bildern, die in der Forschung vielfach bedauert wird und oft zu einer ‚methodisch‘ begründeten, unfruchtbaren Enthaltsamkeit der Interpretation führt, sieht Paul Zanker im Gegenteil als eine spezifische Stärke an: Eben dadurch werden die Betrachter aufgefordert, sich mit den dargestellten Gestalten und Vorgängen zu identifizieren und gewissermaßen die offenen BedeutungsMöglichkeiten nach eigenen Erfahrungen, ethischen Einstellungen, Ängsten, Wünschen oder Hoffnungen auszufüllen. Auch diese Offenheit ist durch Medien und mediale Situationen geprägt: Sie ergibt sich etwa unterschiedlich bei Denkmälern der politischen oder sozialen Repräsentation vor der Öffentlichkeit und bei Sarkophagen in den besinnlichen Räumen der Gräber. Das Spektrum von Bedeutungen römischer Reliefsarkophage mit Mythenbildern auszumessen, bedeutet nach Zanker die Rekonstruktion der möglichen Vorstellungen, die römische Betrachter damit verbinden konnten. Um das spezifische Potential von Bildern auszuloten, aber auch um ihre tatsächliche Rezeption und Wirkung in realen Situationen des sozialen Lebens zu testen, geht er von der Voraussetzung aus, dass ‚normal‘ gebildete Besucher die Grabstätten ohne Gebrauch von erklärenden Schriften betrachteten und die Bilder als solche, in ihrer visuellen Evidenz, verständlich gewesen sein müssen. „Bilder lesen
31 Leben mit Bildern: Muth (1998); Hölscher (2012). In neueren Konzepten des Bildes wird zum Teil vor allem die implizierte Abwesenheit des dargestellten Gegenstands zum Thema gemacht: Vernant (1990) 32; Belting (2001). Das ist aber eine (heutige) anthropologische Sicht, die nicht mit den expliziten Konzeptionen und Praktiken der Antike verwechselt werden darf.
22
Ortwin Dally, Tonio Hölscher, Susanne Muth, Rolf Michael Schneider
ohne Texte“ misst an zwei mythischen Themen das Ideal der ehelichen Liebe in weiten Varianten aus: von bürgerlicher Verbundenheit bis zu erotischer Lebensfreude, von idyllischem Frieden bis zu ungestillter Sehnsucht, von retrospektiver Erinnerung an ein erfülltes Leben bis zu prospektiver Hoffnung auf glückliches Fortleben nach dem Tod32. Mit dem Blick auf die Geschichte entsteht dabei das Bild einer Gesellschaft, die, anders als in früheren Epochen, stark mit ihren persönlichen Befindlichkeiten, mit Streben nach Glück und Harmonie beschäftigt ist, in zunehmend starkem Kontrast zu den offiziellen Manifestationen der Herrscher in den öffentlichen Räumen. Die Überblendung der mythischen Bilder mit Porträts der Bestatteten, die eine unmittelbare Kompatibilität von Mythos und Gegenwart herstellt, ist das deutlichste Symptom der allgemeinen Zeitenthobenheit von Geschichte in der Antike. Lebensbilder und Mythenbilder. Insgesamt führt die Bilderwelt der griechischen und römischen Antike in zwei große Themenkreise: die Lebenswelt der gegenwärtigen Gesellschaft und die ‚mythische‘ Vorzeit. Luca Giuliani legt dar, dass die in der Forschung traditionelle Unterscheidung von Mythenbildern und Lebensbildern unter dem Gesichtspunkt der Darstellungsformen problematisch ist, weil zwischen den beiden Bereichen vielerlei Verbindungen deutlich sind: In zahlreichen Bildern werden Szenen der Lebenswelt und des Mythos in sehr ähnlichen Formen dargestellt, andere Bilder stehen in einem schwer definierbaren Raum zwischen der Lebenswelt und dem Mythos, bei wieder anderen ist die Darstellungsweise so indefinit, dass es unklar bleibt, welchem der beiden Bereiche sie zuzuordnen sind. Eine strikt formale Trennung von Mythen- und Lebensbildern als distinkte Gattungen erscheint dadurch kaum begründbar. Als alternative Kategorien bringt Giuliani die Unterscheidung von „erzählendem“ und „beschreibendem“ Modus ins Spiel: Die Lebenswelt, das heißt ‚die Welt wie sie normalerweise ist‘, wird durchweg zuständlich im Modus der typisierenden Beschreibung dargestellt; bei Mythen dagegen, das heißt einzigartigen Vorgängen mit individuellen Protagonisten, kommt vielfach zu den beschreibenden Motiven ein zusätzlicher Stimulus hinzu, der eine zugrunde liegende erzählte Geschichte zum Verständnis des Bildes nötig macht und dadurch auf diese Geschichte verweist. Wenn man von diesen Kategorien ausgeht, so liegt darin ein fruchtbarer Zugang zum Verständnis der Darstellungen aus den beiden unterschiedlichen Sphären der Mythen und des gesellschaftlichen Lebens. In Bildern der Lebenswelt wird durchgehend ein typisierend beschreibender Modus angewandt: Sie zeigen den Zustand der Welt, „wie sie ist“, in Richtung auf den Zustand, wie sie sein soll; Normalität und Normativität liegen hier nahe beieinander. Das Spektrum der Themen ist relativ begrenzt: Es sind die Grundsituationen der griechischen Gesellschaften und
32 „Bilder lesen ohne Texte“ meint nicht den fundamentalistischen Versuch, Bilder ohne zugrunde liegende verbale Narrative zu verstehen (zu dieser Unmöglichkeit s. oben S. 20), sondern sie mit einem (scil. verbal vermittelten) Vorwissen zu verstehen, das beim Betrachten ein Verstehen ohne zusätzliche Heranziehung erklärender Texte möglich macht.
Einführung: Historien – Historie – Geschichte: Wohin führen die Medien?
23
ihrer sozialen Werte: Krieg und Jagd, religiöse Prozessionen, Feste und Opfer, Symposion und Athletik, Hochzeit, Welt der Frauen und Begräbnis. In den Mythenbildern dagegen werden beide Modi eingesetzt. Ein kleinerer Teil ‚beschreibt‘ in typisierender Form die Helden in denselben Grundsituationen als Leitbilder der normativen Wertvorstellungen. Daneben aber wird vor allem die ‚erzählende‘ Form eingesetzt, um die andere Seite der Mythen herauszustellen: dass die Helden die Normen ständig in unerhörter Weise überschreiten und durchbrechen. Diese Spannung zwischen ‚deskriptiver‘ Darstellung der Normen einerseits und ihrer ‚narrativen‘ Überhöhung, Übersteigerung, Transgression und negativen Bestätigung andererseits ist konstitutiv für die Mythenbilder. So gesehen, wenn auch vielleicht nicht mit Giulianis Zustimmung, können Mythenbilder und Lebensbilder, zwar nicht als ‚Gattungen‘, aber doch als Diskursfelder und in einem erweiterten Sinn als ‚Medien der Geschichte‘ betrachtet werden. Körperbilder. Eine hohe Bedeutung gewinnt in diesem Zusammenhang der menschliche Körper, der in der griechischen und römischen Antike, sowohl in der Kunst wie in der Lebenswelt, ein sensibles Medium von kulturellem Sinn darstellt33. In einer ‚Kultur des unmittelbaren Handelns‘ werden zentrale soziale Werte als LeitBilder in die Körper der Kunst eingeschrieben. Andrew Stewart steckt mit einer markanten Gegenüberstellung polarer Körperbilder – zwischen Frühzeit und Hellenismus, männlich und weiblich, menschlich und göttlich – die Veränderungen der Darstellung von militärischer Macht in den Entwicklungen zwischen den archaischen Poleis und den hellenistischen Monarchien ab; die Einschreibung dieser Konzepte in Bilder von Körpern erfolgt in einer charakteristischen Dialektik zwischen Realität, kultureller Wahrnehmung und Imagination: In archaischen Bildern des Krieges wird die Realität der Kriegsführung aufgebrochen in die Erfahrung der kollektiven Solidarität und der individuellen Herausforderung; in hellenistischen Darstellungen der bewaffneten Aphrodite-Königin wird dagegen ein imaginäres Bild von Sieg und Glück zu Land und See entworfen. Körperkonzepte, Staatsformen, Kriegsführung und Geschlechterdifferenzen werden in einer spannungsreichen Weise aufeinander bezogen. Der Wandel wird, nach Ludwig Wittgensteins Verständnis der Kunst als ‚Lebensform‘, in radikalen Veränderungen der politischen und sozialen Strukturen, der militärischen Praxis und der Gestalten der Götter gesehen. Wenn man diese Überlegungen weiter verfolgt, könnte man die Vorstellungen vom menschlichen Körper und seinen Möglichkeiten des Verhaltens als eine konkrete Form von kulturellem ‚Habitus‘ verstehen: In diesem Begriff Pierre Bourdieus könnten die Zusammenhänge zwischen signifikanten körperlichen ‚Haltungen‘ und allgemeinen kulturellen ‚Einstellungen‘ und Handlungsmustern erfasst werden. Angesichts der eminent visuellen
33 Insbesondere in den angelsächsischen Ländern spielt die Forschung über Körper-Konzepte eine zentrale Rolle: Stewart (1997); Tanner (2006); Osborne (2011); zuletzt Haug (2012) mit weiterer Literatur.
24
Ortwin Dally, Tonio Hölscher, Susanne Muth, Rolf Michael Schneider
Aspekte des Körpers in den antiken Kulturen könnte von hier aus eine neue Perspektive auf die medialen Qualitäten des künstlerischen Stils eröffnet werden. Stilformen. Die vielleicht stärkste Herausforderung der Bildenden Kunst, in begrenzterem Maß auch der Architektur, für das Verständnis von ‚Geschichte‘ liegt in den Stilformen und ihren Veränderungen. Über die unterschiedlichen Formen der Bildwerke hinaus, die durch ihre sachlichen Themen und ihre intendierten Botschaften bedingt sind, schließen sich bekanntlich die Werke bestimmter Epochen, Regionen und sozialer Gruppen durch gemeinsame Eigenheiten des künstlerischen Stils zusammen, die in der älteren Forschung ein zentrales Thema waren, in neuerer Zeit aber wenig reflektiert werden. Adolf H. Borbein geht der Frage nach, wie weit und in welchem Sinn solche kollektiven Stilformen eine geschichtliche Bedeutung haben und wie weit ihre zeitlichen Veränderungen geschichtliche Prozesse anzeigen oder gar selbst als ‚Geschichte‘ zu verstehen sind. Dass es in der Tat Zusammenhänge zwischen den Entwicklungen der Kunst und anderen Sektoren der Geschichte gibt, dürfte dabei weniger fraglich sein als wie solche Zusammenhänge zu verstehen sind. Am Beispiel der neuen Formprinzipien des ‚Kontrapost‘ benennt Borbein in der Kunst des 5. Jahrhunderts v. Chr. Konzepte, die eine strukturelle Verwandtschaft zur Naturauffassung der Atomisten, zur Philosophie des Heraklit und zur Staatsform des Kleisthenes haben; man könnte das Verständnis des menschlichen Körpers in der Medizin oder das Menschenbild und die Dialogformen der Tragödie hinzufügen. In diesem Zusammenhang ist es von Bedeutung, dass in neuerer Zeit mehrfach Formen der Bildkunst, die früher als ‚Stil‘ beschrieben wurden, als körperlicher Ausdruck sozialer Verhaltensformen und Befindlichkeiten gedeutet worden: Das Spektrum führt von konkreten Ausdrucksformen wie Mimik und Gesten über typische Haltungen bis zu allgemeinen ‚schweren‘ und ‚leichten‘ Bewegungsweisen, die für ganze Epochen kennzeichnend sind. Die zugleich physischen und ethischen Dimensionen solcher ‚Haltungen‘ finden sich in dem griechischen Begriff der hexis zusammengeführt. Damit kommt ein Verständnis von Ästhetik in den Blick, das die Bildkunst und die geformte Lebenswelt übergreift34. Monumente. Den stärksten Gegenpol zu den ‚Überresten‘ und ‚Spuren‘ der materiellen Kultur, die absichtslos Zeugnis von Geschichte ablegen, bilden die ‚Denkmäler‘ im prägnanten Sinn des Begriffs: die ‚Monumente‘, in denen Personen, Ereignisse und Ideen intentional zu dauerhafter Bedeutung erhoben werden. Im Vordergrund dieser ‚Monu-Mentalität‘ stehen Themen der eigenen Zeit und ihre Paradigmen der Vorzeit, die als autoritative Vergangenheit für eine antizipierte Zukunft bewahrt werden sollen. Der Blick auf die Gegenwart als künftige Geschichte, der in den Monumenten mit voller Emphase seit dem 5. Jahrhundert v. Chr. auftritt, entspricht in vielerlei Hinsicht, trotz unterschiedlichen Funktionen, der etwa gleichzeitig entstehenden Ge-
34 Schneider (1975); Fehr (1979); Giuliani (1986); Zanker (1995); Tanner (2006), dort zum Konzept der hexis; Hölscher (2009).
Einführung: Historien – Historie – Geschichte: Wohin führen die Medien?
25
schichtsschreibung. Die Aufgabe der Monumente ist, wie im Beitrag von Tonio Hölscher dargelegt, diesen Gestalten, ihren Leistungen und den darin verkörperten ideellen oder ideologischen Konzepten Präsenz in den öffentlichen Räumen der politischen Gemeinschaften zu verschaffen und ihnen dort Geltung als Leitbilder des Handelns zu sichern. In diesem Sinn sind sie Mittel der Herrschaft über die öffentliche Zeit und den öffentlichen Raum der Gemeinschaft. Dort stellen sie Waffen im Kampf um das öffentliche Gedächtnis, um die Definition von kollektiver Identität und um die Autorität über die gemeinschaftlichen Normen und Werte dar. Die mediale Botschaft der Denkmäler liegt zum einen in den Praktiken der Errichtung, durch die sie, je nach der politischen Struktur der Gemeinschaft, ihre spezifische Autorität erhalten. Ihre Bildthemen bringen zum anderen, über den jeweils einzelnen Fall hinaus, grundsätzliche kollektive Auffassungen darüber zum Ausdruck, welche Formen öffentlichen Handelns eine Gemeinschaft im Rahmen ihres Selbstverständnisses als zentral ansetzt. In der griechischen Poliswelt sind das die entscheidenden Leistungen für das gegenwärtige und zukünftige Wohl der Gemeinschaft, in den hellenistischen Monarchien die ‚weltbewegenden‘ Umstürze, im römischen Kaiserreich dagegen die rituelle Erfüllung politisch-ethischer Leitvorstellungen durch den Herrscher zum Wohl der Untertanen: hier dynamische Aktion, dort mehr statische Rolle. Für die betrachtende Nachwelt und die rückblickende Forschung steht in den Denkmälern eine nahezu zeitlos autoritative ‚monumentale Geschichte‘ vor Augen. Räume und Architektur. Die Zusammenführung der verschiedenen materiellen und visuellen Medien findet in den Räumen der menschlichen Kultur statt. Dort gewinnen zunächst die vorgegebenen Elemente der Landschaft, wie Baum, Fels und Quelle, Berge und Meer, Erde und Himmel, semantische Bedeutung; darin wird das soziale Leben in Kommunikation mit und mittels der Gegenstände der Lebenspraxis, wie Bauwerke, Geräte, Bildwerke, Inschriften vollzogen; dort kommen als weitere Medien die Geräusche und Gerüche hinzu, die die Atmosphäre des Raumes mitprägen, weiterhin die ephemeren Gegenstände der Einrichtung, von Möbeln über Waren bis zum Abfall – und vor allem die Menschen, die einerseits als Produzenten und Benutzer Faktoren des Raumes selbst sind, andererseits als wahrnehmende Betrachter in Distanz zum Raum als Objekt stehen. Die intensive Raumforschung der letzten Jahrzehnte hat ein theoretisches Konzept geschaffen, nach dem Raum nicht nur als Kategorie von leeren Dimensionen, sondern als Produkt und zugleich Voraussetzung sozialen Handelns verstanden wird: Raum wird von Menschen durch und für kulturelle Praktiken geschaffen und bedingt seinerseits wieder die weitere kulturelle Praxis derer, die ihn benutzen. Auf dieser Grundlage geht Susanne Muth der Frage nach, inwiefern und mit welchem Ziel Lebensräume historischer Gesellschaften als Medien verstanden werden können. Wenn man Raum nicht nur als Hülle, sondern als Produkt von sozialen (Inter-) Aktionen versteht, gewinnt er eine Substanz, die ihn zum Träger von Bedeutungen macht; in der Kombination von materiellen, bildlichen, schriftlichen, auditiven und performativen Medien wird Raum geradezu zu einem Paradigma der Pluri-Medialität.
26
Ortwin Dally, Tonio Hölscher, Susanne Muth, Rolf Michael Schneider
Mit der Auffassung des Raumes als Medium und Kommunikationssystem gewinnt die geschichtliche Betrachtung ein klareres Verständnis der Strukturen und Potentiale, andererseits der Grenzen der Historischen Raumforschung. Muths Untersuchung des Forum Romanum dient als Testfall nicht lediglich dem Nachweis, dass gebaute Räume als Medien der Geschichte betrachtet werden können, sondern der Diskussion von Problemen, die damit verbunden sind. Von Bedeutung ist dabei die Semantik der materiellen Gestaltung der Räume: in erster Linie des Mediums Architektur, in Form von politischen Stätten und Funktionsbauten, aber auch von Tempeln und Heiligtümern, sodann in politischen Denkmälern, die den Raum des Platzes artikulieren. Bauten, Stätten und Denkmäler bezeugen zum einen die historischen Anlässe ihrer Entstehung, zum anderen konditionieren sie Verhalten, Bewegung und Handlungen der Benutzer und lenken Aufmerksamkeit, Blicke und Reaktionen der Betrachter. Ein Dilemma für die Deutung kann dann aber aus der Dichotomie zwischen repräsentativer Bedeutung und praktischer Funktion entstehen, wie am Beispiel der Rednerbühne und der gliedernden Pflasterung des Forums erörtert wird, die die Nutzung des Platzes stark prägten: Welche Intentionen bei den Initiatoren jeweils Priorität hatten, ist objektiv aus den Befunden kaum zu erschließen – dafür können aber Schriftquellen die tatsächliche Rezeption bezeugen; darüber hinaus können Untersuchungen der Befunde weitere Möglichkeiten der Nutzung bzw. Umnutzung plausibel machen, die von den ursprünglichen Konzepten mehr oder minder abweichen können. Als weiterer Faktor erscheint eine „Eigendynamik medialer Prozesse“, deutlich gemacht am Beispiel von Reiterstatuen, deren Aufstellung auf dem Forum jeweils auf frühere Standbilder antwortet, bis zu dem Kolossalbild des Equus Domitiani im Zentrum; ferner eine „Eigenlogik medialer Räume“, die dazu führt, dass auf dem Forum Romanum und dem Forum des Augustus in der Aufstellung von Ehrenstatuen verschiedene Konzepte des Bezugs zur Vergangenheit realisiert werden. Insgesamt ergibt sich daraus ein Plädoyer für eine multiperspektivische Betrachtung des Mediums Raum und seiner Elemente, die das Potential verschiedener, im Einzelfall sogar widersprüchlicher Funktionen und Rezeptionen für ein möglichst komplexes Bild der Geschichte nutzt. Räume und Bilder. Welches Maß an bewusst konzipierter Komplexität das Zusammenspiel verschiedener Medien grundsätzlich gewinnen kann, zeigt Rudolf Preimesberger an einem Beispiel jenseits der Antike: dem Neubau von St. Peter in Rom im 16. und 17. Jahrhundert. Die sakrale Stätte des Petrusgrabes, Reliquien, Architektur, Skulptur, Mosaik-Malerei und monumentale Schrift gehen hier eine einzigartige mediale Interaktion ein. Die Botschaften entwickeln sich, als ‚Argumente‘ in den Auseinandersetzungen der post-reformatorischen Zeit, in drei verschiedenen Sinn-Dimensionen, die ihren Brennpunkt in der Rechtfertigung Roms und des Papsttums als Zentrum des Christentums haben. Das Grab Petri, als Zeugnis seiner Präsenz, wird überwölbt von der Kuppel, in deren Mosaik seine Auferstehung am Jüngsten Tag vorausgesehen wird, umkreist von dem Schriftband, das ihn in direkter Anrede an diesen Ort der Pracht bindet. Von der unterirdischen Tiefe bis in die Höhe des Him-
Einführung: Historien – Historie – Geschichte: Wohin führen die Medien?
27
mels weist eine zeitliche Achse aus der Vergangenheit über die Gegenwart in die zukünftige Ewigkeit. Die Pylone der Kuppelvierung bilden mit den eingeschlossenen vier Ur-Reliquien, den vier Statuen ihrer Träger sowie vorgestellten Altären die architektonischen wie sakralen Stützen der ‚Kirche‘. Die unmittelbare Vergangenheit ist an der Eingangswand in inschriftlichen und figürlichen Platten der Päpste dokumentiert, die im Wettstreit miteinander den Bau als Restitution nach vergangenem Verfall feiern. Darüber hinaus wird in den Spiralsäulen des Ziboriums der Neubau in die Tradition des konstantinischen Vorgängers und weiterhin in die doppelte Nachfolge Jerusalems und des Römischen Reiches gestellt. Die Architektur und der architektonische Raum werden zu einer umfassenden Darstellung der ‚Kirche‘, als Bau wie als Institution. Darin ergänzen Sinnbilder und Wahlsprüche, res und anima, einander im Sinn der sogenannten ‚imprese‘. Im Ritual des Gottesdienstes tritt der Papst in das Zentrum dieser Sinn-Achsen. Die Teilnehmer, als „schauend lesende und lesend schauende Rezipienten“, sind zugleich Akteure und Adressaten einer multimedialen Performation. Für die Antike ist dies Sinn-System als Folie aufschlussreich: Im Vergleich zu den Bild-Programmen etwa des Parthenon oder der Ara Pacis, die eine konsensuale politische Identität einfordern, ist hier eine höhere Komplexität erreicht, die aus den Auseinandersetzungen zwischen zwei alternativen religiösen Positionen erwachsen ist. Rituale, Zeremonien. Die Integration der materiellen Medien in den übergeordneten Kontext der Lebenswelt und der sozialen Lebenspraxis wird mit besonderer Deutlichkeit von gemeinschaftlichen Ritualen und Zeremonien geleistet: Rituelle und zeremonielle Handlungen operieren mit vielfältigen Medien, wie symbolhaltigen Gegenständen, religiösen Instrumenten und politischen Insignien, setzen semantische Elemente wie Kleidung und Schmuck, Gesten und Gebärden ein, artikulieren sich mit gesprochenen Texten, nutzen die Wirkung von Musik und Gerüchen, entfalten sich in der Semantik von Architekturen und Lebensräumen, und beziehen dabei Denkmäler und Bildwerke ein. Darüber hinaus aber können Rituale und Zeremonien selbst, trotz ihres ephemeren Charakters, als ‚Medien‘ betrachtet werden, insofern es ihre Funktion ist, konzeptuelle Vorstellungen in performativer visueller Form zur Anschauung zu bringen. Karl-Joachim Hölkeskamp zeigt diese multimediale Konstitution von ‚Sinn‘ in einem weiten Spektrum von Bedeutungen auf, die konstitutiv für die Gesellschaften der antiken Stadtstaaten sind. Am Beispiel von gemeinschaftlichen Prozessionen wird deutlich, dass es grundsätzlich drei Dimensionen sind, in denen Rituale und Zeremonien Sinn erzeugen: Konstituierung von Identität, Orientierung in der Welt, und Sicherung von Heil und Macht. Zum einen wird in der formalisierten Partizipation bei herausgehobenen Situationen das Selbstbild der städtischen Gemeinschaften prägnant zur Schau gestellt; dabei kann die Ordnung in ihren Sequenzen und Hierarchien je nach Anlass neu konzipiert werden: Statt Abstufungen des sozialen Ranges können andere Kategorien, wie religiöse Funktionen, Geschlechter, Altersstufen und anderes mehr, in den Vordergrund treten. Prozessionen werden dadurch zu Medien, um kollektive Identität in variablen sozialen Relatio-
28
Ortwin Dally, Tonio Hölscher, Susanne Muth, Rolf Michael Schneider
nen zu artikulieren. Zum zweiten werden durch Prozessionen die gemeinschaftlichen Räume der Städte und Territorien in einer prägnanten Weise ausgemessen, erschlossen und definiert. Politische und sakrale Topographie, mit den Differenzen von Drinnen und Draußen, mit der Konfiguration der Heiligtümer, öffentlichen Plätze und Nekropolen, wird im Ritual aktualisiert. Kreisförmige Rituale dienen der Bezeichnung und dem Schutz von religiösen, sozialen und politischen Räumen, lineare Prozessionen der Verknüpfung von Orten zu gemeinschaftlichen Räumen sowie der Ausmessung von territorialer Macht zwischen Zentrum und Außengrenzen. Somit kann, zum dritten, der Zweck der Rituale und Zeremonien dadurch erfüllt werden, dass die Gemeinschaft in ihrer Identität und ihre Umwelt in ihrer Struktur miteinander in Einklang gebracht werden. Die besondere mediale Kraft von Ritualen und Zeremonien wie dem römischen Triumphzug liegt nach Hölkeskamp in der unmittelbaren Partizipation von Akteuren und Adressaten an der sinnstiftenden Handlung: Sie ist so stark, dass schließlich beide Seiten wechselseitig aufeinander einwirken. Der ‚Sinn‘ entsteht in der Partizipation selbst, nicht als Symbol oder Zeichen, sondern als Aktion. Aus der Sicht der Semiotik: ‚Sender‘ und ‚Empfänger‘ sind die ‚Botschaft‘. Darin liegt die einzigartige Wirkung der Inkorporation, die mit Ritualen und Zeremonien erreicht werden kann. Lebenswelt und Bild. Man kann in diese Richtung weiter gehen. Menschliches Handeln, ob bewusst oder unbewusst, wird in Formen vollzogen, die kulturell geprägt sind und kulturelle Bedeutungen vermitteln. Der Mensch entwirft von sich ein kulturelles Selbstbild, das er im körperlichen Habitus, in Haltung, Bewegung, Gestik, Mimik, Bemalung und Kleidung zum Ausdruck bringt. Darüber hinaus gestalten Individuen und Gesellschaften ihre materielle Umwelt, von Häusern und Siedlungen bis zu Territorien, nach kulturellen Bedürfnissen und Vorstellungen. Und auch die vorgefundene Natur, mit Bergen und Flüssen, Land und Meer, Himmel und Erde, wird durch kulturelle Erfahrung und Deutung als Rahmen dieser kulturell geprägten Lebenswelt verstanden. Das bedeutet: Die Rituale in ihrer starken Medialität sind nur ein Sonderfall. Die Lebenswelt selbst ist ein Konstrukt von ‚Sinn‘, der Mensch mit seinen Handlungen ist Teil dieses Sinn-Gewebes. In diesem Sinn ist die Lebenswelt in ihrer Materialität ein ‚Medium‘. Der Mensch ist aber nicht nur Teil dieses Mediums der Lebenswelt, sondern zugleich Produzent und Adressat, Sender und Empfänger. Hierin liegt ein spezifischer Appell zur Selbst-Reflexion. Diese vom Menschen konstituierte Sinn-Welt erschließt sich vor allem in ihren visuellen Formen. Sobald Menschen beginnen, diese Welt ‚verstehen‘ zu wollen, konfigurieren sie ihre materiellen Elemente kognitiv zu Sinn-Bildern. Aus der Unendlichkeit der visuellen Eindrücke im Vollzug des Lebens werden je nach kultureller Prägung bestimmte Elemente der Umwelt zu Signifikanz erhoben. Sie werden einerseits zueinander in Beziehung gebracht und andererseits in einen Bezug zum sehenden Subjekt gesetzt. Diese Aktivität der Wahrnehmung ist ein Akt der Konstituierung von visuellen Sinn-Bildern im Rahmen der Lebenswelt: Die Umwelt wird zum ‚Bild‘. Es sind solche Sinn-Bilder, die von Bild-‚Künstlern‘ in Bild-Werke mit ihren eigenen Be-
Einführung: Historien – Historie – Geschichte: Wohin führen die Medien?
29
dingungen und Gesetzen umgesetzt werden. So gesehen, sind Lebenswelt und Bildwerke zwei Medien, die mit unterschiedlichen Materialien Sinn-Bilder übermitteln. Ruinen. Ein existentiell zentraler Aspekt der Geschichte, ihre ‚Vergangenheit‘, tritt uns im Medium der Ruinen entgegen. Alain Schnapp geht der von vielen Betrachtern empfundenen Wirkung von Ruinen nach, die letztlich auf einer verstörenden Ambivalenz zwischen Leben und Tod beruht. Ruinen führen uns vor Augen, dass die ‚geschichtliche‘ Welt unwiederbringlich vergangen und zerstört ist – zugleich aber sind sie die einzigen augenscheinlichen Zeugen dafür, dass diese Welt einmal tatsächlich existiert und dem Leben zugehört hat. Damit hängt eine weitere Ambivalenz zusammen: Ruinen können von uns nicht mehr im Sinn ihrer geschichtlichen Funktionen bewohnt werden, sie sind von der Praxis des Lebens und jeder Weiternutzung abgeschnitten; wir können sie nur noch als ‚Zeugnisse‘ einer vergangenen Welt ‚betrachten‘. Zugleich aber wecken sie in uns die nicht nur wissenschaftliche Sehnsucht nach Re-Konstruktion und Heilung von der Zerstörung, sei es durch Wiederaufbau, sei es in Zeichnung oder Modell, oder zumindest in der Vorstellung. Dabei entwickeln wir aus dem Verlust des geschichtlichen Lebens eine erstaunliche überschüssige Kraft der Imagination von möglichem Leben: Je geringer unser Wissen über die verlorene Welt ist, je schwächer die Indizien für ihre Rekonstruktion sind, desto stärker wird die Phantasie für die Möglichkeiten der Wiederbelebung angeregt. Schnapp richtet den Blick auf literarische Reflexionen, in denen solche Ambivalenzen weiter ausgeleuchtet werden. Schon in der Antike wurde der Gegensatz zwischen dem vergänglichen Leben der materiellen Pyramiden und dem unvergänglichen Ruhm, den die Dichtung im immateriellen Wort bewahrt, zum Thema gemacht35. Bei Diderot wird der Verfall der Ruinen in ein weites Panorama gestellt, in dem die Natur die Geschichte des Menschen besiegt. Im nachantiken Ägypten dagegen sind die Pyramiden Ausprägungen einer bewunderten primordialen Kultur, deren monumentales Gedächtnis in seiner Kontinuität und zugleich Bedrohtheit empfunden wird. Schließlich spielt Jorge Luis Borges am Beispiel des Ersten Kaisers von China, mit dem gleichzeitigen Bau der Großen Mauer und der Verbrennung der älteren Bücher, die Dialektik von Errichten und Zerstören, Erinnern und Vergessen durch; während Franz Kafka den Prozess des Bauens der Chinesischen Mauer als Paradigma der unüberbrückten Kluft zwischen planendem Kaiser und ausführendem Arbeiter, und damit der existentiellen Unsicherheit zwischen Gedanken und Wünschen einerseits und Zielen und Erfüllung andererseits darstellt. Das Monument der Mauer erscheint zugleich als „Ruine und Idee, Erinnerung und Vergessen, Macht und Ohnmacht“. Bilder in der Wissenschaft. Jenseits aller Fragen, wie die Wissenschaft mit den medialen Formen umgeht, in denen die Geschichte überliefert ist, stellt sich schließlich das grundsätzliche Problem, wie die Geschichtswissenschaft sich selbst zu den medialen Formen stellt, in denen sie ihr eigenes Geschäft der Erforschung und Dar-
35 Über Ruinen und ihre Bewertung in der Antike s. Papini (2011).
30
Ortwin Dally, Tonio Hölscher, Susanne Muth, Rolf Michael Schneider
stellung der Vergangenheit betreibt. Das betrifft zunächst die traditionellen Formen der Texte, in denen von Wissenschaftlern historisches Geschehen in verbale Erzählung umgesetzt oder einer analytischen Erörterung ausgesetzt und dadurch in einen anderen ontologischen Zustand transferiert wird. Es gilt aber zunehmend auch für die Bilder, in denen Geschichte zur Anschauung gebracht wird. Ortwin Dally untersucht die Bilder im Kopf der Archäologen und die Medien, die sie bei ihren Forschungen einsetzen, in ihrer Wechselwirkung mit den Gegenständen der Untersuchung. Zum einen üben bildhafte Vorstellungen („im Kopf“) der Forscher eine starke vor-prägende Wirkung auf die Wahrnehmung der zu untersuchenden Gegenstände aus; zum anderen werden die Ergebnisse der Forschung wieder in Bildern zur Anschauung gebracht und fixiert, die die weitere Forschung stark vor-prägen. Das gilt für Rekonstruktionen von Bau- und Bildwerken ebenso wie für die Form der Ausstellung in Museen oder die Präsentation in Büchern, Phototheken oder Datenbanken, die ein bestimmtes Verständnis von Objekten und Befunden suggerieren. Ein weiteres Problem in dieser Richtung ist zunehmend die Umsetzung von historischer Erkenntnis in Zahlen sowie in Tabellen und Graphiken. Zugleich aber sind mit den verschiedenen Medien der Forschung und ihrer technischen Entwicklung auch bestimmte Formen der Anschauung und Fragestellungen verbunden. Bei der Erforschung antiker Skulpturen bieten der dreidimensionale Gipsabguss und die zweidimensionale Photographie sehr unterschiedliche Möglichkeiten: hier die Erfahrung konkreter Körperlichkeit im Raum, dort den Vergleich und die Serienbildung von räumlich distanten Objekten. Die Übergänge der Reproduktionstechnik von der Zeichnung zur Photographie und zur Bilddatenbank, von der Dia-Projektion zur Powerpoint-Präsentation sind mit starken Veränderungen der gesamten wissenschaftlichen Parameter verbunden gewesen. Dabei stellt sich nicht nur die Frage, welche weitreichenden Möglichkeiten unzweifelhaft durch die neuen Medien eröffnet wurden; denn eine kritische Reflexion wird andererseits nicht übersehen, dass durch die ‚Überwindung‘ alter medialer Techniken auch wichtige, damit verbundene wissenschaftliche Ansätze und Fähigkeiten verkümmern und obsolet werden können. Insgesamt führt die Wechselwirkung von bildhaftem Vorverständnis und Wahrnehmung der realen Gegenstände in den alten Zirkel der Hermeneutik zwischen Fremderfahrung und Aneignung, der die Grundfrage dessen betrifft, was historische Erkenntnis sein soll. Sie führt aber auch wieder zurück zur Antike, in der sich die Frage nach den Wechselwirkungen ebenfalls stellt: So wirft etwa die Frage nach der Entdeckung und raschen Entwicklung der zweidimensionalen Darstellung von Räumen bei Griechen und Römern in Gestalt von Karten oder Itinerarien die Frage auf, inwiefern die Erfindung dieser Medien und die darin greifbare Abstraktion des hodologischen Raumes durch dessen empirische Erfahrung ausgelöst wurde, sich dann aber wiederum konkret auf das Handeln von Akteuren wie Händlern, Entdeckungsreisenden, Staatsmännern und Politikern auswirken konnte36.
36 Gehrke u.a. (2009–2012); Märtin u.a. (2012).
Einführung: Historien – Historie – Geschichte: Wohin führen die Medien?
31
4 Aus der Perspektive der Medien: Geschichten oder Geschichte? Angesichts der sehr unterschiedlichen Leistungen der verschiedenen Medien einerseits und der zum Teil recht kohärenten Konzeptionen von Geschichte andererseits, die innerhalb einzelner Medien entwickelt wurden oder sich für den Historiker daraus zu ergeben scheinen, stellt sich die Frage nach möglichen Integrationen: ob die untereinander eher heterogenen, aber in sich relativ homogenen Geschichten sich zu einem Bild von Geschichte zusammenführen lassen – oder ob das vielleicht gar nicht wünschenswert erscheint. Dabei kann zunächst wohl von einem Konsens darüber ausgegangen werden, dass die Vorstellung einer singularen ‚Geschichte‘, im Sinne einer alles einzelne Geschehen übergreifenden Bewegung der Veränderung, ein Konzept der modernen Geschichtsauffassung seit dem 18. Jahrhundert ist, das der Antike fremd ist37. In dem neuzeitlichen Konzept wird eine synchrone Einheit der Sektoren des kulturellen Lebens vorausgesetzt, die als solche diachron in geschichtlicher Bewegung ist. Für die Antike dagegen wird in verschiedenen Beiträgen dieses Bandes (siehe besonders Gehrke, Grethlein, Hölscher) hervorgehoben, dass die geschichtliche Zeit nicht als ‚Entwicklungs‘-Sequenz von aneinander anschließenden und aufeinander aufbauenden Epochen in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verstanden wurde; die Zeiten wurden vielmehr ohne Reflexion auf ihre relative Position im ‚Lauf der Geschichte‘ übersprungen, über- und ineinandergeblendet. Das schlagendste Beispiel dafür sind die römischen Sarkophage, in deren Mythenbilder zeitgenössische Porträts eingesetzt sind (siehe Beitrag Zanker). Die Gesellschaften der Gegenwart hielten sich die Vergangenheit als ein entzeitlichtes Damals vor Augen, und sie fügten sich selbst in ihren für die Dauer bestimmten Manifestationen in dies entzeitlichte Gedächtnis für die antizipierte Zukunft ein. Die strukturellen Grundmuster dieser Vorstellung von Zeit sind einerseits die lineare Tradition, andererseits das die Zeit überspringende Exempel. Wenn somit die moderne Geschichtsforschung nach dem übergreifenden Gang der antiken Geschichte fragt, so kann sie sich nicht auf Zeitkonzepte der Antike berufen: Weder bringen die ‚Denkmäler‘ eine solche Sicht explizit zum Ausdruck, noch sind die als ‚Überreste‘ fassbaren Produkte in einem impliziten Bewusstsein einer solchen geschichtlichen Zeitlichkeit geschaffen worden. Das bedeutet natürlich nicht, dass die Frage nach übergreifenden Zusammenhängen aus heutiger Sicht unzulässig wäre. In diesem Band sind tendenzielle Integralisten und Partialisten vertreten: Adolf Borbein sucht und erkennt zumindest strukturelle Verbindungen zwischen den unterschiedlichen Bereichen des künstlerischen Stils, der politischen Ordnung, philosophischen Systemen und breiteren Strömen der
37 S. Koselleck (1967); Koselleck (1973). Dazu Simon Goldhill in: Malincola, Llewelyn-Jones u. Maciver (2012) 347–353.
32
Ortwin Dally, Tonio Hölscher, Susanne Muth, Rolf Michael Schneider
Mentalität; Andrew Stuart verknüpft Körperkonzepte mit Staatsformen, Kriegsführung und Geschlechterdifferenzen, nicht im Sinn von strukturellen Homologien, sondern von Diskursen im Schnittpunkt von aufeinander bezogenen semantischen Feldern. Dagegen optiert Luca Giuliani für Fokussierung auf partielle Geschichten, auf der Basis teil-disziplinärer Medien. In anderen Beiträgen ist die Frage vielleicht absichtlich nicht gestellt worden. Beide Positionen haben ihre Attraktionen und Irritationen. Eine holistische Sicht geht mehr oder minder bewusst von der Voraussetzung aus, dass Menschen in ihrem kulturellen Habitus, ihrem Denken, Fühlen und Handeln, eine grundsätzliche Kohärenz ausbilden, die sowohl individuell als auch kollektiv bei den Angehörigen einer ‚Kultur‘ in Geltung ist. Wer das allerdings als ein reines Postulat ansieht, wird Fragen stellen: nach plausiblen Nachweisen oder zumindest Indizien; nach der Reichweite solcher Kohärenzen; und nach ihrer Entstehung. Tatsächlich haben die Homologien zwischen Prinzipien der ‚klassischen‘ Bildkunst, der Philosophie und der Struktur des Staates eine starke Plausibilität. Wenn man jedoch solchen Zusammenhängen weiter nachgeht, so bleibt eine zentrale Frage, wie diese Kohärenz zwischen weit voneinander liegenden sozialen und kulturellen Lebensbereichen zu verstehen ist, das heißt, wie sie zustande kommen kann. Offensichtlich wurden die Konzepte und Formen der Kultur, zumindest was die bewussten und expliziten Handlungen und Diskurse betrifft, innerhalb der einzelnen Sektoren der Politik, Wissenschaft und Kunst mit dem Ziel spezifischer politischer, wissenschaftlicher und künstlerischer ‚Fortschritte‘ entwickelt. Explizite Verbindungen zwischen den Sektoren wurden nur in besonderen Fällen von einzelnen ‚Denkern‘ hergestellt, zunehmend erst seit dem 5. Jahrhundert v. Chr.: Hippodamos von Milet suchte eine Vermittlung zwischen Stadtplanung und Gesellschaftsstruktur, Alkmaion von Kroton verglich ‚Gesundheit‘ und ‚Krankheit‘ im menschlichen Körper und im Staat, Damon aus Athen postulierte Auswirkungen musikalischer Stile auf die Ethik der Zuhörer. Zumeist aber kann man kaum an direkte Übertragungen von einem Bereich in den anderen, von der Politik in die Philosophie und die Kunst oder umgekehrt, denken; die Komplexität der Strukturen und Veränderungen von ‚Kultur‘ ist mit einem Modell der unmittelbaren Folge von Ursachen und Wirkungen kaum zu erfassen. In der Regel muss es sich bei solchen Zusammenhängen eher um homologe Ausformungen von unbewusst zugrunde liegenden, allgemeinen Denk-, Seh- und Verhaltensweisen handeln, die in den verschiedenen Sektoren zu vergleichbaren Konzepten, Manifestationen und Kreationen führten. Die anthropologischen Grundlagen solcher unbewusster Vernetzung sind noch weitgehend unbekannt; die Voraussetzungen müssten in der Gehirnforschung gesucht werden. Je stärker aber von durchgängigen unbewussten Grundmustern des kulturellen Habitus in den verschiedenen Bereichen des Denkens und Verhaltens ausgegangen wird, desto mehr wird die weitere Frage drängend, wie es in den verschiedenen Sektoren des sozialen und kulturellen Lebens zu geschichtlichen Veränderungen kommt. Da bei diesen Fragen angesichts der unsicheren Grundlagen und fehlender Methoden einstweilen der homogenisierenden Spekulation und Beliebig-
Einführung: Historien – Historie – Geschichte: Wohin führen die Medien?
33
keit keine festen Grenzen gesetzt sind, ist es zumindest verständlich, wenn von vorsichtigeren Stimmen zur Abstinenz von holistischen Konzepten geraten wird. Die Option für partielle Geschichten kann zum einen von dem Zweifel ausgehen, ob Menschen und Gesellschaften ihren kulturellen Habitus tatsächlich zu einer durchgängigen Homogenität ausbilden, oder ob nicht auf den verschiedenen Feldern der sozialen und kulturellen Strukturen und Praktiken beträchtliche Divergenzen auftreten können. Wie weit etwa zwischen den Stilformen der Bildwerke, den Formeln der Inschriften, den Gattungsstilen der Literatur und den Formen der Erinnerung in den Werken der ‚intentionalen Geschichte‘ tatsächlich Kohärenzen ausgemacht werden können, steht zumindest noch in Frage. Zum anderen kann die Option für Partialität für sich in Anspruch nehmen, dass auf diesem Weg überzeugende Erkenntnisse entstanden sind. Die Bücher über Augustus von Jochen Bleicken, Werner Eck und Paul Zanker haben ihre Stärke gerade darin, dass sie von spezifischen Medien, Schriftquellen, Inschriften und Bildkultur mit ihren spezifischen Leistungen, ausgehen und damit ganz verschiedene Aspekte dieses Kaisers hervorheben: Biographie und politische Strukturen, Personalpolitik und Reichsverwaltung, öffentliche Repräsentation und Bildkultur38. Gelingen konnte diese Partialität allerdings nur dadurch, dass dabei die übrigen Bereiche der Geschichte des frühen Prinzipats voll im Blick blieben und implizit präsent sind. Schließlich muss generell eingeräumt werden, dass der Blick und die Darstellung des Historikers grundsätzlich niemals die ganze Komplexität des geschichtlichen Lebens erfassen kann; sonst müsste man das geschichtliche Leben selbst erklärend wiederholen. Was der Historiker ernsthaft tun kann, ist immer nur: partielle Pfade verfolgen – allerdings in dem Bewusstsein, dass sie Teile eines großen Wegenetzes sind, welches erst das ganze Territorium ausmacht. Man wird Kohärenz und Divergenz nicht als alternative Optionen verstehen. Mag sein, dass heute die Divergenzen und Widersprüche in den Weltbildern aktueller sind. Das soll jedoch kein Plädoyer für partielle Geschichten gegenüber der ‚Geschichte‘ sein. Denn es sind dieselben Menschen und Gesellschaften, die mit und in den verschiedenen Medien lebten, und in deren Köpfen und Körpern auch die divergenten und widersprüchlichen Geschichten sich abspielten und produziert wurden. In diesem Sinn wird man sicher danach fragen, in welchen Diskursen Querverbindungen zwischen den verschiedenen kulturellen Feldern gezogen werden konnten. Das geschah – und kann immer geschehen – in räumlicher Differenzierung und zeitlicher Veränderung, also in geschichtlichen Dimensionen. Solange Menschen und Gesellschaften im Fokus unseres Interesses stehen, werden wir ihre kohärenten wie divergenten Geschichten zusammenführen, zu dem Netz von Sinn und Unsinn, das wir Geschichte nennen39.
38 Bleicken (1998/2010); Eck (1998/2006); Zanker (1987/2004). 39 Programm bei Meier (2005).
34
Ortwin Dally, Tonio Hölscher, Susanne Muth, Rolf Michael Schneider
Literaturverzeichnis Appadurai (1986): Arjun Appadurai (Hg.), The Social Life of Things. Commodities in Cultural Perspective, Cambridge u.a. Belting (2001): Hans Belting, Bild-Anthropologie. Entwurf für eine Bildwissenschaft, München. Bleicken (1998/2010): Jochen Bleicken, Augustus. Eine Biographie (4. Auflage 2010, Hamburg), Berlin. Borsó u. Kann (2004): Vittoria Borsó u. Christoph Kann (Hgg.), Geschichtsdarstellung. Medien, Methoden, Strategien, Köln/Weimar/Wien. Buschor (1913/1914): Ernst Buschor, Griechische Vasenmalerei (2. Auflage 1914), München. Buschor (1936): Ernst Buschor, Die Plastik der Griechen, Berlin. Cichorius (1896–1900): Conrad Cichorius, Die Reliefs der Traianssäule, Berlin. Crivellari u.a. (2004): Fabio Crivellari, Kay Kirchmann, Marcus Sandl u. Rudolf Schlögl (Hgg.), Die Medien der Geschichte. Historizität und Medialität in interdisziplinärer Perspektive, Konstanz. Droysen (1883/1935/1971): Johann Gustav Droysen, Historik. Vorlesungen über Enzyklopädie und Methodologie der Geschichte (Hg. Rudolf Hübner 1935, 6. Auflage 1971), München. Eck (1998/2006): Werner Eck, Augustus und seine Zeit (4. Auflage 2006), München. Engell (2003): Lorenz Engell (Hg.), Medien der Antike, Weimar. Engell, Bystricky u. Krtilova (2010): Lorenz Engell, Jiri Bystricky u. Katerina Krtilova (Hgg.), Medien denken. Von der Bewegung des Begriffs zu bewegten Bildern, Bielefeld. Fehr (1979): Burkhard Fehr, Bewegungsweisen und Verhaltensideale, Bad Bramstedt. Fless (2002): Friederike Fless, Rotfigurige Keramik als Handelsware. Erwerb und Gebrauch attischer Vasen im mediterranen und pontischen Raum während des 4. Jhs. v. Chr., Internationale Archäologie, Bd. 71, Rahden. Gehrke u.a. (2009–2012): Hans Joachim Gehrke, Pascal Arnaud u. Francesco Prontera (Hgg.), Geografia e politica in Grecia e a Roma, (Conferenze di ricerca italo-franco-tedesche Villa Vigoni I–III), Geographia Antiqua 18–21, Firenze. Gell (1998): Alfred Gell, Art and Agency. An Anthropological Theory, Oxford. Giuliani (1986): Luca Giuliani, Bildnis und Botschaft. Hermeneutische Untersuchungen zur Bildniskunst der römischen Republik, Frankfurt am Main. Giuliani (2003): Luca Giuliani, Bild und Mythos. Geschichte der Bilderzählung in der griechischen Kunst, München. Gotter (2000): Ulrich Gotter, „Akkulturation als Methodenproblem der historischen Wissenschaften“, in: Wolfgang Eßbach (Hg.), wir/ihr/sie. Identität und Alterität in Theorie und Methode, Würzburg, 373–406. Grethlein (2010): Jonas Grethlein, The Greeks and Their Past. Poetry, Oratory and History in the Fifth Century BCE, Cambridge. Haug (2012): Annette Haug, Die Entdeckung des Körpers. Körper- und Rollenbilder im Athen des 8. und 7. Jahrhunderts v. Chr., Berlin. Helbig (1998): Jörg Helbig (Hg.), Intermedialität. Theorie und Praxis eines interdisziplinären Forschungsgebiets, Berlin. Hesberg u. Thiel (2003): Henner von Hesberg u. Wolfgang Thiel (Hgg.), Medien in der Antike. Kommunikative Qualität und normative Wirkung, Köln. Hickethier (2003): Knut Hickethier, Einführung in die Medienwissenschaft, Stuttgart/Weimar. Hölscher (2009): Tonio Hölscher, Herrschaft und Lebensalter. Alexander der Große: Politisches Image und anthropologisches Modell, Basel. Hölscher (2012): Tonio Hölscher, „Bilderwelt, Lebensordnung und die Rolle des Betrachters im antiken Griechenland“, in: Ortwin Dally, Susanne Moraw u. Hauke Ziemssen (Hgg.), Bild – Raum – Handlung. Perspektiven der Archäologie, Berlin/Boston, 19–44.
Einführung: Historien – Historie – Geschichte: Wohin führen die Medien?
35
Holtorf (2005): Cornelius Holtorf, „Geschichtskultur in ur- und frühgeschichtlichen Kulturen Europas“, in: Jan Assmann u. Klaus E. Müller (Hgg.), Der Ursprung der Geschichte. Archaische Kulturen, das Alte Ägypten und das Frühe Griechenland, Stuttgart, 87–111. Hornung (1966): Erik Hornung, Geschichte als Fest. Zwei Vorträge zum Geschichtsbild der frühen Menschheit, Darmstadt. Kloock u. Spahr (2000): Daniela Kloock u. Angela Spahr, Medientheorien. Eine Einführung (4. Auflage 2012), Paderborn. Koselleck (1967): Reinhart Koselleck, „Historia Magistra Vitae. Über die Auflösung des Topos im Horizont neuzeitlich bewegter Geschichte“, in: Hermann Braun u. Manfred Riedel (Hgg.), Natur und Geschichte. Karl Löwith zum 70. Geburtstag, Stuttgart, 196–219. Koselleck (1973): Reinhart Koselleck, „Geschichte, Geschichten und formale Zeitstrukturen“, in: Reinhart Koselleck u. Wolf-Dieter Stempel (Hgg.), Geschichte, Ereignis und Erzählung. Poetik und Hermeneutik V, München, 211–222. Kurke (2011): Leslie Kurke, Aesopic Conversations. Popular Tradition, Cultural Dialogue, and the Invention of Greek Prose, Princeton. Lagaay u. Lauer (2004): Alice Lagaay u. David Lauer, „Einleitung – Medientheorien aus philosophischer Sicht“, in: Alice Lagaay u. David Lauer (Hgg.), Medientheorien. Eine philosophische Einführung, Frankfurt am Main/New York, 7–29. Latour (1991): Bruno Latour, Nous n’avons jamais été modernes, Paris. Latour (1999): Bruno Latour, Politiques de la nature. Comment faire entrer les sciences en démocratie, Paris. Latour (2005/2007): Bruno Latour, Reassembling the Social. An Introduction to Actor-NetworkTheory, Oxford. Deutsch: Eine neue Soziologie für eine neue Gesellschaft. Einführung in die Akteur-Netzwerk-Theorie, Frankfurt am Main. Leschke (2003): Rainer Leschke, Einführung in die Medientheorie, München. Marincola, Llewelyn-Jones u. Maciver (2012): John Marincola, Lloyd Llewelyn-Jones u. Calum Maciver (Hgg.), Greek Notions of the Past in the Archaic and Classical Eras. History without Historians, Edinburgh. Märtin u.a. (2012): Ralf-Peter Märtin, Friederike Fless, Gerd Graßhoff u. Gabriele Pieke, „Die Welt vermessen“, in: Exzellenzcluster TOPOI – Staatliche Museen zu Berlin (Hg.), Jenseits des Horizonts. Raum und Wissen in den Kulturen der alten Welt. (Ausstellungskatalog Berlin 2012), Stuttgart, 54–65. Meier (2005): Christian Meier, „Programm einer Geschichtsschreibung“, in: Trabant (2005) 149–164. Merten (1999): Klaus Merten, Einführung in die Kommunikationswissenschaft. Band 1/1: Grundlagen der Kommunikationswissenschaft, Münster u.a. Müller (1999): Klaus E. Müller, Die fünfte Dimension. Soziale Raumzeit und Geschichtsverständnis in primordialen Kulturen, Essener Kulturwissenschaftliche Vorträge 3, Göttingen. Müller (2005): Klaus E. Müller, „Der Ursprung der Geschichte“, in: Jan Assmann u. Klaus E. Müller (Hgg.), Der Ursprung der Geschichte. Archaische Kulturen, das Alte Ägypten und das Frühe Griechenland, Stuttgart, 17–86. Münker (2008): Stefan Münker, „Was ist ein Medium? Ein philosophischer Beitrag zu einer medientheoretischen Debatte“, in: Münker u. Roesler (2008) 322–337. Münker u. Roesler (2008): Stefan Münker u. Alexander Roesler (Hgg.), Was ist ein Medium?, Frankfurt am Main. Muth (1998): Susanne Muth, Erleben von Raum – Leben im Raum, Heidelberg. Muth (2011): Susanne Muth, „Ein Plädoyer zur medientheoretischen Reflexion – oder: Überlegungen zum methodischen Zugriff auf unsere historischen Primärquellen“, in: Alexandra Verbovsek, Burkhard Backes u. Catherine Jones (Hgg.), Methodik und Didaktik in der Ägyptologie, Paderborn, 327–346.
36
Ortwin Dally, Tonio Hölscher, Susanne Muth, Rolf Michael Schneider
Osborne (2011): Robin Osborne, The History Written on the Classical Greek Body, Cambridge. Papini (2011): Massimiliano Papini, Città sepolte e rovine nel mondo Greco e romano, Bari. Peter u. Seidlmayer (2006): Ulrike Peter u. Stephan Seidlmayer (Hgg.), Mediengesellschaft Antike? Information und Kommunikation vom Alten Ägypten bis Byzanz, Berlin. Raible (2006): Wolfgang Raible, Medien-Kulturgeschichte. Mediatisierung als Grundlage unserer kulturellen Entwicklung, Heidelberg. Rajewsky (2002): Irina O. Rajewsky, Intermedialität, Tübingen/Basel. Reusser (2002): Christoph Reusser, Vasen für Etrurien. Verbreitung und Funktionen attischer Keramik im Etrurien des 6. und 5. Jahrhunderts vor Christus, Zürich. Riegl (1903/1995): Alois Riegl, Der moderne Denkmalkultus, seine Entstehung, seine Bedeutung, Wien. Wieder abgedruckt in: Wolfgang Kemp (Hg.), Alois Riegl. Gesammelte Aufsätze, Berlin 1995, 144–193. Schneider (1975): Lambert Schneider, Zur sozialen Bedeutung der archaischen Korenstatuen, Hamburg. Schott (1968): Rüdiger Schott, Das Geschichtsbewusstsein schriftloser Völker, Archiv für Begriffsgeschichte 12/2, 166–205. Schott (1990): Rüdiger Schott, Die Macht des Überlieferungswissens in schriftlosen Gesellschaften, Saeculum 41/3–4, 273–316. Schott (2000): Rüdiger Schott, Die Macht des Überlieferungwissens in akephalen Gesellschaften in der westafrikanischen Savanne, Saeculum 51/2, 175–190. Stewart (1997): Andrew Stewart, Art, Desire and the Body in Ancient Greece, Cambridge. Tanner (2006): Jeremy Tanner, The Invention of Art History in Ancient Greece, Cambridge. Trabant (2005): Jürgen Trabant (Hg.), Sprache der Geschichte, München. Vernant (1990): Jean-Pierre Vernant, Figures, idoles, masques, Paris. Walter (2001): Uwe Walter, „Die Botschaft des Mediums. Überlegungen zum Sinnpotential von Historiographie im Kontext der römischen Geschichtskultur zur Zeit der Republik“, in: Gert Melville (Hg.), Institutionalität und Symbolisierung. Verstetigungen kultureller Ordnungsmuster in Vergangenheit und Gegenwart, Köln/Weimar/Wien, 241–279. Zanker (1987/2003): Paul Zanker, Augustus und die Macht der Bilder (4. Auflage 2003), München. Zanker (1995): Paul Zanker, Die Maske des Sokrates. Das Bild des Intellektuellen in der antiken Kunst, München.
Historiographie: Die Gegenwart in der Geschichte
37
Hans-Joachim Gehrke
Historiographie: Die Gegenwart in der Geschichte 1 Tradition: Geschichte im Medium von Kunst Der Blick der Griechen auf und in ihre Vergangenheit war entschieden der Blick des Künstlers, in erster Linie der des Poeten, aber auch – nicht zuletzt Tonio Hölscher hat das besonders im Auge gehabt – der des Bildkünstlers1. In dem Ambiente der frühen Eisenzeit, in der sich die griechischen Gemeinschaften neu formierten, einem – medial gesprochen – oralen Milieu, gab es in diesen Gemeinschaften unterschiedliche Gedächtnisspezialisten. Sehr wichtig, besonders für die Fragen der religiösen Regeln und Rituale, aber auch für die wesentlichen Aspekte des sozialen Zusammenlebens, vor allem die Streitschlichtung, waren die so genannten archives vivantes, die mnámones bzw. mnémones2. Sie kannten die für die Gemeinschaft wesentlichen Rechtssätze auswendig, sakrale wie nicht-sakrale (man sprach seinerzeit vom „Göttlichen“ und „Menschlichen“), und sie dienten deshalb den Funktionsträgern der jeweiligen Gemeinschaften als Experten. Übrigens behielten sie diese Aufgabe auch noch, wenigstens teilweise, nach Einführung der Schrift für die Fixierung der Sakral- und Rechtsvorschriften in schriftlicher Form bei. Sie hielten freilich lediglich fest, was immer zur Hand sein sollte bzw. in dem jeweiligen Fall aktuell gefragt war. Das Ältere, über das sie geboten, wurde nicht als solches thematisiert und der Gegenwart gegenübergestellt, sondern reichte schlicht in sie hinein: Es würde und sollte auch in Zukunft genau so sein. Genau dafür standen diese „Erinnerer“. Sie waren infolgedessen auch weit davon entfernt, von der Vergangenheit zu berichten oder zu erzählen. Was sie erinnerten, erinnerten sie nicht als vergangenes Geschehen, sondern als geltende Sätze. Und sie beließen – jedenfalls idealiter – den von ihnen vorgefundenen Fundus, ohne ihn zu verändern. Dem standen die Sänger gegenüber. Auch sie agierten aus dem Gedächtnis und auch sie waren insofern Gedächtnisspezialisten. Sie waren dies sogar in einer ganz besonderen, man könnte fast sagen, emphatischen Weise. Denn ihnen standen die Töchter der Erinnerung, der Mnemosyne, und des Zeus höchstpersönlich bei, die Musen. Diese verbürgten geradezu, wie Oliver Primavesi jüngst eindrucksvoll gezeigt
1 Im vorliegenden Beitrag werden Gedanken und Beobachtungen weitergeführt, die ich schon andernorts angestellt habe. Verwiesen sei deshalb vor allem auf Gehrke (2005). Gehrke (2010a), wo sich auch weitere Hinweise zu Quellen und Literatur finden. 2 Vgl. hierzu etwa Gehrke (1997) 45–46.
38
Hans-Joachim Gehrke
hat3, den Wahrheitsanspruch der Sänger und Dichter, zugleich aber auch die Eleganz und den ästhetischen Reiz dessen, was diese zu bieten hatten. Diese künstlerische Qualität kam aber auch, wie wir schon an den frühesten uns erhaltenen Werken, bei Homer und Hesiod, sehen können, nicht zuletzt in der variatio der Motive und Formen zum Ausdruck. Hier wurde dann aber auch kreiert, ergänzt, erweitert, modifiziert. Für uns besteht zwischen dieser dichterischen Freiheit, die wir schnell mit dem Fiktionalen verbinden, und dem Anspruch auf Wahrheit, den wir gerne im Sinne der Korrektheit verstehen, ein Spannungsverhältnis – vorsichtig ausgedrückt. Es muss von vornherein festgehalten werden, dass man im alten Griechenland damit offenbar weithin wenig Probleme hatte. Bereits und gerade dies ist für den griechischen Umgang mit der Vergangenheit generell sehr charakteristisch. So schwer es rational nachvollziehbar ist, so deutlich muss man es in Rechnung stellen. Sänger und Dichter waren insofern Hüter des Gedächtnisses, sie sprachen wahr, aber immer wieder auf andere Weise, jedenfalls möglichst attraktiv. Und wahr (alethés) hieß primär: glaubwürdig; innerlich plausibel, möchte man fast sagen. Ob das so verlässlich war, wie die Sätze der „Erinnerer“, fragte man nicht weiter, man unterstellte es; und im Zweifelsfalle hätte man auf die Musen verweisen können, die immer wieder angerufen wurden. Was aber war es nun, was diese Poeten im Gedächtnis hatten bzw. was die Musen ihnen anvertrauten? Nehmen wir Demodokos, den blinden Sänger der Odyssee, der doch diese poetische Gestalt und deren soziale Funktion poetisch reflektiert4. Er singt von Göttern und ihren Affären, und das ist weitgehend zeitlos, wie die Götter selbst es sind. Dann aber kündet er von Heldentaten, von großen und besonderen Leistungen. Diese liegen in großer Nähe, sind fast noch aktuell, ein Beteiligter und incognito Anwesender, Odysseus, fühlt sich lebhaft an seine eigenen Erfahrungen erinnert. Es handelt sich um die jüngste Vergangenheit, eine konkret erinnerte bzw. erinnerbare Eben-Erst-Vergangenheit, die fast noch Gegenwart ist bzw. mit dieser eng zusammenhängt. Wir stellen uns die Entwicklung dann gerne so vor, dass aus derartigen Gesängen, die von Gedächtnisspezialisten dieser Art tradiert wurden, allmählich ein dichtes Gewebe von Liedern und Texten entstand, aus denen auswählend ein bedeutender Autor (oder mehrere von dieser Qualität) sehr voraussetzungsreiche und literarisch höchst komplexe Gebilde wie die Ilias und die Odyssee schuf5. Nie zu übersehen ist aber – und die Demodokos-Szene signalisiert das –, dass es letztlich immer um die Gegenwart ging, genauer: dass deren Bedürfnisse der Ausgangspunkt waren. Denn der soziale Ort und die soziale Funktion des Gesanges war das Stiften des Nachruhms, des kléos. An diesem waren die zeitgenössischen Konsumenten der Poeme lebhaft, ja
3 Primavesi (2009) bes. 106–111. 4 Hom. Od. 8,256–413. 5 Die Literatur hierzu ist unübersehbar, vgl. jetzt den Überblick Zimmermann (2011) 15–17, 47–51 (Michael Reichel). Für eine mögliche Rekonstruktion vgl. Burkert (1987/2001).
Historiographie: Die Gegenwart in der Geschichte
39
existentiell interessiert. Es ging ja um nichts Anderes, als um die Verlängerung des sozialen Ansehens über die individuelle Lebensspanne hinaus, und damit zugleich um nichts Geringeres als um die Gewinnung eines Stücks Unsterblichkeit. Genau diesem Sachverhalt verdanken die Dichter als die Künder, gleichsam Medien des Nachruhms letztendlich ihr soziales Ansehen und ihr Selbstbewusstsein. Es wundert nicht, dass diese Zusammenhänge wieder und wieder thematisiert werden, in den homerischen Epen nicht nur in der Szene mit Demodokos, sondern noch mehr in der Gestalt des Achill, der den Ruhm einem langen Leben vorzieht und dann sein elendes Dasein in der Unterwelt beklagt. Dass er aktuell Nachruhm produziert, war aber auch dem Dichter Simonides etwa präsent, wenn er es in der Plataiai-Elegie mit Homer aufnimmt (es ging ja auch um sein eigenes kléos)6. Überhaupt war das eine ganz gängige Vorstellung, wenn es um Tradierung ging. So könnte man diese Art von Epik und alles, was sich dann in den verschiedensten Genres daran anschloss und immer wieder an ihr Maß nahm, als eine Art umgekehrte Nachruhmpflege sehen: Was einst, zu Lebzeiten der großen Helden, zu deren Nachruhm gesungen wurde, ist über lange Zeiträume hinweg zu Werken geworden, die noch viel später von diesem Ruhm künden. Was die Sänger erinnern (was mithin wesentliche Elemente der griechischen Vergangenheit ausmacht), ist also im Kern zeitgeschichtlicher Bericht, der zum Zwecke des Ruhms erstattet wurde und insofern dem Anschein nach auch Vergangenes treulich wiedergibt, Erinnerungspflege eben als Nachruhmpflege. Der Blick wendet sich nicht, sozusagen historisch, von der Gegenwart aus zurück, sondern von einer zukünftigen Welt, auch einer ganz fern liegenden, zurück in die dann zur Vergangenheit gewordenen Gegenwart – wobei die Zukunft als solche (etwa im Sinne einer Prophezeiung oder einer futurologischen Perspektive) gar nicht interessiert, sondern nur als Zeitraum, in den hinein sich der Nachruhm erstreckt und in den man sich gedanklich schon einmal hineinversetzt7. Auf diese Weise kommt eine sehr spezifische Verquickung von Vergangenheit und Gegenwart zustande (die Zukunft noch mit einbegriffen). Man konnte die Vergangenheit als eine Gegenwart sehen, der gegenüber die aktuelle Gegenwart noch die Zukunft war. Umgekehrt konnte man auf die zutiefst gegenwärtige Vergangenheit wie auf ein längst dahingeschwundenes Präteritum blicken. Zeit bildete hier nicht einen gerichteten Zeitpfeil – auch wenn man sich das, man denke an den Weltaltermythos, so denken konnte. Vielmehr waren die Zeitverhältnisse eher reziprok bzw. ein Hin und Her, was auch bewusst blieb. Das kann man nicht zuletzt an den homerischen Epen beobachten. Während Odysseus durch den Sänger Demodokos mit seinen eigenen Leistungen und den Taten seiner Gefährten konfrontiert wird, haben es die Hörer der homerischen Rhapsoden mit einer ganz anderen Form von Vergangenheit zu tun: Das Geschehen und
6 Sim. fr. 11,15–25 West. 7 Ganz ähnlich sieht das Foxhall (1995), mit weiterem Material.
40
Hans-Joachim Gehrke
seine Protagonisten sind dort ganz betont und in prononcierter Weise in eine Distanz gerückt, und werden dabei zugleich in einer besonderen Weise, wie in einem Fernglas, betrachtet. Sie sind größer und gewaltiger. Die Helden sind einfach viel kräftiger und stärker, ganz konkret heben sie locker und mit links Steine, die die „Heutigen“, d.h. also die Hörer des Epos, nicht einmal beidhändig stemmen könnten. Und sie gleichen doch auf der anderen Seite in all ihren Werten und Motiven, ihrem Verhalten und Denken, ihren Problemen und Ängsten, mitsamt ihrem politisch-sozialen Umfeld all den Menschen, die sich die Gesänge über sie anhören8. Man gewinnt den klaren Eindruck, dass hier ein bestimmtes System zurückprojiziert und dabei vergrößert wurde. Vergleichbar der umgekehrten Nachruhmpflege kommt es auch hier zu einer besonderen Verschränkung von Präteritum und Präsens: Die Vergangenheit wird von der Gegenwart her gesehen, ja konstruiert. Sie, die Gegenwart, ist eigentlich die Herrin über die Vergangenheit. Hier kann man nicht lediglich von der Vergegenwärtigung der Vergangenheit sprechen (wie man es noch in Bezug auf den Ruhm tun könnte), sondern von einer besonderen (nämlich monumentalisierenden) ‚Vergangenheitung‘ der Gegenwart. Freilich wäre auch das zu einfach gesehen. Denn diese künstlich-künstlerisch produzierte Vergangenheit trat denn doch als Vergangenheit auf, sie wurde von ihren Produzenten – man denke an den erwähnten Anspruch auf Wahrheit – durchaus so verstanden. Mindestens konnte man sie so sehen und hat man sie auch so gesehen. Sie konnte der Gegenwart also als eine vergangene Zeit gegenübergestellt werden, als eine glorreiche und ruhmvolle Vergangenheit, mit monumentalen und grandiosen Zügen. Vieles war auf diese Weise besonders klar, wie gezoomt: Leiden und Leidenschaft, Kampf und Krieg, Hassen und Töten. Und was die aktuellen Gemeinschaften, also das Publikum, bewegte, wurde hier gleichsam wie unter einem Mikroskop durchsichtig, Hybris und Konflikt, Ehrsucht und Ruhmbegier, Kränkung und Rache. Die Zeitstrukturen konnten auch gedehnt werden. Hinter dem Präteritum konnte da und dort ein Plusquamperfekt sichtbar werden – zu Jugendzeiten des alten Nestor waren die Leute noch einmal kräftiger und die Ereignisse entsprechend bedeutender. Man findet häufiger die Elterngeneration erwähnt, und in der Odyssee besteht ein besonderer Reiz in dem kontrastierenden Nebeneinander von Großvater, Vater und Sohn. Daneben gibt es Zeichen genealogischen Denkens, bei Odysseus’ Vorfahren und dem Hinweis auf die Aineiaden9. Hier bot sich dann auch die Möglichkeit, die Kluft zwischen Vergangenheit und Gegenwart gleichsam seriell zu überbrücken, durch die Kette von Generationen. Gerade dies wird nun weiter entfaltet durch Hesiod, den wir ja in demselben Milieu ansiedeln können: Hier finden sich schon längere Linien. Vor der Jetztzeit und der Epoche der Heroen, die sich im wesentlichen um
8 Hierzu s. besonders plastisch van Wees (1992). 9 Zu den Generationen s. Hom. Od. 16,117–120. Zu den Aineiaden s. Hom. Il. 20,306–308, vgl. auch Grethlein (2006) 65–77.
Historiographie: Die Gegenwart in der Geschichte
41
die drei Generationen vor, während und nach dem Trojanischen Krieg, ‚dem‘ Großereignis der Griechischen Geschichte im griechischen Selbstverständnis, rankt, liegen noch ältere Zeitalter, und davor die Entstehung der Welt und der Götter sowie die Scheidung von Göttern und Menschen. In den bezeichnenderweise unter Hesiods Namen überlieferten sogenannten Frauenkatalogen und auch anderswo wird die Linie auch in Richtung Präsens ausgezogen. Die Vergangenheit gewinnt hier ein Stück Gegenwart (und vice versa), weil sie in sie hineinreicht, nun nicht nur durch den Nachruhm der Helden, sondern durch die Reihe der Geschlechter von damals bis heute. Vergangenheit und Gegenwart sind genealogisch vermittelt. Dies wird nun besonders wichtig für die Formierung soziopolitischer Einheiten, die mit der Entwicklung dieser Vergangenheitsvorstellungen nicht zufällig zeitlich zusammenfällt. Die neuen und zunehmend auch institutionalisierten Einheiten gewannen auf diese Weise eine kollektive Identität und zugleich einen historischen Platz in der Welt. Das kommt besonders klar zum Ausdruck in dem identifikatorischen „Wir“, mit dem etwa Tyrtaios und Mimnermos von ihrer mythistorischen Vergangenheit, der sogenannten Dorischen und der Ionischen Wanderung sprechen – „wir sind gemeinsam mit den Herakliden auf die Pelopsinsel gekommen“ bzw. „wir haben das steile Pylos und die Stadt des Neleus verlassen“10. So entstand relativ schnell ein dichtes Geflecht von Geschichten und Motiven, Varianten und Versionen, die in Gesängen und schließlich auch in Kunstwerken dargeboten wurden, in jeweils ganz verschiedenen Gattungen – im Vortrag, im Lied, im Chor. Immer wieder wurde dort die Brücke geschlagen zwischen Göttern und Menschen, Vergangenheit und Gegenwart, Mythos und Zeitgeschichte. Noch bei Pindar und in der attischen Tragödie wird das besonders deutlich, auf je verschiedene Weise. Besonders charakteristisch ist dabei, dass die Angehörigen der verschiedenen Gemeinschaften häufig nicht nur als Auditorium fungierten, sondern auch und nicht selten, besonders anlässlich der verschiedenen Feste, beteiligt waren, indem sie für die Götter nicht nur sangen, sondern auch tanzten11. Dabei ging es sehr oft um Mythen, die man als Geschichte verstand, und immer kamen diese im Gewand der Kunst einher, zunehmend auch flankiert und unterstützt durch bildliche Darstellungen, die ihrerseits zunehmend auch die öffentlichen Räume prägten und ihrerseits für eine charakteristische Vergegenwärtigung sorgten12. Mindestens ebenso wichtig war aber die performative Präsenz der Mythistorie in den Gruppengesängen und Tänzen, etwa im Dithyrambenwettbewerb im demokratischen Athen13, wo jeweils 50 Männer und Knaben pro Phyle in Wettbewerben antraten, somit jährlich 1000 Athener, also mehr als zehn Prozent. Hier wurde die Ge-
10 Tyrtaios fr. 2,14f. West (vgl. das Possessivpronomen ebd. 5, 1); Mimnermos fr. 9,1 West. 11 Hierzu s. jetzt vor allem Kowalzig (2007). 12 Vgl. hierzu auch den Beitrag von Tonio Hölscher im vorliegenden Band sowie zu den Spezifika der Bildersprache Giuliani (2010). 13 Vgl. vor allem Zimmermann (2008).
42
Hans-Joachim Gehrke
schichte intensiv memoriert und sogar gleichsam in die Glieder getrieben. Vor allem wurde durch die Darbietung beim Fest und im Agon das an sich schon reziproke Verhältnis von Vergangenheit und Gegenwart gleichsam aktuell bzw. aktualisiert und immer wieder konkret bekräftigt. Gerade die ritualisierte bzw. rituelle, häufig auch kultisch-religiöse Repetition verbürgte die Präsenz und damit das Präsens des Präteritum. Weil das regelmäßig geschah und immer wieder vorkam, war man sich sicher, dass das in der Zukunft ankommen werde und dass man in der Zukunft von der eigenen Gegenwart als einer – dann ebenfalls eigenen – Vergangenheit wissen werde. Es handelte sich darüber hinaus bzw. gerade deshalb um eine wunderschöne Vergangenheit, um eine ganz ästhetische Geschichte, herrlich anzuschauen und wunderbar anzuhören. Sie war anregend und verlockend und attraktiv – und ist das bis heute, sonst würden wir uns kaum damit so intensiv beschäftigen. Zugleich war sie von einer unendlichen Vielfalt und einer grenzenlosen Varianz. Kein Poem glich dem anderen, kein Bild sah so aus wie das, welches doch demselben Gegenstand gewidmet war, keine Darbietung lief so ab wie die vorangegangene. Jeder Hersteller und Beteiligte, schaffender wie darstellender Künstler, Professioneller wie Amateur, wollte besser sein als der Andere und der Vorgänger. Wenn jüngst Dieter Langewiesche von der Pluralität von Geschichtsbildern in Demokratien gesprochen hat14, so haben wir hier – unter ganz anderen Rahmenbedingungen – ein mindestens ebenso pluralistisches Neben-, Mit-, Über- und Gegeneinander der Vergangenheitsvorstellungen. Wir können sie noch heute greifen, wenn auch größtenteils nur in Fragmenten, buchstäblich kleinen Fetzen von Genealogien. Keine übergeordnete Instanz sorgte für einen Kanon, nur der Sinn für ästhetische Qualität unter den Beteiligten führte zur Prävalenz von Werken bzw. Autoren und Künstlern, z.B. Homer und Hesiod, die auf solche Weise, wie später andere, zu Klassikern wurden15. Bei aller Vielfalt galt dennoch mutatis mutandis, was Goethe 1797 sagte: „Die literarische Welt hat das Eigne, dass in ihr nichts zerstört wird, ohne dass etwas Neues daraus entsteht, und zwar etwas Neues derselben Art“16. Gewisse Strukturen kamen nämlich immer wieder vor, ja der gesamte Vergangenheitsraum war auf eine zusammenhängende Weise kartiert. Gewisse Genealogien und Motive wurden immer wieder erzählt und erwähnt, Vergangenheit und Gegenwart immer wieder aufs neue und doch immer wieder auf ähnliche Weise miteinander verbunden, in den langen Linien der Geschlechter oder in der unmittelbaren Konfrontation, der wechselseitigen Vergegenwärtigung und ‚Präterisierung‘, wie sie etwa in Simonides’ Plataiai-Elegie auf besondere Weise sichtbar wird.
14 Langewiesche (2008) 112. 15 Vgl. jetzt Gehrke (2010b). 16 Johann Wolfgang von Goethe an Karl Ludwig von Knebel, Jena, 2. März 1797, in: Goethe u. Knebel (1851) 143.
Historiographie: Die Gegenwart in der Geschichte
43
2 Innovation: Der Einsatz der Historiographie Es wird deutlich: Hier geht es um Themen, die im Rahmen des vorliegenden Bandes auch von anderen behandelt werden (und gewiss auch kompetenter), und nicht um das mir aufgegebene Thema, um Historiographie. Das liegt nicht nur daran, dass Historiker gerne immer weiter zu den Vorläufern zurückgehen und dann in der Vorgeschichte stecken bleiben. Ich hielt und halte das auch – gleichsam als Vorrede und da es ja um Vergegenwärtigung gehen soll – für notwendig. Viel zu sehr gehen wir ja davon aus, in der griechischen Historiographie, in deren Tradition wir uns nicht selten immer noch gerne hineinstellen, ‚das‘ Medium oder wenigstens ein zentrales Element der griechischen Vergangenheitspflege, des kollektiven Gedächtnisses der Griechen, zu sehen. Dabei ist sie doch eher etwas Exzeptionelles, das gerade angesichts auch anthropologisch erfassbarer Formen kollektiver Erinnerung überhaupt nicht selbstverständlich ist, sondern ein zutiefst erklärungsbedürftiges Phänomen darstellt. Als die Geschichtsschreibung einsetzte, hatten die Griechen längst – und das sollten die vorangehenden holzschnittartigen Bemerkungen verdeutlichen – ihre eigene Vergangenheit, in allen Facetten und in Gestalt eines wohl klingenden, gut komponierten und schön aussehenden Ensembles, das im Übrigen bestens bekannt war, weil es bestens gepflegt wurde. Die Griechen haben eben nicht sehnsüchtig auf die Historiographie gewartet, um eine Vergangenheit geschenkt zu bekommen, und sie haben sie dann auch, als es sie denn gab, weitestgehend ignoriert – in dem Maße wahrscheinlich, in dem die heutige Bevölkerung unseres Landes bzw. unserer Länder in ihrer Mehrheit die Debatten und Erkenntnisse der Geschichtswissenschaft nicht zur Kenntnis nimmt (womit wir denn doch eine Gemeinsamkeit zwischen beiden hätten). Vor die Frage nach der Vergegenwärtigung durch Historiographie schiebt sich also das Problem von deren keineswegs selbstverständlicher Entstehung. Bei dessen Erörterung wird sich zeigen, dass die Umstände dieser Entstehung mit dem Aspekt der Vergegenwärtigung in besonderer Weise verbunden sind, dass also beide Fragen bzw. Probleme eng miteinander zusammenhängen. Genetisch gehört die Historiographie nun einerseits ganz gewiss in den Kontext der eben erwähnten Modi und Gattungen der Erinnerung. Dass kann man schon daran erkennen, dass diese in ihrer Zielsetzung (des Tradierens und damit der Nachruhmpflege), mit ihren sprachlichen Fügungen, ihrer verbalen Kunst und ihrer narrativen Struktur massiv auf die Geschichtsschreibung eingewirkt haben17. Wichtige Elemente dieser Erinnerung, die Genealogien sowie insbesondere die Verquickung von Gründungsgeschichten, Helden, Gründerheroen, Gruppen und Gegenwart ließen sich auch in Prosa ausdrücken. Sie kamen auf diese Weise auch auf das Feld der sich gerade im 5. Jahrhundert immer weiter verbreitenden und professionalisierenden Rhetorik. Hie-
17 Hierzu s. statt vieler und besonders instruktiv Boedeker (1996) und Rengakos (2006); zu Herodot s. aber beispielsweise bereits Pohlenz (1937).
44
Hans-Joachim Gehrke
rin könnte man die Linie einer Entwicklung des historischen Erzählens durch die verschiedenen Genres, ausgehend vom Epos und der folgenden Erschließung anderer, zunächst poetischer Gattungen sehen. Auch mit der Rhetorik hätte man die besondere Bedeutung der Performanz und die Wirkung in die gesellschaftlich-bürgerliche Breite hervorzuheben18. Ein neues, ja ganz neues Element kam demgegenüber durch die im 6. Jahrhundert zunächst in Ionien aufblühende Philosophie und historíe¯ ins Spiel, die zunächst mit Erinnerung und Geschichte nichts zu tun hatte19. Es ging dort primär bekanntlich um das Suchen und Fragen nach den archaí im Blick auf die Natur, um das Messen und Zählen, um Konstruieren und Harmonisieren, um das kritische Prüfen entlang den Regeln der Rationalität wie der Subjektivität. Der geistbegabte Kopf, der sich im Sinne eines Geistessportes mit nicht zweckgebundenen Fragen beschäftigte, bildete nicht erst in der späteren Stilisierung einen ganz bestimmten Typus, der sich gerade von der minder begabten und für derart Höheres uninteressierten Masse abhob. Er war entschieden elitär. Der erste Satz im Werk dessen, der sich mit den skizzierten Anliegen und Regularien auf Geographie und Geschichte, und damit auf das Feld der Erinnerung begab, bringt das ganz entschieden zum Ausdruck: „Hekataios von Milet erzählt Folgendes (hóde mytheítai): Ich schreibe dies, wie es mir wahr zu sein scheint, denn die Reden (lógoi) der Griechen sind reichhaltig und lächerlich (polloí kaí geloíoi)“20. Gerade hier sollte mithin kein Platz für die erwähnten traditionellen Formen sein. Es handelte sich, mindestens dem Anspruch nach, um eine klare und gezielte Absage an die herkömmliche Erinnerungspflege und intentionale Geschichte der Griechen und um das Versprechen von etwas Besserem, gerade wenn es um Wahrheit ging, die doch den alten Sängern durch die Musen verbürgt schien, nicht durch ihr eigenes Urteil21. Zu diesem elitären Habitus gehörte nun ganz entschieden auch der geistige Konkurrenzkampf mit den wenigen anderen Größen, die man jeweils auch, wie das Aristokraten gerne tun, in die Nähe der vielen Dummen rückte, also primär ebenfalls der Lächerlichkeit zieh. Das blieb nun aber keineswegs auf die unmittelbare Diskussion beschränkt und auf einer insofern lediglich performativen Ebene. Das Medium der Schrift, das auch in der erwähnten Poesie wichtig war, freilich hinter der Darbietung zurücktrat, bekam hier eine ganz spezifische Funktion: Was richtig und wahr war, handelte man nicht nur mündlich aus. Vielmehr verbreitete man seine jeweiligen Positionen auch in Büchern. Die Debatten der Intellektuellen erhielten auf diese Weise eine diachrone Perspektive.
18 In diese Richtung gehen die Beobachtungen und Überlegungen von Grethlein (2010). 19 Diesen Zusammenhängen hat vor allem von Fritz (1967) nachgespürt – ein heute zu Unrecht nahezu vergessenes Werk. 20 Hekat. FGrHist 1 F 1 Jacoby. 21 Für die Perseveranz dieses methodischen Ansatzes im griechischen historiographischen Diskurs vgl. Plut. Thes. 1,5.
Historiographie: Die Gegenwart in der Geschichte
45
Wie sich daraus lange Linien des argumentativen Hin und Her ergeben konnten, die man auch bei entsprechender Akzentuierung als eine Geschichte des Fortschritts oder doch wenigstens des Fortschreitens wahrnehmen konnte, zeigt bereits ein Blick auf das erste Buch der aristotelischen Metaphysik, in dem der große Philosoph gleichsam die diesbezüglichen Grundsätze und Lehren seiner Vorgänger in ihrer Abfolge skizziert, ein erster Abriss der Philosophiegeschichte22. Ähnliches ließe sich auch für andere Felder und Genres, nicht zuletzt die Historiographie, zeigen. Hier geht es immer wieder um ein argumentatives und polemisches Streiten, aber doch damit zugleich immer wieder um ein Wiederaufgreifen, um ein neues und erneutes Aufgreifen von Dingen, die von den Vorgängern behandelt waren und in denen man sich als besser erweisen konnte und wollte als diese; und das geschah auf lange zeitliche Distanz (wenn man so will, reicht sie bis heute). Im Blick auf solche Zusammenhänge hat Jan Assmann von „Hypolepse“ gesprochen23. Gerade in der Logik dieser Diskurse kam es aber zu dem entscheidenden Sprung in der Genese der Historiographie. Schon längst hatte man in den verschiedenen, älteren und neueren Gattungen der Erinnerungspflege längere Linien in die Vergangenheit gezogen und mittels derer Einmündung in die Gegenwart geschichtlich zu argumentieren gelernt: mit Ansprüchen und Beschuldigungen, wenn es um Konflikt und Konkurrenz, Rechtsstreit oder Krieg ging. Man wusste, wer zuerst im Recht war oder mit dem Ärger angefangen hatte, wer mit wem zusammengearbeitet hatte, wie sich das Geflecht von Aggression und Vergeltung entwickelt hatte. Und zugleich war das angesichts der erwähnten Pluralität immer kontrovers, weil hierzu alle Beteiligten jeweils anderes geltend machen konnten. Wir können solche Verfahrensweisen noch sehr gut nachverfolgen, und Herodot kannte sie natürlich mindestens ebenso gut wir. Er nimmt sie sogar am Anfang seines Geschichtswerks mit der Frage nach der Ursache des großen und grundsätzlichen Konflikts zwischen Hellenen und Barbaren als Geschichte von Frauenentführungen auf – und geradezu auf die Schippe24. An anderer Stelle, in der von ihm selber so konstruierten Debatte zwischen den Tegeaten und den Athenern um den angemessenen Platz in der Schlachtreihe von Plataiai, konfrontiert er sie mit einem ganz anderen Argumentationsmodell25. Und in beiden Fällen kommt die Gegenwart bzw. die nähere und zugängliche Vergangenheit, wir könnten geradezu sagen: die Zeitgeschichte, ins Spiel. Bereits am Anfang von Herodots Geschichtswerk wird aber auch klar, dass der Rekurs auf die Gegenwart bzw. das Zeitnahe aus einem heuristischen bzw. methodischen Grundproblem resultiert, das genau mit der gerade erwähnten Logik des rational-individuellen Verfahrens zusammenhängt, dem sich Herodot verpflichtet weiß.
22 Aristot. metaph. 1,3,983 b 7 – 1,10,993 a 27. 23 Assmann (1992) 280–292. 24 Hdt. 1,1,1–1,5,3. 25 Hdt. 9,26–27., vgl. hierzu Grethlein (2010) 173–177; zu Herodot generell Giangiulio (2005), mit besonderer Betonung der narratologischen Aspekte.
46
Hans-Joachim Gehrke
Es geht, genauer gesagt, um die Frage nach der begründeten Erkenntnis, nach dem Wissen, die wegen des subjektiven Faktors auch mit der persönlichen Erfahrung zusammenhängen26. Indem letztlich das eigene Wahrnehmen, in Gestalt des Sehens oder doch wenigstens des unmittelbaren Hörensagens, den Ausschlag für das Wissen und damit auch das Urteilen gibt, verkürzt sich der Blick in die Vergangenheit, konzentriert sich maximal auf das Drei- oder Vier-Generationenschema der oral history oder des „kommunikativen Gedächtnisses“27. Konsequenterweise kam Herodot dann, indem er das nach den o. a. Kriterien möglichst weit zurückverfolgte, bis zu Kroisos. Geschichte in diesem Sinne, nach den Regeln der Philosophie und historíe¯, von Denken und Gewissheit, ist damit zwangsläufig Zeitgeschichte oder wenigstens so etwas wie Neueste Geschichte. Die hiermit (jedenfalls nach unserem Kenntnisstand) inaugurierte Gattung der Historiographie musste also insofern gar nicht vergegenwärtigen, sie war ganz nah an der Gegenwart, auf Tuchfühlung mit ihr sozusagen. Denn sie war ja überhaupt nur von dieser unmittelbar her zu erschließen und zu ergründen. Wollte sie ihren eigenen Ansprüchen treu sein und bleiben, dann musste sie in ihrer Tiefendimension von der Reichweite des Blicks aus der Gegenwart bestimmt sein. Man könnte sich deshalb – und prima facie vor diesem Hintergrund nicht unplausibel – die Frage stellen, ob Herodot überhaupt ein Historiker im vollen Sinne genannt werden kann. Das ist freilich bei näherem Zusehen ganz unberechtigt. Herodot weiß sich zwar ganz betont der neuen Methode verpflichtet (und Rosalind Thomas hat bis ins Detail hinein beschrieben, wie weit das ging28), aber er wirft das Alte nicht über Bord, im Gegenteil. Seine Wendung zu Kroisos nach der Erörterung der Frauengeschichten zu Beginn des Werkes ist insofern keine totale Absage an das spatium mythicum, wie schon vor einiger Zeit Klaus Nickau unterstrichen hat29. Herodot trägt durchaus die älteren Erinnerungsformen weiter (und auch das mag rechtfertigen, dass ich auf diesen anfangs so lange verweilte). Er hat sich trotz des neuen Ansatzes – wir dürfen durchaus hinzufügen: glücklicherweise – nicht auf das Neue und direkt Ermittelbare beschränkt bzw. er hat den Begriff des Ermittelbaren gerade durch die Dimension des Hörensagens, der logoi eben, ausgedehnt. Denn sein primäres Anliegen war nicht die Recherche an sich, sondern das Bewahren oder umgekehrt: das Verhindern des Vergessens (me¯ exíte¯la géne¯tai). Damit verrät er sich auf jeden Fall und sehr markant als Historiker, und damit steht er zugleich der episch-literarischen Zielsetzung der Nachruhmpflege sehr nahe, wie er ja auch expressis verbis davon spricht, dass die großen Leistungen der Menschen nicht „ohne Ruhm“ (akleâ) sein sollten. Somit gehört zum Gegenstand des For-
26 Hdt. 1,5,3. 27 Vansina (1985); Assmann (1992) 48–64; Foxhall (1995) 132–149. 28 Thomas (2000). 29 Nickau (1990) 91–100. Wie dieser größere Vergangenheitsraum organisiert war, hat Vannicelli (2001) dargelegt.
Historiographie: Die Gegenwart in der Geschichte
47
schens auch, was man früher und über Früheres und noch Früheres erzählt hat. Die lógoi der Hellenen (und anderer) werden nicht so verworfen, wie es Hekataios angekündigt hatte. Wenn man so will, handelt es sich um einen Kompromiss zwischen der alten intentionalen Geschichte und der modernen kritischen Recherche-Geschichte. Mir scheint Herodot das auch selber zu verdeutlichen: Als Berichterstatter und damit als Erzähler seiner historíe¯, seiner Forschungen, verzeichnete er auch, was aktuell als Geschichte kursierte, auch lógoi, die in ältere Zeiten zurückführen. Für diese freilich übernimmt er keine intellektuelle Garantie, wie er am Beispiel der Diskussionen um die Nichtbeteiligung von Argos am Kampf gegen Xerxes zeigt, in dem es um die mythistorische Verwandtschaft von Argivern und Persern, also um ein traditionelles Argumentieren, ging30. Im Übrigen nahm Herodot zu der entfernten Vergangenheit durchaus Stellung, zumal wenn es um die zentrale Hellenen-Barbaren-Thematik ging31. Zudem nimmt er Deutungen der Vergangenheit von der Gegenwart her vor und lässt zugleich Licht von der Vergangenheit auf die Gegenwart fallen, bietet also eine ganz eigene Verschränkung von Vergangenheit und Gegenwart32. Überhaupt hielt er dafür, dass die historischen Ereignisse erst abgeschlossen sein müssten, damit sie ihre didaktische Wirkung entfalten konnten33. Er befand sich also gleichsam in einer mittleren Position. Damit stand er der traditionellen und intentionalen Geschichte nicht völlig fremd gegenüber. Er sucht sie zu integrieren, wie er sich ja auch sprachlich und narrativ auf ihre Formen bezieht34. Dies erklärt nicht zuletzt auch seine Attraktivität. Allerdings bildet das kritisch-rationale Verfahren auch bei ihm die erkenntnistheoretische Grundlage. Und es geht ihm auch und gerade darum, mit seinen Recherchen in der Vergangenheit auf die aktuelle Politik zu wirken und deren Verständnis und Beurteilung zu fördern.
3 Vergangenheit und Gegenwart in der griechischen Geschichtsschreibung Dass Herodot mit diesen Grundsätzen kein Einzelfall blieb, lag nicht nur an seiner Wirkung, sondern auch daran, dass er im Sinne der erwähnten Hypolepse so, wie er sich seinerseits schon auf Hekataios bezog, in Kompetition und Polemik, einen nachahmenden Konkurrenten fand. Dieser schritt auf dem gebahnten Wege energisch und mit besonderer Konsequenz weiter, gerade damit Herodot weiterführend und transzendierend. Er verstärkte das Moment des kritischen Prüfens und des intellektuellen
30 Hdt. 7,152. 31 Nickau (1990) 91–100. 32 Raaflaub (2002) 21. 33 Grethlein (2009) 215. 34 Vgl. die Hinweise o. Anm. 17.
48
Hans-Joachim Gehrke
élenchos gerade im Hinblick auf das Ermitteln und die Genauigkeit, die Wahrheit, wie er sie verstand, mit einer besonderen Skepsis gegenüber der Überlieferung und den traditionellen Formen ihrer Pflege, insbesondere wenn sie sich ins Gewand der Rhetorik kleidete, wie Jonas Grethlein jüngst mehrfach gezeigt hat35. Er reizte das Prinzip besonders aus, indem er die ältere Geschichte geradezu nach den Regeln der Logik – einer anthropologischen Machtlogik – behandelte und damit geradezu zwangsläufig auf Eigenoptik und Zeitgeschichte fixiert war36. Damit bildete Thukydides definitiv ein Modell, wie schon daraus erhellt, dass mehrere Historiker direkt an ihn anschlossen und sein Werk schlicht fortsetzten, darunter bekanntlich Xenophon. Wenn man hinzunimmt, dass Thukydides selber in seiner Darstellung der Pentekontaetie, wenn auch thematisch orientiert, den zeitlichen Anschluss an Herodot findet, dann ergibt sich hieraus gleichsam eine fortgeschriebene griechische Geschichte bzw. ein fortlaufender Bericht über die „griechischen Angelegenheiten“ (ta helle¯niká). Das blieb im jeweiligen zeitlichen, sozusagen biologischen Rahmen der Autoren und Generationen, aber letztlich immer in deren jeweiliger Gegenwart – wobei das kritische Potential durchaus variierte und sich auch markante Veränderungen ergaben, die weiter unten angesprochen werden. Die Historiographie – so wie sie entstanden war und sich in den ersten drei Generationen von Herodot über Thukydides zu Xenophon und anderen entwickelt hatte – benötigte in diesem Sinne eigentlich keine Vergegenwärtigung, weil sie im Grunde präsentisch war. Man kann von hier aus innerhalb der gesamten griechischen Historiographie, bis in die spätbyzantinische Zeit, eine fortlaufende Linie von Autoren ziehen, die immer wieder aneinander anknüpften, nicht ohne Polemik zwar, aber doch so die griechische Geschichte insgesamt von der Perspektive eigenen Erlebens und der eigenen Lebensspanne her stetig fortschreibend. Wie sollte man aber nun, wenn man nicht, wie Xenophon, völlig darauf verzichtete, mit der Vergangenheit umgehen, die man ja schließlich aus den erwähnten Epen, Gedichten, Erzählungen, Reden und Bildern in ihrer ganzen Vielfalt und Varianz kannte und von denen man geradezu überflutet wurde, beim Fest und Kult, in der Volksversammlung und sogar vor Gericht? Herodot wollte die Dinge, wie wir sahen, schlicht festhalten, auch wo er sie nicht erkenntnistheoretisch durchdringen konnte, und tendierte gerade unter dem Aspekt der aus der Geschichte zu ziehenden Lehren für eine größere zeitliche Tiefe. Demgegenüber dehnte Thukydides, wie schon angedeutet, das rationale Verfahren und die kritische Prüfung noch weiter auf die frühe Vergangenheit aus, wohl wissend – wie am Beispiel der Tyrannentöter sichtbar gemacht wird –, dass dies noch schwieriger war als die Recherche unter Zeitzeugen. Damit im Zusammenhang unterzog er aber nicht nur die ältere Überlieferung, sogar eine Autorität wie Homer, einer
35 Vor allem Grethlein (2005); Grethlein (2010) 205–280. 36 Zu Thukydides’ ‚Archäologie‘ in diesem Sinne s. Gehrke (1993); vgl. auch Nicolai (2001).
Historiographie: Die Gegenwart in der Geschichte
49
kritischen Überprüfung, sondern entwickelte darüber hinaus auch ein gedanklichlogisches Instrumentarium zur Rekonstruktion auch der weiter zurück liegenden Vergangenheit, das er aus Beobachtungen und Reflexionen des politischen Geschehens, vor allem des von ihm selbst erfahrenen und bedachten, abstrahierte. Zwar macht er das vor allem in einem Abschnitt zu Beginn seines Werkes, der sogenannten Archäologie37, deutlich, der stark argumentativ geprägt ist, weil es ihm nicht um die Alte Geschichte schlechthin ging, sondern um den Beweis dafür, dass ‚sein‘ Krieg der größte bisher dagewesene war. Aber die frühe Zeit kommt damit in den Blick und Thukydides zeigt, wie er mit ihr umgeht, und dass dabei bestimmte Regeln maßgeblich sind. Gerade diese waren ihm aber – das zeigt die Rede vom ktêma es aeí – besonders wichtig38, denn es handelte sich um Gesetzmäßigkeiten, die sich aus der im Wesentlichen gleich bleibenden Natur des Menschen ergeben. Dieser Blick auf die Vergangenheit kann durchaus als eine Vergegenwärtigung verstanden werden. Bei ihm haben ja gerade Zeitanalysen und -erfahrungen eine Rolle gespielt, freilich auch philosophische Reflexionen über die menschliche Natur, die ihrerseits auf ältere Weisheiten und Einsichten, auch und gerade solche der Poesie, zurückgreifen konnten. Wir können das besonders in der seinerzeitigen Tragödie beobachten, und manche Entsprechung zwischen Thukydides und Euripides unterstreicht dies. Insofern ist übrigens die bekannte Differenzierung in der Poetik des Aristoteles zu relativieren39. Die Vergangenheit gerät also nicht nur in den Blick des aufmerksam-kritisch ermittelnden Historikers, sondern auch einer historisch-philosophisch reflektierten und reflektierenden Analyse allgemein menschlichen Verhaltens, die mit eigenen Zeiterfahrungen rückgekoppelt und abgeglichen wird. Geschichte auf diese Weise, mit dem Anspruch auf Wahrheit und Wirklichkeit, neu zu konstituieren ist ein überaus kühner Gedanke, in dem Thukydides, wenn ich richtig sehe, keinen wirklichen Nachfolger fand. Auch bei ihm liefert also die Gegenwart den Ausgangspunkt. Sie wird aber nicht lediglich zurückprojiziert, sondern aus Logik und nach Regeln, die überzeitlich gelten, gleichsam in die Vergangenheit zurückgeschrieben. Sie ist dann für nachdenkende Menschen gut verständlich und nachvollziehbar, insofern auch nah und gegenwärtig, wenn man so will. Geschichte wird hier nicht schlicht weitergegeben, sondern gleichsam produziert, von einer Gegenwart her, aber gerade mit dem Blick auf ihre zeitlosen Elemente. Was aber geschieht nun mit der ‚richtigen‘ älteren Geschichte, wie die meisten Griechen sie sahen, mit den alten Erzählungen, von dem, was blieb, was berichtet wurde. Thukydides griff ja nur auf, was er argumentativ brauchte, im Sinne der aúxe¯sis am Anfang des Werkes40 bzw. zur Illustrierung der Größe und Bedeutung Siziliens im
37 Thuk. 1,1,2–1,21,2. 38 Thuk. 1,22,4. 39 Vgl. auch Erler (1997) 93 zu „Generalisierungen“ bei Thukydides. 40 Maddoli (1994); vgl. Luraghi (2000).
50
Hans-Joachim Gehrke
6. Buch oder in der Polemik gegen die falschen Geschichtsvorstellungen der Athener. Wie aber werden die alten Geschichten und Erzählungen ansonsten in der griechischen Historiographie vergegenwärtigt? Auch hier liefert Herodot die Beispiele: Es ist – sozusagen ganz traditionell – der Modus des Erzählens, genauer: der narrativen Vergegenwärtigung. Immer wieder wird neu und anders erzählt, die Vielfalt der Varianten und der Performanz hält das Alte lebendig, in der wachsenden Vielfalt der Geschichtsschreibung mit ihrer eigenen Agonalität nicht anders als in der von Varianten strotzenden Literatur und Kunst41. Hier hat sich dann auch eine zunehmende Interaktion zwischen der – sagen wir – populären Geschichte der Kunst und Rhetorik und der intellektuellen Historiographie ergeben. Sie charakterisiert die Optik der griechischen Historiographie seit dem 4. Jahrhundert und dem beginnenden Hellenismus. Die Verlebendigung und damit Vergegenwärtigung der Geschichte in Monument und Fest nimmt Bezug auch auf die Historiographie und vice versa, die Rhetorik entfaltet ihre Vergangenheitsbilder vor allem im Licht epideiktischen und insofern gegenwärtigen Rühmens und färbt schon als das Medium stilistisch-sprachlicher Formung auf die Geschichtsschreibung ab, und in immer länger werdenden Ehrendekreten erweist sich, wie Nino Luraghi gezeigt hat, der Demos als aktueller Erzähler, historiographische Werke nutzend und seinerseits beeinflussend42. Aus Platzgründen kann das hier nicht näher ausgeführt werden. Festgehalten sei nur, dass gerade auf diese Weise eine neue und spezifische Verbindung von Mythos und Historiographie zustande kam, der sich auf die Vergegenwärtigung innerhalb der Historiographie wesentlich auswirkte. Ein alter Mechanismus, den man besonders schon angesichts der intellektuell-ästhetischen Verarbeitung der Perserkriege beobachten konnte, wird nun geläufig: Zeitgeschichte wird mythifiziert, und das wiederum trägt zur narrativen Vergegenwärtigung von Vergangenheit entscheidend bei. Dies zeigt besonders der Umgang mit einem inkommensurablen Ereigniskomplex, nämlich der paradoxen Veränderung der Welt durch Alexander. Viele Alexanderhistoriker mythifizierten den großen König, indem sie seine Leistungen ins Übermenschliche erhöhten. Generell werden seine Taten und Leistungen wie auch die seiner wichtigsten Gefährten von Historikern, die sich ihrerseits als Künder seines – und damit ihres – Ruhmes verstehen, in geradezu homerischer Weise und mit deutlichen Reminiszenzen an die homerische Epik dargestellt, gerade von Kennern wie Ptolemaios und Nearch43. Noch Arrian hebt (im zweiten Proömium seiner Alexándrou anábasis) hervor, dass Alexander – anders als sein Idol und Vorfahr Achill mit Homer – bisher keinen „Herold“ seines Ruhms gefunden habe, nun aber er selber
41 Aspekte der Narratologie werden in der neueren altertumswissenschaftlichen Forschung immer stärker in den Blick genommen, vgl. etwa, exempli gratia, die Beiträge in Grethlein u. Rengakos (2009). 42 Luraghi (2010). 43 Den Hinweis auf Nearch verdanke ich meiner Mitarbeiterin Veronica Bucciantini, die dies in ihrer demnächst erscheinenden Dissertation herausgearbeitet hat.
Historiographie: Die Gegenwart in der Geschichte
51
diese Aufgabe übernommen habe: Er halte sich nicht für unwürdig, den ersten Platz in der griechischen Literatur einzunehmen, vergleichbar dem Alexanders im Krieg44. Wir bleiben generell, um in Anlehnung an anders ansetzende Beobachtungen von Reinhart Koselleck einen kurzen Ausblick zu riskieren, immer im Bereich der historiae, der Geschichten im Plural45. Und diese sind weit entfernt von der historistischen Distanzierung von Vergangenheit und Präteritum mit der Betonung des Eigengewichts vergangener Epochen oder dessen radikalisierter Variante in Michel Foucaults Postulat der Tötung der Gegenwart. Sie mögen uns aber daran erinnern, dass auch der Historismus in seinem Objektivitätspostulat ersticken kann, zumal wenn er es wirklich darauf anlegt, „die Gegenwart zu töten.“46. Sehen wir heute einmal von der möglichen Bereicherung der Geschichte durch die Kunst ab: Auch nach der Sattelzeit kommt Geschichte nicht ohne Vergegenwärtigung aus; das ist ihre Schwäche und ihre Stärke zugleich. Mit Marc Bloch könnte man hervorheben: „Die Zeitalter (sind) so eng miteinander verbunden, dass Verstehbarkeit in beiden Richtungen möglich ist. Unkenntnis der Vergangenheit führt zwangsläufig zu einem mangelnden Verständnis der Gegenwart. Es ist aber vielleicht nicht weniger vergeblich, angestrengt die Vergangenheit verstehen zu wollen, solange man über die Gegenwart nicht Bescheid weiß“47.
Literaturverzeichnis Assmann (1992): Jan Assmann, Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen, München. Bloch (1997/2002): Marc Bloch, L’apologie pour l’histoire ou Métier d’historien, Paris (deutsch: Apologie der Geschichtswissenschaft oder Der Beruf des Historikers, Stuttgart). Boedeker (1996): Deborah Boedeker, „Heroic Historiographie: Simonides and Herodotus on Plataea“, Arethusa 29, 223–242. Burkert (1987/2001): Walter Burkert, „The Making of Homer in the Sixth Century B. C.: Rhapsodes versus Stesichoros“, in: J. Paul Getty Center for the History of Art and the Humanities (Hg.), Papers on the Amasis Painter and his World. (Colloquium Sponsored by the Getty Center for the History of Art and Humanities and Symposium Sponsored by the J. Paul Getty Museum, Malibu 1987, 43–62), jetzt in: Walter Burkert, Kleine Schriften I. Homerica, hrsg. v. Christoph Riedweg, Göttingen 2001, 198–217. Carr (1961/1963): Edward Hallett Carr, What is history?, London (deutsch: Was ist Geschichte?, Stuttgart 1963).
44 Arr. Exped. Alex. 1,12,1–5. 45 Koselleck (2000) 27–77. 46 Foucault, zitiert nach Veyne (1986) 145. Das komplette Zitat lautet: „Die Geschichte dient nicht dazu, die Vergangenheit wiederauferstehen zu lassen, sondern die Gegenwart zu töten.“ 47 Bloch (1997/2002) 50, vgl. Carr (1961/1963) 24: „Drittens können wir die Vergangenheit nur mit den Augen der Gegenwart sehen und sie somit auch nur von daher verstehen“.
52
Hans-Joachim Gehrke
Erler (1997): Michael Erler, „‚Mythos und Historie‘ – Die Atlantisgeschichte als Platons Antwort auf die Frage: ‚Wie und wozu Geschichtsschreibung?‘ und Aristoteles’ Reaktion, Dialog. Klassische Sprachen und Literaturen 31, 80–100. Foxhall (1995): Lin Foxhall, „Monumental Ambitions. The significance of posterity in Greece“, in: Nigel Spencer (Hg.), Time, Tradition and Society in Greek Archaeology: bridging the ‚great divide‘, London, 132–149. Foxhall, Gehrke u. Luraghi (2010): Lin Foxhall, Hans-Joachim Gehrke u. Nino Luraghi (Hgg.), Intentional History. Spinning Time in Ancient Greece, Stuttgart. Gehrke (1993): Hans-Joachim Gehrke, „Thukydides und die Rekonstruktion des Historischen“, Antike und Abendland 39, 1–19. Gehrke (1997): Hans-Joachim Gehrke, „Gewalt und Gesetz. Die soziale und politische Ordnung Kretas in der Archaischen und Klassischen Zeit“, Klio. Beiträge zur alten Geschichte 79, 23–68. Gehrke (2005): Hans-Joachim Gehrke, „Die Bedeutung der (antiken) Historiographie für die Entwicklung des Geschichtsbewußtseins“, in: Eve-Marie Becker (Hg.), Die antike Historiographie und die Anfänge der christlichen Geschichtsschreibung, Berlin/New York, 29–51. Gehrke (2010a): Hans-Joachim Gehrke, „Representations of the past in Greek culture“, in: Foxhall, Gehrke u. Luraghi (2010) 15–33. Gehrke (2010b): Hans-Joachim Gehrke, „Die Griechen und die ‚Klassik‘“, in: Karl-Joachim Hölkeskamp u. Elke Stein-Hölkeskamp (Hgg.), Die Griechische Welt. Erinnerungsorte der Antike, München, 584–600, 668–669. Giangiulio (2005): Maurizio Giangiulio (Hg.), Erodoto e il ‚modello erodoteo‘. Formazione e trasmissione delle tradizioni storiche in Grecia, Trento. Giuliani (2010): Luca Giuliani, „Myth as past? On the temporal aspect of Greek depictions of legend“, in: Foxhall, Gehrke u. Luraghi (2010), 35–55. Goethe u. Knebel 1851: Johann Wolfgang von Goethe u. Karl Ludwig von Knebel, Briefwechsel (1774–1832). 2. Teil, Leipzig. Grethlein (2005): Jonas Grethlein, „Gefahren des lógos. Thukydides ‚Historien‘ und die Grabrede des Perikles“, Klio 87, 41–71. Grethlein (2006): Jonas Grethlein, Das Geschichtsbild der Ilias. Eine Untersuchung aus phänomenologischer und narratologischer Perspektive, Göttingen. Grethlein (2009): Jonas Grethlein, „How Not To Do History: Xerxes in Herodotus’ Histories“, American Journal of Philology 130, 195–218. Grethlein (2010): Jonas Grethlein, The Greeks and Their Past. Poetry, Oratory and History in the Fifth Century BCE, Cambridge. Grethlein u. Rengakos (2009): Jonas Grethlein u. Antonios Rengakos (Hgg.), Narratology and Interpretation. The Content of Narrative Form in Ancient Literature, Berlin – New York. Koselleck (2000): Reinhart Koselleck, Zeitschichten. Studien zur Historik, Frankfurt am Main. Kowalzig (2007): Barbara Kowalzig, Singing for the Gods. Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, Oxford. Langewiesche (2008): Dieter Langewiesche, Zeitwende. Geschichtsdenken heute. Herausgegeben von Nikolaus Buschmann u. Ute Planert, Göttingen. Luraghi (2000): Nino Luraghi, „Author and audience in Thucydides’ archaeology: Some reflections“, Harvard Studies in Classical Philology 100, 227–239. Luraghi (2001): Nino Luraghi (Hg.), The Historian’s Craft in the Age of Herodotus, Oxford. Luraghi (2010): Nino Luraghi, „The demos as narrator: public honors and the construction of future and past“, in: Foxhall, Gehrke u. Luraghi (2010) 247–263. Maddoli (1994): Gianfranco Maddoli, „Die Konzeption von Wachstum und Großwerden in der griechischen Geschichtsschreibung des 5. Jh.“, in: Egert Pöhlmann u. Werner Gauer (Hgg.), Griechische
Historiographie: Die Gegenwart in der Geschichte
53
Klassik (Vorträge bei der interdisziplinären Tagung des Deutschen Archäologenverbandes und der Mommsengesellschaft vom 24.–27. 10. 1991 in Blaubeuren), Nürnberg, 129–139. Nickau (1990): Klaus Nickau, „Mythos und Logos bei Herodot“, in: Wolfram Ax (Hg.), Memoria rerum veterum. Neue Beiträge zur antiken Historiographie und Alten Geschichte. (Festschrift für Carl Joachim Classen zum 60. Geburtstag), Stuttgart, 83–100. Nicolai (2001): Roberto Nicolai, „Thucydides’ Archaeology: Between Epic and Oral Traditions“, in: Luraghi (2001) 263–285. Pohlenz (1937): Max Pohlenz, Herodot, der erste Geschichtsschreiber des Abendlandes, Leipzig. Primavesi (2009): Oliver Primavesi, „Zum Problem der epischen Fiktion in der vorplatonischen Poetik“, in: Ursula Peters u. Rainer Warning (Hgg.), Fiktion und Fiktionalität in den Literaturen des Mittelalters, (Jan-Dirk Müller zum 65. Geburtstag), München, 105–120. Raaflaub (2002): Kurt Raaflaub, „Herodot und Thukydides. Persischer Imperialismus im Lichte der athenischen Sizilienpolitik“, in: Norbert Ehrhardt u. Linda-Marie Günther (Hgg.), Widerstand – Anpassung – Integration. Die griechische Staatenwelt und Rom, Stuttgart, 11–40. Rengakos (2006): Antonios Rengakos, „Thucydides’ Narrative: The Epic and Herodotean Heritage, in: Antonios Rengakos u. Antonis Tsakmakis (Hgg.), Brill’s Companion to Thucydides, Leiden/ Boston, 279–300. Thomas (2000): Rosalind Thomas, Herodotus in Context: Ethnography, Science and the Art of Persuasion, Cambridge. Vannicelli (2001): Pietro Vannicelli, „Herodotus’ Egypt and the Foundations of Universal History“, in: Luraghi (2001) 211–240. Vansina (1985): Jan Vansina, Oral Tradition as History, Madison. Van Wees (1992): Hans van Wees, Status Warriors. War, Violence and Society in Homer and History, Amsterdam. Veyne (1986): Paul Veyne, „Wörterbuch der Unterschiede: Über das Geschichtemachen. Ein Gespräch“, in: Ulrich Raulff (Hg.), Vom Umschreiben der Geschichte. Neue historische Perspektiven, Berlin, 132–146. Von Fritz (1967): Kurt von Fritz, Die griechische Geschichtsschreibung, Bd. 1, Berlin. Zimmermann (2008): Bernhard Zimmermann, Dithyrambos. Geschichte einer Gattung, 2. Auflage, Berlin. Zimmermann (2011): Bernhard Zimmermann (Hg.), Handbuch der griechischen Literatur der Antike. Erster Band. Die Literatur der archaischen und klassischen Zeit. Handbuch der Altertumswissenschaften 7. Abteilung, Bd. 1, München.
54
Jonas Grethlein
Jonas Grethlein
Das homerische Epos als Quelle, Überrest und Monument 1 1
1 Homer als Medium von der Antike bis in die Gegenwart In seiner Archäologie lässt Thukydides die Geschichte Griechenlands Revue passieren, um zu zeigen, dass der Peloponnesische Krieg das größte militärische Unternehmen aller Zeiten sei. Er stelle auch den Trojanischen Krieg in den Schatten, wie man aus Homer ablesen könne: o¾koyn $pisteÖn eåkfi«, o\dÍ t@« òcei« tân pfilevn m»llon skopeÖn Ó t@« dynˇmei«, nom›zein dÍ tÎn strate›an ãke›nhn meg›sthn mÍn genwsùai tân prÌ aÉtá«, leipomwnhn dÍ tân nÜn, tÕ ^Om‹roy aÛ poi‹sei eú ti xrÎ k$ntaÜùa piste÷ein, Än eåkÌ« ãpÏ tÌ meÖzon mÍn poihtÎn ònta kosmásai, ƒmv« dÍ fa›netai kaÏ oœtv« ãndeestwra (1,10,3). Also ist kein Grund zu zweifeln und auf die Pracht einer Stadt mehr zu geben als auf ihre Macht, sondern ist glaublich, daß der Trojanische Krieg wirklich der bedeutendste war aller früheren, jedoch zurückbleibt hinter den heutigen, wenn man sich auch hier wieder auf die Dichtung Homers verlassen will, der ihn als Dichter sehr wahrscheinlich überhöht hat: auch so erweist er sich noch als recht bescheiden2.
Dies belegt Thukydides mit den im Schiffskatalog genannten Zahlen. In nuce blitzt hier die Raffinesse der thukydideischen Geschichtsschreibung auf. Zum einen nutzt Thukydides die Ilias als Quelle, ja, er zitiert sogar die homerischen Zahlenangaben. Zum anderen stellt er sein Zitat unter den Vorbehalt, „wenn man sich auch hier wieder auf die Dichtung Homers verlassen will“, und signalisiert so seinen kritischen Umgang mit Quellen. Zugleich steht die von ihm bemängelte Unzuverlässigkeit Homers im Dienste seiner Argumentation: nicht einmal die dichterisch aufgebauschten Zahlen lassen auf ein Unternehmen von der Größe des Peloponnesischen Krieges schließen. Bereits vor Thukydides haben so verschiedene Autoren wie Heraklit, Xenophanes und Pindar Homer für Übertreibungen und Verzerrungen gescholten, ohne aber die Historizität der von ihm geschilderten Ereignisse in Frage zu stellen. Bis in die Gegen-
1 Eine ausführlichere englische Version der Abschnitte II und III findet sich in Grethlein (2010a). Den Organisatoren und Teilnehmern der Heidelberger Konferenz sei für eine lebhafte Diskussion, Tonio Hölscher für zahlreiche Gespräche und wichtige Anregungen gedankt. 2 Übersetzung von Landmann (1976).
Das homerische Epos als Quelle, Überrest und Monument
55
wart wird der Wert von Ilias und Odyssee als historischer Quelle verteidigt. Mit der suggestiven Rhetorik des Sensationsjournalismus beschließt etwa Joachim Latacz, einer der prominentesten Homerforscher seiner Generation, sein Buch Troja und Homer: „Die frühere Ungewissheit schwindet, und die Lösung scheint näher denn je zu liegen. Es würde nicht verwundern, wenn das Resultat bereits in naher Zukunft lauten würde: Homer ist ernst zu nehmen3.“ Ernst genommen werden die Ilias und Odyssee seit ihrer Entstehung, umstritten bleibt aber auch nach Latacz als Quelle wofür. Im Folgenden soll das homerische Epos als Medium der Geschichte auf drei Ebenen bestimmt werden. Für diese Dreiteilung erlaube ich mir, einen der wichtigsten Denker des Historismus mit einem der schärfsten Kritiker dieser Tradition in einer unfreiwilligen Menage zusammenzusperren. Droysens Historik entstammen die Begriffe ‚Quelle‘ und ‚Überrest‘: Als ‚Quellen‘ bezeichnet Droysen die „schriftlichen und mündlichen Nachrichten für die Erinnerungen4“, als ‚Überreste‘ solche Materialien, die nicht um der Überlieferung willen in die Welt gesetzt wurden, aber von uns als Zeugnisse ihrer Zeit interpretiert werden können. Der dritte in meinem Titel gebrauchte Begriff, ‚Monument‘, findet sich zwar auch in Droysens Heuristik, und zwar als eine besondere Form der ‚Denkmale‘, definiert als eine Mischung aus Quellen und Überresten, aber ich möchte ‚Monument‘ in einer anderen Bedeutung verwenden. Michel Foucault schreibt über seine Archäologie des Wissens: „Sie behandelt den Diskurs nicht als Dokument, als Zeichen für etwas anderes …, sie wendet sich an den Diskurs in seinem ihm eigenen Volumen als Monument5.“ Ohne Foucaults Ansatz als solchen zu übernehmen, entlehne ich seiner Diskursanalyse den Begriff des Monumentes, da er die Erkenntnis impliziert, dass literarische Texte Wirklichkeit nicht nur, in welcher Form auch immer, widerspiegeln, sondern auch Teil von ihr sind und, wie es die Vertreter des New Historicism betonen, an den Kreisläufen von Macht und Legitimation beteiligt sind6. Diese dreifache Annäherung an den Charakter des homerischen Epos als Medium der Geschichte wird uns von den Anfängen der griechischen Geschichte bis in die hellenistische Zeit führen. Der folgende Abschnitt, über ‚Homer als Quelle‘, wird der Frage nachgehen, ob Ilias und Odyssee historische Ereignisse aus mykenischer Zeit berichten (2). Unter der Überschrift ‚Homer als Überrest‘ werden wir uns der archaischen Zeit zuwenden, um zu sehen, inwieweit sich in das Epos seine Entstehungszeit eingeschrieben hat (3). Mit ‚Homer als Monument‘ werden wir uns dann in die Rezeptionsgeschichte der klassischen und hellenistischen Zeit begeben (4). Abschließend werde ich eine These zur Medialität des homerischen Epos als Medium der Geschichte vorstellen (5).
3 Latacz (2001) 342. 4 Droysen (1977) 70. 5 Foucault (1981) 198. 6 Prägend für den New Historicism sind die Arbeiten von Greenblatt, etwa (1980). Für eine Übersicht s. Baßler u. Greenblatt (2001).
56
Jonas Grethlein
2 Homer als ‚Quelle‘ Nachdem Odysseus mit den Phaiaken gespeist und den drei Gesängen des Demodokos gelauscht hat, gibt er sich seinen Gastgebern mit den Worten zu erkennen: eúm# #OdyseŒ« Laertiˇdh«, ¯« p»si dfiloisin $nùrØpoisi mwlv, ka› mey klwo« o\ranÌn ¬kei. (Od. 9,19–20) Ich bin Odysseus, Laertes’ Sohn, der ich mit meinen allfältigen Listen die Menschen beschäftige, und es reicht die Kunde von mir bis zum Himmel7.
In der Ilias sagt Helena über sich und Paris: oësin öpi ZeŒ« ùáke kakÌn mfiron, Ñ« kaÏ çp›ssv $nùrØpoisi pelØmeù# $o›dimoi ãssomwnoisin. (6,357–358) Denen Zeus hat auferlegt ein schlimmes Schicksal, daß wir auch künftig Zum Gesange werden den späteren Menschen8!
Beide Passagen sind Metalepsen, in denen der Erzähler Charaktere sich auf die Erzählung beziehen lässt, in deren Universum sie existieren9. Der Bezug mag von den Charakteren nicht intendiert sein, ist aber für den Rezipienten unmissverständlich: Das Medium von Odysseus’ Ruhm ist die Odyssee; von Helenas und Paris’ Leiden kündet die Ilias. Durch diese und ähnliche Passagen präsentieren sich die Epen als Quelle heroischer Taten. Nicht nur in der Antike, sondern auch in der Moderne hat man sich dementsprechend bemüht, ihre Ereignisse zu lokalisieren und mit anderen Zeugnissen in Verbindung zu setzen. Erst in den letzten Jahren haben Bittlestone und Berktold dem Berg von Arbeiten, die mit viel Scharfsinn versuchen, Ithaka zu identifizieren, zwei weitere Monographien hinzugefügt10. Für noch mehr Aufsehen hat die Diskussion um die Historizität des Trojanischen Krieges gesorgt. Da für sie nicht nur der Abgleich der epischen mit der realen Topographie, sondern weitere Zeugnisse relevant sind, möchte ich mich im Folgenden auf die Ilias und ihren Wert als Quelle im Droysenschen Sinne konzentrieren. Zuletzt wurde die Historizität des Trojanischen Krieges in einer Kontroverse deutscher Altertumswissenschaftler so heftig diskutiert, dass Kommentatoren von einer Neuauflage des Trojanischen Krieges sprachen11. Auslöser waren die Arbeiten von Joachim Latacz, der mit großem rhetorischen Einsatz dafür plädierte, die Ilias als
7 Übersetzung von Schadewaldt (1958). 8 Übersetzung von Schadewaldt (1975). 9 Zur Metalepse in der griechischen Literatur s. de Jong (2009). 10 Bittlestone (2005); Berktold (2007). 11 Für einen Überblick über die Debatte s. Cobet u. Gehrke (2002).
Das homerische Epos als Quelle, Überrest und Monument
57
Zeugnis für einen Krieg um das anatolische Hisarlik, genauer das Troja VII von Schliemanns Ausgrabung, zu lesen12. Er gründete seine These vor allem auf die Ausgrabungen von Korfmann in Hisarlik und auf hethitische Zeugnisse. Die von Korfmann freigelegte Unterstadt bezeuge, dass Troja ein mächtiges Handelszentrum gewesen sei13. Damit sei ein Grund für die militärische Intervention eines großen griechischen Aufgebots gefunden. Ferner sei das in hethitischen Quellen erwähnte Ahhijawa-Reich mit Agamemnons Mykene zu identifizieren. Latacz’ Thesen drangen bis in die Feuilletons der deutschen Tageszeitungen vor und begeisterten eine breite Öffentlichkeit, aber die meisten Altertumswissenschaftler blieben skeptisch, zu Recht14. So wird die These, Troja sei ein mächtiges Handelszentrum gewesen, nicht vom archäologischen Befund gedeckt15. Es lässt sich zudem nicht belegen, dass Troja VII einem militärischen Angriff zum Opfer fiel. Die Stadt wurde durch ein Feuer zerstört, aber die geringe Zahl von Pfeilspitzen lässt etwa Dieter Hertel in Zweifel ziehen, dass Troja überhaupt erobert wurde16. Auch die hethitischen Quellen gestatten es nicht, Latacz’ weitreichende Thesen zu verifizieren. Die Identifikation der Ortsbezeichnungen Wilusa, Taruisa und Ahhijawa mit Ilios, Troia und Achaia ist linguistisch ebenso umstritten wie ihre geographische Lokalisierung unsicher17. In einem Dokument scheint zwar Ahhijawa im Zusammenhang mit einem Streit um Wilusa erwähnt zu werden, aber von einer Belagerung der Stadt durch Achaier ist nicht die Rede18. Gegen Latacz’ These spricht auch die Medialität des homerischen Epos. An der quaestio Homerica scheiden sich zwar noch heute die Geister: vor allem deutsche Unitarier betonen die Rolle der Schrift für die Komposition von Ilias und Odyssee19, während Oralisten besonders in Amerika die Mündlichkeit in den Vordergrund rücken20. Als unbestritten kann aber gelten, dass die homerischen Epen ihren Ursprung in mündlichen Rezitationen haben21. Mit dem Zusammenbruch der mykenischen Zivilisation verschwand die Schrift aus der griechischen Kultur und kehrte erst wieder im 8. Jh. zurück22. Gehen wir also von einer Entstehung des Epos in der ersten Hälfte des 7. Jhs. aus, so hätte die Sage vom Fall Trojas über einen Zeitraum von 550 Jahren mündlich überliefert werden müssen. Komparatistische Studien belegen aber, dass
12 Zu Schliemann s. Calder u. Cobet (1990); Traill (1993); Traill (1995); Easton (2002). 13 Latacz (2001). 14 Zur Kritik an Latacz s. die Beiträge in Ulf (2003); Kolb (2010). 15 Vgl. Hänsel (2003); Kolb (2003) 137–139; Cobet (2003) 34. 16 Hertel (2003a, b). 17 Vgl. Heinhold-Krahmer (2003a; b); zu früherer Literatur s.a. Hajnal (2003). 18 Güterbock (1986) 37. 19 E.g. Latacz (1996 [1985]); Kullmann (1985); Reichel (1994). 20 S. beispielsweise Nagler (1974); Janko (1982); Nagy (1996); Nagy (2003). 21 Vgl. die maßgeblichen Studien von Parry (1971). 22 Vgl. Powell (1991); Powell (2002); Ruijgh (1995).
58
Jonas Grethlein
der Inhalt mündlicher Überlieferung bereits innerhalb weniger Generationen schweren Deformationen ausgesetzt ist23. Im Bereich des Epos bilden Texte von hoher religiöser Dignität wie das indische Maharba-Epos die Ausnahme einer längeren stabilen Tradition24: der Regelfall ist das Nibelungenlied, dessen Darstellung der Niederlage der Burgunder weit entfernt ist von dem, was wir durch andere Quellen rekonstruieren können25. Angesichts der Gewaltsamkeit des Zusammenbruchs der mykenischen Zivilisation und der schweren Umwälzungen in den folgenden ‚Dark Ages‘ ist es höchst unwahrscheinlich, dass es in Griechenland abweichend von anderen Kulturen eine zuverlässige mündliche Tradition gab. Auch einzelne homerische Wörter, die bereits in mykenischen Linear-B-Tafeln belegt sind, etwa anax oder temenos, können nicht als Argument für Latacz’ These dienen. Sie zeigen, dass das homerische Epos teilweise auf eine alte langue zurückgreift, belegen aber keineswegs das Alter der parole. Anders als Latacz meint26, gibt die epische Metrik im Verein mit der homerischen Formelsprache der Überlieferung keineswegs ein stabiles Korsett. Es ist umstritten, ob der Hexameter in die mykenische Zeit zurückreicht27, vor allem haben aber die Arbeiten von Albert Lord gezeigt, dass Hexameter und Formelsprache ein flexibles System sind, das jede Rezitation zu einer Re-komposition macht28. Es ist grundsätzlich schwer, Ereignisgeschichte archäologisch ohne weitere Zeugnisse zu verifizieren. Der Befund von Hisarlik ist zudem weit weniger eindeutig, als es die Darstellungen von Korfmann und Latacz suggerieren. Nimmt man andere epische Traditionen zum Vergleich, für die wir bessere Verifikationsmöglichkeiten haben, und zieht zusätzlich die spezifischen Überlieferungsbedingungen in Griechenland in Betracht, wird man den Wert der Ilias als Quelle im Droysenschen Sinne gering veranschlagen. Vielleicht hat es einen Krieg um das mykenische Troja mit griechischer Beteiligung gegeben, aber das kleos aphthiton der Ilias sollte man nicht als Quelle für seine Rekonstruktion heranziehen. Für Latacz’ Thesen drängt sich das Verdikt auf, das Wilamowitz über Schliemann fällte: „Es war nicht mehr als billig, dass die Welt dem Entdecker zujubelte, mindestens verzeihlich, daß die Masse, die geschichtliche Wissenschaft nicht fassen kann, die realen Schätze als Beweis für die Realität der homerischen Erzählung nahm. Die Leute werden nicht aussterben, welche den Todeslauf Hektors auf der Karte einzeichnen, und auch
23 Vgl. Henige (1974); Henige (1982); Vansina (1985); Thomas (1989) für eine Anwendung auf das klassische Athen. 24 Vgl. Fitzgerald (2010). 25 Zum Nibelungenlied s. Ehrismann (1987) und Classen (2010). Zur Problematik im Allgemeinen s. Raaflaub (2005). 26 Latacz (2001) 300–308. 27 Gegen diese These vgl. u.a. Fantuzzi (1984); Fantuzzi u. Pretagostini (1996). 28 Lord (2000 [1960]).
Das homerische Epos als Quelle, Überrest und Monument
59
nicht die, welche diesen Glauben in Hisarlik bewahren, unbeirrt durch das Höhenprofil des Geländes. Darüber ereifert man sich nicht, man nimmt es aber auch nicht ernst29.“
3 Homer als ‚Überrest‘ Während das Epos als Quelle von geringem Wert ist, erweist es sich als reicher ‚Überrest‘. Dieser Perspektivwechsel geht einher mit einer Verlagerung des Fokus von der mykenischen auf die archaische Zeit und von der Ereignis- auf die Sozial- und Kulturgeschichte. So hat sich in die Ilias und Odyssee ihre Entstehungszeit in vielfältiger Weise eingeschrieben30. Aber auch als Zeugnis für die Sozial- und Kulturgeschichte der archaischen Zeit ist Homer nicht unproblematisch. Die Schwierigkeiten sind offensichtlich, aber da sie in der Forschung dennoch oft unterschätzt oder gar ignoriert werden, seien vier von ihnen hier als caveat genannt: Erstens ist Dichtung nie ein einfacher Spiegel der Wirklichkeit, sondern bricht diese im Prisma ihrer Darstellung. Man sollte von daher selbst bei materiellen Gegenständen vorsichtig damit sein, direkte Entsprechungen zu suchen. Zum Beispiel hat man die als klein und rund beschriebenen Schilde mit den Schilden der archaischen Zeit und die großen, den ganzen Körper der Helden bedeckenden mit mykenischen Schilden identifiziert31. Dagegen hat Hans van Wees gezeigt, dass teilweise dieselben Schilde auf beide Weisen beschrieben werden und deswegen weniger Abbilder realer Schilde als Produkte poetischer Phantasie sind32. Zweitens ist der thematische Rahmen des Epos zu bedenken. Da die Welt der homerischen Helden uns nur Aufschluss über bestimmte Phänomene gibt, sind Argumente ex silentio problematisch. Man hat viel über das Fehlen der Schrift im homerischen Epos nachgedacht33, aber selbst wenn man eine Passage in der Ilias beiseite-
29 Wilamowitz (1906) 60. 30 Es ist das Verdienst von Finley (1956), darauf aufmerksam gemacht zu haben, dass die homerische Gesellschaft nicht mit der mykenischen in Verbindung zu setzen sei. Sein Versuch, sie mit dem 9. Jh. zu identifizieren, hat sich allerdings nicht durchsetzen können. Verbreitet ist heute die „Amalgamthese“, nach der die homerische Gesellschaft Elemente aus verschiedenen Epochen, von der mykenischen bis in die archaische Zeit, miteinander vereint, e.g. Kirk (1962) 179–210; Snodgrass (1974); Sherratt (1990). Dagegen steht die aus meiner Sicht überzeugendere These, die homerische Gesellschaft entspreche in weiten Zügen der archaischen, verkläre sie aber poetisch und gebe ihr durch Archaismen eine heroische Patina, e.g. Raaflaub (1997); Raaflaub (1998); Raaflaub (2008); Grethlein (2010a) 126–129. S. unten zu einer Erklärung mykenischer Elemente gegen die Amalgamthese. 31 Borchhardt (1977) 44–52. 32 Van Wees (1992) 17–21. S.a. Raaflaub (1998) 175–176. 33 Die Absenz von Schreiben im Epos ist oft als Archaismus interpretiert worden, vgl. Crielaard (1995) 273; Raaflaub (1998) 175. Für weitere Literatur s. Heubeck (1979b) 136 nn. 717–721.
60
Jonas Grethlein
lässt, die ein Schriftstück zu erwähnen scheint34, ist zuerst die Frage zu stellen, wo auf dem heroischen Schlachtfeld überhaupt Platz für Schreiben und Lesen sei35. Drittens ist mit der Möglichkeit zu rechnen, dass nicht nur das Epos Elemente der Wirklichkeit aufnimmt, sondern dass umgekehrt die Wirklichkeit vom Epos beeinflusst wird. Beispielsweise sind silberbeschlagene Schwerter, wie sie homerische Helden verwenden, nicht nur für die mykenische Zeit, sondern auch für das 8. Jh. belegt36. Möglicherweise haben Aristokraten den homerischen Helden nachgeeifert und sich Schwerter nach epischem Modell anfertigen lassen. Viertens ist die Gefahr zirkulärer Schlüsse groß. Wir lesen das homerische Zeugnis im Lichte der Ausgrabungen und deren Befunde wiederum vor dem Horizont des Epos37. Erschwert wird die Arbeit durch die Unsicherheit der Datierung des Epos. Parallelen zu archäologischen Befunden werden für seine zeitliche Einordnung herangezogen; umgekehrt wird die Datierung vorausgesetzt, um das Zeugnis des Epos mit materiellen Relikten zu vergleichen. Trotz dieser Gefahren ist der Wert der homerischen Epen als Überrest sehr hoch, nicht zuletzt aufgrund des Mangels an Texten aus der gleichen Zeit. Schauen wir beispielshalber kurz auf die sozio-politische Welt der Helden: Die Wörter anax und temenos tauchen, wie gesagt, bereits in mykenischen Linear-B-Tafeln auf, aber die Stellung der homerischen Helden ist weit entfernt von der, die wir aufgrund archäologischer Quellen für die mykenischen Herrscher rekonstruieren können38. Die Prominenz von Mykene und Pylos im Epos mag an die dort beheimateten mykenischen Reiche erinnern, aber die Grenzen der Gebiete bei Homer sind doch erheblich enger gesteckt39. Zudem ist die Macht von Agamemnon und Co. wenig institutionalisiert, vielmehr stehen die basileis unter starkem Druck, sich im Wettstreit mit ihren peers zu beweisen. Die Versammlungen der Helden und die Gerichtsszene in der iliadischen Schildbeschreibung deuten sogar eine erste Institutionalisierung von Polisstrukturen an40. Damit erinnert die soziale Infrastruktur des Epos stark an die Welt, der wir in der frühgriechischen Lyrik begegnen.
34 Glaukos erwähnt einen Brief des Proitos, s. Hom. Il. 6,168–170; dazu vgl. Heubeck (1979b) 128–146 und, mit einer anderen Interpretation, Powell (1991) 199–200. 35 S.a. Heubeck (1979b) 126–127. 36 Vgl. Kirk (1960) 191, 198 zur mykenischen Zeit; sowie Foltiny (1980) 268–269 Abb. XXIIIe zum 8. Jh. 37 Vgl. Grethlein (2006a) 165–166. 38 Vgl. Heubeck (1979a) sowie Chadwick (1976). Zur Entschlüsselung der Linear-B-Schrift vgl. Ventris u. Chadwick (1953); Ventris u. Chadwick (1956). 39 Vgl. Heubeck (1979a). S.a. Kullmann (1993) und Eder (2003) zu den Ähnlichkeiten zwischen der Geographie des Schifsskatalogs und der Welt des 7. Jhs. 40 Zu dieser Entwicklung vgl. Ulf (1990); Raaflaub (1991) 239–247; Raaflaub (1993) 46–59; Raaflaub (1997); Hammer (2002); Hölkeskamp (2002); Osborne (2004) 211–216. Zur Bedeutung der Heldenversammlung s. Raaflaub (1993) 54–55 (weitere Literatur S. 54 Anm. 54). Vgl. allgemein Stein-Hölkeskamp (1989).
Das homerische Epos als Quelle, Überrest und Monument
61
Zahlreiche weitere Aspekte der homerischen Welt wie etwa die Kampftechnik fügen sich gut in das Bild, das wir aus der Lektüre von Tyrtaios und anderen frühgriechischen Dichtern gewinnen41. Zugleich gibt es aber auch Elemente, welche offensichtlich der mykenischen Kultur entstammen. Ein näherer Blick auf sie zeigt jedoch, dass sie nicht unbedingt die Amalgamtheorie unterstützen, nach der sich im Epos die verschiedenen Epochen seiner langen Entstehungszeit sedimentiert haben42. Es ist auffällig, dass fast alle mykenischen Elemente materielle Gegenstände sind43. Die bronzenen Waffen der Helden werden oft als ein bewusster Archaismus gedeutet, welcher die Materialität mykenischer Waffen aufgreift, um der heroischen Welt eine Patina zu geben44. Allerdings wird Eisen nicht konsequent ignoriert: Nicht nur landwirtschaftliche Geräte in Gleichnissen, sondern auch einzelne Waffen werden als eisern beschrieben45. Neben den Bronzewaffen gibt es für einzelne Gegenstände wie den Eberzahnhelm und den Nestor-Becher archäologische Parallelen aus mykenischer Zeit46. Während die Vertreter der Amalgamthese in ihnen einen Beleg für den mykenischen Ursprung des Epos sehen, scheint es mir plausibler, die Präsenz mykenischer Objekte im Epos auf Relikte zurückzuführen, welche den Barden und ihrem Publikum in archaischer Zeit bekannt waren47. Stützen lässt sich diese These sowohl durch das Zeugnis des Epos als auch durch den archäologischen Befund. So spielen materielle Gegenstände im Epos eine große Rolle als Erinnerungsträger und legen eine ähnliche Funktion von Dingen in archai-
41 Vgl. Latacz (1977); Raaflaub (2005); Raaflaub (2008); Raaflaub (2011). 42 S. oben Anm. 30. 43 Ein weiteres Element, das als mykenisch angesehen wird, sind die Streitwagen und ihr Einsatz in der Schlacht (s. die Literatur bei Raaflaub (2011) n. 66). Während in mykenischer Zeit mit Streitwagen gekämpft wurde, dienten sie in archaischer Zeit vor allem als Prestigeobjekt und wurden bei Wagenrennen oder Begräbnissen genutzt. Die Streitwagen im homerischen Epos sind aber nicht notwendigerweise als eine Erinnerung an das mykenische Kriegswesen zu deuten, sondern können auch zeitgenössische nahöstliche Praxis als Quelle haben. Raaflaub (2011) arbeitet zudem heraus, dass sie bei Homer, wenn sie nicht als Beförderungsmittel genutzt werden, vor allem in den poetisch reich ausgemalten Fluchtszenen zum Einsatz kommen und deswegen als ein phantastisches Element des Epos anzusehen sind. 44 Zu dieser Archaisierung vgl. Redfield (1975) 35–39; Giovannini (1989); Crielaard (1995) 274–275; Hölkeskamp (2002) 301. 45 Zu Metallen in der Ilias s. Gray (1954). Vgl. Grethlein (2010a) 128–129 zur Frage, ob es sich hierbei um einen Archaismus handelt. 46 Zum Eberzahnhelm s. Borchhardt (1972) 79–81. Der Nestor-Becher hat zwar keine direkte mykenische Entsprechung, weist aber starke Ähnlichkeiten zu mykenischen Gefäßen auf; vgl. dazu Marinatos (1954); Collinge (1957); Bruns (1970) 25, 42–43; Hainsworth (1993) ad 11.623–635 mit weiterer Literatur. Dickinson (1986) 22 bezweifelt den mykenischen Charakter des Nestor-Bechers. 47 Diamantis Panagiotopoulos verdanke ich den Hinweis, dass die mykenischen Relikte im homerischen Epos alle aus Gräbern zu stammen scheinen. Etwa die Fresken, welche die mykenischen Paläste schmückten, finden keine Erwähnung. Damit wäre der Rahmen für mykenische Elemente bei Homer noch enger gesteckt.
62
Jonas Grethlein
scher Zeit nahe48. Archäologisch belegt die starke Zunahme des Heroenkultes ebenso wie das Wiederverwenden mykenischer Gegenstände in Gräbern ein Interesse an Relikten49. Von dieser Warte aus betrachtet, erscheinen auch die mykenischen Gegenstände in der Ilias und der Odyssee als „Überrest“, bezeugen sie doch ein neues Interesse an materiellen Überbleibseln als Zeugnissen der Vergangenheit in archaischer Zeit. Dies eröffnet auch eine neue Perspektive auf die Genese des griechischen Heldenepos. Relikte und mykenische Mauern haben sicherlich Spekulationen über eine heroische Vergangenheit angeregt50. Es wäre zu einfach, hier eine Kausalität zu sehen, also anzunehmen, dass die Epen aus der Betrachtung von Ruinen erwachsen sind, aber es ist schwer vorstellbar, dass materielle Zeugnisse die epische Tradition nicht beeinflusst haben. Der Wert des Epos als Quelle für die mykenische Zeit wird dadurch weiter in Frage gestellt; seine Nutzung als Überrest ist, so können wir festhalten, ebenso fruchtbar wie schwierig.
4 Homer als ‚Monument‘ Im Konzeptpapier zur Heidelberger Tagung spielten die Veranstalter mit dem Begriff des Mediums: „Die Medien und Gattungen, die einbezogen werden, sollen unter zwei komplementären Aspekten betrachtet werden: zum einen als ‚Mittel‘, mit denen in der Antike ‚Geschichte‘ generiert wurde, zum anderen als Quellen, aus denen die Forschung ‚Geschichte‘ (re)konstruiert. Dabei sind die beiden Aspekte jeweils in unterschiedlicher Weise relevant: Eine Intention, Geschichte zu schaffen, ist etwa in der Historiographie und in politischen Denkmälern offensichtlich, in der Tragödie und in Mythenbildern meist nur indirekt, in der materiellen Sachkultur kaum jemals und in kulturellen Spuren grundsätzlich nicht zu erkennen.“ Wenden wir uns von der auktorialen Intention ab und der Rezeption zu, so können wir feststellen, dass auch das homerische Epos Geschichte gemacht hat. Die Grenze zwischen Erzählung und Wirklichkeit ist, wie die Vertreter des New Historicism betonen, in beide Richtungen offen. Ilias und Odyssee nehmen nicht nur Bezug auf die Wirklichkeit, in der sie existieren, sondern wirken auch auf mannigfaltige Weise in sie zurück. Ein paar Beispiele mögen dies im Folgenden illustrieren. Es ist ganz offensichtlich, dass die Ilias und Odyssee auf dem Gebiet der Literatur und Kultur Geschichte gemacht haben. Kaum eine literarische Gattung der griechischen Literatur ist frei von homerischem Einfluss. Darin zeigt sich nicht zuletzt die zentrale Stellung, welche den Epen für die Erziehung zukam. Aber auch über die Kul-
48 Vgl. Grethlein (2008) 43–45. 49 Zum Heroenkult s. Antonaccio (1995); Hägg (1999); Boehringer (2001). Zur Wiederverwendung mykenischer Gegenstände s. Boardman (1970) 107. 50 Vgl. Heubeck (1984) 14–21.
Das homerische Epos als Quelle, Überrest und Monument
63
tur hinaus lässt sich beobachten, dass die Ilias und Odyssee die Wahrnehmung von Wirklichkeit prägten. Zum Beispiel stellte die homerische Darstellung des Trojanischen Krieges einen Rahmen bereit, in dem die Griechen die Erfahrung der Perserkriege konzeptualisieren konnten, wie die zahlreichen Vergleiche in verschiedenen Gattungen und Medien zeigen: Simonides stellt den bei Plataia Gefallenen Achill gegenüber und stilisiert sich selbst implizit als zweiten Homer51. Aischylos greift auf homerisches Vokabular und epische Formen wie den Katalog zurück, um die Schlacht bei Salamis in eine heroische Dimension zu rücken52. Die Inschriften auf den EionHermen stellten den Sieg über die Perser neben den Trojanischen Krieg53. Die von Pausanias beschriebenen Wandgemälde der Stoa poikile zeigten neben der Iliupersis auch die Marathonomachie54. In seiner Interpretation der Metopen des Parthenon, auf denen die Kämpfe mit Giganten, Kentauren, Amazonen und Trojanern zu sehen sind, beschreibt Tonio Hölscher treffend die sinnstiftende Dimension des Mythos für die Erfahrungen der Griechen in klassischer Zeit: „These myths therefore are more than mirrors or metaphors of the Persian Wars: they constitute a cosmic-historical panorama within which these wars receive their interpretation and significance55.“ Auch die Odyssee konnte als Modell für eigene Erfahrungen herangezogen werden, wie die Anabasis zeigt: Xenophon warnt als General vor der Versuchung in Persien zu bleiben – „um nicht wie die Lotophagen der Rückkehr nach Hause zu vergessen“ (mÎ —sper oÅ lvtofˇgoi ãpilaùØmeùa tá« oúkade ÇdoÜ, Xen. an. 3,2,25). Später, als die Kyreneer Trapezunt erreichen, wünscht sich Leon, „ausgestreckt wie Odysseus Griechenland zu erreichen“ (ãktaùeÏ« —sper #OdysseŒ« $fikwsùai eå« tÎn ^Ellˇda, Xen. an. 5,1,2). Zusammen mit zahlreichen impliziten Anspielungen evozieren diese expliziten Vergleiche die Odyssee, um den Zug der Zehntausend als einen heroischen nostos zu stilisieren56. Das Beispiel der Anabasis zeigt auch, dass das Epos nicht nur als Modell zitiert, sondern auch in einen spannungsreichen Vergleich mit der jüngeren Vergangenheit gebracht werden konnte. So gibt die Sehnsucht der griechischen Söldner nach Heimkehr der Erzählung ihren Puls, aber Xenophon verweigert den Lesern eine closure nach dem Vorbild der Odyssee: in Kleinasien angekommen, lösen sich die ohnehin stark dezimierten Zehntausend sukzessive auf, eine Kerngruppe begibt sich erneut auf eine Mission im Osten und zieht weiter gegen Tissaphernes57.
51 Zur „Plataia-Elegie“ s. Boedeker u. Sider (2001); Grethlein (2010b) 47–73. 52 Vgl. Grethlein (2010b) 75–79. 53 Vgl. Aeschin. 3,183–185; Plut. Cim. 7,5. 54 Vgl. Hölkeskamp (2001) 342 Anm. 69. Weitere archäologische und ikonographische Zeugnisse finden sich bei Francis (1990); Castriota (1992); Hölscher (1998) 163–169. 55 Hölscher (1998) 167. 56 Vgl. Tuplin (2003) und auch Lossau (1990). 57 Zu der offenen closure der Anabasis s. Purves (2010) 191 und Ma (2004).
64
Jonas Grethlein
Einen besonders interessanten Fall bietet Alexander der Große, der wohl nicht erst in den Darstellungen seiner Historiker zu einem Achilleus redivivus wurde, sondern sich bereits selbst nach seinem homerischen Vorbild stilisiert zu haben scheint58. Dio Chrysostomos schreibt, Alexander habe die Ilias auswendig gekannt, laut Plutarch führte er auf seinem Feldzug in den Osten eine Kopie des Epos mit sich59. Bei seiner Ankunft in Asien habe Alexander seine Rüstung gegen eine alte aus dem Athena-Tempel ausgetauscht, im Glauben, diese stamme aus dem Trojanischen Krieg60. Besondere Ehren habe er dem Grab des Achill dargebracht61, Hephaistos habe indessen das Grab des Patroklos bekränzt, um sein Verhältnis zu Alexander der Beziehung zwischen Achill und Patroklos anzugleichen62. Diese Analogie wird weitergesponnen, wenn Arrian es für nicht unwahrscheinlich hält, dass Alexander später sein Haar über dem Grab des Hephaistion schor63. Zudem habe Alexander Hephaistion mit Grabspielen und einem Heroenkult ehren lassen64. Verschiedene Quellen berichten auch, Alexander habe sich dreimal, beleidigt wie Achill, von seinem Heer abgesondert65. Auch wenn manche Details wie das Opfer des Hephaistion am Grab des Patroklos wenig vertrauenswürdig sind66, dürfte außer Zweifel stehen, dass bereits Alexander sich selbst als zweiten Achill inszenierte. Erzählung und Handeln verschlingen sich hier auf zweifache Weise, die es uns schwer macht, eine klare Trennung zu ziehen. Das Epos prägt Alexanders Handeln, das dann wiederum von der Alexandertradition als heroisch dargestellt wird. In seiner Untersuchung der Alexanderbilder stellt Tonio Hölscher „eine grundsätzliche Ambivalenz im Verhältnis von Bild und Person“ fest und schreibt: „Einerseits stellt das Bildnis eine ‚wirkliche‘ Person dar. Andererseits spielen die ‚wirklichen‘ Personen performative Rollen, und diese ‚wirklichen‘ Rollen sind Bilder. Personen geben sich im ‚realen‘ Leben eine signifikante Erscheinung in Haar- und Barttracht, Kleidung, Schmuck und Kosmetik, Haltung, Mimik und Gebärden. Der Mensch ist sein eigenes Bild67.“
58 Vgl. Heuß (1977) 40–41; Gehrke (1994) 249–250. S.a. Edmunds (1971) 368–381, der den religiösen Hintergrund aufzeigt und betont, die Achill-imitatio sei nicht nur bloße Propaganda gewesen; Ameling (1988); Stewart (1993) 78–86; Cohen (1995), der die Beziehung der Makedonen zu den epischen Helden untersucht; Carney (2000) 274–285. Zu Achill als Exemplum s. King (1987). 59 Dion. Chr. or. 4,39; Plut. Alex. 8,2; 26,1; s. außerdem Plin. nat. 7,29,108–109; Str. 13,1,27. 60 Arr. 1,11. 61 Arr. 1,12,1; Plut. Alex. 15,7–9; Diod. 17,17,3. 62 Arr. 1,12,1. 63 Arr. 7,14,4. 64 S. außer Arr. 7,14 noch Plut. Alex. 72; Diod. 17,110,8; 114–115. 65 Vgl. Carney (2000) 274–285 mit den Quellen. Sie meint, Alexanders Rückzug habe auch eine homoerotische Konnotation, und weist auf die Form des paraklausithyron hin (276–277). 66 Vgl. Stewart (1993) 83 mit weiteren Verweisen in 83 n. 45. 67 Hölscher (2009) 31.
Das homerische Epos als Quelle, Überrest und Monument
65
Mutatis mutandis trifft dies auch auf die Erzählung von Alexander als zweitem Achill zu. Hölschers Reflexion zum Bild kann aufgegriffen und, um die Erzählung erweitert, weitergesponnen werden. Als Medien der Geschichte haben Bilder und Erzählungen einen besonderen Status: sie stellen zwei, vielleicht die zwei grundsätzlichen Modi der Welterschließung und -konstitution dar. Sie setzen beide in Bewusstseinsprozessen ein – wir machen uns ein Bild von der Welt und unsere Erfahrungen haben bereits eine narrative Form68 – und drängen zugleich zum Ausdruck in bildlicher Darstellung und erzählerischer Mitteilung. Dieser Ausdruck wird von Zeitgenossen aufgenommen und zur Grundlage historischer Dokumentation, in unserem Fall der Alexanderdarstellung und -biographie. Diese Quellen wiederum verwenden Historikern für ihre Rekonstruktion, die selbst auch die Form von Bild und Erzählung hat. Als Modi der Welterschließung betten Bilder und Erzählungen historisch Handelnde und Historiker also in ein Kontinuum ein. Die spätere Darstellung historischer Akteure in Bild und Erzählung unterscheidet sich selbstverständlich von den Bildern und Erzählungen, welche sich die Zeitgenossen machen, ist ihnen aber doch homolog und dadurch in der Lebenswelt verankert. In Bild und Erzählung als Medien der Geschichte manifestiert sich der Horizont der Geschichtlichkeit, in welchem Historiker und historisch Handelnde gleichermaßen stehen. Zurück zu Homer: Alexanders Achill-imitatio zeigt, dass die homerischen Epen den Griechen nicht nur narrative Rahmen gaben, mit denen sie ihre eigenen Erfahrungen bewältigen konnten, sondern dass sie auch symbolisches Kapital darstellten. Das Legitimationspotential des Epos wird deutlich, wenn Aristokraten ihren Stammbaum auf einen homerischen Helden zurückführen wie etwa Miltiades, dessen Stammvater laut Pherekydes Philaios, ein Sohn des Aias, war (FGrH F2)69. Homers politische Wirkmächtigkeit zeigt sich auch auf der Ebene von Poleis auf dem diplomatischen Parkett. Ein Beispiel ist die syrakusanische Gesandtschaftsszene bei Herodot (7,153–163)70. Als der Einfall des persischen Heeres unter Xerxes droht, schicken die Griechen eine Gesandtschaft zu Gelon, dem Tyrann des mächtigen Syrakus, mit der Bitte um Hilfe. Gelon erklärt sich dazu bereit unter der Bedingung, dass man ihm die Führung des Heeres überlasse. Der spartanische Gesandte widerspricht dieser Forderung mit einem Zitat aus der Ilias, welches die Führung der Griechen durch Agamemnon im Zug gegen Troja in Erinnerung ruft. Die epische Vergangenheit unterstreicht Spartas Anspruch in der Gegenwart. Als Gelon erklärt, er würde sich auch mit dem Befehl nur über die Landmacht oder die Flotte begnügen, interveniert der athenische Gesandte. Er ver-
68 Zur welterschließenden Funktion von Bildern s. etwa Boehm (1995); zur Narrativisierung im Prozess der Erfahrung s. Carr (1986); zum vielschichtigen Verhältnis von Erfahrung und Erzählung s. Grethlein (2010c). 69 Zur legitimierenden Funktion des Epos für den Adel s. Nicolai (1983); Morris (1986). Für weitere Überlegungen zur Bedeutung der Ilias für Aristokraten s. Rose (1988); zur Relevanz der Odyssee s. Thalmann (1998) 272–305. 70 Für eine eingehende Interpretation dieser Episode s. Grethlein (2006b).
66
Jonas Grethlein
leiht dem Anspruch seiner Stadt auf den Befehl zur See Autorität, indem er das homerische Lob für Menestheus erwähnt. Die Historizität des herodoteischen Berichts mag zweifelhaft sein, er illustriert aber das symbolische Kapital, das Homer in der Politik darstellte71. Die Analyse Homers als Überrest zeigt, dass die Wirklichkeit in poetisch gebrochener Form Einzug in das Epos gefunden hat. Der Blick auf die Rezeptionsgeschichte Homers illustriert, dass die Epen auf ganz unterschiedlichen Ebenen in die Wirklichkeit zurückstrahlen – indem sie als narrativer Rahmen die Bewältigung eigener Erfahrungen erlaubten, als normativer Text Handlungen anleiteten und als symbolisches Kapital Macht und Legitimation generierten. In einem letzten Schritt soll das homerische Epos als Medium der Geschichte unter dem Aspekt seiner Medialität betrachtet werden.
5 Die Spatialität des epischen Erinnerns In seiner Laokoon-Studie stellt Lessing Poesie und Malerei als verschiedene Medien der Darstellung von Wirklichkeit einander gegenüber72. Die Form des Mediums bedinge die Objekte der Darstellung. Während Poesie sequentiell und von daher geeignet sei, Handlungen darzustellen, sei Malerei spatial und könne deswegen besonders gut Körper im Raum abbilden. Lessings Ansatz ist aus unterschiedlichen Perspektiven kritisiert worden, aber seine grundsätzliche Fruchtbarkeit hat zuletzt Luca Giuliani demonstriert, der seine Geschichte des Bildes in der griechischen Kunst entlang des Problems entwirft, wie Bilder narrativ werden können73. Giuliani weist aber auch darauf hin, dass Lessings Gegenüberstellung von bildlicher Simultaneität und narrativer Sukzessivität zu schematisch ist74. Auch Bilder können Sequenzen zum Ausdruck bringen, etwa in Bilderserien, Polyphasenbildern oder im Einzelbild durch die Wahl eines bestimmten Momentes, welcher die Betrachter zur Narrativierung drängt. Umgekehrt wohnt sprachlichen Äußerungen ein simultaner Aspekt inne, entsteht Bedeutung doch erst in einem synchronen Horizont. Bereits vor über 60 Jahren hat Joseph Frank die Spatialität moderner Literatur proklamiert75. Gedichte etwa von Mallarmé und Romane von Djuna Barnes und ande-
71 Einige Zeugnisse deuten aber darauf hin, dass in diplomatischen Verhandlungen und in der Volksversammlung rezente Exempla eine größere Schlagkraft hatten als Parallelen aus der heroischen Zeit. Vgl. Grethlein (2010b) 142–144. Zu „kinship-diplomacy“ s. Jones (1999) und Clarke (2008) 347–363. 72 Lessing (1974 [1766]). 73 Giuliani (2003). 74 Giuliani (2003) 23–37. 75 Frank (1945); erweiterte Version: Frank (1963).
Das homerische Epos als Quelle, Überrest und Monument
67
ren ließen sich nur schlecht in Lessings Schema einordnen – sie erzeugen Sinn weniger durch Sequentialität als durch Simultaneität: „All these writers ideally intend the reader to apprehend their work spatially, in a moment of time, rather than as a sequence76.“ Literaturwissenschaftler haben „spatial form“ auch in Texten anderer Epochen entdeckt und zu einem Charakteristikum von Erzählung schlechthin erklärt77. Trotzdem ist Franks Ansatz systematisch leider kaum entfaltet und mit gewichtigen Problemen behaftet. So vermischt Frank etwa Kategorien von Rezeption und textueller Struktur. Zur Diffusität des Konzepts trägt auch bei, dass Frank es in späteren Aufsätzen mit verschiedenen literaturwissenschaftlichen Systemen verknüpft hat: mit Kermodes ‚plot-concordance‘78, Jakobsons Definition von Poetizität79, der Unterscheidung zwischen fabula und sjuzet des russischen Formalismus80 und schließlich Genettes Narratologie81. Trotzdem hat Frank einen wichtigen Punkt benannt: Die Signifikanten von Erzählungen und ihre Lektüre sind diachron, aber sowohl ihre Signifikate als auch deren Rezeption enthalten synchrone Elemente, die man als spatial betrachten kann. ‚Spatial‘ bezeichnet hier keine literale Räumlichkeit, sondern metaphorisch die Simultaneität, welche nach Lessing Räumlichkeit bestimmt. Ich möchte die Überlegungen zu Sequentialität und Spatialität aufgreifen und auf das homerische Geschichtsbild übertragen. Meine abschließende These ist, dass sich in der eben dargestellten Rezeption von Homer ein spatiales Geschichtsbild manifestiert, das bereits im Epos selbst präfiguriert ist. Unabhängig davon, ob der Rückgriff auf Homer normativ wie in der syrakusanischen Gesandtschaftsepisode oder deskriptiv, etwa bei den Abbildungen der Stoa poikile, ob er implizit, so in den aischyleischen Persern, oder explizit wie in den Eion-Epigrammen ist, all diesen Homerrezeptionen ist gemeinsam, dass sie die heroische Vergangenheit direkt der eigenen Gegenwart oder Zeitgeschichte gegenüberstellen. Der zeitliche Abstand und die dazwischen liegenden Ereignisse bleiben unberücksichtigt. Es geht um den unmittelbaren Vergleich, der es erlaubt, die eigenen Erfahrungen nach epischem Modell zu rahmen oder aus der heroischen Vergangenheit Forderungen für das Hier und Jetzt abzuleiten. Ein solcher Zugang zur Geschichte unterscheidet sich grundlegend von dem Geschichtsbild, das sich um 1800 herausgebildet hat82. Zentral für dieses Geschichtsbild, das, so meine ich, auch heute noch unsere Sicht auf die Vergangenheit prägt, ist der Gedanke der Entwicklung. Er schärft das Bewusstsein für die Einzigartigkeit historischer Epochen und macht einen direkten Vergleich über Epochengrenzen zwar nicht unmöglich, aber
76 Frank (1991) 10. 77 S. die Beiträge in: Smitten u. Daghistany (1981). 78 Frank (1991) 99. 79 Frank (1991) 111–115. 80 Frank (1991) 117–121. 81 Frank (1991) 121–130. 82 Koselleck (1975); Koselleck (1979).
68
Jonas Grethlein
doch problematisch. Wie Reinhart Koselleck gezeigt hat, ist der Topos historia magistra vitae seit 1800 in Misskredit geraten83. Die Rezeption des homerischen Epos hingegen illustriert die Geläufigkeit solcher Gegenüberstellungen in der griechischen Antike84. Dieses Geschichtsbild ist bereits im Epos selbst angelegt. Die Ilias und Odyssee erwähnen zwar an einigen Stellen die Gegenwart des Barden und seines Publikums, etwa wenn die Kraft der Heroen mit der heutiger Männer verglichen wird, aber sie nehmen an keiner Stelle die Entwicklung von der epischen Vergangenheit zur Gegenwart in den Blick. Die epische Vergangenheit entfaltet sich als eine Zeit sui generis. Zudem ist die exemplarische Erinnerung, welche die Rezeption des Epos dominiert, bereits in ihm präfiguriert. Immer wieder greifen die Helden auf Exempla der Vergangenheit zurück, um ihre Gegenwart besser verstehen oder Ansprüche legitimieren zu können85. Wenn beispielsweise Diomedes auf einen ihm unbekannten und in eine goldene Rüstung gewandeten Gegner trifft, erinnert er sich an das Schicksal des Lykurgos: Dieser griff einen Gott, Dionysos, an und wurde dann von diesem furchtbar bestraft. Um ein solches Schicksal zu vermeiden, fragt Diomedes seinen Gegner zuerst nach seiner Identität (Hom. Il. 6,123–143). Im neunten Buch vergleicht dann Phoinix Achills Rückzug aus dem Heer mit Meleagers Weigerung, Kalydon gegen die Kureten zu verteidigen, und leitet daraus das Plädoyer ab, Achill solle in den Kampf zurückkehren, solange er noch Geschenke erhalte (Hom. Il. 9,496–605). Ähnlich wie in der Homerrezeption wird in solchen Exempla die Zeit zwischen Vergangenheit und Gegenwart ausgeblendet – die in die Handlung eingebettete Vergangenheit, das epische Plusquamperfekt, spiegelt das epische Präteritum; das Epos enthält die Form seiner Rezeption bereits in sich selbst. Homer hat den Griechen also nicht nur einen narrativen Rahmen für Irrfahrten und militärische Auseinandersetzungen mit östlichen Nachbarn gegeben, sondern hat auch ihr Geschichtsbild grundlegend geprägt. Der exemplarische Modus der Erinnerung sieht von der Sequenz, welche von der Vergangenheit in die Gegenwart führt, ab und setzt beide direkt miteinander in Verbindung – er ist in einem metaphorischen Sinn spatial, gleicht die direkte Gegenüberstellung doch dem Darstellungsmodus des Bildes. Traditionen spielten im antiken Griechenland eine große Rolle und der Entwicklungsgedanke war den Griechen, wie die Kulturentstehungslehren des 5. Jhs. zeigen, nicht fremd, aber Homer zeigt, wie stark ausgeprägt die Neigung war, Geschichte zu spatialisieren und damit die Unsicherheit menschlichen Lebens zu bannen86. Dadurch entsteht eine interessante Spannung zwischen den Epen als Narration und
83 Koselleck (1979). 84 Zu einem Vergleich der modernen Skepsis gegenüber Exempla mit deren vielschichtiger Rolle bei antiken Historikern s. Grethlein (2011). 85 Vgl. Alden (2000); Grethlein (2006a) 43–63. 86 Vgl. Grethlein (2010b) 281–90, wo dieser Umgang mit Geschichte als Versuch gedeutet wird, Kontingenz zu bewältigen.
Das homerische Epos als Quelle, Überrest und Monument
69
Medium der Geschichte: Als Erzählungen sind Ilias und Odyssee sequentiell, aber der Modus der Erinnerung, der in ihnen angelegt ist und sich dann in ihrer Rezeption zeigt, ist spatial.
Literaturverzeichnis Alden (2000): Maureen Alden, Homer Beside Himself. Para-Narratives in the Iliad, Oxford. Ameling (1988): Walter Ameling, „Alexander und Achilleus. Eine Bestandsaufnahme“, in: Wolfgang Will u. Johannes Heinrichs (Hgg.), Zu Alexander dem Großen, Bd. II, Amsterdam, 657–692. Antonaccio (1995): Carla Antonaccio, An archaeology of ancestors: tomb cult and hero cult in early Greece, Lanham, MD. Baßler u. Greenblatt (2001): Moritz Baßler u. Stephen Jay Greenblatt (Hgg.), New Historicism. Literaturgeschichte als Poetik der Kultur, Tübingen/Basel. Berktold (2007): Percy Berktold, Ithaka und Homer, München. Bittlestone (2005): Robert Bittlestone, Odysseus Unbound. The Search for Homer’s Ithaca, Cambridge. Boardman (1970): John Boardman, Greek Gems and Finger Rings, London. Boedeker u. Sider (2001): Deborah Boedeker u. David Sider (Hgg.), The New Simonides. Contexts of Praise and Desire, Oxford. Boehm (1995): Gottfried Boehm, „Die Wiederkehr der Bilder“, in: Gottfried Boehm (Hg.), Was ist ein Bild, München, 11–38. Boehringer (2001): David Boehringer, Heroenkulte in Griechenland von der geometrischen bis zur klassischen Zeit, Berlin. Borchhardt, H. (1977): Heide Borchhardt, „Frühe griechische Schildformen“, in: Hans-Günter Buchholz (Hg.), Kriegswesen, I: Schutzwaffen und Wehrbauten, Göttingen, 1–56. Borchhardt, J. (1972): Jürgen Borchhardt, Homerische Helme. Helmformen in der Ägäis in ihren Beziehungen zu orientalischen und europäischen Helmen in der Bronze- und frühen Eisenzeit, Mainz. Bruns (1970): Gerda Bruns, Küchenwesen und Mahlzeiten, Göttingen. Calder u. Cobet (1990): William M. Calder u. Justus Cobet (Hgg.), Heinrich Schliemann nach hundert Jahren, Frankfurt am Main. Carney (2000): Elizabeth Donnelly Carney, Women and Monarchy in Macedonia, Norman, OK. Carr (1986): David Carr, Time, Narrative, and History. Studies in Phenomenology and Existential Philosophy, Bloomington. Castriota (1992): David Castriota, Myth, Ethos, and Actuality. Official Art in Fifth-Century B.C. Athens, Madison. Chadwick (1976): John Chadwick, The Mycenaean World, Cambridge. Clarke (2008): Katherine Clarke, Making Time for the Past. Local History and the Polis, Oxford. Classen (2010): Albrecht Classen, „The Nibelungenlied – myth and history: a middle high German epic poem at the crossroads of past and present, despair and hope“, in: David Konstan u. Kurt Raaflaub (Hgg.), Epic and History, London, 262–279. Cobet (2003): Justus Cobet, „Vom Text zur Ruine. Die Geschichte der Troia-Diskussion“, in: Ulf (2003) 19–38. Cobet u. Gehrke (2002): Justus Cobet u. Hans-Joachim Gehrke, „Warum um Troia immer wieder streiten?“, Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 53, 290–325. Cohen (1995): David Cohen, Law, Violence, and Community in Classical Athens, Cambridge.
70
Jonas Grethlein
Collinge (1957): Neville E. Collinge, „Mycenaean DI-PA and DEPAS“, Bulletin of the Institute of Classical Studies 4, 55–59. Crielaard (1995): Jan Paul Crielaard, Homeric Questions, Amsterdam. Dickinson (1986): Oliver T.P.K. Dickinson, „Homer, the poet of the Dark Age“, Greece and Rome 33.1, 20–37. Droysen (1977): Johann Gustav Droysen, Historik, Stuttgart. Easton (2002): Donald F. Easton, Schliemann’s Excavations at Troy 1870–1873, Mainz. Eder (2003): Birgitta Eder, „Noch einmal: der homerische Schiffskatalog“, in: Ulf (2003) 287–308. Edmunds (1971): Lowell Edmunds, „The religiosity of Alexander“, Greek, Roman and Byzantine studies 12, 363–391. Ehrismann (1987): Otfrid Ehrismann, Nibelungen-Lied. Epoche – Werk – Wirkung, München. Fantuzzi (1984): Marco Fantuzzi, „Preistoria dell’esametro e storia della cultura greca arcaica. A proposito di alcuni studi recenti“, Materiali e discussioni per l’analisi dei testi classici 12–13, 35–60. Fantuzzi u. Pretagostini (1996): Marco Fantuzzi u. Roberto Pretagostini (Hgg.), Struttura e storia dell’esametro Greco, Rom. Finley (1956): Moses I. Finley, The World of Odysseus, London. Fitzgerald (2010): James L. Fitzgerald, „No contest between memory and invention: the invention of the Pandava Heroes of the Mahabharata“, in: David Konstan u. Kurt Raaflaub (Hgg.), Epic and History, London, 103–144. Foltiny (1980): Stephan Foltiny, „Schwert, Dolch und Messer“, in: Hans-Günter Buchholz (Hg.), Kriegswesen, II: Angriffswaffen, Göttingen, 231–274. Foucault (1981): Michel Foucault, Archäologie des Wissens, Frankfurt. Francis (1990): Eric David Francis, Image and Idea in Fifth-Century Greece. Art and Literature after the Persian Wars, London. Frank (1963): Joseph Frank, „Spatial form in modern literature“, in: Joseph Frank (Hg.), The Widening Gyre, New Brunswick, 3–62. Gehrke (1994): Hans-Joachim Gehrke, „Mythos, Geschichte, Politik – antik und modern“, Saeculum 45, 239–264. Giovannini (1989): Adalberto Giovannini, „Homer und seine Welt“, Vom frühen Griechentum bis zur römischen Kaiserzeit. Gedenk- und Jubiläumsvorträge am Heidelberger Seminar für Alte Geschichte, Wiesbaden, 25–39. Giuliani (2003): Luca Giuliani, Bild und Mythos. Geschichte der Bilderzählung in der griechischen Kunst, München. Gray (1954): Dorothea H. F. Gray, „Metal-working in Homer“, The Journal of Hellenic Studies 74, 1–15. Greenblatt (1980): Stephen Jay Greenblatt, Renaissance Self-fashioning. From More to Shakespeare, Chicago. Grethlein (2006a): Jonas Grethlein, Das Geschichtsbild der Ilias. Eine Untersuchung aus phänomenologischer und narratologischer Perspektive, Göttingen. Grethlein (2006b): Jonas Grethlein, „The manifold uses of the epic past. The embassy scene in Hdt. 7.153–163“, American Journal of Philology 127, 485–509. Grethlein (2008): Jonas Grethlein, „Memory and Material Objects in the Iliad and the Odyssey“, The Journal of Hellenic Studies 128, 27–51. Grethlein (2010a): Jonas Grethlein, „From imperishable glory to history. The Iliad and the Trojan War“, in: David Konstan u. Kurt Raaflaub (Hgg.), Epic and History, London, 122–144. Grethlein (2010b): Jonas Grethlein, The Greeks and their Past. Poetry, Oratory and History in the FifthCentury BCE, Cambridge. Grethlein (2010c): Jonas Grethlein, „Experientiality and Narrative Reference. With Thanks to Thucydides“, History and Theory 49, 315–35.
Das homerische Epos als Quelle, Überrest und Monument
71
Grethlein (2011): Jonas Grethlein, „Historia magistra vitae in Herodotus and Thucydides?“, in: Alexandra Lianeri (Hg.), The Western Time of Ancient History: Historiographical Encounters with the Greek and Roman Past, Cambridge, 247–263. Güterbock (1986): Hans Gustav Güterbock, „Troy in Hittite texts? Wilusa, Ahhiyawa, and Hittite history“, in: Machteld J. Mellink (Hg.), Troy and the Trojan War, Bryn Mawr, PA, 33–44. Hägg (1999): Robin Hägg (Hg.), Ancient Greek Hero Cult, Stockholm. Hainsworth (1993): John Bryan Hainsworth, The Iliad: A Commentary, III: Books 9–12, Cambridge. Hajnal (2003): Ivo Hajnal, „Der epische Hexameter im Rahmen der Homer-Troia-Debatte“, in: Ulf (2003) 217–231. Hammer (2002): Dean C. Hammer, The Iliad as Politics. The Performance of Political Thought, Norman. Hänsel (2003): Bernhard Hänsel, „Troia im Tausch- und Handelsverkehr der Ägäis oder Troia ein Handelsplatz?“, in: Ulf (2003) 105–119. Heinhold-Krahmer (2003a): Susanne Heinhold-Krahmer, „Ahhiyawa – Land der homerischen Achäer im Krieg mit Wilusa?“, in: Ulf (2003) 193–214. Heinhold-Krahmer (2003b): Susanne Heinhold-Krahmer, „Zur Gleichsetzung der Namen Ilios-Wilusa und Troia-Taruisa“, in: Ulf (2003) 146–168. Henige (1974): David P. Henige, The Chronology of Oral Tradition. Quest for a Chimera, Oxford. Henige (1982): David P. Henige, Oral Historiography, London. Hertel (2003a): Dieter Hertel, „Die Gleichsetzung einer archäologischen Schicht von Troia mit dem homerischen Ilios“, in: Ulf (2003) 85–104. Hertel (2003b): Dieter Hertel, Die Mauern von Troia. Mythos und Geschichte im antiken Ilion, München. Heubeck (1979a): Alfred Heubeck, „Geschichte bei Homer“, Studi micenei ed egeo-anatolici 20, 227–250. Heubeck (1979b): Alfred Heubeck, Schrift, Göttingen. Heubeck (1984): Alfred Heubeck, Kleine Schriften zur griechischen Sprache und Literatur, Erlangen. Heuß (1977): Alfred Heuß, „Alexander der Große und das Problem der historischen Urteilsbildung“, Historische Zeitschrift 225, 29–64. Hölkeskamp (2001): Karl-Joachim Hölkeskamp, „Marathon – vom Monument zum Mythos“, in: Dietriche Papenfuß u. Volker Michael Strocka (Hgg.), Gab es das Griechische Wunder? Griechenland zwischen dem Ende des 6. und der Mitte des 5. Jahrhunderts v. Chr., Mainz, 329–353. Hölkeskamp (2002): Karl-Joachim Hölkeskamp, „Ptolis und Agore. Homer and the archaeology of the city-state“, in: Franco Montanari (Hg.), Omero tremila anni dopo, Rom, 297–342. Hölscher (1998): Tonio Hölscher, „Images and political identity: the case of Athens“, in: Deborah Boedeker u. Kurt Raaflaub (Hgg.), Democracy, Empire, and the Arts in Fifth-Century Athens, Cambridge MA, 153–83. Hölscher (2009): Tonio Hölscher, Herrschaft und Lebensalter. Alexander der Große: politisches Image und anthropologisches Modell, Basel. Janko (1982): Richard Janko, Homer, Hesiod, and the Hymns. Diachronic Development in Epic Diction, Cambridge. Jones (1999): Christopher P. Jones, Kinship Diplomacy in the Ancient World, Cambridge MA. de Jong (2009): Irene de Jong, „Metalepsis in Ancient Greek Literature“, in: Jonas Grethlein u. Antonios Rengakos (Hgg.), Narratology and Interpretation. The Content of Narrative Form in Ancient Literature, Berlin, 87–116. King (1987): Katherine C. King, Achilles. Paradigms of the War Hero from Homer to the Middle Ages, Berkeley. Kirk (1960): Geoffrey Stephen Kirk, „Objective dating criteria in Homer“, Museum Helveticum 17, 189–205.
72
Jonas Grethlein
Kirk (1962): Geoffrey Stephen Kirk, The Songs of Homer, Cambridge. Kolb (2003): Frank Kolb, „War Troia eine Stadt?“, in: Ulf (2003) 120–146. Kolb (2010): Frank Kolb, Tatort „Troia“: Geschichte, Mythen, Politik, Paderborn. Koselleck (1975): Reinhart Koselleck, „Die Herausbildung des modernen Geschichtsbegriffs“, in: Otto Brunner, Werner Conze u. Reinhart Koselleck (Hgg.), Geschichtliche Grundbegriffe II, Stuttgart, 647–691. Koselleck (1979): Reinhart Koselleck, Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten, Frankfurt. Kullmann (1985): Wolfgang Kullmann, „Gods and men in the Iliad and the Odyssey“, Harvard studies in classical philology 89, 1–23. Kullmann (1993): Wolfgang Kullmann, „Festgehaltene Kenntnisse im Schiffskatalog und im Troerkatalog der Ilias“, in: Wolfgang Kullmann u. Jochen Althoff (Hgg.), Vermittlung und Tradierung von Wissen in der griechischen Kultur, Tübingen, 129–147. Landmann (1976): Georg Peter Landmann, Thukydides: Geschichte des Peloponnesischen Krieges, Zürich. Latacz (1977): Joachim Latacz, Kampfparänese, Kampfdarstellung und Kampfwirklichkeit in der Ilias, bei Kallinos und Tyrtaios, München. Latacz (1985): Joachim Latacz, Homer. Eine Einführung, München. Latacz (2001): Joachim Latacz, Troia und Homer. Der Weg zur Lösung eines alten Rätsels, München. Lessing (1974 [1766]): Gotthold Ephraim Lessing, „Laokoon: oder über die Grenzen der Malerei und Poesie“, Werke VI, Darmstadt, 7–187. Lord (2000 [1960]): Albert Bates Lord, The Singer of Tales, Cambridge. Lossau (1990): Manfred Lossau, „Xenophons Odyssee“, Antike und Abendland 36, 47–52. Ma (2004): John Ma, „You can’t go home again: displacement and identity in Xenophon’s Anabasis“, in: Robin J. Lane Fox (Hg.), The long march: Xenophon and the Ten Thousand, New Haven, 330–345. Marinatos (1954): Spyridon Marinatos, „Der ‚Nestorbecher‘ aus dem IV. Schachtgrab von Mykenae“, in: Reinhard Lullies (Hg.), Neue Beiträge zur Klassischen Altertumswissenschaft. Festschrift zum 60. Geburtstag von B. Schweitzer, Stuttgart, 11–18. Morris (1986): Ian Morris, „The use and abuse of Homer“, Classical antiquity 5, 81–138. Nagler (1974): Michael N. Nagler, Spontaneity and Tradition: A Study in the Oral Art of Homer, Berkeley. Nagy (1996): Gregory Nagy, Poetry as Performance. Homer and Beyond, Cambridge. Nagy (2003): Gregory Nagy, Homeric Responses, Austin. Nicolai (1983): Walter Nicolai, „Rezeptionssteuerung in der Ilias“, Philologus 127, 1–12. Osborne (2004): Robin Osborne, „Homer’s society“, in: Robert Fowler (Hg.), The Cambridge Companion to Homer, Cambridge, 206–219. Parry (1971): Milman Parry, The Making of Homeric Verse. The Collected Papers of Milman Parry, Oxford. Powell (1991): Barry B. Powell, Homer and the Origin of the Greek Alphabet, Cambridge. Powell (2002): Barry B. Powell, Writing and the origins of Greek literature, Cambridge. Purves (2010): Alex Purves, Space and Time in Ancient Greek Narrative, Cambridge. Raaflaub (1991): Kurt Raaflaub, „Homer und die Geschichte des 8. Jhs. v. Chr.“, in: Joachim Latacz (Hg.), Zweihundert Jahre Homer-Forschung. Rückblick und Ausblick, Stuttgart, 205–256. Raaflaub (1993): Kurt Raaflaub, „Homer to Solon. The rise of the polis“, in: Mogens Herman Hansen (Hg.), The Ancient Greek City-State, Kopenhagen, 41–105. Raaflaub (1997): Kurt Raaflaub, „Soldiers, citizens, and the evolution of the early Greek polis“, in: Lynette G. Mitchell u. Peter John Rhodes (Hgg.), The Development of the Polis in Archaic Greece, London, 49–59.
Das homerische Epos als Quelle, Überrest und Monument
73
Raaflaub (1998): Kurt Raaflaub, „A historian’s headache. How to read ‚homeric society‘?“, in: Nicolas Fisher u. Hans van Wees (Hgg.), Archaic Greece. New Approaches and New Evidence, London, 169–193. Raaflaub (2005): Kurt Raaflaub, „Homerische Krieger, Protohopliten und die Polis. Schritte zur Lösung alter Probleme“, in: Burkhard Meissner, Oliver Schmitt u. Micheal Sommer (Hgg.), Krieg, Gesellschaft, Institutionen. Beiträge zu einer vergleichenden Kriegsgeschichte, Berlin, 229–266. Raaflaub (2008): Kurt Raaflaub, „Homeric warriors and battles. Trying to resolve old problems“, Classical world 101, 469–483. Raaflaub (2011): Kurt Raaflaub, „Auf dem Streitwagen des Sängers. Die Suche nach einer historischen ‚epischen‘ Gesellschaft“, in: Robert Rollinger u. Christoph Ulf, Lag Troja in Kilikien? Der aktuelle Streit um Homers Ilias, Darmstadt, 341–374. Redfield (1975): James Redfield, Nature and Culture in the Iliad. The Tragedy of Hector, Chicago. Reichel (1994): Michael Reichel, Fernbeziehungen in der Ilias, Tübingen. Rose (1988): Peter W. Rose, „Thersites and the plural voices of Homer“, Arethusa 21, 5–25. Ruijgh (1995): Cornelis Jord Ruijgh, „D’Homère aux origines protomycéniennes de la tradition épique“, in: Jan Paul Crielaard (Hg.), Homeric Questions, Amsterdam, 1–96. Schadewaldt (1958): Wolfgang Schadewaldt, Homer: Die Odyssee, Hamburg. Schadewaldt (1975): Wolfgang Schadewaldt, Homer: Ilias, Frankfurt am Main. Sherratt (1990): E. Susan Sherratt, „„Reading the texts“: archaeology and the Homeric question“, Antiquity 64, 807–24. Smitten u. Daghistany (1981): Jeffrey R. Smitten u. Ann Daghistany (Hgg.), Spatial Form in Narrative, Ithaca. Snodgrass (1974): Anthony Snodgrass, „An historical Homeric society?“, The Journal of Hellenic Studies 94, 114–125. Stein-Hölkeskamp (1989): Elke Stein-Hölkeskamp, Adelskultur und Polisgesellschaft. Studien zum griechischen Adel in archaischer und klassischer Zeit, Stuttgart. Stewart (1993): Andrew Stewart, Faces of Power, Berkeley. Thalmann (1998): William G. Thalmann, The Swineherd and the Bow: Representations of Class in the „Odyssey“, Baltimore. Thomas (1989): Rosalind Thomas, Oral Tradition and Written Record in Classical Athens, Cambridge. Traill (1993): David A. Traill (Hg.), Excavating Schliemann: Collected Papers on Schliemann, Atlanta. Traill (1995): David A. Traill, Schliemann of Troy. Treasure and Deceit, London. Tuplin (2003): Christopher J. Tuplin, „Heroes in Xenophon’s Anabasis“, in: Alberto Barzano, Cinzia Bearzot u. Franca Landucci Gattinoni, Modelli eroici dall’ antichità alla cultura europea, Rom, 115–156. Ulf (1990): Christoph Ulf, Die homerische Gesellschaft. Materialien zur analytischen Beschreibung und historischen Lokalisierung, München. Ulf (2003): Christoph Ulf (Hg.), Der neue Streit um Troja. Eine Bilanz, München. Vansina (1985): Jan Vansina, Oral Tradition as History, Madison. Ventris u. Chadwick (1953): Michael Ventris u. John Chadwick, „Evidence for Greek dialect in the Mycenaean archives“, The Journal of Hellenic Studies 73, 84–103. van Wees (1992): Hans van Wees, Status Warrior. War, Violence and Society in Homer and History, Amsterdam. von Wilamowitz-Moellendorff (1906): Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff, Über die Ionische Wanderung, Berlin.
74
Renate Schlesier
Renate Schlesier
Symposion, Kult und frühgriechische Dichtung: Sappho im Kontext * *
Dass die antike griechische Kultur seit ihren historisch greifbaren Frühstadien in vielfältiger Weise medial und performativ bestimmt war, ist in der Forschung der letzten beiden Jahrzehnte ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt. Hierfür nimmt die Dichtung eine Schlüsselstellung ein. Bereits die beiden ins 8. Jahrhundert v. Chr. datierten, vielleicht ältesten literarischen Überlieferungen griechischer Alphabetschrift – die wir im Übrigen bezeichnenderweise der Symposionskeramik verdanken – sind Zeugnisse für poetische Formen und Aussagen, die in ritualisierte gesellschaftliche Praktiken dichterisch formalisierter und rollenbezogener Mündlichkeit eingebunden sind, dabei aber noch auf jede bildliche Illustration verzichten. Eines der beiden Textzeugnisse, die Inschrift auf einem in der westgriechischen Kolonie Pithekoussai, der Insel Ischia, gefundenen Skyphos aus Rhodos verleiht dem Trinkgefäß selbst die Sprecherrolle (Abb. 1): „Ich bin der Becher des Nestor, aus dem gut zu trinken ist. Wer immer aus diesem Becher trinkt, den wird sofort das Begehren (¬mero«) der schönbekränzten Aphrodite ergreifen“1. Das zweite Testimonium, der (fragmentarische) Text einer am Dipylon-Tor in Athen gefundenen Weinkanne wiederum macht unmissverständlich deutlich, dass es sich um ein Preisgefäß handelt, und verkündet: „Wer von den Tänzern jetzt am anmutigsten tanzt ($talfitata pa›zei, wörtlich: „das Anmutigste spielt“), dem wird dies …“2 Schon hier, in diesen vorwiegend daktylischen, in einer Mischung zwischen dem Metron des Epos und den Metren der Lyrik abgefassten Versen sind also die Motive präsent, die für die altgriechische Poesie kennzeichnend bleiben werden, in der sogenannten archaischen Dichtung vom 7. bis zum frühen 5. Jahrhundert unverkennbar ins Zentrum rücken und auch die zeitgenössische Bildkunst bestimmen: die in ein religiöses Fluidum getauchte Verbindung von Wein und Erotik, die besondere Bedeutung des Tanzes und die agonale Qualität musikalischer Formen von Performance.
* Den Teilnehmern der Heidelberger Tagung ‚Medien der Geschichte‘ vom April 2010 habe ich für anregende Diskussionsbeiträge zur Vortragsfassung dieses Beitrags zu danken, sowie ebenso Therese Fuhrer (Berlin) und Beate Kellner (München) für die Gelegenheiten, ihn im April 2010 bzw. im Januar 2011 zur Diskussion zu stellen. 1 Griechischer Text des ‚Nestorbechers‘, in euböischer Schrift: Jeffery (1961/1989) 235, Taf. 47.1. Zur (umstrittenen) Lesart e[i]mi („ich bin“) s. ebd. und Powell (1991) 164; Pfohl (1969) 19–20; Faraone (1996) 78 n. 3; vgl. jetzt Steinhart (2012), mit weiterer Literatur. 2 Griechischer Text der Oinochoe: Jeffery (1961/1989) 68, Taf. 1.1; vgl. Powell (1991) 158–163; Pfohl (1969) 16–18.
Symposion, Kult und frühgriechische Dichtung: Sappho im Kontext
75
Abb. 1: Spätgeometrischer rhodischer Skyphos, ‚Nestorbecher‘ (mit euböischer Inschrift), 2. Hälfte des 8. Jh. v. Chr. Ischia, Museo Archeologico di Pitecusa.
Die beiden inschriftlichen Zeugnisse zeigen nicht allein, dass die performativen Praktiken des (von Männern bestimmten) Symposions3 und des musischen Agon spätestens im Zeitalter der Entstehung der Polisgesellschaften voll entwickelt waren. Sie verdeutlichen auch, dass die neue Kulturtechnik der vokalisierten griechischen Buchstabenschrift denkbar früh in den Dienst einer ebenfalls performativen, noch für lange Zeit exquisit oralen Kunstform, der Sanges-Poesie, gestellt wurde4. Der heutige Forschungskonsens lässt sich daher wie folgt zusammenfassen: Die antike griechische Kultur war von ihren Anfängen an eine „performance culture“5, diese aber war
3 Vgl. zur Neuausrichtung seiner Erforschung seit den achtziger Jahren des 20. Jh. durch historischanthropologisch orientierte Arbeiten (resümierend) Murray (2009). – Ausgeschlossen vom Symposion waren nicht Frauen überhaupt (wie oft unkritisch repetiert wird), sondern nur verheiratete Frauen. Vgl. auch unten, Anm. 44. 4 Zur Verbindung mit Magie s., am Beispiel der Inschrift des ‚Nestorbechers‘ und vergleichbarer Textzeugnisse, Faraone (1996). 5 Richtungweisend waren v.a.: Nagy (1990); Dougherty u. Kurke (1993); Nagy (1996); Goldhill u. Osborne (1999).
76
Renate Schlesier
zunächst und jahrhundertelang vor allem eine „song culture“6, bei der allerdings der Gesang nicht als etwas Isoliertes vorzustellen ist, sondern in der Regel mit anderen musikalischen Tätigkeiten, dem Tanz und dem Instrumentalspiel, aber auch mit sozialen Anlässen, wie dem Symposion und anderen mehr oder weniger religiös geprägten Aufführungs-Kontexten wie den Wettkämpfen, den Kultfesten oder den lebenszyklischen Zeremonien Hochzeit und Begräbnis verbunden war. Vor dem Hintergrund dieser Einsicht wurde zugleich ein älterer Forschungskonsens über Bord geworfen, die Behauptung einer literaturgeschichtlich chronologischen Abfolge von Epos und Lyrik, woraus noch dazu (am einflussreichsten nach dem 2. Weltkrieg durch Bruno Snell) die These einer sukzessiven Entwicklung der abendländischen Subjektivität bei den Griechen, speziell eine angebliche „Entdeckung“ des Individuums in der archaischen Lyrik, abgeleitet wurde7. Heute dagegen zweifelt wohl kaum jemand daran, dass es sich bei den Genres Epos und Lyrik in Griechenland um zwei parallele Phänomene handelte, und dass der Herausbildung des Epos eine bis in unvordenkliche Zeiten zurückreichende Tradition vielfältigster Dichtungs- und Gesangesformen, monodischer und chorischer, zugrunde lag. Dies bezeugen die homerischen Epen selbst, in denen ja nicht allein von den Auftritten professioneller epische Sänger oder göttlicher Chöre wie denen der Musen oder der Nereiden die Rede ist. In den Verlauf der Erzählung sind eine Vielzahl poetisch-musischer Performances eingebaut, Paiane von Männerchören zu Ehren des Apollon (Hom. Il. 1, 473f.), Threnoi (beim Begräbnis des Hektor: Il. 24, 719–776), die von verschiedenen Personenkreisen aufgeführt werden, und zwar von Klagegesang-Spezialisten, von Frauenchören und von einzelnen namentlich hervorgehobenen Frauen (wie auch am Leichnam des Patroklos von der Beutefrau Briseïs, Il. 19, 287–300). Ebenso sind Hochzeitslieder (Il. 18, 491–493) und weitere Liedformen – wie das bei der Weinernte von einem jungen Mann zur Leier gesungene Linos-Lied, das den Tanz von Mädchen und Jünglingen begleitet (Il. 18, 567–572), – bei Homer präsent. Die Tradition von musischen Wettkämpfen setzt die Ilias ebenfalls voraus und exemplifiziert sie am Beispiel des umherreisenden Sängers Thamyris (Il. 2, 494–600). Die homerischen Epen belegen aber nicht bloß den öffentlichen, von Chören oder Individuen im Ambiente einer gemeinschaftlichen Performance aufgeführten Gesang, sondern dokumentieren auch, am Beispiel des Achill (Il. 9, 186–191), ein monodisches Für-sich-Singen zu einem Saiteninstrument, ohne jeglichen Bezug auf ein Publikum, als eine mögliche und vielleicht spezifisch aristokratische Tätigkeit. Es ist davon auszugehen, dass die Sangespraxis der archaischen Epoche zumindest ebenso vielfältig und gesellschaftlich omnipräsent war, wie es die homerischen Epen nahelegen, wenn auch die Überlieferung frühgriechischer Dichtung äußerst lü-
6 Der Begriff „song culture“: seit Herington (1985) 3 passim. Zur Literarisierung vgl. Latacz (1990); Ford (2003). 7 So Snell (1946), mit mehreren späteren Auflagen.
Symposion, Kult und frühgriechische Dichtung: Sappho im Kontext
77
ckenhaft ist und die Zeugnisse meist nur in fragmentarischer Form vorliegen. Allerdings ist dieses Material seit dem Ende des 19. Jahrhunderts durch Papyrusfunde und -entzifferungen sprunghaft angewachsen (ähnlich wie das der Bildkunst), und weitere Entdeckungen auf diesem Gebiet sind mit großer Sicherheit zu erwarten. Anders als frühere Forscher, die die frühgriechische Poesie als autobiographische Selbstaussage individueller dichterischer Persönlichkeiten ansahen, betonen viele heutige Forscher, gestützt gerade auch auf Neufunde, mehr und mehr den gesellschaftsbezogenen, ‚pragmatischen‘ Aspekt dieser Dichtung. Dabei gehen sie oft von der Hypothese8 aus, dass alle oder fast alle Produkte archaischer Dichtung für einen bestimmten sozialen, in der Regel kultischen, Kontext bestimmt waren und, nach dem Modell der Siegeslieder des Pindar, als Auftragsarbeiten im Dienst einer konsensuellen Gemeinschaft, ja, als deren Stimme anzusehen sind. Tatsächlich ist es nicht von vornherein auszuschließen, dass es sich bei frühgriechischen Dichtungen um normative Medien handeln könnte, mit deren Hilfe die einzelnen Zuhörer zu sozialen Individuen erzogen und, gestützt auf eine religiöse Ideologie, in eine ausdifferenzierte oder in eine umfassende gesellschaftliche Gruppe integriert werden sollten. Gegenüber diesem Deutungsansatz ist indessen zunächst aus drei Gründen eine gewisse Skepsis angebracht: zum einen stimmt dieses normative Dichtungsmodell zu sehr mit Platons, in den Nomoi (2, 653a-673d, und 7, 796e-817e) formulierter Position überein, die von ihm explizit als reformatorisches Programm gegen die bis dato vorherrschende musische Praxis ins Feld geführt wird, als dass es umstandslos in die vorplatonische Epoche zurückprojiziert werden könnte9; zum anderen sind die Siegeslieder des Pindar kaum als Modell für die ältere frühgriechische Dichtung zu gebrauchen, zumal es nur unsichere oder indirekte Belege für vorpindarische Epinikien10 oder andere poetische Auftragsarbeiten zu einem speziellen Anlass gibt; zum dritten und vor allem besitzen wir für kein einziges Produkt frühgriechischer Dichtung vor Pindar irgendeine Information über dessen ursprünglichen Aufführungskontext, was von allen Spezialisten auf diesem Gebiet immer wieder mit großem Bedauern hervorgehoben wird. Ein vierter und entscheidender Grund für berechtigte Skepsis gegenüber dem gegenwärtig vorherrschenden Deutungsparadigma scheint jedoch in einem auffälligen, für die frühgriechische Dichtung charakteristischen Sprechakt zu liegen, den frühere Forscher als Indiz autobiographischer Erlebnislyrik interpretiert hatten: die Prädomi-
8 Der darauf basierende ‚pragmatische‘, vorwiegend rezeptionstheoretisch ausgerichtete Zugang zur archaischen Dichtung wurde besonders dezidiert und einflussreich verfochten von Calame (1977); Rösler (1980); Gentili (1984). 9 Vielmehr ist gerade auch von subversiven Tendenzen in der antiken erotischen Dichtung seit ihren Anfängen auszugehen, vgl. Zeitlin (1999) 58. 10 Evtl. Ibykos (nach neueren Papyrusfunden), sowie Simonides, nach dem Testimonium von Hdt. 5,102,3 (= Simonides fr. 518 PMG). – Zum kompletten Fehlen eines chorischen ‚Ich‘ in Pindars Epinikien s. Lefkowitz (1963).
78
Renate Schlesier
nanz der 1. Person Singular, eines ‚Ich‘, innerhalb dieses Mediums. Es ist nun keineswegs ausgemacht, dass dieses ‚Ich‘, wie manche heutige Forscher wollen, einfach mit dem (chorischen) ‚Wir‘ einer normativ einzustimmenden Gemeinschaft gleichzusetzen ist oder gar sich ausnahmslos darauf reduzieren lässt11. Dieses Ich kann – ähnlich übrigens wie zuweilen bereits bei Homer und Hesiod – durchaus eine einzelne Person vorstellen, auch die des Dichters und Sängers, jedoch nicht im Sinne einer realistisch gemeinten autobiographischen Aussage, sondern als Konstruktion, anders gesagt: als Rollen-Fiktion. In zahlreichen jüngeren Studien konnte herausgearbeitet werden, dass, wie ja auch in moderner Lyrik, das Ich frühgriechischer Dichtung, von Archilochos bis Pindar, eine äußerst flexible, vielfältige ‚Persona‘ ist, wenn man will, eine lyrische Maske, die ein poetisches Experimentieren mit den unterschiedlichsten Rollen und Perspektivierungen erlaubt. Es handelt sich dabei nun kulturspezifisch um ein prä-dramatisches Procedere, das zugleich einen äußerst mannigfaltigen performativen Einsatz ermöglicht, in einem öffentlichen wie (vielleicht besonders) in einem eher eingegrenzten, auf wenige Zuhörer beschränkten Ambiente. Das jeweilige poetische Produkt wird dadurch nicht allein unabhängig vom Autor und von eventuellen ursprünglichen Vortragsbedingungen und -kontexten – dies ist auch bei den epischen Gesängen und bei den späteren Dramen der Fall –, sondern es inkorporiert eine modellhaft individuelle, konkrete Präsenz, die in zukünftigen Situationen nach Belieben von anderen Individuen aktualisiert werden kann. Im Mund anderer Akteure als des Dichters ermöglicht ein solches Ich-Gedicht eine stimmlich verkörperlichte Transformation des Vortragenden selbst, genauer gesagt: eine momentane, spielerische Identifizierung mit einer in sich geschlossenen, auf wenige Aspekte verdichteten, generischen Rolle, oder auch eine nicht weniger rollenhafte, demonstrativ gelehrte, rezitative Distanzierung von einer solchen Persona. Die Pointe dabei ist, dass dieses vexierbildhafte Spiel mit einem Ich, das situativ bestimmt wird und durchaus ein anderes sein kann als das eigene reale, ja, dass der geradezu experimentelle Umgang mit einem fiktiven Ich, welches ausschließlich in der Sprache existiert, bereits das Verfahren der Autoren ist, die dieses Ich poetisch konzipiert und zum Agenten ihrer Kompositionen gemacht haben, so wie auch andere solche Ichs im Rahmen anderer, ja manchmal sogar derselben poetischen Kompositionen. Und Gleiches gilt für das Du, das die Dichter namentlich oder anonym adressieren: Es changiert zwischen der Suggestion einer als real aufgefassten – menschlichen oder göttlichen – Person und der Fiktion einer Figur, deren generische Qualität auch auf andere Namen und Figuren im Sinne eines Perspektivenwechsels appliziert werden kann. Im Rahmen der frühen Poliskultur existierten zweifellos zahlreiche Aufführungsräume und -gelegenheiten, einschließlich von Kultfesten, die als Experimentierfelder
11 Vgl. zusammenfassend Budelmann (2009) 16–17. Zu den kultur- und zeitenübergreifenden Spezifika des lyrischen Ich vgl. jetzt auch (komparatistisch) Schlaffer (2012) passim.
Symposion, Kult und frühgriechische Dichtung: Sappho im Kontext
79
für ein solches poetische Procedere haben dienen können, so wenig wir auch über die jeweiligen konkreten Aufführungskontexte frühgriechischer Dichtung wissen. Allerdings scheint das Symposion12 ein besonders privilegierter Ort und Anlass für ihre Komposition, Aufführung, Wiederverwendung und aktualisierende oder gar überbietende Umformung gewesen zu sein, wie bereits das Ich des ‚Nestorbechers‘ zeigt, das wie ein Sänger (ja wohl auch wie ein Zauberer) zu den Symposiasten spricht und dem sie selbst ihre Stimme leihen konnten. Die vom Weingenuss unterstützten oder hervorgerufenen Erfahrungen von Identitätsverlust und Identitätswechsel, bis zur Ekstase, dem Außer-Sich-Sein, und dem Enthusiasmos, der halluzinatorischen Gotterfülltheit, mögen die Produktion und Rezeption von kunstvollen, durch Musik, Tanz und Erotik emotional verstärkten Vervielfältigungen und Verschränkungen der Ich- und Du-Rollen oder -Konstellationen besonders begünstigt haben. Im religiösen Rahmen der antiken griechischen Kultur überrascht es daher nicht, dass es unter den Göttern vor allem Dionysos, Eros und Aphrodite waren13, unter deren Auspizien symposiastische Erfahrungen poetisch wie bildlich gedeutet und das Symposion zum Schauplatz auch poetischer Erfahrungen werden konnte. Zugleich muss festgehalten werden, dass das Symposion bis in die klassische Zeit hinein ein Ort war, der insbesondere dem Selbstverständnis aristokratischer, gerade auch politisch miteinander rivalisierender Zirkel, diente, die als hetaireiai, Freundeskreise von Gefährten oder Gesinnungsgenossen (hetairoi) bezeichnet wurden14. Die beim Symposion gepflegten, wohl primär monodischen Dichtungsarten, vor allem die Elegie, aber auch der Iambos und die melische Kunst der äolischen und der ionischen Lyrik, sind den Implikationen dieses elitären Selbstverständnisses verpflichtet. Dazu gehören keineswegs nur direkt politische Ermahnungen von Freunden oder Schmähungen von Gegnern, sondern ebenso gnomische Äußerungen über Leben, Lebensstile, Alter und Tod, vor allem aber persönlich akzentuierte Reflexionen über die sich ständig erneuernde Liebe und ihre Auswirkungen auf den Einzelnen. Das darin zum Ausdruck kommende aristokratische Selbstbewusstsein ist bei allen frühgriechischen Dichtern zu finden, deren Kompositionen zweifellos im Rahmen von Symposia aufgeführt wurden, was nicht präjudiziert, dass sie ausnahmslos für diesen Zweck verfasst worden waren15. Die meisten dieser Dichter stammten aus den oligarchischen oder bald auch von Tyrannen regierten Stadtstaaten der ägäischen Inseln, Westkleinasiens oder Süditaliens: vom 7. bis zum frühen 5. Jahrhundert, in annähernd chronolo-
12 Vgl. z.B. Latacz (1990), ausgehend vom ‚Nestorbecher‘. Wecowski (2002) betont die Verbindung zwischen Gleichheit und Konkurrenz bei sämtlichen Performances der Symposiasten. 13 Dionysos: Fehr (2003); Dionysos, Eros und Aphrodite: Henrichs (2008). 14 Vgl. z.B. den konzisen Überblick bei Fisher (1988) 1175–1177. – Hetaireia: zuerst bezeugt bei Hdt. 5,71 als umstürzlerischer Zusammenschluss gleichaltriger Männer unter Führung des Olympiasiegers Kylon von Athen (7. Jh. v. Chr.); hetairos (belegt seit Homer), als Terminus für einen (Symposions-)Gefährten in der frühgriechischen Dichtung: seit Archil. fr. 168,3 West (1989). 15 Vgl. Bowie (1986); Carey (2009) 32–38.
80
Renate Schlesier
gischer Reihenfolge, vor allem Archilochos von Paros, Semonides von Amorgos, Mimnermos aus Smyrna, Alkaios von Lesbos, Stesichoros aus Himera in Sizilien, Anakreon aus Teos, Ibykos aus Rhegion, Xenophanes aus Kolophon, Hipponax aus Ephesos, Simonides von Keos. Zu diesen Dichtern haben die antiken Gelehrten ohne zu zögern auch Sappho von Lesbos gerechnet, die als jüngere bzw. gleichaltrige Zeitgenossin neben die ältesten fünf dieser Dichter gestellt werden muss und nicht weniger berühmt war als diese. Von vielen dieser zumeist an mehreren Orten der griechischsprachigen Mittelmeerwelt aktiven Dichter aus einer ganz besonders kosmopolitischen, polyzentrischen Epoche ist überliefert, dass sie in verschiedenen Gegenden bei Sängerwettkämpfen auftraten und auch Chorlyrik verfasst haben, ein Genre, das wohl primär bei öffentlichen Kultfesten aufgeführt wurde (was allerdings nicht ausschließt, dass sie auch von Einzelnen oder gemeinschaftlich bei Symposien vorgetragen werden konnte): Archilochos, Semonides und Simonides haben Dithyramben, Kultlieder zu Ehren des Dionysos, komponiert, Alkaios Götterhymnen, Anakreon wohl auch Partheneia (Lieder für Mädchenchöre). Eine prinzipielle Unterscheidung zwischen monodischer und chorlyrischer Dichtung und ihre Zuweisung zu bestimmten Autoren ist anhand der überlieferten Textbruchstücke jedoch nur mit Vorbehalt zu vollziehen und in der Forschung umstritten16. Stesichoros etwa, dessen Name ‚der Choraufsteller‘ bedeutet, hat möglicherweise selbst zumindest manche seiner Dichtungen monodisch vorgetragen und auf einem Saiteninstrument begleitet, und von einem der ältesten griechischen Chorlyriker, dem in Sparta wirkenden (aber vielleicht aus dem lydischen Sardes stammenden) Alkman, der für seine Partheneia und Hymenaia (Hochzeitslieder) berühmt war, ist auch monodische Liebesdichtung bezeugt. Ein besonderes Problem für die Klassifikation archaischer Lyrik stellen demgegenüber die ins späte 7. und frühe 6. Jahrhundert zu datierenden poetischen Kompositionen der Dichterin Sappho dar, von denen nunmehr in den letzten zwei Dritteln dieses Beitrags die Rede sein soll. Von allen Dichtern archaischer Zeit vor Pindar ist ihr Werk neben dem ihres Landsmanns Alkaios am relativ umfangreichsten bezeugt, was dokumentiert, welche herausragende und kontinuierliche Anerkennung ihre Dichtung in der antiken Kultur während eines Zeitraums von mindestens tausend Jahren nach ihrem Lebensende genoss. Allerdings ist ihr Werk, ebenso wie das ihrer männlichen Kollegen, nur in vorwiegend verstümmelter Form überliefert, in kurzen, oft bloß aus einem Wort oder einem Vers bestehenden Zitaten spätantiker Autoren und etwas ausführlicher auf Papyrusfetzen, zu denen vor wenigen Jahren ein neuer sensationeller Fund, ‚the New Sappho‘, aus der Kölner Papyrussammlung hinzukam17. In den vergangenen Jahrzehnten wurde nun verstärkt der Versuch unternommen, ihre Kompositionen insgesamt, insbesondere anhand der ca. 15 relativ umfangreich-
16 Zu diesem Problem vgl. Harvey (1955); Davies (1988). 17 S. dazu z.B. Greene u. Skinner (2009).
Symposion, Kult und frühgriechische Dichtung: Sappho im Kontext
81
sten (bis zu 34 Verse langen) Dichtungsfragmente, als chorlyrische Produkte im Dienst gemeinschaftlich-kultischer Zwecke zu deuten18, nachdem gerade auch ihr Werk lange Zeit als subjektive Erlebnislyrik interpretiert worden war. Wenig spricht jedoch dafür, dass das neue Deutungsparadigma gerechtfertigter ist als das alte. Beide Ansätze gehen im Übrigen letztlich auf dieselbe aus dem 19. Jahrhundert stammende, biographistische Hypothese zurück, die im Fin-de-siècle von Wilamowitz19 kanonisiert worden war. Diese Hypothese folgt dem Impuls, die Dichtungen Sapphos aus dem spezifischen kulturellen und poetischen Kontext der frühgriechischen Lyrik herauszulösen und die Lyrikerin anders als ihre männlichen Kollegen nicht so sehr als Dichterin zu verstehen20, sondern als Pädagogin, als Lehrerin junger Mädchen, die angeblich von ihr mittels von Dichtung und damit verbundener kultischer Praktiken auf ihre zukünftige Rolle als Ehefrauen vorbereitet wurden. Die heute vorherrschende Rede von Sapphos „Mädchenkreis“21 oder ihrem angeblichen ‚thiasos‘ (ein Wort, das weder von ihr noch in den antiken Testimonien zu ihr verwendet wird) reproduziert in leicht abgeschwächter Form Wilamowitz’ anachronistische und letztlich puritanisierende Rede von Sappho als Leiterin eines „Mädchenpensionats“22. Zu einer solchen ihr zugeschriebenen Rolle scheint dann für viele gegenwärtige Interpreten eher zu passen, dass Sappho vorgeblich in erster Linie Chorlieder verfasste, die eine rituelle erzieherische Aufgabe – heute oft modisch „Initiation“23 genannt –, und zwar in letztlich wohlanständigem Sinne, für die Mädchen ihres Kreises erfüllt hätten. Nun besteht kein Zweifel daran, dass Sappho Chorlyrik komponiert hat. Spätantike Grammatiker und Lexikographen, denen das viele tausende Verse umfassende Werk der Dichterin noch vorlag, zum Teil auf der Grundlage von gelehrten Editionen hellenistischer Zeit in neun Büchern, sprechen davon, dass in einem davon (dem letzten?) Hochzeitslieder zusammengestellt waren, Epithalamia24, wörtlich: „Lieder vor dem Schlafgemach“. Anhand von Bruchstücken, die moderne Editoren den Epithalamia der Sappho zugeordnet haben, wird oft vermutet, dass diese Lieder, in denen die
18 So besonders seit Calame (1977) Bd. 1, 367–372, in Analogie zu den Partheneia des Alkman; ähnlich auch z.B. Lardinois (1994); vgl. jetzt Ferrari (2010). 19 Vor allem in Wilamowitz (1907) und (1913): ,Ehrenrettung‘ der Sappho als ,reine‘ Frau, der keine homoerotischen Praktiken unterstellt werden dürften, in Anknüpfung an Welcker (1816); vgl. Calder III (1986). 20 Zu methodischer Kritik am Biographismus in der Sappho-Forschung s. richtungweisend Lefkowitz (1973). 21 „Mädchenkreis“: terminologisch v.a. seit Schadewaldt (1950) und Merkelbach (1957). 22 Wilamowitz (1907) 28; „Thiasos“: z.B. Wilamowitz (1913) 42. 23 Dabei werden, seit Merkelbach (1957), fragwürdige kulturanthropologische Theorien (v.a. von Mircea Eliade und Arnold van Gennep) unkritisch übernommen und übertragen; so auch z.B. Rösler (1992); Calame (1996). 24 Der Ausdruck ist nicht vor dem Hellenismus belegt. Vgl. (zu Sappho) z.B. Contiades-Tsitsoni (1990) 68–109.
82
Renate Schlesier
Preisung von Braut oder Bräutigam mit Verspottungen gemischt sein konnte, vor oder während oder am Ende der Hochzeitsnacht von jungen unverheirateten Frauen und jungen unverheirateten Männern aus dem Freundes- und Familienkreis der Braut und des Bräutigams vorgetragen wurden. Hier zwei Beispiele aus der allerdings für diese Liedform besonders begrenzten Textüberlieferung, von denen das erste durch die Wiederholung des Kultrufs ‚Hymenaios‘, des eponymen Hochzeitsheros, skandiert wird: fr. 111 [= Heph. Poem. 7,1]25 úcoi dÎ tÌ mwlaùron· \m‹naon· $wrrete twktone« ¡ndre«· \m‹naon. gˇmbro« †eåswrxetai úso«† ~reyi, ¡ndro« megˇlv pfily mwzvn. Hoch nun das Dach, Hymenaios! Hebt es hoch, Bauleute, Männer, Hymenaios! Ein Bräutigam kommt herein, gleichend dem Ares, viel größer als ein großer Mann.
Während für dieses Beispiel die spöttisch übertreibende und vielleicht sexuell allusive Preisung des göttergleichen Bräutigams charakteristisch ist, erlaubt das zweite Beispiel, das auf Papyrus bezeugt ist, auch gewisse Rückschlüsse auf mit der Hochzeit verbundene ritualisierte Praktiken, die den Bräutigam mit seinen männlichen Altersgenossen, und eventuell auch mit seinen weiblichen, verbunden haben: fr. 30 [= P. Oxy. 1231 fr. 56 + 2166(a)6A] (Abb. 2) n÷kt[…].[ (1) pˇrùenoi d[ pannyxisdo.[.]a.[ ˙ s@n $e›doi.n f[ilfitata kaÏ n÷mfa« åokfilpv.
25 Dieses und die folgenden Sappho-Fragmente entsprechen den Nummerierungen und (sofern nicht anders angegeben) den Textfassungen der Editionen von Lobel u. Page (1955) – reproduziert nach Thesaurus Linguae Graecae online – sowie von Voigt (1971); die Übersetzungen stammen von der Verfasserin. – Das Wort gambrfi« als Bezeichnung für den Bräutigam bzw. den Freier ist in diesem generisch eingeschränkten Sinne erst seit Sappho (in neun Fragmenten) belegt; zuvor (aber in der Regel auch danach) bezeichnet es die durch Heirat (gˇmo«) hergestellten männlichen Verwandtschaftsbeziehungen (wie etwa Schwiegersohn, Schwager, Schwiegervater).
Symposion, Kult und frühgriechische Dichtung: Sappho im Kontext
Abb. 2: Sappho fr. 30, Papyrus Oxyrhynchus 1231 fr. 56 (2. Jh. n. Chr.).
$ll’ ãgwrùei«, ł=ù[e ˙˙ steÖxe soÏ« \mˇlik[a« ˙ óper òsson $ lig÷fv[no« ˙ ˙ ¾pnon [ú]dvmen Nacht … Mädchen … die ganze Nacht lang feiern … deine Liebe zu besingen und die der Braut, der veilchenbusigen. Doch wach auf, Jüngling, … geh zu deinen Altersgenossen, … so dass wir ebenso wenig wie die hellstimmige (Nachtigall) … Schlaf sehen.
83
84
Renate Schlesier
Bei meinem dritten Beispiel, das wohl ebenfalls in einen rituell-poetischen Hochzeitskontext gehört, handelt es sich (neben einem anderen, von dem gleich die Rede sein wird), um eines der frühesten Zeugnisse dialogischer, dramatisierter Rollenpoesie: fr. 114 [= Demetr. Eloc. 140] {(n÷mfh).} parùen›a, parùen›a, poÖ me l›poisa †oúxhi; {(parùen›a).} †o\kwti ójv prÌ« sw, o\kwti ójv†. (Braut:) Mädchenzeit, Mädchenzeit, wohin bist du, mich verlassend, gegangen? (Mädchenzeit:) Niemals werde ich wiederkommen zu dir, niemals werde ich wiederkommen.
In einem rituellen Zusammenhang ist auch ein weiteres Beispiel von frühgriechischer Responsionslyrik – einer poetischen Form, die übrigens nur bei Sappho belegt ist –, zu verorten, allerdings nicht im freudigen Kontext der Hochzeit mit seinen wohl kaum nur sprachlichen Lizenzen, sondern in dem der Totenklage, wie sie beim Adonis-Fest, den Adonia, praktiziert wurde26. In Sapphos Dichtungen finden sich die frühesten und für Jahrhunderte isoliert bleibenden Zeugnisse für den aus der Levante stammenden Adonis-Kult. Bereits der Name des in ihm als gestorbener und wiederbelebter Geliebter der Aphrodite gefeierten Heros verweist auf den semitischen Bereich (‚adon‘ ist ein semitisches Wort für Gott, vgl. biblisch ‚Adonai‘). Detaillierte Zeugnisse über die Riten des Adonis-Kultes stammen erst aus sehr viel späterer Zeit. Aristophanes’ Komödien ist allerdings zu entnehmen, dass er zu seiner Zeit von Frauen in Athen praktiziert wurde, bei jüngeren Komödiendichtern wie Diphilos figurieren die Adonia als Hetärenfest und bei Menander sogar als ein Fest, an dem Hetären und verheiratete Frauen gemeinsam teilnahmen, in Theokrits 15. Idylle ist es ein kosmopolitischer, Männer wie Frauen, Bürger wie Fremde umfassender Stadtkult im Königspalast des ptolemäischen Alexandria, und Lukian schildert es im 2. Jahrhundert n. Chr. als eine Form orgiastischer Verehrung der Aphrodite von Byblos (Dea Syria, 6), die Prostitution von Frauen zu Ehren der Göttin einschloss. Dass die in manchen antiken Zeugnissen betonte ekstatische, ja sexuell ausschweifende Qualität des Adonis-Kultes auch für das archaische Lesbos vorausgesetzt werden kann, ist eine plausible Vermutung, die sich allerdings nicht belegen lässt. Durch die Überlieferungslage ist Sapphos Dichtung nun kontextuell als erste Quelle, und zwar in rituell wie poetisch besonders markanter Form, mit dem AdonisKult assoziiert. Die Erfindung des Versmaßes, das die Dichterin für die Anrufung des Adonis verwendet hat – (Ù tÌn ~dvnin, „oh weh über Adonis“, fr. 168), ein katalektischer daktylischer Dimeter –, schreibt der römische Grammatiker Marius Plotius Sacerdos der Sappho zu und leitet davon die metrische Bezeichnung „Ado-
26 Vgl. dazu und zum Folgenden: Reed (1995), kritisch anknüpfend an Detienne (1972).
Symposion, Kult und frühgriechische Dichtung: Sappho im Kontext
85
nius“ ab27. Nicht weniger kühn und neuartig scheinen Sapphos antispastische Tetrameter gewirkt zu haben, in denen das folgende, auf den Adonis-Kult bezogene Frageund Antwort-Spiel abgefasst ist, das der alexandrinische Grammatiker Hephaistion aus dem 2. Jahrhundert n. Chr. in seinem Handbuch der Metrik als herausragendes metrisches Beispiel zitiert: fr. 140 [= Heph. Ench. 10,4] katùnaskei, Kyùwrh’, ¡bro« ~dvni«· t› ke ùeÖmen; katt÷ptesùe, kfirai, kaÏ kater÷kesùe k›ùvna«. Er stirbt dahin, Kythereia, der prächtige Adonis. Was sollen wir tun? Schlagt euch, junge Frauen, und behaltet die Chitone.
Akustisch besonders auffällig ist hier die zunehmende Häufung von Alliterationen des Buchstabens Kappa (nicht weniger als 10 in 2 Versen!), die für euphemistische Anspielungen auf Sexuelles charakteristisch gewesen zu sein scheinen28. In diesen beiden Versen geht es offenbar um eine bestimmte rituelle Situation im Rahmen des Adonis-Kultes. Den Frauen, die die Göttin fragen, was sie angesichts des sterbenden Adonis tun sollen, befiehlt Aphrodite (bzw. ihre kultische Repräsentantin) einen gewaltsamen Trauergestus: katt÷ptesùe, „schlagt euch“. Ein solches ‚Sich-selbstSchlagen‘ (gegen die Brüste) ist traditionell in vielfältigen Kontexten für Klageriten bezeugt. Gewöhnlich wird dies mit dem Zerreißen der Gewänder verbunden. Letztere Praxis wurde durch eine moderne Emendation aus dem 18. Jahrhundert (Pauw) in Sapphos Text hineinmontiert (katere›kesùe, „zerreißt“). Damit wird jedoch eine wesentliche Partikularität dieses Textes unterschlagen: Die Frauen sollen zwar einen Teil der Klageriten vollziehen (sich selbst schlagen), jedoch gerade nicht den weiteren gewaltsamen Trauergestus, das Zerreißen der Gewänder, sondern die Gewänder unzerrissen ‚(be)halten‘ (kater÷kesùe). Dadurch wird nachdrücklich betont, dass es sich hier um keine gewöhnliche Totenklage handelt, denn für den gestorbenen jugendlichen Liebhaber der Göttin besteht, der Überlieferung zufolge, die freudige Perspektive einer Wiederbelebung.
27 Campbell (1982) 170–171. – In diesem Versmaß, dem Adonius, ist auch der fünfsilbige Schlußvers der sogenannten ‚sapphischen Strophe‘ abgefasst (die ersten drei Verse: Elfsilber); in der alexandrinischen Sappho-Ausgabe waren alle Lieder des 1. Buches in dieser vierzeiligen Strophenform komponiert (z.B. fr. 30, mit Abb. 2: laut der Papyrus-Überlieferung das letzte Gedicht dieses Buches). – Vgl. auch Sappho fr. 117 B (b) Voigt: Ù tÌn ’AdØnion. 28 Vgl. dazu die von Page unter den Carmina popularia eingeordneten Textzeugnisse, fr. 881 PMG. – Lobel u. Page (1955) und Voigt (1971) drucken im 2. Vers von Sappho fr. 140 Pauw’s Konjektur katere›kesùe statt des überlieferten kater÷kesùe; s. im Folgenden die Erklärung, warum ich diese Konjektur nicht übernehme. – Der Ausdruck korai in Vers 2 scheint hier einen Status zu bezeichnen; daraus ein reales, ausnahmslos jugendliches Alter der Sängerinnen bzw. Kultteilnehmerinnen abzuleiten – so Lardinois (1994) 65 („girls“) –, ist nicht möglich; vgl. auch unten, Anm. 43 u. 44.
86
Renate Schlesier
Diese beiden Responsionsverse Sapphos sind aus mindestens zwei Gründen überlieferungsgeschichtlich sensationell: Zum einen, wie John Herington, der Verfasser der bahnbrechenden Studie Poetry into Drama von 1985, hervorgehoben hat29, handelt es sich hier wohl um ein „truly ritual drama“, und er fügt hinzu: „If these considerations are correct, we have to credit none other than Sappho with the earliest fragment of verse drama that survives in the entire European tradition“. Zum anderen, wie Martin West in seiner nicht minder bahnbrechenden Analyse westasiatischer Elemente in der griechischen Dichtung von 1997 unterstrichen hat30, ist dieses zweizeilige Sappho-Fragment das früheste Zeugnis für die Übernahme antiphonischer kultischer Responsion zwischen einem Vorsänger und einem Chor, wie sie etwa im babylonischen Gilgamesch-Epos des 3. Jahrtausends bezeugt ist, aus der vorgriechischen, altorientalischen Mittelmeerkultur in die frühgriechische Dichtung. Dieses Fragment kultisch-dramatischer Poesie ist also zugleich ein Indiz, und zwar nicht das einzige, dafür, dass Sappho, wie im übrigen alle griechischen Dichter vor und nach ihr, ein poeta doctus war, eine hochgebildete Intellektuelle, die keineswegs einem naiven Bild hinterwäldlerischer, isolierter und uninformierter Dichtungspraxis entsprach31. Vielmehr wimmelt ihr Werk nicht allein von metrischen und sprachlichen Erfindungen oder von Wiederaufnahmen und innovativen Umformungen älterer griechischsprachiger epischer und lyrischer Poesie, sondern gerade auch von Spuren levantinischer und anatolischer Musik- und Dichtungstraditionen, die sich bis ins 3. Jahrtausend zurückverfolgen lassen. Dazu gehören nicht allein formale musikalische und poetische Techniken, sondern auch Weisheits- und Wissenstraditionen, die spezielle Gedankenverbindungen und Metaphern, Fachwörter und andere Expertisen über materielle Kultur betreffen. Wie vertraut besonders Sappho, offenbar mehr als ihre männlichen Dichterkollegen, mit aus Kleinasien und der Levante stammenden Fachtermini war, etwa für Ingredienzien der Kultpraxis und des aristokratischen Luxus, zeigt sich zum Beispiel daran, dass bei ihr zum ersten Mal das griechische Wort für Weihrauch bezeugt ist (l›bano«)32, dessen Name unzweideutig auf die nahöstliche Herkunft der Pflanze, ih-
29 Herington (1985) 57, vgl. 211. 30 West (1997) 44 u. 530. Zur nahöstlichen Herkunft griechischer Musikinstrumente und des Symposions: ebd. 31–32. Zur Bedeutung Lydiens für die Entwicklung frühgriechischer Musik, Dichtung und Luxuskultur: Franklin (2008). 31 Die (mittlerweile von den meisten Forschern in Frage gestellte) These einer räumlichen, zeitlichen und sozialen Begrenztheit der Dichtungspraxis von Sappho und ihrem Landsmann Alkaios: bei Rösler (1980) 40: „Die Hetairie … war Voraussetzung und Bestimmungsort der Dichtung des Alkaios“, analog zu Sapphos „Mädchenkreis“, dessen Isolation nur durch die Aufführung von Hochzeitsliedern durchbrochen worden sei (ebd. 36, n. 29); ebd. 46 behauptet Rösler, dass es sich bei den „Zielgruppen“ von Sappho und Alkaios (wie auch von Archilochos) „um voneinander völlig unabhängige, geschlossene Gemeinschaften handelte“; professionelle Erwartung poetischen Nachruhms sei daher für diese (und andere) sog. „Bürgerdichter“ (ebd. 62) auszuschließen (ebd. 68–77). 32 Sappho fr. 2,4; fr. 44,30.
Symposion, Kult und frühgriechische Dichtung: Sappho im Kontext
87
rer Verarbeitung und ihres Gebrauchs verweist. Rätselhaft bleibt allerdings die Art und Weise der Vermittlung all jenes poetischen und anderen kulturellen Wissens, das ja zu einem beträchtlichen Teil sowohl die geographischen und politischen als auch die Sprachgrenzen überschritt. Festzuhalten ist, dass die Formen und Medien oder die örtlichen und zeitlichen Kontexte der unleugbaren Transmission dieser nichtgriechischen und der ebenfalls weitverstreuten griechischen Traditionen, trotz wachsender Forschungsbemühungen auf diesem Gebiet, leider bis heute noch nicht annähernd befriedigend aufgeklärt sind. Die besondere Offenheit für levantinisch geprägte und griechisch adaptierte, sprachliche und materielle Raffinesse zeigt sich bei Sappho noch deutlicher als bei ihren zeitgenössischen männlichen Dichterkollegen. Das Adjektiv 4brfi«, ‚prächtig‘, ‚delikat‘, das in der zitierten Kultresponsion den schönen Jüngling Adonis charakterisiert, gehört zu Sapphos Lieblings-Adjektiven und wird von ihr ansonsten vor allem auf attraktive und elegante Frauen angewendet, ja die Dichterin macht die durch lydische Lebensart inspirierte Liebe zum Luxus, die 4bros÷nh33, in einer geradezu theoretischen begrifflichen Wortbildung zum erotisch-politischen Programm. Es ist bezeichnend, dass der wenig jüngere Dichter und Philosoph Xenophanes, vor dem Hintergrund seiner eigenen, bei ihm jedoch dezidiert maßvollen Symposions-Ideologie (fr. B1 DK), die lydische 4bros÷nh seiner kleinasiatischen Landsleute als Dekadenz geißelt (fr. B3 DK)34. Sappho unterscheidet sich aber von den übrigen frühgriechischen Dichtern allenfalls darin, dass sie offenbar besonders vielseitig war und weitaus mehr in unterschiedlichen Dichtungsformen exzellierte, obwohl von ihr neben den wohl primär chorischen Epithalamien und den von Frauenkollektiven aufgeführten Adonis-Kultdichtungen vorwiegend monodisch geformte, melische Lyrik überliefert ist und sich von den Elegien, Iamben und Epigrammen, die ihr in antiken Quellen ebenfalls zugeschrieben wurden35, keine eindeutigen Belege erhalten haben. Allerdings scheint sie nicht, wie einige ihrer männlichen Kollegen, in Sängerwettkämpfen aufgetreten zu sein oder zum Programm öffentlicher Polisfeste beigetragen zu haben. Dafür gibt es jedenfalls keine direkten oder indirekten antiken Zeugnisse. Auch über mögliche Auftritte Sap-
33 Sappho fr. 58,25 (der erste Beleg für das Substantiv). 34 Zu gegensätzlichen Bewertungen der habrosyne bei Autoren der archaischen Epoche s. Kurke (1992); speziell zum Gegensatz zwischen Sappho und Xenophanes vgl. Schlesier (2011b) 26–27. 35 Sappho test. 1 (Papyrus aus Oxyrhynchos, 2./3. Jh. n. Chr.); test. 2 (Suda-Lexikon). Zu diesen und den im Folgenden erwähnten Testimonia s. Campbell (1982); vgl. Voigt (1971), mit anderer Nummerierung (test. 194–264). – Diese poetische Vielseitigkeit könnte vielleicht ein Grund dafür sein, warum Sappho von allen frühgriechischen Dichtern in der attischen Symposionskeramik am häufigsten (mit Namensbeischrift) dargestellt wurde (das früheste überlieferte Beispiel ist eine Hydria in Six-Technik, 510–500 v. Chr., in Warszawa: Abb. 3). Vgl. Yatromanolakis (2007) 64 und passim, zu den damit verbundenen kulturhistorischen und medienspezifischen Interpretationsproblemen. S. auch unten, Anm. 60. – Spekulative Versuche, Sappho auf eine Chorlyrikerin (und pädagogisch orientierte Chorleiterin) zu reduzieren: z.B. Lardinois (1994); Calame (1996).
88
Renate Schlesier
Abb. 3: Attische Hydria des Sappho-Malers in Six-Technik: Sappho (mit Namensbeischrift) beim Barbitosspiel, 510–500 v. Chr. Warszawa, Nationalmuseum.
phos in Sizilien während ihres dortigen, historisch belegten mehrjährigen Exils36 erfahren wir nichts. Die Fülle der von ihr verwendeten oder erfundenen Versformen und poetischen Genres ist aber sogar in dem uns vorliegenden, so fragmentarischen Textmaterial unübersehbar, und technisch-musikalische Erfindungen wie die einer vielsaitigen, mit lydischen Instrumenten verwandten harfenartigen Leier (der Pektis37) oder
36 Ende des 7. oder Anfang des 6. Jh. v. Chr.: Sappho test. 5 (Marmor Parium); nach Eusebios (Sappho test. 6) war sie zu diesem Zeitpunkt bereits berühmt. 37 Sappho test. 38 (Ath., nach Menaichmos, um 300 v. Chr.); das Wort pektis bei Sappho: fr. 22,11; fr. 156,1; ‚New Sappho‘, neues Fragment, v. 7: Greene u. Skinner (2009) 10. Zur pektis als für lydische und archaisch-griechische Symposia charakterisch: Power (2010) passim. – Weitere Saiteninstrumente bei Sappho: lyra (fr. 103,9; vgl. 44,33; 208); Schildkröten-Leier (chelys/chelynna: fr. 58,12; 118,1); barbitos und baromos (fr. 176, s. auch Abb. 3).
Symposion, Kult und frühgriechische Dichtung: Sappho im Kontext
89
der mixolydischen Tonart sowie des Plektrons zum Zupfen der Lyra38 werden ihr ebenfalls zugeschrieben. Bezeichnend ist nun, dass der größte Teil der von Sappho überlieferten poetischen Kompositionen kaum andere generische Charakteristika aufweist als diejenigen der übrigen frühgriechischen Dichter von Archilochos bis Anakreon und Ibykos. Ein Ich als Sprecherrolle dominiert, und das Du richtet sich an unterschiedliche Götter oder Menschen. Auffällig ist allerdings, dass die Göttin Aphrodite bei Sappho, im Gegensatz zu den männlichen Lyrikern, die weitaus häufigste Adressatin ist, ja sogar zuweilen selbst in Sapphos Dichtungen als ein Ich inkorporiert ist, von dem die Persona der Dichterin namentlich angeredet wird39. Auf die von ihr unüberhörbar privilegierte Liebesgöttin folgen andere göttliche Adressaten wie die Chariten und die Musen erst mit großem Abstand. Die menschlichen Adressaten sind, wie bei den männlichen Dichtern, als Geliebte imaginiert, wenn es sich um preisende oder werbende Gesänge handelt, und auch, wenn Untreue beklagt wird, oder aber als Feinde und Konkurrentinnen, die namentlich oder anonym geschmäht werden. Gerade diese Schmähungen lassen sich jedoch, ebenso wenig wie bei den von männlichen Dichtern formulierten, keineswegs auf ein Modell privater Ranküne und Eifersucht reduzieren. Denn bei den Geschmähten handelt es sich hier wie dort oft um Angehörige gegnerischer politischer Fraktionen oder um Personen, deren Vorlieben gegen aristokratischen Lebensstil verstoßen. Ein besonders großer Anteil von Sapphos Dichtungen besteht in geradezu analytischen Reflexionen über die psychophysischen Auswirkungen, die von der Liebe und ihrer promiskuen Praxis erzeugt werden. Bei Sappho wird dies, mittels des für die frühgriechische Dichtung charakteristischen generischen Adverbs dhÛte, „schon wieder“40, als rekurrentes, immer neu auftretendes, emotional extrem aufwühlendes Phänomen dargestellt und in der 3. Person Singular dem Gott Eros als dem Agenten zugeordnet. Dafür sei hier nur das berühmteste und literarisch einflussreichste Beispiel zitiert, das vor allem die jüngeren Dichter Ibykos und Anakreon zu weiteren Variationen angeregt hat und das selbst eine gelehrte Anspielung auf das alte Epos enthält, in Form des verwendeten Kompositum lysimel‹«, „gliederlösend“, mit dem Homer den Schlaf, Hesiod aber ausdrücklich Eros charakterisiert hatte41:
38 Mixolydische Tonart: Sappho test. 37 (Pseudo-Plut., nach Aristoxenos, 4. Jh. v. Chr.); Plektron: Sappho test. 2 (Suda-Lexikon). 39 So bes. in Sappho fr. 1. Vgl. dazu Schlesier (2011a), sowie zu Aphrodite generell bei Sappho: Schlesier (2011b); (im Druck). 40 Liebe also „sub specie iterationis“, vgl. Snell (1946) 73. S. v.a. die gründliche Analyse von Mace (1993). 41 Schlaf lysimel‹«: Hom. Od. 20,57; 23,343. Eros: Hes. Th. 121 u. 911; vgl. pothos: Alkman, fr. 3(3) col. ii 61 PMG; Archil. fr. 196; Durst: Thgn. 838; die Formel „Eros schon wieder (dhÛte)“: schon bei Alkman, fr. 59a.
90
Renate Schlesier
fr. 130 [= Heph. Ench. 7,7] 5Ero« dhÛtw m’ ç lysimwlh« dfinei, glyk÷pikron $mˇxanon òrpeton· Eros schon wieder, der gliederlösende, treibt mich um, süß-bitteres42 unbezwingbares Kriechtier.
Bereits dieser skizzenhafte Überblick lässt erkennen, dass Sapphos melische Dichtung den thematischen Konventionen des Symposions nicht weniger entspricht als die ihrer männlichen Kollegen. Und ebenso wie bei diesen finden sich bei ihr zuweilen Konstruktionen einer Ich-Figur, die durchaus auch dem anderen Geschlecht angehören kann. Dafür hier ein Beispiel: fr. 129 b [= Ap. Dysc. Pron. 83 bc] ó tin’ ¡llon $nùrØpvn ömeùen f›lhisùa … oder irgendeinen anderen der Menschen als mich liebst du …
Wie steht es nun um die bis heute vorherrschende Hypothese, dass es sich bei den menschlichen Adressaten von Sapphos Dichtung um junge pubertierende Mädchen handelte, die sie vor ihrer Heirat und in Vorbereitung darauf als mehr oder weniger erotisch besetzte, mehr oder weniger kultisch funktionalisierte Erziehungsobjekte an sich band? Die Verfechter dieser biographistisch-spekulativen, heute meist pseudosozialhistorisch oder -kultgeschichtlich verbrämten Theorie haben in Sapphos Werk keinen Beleg dafür finden können. Wörter wie parthenos oder pais (weiblich) kommen tatsächlich niemals bei Sappho als weibliche Adressaten (im generischen Sinne von „junges Mädchen“) vor43. Im Übrigen ist aus der Antike bemerkenswerterweise an keiner Stelle überliefert, dass Sappho, wie etwa ihre männlichen Kollegen Alkman oder Anakreon und später Pindar, regelrechte chorische „Mädchenlieder“, Partheneia, komponiert hätte.
42 S. dazu Schlesier (1986/87). 43 Doch auch wenn dies der Fall wäre, würde dies nicht die anachronistische These von Sappho als Mädchen-Erzieherin belegen. Zur Anrede korai s. oben, Anm. 28; ob in fr. 58,11 der Ausdruck paÖde« eine Anrede darstellt (dies wäre dann der einzige Beleg für eine solche plurale Adressierung in Sapphos Werk), wie ausnahmslos in der Forschung postuliert wird, ist auch nach einer weiteren, ähnlich verstümmelten Überlieferung dieses Verses im neuen Kölner Sappho-Papyrus nicht sicher; vgl. Greene u. Skinner (2009) 11–12. – Als „Erziehende“ (paide÷oysa, von weiblichen Personen) wird Sappho nur in einem Papyrus-Kommentar aus dem 2. Jh. n. Chr. bezeichnet, fr. 214 B,8. Dass Sappho ‚Schülerinnen‘ (maù‹triai) gehabt hätte, basiert allein auf einer Angabe im byzantinischen Suda-Lexikon aus dem 10. Jh. (test. 2).
Symposion, Kult und frühgriechische Dichtung: Sappho im Kontext
91
Wenn Sapphos Lieder aber nicht junge Mädchen adressieren, wer waren dann ihre weiblichen Adressatinnen, und wenn sie keine offiziellen Polis-Chöre komponierte, wer gehörte dann zum bevorzugten Publikum ihrer Lieder? Ein einzeiliges Fragment gibt darauf eine deutliche, statusbezogene Antwort: fr. 160 [= Ath. 13, 571d] tˇde nÜn ãta›rai« taÏ« ömai« twrpna kˇlv« $e›sv dies jetzt für meine Gefährtinnen, das Freudige, werde ich auf schöne Weise singen
Der von Sappho verwendete Terminus ist die weibliche Form desjenigen, den auch die männlichen Dichter für ihre Gefährten beim Symposion, also einem nicht öffentlichen, meist auf die Innenräume von Privathäusern beschränkten Anlass, und bei anderen politisch-kulturell gemeinsamen Tätigkeiten verwenden: Yta›ra, ‚Gefährtin‘. Der entsprechende männliche Terminus, YtaÖro«, ist eine Statusbezeichnung im Rahmen eines Freundeskreises prinzipiell gleichgestellter, oft gleichaltriger Männer, was ausschließt, dass er für die beim Symposion meist ebenfalls anwesenden Jünglinge verwendet werden konnte. Diese sind potentielle oder tatsächliche homoerotische Liebesobjekte der erwachsenen YtaÖroi und werden als paÖ« (‚Knabe‘, ‚Jüngling‘) bezeichnet. Vor diesem Hintergrund hat Martin West vor mehr als dreißig Jahren den eventuell zentralen sozialen Ort von Sapphos Dichtung als eine ebensolche symposiastische Hetaireia wie bei den männlichen Dichtern charakterisiert: „a women’s society which was the mirror image of the men’s, with their own symposia and love affairs“44. Die meisten Interpreten sind ihm bisher darin nicht gefolgt, sondern blieben gebannt durch das Phantasma einer „schoolmistress“ Sappho. Daran hat auch die radikale Dekonstruktion dieses Philologen-Phantasmas durch Holt Parker im Jahre 199345 kaum etwas zu ändern vermocht, und ebensowenig seine zwölf Jahre später publizierte textnahe Rekonstruktion von Sapphos politischer „public world“46 und der dafür signifikanten, wohl oft gleichaltrigen YtaÖrai, die in ebensolche erotischen
44 West (1980) 38; dazu Parker (1993) 346: bei Sappho fänden sich zwar Indizien für „banquets“ von Frauen, nicht aber für „symposia as such“, denn letztere seien „exclusively male drinking parties“ (ein weitverbreiteter Irrtum). Für Lardinois (1994) 78 wiederum kann Sappho kein „sympotic poet“ sein, da sie in ihre Dichtung nur junge Mädchen einbezöge (seine Altersangabe – „twelve to eighteen years old“, ebd. 57, n. 4 – läßt sich aber durch die Verwendung der Ausdrücke kora/korai, parthenos/ parthenoi und pais/paides in der antiken Literatur nicht stützen), angeblich immer bei „public performances“ (ebd. 57 passim); Belege dafür sind indessen selten. – Zu Parallelen zwischen Sapphos poetischen Aussagen und denen des Alkaios sowie späterer Symposionsdichter wie Anakreon s. West (1970); zur Präsenz von Frauen – nicht allein Sklavinnen, sondern oft freien und musisch-literarisch gebildeten Hetären – gemeinsam mit Männern bei Symposia s. z.B. Murray (2009) 518–519. Vgl. unten, Anm. 50 und 51. 45 Parker (1993) stützt sich dabei nicht zuletzt auf Page (1955) 111–112 und Lefkowitz (1973). 46 Parker (2005).
92
Renate Schlesier
und politischen Wirrungen verstrickt sind wie das Ich der dichterischen Sprecherin und ebenso wie dieses sich dem Singen und Saitenspiel widmen. Vielleicht ist es jedoch möglich, auf dem von diesen Autoren eingeschlagenen Weg noch einen Schritt weiterzugehen und zum einen die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, dass in Sapphos Lyrik diese YtaÖrai durchaus in reziproke homoerotische Liebesaffären eingebunden sind, die – anders als offenbar im Falle der symposiastischen YtaÖroi und ihrer männlichen Geliebten – das eromenos/erastes-Modell nicht zu respektieren scheinen: Dabei mögen sie zwar die Rolle der männlichen paÖde« (der eromenoi) übernehmen, unterminieren diese Rolle aber, da sie zugleich ebenso als erastai, analog zu den erwachsenen YtaÖroi, agieren können. Zum anderen aber soll der in der bisherigen Forschung konstant vernachlässigten47 Tatsache nachgegangen werden, dass in solchen Dichtungen Sapphos durchaus auch Männer als Adressaten markiert sind (so wie die männlichen Dichter im erotischen Ambiente des Symposions auch Frauen adressieren, dabei aber meist ihre Zurückweisung beklagen und mit rhetorischen Mitteln ins Gegenteil zu verkehren suchen). Hier ein Beispiel aus Sapphos Dichtung für die Anrede eines „Freundes“ (f›lo«) – im Symposionskontext oft ein Synonym für YtaÖro« – durch eine selbstbewusste Frau: fr. 121 [= Stob. Ecl. 4.2.112] $ll’ övn f›lo« ¡mmi lwxo« ¡rnyso neØteron· o\ g@r tlˇsom’ ögv syno›khn öoisa geraitwra Doch bist du ein Freund für uns, das Bett gewinne dir einer Jüngeren. Denn nicht ertragen werde ich, beim Beiwohnen zu sein die Ältere.
Der spätantike Autor Stobaios, der dieses Fragment im 5. Jahrhundert n. Chr. überliefert, verwendet es kontextlos als Beleg für die von ihm unterstützte lebenspraktische Auffassung, dass man bei der Heirat das Alter der Brautleute berücksichtigen sollte. Daraus folgt jedoch nicht, wie viele moderne Gelehrte ihren Erwartungen entsprechend vermutet haben, dass dies auch von Sappho ernsthaft so gemeint gewesen sein müsste. Zu den Hochzeitsliedern kann das Gedicht jedenfalls nicht gerechnet werden. Vielmehr klingt der Wortlaut verdächtig nach einer Anspielung auf das berühmtberüchtigte, sexuell höchst explizite Gedicht des Archilochos (fr. 196a), dessen Ent-
47 Eine Ausnahme: West (1970) 329, zu den beiden im Folgenden von mir zitierten Beispielen (Sappho fr. 121 u. 138), im Vergleich mit fr. 137 (nach Aristot. rhet. 1, 1367a: Dialog zwischen Alkaios und Sappho). West sieht hier keinen Symposionszusammenhang; er vermutet für fr. 121 einen narrativen Kontext („reported speech“) oder eine „dramatic monody“; bei fr. 138 hält er es für möglich, dass „a brother“ angeredet wurde, oder ein Bräutigam, denn: Sapphos „dominant feelings were homosexual“.
Symposion, Kult und frühgriechische Dichtung: Sappho im Kontext
93
deckung auf einem Kölner Papyrus in den siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts viel Staub unter den Gelehrten aufgewirbelt hat. Sapphos Formulierungen wirken so, als würde hier die bis heute bekanntlich sehr weit verbreitete männliche Vorliebe für jüngere Frauen ironisch als freiwillige Einsicht älterer Frauen dargestellt, von der ein Mann erst überzeugt werden müsste. Oder vielleicht poetisch noch spezifischer: als ginge es hier um eine sarkastische Unterminierung der von Archilochos dargestellten Situation, bei der das männliche Ich, um die jüngere von zwei Frauen als Sexpartnerin zu gewinnen, die ältere als mannstoll (mainolis) denunziert48. Trifft dies zu, so wäre dieses Fragment ein weiteres Beispiel bei Sappho für eine parodistische Abweisung oder Ironisierung von Männern durch Frauen innerhalb eines poetisch umspielten, auch heterosexuell freizügigen Ambientes. Denn ein anderes vergleichbares Fragment wurde von Athenaios überliefert, einem Vertreter der Zweiten Sophistik des 2. bis 3. Jahrhunderts n. Chr. und Verfasser des ‚Gelehrtenmahls‘, bekanntlich eine Fundgrube mit einer Fülle von Zitaten aus ansonsten verlorenen Werken antiker Dichter. Er scheint die folgenden von ihm zitierten, wiederum an einen männlichen „Freund“ gerichteten Verse Sapphos als Ausdruck übertriebener Bewunderung, also erotisch konnotierter Verspottung eines Mannes zu deuten: fr. 138 [= Ath. 13, 564d] st»ùi †k¡nta† f›lo« kaÏ t@n ãp’ òssois’ çmpwtason xˇrin49 steh still frontal, Freund, auch den Reiz in den Augen verbreite
Was für ein antiker kultureller Kontext wäre nun denkbar, bei dem einzelne Frauen einzelne Männer, die mit ihnen in einer Situation des Liebesspiels verbunden sind, auf eine solche Weise poetisch anreden und gar verspotten? Wohl eher nicht das eheliche Schlafgemach, sondern kaum etwas anderes als das Symposion50, bei dem ja keineswegs die erwachsenen Männer mit den jünglingshaften paÖde« unter sich wa-
48 Archil. fr. 196a,30 West (1989). – Auf dieses Archilochos-Gedicht hat Sappho wohl auch in ihrem einzigen vollständig erhaltenen Gedicht (fr. 1,18) subversiv reagiert, indem sie sich Archilochos’ denunziatorisch verwendetes Adjektiv mainolis auf demonstrative Weise positiv zu eigen machte; vgl. dazu Schlesier (2011a) 426. 49 MacLachlan (1993) 65 verweist darauf, dass charis hier von Sappho als etwas Körperliches konzipiert ist. 50 S. dazu oben, Anm. 44. – Bisher wurde in der Forschung meist geradezu axiomatisch postuliert, dass Sapphos Dichtung nicht das Geringste mit der Institution des Symposions zu tun gehabt haben könnte. Selten jedoch wurde so deutlich ausgesprochen, auf welcher petitio principii – im Dienst einer prüden ‚Ehrenrettung‘ – dies basiert, wie von Nagy (2007) 225: „only women of questionable character could be imagined as attending [a symposium]. So a sympotic role for Sappho could not have been performed by Sappho even in the time of Sappho.“
94
Renate Schlesier
ren, sondern auch Musikerinnen und nicht zuletzt unverheiratete luxuriöse Frauen, Hetären51, zur genussvollen elitären Gemeinschaft gehörten. Wobei die letzteren, nach dem Zeugnis der frühgriechischen Dichter, ein großes Selbstbewusstsein an den Tag legten und zum Verdruss ihrer Verehrer bei der Gewährung der Gunst ihrer Partnerschaft sehr wählerisch sein konnten, besonders dann, wenn sie reich und von vielen begehrt waren. Je nach Laune konnten sie männlichen Liebhabern auch eine beim Symposion anwesende Frau vorziehen: Anakreon (fr. 358 PMG) hat dies bezeichnenderweise gerade an einer aus Lesbos stammenden und besonders eleganten jungen Frau exemplifiziert. Der in Analogie zum männlichen Wort YtaÖro« gebildete Terminus Yta›ra als euphemistische Bezeichnung für eine Kurtisane fehlt in der frühgriechischen Lyrik noch, obwohl die später mit diesem Wort eindeutig qualifizierten Akteurinnen die Kompositionen der männlichen Dichter bevölkern, und auch, wie ich vermute, zumindest in den beiden eben zitierten Sappho-Fragmenten agieren – und zwar als IchFiktion. Nun scheint es mir signifikant zu sein, dass das Wort Yta›ra als Terminus technicus für eine reiche Kurtisane an der ersten Stelle, an der er in der antiken Überlieferung belegt ist, in Herodots Historien (Hdt. 2,134–135), ausgerechnet in einem narrativen Zusammenhang mit Sappho verwendet wird. Herodot erzählt dort von der aus Thrakien gebürtigen Yta›ra Rhodopis, die, wie der Historiker betont, zwar tatsächlich eine überaus reiche Frau gewesen war, jedoch nicht, wie einige behauptet hatten, sich in Ägypten eine Pyramide bauen ließ, sondern nur, immerhin, ein Zehntel ihres Vermögens dem Apollon in Delphi in Gestalt von riesigen Bratspießen (çbelo›, den Vorläufern des späteren Münzgeldes) gestiftet habe, die Herodot selbst noch dort vorfand. Über den Verlauf ihrer Hetären-Karriere, nachdem sie, die Mitsklavin des Fabeldichters Äsop, von einem samischen Besitzer zu einem anderen übergewechselt war, berichtet der Historiker wie folgt: ^Rodâpi« dÍ ã« Aúgypton $p›keto Jˇnùev toÜ Sam›oy kom›santfi« [min], $pikomwnh dÍ kat’ ãrgas›hn ãl÷ùh xrhmˇtvn megˇlvn ÉpÌ $ndrÌ« Mytilhna›oy Xarˇjoy toÜ Skamandrvn÷moy paidfi«, $delfeoÜ dÍ SapfoÜ« tá« moysopoioÜ. Oœtv dÎ Ł ^Rodâpi« ãleyùerØùh kaÏ katwmeinw te ãn Aåg÷pt8 kaÏ kˇrta ãpafrfidito« genomwnh megˇla ãkt‹sato xr‹mata (Hdt. 2,135,1) Rhodopis aber kam nach Ägypten mit dem Xanthos von Samos, der sie dorthin brachte, um Geld mit ihr zu verdienen, dann aber wurde sie für eine gewaltige Summe losgekauft von einem Mann aus Mytilene, Charaxos, dem Sohn des Skamandronymos, und das war der Bruder der Sappho, der Dichterin. So wurde Rhodopis frei, blieb aber in Ägypten und war dort sehr begehrt wegen ihrer Reize und erwarb sich großes Vermögen. (Übersetzung: Walter Marg)
51 Vgl. dazu z.B. Calame (1989). Dieser Typus der Hetäre wird heute oft als eine bloße Konstruktion elitärer antiker Männerphantasie aufgefasst; repräsentativ dafür: Kurke (1997); contra: Davidson (2006); Faraone (2006).
Symposion, Kult und frühgriechische Dichtung: Sappho im Kontext
95
Athenaios (13, 596c–d52) merkte dazu später kritisch an, dass Herodot hier wohl zwei berühmte Hetären miteinander verwechselt hat, und dass die von Sapphos Bruder Charaxos geliebte Hetäre nicht Rhodopis, sondern Doricha hieß53. Wie dem auch sein mag, sicher scheint jedenfalls, dass Doricha von Sappho geschmäht wurde und die Dichterin für ihre Verwünschungen der Hetäre auch die Göttin Aphrodite höchstpersönlich als Verbündete in Anspruch nahm54, allerdings ohne dass aus den Fragmenten hervorgeht, ob dies wegen einer der Doricha zugute gekommenen Verschwendungssucht ihres Bruders geschah. Auffällig ist, dass die Schmähungen der Doricha denjenigen ähneln, die an andere von Sappho benannte Frauen gerichtet waren, darunter zum Beispiel eine gewisse Gorgo55 und ihre ‚Partnerin‘ (s÷nzyj) Archeanassa56 alias Pleistodika, wobei die erstere als professionelle Rivalin der Dichterin (so Maximos Tyrios, Or. 18,9: $nt›texno«) und die beiden letztgenannten Namen bisher meist als Verweis auf feindliche aristokratische Familien auf Lesbos gedeutet wurden. Der Name Archeanassa, wörtlich: ‚die Ursprungsherrin‘ oder ‚die herrscherliche Herrin‘, wäre nun allerdings als pleonastischer ‚nom-de-guerre‘ für eine Domina tatsächlich gut geeignet. Und so überrascht es nicht, dass dieser Name bei späteren Autoren als Hetärenname wiederbegegnet, und zwar pikanterweise ausgerechnet für eine Konkubine des Philosophen Platon57.
52 Sappho test. 15. – Lidov (2002)) plädiert dafür, Herodots Rhodopis-Anekdote als einen Rekurs auf die attische Komödie zu verstehen; er verweist zu Recht auf das Fehlen eines Belegs dafür, dass Sappho ihren Bruder in einem Gedicht getadelt habe, wie Herodot (2,135,6) behauptet (das oft herangezogene fr. 5 belegt dies jedenfalls nicht). Gegen Lidovs Komödien-These: Yatromanolakis (2007) 312–337; er nimmt stattdessen an, dass Rhodopis’ Ruhm Symposionsthema war („Rhodopis“ ist als Hetären-Name auf attischen Vasen des frühen 5. Jh. bezeugt, ebd. 322–323). Vgl. auch das (evtl. aus einer Komödie stammende) Sprichwort ´panù’ ƒmoia kaÏ ^Rodâpi« Ł kal‹ (fr. 489 PCG VIII Kassel-Austin), „alles [ist] gleich, auch Rhodopis, die Schöne“, das in zahlreichen antiken Lexika zitiert wurde. 53 Campbell (1982) 15 n. 1 vermutet, dass Rhodopis, wörtlich: ‚Rosengesicht‘, Dorichas „professional name or a nickname“ war; vgl. Page (1955) 49 n. 1. Doch auch das Umgekehrte wäre möglich, s. Yatromanolakis (2007) 334. – Rhodopis: evtl. auch Verweis auf das Rhodope-Gebirge in Thrakien (nach Herodot Herkunftsland dieser Hetäre). 54 Dies ist explizit jedoch nur in Sappho fr. 15,9 der Fall, wo (im Vers 11) auch der Name Doricha überliefert zu sein scheint; in fr. 7,1 ist die Lesung des Namens unsicher. Zu diesem und anderen weiblichen Eigennamen in Sappphos Lyrik s. jetzt Schlesier (2013).– Das bei Athenaios (Sappho test. 15) zitierte Epigramm des Poseidippos (3. Jh. v. Chr.) auf Doricha erwähnt ein „liebes Lied“ (f›lh èid‹) der Sappho: also keine Schmähung – falls nicht, wie Yatromanolakis (2007) 327 n. 185 mit Wilamowitz annimmt, ironisch gemeint. 55 Gorgo (Partnerin der Archeanassa): Sappho fr. 213; vgl. fr. 29(a),9; fr. 144; test. 20 (Maximos Tyrios). 56 Archeanassa (Partnerin der Gorgo): Sappho fr. 213; s. auch fr. 103C(a),4 (Kontext unbestimmt). Archeanaktiden (als Adelsgeschlecht auf Lesbos?): Alkaios fr. 112,24; vgl. aber auch Archilochos fr. 122,10 West (1989). 57 Athenaios 13,589c; Archeanassa: Name einer (gealterten) Hetäre (aus Kolophon) in der Anthologia Graeca 7,217 (Asklepiades, 3. Jh. v. Chr.); nach Diogenes Laertios 3,31 hat Platon dieses Epitaph auf seine Geliebte selbst verfasst.
96
Renate Schlesier
Sollte Archeanassa etwa wie Doricha schon bei Sappho eine Hetäre bezeichnen? Und könnte Sapphos Dichtung vielleicht eher die kulturelle Erfahrungs- und Imaginationswelt von reichen, gebildeten und auch musisch virtuosen Hetären zum Hintergrund haben, die miteinander in rivalisierenden Beziehungen standen, aber auch homoerotischen58 (wie dies etwa Anakreon, fr. 358 PMG, nahezulegen scheint)? Und ist es ein Zufall, dass – noch bevor Anakreon in Athen starb – in der attischen Symposionskeramik Hetären-Symposia auftauchen (Abb. 4a–b)59? Nachdem die moderne Forschung so lange das Phantasma gepflegt hat von Sapphos Kreis jungfräulicher Mädchen, die sie verlassen, um angeblich in andere Mädchen-Schulen überzuwechseln oder auswärts Ehen einzugehen, in denen sie mit ihrer erotisch-musischen Expertise dann wenig anfangen können, ist vielleicht ein Gedankenexperiment erlaubt, das zumindest den Vorteil hätte, mehr mit spezifisch antiken historischen Fakten zu tun zu haben als mit modernen romantischen oder gutbürgerlich-moralischen Projektionen. Ganz knapp und zugespitzt sei dies an drei besonders vieldiskutierten, relativ gut erhaltenen und etwas umfangreicheren Sappho-Texten demonstriert:
58 Der Ausdruck für Frauen, die eher von Frauen erotisch angezogen werden, lautet in Platons Symposion (191e) Ytair›striai (frühester Beleg des Terminus). Homoerotische Beziehungen von Hetären werden explizit erst im 5. von Lukians Hetärengesprächen thematisiert (okkasionelles ‚ménage à trois‘ zwischen der Hetäre Leaina, der reichen ‚männlichen‘ Megilla aus Lesbos und deren ebenfalls reicher Freundin Demonassa aus Korinth); vgl. dazu Gilhuly (2006), die jedoch mit keinem Wort auf eventuelle Anspielungen Lukians auf Sappho, die berühmteste antike ‚Lesbierin‘, eingeht, und nur Verweise auf die philosophische und die Komödien-Tradition behandelt. – Ein mögliches Indiz für (auch poetische) Bildung und Homoerotik von reichen Hetären in der Archaik: die (metrisch komplexe) Inschrift (mit Hetärennamen) auf einem im sizilischen Selinunt gefundenen Salbgefäß aus Alabaster (um 700 v. Chr.) mit korinthischer Schrift: „Oinantha hat mich und eine Tänie der Myrticha geschenkt.“ S. dazu Powell (1991) 138–139; diese und weitere Inschriften aus dem 8./7. Jh. (ein Webstuhlgewicht aus Attika mit Abecedarium a-o; ein proto-korinthischer Aryballos aus Cumae mit Fluchinschrift in Iamben – vgl. den ‚Nestorbecher‘ –: „Ich bin die Lekythos der Tataie. Wer immer mich stiehlt, wird blind.“) bezeugen frühe Schrift-Verbreitung auch unter Frauen; vgl. Pfohl (1969) 15, 20, 24; zu „Tataie“: Jeffery (1961/1989) 45, 238, Taf. 47.3; Powell (1991) 166–167. 59 Zu Hetären-Symposia vgl. Peschel (1987) 70–74 u. 110–112; Reinsberg (1989) 112–114; s. auch Frel (1996) und Faraone (2006) 213–216. – Ein frühes Beispiel (auch für deren hetero- wie homosexuelle Implikationen) aus der attischen Vasenmalerei ist ein mit mehreren Inschriften versehener, rotfiguriger Psykter in St. Petersburg (um 505 v. Chr.), den der Maler Euphronios signiert hat (Abb. 4a–b): Eine der vier dargestellten nackt lagernden Hetären (mit Namen „Smikra“) widmet beim Kottabos-Spiel die Neige des Weins dem sonst sehr häufig mit (homoerotischen) Lieblingsinschriften bedachten Jüngling „Leagros“ und wendet Blick und Haltung dabei demonstrativ dem Unterleib ihrer trinkenden und mit einem Diadem geschmückten, muskulösen Nachbarin „Palaisto“ zu; eine weitere Hetäre (mit Namen „Agapa“) reicht der „Sekline“ genannten Doppelaulos-Spielerin einen Skyphos. Diese Andeutung weiblicher Homoerotik beim Symposion blieb bisher m. W. in der Forschung unbeachtet. Cantarella (1992) 86–88 hat (als erste und einzige bisher?) die Möglichkeit reflektiert, dass sich Hetären beim Symposion ineinander verlieben konnten; dagegen Parker (1993) 342–343 n. 85, demzufolge dies nicht bildlich bezeugt sei und der, wie viele andere Forscher, Anakreon fr. 358 PMG nicht als Beleg dafür ansieht. S. auch unten, Anm. 60.
Symposion, Kult und frühgriechische Dichtung: Sappho im Kontext
97
Abb. 4a: Attisch-rotfiguriger Psykter, signiert vom Maler Euphronios: Symposion von vier Hetären (mit Widmungsinschrift, zugeordnet zu Hetäre „Smikra“, beim Kottabos-Spiel: „Dir schleudere ich dies, Leagros“), um 505 v. Chr. St. Petersburg, Hermitage.
Abb. 4b: Attisch-rotfiguriger Psykter, signiert vom Maler Euphronios: Symposion von vier Hetären (Detail: „Smikra“ und „Palaisto“), um 505 v. Chr. St. Petersburg, Hermitage.
98
Renate Schlesier
Handelt es sich etwa bei der einem „göttergleichen Mann“ gegenübersitzenden namenlosen Frau, die im wohl berühmtesten, durch Catulls Kontrafaktur (carm. 51) und durch Pseudo-Longins Schrift Über das Erhabene bekannten, Fragment Sapphos (fr. 31) die liebende lyrische Persona in eine den Rand des Todes streifende psychophysische Erschütterung versetzt, eventuell um eine besonders attraktive Hetäre im Ambiente eines Symposions? Ist, in einer anderen Dreierkonstellation, diesmal einer ausschließlich weiblichen, die namenlose Heldin eines längeren Pergament-Fragments (fr. 96), die früher auf Lesbos zu den Gefährtinnen der dichterischen Ich-Figur gehörte und auch von deren am häufigsten erwähnter Freundin Atthis geliebt worden war, nun aber unter den „Frauen“ (gynaÖke«) der lydischen Hauptstadt Sardes wie der Mond unter Sternen glänzt, vielleicht ebenso als eine Hetäre vorzustellen, die ähnlich wie Rhodopis/Doricha einen lukrativen Ortswechsel vorgenommen hat? Und wie steht es um die namenlose Frau aus einem weiteren, nicht weniger oft interpretierten Pergament-Fragment (fr. 94), die unter Tränen gezwungen ist, das SprecherIch zu verlassen, das von ihr als „Sappho“ angeredet wird? Diese „Sappho“ vermittelt ihr daraufhin eine programmatisch-tröstliche Reminiszenz an die Befriedigung von erotischem Verlangen auf weichen Betten, und zwar im Kontext anderer empfohlener Erinnerungen an weitere luxuriöse – darunter auch kultische –, meist symposiastische Genüsse 60. Ist sie eventuell ebenfalls als eine Hetäre anzusehen, jedoch eher
60 Vgl. auch Sappho fr. 2; zum dortigen (von Aphrodite selbst dominierten) symposiastischen Ambiente sowie zu Verweisen auf „past convivial activity“ in Sappho fr. 94 und fr. 96: Carey (2009) 35 mit n. 59. S. auch das Wort symposion als Lesart in Sappho fr. 213A(d),5, einem antiken Sappho-Kommentar; die Erfindung der für das Symposion konstitutiven Handlung, des Wein-Mischens, hat Sappho offenbar in einem Gedicht behandelt (und dem Acheloos zugeschrieben), fr. 212. Zur Häufigkeit von Termini für Symposionsgefäße in Sappho-Fragmenten vgl. Schlesier (im Druck). Bisher wurden jedoch in der Forschung allenfalls Parallelen zwischen Gelagen in Sapphos Dichtung und dem (angeblich auf Männer beschränkten) „homosexual male symposium“ gesehen: z.B. Fisher (1988) 1176; vgl. oben, Anm. 44. – Die früheste Sappho-Überlieferung („ich verlange und ich ersehne“, eine Variation von fr. 36) findet sich auf einer rotfigurigen attischen Amphora des Euphronios im Louvre (um 510 v. Chr., Abb. 5a–b), als Gesangstext eines jugendlichen lagernden Lyraspielers (der selbst evtl. Adressat des Kottabos-Wurfs des auf der anderen Gefäßseite dargestellten Jünglings ist), mit der (doppelten, jedem der beiden Symposiasten extra beigeordneten) Lieblingsinschrift „Leagros kalos“; vgl. Yatromanolakis (2001) 166. Die erastes/eromenos-Dichotomie scheint in diesem Bildwerk ebenso wenig respektiert zu sein wie in Sapphos Lyrik. Ein anderes Symposionsgefäß desselben Malers verbindet (in ähnlich subversiver Weise) die bildliche Darstellung des homoerotischen Interesses einer Hetäre mit dem Text eines hier heterosexuell konnotierten, aber sonst mit männlicher Homoerotik verbundenen KottabosSpruchs; s. dazu Anm. 59, mit Abb. 4 a–b. Zur Innovationskraft des Euphronios, im politisch-kulturellen Kontext Athens der 2. Hälfte des 6. Jhs., nicht zuletzt des aristokratischen Symposions und der dabei vorgetragenen Dichtung: s. Giuliani (1991) v.a. 16–18. Vortrag von Sappho-Lyrik in Athener Symposia des frühen 6. Jhs.: einer Solon-Anekdote zufolge (test. 10: Aelian, 3. Jh. n. Chr., via Stobaios), deren historischer Wert allerdings von vielen Forschern angezweifelt wird; vgl. dazu quellenkritisch Yatromanolakis (2007) 85–88. Eine „sympotic appropriation“ der Dichterin Sappho wäre erst im Athen des frühen 5. Jhs. zu finden (ebd. 164 und passim), und der kulturelle Kontext sei ausschließlich bestimmt durch „spaces of male self-defining and reflexive gatherings“ (so die konventionell-reduk-
Symposion, Kult und frühgriechische Dichtung: Sappho im Kontext
99
eine noch unselbständige, die gezwungen ist, ihrem Besitzer und Kuppler nach auswärts zu folgen, wie die Rhodopis bei Herodot in den Frühstadien ihrer Karriere? Mir jedenfalls scheint eine solche Hypothese kulturgeschichtlich wie poetologisch61 weitaus plausibler zu sein, als die sich weiterhin unter Philologen, einschließlich der Feministinnen unter ihnen, hartnäckig haltende und dem archaischen Lesbos implementierte philiströse Vorstellung eines viktorianisch wirkenden Mädchenpensionats mit etwas lockeren Sitten und religiös oder reformpädagogisch idealisierter sexueller Belästigung von Teenagern. Halbwüchsige Mädchen jedenfalls können kaum die Hauptakteurinnen des aus der Levante importierten Adonis-Kults gebildet haben, eher schon erfahrene und gesellschaftlich relativ unabhängige Frauen, wie es etwa reiche, luxuriöse Hetären waren, die diesen Kult auch später offenbar mit besonderer Vorliebe zelebrierten. Dass Helena, die nicht nur für ihre sprichwörtliche Schönheit, sondern auch für ihre unkonventionelle Sexualpraxis (die Bigamie, ja Trigamie, also Polyandrie einschloss) bekannteste Frauenfigur der Antike, von Sappho in einem weiteren vieldiskutierten Papyrusfragment (fr. 16)62 gerade deshalb gefeiert wird, weil sie zugunsten des schönen jungen Mannes, den sie liebte, ihren Gatten verlassen hat, wäre in diesem Zusammenhang nicht weniger signifikant als die Tatsache, dass Sappho, analog dazu, immer wieder Göttinnen gepriesen hat, die sich sterbliche Jünglinge als Liebespartner wählten: nicht allein Aphrodite mit Adonis, sondern auch Selene mit Endymion oder Eos mit Tithonos. Lassen sich die Imaginationen einer Sappho als Liebhaberin und Geliebte mehrerer Männer oder gar als publica63 (‚Prostituierte‘) bei manchen späteren antiken Au-
tionistische Umschreibung von Symposion und Komos); die poetisch wie bildlich seit dem 6. Jh. v. Chr. belegte Präsenz von Hetären (analog zu und oft gemeinsam mit männlichen Symposiasten) berücksichtigt er hierbei allerdings ebenso wenig wie die Symposionsthematik bei Sappho oder das SapphoZitat auf der Pariser Euphronios-Amphora (s. oben). 61 Zur poetologischen Qualität des kulturgeschichtlichen Kontextes bei Sappho vgl. Rudolph (2009). 62 Vgl. Sappho fr. 23,5: die adressierte Frau wird mit Helena verglichen (wie Anaktoria in fr. 16). – Zur Möglichkeit, dass die poetisch-philosophische Form der Priamel, für die Sappho fr. 16 einer der frühesten Belege ist, aus dem für Symposia charakteristischen Spiel mit sprachlichen Übertrumpfungen entstanden ist, vgl. Powell (1991) 176 n. 140. 63 Publica: so der alexandrinische Grammatiker Didymos (1. Jh. v. Chr.), nach Seneca (der dies zurückweist): Sappho test. 22; s. dazu Most (1996) 15, 32, 35: die Komödiendichter hätten eine heterosexuell promiskue Sappho nicht frei erfinden können; vgl. Yatromanolakis (2007) 312 und passim, der zu bedenken gibt, dass es dafür keine direkten Textzeugnisse gibt. S. aber die Elegie des Hermesianax (fr. 7,47–56 Powell, 3. Jh. v. Chr.): Innerhalb eines langen Liebesaffären-Katalogs werden als Sapphos Liebhaber die Dichter Alkaios und Anakreon präsentiert; bei Athenaios (13, 599c), dem dieses umfangreiche Zitat zu verdanken ist, wird nur im Falle von Anakreon die Möglichkeit einer Liebesaffäre mit Sappho angezweifelt, und zwar aus chronologischen Gründen, da die Dichterin bedeutend älter gewesen sei (im Unterschied zu Alkaios, der mit ihr etwa gleichaltrig war). – Vgl. auch Tatian, Or. ad Gr. 33 (2. Jh. n. Chr.): Statue der Yta›ra Sappho von dem Bildhauer Silanion (4. Jh. v. Chr.); nach Cicero (Sappho test. 24) war diese Skulptur (mit einem griechischen Epigramm als Basis-Inschrift) in Syrakus aufgestellt.
100
Renate Schlesier
Abb. 5a: Attisch-rotfigurige Strickhenkelamphora des Euphronios, Seite B, Halsfries: Lyraspieler (mit Textvariante von Sappho fr. 36: „ich verlange und ich ersehne“, sowie Lieblingsinschrift: „Leagros kalos“), um 510 v. Chr. Paris, Musée du Louvre.
toren nur als böswillige Verleumdungen oder als komische Unwahrscheinlichkeiten verstehen, und wie sind die ebenfalls schon antiken Ehrenrettungsversuche derer zu werten, die sich bemüßigt fühlten, neben der Dichterin Sappho eine zweite mit demselben Namen zu erfinden, die „eine Hetäre, aber keine Dichterin“ war64? In Athenaios’ ‚Gelehrtensymposion‘ (13,596e) jedenfalls wird der Dichterin Sappho
64 „Ich höre, daß auf Lesbos auch eine andere Sappho war, eine Hetäre, keine Dichterin“ (pynùˇnomai dÍ ƒti kaÏ Ytwra ãn tÕ Lwsb8 ãgwneto SapfØ, Yta›ra, o\ poi‹tria): so Aelian, V. H. 12.19 = Sappho test. 4; vgl. test. 3 (Suda-Lexikon). – Zum Problem vgl. Faraone (2006) 210: „many or most of the small number of female poets from ancient Greece may in fact have been courtesans“; dass Sappho ebenfalls in diese Kategorie gehört, bezeichnet Faraone ebd. jedoch als „amazingly wrongheaded idea circulating during Roman times“; s. auch ebd. 217–218: „it seems obvious, unless proven otherwise, that the symposium was the site for Sappho’s performances as well. And since most female performers in this context were either slaves or courtesans, it is quite reasonable that Greeks in the later periods – presumably those who had not taken the time to read Sappho’s poems carefully – might assume that she, too, was a courtesan.“ Und wenn dies doch gerade die gründlichen Leser waren? Mir scheint jedenfalls (ganz unabhängig von biographischen Spekulationen) am ehesten wahrscheinlich zu sein, dass Sappho, unter den ihre Dichtung unverkennbar dominierenden Auspizien der Aphrodite, sowohl die Ich-Persona als auch weibliche Adressaten ihrer Gedichte oft (vielleicht sogar vorwiegend) nach dem Modell einer (homo- wie heterosexuell konnotierten) Hetäre und musischen Künstlerin konzipiert hat, als deren performativer Wirkungsbereich gerade auch Symposia – mit oder ohne Männer – poetisch imaginiert sind.
Symposion, Kult und frühgriechische Dichtung: Sappho im Kontext
101
Abb. 5b: Attisch-rotfigurige Strickhenkelamphora des Euphronios, Seite A, Halsfries: Symposiast beim Kottabos-Spiel (mit Lieblingsinschrift: „pais Leagros kalos“), um 510 v. Chr. Paris, Musée du Louvre.
selbst, nicht ohne ein Augenzwinkern des Autors gegenüber seinen belesenen und wenig prüden Bankettgenossen, als Liebhaberin des jungen Phaon die Bezeichnung Yta›ra (die auch ein kultisches Epitheton der Aphrodite war65) wie ein Ehrenname verliehen66, kurz vor dem Ende der Aufzählung einer langen Reihe anderer legendär berühmter und erfolgreicher historischer Hetären. Phaon aber, so hieß es im Text zuvor (2,69d), war auch ein Geliebter der Aphrodite höchstpersönlich, nicht anders als Adonis. Athenaios dokumentiert in seinem Werk, dass Komödiendichter der klassi-
65 Vgl. dazu Athenaios 13, 571c und 573a. Zu Aphrodite als am kontinuierlichsten von Hetären verehrter Göttin s. z.B. Scheer (2009) 237–238; zum hetairos-ähnlichen sozialen Status der Hetären und zu Aphrodite Hetaira im Athen klassischer Zeit: Calame (1989). Phaon bei Sappho: vgl. die Testimonia in fr. 211. 66 Athenaios beruft sich hierfür auf den hellenistischen Historiker Nymphodoros aus dem sizilischen Syrakus. Das Skandalon der Hetäre Sappho ist jedoch in den modernen Athenaios-Ausgaben (13, 596e) durch eine emendierende Text-Ergänzung (Kaibel) entschärft; noch die aktuellste Edition (Olson 2011) übernimmt dies: kaÏ Ł ãj #Erwsoy dÍ tá« < poihtr›a« ÇmonØnymo« Kaibel > Yta›ra« Sapfø … Damit wird die (nicht vor der römischen Kaiserzeit nachweisbare) antike Erfindung einer ‚anderen‘ Sappho – die anders als ‚die Dichterin‘ eine Hetäre gewesen sei – kanonisiert; vgl. auch oben, Anm. 63 u. 64.
102
Renate Schlesier
schen und hellenistischen Zeit es sich nicht hatten nehmen lassen, Sappho in ihren Stücken einen Auftritt als Protagonistin zu verschaffen und sie dem Gespött des Theaterpublikums auszusetzen, wobei etwa ihre Dichterkollegen Archilochos und Hipponax zu ihren Liebhabern (erastai) gemacht wurden (13,599d, in Diphilos’ Sappho). Was davon im Hinblick auf Sapphos eigene Dichtung zu halten ist, brauchte Athenaios angesichts einer wohl noch unverstümmelten und allen Gebildeten schriftlich zugänglichen poetischen Tradition nicht genauer zu erläutern. Anders als für uns galt für ihn und seine Zeitgenossen: „Dem Wissenden ist es genug“, sapienti sat est (Plautus Persa 4,7, v. 729). Ob auf der Komödienbühne die so überaus berühmte, vielbewunderte und hochverehrte Liebesdichterin mit der unglücklich liebenden Liebesgöttin verschmolzen oder zu ihrer Konkurrentin stilisiert wurde (denn auch Komödien mit dem Titel Phaon sind bezeugt), wissen wir nicht. Aber eins ist sicher: Folgende Verszeile von Sappho, die wir der gewissenhaften Dokumentation eines besonders seltenen griechischen Wortes für ‚schlafen‘ durch einen antiken Lexikographen verdanken und die auch den Ausdruck Yta›ra enthält, war zu Lebzeiten der Dichterin wie in nachfolgenden Epochen zweifellos in mannigfaltigen performativen Kontexten einsetzbar, innerhalb wie außerhalb des Symposions, und konnte für alle möglichen Dus, männlichen wie weiblichen Geschlechts, gebraucht und auf alle möglichen weiblichen Ichs und Sies, nicht zuletzt aber auf Hetären, angewendet werden: fr. 126 [= Et. Mag. 250,10, nach Herodian] da÷oi« $pˇla« ãtˇra« ãn st‹ùesin mögst du schlafen an einer zarten Gefährtin Brust …
Literaturverzeichnis Bowie (1986): Ewen L. Bowie, „Early Greek Elegy, Symposium and Public Festival“, Journal of Hellenic Studies 106, 13–35. Budelmann (2009): Felix Budelmann, „Introducing Greek lyric“, in: Felix Budelmann (Hg.), The Cambridge Companion to Greek Lyric, Cambridge, 1–18. Calame (1977): Claude Calame, Les chœurs de jeunes filles en Grèce archaïque, 2 Bde., Roma. Calame (1989): „Entre rapports de parenté et relations civiques: Aphrodite l’hétaïre au banquet politique des hétairoi“, in: Françoise Thelamon (Hg.), Aux sources de la puissance: sociabilité et parenté, Rouen, 101–111. Calame (1996): Claude Calame, „Sappho’s Group: An Initiation into Womanhood“, in: Ellen Greene (Hg.), Reading Sappho. Contemporary Approaches, Berkeley u.a., 113–124. Calder (1986): William M. Calder III, „F. G. Welcker’s Sapphobild and its Reception in Wilamowitz“, in: William M. Calder u.a. (Hgg.), Friedrich Gottlieb Welcker. Werk und Wirkung, Stuttgart, 131–156. Campbell (1982): David A. Campbell (Hg.), Greek Lyric 1: Sappho. Alcaeus, Cambridge (Mass.) / London.
Symposion, Kult und frühgriechische Dichtung: Sappho im Kontext
103
Cantarella (1992): Eva Cantarella, Bisexuality in the Ancient World, New Haven / London [ital. Erstausgabe 1988]. Carey (2009): Chris Carey, „Genre, occasion and performance“, in: Felix Budelmann (Hg.), The Cambridge Companion to Greek Lyric, Cambridge, 21–38. Contiades-Tsitsoni (1990): Eleni Contiades-Tsitsoni, Hymenaios und Epithalamion. Das Hochzeitslied in der frühgriechischen Lyrik, Stuttgart. Davidson (2006): James Davidson, „Making a Spectacle of Her(self): The Greek Courtesan and the Art of the Present“, in: Martha Feldman u. Bonnie Gordon (Hgg.), The Courtesan’s Arts. CrossCultural Perspectives, Oxford, 29–51. Davies (1988): Malcolm Davies, „Monody, Choral Lyric, and the Tyranny of the Hand-Book“, Classical Quarterly 38, 52–64. Denoyelle (1994): Martine Denoyelle, Chefs-d’œuvre de la céramique grecque dans les collections du Louvre, Paris. Detienne (1972): Marcel Detienne, Les jardins d’Adonis. La mythologie des aromates en Grèce, Paris. Dougherty u. Kurke (1993): Carol Dougherty u. Leslie Kurke (Hgg.), Cultural Poetics in Archaic Greece. Cult, Performance, Politics, Cambridge. Faraone (1996): Christopher A. Faraone, „Taking the ‚Nestor’s Cup Inscription‘ Seriously: Erotic Magic and Conditional Curses in the Earliest Inscribed Hexameters“, Classical Antiquity 15, 77–112. Faraone (2006): Christopher A. Faraone, „The Masculine Arts of the Ancient Greek Courtesan: Male Fantasy or Female Self-representation?“, in: Martha Feldman u. Bonnie Gordon (Hgg.), The Courtesan’s Arts. Cross-Cultural Perspectives, Oxford, 209–220. Fehr (2003): Burkhard Fehr, „What has Dionysos to do with the symposion?“, Pallas 61, 23–37. Fisher (1988): Nicholas R. E. Fisher, „Greek Associations, Symposia, and Clubs“, in: Michael Grant u. Rachel Kitzinger (Hgg.), Civilization of the Ancient Mediterranean II, New York, 1167–1197. Ferrari (2010): Franco Ferrari, Sappho’s Gift. The Poet and Her Community, Ann Arbor [ital. Erstausgabe 2007]. Ford (2003): Andrew Ford, „From Letters to Literature: Reading the ‚Song Culture‘ of Classical Greece“, in: Harvey Yunis (Hg.), Written Texts and the Rise of Literate Culture in Ancient Greece, Cambridge, 15–37. Franklin (2008): John Curtis Franklin, „‚A Feast of Music‘: The Greco-Lydian Musical Movement on the Assyrian Periphery“, in: Billie Jean Collins u.a. (Hgg.), Anatolian Interfaces. Hittites, Greeks and Their Neighbours, Oxford, 191–201. Frel (1996): Jirí Frel, „La céramique et la splendeur des courtisanes“, Rivista di Archeologia 20, 38–53. Furtwängler (1909): Adolf Furtwängler, Griechische Vasenmalerei. Auswahl hervorragender Vasen Bd. II, München. Gentili (1984): Bruno Gentili, Poesia e pubblico nella Grecia antica, da Omero al V secolo, Rom. Gilhuly (2006): Kate Gilhuly, „The Phallic Lesbian: Philosophy, Comedy, and Social Inversion in Lucian’s Dialogues of the Courtesans“, in: Christopher A. Faraone u. Laura K. McClure (Hgg.), Prostitutes and Courtesans in the Ancient World, Madison / London, 274–291. Giuliani (1991): Luca Giuliani, „Euphronios: ein Maler im Wandel“, in: Giuliani u. Heilmeyer (1991) 14–25. Giuliani u. Heilmeyer (1991): Luca Giuliani u. Wolf-Dieter Heilmeyer (Hgg.), Euphronios der Maler. (Katalog zur Ausstellung des Antikenmuseums Berlin, 20. März – 26. Mai 1991), Mailand. Goldhill u. Osborne (1999): Simon Goldhill u. Robin Osborne (Hgg.), Performance Culture and Athenian Democracy, Cambridge. Greene u. Skinner (2009): Ellen Greene u. Marilyn B. Skinner (Hgg.), The New Sappho on Old Age. Textual and Philosophical Issues, Cambridge (Mass.) / London. Harvey (1955): A. E. Harvey, „The Classification of Greek Lyric Poetry“, Classical Quarterly 5, 157–175.
104
Renate Schlesier
Henrichs (2008): Albert Henrichs, „Dionysische Imaginationswelten: Wein, Tanz, Erotik“, in: Renate Schlesier u. Agnes Schwarzmaier (Hgg.), Dionysos – Verwandlung und Ekstase (Katalog zur Ausstellung im Pergamonmuseum Berlin, 2008–2010), Regensburg, 18–27. Herington (1985): John Herington, Poetry into Drama. Early Tragedy and the Greek Poetic Tradition, Berkeley u.a. Jeffery (1961/1989): Lillian H. Jeffery, The Local Scripts of Archaic Greece. A Study of the Origin of the Greek Alphabet and its Development from the Eigth to the Fifth Centuries B.C. (überarbeitet von A. W. Johnston 1989, 1. Auflage 1961), Oxford. Kurke (1992): Leslie Kurke, „The Politics of HABROSYNE in Archaic Greece“, Classical Antiquity 11, 91–120. Kurke (1997): Leslie Kurke, „Inventing the ‚Hetaira‘: Sex, Politics, and Discursive Conflict in Archaic Greece“, Classical Antiquity 16, 106–150. Lardinois (1994): André Lardinois, „Subject and Circumstance in Sappho’s Poetry“, Transactions of the American Philological Association 124, 57–84. Latacz (1990): Joachim Latacz, „Die Funktion des Symposions für die entstehende griechische Literatur“, in: Wolfgang Kullmann u. Michael Reichel (Hgg.), Der Übergang von der Mündlichkeit zur Literatur bei den Griechen, Tübingen, 227–264. Lefkowitz (1963): Mary R. Lefkowitz, „TO KAI EGO. The First Person in Pindar“, Harvard Studies in Classical Philology 67, 177–253. Lefkowitz (1973): Mary R. Lefkowitz, „Critical Stereotypes and the Poetry of Sappho“, Greek, Roman, and Byzantine Studies 14, 113–123. Lidov (2002): Joel B. Lidov, „Sappho, Herodotus, and the ‚Hetaira‘“, Classical Philology 97, 203–237. Lobel u. Page (1955): Edgar Lobel u. Denys Page (Hgg.), Poetarum Lesbiorum Fragmenta, Oxford. Mace (1993): Sarah T. Mace, „Amour, Encore! The Development of DEUTE in Archaic Lyric“, Greek, Roman, and Byzantine Studies 34, 335–364. MacLachlan (1993): Bonnie MacLachlan, The Age of Grace. Charis in Early Greek Poetry, Princeton. Merkelbach (1957): Reinhold Merkelbach, „Sappho und ihr Kreis“, Philologus 101, 1–29. Most (1996): Glenn W. Most, „Reflecting Sappho“, in: Ellen Greene (Hg.), Re-Reading Sappho. Reception and Transmission, Berkeley u.a., 11–35. Murray (2009): Oswyn Murray, „The Culture of the Symposion“, in: Kurt A. Raaflaub u. Hans van Wees (Hgg.), A Companion to Archaic Greece, Oxford, 508–523. Nagy (1990): Gregory Nagy, Pindar’s Homer. The Lyric Possession of an Epic Past, Baltimore. Nagy (1996): Gregory Nagy, Poetry and Performance. Homer and Beyond, Cambridge. Nagy (2007): Gregory Nagy, „Did Sappho and Alcaeus Ever Meet? Symmetries of Myth and Ritual in Performing the Songs of Ancient Lesbos“, in: Anton Bierl u.a. (Hgg.), Literatur und Religion 1: Wege zu einer mythisch-rituellen Poetik bei den Griechen, Berlin / New York, 211–269. Olson (2011): S. Douglas Olson (Hg.), Athenaeus. The Learned Banqueters VII: Books 13. 594b–14, Cambridge (Mass.) / London. Page (1955): Denys Page, Sappho and Alcaeus. An Introduction to the Study of Ancient Lesbian Poetry, Oxford. Page (1962): Denys Page (Hg.), Poetae Melici Graeci [= PMG], Oxford. Parker (1993): Holt N. Parker, „Sappho Schoolmistress“, Transactions of the American Philological Association 123, 309–351. Parker (2005): Holt N. Parker, „Sappho’s Public World“, in: Ellen Greene (Hg.), Women Poets in Ancient Greece and Rome, Norman, 3–24. Peschel (1987): Ingeborg Peschel, Die Hetäre bei Symposion und Komos in der attisch-rotfigurigen Vasenmalerei des 6.–4. Jahrh. v. Chr., Frankfurt am Main u.a.
Symposion, Kult und frühgriechische Dichtung: Sappho im Kontext
105
Pfohl (1969): Gerhard Pfohl, „Die ältesten Inschriften der Griechen“, Quaderni Urbinati di Cultura Classica 7, 7–25. Powell (1991): Barry B. Powell, Homer and the Origin of the Greek Alphabet, Cambridge. Power (2010): Timothy Power, The Culture of Kitharôidia, Cambridge (Mass.) / London. Pugliese Carratelli (1996): Giovanni Pugliese Carratelli (Hg.), I Greci in Occidente (Catalogo della Mostra in Palazzo Grassi, Venezia), Milano. Reed (1995): Joseph D. Reed, „The Sexuality of Adonis“, Classical Antiquity 14, 317–347. Reinsberg (1989): Carola Reinsberg, Ehe, Hetärentum und Knabenliebe im antiken Griechenland, München. Rösler (1980): Wolfgang Rösler, Dichter und Gruppe. Eine Untersuchung zu den Bedingungen und zur historischen Funktion früher griechischer Lyrik am Beispiel Alkaios, München. Rösler (1992): Wolfgang Rösler, „Homoerotik und Initiation: Über Sappho“, in: Theo Stemmler (Hg.), Homoerotische Lyrik (6. Kolloquium der Forschungsstelle für europäische Lyrik des Mittelalters), Mannheim, 43–54. Rudolph (2009): Alexander Rudolph, „Die Transgression der Situation. Zur Text-Kontext-Relation als Konstituens der Literarizität sapphischer Lyrik“, Poetica 41, 331–354. Schadewaldt (1950): Wolfgang Schadewaldt, Sappho. Welt und Dichtung, Dasein in der Liebe, Potsdam. Scheer (2009): Tanja Scheer, „Tempelprostitution in Korinth?“, in: Tanja Scheer u. Martin Lindner (Hgg.), Tempelprostitution im Altertum. Fakten und Fiktionen, Berlin, 221–266. Schlaffer (2012): Heinz Schlaffer, Geistersprache. Zweck und Mittel der Lyrik, München. Schlesier (1986/87): Renate Schlesier, „Der bittersüße Eros. Ein Beitrag zur Geschichte und Kritik des Metapherbegriffs“, Archiv für Begriffsgeschichte 30, 70–83. Schlesier (2011a): Renate Schlesier, „Aphrodite reflétée. À propos du fragment 1 (LP/V) de Sappho“, in: Francesca Prescendi u. Youri Volokhine (Hgg.), Dans le laboratoire de l’historien des religions. Mélanges offerts à Philippe Borgeaud, Genève, 416–429. Schlesier (2011b): Renate Schlesier, „Presocratic Sappho. Her Use of Aphrodite for Arguments about Love and Immortality“, Scientia Poetica 15, 1–28. Schlesier (2013): Renate Schlesier, „Atthis, Gyrinno, and Other hetairai: Female Personal Names in Sappho’s Poetry“, Philologus 157, 199–222. Schlesier (im Druck): Renate Schlesier, „Gold as Mediator between Divinities and Humans in Sappho’s Poetry“, in: Marisa Tortorelli Ghedini (Hg.), AURUM. Funzioni e simbologie dell’oro nelle culture antiche (im Druck). Snell (1946): Bruno Snell, Die Entdeckung des Geistes. Studien zur Entstehung des europäischen Denkens bei den Griechen, Hamburg. Steinhart (2012): Matthias Steinhart, „Zwei ,Becher des Nestor‘ und der Zauber der Aphrodite“, Würzburger Jahrbücher für die Erforschung des Altertums, N.F. 36, 7–37. Turner (1971): Eric Gardner Turner, Greek Manuscripts of the Ancient World, Oxford. Voigt (1971): Eva-Maria Voigt (Hg.), Sappho et Alcaeus. Fragmenta, Amsterdam. Wecowski (2002): Marek Wecowski, „Towards a Definition of the Symposion“, in: Tomasz Derda u.a. (Hgg.), EUERGESIAS CHARIN. Studies Presented to Benedetto Bravo and Ewa Wipszycka by Their Disciples, Warschau, 337–361. Welcker (1816): Friedrich Gottlieb Welcker, Sappho von einem herrschenden Vorurtheil befreyt, Göttingen. West (1970): Martin L. West, „Burning Sappho“, Maia 22, 305–330. West (1980): Martin L. West, „Other early poetry“, in: Kenneth J. Dover (Hg.), Ancient Greek Literature, Oxford, 29–49. West (1989): Martin L. West, Iambi et Elegi Graeci I, Editio Altera, Oxford. West (1997): Martin L. West, The East Face of Helicon. West Asiatic Elements in Greek Poetry and Myth, Oxford.
106
Renate Schlesier
Wilamowitz (1907): Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff, „Die griechische Literatur des Altertums“, in: Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff u.a., Die griechische und lateinische Literatur und Sprache, 2. Auflage, Berlin / Leipzig, 3–238. Wilamowitz (1913): Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff, Sappho und Simonides. Untersuchungen über griechische Lyriker, Berlin. Yatromanolakis (2001): Dimitrios Yatromanolakis, „Visualizing Poetry: An Early Representation of Sappho“, Classical Philology 96, 159–168. Yatromanolakis (2007): Dimitrios Yatromanolakis, Sappho in the Making. The Early Reception, Cambridge (Mass.) / London. Zeitlin (1999): Froma I. Zeitlin, „Reflections on Erotic Desire in Archaic and Classical Greece“, in: James I. Porter (Hg.), Constructions of the Classical Body, Ann Arbor, 50–76.
Abbildungsnachweise Abb. 1 Abb. 2 Abb. 3 Abb. 4a Abb. 4b Abb. 5a Abb. 5b
Pugliese Carratelli (1996) 192, Cat. 21 Turner (1971) 47 Pl. 17b Photo Ligier Piotr/Muzeum Narodowe W Warszawie Furtwängler (1909) Taf. 63 Giuliani u. Heilmeyer (1991) Kat. 33, 181 Abb. unten Denoyelle (1994) 107 Giuliani u. Heilmeyer (1991) Kat. 20, 156 Abb. oben
Tragic Myth as Medium of Social and Cultural History
107
Edith Hall
Tragic Myth as Medium of Social and Cultural History: Black Sea Artemis and the Cults of the Roman Empire latet arbore opaca aureus et foliis et lento uimine ramus, Iunoni infernae dictus sacer; … In a shady tree there lies concealed a bough, with golden leaves and a supple stem, said to be sacred to Juno of the Underworld [i.e. Proserpina]; …
These are some of the most famous lines in the Aeneid, which inspired the title and intellectual project of Sir James Frazer’s The Golden Bough (1890)1. The Sibyl of Cumae tells Aeneas that, before he can enter the underworld, he needs to locate the special tree which conceals the gold-leaved bough2. The remark on this passage made by the fourth-century commentator Servius shows how the Black Sea adventure of Orestes and Iphigenia, first dramatised in Euripides’ tragedy Iphigenia in Tauris in the late 5th century BC, had become implicated even in this most Roman of foundation narratives. Servius says that although experts on the rites of Proserpina say that it is in her mysteries that the golden bough is used, the ‘general view’ (publica opinio) is different: Orestes, after the killing of King Thoas in the Tauric land, fled with his sister Iphigenia … and the image of Diana that he brought from there he set up not far from Aricia. In her precinct, after the sacrificial ritual was changed, there was a certain tree, from which it was not permitted to break off a branch.3
In this version, the golden bough grew on a tree within the sanctuary of Diana near Aricia in the Alban hills – that is, the sanctuary of ‘Diana of the wood’, Diana Nemorensis, one of the most ancient and important cult places in Italy. Moreover, it grew in a sanctuary which had been founded by Orestes when he installed the very image of Diana which he had brought with him from the Taurians. The version of the story presented by Servius includes Iphigenia, but it is Orestes who is the founder of the cult, just as in Euripides’ play he was to found the cult at Halai Araphenides, the des-
1 See the brilliant discussion in Smith (1978) 221–234. 2 Verg. Aen. 6,136–138. 3 Serv. Aen. 2,116.
108
Edith Hall
tination of the image of Taurian Artemis4. Servius’ aetiology for the Cult of Diana Nemorensis contains one major difference from the story told in Euripides. Servius’ Orestes only became responsible for the preservation of the image and thus of the cult because he had killed King Thoas. The violent method by which each successive priest of Diana, each ‘King of the Wood’ (Rex Nemorensis) was replaced in the cult, when a runaway slave mounted a challenge and then defeated the incumbent priest in single combat, was thus provided with an ancient precedent in Orestes’ execution of the Taurian king. This is a vivid transference of a Greek aetiology to Roman religion. In this article we shall catch glimpses of the living presence of the story of the cult of the bloody Black Sea maiden goddess in several other places in Italy, and also in the eastern Roman Empire from Lydia to Cappadocia. In a forthcoming monograph devoted to the reception of Euripides’ Iphigenia in Tauris from classical Athens to the third millennium, I address the reasons for the exceptional popularity of this play in antiquity. One of my aims is to show how tracing the ancient Nachleben of canonical pagan literary works in diverse media and genres, from the visual arts to Christian polemic, can enrich our understanding not only of the resonances of those canonical texts and the texts in which they were embedded for their ancient readers, audiences and viewers, but for ancient cultural and social history defined more widely. In particular, I argue that Iphigenia in Tauris could be used to explain the arrival of an Artemis cult almost anywhere else, provided that the Atreid siblings were diverted from Athens and made to escort the ancient image to another part of the ancient Mediterranean world5. The social and ideological aspects of Iphigenia in Tauris, especially its portrayal of ethnic confrontation and its idealisation of male friendship, certainly contributed to its continuing importance in antiquity. Its aesthetic dimension – its nature as an adventure narrative in which attractive heroic characters first face mortal jeopardy and then escape it – was also fundamental to one of the directions in which ancient literature and entertainment developed in the ancient Greek and Roman worlds6. But the popularity of scenes from the play on vases placed in graves by mourners at south Italian funerals in the 4th century BC, which I have discussed elsewhere7, shows that we ignore the importance of the metaphysical dimension of the myth of the Black Sea Artemis at our peril. Here, I explore some of the intricate
4 See below. 5 Hall (2012). The argument in the current article builds on, and is deeply indebted to important articles by Graf (1979), Hölscher (1991) and Hölscher (2004), and Giuliani (1989) and Giuliani (1995). The last section, on Roman sarcophagi, owes much to the brilliant monograph of Bielfeldt (2005). I was delighted to be introduced personally, for the first, time, not only to the distinguished honorand, but also Professors Giuliani and Bielfeldt, at the Heidelberg conference which gave rise to this publication. 6 Hall (2010). 7 Hall (2013).
Tragic Myth as Medium of Social and Cultural History
109
relationships between the myth which Euripides had popularised and the religious sensibility of the societies which reused it until the Christians’ closure of the pagan sanctuaries. Servius’ connection of the foundation of the cult of Diana at Aricia with the arrival of the image from Tauris was anticipated several centuries earlier by the Pontic Greek Strabo, whose Geography was written during the reigns of Augustus and Tiberius. Strabo, although a supporter of Roman imperialism, was through his mother related to individuals who had served under Mithradates VI of Pontus, and may have had a particular interest in Black Sea legends. Strabo writes that Aricia lies on the Appian way, and on the left as you ascend from Aricia is the Artemision, which is named ‘Nemus’: They say that the sacred image of the Arician goddess is a copy of the one from Tauropolos. And in fact, a somewhat barbarian and Scythian element predominates in the temple customs. For they establish as priest a runaway slave who becomes the priest by slaying with his own hand the previous man consecrated to that office; he is therefore always armed with a sword, looking around for attacks, and ready to make a defence. The temple is in a grove, and before it is a lake which resembles the sea; and around it in a circle lies an unbroken and very high mountain brow, which encloses both the temple and the water in a place that is hollow and deep.8
Strabo describes with great accuracy the setting of Lake Nemi, which made a considerable impact on all the gentlemen who toured classical sites in Italy in the 18th and early 20th centuries. Turner’s watercolour of 1840 shows the classical ruins in the lower right-hand section lead towards the town on the hill-top, while a girl tends her goats beside the mirror-like disc of water high in the Alban hills (Fig. 1). Macaulay’s poem ‘The Battle of the Lake Regillus’ in Lays of Ancient Rome (1842) helped young Victorians embed the grim succession ritual of the King of the Wood in their memories: The still glassy lake that sleeps Beneath Aricia’s trees Those trees in whose dim shadow The ghastly priest doth reign, The priest who slew the slayer, And shall himself be slain.
Strabo says that in the mysterious sanctuary on the shores of this lake the cult image of Diana of the Wood was ‘copied’ from the Tauric one, but he intelligently perceives that the purportedly ‘barbarian’ element within the rituals practised at Aricia were less to do with their provenance than with a psychological quality, in symbolising their particular savagery9.
8 Strab. geogr. 5,132. 9 See Pairault (1969) and Graf (1979) 261–264, and on the psychological uses of geography in myth, Hall (1992).
110
Edith Hall
Fig. 1: Joseph Turner, Lake Nemi, watercolour, 1840. London, British Museum.
When Frazer wrote The Golden Bough, the world had just woken up to the exciting Arician cult of Diana. In 1886 seven bales and sixteen cases of antiquities excavated at Nemi arrived at the Castle Museum in Nottingham, England, donated by the amateur archaeologist Sir John Savile Lumley, an ambassador in Rome. Lumley’s finds gave a thrilling context to Ovid’s story that the wife of Numa had disturbed the rites of ‘Orestean Diana’ at Aricia in the 7th century BC10. There had certainly been a sanctuary in Aricia, an atmospheric location eleven miles south of Rome, since at least the sixth century. The first significant temple there may have been the grand building, with a gilded roof, erected in around 300 BC after Aricia was incorporated fully into the Roman state11. The sanctuary expanded during the later republic, acquiring baths and a small theatre12. These were excavated in the 1920s but covered up again when Eduardo Gatti, the excavator, died. Lucia Morpurgo, who in 1931 published what had been inferred about the theatre before it disappeared, described a cavea with banked seats, a scaenae frons with three doors, a room for actors, and frescoes portraying theatrical props13. It has been suggested that in addition to performances intimately related
10 Ov. Met. 15,487–492. 11 Green (2007) 15–16. 12 Morpurgo (1931) 292–299. 13 Morpurgo (1931) 302.
Tragic Myth as Medium of Social and Cultural History
111
to rituals, the theatre may have been the venue for performances of ‘translations of Greek plays (Euripides especially) and the Latin plays of Ennius, Pacuvius, and the rest14.’ Iphigenia in Tauris or Pacuvius’ Latin tragedy Orestes, which dramatised the same story, may actually have been performed there. Augustus, whose mother was Arician15, had a particular interest in the area and the cult. In identifying himself with Apollo, he used iconography at different times to associate Diana with his mother, sister Octavia and daughter Julia16. But Arician Diana became crucial to his self-representation shortly after the battle of Actium. It was almost certainly at this moment that the bones of Orestes, which were said to have been long held at Aricia, were moved to Rome17. They were put on display in an urn at the temple of Saturn, close to the Temple of Concord. The bones constituted one of the seven sacred ‘pledges of Roman rule’18, which also included, for example, the Palladion of Athena from Troy. Tonio Hölscher has argued persuasively that Octavian deliberately adopted the remains of Orestes as a symbol of himself as the ‘avenger from Aricia’; in Orestes’ expiation lay a prototype for Augustus’ proposed solution to the violence of the civil war in Italy19. Octavian thus created a privileged place for ‘Scythian’ Diana, through her association with Orestes, in the ideological web he spun around the imperial family and Roman state religion. The connection between Diana Nemorensis and the Tauric Artemis probably dated back to the fourth century BC, when the story of Iphigenia in Tauris became popular in the vase-paintings produced further south in Italy20. By the time of Cato the Elder (234–149 BC), the Taurians had been directly associated with southern Italy as well, as we can see from a fragment of his prose history Origines21. Although the spellings of the proper names are doubtful, he says that there was an ancient people who lived in the region bordering on Rhegion, somewhere on the western coast of southern Italy, called the ‘Thesunti’ or ‘Tauriani’. They acquired the second name, says Cato, because it was to one of the rivers in their territory that Orestes came to be purified, in company with Iphigenia and Pylades. The Italian Tauriani claimed that Orestes had left a sword in a tree there when he departed. In this fragment of Cato, we have textual evidence that the people of southern Italy had made a direct connection between their own territory and the Taurians of Euripides’ tragedy22. This in turn may have been associated with a name ‘Phakelitis’, under which Artemis was worshipped
14 Green (2007) 65. 15 Cic. Phil. 3,6,15–17. 16 Green (2007) 40–41. 17 Hölscher (1991). 18 Servius on Aen. 7,188. 19 Hölscher (1991) 164. 20 See Green (2007) 77–79; Hall (2013) and below. 21 fr. 71 in Peter (1914). 22 Green (2007) 202–203.
112
Edith Hall
in southern Italy in the region of the straits dividing the mainland from Sicily. The name was explained by the story that Orestes had brought the image of Artemis there, hidden in a bundle of reeds. One late source locates a cult of Taurian Artemis ‘Phakelitis’ as far North as Kyme, as well as in two other Euboean foundations, Rhegion and Tyndaris23, and there is also some evidence for an early cult of Artemis at Naples. Here we may be dealing with one of the routes by which the traditions of the Tauric Artemis travelled north to Latium, to arrive at Aricia and be fused with the cult of Diana Nemorensis. At some point a conceptual triangle was forged to link (1) the cult of Artemis under the title ‘Phakelitis’ in southern Italy, (2) the Taurian statue, and (3) Diana at Aricia. This complex set of associations is outlined by Servius when he comments on Apollo’s oracular allusion to the sacrifice of Iphigenia at Aeneid: After Thoas was killed, Orestes stole the statue, concealed in a bundle (fasces) of wooden twigs, and so she is also called ‘Facelitis’ – this is not just because of the torch with which she is painted, which also explains the title ‘Lucifera’. And he brought her to Aricia. But afterwards, when the cruelty of her rites upset the Romans, even though only slaves were being sacrificed, Diana was transferred to the Laconians.24
In a breathtaking tour of the world of Diana/Artemis, Servius connects Orestes’ arrival in Italy with a cult title under which she was worshipped in the Greek (Euboean) colonies of Rhegion and Tyndaris, as well as with Aricia. But to this he adds Sparta, in this version the ultimate destination of the Taurian statue. The much-travelled image has been passed from the Black Sea to Aricia and thence to Greece, forging mental links internationally between multifarious manifestations of her cult. As we shall see below, Sparta did indeed lay claim to the ‘original’ Tauric statue25. The single most significant factor in the maintenance of the story first dramatised in Iphigenia in Tauris, across the nine centuries between Euripides and Servius, was therefore its twin nature as a paradigm for sacrificial ritual and a foundation narrative for cults of Artemis/Diana in the Greek and Roman worlds. Just as Iphigenia is the only priest-protagonist in Greek tragedy, so Iphigenia in Tauris is one of the handful of canonical Greek tragedies set in the sacred space of a sanctuary rather than the secular space at the entrance to a palace, tent, or cave. Performing it, or visually representing it, necessarily meant mimetically creating a place where a divinity was worshipped. Most of Athena’s speech ex machina in Euripides is devoted to detailed instructions for not one but two cults of Artemis in mainland Greece:
23 A scholion on Augustine’s City of God 2.3. The text is reproduced in Frederiksen (1984) 76, 83 n.150. See also Mele (1987). 24 Verg. Aen. 2,116. 25 See Dyson (2001) 142–143.
Tragic Myth as Medium of Social and Cultural History
113
Orestes, hear your instructions from me. You may be far off but you can hear my voice. Leave here, taking the statue and your sister. When you arrive at the god-built city of Athens, there is a place near Attica’s most distant boundary, beside the crags of Carystos. It is sacred. My people call it Halai. Build a temple there and instal the statue, naming it after the Taurians’ land and your ordeal, the one you labored through, scurrying across Greece, goaded on by the Erinyes. People will perpetually sing hymns to her as Artemis Tauropolos. And draw up this rule: when the people hold her festival, a sword is to be held at a man’s neck, and his blood let, for reasons of sanctity, so that the goddess may retain her privileges. You, Iphigenia: you are to serve this goddess in her Brauronian meadows as keeper of her priestly key. It is there that you will be buried when you die, and people will pay you the honour of dedicating to you the fine-meshed fabric gowns left behind in households by women who die in childbirth.26
Few ancient texts are so explicitly and extensively connected with the foundation of significant cults. A similar function is performed by Aeschylus’ Eumenides, with its establishment of the cult of the Eumenides beneath the Athenian acropolis, by Sophocles’ Oedipus at Colonus, which creates the narrative underlying the cult of Oedipus as hero in Attica, and Bacchae, which tells of the arrival of the cult of Dionysus in Thebes. But IT was the ‘Artemis cult’ text of antiquity par excellence. Maiden goddesses connected with the biological transition into adulthood, with male hunting and female reproductive energy, were important figures in ancient polytheism. Artemis’ connection with healing, for example at Heraclea in Lucania, Italy, where as So¯teira she was connected with the healing of both physical and psychological maladies27, is also a persistent feature in later evidence for the cult of the ‘Tauric’ Artemis. Braund points out that in Tauric Chersonese (around modern Sevastopol) itself, Asclepius was a key deity, and his cult is likely to have been connected with that of the Parthenos28. Take the arresting figure of Vera, priestess of Artemis of Patmos, and daughter of a doctor. Vera is the subject of an inscription found on her island, dating from the 2nd or 3rd century AD:
26 Eur. Iph. T. 1446–67; My translation. 27 Artemis’ connections with medicine are well brought out in Morizot (1994). 28 Braund (2007) 195.
114
Edith Hall
Artemis herself, the virgin huntress, herself chose Vera as her priestess, the noble daughter of Glaukias, so that as water-carrier at the altar of the Patmian goddess she should offer sacrifices of the foetuses of quivering goats which had already been sacrificed. As a young girl Vera was raised in Artis [i.e. Lebedos, north of Ephesus], but she was born and nursed on Patmos, the island of which Leto’s daughter is most proud, which she protects as her throne in the deeps of the Aegean Sea, from the time when the warrior Orestes, having brought her from Scythia, installed her, and he was cured of the terrible madness which followed the murder of his mother. Now the lovely Vera, daughter of the wise doctor Glaukias, has sailed by the will of Scythian Artemis over the wintry swell of the waters of the Aegean in order bring lustre to the rites and the festival, as the divine law instructed.29
Perhaps there is more than a coincidental link between Glaukias’ profession and his daughter’s office as priestess of ‘Scythian’ Artemis, who cured Orestes of his insanity. Patmos, described as ‘the most sacred island’ of Artemis (i.e. Artemis of the Ephesians) in Acts 19:28, was under Ephesian governance at this time. But it was also the site of some of the principal early Christian activities and traditions. It is possible that in Glaukias’ proud description of his daughter’s selection as priestess, and her striking sacrifice of pregnant nanny-goats and their foetuses, we can hear the defiance of the old pagan religion, symbolised in the cult of bloodthirsty ‘Scythian’ Artemis, in the face of perceived encroachments of the new Christian faith30. It is certainly the case that the cult of Artemis seems to be singled out as an especially potent symbol of pagan ritual practice in the New Testament, which otherwise says little on the topic of the old religion. Only Zeus and Hermes are mentioned besides Artemis, and not at anything like such length; the epigraphic evidence in the eastern Aegean and Turkey confirms the exceptional status of Artemis in those regions during the 1st and 2nd centuries AD31. St. Paul encountered stiff opposition when he took his Christian mission to Ephesus in the 6th decade AD. He was almost certainly imprisoned at least once, and feared for his life32. The most dramatic evocation of any pagan cult in the whole New Testament is the account in Acts of the Apostles ch. 19 of the riot of the silversmiths which followed Paul’s sermon in the great theatre of Ephesus33. A silversmith named Demetrius, ‘who made silver shrines of Artemis’, providing a good deal of business to silversmiths and craftsmen in allied trades in the city, organised a meeting and told them that Paul would damage their business. Paul had been claiming ‘that gods made by hands are not gods at all’, which, argued Demetrius, would damage the reputation both of the temple of Artemis and the entire prov-
29 This is my translation of the text of the inscription as edited by Merkelbach u. Stauber (1998) 169–170. 30 Merkelbach u. Stauber (1998) 169 suggest that this inscription documents an attempt to reintroduce traditional old customs, probably in the time of Julian. 31 Strelan (1996) 4–5. 32 2 Cor. 1,8–10. 33 Here quoted in the NET online translation (http://bible.org/netbible/ (Stand 24. 05. 2013)).
Tragic Myth as Medium of Social and Cultural History
115
ince of Asia. His audience ‘became enraged and began to shout, Great is Artemis of the Ephesians’. The city became filled with uproar, and two of Paul’s companions were dragged into the theatre: when a Jewish lawyer named Alexander was put forward to address the situation, the crowd became further enflamed, shouting in unison34: ‘Great is Artemis of the Ephesians!’ for about two hours. After the city secretary quieted the crowd, he said, ‘Men of Ephesus, what person is there who does not know that the city of the Ephesians is the keeper of the temple of the great Artemis and of her image that fell from heaven? So because these facts are indisputable, you must keep quiet and not do anything reckless. For you have brought these men here who are neither temple robbers nor blasphemers of our goddess. If then Demetrius and the craftsmen who are with him have a complaint against someone, the courts are open and there are proconsuls; let them bring charges against one another there. But if you want anything in addition, it will have to be settled in a legal assembly. For we are in danger of being charged with rioting today, since there is no cause we can give to explain this disorderly gathering.’ After he had said this, he dismissed the assembly.
It was not going to prove easy to convince the inhabitants of the province of Asia to give up their bloodthirsty goddess, regardless of whether they were primarily motivated by religious conviction or perceived threat to their income and international status. In the event, the temple of Artemis was burned down in the 3rd century, only to be restored; the cult was only finally scrapped in around 450 AD. There is a note of triumph in the Ephesian inscription set up by a Christian named Demeas, who emphasised with the sign of the cross his claim that he had taken down the ‘false image of the daimo¯n Artemis’ (not the great cult statue inside the temple but one that stood in front of the doors)35. One of the features of the Ephesian Artemis which made her so special was that her main statue was believed to be diopetes, to have fallen from the sky, cast by the hand of god, onto the spot where the sanctuary was built. This provenance is echoed in IT by Iphigenia, who arrived in Tauris not by ship but from the ‘shining air’ through which Artemis has carried her (29–30). There were very few ‘sky-fallen’ statues in antiquity, and this is therefore one feature which the Ephesian cult emphatically shares with the Tauric cult portrayed in Euripides’ IT and in all the sanctuaries where it was claimed that the Tauric image had been brought by the Atreids. In the course of this article we have already encountered two places besides Halai Araphenides, specified by Euripides’ Athena, which claimed they possessed the ‘original’ Tauric statue: the Arician cult of Diana Nemorensis and the cult of Artemis on Patmos where Vera presided. But the claim was made in other important sanctuaries of Artemis as well. Indeed, by the travel writer Pausanias’ day, in the second century AD, it was at Brauron rather than (or in addition to) Halai Araphenides that the Athenians claimed to
34 Acts 19,34–41. 35 Burkert (1999) 59.
116
Edith Hall
keep the ‘real’ Taurian statue36; they said that Iphigenia had not stayed at Brauron, however, but had travelled onwards to Athens and Argos. Perhaps Argos, too, reinserted itself into Iphigenia’s myth by at least claiming that she had died there. But one of the best-known cults of Artemis, rather than Iphigenia, was based in Sparta beside the river Eurotas – the cult of Artemis Orthia. When Pausanias visited Sparta in the second century AD, he was told that Orestes had brought the Tauric statue to this sanctuary: They say that the xoanon [‘archaic wooden image’] there is the one that Orestes and Iphigenia once stole away from the Tauric land; and the Lacedaemonians say that it was brought to their territory because Orestes was king there as well. I think they make more sense than the Athenians. For why would Iphigenia have left the agalma [‘statue’] behind at Brauron? Or why, when the Athenians were preparing to abandon their land, didn’t they take that [agalma] too onto their ships?37
The Spartans and Athenians, at least by this date, were in competition over the ownership of the ‘true’ image from Tauris. Pausanias – or his source – believes that the rival statue was at Brauron, rather than the Euripidean Halai Araphenides, but that is a minor detail. The cult aetiology in Euripides’ play is still, over half a millennium after its composition, underlying the controversy. Pausanias offers ‘other evidence that the Orthia in Lakedaimon is the wooden image from the foreigners.’ Contact with the image has caused insanity (here we see the medical link again), and on one occasion even mass deaths at the altar and an outburst of disease caused by a quarrel between men from rival local villages which broke out during sacrifice. Pausanias says that this prompted an oracle saying that in order to obtain a cure, ‘they should stain the altar with human blood’, and the Spartans used to practise human sacrifice, choosing the unfortunate victim by lot. But Lycurgus had changed the ritual to flogging instead, thus staining the altar with human blood: By them stands the priestess, holding the wooden image. Now, it is small and light, but if ever the scourgers spare the lash because of a lad’s beauty or high rank, then at once the priestess finds the image grow so heavy that she can hardly carry it. She lays the blame on the scourgers, and says that it is their fault that she is being weighed down. So the image ever since the sacrifices in the Tauric land keeps its fondness for human blood.38
The image which Euripides’ play brings from Tauris to Greece thus oversees and intervenes in one of the most notorious rituals in antiquity, the flogging of the young Spartan warriors. A pattern is emerging. The crude wooden image in the name of which humans were slaughtered in Tauris symbolises the bloody violence underlying all animal sac-
36 Paus. 1,33,1. 37 Paus. 3,16,7. 38 Paus. 3,16,10–11. Translation by W.H.S.C. Jones and H.A. Ormerod.
Tragic Myth as Medium of Social and Cultural History
117
Fig. 2: Roman silver repoussé kantharos cup, found in Turkey: Orestes, Iphigenia and Pylades meet Chryses in a sanctuary of Apollo, 25 BCE-25 AD. London, British Museum.
rifice, explained as having evolved from the killing of a human, long ago, whether in Attica, Sparta, Patmos, or Aricia. It is almost certainly necessary to add to this list north-western Turkey, in the region of the Troad. In about 1960, a small silver repoussé kantharos cup, its handles and foot missing, was acquired by the British Museum. It is Roman, said to have been found in Turkey, and dates from between 25 BC and 25 AD (Fig. 2). The scene shows Orestes, Iphigenia and Pylades at Sminthe near Troy. It is important because it is the only complete visual depiction of any exploit of Iphigenia, Orestes, and Pylades after their escape from the Taurians, although a few fragments of Arretine pottery show similar scenes. The setting is the sanctuary of Apollo Smintheus, renowned in the literature of antiquity because it was presided over by Chryses the priest in the first book of the Iliad. The sanctuary setting is indicated by a filleted omphalos, a kouros-like statue, and dedicated weapons suspended from a sacred tree. Pylades and Orestes, wearing only mantles, have taken refuge at the altar/tree of this sanctuary; Iphigenia sits between them, veiled and desolate, holding a small female statue on her knees39. The scene shows why they are seeking sanctuary: they have been pursued by Thoas, who has
39 There are good close-up photographs of all the figures on the cup reproduced in Stenico (1966).
118
Edith Hall
arrived with a bodyguard. But between the Taurians and the refugees stand a young priest and a veiled priestess. She is Chryseis, the famous war-prize whom Agamemnon had to return to her father, the priest of Apollo. But in the myth portrayed here, she subsequently gave birth to Agamemnon’s child, who grew up to become this young priest Chryses, in succession to his grandfather. The suppliants he is about to hand over to Thoas are in fact his half-brother and half-sister: he is another Atreid. Fortunately, their relationship will be discovered before any death ensues. This ‘sequel’ to the story of Iphigenia in Tauris is not well known because Sophocles’ play about it, Chryses, has not survived, and neither has the Roman version of Pacuvius. But we do have a summary of a similar story by the Augustan scholar Hyginus, which also features the now aged grandfather of Chryses the younger, after whom he was named: Later when Chryses was about to return Iphigenia and Orestes to Thoas, he [Chryses the elder] learned that they were children of Agamemnon, and revealed to Chryses [the younger] the truth – that they were brothers and that he was a son of Agamemnon. Then Chryses, thus informed, with Orestes his brother, killed Thoas, and from there they came safe to Mycenae with the statue of Diana.40
This plot replicates several features of Iphigenia in Tauris – averted sibling-murder, a sanctuary setting, priestly personnel, a recognition, and the totemic image of Apollo’s sister41. The story may have explained (or created a reason for introducing) the inclusion of Artemis in worship of Apollo in the Troad. The plot differs from that in Iphigenia in Tauris, however, in that Thoas has apparently not accepted the removal of the statue from Tauris, and is killed off by the half-brothers Chryses and Orestes. Orestes also brings the statue neither to Attica nor to the sanctuary of Artemis Orthia at Sparta, but to one of his family’s legendary seats of power at Mycenae. The final destinations of the statue carry on multiplying. Pausanias augments the list we have so far accumulated with several places in Asia, where he says that the reputation of the Tauric goddess remained so high that her ‘original’ image was claimed by the Laodiceans in Syria, the Cappadocians, and the Lydians, who called her Abaïtis42. In the case of Cappadocia, Pausanias’ statement is supported in the sixth century AD by the Byzantine historian Procopius. He claims that Orestes actually founded three temples in two cities south of the Black Sea, since both the Pontic and the Cappadocian cities by the name of Komana traced their origins to the foundation of a temple of Artemis by Orestes43. When the three Greeks had fled from the Taurians, Orestes became ill, and was told by an oracle that his illness
40 Soph. Fab. 121. 41 Manuwald (2003) 30. 42 Paus. 3,16,8. 43 Prok. Pers. 1,17,11–20.
Tragic Myth as Medium of Social and Cultural History
119
would continue until he had built a temple to Artemis in a spot just like her Tauric sanctuary, cut his hair, and named a city after the place where he had built the temple and shorn his hair (the Greek for ‘hair’ is koma or kome¯). He first came to Pontus, but after building the temple, founding the city Comana, and cutting the hair, still obtained no relief; so he continued on south to Cappadocia, where be built an imposing city and two temples: … the one to Artemis and the other to his sister Iphigenia, which the Christians have made sanctuaries for themselves, without changing their structure at all. This is called even now Golden Comana, being named from the hair of Orestes, which they say he cut off there and thus escaped from his affliction. But some say that this disease from which he escaped was nothing else than that of madness which seized him after he had killed his own mother.44
The Cappadocian connection will have been tempting to draw because the ancient name of the high Anatolian mountain range, Taurus, was easily confused with the home of the Crimean Tauri. Indeed, this etymological connection probably explains the strangest aetiology which Euripides’ IT ever prompted: the association of the city of Tyana with Thoas. In the second century AD, the Bithynian Arrian noted that the inhabitants of Tyana in Cappadocia liked to say that their city used to be called Thoana, ‘Thoas’ city’, since the Taurian King had travelled there and died when pursuing Orestes and looking for a cure for an incurable disease45. Thoas has almost merged, for etymological convenience, with the sick wanderer Orestes who visited his kingdom. Tyana lay beneath the Taurus mountain range, near the city of Castabala, where Strabo says there was yet another temple of Artemis, the one known as ‘Perasian Artemis’, since “the priestesses there, it is said, walk with naked feet over hot embers without pain. And here, too, some tell us over and over the same story of Orestes and Tauropolos, asserting that she was called ‘Perasian’ because she was brought ‘from the other side’”46. Perhaps we are to understand here, with Strabo’s false etymological connection of this Artemis’ title with the Greek adverb perathen (‘from the other side’), that she was brought ‘from the other side’ of the Black Sea. Orestes and the Taurian goddess, under different names and titles, had thus penetrated deep into the imagination and religious life of the eastern Roman Empire. The last local divinity who Pausanias said had been connected with ‘the Tauric goddess’ was the Lydian Anaïtis47, and in a recent brilliant study, Barbara Burrell has shown that a coin from Philadelphia in Lydia signifies the story dramatised in Iphigenia in Tauris. The coin image makes the claim that Iphigenia, Orestes, and Pylades fled from the land of the Taurians to Philadelphia in Lydia (modern Alasehir in Tur-
44 45 46 47
Prok. Pers. 1,17,18–20. Arrian. peripl. p. E. 6. Strab. 12,2,7. Paus. 3,16,8.
120
Edith Hall
Fig. 3: Reverse of coin of Philadelphia in Lydia, showing concord Iphigenia, Orestes and Pylades symbolising a concord with Ephesos, ca. 250 AD. Paris, Bibliothèque nationale de France 1033.
key), and there set up their stolen image, identified by the Philadelphians as their patron Artemis Anaïtis48. This fits with the profile of a late antique city which the Neoplatonists called ‘little Athens’ on account of its enthusiasm for the festivals and temples of ‘the idols’49. The scene that needs interpreting is on the reverse of a bronze coin issued by Philadelphia in Lydia in commemoration of its relationship with the city of Ephesos; it is known through three examples. On the obverse is inscribed ‘Emperor Caesar Gaius Quintus Trajanus Decius’ over his laureate draped cuirassed bust, as most coins of this kind from the Roman provincial cities of Asia did during Trajan Decius’ reign (249–51 AD). But on the reverse is inscribed “Under Aurelius Rufinus, archon; concord of Philadelphians, temple-wardens, of Ephesians”. The illustrations shows a woman, carrying a small Anatolian-style dressed image, walking left, turning her head right toward two males. They are both naked except for cloaks, standing right and looking left at her; on the left is a distyle temple with diamond-patterned roof, in three-quarter view (Fig. 3). Burrell has noticed that the image bears a strong resemblance to the vasepainting of the escape of Iphigenia, Orestes and Pylades on a St. Petersburg vase (Fig. 4), and to several scenes on Roman sarcophagi to be discussed below. Previous numismatists offered quite different interpretations, for example claiming that the ob-
48 Burrell (2005). On the association of Artemis with Anaitis see also Brosius (1998). 49 Lyd. mens. 4,58.
Tragic Myth as Medium of Social and Cultural History
Fig. 4: Campanian crater: escape of Iphigenia, Orestes and Pylades, 330–320 BC. St. Petersburg, Hermitage B 2080 (W 1033).
121
122
Edith Hall
Fig. 5: Pediment of a Roman funeral monument from Frenz: escape of Iphigenia, Orestes and Pylades. Bonn, Rheinisches Landesmuseum U 194.
verse figures were members of the imperial family50, or that the woman is a city-goddess (despite her lack of kalathos or mural crown and cornucopia, which might be expected in such a personification), or that the scene represents the introduction of the cult of Ephesian Artemis into Philadelphia51. But the heroic nudity implies that we are talking about a mythical version of the arrival of a cult, and I am convinced by Burrell’s argument that the scene is derived from the myth fist related in Iphigenia in Tauris. But versions of this scene are also to be found on another substantial group of ancient artefacts, Roman sarcophagi, most of which date from the mid-second century AD. The simplest design amongst this group of sarcophagus carvings is in Bonn. Iphigenia, carrying the statue, moves swiftly away from the temple, the apex of the tomb sculpture mirroring the top of the temple pediment it portrays. Tomb and temple of ‘Tauric’ Artemis meld into one (Fig. 5). Iphigenia is flanked by her brother and Pylades, heroically naked but carrying swords. In the background is a deer, apparently slain, and a sacrificial altar, but there is no other detail. At the other end of the spectrum of elaboration and complexity stands a famous relief, on a sarcophagus now in the Munich Glyptothek. But in the 18th century it was in the Villa Ridolfi in Rome, and through later artists’ responses to it, forms an important link between the ancient and modern reception of Euripides’ play52. Reading from left to right, the sarcophagus 50 Mionnet (1809) 108–109 no. 597. 51 Kampmann (1998) 373 n. 2; Burnett (1999) 145 Fig. 121. 52 An imitation of it is embedded, for example, in the famous painting ‘Goethe in the Campagna, 1786–1787’, by Johann Heinrich Wilhelm Tischbein, who incorporated the resounding reference to the story of Iphigenia because Goethe was working on the final version of Iphigenie auf Tauris while they travelled. Although he may have made use of a sketch by Winckelmann, Tischbein saw the original sarcophagus in Rome. Before it was bought by the Munich Glyptothek in 1817, it was housed in the Villa Ridolfi, where it was in all probability studied intently by Tischbein and Goethe together.
Tragic Myth as Medium of Social and Cultural History
123
Fig. 6: Detail of relief on front of sarcophagus: the meeting of Iphigenia and the captive Greeks, Mid-2nd century AD. Munich Glypothek, GL 363.
takes us through four scenes. First, the statue of Artemis stands beneath the branch of a tree, tended by Iphigenia, to whom the captive Greeks are presented by a Scythian archer (Fig. 6). In the second, Orestes, seated, is tended by Pylades while being hounded by a Fury. In the third, Iphigenia is carrying the statue while one of the young Greeks attacks two Scythians. In the fourth, Iphigenia is carrying the statue to the ship, holding a man’s hand and protected by either Orestes or Pylades. The viewer of this relief sculpture is taken psychologically from danger to safety. Numerous examples of scenes like these survive on Roman sarcophagi of the second century AD. Most of these were found in Italy, but there are a couple of fragments of examples from Attica, and others from much further west, in Marseilles/Massilia, and north, in Slovenia, Germany and Gaul. Sections of a rather crude version carved on limestone, with a distinctively chubby Taurian guard, were found near the town of Sens (ancient Senonis) in Burgundy; it dates from the late first century AD53. There are variations in the choice of scenes; sometimes the recognition through the letter appears54, and sometimes it does not. They are often paired with scenes depicting scenes from Orestes’ earlier life, especially the murder of Clytemnestra and Aegisthus; some-
53 Musée gallo-romain de Sens, inv. no. Juilliot 98–100. See Jucker (1988) 116, 130 and Fig. 16. 54 See e.g. the fragmentary sarcophagus reliefs in New York’s Metropolitan Museum of Art, published by Alexander (1930) 38 with Fig. 3.
124
Edith Hall
times one story is told on the lid and the other on the sides of the sarcophagus. But there are rather more sarcophagi in total showing the Tauris story than the previous episodes in Orestes’ life, which raises the question we asked in a different form in the discussion of the Greek vase-paintings: what are Orestes and Iphigenia’s adventures in Tauris doing in Roman funerary art? The question is made much more difficult to answer because the sarcophagi were usually torn from their contexts and removed to galleries where there is no sense of the social and ritual milieux for which they were originally designed. In 1942 François Cumont took a great stride forward when he argued, in Recherches sur le symbolisme funéraire des Romains (1942), that scholars need to think about how the Greek myths were psychologically mediated through Roman filters by the sculptors and their customers. Rather than focussing on the Romans’ knowledge of Greek literature, it was more fruitful to focus on their core values and ideal virtues, such as clementia, amicitia, pietas, and concordia. The stories of Meleager, or Admetus and Alcestis, popular on sarcophagi, have proven susceptible to this type of reading55. In the context of bereavement, the emotional parallels which the viewer might draw with mythical figures is another important factor56. In his fine work on sarcophagi with sculptures dealing with Achilles, Luca Giuliani has proposed that the world of the depicted heroes and that of the humans – both the deceased and the mourners – became psychologically fused, and produced a syntax of canonical images, structured scenes, and sequences of episodes, corresponding to structural elements in sepulchral rhetoric of the empire57. These may indeed commemorate the deeds and death of the deceased, but they also express the feelings and obligations of those left behind. This question has recently been explored specifically in relation to the Iphigenia and Orestes sarcophagi in a brilliant study, with plentiful illustrations, by Ruth Bielfeldt58. She draws on the model Tonio Hölscher developed for thinking about the reciprocal and highly charged relationship in political art between myth and environment: just as the citizen becomes ‘heroised’ by the process of identification with a mythical hero, so the hero underwent a corresponding process of being turned into a modern citizen59. She identifies several different ways of thinking about the resonances of the episodes from IT story frequently found on sarcophagi. The image of the two men approaching the altar functions as a display of pietas and amicitia in a sacred space, which was one way of thinking about the social role of mourners at a funeral. Indeed, very similar arguments apply to the large group of fourth-century BC vases related to Iphigenia in Tauris found in south Italian graves. It is not at all impossible that actual theatrical performances took place at funerals in south Italy, as they were in
55 56 57 58 59
Koch u. Sichtermann (1982) 136–138; Huskinson (2002). Koortbojian (1995); Huskinson (2002), 19–24; Zanker u. Ewald (2004) 60–115. See, for example, the discussion of Achilles in sarcophagus art in Giuliani (1989). Bielfeldt (2005) 167–332. The most accessible point of access to these ideas is Hölscher (2004).
Tragic Myth as Medium of Social and Cultural History
125
later Roman times, although positive evidence for this is lacking. Luca Giuliani has argued for a slightly different interpretation of the evidence. He thinks that such vases were put on display at funeral ceremonies, when the meanings of the pictures they bore were explicated in special funeral orations. These could have been delivered by travelling actors, hired to praise the dead and console the living, but not actually amounted to theatrical performances60. But his attractive hypothesis is not provable. We need to think about the images in terms which make it unnecessary to assume any particular type of performance, theatrical or rhetorical. It may be simply that the sheer number of IT vases suggests that the choice of scenes from this play became ‘fashionable’, as it were, as it did later in Roman imperial sarcophagus carving61, and perhaps easily available or commissionable at the local centre for purchasing funeral accoutrements. It is absolutely indisputable that someone – whether mourners or retailers – had selected the image as suitable for the purpose of obsequies. The same goes for the bronze krater of the same date depicting the IT story found in a grave far away near the Black Sea coast of Bulgaria62. The perceived relevance or appropriateness of the images to funerals may not be dismissed, although it may have to be explained in broad cultural terms. We know so little about the identity of the dead individuals either in the south Italian graves of the fourth century BC or the imperial sarcophagi that it is difficult to ascertain any pattern connecting the Iphigenia in Tauris scenes with their gender, age, or family status. It is possible that they were popular choices for young adults of either sex, women who had died in childbirth, specially loved sisters, or close family friends, but this remains speculation. The affective relationships between members of the same natal family and close family friend are nevertheless relevant. The story told in the play, with its buoyant ending, absence of death, and avoidance of sex, had few rivals as a ‘safe’ choice at a moment of emotional crisis. The recurring scene of the recognition, usually incorporating also the mutual predicament in which the friends find themselves, invites the viewer to participate in the most intense symbolic moment in these relationships. The vases would have been on display at a social ritual in which family and familial friends publicly exhibited and affirmed their social and affective bonds with the deceased and with others present. The relationships between the three principal Greek characters were ones in which responsibility for death rites featured importantly. This will have been clear to any viewer who dwelt on the image, regardless of whether he or she was particularly familiar with the tragic poetry which includes Iphigenia’s concern to perform rituals and her beautiful dirge for the brother she believes dead63, Orestes’ longing for a sister to perform the death rituals over him
60 Giuliani (1995). 61 Aravantinos (2008) 79–85. 62 Robinson (1932) 550, with further bibliography; Curtius (1934) Figs. 1–2; Jucker (1988) Fig. 17. 63 Eur. Iph. T. 61–2, 157–78.
126
Edith Hall
and Iphigenia’s promise to prepare his corpse for the flames with honey and oil64, and above all the pledge Pylades makes as he agrees to this request of Orestes’ to act as his heir and ke¯deste¯s, or adopted male next-of-kin who took responsibility for his funeral, dependent womenfolk and the future wellbeing of the family line: If you survive, you’ll have children with my sister, whom I gave to you as your wife; my name will live on; my ancestral household will never be obliterated through childlessness. So go, live, and manage my father’s house. When you arrive in Greece, at Argos where horses graze, this is the obligation which I charge you with, by your right hand: make me a funeral mound, and put my memorial stone on it, and let my sister leave her tears and hair on the grave. Tell them that I died at the altar, at the hands of an Argive woman, purified for slaughter. And never abandon my sister, however forlorn my father’s house, which you have joined by marriage, may seem.65
The importance of this oath ritual should not be under-estimated. The oath formalises the relationship between the two men, already related by marriage through Electra. With their ritual clasping of right hands66, they make official an inter-familial friendship between them that resembles very intimate kinship, since it incorporates the obligation to oversee obsequies. On the Roman sarcophagi, two friends saddened by the prospect of the other’s imminent death, and a sister’s acknowledgement of her brother, sometimes suggested by Iphigenia’s lifted hand, have obvious affective resonances suitable for funerals and for consolidating the identity of an extended familia67. The scenes of fighting with the Taurians will have appealed to a military sensibility, and the pleasure in vanquishing barbarians, in the sight of other barbarians, is of course evident in much Roman art of this period besides funerary sculpture68. The depiction of Iphigenia getting onto the boat may have prompted associations, in the context of a woman’s death, with the idea of Charon’s ferry69. But Bielfeldt also thinks that the connections with the cult of Diana Aricia, and thereby with Orestes’ bones in Rome, were of crucial importance. By making Orestes’ bones one of the sacred pledges of Rome, which guaranteed its success and power, the cult of Taurian Artemis was associated with the Palladion, the wooden statue of Athena, which fell from the
64 Eur. Iph. T. 627–35. 65 Eur. Iph. T. 695–707. 66 For illustrations see Herman (1987) 50–54. 67 Bielfeldt (2005) 195–198, 225–231, 296, see also 257–258, where she points out that the late Latin author Dracontius suggestively compares the relationship between Orestes and Pylades to that of loving brothers (Orestis Tragoedia 247). On p. 297 Bielfeldt suggests that Iphigenia’s beauty and purity made it easy for her and Orestes, although siblings, to substitute for an ideal married couple. 68 Bielfeldt (2005) 261–264, 294. 69 Bielfeldt (2005) 194–195.
Tragic Myth as Medium of Social and Cultural History
127
sky to Troy and was brought thence to Rome. The viewers of the sarcophagi will probably have felt a strong analogy between the Roman foundation legend and the story of the statue of the Taurian Artemis. There were obvious connections to be drawn. The figure of Iphigenia, fleeing terrible danger with the cult image in her arms, offered a parallel to the abduction of the Palladion by the Greeks from Troy70. But it also resembled the flight of Aeneas and Anchises with their Penates (‘household gods’). Moreover, in some versions of the legend, the Palladion was said to have been given to Aeneas by Diomedes71. Cicero had already called the Palladion one of the pignora fatalia72; Julius Caesar issued a denarius in 48 BC with Aeneas as a nude warrior, carrying the statue73. The analogy with Aeneas, as Bielfeldt points out, was obvious in some of the earlier imperial frescoes depicting Iphigenia carrying the statue in scenes from the IT story; the best examples are in the Casa dei Dioscuri in Pompeii74, the colourful Iphigenia discovered at Madgalensberg (Roman Virunum), Kärnten in Austria75, and in the panel of the Villa San Marco at Stabiae. Many funerary relief sculptures depicting the story of Orestes and Iphigenia in Tauris were discovered in or near Rome, where the foundation myths will have resonated most deeply. Others may have found their way there at the time when serious collecting of classical artefacts began during the Renaissance. But the Magdalensberg fresco portraying Iphigenia reminds us that this story meant something to bereaved families much further afield in imperial times. Another outstanding example is the tomb of the Priscianus family at Åempeter near Celje (Roman Celeia), in east-central Slovenia. This is adorned with a remarkable triptych of three reliefs portraying the sacrifice of Iphigenia in Aulis, the moment when Orestes and Iphigenia met in Tauris, and the flight from Tauris. The reliefs were made in the late second century AD, of local marble by local craftsmen76. In these three images, specific artistic features characteristic of the art of the region, developed for centuries before Roman domination by the ‘Norican’ Celts who inhabited the area south of the Danube in what is now Austria and the Pannonians in the west of what is now Hungary. The figures in the story are simply and austerely portrayed. Yet the scholar who has compared the Åempeter depictions of the IT story (as well as two other IT reliefs found elsewhere in Slovenia)
70 The equivalence is illuminated by comparing the figure of Ulysses holding the Palladion, which protrudes above his left shoulder, on a Pompeii fresco (Bragantini u. Sampaolo (2009) 271, no. 116). 71 Galinsky (1969) 49, 115–116; Bielfeldt (2005) 244–247. In yet another statue myth, Aeneas was said to have dedicated at Laurentum, where he received the Palladion from Diomedes, a statue of Venus Frutis he had acquired in Sicily (the source is Cassius Hemina, quoted in Solinus 2,14). 72 Cic. Scaur. 48. 73 Galinsky (1969) 5 and Fig. 2a. 74 This obscure image is illustrated best by the drawing in Bielfeldt (2005) Fig. 81 = LIMC V s.v. ‘Iphigenia’ no. 63. See also the figures on the fresco in the House of the Vettii in Pompeii, Bielfeldt (2005) 243 Fig. 77 = LIMC V s.v. ‘Iphigenia’ no. 61. 75 Bielfeldt (2005) Fig. 79 = LIMC V s.v. ‘Iphigenia’ no. 34. 76 Kastelic (1999) 259–260, with 277 Fig. 18 = LIMC V s.v. ‘Iphigeneia’ no. 71.
128
Edith Hall
with those found at Rome, insists that the all ‘speak’ the same language of Roman ‘ecumenicity’ in terms of the normative symbolism and narratives felt appropriate to the burial of the dead regardless of the first language or ethnic identification of the family involved77. The story of the Black Sea Iphigenia was susceptible to infinite cultural translation. Despite all the stylistic variations, differences in stone quality and stone-cutting techniques, the same fundamental images of Iphigenia, Orestes, Pylades and the Taurians were carved on the containers in which families placed their dead across vast tracts of the Roman Empire. The direct relationship between most of these sculptures and the stage performance of Euripides’ tragedy or its Roman derivatives may often have been slight or almost non-existent: a well-known basic design, even if ultimately inspired by a play, can develop its own autonomous life in the visual imagination of a culture, to be reproduced over generations. Yet the awareness of the theatrical origins of the story is still sometimes encoded into even the most mainstream of recycled imagery in sarcophagus art78. The IT story is carved in great detail on the lid, for example, of a beautiful, elaborate sarcophagus in the Vatican. It was discovered in 1839 in Rome, near the Porta Viminalis79. At both corners of the lid of the sarcophagus, in the form of akroteria, are carved two large heads, which represent Taurian guards. Their noses are broad, their lower jawlines are heavy, and one is bearded. They both have long hair and Phrygian caps with the peaks bent forwards80. These accoutrements create the distinct effect of stage masks, suggestively framing the images within them in theatrical terms. The mythical images are carved on the long, continuous relief and divided into three scenes, portraying the meeting of Iphigenia and the young Greek men, the procession, and the flight respectively. The scenes include curious concrete details of objects not often encountered in other sarcophagi, for example in the scene where Iphigenia is handing the letter to Pylades, there is a capsa or special kind of pot for containing epistolary scrolls standing at their feet. But what is most remarkable is the way in which the important Taurian gazing out at the viewer – presumably Thoas – is carved in the procession scene (Fig. 7). He is not dressed in Scythian fighting gear with weapons, as he and other Taurians usually are on the sarcophagi, and his own soldiers are on this one. Rather, he wears a long, soft robe and pointed shoes that have been described as ‘an actor’s costume’; he ‘tands in the pose of one reciting on stage’81. He also holds a large torch in his right hand. Moreover, the positioning of the figures ‘accentuates the architectural scenery by Thoas on the right:’ a fluted pilaster arching over his head
77 Kastelic (1999) 278. 78 Turcan, R. (1978) 1727; Huskinson (2008). 79 Museo Gregoriano Profano inv. no. 10450 = LIMC V s.v. ‘Iphigeneia’ no. 77; Kastelic (1999) 267 Fig. 7, 273 Fig. 13. 80 Sichterman u. Koch (1975) plate 138; Kastelic (1999) 276 Fig. 17a. 81 Kastelic (1999) 273.
Tragic Myth as Medium of Social and Cultural History
129
Fig. 7: Detail of the centre of the lid of a sarchophagus: the meeting of Iphigenia and the captive Greeks, Mid 2nd-century AD. Vatican, Museo Gregorio Profano 10450.
creates the unmistakeable impression of the exit marked by palaces in the Hellenistic and Roman theatres82. Euripides’ ‘Artemis play’ left its traces on numerous ancient cults of that goddess, many of which claimed that their own cult image was the one which had first fallen from the sky in the far northern Euxine coast, and had been removed by Orestes and Iphigenia. The places which we know for certain linked themselves to the story told in the play included Halai Araphenides and Brauron in Attica, Sparta, Mycenae, the Troad, Laodicea in Syria, Comana in Pontus, Golden Comana and Tyana in Cappadocia, Castabala in Cilicia, Philadelphia in Lydia, in addition to the great sanctuary of Diana in the Alban hills of Italy, Kyme, Rhegion and Tyndaris, making at least fifteen in all. Yet although the ancient reception of Iphigenia in Tauris has taken us into almost every corner of the ancient Mediterranean and Black Sea, and into many different literary genres, social practices and cultural media, including poetry, scholia, travel writing, coins, vases, sarcophagi and ritual, the sculptor who designed the Thoas of the Porta Viminalis sarcophagus had not forgotten that the story was inextricably bound to its genesis in the world of theatre.
Literaturverzeichnis Alexander (1930): Christine Alexander, “Unpublished Fragments of Roman Sarcophagi in the Metropolitan Museum of Art”, Metropolitan Museum Studies 3, 38–46. Aravantinos (2008): Margherita Bonanno Arvantinos, “Ifigenia nell’arte greca e romana”, in: Lia Secci (Hg.), Il mito di Ifigenia, da Euripide al Novecento, Rom, 75–109.
82 Kastelic (1999) 273.
130
Edith Hall
Bielfeldt (2005): Ruth Bielfeldt, Orestes auf römischen Sarkophagen, Berlin. Bragantini u. Sampaolo (2009): Irene Bragantini u. Valeria Sampaolo, La Pittura Pompeiana, Neapel. Braund (2007): David Braund, “Parthenos and the nymphs at Crimean Chersonesos: colonial appropriation and native integration”, in: Alain Bresson, Askold Ivantchik u. Jean-Louis Ferrary (Hgg.), Une Koinè pontique: cites grecques, sociétés indigenès et empires mondiaux sur littoral nord de la mer noire, Bordeaux, 191–200. Brosius (1998): Maria Brosius, “Artemis Persike and Artemis Anaitis”, in: Maria Brosius u. Amélie Kuhrt (Hgg.), Studies in Persian History: Essays in Memory of David M. Lewis, Leiden, 227–238. Burkert (1999): Walter Burkert, “Die Artemis der Epheser: Wirkungsmacht und Gestalt einer Grossen Göttin”, in: H. Friesinger u. F. Krinzinger (Hgg.), 100 Jahre Österreichische Forschungen in Ephesos (Textband), Wien, 59–70. Burnett (1999): Andrew Burnett, “Buildings and Monuments on Roman Coins”, in: George M. Paul (Hg.), Roman Coins and Public Life Under the Empire, Ann Arbor, MN, 137–164. Curtius (1934): Ludwig Curtius, “Orest und Iphigenie in Tauris”, Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Institutes, Römische Abteilung 49, 247–294. Dyson (2001): Julia T. Dyson, King of the Wood: The Sacrificial Victor in Virgil’s Aeneid, Norman, OK. Frazer (1890): James Frazer, The Golden Bough Bd. 3, London. Frederiksen (1984): Frederiksen, Campania, hg. und ergänzt von Nicholas Purcell, Rom. Galinsky (1969): Karl Galinsky, Aeneas, Sicily, and Rome, Princeton, NJ. Giuliani (1989): Luca Giuliani, “Achill-Sarkophage in Ost und West. Genese einer Ikonographie”, Jahrbuch der Berliner Museum 31, 25–39. Giuliani (1995): Luca Giuliani, Tragik, Trauer und Trost: Bildervasen für eine apulische Totenfeier, Berlin. Graf (1979): Fritz Graf, “Das Götterbild aus dem Taurerland”, Antike Welt 10, 33–41. Green (2007): Carin M. C. Green, Roman Religion and the Cult of Diana at Aricia, Cambridge. Hall (1992): Edith Hall, “When is a myth not a myth? Bernal’s ‘Ancient Model’”, Arethusa 25, 181–201. Hall (2010): Edith Hall, “Iphigenia in Oxyrhynchus and India: Greek tragedy for everyone”, in: S. Tsiridis (Hg.), Parachoregema: Studs. G.M. Sifakis, Heraklion, 225–250. Hall (2012): Edith Hall, Adventures with Iphigenia in Tauris: A Cultural History of Euripides’ Black Sea Tragedy, New York. Hall (2013): Edith Hall, “Why was ‘Iphigenia in Tauris’ so popular in the fourth century BCE?”, in: Eric Csapo u. Peter Wilson (Hgg.), Greek Theatre in the Fourth Century BC, Cambridge. Herman (1987): Gabriel Herman, Ritualised Friendship and the Greek City, Cambridge. Hölscher (1991): Tonio Hölscher, “Augustus and Orestes”, Travaux du Centre d’Archéologie Méditerranéenne de l’Académie Polonaise des Sciences 30, E˙tudes et Travaux 15, 164–168. Hölscher (2004): Tonio Hölscher, The Language of Images in Roman Art, Cambridge. Huskinson (2002): Janet Huskinson, “Representing women on Roman sarcophagi”, in: Anne McClanan u. Karen R. Encarnacion (Hgg.), Personal Objects, Social Subjects: The material culture of sex, procreation and marriage in pre-modern Europe, New York, 11–31. Huskinosn (2008): Janet Huskinson, “Pantomime performance and figured scenes on Roman sarcophagi”, in: Edith Hall u. Rosie Wyles (Hgg.), New Directions in Ancient Pantomime, Oxford, 87–109. Jucker (1988): Ines Jucker, “Euripides und der Mythos von Orest und Iphigenie in der bildenden Kunst”, in: Bernhard Zimmermann (Hg.), Euripides, Iphigenie bei den Taurern, übersetzt von Georg Finsler, Stuttgart, 105–138. Kampmann (1998): U. Kampmann, “Homonoia Politics in Asia Minor: The Example of Pergamon”, in: Helmut Koester (Hg.), Pergamon, Citadel of the Gods, Harvard Theological Studies 46, Cambridge, MA, 373–393.
Tragic Myth as Medium of Social and Cultural History
131
Kastelic (1999): Joze Kastelic, “The Alcestis sarcophagus and the Orestes sarcophagus in the Vatican and reliefs in Åempter”, Arheoloˇski Vestnik 50, 259–286. Koch u. Sichtermann (1982): Guntram Koch u. Hellmut Sichtermann, Römische Sarkophage [= Handbuch der Archäologie], München. Koortbojian (1995): Michael Koortbojian, Myth, Meaning and Memory on Roman Sarcophagi, Berkeley, CA. Manuwald (2003): Gesine Manuwald, Pacuvius: Summus tragicus poeta, Munich – Leipzig. Mele (1987): Alfonso Mele, “Aristodemo, Cuma e il Lazio”, in: Mauro Cristofani (Hg.), Etruria e Lazio arcaico [= Quaderni del Centro di studio per l’archeologia etrusco-italica 15], Rom, 155–177. Merkelbach u. Josef Stauber (1998): Reinhold Merkelbach u. Josef Stauber (Hgg.), Steinepigramme aus dem griechischen Osten, Stuttgart/Leipzig. Mionnet (1809): Théodore Mionnet, Description des me’dailles antiques, grecques et romaines, Vol. 4, Paris. Morizot (1994): Yvette Morizot, “Artémis: l’eau et le vie humaine”, in: René Ginouvès (Hg.) L’eau, la santeì et la maladie dans le monde grec, Athens, 201–213. Morpurgo (1931): Lucia Morpurgo, “Nemi-Teatro ed altri edifice romani in contrada ‘La Valle’”, Notizie degli Scavi di Antichità (Reale Accademia Nazionale de Lincei), 237–305. Pairault (1969): Francoise Hélène Pairault, “Diana Nemorensis”, Mélanges de l’Ecole française de Rome. Antiquité 81, 425–471. Peter (1914): Hermann Peter (Hg.), Historicorum Romanorum Reliquiae, Bd. 1, Leipzig. Robinson (1932): David M. Robinson, “Archaeological discussions”, American Journal of Archaeology 36, 521–555. Sichtermann u. Koch (1975): Hellmut Sichtermann u. Guntram Koch, Griechische Mythen auf römischen Sarkophagen, überarbeitet von Gerhard Singer, Tübingen. Smith (1978): Jonathan Z. Smith, Map is not Territory: Studies in the History of Religions, Leiden. Stenico (1966): Arturo Stenico, “I figli di Agamemnone a Sminthe. Toreutica e ceramica arretina”, in: Arte in Europa. Scritti di Storia dell’ Arte in onore di E. Arslan, Bd. 1, Mailand, 29–24. Strelan (1996): Rich Strelan, Paul, Artemis, and the Jews in Ephesus, Berlin/New York. Turcan (1978): Robert Turcan, “Les sarcophages romains et le problem du symbolisme funéraire”, in: Wolfgang Haase (Hg.), Aufstieg und Niedergang der römischen Welt 16.2, 1700–1735. Zanker u. Ewald (2004): Paul Zanker u. Christian B. Ewald, Mit Mythen leben. Die Bilderwelt der römischen Sarkophage, München.
Abbildungsnachweise Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6 Fig. 7
Watercolour reproduced by courtesy of the British Museum, London Photo reproduced courtesy of the British Museum, London Photo by Michel Amandry, Paris, Bibliothèque nationale de France LIMC V.2 s.v. ‘Iphigenia’ no. 29 LIMC V.2 s.v. ‘Iphigeneia’ no. 73 LIMC V.2 s.v. ‘Iphigeneia’ no. 75 Bielfeldt (2005) Pl. 3 Fig. 2
132
Angelos Chaniotis
Angelos Chaniotis
Mnemopoetik: Die epigraphische Konstruktion von Erinnerung in den griechischen Poleis 1 Epigraphisch überlieferte Texte als Medium 1 der Erinnerung 1 Kurz nach meinem 50. Geburtstag fing ich an, Orhan Pamuks Istanbul zu lesen. Es war, als ob ich von einem Zauberstab berührt worden wäre, der die Erinnerungen an meine eigene Kindheit wachrief. Woran ich mich erinnerte, das waren Fragmente, keine Handlungssequenzen. Ich konnte mich an den Namen der Buchhandlung erinnern, wo ich meine ersten Schulbücher kaufte; an die Hausmeisterin meiner ersten Schule, die die Glocke am Ende der Pause läutete; an eine Karnevalmaske und ihren Geruch; an den Hut meines Vaters, und wie er sich anfühlte; an das erste Mal, dass ich Coca Cola getrunken habe; an die Stimme des Nachrichtensprechers am Tag des Putsches von 1967. Diese Fragmente fügten sich aber nicht in eine kontinuierlich zu erzählende Geschichte zusammen, wie die Geschichten, die Orhan Pamuk von seiner eigenen Kindheit erzählt. Die einzigen Ereignisse, die aus mehr als einem winzigen Fragment bestanden, waren Ereignisse, die in meiner Familie immer wieder – irgendwann auch von mir selbst – erzählt wurden, oder Ereignisse, über die ich oft nachgedacht hatte, also Ereignisse, die ich mir selbst gewissermaßen erzählte. Die Erzählung, die sprachliche Ausformulierung und somit die Strukturierung machen den Unterschied zwischen Erinnerungsfragmenten und erinnerten Geschichten aus. Die Erinnerungsfragmente sind sozusagen rohes Quellenmaterial meiner eigenen Vita, die Erzählungen das Ergebnis von Auswahl und Konstruktion. Das Quellenmaterial des Althistorikers ähnelt meinen Erinnerungen. Die Grundlage unserer Arbeit sind literarische Quellen, die der Vergangenheit eine Struktur geben: die Werke der Historiker, der Geographen, der Philosophen, der Dichter, der Grammatiker. Ihre Autoren präsentieren einen nach subjektiven Kriterien ausgewählten Teil von dem, was Menschen beobachtet, erlebt oder erfunden haben. Neben diesen strukturierten Darstellungen stehen isolierte Zeugnisse: eine Grabinschrift, der Brief einer Mutter an ihren Sohn auf einem Papyrus, ein Amphorenstempel, ein Gefäß mit einer Schlachtdarstellung, eine Kultregelung, das Edikt eines römischen Statthalters, die Ehreninschrift für einen Kaiser, eine Weihung, ein Orakelspruch, die Beichte eines Sünders, der Fluch einer zornigen Frau usw. Erst durch unsere Bearbeitung, die
1 Für epigraphische Corpora werden die Abkürzungen des Supplementum Epigraphicum Graecum verwendet.
Mnemopoetik
133
diese Bausteine in einen (re)konstruierten Kontext setzt, werden diese Zeugnisse Teil einer Erzählung. Die Inschriften – und generell die dokumentarischen Quellen – kommen zu uns als Bausteine, mit denen wir ‚unsere‘ Darstellung der Vergangenheit bauen. Die erzählenden literarischen Quellen dagegen werden als fertiges Gebäude geliefert, das wir mit unseren methodischen Mitteln in seine Bestandteile auseinandernehmen und wieder zusammensetzen. Viele Inschriften sind in der Tat lose Bausteine. Aber nicht ihnen gilt diese Studie, sondern jenen Inschriften, öffentlichen wie privaten, die zwar als loses Material überliefert werden, als versteinerte, isolierte Erinnerungen, aber in ihrer Entstehungszeit Bestandteile einer Konstruktion waren, einer Konstruktion von Vergangenheit für die Zukunft. In dieser Untersuchung ist eine scharfe Trennung zwischen Bürgergemeinden und Monarchien notwendig, und aus diesem methodologischen Grund wird hier nur von der epigraphischen Konstruktion von Erinnerung in den griechischen Poleis die Rede sein. Wie Alleinherrscher ihr Bild von der Vergangenheit durch das Medium der Inschrift, z.B. durch Tatenberichte2, prägten, kann hier nicht berücksichtigt werden. Die Bezeichnung ‚Inschrift‘ läßt die Distanz zwischen den literarischen Quellen und den auf Stein überlieferten Zeugnissen größer erscheinen als sie wirklich ist. Die Inschriften sind an erster Stelle Texte; sie haben Autoren und Adressaten; sie sind Produkte von Komposition und Intention. Man sollte eher von ‚epigraphisch überlieferten Texten‘ reden. Obwohl die Inschriften primär Texte sind und auch literarische Texte (Epigramme, historiographische Werke, Hymnen, Reden, wissenschaftliche Abhandlungen, Biographien usw.) umfassen3, gibt es grundlegende Unterschiede zwischen epigraphischen bzw. literarischen Texten sowohl im Inhalt als auch in der Funktion als Medium der Kommunikation. Die beiden größten Gruppen epigraphisch überlieferter Texte, die Grabinschriften und die Weihungen, waren ausschließlich für die inschriftliche Aufzeichnung bestimmt und sind nur sekundär in literarischen Quellen zu finden, z.B. in den Werken von Historikern oder Periegeten4. Andere Texte (Verträge, Dekrete, Gesetze, Briefe usw.) waren an erster Stelle für die Aufbewahrung in öffentlichen Archiven bestimmt5 und sind nur aufgrund von Selektion epi-
2 Der Bericht Prolemaios’ III. von seinem Feldzug in Asien während des 3. Syrischen Krieges (246 v. Chr.) ist das früheste Beispiel von solchen Tatenberichten (OGIS 54), die Res Gestae Divi Augusti das Bekannteste: einige Beispiele in Baslez (1993) 71–72. 3 Beispiele in Chaniotis (1988) 278–286. 4 Z.B. Herodot: West (1985) und Fabiani (2003); Thukydides: Meyer (1955) und Bearzot (2003) 272–276; Pausanias: Habicht (1985) 64–94; Whittaker (1991); Zizza (2006). Antike Sammlungen von Inschriften: Krateros, FGrH 342 (SynagvgÎ tân chfismˇtvn); Philochoros, FGrH 328 T1 (#Epigrˇmmata [ttikˇ); Polemon von Ilion: Strab. 9.1.6 (PerÏ tân $naùhmˇtvn tân ãn $kropfilei); Athen. 10.436 d und 442 e (PerÏ tân kat@ pfilei« ãpigrammˇtvn); die ‚Anagraphe von Lindos‘: s.u. Anm. 33. 5 Über Archive in griechischen Städten s. jüngst Faraguna (2005) 61–86; s. auch Sickinger (1999) zu Athen; Rhodes (2001) 33–44; Weiss (2004) 78–84 (öffentliche Sklaven und ihre Verantwortung für Archive).
134
Angelos Chaniotis
graphisch, seltener auch literarisch, überliefert worden. Durch die Verwendung von nicht vergänglichem Material und die Aufstellung an öffentlichen Orten – Agoras, Heiligtümern, Friedhöfen, Gymnasien – sollen die primär ‚epigraphisch überlieferten Texte‘ ihre Adressaten dauerhaft und in großen Zahlen erreichen. Wenn ihre Aufzeichnung auf die Initiative eines Kollektivs (Volksversammlung, Rat, Verein usw.) zurückgeht, beanspruchen die ‚epigraphisch überlieferten Texte‘ auch eine gewisse Autorität und Zuverlässigkeit, die über die Tatsache hinwegtäuscht, dass sie Kompositionen einzelner Individuen sind. Die epigraphisch überlieferten Texte haben einen Verfasser, auch wenn wir ihn oft namentlich nicht kennen. Was sie darstellen und wie sie es darstellen, ist das Ergebnis von Komposition, und auch darin unterscheiden sich die epigraphisch überlieferten Texte nicht von den literarischen Quellen. Manche Verfasser epigraphisch überlieferter Texte waren literarische Persönlichkeiten ersten Ranges, wie Simonides, Aristoteles, Demosthenes und Herodes Atticus6. Die epigraphisch überlieferten Texte haben Adressaten – Leser7 und Zuhörer –, ja Adressaten, die sie manchmal explizit ansprechen. Manchmal insinuieren sie sogar ein Gespräch mit ihrem Leser8. Obwohl wir es meistens nicht erkennen können, setzen die für die Öffentlichkeit bestimmten Inschriften ein strukturiertes und konstruiertes Bild von der Vergangenheit voraus, das den Menschen der Zukunft überliefert werden soll. Sie unterscheiden sich nicht von der Geschichtsschreibung als Zeugnisse einer ‚intentionalen Historie‘9. Sie konstruieren die Erinnerung der Zukunft. Eben diese Funktion, die Konstruktion der Erinnerung der Zukunft bezeichne ich als ‚Mnemopoetik‘. Der Begriff Mnemopoetik impliziert zweierlei: Die Erinnerung, die von Inschriften überliefert wird, ist erstens konstruierte Erinnerung (mneme + poiein) und zweitens Komposition (mneme + Poetik)10. Epigraphisch überlieferte Texte konstruieren zwei Formen von Erinnerung: erstens Erinnerung an gemeinsam erlebte Ereignisse (also das kollektive Gedächtnis im engeren Sinne); und zweitens Erinnerung an tradierte Fakten der fernen Vergangenheit (also kulturelles Gedächtnis)11.
6 Simonides: Petrovic (2007). Aristoteles (Pythionikon Anagraphe): F. Delphes III.1.400; GHI II 187; Chaniotis (1988) 293–296; Demosthenes: Lambert (2001); Herodes Atticus: Tobin (1997) 113–160. 7 Beispiele für die Lektüre von Inschriften in Chaniotis (2012a). S. auch Hedrick (2006) 111–121. 8 Zuletzt (mit weiterer Literatur): Tsagalis (2008) 252–261; Baumbach, Petrovic u. Petrovic (2010) 11–13; Schmitz (2010); Tueller (2010); Vestrheim (2010). 9 Zum Begriff der intentional history s. Gehrke (2001); Dillery (2005) 519–522 (mit weiterer Bibliographie); Foxhall u. Luraghi (2010). Zur Bedeutung der attischen Inschriften des 4. Jh. für das Studium der damaligen Auffassung von der Vergangenheit s. Lambert (2012b). 10 Als ich den Begriff ‚mnemopoetic‘ in diesem Sinne in einem Vortrag 2005 verwendete (Chaniotis (2009a) 253–255), wusste ich nicht, dass bereits 1997 Mererid Davies in einem unpublizierten Vortrag den Begriff ‚mnemopoetics‘ geschaffen hatte; s. Bada (2008) 12. 11 Zu diesem Unterschied zwischen kollektivem und kulturellem Gedächtnis s. Chaniotis (2005) 215–216 und Chaniotis (2009a) 255–259.
Mnemopoetik
135
Die ‚mnemopoetische‘ Funktion von Inschriften werde ich vor allem anhand einer 2003 veröffentlichten Inschrift aus Metropolis (Ionien) skizzieren (s. Anhang Text A)12. Es handelt sich um einen Block einer Statuenbasis, welche die Bronzestatue eines prominenten Bürgers und Offiziers, nämlich eines gewissen Apollonios, trug, der in einer Schlacht zu Beginn des Krieges zwischen den Römern und dem Rebellen Aristonikos (Mai 132 v. Chr.) gefallen war. Die Statue stand direkt vor dem Rathaus der Stadt. Auf der Basis waren mehrere Texte aufgezeichnet, von denen drei erhalten sind. Auf der Vorderseite stand der Beschluss, Apollonios posthum zu ehren (A Z. 1–48) und eine Liste der in derselben Schlacht gefallenen Männer (A Z. 49–56); auf einer der Seiten zeichnete man zur gleichen Zeit einen älteren Ehrenbeschluss für denselben Apollonios auf (B Z. 1–40). Eine kurze Ehreninschrift, die auf der Basis anzubringen war13, stand wohl auf einem der verlorenen Blöcke und ist nicht mehr erhalten. Ob später auch weitere Texte (auf heute nicht mehr erhaltene Blöcke der Basis) aufgezeichnet wurden, kann man nicht sagen14. In dieser einen Inschrift kann man in paradigmatischer Weise einige Aspekte der epigraphischen Konstruktion von Erinnerung beobachten.
2 Epigraphische Texte sind das Ergebnis von Auswahl Eine typische Klausel griechischer Dokumente öffentlichen Charakters betrifft deren Aufzeichnung. Wir finden diese Klausel auch im Psephisma von Metropolis: Dieser Volksbeschluss und jener, der frührer für ihn ergangen ist, sollen auf dem Marktplatz auf einen Sockel aufgezeichnet werden, damit, wenn auch die übrigen die Haltung des Volks gegen gute und tugendhafte Männer erkennen, sie sich auch selbst der Tugend zuwenden. Man soll auch die Namen der im Kampf Gefallenen mit aufschreiben, damit auch jene eine Ehrung vom Volk erhalten. (A Z. 45–47)
Allein die Existenz einer Aufzeichnungsklausel zeigt, dass nicht jede Urkunde epigraphisch aufgezeichnet wurde15. Einige Urkunden wurden aus praktischen Gründen
12 Dreyer u. Engelmann (2003) = I.Metropolis 1; SEG LIII 1312; An.Ép (2003) Nr. 1679. Zum historischen Kontext der Inschrift, auf den ich hier nicht eingehen kann, s. vor allem Jones (2004); Coarelli (2005); Dreyer (2005); Daubner (2006) 68–70; Virgilio (2006). 13 A Z. 38–40: ãpigrafÎn poihsamwnoy«· „^O d[á]mo« [pollØnion [ttˇloy toÜ ~ndrvno« $retá« õneken kaÏ e\no›a« fl« öxvn dietwlei prÌ« t@ ^Rvma›vn prˇgmata kaÏ prÌ« tÎn pfilin“ („Das Volk ehrt Apollonios, Sohn des Attalos, Enkel des Andron, für seine Tugend und das Wohlwollen, das er stets gegenüber den Interessen der Römer und der Stadt zeigte“). 14 Für die Aufzeichnung weiterer Texte auf der Statuenbasis eines Kriegshelden s. Ma (2005). 15 Vgl. Eilers (2009).
136
Angelos Chaniotis
aufgezeichnet, nur damit sie nachgeschlagen werden konnten – so etwa die Regelung über der Verkauf des Amtes des Priesters der Homonoia in Kos16. Andere aber erfüllten eine erzieherische oder kommemorative Funktion, selbst wenn dies nicht explizit gesagt wird. Sie wurden für die Aufzeichnung ausgewählt, weil sie für künftige Adressaten geeignet waren. Die Aufzeichnung in Metropolis erfüllte primär ein erzieherisches Ziel. Die Inschrift sollte als Exemplum dienen. Dies wird sehr oft in griechischen Beschlüssen in der sogenannten Hortativformel zum Ausdruck gebracht17. Eine etwa zeitgenössische Inschrift von Eretria zu Ehren eines gewissen Theopompos ist ein gutes Beispiel für diese Praxis18: Damit es offenbar wird, dass das Volk die in Tugend und Ansehen herausregenden Männer ehrt und damit sich viele um die gleichen Ehren mit Eifer bemühen, wenn die guten und tugendhaften Männer geehrt werden, … möge man ihn mit einem goldenen Kranz und zwei bronzenen Bildnissen auszeichnen; eine von ihnen soll man im Heiligtum der Artemis, am Ort der größten Sichtbarkeit, aufstellen, die andere im Gymnasion. Man soll folgendes aufzeichnen: ‚Das Volk der Eretrieis ehrt Theopompos, Sohn des Archedemos, für seine Tugend und sein Wohlwollen gegenüber dem Volk‘. Diesen Beschluss soll man auf zwei steinerne Stelen aufzeichnen und neben die Bildnisse aufstellen, damit seine Größe und Tugend sowie die Dankbarkeit des Volkes gegenüber den guten und tugendhaften Männern allen Bürgern und den anwesenden Fremden sichtbar ist und sie sich um das Gleiche mit Eifer bemühen.
Je konkreter das Exemplum, desto glaubwürdiger und wirksamer. Der Ehrenbeschluss für Apollonios beschreibt die näheren Umstände seines Todes, und so vermittelt er auch eine bestimmte Version der jüngsten historischen Ereignisse19. Auf der Statuenbasis aufgezeichnet, wendete er sich an die künftigen Bürger und erfüllte eine kommemorative Funktion als hypomnema.
16 SEG LV 931 = IG XII.4.315. 17 Zur Hortativformel in Athen s. Henry (1996); Luraghi (2010) 249–251; Lambert (2011a) 194–197; Lambert (2011b) 176–178; allgemein: McLean (2002) 221–222. S. auch Demosthenes, Gegen Leptines (20) 64. 18 IG XII.9.236 + Suppl. 553 (um 100 v. Chr.): ƒpv« oÛn kaÏ Ç dámo« e\xˇristo« fa›nhtai timân toŒ« $retÕ kaÏ dfij> diafwronta« ¡ndra«, zhlvta› te polloÏ tân Çmo›vn g›nvntai timvmwnvn {te} tân kalân kaÏ $gaùân $ndrân … stefa[n]âsai a\tÌn xrysˆ stefˇn8 kaÏ eåkfisin xalkaÖ« dys›n, ìn tÎn mÍn m›an stásai ãn tˆ Åerˆ tá« [rtwmido« tá« [marys›a« ãn tˆ ãpifanestˇt8 tfip8, tÎn dÍ ¡llhn ãn tˆ gymnas›8 ãpigrˇcanta«· „Ç dámo« Ç #Eretriwvn Uefipompon [rxed‹moy $retá« õneken kaÏ e\no›a« tá« eå« aÉtfin“· $nagrˇcai dÍ tfide tÌ c‹fisma eå« st‹la« liù›na« d÷o kaÏ $naùeÖnai par@ t@« eåkfina«, ƒpv« ãkfanΫ Épˇrx> toÖ« te pol›tai« p»sin kaÏ tân jwnvn toÖ« parepidhmoÜsin û te toÜ $ndrÌ« megalomwreia kaÏ kalok$gaù›a kaÏ Ł toÜ d‹moy e\xarist›a eå« toŒ« kaloŒ« kaÏ $gaùoŒ« ¡ndra« kaÏ polloÏ zhlvtaÏ g›nvntai tân Çmo›vn. Weitere Beispiele in Anm. 23. 19 S. u. S. 151–153.
Mnemopoetik
137
3 Epigraphische Texte sind hypomnemata Epigraphisch überlieferte Texte sind hypomnemata: Gedächtnisstützen und Medien der Erinnerungskontrolle. Ein gutes Beispiel für diese Funktion ist ein in Xanthos gefundenes Dokumentendossier (206 v. Chr.)20. Sein eigentlicher Gegenstand ist die Bitte der kleinen Stadt Kytenion in Doris um finanzielle Unterstützung für den Wiederaufbau der durch Erdbeben und den anschließenden Angriff des makedonischen Königs zerstörten Stadtmauer. Wen würde es überraschen, wenn der Beschluss aufgezeichnet worden wäre, um die Großzügigkeit der Xanthier zu belegen? Denn geleistete Wohltaten werden auf Stein registriert, nicht verweigerte – ein klarer Fall von Auswahl der mitgeteilten Information. Der Beschluss teilt uns jedoch mit, dass die Xanthier aufgrund der eigenen finanziellen Engpässe nur den lächerlichen Betrag von 500 Drachmen geben konnten: „Wenn der Haushalt der Stadt nicht in dieser Lage wäre, hätten wir unser Wohlwollen gezeigt und alle anderen in Menschenfreundlichkeit übertroffen“. Ist denn der Beschluss nur als Zeugnis der Höflichkeit der Xanthier aufgezeichnet? Der Text fährt fort: Damit auch die Nachkommen ein Erinnerungsstück (hypomnema) unserer Freundschaft zu den Doriern und unserer Zuneigung aufgrund unserer Verwandtschaft zu ihnen haben, sollen die Beamten den Beschluss der Ätoler, auch den von den Strategen und Ratsmitgliedern geschriebenen Brief, ebenso den von den Doriern an unsere Stadt geschickten Brief und auch diesen Beschluss auf eine steinerne Stele aufzeichnen und im Heiligtum der Leto weihen. (A Z. 49–52)
Darum ging es also: Die Gesandten der Kytenier hatten den Xanthiern den Beweis geliefert, dass sie mit den Doriern verwandt waren. Ihre Erzählung mit Hinweisen auf Göttergeburten und Kolonisationsmythen wird im Dekret zusammengefasst. Der anonyme Xanthier, der diesen Text entwarf, präsentierte mit dieser Inschrift nicht nur eine selektive Version der Gegenwart – die schwere Not, die finanziellen Leistungen der Reichen, die Bestürzung der Volksversammlung über das schwere Schicksal der armen Verwandten aus der alten Welt –, sondern verewigte auch eine konstruierte Version der Vergangenheit. Um künftige Erinnerung zu kontrollieren, nahmen die Xanthier, trotz ihrer finanziellen Not, beträchtliche Kosten auf sich. Denn diese Inschrift hat etwa 4,500 Buchstaben, für deren Aufzeichnung ein Steinmetz ein Honorar von etwa 45 Drachmen erhalten haben mag21. Hinzu kamen noch die Kosten für die Stele aus Kalkstein. Das war es den Xanthiern wert. Die epigraphische Aufzeichnung vieler Urkunden hat also eine kommemorative Funktion, die mit dem Wort hypomnema zum Ausdruck gebracht wird. Hypomnema
20 SEG XXXVIII 1476. Die Inschrift ist oft behandelt worden: Bousquet (1988); Curty (1995) 183–191 Nr. 75; Hadzis (1997); Jones (1999) 61–62, 139–143; Paschidis (2008) 328–332; Chaniotis (2009a) 249–255. 21 Für das Honorar eines Steinmetzen im späten 4. Jh. v. Chr. (1 Drachme für 100 Buchstaben) geben die delphischen Rechnungen Auskunft: CID II 74 col. II Z. 8; 98 B 7–8.
138
Angelos Chaniotis
ist eine Gedächtnisstütze, das Medium für die Kontrolle von Erinnerung. Als hypomnema werden historische Gedenktage bezeichnet, Denkmäler, Weihungen, Ehrenstatuen, Ehrenkränze und Gräber22. In den meisten Fällen finden wir aber das Wort hypomnema als Begründung der Aufzeichnung einer Urkunde23, manchmal mit dem ausdrücklichen Hinweis darauf, dass die Inschrift als Erinnerung für die Nachkommen (ãpigignfimenoi) dienen soll24. Kein Beleg für hypomnema in diesem Sinne ist älter als das ausgehende 4. Jh. v. Chr.25, und dies hängt m.E. mit Veränderungen im Geschichtsbewusstsein in der ausgehenden klassischen Zeit und mit einer größeren Sensibilisierung für die kommemorative Funktion von öffentlichen Inschriften zusammen – mit einem ‚commemorative turn‘ sozusagen. Die relevanten Phänomene können wir am besten im Hellenismus und dann in der Kaiserzeit beochachten. Sie reichen von der epigraphischen Veröffentlichung historiographischer Werke, der Sammlung und Aufzeichnung alter (oder gefälschter) Urkunden und der Ehrung ‚beruflich spezialisierter‘ Historiker für ihre öffentlichen Vorträge bis zur langen biographischen Ehrendekreten, Genealogien, chronikartigen Notizen in Listen von Magistraten und der Begründung diplomatischer Beziehungen mit Hinweisen auf eine mythische Verwandtschaft26.
22 Gedenktage: IG II2 657, 680, 834; Agora XVI 114; F.Delphes III.1.482; III.3.215; III.4.367; IG IX2.1.194; IG XII.9.192. Historisches Denkmal: IG II2 677 (s.u. S. 145). Weihungen: IG II2 1034, 1036, 1224, 1326. Weihung im Zusammenhnag mit Liturgien: SEG XLV 101. Ehrenstatuen: IG II2 1326; IG XII.7.240: Ehrenkranz: Agora XVI 123. Grabmäler: I.Kyzikos 113, 118, 252, 352, 525 und viele andere; SEG XXIX 268. 23 Einige Beispiele: IG II2 570, 637, 653, 677, 706, 858, 891, 895, 908, 909, 927, 954, 982, 984, 987, 997, 1008, 1011, 1024, 1037, 1047, 1223, 1224, 1331, 1534; Agora XVI 276; IG XII.3.331; XII.9.237. S. auch Hedrick (1999) 421–422 und 434; Luraghi (2010) 259–260. 24 So z.B. im Beschluss der Theaterkünstler für Aribazos (Athen, um 130 v. Chr.): IG II2 1331 + add. Z. 6–8: ƒpv« t[á« te [ribˇzoy megalome]re›a« Épˇrx> Épfimnhma toÖ« ãpiginomwno[i« kaÏ tá« ÉpÌ tân texni]tân gegone›a« eå« a\tÌn e\xarist›a« („damit die Nachkommen eine Erinnerung haben an die Großzügigkeit des Aribazos und an die Dankbarkeit, die ihm die Techniten zukommen ließen“); I.Kaunos 17: ¬na dÍ kaÏ toÖ« ãpiginomwnoi« Épfimnhma katale›phtai tá« tân proe irhmwnvn $ndrân ˙ ˙ $retá« kaÏ tá« toÜ d‹moy toÜ Zmyrna›vn e\xarist›a« („damit für die Nachkommen eine Erinnerung an die Tugend der vorher erwähnten Männer und an die Dankbarkeit des Volkes der Smyrnäer bleibt“); vgl. IG XII.8.269; IG XII.9.237; SEG LVIII 370 Z. 84–85. 25 Aus einer Suche in der epigraphischen Datenbank des Packard Humanities Institute ergibt sich, dass die frühesten Belege aus dem ausgehenden 4. Jh. v. Chr. in Athen stammen: Agora XVI 114 (304 v. Chr.); IG II2 570 (spätes 4. Jh.). 26 Für die zeitliche Verbreitung dieser Phänomene s. Chaniotis (1988) 133–139, 354–389. Historiographische Werke in Inschriften: Chaniotis (1988) 14–182; Sammlung und (Neu)aufzeichnung von Urkunden und alten Inschriften: Chaniotis (1988) 234–277; vgl. Davies (2003) 333–339; s. auch S. 139–145; Ehreninschriften für Historiker: Chaniotis (1988) 287–389; Clarke (2005); Schepens (2006); Hamon (2008); biographische Dekrete: s.u. Anm. 79; Genealogien: Chaniotis (1988) 223–226; chronikartige Notizen: Chaniotis (1988) 188–190; mythische Verwandtschaft und Diplomatie: Chaniotis (1988) 80–86, 114–116, 149, 364; Curty (1995), (1999) und (2005); Jones (1999).
Mnemopoetik
139
4 Epigraphische Texte wurden als historische Zeugnisse verstanden Aus der Aufzeichnungsklausel der Inschrift von Metropolis (A Z. 12 und 46) erfahren wir, dass Apollonios schon einmal im Jahr 144 v. Chr. für seine Leistungen geehrt worden war. Jenes Ehrendekret ordnete Apollonios’ Bekränzung im Theater an, damals war aber eine Aufzeichnung nicht vorgesehen. Erst der heroische Tod des Apollonios im Krieg zwölf Jahre später führte zur nachträglichen Aufzeichnung des alten Beschlusses (s. Anhang Text B). Der alte Text wurde nicht wegen der nicht mehr aktuellen Maßnahmen, die er enthielt, veröffentlicht, sondern als historisches Zeugnis über die Vita eines lokalen Helden. Die epigraphische Veröffentlichung eines alten Dokuments ist eine übersteigerte Form der Auswahl dessen, was aufgezeichnet werden soll. Dieses Phänomen habe ich bereits einmal ausführlich besprochen und seine Verwandtschaft zur Historiographie begründet27. Ich fasse kurz die Ergebnisse zusammen.
a) Wiederaufzeichnung zerstörter Inschriften Manche Texte wurden wegen ihrer historischen Bedeutung wiederaufgezeichnet, weil die ursprüngliche Inschrift zerstört worden war. Die Entscheidung, welche Inschriften restauriert werden sollen, war fast immer politisch motiviert. Eine politische Motivation erklärt z.B. die Restaurierung von Inschriften, die in Athen während der Herrschaft der Dreißig Tyrannen zerstört worden waren28. Ein derartiges Vorgehen setzt ein historisches Bewusstsein voraus. Eine athenische Weihung liefert ein gutes Beispiel. Im Jahr 506 v. Chr. errichteten die Athener auf der Akropolis ein Viergespann als Siegesdenkmal. Das dazugehörige Epigramm erinnerte an den Sieg über die Böoter und die Chalkider29. Erst seit wenigen Jahren wissen wir, dass die Böoter zur gleichen Zeit eine andere Version vom gleichen Krieg epigraphisch präsentiert hatten. Ein in Theben gefundenes Weihepigramm erwähnt ihre anfänglichen Siege und die Befreiung chalkidischer Gefangener, nicht aber
27 Chaniotis (1988) 234–277; vgl. Davies (1996) und (2003). 28 Chaniotis (1988) 238–239. Für ein weiteres Beispiel eines zerstörten Ehrendekretes s. IG II2 448 und Luraghi (2010) 256. 29 IG I3 501; CEG I 179 (cf. Hdt. 5.77.4). Zum Text s. zuletzt Petrovic (2007) 209–222: desmˆ ãn †$xnywnti† siderwoi ösbesan h÷brin | paÖde« [ùena›on örgmasi ãm polwmo | öùnea Boivtân kaÏ Xalkidwon damˇsante« | tân h›ppo« dekˇten Pallˇdi tˇsd# öùesan („Mit schmerzlicher eiserner Fussfessel haben die Söhne Athens Hybris ausgelöscht, als sie durch ihre Kriegstaten die Völker der Böotier und Chalkideer bezwangen. Davon weihten sie Zehntel diese Stuten der Pallas“, übers. A. Petrovic).
140
Angelos Chaniotis
die Niederlage30. Das athenische Denkmal und die Inschrift wurden 480 v. Chr. von den Persern zerstört. Eine Restaurierung erfolgte nicht sofort, sondern wahrscheinlich nach einem neuen athenischen Sieg – entweder 457 v. Chr. über die Böoter oder 446 v. Chr. über die Chalkider. Bei der Wiederaufzeichnung bezogen die Athener den Text zugleich auf das spätere Ereignis, was zur Änderung der Reihenfolge der Verse führte31. Unter den vielen Fällen von Inschriften, deren Restaurierung eine ‚mnemopoetische‘ Funktion hatte, nenne ich nur noch ein Beispiel. Im Jahre 99 v. Chr. verfassten die Lindier Timachidas und Thrasagoras im Auftrag ihrer Gemeinde einen Katalog der alten, im Laufe der Zeit zerstörten Weihungen im Heiligtum der Athena Lindia32. Die Abfassung dieser Sammlung wurde im Hinblick auf das Alter und den Ruhm des Heiligtums begründet33. Die meisten Weihinschriften dieser Sammlung sind jedoch Fälschungen34.
b) Veröffentlichung ‚historischer‘ Urkunden Die lindische Sammlung von (meist gefälschten) Weihinschriften ist mit der Auswahl und Veröffentlichung alter, für das Geschichtsbewusstsein einer Gemeinde wichtiger Urkunden verwandt35. Auch solche Dokumente erweisen sich oft als Fälschungen. Das bekannteste Dossier dieser Art besteht aus Dokumenten über die Perserkriege, die in Athen in der Mitte des 4. Jhs. von Rednern zitiert und teilweise aufgezeichnet wurden36. Auch das in Troizen im frühen 3. Jh. v. Chr. aufgestellte ‚Themistokles-
30 SEG LIV 518 und LVI 521: [---] o« ˙oinfia« kaÏ Fyl»« | [---] helfinte« kãleysÖna | [---]ai Xalk›da ˙ lysˇmenoi | [---]moi $nwùeian („Sie eroberten Oinoe und Phlylai und – Eleusis – Chalkis – sie befreiten ˙ und weihten“). S. Aravantinos (2006). Zum historischen Kontext s. Berti (2010b). 31 Page (1981) 192; Petrovic (2007) 214. Berti (2010a) bevorzugt die frühere Datierung (457 v. Chr.). 32 I.Lindos 2; neueste kritische Edition und Kommentar: Higbie 2003; vgl. meine Korrekturen in SEG LIII 821 und die Besprechung von Bresson (2006). Zur Bedeutung des Textes für das historische Bewussstein der Rhodier s. Chaniotis (1988) 52–57, 116–117; Chaniotis (2005) 222; Koch Piettre (2005); Shaya (2005); Massar (2006). 33 I.Lindos 2 Z. 2–3: [ãpeÏ tÌ ÅerÌ]n t»« [ùˇna« t»« Lind›a« $rxaifitatfin te kaÏ ãntimfi[ta]ton Épˇrxon. Zu den unterschiedlichen Ergänzungen des Dekrets s. zuletzt Ryan (2007) und SEG LVII 765. 34 Chaniotis (1988) 267–270. Für die Methoden antiker Fälscher von Inschriften s. Chaniotis (1999) 61–64. 35 Chaniotis (1988) 274–275. 36 Grundlegend: Habicht (1961). S. auch Chaniotis (1988) 238–243, 259–263. Neulich hat Krentz (2007) die Ansicht vertreten, dass der auf einer Stele in Acharnai aufgezeichneter Eid nicht jener von Plataiai ist – ausführlich behandelt durch Siewert (1972) –, sondern der Eid der Athener vor der Schlacht bei Marathon.
Mnemopoetik
141
Dekret‘ gehört zu dieser Gruppe37. Der Eid der Kolonisten von Kyrene, angeblich ein Dokument des 7. Jhs. v. Chr., aber m.E. eine spätere Fälschung, wurde im frühen 4. Jh. v. Chr. in Kyrene im Zusammenhang mit der Verleihung des Bürgerrechts an Theräer aufgezeichnet38. Im Falle des Beschlusses des Kretischen Bundes über Hilfeleistung an die Kolonisten von Magnesia am Mäander im 10. Jh. v. Chr. braucht man nicht zu rätseln: Der Text ist sicher Produkt eines geschickten Fälschers; er wurde im Rahmen der Bemühungen von Magnesia um Anerkennung seiner Asylie zusammen mit anderen historischen Zeugnissen aufgezeichnet39. Die Veröffentlichung dieser Texte diente der Konstruktion eines „kulturellen Gedächtnisses“.
c) Urkunden-Dossiers als Beweismaterial in rechtlichen oder politischen Konflikten Alte Dokumente wurden ferner als Beweismaterial im Zusammenhang mit rechtlichen oder politischen Konflikten aufgezeichnet40. Ein gutes Beispiel ist das Dossier von Dokumenten über die Tyrannenherrschaft in Eresos41. Als die Nachkommen ehemaliger Tyrannen an König Antigonos Monophthalmos appellierten, um ihre Rückkehr in die Heimat zu erreichen (spätes 4. Jh. v. Chr.), lehnten die Eresier dies ab und veröffentlichten eine Sammlung alter Dokumente, die diese Angelegenheit betrafen. Diese Zeugnisse enthielten sehr detaillierte Beschreibungen der Greueltaten der Tyrannen. Indem die Aufzeichnung die Erinnerung an das Leiden des Volkes wachrief, erweckte sie das Gefühl des Hasses und begründete die Entscheidung gegen die Versöhnung: Mneme gegen Amnestie42. Diese Verbindung zwischen Erinnerung und Emotion kennzeichnet öffentliche Inschriften etwa seit dem letzten Viertel des 4. Jhs. v. Chr.43.
37 SEG XVIII 153; Meiggs-Lewis GHI2 23. Die Authentizität dieses Dokuments wird nach wie vor debattiert; für die jüngsten Arbeiten zu diesem Thema s. SEG LI 428; LII 333; LIV 438; LVI 434. Ich vermute nach wie vor, dass der Text vom Lokalhistoriker Kleidemos fabriziert wurde; s. Chaniotis (1988) 259–267. 38 Meiggs-Lewis, GHI2 5; Chaniotis (1988) 238 D7, 264. 39 I. Magnesia 20; Diskussion: Chaniotis (1988) 246 D27, 257–258; Chaniotis (1999) 61–64. Weitere Beispiele: Delphischer Orakelspruch an Agamemnon: SEG XIX 399. Dokument über die Einführung des Dionysoskultes in Magnesia: I.Magnesia 215. Delphisches Orakel an Harmodios und Aristogeiton: IG II2 5007. 40 Chaniotis (1988) 273. 41 IG XII.2.526 + Suppl.; OGIS 8. Zum historischen Kontext s. Lott (1996); Labarre (1996) 25–31; 327–332 Nr. 6; Bencivenni (2003) 55–77; Dmitriev (2004). 42 Chaniotis (2013a). 43 S.u. S. 153–158.
142
Angelos Chaniotis
d) Alte Urkunden und die Begründung von Rechten Die größte Gruppe unter den neu- oder wiederaufgezeichneten Dokumenten machen Sammlungen alter Urkunden als Begründung von Rechten und Privilegien aus44. Die bekannteste Sammlung dieser Art stammt aus Aphrodisias in Karien. Auf der nördlichen Parodos des Theaters wurden um 230 n. Chr. Dokumente über die Beziehungen zwischen Aphrodisias und Rom vom zweiten Triumvirat bis zum frühen 3. Jh. n. Chr. aufgezeichnet45. Die Bezeichnung dieser Sammlung als ‚Archivwand‘ ist irreführend. Diese Wand diente eben nicht als Archiv, in dem Urkunden, ganz unabhängig von ihrer Bedeutung, aufbewahrt wurden, sondern der Veröffentlichung ausgewählter Dokumente46. Gerade diese Tatsache macht die hier aufgezeichneten Dokumente zu einer hervorragenden Quelle für das Geschichtsbewusstsein der Aphrodisieis. Unter den Dokumenten finden sich auch zwei Schreiben Octavians, die an andere Städte, Ephesos bzw. Samos, adressiert waren47. In diesen Briefen betont Octavian nicht nur, wie er Aphrodisias unterstützt hat, sondern auch, dass er diese Gemeinde ‚bevorzugt‘ hat. Es muss die Aphrodisieis sehr stolz gemacht haben, die Besucher ihres Theaters drei Jahrhunderte nach dem Ende der Bürgerkriege und in einer Zeit starker Konkurrenz unter den kleinasiatischen Städten48 an die Worte Octavians zu erinnern: „Diese eine Stadt in ganz Asien habe ich als meine eigene genommen. Ich will, dass diese Menschen wie meine eigenen Mitbürger beschützt werden“49. Dass eine Gemeinde Urkunden epigraphisch veröffentlicht, die nicht an sie adressiert waren, ist ein sehr seltenes Vorgehen, das immer mit einer intentionalen Erinnerungskonstruktion zusammenhängt. Eine gute Parallele bietet ein Dossier in Nysa zu Ehren des lokalen Staatsmannes Chairemon kurz nach dem Mithridates-Krieg (nach 88 v. Chr.); zwei von den drei Dokumenten des Dossiers sind Briefe von Mithridates VI. an seinen Satrapen Leonippos, in denen der König die Anweisung gibt, Chairemon wegen seiner feindlichen Haltung ihm gegenüber und seiner Verdienste um die Römer zu töten oder gefangen zu nehmen50. Was für einen besseren Beweis für die Bündnistreue von Nysa und die Leistungen des Chairemon hätten spätere Generationen haben können als diese haßerfüllten Briefe des Mithridates?
44 Chaniotis (1988) 273. Beispiele: I.Priene 1; I.Labraunda 1B, 2, 3, 3B, 8–10, 53, 54A, 72, 88, 110; I.Pessinous 1–7; Welles (1934) Nr. 64 (Nysa); Reynolds (1982) 33–146 Nr. 6–25. 45 Grundlegend: Reynolds (1982) 33–146 Nr. 6–25 (‚archive wall‘). 46 Cf. Jones (1999) 102; Chaniotis (2003) 73. 47 Reynolds (1982) 101–103 Nr. 12 (IAph2007 8.31) und 104–106 Nr. 13 (I.Aph2007 8.32; IG XII 6.1.160); vgl. Eilers (2009) 303. 48 Zu diesem Thema s. zuletzt Heller (2006). 49 Reynolds (1982) Nr. 10 Z. 3–4 (I.Aph2007 8.29): m›an pfilin ta÷thn ãj ƒlh« tá« [s›a« ãmaytˆ eúlhpfa· to÷toy« oœtv ùwlv fylaxùánai Ñ« ãmoŒ« pole›ta« (Brief Oktavians an Stephanos, 39/38 v. Chr.). 50 Syll.3 741 II und III.
Mnemopoetik
143
e) Urkunden-Dossiers zu Ehren von Staatsmännern Eine letzte Gruppe von spät veröffentlichten Sammlungen von Dokumenten erfüllt eine ‚biographische‘ Funktion. Im Zusammenhang mit der Ehrung von Staatsmännern wurden manchmal Sammlungen von Urkunden veröffentlicht, die ihr Leben und politisches Wirken betrafen51, wie das gerade erwähnte Dossier für Chairemon in Nysa. Das früheste Beispiel ist die Aufzeichnung und Aufstellung aller Anträge zu Ehren des Rhetors Lykourgos nach seinem Tod (307/6 v. Chr.) auf der Akropolis von Athen52. Diese Praxis ist seit der späthellenistischen Zeit sehr verbreitet53. Alle diese Kategorien von Texten, die erst lange Zeit nach ihrer Entstehung epigraphisch aufgezeichnet wurden, wurden durch die epigraphische Veröffentlichung zu hypomnemata. Die Aufzeichnung des alten Dekrets für Apollonios ist im Lichte solcher Parallelen zu verstehen.
5 Der Ort der epigraphischen Aufstellung ist Ort der Erinnerung Die Hauptehre für Apollonios war die Errichtung seiner Statue: Man soll seine Bronzestatue auf einem Sockel aus Marmor an der Stelle des Marktes mit der größten Sichtbarkeit aufstellen und folgende Aufschrift anbringen: ‚Das Volk (ehrt) Apollonios, Sohn des Attalos, Enkel des Andron, für die Tapferkeit und die wohlwollende Gesinnung, die er der Sache der Römer und seiner Stadt unentwegt erwiesen hat‘. Da aber seine Söhne, Attalos und Hagesandros, erklären, ihrerseits die hierfür anfallenden Ausgaben zu tragen, soll man auch sie loben für ihr Wohlwollen gegenüber dem Volk und für die Liebe zu ihrem Vater; sollen seine Söhne auch die Erlaubnis erhalten, ein Heroon vor dem Stadttor auf eigenem Grund zu errichten“. (A Z. 37–42)
Etwa 230 hellenistische und kaiserzeitliche Volksbeschlüsse ordnen an, dass eine Inschrift (ein Dekret oder eine Ehreninschrift) am epiphanestatos oder episemotatos topos aufgestellt werden soll. Die Beschlüsse, die eine solche Aufstellung nicht vorsehen, gehen in die Tausende. Nicht alle Urkunden wurden aufgezeichnet und nicht alle, die aufgezeichnet wurden, erhielten die gleiche Aufmerksamkeit54. Der epipha51 Chaniotis (1988) 274. 52 IG II2 457, 513, 3207; vgl. [Plut.], X orat. V 852 e. Lambert (2012a) 355 mit Anm. 40; Lambert (2012b) 26–27; vgl. Chaniotis (1988) 244–245 D22. 53 Z.B. Potamon von Mytilene: IG XII.2.23–71. Menogenes von Sardeis: Sardis 8. Demetrios von Athen: F.Delphes III.2.161. Opramoas von Rhodiapolis: TAM II.3.905; Kokkinia (2000). Iason von Kyaneai: Berling (1993). 54 Die Wahl des Aufstellungsortes von Inschriften und die Absichten hinter dieser Wahl sind vor allem in Athen untersucht worden: Liddel (2003); Shear (2007); Lambert (2011) 201. Für das römische Reich s. Hesberg (2009).
144
Angelos Chaniotis
nestatos topos ist der Ort der größten Sichtbarkeit und Wirksamkeit; als Attribut von Göttern hat epiphanes diese Bedeutung: epiphanes ist der Gott, dessen Macht sichtbar wirksam ist. Sichtbarkeit und Erinnerung gehören zusammen. Ein Proxenie-Dekret aus Gytheion (um 70 v. Chr.) sollten die Ephoren „an der prominentesten Stelle der Agora aufstellen, damit alle dieses Denkmal (hypomnema) der Tugend des Damiadas und des Wohlwollens unserer Stadt gegenüber den Wohltätern sehen“55. Es wurden auch Maßnahmen getroffen, um die Sichtbarkeit der aufgezeichneten Urkunden zu erhöhen, etwa durch die Verwendung von weißem Marmor56 und die Verzierung, z.B. durch Reliefs57. Im späten 4. Jh. v. Chr. stellten einflussreiche Staatsmänner in Athen sicher, dass, wenn die von ihnen vorgeschlagenen Volksbeschlüsse auf Stein aufgezeichnet wurden, ihre Namen hervorgehoben und für alle sichtbar waren58. Der Ort der Aufstellung war manchmal mit dem Ziel ausgesucht, ein Ereignis mit einem anderen oder mit einem Begriff zu assoziieren. Die Ehreninschrift und die Statue von Demetrios Poliorketes stellte man in Athen neben der Statue der Demokratie auf, weil der König die Feinde der Demokratie vetrieben hatte (302/1 v. Chr.), und am gleichen Ort stellte man 105 v. Chr. ein Ehrendekret für Epheben auf59. Eine der Statuen von Apollonis in Kyzikos errichtete man im Charitesion, im Heiligtum der Chariten, der Personifikation von Gunst und Dankbarkeit60. Die Ehreninschrift für eine Person stand oft absichtlich in der Nähe des Ehrendenkmals für einen Verwandten und wurde somit zum Zeugnis der Geschichte einer Familie und deren Verdienste. Die Statue des T. Statilius Lamprias (um 40 n. Chr.) sollte z.B. in Eleusis in der Nähe der Statuen seinen Vorfahren aufgestellt werden61. Ich behaupte nicht, dass alle Inschriften tatsächlich beachtet oder Teil einer historischen Erinnerung wurden. Es gibt aber genug Hinweise darauf, dass dies geschah, dass sogar Monumente und die dazugehörigen Inschriften am gleichen Ort für die Vermittlung divergierender Geschichtsbilder konkurrierten. 246 v. Chr. organisierte der Ätolerbund das Fest Soteria in Delphi, um die Rettung Griechenlands 30 Jahre davor als seine Leistung zu präsentieren. Leider ist der ätolische Beschluss für die Grün-
55 IG V.1.1145: $naùwntvn eå« tÌn ã[pifanwsta]ton t»« $gor»« tfipon, ƒpv« p»sin [fanerÌn Òi tfi t]e ˙ ˙ ˙ Damiˇda kalokagaù›a« kaÏ e\n [o›a« t»«] pfi]lev« 4mân eå« toŒ« e\ergwta« [Épfimna]m a. ˙ ˙ 2 3 56 Z.B. IOSPE I 40 Z. 42; 52 Z. 19. Vgl. Syll. 679 I 28–29 (Verwendung von vergoldeten Nägeln für eine Tafel). 57 Lambert (2011) 200–201. Beispiele für die Wirkung von Urkundenreliefs: Blanshard (2004) und (2007). 58 Tracy (2000). 59 Demetrios: SEG XXV 149 Z. 14. Ephebisches Ehrendekret: IG II2 1011 Z. 62. 60 SEG XXVIII 953 Z. 57–59 (ca. 50–75 n. Chr.). Die Tafel mit dem Vertrag zwischen Pergamon (?) und Rom war neben der Statue der Demokratie aufgestellt (Syll.3 694 Z. 31–32). Die Liste der Poseidonpriester in Halikarnass stand neben den Statuen des Gottes: Syll.3 1020 Z. 1–3. Weitere Beispiele: Knoepfler (2007) 1222–1225. 61 IG IV2.1.83: par@ toÖ« progfinoi«; vgl. IG IV2.1.84 Z. 35–36. Vgl. z.B. I.Pergamon 256 Z. 7–8: Eine Statue des Diodoros Paspartos sollte neben den Bildnissen des Asklapon errichtet werden.
Mnemopoetik
145
dung des Festes nicht erhalten. Beschlüsse vieler Stadtgemeinden erklärten ihre Beteiligung an diesem Fest, ohne jedoch immer auch die ätolische Version der Geschichte zu übernehmen62. Während die Chier mit ihrem Psephisma die Ätoler mit einen goldenen Kranz für Frömmigkeit und „Tapferkeit gegen die Barbaren“ ($ndragaù›a« tá« eå« toŒ« barbˇroy«) ehrten, erwähnten die Athener in ihrem Dekret nur den Beitrag ihrer eigenen Soldaten63. Zur gleichen Zeit gründete der König von Makedonien Antigonos Gonatas auf Delos ein anderes Fest mit dem gleichen Namen (Soteria) sowie das Fest Pania (‚Fest für Pan‘), um die Rettung Griechenlands von den Galatern als sein Verdienst zu feiern64. Wohl in den gleichen Kontext konkurrierender Interpretationen der Geschichte ist auch eine andere Initiative zu setzen. Um die Mitte des 3. Jhs. v. Chr. weihte Herakleitos, General der makedonischen Garnison in Piräus, ein Denkmal mit Berichten (oder Bildern oder beides), welche „Erinnerungen an die Taten des Königs gegen die Barbaren für die Rettung der Griechen enthielten“65. Der Ort, wo Herakleitos dieses Denkmal aufstellte, ist sehr aussagekräftig. Das Denkmal war der Athena Nike geweiht, es stand also auf der Akropolis zusammen mit Kunstwerken, die die Siege der Athener (und der Griechen) über die Barbaren (die Amazonen, die Trojaner, die Perser) zum Thema hatten. Auf dieser Bühne aufgestellt, assoziierte das Denkmal des Herakleitos den Sieg des Antigonos mit den griechischen Traditionen militärische Siege über die Barbaren. Hier begegnete das kollektive Gedächtnis des neuen Krieges über die Gallier dem kulturellen Gedächtnis aller Griechen. Antigonos wurde als Retter der Griechen präsentiert, ähnlich wie vor ihm Theseus und die Marathonkämpfer. Es ist sicher kein Zufall, dass der gleiche Ort auch von Attalos I. oder II. ausgewählt wurde, um Skulpturen mit Darstellungen mythischer und historischer Kämpfe aufzustellen, darunter der Schlacht von Marathon und des Sieges der Pergamener über die Galater.
62 Für die Bemühungen der Ätoler um die Anerkennung des agonistischen Festes und für die Geschichte des Festes grundlegend Nachtergael (1977). S. auch Champion (1995). 63 Chios: F.Delphes III.3.215 Z. 20. Athen: IG II2 680 (um 249–246 v. Chr.): … tÌn $gâna tân Svthr›vn tiùwnai tâi Di[Ï t]âi Svtári kaÏ tâi [pfillvni tâi Pyù›vi Épfimnhma tá[«] mˇxh« tá« genomwnh« prÌ« toŒ« barbˇroy« toŒ« ãpis[t]rate÷santa« ãp› te toŒ« 6Ellhna« kaÏ tÌ toÜ [pfillvno« ÅerÌn tÌ koinÌn tân ^Ell‹nvn, ãf# o?« kaÏ Ç dámo« ãjwpemce[n] to÷« te ãpilwktoy« kaÏ toŒ« ÅppeÖ« synagvnioymw[noy«] ÉpÍr tá« koiná« svthr›a« („den Wettkampf Soteria einzurichten zu Ehren des Zeus Soter und des Apollon Pythios zur Erinnerung an die Schlacht gegen die Barbaren, die zu Felde gegen die Hellenen und das Apollon-Heiligtum, das gemeinsame Heiligtum der Hellenen, gezogen waren; gegen diese Barbraren hat unser Volk die Epilektoi und die Reiter als Mitkämpfer für die gemeinsame Rettung ausgesandt“). 64 Champion (2004/05). 65 IG II2 677 (ca. 250–240 v. Chr.): $nat›ùhsin tái [ùhn»i tái [N›khi st‹l?]a« (oder [graf]@«?) ãxo÷sa« Épomn‹mata tân [tâi basileÖ p]epragmwnvn prÌ« toŒ« barbˇroy« ÉpÍr tá« tân ^Ell‹nvn svthr›a«. Zum Text s. Chaniotis (1988) 301; Schmidt-Dounas (1996) 132 Anm. 89. Zu Herakleitos s. Paschidis (2008) 177–179.
146
Angelos Chaniotis
Welche Rolle das Denkmal des Apollonios in späteren Zeiten spielte, wissen wir nicht. Wir wissen aber, dass manchmal solche epigraphischen Monumente zu einem wahren Ort der Erinnerung wurden, dessen Wirksamkeit durch Rituale erhöht wurde. Ein ausgezeichnetes Beispiel für diese Praxis ist die Ehreninschrift für den KavallerieOffizier Eugnotos von Akraiphia66. Als Eugnotos während einer Schlacht bei Onchestos gegen das Heer des Demetrios Poliorketes erkannte, dass die Schlacht verloren war, wählte er den Freitod. Akraiphia stellte seine Statue neben dem Altar des Zeus auf dem Markt auf. Von diesem Zeitpunkt an fanden Opfer an Zeus, der in Akraiphia mit der Epiklese Soter (‚der Retter‘) verehrt wurde67, direkt unter den Augen des Eugnotos statt. Statue und Inschrift sollten zum Exemplum für die Jugend der Stadt werden („In dieser Weise, junge Männer, werdet Krieger in Ruhm; so werdet tapfer und verteidigt die Stadt der Väter!“). In diesem Fall wissen wir, dass dies in der Tat geschah. Hundert Jahre nach dem Tod des Eugnotos fing man an, auf der Basis seiner Statue Listen mit den Namen der jungen Rekruten aufzuzeichnen. Fünf solche Listen zwischen 190 und 140 v. Chr. sind erhalten. Wie John Ma beobachtet hat, spiegelt die Auflistung der jungen Soldaten den Aufruf an die jungen Männer im Epigramm wider, die Heimat zu verteidigen. Ich vermute, dass die Vereidigung der Soldaten gerade an diesem Ort stattfand, wo Eugnotos als Statue und Vorbild stand. Die Statue des Eugnotos wurde zum zentralen Ort der Erinnerung für Akraiphia, eine Erinnerung, die mit Ritualen direkt (Vereidigung von Soldaten) und indirekt (Opfer an den rettenden Zeus) verbunden war. Indem das Denkmal an den heroischen Selbstmord des Eugnotos erinnerte, wurde die Niederlage vergessen. Die kollektive Erinnerung an die verlorene Schlacht verblaßte einige Jahrzente nach dem Ereignis. Vom historischen Ereignis blieb nur die Erinnerung an den heroischen Tod wach und wurde zum verpflichtenden Symbol und zum Teil des lokalen ‚kuturellen Gedächtnisses‘.
66 Moretti (1967) Nr. 69. Neue Ausgabe und ausaführliche Behandlung: Ma (2005); vgl. SEG LV 553: ToÖo« ãøn E¾gnvto« ãnant›o« eå« basiláo« | xeÖra« $nhr›ùmoy« Òlùe boadromwvn, | ùhjˇmeno« BoivtÌn ãpÏ plefinessi ~rha. | O\ d# ÉpÍr #OgxhstoÜ xˇlkeon Ùse nwfo«· | Ò dÎ g@r dorˇtessin ãle›peto ùrayomwnoisin, | ZeÜ pˇter, ¡rhkton láma parasxfimeno«· | çktˇki g@r dekˇki« te syn‹lasen åladÌn ¬ppv[i] | ûssoni dÍ zØein o\ kalÌn Ñr›sato, | $ll# ƒg# $neÏ« ùØraka par@ j›fo« ¡rseni ùymâi | p[l]‹jato, genna›vn Ñ« öùo« 4gemfinvn. | tÌm mÍn ¡r# $sk÷leyton ãle÷ùeron aÚma xwonta | dâkan ãpÏ ˙ progfinvn ória dysmenwe«· | nÜn dw nin ök te ùygatrÌ« ãoikfita k$pÌ syne÷noy | xˇlkeon [eåk?]on# öxei ˙ p[w]tro« [kraifiwvn· | $llˇ, nwoi, g›[n]esùe kat@ klwo« Ùde maxhta›, | Ùd# $gaùo›, patwrvn ¡stea [®]yfimenoi („So sah Eugnotos aus, als er zum Kampf gegen die zahllosen Krieger des Königs eilte und den böotischen Ares zum Kampf gegen eine Übermacht ermutigte. Und doch hat er die bronzene Wolke über Onchestos nicht wegstossen können. Mitten in den brechenden Lanzen wurde er besiegt, Vater Zeus, sein Mut wurde aber nicht gebrochen. Acht und zehn Mal griff er mit der Kavallerie an und hielt es für unschön, besiegt weiter zu leben. Er entfernte die Brustplatte und fiel mit männlichem Geist auf sein Schwert, wie es der Brauch der tapferen Heeresführer ist. Er vergoß freies Blut, als ihn die Feinde zurückgaben, ohne ihn auszuziehen, für (Bestattung in den) Gräbern der Vorfahren. Und nun hat ihn der Fels von Akraiphia als bronzenes Abbild, von der Frau und der Tochter geschenkt. In dieser Weise, junge Männer, werdet Krieger in Ruhm; so werdet tapfer und verteidigt die Stadt der Väter!“). 67 IG VII Z. 56–57; SEG XV 332.
Mnemopoetik
147
Ob auch die Statue des Apollonios die gleiche Funktion erfüllte, läßt sich nicht sagen. Sie war aber sicher Ort der Erinnerung für seine Familie und für die Familien der jungen Männer, deren Namen auf der Basis standen. Statuen wurden regelmäßig bekränzt und die Inschriften aus solchen Anläßen öffentlich verlesen68. Nicht zufällig bezeichnet ein Ehrendekret von Chersonesos für T. Aurelius Calpurnianus Apollonidas die für ihn zu errichtenden Bildnisse als „ewige Ankündigungen seines sichtbaren Wohlwollens gegen uns“69. Eine von einer Ehreninschrift begleitere Statue war wichtiger Bestandteil der Familientradition, wie wir aus den Bemühungen von Personen erkennen, beschädigte Statuen ihrer Vorfahren zu restaurienen70. Ein ausgezeichnetes Zeugnis für den Stolz einer Familie für die Statue und die Ehreninschrift eines Vorfahren ist das Grabepigram eines 12jährigen Jungen aus Kalindoia in Makedonien (1. Jh. v. Chr.)71: … Ich starb zwölf Jahre alt und gehe ins Grab ohne Ruhm, obwohl mir der gleiche Name wie jener meines ruhmreichen Großvaters zugeteilt worden war. Auch ihn nannte man Philotas, des Aristomenes Sohn. Sein Urteil in der Heimat war jenem der himmlischen Götter gleich. Zu seinem Andenken stellten die Bürger ein bronzenes Bildnis auf, als sie in guter politischer Ordnung standen. Sitzend hat er eine Hand auf dem Knie, mit der anderen hält er diesen (Ehren)kranz des Rates und des Volkes. Und die Stele, ein Stadion hoch, verkündet mit vielen geschriebenen Worten seine Tapferkeit in der Schlacht und wie er als Vorkämpfer vor den Türmen erschien ….
6 Historische Erinnerung in epigraphischen Texten ist (auch) Erinnerung an Protagonisten und Familien Von den jungen Männern, die zusammen mit Apollonios in der Schlacht fielen, wissen wir nicht mehr als den Namen, den Namen des Vaters und in wenigen Fällen den Namen des Großvaters. Die Namen sind nicht alphabetisch geordnet; welches Ord-
68 Z.B. SEG XXVIII 953 Z. 63 und 71–72 (ca. 50–75 n. Chr.); I.Pergamon 256; Holleaux (1898) 44–47. 69 SEG XLV 985 A Z. 20–22: aåØn i[a] kar÷gmata ãsso÷mena t»[« f]aner[»]« ã« 4mÍ e\no›a« ˙ (174 n. Chr.). 70 MAMA VIII 406 = IAph2007 12.402 (Aphrodisias, ca. 50 n. Chr.): Kallikrˇth« MolossoÜ ÅereŒ« MhnÌ« [skainoÜ kaÏ ^ErmoÜ [gora›oy t@« tân propatfirvn tim@« ãpiskeyˇsa« $pokaùwsthsen. Vgl. SEG XLIV 938 Z. 17–22 (Milet, um 50 n. Chr., Statue des C. Iulius Epikrates): Gˇ=o« #Io÷lio« Diado÷meno« tÌn $ndriˇnta ãmprhsmˆ diaforhùwnta ãn tˆ gymnas›8 ãpiskeyˇsa« $pokatwsthse aå t hsˇmeno« $pÌ ˙˙˙ tá« boylá« c‹fisma perÏ to÷toy. Das Verhältnis von Diadoumenos zu Epikrates ist nicht bekannt. 71 SEG XXVIII 541; Harzopoulos und Loukopoulou (1992) 98–101: [Dvdekwth« ö]ùanon, ba›nv d# ÉpÌ t÷mbon ¡fh[mo« | ãndfijoy p]ˇppoy t$tÌ laxÌn ònoma· | [kwklht# oÛn k]$keÖno« [ristomwnoio Fi˙ ˙ ˙˙ lØta«, | ƒ« pˇtrai gnØman ösxen åsoyrˇnion· | dÎ toÜ xalke›an mÍn $nwstasan poli»tai | åkfinan | eå« ˙ mnˇman, bˇnte« ãn e\nom›ai· | Yzfimeno« g@r öxei xwra go÷nati, t@ dw tey ¡lla | dˇmoy kaÏ boyl»« tfinde ˙ ˙ ˙ krateÖ stwfanon· [ka]r÷ssei d# $ret@n daË 4 stadi[a›]a pol÷grapto« | stˇla kaÏ p÷rgvn Ñ« ãfˇnh ˙ prfimaxo«. ˙ ˙
148
Angelos Chaniotis
nungsprinzip gewählt wurde (Alter, Rang, soziale Stellung, ein Losverfahren?), entgeht uns. Der deutliche Unterschied zwischen dem einen Offizier von hoher sozialer Stellung und Reichtum und den vielen Soldaten macht dieses Denkmal zum Spiegelbild einer hierarchischen Gesellschaftsstruktur. Verschiedene Mittel wurden angewandt, um die herausragende Leistung und Stellung eines Mannes hervorzuheben. Das Dekret für Orthagoras von Araxa für seine Taten in mehreren Kriegen in Lykien (um 180 v. Chr.) ist ein gutes Beispiel72. Der Antragsteller verwendet dreimal das Verb prvtagvnistwv („als erster am Kampf/Wettkampf teilnehmen“, „die erste Rolle spielen“) im Zusammenhang mit seinen Leistungen73. Es fällt ferner auf, dass er zweimal erwähnt, dass Orthagoras beritten in den Krieg zog74. Dieses scheinbar überflüssige Detail in einem langen Text soll einen visuellen Eindruck von seiner Tapferkeit geben – ein Beispiel von enargeia75. Einige unter den Zuhörern in der Volksversammlung erinnerten sich an Orthagoras auf dem Pferd; andere hatten nur davon gehört. Zur Zeit der Verabschiedung des Psephisma waren die Erzählungen davon, wie Orthagoras auf dem Pferd gegen die Feinde kämpfte, Teil des lokalen ‚kollektiven Gedächtnisses‘. Zum ‚kulturellen Gedächtnis‘ seiner Gemeinde wurde das Bild des kämpfenden Orthagoras Jahrzehnte später, immer dann, wenn die Bewohner von Araxa die Reiterstatue des lokalen Kriegshelden sahen und den Text lasen. Zur enargeia des Textes trägt auch ein weiteres Detail bei: Orthagoras’ Widerstand gegen die Tyrannen beschrieb der Antragsteller mit dem Verb $ntiblwpv („jemandem mutig ins Gesicht schauen“)76 und prägte auch damit den Zuhörern und Lesern einen visuellen Eindruck von einer durch Körperprache ausgedrückten Tapferkeit ein. Solche rhetorischen Mittel konstruieren die Erinnerung an den Protagonisten. In Metropolis war Apollonios’ Denkmal nicht nur sein Denkmal; es war auch Denkmal seiner Familie. Schauen wir uns die Klausel über seine Ehrenstatue noch einmal an: Da aber seine Söhne, Attalos und Hagesandros, erklären, ihrerseits die hierfür anfallenden Ausgaben zu tragen, soll man auch sie loben für ihr Wohlwollen gegenüber dem Volk und für die Liebe zu ihrem Vater. (A Z. 40–41)
72 SEG XVIII 570. 73 Z. 10: dietwlei prvtagvnistân; Z. 30–31.: öfipp« Ên dietwlei prvtagvnistân; Z. 49: prvtagvnistân dietwlei. Das Verb erscheint auch im ersten Ehrendekret für Apollonios: I.Metropolis 1 B Z. 15–17. Für dieses Verb in ähnlichem Kontext in hellenistischen Ehrendekreten s. SEG XXXIV 1198 Z. 9–10 (Ioulia Gordos, um 130 v. Chr.); Holleaux (1898) Z. 8; vgl. Z. 39–40 (Alabanda, 2./1. Jh. v. Chr.); I.Mylasa 132 Z. 8 (hellenistisch); Hepding (1910) 409 Nr. 3 (Pergamon, um 70 v. Chr.). 74 Z. 31f: öfipp« Ên dietwlei prvtagvnistân; Z. 47: öfippo« Ên synestrˇteysen. 75 Vgl. und s.u. S. 155. 76 Z. 25–27: kaùfiloy te toÖ« tyrˇnnoi« $ntiblwpvn o\dwna kairÌn paralwloipen.
Mnemopoetik
149
Wann hatten die Söhne des Apollonios ihr Angebot gemacht? Wahrscheinlich nicht in der Volksversammlung, in der dieser Antrag zur Abstimmung vorgelegt wurde, sondern vermutlich noch während der Beratungen im Rat. Die Familie des Apollonios war also an der Gestaltung der Ehrung beteiligt, möglicherweise auch an der Gestaltung des Textes. Auch die Statue des Eugnotos von Akraiphia77 war von seiner Frau und seiner Tochter gestiftet. Historische Erinnerung in der griechischen Stadt ist zum großen Teil Erinnerung an große Individuen; sie ist zugleich auch Familiengeschichte. Sie setzt die kommemorative Funktion des Gesangs über das kleos großer Männer fort. Für die Präsentation dieser Familiengeschichten waren die Inschriften (in der Regel von Bildnissen begleitet) das bevorzugte Mittel. Eine Vielfalt von Inschriften konnten diese Funktion erfüllen: genealogische Texte78, lange biographische Ehrendekrete79 und andere biographische und autobiographische Inschriften – z.B. Weihungen, Rechenschaftsberichte, Grabinschriften mit Auflistungen von Ämtern und Leistungen80 –, Anträge von Bürgern für die eigene Ehrung oder die Ehrung von Familienmitgliedern81, Ehrenstatuen aufgestellt durch Familienmitglieder82 usw. Auch Individuen ergriffen manchmal die Initiative für die Verewigung ihrer eigenen Leistung oder eines besonderen Erlebnisses. Lykurgos von Athen ließ vor der von ihm erbauten Palaistra eine Stele mit seinem Rechenschaftsbericht aufstellen83. Der Dichter Isyllos erzählte in seinem Hymnus in Epidauros seine Begegnung mit Asklepius in seiner Jugend (frühes 3. Jh. v. Chr.)84. Einige Wohltäter reichten dem Rat Berichte von ihren Verdiensten ein
77 S.o. S. 146. 78 Chaniotis (1987a) und (1988) 223–226. 79 Zu diesem Phänomen s. Chaniotis (1987b); Rosen (1987); Chaniotis (2005) 226–227, 242; Culasso Gastaldi (2007); Luraghi (2010) 252–260. Gute Beispiele sind die Ehrendekrete für Kallias von Sphettos in Athen (Shear 1978; SEG XXVIII 60), Diophantos in Chersonesos in Tauris (IOSPE I2 352; Chaniotis 1987b), Protogenes (IOSPE I2 32; s.u. S. 154–155) und Nikeratos in Olbia (IOSPE I2 34), Polemaios und Menippos in Kolophon (Robert u. Robert 1989; SEG XXXIX 1243 und 1244), Pyrrhakos in Alabanda (Holleaux (1898)), Moschion in Priene (I.Priene 108). 80 Ein nützlicher Überblick von Inschriften mit autobiographischen Zügen bei Baslez (1993); sie erwähnt u.a. Rechenschaftsberichte, Beichtinschriften und Weihungen. Das Phänomen ist in embryonaler Form älter als das 4. Jh. v. Chr. – so Baslez (1993) 74. Die Weihinschrift des Athleten Damonon, in der er eine lange Liste seiner Siege gibt (IG V.1.213, Lakonien, um 450 v. Chr.), weist deutlich autobiographische Züge auf. Vgl. die lateinischen Inschriften mit dem cursus honorum von Männern: Eck (1995). 81 Baslez (1993) 74; Lefèvre (1993); Culasso Gastaldi (2007) 132–137. Beispiele von Personen, die sich um die eigene Ehrung bemühten: IG II2 682 und 844 Z. 55–57; Agora XVI 261 Z. 31–36; SEG LVI 636 II. Antrag eines Bürgers auf die Ehrung eines Familienmitgliedes: z.B. IOSPE I2 344. 82 Z.B. SEG XXIII 220; IGBulg III.2.1578; I.Didyma 87, 91. 83 [Plut.], mor. 843f: pˇntvn d# ìn di”khsen $nagrafÎn poihsˇmeno« $nwùhken ãn st‹l> prÌ tá« Ép# a\toÜ kataskeyasùe›sh« pala›stra« skopeÖn toÖ« boylomwnoi«; Baslez (1993) 74–75. Für Lykurgos’ starkes Interesse an der Veragngenheit im Lichte der epigraphischen Zeugnisse s. Lambert (2010). 84 IG IV2.1.128; Baslez (1993) 78. Neue ausführliche Behandlung des Textes: Kolde (2003).
150
Angelos Chaniotis
und baten um ihre eigene Ehrung85. Athleten und Künstler des Theaters stellten Inschriften mit langen Listen ihrer Siege auf86. Ein verbreiteter Typus von Weihinschrift ist die Weihung eines Beamten, Priesters oder Kultfunktionärs nach dem Ausscheiden aus dem Amt; durch eine solche Weihung sorgte eine Person dafür, dass ihr Name Glied einer Kette wurde, die die Kontinuität des öffentlichen Lebens ihrer Gemeinde zum Ausdruck brachte. So entstehen lange Reihen von Weihungen, wie etwa der Apollon-Priester und der Hieropoioi in Halasarna auf Kos und der Hydrophoroi und Propheten in Didyma (Milet)87. Abweichungen von den stereotypischen Formulierung zeigten die besondere Leistung88, und die Dedikanten heben auch ihre Familiengeschichte durch die Nennung berühmter Vorfahren hervor89. In Listen mit den Namen von Jahresbeamten wurden nach ihrem Ausscheiden aus dem Amt kurze chronikartige Nachrichten angebracht90. Auch solche Inschriften erfüllten die Funktion von hypomnemata. Männer (und Frauen) ergriffen die Initiative für die Aufstellung solcher mit Inschriften versehenen Monumente, weil sie sich über deren Wirkung bewusst waren. Um 238 n. Chr. stellte der Lehrer und Wohltäter Euarestos in Oinoanda seine eigene Statue auf, um die fünfte Veranstaltung eines von ihm gestifteten agonistischen Festes zu feiern. Auf die Basis ließ er ein von ihm selbst verfasstes Epigramm schreiben91: Viele haben schöne Wettkämpfe in ihren Städten nach ihrem Tod gestiftet, keiner der kurzlebigen Menschen hat dies zu Lebzeiten getan. Ich bin der einzige, der dies mutig unternommen hat, und mein Herz erfüllt sich mit Freude an den erzgegossenen Statuen. Laßt nun die Nörgelei, ihr alle, die ihr den argen schrecklichen Neid habt, und blickt auf meine Statue mit Augen, die mich nachzuahmen wünschen!
Man beobachtet hier nicht nur Euarestos’ Übertreibung bei der Darstellung seiner Leistung, sondern auch seine Gewissheit, dass man in der Zukunft seine Statue ansehen würde, und zwar mit Neid.
85 S. oben Anm. 80. 86 Ein frühes Beispiel: IG V.1.213. S. z.B. F.Delphes III.1.89, 547; IGUR 240; I.Ephesos 1695, 4114; I.Tralles 118. 87 Halasarna: SEG LIV 762–765. Milet, Hydrophoroi: I.Didyma 307–387; Propheten: I.Didyma 95, 96, 105, 218, 236, 281, 288. 88 Beispiele aus Milet: I.Didyma 268, 289, 297, 303, 312, 314, 326, 327, 360, 375, 382, 384. 89 Z.B. I.Didyma 345 und 358. 90 Chaniotis (1988) 188–190. 91 SEG XLIV 1182 B: … pleÖstoi mÍn g@r öùhkan $wùlia kal@ pfilesi | teùnefite«, zvÌ« d# o¾ti« ãfhmer›vn· | moÜno« d# a\tÌ« ãgøn ötlhn tfide, ka› ®# ãmÌn Òto[r] | ghùeÖ terpfinon xalkelˇtoi« joˇnoi«· | toig@r mâmon $nwnte« ƒsoi fùfinon aånÌn öxoys[in] | meimhloÖ« òssoi« eås›det# eåkfin# ãm‹n.
Mnemopoetik
151
7 Epigraphische Texte vermitteln eine selektive Version der Vergangenheit Epigraphische Texte sind das Werk von Individuen, und es ist nicht zuletzt deswegen, dass sie eine subjektive Version des Geschehenen präsentieren. Das Ehrendekret für Apollonios (s. Anhang Text A) zeigt sehr deutlich, wie sein Verfasser um eine durchaus tendenziöse Konstruktion künftiger Erinnerung bemüht war. Schauen wir uns jene Stellen an, die historische Ereignisse erwähnen: Nachdem jetzt der König Philometor verstorben ist und die Römer, die gemeinsamen Wohltäter und Retter, aufgrund eines Beschlusses die Freiheit allen zurückgegeben hatten, die frührer Untertanen der Königsherrschaft des Attalos gewesen waren, und Aristonikos auftrat und uns die Freiheit, die der Senat uns zurückgegeben hatte, entreißen wollte, nahm er es auf sich, allenthalben gegen diesen Mann zu reden und vorzugehen, der sich die Königsherrschaft wider die Entscheidung unserer gemeinsamen Wohltäter, der Römer, umgelegt hatte, und nahm sich auf ehrliche Weise der Freiheit an, dem Willen des Volkes entsprechend. (A Z. 13–19)
Dieser kurze Text ist eine Abrechnung mit der Herrschaft der Attaliden von Pergamon. Das Testament des Attalos III., dank dessen die Städte frei wurden, wird verschwiegen; die Rückgabe der Freiheit wird ausschließlich den Römern zugeschrieben92; vier Mal wird die Freiheit erwähnt, und drei Mal mit dem Verb „zurückgeben“ (apodedomene), um zu betonen, dass Metropolis vor der Attaliden-Herrschaft eine freie Polis gewesen ist und nun diese Freiheit zurückgewonnen hat. Ähnlich bestanden die Athener bei ihren Verhandlungen mit Philipp II. um Halonnesos (346 v. Chr.) darauf, dass Philipp diese Insel „zurückgibt“ und nicht „gibt“93. Nach der Betonung der protagonistischen Rolle des Apollonios in der Entscheidung der Metropoliten, für die Römer zu kämpfen, geht der Text weiter: Und nachdem es notwendig geworden war, junge Männer in das Heerlager bei Thyateira zu schicken, wählte das Volk, das sich von Anbeginn an für die Sache der Römer und den Freundschafts- und Beistandsvertrag mit ihnen entschieden sowie mit größter Freude die Freiheit empfangen hatte und die ihm eigene Zuneigung und Wohlwollen, die es für die römische Republik hegt, auch in den kritischen Zeiten zeigen wollte, den Apollonios, Sohn des Attalos, Enkel des Andron, als Anführer für die Entsendung der jungen Männer. (A Z. 19–24)
Hier wird nur eins über Apollonios gesagt: Er war vom Volk durch Handzeichen gewählt worden. Der Rest des Textes will nicht Apollonios ehren, sondern die Bündnistreue von Metropolis unterstreichen. Die wichtigste Aussage dabei ist „von Anbeginn
92 Zum historischen Kontext s. Dreyer und Engelmann (2003) 28–34, 79–86; Jones (2004) 480–481; Daubner (2006) 68–70; Snowdon (2008). 93 Demosthenes 7,5; 12,14; vgl. Aeschines 3,83. Für eine Diskussion des Motivs der Rückgabe der Freiheit im hellenistischen Kontext s. Snowdon (2008).
152
Angelos Chaniotis
an“ ($p# $rxá«). Anders als manch eine opportunistische Stadt (wie z.B. die Nachbarstadt Kolophon), die die Entwicklung des Krieges abwartete, um sich zu entscheiden94, hatte Metropolis von Anfang an eine klare Position. Zur Zeit seiner Abfassung hatte dieser Passus nicht die Bürger als Adressaten, sondern die Fremden: die römischen Verbündeten und die kleinasiatischen Konkurrenten von Metropolis. Der Ausdruck $pÌ tá« $rxá« kommt auch in einer Inschrift von Methymna aus der gleichen Zeit des Aristonikos-Krieges im Zusammenhang mit Treue gegenüber den Römern vor95. Die sofortige Entscheidung der Bürger von Metropolios für Rom war ein wichtiger Aspekt ihrer selektiven Erinnerung. Wir erkennen die Bedeutung dieses Aspektes, wenn wir den Text aus Metropolis mit einem ephesischen Beschluss vergleichen. Eine Generation später, während eines anderen Krieges, der die römische Herrschaft bedrohte (Erster Mithridates-Krieg, 88–85 v. Chr.), bemühte sich Ephesos um eine selektive Version der Ereignisse. Ein gegen Ende des Krieges verabschiedeter Volksbeschluss (um 86 v. Chr.) erklärt96: Mithradates, der König von Kappadokien, verletzte die Verträge mit den Römern, versammelte seine Truppen und versuchte, Land, das ihm überhapt nicht zustand, unter seine Gewalt zu bringen. Nachdem er erst die vor uns liegenden Städte mit Betrug besetzt hatte, nahm er auch unsere Stadt unter seine Gewalt, indem er (uns) durch die Größe seiner Truppen und den unerwarteten Angriff in Schrecken versetzte. Als unser Volk, das von Anfang an das Wohlwollen gegenüber den Römern mitbewahrt hat, eine Gelegenheit hatte, um zur gemeinsamen Sache beizutragen, beschloß es, den Krieg gegen Mithridates für die Herrschaft der Römer und die gemeinsame Freiheit zu erklären, und alle Bürger setzten sich einmütig für die hierfür notwendigen Kämpfe ein.
Dieser Beschluss weist die Behörden nur an, die geeigneten Maßnahmen zu treffen. Letztlich hat er also keinen Gegenstand. Sein eigentlicher Gegenstand ist die tendenziöse Darstellung der frühen Phase des Krieges. Die Unterstützung der Ephesier für Mithridates wird ebenso verschwiegen wie das Blutbad an Tausenden von Italikern im Mai 88 v. Chr. Nicht die Ephesier seien verwantwortlich, sondern Betrug, der plötzliche Angriff, und Panik. Als Verbündete der letzten Stunde zeichneten die Ephesier
94 Dreyer und Engelmann (2003) 69. 95 IG XII Suppl. 116 Z. 9–10. In Ehrendekreten für gute Bürger und Wohltäter unterstreicht die Wendung $pÌ (tá«) $rxá« die Beständigkeit ihrer Haltung. Einige Beispiele: IG XII.5.719; XII.9.236; SEG XLIII 371; I.Mylasa 110, 118; I.Priene 46. 96 I.Ephesos 8 Z. 3–14: Miùradˇth« Kappadok›[a« basileŒ« parab@« t@« p]rÌ« ^Rvma›oy« synù‹ka« kaÏ synagagø[n t@« dynˇmei« ãpexe›rh]sen k÷rio« genwsùai tá« mhùÍn Yaytâi pro[shko÷sh« xØra]«, kaÏ prokatalabfimeno« t@« prokeimwna« Łmân pfi[lei« $pˇt]>, ãkrˇthsen kaÏ tá« Łmetwra« pfilev« kataplhjˇmeno« [tâi] te pl‹ùei tân dynˇmevn kaÏ tâi $prosdok‹tvi tá« ãpibolá«· [Ç] dÍ dámo« Łmân $pÌ tá« $rxá« synfylˇssvn tÎn prÌ« ^Rvma›oy« e¾noian, ãsxhkø« kairÌn prÌ« tÌ bohùeÖn toÖ« koinoÖ« prˇgmasin, kwkriken $nadeÖjai tÌn prÌ« Miùradˇthn pfilemon Épwr te tá« ^Rvma›vn Łgemon›a« kaÏ tá« koiná« ãleyùer›a«, ÇmoùymadÌn pˇntvn tân politân ãpidedvkfitvn YaytoŒ« eå« toŒ[« p]erÏ to÷tvn $gâna«.
Mnemopoetik
153
diesen Beschluss nicht etwa auf, um irgenwelche Maßnahmen schriftlich festzuhalten, sondern um ein tendenziöses Geschichtsbild zu prägen. Im Text von Metropolis wird der Tod des Apollonios nur mit wenigen Worten zur Sprache gebracht („er hat mit den jungen Männern gekämpft und ist gefallen“); dass jene Schlacht verloren wurde97, wird verschwiegen, dafür wird aber seine Kampfparänese zusammengefasst: Als aber zuletzt die Sache zur Entscheidung anstand, spornte er die Männer, die mit ihm ins Feld gezogen waren, an, wie es ihm und unserer Stadt angemessen war, und meinte, es zieme sich, für die Vaterstadt und die Mitbürger und die zurückgegebene Freiheit zu kämpfen und den Ruhm und die Ehre, die mit seiner Person in Zukunft verbunden sind, als Gabe am Grabe zu erhalten. (A Z. 30–33)
Von Rom und Loyalität zu den Römern ist in dieser letzten emotionalen Rede des Apollonios keine Spur. Nicht für Rom führte er die jungen Männer in den Tod, sondern für die Freiheit. Der Unterschied zwischen der Zusammenfassung dieser Kampfparänese und dem Rest des Beschlusses läßt eine Spannung im Text erkennen, die Existenz unterschiedlicher Auffassungen und unterschiedlicher Adressaten: Im einen Fall sind junge Männer die Adressaten, die ermutigt werden, für das Vaterland zu sterben; im anderen Fall wird die Loyalität gegenüber den Römern als Begründung einer verdienten Freiheit hervorgehoben. So wie sich die Akzente im Text selbst verschieben, so veränderte sich auch seine emotive Wirkung, als die Entfernung von den Ereignissen wuchs.
8 Epigraphische Texte erwecken Emotionen So komme ich auf den letzten Punkt meiner Ausführungen zu sprechen, auf die emotive Funktion von Inschriften als Träger eines emotionalen Gedächtnisses98. Um die Elemente von Emotionalität im Ehrendekret für Apollonios zu verstehen, müssen wir erst diese Inschrift in ihren historischen Kontext setzen. Wie ich in anderen Arbeiten dargelegt habe99, werden öffentliche Inschriften – insbesondere Dekrete – vom späten 4. Jh. v. Chr. an durch ‚emotionale Sprache‘ und Zurschaustellung von Gefühlen charakterisiert. Als ‚emotionale Sprache‘ bezeichne ich Ausdrücke, welche Gefühle zeigen, beschreiben oder wecken. Das früheste Bespiel von Verwendung ‚emotionaler
97 Zum für die Römer unglücklichen Verlauf des Krieges in seiner ersten Phase s. Dreyer und Engelmann (2003) 71–72 (aber mit Datierung der Schlacht um Thyatira ins Jahr 131, und nicht im Mai 132 v. Chr.); Jones (2004) 481–485. 98 Zur komplexen Verbindung zwischen Emotion und Gedächtnis von der Perspektive der kognitiven Psychologie s. jüngst Levine und Pizzaro (2006) mit weiterer Literatur. 99 Zur emotiven Funktion hellenistischer Dekrete s. Chaniotis (2013c) und (2013d).
154
Angelos Chaniotis
Sprache‘ in einem Psephisma ist das posthume Ehrendekret für den attischen Redner Lykurg (307/6 v. Chr.), zugleich auch der früheste Fall eines detaillierten ‚biographischen‘ Ehrendekrets. An einer fragmentarischen Stelle beschreibt der Antragsteller die Leistungen Lykurgs. Der Teil über Alexanders Herrschaft ist gut erhalten100: Als große Ängste und Gefahren die Griechen umgaben, nachdem Alexander Theben besiegt hatte und ganz Asien und andere Teil der bewohnten Erde unterworfen hatte, widersetzte er sich stets Alexander für das Volk und zeigte sich während seines ganzen Lebens als nicht korrupt und über jeden Vorwurf erhaben für das Vaterland und für die Rettung aller Griechen, indem er mit allen Mitteln kämpfte, damit die Stadt frei und autonom bleibt. Als Alexander seine Auslieferung verlangte, weigerte sich aus diesem Grund das Volk, nachzugeben und auch nur darüber zu reden …
Der Antragsteller stellt die Furcht der Griechen und den Mut Lykurgs und der Athener gegenüber. Er verstärkt den Kontrast durch den Hinweis auf Theben, dessen Zerstörung klar gemacht hatte, welches Schicksal Alexanders Widersacher erwartete. Auch der Hinweis auf Freiheit und Autonomie nur kurze Zeit nach dem Sturz des makedonenfreundlichen Regimes von Demetrios von Phaleron hatte einen starken emotionalen Aspekt. Die Verwendung von ‚emotionaler Sprache‘ in Volksbeschlüssen, wie jenes für Lykurg, erfüllt vier Funktionen: explikative, emotive, kommemorative, performative. Sie rechtfertigt Handlungen und Entscheidungen durch Hinweis auf Emotionen; sie beabsichtigt, Emotionen zu erwecken; sie trägt dazu bei, dass der Leser/Zuhörer ein lebhaftes Bild von einer vergangenen Situation hat; und sie soll Leser/Zuhörer stark beeindrucken. In dieser Hinsicht unterscheiden sich die Dekrete, die solche Merkmale aufweisen, nicht von rhetorischen oder historiographischen Texten. Ein hervorragendes Beispiel für ‚emotionale Sprache‘ in hellenistischen Psephismata ist das lange biographische Ehrendekret für Protogenes von Olbia (um 200 v. Chr.). Ich beschränke mich hier auf die Stelle, an der von einem bevorstehenden Angriff die Rede ist101:
100 Antrag des Stratoklos: Syll.3 326 Z. 10–19 (=IG II2 457): 10 || ffibvn k[aÏ kind÷nvn megˇlvn toŒ«] Ellhna« peristˇntvn [le|[jˇndrvi Uhbân ãpikrat‹sa]nti kaÏ p»san tÎn [s›an k|[aÏ t@ ¡lla tá« oåkoymwnh«? m]wrh katastrecamwnvi di|[etwlei ãnantio÷meno« ÉpÍ]r toÜ d‹moy $diˇfùoron k|[aÏ $nejwlenkton aÉtÌn ÉpÍ]r tá« patr›do« kaÏ tá« tâ15||[n ^Ell‹nvn 4pˇntvn svthr›a«] di@ pantÌ« toÜ b›oy par|[wxvn kaÏ ÉpÍr toÜ tÎn pfilin] ãleyùwran eÚnai kaÏ a\t|[finomon pˇshi mhxanái $gvni]zfimeno«, di’ ƒper ãjait‹|[santo« a\tÌn [lejˇndroy Ç d]ámo« $pwgnv mÎ synxvrá|[sai mhdÍ lfigon poeÖsùai tá«] ãjait‹sev«. 101 Dekret für Protogenes: IOSPE I2 32 B Z. 1–21: öti dÍ toÜ ple›stoy mwroy« toÜ prÌ« tÌm pot[a]|mÌn tá« pfilev« $teix›stoy ònto«, toÜ te kat [@] | tÌn limwna pantÌ« kaÏ toÜ kat@ tÌ prfiter[on] | Épˇrxon ˙ åxùyopØlion, õv« oí Ç ûrv« Ç Svs›a«, 5 || tân dÍ a\tomfilvn ãpaggellfintvg Galˇ|ta« kaÏ Sk›roy« ˙ pepoiásùai symmax›an kaÏ d÷|namin synáxùai megˇlhn kaÏ ta÷thn toÜ xei|mâno« ûjein ãpaggellfintvn, prÌ« dÍ to÷|toi« Uisamˇta« kaÏ Sk÷ùa« kaÏ Saydarˇta« ãpi10||ùymeÖn toÜ çxyrØmato«, dedifita« Ñsa÷tv« kaÏ | a\toŒ« tÎn tâg Galatân èmfithta, kaÏ di@ | taÜta pollân ãxfintvn $ù÷mv« kaÏ
Mnemopoetik
155
Der größte Teil der Stadt entlang des Flusses war unbefestigt, ebenso der ganze Teil auf der Seite des Hafens und des alten Fischmarktes, bis zum (Kultort des) Heros Sosias; und die Deserteure kündigten an, dass die Galater und die Skiroi ein Bündnis gebildet hatten, und dass sich eine große Streitmacht gebildet hatte und im Winter kommen würde; sie kündigten zusätzlich an, dass die Thisarnatai, die Skythen und die Saudaratai die Festung begierig beobachteten, weil auch sie vor der Grausamkeit der Galater Angst hatten. Aus diesem Grund waren viele verzweifelt und dabei, die Stadt zu verlassen. Ausserdem gab es große Verluste auf dem Lande, da die gesamte unfreie Bevölkerung und die Halbgriechen, die auf der Ebene entlang des Ufers leben, verloren gegangen waren, nicht weniger als 1500, die im vergangenen Krieg als Verbündete der Stadt gekämpft hatten; und viele Fremde und nicht wenige Bürger hatten die Stadt verlassen.
Auffällig ist hier die Freude an Details. Der Redner/Antragsteller beschreibt die genaue Länge der unbefestigten Perimeter der Stadt; er gibt eine Zahl für die Deserteure auf dem Lande; er listet die Namen der Barbaren auf, die die Stadt bedrohen. Er hätte leicht sagen können: „Der größte Teil der Stadt war unbefestigt und eine große barbarische Streitmacht war dabei, anzugreifen. Aus diesem Grund waren zahlreich die Deserteure, zahlreich die Verzweifelten“. Der anonyme Redner gab aber diese Details, weil sie der lebhaften Beschreibung jener Erfahrung dienten und beim Zuhörer Emotionen erweckten. Die lange Liste barbarischer Namen vergegenwärtigte die Größe der Gefahr und die Fremdartigkeit des Feindes, der mit seiner Grausamkeit (omotes) jenseits der zivilisierten Welt stand. Die Auflistung der unbefestigten Teile der Stadt unterstrich ihre Verletzlichkeit. Die Nennung des Helden Sosias (des ‚Rettenden‘) spielte auf die Notwendigkeit eines neues Retters an, eines Soter. All das bezeichnet die hellenistische Theorie der Rhetorik als enargeia102: die Zeichnung mentaler Bilder, die dem Zuhörer den Eindruck erwecken, er sei Augenzeuge eines Ereignisses. Ziel dieses Teils der Rede war die Vergegenwärtigung der emotionalen Lage in Olbia zur Zeit der Verzweiflung und dann der Erleichterung. Die Erinnerung an Gefahr und Angst begründete das Gefühl grenzenloser Dankbarkeit. Die folgende Stelle beschreibt mit ähnlicher enargeia eine Szene in der Versammlung103:
pareske|asmwnvn ãgle›pein tÎm pfilin, ´ma dÍ tâi kaÏ | ¡lla gegenásùai ãlattØmata poll@ 15 || kat@ tÎg xØran, ãfùˇrùai mÍn tÎn oåkete›|an ´pasan kaÏ toŒ« tÎm parØreian oå|koÜnta« Mijwllhna«, o\k ãlˇttoy« òn|ta« tÌn $riùmÌn xil›vn kaÏ pentakos›vn, | toŒ« ãn tâi protwrvi polwmvi symmax‹santa« 20 || ãn tái pfilei, ãgleloipwnai dÍ polloŒ« mÍn | tâg jwnvn, o\k çl›goy« dÍ tâm politân. Nähere Besprechung in Chaniotis (2013b). 102 Zu enargeia in der rhetorischen Theorie s. Webb (2009) insb. 87–105. Zu enargeia in hellenistischen Dekreten s. Chaniotis (2013b). 103 IOSPE I2 32 B Z. 21–27: ìn õ|neken synelùøn Ç dámo« dihgvniakø« kaÏ tÌg | k›ndynon tÌm mwllonta kaÏ t@ dein@ prÌ ç|fùalmân poio÷meno« parekˇlei pˇnta« 25 || toŒ« åsx÷onta« bohùásai kaÏ mÎ periideÖn tÎn ãk | pollân ãtân tethrhmwnhm patr›da Époxe›|rion genomwnhn toÖ« polem›oi«.
156
Angelos Chaniotis
Aus diesem Grund versammelte sich das Volk in großer Furcht, und die bevorstehenden Übel vor Augen haltend forderte es alle Mächtigen auf, zu helfen und nicht mit Gleichgültigkeit zu sehen, wie die Heimat, die von so vielen Gefahren gerettet war, in die Hände der Feinde fällt.
Abgesehen vom direkten Hinweis auf das Gefühl der Angst beobachtet man hier auch Hinweise auf die Sinne: auf das Hören und das Sehen: Das Volk sah die Katastrophe vor Augen (dein@ prÌ çfùalmân poio÷meno«); es flehte an (parekˇlei, łj›oy). In der Poetik rät Aristoteles dem Dichter, die Handlung so zu konstruieren und die sprachliche Formulierung so zu bearbeiten, dass die Zuschauer die Handlung vor Augen haben (prÌ çmmˇtvn tiùwmenon)104. In jener Volksversammlung in Olbia präsentierten die Volksredner lebhafte Bilder der bevorstehenden Katastrophe. Die Stadt, deren Name selbst (Olbia, die ‚Glückselige‘) Prosperität und Glück verhieß, stand vor der Vernichtung. Und just in diesem Moment der absoluten Verzweiflung erschien Protogenes als deus ex machina und „versprach, beide Teile der Stadtmauer bauen zu lassen und das Geld vorzuschießen“. Der Antragsteller rekonstruierte jene dramatische Sutuation, um die Ehrung des Protogenes zu begründen. Indem der Text epigraphisch aufgezeichnet wurde, gestaltete er eine emotionale Version der Vergangenheit, die dauerhaft auf die Empathie des Lesers zielte. Bürgergemeinden, die einen fremden Angriff erwarten, mögen zwar Angst empfinden, nach aussen hin zeigen sie aber theatralischen Mut. Als Aphrodisias 88 v.Chr. einen Angriff des Mithridates erwartete, erklärten die Behörden gegenüber den Römern105: Unser gesamtes Volk, zusammen mit den Frauen und den Kindern und unserer gesamten Habe, ist bereit alles für Quintus und die Sache der Römer zu riskieren; ohne die Führung der Römer sind wir bereit nicht einmal zu leben.
Die Behörden hatten die Frauen, die Kinder und die Sklaven gewiss nicht um ihre Meinung gefragt. Das ist theatralische Manifestation von Mut. Für die Aufzeichnung ausgewählt, konstruierte dieses Dokument eine Erinnerung an Krieg, Treue und Leiden, die noch Jahrhunderte später wirksam war. Denn dieses Dokument ist im 2. Jh. n. Chr. für eine Neuaufzeichnung im Theater der Stadt ausgewählt worden. Warum spielt also die Angst so eine große Rolle im Dekret von Olbia und in einigen weiteren öffentlichen Inschriften, wie etwa im vorhin zitierten Beschluss von Ephesos106? Der Kontext der Kommunikation gibt die Antwort. Ziel des Dekrets war die Erweisung von ausserordentlichen Ehren an Protogenes. Die Beschreibung der Panik von damals unterstrich die Erleichterung für die Abwehr der Gefahr und ließ
104 Aristot. poet. 1455a23: deÖ dÍ toŒ« m÷ùoy« synistˇnai kaÏ tÕ lwjei synapergˇzesùai ƒti mˇlista prÌ çmmˇtvn tiùwnai. Vgl. Polyb. 2.56.8: peirØmeno« (d.h. Phylarchos) ãn Ykˇstoi« $eÏ prÌ tân çfùalmân tiùwnai t@ deinˇ. Zu dieser Formulierung bei Aristoteles and Polybios s. Williams (2007) 28–37; Marincola (2010) 449–451. 105 Reynolds (1982) 11–16 Nr. 2 b II 11–14; IAph2007 8.3. 106 S. o. S. 152.
Mnemopoetik
157
die Wohltat des Protogenes so groß erscheinen, dass jede Ehrung gerechtfertigt erscheinen musste107. Die Manifestation von Emotionen erweist sich hier als Überzeugungsstrategie. Durch die Volksversammlung angenommen wurde dann der Text epigraphisch aufgezeichnet, um die Erinnerung an jene dunkle Stunde und das Gefühl der Dankbarkeit dauerhaft zu bewahren. Wie lange wirkte diese Inschrift? Wie lange tolerierten die Bürger von Olbia diese Erinnerung? Die Inschrift des Protogenes ist nicht vollständig erhalten, und ich frage mich, ob sie nicht von neidischen Olbianern zerstört wurde. Auch die Ehreninshrift für Apollonios gehört zur Gruppe hellenistischer Psephismata, die eine ‚emotionale Sprache‘ verwenden. Gefühle werden direkt erwähnt oder impliziert. Die Freude des Volkes für die wiedergewonnene Freiheit wird explizit genannt (A Z. 21f.: met@ tá« meg›sth« xar»« $podejˇmeno« tÎn ãleyùer›an). Wiederholt wird die Furchtlosigkeit des Apollonios angesprochen (A Z. 28: tÎn kaù# YaytÌn e\cyx›an), der keiner Gefahr auswich (A Z. 4: o¾te k›ndynon o¾te kakop[ˇùeian ãkkl›na«]; A Z. 29: o\dwpote diakl›na« tÌn ãsfimenon a\tâi prÌ« toŒ« ãnant›oy« $gâna; vgl. A Z. 17: pˇnta kaÏ lwgein kaÏ prˇssein Épwsth; A Z. 24: Épome›na«). Man hört ferner von der Heimatliebe des Apollonios (Z. 6f.: tá« prÌ« tÎ[n patr›da] e\no›a«; Z. 10f.: toÖ« met# e\no›a« õkasta prˇssoysin ÉpÍr tá« pfilev«; A Z. 25: t‹n te prÌ« tÎn patr›da kaÏ #Rvma›oy« e¾noian), der Dankbarkeit des Volkes (A Z. 11: t@« kataj›a« $podidfinai xˇrita«), der Freiheitsiebe (A Z. 18f.: tÎn toÜ d‹moy prfiùesin tá« ãleyùer›a«; A Z. 32f.: ÉpÍr patr›do« kaÏ politân kaÏ tá« $podedomwnh« ãleyùer›a« $gvnisˇmeno«), und der Zuneigung der Söhne gegenüber dem Vater (A Z. 40f: tái prÌ« tÌn patwra filostorg›ai). Nicht direkt angesprochen, aber deutlich zu erkennen ist ferner das Gefühl der Hoffnung (A Z. 43f.: Ñ« ©n tˇxista … eå« eår‹nhn kaÏ e\nom›an katast‹svsin t@ prˇgmata). Dieser emotionale Text war erst in der Versammlung als Antrag vorgetragen worden. Zu jenem Zeitpunkt war der Krieg noch unentschieden. Es war nicht einmal sicher, ob man je Apollonios’ Gebeine zurückführen konnte: Ferner solle man sich bemühen, seine Gebeine heimzuführen, sobald die Gesandten, die vom Senat angekommen sind, dank ihrer persönlichen Tapferkeit und Tüchtigkeit die Wende (im Krieg) gegen Aristonikos erreicht und die Verhältnisse in einen friedvollen und wohlgeordneten Zustand gebracht haben.
Wir wissen, dass der Krieg gewonnen wurde; die Volksversammlung, die den Beschluss verlangte und dann verabschiedete, wusste es nicht. Es vergingen Monate, möglicherweise Jahre, bis das Denkmal fertig war. Der Krieg war vielleicht zu Ende,
107 Andere hellenistische Volksbeschlüsse, in denen die explizite Erwähnung von Furcht dazu dient, die besondere Leistung einer Person hervorzuheben: IG II2 457 fr. b1 (307 v. Chr.); I.Erythrai 24 (um 275 v. Chr.); I.Histriae 15 (um 200 v. Chr.); I.Sestos 1 (um 100 v. Chr.); F.Delphes III.4.69. Dieses Phänomen ist vor dem späten 4. Jh. v. Chr. unbekannt.
158
Angelos Chaniotis
als das Denkmal eingeweiht wurde, nicht nur als Ehrens-, sondern nun als Siegesdenkmal und Beweis, dass Metropolis in schwerster Not den Römern treu geblieben war. Jahrzehnte später erinnerte es nur daran, dass Metropolis früher einmal frei gewesen war. Die emotionale Reaktion auf den Text veränderte sich innerhalb weniger Jahre. Auf die Angst um die Zukunft folgte die Freude über den Sieg und irgendwann später die Enttäuschung über die wiederverlorene Freiheit. (A Z. 43–44)
9 Ergebnisse Im frühen 1. Jh. v. Chr. fiel Nikeratos von Olbia, Staatsmann und Anführer seiner Stadt im Krieg, einem Attentat zum Opfer108: „Da die Feinde seine unwiderstehliche Tugend fürchteten, hatten sie nicht den Mut, ihn offen anzugreifen, sondern sie ermordeten ihn hinterhältig in der Nacht“. Vor diesem Ereignis erschüttert und bewegt beschlossen die Bürger von Olbia, ihn mit öffentlichem Begräbnis und einer Statue zu ehren109: Man soll eine Statue, die ihn als Reiter darstellt, an dem Ort aufstellen, den seine Angehörigen wollen, und ihm folgende Inschrift gewähren: ‚Das Volk (ehrt) Nikeratos, Sohn des Papias, für seine Tugend und seine Wohltaten ihm gegenüber, der in der Tradition seiner Vorfahren ein Wohltäter gewesen ist und viel Gutes für die Stadt erreicht hat‘. Man soll die Statue jedes Jahr bekränzen, während der Wahlersammlung und [- – – und] auch während des Wettkampfes zu Ehren von Achill, zum Zeitpunkt des Verlesens des Orakels für den Reiterwettkampf, indem der Herold den Text der Inschrift seiner Statue vorträgt.
Inschriften sind Texte und als solche das Ergebnis von Selektion, Komposition und Intention. Auf nicht vergänglichem Material aufgeschrieben und an öffentlichen Orten aufgestellt, sind sie auch Monumente, deren Wirkung durch Rituale und performative Akte erhöht wird. Nur gelegentlich erhalten wir Auskunft davon, wie Inschriften in Rituale (z.B. Vereidigungen, Gedächtnisfeiern usw.) integriert waren110. Selbst
108 IOSPE I2 34 Z. 18–20: oÅ polwmioi, tÌ $nypfistaton a\toÜ tá« $retá« de›sa[nte«, ãk mÍn toÜ faneroÜ] o\k [ãù]ˇrrhsan ãpibaleÖn, ãnedre÷sante« dÍ a\tÌn n÷ktr ãdo[lof]finh[san]. 109 IOSPE I2 34 Z. 26–31: $nastaùána› te a\]toÜ kaÏ $ndriˇnta öfippon ãn ˚ ©n tfip8 oÅ pros‹konte« a\toÜ [bo÷lvntai kaÏ ãpigrafÎn d]oÜnai t‹nde· „Ç dámo« Neik‹raton Pap›oy, tÌn $[p]Ì progfinvn e\er[gwthn ònta kaÏ pleÖsta t]ái pfilei katorùvsˇmenon $gaùˇ, $retá« õ[n]eka kaÏ e\erges›a« [tá« eå« aÉtfin„· stefa]noÜsùai dÍ a\tÌn kaÏ kaù’ õkaston ãniaytÌn ãn tái $rxairetikái ãk[lhs›ai kaÏ ãn tâi – – – $]gâni t$xilleÖ kat@ tÌ pyùfixrhston tá« Åppodrom›a«, toÜ k‹ryko« $n[agore÷onto« kaùø« Ł ãp]igrafÎ {i} toÜ $ndriˇnto« periwxei. Der Sinn von kat@ tÌ pyùfixrhston tá« Åppodrom›a« ist nicht klar. Ich übersetze „am Zeitpunkt des Verlesens des Orakels für den Reiterwettkampf“; Ehrendekrete geben oft den genauen Zeitpunkt der Bekränzung an; s. Chaniotis (2007) 56–57. Andere Deutungen sind möglich. 110 Für Inschriften in religiösen Ritualen s. Chaniotis (2011) 284–285. Bekränzung von Statuen: z.B. I.Ephesos 5113 Z. 14–15. Für historische Gedenktage, die oft mit Kriegsdenkmälern zusammenhingen s. Chaniotis (1991), (2005) 227–236 und (2012b).
Mnemopoetik
159
wenn dies nicht ausdrücklich gesagt wird111, können wir aber davon ausgehen, dass Rituale nicht nur ein Denkmal (Ehrenstatue, Grab, Siegesdenkmal), sondern auch die dazugehörige Inschrift (wie im Falle des Nikeratos von Olbia) einschlossen. Rituale, wie das Verlesen einer Inschrift während der periodischen Bekränzung einer Statue, trugen zur Bedeutung von Inschriften als Medium der Geschichte bei. In dieser Arbeit wurden einige wichtige Aspekte der ‚mnemopoetischen‘ Funktion von Inschriften herausgearbeitet, die ich hier kurz zusammenfasse: Epigraphische Texte sind das Ergebnis von Auswahl, aufgezeichnet, um eine selektive Version der Vergangenheit zu vermitteln. Sie bewahren ein sorfältig gestaltetes Stück Vergangenheit für künftige Leser und sind in diesem Sinne Medien einer ‚intentionalen Historie‘112. Als hypomnemata dienen sie als Gedächtnisstützen und Medien der Erinnerungskontrolle; der Ort ihrer Aufstellung ist Ort der Erinnerung. Epigraphische Texte wurden als historische Zeugnisse verstanden und als solche wurden sie restauriert, aber auch absichtlich zerstört113. Oft förderten sie die Erinnerung an Protagonisten und deren Familie. Schließlich erweckten die epigraphischen Texte Emotionen. Diese ‚mnemopoetische‘ Funktion gilt allerdings auch für Inschriften jenseits der öffentlichen Sphäre, z.B. für Weihungen und Grabinschriften. Weihungen an Götter, privat wie öffentlich, erinnerten oft an den Anlass der Weihung – Erfolg im Wettkampf, Sieg im Krieg, Rettung aus einer Gefahr, Erscheinen des Gottes im Traum. Ihre Verfasser hatten dadurch die Möglichkeit, ihr persönliches Bild vom Geschehenen zu vermitteln. Ich gebe zwei Beispiele: eine Weihung und eine Grabinschrift. Als um 130 v. Chr. die Nachricht in Bouchetion (Epeiros) ankam, dass der römische Konsul Marcus Perpena einen Feldzug gegen Aristonikos organisierte, schlossen sich drei adlige Männer, Philotas, Hipparchos und Kylisos den römischen Truppen an. Etwa ein Jahr später kehrten sie siegreich in ihre Heimat zurück und dankten Herakles, ihrem Retter in den Schlachten, durch die Weihung seiner Statue in Kassope. Das Weihepigramm ist erhalten114:
111 Ein Beispiel: Als die dionysischen Künstler von Ionien und Hellespont ihren Wohltäter, den Flötenspieler Kraton von Kalchedon ehrten, beschlosse sie u.a. bei allen Prozessionen und Schaustellungen im Theater einen Dreifuss und einen Weihrauchbrenner vor seine Ehrenstatue aufzustellen; CIG 3068 Z. a 22–24: parat›ùesùai dÍ kaÏ ãn taÖ« ùwai« kaÏ ãn taÖ« pompaÖ« par@ tÌn $ndriˇnta tÌn Krˇtvno« tÌn ãn tâi ùeˇtrvi tr›podˇ te kaÏ ùymiat‹rion (Teos, frühes 2. Jh. v. Chr.). 112 Hierzu s. oben Anm. 9. 113 Beispiele in Flower (2006) 26–34. 114 SEG XXXVI 555: FilØta« Fr÷nvno«, | 6Ipparxo« Filojwnoy, | K÷liso« Polyjwnoy | ^HrakleÖ Svtári. | tÌn ãg DiÌ« blastfinta paÖd’ #Hraklwa | Svtár’ $nhgfireysan oÅ $pÌ K[as]sØph« | molfinte« ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙| ãp’ [ristfinikon, ¯n krat‹sante« [s›an ÅppikoÖ« çx‹masin, | ƒte strathgÌ« Òge Mˇarko« stratÌn ˙ ˙ dorÏ | ®Ømhn ¡goysin o¬de Boyxet›vn ¡po | blastfinte« #Oj[÷l]oy te toÜ pala›xùono«, | svùwnte« ù÷oysin eå« pˇtran $feigmwnoi, | tÌn synpa[r]astatoÜ[nt]a polemikaÖ« $eÏ | mˇxai« $nidr÷santo tfind’ ˙ ^Hraklwa. Vgl. Chaniotis (2005) 214.
160
Angelos Chaniotis
Diese Männer, die von Kassope aus mit Kriegswagen nach Asien gingen, als der Feldherr Marcus sein Heer gegen Aristonikos führte, erklärten öffentlich den von Zeus gezeugten Herakles als ihren Retter. Nachdem diese Männer von Bouchetion, Nachfahren des Oxylos, des alten Bewohners des Landes, ihn (Aristonikos) in einer Schlacht besiegt hatten, brachten sie Kraft zu ihrer Heimat. Anläßlich ihrer sicheren Rückkehr in ihr Vaterland brachten sie ein Opfer dar und stellten diese Statue des Herakles auf, der in allen Schlachten an ihrer Seite stand.
Dankbar und gleichzeitig stolz vermittelten die drei Männer ihren Landsleuten ihr selektives Bild vom Geschehenen durch diese Inschrift – und natürlich durch ihre mündlichen Erzählungen. Nicht nur hatten sie Aristonikos besiegt, auch Herakles hatte ihnen Beistand geboten. Ihre Weihung, wie alle Weihungen, war Zeugnis eines privilegierten Verhältnisses zur Gottheit: Sie hätten in direkter Kommunikation mit dem Gott gestanden. Genau wie Götter an der Seite der homerischen Helden kämpften, so kämpfte Herakles an ihrer Seite. Das Bild des Kriegswagens (ÅppikoÖ« çx‹masin) verstärkte die Verbindung der drei Männer mit heroischen Traditionen; mit dem Hinweis auf den mythologischen Nachfahren Oxylos erhöhten sie ihren Status und gaben ihrer Gemeinde einen Gründer in der Urzeit; mit der Aufstellung der Statue in der größeren Stadt Kassope erreichten sie ein größeres Publikum; das Wortspiel ®Ømhn ¡goysin („sie bringen Kraft“, „sie bringen Rom“) erinnerte daran, welche Vorteile sich für ihre Heimat durch ihren Dienst für Rom ergaben. Auch solche privaten, individuellen Initiativen konstruierten Erinnerung. Eine häufige Bezeichnung des Grabmnuments im Hellenismus und in der Kaiserzeit ist das Wort mnemeion. Das strategeion ist das Amtslokal der Strategen, das grammateion das des Schreibers, das mnemeion ist das Haus der Mneme, der Ort der Erinnerung an Individuen. Auch diese Erinnerung ist selektiv, konstruiert und emotional. Das Ziel auch solcher Texte besteht darin, Gedächtnis und Gefühl künftiger Leser zu manipulieren. Ein Grabepigramm aus Philippopolis verdeutlicht dies (2./3. Jh. n. Chr.)115: Hier liege ich bestattet, der skeuas [mit der linken Hand kämpfende Gladiator] Victor. Thessalonike war meine Vaterstadt. Ein Gott hat mich umgebracht, nicht der Betrüger Pinnas. Nicht länger wird er prahlen. Denn als Waffenkameraden hatte ich Polyneikes, der meinen Tod gerächt hat.
Es ist natürlich nicht der tote Victor, der hier spricht und seine Version von seinem Tod – wie in Akira Kuroshawas Rashomon – gibt, sondern der lebende Polyneikes. Er manipuliert die Stimme des Toten und läßt sich selbst das sagen, was er hören will, dass er seine Pflicht getan hat116. Dieser Text zeigt bei seiner Kürze in übersteigerter
115 IG X.2.1,1035: B›ktvr skey»« ãnùˇde keÖmai, patrÏ« dw moy Uessalone›kh· ökteine me da›mvn, o\x Ç ãp›orko« Pinna«. Mhkwti kayxˇsùv· ösxon ãgø synopl» Polyne›khn, ¯« kte›na« Pinnan ãjed›khsen ãmw. Kl(a÷dio«) Uˇllo« prowsth toÜ mnhme›oy ãj ìn katwlipen. 116 Für die Manipulation der Stimme des Toten in Grabepigrammen s. Casey (2004).
Mnemopoetik
161
Form, was die epigraphisch überlieferten Texte beabsichtigen. Inschriften sind Medium der Erinnerung, nicht weil sie zufällig erhalten sind, sondern weil sie mit Absicht auf Stein aufgezeichnet wurden, damit sie erhalten werden und künftige Erinnerung kontrollieren. Jedes Mal, wenn wir diese Inschrift lesen – laut lesen, wie es sich gehört –, wird auch unsere Stimme manipuliert und Polyneikes’ Name wird wieder gehört. Seine epigraphische Konstruktion von Erinnerung ist immer noch erfolgreich.
Literaturverzeichnis Aravantinos (2006): Vasileios L. Aravantinos, „A New Inscribed Kioniskos from Thebes“, The Annual of the British School at Athens 101, 369–377. Bada (2008): Valérie Bada, Mnemopoetics: Memory and Slavery in African American Drama, Brüssel. Baslez, Hoffmann u. Pernot (1993): Marie Françoise Baslez, Philippe Hoffmann u. Laurent Pernot (Hgg.), L’invention de l’autobiographie d’Hésiode à saint Augustine. (Actes du deuxième colloque de l’Équipe de recherches sur l’hellénisme postclassique. Paris 14–16 juin 1990), Paris. Baslez (1993): Marie Françoise Baslez, „Écriture monumentale et traditions autobiographiques: L’apport des inscriptions grecques“, in: Baslez, Hoffmann u. Pernot (1993) 71–80. Baumbach, Petrovic u. Petrovic (2010): Manuel Baumbach, Andrej Petrovic u. Ivana Petrovic (Hgg.), Archaic and Classical Greek Epigram, Cambridge. Baumbach, Petrovic u. Petrovic (2010): Manuel Baumbach, Andrej Petrovic u. Ivana Petrovic, „Archaic and Classical Greek Epigram. An Introduction“, in: Baumbach, Petrovic u. Petrovic (2010) 1–19. Bearzot (2003): Cinzia Bearzot, „L’usi dei documenti in Tucidide“, in: Biraschi u.a. (2003) 267–314. Bencivenni (2003):Alice Bencivenni, Progetti di riforme costituzionali nelle epigrafi greche dei secoli IV–II a.C., Bologna. Berling (1993): L.G. Berling, „Das Iason-Monument von Kyaneai“, in: Frank Kolb (Hg.), Lykische Studien, Bonn, 25–37. Berti (2010a): Stefano Berti, „La dedica degli Ateniesi per la vittoria su Beoti e Calcidesi del 506 a.C. (IG I3 501) e la data del suo ripristino“, Aevum 84, 7–40. Berti (2010b): Stefano Berti, „The Athenian Victory Over the Boeotians and the Chalkidians (506 B.C.) in the Light of the Epigraphical Findings“, Ancient History Bulletin 24, 3–23. Biraschi u.a. (2003): Anna Maria Biraschi, Paolo Desideri, Sergio Roda u. Giuseppe Zechini (Hgg.), L’uso dei documenti nella storiografia antica. (Incontri Perugini di storia della storiografia 12, Gubbio, 22–24 maggio 2001), Napoli. Blanshard (2004): Alastair J. L. Blanshard, „Depicting Democracy: An Exploration of Art and Text in the Law of Eukrates“, The Journal of Hellenic Studies 124, 1–15. Blanshard (2007): Alastair J. L. Blanshard, „The Problems with Honouring Samos: an Athenian Document Relief and its Interpretation“, in: Zahra Newby u. Ruth E. Leader-Newby (Hgg.), Art and Inscriptions in the Ancient World, Cambridge, 19–37. Bousquet (1988): Jean Bousquet, „La stèle des Kyténiens au Létôon de Xanthos“, Revue des études grecques 101, 12–53. Bresson (2006): Alain Bresson, „Relire la Chronique de Lindos“, Tfipoi. Orient – Occident 14, 527–551. Casey (2004): Eric Casey, „Binding Speeches: Giving Voice to Deadly Thoughts in Greek Epitaphs“, in: Ineke Sluiter u. Ralph M. Rosen (Hgg.), Free Speech in Classical Antiquity, Leiden/Boston, 63–90. Champion (1995): Craige B. Champion, „The Soteria at Delphi: Aetolian Propaganda in the Epigraphical Record“, American Journal of Philology 116, 213–220.
162
Angelos Chaniotis
Chaniotis (1987a): Angelos Chaniotis, „Ein neuer genealogischer Text aus Milet“, Epigraphica Anatolica 10, 41–44. Chaniotis (1987b): Angelos Chaniotis, „Das Ehrendekret für Diophantos (IOSPE I2 352) und die Geschichtsschreibung“, in: Alexander Fol, Vladimir Zhivkov u. Nikolai Nedjalkov (Hgg.), Acta Centri Historiae Terra Antiqua Balcanica II, Sofia, 233–235. Chaniotis (1988): Angelos Chaniotis, Historie und Historiker in den griechischen Inschriften. Epigraphische Beiträge zur griechischen Historiographie, Stuttgart. Chaniotis (1991): Angelos Chaniotis, „Gedenktage der Griechen: Ihre Bedeutung für das Geschichtsbewusstsein griechischer Poleis“, in: Jan Assmann (Hg.), Das Fest und das Heilige. Religiöse Kontrapunkte zur Alltagswelt, Gütersloh, 123–145. Chaniotis (1999): Angelos Chaniotis, „Empfängerformular und Urkundenfälschung: Bemerkungen zum Urkundendossier von Magnesia am Mäander“, in: Raif Georges Khoury (Hg.), Urkunden und Urkundenformulare im Klassischen Altertum und in den orientalischen Kulturen, Heidelberg, 51–69. Chaniotis (2003): Angelos Chaniotis, „Vom Erlebnis zum Mythos: Identitätskonstruktionen im kaiserzeitlichen Aphrodisias“, in: Elmar Schwertheim u. Engelbert Winter (Hgg.), Stadt und Stadtentwicklung in Kleinasien, Bonn, 69–84. Chaniotis (2005): Angelos Chaniotis, War in the Hellenistic World: A Social and Cultural History, Malden/Oxford. Chaniotis (2007): Angelos Chaniotis, „Theatre Rituals“, in: Peter Wilson (Hg.), The Greek Theatre and Festivals. Documentary Studies, Oxford, 48–66. Chaniotis (2009a): Angelos Chaniotis, „Travelling Memories in the Hellenistic World“, in: Richard Hunter and Ian Rutherford (Hgg.), Wandering Poets in Ancient Greek Culture: Travel, Locality, and Panhellenism, Cambridge, 249–269. Chaniotis (2011): Angelos Chaniotis, „Emotional Community through Ritual. Initiates, Citizens, and Pilgrims as Emotional Communities in the Greek World“, in: Angelos Chaniotis (Hg.), Ritual Dynamics in the Ancient Mediterranean: Agency, Emotion, Gender, Representation, Stuttgart, 264–290. Chaniotis (2012a): Angelos Chaniotis, „Listening to Stones: Orality and Emotions in Ancient Inscriptions“, in: John Davies u. John Wilkes (Hgg.), Epigraphy and the Historical Sciences. XIII International Congress of Greek and Latin Epigraphy, Oxford, 299–328. Chaniotis (2012b): Angelos Chaniotis, „The Ritualised Commemoration of War in the Hellenistic City: Memory, Identity, Emotion“, in: Polly Low, Graham Oliver u. Peter Rhodes (Hgg.), Cultures of Commemoration: War Memorials, Ancient and Modern, Oxford, 41–62. Chaniotis (2013a): Angelos Chaniotis, „Normen stärker als Emotionen? Der kulturhistorische Kontext der griechischen Amnestie“, in: Kaja Harter-Uibopuu u. Fritz Mitthof (Hgg.), Vergeben und Vergessen? Amnestie in der Antike (Akten des ersten Wiener Kolloquiums zur Antiken Rechtsgeschichte, Wien, 27. – 28. 10. 2008), Wien, 47–70. Chaniotis (2013b): Angelos Chaniotis, „Paradoxon, Enargeia, Empathy: Hellenistic Decrees and Hellenistic Oratory“, in: Christos Kremmydas u. Kathryn Tempest (Hgg.), Hellenistic Oratory: Continuity and Change, Oxford, 201–216. Chaniotis (2013c): Angelos Chaniotis, „Emotional Language in Hellenistic Decrees and Hellenistic Histories“, in: Manuela Mari, Daniela Motta, Umberto Roberto u. John Thornton (Hgg.), Linguaggio politico e lessico storiografico in età ellenistica, Rom, 339–352. Chaniotis (2013d): Angelos Chaniotis, „Affective Epigrahy: Emotional Display in Public Inscriptions of the Hellenistic Period“, Mediterraneo Antico (im Druck). Clarke (2005): Katherine Clarke, „Parochial Tales in a Global Empire: Creating and Recreating the World of the Itinerant Historians“, in: Lucio Troiani u. Giuseppe Zecchini (Hgg.), La cultura storica nei primi due secoli dell’impero romano, Rom, 111–128.
Mnemopoetik
163
Coarelli (2005): Filippo Coarelli, „Aristonico“, in: Biagio Virgilio (Hg.). Studi Ellenistici 16, Pisa, 211–240. Culasso Gastaldi (2007): Enrica Culasso Gastaldi, „Atene nella prima età ellenistica: la testimonianza dei decreti onorari“, in: Desideri, Roda u. Biraschi (2007) 115–138. Curty (1995): Olivier Curty, Les parentés légendaires entre cités grecques. Catalogue raisonné des inscriptions contenant le terme syggwneia et analyse critique, Genf. Curty (1999): Olivier Curty, „La parenté légendaire à l’époque hellénistique. Précisions méthodologique“, Kernos 12, 167–194. Curty (2005): Olivier Curty, „Un usage fort controversé: La parenté dans le langage diplomatique de l’époque hellénistique“, Ancient Society 35, 101–117. Daubner (2006): Frank Daubner, Bellum Asiaticum. Der Krieg der Römer gegen Aristonikos von Pergamon und die Einrichtung der Provinz Asia, 2. Auflage, München. Davies (1996): John K. Davies, „Documents and ‚Documents‘ in Fourth-Century Historiography“, in: Pierre Carlier (Hg.), Le IVe siècle av. J.-C. Approches historiographiques, Nancy, 29–39. Davies (2003): John K. Davies, „Greek Archives: From Record to Monument“, in: Maria Brosius (Hg.), Ancient Archives and Archival Traditions: Concepts of Record-Keeping in the Ancient World, Oxford, 323–343. Desideri, Roda u. Biraschi (2007): Paolo Desideri, Sergio Roda u. Anna Maria Biraschi (Hgg.), Costruzione e uso del passato storico nella cultura antica. (Atti del convegno internazionale di studi, Firenze 18–20 settembre 2003), Alessandria. Dillery (2005): John Dillery, „Greek Sacred History“, American Journal of Philology 126, 505–526. Dmitriev (2004): Sviatoslav Dmitriev, „Alexander’s Exiles Decree“, Klio. Beiträge zur alten Geschichte 86, 348–381. Dreyer (2005): Boris Dreyer, „Rom und die griechischen Polisstaaten an der westkleinasiatischen Küste in der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts v. Chr. Hegemoniale Herrschaft und lokale Eliten im Zeitalter der Gracchen“, in: Altay Çoskun (Hg.), Roms auswärtige Freunde in der späten Republik und im frühen Prinzipat, Göttingen, 55–74. Dreyer u. Engelmann (2003): Boris Dreyer u. Helmut Engelmann, Die Inschriften von Metropolis, Teil I. Die Dekrete für Apollonios: städtische Politik unter den Attaliden und im Konflikt zwischen Aristonikos und Rom (Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien 63.1), Bonn. Eck (1995): Werner Eck, „Tituli honorarii, curriculum vitae und Selbstdarstellung in der Hohen Kaiserzeit“, in: Heikki Solin, Olli Salomies u. Uta-Maria Liertz (Hgg.), Acta Colloquii Epigraphici Latini, Helsinki, 211–237. Eilers (2009): Claude Eilers, „Inscribed Documents, Un-Inscribed Documents, and the Place of the City in the Imperium Romanum“, in: Haensch (2009) 301–312. Fabiani (2003): Roberta Fabiani, „Epigrafi in Erodoto“, in: Biraschi u.a. (2003) 163–185. Faraguna (2005): Michele Faraguna, „Scrittura e amministrazione nelle città Greche: Gli archivi pubblici“, Quaderni urbinati di cultura classica 80, 61–86. Flower (2006): Harriet I. Flower, The Art of Forgetting. Disgrace and Oblivion in Roman Political Culture, Chapel Hill. Foxhall u. Luraghi (2010): Lin Foxhall u. Nino Luraghi, „Introduction“, in: Gehrke, Luraghi u. Foxhall (2010) 9–14. Gehrke (2001): Hans-Joachim Gehrke, „Myth, History, and Collective Identity: Uses of the Past in Ancient Greece and Beyond“, in: Nino Luraghi (Hg.) The Historian’s Craft in the Age of Herodotus, Oxford, 286–313. Gehrke, Luraghi u. Foxhall (2010): Hans-Joachim Gehrke, Nino Luraghi u. Lin Foxhall (Hgg.), Intentional History: Spinning Time in Ancient Greece, Stuttgart. Habicht (1961): Christian Habicht, „Falsche Urkunden zur Geschichte Athens im Zeitalter der Perserkriege“, Hermes 89, 1–35.
164
Angelos Chaniotis
Habicht (1985): Christian Habicht, Pausanias’ Guide to Ancient Greece, Berkeley, Los Angeles/ London. Hadzis (1997): Catherine D. Hadzis, „Corinthiens, Lyciens, Doriens et Cariens: Aoreis à Corinthe, Aor, fils de Chrysaôr et Alétès fils d’Hippotès“, Bulletin de correspondance hellénique 121, 1–14. Haensch (2009): Rudolf Haensch (Hg.), Selbstdarstellung und Kommunikation. Die Veröffentlichung staatlicher Urkunden auf Stein und Bronze in der römischen Welt. (Internationales Kolloquium an der Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik in München 1. – 3. Juli 2006), München. Hamon (2008): Patrice Hamon, „Études d’épigraphie thasienne. I. Décret pour un historien thasien (fin du IIe s. ou début de Ier s. ac. J.-C.)“, Bulletin de correspondance hellénique 132, 404–416. Hatzopoulos u. Loukopoulou (1992): Miltiades B. Hatzopoulos u. Louisa D. Loukopoulou, Recherches sur les marches orientales des Temenides, Vol. I: Anthémonte-Kalindoia, Athen. Hedrick (1999): Charles W. Hedrick, „Democracy and the Athenian Epigraphical Habit“, Hesperia 68, 387–439. Hedrick (2006): Charles W.Hedrick, Jr., Ancient History. Monuments and Documents, Oxford. Heller (2006): Anna Heller, „Les bêtises des Grecs“. Conflits et rivalités entre cités d’Asie et de Bithynie à l’époque romaine (129 a.C.-235 p.C.), Bordeaux. Henry (1996): Alan S. Henry, „The Hortatory Intention in Athenian State Decrees“, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 112, 105–119. Hepding (1910): Hugo Hepding, „Die Arbeiten zu Pergamon 1908–1909“, Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Athenische Abteilung 35, 401–493. Hesberg (2009): Henner von Hesberg, „Archäologische Charakteristika der Inschriftenträger staatlicher Urkunden – einige Beispiele“, in: Haensch (2009) 19–56. Higbie (2003): Caroline Higbie, The Lindian Chronicle and the Greek Creation of their Past, Oxford. Holleaux (1898): Maurice Holleaux, „Décret d’Alabanda“,Revue des études grecques 11, 258–266. Jones (1999): Christopher P. Jones, Kinship Diplomacy in the Ancient World, Cambridge MA/London. Jones (2004): Christopher P. Jones, „Events Surrounding the Bequest of Pergamon to Rome and the Revolt of Aristonicos: New Inscriptions from Metropolis“, Journal of Roman Archaeology 17, 469–485. Knoepfler (2007): Denis Koepfler, „De Delphes à Thermos: un témoignage épigraphique méconnu sur le trophée galate des Étoliens dans leur capitale (le traité étolo-béotien)“, Académie des inscriptions et belles-lettres. Comptes rendus des séances de l’année, 1215–1253. Koch Piettre (2005): Renée Koch Piettre, „La Chronique de Lindos, ou comment accommoder les restes pour écrire l’Histoire“, in: Philippe Borgeaud u. Youri Volokhine (Hgg.), Les objets de la mémoire. Pour une approche comparatiste des reliques et de leur culte, Bern, 95–145. Kokkinia (2000): Christina Kokkinia, Die Opramoas-Inschrift von Rhodiapolis. Euergetismus und soziale Elite in Lykien, Bonn. Kolde (2003): Anje Kolde, Politique et religion chez Isyllos d’Épidaure, Basel. Krentz (2007): Peter Krentz, „The Oath of Marathon, not Plataia?“, Hesperia 76, 731–742. Labarre (1996): Guy Labarre, Les cités de Lesbos aux époques hellénistique et impériale, Paris. Lambert (2001): Stephen D. Lambert, „The Only Extant Decree of Demosthenes“, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 137, 55–68. Lambert (2010): Stephen D. Lambert, „Connecting with the Past in Lykourgan Athens: an Epigraphical Perspective“, in: Gehrke, Luraghi u. Foxhall (2010) 225–238. Lambert (2011a): Stephen D. Lambert, „What Was the Point of Inscribed Honorific Decrees in Classical Athens?“, in: Stephen D. Lambert (Hg.), Sociable Man. Essays in Greek Social Behaviour in Honour of Nick Fisher, Swansea, 193–210. Lambert (2011b): Stephen D. Lambert, „Some Political Shifts in Lykourgan Athens“, in: Vincent Azoulay u. Paulin Ismard (Hgg.), Clisthène et Lycurge d’Athènes. Autour du politique dans la cité classique, Paris, 175–190.
Mnemopoetik
165
Lambert (2012a): Stephen D. Lambert, Inscribed Athenian Laws and Decrees 352/1–322/1 BC: Epigraphical Essays, Leiden. Lambert (2012b): Stephen D. Lambert, „Inscribing the Past in Fourth-Century Athens“, in: John Marincola, Lloyd Llewellyn-Jones u. Calum Maciver (Hgg.), Greek Notions of the Past in the Archaic and Classical Eras. History Without Historians, Edinburg, 253–275. Lazzarini (1976): Maria Letizia Lazzarini, „Le formule delle dediche votive nella Grecia archaica“ Memorie Lincei s. VIII, v. 19.2, Rom, 45–354. Lefèvre (1993): François Lefèvre, „Parler de soi-même dans la cité d’Athènes: l’exemple du décret honorifique pour Phaidros de Sphettos“, in: Baslez, Hoffmann u. Pernot (1993) 81–83. Levine u. Pizarro (2006): Linda J. Levine u. David A. Pizarro, „Emotional Valence, Discrete Emotions, and Memory“, in: Bob Uttl, Amy L. Siegenthaler u. Nobuo Ohta (Hgg.), Memory and Emotion. Interdisciplinary Perspectives, Malden/Oxford, 37–58. Liddel (2003): Peter Liddel, „The Places of Publication of Athenian State Decrees from the Fifth Century BC to the Third Century AD“, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 143, 79–93. Lott (1996): J.B. Lott, Jr., „Philipp II, Alexander, and the Two Tyrannies at Eresos of IG XII.2.526, 26“, Phoenix 50, 26–40. Luraghi (2010): Nino Luraghi, „The Demos as Narrator: Public Honours and the Construction of Future and Past“, in: Gehrke, Luraghi u. Foxhall (2010) 247–263. Ma (2005): John Ma, „The Many Lives of Eugnotos of Akraiphia“, in: Biagio Virgilio (Hg.), Studi Ellenistici 16, Pisa, 141–191. Massar (2006): Natasha Massar, „La ‚Chronique de Lindos‘: un catalogue à la gloire du sanctuaire d’Athéna Lindia“, Kernos. Revue internationale et pluridisciplinaire de religion grecque antique 19, 229–243. McLean (2002): Bradley Hudson McLean, An Introduction to Greek Epigraphy of the Hellenistic and Roman Times from Alexander the Great Down to the Reign of Constantine (323 B.C. – A.D.337), Ann Arbor. Moretti (1967): Luigi Moretti, Iscrizioni storiche ellenistiche I, Firenze. Page (1981): Denys L. Page, Further Greek Epigrams, Cambridge. Paschidis (2008): Paschalis Paschidis, Between City and King. Prosopographical Studies on the Intermediaries between the Cities of the Greek Mainland and the Aegean and the Royal Courts in the Hellenistic Period (322–190 BC), Athen. Nachtergael (1977): Georges Nachtergael, Les Galates en Grèce et les Sotéria de Delphes. Recherches d’histoire et d’épigraphie hellénistique, Brüssel. Petrovic (2007): Andrej Petrovic, Kommentar zu den simonideischen Versinschriften, Leiden. Reynolds (1982): Joyce Reynolds, Aphrodisias and Rome, London. Rhodes (2001): Peter J. Rhodes, „Public Documents in the Greek States: Archives and Inscriptions“, Greece & Rome 48, 33–44, 136–153. Robert u. Robert (1989): Jeanne Robert u. Louis Robert, Claros I. Décrets hellénistiques, Paris. Rosen (1987): Klaus Rosen, „Ehrendekrete, Biographie und Geschichtsschreibung. Zum Wandel der griechischen Polis im frühen Hellenismus“, Chiron 17, 277–292. Ryan (2007): Francis X. Ryan, „The Decree Authorizing the Stala of Athana Lindia“, Epigraphica 69, 9–64. Schepens (2006): Guido Schepens, „Travelling Greek Historians“, in: Maria Gabriella Angeli Bertinelli u. Angela Donati (Hgg.), Le vie della storia. Migrazioni di popoli, viaggi di individui, circolazione di idee nel Mediterraneo antico (Serta antiqua et mediaevalia 9), Rom, 99–102. Schmidt-Dounas (1996): Barbara Schmidt-Dounas, „Die Halle des Antigonos Gonatas auf Delos“, in: Fritz Blakolmer u.a. (Hgg.), Fremde Zeiten. Festschrift für Jürgen Borchhardt zum sechzigsten Geburtstag am 25. Februar 1996 dargebracht von Kollegen, Schülern und Freunden II, Wien, 125–137.
166
Angelos Chaniotis
Schmitz (2010): Thomas Schmitz, „Speaker and Addressee in Early Greek Epigram and Lyric“, in: Baumbach, Petrovic u. Petrovic (2010) 25–41. Shaya (2005): Josephine Shaya, „The Greek Temple as Museum: The Case of the Legendary Treasure of Athena from Lindos“, American Journal of Archaeology 109, 423–442. Shear (2007): Julia L. Shear, „Cultural Change, Space, and the Politics of Commemoration“, in: Robin Osborne (Hg.), Debating the Athenian Cultural Revolution, Cambridge, 91–115. Shear (1978): T. Leslie Shear Jr., Kallias of Sphettos and the Revolt of Athens in 287 B.C., Princeton. Sickinger (1999): James P. Sickinger, Public Records and Archives in Classical Athens, Chapel Hill. Siewert (1972): Peter Siewert, Der Eid von Plataiai, München. Snowdon (2008): Michael Snowdon, „Commemorating Freedom: I. Metropolis and the Restoration of Freedom“, Mouseion Series III.8, 377–393. Tobin (1997): Jennifer Tobin, Herodes Attikos and the City of Athens. Patronage and Conflict under the Antonines, Amsterdam. Tracy (2000): Stephen V. Tracy, „Athenian Politicians and Inscriptions of the Years 307 to 302“, Hesperia 69, 227–233. Tueller (2010): Michael Tueller, „The Passer-by in Archaic and Classical Epigram“, in: Baumbach, Petrovic u. Petrovic (2010) 42–60. Vestrheim (2010): Gjert Vestrheim, „Voice in Sepulchral Epigrams: Some Remarks on the Use of First and Second Person in Sepulchral Epigrams, and a Comparison with Lyric Poetry“, in: Baumbach, Petrovic u. Petrovic (2010) 61–77. Virgilio (2006): Biagio Virgilio, „Sui decreti di Metropolis in onore di Apollonio“, in: Biagio Virgilio (Hg.), Studi Ellenistici 19, Pisa, 249–268. Weiss (2004): Alexander Weiss, Sklave der Stadt. Untersuchungen zur öffentlichen Sklaverei in den Städten des römischen Reiches, Stuttgart. Webb (2009): Ruth Webb, Ekphrasis, Imagination, and Persuasion in Ancient Rhetorical Theory and Practice, Farnham. Welles (1934): Charles B. Welles, Royal Correspondence in the Hellenistic Period, New Haven. West (1985): Stephanie West: „Herodotus’ Epigraphical Interests“, Classical Quarterly 35, 278–305. Whittaker (1991): Heléne Whittaker, „Pausanias and his Use of Inscriptions“, Symbolae Osloenses 66, 171–186. Williams (2007): M. F. Williams, „Polybius’ Historiography and Aristotle’s Poetics“, Ancient History Bulletin 21, 1–64. Zizza (2006): Cesare Zizza, Le iscrizioni nella Periegesi di Pausania. Commento ai testi epigrafici, Pisa.
Mnemopoetik
167
Anhang Ehrung für Apollonios, 132 v. Chr., I.Metropolis 1; SEG LIII 1312.
A) Ehrendekret von 132 v. Chr. #EpÏ Åerwv« Mhtrofˇnoy toÜ [pollvn[›oy toÜ deÖno«, Åerw]v« dÍ tá« ^RØmh« [- - toÜ | D]eonnÜd[o«] toÜ f÷sei Dhmhtr›oy, mhnÌ« Dais›oy õkth[i· ödoj]en tái boylái, strathgâ[n gnØmhi tân] | perÏ [lwjandron Trv˝loy· ãpeidÎ [pollØnio« [ttˇloy toÜ ~ndrvno« prfiterfin te p[»san pros]|efwreto spoydÎn ÉpÍr tân tá« pfilev« pragmˇtvn o¾te k›ndynon o¾te kakop[ˇùeian ãkkl›na«], 5|| ãj ìn synwbainen eå« polŒ belt›ona katˇstasin parag›nesùai tÌn dámon, po[ll@« $po]|de›jei« a\toÜ prosenegkamwnoy ãn toÖ« $nagkaiotˇtoi« kairoÖ« tá« prÌ« tÎ[n patr›da] | e\no›a«, ÅkanoŒ« dÍ $gâna« ãpÏ tân basilwvn kaÏ tân ¡llvn ãjoysiân xeir›san[to«] dika›v« | kaÏ met@ pˇsh« ãktene›a«, kaÏ Ñ« Òn kaùákon $ndrÏ kalâi kaÏ $gaùâi $nadedeixfiti Y|aytÌn khdemfina kaÏ boihùÌn tá« pfilev«, ƒùen Ç dámo« öxvn ÉpÍr a\toÜ tÎn $r›sthn 10|| diˇlhcin kaÏ kalÌn eÚnai Łghsˇmeno« toÖ« met# e\no›a« õkasta prˇssoysin ÉpÍr tá« pfile|v« t@« kataj›a« $podidfinai xˇrita«, $e› mwn pote a\tÌn ãm p»sin dietwlei timá« kaÏ promh|ù›a« $jiâ, ãd‹lvsen dÍ kaÏ met@ chf›smato« tÎn parakoloyùoÜsan tˆ $ndrÏ par# ƒlon tÌn b›|on $ret‹n te kaÏ kalokagaù›an· nÜn dÍ toÜ mÍn Filom‹toro« basilwv« metallˇjanto«, ^Rv|ma›vn dÍ tân koinân e\ergetân te kaÏ svt‹rvn $podfintvn, kaùˇper ãdogmˇtisan, tÎn ã15||leyùer›an p»sin toÖ« prfiteron tassomwnoi« ÉpÌ tÎn [ttˇloy basile›an, [riston›koy dÍ para|gegonfito« kaÏ boylomwnoy paraireÖsùai tÎn $podedomwnhn ŁmÖn ãleyùer›an ÉpÌ tá« sygkl‹|toy, pˇnta kaÏ lwgein kaÏ prˇssein Épwsth kat@ toÜ periteùeikfito« Yaytâi basile›an pa|r@ tÎn tân koinân e\ergetân ^Rvma›vn kr›sin, $ntilambanfimeno« gnhs›v« kat@ tÎn toÜ | d‹moy prfiùesin tá« ãleyùer›a«· genomwnh« te xre›a« —ste $postalánai nean›skoy« eå« tÎn 20|| perÏ Uyˇteira stratopede›an Ç dámo« $p# $rxá« Qretikø« t@ ^Rvma›vn prˇgmata kaÏ tÎn prÌ« a\|toŒ« fil›an te kaÏ symmax›an, kaÏ met@ tá« meg›sth« xar»« $podejˇmeno« tÎn ãleyùer›|an, boylfimenfi« te tÎn åd›an a¬resin kaÏ e¾noian ãn toÖ« $nagkaiotˇtoi« kairoÖ«, Än öxei prÌ« | t@ dhmfisia ^Rvma›vn prˇgmata, ãnapode›knysùai, ãxeirotfinhsen Łgemfina ãpÏ tá« tân nean›skvn | ãjapostolá« [pollØnion [ttˇloy toÜ ~ndrvno«, ¯« Épome›na« kaÏ proairo÷meno« $kfiloyùo« Y25||aytâi g›nesùai kaÏ t‹n te prÌ« tÎn patr›da kaÏ #Rvma›oy« e¾noian faner@n kaÏ di@ tân örgvn poiásai, | labøn toŒ« Épotagwnta« Yaytâi nean›skoy« kaÏ $fikfimeno« prÌ« Pfiplion kaÏ Gˇ=on kaÏ Pˇpon toŒ« ònta« | ãpÏ toÜ strate÷mato«, ön te taÖ« ginomwnai« ãjod›ai« kaÏ taÖ« ¡llai« xre›ai« synøn t‹n te kat@ toŒ« nea|n›skoy« e\taj›an parwsxen, kaÏ tÎn kaù# YaytÌn e\cyx›an ´pasin toÖ« paratygxˇnoysin kaÏ Épotassomwnoi« [f]a|ner@n ãpo›hsen, kaÏ o\dwpote diakl›na« tÌn ãsfimenon a\tâi prÌ« toŒ« ãnant›oy« $gâna synet‹rhsen met@ tân 30|| nean›skvn tÎn progegenhmwnhn toÖ« progfinoi« Łmân $ret‹n te kaÏ dfijan kaÏ ãn taÖ« polemikaÖ« prˇjesin, kaùˇ|per a\tâi
168
Angelos Chaniotis
diemartyr‹ùh· tÌ dÍ teleytaÖon tá« prˇjev« mello÷sh« synteleÖsùai parakalwsa« toŒ« systra|teyomwnoy«, Ñ« ûrmosen ãke›nvi te kaÏ tái pfilei Łmân, kaÏ kalÌn eÚnai Łghsˇmeno« ÉpÍr patr›do« kaÏ politân | kaÏ tá« $podedomwnh« ãleyùer›a« $gvnisˇmeno« ãntˇfion öxein tÎn ãpesomwnhn a\tâi dfijan kaÏ tim‹n· | kaÏ di@ taÜta, łgvnismwnoy a\toÜ met@ tân nean›skvn kaÏ peptvkfito«, kaÏ tá« ãkklhs›a« ãpitajˇsh« 35|| toÖ« strathgoÖ« tÎn kall›sthn poi‹sasùai perÏ a\toÜ prfinoian dedfixùai tâi d‹mvi· ãpainwsai [pol|lØnion [ttˇloy toÜ ~ndrvno« ¡ndra kalÌn kaÏ $gaùÌn gegonfita prfiterfin te perÏ tÎn polite›an kaÏ nÜn $g[a]|ùâ« kaÏ $j›v« tá« te åda« $retá« łgvnismwnon kaÏ tÕ tá« patr›do« ÉpÍr atoÜ dial‹cei· stásai dÍ a\toÜ kaÏ eåkfi|na xalkán ãpÏ b‹mato« marmar›noy ãn tˆ ãpifanestˇtvi tfipvi tá« $gor»« ãpigrafÎn poihsamwnoy«· „^O d[á]|mo« [pollØnion [ttˇloy toÜ ~ndrvno« $retá« õneken kaÏ e\no›a« fl« öxvn dietwlei prÌ« t@ ^Rvma›40||vn prˇgmata kaÏ prÌ« tÎn pfilin„· tân dÍ yÅân a\toÜ [ttˇloy kaÏ ]ghsˇndroy famwnvn par# Yaytân dØsein | tÌ genfimenon eå« taÜta dapˇnhma ãpainwsai kaÏ to÷toy« ãpÏ tái prÌ« tÌn dámon e\no›ai kaÏ tái prÌ« tÌn pa|twra filostorg›ai· dedfisùai dÍ ãjoys›an toÖ« yÅoÖ« a\toÜ poiásai Łrâion prÌ tá« p÷lh« ãn toÖ« åd›oi«· kaÏ speÜsai | perÏ tá« tân çstân $nakomidá«, Ñ« ©n tˇxista oÅ paragegonfite« $pÌ sygkl‹toy presbeytaÏ di@ tÎn åd›an $ndre›|an kaÏ $retÎn poihsˇmenoi tÎn kat@ [riston›koy tropÎn eå« eår‹nhn kaÏ e\nom›an katast‹svsin t@ prˇgmata, gego45||nø« ãm p»sin $nÎr $gaùÌ« eå« tÌn dámon t÷x> tá« kaùhko÷sh« khde›a«· $nagraf‹tv dÍ tfide tÌ c‹fisma ãn tái $go|r»i ãpÏ b‹mato« kaÏ tÌ prfiteron a\tâi gegonfi«, ƒpv« kaÏ oÅ loipoÏ eådfite« tÎn toÜ d‹moy a¬resin Än öxei prÌ« toŒ« ka|loŒ« kaÏ $gaùoŒ« tân $ndrân trwpvntai kaÏ a\toÏ prÌ« $ret‹n· synanagraf‹tv dÍ kaÏ tân peptvkfitvn ãn tái mˇxhi | çnfim[at]a ¬na kaÏ ãkeÖnoi teteyxfite« Ùsin par@ toÜ d‹moy timá«. Es folgen 13 Namen in 2 Kolumnen. Col. I: [sklhpiˇdh« [sklhpiˇdoy toÜ Dhmhtr›oy, ^Hgˇdh« Peroit›oy, [lwjandro« Kallikrˇtoy, Sarap›vn Dikaiogwnoy, [pollØnio« Kyn›skoy, Mhtrfidvro« MhtrodØroy, Nwvn Diom‹doy, Difidoto« Dhmhtr›oy toÜ Killamˇsio«, [- - -]mono« E\klwoy« toÜ Meijid‹moy. Col. II: Perigwnh« [pollodfitoy, Pˇpylo« Pap÷loy, Sfilvn Svkrˇtoy, [pollØnio« Matrwoy, Klefiniko« Klwvno«.
B) Ehrendekret von 144 v. Chr. Basile÷onto« [ttˇloy Filadwlfoy ötoy« pentekaidekˇtoy mh|nÌ« Pan‹moy õkthi· ödojen tái boylái, strathgân gnØmhi [ndromˇxoy | toÜ Kyn›skoy, ^Hgelfixoy toÜ Moysa›oy, Fil›ppoy toÜ Fil›ppoy, Boyù‹roy toÜ Nwv|no«, ]ghsˇndroy toÜ ]ghsˇndroy· ãpeÏ [pollØnio« [ttˇloy toÜ ~ndrvno« 5|| tá« kall›sth« $gvgá« teteyxø« $pÌ tá« prØth« Łlik›a« proe›rhtai perÏ t@ bwl|tista ginfimeno« 4mill»sùai prÌ« $retÎn ãn ´pasin, filopfinv« kaÏ met# e\taj›a« Éfestˇmeno« tÌn | a\toÜ b›on, di# ìn o\ mfinon ãn tái patr›di tÎn par@ tân politân periepoi‹sat# e\fhm›|an, $ll@ kaÏ ãpÏ jwnh«, ãn aë« pareped‹mhsen pfilesin, öndojon katwsthsen Yaytfin, pe|ripoiân
Mnemopoetik
169
tina kaÏ tái patr›di tim‹n, ãgmartyroymwnhn labøn par@ tân pfilevn tÎn kaù# aÉ10|| tÌn e\fhm›an· ãk te tá« $podhm›a« paragenfimeno« proálùen ãpÏ tÌ polite÷esùai sym|ferfintv« kaÏ ãn leitoyrg›ai« ösxen a\toÜ xre›an ãpididoŒ« YaytÌn $fiknv«, Ñ« prwpon | Òn pol›thi filostfirgvi [eå«] tÎn patr›da, dietwlei presbe÷vn prfi« te toŒ« basileÖ« kaÏ | toŒ« ¡lloy« met@ pˇsh« ãktene›a«, spoydá« kaÏ filotim›a« o\dÍn ãlle›pvn· | katˇ te t@« ginomwna« prÌ« toŒ« parakeimwnoy« ÉpÍr xØra« $mfizbht‹sei«, ƒper ãs15||tÏn mwgiston pfilei, pˇnta de÷tera tiùwmeno« tá« prÌ« tÎn patr›da e\no›a« ãprv|tagvn›stei prosferfimeno« tÎn ãj YaytoÜ filopon›an kaÏ spoydÎn o\dwpote tá« | åd›a« èfel›a« õneken $llajˇmeno« t@ koin@ tá« pfilev« prˇgmata· diÌ symbw|bhken tethrásùai t@ toÜ d‹moy mhdenÌ« ãlassØmato« perigegonfito«· É|pÍr tân ãfeyriskomwnvn ŁmeÖn telân ÉpÌ tân ènhsamwnvn t@ diagØgi20||a toÜ Ka=ystrianoÜ limwno«, eå« $gvn›an kaÏ taraxÎn paragenomwnvn | Łmân tÎn meg›sthn, Épolabøn údion eÚnai tÌ symbebhkÌ« ãlˇssvma tái pfi|lei, pˇnta paridøn t@ kaù# Yaytfin, Épwsth paraklhùeÏ« kaÏ tÎn prÌ« to÷toy« | diˇkrisin, di# fl« ãt‹rhsen tÎn Épokeimwnhn ãn toÖ« twlesin filanùrvp›an· ãje|por›sato dÍ kaÏ par@ toÜ basilwv« di@ tÎn åd›an ãktwneian kaÏ toÖ« nwoi« eå« 25|| ãlaioxre›stion kaù# õkaston ãniaytÌn draxm@« f^, Çmo›v« dÍ [k]aÏ toÖ« ãleyùw|roi« paisÏn eå« t@ maù‹mata < f^, ´per o\ tÎn tyxoÜsan tái pfilei parwsxhken ãn|tim›an· ãn toÖ« ¡lloi« p»sin politeyfimeno« diateleÖ kaùare›v« kaÏ proù÷mv« | prÌ« pˇnta t@ kalâ« öxonta synepididoŒ« Yaytfin· difiper Ç dámo« ãn ´pasin e|[ca. 10]aytâi proairo÷meno« kat@ tÌ d›kaion ãn timái te kaÏ promhù›ai DIA30||[ca. 13 [p]ollØnion diateleÖ ãgmartyroymwnhn dÍ kaÏ tÎn ÉpÍr |[ca. 28 ƒp]v« oítfi« te kat@ tÌ kalâ« öxon timá« | [tygxˇnhi tá« kaùhko÷sh« kaÏ oÅ loipoÏ] ùevroÜnte« tÎn toÜ d‹moy perÏ tân |[ca. 23 ãùwlvsi]n 4mill»sùai prÌ« $retÎn ˙ öxonte« |[ca. 24 tÎn toÜ d‹m]o y e\xarist›an, dedfixùai tâi 35|| [d‹mvi· ãpainwsai [pol˙ lØnion ãpÏ toÖ« progegr]a mmwnoi« kaÏ toÜ chf›sma|[to« (ãpi)kyrvùwnto« stefanâ˙ sai a\tÌn ãn tâi d‹m]vi (?) toÜ k‹ryko« $nago|[re÷onto«· „Ç dámo« stefanoÖ [pollØnion [ttˇloy t]oÜ ~ndrvno« ¡ndra | [kalÌn kaÏ $gaùÌn gegonfita perÏ tÎn polite›an„· kaÏ] tâi ~rei poihsˇsùv | [ùys›an [pollØnio« ÉpÍr toÜ d‹moy met@ tâ]n presbytwrvn kat@ t@ pˇ40||[tria].
170
Joseph Maran
Joseph Maran
Urgeschichte – Frühgeschichte: Geschichte? Das Beispiel des mykenischen Griechenland 1 Gesellschaften ohne Geschichte? Die Veranstalter des Symposiums, aus dem der vorliegende Band hervorgegangen ist, haben mir aus gutem Grund das Rahmenthema „Spuren/Relikte“ vorgegeben, denn diese Stichwörter charakterisieren recht gut die Art der Medien, mit denen es das Fach Ur- und Frühgeschichte zu tun hat. In einem Tagungsband, dessen Beiträge von der Spannung zwischen der Reflektion von Geschichte in textlicher vs. archäologischer Überlieferung geprägt sind, nimmt dieses Fach eine Sonderstellung ein, definiert es sich doch über das Fehlen schriftlicher Überlieferung in der Urgeschichte bzw. einer geringen Menge von Schriftquellen in der Frühgeschichte. Es ist für mich nicht trivial, ob mein Fach als Ur- und Frühgeschichte oder Vor- und Frühgeschichte bezeichnet wird, weil jeder dieser Begriffe eine Einstellung gegenüber der Natur des Untersuchungsgegenstands verrät1. Der Begriff „Vorgeschichte“ insinuiert, es könne menschliche Gesellschaften ohne Geschichte geben. Eine solche Sicht setzt entweder voraus, Geschichte bedürfe schriftlicher Überlieferung, oder aber sie macht Geschichte von der Benennung geschichtswirksamer Personen oder Ereignisse abhängig, was beides in der Urgeschichte nicht möglich ist. Während es mittlerweile aus guten Gründen ungebräuchlich geworden ist, Geschichte mit der Benennung bestimmter Ereignisse und den Taten großer Persönlichkeiten gleichzusetzen, ist das Verdikt, Geschichte bedürfe der Schrift, weiterhin wirkungsmächtig geblieben. Dabei privilegiert diese Sicht die, bezogen auf das Gesamtalter der Menschheit, äußerst kurzen Zeitabschnitte, in denen in bestimmten Zonen der Welt Schrift verwendet wurde, was in der Regel gleichbedeutend mit einer staatlichen Organisationsform ist2. Zur Geschichtslosigkeit verdammt werden damit nicht nur viele Jahrhunderttausende der Menschheitsentwicklung, sondern auch sämtliche rezenten Gesellschaften, die keine Schrift verwendeten und nicht-staatlich organisiert waren3. Mein Standpunkt ist der folgende: Wenn der Mensch seine Position in der Welt und in der Zeit zu erklären und bestimmen versucht, macht er eine Erfahrung, die eine geschichtliche ist4 und sofern der Mensch in die Welt eingreift, um sie in Verbin-
1 2 3 4
Eggert (2001) 2–5. Clastres (1974) 161–163; ausführlich Holtorf (2005) mit weiterer Literatur. Clastres (1974) 161–186. Castoriadis (1975) 256–257; Holtorf (2005).
Urgeschichte – Frühgeschichte: Geschichte?
171
dung mit anderen zu gestalten, ihr Ordnung zu geben und sie zu verändern, entstehen Prozesse, die auch für uns als Geschichte wahrnehmbar sind. Eine andere Frage ist, wie viel wir von diesen Prozessen erfassen können, und auf der Grundlage welcher Quellen dies geschieht.
2 Das unterschätzte sozialgeschichtliche Potential materieller Kultur Es versteht sich, dass im Falle der schriftlosen und frühschriftlichen Zeitabschnitte der Menschheit ausschließlich bzw. ganz überwiegend nicht-textliche materielle Spuren vergangener Gesellschaften zur Verfügung stehen. Was die Herangehensweise an diese Spuren anbelangt, möchte ich zwei Missverständnisse ansprechen, die die Bewertung der Bedeutung dieser Quellen nachhaltig behindert haben. Das eine Missverständnis ist das in der deutschen Ur- und Frühgeschichtsforschung lange Zeit verbreitete, es genüge, die materiellen Quellen nach chronologischen, formenkundlichen und chorologischen Gesichtspunkten zu ordnen und aus der regelhaften Vergesellschaftung bestimmter Formen sog. archäologische Kulturen zu definieren sowie deren Verbreitung und Veränderung zu untersuchen. Einer weitergehenden Erklärung solle man sich aber enthalten, da dies spekulativ sei5. Das Fach hat seinen Kulturbegriff und einen Teil der Methodologie von der Anfang des 20. Jhs. die Ethnographie im deutschsprachigen Raum beherrschenden kulturhistorischen Ethnologie übernommen und hieran selbst dann noch festgehalten, als diese Richtung in der Ethnologie längst diskreditiert war6. Die Hauptschwäche dieser später als „Kulturkreislehre“ bezeichneten Richtung der Ethnologie, die in die Ur- und Frühgeschichte hineingetragen wurde, bestand darin, Kultur als Objekt und nicht als generatives Prinzip zu verstehen7. Das Ergebnis war ein statisches Kulturverständnis, das einen Wandel der Bedeutung materieller Formen nicht in Betracht zog. Das andere Missverständnis wurde ironischerweise von der angelsächsischen „New Archaeology“ ab den 1960er Jahren als Alternative zu dem genannten, Kultur als Objekt erachtenden Ansatz in Stellung gebracht. Es besteht darin anzunehmen, alle „wirklich wichtigen“ Sachverhalte wie z.B. religiöse Ideen, soziale Beziehungen oder politische Organisationsformen seien rein immateriell, weshalb man von den archäologisch nachweisbaren materiellen Spuren abstrahieren müsse, um Kultur und Gesellschaft zu verstehen8. Die Beschäftigung mit materieller Kultur wurde aus dieser
5 Hierzu Eggert (1998); Eggert (2001) 22–30. 6 Rössler (2007) 8–15; Maran (2012a). 7 Friedman (1997) 82; Maran (2012a). 8 Bezeichnenderweise waren in einflussreichen Publikationen wie Clarke (1968) oder Renfrew (1973) Abbildungen archäologischer Objekte nicht enthalten.
172
Joseph Maran
Perspektive auf die antiquarisch-typologische Ebene reduziert und gegen die viel bedeutsamere Analyse des vermeintlich immateriellen Sozialen ausgespielt9. Die mit der post-strukturalistischen Wende einhergehende besondere Beachtung der Bedingungen und der Mittel der Hervorbringung von Kultur und Gesellschaft hat indes diese Position in Frage gestellt und ein neues Interesse an Materialität und ihrer Einbeziehung in soziales Handeln entstehen lassen10. Die Quellen des Faches Ur- und Frühgeschichte erscheinen hierdurch aus einem anderen Blickwinkel, denn wenn das, was von Menschen als gesellschaftliche Realität empfunden wird, unter Einsatz materieller Medien ständig wieder von Neuem erzeugt und verändert wird, dann sind Materielles und Immaterielles untrennbar miteinander verbunden11, und es sollte möglich sein, aus materiellen Spuren Hypothesen darüber abzuleiten, wie und warum Menschen der Vergangenheit im Handeln ihre Lebenswelt gestaltet und ihr Sinn gegeben haben. Diese Hypothesen werden wegen des konstruktiven Charakters auch der Bilder, die wir uns von der Vergangenheit machen, notwendigerweise Züge annehmen, die im Rückblick als zeitbedingt erkannt werden. Wissenschaftliche Erkenntnis lässt sich allerdings auch in meinem Fach nicht auf diese Metaebene reduzieren, sondern kann, davon bin ich überzeugt, Aspekte der Hintergründe und Motive vergangenen Handelns erfassen, die der Prüfung durch spätere Forschung standhalten werden. Insgesamt würde ich sagen, dass das Fach Ur- und Frühgeschichte insofern, als es Spuren vergangenen Handelns untersucht, den Kulturwissenschaften zuzurechnen ist und indem es die Veränderungen kulturspezifischer Muster in zeitlicher Tiefe nachvollzieht, historische Erkenntnis generiert. Das Fach würde ich somit als eine historisch arbeitende Kulturwissenschaft, die sich archäologischer Methoden bedient, bezeichnen.
3 Die Entstehung der mykenischen Kultur aus der Auseinandersetzung mit dem minoischen Kreta Am Beispiel des mykenischen Griechenlands möchte ich das Gesagte veranschaulichen. Diese Kultur scheint wie aus dem Nichts zu entstehen und in ihren ersten Jahrhunderten, der frühmykenischen Zeit (Späthelladisch [SH] I–II) bis ca. 1400 v. Chr., keine Schrift zu kennen. In ihrem mittleren Abschnitt zwischen ca. 1400 und 1200 v. Chr. (SH IIIA und IIIB) wurde die Linear B-Schrift verwendet, eine Kanzleischrift, deren Auftreten eng an die während dieser beiden Jahrhunderte auf der Peloponnes und im östlichen Mittelgriechenland nachweisbaren mykenischen Paläste gebunden
9 Latour (2005) 70–78; Tilley u.a. (2006) 2–3. 10 Bourdieu (1979); Hodder (1982); Miller (1998); Miller (2005); Latour (1986); Latour (2005) 63–87. 11 Callon (1986); Latour (1986); Miller (2005) 20–29; Maran u. Stockhammer (2012).
Urgeschichte – Frühgeschichte: Geschichte?
173
war. Wie eng, zeigt sich daran, dass Linear B nach der um 1200 v. Chr. stattfindenden Zerstörung aller Palastzentren verschwindet, woran sich noch einmal rund 150 Jahre anschließen (SH IIIC), in der die mykenische Kultur in ihre nachpalastzeitliche Phase eintritt, aber keine Schrift gekannt zu haben scheint. Innerhalb von rund sechs Jahrhunderten Dauer der mykenischen Kultur können wir somit den Wechsel von Urgeschichte zu Frühgeschichte und wieder zur Urgeschichte feststellen. Ich möchte mich in diesem Beitrag auf die beiden urgeschichtlichen Abschnitte des Beginns und des Endes der mykenischen Kultur konzentrieren, weil sich an ihnen beispielhaft zeigen lässt, dass sich in den Medien schriftloser Zeitabschnitte sehr wohl geschichtswirksame Prozesse widerspiegeln. Am Beginn der Erforschung der mykenischen Kultur stand bekanntermaßen die Entdeckung der Schachtgräber von Mykene durch Heinrich Schliemann im Jahre 1876. Die in diesen Gräbern beigesetzten Männer treten uns in Bildern und in den beigegebenen Objekten als große Krieger und Jäger entgegen. Frauen sind indes über und über mit Goldobjekten geschmückt12. Die Gräber des Gräberrundes A von Mykene, wie wir es heute bezeichnen, markieren nicht nur in wissenschaftsgeschichtlicher Hinsicht die Geburtsstunde der mykenischen Kultur. Der Zufall wollte es nämlich, dass mit diesen Gräbern Befunde ausgegraben worden, die buchstäblich am Beginn jenes Zeitalters stehen, das wir seit Schliemann als „mykenisch“ bezeichnen. Bis zum heutigen Tag nehmen die Schliemannschen Schachtgräber zusammen mit den erst 1950 entdeckten und zumeist etwas älteren des Gräberrundes B13 von Mykene im Umfang und der Qualität ihrer Beigabenausstattungen eine Sonderstellung ein. Sie bilden in jeder Hinsicht eine Zäsur zu den Traditionen des vorangegangenen Zeitabschnitts der ersten und zweiten Stufe des Mittelhelladikums in der Argolis14, was sich nicht nur an dem Reichtum der Grabausstattungen, sondern auch an der Masse an Bildwerken erkennen lässt, die in eine geographische Zone geradezu hinein brechen, deren Bewohner zuvor Bilder allenfalls in sehr geringem Umfang hergestellt zu haben scheinen15. Schließlich äußert sich die absolute Sonderstellung der in den Schachtgräbern bestatteten Individuen auch in der Bestattung in eigenen abgegrenzten Arealen. In der Abgrenzung sowohl in räumlicher Hinsicht, als auch mittels sozialer Güter, sehe ich Anzeichen dafür, dass die in den Schachtgräbern beigesetzte Personengruppe eine aktive Rolle im Festlegen neuer Normen und Werte einnahm, die das generierten, was wir als kennzeichnend „mykenisch“ bezeichnen16. Der hohe Anteil minoischer Objekte unter den Beigaben der Schachtgräber, darunter viele, die so
12 Karo (1930). 13 Mylonas (1972–1973). Zur Datierung der Schachtgräber von Mykene vgl. Graziadio (1988); Dietz (1991). 14 Dickinson (1977) 39–57; Wright (2008a). 15 Voutsaki (1999) 114; Voutsaki (2004) 359; Muskett (2007) 20–24. 16 Dickinson (1977) 39–57, 107–110; Voutsaki (1997); Voutsaki (1999); Wright (1987) 175; Wright (2008b) 146–147.
174
Joseph Maran
erlesen sind, dass sie nur durch dynastische Geschenke kretischer Paläste – und speziell aus Knossos – zu erklären sind, belegt, dass interkulturelle Kontakte besonders zum neupalastzeitlichen Kreta eine zentrale Rolle bei der Formung der Identität der neuen mykenischen Elite gespielt haben17. Umso mehr überraschte die Forschung seit jeher die Betonung kriegerischer Gewalt, die ganz und gar keine Widerspieglung in den Bildern und Grabausstattungen der gleichzeitigen Palastkultur Kretas findet. In den Anfängen der Erforschung altägäischer Kulturen war es üblich, die Unterschiede zwischen minoischer und mykenischer Kultur durch die Gegenüberstellung einer friedlichen Natur der Kreter und einer kriegerischen der Festlandsgriechen zu erklären18. Diese Bezugnahme auf einen unabänderlichen Wesenskern menschlicher Gesellschaften, einen „Volksgeist“, war natürlich eine Widerspiegelung der essentialistischen Definition von Ethnizität, wie sie Anfang des 20. Jhs. gebräuchlich war19. Absurd ist eine solche Deutung aber nicht nur deshalb, sondern weil die Betonung von Krieg und Gewalt auf dem Festland erst mit den Schachtgräbern fassbar wird20 und überdies die Ursprünge der mykenischen Waffen sich auf die Palastwerkstätten Kretas zurückführen lassen21. Zu fragen ist also, aus welchem Grunde die Betonung männlicher Aggressivität ausgerechnet in einer Zeit der Intensivierung der Beziehungen zu der angeblich friedlichen minoischen Sphäre entgegentritt und sich die Merkmale der entstehenden mykenischen Kultur, trotz der nachweisbar intensiven Kontakte, so stark von dem unterscheiden, was wir für typisch kretisch halten? Die Antwort hierauf sehe ich in einer Kombination der Handlungsmacht bestimmter sozialer Gruppen mit der Art, wie diese die sie umgebende Welt wahrgenommen haben22. Die Erfahrung des Kontaktes zu Kreta dürfte vor allem aus zwei Gründen einen so tiefen Eindruck bei den nördlichen Nachbarn hinterlassen haben: einerseits wegen der Wirkung der minoischen Güter, deren Technologie und Bilderwelt alles überstiegen, was man auf dem griechischen Festland je gesehen hatte; und andererseits wegen der auf militärischer Gewalt gegründeten, bis dahin in der Ägäis beispiellosen Machtentfaltung der Palastkultur Kretas. Um zu verstehen, wie das Fremde auf dem griechischen Festland rezipiert und angeeignet wurde, muss berücksichtigt werden, dass die festlandsgriechischen Eliten der beginnenden mykenischen Zeit über ein nur sehr vages Bild von den sozialen und politischen Verhältnissen auf Kreta verfügt haben dürften, da sie die ferne Insel und ihre Paläste wohl nicht aus eigener Anschauung kannten. Entscheidend war die Vorstellung, die man aufgrund der Begegnungen
17 Voutsaki (1997) 45–48; Voutsaki (2010); Wright (2008a) 238–243; Maran (2011a). 18 Vgl. z.B. Rodenwaldt (1921) 47–52, 58–59; Karo (1927) 389–390. Als Beispiel dafür, dass diese Denkschemata bis heute nachwirken vgl. Wightman (2007) 358. 19 Jung (2000) 77–80; Roessel (2006). 20 Maran (2011a). 21 Hiller (1984); Hiller (1999) 324, 327; Wiener (1991) 331–340; Kilian-Dirlmeier (1997) 13–50. 22 Hierzu ausführlich Maran (2011a).
Urgeschichte – Frühgeschichte: Geschichte?
175
mit minoischen Händlern und Abgesandten sowie durch Erzählungen von Reisenden von dem fremden Zentrum politischer und vor allem religiöser Macht hatte, d.h. die soziale Imagination23. Dies erklärt, warum als Ergebnis der Auseinandersetzung zwar minoische Kulturelemente auf dem Festland aufgenommen wurden, dieses Fremde aber in einen auf uns höchst unminoisch wirkenden Kontext eingebunden wurde. Der Vorgang der Schaffung einer neuen Form elitärer Selbstdarstellung dürfte von einem interkulturellen Missverständnis befördert worden sein. Ich vermute, dass die minoische Elite der Alt- und Neupalastzeit ein dualistisches, scharf zwischen Innen und Außen unterscheidendes Weltbild zugrunde legte. Nach innen herrschte, so die Vorstellung, eine von göttlichen Kräften aufrechterhaltene Harmonie, nach außen jedoch das Chaos, dem man mit militärischer Kraft entgegentreten musste. Während die archäologische Forschung von dem ersten, „friedlichen“ Gesicht geleitet wurde, offenbarte sich den Festlandsgriechen vor allem das zweite Gesicht, wenn sie mit kretischen Delegationen, die Waffen trugen oder von Kriegern begleitet wurden, in Berührung kamen24. Durch diese Erfahrung entstand der Eindruck, das Kriegerische sei das konstituierende Element des minoischen Selbstverständnisses, wo es doch in Wahrheit für die Außenwirkung bestimmt war25. Dementsprechend halte ich es für wahrscheinlich, dass die Darstellungen von Eberzahnhelmen oder von Kriegern mit solchen Helmen und Turmschilden in den Fresken von Akrotiri nicht, wie in der Forschung oft angenommen wird, von Kontakten mit dem mykenischen Bereich zeugen, sondern ihren Ursprung in der Erfahrung mit der Militärmacht Kretas hatten26. Die Entstehung der mykenischen Kultur wäre somit ein Beispiel dafür, wie Teile einer Gesellschaft sich von ihrer eigenen Imagination über das Wesen eines fernen, bewunderten „Zentrums“ politischer und religiöser Macht leiten ließen und durch Aneignung und Einbindung des Fremden in den lokalen Kontext einer neuen kulturellen Identität materiellen Ausdruck verliehen. Diese Auseinandersetzung mit der Kultur Kretas hielt während des gesamten Frühabschnitts der mykenischen Kultur an und steigerte sich dabei immer mehr. Die Anziehung, ja Faszination, die das Kreta der Neupalastzeit auf die Vorstellungswelt der schachtgräberzeitlichen Eliten ausgeübt hat, führte zunächst zu dem Wunsch, die Geheimnisse der anderen Kultur zu ergründen. Schon bald jedoch, nämlich im Laufe von SH II, erwuchs hieraus das Bedürfnis, diese Kultur in Besitz zu nehmen und schließlich mit ihr eins zu werden, indem man an ihre Stelle trat, was ich als eine Grundvoraussetzung für die Entstehung der mykenischen Paläste erachte27.
23 Castoriadis (1975) 159–230, 457–498; Anderson (1983); Taylor (2004) 23–30. 24 Wiener (1991) 333–334; Wiener (1999) 411–412, 419–420. 25 Hierzu ausführlich Maran (2011a). 26 Bereits Hiller (1984) 29–30 mit Anm. 12–13 (dort weitere Literatur) hat die in den Wandmalereien von Akrotiri dargestellten Krieger als minoisch identifiziert; vgl. ferner Niemeier (1990). 27 Maran u. Stavrianopoulou (2007) 290–291.
176
Joseph Maran
4 Das Ende der mykenischen Kultur und die Erinnerung an die palatiale Vergangenheit Seit den Entdeckungen Schliemanns ist die Diskussion darüber nicht abgerissen, inwieweit die Homerischen Epen tatsächlich von der Welt der ausgehenden mykenischen Kultur des 13. und 12. Jhs. v. Chr., oder aber eher von der der frühen Eisenzeit des 10. Jhs. v. Chr. oder gar erst von der zeitgenössischen Welt Homers inspiriert wurden. Ich werde mich an dieser Diskussion nicht beteiligen, denn ich glaube, dass man einem Epos nicht gerecht wird, wenn man ihn gerade unter dem Blickwinkel seines Gehalts an historischer Wahrheit betrachtet28. Mehr als die nicht zu beantwortende Frage nach der historischen Verortung interessiert mich die nach den Wurzeln des spezifischen Vergangenheitsbezugs dieser Epen, den Jan Assmann als gutes Beispiel für eine Verbindung kontrapräsentischer mit fundierender Erinnerung bezeichnet hat29. Kontrapräsentisch30 insofern, als die Vergangenheit vor dem Hintergrund einer als unzureichend empfundenen Gegenwart überhöht wird, fundierend insofern, als diese Gegenwart in die Tradition der Vergangenheit gestellt wird und durch sie ihren Sinn erhält. Vor wenigen Jahren hat Ian Morris ausdrücklich ausgeschlossen, dass die nachpalastzeitliche Phase der mykenischen Kultur derjenige Zeitraum gewesen sein könne, während der die aus den Homerischen Epen bekannte Überhöhung einer heroischen Vergangenheit ihren Anfang genommen habe, denn er meint, den Menschen nach 1200 v. Chr. seien die sozialen und politischen Verhältnisse der Palastzeit noch so vertraut gewesen, dass sie sich direkt hierauf beziehen konnten, ohne die Vergangenheit zu verklären. Dies sei erst am Beginn der frühen Eisenzeit, um 1000 v. Chr., geschehen31. Übertragen wir diesen Gedanken von Morris in die Terminologie der modernen kulturwissenschaftlichen Erinnerungsforschung, so hieße dies, dass die Palastzeit für die Menschen des 12. Jhs. v. Chr. eine „nahe Vergangenheit“ („recent past“) war, von der man über den Bruch hinweg dank des kommunikativen Gedächtnisses zu genau Kenntnis hatte, als dass schon eine Entrückung, wie sie für das kulturelle Gedächtnis typisch ist, hätte einsetzen können32. Aufbauend auf Überlegungen von Sue Sherratt und Sigrid Deger-Jalkotzy33 möchte ich dem indes widersprechen und im Gegensatz zu Ian Morris die Meinung vertreten, dass das Grundmuster eines kontrapräsentische und fundierende Erinnerung verschmelzenden Vergangenheits-
28 Sherratt (1990) 815/820; Sherratt (2004) 191/213; Sherratt (2005) 133/136; Dickinson (2006) 239/240; S.P. Morris (2007); Grethlein (2010). 29 Assmann (2000) 79. 30 Vgl. Theissen (1988) 171. 31 I. Morris (1999) 65–67; I. Morris (2000) 231–237. 32 Vansina (1985) 23–24, 168–169; Assmann (2000) 48–56. 33 Sherratt (1990) 819–820; Deger-Jalkotzy (1991a) 65; Deger-Jalkotzy (1991b) 148–149; Deger-Jalkotzy (1994) 20–22.
Urgeschichte – Frühgeschichte: Geschichte?
177
bezugs viel älter ist und im sozialen und politischen Umfeld des Beginns der „Dunklen Jahrhunderte“, dem 12. Jh. v. Chr., wurzelte34. Forschungen der letzten Jahrzehnte haben gezeigt, dass sich der Untergang der Paläste auf die einzelnen Landschaften des südlichen Griechenlands höchst unterschiedlich ausgewirkt hat. Einer ehemaligen Palastregion wie Messenien, für die die Ereignisse um 1200 v. Chr. eine gravierende und lange anhaltende siedlungsgeschichtliche und kulturelle Zäsur bedeutet zu haben scheinen35, steht mit der Argolis eine andere Palastregion gegenüber, die nennenswerte Anzeichen für restaurative Bestrebungen während der Phase SH IIIC erbracht hat36. Es ist nicht nur diese Sonderentwicklung, sondern vor allem die Allgegenwart der Monumente der Palastzeit, die die Argolis zu einem besonders geeigneten Ansatzpunkt für die Frage nach dem Wandel der Einstellung gegenüber der palatialen Vergangenheit machen. Von allen Orten des mykenischen Griechenlands tritt der Versuch, eine Brücke in die Vergangenheit zu schlagen, am deutlichsten in Tiryns hervor, das nach 1200 v. Chr. eine geradezu atemberaubende Dynamik durchmachte37. In einer Zeit, als alle anderen ehemaligen Palastzentren schrumpften38 oder verlassen wurden39, scheint Tiryns expandiert zu haben. Im Areal des ehemaligen Palastes wurden schon bald nach der Zerstörung Punkte besonders hoher ehemaliger politischer Symbolik – und nur diese – wieder beansprucht. In die Ruine des zentralen Palastgebäudes wurde ein lang gestreckter Antenbau so integriert, dass der Thronplatz wiederverwendet werden konnte, und ebenso wurde ein unter freiem Himmel gelegener Altar nach einem Umbau erneut genutzt40. Nicht nur wurden die neuen Baumaßnahmen so ausgeführt, dass nur bestimmte Bereiche der Oberburg wiederbenutzt wurden, sondern es war wohl von Anfang an vorgesehen, den Antenbau freizustellen und andere Teile des Palastes niemals wieder in Benutzung zu nehmen41. Der an einem so geschichtsträchtigen Platz wie der Ruine des Großen Megaron errichtete Antenbau ist als ein Monument anzusehen, in dem sich die nachpalastzeitliche Elite von Tiryns versammelte, um unter völlig anderen politischen und kulturellen Rahmenbedingungen durch den Bezug auf vergangene Größe Legitimation für das Jetzt zu erhalten42. Ähnliche Hinweise auf die Wiederverwendung von Symbolen palatialer Macht lassen sich bei beweglichen Insignien beobachten, die im 12. Jh. v. Chr. in neue Formen so-
34 Vgl. hierzu auch ausführlich Maran (2011b). 35 Eder (1998) 141–178, 195–197; Eder (2006) 549–554; Cavanagh (2010) 639. 36 Maran (2006); Thomatos (2006) 252–260; Deger-Jalkotzy (2008). 37 Maran (2006); Maran (2008); Maran (2010) 729–731. 38 Vgl. für Mykene: French (2002) 135–140; French (2007); Iakovidis (2003). 39 Davis (2010) 687. 40 Maran (2000); Maran (2008). 41 Maran (2012b). 42 Mühlenbruch (2002) 48; Mühlenbruch (2004) 424–425; Mühlenbruch (2010); Maran (2006) 126, 142; Maran (2012b).
178
Joseph Maran
zialen Handelns eingebunden wurden, wofür besonders der Tiryns-Schatz ein beredtes Zeugnis ablegt43. Um diese offensichtlichen Anzeichen eines Rückbezugs auf die palatiale Vergangenheit zu bewerten, müssen wir uns vergegenwärtigen, was der Umbruch von einem stark hierarchischen und in seiner politischen Führungsebene hermetisch abgeschlossenen System zu einer viel einfacher strukturierten Gesellschaft bedeutet hat44. Das Wissen um die internen Mechanismen der Königsherrschaft und besonders um seinen ideologischen Kern45 sowie seine Rituale dürfte nämlich entweder verlorengegangen oder allenfalls fragmentarisch übermittelt worden sein. Worauf ich hinaus will ist, dass der durch das katastrophale Ende der Palastherrschaft bewirkte Bruch selektiv das kommunikative Gedächtnis auf der höchsten Ebene der Gesellschaft außer Kraft gesetzt hat. Hierdurch trat eine Situation ein, bei der zentrale Merkmale der palatialen Vergangenheit, obwohl sie gerade erst geendet hatte, dennoch so entfernt schienen, dass diese Vergangenheit unmittelbar zum Bezugspunkt eines kulturellen Gedächtnisses werden konnte, das im 12. Jh. v. Chr. vor allem durch drei Faktoren charakterisiert wurde: Erstens der Ambivalenz zwischen einer nahezu umfassenden und ungebrochenen Erinnerung auf der Ebene der Alltagskultur, und einem in Richtung der höheren Ebenen politischer und religiöser Macht immer unvollständigeren Wissen; zweitens der Erfahrung der Unzulänglichkeit der Gegenwart im Vergleich zu den Leistungen der Palastzeit, die nicht nur durch den Anblick der Monumente, sondern auch in der Erinnerung von noch lebenden Zeitzeugen sehr präsent waren; drittens der wenig gefestigten politischen und sozialen Ordnung der Nachpalastzeit, die Personen und Gruppen mehr Möglichkeiten als in der Palastzeit eröffnete, eigene Machtansprüche durchzusetzen, und hierdurch ein erhöhtes Konfliktpotential heraufbeschwor46. Die Kombination der drei genannten Faktoren sorgte meiner Meinung nach dafür, dass der Bezug auf die Vergangenheit zu einem integralen Bestandteil des Wertesystems der gesellschaftlichen Führungsschicht, ja zu einer Waffe im Ringen um soziale Positionen in der nachpalastzeitlichen Argolis wurde47. In diesem Zusammenhang möchte ich anmerken, dass Forschungen der letzten Jahrzehnte zu sozialem und kulturellem Gedächtnis dazu tendieren, „kollektive“ Muster der Konstruktion von Vergangenheit als gegeben anzunehmen und dem Entstehen dieser Muster nicht nachzugehen. Es entsteht der Eindruck, die Gesellschaft als Ganzes wäre an der Erzeugung ein und derselben gemeinsamen Vergangenheit beteiligt. Dem liegt ein Bild der Gesellschaft zugrunde, in dem alle Individuen und Gruppen dem Ganzen untergeordnet sind und von diesem gesellschaftlichen Ganzen Werte und Vorstellungen empfan-
43 44 45 46 47
Maran (2006) 129–144; Maran (2012c); Stockhammer (2008) 295–328; Stockhammer (2009). Hierzu ausführlich Maran (2011b). Maran u. Stavrianopoulou (2007). Deger-Jalkotzy (2008) 403–406; Maran (2011b). Maran (2006) 143.
Urgeschichte – Frühgeschichte: Geschichte?
179
gen. Hiermit folgte man, ohne sich darüber bewusst zu sein, einer Tradition des Funktionalismus, Gesellschaft als einen Organismus zu begreifen, die über die Rezeption der Arbeiten von Maurice Halbwachs in die zeitgenössische Forschung zu sozialem Gedächtnis hineingetragen wurde48. Die Betonung des „Kollektiven“ führte meines Erachtens dazu, die integrativen Züge des sozialen Gedächtnisses zu überbewerten, hingegen seine polarisierenden und potentiell entzweienden Züge außer Acht zu lassen49. Wie stark Bilder der Vergangenheit in kontroversen Diskursen erzeugt werden und wie sehr hierbei Macht und Interessen eine Rolle spielen, hat in den letzten Jahren vor allem die besonders von den Forschungen Ruth Wodak geprägte diskurshistorische Schule der Kritischen Diskursanalyse am Beispiel zeitgenössischer Konstrukte von Vergangenheiten und Nationalismen gezeigt50. Begünstigt wurde die polarisierende Wirkung des Vergangenheitsbezuges im Falle der nachpalastzeitlichen mykenischen Argolis dadurch, dass, anders als in der Palastzeit, keine soziale Gruppe der Region über die nötigen Machtmittel verfügte, die eigene Sichtweise auf die Vergangenheit allen anderen aufzuoktroyieren. Es war vielmehr Überzeugungsarbeit und die Zugehörigkeit zu einer möglichst starken und schlagkräftigen Gruppe notwendig51. Die Voraussetzung dafür, eine Brücke zur Vergangenheit zu schlagen, dürfte in den Jahrzehnten nach der Zerstörung des Palastes darin bestanden haben, für sich und die Seinen eine möglichst tiefe Verankerung in der lokalen Geschichte und vermutlich auch eine genealogische Verbindung zur palastzeitlichen Elite glaubhaft machen zu können52. Darüber hinaus ging es um die Inbesitznahme von unbeweglichen und beweglichen Symbolen vergangener Größe sowie deren Einbindung in Formen institutionalisierter sozialer Kommunikation, durch die die Bedeutung der Symbole wachgerufen und die eigene Beziehung zu den Personen und den Geschehnissen der Vergangenheit erklärt und bekräftigt wurden53. Das Bemühen, unter den sozial und politisch höchst beweglichen Verhältnissen des 12. Jhs. v. Chr. Legitimation zu gewinnen und zu behalten, dürfte so eine Dynamik in Gang gesetzt haben, bei der die führenden Sippen der nachpalastzeitlichen Zentren danach trachteten, den jeweils eigenen Vergangenheitsentwurf gegenüber möglichst vielen als authentisch durchzusetzen. Die durch die spezifische Art des Vergangenheitsbezugs angetriebene innergesellschaftliche Dynamik wird noch dadurch verschärft worden sein, dass die in Tiryns lebenden sozialen Gruppen über höchst unterschiedliche Voraussetzungen verfügt haben müssen, eine Verbindung zur örtlichen Vergangenheit glaubhaft herzustellen
48 Halbwachs (1950). 49 Zu diesem Aspekt ausführlich Maran (2011b). 50 Wodak u.a. (1994) 11–14, 34–35, 191; Wodak u.a. (1999) 10–48. 51 Deger-Jalkotzy (1999) 129–130; Deger-Jalkotzy (2006) 173–175. 52 Deger-Jalkotzy (1991a) 65; Maran (2006) 143–144; Stockhammer (2008) 295–310; Stockhammer (2009) 167. 53 Maran (2006) 141–144; Stockhammer (2008) 302–307; Stockhammer (2009) 165–169.
180
Joseph Maran
und anderen zu vermitteln. Sippen, die sich erst nach der Katastrophe in Tiryns niedergelassen hatten, sowie solche, die bereits in der Palastzeit aus mehr oder weniger weit entfernten Regionen zugezogen waren54, aber an deren fremde Abkunft man sich noch erinnerte, waren vermutlich davon ausgeschlossen, Personen und Ereignisse der lokalen Vergangenheit als Bezugspunkte ihrer Familientradition heranzuziehen55. Anstatt dessen mögen sich die Mitglieder dieser Sippen dafür entschieden haben, auf andere Weise symbolisches Kapitel zu erwerben, etwa indem sie ihre Beziehungen zu entfernten Eliten dazu nutzten, in den Besitz exquisiter Fremdobjekte zu gelangen und diese im sozialen Handeln zur Schau zu stellen. Die erstaunliche Vielfalt herausragender Fremdobjekte im Tiryns-Schatz, unter denen vor allem solche aus Zypern hervorstechen, mögen auf solche Bemühungen zurückgehen56. Es liegt nahe anzunehmen, dass diese in besonderem Maße agonalen Verhältnisse der Nachpalastzeit ein besonders günstiges Milieu für die Entstehung einer die Vergangenheit verherrlichenden epischen Dichtung geschaffen haben57. Für eine solche Sichtweise hat sich jüngst Emmanouil Mikrakis ausgesprochen58, als er das für das 12. Jh. v. Chr. im Ostmittelmeerraum wahrscheinlich zu machende Aufkommen der sog. mindersaitigen Leier mit der Entstehung epischer Dichtung in den Zentren der Nachpalastzeit Griechenlands in Verbindung brachte. Das genannte Saiteninstrument scheint die auf minoische Vorbilder zurückgehende mehrsaitige Leier, die noch bis an das Ende der mykenischen Paläste nachgewiesen ist, abgelöst zu haben, was von Mikrakis als ein Indiz für eine größere Bedeutung des Gesanges gegenüber der Melodie angesehen wird. Es fällt nicht schwer, sich vorzustellen, dass in einem Bau an einem so geschichtsträchtigen Platz wie dem in der Ruine des Großen Megaron von Tiryns errichteten im Rahmen von Feierlichkeiten derartige Dichtung zur Aufführung kam59. Die Annahme innergesellschaftlich divergierender Einstellungen gegenüber der palastzeitlichen Vergangenheit eröffnet schließlich auch eine neue Perspektive auf die Hintergründe des Phänomens des Verschwindens der mykenischen Kultur60. Es verdient Hervorhebung, dass es sich in der Argolis beim Übergang zwischen SH IIIC
54 Zur Anwesenheit fremder Bevölkerungsgruppen in Tiryns vgl. Maran (2004) 24–26; Kilian (2007) 77–80; Stockhammer (2008) 283–294; Kostoula u. Maran (2012); Brysbaert u. Vetters (2010) 32–37. 55 Hierzu schon Maran (2011b). 56 Maran (2012c). 57 Vgl. hierzu schon Sherratt (1990) 819–820; Deger-Jalkotzy (1991b) 149; Deger-Jalkotzy (1994) 20–21; Deger-Jalkotzy (2008) 406. 58 Mikrakis (2006). 59 Hierzu Mikrakis (2006). 60 Das hier geschilderte Szenario beansprucht keine Gültigkeit für andere Regionen. Genauso wie pauschale Aussagen zu der Schärfe des Umbruchs vom 13. zum 12. Jh. v. Chr. nicht möglich sind, lassen sich von Region zu Region markante Unterschiede im Ausmaß an Kontinuität kultureller Merkmale zwischen der mykenischen Zeit und der frühen Eisenzeit feststellen: Dickinson (2006) 58–78, 238–258; Eder (1998) 25–178.
Urgeschichte – Frühgeschichte: Geschichte?
181
und der frühen Eisenzeit nicht um einen bloßen Wandel von Keramikstilen, sondern um eine tiefgreifende Transformation von Kultur und Gesellschaft gehandelt hat61. In submykenischer und protogeometrischer Zeit wurde nur noch vereinzelt in den mykenischen Kammergräbernekropolen bestattet62 und die Herstellung sowie Verwendung anthropomorpher Figurinen scheint vollständig zum Erliegen gekommen zu sein. In Tiryns geht der Übergang zur frühen Eisenzeit mit einer Aufgabe der Akropolis als Siedlungsraum einher63, wobei selbst im Falle des Antenbaus im Großen Megaron nichts auf eine Nutzung noch in der frühen Eisenzeit hindeutet64. In der Unterstadt müssen sich gleichzeitig einschneidende Vorgänge der Umformung der Siedlungsstruktur abgespielt haben. Nicht nur konnten bisher in keiner der Ausgrabungen in der Unterstadt Hinweise auf eine Siedlungskontinuität zwischen SH IIIC und der frühen Eisenzeit erbracht werden, sondern gemäß der Analyse von Alkestis Papadimitriou muss sich das submykenische und protogeometrische Siedlungsmuster in der Unterstadt gravierend von dem der mykenischen Nachpalastzeit unterschieden haben65. Verstreute Gruppen von Häusern jeweils mit eigenen Bestattungsplätzen wurden ab der beginnenden Eisenzeit zur Regel und traten an die Stelle der SH IIICzeitlichen Bebauung, die in manchen Teilen der Unterstadt ausgesprochen dicht und regelhaft angeordnet gewesen war66. Dass wir bislang, ganz im Gegensatz zu der Situation in SH IIIC, fast nichts über die Hausarchitektur im submykenischen und protogeometrischen Tiryns aussagen können, lässt sich als Anzeichen für einschneidende Veränderungen auch auf der Ebene von Architekturformen und Baumaterialien werten. Die Tiefe des Wandels ist ferner daran zu ermessen, dass für die gesamte Phase SH IIIC bisher keine regulären Bestattungen im Gebiet der tirynther Unterstadt bekannt geworden sind, was den Eindruck verstärkt, zu dieser Zeit seien Verstorbene in dieser Zone nicht „intra muros“, sondern in Kammergräbern außerhalb des besiedelten Areals beigesetzt worden. All dies sind Anzeichen dafür, dass die SH IIIC-zeitliche Gemeinschaft, die in einer wohl geordneten Siedlung gelebt und ihre Toten in einem gemeinsamen Bestattungsplatz beigesetzt hatte, am Übergang zur Eisenzeit Vorgängen der Auflösung und Fragmentierung unterworfen war. Wie konnte es zu dieser Transformation kommen, die anscheinend einem regelrechten Zerfall der inneren Kohäsion eines Gemeinwesens gleichkam? In den letzten Jahren zeichnet sich immer deutlicher ab, dass der Prozess des Wandels bereits in den letzten Jahrzehnten der mykenischen Nachpalastzeit eingesetzt haben muss, was anhand von zwei Beispielen erläutert werden soll. Zum einen hat die von Tobias Mühlenbruch vorgenommene Auswertung der Ergebnisse der Ausgrabungen von Klaus
61 62 63 64 65 66
Vgl. auch Eder (1998) 55–71; Eder (2006). Hägg (1974) 26, 47–51, 80–84; Papadimitriou (2006) 532. Kilian (1985) 77–78; Kilian (1988) 106–107; Papadimitriou (2001) 55. Maran (2000) 13. Papadimitriou (1998) 118–119; Papadimitriou (2006) 545–546. Maran u. Papadimitriou (2006) 127–132.
182
Joseph Maran
Kilian in der Unterburg von Tiryns klare Hinweise auf einen spürbaren Rückgang der Siedlungsdichte bereits kurz vor dem Ende von SH IIIC erbracht67. Dies deutet darauf hin, dass die Unterburg als Siedlungsraum aufgegeben wurde und ihre Einwohner woanders hinzogen, wahrscheinlich mehrheitlich in die Unterstadt68. Zum anderen konnte Melissa Vetters anhand der Analyse der Verbreitung anthropomorpher Figurinen in der Unterburg wahrscheinlich machen, dass in den späteren Unterphasen von SH IIIC nur noch bestimmte Haushalte solche Objekte in rituelle Praktiken integrierten, während sie in anderen Haushalten fehlten69. Aufbauend auf diesen Erkenntnissen möchte ich die These aufstellen, dass der Zerfall der mykenischen Kultur in Tiryns die Folge von Widersprüchen und Auseinandersetzungen innerhalb der Gesellschaft der mykenischen Nachpalastzeit war, die im Laufe der Phase SH IIIC sich immer mehr zugespitzt haben und die von der polarisierenden Wirkung zeitspezifischer Formen des sozialen Gedächtnisses verstärkt wurden. Drei bis vier Generation nach dem Ende der Palastzeit könnten jene Formen des Vergangenheitsbezugs ihre gesellschaftliche Wirkung eingebüßt haben, die im unmittelbaren Anschluss an das Ende der Paläste entstanden waren und die bewegliche und unbewegliche materielle Formen eingesetzt hatten, um eine direkte und vermutlich genealogisch begründete persönliche Verbindung zur ehemaligen Elite zu visualisieren. Vielleicht geschah dies, weil es im Laufe der Zeit immer schwieriger wurde, eine solche persönliche Verbindung glaubhaft zu vermitteln, lag doch das Ende der Palastzeit in der Zeit um 1100 v. Chr. genau jenen kritischen Zeitraum von 80–100 Jahren zurück, den Jan Vansina bei ethnographischen Forschungen als maximale Reichweite der Weitergabe bestimmter „historischer“ Ereignisse allein durch mündliche Überlieferung durch Zeitzeugen und ihre unmittelbaren Nachkommen festgestellt hatte70. Wie Philipp Stockhammer vermutet, könnte dabei auch ein „Generationsproblem“ im Spiel gewesen sein, da die jüngeren Einwohner die Palastzeit nicht aus eigenem Erleben kannten und nach anderen Wegen suchten, kulturelle Identität auszudrücken und neue Allianzen zu schmieden71. Schließlich muss noch ein weiterer Faktor für die nachlassende Wirkung der Art des Vergangenheitsbezugs, der sich im frühen 12. Jh. v. Chr. herausgebildet hatte, in Betracht gezogen werden. Der durch den Zuzug neuer Bevölkerungsgruppen ausgelöste demographische Wandel im Laufe der Nachpalastzeit mag bewirkt haben, dass eine Instrumentalisierung der Vergangenheit, von der Einwohner ohne tiefe familiäre Verankerung in der örtlichen Geschichte von vornherein ausgeschlossen waren, immer größeren Widerstand hervorrief.
67 Mühlenbruch (2007) 246; Mühlenbruch (2009). 68 Mühlenbruch (2009) 315. 69 Vetters (2009). 70 Vansina (1985) 23–24. 71 Stockhammer (2008) 308–309, der den Beginn der Veränderung des Vergangenheitsbezugs allerdings bereits in SH IIIC Mitte ansetzt.
Urgeschichte – Frühgeschichte: Geschichte?
183
All dies soll allerdings keineswegs heißen, dass der Bezug auf die palatiale Vergangenheit am Übergang von der mykenischen Zeit zur Eisenzeit seine soziale und politische Wirkungsmacht eingebüßt hat, sondern eher, dass auch diesbezüglich ein Wandel stattgefunden hat. Die Vergangenheit wurde immer mehr von der Welt der Lebenden entrückt, wodurch die Akropolis von einem in SH IIIC noch, was die Unterburg anbelangt, teilweise zu Siedlungszwecken genutzten Areal in einen Erinnerungsort verwandelt wurde, auf den keine soziale Gruppe mehr einen exklusiven Anspruch erheben konnte, und der hierdurch zu einem gesamtgesellschaftlichen Referenzpunkt wurde. Durch diesen Akt der Distanzierung der Gesellschaft von ihrer imaginierten Vergangenheit wurde ein entscheidender Schritt in Richtung auf die Herausbildung der Vorstellung eines für immer verlorenen Zeitalters der Helden getan, die ihre volle Wirkungsmacht in den folgenden Jahrhunderten entfalten sollte. Die homerischen Epen handeln meines Erachtens zwar nicht von der mykenischen Zeit, doch liegt der Form des Erinnerns eine bestimmte Einstellung zugrunde, deren Ursprünge ich meine, in die Zeit unmittelbar nach der Zerstörung der mykenischen Paläste zurückverfolgen zu können, als Menschen begannen, sich auf eine scheinbar nahe, aber aus bestimmten Gründen doch sehr ferne Vergangenheit zu beziehen. Die Ausgestaltung dieses Vergangenheitsbezugs blieb indes während der „dunklen Jahrhunderte“ alles andere als stabil, sondern unterlag den jeweiligen Diskursen und muss sich dementsprechend oft und markant gewandelt haben.
5 Eine kulturelle Anthropologie der Antike Mit den beiden Fallbeispielen sollte deutlich gemacht werden, dass sich die Handlungsmacht politischer Akteure in urgeschichtlichen Kontexten ebenso widerspiegeln kann wie das Wirken innergesellschaftlicher Diskurse. Eine Besonderheit der Bedingungen wissenschaftlicher Erkenntnis über die Urgeschichte besteht darin, dass es von vornherein ausgeschlossen ist, durch einen Textfund zu erfahren, „wie es wirklich war“ – wenn mir dieser platte Ausdruck gestattet sei. Vielmehr werden in der fachinternen Auseinandersetzung immer Hypothesen miteinander konkurrieren und im Lichte neuer Befunde oder der veränderten Bewertung alter Befunde ihre größere oder geringere Plausibilität erweisen müssen. Nur wenn wir aber neue Interpretationen an vermeintlich bekannte Befunde herantragen, wird die Auseinandersetzung mit den schriftlosen und frühschriftlichen Abschnitten der Menschheitsgeschichte ihr einzigartiges Potential entfalten, das Wissen um die Vielfalt von Kulturen um ein wahres Universum von Erscheinungsformen zu erweitern und die Moderne mit anderen Entwürfen des Lebens und anderen Formen sozialer Organisation zu konfrontieren, wie sie sonst nur die Ethnologie zu beschreiben in der Lage ist. Für eine Anthropologie der Antike, wie sie Tonio Hölscher vorschwebt, wäre dies ein großer Gewinn.
184
Joseph Maran
Literaturverzeichnis Anderson (1983): Benedict Anderson, Imagined Communities, London/New York. Assmann (2000): Jan Assmann, Das kulturelle Gedächtnis: Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen, München. Bourdieu (1979): Pierre Bourdieu, Critique sociale du jugement, Paris. Brysbaert u. Vetters (2010): Ann Brysbaert u. Melissa Vetters, „Practicing Identity: A Crafty Ideal“, Mediterranean Archaeology and Archaeometry 10.2, 25–43. Callon (1986) M. Callon, „Some Elements of a Sociology of Translation: Domestication of the Scallops and Fishermen of St. Brieuc Bay“, in: Law (1986) 196–233. Castoriadis (1975): Cornelius Castoriadis, L’institution imaginaire de la société, Paris. Cavanagh (2010): William G. Cavanagh, „Central and Southern Peloponnese“, in: Cline (2010) 631–642. Clarke (1968): David L. Clarke, Analytical Archaeology, London. Clastres (1974): Pierre Clastres, La société contre l’état, Paris. Cline (2010): Eric H. Cline (Hg.), Oxford History of the Bronze Age Aegean, Oxford. Davis (2010): Jack L. Davis, „Pylos“, in: Cline (2010) 680–689. Deger-Jalkotzy (1991a): Sigrid Deger-Jalkotzy, „Diskontinuität und Kontinuität: Aspekte politischer und sozialer Organisation in mykenischer Zeit und in der Welt der Homerischen Epen“, in: Domenico Musti, Anna Sacconi, Luigi Rocchetti u.a. (Hgg.), La transizione dal Miceneo all’alto Arcaismo. Dal palazzo alla città. Atti del Convegno Internazionale, Roma, 14–19 marzo 1988, Rom, 53–66. Deger-Jalkotzy (1991b): Sigrid Deger-Jalkotzy, „Die Erforschung des Zusammenbruchs der sogenannten mykenischen Kultur und der sogenannten dunklen Jahrhunderte“, in: Joachim Latacz (Hg.), Zweihundert Jahre Homer-Forschung. Rückblick und Ausblick (Colloquium Rauricum 2), Stuttgart/Leipzig, 127–154. Deger-Jalkotzy (1994): Sigrid Deger-Jalkotzy, „The Post-Palatial Period of Greece: An Aegean Prelude to the 11th century B.C. in Cyprus“, in: Vassos Karageorghis (Hg.), Cyprus in the 11th century BC. (Proceedings of the International Symposium Organized by the Arcaeological Research Unit of the University of Cyprus and the Anastasios G. Leventis Foundation, Nicosia, 30–31 October 1993), Nikosia, 11–30. Deger-Jalkotzy (1999): Sigrid Deger-Jalkotzy, „Military Prowess and Social Status in Mycenaean Greece“, in: Laffineur (1999) 121–131. Deger-Jalkotzy (2006): Sigrid Deger-Jalkotzy, „Late Mycenaean Warrior Tombs“, in: Deger-Jalkotzy u. Lemos (2006) 151–179. Deger-Jalkotzy (2008): Sigrid Deger-Jalkotzy, „Decline, Destruction, Aftermath“, in: Shelmerdine (2008) 387–415. Deger-Jalkotzy u. Lemos (2006), Sigrid Deger-Jalkotzy u. Irene S. Lemos, (Hgg.), Ancient Greece: From the Mycenaean Palaces to the Age of Homer. Edinburgh Leventis Studies 3, Edinburgh. Deger-Jalkotzy u. Zavadil (2007): Sigrid Deger-Jalkotzy u. Michaela Zavadil (Hgg.), LH IIIC Chronology and Synchronisms II: LH IIIC Middle. (Proceedings of the International Workshop Held at the Austrian Academy of Sciences at Vienna, October 29th and 30th, 2004), Wien. Dickinson (1977): Oliver T. P. K. Dickinson, „The Origins of Mycenaean Civilisation“, Studies in Mediterranean Archaeology 49, Göteborg. Dickinson (2006): Oliver T. P. K. Dickinson, The Aegean from Bronze Age to Iron Age. Continuity and Change Between the Twelfth and Eight Centuries B.C., London/New York. Eder (1998): Birgitta Eder, Argolis, Lakonien, Messenien. Vom Ende der mykenischen Palastzeit bis zur Einwanderung der Dorier, Wien. Dietz (1991): Sören Dietz, The Argolid at the Transition to the Mycenaean Age: Studies in the Chronology and Cultural Development in the Shaft Grave Period, Kopenhagen.
Urgeschichte – Frühgeschichte: Geschichte?
185
Eder (2006): Birgitta Eder, „The World of Telemachus: Western Greece 1200–700 BC“, in: DegerJalkotzy u. Lemos (2006) 549–580. Eggert (1998): Manfred K. H. Eggert, „Theorie in der Ur- und Frühgeschichtlichen Archäologie: Erwägungen über und für die Zukunft“, in: Eggert u. Veit (1998) 357–377. Eggert u. Veit (1998): Manfred K.H. Eggert u. Ulrich Veit (Hgg.), Theorie in der Archäologie: Zur englischsprachigen Tradition, Tübinger Archäologische Taschenbücher 1, Münster/ New York/München/Berlin. Eggert (2001): Manfred K.H. Eggert, Prähistorische Archäologie. Konzepte und Methoden, UTB für Wissenschaft 2092, Tübingen/Basel. French (2002): Elizabeth French, Mycenae: Agamemnon’s Capital, Stroud. French (2007): Elizabeth French, „Late Helladic IIIC Middle at Mycenae“, in: Deger-Jalkotzy u. Zavadil (2007) 175–187. Friedman (1997): Jonathan Friedman, „Global Crises, the Struggle for Cultural Identity and Intellectual Porkbarelling: Cosmopolitans versus Locals, Ethnics and Nationals in an Era of De-hegemonisation“, in: Pnina Werbner u. Tariq Modood (Hgg.), Debating Cultural Hybridity: Multi-Cultural Identities and the Politics of Anti-Racism, London/New Jersey, 70–89. Graziadio (1988): Giampaolo Graziadio, „The Chronology of the Graves of Circle B at Mycenae: A New Hypothesis“, American Journal of Archaeology 92, 343–372. Grethlein (2010): Jonas Grethlein, „From ‚Imperishable Glory‘ to History: The Iliad and the Trojan War“, in: David Konstan u. Kurt Raaflaub (Hgg.), Epic and History, London, 122–144. Hägg (1974): Robin Hägg, Die Gräber der Argolis in submykenischer, protogeometrischer und geometrischer Zeit, Uppsala. Halbwachs (1950): Maurice Halbwachs, La mémoire collective, Paris. Hiller (1984): Stefan Hiller, „Pax Minoica versus Minoan Thalassocracy. Military Aspects of Minoan Culture“ in: Robin Hägg u. Nanno Marinatos (Hgg.) The Minoan Thalassocracy: Myth and Reality. (Proceedings of the Third International Symposium at the Swedish Institute in Athens, 31 May–5 June, 1982), Stockholm, 27/31. Hiller (1999): Stefan Hiller, „Scenes of Warfare and Combat in the Arts of Aegean Late Bronze Age. Reflections on Typology and Development“, in: Laffineur (1999) 319/330. Hodder (1982): Ian Hodder, Symbols in Action: Ethnoarchaeological Studies of Material Culture, Cambridge. Holtorf (2005): C. Holtorf, „Geschichtskultur in ur- und frühgeschichtlichen Kulturen Europas“, in: J. Assmann u. K. E. Müller (Hgg.), Der Ursprung der Geschichte. Archaische Kulturen, das Alte Ägypten und das Frühe Griechenland, Stuttgart, 87–111. Iakovidis (2003): Spyros Iakovidis, „Late Helladic IIIC at Mycenae“, in: Sigrid Deger-Jalkotzy u. Michaela Zavadil (Hgg.), LH IIIC Chronology and Synchronisms. (Proceedings of the International Workshop at the Austrian Academy of Sciences at Vienna, May 7th and 8th, 2001), Wien, 117–123. Jung (2000): Reinhard Jung, „Das Megaron – Ein Analogie(kurz)schluss der ägäischen Archäologie“ in: Alexander Gramsch (Hg.), Vergleichen als archäologische Methode. Analogien in den Archäologien. BAR International Series 825, Oxford, 71–95. Karo (1927): Georg Karo, „Mykenische Kultur“, in: Max Ebert (Hg.) Reallexikon der Vorgeschichte 8, Berlin, 389–392. Karo (1930): Georg Karo, Die Schachtgräber von Mykenai, München. Kilian (1985): Klaus Kilian, „La caduta dei palazzi Micenei continentali: aspetti archeologici“, in: Domenico Musti (Hg.), Le origini dei Greci – Dori e mondo Egeo, Rom. Kilian (1988): Klaus Kilian, „Ausgrabungen in Tiryns 1982/83. Bericht zu den Grabungen“, Archäologischer Anzeiger, 105–151. Kilian (2007): Klaus Kilian, Die handgemachte geglättete Keramik mykenischer Zeitstellung. Tiryns – Forschungen und Berichte XV, Wiesbaden.
186
Joseph Maran
Kilian-Dirlmeier (1997): Imma Kilian-Dirlmeier, Das mittelbronzezeitliche Schachtgrab von Ägina. Alt-Ägina IV(3), Mainz. Kostoula u. Maran (2012): Maria Kostoula u. Joseph Maran, „A Group of Animal-headed Faience Vessels from Tiryns“, in: Gunnar Lehmann, Zipi Talshir, Mayer Gruber u. Shmuel Ahituv (Hgg.), All the Wisdom of the East. Studies in Near Eastern Archaeology and History in Honor of Eliezer D. Oren, Orbis Biblicus et Orientalis, Fribourg. Laffineur (1999): Robert Laffineur (Hg.), POLEMOS. Le contexte guerrier en Égée à l’âge du Bronze, (Actes de la 7e Rencontre égéenne internationale, Université de Liège, 14–17 avril 1998), Aegaeum 19, Liège/Austin. Latour (1986): Bruno Latour, „The Powers of Association“, in: Law (1986) 264–280. Latour (2005): Bruno Latour, Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory, Oxford. Law (1986): John Law (Hg.), Power, Action and Belief: A New Sociology of Knowledge? London, Boston/ Henley. Maran (2000): Joseph Maran, „Das Megaron im Megaron. Zur Datierung und Funktion des Antenbaus im mykenischen Palast von Tiryns“, Archäologischer Anzeiger, 1–16. Maran (2004): Joseph Maran, „The Spreading of Objects and Ideas in the Late Bronze Age Eastern Mediterranean: Two Case Examples from the Argolid of the 13th and 12th Centuries B.C.“, Bulletin of the American Schools of Oriental Research 336, 11–30. Maran (2006): Joseph Maran, „Coming to Terms with the Past: Ideology and Power in Late Helladic IIIC“, in: Deger-Jalkotzy u. Lemos (2006) 123–150. Maran (2008): Joseph Maran, „Nach dem Ende: Tiryns – Phönix aus der Asche“, in: Harald Siebenmorgen u. Katharina Horst (Hgg.), Zeit der Helden. Die „dunklen Jahrhunderte Griechenlands“ 1200–700 v. Chr., Darmstadt, 63–73 Maran (2010): Joseph Maran, „Tiryns“, in: Cline (2010) 722–734. Maran (2011a): Joseph Maran, „Lost in Translation: The Emergence of Mycenaean Culture as a Phenomenon of Glocalisation“, in: John Bennet, Sue Sherratt u. Toby Wilkinson (Hgg.), Interweaving Worlds: Systemic Interactions in Eurasia, 7th to 1st Millennia BC. (Proceedings of the Conference Ancient World Systems, Sheffield, 1st–4th April 2008 in Memory of Andrew Sherratt), Oxford, 282–294. Maran (2011b): Joseph Maran, „Contested Pasts – The Society of the 12th c. B.C.E. Argolid and the Memory of the Mycenaean Palatial Period“, in: Walter Gauss, Michael Lindblom, Angus Smith u. James C. Wright. (Hgg.), Our Cups are Full: Studies Presented to Jeremy B. Rutter, Philadelphia. Maran (2012a): Joseph Maran, „One World is not Enough: The Transformative Potential of Intercultural Exchange in Prehistoric Societies“, in: Philipp Stockhammer (Hg.), Conceptualizing Cultural Hybridization: A Transdiciplinary Approach. Transcultural Research. Heidelberg Studies on Asia and Europe in a Global Context 2, Berlin/Heidelberg, 59–66. Maran (2012b): Joseph Maran, „Architektonischer Raum und soziale Kommunikation auf der Oberburg von Tiryns – Der Wandel von der mykenischen Palastzeit zur Nachpalastzeit“, in:. Felix Arnold, Rudolf Haensch u. Ulrike Wulf-Rheidt (Hgg.), Orte der Herrschaft. Charakteristika antiker Machtzentren von der babylonischen Zeit bis in den Frühislam. Menschen – Kulturen – Traditionen, Studien aus den Forschungsclustern des Deutschen Archäologischen Instituts, Forschungscluster 3, Band 3, Rahden, 149–162. Maran (2012c): Joseph Maran, „Ceremonial Feasting Equipment, Social Space and Interculturality in Post-Palatial Tiryns“, in: Joseph Maran u. Philipp Stockhammer, Materiality and Social Practice: Transformative Capacities of Intercultural Encounters, Oxford/Oakville, 121–136. Maran u. Papadimitriou (2006): Joseph Maran u. Alkestis Papadimitriou, „Forschungen im Stadtgebiet von Tiryns 1999–2002“, Archäologischer Anzeiger, 97–169.
Urgeschichte – Frühgeschichte: Geschichte?
187
Maran u. Stavrianopoulou (2007): Joseph Maran u. Eftychia Stavrianopoulou, „Pfitnio« An‹r – Reflections on the Ideology of Mycenaean Kingship“, in: Eva Alram-Stern u. Georg Nightingale (Hgg.), KEIMELION. The Formation of Elites and Elitist Lifestyles from Mycenaean Palatial Times to the Homeric Period. Akten des internationalen Kongresses vom 3. bis 5. Februar 2005 in Salzburg, Wien, 285–298. Maran u. Stockhammer (2012): Joseph Maran u. Philipp Stockhammer, „Introduction“, in: Joseph Maran u. Philipp Stockhammer, Materiality and Social Practice: Transformative Capacities of Intercultural Encounters, Oxford/Oakville, 1–3. Mikrakis (2006): Emmanouil Mikrakis, Saiteninstrumente in der Ägäis und auf Zypern in der Bronzeund Früheisenzeit. Musikausübung und Kultur zwischen Kontinuität und Wandel, Dissertation Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. Miller (1998): Daniel Miller, „Why Some Things Matter“ in: D. Miller (Hg.), Material Cultures. Why Some Things Matter, Chicago, 3–21. Miller (2005): Daniel Miller, „Materiality: An Introduction“, in: Daniel Miller (Hg.), Materiality, Durham/London, 1–50. I. Morris (1999): Ian Morris, „Iron Age Greece and the Meanings of ‚Princely Tombs‘“, in: Pascal Ruby (Hg.), Les princes de la Protohistoire et l’émergence de l’état, (Actes de la table ronde internationale organisée par le Centre Jean Bérard et l’École française de Rome, Naples, 27–29 octobre 1994), Neapel/Rom, 57–80. I. Morris (2000): Ian Morris, Archaeology as Cultural History, Malden. S. P. Morris (2007): Sarah P. Morris, „Troy between Bronze and Iron Ages: Myth, Cult and Memory in a Sacred Landscape“, in: Sarah P. Morris u. Robert Laffineur (Hgg.), EPOS. Reconsidering Greek Epic and Aegean Bronze Age Archaeology. (Proceedings of the 11th International Aegean Conference Los Angeles, UCLA – The J. Paul Getty Villa, 20–23 April 2006), Aegaeum 28, Liège/Austin, 59–69. Mühlenbruch (2002): Tobias Mühlenbruch, Mykenische Architektur: Studien zur Siedlungsentwicklung nach dem Untergang der Paläste in der Argolis und Korinthia, Magisterarbeit RuprechtKarls-Universität Heidelberg. Mühlenbruch (2004): Tobias Mühlenbruch, Ein dunkles Zeitalter? Untersuchungen zur Siedlungsstruktur der Unterburg von Tiryns in der mykenischen Nachpalastzeit, Dissertation RuprechtKarls-Universität Heidelberg. Mühlenbruch (2007): Tobias Mühlenbruch, „The Post-Palatial Settlement in the Lower Citadel of Tiryns“, in: Deger-Jalkotzy u. Zavadil (2007) 243–251. Mühlenbruch (2009): Tobias Mühlenbruch, „Tiryns – The Settlement and Ist History in LH IIIC“, in: Sigrid Deger-Jalkotzy u. Anna Elisabeth Bächle, LH IIIC Chronology and Synchronisms III: LH IIIC Late and the Transition to the Early Iron Age. (Proceedings of the International Workshop Held at the Austrian Academy of Sciences at Vienna, February 23rd and 24th, 2007), Wien, 313–326. Mühlenbruch (2010): Tobias Mühlenbruch, „Soziale Räume im spätbronzezeitlichen Tiryns I: Architektur“, in: Barbara Horejs u. Tobias L. Kienlin (Hgg.), „Siedlung und Handwerk – Studien zu sozialen Kontexten in der Bronzezeit“, Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie 194, Bonn, 95–106. Muskett (2007): Georgina Muskett, Mycenaean Art: A Psychological Approach, British Archaeological Reports International Series 1636, Oxford. Mylonas (1972–1973): Georgios E. Mylonas, O tafikfi« k÷klo« B tvn MykhnØn, Athen. Niemeier (1990): Wolf-Dietrich Niemeier, „Mycenaean Elements in the Miniature Fresco from Thera?“, in: David A. Hardy, Christos G. Doumas, Jannis A. Sakellarakis u. Peter M. Warren (Hgg.) Thera and the Aegean World III. Volume One: Archaeology. (Proceedings of the Third International Congress, Santorini, Greece, 3–9 September 1989), London, 267–284.
188
Joseph Maran
Papadimitriou (1998): Alkestis Papadimitriou, „H oikistik‹ ejwlijh th« T›rynùa« metˇ th Mykhnaïk‹ epox‹. Ta arxaiologikˇ eyr‹mata kai h istorik‹ ermhne›a toy«“, in: Anne Pariente u. Gilles Touchais (Hgg.), Argos et l’Argolide: Topographie et Urbanisme. (Actes de la Table Ronde internationale, Athènes-Argos 28/4–1/5/1990), Paris, 117–130. Papadimitriou (2001): Alkestis Papadimitriou, Tiryns. Historischer und archäologischer Führer, Athen. Papadimitriou (2006): Alkestis Papadimitriou, „The Early Iron Age in the Argolid: Some New Aspects“, in: Deger-Jalkotzy u. Lemos (2006) 531–547. Renfrew (1973): Colin Renfrew (Hg.), The Explanation of Culture Change: Models in Prehistory, London. Rodenwaldt (1921): Gerhart Rodenwaldt, Der Fries des Megarons von Mykenai, Halle. Roessel (2006): David Roessel, „Happy Little Extroverts and Bloodthirsty Tyrants: Minoans and Mycenaeans in Literature in English after Evans and Schliemann“, in: Yannis Hamilakis u. Nicoletta Momigliano (Hgg.), Archaeology and European Modernity: Producing and Consuming the ‚Minoans‘, Creta Antica 7, Padova, 197–207. Rössler (2007): Martin Rössler, Die deutschsprachige Ethnologie bis ca. 1960: Ein historischer Abriss, Kölner Arbeitspapiere zur Ethnologie 1, Köln. Shelmerdine (2008): Cynthia W. Shelmerdine (Hg.), The Cambridge Companion to the Aegean Bronze Age, Cambridge. Sherratt (1990): Sue Sherratt, „Reading the Texts’: Archaeology and the Homeric Question“, Antiquity 64, 807–824. Sherratt (2004): Sue Sherratt, „Feasting in Homeric Epic“, in: James C. Wright (Hg.), The Mycenaean Feast. (Papers of a Colloquium at the General Meeting of the Archaeological Institute of America, Philadelphia, January 2001), Hesperia 73, 2, Princeton, 181–217. Sherratt (2005): Sue Sherratt, „Archaeological Contexts“, in: John M. Foley (Hg.), A Companion to Ancient Epic, Malden, 119–141. Stockhammer (2008): Philipp Stockhammer, Kontinuität und Wandel – Die Keramik der Nachpalastzeit aus der Unterstadt von Tiryns, Dissertation Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/8612 (Stand 20. 05. 2013). Stockhammer (2009): Philipp Stockhammer, „The Change of Pottery’s Social Meaning at the End of the Bronze Age: New Evidence from Tiryns“, in: Christoph Bachhuber u. R. Gareth Roberts (Hgg.), Forces of Transformation: The End of the Bronze Age in the Mediterranean, Themes from the Ancient Near East BANEA Publication Series 1, Oxford, 164–169 Taylor (2004): Charles Taylor, Modern Social Imaginaries, Durham/London. Thomatos (2006): Marina Thomatos, The Final Revival of the Aegean Bronze Age: A Case Study of the Argolid, Corinthia, Attica, Euboea, the Cyclades and the Dodecanese during LH IIIC Middle, BAR International Series 1498, Oxford. Theissen (1988): Gerd Theissen, „Tradition und Entscheidung. Der Beitrag des biblischen Glaubens zum kulturellen Gedächtnis“, in Jan Assmann u. Tonio Hölscher (Hgg.), Kultur und Gedächtnis, Frankfurt am Main, 171–196. Tilley u.a. (2006): Chris Tilley, Webb Keane u. Susanne Küchler (Hgg.). Handbook of Material Culture, Los Angeles/London/New Delhi. Vansina (1985): Jan Vansina, Oral Tradition as History, Madison. Vetters (2009): Melissa Vetters, Die spätbronzezeitlichen Terrakotta-Figurinen aus Tiryns. Überlegungen zu religiös motiviertem Ritualverhalten in mykenischer Zeit anhand von Kontextanalysen ausgewählter Siedlungsbefunde, Dissertation Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. Voutsaki (1997): Sophia Voutsaki, „The Creation of Value and Prestige in the Aegean Late Bronze Age“, Journal of European Archaeology 5, 34–52.
Urgeschichte – Frühgeschichte: Geschichte?
189
Voutsaki (1999): Sophia Voutsaki, „Mortuary Display, Prestige and Identity in the Shaft Grave Era“, in: Imma Kilian-Dirlmeier (Hg.), Eliten in der Bronzezeit. Ergebnisse zweier Kolloquien in Mainz und Athen, Monographien des Römisch-Germanischen Zentralmuseums 43, Mainz, 103–117. Voutsaki (2004): Sophia Voutsaki, „Age and Gender in the Southern Greek Mainland, 2000–1500 BC“, Ethnographisch-Archäologische Zeitschrift 45, 339–363. Voutsaki (2010): Sophia Voutsaki, „From the Kinship Economy to the Palatial Economy: The Argolid in the Second Millennium BC“, in: Daniel J. Pullen (Hg.), Political Economies of the Aegean Bronze Age. Papers from the Langford Conference, Florida State University, Tallahassee 22–24 February 2007, Oxford/Oakville, 86–111. Wiener (1991): Malcolm H. Wiener, „The Nature and Control of Minoan Foreign Trade“, in: Noel H. Gale (Hg.) Bronze Age Trade in the Mediterranean. Papers Presented at the Conference Held at Rewley House, Oxford, in December 1989, Studies in Mediterranean Archaeology 90, Jonsered, 325–350. Wiener (1999): Malcolm H. Wiener, „Present Arms/Oars/Ingots: Searching for Evidence of Military or Maritime Administration in LM IB“, in: Laffineur (1999) 411–424. Wightman (2007): Gregory J. Wightman, Religious Architecture in the Ancient World, Louvain. Wodak u.a. (1994): Ruth Wodak, Florian Menz, Richard Mitten u. Frank Stern (Hgg.), Die Sprachen der Vergangenheiten. Öffentliches Gedenken in österreichischen und deutschen Medien, Frankfurt am Main. Wodak u.a. (1999): Ruth Wodak, Rudolf de Cillia, Martin Reisigl u. Karin Liebhart (Hgg.), The Discursive Construction of National Identity, Edinburgh. Wright (1987): James C. Wright, „Death and Power at Mycenae: Changing Symbols in Mortuary Practice“, in: Robert Laffineur (Hg.), THANATOS. Les coutumes funéraires en Égée à l’âge du Bronze. (Actes du colloque de Liège, 21–23 avril 1986), Aegaeum 1, Liège, 171–184. Wright (2008a): James C. Wright, „Early Mycenaean Greece“, in: Shelmerdine (2008) 230–257. Wright (2008b): James C. Wright, „Chamber Tombs, Family, and State in Mycenaean Greece“, in: Chrysanthi Gallou, Mercourios Georgiadis u. Georgina Muskett (Hgg.), DIOSKOUROI, Studies Presented to W.G. Cavanagh and C.B. Mee on the Anniversary of Their 30 – year Joint Contribution to Aegean Archaeology, BAR International Series 1889, Oxford, 144–153.
190
Paul Zanker
Paul Zanker
Bilder lesen ohne Texte Die mit aufwendigen Reliefs geschmückten römischen Sarkophage des 2. und 3. Jahrhunderts n. Chr. stellen ein Luxus-Phänomen des Grabkultes dar1. Vor allem die zahlreichen mythologischen Reliefs lassen sich als eine Art von Grabpoesie in Bildern verstehen. Dieses Sprechen in hochgreifenden dichterischen Allegorien ist zweifellos dem kulturellen Klima der sog. Zweiten Sophistik zuzuordnen, doch das wäre ein eigenes Thema. Zumindest die früheren Sarkophage mit Mythenbildern standen nicht selten in ebenfalls aufwendig verzierten Grabkammern, an deren Wänden und Dekken ebenfalls Mythen und mythische Gestalten dargestellt waren. In meinem Beitrag gehe ich davon aus, dass den mythologischen Reliefs häufig keine eindeutige Aussage über die Toten oder den Tod oder auch für die Lebenden abzulesen ist. Statt dessen bieten die Bilder dem Betrachter mehrere Assoziations-Anreize an. Gemeinsam ergeben diese Assoziations-Anreize einen Bedeutungshorizont oder Bedeutungsrahmen für das Verständnis der jeweiligen Bilder. Ich will dies am Beispiel zweier eng aufeinander bezogener Bildtypen zu zeigen versuchen. Dabei gehe ich von den Bildern selbst aus, nicht von antiken Texten und von philosophischen sowie allegorischen Deutungen, die diese für die Bilder eventuell anbieten. Während Texte in der Regel den Mythos als solchen oder auch die einzelne mythische Gestalt reflektieren, geht es mir allein um die ausgewählten Szenen und Figuren und deren konkrete Ausformung im Bild. Das Bild trägt die Botschaft, es muss aus sich selbst verständlich sein, so meine Hypothese. Dass dabei je nach Bild ein mehr oder weniger breites Spektrum von Assoziationen und Bedeutungs-Varianten vermittelt wird, entspricht meiner Ansicht nach der von den Zeitgenossen geschätzten Eigenart des Sprechens in mythischen Allegorien. Die Unschärfe des sich dabei abzeichnenden Bedeutungsrahmens betrachte ich als eine positive Eigenart des Bild-Mediums ‚Mythos‘. Sie ermöglicht unterschiedliche und, je nach Betrachter, auch persönliche Lesarten. Was diesen einstigen Betrachter anbelangt, so gehe ich von der Tatsache aus, dass es sich bei den Auftraggebern in der Regel nicht um intellektuelle, philosophisch geschulte Menschen, sondern um Bürger aus unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft gehandelt hat: Bürger eben, die sich einen Sarkophag leisten konnten, Leute wie die Bewohner von Pompeji, die ihre Häuser zum Teil mit denselben Mythen ausmalen liessen, die auch auf den Sarkophagreliefs erscheinen. Als Beispiele für meine Überlegungen wähle ich die beiden Liebesmythen von Luna und Endymion sowie von Dionysos und Ariadne aus. Hier wie dort sind die Lie-
1 Diese Überlegungen habe ich zuerst in einem Kolloquium, das im Institute for the Study of the Ancient World in New York 2010 stattgefunden hat, vorgetragen, wo eine englische Version auch veröffentlicht ist: Res 61/62, 2012, 167–177. Zur allgemeinen Orientierung: Koch u. Sichtermann (1982); Zanker u. Ewald (2004).
Bilder lesen ohne Texte
191
Abb. 1: Sarkophag, Endymion und Selene, um 240 v. Chr. Paris, Louvre.
Abb. 2: Sarkophag, Dionysos mit Thiasos und Ariadne, um 240 v. Chr. Paris, Louvre.
benden in demselben ikonographischen Schema dargestellt: Einer von ihnen naht sich ‚dem‘ oder ‚der‘ Geliebten, die im gleichen Bildschema schlafend vor ihm oder ihr liegen. Die beiden Bildtypen wurden schon von den Zeitgenossen miteinander verglichen und zumindest in einem uns erhaltenen Fall sogar bewusst als Pendant aufeinander bezogen. Es handelt sich um die beiden Prachtsarkophage im Louvre, die aus einem Grabbau bei Bordeaux stammen (Abb. 1, 2)2. Sie sollen im Zentrum meiner Überlegungen stehen.
2 Zanker u. Ewald (2004) 108 Abb. 91, 109 Abb. 92.
192
Paul Zanker
Abb. 3: Sarkophag, Endymion und Selene, um 230 n. Chr. Rom, Palazzo Galeria Doria Pamphilj.
Auf einem Teil sowohl der Endymion-Luna- als auch der Ariadne-Dionysos-Sarkophage sind die mythischen Paare durch Bildnisse und zeitgenössische Modefrisuren direkt auf die im Sarkophag Bestatteten bezogen – wohl in der Regel Eheleute. Im Fall der beiden Sarkophage im Louvre war eine solche Identifizierung durch Bildnisse vorgesehen, weshalb die Köpfe der Eheleute in der Bosse stehen gelassen worden sind. Die Vergegenwärtigung der Verstorbenen in Gestalt von Gottheiten oder Heroen und Heroinen begrenzt die denkbaren allegorischen Bezüge auf Aussagen, die im Rahmen familiärer Zusammengehörigkeit sinnvoll erscheinen. Damit ergäbe sich bereits eine wesentliche Begrenzung des Assoziationsrahmens für beide Sarkophage. Für die Fälle, in denen zwei oder noch mehr der Protagonisten mit Bildnissen versehen waren, dürfen wir annehmen, dass zum Zeitpunkt der Sarkophagbestellung und Aufstellung einer oder mehrere der Porträtierten noch am Leben waren, denn in der Regel werden ja auch bei Ehepaaren nicht beide Partner gleichzeitig gestorben sein. Der Überlebende wurde demnach, solange er noch lebte, in die Mythen-Diskurse am Grab mit einbezogen. Er sah sich selbst in Gestalt eines der mythischen Protagonisten wie zum Beispiel im Falle des Endymion-Sarkophages in der Galleria Doria Pamphilj (Abb. 3)3. Diese Einbeziehung des noch lebenden Partners muss bei der Rekonstruktion des Assoziations-Rahmens berücksichtigt werden, denn sie bestätigt den familiä-
3 Zanker u. Ewald (2004) 25 Abb. 17, sowie Ausschnitt in Zanker u. Ewald (2004) 47 Abb. 32.
Bilder lesen ohne Texte
193
Abb. 4: Sarkophag, Admet eilt ans Sterbebett der Alkestis, um 160 n. Chr. Vatikanische Museen.
ren Charakter der intendierten Aussagen. Bei einer probeweisen Umsetzung in einen Text könnte der überlebende Partner in seiner allegorischen Rolle „ich“ sagen. Im Bild des Endymion-Sarkophages Doria Pamphilj könnte die als Luna erscheinende Ehefrau zum Beispiel sagen: „Ich liebte meinen Ehemann und sehne mich nach ihm, wie Luna sich nach Endymion sehnte.“ Und entsprechend könnten die vor dem Sarkophag stehenden Familien-Angehörigen etwa sagen: „Sie liebten sich wirklich.“ Sind mehrere Familienmitglieder mittels Porträts in mythischen Gestalten dargestellt, wie zum Beispiel auf dem bekannten Alkestis-Sarkophag (Abb. 4), erweitert sich natürlich der Dialog. Ein ganzer Teil der engeren Familie kommt in einem solchen Falle zu Wort4. Sowohl die Luna-Endymion- wie auch die Dionysos-Ariadne-Sarkophage sprechen von Liebe und Verbundenheit. Im Falle der Endymionsarkophage wird das häufig noch zusätzlich durch eine Vielzahl von Eroten als Begleiter und Helfer unterstrichen. Die Themen Liebe und eheliche Verbundenheit nehmen unter den mythologischen Sarkophagreliefs zahlenmässig überhaupt eine ganz herausgehobene Stellung ein, man denke nur an die Bilder mit Venus-Adonis, Ares-Rhea Silvia, Protesilaos-Laodameia, Phaedra-Hippolytos oder Alkestis-Admet. Sie werden darin nur noch von den Glücksvisionen des dionysischen Thiasos und der Meerwesen übertroffen. Dass die Liebe und nicht der Tod bei den meisten dieser Bilder das Hauptthema – und damit für den Bedeutungsrahmen entscheidend – war, legt die jeweilige Inszenierung der Szenen auf den Sarkophagen nahe. Für die Endymion-Sarkophage kommt dies auf einem Sarkophag im Vatikan besonders deutlich zum Ausdruck, auf dem Endymion und Luna mit dem nächtlichen Besuch von Mars bei Rhea Silvia parallelisiert werden5. Rhea Silvia ist zwar in der gleichen Haltung wie Endymion und Ariadne dargestellt, aber sie schläft nicht. Was beide
4 Zanker u. Ewald (2004) 202 Abb. 182, 203 Abb. 183 (Ausschnitt); 298–301 Nr. 8. 5 Zanker u. Ewald (2004) 164, 215 Abb. 194.
194
Paul Zanker
Bilder verbindet, ist allein der Besuch des beziehungsweise der Liebenden bei dem beziehungsweise der Geliebten. Entscheidend bei der Gegenüberstellung der beiden Paare war vermutlich, dass in einem Fall der männliche Geliebte, im anderen die weibliche Geliebte die aktive Rolle spielen. Auf diese Weise kamen die Verstorbenen wechselseitig zu Wort, konnten sich gegenseitig ihrer Liebe und Sehnsucht versichern. Dass der jeweils aktive Partner in Gestalt einer Gottheit, der passive in Gestalt eines Heros beziehungsweise einer Heroine auftritt, zeigt nur, dass dieser Unterschied im mythologischen Scharadenspiel nicht bedeutungsvoll ist. Das zweite Motiv, das die Bildtypen der Luna-Endymion- und Dionysos-AriadneSarkophage verbindet, ist der Schlaf eines der Liebenden. Dem liegt die auch interkulturell verbreitete Vorstellung vom Schlaf als dem Bruder des Todes zugrunde. Sich den Toten als Schlafenden vorzustellen, wurde und wird als tröstlich empfunden. Der Schlaf ist kein endgültiger Zustand, der Tote ist als Schlafender scheinbar noch erreichbar. „Der Tote schläft nur, er ruht sich aus von den Mühen des Lebens.“ Man findet diese Vorstellung auch auf Grabinschriften, die vom Tod als somnus und somnus aeternus oder quies und quies aeterna sprechen6. Aber auch das Bild der Toten als Schlafende kannte man in Rom schon bevor die Sarkophag-Reliefs in Mode kamen: Auf den sogenannten Klinen-Monumenten sind es vor allem verstorbene Frauen, die schlafend dargestellt wurden7. Bezeichnenderweise wird auf diesen Grabmonumenten häufig auf das Gastmahl angespielt. Denn die Toten halten wie die Gelageteilnehmer Girlanden in ihren Händen. Häufig werden die Verstorbenen ja überhaupt beim Mahle liegend in Erinnerung gerufen8. Im Kontext des Grabes unterstützt dies die Vorstellung, sie seien bei den Gedächtnisfeiern, die die Angehörigen zu ihren Ehren regelmässig am Grab abhielten, in irgendeiner Form gegenwärtig. Deshalb stellte man ihnen auch etwas vom Essen hin oder bedachte sie zumindest mit einem Guss vom Wein. Denn die unterschiedlichen, vom Schlaf der Verstorbenen ausgehenden Assoziations-Anreize zielten alle darauf hin, sich die Verstorbenen als noch unter ihren Verwandten gegenwärtig vorzustellen. Soweit stimmen die von den Luna-Endymion- und Dionysos-Ariadne-Reliefs ausgehenden Assoziationsmöglichkeiten überein. Um weitere Möglichkeiten zu benennen, wollen wir die beiden Sarkophage im Louvre aus der Zeit um 230 n. Chr. näher betrachten (Abb. 1, 2). Sie stammen aus derselben, vermutlich römischen Werkstatt, sind als Gegenstücke gearbeitet und waren für dasselbe Grab und vermutlich auch für dasselbe Ehepaar bestimmt. Wie auf dem Sarkophag, auf dem Mars-Rhea Silvia und Endymion-Luna nebeneinander gezeigt werden, sind Mann und Frau auch hier abwechselnd in Gestalt der aktiven – beziehungsweise passiven – mythischen Gestalten dargestellt. Luna naht dem schlafenden Endymion, bei der Auffindung der schlafen-
6 Lattimore (1942); Zanker u. Ewald (2004) 110–115. 7 Wrede (1977) 395–431. 8 Zanker u. Ewald (2004) 189 Abb.171.
Bilder lesen ohne Texte
195
den Ariadne ist es umgekehrt. Jedoch wird der Ehemann der als Ariadne gefeierten Frau nicht direkt mit Dionysos identifiziert, worauf wir noch zurückkommen werden. Soweit gehen die Übereinstimmungen. Unterschiedlich jedoch ist das Verhalten der aktiven Partner, sowie vor allem die Umgebung, in der die beiden Verstorbenen als Schlafende liegen.
1 Endymion und Luna Betrachten wir zuerst den Endymion-Sarkophag. Luna steigt mit elegantem Schritt vom Wagen. Die Schönheit ihrer Erscheinung und ihres Auftretens kann als ein rühmendes Adjektiv für die Ehefrau gelesen werden, deren Bildnis die Göttin ja tragen sollte. Dasselbe gilt für den Ehemann. Endymion wird wie einer der Villenbesitzer als Jäger mit Jagdspeeren und mit kurzer Tunica und Mäntelchen gezeigt. Er ist ein kräftiger, muskulöser Jüngling, der von der Jagd ermüdet eingeschlafen ist (wobei die konkrete Situation hier den Schlaf zusätzlich als vorübergehenden Zustand charakterisiert). Es ist Nacht, Eroten mit Fackeln weisen der Göttin den Weg und beleuchten den Geliebten. Hirten mit ihren Herden lagern in der Gegend, Quellennymphen und ein junger Flussgott deuten die friedliche Landschaft an, in der selbst die Erdgöttin in Schlaf gesunken ist. Frieden und Harmonie umgeben die Liebenden, auch dies eine weitere Assoziationsmöglichkeit. Zudem wollen die beiden Bildchen auf dem Sarkophag-Deckel im Betrachter zusätzliche Assoziationen aufrufen. Das eine stellt das Parisurteil, das andere eine Girlandenbinderin mit ihren Helfern dar. Das Parisurteil huldigt der Liebesgöttin, deren Gunst sich das mythische Paar ebenso wie das Ehepaar erfreut. Auch die Girlanden bindende Blumenfrau steht in direktem Zusammenhang mit den Toten und dem Grabkult. Denn sie und ihre Helfer arbeiten für die am Grab gefeierten Totenfeste. Die Träger eilen mit ihren Blumenkörben zum Grab hin, das Schmücken des Grabes an den Totenfesten war ein wesentlicher Bestandteil des Rituals. Das Bildchen schlägt so eine direkte Brücke zu der Situation am Grab. Es gibt ungefähr 100 Endymion-Sarkophage in diesem Bildtypus, keine dieser Wiederholungen ist jedoch eine exakte Kopie der anderen9. Der Kern des Bildes bleibt zwar immer der gleiche, aber die vom Beiwerk und den einzelnen Details ausgehenden Assoziationsanreize weisen durchaus interessante Unterschiede auf. Um eine Vorstellung von diesen Variationsmöglichkeiten zu gewinnen, die der Bildtypus trotz seiner vermeintlichen Erstarrung für Bildhauer wie Besteller bot, wollen wir einen Blick auf drei weitere Endymion-Sarkophage werfen. Die dabei zum Vorschein kommenden Unterschiede standen dem Auftraggeber zumindest theoretisch zur Wahl. Sie
9 Sichtermann (1992).
196
Paul Zanker
Abb. 5: Sarkophag, Endymion und Selene, 3. Jh. n. Chr. New York, Metropolitan Museum.
stellen in unserem Zusammenhang deshalb Beispiele für potentielle Assoziationsmöglichkeiten dar. Für die praktische Realisierung mussten natürlich entsprechende Vorlagen in der Werkstatt vorhanden sein. Auf dem überaus kunstvollen Sarkophag im Metropolitan Museum von New York ist Endymion kein Jäger, sondern ein Hirte (Abb. 5)10. Er schläft inmitten einer jetzt mit zahlreichen Figuren ausstaffierten bukolischen Landschaft, die hier sogar auf die Rückseite des Sarkophages übergreift. Dort lagert umgeben von weidenden Rindern und Pferden ein Hirte in demselben Schema wie Endymion. Auf diese Weise wird Endymion noch unmittelbarer, wie auf dem Sarkophag im Louvre, in die friedliche Hirtenwelt einbezogen. Er wird zum schlafenden Hirten unter schlafenden Hirten. Während der Vergleich mit dem Jäger auch als Hinweis auf die soziale Stellung des Verstorbenen gelesen werden konnte, liegt der Vergleich mit der Welt der Hirten mehr auf poetischer Ebene. Man kann in dieser Betonung des bukolischen Friedens aber auch einen Wunsch für den Verstorbenen im Sinne von requiescat in pace sehen. Im Gegensatz zum Jäger auf dem späteren Sarkophag im Louvre ist der Hirte Endymion hier nackt dargestellt. Und zwar wie auch auf anderen Sarkophagen in einer Art und Weise, die den erotischen Charakter der Begegnung hervorhebt, eine Konnotation, die durch die unbekleidete Brust der Luna noch verstärkt wird. Eifrige Eroten beleuchten zudem den schönen Körper. Diesen erotischen Aspekt werden wir bei der schlafenden Ariadne wiederfinden. Er konnte eine Fülle von Vorstellungen, Erinnerungen und Sehnsüchten wachrufen. Der reich verzierte Sarkophagdeckel führt auch hier das Thema Liebe in Form mehrerer kleiner Bildchen weiter, darunter sind drei Liebespaare (Amor und Psyche, Aphrodite und Ares sowie noch einmal Endymion und Luna). Wie in einem Gedicht werden mehrere mythologische Vergleiche nebeneinander aufgerufen, um die Liebe
10 Zanker u. Ewald (2004) 55 Abb. 37, 103 Abb. 87 (Ausschnitt); 322 Nr. 15.
Bilder lesen ohne Texte
197
Abb. 6: Sarkophag, Endymion und Selene, um 200 n. Chr. Rom, Museo Capitolino.
der beiden zu feiern. Als Detail ist interessant, dass der ewige Schlaf des Endymion die Phantasie keineswegs einengt, denn auf dem Bildchen wird die Erinnerung an die Liebe des Paares, das sich umarmt und küsst, aufs Schönste aufgerufen. Der Verweis auf andere mythische Liebespaare erweitert die Assoziationskette, die ja bereits mit der Gegenüberstellung von Luna-Endymion und Dionysos-Ariadne beginnt. Sie ist für das Verständnis des Sprechens ‚in‘ und des Betrachtens ‚von‘ mythischen Bildern fundamental, zeigt sie doch, wie sich eine Vorstellung locker an die andere anschliesst, wie ein Bild durch ein weiteres bereichert werden konnte, und wie es zugleich begrenzt werden kann. Wir haben es mit einem gefühlvollen Nachsinnen, einem, wie man früher sagte „in Gedanken versunken“ sein zu tun. Der Sarkophag im Metropolitan Museum wurde (wohl erst in zweiter Verwendung) von einer Tochter für ihre Mutter bestimmt. Die Zeitgenossen konnten offenbar von Geschlecht und Rollenverteilung der mythischen Personen zueinander abstrahieren und die Liebe des Paares (wie in diesem Falle) auf Liebe und Sehnsucht der Tochter nach ihrer verstorbenen Mutter beziehen. In einem anderen Falle in der_ Ny Carlsberg Glyptotek sind es, durch Inschrift bezeugt, die Eltern, die im Bild von Luna und Endymion von ihrer Liebe zu ihrem verstorbenen Sohn sprechen wollen11. Auf einigen Endymion-Sarkophagen wird die ‚Abfahrt‘ der Luna als eigene Szene dargestellt12. Das Relief sollte auf diese Weise dem länglichen Format des Kastens besser angepasst werden. Auf einem Sarkophag im Museo Capitolino benutzte der Bildhauer diese zusätzliche Szene, um die Sehnsucht der Göttin durch einen schmachtenden Blick, mit dem sie sich nach ihrem Liebsten zurückwendet, zu intensivieren (Abb. 6)13. Auch auf anderen Endymion-Sarkophagen weisen die Gestirnsgottheiten Helios und Selene auf die Nacht als die begrenzte Zeit der Liebenden, dieses uralte Motiv der Liebesdichtung, hin.
11 Sichtermann (1992) 109 Nr. 35 Taf. 28,6; Østergaard (1996) 80 Nr. 34; Zanker u. Ewald (2004) 106. 12 z.B. Mantua, Palazzo Ducale: s. Sichtermann (1992) 115 Nr. 52 Taf. 52,2. 13 Rom, Museo Capitolino: Sichtermann (1992) 114 Nr. 51.
198
Paul Zanker
Abb. 7: Relief, Endymion und Selene, frühes 3. Jh. n. Chr. Rom, San Paolo fuori le mura.
Auf einem Sarkophag im Chiostro di S. Paolo fuori le mura (Abb. 7) hatte der Auftraggeber oder – wahrscheinlicher – die Auftraggeberin einen besonderen Wunsch14. Sie wollte sich nämlich als Braut des mit Endymion identifizierten Geliebten darstellen lassen. Der Mantel und das verhüllte Haupt kennzeichnen sie als solche. Aber sie ist nicht nur anders gekleidet, sie agiert auch in einer vom Bildtypus abweichenden Weise. Sie schreitet nicht wie sonst, sondern schwebt mit sehnsuchtsvoll ausgestreckten Armen auf den Geliebten zu. Die Nacht (über ihr die Sterne) geleitet sie, zwei Knaben deutet man auf Hesperos und Phosphoros, den Abend- und Morgenstern, die die den Liebenden zugemessene Zeitspanne andeuten. Die Liebesgöttin selbst hat sich auf diesem Bild in den Dienst der Verliebten Luna gestellt, indem sie ihren diesmal von Stieren gezogenen Wagen zum Ziel lenkte, auch dies in völliger Abwendung vom Bildtypus. Im Zusammenhang mit der Betonung der Nacht und dem Bild der sehnsuchtsvollen Braut hat Michael Koortbojian den Gedanken an Begegnungen mit dem oder der Verstorbenen im Traum ins Spiel gebracht15. Auch diese Assoziation trägt zweifellos zur Definition des Bedeutungsrahmens bei. Jedenfalls hören wir mehrfach von solchen nächtlichen Begegnungen mit Verstorbenen, z.B. im Grabgedicht einer jungen Frau, die ihren Geliebten nach kurzer Ehe verloren hat: […]ita peto vos Manes sanctissimae / commendat[um] habeatis / meum ca[ru]m et vellitis / huic indulgentissimi esse / horis nocturnis / ut eum videam / et etiam me fato suadere / vellit ut et ego possim / dulcius et celerius / aput eum pervenire.
14 Sichtermann (1992) 149 Nr. 98 Taf. 100–104; Zanker u. Ewald (2004) 105 Abb. 89. 15 Koortbojian (1995) 100–113.
Bilder lesen ohne Texte
199
Deshalb bitte ich Euch, manes sanctissimae, nehmt meinen Geliebten gut auf, und gewährt ihm, dass ich ihn in den Stunden der Nacht sehen kann. Auch soll er vom Geschick erbitten, dass ich süsser und schneller zu ihm kommen kann. (CIL VI 18817)
Damit könnte man das Relief in S. Paolo fuori le mura sehr gut vergleichen. Aus den zahlreichen konkret dargestellten Assoziationsanreizen ergab sich so für den Betrachter ein flexibler Rahmen, in dem er Bedeutungen und Sinnzusammenhänge finden konnte. Im Zentrum der Endymion-Reliefs steht ganz eindeutig die Liebe. Vom Tod ist – sieht man von den wenigen Exemplaren, auf denen Eroten mit gesenkter Fackel das Bild einrahmen, ab – nur indirekt in Form des schlafenden Endymion die Rede. Die Bewegung der Göttin und ihre ständige Wiederkehr in jeder Nacht bringt die nie endende Sehnsucht nach dem Geliebten zum Ausdruck. Liebe als Sehnsucht ist die Botschaft. Denn auf all den vielen Endymion-Sarkophagen wird immer nur das Sich-Nahen, nie die Erfüllung gezeigt. Dazu kommen die Wünsche: Der Geliebte möge so friedlich und sorglos schlummern wie die Hirten in ihrer bukolischen Welt (eine Vorstellung für sich genommen wieder reich an assoziationsträchtigen Bildern). Ferner fanden wir Elemente des Totenlobes, die Schönheit des oder der Toten, die Erinnerungen an die körperlichen Freuden der Liebe, die Assoziationen von Braut und Hochzeit, schliesslich die Hoffnung auf ein Wiedersehen, wenn nicht im Jenseits, so doch zumindest im Traum.
2 Dionysos und Ariadne Damit wenden wir uns dem anderen Sarkophag im Louvre zu, der als Pendant zum Endymion-Sarkophag aufgestellt war (Abb. 2)16. Anders als Endymion ist Ariadnes Gestalt, obwohl sie das Bildnis der Verstorbenen tragen sollte, ohne besondere Hervorhebung in das Treiben des Thiasos eingegliedert. Auf der gegenüberliegenden Seite hat der Bildhauer eine ebenfalls am Boden liegende Mänade als Pendant hinzugefügt, die sogar etwas grösser proportioniert ist. Die Verstorbene gehört hier schon ganz der Welt des Dionysos an. Dieser steigt vom Wagen, schreitet aber anders als Luna nicht auf Ariadne zu, sondern hält inne und ist inmitten des lärmenden Thiasos in stille Bewunderung der Schlafenden versunken. Dieses Motiv findet man bei Dionysos auf allen Sarkophagen mit der Auffindung der Ariadne. Der Blick des Dionysos enthält eine wesentliche Aussage: Bewunderung und Staunen im Anblick der schönen Frau17. Auf anderen Sarkophagen desselben Themas wird der erotische Aspekt stärker betont: Satyrn enthüllen den Körper der Ariadne und der kleine Pan naht sich ihr voller Begier, nicht aber der Gott. Man sieht Satyrn und Mänaden, die voller Lebens-
16 Zanker u. Ewald (2004) 109 Abb. 92, s. Anm. 2. 17 Über das Motiv des Blicks bei Catull, Properz und Ovid vgl. Elsner (2007) 20–44.
200
Paul Zanker
Abb. 8: Sarkophag, Dionysos und Ariadne mit Mänaden und Satyrn, Ende 2. Jh. n. Chr. Kopenhagen, Ny Carlsberg Glyptotek.
freude tanzen, spielen und singen. Sie alle feiern voller Lebenslust. Man sieht Paare und Kinder, sogar eine Kentaurin, die mit ihrem Kind spielt, ist an hervorgehobener Stelle zu sehen. Auf der linken Seite erscheint als Zeichen der Verehrung ein Altar im Hintergrund, ohne jedoch in eine Opferhandlung einbezogen zu sein. Auch die Deckelreliefs beherrscht Bachus. Links zieht er im Triumph dahin, rechts wird sogar die würdige Büste des Grabherrn in den Thiasos eingebunden: Zwei tanzende Mänaden breiten hinter ihm das Parapetasma aus, ein Satyr mit der Syrinx steht bereit und Pan bläst dem Ehemann mit seiner schrillen Doppelflöte in die Ohren. Die Assoziationsanreize ergeben in diesem Fall zunächst einen völlig einheitlichen Bedeutungsrahmen: dionysische Festesfreude. Auch der Betrachter wird in das Bild einbezogen: Mit Dionysos soll er innehalten und die schlafende Ariadne bewundern, die ihm und nicht dem Gott den für ein Bildnis roh belassenen Kopf zuwendet. Denn dass wir in ihr die Verstorbene sehen sollen, legt der Schlaf und auch der schlafende Endymion als Pendant nahe. Auch der Grabherr kann als Betrachter gelten und mit einstimmen in das Lob seiner Frau. Er liess sich zwar nicht als Dionysos darstellen, aber seine von Satyrn und Mänaden umgebene Büste erscheint doch direkt über Dionysos. Dass auch der Ehemann – trotz des zunächst so problematischen Verhältnisses der Römer zu Dionysos, wenn es um Selbstdarstellung und Selbstverständnis ging – mit diesem identifiziert werden konnte, wissen wir von einem der sog. Dionysischen Hochzeitssarkophage, auf denen die beiden Protagonisten sich gegenseitig bewundernd betrachten (Abb. 8)18. Auch in diesem Falle konnte demnach die Liebe des Gottes zu Ariadne auf die des verstorbenen Paares bezogen werden. Der Grab-
18 Zanker u. Ewald (2004) 165 Abb. 151, sowie in einem anderem Beispiel bei Zanker u. Ewald (2004) 164 Abb. 150; 309 Nr. 11.
Bilder lesen ohne Texte
201
herr könnte auch hier durchaus sagen: „Wir waren Zeit unseres Lebens glücklich miteinander“. In diesem Sinne konnten die Betrachter das Bild angesichts des Grabes auch als Aufforderung zum Lebensgenuss lesen, im Sinne von „carpe diem“. Denn sie kannten dieselben Bilder ja aus ihren Häusern und lasen sie dort frei von Todes- und Jenseitsassoziationen, vor allem im Kontext des abendlichen Gastmahls, das als Dionysosfest verstanden wurde. Eine durchaus vergleichbare Situation ergab sich, ich erwähnte es bereits, bei den am Grab oder in seiner Nähe gefeierten Erinnerungsfeiern mit Mahl und Gelage. Aber kann man Fest und Lebensfreude, die Ariadne umgeben, nicht auch als Wunsch für die Tote verstehen? Wie im Falle des Endymion in der friedlichen Welt der Hirten konnte man vermutlich auch in der Auffindung der Ariadne durch Dionysos und in ihrer Aufnahme in den Thiasos durchaus einen prospektiven Wunsch sehen. Der Betrachter könnte sich gesagt haben: „Möge die Verstorbene dort, wo sie jetzt ist, dieselben Freude geniessen, die sie hier genossen hat“, oder auch: „Möge sie in Dionysos die Mühsal des Lebens vergessen“ (letzteres scheint mir bei diesem Sarkophag angesichts des würdigen Grabherrn und des ganzen Bildes allerdings wenig wahrscheinlich, jedenfalls gibt es im Bild keinerlei Hinweise auf einen negativen Rückblick). Der Bedeutungsrahmen des Dionysos-Ariadne-Sarkophages umfasst jedenfalls, ob man ihn nun prospektiv oder retrospektiv las, lauter positive, glückliche Assoziationen.
3 Prospektive Hoffnung und respektive Erinnerung Was ergibt sich nun für unsere Frage nach Assoziationen und Sinngehalt aus der Tatsache, dass diese beiden Sarkophage als Pendants gearbeitet und aufgestellt, und dass sie vermutlich für ein und dasselbe Ehepaar bestimmt waren? Zunächst bestätigen sich die Bilder gegenseitig in ihren Aussagen. In beiden Fällen geht es um Liebe, wenn auch in unterschiedlicher Akzentuierung – Sehnsucht auf der einen, Erfüllung im staunenden Betrachten auf der anderen Seite. Hier wie dort wird das Lob ‚der‘ beziehungsweise ‚des‘ Verstorbenen gesungen. Hier wie dort haben wir es mit Aussagen im und für den Kreis der Familie, mit einem pivaten Bezugsrahmen zu tun, nicht mit Allegorien allgemeiner Art. Die Gegenüberstellung der beiden Liebespaare als Pendants erweiterte darüber hinaus diese mit dem Hauptthema „Liebe“ verbundenen Vorstellungen und Hoffnungen. Der Betrachter konnte, ja, er sollte die in ‚beiden‘ Bildern kodierten Vorstellungen miteinander verbinden. Dadurch erweiterte sich das Spektrum der möglichen Assoziationen erheblich: Die Vorstellung der nie endenden Sehnsucht nach dem Geliebten und auf ein eventuelles Wiederfinden von ihm schliesst den Wunsch nach dionysischem Rausch ebenso wenig aus wie den nach bukolischem Glück. Die Attribute des Totenlobes können sich ebenso akkumulieren wie die Wünsche und Hoff-
202
Paul Zanker
Abb. 9: Wandmalerei aus dem Arcosolgrab der Vibia, Eintritt ins Elysium, um 350 n. Chr. Rom, Vibia-Katakombe.
nungen. Das gilt auch für die prospektiven Wünsche und Hoffnungen für und auf eine jenseitige Existenz und für die rückblickenden Versicherungen von Liebe und glücklichem Leben. Prospektive Hoffnungen und retrospektive Versicherungen können nebeneinander in ein und demselben Gemüt aufgerufen und als allegorischer Sinngehalt erfahren werden. Im anthropologischen Vergleich würde man dieses Nebeneinander immer wiederfinden. Es ist auch in unseren Gesellschaften, unabhängig von den Glaubensbekenntnissen, weit verbreitet. So betrachtet könnte man die Reliefbilder mit guten Gedichten vergleichen, deren Wörter im Leser vielseitige Vorstellungen aufrufen können, Vorstellungen, die sich je nach Leser und bei wiederholter Lektüre erweitern oder auch verengen können. Dass eine solche Rekonstruktion, wie ich sie hier versucht habe, allenfalls in Umrissen möglich ist (und natürlich auch viel Selbstverständliches zur Sprache bringt), liegt auf der Hand. Denn jeder Betrachter ging beim Anschauen der Bilder und beim Schweifen in Vorstellungen und Gefühlen ja von seiner persönlichen Situation aus. Die Mythenbilder eigneten sich gerade wegen ihres flexiblen Bedeutungsrahmens besonders gut für die Stimulierung von vielfältigen und auch gegensätzlichen Vorstellungen und Sinnbezügen. Die alte Streitfrage, ob der eine oder andere Mythos auf Hoffnungen nach einem Leben nach dem Tode verweist oder nicht, kann nicht entschieden werden. Aber sie verliert bei meinen Überlegungen ihre Bedeutung, wird also eher an den Rand gedrängt. Es ist eine Vorstellung, die mit vielen anderen gleichzeitig aufgerufen werden und in ein und demselben Betrachter wirksam werden konnte. Der Grund dafür ist, dass alle Assoziationen sich auf irdische Erfahrungen, Freuden und Schmerzen beziehen müssen. Dafür zeige ich als abschliessendes Beispiel ein Fresko, das sich in
Bilder lesen ohne Texte
203
einem Arcosolgrab der Vibia-Katakombe in Rom befindet (Abb. 9)19. Die verstorbene Vibia wird hier von einem Angelus Bonus zu den Bonorum iudicio iudicati im Jenseits geführt. Und sie findet diese in fröhlichem Zusammensein beim Essen und Trinken auf einer Wiese liegen – nicht anders als es ihre Verwandten tun, die sich an den Totengedenktagen an ihrem Grab oder in ihrem Grabgarten zu fröhlichem Zusammensein versammeln.
Literaturverzeichnis Amedick (1991): Rita Amedick, Die Sarkophage mit Darstellungen aus dem Menschenleben. Vita privata. Die antiken Sarkophagreliefs I.4, Berlin. Elsner (2007): Jas Elsner, „Viewing Ariadne: From Ekphrasis to Wall Painting“, Classical Philology 102, 20–44. Koch u. Sichtermann (1982): Guntram Koch u. Hellmut Sichtermann, Römische Sarkophage, München. Lattimore (1942): Richmond Lattimore, Themes in Greek and Latin Epitaphs, Urbana/Illinois. Koortbojian (1995): Michael Koortbojian, Myth, Meaning and Memory on Roman Sarcophagi, Berkeley. Sichtermann (1992): Hellmut Sichtermann, Die mythologischen Sarkophage. Apollon, Ares, Bellerophon, Daidalos, Endymion, Ganymed, Giganten, Grazien. Antike Sarkophagreliefs XII.2, Berlin. Østergaard (1996): Jan Stubbe Østergaard, Catalogue Imperial Rome. Ny Carlsberg Glyptotek, Kopenhagen. Wrede (1977): Henning Wrede, „Stadtrömische Monumente, Urnen und Sarkophage des Klinentypus“, Archäologischer Anzeiger 1977, 395–431. Zanker u. Ewald (2004): Paul Zanker u. Björn Christian Ewald, Mit Mythen leben. Die Bilderwelt der römischen Sarkophage, München.
Abbildungsnachweise Abb. 1 Abb. 2 Abb. 3 Abb. 4 Abb. 5 Abb. 6 Abb. 7 Abb. 8 Abb. 9
Zanker u. Ewald (2004) 108 Abb. 91 Zanker u. Ewald (2004) 109 Abb. 92 Zanker u. Ewald (2004) 25 Abb. 17 Zanker u. Ewald (2004) 202 Abb. 182 Zanker u. Ewald (2004) 55 Abb. 37 Sichtermann (1992) 114 Nr. 51 Zanker u. Ewald (2004) 105 Abb. 89 Zanker u. Ewald (2004) 165 Abb. 151 Zanker u. Ewald (2004) 176 Abb. 160
19 Zanker u. Ewald (2004) 176 Abb. 160; Amedick (1991) 3.
204
Luca Giuliani
Luca Giuliani
Mythen- versus Lebensbilder? Vom begrenzten Gebrauchswert einer beliebten Opposition Wenn man sich mit der Ikonographie griechischer Mythen befassen will, liegt es nahe, in einem ersten Schritt zu unterscheiden zwischen Bildern, die sich auf Erzählungen des Mythos beziehen, und anderen, für die ein solcher Bezug nicht gilt: um überhaupt zu entscheiden, wovon man handeln will und wovon nicht. In diesem Sinn werden in unserer Disziplin häufig Mythenbilder und Lebensbilder einander gegenübergestellt; das geschieht meist mit einer gewissen Selbstverständlichkeit und ohne der Unterscheidung selbst weitere Aufmerksamkeit zukommen zu lassen1. Aber gerade wenn wir antike Ikonographie als historische Quelle verwenden möchten, sollten wir vielleicht doch prüfen, ob die Unterscheidung der historischen Spezifizität antiker Ikonographie gerecht wird. Vor allem aber sollten wir klären, worauf diese Unterscheidung primär zielt. Es ist eine Sache, bei einem Bild zu fragen, ob es auf den Zusammenhang einer mythischen Erzählung verweist oder nicht: Daraus ergeben sich keine nennenswerten Probleme. Es ist aber eine ganz andere Sache, die Frage so zu formulieren, dass dabei Mythenbilder und Lebensbilder als entgegengesetzte Gattungen ins Spiel kommen. Wenn es sich um Gattungen handelt, müssen sie sich auch durch entsprechende Gattungsmerkmale unterscheiden. In diesem Sinn pflegt man Mythenbilder auf Begebenheiten einer längst verflossenen Vergangenheit, die man allenfalls vom Hörensagen kennt, Lebensbilder hingegen auf den unmittelbar gegebenen, gegenwärtigen Erfahrungshorizont zu beziehen; daraus resultiert auch ein unterschiedlicher ontologischer Status: Mythen werden in z.T. widersprüchlichen Varianten überliefert; an ihrem Wahrheitsgehalt kann man im Einzelfall, aber auch im Allgemeinen durchaus zweifeln; an der Realität der Lebenswelt gibt es hingegen keinerlei Zweifel: Sie ist Gegenstand der allgemeinen, sich Tag für Tag immer wieder bestätigenden Erfahrung.
1 Bereits Fittschen (1969) setzt den Sagenbildern die „Lebensbilder“ gegenüber – in Anführungszeichen, aber ohne auf die Terminologie weiter einzugehen (18 und passim); faktisch gelten ihm all jene figürlichen Darstellungen, die nicht auf eine mythische Erzählung verweisen, eo ipso als Lebensbilder: ein rein negatives Kriterium. Eine positive Definition versucht Junker (2005) 54, der dafür Husserl bemüht: „Der Begriff „Lebenswelt“ […] hat sich in jüngerer Zeit als Sammelbezeichnung für den Gesamtbereich der sinnlich erfahrbaren Welt eingebürgert, d.h. für alle Erscheinungen, die wir in unserer Umwelt wahrnehmen können, im Gegensatz zur mythischen Welt mit ihren nur vorgestellten Personen, Orten und Ereignissen.“ Ein Lebensbild bezieht sich also auf das, was (jederzeit und überall?) sinnlich erfahren werden kann, ein Mythenbild hingegen auf etwas, das bloß vorgestellt ist. Ähnlich auch Junker (2003) 30f. Für eine skeptischere Problematisierung der Unterscheidung von Alltag- bzw. Genrebildern und Mythenbildern vgl. Zinserling (1977) 39–56, v.a. 43–44, 46–49; Ba}ant (1981) 13–16; Ferrari (2003) 37–54.
Mythen- versus Lebensbilder?
205
Diese Gegenüberstellung von Mythenbildern und Lebensbildern als zweier unterschiedlich konnotierter Bilder-Gattungen ist ganz offenkundig beeinflusst durch die Unterscheidung von Historien- und Genremalerei, die seit der Mitte des 19. Jahrhunderts zum selbstverständlichen begrifflichen Instrumentarium der Kunstgeschichte gehört. Die begrifflichen Gegensatzpaare ähneln sich – aber ähneln sich auch die dadurch bezeichneten, konkreten Phänomene? Es scheint sinnvoll, mit einem kurzen Blick auf die Geschichte dieser Gegenüberstellung in der Kunstgeschichte zu beginnen. In der italienischen Malerei des späten 16. Jahrhunderts kommen (zunächst vereinzelt) Bilder auf, die sich vom Sujet her weder als Historienbilder noch als Porträts bezeichnen lassen; ich verweise auf zwei berühmte Beispiele: Carraccis Bohnenesser (1583 gemalt) und Caravaggios Wahrsagerin (1594). Typisch an beiden Gemälden ist, dass sie mit scharfer Aufmerksamkeit auf Angehörige der unteren Gesellschaftsschichten und auf Episoden blicken, die bis dahin als nicht bildwürdig gegolten hatten. Ein adäquater Begriff für diese Gattung ist mit bemerkenswerter Verspätung, nämlich erst im 18. Jahrhundert gefunden worden: Diderot verwendet in seinem Essai sur la peinture von 1766 erstmals die Gegenüberstellung von „peintre d’histoire“ und „peintre de genre“2. Damit war das fünfgliedrige hierarchische System malerischer Gattungen vollständig; in der Reihe abnehmenden Prestiges: Historie, Porträt, Genre, Landschaft und Stillleben. Die Implikationen dieses Prestigegefälles veranschaulicht eine Episode, die sich gegen Ende der 1760er Jahre in Paris abspielte3. Der von Diderot hochgeschätzte Maler Jean-Baptiste Greuze war 1755 als junger Mann zum membre agréé der königlichen Académie gewählt worden. Es handelte sich dabei um eine Art Mitgliedschaft auf Bewährung; Greuze erhielt mit ihr auch das Recht, seine Gemälde künftig in den jährlichen Ausstellungen der Akademiemitglieder zu präsentieren; freilich erwarteten diese noch die Einreichung eines offiziellen Antrittsbildes; damit aber ließ Greuze sich ungewöhnlich lange Zeit – bis ihm die Académie 1769 ein Ultimatum stellte. Daraufhin reichte Greuze endlich sein Gemälde ein. Es handelte sich um ein klassisches Historienbild (Abb. 1): Dargestellt ist Kaiser Septimius Severus in seinem Bett, aus dem er sich eben aufgerichtet zu haben scheint; mit einer Hand weist er auf ein gezücktes Schwert, das neben ihm auf einem Tischchen liegt; die andere Hand richtet er mit matter Gebärde auf seinen Sohn Caracalla, der sich am Fuß des Bettes mit betroffener Miene vom Vater abwendet, während auf der anderen Seite zwei ältere Militärs sorgenvoll tuscheln. Der lange, explikative Titel lautet: Septime Sevère reproche à Caracalla son fils d’avoir voulu l’assassiner dans les défilés d’Écosse, et lui dit: „Si tu désires ma mort, ordonne à Papinien de me la donner avec cette épée …“. Das bezieht sich auf eine Episode, die in der Römischen Ge-
2 Gaehtgens (2002) 281–288. 3 Seznec (1966); Brookner (1971) 65–70; Arasse (1986).
206
Luca Giuliani
Abb. 1: Jean-Baptiste Greuze, L’empereur Sevère reproche à Caracalla son fils d’avoir voulu l’assassiner, 1769. Paris, Louvre.
schichte des Dio Cassius nachzulesen ist4. Caracalla hatte einen halbherzigen, erfolglosen Anschlag auf das Leben seines Vaters unternommen; daraufhin rief Septimius – so Dio – Caracalla zusammen mit Papinian, dem Kommandanten der Prätorianergarde, und einem weiteren Offizier zu sich; er befahl, ein Schwert bereit zu stellen, und wandte sich dann offen an Caracalla: Nun, wenn du mich tatsächlich beseitigen willst, so tu es hier an Ort und Stelle! Denn du stehst in der Kraft der Jahre, während ich ein alter Mann bin und darniederliege. Wenn du vor solcher Tat nicht zurückschreckst, sondern Bedenken trägst, mir eigenhändig das Leben zu nehmen, so steht der Präfekt Papinianus an deiner Seite, und dem kannst du den entsprechenden Befehl erteilen, daß er mir den Garaus macht! Denn er wird ganz bestimmt jede Anordnung von dir ausführen, da du doch wirklich Kaiser bist.5
4 Cass. Dio 77,14,4–7. 5 „(5) … ‚$ll# eúge $posfˇjai me ãpiùymeÖ«,‘ (6) ãntaÜùˇ me katˇxrhsai: örrvsai gˇr, ãgø dÍ kaÏ gwrvn eåmÏ kaÏ keÖmai. Ñ« eúge toÜto mÍn o\k $nad÷>, tÌ dÍ a\tfixeir moy genwsùai çkneÖ«, parwsthkw soi PapinianÌ« Ç öparxo«, ˚ d÷nasai keleÜsai ¬na me ãjergˇshtai: pˇntv« gˇr poy p»n tÌ keleysùÍn ÉpÌ soÜ, ´te kaÏ a\tokrˇtoro«’“, Cass. Dio 77,14,5–6; Übersetzung: Veh (2007) Bd. V, 378.
Mythen- versus Lebensbilder?
207
Abb. 2: Jean-Baptiste Greuze, La mère bien-aimée, 1769. Madrid, Slg. Laborde.
Der ausführliche Titel rechnet mit einem Betrachter, der diese (etwas entlegene) Passage nicht unbedingt im Kopf hat, und fasst deshalb das Wesentliche zusammen; ohne diese Hilfe dürfte es unmöglich sein, die dargestellte Szene zu verstehen. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass das Gemälde vorwiegend auf Kritik stieß. Tatsächlich war Greuze ja auch für eine ganz andere Sorte von Bildern berühmt. Ein gutes Beispiel dafür ist ein im selben Jahr gemaltes Gemälde mit dem Titel La mère bienaimée caressée par ses enfants (Abb. 2)6: Ein Mann kehrt heim von der Jagd und bleibt, kaum dass er in die Stube getreten ist, zutiefst gerührt mit offenen Armen stehen; vor ihm sitzt seine Frau, die dem jüngsten Kind gerade noch die Brust gegeben hat; nunmehr gesättigt, klettert der Kleine an ihr empor um sie zu küssen; aber auch die fünf Älteren schmiegen sich auf der Suche nach Körperkontakt an die Mutter; zwei streiten gerade um ihre rechte Hand; die Mutter selbst, von so viel Liebe überwältigt, lässt in vollständiger Gelöstheit alles mit sich geschehen und wendet die Augen zum Himmel: eine höchst anmutige, aber zugleich unübersehbar anzügliche Erscheinung. Zwischen diesen beiden Bildern dürften die Zeitgenossen einen beträchtlichen Qualitätsunterschied empfunden haben. Die Reaktion der Akademiker auf das von Greuze
6 Barker (2005) 90–112.
208
Luca Giuliani
eingereichte Historienbild war dementsprechend eindeutig: Greuze wurde mitgeteilt, dass die Académie ihn als Mitglied anerkenne, aber nicht als peintre d’histoire, sondern als peintre de genre – eine Bezeichnung, die im Zusammenhang der Académie bis dahin nie verwendet worden war. Greuze fühlte sich herabgestuft und vor den Kopf gestoßen. Nach der geläufigen Definition unterscheiden sich Historienbild und Genremalerei durch ihre Sujets: Während die Themen der Historienmalerei aus der Geschichte, der Mythologie oder der religiösen Überlieferung stammen (wodurch zugleich ihre Abhängigkeit von Texten impliziert ist), werden in Genrebildern „keine heroischen Taten und historischen Ereignisse, keine bekannten und bedeutenden Persönlichkeiten, sondern anonyme […] Figuren in ihrem individuellen Lebensbereich […] dargestellt“7. Darüber hinaus wird man in unserem Fall sagen können: Das Historienbild spielt in der fernen Vergangenheit, das Genrebild in der Gegenwart; der Wahrheitsgehalt des Historienbildes wird durch einen Text beglaubigt, auf den es implizit verweist; das Genrebild hingegen bezieht sich unmittelbar auf eine Lebenssphäre, die uns allen gemeinsam ist und in ihrer Allgemeingültigkeit anonym bleibt. Bei La mère bienaimée wäre es unsinnig, nach den Namen der dargestellten Personen zu fragen: Im Spiegel zeitgenössischer Bürgerlichkeit wird eine vermeintlich überzeitliche, schlechterdings menschliche Konstellation vor Augen geführt, das ewig Männliche und das ewig Weibliche. Die Frage ist nun: Gibt es im Horizont der antiken Ikonographie eine ähnliche Opposition zwischen Mythen- und Lebensbildern wie die zwischen Historien- und Genrebilder in der Neuzeit? Genau das möchte ich bezweifeln. In der Neuzeit war die Historienmalerei die ältere und herkömmliche Bildergattung, von der sich die Genrebilder ganz bewusst absetzten, indem sie einen ganz neuen thematischen Horizont erschlossen; Adressaten solcher Bilder waren private Sammler, die im späten 16. Jahrhundert die ersten Bildergalerien zusammenstellten: ein neues Publikum, das sich damals überhaupt erst herausbildete. Wenn wir Historien- und Genrebilder als unterschiedliche Gattungen betrachten, so entspricht dies den Absichten und Verständnis sowohl der Maler als auch ihres Publikums. In der Antike verhält es sich gewissermaßen umgekehrt: Die frühesten Figurenbilder in der geometrischen Vasenmalerei weisen keinerlei Bezug zu narrativen Texten auf: Sie führen ein bestimmtes Wissen über die Welt vor Augen, zeigen in deskriptiv-normativer Absicht Facetten der Welt, wie sie ist bzw. zu sein hat. Narrative Mythenbilder kommen wahrscheinlich erst um die Wende vom 8. zum 7. Jahrhundert auf, sind demnach ein jüngeres Phänomen und bleiben auch danach quantitativ in der Minderheit. Dazu kommt der Umstand, dass narrative und nicht-narrative Ikonographie sowohl in der Form wie auch im Inhalt einander außerordentlich nahe stehen: Oft besteht der einzige Unterschied darin, dass in narrativen Bildern den han-
7 Gaehtgens (2002) 13.
Mythen- versus Lebensbilder?
209
delnden Figuren Namen beigeschrieben sind, die auf die mythologische Tradition verweisen. Wenn die Ähnlichkeiten aber schwerer wiegen als die Unterschiede, scheint es mir nicht hilfreich, unterschiedliche Gattungen ins Spiel zu bringen. Vor allem aber: Die binäre Gegenüberstellung von Mythenbildern und Lebensbildern schafft eine enge Verknüpfung zwischen Unterscheidungen, die auf drei ganz unterschiedlichen Ebenen angesiedelt sind und in logischer Hinsicht nichts miteinander zu tun haben. Da gibt es erstens die Unterscheidung zwischen einem narrativen und einem nicht-narrativen Modus der Darstellung; zweitens die Unterscheidung zwischen Themen der Vergangenheit und Themen der Gegenwart; und drittens die Unterscheidung zwischen fiktiven und realen Gegenständen. Wenn wir Lebensbilder als nicht narrative Darstellungen bezeichnen, die auf reale Gegenstände der gegenwärtigen Lebenswelt bezogen sind, dann werden bei dieser Definition alle drei genannten Unterscheidungen einer willkürlichen Gleichschaltung unterworfen. Das kann zu erheblichen Problemen führen. Dafür zwei Beispiele. Auf einer ganzen Reihe von geometrischen Vasen finden wir Darstellungen von Kentauren8. Der ontologische Status von Kentauren ist in unserem Weltbild ganz eindeutig. Aber liefert der Umstand, dass in zoologischen Gärten keine Kentauren zu besichtigen sind, einen ausreichenden Grund dafür, antike Bilder von Kentauren als phantastisch und ergo als Mythenbilder zu bezeichnen? Oder möchten wir etwa die Darstellung eines Engels auf einem mittelalterlichen Andachtsbild als ein Sagenbild bezeichnen, nur weil wir zufällig nicht mehr an Engel glauben? Wir sollten uns davor hüten, unsere Vorstellungen über das, was real bzw. nicht real ist, ohne weiteres zum allgemeinen Maßstab zu erheben. Wir wissen schlicht nicht, ob ein Betrachter des 8. Jahrhunderts es wirklich ausgeschlossen hätte, in der Wildnis an einem entlegenen Ort je einem Kentauren begegnen zu können. Was wir aber nicht wissen können, sollte auch nicht zur methodischen Grundlage einer Bilderhermeneutik gemacht werden. Das zweite Beispiel betrifft die jüngste Diskussion um die attischen Löwenbilder des 8. Jahrhunderts9. Zwar sind Löwen, anders als Kentauren, durchaus in zoologischen Gärten zu besichtigen. Dennoch dürfte es im 8. Jahrhundert in Mittelgriechenland mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keine Löwen mehr gegeben haben. Daraus hat man gefolgert, dass Löwen, wenn sie auf attischen Vasenbildern dieser Zeit erscheinen, nicht als reale, sondern als imaginäre Wesen zu gelten haben; die entsprechenden Darstellungen könnten dann, da sie sich nicht auf die Realität beziehen, keine Lebensbilder sein, sondern „stellen sich in die nächste Nähe der Mythenbilder: Vom legendären Raubtier zum riesenhaften Poly-
8 LIMC VIII, 674–682 s.v. Kentauroi 3 und 6; 81–83; 92–93; 110–112; 127; in keinem Fall erscheinen die Kentauren in eine Interaktion verwickelt, die plausiblerweise Gegenstand einer mythischen Erzählung werden könnte. 9 Junker (2009) 65–76, hier v.a. 67–68.
210
Luca Giuliani
phem ist es nur ein kleiner Schritt. Es sind gleichsam Proto-Mythenbilder, um die es hier geht“10. Die Schlussfolgerung ist indessen ebenso wenig befriedigend wie bei den Kentauren. Natürlich können wir den Löwen, da er nicht zu der mittelgriechischen Fauna gehört, als ein Produkt der Phantasie bezeichnen. Aber rückt er deswegen in die Nähe des Mythos? Was Polyphem zu einer Figur des Mythos macht, ist nicht etwa die Tatsache, dass es in der Mittelmeerwelt in der Antike keine einäugigen Riesen gegeben hat, sondern schlicht der Umstand, dass Polyphem Gegenstand einer Geschichte ist (ebenso wie auch sein Widder und seine Schafe: ungeachtet des Umstands, dass Widder und Schafe sehr wohl zur griechischen Alltagswirklichkeit dieser Zeit gehören). In Bezug auf die Löwenbilder muss man zwischen zwei Ebenen der Fragestellung deutlich unterscheiden: das eine Mal geht es um den ontologischen Status von Löwen, das andere Mal um den Modus der Darstellung. Auf der ersten Ebene stellt sich die Frage, ob Löwen im 8. Jahrhundert zum Gegenstand realer Erfahrung gehörten oder nicht, und ob die Zeitgenossen sie als reale Wesen betrachteten oder nicht. Auf der zweiten Ebene hingegen fragen wir, ob sich bei einem gegebenen Bild der Verweis auf eine Erzählung plausibel machen lässt; wenn ja, dann handelt es sich um ein Mythenbild, tout court, und man braucht der Bezeichnung dann auch kein kautelatives Präfix („Proto“) vorzuschalten; oder aber es gibt keinen narrativen Zusammenhang, und dann sollten wir die Bezeichnung „Mythenbild“ lieber vermeiden. Hilfreich ist ein Blick auf die epische Dichtung. Die Rückschlüsse, die sich daraus ergeben, betreffen sowohl den ontologischen Status der Löwen als auch den Modus der Darstellung. Erstens: Löwen kommen im Rahmen der homerischen Gleichnisse vor (häufig in der Ilias, seltener in der Odyssee); da in den Gleichnissen ausschließlich Elemente der realen Welt angeführt werden, wird man auch den Löwen als Element dieser Realität betrachten müssen; schließlich geht das, was in einer Kultur als real betrachtet wird, weit über deren Horizont des Alltäglichen hinaus. Zweitens: In beiden Epen kommen Löwen interessanterweise nur in den Gleichnissen vor, und nicht im erzählerischen Hauptteil; sie sind nicht Gegenstand von Geschichten, und damit auch keine Figuren des betreffenden Mythos. Das gilt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch für die Löwenbilder auf attischen geometrischen Vasen: Diese liefern uns eine Beschreibung der Welt, ohne auf eine Erzählung zu verweisen; es handelt sich also gerade nicht um Mythenbilder. Die begriffliche Opposition „Mythen- versus Lebens-Bilder“ ist demnach mit Vorsicht zu verwenden. Ich habe deshalb vorgeschlagen, sie zu ersetzen durch die Unterscheidung zwischen einem deskriptiven und einem narrativen Darstellungsmodus11:
10 Junker (2009) 68; vgl. auch 71: „[Ü]berall sonst Lebensweltliches von mehr oder minder dokumentarischem Charakter, hier dagegen etwas nur Gedachtes und für die Griechen im Grunde genommen Phantastisches“. 11 Giuliani (2003) 22–23, 36–37, 40–46, 74–75, 281–286. Es liegt auf der Hand, dass diese Unterscheidung – wie jede andere auch – keinen Selbstzweck darstellt, sondern einem bestimmten Erkenntnis-
Mythen- versus Lebensbilder?
211
Der deskriptive Modus strebt nach einer Wiedergabe der Welt, wie wir sie kennen, wie sie ist oder sein sollte. Der narrative Modus führt etwas vor Augen, was vom üblichen Gang der Welt abweicht, insofern Erstaunen hervorruft und einer Erklärung bedarf; diese Erklärung wird durch eine Geschichte gegeben; wichtig ist dabei, dass die Geschichte vom narrativen Bild selbst nicht mitgeliefert wird, denn das Bild ist als solches sprachlos: Es bedarf einer Geschichte, die es nicht selbst erzählen kann; das Erzählen ist Sache des Betrachters. Das Bild liefert lediglich gewisse Schlüsselelemente, die es dem Betrachter erlauben, die passende Geschichte überhaupt zu identifizieren – und das ist wiederum nur möglich, wenn er die Geschichte bereits kennt. Narrative Bilder setzen somit bekannte Geschichten voraus. Bleiben wir zunächst bei der Löwenikonographie. Auf den vier Füßen eines attisch-geometrischen Kesseluntersatzes sind vier behelmte Krieger dargestellt12: Zwei von ihnen halten ein junges Kalb im Arm und beschützen es vor dem Angriff eines Löwen; die anderen zwei Krieger gehen mit Waffen gegen einen Löwen vor. Verweisen diese Bilder auf Geschichten? In der griechischen Mythologie, so wie sie uns überliefert ist, gibt es nur einen einzigen Löwenbezwinger, und das ist Herakles. Zu ihm passen allerdings die Bilder auf dem Kesseluntersatz schlecht: Erstens ist Herakles ein Monster-Killer; die Fürsorge für ein Kalb passt schlecht zu seinem Charakter; zweitens ist für ihn bezeichnend, dass er seinen Löwen ohne Waffen zur Strecke bringt. Es gibt unter den Erzählungen der griechischen Mythologie keine, die ohne weiteres auf die Bilder am Kesseluntersatz passen würde13. Was also hat der Maler gemeint? Der Löwe ist für ihn (wie für den epischen Dichter der Ilias und Odyssee) das gefährlichste und stärkste aller Raubtiere; insofern stellt er die größte denkbare Bedrohung und die ultimative Bewährungsprobe für aristokratischen Kriegermut dar. Dementsprechend spielt der Löwe, so wenig er in Mittelgriechenland zum Alltag gehört, im griechischen Weltbild dieser Zeit eine unverzichtbare Rolle. Die Bilder auf dem Untersatz gehören in den Umkreis einer kriegerisch-aristokratischen Viehzüchkterkultur, in der Krieger und Hirte keine Gegensätze, sondern zwei Facetten ein und derselben Figur sind; sie zeigen keine spezifische Geschichte, sondern den Kampf eines aristokratischen Jedermanns gegen jeden beliebigen Löwen, so wie er sich überall (wo es Löwen gibt) und zu jeder Zeit abspielen kann; sie sind deskriptiv und nicht narrativ zu verstehen.
interesse dient und einen bestimmten Fragehorizont voraussetzt: Mir ging (und geht) es um die Klärung der spezifischen Probleme jener Ikonographie, die den Betrachter auf sprachlich vorgeformte Erzählungen verweist. Wenn man sich (was vollkommen legitim ist) für diese Probleme nicht interessiert, wird man auch der Unterscheidung kaum großen heuristischen Wert abgewinnen. 12 Athen, Kerameikos-Museum, Inv.407: Hurwit (1985) 113–119; Giuliani (2003) 47–52. 13 Natürlich könnte man annehmen, dass die literarische Überlieferung lückenhaft sei, und dass der Ständer sich auf eine Heldengeschichte beziehe, die uns nicht überliefert ist. Das ist in der Tat nicht auszuschließen, hat aber den Nachteil, das es zu einem zirkulären Verfahren führt: Wir erklären das Bild durch eine Geschichte, für die das Bild selbst unser einziges Zeugnis ist; methodisch ist das kaum zu empfehlen.
212
Luca Giuliani
Abb. 3: Attisch-schwarzfiguriger Kelchkrater aus Athen, Seite B: Kampf um Patroklos, um 530 v. Chr. Athen, Agora-Museum, Inv. AP 1044.
Etwa ein Jahrhundert später kommen Bilder auf, die sich deutlich davon unterscheiden: Sie zeigen einen Helden, der mit bloßen Händen einen Löwen würgt14. Genau das aber ist ein singuläres, auffälliges und erklärungsbedürftiges Merkmal: Denn so ist die Welt auch nach archaischem Verständnis eben nicht beschaffen, dass Menschen mit Löwen ringen; Ringkampf ist eines, und Löwenjagd etwas anderes. Es ist genau diese Abweichung vom normalen Gang der Welt, die nach einer Erklärung verlangt; und um diese zu liefern, muss man die entsprechende Geschichte kennen.
14 LIMC 5, 16–33 s.v. Herakles 1762–1922.
Mythen- versus Lebensbilder?
213
Abb. 4: Attisch-schwarzfiguriger Kelchkrater aus Pharsalos, Seite A: Kampf um einen Gefallenen, um 530 v. Chr. Athen, Nationalmuseum, Inv. 26746.
Man muss wissen, dass es in der Gegend von Nemea einen Löwen mit einem unverwundbaren Fell gab, das keine Waffe zu durchdringen vermochte15; Herakles bezwang ihn, indem er ihm ohne Waffen gegenübertrat und ihn, ohne sein Fell zu verletzen, mit bloßen Händen erwürgte. Narrative Bilder verweisen wortlos auf eine Geschichte, die der Betrachter kennen muss, weil ihm sonst der Schlüssel zu ihrem Verständnis fehlt. Wenden wir uns nun einigen Darstellungen kämpfender Hopliten zu: einem Thema, das in der Vasenmalerei archaischer und klassischer Zeit besonders reich vertreten ist. Ich beginne mit drei Vasen von der Hand oder aus dem Umkreis des Exekias, auf denen der Kampf um die Leiche eines Gefallenen dargestellt ist. Auf einem
15 Die Unverwundbarkeit des Löwen ist ein entscheidender Ausgangspunkt für die Geschichte, wird in der Ikonographie aber nur selten explizit zum Thema gemacht; vgl. indessen eine Amphora von Ende des 6. Jhs. in Rom, Museo di Villa Giulia, wo unterhalb der Ringergruppe von Herakles und dem Löwen ein verbogenes Schwert am Boden liegt: LIMC 5, 25 s.v. Herakles 1882.
214
Luca Giuliani
Kelchkrater (Abb. 3), der am Nordhang der Athener Akropolis gefunden wurde16, treten zweimal drei Krieger gegeneinander an; es haben sich insgesamt drei Namensbeischriften erhalten: bei der Gruppe rechts ist der Vorkämpfer als Hektor, bei der Gruppe links der hinterste Krieger als Diomedes benannt; oberhalb vom Kopf des Gefallenen steht [P]a[tr]oklos; die anderen Namensbeischriften sind verloren, aber das Erhaltene genügt, um eine ganz bestimmte Geschichte ins Spiel zu bringen: Dargestellt ist offenkundig der Kampf um den Leichnam des Patroklos, wie er auch im 17. Buch der Ilias geschildert wird; zwar stimmen die Namen der Protagonisten nicht vollständig überein: In der Ilias werden unter den Achäern vor allem der große und der kleine Aias sowie Menelaos und Idomeneus genannt; Diomedes kommt in diesem Zusammenhang nicht vor; aber man wird von Exekias kaum erwarten dürfen, dass er die entsprechenden Verse auswendig konnte – und noch viel weniger, dass er zu einer schriftlichen Fassung des Textes Zugang gehabt hätte. Ein weiterer Kelchkrater aus derselben Werkstatt stammt aus Pharsalos in Thessalien (Abb. 4)17 und ist mit dem Athener Krater eng verwandt: Wieder kämpfen zweimal drei Krieger gegeneinander, aber der Maler hat diesmal keine Namensbeischriften verwendet. Sollte man trotzdem davon ausgehen, dass auch hier der Kampf um den toten Patroklos dargestellt sei? Ein solcher Schluss wäre voreilig. Nehmen wir als drittes Beispiel die Henkelbilder der Münchner Exekias-Schale (Abb. 5 & 6)18: Wieder haben wir jeweils zwei Gruppen von drei Kriegern, und es gibt keine beigeschriebenen Namen. In diesem Fall ist eine Beziehung zum Patroklos-Kampf allerdings ganz unwahrscheinlich: Von den beiden Gefallenen liegt einer auf dem Rükken und ist nackt (d.h. seiner Waffen beraubt), der andere hingegen ist bewaffnet und liegt auf dem Bauch. Die Henkelbilder führen demnach die (sehr beschränkte) Vielfalt der grundsätzlichen Möglichkeiten vor Augen; es wird keine spezifische Geschichte erzählt19; vielmehr werden Variationen innerhalb eines gemeinsamen Grundmusters vorgeführt; dieses Muster bezeichnet eine allgemeine Kampfsituation, wie sie sich überall und zu jeder Zeit ereignen kann. So ist die Welt beschaffen, so führen Männer Krieg, indem sie miteinander um die Gefallenen kämpfen.
16 Athen, Agora-Museum, AP 1044: ABV 145,19 („Exekias“): A: Wagengespann der Athena mit Herakles; dabei stehen Apollon, Artemis, Poseidon, Aphrodite (?) und Hermes; B: Kampf um Patroklos; Para 60; Add2 40; Broneer (1937) 469–586; Broneer (1956) 345–349; Moore (1986) 35–39; Knittelmayer (1997) Taf. 11,3; Mackay (2010) 354–357. 17 Athen, Nationalmuseum, Inv.26746: ABV 148,9 („Manner of Exekias“): A: Kampf um einen gefallenen Krieger; B: Viergespann in Vorderansicht; Para 62,518; Add2 41; Verdelis (1952) 96–116; Broneer (1956) 345–349 mit Taf. 51 Abb. d; Mackay (1988) 369–378, v.a. 373–76 mit Abb. 5. 18 München, Antikensammlungen, Inv.8729 = J339; ABV 146,21 („Exekias“); Para 60; Fellmann (2004) Taf.1–3; Mackay (2010) 221–241. 19 Anders Mackay (2010) 226–230, die das Henkelbild B-A auf den Kampf um Patroklos, das Bild A-B hingegen auf den Kampf um Sarpedon deuten möchte; ich kann ihre Argumente nicht nachvollziehen.
Mythen- versus Lebensbilder?
215
Abb. 5–6: Attisch-schwarzfigurige Schale des Exekias, Henkel A-B und B-A: Kampf um Gefallene, um 540 v. Chr. München, Antikensammlungen, Inv. 8729.
216
Luca Giuliani
Im selben Licht haben wir wohl auch das Bild auf dem Pharsalos-Krater zu verstehen (Abb. 4). Es empfiehlt sich, Namensbeischriften ernst zu nehmen: nicht nur, wenn sie vorhanden sind, sondern auch, wenn sie fehlen, und das heißt: vom Maler vermieden worden sind. In einem solchen Fall, und wenn es keine weiteren Argumente für eine Benennung gibt, ist es ein gutes methodisches Prinzip, die Figuren im Zustand der Anonymität zu belassen. Das gilt für den Pharsalos-Krater ebenso wie für die Henkelbilder der Münchner Schale: Sie führen namenlose Krieger in einer allgemeinen Kampfsituation vor Augen, ohne irgendeinen Verweis auf einen spezifischen narrativen Zusammenhang. Ich bezeichne solche Bilder als deskriptiv. Rückblickend kann man feststellen, dass auch der Athenische Krater vom Akropolis-Abhang (Abb. 3) in seiner Grundstruktur dem deskriptiven Modus entspricht; das einzige, was davon abweicht, sind die Namensbeischriften. Genau diese aber implizieren eine Frage, die den Betrachter auf einen narrativen Zusammenhang rekurrieren lässt. Wer ist Patroklos, um dessen Leiche da gekämpft wird? Wenn man diese Frage beantworten will, muss man zwangsläufig eine Geschichte erzählen. Die Bilder, in denen zweimal drei Krieger gegeneinander kämpfen, sind eine vergleichsweise seltene Variante: Sehr viel häufiger sind Bilder, die einen Zweikampf zeigen: manchmal über einer Leiche, häufig auch ohne. In vielen Fällen ist einer der beiden Krieger als unterliegender gekennzeichnet. Ein typisches, besonders reiches Beispiel liefert ein Salbgefäß, das etwa eine Generation älter ist als die Exekias-Bilder20. Solche Einzelkämpfe zwischen Kriegern, die oft mit erhobener Lanze zum Wurf ausholen, entsprechen sehr genau den Kampfbeschreibungen in der Ilias. Mit der zu jener Zeit aktuellen Kampfweise, bei der die Kämpfer sich zur einheitlichen Phalanx formierten und mit gesenkter Lanze zustießen, haben solche Bilder nicht viel zu tun. Man könnte aus der unzeitgemäßen Art des Einzelkampfes schließen, dass hier Krieger einer heroischen Vergangenheit vor Augen geführt würden: vielleicht also doch Figuren des Mythos? Aber bereits die Prämisse, nämlich dass hier Kämpfe der Vergangenheit gemeint sein müssen, erweist sich rasch als verfehlt. Seit dem dritten Jahrzehnt des 5. Jahrhunderts finden sich auf attischen Vasen Bilder von Kämpfen zwischen Griechen und Persern. So führen etwa die Außenbilder einer Schale in New York (Abb. 7 und 8) ein komplexes Geschehen vor Augen, das indessen in Einzelkämpfe aufgelöst erscheint: es gibt keinerlei Versuch, den Einsatz einer Phalanx zu veranschaulichen21. Dennoch, und dieser unzeitgemäßen Darstellungsweise zum Trotz, besteht gar kein Zweifel daran, dass die Bilder der Schale nicht auf die heroische Vergangenheit, sondern auf aktuelle Kriege zu beziehen sind: Das
20 Paris, Louvre, CA 616: ABV 58,122; Para 23; Add2 16; Hölscher (1973) 26 Abb. 2; Muth (2008) 147 Abb. 76. 21 New York, Metropolitan Museum of Art; Inv. 1980.11.21 (ex Rom, Basseggio): ARV2 417,4; Para 373; Add2 234; Hölscher (1973) 38–43 A4; Hölscher (2000) 301–302 Abb. 4; Muth (2008) 248–249 Abb. 163.
Mythen- versus Lebensbilder?
217
Abb. 7–8: Attisch-rotfigurige Schale, Außenbilder A und B: Kämpfe zwischen Griechen und Persern, um 480–470 v. Chr. New York, Metropolitan Museum of Art, Inv. 1980.11.21.
218
Luca Giuliani
Abb. 9–10: Attisch-rotfigurige Schale, Außenbilder A und B: Kampfszenen, um 500–480 v. Chr. Boston, Museum of Fine Arts, Inv. 01.8021.
ergibt sich ganz eindeutig aus der Anwesenheit persischer Kämpfer. Aber wie verhält es sich, wenn dieses Vergegenwärtigungsmerkmal fehlt? Es gibt eine kaum überschaubare Menge ähnlich komponierter Vasenbilder, auf denen Griechen nicht gegen Perser, sondern gegen Griechen kämpfen. Man nehme etwa als beliebiges Beispiel eine etwas ältere Schale in Boston (Abb. 9 und 10)22. Die Ähnlichkeit in der Komposi-
22 Boston, Museum of Fine Arts, 01.8021; ARV2 320,14; Add2 215; Caskey u. Beazley (1954) Taf. 39; Muth (2008) 202–204 Abb. 126.
Mythen- versus Lebensbilder?
219
tionsweise ist augenfällig; als Unterschied könnte man allenfalls den Umstand anführen, dass einige der Kämpfer nackt sind. Aber auch dafür ließen sich in der Ikonographie der Perserkämpfe Parallelelen anführen. Diese Ähnlichkeit legt die Vermutung nahe, dass auch das Bild der Bostoner Schale vom damaligen Betrachter auf die Gegenwart bezogen werden konnte – ohne dass aber dazu eine strikte Notwendigkeit bestanden hätte. Was folgt daraus? Es gibt Kampfbilder, die – durch Namensbeischriften gesichert – eindeutig Episoden des Mythos darstellen. Hier war jedem Betrachter klar, dass die dargestellten Ereignisse sich in einer längst vergangenen Zeit abgespielt hatten. In den meisten Fällen sind es aber nur die Namensbeischriften, die den Bezug zum Mythos sichern: Ansonsten gibt es zwischen mythischen und nicht mythischen Kampfbildern keine signifikanten Unterschiede, weder in der allgemeinen Komposition noch in den Einzelmotiven. Der Schluss scheint mir unausweichlich, dass man auf den Unterschied zwischen mythischer Vergangenheit und aktueller Gegenwart zumindest auf der ikonographischen Ebene keinen großen Wert gelegt hat: Weder hat man die Kämpfe des Mythos als vergangene, noch auch die der Gegenwart als moderne markiert. Wir haben es demnach mit einer Ikonographie zu tun, die keine temporalen Indikatoren verwendet. In den Bildern sind keine Verweise darauf zu finden, wann das Dargestellte stattgefunden hat. Vergangenheit und Gegenwart werden nicht unterschieden, und zwar in doppelter Hinsicht. Erstens: Episoden des Mythos werden, was die Waffen betrifft, ausnahmslos dem gegenwärtigen technologischen Stand angepasst; mythische Krieger tragen Schilde mit exzentrischem Doppelgriff, korinthische Helme, Glockenpanzer und Beinschienen (lauter Waffen, die im späten 8. oder frühen 7. Jahrhundert eingeführt worden sind). Zweitens: Auch dann, wenn sich eine Kampfszene nicht auf den Mythos, sondern auf die Gegenwart bezieht, zeigt sie in aller Regel nicht die für die Gegenwart typische Phalanxtaktik, sondern bleibt dem Einzelkampfschema treu, wie er für die epische Erzählung kanonisch ist. Wir können also eine doppelte, wechselseitige Angleichung feststellen: des Mythos an die Gegenwart und der Gegenwart an den Mythos23. Die Bilder wollen zeigen, wie man Krieg zu führen hat, immer schon, und für alle Zeiten: Sie liefern eine normative Beschreibung. Zwischen Mythos und aktuellem Geschehen besteht eine weitgehende Homologie. Diese wiederum hat zur Konsequenz, dass mythische Heroen und deren Taten paradigmatische Bedeutung haben, dass der Mythos insgesamt immer wieder als Spiegel für die Gegenwart verwendet werden kann (und soll). Die Kampfbilder sind ein extremes Beispiel für die Angleichung von Mythos und Gegenwart. In anderen Fällen ist das Verhältnis komplizierter. Ich beschränke mich auf ein einziges, wiederum berühmtes Beispiel. Auf einer Bauchamphora aus den 30er Jahren des 6. Jahrhunderts im Vatikan ist eine Trauerszene in waldiger Umge-
23 Vgl. Giuliani (2010) 35–55.
220
Luca Giuliani
Abb. 11: Attisch-schwarzfigurige Amphora, Seite A: Eos (?) trauert um ihren gefallenen Sohn, um 540 v. Chr. Vatikan, Museo Gregoriano Etrusco, Inv. 16589.
bung dargestellt (Abb. 11)24: Am Boden liegt der Leichnam eines Kriegers, dessen Waffen ganz links aufgestellt sind; zu Füßen des Toten steht eine trauernde Frau: Mit der Linken greift sie in ihr Haar, während sie sich mit der Rechten einen Zipfel des Mantels vor das Gesicht zieht. Trauer ist allerdings normalerweise ein kollektives, an den Oikos des Verstorbenen gebundenes Ritual: hier wird der Leichnam aufgebahrt und betrauert. Das ist das, was die geläufige Prothesis-Ikonographie uns vor Augen führt25. Die vatikanische Amphora greift einzelne Elemente dieser Ikonographie auf, um sie in ihr Gegenteil zu verkehren: Der Tote liegt nicht auf einer Kline, sondern auf Reisig gebettet; die Trauernde ist nicht Mitglied einer Gemeinschaft, sondern ganz auf sich allein gestellt; das Fehlen der Mittrauernden wird dadurch
24 Vatikan, Museo Gregoriano Etrusco, Inv.16589; Beazley, ABV140,1 („Group E, Painter of the Vatican Mourner“); 686; Paral. 58; Add2 38; Beazley (1928), wieder abgedruckt in: Kurtz (1989) 8: „The man may be Memnon, and Eos, the Dawn, his mother. Eos is usually winged, but Greek artists are ready to wing and unwing at need“; Simon (1981) 88–89, Taf.77; Dietrich (2010) 363–65 Abb. 296. 25 Vgl. etwa die Tontafel des Exekias, Berlin, Antikensammlung F 1811 + 1826: Mommsen (1997) 27–32, Taf.1; oder die Tafel Louvre MNB 905 des Sappho-Malers: Mommsen (1997) Beil. C.
Mythen- versus Lebensbilder?
221
zusätzlich betont, dass an deren Stelle die Bäume und ein einsamer Vogel getreten sind; hier geht es nicht um die Schilderung einer landschaftlichen Idylle; markiert wird vielmehr die Entfernung zum Oikos und zur Polis. Diese Polis-Ferne wäre bei einer sterblichen Frau undenkbar: Es muss sich also um eine Göttin handeln, die hier trauert, und der Tote kann kein anderer sein als ihr Sohn. In Frage kommen Eos und Memnon, oder Europa und Sarpedon. Die Frage, auf welche der beiden Konstellationen das Bild sich bezieht, ist letztlich kaum zu entscheiden. Wichtiger als diese Frage ist für uns allerdings der Umstand, dass das Mythenbild ganz evidenterweise auf die geläufige Prothesis-Ikonographie bzw. das Prothesis-Ritual zurückgreift, um durch gezielte Abweichungen dem Betrachter den Schlüssel für eine narrative Deutung zu liefern. Es scheint mir für das Verständnis der Ikonographie hilfreich zu sein, zwischen einem deskriptiven und einem narrativen Darstellungsmodus zu unterscheiden. Nur sollte man dabei nicht vergessen, dass diese beiden Modi in der griechischen Vasenmalerei gerade nicht zur Entstehung unterschiedlicher Bildergattungen geführt haben. Der Vergleich mit den neuzeitlichen Verhältnissen, wo Historien- und Genremalerei sich als Gattungen etablieren, ist gerade deshalb aufschlussreich, weil er die völlige Andersartigkeit der griechischen Vasenikonographie beleuchtet. Hier liefert die deskriptive Ikonographie, die den Gang der Welt wiedergibt, den Hintergrund, vor dem narrative Bilder sich als solche abheben können. Dabei wird deutlich, dass der Begriff eines „narrativen Bildes“ letztlich eine unzulässige Verkürzung darstellt: Es sind, in jedem solchen Bild, immer nur einzelne Elemente, die vom Normalfall deskriptiver Ikonographie abweichen. Der narrative Darstellungsmodus setzt somit den deskriptiven voraus und benutzt ihn als Folie, um in Einzelheiten freilich davon abzuweichen: Es sind genau diese abweichenden Einzelheiten, die einer Erklärung bedürfen und damit eine Erzählung ins Spiel bringen: wenn ein Leichnam nicht auf eine Kline, sondern auf Reisig gebettet ist; wenn ein Mann mit bloßen Händen mit einem Löwen ringt; oder auch nur wenn Kämpfer mit bestimmten Namen versehen werden und damit aus der Anonymität deskriptiver Ikonographie herausgehoben werden. Auf eine kurze Formel gebracht: Die Eigenart des narrativen Modus besteht in der (immer nur partiellen) Abweichung vom deskriptiven Modus. Narrative und deskriptive Ikonographie verhalten sich zueinander nicht wie Äpfel und Birnen, sondern wie Gestalt und Hintergrund; genau wie eine Gestalt nicht ohne den Hintergrund, ist auch die narrative Ikonographie ohne die Folie der rein beschreibenden Bilder nicht zu verstehen26. Und gerade wenn wir die griechischen Vasenbilder als historische Zeugnisse interpretieren möchten, scheint mir dieser notwendige Rückbezug des Narrativen auf
26 Renate Schlesier hat im Verlauf der Diskussion in Heidelberg vorgeschlagen, meine Unterscheidung zwischen deskriptiven und narrativen Elementen mit der Opposition merkmallos/merkmalhaltig in Verbindung zu bringen, wie sie von Roman Jakobson in der Linguistik eingeführt worden ist: das scheint mir sinnvoll und klärend. Vgl. Holenstein (1975) 134–141.
222
Luca Giuliani
den deskriptiven Modus, diese Verzahnung der beiden Ebenen ein interessanter Befund. Aber was heißt es genau, Vasenbilder als Medien der Geschichte zu betrachten? Zunächst: Man kann wohl davon ausgehen, dass keiner von uns mehr an die Autonomie von Kunst glaubt; Texte oder Artefakte, die wir behandeln, sind in einem gegebenen historischen Horizont verankert und nur aus diesem heraus zu begreifen. Diesen Horizont wiederum erschließen wir nicht (nur) aus literarischen Quellen, sondern (auch) aus der materiellen Hinterlassenschaft der antiken Kultur insgesamt, und das heißt: nicht zuletzt aus den Artefakten, die in eben diesen Horizont eingebettet sind. Das läuft ganz augenfällig auf eine Variante des klassischen hermeneutischen Zirkels hinaus. Dieser scheint mir vergleichsweise unproblematisch zu sein – jedenfalls so lange, wie er sich (seinem Namen zum Trotz) eine gewisse Offenheit bewahrt: Die hermeneutische Tätigkeit sollte idealerweise gerade nicht zirkulär verfahren, sondern in Form einer Spirale, die immer wieder auf die gleichen Phänomene zurückkommt, dabei aber ihren Radius kontinuierlich erweitert. Hier sehe ich keine Probleme. Aber es gibt zwei andere Punkte, die vielleicht einer Diskussion bedürfen. Erstens: Was meinen wir genau, wenn wir von einer Geschichte im Singular sprechen? Man kann sich schnell darüber einigen, dass es eine einheitliche geschichtliche Wirklichkeit gegeben hat27: Diese freilich ist versunken und verloren. Greifbar sind uns nur noch deren Spuren, Überreste, Monumente, Quellen; uns bleibt nichts anderes übrig, als diese Spuren zu nutzen, um (unsere) Geschichten dessen, was vergangen ist, zu konstruieren. Dabei würde ich auf den Plural lieber nicht verzichten: Wir konstruieren nicht Geschichte, sondern Geschichten, eine Vielzahl davon; jede Disziplin neigt dazu, eigene Geschichten zu entwerfen. Das macht den Austausch unter den klassischen Altertumswissenschaften, die schließlich alle ein und dieselbe Kultur bearbeiten, so notwendig. Wenn ich die Sprache der Historiker verwenden wollte, würde ich sagen: Jedes Fach ist darauf angewiesen, die anderen Disziplinen als Hilfswissenschaften einzusetzen. Der reziproken Verhilfswissenschaftlichung würde ich keine Grenzen setzen. Aber ich bin nicht sicher, ob die utopische Vorstellung, alle Geschichten könnten und sollten letzten Endes in eine einzige Geschichte münden, wirklich sinnvoll bzw. wünschenswert ist. Wichtiger scheint mir allerdings ein zweiter Punkt. Er betrifft den Begriff des Mediums und unsere Perspektive auf die Gegenstände. Ich erlaube mir ein fachfremdes Beispiel: Dantes Commedia ist nur zu verstehen, wenn wir sie in ihrem geschichtlichen Kontext verorten. Aber es gibt dabei zwei mögliche Perspektiven, die sich grundsätz-
27 Vgl. dazu – um in der Familie zu bleiben – Hölscher (2009) 68–99, v.a. 69: Geschichtswissenschaft sei nur unter der Voraussetzung möglich, „dass es – unbeschadet der unterschiedlichen subjektiven Wahrnehmungen von vergangenen Tatbeständen – doch nur jeweils eine einzige historische Realität gibt, auf die diese sich beziehen.“
Mythen- versus Lebensbilder?
223
lich voneinander unterscheiden. Entweder wir lesen die Commedia, um etwas über Florenz um 1300 zu erfahren, und in diesem Fall benutzen wir den Text als ein Medium; oder aber wir rekurrieren auf unser Wissen über Florenz um 1300, um die Commedia zu lesen: in diesem Fall ist unser Wissen das Medium, und nicht der Text: dieser ist nicht Mittel, sondern Ziel unserer Aufmerksamkeit. Ich würde diese Art der Aufmerksamkeit als eine ästhetische Aufmerksamkeit bezeichnen28. Der Begriff ist etwas altmodisch, trifft aber das, was mir wichtig ist. In Kants Kritik der Urteilskraft stand im Zentrum der Ästhetik die Betrachtung des Schönen; die Lust, die dadurch ausgelöst werde, bezeichnete Kant als reines, uninteressiertes Wohlgefallen29. Inzwischen haben sich die Künste von einer Fixierung auf das Schöne losgesagt, und wir betrachten Interesse (welches auch immer) als Grundvoraussetzung für den Erwerb von Erkenntnis überhaupt; ich würde deshalb statt von interesselosem Wohlgefallen lieber von zweckfreier Aufmerksamkeit sprechen. Zweckfrei ist ästhetische Aufmerksamkeit insofern, als sie dem Gegenstand selbst gilt, seiner Oberfläche und konkreten Gestalt30. Wenn wir einen Gegenstand hingegen zum Medium machen, verfolgen wir eine Absicht, die nicht das Medium selbst betrifft; dann droht die Aufmerksamkeit durch den Gegenstand hindurch zu gleiten bzw. sich von ihm auf ein anderes, ferneres Ziel zu verlagern: ist das Medium doch per definitionem etwas, das wenig Aufmerksamkeit fordert bzw. als transparent vorausgesetzt wird (es sei denn, man sei Medienwissenschaftler). Warum ist mir die ästhetische Aufmerksamkeit so wichtig? Weil sie mir eine entscheidende Voraussetzung dafür zu sein scheint, dass wir dem Gegenstand seine Widerspenstigkeit belassen und an ihm etwas entdecken, das gerade nicht unseren Erwartungen entspricht: etwas Neues. Auf diese Überraschung aber kommt es entscheidend an. Sie ist (pathetisch ausgedrückt) ein Glücksfall, und es gibt keine Garantie dafür, dass sie eintritt. Aber indem wir unsere Aufmerksamkeit auf den Gegenstand allein fokussieren, erhöht sich die Chance, dass uns eine Überraschung zuteil wird und wir an ihm eine zuvor nicht erwartete Komplexität entdecken. Ohne Überraschungen aber laufen wir Gefahr, bei unseren Betrachtungen nur das zu finden, was
28 Für einen einführenden Überblick vgl. Küpper u. Menke (2003). Unter Aufmerksamkeit verstehe ich eine bestimmte Art der Hinwendung, deren Ergebnis allerdings offen bleibt; auf eine ganz andere Bahn gerät man, wenn man – in Anschluss an Dilthey – von einem ästhetischen Erlebnis spricht: vgl. Gadamer (1986) 66–76; Gumbrecht (2003) 122–124, 132–133. 29 I. Kant, Kritik der Urteilskraft, § 2. Zu den damit verbundenen Interpretationsproblemen vgl. etwa Ginsborg (2008) 61–64. 30 Geuss (2009) 115 sieht das neuzeitliche Museum als den natürlichen Ort für eine solche Betrachtungsweise: „One of the main points of having a museum in the modern sense at all is that the individual object has some kind of stubborn independence, radical otherness, and it is good for us to be confronted with this. If there was no distinction between actually seeing some individual objects and reading a narrative or a general theoretical description, then there would be no need for museums, just for textbooks“.
224
Luca Giuliani
wir immer schon gewusst haben (und damit aus einer offenen Spirale in einen geschlossenen Zirkel zurück zu fallen). Deshalb brauchen wir ein Gegengewicht zur Mediatisierung, und deshalb können wir auf eine Pflege der ästhetischen Betrachtungsweise nicht verzichten31. nicht zuletzt im Interesse einer Mehrung der historischen Erkenntnis.
Literaturverzeichnis Arasse (1986): Daniel Arasse, „L’échec du Caracalla. Genre et ‚l’étiquette du regard‘“, in: Antoinette Ehrard u. Jean Ehrard (Hgg.), Diderot et Greuze. (Actes du Colloque de Clermont-Ferrand 16. 11. 1984), Clermont-Ferrand, 107–119. Bailey u.a. (2004): Colin B. Bailey, Philip Conisbee u. Thomas W. Gaehtgens, Meisterwerke der Französischen Genremalerei. Im Zeitalter von Watteau, Chardin und Fragonard, Ausstellungskatalog Ottawa, Berlin/Köln. Barker (2005): Emma Barker, Greuze and the Painting of Sentiment, Cambridge. Ba}ant (1981): Jan Ba}ant, Studies on the Use and Decoration of Athenian Vases, Prag. Beazley (1928): John D. Beazley, „Attic Black Figure. A Sketch“, in: Donna C. Kurtz (Hg.), Greek Vases. Lectures by Beazley, Oxford. Broneer (1937): Oscar Broneer, „A Calyk-Krater by Exekias“, Hesperia 6, 1937, 469–586. Broneer (1956): Oscar Broneer, „The North Slope Krater. New Fragments“, Hesperia 25, 345–349. Brookner (1971): Anita Brookner, Greuze. The rise and fall of an eighteenth-century phenomenon, London. Caskey u. Beazley (1954): Lacey Davis Caskey u. John Davidson Beazley, Attic Vase Paintings in the Museum of Fine Arts, Boston/London. Fellmann (2004): Berthold Fellmann, Attisch-schwarzfigurige Augenschalen. CVA München, Antikensammlungen Bd. 13, München. Dietrich (2010): Nikolaus Dietrich, Figur ohne Raum? Bäume und Felsen in der attischen Vasenmalerei des 6. und 5. Jahrhunderts v. Chr., Berlin. Ferrari (2003): Gloria Ferrari, „Myth and Genre on Athenian Vases“, Classical Antiquity 22, 37–54. Fittschen (1969): Klaus Fittschen, Untersuchungen zum Beginn der Sagendarstellungen bei den Griechen, Berlin. Gadamer (1986): Hans-Georg Gadamer, Wahrheit und Methode. Hermeneutik I. Gesammelte Werke Bd. 1, Tübingen. Gaehtgens (2002): Barbara Gaehtgens (Hg.), Genremalerei, Berlin. Geuss (2010): Raymond Geuss, „On Museums“, in: Raymond Geuss, Politics and the Imagination, Princeton.
31 Erhellend dazu Gumbrecht (2003) 109–137 unter der Überschrift „Das Lehren von Komplexität“. Selbstverständlich geht es nicht an, ästhetische Erfahrung „als verbindlichen Stoff in den Lehrplan aufzunehmen. Die Universität (oder irgendeine sonstige Institution) kann nichts weiter tun, als Rahmenbedingungen zu schaffen, die es ermöglichen, daß sich ästhetische Erfahrungen einstellen“ (137).
Mythen- versus Lebensbilder?
225
Ginsborg (2008): Hannah Ginsborg, „Interesseloses Wohlgefallen und Allgemeinheit ohne Begriff (§§ 1–9)“, in: Otfried Höffe (Hg.), Immanuel Kant, Kritik der Urteilskraft. Klassiker Auslegen Bd. 33, Berlin, 61–64. Giuliani (2003): Luca Giuliani, Bild und Mythos, München. Giuliani (2010): Luca Giuliani, „Myth as past?. On the temporal aspect of Greek depictions of legend“, in: Lin Foxhall (Hg.), Intentional History. Spinning Time in Ancient Greece, Stuttgart, 35–55. Gumbrecht (2003): Hans Ulrich Gumbrecht, Die Macht der Philologie. Über einen verborgenen Impuls im wissenschaftlichen Umgang mit Texten, Frankfurt am Main. Hölscher (1973): Tonio Hölscher, Griechische Historienbilder des 5. und 4. Jahrhunderts v. Chr., Würzburg. Hölscher (2000): Tonio Hölscher, „Feindwelten – Glückswelten. Perser, Kentauren und Amazonen“, in: Tonio Hölscher (Hg.), Gegenwelten zu den Kulturen Griechenlands und Roms in der Antike, München. Hölscher (2009): Lucian Hölscher, „Die Einheit der historischen Wirklichkeit und die Vielfalt der geschichtlichen Erfahrung“, in: Lucian Hölscher, Semantik der Leere. Grenzfragen der Geschichtswissenschaft, Göttingen, 68–99. Holenstein (1975): Elmar Holenstein, Roman Jakobsons phänomenologischer Strukturalismus, Frankfurt am Main. Hurwit (1985): Jeffrey M. Hurwit, The Art and Culture of Early Greece, Ithaca. Junker (2003): Klaus Junker, „Pseudo-Homerica. Kunst und Epos im archaischen Athen“, Winckelmannsprogramm der Archäologischen Gesellschaft zu Berlin 141, Berlin. Junker (2005): Klaus Junker, Griechische Mythenbilder, Stuttgart. Junker (2009): Karl Junker, „Zur Bedeutung der frühesten Mythenbilder“, in: Stephan Schmidt u. John H. Oakley (Hgg.), Hermeneutik der Bilder. Beihefte zum Corpus Vasorum Antiquorum 4, München. Knittlmayer (1997): Brigitte Knittlmayer, Die attische Demokratie und ihre Helden. Darstellungen des trojanischen Sagenkreises im 6. und frühen 5. Jh. v. Chr., Heidelberg. Küpper u. Menke (2003): Joachim Küpper u. Christoph Menke (Hgg.), Dimensionen ästhetischer Erfahrung, Frankfurt am Main. Mackay (1988): E. Anne Mackay, „Painters near Exekias“, in: Jette Christiansen (Hg.), Proceedings of the 3rd Symposium on Ancient Greek and Related Pottery, Kopenhagen, 369–378. Mackay (2010): E. Anne Mackay, Tradition and Originality. A Study of Exekias, Oxford. Mommsen (1997): Heide Mommsen, Exekias I. Die Grabtafeln, Mainz am Rhein. Moore (1986): Mary B. Moore, „Athena and Herakles on Exekias’ Calyx-Krater“, American Journal of Archaeology 90, 35–39. Muth (2008): Susanne Muth, Gewalt im Bild. Das Phänomen der medialen Gewalt im Athen des 6. und 5. Jahrhunderts v. Chr., Berlin/New York. Seznec (1966): Jean Seznec, „Diderot et l’affaire Greuze“. Gazette des beaux-arts 47, 339–356. Simon (1981): Erika Simon, Die Griechischen Vasen, 2. Auflage, München. Veh (2007): Cassius Dio, Römische Geschichte. Übersetzt von Otto Veh, Düsseldorf. Verdelis (1952): Nicolaos M. Verdelis, „Kalikoeides krater tes technes tou Exekiou.“ Archaiologike Ephemeris. Periadikon tes en Athenais Archaialagikes Hetaireias 91, 96–116. Zinserling (1977): Verena Zinserling, „Zum Problem von Alltagsdarstellungen auf attischen Vasen“, in: Max Kunze (Hg.), Beiträge zum antiken Realismus, Berlin, 39–56.
226
Luca Giuliani
Abbildungsnachweise Abb. 1 Abb. 2 Abb. 3 Abb. 4 Abb. 5–6 Abb. 7–8 Abb. 9–10 Abb. 11
Bailey u.a. (2004) 62 Abb. 41 Barker (2005) 151 Abb. 3 Muth (2008) 101 Abb. 55 Broneer (1956) Taf. 51b CVA München, Antikensammlungen, Bd. 77 (München 2004) Taf. 2–3 Muth (2008) 249 Abb. 163 Muth (2008) 204 Abb. 126 A-B Dietrich (2010) 363 Abb. 296
Two Notes on Greeks Bearing Arms
227
Andrew Stewart
Two Notes on Greeks Bearing Arms: The Hoplites of the Chigi Jug and Gelon’s Armed Aphrodite 1 1
For Tonio Hölscher
If the theme “Medien der Geschichte” offers wide scope for in(ter)vention, then an invitation to discuss “Körper: Bilder vom Menschen” offers an even wider one. It is in the spirit of Tonio Hölscher’s voluminous and varied writings on and around these subjects that I offer these two notes, which bridge the archaic Greek world and the Hellenistic, the city state and the kingdom, the historical and the monumental, the human and the divine, the masculine and the feminine, and last but not least, the real and the imaginary.
1 The Warriors of the Chigi Jug The Chigi Jug (Figs. 1–2) rightly commands a privileged position in histories both of archaic Greek art and archaic Greek warfare2. A masterpiece of the miniaturist Corinthian polychrome style, apparently the earliest depiction of Greek phalanx warfare, and (as Jeffrey Hurwit has shown)3 the earliest Greek artwork to present an integrated iconographic program, it has achieved a status in the field of classical archaeology out of all proportion to its small size, utilitarian function, and humble material. Almost forty years ago, in the published version of his Habilitationschrift, Tonio Hölscher eloquently discussed the Chigi Jug’s depiction of hoplite battle4. In particular, he dwelt at some length on how it exemplifies in truly classic form one pole of the archaic Greek artist’s engagement with the twin imperatives of contemporary hoplite warfare: collective discipline and individual prowess5. (The latter, the opposite pole, is represented by the ubiquitous black-figure one-on-one duels: Fig. 3). En route, Höl-
1 I would like to thank Tonio Hölscher, Ortwin Dally, Susanne Muth and Rolf Schneider for their kind invitation to contribute this essay, and Peter Bing, Christopher Hallett, Tonio Hölscher, Rachel Kousser, Michael Padgett and lecture audiences at Berkeley and Washington University in St. Louis for help at various stages in its production; and Marta Fodor at the Museum of Fine Arts, Boston. All mistakes and misstatements remain my own. 2 Rome, Villa Giulia 22679, from Veii: Amyx (1988) 32 Nr. 3; see most recently Hurwit (2002). 3 Hurwit (2002). 4 Hölscher (1973) 25ff. Fig. 1. 5 Well understood (though not apropos this vase) by Lendon (2005) 45ff.
228
Andrew Stewart
Fig. 1: Middle-late Protocorinthan olpe, the “Chigi Jug”: Hoplite battle, center. Ca. 650 B.C. Rome, Villa Giulia 22679.
scher allowed that in certain respects the picture seems to illustrate a phalanx that still had some way to evolve, since (echoing Homeric practice) all of the soldiers carry a second, backup spear and two of them at far left still have throwing loops attached to their spear shafts (Fig. 2). In recent years, this less rigid picture of the archaic hoplite phalanx has gained ground rapidly, to the extent that some military historians now contend that the “mature” phalanx, purified of archers, missile-throwers, and other irregulars, was actually a creation of the period of the Persian Wars6. Although I leave this particular contest to others, it is worth pointing out that the Chigi Jug’s battle scene offers little concrete support for the revisionist view. Even the spears with throwing loops belong to soldiers accoutered exactly like the other phalangites, whose spears conspicuously bear no such loops (Fig. 1). Yet recently one leading historian has radically reinterpreted even this picture along revisionist lines. He contends that this is a case of pars pro toto; that every spear in the scene should be thought of as looped; and that far
6 E.g. Krentz (2002); van Wees (2004) 166–98; Krentz (2007a); Krentz (2007b).
Two Notes on Greeks Bearing Arms
229
Fig. 2: Middle-late Protocorinthan olpe, the “Chigi Jug”: Hoplite battle, left side. Ca. 650 B.C. Rome, Villa Giulia 22679.
from using these spears for stabbing, “the two front lines are about to hurl javelins at each other, and contrary to appearances are evidently meant to be standing some way apart.7” The qualifier “contrary to appearances” gives the game away. A classic case of special pleading, this proposal rests on a misunderstanding of archaic Greek pictorial convention. For archaic Greek art is above all a literal mode of representation – which emphatically is not the same thing as saying that it is realistic. To simplify somewhat, scholars from Carl Robert through Nikolaus Himmelmann to Susanne Muth have shown that archaic figural compositions are governed by a formal syntax that assigns every figure and every detail its place in the context of the whole, and that each individual figure and detail tells its own story, which in sum make up the whole8. Thus, if a picture shows two men fighting each other at close quarters with spears and shields interlocked (Fig. 3, left), that is exactly what we are meant to envisage: a toe-to-toe, shield-to-shield, spear-to-spear, and face-to-face duel between two brave 7 Van Wees (2004) 170. 8 Robert (1881/1975); Himmelmann (1967/1998); Muth (2008).
230
Andrew Stewart
Fig. 3: Middle Corinthian column-krater: Hoplite battle. Ca. 600–575 B.C. Berkeley, Phoebe Apperson Hearst Museum of Anthropology 8/361.
men9. Add a corpse at their feet, and we understand the immediate reason for the encounter. Add a woman behind each of them tearing her hair or otherwise gesticulating, and we remember that somewhere – at home, or on the city wall – their respective womenfolk are anguishing over the outcome. Add another duel where one man has turned to flee and is being speared through the thigh (Fig. 3, right), and we recall that some warriors in this situation are less strong, less brave, and less lucky than others. Add a bird flying towards the victor (Fig. 3, right), and we see that the omens, and thus the gods, are on his side – the side of the bravest and strongest. In each case the logic is primarily causal, not temporal and/or spatial, and the governing theme is simple: hoplite battle. Time and space are secondary, even irrelevant to these very literal messages about it, and Aristotle’s notorious trio of classicizing unities lies far in the future10.
9 Middle Corinthian column-krater, Berkeley, Phoebe Apperson Hearst Museum of Anthropology 8/361: Amyx (1988) 156 Nr. 5 Taf. 59,2–60,1: A: hoplite fights; B: armed riders. 10 Arist. Poet. 5,8,23.
Two Notes on Greeks Bearing Arms
231
Thus, in the same way those archaic Greek pictures of the phalanx battle and the duel (Figs. 1–3) represent the twin poles of archaic warfare as contemporaries actually experienced them, the various subtypes of duels (Fig. 3) complement and comment on one another, exemplifying in toto the exhilarating yet terrifying experience of faceto-face fighting with edged weapons. As Victor Hanson has eloquently remarked: The peacetime fascination with the use of shield and spear, the hoplite’s ritualistic dance, the competitive race in armor – and the interest of sculptor, vase-painter and poet – was, I believe, symptomatic of the anticipation and anxiety that gnawed in the heart of every man, growing large in inverse proportion to the relatively few moments of actual fighting on the battlefield … For men aged twenty through sixty – uninitiated and veteran alike – the charge, the collision of spears, the pushing, trampling, wounding, panic, confusion, even the pile of battlefield dead, were all similar events to be experienced one awful, fatal time, or perennially, until a man could fight no more … For the Greek citizen of every age, there was one image alone of the hoplite spearman, imprinted in the mind like the warriors on the frieze courses of so many Greek temples, a picture that every man shared with every man he knew.11
Or, as a feminist critic once shrewdly put it: “In mastery of fear, men experience freedom: Conflict is action, action is masculine.12” This is why in the archaic and classical periods, phalanxes such the one shown on the Chigi Jug (Fig. 1) can be numbered almost on one hand. The supreme image of unfettered, triumphant masculinity in archaic and classical Greek art was not the collective killing machine of the phalanx but the individual hoplite warrior, represented exactly as he was at that fateful moment: alone. With this image every Greek male could identify, for in it he saw himself. Where does this leave the Chigi Jug (Fig. 1)? First, against the assertion that “the two front lines … contrary to appearances are evidently meant to be standing some way apart,” the toes, shields, and spears of the warriors furthest from the picture plane, but at the very focus of the entire composition overlap. This must signal that the armies have closed and are just about to clash. Second, against the assertion that “the two front lines are about to hurl javelins at each other,” their spears are pointing not upwards for the throw but downwards, hoplite-style, straight towards the vulnerable eyes, mouths, and necks of their opponents. And third, against the assertion that all the spears are to be thought of as equipped with throwing loops, the few thus endowed not only are placed at the extreme left of the composition but also are given to two stragglers (Fig. 2). So the painter has literally sidelined them and their tardy owners – who have lost their chance to use them as intended – along with them. They have missed their opportunity, their kairos. In sum, the painter has spoken and we must take him literally. Had he intended us to interpret these weapons as throwing spears, he never would have omitted their throwing loops and at the same time represented the two front ranks so close to-
11 Hanson (1989) 221f.; compare now Lendon (2005) 45ff. 12 Dworkin (1981) 51; on all this, see already Stewart (1996) 89ff.
232
Andrew Stewart
gether. We must take all this at face value. They are stabbing at each other at close quarters, not “standing some way apart” and readying their spears for the throw. That sort of warfare, the painter suggests, is now obsolete and literally a sideshow. Moreover, implying the same thing, he has omitted both to give the rear rank of the lefthand army – by archaic convention, the eventual victor – backup spears either (see Fig. 2, right) and has given none of the soldiers a sword13. In the end, then, the traditional interpretation of the scene in Fig. 1 holds. This is the split-second before the clash: the ôthismos or face-to-face shoving match that would determine the outcome of this exclusively hoplite battle and the fates of its participants. As Tyrtaios exhorted his Spartan audience, don’t stand aloof beyond the hail of missiles, but: $llˇ ti« ãggŒ« åøn a\tosxedÌn ögxe= makrâi Ó j›fei o\tˇzvn d‹=on ¡ndr’ Ylwtv, kaÏ pfida p@r podÏ ùeÏ« kaÏ ãp’ $sp›do« $sp›d’ ãre›sa«, ãn dÍ lfifon te lfifvi kaÏ kynwhn kynwhi kaÏ stwrnon stwrnvi peplhmwno« $ndrÏ maxwsùv, Ó j›feo« kØphn Ó dfiry makrÌn öxvn. [Tyrtaios 12 West] Instead, each man get close and spear your enemy, Or spit him with your sword and take his life. With foot set against foot and shield set against shield, And crest against crest and helm against helm, And chest thrusting hard against chest, let each man fight With sword in hand, or far-injuring spear.14
Regardless of the precise stage in the development of hoplite warfare that the Chigi Painter intended to show, this is his true achievement, to combine in one picture the twin poles of phalanx fighting: the rugged discipline of the mass and the iron courage of the individual. Together, he declares, they represent the hoplite ideal.
13 As Michael Padgett aptly notes (pers. comm., 12/28/10): “The fact that the Chigi vase shows the new hoplite formation is evidenced not only by their massed formations with overlapping shields, but by the absence of swords, the ubiquitous mark of a warrior on Geometric vases. There are very few vase-paintings, Attic or Corinthian, that show either a warrior throwing a spear or a thrown spear having landed. The only time one normally sees a short throwing spear is in the hands of a cavalryman. However much later Greek warriors wanted to emulate the Homeric heroes, they were too smart to let go of their spears!” Indeed, to go into battle with only a throwing spear (or two) and no sword would be insane, since one would have only one’s bare hands to fight with if one missed. A second spear, however, would be just as useful in a hoplite stabbing fight as in a Homeric javelin contest, since if one’s spear splintered against an enemy’s armor, having no backup would put one at a major disadvantage. 14 Translation Richmond Lattimore, slightly adapted.
Two Notes on Greeks Bearing Arms
233
2 Arsinoe-Aphrodite at Arms Sometime after 269/8 B.C., Poseidippos of Pella, at that time residing in Alexandria, wrote an epigram for a dedication of a piece of linen, perhaps a curtain, veil, mitra, or even a royal diadem, by a Macedonian maiden, Hegeso, to Queen Arsinoe II Philadelphos: [rsinfih, soÏ toÜto di@ stol›dvn $nemoÜsùai b÷ssinon ¡gkeitai brwgm’ $pÌ Naykrˇtio«, ìi s÷, f›lh, kat’ òneiron çmfirjasùai glykŒn Ådrâ óùele«, çtrhrân paysamwnh kamˇtvn· Á« ãfˇnh«, Filˇdelfe, kaÏ ãn xerÏ do÷rato« aåxm‹n, pfitna, kaÏ ãn p‹xei koÖlon öxoysa sˇko«· Ł dÍ soÏ aåthùeÖsa tÌ leyxwanon kanfinisma parùwno« ^Hghsø ùáke gwno« Makw[th.] [P. Mil. Vogl VIII 309, col. vi. 10–17; Poseidippos 36 AB] Arsinoe, for you this tissue of linen from Naukratis is hung here To flutter in the wind across your dress! In my dream, beloved, your eager struggles over, you seemed To reach for it, as if to wipe the fragrant sweat From your limbs – I see you still, Lady Philadelphos, the sharp Spear in your hand, the hollow shield on your arm. Here, then, it is: to you from maiden Hegeso, of Macedonian Stock, this delicate strip of white cloth.15
The first editors of the poem, puzzled by its mention of spear and shield, thought that Arsinoe was appearing in the guise of Athena, adducing a dream recounted in Plutarch’s Lucullus in which the goddess’s efforts on behalf of Kyzikos during the Mithradatic Wars cause her to break out in a sweat. In 2003, however, Peter Bing realized that the goddess in question ought to be Aphrodite and argued that the cult was the famous maritime one of Arsinoe-Aphrodite at Cape Zephyrion. He concluded with a query: “Could it be that the maiden was thinking about an armed Arsinoe-Aphrodite, even dreaming of her, because she cared about someone involved in a war, a prospective husband perhaps.16” Although this interpretation now seems to be generally accepted17, and we must not forget that Arsinoe’s epiphany occurred in a dream (which the ancients believed
15 Gutzwiller (2005) 25 (translation Frank Nisetich), slightly adapted. Since Hegeso addresses Arsinoe as “Philadelphe” the poem must postdate her death in 269/8: see Hölbl (2001) 101ff. for a convenient survey of the development of her cult titles. 16 Bastianini and Gallazzi (2001) 151, citing Plut. Luc. 10; Bing (2003) 258ff.; reprised in Bing (2009) 247. Might this sweaty epiphany be a double-entendre: a cheeky allusion also to Arsinoe’s bed-time trysts with her brother/husband Ptolemy? 17 See, e.g., Gutzwiller (2005) 108 (Dirk Obbink).
234
Andrew Stewart
would foretell the future), its implications have yet to be fully explored. In particular, how does it square with the cultic, literary, and iconographic tradition of Aphroditeat-Arms? Fortunately, the cultic evidence has been explored very thoroughly in a recent book by Gabriella Pironti and the rest in a 1991 dissertation by Johan Flemberg18. At Zephyrion, Arsinoe was worshiped as Aphrodite Euploia, referencing the goddess’s control over all liquids and the foam (aphros) that they generate. The Ptolemaic admiral Kallikrates founded the cult shortly before the queen’s death in 269/8 and at least three leading Hellenistic poets celebrated it in multiple epigrams19. Unfortunately, none of them describes its cult image, though the Poseidippos epigram quoted above would suggest that it was at least partially draped if (as Bing proposed) Hegeso was dreaming of this goddess and not of a separate image of Arsinoe/Aphrodite-atArms. Yet might the queen have been worshiped in both guises in the same temple, given the vividness of Hegeso’s dream; the close association between Aphrodite the sea goddess and Aphrodite the warrior; and the prior existence of an ancient iconographic tradition for the latter? As a sailors’ goddess, Arsinoe-Aphrodite was responsible above all for calm seas and prosperous voyages, which (as Louis Robert saw long ago)20 linked this cult not only with the many humble private dedications to Arsinoe found in port cities around the eastern Mediterranean (some of which actually were named after her), but also with such major Aegean cults of Aphrodite Euploia as those at Piraeus and Knidos. The Athenian admiral Konon had founded the former after the battle of Knidos in 394 – a victory widely regarded as reversing the result of the Peloponnesian War – and Praxiteles had created antiquity’s most famous statue of Aphrodite for the latter, probably during his akme in 364–361. As Bing has remarked, “the links Kallikrates forged went in both directions: from old Hellas to Egypt and from Egypt back to old Hellas.21” The same is true of Arsinoe/Aphrodite-at-Arms. According to the sources, the cult of Aphrodite-at-Arms originated in Cyprus but soon spread via Kythera to the Peloponnese, where inter alia it took root in Sparta at an early date and in Corinth after the Battle of Salamis in 48022. At first sight, the love goddess seems distinctly out of place on the battlefield, and Homer’s account in Iliad 5 of her discomfiture outside the walls
18 Pironti (2007); Flemberg (1991). 19 Poseidippos 39, 116, 119 AB, and possibly also 36 and 37 AB; Callim. Ep. 14 Gow-Page (= 5 Pfeiffer = Athen. 7.318d); Hedylos 4 GP (= Athen. 11.497d); see esp. Bing (2003); Bing (2009); Susan Stephens in Gutzwiller (2005) 244ff. 20 Robert (1966) 201f.; 208; summary and update, Hölbl (2001) 104. 21 Paus. 1.1.3; cf. Pirenne-Delforge (1994) 33, 373, 399, 433f., 469; Pironti (2007) 166, 203, 245ff., 271; Bing (2009) 244. On Praxiteles’ statue see most recently Corso (2007) 9–186, with the present author’s remarks in Stewart (1996) 97ff., updated in Stewart (2010) 13ff. 22 Cyprus: Hesych. s.v. “Encheios.” Greece: e.g., Paus. 3.15.10–11, 17.5, 18.8; Plut. Mor. 239A, 317F; Plut. Anth.Gr. 9.320 (Sparta); Paus. 23.1 (Kythera); Paus. 2.5.1; Strab. 8.6.21, 379 (Corinth); cf. Anth.Gr. 9. 321; 16.171–177; Flemberg (1991) 27ff., Nr. 1ff.; Pironti (2007) 231ff.
Two Notes on Greeks Bearing Arms
235
of Troy has often been cited in support. Yet she fights in the Gigantomachy from at least the mid sixth century, and as Pironti has shown, her domain included all forms of desire and corporeal mixis, from the sexual to the martial23. In cult, this domain embraced not only the soldier’s love of battle but also the eros that bonded him to his fellow soldiers, to his commanders, and to his city and its governing regime. Apart from the numerous cults of Aphrodite Areia scattered throughout Greece, on Kos (for example) Aphrodite Pontia and Aphrodite Pandamos occupied twin temples, and the local soldiery sacrificed to the former; and at Athens, Aphrodite Hêgemonê was honored both in the frontier towns of Attica by their garrisons and in the city by the general “in charge of equipment” (ãpÏ tÎn paraskey‹n)24. Alexandria and the Ptolemies had strong ties to all these places, and Kallikrates and his advisers cannot have been ignorant of the precedents that they had set. Together, these testimonia and Poseidippos’s epigram, cited above, suggest that (at least in the Alexandrian imaginary), Arsinoe was idolized not only as Queen or basilissa of the Ptolemaic kingdom and its far-flung possessions, but as basilissa of both sea and land (i.e., of the entire oikoumenê in both war and peace) in the cultic sphere also. As to how Hegeso could have envisioned Arsinoe/Aphrodite-at-Arms or (in a maximalist interpretation) could have seen her in reality, the ancient xoana of Aphrodite Areia at Sparta and elsewhere no doubt were fully draped. If the Aphrodite at Amyklai by Polykleitos II, dedicated after the battle of Aigospotamoi in 405, is to be identified with the armed Aphrodite of the Epidauros type (Fig. 4), as some believe, the statue was draped in a thin chiton and himation that left her right breast bare, and carried a sword and probably also a spear25. A century or so later, the armed Aphrodite of Acrocorinth carried a shield, wore only a himation, and was naked to the waist, if the long-postulated association between this statue, a series of Corinthian coins, and the Capuan-type Aphrodite is to be trusted26. A splendid engraved red garnet ring-stone signed by Gelon (Fig. 5), found in the Tomb of the Erotes at Eretria and probably predating the end of the third century, shows Aphrodite similarly attired, but now her himation has slipped enticingly below
23 Aphrodite in the Gigantomachy: Michael Padgett kindly reminds me of the Attic black-figure dinos by Lydos, Athens NM Akr. 607: ABV 107/1; Beazley Addenda2 29; Moore (1979) 87f. Taf. 12,5; LIMC II (1984) s.v. Aphrodite Nr. 1394 Taf. 137; LIMC IV (1988) s.v. Gigantes Nr. 105; Muth (2008) 272ff. Fig. 174A. Mixis: Pironti (2007) 41ff. and passim. 24 See Pironti (2007) 242ff. with references; and, e.g., SEG XLI 90f.; SEG XLIII 64; IG II2 2798, with Stewart (2012) 288ff. 25 Paus. 3.18.8, cf. 4.14.2; on the Epidauros type see LIMC Aphrodite Nr. 243f. pl. 28; Flemberg (1991) 46ff. Fig. 1. 26 Paus. 2.5.1; for the coins see Imhoof-Blumer u. Gardner (1887/1964) 25ff. Nr. 33 Taf. G; LIMC Aphrodite 627ff. Taf. 61f.; and for a thorough discussion of the Capuan type in this context, Kousser (2008) 19ff.; yet the latter can only be a variant of the Corinthian statue, since as Hölscher (1967) 124 noticed, the coins show clearly that the statue held her shield with both hands, a pose now confirmed by a Roman fresco found near the theater in 1990: Kousser (2008) 21 Fig. 9.
236
Andrew Stewart
Fig. 4: Aphrodite-at-Arms, from Epidauros. Roman copy, original ca. 400 B.C. Athens, National Museum 262.
Two Notes on Greeks Bearing Arms
Fig. 5: Garnet ring stone signed by Gelon, from the Tomb of the Erotes at Eretria. Ca. 250–200 B.C. Boston, Museum of Fine Arts 21.1213.
237
238
Andrew Stewart
her buttocks27. Yet like the goddess in Hegeso’s dream, she is now equipped with both shield and spear, and suggestively also seems to wear a scarf around her hair that flutters down her back. One is tempted to connect text and image more directly, especially since the only other example of this type is also provenanced to the eastern Mediterranean littoral. Yet the “scarf” is probably the corner of her himation (its continuation is clearly visible between her breasts), and the three-quarter back view would be most peculiar for a cult statue, which normally would not be visible from this angle. Probably, then, Gelon’s model was a Ptolemaic painting or even another gem. Images of this sort seem to have been popular in third-century Alexandria, to judge from some suggestive lines of Apollonios of Rhodes’s Argonautika28. (Famously, Caesar’s finger ring bore a similar one, probably echoed in various forms on Augustus’s coins and those of his successors.29) Finally, there is the fully naked Aphrodite with a sword known in at least fifteen Roman copies (Fig. 6). The location of the original cannot be determined with certainty, though Roman coins of both Corinth and Kyzikos feature a very similar figure, and the wide hips and relatively small torsos of some of the replicas have suggested a date later in the Hellenistic period rather than earlier. Yet like the Capitoline Aphrodite type, the Florentine replica (Fig. 6) is accompanied by a slim, ribbed loutrophoros. This vessel type disappeared after ca. 300 and thus (as the lectio difficilior) should
27 Signed by Gelon, Ring with Aphrodite Taking Up Arms. Greek, Hellenistic Period, 3rd century B.C. Greece Euboia, Eretria, Tomb of the Erotes. Gold; garnet. Length × width: 2.9 × 2.4 cm (1 1/8 × 15/16 in.). Museum of Fine Arts, Boston: Francis Bartlett Donation of 1912, inv. 21.1213: Furtwängler (1900) II. 305f. Taf. 66,4; Richter (1968) 143 Nr. 552, cf. Nr. 555 (from Amrit in Syria); LIMC Aphrodite Nr. 658f. Taf. 65, with earlier bibliography; Zazoff (1983) 205 Taf. 53,1; Flemberg (1991) 58; Plantzos (1999) 68f. Nr. 165f. Taf. 29, arguing strongly for an Alexandrian origin; Huguenot (2008) vol. 1, 180ff, vol. 2, 18 Nr. 69, Taf. 32,1–3. Huguenot assigns the tomb tentatively to the first quarter of the third century and to Kratesipolis I, the occupant of Throne A in the tomb and perhaps identical with the wife of Polyperchon’s son Alexandros; widowed in 313, she is last heard of in 307 desperately seeking a husband. This date, however, provides only a terminus post quem for the finds, which cumulatively suggest continued (re)use of the tomb through most of the third century. 28 I.742–6 (though evidently draped, coiffed, and poised differently): ^Eje›h« d’ óskhto baùyplfikamo« Kyùwreia ~reo« çxmˇzoysa ùoÌn sˇko«, ãk dw oÅ ümoy páxyn öpi skaiÌn jynoxÎ kexˇlasto xitâno« nwrùe parÍk mazoÖo· tÌ d’ $nt›on $trekÍ« a¾tv« xalke›> de›khlon ãn $sp›di fa›net’ ådwsùai. [Next in place Kythereía the deep-tressed goddess was fashioned Gripping a swift shield, the armor of Ares; away from her shoulder Over her left forearm her tunic was fastened to hang down Loosely beneath her breast; and the image of her that was gleaming Opposite, there on the bronze-wrought shield, showed her to perfection.] (Translation courtesy of Rodney Merrill) 29 Dio 43.43.3; cf. LIMC VIII (1999) s.v. Venus Nr. 196ff. Taf. 146; Flemberg (1991) 35 Nr. 26, 110ff., Fig. 56f.
Two Notes on Greeks Bearing Arms
Fig. 6: Aphrodite-at-Arms. Roman copy, original ca. 300 B.C. Florence, Accademia di Belle Arti.
239
240
Andrew Stewart
date the copy’s original to that period, contemporary with the Capitoline type. So just as in Hegeso’s dream, cited above, the goddess must be taking off her sword to bathe after her sweaty labors, not putting it on as normally believed. Like the Capitoline Aphrodite, she turns towards an intruder off to the right (again, presumably Ares), but, being caught in medias res, has yet to react properly to his presence30. These types give us an excellent conspectus of the ways in which Hegeso could have envisioned Arsinoe/Aphrodite-at-Arms, and how any such Ptolemaic image of her might have looked. Whether Poseidippos was alluding to an actual statue of the queen in this guise or fancifully referencing the already established type(s) of Aphrodite-at-Arms of course cannot be determined unless more evidence comes to light.
3 Conclusion: History as (Self-)Image The four centuries spanned by this brief discussion witnessed a radical change in the self-image of the Greek community in arms: From the bronze-clad, spear-wielding citizen hoplite of the seventh century (Figs. 1–3) to the draped or maybe even semidraped body of a deceased, deified, idealized, third-century Ptolemaic queen also equipped – most incongruously to our eyes – with spear and shield (compare Figs. 4–6). As Wittgenstein famously remarked, art is a ‘form of life’ (Lebensform) and thus is linked inextricably with cultural change31. So it is reasonable to argue that the radical changes in Greek culture that occurred during these four centuries, culminating in the foundation of the Hellenistic kingdoms around 300, must have been largely responsible for this extraordinary iconographic transformation. These shifts in the geographical location, size, composition, structure, and power of agency of the Greek social body itself are perhaps best summarized in tabular form:
Location: State: Armed forces: Army: Symbol:
Ca. 650 B.C.
Ca. 270 B.C.
Greece Polis Citizens Hoplites (plus peltasts and cavalry) THE HOPLITE
Egypt and environs Kingdom Mercenaries Cavalry, elephants, sarissophoroi, hypaspists, peltasts, slingers, archers, etc. QUEEN/GODDESS
30 LIMC Aphrodite Nr. 456ff. Taf. 44; Flemberg (1991) 62ff. Fig. 7–54; cf. Stewart (2010) 15, 19f. on the Capitoline Aphrodite type and its loutrophoros. The other replicas of the Armed Aphrodite type substitute Eros, a tree trunk and cloak, and/or helmet and shield; for a similar pattern of substitution, compare the replicas of the Capitoline type. 31 See esp. Gier (1980); Wollheim (1980), as qualified by Cooper (1985); cf. Hanfling (2002).
Two Notes on Greeks Bearing Arms
241
To focus on the last column, four closely associated changes of relevance to this essay occurred more-or-less simultaneously during the period in question. First, the Hellenistic kingdoms decisively eclipsed the independent Greek poleis as the powers to be reckoned with in Greece and the East, marginalizing the ideology of the polis and problematizing its traditional expressions in word and image (i.e., Greek literature and art). Second, mercenary armies largely usurped the dominating role in Greek warfare hitherto played by citizen militias (Fig. 1), effectively sidelining the citizen hoplite also. Third, these armies were far more diverse, featuring cavalry (their main strike force), elephants, sarissophoroi (pikemen), hypaspists, peltasts, slingers, archers, and/or sundry other light-armed troops and auxiliaries. And fourth, the ruler cult joined the Olympian religion as an index in the realm of the imaginary of the social body’s new structure and enormously augmented power of agency. In these circumstances, to place the Ptolemaic kingdom’s pretensions to hegemony over land and sea and to pre-eminence in both war and peace under the sign of the deified Arsinoe/Aphrodite was more than a stroke of near genius32. At that time and place, perhaps it was all but inevitable.
Literaturverzeichnis Amyx (1988): Darrell A. Amyx, Corinthian Vase-Painting of the Archaic Period, Berkeley / Los Angeles / London. Bastianini u. Gallazzi (2001): Guido Bastianini u. Claudio Gallazzi, Epigrammi: P. Mil. Vogl. VIII 309 / Posidippo di Pella, Mailand. Bastianini u. Austin (2003): Guido Bastianini u. Colin Austin, Posidippi Pellaei quae supersunt omnia, Mailand. Bing (2003): Peter Bing, “Posidippus and the Admiral: Kallikrates of Samos in the Milan Epigrams”, Greek, Roman, and Byzantine Studies 43, 243–266. Bing (2009): Peter Bing, The Scroll and the Marble. Studies in Reading and Reception in Hellenistic Poetry, Ann Arbor. Cooper (1985): Wesley E. Cooper, “Is Art a Form of Life?”, Dialogue 24, 443–453. Corso (2007): Antonio Corso, The Art of Praxiteles 2: The Mature Years, Rom. Dworkin (1981): Andrea Dworkin, Pornography, London. Flemberg (1991): Johan Flemberg, Venus Armata. Studien zur bewaffneten Aphrodite in der griechischrömischen Kunst (Acta Instituti Atheniensis Regni Sueciae, series in 8o, Nr. 10), Stockholm. Furtwängler (1900): Adolf Furtwängler, Die antiken Gemmen, Leipzig / Berlin.
32 As Tonio Hölscher remarks per litteras, all this in turn prompts a reconsideration of the Armed Aphrodite’s possible links, on the one hand, with the ancient Near Eastern goddesses Inanna, Ishtar/ Astarte (largely bracketed by Pironti (2007) 12, 154ff.), Anat, Anahita, Tanit, and especially in the present context the Egyptian war goddess Neith; and on the other, to the Roman Venus Victrix, as represented, for example on Julius Caesar’s signet ring, Octavian’s Alexandrian victory coins, and so on: Dio 43,43,3; Flemberg (1991) 110ff., figs. 56ff. Limitations of space prohibit me from pursuing these inquiries here.
242
Andrew Stewart
Gier (1980): Nicholas Gier, “Wittgenstein and Forms of Life”, Philosophy of the Social Sciences 10, 241–258. Gutzwiller (2005): Kathryn Gutzwiller (Hg.), The New Posidippus. A Hellenistic Poetry Book, Oxford. Hanfling (2002): Oswald Hanfling, Wittgenstein and the Human Form of Life, London / New York. Hanson (1989): Victor Davis Hanson, The Western Way of War. Infantry Battle in Classical Greece, New York. Himmelmann (1967): Nikolaus Himmelmann, Erzählung und Figur in der archaischen Kunst, Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz. Abhandlungen der Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Klasse 1967 Nr. 2, Wiesbaden, 73–97. Himmelmann (1998): Nikolaus Himmelmann, “Narrative and Figure in Archaic Art”, in: William Childs (Hg.), Reading Greek Art. Essays by Nikolaus Himmelmann, Princeton, 67–102. Hölbl (2001): Günther Hölbl, A History of the Ptolemaic Empire, London / New York. Hölscher (1967): Tonio Hölscher, Victoria Romana, Mainz. Hölscher (1973): Tonio Hölscher, Griechische Historienbilder des 5. und 4. Jahrhunderts v. Chr. (Beiträge zur Archäologie 6), Würzburg. Huguenot (2008): Caroline Huguenot, Le Tombeau des Érotes et le tombeau d’Amarynthos (Eretria 19), Lausanne. Hurwit (2002): Jeffrey Hurwit, “Reading the Chigi Vase”, Hesperia 71, 1–22. Imhoof-Blumer u. Gardner (1887): Friedrich Imhoof-Blumer u. Percy Gardner, A Numismatic Commentary on Pausanias, London; Wiederabgedruckt in: Oikonomedes (1964): A. N. Oikonomedes (Hg.), Ancient Coins Illustrating Lost Masterpieces of Greek Art, Chicago. Kousser (2008): Rachel Kousser, Hellenistic and Roman Ideal Sculpture. The Allure of the Classical, Cambridge. Krentz (2002): Peter Krentz, “Fighting by the Rules. The Invention of the Hoplite Agon”, Hesperia 71, 23–39. Krentz (2007a): Peter Krentz, “Archaic and Classical Greece: War”, in: Philip Sabin, Hans van Wees, u. Michael Whitby (Hgg.), The Cambridge History of Greek and Roman Warfare, 1. Greece, the Hellenistic World, and the Rise of Rome, Cambridge, 147–185. Krentz (2007b): Peter Krentz, “Warfare and Hoplites”, in: Harvey Alan Shapiro (Hg.), The Cambridge Companion to Archaic Greece, Cambridge, 61–84. Lendon (2005): J. E. Lendon, Soldiers and Ghosts. A History of Battle in Classical Antiquity, New Haven. Moore (1979): Mary B. Moore, “Lydos and the Gigantomachy”, American Journal of Archaeology 83, 79–99. Muth (2008): Susanne Muth, Gewalt im Bild. Das Phänomen der medialen Gewalt im Athen des 6. und 5. Jahrhunderts v. Chr., Berlin / New York. Pirenne-Delforge (1994): Viviane Pirenne-Delforge, L’Aphrodite grecque. Contribution à l’étude de ses cultes et de sa personalité dans le pantheon archaïque et classique (Kernos, Supplément 4), Liège. Pironti (2007): Gabriella Pironti, Entre ciel et guerre. Figures d’Aphrodite en Grèce ancienne (Kernos, Supplément 18), Liège. Plantzos (1999): Dimitris Plantzos, Hellenistic Engraved Gems, Oxford. Richter (1968): Gisela M. A. Richter, Engraved Gems of the Greeks and Etruscans, London. Robert (1881/1975): Carl Robert, Bild und Lied. Archäologische Beiträge zur Geschichte der griechischen Heldensage, Berlin 1881 / repr. New York 1975. Robert (1966): Louis Robert, “Sur un décret d’Ilion et sur un papyrus concernant les cultes royaux”, in: A. E. Samuel (Hg.), Essays in Honor of C. Bradford Welles, American Studies in Papyrology 1, New Haven, 175–211. Stewart (1996): Andrew Stewart, Art, Desire, and the Body in Ancient Greece, Cambridge.
Two Notes on Greeks Bearing Arms
243
Stewart (2010): Andrew Stewart, “A Tale of Seven Nudes: The Capitoline and Medici Aphrodites, Four Nymphs at Elean Herakleia, and an Aphrodite at Megalopolis”, Antichthon 44, 12–32. Stewart (2012): Andrew Stewart, “Hellenistic Free-Standing Sculpture from the Athenian Agora. 1. Aphrodite”, Hesperia 81, 267–342. Van Wees (2004): Hans van Wees, Greek Warfare: Myths and Realities, London. Wollheim (1980): Richard Wollheim, Art and Its Objects, Cambridge. Zazoff (1983): Peter Zazoff, Die antiken Gemmen, München.
Abbildungsnachweise Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6
UCLA photo archive From Antike Denkmäler 2 (1901) pl. 44 Photo A. Stewart Photo: © Erin and Jure Babnik Photo: © 2012 Museum of Fine Arts, Boston Photo: © Alinari-Art Resource 1329
244
Adolf H. Borbein
Adolf H. Borbein
Das Medium der künstlerischen Form. Medium – künstlerische Form – Geschichte: Drei Begriffe und zugleich drei Problemfelder 1 Medium Warum ‚Medien‘ der Geschichte? Taugt der in den Geschichts- und Altertumswissenschaften seit Jahrhunderten eingeführte metaphorische Begriff der ‚Quelle‘ nicht mehr? Will man sich mit einem Modebegriff den Platz in der Gegenwart der ‚Medienwelt‘ sichern? Nein, es gibt gute Gründe, der ‚Quelle‘ das ‚Medium‘ zur Seite zu stellen oder vielmehr: beides als Einheit zu verstehen. Spricht man von ‚Quelle‘, dann deutet man den Weg von dem Belegstück (Objekt oder Text) zur historischen Erkenntnis, von der Vergangenheit zur Gegenwart primär als Einbahnstraße: Die Quelle fließt (existiert) und bleibt dieselbe unabhängig davon, ob jemand sie anzapft (benutzt). Spricht man hingegen von ‚Medium‘, dann betont man den Vorgang der Vermittlung, der notwendig auch dann stattfindet, wenn Aussagen über Vergangenes getroffen werden. ‚Medium‘ drückt hier aus, dass zwischen Objekt und Rezipient, zwischen Einst und Jetzt eine wechselseitige Kommunikation sich ereignet: Nicht nur der Forscher (Historiker) verändert sich im Prozess der Forschung, sondern auch sein Objekt (die ‚Quelle‘); das Objekt stellt sich in neuer Weise dar, es zeigt – etwa indem man es in einem neuen Kontext betrachtet – neue, bisher unentdeckte Aspekte und Eigenschaften. Der Begriff ‚Medium‘ zielt zwar auf denselben Sachverhalt wie ‚Quelle‘, signalisiert aber ein verändertes Problembewusstsein.
2 Kunst Der Begriff ‚Kunst‘ dient im allgemeinen Sprachgebrauch als Prädikat: ‚Kunst‘ bezeichnet zumeist Objekte (auch Schriften) von formalem Anspruch, Objekte, deren ästhetische Gestaltung einen gewissen Eigenwert besitzt und den vorhandenen Gebrauchswert übersteigt. Ein solcher ästhetischer Eigenwert und also das Prädikat ‚Kunst‘ kann aber auch – wie es heute oft geschieht – selbst solchen Objekten zugesprochen werden, die nicht von vornherein als Kunst entstanden, ja nicht einmal von Menschen geschaffen worden sind. Zu definieren, was Kunst ist und – vor allem – was sie nicht ist, also genau zu unterscheiden zwischen Kunst und Nicht-Kunst, das ist uns heute kaum mehr möglich,
Das Medium der künstlerischen Form
245
zumindest gibt es keine weithin akzeptierten Definitionen mehr. Anhänger und Wirkung verloren hat insbesondere die philosophische Ästhetik, wie etwa Kant oder Hegel sie formulierten und die bis weit in das 20. Jahrhundert hinein auch die Klassische Archäologie beeinflusste1 – besonders deutlich auf dem Feld der ‚Meisterforschung‘2. Damit befinden wir uns in einer ähnlichen Situation wie die Antike, die zwischen Kunst und Nicht-Kunst, zwischen Kunst und Handwerk keinen grundsätzlichen Unterschied kannte. Graduelle Unterschiede bei der Beurteilung von Artefakten machte die Antike aber durchaus: Schon Homer hob den besonderen Rang bestimmter Produkte des Handwerks hervor, etwa den des Schildes des Achilleus, geschaffen von Hephaistos, oder den des berühmten Bechers des Nestor3. Später wurden Bildhauer wie Polyklet und Lysipp oder Maler wie Polygnot und Apelles wegen ihrer besonderen Fähigkeiten und ‚Erfindungen‘ aus der Menge ihrer Kollegen deutlich herausgehoben. Allein der auf solchen anerkannten Leistungen beruhende Ruhm ihrer Schöpfer, nicht eine die Künstler vor anderen Handwerkern auszeichnende ‚Genialität‘ im Sinne Kants, galt als Gütesiegel bestimmter Kunstwerke4. Befreit von der Last, die Grenze zwischen Kunst und Kunstgewerbe bestimmen zu müssen, betrachtet der Historiker alle von Menschen produzierten Objekte, also alle Objekte auch der Archäologie zunächst unterschiedslos als Artefakte. Unterschiedlich sind freilich die Produktionsprozesse, aus denen einzelne Artefakte hervorgegangen sind, vor allem der Grad an intellektueller und künstlerisch-technischer Reflexion, der die Produktion steuerte. Je komplexer die Voraussetzungen waren, die zu einem bestimmten Werk führten und die in das Werk eingingen, um so eher sprechen wir von ‚Kunst‘. Derartige ‚Kunstwerke‘ enthalten mehr Informationen als etwa schlichte Gebrauchsgegenstände und können daher mit Interpretationen stärker ‚belastet‘ werden. Bei ihnen sind auch und gerade Details wichtig zu nehmen und können Abweichungen vom Üblichen nicht als ‚zufällig‘ abgetan werden. Die Interpretation solcher Kunstwerke muss von deren reflektiert gestalteter Form ausgehen. Sie kann dabei aber nicht stehen bleiben, wenn sie Form mit Geschichte verknüpfen will, wenn ein historischer Kontext rekonstruiert werden soll: Dieser Kontext (mit Blick z.B. auf Anlass, Auftraggeber, Material, Technik, auch künstlerische Konventionen) bedingt und erklärt Form und Funktion des Kunstwerks, doch zugleich wird er erst durch das Kunstwerk sichtbar und näher bestimmt.
1 Franke (1976). 2 Borbein (2005) 224–226. 3 Schild des Achilleus: Hom. Il. 18,478–613. – Nestorbecher: Hom. Il. 11,632–637; Od. 3, 40–63. Vgl. Himmelmann (1969) bes. 28–49. 4 Overbeck (1868) Nr. 967–977 (Polyklet); Nr. 1508–1512 (Lysipp); Nr. 1067–1079 (Polygnot); Nr. 1890–1906 (Apelles). – Auf den Basen älterer und zeitgenössischer Skulpturen der ‚Kunstsammlung‘ der Attaliden in Pergamon waren die Namen (Signaturen) der entsprechenden Bildhauer eingemeißelt, dazu: Schober (1951) 39–42. – Plin. n. h. 36, 27–29 vermisst etwas Wichtiges, wenn der Name des Bildhauers einer Statue unbekannt ist.
246
Adolf H. Borbein
Bei der historischen Interpretation von antiken ‚Kunstwerken‘ ist die Klassische Archäologie – im Unterschied zur Prähistorie – nicht auf die Form und Formtradition allein und etwa einen Fundzusammenhang angewiesen. Zu der Formanalyse und überhaupt dem archäologischen Befund tritt hier die literarische und epigraphische Überlieferung. Diese muss sich nicht direkt auf das zu deutende Artefakt beziehen; sie ist auch dann wichtig, wenn sie – z.B. die Epen Homers und Vergils – nur den allgemeinen historischen und kulturellen Kontext erhellen, in den das konkrete Werk gehört5.
3 Geschichte Wenn wir die künstlerische Form als Medium der Geschichte begreifen, dann verwenden wir einen Begriff von Geschichte, der sich seit dem 18. Jahrhundert in den ‚westlichen‘ historischen Wissenschaften ausgebildet hat6. Dementsprechend (re)konstruieren wir die Vergangenheit nach unseren eigenen Kategorien und in unserem eigenen Interesse. Auch das uns zunächst fremde historische Bewusstsein der Antike können wir nur auf diesem Umweg zu erfassen versuchen. In der Klassischen Archäologie wurde schon früh ein Begriff von Geschichte wirksam, wie ihn J. J. Winckelmann in seiner Geschichte der Kunst des Alterthums (1764) definiert hatte. Winckelmann, der als erster einen engen Zusammenhang zwischen Kunst und Geschichte postulierte, unterschied Geschichte „in der weiteren Bedeutung“ von Geschichte „im engeren Verstande“7. Letztere ist die Ereignisgeschichte, auch die Sozialgeschichte oder – nach Winckelmann – „die äußeren Umstände“ (vom Klima bis zur politischen Verfassung), unter denen Kunst entsteht8. Geschichte „in der weiteren Bedeutung“ ist dagegen mehr als die bloße Erzählung einer Zeitfolge und der sich darin ereignenden Veränderungen; ihr eigentliches Ziel ist es nach Winckelmann, Sinn und Zweck der historischen Veränderungen zu erkennen, sogar Lehren daraus zu ziehen und schließlich zu einem „Lehrgebäude“, einem allgemein gültigen System der aus dem historischen Studium ableitbaren Einsichten zu gelangen. Winckelmann beruft sich hier ausdrücklich auf die umfassendere Bedeutung, die Geschichte, historíe, in der griechischen Sprache habe. Er denkt dabei wohl vor allem an Herodot und Thukydides, die sich mit der Schilderung von Fakten und Abläufen nicht begnügten, vielmehr etwas Allgemeingültiges, für künftige Generationen Nützliches herausfinden wollten: Geschichte als ktêmá te es aieí9.
5 6 7 8 9
Zu den Problemen der Formanalyse auch Borbein (2000). Scholtz (1974). Winckelmann (2002) XVI (IX–X). Dazu zuletzt Décultot (2009). Thuk. 1, 22, 4.
Das Medium der künstlerischen Form
247
Winckelmann erforschte die Vergangenheit nicht um der Vergangenheit willen; er wollte am Beispiel insbesondere der griechischen Kunst zeigen, unter welchen äußeren Bedingungen eine Kunst entsteht, die Maßstab und Vorbild sein muss noch für die Gegenwart. Das antike Kunstwerk ist auch bei ihm ein Medium der Geschichte, auch bei ihm reflektiert Kunst Geschichte. Sein Interesse zielt aber weniger auf historische Erkenntnis qua Kunst; es zielt umgekehrt primär auf das Begreifen von Kunst qua Geschichte. Beide Richtungen des Interesses an Kunst (am Artefakt) und Geschichte sind auch heute möglich und ergebnisreich. Um ein Beispiel zu geben: Entweder analysiert man die einzelnen Teile der Ara Pacis Augustae, um dort eine bestimmte politische Ideologie zu erkennen, oder man geht von der durch andere Medien bekannten augusteischen Ideologie aus, um ein Werk wie die Ara Pacis zu verstehen. Welche Richtung des Interesses und der Interpretation vorzuziehen ist, kann von objektiven Gegebenheiten der künstlerischen und historischen Überlieferung abhängen, aber auch von subjektiven Vorentscheidungen des einzelnen Forschers. In der Praxis werden beide Richtungen sich nach Möglichkeit durchdringen und ergänzen.
4 Subjektives Interesse Die Beschäftigung mit Kunst und vor allem mit ihren formalen Aspekten gilt wegen der damit notwendig verbundenen subjektiven Komponente oft – und wenig reflektiert – als unwissenschaftlich. Doch subjektiv ist unsere Wahrnehmung der Welt in jedem Fall – obwohl wir hoffen können, dabei dennoch etwas auch Objektives zu erfassen. Das gilt ebenso für die Erforschung der Vergangenheit: Wir vertrauen darauf, bei unserer subjektiven Betrachtung etwas einst objektiv Vorhandenes zu erkennen – auch wenn wir wissen, dass es sich immer nur um Teilaspekte, Teilwahrheiten handelt. Nur in Bezug auf uns, auf unsere Erkenntnismöglichkeiten und Interessen können wir Geschichtsforschung betreiben – und nur so, als unser Konstrukt, wird Geschichte mehr als eine Anhäufung toter Fakten. Auch die Medien, die uns Geschichte vermitteln, betrachten und beurteilen wir mit unseren Augen. Wenn wir sie anwenden, um Geschichte zu (re)konstruieren, werden sie zu Werkzeugen unseres Erkenntnisinteresses. Andererseits handelt der Historiker (Archäologe) zumeist nicht als isoliertes Subjekt: Andere teilen seine Fragestellungen und Methoden; es gibt ein allgemeines, zeitgebundenes Interesse an der Vergangenheit. Dieses Interesse ist oft darauf gerichtet, für gegenwärtige Probleme historische Parallelen zu finden und aktuelle Diskussionen auf Phänomene der Vergangenheit zu übertragen. Anders ausgedrückt: die Gegenwart sensibilisiert für bestimmte Aspekte der Vergangenheit. Die in der Forschung wechselnde Beliebtheit bestimmter Fragestellungen und die wechselnde Bevorzugung bestimmter Epochen der Vergangenheit erscheint daher nicht nur gerechtfertigt, sondern als geradezu notwendig für den Fortschritt der Erkenntnis.
248
Adolf H. Borbein
5 Form und Stil Dass z.B. die von einer griechischen Polis in ein Heiligtum geweihte Statuengruppe oder die Ara Pacis Augustae historische Zeugnisse sind und also auch Medien der Geschichte, das versteht sich von selbst. Wie aber kann die gestaltete Form als solche, d.h. zunächst unabhängig von ihrem aktuellen Darstellungszweck, ein Medium der Geschichte sein? Kann die künstlerische Form eine Grundlage abgeben für die (Re)konstruktion von Geschichte? Der Historiker erkennt das Spezifische einer künstlerischen Form erst im Vergleich mit anderen Formen. Er versucht, Eigenschaften zu ermitteln, die einer Gruppe von Artefakten gemeinsam sind und die sie von anderen Artefakten mehr oder weniger stark unterscheiden. Das heißt: Er beschreibt den ‚Stil‘ eines Artefakts/Kunstwerks. „Erst der Stilbegriff macht den Formbegriff wissenschaftlich fruchtbar“10. Ein wichtiges Ziel der Stilanalyse ist die Rekonstruktion der Stil-Geschichte oder Stil-Entwicklung, wie es am Beispiel der griechischen Kunst besonders intensiv und wirkungsvoll unternommen wurde. Hier vor allem konnte der Verlauf der Stilgeschichte zum Paradigma des geschichtlichen Prozesses überhaupt werden und – nicht zuletzt – zur vermeintlich sicheren Basis für Feindatierungen. Letzteres ist für die archäologische Praxis nach wie vor die wichtigste Art der Anwendung von Methoden der Stilanalyse. Die Gültigkeit, ja die Zulässigkeit einer rein formbezogenen, also ‚autonomen‘ Stilgeschichte oder gar von vermeintlich ‚logischen‘ Stilreihen wird heute nicht zu Unrecht bezweifelt. Oft nimmt man dabei fälschlich an, dass insbesondere Winckelmann die Archäologie mit dem Virus der Autonomie der Kunst infiziert habe. Winckelmann ging es darum zu zeigen, wie sich das ‚Wesen‘ der Kunst in der Geschichte entfaltet. Darin sah er aber kein autonomes Geschehen; er verknüpfte die Entwicklung der Kunst vielmehr unmittelbar mit dem Gang der allgemeinen, besonders der politischen Geschichte. Eine tatsächlich autonome Stilgeschichte – die freilich in reiner Form kaum je vertreten wurde – wurde erst in Verbindung mit jenem Entwicklungsbegriff möglich, der aus den Naturwissenschaften stammte und seit dem 18. Jahrhundert die Geisteswissenschaften beeinflusste11 – vom biologistischen Konzept von Wachstum, Blüte und Verfall (auch bei Winckelmann, der hier antiken Vorbildern folgte) bis hin zu mechanistischen Vorstellungen von gleichsam selbstläufigen, ‚notwendigen‘ Entwicklungen gerade auch im Hinblick auf die Veränderung von Stilformen (z.B. die unumkehrbare Folge von ‚geschlossenen‘ zu ‚offenen‘ Formen)12. Trotz aller möglichen Kritik an den Grundlagen des Verfahrens hat die Archäologie aber mit Erfolg Techniken ausgebildet, durch Formanalyse und Vergleich zu Stil-
10 Schweitzer (1969) 175. 11 Kocka (2010). 12 Vgl. Schweitzer (1969) 175–176 und 202 (Hausmann); Himmelmann (1960) bes. 16.
Das Medium der künstlerischen Form
249
reihen zu gelangen und über diese zu relativen Datierungen. Für den Historiker werden solche relativen Datierungen dann bedeutsam, wenn es gelingt, die Stilreihen an einigen Punkten mit von außen kommenden absoluten Daten zu verknüpfen, d.h. sie im geschichtlichen Verlauf zu verorten. Andererseits bleibt es eine Tatsache, dass es Stilreihen oder formale Entwicklungen gibt, die als solche historische Prozesse reflektieren. Artefakte/Kunstwerke erscheinen hier nicht als sekundäre Illustrationen, sondern als primäre Zeugnisse von geschichtlichen Zuständen und Ereignissen. Damit eröffnen sie einen eigenen, spezifischen Zugang zur Geschichte. Zum Medium der Geschichte wird neben ihrem Inhalt ihre Form. Insofern, also im Hinblick auf das Spezifische der gestalteten Form, kann man sogar von Autonomie der Kunst sprechen13.
6 Form und Zeitgeist Die Kunst hat ihre eigene Geschichte, aber diese erschöpft sich nicht in der Entwicklung der Form und der Stilgeschichte. Kunst reflektiert wie jedes Artefakt die Umwelt, in der sie entstand. Aber was reflektiert sie? Sind es nur Verhältnisse und Absichten, die unmittelbar mit ihrer Entstehung verbunden sind wie Anlass, Auftraggeber, Aufstellungsort, Zielgruppe, Materialbeschaffenheit, Werkstatteigenheiten, künstlerische und ikonographische Traditionen? Oder eröffnet reflektiert produzierte Kunst – und zwar als gestaltete Form – einen Zugang zu Phänomenen und Kräften, die hinter den Formkonzepten zu vermuten sind und die auch die materiellen Voraussetzungen von Kunstwerken beeinflussten? Eröffnet sie einen Zugang zum Weltverständnis, zum ‚Zeitgeist‘ oder – wie man heute lieber sagt – zur ‚Mentalität‘ einer Gruppe, einer Epoche? Das ist in der Tat zu erwarten. Denn darauf deutet schon die Möglichkeit, bestimmte Stilformen einer Epoche zu einem Zeitstil zusammenzufassen, der dazu dienen kann, Epochen voneinander abzugrenzen und deren charakteristische Merkmale zu definieren. Eine spezifische Form des Zeitstils spielt z.B. in der Porträtforschung eine wichtige Rolle: das ‚Zeitgesicht‘, das mit einem bestimmten physiognomischen Typus zugleich die ästhetischen Normen und Vorlieben einer Epoche repräsentiert14. Die Darstellung des nackten männlichen Körpers in der griechischen Kunst von der geometrischen bis zur klassischen Epoche führt zur Ausbildung und Perfektionierung relativ weniger Bildtypen. Sie lässt dabei einen alle Detailformen in unterschiedlicher Intensität prägenden Wandel in der Auffassung des menschlichen Körpers und seiner Funktionen erkennen. Dass es sich hier nicht um ein allein ästhetisches Phänomen handelt, verdeutlicht am besten die Darstellungsweise, die den Übergang zur Klassik markiert: Der ‚Kontrapost‘ zeigt den Körper als ein gegliedertes Gebilde, des-
13 Gadamer (1972) 541. 14 Zanker (1982); Bergmann (1982).
250
Adolf H. Borbein
sen Teile eigenständig und zugleich aufeinander bezogen sind. Dadurch, dass der Konflikt zwischen Schwerkraft und Lebensimpuls durch alle Glieder hindurch sichtbar ausgetragen wird, werden Standfestigkeit und Bewegungsfähigkeit des Körpers, die Grundbedingungen menschlichen Lebens und Handelns, unmittelbar sinnfällig. Ziel des Kontraposts ist aber nicht primär eine richtigere Wiedergabe der Wirklichkeit, sondern vielmehr deren Interpretation. Diese Interpretation ist Ausdruck eines zeittypischen Weltverständnisses, einer Mentalität oder Sehweise, die die Wirklichkeit zu verstehen suchte, indem sie sie – wie die Atomisten – auf kleinste Einheiten zurückführte, und indem sie – wie Heraklit – aus antagonistischen Elementen ein organisches Ganzes entstehen ließ. Die politischen Reformen des Kleisthenes und die Ausbildung der Demokratie beruhen auf dieser gleichen Weltsicht, für die die künstlerische Form des Kontraposts also ein gleichrangiges und primäres Zeugnis ist15. Der tiefgreifende Mentalitätswandel, der sich in Griechenland mit dem Ende der Hochklassik an der Wende vom 5. zum 4. Jahrhundert v. Chr. ereignet hat, äußert sich in der Kunst in einem veränderten Rezeptionsverhalten. Bildwerk und Betrachter treten – z.B. durch die Art der Aufstellung von Statuen – in eine reflektierende Distanz, was sich – etwa durch die Privilegierung einer Hauptansicht – unmittelbar auch in der formalen Gestaltung niederschlägt. So setzen die Künstler jetzt mehr als zuvor auf die optische Wirkung von Konturlinien16. Das Vortäuschen plastischer Formen durch den optischen Effekt des Wechsels von beleuchteten und verschatteten Partien kennzeichnet im späten 2. Jahrhundert n. Chr. den ‚antoninischen Stilwandel‘. Auch hier, am Beginn der Spätantike, signalisiert die künstlerische Form einen Mentalitätswandel17. Ein letztes Beispiel: Tonio Hölscher hat überzeugend vorgeführt, wie auf dem ‚Alexandermosaik‘ die Darstellung des Raumes und der in ihm sich vollziehenden Handlung nicht nur einen Wandel in der militärischen Strategie und der sozialen Ordnung anzeigt, sondern eine veränderte Stellung zur Welt überhaupt am Beginn der Epoche des Hellenismus18.
7 Usurpierte Form Veränderung der Form führt immer zu einer Veränderung der inhaltlichen Aussage des Artefakts oder setzt diese voraus. Auch deshalb bleiben Form und Geschichte eng miteinander verflochten. Wie aber verhält es sich in den Fällen, in denen Auftraggeber und Künstler sich weigern, für die zu vermittelnden Inhalte eine eigene Form zu
15 16 17 18
Borbein (1989). Borbein (1973). Rodenwaldt (1935); vgl. die differenzierenden Interpretationen von Jung (1984) und Pirson (1996). Hölscher (1973) 122–169.
Das Medium der künstlerischen Form
251
finden und stattdessen Formen usurpieren, die für andere Zwecke und Inhalte geschaffen wurden? Auch hier lässt sich der Stil der Entstehungszeit in aller Regel zumindest im Detail nicht unterdrücken, obwohl es nicht immer leicht fällt, ihn zu erkennen. Römische Kopien griechischer Kunstwerke können deren Aussehen und Stil so getreu reproduzieren, dass sie die kopierten Originale weitgehend vertreten. Dennoch lassen sie auch den römischen Zeitstil erkennen, der es erlaubt, sie – mit mehr oder weniger Mühe – zu datieren19. Griechische oder römische archaistische Schöpfungen wird man ohnehin kaum mehr mit archaischen verwechseln. Schwieriger sind Fälle, in denen wissenschaftliche Kriterien der Analyse zu fehlen scheinen und das Urteil schließlich auf subjektivem Ermessen, auf Kennerschaft beruhen muss: So bleibt es bisweilen zweifelhaft, ob eine Statue ein griechisches Original oder eine römische Kopie ist20, oder ob ein plastisches Porträt in der Antike oder als Nachschöpfung in der Neuzeit gearbeitet wurde21. Besonders irritierend sind Versuche, der zeitgenössischen Formensprache etwas ganz anderes entgegenzusetzen und dabei die Kennzeichen der eigenen Zeit bewusst zu unterdrücken. Beispiele dafür sind die Verkleidung des wieder zu errichtenden Hohenzollern-Schlosses in der Mitte Berlins mit Kopien der historischen Fassaden oder die Skulpturen des Schotten Alexander Stoddart (geb. 1959) im Stil der um 1800 tätigen Bildhauer wie Thorvaldsen und Canova22. Die 1964/65 geschaffene Gruppe von 114 Großterrakotten in Dayi (Provinz Sichuan, China) zeigt Szenen aus dem Leben eines Großgrundbesitzers im vorrevolutionären China23. Die einzelnen Figuren wirken ‚stilfrei‘ wie nach der Natur modelliert – ein Verismus mit kritischer Absicht, doch nicht leicht mit der Kategorie ‚sozialistischer Realismus‘ zu erfassen. Kunst ist zwar als solche und auf naive Weise rezipierbar, und auch so kann sie Genuss und Erkenntnis fördern. Will man sie aber voll verstehen und dementsprechend ästhetisch würdigen, erweist sich der historische Kontext als unerlässlich.
19 Zum Stand der Diskussion: Junker u. Stähli (2008). 20 Z.B. die Aphrodite mit der Schildkröte, Berlin, Antikensammlung Inv. Sk 1459 (K5): Angelos Delivorrias, in: Klassik (2002) 347 Kat Nr. 229. 21 Z.B. die Büste des Commodus, Malibu, J. Paul Getty Museum Inv.-Nr. 92.SA.48: Miner u. Daehner (2010). 22 Stoddart (2005) 353–366. 23 Schlicht u. Hollein (2009).
252
Adolf H. Borbein
Literaturverzeichnis Bergmann (1982): Marianne Bergmann, „Zeittypen im Kaiserporträt?“, Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universität zu Berlin, Gesellschafts- und Sprachwissenschaftliche Reihe 2/3, 143–147. Borbein (1973): Adolf H. Borbein, „Die griechische Statue des 4. Jahrhunderts v. Chr. Formanalytische Untersuchungen zur Kunst der Nachklassik“, Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts 88, 43–212. Borbein (1989): Adolf H. Borbein, „Tendenzen der Stilgeschichte der bildenden Kunst und politischsoziale Entwicklungen zwischen Kleisthenes und Perikles“, in: Wolfgang Schuller, Wolfram Hoepfner u. Ernst Ludwig Schwandner (Hgg.), Demokratie und Architektur. Der hippodamische Städtebau und die Entstehung der Demokratie (Konstanzer Symposion vom 17. bis 19. Juli 1987), München, 91–108. Borbein (2000): Adolf H. Borbein, „Formanalyse“, in: Adolf H. Borbein, Tonio Hölscher u. Paul Zanker (Hgg.), Klassische Archäologie. Eine Einführung, Berlin, 109–128. Borbein (2005): Adolf H. Borbein, „Sinn und Unsinn der Meisterforschung“, in: Volker Michael Strocka (Hg.), Meisterwerke (Internationales Symposion anlässlich des 150. Geburtstages von Adolf Furtwängler, Freiburg im Breisgau 30. Juni-3. Juli 2003), München, 223–233. Décultot (2009): Élisabeth Décultot, „Anthropologie et Ethnologie d’histoire de l’art au XVIIIe siècle. Winckelmann et le tableau des peuples antiques“, Études Germaniques 64.4, 821–840. Franke (1976): Ursula Franke, „Kunst, Kunstwerk“, in: Joachim Ritter u. Karlfried Gründer (Hgg.), Historisches Wörterbuch der Philosophie 4, Basel, 1378–1402. Gadamer (1972): Hans-Georg Gadamer, Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik, 3. Auflage, Tübingen. Himmelmann (1960): Nikolaus Himmelmann-Wildschütz, „Der Entwicklungsbegriff der modernen Archäologie“, Marburger Winckelmann-Programm, 1960, 13–40. Himmelmann (1969): Nikolaus Himmelmann, Über bildende Kunst in der homerischen Gesellschaft (Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz, Abhandlungen der Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Klasse 1969, 7), Mainz. Hölscher (1973): Tonio Hölscher, Griechische Historienbilder des 5. und 4. Jahrhunderts v. Chr., Würzburg. Jung (1984): Helmut Jung, „Zur Vorgeschichte des spätantoninischen Stilwandels“, Marburger Winckelmann-Programm, 1984, 59–103. Junker u. Stähli (2008): Klaus Junker u. Adrian Stähli, unter Mitarbeit von Christian Kunze (Hgg.), Original und Kopie. Formen und Konzepte der Nachahmung in der antiken Kunst (Akten des Kolloquiums in Berlin 17.–19. Februar 2005), Wiesbaden. Klassik (2002): Die griechische Klassik. Idee oder Wirklichkeit. (Katalog zur Ausstellung der Antikensammlung Berlin, 1. März – 2. Juni 2002), Berlin. Kocka (2010): Jürgen Kocka, „Evolution und Revolution: begriffsgeschichtliche Überlegungen“, in: Freia Hartung (Hg.), Wer hat die Deutungshoheit über die Evolution? (Streitgespräche in den Wissenschaftlichen Sitzungen der Versammlung der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften am 21. November 2008 und am 26. Juni 2009, Debatte Heft 8), Berlin, 11–16. Miner u. Daehner (2010): Carolyn Miner u. Jens Daehner, „Emperor in the Arena“, Apollo, Febr. 2010, 42–47. Overbeck (1868): Johannes Overbeck, Die antiken Schriftquellen zur Geschichte der bildenden Künste bei den Griechen, Leipzig. Pirson (1996): Felix Pirson, „Style and Message on the Column of Marcus Aurelius“, Papers of the British School at Rome 64, 139–179.
Das Medium der künstlerischen Form
253
Rodenwaldt (1935): Gerhart Rodenwaldt, Über den Stilwandel in der antoninischen Kunst (Abhandlungen der Preußischen Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse 3), Berlin. Schlicht u. Hollein (2009): Esther Schlicht u. Max Hollein, Kunst für Millionen: 100 Skulpturen der Mao-Zeit. (Ausstellungskatalog „Kunst für Millionen: 100 Skulpturen der Mao-Zeit“, Frankfurt, 24. September 2009–03. Januar 2010), München. Schober (1951): Arnold Schober, Die Kunst von Pergamon. Innsbruck/Wien. Scholtz (1974): Gunter Scholtz, „Geschichte“, in: Joachim Ritter (Hg.), Historisches Wörterbuch der Philosophie 3, Basel, 361–380. Schweitzer (1969): Bernhard Schweitzer, „Das Problem der Form in der Kunst des Altertums“, in: Ulrich Hausmann (Hg.), Allgemeine Grundlagen der Archäologie (Handbuch der Archäologie), München, 163–203. Stoddart (2005): Alexander Stoddart, „Looking for silence: How I discovered Thorvaldsen“, in: Paul Henderson Scott (Hg.), Spirits of the Age: Scottish Self Portraits, Edinburgh, 353–366. Winckelmann (2002): Johann Joachim Winckelmann, „Geschichte der Kunst des Alterthums. Text: Erste Auflage Dresden 1764. Zweite Auflage Wien 1776“, in: Adolf H. Borbein, Thomas W. Gaehtgens, Johannes Irmscher u. Max Kunze (Hgg.), J. J. Winckelmann, Schriften und Nachlaß 4.1, Mainz. Zanker (1982): Paul Zanker, „Herrscherbild und Zeitgesicht“, Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universität zu Berlin, Gesellschafts- und Sprachwissenschaftliche Reihe 2/3, 307–312.
254
Tonio Hölscher
Tonio Hölscher
Monumente der Geschichte – Geschichte als Monument? 1 Einleitung Es ist alles andere als selbstverständlich, wenn eine Gesellschaft Denkmäler errichtet. Viele Gesellschaften kommen ohne Denkmäler aus. In jenen Gesellschaften, die Denkmäler setzen, ist dies oft eine höchst kontroverse Praxis. In neuerer Zeit mehren sich die kritischen Stimmen: „Die meisten Denkmäler sind hohl“, konstatiert der polnische Aphoristiker Stanislaw Jerzy Lec aus leidvoller Erfahrung mit den Monumenten der Unterdrücker seines Volkes. Die Kultur des Denkmals entwickelt sich in den betreffenden Gesellschaften unter spezifischen Bedingungen. Sie setzt zunächst Strukturen der Macht voraus, die bestimmte Personen oder Ereignisse autoritativ als denkmalwürdig zur Geltung bringt; sie begründet sich auf ein ausgeprägtes Netz von ideellen Wertvorstellungen und Leitbildern, die diesen Personen und Ereignissen ihre Gültigkeit sichern; sie benötigt einen Raum und eine Praxis der ‚Öffentlichkeit‘, in der diese Themen kollektive Wirkung entfalten und Anerkennung gewinnen können; und sie bezeugt ein Konzept von gemeinschaftlicher Zeit, in dem die Gegenwart sich im Hinblick auf die Vergangenheit und die Zukunft positioniert. Eine Schlüsselstellung in der Entstehungsgeschichte des öffentlichen Denkmals nimmt die Statuengruppe der Tyrannenmörder im antiken Athen ein. Bald nachdem Kleisthenes dort im Jahr 508–7 v. Chr. eine isonome Staatsordnung durchgesetzt hatte, muss ein einflussreicher Mann, wohl aus der neuen Führungsgruppe der Stadt, in der Volksversammlung den Antrag gestellt haben, für Aristogeiton und Harmodios, die Helden des sechs Jahre zurückliegenden, vergeblichen Attentats auf die Tyrannen der Stadt, Bildnisstatuen auf der Agora aufzustellen. Zur Begründung wird man retrospektiv den ‚unvergänglichen Ruhm‘ angeführt haben, den die beiden Helden verdient hätten, und prospektiv ihre paradigmatische Bedeutung als Vorbilder politischen Handelns. Die Standbilder wurden so emphatisch als Symbole des attischen Staates betrachtet, dass die Perser sie bei der Eroberung 480 v. Chr. abtransportierten; den Athenern waren sie so wichtig, dass sie unmittelbar danach eine Ersatzgruppe aufstellten (Abb. 1)1. Ein ähnlicher Vorgang, aber unter ganz anderen Vorzeichen, ist wenig später für Syrakus überliefert. Der Tyrann Gelon soll nach dem Sieg bei Himera 480 v. Chr. ohne
1 Zur Statuengruppe der Tyrannenmörder s. Brunnsaker (1971); Fehr (1984); Taylour (1992); Hölscher F. (2010).
Monumente der Geschichte – Geschichte als Monument?
255
Abb. 1: Denkmal der Tyrannenmörder Aristogeiton und Harmodios, 477/6 v. Chr. Rekonstruktion in Gips. Roma, La Sapienza, Museo dei Gessi.
256
Tonio Hölscher
Waffen vor die Volksversammlung getreten sein, an seine Verdienste für die Stadt erinnert und dann sein Amt zur Verfügung gestellt haben. Die Syrakusaner lehnten das ab, bestätigten ihn in seiner Herrschaft – und errichteten ihm eine Bildnisstatue, angeblich in einem Hera-Tempel. Sie stellte Gelon im ungegürteten Chiton dar, also in der expliziten Schutzlosigkeit, in der er aufgetreten war. Auch für dies Standbild dürfte ein Antrag an das Volk gestellt worden sein, auch dabei müssen Verdienste des Geehrten in der Vergangenheit und Vorbildlichkeit für die Zukunft maßgeblich gewesen sein, wenn auch sehr viel stärker auf seine individuelle Person bezogen2. Beide Anträge hatten am Ende Erfolg – aber man kann kaum fehl gehen mit der Vermutung, dass es weit mehr als bei gewöhnlichen Statuensetzungen zu längeren Debatten gekommen sein muss. In Athen gab es noch zahlreiche, durchaus einflussreiche Anhänger der vertriebenen Tyrannen, in Syrakus werden kaum alle Bürger mit der Fortsetzung der Alleinherrschaft einverstanden gewesen sein. Aber auch bei den Befürwortern der neuen Ordnung in Athen wie bei denen der Herrschaft Gelons in Syrakus kann es zu Irritationen gekommen sein. Denn das hatte es bis jetzt noch nicht gegeben: Bildwerke im öffentlichen Raum, in Athen sogar nicht einmal im Heiligtum, auch nicht auf dem Grab, die einzig dem rühmenden Gedächtnis an Personen oder ihre Leistung dienten. Und dies auf Beschluss der gesamten politischen Gemeinschaft. Erst recht konnte niemand wissen, dass damit ein Anfang gesetzt wurde für das, was wir heute ein ‚politisches Denkmal‘ nennen. Die beiden Fälle zeigen, dass das Phänomen neu, aber weder charakteristisch athenisch noch spezifisch ‚demokratisch‘ ist. Vielmehr ist es in einem neuen Sinn ‚politisch‘.
2 Definition: Monu-Mentalität Die Standbilder der Tyrannenmörder können dazu dienen, ein genaueres Verständnis des Begriffs des ‚Denkmals‘ zu entwickeln. Dabei geht es nicht darum, eine statische Definition von ‚Merkmalen‘ zu geben, sondern ein dynamisches Konzept von Funktionen und Intentionen zu bezeichnen: nicht was ein Denkmal ‚ist‘, sondern was es ‚will‘ und ‚leistet‘, wie es von seinen Initiatoren verwendet und von seinen Rezipienten aufgenommen wird3. Grundsätzlich weist der Begriff des Denkmals bzw. Monuments auf die Funktion und Intention hin, an etwas zu erinnern, etwas ins Gedächtnis zu rufen: eine Person oder eine Idee, die im Kontext des öffentlichen Lebens in materieller und visueller
2 Ael. VH13, 37; Krumeich (1997) 30–31. 3 Die Literatur zum Begriff des Denkmals, gewöhnlich im Bereich der neueren Kunstgeschichte entwickelt, ist umfangreich. Kleine Auswahl: Scharf (1984) bes. 1–10; Mittig (1987); Borg (1991); Reuße (1995) bes. 13–28; Alings (1996) bes. 3–15; Bradley (1998); Menkovic (1998); Schlie (2008). Für Hinweise auf Literatur zur prähistorischen Denkmal-Kultur danke ich Mariya Ivanova.
Monumente der Geschichte – Geschichte als Monument?
257
Form präsent gemacht werden sollen. Diese grundsätzliche Referentialität ist in den griechischen und lateinischen wie den neuzeitlichen Begriffen mnema, monumentum, Denkmal enthalten, die alle das Gedächtnis an etwas zum Inhalt haben. Die Intention, bestimmte Personen oder Ereignisse im Gedächtnis zu halten, kann von unterschiedlicher Intensität sein. Die Statuen der Tyrannenmörder erinnern mit starker Emphase an einen entscheidenden historischen Vorgang; dagegen bezeugen Votivstatuen in Heiligtümern, etwa das Bild des Rhombos auf der Athener Akropolis, der ein Kalb auf der Schulter zum Opfer trägt, oder die Familiengruppe eines gewissen -]arches mit Ehefrau und Kindern im Hera-Heiligtum von Samos, zunächst die Frömmigkeit des Dedikanten gegenüber der Gottheit und sichern erst in zweiter Hinsicht ihren Ruhm für die Nachwelt. Insofern kann Denkmalhaftigkeit als eine Qualität betrachtet werden, die den materiellen Trägern von Gedächtnis teils in mehr, teils in minder starkem Maß eigen ist. Begriffe. Die Begriffe ‚Monument‘ oder ‚Denkmal‘ können in drei verschiedenen Bedeutungen verwendet werden4: – Überrest und Zeugnis der Vergangenheit. Die ‚Denkmäler‘ des antiken Rom sind ‚monumentale‘ Zeugnisse der römischen Kultur, im Gegensatz zu den schriftlichen Quellen. Es ist diese breite Bedeutung des ‚Denkmals‘, die der Aufgabe des Denkmal-Schutzes zugrunde liegt. Darin ist grundsätzlich keine Intention der Urheber impliziert, historisches Gedächtnis zu stiften: Tempel, Häuser und Straßen werden zunächst nicht zu dem Zweck gebaut, die Erinnerung an Ereignisse oder Personen für die Nachwelt wach zu halten. Vielmehr ist es die Sicht der Nachwelt, die die Ruinen als kulturelle Zeugnisse der Vergangenheit wertet. Diese breite Bedeutung des Begriffs ‚Denkmal‘ kann als dokumentarisch, un-intentional und rezeptions-bedingt bezeichnet werden. – Manifestation von herausragender, überzeitlicher Bedeutung. Seit dem Neolithikum haben Gesellschaften von komplexerer Kultur ‚Monumente‘ errichtet, in denen sie sich selbst dauerhafte sichtbare Zeichen für ihre zentralen Strukturen und Praktiken der Macht und Identität setzten. In Griechenland und Rom wurde eine Kultur der Monumente, nach dem Vorgang des Vorderen Orients und Ägyptens, in der archaischen Zeit des 8. bis 6. Jahrhunderts v. Chr. in der Architektur von Tempeln und anderen öffentlichen Bauten sowie in großformatigen Skulpturen für Heiligtümer und Gräber ausgebildet und in den folgenden Epochen zu einer spezifischen Kultur der öffentlichen Räume weiterentwickelt. Der Parthenon in Athen wurde von der athenischen Bürgerschaft, das Colosseum in Rom vom Kaiser Vespasian zum öffentlichen Gebrauch für Götterkult und Unterhaltung errich-
4 Lesenswert dazu immer noch Droysen (1857) §§ 19–26; Riegl (1903/1995) 144–193 unterscheidet aus kunsthistorischer Perspektive verschiedene „Denkmalwerte“, in Bezug auf die Vergangenheit „gewollter Erinnerungswert“, „historischer Wert“ und „Alterswert“, in Bezug auf die Gegenwart „Gebrauchswert“ und „Kunstwert“.
258
–
Tonio Hölscher
tet, zugleich aber auch als Ausdruck der besonderen Frömmigkeit und Freigebigkeit, Macht und ‚Größe‘ ihrer Bauherren. Diese Rühmung richtet sich nicht nur an die eigene Zeit, sondern auch an die Zukunft. Solche Referenz auf einen berühmten Bauherren kann sogar im Namen des Bauwerks zum Ausdruck kommen, darüber hinaus kann auch ein ruhmreiches Ereignis hinter der Gründung stehen: Die Bauten der Athener Akropolis waren im Kreis des Perikles konzipiert worden und wurden als ‚Leistungen des Perikles‘ bezeichnet; das Colosseum war aus der Beute des Jüdischen Kriegs finanziert und wurde Amphitheatrum Flavium genannt. Hier ist also eine Intention deutlich, den Ruhm einer Person und seiner Leistungen für die Nachwelt präsent zu halten – doch dies ist nicht die explizite Botschaft des Bauwerks. Wenn wir solche Bauten als ‚Denkmäler‘ ihrer Bauherren verstehen, dann ist deren kommemorative Funktion intentional, bleibt dabei aber implizit5. Stiftung von ‚öffentlichem Gedächtnis‘. Die Statuengruppe der Tyrannenmörder in Athen oder die Traianssäule in Rom wurden von der athenischen Bürgerschaft bzw. dem römischen Senat und Volk mit der Intention errichtet, die Gründerhelden und die Gründungstat des neuen ‚isonomen‘ (später: demokratischen) Staates bzw. den siegreichen Kaiser und seine triumphalen Kriegszüge zu ehren und ihnen ein immerwährendes Gedächtnis zu sichern. Diese Denk-Mäler des emphatischen Gedächtnisses werden im Folgenden auch als ‚Monumente‘ bezeichnet. Die ruhmreichen Themen des Gedächtnisses, Personen und Ereignisse, können der Vergangenheit oder der Gegenwart angehören, in jedem Fall aber ist es eine ‚prospektive Erinnerung‘, die für die Zukunft bewahrt werden soll. Die Erinnerungen sind Träger emphatischer bildlicher Botschaften, die der einzige Zweck der ‚Denk-Mäler‘ sind. Kommemoration ist dabei nicht nur intentional, sondern auch explizit6.
In den Manifestationen von ‚Größe‘ wie in der Stiftung von öffentlichem Gedächtnis durch ‚Denkmäler‘ kommt eine Art von ‚Monu-Mentalität‘ zum Ausdruck, die bei den betreffenden Gesellschaften eine emphatische kollektive Identität und einen spezifischen Anspruch auf dauerhafte Dominanz bezeugt. Solche ‚monu-mentale‘ SelbstPräsentationen können auch in anderen Medien auftreten, etwa in Ritualen, Zeremonien und Festen, in öffentlichen Reden und performativen Inszenierungen oder aufwändigen Lebensformen; sie greifen weit über die politische Identität hinaus in alle Bereiche der Kultur aus, haben aber meist einen starken Kristallisationspunkt in Strukturen der politischen Macht7.
5 Neolithikum: Bradley (1998). Ägypten: Assmann (1991); Assmann (1992) 167–177. 6 Prospektive Erinnerung: Assmann (1992) 170. 7 Zum Phänomen der Monumentalität, bezogen auf Ägypten, s. Assmann (1991); Assmann (1992) 170 spricht von „monumentalem Diskurs“. – Griechenland und Rom: Bergmann (2000).
Monumente der Geschichte – Geschichte als Monument?
259
Im Folgenden stehen die öffentlichen Denkmäler im Zentrum, die die Gesellschaften der Vergangenheit intentional, aus ihrer eigenen Perspektive, mit Blick in die eigene Zukunft, als explizite Träger von ‚öffentlichem Gedächtnis‘ gesetzt haben. Leistungen und Wirkungen. Die spezifischen Leistungen von öffentlichen Denkmälern können wie folgt beschrieben werden: 1. Der primäre Zweck von Denkmälern besteht darin, dass sie Personen, Ereignisse oder Ideen materiell und visuell in der Öffentlichkeit zur Darstellung bringen und damit autoritativ zu kollektiver Bedeutung erheben. Denkmäler verschaffen diesen Themen eine konkrete Präsenz, die sie von sich selbst aus nicht erreichen könnten. Sie sind Mittel gegen die Vergänglichkeit in der Zeit und gegen die Abwesenheit im Raum: Denkmäler sichern Personen und Ereignissen der Vergangenheit eine memoriale Gegenwart in der Gemeinschaft der Lebenden; sie schaffen absenten Personen der eigenen Zeit eine ständige Präsenz; und sie sichern immateriellen Konzepten, etwa der Freiheit oder des Friedens, eine wirkungsvolle Präsenz in der Lebenswelt. 2. Öffentliche Denkmäler werden von denjenigen politischen Akteuren errichtet oder zugelassen, die die Autorität über die öffentlichen Räume haben: Volksversammlung, Ratsversammlung oder Machthaber. Andere Initiatoren öffentlicher Denkmäler sind auf die Akzeptanz der obersten Autoritäten angewiesen. Jedes öffentliche Denkmal und das von ihm verkörperte öffentliche Gedächtnis ist damit direkt oder indirekt von den Institutionen oder Vertretern der Gemeinschaft autorisiert. 3. Die Schaffung der Präsenz in der Lebenswelt mit Denkmälern dient dazu, der Gemeinschaft einen konkreten Umgang mit den ‚abwesenden‘ Personen, Ereignissen und Ideen möglich zu machen. Sofern Denkmäler vor allem die Vergangenheit präsent machen, dienen sie dem Umgang mit ‚Geschichte‘. Es ist eine These dieses Beitrags, dass Denkmäler in der Antike einem zentralen Bedürfnis von Gemeinschaften nach Konstruktion von ‚Geschichte‘ entsprechen. 4. Ein semantischer Grundzug von Denkmälern besteht darin, dass sie einen Verweis geben auf etwas, das jenseits ihrer selbst liegt. Eine Kirche oder ein Schloss haben ihre primäre Bedeutung in sich selbst und ihrer eigenen Funktion. Denkmäler dagegen verweisen auf Personen, Ereignisse oder Ideen, die eine autonome Bedeutung haben. In diesem Sinn liegt bei den ikonischen Statuen von Aristogeiton und Harmodios die Bedeutung in der Referenz auf die historischen Tyrannenmörder, ihre Tat und ihre politischen Ideale. Aber auch anikonische Denkmäler wie das Berliner Holocaust-Mahnmal haben ihre Wirkung einzig durch den Bezug auf die Verbrechen des Nationalsozialismus. 5. Denkmäler besitzen eine besondere Intentionalität des Verweisens. Zwar stellen alle ikonischen Bilder Lebewesen und Gegenstände dar, die außerhalb ihrer selbst existieren, sei es in der Wirklichkeit, sei es in der Phantasie. Ein Denkmal wie die Tyrannenmörder aber stellt nicht nur dar, sondern prägt das Thema allen Betrachtern emphatisch ins Gedächtnis ein. Dies ist in der sprachlichen Bedeu-
260
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Tonio Hölscher
tung des ‚Denk-Mals‘ und des ‚Monuments‘ enthalten: das emphatische Ge-Denken, das eindringliche ‚monere‘, daran Erinnern. Die Emphase, mit der Denkmäler Anspruch auf öffentliches Gedächtnis erheben, begründet sich durch den Anspruch auf die zentrale und verbindliche Bedeutung ihrer ‚monumentalen‘ Gegenstände und Botschaften für die Gemeinschaft. Diese Themen werden von den Denkmälern über die Vergänglichkeit und Flüchtigkeit der Alltäglichkeit in die Dauer des kollektiven Gedächtnisses erhoben. Sie werden nicht in neutraler ‚sachlicher‘ Darstellung dem Urteil der Betrachter vorgestellt, sondern geben in ihrer Gestaltung intentional eine autoritative Deutung im Sinn einer ‚Botschaft‘ vor. Betrachter, die ein Denkmal anders, kritisch oder subversiv, sehen, tun das gegen seine explizite Intention. Diese kollektive Bedeutung entfalten die Denkmäler durch ihre Aufstellung im ‚monumentalen‘ öffentlichen Raum. Denkmäler beherrschen die Räume der Gemeinschaft: Agora und Forum, zentrale Heiligtümer, öffentliche Gebäude, frequentierte Straßen. Dort behaupten sie für die von ihnen repräsentierten Personen, Ereignisse und Ideen eine Präsenz im öffentlichen Gedächtnis, die unbedingte Anerkennung fordert. Die Beherrschung des öffentlichen Raumes setzt großen Maßstab voraus: Denkmäler müssen unübersehbar sein. Damit hängt weiterhin örtliche Stabilität zusammen: Sie dürfen nicht verrückbar sein. Denkmäler müssen sich dem Betrachter im Raum unausweichlich entgegenstellen und sich dem Gedächtnis mit unbestreitbarer ‚Monumentalität‘ aufzwingen. Denkmäler entfalten sich in der öffentlichen, das heißt in der gemeinschaftlichen Zeit. Dies ist nicht die genealogische Zeit der Familien und nicht die biographische Zeit von Individuen, sondern die Zeit der politischen Gemeinschaft. Diese ‚monumentale‘ Zeit schafft für die Gegenwart Orientierung in drei Zeiträumen: Die gegenwärtige Gemeinschaft verweist auf ihre mythischen Anfänge, in denen sie ihre Existenz begründet und ihre Maßstäbe setzt; sie schließt an die jüngere Vergangenheit an, als deren Fortsetzung sie sich darstellt; und sie ist bestrebt, für die Zukunft die Existenz und die Normen der Gemeinschaft zu sichern. Der Anspruch auf zeitüberdauernde Gültigkeit der Themen und Botschaften, für die die Denkmäler stehen, findet einen materiellen wie auch symbolischen Ausdruck in der Verwendung unvergänglicher Materialien, wie Marmor, Bronze, Gold. Die Verbindung von ‚monumentalen‘ Themen und Formen, öffentlichem Raum und gemeinschaftlicher Zeit bezeugt bei den betreffenden Gesellschaften eine emphatische kollektive Identität, die ihren Ausdruck in einer spezifischen ‚MonuMentalität‘ findet. Alle diese Bestimmungen, was ein Denkmal ist, bleiben jedoch tot, wenn man sie nur als eine Summe von statischen Qualitäten nimmt. Entscheidend ist die dynamische Wirkung von Denkmälern in der Praxis des öffentlichen Lebens. Denn öffentliche Denkmäler sind vor allem Symbole und Kristallisationspunkte in komplexen politischen und gesellschaftlichen Vorgängen, Konflikten und Prozessen,
Monumente der Geschichte – Geschichte als Monument?
261
in kommunikativen Handlungen zwischen unterschiedlichen Kräften und Interessen, die um die Herrschaft über den öffentlichen Raum und die gemeinschaftliche Zeit kämpfen. Aus diesem Grund sind öffentliche Denkmäler mehr als andere Bau- und Bildwerke mit den Personen ihrer Initiatoren und den Anlässen ihrer Errichtung verbunden. Die Auftraggeber identifizieren sich selbst emphatisch mit dem Gegenstand des Denkmals. Sie sichern damit zugleich für sich selbst, ihre Leistungen und ihre ideellen Leitbilder kollektive Anerkennung und öffentliches Gedächtnis. In diesem Sinn besitzen Denkmäler ein starkes eigenes Potential der Präsent-Machung gegenüber anderen Medien der Repräsentation. Es ist ein Potential der Durchsetzung und Behauptung von Macht. Denkmäler werden von politischen Akteuren als Zeichen der eigenen Macht und der Gültigkeit von gesellschaftlichen, religiösen und kulturellen Leitbildern errichtet und als Faktoren im Kampf um Macht eingesetzt. Sie besetzen mit ihrer Aufstellung den öffentlichen Raum, richten sich an die Gemeinschaft, fordern deren Anerkennung – oder provozieren Widerspruch. Sie erlauben keine Indifferenz, weil Hinnahme bereits Akzeptanz bedeutet. Denkmäler sind die konkrete Manifestation der öffentlichen Bedeutung und Identität der Personen, Ereignisse und Leitbilder, die sie repräsentieren. Ihre Zerstörung bedeutet die Auslöschung der Identität dieser Personen, Ereignisse und Werte. Innerhalb der Gemeinschaft stiften Denkmäler ideologische Kohärenz und kollektive Identität. Nach außen grenzen Denkmäler die Gemeinschaft oft aggressiv gegen fremde oder feindliche Gemeinschaften ab. Denkmäler sind Waffen. Ob man in der Antike von einer ‚Gattung‘ des öffentlichen Denkmals reden kann, scheint eher fraglich. Jedenfalls hängt es davon ab, wie man ‚Gattung‘ definiert. Im Unterschied zur Literaturwissenschaft haben Archäologie und Kunstwissenschaft keinen prägnanten Begriff der ‚Gattung‘ ausgebildet. Landläufig werden ‚Gattungen‘ teils nach Techniken definiert: Rundskulptur (in Bronze, Marmor etc.), Relief, Malerei, Glyptik; oder nach Funktionen: Standbilder (Kult-, Votivbilder etc.), Vasen, Grabreliefs, Sarkophage, Gefäße; oder nach Themen: Götterbilder, Porträts, Historienbild; und dergleichen mehr8. Abgesehen von der Unklarheit der Begriffe, lassen sich die ‚Denkmäler‘ der griechischen und römischen Antike grundsätzlich nicht mit derartigen Kategorien erfassen. Denkmäler in dem bezeichneten Sinn können als Rundskulptur, Relief, Gemälde, Architektur oder als Verbindung mehrerer dieser Möglichkeiten gestaltet sein, sie können die Funktion von profan-öffentlichen Monumenten, sakralen Votivgaben oder Grabmälern haben, sie können nach ihren Themen Porträts, Historienbilder, allegorische Standbilder sein, und so fort. Allgemein können Bild- und Bauwerke verschiedener ‚Gattungen‘ mehr oder minder stark ausgeprägt ‚denkmalhafte‘ Züge und Funktionen erhalten. Entscheidend für einen pragmati-
8 Zum Begriff der Gattung in der Bildenden Kunst s. Schweitzer (1939) 378 = (1969) 179–180.
262
Tonio Hölscher
schen und dynamischen Begriff des Denkmals sind nicht formale oder technische Merkmale, sondern die Intentionen und Praktiken der Stiftung von öffentlichem Gedächtnis. Dass dies in ‚medialer‘ Form geschieht, ist offensichtlich. Ein offener Begriff des ‚Mediums‘ kann, gegenüber dem zugleich eingeschränkten und unklaren Begriff der ‚Gattung‘, hilfreich sein, die oben gegebenen Bestimmungen als ‚Medium Denkmal‘ zusammenzufassen.
3 Initiatoren, Botschaften und Rezipienten Die primäre Funktion öffentlicher Denkmäler scheint zunächst wenig attraktiv für komplexe Fragen an die Geschichte zu sein. Die Initiatoren von Denkmälern verfolgen in der Regel eindeutige Intentionen und stellen Personen, Ereignisse und ideelle Leitbilder in offensichtlich positiver, rühmender Weise vor Augen. Intention und Wirkung. Die Statuen der Tyrannenmörder stellen das Ereignis in einer ideologisch geprägten Kunst-Form dar. Sie schildern die Tat ohne das Opfer: nicht als interaktiven Vorgang, sondern als heroische Leistung. Dabei heben sie staatsbürgerliche Qualitäten hervor, die bei den Betrachtern hoch in Geltung standen: Das Freundespaar als solches weist zunächst auf die soziale Kohärenz, die mit der Homoerotik verbunden wurde, das Voranschreiten im Gleichschritt auf die politische Solidarität der ‚isonomen‘ Eintracht. Harmodios verkörpert mit dem ungeschützten Schlag von oben den Mut der Jugend, Aristogeiton zeigt mit dem Schutz durch das Manteltuch und dem Stich von unten die bedachte Vorsicht des höheren Alters; beide repräsentieren mit ihren trainierten Körpern den Glanz athletisch-aristokratischer Ausbildung. Das sind eindeutige Botschaften: Die Intention der Rühmung lässt, zumindest bei den Initiatoren, keine Doppelbödigkeit zu. Indem die Initiatoren des Denkmals, Anhänger oder Nachfolger des Kleisthenes, die ‚Tyrannenmörder‘ zu Gründerfiguren der neuen Staatsform erhoben und sie mit diesen Standbildern ehrten, bewirkten sie zweierlei: Zum einen setzten sie in der Volksversammlung die Anerkennung der beiden Attentäter, ihrer Tat und der damit verbundenen Ideale durch, zum anderen machten sie sie als Leitbilder materiell und visuell im Zentrum des bürgerschaftlichen Lebens als unausweichlichen Anspruch präsent. Dieser Anspruch war deutlich in die Zukunft gerichtet. In diesem Sinn ehrten die Athener kurz nach dem Denkmal der Tyrannenmörder ihren Feldherrn Kimon und seine Mit-Strategen mit einem Denkmal von drei Hermen, deren Epigramme die Gegenwart mit der Vergangenheit und der Zukunft verbanden: Die gegenwärtigen Heerführer hätten sich als würdige Nachfolger der mythischen Helden Athens im Troianischen Krieg erwiesen und würden künftigen Generationen zum Vorbild dienen9.
9 Thompson u. Wycherley (1972) 94.
Monumente der Geschichte – Geschichte als Monument?
263
Bei den Adressaten zielen Denkmäler auf eindeutig positive Akzeptanz. Sie beruht nicht auf rationaler Überzeugung, sondern auf dem physisch-visuellen Erlebnis des materiellen Denkmals. Gleichwohl, oder gerade deshalb, entfalten Denkmäler, nachdem sie einmal errichtet sind, vielfältige Wirkungen, die den Intentionen der Initiatoren entweder entsprechen oder auch widersprechen können. Die Statuen der Tyrannenmörder erhoben sich am Rand der Stätte der Volksversammlung. Dort standen alle politischen Aktivitäten unter der höchsten Forderung, eine neue Tyrannis zu verhindern, die Archonten mussten das bei ihrem Amtsantritt schwören. Die Statuengruppe gab das Leitbild vor: Jeder athenische Bürger sollte zum Tyrannenmord bereit sein! Da die Standbilder von der Mehrheit der Bürgerschaft beschlossen worden waren, muss auch die politisch entscheidende Mehrheit der Betrachter ihrer Botschaft zugestimmt haben. Doch ein Symbol politischer Einigkeit waren sie wohl nicht: Die immer noch in Athen lebenden Anhänger der Tyrannen mussten sich durch das Denkmal symbolisch aus der Stadt vertrieben fühlen. In der Folgezeit wirkte einerseits vieles zusammen, das das Ansehen des Denkmals erhöhte: Der Abtransport durch die Perser bestätigte es als Symbol der politischen Identität, die durch das Ersatzdenkmal wiederhergestellt wurde. Das neue Denkmal wurde zum Referenzpunkt politischer Argumentation im Sinn von Freiheit und Demokratie: Am Hephaisteion wurde der mythische Stadtheros Theseus im Schema des Harmodios als Vorläufer der Tyrannenmörder dargestellt; und in Aristophanes’ Lysistrate bringt der Anführer der Männer seine Bereitschaft, den Angriff der aufmüpfigen Frauen abzuwehren, darin zum Ausdruck, dass er sich als neuer Tyrannenmörder geriert. Dabei kam die Wirkung wohl oft nicht so sehr durch intensive Interpretation seiner ‚Botschaften‘ zustande, sondern durch unmittelbare Anschauung und ‚Inkorporierung‘: Der Held bei Aristophanes stellt sich einfach neben das Standbild des Aristogeiton, offenbar in der Haltung des Harmodios, um den Staat in bewährt heroischer Weise zu verteidigen: Er ahmt einfach nach10. Andererseits konnte gleichzeitig Thukydides den politischen Charakter des Attentats auf die Tyrannen stark relativieren, indem er es als Ergebnis einer rein privaten Affäre erklärte. Und bald darauf, während der kurzen Perioden einer Tyrannis und einer Oligarchie, werden die neuen Herrscher Athens das Denkmal eher unbequem gefunden haben: Jedenfalls erscheinen die Tyrannenmörder im Jahr 403 v. Chr., nach der Befreiung von der Tyrannis, als Schildzeichen der Stadtgöttin Athena auf den offiziellen panathenäischen Preisamphoren. Der emphatische Anspruch von Denkmälern fördert Polarisierung: Er provoziert entweder Akzeptanz und Affirmation oder Opposition11. Ähnlich paradigmatisch muss das Bildnis Gelons in Syrakus intendiert gewesen sein: hier nicht als Leitbild für die Bürger, sondern als Maßstab für alle späteren Herr-
10 Hephaisteion: Thompson u. Wycherley (1972) 148, pl. 75. – Aristoph. Lys. 631–634. 11 Thuk. 6, 53–60. – Simon u. Hirmer (1981) Taf. LI.
264
Tonio Hölscher
scher. Auch bei Gelon wird die Situation komplex gewesen sein. Wenn die Bürgerschaft als Initiator des Denkmals genannt wird, so muss die Volksversammlung in ihrer Mehrheit zugestimmt haben – allerdings wiederum kaum einstimmig: Sicher gab es auch entschiedene Gegner der Alleinherrschaft. Darüber hinaus war bei den Initiatoren die Intention sicher doppelbödig und nicht nur als affirmative Ehrung gemeint; denn die Darstellung im ungegürteten Chiton, ohne Waffen, bedeutete zugleich eine unmissverständliche Forderung: Gelon, wie alle seine Nachfolger, sollten auf Waffengewalt zur Sicherung der Herrschaft verzichten. Gleichwohl müssen die folgenden Herrscher in dieser oder in anderer Hinsicht Anstoß erregt haben: Nach dem Ende der Tyrannis 344 v. Chr. wurden unter der Regentschaft des Timoleon die Standbilder aller Herrscher von Syrakus – außer denen Gelons und Dionysios’ I. – unter Anklage gestellt und daraufhin eingeschmolzen. Das Urteil über die Denkmäler, positiv wie negativ, entsprach dem über die Dargestellten12. Botschaft und Wirklichkeit. Denkmäler stehen in einer besonders starken Spannung zwischen vorgegebener ‚Wirklichkeit‘ und intendierter ‚Bedeutung‘. Auf der einen Seite liegt ihr ganzer Sinn in der Behauptung, dass sie Personen und Ereignisse der Vergangenheit als tatsächliche Wirklichkeit wiedergeben: Nur dieser Bezug auf ihre Wirklichkeit verleiht den dargestellten Personen und Ereignissen die Autorität der Vorbildlichkeit, jeder Anschein der Fiktivität würde die Forderung der Nachahmung abschwächen. Denkmäler behaupten emphatisch: so war er bzw. sie, so hat es sich zugetragen. Auf der anderen Seite aber muss die Botschaft in der bildlichen Form ideelle Aspekte hervorheben, die den politischen und ethischen Appell des Denkmals zur Wirkung bringen. In der Tat sind die Tyrannenmörder in der historischen Situation nicht so aufgetreten, wie das Denkmal sie schildert: Weder waren sie nackt noch werden sie derart koordiniert im Gleichschritt vorangestürmt sein. Dennoch wäre es zu einfach, wenn man ihre Rühmung im Bild als ‚Idealisierung‘ begriffe, die in einem Gegensatz zur Kontingenz der ‚Wirklichkeit‘ stünde. Denn Aristogeiton und Harmodios bringen im Bild wie bei der Tat selbst ihre wohltrainierten Körper zum Einsatz: Ihre Nacktheit ist keine ‚Idealisierung‘, sondern macht die realen Kräfte ihrer Leistung anschaulich, auch wenn sie ‚in Wirklichkeit‘ unter dem Gewand verborgen waren. Und sie stürmen im Bild gemeinsam vorwärts, so wie sie es wohl zumindest intendiert hatten. Die Bildwerke schildern eine ‚konzeptuelle‘ Wirklichkeit, auch wenn diese nicht in dieser Form sichtbar zu Tage trat. Die Konzepte, die in dieser Realität zum Ausdruck gebracht werden, sind die Ideale der körperlichen Leistungsfähigkeit und Schönheit, der homoerotischen Verbindung und der gemeinschaftlichen Kampfbereitschaft. Es sind Ideale nicht jenseits, sondern in der Wirklichkeit, die das Bildwerk präsent macht. Perspektiven der Sieger. In all dem wird, ohne jede Einschränkung oder Relativierung, die Sicht der Sieger und der Herrschenden zum Ausdruck gebracht. Hier liegt
12 Krumeich (1997) 48, der allerdings die politische Bedeutung des Vorgangs verkennt.
Monumente der Geschichte – Geschichte als Monument?
265
wohl das größte Hemmnis, um Denkmäler als differenzierte Zeugnisse der Geschichte ernst zu nehmen. Denkmäler gehen mehr als andere Zeugnisse in ihrer Intention auf, ihre Botschaften sind intentional eindeutig und eindimensional. Denkmäler setzen die Perspektive ihrer Autoren absolut, bringen ihr reales Thema auf eine rühmende Formel und unterdrücken Gegenpositionen; sie geben keine Begründungen, formulieren keine Reflexionen und sind darum aus sich selbst heraus nicht zu hinterfragen. Sie eröffnen kaum eine Sicht hinter ihre eigenen Kulissen, sondern präsentieren ‚autoritative Geschichte‘: Einmal aufgestellt, petrifizieren Denkmäler die Sicht der Sieger als Faktum der Geschichte13. Erst seit dem 20. Jahrhundert wird öffentliches Gedenken gegen den Strom der Affirmation monumentalisiert: subversiv in den Denkmälern für die Toten seit dem Ersten Weltkrieg, die den traditionellen Kriegsruhm in Frage stellen, bis zu denen für die Deserteure des Zweiten Weltkriegs; aufrührend in den Denkmälern für den Holocaust, die das Gedächtnis an die verbrecherische Vergangenheit präsent halten; reflektierend in dem Denkmal von Ground Zero, das den Abgrund terroristischer Zerstörung vor Augen führt. Gleichwohl aber verkörpern Denkmäler weiterhin nationale oder andere kollektive Identität: Noch 2007 wurde das Monument der Roten Armee in Tallinn zum Symbol und Kristallisationspunkt in den Auseinandersetzungen um das Verhältnis zwischen Estland und Russland; und 2011 erreichten die Spannungen zwischen der Türkei und Armenien einen neuen Höhepunkt im Konflikt um das ‚Mahnmal der Menschlichkeit‘ des Bildhauers Mehmed Aksoy, der mit dem vom türkischen Ministerpräsidenten verordneten Abriss des Denkmals endete14. Ambivalenz, Doppelbödigkeit und Subversion fehlt den Denkmälern der Antike: Sie stellen autoritativ dar, welche Werte im Zentrum der politischen Gemeinschaft stehen sollen. Kaum eine andere Gruppe von historischen Zeugnissen ist in einem solchen Maß eine Manifestation von kollektiver Identität. Und in wenigen anderen Zeugnissen kommt Identität in derart offensiver Weise zum Ausdruck: Denkmäler entstehen im Kampf um Identität, und sie entfalten ihre Wirkung im Kampf für Identität. Dabei stehen Denkmäler in einer starken Spannung zwischen Okkasionalität und Überzeitlichkeit. Ihre Themen sind einerseits spezifisch von den Personen geprägt und auf die Situationen bezogen, für die sie geschaffen sind. Andererseits aber werden dabei Botschaften entwickelt, die einen emphatischen Anspruch auf dauerhafte Geltung erheben. Diese Spannung zwischen ephemerem Zweck und unverrückbarer Dauer lässt öffentliche Denkmäler oft so rasch als überholte ideologische Möbelstükke unserer Städte erscheinen.
13 Der hier gebrauchte Begriff ‚autoritative Geschichte‘ entspricht weitgehend dem, was HansJoachim Gehrke als ‚intentionale Geschichte‘ analysiert hat (s. zuletzt seinen Beitrag in diesem Band). 14 Kriegsdenkmäler: Koselleck u. Jeismann (1994). Zu anderen Formen von Denkmälern der Gegenwart s. die Lit. in Anm. 3.
266
Tonio Hölscher
Wenn öffentliche Denkmäler gleichwohl das Interesse der Historiker verdienen, dann nicht weil sie besonders komplexe Zeugnisse für historische Zusammenhänge sind, sondern weil sie besonders schlagkräftige Leitbilder der kollektiven Identität verkörpern, die Durchsetzungskraft der dahinter stehenden politischen oder gesellschaftlichen Macht demonstrieren und gegebenenfalls zu Symbolen von Machtkämpfen werden.
4 Die Praxis der Setzung öffentlicher Denkmäler Ein besonders starkes politisches Potential von Denkmälern liegt in der Praxis ihrer Errichtung. Denkmäler mit ausgeprägten politischen Botschaften sind, weit mehr als andere Artefakte, Elemente von gesellschaftlichen Praktiken: Im Kampf um ihre Errichtung – gegebenenfalls auch um ihre Zerstörung – können sich vielfältige Motivationen und Intentionen artikulieren. Diese Praktiken hängen eng mit den politischen Strukturen der Gemeinwesen zusammen15. Die politischen Gemeinschaften der Antike bildeten komplexe Verfahren aus, mit denen die Macht von Denkmälern sowohl genutzt als auch begrenzt wurde. Grundsätzlich waren die antiken Gemeinschaften einerseits stark darauf angelegt, Führungskraft und außergewöhnliche Leistungen zu mobilisieren, und da dies weder durch stabile politische Machtpositionen noch durch substantielle wirtschaftliche Vergütung geschehen konnte, war gesellschaftliches Prestige, d.h. rühmende öffentliche Anerkennung durch eine Platz im kollektiven Gedächtnis von hoher Bedeutung. Andererseits aber verbot die kompetitive Konstellation innerhalb der städtischen Eliten wie auch zwischen den verschiedenen Staaten die dauerhafte Hervorhebung und Anerkennung von Ausnahmepositionen einzelner Personen oder Gemeinwesen. Aus dieser Ambivalenz ergab sich ein ständiger Konflikt zwischen überzeitlicher Verstetigung und zeitlicher Relativierung von Gedächtnis, die in jeder politischen Gemeinschaft und in jeder Generation immer wieder neu ausbalanciert wurden. In einem weiten Sinn war jede Aufstellung eines politischen Denkmals eine öffentliche Handlung: für die öffentlichen Räume innerhalb der Städte mit einem Antrag an die Volksversammlung, gefolgt von einer öffentlichen Debatte, die oft kontrovers geführt wurde, wie es von den Setzungen der Ehrenstatuen in Athen bekannt ist; für die städtischen und vor allem die panhellenischen Heiligtümer mit einer Anfrage an die sakralen Gremien, die durchaus abgelehnt werden konnte, wie es keinem Geringeren als Themistokles einmal in Delphi ergangen sein soll. Die Denkmäler erhalten ihre Macht von den politischen und gesellschaftlichen Autoritäten, die sie initiiert bzw. zugelassen haben, und entfalten ihre Wirkung in den öffentlichen Räumen, die
15 Praxis der Denkmalsetzung, Griechenland: Hölscher (1998b); Tanner (2006). – Rom: Sehlmeyer (1999); Tanner (2000).
Monumente der Geschichte – Geschichte als Monument?
267
sie beherrschen. Denkmäler sind darum nicht sekundäre Spiegelungen von Ansehen und Ruhm, sondern primäre Faktoren im Kampf um Positionen der Macht16. Praxis der Aufstellung. Die Aufstellung von Denkmälern hat eine aufschlussreiche Geschichte. Jede Epoche hatte ihre spezifischen Praktiken, die jeweils den Strukturen der politischen Macht entsprachen. Im Gegensatz zu den benachbarten Kulturen Ägyptens und des Vorderen Orients ist es für Griechenland bezeichnend, dass derartige monumentale Skulptur nicht im Dienst monarchischer Herrschaft, sondern individueller ‚Bürger‘ entstand. In der archaischen Zeit wurden zunächst vor allem die Toten von ihren Angehörigen mit monumentalen Standbildern auf ihren Gräbern im Gedächtnis gehalten. Da die Grabbezirke meist an den Ausfallstraßen der Städte oder an anderen stark frequentierten Orten angelegt wurden, sicherten die Bildwerke dank ihrer ‚Sichtbarkeit‘, obgleich auf ‚privatem‘ Grund aufgestellt, den Toten doch eine ‚öffentliche‘ Präsenz. Daneben konnten ambitionierte Personen Votivstatuen in die städtischen Heiligtümer weihen, die sie durch Namensinschriften auf sich selbst oder ihre Familien bezogen: etwa Rhombos mit der Figur des ‚Kalbträgers‘ auf der Athener Akropolis oder -]arches und seine Angehörigen mit einer Figurengruppe im Heraion von Samos. Diese Praxis der Selbstweihung, die über lange Zeit in Gebrauch war, richtete sich in erster Linie an die Gottheit und implizierte erst sekundär die Repräsentation des Stifters im kollektiven Gedächtnis17. Dem gegenüber bedeutet das Denkmal der Tyrannenmörder eine revolutionäre Neuerung: Zum ersten Mal unternimmt es die Gemeinschaft der Bürger, zwei ihrer Mitglieder durch Standbilder auf Dauer ins öffentliche Gedächtnis zu heben. Der Rahmen für dieses Denkmal ist nun nicht mehr der sakrale Raum der Götter oder der Toten, sondern der politische Raum der Bürgerschaft, die Agora. Grundsätzlich setzt mit dieser Praxis eine neue Stufe der politischen Selbst-Konzeptualisierung ein. Die Gruppe der Tyrannenmörder ist das erste politische Denkmal im eigentlichen Sinn. Die Agora wird damit zum ersten Mal semantisch zum Raum der Politik gemacht. Dies ist ein besonders starkes Symptom der „Entstehung des Politischen“, wie Christian Meier es analysiert hat18. In diesem Sinn konnten nun auch Weihgeschenke in den zentralen städtischen wie in den panhellenischen Heiligtümern stärker denkmalhaften Charakter annehmen. Die junge athenische Demokratie versicherte sich ihrer neuen Kraft nach einem Sieg gegen Chalkis und Boiotien mit der Weihung einer Quadriga auf der Athener Akropolis, bei der die Fesseln der gefangenen und gegen Lösegeld frei gelassenen Feinde auf das spezifische Ereignis verwiesen. Neben den Tyrannenmördern, die die
16 Ehrenstatuen Athen: s. unten S. 269. Votiv-Denkmäler Delphi: Jacquemin (1999) 101–107. Themistokles: Paus. 10, 14, 5–6. 17 Selbstweihung: Himmelmann (2001); Franssen (2011). – Monumentalität in Ägypten: Assmann (1991) 16–31, 138–168. 18 Meier (1980).
268
Tonio Hölscher
neue politische Ordnung im Inneren rühmten, wurde gleichzeitig die Stärke der Gemeinschaft nach außen herausgestellt19. Vor allem in den Perserkriegen wurde die traditionelle Praxis, der Gottheit zum Dank für den Sieg ein Votiv zu stiften, mehr und mehr umgewandelt in eine Rühmung des siegreichen Initiators und des Ereignisses des Sieges. Dabei kam immer bewusster geschichtliche Zeitlichkeit ins Spiel. Traditioneller Dank bestand darin, dem Gott ein bleibendes Geschenk in wertvollem Material darzubringen, etwa ein Bild eines Opfertieres oder der Gottheit selbst. Das dauerhafte Material sichert den Votiven Zeitlosigkeit. Ein neuer Impuls führte dann dazu, in den Votiven Stifter und Ereignisse zum Thema zu erheben: Die Apollon-Statue, die die griechischen Verbündeten gegen die Perser in Delphi weihten, trug einen Schiffsbug als Attribut, zum Hinweis auf den Sieg bei Salamis; der monumentale Votiv-Dreifuß nach dem Sieg bei Plataiai, ebenfalls in Delphi, wurde mit den Namen aller an der Schlacht beteiligten Städte versehen; andere Weihgeschenke stellten die Götter, Heroen und sogar die führenden Männer der betreffenden Städte dar. Damit wurden die Votive zu Trägern eines autoritativen Gedächtnisses, das zunächst prospektive Dauerhaftigkeit zum Ziel hatte20. Schließlich sprengten die beiden größten Protagonisten, Athen und Sparta, endgültig die bisher geltende Praxis, der Gottheit unmittelbar nach der Schlacht ein Anathem des Dankes zu errichten, indem sie die Persersiege auch später noch retrospektiv mit kommemorativen Denkmälern feierten. Jede Stadt wollte der größte Persersieger sein. Athen ging um 460 v. Chr. voran mit der kolossalen Athena Promachos auf der eigenen Akropolis, mit dem Gemälde der Schlacht von Marathon an der Agora, mit einem steinernen Tropaion auf dem Schlachtfeld von Marathon und mit dem vielfigurigen Marathon-Denkmal in Delphi; Sparta antwortete mit einer ‚Perserhalle‘ an der städtischen Agora sowie mit lange nach dem Tod errichteten Ehrengräbern für die Helden der Perserkriege, Leonidas und den rehabilitierten Pausanias. Damit hat das öffentliche Gedächtnis die gleichgewichtigen Dimensionen von retrospektiver und prospektiver Zeit gewonnen21. Der anschließende Konflikt zwischen Athen und Sparta mit ihren Verbündeten wurde nicht zuletzt über zwei Generationen in einem über ganz Griechenland ausgreifenden Denkmälerkrieg ausgetragen: Athen und andere Städte präsentierten sich selbst mit komplementären Denkmälern einerseits in der eigenen Stadt, innerhalb der Bürgerschaft, und andererseits in den panhellenischen Heiligtümern, gegenüber der ganzen griechischen Welt; Verbündete wie Athen und Argos stellten ihre Verbundenheit durch benachbarte Denkmäler in Delphi dar; Gegner wie Athen und Sparta stachen einander mit polemischen Denkmälern in Delphi, Olympia und in der eige-
19 Denkmal für Sieg über Chalkis und Böotien: Hdt. 5, 77. Raubitschek (1949) Nr. 168, 173. 20 Zusammenfassend zu Denkmälern der Perserkriege: Gauer (1968). Allgemein zu politischen Denkmälern und Anathemen des 5. Jahrhunderts s. auch Ioakimidou (1997); Hölscher (1998b) 158–176; Krumeich (1999); Stewart (2008). 21 Hölscher (1998a) 84–103.
Monumente der Geschichte – Geschichte als Monument?
269
nen Stadt aus. Hier gewinnt die Praxis eine interaktive Zeitlichkeit über viele Generationen hinweg22. Innerhalb einzelner Städte bildete sich eine komplexe Praxis der Errichtung öffentlicher Denkmäler aus, durch die öffentliches Ansehen und Gedächtnis von Personen und Ereignissen zwischen den führenden Gruppen der Stadt ausgehandelt wurden. Am besten ist dies in Athen seit dem 4. Jahrhundert und bald darauf in Rom bekannt. In Athen war mit dem Denkmal der Tyrannenmörder die Gattung der öffentlichen Ehrenstatue geschaffen – und gleich wieder für mehrere Generationen sistiert worden, weil die rigorose Demokratie die von der Gemeinschaft getragene Heraushebung einzelner Bürger in ihrem politischen Zentrum nicht tolerierte. Vielfach wich man auf weniger anspruchsvolle Formen von Gedenkstatuen in Heiligtümern aus: auf der Akropolis postume Votivbildnisse für Feldherren oder auch Selbstweihungen von Athletenstatuen zu Lebzeiten; in Delphi konnte sogar der Staat Miltiades ehren. Aber die Agora war lange Zeit für individuelle Ehrungen verschlossen: Die Institution des Ostrakismos bezeichnet die Tendenzen, die der Anerkennung von Führungspersonen entgegenstanden. Erst das 4. Jahrhundert führte, bezeichnenderweise nach dem Abbrechen des Ostrakismos, zu einer dichteren Errichtung von öffentlichen Ehrenstatuen vor allem für lebende Staatsmänner, erstmals für Konon 394 v. Chr. Entsprechend der politischen Brisanz waren die Verfahrensweisen streng geregelt, mit Antrag an die Volksversammlung und intensiven Debatten. Man orientierte sich an Präzedenzfällen und signifikanten Kriterien: für welche Verdienste eine Ehrenstatue gerechtfertigt war, ob zu Lebzeiten oder nach dem Tod, an welchem Ort auf der Agora, neben welchen früheren Denkmälern sie errichtet werden sollte, ob der Staat oder die Geehrten selbst für die Kosten aufzukommen hatten. Damit war eine Praxis geschaffen, die in der Folgezeit weite Verbreitung fand23. Im Hellenismus entstand eine starke Divergenz zwischen den Denkmälern der Monarchien und der bürgerlichen Elite der Städte. Seit Alexander dem Großen präsentierten sich die Herrscher, deren Macht auf ihrem überragenden Charisma beruhte, mit Monumenten von überwältigendem Eindruck: Alexanders 70 m hoher Scheiterhaufen für Hephaistion mit sieben Registern vergoldeter Figuren oder das im Alexandermosaik kopierte Gemälde der Schlacht zwischen Alexander und Dareios sind Manifestationen der Macht von einzigartiger emotionaler Wirkung. Dabei entwickelte sich eine balancierte Verteilung der Rollen zwischen Erweisen und Empfangen von Ehrungen: In Pergamon errichtete der König selbst im Athena-Heiligtum auf der Akropolis ein vielfiguriges Statuen-Anathem, in dem die Feldzüge und Schlachten Pergamons allgemein mit pathetischen Figuren unterlegener Gegner gerühmt wurden; dazu stifteten die Generäle und Soldaten ein Reiterstandbild des Königs, der
22 Hölscher (1974). 23 Krumeich (1999) 207–212; Dillon (2006) 101–106; Tanner (2006) 97–140.
270
Tonio Hölscher
damit als eigentlicher Sieger geehrt wurde. Das Prinzip war die gegenseitige Anerkennung von Herrscher und Heeresgemeinschaft24. In den städtischen Gemeinden wurde die Ehrung mit öffentlichen Bildnisstatuen zu einer zentralen politischen Praxis ausgebildet, in der das Verhältnis der Bürgerschaften zu potenten und mächtigen Einzelnen, Mitbürgern und Fremden bis hinauf zu den Königen, ausgehandelt und definiert wurde. Die jeweiligen Kräfteverhältnisse wurden an den betreffenden Orten ausbalanciert, in einer Residenzstadt wie Pergamon anders als in anderen Städten wie Priene. Die Inschriften beschreiben dies Verhältnis in einem Spektrum zwischen dem Erweis von Dankbarkeit, mit dem Hinweis auf den Geehrten im Akkusativ, und der Akzeptanz von Repräsentation, mit seiner Nennung im Nominativ. Im Denkmal kommen die öffentlichen Verdienste der Geehrten ebenso wie die öffentliche Anerkennung durch die Ehrenden und die öffentliche Rolle der Initiatoren zur Erscheinung. Dabei werden politische Konstellationen, Konkurrenzen und Konflikte ausgetragen. Durch die Aufstellung der Standbilder an den ‚sichtbarsten Orten‘ ihrer Städte schufen die politischen Gemeinschaften die Möglichkeit, ihre gemeinschaftlichen Angelegenheiten in Präsenz von und Interaktion mit ihren ‚großen‘ Mitgliedern, den lebenden wie den toten, zu vollziehen25. Im republikanischen Rom war die Errichtung von öffentlichen Standbildern Teil einer vielfältigen, systematischen Praxis zwischen Ansprüchen und Anerkennung der führenden Männer. Die res publica brauchte für die Aufgaben, die die Expansion zu einem Weltreich seit dem 4. Jh. v. Chr. stellte, den Führungswillen und Ehrgeiz einzelner Staatsmänner, musste aber zugleich auf deren Integration in die Gemeinschaft der Bürger bestehen. Der Senat hatte Möglichkeiten der Auszeichnung für herausragende Verdienste, vor allem im Krieg: zum einen den ephemeren Triumph, zum anderen dauerhafte Ehrenstatuen. Diese wurden jeweils nach dem Maßstab von Präzedenzfällen errichtet – und zugleich immer mit einem tolerierbaren Maß von Varianten, etwa Statuen zu Pferd oder auf Säulen. In den öffentlichen Räumen der Stadt antwortete jedes neue Bildnis im Motiv und Standort auf alle vorausgehenden. Die Feldherren ihrerseits hatten die Möglichkeit, zum einen den Triumphzug zu einer spektakulären einmaligen Gedächtnisfeier auszugestalten, zum anderen aus der Beute bleibende monumenta, etwa Tempel oder programmatische Bildwerke zu stiften. Auch sie bezogen sich kompetitiv aufeinander: 264 v. Chr. errichtete M. Fulvius Flaccus am Forum Boarium, beim Beginn des Triumphzuges, ein berühmtes Beutedenkmal mit Bronzefiguren aus Volsinii – im Jahr darauf stiftete Mn. Valerius Messalla an der Kurie, gegen Ende des Triumphweges, ein Gemälde mit dem Sieg über Hieron und die Karthager. Dabei blieb über lange Zeit die Balance zwischen den individuellen Ansprüchen der führenden Männer und den kollektiven Maßstäben des Senats einigermaßen stabil: Letzten Endes waren es die kollektiven ideologischen Leit-
24 Schalles (1985) 56–59, 68–104; Bielfeldt (2010). 25 Ma (2007); Ma (2012); Bielfeldt (2010); Bielfeldt (2012).
Monumente der Geschichte – Geschichte als Monument?
271
vorstellungen der res publica, wie virtus, pietas, fides und honos, die in den Denkmälern exemplarisch verkörpert waren26. In der ausgehenden Republik änderte sich die Praxis zunehmend radikal. Die mächtigen Feldherren führten gegeneinander einen veritablen ‚Krieg‘ mit öffentlichen Denkmälern. Sie ergriffen mehr und mehr selbst die Initiative für anspruchsvolle Monumente, provozierten intentional die Öffentlichkeit, suchten einander auszustechen und zerstörten die Monumente der Gegner. Die Geste der Macht wurde wichtiger als die zustimmende Akzeptanz; die kollektiven Leitvorstellungen traten hinter dem Anspruch auf einzigartige, dauerhafte und universelle Herrschaft zurück27. Erst Augustus hat dann die Praxis des Ehrendenkmals noch einmal so umgestaltet, dass sie zu einer sensiblen Austarierung der Ansprüche und Erwartungen auf beiden Seiten wurde. Die Initiative ging nun grundsätzlich vom Senat und Volk aus, die dem Kaiser sehr weit gehende Ehren anboten – damit dieser sie zum Teil ablehnen und man sich irgendwo in der Mitte treffen konnte. Dadurch konnte die Stellung des Princeps jeweils in einer Balance zwischen extremen Positionen definiert werden. Die Bau- und Denkmälerpolitik der Kaiserzeit ist durchweg von dieser reziproken Praxis geprägt: Der Kaiser baut ‚für das Volk‘ Fora und Tempel, Thermen und andere Nutzbauten und schafft sich damit implizit Ruhm und Gedächtnis; aber die Denkmäler der mehr oder minder expliziten Ehrung des Kaisers, die ‚Triumph‘-Bögen von Augustus bis Konstantin, die Traians- und Marcussäule, die Tausende von Bildnisstatuen im ganzen Reich, werden von anderen Institutionen für ihn gesetzt, in Rom vor allem vom Senat und Volk, in Italien und den Provinzen von den verschiedensten Institutionen und Gruppen. Ehrung kann nicht von der Person des Geehrten ausgehen, sie muss von außen kommen, und sie kam von allen Seiten. Die Ehrendenkmäler für den römischen Kaiser brachten jene Form des allgemeinen Konsenses zum Ausdruck, in der allein – nach einer Jahrhunderte lang währenden Republik – eine Alleinherrschaft Akzeptanz finden konnte28. Rezeption. Die Wirkung öffentlicher Denkmäler beruht zunächst auf ihrer reinen unübersehbaren Präsenz. Einzelheiten und Nuancen der politischen Botschaften müssen nicht von allen Betrachtern wahrgenommen werden oder wahrnehmbar sein. Das Bildprogramm des Parthenon, das ein komplexes Konzept des attischen Staates enthielt, bot sich dem Blick in höchst ungünstigen Ansichten dar. Die Reliefs der Traianssäule mit ihrem ideologisch aufgeladenen Bildbericht der Kriege gegen die Daker waren in der Höhe kaum ablesbar. Entscheidend war der überwältigende Gesamteindruck der Größe und der Vielfalt des Bildschmuckes, dessen Bedeutung in
26 Hölscher (1978). Zu den Ehrenstatuen s. Sehlmeyer (1999); Tanner (2000); Hölscher (2004); Papini (2004). 27 Hölscher (2004). 28 Hölscher (2000) 247–259.
272
Tonio Hölscher
allgemeinen Zügen und in einigen Details wahrgenommen wurde und auf das ganze projiziert werden konnte: eine ‚Botschaft mit reduzierter Wahrnehmbarkeit‘. Die tatsächliche Rezeption der Denkmäler konnte ambivalent sein. Bei den Tyrannenmördern und den weiteren öffentlichen Ehrenstatuen in Athen wie in Rom überwog zweifellos, und im Lauf der Geschichte immer stärker, die intendierte positive Rezeption als Vorbilder politischen Handelns. In öffentlichen Debatten und Reden konnten die Bildnisse als Argumente angeführt werden. Gelegentlich konnten sie auch Maßstäbe setzen, um negatives Verhalten zu brandmarken: Wenn Lykurg seinen Gegner Lysikles beschimpft, er könne sich nach seinem schändlichen Verhalten nicht auf der Agora blicken lassen, so hat er sicher auch die Ehrenbildnisse im Blick, die diesen Platz zu einem Raum politischer Vorbilder machten29. Andererseits erregten die Bildnisse exponierter Männer auch Widerstand. Themistokles stellte in dem von ihm gegründeten Heiligtum der Artemis Aristoboule ein eikonion von sich selbst auf und erregte unter anderem damit eine öffentliche Kritik, die schließlich zu seiner Ostrakisierung führte. Der berühmte Athlet Theagenes von Thasos wurde auf der Agora seiner Stadt mit einem Ehrenbildnis ausgezeichnet – das nach seinem Tod von einem persönlichen Feind als Objekt der Rache genutzt und jede Nacht ausgepeitscht wurde. Am deutlichsten wird die potentielle Ambivalenz von öffentlichen Denkmälern in den Gemälden, die Alkibiades 416 v. Chr. nach seinen olympischen Siegen in dem Bankettsaal der Propyläen der Akropolis als Selbstweihung präsentierte. Sie stellten ihn in denkbar ambitiöser Weise dar: das eine zwischen den Personifikationen der olympischen und der pythischen Spiele, die ihn beide bekränzten, das andere im Schoß der Nemea sitzend. Auf diese Bilder sollen die Älteren mit Empörung, die Jüngeren mit Begeisterung reagiert haben – und das muss auch voraussehbar gewesen sein. Alkibiades stiftete die Bilder offenbar als Prüfstein, wie weit er die Anerkennung einer Ausnahmeposition für sich durchsetzen konnte. Damit war er ein Vorläufer der Feldherren im spätrepublikanischen Rom, die mit provozierenden Denkmälern ihre Durchsetzungskraft erprobten und demonstrierten30. Die äußerste Form des Widerstands gegen öffentliche Bildnisse trat bei starken politischen Umschwüngen ein. In Athen wurde nach dem Sturz der Peisistratiden sogar ein auf die Akropolis geweihtes Standbild ihres Anhängers Hipparchos, Sohn des Charmos, eingeschmolzen und in eine Stele mit den Namen der Staatsverräter umgemünzt. Nach dem Ende der Herrschaft des Demetrios von Phaleron sollen seine legendären 360 Bildnisstatuen in Athen umgestürzt worden sein; und nach der Ermordung Caesars wurden in Athen zunächst Ehrenbildnisse für die Attentäter Brutus und Cassius errichtet, die dann nach dem Sieg der Caesarerben rasch wieder beseitigt wur-
29 Allgemein Tanner (2000), (2006) 97–140. Eindringliches Beispiel: Hölkeskamp (2012). Lykurg, Lysikles Fr. XII 1. 30 Themistokles: Plut. Them. 22, 2–3. Theagenes: Paus. 6, 10, 2–9. Alkibiades: Satyros wiedergegeben bei Athenaios, s. Athen. 12, 534d. – Krumeich (1997) 78–79, 131–134.
Monumente der Geschichte – Geschichte als Monument?
273
den. Bei der damnatio memoriae römischer Kaiser wurde die Zerstörung ihrer Bildnisse zum Ritual31. Jenseits von Affirmation und Zerstörung liegt die Alternative von Gedächtnis und Vergessen. Denkmäler fallen in ihrer Bedeutung vielfach mehr und mehr der NichtBeachtung anheim. Die Denkmäler Bismarcks in deutschen Städten finden kaum noch Beachtung, das Völkerschlacht-Denkmal bei Leipzig wurde bald zum Ausflugsziel von Familien, die kaum mehr an den Sieg der Verbündeten gegen Napoleon dachten, und am Berliner Denkmal für den Holocaust müssen Schilder „das Lagern im Stelenfeld, auf Stelen zu klettern, von Stele zu Stele zu springen und sich in Badebekleidung auf einer Stele zu sonnen“ und sogar „Rauchen, Genuss alkoholischer Getränke und Grillen“ verbieten. Gleichwohl steht die Unvergänglichkeit der Denkmäler dafür, dass die Personen und Ereignisse präsent bleiben. Denkmäler haben eine gewisse autonome Bedeutung, die über ihre Rezeption hinausgeht: Sie bewahren eine ‚Vergangenheit, die nicht vergehen will‘. Begriffe. Die Praktiken der Aufstellung öffentlicher Denkmäler in der Antike machen deutlich, dass das Phänomen mit den häufig benutzten Begriffen der ‚Propaganda‘ oder der ‚Selbstdarstellung‘ nicht sinnvoll bezeichnet wird. ‚Propaganda‘ bedeutet Steuerung der öffentlichen Meinung vom Zentrum der Macht aus, zum Zweck der Erhaltung und Steigerung der eigenen Macht, und verdeckt damit die entscheidende Tatsache, dass es sich um Manifestationen des Konsenses von außen zu dem Zentrum der Macht handelt; ‚Selbstdarstellung‘ hebt Eigeninitiative hervor, wie sie meist nicht in öffentlichen Denkmälern, sondern nur an Grabdenkmälern üblich ist. Neutraler und umfassender ist der Begriff der ‚Repräsentation‘: Ereignisse und Personen von öffentlicher Bedeutung werden im öffentlichen Raum ‚präsent‘ gehalten, um ihnen die beanspruchte Stellung und Wirkung im öffentlichen Leben der Gemeinschaft zu verschaffen32.
5 Grundthemen der geschichtlichen Repräsentation In den verschiedenen Gesellschaften der Antike waren jeweils bestimmte Themen des öffentlichen Rühmens und Gedenkens wert, die zu Grundlagen der kollektiven Identität wurden. Dabei standen drei Grundkategorien im Vordergrund, die für jede Form der Geschichte zentral sind:
31 Hipparchos Charmou: Lykurg. 117–119. Demetrios von Phaleron: Diog. Laert. 5, 75. Brutus und Cassius: Cass. Dio 47, 20, 4; Plut. Brut. 24, 1. Krumeich (1999) 63–64, 211. – Damnatio memoriae: Fejfer (2008) 377–380. 32 Gegen den Begriff ‚Propaganda‘: Mayer (2002) 4–27; Zanker (2007) 66–69; Mayer (2010). Für den Begriff ‚Repräsentation‘ s. die ausgezeichneten Überlegungen von Bergmann (2000).
274
Tonio Hölscher
Abb. 2: Alexander der Große, Bronzestatuette, Wiedergabe nach großformatiger Bildnisstatue des späten 4. Jahrhunderts v. Chr. Paris, Musee du Louvre.
–
Personen. Bedeutende Personen erhielten ein monumentales Gedächtnis vor allem in Bildnissen. Die Darstellung konnte grundsätzlich von typisierten Gestalten mit Namensbeischriften bis zu individuellen Physiognomien reichen. Bedeutungen und Botschaften werden in den Bildnissen jedoch nicht durch ‚natürlich‘ vorgegebene physiognomische Körpereigenschaften, sondern durch intentionalen Habitus, wie Mimik, Gestik und Bewegung, Tracht, Kleidung und Attribute vermittelt. Dabei oszilliert die überzeitliche Bedeutung von Personen für die Nachwelt zwischen ‚Einzigartigkeit‘ und ‚Rolle‘. Alexander der Große wird in den Bildnissen zur überwältigenden Erscheinung eines heldenhaften Eroberers gesteigert; für die Nachwelt stellt er ein einzigartiges Ideal dar, das als Vorbild bewundert, aber kaum je konkret imitiert wird (Abb. 2). Dagegen
Monumente der Geschichte – Geschichte als Monument?
275
Abb. 3: Sesterz des Antoninus Pius, 140–144 n. Chr.: Statuengruppe des A. P. und der Faustina im Handschlag verbunden; dazwischen bürgerliches Ehepaar mit demselben Gestus.
–
–
stellt eine Bildnisgruppe des Kaisers Antoninus Pius und seiner Gemahlin Faustina, im Handschlag verbunden, ein kollektives, rollenhaftes Muster ehelichen Verhaltens dar, das alle neu vermählten Ehepaare rituell nachzuahmen hatten (Abb. 3, s. unten)33. Ereignisse. Große Ereignisse der Vergangenheit konnten in öffentlich ausgestellten Gemälden, großformatigen Reliefs oder auch vielfigurigen Statuengruppen in rühmender Erinnerung gehalten werden. Dabei stehen in der Regel nicht so sehr narrative Vorgänge, sondern die großen Protagonisten und ihre Leistungen im Vordergrund. Das Alexander-Mosaik aus Pompeii, Kopie eines frühhellenistischen Gemäldes, schildert die entscheidende Schlacht gegen den Perserkönig Dareios III. als einen Massenkampf, der in dem Agon der beiden Könige kulminiert. Die Komposition bringt die Gegnerschaft auf einprägsame Antithesen: Alexander als dynamischer primus inter pares an der Spitze seiner Soldaten vorstürmend, Dareios im Königswagen aufragend, als hilfloser Autokrat über seinem Gefolge; die makedonische Reiterei eine diszipliniert geschlossene Truppe, das persische Heer in nutzlosen Einzelaktionen und verzweifeltem Klagen aufgelöst (Abb. 4)34. Ideen. Die bedeutenden Personen und Ereignisse der Vergangenheit stehen für ideelle Konzepte und ideologische Botschaften. Sie erhalten ihre Bedeutung
33 Intentionaler Habitus versus natürliche Physiognomie: Giuliani (1986) 25–55. – Alexander: Stewart (1993); Hölscher (2009, mit weiterer Lit.). – Antoninus Pius und Faustina: Weiß (2008). 34 Andreae (1977); Hölscher (1973) 122–169; Stewart (1993) 130–150; Cohen (1997).
276
Tonio Hölscher
als Vertreter dieser Konzepte und Ideologien und verschaffen ihnen umgekehrt durch ihre Person und Leistung überzeitliche Geltung. In Athen wurde im früheren 4. Jh. v. Chr. die Idee des gesamtgriechischen Friedens durch ein Standbild auf der Agora präsentiert, das die Friedensgöttin Eirene mit dem Knaben Plutos/ Reichtum auf dem Arm darstellte (Abb. 5). Auf einem Altar wurden ihr staatliche Opfer dargebracht. In Rom errichteten die Feldherren nach siegreichen Kriegszügen Memorialtempel für ihre Schutzgottheiten, oft Verkörperungen von politischen Leitbildern wie Victoria/Sieg, Virtus/kriegerische Tüchtigkeit, Fides/Bündnistreue, Pietas/ Frömmigkeit, und so fort. Auch diese Gottheiten wurden mit staatlichen Opfern gefeiert35. Die starke Wirkung dieser Denkmäler beruhte darauf, dass diese Themen nicht als ferne Welt des Ruhmes oder der Vergangenheit vor Augen gestellt, sondern eng auf die Gegenwart und die Gesellschaft der lebenden Betrachter bezogen wurden. Zum einen wurden die drei genannten Faktoren nicht getrennt, sondern eng miteinander verbunden eingesetzt. Die bedeutenden Personen wurden als Muster, die großen Ereignisse als Realisierungen der ideellen und ideologischen Leitbilder aufgefasst und dargestellt. Diese Leitvorstellungen aber gehörten nicht der Vergangenheit an, sondern waren von überzeitlicher Geltung, bis in die Gegenwart und die Zukunft hinein; darum gehörten auch die in den Denkmälern präsenten Personen und Ereignisse der gegenwärtigen Welt an. Zum zweiten stellten die Bild-Denkmäler die exemplarischen Personen und Ereignisse der Vergangenheit nicht als idealisierende Konstrukte der realen Welt der Lebenden gegenüber, sondern hoben Bedeutungen hervor, die bereits in der Realität selbst enthalten waren. Denn Alexander der Große wie Antoninus Pius und alle anderen Staatsmänner der Antike haben ihre tatsächliche äußere Erscheinung und ihre öffentlichen Auftritte in einer Form gestaltet, die in ihrer Wirkung den Bildwerken entsprach; Alexander hat auch in Wirklichkeit seine Schlachten als persönlichen Agon gegen den Perserkönig aufgefasst und seine Taktik ganz auf einen Zweikampf mit ihm eingestellt. Auch die realen Personen und Handlungen von geschichtlicher Bedeutung sind Konstrukte, ‚Bilder‘ von lebenden Körpern und Bewegungen. Die Bildwerke wie die tatsächlichen Akteure selbst gestalten, in den spezifischen ‚Medien‘ der Bilder bzw. der lebenden Körper bedeutungsvolle Konzepte von Personen und Ereignissen. Selbst eine so ‚abstrakte‘ Allegorie wie die Friedensgöttin als Erzeugerin von Reichtum wird in die Gestalt einer Mutter mit Kind umgesetzt. Durch diese Homologie gelingt die wechselseitige Durchdringung von Bildwerken und Wirklichkeit. Zum dritten wurden Denkmäler auf vielfältige Weise in das öffentliche Leben integriert. Die Statuen der Tyrannenmörder und andere öffentliche Ehrenbildnisse wurden bei Festen bekränzt und so in die Festgemeinde einbezogen. Das Denkmal der
35 Eirene: Simon (1988); Meyer (2008). – Römische Memorialtempel: Ziółkowski (1992).
Monumente der Geschichte – Geschichte als Monument?
277
Abb. 4: Alexandermosaik aus Pompeii, Kopie eines Gemäldes des späten 4. Jahrhunderts v. Chr. Schlacht Alexanders des Großen gegen den Perserkönig Dareios III. Napoli, Museo Nazionale Archeologico.
Abb. 5: Friedensgöttin Eirene mit dem PloutosKnaben. Römische Kopie nach griechischem Original des 4. Jahrhunderts v. Chr. München, Glyptothek.
278
Tonio Hölscher
athenischen Friedensgöttin war nicht nur ein Bildwerk zum Betrachten, sondern Gegenstand eines religiösen Kultes, durch den die Teilnehmer an dem Konzept des Friedens aktiv ‚teilnehmen‘ konnten. Die Standbilder des Kaiserpaares Antoninus und Faustina waren ein bildliches Exempel der concordia, das die jungen Ehepaare durch Opfer verehrten und darüber hinaus sogar in der symbolischen Geste des Handschlags imitierten. Die Denkmäler waren Faktoren des öffentlichen Lebens: Sie hoben Personen und Ereignisse in ihrer ideellen Bedeutung über das alltägliche Leben hinaus und forderten die Betrachter auf, an diesen über-alltäglichen Leitbildern teilzuhaben und sich daran zu orientieren. Neben diesem gemeinsamen Fokus auf Personen, Ereignisse und Ideen zeigen sich aber bezeichnende Unterschiede zwischen Griechenland und Rom darin, welche Art von Themen für die Rühmung in Denkmälern gewählt wurde. In Griechenland wird vor allem das Gedächtnis an die ereignishaften Wendepunkte der Geschichte gestiftet. Die Inschrift zu der Gruppe der Tyrannenmörder beginnt: „Wahrlich, ein großes Licht ging den Athenern auf, als Aristogeiton und Harmodios das Vaterland …“ (in Freiheit setzten?). Sodann werden vor allem entscheidende Schlachten gefeiert: Griechen gegen Perser bei Marathon, Alexander gegen Dareios bei Gaugamela (?) und so fort. Umbrüche und Neuanfänge bestimmen das Bild. In den Denkmälern der griechischen Zentren von Delphi, Olympia und Athen erscheint Geschichte als ein Panorama von einzigartigen Höhepunkten des Ruhmes. In Rom dagegen wird machtvolles Handeln weit stärker als Sequenz von öffentlichen Ritualen konzipiert; darin werden in visueller Form Tugenden und Leitbegriffe der Herrschaft vor Augen geführt. In einem Reliefzyklus des Marc Aurel, der die Siege gegen die Marcomannen verherrlicht, ist keine einzige Schlachtszene erhalten, und vielleicht hat es nie eine gegeben. Jedenfalls wird der Feldzug sehr weitgehend in bedeutungsvollen rituellen Aktionen vollzogen: Der Auszug in den Krieg steht für virtus, fortitudo und bellum iustum, die rituelle Reinigung des Heeres für pietas und providentia, die Ansprache an die Soldaten für fides und concordia, die Begnadigung sich unterwerfender Gegner für clementia, und so fort. In den Denkmälern Roms manifestiert sich die Vergangenheit als Sequenz von großen Staatsakten, die in der Erfüllung eines relativ statischen Kanons von Leitvorstellungen durch immer wieder andere Protagonisten der res publica bestehen36. Die griechischen Denkmäler heben vor allem dynamische Kräfte und Aspekte der Geschichte hervor. Die römischen Denkmäler betonen dagegen mehr statische Strukturen und Ideologien. Sie stehen darin den Monumenten des pharaonischen Ägypten nahe, deren Thema pointiert mit „Geschichte als Fest“ bezeichnet wurde37. In Griechenland wie in Rom setzte die Aufstellung von politischen Denkmälern in einer besonders kritischen Phase der Geschichte ein. In Griechenland war es im
36 Hölscher (1980); Zanker (2007) 45–72. 37 Hornung (1966).
Monumente der Geschichte – Geschichte als Monument?
279
5. Jahrhundert v. Chr. die Ablösung der gewachsenen Strukturen der archaischen Polis durch die bewusster gestalteten und umstrittenen politischen Ordnungen der ‚klassischen‘ Zeit, die zu einer neuen Einschätzung von politischem Handeln, politischer Identität und ideeller Orientierung an der Vergangenheit für die Zukunft führte. In Rom war es seit dem 4. die Entstehung einer neuen Leistungs-Elite, der ‚Nobilität‘, die die großen neuen Anforderungen der Expansion von einem Stadtstaat zur ‚Weltmacht‘ zu erfüllen hatte und dabei große Vorbilder für die leitenden politischen Konzepte der res publica ausbildete. In beiden Situationen kam es zu einer in mancher Hinsicht analogen Explizierung des Bereichs der Politik, die in den öffentlichen Denkmälern einen prägnanten Ausdruck gefunden hat38.
6 Monumentale Geschichte Fragt man nach der spezifischen Zeitlichkeit der Denkmäler, so zeigt sich ein paradoxes Phänomen. Während ihre Errichtung nicht nur sukzessiv, sondern auch in einem gezielten, teils polemischen, teils affirmativen diachronen Bezug aufeinander erfolgt war, müssen sich die Monumente aus der Distanz späterer Epochen zu einem großen nahezu synchronen Schaubild vereinigt haben. Schon im späteren 4. Jahrhundert wird einem athenischen Bürger der Besuch der Agora streitig gemacht, weil sein politisches Verhalten nicht der Ehre derer entspreche, die dort in Bildnissen stehen. Hier werden alle Bildwerke in einer gewissen ‚Entzeitlichung‘ als geschichtliches Panorama historischer Größe der Stadt zusammen gesehen. Eine solche gewachsene Ordnung historischer ‚Größe‘ war auch in den sukzessiv aufgestellten Bildnisstatuen auf dem Forum in Rom entstanden. Angesichts der latenten Zeitlosigkeit der Denkmäler war es dann nur konsequent, dass in der Forums-Anlage des Augustus Galerien von Ehrenbildnissen zu einem einheitlichen Konzept zusammengestellt wurden: alle berühmten Männer der Republik, Parteigänger wie Gegner, als Repräsentanten der Größe Roms; dazu der Kaiser, die Personifikationen der Provinzen, die Götter von Nord und Süd: ein zeitenthobenes Panorama des Reiches, seiner Leitbilder, seiner Macht39. Geschichte, wie sie in öffentlichen Denkmälern der Antike, und bis weit in die Neuzeit hinein, vor Augen gestellt wird, ist nicht eine Folge von Ursachen und Wirkungen, von Motivationen und Folgen, von Entwicklungen und Prozessen, auch nicht ein Panorama von sozialen ‚Verhältnissen‘, kollektiven Sitten und Gebräuchen, oder von kulturellen Feldern wie Gewerbe und Handel, ‚Kultur‘ und Religion, Heeroder Finanzwesen. All dies kann implizit in Denkmälern eingeschlossen sein, aber die expliziten Themen der Denkmäler sind ‚große‘ Menschen und ihre ‚großen‘ Taten.
38 Griechenland: Hölscher (1973). – Rom: Hölscher (1978); Hölkeskamp (1987/2011). 39 Zanker (1968); Zanker (1987) 196–217; Spannagel (1999).
280
Tonio Hölscher
Nicht einmal allgemeine politische Leistungen wie Perikles’ Kulturpolitik und Augustus’ Gründung des Principats, sondern Aristogeiton und Harmodios als Tyrannenmörder, Octavian als Sieger bei Actium. Die politischen Leitbilder, Freiheit beim Tyrannenmord, virtus beim Sieg über den ‚Staatsfeind‘, werden im exemplum ‚großer‘ Personen und Taten aufgerufen. Diese werden in einer Form und einer Auffassung dargestellt, die den Anspruch auf überzeitliche Geltung erhebt. Der Prototyp einer solchen ‚monumentalen‘ Geschichtskultur ist das pharaonische Ägypten, in dessen Pyramiden die monumentale Größe, das ‚unvergängliche‘ Material und die Idee des allmächtigen Herrschertums sich zur Monu-Mentalität von „Stein und Zeit“ vereinigen40. Friedrich Nietzsche hat in seiner Typologie der Geschichte bekanntlich drei Arten der Historie unterschieden: Noch vor der antiquarisch-bewahrenden und der kritischurteilenden nennt er als erstes die monumentale Historie. Es ist die Geschichte alles Großen, das einmal war und darum wieder möglich sein soll. Eine Geschichte für diejenigen, die handeln und aus der Vergangenheit Maßstäbe und Zuversicht schöpfen. Nietzsche hat aber auch schon die Gegenrechnung für die Monumentalisierung der Geschichte aufgemacht: dass die fremdartige Individualität des Vergangenen um der Übereinstimmung mit der Gegenwart willen übersehen wird, dass die Vergangenheit gewaltsam der Gegenwart angepasst wird, dass dadurch die Grenze zwischen Geschichte und Mythos verschleiert wird. Monumentale Geschichte „reizt mit verführerischen Ähnlichkeiten den Mutigen zur Verwegenheit, den Begeisterten zum Fanatismus; und denkt man sich gar diese Historie in den Händen und Köpfen der begabten Egoisten und der schwärmerischen Bösewichter, so werden Reiche zerstört, Fürsten ermordet, Kriege und Revolutionen angestiftet“. Wie sehr das bis heute gilt, zeigt sich schlagend an dem Streit zwischen Griechenland und Mazedonien um Alexander den Großen41. Wir werden heute nicht wieder monumentale Historie schreiben. Aber wir sollten uns vor Augen halten, wie viele Zeugnisse der Antike monumentale Geschichte repräsentieren. Diese Zeugnisse beziehen sich einerseits auf die Protagonisten und die Ereignisse der Geschichte, andererseits aber beziehen sie sich aufeinander und bilden ein semantisches Subsystem mit eigenen Grundmustern und Regeln. Wir müssen uns die Frage stellen, wie wir diese Zeugnisse für unsere kritische Geschichte nutzen – und in welches Verhältnis wir sie zu anderen Geschichten setzen, die wir nach anderen medialen Vorgaben konstruieren.
40 Assmann (1991); Assmann (1992) 167–177. 41 Nietzsche (1874/1966); Gehrke (1994) bes. 258–260.
Monumente der Geschichte – Geschichte als Monument?
281
7 Geschichtsbewusstsein? Denkmäler konstituieren Geschichte. Wenn sie Personen oder Ereignisse der mythischen oder ‚historischen‘ Vergangenheit, etwa die Taten des Theseus oder die Schlacht von Marathon, zum Thema machen, so schaffen sie eine Vergangenheit für die Gegenwart; wenn sie Personen und Ereignisse der eigenen Zeit rühmen, etwa lebende Staatsmänner oder aktuelle politische Erfolge, so erheben sie die Gegenwart zur Vergangenheit für die Zukunft. In jedem Fall wird ‚Früheres‘ für ‚Späteres‘ aufbereitet. Damit kommt ‚öffentliche‘ oder ‚kollektive Zeit‘ ins Spiel. Öffentliche Denkmäler (und Inschriften) waren – wohl mehr als die Geschichtsschreibung – die Form, in der die kollektive Vergangenheit den Menschen in der Antike vor allem präsent war und vor Augen stand. Denkmäler sind aber auch die Form, in der Vergangenheit am deutlichsten auf die gegenwärtige Welt bezogen war und Orientierung für Gegenwart und Zukunft schaffen sollte. Sie markierten und schufen öffentliche Räume als Räume, in denen die Gemeinschaft der Gegenwart mit ihren autoritativen Repräsentanten aus der Vergangenheit und der eigenen Zeit in Kontakt trat und das auch in Zukunft tun sollte. Das ist der pragmatische Aspekt der ‚kollektiven Zeit‘, ihre Umsetzung in gelebtes Leben. Man wird hier nicht gleich von einem ausgeprägten ‚Geschichtsbewusstsein‘ sprechen. Wenn Geschichte als Einheit aller einzelnen ‚Geschichten‘, im Sinn einer umfassenden gerichteten Zeitlichkeit aller menschlichen (und gar der natürlichen) Dinge und Verhältnisse verstanden wird und Geschichtsbewusstsein als Reflexion über diese grundsätzliche geschichtliche Einbindung des Menschen in die allgemeine geschichtliche Bewegung, dann sind die Denkmäler der Antike sehr weit entfernt von bewusster ‚Geschichtlichkeit‘. Immerhin aber bezeugen sie – nicht nur bei den Gebildeten, sondern bei der breiten Bevölkerung, die mit den Denkmälern ‚lebte‘ – einen ausgeprägten Sinn für geschichtliche Zeiten, für die eigene Gegenwart im Verhältnis zu ihrer Vergangenheit oder ihren Vergangenheiten wie zu ihrer Projektion in die Zukunft.
Literaturverzeichnis Alings (1996): Reinhard Alings, Monument und Nation. Das Bild vom Nationalstaat im Medium Denkmal – zum Verhältnis von Nation und Staat im deutschen Kaiserreich 1871–1918, Berlin. Andreae (1977): Bernard Andreae, Das Alexandermosaik aus Pompeji, Recklinghausen. Assmann (1991): Jan Assmann, Stein und Zeit. Mensch und Gesellschaft im Alten Ägypten, München. Assmann (1992): Jan Assmann, Kultur und Gedächtnis, München. Bergmann (2000): Marianne Bergmann, „Repräsentation“, in: Adolf H. Borbein, Tonio Hölscher u. Paul Zanker (Hgg.), Klassische Archäologie. Eine Einführung, Berlin,166–188. Bielfeldt (2010): Ruth Bielfeldt, „Wo nur sind die Bürger von Pergamon? Eine Phänomenologie bürgerlicher Unscheinbarkeit im städtischen Raum der Königsresidenz“, Istanbuler Mitteilungen 60, 117–201.
282
Tonio Hölscher
Bielfeldt (2012): Ruth Bielfeldt, „Polis Made Manifest: The Physiognomy of the Public in the Hellenistic City with a Case Study on the Agora of Priene“, in: Christina Kuhn (Hg.), Politische Kommunikation und öffentliche Meinung in der antiken Welt, Stuttgart, 87–122. Borg (1991): Alan Borg, War Memorials. From Antiquity to the Present. London. Bradley (1998): Richard Bradley, The Significance of Monuments. On the Shaping of Human Experience in Neolithic and Bronze Age Europe. London u.a. Brunnsåker (1971): Sture Brunnsåker, TheTyrant-Slayers of Kritios and Nesiotes, Lund. Cohen (1997): Ada Cohen, The Alexander Mosaic. Stories of Victory and Defeat, Cambridge. Fehr (1984): Burkhard Fehr, Die Tyrannentöter oder: Kann man der Demokratie ein Denkmal setzen?, Frankfurt am Main. Fejfer (2008): Jane Fejfer, Roman Portraits in Context, Berlin. Franssen (2011): Jürgen Franssen, Votiv und Repräsentation. Statuarische Weihungen archaischer Zeit aus Samos und Attika, Heidelberg. Gauer (1968): Werner Gauer, Weihgeschenke aus den Perserkriegen, Tübingen. Gehrke (1994): Hans-Joachim Gehrke, „Mythos, Geschichte, Politik – antik und modern“, Saeculum 45, 239–264. Giuliani (1986): Luca Giuliani, Bildnis und Botschaft. Hermeneutische Untersuchungen zur Bildniskunst der römischen Republik, Frankfurt am Main. Himmelmann (2001): Nikolaus Himmelmann, Die private Bildnisweihung bei den Griechen, Wiesbaden. Hölkeskamp (1987): Karl-Joachim Hölkeskamp, Die Entstehung der Nobilität, 2. erw. Auflage 2011, Stuttgart. Hölkeskamp (2012): Karl-Joachim Hölkeskamp, „Im Gewebe der Geschichte(n). Memoria, Monumente und ihre mythistorische Vernetzung“, Klio 94, 380–414. Hölscher F. (2010): Fernande Hölscher, „Die Tyrannenmörder – ein Denkmal der Demokratie“, in: Elke Stein-Hölkeskamp u. Karl-Joachim Hölkeskamp (Hgg.), Die griechische Welt. Erinnerungsorte der Antike, München, 244–258. Hölscher (1973): Tonio Hölscher, Griechische Historienbilder des 5. und 4. Jahrhunderts v. Chr., Würzburg. Hölscher (1974): Tonio Hölscher, „Die Nike der Messenier und Naupaktier in Olympia“, Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts 89, 70–111. Hölscher (1978): Tonio Hölscher, „Die Anfänge römischer Repräsentationskunst“, Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Römische Abteilung, 315–357. Hölscher (1980): Tonio Hölscher, „Die Geschichtsauffassung in der römischen Repräsentationskunst“, Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts 95, 265–321. Hölscher (1998a): Tonio Hölscher, Öffentliche Räume in frühen griechischen Städten, Heidelberg. Hölscher (1998b): Tonio Hölscher, „Images and Political Identity: The Case of Athens“, in: Deborah Boedeker u. Kurt Raaflaub (Hg.), Democracy, Empire, and the Arts in Fifth-Century Athens, Cambridge, Mass., 153–183. Hölscher (2000): Tonio Hölscher, „Augustus und die Macht der Archäologie“, in: Adalberto Giovannini (Hg.), La révolution romaine après Ronald Syme. Bilans et perspectives. Entretiens sur l’antiquité classique XLVI, Genève, 237–281. Hölscher (2004): Tonio Hölscher, „Provokation und Transgression als politischer Habitus in der späten römischen Republik“, Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Römische Abteilung 111, 83–104. Hölscher (2009): Tonio Hölscher, Herrschaft und Lebensalter. Alexander der Große: Politisches Image und anthropologisches Modell, Basel. Hornung (1966): Erik Hornung, Geschichte als Fest, Darmstadt. Ioakimidou (1997): Chryssula Ioakimidou, Die Statuenreihen griechischer Poleis und Bünde aus spätarchaischer und klassischer Zeit, München.
Monumente der Geschichte – Geschichte als Monument?
283
Jacquemin (1999): Anne Jacquemin, Offrandes monumentales à Delphes, Paris. Koselleck u. Jeismann (1994): Reinhart Koselleck u. Michael Jeismann (Hgg.), Der politische Totenkult. Kriegerdenkmäler in der Moderne, München. Krumeich (1997): Ralf Krumeich, Bildnisse griechischer Herrscher und Staatsmänner im 5. Jahrhundert v. Chr., München. Ma (2007): John Ma, „Hellenistic Honorific Statues and their Inscriptions“, in: Zahra Newby u. Ruth E. Leader-Newby, Art and Inscriptions in the Ancient World, Cambridge, 203–220. Ma (2012): John Ma, „Honorific Statues and Hellenistic History“, in: Cristopher Smith u. Liv Mariah M. Yarrow (Hgg.), Imperialism, Cultural Politics, and Polybius, Oxford, 230–251 Mayer (2002): Emanuel Mayer, Rom ist dort, wo der Kaiser ist, Mainz. Mayer (2010): Emanuel Mayer, „Propaganda, Staged applause, or Local Politics? Public Monuments from Augustus to Septimius Severus“, in: Björn C. Ewald u. Carlos F. Noreña (Hgg.), The Emperor and Rome. Space, Representation and Ritual, Cambridge, 111–134. Meier (1980): Christian Meier, Die Entstehung des Politischen bei den Griechen, Frankfurt am Main. Menkovic (1998): Biljana Menkovic, Politische Gedenkkultur. Denkmäler: Die Visualisierung politischer Macht im öffentlichen Raum, Wien. Meyer (2008): Marion Meyer, „Das Bild des ‚Friedens‘ im Athen des 4. Jhs. V.Chr.: Sehnsucht, Hoffnung und Versprechen“, in: Marion Meyer (Hg.), Friede – eine Spurensuche, Wien, 61–81. Mittig (1987): Hans-Ernst Mittig, „Das Denkmal“, in: Werner Busch u. Peter Schmoock (Hgg.), Kunst. Die Geschichte ihrer Funktion, Weinheim u.a. Nietzsche (1874/1966): Friedrich Nietzsche, „Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben“, „Unzeitgemäße Betrachtungen, zweites Stück“, in Friedrich Nietzsche, Werke in drei Bänden (Hg. Karl Schlechta), München 1966, 209–285. Papini (2004): Massimiliano Papini, Antichi volti della repubblica. La ritrattistica in Italia centrale tra IV e II secolo a.C., Roma. Raubitschek (1949): Antony E. Raubitschek, Dedications from the Athenian Acropolis, Cambridge, Mass. Reuße (1995): Felix Reuße, Das Denkmal an der Grenze seiner Sprachfähigkeit, Stuttgart. Riegl (1903/1995): Alois Riegl, Der moderne Denkmalkultus, seine Entstehung, seine Bedeutung, Wien. Wieder abgedruckt in: Wolfgang Kemp (Hg.), Alois Riegl. Gesammelte Aufsätze, Berlin, 1995, 144–193. Schalles (1985): Hans-Joachim Schalles, Untersuchungen zur Kulturpolitik der pergamenischen Herrscher im dritten Jahrhundert v. Chr., Tübingen. Scharf (1984): Helmut Scharf, Kleine Kunstgeschichte des deutschen Denkmals, Darmstadt. Schlie (2008): Ulrich Schlie, Die Nation erinnert sich. Die Denkmäler der Deutschen. München. Schweitzer (1939) = (1969): Bernhard Schweitzer, „Das Problem der Form in der Kunst des Altertums“, in: Walter Otto (Hg.), Handbuch der Archäologie, München 1939, 363–399. Wieder abgedruckt in: Ulrich Hausmann (Hg.), Allgemeine Grundlagen der Archäologie. Handbuch der Archäologie, München 1969, 163–203. Sehlmeyer (1999): Markus Sehlmeyer, Stadtrömische Ehrenstatuen der republikanischen Zeit, Stuttgart. Simon (1988): Erika Simon, Eirene und Pax. Friedensgöttinnen der Antike, Stuttgart. Simon u. Hirmer (1981): Erika Simon, Max Hirmer u. Albert Hirmer, Die griechischen Vasen, München. Spannagel (1999): Martin Spannagel, Exemplaria principis. Untersuchungen zu Entstehung und Bedeutung des Augustusforums, Heidelberg. Stähler (1993): Klaus Stähler, Form und Funktion. Kunstwerke als politisches Ausdrucksmittel, Münster. Stewart (1993): Andrew Stewart, Faces of Power. Alexander’s Image and Hellenistic Politics, Berkeley u.a.
284
Tonio Hölscher
Stewart (2008): Andrew Stewart, Classical Greece and the Birth of Western Art, Cambridge. Strack (1937): Paul Strack, Untersuchungen zur römischen Reichsprägung des zweiten Jahrhunderts III. Die Reichsprägung zur Zeit des Antoninus Pius, Berlin. Tanner (2000): Jeremy Tanner, „Portraits, Power and Patronage in the Late Roman Republic“, Journal of Roman Studies 90, 18–50. Tanner (2006): Jeremy Tanner, The Invention of Art History in Ancient Greece, Cambridge. Taylor (1992): Michael W. Taylor, The Tyrant Slayers. The heroic image in fifth-century B.C. Athenian art and politics. 2. Auflage, Salem, N.H. Thompson u. Wycherley (1972): Homer A. Thompson u. Richard E. Wycherley, The Agora of Athens. The Athenian Agora 14, Princeton, N.J. Weiß (2008): Peter Weiß, „Die vorbildliche Kaiserehe. Zwei Senatsbeschlüsse beim Tod der älteren und der jüngeren Faustina, neue Paradigmen und die Herausbildung des ‚antoninischen‘ Prinzipats“, Chiron 38, 1–45. Zanker (1970): Paul Zanker, Forum Augustum. Das Bildprogramm, Tübingen. Zanker (1987): Paul Zanker, Augustus und die Macht der Bilder, München. Zanker (2007): Paul Zanker, Die römische Kunst, München. Ziółkowski (1992): Adam Ziółkowski, The Temples of Mid-Republican Rome and their Historical and Topographical Context, Rom.
Abbildungsnachweise Abb. 1 Abb. 2 Abb. 3 Abb. 4 Abb. 5
Photo DAI Rom Photo Musée du Louvre, Paris nach Strack (1937) Taf. 10, 826 Photo DAI Rom Photo Glyptothek, München
Historische Dimensionen des gebauten Raumes
285
Susanne Muth
Historische Dimensionen des gebauten Raumes – Das Forum Romanum als Fallbeispiel 1 1
Räumliche Wahrnehmung rettet für die Historiographie jene Komplexität, mit der die lebensweltliche Erfahrung Tag für Tag und unausgesetzt konfrontiert ist. … Der Blick in den Raum ist eine gute Schule für eine grundlegende Erfahrung: für die Wahrnehmung der Gleichzeitigkeit der Ungleichzeitigkeit, für das Heterotope und Heterogene. Der Hauptgewinn ist die Rückgewinnung von Komplexitätsbewusstsein und eine darauf basierende ‚Strategie‘ der Steigerung von Komplizierungen anstelle einer Strategie der Reduzierung und Simplifizierung. Geschichtliche Wahrnehmung wird reicher und Geschichtsschreibung komplexer und komplizierter.“ Karl Schlögel.2
1 Der gebaute Raum als plurimediales Produkt Seit den wegweisenden Arbeiten von Walter Benjamin und Fernand Braudel ist der Raum zu einer immer festeren Größe in den historischen Wissenschaften geworden3. Seine geschichtliche Relevanz definiert sich dabei sowohl in seiner Formung durch die Menschen, die ihn benutzen, als auch in seiner Wirkung auf die Menschen, die in ihm leben und handeln. Diese Eignung des Raumes als polyvalenter Forschungsgegenstand hat ihn zunehmend für verschiedenste Fragestellungen der geschichts-, kultur- und sozialwissenschaftlichen Disziplinen attraktiv werden lassen – was schließlich in den späten 1980er/frühen 1990er Jahren zu einer pro-
1 Dank für kritische Lektüre und anregende Diskussion sage ich Jessica Bartz, Lukas Bossert, Nikolaus Dietrich, Tonio Hölscher und Eva Winter, sowie ferner Armin Müller für die digitalen Rekonstruktionen zum Forum, die dem virtuellen Modell des vom Exzellenzcluster Topoi geförderten DigitalenForum-Romanum-Projektes an der HU Berlin (http://www.digiforo.hu-berlin.de (Stand 24. 05. 2013)) entstammen. – Die im Sinn eines Fallbeispiels dargelegten Überlegungen zum Forum Romanum basieren auf einem größeren Forschungsprojekt, an dem ich dank eines Fellowships am Wissenschaftskolleg zu Berlin 2007/08 sowie der Mitarbeit am Exzellenzcluster Topoi seit 2009 arbeiten konnte: Beiden Institutionen gilt mein Dank für die wunderbaren Möglichkeiten intensiven Forschens. Da die Ergebnisse dieses Projektes in einer Monographie zum Forum Romanum dargelegt werden, beschränke ich die folgenden exemplarischen Ausführungen hier auf das Nötigste und verweise auf die zukünftige ausführlichere Darstellung. 2 Zitat: Schlögel (2007) 46. 3 Grundlegend waren vor allem Walter Benjamins Passagen-Werk von 1927–1940 (Benjamin [1991]) sowie Fernand Braudels La Méditeranée von 1949 (Braudel [1949]). – Zur Geschichte der (Wieder-)Entdeckung des Raumes in den Geschichts-, Kultur- und Sozialwissenschaften allgemeinen s. die Darstellungen bei Ebeling (2010); Kajetzke u. Schroer (2010); Bachmann-Medick (2006) 284–328; sowie für die einzelnen Disziplinen: Löw (2001); Schlögel (2003) bes. 60–71; Schlögel (2007); Böhme (2009); Sandl (2009); Schroer (2009); Rau (2013).
286
Susanne Muth
grammatischen Hinwendung zum Raum führte, in Gestalt des vielbeschworenen ‚spatial turn‘ (sowie seiner kultur- und medienwissenschaftlichen Ausdifferenzierungen in Form des ‚topographical turn‘ bzw. ‚topological turn‘)4. Heutzutage sind die Geschichtsdurchdringung von Raum bzw. die Verräumlichung von Geschichte geradezu Selbstverständlichkeiten in den Diskussionen der Geschichts- und Kulturwissenschaften. Im Kontext von ‚Geschichte‘ von ‚Raum‘ zu sprechen, bedarf folglich keiner Rechtfertigung. Wie aber verhält es sich bei der Frage nach den ‚Medien‘, auf welche der vorliegende Band ebenso zielt? Wie sinnvoll bzw. hilfreich ist es, hierbei ‚Raum‘ als eigene Kategorie anzuwenden? Angesichts der vielfältigen Definitionen des Medienbegriffs mag man auf diese Frage hin unterschiedliche Positionen einnehmen und entsprechend verschieden antworten5: Gemäß einer weiteren, abstrakten Definition von den Medien als ‚symbolische Kommunikationsmedien‘, die in der Welt Sinn und Wissen vermitteln und Realitäten schaffen, wie dies vor allem seitens der Systemtheorie favorisiert wird6, mag schließlich auch der ‚Raum‘ als Medium einbezogen werden, da auch er Vorstellungen von der Welt und der Gesellschaft vermittelt bzw. Wahrnehmungen konstruiert. Anders sieht es jedoch aus, wenn wir einen engeren Medienbegriff anlegen, der den Fokus stärker auf die technologische bzw. sensuelle Materialität des medialen Objektes legt und entsprechend eher nach den ‚konkreten Vermittlungsmedien‘ fragt, wie dies vor allem aus Sicht der Kultur- und Medienwis-
4 Zum ‚spatial turn‘ bzw. seine Ausdifferenzierungen in ‚topographical turn‘ und ‚topological turn‘: Bachmann-Medick (2006) 284–328; Döring u. Thielmann (2008); Csáky u. Leitgeb (2009); Warf u. Arias (2009); Döring (2010); Wagner (2010); Lippuner u. Lossau (2010); Günzel (2007); Günzel (2008); Hilger (2011). 5 Zu den verschiedenen Positionen in der Medientheorie s. die Überblick bei Leschke (2003) 9–31, 161–297; Schanze (2002b); Lagaay u. Lauer (2004a, 2004b); Münker u. Roesler (2008); Schläger (2008); sowie ferner Kloock u. Spahr (2000); Helmes u. Köster (2002). 6 Zum Spektrum eines weiter gefassten Medienbegriffs und der damit verbundenen Problematik seiner semantischen Entgrenzung: Lagaay u. Lauer (2004b) 7–8, 15–16, 22 (ebd. 7: „Er [i.e. der Medienbegriff, SM] steht im Begriff, sich als Bezeichnung für konstitutive Faktoren des menschlichen Selbstund Weltverhältnisses überhaupt zu etablieren und somit die Famile der diskurskonstituierenden Schlüsselbegriffe der genannten Wissenschaften (wie „Sprache“, „Zeichen“, „Text“, „Kultur“ und „Praxis“) als neues Mitglied zu bereichern.“); Leschke (2003) 11, 17–18; Münker u. Roesler (2008) 10–11; Rauscher (2008); Schmidt (2008) 150–157; Wiesing (2008). – Grundlegend hierbei vor allem die Definition des Medienbegriffs bei Niklas Luhmann: Luhmann (1987) 220–223, 338–339, 513; Luhmann (1997) 190–412; s. hierzu auch Leschke (2003) 215–223. Luhmann unterscheidet drei Arten von Medien: Sprache, Vermittlungsmedien und symbolisch generalisierte Kommunikationsmedien; erst letztere garantieren den Erfolg der gesellschaftlichen Kommunikation. Zu ihnen zählt er u.a. „Wahrheit, Liebe, Eigentum/Geld, Macht/Recht; in Ansätzen auch religiöser Glaube, Kunst und heute vielleicht zivilisatorisch standardisierte ‚Grundwerte‘“(Luhmann [1987] 222). – Eine ebenso weite, theoretisch jedoch anders begründete Mediendefinition wählt Herbert Marshall McLuhan, der die Medien als Ausweitung des Körpers, seines Handelns und Wahrnehmens versteht: McLuhan (1964); s. dazu Leschke (2003) 245–257; Kloock u. Spahr (2000) 39–76.
Historische Dimensionen des gebauten Raumes
287
senschaften bevorzugt wird7: Hier wird man ‚Raum‘ kaum als eigenständiges Medium, denn vielmehr als ein medial konstruiertes Produkt verstehen – ein Konstrukt, das erst im Zusammenspiel verschiedener Medien (Literatur, Bild, Architektur etc.) vermittelt wird. Im Horizont der Klassischen Archäologie, der an einer möglichst differenzierten Definition der verschiedenen materiellen Praktiken sozialer Kommunikation gelegen ist, wird man wohl einer solchen, engeren Anwendung des Medienbegriffs eher den Vorzug geben wollen. Warum dann aber ein Beitrag zu ‚Raum‘ in diesem Band zu den ‚Medien der Geschichte‘? Nun gäbe es freilich diesen Beitrag hier nicht, wenn sich nicht auf diese Frage auch eine positive Antwort geben ließe. Die Anwendung eines engeren Medienbegriffs auf den ‚Raum‘ findet letztlich ihre Rechtfertigung, und darüber hinaus sogar ihren Sinn – jedenfalls dann, wenn wir uns innerhalb der vielfältigen Raumkonzepte8 auf den physisch realen und konkreten materiellen, sprich den ‚gebauten Raum‘ beziehen, der im Zentrum der folgenden Überlegungen stehen soll. Auch im gebauten Raum wirken verschiedene Einzelmedien zusammen: in erster Linie Architektur9 (in Form von raumgestaltenden und raumbegrenzenden Strukturen), sodann Bilder (beispielsweise in Form von statuarischen Monumenten oder architektonischem Bildschmuck), eventuell Texte (in Form von Inschriften) oder performative Handlungen (in Form von Ritualen). Erst aus ihrem medialen Zusammenspiel konstituiert sich dann der gebaute Raum, sei es ein Innenraum oder Gebäude, sei es ein urbaner Raum, sei es ein Stadtraum oder Landschaftsraum. Dieses Zusammenwirken verschiedener distinktiver Einzelmedien lässt den gebauten Raum somit zu einer Medienkombination werden. Gerade hierin aber, in seiner Bedeutung als Medienkombination, gewinnt der Raum plötzlich ein eigenes mediales Profil. Die Medienkombination gilt bekanntlich als Teilphänomen der Intermedialität, welche sich in der jüngeren medienwissenschaftlichen Diskussion als ein vielversprechender Schlüssel zum Verstehen der Medien in ihrem kulturellen Funktionieren erweist10. Das Interesse an Medienkombina-
7 Zum engeren Medienbegriff und seiner konkreten Anwendung in der Forschung s. Leschke (2003) 23–25, 33–159; Lagaay u. Lauer (2004b) 19–22; Kloock u. Spahr (2000) 99–131 (Neil Postman), 165–203 (Friedrich A. Kittler); Wiesing (2008) 238–248; Schmidt (2008). 8 Zum weiten Spektrum der Konzepte zwischen einerseits abstrakten Räumen, die in Literatur oder Kunst vermittelt werden, und andererseits physisch konkreten Räumen s. Günzel (2007); Döring u. Thielmann (2008); Bachmann-Medick (2010) 284–328; Günzel (2010); Hilger (2011) 11–52. 9 Zur Betonung der Architektur als ‚soziales Medium‘: Delitz (2009a) bes. 11–27, 167–191, 191–209; Delitz (2009b) bes. 86–89, 90–111; Delitz (2009c) bes. 164, 166, 177; Fischer u. Delitz (2009) 13; Delitz (2010); Fischer (2010). Dem kulturphilosophische Ansatz von Helmuth Plessner folgend, wird besonders bei Delitz (2009a, 2009b, 2009c) und Fischer ([2010] 65–68) die Eigenlogik der Architektur als eigenes Medium betont, in Absetzung von anderen Medien wie Sprache, Bild, Musik; für ihr mediales Funktionieren wesentlich ist die Kombination von Visualität, Taktilität und Kinästhetik. 10 Rajewsky (2002), speziell zur Medienkombination ebd. 15–16, 18–22, 25, 53–54, 56–57, 176–177; Siebert (2002); Wolf (2008); Paech (2009); Müller (2009); Helbig (2009).
288
Susanne Muth
tionen basiert dabei auf der Tatsache, dass in der kulturellen Realität die Mehrzahl der Einzelmedien nur selten für sich separiert wirken, sondern dies meist neben anderen Medien oder sogar konkret mit ihnen zusammen tun. Im parallelen oder aufeinander bezogenen Wirken der Einzelmedien entstehen neue mediale Angebote, bei denen sich die Potentiale der einzelnen medialen Verfahren der Bedeutungskonstitution gegenseitig festigen, ergänzen, verstärken, erweitern, widersprechen oder aufheben; oftmals werden die jeweiligen Potentiale sogar gezielt aufeinander ausgerichtet, um eine komplexere Kommunikation zu realisieren. Solche Medienkombinationen können dabei neue multimediale Produkte schaffen, die ihrerseits als eigenständige (‚plurimediale‘) Medien verstanden werden können: Berühmte Beispiele hierfür sind etwa Oper oder Klanginstallationen, bei denen erst die Kombination verschiedener (sprachlicher, akustischer und visueller) Kommunikationssysteme die eigentlich intendierte Bedeutung rezipierbar werden lässt11. Auch mit Blick auf die antiken Medien ist die Frage nach den Medienkombinationen verheißungsvoll. Viele der Einzelmedien, die in diesem Band diskutiert werden, wirkten in den konkreten Kontexten der antiken Lebenskultur nebeneinander und teils sogar bewusst aufeinander bezogen, als verschiedene Seiten einer intentional zusammengeführten Kommunikation. Und die Menschen der antiken Kulturen bedienten sich der verschiedenen Medien auch immer wieder ganz bewusst im dialogischen Zusammenspiel, um sich von einer komplexeren diskursive Atmosphäre umgeben zu lassen: So wurden beim griechischen Symposion sowohl Epen vorgetragen als auch gleichzeitig Bilder auf der bemalten Luxuskeramik betrachtet; auf den römischen Fora bestimmten Inschriften und Bilder gemeinsam die Wirkung der repräsentativen Monumente; in den römisch-kaiserzeitlichen Gräbern wurden verschiedene Aspekte des Totenlobs auf die verschiedenen Kommunikationssysteme, Grabepigramme und bildgeschmückte Sarkophage, verteilt, um so die verschiedenen Seiten des Diskurses gemäß den jeweiligen medialen Potentialen eindrücklicher zu formulieren: präzise Rühmung der Tugenden im Epigramm, emotional aufgeladenes und panegyrisches Totenlob im Sarkophagbild12. Verstehen wir derartige Kombinationen verschiedener medialer Systeme als konstitutives Phänomen bei der konkreten Ausgestaltung antiker Lebenskontexte, was m.E. sinnvoll erscheint, dann ist es legitim und zugleich wichtig, bei den Fragen nach dem Umgang der antiken Gesellschaften mit ihren Medien neben der Analyse der Einzelmedien auch den Blick auf die Medienkombinationen bzw. (als deren Sonderform) auf
11 Zur Definition von ‚plurimediale Medien‘ (auch ‚polymediale‘ oder ‚hybride‘ Medien genannt): Rajewsky (2002) 15–16, 18–22, 35, 57, 163, 176; Wolf (2008) 327; Müller (2009). 12 Zur Erforschung des dialogischen Zusammenwirkens der verschiedenen Medien in den antiken Kulturen (bezogen auf Bild und Text): Squire (2009); Muth u.a. (2012). – Zum konzeptionellen Zusammenspiel von Bild und Grabepigramm im römischen Grabkontext: Muth (2005) 262–264; Muth (2011) 334–337; Muth u. Petrovic (2013) 306–311.
Historische Dimensionen des gebauten Raumes
289
die plurimedialen Medien zu lenken13. Bezogen auf den gebauten Raum, von dem wir ausgegangen waren, ist somit die Antwort ebenfalls klar: Als ein plurimediales Produkt, in dem Architektur, Bilder, Inschriften sowie Rituale als einzelne distinktive Kommunikationssysteme zusammen wirken und dadurch ein eigenständig wahrnehmbares kommunikatives Angebot bilden, stellt auch der gebaute Raum folglich eine mediale Kategorie dar, die es im Rahmen der ‚Medien der Geschichte‘ zu berücksichtigen gilt. Die Frage nach der Rechtfertigung ist die eine Seite, die nach der Sinngebung die andere. Entsprechend müssen wir uns auch fragen, was wir damit eigentlich gewinnen, wenn wir den gebauten Raum als ein plurimediales Medium ansprechen? Seine Bedeutung als historisches Zeugnis steht außer Frage, vor allem gemäß den Ansätzen der Architektursoziologie14, jenseits aller Mediendiskussion. Was erschließen wir also darüber hinaus für die Fragen nach der Geschichte, wenn wir den Raum statt einfach nur als ‚Zeugnis‘ nun als ‚Medium der Geschichte‘ ansprechen? Die Reflexion auf den Medienbegriff erwirkt für die Besprechung der materiellen Zeugnisse vor allem eine stärkere Differenzierung in ihrer historischen Aussagekraft. Denn die Mediendiskussion fragt nach den spezifischen Strukturen, Potentialen und Grenzen der jeweiligen Kommunikationssysteme bei ihrer Konstitution von Bedeutung, betont somit nachhaltig die mediale Eigenständigkeit, Eigengesetzmäßigkeit und auch Eigenlogik der verschiedenen (medialen) Typen von Zeugnissen – und sensibilisiert folglich den Blick vor allem für die Fragen nach den Divergenzen in der historischen Aussagekraft der Zeugnisse. Die mediale Reflexion auf die historischen Zeugnisse fördert es somit, bei der Erforschung der historischen Realitäten vor allem die Komplexitäten, Kompliziertheiten und gegebenenfalls auch Widersprüche aufzudecken, – und wirkt entsprechend einer zu starken Vereinheitlichung der aus den Zeugnissen (re-)konstruierten Geschichte entgegen. Gleichzeitig gewinnt aber auch das als ‚historisches Zeugnis‘ diskutierte Objekt an eigenem und komplexerem Potential, indem wir es eben nicht nur als statisches ‚Zeugnis‘, sondern als dynamisches ‚Medium‘ befragen. Während der Begriff des ‚Zeugnisses‘ die Bedeutung und Wirkungskraft des Objektes allein auf diejenigen Kriterien reduziert, auf die hin wir es eben als Zeugnis befragen, impliziert der Begriff des ‚Mediums‘ eingedenk der Eigenständigkeit und Eigenlogik des Medialen, dass hier ein Bedeutungs- und Wirkungsüberschuss vorliegt, den es ebenso als Angebot zu bedenken gilt, der jedoch bei der enger gefassten Perspektive auf das ‚Zeugnis‘ aus dem
13 Entsprechendes Plädoyer für eine verstärkte Berücksichtigung intermedialer Phänomene in den Altertumswissenschaften: Squire (2009); Muth in: Muth u.a. (2012) bes. 13–14, 21. Bezogen allgemein auf die Geisteswissenschaften: Rajewsky (2002) 1–2; Paech (2009); Helbig (2009). 14 Grundlegend für die Ansätze der Architektursoziologie: Schäfers (2006); Delitz (2009b); Delitz (2009c); Schäfers (2009); Schäfers (2010); sowie verschiedene Beiträge in Delitz (2009a), Fischer u. Delitz (2009) und Trebsche u.a. (2010).
290
Susanne Muth
Blick gerät15. So mag man im Fall des gebauten Raumes, jenseits aller mit der Architektur zunächst auf vordergründigen Ebenen intendierten Leistungen wie z.B. die Konstruktion von Machtverhältnissen oder sozialen Beziehungen oder aber die Förderung bzw. Eingrenzung sozialen Handelns, etwa an die Evozierungen von Atmosphäre oder die Erwirkung sinnlicher Affekte durch die Materialität und Ästhetik des gebauten Raumes denken16. Der Medienbegriff vermag somit für das als historisches Zeugnis befragte Objekt seine Eigenwertigkeit und Eigenkapazität zu retten. Diese beiden Überlegungen machen deutlich, dass sowohl die Frage nach der Geschichte als auch die Diskussion des gebauten Raumes als historisches Zeugnis von der Einbindung des Medienbegriffes durchaus gewinnen. Entsprechend sei es im Folgenden als zweifache Chance verstanden, den gebauten Raum im Kontext der ‚Medien der Geschichte‘ zu besprechen.
2 Die historische Interpretierbarkeit des gebauten Raumes Was gewinnen wir nun für unser historisches Verständnis von den Kulturen des antiken Griechenlands und Roms, wenn wir den gebauten Raum betrachten? Was leistet der gebaute Raum für die historischen Fragen, welchen Einblick in ‚Geschichte‘ eröffnet er, was gewinnen wir eventuell gar gegenüber den über andere Medien ermöglichten Zugriffen – aber auch: was verlieren wir beim Blick auf den Raum, wo sind seine Grenzen? Da der gebaute Raum zugleich auch immer ein physisch realer Ort ist, ist er automatisch entsprechend geschichtsbeladen. Denn als Schauplatz verschiedenster
15 Zum Bedeutungs- und Effektüberschuss des Mediums s. vor allem Münker (2008) 327–328: „Philosophisch interessant sind Medien selbst, …, weil ihnen ein gewisses Surplus an Sinn ebenso wie an Wirkung innewohnt, ein Bedeutungs- und Effektüberschuss eigen ist, der dazu führt, dass Medien zumeist mehr sind, als sie zunächst scheinen; dass sie meist (auch) anderes tun, als sie eigentlich sollen – und dass sie das, was sie tun, immer wieder anders tun, als wir es zunächst erwarten. Medien sind Dinge, die in ihrer Dinglichkeit nicht aufgehen; ihre mediale Idee transzendiert immer wieder die eigene Gegenständlichkeit – und überrascht, enttäuscht oder übertrifft die Erwartungen ihrer Nutzer.“ (ebd. 327). – Im Sinne des Surplus der Medien wäre etwa im Fall der Bilder das von Luca Giuliani in seinem Beitrag (s. o. S. 223–225) angesprochene Potential der ästhetischen Unterhaltung zu bedenken. – Voraussetzung für diese Sicht ist freilich die Ablehnung eines Medienverständnisses, das das Medium primär auf seine Funktion eines neutralen und möglichst transparenten Träger von Information reduziert, wie dies etwa in den phänomenologischen Medientheorien vertreten wird, s. dazu Groys (2000); sowie kritisch Lagaay u. Lauer (2004b) 12, 24–25; Krämer (2008) 68–73; Wiesing (2008) bes. 236, 245–254. 16 Hierzu s. etwa Böhme (2006); Bieger (2007); Hasse (2012); Delitz (2009a) u.a. 183–185, 191–200, 320–322; Delitz (2009b) 78–89; Delitz (2009c) 174–175; Lehnert (2011) 9–17.
Historische Dimensionen des gebauten Raumes
291
Schichten von (Ereignis-)Geschichte(n) ist in ihm immer Geschichte unterschiedlichster Couleur eingeschrieben: das Haus in Pompeji als Schauplatz des Todes einer Familie beim Vesuvausbruch, eine Stadtvilla im spanischen Italica als Geburtsort des späteren Kaisers Traian, das Forum Romanum als Bühne der Reden Ciceros gegen Catilina oder Marc Anton, das Capitol als Schauplatz der Kämpfe zwischen den Anhängern des Vitellius und des Vespasian, der Palatin als Ort der Ermordung Domitians etc. Die Bedeutung des gebauten Raumes als ‚Bühne von Ereignisgeschichte‘ kann jedoch kaum das sein, wonach wir primär fragen, wenn wir die (pluri)mediale Dimension des gebauten Raumes für die Fragen nach der Geschichte diskutieren wollen. Hat doch die mediale/materielle Ausgestaltung des Raumes kausal zunächst wenig mit den hier konkret geschehenen Ereignissen zu tun; diese sind vielmehr von außen in ihn hineingetragen worden und beeinflussen somit nicht zwangsläufig das Erscheinungs- und Wirkungsbild des gebauten Raumes. Erst wenn an diese Ereignisse wiederum am Ort des Geschehens in Form von Monumenten, Ruinen o.ä. memoriert wird, wird eine solche Ereignisgeschichte konkret durch die materielle Ausgestaltung des Raumes konstituiert und kommuniziert: Doch diese materiell konkretisierte Memorierung des Raumes als Schauplatz von punktueller Ereignisgeschichte bildet nur einen Sonderfall innerhalb der historischen Dimensionen des gebauten Raumes. Weitaus grundlegender für unsere Fragestellung erweist sich dagegen das Verständnis vom gebauten Raum als wechselseitig funktionierendes soziales Produkt: einerseits von der Gesellschaft17 geschaffen und andererseits das Handeln, Kommunizieren und Leben in ihm konstituierend – wie es besonders von Henri Lefebvre und Michel Foucault betont und jüngst als neuer Ansatz in der Architektursoziologie weiterentwickelt wurde18. Wichtig dabei ist, den Raum nicht als statisch-passive ‚Kulisse‘ bzw. ‚Bühne‘ des Handelns oder als neutralen ‚Spiegel‘ bzw. ‚Ausdruck‘ der Gesellschaft zu begreifen; vielmehr kommt dem Raum auch dynamisch-aktive Kraft zu, indem er mittels seiner Materialität Bewegungen, Wahrnehmungen und Emotionen evoziert und somit Handeln, Kommunizieren und Leben konstituiert19. „Zwar wirkt sich das Soziale zweifelsohne auf die Architektur aus; aber zugleich hat die gebaute
17 Wenn hier und im Folgenden der Begriff der ‚Gesellschaft‘ im Singular verwendet wird, so geschieht dies freilich im Wissen um die Probleme einer solchen Simplifizierung: Selbstverständlich ist hier immer von unterschiedlichen diachronen und synchronen Differenzierungen von ‚Gesellschaft‘ auszugehen, je nachdem, welche Gruppierungen der ‚Gesellschaft‘ jeweils Anteil an der Entscheidungsfindung über die Ausgestaltung von Raum haben bzw. konkret den Raum benutzen. 18 Lefebvre (1991); Foucault (1977); Architektursoziologie: bes. Delitz (2009a, 2009b, 2009c). 19 So schon Lefebvre (1991) 411 „The outcome is a vast movement in terms of which space can no longer be looked upon as an ‚essence‘, as an object distinct from the point of view of (or as compared with) ‚subjects‘, as answering to a logic of its own. Nor can it be treated as a result or resultant, as an empirically verifiable effect of a past, a history or a society. Is space indeed a medium? A milieu? An intermediary? It is doubtless all of these, but its role is less and less neutral, more and more active, both as instrument and as goal, as means and as end.“. – Vgl. auch Delitz (2009b) 74–89; (2009c) bes. 164–165, 174–177.
292
Susanne Muth
Gestalt zutiefst eine eigene soziale ‚Effektivität‘“ (Heike Delitz20). Diese Wechselwirkung zwischen Raum und Gesellschaft gilt es bei allem Fragen im Blick zu halten. Wenn sich die Gesellschaft also den betreffenden Raum materiell so formt, dass er die von ihr hier gesuchten/gewünschten Praktiken des Lebens, Handelns, Kommunizierens und Fühlens unterstützt, und wenn umgekehrt der so gestaltete Raum seinerseits seinen Benutzern bestimmte Aktionen, Reflexionen, Diskurse und Emotionen primär nahelegt und andere eher unterbindet – und damit aktiv Anteil an der Vollziehung von Leben und Realisierung von Geschichte hat –, dann eröffnet die Analyse des gebauten Raumes entsprechende Einblicke in die Vorstellungen von der Welt und dem Leben, soweit sie den jeweiligen Raum und das Leben in ihm betreffen. Konkret lassen sich hier Vorstellungen von der sozialen Struktur, der politischen Macht sowie den gesellschaftlichen (Wert-)Diskursen rekonstruieren, ferner Wahrnehmungen von sozialen Rollen sowie vom kommunikativen Handeln im Raum, schließlich Umgang mit Emotionen und Stimmungen, kurzum: verschiedenste Aspekte des diskursiven, mentalen und psychischen Haushaltes der jeweiligen Gesellschaft. Und damit werden wiederum verschiedene Ebenen von ‚Geschichte(n)‘ berührt, im Spektrum von Sozial-, Politik-, Wirtschafts-, Kultur-, Religions- und Mentalitätsgeschichte. Bei der Ausgestaltung des gebauten Raumes ist folglich konkret zu fragen21: Welche Bewegungen und Handlungen werden durch die architektonische Formung provoziert und unterstützt, und welche eher verhindert oder zumindest erschwert? Welche Diskurse werden durch bildliche Ausstattung und Inschriften evoziert und welche nicht? Welche Atmosphären werden geschaffen und dem Benutzer angeboten? Und wer entscheidet über die jeweiligen Praktiken der materiellen Formung des Raumes, wer ist Auftraggeber, wer primär intendierter Benutzer, wer eher zufälliger oder nicht intendierter Benutzer? Neben der konkreten Schaffung und Formung des jeweiligen Raumes ist darüber hinaus aber auch dessen Dauer über die Zeit seiner Entstehung hinaus zu bedenken22: Gebaute Räume überdauern in der Mehrzahl die sie schaffenden Gesellschaften und wirken auf spätere Benutzer gleichermaßen, indem sie deren Handeln, Kommunizieren, Wahrnehmen und Fühlen ebenso (zumindest zum Teil) konstituieren. Hier
20 Delitz (2009a) 12; entsprechend spricht Delitz die Architektur als „aktives ‚Medium‘ des Sozialen“ an (ebd.). 21 Zum Folgenden s. besonders: Schäfers (2006) 28–38, 44–54; Böhme (2006); Delitz (2009a) bes. 12–27, 167–200; Delitz (2009c); Fischer (2010); Schäfers (2010); Lehnert (2011); Hasse (2012). – Beispiele entsprechender Diskussionen (jenseits der Räume der Antike): Janson u. Bürklin (2002); Böhme (2006) 126–150; Hochmuth u. Rau (2006); Bieger (2007); Delitz (2009a) 217–315; Delitz (2010); Schäfers (2010) 36–38; Nova u. Jöchner (2010); Hasse (2012) passim; Rau (2013) bes. 122–191. 22 S. hierzu auch die Unterscheidung von ‚Räumen‘ der Gegenwart bzw. Zukunft und den ‚Orten‘ der Vergangenheit als die beiden zusammenhängenden Seiten des gebauten Raumes bei Assmann (2009). Zu Raumdynamiken generell auch Rau (2013) bes. 164–171.
Historische Dimensionen des gebauten Raumes
293
kommt die aktive Wirkungskraft des gebauten Raumes in besonderem Maße zum Tragen23. Entsprechend ist beim gebauten Raum also ebenso zu fragen, wie sich der Umgang mit dem ‚vergangenen Raum‘ gestaltet: Ob (und wenn ja: wie lange) er jenseits seiner Entstehungszeit bewahrt und akzeptiert wird – und wie sich sein mediales Angebot zu den neuen Konstellationen einer anderer Gesellschaft bzw. anders konditionierten und anders kulturell determinierten Benutzern verhält? Oder aber, ob (und wenn ja: wo konkret) es in späterer Zeit zu Eingriffen kommt, was verändert wird, bis schließlich hin zu Ablehnungen der vorhandenen Struktur des gebauten Raumes in Form von Zerstörungen oder gar Ausradierungen? Oder auch, inwieweit Zwischenwege einer partiellen Akzeptanz und gleichzeitig partiellen Ablehnung und zuwiderlaufenden Nutzung gewählt werden – und was dies wiederum für die sinnund identitätsstiftende Wirkungskraft des gebauten Raumes aussagt? Hier spielt dann schließlich auch die materielle Inszenierung des Raumes als Erinnerung an bestimmte (reale oder fiktive) Ereignisgeschichte herein, die wir anfangs als Sonderform innerhalb der historischen Dimensionen des gebauten Raumes ansprachen. Bei einer solchen historischen Analyse des gebauten Raumes sind allerdings immer dessen spezifisches (pluri-)mediales Potential und seine (pluri-)mediale Eigenlogik im Blick zu behalten. Grundsätzlich basiert sein mediales Funktionieren auf der Kombination von Visualität, Taktilität und Kinästhesie; primär dominiert die nonverbale Kommunikation, die Einbindung von Inschriften holt jedoch auch die verbale Kommunikation herein24. Das visuelle Angebot der architektonischen Form bzw. Ästhetik sowie die Ausstattung mit Bildern und Inschriften evoziert Diskurse und Atmosphären und konstituiert damit die Selbst- und Gesellschaftswahrnehmung; die den Bewegungsraum formende Architektur beeinflusst zudem Blickführung und Bewegung im Raum und somit Handeln, Habitus und Empfinden; die taktisch wahrnehmbare Materialität evoziert schließlich Diskurse, Emotionen und Atmosphären. Insgesamt sind es also unterschiedlichste Faktoren, aus denen sich die Wirkungskraft des gebauten Raumes speist – und folglich auch verschiedene Aspekte, auf die hin der gebaute Raum in seinen historischen Dimensionen befragt werden kann. Je nach Raumtyp sowie dessen überlieferter materieller Beschaffenheit wird man bei der historischen Interpretation des jeweiligen Raumes folglich auch mehr den einen oder anderen Aspekt akzentuieren: Die historische Interpretation einer einfachen Hütte oder einer luxuriösen Landvilla, einer engen, von Händlerläden gesäumten Straße oder eines monumentalen öffentlich-politischen Platzes erschließt immer wieder andere Perspektiven auf die zu rekonstruierende Geschichte. Entsprechend wird auch unsere Diskussion durch die Wahl des Fallbeispiels, das wir im Folgenden be-
23 Zur Wirkungskraft des vergangenen Raumes auf spätere Generationen und Gesellschaften („Sollsuggestion“): Delitz (2009a) 183–185; Delitz (2009c) 174–175; Fischer (2010) 77–78; Schäfers (2010) 30. 24 Zur medialen Eigenlogik des gebauten Raumes bes. Delitz (2009a) bes. 13–18, 191–209; Delitz (2009b) bes. 85–89; Delitz (2009c) bes. 164–166, 177; Fischer (2010) 65–68.
294
Susanne Muth
trachten wollen, konsequenterweise eine bestimmte Richtung einschlagen – und eine andere weniger bedienen. Als Beispiel soll uns das Forum Romanum dienen, das öffentlich-politische Zentrum des antiken Roms. Hier ist die historische Interpretierbarkeit des gebauten Raumes mehr als evident, gibt es doch kaum einen urbanen Raum im antiken Rom, in dem sich der Zusammenhang zwischen der Ausgestaltung des gebauten Raumes und der politisch-gesellschaftlichen (Ereignis-)Geschichte derart stark verdichtet. Wollte man an einem solchen Fallbeispiel die grundsätzliche Evidenz des historischen Interpretationsansatzes darlegen, wäre dies wenig überraschend und folglich auch wenig hilfreich: Um für die Allgemeingültigkeit des Ansatzes und die Vielfalt an Einblicken werben zu wollen, würde man wohl eher ein anderes, weniger erwartungsgemäßes Beispiel wie ein Haus in Pompeji oder ein Grab in Ostia wählen, bei dem die historische Aussagekraft zunächst weniger offenkundig ist. Doch scheint mir eine solche Argumentation aktuell kaum dringlich: wer würde heutzutage an der historischen Interpretierbarkeit des gebauten Raumes grundsätzlich zweifeln wollen? Weitaus wichtiger ist mir jedoch eine andere Akzentuierung unserer Diskussion: indem wir die historische Interpretierbarkeit als Selbstverständlichkeit voraussetzen und entsprechend differenzierter den Chancen auch die Probleme und Herausforderungen dieses Ansatzes gegenüberstellen – im Sinne einer stärker problemorientierten Diskussion um die historische Interpretierbarkeit des gebauten Raumes. Und genau hierfür eignet sich das Forum Romanum als Fallbeispiel letztlich umso mehr: denn gerade hier mag eine solche problemorientierte Perspektive weniger erwartungsgemäß sein, dafür aber umso aufschlussreicher.
3 Das Forum Romanum – Chancen und Herausforderungen der historischen Interpretation So fragmentarisch auch immer das heutige Erscheinungsbild des freigelegten Forums (Abb. 1) ist, die überlieferte Platzanlage im Herzen Roms eröffnet mancherlei Möglichkeiten, um das Aussehen des einstigen Zentrums sowie den diachronen Wandel seines Erscheinungsbildes ansatzweise zu rekonstruieren25. Damit ist die Grundlage für die historische Interpretation des gebauten Raumes gegeben. Als Zentrum der politischen Entscheidungsfindung und Machtrepräsentation im antiken Rom wird das Forum Romanum gern seitens archäologischer und althistorischer Darstellungen immer wieder aufgegriffen, um ausgehend von der Topographie und der Entwicklung des Platzes eine umfassende Geschichte der politisch-öffent-
25 Überblick über die architektonische Formung des Forum Romanums und seinen diachronen Wandel: Zanker (1972); Coarelli (1983, 1985); Giuliani u. Verduchi (1995); Purcell (1995); Hölscher (2006a); Freyberger (2009a); Freyberger (2009b); Filippi (2012); demnächst Muth (s.o. Anm. 1).
Historische Dimensionen des gebauten Raumes
295
Abb. 1: Ansicht des Forum Romanum von Westen.
lichen Kultur Roms zu erzählen26 (Abb. 2; 3a–c). Jede Epoche scheint sich hierbei markant in den Platz eingeschrieben zu haben – und kann von diesen Spuren aus wieder rekonstruiert werden: von der Stadtwerdung Roms unter den etruskischen Königen im 6. Jh. v. Chr. bis zum langsamen Niedergang der politischen Bedeutung der Stadt in der Spätantike. Bei all dem ist es freilich vor allem die Kombination von literarischen Quellen (mit ihren Zeugnissen zur Ereignisgeschichte, zur politischen Kultur sowie zu den öffentlich-politischen Handlungen bzw. Ritualen auf dem Forum) und archäologischen Befunden am Forum, die eine solche Erzählung der Geschichte Roms erst möglich macht. Wie viel von dieser Geschichte ist jedoch allein auf der Grundlage der archäologischen und bauhistorischen Analyse des Forums rekonstruierbar? Diese Frage soll uns im Folgenden leiten: Was ist tatsächlich im Befund des Forums an Geschichte ‚eingeschrieben‘ – und welche Geschichte wird greifbar, wenn wir uns primär auf die materielle Ausgestaltung des Forums im Sinne des gebauten Raumes konzentrieren?
26 Bezeichnend in ihrem Ausmaß der ereignishistorischen Darstellung etwa Buchner (1990); Kissel (2004).
296
Susanne Muth
Abb. 2: Topographie des kaiserzeitlich-spätantiken Forum Romanum: (1) Basilica Paulli/Aemilia; (2) Heiligtum der Venus Cloacina; (3) Comitium; (4) Standort der republikanischen Curia Hostilia; (5) Lapis Niger; (6) Curia Iulia; (7) spätantike Säulenmonumente; (8) Bogen des Septimius Severus; (9) Rostra Augusti; (10) Saturn-Tempel; (11) Porticus Deorum Consentium; (12) Vespasians-Tempel; (13) Concordia-Tempel; (14) Carcer; (15) freie Forumsfläche; (16) Basilica Iulia; (17) Dioskuren-Tempel; (18) Iuturna-Quelle; (19) Standort des Equus Domitiani; (20) Caesar-Tempel; (21) Augustus-Bogen; (22) Regia; (23) Vesta-Tempel; (24) Tempel des Antoninus Pius und der Faustina.
a) Auf der Suche nach der in den Raum ‚eingeschriebenen‘ Geschichte Die Einrichtung des Forums als architektonischer Raum erweist sich in verschiedener Hinsicht als aussagekräftig. Vor allem aufschlussreich sind dabei etwa die Errichtung von Bauten der politischen Entscheidungsfindung, von Tempeln bzw. Heiligtümern und öffentlichen Monumenten – sowie deren Restaurierung, Neuerrichtung oder auch Zerstörung. Die entsprechenden Befunde sind oftmals schon diskutiert worden, so dass ich mich auf wenige Beispiele beschränken will, um das Potential der historischen Interpretation zu skizzieren27.
27 Grundlegend für die folgenden Diskussionen vor allem: Zanker (1972); Coarelli (1983 &, 1985); Hölscher (2006a); Freyberger (2009a).
Historische Dimensionen des gebauten Raumes
297
Schon die Konstituierung des Forums als öffentlicher Platz für die römische Bürgerschaft sowie die Einrichtung des Comitiums als öffentliche Versammlungsstätte – beides im stratigraphischen Befund für die Zeit des späten 7. und 6. Jh. v. Chr. greifbar – verwiesen auf wichtige Etappen der Urbanisierung sowie der Etablierung der politischen Kultur im frühen Rom. Auch der weitere Ausbau und spätere Umbau bzw. schließlich die Zerstörung eben jenes Comitiums (Abb. 2: Nr. 3) deuten auf bedeutsame Momente in der Konstituierung der politischen Kräfte hin (bzw. lassen sich mit diesen in Verbindung bringen und bestätigen somit den Zusammenhang von urbanem Ausbau und politischer Geschichte)28: Im frühen 5. Jh. wird die Versammlungsstätte weiter ausgebaut und erstmals mit einer repräsentativen Rednertribüne aus Stein versehen (Abb. 3a) – ein Eingriff, der für die Zeitgenossen der jungen Republik die nun gesteigerte Bedeutung der hier stattfindenden comitia und contiones für die politische Entscheidungsfindung konstituierte. Die Tribüne und der anschließende Versammlungsplatz wurden im mittleren 4. Jh. nochmals prächtiger gestaltet und von nun an auch von der Bürgerschaft als Ort der politischen Repräsentation für führende Politiker und deren Familien genutzt und wahrgenommen (Abb. 3b; 4a) – beides Momente in der Ausformung des gebauten Raumes, die einerseits die zunehmende Politisierung des Forums sowie andererseits das Aufkommen einer neuen und schnell aufgeheizten Kultur der politischen Repräsentation hier erkennen lassen, zwei Phänomene, die im Kontext der sich neu etablierenden Nobilität stehen bzw. auf diesen zurück verweisen. Unter Sulla kommt es hingegen zu Einschränkungen in der Nutzbarkeit der Fläche als Versammlungsort und unter Caesar wird schließlich das Areal des Comitiums endgültig aufgelassen bzw. zerstört (Abb. 3c; 4b) – in ihrem Ausmaß bislang einzigartige Eingriffe in den Raum der politischen Entscheidungsfindung, die den Zeitgenossen (und damit auch vice versa den Historikern) das langsame Aufkommen monarchischer Herrschaftsstrukturen im 1. Jh. v. Chr. (zunächst experimentell in Form der Dictatur, dann unter Augustus in Form des Principats realisiert) erkennbar werden ließen. Durch die jeweilige räumliche Gestaltung des Comitiums wurden also die Zeitgenossen in ihrer Nutzung und Wahrnehmung des Raumes gelenkt – und die hier stattfindenden Handlungen sowie die damit einhergehende Rollenerfahrung erhielten hierdurch ihre jeweils erwünschte Sinnstiftung: Wenn auch gegebenenfalls unterschwellig, so wurden doch damit die politischen Strukturen und die Machtkonstellationen nachhaltig erlebbar und dadurch mit konstituiert. In die architektonische Einrichtung des Comitiums ist
28 Zur Geschichte des Comitiums (mit teils divergierenden Datierungen der Phasen sowie unterschiedlichen Rekonstruktionen der Anlage in ihrem jeweiligen architektonischen Erscheinungsbild): Zanker (1972) 7–12, 40–43; Coarelli (1983) 119–160; Coarelli (1985) 11–38, 87–123, 196–198, 233–257; Gros u. Torelli (1988) 78–79, 83, 93–95, 99, 120, 124–126; Coarelli (1993); Kolb (1995) 77–81, 122, 146–148, 252, 254, 262–263, 357; Carafa (1998); Coarelli (1999); Knell (2004) 28–31; Hölscher (2006a) 109, 111; Freyberger (2009a) 27–30, 54–56.
298
Susanne Muth
Abb. 3a: Rekonstruktion des mittelrepublikanischen Forums im 4. Jh. v. Chr.
Abb. 3b: Rekonstruktion des spätrepublikanischen Forums im 2. Jh. v. Chr.
Historische Dimensionen des gebauten Raumes
299
Abb. 3c: Rekonstruktion des frühkaiserzeitlichen Forums im 1. Jh. n. Chr.
folglich die politische Geschichte der Republik mit eingeschrieben – und ist hieraus für uns wieder ‚lesbar‘. Auch die am Forum errichteten Tempel trugen wesentlich zu Konstituierung von Sinn und Atmosphäre bei. Drei Beispiele mögen dies gerade im diachronen Vergleich veranschaulichen: Der Tempel der Dioskuren, der im frühen 5. Jh. zur Feier des Sieges über die Latiner und den vertriebenen Tyrannen Tarquinius Superbus in der Südostecke des Platzes errichtet wurde (Abb. 2: Nr. 17; 3a), etablierte die Schutzgötter der Patrizier zugleich als dominante göttliche Macht am Forum29. Bei allen sakralen Handlungen zu Ehren dieser göttlichen Schutzpatrone der herrschenden Adelsschicht wurde somit für jeden Teilnehmer, gleichgültig ob Patrizier oder Plebejer, die vorherrschende politische und gesellschaftliche Konstellation im Zeitalter der Ständekämpfe unmittelbar erlebbar und zugleich bestätigt. Der Tempel für Concordia, der eventuell 367 gelobt und an der westlichen Schmalseite des Platzes nahe dem Comitium errichtet wurde (oder aber, falls es diesen nicht gab: die Aedicula für Con-
29 Frührepublikanischer Dioskurentempel: Gros u. Torelli (1988) 84; Nielsen u. Poulsen (1992) 61–79; Nielsen (1993) 242–243; Kolb (1995) 119–122; Hölscher (2006a) 107; Freyberger (2009a) 31–32.
300
Susanne Muth
Abb. 4a: Digitale Rekonstruktion des spätrepublikanischen Forums im späten 2. Jh. v. Chr. (Blick von Südosten).
Abb. 4b: Digitale Rekonstruktion des augusteischen Forums um 10 n. Chr. (Blick von Südosten).
cordia, die hier 304 definitiv errichtet wurde), holte eine andere Sinnstiftung in den Raum des Forums30 (Abb. 2: Nr. 13; 3a): Indem der Bau die Überwindung der Ständekämpfe feierte und die politische Eintracht der neue Leistungselite beschwor, hielt er die Erinnerung an die jüngste Vergangenheit und zugleich die Mahnung an die Gegenwart und Zukunft präsent – und dies dicht über dem Comitium und der Curia als
30 Mittelrepublikanischer Concordiatempel, dessen Errichtung im 4. Jh. jedoch kontrovers diskutiert wird; in jedem Fall gilt das Gesagte dann für die wenig später errichtete Aedicula: Momigliano (1942/1984); Gasparri (1979) 11, 16–17; Gros u. Torelli (1988) 90–91; Ziolkowski (1992) 22–24; Ferroni (1993) 317; Kolb (1995) 146; D’Arco (1998); Hölscher (2006a) 108; Heyworth (2011) 56–69.
Historische Dimensionen des gebauten Raumes
301
den Schauplätzen der politischen Entscheidungsfindung. Gleichzeitig etablierte dieser Bau ein neues diskursives Klima am Forum, in dem die Reflexion auf die politischen Tugenden immer wichtiger wurde (wie dies bekanntlich für das Selbstverständnis und die Selbstrepräsentation der neuen Nobilität damals grundlegend wurde). Wieder später, 29 v. Chr., weihte Augustus auf der gegenüberliegenden Ostseite des Forums den Tempel für den Divus Iulius ein und gab der sakralen Topographie am Forum wieder eine andere ideelle Gewichtung, die ebenfalls auf die aktuellen Machtverhältnisse verwies31 (Abb. 2: Nr. 20; 3c): Nun war es der vergöttlichte Vater des Herrschers, unter dessen Augen das Handeln und Bewegen auf dem Forum stattfand – gewissermaßen in Antwort auf den realen Auftritt seines Sohnes, des Princeps Augustus, auf der neuen Rednertribüne an der gegenüberliegenden Westseite des Platzes. Bei diesem Tempel wird die Wirkungskraft des architektonisch gestalteten Raumes besonders signifikant, besetzte er doch ein zuvor offenes Areal, blockierte eine Straßenführung und gab dem Forum zugleich einen ganz neuen (optischen und realen) Abschluss an seiner Ostseite: Nachdrücklicher konnte man einen neuen ideologischen Akzent innerhalb eines bestehenden architektonischen Raumes kaum setzen – und ihn unausweichlich wahrnehmbar und geradezu körperlich erfahrbar werden lassen. Nicht minder bedeutsam für die sinnstiftende Wirkung des Forums waren auch die öffentlichen Monumente, Ehrenstatuen und Beuteweihungen, teils in Form von aufwendigen Bogen- und Säulenmonumenten errichtet, welche die Fläche des Platzes ihrerseits gliederten: Auch sie lenkten als Blickpunkte, Anziehungspunkte oder auch Barrieren die Bewegungen und Blicke der Benutzer auf dem Forum, beeinflussten somit deren Wahrnehmung des Raumes und trugen zugleich zur Verdichtung eines ideellen Klimas bei32. Besonders illustrativ ist hier der Vergleich zwischen dem mittelrepublikanischen und dem augusteischen Forum, der verschiedene Optionen in der Bespielung des gebauten Raumes durch Monumente verdeutlicht. Als man ab 338 v. Chr. begann, am Forum Beuteweihungen und Ehrenstatuen aufzustellen, füllte sich der Platz schnell mit einer Vielzahl von unterschiedlichsten Monumenten33: kon-
31 Caesartempel: Zanker (1972) 12–15; Coarelli (1985) 231–232; Zanker (1987) 44, 80, 86–88; Kolb (1995) 353–354; Gros (1996a); Knell (2004) 37–38; Hölscher (2006a) 113–114; Freyberger (2009a) 58–61; Newsome (2010) 164–167; Newsome (2011b) 303–304; Sumi (2011). 32 Grundsätzlich zum Funktionieren öffentlicher Monumente s. den Beitrag von Tonio Hölscher in diesem Band. 33 Errichtung von Siegesmonumenten und Ehrenstatuen am republikanischen Forum: Hölscher (1978) bes. 318–344; Lahusen (1983) 12–22 und passim; Coarelli (1985) 87–123; Sehlmeyer (1999) 48–66, 83–109, 110–141; Hölscher (2001) 188–194; Hölkeskamp (2004) 137–165, 173–175; Hölscher (2004) 90–96; Walter (2004) 131–154, 157–160; Schmuhl (2008) passim; Hölscher (2009) 163–164, 166–177; Muth (2012b) 7–17. – Zur Verortung des Phänomens einer aufkommenden politischen Erinnerungskultur im historischen Kontext grundlegend: Hölscher (1978) bes. 348–357; Hölscher (2001) 188–189; Hölkeskamp (2004) bes. 158–165, 169–198; Walter (2004) 132; Hölscher (2009) 166–169; Hölkeskamp (2011) 204–240. – Generell zur Wirkungsmacht von Bildwerken bei der diskursiven Aufladung der öffentlichen Räume Roms und bei der Manifestation von Machtanspruch s. auch Hölscher (2001)
302
Susanne Muth
zentriert vor allem auf die prominenten Areale beim Comitium sowie vor dem Dioskurentempel, jeweils einzelne siegreiche Feldherren ehrend und herausragende Siege memorierend, und durch immer wieder aufsehenerregende Formen um die Aufmerksamkeit der Betrachter werbend, in Konkurrenz zu den anderen, sich daneben erhebenden Monumenten. Insgesamt entstand hierbei eine zunehmend heterogene Ansammlung von verschiedenartigen Monumenten auf dem Platz, die alle jeweils punktuell auf einzelne Leistungen der ruhmreichen Geschichte verwiesen und für einzelne Nobiles Anerkennung einforderten. Die Zeitgenossen sahen sich somit ringsum mit einer Vielzahl gefeierter Politiker bzw. Feldherrn und erinnerungswürdiger Taten konfrontiert, in deren Summe sich die ruhmreiche Geschichte Roms konstituierte. In der Gestalt dieser Monumente erhielt diese Geschichte eine geradezu körperliche Präsenz am Forum, alles Handeln und Wahrnehmen in der Gegenwart geschah hier im Angesicht der ruhmreichen Vergangenheit und somit immer im unmittelbaren Dialog mit ihr. Erfasste man die Monumente in ihrer Summe, dann war die Vergangenheit am Forum omnipräsent und zugleich dominierend. Nahm man hingegen die Monumente mehr als einzelne Elemente wahr (was die Heterogenität ihres Erscheinungsbildes und ihrer Aufstellung zumindest förderte), dann war die Vergangenheit eher als eine vielteilige Addition punktueller Taten und Personen begreifbar, die auf die Blickführung und Wahrnehmung auch herausfordernd, wenn nicht sogar verwirrend wirken mochte: im einen wie im anderen Fall wurde so eine intensivere Auseinandersetzung mit den Monumenten unterstützt, mit allen Konsequenzen sinnstiftender Wirkung. Unter Augustus finden wir dagegen einen anderen Umgang mit den Monumenten im Raum. Die kleinteilige Vielfalt und Heterogenität wird zurückgenommen, eine ganze Reihe älterer Ehrenstatuen findet auf dem umgestalteten Forum keine erneute Aufstellung34 (dazu ausführlicher s.u.). Dafür besetzen nun mehrere neue Monumente dominant den Raum, die alle eindringlich auf Augustus und seine militärischen Taten verweisen35: Auf seinen Sieg bei Naulochos weisen eine Columna rostrata und eventuell auch ein Bogenmonument, auf den bei Actium weitere Columnae rostratae, ein Bogenmonument und die Schiffschnäbel am Caesartempel (sowie auch der Giebelschmuck des Saturntempels), auf den Frieden mit den Parthern wiederum ein Bogenmonument sowie die Partherstatuen an der Porticus Cai et Luci Caesaris bzw. der Basilica Aemilia; hinzu kam schließlich noch eine Reiterstatue des Augustus auf den
191–194, 199–201; 206–207, 207–209; Hölscher (2006b) passim, bes. 187, 194–197, 198–199; Hölscher (2009) passim, bes. 162–165. 34 Zur Situation der republikanischen Monumente am Forum des ausgehenden 1. Jh. v.Chr: Sehlmeyer (1999) 270–271; Muth (2012b) 18–24; s. auch unten S. 318–320. 35 Zu den Siegesmonumenten des Augustus auf dem Forum (wobei deren konkrete Lokalisierung und Rekonstruktion teils kontrovers diskutiert ist): Zanker (1972) 15–17; Coarelli (1985) 258–308; Zanker (1987) 46–52, 85–87; Nedergaard (1993); Palombi (1993a, 1993b); Sehlmeyer (1999) 249–251, 255–259; Knell (2004) 41–43; Hölscher (2006a) 115–116; Schmuhl (2008) 143–145, 148–154, 165–168; Freyberger (2009a) 61–70, 74.
Historische Dimensionen des gebauten Raumes
303
Rostra. An die Stelle des vielfältigen Verweises auf unterschiedlichste Personen und Taten tritt nun eine merkliche Konzentration, die alle Wahrnehmung auf eine Person und wenige Taten fokussiert – wobei diese Person und ihre Taten dafür nun gleich mehrfach und zudem in teils innovativer und spektakulärer Weise (durch Bogenmonumente und Columnae rostratae) gefeiert werden, was sie nochmals mehr von den verbleibenden älteren Monumenten absetzt und über sie erhebt. Die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit gewinnt damit am Forum eine neue Qualität: Die ablenkende Vielfalt an Monumenten, die dem Betrachter zuvor eine aktivere Auseinandersetzung abforderte, wird auf dem Forum reduziert und dafür eine hierarchisierende Engführung der Ehrung und Memorierung erwirkt, die dazu beiträgt, dass auf dem Forum die Vergegenwärtigung der ruhmreichen Geschichte Roms nun vor allem auf die jüngste Vergangenheit konzentriert wird. Nicht mehr so sehr im Angesicht der dichten Reihen herausragender Politiker und Feldherrn der vergangenen Jahrhunderte, sondern primär unter den Augen des neuen Herrschers (und seines vergöttlichten Vaters im Tempel) steht von nun an alles Handeln auf dem Forum. Je nachdem, wie Monumente den öffentlichen Platz bespielen, entwickelt der Raum somit ein anderes Potential der Sinnstiftung: Die Präsenz von Geschichte und der Umgang mit der Vergangenheit, die Wahrnehmung der aktuellen Machtverhältnisse und der eigenen Rolle, sie alle können je nach Inszenierung der Monumente im Raum verschiedenartig erlebbar werden.
b) Repräsentation versus Praktikabilität: Welche Geschichte offenbart sich im Raum? So sehr die eben besprochenen Beispiele evident machen, wie weitgehend der gebaute Raum historisch interpretierbar ist: das Forum Romanum erlaubt, nicht nur die Chancen dieses Ansatzes aufzuzeigen, sondern gleichzeitig auch die ihm eigenen Herausforderungen, bis hin zu seinen Grenzen. Probleme entstehen vor allem dadurch, dass jede Architektur neben ihrer repräsentativen natürlich auch eine (und meist sogar: ihre primäre) funktionale Dimension besitzt. Ihr Ziel ist die Unterstützung derjenigen Handlungen, die im betreffenden Raum in erster Linie realisiert werden sollen, – und dies in einem ganz pragmatischen Sinn: Sie lenkt, rhythmisiert und reguliert Bewegungsabläufe in der gewünschten Weise, sie koordiniert, kontrolliert und hierarchisiert Handlungen, sie schafft geeignete optische, akustische und klimatische Rahmenbedingungen, kurzum: sie gewährleistet, dass der betreffende Raum für spezifische Situationen und Handlungen möglichst optimal genutzt werden kann, für deren Realisierung er primär ausgestaltet wurde. Mehrheitlich wird in den jüngeren Diskussionen um das Forum diese pragmatische Perspektive auf den gebauten Raum kaum berücksichtigt36 –
36 Aktuell keimt jedoch wieder ein neuer Zugriff auf stärker pragmatische Perspektiven vor allem seitens der Fragen nach Mobilität und Verkehr im antiken Raum auf. Bezogen auf das Forum Romanum
304
Susanne Muth
Abb. 5: Plan des Forums mit den Veränderungen im Bereich des Comitiums unter Sulla, Caesar und Augustus (a–b: republikanisches Comitium mit Rostra; c: republikanische Curia Hostilia bzw. Cornelia; g: caesarisch-augusteische Rostra, p: Curia Iulia).
die Fragen nach der sinn- und identitätsstiftenden Qualität von Architektur erscheint vielversprechender als die nach der Praktikabilität der architektonischen Handlungsbühne. Dass jedoch die funktionale Dimension immer als wesentliche Größe mit eingerechnet werden muss, auch und gerade angesichts der Fragen nach der historischen Bedeutung, sollen zwei Beispiele zeigen. Das erste Beispiel führt uns nochmals zu der Zerstörung des Comitiums unter Caesar zurück37 (Abb. 5). Dieser ließ bekanntlich die Curia in größerem Ausmaß und
sind hier in den letzten Jahren erste vielversprechende Untersuchungen zur Lenkung von Verkehr und zur bewegten Wahrnehmung des Raumes entstanden: Johanson (2008); Favro u. Johanson (2010); Newsome (2010); Laurence u. Newsome (2011) passim. Ein neues Projekt zur Raumnutzung und Raumbeanspruchung öffentlicher Räume im antiken Rom wird im Rahmen des Exzellenzclusters Topoi von Susanne Muth, Ulrike Wulf-Rheidt und Hauke Ziemssen verfolgt, bei dem u.a. die Benutzung des Forum Romanum hinsichtlich der Dichte der Frequentierbarkeit, der Spielräume von Mobilität und Akustik, der Möglichkeiten der Kontrolle und Sicherheit sowie schließlich der Reaktionen auf klimatische Beeinträchtigungen untersucht werden soll (http://www.topoi.org/project/c-6–1/ (Stand 24. 05. 2013)). 37 Zur Zerstörung des Comitiums und der Verlagerung der Rostra: Zanker (1972) 7; Coarelli (1983) 135–136; Coarelli (1985) 237–257; Gros u. Torelli (1988) 124–126; Patterson (1992) 193–194; Coarelli (1993) 312–314; Kolb (1995) 254, 262–263; Carafa (1998) 148–155, 156–159; Coarelli (1999) 213; Verduchi (1999) 214–215; Knell (2004) 28–31; Sumi (2005) 50–52, 223; Hölscher (2006a) 111; Freyberger (2009a) 55–56.
Historische Dimensionen des gebauten Raumes
305
Abb. 6: Digital Rekonstruktion des spätrepublikanischen Comitiums in der Nordwestecke des Forums, spätes 2. Jh. v. Chr.
Abb. 7: Digitale Rekonstruktion der augusteischen Rostra an der Westseite des Forums, um 10 n. Chr.
an einer etwas versetzten Stelle neu errichten (Abb. 5: Nr. p), nun eng auf sein Forum Iulium orientiert und dabei zugleich ein Teil der Fläche des Comitiums okkupierend. Gleiches tat Caesar auch mit der Rednertribüne, indem er die Rostra an ihrer ursprünglichen Stelle am südöstlichen Rand des Comitiums (Abb. 5: Nr. a; 6) abreißen und an der westlichen Schmalseite des Forums wieder errichten ließ (Abb. 5: Nr. g; 7). Wie ist diese Maßnahme der Verlegung der Rostra und damit der Abwertung des Comitiums zu bewerten – und wie historisch zu interpretieren? Gern wird dieser Eingriff als Ausdruck der politischen Einstellung Caesars gedeutet38: Sein Desinteresse (oder
38 Besonders bezeichnend etwa: Kolb (1995) 254 („Rücksichtslosigkeit Caesars gegenüber sakralen und politischen Traditionen“), 263–264; Kissel (2004) 314, 318–319 (ebd. 318 „… unverholene Bot-
306
Susanne Muth
gar: seine Verachtung) gegenüber den traditionellen politischen Institutionen hätte diese Vorgehensweise ausgelöst, ihn die alten Stätten zumindest nicht bewahren, sondern einfach verändern lassen. Und seine eigenen politischen Interessen hätten zudem eine stärkere Kontrolle (oder gar: politische Entmachtung) der beiden Institutionen, Senat und Volksversammlung, notwendig gemacht, was wiederum auch eine Neugestaltung ihrer Handlungsräume begünstigt hätte, tagte doch der Senat und versammelte das Volk sich nun gemäß den räumlichen Vorgaben des Dictators und gleichzeitig in Räumen, die Caesar ihnen selbst gestiftet hatte. Die Verlegung der Rostra wird aus dieser Perspektive somit vor allem als ein symbolischer Akt der Machtrepräsentation verstanden. Dass dies so von den Zeitgenossen wahrgenommen werden konnte (und es die Gegner Caesars sicher auch taten), steht außer Frage. Aber war dies auch die primäre Absicht Caesars? Diese Frage ist zumindest insofern berechtigt, als die Verlegung der Rednertribüne auch andere positive Effekte nach sich zog – Vorteile, die eher die Funktionalität der Rostra als Rednertribüne betreffen. Denn wesentlich für deren Dienlichkeit war, dass der Redner mit der vor ihm versammelten Bürgerschaft angemessen interagieren konnte: Abgesehen davon, dass er immer erhöht stehen musste, war wichtig, dass er mit seinen Zuhörern gut kommunizieren und diese ihn ausreichend gut hören und sehen konnten; ferner musste er von seiner erhöhten Position aus in der Lage sein, eine größere Volksmenge zu dirigieren, sie emphatisch anzusprechen und auf verschiedene Gruppen innerhalb der Zuhörerschaft zu reagieren39. Dass die alte Rednertribüne am Comitium schon längst nicht mehr den Bedürfnissen der Volksversammlung angemessen nachkam, zeigte sich schon früher, indem einerseits die wichtigen comitia sukzessive vom Forum auf das Marsfeld verlagert wurden und andererseits die Redner seit der 2. Hälfte des 2. Jh. v. Chr. begannen, nicht mehr wie zuvor zum Comitium hin (Abb. 8a), sondern zu der sich hinter den Rostra öffnenden Forumsfläche hin gewandt zu sprechen (Abb. 8b), wo sich eine größere Zuhörerschar als im Comitium versammeln konnte40. Diese Verlagerung der Ver-
schaft an die Zeitgenossen, mit der Caesar altrepublikanische Institutionen schlechterdings für anachronistisch erklärte und seine monarchischen Attitüden deutlich zum Ausdruck brachte …“); Knell (2004) 31 („Man kann diesen Vorgang nicht nur als das Ergebnis einer Bemühung um eine ästhetisch anspruchsvolle und repräsentative Neuformulierung des Forum Romanum verstehen, sondern auch als Ausdruck eines politischen und gesellschaftlichen Wandels, zu dessen wenig später eingetretenen Ereignissen der Beginn der römischen Kaiserzeit gehören sollte.“); vgl. auch Sumi (2011) 209–210 („It is possible that one of Caesar’s objectives in moving the Rostra to the west end of the Forum was to reverse the effect of the Sullan legislation, at least in so far as it moved the Rostra out from under the shadow of the Curia.“). 39 Zur Situation der comitia und contiones: Taylor (1966) 1–8, 15–33; Pina Polo (1996) passim; Döbler (1999) 136–141; Hölkeskamp (2004) 233–234, 234–242 (zu den contiones); Morstein-Marx (2004) passim; Sumi (2005) passim, bes. 17–25. – Zur zunehmenden Bedeutung des rhetorischen Agierens und des Dialogs mit der Zuhörerschaft im 1. Jh. v. Chr.: Nippel (1988) 59–60. 40 Zur Verlagerung von Versammlungen auf das Marsfeld und zur Einbindung der Forumsfläche: Taylor (1966) 21–28; Coarelli (1985) 130–131, 157–166, 199–200; Patterson (1992) 190–192; Kolb (1995)
Historische Dimensionen des gebauten Raumes
307
sammlungsfläche gewährleistete somit zwar eine bessere Realisierung der Ansprachen von den Rostra. Aber auch sie war freilich weiterhin mit funktionalen Nachteilen behaftet: Die Versammlungsfläche der Zuhörerschaft erstreckte sich nun vor allem in die Breite, so dass der Redner ein weites Segment vor der gebogenen Tribüne aus überschauen musste – ideal für die rhetorische ‚Beherrschung‘ der Volksmenge war dies kaum (Abb. 6). Aber auch in akustischer und optischer Hinsicht erwies sich die neue Situation als nur bedingt glücklich – die Tribüne lag bezogen auf die Forumsfläche nicht erhöht genug, als dass man den Redner von weitem noch gut sehen konnte, und die schräge Ausrichtung der Tribüne auf die Forumsfläche war auch für die akustischen Rahmenbedingungen ungünstig41. Gerade diese Nachteile wurden mit der Verlegung der Rednertribüne an die westliche Schmalseite des Forums jedoch nahezu aufgehoben42 (Abb. 7; 8c; 9): Dank des ansteigenden Geländes an der Westseite steigerte die nun deutlich erhöhte Position die Sichtbarkeit des Redners und damit die Möglichkeiten gestischer Kommunikation, die Ausrichtung der Tribüne auf den sich von hier aus länglich nach hinten erstreckenden Platz erlaubte ein zielgerichteteres Interagieren mit den verschiedenen Gruppen innerhalb der Zuhörerschaft, und die axiale Orientierung der Tribüne auf den von aufragender Architektur gefassten Platz optimierte die akustischen Bedingungen und steigerte auch in dieser Hinsicht die Möglichkeiten der Kommunikation zwischen Redner und Zuhörerschaft43. Ist es ausgeschlossen, dass es gerade diese funktionale Optimierung war, die Caesar bei der Verlegung der Rostra im Blick hatte und seine Intention primär auf die Verbesserung der pragmatischen Rahmenbedingungen für die Ansprachen an das Volk zielte (wovon er freilich dann auch wiederum zu profitieren gedachte)? In konsequenter Fortführung der Suche nach einer Raumlösung, die längst vor Caesar begonnen, aber noch nicht überzeugend abgeschlossen worden war (ähnlich konsequent wie auch bei der ‚Entmachtung‘ des Comitiums, dessen Entfunktionalisierung ebenfalls schon vor Caesar erfolgt war und bei der die Maßnahme Caesars lediglich den letzten und naheliegenden Schritt in einer früher eingeläuteten Entwicklung darstellte)? Ohne Zweifel, die Verlegung der Rednertribüne und der damit erfolgte Eingriff in die Raum-
207–208; Döbler (1999) 23, 35–36, 62, 137–140; von Hesberg (2005) 111–112. – Taylor (1966) 25, 41–45 betont zudem die Schwierigkeiten bei der Abhaltung der Abstimmungen, die das alte Comitium bot. – Visualisierung der Sichtbarkeit des Redners konkret im Kontext der laudationes funebres: Johanson (2008) passim, bes. 68–100, 134–173; Favro u. Johanson (2010) 16–23. 41 Dazu auch Döbler (1999) 139–140, unter Betonung der Vorteil der Rednertribüne beim Dioskurentempel; Taylor (1966) 25, 41–45, bezogen auf die Abhaltung der Abstimmungen. 42 Vgl. dagegen etwa Knell (2004) 29–31, der primär den Gewinn an repräsentativer Wirkung betont. Dass dies zweifelsohne auch geschah, steht außer Frage, aber es erscheint mir zu einseitig, allein repräsentative Aspekte in den Blick zu nehmen und die pragmatische Dimension, die letztlich wesentlicher Motor für die repräsentative Qualität der realen Auftritte auf den Rostra wiederum war, nicht konkreter zu bedenken. 43 Zu den Rahmenbedingungen akustischer und gestischer Kommunikation bezogen auf die Rostra Augusti s. auch Betts (2011) 126–128.
308
Susanne Muth
Abb. 8a: Plan des spätrepublikanischen Forums (1. Hälfte des 2. Jh. v. Chr.): Postition der Rednertribüne und der Zuhörerschaft im Comitium.
Abb. 8b: Plan des spätrepublikanischen Forums (ab 2. Hälfte des 2. Jh. v. Chr.): Postition der Rednertribüne und der Zuhörerschaft auf der freien Forumsfläche.
Historische Dimensionen des gebauten Raumes
Abb. 8c: Plan des augusteischen Forums (10 n. Chr.): Postition der neuen Rednertribüne und der Zuhörerschaft auf der freien Forumsfläche.
Abb. 9: Digitale Rekonstruktion einer kaiserlichen Ansprache von den Rostra Augusti (Rekonstruktion: Armin Müller).
309
310
Susanne Muth
Abb. 10: Plan des Forum Romanum, Pavimentierung der Forumsinsel und der umgebenden Straßen.
struktur des Forums hatten verschiedene Auswirkungen. Welche dieser Auswirkungen jedoch Caesar als primäre Intention verfolgte, kann aus dem Befund des gebauten Raumes letztlich nicht entschieden werden: Die erwirkten Effekte auf der symbolisch-repräsentativen und auf der pragmatischen Ebene sind aus der Retrospektive nicht gegeneinander abzuwägen. Und so mündet unsere Frage nach der historischen Interpretation schließlich in der Frage nach der historischen Erwartungshaltung: welches Bild von Caesar man favorisiert, welche Intention man ihm eher unterstellt, und welche Deutung der baupolitischen Maßnahme man folglich für plausibler hält. Im Angesicht dieses Zirkelschlusses wird man folglich die Verlegung der Rostra kaum als eigenwertiges Argument für die historische Interpretation der (Bau-)Politik Caesars heranziehen wollen. Und im Wissen, dass neben den repräsentativen Faktoren genauso auch pragmatische Aspekte bei der Bewertung baupolitischer Maßnahmen bedacht werden müssen, empfiehlt es sich dann auch grundsätzlicher (jenseits aller Deutungen um die caesarischen Rostra), bei den Fragen nach der historischen Interpretation des gebauten Raumes behutsamer vorzugehen – jedenfalls da, wo sich plausible Erklärungsvorschläge aus der pragmatischen Deutung ergeben. Die unterschiedlichen Auswirkungen, die der gebaute Raum auf das Wahrnehmen und Handeln in ihm hat, führen immer wieder zu derartigen Situationen, bei denen die historische Interpretation schwierig wird. Wir können lediglich die Konsequenzen der Baumaßnahme bemessen, nicht immer aber sicher die mit ihr vorrangig verfolgte Intention bestimmen. Und selbst dort, wo wir die Art des durch die Architek-
Historische Dimensionen des gebauten Raumes
311
Abb. 11: Ansicht des Forums mit der gepflasterten Forumsinsel und den rahmenden Straßen (von Nordwesten).
tur gelenkten Handelns sicher benennen können, mögen unterschiedliche Intentionen dahinter stehen. Nehmen wir den Versammlungsraum auf der Forumsfläche, wie er sich infolge der Errichtung der caesarischen Rostra konstituierte, weiterhin als Beispiel44 (Abb. 2: Nr. 15; 10–11). Die Fläche vor der Rednertribüne zeigt eine Pflasterung aus Travertinplatten, wie sie für Forumsanlagen dieser Zeit üblich ist. Allerdings reicht diese Pflasterung nicht bis an die Ränder des Platzes, wie dies normalerweise bei den Fora der Fall ist, sondern sie wird wie eine Platzinsel auf vier Seiten von rahmenden Straßen begrenzt, welche mit Basaltsteinen gepflastert sind45. Diese verschiedenartigen Pavimentierungen unterteilen für jeden Benutzer das Forum in zwei unterschiedliche Bereiche des Bewegens und Handelns: außen am Rand die Straßen als der dynamische Raum der schnellen Bewegung und des Durchquerens des Forums, innen hingegen die verkehrsberuhigte Platzinsel als eher statischer Raum des langsameren Flanierens, Verweilens und Versammelns46. Eine solche materiell angezeigte Aufteilung des Forums in Platzinsel und rahmende Straßen ist für römische
44 Zum Folgenden vorläufig ausführlicher Muth (2009) 334–346 sowie ausführlicher demnächst. 45 Zur Befundsituation: Zanker (1972) 24–25; Coarelli (1985) 211–233 passim; Giuliani u. Verduchi (1987) 31–66; Muth (2009) 334, 337; Newsome (2010) 148–149, 170, 301–302. 46 Dabei ist vor allem die unterschiedliche Qualität des Steinbelages zu bedenken, die ein längeres statisches Verweilen unterbinden oder aber unterstützen kann, hierzu Newsome (2010) 149–150, 301–303.
312
Susanne Muth
Platzanlagen ungewöhnlich47 – und wird dadurch zu einem besonders interessanten Befund für die Fragen nach der historischen Interpretation des gebauten Raumes. Die konkrete Konzeption kann als Ergebnis der Umgestaltung des Forums im späteren 1. Jh. v. Chr. plausibel gemacht werden48: Weder aus der Genese und der früheren Geschichte des Forums kann diese Struktur erklärt werden, noch ergibt sie vor der Errichtung der caesarischen Rostra an der Forums-Westseite Sinn. Erstmals greifbar wird sie in der augusteischen Neupflasterung der Forumsfläche um 12 bzw. 9 v. Chr. Inwieweit sie erst damals aufkam oder schon früher beschlossen war, etwa im Zuge der Verlegung der Rostra unter Caesar oder bei der Neugestaltung der Rostra unter Augustus, bleibt letztlich offen – in jedem Fall aber handelt es sich um einen Eingriff, der in den letzten Jahrzehnten des 1. Jh. v. Chr. erfolgte und unter Augustus bestätigt, wenn nicht gar auch unter ihm beschlossen wurde. Wieso aber kam es damals zu dieser ungewöhnlichen Trennung zwischen einer verkehrsberuhigten Platzinsel und den sie rahmenden Straßen? Klar ist, dass die Platzinsel in engem Zusammenhang mit der neu errichteten Rednertribüne an der Westseite steht, auf die sie hin konzi-
47 Gewöhnlich wird das Forum mittels einer einheitlichen und durchgehenden Pavimentierung als ein zusammenhängender Raumkörper markiert, der sich durch die Zäsur in der Pflasterung deutlich von den von außen heranführenden Straßen absetzt (s. etwa die Fora in Pompeji, Cosa, das Forum vetus in Leptis Magna oder evtl. die Fora von Liternum und Paestum: Gros u. Torelli (1988) 126–164, 209–372 passim mit Abb. 100, 109, 153; Lackner (2008) 82–83, 105–106, 141–144, 348, 354, 366). In manchen Landstädten, in denen zentrale Straßen, vor allem Überlandstraßen in ihrer Funktion als wichtige, auch wagentechnisch genutzte Verkehrsachsen das Forum tangieren, kann der Verlauf dieser Straße an der betreffenden Seite des Areals vom eigentlichen Forumsplatz durch den Wechsel in der Pavimentierung (sowie teils auch durch Schwellsteine bzw. Abstufungen) abgesetzt werden; die restlichen Seiten des Forumsareals zeigen hingegen wieder die Heranführung der spezifischen Forumspflasterung bis an die aufragende Architektur an den Rändern (s. etwa die Fora von Luna, Minturnae, Saepinum, Tarracina: Gros u. Torelli (1988) 126–164, 209–372 passim mit Abb. 99, 103, 105; Lackner (2008) 115–119, 122–124, 198–199, 357, 359, 382; eine Sonderform zeigt das flavisch neu gegründete Forum in Volsinii: Gros (1981) 25, 40–41, 44–54; unklar bleibt die nur punktuell greifbare Situation des Forums in Alba Fucens: hier tangieren zwei zentrale Straßen den Forumsplatz, von dem sie durch Randsteine und im Fall der nördlichen via di Porta Massima auch durch eine andere Pavimentierung abgesetzt scheinen; die Rekonstruktion des Forums jedoch als ein an allen vier Seiten von Straßen begrenzter Platz, wie etwa Lackner (2008) 25 betont, ist m.E. aus dem Befund nicht zu sichern; zudem verweist die Umgestaltung an der Südseite des Platzes gerade auf ein gegenteiliges Interesse bei der Ausgestaltung des Forums [Mertens (1968); Catalli (1992) 26–34; Etxebarria Akaiturri (2008) 118–119, 348–350; Lackner (2008) 23–25, 273]). Die Einfassung der Platzfläche jedoch durch anders pavimentierte Straßen an allen vier Seiten, wie dies das kaiserzeitliche Forum Romanum zeigt, erscheint anderenorts nicht greifbar. Eine genaue Erforschung der römischen Fora hinsichtlich der Gestaltung ihrer Pavimentierung wäre wünschenswert; s. vorläufig die Ausführungen bei Lackner (2008) 273–274 mit Anm. 384 und Etxebarria Akaiturri (2008) 118–119, sowie zur allgemeineren Konzeption des Forums als verkehrserschlossener bzw. -beruhigter Raum: Gros (1996b) 207–234 passim; Lackner (2008) 280–282, 284–289; Gros (2008); Etxebarria Akaiturri (2008) 45–51, 63–79, 103–105; sowie vor allem jetzt Newsome (2010) passim, bes. 251–301; Newsome (2011b). 48 Zur Frage nach der Datierung s. vorläufig Muth (2009) 341–344.
Historische Dimensionen des gebauten Raumes
313
piert ist; entsprechend markierte die Platzinsel also die neue Fläche, auf der sich die Bürger anlässlich der Ansprachen von den Rostra nun versammelten. Die Ausgestaltung des Platzbodens im gesamten Forumsareal fungierte somit als Handlungsanweisung für die Nutzung: Der Verkehr, der vornehmlich in Gestalt von Sänften, leichten Wagen und wohl auch dem dichteren Fußgängerstrom das Forum durchquerte, wurde von nun an betonter an die Ränder des Platzes abgedrängt, und mit ihm alle damit verbundenen negativen Erscheinungen wie Chaos, Gedränge, Gestank, Dreck, Lärm49; die Fläche in der Mitte wurde hingegen nun als verkehrsberuhigter und somit komfortablerer und repräsentativerer Raum des Versammelns und Stehens markiert. Warum aber war man gerade damals daran interessiert, die Platzinsel als die Versammlungsstätte der römischen Bürger nun so nachdrücklich herauszuheben? Vor allem zwei Optionen erscheinen mir denkbar50: Zum einen konnte man das Forum nun vor allem in seiner Funktion als Versammlungsraum der römischen Bürgerschaft wahrnehmen – eine Wahrnehmung, die auch jenseits des konkreten Versammelns garantiert war, erschien doch diese Fläche so prominent als eigenes Zentrum aus der Forumsfläche ausgeschnitten und herausgehoben. Betonung und Heraushebung der Funktion übertrugen sich dann freilich auch auf die versammelte Bürgerschaft, die
49 Zur Rekonstruktion der Verkehrssituation in Rom und am Forum: Kaiser (2011) 174–175, 184–192; Macaulay-Lewis (2011) 262, 269; Laurence (2008); Newsome (2010) 14–15; (2011a) 14–20. – Zu den Nebenerscheinungen: Betts (2011) bes. 118–121; Favro (2011) 332; Hartnett (2011) 137–138; Holleran (2011) 248–249; Kaiser (2011) 188–190; Newsome (2011a) 11–12; derartige Beeinträchtigungen sind als nicht unwesentliches Kriterium bei der Ausgestaltung öffentlicher Plätze in Rom auch zu bedenken; allgemein bezogen auf den Ausbau des spätrepublikanischen und augusteischen Roms: Davies (2012). 50 Alleine verkehrstechnische Gründe postulieren zu wollen, würde die spezifische funktionale Qualität des Forums verkennen, das damals weniger Handels- und Verkehrsraum denn vielmehr vor allem Raum der politischen und sozialen Kommunikation und Repräsentation war. Natürlich trägt die neue Pavimentierung zu einer klareren Fixierung der Verkehrsrouten und damit zu einer stärkeren Kontrolle und Lenkung des Verkehrs auf dem Forum bei. Und ein solcher Eingriff passt seinerseits gut in den Kontext der generellen Normierungsmaßnahmen des öffentlichen Alltags, wie sie für die Zeit Caesars bezeugt sind – s. etwa die lex Iulia municipalis, die u.a. den Verkehr schwerer Wagen durch die Stadt zeitlich einschränkte (Favro (2011) 332–334; Hartnett (2011) 147–148; Kaiser (2011) 174–175, 187, 189; Newsome (2011a) 14–17 mit weiterer Literatur). Doch ist mit dem Hinweis auf die Reglementierung des Verkehrs allein wenig gewonnen, da sich weiterhin die Frage stellt, warum man damals an diesem Eingriff in die Verkehrssituation am Forum interessiert war – und damit landen wir wieder bei der Heraushebung der Platzinsel als dem eigentlichen Dreh- und Angelpunkt der Maßnahme. – Vgl. dagegen Newsome (2010) 148–149, 170, 301–302, der die Unterschiede in der Pavimentierung allein aus der Trennung von Bereichen für Fußgänger- und Wagenverkehr erklärt. Der Befund am Forum, wie etwa das Fehlen von Pollersteinen und anderer Schutzvorrichtungen gegenüber Wagenverkehr, macht deutlich, dass hier nicht mit einem derartigen Verkehrsaufkommen zu rechnen ist, wie es Newsome anzunehmen scheint. Vgl. zur Situation am Forum etwa die verkehrstechnische Aufrüstung von Straßen in Herculaneum und Pompeji: Hartnett (2011) bes. 148–158; Kaiser (2011) passim. Zur Organisation von Bauvorhaben auf dem Forum als besondere Herausforderung der Verkehrssituation, am Beispiel der Errichtung des Severusbogen: Favro (2011).
314
Susanne Muth
hier nun wortwörtlich in das Zentrum des Forums gerückt erschien – als politisches Gegenüber des neuen Herrschers. So gesehen wäre die Schaffung der herausgehobenen Platzinsel vor allem auch als eine Maßnahme des popularen Umwerbens des Volkes zu deuten51, und damit als eine geschickte Strategie zur Kompensation der damals zunehmenden politischen Entmachtung des Volkes – eine Strategie, die sich sowohl gut in die Politik Caesars einfügt, als dann auch in die ansonsten übliche Verschleierung der aktuellen politischen Machtverhältnisse, die bekanntlich Augustus damals mit dem Konzept des Principats verfolgte. Doch auch eine andere Perspektive ist denkbar, die letztlich eine gegenläufige Intention implizieren würde: Denn das betonte Einschreiben der Versammlungsinsel auf der Forumsfläche konnte gleichermaßen auch als eine reglementierende Anweisung verstanden werden – hier und nur hier sollte sich die Bürgerschaft versammeln, vor der neuen Rednertribüne an der Westseite. Die zunehmend tumultartigen Zustände, in die das politische Treiben auf dem Forum im Laufe des 1. Jh. v. Chr. immer wieder ausartete52, hatten einen Erfahrungshorizont geschaffen, der wirksame Kontrolle und Reglementierung größerer Menschenansammlungen wünschenswert werden lassen musste. Die bürgerkriegsartigen Unruhen, in die Clodius und seine Anhänger das Forum 58 v. Chr. versinken ließen, bildeten lediglich den signifikanten Höhepunkt für die grundsätzlich prekäre Situation. Und nicht zuletzt die Instabilität der politischen Verhältnisse nach den Iden des März hatte wieder allzu eindrücklich gezeigt, wie schnell die Mobilisierung der versammelten Plebs bzw. Veteranen als schlagkräftige Waffe im Kampf um die Macht eingesetzt werden konnte, wenn die Interessen der konkurrierenden Politiker nicht über die Zustimmung des Senates zu erreichen waren53. Bei dem Kampf um die meinungsbildende ‚Vorherrschaft‘ auf dem Forum erwies sich ferner als vorteilhaft, dass die Versammlungen an verschiedenen Orten stattfinden und von dort aus dirigiert werden konnten54. Besonders der Dioskurentempel mit seiner vorgelagerten Tribüne
51 Angesichts des anfänglich schlechten Verhältnisses Octavians zur plebs urbana ist sein Bemühen um diese ein nicht zu unterschätzender Faktor bei der Konstituierung der Principatsordnung; dies ist nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund der immer weiter wachsenden Bedeutung der plebs urbana als unverzichtbare und nur schwer kontrollierbare Größe im politischem Machtkampf seit den Ereignissen in den 50er Jahre des 1. Jh. v. Chr. zu sehen. Hierzu allgemein Nippel (1988) 136, 144–145, 147–149, 150–151; Sumi (2005) passim, bes. 18–22, 110–120, 140–141, 196–197, 204, 219; speziell zu Octavian/Augustus Nippel (1988) 151, 153–155; Pina Polo (1996) 155; Sumi (2005) 197. 52 Hierzu s. Nippel (1988) 54–69, 108–152; Kolb (1995) 292–294; Pina Polo (1996) 126–140, 151–162; Döbler (1999) 31–32, 136–141, 220–356. – Zu den von Clodius und seinen Anhängern erwirkten Unruhen: Nippel (1988) 108–144; Döbler (1999) 334–356. Zur prekären Situation nach den Iden des März: Nippel (1988) 144–152; Gotter (1996); Sumi (2005) 74–185. 53 Gerade Octavian/Augustus hatte mehrfach das bedrohliche Potential der plebs urbana erleben müssen (s. hierzu Anm. 51); vor dem Hintergrund seiner Erfahrungen wäre demnach der Wunsch nach stärkerer Kontrolle der Volksversammlungen verständlich. 54 Verschiedene Orte der Volksversammlung auf dem Forum: Döbler (1999) 136–141, bes. 139–141; Taylor (1966) 21–28, 41–45; Sumi (2005) 24–25. – Dioskurentempel als Handlungsort des Clodius:
Historische Dimensionen des gebauten Raumes
315
bot eine Alternative zu den stärker unter der Kontrolle der Curia stehenden Rostra beim Comitium (Abb. 2: Nr. 3–4 und 17) – nicht von ungefähr hatte gerade Clodius den Dioskurentempel als Ausgangspunkt für sein politisches Agieren gewählt: Die Wahl des Versammlungsortes wurde somit zum Teil der politischen Auseinandersetzung. Vor dem Hintergrund dieser Erfahrungen mag es bei der Etablierung der neuen Machtverhältnisse in Rom also durchaus erstrebenswert gewesen sein, die Spielregeln des politischen Versammelns neu zu diktieren und sie in geregelte Bahnen zu lenken55. Jedenfalls bot der eine nun fest definierte Versammlungsplatz vor den caesarisch-augusteischen Rostra entsprechende Chancen, die Auftritte der Redner auf der Rednertribüne und die Mobilisierung des Volkes auf dem Platz besser zu kontrollieren und gegebenenfalls Unruhen durch einzelne Anhängergruppen schneller zu unterbinden. Die Reglementierung des Handelns auf dem Forum bildete somit also ebenfalls eine Konsequenz, die aus der Neustrukturierung der Forumsfläche resultierte56. Je nachdem, welche der beiden Konsequenzen – symbolische Heraushebung des versammelten Volkes oder aber Reglementierung des Versammelns – plausibler erscheinen mag, ergeben sich sehr unterschiedliche Rückschlüsse auf die hinter der Baumaßnahme stehende Absicht. Und damit auch sehr divergierende Interpretationen mit Blick auf den Umgang des Augustus mit dem römischen Volk, die man aus diesem gebauten Befund entwickeln kann. Das Abwägen zwischen alternativen Deutungsvorschlägen gehört freilich zum Alltag einer jeden historischen Interpretation. Gemeinhin fragen wir danach, welchem der Deutungsvorschläge im Gesamtkontext der betreffenden Zeit, politischen Situation u.a. die größere Plausibilität zukommt. Das ist bekanntlich ein probater Weg – den wir auch hier beim Forum beschreiten können und entsprechend in den beiden Fallbeispielen gemäß unserem historischen Verständnis von Caesar bzw. Augustus den einen oder anderen Interpretationsvorschlag favorisieren. Doch genau an diesem Punkt mahnt nun die Frage nach den Medien der Geschichte zur Vorsicht – jedenfalls dann, wenn wir die Eigenlogik und Eigengesetzmäßigkeit der jeweiligen Medien bzw. medialen Produkte bedenken. Dieses Problem führt uns zu einem letzten Schritt in unserer Diskussion.
Taylor (1966) 28, 41; Nippel (1988) 242 Anm. 84; Döbler (1999) 338–340. Der Bereich beim Dioskurentempel als Raum der plebs: Sumi (2011) 209–210. 55 Hierzu s. auch Taylor (1966) 33. – Hierzu steht nicht im Widerspruch, dass faktisch die Volksversammlung mit Einrichtung des Principats zunehmend an Bedeutung für die Kommunikation zwischen Kaiser und Volk verlor und die Versammlungen im Theater und im Circus partiell die Rolle der republikanischen Volksversammlungen übernahm: diese Verschiebung im Bedeutungspotential der verschiedenen Handlungsräume war ein schleichender Prozess, der in den Jahrzehnten, als die Umgestaltung des Forums erfolgte, keineswegs in seinem Ergebnis absehbar gewesen sein wird; hierzu s. etwa Nippel (1988) 127–128, 154, 156, 159–160. 56 Generell zu den Strukturen und Möglichkeiten der Reglementierung von Bewegung und Versammeln auf dem Forum: Newsome (2010) 149–152, 156–162; Newsome (2011b) 299–305, zur Zunahme derartiger Eingriff in der ausgehenden Republik und augusteischen Zeit ebd. 302–305.
316
Susanne Muth
c) Eigendynamik und Eigenlogik: die Eigengesetzlichkeit von Geschichte im Raum Die Formung des gebauten Raumes unterliegt immer auch äußeren Rahmenbedingungen. Sie muss einerseits auf geographische und topographische Gegebenheiten reagieren, und andererseits, soweit der gebaute Raum nicht von Grund auf neu geschaffen wird, auf die Vorgaben durch die frühere Formung. Die konkrete Ausgestaltung des gebauten Raumes ist somit auch maßgeblich von äußeren Faktoren determiniert: Hieraus ergeben sich eigendynamische und eigenlogische Strukturen, die es bei der Interpretation des gestalteten Raumes ebenso zu bedenken gilt57. Nehmen wir als ein erstes Beispiel die Aufstellung des Equus Domitiani mitten auf der Forumsfläche58 (Abb. 2: Nr. 19; 12). Die monumentale Reiterstatue des Domitian, die in der Mitte der freien Forumsfläche aufgestellt und nach dem Sturz des Kaisers auch schnell wieder beseitigt wurde59, gilt in der Forschungsdiskussion gern als signifikantes Symbol für den neuen, absoluten Herrschaftsanspruch des Flaviers. Die Aufstellung einer Reiterstatue mitten auf dem Platz war damals ein Novum, bis dahin standen die Reiterstatuen bei bzw. auf den Rostra: dort standen die des Sulla, des Pompeius, des Caesar und auch die des Augustus – mit dem Equus Domitiani bekam die statuarische Herrscherrepräsentation am Forum somit eine neue Qualität. Entsprechend sieht man hierin auch den „Wandel des Forum vom Staatsplatz des augusteischen Prinzipats zur Stätte monarchischer Herrschaft“60 – der bis dahin der Versammlung des Volkes zugewiesene freie Platz des Forums erscheint nun als Repräsentationsbühne des flavischen Kaisers umfunktioniert und okkupiert. Doch war die Aufstellung der Reiterstatue des Domitian in der Tat so unerhört? Solange man sie an den alten Traditionen der Republik und des Übergangs zur Kaiserzeit misst, mag dies zunächst so erscheinen. Allerdings waren diese Traditionen ihrerseits stets in Bewegung – und hatten mit Beginn der Kaiserzeit eine nochmals ganz eigene Dynamik erfahren. Die Aufstellung von Reiterstatuen (und weiterer Ehrenstatuen) auf bzw. bei den Rostra galt seit dem 1. Jh. v. Chr. als die höchste Form statuarischer Ehrung: wie schon Sulla und Pompeius erhielten auch Caesar und dann später Augustus Reiter-
57 Seitens der Stadtsoziologie und Städteplanung wird die ‚Eigenlogik‘ mehr und mehr als wesentlicher Faktor bei der Konstituierung von urbanem Raum betont, s. Berking u. Löw (2008); Löw (2008); Löw u. Terizakis (2011). 58 Zum Folgenden ausführlicher Muth (2010) 487–488, 490–493. 59 Zum Equus Domitiani: Zanker (1972) 26–27; Coarelli (1985) 211–217; Giuliani u. Verduchi (1987) 118–122 [sowie ferner 133–139 zur früheren, fälschlichen Identifizierung des Statuenfundaments auf der Forumsfläche]; Bergemann (1990) 164–166; Giuliani (1995); Knell (2004) 146–147; Thomas (2004) [28–43 mit abweichendem Vorschlag zum Aufstellungsort innerhalb der Forumsfläche]; Hölscher (2006a) 117–118; Coarelli (2009) 81–83; Freyberger (2009) 90; Muth (2010) 490–493. 60 Zitat: Knell (2004) 137; vgl. dazu auch ebd. 146–147.
Historische Dimensionen des gebauten Raumes
317
Abb. 12: Rekonstruktion des Forums mit dem Equus Domitiani, im Hintergrund Dioskuren-Tempel und Basilica Iulia (Zeichnung: Francesco Corni).
statuen dort errichtet61. Die Beschränkung der Ehrung auf die jeweiligen politischen Hoffnungsträger bzw. Retter des Staates markierte die Exklusivität der Rostra als Ort der Statuenehrung – und diese Exklusivität unterstrich dann ihrerseits wiederum deren exzeptionellen Rang. So gesehen hätte auch die Reiterstatue des Domitian dort eigentlich ihre Aufstellung finden können. Doch war eben jene Exklusivität des Ortes im Jahr 56 n. Chr. aufgebrochen worden, als Nero dort dem Consul L. Volusius Saturinus eine Reiterstatue aufstellen und diesen damit in einzigartiger Weise auszeichnen ließ62. Damit konnten die Rostra nicht mehr als ein exklusiv den Herrschern vorbehaltener Ort statuarischer Ehrung gelten – und es musste von neuem ein attraktiver und exklusiver Ort für die kaiserliche Selbstdarstellung am Forum gesucht werden. Die freie Forumsfläche war hierfür die nächstliegende Alternative (zumal die anderen beiden Fora des Caesar und des Augustus inzwischen beste Vorbilder für die wirkungsvolle Besetzung der Platzmitte mit einer dominierenden Statue boten). So erscheint es also aus der dynamischen Entwicklung der Statuenaufstellung am Forum letztlich nur konsequent, dass für die Reiterstatue des Domitian eben jene freie Forumsfläche gewählt wurde63. Hinzu kam, dass sich auch die Wahrnehmung der Forumsflä-
61 Reiterstatuen des Sulla, Caesar, Pompeius und Augustus (sowie auch kurzfristig L. Antonius und M. Aemilius Lepidus) an den Rostra: Bergemann (1990) 34–35, 159–163; Sehlmeyer (1999) 204–211, 231–234, 245–251; Hölscher (2006a) 113; Freyberger (2009) 54–55; Muth (2012b) 16–17. 62 Postume Reiterstatue des Volusius Saturinus: Bergemann (1990) 36, 41, 120. Zum Aufweichen des exklusiven Charakters der Rostra als Standort kaiserlicher Reiterstandbilder ebd. 41 (mit weiteren, späteren Befunden). 63 Was wiederum dann Konsequenzen für das Ausmaß der Reiterstatue hatte, wollte sie die optische Konkurrenz mit der umgebenden hochaufragenden Architektur halten können: hierzu ausführlicher Muth (2010) 492–493.
318
Susanne Muth
che im Laufe der Zeit gewandelt hatte. In der republikanischen Zeit lagen die Bereiche der politischen Repräsentation – und damit die attraktiven Orte für die Errichtung von Ehrenstatuen – mehr am Rand der Fläche, am Comitium in der Nordwestecke sowie beim Dioskurentempel in der Südostecke; die freie Forumsfläche konnte demgegenüber weniger als Ort herausragender Repräsentation überzeugen. Dies änderte sich jedoch im Zuge der grundlegenden Neuordnung des Forums unter Augustus – die freie Forumsfläche rückte nun mehr und mehr ins Zentrum der Wahrnehmung. Und so war es wohl nur eine Frage der Zeit, bis man sich auch bei der Lokalisierung exklusiver Orte für die Statuenaufstellung am Forum neu orientierte. Genau genommen hatte wahrscheinlich schon Augustus selbst den Startschuss für diese Neuorientierung gegeben: Es spricht vieles dafür, dass genau hier in der Mitte der freien Forumsfläche die Columnae rostratae des Augustus standen64 (bezeichnenderweise gilt dies in der historischen Forschung nicht als unerhörter Eingriff – dieser Vorwurf bleibt Domitian vorbehalten); diese Columnae wurden unter Domitian hoch auf das Capitol versetzt, wohl, um Platz für seine eigene Reiterstatue eben in der Mitte der freien Forumsfläche zu schaffen. Wenn wir diese eigendynamischen Prozesse, sowohl in der Lokalisierung attraktiver Orte für exklusive Statuenaufstellungen als auch in der Wahrnehmung der mittleren Forumsfläche, bedenken, dann erscheint die Bewertung des Equus Domitiani in einem anderen Licht – und man wird es weniger zuversichtlich als Argument für das neue Herrschaftsverständnis Domitians ansprechen können. Derartige eigendynamische Prozesse bedingen längerfristig gesehen konsequenterweise also eine Eigenlogik im Funktionieren der betreffenden Räume, die es immer im Blick zu behalten gilt. Entsprechend lassen sich Beobachtungen im gebauten Raum nicht durch Vergleiche mit anderen Räumen rekonstruieren bzw. interpretieren, im Sinne zeitspezifischer, kontextübergreifender Phänomene; vielmehr sind die Beobachtungen zunächst immer aus den spezifischen eigenlogischen Gegebenheiten des Raumes und der dort bestehenden eigendynamischen Entwicklungen zu befragen und zu deuten. Bleiben wir bei der Statuenaufstellung und nehmen nochmals die Situation am augusteischen Forum als letztes Beispiel: Wie oben schon angesprochen, finden etliche der älteren Ehrenstatuen aus den vorausgehenden Jahrhunderten keine Aufstellung mehr an dem unter Caesar und Augustus umgewandelten Forum – darunter Statuen berühmter Protagonisten des königszeitlichen und republikanischen Roms wie etwa die Reiterstatuen des C. Maenius, Furius Camillus und Q. Marcius Tremulus, die Statue des Attus Navius oder die meisten Statuen der ermordeten Gesandten65. Man wird die merkliche Reduktion im Statuenbestand kaum als ‚Unfall‘ etwa im Zuge der Umbauarbeiten am Forum erklären wollen, zumal gleichzei-
64 Zur Lokalisierung der augusteischen Columnae rostratae: Coarelli (1985) 259; Zanker (1987) 50, 86–87; Palombi (1993a); Palombi (1993b); Sehlmeyer (1999) 255–257; Schmuhl (2008) 143–145, 149–150. 65 S. oben S. 301–303. – Ausführlicher hierzu Muth (2012b) 18–31.
Historische Dimensionen des gebauten Raumes
319
tig Beispiele für die Restaurierung oder gar Neuaufstellung älterer Statuen überliefert sind. Das Verschwinden dieser Statuen ist vielmehr Zeugnis dafür, dass man an ihrer Präsenz am Forum nicht mehr interessiert war – und sich explizit gegen sie entschieden haben muss. Ein solches Desinteresse an der Präsentmachung der glorreichen Vergangenheit Roms mag mit Blick auf Augustus verwundern. Vor allem, wenn wir die Nachdrücklichkeit bedenken, mit der am Augustusforum die Inszenierung eben jener Vergangenheit mittels der Reihen unzähliger Statuen in den Portiken und Exedren gesucht wurde66. Dort wurde die Erinnerung und die Vergegenwärtigung der glorreichen Vergangenheit offensichtlich als unverzichtbares Element für das gewünschte diskursive Klima begriffen – im eklatanten Unterschied zur Situation am Forum, wo eben an jenem betonten Dialog mit der Vergangenheit weniger Interesse bestand, und das, obwohl er sich hier letztlich mehr anbot als auf dem neu geschaffenen Augustusforum (ein ähnliches Desinteresse am Dialog mit der präsenten Vergangenheit scheint sich unter Augustus auch am Capitol abzuzeichnen67). Diese Divergenz im Umgang mit der Vergangenheit im öffentlich-politischen Raum resultiert aus den unterschiedlichen Möglichkeiten, die sich jeweils für die Inszenierung des Dialogs zwischen Gegenwart und Vergangenheit eröffneten. Im neu geschaffenen Augustusforum waren die Optionen vergleichsweise optimal, die Vergangenheit präsent zu halten und sie dennoch nicht mit der Gegenwart konkurrieren zu lassen: Die Vergangenheit ließ sich dort in kontrollierten Bahnen inszenieren, ihre Vergegenwärtigung erfolgt immer mit der klaren Zielrichtung, lediglich ein Vorspiel für die umso glorreichere Gegenwart und Herrschaft des Augustus zu sein68. Entsprechend flankierten und orchestrierten die Statuen in den Portiken die große Statue des Augustus in der Quadriga, die das Augustusforum in der Mitte des Platzes dominierte, als Zielpunkt aller statuarischen Ausstattung. Eine solch inszenierte Orientierung der Vergangenheit auf die Gegenwart war hingegen auf dem Forum Romanum nicht umsetzbar. Hier war die Präsenz der bisherigen Monumente nicht derart zurückzunehmen und sie derart zu einer orchestrierenden Staffage umzufunktionalisieren, dass sie den Monumenten des neuen Herrschers nicht die Aufmerksamkeit stahlen und nicht mit ihnen zu laut konkurrierten. Insofern wurde hier, wo die Erinnerung weniger leicht
66 Zur Beschwörung der Vergangenheit am Augustusforum: Zanker (1968) 14–18; Lahusen (1983) 23–26; Zanker (1987) 204–206, 213–217; Spannagel (1999) 86–255, 256–358; Itgenshorst (2004) 452–458; Walter (2004) 417–422; Itgenshorst (2005) 9–11, 223–226; Meneghini u. Santangeli Valenzani (2007) 55–58; Ungaro (2007) 120–122, 126, 159–169; Geiger (2008); Meneghini (2009) 71–73. 67 Abräumen der Statuen auf dem Capitol unter Augustus: Lahusen (1983) 10–11; Sehlmeyer (1999a) 270–271; Muth (2012b) 25 mit Anm. 73. 68 In gleicher Weise wird die Vergangenheit bekanntlich auch bei den fasti consulares und triumphales am Augustusbogen am Forum sowie dann auch bei der pompa funebris des Augustus instrumentalisiert: Muth (2012b) 28–30 mit weiteren Verweisen. – Die „Vereinnahmung der Geschichte“ bes. eindrücklich bei Walter (2004) 419–422 herausgearbeitet, zum generellen Umgang mit Vergangenheit und zur Instrumentalisierung von Geschichte unter Augustus ebd. 408–426
320
Susanne Muth
kontrollier- und lenkbar war, die Vergegenwärtigung der Vergangenheit in der zuvor präsenten Weise zurückgenommen, um der Inszenierung der Gegenwart ausreichend Bühne auf dem Forum zu geben69. Beide Räume, Forum Romanum und Augustusforum, boten folglich verschiedene Voraussetzungen für die gewünschte Auseinandersetzung mit der Vergangenheit – und diese Voraussetzungen determinierten somit die Möglichkeiten, wie jeweils der Dialog zwischen Gegenwart und Vergangenheit praktiziert werden konnte70. Das Forum Romanum entwickelte dabei also eine Eigenlogik hinsichtlich des Umgangs mit der Vergangenheit. Von hieraus würde man wohl kaum auf den Modus der Erinnerungskultur am Augustusforum schließen – und umgekehrt: Die Eigenlogik der jeweiligen Räume kann folglich zu durchaus konträren Konzepten in der statuarischen Bespielung des gebauten Raumes führen – allen Erwartungen an zeitspezifischen und kontextübergreifenden Strukturen im kulturellen Haushalt einer Epoche zum Trotz.
4 Die Komplexität der Geschichte – Plädoyer für eine differenziertere Sicht auf die historischen Dimensionen des gebauten Raumes Wohin hat uns die Betrachtung unseres Fallbeispiels nun gebracht? Und ist es das, was wir an Perspektiven für unsere Diskussion um die historischen Dimensionen des gebauten Raumes erwartetet haben? Es sind ohne jeden Zweifel vielfältige Einblicke in die ‚Geschichte‘, die uns unser Fallbeispiel, das Forum Romanum, zu eröffnen erlaubt, wenn wir es hinsichtlich seiner historischen Aussagekraft befragen. Allerdings ist das Spektrum an Einblicken etwas weiter und vielleicht auch etwas komplexer, als wir gemeinhin gewohnt sind, aus einem solchen gebauten Raum zu erschließen. Neben Einblicken in die Geschichte der politischen Kultur und Repräsentation der Macht, welche wir bei einem öffentlichpolitischem Raum wie dem Forum Romanum naheliegenderweise erwarten und nach denen wir auch primär fragen, eröffnen sich auch Einblicke in ganz andere Segmente von Geschichte: etwa in die Geschichte der pragmatischen Organisation des öffent-
69 Offensichtlich als Kompensation wird wohl dann gleichzeitig ein anderer Modus der Erinnerungskultur am Forum gesucht, der einerseits stark auf die fern zurückliegende mythische Vergangenheit zielt und andererseits sich weniger auf die Erinnerung von Personen als mehr diejenige an Handlungen konzentriert, ausführlicher dazu Muth (2012b) 31–38; s. auch Muth (2012a) 271. 70 Muth (2012b) 30–31. Zu der grundsätzlich komplexen und in ihrer Wahrnehmbarkeit schwer strukturier- und kontrollierbaren Situation der Monumente auf dem spätrepublikanischen Forum s. auch Walter (2004) 157–160; im Vergleich mit dem Augustusforum ebd. 420; Zu den grundlegenden Zäsuren im Funktionieren einer politisch motivierten Erinnerungskultur an dem Übergang von der späten Republik zur Monarchie s. auch im weiteren Kontext Walter (2004) 408–426; Gowing (2005) 135–145.
Historische Dimensionen des gebauten Raumes
321
lichen Raumes (Lenkung von Bewegungen und Blickführungen, Handlungsanweisungen), in die Geschichte der Realisierung und Optimierung architektonischer Handlungsräume (Akustik, Sicherheit, Kontrolle, Reaktion auf klimatische Gegebenheiten), in die Geschichte der räumlichen Inszenierung präsenter Vergangenheit und damit in die Geschichte der Konstruktion von Geschichte in der Antike selbst, oder auch in die Geschichte der Hierarchisierung von Handlungsabläufen, Wahrnehmungen und atmosphärischen Eindrücken – hier eröffnen sich verschiedene Facetten in der Kulturgeschichte eines öffentlich-politischen Raumes, die weniger mit der konkreten (Ereignis-)Geschichte der Politik und Macht zusammenhängen, als vielmehr mit der strukturellen Benutzung und Wahrnehmung von öffentlichen Räumen, und die durchaus in anderen zeitlichen Rhythmen und mit anderen zeitlichen Zäsuren funktionieren können, als die Ereignisgeschichte dem historischen Fragen zunächst nahelegt. Diese Vielfalt an historischen Einblicken mahnt ihrerseits dann aber auch zugleich zu einem differenzierteren Befragen des gebauten Raumes: Am Beispiel des Forums zeigt sich eindrücklich, dass manche der erwartungsgemäßen Einblicke in die politische Kultur und die Machtrepräsentation möglich werden, andere aber auch wiederum nicht, so dass unser gezieltes historisches Fragen auch ins Aus laufen kann. Dies ergibt sich aus der Eigengesetzmäßigkeit im medialen Funktionieren des gebauten Raumes: Der Raum kann eben mehr erwirken, als lediglich diskursive Vorstellungen und symbolische Repräsentationen zu kommunizieren – das Erwirken von pragmatischen Anweisungen der Bewegung, des Handelns und des Wahrnehmens im Raum gehört ebenfalls zum Potential intendierter Auswirkungen des gebauten Raumes auf seine Benutzer (so sehr dies dann auch wieder sinn- und identitätsstiftend wirken kann, aber eben nicht unbedingt im Horizont politischer Rollen- und Wertvorstellungen). Oftmals divergieren die rekonstruierbaren Konsequenzen, die die Gestaltung des Raumes erzielt, zu sehr, als dass plausibel entschieden werden kann, welche von ihnen den Ausschlag gaben, welche Intention und welche ‚Nebeneffekt‘ waren: In solchen Fällen eröffnet der gebaute Raum dann also Einblicke in verschiedene Segmente von Geschichte, was die Wirkungen des Raumes auf seine Benutzer betrifft – die vom Baustifter intendierte Zielsetzung als Teil eines anderen Segments der Geschichte bleibt dagegen unklar. Diese Grenzen in der historischen Interpretierbarkeit des gebauten Raumes zu bedenken, ist insofern wichtig, als dies uns mahnt, unsere historischen Erwartungshaltungen nicht zu schnell auf Befunde des Raumes zu projizieren und den so konstruierten Interpretationen dann eine scheinbare argumentative Sicherheit zu geben, die diesen vom tatsächlichen Befund her nicht zukommt. Vielmehr muss es unser Ziel sein, zunächst allein im spezifischen Horizont des betreffenden Raumes das Wirkungspotential seiner Formung zu prüfen und dort nach Indizien zu suchen, die die verschiedenen Wirkungsoptionen plausibel in primär intendierte und sekundäre Effekte zu unterteilen erlauben. Nur wenn wir uns auf die konkreten Gegebenheiten des jeweiligen Raumes nahsichtig einlassen, kann es gelingen, ihm in seiner tatsächlichen historischen Aussagekraft gerecht zu werden. Und nur dann kann es auch
322
Susanne Muth
gelingen, die Einwirkung äußerer Faktoren auf die jeweilige Formung des Raumes sicherer zu erkennen, um wiederum die Eigenlogik und die Eigendynamik in der Ausgestaltung des gebauten Raumes zu entdecken – als conditio sine qua non für jede historische Interpretation des gebauten Raumes. Wenn wir aus einer solchen sensibilisierten Perspektive der in den Raum eingeschriebenen Geschichte nachspüren, dann wird die hieraus ‚lesbare‘ Geschichte zweifelsohne bunter und eigenwilliger – manchmal sogar redefreudiger als erhofft, manchmal aber auch schweigsamer als befürchtet. Und auch umgekehrt eignet sich ein bestimmter Raum auch nur bedingt zum Schreiben einer bestimmten übergreifenden Geschichte. Nehmen wir zum letzten Mal unser Fallbeispiel. So sehr das Forum reichliche Informationen für die Rekonstruktion der politischen Geschichte Roms bietet: Würden wir diese Geschichte allein auf der Grundlage des Forums schreiben wollen, würde die von hieraus erzählbare Geschichte wohl kaum dem entsprechen, was wir gemeinhin von der politischen Kultur und der Konstellation der Macht im antiken Rom wissen. Zwar würden manche Kapitel durchaus das am Forum beobachten lassen, was an strukturellen Phänomenen auch andere Medien überliefern – wie etwa die oben aufgeführten Beispiele zum Comitium, den Tempeln und den Ehrenstatuen. Andere Kapitel in der politischen Geschichte Roms würden hingegen leer bleiben, da wir diese Epochen am Forum nicht greifen können – wie etwa die Geschichte Roms während des Ersten und Zweiten Punischen Krieges, die Bedeutung Agrippas für Augustus, die Herrschaftsrepräsentation Vespasians und die Legitimierung der neuen Dynastie der Flavier, oder auch das Herrschaftsverständnis der Adoptivkaiser71. Und nochmals andere Kapitel würden uns aufgrund der Eigenlogik des Forums bestimmte Phänomene anders, ja gegebenenfalls sogar gegenläufig beschreiben lassen, als uns andere Medien und andere Räume ihr strukturelles Funktionieren bezeugen – wie etwa der gerade diskutierte Umgang mit der Vergangenheit am augusteischen Forum, oder auch das Interesse der Spätantike, die politische Identität der Stadt über die betonte Rückbesinnung auf die ruhmreiche Vergangenheit Roms zu formulieren72. In jedem Fall wäre es eine andere Geschichte der Politik und Macht in Rom, die wir ausgehend vom Forum rekonstruieren würden, als diejenige, die wir sonst im Zusammentragen verschiedener medialer Zeugnisse plausibel rekonstruieren können. Das bedeutet schließlich, dass die Geschichte, die ein gebauter Raum wie das Forum zu erschließen erlaubt, zunächst immer nur als die Geschichte dieses betreffenden Raumes zu verstehen ist – und mit den vielen anderen Geschichten anderer Räume und anderer medialer Produkte zusammentragen werden muss, um überhaupt übergreifende Strukturen rekonstruieren bzw. angenommene Strukturen überprüfen zu können. Wenn wir den gebauten Raum in dieser Weise auf seine historische
71 Zum ‚Fehlen‘ bestimmter Epochen oder Personen in der in das Forum eingeschriebenen Geschichte: Zanker (1973) 23; Kolb (1995) 177–185, 358; Muth (2012a) 274–275; Muth (2010) 488–490. 72 Dazu Muth (2012a) 263–270, 276–278.
Historische Dimensionen des gebauten Raumes
323
Dimension hin befragen, dann wird jene Geschichte, die er uns erzählt und uns wiederum zu erzählen erlaubt, in jedem Fall komplexer – aber letztlich auch spannender und vor allem: der Vielfalt historischer Realität näher kommend.
Literaturverzeichnis Assmann (2009): Aleida Assmann, „Geschichte findet Stadt“, in: Csáky u. Leitgeb (2009) 13–27. Bachmann-Medick (2006): Doris Bachmann-Medick, Cultural Turns. Neuorientierungen in den Kulturwissenschaften, Reinbek bei Hamburg. Benjamin (1991): Walter Benjamin, Gesammelte Schriften, Bd. V: Das Passagen-Werk, hgg. Hermann Schweppenhäuser u. Rolf Tiedemann, Frankfurt am Main. Bergemann (1990): Johannes Bergemann, Römische Reiterstatuen. Ehrendenkmäler im öffentlichen Bereich, Mainz. Berking u. Löw (2008): Helmuth Berking u. Martina Löw (Hgg.), Die Eigenlogik der Städte. Neue Wege für die Stadtforschung, Frankfurt/New York. Betts (2011): Eleanor Betts, „Towards a Multisensory Experience of Movement in the City of Rome“, in: Laurence u. Newsome (2011) 118–135. Bieger (2007): Laura Bieger, Ästhetik der Immersion: Raum-Erleben zwischen Welt und Bild. Las Vegas, Washington und die White City, Bielefeldt. Braudel (1949): Fernand Braudel, La Méditeranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II, Paris. Böhme (2006): Gernot Böhme, Architektur und Atmosphäre, München. Böhme (2009): Hartmut Böhme, „Kulturwissenschaft“, in: Günzel (2009) 191–207. Buchner (1990): Wolfgang K. Buchner, Zentrum der Welt. Das Forum Romanum als Brennpunkt der römischen Geschichte, Gernsbach. Carafa (1998): Paolo Carafa, Il Comizio di Roma dalle origini all’età di Augusto, Roma. Catalli (1992): Fiorenzo Catalli, Alba Fucens, Roma. Coarelli (1975): Filippo Coarelli, Rom. Ein archäologischer Führer, Freiburg/Basel/Wien. Coarelli (1983): Filippo Coarelli, Il Foro Romano I. Periodo Arcaico, Roma. Coarelli (1985): Filippo Coarelli, Il Foro Romano II. Periodo Repubblicano e Augusteo, Roma. Coarelli (1993): Filippo Coarelli, „Comitium“, in: Eva Margareta Steinby (Hg.), Lexicon Topographicum Urbis Romae, Bd. I, Roma, 309–314. Coarelli (1999): Filippo Coarelli, „Rostra (età repubblicana)“, in: Eva Margareta Steinby (Hg.), Lexicon Topographicum Urbis Romae, Bd. IV, Roma, 212–214. Coarelli (2009): Filippo Coarelli, „I Flavi e Roma“, in: Filippo Coarelli (Hg.), Divus Vespasianus. Il bimillenario dei Flavi, Milano, 68–97. Csáky u. Leitgeb (2009): Moritz Csáky u. Christoph Leitgeb (Hgg.), Kommunikation, Gedächtnis, Raum. Kulturwissenschaften nach dem „Spatial Turn“, Bielefeld. D’Arco (1998): Ines D’Arco, Il culto di Concordia e la lotta politica tra IV e II sec. a.C., Roma. Davies (2012): Penelope J.E. Davies, „Pollution, propriety and urbanism in Republican Rome“, in: Mark Bradley (Hg.), Rome, Pollution and Propriety. Dirt, Disease and Hygiene in the Eternal City from Antiquity to Modernity, Cambridge, 67–80. Delitz (2009a): Heike Delitz, Gebaute Gesellschaft. Architektur als Medium des Sozialen, Frankfurt/ New York. Delitz (2009b): Heike Delitz, Architektursoziologie, Bielefeldt. Delitz (2009c): Heike Delitz, „Expressiver Außenhalt. Die ‚Architektur der Gesellschaft‘ aus Sicht der Philosophischen Anthropologie“, in: Fischer u. Delitz (2009) 163–194.
324
Susanne Muth
Delitz (2010): Heike Delitz, „‚Die zweite Haut des Nomaden‘. Zur sozialen Effektivität nicht-moderner Architekturen“, in: Trebsche, Müller-Scheeßel u. Reinhold (2010) 83–106. Döbler (1999): Christine Döbler, Politische Agitation und Öffentlichkeit in der späten Republik, Frankfurt am Main/Berlin/Bern/u.a. Döring (2010): Jörg Döring, „Spatial Turn“, in: Günzel (2010) 90–99. Döring u. Thielmann (2008): Jörg Döring u. Tristan Thielmann (Hgg.), Spatial Turn. Das Raumparadigma in den Kultur- und Sozialwissenschaften, Bielefeld. Ebeling (2010): Knut Ebeling, „Historischer Raum: Archiv und Erinnerungsort“, in: Günzel (2010) 121–144. Etxebarria Akaiturri (2008): Alaitz Etxebarria Akaiturri, Los foror romanos republicanos en la Italia centro-meridional tirrena. Origen y evolución formal, Madrid. Favro (2011): Diana Favro, „Constructing Traffic in Imperial Rome: Building the Arch of Septimius Severus“, in: Laurence u. Newsome (2011) 322–360. Favro u. Johanson (2010): Diane Favro u. Christopher Johanson, „Death in Motion: Funeral Processions in the Roman Forum“, Journal of the Society of Architectural Historians 69, 12–37. Ferroni (1993): Angela Maria Ferroni, „Concordia, aedes“ & „Concordia, aedicula“, in: Eva Margareta Steinby (Hg.), Lexicon Topographicum Urbis Romae, Bd. I, Roma, 316–321. Filippi (2012): Dunia Filippi, „Regione VIII. Forum Romanum Magnum“, in: Andrea Carandini (Hg.), Atlante di Roma antica. Biografia e ritratti della città, Milano, Bd. 1, 143–206; Bd. 2, Taf. 1–60 passim. Fischer (2010): Joachim Fischer, „Architektur als „schweres Kommunikationsmedium“ der Gesellschaft. Zur Grundlegung der Architektursoziologie“, in: Trebsche, Müller-Scheeßel u. Reinhold (2010) 63–82. Fischer u. Delitz (2009): Joachim Fischer u. Heike Delitz (Hgg.), Die Architektur der Gesellschaft. Theorien für die Architektursoziologie, Bielefeld. Foucault (1977): Michel Foucault, Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses, Frankfurt am Main (franz. Original 1975). Freyberger (2009a): Klaus Stefan Freyberger, Das Forum Romanum. Spiegel der Stadtgeschichte des antiken Rom, Mainz. Freyberger (2009b): Klaus Stefan Freyberger, „Il foro Romano“, in: Henner von Hesberg u. Paul Zanker (Hgg.), Architettura romana: I grandi monumenti di Roma, Milano, 152–163. Gasparri (1979): Carlo Gasparri, Aedes Concordiae Augustae, Roma. Geiger (2008): Joseph Geiger, The First Hall of Fame. A Study of the Statues in the Forum Augustum, Leiden/Boston. Giuliani (1995): Cairoli Fulvio Giuliani, „Equus: Domitianus“, in: Eva Margareta Steinby (Hg.), Lexicon Topographicum Urbis Romae, Bd. II, Roma, 228–229. Giuliani u. Verduchi (1987): Cairoli Fulvio Giuliani u. Patrizia Verduchi, L’area centrale del foro Romano, Firenze. Giuliani u. Verduchi (1995): Cairoli Fulvio Giuliani u. Patrizia Verduchi, „Forum Romanum (età tarda)“, in: Eva Margareta Steinby (Hg.), Lexicon Topographicum Urbis Romae, Bd. II, Roma, 342–343. Gotter (1996): Ulrich Gotter, Der Dictator ist tot! Politik in Rom zwischen den Iden des März und der Begründung des Zweiten Triumvirats, Stuttgart. Gowing (2005): Alain M. Gowing, Empire and Memory. The Representation of Roman Republic in Imperial Culture, Cambridge. Gros (1981): Pierre Gros, Bolsena. Guide des Fouilles, Roma. Gros (1996a): Pierre Gros, „Iulius, divus, aedes“, in: Eva Margareta Steinby (Hg.), Lexicon Topographicum Urbis Romae, Bd. III, Roma, 116–119. Gros (1996b): Pierre Gros, L’architecture romaine du début du IIIe siècle av. J.-C. à la fin du HautEmpire. 1. Les monuments publics, Paris.
Historische Dimensionen des gebauten Raumes
325
Gros (2008): Pierre Gros, „Entrer dans la ville ou la contourner? Remarques sur les problèmes posés par les tronçons urbains des voies de communication sous le Haut-Empire“, in: Mertens (2008) 145–163. Gros u. Torelli (1988): Pierre Gros u. Mario Torelli, Storia dell’ urbanistica: Il mondo romano, Bari. Groys (2000): Boris Groys, Unter Verdacht. Eine Phänomenologie der Medien, München – Wien. Günzel (2007): Stephan Günzel (Hg.), Topologie. Zur Raumbeschreibung in den Kultur- und Medienwissenschaften, Bielefeld. Günzel (2008): Stephan Günzel, „Spatial Turn – Topographical Turn – Topological Turn. Über die Unterschiede zwischen Raumparadigmen“, in: Döring u. Thielmann (2008) 219–237. Günzel (2009): Stephan Günzel (Hg.), Raumwissenschaften, Frankfurt am Main. Günzel (2010): Stephan Günzel (Hg.), Raum. Ein interdisziplinäres Handbuch, Stuttgart – Weimar. Hartnett (2011): Jeremy Hartnett, „The Power of Nuisances on the Roman Street“, in: Laurence u. Newsome (2011) 135–159. Hasse (2012): Jürgen Hasse, Atmosphären der Stadt. Aufgespürte Räume, Berlin. Helbig (2009): Jörg Helbig, Intermedialität-Theorie und Praxis eines interdisziplinären Forschungsgebietes, London (Original 1998). Helmes u. Köster (2002): Günter Helmes u. Werner Köster (Hgg.), Texte zur Medientheorie, Stuttgart. Heyworth (2011): Stephen J. Heyworth, „Roman topography and latin diction“, Papers of the British School at Rome 79, 43–69. Hilger (2011): Christina Hilger, Vernetze Räume. Plädoyer für den Spatial Turn in der Architektur, Bielefeld. Hochmuth u. Rau (2006): Christian Hochmuth u. Susanne Rau (Hgg.), Machträume der frühneuzeitlichen Stadt, Konstanz. Holleran (2011): Claire Holleran, „The Street Life of Ancient Rome“, in: Laurence u. Newsome (2011) 245–261. Hölkeskamp (2004): Karl-Joachim Hölkeskamp, SENATVS POPVLVSQVE ROMANVS. Die politische Kultur der Republik – Dimensionen und Deutungen, Wiesbaden Hölkeskamp (2011): Karl-Joachim Hölkeskamp, Die Entstehung der Nobilität. Studien zur sozialen und politischen Geshcichte der Römischen Republik im 4. Jh. v. Chr., 2. erweiterte Auflage (1. Auflage 1987), Stuttgart. Hölscher (1978): Tonio Hölscher, „Die Anfänge römischer Repräsentationskunst“, Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Institutes, Römische Abteilung 85, 315–357. Hölscher (2001): Tonio Hölscher, „Die Alten vor Augen. Politische Denkmäler und öffentliches Gedächtnis im republikanischen Rom“, in: Gert Melville (Hg.), Institutionalität und Symbolisierung. Verstetigungen kultureller Ordnungsmuster in Vergangenheit und Gegenwart, Köln/ Weimar/Wien, 183–211. Hölscher (2004): Tonio Hölscher, „Provokation und Transgression als politischer Habitus in der späten römischen Republik“, Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Institutes, Römische Abteilung 111, 83–104. Hölscher (2006a): Tonio Hölscher, „Das Forum Romanum – die monumentale Geschichte Roms“, in: Elke Stein-Hölkeskamp u. Karl-Joachim Hölkeskamp (Hgg.), Erinnerungsorte der Antike. Die römische Welt, München, 100–122. Hölscher (2006b): Tonio Hölscher, „Macht, Raum und visuelle Wirkung: Auftritte römischer Kaiser in der Staatsarchitektur von Rom“, in: Joseph Maran, Carsten Juwig, Hermann Schwengel u. Ulrich Thaler (Hgg.), Constructing Power. Architecture, Ideology and Social Practice/Konstruktion der Macht. Architektur, Ideologie und soziales Handeln, Hamburg, 185–201. Hölscher (2009): Tonio Hölscher, „Denkmäler und Konsens. Die sensible Balance von Verdienst und Macht“, in: Karl-Joachim Hölkeskamp (Hg.), Eine politische Kultur (in) der Krise? Die „letzte Generation“ der römischen Republik, München, 161–181.
326
Susanne Muth
Huelsen (1905): Christian Huelsen, Das Forum Romanum, seine Geschichte und seine Denkmäler, Rom. Itgenshorst (2004): Tanja Itgenshorst, „Augustus und der republikanische Triumph: Triumphalfasten und summi viri-Galerie als Instrumente der imperialen Machtsicherung“, Hermes 132, 436–458. Itgenshorst (2005): Tanja Itgenshorst, Tota illa pompa. Der Triumph in der römischen Republik, Göttingen. Janson u. Bürklin (2002): Alban Janson u. Thorsten Bürklin, Auftritte/Scenes. Interaktionen mit dem architektonischen Raum: die Campi Venedigs/Interaction with Architectural Space: the Campi of Venice, Basel/Boston/Berlin. Johanson (2008): Christopher John Johanson, Spectacle in the Forum: Visualizing the Roman aristocratic funeral of the Middle Republic, Ann Arbor. Kähler (1964): Heinz Kähler, Das Fünfsäulendenkmal für die Tetrarchen auf dem Forum Romanum, Köln. Kaiser (2011): Alan Kaiser, „Cart Traffic Flow in Pompeii and Rome“, in: Laurence u. Newsome (2011) 174–193. Kajetzke u. Schroer (2010): Laura Kajetzke u. Markus Schroer, „Sozialer Raum: Verräumlichung“, in: Günzel (2010) 192–203. Kissel (2004): Theodor Kissel, Das Forum Romanum. Leben im Herzen der Stadt, Düsseldorf/Zürich. Kloock u. Spahr (2000): Daniela Kloock u. Angela Spahr, Medientheorien. Eine Einführung, 2. Auflage, München. Kolb (1995): Frank Kolb, Rom. Geschichte der Stadt in der Antike, München. Krämer (2008): Sybille Krämer, „Medien, Boten, Spuren. Wenig mehr als ein Literaturbericht“, in: Münker u. Roesler (2008) 65–90. Lackner (2008): Eva-Maria Lackner, Republikanische Fora, München. Lagaay u. Lauer (2004a): Alice Lagaay u. David Lauer (Hgg.), Medientheorien. Eine philosophische Einführung, Frankfurt/New York. Lagaay u. Lauer (2004b): Alice Lagaay u. David Lauer, „Einleitung – Medientheorien aus philosophischer Sicht“, in: Lagaay u. Lauer (2004a) 7–29. Lahusen (1983): Götz Lahusen, Untersuchungen zur Ehrenstatue in Rom, Rom. Laurence (2008): Ray Laurence, „City Traffic and the Archaeology of Roman Streets from Pompeii to Rome“, in: Mertens (2008) 87–106. Laurence u. Newsome (2011): Ray Laurence u. David John Newsome (Hgg.), Rome, Ostia and Pompeii: Movement and Space, Oxford. Lefebrve (1991): Henri Lefebvre, The Production of Space, Oxford (franz. Original 1974). Lehnert (2011): Gertrud Lehnert (Hg.), Raum und Gefühl. Der Spatial Turn und die neue Emotionsforschung, Bielefeldt. Leschke (2003): Rainer Leschke, Einführung in die Medientheorie, München. Lippuner u. Lossau (2010): Roland Lippuner u. Julia Lossau, „Kritik der Raumkehren“, in: Günzel (2010) 110–119. Löw (2001): Martina Löw, Raumsoziologie, Frankfurt am Main. Löw (2008): Martina Löw, Soziologie der Städte, Frankfurt am Main. Löw u. Terizakis (2012): Martina Löw u. Georgios Terizakis (Hg.), Städte und ihre Eigenlogik: Ein Handbuch für Stadtplanung und Stadtentwicklung, Frankfurt/New York. Luhmann (1987): Niklas Luhmann, Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie, Frankfurt am Main. Luhmann (1997): Niklas Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft, Frankfurt am Main. Macaulay-Lewis (2011): Elizabeth Macaulay-Lewis, „The City in Motion: Walking for Transport and Leisure in the City of Rome“, in: Laurence u. Newsome (2011) 262–289. Meneghini (2009): Roberto Meneghini, I Fori Imperiali e i Mercati di Traiano, Roma Meneghini u. Santangeli Valenzani (2007): Roberto Meneghini u. Riccardo Santangeli Valenzani, I Fori Imperiali. Gli scavi del Comune di Roma (1991–2007), Roma.
Historische Dimensionen des gebauten Raumes
327
Mertens (1968): Joseph Mertens, „Il foro di Alba Fucens“, Notizie degli scavi di antichità 22, 205–217. Mertens (2008): Dieter Mertens (Hg.), Stadtverkehr in der antiken Welt, Wiesbaden. Momigliano (1942/1984): Arnoldo Momigliano, „Camillus and Concord“ (1942), Secondo contributo alla storia degli studi classici, Roma, 89–104. Morstein-Marx (2004): Robert Morstein-Marx, Mass Oratory and Political Power in the Late Roman Republic, Cambridge. Müller (2009): Jürgen E. Müller, „Intermedialität als poetologisches und medientheoretisches Konzept. Einige Reflexionen zu dessen Geschichte“, in: Helbig (2009) 31–40. Münker (2008): Stefan Münker, „Was ist ein Medium? Ein philosophischer Beitrag zu einer medientheoretischen Debatte“, in: Münker u. Roesler (2008) 322–337. Münker u. Roesler (2008): Stefan Münker u. Alexander Roesler (Hgg.), Was ist ein Medium?, Frankfurt am Main. Muth (2005): Susanne Muth, „Im Angesicht des Todes. Zum Wertediskurs in der römischen Grabkultur“, in: Andreas Haltenhoff, Andreas Heil u. Fritz-Heiner Mutschler (Hgg.), Römische Werte als Gegenstand altertumswissenschaftlicher Forschung, München/Leipzig, 259–286. Muth (2009): Susanne Muth, „Seiner Zeit voraus? Wie das Forum Romanum zu einer neuen Platzstruktur fand“, Wissenschaftskolleg zu Berlin, Jahrbuch 2007/2008, 324–346. Muth (2010): Susanne Muth, „Auftritt auf einer bedeutungsschweren Bühne: Wie sich die Flavier im öffentlichen Zentrum der Stadt Rom inszenieren“, in: Christiane Reiz u. Norbert Kramer (Hgg.), Tradition und Erneuerung. Mediale Strategien in der Zeit der Flavier, Berlin, 485–496. Muth (2011): Susanne Muth, „Ein Plädoyer zur medientheoretischen Reflexion – oder: Überlegungen zum methodischen Zugriff auf unsere historischen Primärquellen“, in: Alexandra Verbovsek, Burkhard Backes u. Catherine Jones (Hgg.), Methodik und Didaktik in der Ägyptologie. Herausforderungen eines kulturwissenschaftlichen Paradigmenwechsels in den Altertumswissenschaften, Paderborn, 327–346. Muth (2012a): Susanne Muth, „Der Dialog von Gegenwart und Vergangenheit am Forum Romanum in Rom – oder: wie spätantik ist das spätantike Forum?“, in: Therese Fuhrer (Hg.), Rom und Mailand in der Spätantike: Die Repräsentation des städtischen Raumes in Literatur, Architektur und Kunst, Berlin, 263–282. Muth (2012b): Susanne Muth, „Reglementierte Erinnerung: Das Forum Romanum unter Augustus als Raum kontrollierter Kommunikation“, in: Felix Mundt (Hg.), Kommunikationsräume im kaiserzeitlichen Rom, Berlin, 3–47. Muth u.a. (2012c): Susanne Muth, Richard Neer, Agnès Rouveret u. Ruth Webb, „Texte et image dans l’Antiquité: lire, voir et percevoir“, Perspective 2012, 2, 11–28. Muth u. Petrovic (2013): Susanne Muth u. Ivana Petrovic, „Medientheorie als Chance – Überlegungen zur historischen Interpretation von Texten und Bildern“, in: Birgit Christiansen u. Ulrich Thaler (Hgg.), Ansehenssache. Formen von Prestige in Kulturen des Altertums, München, 281–318. Nedergaard (1993): Elisabeth Nedergaard, „Arcus Augusti (a. 29 a.C.) & Arcus Augusti (a. 19. a.C.)“, in: Eva Margareta Steinby (Hg.), Lexicon Topographicum Urbis Romae, Bd. I, Roma, 80–85. Newsome (2010): David John Newsome, The Forum and the city: Rethinking centrality in Rome and Pompeii (3rd century B.C. – 2nd century A.D.), Ph.D.Thesis, Birmingham, http://etheses.bham.ac.uk/814/ (Stand 24. 05. 2013) Newsome (2012a): David John Newsome, „Introduction: Making Movement Meaningful“, in: Laurence u. Newsome (2011) 1–54. Newsome (2012b): David John Newsome, „Movement and fora: from shortcuts to obstacles“, in: Laurence u. Newsome (2011) 290–311. Nielsen (1993): Inge Nielsen, „Castor, aedes, templum“, in: Eva Margareta Steinby (Hg.), Lexicon Topographicum Urbis Romae, Bd. I, Roma, 242–245.
328
Susanne Muth
Nielsen u. Poulsen (1992): Inge Nielsen u. Birte Poulsen, The Temple of Castor and Pollux: The pre-Augustan temple phases with related decorative elements, Roma. Nippel (1988): Wilfried Nippel, Aufruhr und „Polizei“ in der römischen Republik, Stuttgart. Nova u. Jöchner (2010): Alessandro Nova u. Cornelia Jöchner (Hg.), Platz und Territorium. Urbane Struktur gestaltet politische Räume, Berlin. Nünning (2008): Ansgar Nünning (Hg.), Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie. Ansätze – Personen – Grundbegriffe, 4. Auflage, Stuttgart/Weimar. Paech (2009): Joachim Paech, „Intermedialität, Mediales Differenzial und transformative Figurationen“, in: Helbig (2009) 14–30. Palombi (1993a): Domenico Palombi, „Columnae Rostratae Augusti“, Archeologia Classica 45, 321–332. Palombi (1993b): Domenico Palombi, „Columnae Rostratae Augusti“, in: Eva Margareta Steinby (Hg.), Lexicon Topographicum Urbis Romae, Bd. I, Roma, 308. Patterson (1992): John R. Patterson, „The City of Rome: From Republic to Empire“, The Journal of Roman Studies 82, 186–215. Pina Polo (1996): Francisco Pina Polo, Contra arma verbis. Der Redner vor dem Volk in der späten römischen Republik, Stuttgart. Purcell (1995): Nicholas Purcell, „Forum Romanum (the Imperial period)“, in: Eva Margareta Steinby (Hg.), Lexicon Topographicum Urbis Romae, Bd. II, Roma, 336–342. Rajewsky (2002): Irina O. Rajewsky, Intermedialität, Tübingen/Basel. Rau (2013): Susanne Rau, Räume: Konzepte, Wahrnehmungen, Nutzungen, Frankfurt/New York. Rauscher (2008): Josef Rauscher, „Unvorgreiflicher Versuch, sich im fragwürdigen Medium der Fragen von der Frage „Was ist ein Medium?“ über „Was ist das paradigmatische Medium“ zu „Was sind und leisten (sich) die Medien?“ vorzutasten“, in: Münker u. Roesler (2008) 272–321. Sandel (2009): Marcus Sandl, „Geschichtswissenschaften“, in: Günzel (2009) 159–174. Schäfers (2006): Bernhard Schäfers, Architektursoziologie. Grundlagen – Epochen – Themen, 2. Auflage, Wiesbaden. Schäfers (2009): Bernhard Schäfers, „Architektursoziologie. Zur Geschichte einer Disziplin“, in: Delitz u. Fischer (2009) 365–384. Schäfers (2010): Bernhard Schäfers, „Architektursoziologie. Grundlagen – theoretische Ansätze – empirische Belege“, in: Trebsche, Müller-Scheeßel u. Reinhold (2010) 29–40. Schanze (2002a): Helmut Schanze (Hg.), Metzler Lexikon Medientheorie und Medienwissenschaft, Stuttgart/Weimar. Schanze (2002b): Helmut Schanze, „Medien“, in: Schanze (2002a) 199–201. Schläger (2008): Jürgen Schläger, „Medientheorien“, in: Nünning (2008) 476–478. Schlögel (2006): Karl Schlögel, Im Raume lesen wir die Zeit. Über Zivilisationsgeschichte und Geopolitik, Frankfurt am Main. Schlögel (2007): Karl Schlögel, „Räume und Geschichte“, in: Günzel (2007) 33–51. Schmidt (2008): Siegfried J. Schmidt, „Der Medienkompatktbegriff“, in: Münker u. Roesler (2008) 144–157. Schroer (2009): Markus Schroer, „Soziologie“, in: Günzel (2009) 354–369. Sehlmeyer (1999): Markus Sehlmeyer, Stadtrömische Ehrenstatuen der republikanischen Zeit, Stuttgart. Siebert (2002): Jan Siebert, „Intermedialität“, in: Schanze (2002a) 152–154. Spannagel (1999): Martin Spannagel, Exemplaria principis. Untersuchungen zu Entstehung und Ausstattung des Augustusforums, Heidelberg. Squire (2009): Michael Squire, Image and Text in Graeco-Roman Antiquity, Cambridge. Stambaugh (1988): John E. Stambaugh, The ancient Roman City, Baltimore/London. Sumi (2005): Geoffrey S. Sumi, Ceremony and Power. Performing Politics in Rome between Republic and Empire, Ann Arbor.
Historische Dimensionen des gebauten Raumes
329
Sumi (2011): Geoffrey S. Sumi, „Topography and Ideology: Caesar’s monument and the aedes divi Iulii in Augustan Rome“, The Classical Quarterly 61.1, 205–229. Ulrich (1993): Roger B. Ulrich, „Julius Caesar and the Creation of the Forum Iulium“, American Journal of Archaeology 97, 49–80. Ungaro (2007): Lucrezia Ungaro, „Il Foro di Augusto & La memoria dell’antico“, in: Lucrezia Ungaro (Hg.), Il Museo dei Fori Imeriali nei Mercati di Traiano, Roma, 18–169. Taylor (1966): Lily Ross Taylor, Roman voting assemblies from the Hannibalic war to the dictatorship of Caesar, Ann Arbor. Thomas (2004): Michael L. Thomas, „(Re)locating Domitian’s Horse of Glory: The „Equus Domitiani“ and Flavian Urban Design“, Memoirs of the American Academy in Rome 49, 21–46. Trebsche u.a. (2010): Peter Trebsche, Nils Müller-Scheeßel u. Sabine Reinhold (Hgg.), Der gebaute Raum. Bausteine einer Architektursoziologie vormoderner Gesellschaften, Münster/New York/ München/Berlin. Verduchi (1999): Patrizia Verduchi, „Rostra Augusti“, in: Eva Margareta Steinby (Hg.), Lexicon Topographicum Urbis Romae, Bd. IV, Roma, 214–217. Von Hesberg (2005): Henner von Hesberg, Römische Baukunst, München. Wagner (2010): Kirsten Wagner, „Topographical Turn“, in: Günzel (2010) 100–109. Walter (2004): Uwe Walter, Memoria und res publica. Zur Geschichtskultur im republikanischen Rom, Frankfurt am Main. Warf u. Arias (2009): Barney Warf u. Santa Arias (Hgg.), The Spatial Turn. Interdisciplinary perspectives, London/New York. Welch (2003): Katherine Welch, „A new view of the origins of the basilica. The Atrium Regium, Graecostasis and Roman diplomacy“, Journal of Roman Archaeology 16, 5–34. Wiesing (2008): Lambert Wiesing, „Was sind Medien?“, in: Münker u. Roesler (2008) 235–248. Wolf (2008): Werner Wolf, „Intermedialität“, in: Nünning (2008) 327–328. Zanker (1968): Paul Zanker, Forum Augustum. Das Bildprogramm, Tübingen. Zanker (1972): Paul Zanker, Forum Romanum. Die Neugestaltung durch Augustus, Tübingen. Zanker (1987): Paul Zanker, Augustus und die Macht der Bilder, München. Ziolkowski (1992): Adam Ziolkowski, The Temples of mid-republican Rome and their Historical and Topographical Context, Roma.
Abbildungsnachweise Abb. 1 Abb. 2 Abb. 3a-c Abb. 4a-b Abb. 5 Abb. 6 Abb. 7 Abb. 8a-b Abb. 8c Abb. 9 Abb. 10 Abb. 11 Abb. 12
Photo S. Muth nach Coarelli (1975) 50, überarbeitet S. Muth nach Stambaugh (1988) 108 Abb. 7, 112 Abb. 8, 115 Abb. 9; überarbeitet S. Muth Rekonstruktion Armin Müller, DigiForo HU Berlin nach Ulrich (1993) 52 Abb. 1; überarbeitet S. Muth Rekonstruktion Armin Müller, DigiForo HU Berlin Rekonstruktion Armin Müller, DigiForo HU Berlin nach Welch (2003) 6 Abb. 1, überarbeitet S. Muth nach Kähler (1964), überarbeitet S. Muth Rekonstruktion Armin Müller, DigiForo HU Berlin Huelsen (1905) Taf. I Photo S. Muth Coarelli (2009) 81 Abb. 21
330
Rudolf Preimesberger
Rudolf Preimesberger
St. Peter in Rom: Medien und Gattungen seit 1506 Seit 1606 befindet sich in St. Peter in Rom am Sprengring der Kuppel eine der größten Inschriften der westlichen Welt (Abb. 1). Sie lautet: „Tu es Petrus et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam tibi dabo claves regni coeli“. Ihre Ausmaße sind kolossal, sie ist in Mosaik und befindet sich an einem der damals öffentlichsten Orte Europas. Die Worte bezeichnen Unsichtbares, wenn nicht Abwesendes, die körperlichen Überreste des galiläischen Fischers und charismatischen Wanderpredigers, von dem die – damals nicht mehr unangefochtene – Tradition sagt, er sei um die Mitte des ersten Jahrhunderts aus dem Osten des Imperiums nach Rom gekommen, habe hier das Martyrium erlitten und sei am vatikanischen Hügel bestattet worden. Sie bezeichnen jenen Ort unter der Kuppel, der seit der Mitte des zweiten Jahrhunderts Mittelpunkt eines Grabkultes ist, den Konstantin zum Ausgangspunkt der Planung einer kaiserlichen Basilika machte, den Donato Bramante zum Mittelpunkt seiner Planung Neu-St. Peters machte und den die Kuppel des Michelangelo überwölbt1. Es sind nicht Worte allein, die an ihr erscheinen, sondern auch Bilder, und beides ist mit Sicherheit keine Idee Michelangelos gewesen. Die Entscheidung, die Kuppel doppelt sprechend zu machen, war wohl erst im Pontifikat Sixtus’ V. Peretti gefallen, der den Neubau nach knapp neunzigjähriger Bauzeit liturgisch gebrauchsfähig machte, indem er die Kuppel am 14. Mai 1590 schloss2. Ihre Ausstattung mit Mosaiken, der altchristlichen Kunstgattung schlechthin und zudem einer „petrinischen“, nämlich steinernen Gattung, begann 1603 und war im Jahr 1612 abgeschlossen3. Gezeigt ist das christliche Thema schlechthin: Jüngster Tag, Auferstehung des Fleisches, Gericht und künftiges Leben, der Grundgedanke sehr einfach: Unter der Kuppel harren die Gebeine des Petrus ihrer Erweckung am Jüngsten Tag; der Ort seines Grabes ist zugleich der seiner künftigen leiblichen Auferstehung. Wie wird der Auferstehungsleib des Menschen beschaffen sein? In der Geschichte des christlichen Denkens über diese Frage stehen am Ende des Jahrhunderts der Re-
1 Wolff Metternich (1972); Wolff Metternich (1975); Frommel (1976); Frommel (1977); Francia (1977); Thoenes (1986) 481–501; Wolff Metternich (1987); Arbeiter (1988); Hubert (1988) 195–221; Francia (1989); Saalman (1989) 103–140; Krauss u. Thoenes (1991/92); Thoenes (1992) 51–61; Hubert (1992); Thoenes (1994) 109–132; Thoenes (1995–1997); Pinelli (2000); Bredekamp (2000); Lavin (2000) 177–236; Ostrow (2000a) 241–251; Thoenes (2005) 64–92; Millon (2005) 93–110; Lavin (2005) 111–243; Tronzo (2005); Roser (2005); Satzinger (2005) 45–74; Satzinger u. Schütze (2008); Thoenes (2008) 9–28; Niebaum (2008) 49–82; Hubert (2008) 111–126; Satzinger (2008) 127–146. 2 Orbaan (1917) 189–207; Bellini (2008) 175–194. 3 Orbaan (1919) 34–35, 42, 45; Di Federico (1983) 64–66; Ostrow (2000b) 795–796; Kummer (2008) 243–256; Fiore (2010) 65–70.
St. Peter in Rom: Medien und Gattungen seit 1506
331
Abb. 1: St. Peter, Rom: Kuppelraum.
formation, knapp gesagt, wiederum die beiden Grundpositionen einander gegenüber. Der Protestantismus argumentiert spiritualistisch: Keine Kontinuität zwischen den körperlichen Überresten und dem Auferstehungsleib mit den bekannten Folgerungen gegenüber der Grab- und Reliquienverehrung. Auf der altkirchlichen Seite hingegen die Lehre einer gewissen Kontinuität, der Glaube an die Wiederherstellung der ursprünglichen psychosomatischen Einheit des Menschen mit den nicht minder bekannten Folgen für die Grab- und Reliquienverehrung. Nicht weniger als zweiundzwanzig positive Gründe weiß der führende Kontroverstheologe der altkirchlichen Seite, Robert Bellarmin, ihren Gegnern entgegenzuhalten, darunter als Beispiel den tumulus piscatoris in St. Peter4. Genau dies ist in den Mosaiken der Kuppel dargestellt: Die leibliche Auferstehung des Petrus am Jüngsten Tag (Abb. 2). Deshalb der eschatologische Christus in hieratischer Frontalität auf Wolken im Formular der maiestas Domini; durch den Globus in seiner Hand ist er als der Weltenherrscher, durch die erhobene Rechte mit dem Wundmal und die Instrumente seiner Passion als der künftige Weltenrichter charakterisiert. Deshalb zu seinen Füßen in den Lunetten die Halbfiguren von sechzehn Päpsten
4 Walker Bynum (1995); Bellarmin (1871) 199–266.
332
Rudolf Preimesberger
Abb. 2: St. Peter, Rom: Mosaiken der Kuppel.
und Bischöfen, allesamt in der Haltung, den Gebärden und der Mimik der Auferstehung. In der prominentesten Position in der Mittelachse erscheint Petrus in Pontifikalien. Er ist von seinen ersten Nachfolgern umgeben, unter ihnen wohl Linus, Cletus, Anacletus, Evaristus, Sixtus, Telesphorus, Hyginus, Eleutherius, Victor, Fabianus, Johannes, von denen der Liber Pontificalis im Anschein historischer Gewissheit das suggestive Bild entwirft, sie seien allesamt nahe seinem Grab bestattet worden. Heilige Päpste der Urkirche, um den ersten Papst geschart! Ein für die Geschichte und die Selbstdeutung des Papsttums um 1600 bedeutsames Thema: das Bild einer heroi-
St. Peter in Rom: Medien und Gattungen seit 1506
333
Abb. 3: St. Peter, Rom: Inschrift Sixtus’ V. am Fuß der Kuppellaterne.
schen „besseren Kirche“ der Frühzeit. Allesamt sind es der Tradition nach Märtyrer oder Bekenner5. Die kollektive vatikanische Grablege der frühen Päpste ist allerdings eine Fiktion! Erst im fünften Jahrhundert ist Leo der Große der erste gewesen, der sich im Atrium von St. Peter beisetzen ließ. Noch aber galt sie als historische Gewissheit. Eine Reihe von Gräbern im Bereich der Confessio, die archäologisch zu identifizieren man nicht in der Lage war, schien es zu bestätigen. Als man im Jahr 1626 eine fragmentierte Inschrift mit den Buchstaben „CL“ fand, deutete man sie folgerichtig auf den Namen Cletus. Das Grab des zweiten Nachfolgers Petri schien gefunden6. 5 Borgolte (1989) 15–93. 6 Cerrati (1914) 36–37.
334
Rudolf Preimesberger
Auferstehung bedeutet Verklärung des Leibes. Es könnte das Indiz einer verstärkten Rolle des Wortes in der nachreformatorischen Situation sein, wenn die Widmungsinschrift Sixtus’ V. im Scheitel der Kuppel (Abb. 3) genau diesen Inhalt wörtlich ausdrückt. Im fünften Jahr seines Pontifikats habe der Papst die Kuppel „S(ancti) Petri gloriae …“ geweiht. Der lesende Laie liest hier primär „Ruhm“ und „Ehre“ des Petrus. Der räumliche und funktionale Kontext deutet jedoch zugleich auf ein Anderes. Nahezu lotrecht über seinen geglaubten Gebeinen, die hier der leiblichen Auferstehung harren, und im Scheitel einer Kuppel, die diese im Bild zeigt, bezeichnet das Wort mehr. Denn theologisch gelesen bedeutet gloria, das lateinische Synonym für doxa, nichts anderes als „Herrlichkeit“ und „Verklärung“, bedeutet sie schon im Judentum, dessen Gott ein „Herr der Herrlichkeit“ ist, die „äußere Erscheinungsweise der überweltlichen Majestät Jahwes“, bezeichnet sie im Christentum „das Phänomen der himmlischen Welt schlechthin“, so in den Angelophanien wie der der lukanischen Weihnachtserzählung, so in den Christophanien, wie der der Verklärung auf dem Berg, der Auferstehung oder der „vollen Herrlichkeit“ der Parusie. Anthropologisch gelesen bezeichnet gloria nichts anderes als die Verklärung des menschlichen Leibes bei der Auferstehung des Fleisches am Jüngsten Tag7. Der künftigen „Herrlichkeit“ und „Verklärung“, dem „Glanz“ des Körpers Petri hat Sixtus V. also die Kuppel geweiht. Durch Bild und Wort ist der Kuppelraum von St. Peter als der Ort des Grabes und der künftigen leiblichen Auferstehung des ersten Papstes bezeichnet und gedeutet. Um 1600 ist dies ein brüchiger Glaube. Der Protestantismus bestreitet ihn bekanntlich heftig. Noch während der Bauzeit Neu-St. Peters hatte Paul IV. es im Jahr 1557 für nötig befunden, den lokalen liturgischen Gedenktag, das Fest Petri am 18. Januar, für die Gesamtkirche einzuführen, mit der erklärten Absicht, man müsse „den Irrtum der Häretiker bekämpfen, Petrus sei nie in Rom gewesen“8. Die römische PetrusTradition, die die Ausstattung des Kuppelraumes so eloquent zu bestätigen scheint, ist um 1600 längst zu einer Petrus-Frage geworden. War Petrus überhaupt in Rom gewesen? Wie alt und zuverlässig ist die Tradition, die besagt, er sei in Rom als Märtyrer gestorben und am Vatikanischen Hügel begraben? Worauf gründet sich der Primat des Papstes? Bekanntlich hatte sich das im Neuen Testament gebotene Bild vom Apostel Simon Petrus erst im zweiten Jahrhundert literarisch zu einer römischen Petrus-Tradition geweitet, als explizite Aussagen über seinen Märtyrer-Tod in Rom formuliert wurden, die sich zwischen dem Verfasser des ersten Clemensbriefes und Leo dem Großen im fünften Jahrhundert entwickelten und verfestigten9. Zu einer PetrusFrage mit fundamentalen Folgerungen für die Lehre vom Primat Petri und seiner Nachfolger wurde sie erstmals durch die Kritik der Waldenser, dann anderer, die den
7 Schnackenburg (1959) 532–534; Nielen u. Jungmann (1959) 534–536. 8 Torrigio (1644) 3–4; Roser (2008) 257–273. 9 Cullman (1960); Böcher (1962) 263–273; Fröhlich (1962) 273–278; Bäumer (1962) 20–57; Gnilka (2002); Gnilka, Heid u. Riesner (2010).
St. Peter in Rom: Medien und Gattungen seit 1506
335
Kampf gegen den Primat des Papstes mit der fundamentalen These führten, Petrus sei nie in Rom gewesen; kulminierend nach der Leipziger Disputation von 1520 in dem „Tractatus quod Petrus apostolus numquam Romae fuerit“ des böhmischen Humanisten Ulricus Velenus Mnichoviensis mit seinem klaren „Nein“ gegenüber einem römischen Aufenthalt Petri; ebenso Calvin, während Luther daran fest hält, doch wisse man nicht, wo in Rom die Körper Petri und Pauli lägen. Der Primat Petri und seiner Nachfolger sei zu bestreiten, da Paulus der bedeutendere Apostel gewesen sei. Die Traditionsbeweise der altkirchlichen Kontroverstheologen hingegen fasst Robert Bellarmin kurz vor 1600 in seinen „Controversiae“ zusammen: Sieben Jahre habe Petrus den Bischofsstuhl von Antiochia besessen, in Rom aber als erster Papst bis zu seinem Martyrium unter Nero fünfundzwanzig Jahre lang gelebt10. Einer der Kernpunkte der Kontroverse ist die Frage nach dem vatikanischen Grab, mit dessen fehlender archäologischer Evidenz die Waldenser als erste argumentiert hatten. Die Frage, bekanntlich nicht frei von einer Reihe methodischer und sachlicher Aporien, ist hier nicht abzuhandeln; nicht die inzwischen wohl mehrheitlich vertretene Wahrscheinlichkeit einer Historizität des Martyriums in Rom; nicht das Fehlen historischer Anhaltspunkte für eine individuelle Hinrichtung in der liturgischen Form eines dies natalis; nicht die Hypothese eines Martyriums unter den katastrophalen Umständen der bei Tacitus überlieferten Massenhinrichtung der Christen unter Nero mit der Schwierigkeit, sich eine Bergung und frühe Verehrung des Leichnams vorzustellen. Der archäologische Befund der Grabungen der vierziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts macht es bekanntlich möglich, die Tradition eines vatikanischen Grabes Petri bis in die Zeit um 140–160 zurückzuverfolgen. Von da an die Verehrung, mündend in einen der wohl bedeutendsten Grabkulte, die das Christentum gesehen hat, mit den bekannten weitreichenden geschichtlichen Folgen11. Dass Petrus dereinst am Jüngsten Tag in St. Peter leiblich auferstehen werde, ist die Aussage der eschatologischen Bilder der Kuppelschale, die Behauptung, seine Gebeine ruhten tatsächlich unter der Kuppel des Michelangelo, die raison d’être der Inschrift vor goldenem Mosaikgrund an deren Fuß, in der sich die wirkungsästhetische Kategorie des „Glanzes“ oder splendor geradezu verkörpert. In kolossalen Lettern erscheinen die Worte, auf denen im altkirchlichen Verständnis der Primat des Petrus und seiner Nachfolger beruht, Höhepunkt der von Matthäus als vorösterlich berichteten Erzählung, in der Simon als erster die Messianität und Gottessohnschaft Jesu bekennt und dafür den Symbolnamen Kephas und die Verheißung empfängt, er sei Felsen und Fundament der Kirche. Der Gedanke ihrer Anbringung gehört, wie schon erwähnt, wohl in den Pontifikat des Papstes, der das Medium monumentaler Epigraphik an seinen Bauten und Monu-
10 Bellarmin (1871) 538–545. 11 Apollonj-Ghetti, Ferrua, Josi u. Kirschbaum (1951); Arbeiter (1988); Fink (1988); Guarducci (1989); Sperandio u. Zander (1999); Thümmel (1999); Gatz (2010) 186–188.
336
Rudolf Preimesberger
Abb. 4: St. Peter, Rom: Inschrift TV ES PETRVS am Fuß der Kuppel.
menten allenthalben einsetzte: Sixtus V. Peretti. Schöpfer der sixtinischen Capitalis ist der vatikanische Scriptor Luca Orfei, diese selbst eine christliche Revision der kaiserlichen Capitalis vor Konstantin; vor allem die Inschriften Trajans wurden nachgeahmt, weil unter diesem das Imperium seine größte Ausdehnung erreicht hatte. Die Lettern der Inschrift (Abb. 4) in den Farben des Petrus, Blau und Gold, die seinen Glauben ausdrücken, hat einer der Nachfolger Orfeis, Ventura Farfallini, entworfen12. Sie folgen kaiserzeitlichen Vorbildern, sind jedoch anders als diese von kolossalen Ausmaßen, wie sie die römische Kaiserzeit meines Wissens nicht kannte. Größe, Macht, Glanz und Schönheit der päpstlichen Buchstaben scheint die der Kaiser zu übertreffen. Was ist ihre Funktion? Als erstes wäre hier von der eminenten ästhetischen und emotionalen Wirkung der feierlich isolierten und rhythmisierten blauen Buchstaben vor Goldgrund zu sprechen, deren ikonische Qualität auch den Betrachter erreicht, der sie nicht lesen kann. Für den Lesenden sind es bedeutungsschwere Worte! Selbst wenn er nur die ersten drei, „Tu es Petrus …“, versteht, erkennt er, dass das appellative „Tu“ unmittelbar an Petrus gerichtet sein muss. Er erfährt oder beobachtet eine geradezu klassische persuasio. Nicht in diskursiver Form, sondern, rhetorisch ge-
12 Bonanni (1696) 98; Orbaan (1919) 34–35, 42, 45; Mosley (1964), 21–27; Kajanto (1982); Petruccci (1986) 29–40, 670–680; Ostrow (2000b) 796.
St. Peter in Rom: Medien und Gattungen seit 1506
337
sprochen, durch das zutiefst problematische und gewagte Kunstmittel des paradoxon schema13, das der Rhetor vor Gericht nur für die schwer zu vertretende und schiefe causa einsetzen soll, behaupten die Worte, Petrus selbst sei im Kuppelraum anwesend. Der Lesende schließt, dass sie sich an den Petrus in dem Grab unter der Kuppel richten müssen. In kolossalen Lettern wird ihm also der Schluss insinuiert, dass die Gebeine des ersten Papstes, weil sie ja mit Namen angesprochen werden, folglich auch da sein müssen, obwohl man sie nicht sieht. Will man sich die ursprüngliche Wirkung der hier inszenierten Persuasion vergegenwärtigen, so hat man zu bedenken, dass es das Bronzeziborium Giovanni Lorenzo Berninis im Jahr 1606 noch nicht gab, und dass in diesem Zustand relativer Leere des Kuppelraums die Beziehung zwischen der appellativen Inschrift am Fuß der Kuppel und den unsichtbaren Gebeinen unter dem Altar ungleich klarer als heute erkennbar war. Es sind, um die Frage nach Medium und Gattung zu berühren, die Konstruktionsund Wirkungsweisen einer ‚Renaissance-Imprese‘, die hier sichtbar werden. Man bemerkt ihr Prinzip: die inszenierte Spannung zwischen res und verbum. Man bemerkt die Willkür der Bedeutungskonstitution: das Zusammenführen zweier Komponenten aus grundverschiedenen Kontexten, die „in Wahrheit“ nicht zueinander passen und gerade dadurch im schauend lesenden und lesend schauenden Rezipienten den neuen dritten Sinn produzieren können, den sie für sich allein genommen, nicht haben und nicht haben können14. Das „falsche“ Wort zum „falschen“ Ding! Die Worte „Tu es Petrus“ entstammen dem Evangelium des Matthäus. Christus hat sie dort „in der Gegend von Caesarea Philippi“ zu seinem Apostel gesprochen. Aus diesem ihren ursprünglichen Textzusammenhang sind sie gelöst. Erst durch ihre Isolierung sind sie für neue Signifikationen offen. Dem neuen Kontext des Grabaltars unter der Kuppel hinzugefügt, produzieren sie mit diesem zusammen die neue dritte Bedeutung: Die unsichtbaren Gebeine, die hier verehrt werden, sind die des Petrus! Das Grab unter der Kuppel ist das Grab des ersten Papstes. Warum der Terminus ‚Imprese‘? Als die Beziehung zwischen anima und corpus hatte ihr erster Theoretiker Paolo Giovio das Verhältnis zwischen dem Wort-Bestandteil und der res im Bild-Bestandteil der Imprese charakterisiert und damit ein konkurrenzlos erfolgreiches theoretisches Modell der Gattung geschaffen15. So wohl auch hier! Erst die Worte „Tu es Petrus …“ in der Rolle der anima geben der res der unsichtbaren Gebeine Petri unter der Kuppel, einem unbelebten corpus par excellence, Namen und Seele. Sie erst machen das Grab des ersten Papstes beredt. Als einen wichtigen Aspekt mag man dabei die deiktische Komponente ansehen. „Tu es Petrus …“ besagt: „Du hier bist Petrus“. Es geht um ein Zeigen durch Sprache. Die ursprünglich
13 Neumeyer (2003) 516–524; Celentano (2003) 524–526. 14 Sulzer (1977) 401–426; Sulzer (1981) 209–240; Klein (1957) 320–341. 15 Giovio (1555).
338
Rudolf Preimesberger
biblische Rede ist im neuen Kontext eine deiktische insofern, als es in ihr um das Erzeugen der Anwesenheit eines Abwesenden mit sprachlichen Mitteln geht. Warum dies alles 1606? Es ist ein Gemeinplatz, dass die Worte bei Matthäus 16, 18 ihre eigene Problemgeschichte haben. Vom frühen Mittelalter an hat das Papsttum seinen Primat auf sie gegründet: Petrus der Felsen, auf dem Christus seine Kirche baut. Allein, die Exegese ist kontrovers. Kein Geringerer als Augustinus hatte anders gedeutet. Christus selbst sei hier gemeint: „Super hanc petram, hoc est super me ipsum, quia petra erat Christus“. Eine historisch folgenreiche Exegese! Denn so deuten die Reformatoren; Luther, Calvin, Zwingli, Melanchthon, sie alle erschüttern dadurch den Primat Petri16. Unverkennbar deshalb die spezifisch nachreformatorischen Konnotationen der kolossalen Inschrift, unverkennbar ihre antiprotestantische Stoßrichtung! Sie betont den Primat Petri just an dessen vom Protestantismus massiv bezweifelter Begräbnisstätte und mit Hilfe just jener Worte, die der Protestantismus als biblische Begründung des päpstlichen Primats ablehnt! Die Worte richten sich nicht an die Gebeine des historischen Petrus allein. Nolens volens vollzieht der Lesende des Jahres 1606 die ihm insinuierte Deutung, dass sie ebenso dessen Nachfolger in der jeweiligen Gegenwart ansprechen sollen. Die Voraussetzungen sind bekannt. Im fünften Jahrhundert hatte der für die Ausbildung des Primats-Gedankens hochbedeutende Leo der Große die Lehre begründet, dass unter dem altrömisch geformten Rechtsinstitut des indignus haeres beati Petri jeder Papst der unmittelbare persönliche Universalerbe des heiligen Petrus sei. Jeder der fortlebende Petrus17! Dass dem so ist, wird wohl dann am deutlichsten, wenn der Papst im Ritus der Papst-Messe unter der Kuppel selbst anwesend ist, unausweichlich, wenn er sich zu Beginn in Prozession dem Apostelaltar nähert und dort von der Schola mit dem Hymnus „Tu es Petrus …“ begrüßt wird. Der Betrachter sieht, liest und hört in einem. Spätestens in dieser Situation erlebt oder beobachtet er eine zweite, weiter gehende persuasio. Er soll die Worte, die einst den Primat des Petrus begründeten, auf den gegenwärtigen Papst übertragen und in ihm den Träger der dem Petrus gegebenen Verheißung von den Schlüsseln des Himmelreiches, vom Binden und Lösen und vom Bestand der Kirche bis an das Ende der Zeiten erkennen. Ob katholisch, protestantisch oder indifferent, ob in Zustimmung, Neutralität oder Ablehnung, erfährt oder beobachtet er ein Beispiel starker affektiver Medienwirkung durch kolossale Epigraphik. Die Worte des Kuppelraumes evozieren Gegenwart. Nicht die der Eingangswand (Abb. 5)! Hier erfährt und beobachtet der Betrachter zwischen 1618 und 1650 ein Anderes, und dies in spezifischer Form: den epigraphischen Wettstreit dreier Päpste um das Gedächtnis ihrer Verdienste um Neu-St. Peter. Zunächst war es Paul V. Borghese gewesen, der die Mitte der Eingangswand mit einer gewaltigen Inschrift-Tafel besetzt
16 Lapide (1732) 315–321; Lampe (1979) 227–245; Grech (2000) 177–178. 17 Ullmann (1960) 25–51.
St. Peter in Rom: Medien und Gattungen seit 1506
339
hatte, die ihn als den Vollender des von Julius II. begonnenen Werks, die eben abgeschlossene Errichtung des Langhauses und der Fassade aber als „opus amplissimum ac magnificentissimum“ pries, und die, an die Gegner des Abbruchs des konstantinischen Langhauses gerichtet, das defensive Argument enthielt, sein Neubau bedecke die gesamte Ausdehnung der „wegen der Religion“ verehrungswürdigen konstantinischen Basilika18. Es folgte Urban VIII. Barberini, der die Mitte der Eingangswand mit einem Relief der zweiten Gründungsszene des Papsttums nach Johannes im dreiundzwanzigsten Kapitel, dem Pasce oves meas Giovanni Lorenzo Berninis, besetzte. Es scheint, dass dies zugleich den wohl nicht ganz unwillkommenen Anlass bot, die Inschrift des Vorvorgängers aus der Mitte zu entfernen, in einem neuen verkürzten Text den Begriff der Magnifizenz zu tilgen, den Ton insgesamt herab zu stimmen, die verkleinerte Tafel auf der linken Seite der Eingangswand anzubringen und sie zum schwächeren Gegenstück seiner eigenen Inschrift-Tafel (Abb. 6) auf der rechten, der Evangelienseite, zu machen. Der historische Ausgriff der Inschrift Urbans VIII. ist weiter. An die gesamte Geschichte des Baues seit Konstantin und Papst Sylvester ist erinnert. Der Neubau ist das Verdienst der „religiösen Magnifizenz vieler Päpste“, das eigene Verdienst aber sind Weihe und Schmuck, die eherne moles über dem Apostelgrab, Altäre, Kapellen und Statuen19. Urban VIII. konnte nicht ahnen, dass bereits sein unmittelbarer Nachfolger Innozenz X. Pamphilj das Relief Berninis entfernen und die Mitte der Eingangswand mit einer eigenen Inschrift-Tafel besetzen werde, die die der beiden Vorgänger nach Größe und Inhalt überbietet. „Großartiger“ als sie habe er den Bau vollendet: „… magnificentius terminavit“20. „Religiosa multorum pontificum magnificentia …“. In lapidarer Form und sowohl durch das Adjektiv „religiosa“ als auch den Genitivus possessivus „multorum pontificum“ spezifiziert, hat Urban VIII. dem Bau und seinem eigenen Tun einen nicht unumstrittenen Begriff deutend hinzugefügt, den der magnificentia. Magnifizenz mit ihrem der Epoche sehr bewussten Ursprung in der megaloprepeia der älteren Eudemischen wie der jüngeren Nikomachischen Ethik des Aristoteles und schon dort nicht allein politisch und sozialethisch, sondern wirkungsästhetisch konnotiert, ist erst bei Thomas von Aquin zu einer christlichen Tugend geworden21. Deutlich berührt die Verbindung der drei Begriffe „Magnifizenz“, „Religion“ und „Papsttum“ ein dem Jahrhundertbau und seiner Ausstattung geschichtlich längst verknüpftes Problem: die in der nachreformatorischen und nachtridentinischen Situation verschärft gestellte Frage nach der Rechtfertigung ostentativer Kapitalverschwendung im großartigen
18 De Rossi (1645) 17; Gani (2000) 739. 19 Gani (2000) 739–740; Thelen (1967b) 52–53; Bauer (2000) 15–25; Fiore (2010) 71–72. 20 Gani (2000) 739. 21 Jenkins (1970) 162–170; Gampp (1994) 343–368; Oberli (1999) 21–39.
340
Rudolf Preimesberger
Abb. 5: St. Peter, Rom: Eingangswand.
Kirchenbau und die dahinter leicht erkennbare Grundfrage nach Spiritualität oder Sichtbarkeit, nach einer Religion „im Geist“ oder in sichtbarer Gestalt, nach dem Verhältnis von Gottesdienst und ästhetischer Kultur. „Religiosa … magnificentia“. Das semantische Klima der Inschrift ist defensiv. „Aus der Religion“ und „um der Religion willen“ sei die Magnifizenz der Päpste, wie sie sich an dem gewaltigen prachtvoll ausgestatteten Neubau zeige, motiviert gewesen. Diesseits wie jenseits der konfessionellen Gräben herrscht derselbe Rechtfertigungsdruck! „Exemplum religionis non structurae“ lautet die geradezu beschwörend defensive Fassadeninschrift des Jahres 1613 an der Stadt- und Residenzkirche des lutherischen Reichsgrafen und künftigen Reichsfürsten Ernst zu Holstein-Schaumburg in Bückeburg22, wobei die durch Vergoldung hervorgehobenen Buchstaben als deutschsprachiges, das heißt: breiter adressiertes Anagramm seinen Vornamen Ernst ergeben. Rechtfertigende Worte begleiteten schon den Beginn Neu-Sankt-Peters, als Julius II. am 18. April 1506 in der Baugrube des Südwestpfeilers in einem irdenen Topf zweiundzwanzig Exemplare einer Gründungsmedaille deponierte! Dies vor einer Grund-
22 Habich (1969) 75.
St. Peter in Rom: Medien und Gattungen seit 1506
341
Abb. 6: St. Peter, Rom: Eingangswand, Inschrift Urbans VIII.
steinplatte, in deren Inschrift er, kaiserzeitlichen Vorbildern vergleichbar, als ein restitutor a fundamentis, als „der Wiederhersteller von Grund auf“ der „durch Alter und Vernachlässigung vor Schmutz starrenden aedes des Apostelfürsten“ bezeichnet wird: „Aedem principis apostolorum in Vaticano vetustate ac situ squalentem a fundamentis restitutit Julius ligurius pontifex maximus anno MDVI“23. Die hyperbolisch negative Charakterisierung des Alten weist wohl in die Richtung der rechtlichen Ursprünge des hier verwendeten Hauptbegriffs. Denn restitutio ist das Herstellen alten Rechts nach einem Zustand des Unrechts, ist ursprünglich die durch prätorisches Edikt gewährte Wiedereinsetzung in den vorigen Stand24. Der Zustand der Basilika 23 Satzinger (2004) 107–108; Staubach (2008) 29–40. 24 Klingmüller (1914) 676–685.
342
Rudolf Preimesberger
Abb. 7: Cristoforo Caradosso, Gründungsmedaille Neu-St. Peters, 1506. Berlin, Münzkabinett.
vor 1506 erscheint hier als ein Zustand des Unrechts, ja der Krankheit, wie die – allerdings erst später nachzuweisende – medizinische Verwendung des Begriffs der restitutio ad integrum als Bezeichnung der vollständigen Ausheilung einer Krankheit vermuten ließe. Instauratio ist das zweite rechtfertigende Wort, das den Baubeginn Neu-SanktPeters 1506 begleitet. Es erscheint als Motto auf dem Revers der Gründungsmedaille (Abb. 7) des Caradosso25. Diese zeigt das Modell oder den typus des künftigen Baues. Er erhebt sich – anders als in der Wirklichkeit – über felsigem Untergrund. Die damit verknüpfte Inschrift lautet „Vaticanus m(ons)“. Eine Inversion der Medien ist hier zu konstatieren: Bild und Schrift erscheinen in vertauschten Rollen. Anstelle der sichtbaren Wirklichkeit des vatikanischen Hügels, über dem der Neubau entstehen soll, zeigt das Bild eine Metapher: den Felsen Petri. Die Inschrift hingegen bezeichnet mit den Worten: „Vaticanus m(ons)“ jene Realität, die das Bild nicht zeigt, den vatikanischen Hügel. Das Motto der Medaille, das die Darstellung Neu-St. Peters umfängt, lautet: „Templi Petri instauracio“. Instauratio, in Zusammenhang mit den an der Antike orientier-
25 Thoenes (1994) 110–117; Bredekamp (2000) 35–36; Satzinger (2004) 107–108.
St. Peter in Rom: Medien und Gattungen seit 1506
343
ten städtebaulichen Maßnahmen der Päpste im Rom des Quattrocento mehrfach gebraucht, ist die altrömische Bezeichnung für die Wiederholung eines Rituals oder einer Zeremonie, deren erste Ausführung entweder unterbrochen wurde oder fehlgegangen war, und besagt im weiteren Sinn die Wiederholung oder Erneuerung einer Aktion überhaupt. Im Mittellateinischen tritt zur generellen Bedeutung des „WiederInstand-Setzens“ und „Wiederherstellens“ die des „Heilens“, des „sich Erholens“ und vereinzelt, wie bei Petrarca und Charles de Bovelles, sogar die der endzeitlichen „Auferstehung des Fleisches“26. Deutlich scheint mir der anschauliche Bestand der Medaille mit seiner doppelten Bindung des Wortes „instauracio“ an den Text und an das Bild des künftigen „templum Petri“ für den lesend Schauenden und schauend Lesenden den Begriff in seine altrömische sakralrechtliche Sphäre zurückzubinden. Man kann in der Tat nicht scharf genug betonen, dass „instauracio“ im anschaulichen wie wörtlichen Zusammenhang der Medaille, die ihr innewohnende Bedeutung der Wiederholung eines Rituals oder einer Zeremonie, deren erste Ausführung fehlgegangen war, hervorkehrt. Es geht um die Herstellung eines Gültigen und Endgültigen nach einem zum selben Zweck und am selben Ort unternommenen Missglückten. Wiederum scheint die raison d’ être des Wortes an dieser Stelle nicht zuletzt in der dem Begriff per se inhärenten Negativität der Beurteilung des Vorausgegangenen zu liegen. Der Kuppelpfeiler, in den die Medaillen 1506 versenkt worden waren, ist jener pilone di papa Giulio, der in der Folgezeit als erster hochgeführt wurde (Abb. 8). Seit dem Jahr 1606 ist er ein Reliquienpfeiler. Beim Abbruch des konstantinischen Schiffes und seiner Ersetzung durch das Langhaus des Maderno waren die drei Hauptreliquien Alt St. Peters, das Schweißtuch der Veronika, die Heilige Lanze und das Haupt des Apostels Andreas, heimatlos geworden27. Paul V. hatte sie deshalb in den Neubau übertragen und zunächst in einem, dann in den beiden vorderen Kuppelpfeilern verwahren lassen, Urban VIII. sie, nicht zuletzt aus Gründen der Symmetrie, um eine Reliquie des Heiligen Kreuzes auf vier ergänzt und so zum Ausgangspunkt einer den gesamtem Kuppelraum umspannenden Ausstattungskonzeption gemacht, in der alle vier Pfeiler zu scheinhaften kolossalen Reliquiengehäusen werden sollten: die Reliquien in der Höhe der Pfeiler und in deren Innerem hinter den Loggien verwahrt, von denen aus sie drei Mal im Jahr gezeigt werden sollten, erhöht, jedoch entrückt und verborgen; in den Reliefs der Reliquienloggien in den Händen eschatologischer Engel vor bunt geflammtem Hintergrund zugleich dauernd repräsentiert und einer intensiven Deutung als die künftigen eschatologischen Zeichen am Himmel des Jüngsten Tags unterzogen; zu ihren Füßen kolossale Statuen ihrer historischen oder scheinhistorischen Träger Veronika, Longinus, Helena und Andreas; die vier Reliquienaltäre darunter auf das Niveau der Unterkirche versenkt; deren Altarbilder aber als die
26 Stinger (1985) 156–234; Guidoni (1989), 477–488; Hubert (1988) 203–208; Klodt (1996) 121. 27 Lavin (1968); Preimesberger (1984) 36–55; Lavin (2000) 177–236; Dobler (2008) 301–323.
344
Rudolf Preimesberger
Abb. 8: St. Peter, Rom: Veronika-Pfeiler.
jeweils kommentierende „storia della statua“ für den Nähertretenden durch eine fenestella im Statuensockel sichtbar28. An der Statue des Veronika-Pfeilers ist in der Paradoxie eines laufenden weiblichen Kolosses nicht allein die bekannte legendäre Extension der Passionserzählung
28 Lutz (2000) 298–321; Fumaroli (1978) 797–835; Rietbergen (2006); Schütze (2007); Lavin (1968); Preimesberger (1984) 36–55; Schütze (1994) 213–287; Dombrowski (2003) 340–392; Lavin (2000) 177–236; Lavin (2005) 111–243; Schütze (2005) 117–138; Dobler (2008) 301–323; Preimesberger (2008) 325–335.
St. Peter in Rom: Medien und Gattungen seit 1506
345
verkörpert, da Veronika, die außerbiblische Kunstfigur, mit dem Schweißtuch in Händen schreiend vom Kreuzweg Christi wegläuft, sondern – in der symbolisch verkürzenden Mimesis der Skulptur, die „vieles in einem“ zeigt, – zugleich die Translation der Reliquie von Jerusalem nach Rom. In der Legende geschieht dies schon zu Zeiten des Kaisers Tiberius, der durch sie geheilt wird. Das Schweißtuch ist hier die römische Urreliquie Christi, schon vor Petrus nach Rom übertragen und lange vor Konstantin, seit Linus, dem ersten Nachfolger Petri, bereits am Vatikan29. Das ästhetische Konzept der Ausstattung des Kuppelraums ist das der monarchischen Magnifizenz. Es geht um die gehäufte Verbindung der Gattungen und Medien zu der einen großartigen Wirkung; es geht um eine Stil-Höhe, angemessen der „Majestät des Ortes“. Dies ist wörtlich, nämlich im Medium monumentaler Epigraphik, ausgedrückt. Denn just die beiden Worte „loci maiestas“ hat Urban VIII. dem Kuppelraum deutlich sichtbar in der Stiftungsinschrift des Hauptpfeilers hinzugefügt: „Auf dass die Majestät des Ortes das Bild des Erlösers, dem Schweißtuch der Veronika eingeprägt, angemessen verwahre, hat Urban VIII., Pontifex Maximus, den Verwahrungsort errichtet und geschmückt im Jubeljahr 1625“. – „Salvatoris imaginem Veronicae sudario exceptam ut loci maiestas decenter custodiret Urbanus VIII. pont. max. conditorium extruxit et ornavit anno iubilaei MDCXXV“30. „Loci maiestas“. Durch seine Bindung an den Ort Neu-Sankt-Peter vermittelt der Begriff maiestas zwischen seiner religiösen, seiner politischer und seiner ästhetischen Bedeutung: Die Majestät des Ortes, an dem Petrus begraben ist, die religiöse, die Majestät des Ortes, an dem der Papst als oberster Liturge, Richter und Monarch der Gesamtkirche erscheint, die politische, die Majestät des Ortes unter der Kuppel des Michelangelo in ihrer schieren Größe und Vollendung, die ästhetische Bedeutung! „Ut decenter custodiret …“ heißt: „angemessen“, „geziemend“, „passend“ zur Majestät des Ortes. Maiestas erscheint hier als die Norm dessen, was im Kuppelraum künstlerisch zu geschehen hatte. Kolossale Skulpturen und Reliefs, die durch die Buntheit ihrer marmornen Hintergründe die Gattung Malerei in sich integrieren, erscheinen an den vier Pfeilern übereinander. Doch ist es kein Aszensus der Kunstgattungen allein, sondern einer der Medien. Jede der vier Pfeilerdekorationen ist von einem Spruchband mit einem Motto bekrönt. Es sind kolossale Bild-Wort-Verbindungen, die den Kuppelraum umstellen. Das Motto des Veronika-Pfeilers (Abb. 9) „Vultum tuum deprecabuntur“ ist in einer ersten Lesung als ein vaticinium ex eventu zu verstehen, das die gegenwärtige Verehrung des Schweißtuchs Christi in Sankt Peter bezeichnet. Doch ist es zugleich unverkennbar eschatologisch konnotiert. Denn zusammen mit dem Bild des Angesichts Christi in den Händen des Engels vor dem geflammten Himmel des Jüngsten Tags weisen die Worte auf einen der bekanntesten Gemeinplätze der christlichen
29 Preimesberger (1993) 473–481. 30 Forcella (1875) Nr. 542; Preimesberger (1984) 36–55.
346
Rudolf Preimesberger
Abb. 9: St. Peter, Rom: Reliquienloggia des Veronika-Pfeilers.
Eschatologie hin, das paulinische Wort von der endzeitlichen Schau nicht mehr „in Spiegel und Gleichnis“, sondern „von Angesicht zu Angesicht“, das Ende jedweden Bildes beim Erscheinen der Wahrheit. Universale Eschatologie ist hier ausgedrückt31. Vergleichbares begegnet an dem Helena-Pfeiler (Abb. 10). Doch ist dem im Relief der Reliquienloggia gleichfalls endzeitlich erscheinenden Kreuz das der Geschichte Konstantins entstammende Motto „In hoc vinces“ verknüpft. Es engt die eschatologische Aussage ein. Denn so wie die Statue Helenas am Fuß des Pfeilers sich dem Besu-
31 Preimesberger (1993) 473–481; Spagnolo (2000) 770–772.
St. Peter in Rom: Medien und Gattungen seit 1506
Abb. 10: St. Peter, Rom: Reliquienloggia des Helena-Pfeilers.
347
348
Rudolf Preimesberger
cher als Einzelnem sprechend zuwendet und ihm das Kreuz und die Nägel der Passion zeigt, so wendet sich das Motto in der Höhe des Pfeilers mit dem leicht verständlichen Gemeinplatz, er werde „in diesem“, das heißt: im Kreuz „siegen“, das heißt: das ewige Leben erlangen, an den einzelnen Lesenden. „Du wirst siegen“! Individuelle Eschatologie ist hier gemeint, das sogenannte ‚individuelle‘ oder ‚Sondergericht‘, das im altkirchlichen Verständnis jeden einzelnen Menschen unmittelbar nach seinem Tode erwartet. Die Situation, die zur Entstehung des Bronzeziborums Urbans VIII., der rituell geforderten Überdachung des Apostelaltars über der exzentrisch gelegenen Bedeutungsmitte des Kuppelraums, geführt hat, ist oft geschildert worden. Sie konvergiert einem letzten Thema, das noch skizzenhaft berührt sei: dem der Spiralsäulen und ihrer Deutung. Acht von ihnen umstehen, als Architekturreliquien Alt-St. Peters in die Höhe der Reliquiennischen der vier Kuppelpfeiler entrückt, das Ziborium. Sechs Säulen hatte Konstantin gestiftet, Spolien von besonderer Kostbarkeit aufgrund der virtuosen Bearbeitung, als Monolithe die größten ihrer Art, Weinrankensäulen und durch den Umstand, dass sie gewunden sind, von besonderer Seltenheit. Sie sind vielleicht in das frühe dritte Jahrhundert zu datieren. Die Frage ihrer Herkunft – Byzanz, Kleinasien, Ephesus – wird kontrovers beurteilt. Sie waren der Hauptbestandteil der Petrus-Memorie Konstantins gewesen. Gregor der Große hatte diese verändert, das Podium, die Pallien-Nische, Treppen und die Ringstollenkrypta hinzugefügt. Seit der Mitte des achten Jahrhunderts standen davor in doppelter Reihe zwölf Säulen. Gregor III. (731–741) hatte die konstantinische Serie um sechs sehr ähnlich geformte, die er vom Exarchen Eutychius von Ravenna erhalten hatte, ergänzt32. Der Apsis-Bezirk der Basilika Konstantins mit dem von Julius II. für unverrückbar erklärten Petrusgrab als Zentrum ist bekanntlich Angelpunkt und Problem der Planung Neu-St. Peters in einem gewesen. Da er inmitten des gewaltigen Erneuerungswerkes liturgisch weiter genutzt werden musste, hatte Bramante über ihm das Schutzhaus oder tegurium zu errichten, das bis 1592 inmitten des langsam emporwachsenden Kuppelraums aufrecht stehen sollte, darin der auf vier Exemplare geschrumpfte Rest der Serie der Schraubensäulen. Zwei hauptsächliche Deutungstraditionen verknüpften sich ihnen: die salomonische und die apollinische. Jerusalem oder Troja? Beide Deutungen sind erfolgreich gewesen. Die erstgenannte, die in offenem Widerspruch zur Autorität des Liber Pontificalis steht, ist die historisch jüngere. Die Legende einer Herkunft der Säulen aus dem salomonischen Tempel ist hochmittelalterlich. Ihre ausführlichste Version berichtet von einer Übertragung durch Titus und Vespasian in das römische Templum Pacis, von wo Konstantin sie nach Sankt Peter übertragen habe. Ihr konvergiert die Legende der Colonna Santa oder degli spiritati, an die Christus im
32 Duchesne (1886) 176, 417; Cerrati (1914) 53–57; Ward-Perkins (1952) 21–33; Lavin (1968) 15; Wegner (1976–77) 49–64; Brenk (1987) 103–109; Kinney (1995) 53–62; Rice (1997) 125, 213, 215; Spagnolo (2000) 787–794; Müller (2003) 196–197; Kinney (2005) 16–47.
St. Peter in Rom: Medien und Gattungen seit 1506
349
Tempel sich angelehnt habe. 1382 wird sie erstmals als wundertätig gegen die Epilepsie bezeichnet. Veduten des sechzehnten Jahrhunderts zeigen sie, von einem Gitter umgeben, inmitten der chaotischen Baustelle unter offenem Himmel33. Für die Ideenbildung und den Gang der Planungen Urbans VIII., die in einem Projekt Giacomo Vignolas, in dem sie in Gestalt einer Kreiskolonnade den Hochaltar umstehen sollten, ihren Vorläufer haben34, war die kontinuierliche Präsenz der Architekturreliquien Alt-St. Peters und seiner konstantinischen Anfänge im Kuppelraum fundamental. An der moles des Ziboriums sind sie, vierfach in vergoldeter Bronze wiederholt, ins Kolossale gesteigert, andere und doch dieselben! Die Enthüllung des Ziboriums erfolgte am 29. Juni 1633, dem Fest Peter und Paul35. Die zeitgenössische Rezeption begegnet ihm mit den Begriffen des Majestätischen, Erhabenen und Großartigen, das durch immense Größe, Pracht und Kostbarkeit des Materials überwältigt, nicht minder aber durch seine überraschende, bizarre Struktur. Selbst in der negativen Charakterisierung als „Chimäre“ spiegelt sich der Eindruck der Verbindung disparater Elemente zum noch nicht da gewesenen Neuen. Erst in einem zweiten Schritt dürfte dem Betrachter von 1633 der Blick auf die antiken Schraubensäulen, die, zum Vergleich herausfordernd, den Kuppelraum in der Höhe der Reliquien-Loggien der vier Pfeiler achtfach umstehen, das einfache Argument: das Alte im Neuen aufgehoben, Kontinuität zwischen Ur-Bau und Neu-Bau, zwischen Konstantin und der Gegenwart Papst Urbans VIII., nahegebracht haben. Dazu ein Anderes: der so deutlich angeregte Vergleich zwischen den riesenhaften Bronzesäulen des regierenden Papstes in der Mitte und den nur mittelgroßen antiken Marmorsäulen an den Grenzen des Kuppelraums legte nicht allein Kontinuität bloß, sondern zugleich Wettstreit, etwa in der simplen Überbietungsformel: „Was einst Konstantin tat, tut in größerer prachtvollerer Form der Nachfolger Urban VIII.“ Der Papst nicht der Erbe Petri allein, sondern auch der Erbe Konstantins, die längst verblasste Erinnerung an den Papst als den eigentlichen Kaiser des Westens36, dies sind wohl die Gemeinplätze, die sich selbst im Jahr 1633 noch einstellen konnten oder sollten. Ist das alles? Der salomonischen Deutung der Säulen steht eine apollinisch-trojanische gegenüber. Im Gegensatz zu dieser ist sie die providentiell deutende Fortschreibung der historischen Nachricht des Liber Pontificalis, Konstantin habe die Säulen aus Griechenland nach St. Peter übertragen. Petrus Mallius, Kleriker der Basilika im zwölften Jahrhundert, ist ihr erster Zeuge. Er gibt sie in seiner im Pontifi-
33 Cerrati (1914) 53–57; Kinney (2005) 35. 34 Siebenhüner (1962) 291; Blauuw (2008) 227–241. 35 Thelen (1967a); Lavin (1968); Kirwin (1977); Kirwin (1981) 141–171; Schütze (1994) 219–256; Kirwin (1997); Lavin (2005) 116–130; Schütze (2005) 117–138; Lavin (2008) 275–300; Preimesberger (2008) 325–335; Rice (2008) 337–352. 36 Fuhrmann (1968); Fuhrmann (1973) 354–407; Schramm (1970a) 57–106; Baar (1956); Schramm (1970b) 180–191; Goez (1958) 62–76, 137–188; Schramm (1984); Thomas (1999) 944–946; Fuhrmann (1999) 1385–1387.
350
Rudolf Preimesberger
kat Alexanders III. (1159–1181) verfassten Descriptio Basilicae Vaticanae wieder. Die Worte des Liber Pontificalis über die Herkunft der konstantinischen Serie: „… et alias columnas vitineas quas de Grecias perduxit …“ bezieht er fälschlich auf alle zwölf Säulen: „Duodecim columnas vitineas quas de Grecia portari fecit …“. Dann die Fortschreibung in die Vergangenheit: „… quae fuerunt de Templo Apollinis Troiae“37. Alle zwölf ursprünglich aus dem Tempel des Apoll in Troja! Wie immer man das Alter und die Herkunft dieser Ursprungserzählung einschätzen mag, evident ist ihr Zusammenhang mit der papalen Variante des christlichen Romgedankens. Imperium und Papsttum, Imperium und Epos sind hier angesprochen. Voraussetzung ist – in welcher Vermittlung immer – die Ursprungserzählung des Imperium Romanum in Vergils Aeneis. Was hier im christlich-providentiellen Verständnishorizont begegnet, dürfte der bekannte anagogische Sinn des Vergilschen Epos als einer Präfiguration des gottgelenkten Schicksals der Kirche und des Papsttums sein. Göttliche Providenz – Troja – Rom – Kirche, Aeneas – Petrus – Papsttum, mit diesen Begriffen dürfte jenes „Geflecht an Semiosen“ zumindest angedeutet sein, das sich – bei Petrus Mallius erstmals erkennbar – den Schraubensäulen spätestens im 12. Jahrhundert offenbar verband. Das römische Reich und seine Rolle im Heilsplan, die pax romana Vorbereiterin des Christentums, Rom das Ziel einer von Urzeiten her göttlich gelenkten Geschichte, das augusteische Rom darin nicht Ziel, sondern nur vorbereitende Macht im größeren Zusammenhang, ist wohl der eine topische Bereich, dem die Deutung der Säulen entstammt; die Flucht und die gefahrvolle Fahrt in das latinische Land, die Geschichte der Übertragung der Herrschaft von Troja nach Rom, jener Herrschaft, die dem älteren Stamm des Priamos genommen und auf den jüngeren übertragen wird, um in Rom in Imperium und Kirche ohne Grenzen und Ende wieder zu erblühen, der andere; Aeneas, dem bei seinem Abstieg in die Unterwelt die Offenbarung künftiger Weltherrschaft zuteilwird, deshalb zum Vater des Imperiums und deshalb zum Ahnherrn für Kirche und Papsttum ausersehen, der dritte38. Dass seine Flucht aus Troja, und mit ihr die Geschichte der Übertragung des Imperiums nach Rom, just von einem Tempel des Apoll ihren Ausgang nimmt, dürfte dabei für die providentielle Deutung der Schraubensäulen von großer, wenn nicht entscheidender Bedeutung gewesen sein. Sicher ist, dass die trojanische neben der Jerusalem-Tradition Bestand hatte. Denn unter radikal veränderten historischen Bedingungen der Rezeption, gekennzeichnet durch die Erfahrung einer Vielzahl dynastischer, städtischer und anderer Adaptierungen des Troja-Mythos in Mittelalter und früher Neuzeit, unter den radikal veränderten Bedingungen der Vergil-Rezeption unter der neu gestellten Frage nach
37 Petrus (1946) 384; Cerrati (1914) 54, 56; Ward-Perkins (1952) 21–33; Kinney (2006) 35; Schroeter (1980) 208–240; Schütze (1994) 245. 38 Cobet u. Patzek (2003) 594–615; Pistorius (2003) 615–624; Preimesberger (1976) 221–287; Preimesberger (1977) 315–325; Schroeter (1980) 208–240; Schütze (1994) 240–246; Stierle (1996) 55–67; Mehl u. Lavagnini (1997) 1034–1041; Contamine (1997) 1041; Dizdar (2006) 27–38.
St. Peter in Rom: Medien und Gattungen seit 1506
351
dem Dichterpropheten, nach dem Verhältnis von Dichtung und Geschichte im Cinquecento, mit der Erfahrung des säkularen Erfolgs von Tassos historischem Epos „La Gerusalemme liberata“ – im Gegensatz zu dem lügenhaften Ariost, – mit seinen eigenen Versuchen der Konstruktion einer antimarinistischen Poesia sacra im Rükken, hat kein Anderer und kein Geringerer als Kardinal Maffeo Barberini, seit 1623 Papst Urban VIII. und auctor der spektakulären Ausstattung des Kuppelraums von St. Peter mit dem Bronzeziborium in seiner Mitte, in einem Gedicht mit dem gattungstheoretisch aufschlussreichen und gleichsam das Problem benennenden Namen „Elegeia historike“ unter dem Titel „Religionis orthodoxae primordia per apostolorum principes Petrum et Paulum constituta“ die providentielle ekklesiologische Dimension des Vergilschen Epos explizit benannt. Angesichts der Peterskirche, deren durch Paul V. errichtete Fassade er scharf kritisierte und deren Inneres er alsbald verändern sollte, preist er das wunderbare Wachsen des Imperiums, das zum Sitz Petri erkoren war. Jupiter, der sich vom älteren Stamm des Priamos abwendet, der dem Aeneas „… et nati natorum, et qui nascentur ab illis …“ die Herrschaft gibt, ist nichts anderes, als ein Bild der Übertragung der Kirche aus dem Osten nach Rom. Denn während „… nati natorum …“ die Kirche bedeute, sei Aeneas die Präfiguration des Papstes, wörtlich: „Per Aeneam praesignatus fuit pontifex romanus“39. Dass dies, dass der Troja-Mythos in Gestalt einer episch überhöhten eigentlichen Vergangenheit, als Hintergrund in dem Ziborium Urbans VIII. präsent sei, wäre zu wenig gesagt. Gerade durch ihren so deutlich gemachten Ähnlichkeitsbezug zu ihren konstantinischen Vorgängern sind die vier kolossalen Bronzesäulen explizit sprechend gemacht. Nicht wie diese mit Weinlaub, sondern von Lorbeer umwunden, sind sie apollinische columnae laureatae. Ihre Gestalt scheint auf ihre eigentliche, nämlich providentielle Bedeutung zurückgeführt. Sie sind so, wie sie eigentlich sein sollten. Persönlich sprechend sind sie insofern, als sie Träger der beiden persönlichen Hauptimpresen Urbans VIII. und seines Pontifikats sind: Der apollinischen Sonnenimprese „Aliusque et idem“ aus Horaz, die sich im neuen Kontext einer domus des Petrus über seinem Grab aus einer persönlichen Imprese des stiftenden Papstes in eine Imprese des Papsttums verwandelt: „Ein anderer und doch derselbe“. Vor allem aber gilt dies von der Lieblingsimprese Urbans VIII., deren Bild- und Wortbestandteil beide der Aeneis entstammen, sowohl das Bild der Bienen am Lorbeerbaum als auch das Motto: „Hic domus“. Das Bild ist nichts anderes als die sichtbare Erfüllung eines vaticinium des Apoll, da im Hof des Königs Latinus die Bienen am Lorbeerbaum die Ankunft des „Fremden“ ankündigen, der in Latium Haus, Heimat und Imperium gewinnen wird, das Wort aber jenes, das Aeneas ausspricht, als er nach langer Fahrt an der Küste Latiums endlich den Sinn des Orakels des Apoll und in ihm die neue Heimat erkennt: „Hic domus, haec patria est“40. Wer die Hauptimprese des Pontifikats kennt, für den
39 Barberini (1643) 65–69, 70–93; Kauffmann (1970) 37; Preimesberger (1976) 221–287. 40 Schütze (1994) 246–251.
352
Rudolf Preimesberger
ist die apollinische Gestalt der vier Säulen deshalb sprechend: „Hic domus“ – „Hier ist das Haus des Petrus, der aus der Fremde kam, um in Latium das Imperium ohne Ende zu gewinnen“. Die Säulen stehen am richtigen Ort. Denn dass Petrus bei dem Tempel des vatikanischen Apoll bestattet worden sei, dass Konstantin die Basilika „ante templum Apollinis in Vaticano“ errichtet habe, galt als gesicherte Wahrheit ebenso wie das fünfundzwanzigjährige apostolische Wirken des ersten Papstes am Vatikan. Hier habe er gepredigt und getauft, hier an der künftigen Stelle der Basilika bereits ein Oratorium errichtet. Hier habe der erste römische Bischofsstuhl gestanden. Hierher seien die ersten Christen zusammengeströmt, um Petrus zu hören41. In seiner „Elegeia historike“ hat Maffeo Barberini den geschichts-theologischen Topos des Prudenz von der Ablösung der antiken Welt durch das Christentum im Bild der verödenden Tempel auf den Vatikan übertragen. An die Stelle des vatikanischen Apoll sei der vatikanische Petrus getreten und – in einer lectio audacior des päpstlichen Lehramtes und der künftigen Infallibilität – an die Stelle des Orakels des Apoll das Orakel des Heiligen Stuhls: „Gliscit fama Petri, vilescit Apollinis aedes / Et minor augurio vatis habetur honor“42.
Literaturverzeichnis Apollonj-Ghetti u.a. (1951): Bruno Maria Apollonj-Ghetti, Antonio Ferrua, Enrico Josi u. Engelbert Kirschbaum, Esplorazioni sotto la Confessione di S. Pietro in Vaticano eseguite negli anni 1940/1949, Vatikanstaat (Città del Vaticano). Arbeiter (1988): Achim Arbeiter, Alt-St. Peter in Geschichte und Wissenschaft, Berlin. van den Baar (1956): Piet A. van den Baar, Die kirchliche Lehre der Translatio Imperii Romani bis zur Mitte des 13. Jahrhundert, Analecta Gregoriana 77, Rom. Bäumer (1962): Remigius Bäumer, „Die Auseinandersetzungen über die römische Petrustradition in den ersten Jahrzehnten der Reformationszeit“, Römische Quartalschrift für Christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte 57, Festschrift für Engelbert Kirschbaum, 1. Teil, 20–57. Barberini (1643): Maffeo Barberini, „Religionis orthodoxae primordia per apostolorum principes Petrum et Paulum constituta“, in: Maphaei S. R. E. Card. Barberini nunc Urbani PP. VIII Poemata Henricus Dormalius explicabat, Rom (Ex Typographia Ludovici Gragignani), 65–69, 70–93. Barock im Vatikan (2005): Barock im Vatikan. Kunst und Kultur im Rom der Päpste II. 1572–1676, (Katalog zur Ausstellung der Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, Bonn, 25. November 2005–19. März 2006 u. des Martin-Gropius-Baues, Berlin, 11. April – 10. Juli 2006), Bonn/Leipzig. Bauer (2000): George C. Bauer, „Berninis „Pasce oves meas“ and the entrance wall of St. Peters“, Zeitschrift für Kunstgeschichte 63, 15–25.
41 Bellarmin (1871) 538–545; Schroeter (1980) 208–240; Preimesberger (1976) 221–287; Schütze (1994) 240–246; Roser (2008) 257–273. 42 Barberini (1643) 69.
St. Peter in Rom: Medien und Gattungen seit 1506
353
Bellarmin (1871): Robert Bellarmin, „Controversiae“, in: Justin Fèvre (Hg.), Roberti Bellarmini opera omnia 3, Paris. Bellini (2008): Federico Bellini, La cupola di San Pietro da Michelangelo a Della Porta, in: Satzinger u. Schütze (2008) 175–194. Blauuw (2008): Sible de Blauuw, „Unum et idem: Der Hochaltar von St. Peter im 16. Jahrhundert“, in: Satzinger u. Schütze (2008) 227–241. Böcher (1996): Otto Böcher, „Petrus I“, in: Theologische Realenzyklopädie 26, Berlin/New York, 263–273. Bonanni (1696): Filippo Bonanni, Numismata Summorum Pontificum Templi Vaticani fabrica indicantia, Rom. Borgolte (1989): Michael Borgolte, Petrusnachfolge und Kaiserimitatio. Die Grablegen der Päpste, ihre Genese und Traditionsbildung, Göttingen. Bredekamp (2000): Horst Bredekamp, Sankt Peter in Rom und das Prinzip der produktiven Zerstörung. Bau und Abbau von Bramante bis Bernini, Berlin. Brenk (1987): Beat Brenk, „Spolia from Constantine to Charlemagne. Aesthetics versus Ideology,“ Dumbarton Oaks Papers 41, 103–109. Celentano (2003): Maria S. Celentano, „Paradoxon“, in: Gert Ueding (Hg.), Historisches Wörterbuch der Rhetorik 6, Darmstadt, 524–526. Cerrati (1914): Michele Cerrati (Hg.), Tiberii Alpharani de Basilicae Vaticanae antiquissima et nova structura, Documenti e ricerche per la storia dell’antica basilica Vaticana, Studi e testi 26, Rom. Cobet u. Patzek (2003): Justus Cobet u. Barbara Patzek, „Troja I. Allgemein“, Der Neue Pauly 15/3, Stuttgart/Weimar, 594–615. Contamine (1997): Philippe Contamine, „Trojanerabstammung“, in: Norbert Angermann (Hg.), Lexikon des Mittelalters 8, 1041. Lapide (1732): Cornelius a Lapide, Commentaria in Quatuor Evangelia, Bd. 1, Antwerpen. Cullman (1960): Oscar Cullman, Petrus. Jünger. Apostel. Märtyrer. Das historische und das theologische Petrusproblem, Zürich/Stuttgart. De Rossi (1645): Filippo De Rossi, Ritratto di Roma moderna, Rom. DiFederico (1983): Frank DiFederico, The Mosaics of Saint Peter’s: Decorating the New Basilica, University Park, London. Dizdar (2006): Dilek Dizdar, Translation. Um- und Irrwege, Berlin. Dobler (2008): Ralph-Miklas Dobler, „Die Vierungspfeiler von Neu-Sankt-Peter und ihre Reliquien“, in: Satzinger u. Schütze (2008) 301–323. Dombrowski (2003): Damian Dombrowski, „Von der ‚Ecclesia triumphans‘ zur ‚Ecclesia universalis‘: Zum gedanklichen Wandel in Berninis Ausstattung von St. Peter“, Zeitschrift für Kunstgeschichte 66, 340–392. Duchesne (1886–1892): Louis Duchesne (Hg.), Le Liber Pontificalis. Texte, introduction e commentaire, 2 Bd., Paris. Fink (1988): Josef Fink, Das Petrusgrab in Rom, Innsbruck. Fiore (2010): Camilla Fiore, Marcello Provenzale e l’ arte del mosaico, Cento. Forcella (1875): Vincenzo Forcella, Iscrizioni delle chiese e d’altri edificii di Roma dal secolo XI fino ai giorni nostri 6, Rom. Francia (1977): Ennio Francia, 1506–1606. Storia della Costruzione del nuovo San Pietro, Rom. Francia (1989): Ennio Francia, Storia della Costruzione del nuovo S.Pietro, Da Michelangelo a Bernini, Rom. Fröhlich (1996): Karlfried Fröhlich, „Petrus II“, in: Theologische Realenzyklopädie 26, Berlin/ New York, 273–278. Frommel (1976): Christoph Luitpold Frommel, „Die Peterskirche unter Papst Julius II. im Licht neuer Dokumente“, Römisches Jahrbuch für Kunstgeschichte 16, 57–136.
354
Rudolf Preimesberger
Frommel (1977): Christoph Luitpold Frommel, „Cappella Julia. Die Grabkapelle Julius’ II. in Neu-St. Peter“, Zeitschrift für Kunstgeschichte 40, 26–62. Fuhrmann (1968): Horst Fuhrmann (Hg.), Das Constitutum Constantini (Konstantinische Schenkung). Text, (Fontes Juris Germanici Antiqui, in usum scholarum, ex monumentis Germaniae historicis, separatim editi 10), Hannover. Fuhrmann (1973): Horst Fuhrmann, „Constitutum Constantini und pseudoisidorische Dekretalen. Der Weg der Konstantinischen Schenkung zu ihrer Wirksamkeit“, in: Horst Fuhrmann, Einfluss und Verbreitung der pseudoisidorischen Fälschungen. Von ihrem Auftauchen bis in die neuere Zeit 2, Stuttgart, 354–407. Fuhrmann (1999): Horst Fuhrmann, „Konstantische Schenkung“, in: Norbert Angermann (Hg.), Lexikon des Mittelalters 5, München, 1385–1387. Fumaroli (1978): Marc Fumaroli, „Cicero Pontifex Romanus. La tradition rhétorique du collège Romain et les principes inspirateurs du mécénat des Barberini“, Mélanges de l’ École Française de Rome (Moyen Age-Temps Modernes) 90, 797–835. Gampp (1994): Axel Gampp, „Magnificentia Barberiniana. Santa Rosalia in Palestrina. Die Grablege der Barberini und das ästhetische Konzept der ‚Magnificentia‘“, Römisches Jahrbuch der Bibliotheca Hertziana 29, 343–368. Gani (2000): Michela Gani, „The counter-facade“, in: Pinelli (2000), Text. Notes, 739–740. Gatz (2010): Erwin Gatz, „Tagungsverlauf“ (III. Römische Tagung zur frühen Kirche: Petrus in Rom, 13.–16. Februar 2010), in: Jahres-und Tagungsbericht der Görres-Gesellschaft, 186–188. Giovio (1555): Paolo Giovio, Dialogo dell’ imprese militari et amorose (hg. v. Maria Luisa Doglio, Rom 1978), Rom. Gnilka (2002): Joachim Gnilka, Petrus und Rom. Das Petrusbild in den ersten zwei Jahrhunderten, Freiburg im Breisgau. Gnilka, Heid u. Riesner (2010): Christian Gnilka, Stefan Heid u. Rainer Riesner, Tod und Grab des Petrus in Rom, Regensburg. Goez (1958): Werner Goez, Translatio Imperii. Ein Beitrag zur Geschichte des Geschichtsdenkens und der politischen Theorien im Mittelalter und der frühen Neuzeit, Tübingen. Grech (2000): Prosper Grech, „Pietro, Santo“, in: Massimo Bray (Hg.), Enciclopedia dei Papi 1, Rom, 175–194. Guarducci (1988): Margherita Guarducci, La tomba di San Pietro. Una straordinaria vicenda, Mailand. Guidoni (1989): Enrico Guidoni, „Antico e moderno nella cultura urbanistica romana del primo Rinascimento“, in: Silvia Danesi-Squarzina (Hg.), Roma, centro ideale della cultura dell’ Antico nei secoli XV e XVI: da Martino V. al sacco di Roma 1417–1527 (Convegno internazionale di studi su Umanesimo e Rinascimento, Rom 25.–30. November 1985), Mailand, 477–488. Habich (1969): Johannes Habich, Die künstlerische Gestaltung der Residenz Bückeburg durch Fürst Ernst 1601–1622, Bückeburg. Hubert (1988): Hans Hubert, „Bramantes St. Peter-Entwürfe und die Stellung des Apostelgrabes“, Zeitschrift für Kunstgeschichte 51, 195–221. Jenkins (1970): A. D. Fraser Jenkins, „Cosimo de’Medici’s Patronage of Architecture and the Theory of Magnificence“, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 33, 162–170. Kajanto (1982): Iiro Kajanto, Papal Epigraphy in Renaissance Rome, Helsinki. Kauffmann (1970): Hans Kauffmann, Giovanni Lorenzo Bernini. Die figürlichen Kompositionen, Berlin. Kinney (1995): Dale Kinney, „Rape or Restitutio of the Past? Interpreting Spolia“, in: Susan Scott (Hg.), The Art of Interpreting, University Park Pennsylvania 1995, 53–62. Kinney (2005): Dale Kinney, „Spolia“, in: Tronzo (2005) 16–47. Kirwin (1997): William Chandler Kirwin, Powers Matchless. The Pontificate of Urban VIII, the Baldachin, and Gianlorenzo Bernini, New York.
St. Peter in Rom: Medien und Gattungen seit 1506
355
Klein (1957): Robert Klein, „La théorie de l’ expression figurée dans les traités italiens sur les ‚Imprese‘, 1555–1612“, in: Bibliothèque d’Humanisme et renaissance 19, 320–341. Klingmüller (1914): F. Klingmüller, „Restitutio“, in: Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaften (Neue Bearbeitung, begonnen von Georg Wissowa, Zweite Reihe, Erster Halbband), Stuttgart, 676–685. Klodt (1992): Olaf Klodt, Templi Petri Instauracio. Die Neubauentwürfe für St.Peter in Rom unter Papst Julius II.und Bramante (1505–1513), Ammersbek bei Hamburg. Krauss u. Thoenes (1991/92): Franz Krauss u. Christof Thoenes, „Bramantes Entwurf für die Kuppel von St. Peter“, Römisches Jahrbuch der Bibliotheca Hertziana 27/28, 183–199. Kummer (2008): Stefan Kummer, „Zur Bildausstattung in St. Peter um 1600“, in: Satzinger u. Schütze (2008) 243–256. Lampe (1979): Peter Lampe, „Das Spiel mit dem Petrusnamen – Matt. XVI.18“, New Testament Studies 25, 227–245. Lavin (1968): Irving Lavin, Bernini and the Crossing of Saint Peter’s, New York. Lavin (2000): Irving Lavin, „Bernini at St Peter’s“, in: Pinelli (2000), Text. Essays, Essays, 177–236. Lavin (2005): Irving Lavin, „Bernini at St. Peter’s. Singularis in Singulis, in Omnibus unicus“, in: Tronzo (2005) 111–243. Lavin (2008): Irving Lavin, „The Baldacchino. Borromini vs. Bernini. Did Boromini forget himself?“, in: Satzinger u. Schütze (2008) 275–300. Lutz (2000): Georg Lutz, s. v. „Urbano VIII.“, in: Massimo Bray (Hg.), Enciclopedia dei Papi 3, Rom, 298–321. Mehl-Lavagnini (1997): Dieter Mehl u. Renata Lavagnini, „Trojadichtung“, in: Lexikon des Mittelalters 8, München, 1034–1041. Millon (2005): Henry A. Millon, „Michelangelo to Marchionni“, in: Tronzo (2005) 93–110. Mosley (1964): James Mosley, „Trajan Revived“, Alphabet 1, 17–36. Müller (2003): Rebecca Müller, „Spolien“, in: Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike. Rezeptionsund Wissenschaftsgeschichte 15/3, Stuttgart/Weimar, 195–208. Neumeyer (2003): Martina Neumeyer, „Paradoxe, das“, in: Gert Ueding (Hg.), Historisches Wörterbuch der Rhetorik 6, Darmstadt, 516–524 Niebaum (2008): Jens Niebaum, „Zur Planungs-und Baugeschichte der Peterskirche zwischen 1506 und 1513“, in: Satzinger u. Schütze (2008) 49–82. Nielen u. Jungmann (1959): Josef Maria Nielen u. Josef Andreas Jungmann, „Doxologie“, in: Lexikon für Theologie und Kirche 3, Freiburg im Breisgau, 534–536. Orbaan (1917): Johannes A. F. Orbaan, „Zur Baugeschichte der Peterskuppel“, Jahrbuch der Preußischen Kunstsammlungen 38, Beiheft, 189–207. Orbaan (1919): Johannes A. F. Orbaan, „Der Abbruch Alt-Sankt Peters 1605–1615“, Jahrbuch der Preußischen Kunstsammlungen 39, Beiheft, 1–119. Oberli (1999): Matthias Oberli, Magnificentia Principis. Das Mäzenatentum des Prinzen und Kardinals Maurizio von Savoyen (1593–1657), Weimar. Ostrow (2000a): Steven F. Ostrow, „The architectural decoration“, in: Pinelli (2000), Text. Essays, Essays, 241–251. Ostrow (2000b): Steven F. Ostrow, „Cupola. Tambour. Spandrels“, in: Pinelli (2000), Text. Notes, Notes, 795–796. Pesch (1980): Rudolf Pesch, Simon-Petrus. Geschichte und geschichtliche Bedeutung des ersten Jüngers Christi, Stuttgart. Petrucci (1986): Amando Petrucci, La scrittura. Ideologia e rappresentazione, Turin 1986. Petrus (1946): Petrus Mallius, „Descriptio basilicae Vaticanae aucta atque emendata a Romano presbitero“, in: Roberto Valentini u. Giuseppe Zucchetti (Hgg.), Codice topografico della città di Roma 3, Rom, 375–442.
356
Rudolf Preimesberger
Pinelli (2000): Antonio Pinelli (Hg.), The Basilica of St Peter in the Vatican. La basilica di San Pietro in Vaticano, Bde. 1–4, Modena. Pistorius (2003): Kristin Pistorius, Art. „Troja II. Trojaner-Geschichte als Gründungsmythos“, in: Der Neue Pauly 15/3, Stuttgart/Weimar, 615–624. Preimesberger (1976): Rudolf Preimesberger, „Pontifex Romanus per Aeneam praesignatus. Die Galleria Pamphilj und ihre Fresken“, in: Römisches Jahrbuch für Kunstgeschichte 16, 221–287. Preimesberger (1977): Rudolf Preimesberger, „Pignus imperii. Ein Beitrag zu Berninis AeneasGruppe“, in: Friedrich Piel u. Jörg Traeger, Festschrift Wolfgang Braunfels, Tübingen, 315–325. Preimesberger (1984): Rudolf Preimesberger, „Die Ausstattung der Kuppelpfeiler von St. Peter, Rom, unter Papst Urban VIII.“, in: Jahres- und Tagungsbericht der Görres-Gesellschaft 1983, 36–55. Preimesberger (1993): Rudolf Preimesberger, „Skulpturale Mimesis: Zu Mochis Heiliger Veronika“, in: Thomas Gaehtgens (Hg.), Artistic Exchange. (Acts of the XXVIIIth International Congress of the History of Art, Berlin, 15.–20. Juli 1992), Berlin, 473–481. Preimesberger (2001): Rudolf Preimesberger, „Il San Longino del Bernini in San Pietro in Vaticano: dal bozzetto alla statua“, in: Maria Grazia Bernardini (Hg.), Bernini a Montecitorio (Ciclo di conferenze nel quarto centenario della nascita di Gian Lorenzo Bernini in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Roma, Oktober – Dezember 1999), Rom, 95–111. Preimesberger (2008): Rudolf Preimesberger, „Ein ehernes Zeitalter in St. Peter?“, in: Satzinger u. Schütze (2008) 325–335. Rice (1997): Louise Rice, Altars and Altarpieces of New St. Peter’s. Outfitting the Basilica, 1621–1666, Cambridge. Rietbergen (2006): Peter Rietbergen, Power and Religion in Baroque Rome: Barberini Cultural Policies, Leiden/Boston. Roser (2005): Hannes Roser, St. Peter in Rom im 15. Jahrhundert. Studien zur Architektur und skulpturalen Ausstattung, München. Roser (2008): Hannes Roser, „Sankt Peter in den ‚Sacri trofei romani‘ des Francesco Maria Torrigio“, in: Satzinger u. Schütze (2008) 257–273. Satzinger (2004): Georg Satzinger, „Baumedaillen: Formen, Funktionen. Von den Anfängen bis zum Ende des 16. Jahrhunderts“, in: Georg Satzinger (Hg.), Die Renaissance-Medaille in Italien und Deutschland, Münster, 97–124. Satzinger (2005): Georg Satzinger, „Die Baugeschichte von Neu St. Peter“, in: Jutta Frings (Hg.) Barock im Vatikan. Kunst und Kultur im Rom der Päpste II. 1572–1676 (Katalog zur Ausstellung der Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, Bonn, 25. November 2005–19. März 2006 u. des Martin-Gropius-Baues, Berlin, 11. April – 10. Juli 2006), Bonn/Leipzig, 45–74. Satzinger u. Schütze (2008): Georg Satzinger u. Sebastian Schütze (Hgg.), Sankt Peter in Rom 1506–2006. (Beiträge der internationalen Tagung vom 22.–25. Februar 2006 in Bonn), München. Schnackenburg (1959): Rudolf Schnackenburg, „Doxa“, in: Lexikon für Theologie und Kirche 3, Freiburg im Breisgau, 532–534. Schramm (1970a): Percy Ernst Schramm, „Sacerdotium und regnum im Austausch ihrer Vorrechte: ‚imitatio imperii‘ und ‚imitatio sacerdotii‘. Eine geschichtliche Skizze zu Beleuchtung des ‚Dictatus papae‘ Gregors VII.“, in: Percy Ernst Schramm, Kaiser, Könige und Päpste. Gesammelte Aufsätze zur Geschichte des Mittelalters 4, 1, Stuttgart, 57–106. Schramm (1970b): Percy Ernst Schramm, „Die imitatio imperii in der Zeit des Reformpapsttums“, in: Percy Ernst Schramm, Kaiser, Könige und Päpste. Gesammelte Aufsätze zur Geschichte des Mittelalters 4, 1, Stuttgart, 180–191. Schramm (1984): Percy Ernst Schramm, Kaiser, Rom und Renovatio. Studien zur Geschichte des römischen Erneuerungsgedankens vom Ende des karolingischen Reiches bis zum Investiturstreit, Darmstadt.
St. Peter in Rom: Medien und Gattungen seit 1506
357
Schroeter (1980): Elisabeth Schroeter, „Der Vatikan als Hügel Apollons und der Musen“, Römische Quartalschrift 75, 208–240. Schütze (1994): Sebastian Schütze, „Urbano inalza Pietro, e Pietro Urbano. Beobachtungen zu Idee und Gestalt der Ausstattung von Neu-St. Peter unter Urban VIII.“, Römisches Jahrbuch der Bibliotheca Hertziana 29, 213–287. Schütze (2005): Sebastian Schütze, „Die Ausstattung von Neu St. Peter“, in: Jutta Frings (Hg.) Barock im Vatikan. Kunst und Kultur im Rom der Päpste II. 1572–1676 (Katalog zur Ausstellung der Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, Bonn, 25. November 2005–19. März 2006 u. des Martin-Gropius-Baues, Berlin, 11. April – 10. Juli 2006), Bonn u. Leipzig, 117–138. Schütze (2007): Sebastian Schütze, Kardinal Maffeo Barberini, später Papst Urban VIII. und die Entstehung des römischen Hochbarock, München. Siebenhüner (1962): Herbert Siebenhüner, „Umrisse zur Geschichte der Ausstattung von St. Peter in Rom von Paul III. bis Paul V. (1547–1606)“, in: Karl Oettinger u. Mohammed Rassem, (Hgg.) Festschrift für Hans Sedlmayr zum 65. Geburtstag, München, 229–320. Spagnesi (1997): Gianfranco Spagnesi (Hg.), L’Architettura della Basilica di San Pietro. Storia e Costruzione, Rom (Quaderni dell’Istituto di Storia dell’Architettura. Dipartimento di Storia dell’ Architettura, Restauro e Conservazione dei Beni Architettonici), n. s. 25–30 (1995–1997). Spagnolo (2000a): Maddalena Spagnolo, „Crossing. South-west pier (Pier of Veronica)“ in: Pinelli (2000), Text. Notes, Notes, 770–772. Spagnolo (2000b): Maddalena Spagnolo, „Crossing. North-west pier (Pier of Helena)“ in: Pinelli (2000), Text. Notes, Notes, 772–775. Spagnolo (2000c): Maddalena Spagnolo, „Gian Lorenzo Bernini (1598–1680) and assistants. Baldachin (1624–1635)“, in: Pinelli (2000), Text.Notes, Notes, 787–794. Sperandio u. Zander (1999): Antonio Sperandio u. Pietro Zander (Hgg.), La tomba di San Pietro. Restauro e illuminazione della necropoli vaticana, Mailand. Staubach (2008): Nikolaus Staubach, „Der Ritus der impositio primarii lapidis und die Grundsteinlegung von Neu-Sankt Peter“, in: Satzinger u. Schütze (2008) 29–40. Stierle (1996): Karlheinz Stierle, „Translatio Studii and Renaissance: From Vertical to Horizontal Translatio“, in: Sanford Budick u.Wolfgang Iser (Hgg.), The Translatability of Culture. Figurations of the Space between, Stanford, 55–67. Stinger (1985): Charles L. Stinger, The Renaissance in Rom, Bloomington. Sulzer (1977): Dieter Sulzer, „Poetik synthetisierender Künste und Interpretation der Emblematik“, in: Herbert Anton, Bernhard Gajek u. Peter Pfaff (Hgg.), Geist und Zeichen. Festschrift für Arthur Henkel zu seinem 60. Geburtstag. Heidelberg, 401–426. Sulzer (1981): Dieter Sulzer, „Bemerkungen zu einer Soziologie der Imprese“, in: Jürgen Kühnel, Hans-Dieter Mück u. Ulrich Müller (Hgg.), De poeticis medii aevi quaestiones. Käte Hamburger zum 85. Geburtstag (Göppinger Arbeiten zur Germanistik 335), Göppingen, 209–240. Thelen (1967a): Heinrich Thelen, Zur Entstehungsgeschichte der Hochaltar-Architektur von St. Peter in Rom, Berlin. Thelen (1967b): Heinrich Thelen, Francesco Borromini. Die Handzeichnungen, I. Abteilung, Graz. Thoenes (1986): Christof Thoenes, „St. Peter als Ruine. Zu einigen Veduten Heemskercks“, Zeitschrift für Kunstgeschichte 49, 481–501. Thoenes (1992): Christof Thoenes, „Alt- und Neu-St.-Peter unter einem Dach. Zu Antonio da Sangallos ‚Muro Divisorio‘“, in: Michael Jansen (Hg.), Architektur und Kunst im Abendland. Festschrift für Günter Urban, Rom, 51–61. Thoenes (1994): Christof Thoenes, „Neue Beobachtungen an Bramantes St. Peter-Entwürfen“, Münchner Jahrbuch der bildenden Kunst, 3. Serie, 45, 109–132.
358
Rudolf Preimesberger
Thoenes (1997): Christof Thoenes, „S. Pietro: Storia e ricerca“, in: Gianfranco Spagnesi (Hg.), L’Architettura della Basilica di San Pietro. Storia e Costruzione (Quaderni dell’Istituto di Storia dell’Architettura. Dipartimento di Storia dell’ Architettura, Restauro e Conservazione dei Beni Architettonici, n. s. 25–30, 1995–1997), 13–30. Thoenes (2005): Christof Thoenes, „Renaissance St. Peter’s“, in: Tronzo (2005) 64–92. Thoenes (2008): Christof Thoenes, „Über die Größe der Peterskirche“, in: Satzinger u. Schütze (2008) 9–28. Thomas (1999): Heinz Thomas, „Translatio imperii“, in: Lexikon des Mittelalters 8, München, 944–946. Thümmel (1999): Hans Georg Thümmel, Die Memorien für Petrus und Paulus in Rom. Die archäologischen Denkmäler und die literarische Tradition, Berlin/New York. Torrigio (1644): Francesco Maria Torrigio, I Sacri trofei Romani del trionfante prencipe degli Apostoli san Pietro gloriosissimo, Rom. Tronzo (2005): William Tronzo (Hg.), St. Peter’s in the Vatican, Cambridge/New York/Melbourne. Ullmann (1960): Walter Ullmann, „Leo I and the theme of papal primacy“, The Journal of Theological Studies NS 11, 25–51. Ward-Perkins (1952): John Ward-Perkins, „The Shrine of St. Peter and its Twelve Spiral Columns“, Journal of Roman Studies 42, 21–33. Walker Bynum (1995): Caroline Walker Bynum, The Resurrection of the Body in Western Christianity, 200–1336, New York. Wegner (1976–1977): Max Wegner, „Gewundene Säulen von Ephesos“, Jahreshefte des Österreichischen Archäologischen Institutes in Wien 51, Beiblatt, 49–64. Wolff Metternich (1972): Franz Graf Wolff Metternich, Die Erbauung der Peterskirche zu Rom im 16. Jahrhundert. Erster Teil. (Römische Forschungen der Bibliotheca Hertziana 20), Wien/ München. Wolff Metternich (1975): Franz Graf Wolff Metternich, Bramante und St. Peter, München. Wolff Metternich (1987): Franz Graf Wolff Metternich, Die frühen St.-Peter-Entwürfe. 1505–1514, aus dem Nachlass herausgegeben, bearbeitet u. ergänzt v. Christof Thoenes (Römische Forschungen der Bibliotheca Hertziana 25), Tübingen.
Abbildungsnachweise Abb. 1 Abb. 2 Abb. 3 Abb. 4 Abb. 5 Abb. 6 Abb. 7 Abb. 8 Abb. 9 Abb. 10
Bildarchiv R. Preimesberger Pinelli (2000) Photo-Atlas/Atlante fotografico 2, 999 Abb. 1351 Pinelli (2000) Photo-Atlas/Atlante fotografico 2, 1009 Abb. 1371 Bildarchiv R. Preimesberger Pinelli (2000) Photo-Atlas/Atlante fotografico 2, 881 Abb. 1192 Pinelli (2000) Photo-Atlas/Atlante fotografico 2, 882 Abb. 1195 Bildarchiv R. Preimesberger Satzinger u. Schütze (2008) 313 Abb. 7 Bildarchiv R. Preimesberger Bildarchiv R. Preimesberger
359
Raum – Präsenz – Performanz
Karl-Joachim Hölkeskamp
Raum – Präsenz – Performanz. Prozessionen in politischen Kulturen der Vormoderne – Forschungen und Fortschritte
*
Little, or much, of what we see we do, We’re all both actors and spectators, too. William Shakespeare (nach Ernest Schanzer, „Hercules an his Load“, in: Review of English Studies 19, 1968, 51–53)
1 Konzepte und Kategorien Allenthalben hat sich mittlerweile die Einsicht durchgesetzt, daß Kulturen respektive die sie tragenden und produzierenden sozialen Gruppen ihre Wertsysteme, Orientierungen und überhaupt die wesentlichen Fundamente ihrer spezifischen Konstitution und Identität nicht nur in Texten und Monumenten formulieren bzw. darstellen. Vielmehr kennen alle Kulturen – historische und auch gegenwärtige – auch andere Medien und Praktiken, um ihre kollektiven Orientierungssysteme und Weltdeutungen zu artikulieren, ihre Wertordnungen und Leitvorstellungen zu verhandeln, ihr Selbstbild und ihr Selbstverständnis zu bestätigen oder auch zu transformieren: Rituale und Zeremonien, Feste, Spiele und Wettkämpfe, Aufführungen, ‚Inszenierungen‘ oder ‚Spektakel‘ ganz unterschiedlicher, wiederum aber jeweils kulturspezifischer Art1. Mehr noch: diese Praktiken sind integrale, ja konstitutive Elemente der jeweiligen Lebenswelt, die sie so und eben nicht anders hervorgebracht, ausgestaltet, bewahrt und weiterentwickelt hat – und das macht sie zu „existentiellen Kategorien des Gesellschaftlichen“. Denn diese Lebenswelt mit ihren Institutionen und Normen ist selbst als „raum- und zeitbedingte soziale Wirklichkeit“ zu verstehen, der die in ihr handelnden Individuen und Gruppen eben nicht gegenüberstehen, sondern der sie
* Der vorliegende Text ist eine erheblich erweiterte und ausführlich dokumentierte Fassung des Vortrages, den ich auf der Tagung in Heidelberg gehalten habe. Für die Einladung zu (und die Gastfreundschaft während) dieser Tagung danke ich Susanne Muth (Berlin), Ortwin Dally (Berlin), Rolf Michael Schneider (München) und insbesondere Tonio Hölscher (Heidelberg). Für Kritik und Anregungen bin ich Heribert Müller (Frankfurt), Hillard von Thiessen (Rostock) und natürlich wie immer Elke SteinHölkeskamp verbunden. 1 Martschukat u. Patzold (2003); Fischer-Lichte (1998/2002) 289ff. und passim; Fischer-Lichte (2003); Wulf u. Zirfas (2001, 2004).
360
Karl-Joachim Hölkeskamp
als historische Subjekte auf besondere Weise angehören. Denn diese Lebenswelt ist eine durch diese Menschen selbst „immer schon symbolisch gedeutete Welt“, also eine durch ihre „Wahrnehmungsweisen und Sinnstiftungsmuster, Selbstdeutungen und Weltbilder“ erst „gesellschaftlich konstituierte“ und „kulturell ausgeformte Wirklichkeit“. Und das heißt mutatis mutandis, daß gerade die erwähnten Medien und Praktiken in die Mitte jener Gesamtheit der „Weisen lebensweltlicher Wirklichkeitserfahrung und -gestaltung, der symbolischen Wirklichkeitsdeutungen, Kommunikationsformen, Produktionsweisen und Machtverhältnisse“2 vormoderner wie moderner Gesellschaften gehören – und daß die empirische Analyse dieser Praktiken auf der Basis ‚dichter Beschreibungen‘ einen geradezu privilegierten Zugang zur Rekonstruktion der so verstandenen vergangenen Lebenswelten bietet. Die Begriffe aus der Welt der Bühne, die in den einschlägigen Debatten über Theorien, Methoden und Kategorien im Zuge des sogenannten ‚performative turn‘ der Semantisierung der (im doppelten Sinne) spektakulären Dimensionen von Kulturen dienen, haben längst den konnotativen Ruch des schönen Scheins, der gekünstelten Theatralik, des bloßen Blendwerks oder auch der manipulativen Täuschung, der ihnen allgemein anzuhaften pflegte, verloren und sind mittlerweile sogar zu Schlüsselbegriffen der neuen Kulturwissenschaften avanciert. Mit diesen Begriffen werden Handlungsweisen, Praktiken und Strategien der Selbstdarstellung und -vergewisserung bezeichnet, die erst in ihrem Vollzug, in der Handlung selbst Bedeutung erlangen, Sinn stiften und damit fundamentale sozialintegrative Funktionen erfüllen. Im Gegensatz zu Texten und Monumenten sind ‚spektakuläre‘ Praktiken aller Art als solche nicht fixierbar und daher auch nicht direkt tradierbar, sondern einmalig und unwiederholbar, ephemer und transitorisch. Gerade deswegen setzen diese ‚performativen‘ Praktiken notwendig die physische Präsenz aller Beteiligten voraus – genauer gesagt: die „Ko-Präsenz“ von Darstellern und Zuschauern, Akteuren und Adressaten3. Selbst in der (jedenfalls lange Zeit) weniger innovationsfreudigen Althistorie sind „Brot und Spiele“ und darüber hinaus das breite Spektrum besonders ‚spektakulärer‘ Ausdrucksformen und Praktiken antiker Zivilisationen sogar schon avant la lettre als
2 Vierhaus (1995), Zitate: 14 und 16; Daniel (1997), Zitat: 200. S. zur Entwicklung der (älteren) Forschung außerdem Hugger (1987). 3 Fischer-Lichte (2003) 39, 41; vgl. auch Watanabe-O’Kelly (2002) 15ff.; Wirth (2002) enthält eine Sammlung wichtiger Texte zum Konzept der Performanz, seinen Ursprüngen und (An-)Wendungen in den neueren Kulturwissenschaften; vgl. zur ‚performance theory‘ insbesondere etwa Turner (1987) 72ff. und passim; Bell (1997/2009a) 37ff. und (1997/2009b) 72ff.; 159ff., ferner etwa MacAloon (1984); Snoek (2003). S. zum ‚performative turn‘ grundlegend Bachmann-Medick (2006) 104ff.; Manfred Pfister, „Performance/Performativität“, und Susanne Bach, „Theatralität“, in: Nünning (2008) 562ff. bzw. 716, jeweils mit weiteren Nachweisen, sowie aus anderer (nämlich postmodern-altertumswissenschaftlicher) Sicht: Goldhill (1999) und Kavoulaki (1999) 293ff.
Raum – Präsenz – Performanz
361
spezifische Dimension etwa der römischen Lebenswelt der (hohen und späten) Republik und der Kaiserzeit ausgemacht worden: Längst hat man auch erkannt, daß diese fundamentale Dimension durchaus tief in jener Epoche wurzelte, in der das römische Volk, der freie populus Romanus, noch souverän imperium, fasces, legiones, die institutionelle Macht und ihre äußeren Zeichen, die militärische Befehlsgewalt und die Legionen geradezu souverän vergeben habe – anders als der satirische Dichter Juvenal, der unter dem autokratischen Regime der flavischen Kaiser lebte (und angeblich litt), es in der berühmten Passage über „panem et circenses“ von der Warte der nostalgischen Rückschau suggeriert4. Man könnte es wiederum auch in der Metaphorik der Bühne formulieren: Augustus war vielleicht der erste (und gleich schon vollendete) ‚Impresario‘, der den gesamten Spielplan des römischen ‚Theaters der Macht‘ souverän bestimmte5 – und die dort inszenierten Dramen und raffiniert choreographierten Spektakel hatten bei aller (im doppelten Sinne) imperialen Steigerung praktisch durchweg republikanische Vorläufer und -bilder, was die ideologische Vorgabe der Selbstverortung in einer (re-)konstruierten Tradition eben nicht nur inhaltlich, sondern auch medial widerspiegelte. Das erwähnte Spektrum ‚spektakulärer‘ Praktiken ist jüngst noch mehr in den Mittelpunkt des Interesses einer modernen, vom ‚cultural turn‘ ebenfalls inspirierten internationalen Altertumswissenschaft gerückt6 – und auch hier sind es einerseits die kulturspezifisch ausgestalteten feierlichen ‚exits‘ und ‚enters‘, die oft hochgradig elaborierten Rituale des ‚Auszuges‘ (profectio) und der Rückkehr, der Ankunft und des ‚Einzuges‘ (adventus) in der hohen und späten Kaiserzeit, ihre spezifische Symbolik und hochelaborierte Struktur oder ‚Syntax‘, die als Sprache sui generis mit einer eigenen Semantik gedeutet (oder ‚gelesen‘) werden, wie etwa in Paul Zankers Deutung der Apotheose7. Andererseits entwickelt sich in jüng-
4 Juv. Sat. 10,78ff.: „nam (sc. populus) qui dabat olim/imperium, fasces, legiones, omnia, nunc se/continet atque duas tantum res anxius optat,/panem et circenses“. Vgl. dazu etwa Griffin (1991) 34ff.; Gunderson (1996) 113ff., mit weiteren Belegen. Zu ‚civic rituals‘ außerhalb Roms s. etwa Bruun (2009) mit weiteren Nachweisen. 5 So der Titel von Beacham (2005). 6 Vgl. etwa Nicolet (1976) 456ff. und passim; Veyne (1976/1988); Price (1984) 101ff., 234ff. und passim; Clavel-Lévêque (1984); Hopkins (1991) 484ff., 495ff.; Bergmann u. Kondoleon (1999); Beacham (1999) und Beacham (2005); Benoist (1999) und (2005); Flaig (2003); Bell (2004); Flower (2004); Hölkeskamp (2004) 58ff., 85ff.; (2006a); (2006/2007) und (2008), jeweils mit weiterer Literatur, sowie die einschlägigen Beiträge in Ambos (2005) und Stavrianopoulou (2006), sowie zuletzt Rasmus Brandt u.a. (2012). S. dort auch die theoretischen Beiträge zu Strukturen und Funktionen antiker Feste: Rasmus Brandt u.a. (2012a) und Iddeng (2012). S. auch die neueren Analysen eines besonders interessanten (und ausnahmsweise gut bezeugten) Beispiels eines „dynastic festival“ einer sich gerade erst konsolidierenden hellenistischen Monarchie: Walbank (1996) 121ff. und Thompson (2000) passim, Zitat: 378. 7 Zanker (2004). Vgl. bereits MacCormack (1972) und (1981) 17ff. und passim; s. auch Koeppel (1969) zur Darstellung dieser Rituale auf monumentalen Staatsreliefs; Price (1987) sowie neuerdings Benoist (1999) und (2005) mit umfangreichen Literaturnachweisen.
362
Karl-Joachim Hölkeskamp
ster Zeit ein neues Interesse an der eigentümlichen ‚spektakulären‘ Seite der republikanischen politischen Kultur8 – im Mittelpunkt standen und stehen dabei zunächst die pompa funebris, die ihr eigentümliche Choreographie der Ahnenreihe und die spezifische Multimedialität dieser Form familialer Traditionspflege9 und die pompa triumphalis und ihre besonders komplexe Dramaturgie: Gerade die Syntax der hochgradig ritualisierten Rückkehr des siegreichen Feldherrn als imperator an der Spitze seines Heeres aus dem Krieg in die Stadt, die komplexe Semantik der dabei zur Schau gestellten Beute in Gestalt von besiegten und gefangenen Feinden, von materiellen Gütern aller Art und vor allem von vielfältigen und -sagenden Bildern von Siegen und Eroberungen ist neuerdings zu einem zentralen Thema geworden10. Darüber hinaus sind nun auch die vielschichtige Einbettung von Politik, Verfahren und Institutionen in jeweils spezifische Formen von Zeremoniell, die intensive Durchdringung der Entscheidungsverfahren durch rituelle Elemente aller Art und damit die ‚theatralischen‘ Seiten des Auftretens und Handelns der Akteure auf der großen ‚Bühne‘ des Forum Romanum in den Blick gerückt11 – man hat begonnen, den Zeitzeugen und ebenso parteilichen wie intimen Kenner der Verhältnisse M. Tullius Cicero auf neue Weise ernstzunehmen: Nicht zufällig hatte schon dieser große Redner, gesuchte Anwalt und ambitionierte homo politicus die Versammlungen des römischen Volkes auf eben diesem ‚Forum‘ (im doppelten Sinne des Begriffs) als die ‚größte Bühne‘ (maxima scaena) des Redners und das Volk selbst als Publikum der dort stattfindenden Inszenierungen beschrieben; und Cicero wußte sehr gut, über was er da räsonnierte, beherrschte er doch selbst nicht nur die hochentwickelte Dramaturgie des Deklamierens, sondern gefiel sich gelegentlich selbst in großen Gesten
8 Vgl. die Übersichten bei Flower (2004); Beck (2005); Linke (2006); Hölkeskamp (2006a) und Hölkeskamp (2008), sowie allgemein Hölkeskamp (2004) 57ff. = Hölkeskamp (2010a) 53ff., jeweils mit weiteren Nachweisen und auch zum folgenden. 9 Vgl. dazu grundlegend Flaig (2003) 49ff., 69ff. und bereits Flower (1996); s. ferner Blösel (2003) und zuletzt Hölkeskamp (2008) 104ff. mit weiteren Nachweisen. Ein systematischer Vergleich mit vergleichbaren Ritualen, vor allem etwa Leichenzügen – z.B. Dörk (2004) und Weller (2006) 230ff. zu Beispielen aus der frühen Neuzeit –, ist bislang noch nicht versucht worden. Das Erkenntnispotential eines solchen komparativer Ansatzes bzw. der mögliche Gewinn an Trennschärfe ist daher nicht abzuschätzen. 10 Vgl. zu verschiedenen Aspekten dieses komplexen Rituals, insbesondere auch zu seiner (Re-)Konstruktion in den literarischen Quellen, etwa Itgenshorst (2005). Grundlegend, wenn auch radikal in ihrer Lesung des Rituals, sind hier wiederum die Ansätze und Anregungen von Flaig (2003) 32ff. und Flaig (2003a). S. ferner neuerdings die (sehr unterschiedlich argumentierenden) Arbeiten von Hölkeskamp (2006a) 339ff., 351ff.; (2006/2007) und (2008) 97ff., 110ff.; Bastien (2007); Beard (2007); Pittenger (2008) und Östenberg (2009) und dazu die Rezensionen Hölkeskamp (2010b) und Hölkeskamp (2011). 11 Vgl. etwa Bell (1997) und (2004); Aldrete (1999); Flaig (2003); Jehne (2003); Morstein-Marx (2004); Sumi (2005).
Raum – Präsenz – Performanz
363
und pompösen Posen und bewunderte auch den berühmtesten Schauspieler seiner Zeit, Q. Roscius, und dessen einschlägige Talente12. Außerdem hat man gerade in den benachbarten historischen Wissenschaften (wie der Mittelalter- und vor allem der Frühneuzeitforschung) erkannt, daß politische Kulturen im engeren Sinne – also der gesamte Komplex der Voraussetzungen und Bedingungen, Strukturen, Muster und Regeln jenes individuellen wie kollektiven Handelns in einem gegebenen gesellschaftlichen Kontext, das auf die Herstellung, Vermittlung und Durchsetzung von Entscheidungen mit dem Anspruch allgemeiner Verbindlichkeit zielt – eben nicht nur eine „Inhaltsseite“, sondern auch eine „Ausdrucksseite“ und eine entsprechende „kognitive“ Ebene hat13: Politische Kulturen – vergangene, vormoderne wie rezente und moderne – haben symbolische und ästhetische Dimensionen, die für die permanente Reproduktion der Legitimität des Systems insgesamt konstitutiv sind, und sie entwickeln vor allem dementsprechende Formen und Medien der Kommunikation. Denn es ist vor allem diese „Ausdrucksseite“, die der Erzeugung von Zugehörigkeit und Zustimmung, der Stiftung von Sinn und Sinnhaftigkeit politischen Handelns und damit der Begründung einer kollektiven Identität dient – und wie wichtig diese Funktion tatsächlich ist, wird nicht zuletzt dann historisch-empirisch besonders faßbar, wenn es um die radikale Neukonstituierung einer solchen Identität ging wie im Frankreich nach 1789: Die auffällig vielfältige, ebenso elaborierte wie artifiziell anmutende, geradezu systematisch gestiftete Kultur der revolutionären Feste muß zugleich als Medium und Motor dieses Prozesses begriffen werden – wie die Feste der „Föderation“, der „Freiheit“, der „Vernunft“ und des „höchsten Wesens“, deren jeweilige Bilder, Symbole und Strukturen jedes einzelne als spezifisch „ästhetisiertes, visuell betontes Ritual“ auszeichnen14. Das antike Beispiel einer ge-
12 Cic. de orat. 2,338; Cic. Lael. 97, vgl. auch Cic. de orat. 1,128ff.; 130; 132; 2, 242; 3, 220; Cic. Brutus 290 etc. S. dazu etwa Dupont (1985) 102ff. 13 S. zu diesen Konzepten Rohe (1990) 336ff.; Rohe (1994) 6f., 16. Vgl. generell zu den „symbol-“ bzw. „wissenszentrierten“ Ansätzen der neueren politischen Kulturforschung etwa Schwelling (2001) mit Literatur, sowie den einführenden Überblick zu den neuen Richtungen der ‚historischen Politikforschung‘, die sich als ‚Kulturgeschichte des Politischen‘ verstehen: Schorn-Schütte (2006) 77ff., 104ff.; Frevert (2002) und (2005); Mergel (2002) und (2004); Stollberg-Rilinger (2004) und (2005). S. zur Rezeption dieser Ansätze in der neueren Mediävistik außerdem etwa Althoff (1997), Althoff u. Siep (2000) und zuletzt Rexroth (2009) 75ff. und passim. Vgl. zur Frühneuzeit-Forschung insbesondere noch Stollberg-Rilinger (2000) und Schlögl (2004a), (2005) und (2008); Rogge (2004); Goppold (2007) 22ff., jeweils mit weiteren Nachweisen. S. zum Konzept der Konstituierung des Politischen durch/in Diskursen außerdem Landwehr (2003) 105ff. und passim. Ich habe in verschiedenen Zusammenhängen auf das Potential dieser Ansätze für eine moderne althistorische Forschung hingewiesen: Hölkeskamp (2004) 57ff. (=2010a) 53ff.); (2009a) 1ff., 36ff. und (2009b) 11ff. 14 Vgl. dazu Hunt (1984/1989) 38, 43f., 50f., 79ff., 82ff., 137f., sowie die grundlegende Arbeit von Ozouf (1976) und danach Ozouf (1987) 90f. und passim, ferner Marin (1987) 225ff.; die zitierte Formulierung nach Reinhard (1999) 91. Reiches, im doppelten Sinne anschauliches Material bietet Christina Schröder, in: Stollberg-Rilinger u.a. (2008) 216ff.
364
Karl-Joachim Hölkeskamp
rade nicht vordergründig-offensiven, sondern höchst komplexen und hintergründigcamouflierten, nichtsdestoweniger radikalen Neukonstituierung einer solchen Identität auf der Basis einer multimedial inszenierten und (dadurch) homogenisierenden Konsensfiktion kann hier nur noch einmal erwähnt werden: Auch die Welt der Bauten, Bilder und Botschaften im Rom des Augustus brauchte Kulte und Feste, Spiele und alle anderen Arten öffentlicher ‚Spektakel‘ im umfassenden Sinn des Begriffs15. Dieser neue Blick auf die „Ausdrucksseite“ politischer Kulturen ist Teil eines umfassenden Paradigmenwechsels – hier ist dieser anspruchsvolle Begriff noch am ehesten angemessen. Denn nach diesem ‚turn‘ stellt sich Politik bzw. politisches Handeln nicht (mehr) „als eindimensionaler Akt oder Prozeß dar, in dem von oben dekretiert, regiert, entschieden wird“. Vielmehr soll Politik konsequent als „Handlungs- und Kommunikationsraum“, das Handeln in diesem Raum also als „kommunikatives Handeln“ im weitesten Sinne begriffen werden. Dieses Handeln umfaßt alle konkreten Akte, die „der Herstellung, Darstellung und Durchsetzung von Entscheidungen mit dem Anspruch allgemeiner Verbindlichkeit“ und damit der „Durchsetzung von Herrschaft“ dienen – und das gelingt auf die Dauer nur dann, wenn in dieser „kommunikativen Praxis politischer Prozesse“ immer auch der notwendige „Legitimitätsglaube an die Rechtmäßigkeit von Herrschaftsbeziehungen“ und an die Ausübung von Macht in Gestalt der erwähnten Durchsetzung von verbindlichen, auch mit Sanktionen bewehrten Entscheidungen (re-)produziert wird. Damit rückt die Dimension des Aushandelns von Agenden, Ansprüchen und ihrer Anerkennung, von Konfliktbeilegung und Kompromissen zwischen Regierenden und Regierten, Magistraten und Bürgern, herrschenden Klassen und breiten Schichten in den Blickpunkt – und dieses ‚Ver-‘ und ‚Aushandeln‘ von Politik in einem impliziten Dialog und die darin notwendig beschlossene Reziprozität setzen wiederum Formen der Partizipation etwa der ‚Adressaten‘ politischen Entscheidungshandelns notwendig voraus. Diese Partizipation nimmt zwar keineswegs unbedingt (und empirisch-historisch nicht einmal häufig) die Gestalt einer voll entwickelten „gleichberechtigten Teilhabe“ an, muß aber doch (oder gerade deswegen) in ihren jeweils kulturspezifischen Ausprägungen, Graden und institutionellen Formen bestimmt werden16.
15 S. dazu immer noch Zanker (1987) 119ff. und passim, ferner etwa Benoist (1999) und (2005), sowie zum Charakter dieser Identität(en) und ihren einzelnen Aspekten Galinsky (1996); Wallace-Hadrill (2008) und die einschlägigen Beiträge in Huskinson (2000) und Galinsky (2005). 16 Frevert (2002) 158 und (2005) 14ff.; Goppold (2007) 22; Andres u.a. (2005) 11 (Zitate). Vgl. außerdem etwa Rogge (2004) 404ff. und passim, und bereits Bryant (1986) 15, wonach Zeremonien generell „functioned as a dramatic and symbolic mediation of social, legal and power relations“; de Mérindol (1997) 39ff. zum ‚Dialog‘ zwischen Stadt und Herrscher über Ritualregeln, und neuerdings Yatromanolakis u. Roilos (2004) 4, deren Konzept der „ritual poetics“ auf eine ähnliche Dimension des Rituals zielt, nämlich „the exploration of dialogic construction, subversion, negotiation, and conveyance of meaning in a number of interrelated social, cultural, and aesthetic domains of human experience and expression“.
Raum – Präsenz – Performanz
365
Dazu gehören auch die einer (politischen) Kultur jeweils eigentümlichen Formen „ritueller“ und „symbolischer Kommunikation“, als „eines Spektrums von spezifischen „habituellen Verfestigungen von Kommunikationssituationen“, das nach Spannweite, Formen und Graden jeweils konkret zu bestimmen ist. Dieses Repertoire umfaßt eben nicht nur etwa das gesprochene Wort in öffentlicher Rede, sondern auch Gesten, Gebärden und nicht zuletzt Zeremonien, Rituale und andere „Handlungen symbolischer Qualität“ – kurzum: Hier treffen sich ‚performative turn‘ und neue historische Politikforschung. Deren wichtigste Prämisse besteht darin, daß das erwähnte performative Repertoire einerseits „als wichtigste Leistung die ständige Vergewisserung und Verpflichtung aller Beteiligten“ erbringt und sie andererseits dabei zugleich auf Akzeptanz und Verbindlichkeit der geltenden Ordnung festlegt17 – also auch und vor allem den erwähnten Glauben an die Legitimität von Herrschaftsausübung generiert. Gerade die erwähnten Feste, Spiele und sonstigen ‚Spektakel‘ dienen als ‚symbolische Praktiken‘ mithin eben nicht einer veräußerlichten Darstellung von Macht in Glanz und Gloria – zugespitzt formuliert: Politische Symbole und Rituale dürfen nicht als bloße „Metaphern der Macht“ begriffen werden18. Vielmehr spielt das gesamte Repertoire an solchen Ausdrucksformen schon bei der Konstitution und Reproduktion von politisch-sozialen Ordnungsstrukturen und Machtbeziehungen, von Institutionen und Verfahren, von Deutungs- und Orientierungssystemen und (damit) von Geltungs-, Legitimitäts- und Herrschaftsansprüchen eine eigene und eigengewichtige, jeweils genauer zu bestimmende, jedenfalls fundamentale Rolle. Nochmals mit anderen Worten: sie sind als zentrale Elemente oder eben einzelne ‚Zeichen‘ „symbolischer Politik als eines Zeichensystems“ zu begreifen, das „via Kommunikation politische Wirklichkeit konstruiert“19. Das gilt insbesondere für Rituale und Zeremonien, die sich theoretisch und konzeptuell dadurch unterscheiden (sollen), daß dem Ritual eine „performative Wirkmächtigkeit“ zugeschrieben wird, die in einer dauernden oder ephemeren Statusveränderung, einem „Übergang“ oder einer sonstigen Transformation des oder der Beteiligten bestehe; die Zeremonie habe dagegen „eher darstellenden, abbildenden Charakter“ und diene etwa dazu, „eine immer schon gegebene politisch-soziale
17 Althoff (1997) 373; Schlögl (2004a) 24, vgl. 37f.; vgl. auch Hunt (1984/1989) 70ff.; Stollberg-Rilinger (2001) 22; Rogge (2004) 392ff. u. ö.; Dartmann (2004) 172. Vgl. zu Konzept, Formen und Medien „symbolischer Kommunikation“ (nicht nur) in der Vormoderne etwa Althoff (1999) 142ff.; Althoff u. Siep (2000) 395ff.; Stollberg-Rilinger (2000) und (2004); Rogge (2004) 385ff., 399f. u. ö., mit weiteren Nachweisen. 18 Hunt (1984/1989) 72. 19 Frevert (2002) 161, vgl. Stollberg-Rilinger (2005) 16 und bereits Bryant (1986) 15f. u. ö.; Bryant (1992) 127; Keller (2001) 23f. Eine Reihe neuerer Arbeiten, die den erwähnten Richtungen der ‚Neuen Politikgeschichte‘ verpflichtet sind, belegen das erhebliche (und noch längst nicht ausgeschöpfte) Erklärungspotential dieser Ansätze, z.B. Krischer (2006); Weller (2006); Goppold (2007). Vgl. auch die Beiträge in wichtigen Sammelbänden Cannadine u.a. (1987); Schlögel (2004); Johanek u. Lampen (2009).
366
Karl-Joachim Hölkeskamp
Ordnung“ bloß zu „bekräftigen“20. In ihrer formalen Struktur lassen sich Rituale und Zeremonien allerdings kaum unterscheiden: Sie stellen Inszenierungen dar, die aus komplexen, strukturierten und geordneten Sequenzen von Handlungen (wie etwa Opfern und Tänzen), Gesten, Gebärden und/oder Worten (wie etwa Formeln und Sprüchen, Gebeten und Gesängen) bestehen; diese Sequenzen sind also zwangsläufig multimedial. Zu diesen ‚Medien‘ gehören daher auch Kultgeräte, Bilder von Göttern, Helden oder Heiligen, Weihgaben und andere Gegenstände mit religiöser oder sonstiger symbolischer Bedeutung; ferner „Embleme“21 wie Amtstrachten und -insignien, toga praetexta und fasces, Fahnen, Feldzeichen, Wappen und andere unmittelbar lesbare Zeichen der Identität, des Status und des Ranges von Individuen oder Gruppen; und schließlich weitere optische und auch akustische Signale wie Musik und Fanfaren einerseits, allegorische Bilder und Figuren bis hin zu raffiniert komponierten anspielungsgesättigten ‚tableaux vivants‘ andererseits22. Dabei können sich „Visualisierung und Performanz“23, verbale und non-verbale Ausdrucksformen auf viele Weisen miteinander kombinieren, aufeinander verweisen und gegenseitig bestätigen. Gerade das symbolisch besonders vielschichtige, vieldeutige und ‚spektakuläre‘ Ritual der Einzüge des Herrschers oder Stadtherrn (adventus) – nicht nur dessen bereits erwähnte Ausprägung in der römischen Kaiserzeit, sondern auch das breite Spektrum
20 Stollberg-Rilinger (2001) 10 und (2000) 397, vgl. 390f.; Althoff u. Siep (2000) 397f. und Althoff u. Stollberg-Rilinger (2008) 15f.; Schenk (2003) 66ff., auch zum folgenden; s. bereits (aus durchaus unterschiedlichen disziplinären Perspektiven) Turner (1987) 157f.; Paravicini (1997) 14; Gebauer u. Wulf (1998) 128ff., 135ff.; Lang (1998) 448ff.; Rüpke (2001) 87ff.; Jehne (2003) 279f.; Dartmann (2004) 173. Vgl. aber die Differenzierung von Watanabe-O’Kelly (2002) 15f.: „Ceremonies are those events which do not just demonstrate power relations in symbolic fashion but which actually bring power structures into being“. „While ceremonies create power structures, …, spectacles act them out and present them symbolically“ – anders gesagt: „these are representations of the nature of power“. Die Debatten über die Konzepte ‚Ritual‘, ‚Ritualismus‘, ‚Ritus‘ etc. und ihre forschungspraktische Anwendung ist kaum überschaubar: S. dazu etwa (aus anthropologischer bzw. religionswissenschaftlicher Sicht) Bell (1997/2009a) und (1997/2009b); Lang (1998) 442ff., 453ff.; Bourque (2000); Wulf u. Zirfas (2003), sowie aus soziologischer Perspektive etwa Rehberg (2004a) 24ff. Vgl. auch die einschlägigen Beiträge in einigen neueren Sammelbänden: Caduff u. Pfaff-Czarnecka (2002); Belliger u. Krieger (2003), darin bes. die Einführung der Herausgeber (7ff.); Yatromanolakis u. Roilos (2004); Weinfurter (2005); Burckhard Dücker, „Ritual“, in: Nünning (2008) 629ff., jeweils mit weiteren Belegen. Grundlegend für das Phänomen, seine Vielgestaltigkeit und seine Funktionen in der Vormoderne aus sozial- und kulturhistorischer Sicht bleibt Muir (1997). Vgl. zur neueren mediävistischen Forschung zum Thema außerdem Buc (2000) und vor allem Rexroth (2003). 21 Vgl. zu diesem Konzept (in Absetzung vom „Symbol“) de Mérindol (1997) 27, vgl. de Mérindol (1991) 192ff.; Strong (1991) 41ff.; Althoff u. Siep (2000) 398. Reiches Anschauungsmaterial zu dem breiten Spektrum dieser Zeichen und Signale bieten Stollberg-Rilinger u.a. (2008). 22 Vgl. Muir (1979) 40ff.; Löther (1996) 112ff. (tableaux vivants in Festen der Serenissima); Östenberg (2009) 189ff. und 251ff. (am Beispiel römischer Triumphe). 23 Vgl. dazu Keller (2001) 24f., außerdem Reinhard (1999) 91, der „Zeremoniell“ als „ästhetisiertes, visuell betontes Ritual“ verstehen will.
Raum – Präsenz – Performanz
367
dieses Typs in Mittelalter und früher Neuzeit24 – konnte nicht nur ganz unterschiedliche Personenkreise und Statusgruppen, verschiedene Arten und Grade von Öffentlichkeit (oder auch Nichtöffentlichkeit), wechselnde Zeitpunkte und Schauplätze in sich vereinen; darüber hinaus belegt es eben auch eine praktisch unbegrenzte Vielfalt der Varianten, der Embleme, Bilder und Zeichen und nicht zuletzt der Möglichkeiten ihrer Vernetzung. In jedem Fall geschieht die Strukturierung der Handlungssequenz ‚Ritual‘ oder ‚Zeremonie‘ nach einer mehr oder weniger strengen, normierten und normierenden Syntax oder „Taxonomie“25, die aus Konventionen, formalen Regeln oder Vorschriften über Ort und Zeit, den Ablauf, die Ausstattung und nicht zuletzt über die Zusammensetzung der Teilnehmer und das Recht oder die Pflicht zur Teilnahme besteht. Rituale wie Zeremonien zeichnen sich durch Stereotypie und Wiedererkennbarkeit, Wiederholbarkeit und praktische Wiederholung aus, die eine besondere Art der ‚Authentizität‘ respektive der Richtigkeit des Ablaufs begründen und garantieren. Darin liegt ihre symbolisch-ordnende Kraft und zugleich ihre „Verletzbarkeit“; denn ihre „Integrität“ ist immer latent bedroht. Gerade die Normierung des Rituals läßt nämlich Mißverständnisse, Abweichungen, „Fehltritte“ und selbst „Mikroverletzungen“ der in der Syntax des Rituals „institutionell formierten Verhaltenserwartungen“ eben auch unmittelbar deutlich und für Akteure und Adressaten erkennbar werden – das gilt insbesondere auch für zufällige, mutwillige oder gar absichtsvolle und ganz gezielte Transgressionen und Provokationen, die wiederum ihrerseits selbst symbolische Botschaften vermitteln können und sollen: Die Triumphe eines Pompeius und dann eines Caesar in den Jahren 71 und 61 bzw. 46/45 v. Chr. belegen nicht nur die sich in diesen provozierend opulenten Inszenierungen machtvoll manifestierende immanente Steigerungsdynamik dieses traditionell republikanischen Rituals, sondern auch und gerade die dadurch durchaus gezielt zum Ausdruck gebrachten Ansprüche dieser Gestalten auf einen uneinholbaren Vorrang und eine (Über-)Größe, die diese Übersteigerungen und Transzendierungen der hergebrachten Syntax des Triumphrituals besonders anstößig erscheinen lassen mußten26. Unter Umständen kann eine
24 Vgl. allgemein Tenfelde (1982) und Tenfelde (1987); Strong (1991) 15ff., 79ff.; Schenk (1996) und Schenk (2003); Muir (1997) 239ff., 255f.; Krischer (2006) 274ff.; Fassler (2007) 13ff.; Lampen u.a. (2009) VIIff.; Lampen (2009) 1ff., sowie zuletzt die übrigen Beiträge in Johanek u. Lampen (2009). S. außerdem speziell zu den herrscherlichen ‚entrées‘ in Frankreich vor allem Guenée u. Lehoux (1968); Marin (1987) 226; de Mérindol (1997) und die übrigen Beiträge in Guenée u.a. (1997). Vgl. generell die auch methodisch wichtigen Studien zu ‚civic rituals‘ in italienischen (und anderen) Städten des Spätmittelalters und der Renaissance: Muir (1981); Trexler (1980/1994) und dazu Schwerhoff (1994); Casini (1996); Visceglia (2002); Ventrone (2003) und die Beiträge in Wisch u. Munshower (1990) und Hanawalt u. Reyerson (1994). 25 Diesen Begriff definiert de Mérindol (1991) 196, als „science des signes de désignation, de classement et de hiérarchisation de la société“; vgl. de Mérindol (1997) 27. Schlögl (2008) 192f. nennt das ein „starkes Drehbuch“. 26 Hölscher (2004) und (2009) 169ff.; Hölkeskamp (2008).
368
Karl-Joachim Hölkeskamp
daraus resultierende „Gleichgewichtsstörung“ sogar dazu führen, daß eine „gesamte Sozialgeographie“ in Mitleidenschaft gezogen wird27 – ob und gebenenfalls wie auch dieser Faktor in eine moderne Gesamtdeutung der Krise der Republik eingehen muß, kann hier zunächst nur als Frage formuliert werden: Die verschiedenen Formen demonstrativ-ritualisierter Gewaltaktionen durch die Anhängerschaften etwa des P. Clodius Pulcher einerseits und die zu „Ritualen der Rache“ umfunktionierten – oder auch: entgrenzten – Begräbnisfeiern für den toten Dictator Caesar im März 44 v. Chr. und schon einige Jahre zuvor, Anfang 52 v. Chr., für den ebenfalls ermordeten Clodius andererseits sind jedenfalls zumindest Symptome für die finale Krise des oligarchischen Senatsregimes – und mehr als das: Dabei ging es auch und vor allem um die dynamische Erosion einer wesentlichen Ressource dieses Regimes, nämlich der Akzeptanz und (damit) der Legitimität einer politischen Klasse, die als ‚Meritokratie‘ genau darauf besonders angewiesen war28. Zu derart weitreichenden und irreversiblen Folgen (wie etwa im Laufe des berühmt-berüchtigten Karneval in Romans im Jahre 1580, der in blutige Konfrontationen zwischen sozialen Gruppen degenerierte)29 muß es aber nicht immer, bei jeder Art und jedem Grad der Abweichung kommen – und das hängt nicht nur von der Schwere des ‚Fehltritts‘ ab, sondern auch und vor allem von der spezifischen Abweichungstoleranz, die ihrerseits in die jeweilige Syntax eines Rituals eingeschrieben ist. Dieser Toleranz verdankt sich eine (zumindest begrenzte, im Einzelfall wiederum zu bestimmende) Flexibilität und Dehnbarkeit, die es erlaubt (und geradezu erlauben soll), auch Varianten und Modifikationen zu integrieren und damit Sinn und vor allem die Geltung der Ritualsyntax zu bestätigen. Bei Ritualen wie Zeremonien haben Handlungen und Worte symbolische Bedeutungen, die über das visuell und akustisch konkret Wahrnehmbare hinausweisen – alle Elemente der Syntax dienen der performativen „Vergegenwärtigung von unsichtbaren Realitäten“, indem diese sichtbar, hörbar und vor allem miterlebbar gemacht werden30. Die beteiligten Akteure erfüllen dementsprechende immer auch symbolische Rollen. Wie bei allen ‚Inszenierungen‘ oder ‚Spektakeln‘ im eingangs definierten Sinne müssen den Akteuren die Adressaten gegenübertreten – Rituale und Zeremonien sind auf die Öffentlichkeit eines Publikums sogar notwendig angewiesen und
27 Vgl. dazu Rehberg (2001) 419f., 430ff. (Zitate und Begriffe). S. auch Muir (1997) 104ff. u. ö.; Löther (1998) 451ff.; von Heusinger (2007); Althoff u. Stollberg-Rilinger (2008) 18 und die einschlägigen Beiträge in Ambos u.a. (2005), sowie zu (etwa durch Inversion, Parodie o.Ä.) „verkehrten Ritualen“ in Mittelalter und früher Neuzeit: Christel Meier-Staubach, in: Stollberg-Rilinger u.a. (2008) 81ff. 28 Vgl. dazu Nippel (1981) und (1988) 54ff., 108ff., 128ff.; Vanderbroeck (1987) 142ff. und passim; Flaig (2009) 204ff., 208ff. und jetzt die Analyse der (älteren und jüngeren) Forschung zu den Organisationen der plebs urbana, den Formen kollektiven Verhaltens und ihrer Thematisierung „im Feld kulturwissenschaftlicher Forschungsperspektiven“ von Dissen (2009), hier 200ff., 239ff., 281ff. u. ö. 29 S. dazu die klassische Arbeit von Le Roy Ladurie (1979/1981) und dazu Muir (1997) 85f., 92. 30 Begriffe nach Keller (2001) 25.
Raum – Präsenz – Performanz
369
müssen geradezu darin eingebettet sein, wenn sie als performative Strategien der Selbstdarstellung und Selbstverständigung von sozialen Gruppen, politischen Einheiten und anderen Kollektiven ihre fundamentale Funktion der Konstitution, Reproduktion oder Transformation dieser Gemeinschaften erfolgreich erfüllen sollen31. Diese Bedingung setzt wiederum voraus, daß ein gewisses ‚rituelles Wissen‘ etwa über die erwähnte Syntax der Ordnung und der Regeln des Rituals und über die Semantik der Symbolik zwischen Akteuren und Adressaten geteilt wird. Erst dann kann ein Ritual bzw. eine Zeremonie endlich als „kulturell konstruiertes System symbolischer Kommunikation“ zwischen den Beteiligten im vollen Sinne dieser Definition funktionieren32 – also im Kontext aller einer Gesellschaft zur Verfügung stehenden derartigen „kulturellen Texte“ dazu beitragen, jenes „Bewußtsein von Einheit, Zusammengehörigkeit und Eigenart“ zu stiften und zu erneuern, das eben nicht nur die gewissermaßen aktuelle „Identität und Kohärenz einer Gesellschaft“ bestimmt und deren „Sinnwelt“ strukturiert: Darüber hinaus dienen Rituale und Zeremonien vor allem der Weitergabe dieses Bewußtseins über die ‚erinnerungstechnisch‘ sensiblen Grenzen der Generationen hinweg, mithin der Sicherung der erwähnten kulturellen Identität und Kohärenz in Raum und Zeit und damit der Reproduktion dieser Gesellschaft selbst33.
2 Prozession als Performanz I: Botschaft(en) eines Mediums Ein konkretes Beispiel für das Aufeinanderverweisen von Präsenz und Performanz, Multimedialität und Raum im Rahmen einer vernetzten Syntax ist das Ritual, in dem ein Consul seine ursprüngliche und wichtigste Rolle als Träger des imperium förmlich, sichtbar und insofern konkret übernimmt, nämlich diejenige als Oberbefehlshaber des Aufgebots und Feldherr der Republik: Der Aufbruch eines Consuls in einen Krieg war ein Ritual, das jedenfalls in der mittleren Republik fast ebenso regelmäßig stattfand wie ein fest im Kalender verankertes religiöses Fest – und ebenso wie bei anderen Ritualen ging es auch hier, um es mit Livius auszudrücken, „cum magna dignitate ac maiestate“ zu34. Denn auch eine solche profectio gehorchte selbstverständlich einer durchaus elaborierten Syntax: Dieses ‚Spektakel‘ begann (wie übrigens auch die
31 Vgl. etwa Rehberg (2004) 248, 255f. und (2004a) 27; s. auch Assmann (1992) 56f.; Watanabe-O’Kelly (2002) 15. Vgl. außerdem zu ‚Öffentlichkeit(en)‘ in der Vormoderne Althoff (1993/1997) 229ff.; Löther (1998) 437ff.; Schwerhoff (2004) 115ff. und passim. 32 Wulf u. Zirfas (2001) 97, 111; Wulf u. Zirfas (2004), 30f. u. ö.; Tambiah (1985/2002) 213; vgl. auch Kertzer (1988) 8ff. 33 Assmann (2000) 149f., vgl. Assmann (1991) 23f. und (1992) 57. 34 Liv. 42,49,2 und 49,1ff.; vgl. auch Cic. Verr. 2,5,34; Liv. 31,14,1; 41,10,5; 45,39,11 etc. S. dazu Marshall (1984) 121f. mit weiteren Nachweisen; Rüpke (1990) 124ff., 135f., auch zum folgenden.
370
Karl-Joachim Hölkeskamp
Übernahme des Amtes selbst) auf dem Capitol, wo der Consul – natürlich von seinen Lictoren mit den fasces als Insignien der magistratischen ‚Macht‘ umgeben – am Morgen des Tages seines Aufbruchs die Auspicien einzuholen und dem Iuppiter Optimus Maximus und den anderen Göttern feierliche Gelübde für den Fall des Sieges zu leisten hatte. Dann vertauschte der Consul die toga praetexta als Amtstracht im Bereich domi, dem topographisch und symbolisch genau markierten zivilen ‚Innenraum‘ der Stadt, mit dem roten Kriegsmantel (paludamentum), und auch seine Lictoren legten diese Tracht an. Dieser Akt verwies symbolisch bereits auf den Übertritt in den Amtsbereich militiae außerhalb der Stadt. Dann bliesen die Hörner und gaben damit ein ebenfalls schon eindeutig militärisches akustisches Signal zum Abmarsch. In Begleitung seiner Freunde, gelegentlich auch einiger Kriegstribune und anderer Offiziere und vor allem einer Menge von „omnium ordinum homines“ brach der Consul also auf, überschritt die heilige Stadtgrenze des pomerium – damit war er nun Feldherr mit unbegrenztem imperium. Wiederum ist es Livius, der die zentrale Rolle dieser „Menschen aus allen Ständen“ in diesem Ritual durchaus genau und vielschichtig charakterisiert hat – auch wenn diese Beschreibung anläßlich des Aufbruchs des P. Licinius Crassus, Consul 171 v. Chr., zum Feldzug gegen Makedonien und seinen König Perseus eine literarische Stilisierung eigener Prägung ist. Dieses Publikum komme hier nicht nur zur Erfüllung einer Pflicht, so Livius, sondern auch aus Lust an diesem Schauspiel (studium spectaculi) zusammen – um nämlich jenen Consul und Feldherrn zu sehen, den eben dieselben Menschen zuvor dazu bestellt hatten und den sie damit nun in den bevorstehenden Krieg schickten35. Anders, modern und abstrakt ausgedrückt: Das Publikum dieses Rituals ist nicht nur dessen gewissermaßen passiv-partizipatorischer Adressat, sondern auch und zugleich impliziter Akteur, nämlich als Bürgerschaft in den comitia centuriata, die dem nun aufbrechenden Feldherrn zuvor Amt und imperium verliehen hat. Hier manifestiert sich die bereits erwähnte, für Rituale nicht nur dieser Art konstitutive ‚Ko-Präsenz‘ von Akteuren und Adressaten als kollektiver ‚Ko-Akteur‘ in der besonderen Variante der Verschränkung komplementärer Rollen, die für die politische Kultur der Stadtstaatlichkeit typisch ist. Diese Verschränkung ist auch und vor allem ein spezifisches Merkmal jenes Typs von Ritual bzw. Zeremonie, um den es jetzt konkret gehen soll: Das Ritual der profectio des Imperiumsträgers – und natürlich auch dasjenige seiner Rückkehr im Triumph – sind als Prozessionen im engeren Sinne dieses Begriffs zu beschreiben. Im Rahmen neuerer kulturhistorischer Ansätze muß dieser Begriff als Kategorie nun ebenfalls inhaltlich genau und trennscharf gefaßt werden. Zunächst erfüllt die Prozession generell die wesentlichen Kriterien eines Rituals oder einer Zeremonie: Auch sie verläuft nach einer normativen Syntax, auch sie ist durch Stereotypie, Formalität, Wiederholbarkeit bzw. Wiederholung charakterisiert, auch sie vermittelt symboli-
35 Liv. 42,49,3–6.
Raum – Präsenz – Performanz
371
sche Botschaften, und vor allem ist sie notwendig performativ und (schon deswegen) in eine ‚ko-präsente‘ Öffentlichkeit eingebettet: Konkret ist die Prozession also eine strukturierte Handlungssequenz, in deren Verlauf eine bestimmte Gruppe von Menschen sich in einer normativ choreographierten Abfolge in einem definierten Raum von einem ebenfalls festgelegten Ausgangspunkt zu einem Endpunkt bewegt respektive, wie das Wort schon indiziert, feierlich „voranschreitet“, um am Ziel eine (zumeist kultische) Handlung teils performativ zu vollziehen, teils durch ihre Präsenz zu bezeugen36 – vor allem gehört auch zu diesem Ritualtyp die ‚Ko-Präsenz‘ einer ‚Öffentlichkeit‘ als Publikum als geradezu konstitutives Element: Schon durch den Akt des Zuschauens selbst – und erst recht durch das Übergehen zu verschiedenen Formen des ‚Ko-Agierens‘ – werden die Zuschauer genauso zu einem Element der Syntax der Prozession wie die Akteure selbst37.
3 Prozession als Performanz II: Raum, Route und Richtung Die Route der Prozession – also die Straßen und Plätze, über die sie führte, und vor allem die an diesem Weg liegenden und ihn zugleich definierenden Marken wie Tempel bzw. Kirchen, Rathäuser und andere öffentliche Bauwerke, Tore in der Stadtmauer, Denkmäler und sonstige markante Punkte von symbolischer Bedeutung – sind für die Prozession selbst ein integrales Konstitutivum ihrer spezifischen Syntax. Auf die konkreten Ausprägungen dieser räumlichen Dimension in verschiedenen vormodernen Kulturen wird noch zurückzukommen sein. Hier kommt es zunächst auf eine möglichst allgemeine, aber zugleich trennscharfe Bestimmung des gesamten Ensembles der konstitutiven Elemente der Prozession als eines spezifischen Typs des Rituals an. Dazu gehören neben dem soeben erwähnten Eingeschriebensein der Route in einen definierten (öffentlichen) Raum noch die kodierte Formulierung und symbolische Affirmation bestimmter Botschaften, die auch bei diesem Ritualtyp regelmäßig multimedial – das heißt durch Bilder und akustische Signale, Gesten und andere performative Akte – auf die ‚Bühne‘ des erwähnten öffentlichen Raumes gebracht werden.
36 Fless (2004) 33. Vgl. außerdem allgemein Löther (1998) 435ff. und Löther (1999) 1ff.; Rüpke (2001) 95f., 100f.; 176; Enzel (2004) 474ff.; Gengnagel u.a. (2008); Signori (2008), auch zum folgenden, sowie die Versuche zu einer „Systematisierung“ der antiken und christlichen Prozessionen aus theologischer Sicht Felbecker (1995) 151ff., 440ff. Vgl. zur (mediävistischen) Prozessionsforschung außerdem Weiß (2004) mit umfangreicher Literatur. 37 Bezeichnenderweise wird diese ‚Ko-Präsenz‘ in den bildlichen Darstellungen ganz verschiedener Prozessionen aus dem 15. und 16. Jh. immer wieder geradezu hervorgehoben, wie Muir (2007) 130ff. gezeigt hat. Vgl. auch Marin (1987) 227f.
372
Karl-Joachim Hölkeskamp
Im Sonderfall der Prozession kommt ein Spezifikum hinzu: die genau geregelte ‚Abfolge‘ der Akteure als Träger der symbolischen Rollen – seien es Individuen, etwa Priester oder Magistrate mit ihren Insignien, oder an bestimmten, dafür reservierten Zeichen erkennbar definierte Gruppen von Menschen –, die sich gemessen und feierlich in eine ebenfalls festliegende ‚Richtung‘ bewegen. Darauf wird noch zurückzukommen sein. Hier geht es zunächst um die Ordnung der Akteure im Raum und ihren symbolischen Gehalt. Diese Ordnung wirkt bereits als solche, als strukturierte Sequenz, als ebenso repräsentative wie bedeutungsvolle Inszenierung einer Ordnung oder auch einer „politischen Ideologie“ respektive eines „Programms der Macht“38. Eine besonders sinnfällige konkrete Ausprägung dieses Charakteristikums begegnet etwa in der spezifischen, wohl auch relativ strikt eingehaltenen Sequenz der einzelnen Gruppen des Triumphes, die auf die Figur des triumphierenden Feldherrn fokussiert war, und zwar nicht nur durch die Triumphaltracht und weitere Insignien, sondern vor allem durch seine zentrale Position in der Sequenz. Ob allerdings solche Sequenzen zwangsläufig und in jedem Falle als Repräsentation einer konkreten sozialen und politischen Hierarchie aufzufassen sind, sollte zunächst eine offene Frage bleiben – auch wenn die Masse der empirischen Beispiele eine Verallgemeinerung zu einer geradezu metahistorischen Konstante nahezulegen scheint. Bei genauerem Hinsehen hat sich aber längst herausgestellt, daß eine Prozession gerade nicht einfach als unmittelbares „Spiegelbild der sozialen Schichtung“ einer Stadt, womöglich sogar als „miniature replica“ oder als „getreues Abbild der sozialen und verfassungsmäßigen Gliederung“ ihrer Einwohnerschaft genommen werden kann – Prozessionen, ihre Ordnungen und ihre ‚Syntaxen‘ folgen vielmehr einer spezifischen Eigenlogik, weil und indem sie eine ‚Ordnung‘ (re-)konstruieren und insofern notwendig eher als Inszenierungen einer „Wahrnehmung der Stadt“, einer bestimmten Sicht- und Deutungsweise ihrer geltenden ‚Verfassung‘ und ihrer „essence of society“ gelesen werden müssen. Oft war das nachgewiesenermaßen natürlich die „Wahrnehmung der städtischen Obrigkeit“, die erfolgreich die Gestaltungshoheit über diese Inszenierung wie über andere ‚civic rituals‘ zu monopolisieren versuchte39 – aber einerseits gelang dies weder regelmäßig noch vollständig und nachhaltig; andererseits ist es überhaupt nicht ohne weiteres als eine metahistorische Kon-
38 Holliday (1990) 73. Vgl. auch Chaniotis (1991) 128. 39 Löther (1998) 435ff. und (1999) 143 bzw. 142, 144; bzw. Darnton (1984) 123 (Zitate). Vgl. auch Enzel (2004) 471ff., 487, 496f.; von Heusinger (2007) 147ff., 152f., sowie Phythian-Adams (1972) 63f., der zunächst für die Syntax einiger Prozessionen in Coventry festhält:„the order of march … was based not on a system of precedence reflecting some economic class division of society …, but on occupational groupings whose order was determined apparently by the contribution of each to civic office-holding.“ Seine weitere Einsicht könnte aber durchaus generell gelten: „Thus although ceremony obviously helped to transform the formal constitution of the city into some sort of social reality, conversely it was also a valued instrument through which the basic divisions of humanity, by sex, age and wealth, could be related to the structure of the community.“
Raum – Präsenz – Performanz
373
stante zu nehmen, die für alle Kulturen oder auch nur für alle Varianten solcher Rituale und Zeremonien innerhalb einer Kultur selbstverständlich vorausgesetzt werden darf. Und außerdem: wenn politische Macht, Ordnung und Hierarchie, ihre Geltung und Legitimität nun auch (und gerade) als Prozeß eines performativen Aushandelns begriffen werden müssen, dann kann selbst ein solches Gestaltungsmonopol eben nie ein absolut einseitiger ‚top-down‘ Oktroi einer ‚herrschenden‘ classe dirigeante sein40. Die Gegenüberstellung zweier Beispiele soll das verdeutlichen: Bei den Prozessionen des Dogen im Venedig der Renaissance ging es zweifellos um die symbolische Konstruktion von Autorität und Macht – nämlich die zeremonielle Inszenierung der sozialen Ordnung der Republik, der ihr korrespondierenden institutionellen Grundstruktur ihrer Verfassung und dabei insbesondere ihrer ebenso differenzierten wie strikt hierarchischen Gliederungen: Die jeweilige Position der einzelnen Akteure und die relative Nähe dieser Position zum Dogen selbst – von den untergeordneten Beamten aus der Klasse der nichtadligen cittadini, die die Spitze der Züge bildeten, und den sukzessiv folgenden höheren Amtsträgern, die unmittelbar vor der Gruppe des Dogen selbst eingeordnet waren, über dessen unmittelbare Begleitung (darunter die prominentesten Gesandten, etwa der päpstliche Nuntius) bis zum Gefolge der wiederum nach ihrem Rang, nun allerdings ‚absteigend‘ geordneten Reihen der adligen Würdenträger – spiegelten diese Hierarchien genau wider, und zwar nicht nur die fundamentale Trennung zwischen Adel und cittadini, sondern auch die feineren Abstufungen nach Rang, Funktion und Einfluß41. Auch die Prozession im Rahmen der Panathenäen im klassischen Athen unterlag, so weit wir wissen, einem durchaus vergleichbar strengen Regelwerk, das natürlich zunächst die symbolisch bedeutungsvolle Route beherrschte – wie bei der Prozession des Dogen, die in der Regel vom Palast ausging und durch die Peripherie der Piazza San Marco zu diesem unvergleichlichen Platz und dem dort liegenden sakralen Zentrum Venedigs, der Basilika San Marco, führte42. Der Zug der Panathenäen begann am Kerameikos, führte mitten durch das Zentrum der Stadt, über die Agora, zum Tempel jener Gottheit auf der Akropolis, deren Ehrung im Mittelpunkt des ganzen Festes
40 Vgl. generell Muir (1981) 5: „Although civic rituals often served the rulers’ interests, they were not just propaganda and did not pass messages only in one direction.“ S. etwa auch Schwerhoff (2004) 126ff. 41 Muir (1981) 203, und insgesamt 189ff. Vgl. generell zu den Prozessionen der Serenissima und ihrer spezifischen Taxonomie außerdem Casini (1996) 149ff.; Ventrone (2003) 175ff. In Venedig zählten zu den cittadini etwa 5–8 % der städtischen Bevölkerung (gegenüber gut 4 % nobili, die zu den im Goldenen Buch verzeichneten Familien gehörten); für die cittadini (und die Masse der popolani) stand – in Relation zu den Funktionen, die nur den ratsfähigen nobili zugänglich waren – etwa die vierfache Zahl an untergeordneten, aber durchaus noch lukrativen Ämtern zur Verfügung; vgl. Reinhard (1999) 250f. und die 581f. aufgeführte weitere Literatur. Eine vergleichbare ‚Syntax‘ (oder „general morphology“) haben Gorse (1990) 190 und passim, respektive Darnton (1984) 123, vgl. 116ff., für Prozessionen in Genua bzw. Montpellier gezeigt; s. auch Enzel (2004) 477ff. zur hierarchischen Ordnung der „Großen Kölner Gottestracht“. 42 Muir (1981) 209ff.
374
Karl-Joachim Hölkeskamp
stand, der Athena Polias43. Auch in diesem Fall hatten die Akteure – von den jugendlichen Trägern und vor allem den jungfräulichen Trägerinnen der Opfergeräte und -gaben bis zu den (jungen) Reitern und den „stattlichen alten Männern“ – jeweils bestimmte Positionen und ließen so eine ‚Ordnung‘ sichtbar werden. Auch hier könnten die höchsten Funktionsträger wie die neun Archonten, die Schatzmeister der Athene und die Prytanen besondere Plätze in dieser Ordnung gehabt haben44. Aber weder die Archonten noch die (ursprünglich aristokratischen) Reiter standen in einer Weise im Zentrum dieser ‚Ordnung‘, die auch nur entfernt mit der für die spezifische Syntax der Dogen-Prozession typischen Zentrierung auf Hierarchien und vertikale Differenzierungen jeder Art vergleichbar wäre. Die Prozession war keineswegs einfach ein „Monopol der sozialen und politischen Elite“45 – im Gegenteil: Sie war in die Panathenäen eingebettet, mithin in ein Fest, das „von einer Gemeinschaft begangen wird, die sich als solche fühlt“. Es war also eine „Bürgerveranstaltung“ im vollen Sinne des Begriffs46: Hier nahm die demokratisch verfaßte Bürgerschaft Athens als eine aus Gruppen zusammengesetzte, aber zugleich homogene sakrale Gemeinschaft Gestalt an, indem sie sich als solche in ihrer eigenen (räumlichen wie metaphorischen) Mitte feierlich und glanzvoll in Szene setzte, vor den Augen ganz Griechenlands (nicht zuletzt derjenigen Städte, die im Attischen Seebund unter ihrer Hegemonie standen) und zugleich vor sich selbst als ‚ko-präsentem‘ Publikum. Mit anderen Worten: Die Prozession im Rahmen der Panathenäen war keine realistisch-getreue Abbildung der politisch-sozialen Ordnung Athens, sondern ein „Kommentar“ über diese Ordnung, über die ihr eigene Dynamik und nicht zuletzt über die Beziehungen der Stadt zur Außenwelt – und zwar ein Kommentar in Gestalt eines „idealizing or even utopian image“47. Die bei diesem ‚Staatsfest‘ des demokratischen Athen inszenierten ‚Hierarchien‘ (wenn dieses Konzept denn hier überhaupt anwendbar ist, ohne seine begriffliche Trennschärfe zu verlieren) waren also ganz anderer Art als diejenigen in anderen vormodernen stadtstaatlichen politischen Kulturen – Alter, Geschlecht und sexueller Status etwa waren hier ebenso markiert wie militärische und zivile Unterteilungen der Bürgerschaft. Es kommt mithin darauf an, die jeweils kulturspezifische Art der ‚Hierarchie‘ empirisch genau zu bestimmen.
43 S. dazu generell Deubner (1966) 22ff.; Ziehen (1949) 463ff.; Felbecker (1995) 93ff.; Köhler (1996) 20ff.; Graf (1996) 58f.; Bergmann (2001) 184ff., jeweils mit weiteren Nachweisen und Literatur; Burkert (1987) 28ff.; Chaniotis (1991) 128f. und Kavoulaki (1999) 299ff. mit Vergleichsmaterial aus anderen Poleis, ferner Neils (1996) 178ff. und (2012), auch zur Ikonographie, sowie Osborne (1994). 44 Ziehen (1949) 469f., bzw. 467f.; Burkert (1987) 30f. 45 So Giovannini (1991) 472; ähnlich Maurizio (1998) 316, vgl. 307. 46 Zitate bei Deubner (1966) 22 und Bergmann (2001) 189. Vgl. auch Bömer (1952) 1894; Parker (1996) 91; Osborne (1994) 145. S. dagegen Maurizio (1998), die ein differenzierteres Bild der hier repräsentierten Gruppen der Bürgerschaft zu entwerfen und weist auf die eben nicht inkludierten Teile hin. 47 Begriffe bzw. Zitate: Muir (1981) 5 und Maurizio (1998) 307.
Raum – Präsenz – Performanz
375
4 ‚Performative turn‘ meets ‚spatial turn‘ Diese launig-postmoderne Wendung soll eine bereits angedeutete Dimension der Prozession als Ritual hervorheben, deren fundamentale Bedeutung durch eine weitere Theoriedebatte in jüngster Zeit und die daraus resultierende „gesteigerte Aufmerksamkeit für die räumliche Seite der geschichtlichen Welt“ in den Fokus auch der empirischen Geschichtswissenschaften gerückt ist48. Der Ritualtyp ‚Prozession‘ muß also noch nach weiteren, eher typologischen Kriterien genau differenziert werden – und dabei steht bezeichnenderweise jene Dimension im Vordergrund, die die spezifische Syntax dieses Rituals und seine konkreten Varianten offensichtlich beherrscht, nämlich diejenige des Eingeschriebenseins der Prozessionsroute in den Raum der Stadt, in ihre urbane religiöse, politische und spezifische symbolische Topographie49. Wenn der Ausgangs- und der Endpunkt der Prozession identisch sind, handelt es sich um eine Kreisprozession, in deren Verlauf ein bestimmter Ort umschritten wird, oder um einen Umgangsritus – wie etwa der jährlich im Februar stattfindende Lauf der Luperci, der vom Lupercal am Fuß des Palatin um diesen ältesten Kern der Stadt herum auf die Sacra via und das Forum führte. Zumindest im Prinzip galt das auch noch in historisch heller Zeit, als das Forum der Hauptschauplatz jenes frivol-karnevalesken Treibens der (fast) nackten jungen Männer geworden war, das sich aus einem uralten Reinigungs- und Fruchtbarkeitsritual entwickelt hatte50. Aber wiederum gilt auch hier, daß die Akteure und die ‚ko-präsenten‘ Zuschauer als ‚Ko-Akteure‘ – in diesem Fall die Luperci und vor allem die jungen Frauen am Rand ihrer Route, die sich ihnen geradezu in den Weg stellten und sich von ihnen mit ihren Bocks- oder Ziegenfellriemen scherzhaft schlagen ließen – sich gemeinsam an einem traditionellen Ritual beteiligten, das jahrhundertelang ein fester Bestandteil des sakralen Kalenders und (damit) der religiösen Identität des populus Romanus war51.
48 Schlögel (2003) 68, vgl. 60ff. S. zum sogenannten ‚spatial turn‘ etwa Bachmann-Medick (2006) 284ff. und Doris Bachmann-Medick, „Spatial turn“, in: Nünning (2008) 664f. 49 Vgl. dazu generell Cancik (1985–86); Rüpke (1990) 29ff. u. ö. und Rüpke (2001) 173ff., sowie Marin (1987) 223f.; Laurence (1993); Price (1984) 110f.; Hölkeskamp (2001/2004a) 142ff. und (2006b) 481ff., jeweils mit weiteren Nachweisen. S. zur Bedeutung des pomerium außerdem Rüpke (1990) 30ff.; Laurence (1993) 80ff. 50 Varro ling. Lat. 6,34; Aelius Tubero, FRH (2001) II 18 F 4 (= Dion. Hal. ant. 1,80,1ff.), mit dem Kommentar etc. Vgl. dazu Scullard (1981) 76ff. und grundlegend Ulf (1982); Hinard (1991) 41f.; Wiseman (1995) 77ff. Die Kritik, die an der Rekonstruktion der Route geübt wurde – zusammenfassend Harmon (1978) 1441ff.; Ulf (1982) 68ff.; Smith (1996) 155 mit Anm. 19 – überzeugt letztlich nicht: Wenn der Lauf am Lupercal – also etwa am Fuß des Palatin beim Circus Maximus – begann und auf dem Forum oder am Comitium endete, so vorsichtig Ulf (1982) 36ff., 66; Wiseman (1995) 81f., liegt eine Umrundung des Palatin jedenfalls nahe; vgl. auch Laurence (1993) 81f.; Smith (2000) 33; Rüpke (2001) 176. 51 Das betont mit Recht Hopkins (1991) 479ff., bes. 482f.
376
Karl-Joachim Hölkeskamp
Im anderen Fall wird durch die Prozession der Wechsel des Ortes inszeniert, wenn etwa Götterbilder von einem Tempel zum Circus getragen werden – das war ein integrales Element der pompa circensis, die regelmäßig anläßlich der wichtigen Spiele stattfand: Sie führte vom Capitol über den clivus Capitolinus hinunter auf das Forum, dann über den vicus Tuscus zum Velabrum und über das Forum Boarium und erreichte ihr Ziel durch das mittlere Tor des Circus Maximus52. Zu der gleichen Variante der Prozession als Ritualtyp gehören auch jene zahlreichen Gelegenheiten, bei denen Magistrate, Priester oder Priestercollegien sich feierlich zu einem bestimmten Ort begeben, um dort Amts- oder Kulthandlungen zu vollziehen – im Unterschied zu der bereits genannten „zirkulären“ Form handelt es sich also um „lineare“ Prozessionen, die je nach der Lage des Zielpunktes noch in einen „zentripetalen“ oder „zentrifugalen“ Typ unterteilt werden können53: Zu der ersten Kategorie gehört natürlich einerseits die bekannte Prozession im Rahmen der Panathenäen, die ja vom Kerameikos zur Akropolis, also geradezu klassisch von ‚außen‘ nach ‚innen‘ führte, andererseits der ebenfalls bereits mehrfach erwähnte Triumph, der ebenfalls im ‚Außenraum‘ militiae begann und am religiösen Zentrum der Stadt auf dem Capitol endete. Zu dem zweiten Typ zählen nicht nur jene Prozessionen, die in vielen griechischen Poleis von deren urbanen Zentren zu den „sub-“ bzw. „extraurbanen“ Heiligtümern führten54, und auch nicht nur jene feierlichen Umzüge aus der urbs Roma, die etwa im Rahmen uralter agrarischer Kulte wie der Robigalia stattzufinden hatten55. Auch die erwähnte profectio des Imperiumsträgers muß natürlich als „zentrifugal“ kategorisiert werden. In diesem besonderen Fall sind beide Typen auf spezifische Weise komplementär, wie noch zu zeigen sein wird. Ein besonders interessantes, allerdings auch rätselhaftes Ritual, das sich allerdings einer völlig eindeutigen Zuordnung entzieht, ist der Zug der Praetoren, der Pontifices, der Vestalinnen und der flaminica, also der Gattin des Iuppiter-Priesters, die selbst auch kultische Funktionen zu erfüllen hatte. Bei dieser Gelegenheit trat sie im Habitus der Trauer bzw. des Bittflehens auf – „mit strengem Gesicht, nicht frisiert und ohne Schmuck“. Die Prozession, die Jahr ein, Jahr aus am 14. Mai stattfand, führte durch die Stadt zum uralten Pons Sublicius, wo 27 (oder 30) simulacra hominum aus Binsenstroh in den Tiber geworfen werden mußten. Auch dieses Ritual der Reinigung und Entsühnung der Stadt fand übrigens, wie ausdrücklich betont wird, in Anwesenheit oder ‚Ko-Präsenz‘ der zur Teilnahme berechtigten römischen Bürger statt56. Diese Binsenpuppen, die Argei genannt wurden, wurden offen-
52 Vgl. dazu Hölkeskamp (2008) 107f. mit weiteren Nachweisen. 53 Begriffe nach Gutschow (2008) 400, 419f. respektive Graf (1996) 57ff. und passim. 54 Vgl. dazu generell de Polignac (1995) 40, 84, 153 u. ö.; Graf (1996) 60ff. 55 Vgl. dazu Wissowa (1912) 195f.; Scullard (1981) 169ff. mit den Belegen. 56 Dion. Hal. ant. 1,38,3, vgl. auch Varro ling. Lat. 7,44; Ov. Fast. 5,621ff.; Plut. Quaest.Rom. 32; 86 (= mor. 272B; 285A); Gell. 10,15,30; Paul. Fest. 14 s.v. Argeos; 450; Lindsay s.v. Sexagenarios. Vgl. dazu Latte (1960) 412ff.; Scullard (1981) 120f.; Harmon (1978) 1446ff.; Nagy (1985/1993) und Graf (2000), je-
Raum – Präsenz – Performanz
377
bar zuvor bei jenen 27 gleichnamigen Kultorten (sacraria) abgeholt, die über die vier uralten Regionen der Stadt verteilt waren und die von den erwähnten Priesterinnen und Priestern in einer bestimmten, sehr komplizierten Reihenfolge abgeschritten werden mußten – wie vermutlich jeweils auch zwei Monate zuvor, an einem feststehenden Termin Mitte März, an dem ebenfalls eine Prozession zu den sacraria der Argei stattfand57. Wie auch immer man sich die Beziehung zwischen diesen beiden Ritualen vorzustellen hat: bei beiden Prozessionen wurden nicht nur die einzelnen Hügel (außer Capitol und Aventin) als solche einbezogen, sondern auch rituell miteinander zum kohärenten Ganzen der urbs Roma verbunden58. Eine ganz andere Art des Umzuges fand nur zu bestimmten Anlässen statt, die allerdings keineswegs selten waren – wenn nämlich besonders alarmierende Prodigien eine Störung der pax deorum anzuzeigen schienen und deswegen die Sibyllinischen Bücher konsultiert werden mußten: Daraufhin wurde recht häufig eine Bittprozession unter der Leitung der decemviri sacris faciundis angeordnet, die vor allem aus einem Chor von genau 27 (nämlich, wie es präzise heißt, „dreimal neun“) Jungfrauen in langen Gewändern bestand (Abb. 1). Sie zogen hinter den weißen Opfertieren und den mitgetragenen Götterbildern als Weihgeschenken und vor den decemviri selbst, die zu diesem Anlaß mit Lorbeer bekränzt und mit der toga praetexta bekleidet waren – diese Tracht, die üblicherweise höheren Magistraten vorbehalten war, betont symbolisch zugleich die außeralltägliche Feierlichkeit und die besondere Bedeutung dieses Rituals für die res publica. Die Prozession folgte einer bestimmten Route durch die Stadt – sie bewegte sich vom Apollon-Tempel auf dem Marsfeld durch die porta Carmentalis und über den vicus Iugarius zum Forum Romanum, wo der Zug anhielt und der Chor ein Kultlied sang, dann weiter über den vicus Tuscus zum Velabrum, über das Forum Boarium und den clivus Publicius auf den Aventin zum Heiligtum der Iuno Regina, der die Opfer und Geschenke dargebracht wurden59. Eine andere Variante der Bittprozession belegt die besondere Bedeutung des Zieles im Rahmen der jeweiligen Syntax des Rituals: In Zeiten anhaltender Dürre legten die Magistrate demonstrativ ihre toga praetexta ab, ließen die fasces umkehren und zogen mit den verheirateten Frauen, die dabei die langen stolae als Zeichen ihres Status als Matronen trugen, aber mit gelösten Haaren und nackten Füßen (daher der Name nudipedalia) gingen, auf das Capitol, um dort zu Iuppiter als Gott des Regens
weils mit weiteren Nachweisen und ausführlicher Diskussion der verschieden Theorien zur religiösen Bedeutung des Rituals und der Symbolik. 57 Ov. Fast. 3,791 und dazu Scullard (1981) 90f. 58 Die genaue Liste dieser sacraria und ihres jeweiligen Ortes bei Varro ling. Lat. 5, 45–54 stammt aus einem Handbuch über die einschlägigen Ritualvorschriften. Vgl. zu diesem Teil des Rituals Bömer (1958) 327ff. (zu Ov. fast. 5, 621ff.); Hinard (1991) 39f.; Coarelli (1993), 120ff. und zuletzt Rüpke (2001) 176f. (Zitat 177). 59 Liv. 27,37,7ff.; 31,12,9f.; Iul. Obs. 27; 34; 36; 43; 46; 48; 53. S. dazu Wissowa (1912) 426f.; Bömer (1952) 1986; Latte (1960) 257f.; Coarelli (1993a), 284; Andreussi (1996), 125f.
378
Karl-Joachim Hölkeskamp
Opfertiere F Götterbilder F 3 x 9 Jungfrauen
Tempel der Iuno Regina auf dem Aventin F clivus Publicius F Forum Boarium F Velabrum F vicus Tuscus F Forum Romanum
F DECEMVIRI SACRIS FACIUNDIS
F vicus Iugarius F porta Carmentalis F
Apollon-Tempel auf dem Marsfeld Abb. 1: Aufstellung und Route einer Bittprozession der virgines (idealtypisch, teilweise hypothetisch).
zu beten60. Der große Tempel des höchsten Gottes war natürlich auch der bedeutungsvolle Endpunkt der Route der pompa triumphalis – mit dem Erreichen dieses Zieles schloß sich nämlich symbolisch der Kreis des Krieges, der genau hier mit der erwähnten profectio ja auch begonnen hatte. Die vorherigen Stationen bzw. Abschnitte dieser Route scheinen allerdings keineswegs so eindeutig fixiert gewesen zu sein. Nach vorherrschender Ansicht begann die pompa triumphalis außerhalb des pomerium auf dem Marsfeld, führte durch die porta triumphalis, die wahrscheinlich am südlichen Fuß des Capitols bei der porta Carmentalis bzw. dem Doppeltempel der Fortuna und Mater Matuta lag, über das Forum Boarium und durch den Circus Maximus und verlief weiter um den Palatin herum auf die Sacra via und dann über die gesamte
60 Petron. 44,18; Tertull. apol. 40,14; Tertull. de ieiun. 16,5; und dazu Wissowa (1912) 121; Latte (1960) 79.
Raum – Präsenz – Performanz
379
Abb. 2: Rom in der mittleren Republik – Route des Triumphzuges.
Länge des Forum Romanum bis zum Beginn des clivus Capitolinus (Abb. 2). Diese Route, ihre Verbindlichkeit und regelmäßige Geltung werden neuerdings eigens thematisiert und durchaus kontrovers diskutiert61 – und das ist allein schon ein Indiz für die Bedeutung, die der räumlichen Dimension der Ritualsyntax dieser Prozession nun beigelegt wird. Unumstritten ist dabei ein bereits erwähntes zentrales und ubiquitäres Charakteristikum des Ritualtyps der Prozession in seiner nicht nur römischen und auch nicht nur antiken Gestalt, das an diesen Beispielen besonders deutlich wird: die Festlegung von symbolträchtigen Orten als Ausgangs- bzw. Endpunkten der Prozession und (zu-
61 Grundlegend zur Verschränkung von Ritual, Route und Raum beim Triumph S. etwa Favro (1994); daneben Hölscher (2001) 194ff.; Hölkeskamp (2001/2004a) 147ff.; dagegen Beard (2007) 92ff. S. neuerdings Martini (2008); Schipporeit (2008) und zuletzt Östenberg (2010) mit weiteren Nachweisen.
380
Karl-Joachim Hölkeskamp
mindest oft) auch der genauen Route zwischen ihnen. Allgemeiner formuliert: die Verortung der Handlungssequenz in einem definierten (öffentlichen) Raum der Stadt und ihre Einschreibung in die religiös-politische Topographie, die diesen Raum strukturiert, ist ein integraler Bestandteil der typischen Syntax dieses Typs des Rituals bzw. der Zeremonie62. Diese Dimension der Prozession ist notwendig deswegen so zentral, weil sie wie alle anderen Typen öffentlichen Handelns in den Kontext jener besonderen Unmittelbarkeit, Direktheit und Dichte von Kommunikation und anderer Interaktion, welche nicht nur die antike ‚Stadtstaatlichkeit‘ auszeichnete, eingebettet ist – sie macht letztlich den eigentlichen Kern der eigentümlichen „processional identity“ der Stadt aus63. Diese Dichte ist ja durchaus auch und gerade physisch, dinglich und sinnlich zu verstehen – ‚Stadtstaatlichkeit‘ manifestiert sich schließlich in ihrer ‚Räumlichkeit‘. Zunächst kann die Stadt als ‚be‘bauter und oft auch ‚um‘bauter Ort oder Raum in einem unmittelbaren, gewissermaßen physischen Sinne wahrgenommen werden, mit einer Mauer und Toren nach außen und den Häusern der Bürger im Inneren, Portalen und Portiken, Plätzen, Straßen und öffentlichen Gebäuden – gerade diese sind auch schon im Verständnis der Antike ein zentrales Charakteristikum, und zwar bereits seit frühester Zeit, nämlich seit der Entstehung und Konsolidierung der Polis als sozialer und politischer Organisationsform im 8. und 7. Jahrhundert v. Chr.: Die ptolis der homerischen Epen wird bereits als Raum konzeptualisiert, der einerseits durch Mauern und Tore gegen die Außenwelt abgegrenzt und dadurch als besonders geschützt definiert ist und der andererseits auf spezifische Weise ausgestaltet wird, nämlich durch Häuser, breite Straßen, Heiligtümer und nicht zuletzt durch reservierte und markierte öffentliche Räume, die schon hier agore genannt werden64. Eine ganz ähnliche, durchaus bewußte Wahrnehmung der Polis als gestaltetem Raum läßt sich etwa aus der urbanistischen Entwicklung der Stadtanlagen in Sizilien und Unter-
62 Flower (2004) 337f.; Fless (2004) 34. Vgl. bereits Price (1987) 110ff.; Hinard (1991); Kavoulaki (1997) 297f.; Beacham (1999) 24f. u. ö.; Smith (1996) 156f. und (2000) 33; Rüpke (2001) 174ff. 63 Begriff nach Trexler (1980/1994) 1. Vgl. generell zu den Parametern der Verschränkung ‚Raum‘-‚Ritual‘ etwa Paravicini (1997a), und außerdem, wiederum aus ganz verschiedenen disziplinären Perspektiven, etwa Schütte (1997); Muir (2007) 131; Lampen u. a. (2009) XIff.; Schweers (2009) 39 ff. und bereits Mumford (1979) 324 ff., sowie interkulturell vergleichend Gutschow (2008). Vgl. zur Bedeutung des (städtischen) Raumes und der Route im Prozessionswesen des Mittelalters und der (frühen) Neuzeit im Einzelnen etwa Trexler (1973) 125 ff. und (1980/1994) 47 ff. (Florenz); Muir (1981) 209 ff.; Brown (1990), besonders 140, 145 f.; Casini (1996) 149 ff. u. ö. (Venedig); Gorse (1990) 191 f. und passim Abb. 5–4 (Genua); Boiteux (1991) (Rom im 16. Jh.); Coulet (1982) (Südfrankreich); Chiffoleau (1990) 53 ff. (Paris); von Heusinger (2007) 150 f., 153 (Straßburg); Phythian-Adams (1972) 76 f. (Coventry um 1500); Schütte (1997) 306 ff.; Löther (1999) 105 ff., 172, 249 ff. (Prozessionsrouten in Nürnberg bzw. Erfurt); Gedeon (2000) 17, 26 ff. (Prozessionen in Frankfurt am Main seit dem 14. Jh.); Ozouf (1987) 91 ff. (zur Bedeutung der Räume und Routen im Festwesen des revolutionären Frankreich). 64 Vgl. dazu ausführlich Hölkeskamp (2002) mit Belegen und Literatur.
Raum – Präsenz – Performanz
381
italien seit der Wende zum 6. Jahrhundert mit ihren Tempeln, Theatern, Agorai und Straßen als strukturierenden Achsen erkennen65. Und noch Jahrhunderte später, als diese und alle anderen (griechischen) Städte des Mittelmeerraumes längst zum Imperium Romanum gehörten, wollte der weitgereiste und gebildete Grieche Pausanias einen Ort, „der weder Amtsgebäude, noch ein Gymnasion, noch ein Theater, noch eine Agora besitzt“, ja „noch nicht einmal Wasser, das in einen Brunnen fließt“, eigentlich nicht als Stadt (polis) bezeichnen66. Diese Gebäude wie das griechische Gymnasium oder der Circus Maximus, aber auch Tempel, Altäre und Monumente und vor allem die öffentlichen Räume der Stadt in Gestalt der Plätze – Akropolis, Agora und Pnyx in Athen, Capitol, Marsfeld, Forum und Comitium in Rom – bilden als Ensemble erst die erwähnte politisch-sakrale Topographie, weil und indem sie jene Funktionen und Aktivitäten beherbergen, die die ‚Stadtstaatlichkeit‘ und ihre spezifische ‚Öffentlichkeit‘ konstituieren. Deren entscheidendes Charakteristikum besteht gerade darin, daß ihre ‚Räumlichkeit‘ bzw. Verräumlichung nicht nur abstrakt, also metaphorisch-mental, sondern auch und vor allem konkret, nämlich sinnlich-real zu begreifen ist. Denn in diesen konkreten markierten und reservierten Orten und „Räumen des ‚Miteinander‘“ findet nicht nur jede Art von alltäglich-informeller, ‚privater‘ Kommunikation, Handel und Wandel statt. Auch und vor allem sind hier die erwähnten formalisierten und ritualisierten performativen Aktivitäten im konkreten wie metaphorischen Sinne des Wortes ‚verortet‘, durch die sich einerseits die Bürgerschaft als exklusives Kollektiv konstituierte und reproduzierte und die andererseits das Bürgersein generell, die Zugehörigkeit und den Status des Einzelnen in diesem Kollektiv durch seine persönliche Teilnahme realisierten. Genau hier und nur hier treten sich alle am politischen Prozeß beteiligten Institutionen – Magistrate und alle anderen personalen Träger öffentlicher Rollen und Funktionen, Ratsorgane und Versammlungen – immer direkt, face-to-face, gegenüber, und genau hier vollzieht sich ihr konkretes Handeln in diesen Rollen. Alle Verfahren politischen Entscheidens sind notwendig und im strengen Sinne ‚öffentlich‘, weil und indem sie im Wortsinne sichtbar für alle Bürger bleiben. Wiederum genau hier und nur hier wird diese Öffentlichkeit zudem selbst zu einem Teilnehmer oder Teilhaber am politischen Prozeß – zumindest symbolisch, wie in der römischen Republik oder auch durchaus materiell und substantiell wie in der athenischen Demokratie: Als Volksversammlung nimmt diese Öffentlichkeit regelmäßig die Gestalt einer Institution an. Mehr noch: in dieser Institution ist die Öffentlichkeit der Bürgerschaft zugleich Akteur und Adressat ihres Handelns, hier werden idealiter Integration und Zusammenhalt in konkreten formalisierten, „technisch-instrumentellen“ Verfahren des politischen Entscheidens zugleich zu „symbolisch-expressiven“ Ritualen des Zu-
65 S. dazu grundlegend Hölscher (1998a), ferner den Überblick von Hölkeskamp (2004b) mit weiterer Literatur und jetzt Mertens (2006). 66 Paus. 10,4,1.
382
Karl-Joachim Hölkeskamp
sammenhandelns67, die zu den erwähnten anderen Formen und Medien der Selbstkonstitution und -reproduktion der Bürgerschaft (und/oder einzelner Gruppen) in ihrer Mitte und vor ihr selbst als Öffentlichkeit hinzutreten, gelegentlich auch auf sie verweisen und jedenfalls mit ihnen vernetzt sind. Anders formuliert: genau hier und nur hier, durch die besondere Verdichtung dieser ‚Öffentlichkeit‘ im städtischen Raum einerseits und die multidimensionale Verschränkung bzw. partielle Überschneidung „technisch-instrumenteller“ und „symbolisch-expressiver“ Formen der Selbstkonstruktion andererseits, wird der dieser ‚Stadtstaatlichkeit‘ eigentümliche Zusammenfall von communauté und publicité permanent und geradezu alltäglich performativ aktualisiert68. Nicht nur in bezug auf diesen historischen Sonderfall dürfen die vielzitierten Überlegungen von Jürgen Habermas zu vormodernen Öffentlichkeiten als überholt, weil reduktionistisch gelten: Einerseits greift es zu kurz, das „Gespräch der Bürger miteinander“, in dem „die Dinge zur Sprache“ kommen und dadurch „Gestalt“ gewinnen und das auch „die Form der Beratung und des Gerichts annehmen“ könne, als wesentliches Konstitutivum eines „Modell(s) der hellenischen Öffentlichkeit“ zu privilegieren; andererseits verstellt die relativierende Bemerkung, daß das „öffentliche Leben, bios politikos,“ sich zwar „auf dem Marktplatz, der agora,“ abspiele, aber deswegen „nicht etwa lokal gebunden“ sei69, den Blick auf fundamentale lebensweltliche Bedingungen antiker Stadtstaatlichkeit. Auch Habermas’ Konzept einer „repräsentativen Öffentlichkeit“ ist längst ins Gerede gekommen: Dieser vormoderne „Typus“ habe sich nicht „als ein sozialer Bereich“ konstituiert, sei – im Gegensatz zur „Öffentlichkeit der griechischen Polis“ – auch „keine Sphäre politischer Kommunikation“ und habe daher auch keinen „angebbaren“ bzw. „definierten Ort“ gekannt, sondern sei lediglich „so etwas wie ein Statusmerkmal“ gewesen, das als „Aura feudaler Autorität“ den „sozialen Status“ von Herrschaftsträgern im hohen Mittelalter „signalisiert“ habe, um sich dann im 17. und 18. Jahrhundert allmählich auf den Hof der Monarchen zu konzentrieren70. Daran hat sich die neuere historische Forschung zum europäischen Mittelalter und zur (frühen) Neuzeit mittlerweile zur Genüge abgearbeitet – dazu haben nicht zuletzt die von den erwähnten ‚turns‘ inspirierten Erweiterungen der Fragehorizonte und Begriffsraster beigetragen71. Die neuen Blicke richten sich dabei bezeichnenderweise nicht nur auf das reichhaltige
67 Begriffe nach Stollberg-Rilinger (2000) 395f., (2001) 12ff. und (2005) 13ff.; (2004). 68 Begriffe nach Ruzé (1997) 47, im Anschluß an Detienne (1996) 95ff. S. dazu insgesamt Hölkeskamp (2003) 86 und (2009a) 44ff., jeweils mit weiteren Nachweisen. 69 Habermas (1962/1971) 15ff., Zitate 15 und 16. 70 Habermas (1962/1971) 17ff., Zitate 19f., 21 und 24. 71 Vgl. allgemein Hoffmann (2001) 69ff., 75ff. S. zur Kritik an Habermas aus mediävistischer Sicht etwa Gestrich (1994) 18f. S. zur Auseinandersetzung mit H. in der Frühneuzeitforschung Gestrich (1994) 28ff.; Würgler (1995) 31ff.; Körber (1998) 4ff.
Raum – Präsenz – Performanz
383
Repertoire der Formen symbolisch vermittelter Kommunikation, die jeweils epochen- bzw. kulturspezifischen Kombinationen verbaler und non-verbaler Elemente – auch und gerade in der politischen Kommunikation – und schließlich die daran beteiligten „Kommunikationskreise“, also die diversen Personengruppen als Teilhaber an der Kommunikation. Auch und gerade die (metaphorischen sozialen wie durchaus konkreten topographischen) „Kommunikationsräume“ sind mittlerweile als Dimensionen sui generis kommunikativer Prozesse aller Art erkannt worden72. Die Entfaltung und Differenzierung einer (etwa im Vergleich zur antiken Stadtstaatlichkeit) andersartigen, aber ähnlich komplexen „sozialen Geographie“, der entsprechenden spezifischen Formen von „sociability“ und der jeweiligen Foren einer ‚Öffentlichkeit‘ in Gestalt einer „strong ‚civic‘, public sphere“ – nicht nur im Florenz wie im Venedig der Renaissance, sondern etwa auch in der Reichsstadt Köln in der frühen Neuzeit73 – erscheinen damit durchaus miteinander vergleichbar. Es wird in Zukunft darauf ankommen, das Potential und die Reichweite inter- bzw. transepochaler Vergleiche weiter auszuloten. Eine allgemeine Ausgangsposition läßt sich immerhin schon jetzt formulieren: Die komplexe Interdependenz von Raum, Präsenz und Performanz ermöglicht überhaupt erst jene spezifische „Vergesellschaftung unter Anwesenden“74, die wiederum erst durch ihre besondere Verdichtung und Verschränkung die besondere, ihr eigentümliche „kommunikative Form des Politischen“ und die daraus resultierende Art und Weise gesteigerter Partizipation generiert – und genau das sind also die definierenden Parameter dessen, was wiederum Tonio Hölscher treffend als „Staatsform der persönlichen Präsenz“, eingebettet in eine eigentümliche „Kultur des unmittelbaren Handelns“ beschrieben hat75. Damit darf nun zumindest ein gemeinsamer Kern der besonderen politischen Kulturen der vormodernen ‚Stadtstaatlichkeit‘ als identifiziert gelten. Aber das kann und soll nicht als Resultat mit (End-)Gültigkeitsanspruch mißverstanden werden, sondern als programmatische Formulierung einer Herausforderung, die erst noch durch eine neue, offene inter- und/oder transdisziplinäre Forschungspraxis empirisch umgesetzt werden muß – gerade der methodische Ansatz einer systematisch-komparativen Analyse der ‚civic rituals‘ vormoderner Stadtstaaten, der hier nur skizziert werden konnte, erscheint dabei als eine Strategie, deren Potential längst nicht ausgeschöpft ist. Da darf man sich vielleicht noch einmal des
72 Hoffmann (2001) 71, 80f., 86, vgl. 109f. 73 Vgl. dazu einerseits Muir u. Weissman (1989) 85ff., 99f. und passim, und andererseits Schwerhoff (2004). 74 S. dazu grundlegend Schlögl (2004a) und (2008), auch zum folgenden. Vgl. zum Zusammenhang zwischen „verdichteter Kommunikation“ und städtischer Kultur im Mittelalter etwa Oberste (2007a), sowie zum Konzept der ‚Anwesenheit‘ als Voraussetzung und Bedingung von „wechselseitiger Wahrnehmung und Kommunikation“ Berger (1995) 99f., 104ff. 75 Hölscher (1998b) 69ff. und (2003) 164 u. ö. und danach Hölkeskamp (2003) 85ff.
384
Karl-Joachim Hölkeskamp
berühmten, auch hier wieder völlig dekontextualisierten Zitats Winston Churchills bedienen: „Now this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning.“
Literaturverzeichnis Aldrete (1999): Gregory S. Aldrete, Gestures and Acclamations in Ancient Rome, Baltimore u.a. Althoff (1993/1997): Gerd Althoff, „Demonstration und Inszenierung. Spielregeln der Kommunikation in mittelalterlicher Öffentlichkeit“ (zuerst 1993), in: Gerd Althoff, Spielregeln der Politik im Mittelalter. Kommunikation in Frieden und Fehde, Darmstadt, 229–257. Althoff (1997): Gerd Althoff, „Zur Bedeutung symbolischer Kommunikation für das Verständnis des Mittelalters“, Frühmittelalterliche Studien 31, 370–389. Althoff (1999): Gerd Althoff, „Rituale – symbolische Kommunikation. Zu einem neuen Feld der historischen Mittelalterforschung“, Geschiche in Wissenschaft und Unterricht 50, 140–154. Althoff u. Siep (2000): Gerd Althoff u. Ludwig Siep, „Symbolische Kommunikation und gesellschaftliche Wertesysteme vom Mittelalter bis zur französischen Revolution“, Frühmittelalterliche Studien 34, 393–412. Althoff u. Stollberg-Rilinger (2008): Gerd Althoff u. Barbara Stollberg-Rilinger, „Spektakel der Macht? Einleitung“, in: Stollberg-Rilinger u.a. (2008) 15–19. Ambos u.a. (2005): Claus Ambos, Stephan Hotz, Gerald Schwedler u. Stefan Weinfurter (Hgg.), Die Welt der Rituale. Von der Antike bis heute, Darmstadt. Andres u.a. (2005): Jan Andres, Alexa Geisthövel u. Matthias Schwegelbeck, „Einleitung“, in: Jan Andres, Alexa Geisthövel u. Matthias Schwegelbeck (Hgg.), Die Sinnlichkeit der Macht. Herrschaft und Repräsentation seit der Frühen Neuzeit, Frankfurt am Main u.a. Andreussi (1996): M. Andreussi, „Iuno Regina“, in: Lexicon topographicum urbis Romae 3, 1996, 125–126. Assmann (1991): Jan Assmann, „Der zweidimensionale Mensch: das Fest als Medium des kollektiven Gedächtnisses“, in: Assmann u. Sundermeier (1991) 13–30. Assmann (1992): Jan Assmann, Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen, München. Assmann (2000): Jan Assmann, Religion und kulturelles Gedächtnis. Zehn Studien, München Assmann u. Sundermeier (1991): Jan Assmann u. Theo Sundermeier (Hgg.), Das Fest und das Heilige. Religiöse Kontrapunkte zur Alltagswelt, Gütersloh. Bachmann-Medick (2006): Doris Bachmann-Medick, Cultural Turns. Neuorientierungen in den Kulturwissenschaften, Reinbek bei Hamburg. Bastien (2007): Jean-Luc Bastien, Le triomphe romain et son utilisation politique à Rome aux trois derniers siècles de la République, Rom. Beacham (1999): Richard C. Beacham, Spectacle Entertainments of Early Imperial Rome, New Haven u.a. Beacham (2005): Richard C. Beacham, „The Emperor as Impresario: Producing the Pageantry of Rome“, in: Galinsky (2005) 151–174. Beard (2007): Mary Beard, The Roman Triumph, Cambridge Mass. Beck (2005): Hans Beck, „Züge in die Ewigkeit. Prozessionen durch das republikanische Rom“, Göttinger Forum für Altertumswissenschaft 8, 73–104. Bell (1997): Andrew Bell, „Cicero and the Spectacle of Power“, Journal of Roman Studies 87, 1–22. Bell (2004): Andrew Bell, Spectacular Power in the Greek and Roman City, Oxford.
Raum – Präsenz – Performanz
385
Bell (1997/2009a): Catherine Bell, Ritual Theory, Ritual Practice, 2. Auflage, Oxford. Bell (1997/2009b): Catherine Bell, Ritual. Perspectives and Dimensions, 2. Auflage, Oxford. Belliger u. Krieger (2003): Andrea Belliger u. David J. Krieger (Hgg.), Ritualtheorien. Ein einführendes Handbuch, Wiesbaden. Benoist (1999): Stéphane Benoist, La Fête à Rome au premier siècle de l’Empire. Recherches sur l’univers festif sous les règnes d’Auguste et des Julio-Claudiens, Brüssel. Benoist (2005): Stéphane Benoist, Rome, le prince et la cité. Pouvoir impérial et cérémonies publiques (Ier siècle av. – début du IVe siècle apr. J.-C.), Paris. Berger (1995): Peter A. Berger, „Anwesenheit und Abwesenheit. Raumbezüge sozialen Handelns“, Berliner Journal für Soziologie 1, 99–111. Bergmann u. Kondoleon (1999): Bettina Bergmann u. Christina Kondoleon, „Introduction: The Art of Ancient Spectacle“, in: Bettina Bergmann u. Christina Kondoleon (Hgg.), The Art of Ancient Spectacle, New Haven, 9–35. Bergmann (2001): Marianne Bergmann, „Festprozessionen der griechischen Stadtstaaten und der hellenistischen Könige“, in: Harald Kimpel u. Johanna Werckmeister (Hgg.), Triumphzüge. Paraden durch Raum und Zeit, Marburg, 180–197. Blösel (2003): Wolfgang Blösel, „Die memoria der gentes als Rückgrat der kollektiven Erinnerung im republikanischen Rom“, in: Ulrich Eigler, Ulrich Gotter, Nino Luraghi u. Uwe Walter (Hgg.), Formen römischer Geschichtsschreibung von den Anfängen bis Livius. Gattungen – Autoren – Kontexte, Darmstadt, 53–72. Bömer (1952): Franz Bömer, „Pompa“, in: Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft 21, 2, 1952, 1878–1994. Bömer (1958): Franz Bömer, P. Ovidius Naso. Die Fasten, hg., übersetzt und kommentiert von F. B., Heidelberg. Boiteux (1991): M. Boiteux, „Espace urbain, pratiques rituelles, parcours symboliques. Rome dans la seconde moitié du XVIe siècle“, in: Hinard u. Royo (1991) 111–145. Bourque (2000): Nicole Bourque, „An Anthropologist’s View of Ritual“, in: Edward Bispham u. Christopher Smith (Hgg.), Religion in Archaic and Republican Rome and Italy. Evidence and Experience, Edinburgh, 19–33. Brown (1990): Patricia Fortini Brown, „Measured Friendship, Calculated Pomp: The Ceremonial Welcomes of the Venetian Republic“, in: Wisch u. Munshower (1990) 136–186. Bruun (2009): Christer Bruun, „Civic Rituals in Imperial Ostia“, in: Olivier Hekster, Sebastian Schmidt-Hofner u. Christian Witschel (Hgg.), Ritual Dynamics and Religious Change in the Roman Empire, Leiden u.a., 123–141. Bryant (1986): Lawrence M. Bryant, The King and the City in the Parisian Royal Entry Ceremony: Politics, Ritual, and Art in the Renaissance, Genf. Bryant (1992): Lawrence M. Bryant, „Politics, Ceremonies, and Embodiments of Majesty in Henry II’s France“, in: Heinz Duchhardt, R.A. Jackson u. D. Sturdy (Hgg.), European Monarchy. Its Evolution and Practice from Roman Antiquity to Modern Times, Stuttgart, 127–154. Buc (2000): Philippe Buc, „Political Ritual: Medieval and Modern Interpretations“, in: Hans-Werner Goetz (Hg.), Die Aktualität des Mittelalters, Bochum, 255–272. Burkert (1987): Walter Burkert, „Die antike Stadt als Festgemeinschaft“, in: Hugger u.a. (1987) 25–44. Caduff u. Pfaff-Czarnecka (2002): Corina Caduff u. Joanna Pfaff-Czarnecka (Hgg.), Rituale heute. Theorien – Kontroversen – Entwürfe, Berlin. Cancik (1985–86): Hubert Cancik, „Rome as a Sacral Landscape. Varro and the End of Republican Religion in Rome“, Visible Religion 4–5, 250–265. Cannadine u.a. (1987): David Cannadine, Simon Price (Hgg.), Rituals of Royalty. Power and Ceremonial in Traditional Societies, Cambridge.
386
Karl-Joachim Hölkeskamp
Casini (1996): Matteo Casini, I gesti del principe. La festa politica a Firenze e Venezia in età rinascimentale, Venedig. Chaniotis (1991): Angelos Chaniotis, „Gedenktage der Griechen. Ihre Bedeutung für das Geschichtsbewußtsein griechischer Poleis“, in: Assmann u. Sundermeier (1991) 123–145. Chiffoleau (1990): Jacques Chiffoleau, „Les processions parisiennes de 1412. Analyse d’un rituel flamboyant“, Revue historique 114, 37–76. Clavel-Lévêque (1984): Monique Clavel-Lévêque, L’empire en jeux. Espace symbolique et pratique sociale dans le monde romain, Paris. Coarelli (1993): Filippo Coarelli, „Argei, sacraria“ in: Lexicon topographicum urbis Romae 1, 1993, 120–125. Coarelli (1993a): Filippo Coarelli, „Clivus Publicius“, in: Lexicon topographicum urbis Romae 1, 1993, 284. Coulet (1982): Noël Coulet, „Processions, espace urbain, communauté civique“, Liturgie et musique. Cahier de Fanjeaux 17, 381–397. Daniel (1997): Ute Daniel, „Clio unter Kulturschock. Zu den aktuellen Debatten der Geschichtswissenschaft“, Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 48, 195–219, 259–278. Darnton (1984): Robert Darnton, The Great Cat Massacre And Other Episodes in French Cultural History, New York. Dartmann (2004): Christoph Dartmann, „Schrift im Ritual. Der Amtseid des Podestà auf den geschlossenen Statutencodex der italienischen Stadtkommune“, Zeitschrift für Historische Forschung 31, 169–204. Detienne (1996): Marcel Detienne, The Masters of Truth in Archaic Greece (zuerst franz. 1967), New York. Deubner (1966): Ludwig Deubner, Attische Feste (zuerst 1932), Berlin. Dissen (2009): Margret Dissen, Römische Kollegien und deutsche Geschichtswissenschaft im 19. und 20. Jahrhundert, Stuttgart. Dörk (2004): Uwe Dörk, „Memoria und Gemeinschaft. Städtische Identitätskonstruktion im Totenkult. Drei Bestattungen in Bern und Ulm“, in: Schlögl (2004) 517–561. Dupont (1985): Florence Dupont, L’acteur-roi ou le théâtre dans la Rome antique, Paris. Enzel (2004): Kathrin Enzel, „Eins Raths Kirmiß … Die ‚große Kölner Gottestracht‘ als Rahmen der politischen Selbstdarstellung städtischer Obrigkeiten“, in: Schlögl (2004) 471–497. Fassler (2007): Margot Fassler, „Adventus at Chartres: Ritual Models for Major Processions“, in: Howe (2007) 13–62. Favro (1994): Diane Favro, „The Street Triumphant. The Urban Impact of Triumphal Parades“, in: Zeynep Çelik, Diane Favro u. Richard Ingersoll (Hgg.), Streets. Critical Perspectives on Public Space, Berkeley, 151–164. Felbecker (1995): Sabine Felbecker, Die Prozession. Historische und systematische Untersuchungen zu einer liturgischen Ausdruckshandlung, Altenberge. Fischer-Lichte (1998/2002): Erika Fischer-Lichte, „Grenzgänge und Tauschhandel. Auf dem Wege zu einer performativen Kultur“ (zuerst 1998), in: Wirth (2002) 277–300. Fischer-Lichte (2003): Erika Fischer-Lichte, „Performance, Inszenierung, Ritual. Zur Klärung kulturwissenschaftlicher Schlüsselbegriffe“, in: Martschukat u. Patzold (2003a) 34–54 Flaig (2003): Egon Flaig, Ritualisierte Politik. Zeichen, Gesten und Herrschaft im Alten Rom, Göttingen. Flaig (2003a): Egon Flaig, „Warum die Triumphe die römische Republik ruiniert haben – oder: Kann ein politisches System an zuviel Sinn zugrunde gehen?“, in: Hölkeskamp u.a. (2003) 299–313. Flaig (2009): Egon Flaig, „Neugründung der res publica und Racheritual“, in: Hölkeskamp u.a. (2009) 195–213. Fless (2004): Friederike Fless, „Römische Prozessionen“, in: Thesaurus Cultus et Rituum Antiquorum 1, 33–58.
Raum – Präsenz – Performanz
387
Flower (1996): Harriet I. Flower, Ancestor Masks and Aristocratic Power in Roman Culture, Oxford. Flower (2004): Harriet I. Flower, „Spectacle and Political Culture in the Roman Republic“, in: Harriet I. Flower (Hg.), The Cambridge Companion to the Roman Republic, Cambridge, 322–343. Frevert (2002): Ute Frevert, „Neue Politikgeschichte“, in: Joachim Eibach u. Günther Lottes (Hgg.), Kompass der Geschichtswissenschaft, Göttingen, 152–164. Frevert (2005): Ute Frevert, „Neue Politikgeschichte: Konzepte und Herausforderungen“, in: Ute Frevert u. Heinz-Gerhard Haupt (Hgg.), Neue Politikgeschichte. Perspektiven einer historischen Politikforschung, Frankfurt am Main, 7–26 FRH (2001/2004): Die Frühen Römischen Historiker, übersetzt und kommentiert von H. Beck u.U. Walter, Bd. I–II, Darmstadt. Galinsky (1996): Karl Galinsky, Augustan Culture. An Interpretive Introduction, Princeton. Galinsky (2005): Karl Galinsky (Hg.), The Cambridge Companion to the Age of Augustus, Cambridge. Gebauer u.Wulf (1998): Gunter Gebauer u. Christoph Wulf, Spiel – Ritual – Geste. Mimetisches Handeln in der sozialen Welt, Hamburg. Gedeon (2000): Luitgard Gedeon, „Prozessionen in Frankfurt am Main“, Archiv für mittelrheinische Kirchengeschichte 52, 11–53. Gengnagel u.a. (2008): Jörg Gengnagel, Monika Horstmann u. Gerald Schwedler (Hgg.), Prozessionen, Wallfahrten, Aufmärsche. Bewegung zwischen Religion und Politik in Europa und Asien seit dem Mittelalter, Köln. Gengnagel u.a. (2008a): Jörg Gengnagel, Monika Horstmann u. Gerald Schwedler, „Einleitung“, in: Gengnagel u.a. (2008) 3–15. Gestrich (1994): Andreas Gestrich, Absolutismus und Öffentlichkeit. Politische Kommunikation in Deutschland zu Begrinn des 18. Jahrhunderts, Göttingen. Giovannini (1991): Adalberto Giovannini, „Symbols and Rituals in Classical Athens“, in: Molho u.a. (1991) 459–478. Goldhill (1999): Simon Goldhill, „Programme notes“, in: Goldhill u. Osborne (1999) 1–29. Goldhill u. Osborne (1999): Simon Goldhill u. Robin Osborne (Hgg.), Performance culture and Athenian democracy, Cambridge. Goppold (2007): Uwe Goppold, Politische Kommunikation in den Städten der Vormoderne. Zürich und Münster im Vergleich, Köln. Gorse (1990): George L. Gorse, „Between Empire and Republic: Triumphal Entries into Genoa During the Sixteenth Century“, in: Wisch u. Munshower (1990) 188–257. Graf (1996): Fritz Graf, „Pompai in Greece. Some Considerations about Space and Ritual in the Greek Polis“, in: Robin Hägg (Hg.), The Role of Religion in the Early Greek Polis, Stockholm, 55–65. Graf (2000): Fritz Graf, „The Rite of the Argei – Once Again“, Museum Helveticum 57, 94–103. Griffin (1991): Miriam Griffin, „Urbs Roma, Plebs and Princeps“, in: Loveday Alexander (Hg.), Images of Empire, Sheffield, 19–46. Gunderson (1996): Eric Gunderson, „The ideology of the Arena“, Classicial Antiquity 15, 113–151. Guenée u. Lehoux (1968): Bernard Guenée u. Françoise Lehoux, Les entrées royales françaises de 1328 à 1515, Paris. Guenée u.a.(1997): Bernard Guenée, Christian Desplat u. Paul Mironneau (Hgg.), Les Entrées. Gloire et déclin d’un cérémonial. (Colloque … Château de Pau), Biarritz. Gutschow (2008): Niels Gutschow, „Begehungen und Umgehungen – das Durchmessen und die Besetzung von Raum durch Wallfahrten und Prozessionen“, in: Gengnagel u.a. (2008) 399–435. Habermas (1962/1971): Jürgen Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft (zuerst 1962), 2. Auflage, Neuwied u.a. Hanawalt u. Reyerson (1994): Barbara Hanawalt u. Kathryn L. Reyerson (Hgg.), City and Spectacle in Medieval Europe, Minneapolis.
388
Karl-Joachim Hölkeskamp
Harmon (1978): Daniel P. Harmon, „The Public Festivals of Rome“, in: Hildegard Temporini u. Wolfgang Haase (Hgg.), Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt, Bd. II 16, 2, Berlin, 1440–1468. von Heusinger (2007): Sabine von Heusinger, „‚Cruzgang‘ und ‚umblauf‘ – Symbolische Kommunikation im Stadtraum am Beispiel von Prozessionen“, in: Oberste (2007) 141–155. Hinard (1991): François Hinard, „Rome dans Rome. La Ville définie par les procédures administratives et les pratiques sociales“, in: Hinard u. Royo (1991) 31–54 Hinard u. Royo (1991): François Hinard u. Manuel Royo (Hgg.), Rome. L’espace urbain et ses représentations, Paris. Hölkeskamp (2001/2004a): Karl-Joachim Hölkeskamp, „Capitol, Comitium und Forum: Öffentliche Räume, sakrale Topographie und Erinnerungslandschaften“ (zuerst 2001), in: Hölkeskamp (2004a) 137–168. Hölkeskamp (2002): Karl-Joachim Hölkeskamp, „Ptolis and agore. Homer and the Archaeology of the City-State“, in: Franco Montanari (Hg.), Omero tremila anni dopo, Rom, 297–342. Hölkeskamp (2003): Karl-Joachim Hölkeskamp, „Institutionalisierung und Verortung. Die Entstehung der Öffentlichkeit im frühen Griechenland“, in: Hölkeskamp u.a. (2003) 81–104. Hölkeskamp (2004): Karl-Joachim Hölkeskamp, Rekonstruktionen einer Republik. Die politische Kultur des antiken Rom und die Forschung der letzten Jahrzehnte, München. Hölkeskamp (2004a): Karl-Joachim Hölkeskamp, Senatvs Popvlvsqve Romanvs. Die politische Kultur der Republik – Dimensionen und Deutungen, Stuttgart. Hölkeskamp (2004b): Karl-Joachim Hölkeskamp, „The Polis and its Spaces – the Politics of Spatiality. Tendencies in Recent Research“, Ordia Prima 3, 25–40. Hölkeskamp (2006): Karl-Joachim Hölkeskamp, „Konsens und Konkurrenz. Die politische Kultur der römischen Republik in neuer Sicht“, Klio. Beiträge zur alten Geschichte 88.2, 360–396. Hölkeskamp (2006a): Karl-Joachim Hölkeskamp, „Rituali e cerimonie „alla romana“. Nuove prospettive sulla cultura politica dell’età repubblicana“, Studi Storici 47, 2, 319–363. Hölkeskamp (2006b): Karl-Joachim Hölkeskamp, „History and Collective Memory in the Middle Republic“, in: Rosenstein u. Morstein-Marx (2006) 478–495. Hölkeskamp (2006c): Karl-Joachim Hölkeskamp, „Der Triumph – „erinnere Dich, daß Du ein Mensch bist““, in: Elke Stein-Hölkeskamp u. Karl-Joachim Hölkeskamp (Hgg.), Erinnerungsorte der Antike: Die römische Welt, München, 258–276, 745–747. Hölkeskamp (2006/2007): Karl-Joachim Hölkeskamp, „Pomp und Prozessionen. Rituale und Zeremonien in der politischen Kultur der römischen Republik“, Jahrbuch des Historischen Kollegs 2006 (2007) 35–72. Hölkeskamp (2008): Karl-Joachim Hölkeskamp, „Hierarchie und Konsens. Pompae in der politischen Kultur der römischen Republik“, in: Alexander Arweiler u. Bardo Gauly (Hgg.), Machtfragen. Zur kulturellen Repräsentation und Konstruktion von Macht in Antike, Mittelalter und Neuzeit, Stuttgart, 79–126. Hölkeskamp (2009a): Karl-Joachim Hölkeskamp, „Mythos und Politik – (nicht nur) in der Antike“, Historische Zeitschrift 237, 1–50. Hölkeskamp (2009b): Karl-Joachim Hölkeskamp, „Eine politische Kultur (in) der Krise? Gemäßigt radikale Vorbemerkungen zum kategorischen Imperativ der Konzepte“, in: Hölkeskamp u.a. (2009) 1–25. Hölkeskamp (2010a): Karl-Joachim Hölkeskamp, Reconstructing the Roman Republic. An Ancient Political Culture and Modern Research, Princeton. Hlökeskamp (2010b): Karl-Joachim Hölkeskamp, „Rezensionen zu Beard (2007) und Pittenger (2008)“, Gnomon 82, 130ff., 714ff. Hölkeskamp (2011): Karl-Joachim Hölkeskamp, „The Pageantry of Power – or: the Power of Pageantry, „Rezension zu Östenberg (2009)“, Classical Review 61, 220ff.
Raum – Präsenz – Performanz
389
Hölkeskamp u.a. (2003): Karl-Joachim Hölkeskamp, Jörn Rüsen, Elke Stein-Hölkeskamp u. Heinrich Th. Grütter (Hgg.), Sinn (in) der Antike. Orientierungssysteme, Leitbilder und Wertkonzepte im Altertum, Mainz. Hölkeskamp u.a. (2009): Karl-Joachim Hölkeskamp (Hg., unter Mitarbeit von Elisabeth Müller-Luckner), Eine politische Kultur (in) der Krise? Die „letzte Generation“ der römischen Republik, München. Hölscher (1998a): Tonio Hölscher, Öffentliche Räume in frühen griechischen Städten, Heidelberg. Hölscher (1998b): Tonio Hölscher, Aus der Frühzeit der Griechen. Räume – Körper – Mythen, Stuttgart. Hölscher (2001): Tonio Hölscher, „Die Alten vor Augen. Politische Denkmäler und öffentliches Gedächtnis im republikanischen Rom“, in: Melville (2001) 183–211. Hölscher (2003): Tonio Hölscher, „Körper, Handlung und Raum als Sinnfiguren in der griechischen Kunst und Kultur“, in: Hölkeskamp u.a. (2003) 163–192. Hölscher (2004): Tonio Hölscher, „Provokation und Transgression als politischer Habitus in der späten römischen Republik“, Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Römische Abteilung 111, 83–104. Hölscher (2009): Tonio Hölscher, „Denkmäler und Konsens. Die sensible Balance von Verdienst und Macht“, in: Hölkeskamp u.a. (2009) 161–181. Hoffmann (2001): Carl A. Hoffmann, „‚Öffentlichkeit‘ und ‚Kommunikation‘ in den Forschungen zur Vormoderne. Eine Skizze“, in: Carl A. Hoffmann u. Rolf Kießling (Hgg.), Kommunikation und Region, Konstanz, 69–110. Holliday (1990): Peter J. Holliday, „Processional Imagery in late Etruscan Funerary Art“, American Journal of Archaeology 94, 73–93. Hopkins (1991): Keith Hopkins, „From Violence to Blessing: Symbols and Rituals in Ancient Rome“, in: Molho u.a. (1991) 479–498. Howe (2007): Nicholas Howe (Hg.), Ceremonial Culture in Pre-Modern Europe, Notre Dame. Hunt (1984/1989): Lynn Hunt, Symbole der Macht – Macht der Symbole. Die Französische Revolution und der Entwurf einer politischen Kultur, Frankfurt am Main. (zuerst engl.: Politics, Culture, and Class in the French Revolution, Berkeley u.a.). Hugger (1987): Paul Hugger, „Einleitung: Das Fest – Perspektiven einer Forschungsgeschichte“, in: Hugger u.a. (1987) 9–24. Hugger u.a. (1987): Paul Hugger, Walter Burkert u. Ernst Lichtenhahn (Hgg.), Stadt und Fest. Zu Geschichte und Gegenwart europäischer Festkultur, Stuttgart u.a. Huskinson (2000): Janet Huskinson (Hg.), Experiencing Rome. Culture, Identity and Power in the Roman Empire, London. Iddeng (2012): Jon W. Iddeng, „What is a Graeco-Roman Festival? A Polythetic Approach“, in: Rasmus brandt u.a. (2012) 11–37. Itgenshorst (2005): Tanja Itgenshorst, Tota illa pompa. Der Triumph in der römischen Republik, Göttingen. Jehne (2003): Martin Jehne, „Integrationsrituale in der römischen Republik. Zur einbindenden Wirkung der Volksversammlungen“, in: Hölkeskamp u.a. (2003) 279–297. Johanek u. Lampen (2009): Peter Johanek u. Angelika Lampen (Hgg.), Adventus. Studien zum herrscherlichen Einzug in die Stadt, Köln u.a. Kavoulaki (1999): Athena Kavoulaki, „Processional performance and the democratic polis“, in: Goldhill u.Osborne (1999) 293–320. Keller (2001): Hagen Keller, „Ritual, Symbolik und Visualisierung in der Kultur des ottonischen Reiches“, Frühmittelalterliche Studien 35, 23–59. Kertzer (1988): David I. Kertzer, Ritual, Politics, and Power, New Haven u.a. Köhler (1996): Jens Köhler, Pompai. Untersuchungen zur hellenistischen Festkultur, Frankfurt am Main u.a. Koeppel (1969): Gerhard Koeppel, „Profectio und Adventus“, Bonner Jahrbücher 169, 130–194.
390
Karl-Joachim Hölkeskamp
Körber (1998): Esther-Beate Körber, Öffentlichkeit in der frühen Neuzeit. Teilnehmer, Formen, Institutionen und Entscheidungen öffentlicher Kommunikation im Herzogtum Preußen von 1525 bis 1618, Berlin u.a. Krasser u.a. (2008): Helmut Krasser, Dennis Pausch u. Ivana Petrovic (Hgg.), Triplici invectus triumpho. Der römische Triumph in augusteischer Zeit, Stuttgart. Krischer (2006): André Krischer, Reichsstädte in der Fürstengesellschaft. Politischer Zeichengebrauch in der Frühen Neuzeit, Darmstadt. Lampen (2009): Angelika Lampen, „Das Stadtttor als Bühne. Architektur und Zeremoniell“, in: Johanek u. Lampen (2009) 1–36. Lampen u.a. (2009): Angelika Lampen u. Peter Johanek, „Adventus. Studien zum herrscherlichen Einzug in die Stadt. Zur Einführung“, in: Johanek u. Lampen (2009) 7–16. Landwehr (2003): Achim Landwehr, „Diskurs – Macht – Wissen. Perspektiven einer Kulturgeschichte des Politischen“, Archiv für Kulturgeschichte 85, 71–117. Lang (1998): Bernhard Lang, „Ritual/Ritus“, in: Hubert Cancik, Burkhard Gladigow u. Karl-Heinz Kohl (Hgg.), Handbuch religionswissenschaftlicher Grundbegriffe, Bd. IV, 442–458. Latte (1960): Kurt Latte, Römische Religionsgeschichte, München. Laurence (1993): Ray Laurence, „Emperors, nature and the city: Rome’s ritual landscape“, The Accordia Research Papers 4, 79–87. Le Roy Ladurie (1979/1981): Emmanuel Le Roy Ladurie, Carnival in Romans. A People’s Uprising at Romans 1579–1580, Harmondsworth (franz. Orig. 1979). Linke (2006): Bernhard Linke, „Politik und Inszenierung in der Römischen Republik“, Aus Politik und Zeitgeschichte 7, 33–38. Löther (1996): Andrea Löther, „Rituale im Bild. Prozessionsdarstellungen bei Albrecht Dürer, Gentile Bellini und in der Konzilschronik Ulrich Richentals“, in: Andrea Löther, Ulrich Meier, Norbert Schnitzler, Gerd Schwerhoff u. Gabriela Signori (Hgg.), Mundus in imagine. Bildersprache und Lebenswelten im Mittelalter. Festgabe für Klaus Schreiner, München, 99–123. Löther (1998): Andrea Löther, „Städtische Prozessionen zwischen repräsentativer Öffentlichkeit, Teilhabe und Publikum“, in: Gert Melville u. Peter von Moos (Hgg.), Das Öffentliche und Private in der Vormoderne, Weimar u.a., 435–459. Löther (1999): Andrea Löther, Prozessionen in spätmittelalterlichen Städten. Politische Partizipation, obrigkeitliche Inszenierung, städtische Einheit, Köln. MacAloon (1984): John J. MacAloon, „Introduction: Cultural Performances, Cultural Theory“, in: John J. MacAloon (Hg.), Rite, Drama, Festival, Spectacle. Rehearsals Toward a Theory of Cultural Performance, Philadelphia, 1–15. MacCormack (1972): Sabine MacCormack, „Change and Continuity in Late antiquity: The Ceremony of Adventus“, Historia 21, 721–752. MacCormack (1981): Sabine MacCormack, Art and Ceremony in Late Antiquity, Berkeley. Marin (1987): Louis Marin, „Notes on a Semiotic Approach to Parade, Cortege, and Procession“, in: Alessandro Falassi (Hg.), Time out of Time. Essays on the Festival, Albuquerque, 223–228. Marshall (1984): Anthony J. Marshall, „Symbols and Showmanship in Roman Public Life: The Fasces“, Phoenix 38, 120–141. Martini (2008): Wolfram Martini, „Raum und Ritual im römischen Triumph. Die Wegstrecke des Triumphzuges“, in: Krasser u.a. (2008) 75–94. Martschukat u. Patzold (2003): Jürgen Martschukat u. Steffen Patzold, „Geschichtswissenschaft und ‚performative turn‘. Eine Einführung in Fragestellungen, Konzepte und Literatur“, in: Martschukat u.a. (2003a) 1–31. Martschukat u. Patzold (2003a): Jürgen Martschukat u. Steffen Patzold (Hgg.), Geschichtswissenschaft und „performative turn“. Ritual, Inszenierung und Performanz vom Mittelalter bis zur Neuzeit, Köln u.a.
Raum – Präsenz – Performanz
391
Maurizio (1998): Lisa Maurizio, „The Panathenaic Procession: Athens Participatory Democracy on Display?“ in: Deborah Boedeker u. Kurt A. Raaflaub (Hgg.), Democracy, Empire, and the Arts in Fifth-Century Athens, Cambridge (Mass.) u.a., 297–317, 415–421. Melville (2001): Gert Melville (Hg.), Institutionalität und Symbolisierung. Verstetigungen kultureller Ordnungsmuster in Vergangenheit und Gegenwart, Köln u.a. Mergel (2002): Thomas Mergel, „Überlegungen zu einer Kulturgeschichte der Politik“, Geschichte und Gesellschaft 28, 574–606. Mergel (2004): Thomas Mergel, „Kulturwissenschaft der Politik: Perspektiven und Trends“, in: Friedrich Jaeger u. Jörn Rüsen (Hgg.), Handbuch der Kulturwissenschaften, Bd. 3: Themen und Tendenzen, Stuttgart, 413–425. de Mérindol (1991): Christian de Mérindol, „Théâtre et politique à la fin du Moyen Âge. Les entrées royales et autres céremonies mises au point et nouveaux aperçus“, in: Comité des travaux historiques et scientifiques (Hg.), Théâtre et spectacles hier et aujourd’hui. Moyen Âge et Renaissance (Actes du 115e Congrès national des Sociétés Savantes), Paris, 179–212. de Mérindol (1997): Christian de Mérindol, „Entrées royales et princières à la fin de l’époque médiévale: jeux de taxinomie, d’emblématique et de symbolique“, in: Guenée u.a. (1997) 27–47. Mertens (2006): Dieter Mertens, Städte und Bauten der Westgriechen. Von der Kolonisation bis zur Krise am Ende des 5. Jh. v. Chr., München. Molho u.a. (1991): Anthony Molho, Kurt Raaflaub u. Julia Emlen (Hgg.), City-States in Classical Antiquity and Medieval Italy, Stuttgart. Morstein-Marx (2004): Robert Morstein-Marx, Mass Oratory and Political Power in the Late Roman Republic, Cambridge. Muir (1979): Edward Muir, „Images of Power: Art and Pageantry in Renaissance Venice“, American Historical Review 84, 16–52. Muir (1981): Edward Muir, Civic Ritual in Renaissance Venice, Princeton. Muir (1997): Edward Muir, Ritual in Early Modern Europe, Cambridge. Muir (2007): Edward Muir, „The Eye of the Procession: Ritual Ways of Seeing in the Renaissance“, in: Howe (2007) 129–153. Muir u. Weissman (1989): Edward Muir u. Ronald F.E. Weissman, „Social and symbolic places in Renaissance Venice and Florence“, in: John A. Agnew u. James S. Duncan (Hgg.), The Power of Place. Bringing together geographical and sociological imagination, Boston u.a., 81–103. Mumford (1979): Lewis Mumford, Die Stadt. Geschichte und Ausblick, München. Nagy (1985/1993): Blaise Nagy, „The Argei Puzzle“, American Journal of Ancient History 10, 1–27. Neils (1996): Jenifer Neils, „Pride, Pomp, and Circumstance: The Iconography of Procession“, in: Jenifer Neils (Hg.), Worshipping Athena. Panathenaia and Parthenon, Madison, 177–197. Nicolet (1976): Claude Nicolet, Le métier de citoyen dans la Rome républicaine, Paris. Nippel (1981): Wilfried Nippel, „Die plebs urbana und die Rolle der Gewalt in der späten römischen Republik“, in: Hans Mommsen u. Winfried Schulze (Hgg.), Vom Elend der Handarbeit, Stuttgart, 70–92. Nippel (1988): Wilfried Nippel, Aufruhr und „Polizei“ in der römischen Republik, Stuttgart. Nünning (2008): Ansgar Nünning (Hg.), Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie. Ansätze – Personen – Grundbegriffe, Stuttgart u.a. Oberste (2007): Jörg Oberste (Hg.), Kommunikation in mittelalterlichen Städten, Regensburg. Oberste (2007a): Jörg Oberste, „Einführung: Verdichtete Kommunikation und städtische Kultur“, in: Oberste (2007) 7–10. Osborne (1994): Robin Osborne, „Democracy and Imperialism in the Panathenaia Procession: The Parthenon Frieze in its Context“, in: William D.E. Coulson, Olga Palagaia, T. Leslie Shear, H. Alan Shapiro u. Frank J. Frost (Hgg.) The Archaeology of Athens and Atttica under the Democracy, Oxford, 143–150.
392
Karl-Joachim Hölkeskamp
Östenberg (2009): Ida Östenberg, Staging the World. Spoils, Captives, and Representations in the Roman Triumphal Procession, Oxford. Östenberg (2010): Ida Östenberg, „Circum metas fertur: An Alternative Reading of the Triumphal Route“, Historia 59, 303–320. Ozouf (1976): Mona Ozouf, La fête révolutionnare 1789–1799, Paris. Ozouf (1987): Mona Ozouf, „La fête révolutionnaire et l’espace urbain“, in: Hugger u.a. (1987) 89–102. Paravicini (1997): Werner Paravicini (Hg.), Zeremoniell und Raum. (4. Symposium der ResidenzenKommission der Akademie der Wissenschaften in Göttingen), Sigmaringen. Paravicini (1997a): Werner Paravicini, „Zeremoniell und Raum“, in: Werner Paravicini (1997) 11–36. Parker (1996): Robert Parker, Athenian Religion. A History, Oxford. Phythian-Adams (1972): Charles Phythian-Adams, „Ceremony and the citizen: The communal year at Coventry 1450–1550“, in: Peter Clark u. Paul Slack (Hgg.), Crisis and order in English towns 1500–1700. Essays in urban history, London, 57–85. Pittenger (2008): Miriam R. Pelikan Pittenger, Contested Triumphs. Politics, Pageantry, and Performance in Livy’s Republican Rome, Berkeley u.a. De Polignac (1995): François de Polignac, Cults, Territory, and the Origins of the Greek City-State, Chicago u.a. (überarbeitete Übers. von La naissance de la cité grecque, 1984). Price (1984): Simon Price, Rituals and Power. The Roman imperial cult in Asia Minor, Cambridge. Price (1987): Simon Price, „From noble funerals to divine cult: the consecration of Roman Emperors“, in: Cannadine u.a. (1987) 56–105. Rasmus Brandt u.a. (2012): Johann Rasmus Brandt u. Jon W. Iddeng (Hgg.), Greek and Roman Festivals. Content, Meaning, and Practice, Oxford. Rasmus Brandt u.a. (2012a): Johann Rasmus Brandt u. Jon W. Iddeng, „Introduction: Some Concepts of Ancient Festivals“, in: dies. (2012) 1–10. Rehberg (2001): Karl-Siegbert Rehberg, „Der ‚Fehltritt‘ als Heuristik bedrohter Integrität“, in: Peter von Moos (Hg.), Der Fehltritt. Vergehen und Versehen in der Vormoderne, Köln u.a., 419–446. Rehberg (2004): Karl-Siegbert Rehberg, „Institutionelle Ordnungen zwischen Ritual und Ritualisierung“, in: Wulf u. Zirfas (2004a) 247–265. Rehberg (2004a): Karl-Siegbert Rehberg, „Präsenzmagie und Zeichenhaftigkeit. Institutionelle Formen der Symbolisierung“, in: Gerd Althoff (Hg.), Zeichen – Rituale – Werte. (Internationales Kolloquium des Sonderforschungsbereichs 496 an der westfälischen Wilhelms-Universität Münster), Münster, 19–36. Reinhard (1999): Wolfgang Reinhard, Geschichte der Staatsgewalt. Eine vergleichende Verfassungsgeschichte Europas von den Anfängen bis zur Gegenwart, München. Rexroth (2003): Frank Rexroth, „Rituale und Ritualismus in der historischen Mittelalterforschung. Eine Skizze“, in: Hans-Werner Goetz u. Jörg Jarnut (Hgg.), Mediävistik im 21. Jahrhundert. Stand und Perspektiven der internationalen und interdisziplinären Mittelalterforschung, München, 391–406. Rexroth (2009): Frank Rexroth, „Politische Rituale und die Sprache des Politischen in der historischen Mittelalterforschung“, in: Angela De Benedictis, Gustavo Corni, Brigitte Mazohl u. Luise Schorn-Schütte (Hgg.), Die Sprache des Politischen in actu. Zum Verhältnis von politischem Dandeln und politischer Sprache von der Antike bis ins 20. Jahrhundert, Göttingen, 71–90. Rogge (2004): Jörg Rogge, „Kommunikation, Herrschaft und politische Kultur. Zur Praxis der öffentlichen Inszenierung und Darstellung von Ratsherrschaft in Städten des deutschen Reiches um 1500“, in: Schlögl (2004) 381–407. Rohe (1990): Karl Rohe, „Politische Kultur und ihre Analyse. Probleme und Perspektiven der politischen Kulturforschung“, Historische Zeitschrift 250, 321–346.
Raum – Präsenz – Performanz
393
Rohe (1994): Karl Rohe, „Politische Kultur: Zum Verständnis eines theoretischen Konzepts“, in: Oskar Niedermayer u. Klaus von Beyme (Hgg.), Politische Kultur in Ost- und Westdeutschland, Berlin, 1–21. Rosenstein u. Morstein-Marx (2006): Nathan Rosenstein u. Robert Morstein-Marx (Hgg.), A Companion to the Roman Republic, Malden u.a. Rüpke (1990): Jörg Rüpke, Domi militiae. Die religiöse Konstruktion des Krieges in Rom, Stuttgart. Rüpke (2001): Jörg Rüpke, Die Religion der Römer. Eine Einführung, München. Ruzé (1997): Françoise Ruzé, Délibération et pouvoir dans la cité grecque de Nestor à Socrate, Paris. Schenk (1996): Gerrit Jasper Schenk, Der Einzug des Herrschers. ‚Idealschema‘ und Fallstudie zum Adventuszeremoniell für römisch-deutsche Herrscher in spätmittelalterlichen italienischen Städten zwischen Zeremoniell, Diplomatie und Politik, Marburg. Schenk (2003): Gerrit Jasper Schenk, Zeremoniell und Politik. Herrschereinzüge im spätmittelalterlichen Reich, Köln u.a. Schipporeit (2008): Sven Th. Schipporeit, „Wege des Triumphes. Zum Verlauf der Triumphzüge im spätrepublikanischen und augusteischen Rom“, in: Krasser u.a. (2008) 95–136. Schlögel (2003): Karl Schlögel, Im Raume lesen wir die Zeit. Über Zivilisationsgeschichte und Geopolitik, München u.a. Schlögl (2004): Rudolf Schlögl (Hg.), Interaktion und Herrschaft. Die Politik der frühneuzeitlichen Stadt, Konstanz. Schlögl (2004a): Rudolf Schlögl, „Vergesellschaftung unter Anwesenden. Zur kommunikativen Form des Politischen in der vormodernen Stadt“, in: Schlögl (2004) 9–60. Schlögl (2005): Rudolf Schlögl, „Interaktion und Herrschaft. Probleme der politischen Kommunikation in der Stadt“, in: Stollberg-Rilinger (2005) 115–128. Schlögl (2008): Rudolf Schlögl, „Kommunikation und Vergesellschaftung unter Anwesenden. Formen des Sozialen und ihre Transformation in der Frühen Neuzeit“, Geschichte und Gesellschaft 34, 155–224. Schorn-Schütte (2006): Luise Schorn-Schütte, Historische Politikforschung. Eine Einführung, München. Schütte (1997): Ulrich Schütte, „Stadttor und Hausschwelle. Zur rituellen Bedeutung architektonischer Grenzen in der frühen Neuzeit“, in: Paravicini (1997) 305–324. Schweers (2009): Regine Schweers, „Die Bedeutung des Raumes für das Scheitern oder Gelingen des Adventus“, in: Johanek u. Lampen (2009) 37–55. Schwelling (2001): Birgit Schwelling, „Politische Kulturforschung als kultureller Blick auf das Politische. Überlegungen zu einer Neuorientierung der Politischen Kulturforschung nach dem ‚cultural turn‘“, Zeitschrift für Politikwissenschaft 11, 2, 601–629. Schwerhoff (1994): Gerd Schwerhoff, „Das rituelle Leben der mittelalterlichen Stadt. Richard C. Trexlers Florenzstudien als Herausforderung für die deutsche Geschichtsschreibung“, Geschichte in Köln 35, 33–60. Schwerhoff (2004): Gerd Schwerhoff, „Öffentliche Räume und politische Kultur in der frühneuzeitlichen Stadt: Eine Skizze am Beispiel der Reichsstadt Köln“, in: Schlögl (2004) 113–136. Signori (2008): Gabriela Signori, „Ereignis und Erinnerung: Das Ritual in der städtischen Memorialkultur des ausgehenden Mittelalters (14. und 15. Jahrhundert)“, in: Gengnagel u.a. (2008) 108–121. Scullard (1981): Howard H. Scullard, Festivals and Ceremonies of the Roman Republic, London. Smith (1996): Christopher J. Smith, Early Rome and Latium. Economy and Society c. 1000 to 500 BC, Oxford. Smith (2000): Christopher J. Smith, „Early and Archaic Rome“, in: J. Coulston u. H. Dodge (Hgg.), Ancient Rome: The Archaeology of the Eternal City, Oxford, 16–41.
394
Karl-Joachim Hölkeskamp
Snoek (2003): Joannes Snoek, „Performance, Performativity, and Practice. Against Terminological Confusion in Ritual Studies“, Paragrana. Internationale Zeitschrift für Historische Anthropologie 12, 1–2, 78–87. Stavrianopoulou (2006): Eftychia Stavrianopoulou (Hg.), Ritual and Communication in the GraecoRoman World, Liège. Stollberg-Rilinger (2000): Barbara Stollberg-Rilinger, „Zeremoniell, Ritual, Symbol. Neue Forschungen zur symbolischen Kommunikation in Spätmittelalter und Früher Neuzeit“, Zeitschrift für Historische Forschung 27, 389–405. Stollberg-Rilinger (2001): Barbara Stollberg-Rilinger, „Einleitung“, in: Barbara Stollberg-Rilinger (Hg.), Vormoderne politische Verfahren, Berlin, 9–24. Stollberg-Rilinger (2004): Barbara Stollberg-Rilinger, „Symbolische Kommunikation in der Vormoderne. Begriffe – Thesen – Forschungsperspektive“, Zeitschrift für Historische Forschung 31, 489–527. Stollberg-Rilinger (2005): Barbara Stollberg-Rilinger, „Was heißt Kulturgeschichte des Politischen? Einleitung“, in: Stollberg-Rilinger (2005) 9–24. Stollberg-Rilinger (2005a): Barbara Stollberg-Rilinger (Hg.), Was heißt Kulturgeschichte des Politischen?, Berlin. Stollberg-Rilinger u.a. (2008): Barbara Stollberg-Rilinger, Matthias Puhle, Jutta Götzmann u. Gerd Althoff (Hgg.), Spektakel der Macht. Rituale im alten Europa 800–1800, Darmstadt. Strong (1991): Roy Strong, Feste der Renaissance 1450–1650. Kunst als Instrument der Macht, Würzburg (zuerst engl. 1973, 1984). Sumi (2005): Geoffrey S. Sumi, Ceremony and Power. Performing Politics in Rome between Republic and Empire, Ann Arbor. Tambiah (1985/2002): Stanley J. Tambiah, „Eine performative Theorie des Rituals“, in: Wirth (2002) 210–242 (= Stanley J. Tambiah, „A Performative Approach to Ritual“, in: Stanley J. Tambiah, Culture, Thought, and Social Action. An Anthropological Perspective, Cambridge, Mass. 1985, 123–166). Tenfelde (1982): Klaus Tenfelde, „Adventus. Zur historischen Ikonologie des Festzuges“, Historische Zeitschrift 235, 45–84. Tenfelde (1987): Klaus Tenfelde, „Adventus: Die fürstliche Einholung als städtisches Fest“, in: Hugger u.a. (1987) 45–60. Thompson (2000): Dorothy Thompson, „Philadelphus’ Procession: Dynastic Power in a Mediterranean Context“, in: Leon Mooren (Hg.), Politics, Asministration and Society in the Hellenistic World, Leuven, 365–388. Trexler (1973): Richard C. Trexler, „Ritual Behavior in Renaissance Florence: The Setting“, Medievalia et Humanistica. Studies in Medieval and Renaissance Culture 4, 1973, 125–144. Trexler (1980/1994): Richard C. Trexler, Public Life in Renaissance Florence, Ithaca (zuerst 1980). Turner (1987): Victor Turner, The Anthropology of Performance, New York. Ulf (1982): Christoph Ulf, Das römische Lupercalienfest. Ein Modellfall für Methodenprobleme in der Altertumswissenschaft, Darmstadt. Vanderbroeck (1987): Paul J.J. Vanderbroeck, Popular Leadership and Collective Behavior in the Late Roman Republic, Amsterdam. Ventrone (2003): Paola Ventrone, „Feste e rituali civici: città italiane a confronto“, in: Giorgio Chittolini u. Peter Johanek (Hgg.), Aspetti e componenti dell’identità urbana in Italian e in Germania (secoli XIV–XVI) – Aspekte und Komponenten der städtischen Identität in Italien und Deutschland (14.–16. Jahrhundert), Bologna u.a. Veyne (1976/1988): Paul Veyne, Le pain et le cirque. Sociologie historique d’un pluralisme politique, Paris (dt. 1988).
Raum – Präsenz – Performanz
395
Vierhaus (1995): Rudolf Vierhaus, „Die Rekonstruktion historischer Lebenswelten. Probleme moderner Kulturgeschichtsschreibung“, in: Hartmut Lehmann (Hg.), Wege zu einer neuen Kulturgeschichte, Göttingen, 7–28. Visceglia (2002): Maria Antonietta Visceglia, La città rituale. Roma e le sue cerimonie in età moderna, Rom. Walbank (1996): Frank Walbank, „Two Hellenistic Processions: A Matter of Self-Definition“, Scripta Classica Israelica 15, 119–130. Wallace-Hadrill (2008): Andrew Wallace-Hadrill, Rome’s Cultural Revolution, Cambridge. Watanabe-O’Kelly (2002): Helen Watanabe-O’Kelly, „Early Modern European Festivals – Politics and Performance, Event and Record“, in: J.R. Mulryne, Helen Watanabe-O’Kelly u. Margaret Shewring, Europa Triumphans. Court and Civic Festivals in Early Modern Europe, Aldershot u.a., 15–25. Weinfurter (2005): Stefan Weinfurter, „Die Welt der Rituale: Eine Einleitung“, in: Ambos u.a. (2005) 1–7. Weiß (2004): Dieter J. Weiß, „Prozessionsforschung und Geschichtswissenschaft“, Jahrbuch für Volkskunde N.F. 27, 63–79. Weller (2006): Thomas Weller, Theatrum Praecedentiae. Zeremonieller Rang und gesellschaftliche Ordnung in der frühneuzeitlichen Stadt: Leipzig 1500–1800, Darmstadt. Wirth (2002): Uwe Wirth (Hg.), Performanz. Zwischen Sprachphilosophie und Kulturwissenschaften, Frankfurt am Main. Wisch u. Munshower (1990): Barbara Wisch u. Susan Scott Munshower (Hgg.), „All the world’s a stage …“. Art and Pageantry in the Renaissance and Baroque, Pennsylvania. Wiseman (1995): T. Peter Wiseman, Remus. A Roman myth, Cambridge. Wissowa (1912): Georg Wissowa, Religion und Kultus der Römer, 2. Auflage, München. Würgler (1995): Andreas Würgler, Unruhen und Öffentlichkeit. Städtische und ländliche Protestbewegungen im 18. Jahrhundert, Tübingen. Wulf u. Zirfas (2001): Christoph Wulf u. Jörg Zirfas, „Die performative Bildung von Gemeinschaften. Zur Hervorbringung des Sozialen in Ritualen und Ritualisierungen“, Paragrana. Internationale Zeitschrift für Historische Anthropologie 10, 1, 93–116. Wulf u. Zirfas (2003): Christoph Wulf u. Jörg Zirfas, „Anthropologie und Ritual. Eine Einleitung“, Paragrana. Internationale Zeitschrift für Historische Anthropologie 12, 1–2, 11–28. Wulf u. Zirfas (2004): Christoph Wulf u. Jörg Zirfas, „Performative Welten. Einführung in die historischen, systematischen und methodischen Dimensionen des Rituals“, in: dies. (2004) 7–45. Wulf u. Zirfas (2004a): Christoph Wulf u. Jörg Zirfas (Hgg.), Die Kultur des Rituals. Inszenierungen. Praktiken. Symbole, München. Yatromanolakis u. Roilos (2004): Dimitrios Yatromanolakis u. Panagiotis Roilos, „Provisionally Structured Ideas on a Heuristically Defined Concept: Toward a Ritual Poetics“, in: Dimitrios Yatromanolakis u. Panagiotis Roilos, Greek Ritual Poetics, Cambridge Mass.u.a., 3–34. Zanker (1987): Paul Zanker, Augustus und die Macht der Bilder, München. Zanker (2004): Paul Zanker, Die Apotheose der römischen Kaiser. Ritual und städtische Bühne, München. Ziehen (1949): Ludwig Ziehen, „Panathenaia“, in: Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft 18, 3, 1949, 457–493.
Abbildungsnachweise Abb. 1 Abb. 2
K.-J. Hölkeskamp Hölkeskamp (2006c) 262 Abb. 29
396
Alain Schnapp
Alain Schnapp
Im Schatten der Pyramiden Ruinen sind nicht nur Monumente der Vergangenheit, sie verkörpern auch die Vergänglichkeit des menschlichen Lebens, sie erwecken zugleich Angst und Freude: Angst vor dem Tode einerseits, und andererseits, wie Denis Diderot sagt, die Freude des Philosophen, der durch die Ruinen einen Blick auf die Dimension der Geschichte gewinnt. Die Gegenüberstellung von Ruinen und menschlichem Dasein ist eine Erfindung der Aufklärung und der Romantik, aber das Thema wird bereits in der Antike berührt. Hekataios von Abdera schrieb im 3. Jahrhundert v. Chr. nach seiner Reise nach Ägypten: Die Einheimischen geben der im Leben verbrachten Zeit einen ganz geringen Wert. Dagegen legen sie das größte Gewicht auf ihre Zeit nach dem Tode, während der man durch die Erinnerung an die Tugend (areté) im Gedächtnis bewahrt wird. Die Behausungen der Lebenden nennen sie ‚Absteigen‘ (katalyseis), da wir nur kurze Zeit in ihnen wohnten. Die Gräber der Verstorbenen bezeichnen sie als ‚ewige Häuser‘ (aidioi oikoi), da sie die unendliche Zeit im Hades verbrächten.1
1 Die Dichter sind langlebiger als die Monumente Das Ewigkeitsbegehren ist nach Auffassung von Jan Assmann „die spezifisch ägyptische Form von Todesvergessenheit“. Ein Papyrustext des mittleren Reiches lautet: Die da bauten in Granit, die schönen Pyramiden bauten in vollendeter Arbeit. Sobald die Bauherrn gestorben sind, blieben die Opfersteine leer …2
Die Pharaonen und edlen Leute der Vergangenheit haben Pyramiden und Gräber errichtet, die tausend Jahre alt sind, aber ihre Namen sind vergessen und ihre Bauten stehen öd und leer. Nur die Dichter sind unsterblich, unsterblicher sicher als die Großen, wie es im Chester Beatty Papyrus heißt: Jene gelehrten Schreiber aber seit der Zeit derer, die nach den Göttern kamen, jene Zukunfts-Wahrsager, sie sind zu solchen geworden, deren Name in Ewigkeit bleibt, obwohl sie dahingegangen sind, nachdem sie ihre Lebenszeit vollendet hatten, und alle ihre Zeitgenossen vergessen sind.
1 Diod. 1,51, zitiert nach Assmann (1995) 223–224. 2 Pap. Berlin 3024 (55–68), zitiert nach Assmann (1995) 224.
Im Schatten der Pyramiden
397
Sie haben sich keine Pyramiden aus Erz geschaffen und keine Stelen dazu aus Eisen; sie haben es nicht verstanden, Erben zu hinterlassen in Gestalt von Kindern, ihre Namen lebendig zu erhalten. Doch sie schufen sich Bücher als Erben und Lehren, die sie verfasst haben. (…) Man machte ihnen Tore und Kapellen – sie sind zerfallen; ihre Totenpriester sind davongegangen, ihre Altäre sind erdverschmutzt, ihre Grabkapellen vergessen. Aber man nennt ihre Namen auf ihren Schriften, die sie geschaffen haben (…) Wertvoller ist ein Buch als ein Grabstein mit Inschrift, als eine festgefügte Grabkammer. Diese Bücher handeln als Grab und Pyramide, um ihre Namen lebendig zu erhalten. Es ist gewiss etwas Wertvolles im Jenseits: ein Name im Munde des Menschen.3
Die Dichter sind die wirklichen und ernsthaften Träger der Erinnerung, nur Menschen können an andere Menschen denken. Der Dichter ist der einzige, der diese Macht der Zeit überwinden kann. Deshalb sind die Ruinen ohne Dichter wertlos. Keiner hat das besser verstanden als Diderot: Die Ideen, die Ruinen in mir erwecken, sind groß. Alles wird zunichte gemacht, alles verfällt, alles vergeht. Allein die Erde bleibt noch übrig. Allein die Zeit dauert an. Wie die Welt doch alt ist.4
Mit diesen kurzen Zeilen begründet Diderot die in der Neuzeit vorherrschende Auffassung der Ruinen. Er verknüpft die Geschichte der Menschheit und die Geschichte der Natur. Er erkennt den Philosophen und Dichter als Begründer der Neuzeit. Diese Erkenntnis wird bei Chateaubriand noch weiter gefasst, seiner Auffassung nach haben die Ruinen in Ägypten eine besondere Bedeutung: Die Ruinen haben einen anderen Charakter in Ägypten; häufig zeigen sie auf engem Raume alle Arten und Stile von Bauwerken und alle Arten von Erinnerung. Die Sphinx und die Säulen des altägyptischen Stils erheben sich neben der schlanken korinthischen Säule; ein Bruchstück in Toskanischer Ordnung fügt sich in einen arabischen Turm ein. Unzählige Trümmer sind in den Nil gerollt, liegen im Boden vergraben, sind unter Gras verborgen; Felder von Bohnen oder Reis oder weite Flächen mit Klee erstrecken sich im Umkreis.5
Die Ruinen Ägyptens sind ein mikrokosmos der Geschichte. Jede Epoche hat materielle Reste auf dieser Erde hinterlassen. Die verschiedenen Kulturen sind zu einem 3 Pap. Chester Beatty IV, zitiert nach Assmann (1995) 175. 4 Diderot (1990) 338. 5 de Chateaubriand (1804) 25–27.
398
Alain Schnapp
Bild der Ruinen verschmolzen, das die Phantasie des Schriftstellers oder Dichters erregt. Zugleich spürt man da das Wirken der Natur, die Geschichtlichkeit der Monumente wird durch die Strömung und die Pflanzen überdeckt. Die Natur besiegt die Geschichte. Die Surrealisten sind in dieser Hinsicht noch weitergegangen. In einem berühmten Gedicht schreibt Benjamin Péret: Der Mensch beneidet das stille Glück der Muschel und der Schnecke und er strebt – wenn’s ein jämmerlicher Kleinbürger ist – nach der abscheulichen Vorstadtvilla, nach der Strohhütte, wenn er Nomade ist, und wenn er Künstler ist nach irgendeiner sammetschaumigen Ruine, die er der Vegetation und den Raubvögeln abtrotzen müssen wird, einer Ruine, die er in seine engere Heimat verpflanzen wird, falls er Bereicherung im Wursthandel findet.6
Was ist am Ende Sinn und Bedeutung der Ruinen? Volney und Chateaubriand haben die Ruinen Ägyptens als eine eigenartige Darstellung der Vergangenheit gesehen. Aber wie sahen die Bewohner des Landes die Ruinen der Pharaonen? Ein Schreiber des 12. Jahrhunderts, Ali Bagdhadi, erkannte in den Pyramiden eine Schöpfung der Menschheit, ein Produkt des menschlichen Wissens: Wenn ihr darüber nachdenkt, werdet ihr entdecken, dass die größten Geister in irgendeiner Weise daran beteiligt waren. Die aufgeklärtesten Seelen haben ihre ganze Kraft darauf verwendet. Das Wissen der Bautechniker hat sie als Beispiel ihrer höchsten Fähigkeiten errichtet. Sie (die Pyramiden) sind fast in der Lage, von ihren Erbauern zu sprechen, uns ihre hohe Stellung mitzuteilen, uns über ihre Wissenschaft und ihre Intelligenz zu unterrichten und ihre Lebensläufe und ihre Erinnerungen zu überliefern.7
Für Ali Baghdadi sind die Pyramiden die Monumente einer aufgeklärten Kultur, eine Ausprägung der Vernunft und des Wissens einer hochentwickelten Gesellschaft. Obwohl er nicht in der Lage ist, die Hieroglyphen zu verstehen, kann er Wert und Bedeutung der Ingenieure und Architekten einschätzen. Der Historiker des 15. Jahrhunderts Jalal al-Din al-Suyuti zitiert einen Dichter, der die Pyramiden mehr als ein Kunstereignis, ein Wunder denn als eine menschliche Schöpfung sah: Die Pyramiden sind eine Herausforderung des Geistes für alle intelligenten Menschen, und die hochfliegendsten Träume verlieren angesichts ihrer Unermesslichkeit jede Bedeutung. Ihre Oberfläche ist glatt, sie haben die Form eines Dreiecks und sind so hoch, dass ein Pfeil, der zu ihrer Spitze hin abgeschossen wird, diese nicht erreichen kann. Ich weiß nicht – denn jeder Gedanke ist vor ihnen unzureichend, und jede Vermutung wird von ihrem Glanz geblendet –, ob sie die Gräber heidnischer Könige sind, Talismane gegen (die Verwüstung) des Sandes oder Denkmäler.8
6 Péret (1939) 12–13, 57 (Übersetzung Martin Stritt). 7 Baghdadi, Al-Ifadah (1161–1231), zitiert bei El-Daly (2005) 48. 8 al-Suyuti (1939) 21.
Im Schatten der Pyramiden
399
Die Pyramiden waren schon für die Bevölkerung Ägyptens des Mittelalters eine Erscheinung von ganz eigener Art. In ihrem Schatten haben viele Historiker und Dichter eine Lehre der Wissenschaft und Kunst zu finden gesucht. Ihre schiere Größe und massive Bauweise erheben sie über alles. In dieser Rezeption der Pyramiden können wir eine gewisse Kontinuität finden. Für die Ägypter selbst aber sind die Pyramiden Zeichen einer unendlichen Vergangenheit, die dennoch durch die Zeit bedroht sind. Sie sind Träger der Kunst einer edlen Vorzeit. In der Geschichte der Menschheit gibt es einen einzigen Moment, der die Beziehung zwischen Monumentalität und Gedächtnis so eindringlich aufzeigt wie die Pyramiden in Ägypten: die Zeit der Errichtung der ‚Chinesischen Mauer‘. Wir wissen sehr wenig von diesem Bau. Die Überlieferung scheint nach den ersten schriftlichen Quellen im 7. Jahrhundert v. Chr. im Qi-Staat zu beginnen, und es folgten Berichte über zahlreiche andere Mauern. Der Beginn des Baus der Mauer als solcher wird mit der Festlegung einer neuen Grenze in den Jahren 207–201 v. Chr. in Verbindung gebracht, die durch den Ersten Kaiser von Qin erfolgte, der sich als Erhabener Gottherrscher, „Huangdi“, bezeichnete. Diese Grenze wird „zehntausend li lange Mauer“ genannt9. Die Überlieferung folgt zwei verschiedenen Auffassungen, von denen die erste die kaum glaubliche Größe des Werkes unterstreicht: Der Kaiser ist der Gründer eines Baus, der grösser ist als jedes andere Bauwerk. Die zweite Auffassung hat mit der Darstellung der Macht zu tun: Der Kaiser ist ein Neugründer, der eine neue Welt erschafft, aber diese neue Welt stammt aus der Urgeschichte. Dieter Kuhn kommentiert: Der Terminus huang war von den Drei Erhabenen (sanhuang), den Urkaisern, abgeleitet, und di verwies auf die fünf Kaiser (wudi) die vor der Xia (Ur)Dynastie das Land regiert haben sollen.10
Der Gründer des Kaisertums gilt zugleich als Errichter der Mauer und als derjenige, der die Verbrennung der alten Bücher veranlasste. Letzteres bedeutet einen Kampf gegen die Tradition und das Altertumserbe. Sein Berater Li Si soll in einem Ausfall gegen die Konfuzianer behauptet haben: Die Gelehrten nehmen sich nicht die Gegenwart zur Vorbild, sondern studieren das Altertum, um die heutige Zeit herabzuwürdigen und Zweifel und Unruhe in den Massen zu erregen. … Im Altertum war das Reich zerrissen und voll Aufruhr. Niemand war da, der es einigen konnte. … [Die konfuzianischen Gelehrten] aber machen in ihren Reden das Altertum zum Leitbild und tun damit der Gegenwart Gewalt an.11
Für Li Si und den Ersten Kaiser ist das Studium des Altertums eine Ideologie, die ihre neue Politik gefährdet. Die Vergangenheit bedroht die Gegenwart. Alles muss vernichtet werden, um eine neue Welt zu gründen.
9 Waldron (1990) 13–15. 10 Kuhn (2001) 67. 11 Si Maqian (1967) 171–172.
400
Alain Schnapp
2 Borges und der Schatten der Mauer Borges, der die chinesische Klassik durch die Übersetzungen von Herbert Allen Giles kannte, hat einen Aufsatz über den Ersten Kaiser geschrieben, in dem er die Geschichte der Erbauung der Mauer wiedergibt: Ich las vor einigen Tagen, dass der Mann, der den Bau der nahezu unendlichen Chinesischen Mauer anordnete, jener erste Kaiser war, Schih Huang Ti [=Shihuangdi in der gängigen pinyinUmschrift], der ebenso alle Bücher verbrennen ließ, die vor ihm da waren. Dass die beiden weitreichenden Operationen – die zweieinhalb- bis dreitausend Kilometer aus Stein zur Abwehr der Barbaren, die rücksichtslose Beseitigung der Geschichte, das heißt der Vergangenheit – von einer Person ausgingen und irgendwie deren Attribute waren, befriedigte mich auf unerklärliche Weise und beunruhigte mich zugleich.12
Die Beziehung zwischen Errichtung der Mauer und Verbrennung der Bücher wird in dieser Deutung von Borges eine strukturelle Dimension des Wirkens und der historischen Figur des Ersten Kaisers. Das ist natürlich eine Erklärung, die mehr von Herbert A. Giles stammt als von Sima Qian. Für die Erforscher der Geschichte Chinas sind die Verbrennung der Bücher und der Bau der Mauer zwar Taten ein und desselben Kaisers, aber sie gehören doch in zwei verschiedene Welten. Die Bücherverbrennung hat mit der Geschichte der Gelehrsamkeit zu tun, mit der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, während der Bau der Mauer eine Aufgabe des Herrschers ist, die in den Bereich der Zukunft gehört. Borges’ philosophische und poetische Analyse versucht indes eine unwiderlegbare Beziehung zwischen den beiden Ereignissen herzustellen: Bücher verbrennen und Befestigungen bauen ist allgemein Aufgabe von Herrschern; das einzig Merkwürdige an Schih Huang Ti ist das Ausmaß seines Wirkens.13
Aber Borges geht noch weiter und versucht der Psychologie des Kaisers näherzukommen: Schih Huang Ti untersagte, den Geschichtsschreibern zufolge, die Erwähnung des Todes und suchte nach dem Elixier der Unsterblichkeit und schloss sich in einem symbolhaften Palast ein, der aus so vielen Gemächern bestand, wie das Jahr Tage hat; diese Daten suggerieren, dass die Mauer im Raum und der Brand in der Zeit magische Schranken waren, die den Tod aufhalten sollten.14
Borges Deutung erinnert an das Gedicht, das über dem Eingang des Hauses der Crescentii in Rom steht, ein Haus, das völlig aus römischen Spolien erbaut ist:
12 Borges (2007). 13 Ebenda (2007) 14. 14 Ebenda (2007) 12.
Im Schatten der Pyramiden
401
… Nulli sua vita perhenis mansio nostra brevis cursus et ipse levis. si fugas ventum, si claudas ostia centum, lisgor mille jubes, non sine morte cubes.15
Ich weiß nicht, ob Borges dieses Gedicht je gelesen hat, aber die Metapher der 365 Räume entspricht ihm. Ob der Kaiser zugleich ein Gründer und ein Zerstörer war, oder zuerst ein Zerstörer und dann ein Gründer, ist nicht klar. Beide Vermutungen sind möglich, doch in Borges’ Darstellung sind das Bauen und das Verbrennen Teile ein und derselben Geschichte. Aber der Autor beschränkt sich nicht auf diese Feststellung, sondern er fügt noch eine andere Bemerkung hinzu: Vielleicht war die Mauer eine Metapher, vielleicht verurteilte Schih Huang Ti die Verehrer der Vergangenheit zu einem Werk, das ebenso weit, so schwerfällig und so nutzlos war wie die Vergangenheit.16
Hat die Macht des Kaisers mehr mit der Vergangenheit als mit der Zukunft zu tun? Diese Frage bildet sicher den Kern bei Borges’ Interesse an der Geschichte des ersten Kaisers von China. Der Kaiser, so Borges, stellte sich selbst diese Frage: Die Menschen lieben di Vergangenheit und gegen diese Liebe vermag ich nichts, so wenig wie meine Henker, aber vielleicht wird es einmal einen Menschen geben, der so fühlt wie ich, und dieser wird meine Mauer zerstören, wie ich die Bücher zerstört habe, und dieser wir mein Andenken austilgen und wird mein Schatten und mein Spiegel sein und es nicht wissen.17
Borges folgt hier einer Tradition, die in Wahrheit mehr mesopotamisch ist als chinesisch. Die Könige Mesopotamiens versuchten in einer ähnlichen Weise Vergangenheit und Zukunft zu verknüpfen. Das „Temenu“, d.h. die Inschrift, die an den Bau eines Tempels erinnerte, war auf einer Tontafel oder einem Ziegel niedergeschrieben und den Königen der Zukunft gewidmet. Wehe dem König, der die alte Inschriften seinen Vorgänger nicht schätzte! Wehe dem Nachfolger, die sie nicht las und nicht nachschreiben wollte! Der unbekannte Leser bei Borges ist wie der unbekannte Mensch für den Kaiser und wird, indem er die Mauer zerstört, zum Rächer: Er ruft die verbrannten Bücher ins Leben zurück. Die Erinnerung ist wie eine Entschädigung: Jeder findet im Laufe der Geschichte den Preis seiner Tugend, jeder Akt verursacht einen Gegenakt.
15 Inschrift an der Fassade der Casa dei Crescenzi, Rom, 12. Jahrhundert. „Für niemanden währt sein Leben ewig, unser Verbleiben ist kurz und sein ganzer Verlauf ist flüchtig. Auch wenn du dem Wind entkämest, auch wenn du hundert Türen schließen oder über tausend Schildwachen gebieten könntest, würdest du dich nicht niederlegen können ohne zu sterben“. Apolloni (1940) 28–29. 16 Borges (2007) 13. 17 Ebenda (2007) 13.
402
Alain Schnapp
Die trutzige Mauer, die in diesem Augenblick und in jedem Augenblick über Länder, die ich nicht sehen werde, ihr Schattensystem erstreckt, ist der Schatten eines Cäsaren, der anordnete, dass die ehrerbietigste unter allen Nationen ihre Vergangenheit verbrenne; wahrscheinlich berührt uns der Gedanke als solcher, abgesehen von den Mutmaßungen, die er erlaubt. (Seine Kraft mag auf dem Gegensatz zwischen Errichten und Zerstören, in ihrem ungeheuren Ausmaß beruhen).18
Errichten und Zerstören sind eine Metapher der Erinnerung und des Vergessens. Was Shihuangdi betrifft, so ist es nicht der Schatten seiner unbeschränkten Macht, der ihn quält, sondern es ist seine unüberwindbare Angst, vergessen zu werden. Bücherverbrennung und Mauergründung sind ein Mittel gegen das Vergessen. Die Interpretation bei Borges ist eine Stellungnahme zur Kunst und Wissenschaft des Vergessens und steht einem anderen seiner Werke gegenüber: Funes il Memorioso. Dabei geht es um das unerbittliche Gedächtnis eines Mannes, der, anders als der Kaiser, nicht das Vergessen, sondern das Gedächtnis fürchtet. Wer sich an alles erinnert, kann nicht mehr denken. Für Funes, der imstande ist, sich an alles zu erinnern, ist die Erinnerung an und für sich eine Leidenschaft. Jemand der so viel Gedächtnis hat, scheint selbst ein Monument zu werden: „Ireneo war neunzehn Jahre alt; er war 1868 geboren; er schien mir monumental wie Erz, älter als Ägypten, früher als die Prophezeiungen und die Pyramiden.19“ Die Ruinen verkörpern ein materielles Gedächtnis, aber die wenigen Menschen, die ein unendliches Gedächtnis besitzen, werden selbst Ruinen. Sie sind Monumente, die das Geschehen der ganzen Welt mit sich tragen. Zwischen Erinnerung und Vergessen muss ein Gleichgewicht herrschen. Ebenso wie die Menschen, die den Prozess des Erinnerns vernichten wollen, sich damit selber vernichten, sind die Mnemonisten Menschen, die ihr unerbittliches Gedächtnis nicht ertragen können. Sie werden zu lebendigen Ruinen. Keiner hat das mehr empfunden als Benjamin Péret: Gejagt von tausend quälenden Gespenstern kommt der Mensch schreiend aus einem Schloss unvergesslicher Finsternis hervor, das ihn sein ganzes Leben lang heimsucht bis er, tot, in ein anderes Schloss eingesperrt wird, ein lächerliches Vogelscheuchenschloss, gebaut nach den Maßen des Wurms, der an ihm nagt. Aber da haben wir ihn, den Menschen, sich selbst Gespenst und Schloss, in dem sein eigenes Gespenst spukt. Wie fern man ihn antrifft, so jung man ihn sieht, sein Verlangen nimmt die Form eines Schlosses an: sei es die einem Bär streitig gemachte Höhle oder das winzige Konstrukt, von dem die Erinnerung nichts als das Bild eines Glimmersteins bewahrt.20
Zwischen Mensch und Monument, sei es Monument der Natur oder Monument der Kultur, besteht eine strukturelle Beziehung: die Wohnung des Menschen ist die frühere Wohnung anderer Menschen oder Tiere. Von einem Bewohner zum anderen geht
18 Borges (2007) 13–14. 19 Borges (1992) 103. 20 Péret (1939) 57.
Im Schatten der Pyramiden
403
die Erinnerung verloren, die Menschen wissen nicht, wer ihre Vorgänger gewesen sind. Jede Gesellschaft versucht ohne es zu wissen die unmittelbaren Vorgänger zu ignorieren und zu vergessen, indem sie ihre sogenannten Vorfahren verherrlicht: Eine Ruine jagt die andere, diejenige die ihr vorausging und sie umbringt. Aus den eingestürzten Burgen der Feudalherren quillt eine zähe Lava, die für immer die Arenen und übrigen römischen Zirkusse erstickt.21
Zwischen Borges und Péret besteht eine besondere Parallelität der Interpretationen, aber Péret geht es doch um einen anderen Zusammenhang zwischen Erinnerung und Vergessen: Er sieht in jeder Erinnerung an die Vergangenheit den Prozess eines unwiderstehlichen Vergessens. Man könnte meinen, dass jeder Erinnerungsprozess für Péret eine lächerliche Nachahmung des Geschehens ist: Nichts wäre an der kollektiven Kindheit zu verleugnen, außer für die Gesellschaften, die ihrer unwürdig geworden sind und sie glorifizieren, nur um sie besser zu verleugnen. Mussolini feiert das antike Rom, obwohl seine Taten dem Fortschritt, den Rom der Welt gebracht hat, zuwiderlaufen. Stalin versucht, eine tote Ruine aus Lenin zu machen, um ihn besser zu verraten. Es ist damit überall das Gleiche. Die Ruinen werden von denjenigen verleugnet, für die das Leben schon nichts mehr anderes ist als eine Ruine, von der nichts weiter übrigbleiben wird als das Andenken eines Ausspuckens.22
Péret geht in den Konsequenzen seiner poetischen Einstellung bis an die äußerste Grenze und meint, die Menschheit könne sich nicht von dem Druck der Ruinen befreien und die Gesellschaften seien ihrer Vorfahren unwürdig. Zu Beginn von Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte schrieb Karl Marx: „Hegel bemerkt irgendwo, dass alle großen weltgeschichtlichen Tatsachen und Personen sich sozusagen zweimal ereignen. Er hat vergessen hinzuzufügen: das eine Mal als Tragödie, das andere Mal als Farce.23“ Als guter Surrealist geht Péret in seiner Ironie noch weiter. Für ihn bedeutet die Geschichte der Menschheit einen kontinuierlichen Prozess von Vergessen und Erinnerung, doch wer weiß, was im Grunde besser ist: Wahnsinnige Monumente oder irrige Erklärungen der Vorzeit? In den Augen von Borges und Péret sind die Ruinen eine Belastung, aber auch eine Notwendigkeit der Gesellschaften.
21 Ebenda (1939) 59. 22 Ebenda (1939) 58–59. 23 Marx (1885) 7.
404
Alain Schnapp
3 Kafka und die Ansichten eines Vorarbeiters Kafka folgt einer anderen Richtung. Anders als Borges beginnt Kafka mit einer sorgfältigen Beschreibung der Großen Mauer. Was ihn interessiert, ist der Bauprozess: Die Chinesische Mauer ist an ihrer nördlichsten Stelle beendet worden. Von Südosten und Südwesten wurde der Bau herangeführt und hier vereinigt. Dieses System des Teilbaues wurde auch im Kleinen innerhalb der zwei großen Arbeitsheere, des Ost- und des Westheeres, befolgt. Es geschah das so, dass Gruppen von etwa zwanzig Arbeitern gebildet wurden, welche eine Teilmauer von etwa fünfhundert Metern Länge aufzuführen hatten, eine Nachbargruppe baute ihnen dann eine Mauer von gleicher Länge entgegen. Nachdem dann aber die Vereinigung vollzogen war, wurde nicht etwa der Bau am Ende dieser tausend Meter wieder fortgesetzt, vielmehr wurden die Arbeitergruppen wieder in ganz andere Gegenden zum Mauerbau verschickt. Natürlich entstanden auf diese Weise viele große Lücken, die erst nach und nach langsam ausgefüllt wurden, manche sogar erst, nachdem der Mauerbau schon als vollendet verkündigt worden war.24
Diese Lücken stellen von Anfang an eine entscheidende Frage: Was ist der Zweck der Mauer, was ist das Ziel einer so imponierenden Struktur? Von Anfang an ist das Projekt der Errichtung der Mauer ein kollektives Unternehmen des Staates, dessen Vollendung auf der Kraft des Volkes beruht: Schule und Unterricht sollen die Wissenschaft der Baukunst in allen Dörfern Chinas verbreiten. Borges erzählt den Bau der Mauer aus der Sicht und vom Standpunkt des Kaisers aus, während Kafkas Erzählung der Lebensbericht eines Vorarbeiters ist, der seine Tätigkeit schildert, aber keine präzise Daten zur Chronologie oder Geographie gibt. Der Vorarbeiter berichtet, wie die Arbeit eingeteilt und strukturiert war. Der Bau der Mauer hängt von einem bürokratischen System ab, aber es ist ein System, das nicht auf Zwang, sondern auf dem freien Willen des Volkes beruht. Das ruhige Leben der Heimat, in der sie einige Zeit verbrachten, kräftigte sie, das Ansehen, in dem alle Bauenden standen, die gläubige Demut, mit der ihre Berichte angehört wurden, das Vertrauen, das der einfache, stille Bürger in die einstige Vollendung der Mauer setzte, alles dies spannte die Saiten der Seele. Wie ewig hoffende Kinder nahmen sie dann von der Heimat Abschied, die Lust, wieder am Volkswerk zu arbeiten, wurde unbezwinglich. Sie reisten früher von Hause fort, als es nötig gewesen wäre, das halbe Dorf begleitete sie lange Strecken weit. Auf allen Wegen Gruppen, Wimpel, Fahnen, niemals hatten sie gesehen, wie groß und reich und schön und liebenswert ihr Land war. Jeder Landmann war ein Bruder, für den man eine Schutzmauer baute, und der mit allem, was er hatte und war, sein Leben lang dafür dankte. Einheit! Einheit! Brust an Brust, ein Reigen des Volkes, Blut, nicht mehr eingesperrt im kärglichen Kreislauf des Körpers, sondern süß rollend und doch wiederkehrend durch das unendliche China.25
24 Kafka (1950) 50. 25 Kafka (1950) 53–54.
Im Schatten der Pyramiden
405
Der Bau ist ein Projekt der Gesellschaft und jeder Bürger sieht ihn als ein Volkswerk und ein Monument der Zukunft. Doch was steht als Ziel dahinter? Ist die Mauer eine Art neuer Turm von Babel? Der Vorarbeiter meint das nicht. Er hält die Mauer für ein konkretes und vernünftiges Werk, durchgeführt von einer aufgeklärten Führerschaft: Unschuldige Nordvölker, die glaubten ihn verursacht zu haben, verehrungswürdiger, unschuldiger Kaiser, der glaubte er hätte ihn angeordnet. Wir vom Mauerbau wissen es anders und schweigen.“ Schon vorher hatte er versichert, „dass ohne die Führerschaft weder unsere Schulweisheit noch unser Menschenverstand für das kleine Amt, das wir innerhalb des großen Ganzen hatten, ausgereicht hätte. In der Stube der Führerschaft – wo sie war und wer dort saß, weiß und wusste niemand, den ich fragte – in dieser Stube kreisten wohl alle menschlichen Gedanken und Wünsche und in Gegenkreisen alle menschlichen Ziele und Erfüllungen.26
Wie die Beamten des Shihuangdi bei Borges weiß diese Führerschaft, wohin der Bau führt; aber warum bleibt dann die Mauer unvollendet und voller Lücken? Warum veranlasste die Führerschaft ein so unzweckmäßiges Projekt? Der Erzähler stammt aus dem südöstlichen China und weiß, dass dort keine Nordvölker die Einwohner bedrohen. Als Land ist China einfach zu groß. Welche Absicht hinter die Mauer steht, weiß niemand, aber etwas anderes ist sicher: Der Vorarbeiter versucht, mehr zu erkennen, er beschäftigt sich mit vergleichender Völkergeschichte und kommt zu folgender Schlussfolgerung: Genau so, so hoffnungslos und hoffnungsvoll, sieht unser Volk den Kaiser. Es weiß nicht, welcher Kaiser regiert, und selbst über den Namen der Dynastie bestehen Zweifel. In der Schule wird vieles dergleichen der Reihe nach gelernt, aber die allgemeine Unsicherheit in dieser Hinsicht ist so groß, dass auch der beste Schüler mit in sie gezogen wird. Längst verstorbene Kaiser werden in unseren Dörfern auf den Thron gesetzt, und der nur noch im Liede lebt, hat vor kurzem eine Bekanntmachung erlassen, die der Priester vor dem Altare verliest. … So verfährt also das Volk mit den vergangenen, die gegenwärtigen Herrscher aber mischt es unter die Toten.27
Die Distanz zwischen Volk und Hof ist so groß, dass Raum und Zeit zu Einem verschmelzen, längst verstorbene Kaiser gelten als aktuelle Machthaber und man hört ihren Anordnungen zu und lebendige Kaiser werden als Bilder der Vergangenheit verehrt. Für die Bevölkerung sind Kaiser und Hof im Grunde reine Phantasmen, sie haben keine wirkliche Existenz: „Wenn man aus solchen Erscheinungen folgern wollte, dass wir im Grunde gar keinen Kaiser haben, wäre man von der Wahrheit nicht weit entfernt.28“ Die Mauer ist ein Traum und Wahn, aber auch eine materielle Verwirklichung der Macht – nicht der persönlichen Macht eines einzigen Kaisers, sondern der Macht
26 Kafka (1950) 57. 27 Kafka (1950) 60. 28 Ebenda (1950) 61.
406
Alain Schnapp
einer Kultur. Borges sah in der Mauer die Auseinandersetzung zwischen Vergessen und Erinnern, Kafka verneint diese Polarität. Die Mauer ist für ihn das Symbol der chinesische Monarchie: im Schatten der Mauer verkörpert sich eine politische und religiöse Struktur, die Geheimnisse einer autoritären Führerschaft, die dem Volk nichts erklären will, weil jede Erklärung ihre eigene Macht bedrohen könnte. Der Vorarbeiter hat das verstanden: Die Mauer ist eine Parabel, ganz wie die Pyramiden und die größten Monumente der Weltgeschichte. Zwischen Erinnerung und Vergessen gibt es Raum für eine Gegenwart, die sich im Spiegel des Monuments darstellt. Sind Borges und Kafka so gegensätzlich in ihrer Auffassung? Die Frage ist nicht eindeutig zu beantworten. Eine andere Erzählung von Borges scheint dasselbe Thema zu betreffen: In jenem Reich erlangte die Kunst der Kartographie eine solche Vollkommenheit, dass die Karte einer einzigen Provinz den Raum einer Stadt einnahm und die Karte des Reichs den einer Provinz. Mit der Zeit befriedigten diese maßlosen Karten nicht länger, und die Kollegs des Kartographen erstellten eine Karte des Reiches, die die Größe des Reiches besaß und sich mit ihm in jeden Punkt deckte. Die nachfolgenden Geschlechter, die dem Studium der Kartographie nicht mehr so ergeben waren, waren der Ansicht, diese ausgedehnte Karte sei unnütz, und überließen sie, nicht ohne Verstoß gegen die Pietät, den Unbilden der Sonne und der Winter. In den Wüsten des Westens überdauern zerstückelte Ruinen der Karte, besiedelt von Tieren und von Bettlern; im ganzen Land gibt es keine anderen Überreste der geographischen Lehrwissenschaften.29
Die Karte des unbekannten Reiches ist wie die Mauer und die Pyramiden zugleich zu groß und zu klein, eine Ruine und eine Idee, Erinnerung und Vergessen, Macht und Ohnmacht.
Literaturverzeichnis al-Suyuti (1939): Jalal al-Din al-Suyuti, The Treatise on the Egyptian Pyramids, Leon Nemoy (Hg. u. Übers.), ISIS 30.1, 1939. Apolloni (1940): Bruno Maria Apolloni, „La casa dei Crescenzi nell’architettura e nell’arte di Roma medievale“, in: Il Centro di Studi per la Storia dell’Architettura, Roma, 27–37. Assmann (1995): Jan Assmann, Stein und Zeit. Mensch und Gesellschaft im Alten Ägypten, München. Borges (1982): Jorge Luis Borges, Borges und ich. Gesammelte Werke Bd. 6, München/Wien. Borges (1992): Jorge Luis Borges, „Das unerbittliche Gedächtnis“, in: Jorge Luis Borges, Fiktionen. Erzählungen 1939–1944 (Werke in 20 Bänden, Bd. 5), Frankfurt am Main. Borges (2007): Jorge Luis Borges, „Die Mauer und die Bücher“, in: Jorge Luis Borges, Inquisitionen. Essays 1941–1952 (Werke in 20 Bänden, Bd. 7), Frankfurt am Main. de Chateaubriand (1804): François René de Chateaubriand, Génie du Christianisme, Paris.
29 Borges (1982) 121.
Im Schatten der Pyramiden
407
Diderot (1990): Denis Diderot, „Salon de 1767, Salon de 1769, Beaux Arts III“, in: Else Marie Bukdahl, Michel Delon u. Annette Lorenceau, Edition Critique et Annotée Présentée, Paris. El-Daly (2005): Okasha El-Daly, Egyptology: The Missing Millenium, Ancient Egypt in Medieval Arabic Writings, London. Kafka (1950): Franz Kafka, „Beim Bau der chinesischen Mauer“, in: Franz Kafka, Gesammelte Werke Bd. 7, Frankfurt am Main. Kuhn (2001): Dieter Kuhn, „Einführung in die Gegenwart der Altertums in China“, in: Dieter Kuhn (Hg.), Die Gegenwart des Altertums: Formen und Funktionen des Altertumsbezugs in der Alten Welt, Heidelberg. Marx (1885): Karl Marx, Der Achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte, 3. Auflage, Hamburg. Péret (1939): Benjamin Péret, „Ruines: Ruine des Ruines“, Minotaure, 12–13. Si Maqian (1967): Les Mémoires Historiques de Se-Ma-Tsien, übersetzt u. kommentiert von E. Chavannes, Bd. 2, Paris. Waldron (1990): Arthur Waldron, The Great Wall of China, Cambridge.
408
Ortwin Dally
Ortwin Dally *
Bilder im Kopf. Archäologen und ihre Medien
Die Diskussion um Medien hat Konjunktur, längst hat sie nicht nur die Geschichtswissenschaften erfasst1, sondern auch zur Etablierung der Mediengeschichte bzw. Medienwissenschaften als eigenständiger universitärer Disziplin geführt, nicht zuletzt ein Ergebnis technischer Entwicklungen wie des Rundfunks, des Fernsehens und der digitalen Revolution, die zu einer starken Ausweitung eines traditionellen auf Objekte und Texte ausgerichteten Medienbegriffs geführt hat2. An der Debatte um den Medienbegriff, der mittlerweile angesichts des inflationären Gebrauchs schon das Etikett Ubiquität angehängt wird3, sind die Altertumswissenschaften freilich bislang nur eingeschränkt beteiligt: Bislang kreist die Debatte primär um den Einsatz von Medien zur Vermittlung von Wissen in einer breiten Öffentlichkeit4. Obwohl die Archäologie als objektbezogene Wissenschaft von Anfang an mit einer Vielzahl von Abbildungen und Abbildungstechniken umgegangen ist, ist die Frage, inwiefern und in welcher Form sich die Fachdisziplin Archäologie Medien bedient zur Vermittlung von Erkenntnisfortschritten in ihrer Teildisziplin, und wie diese Medien wiederum den Zugang zur Antike prägen, bislang nur zögerlich diskutiert worden. Das hängt damit zusammen, dass sie einen Medienbegriff vor allem an den Zielobjekten ihrer Forschung festgemacht hat, nicht aber an den Werkzeugen, mit denen sie die Erträge ihrer Forschung darstellt und kommuniziert. Die Medien, derer sich Archäologen vom Text bis hin zur Zeichnung, dem Foto oder dem Satellitenbild bedienen, haben jedoch einen entscheidenden Anteil daran, dass Bilder und Fragestellungen in der Vorstellung der Forscher entstehen. Doch wie entstehen solche Bilder oder, besser gesagt, Sehgewohnheiten? Und welchen Anteil haben dabei Medien, derer sich die Forscher zur Dokumentation, aber auch in der Rezeption bedienen?
* Wertvolle Anregungen für den Artikel verdanke ich Diskussionen mit Friederike Fless (Berlin), aber auch innerhalb der Cross-Sectional Group Space & Collective Identities des DFG-ExzellenzClusters TOPOI (TOPOI 1.0), der Research Group C-3 Fragments, Ruins and Space. The perception and representation of ancient spaces in modern contexts (TOPOI 2.0) und des Clusters 5 des Deutschen Archäologischen Instituts zur Geschichte der Archäologie. Für die Bereitstellung von Fotografien danke ich H.-R. Goette (Berlin), für eine weitere Abbildungsgenehmigung H. Knell (Darmstadt). 1 Crivellari u.a. (2004); Kümmel u.a. (2004). 2 Vgl. die zahlreichen in jüngster Zeit erschienenen Einführungen: Schanze (2001); Schanze (2002); Faulstich (2003); Faulstich (2004); Stöber (2008); Hickethier (2010). 3 Münker u. Roesler (2008) 11. 4 Gehrke u. Sénécheau (2010); Pirker u.a. (2010); Kircher (2012).
Bilder im Kopf. Archäologen und ihre Medien
409
1 Archäologen schaffen Bilder Wenn wir von der Vergangenheit reden, so sprechen wir von einer Vielzahl unterschiedlicher Zeugnisse, die von Texten bis hin zu materiellen Objekten reichen. Um sie zum Sprechen zu bringen, müssen sie zueinander in Beziehung gesetzt und gedanklich miteinander verbunden werden. Archäologische Befunde und Funde sind nur fragmentarisch erhalten. Um sie zum Sprechen zu bringen und um kulturgeschichtliche Fragen zu beantworten, müssen diese Fragmente über bewusste oder unbewusste Theorienbildung bzw. Vorannahmen oder Überzeugungen in einen Sinnzusammenhang gestellt werden. Diese Theorienbildung beeinflusst nicht nur die Methodik der Grabung als solcher, sondern auch die Wahl der verwendeten Werkzeuge und der Medien, die zur Dokumentation Verwendung finden. Die Produktion von Bildern beginnt also schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt. Diese ist von einem bestimmten Erkenntnisinteresse geleitet. Daran bemisst sich nicht nur die Entscheidung, welcher Schnitt aufgemacht oder welches Gebäude dokumentiert wird. Daran bemisst sich auch, wie mit den Funden umgegangen wird. Als die ersten Ausgräber im Zeusheiligtum von Olympia begannen, zu graben, war der Ausgangspunkt ihres Erkenntnisinteresses wesentlich bestimmt von der Suche nach den Kunstwerken, die der griechische Reiseschriftsteller Pausanias beschrieben hatte. Statt der erwarteten und erhofften Kunstfunde stießen die Ausgräber aber auf eine Fülle ganz unterschiedlicher Materialien, die sie vorher noch nie gesehen hatten, darunter auch eine Unmenge an Knochen insbesondere in einer schwarzen Schicht, die vom Aschealtar des Zeus herrührte. Diese wurden fast durchweg weder ausführlich dokumentiert noch aufbewahrt – sie hatten offensichtlich nichts mit Kunst zu tun. In der Aussonderung der Knochen liegt eine wesentliche Ursache dafür, dass auch in der Folge eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dieser materiellen Quelle nicht befördert wurde; da Knochen ausgesondert, nicht dokumentiert und publiziert wurden, konnten sie keinen maßgeblichen Einfluss auf den Diskurs über Olympia gewinnen. Die Präferierung von Kunstwerken sollte sich aber nicht nur auf die Auswahl der aufgenommen Materialien auswirken, sondern auch auf die Publikationspraxis, mithin die mediale Verbreitung und Kommunikation der erzielten Forschungsergebnisse: In der Veröffentlichung der Bronzen von A. Furtwängler erschienen herausragende Plastikfunde als Fotografien auf den ersten 4 Tafeln, zahlreiche Tierstatuetten erschienen hingegen auf den folgenden Tafeln in gezeichneter Form5. In der Anordnung und der Wahl der Dokumentation kommt die Privilegierung der Plastik zum Ausdruck. Das Bild, das die Ausgräber zu Beginn der Grabungen hatten, wirkte sich also zunächst auf die Selektion der dokumentierten Materialien aus; durch deren Publikation wurde zugleich eben diese Sicht auf Olympia verstärkt. Erst jüngst sind bei Nachforschungen im Bereich des Pelopions auch Knochenreste auf-
5 Furtwängler (1890).
410
Ortwin Dally
genommen und wissenschaftlich als wesentliche Quelle zum Verständnis des Kultgeschehens ausgewertet worden6. Ähnlich gelagert ist die von Theodor Wiegand in Angriff genommene Freilegung des Apollontempels in Didyma. Wiegands Ziel war es, den griechischen Tempel freizulegen. Der Schutthügel, aus dem nur vereinzelte Säulen des Tempels herausragten, wurde jedoch zu Beginn der Grabungen Wiegands von einer historischen Windmühle bekrönt7. Diese wurde ebenso abgeräumt wie die Überreste einer frühbyzantinischen Kirche, deren gut erhaltenen Reste Wiegand im Sekos des Apollontempels antraf8. Auch diese war für Wiegand nicht von primären Interesse, da sie deutlich später als der Tempel entstanden war und in eine Zeit gehörte, der allgemein das Etikett Verfall anhing. Im Ergebnis der Grabungen Wiegands blieb ein stark gereinigter Sekos zurück, der auch entsprechend bildlich dokumentiert worden ist und auf vielfältige Art und Weise bis heute redupliziert wird – eine entscheidende Rolle spielten hier wie auch in anderen Fällen nicht nur Zeitungsartikel, sondern auch Handbücher und nicht zuletzt Postkarten. Die Kirche war zwar von Wiegand dokumentiert worden, sie wurde aber im Gegensatz zu anderen Materialien nicht als publikationswürdig angesehen. Hier dürfte eine wesentliche Ursache dafür liegen, dass sie und die Geschichte Didymas in der frühbyzantinischen Zeit erst in der jüngsten Vergangenheit mehr Interesse gefunden hat. Als 1885 Panagiotis Kavvadias und Georg Kawerau Ausgrabungen auf der Athener Akropolis in Angriff nahmen, waren sie mit einem jahrhundertealten Monument konfrontiert, zu dem nicht nur Tempel des 5. und 4. Jhs. v. Chr., sondern auch Kirchen und eine Moschee zählten. Innerhalb von 5 Jahren wurde das gesamte Plateau bis auf wenige Gebäude, den Parthenon, das Erechtheion, die Propyläen und den Niketempel, freigeräumt. Der Unternehmung zum Opfer fielen zahlreiche Bauten unter anderem des Mittelalters und der osmanischen Zeit. Zum Abschluss seines Berichts vermerkt der Ausgräber Kavvadias im Deltion 1890, S. 3: „So übergibt Hellas der civilisierten Welt die Akropolis als ein vornehmes, von allem Barbarentum gereinigtes Denkmal des griechischen Geistes, als eine ehrwürdige und einzigartige Schatzkammer erhabener Werke der antiken Kunst (auch der vorpersischen Zeit, die dann in das Akropolismuseum wanderten), welche alle Kulturvölker ohne Unterschied einlädt zum Studium, zur Mitarbeit und zum edlen Wettstreit behufs Förderung der archäologischen Wissenschaft.“9. Die Ausgräber zeigen sich damit selber geprägt durch ein bestimmtes Griechenlandbild, das sich in der Folge der Schriften von Johann Joachim Winckelmann schon vor ihrer Zeit in der Forschung fest etabliert hatte. Dieses Bild, das im 19. Jahrhundert nicht wirklich in Frage gestellt wurde, im Kopf, trafen die Ausgräber
6 7 8 9
Benecke (2006). Alexandridis u. Heilmeyer (2004) 36 Abb. 22. Zuletzt: Bumke (2009) 77–78 Abb. 1, 5, 7, 8. Kavvadias (1890) 3, wiederabgedruckt: Kavvadias u. Kawerau (1906) 46.
Bilder im Kopf. Archäologen und ihre Medien
411
der Athener Akropolis die Entscheidung, radikal einen Großteil der Bauten und Denkmäler abzuräumen. Zurück blieb ein in Stein gemeißeltes Zeitfenster in das 5.–4. Jh. v. Chr., das aber seine Wirkung bis heute entfaltet und immer wieder durch Restaurierungsmaßnahmen weiter konserviert wird. Sowohl in den Archiven und Fototheken als auch auf Postkarten finden sich immer wieder Bilder und Reproduktionen dieser Denkmäler, die damit auch dieses Bild immer wieder aufs Neue bekräftigen. So erscheint es kaum verwunderlich, dass bis heute Forschungsprojekte zu Athen und der Zeit des Hellenismus und der römischen Kaiserzeit erst in den letzten 10–15 Jahren verstärkt an Bedeutung gewonnen haben, jedoch, was die Quantität anbetrifft, immer noch weit hinter den Studien zu Athen im 5. Jh. v. Chr. zurückstehen10. Dies dürfte nicht nur das Ergebnis einer schlechteren, durch Archäologen verursachten Quellenlage sein, vielmehr dürfte dies auch das Ergebnis von Bildern sein – Bilder, die Archäologen in ihrem Kopf haben, und die sie durch ihr Wirken geschaffen haben. Durchaus vergleichbar ist Rom. In der Kaiserzeit war die Vorstellung von der Größe und Zentralität Roms eng mit dem Palatin verknüpft. Diese Vorstellung sollte sich im Frühmittelalter wandeln – Rom als Ganzes wurde zum Signet für seine vergangene Größe11. Die Zeichnungen Piranesis mit ihren übergroßen Ruinen vermitteln dieses Bild sehr eindrücklich. Es findet sich aber auch auf frühen Fotografien aus Rom aus der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts, die die erhaltenen Denkmäler in übersteigerter Form präsentieren12. Noch zu Zeiten Mussolinis waren zentrale Denkmäler der römischen Kaiserzeit wie das Mausoleum des Augustus, die Ara Pacis oder die Kaiserfora freilich verborgen und eingebunden in historische Bauensembles. Durch deren brachiale Zerstörung wurden die Ruinen der römischen Kaiserzeit innerhalb kurzer Zeit freigelegt. Mit ihnen ließ sich die von Mussolini vertretene Vorstellung von der neugewonnenen politischen Stärke Italiens in der Tradition des großen Imperium Romanum nicht zuletzt durch die Einbindung der Ruinen in faschistische Rituale und eine große Ausstellung zum Kaiser Augustus sinnfällig verbinden13. Die auch heute noch im Stadtbild sichtbaren Denkmäler prägen maßgeblich den Eindruck der Besucher, aber auch der Forschung. Insbesondere die frühe und hohe Kaiserzeit wird in besonderem Maß erforscht, spätere Epochen der römischen Kaiserzeit jedoch nicht mit derselben Intensität. Gerade am Beispiel Roms lässt sich auch nachvollziehen, wie sich die Forschung bis vor kurzem ausschließlich mit den monumentalen Resten von Bauten und Denkmälern, die auch noch heute im Stadtbild sichtbar sind, auseinandersetzte. Bauten wie das Kolosseum oder die Tempel auf dem Forum Romanum werden vielfach reproduziert und bestimmen nicht nur den Parcours der Touristen, sondern haben auch den Gang der Forschung wesentlich mitgeprägt. Das darin zum
10 Vgl. jetzt Krumeich u. Witschel (2010). 11 Disselkamp (2013). 12 Ritter (2005). 13 Vgl. dazu Binder (1991) 24–29; Altekamp (im Druck) 5–6.
412
Ortwin Dally
Ausdruck kommende Verständnis von Stadt als physischem Raum oder architektonischem Gebilde blendet die Lebensumstände der meisten Menschen aus. Fassbar sind die Relikte des öffentlichen Handelns einer Elite, also der gesellschaftlichen Spitze. Wie das Gros der Menschen in der Vergangenheit gelebt hat, bleibt damit weitgehend unerforscht; dies gilt auch für zentrale Fragen der Geschichte Roms in Bronze-, Eisenzeit und Republik. Archäologen erschaffen jedoch wirkungsmächtige Bilder nicht nur durch ihre Grabungstätigkeit, sondern auch durch selektive Rekonstruktionen: Ohne Zweifel beeinflussen wieder errichtete Bauten wie die Stoa des Attalos auf der Athener Agora, das Trajaneum in Pergamon oder die Celsusbibliothek in Ephesos die Sicht der Besucher auf die jeweiligen Ruinenstätten14. Diese entspricht jedoch häufig nicht der tatsächlichen Bedeutung von Gebäuden und Denkmälern, sofern diese erschlossen werden kann. In Pergamon prägt ein kaiserzeitlicher Tempel, das Trajaneum, das Bild der Landschaft15, die hellenistischen Königspaläste, die weitaus schlechter erhalten sind, treten demgegenüber in der Wahrnehmung zurück. In Ephesos verblassen die kaum noch fassbaren Reste des Artemistempels, eines der 7. Weltwunder in der Antike, gegenüber der Celsusbibliothek und weiteren rekonstruierten Bauten auf der sog. Kuretenstraße. Auf der Athener Agora kann der Besucher nur schwer einen Eindruck von der Art und Weise gewinnen, wie der athenische Staat im 5. Jh. v. Chr. funktionierte, da die entsprechenden Bauten und Denkmäler nur noch bruchstückhaft überliefert und nicht rekonstruiert worden sind. Beherrscht wird der Platz von der wieder aufgebauten, hellenistischen Attalosstoa und dem sog. Theseion. Ähnlich ergeht es dem Besucher von Ruinenstätten in Libyen, die während der Zeit der italienischen Besatzung entstanden sind. Besonderes Interesse fanden Denkmäler der römischen Kaiserzeit, die von der Größe des römischen Reiches zeugten und deshalb in rekonstruierter Form die enge Verbindung zwischen Italien und Nordafrika zum Ausdruck brachten. In Sabratha wurde das 1927–1930 freigelegte römische Theater bis 1937 wiedererrichtet (Abb. 1–2), in Leptis Magna wurden in den dreißiger Jahren große Anstrengungen unternommen, das severische Forum und die angrenzende Basilika zu rekonstruieren und eine Anastylose anzugehen (die auch letztlich ausschließlich umgesetzt wurde), und in Tripolis wurde der Quadrifons des Marc Aurel und des Lucius Verus aus der arabischen Altstadt sukzessive zwischen 1912 und 1937 herausgeschnitten und isoliert (Abb. 3)16. Geprägt sind diese ambitionierten Rekonstruktionsmaßnahmen von der Vorstellung der imperialen Größe Roms, die in der Zeit Mussolinis sich auch besonders in Rom selber artikulieren sollten. Rücksichtslos wurde das Mausoleum des Augustus aus seinem städtebaulichen Verbund herausgeschält und Teil einer faschistischen Platzanlage; die mit großer Hast durchgeführten Grabungen im
14 Borbein (2011) 56–64. 15 Zuletzt: Nohlen (2011). 16 Vgl. dazu Altekamp (2000) 191–200.
Bilder im Kopf. Archäologen und ihre Medien
413
Abb. 1–2: Das 1937 wieder errichtete römische Theater von Sabratha.
Bereich der Kaiserfora wurden durch den Bau der Via dei Fori Imperiali abgeschlossen, die über die Fora führte und für die faschistischen Umzüge, flankiert durch Karten des Imperium Romanum, eine passende Kulisse bot17. Eine wesentliche Rolle in der Übermittlung von Wissen spielen schließlich auch Museen. In der Auswahl der Objekte und der Art und Weise, wie diese einem breitem
17 Altekamp (2000) 192–193.
414
Ortwin Dally
Abb. 3: Der Quadrifons des Marc Aurel und des Lucius Verus in der Altstadt von Tripolis.
Publikum vorgeführt werden, spiegeln sich Fragestellungen und Konzepte der Planer und Museumsleiter; geschaffen werden auch hier Bilder, die vielfach rezipiert werden und ihrerseits eben diese Vorstellungen verstärken. Dies sei am Beispiel von Tanais im Dondelta verdeutlicht. Schon im frühen 19. Jahrhundert war den ersten russischen Ausgräbern bewusst, dass die Stadt von Kaufleuten aus dem Bosporanischen Reich gegründet worden war – nach neuesten Erkenntnissen im 2. Viertel des 3. Jhs. v. Chr., sie gilt daher bis heute als „griechische“ Stadt. Hier lag auch der Antrieb für ein deutsch-russisches Gemeinschaftsprojekt, das von 1995–2005 lief und darauf zielte, die Agora der griechischen Stadt zu entdecken18. Den Besucher beeindrucken die Unmengen an Amphoren aus dem Mittelmeer- und Schwarzmeerraum, die er in einem eigens eingerichteten Magazin bewundern kann (Abb. 4). Sie zeugen davon, dass Tanais bis in die Spätantike hinein ein blühendes Handelszentrum mit weitreichenden Verbindungen in den Schwarzmeerraum und den östlichen Mittelmeerraum war. Erst
18 Vgl. die Synthese von Böttger (2005).
Bilder im Kopf. Archäologen und ihre Medien
415
Abb. 4: Tanais am Don: Amphorenmagazin.
auf den zweiten Blick fällt im Vergleich zu anderen Fundplätzen im nordöstlichen Schwarzmeerraum auf, dass ebenso wie in dem lokalen Museum einheimisch handgemachte Keramik, die sog. Lepnaja, weitgehend fehlt. In Taganrog etwa, einem frühgriechischen Handelsstützpunkt in der Nähe, der vermutlich im letzten Viertel des 7. Jahrhunderts v. Chr. gegründet worden ist, zählt Lepnajakeramik von Anbeginn an zum Bestand der materiellen Kultur des Fundplatzes19. Der Grund für das Fehlen der Lepnajakeramik, das sich nicht nur in der Einrichtung der Magazine für die Grabungsfunde niederschlägt, sondern auch in den aufbewahrten Relikten, war zumindest bis in die jüngere Vergangenheit hinein die Vorstellung, es handele sich um eine „griechische“ Stadt. Bei der Genese derartiger Bilder und Vorstellungen können aber auch andere Faktoren eine bedeutende Rolle spielen: Eine wesentliche Rolle bei der Vermittlung der Bilder spielt die Art und Weise, wie Wissenschaftler sozialisiert bzw. welche persönlichen Erfahrungen sie machen. In der 1948 erschienenen Monographie des australischen Forschers Thomas James Dunbabin setzt sich dieser mit dem Phänomen der
19 Vgl. Dally u.a. (2009) 80, 103.
416
Ortwin Dally
Abb. 5: Samos, Südhalle: Rekonstruktion (nach Gottfried Gruben).
griechischen Kolonisation Unteritaliens und Siziliens auseinander20. Seine Prägung durch den scharfen Kontrast zwischen weißen Siedlern und einheimische Aborigines wirkt sich unmittelbar auf die Schilderung der Beziehungen zwischen Griechen und Einheimischen in Unteritalien und Sizilien aus: erstere gelten als zivilisatorisch überlegen, letztere als Kulturnehmer. Diese Sicht spiegelt sich auch in der Interpretation materieller Zeugnisse. Fragen der Akkulturation und des Kulturkontakts spielen seit den neunziger Jahren eine wichtige Rolle im Diskurs der Altertumswissenschaften; darin dürften sie auch maßgeblich geprägt sein vom Metadiskurs der Globalisierung. In der Klassischen Archäologie erfreuen sich Studien zur Gewalt und Gewaltanwendung derzeit einer hohen Aufmerksamkeit, wohl auch eine Folge der Thematisierung in Filmen und Computerspielen21. Eine wesentliche Rolle kann aber auch die hohe Autorität einer Forscherpersönlichkeit spielen. Als Beispiel sie die Diskussion um die sog. Südhalle im Heiligtum der Hera auf der Insel Samos angeführt. Um 630 v. Chr. entstanden, gilt sie als erste Halle der griechischen Architekturgeschichte. Ergraben wurde sie von Ernst Buschor in der 2. Hälfte der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts in der Nähe des 1. Heratempels, des sog. Hekatompedos. Eingang in die Forschung fand der Bau in einer ersten vorläufigen Publikation 1930; veranschaulicht wurde der Bau durch Rekonstruktionszeichnungen Hans Schleifs22. 1957 legte dann Gottfried Gruben, der als Ordinarius für Baugeschichte an der Technischen Universität München die Fachdisziplin Bauforschung über Jahrzehnte maßgeblich geprägt hat, eine endgültige Publikation vor, die den Bau als längs gerichtete Halle zeigt (Abb. 5)23. Das Flachdach lastet auf längs gerichteten Balken, die ihrerseits von Sattelhölzern gestützt werden. Die rechteckigen Kant-
20 Dunbabin (1948) VI–VII. – Vgl. dazu Shepherd (1999) bes. 272–273. 21 Stähli (2005) 19–20; Muth (2008) 7–8; Kunze (2010/2011) 596. 22 Buschor (1930). 23 Gruben (1957); Gruben (2001) 353 Abb. 268.
Bilder im Kopf. Archäologen und ihre Medien
417
Abb. 6: Randfragment einer klazomenischen Amphora aus Taganrog (Südrussland), 3. Viertel 7. Jh. v. Chr., Mus. Taganrog Inv. TAG 10-X-239.
hölzer, die das Pultdach mit Erdschicht stützen, enden in einer Flucht mit der Kante des Daches. Die Rekonstruktion des Baus und seines Daches sind seither vielfach reproduziert worden, nicht zuletzt von Gruben selber, der damit zugleich die Lösung für ein zentrales Problem der Architekturgeschichte gefunden zu haben glaubte: die Frage nach der Genese des Zahnschnitts und – noch grundsätzlicher – des ionischen Gebälks. Gruben selber hatte vermutlich, als er an den Bau heranging, bereits ein evolutionistisches Bild im Kopf: Das erste ionische Gebälk bestand aus Holz, bevor es in Stein umgesetzt wurde. Die Südhalle in Samos bot die Gelegenheit, diese gedankliche Vorstellung in das Medium einer Rekonstruktionszeichnung zu übersetzen. Obwohl schon seit längerem deutlich geworden ist, dass anders, als es Hans Walter sehen wollte, Samos nicht „das griechische Heiligtum“ ist24, sondern sich in vielfacher Hinsicht von gleichzeitigen Heiligtümern unterscheidet25, ist die Rekonstruktion Grubens nicht in Frage gestellt worden: dagegen stand seine Autorität ebenso wie die sehr gut fassbare Rekonstruktionszeichnung, die durch ihre Vervielfältigung in unterschiedlichen Kontexten ihrerseits die Wahrnehmung frühgriechischer ionischer Architektur entscheidend geprägt hat. Erst jüngst konnte der langjährige Ausgräber im Heraion von Samos, Hermann Kienast, deutlich machen, dass die Rekonstruktion Grubens nicht zutreffen kann26: Die lang rechteckigen Basen sind mit ihrer Schmalseite zur Front des Baus hin ausgerichtet und trugen vermutlich runde Säulen. Damit wird aber auch die Rekonstruktion des Flachdaches hinfällig. Wahrscheinlicher ist ein Satteldach, das bereits Schleif angenommen hatte, und auf Innen- und Außenstützen lastete. Dieses Beispiel zeigt zugleich, dass auch die Art und Weise, wie ein bestimmtes Objekt, ein Befund oder ein Denkmal dokumentiert und im Bild vermittelt wird, Auswirkungen haben kann: Charakteristisch für Keramikzeichnungen beispielsweise ist,
24 Walter (1990). 25 Offenbar ein Ergebnis der Rolle von Samos als Knotenpunkt für Seefahrer, Händler und Piraten: Kilian-Dirlmeier (1985) 235–243, 248–253; Kreutzer (1994). 26 Kienast (2011).
418
Ortwin Dally
dass sie von spezialisierten technischen Zeichnern und Archäologen angefertigt werden. Individuelle Merkmale werden unterdrückt zugunsten vergleichbarer Merkmale (Abb. 6). Die Zeichnungen sind von daher nicht realistisch, sondern selektiv27. Fragen, die man an ein individuelles Gefäß richten könnte, werden durch die Art und Weise der Dokumentation unterdrückt oder zumindest stark erschwert. Ähnliche Beobachtungen ließen sich auch an der Behandlung anderer Materialgruppen und -klassen in der Forschung nachvollziehen. Als Carl Robert das Corpus der römischen Sarkophage in Angriff genommen hatte, entschied er sich für Zeichnungen, da er auf diese Weise besser den ikonographischen und mythologischen Gehalt des bildlichen Schmuckes, seines Hauptinteresses, illustrieren konnte28. Dadurch wurde der Zugang zu anderen Fragen, etwa der Wiedernutzung oder einer auf stilistischen Argumenten beruhenden Chronologie, stark erschwert. Sie gewann erst im Verlaufe des 20. Jahrhunderts an Gewicht, dann aber in Verbindung mit der Fotografie. Darüber hinaus geht die visuelle Vermittlung komplexerer Zusammenhänge wie etwa die Kartierung von archäologischer Sachkultur. Sie erleichtert die Veranschaulichung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden bestimmter Materialien und Materialgruppen hinsichtlich Kriterien wie der Typologie, Chronologie etc. über weitere geographische Räume hinweg. Derartige Gemeinsamkeiten werden zumeist unter dem Sammelbegriff bestimmter Kulturgruppen subsumiert. Die Art der Visualisierung in Form von Verbreitungskarten hat sicherlich entscheidend dazu beigetragen, die Idee von ethnischen und sozialen Gruppierungen in einem bestimmten geographischen Gebiet als Träger dieser Kulturgruppen zu entwickeln29. Obwohl eben dieser Zusammenhang in der Forschung mittlerweile sehr kritisch gesehen wird30, legen gerade die Bilder vielfach auch in Museen dem Besucher bis heute genau diese Verbindung sehr nahe.
2 Bilder prägen Archäologen Die geschilderten Bilder wirken sich demnach auch umgekehrt unmittelbar auf die in Interpretation von Befunden aus. Dies geschieht auf zwei eng miteinander verbundenen Ebenen – einerseits auf einer sehr konkreten Ebene, auf der sich tatsächlich die Rezeption eines ganz bestimmten Textes oder Bildes nachweisen lässt, anderseits auf einer abstrakten, allgemeinen Ebene wie der Vorstellung von der Größe Roms oder der Rolle Athens als Zivilsationsbringer; hier ist eher eine Verdichtung von Bildern oder besser gesagt kanonisierten Bildern charakteristisch.
27 28 29 30
So zutreffend: Kavanagh (2007) 149. Klamm (2007) 124–125. Haymond (1980); Orton (1982) 179–194; Fitzpatrick (1987). Vgl. etwa Brather (2010).
Bilder im Kopf. Archäologen und ihre Medien
419
Abb. 7: Samothrake, Kabirenheiligtum: Rekonstruierter Blick von der Orchestra über das Theater auf das Nike-Anathem (nach Heiner Knell).
Zunächst zu der konkreten Ebene: Zu den Inkunabeln des Pariser Louvre zählt die Statue der Nike von Samothrake. Nachdem diese bereits 1884 in den Louvre gelangt war, wurde sie 1934 neu arrangiert und oberhalb einer großen Treppe zum 1. Stock des Museums platziert31. Dort empfängt sie noch heute die Besucher und scheint von oben herabzuschweben. Diese Aufstellung, deren Wirkung auch ganz wesentlich auf der Ergänzung von Partien des Vordergewandes und des kompletten rechten Flügels durch Felix Ravaisson (1880–1884) beruht32, entspricht nicht der antiken Präsentation. Zwar stand sie auf dem Vorderteil eines Schiffes, wie auch noch heute zu sehen, war aber vermutlich ebenerdig in einem Naiskos als Siegesdenkmal eines hellenistischen (makedonischen?) Herrschers des mittleren 3. Jhs. v. Chr. auf dem Westhügel des Hierons von Samothrake aufgestellt. Darauf deuten jedenfalls die noch verfügbaren Informationen von Charles Chamoiseau hin, der die Statue 1863 entdeckt und 1864 nach Paris überführt hatte33. In Unkenntnis der Unterlagen ist in der Forschung eine Debatte geführt worden zur ursprünglichen Positionierung. Dabei spielten vermutlich nicht zutreffende Überlegungen zur Aufstellung der Nike in einem Bassin ebenso eine Rolle wie die Annahme, dass die Statue oberhalb des Theaters gestanden haben müsse. Gerade diese Rekonstruktion, die die Nike von unten aus der Orchestra des Theaters heraus gesehen oberhalb desselben zeigt und Heiner Knell verdankt
31 Zur Geschichte der Erwerbung und ihrer Aufstellung im Louvre vgl. jetzt Hamiaux (2007) 6–14. – Zur Diskussion um die Datierung vgl. zuletzt Weber (2013) 263 mit Anm. 2. 32 Hamiaux (2007) Abb. S. 13. 33 Champoiseau (1880). Vgl. dazu und zu weiteren modernen Rekonstruktionsversuchen Hamiaux a.O. 32–34.
420
Ortwin Dally
wird (Abb. 7)34, ist aufschlussreich. Das Bild von Knell zeigt deutlich, dass er von dem Bild der Nike und deren Aufstellung im Louvre oberhalb der Darutreppe beeinflusst war35. Dieser Eindruck war so wirkungsmächtig, dass er in seiner Rekonstruktionszeichnung offensichtliche Ungereimtheiten in Kauf nahm: Die Proportionen der Nike auf der Rekonstruktionsskizze Knells wirken überdehnt – wäre sie mit ihren tatsächliche Proportionen oberhalb des Theaters gezeichnet worden, wären die Beine nur teilweise zu sehen gewesen. Ferner ist das rekonstruierte Bild der Statue auch nicht in der Mittelachse des Theaters wiedergegeben. Als ebenso wirkungsmächtig erweisen sich häufig von Archäologen geschaffene Bilder in Form von Rekonstruktionen: Die 1506 in Rom entdeckte Statuengruppe des trojanischen Priesters Laokoon und seiner beiden Söhne gehört zu den antiken Skulpturen, die bis heute immer wieder das Interesse der Forschung gefunden haben. Die Diskussion um die korrekte Ergänzung der unvollständig überlieferten Skulpturengruppe im Belvedere des Vatikan wurde wesentlich befeuert durch die Entdeckung des sog. Pollackschen Armes, der schließlich in eine Anstückung des Armes an die Gruppe durch Filippo Magi 1960 mündete. Wie kürzlich Maria Wiggen zeigen konnte36, beruht jedoch die Rekonstruktion Magis, die dieser effektvoll unter Zuhilfenahme von Gips und Fotografien untermauerte, ebenso wenig wie weitere neuzeitliche Rekonstruktionsversuche auf gesicherten archäologisch nachvollziehbaren Erkenntnissen. Die Annahme, dass der nicht erhaltene Arm des Laokoon angewinkelt gewesen sein müsse, beruht zum einen auf der Zuschreibung eines bossierten angewinkelten Armes, der lange Zeit in der Nähe der Laokoongruppe im vatikanischen Belvedere lag37, und als eine frühere neuzeitliche Ergänzung gelten muss, an Michelangelo, dessen Genius damit zum Paten für die Idee wurde, der rechte Arm sei schon in der Antike angewinkelt gewesen38. Die Forschung ließ sich von dieser Grundüberzeugung auch bei der Zuweisung des sog. Pollackschen Armes an die Gruppe leiten. Damit verquickt ist eine zweites Argument, die lange Tradierung eben dieses angewinkelten rechten Armes in der Geschichte der neuzeitlichen Rekonstruktionen39. Es handelt sich in beiden Fällen nicht um stichhaltige wissenschaftlich überprüfbare und nachvollziehbare Hypothesen40 – danach müsste der sog. Pollacksche Arm von der rechten Schulter des Laokoon ebenso wie weitere neuzeitliche Ergänzungen entfernt werden, da sie nicht sicher dem antiken Bestand der Gruppe zuzuweisen sind
34 Knell (1995) 76–77 Abb. 62. 35 Vgl. auch Hamiaux (2007) 34: „ …, cette version paraît trop directement influencé par la perspective de la Victoire vue du bas de l’escalier Daru pour être vraiment convaincante.“ 36 Wiggen (2011). 37 Ebenda (2011) 61. 38 Ebenda (2011) 66–68, 74–77, 181. 39 Ebenda (2011) 181. 40 Ebenda (2011) 252.
Bilder im Kopf. Archäologen und ihre Medien
421
und dem Befund sogar in vielerlei Hinsicht widersprechen41 –, wohl aber um ein Beispiel für die Art und Weise, wie Bilder in den Köpfen von Forschern entstehen und weiter tradiert werden bzw. ihrerseits die Forschung wieder beeinflussen: Auf der Rekonstruktion Magis fußend hat Bernard Andreae u.a. die Ansicht vertreten, die Gruppe des Laokoon sei ein hellenistisches Original, da der Arm dasselbe Bewegungsschema wie der Gigant Alkyoneus auf dem Fries des Pergamonaltares erkennen lasse42. Ähnliche Beobachtungen lassen sich auch bei architektonischen Rekonstruktionen machen: Von 1903 bis 1906 rekonstruierte Jean Replat das Schatzhaus der Athener in Delphi43. Der Bau prägt das Bild des Heiligtums bis heute nachhaltig, da er sich auf halbem Weg zwischen dem Eingang des Heiligtums und dem Tempel des Apollon über den Denkmälern und Bauten seiner Umgebung, die nicht rekonstruiert worden sind, weithin sichtbar erhebt. Als italienische Archäologen in Kyrene während der italienischen Kolonialzeit anfingen zu graben, spielten auch dort Rekonstruktionen von Anfang an eine wesentliche Rolle, vor allem im Bereich des Caesareums, wo spätere Spuren der Nutzung komplett beseitigt wurden, der Agora, aber auch des Apollonheiligtums44. Im Zentrum des Interesses stand die Glanzzeit der griechischen Periode Kyrenes. Dort wurden Teile des Apollontempels, des Altars und ein kaiserzeitlicher Bau, das sog. Strategeion, wiederaufgebaut (Abb. 8–9). Der gesuchte Bezug zu dem Heiligtum in Delphi ist evident. In beiden Fällen handelt es sich um ein Heiligtum des Apollon, darüber hinaus erinnert die Landschaft, in die das Heiligtum des Apollon in Kyrene eingebettet ist, an die des Parnass in Delphi. Tatsächlich war eine der wesentlichen Antriebsfedern der Grabungen in Kyrene gewesen, dort einen Platz zu kreieren, der sich mit Olympia, Pergamon oder Delphi messen konnte45. Handelt es sich in diesem Fall um das wirkungsmächtige Bild des neuzeitlichen Arrangements einer antiken Statue im Museum bzw. um Rekonstruktionen, die Auswirkungen auf die Forschung haben, erweisen sich in anderen Fällen Texte, die von Archäologen zur Vermittlung ihrer Forschungsergebnisse geschaffen worden sind, als ebenso wirkungsmächtig: Bereits in Dresden entstanden die 1755 in der ersten und 1756 in der zweiten Auflage erschienen Gedanken über die Nachahmung der griechischen Werke in der Malerey und Bildhauer-Kunst von Johann Joachim Winckelmann. In diesem grundlegenden Text des Klassizismus begründet Winckelmann auf der Grundlage philologischer und archäologisch-antiquarischer Studien sowie in Auseinandersetzung mit der englischen und französischen Aufklärung und Kunst-
41 Ebenda (2011) 260–262. 42 Andreae (1988) 58–59; Andreae (1991) 16–21. – Vgl. dazu Wiggen (2011) 255–256. 43 Publikation der Inschriften: Colin (1909–1913). – Publikation des Baus: Audiat (1933). – Zur Anastylosis vgl. Redécouverte (1992) 210–212. 44 Caputo 1982, 38; Altekamp (2000) 196. 45 Vgl. dazu Altekamp (2000) 112, 185 (zum Fund eines marmornen Zeus-Kopfes, der als Replik des phidiasischen Zeus in Olympia angesehen wurde).
422
Ortwin Dally
Abb. 8: Das Apollonheiligtum von Kyrene.
theorie die Vorbildlichkeit griechischer Kunst, die er den Künstlern seiner Zeit als Vorbild empfiehlt. In seinem zweiten Hauptwerk, der 1764 in der ersten und 1776 in der zweiten Auflage erschienenen Geschichte der Kunst des Alterthums begründet Winckelmann erneut den Primat der griechischen Kunst und verbindet diesen mit dem biologistischen Modell von Entstehen, Höhepunkt und Verfall. Dadurch war es ihm möglich, Stilepochen, in der Sprache Winckelmanns den älteren, den hohen Stil im 5. Jh. v. Chr., den schönen Stil und den Stil der Nachahmer, mit formalen Charakteristika zu scheiden und Kunstwerke als Teil einer Kunstentwicklung zu begreifen. Vor allem durch diese beiden Abhandlungen ist Winckelmann zum Begründer der modernen Archäologie und Kunstwissenschaft avanciert. Winckelmann kannte sie
Bilder im Kopf. Archäologen und ihre Medien
423
Abb. 9: Das Strategeion im Apollonheiligtum von Kyrene.
alle aus eigener Anschauung, und genau darauf kam es ihm an: die Vermittlung seiner eigenen Anschauung durch das geschriebene Wort. So bebilderte er die beiden Auflagen der Geschichte der Kunst des Alterthums nur ausgesprochen spärlich mit Kupferstichen46. Möglicherweise liegt hierin auch ein Grund dafür, dass das von Winckelmann entwickelte Modell sich als sehr wirkungsmächtig erwies, denn zu der inneren Logik eines historistischen Modells mit den Parametern Werden – Höhepunkt – Verfall – passt das Medium des Textes sehr gut. Anders als bei einem Bild, wo der Blick in ganz viele Richtungen geht, ist die Rezeption des Textes eine vollkommen andere: Die Augen vollziehen durch die strenge Linierung des Textes s-förmige Bewegungen47. In der Überlieferung von Winckelmanns Hauptwerken als Text mit einer sehr spärlichen Bebilderung könnte auch ein Grund dafür gelegen haben, dass sein Modell zwar von der Forschung rasch aufgegriffen und weiterentwickelt worden ist, sich
46 Die 431 Seiten umfassende Erstauflage der Geschichte der Kunst des Alterthums (1764) enthielt (24 Kupferstiche, die 881 Seiten umfassende Zweitauflage (1776) 22 Kupferstiche. 47 Vgl. dazu Giuliani (2003) 27–29 Abb. 1–2.
424
Ortwin Dally
aber in methodologischer Hinsicht vor allem auf die Auswertung von Textquellen und nicht von Bildern stützte. Es bedürfte noch einmal einer genaueren Prüfung, ob den meisten Lesern im 19. Jahrhundert jeweils die zahlreichen Veröffentlichungen von Antikensammlungen und Denkmälercorpora aus dem 18. Jahrhundert zur Verfügung standen, die zunächst einmal für ein fürstliches Milieu geschaffen worden waren, und derer es bedurft hätte, um das Oeuvre Winckelmanns, dessen Untersuchungen sich primär auf die Autopsie von Originalen gründeten, vollumfänglich nachvollziehen zu können48. Noch heute wird den Studenten eine bestimmte Periodeneinteilung der antiken Kunstgeschichte vermittelt, die sich im Falle der griechischen Kunstgeschichte im Kern bis auf Winckelmann zurückverfolgen lässt. Sie gliedert sich nach der geometrischen, archaischen, klassischen und hellenistischen Epoche. Auch wenn die Epocheneinteilung der römischen Kunst mit der Zeit der Könige, der Republik und der Kaiserzeit an politischen Eckdaten ausgerichtet wurde49, ist das Prinzip der Epocheneinteilung als solches vergleichbar; das Modell dürfte durch das Medium des Texte wesentlich mitbefördert worden sein. Bei der Vermittlung von Diskursen und Vorstellungen spielt Sprache, in der Vorstellungen und Hypothesen gerinnen, eine wesentliche Rolle. Sie ist nicht nur Ausdruck bestimmter Bilder, sondern unterstützt und verstärkt diese: In der deutschen Archäologie hat sich das Wort Befund als zentrale Kategorie der Beschreibung von Grabungen eingebürgert50. Sie zeigt ein sehr technisches Verständnis von Grabungen. Das Wort ist der Medizin entlehnt und verdeutlicht, dass im Kern der Ausgrabung das Herauspräparieren von Artefakten, Schichten oder Architektur steht. In der russischen Sprache hingegen gibt es beispielsweise kein Äquivalent für dieses Wort. Dahinter steht letztlich eine andere Auffassung von Ausgrabungen. Augustus wurde im lateinischen Sprachgebrauch princeps genannt. In der deutschen Forschung ist dieses Wort zumeist mit Kaiser übersetzt worden. Der Begriff weckt Assoziationen, die an Wilhelm II. denken lassen, dem römischen princeps aber wohl nicht gerecht werden dürften51. Ein derartiger Sprachgebrauch evoziert Bilder, Assoziationen, und diese wiederum wirken auf die Forschung zurück. Nicht nur von Forschern geschaffene Texte, sondern auch von Forschern geschaffene Bilder verleiten zu ihrer Rezeption: Schon in der einflussreichen Veröffentlichung unteritalischer und etruskischer Vasen der Sammlung Sir William Hamiltons (1731–1803), die durch Pierre-François Hugues d’Hancarville betreut worden war, standen figürliche Bilder mit mythologischen Szenen im Vordergrund des Interesses52. Dieses Interesse an den Bildern blieb auch im 19. Jh., genährt durch die Lektüre antiker Schriftsteller, lebendig. Davon zeugen nicht nur die Veröffentlichungen des
48 Vgl. dazu Borbein (2008) 269–270. 49 Hölscher (2002) 31–45. 50 Eggert (2008) 53. 51 Windt u.a. (2005). – Vgl. Dally (2007) 251–252. 52 Erstauflage: d’ Hancarville (1766–1767).
Bilder im Kopf. Archäologen und ihre Medien
425
1829 gegründeten Instituto di corrispondenza archeologica, sondern auch Veröffentlichungen wie die von Adolf Furtwängler und Karl Reichhold53, die die Bilder griechischer Vasen in Abrollungen präsentieren, so dass die Bilder klar verständlich waren54. Nachdem das Problem der Fotografie von Vasen in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts durch Ernst Langlotz einer befriedigenden Lösung zugeführt worden war55, setzte sich diese privilegierte Form der Veröffentlichung unter den Bedingungen der Fotografie fort. Undekorierte bzw. nicht figürlich dekorierte Gefäße fanden hingegen kaum Beachtung, obwohl sie auch bei Grabungen in Ländern und Regionen wie Griechenland, Kleinasien oder Unteritalien meistens das Gros der Funde ausmachen. Ähnliche Traditionsstränge in der medialen Vermittlung von Forschung lassen sich auch in der Skulpturen- und Porträtforschung ausmachen: Als das hauptsächliche Ziel der Forschung hatte sich im Verlaufe des 19. Jahrhunderts die Identifizierung griechischer Meisterwerke und der hinter ihnen stehenden Künstler etabliert56. Gipsabgüsse und die rasante technische Entwicklung der Photographie waren eine wesentliche Voraussetzung für ein verändertes methodologisches Vorgehen: das Ouevre griechischer Meister wurde nicht mehr primär über Schriftquellen, sondern über den Vergleich gleicher Ansichten römischer Kopien nach griechischen Vorbildern des 5. und 4. Jhs. v. Chr. erschlossen (Abb. 10)57. Als in den 1930er Jahren Forschungen zum römischen Kaiser und damit verbunden auch zu den Porträts römischer Kaiser verstärkt die Aufmerksamkeit der deutschsprachigen Forschung fanden, bediente man sich derselben Methode – der Rekonstruktion des Urbildes eines römischen Kaiserporträts über die Rezension von bekannten Repliken nach Bildnissen, die sich auf einen gemeinsamen Typus zurückführen ließen (Abb. 11); auch in diesem Fall wurden durchweg gleichartige Ansichten von Köpfen miteinander verglichen und entsprechend publiziert, um Gemeinsamkeiten eines Urbildes zu rekonstruieren58. Letztlich sind in beiden Fällen die Bilder auch Ausdruck eines verbindenden Leitgedankens, der Annahme der Forschung, über die Replikenrezension auf ein Urbild schließen zu können, das in dem einen Fall der geniale Künstler eines griechischen Kunstwerkes, in dem anderen Fall der zentrale Lenker des römischen Reiches war, eine Vorstellung, die erst seit den späten achtziger Jahren zunehmend kritisch gesehen wurde59. Auf einer abstrakteren Ebene können sich einzelne Bilder, seien sie nun textlich oder auf einer konkreten Ebene bildlich vermittelt, zu einem Gesamtbild verdichten,
53 54 55 56 57 58 59
Furtwängler u. Reichhold (1904–1932). Klamm (2007) 122–123. Langlotz (1928). Vgl. dazu Stähli (2001); Graepler (2001). Furtwängler (1893). Fittschen (1971) 221. Vgl. Dally (2007); Ewald u. Noreña (2010) 24–37; von den Hoff (2011).
426
Ortwin Dally
Abb. 10: Der Vergleich ähnlicher Ansichten von zwei Kopien (Gipsabgüssen) des Diomedes Cumae (nach Adolf Furtwängler [1893]).
Bilder im Kopf. Archäologen und ihre Medien
427
Abb. 11: Bildnisse des Commodus (nach Max Wegner [1939]).
das sich dann ebenfalls in der Rezeption durch die Forschung bemerkbar macht, weitervermittelt und verstärkt wird: In den letzten Jahren hat sich ein verstärkte Diskussion um Siedlungsformen früher Siedler im Zuge der sog. großen griechischen Kolonisation entwickelt. Sowohl im westlichen Mittelmeerraum als auch im Schwarzmeerraum ist deutlich geworden, dass vielfach nicht großangelegte Planstädte am Beginn standen, sondern kleine Hütten, die in die Erde eingetieft waren. In der Diskussion spiegelt sich teilweise ein tiefes Unbehagen darüber wieder, da Griechen nicht in Erdhütten gehaust haben können. Dahinter steht die wiederum durch eigene Anschauung und Bilder gewonnene Ansicht, steinerne Tempel und Theater seien bestimmend für das Bild „griechischer Städte“. So wird in einer Publikation zu einer großen Siedlung im Dondelta, dem um die Wende vom 6. zum 5. Jh. v. Chr. gegründeten Elisavetovka, überzeugend zwischen großen, in den Boden eingetieften Hausbauten und solchen mit einem steinernen Fundament differenziert. In den Holz-Lehmbauten sollen Skythen gelebt habe60, in den steinernen Bauten Griechen aus dem Borsporanischen Reich61. Dem Areal wird denn auch in der Publikation der Name
60 Marbenko u.a. (2000) 93–131 (Die Architekturkomplexe der einheimischen Bevölkerung [Wohnund Wirtschaftsbauten]). 61 Ebenda 249–261 (Die griechischen Niederlassungen auf dem Territorium der Elisavetovka-Siedlung).
428
Ortwin Dally
„Akropolis“ zugewiesen – hier schwingt die Vorstellung von Athen als „der“ Akropolis schlechthin mit; dort sollen Griechen aus dem Bosporanischen Reich um die Mitte des 4. Jhs. v. Chr. eine Art „Enoikie“ oder Kolonie gegründet haben62. Das gesamte Areal ist nicht gründlich untersucht worden63. Gleichwohl gehen die russischen Forscher davon aus, dass hier Griechen gelebt haben müssen. Sie machen dies in erster Linie an der Architektur, den Importen (Terrakotten, Schmuck, Keramik mit Graffiti) sowie einer Bosporanischen Kalksteinstele fest, die sie im Fundamentbereich eines Hauses verbaut vorfanden64. Gleichzeitig stellen sie aber fest, dass ein hoher Anteil handgemachter Keramik auch dafür sprechen könne, dass dort neben den Griechen auch „Barbaren“ lebten65. Es könnte sich also auch um eine einheimische Elite gehandelt haben, die sich eines griechischen Lebensstils bediente.
3 Die Rolle der Medien Archäologen schaffen Bilder – durch Ausgrabungen, durch die Auswahl von Funden für die langfristige Aufbewahrung und Publikation, durch Rekonstruktionen und durch museale Arrangements. Diese von Archäologen geschaffenen Bilder werden in wissenschaftliche Diskurse eingebracht durch eine Übersetzung in medial vermittelte Bilder in Form von Texten, Photographien, Zeichnungen, Satellitenbildern etc. Die vorangegangenen Zeilen sollten verdeutlichen, dass dieser Prozess nicht einseitig ist. Gerade die medial vermittelten Bilder wirken wiederum zurück und führen dazu, dass bestimmte Leitvorstellungen – Bilder im Kopf – verstärkt und weiter tradiert werden. Eine entscheidende Rolle kommt in diesem Prozess sicherlich dem Studium zu, das man geradezu in einem übertragenen Sinne als „Transmissionsriemen“ bezeichnen könnte, denn hier wird ein fachspezifischer Umgang mit Bildern und bestimmten Medien im Rahmen von Lehrveranstaltungen vermittelt und antrainiert. So galten in der universitären Ausbildung in Frankreich bis vor wenigen Jahren vielerorts Texte als entscheidende Quelle zum Verständnis antiker griechischer und römischer Kultur66. Anders als an deutschsprachigen Universitäten stand zunächst das Studium antiker Schriftsteller im Vordergrund der Ausbildung, erst zu einem späteren Zeitpunkt wurde der Umgang mit Primärdenkmälern Gegenstand des universitären Unterrichts. So kommt denn ein viel gelesenes französisches Handbuch zur Archäo-
62 63 64 65 66
Ebenda 249. Ebenda 255. Ebenda 257. Ebenda 257, 261. Therrien (1998).
Bilder im Kopf. Archäologen und ihre Medien
429
logie, das für Studentinnen und Studenten gedacht ist, ohne eine einzige Abbildung aus67. Als sich die prähistorische Archäologie als eigenständige Disziplin zu etablieren begann, wurde die typologische und zugleich chronologische Ordnung von Objektklassen zu ihrem Markenzeichen. Objekte wurden gezeichnet, bei der Keramik wurde das Profil zum wesentlichen Kriterium für die typologische und zeitliche Einordnung eines Gefäßes. Diese Sehweise wird auch im universitären Unterricht vermittelt durch Zeichnungen, vor allem aber noch bis vor kurzem durch Typentabellen, die aufwendig für Seminare durch die Zusammenstellung von Abbildungen aus einer Vielzahl von Publikationen erstellt wurden. Diese Unterrichtsweise trägt einerseits zu einer Privilegierung eben dieser Dokumentationsform bei den Studenten bei, andererseits aber auch zu einer Ausblendung bestimmter Aspekte, die, um beim Beispiele eines Gefäßes zu bleiben, auch von großer Bedeutung sind: etwa des Dekors bzw. der Ästhetik eines Gefäßes. Ähnlich prägend dürfte die Diadoppelprojektion sein, die nach dem 1. Weltkrieg flächendeckend vor allem in der Kunstgeschichte und der Klassischen Archäologie im deutschsprachigen Raum bis in die neunziger Jahre des 20. Jahrhunderts in Gebrauch war68. Ohne Zweifel war sie besonders geeignet, das vergleichende Sehen zu fördern und damit auch das Paradigma des Künstlers, das ja im Wesentlichen auf der Rekonstruktion von Urbildern aufgrund von Replikenrezensionen römischer Kopien beruhte, lebendig zu halten und weiter zu tradieren. Hierin spiegeln sich fachspezifische Formen der Verwendung von Medien, die ganz wesentlich auch über die Laboratorien der Forschung in Form von Archiven, Bibliotheken und Fototheken gestützt und weiter tradiert werden. Letztere sind seit dem letzten Viertel des 19. Jahrhunderts an Abteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts u.a. in Athen und Rom, aber auch an den Universitäten gefördert durch kommerzielle Firmen auf der Grundlage von Fotokampagnen, aber auch einzelne Vertreter der noch jungen Fachdisziplin, die als Multiplikatoren dienten, ausgebaut worden. Bei genauerem Hinsehen stellt man fest, dass durch diese Netzwerke vielerorts ein vergleichbarer strukturierter Kernbestand an Bildern mit standardisierten Ansichten von Denkmälern entstand69, der dann auch im Unterricht, aber auch in Büchern weiter reproduziert wurde. So hat vor einigen Jahren eine Analyse der bestellten Bilder der Fotothek der Außenstelle Teheran des Deutschen Archäologischen Instituts gezeigt, dass von dem gesamten Bildbestand nur ein Drittel von primärem Interesse ist. Es handelt sich um Bilder aus Persepolis, die immer und immer wieder in leichten Variationen in Publikationen zu
67 Bruneau u. Balut (1997). – Vgl. auch die Zeitschrift Revue d’Archéologie moderne et d’Archéologie générale, die ebenfalls vom Institut d’art et d’archéologie de l’université de Paris-Sorbonne herausgegeben wird. Auch sie kommt mit sehr wenigen Abbildungen aus. 68 Vgl. dazu aus Sicht der Kunstgeschichte mit weiterer Literatur Beyer (2005); Dilly (2009). – Aus Sicht der Archäologie vgl. bislang lediglich Weitmann (2012). 69 Exemplarische Untersuchung anhand von Foto Marburg: Matyssek (2009).
430
Ortwin Dally
Persien und Persepolis zu finden sind70. Handbücher, wie sie auf der Grundlage eigener Fotoarchive im Verlagen wie dem Hirmer Verlag vorgehalten werden71, haben ebenfalls mit ihren kanonisierten Ansichten antiker Denkmäler und Bauten einen wichtigen Anteil an der Vermittlung bestimmter Bilder sowohl in der breiten Leserschaft als auch der Fachöffentlichkeit72. In Bezug auf die Archäologie noch nicht erforscht ist die Frage, die in die Verhaltensforschung und die Neurowissenschaften führt, inwiefern das Training des Umgangs mit bestimmten Medien sich auch auf das Gehirn auswirkt73. Forschungen der Neurowissenschaften zeigen mittlerweile sehr deutlich, dass sich bestimmte Regionen des menschlichen Gehirns, wenn sie dauerhaft genutzt werden, sich ausweiten können; dies kann dann auch bei einer sehr starken Beanspruchung zum Verlust der Fähigkeit, sich neues Wissen anzueignen, führen. So hat eine vieldiskutierte Langzeitstudie unter Londoner Taxifahrern ergeben, dass die hintere hippocampale Struktur im Gehirn, in der Raumvorstellungen verortet werden, vergrößert war und offenbar mit Dauer der Berufspraxis weiter ausgebaut wurde, wenn sie ihre (hodologische) Ortskenntnis sehr lange genutzt haben. Gleichzeitig hatten sie Schwierigkeiten, wie ein Vergleich mit Busfahrern gezeigt hat, sich neue räumliche Vorstellungen anzueignen74. Andererseits hat eine Forschergruppe in New York kürzlich, basierend auf Experimenten mit Mäusen, die These formuliert, dass sich Nervenzellen, wenn sie neuartigen Reizen ausgesetzt sind, sehr schnell reorganisieren können75. Derzeit erleben wir einen medialen Wandel. Digitale Daten und das Internet bestimmen mittlerweile weitestgehend die Forschungspraxis auch in der Archäologie. Nach wie vor besteht hier ein Wechselverhältnis. Digitale Daten sind potentiell verknüpfbar und deshalb geeignet, spartenartig aufbereitete Wissensarchive wie Bibliotheken, Archive etc. miteinander zu vernetzen. Dadurch kommen sie der in der Forschung privilegierten kontextuellen Betrachtung von Objekten ebenso wie grundsätzlichen Fragen zu Raum, Zeit oder Mensch-Umwelt-Beziehungen, wie sie derzeit die Forschungslandschaft prägen, entgegen und wirken umgekehrt auf diese wiederum zurück. Dies gilt auch für die universitäre Lehre, wo Powerpoint-Präsentationen, die eine Vielzahl von Bilden und Texten gleichzeitig zeigen können, an die Stelle des doppelt verwendeten Diaprojektors getreten sind76. Solch ein medialer Wechsel schärft zugleich aber auch das Bewusstsein dafür, dass hierdurch wiederum Fragestellungen in den Hintergrund treten können, die stark mit der Verwendung bestimmter Medien gekoppelt sind: So hat die faktische Abschaffung des Diaprojektors sicher-
70 71 72 73 74 75 76
Die Information verdanke ich B. Helwing (Berlin/Teheran). Vgl. z.B. Berve u.a. (1978); Lullies u. Hirmer (1979); Gruben (2001). Vgl. dazu Borbein (2008), der freilich nur auf den Beginn des 20. Jahrhundert näher eingeht. Eibl-Eibesfeld (1999) 417–448. Terrazas u. McNaughton (2000); Maguire u.a. (2006). Marik u.a. (2010). Schnettler u. Knoblauch (2007).
Bilder im Kopf. Archäologen und ihre Medien
431
lich dazu beigetragen, dass Fragen des stilistischen und formalen Vergleichs von Artefakten, die sehr stark von der Projektion zweier Lichtbilder an die Wand eines abgedunkelten Raumes profitiert hatten, mittlerweile deutlich zurückgegangen sind. Der polnische Biologe und Wissenschaftstheoretiker Ludwik Fleck hat schon in den dreißiger Jahren des vergangenen Jahrhunderts am Beispiel der Medizin die Theorie entwickelt, dass unsere Wahrnehmung mitnichten frei von Vorannahmen ist, sondern vielmehr kulturell geprägt ist. Das gilt auch für die Wissenschaft. „Wir schauen mit den eigenen Augen, aber wir sehen mit den Augen des Kollektivs Gestalten, deren Sinn und Bereich zulässiger Transpositionen das Kollektiv geschaffen hat.“77 Übertragen auf die Archäologie bedeutet dies, dass wir in erster Linie durch Medien die Vergangenheit wahrnehmen. Das Verhältnis zu den Zeugnissen der Vergangenheit ist reziprok: Archäologen wählen aufgrund bestimmter Bilder bestimmte Medien; diese prägen aber auch wiederum die Wahrnehmung von Objekten durch die Archäologen, die sich letztlich über diesen Prozess selber als Denk- und Bildgemeinschaft reproduzieren.
Literaturverzeichnis Alexandridis u. Heilmeyer (2004): Annetta Alexandridis u. Wolf-Dieter Heilmeyer, Archäologie der Fotografie. Bilder aus der Photothek der Antikensammlung Berlin, Mainz. Altekamp (2000): Stefan Altekamp, Rückkehr nach Afrika. Italienische Kolonialarchäologie 1911–1943, Köln u.a. Altekamp (im Druck): Stefan Altekamp, „Klassische Archäologie und Nationalsozialismus“, in: Jürgen Elvert u. Jürgen Nielsen-Sikora (Hgg.), Kulturwissenschaften und Archäologie, http://edoc.hu-berlin.de/oa/bookchapters/reD5IMz1lbPVM/PDF/291OSMHgfjGYo.pdf (04. 05. 2013) Andreae (1988): Bernhard Andreae, Laokoon und die Gründung Roms, Mainz. Andreae (1991): Bernhard Andreae, Laokoon und die Kunst von Pergamon. Die Hybris der Giganten, 2. Auflage, Frankfurt am Main. Audiat (1933): Jean Audiat, FdD II. Le Trésor des Athéniens, Paris. Benecke (2006): Norbert Benecke, „Die Tierreste“, in: Helmut Kyrieleis, Anfänge und Frühzeit des Heiligtums von Olympia. Die Ausgrabungen am Pelopion 1987–1996, Olympische Forschungen 31, Berlin/New York, 247–248. Berve u.a. (1978): Helmut Berve, Gottfried Gruben u. Max Hirmer, Tempel und Heiligtümer der Griechen, München. Beyer (2005): Andreas Beyer, „Lichtbild und Essay. Kunstgeschichte als Versuch“, in: Wolfgang Braungart u. Kai Kauffmann (Hgg.), Essayismus um 1900, Heidelberg, 37–48. Binder (1991): Gerhard Binder, „Exkurs „Augusteische Erneuerung“ in der Archäologie 1933–1945“, in: ders. (Hg.), Saeculum Augustum Bd. 3. Kunst- und Bildersprache, Darmstadt, 19–30. Boettger (2005): Burkhard Böttger, „Tanais in hellenistischer Zeit“, Eurasia Antiqua 11, 103–114.
77 Fleck (2011) bes. 400 (Zitat).
432
Ortwin Dally
Borbein (2008): Adolf H. Borbein, „Kunstgeschichte als ästhetisches Ereignis. Die Kunst der Antike in deutschsprachigen wissenschaftlichen Monographien für ein bürgerliches Publikum im 19. und frühen 20. Jahrhundert“, in: Ernst Osterkamp (Hg.), Wissensästhetik. Wissen über die Antike in ästhetischer Vermittlung, Transformationen der Antike 6, Berlin/New York, 267–281. Borbein (2011): Adolf H. Borbein, „Distanz und Verfremdung. Zur Rezeption des archäologischen Objekts in Wissenschaft und Kunst vom 20. zum 21. Jahrhundert“, in: Eva Kocziszky (Hg.), Ruinen in der Moderne. Archäologie und die Künste, Berlin, 45–74. Brather (2010): Sebastian Brather, „Archäologische Kulturen und historische Interpretation“, in: Stefan Burmeister u. Nils Müller-Scheeßel (Hg.), Fluchtpunkt Geschichte. Archäologie und Geschichtswissenschaft im Dialog, Münster, 207–226. Bruneau u. Balut (1997): Philippe Bruneau u. Pierre-Yves Balut, Artistique et archéologie, Mémoires d’Archéologie Générale 1–2, Paris-Sorbonne. Bumke (2009): Helga Bumke, „Didyma in der Spätantike“, in: Ortwin Dally u.a. (Hg.), ZeitRäume. Milet in Kaiserzeit und Spätantike, Ausstellungskatalog Berlin 2009, Regensburg, 68–81. Buschor (1930): Ernst Buschor, „Heraion von Samos. Frühe Bauten“, Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Institutes, Athenische Abteilung 55, 22–25. Caputo (1982): Giacomo Caputo, „Dallo scavo all’anastilosi, dall’anastilosi al restauro“, in: Carla Pietramellara u. Luigi Marino (Hg.), Contributi sul ‚restauro archeologico‘, Seminar Florenz 1980/81, Florenz, 37–50. Champoiseau (1880): Charles Champoiseau, „La Victoire de Samothrace“, Revue archéologique 1, 11–17 Taf. 2. Colin (1909–1913): Gaston Colin, FdD III.2. Inscriptions du Trésor des Athéniens, Paris. Crivellari u.a. (2004): Fabio Crivellari, Kay. Kirchmann, Marcus Sandl u. Rudolf Schögl (Hgg.), Die Medien der Geschichte, Konstanz. Dally (2007): Ortwin Dally, „Das Bild des Kaisers in der Klassischen Archäologie, oder: Gab es einen Paradigmenwechsel nach 1968?“, Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts 122, 223–256. Dally u.a. (2009): Ortwin Dally, Regina Attula, Helmut Brückner, Daniel Kelterbaum, Pavel A. Larenok, Reinder Neef u. Torsten Schunke, „Die Griechen am Don – Ergebnisse der deutsch-russischen Ausgrabungen in Taganrog und Umgebung“, Archäologischer Anzeiger 2009/1, 73–119. Dilly (2009): Heinrich Dilly, „Weder Grimm, noch Schmarsow, geschweige denn Wölfflin … Zur jüngsten Diskussion über die Diaprojektion um 1900“, in: Constanza Caraffa (Hg.), Fotografie als Instrument und Medium der Kunstgeschichte, München, 91–116. Disselkamp (2013): Martin Disselkamp, „Nichts ist, Rom, dir gleich.“ Topographien und Gegenbilder aus dem mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Europa, Stendaler WinckelmannForschungen 10, Ruhpolding/Mainz. Dunbabin (1948): Thomas James Dunbabin, The Western Greeks. The History of Sicily and South Italy from the Foundation of the Greek Colonies to 480 B.C, Oxford. Eggert (2008): Manfred Eggert, Prähistorische Archäologie, 3. Auflage, Tübingen. Eibl-Eibesfeld (1999): Irenäus Eibl-Eibesfeld, Grundriß der vergleichenden Verhaltensforschung. Ethologie, 8. Auflage, München/Zürich. Ewald u. Noreña (2010): Björn Christian Ewald u. Carlos F. Noreña, „Introduction“, in: dies. (Hgg.), The Emperor and Rome. Space, Representation, and Ritual, Yale Classical Studies 35, Cambridge, 1–43. Faulstich (2003): Werner Faulstich, Einführung in die Medienwissenschaft, Zürich. Faulstich (2004): Werner Faulstich, Medienwissenschaft, Zürich. Fittschen (1971): Klaus Fittschen, „Zum angeblichen Bildnis des Lucius Verus im Thermen-Museum“, Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts 86, 214–252.
Bilder im Kopf. Archäologen und ihre Medien
433
Fleck (2011): Ludwik Fleck, „Patrzeê, widzieê, wiedzieê“, Problemy 2, 1947, 74–84, in deutscher Übersetzung von Thomas Schnelle wiederabgedruckt: ders., „Schauen, Sehen, Wissen“, in: Sylwia Werner u. Claus Zittel (Hgg.), Ludwik Fleck, Denkstile und Tatsachen. Gesammelte Schriften und Zeugnisse, Frankfurt, 390–418. Furtwängler (1890): Andreas Furtwängler, Olympia. Die Ergebnisse der von dem Deutschen Reich veranstalteten Ausgrabung 4. Die Bronzen und die übrigen kleineren Funde von Olympia, Berlin. Furtwängler (1893): Andreas Furtwängler, Meisterwerke der griechischen Plastik. Kunstgeschichtliche Untersuchungen, Leipzig. Furtwängler u. Reichhold (1904–1932): Andreas Furtwängler u. Karl Reichhold, Griechische Vasenmalerei, 3 Bände, München. Gehrke u. Sénécheau (2010): Hans-Joachim Gehrke u. Miriam Sénécheau (Hgg.), Geschichte. Archäologie. Öffentlichkeit: Für einen neuen Dialog zwischen Wissenschaft und Medien. Standpunkte aus Forschung und Praxis, Bielefeld. Giuliani (2003): Luca Giuliani, Bild und Mythos. Geschichte der Bilderzählung in der griechischen Kunst, München. Graepler (2001): Daniel Graepler, „Kunst – Bilderwelt – materielle Kultur. Über das unklare Verhältnis der Klassischen Archäologie zu ihrer kunstwissenschaftlichen Vergangenheit“, in: Stefan Altekamp, Mathias René Hofter u. Michael Krumme (Hgg.), Posthumanistische Klassische Archäologie. Historizität und Wissenschaftlichkeit von Interessen und Methoden (Kolloquium Berlin 1999), München, 340–347. Gruben (1957): Gottfried Gruben, „Die Südhalle“, Deutschen Archäologischen Institutes, Athenische Abteilung 72, 52–64. Gruben (2001): Gottfried Gruben, Griechische Tempel und Heiligtümer, 5. Auflage, München. Hamiaux (2007): Marianne Hamiaux, La Victoire de Samothrace, Paris. d’ Hancarville (1766–1767): Pierre-Francois Hugues d’ Hancarville (Hg.), Collection of Etruscan, Greek, and Roman antiquities from the cabinet of the Honble. Wm. Hamilton. = Antiquités etrusques, grecques et romaines. Tirées du Cabinet de M. Hamilton 1–4. Imprimé par François Morelli, Neapel. Hickethier (2010): Knut Hickethier, Einführung in die Medienwissenschaft, 2. Auflage, Stuttgart. Hölscher (2002): Tonio Hölscher, Klassische Archäologie. Grundwissen, Darmstadt. Kavanagh (2007): Hugh Kavanagh, „The Repertoire of Archaeological Images,“ in: James Elkins (Hg.), Visual Practices across the University, München, 141–151. Kavvadias (1890): Panagiotis Kavvadias, Deltion Archaiologikon Ekdidomenon tou Genikou Ephorou ton Archaiotiton kai Mouseion, Athen. Kavvadias u. Kawerau (1906): Panagiotis Kavvadias u. Georg Kawerau, I Anaskaphi tis Akropoloeios apo tou 1885 mechri to 1890. Die Ausgrabung der Akropolis vom Jahre 1885 bis zum Jahre 1890, Athen. Kienast (2011): Herman Kienast, „Zur Rekonstruktion der Südhalle im Heraion von Samos“, in: Alexander von Kienlin (Hg.), Holztragewerke der Antike (Internationale Konferenz München 2007), Byzas 11, Istanbul, 75–80. Kilian-Dirlmeier (1985): Imma Kilian-Dirlmeier, „Fremde Weihungen in griechischen Heiligtümern vom 8. bis zum Beginn des 7. Jahrhunderts v. Chr.“, Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz 32, 215–254. Kircher (2012): Marco Kircher, Wa(h)re Archäologie: Die Medialisierung archäologischen Wissens im Spannungsfeld von Wissenschaft und Öffentlichkeit, Bielefeld. Klamm (2007): Stefanie Klamm, „Bilder im Wandel. Der Berliner Archäologe Reinhard Kekulé von Stradonitz und die Konkurrenz in Zeichnung und Fotografie“, Jahrbuch der Berliner Museen N. F. 49, 115–126. Knell (1995): Heiner Knell, Die Nike von Samothrake, Darmstadt.
434
Ortwin Dally
Kreutzer (1994): Bettina Kreutzer, „Überlegungen zum Handel mit bemalter Keramik im 6. Jahrhundert v. Chr. unter besonderer Berücksichtigung des Heraions von Samos“, Klio. Beiträge zur alten Geschichte 76, 103–119. Kümmel u.a. (2004): Albert Kümmel, Leander Scholz u. Eckhard Schumacher, Einführung in die Geschichte der Medien, Paderborn. Krumeich u. Witschel (2010): Ralf Krumeich u. Christian Witschel (Hgg.), Die Akropolis von Athen im Hellenismus und in der römischen Kaiserzeit (Internationales Kolloquium Bonn 2006), Wiesbaden. Kunze (2010/2011): Christian Kunze, „Rezension zu: Susanne Muth, Gewalt im Bild. Das Phänomen der medialen Gewalt im Athen des 6. und 5. Jahrhunderts v. Chr., Image and Context 1 (Berlin/New York 2008)“, Bonner Jahrbücher des Rheinischen Landesmuseums in Bonn 210/211, 595–602. Langlotz (1928): Ernst Langlotz, „Über das Fotografieren von griechischen Vasen“, Archäologischer Anzeiger 1928, 94–101. Lullies u. Himer (1979): Reinhard Lullies, Max Hirmer u. Albert Hirmer, Griechische Plastik. Von den Anfängen bis zum Beginn der römischen Kaiserzeit, 4. Auflage, München. Maguire u.a. (2006): Eleanor A. Maguire, Kathrine Woollett u. Hugo J. Spiers, „London taxi drivers and bus drivers. A structural MRI and neuropsychological analysis“, Hippocampus 16, 1091–1101, http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/Maguire/Maguire2006.pdf (Stand 19. 12. 2012). Marik u.a. (2010): Sally A. Marik, Homare Yamahachi, Justin N. J. McManus, Gabor Szabo u. Charles D. Gilbert, „Axonal Dynamics of Excitatory and Inhibitory Neurons in Somatosensory Cortex“, PLOS Biology 8/6, 1–16, http://www.plosbiology.org/article/info%3Adoi%2F10.1371 %2Fjournal.pbio.1000395 (Stand 18. 12. 2012). Marbenko u.a. (2000): Konstantin K. Marbenko, Viktor G. {itnikov u. Viktor P. Kopylov, Die Siedlung Elisavetovka am Don, Pontus Septentrionalis II. Tanais 2, Moskau. Matyssek (2009): Angela Matyssek, Kunstgeschichte als fotografische Praxis. Richard Hamann und Foto Marburg, Berlin. Münker u. Roesler (2008): Stefan Münker u. Alexander Roesler (Hgg.), Was ist ein Medium?, Frankfurt am Main. Muth (2008): Susanne Muth, Gewalt im Bild. Das Phänomen der medialen Gewalt im Athen des 6. und 5. Jahrhunderts v. Chr., Berlin/New York. Nohlen (2011): K.laus Nohlen, „„Pfusch am Bau?“ – Zur Dachrekonstruktion der Seitenhallen des Traianeums in Pergamon“, in: Alexander von Kienlin (Hg.), Holztragewerke der Antike (Internationale Konferenz München 2007), Byzas 11, Istanbul, 225–234. Pirker u.a. (2010): Eva Ulrike Pirker, Mark Rüdiger, Christa Klein, Thorsten Leiendecker, Carolyn Oesterle u. Miriam Sénécheau (Hgg.), Echte Geschichte: Authentizitätsfiktionen in populären Geschichtskulturen, Bielefeld. Redécouverte (1992): École française d’Athènes (Hg.), La redécouverte de Delphes, Paris. Ritter (2005): Dorothea Ritter, Rom 1846–1870. James Anderson und die Maler-Fotografen, Ausstellungskatalog München 2005, Bönningheim. Schanze (2001): Helmut Schanze (Hg.), Handbuch der Mediengeschichte, Stuttgart. Schanze (2002): Helmut Schanze, Lexikon Medientheorie und Medienwissenschaft, Stuttgart. Schnettler u. Knoblauch (2007): Bernt Schnettler u. Hubert Knoblauch (Hgg.), PowerpointPräsentationen. Neue Formen der gesellschaftlichen Kommunikation von Wissen, Konstanz. Shepherd (1999): Gillian Shepherd, „Fibulae and Females. Intermerriage in the Western Greek colonies and evidence from the cemeteries“, in: Gocha R. Tsetskhladze (Hg.), Ancient Greeks East and West, Leiden u.a., 267–300. Stähli (2001): Adrian Stähli, „Vom Ende der Klassischen Archäologie“, in: Stefan Altekamp u.a. (Hgg.), Posthumanistische Klassische Archäologie. Historizität und Wissenschaftlichkeit von Interessen und Methoden (Kolloquium Berlin 1999), München, 147–160.
Bilder im Kopf. Archäologen und ihre Medien
435
Stähli (2005): Adrian Stähli, „Die Rhetorik der Gewalt in Bildern des archaischen und klassischen Griechenlands“, in: Günter Fischer u. Susanne Moraw (Hgg.), Die andere Seite der Klassik: Gewalt im 5. und 4. Jahrhundert v. Chr. (Kolloquium Bonn 2002), Stuttgart, 19–44. Stöber (2008): Rudolf Stöber, Kommunikations- und Medienwissenschaften: Eine Einführung, München. Terrazas u. McNaughton (2000): Alejandro Terrazas u. Bruce L. McNaughton, Brain growth and the cognitive map, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 4414–4416, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC34310/ (Stand 19. 12. 2012). Therrien (1998): Lyne Therrien, L’histoire de l’art en France. Genèse d’une discipline universitaire, Paris. von den Hoff (2011): Ralf von den Hoff, „Kaiserbildnisse als Kaisergeschichte(n). Prolegomena zu einem medialen Konzept römischer Herrscherporträts“, in: Aloys Winterling (Hg.), Zwischen Strukturgeschichte und Biographie. Probleme und Perspektiven einer neuen römischen Kaisergeschichte zur Zeit von Augustus bis Commodus, München, 15–44. Walter (1990): Hans Walter, Das griechische Heiligtum dargestellt am Heraion von Samos, Stuttgart. Weber (2013): Ulf Weber, Versatzmarken im antiken griechischen Bauwesen, Philippika, Marburger altertumskundliche Abhandlungen 58, Wiesbaden. Weitmann (2012): Pascal Weitmann, Wider den digitalen Götzendienst. Kritische Anmerkungen zum modischen Verhältnis von Kunstwissenschaft und ‚neuen Medien‘, punctum 24, München. Der Beitrag ist ein leicht veränderter Nachdruck von ders., „Die Doppelprojektion – von der Sichtbarmachung der Kunstauffassung bis zum Untergang vor dem Beamer“, in: Festschrift für Max Kunze, „ … die Augen ein wenig zu öffnen“ (J. J. Winckelmann). Der Blick auf die antike Kunst von der Renaissance bis heute, Ruhpolding, 229–244. Wegner (1939): Max Wegner, Die Herrscherbildnisse in antoninischer Zeit, Herrscherbild Bd. II 4, Berlin. Wiggen (2011): Maria Wiggen, Die Laokoon-Gruppe. Archäologische Rekonstruktionen und künstlerische Ergänzungen, Stendaler Winckelmann-Forschungen 9, Ruhpolding/Mainz. Windt u.a. (2005): Franziska Windt, Jürgen Luh u. Carsten Dilba, Die Kaiser und die Macht der Medien, Berlin.
Abbildungsnachweise Abb. 1–3. 8–9 Abb. 4 Abb. 5 Abb. 6 Abb. 7 Abb. 10 Abb. 11
Photo H. R. Goette Photo O. Dally nach Gruben (1957) Abb. 2 Zeichnung N. Ullrich nach Knell (1995) Abb. 62 nach Furtwängler (1893) Taf. 13–14 nach Wegner (1939) Taf. 51

![Die antike Mathematik: Geschichte der Mathematik in Alt-Griechenland und im Hellenismus [2. Aufl.]
9783662613948, 9783662613955](https://ebin.pub/img/200x200/die-antike-mathematik-geschichte-der-mathematik-in-alt-griechenland-und-im-hellenismus-2-aufl-9783662613948-9783662613955.jpg)
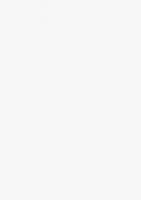
![Medien und Diskurs: Zur Skandalisierung von Privatheit in der Geschichte des Fernsehens [1. Aufl.]
9783839409947](https://ebin.pub/img/200x200/medien-und-diskurs-zur-skandalisierung-von-privatheit-in-der-geschichte-des-fernsehens-1-aufl-9783839409947.jpg)
![Heimkehr: Eine zentrale Kategorie der Nachkriegszeit: Geschichte, Literatur und Medien [1 ed.]
9783428533794, 9783428133796](https://ebin.pub/img/200x200/heimkehr-eine-zentrale-kategorie-der-nachkriegszeit-geschichte-literatur-und-medien-1nbsped-9783428533794-9783428133796.jpg)

![Geschlecht und Geschichte in populären Medien [1. Aufl.]
9783839423738](https://ebin.pub/img/200x200/geschlecht-und-geschichte-in-populren-medien-1-aufl-9783839423738.jpg)
![Taschenbuch aus Italien und Griechenland auf das Jahr .... 1830: Zweites Buch: Neapel und Rom [Reprint 2021 ed.]
9783112442821, 9783112442814](https://ebin.pub/img/200x200/taschenbuch-aus-italien-und-griechenland-auf-das-jahr-1830-zweites-buch-neapel-und-rom-reprint-2021nbsped-9783112442821-9783112442814.jpg)

![Optische Magie: Zur Geschichte der visuellen Medien in der Frühen Neuzeit [1. Aufl.]
9783839402405](https://ebin.pub/img/200x200/optische-magie-zur-geschichte-der-visuellen-medien-in-der-frhen-neuzeit-1-aufl-9783839402405.jpg)