Erinnerungswege: Kolloquium zu Ehren von Johannes Fried 3515118314, 9783515118316
Der Historiker Johannes Fried hat der Geschichtswissenschaft zahlreiche Impulse gegeben. Freunde, Kollegen und Schüler s
103 73 2MB
German Pages 256 [258] Year 2018
INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT
John Van Engen (Notre Dame):
Johannes Fried, Historian of the Middle Ages. A Tribute
Klaus Herbers (Erlangen):
Rom oder Westfranken? Papst Nikolaus I. (858–867) in Überlieferung
und Erinnerung
Matthias M. Tischler (Barcelona):
Karl der Große in der Erinnerung der Karolingerfamilie
Daniel Ziemann (Budapest):
Verzerrte Erinnerungen. Die Frage nach der Autorschaft
der älteren Adalbertsvita im Lichte der neueren Forschung
Jörg W. Busch (Frankfurt am Main):
Im Schlagschatten von Canossa 1077: Brixen 1080.
Die Einleitung eines kanonischen Verfahrens gegen Gregor VII.
Daniel Föller (Frankfurt am Main):
Autorität ohne Autoritäten. Mündlichkeit in der Geschichtsschreibung
der Salierzeit
Ernst-Dieter Hehl (Mainz):
Beneficium – wohlwollend interpretiert. Der Hoftag von Besançon 1157
Carola Föller (Erlangen):
„… da war ich auch dabei“. Erinnerungskritische Fragen an
Joinvilles „Vie de saint Louis“
Andrew Gow (Edmonton):
Protestant “Geschichtsklitterungen”. The History of Medieval German
and Netherlandish Bibles
Johannes Heil (Heidelberg):
Erinnerungsspuren und Ereigniskumulationen. Die Nürnberger Juden
im städtischen Gedächtnis 1350–1946
Janus Gudian (Frankfurt am Main):
Porzellan und Propaganda – Karl der Große im NS-Geschichtsbild
Mordechay Lewy (Bonn):
Zwischen Gedächtnis und Ritualisierung – Varianten
der Stabilisierungsstrategie. Der verewigte Streit um das Weihnachtsfest in
Jerusalem und die Memorialzeit in der isländischen „Njals Saga“
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
DIE AUTOREN
Recommend Papers
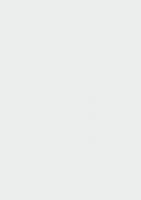
- Author / Uploaded
- Janus Gudian
- Johannes Heil
- Michael Rothmann
- Felicitas Schmieder (eds.)
File loading please wait...
Citation preview
Erinnerungswege Kolloquium zu Ehren von Johannes Fried Herausgegeben von Janus Gudian, Johannes Heil, Michael Rothmann und Felicitas Schmieder
Geschichte Franz Steiner Verlag
Frankfurter Historische Abhandlungen – 49
Janus Gudian / Johannes Heil / Michael Rothmann / Felicitas Schmieder (Hg.) Erinnerungswege
Frankfurter Historische Abhandlungen Herausgegeben von Frank Bernstein, Christoph Cornelißen, Birgit Emich, Moritz Epple, Andreas Fahrmeir, Annette Imhausen, Bernhard Jussen, Hartmut Leppin, Werner Plumpe, Sybille Steinbacher und Dorothea Weltecke Band 49
Erinnerungswege Kolloquium zu Ehren von Johannes Fried Herausgegeben von Janus Gudian, Johannes Heil, Michael Rothmann und Felicitas Schmieder
Franz Steiner Verlag
Gedruckt mit freundlicher Unterstützung von Bankhaus B. Metzler seel. Sohn & Co. Alfons und Gertrud Kassel-Stiftung historiae faveo
Umschlagabbildung: René Magritte, Unerwartete Antwort, © VG Bild-Kunst, Bonn 2017 // RMFAB, Brussels; photo: J. Geleyns – Art Photography. Umschlagabbildung: Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über abrufbar. Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar. © Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2018 Satz: DTP + TEXT Eva Burri, Stuttgart Druck: Hubert & Co., Göttingen Gedruckt auf säurefreiem, alterungsbeständigem Papier. Printed in Germany. ISBN 978-3-515-11831-6 (Print) ISBN 978-3-515-11832-3 (E-Book)
Johannes Fried
INHALTSVERZEICHNIS Vorwort............................................................................................................
9
John Van Engen (Notre Dame) Johannes Fried, Historian of the Middle Ages. A Tribute ...............................
11
Klaus Herbers (Erlangen) Rom oder Westfranken? Papst Nikolaus I. (858–867) in Überlieferung und Erinnerung ................................................................................................
25
Matthias M. Tischler (Barcelona) Karl der Große in der Erinnerung der Karolingerfamilie ................................
37
Daniel Ziemann (Budapest) Verzerrte Erinnerungen. Die Frage nach der Autorschaft der älteren Adalbertsvita im Lichte der neueren Forschung ............................
53
Jörg W. Busch (Frankfurt am Main) Im Schlagschatten von Canossa 1077: Brixen 1080. Die Einleitung eines kanonischen Verfahrens gegen Gregor VII. ...................
83
Daniel Föller (Frankfurt am Main) Autorität ohne Autoritäten. Mündlichkeit in der Geschichtsschreibung der Salierzeit ................................................................................................... 105 Ernst-Dieter Hehl (Mainz) Beneficium – wohlwollend interpretiert. Der Hoftag von Besançon 1157 ...... 135 Carola Föller (Erlangen) „… da war ich auch dabei“. Erinnerungskritische Fragen an Joinvilles „Vie de saint Louis“ ........................................................................ 157 Andrew Gow (Edmonton) Protestant “Geschichtsklitterungen”. The History of Medieval German and Netherlandish Bibles ................................................................................ 177
8
Inhaltsverzeichnis
Johannes Heil (Heidelberg) Erinnerungsspuren und Ereigniskumulationen. Die Nürnberger Juden im städtischen Gedächtnis 1350–1946 ............................................................ 191 Janus Gudian (Frankfurt am Main) Porzellan und Propaganda – Karl der Große im NS-Geschichtsbild ............... 223 Mordechay Lewy (Bonn) Zwischen Gedächtnis und Ritualisierung – Varianten der Stabilisierungsstrategie. Der verewigte Streit um das Weihnachtsfest in Jerusalem und die Memorialzeit in der isländischen „Njals Saga“ ................. 241 Abkürzungsverzeichnis ................................................................................... 251 Die Autoren ................................................................................................... 253
VORWORT „Erinnerungswege“ – wann was von wem wie weswegen erinnert wird – ist eine Thematik, deren Spur zu Johannes Fried führt. Doch während die Suche nach den Spuren und Strukturen fremder, vergangener Erinnerungswege nach wie vor das täglich Brot der Historiker ausmacht, kommt eine eigene, bislang gängige akademische Erinnerungskultur zunehmend außer Mode: Die Festschrift. Der 1895 (wie so viele andere jüdische Intellektuelle der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts) in Posen geborene und 1963 (wie manch anderer akademischer Flüchtling vor dem Nationalsozialismus) in Princeton verstorbene Ernst Kantorowicz (dessen Frankfurter Lehrstuhl Johannes Fried von 1982 bis 2009 innehatte) ist in seinen späten Jahren über all den Verpflichtungen schier verzweifelt, welche die von ihm so genannten „Pestschriften“ mit sich brachten. Insofern hätte Kantorowicz dem Abklingen der kulturellen Praxis ‚Festschrift‘ mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keine Träne nachgeweint. Aber an ihm hat es selbstredend nicht gelegen, dass seit dem Frankfurter Festkolloquium für Johannes Fried bis zum Erscheinen dieses Bandes überreichlich Zeit vergangen ist. Der Lehrer, Jubilar und Kollege seinerseits hat auch so keinen Wert darauf gelegt, den Genrebegriff und seinen Namen im Titel dieses Buches zu finden. Aber ganz gleich, wie Kantorowicz und Fried auch sonst zueinander stehen, liegt hier nun der mehr als verdiente liber amicorum vor. Mit ihm wird nicht nur der Wissenschaftler gewürdigt, sondern zugleich auch der von ihm ausgehende Einfluss aufgezeigt – und Johannes Fried gestaltete mit seinen Themen und Erkenntnissen, mit seiner erinnerungskritischen Methode sowie seiner vielfältigen Gremienarbeit über Jahre hinweg die Geschichtswissenschaft nicht nur in Deutschland entscheidend mit. Allerdings lag der Aufbau einer ‚Schule‘ nie in seiner Absicht – vielmehr sind es die in ganz unterschiedliche Richtungen verlaufenden Lehrer-Schüler-Filiationen, die seiner Auffassung von Lehre zugrundeliegen: Nicht einfach die eigene Sicht der Dinge multiplizieren, nicht bloß das eigene, Friedʼsche Denken unterrichten, sondern anderen sowohl einen Raum als auch die Muße zum jeweils eigenen Fragen und Forschen ermöglichen, die eigenen, Friedʼschen Argumente – durchaus im streitbaren Disput – als ‚geistigen Wetzstein‘ anbieten. Und während Kantorowicz zufolge dem Individuum der wissenschaftliche Eros vermittelt beziehungsweise in ihm entzündet werden müsse, damit es zu einem „Träger der [wissenschaftlichen] Flamme“ avancieren könne, spricht Fried – sich an den Duktus seines Vorgängers anlehnend – von einem „erotischen Verhältnis“, das zwischen dem Forscher und seiner Arbeit herrschen sollte. Diese Auffassung kann wiederum soweit gehen, dass, so wie ein Bischof mit seiner Diözese ‚verheiratet‘, es idealiter auch der Wissenschaftler mit seiner Disziplin ist, um noch einmal Kantorowicz zu paraphrasieren. Beide, Kantorowicz und Fried, wählten das akademische Arbeiten als Lebenseinstellung – und lebten beziehungsweise leben dies auch vor. Grund genug, dass sich Freunde, Kollegen und Schüler mit Frieds Arbeiten in einem Kolloquium an der Goethe-Universität Frankfurt am Main aus-
10
Vorwort
einandersetzten und ihre Beiträge hier präsentieren: Dem einen zum Jubiläum, den Beteiligten selbst aber zur Freude. Neben Giuseppe Cusa, Stephanie Filusch, Sinja Lohf und Sabine Strupp, die uns tatkräftig unterstützten, gilt unser großer Dank dem Bankhaus B. Metzler seel. Sohn und Co., der Alfons und Gertrud Kassel-Stiftung sowie historiae faveo, dem Förder- und Alumniverein der Geschichtswissenschaften an der Goethe-Universität, mit deren Spenden sowohl das Kolloquium als auch die Drucklegung des vorliegenden Bandes finanziert werden konnten. Frankfurt am Main, Hagen, Hannover und Heidelberg im März 2017 Die Herausgeber
JOHANNES FRIED, HISTORIAN OF THE MIDDLE AGES. A TRIBUTE John Van Engen Johannes Fried is a sympathetic colleague, a gentle man, and a humane friend. He is also, and no less, a passionate historian and an engaged conversationalist on all things historical and human. Born in Hamburg during the War (1942), he studied History under Peter Classen at Heidelberg (as well as German philology and political science). Through all his years as a professor, first briefly at Cologne, then for twenty-seven years at Frankfurt, he has lived in Heidelberg with his inseparable companion, intellectual partner, and devoted wife Sigrid. Fried’s dissertation, completed in 1970 and published in 1974, explored the emergence of a class of university-trained lawyers (“Juristenstand”) as judges and administrators in north Italian cities. This book, based on numerous documents, with the key term in its title echoing a distinct class early modern German society, identified that point in medieval urban society when the new learning of Bologna and the schools first intersected with a new political class in the Italian communes, this evident from the late twelfth century onwards. That intersection of university and society, of learning with life or practice, would remain a central theme in Fried’s subsequent work, if explored in all differing variations. Following Classen’s too early death, Fried edited a volume of his selected essays as well as his “Doktorvaterʼs” important studies on “Learning and Society”, a subject Classen had taken up amidst battles over university governance and curriculum waged during the 1970s. For his “Habilitationsschrift” Fried turned to a different subject, if also related in certain respects to Classen’s expertise, this a subject that turned on documents and privileges as instruments and expressions of an emerging central governance. In the 1960s–70s, and going back to the work of Tellenbach and Rosenstock-Huessy and many others, multiple claims were made about the Investiture Contest as a turning-point in European history. In this book, and amidst this nearly endless discussion, Fried took a different angle of approach to the reputed emergence of papal monarchy, here with sources especially from Iberia. He focused attention and interpretation on intriguing cases of papal privileges which offered protection to lay lords and princes. One of Fried’s earliest articles, in “Deutsches Archiv”, had already examined, or rather re-examined, the notion of regalia as it emerged from the Investiture Struggle in an attempt to find conceptual language for distinct royal rights, claims, and privileges. Still another article had detailed the appearance in canon law of new “procedural manuals”, these a manifestation, again both intellectual and practical, of busier church courts and a broader turn toward learned law. This was the conjunction that intrigued him, and he had a nose, as we would say in English, for locating just those documents that illumined this intersection between theory and practice.
12
John Van Engen
Writing a dissertation, also in many respects an “Habilitationsschrift”, served – and in many ways does still – as a medieval apprenticeship, even in our modern academic world, if always, in principle at least, with opportunities for personal freedom and originality. What historians do when they become, so to speak, their own person is what’s truly revealing: whether they develop new ideas and keep up the writing, to what sources they turn most readily, what style of article and book they prefer to write. Johannes Fried, as anyone reading this tribute will know, kept writing at a truly astounding pace throughout his life: nearly twenty books, another twenty edited volumes, and some 150 essays, not to speak of numerous reviews. Fried published his book on “päpstliche[n] Laienschutz” in 1980. Over the next decade he began to write articles, both important and original, on a series of themes that would remain abiding interests. These took up subjects moreover that general historians and readers could readily enter into, whatever their own special interests: the nature of freedom; human social bonds and the nature of polity (especially in the Carolingian era); powers of human perception in the face of new experience (Mongols); the spread of university learning (also into German lands); and Christian expectations both anxious and curious of an approaching End-time, with its paradoxical effect of spurring human enterprise. Some of these essays reappear now in his volume “An Invitation to the Middle Ages” (“Zu Gast im Mittelalter”). Two of the topics would provide themes for meetings of the “Konstanzer Arbeitskreis” (freedom, and school learning), even as schooled learning (rhetoric and dialectic) became the theme for the conference he organized during his year at the “Historisches Kolleg” in Munich (1990–91). Beyond these articles during this decade Fried also published two books, and they also engage new themes, one (“Otto III. und Boleslaw Chrobry”, 1989) treating the now sensitive topic (post-War) of Ottonian imperial relations to Slavic neighbors to the east, especially the Polish and Hungarian princes, the other his textbook on the Carolingian and Ottonian realms for the “Oldenbourg Grundriss” series. It was with this latter volume that Fried first undertook to write narrative history, an enterprise at which he would come to excel. Writing narrative, and accessible narrative, and doing so in language meant to captivate, intrigue, surprise, and finally persuade – this has become a hallmark of Fried’s writing as a historian. In these narratives readers are invited to enter into the passion that drives him as a historian, this desire to make all things human intelligible, even or especially in their strangeness or otherness. The prose aims to make them come alive once again in the telling: for the human energies embedded in those historical moments a thousand years in the past to become real and active, a continuing presence in the telling and the reading. In his book on Otto III and Boleslaw Chrobry Fried also made his own approaches and insights associated with some of the great historians of a previous generation, including Percy Ernst Schramm (who was one of the teachers of Peter Classen) and Ernst H. Kantorowicz (a predecessor at Frankfurt, who wrote his “Frederick the Second 1194–1250” in Heidelberg): thus, to illumine Ottonian history by way of the splendid royal and imperial images in its most precious manuscripts. History went beyond the textual: it was also visual, the visual sources sometimes speaking more tellingly than the textual. Fried has a wonderful eye, it turns
Johannes Fried, Historian of the Middle Ages. A Tribute
13
out, and anyone who has been a guest in his house and has studied the sketches and paintings on his walls will know that his visual acumen rests upon inherited family genes as well as his own singular gifts. At his most distinctive and his most passionate Johannes Fried is properly a historian of the human spirit. He cares deeply about how people think, therefore also what they thought and how they thought in the past; more precisely, how ways of thinking drove history, spurred historical change. Fried is a masterful and imaginative reader of medieval sources with an amazing mastery of medieval sources across several centuries. But his most original research often turns precisely on trying to grasp forms of medieval thinking (“das Denken”) and knowing (“das Wissen”). He is interested in schools and learning as such, but his real passion and insights circle around thinking as such, how thinking and learning and knowing intersect with human action to make history. During his term at the “Historisches Kolleg” in Munich his public lecture explored varied ways in which scholarly learning (“Wissenschaft”) and economy (“Wirtschaft”) came together in merchants and fairs, including eventually book fairs such as that of Frankfurt. Accounting, arithmetic, and keeping books schooled both merchants and schoolmen, and shaped their mindset – as Joel Kaye would subsequently argue for Paris. This particular union and its resultant mindset, Fried argues, in fact distinguished medieval and later European history from Antique culture and society. This drive to know, to satisfy curiosity, to answer questions, must be understood not only as an end in itself, which it could be, but as an orientation toward addressing human and social needs – it then one of the most fruitful energies in the making of medieval European history. An article he had written a decade earlier, honoring Carlrichard Brühl as a teacher, investigated thirteenth-century travel reports concerning Mongols under the striking title “In Search of Reality” (“Auf der Suche nach der Wirklichkeit”). What he found at work in these authors were the methods of the university and the new schools, inquisitio and all the other dialectical techniques for determining truth, here applied to uncover what they could about people living beyond the realm and customs of Latin Christians – and yet these tools in some sense not fully sufficing to account for the strange “reality” they here observed. Fried argues in several publicatons – also in his recent book on “Charlemagne, Power and Faith” (“Karl der Große. Gewalt und Glaube”) – that this drive to know and understand was found already in the Carolingian and the Salian periods, whence his conference at the “Historisches Kolleg” on rhetoric and dialectic, the schooled forms of thinking that predated scholastic inquisitio. Further, in a wide-ranging article, part of a volume he co-edited on “Wissenskulturen”, Fried applied this “forschungsstrategische Konzept” to yet another lay setting, the royal court, also beginning in the Carolingian era and going forward all the way into the thirteenth century and the court of Frederick II. Here he also evaluates all the varied claims about the culture of Frederick’s court, as elsewhere he would bring out Frederick’s book on falcons and falconry, a lay case of applied learning. His insistent interest turns on that drive to know and to apply, here as importantly mediated outwards from princely courts – first on a grand scale, he argues in various places, with the Carolingian kings. We should note too his essay on “The universality of freedom in
14
John Van Engen
the Middle Ages” (“Über den Universalismus der Freiheit im Mittelalter”), where Fried traced notions of a human freedom that cut across social class and legal condition and could reach to ideas, particularly the ideas of churchmen such as Rather of Verona or Pope Gregory VII. In all these studies Fried attempts to lift out, and to narrate for his readers, the historical reality of medieval human beings energized by way of thinking and learning to address their lived situations, be this in their work, in power and politics, in commerce, the organization of society, or notions and privileges attending the status of human beings. Over the last generation medieval historians have taken up religious history extensively, but in ways that rise above older and often narrower forms of church history. In his work Fried too takes religious beliefs and energies and thinking seriously as shapers of medieval and ultimately European history – but he does so from his particular perspective as a historian of the human spirit. In a large article (“Endzeiterwartung um die Jahrtausendwende”) dense with materials and sources, published in “Deutsches Archiv” in 1989, Fried drew attention to a matter that has become central to his work ever since: medieval Christian notions of an approaching End-time when all humans would have to render an account of their lives before the Lord God. What intrigues Fried here is only in part the unavoidable giving of an account, important as that might be to a person’s sense of self and to human action. He keys rather on the anxieties that attended the anticipation of this dawning End, the looking ahead to this inevitable moment when an end to historical time would break in. In this first article Fried’s interpretation singled out two key claims: that anxieties and expectations around the year 1000 were real and reasonably widespread (over against historians who had expressed skepticism), and – as importantly – that people on the other side of the year 1000 took heart, turned their minds to tasks at hand, and came away re-energized. The consequences he sees manifest in the richness of eleventh-century history and culture, whether or not one calls it a “svolto”, a turning-point, to echo another conference (German-Italian) in which Fried took a prominent role. This End-time “form of thinking” has come to inform numerous of his writings over the past twenty-five years, including a new book to appear within the year, and has generated strong claims to its import for the making of medieval European history. Along the way he has reworked standing interpretations of Augustine’s thinking on time and history, and identified other pivotal moments of End-time expectation from Charlemagne to Isaac Newton. A decade after that first article Fried expanded his argument into a preliminary general book, now succeeded by a more comprehensive one (“Dies irae. Eine Geschichte des Weltuntergangs”), on apocalyptic and End-time thinking, “Ascent out of Decline” (“Aufstieg aus dem Untergang”). Here he works out a broader and more specific argument about the effects of this form of thinking on European history, specifically that this fixation on a coming Doomsday paradoxically drove medieval Europe forward into the modern world, into indeed a “scientific” and “secularized” modern world. More, in his conclusion he provocatively poses the question as to whether this “form of thinking” (“Denkstil”) accounted for the “rise of the West”, particularly the scientific (“naturwissenschaftlich”) West. The issue historically, he argues, was that people needed
Johannes Fried, Historian of the Middle Ages. A Tribute
15
to know how to read the signs of the times, signs to be found in stars, comets and eclipses, in famines and earthquakes. If serious-minded Christians were to prepare themselves, figure out when that End was near, they had to understand these natural phenomena just as much as holy texts, both words from God – even though, historically and ironically, the more they grasped the phenomena themselves the more distant God became. The brilliance of this book works at several levels, even if discussion and arguments continue, a sign that its insights have touched something real. Fried has written it in an altogether accessible format while basing it on scholarly research; he has taken a form of belief nearly unintelligible to many moderns and rendered it central to the story of Europe’s making; and he here raises questions about the shape of European history and of a distinctive European human experience grounded in distinctive and even “strange” ways of perceiving and thinking. Johannes Fried is not an intellectual historian in the classic or narrow sense of that term, as anyone will instantly recognize who reads his narrative histories, filled to bursting with human detail, with anecdotes and stories that he first gathered into binders in his office. These too were the stuff of his day-to-day teaching on all conceivable aspects of human life. As a historian, nonetheless, Fried writes in ways that are more self-aware, as well as self-reflective and self-critical, than most. I might illustrate this from an early talk he gave often after finishing his “Habilitation” – serving in part as what Americans would call a “job-talk”, what his teacher Peter Classen I once heard call “das Vorsingen”, also the first of many articles he would publish in the “Historische Zeitschrift” (“Der karolingische Herrschaftsverband”, 1982). Fried took up an old subject, the nature of politics and power in the Carolingian era, in effect raising the theme, tainted by recent history, of the “state” and statecraft. What was required first to approach this matter, he declared, was a “political hermeneutic”, a deeper conceptual unpacking of the terms Carolingians used to instantiate power and its expression. Here he worked out his own views, with which he has largely stuck: that the people of that era had in fact no different “form of thinking” with respect to royal power than what they held toward that exercised by powerful individual lords. It was however a reforming Carolingian church, indebted to late antiquity but itself still badly underdeveloped as an institution, that first lent to kingship and to administrative functions the language and set of conceptual terms that enabled churchmen and administrators to turn personal power, such as that over a household small or large, into more abstract and institutional notions of a polity. Eventually Fried also made his own the insistence of many on the overwhelming orality of early medieval society. At issue then was how, apart from texts, power could be represented and made real (“Aktualisierung”). The example he chose to focus on was the elevation of King Henry I, the reputed beginnings of “Germany”, a case still raw from its use and abuse in the 1930s, and one to which Fried would repeatedly return in future work. Fried’s boldest and most renowned early effort at deconstructing and then reconstructing history came in 1994 with his volume for the prestigious “Propyläen Geschichte Deutschlands”. His volume, the first in the series, treated the politically and historically fraught matter of beginnings, and he titled it “The Path into History” (“Der Weg in die Geschichte”). Perhaps the title was meant to echo arguments
16
John Van Engen
current among modern historians about a disputed alternative path (“Sonderweg”) into German statehood eventuating in the catastrophe of the Third Reich. However that may be, what Fried meant to write was a history providing both scholars and general readers with an alternative to all the hidden ideological landmines buried in nineteenth-century nationalist and racist notions of the German people or the German state, also all those attempts by both historians and politicians earlier to locate their agenda in an “authenticating” and original medieval past. For his achievement in this book Fried was honored with one of the highest prizes Germany has to offer a historian, the “Preis des Historischen Kollegs” (1995), personally conferred by the President of the German Republic. At the ceremony Arnold Esch read a wonderful “Laudatio”, at once thoughtful and amusing. Fried then presented a carefully crafted talk on “Learning and Phantasy” (“Wissenschaft und Phantasie. Das Beispiel der Geschichte”), an essay which ought to be required reading for students of history. It represents his most programmatic reflections on the task of a historian together with a response to some who had critiqued his efforts to intuit and narrate the lives of early medieval people as going beyond what the sources strictly permitted. In this book, both highly creative and deeply anchored in the sources, he retold the story of the early history of the German-speaking peoples in central Europe. While implicitly confronting tortured issues that still hung over matters touching German “origins”, Fried lifted the conversation and narrative above fate or race or nationalism. He planted the coming of a German people firmly and entirely in history, all the contingent accidents of events, of competing intents and purposes, which taken together brought these peoples slowly to identify themselves as “Germans”, a designation in fact largely taken over initially from the outside. Fried was writing, after 1990, at a time when broader shifts in the German historical community were also in play. The great and influential medieval historians who had retained their positions under the NS-Regime had now passed on. Discussions now began to turn more openly on party memberships and degrees of complicity. Fried was among those who most openly raised these issues among medieval historians in talks he delivered at the “Konstanzer Arbeitskreis” and then as incoming president of the “Historikertag” 1998. At this same time too, the Wall came down, reuniting east and west, also historians of wholly varied life experiences and intellectual dispositions. However much the DDR was folded into the BRD, and however little the new boundaries of the German Republic matched any of the older medieval ones, a new sense of “Germany” was inevitably in the air, and thus also in some sense implicitly opened for historical discussion again. Further, the German Republic was now an essential part of the European Community, indeed its largest and wealthiest state, and that in turn has raised a whole new horizon of conceptual expectations. Was “national” history even relevant anymore? Fried began his book by in effect declaring a tabula rasa. The historian’s task was to imagine German-speaking peoples and their lands and lives and culture in “becoming”, as contingent products of history and time, if no less real for also being historical and contingent. So he started by asking: Who were they? How did they live? How did they think? What ends did they pursue? Any myths of national “being” or “people” or “place” were banished. The book ends by asking again “What’s German?” The
Johannes Fried, Historian of the Middle Ages. A Tribute
17
answer lies in history, all the fullness of the stuff excavated from surviving sources, the life and ways these materials suggest – here brought to life in compelling, and sometimes urgent, narrative. This ability to create narrative out of the tiniest bits, and out of a great multitude of bits, is one of Fried’s real markers. Indeed it is more than narrative – whence it raised eyebrows for some. It is an attempt to enter into the lives of these people, to make them speak and feel again. All these same traits would become evident again a decade later in his highly successful “The Middle Ages” (“Das Mittelalter”), just translated into English and widely reviewed, and now a decade later in his account of Charlemagne and his era under the rubric of “Power and Faith”, or if we retain his alliteration “Force and Faith”. Fried, I might add, has repeatedly proved extremely good at titles, often eye-catching, sometimes provocative, nearly always an expression of the vision that underlies the narrative of the book or article. In September 2000 Johannes Fried completed his term as “Vorsitzender des Verbandes der Historiker und Historikerinnen Deutschlands” (1996–2000), the equivalent of the American Historical Association, his election a sign of the respect and recognition he now enjoyed among German historians more generally. Around then I remember talking with a distinguished German historian of law – we were both then at the Institute for Advanced Study in Princeton, where Fried also spent a term (1995–96) – and he remarked to me of Fried (in German): “He has ideas.” It was high praise. For all the value we scholars invest in “Wissenschaft” as its own noble end, this scholarly learning, without ideas, without intuitive imagination, without new ways of conceiving issues and answers, is not in itself self-sustaining, not in the larger public, not even among ourselves. The themes Fried opened up in the 1980s and would pursue in the 1990s have remained central to his work, made manifest and further deepened in many innovative interpretive essays, especially in the fields of Carolingian and Ottonian history, though also with a recurring interest in Henry the Lion, that would-be king, that alternative reshaping of northern German history. Around 2000 however Fried also began to press his fellow historians to think harder about their own craft, to turn “das Denken” and “das Wissen” back on themselves as well as onto their medieval sources. We may hear two differing expressions of this challenge in the two addresses he delivered on the grand and very public stage of the “Historikertag”. In the first he challenged historians to look back with moral scrutiny at the integrity of their own profession, indeed their own teachers, and how they fared in history. This of course pointed particularly to how universities survived under the NS-Regime and the death and destruction it brought upon Europe and finally upon Germany itself. He called for historians to be honest about their own history, even like good researchers to document which medieval historians joined the Party and when and with what consequences – a step at which some of his peers balked. In his closing address Johannes Fried turned to a subject which had come to dominate his personal reflections on writing history, these issuing in 2004 in his grand synthetic work, “The Veil of Memory” (“Der Schleier der Erinnerung. Grundzüge einer historischen Memorik”), his “outlines for a historical science of memory”. Earlier he had written a series of articles and smaller books on “History
18
John Van Engen
and the Brain” and “The Relevance (Aktualität) of the Middle Ages” and in English “The Veil of Memory. Anthropological Problems when Considering the Past”. The issues Fried raises here are complex, and have been variously discussed and variously received. To grasp what is at stake, and what is intended, one must sort out in effect several interwoven strands. His stance is predicated on a passionate plea for the relevance of the thousand years that comprise medieval history, in effect the first thousand years of European history, now in the face too of an overwhelming modern presentism. This is what Fried has undertaken as a gifted narrative historian, his efforts to bring it to life, to make its worries and actions alive, “present”, if you like, while always respecting its distance and its difference. But this comes with an equally powerful plea addressed to his fellow practitioners of medieval history. The “remembered data” which are the basis for significant portions of our written sources must be re-considered, he argues, in the light of the modern scientific study of cognition, taking account of the neurological functions of the brain as an organ as well as psychological findings on the nature of memory as constitutive of both consciousness and the “subconscious”. Once again his title, that of the published form of his address to the “Historikertag”, captures his fundamental position as it challenges our historical craft: “Memory and Forgetting. The Present Founds the Unity of the Past” (“Erinnerung und Vergessen. Die Gegenwart stiftet die Einheit der Vergangenheit”). At one level one may understand this, as several have, including some critics, as Fried’s personal response to the truth of human subjectivity, to the inevitably personal framing of all our perceptions. As such it is also the sharpest affront to any naïve positivism or simplistic notion of history-writing “wie es eigentlich gewesen ist”. Some too may shrug, or may even dismiss Fried’s intervention, as yet another scholar who has simply taken a radical “post-modern” turn. But that is to get it wrong. It gives Fried no credit for his deep immersion in contemporary brain science and the neurology of memory. It is also to overlook one of the deepest truths about Fried and his work: He is a historian through and through, also as it happens a historian of a fairly distant past which has comparatively fewer surviving written sources. In a certain sense Fried’s position rests on a paradox. He perceives and wants two things at once. He wants to get at the truth, the data, the “facts”, and to reconstruct the story as fully and as accurately and as compellingly as he can for this generation – and he does that exceedingly well, as well as any medieval historian in his generation. At the same time he wants historians to be fully cognizant of modern scientific “facts” about the nature of human knowing and human remembering and human forgetting. Because in many of our medieval written sources the first set of “facts” are dependent upon, or mediated by, the second set of “facts”, these two must be considered together – just as, I might suggest, historians have taken for granted since the nineteenth century or before that they must bring, say, philology to bear on the reading and interpretation of their texts. What Fried sought to do in his “Veil of Memory” or his article on “Remembering and Forgetting”, also in work published since then, is to bring the historical and the cognitive together in symbiotic ways as mediated by the human and cognitive process of remembering. Once again Fried’s title articulates his insight. Memory of the past is veiled, veiled by mis-remembering, by forgetting, by re-remembering under new circum-
Johannes Fried, Historian of the Middle Ages. A Tribute
19
stances, and so on, all of this in turn conditioned by the capacities of human consciousness – and these modern cognitive science can illumine. At the same time the historian is also always busy trying to lift that veil, to see the real person or history underneath, while recognizing too that this can never quite fully or truly be achieved. What Fried has undertaken in much of his work over the last decade, including new books on Canossa and on the Donation of Constantine, is to put his insight and his agenda into practice. That means he is not talking “theory” but he constantly turns back to writing medieval history. The ultimate end is to grasp what we can know, or know better, about the submission of Tassilo or the crowning of Charlemagne or the Pseudo-Isidorian Decretals or the forged Donation of Constantine or St. Benedict – and so on through the list. In many ways what Fried is striving for, coming at it from the beginning out of his focus on “das Denken” and “das Wissen” as central to the human condition, and then latterly through research in neurology and cognition, is a twenty-first century response to what Ranke and his generation sought when they strove to give history the status of “Wissenschaft”. In both cases the historian, while doing his own proper work, reached for learning and for models taken from paradigms in the natural sciences (“die Naturwissenschaften”), in the twenty-first century from the human sciences centered on the brain and cognition. What Fried fears, or does not want, is a notion of the Humanities or “die Geisteswissenschaften”, as proposed by Dilthey or in various other forms, that effectively hives them off as their own private world, even their own private amusement park, while the real work of science goes on elsewhere. The two must be held together. Fried’s focus is not upon that historical form of memory culture which preoccupied a previous generation of German historians interpreting obituaries and necrologies and genealogies. He has in fact called some of their work into question, including that of the then influential Eduard Hlawitschka. His work comes closer at times to that of Patrick Geary and others like him. But in the end it is driven far more by the nature of memory and forgetting itself as a human dynamic, not just as instantiated in certain cultural materials manifest in the making of “Traditionsbücher” or cartularies. What Fried does work with in his writing is the notion of “lieux de mémoire” associated especially with the historian Pierre Nora, those monuments or moments or events around which memory constellates in time and over time, if still ever changing. Taking the notion of “Rome as Empire” for such a “place of memory”, Fried wrote a stunningly concise and insightful narrative stretching across the whole Middle Ages, in this case also in part honoring his teacher Peter Classen, though the essay was dedicated to Horst Fuhrmann, perhaps the most influential historian in Fried’s early years as a professor, member of the “Zentraldirektion” of the “Monumenta Germaniae Historica”, and for whom he also wrote a moving obituary in the “Historische Zeitschrift”. In historical practice the “veils” Fried is attempting to lift are often multiple, evident for instance in his recent book on “Canossa, the Unmasking of a Legend. A Polemical Pamphlet” (“Canossa. Entlarvung einer Legende. Eine Streitschrift”). The title is itself full of wordplay and allusion. In German historical narrative for over a century now, going back to its invocation by Bismarck (“We [the Germans] will not go to Canossa”) on the eve of the “Kulturkampf”, Canossa has come to
20
John Van Engen
represent a crucial turning-point in church and state. But “Canossa” is no less invoked by church historians as a turning-point in the emergence of a powerful monarchical papacy, and is still in German popular culture a “place of memory” as evidenced by a massively attended exhibition in 2006. The tempestuous conflicts of that era produced a series of polemical writings which, notably (around 1900), were given their own series in the “Monumenta Germaniae Historica” as Libelli de lite. Fried here writes his own “polemical pamphlet”, first of all to peel away the legendary veils that have come to cover the historical event itself (he not the first to do that). But he goes on to peel away the veils of faulty memory that mask the written sources surviving from the era itself, all the politicized and emotionalized and mistaken and mis-told accounts that now constitute our primary written materials. In the end Fried does not find Canossa to be the world-changing event that all the veiled legends have made it out to be, even if those were world-changing times. But equally, and importantly, through his own reconstruction of the sources now unveiled or unmasked he offers his understanding of what may have happened there, and of what was intended once all the other veils are lifted away, even if his evidence is slight (one key source). His evidence comes from counter-evidence too, the nature of travel in the late eleventh century and what kinds of distances could be covered in how many days, what information was available to participants (or often not). With this study, as with his many studies of for instance King Henry I or Henry the Lion, one must hold two moves paradoxically in balance to get at Fried’s intent: the unveiling of false and falsified memory but no less the attempt, even while unmasking the limitations of human cognition and memory, to glimpse nonetheless the face of history underneath those veils. In bemused conversation with me one day Johannes Fried referred to himself as a “Ketzer”. He meant more than his sometimes standing apart, his stubbornly thinking for himself, coming to his own conclusions, or uncovering overlooked connections and stories. On that occasion he was alluding to his family’s connections with the “Rudolf Steiner Gesellschaft” and its allied “Christengemeinschaft”. Fried entered the profession of medieval history at a time when most in Germany, perhaps even more so in the circle of medieval historians, identified still as Protestant or Catholic, with Jews nearly gone, and a few people now beginning to claim no religious allegiance. Steiner, a creative and independent thinker about human consciousness, himself pursued a form of “Geisteswissenschaft” which he understood as distinct from Dilthey’s. It would be mistaken to suggest that Fried’s personal history and experience “explains” the direction his own historical thought and practice have gone – even as in historical interpretation context does not, at least my view, “determine” event or belief, though it may predispose. The truth here may be almost an inversion. Those early intuitions and teachings opened him to questions and puzzles concerning the human condition and human understanding that other medieval historians simply never imagined or considered, and to which Fried has given a scholarly lifetime in seeking his own creative answers. That seeking is anchored deep in the medieval materials, what we can know about them through or despite the veil of memory, all of it animated by his constant musing over the nature of the human spirit as revealed in history.
Johannes Fried, Historian of the Middle Ages. A Tribute
21
For all of this work Johannes Fried has gained widespread recognition in Germany and beyond as a prodigious and innovative historical writer. Reviewers refer to him as “der renommierte Historiker des Mittelalters” or as the “éminence grise” among German medieval historians, and to his survey of the Middle Ages as a “splendid historical tapestry”. He has held key roles in scholarly academies across Germany as well as Hungary and the Czech Republic, has been a central editorial figure for a generation with “Historische Zeitschrift” and “Deutsches Archiv”, turned down several offers to other universities, and has garnered several prizes including, beyond those already noted, the “Sigmund Freud Preis” for scholarly writing (2006) and the “Gauß Medal” (2015) for innovative scholarship. In 2008 Johannes Fried also received an honorary doctorate from the Philosophical Faculty of the “Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule” in Aachen. In 2009 he retired from the University of Frankfurt. For Johannes Fried, historian of the Middle Ages, no less a historian of the human spirit, the thousand years of the European Middle Ages represent a rich and in various ways still – if often mis-remembered or not finally fully knowable – a living past. Understanding them is vital to what Europe now is and what it might yet become. More than most university historians, and also with more success, he has written history that can reach broader audiences and he has also joined discussions in public media. At the same time Johannes Fried is fully a scholar’s scholar. In his work he always returns to the sources, and he writes from the sources, often reproducing those sources for the modern reader. But Fried, like a true scholar, is not content with any notion of reading sources as if they and their meanings were self-explanatory. Like a classic nineteenth-century scholar he knows about manuscripts and editions and transmission and linguistic meanings, but as a scholar of the late twentieth and twenty-first century he insists that knowing and understanding, maybe particularly historical knowing, spring ultimately from ourselves, how we think, and hinge thus on perception and cognition and memory. He insists upon “othering” those medieval peoples, respecting their difference or even strangeness in ways of thinking and perceiving and believing, precisely while also trying to bring them nearer, to lift the veil, to catch some glimpse of the historical face. So it is in his recent book on Charlemagne, which he calls “a life”, echoing Einhard’s, even while insisting that apart from one letter to his wife and perhaps the Frankish Annals we have no direct access to this man as a man. Yet he fills the pages with overwhelming detail supplied by ninth-century documents, thus bringing the world of Charlemagne to life and so in some sense too its dominant royal figure. He sets aside notions of Charlemagne as the “Father of Europe” – a unifying ideal beloved in the immediate post-War period – and yet insists that this Frankish King and Roman Emperor’s insistence on knowing things, from estate management to astronomy to basic rhetoric and dialectic, lies at the origins of what would ultimately make Europe distinctively “European”. Thus we can and cannot know Charlemagne as a man, and yet he is ours, and must be ours if we are to understand ourselves as likewise the offspring of history. Fried is a historian of many things, and masterly in his craft, but always with a focus on the human spirit, a reality which we cannot ultimately reach historically except in its “veiled” manifestations and yet must ever seek to know and can know
22
John Van Engen
to some extent, glimpses behind and through the veil. For him the study of the past is one with the study of human character and the human condition. And a central feature of the human condition is that it is historical, that people live in time and move through time. History is therefore crucial to our own efforts to grasp who we are and who we were – this fully as true for the Middle Ages as for the modern era, and indeed going back deep into our evolutionary past. As much as any German medieval historian of his generation, or maybe more, Johannes Fried has made real both the distance between us and the people of the Middle Ages, and the vitality of the connection still, of the presence of that veiled past. SELECTIVE BIBLIOGRAPHY OF JOHANNES FRIED I. Monographies Die Entstehung des Juristenstandes im 12. Jahrhundert. Zur sozialen und politischen Bedeutung gelehrter Juristen in Bologna und Modena, Phil. Diss. Heidelberg 1970 (Forschungen zur neueren Privatrechtsgeschichte 21) Köln/Wien 1974. Der päpstliche Schutz für Laienfürsten. Die politische Geschichte des päpstlichen Schutzprivilegs für Laien (11.–13. Jh.) (Abhandlungen der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse 1980, 1) Heidelberg 1980. Otto III. und Boleslaw Chrobry. Das Widmungsbild des Aachener Evangeliars, der “Akt von Gnesen” und das frühe polnische und ungarische Königtum. Eine Bildanalyse und ihre historischen Folgen (Frankfurter Historische Abhandlungen 30) Stuttgart 1989, ebd. 22001. In polnischer Übersetzung: Otton III i Bolesław Chrobry. Miniatura dedykacyjna z Ewangeliarza z Akwizgranu, zjazd gnieźnieński a królestwa polskie i węgierskie. Analiza ikonogra ficzna i wnioski historyczne (Klio w Niemczech 6) übers. von Elżbieta Kaźmierczak/Witold Leder, Warschau 2000. Die Formierung Europas 840–1046 (OGG 6) München 1991, ebd. 21993, ebd. 32008. Der Weg in die Geschichte. Die Ursprünge Deutschlands bis 1024 (Propyläen Geschichte Deutschlands 1) Berlin 1994, ebd. 21998, ebd. 32015 (unter dem Titel: Die Anfänge der Deutschen. Der Weg in die Geschichte). Kaiser Friedrich II. als Jäger oder: ein zweites Falkenbuch Kaiser Friedrichs II. (Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen. Philologisch-Historische Klasse 4) Göttingen 1996. Auch erschienen in: Enrico Menestò (Hg.), Esculum e Federico II. L’imperatore e la città. Per una rilettura dei percorsi della memoria. Atti del Convegno di studio svoltosi in occasione della nona edizione del “Premio internazionale Ascoli Piceno”, Ascoli Piceno, 14–16 dicembre 1995 (Atti del “Premio internazionale Ascoli Piceno” N. S. 6) Spoleto 1998, S. 31–86. The Veil of Memory. Anthropological Problems when Considering the Past (German Historical Institute London. Annual Lecture 1997) London 1998. Aufstieg aus dem Untergang. Apokalyptisches Denken und die Entstehung der modernen Naturwissenschaft im Mittelalter, München 2001. In französischer Übersetzung: Les fruits de l’Apocalypse. Origines de la pensée scientifique moderne au Moyen Âge. Avec une préface de Jean-Claude Schmitt, übers. von Denise Modigliani, Paris 2004. Die Aktualität des Mittelalters. Gegen die Überheblichkeit unserer Wissensgesellschaft, Stuttgart 2002, ebd. 22002, ebd. 32003. Geschichte und Gehirn. Irritationen der Geschichtswissenschaft durch Gedächtniskritik (Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz. Abhandlungen der geistes- und sozialwissenschaftlichen Klasse 2003, 7) Stuttgart 2003. Der Schleier der Erinnerung. Grundzüge einer historischen Memorik, München 2004, erneut (Beck’sche Reihe 6022) ebd. 2012.
Johannes Fried, Historian of the Middle Ages. A Tribute
23
“Donation of Constantine” and “Constitutum Constantini”. The Misinterpretation of a Fiction and its Original Meaning. With a Contribution by Wolfram Brandes: “The Satraps of Constantine” (Millennium Studies 3) Berlin/New York 2007. Zu Gast im Mittelalter, München 2007 (Aufsatzsammlung). Das Mittelalter. Geschichte und Kultur, München 2008. In englischer Übersetzung: The Middle Ages, übers. von Peter Lewis, Cambridge, MA/London 2015. Canossa. Entlarvung einer Legende. Eine Streitschrift, Berlin 2012. Karl der Große. Gewalt und Glaube. Eine Biographie, München 2013, ebd. 22014, ebd. 32014, ebd. 42014.
II. Editorships Zusammen mit Peter Classen, Studium und Gesellschaft im Mittelalter (Schriften der MGH 29) Stuttgart 1983. Die Frankfurter Messe. 750 Jahre Messen in Frankfurt. Besucher und Bewunderer. Literarische Zeugnisse aus ihren ersten acht Jahrhunderten, Frankfurt am Main 1990. Die abendländische Freiheit vom 10. zum 14. Jahrhundert. Der Wirkungszusammenhang von Idee und Wirklichkeit im europäischen Vergleich (VuF 34) Sigmaringen 1991. Dialektik und Rhetorik im früheren und hohen Mittelalter. Rezeption, Überlieferung und gesellschaftliche Wirkungen vornehmlich im 9. und 12. Jahrhundert (Schriften des Historischen Kollegs. Kolloquien 27) München 1997. Zusammen mit Thomas Kailer, Wissenskulturen. Beiträge zu einem forschungsstrategischen Konzept (Wissenskulturen und gesellschaftlicher Wandel 1) Berlin 2003. Zusammen mit Olaf B. Rader, Die Welt des Mittelalters. Erinnerungsorte eines Jahrtausends, München 2011.
III. Articles Der Regalienbegriff im 11. und 12. Jahrhundert, in: DA 29, 1973, S. 450–528. Die römische Kurie und die Anfänge der Prozeßliteratur, in: ZRG KA 59, 1973, S. 151–174. Der karolingische Herrschaftsverband im 9. Jahrhundert zwischen “Kirche” und “Königshaus”, in: HZ 235, 1982, S. 1–43. Über den Universalismus der Freiheit im Mittelalter, in: HZ 240, 1985, S. 313–361; wieder in: ders., Zu Gast im Mittelalter, München 2007, S. 143–173. Auf der Suche nach der Wirklichkeit. Die Mongolen und die europäische Erfahrungswissenschaft im 13. Jahrhundert, in: HZ 243, 1986, S. 287–332; wieder in: ders., Zu Gast im Mittelalter, München 2007, S. 174–207. L’attesa della fine dei tempi alla svolta del millennio, in: Ovidio Capitani/Jürgen Miethke (Hgg.), L’attesa della fine dei tempi nel Medioevo (AnnTrento. Quaderno 28) Bologna 1990, S. 37–86; erweiterte deutsche Fassung: Endzeiterwartung um die Jahrtausendwende, in: DA 45, 1989, S. 381–473. Die Königserhebung Heinrichs I. Erinnerung, Mündlichkeit und Traditionsbildung im 10. Jahrhundert, in: Michael Borgolte (Hg.), Mittelalterforschung nach der Wende 1989 (HZ Beihefte 20) München 1995, S. 267–318; wieder in: ders., Zu Gast im Mittelalter, München 2007, S. 47–81. Wissenschaft und Phantasie. Das Beispiel der Geschichte, in: HZ 263, 1996, S. 291–316; wieder in: Jahrbuch des Historischen Kollegs 1996, S. 23–47; nochmals in: ders., Zu Gast im Mittelalter, München 2007, S. 239–259. Erinnerung und Vergessen. Die Gegenwart stiftet die Einheit der Vergangenheit, in: HZ 273, 2001, S. 561–593. Nekrolog. Horst Fuhrmann (1926–2011), in: HZ 294, 2012, S. 872–879.
ROM ODER WESTFRANKEN? Papst Nikolaus I. (858–867) in Überlieferung und Erinnerung Klaus Herbers I. VORBEMERKUNGEN „Wie ein Herr der Welt“, ein dominus orbis terrarum, erschien schon Regino von Prüm am Ende des 9. Jahrhunderts Papst Nikolaus I., der von 858 bis 867 Bischof von Rom war. Er wie einige weitere Päpste in der Mitte des 9. Jahrhunderts gelten bis heute als bedeutend, wenn man in Überblickswerke oder einschlägige Lexikonartikel blickt.1 Auch der Jubilar hat sich seit seinen frühesten wissenschaftlichen Anfängen immer wieder zu dieser Epoche der Papstgeschichte geäußert.2 Schon bei Nikolaus I. und seinen unmittelbaren Nachfolgern – so heißt es oft – seien Ansätze primatialer Politik, sei aktives päpstliches Handeln erkennbar, das aber seit dem Ende des 9. Jahrhunderts nicht weiter fortgeführt worden sei.3 Dies relativiert zumindest für einen kurzen Abschnitt der Papstgeschichte die Bedeutung der in neuerer Zeit immer stärker ins Blickfeld gerückten sogenannten „papstgeschichtlichen Wende“ im 11. Jahrhundert, wonach die Päpste bis zu dieser Zeit vor allem reagier-
1
2
3
Vgl. umfassend François Bougard, Niccolò I, in: Enciclopedia dei papi, o. O. 2000, 2, S. 1–22. Ich beschränke mich im folgenden Beitrag auf die wichtigsten Quellen- und Literaturangaben. Für kritische Hinweise danke ich Veronika Unger und für Hilfe bei der Erstellung der Druckfassung Kevin Klein und Verena Forster (Erlangen). Johannes Fried, Die Formierung Europas 840–1046 (OGG 6) München 32008; ders., Formen päpstlichen Schutzes für Laienfürsten (9. bis 13. Jahrhundert), in: Stephan Kuttner/Kenneth Pennington (Hgg.), Proceedings of the Fifth Congress of Medieval Canon Law. Salamanca, 21–25 September 1976 (Monumenta Iuris Canonici, Ser. C, Subsidia 6) Città del Vaticano 1980, S. 345–359; ders., Die Päpste im Karolingerreich von Stephan III. bis Hadrian II., in: Martin Greschat (Hg.), Das Papsttum 1: Von den Anfängen bis zu den Päpsten in Avignon (Gestalten der Kirchengeschichte 11) Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz 1985, S. 115–128. Vgl. aber zu Kontinuitätslinien über das ausgehende 9. Jahrhundert hinaus in Bezug auf die päpstliche Schriftlichkeit Klaus Herbers, ‚Päpstliche Autorität‘ und päpstliche Entscheidungen an der Wende vom 9. zum 10. Jahrhundert, in: Wilfried Hartmann (Hg.), Recht und Gericht in Kirche und Welt um 900 (Schriften des Historischen Kollegs. Kolloquium 69) München 2007, S. 7–30; ND in: Gordon Blennemann/Wiebke Deimann/Matthias Maser/Christofer Zwanzig (Hgg.), Klaus Herbers. Pilger, Päpste, Heilige. Ausgewählte Aufsätze zur europäischen Geschichte des Mittelalters, Tübingen 2011, S. 313–337; vgl. neben den Beiträgen des Sammelbandes von 2007 auch Wilfried Hartmann, Kirche und Kirchenrecht um 900. Die Bedeutung der spätkarolingischen Zeit für Tradition und Innovation im kirchlichen Recht (MGH Schriften 58) Hannover 2008.
26
Klaus Herbers
ten, aber noch kaum zu einer aktiven Politik fanden.4 Wie aber wurde das Bild von diesen Ausnahmepäpsten konstruiert? Welche Grundlagen für die spätere Erinnerung legte die Überlieferung? Wo lagen die Werkstätten der Erinnerung? Ich will dies – auch auf der Basis der erschienenen Regesten Nikolaus’ I.5 – mit einigen Überlegungen verfolgen, um zu dokumentieren, welche Möglichkeiten ein sehr traditionelles Hilfsmittel unserer Wissenschaft auch für moderne Fragestellungen bietet. Damit würdige ich nicht nur den Erinnerungshistoriker Johannes Fried, sondern auch den (vormaligen) Vorsitzenden der Regestenkommission. In der begrenzten Zeit werde ich drei Erinnerungsspuren, die durch die Überlieferung gelegt wurden, verfolgen: die römische im „Liber pontificalis“, die rheinische bei Regino von Prüm und die westfränkische in Beauvais, Laon oder Reims. Dabei betreffen die ersten beiden Abschnitte eher historiographische Traditionen, der dritte die Briefe und Briefsammlungen des Papstes. Abschließend werde ich einen Blick auf die Erinnerungen werfen, die diesem Papst im 11. Jahrhundert – also zur Zeit der papstgeschichtlichen Wende – galten. II. RÖMISCHE SPUREN DER ERINNERUNG. DER „LIBER PONTIFICALIS“ Für die römische Perspektive gelten vor allem vom 6. bis 9. Jahrhundert die Viten im „Liber pontificalis“ als wichtige Orientierung. Sie erlauben es, römische, wenngleich offiziöse Sichtweisen über die jeweiligen Päpste zu eruieren. Die Viten bleiben meist sehr schematisch, lassen aber neben den aufgezählten Stiftungen für die Kirchen Roms und andere Institutionen auch zuweilen „politische“ Nachrichten einfließen. Bei Nikolaus I. ist dies sogar in relativ starkem Maße der Fall. Trotzdem wird die Memoria des Papstes explizit erst am Schluss bei der letzten Eintragung der Stiftungen ausgesprochen: Der Verfasser benutzt Worte, die den Überfluss und die Fülle in unterschiedlicher Form evozieren: Es seien die ubertas, die victuum copia und die abundantia, welche die memoria Nikolaus’ I. über seinen Vorgänger erhöben.6 Und im Schlussabschnitt heißt es dann zusammenfassend vor der Notiz
4
5 6
Rudolf Schieffer, Motu proprio. Über die papstgeschichtliche Wende im 11. Jahrhundert, in: HJb 122, 2002, S. 27–41; hierzu auch Johannes Laudage (†), Die papstgeschichtliche Wende, in: Stefan Weinfurter (Hg.), Päpstliche Herrschaft im Mittelalter. Funktionsweisen – Strategien – Darstellungsformen (Mittelalter-Forschungen 38) Ostfildern 2012, S. 51–68. Klaus Herbers, Die Regesten des Kaiserreiches unter den Karolingern 751–918 (926/962) 4: Papstregesten 800–911, Teil 2: 844–872, Lieferung 2: 858–867 (J. F. Böhmer, Regesta Imperii 1) Köln/Weimar/Wien 2012 (künftig Böhmer-Herbers). Le Liber pontificalis. Texte, introduction et commentaire 1–2, hg. von Louis Duchesne (Bibliothèque des Écoles Françaises dʼAthènes et de Rome Ser. 2, 3, 1–2) Paris 1886–1892, hier 2, S. 166, Z. 32 f.: Huius quippe beati temporibus presulis tanta ubertas et victuum copia extitit ut omnem memoriam famis decessoris sui factae diebus haec oblivioni traderet abundantia.
Rom oder Westfranken?
27
zum Tod, Nikolaus habe äußerst siegreich wie ein athleta Dei und zwar catholice ac principaliter regiert.7 Soweit das Schlussresümee, das eine memoria begründen konnte und zugleich Stiftungstätigkeiten und politische Wirksamkeit Nikolaus’ I. ins Spiel bringt. Was berichten die Seiten kurz vorher? Neben den Stiftungsnotizen werden wichtige „politische“ Fragen der Zeit angesprochen. Nach dem Erhebungsbericht sind es mehrfach die Kontakte mit Kaiser Ludwig II. – so das harmonisch anmutende gemeinsame Mahl und der Stratordienst des Kaisers in Tor di Quinto –, Kontakte, die aber auch im Falle der Auseinandersetzung mit dem Erzbischof von Ravenna oder des Ehestreits Lothars II. recht kämpferisch ausfallen konnten. Diese Themen werden ergänzt durch die Berichte über die Angelegenheiten der Streitigkeiten von Metropolit und Suffragan im Westfrankenreich (Hinkmar von Reims und Rothad von Soissons), über die Reise des päpstlichen Legaten Arsenius dorthin sowie über die Phasen des Verhältnisses zu Byzanz und das Ringen um Bulgarien. Insgesamt hatten aber offenbar am ehesten Ereignisse, die auch in Rom länger verhandelt, vielleicht auch in einer (römischen) Konzilsversammlung entschieden wurden, eine Chance, in das Papstbuch aufgenommen zu werden. Wenn man dies berücksichtigt, dann erstaunt es kaum, dass die grundsätzlich ebenso umfangreichen päpstlichen Beziehungen zur Bretagne, zu Le Mans oder andere Angelegenheiten und Konflikte kein Thema der Nikolausvita sind. Wichtige Themen, die heute noch die Lexikonartikel und biographischen Skizzen zu Nikolaus bestimmen, finden sich somit schon in der Nikolausvita. Ohne auf Einzelheiten einzugehen, sei bereits an dieser Stelle vermerkt, dass viele Aspekte, die das Verhältnis zum Kaiser, aber auch zu wichtigen Personen der karolingischen Teilreiche betreffen, in den einschlägigen Annalen aus den fränkischen Teilreichen durchaus anders erinnert werden, zum Beispiel wenn die Erhebung des Papstes in den „Annales Bertiniani“ als ein Akt des Kaisers erscheint, Nikolaus sei mehr durch die Anwesenheit und Gunst des Königs (!) Ludwig und seiner Großen als durch die Wahl des Klerus erhoben worden, heißt es dort.8 Die unterschiedliche Sichtweise und damit auch die abweichende Erinnerungsspur ließen sich für viele andere Bereiche durchdeklinieren. Zum zweiten wird deutlich, dass auch Nikolaus in der Perspektive des oder der Verfasser eher reagierte als agierte, denn es sind immer wieder Anfragen oder Gesandtschaften, die den Papst erst als großen Akteur erscheinen lassen. Und zum dritten bleibt trotz aller Besonderheiten auch die Nikolausvita wie die anderen Viten des „Liber pontificalis“ römisch bestimmt, denn Nikolaus baut, stiftet und kümmert sich um die Versorgung der römischen Bevölkerung. So besteht in jedem Fall die Grundstruktur
7 8
Ebd., 2, S. 167, Z. 2 f.: Postquam autem sedem apostolicam victoriosissime et ut verus Dei athleta catholice ac principaliter rexit. Annales Bertiniani, hg. von Félix Grat/Jeanne Vielliard/Suzanne Clémencet, Les Annales de Saint-Bertin, Paris 1964, S. 78 (ad a. 858): Nicolaus praesentia magis ac favore Ludoici regis et procerum eius quam cleri electione substitutur.
28
Klaus Herbers
eines Wechsels der politischen Nachrichten mit Bau- und Stiftungsnotizen9 trotz mancher Besonderheiten auch in dieser Vita.10 Könnte aber die römische Wertung des Papstes in der Nikolausvita des „Liber pontificalis“ auf Formen der Überlieferung jenseits der Historiographie verweisen? Indirekt ja, wenngleich die Belege hierzu spärlich sind. Aber eine Passage der Vita zur Entsendung von zwei Legaten ist aufschlussreich, denn am Ende dieses kurzen Vermerks wird auf das Register Nikolaus’ I. angespielt. Die Passage erläutert, dass die von Legaten transportierten Briefe in ein (römisches) Register eingetragen wurden.11 Diese Bemerkung unterstreicht einen weiteren Befund: Zu allen in der Nikolausvita vorgestellten größeren Auseinandersetzungen liegen neben dem „Liber pontificalis“ briefliche Überlieferungen vor, die dem in der Nikolausvita entworfenen Bild in der Regel zumindest nicht grundsätzlich widersprechen. Was dies für den Zugang des Vitenschreibers zu den Materialien des anzunehmenden päpstlichen Registers12 bedeutet, ist noch näher zu bestimmen. Ebenso bleibt offen, ob hiermit die alte These, Anastasius Bibliothecarius sei der Autor großer Teile dieser Vita13, oder der jüngste Vorschlag Bougards, der Diakon Johannes Hymmonides habe die Vita (neu) verfasst14, eher gestützt oder geschwächt werden. 9
10 11
12 13
14
Zu diesen Fragen der Struktur vgl. grundlegend Herman Geertmann, More Veterum. Il Liber pontificalis e gli edifici ecclesiastici di Roma nella tarda antichità e nellʼalto medioevo, Groningen 1975; Sible de Blaauw, Cultus et decor. Liturgie en architectuur in laataniek en meddeleeuws Rome. Basilica Salvatoris, Sanctae Mariae, Sancti Petri, Delft 1987; Klaus Herbers, Leo IV. und das Papsttum in der Mitte des 9. Jahrhunderts. Möglichkeiten und Grenzen päpstlicher Herrschaft in der späten Karolingerzeit (Päpste und Papsttum 27) Stuttgart 1996, S. 11–48; und die Beiträge des Sammelbandes: François Bougard/Michel Sot (Hgg.), Liber, Gesta, histoire. Écrire l’histoire des évêques et des papes, de l’Antiquité au XXIe siècle, Turnhout 2009. Vgl. hierzu Anm. 13. Liber pontificalis (wie Anm. 6), 2, S. 162, Z. 16–23: Tunc mellifluos et prevaricantibus, a sancto Spiritu doctus, terribiles suae praedicationis quae in universo orbe micabat componens apices, missos etiam strenuos, Paulum Populoniensem episcopum et Saxu, venerabilis monasterii sanctorum Iohannis et Pauli abbatem, accersiens, misit eos illuc, ut eandem gentem Sardorum a tanto revocarent errore. Quibus euntibus, valde quosdam ex eis invenerunt adversos disciplinae, monita recipere contempnentes. Verumtamen secundum preceptionis summi presulis auctoritatem, surdos excommunicaverunt ac anathematizaverunt auditores, quousque malum incestarum effugerent copularum penitentiae medicamina requirentes, sicut in epistolis quas idem legati Sardiniam deportaverunt, regesto ipsius praesulis continetur insertis. Et sic Romam post affluentes praedicationes datas reversi sunt, vgl. Böhmer-Herbers, Papstregesten (wie Anm. 5), Nr. 716. Zu den Papstregistern des 9. Jahrhunderts bereitet Veronika Unger (Erlangen) eine Dissertation vor. Vgl. hierzu Wilhelm Wattenbach/Wilhelm Levison/Heinz Löwe, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter. Vorzeit und Karolinger 4–6, Weimar 1963–1990, hier 4, S. 460 f.; zu neueren Thesen vgl. François Bougard, Anastase le Bibliothécaire ou Jean Diacre? Qui a récrit la Vie de Nicolas Ier et pourquoi, in: Jean-Marie Martin/Bernadette Martin-Hisard/Agostino Paravicini Bagliani (Hgg.), Vaticana et medievalia. Études en l’honeur de Louis Duval-Arnould (Millennio medievale. Strumenti e studi N. S. 16) Florenz 2008, S. 27–40; Klaus Herbers, Agir et écrire. Les actes des papes du IXe siècle et le Liber pontificalis, in: Bougard/Sot, Liber (wie Anm. 9), S. 109–126; dens., Das Ende des alten Liber pontificalis (886). Beobachtungen zur Vita Stephans V., in: MIÖG 119, 2011, S. 141–145. Bougard, Anastase (wie Anm. 13), S. 27–40. Zum Hintergrund des „Liber pontificalis“ insgesamt vgl. die Beiträge in Bougard/Sot, Liber (wie Anm. 9).
Rom oder Westfranken?
29
III. ERINNERUNGEN AUS DEM MITTELREICH. REGINO VON PRÜM Zwar stimmt der Satz „Der Prophet gilt nichts im eigenen Lande“ für die Nikolausvita des „Liber pontificalis“ nicht, aber viel emphatischer lobt der schon eingangs erwähnte Regino von Prüm mit der um ein Jahr falschen Anordnung unter der Notiz zum Jahr 868 den verstorbenen Papst Nikolaus in den höchsten Tönen: „Im Jahr der göttlichen Menschwerdung 868 ging der heiligste und gottseligste Papst Nicolaus nach vielen Mühen für Christus und vielen Kämpfen für den unverletzten Bestand der heiligen Kirche in das Himmelreich ein, um für die treue Verwaltung des ihm anvertrauten Amtes von dem allgütigen Herrn einen unverwelklichen Ruhmeskranz zu empfangen: über seine Gott wohlgefälligen Taten hätte sich noch vieles Erwähnenswerte sagen lassen, wenn wir uns nicht, der Kürze beflissen, vorgenommen hätten, mehr die Ursachen der Begebenheiten in den Hauptzügen anzudeuten, als sie ausführlich zu entwickeln. Denn seit dem seligen Gregor bis auf den gegenwärtigen Tag scheint kein Bischof von allen, die in der Stadt Rom zur Hohenpriesterwürde erhoben wurden, jenem gleichgestellt werden zu dürfen. Den Königen und Tyrannen gebot er und beherrschte sie durch seine Autorität, als ob er der Herr der Welt gewesen wäre; gegen fromme und Gottes Befehlen gehorsame Bischöfe und Priester zeigte er sich demütig, freundlich, ergeben und mild, den Unfrommen dagegen und vom rechten Pfade Abirrenden erschien er schrecklich und voll Strenge, so daß man mit Recht glauben mag, daß von Gott erweckt in ihm für unsere Zeit ein zweiter Elias erstanden ist, wenn auch nicht dem Leibe, so doch dem Geiste und der Tugend nach.“15
Wie begründet sich dieses herausragende und ausführliche Urteil? Regino stellt in den Passagen zuvor ganz bestimmte Erinnerungsspuren zusammen. Seine Weltchronik, die er 908 dem Bischof Adalbero von Augsburg übersandte, gilt erst ab der Zeit Lothars I. als relativ selbständig, bis zum Jahr 814 hat man die verschiedenen schriftlichen Quellen eruiert, auf denen seine Darstellung beruhen soll.16 Regino wurde wohl um 840 geboren, könnte also als Heranwachsender die Papstzeit Niko15
16
Reginonis abbatis Prumiensis Chronicon cum continuatione Treverensi, hg. von Friedrich Kurze (MGH SS rer. Germ. 50) Hannover 1890, ND ebd. 1989, S. 94 (ad a. 868); der dt. Text folgt: Regino von Prüm, Chronik, hg. von Reinhold Rau, Quellen zur karolingischen Reichsgeschichte 3 (Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters – FStGA 7) Darmstadt 1960, S. 179–319, hier S. 219; vgl. die davon abhängigen Notizen bei Böhmer-Herbers, Papstregesten (wie Anm. 5), in Nr. 867 zum Tod Nikolaus’ I. Wattenbach/Levison/Löwe, Geschichtsquellen (wie Anm. 13), hier 6, S. 901 f.; vgl. allgemein zu Regino (meist vor allem zum historiographischen Werk): Wolf-Rüdiger Schleidgen, Die Überlieferungsgeschichte der Chronik des Regino von Prüm (Quellen und Abhandlungen zur mittelrheinischen Kirchengeschichte 31) Mainz 1977; Hans-Henning Kortüm, Weltgeschichte am Ausgang der Karolingerzeit. Regino von Prüm, in: Anton Scharer/Georg Scheibelreiter (Hgg.), Historiographie im frühen Mittelalter (Veröffentlichungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 32) Wien/München 1994, S. 499–513; Gerhard Schmitz, Regino von Prüm OSB, in: Kurth Ruh u. a. (Hgg.), Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon 7: ‚Oberdeutscher Servatius‘ – Reuchart von Salzburg, Berlin/New York 21989, Sp. 1115–1122; Wilfried Hartmann, Zu Effektivität und Aktualität von Reginos Sendhandbuch, in: Wolfgang P. Müller/Mary E. Sommar (Hgg.), Medieval Church Law and the Origins of the Western Legal Tradition. A Tribute to Kenneth Pennington, Washington, D. C. 2006, S. 33–49; Francesco Roberg, Neues zur Biographie des Regino von Prüm, in: RhVjbll 72, 2008, S. 224– 229 (zu neu erschlossenen nekrologischen Quellen); Wilfried Hartmann, Regino von Prüm, in: Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften (Hg.), NDB 21,
30
Klaus Herbers
laus’ I. noch erlebt haben. Auffällig ist, dass er die Erhebung Nikolaus’ I. nicht verzeichnet; ab 860 werden seine Notizen in der Weltchronik dichter. Papst Nikolaus I. erscheint sogar erst seit den Jahreseinträgen von 864, in denen nach einer ausführlichen Schilderung des Ehestreites Lothars II. mit allerlei Hinweisen auf Synoden, aber auch Geschichtlein deutlich wird, wie sehr rechtliche Entscheidungen den Prümer Abt interessierten. Der Jahreseintrag endet mit den Worten: „dies [wurde] alles zur Kenntnis des Papstes Nicolaus gebracht, der zu dieser Zeit der römischen Kirche vorstand.“17 Die beiden Jahreseinträge zu 865 und besonders zu 866 bieten dann weitere Schilderungen zum Ehestreit Lothars II. beziehungsweise zu den beiden beteiligten Bischöfen Gunther von Köln oder Thietgaud von Trier. Dabei inseriert oder zitiert Regino sogar mehrere päpstliche Schreiben.18 Wo aber lagen die – dem Verfasser vielleicht kaum bewussten – Gründe für Reginos so positive, aber auch einseitige Erinnerung an Nikolaus? Der Abt von Prüm und Historiograph Regino schrieb etwa 40 Jahre nach Nikolaus’ Tod. Geht man nur von seiner Chronik aus, so scheint seine Erinnerung vor allem vom lokalen Geschehen im lotharingischen Mittelreich mitbestimmt. Hinzu trat jedoch ein weiterer Punkt: Mit seinem Werk „De synodalibus causis“ wird das ausgesprochen kanonistische Interesse Reginos dokumentiert19, das auch in den Bemerkungen zum Ehestreit immer wieder erkennbar wird. Schließlich dürfte aber, drittens, auch die Überlieferung einiger Briefe Nikolaus’ I. in Trier und Metz oder vielleicht auch an anderer Stelle zu der besonders dichten und zugleich positiven Erinnerung über den römischen Pontifex geführt haben. Man glaubt in seinem zusammenfassenden Urteil erkennen zu können, wen er meinte, wenn er Nikolaus als Gebieter über Könige und Tyrannen charakterisiert und bei seiner Führung von Bischöfen und Priestern unterschieden wird zwischen den religiosi und den inreligiosi: Die ersteren erfuhren Nikolaus als freundlich und milde, die anderen als streng und schrecklich.20 IV. SAMMLUNGEN DER BRIEFE NIKOLAUS’ I. Sowohl „Liber pontificalis“ als auch Regino verweisen auf damit zusammenhängende, aber zunächst unabhängig verfasste Schreiben. Dies leitet aber zu einer weiteren Frage über: Was bedeutete die briefliche Überlieferung für die Erinnerung an
17 18 19
20
Berlin 2003, S. 269–270 [Onlinefassung]; http://www.deutsche-biographie.de/pnd118598996. html [Stand: 04.07.2017]. Reginonis Chronicon (wie Anm. 15), S. 82; dt. Fassung bei Rau, Quellen (wie Anm. 15), S. 197. Vgl. hierzu Böhmer-Herbers, Papstregesten (wie Anm. 5), Nr. 780, 800, 840 und 843; vgl. Nr. 600, 670, 759, 781 und 833. Reginonis abbatis Prumiensis Libri duo de synodalibus causis et disciplinis ecclesiasticis, hg. von Friedrich Wilhelm Wasserschleben, Leipzig 1840, ND Graz 1964; eine Teilausgabe und Übersetzung bei Wilfried Hartmann, Das Sendhandbuch des Regino von Prüm (Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters – FStGA 42) Darmstadt 2004. Vgl. oben Anm. 15.
Rom oder Westfranken?
31
Nikolaus I. insgesamt? Haben vielleicht weniger Historiographen als Briefe und Briefsammlungen nicht nur die Überlieferung, sondern auch die Erinnerung an den Pontifikat Nikolaus’ I. bestimmt? Vor allem die großen Auseinandersetzungen um kirchliche, rechtliche und disziplinarische Fragen führten zu einer Aufzeichnung und Aufbewahrung in umfangreichen Sammlungen. Für diesen Schritt waren die Interessen und Bedürfnisse einiger mittelbar oder unmittelbar betroffener Zeitgenossen, die schwerpunktmäßig im westlichen Frankenreich, aber auch im burgundischen Raum anzutreffen sind, ausschlaggebend.21 Lassen wir einige wichtige solcher Sammlungen mit Nikolausbriefen kurz Revue passieren. Die Sammlung des Erzbischofs Ado von Vienne (860–875) (Vat. Reg. lat. 566) ist nur in einer Kopie des 10. Jahrhunderts überliefert.22 Wichtiger wurde die durch Erzbischof Hinkmar von Reims (845–882) wohl in Auftrag gegebene Sammlung, die in Laon, Bibliothèque Municipale 407 verwahrt wird (aus dem 9. Jahrhundert). Die Nikolausbriefe in dieser Sammelhandschrift betreffen vor allem die von Erzbischof Ebo, Hinkmars Vorgänger, geweihten und von Hinkmar abgesetzten Kleriker.23 Fünfzehn Schreiben zu Auseinandersetzungen um Bischof Rothad von Soissons (gest. 869), der sich gegen seinen Metropoliten Hinkmar von Reims gewandt hatte, finden sich in einer Sammlung, die in der römischen Biblioteca Vallicelliana unter der Signatur D 38 aufbewahrt wird. Sie wurde in der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts in der Kirchenprovinz Reims angelegt24; weitere Überlieferungen25 leiten sich wohl von dieser Handschrift ab. Die Pariser Handschrift Ms. lat. 3854 aus dem 12. Jahrhundert bietet ebenso Nikolausbriefe zur Angelegenheit Rothads. In dieser und der eben genannten Handschrift der Vallicelliana werden aber bemerkenswerterweise ebenso pseudoisidorische Texte überliefert. Neben solchen sachbezogenen Sammlungen dürften stärker regionale Aspekte für die Zusammenstellung von Briefsammlungen in den beiden Pariser Handschriften Ms. lat. 1557 und Ms. lat. 1458 verantwortlich gewesen sein. Hier finden sich Briefe hauptsächlich zu Angelegenheiten des westfränkischen Reiches. Die 45 Nikolausbriefe in der Handschrift 1557 entsprechen weitgehend dieser geographischen Ausrichtung; es folgen 27 Schreiben Hadrians II. sowie zwei weitere Schrift21
22 23 24 25
Zu den folgenden Überlegungen vgl. Ernst Perels, Die Briefe Papst Nikolaus’ I. 1, in: NA 37, 1912, S. 535–586; dens., Die Briefe Papst Nikolaus’ I. 2, in: NA 39, 1914, S. 43–153; sowie Detlev Jasper, The Beginning of the Decretal Tradition. Papal Letters from the Origin of the Genre through the Pontificate of Stephen V, in: ders./Horst Fuhrmann (Hgg.), Papal Letters in the Early Middle Ages (History of Medieval Canon Law 2) Washington, D. C. 2001, S. 3–133, zu Nikolaus insb. S. 110–125; vgl. auch die Verzeichnisse zur handschriftlichen und kanonistischen Überlieferung bei Böhmer-Herbers, Papstregesten (wie Anm. 5), S. 367–380. Vgl. Jasper, Beginning (wie Anm. 21), S. 111, Anm. 99; zu den Abschriften dieser Sammlung jetzt Beate Schilling (Hg.), Gallia pontificia 3: Province écclésiastique de Vienne, 1: Diocèse de Vienne, Appendix: Regnum Burgundiae, Göttingen 2006, S. 49. Vgl. außer Jasper, Beginning (wie Anm. 21), jetzt auch Steffen Patzold, Episcopus. Wissen über Bischöfe im Frankreich des späten 8. bis frühen 10. Jahrhunderts (Mittelalter-Forschungen 25) Ostfildern 2008, S. 346–350. Jasper, Beginning (wie Anm. 21), S. 112. Vat. lat. 1343 und Vat. lat. 1344 sowie der Vallicellianus C 15.
32
Klaus Herbers
stücke Nikolaus’ I.26 Die Entstehung der Sammlung lässt sich genauer bestimmen: Sie wurde wohl zwischen 872 und 882 in der Kathedrale von Laon geschrieben.27 Der Kontext der dort überlieferten Briefe macht sie aber besonders interessant.28 Die „Schwesterhandschrift“ 1458 gehört vielleicht auch in den Zusammenhang des Kreises um Bischof Hinkmar von Laon; sie wurde aber nicht dort, sondern wahrscheinlich in Beauvais zusammengestellt.29 Weil sich aber in der Handschrift Ms. lat. 1557 inmitten einer Folge von Briefen Nikolaus’ I. dessen Privileg für Corbie30 in einer sehr verlässlichen Form findet, lassen sich weitere Überlegungen zu den Werkstätten der Erinnerung gewinnen. Denn hieraus ergibt sich die spannende Frage, welche Rolle Bischof Odo von Beauvais bei der Zusammenstellung der Handschrift gespielt haben könnte. Seine Person, durch eine wichtige Legation nach Rom 863 belegt, verbindet die beiden nordfranzösischen Orte Beauvais und Corbie, denn nach seinem 851 begonnen Abbatiat in Corbie wurde er 861 Bischof von Beauvais.31 Er vermittelte maßgeblich im Streit zwischen Erzbischof Hinkmar von Reims und Bischof Rothad von Soissons, worauf ich hier nicht im Einzelnen eingehen kann. Als er im April 863 nach Rom kam, brachte er unter anderem Briefe Hinkmars, aber auch der Synodalteilnehmer der Versammlung von Pîtres-Soissons mit nach Rom.32 Auf seinem Rückzug ins Frankenreich nahm er nachgewiesen mindestens zwölf Briefe und Urkunden mit, darunter Privilegien für Corbie, SaintDenis und Reims aber auch Briefe an die verschiedensten Empfänger im Westfrankenreich.33 In der Handschrift Paris Ms. lat. 1557 fehlen von diesen mitgebrachten Schreiben aber nur die päpstliche Antwort an das Konzil von Pîtres-Soissons sowie die Privilegien für andere Institutionen als Corbie. Das Privileg für Corbie in Briefsammlungen scheint deshalb die Überlieferung der Nikolausbriefe noch auf andere Weise zu erschließen. Schon Ernst Perels hatte 26 27
28 29 30
31
32 33
Jasper, Beginning (wie Anm. 21), S. 113. Nach John Joseph Contreni, Codices Pseudo-Isidoriani. The Provenance and Date of Paris, B. N. MS lat. 9629, in: Viator 13, 1982, S. 1–14; ND in: ders. (Hg.), Carolingian Learning, Masters and Manuscripts (Variorum Collected Studies Series 363) Aldershot 1992, S. 1–14, bes. S. 9 ff., gehörte diese Handschrift ursprünglich der Randnotizen wegen mit dem PseudoIsidor-Manuskript Paris, BnF, Ms. lat. 9629 zu einem gemeinsamen Codex. Vgl. Philippe Lauer (Hg.), Catalogue Général des Manuscrits Latins 2, Paris 1940, S. 65 f. Vgl. bereits Henri Omont, Recherches sur la Bibliothèque de l’Église cathédrale de Beauvais, in: Mémoires de l’Institut national de France. Académie des inscriptions et belles-lettres 40, 1914, S. 1–93, hier S. 74 f. Vgl. Böhmer-Herbers, Papstregesten (wie Anm. 5), Nr. 623; zur anderen Überlieferungssituation des Benediktprivilegs für Corbie vgl. Klaus Herbers, Die Regesten des Kaiserreiches unter den Karolingern 751–918 (926/962) 4: Papstregesten 800–911, Teil 2: 844–872, Lieferung 1: 844–858 (J. F. Böhmer, Regesta Imperii 1) Köln/Weimar/Wien 1999, Nr. 374. Vgl. das Lebensbild bei Philip Grierson, Eudes Ier, évêque de Beauvais, in: Le Moyen Âge 45, 1935, S. 161–198, und Egon Boshof, Odo von Beauvais, Hinkmar von Reims und die kirchenpolitischen Auseinandersetzungen im westfränkischen Reich, in: Dieter Berg/Hans-Werner Goetz (Hgg.), Ecclesia et Regnum. Beiträge zur Geschichte von Kirche, Recht und Staat im Mittelalter. FS für Franz-Josef Schmale zu seinem 65. Geburtstag, Bochum 1989, S. 39–59. Böhmer-Herbers, Papstregesten (wie Anm. 5), Nr. 620. Ebd., Nr. 635.
Rom oder Westfranken?
33
bei seiner Beschreibung der Handschriften34 auf eine mögliche gemeinsame Quelle von drei Briefsammlungen (Vallicellianus C 15, Parisinus 3859A und Parisinus 1557) hingewiesen, die alle das zitierte Corbie-Privileg inmitten der Briefe Nikolaus’ I. verzeichnen. Könnte man vielleicht sogar auch aufgrund des skizzierten Befundes eine gemeinsame Anlage oder Vorbereitung der zugrunde liegenden Sammlung(en) in Corbie vermuten? Dies würde die Bedeutung dieser Abtei für die Überlieferung der Briefe Nikolaus’ I. und eventuell auch die Rolle Odos von Beauvais, der ja die einschlägige Urkunde ins Westfrankenreich mitbrachte und in persona als Bindeglied zwischen Corbie und Beauvais gelten kann, in ein neues Licht stellen. Da zudem Klaus Zechiel-Eckes die Redaktion der pseudoisidorischen Dekretalen nach Corbie verlegt hat35, wird Corbies Rolle für die Papstgeschichte des 9. Jahrhunderts auch vor dem Hintergrund der Nikolausbriefe neu zu bestimmen sein. Und wenn auch das „Constitutum Constantini“ in das westfränkische Reich und in die Zeit um 830 gehört – wie der Jubilar erst vor wenigen Jahren wahrscheinlich gemacht hat36 –, dann dürfte eine wichtige Spur für die Konzeption des Papstamtes wie auch für die Erinnerung an einzelne Vertreter im nordwestlichen Frankenreich liegen. Warum aber – so bleibt eine Frage – wurden die Sammlungen auch zu Ausgangspunkten oder zu Wegen der Erinnerung? Die Zusammenstellungen waren offensichtlich zunächst dazu gedacht, Material für die verschiedenen, auf mehreren Konzilien immer wieder behandelten Streitfragen vorzuhalten. Dass Papstbriefe hier eine Rolle spielten, zeigen nicht nur die erhaltenen Konzilsakten, sondern auch die zahlreichen Traktate und Schriften Hinkmars von Laon und Hinkmars von Reims sowie Hinweise auf heute nicht mehr existierende Libelli wie zum Streit in Le Mans.37 Als Erinnerungsspeicher kann das Frankenreich aber auch für Nikolaus’ Auseinandersetzung mit der Ostkirche und Byzanz gelten, denn aus Beauvais stammt die älteste Sammlung mit sechzehn Briefen zu diesem Themenkomplex (Cod. Vat. lat. 3827).38 Der in diesem Streit besonders wichtige Brief, der Roms 34
35
36
37 38
Perels, Briefe (wie Anm. 21), 1, S. 569 (vgl. dort auch S. 555). Vgl. zu Paris 1557 jetzt ausführlich Clara Harder, Pseudoisidor und das Papsttum. Funktion und Bedeutung des apostolischen Stuhls in den pseudoisidorischen Fälschungen (Papsttum im mittelalterlichen Europa 2) Köln/ Weimar/Wien 2014, S. 187–193. Klaus Zechiel-Eckes, Fälschung als Mittel politischer Auseinandersetzung. Ludwig der Fromme (814–840) und die Genese der pseudoisidorischen Dekretalen (Nordrhein-Westfälische Akademie der Künste. Vorträge G 428) Paderborn/München/Wien/Zürich 2011; kritisch zu Zechiel-Eckes: Patzold, Episcopus (wie Anm. 23), S. 221–226. Johannes Fried, „Donation of Constantine“ and „Constitutum Constantini“. The Misinterpretation of a Fiction and its Original Meaning. With a Contribution by Wolfram Brandes: „The Satraps of Constantine“ (Millennium Studies 3) Berlin/New York 2007; ders., Die Konstantinische Schenkung, in: ders./Olaf B. Rader (Hgg.), Die Welt des Mittelalters. Erinnerungsorte eines Jahrtausends, München 2011, S. 295–311. Vgl. den Kommentar bei Böhmer-Herbers, Papstregesten (wie Anm. 5), Nr. †681. Zu Cod. Vat. lat. 3827, der inzwischen dem 9. Jahrhundert zugewiesen ist, vgl. allgemein Wilfried Hartmann (Hg.), Konzilien der karolingischen Teilreiche 843–859 (MGH Conc. 3) Hannover 1984, S. 349; und Hubert Mordek, Bibliotheca capitularium regum Francorum manuscripta. Überlieferung und Traditionszusammenhang der fränkischen Herrschererlasse
34
Klaus Herbers
Position als prima sedes unterstreicht39, ist in der Handschrift sogar wie weitere Briefe in dieser Angelegenheit ein zweites Mal als Insert enthalten. Abgerundet wird diese Handschrift, von der zahlreiche weitere abhängen40, mit dem Antwortschreiben des Papstes an die Bulgaren.41 Hier war der aktuelle Anlass zur Sammlung der Briefe vielleicht der Aufruf des Papstes am 23. Oktober 867, kurz vor seinem Tod, an Hinkmar von Reims und den Episkopat in Westfranken zu einer Synode, welche die Irrtümer der Griechen zurückweisen solle.42 Neben die aktuellen Bedürfnisse trat aber die Festigung der Erinnerung in der Kanonistik. Nur ein Beispiel: Von dem entscheidenden Brief Nikolaus’ I. vom 25. Januar 867 zur Ehe Lothars43 inserierte Regino von Prüm nicht nur Ausschnitte in seine Chronik, sondern auch in sein kanonistisches Werk „De synodalibus causis“. Von dort gelangten die Auszüge über Burchard von Worms und zahlreiche andere Sammlungen in die hochmittelalterlichen kanonistischen Kompendien. Ähnliches geschah zum Beispiel mit dem Schreiben des Papstes an den byzantinischen Kaiser Michael III. vom 28. September 865 („Proposueramus“)44, das beispielsweise schon Hinkmar von Laon in seinem „Pittaciolus“ zitierte.45 Ebenso beliebt war aber auch das Lehrschreiben an die Bulgaren46, das zu einer wahren Fundgrube für Reformkanonisten wurde. Auf welchen Wegen allerdings in Rom arbeitende Kanonisten im 11. Jahrhundert das Material rezipierten, ist offen; ebenso, ob heute verlorene Register hier eine Rolle gespielt haben. V. BILANZ Wie können wir uns vor diesem Hintergrund an Nikolaus erinnern? Erinnerungsspuren werden jedenfalls nicht nur durch Historiographen, sondern auch durch Sammler oder Gesandte gelegt, manchmal könnten es sogar dieselben Personen gewesen sein. Der in gängigen Traditionen stehenden, aber durchaus ein vergleichsweise größeres eigenständiges Profil zeigenden römischen Vita des Papstes Nikolaus, heiße der Verfasser nun Johannes Hymmonides oder Anastasius Bibliothecarius, war für die langfristige Erinnerung – obwohl nahe am Geschehen – nur eingeschränkter Erfolg beschieden. Der kanonistisch und regional interessierte Regino von Prüm besaß größeren Einfluss, um die langfristige Erinnerung zu bestimmen. Schließlich aber konnten die Briefsammlungen nicht nur aktuell, sondern auch län-
39 40 41 42 43 44 45 46
(MGH Hilfsmittel 15) München 1995, S. 858 f. und 862 f.; zur Bedeutung auch für Leo IV. vgl. Herbers, Leo IV. (wie Anm. 9), S. 67–73 und 458–460. Böhmer-Herbers, Papstregesten (wie Anm. 5), Nr. 777. Mordek, Bibliotheca capitularium (wie Anm. 38), S. 858 f. Böhmer-Herbers, Papstregesten (wie Anm. 5), Nr. 822. Ebd., Nr. 857. Ebd., Nr. 843. Ebd., Nr. 777. Vgl. ebd.; und Hinkmar von Laon, Pittaciolus, hg. von Rudolf Schieffer (MGH Conc. 4, 2) Hannover 2003, S. 57–97, hier S. 91–93. Böhmer-Herbers, Papstregesten (wie Anm. 5), Nr. 822.
Rom oder Westfranken?
35
gerfristig zusammen mit anderen Werken auf weitere Traktate und auf kanonistische Sammlungen einwirken. Hinzu traten vielleicht römische Erinnerungsspuren. Die größten Werkstätten, um das Wirken Papst Nikolaus’ I. zu erinnern, lagen jedoch wie es scheint im 9. Jahrhundert im nordwestlichen Frankenreich. Das Bild des gegenüber dem 8. und 10. Jahrhundert so exzeptionell erscheinenden Papsttums, besonders der Person Nikolaus’ I., wurde durch länger aufbewahrte Briefsammlungen vor allem hier geschmiedet, verändert und für die mögliche Erinnerung der Zukunft aufbereitet. Odo von Corbie beziehungsweise Beauvais könnte für die Zusammenstellung der Überlieferung und die damit gegebene mögliche Beeinflussung der Erinnerung wichtig geworden sein. Die Erinnerung an den primatial agierenden Nikolaus entstand somit vermutlich zunächst im Frankenreich – bei Regino, aber vor allem im Nordwesten, in Corbie, Beauvais, Laon oder Reims. Die Agenten der Sammlungen und Schriften bestimmten teilweise, wenn wohl auch nicht ausschließlich, die spätere Erinnerung: Überlieferung und Erinnerung gehörten zusammen. Die Grundlagen für ein Bild des primatialen Papsttums ‚avant la lettre‘, wie es in Rom vor allem Anastasius Bibliothecarius auf Anfragen hin konturierte, fielen eher nördlich der Alpen, nicht in Rom auf einen besonders fruchtbaren Boden und wurden hier weiterentwickelt. Antwortwege auf die Frage „Rom oder Westfranken?“ dürften damit angedeutet sein. Insofern bündeln sich aber verschiedene Beobachtungen neu, denn römische Positionen hingen mehr als einmal seit dem ausgehenden 8. Jahrhundert von fränkischen Entscheidungen ab, denkt man an Bilderstreit, Adoptianismus oder filioque.47 Provokant formuliert ergibt sich die freilich immer noch teilweise zu beantwortende Frage: Was verdankt die „papstgeschichtliche Wende“ der Vorarbeit aus den Gebieten nördlich der Alpen? Selbst für die Auseinandersetzung Nikolaus’ I. mit Byzanz bleibt richtig, dass fast die gesamte Überlieferung zum päpstlichen Schriftverkehr im Westfrankenreich gesichert wurde. Die heute noch erhaltenen Werkstätten der Erinnerung lagen vor allem im Mittel- und Westfrankenreich, nicht in Italien, wenn wir die Ursprungsorte der meisten erhaltenen Briefsammlungen betrachten. Denkt man an die neueren Ergebnisse zu Pseudoisidor und zum „Constitutum Constantini“, dann bündelten sich im Nordwesten Frankreichs im 9. Jahrhundert Konzeptionen, die Rom und die prima sedes betrafen. Was dies für die Urteile über einen kraftvoll agierenden Nikolaus I. zugleich bedeutet, liegt auf der Hand. Wie sehr aber die Wege von Überlieferung und Erinnerung die bis heute gängigen Schlüsse über einen bedeutenden oder unbedeutenden Papst bestimmen, mag das Beispiel Nikolaus’ I. hoffentlich gut erläutert haben. Nikolaus I. war also nicht einfach nur ein machtvoller Papst, sondern die Bedingungen für diese Zuschreibung waren kompliziert – Überlieferung und Erinnerung wirkten zusammen. 47
Klaus Herbers, Ost und West um das Jahr 800. Das Konzil von Aachen 809 in seinem historischen Kontext, in: Michael Böhnke/Assaad Elias Kattan/Bernd Oberdorfer (Hgg.), Die Filioque-Kontroverse. Historische, ökumenische und dogmatische Perspektiven 1200 Jahre nach der Aachener Synode (Quaestiones disputatae 245) Freiburg 2011, S. 30–70, und die weiteren Beiträge in diesem Band. Zum Gesamtzusammenhang Johannes Fried, Karl der Große. Gewalt und Glaube. Eine Biographie, München 2013, bes. S. 433–495.
KARL DER GROSSE IN DER ERINNERUNG DER KAROLINGERFAMILIE* Matthias M. Tischler I. VORBEMERKUNGEN Viel ist in den letzten Jahrzehnten nicht zuletzt in der deutschsprachigen Forschung über die Erinnerung als einer wesentlichen Grundlage des religiösen Lebens1 wie überhaupt des menschlichen Daseins im Mittelalter und darüber hinaus geredet und geschrieben worden.2 Auch die Erinnerung an den wohl bedeutendsten Herrscher dieses Zeitalters ist immer wieder Gegenstand der Geschichtsschreibung, insbesondere in der nach dem Zweiten Weltkrieg nach neuer Orientierung suchenden internationalen Historiographie gewesen.3 Doch hat sich diese Perspektive in den ver*
1
2 3
Grundzüge dieses Essays hatte ich bereits auf dem ‚2. Einhard-Symposium‘ in Seligenstadt am 26. September 2008 vorgestellt. Eine hierauf aufbauende Studie mit dem Titel: David – Herodes – Theoderich. Karl der Große in der karolingischen Erinnerungskultur des 8. und 9. Jahrhunderts, Berlin/Boston, ist in Druckvorbereitung. Die Karls- und Einhartsmonographien von Johannes Fried, Karl der Große. Gewalt und Glaube. Eine Biographie, München 2013, ebd. 52014; Stefan Weinfurter, Karl der Große. Der heilige Barbar, München 2013; Steffen Patzold, Ich und Karl der Große. Das Leben des Höflings Einhard, Stuttgart 2013, habe ich für diesen Beitrag gegengelesen. Karl Schmid/Joachim Wollasch (Hgg.), Memoria. Der geschichtliche Zeugniswert des liturgischen Gedenkens im Mittelalter (Münstersche Mittelalter-Schriften 48) München 1984; Rainer Berndt (Hg.), Wider das Vergessen und für das Seelenheil. Memoria und Totengedenken im Mittelalter (Erudiri Sapientia. Studien zum Mittelalter und zu seiner Rezeptionsgeschichte 9) Münster in Westfalen 2013. Johannes Fried, Der Schleier der Erinnerung. Grundzüge einer historischen Memorik, München 2004, erneut (Beck’sche Reihe 6022) ebd. 2012. So sind nach dem vierbändigen Karlswerk von 1965 ff. – Helmut Beumann (Hg.), Karl der Große. Lebenswerk und Nachleben 1: Persönlichkeit und Geschichte, Düsseldorf 1965, ebd. 21967; Bernhard Bischoff (Hg.), […] 2: Das geistige Leben, Düsseldorf 1965, ebd. 31967; Wolfgang Braunfels/Hermann Schnitzler (Hgg.), […] 3: Karolingische Kunst, Düsseldorf 1965, ebd. 31967; Wolfgang Braunfels/Percy Ernst Schramm (Hgg.), […] 4: Das Nachleben, Düsseldorf 1967 – in fast allen großen europäischen Ländern bis unlängst eine oder mehrere neue umfangreiche Karlsmonographien erschienen, so in Deutschland: Dieter Hägermann, Karl der Große. Herrscher des Abendlandes. Biographie, Berlin 2000 (u. ö.); Wilfried Hartmann, Karl der Große (Kohlhammer Urban-Taschenbücher 643) Stuttgart 2010; Frankreich: Jean Favier, Charlemagne (Le grand livre du mois) Paris 1999; Italien: Alessandro Barbero, Carlo Magno. Un padre dell’Europa (Storia e società) Rom/Bari 2000 [ND: (Protagonisti della storia 8) Mailand 2005]; England: Roger Collins, Charlemagne, Basingstoke 1998; Rosamond McKitterick, Charlemagne. The Formation of a European Identity, Cambridge/New York 2008 (letztere mehr eine Sammlung monographischer Einzelstudien).
38
Matthias M. Tischler
gangenen Jahren eines wachsenden Europa vielleicht auch zugunsten eines Karlsbildes verschoben, das immer weniger von politischen Vorgaben oder Sehnsüchten abhängt4 und daher unbeschwerter auch neue kritische Fragen an den großen Frankenkönig und -kaiser stellen kann. Es kann nicht Aufgabe meines Essays sein, die Facetten der frühen Erinnerungskultur um Karl den Großen in ihrer Gänze vorzustellen. Wenn hier von der Memoria dieses großen Karolingers während des 8. und 9. Jahrhunderts die Rede ist, dann deshalb, weil in diesem Zeitraum ganz wesentliche Bestandteile seines Erinnerungsbildes für das gesamte weitere Mittelalter, ja darüber hinaus entstanden sind, aber auch zentrale Aspekte des historischen Karl ausgeblendet wurden, welche die Forschung erst in jüngerer Zeit wiederentdeckt. In jedem Fall bleibt festzuhalten, dass diese Erinnerungsarbeit schon im 8. Jahrhundert einsetzt, weil – wie wir gleich sehen werden – nicht zuletzt Karl selbst und sein Hof hieran mitgewirkt haben. Eine der wichtigsten Erkenntnisse der zahlreichen Forschungen zur Karolingerzeit in den letzten Jahrzehnten dürfte darin bestehen, dass die karolingische Erinnerungskultur neu sortiert und verortet werden muss, was gerade am prominenten Beispiel Karls des Großen aufgezeigt werden kann. Denn inzwischen sehen wir, dass wir die ‚karolingische Geschichte‘ nicht mehr so sehr von einer ‚Reichsperspektive‘ aus betrachten dürfen, sondern dass wir die zeitgenössischen Texte als authentische Erinnerungskonstrukte verschiedener Zweige der Karolingerfamilie, ihrer Höfe und Klöster sowie der dort schreibenden Autoren lesen müssen. Außerdem erkennen wir immer deutlicher das diskursive Spannungsverhältnis zwischen diesen Erinnerungsleistungen, die sich in den gebildeten Zentren und Peripherien des Karolingerreiches entwickelt haben, deren stabile wie auch wechselnde Zugehörigkeiten zu den einzelnen Personennetzwerken der Karolingerfamilie viel stärker in unsere künftige Beurteilung dieser Karlsbilder einfließen müssen. Freilich ist diese ‚Proso-Topographie der karolingischen Erinnerungskultur‘ erst noch zu schreiben und kann hier daher nur an einigen Beispielen aufgezeigt werden. II. ERINNERUNG WIRD SCHON ZU LEBZEITEN GEMACHT. DIE MACHT ÜBER NAMEN UND DATEN Die Forschung hat immer stärker herausarbeiten können, wie sehr Karl und sein Umfeld schon zu Lebzeiten, ja zeitnah zu den Ereignissen die künftigen Bilder von seiner Person und seiner Familie gesteuert haben. In der familieninternen Erinnerung liefert der von 768 bis 771 ausgetragene Machtkampf zwischen Karlmann und Karl, den beiden Söhnen Pippins des Jüngeren, ein Beispiel für die gezielte Verwischung der wahren Machtverhältnisse. Seit längerem erkannt ist die Manipulation 4
Helmut Reuther (Hg.), Der Internationale Karlspreis zu Aachen. Zeugnis europäischer Geschichte. Symbol europäischer Einigung. Eine Dokumentation 1950–1993, Bonn 1993; Florian Greiner, Der Internationale Karlspreis zu Aachen. Karl der Große in der neuzeitlichen Rezeption, München 2004.
Karl der Große in der Erinnerung der Karolingerfamilie
39
des historischen Geburtsjahres Karls des Großen (742 statt angeblich 748) im Verhältnis zu Karlmanns historischem Geburtsjahr (751)5, um Karl ein politisches Gewicht zu verleihen, das er zum Zeitpunkt seiner Geburt als Sohn eines Hausmeiers noch gar nicht gehabt haben konnte. So werden Karls angebliche 71 Lebensjahre auch erst durch jene späten Aachener Zeugnisse, die Karls Tod berichten, seit 814 bekannt gegeben.6 Weniger beachtet ist in diesem Zusammenhang, dass Karlmann viele persönliche und machtstrategische Vorteile gegenüber seinem Bruder Karl besaß, die in der Erinnerung der Familie weitestgehend ausgelöscht worden sind, und dass beider Mutter Bertrada Karl gegenüber Karlmann bevorzugte. Es ging freilich nicht um einen Rangstreit der Brüder wegen ihrer Geburt zu unterschiedlichen Herrschaftszeiten des Vaters als Hausmeier (Karl) oder König (Karlmann)7 oder wegen ihrer Geburt im Stand einer illegitimen (Karl) oder legitimen Ehe (Karlmann)8; vielmehr war zwischen den Eltern die Streitfrage entbrannt, wer von den beiden Söhnen die Primogenitur zu Recht beanspruchen konnte, da sie wohl zur selben Zeit, aber hintereinander geboren worden waren: Was ein Jahrhundert später Andreas von Bergamo im Kontext des Bruderkonflikts offen behauptet9, deutet zeitnah um 775 der Ire Cathwulf in einer paränetischen Homilie an Karl mit dem brisanten Jakob- und Esau-Bild aus Gn 25 und 27 in typologischer Perspektive nur vorsichtig an10, nämlich dass sich der jüngere Sohn das Erstgeburtsrecht erworben hatte, die Eltern aber hierüber in die Haare geraten waren: Wie einst Isaak habe 5 6
7
8 9 10
Karl Ferdinand Werner, Das Geburtsdatum Karls des Großen, in: Francia 1, 1973, S. 115–157; Matthias Becher, Neue Überlegungen zum Geburtsdatum Karls des Großen, in: ebd. 19, 1, 1992, S. 37–60. Annales regni Francorum bzw. Annales qui dicuntur Einhardi = Annales regni Francorum inde ab a. 741. usque ad a. 829. qui dicuntur Annales Laurissenses maiores et Einhardi, hg. von Friedrich Kurze (MGH SS rer. Germ. [6]) Hannover 1895, S. 2–178, hier S. 140, Z. 2–7: Domnus Karolus imperator, dum Aquisgrani hiemaret, anno aetatis circiter septuagesimo primo, regni autem quadragesimo septimo subactaeque Italiae quadragesimo tertio, ex quo vero imperator et augustus appellatus est anno xiiii. v. kal. Febr. rebus humanis excessit; Einhart, Vita Karoli = Einhardi Vita Karoli Magni, hg. von [Georg Waitz/]Oswald Holder-Egger (MGH SS rer. Germ. [25]) Hannover 1911, S. 1–41, hier c. 30, S. 35, Z. 10 f.: decessit anno aetatis suae septuagesimo secundo; c. 31 (Epitaph), S. 35, Z. 25 – S. 36, Z. 2: Sub hoc conditorio situm est corpus Karoli magni atque orthodoxi imperatoris, qui regnum Francorum nobiliter ampliavit et per annos xlvii feliciter rexit. Decessit septuagenarius anno domini dcccxiiii, indictione vii, v kal. Febr. So Gunther G. Wolf, Die Königssöhne Karl und Karlmann und ihr Thronfolgerecht nach Pippins Königserhebung 750/51, in: ZRG GA 108, 1991, S. 282–296 (wieder abgedruckt in: ders., Satura mediaevalis. Gesammelte Schriften. Herausgegeben zum 65. Geburtstag 1: Germanenreiche und Karolingerzeit, Heidelberg 1995, S. 183–196). So Lewis G. M. Thorpe (Übers.), Einhard and Notker the Stammerer. Two Lives of Charlemagne, London 1969 (Harmondsworth 21974), S. 17 f. Andreas von Bergamo, Historia, hg. von Georg Waitz, MGH SS rer. Lang. 1, Hannover 1878, S. 221–230, hier c. 3, S. 223, Z. 40 f.: Habebat Carolus suus germanus maior se Karlemannus nomine, ferebundus et pessimus. Homilia, hg. von Ernst Dümmler, Epistolae Karolini aevi 2 (MGH Epp. 4) Berlin 1895, S. 502–505, hier S. 502, Z. 21 f.: ut de fratris tui insidiis in omnibus Deus te conservavit; ut de Iacob et Esau legitur.
40
Matthias M. Tischler
Pippin den älteren Sohn, also Karlmann, Bertrada aber wie einst Rebekka den jüngeren Sohn, also Karl, bevorzugt. Karlmann und Karl waren folglich, worauf schon die im Prinzip gleichen Namen hindeuten, wohl Zwillingsbrüder, aber Karlmann der Erste, der auf die Welt kam.11 Aus dieser onomastischen12, politisch freilich kaum zu verwirklichenden Gleichberechtigung der beiden Brüder sollte sich bald schon der jüngere Karl mithilfe seiner Mutter emanzipieren. Bertrada lebte nicht nur offensichtlich am Hofe Karls des Großen13, sondern sie stellte sich auch von Anfang seiner Herrschaft an demonstrativ auf seine Seite. Während Einhart verschleiernd nur von einer Volksversammlung der Franken spricht, auf der die Brüder zu Königen eingesetzt worden seien, und zwar unter der Bedingung, dass das Königreich gleichmäßig verteilt würde14, und während beim Begräbnis König Pippins am 24. September 768 noch dessen Witwe und beide Söhne zugegen waren15, war Bertrada zwei Wochen später bei Karls Königsweihe, nicht aber bei Karlmanns gleichzeitiger Erhebung anwesend, wobei sich bekanntlich beide Brüder zur selben Zeit, nämlich am Festtag des fränkischen Königsheiligen Dionysius, dem 9. Oktober, aber an verschiedenen, gleichwohl benachbarten Orten zu Königen erheben ließen: Karl in der Bischofs- und Königsstadt Noyon, Karlmann aber wie sein Vater 11
12
13 14
15
Tatsächlich werden beide im selben Jahr 763 parallel zu Grafen eingesetzt: Annales Petaviani, hg. von Georg Heinrich Pertz, MGH SS 1, Hannover 1826, S. 7–18, hier S. 11, Z. 36 f.: deditque [sc. Pippinus] comitatus dilectis filiis suis; Annales Mosellani, hg. von Johann Martin Lappenberg, MGH SS 16, Hannover 1859, S. 494–499, hier S. 496, Z. 3: dedit rex Pippinus aliquos comptadus filiis suis; Annales Laureshamenses, hg. von Georg Heinrich Pertz, MGH SS 1, Hannover 1826, S. 22a-39, hier S. 28a, Z. 27 f.: dedit rex Pippinus aliquos comitatos suos filios. Die im Jahr 760 ausgestellte Urkunde Pippins, in der Karls mundeburdium über Saint-Calais und damit dessen angebliche Volljährigkeit mit 12 Jahren bezeugt wird, ist nicht im Original erhalten, aber gleich zweimal von Karl selbst (771 und 779) ‚bestätigt‘ worden: hg. von Engelbert Mühlbacher, MGH DD Kar. 1, Hannover 1906, S. 81–478, Nr. 55–316, hier S. 90 f., Nr. 62 und S. 178 f., Nr. 128. Rolf Bergmann (Bamberg) teilt mir hierzu mit, dass der Name ‚Karl-mann‘ wegen seiner tautologischen Semantik bemerkenswert sei, weil ja ‚Karl‘ als Appellativ selbst schon ‚Mann‘ bedeutet, und dieser Doppelname bei den Karolingern ohnehin auffällig und gewissermaßen exklusiv sei (E-mail vom 24. November 2012). Dieter Geuenich (Freiburg im Breisgau) hebt hingegen darauf ab, dass das Suffix ‚-man(n)‘ zweifellos sehr alt sei, aber kaum noch eine andere hervorhebende Bedeutung als die eines Kosenamens (‚kleiner Karl‘) gehabt habe (E-mail vom 23. November 2013). Den Verlust der appellativischen Bedeutung von ‚-man(n)‘ bestätigt auch Wolfgang Haubrichs (Saarbrücken) (E-mail vom 27. November 2013). Codex Carolinus, hg. von Wilhelm Gundlach, MGH Epistolae Merowingici et Karolini aevi 1 (MGH Epp. 3) Berlin 1892, S. 476–657, hier S. 564 f., Nr. 46 und S. 566 f., Nr. 48. Einhart, Vita Karoli (wie Anm. 6), c. 3, S. 5, Z. 22 – S. 6, Z. 6: Franci siquidem facto sollemniter generali conventu ambos sibi reges constituunt, ea conditione praemissa, ut totum regni corpus ex aequo partirentur, et Karolus eam partem, quam pater eorum Pippinus tenuerat, Karlomannus vero eam, cui patruus eorum Karlomannus praeerat, regendi gratia susciperet. Continuatio Fredegarii = Chronicarum quae dicuntur Fredegarii scholastici libri IV cum continuationibus, hg. von Bruno Krusch, MGH SS rer. Merov. 2, Hannover 1888, S. 18–193, hier c. 53, S. 192, Z. 24–26 und S. 193, Z. 3 f.: Inde promovens, cum praedicta regina Bertradane et filios suos Carlo et Carlomanno usque ad Parisius ad monasterio beati Dionisi martiris veniens; ibique moratus est aliquandiu […] sepelieruntque eum praedicti reges Carlus et Carlomannus, filii ipsius reges, in monasterio Sancti Dionisi martiris.
Karl der Große in der Erinnerung der Karolingerfamilie
41
Pippin in der bedeutenderen Bischofs- und Königsstadt Soissons.16 Dies ist ein Indiz für die Nachfolge Karlmanns im ehemaligen Erbteil des Vaters und ein konkreter Hinweis auf seinen Vorrang, den Einhart dadurch verschleiert, dass er Karlmann genau umgekehrt – unter Verweis auf die Reichsteilung zwischen dem Vater und Karlmann dem Älteren – in das Erbteil dieses später ebenso unterlegenen, den gleichen Namen tragenden Onkels einrücken lässt und damit die wahren Verhältnisse genau ins Gegenteil verkehrt.17 Ortswahl und Königserhebung am selben Tag des fränkischen Reichsheiligen sind freilich Ausdruck von Rivalität um die wahre Legitimität und die Kontinuität der Herrschaft des Vaters. Dieses Ringen setzte sich im Januar 769 fort, als beide Brüder eine Urkunde zugunsten von Saint-Denis ausstellten, um dem dort nur drei Monate zuvor bestatteten Vater Pippin das Gebetsgedenken zu sichern.18 Eine Reihe von Rechten jeweils im Reichsteil des Bruders deutet freilich darauf hin, dass Pippin einst einen Ausgleich zwischen seinen Söhnen herstellen wollte. Dieser Ausgleich zwischen den Brüdern setzte sich auch in der Wahl ihrer Grablegen noch zu Lebzeiten fort: Karl der Große sicherte sich seine Sepultur in Saint-Denis, also der Grabeskirche seines Vaters, die auf dem Territorium Karlmanns lag, woraufhin sich Karlmann seinerseits seine Grablege in SaintRemi sicherte. Schon hier zeigt sich übrigens die spätere Rivalität zwischen SaintDenis und Saint-Remi als Zentralorten des westlichen Frankenreiches und Frankreichs, die noch im Hochmittelalter weitergepflegt wurde.19 Der Kampf der Brüder um die bessere Position wurde auch im eigenen Familienzweig fortgeführt: Beider erstgeborene Söhne erhielten den Namen des Großvaters, sowohl Karls Erstling, der als Pippin ‚der Bucklige‘ in die Geschichte eingehen sollte, wie auch Karlmanns erster, aber gesunder Nachkomme, dessen Geburt und Namen wir nur aus einer wohl an Karlmanns Hof entstandenen Bearbeitung der „Annales Petaviani“20 kennen.21 Schließlich versuchten beide Brüder auch eine politisch vorteilhaftere Ehepartie nach der vom Vater veranlassten Erstverheiratung mit fränkischen Frauen einzugehen. Um Karls nachteilige Position zu verbessern, zumal sein Reichsteil im Gegensatz zu dem Karlmanns keinen direkten Zugang nach Italien hatte, handelte Bertrada eine neue politische Ehe mit einer Tochter des Langobardenkönigs Desiderius aus. Doch scheint es auch hier eine Rivalität der Brüder um diese Frau gegeben zu haben, da Papst Stephan III. zunächst gar nicht wusste, wer von den beiden die Langobardenprinzessin heiraten sollte.22 16 17 18 19 20 21 22
Ulrich Nonn, Zur Königserhebung Karls und Karlmanns, in: RhVjbll 39, 1975, S. 386 f., hier S. 386. Wie Anm. 14. MGH DD Kar. 1 (wie Anm. 11), S. 62 f., Nr. 43 und S. 81 f., Nr. 55. Mario Kramp, Kirche, Kunst und Königsbild. Zum Zusammenhang von Politik und Kirchenbau im capetingischen Frankreich des 12. Jahrhunderts am Beispiel der drei Abteien Saint-Denis, Saint-Germain-des-Prés und Saint-Remi/Reims, Weimar 1995. Paris, BnF, Ms. lat. 4995, fol. 1r–8v. Annales Petaviani (wie Anm. 11), S. 13, Z. 9: nativitas Pipini [Pipino Hs.] filii [filio Hs.] Karlomanni [Karlemanni Hs.]. Codex Carolinus (wie Anm. 13), S. 560–563, Nr. 45, hier S. 561, Z. 4–6 und S. 563, Z. 11–13: Itaque nostrae perlatum est notioni, quod certae cum magno cordis dolore dicimus: eo quod
42
Matthias M. Tischler
Die zeitgenössische Gestaltung der Erinnerung der Karolingerfamilie lässt sich nur im Zweig des im Jahr 771 übriggebliebenen Monarchen Karl einigermaßen nachzeichnen. Details seiner persönlichen Memoria fassen wir wohl bisweilen in den „Annales regni Francorum“, den am Hof geführten offiziösen Jahrbüchern.23 Wichtiger aber ist, dass Karl die Erinnerung an seine ersten beiden Gemahlinnen, die Fränkin Himiltrud und die eben genannte Langobardin, sowie an seine dritte Frau Hildegard gezielt gesteuert hat, um die erste Ehe und den vollbürtigen Sohn Pippin aus dieser Beziehung zu diskreditieren, vor allem aber um die 770 geschlossene Ehe mit der Langobardin zugunsten der in Wahrheit illegitimen Beziehung mit Hildegard und ihrer Kinder zu verschleiern. Während die Trennung von der auffallend namenlosen Langobardin und die möglichen Gründe hierfür noch bis weit ins 9. Jahrhundert heiß diskutiert werden, liefert die auffallend zögerliche Einführung der neuen Gattin Hildegard in die Geschichtsschreibung des Hofes gleichsam den zeitgenössischen Kommentar hierzu.24 Hadrians I. Lebensbeschreibung im „Liber pontificalis“ zementiert schließlich die offiziöse Haltung des Papsttums zu dieser ‚Ehe‘, indem sie Hildegard geradezu überschwänglich lobt.25 Der nächste Schritt zur Legitimierung dieser Beziehung ist Papst Hadrians ‚Umtaufung‘ ihres Sohnes Karlmann in Pippin sowie seine Krönung und Salbung zum König von Italien zu Ostern 781. Diese Auslöschung des Unglücksnamens der Familie durch onomastische Gegenerinnerung erfahren wir nur aus ältesten und engstens mit dem Herrscherhaus verbundenen Texten.26 Sie sollte aber nicht nur Karls des Großen Onkel
23 24
25
26
Desiderius Langobardorum rex vestram persuadere dinoscitur excellentiam, suam filiam uni ex vestra fraternitate in conuvio copulari […] ut nullo modo quisquam de vestra fraternitate praesumat filiam iam dicti Desiderii Langobardorum regis in coniugium accipere. Annales regni Francorum (wie Anm. 6). Nur ihr Tod zu 783: Annales Laureshamenses (wie Anm. 11), S. 32, Z. 12: Obiit Hildigard regina. Ersterwähnung bei der Romreise 780/81: Annales regni Francorum (wie Anm. 6), S. 56, Z. 10–12: Tunc sumpto consilio, ut iter perageret orationis causa partibus Romae, una cum uxore sua domna Hildegarde regina; Annales Mettenses priores, hg. von Bernhard von Simson (MGH SS rer. Germ. [10]), Hannover/Leipzig 1905, S. 1–105, hier S. 68, Z. 19 f.: Eodem anno orationis causa partibus Romanae urbis iter direxit una cum uxore sua Hildegarde regina. Unterschlagung ihres Namens: Annales qui dicuntur Einhardi (wie Anm. 6), S. 57, Z. 13 f.: Initoque consilio orandi ac vota solvendi causa Romam statuit proficisci sumptisque secum uxore ac liberis. Todesdatum: Annales regni Francorum (wie Anm. 6), S. 64, Z. 5–7: Tunc obiit domna ac bene merita Hildegardis regina pridie Kal. Mai., quod evenit in die tunc in tempore vigilia ascensionis Domini; Annales qui dicuntur Einhardi (wie Anm. 6), S. 65, Z. 11–13: Hildigardis regina uxor eius decessit ii. Kal. Mai. Cuius funeri cum more solemni iusta persolveret. Begräbnisort: Annales Mettenses priores, S. 70, Z. 19–22: Anno ab incarnatione Domini dcclxxxiii. Bonae memoriae Hildegardis regina obiit pridie kal. Maii, sepultaque est iuxta Metensem urbem in basilica beati Arnulfi confessoris. Vita Hadriani I papae, hg. von Louis Duchesne, Le Liber Pontificalis 1 (Bibliothèque des Écoles françaises d’Athènes et de Rome Ser. 2, 3, 1) Paris 1886, S. 486–514, hier c. 34, S. 496, Z. 15 f.: ibidem apud se Papiam adduci fecit suam coniugem excellentissimam Hildigardis reginam et nobilissimos filios. Gedicht des Godesscalc in dem nach ihm benannten Evangelistar, hg. von Ernst Dümmler, MGH Poetae 1, Berlin 1881, S. 94 f., Nr. VII, hier S. 95, V. 25–28: Principis hic Caroli claris natalibus ortam / Carlmannum sobolem, mutato nomine Pippin, / Fonte renascentem, et sacro
Karl der Große in der Erinnerung der Karolingerfamilie
43
und Bruder in Vergessenheit geraten lassen, sondern zugleich seinen ältesten Sohn aus erster Ehe zugunsten Karls des Jüngeren, Karls ältesten Sohnes aus der Verbindung mit Hildegard, delegitimieren, da Pippin ‚der Bucklige‘ im selben Jahr volljährig wurde. Somit war auch dessen Erinnerung durch einen päpstlich legitimierten zweiten Träger dieses Namens überlagert. Um 784, also nur wenige Jahre später und schon bald nach Hildegards Tod (783), wirkte Karls erster Hofhistoriograph Paulus Diaconus in seinem „Liber de episcopis Mettensibus“ am offiziellen Erinnerungsbild der Karlsfamilie mit. Er erwähnt hier Himiltrud, die erste Ehefrau Karls des Großen, zum ersten Mal überhaupt, stellt sie freilich auch als Konkubine hin, indem er die neue Verbindung mit Hildegard als ‚rechtmäßige Ehe‘ bezeichnet.27 Diese neuen Details gehen höchstwahrscheinlich auf Karl den Großen selbst zurück. Es hat etwas von Ironie, dass ein Langobarde als erster Biograph des Karolingerhauses an der Ausblendung ausgerechnet der langobardischen Anteile der Familiengeschichte zugunsten Hildegards mitwirkte. Damit setzte er den künftigen Trend, Karls Eheverbindungen mit Himiltrud und der namenlosen Langobardin zugunsten Hildegards zu delegitimieren. Bei Einhart ist Himiltrud schließlich sogar eine namenlose Konkubine.28 Als komplementäre Maßnahme zu dieser Informationspolitik am Hofe Karls des Großen ist das fast systematische Auslöschen der Erinnerung an die von der Herrschaft ausgeschlossenen Familienmitglieder zu betrachten, wenn nicht gar ihre wie auch immer geartete physische Ausschaltung.29 Den Namen der Ehefrau Karlmanns des Älteren kennen wir nicht.30 Auch ihre Kin-
27
28 29
30
baptismate lotum, / Extulit albatum sacratis conpater undis; Annales Mosellani (wie Anm. 11), S. 497, Z. 13 f.: perrexit rex Karlus Romam et baptizatus est ibi filius eius, qui vocabatur Karlomannus, quem Adrianus papa mutato nomine vocavit Pippinum; Annales Laureshamenses (wie Anm. 11), S. 31, Z. 31 f.: Perrexit rex Carlus Romam, et baptizatus est ibi filius eius, qui vocabatur Carlomannus; quem Adrianus papa mutato nomine vocavit Pippinum. Paulus Diaconus, Liber de episcopis Mettensibus, hg. von Georg Heinrich Pertz, MGH SS 2, Hannover 1829, S. 261–268, hier S. 265, Z. 22–24: Habuit tamen, ante legale connubium, ex Himiltrude nobili puella filium nomine Pippinum. Weitere Erwähnung als Konkubine und Mutter des 792 aufständischen Sohnes Pippins des Buckligen finden sich in den Annales Laureshamenses (wie Anm. 11), S. 35, Z. 15–17; in den Annales Mosellani (wie Anm. 11), S. 498, Z. 10–13; und im Chronicon Laurissense breve (Codex Fuldensis), hg. von Hans Schnorr von Carolsfeld, Das Chronicon Laurissense breve, in: NA 36, 1911, S. 13–39, hier S. 37, Z. 3–5. Einhart, Vita Karoli (wie Anm. 6), c. 18, S. 22, Z. 14 f.: de concubina quadam, cuius nomen modo memoriae non occurrit; c. 20, S. 25, Z. 13 f.: Erat ei filius nomine Pippinus ex concubina editus, cuius inter ceteros mentionem facere distuli. Johannes Fried, Erfahrung und Ordnung. Die Friedenskonstitution Karls des Großen vom Jahr 806, in: Brigitte Kasten (Hg.), Herrscher- und Fürstentestamente im westeuropäischen Mittelalter (Norm und Struktur 29) Köln/Weimar/Wien 2008, S. 145–192, hier S. 162; ders., Das Mittelalter. Geschichte und Kultur, München 2008 (u. ö.), S. 58. Vita Hugberti episcopi Traiectensis, hg. von Wilhelm Levison, MGH SS rer. Merov. 6, Hannover/Leipzig 1913, S. 482–496, hier c. 20, S. 495, Z. 24–27: Haec audiens vir Dei nobilissimus princeps Carlomannus, statim surrexit de solio suo una cum uxore sua atque obtimatibus suis, qui primati erant eius palacio, et venerunt simul ad sanctum Dei Hugbertum et viderunt, quae acta erant de ipso.
44
Matthias M. Tischler
der bleiben bis auf Drogo namenlos.31 Der Name der Ehefrau Karlmanns des Jüngeren, Gerberga, wird nur in wenigen abseitigen Zeugnissen erwähnt, die aus dem Umfeld Karlmanns und seiner Sympathisanten stammen.32 Auch hier sind wieder die Namen der beiden weiteren Kinder neben dem allein bekannten erstgeborenen Pippin ausgelöscht. Genauso sind alle Namen der Ehefrauen in der karolingischen Seitenlinie Bernhards des Älteren so gut wie nicht überliefert und nur teilweise erschließbar: Karl Martells Konkubine und Mutter Bernhards war wohl Ruodhaid33, seine beiden eigenen Gattinnen, die Mütter Adalharts und Walas, sind namentlich unbekannt34, die Ehefrau Pippins von Italien und somit die Mutter Bernhards von Italien, ist erst vor einigen Jahren mit Theodrada, der Schwester Adalharts und Walas, identifiziert worden35 und Walas eigene Ehefrau dürfte Rothlindis, eine Tochter Wilhelms von Toulouse, gewesen sein.36
31
32
33 34 35
36
Ihre Ausschaltung wird zudem nur in einigen kleineren Annalen, nicht aber in der offiziösen Reichsannalistik zu 753 berichtet: Annales Petaviani (wie Anm. 11), S. 11, Z. 15–17: et papa Stephanus venit ab urbe Roma in Franciam, et Karolomannus post eum, et filii eius tonsi sunt; Annales Mosellani (wie Anm. 11), S. 495, Z. 26 f.: et papa de Roma venit et Karlamannus post eum et filii sui tonsi; Annales Laureshamenses (wie Anm. 11), S. 26a, Z. 25 – S. 28a, Z. 2: Et papa de Roma venit, et Carlomannus post illum, et filii sui tonsi. Annales Mettenses priores (wie Anm. 24), ad a. 771, S. 58, Z. 2–5: Gerberga vero uxor Carolomanni cum duobus parvulis et paucis principibus de parte coniugis sui Carolomanni Italiam petiit et ad Desiderium regem Langobardorum pervenit. Fragmentum Basiliense (Basel, UB, N I 4, E): Gerberga vero, uxor Carolomanni, cum duobus parvulis, et paucis principibus de parte coniugis sui Carolomanni Italiam petens, et ad Desiderium regem Langobardorum pervenit, hg. von Georg Waitz, MGH SS 13, Hannover 1881, S. 27af., hier S. 28a, Z. 4–8. Die Saint-Bertiner „Vita Karoli“-Handschrift Paris, BnF, Ms. lat. 4955 aus der 1. Hälfte des 11. Jahrhunderts ergänzt in c. 3 den Namen Tedberga, doch scheint dies ein verballhorntes Gerberga zu sein: que dicitur tedberga: Matthias Martin Tischler, Einharts Vita Karoli. Studien zur Entstehung, Überlieferung und Rezeption (MGH Schriften 48, 1–2) Hannover 2001, S. 1323–1325 mit Anm. 24. Andreas von Bergamo, Historia c. 3, wo in der ältesten Handschrift St. Gallen, Bibliotheca Vadiana, Cod. 317, fol. 79v zunächst wohl auch Gerberga stand, was dann eine andere Hand mit dunklerer Tinte auf Rasur in Bertrada abänderte: (wie Anm. 9), S. 223, Z. 37 mit Anm. l und S. 224, Z. 1 mit Anm. a. Diesen zweiten Namen bezeugt auch Johannes Aventin (oder seine Quelle Creontius?) in seinen Annales ducum Boiariae, hg. von Siegmund Riezler, Johannes Turmair’s genannt Aventinus Annales ducum Boiariae 1–2 (Johannes Turmair’s Sämtliche Werke 2–3) München 1881–1884, III 10 (ad a. 771), S. 410, Anm. 1, Z. 1 f.: Eodem anno Berchthraeda regina expulsa est a Carolo rege Francorum. Sie wird auffallenderweise erst erwähnt im Necrologium Augiense, hg. von Johanne Autenrieth/Dieter Geuenich/Karl Schmid, Das Verbrüderungsbuch der Abtei Reichenau (Einleitung, Register, Faksimile) (MGH Libri mem. N. S. 1) Hannover 1979, Faksimile S. 114 A 2. Johannes Fried, Kanonistik und Mediävistik. Neue Literatur zu Kirchenrecht, Inzest und zur Ehe Pippins von Italien, in: HZ 294, 2012, S. 115–141, hier S. 136. Ders., Elite und Ideologie oder Die Nachfolgeordnung Karls des Großen vom Jahre 813, in: Régine Le Jan (Hg.), La royauté et les élites dans l’Europe carolingienne (début ixe siècle aux environs de 920) (Collection Histoire et littérature régionales 17) Villeneuve d’Ascq 1998, S. 71–109, hier S. 93 f.; ders., Erfahrung (wie Anm. 29), S. 167 und 177 f. mit Anm. 68. Lorenz Weinrich, Wala. Graf, Mönch und Rebell. Die Biographie eines Karolingers (Historische Studien 386) Lübeck/Hamburg 1963, S. 18 mit Anm. 64 f.
Karl der Große in der Erinnerung der Karolingerfamilie
45
Doch die Kontrolle der Erinnerung muss im Reich der Karolinger auch weit über die engeren Familienkreise hinausgegangen sein. Denn es fällt auf, dass konkurrierende Erinnerungen zur offiziösen Darstellung Karls und seiner Familie in den Peripherien des expandierenden Karolingerreiches weitestgehend fehlen: Während in Sachsen eine solche wegen der noch wenig entwickelten Schriftkultur zunächst nicht zu erwarten ist, scheint die karlskritische Erinnerung im agilolfingischen Bayern unter Herzog Tassilo weitestgehend verloren zu sein. So kennen wir eine Lebensbeschreibung Tassilos von seinem Kanzler Creontius fast nur aus Auszügen, die der bayerische Humanist Johannes Aventin in den „Annales ducum Boiariae“ überliefert hat.37 Doch auch die zeitgenössische Karlserinnerung in Italien wird von den Karolingern kontrolliert. Ihr bester Vertreter, der Langobarde Paulus Diaconus, weilt selbst am Hof Karls des Großen, wo er wie oben schon erwähnt die erste karolingische Familiengeschichte schreibt.38 Bruchstücke einer italienischen Karlsmemoria, die nicht wenig auf mündlicher Tradition beruht, sind erst im weiteren 9. Jahrhundert etwa bei Andreas von Bergamo nachweisbar (um 877).39 III. KARL DER GROSSE IM RÜCKBLICK. DAS RINGEN UM DIE RECHTE ERINNERUNG Doch das an Karlmanns Familie und seinen Anhängern geschehene Unrecht ließ sich nicht auf Dauer verbergen und unterdrücken. War schon die in den offiziösen Darstellungen des Hofes verschwiegene Ehe des Karlssohns Pippin von Italien mit Theodrada ein Akt der Versöhnung innerhalb der Karolingerfamilie40, so zwang die Geburt ihres Sohnes Bernhard zu einer umfassenden Friedensvereinbarung, da nun erneut ein Konflikt zwischen Onkeln und Neffen wie einst zwischen Karl und Karlmanns Söhnen drohte. Dies erklärt die Beteiligung Adalharts und Walas, der Onkel Bernhards, an der Beratung und Verbreitung der sogenannten „Divisio regnorum“ von 80641, die indirekt auf Karls einstigen Konflikt mit seinem Bruder und die wohl 37 38 39
40
41
Wilhelm Wattenbach/Wilhelm Levison/Heinz Löwe, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter. Vorzeit und Karolinger 2, Weimar 1953, S. 191 mit Anm. 77. Paulus Diaconus, Liber de episcopis Mettensibus (wie Anm. 27). Andreas von Bergamo, Historia (wie Anm. 9), c. 3, S. 223, Z. 40 – S. 224, Z. 4: Habebat Carolus suus germanus maior se Karlemannus nomine, ferebundus et pessimus; contra Carolus iracundus surrexit, eum iurare fecit, ut ipsa ‚Berterad‘ ultra non haberet coniuge. Quid multa? Remisit eam Ticino, unde dudum eam duxerat. Mater vero eorum haec separatio audiens, Carlemanni, filii sui, blasphemiam intulit; oculorum cecitate perculus est, cum periculo vita finivit. Und zwar zwischen den Familienzweigen Karls und Karlmanns, denn Theodrada, die (Halb-) Schwester der Karolinger Adalhart und Wala, war wohl die Ehefrau Pippins von Italien: wie Anm. 35. Adalhart aber war wiederum bis 771 auf der Seite Karlmanns gestanden und dann wohl politisch kaltgestellt worden: Brigitte Kasten, Adalhard von Corbie. Die Biographie eines karolingischen Politikers und Klostervorstehers (Studia humaniora. Düsseldorfer Studien zu Mittelalter und Renaissance 3) Düsseldorf 1986, S. 28 f. und 35 Anm. 91. Matthias Martin Tischler, Die ‚Divisio regnorum‘ von 806 zwischen handschriftlicher Überlieferung und historiographischer Rezeption, in: Kasten (Hg.), Herrscher- und Fürstentestamente (wie Anm. 29), S. 193–258, hier S. 199 f., 205 mit Anm. 45 und 232 f.
46
Matthias M. Tischler
tödlichen Folgen für dessen Söhne 771 Bezug nimmt.42 Die weitere Geschichte der Familie der Karolinger war eine permanente Auseinandersetzung mit dieser Friedenskonstitution, die dem Trauma des Verwandtenmordes in der Familie ein Ende setzen sollte. Der Kern dieser Regelungen wurde unter entscheidender Beteiligung Einharts nach dem Tod von Karls Söhnen Pippin von Italien (810) und Karl dem Jüngeren (811) mit Bernhards Erhebung zum König von Italien (812) und mit der Aachener Friedensordnung (813) bewahrt. Doch stand einem dauerhaften Ausgleich ein ungelöstes, im letzten unlösbares Problem der Familie entgegen: Im Gegensatz zu Ludwig war Bernhard ein legitimer Königssohn, was Karls Bevorzugung Pippins und Bernhards, zugleich aber seine deutliche Zurückhaltung gegenüber dem von ihm bis zuletzt abgelehnten jüngsten Sohn Ludwig erklärt. Die Nachfolge Karls des Großen wurde daher erst nach langwierigen Verhandlungen in seinen letzten Lebensmonaten durch die im September 813 in Aachen vollzogene Mitkaiserkrönung Ludwigs und durch dessen Schwur geregelt, womit die Einhaltung der väterlichen Erbverfügung und die Sicherheit Bernhards garantiert werden sollten. Doch scheint diese Ordnung Ludwigs Herrschaftsübernahme nach Karls Tod keineswegs gesichert zu haben. Dafür sprechen Ludwigs zögerliche Annäherung an Aachen und seine Angst vor der Macht des dort als Pfalzgrafen eingesetzten Onkels Wala, der gerade wegen der ungelösten Legitimitätsfrage in der Familie ein ernstzunehmender Rivale in der Herrschaftsnachfolge war.43 Es war daher nur konsequent, dass Ludwig nach der geglückten Festigung seiner Machtstellung noch 814 den gesamten Familienzweig um Adalhart und Wala vom Hof entfernte und ins Exil schickte. Doch die legitimatorische wie auch faktische Demontage ihres Neffen Bernhard von Italien ließ noch auf sich warten. Erst 817 sollte es soweit sein, als mit der sogenannten „Ordinatio imperii“, die Ludwigs ältesten Sohn Lothar I. anstelle Bernhards zum Erben in Italien einsetzte, die einst Karl mit Adalhart, Wala und Bernhard versöhnlichen Regelungen von 806 und 813 zunichte gemacht wurden und der nun zum Konkubinenkind herabgestufte Bernhard44 auch faktisch von 42
43
44
Divisio regnorum, hg. von Alfred Boretius, MGH Capit. 1, Hannover 1883, S. 126–130, Nr. 45, hier c. 18, S. 129, Z. 46 – S. 130, Z. 4: De nepotibus vero nostris, filiis scilicet praedictorum filiorum nostrorum, qui eis vel iam nati sunt vel adhuc nascituri sunt, placuit nobis praecipere, ut nullus eorum per quaslibet occasiones quemlibet ex illis apud se accusatum sine iusta discussione atque examinatione aut occidere aut membris mancare aut excaecare aut invitum tondere faciat; sed volumus ut honorati sint apud patres vel patruos suos et obedientes sint illis cum omni subiectione quam decet in tali consanguitate esse. Astronomus, Vita Hludowici imperatoris, hg. von Ernst Tremp, Theganus, Gesta Hludowici imperatoris. Astronomus, Vita Hludowici imperatoris (MGH SS rer. Germ. 64) Hannover 1995, S. 280–554, hier c. 21, S. 346, Z. 14–20: Timebatur [sc. Hludowicus] enim quam maxime Uuala, summi apud Karolum imperatorem habitus loci, ne forte aliquid sinistri contra imperatorem moliretur. Qui tamen citissime ad eum venit et humillima subiectione se eius nutui secundum consuetudinem Francorum commendans subdidit. Post cuius ad imperatorem adventum, emulati eum omnes Francorum proceres certatim gregatimque ei obviam ire certabant. Ordinatio imperii, hg. von Boretius, MGH Capit. 1 (wie Anm. 42), S. 270–273, Nr. 136, hier c. 15, S. 273, Z. 3–5: Si vero absque legitimis liberis aliquis eorum decesserit, potestas illius ad seniorem fratrem revertatur. Et si contigerit illum habere liberos ex concubinis, monemus ut erga illos misericorditer agat; Thegan, Gesta Hludowici imperatoris, hg. von Tremp, The-
Karl der Große in der Erinnerung der Karolingerfamilie
47
der künftigen Herrschaft ausgeschlossen wurde. Mit Bernhards berechtigtem Aufstand, seiner Haft und Blendung mit Todesfolge schien sich die Geschichte des schon einmal ausgeschalteten Familienzweigs der Karolinger zu wiederholen. Doch mit dem Tod Benedikts von Aniane, Ludwigs zentralen Beraters am Hof und entschiedenen Gegners Adalharts und Walas (821), wurde der Weg zur erneuten Aussöhnung in der Familie frei. Adalhart und Wala kehrten an den Hof zurück und leiteten die Wende in Ludwigs Herrschaft und in der Erinnerung seines Vaters, die noch immer keine Verschriftlichung gefunden hatte, ein. Auf der von ihnen angeregten Reichsversammlung von Attigny im Sommer 822 wurde gleichsam die Büchse der Pandora geöffnet, denn die dort inszenierte öffentliche Beichte Ludwigs des Frommen förderte jahrzehntelang unterdrückte Familieninterna zutage, die einen Streit um Karls Erinnerung zwischen den konkurrierenden Familienzweigen offenlegten: Ludwigs Taten wurden mit denen seines Vaters Karl verglichen, und der Kaiser erklärte sich bereit, für sich und seinen Vater zu büßen:45 Doch die neuen Deutungsangebote erschütterten auch das vertraute Bild von Karl als ‚neuem David‘ in seinen Grundfesten. Zwei bald nach Attigny auf der Reichenau entstandene Texte erhoben schwere Vorwürfe gegen Karl und Ludwig: Die Vision einer alten Frau lässt Karl Qualen im Jenseits erleiden, für dessen Erlösung zum ewigen Leben sein Sohn Ludwig einstehen müsse, und bezeichnet letzteren zudem als Mörder Bernhards von Italien. Offensichtlich wird die von Ludwig veranlasste Blendung Bernhards mit Karls Beseitigung der Kinder Karlmanns des Jüngeren verglichen.46 Vor dem Hintergrund der inzwischen virulenten Rezeption des Flavius Josephus und dessen detaillierten Herodes-Bildes schildert eine weitere Vision des Reichenauer Mönches Wetti Karls Höllenqualen als gerechte Strafe für den ‚neuen Herodes‘. Denn Heito und Walahfrid, die diese Vision aufzeichnen, präzisieren hier
45 46
ganus, Gesta Hludowici imperatoris (wie Anm. 43), S. 174–258, hier c. 22, S. 210, Z. 5–7: Ipso eodem anno Bernhardus, filius Pippini ex concubina natus, per exhortationem malorum hominum extollens se adversus patruelem suum, voluit eum a regno expellere. Annales regni Francorum bzw. Annales qui dicuntur Einhardi (wie Anm. 6), ad a. 822, S. 158, Z. 12–14: in quo, quidquid similium rerum vel a se vel a patre suo factum invenire potuit, summa devotione emendare curavit. Visio cuiusdam pauperculae mulieris, hg. von Hubert Houben, ‚Visio cuiusdam pauperculae mulieris‘. Überlieferung und Herkunft eines frühmittelalterlichen Visionstextes (mit Neuedition), in: ZGO 124, 1976, S. 31–42 [mit 1 Abbildung], hier S. 41, Z. 7–11 und S. 42, Z. 1–10: Ibi etiam videbat quendam principem Italię in tormentis […] Interrogavit illa eundem ductorem illius si ille ad ęternam ultra vitam rediere debuisset. At ille: Utique debet. Nam si Hlodovuicus, inquit, imperator, natus eius, septem agapes pro illo pleniter dispensat, resolutus est […] Cumque inde pergerent, ostendit ei ductor illius murum, cuius cacumen celum usque tendebat, et post eum alterum, qui totus scriptus erat aureis caracteribus. Interrogavitque illa, quid hoc esset. Terrestris, inquit, paradisus est, ubi nullus intrabit nisi qui hic scriptus reperitur. Imperavitque illi, ut legeret. At illa ait. Non didici litteras. Scio, inquit, sed tamen lege! Legit namque illa et invenit nomen Bernharti quondam regis tam luculentis litteris exaratum sicut nullius ibidem fuit, postea Hlodouuici regis tam obscurum et oblitteratum, ut vix agnosci potuisset. At illa: Quid est, inquit, quod istud nomen tam oblitteratum est? Antequam, ait, in Bernhartum homicidium perpetrasset, nullius ibi nomen clarius erat. Illius interfectio istius oblitteratio fuit.
48
Matthias M. Tischler
Karls tormenta als Zerfleischung seiner Geschlechtsteile.47 Offenkundig werden hier Karl und Ludwig mit Herodes, dem Kindermörder von Bethlehem, Karl aber zusätzlich auch mit Herodes, dem Ehebrecher, verglichen. Wir können Ludwigs Selbstverständnis und Rolle im Geschehen von Attigny nur aus der späteren Deutung seines jüngeren Biographen, des sogenannten Astronomus, erschließen. Nach diesem sei Ludwig damals ein Theodosius gewesen, der sich, wie in der „Vita S. Ambrosii“ geschildert, vor dem Bischof von Mailand für seine Sünden verantwortet habe. Dort aber wird der römische Kaiser vor dem biblischen Hintergrund des Kindermords von Bethlehem als ein neuer Herodes geschildert.48 In Replik auf Ambrosius’ Empfehlung, wie einst König David öffentlich zu büßen, habe ihm Theodosius entgegnet, dass dieser im Gegensatz zu ihm Ehebruch und Mord begangen habe.49 Ludwig muss sich also zumindest gegen bestimmte Vorwürfe gewehrt haben: Zwar gestand er wohl ein, wegen der tödlichen Blendung Bernhards zum Kindsmörder geworden zu sein, doch ein Ehebrecher wie David, sein Vater, sei er nicht gewesen. Zudem sei er sich selbst der anklagende Ambrosius gewesen. Doch mit wem hatte Karl einst die Ehe gebrochen und welche Konsequenzen ergaben sich daraus? Die ersten karlskritischen Texte wagten es noch nicht, konkreter zu werden und zu verraten, mit wem genau Karl diese Sünde begangen hatte. Erst das weitere Ringen zwischen dem Karlsbild, das Paschasius Radbertus in der Adalhart-Vita um 826 und Einhart mit seiner Karlsvita als Antwort hierauf um 828 entwarfen, gab eine Antwort auf diese Frage. Denn diese beiden frühesten Karolinger-Biographien liefern zwei gegensätzliche, aber aufeinander bezogene Lebensmodelle und Gegenmodelle zum jeweils anderen. Die „Vita Adalhardi“ spricht hierbei Grundprobleme der Karolingerfamilie und Karls des Großen an, die aus anderen karolingischen Texten kaum aufscheinen, so insbesondere das spannungsreiche 47
48
49
Heito, Visio Wettini, hg. von Ernst Dümmler, MGH Poetae 2, Berlin 1884, S. 267–275, hier S. 271, Z. 10 f.: vidisse […] et verenda eius cuiusdam animalis morsu laniari, reliquo corpore inmuni ab hac lesione manente; Walafrid Strabo, Visio Wettini, hg. von Hermann Knittel, Walahfrid Strabo, Visio Wettini – Die Vision Wettis. Lateinisch-Deutsch. Übersetzung, Einführung und Erläuterungen, Sigmaringen 1986, S. 66, V. 449 f.: Oppositumque animal lacerare virilia stantis; / Laetaque per reliquum corpus lue membra carebant. Paulinus von Mailand, Vita S. Ambrosii, hg. von Antonius Adrianus Robertus Bastiaensen, Vita di Cipriano, Vita di Ambrogio, Vita di Agostino (Vite dei santi 3) Mailand 1975, S. 54–124, hier c. 24, § 1–3, S. 84, Z. 1–17: Per idem tempus causa Thessalonicensis civitatis non minima successit tribulatio sacerdoti, cum civitatem paene deletam comperisset. Promiserat enim illi imperator se veniam daturum civibus supradictae civitatis; sed agentibus comitibus occulte cum imperatore, ignorante sacerdote, usque in horam tertiam gladio civitas et donata atque plurimi interempti innocentes. Quo facto ubi cognovit sacerdos, copiam imperatori ingrediendi ecclesiam denegavit, nec prius dignum iudicavit coetu ecclesiae vel sacramentorum communione quam publicam ageret paenitentiam. Cui imperator contra adserebat David adulterium simul et homicidium perpetrasse. Sed responsum illico est: ‚Qui secutus es errantem, sequere corrigentem.‘ Quod ubi audivit clementissimus imperator, ita suscepit animo, ut publicam paenitentiam non abhorreret; cuius correctionis profectus secundam illi paravit victoriam. Ebd., § 2, Z. 7–12: Quo facto ubi cognovit sacerdos, copiam imperatori ingrediendi ecclesiam denegavit, nec prius dignum iudicavit coetu ecclesiae vel sacramentorum communione quam publicam ageret paenitentiam. Cui imperator contra adserebat David adulterium simul et homicidium perpetrasse.
Karl der Große in der Erinnerung der Karolingerfamilie
49
Verhältnis zwischen Karl, Karlmann und Adalhart. Die Entstehung dieser ersten biographischen Schrift über ein Mitglied der Karolingerfamilie recht bald nach seinem Ableben, die weitere negative Facetten aus Karls Erdendasein lieferte, muss den Druck zur Verschriftlichung einer positiven Gegendarstellung enorm erhöht haben, und so lieferte Einhart bald darauf seine Karlsbiographie, die kein Epitaph und keine Totenklage, sondern ein Triumphbild ist, in dem die bei Adalhart noch recht deutlich angesprochenen Sachverhalte bewusst als Fehlstellen inszeniert sind. Die Notwendigkeit zur überfälligen Verschriftlichung der Erinnerung Karls wegen eines durch konkurrierende Deutungen in Bewegung geratenen Karlsbildes bezeugt Einhart im Vorwort zu seiner „Vita Karoli“ sogar ausdrücklich.50 Die Aufdeckung zentraler Konfliktfelder in der Karolingerfamilie durch Paschasius Radbertus erklärt also die verschleiernde Antwort Einharts, der die genauen Zusammenhänge zwischen ihnen nur für Eingeweihte erkennen ließ: Nach dem Tod Karlmanns sei dessen Ehefrau, deren Namen Einhart nicht nennt, mit ihren wiederum namenlosen Kindern und führenden Großen der Entourage ihres Ehemanns, ohne Gründe und unter Missachtung Karls des Großen, nach Italien zum Langobardenkönig Desiderius geflohen.51 Mit der knappen Feststellung des Übergangs der Gesamtherrschaft auf Karl den Großen beendet Einhart die Geschichte des Karlmannzweiges in der Familie, aber mit ihr auch die Geschichte der Karlmann nahestehenden Großen.52 Sie ist aber nur die Vorgeschichte zum eigentlichen Leben Karls des Großen, das mit einer Rubrik zu ihrer Gliederung eröffnet wird.53 Der gemeinsame Nenner dieser tendenziösen Familiengeschichte ist das systematische Verschweigen von Ereignissen, die Karlmanns Ehefrau, ihre Kinder und ihre Anhänger betreffen, das heißt die hiermit zusammenhängende Frage nach der Legitimität der Herrschaft Karls des Großen und seiner allein herrschenden Nachfahren aus der neuen Beziehung mit Hildegard. Keinen Grund könne er, Einhart, dafür nennen, warum Karl
50
51
52 53
Einhart, Vita Karoli (wie Anm. 6), Praefatio, S. 1, Z. 10–22: Et quamquam plures esse non ambigam, qui otio ac litteris dediti statum aevi praesentis non arbitrentur ita neglegendum, ut omnia penitus quae nunc fiunt velut nulla memoria digna silentio atque oblivioni tradantur, potiusque velint amore diuturnitatis inlecti aliorum praeclara facta qualibuscumque scriptis inserere quam sui nominis famam posteritatis memoriae nihil scribendo subtrahere, tamen ab huiuscemodi scriptione non existimavi temperandum, quando mihi conscius eram nullam ea veracius quam me scribere posse, quibus ipse interfui, quaeque praesens ocultata, ut dicunt, fide cognovi et, utrum ab alio scriberentur necne, liquido scire non potui. Ebd., c. 3, S. 6, Z. 12–18: Sed in hoc plus suspecti quam periculi fuisse ipse rerum exitus adprobavit, cum defuncto Karlomanno uxor eius et filii cum quibusdam, qui ex optimatum eius numero primores erant, Italiam fuga petiit et nullis existentibus causis, spreto mariti fratre, sub Desiderii regis Longobardorum patrocinium se cum liberis suis contulit. Ebd., Z. 19–22: Et Karlomannus quidem post administratum communiter biennio regnum morbo decessit; Karolus autem fratre defuncto consensu omnium Francorum rex constituitur. Ebd., c. 4, S. 7, Z. 2–7: ad actus et mores ceterasque vitae illius partes explicandas ac demonstrandas, omissis incognitis, transire disposui; ita tamen, ut, primo res gestas et domi et foris, deinde mores et studia eius, tum de regni administratione et fine narrando, nihil de his quae cognitu vel digna vel necessaria sunt praetermittam.
50
Matthias M. Tischler
seine langobardische Ehefrau nach nur einem Jahr verstoßen habe.54 Mit Absicht spricht Einhart nur vage von einem Zeitraum von einem Jahr zwischen Heirat und Verstoßung, ohne letzteres Ereignis angeblich näher begründen zu können. Damit ließ er bewusst die Frage offen, ob der Beschluss der Verstoßung noch vor oder erst nach Karlmanns Tod gefallen war. Denn Einhart wusste, dass der von Karl beim Tode Karlmanns 771 übergangene Familienzweig um Adalhart sehr wohl den Grund und den Zeitpunkt der Verschmähung der einst ersehnten Langobardin kannte: Es war Karls Verhältnis mit einer neuen Frau trotz seiner gültigen Ehe mit jener.55 Indem Paschasius Radbertus seinen Helden Adalhart gegenüber König Karl als neuen Johannes den Täufer auftreten ließ56, deckte er die Illegitimität der Beziehung dieses neuen Herodes mit Hildegard und damit die unrechtmäßige Herrschaft ihrer Nachkommen, vor allem aber Kaiser Ludwigs des Frommen auf. Einharts systematische Ausblendung der Verwandtschaftsbeziehungen zwischen den Zweigen der Karolinger verschleierte die wahren Familienverhältnisse zum Zwecke der Legitimierung des allein von Karl und Hildegard ausgehenden Zweiges und damit der monarchischen Herrschaft Karls des Großen und Ludwigs des Frommen. Daher musste Einhart auch Karls Übergehung der legitimen Herrschaftsansprüche seiner Neffen durch deren angeblich unbegründete Flucht nach Italien verschleiern. Nur die Siegerseite besitzt das Recht zur Verleumdung! Tatsächlich wurden zur Entstehungszeit der „Vita Karoli“ noch weitere Argumente für Ludwigs legitime Nachfolge vorgebracht. So sollen zwei Vatizinien des Paulinus von Aquileja († 802) und des Alkuin († 804) Ludwig noch vor dem Ableben seiner Brüder als geeignetsten Nachfolger angekündigt haben.57 Wie zentral diese Debatte um die Rechtmäßigkeit der Trennung von der Langobardin zugunsten Hildegards und ihrer Nachkommen 54
55
56
57
Ebd., c. 18, S. 22, Z. 4–7: Deinde cum matris hortatu filiam Desiderii regis Langobardorum duxisset uxorem, incertum qua de causa, post annum eam repudiavit; S. 23, Z. 6–9 : Colebat [sc. Karolus] enim eam [sc. Berhtradam] cum summa reverentia, ita ut nulla umquam invicem sit exorta discordia, praeter in divortio filiae Desiderii regis, quam illa suadente acceperat. Paschasius Radbertus, Vita Adalhardi, hg. von Jacques-Paul Migne, Patrologia Latina 120, Paris 1852, Sp. 1507–1556, hier c. 7, Sp. 1511, Z. 29–40: Unde factum est, cum idem imperator Carolus desideratam Desiderii regis Italorum filiam repudiaret, quam sibi dudum etiam quo rumdam Francorum juramentis petierat in conjugium; ut nullo negotio beatus senex persuaderi posset, dum esset adhuc tiro palatii, ut, ei quam vivente illa rex acceperat, aliquo communicaret servitutis obsequio; sed culpabat modis omnibus tale connubium, et gemebat puer beatae indolis, quod et nonnulli Francorum eo essent perjuri, atque rex illicito uteretur thoro, propria, sine aliquo crimine, repulsa uxore. Ebd., Z. 44–47: Nec minus igitur Joanne pro justitia mori paratus fuisse creditur, qui pari adnisu illicitam reprehendebat regis audaciam, et spernebat hujusmodi nuptias; Dieter von der Nahmer, Die Bibel im Adalhardleben des Radbert von Corbie, in: Studi Medievali Ser. 3, 23, 1982, S. 15–83, hier S. 19 f. und 73 f. Ermoldus Nigellus, In honorem Hludowici christianissimi caesaris augusti, hg. von Ernst Dümmler, MGH Poetae 2, Berlin 1884, S. 5–79, I 565–600, hier I 597–600 (a. 826/828), S. 23: ‚Si Deus e vestro Francorum semine regem / Ordinat, iste tuis sedibus aptus erit.‘ / Haec paucis sapiens Carolus pandebat alumnis, / Quorum causa sibi credula sive placens; Vita Alcuini, hg. von Wilhelm Arndt, MGH SS 15, 1, Hannover 1887, S. 184–197, hier c. 15 (a. 826/829), S. 192 f.
Karl der Große in der Erinnerung der Karolingerfamilie
51
gewesen sein muss, zeigt die Tatsache, dass sie noch bei Notker Balbulus gegen Ende des 9. Jahrhunderts eine Rolle spielte.58 Von dem Verwirrspiel der konkurrierenden Deutungen Karls, dem Streit um Karls rechtes Bild und Ludwigs Positionierung dazu vermitteln die jüngeren Autoren Ermoldus Nigellus, Thegan, Astronomus und Nithart nur noch bruchstückhaft einen Eindruck. Ihr Blick richtet sich insbesondere auf die Frage nach Karls privatem Erbe, wie er es in seinem vielleicht von Einhart redigierten privaten Testament von 811 festgelegt und wie es sein Nachfolger Ludwig der Fromme auch weitestgehend befolgt hatte.59 Für die Kanonisierung des von Einhart und der Hoftradition festgelegten offiziösen Karlsbildes sorgte hingegen die frühe Verbreitung der einst Ludwig dem Frommen überreichten Widmungsfassung der „Vita Karoli“ über Angehörige des Hofes selbst wie auch der vollständigen Fassung des Textes mit Einharts Vorwort über zentrale Orte des Reiches in seinen östlichen wie westlichen Teilen. Eine Schlüsselrolle kam hier einem wohl noch karolingischen Kompendium zu, das Einharts Karlsleben mit den sogenannten Einhartannalen, einer überarbeiteten Fassung der Reichsannalen, verband.60 Diese Texte haben unser Karlsbild bis 58
59
60
Notker Balbulus, Gesta Karoli imperatoris, hg. von Hans Frider Haefele (MGH SS rer. Germ. N. S. 12) München 21980, S. 1–93, hier II 17, S. 82, Z. 3–5: Qua non post multum temporis, quia esset clinica et ad propagandam prolem inhabilis, iudicio sanctissimorum sacerdotum relicta velut mortua. Ermoldus Nigellus, In honorem (wie Anm. 57), II 159–166, S. 29: Protinus expendit thesauros largus avitos / Pro mercede patris atque animae requie, / Quaeque patrum virtus, Carolus congesserat ipse, / Pauperibus tribuit ecclesiisque sacris. / Aurea vasa dedit, vestes seu pallia multa, / Argenti cumulat ampla talenta meri. / Spargit opes varias, arma, innumerandaque valde / Munera distribuit, pauper, habenda tibi; Thegan, Gesta Hludowici imperatoris (wie Anm. 44), c. 8, S. 188, Z. 11 f. und S. 190, Z. 1 f.: et quicquid remanserat, dedit pro anima patris […] quod pro patre tradidit; Astronomus, Vita Hludowici imperatoris (wie Anm. 43), c. 22, S. 350, Z. 12–22: Nam recitato paterno testamento, nichil relictum est paternorum bonorum, quin secundum eius partiretur sectionem; nil enim ab eo intestatum est relictum. Sed quod ecclesiis distribuendum censit, metropolitanorum subdivisit superscriptione nominum, quarum partes fuere xxi. Quod autem ornatui conducebat regio, posteriori reliquit aetati. Statuit etiam, quid secundum morem Christianorum filiis filiorumque filiis et filiabus, necnon et servis ancillisque regalibus, sed et in commune omnibus distribueretur pauperibus. Que cuncta domnus imperator Hludouuicus ut scripta relegit, operis executione complevit; Nithart, Historiarum libri IV, hg. von Ernst Müller (MGH SS rer. Germ. [44]) Hannover 31907, S. 1–50, hier I 2, S. 2, Z. 8–26: Heres autem tante sublimitatis Lodhuwicus, filiorum eius iusto matrimonio susceptorum novissimus, ceteris decedentibus successit. Qui ut pro certo patrem obisse comperit, Aquis ab Aquitania protinus venit […] Initio quidem imperii suscepti pecuniam ingenti numero a patre relictam trifariam dividere iussit et unam partem causa funeris expendit, duas vero inter se et sorores suas a patre iusto matrimonio susceptas divisit, quas et instanter a palatio ad sua monasteria abire praecepit. Fratres quoque adhuc tenera aetate, Drugonem, Hugonem et Teodericum, participes mensae effecit, quos et in palatio una secum nutriri praecepit, et Bernardo nepoti suo, filio Pippini, regnum Italiae concessit. Qui quoniam ab eo paulo post defecit, capitur et a Bertmundo Lugdunensis provinciae praefecto luminibus et vita pariter privatur. Tischler, Einharts Vita Karoli (wie Anm. 32); ders., Der doppelte Kontext. Neue Perspektiven für die Erforschung der karolingischen Annalistik, in: Richard Corradini/Max Diesenberger/ Meta Niederkorn-Bruck (Hgg.), Zwischen Niederschrift und Wiederschrift. Hagiographie und Historiographie im Spannungsfeld von Kompendienüberlieferung und Editionstechnik (For-
52
Matthias M. Tischler
in die jüngste Vergangenheit so nachhaltig geprägt, dass wir erst jetzt allmählich die in ihnen verborgenen Diskurse aufzudecken lernen. Johannes Fried hat durch seine wegweisende Memorik61 zu dieser Entwicklung wesentliche Anstöße gegeben, wofür ihm unser ganzer Dank ausgesprochen sei. Prof. Dr. Matthias M. Tischler, Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, Research Professor, Institut d’Estudies Medievals (IEM), Universitat Autònoma Barcelona, Edifici B, Campus de la UAB, E-08193 Bellaterra.
61
schungen zur Geschichte des Mittelalters 18 = Denkschriften der Philosophisch-Historischen Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 405) Wien 2010, S. 17–28. Wie Anm. 2.
VERZERRTE ERINNERUNGEN Die Frage nach der Autorschaft der älteren Adalbertsvita im Lichte der neueren Forschung Daniel Ziemann I. DIE ADALBERTSVITA IM BLICK DER TRADITIONELLEN FORSCHUNG Es ist nun über zehn Jahre her, dass der 2002 im Rahmen des Sammelbandes „Polen und Deutschland vor 1000 Jahren“ erschienene Aufsatz mit dem Titel „Gnesen – Aachen – Rom. Otto III. und der Kult des heiligen Adalbert“ publiziert wurde. Johannes Fried hatte auf der zwei Jahre zuvor zum Jubiläum des Aktes von Gnesen stattfindenden Tagung in Berlin eine neue These zur Adalbertsvita vorgestellt. In seinem Beitrag zweifelte Johannes Fried an der einst von Georg Heinrich Pertz aufgestellten These der Identifikation des Mönches Johannes Canaparius aus dem Kloster SS. Bonifacio e Alessio auf dem Aventin in Rom mit dem Autor der älteren Version der Vita des heiligen Adalbert.1 Der These von Pertz war ein Großteil der Forschung gefolgt, darunter auch die maßgeblichen Editionen der beiden Viten von Jadwiga Karwasińska, welche die ältere, Johannes Canaparius zugesprochene, im Jahr 1962 und die Bruns von Querfurt im Jahr 1969 publizierte. Die Annahme, Johannes Canaparius als Autor der älteren Vita zu sehen, beruhte auf einigen wenigen Hinweisen in der Vita selbst, die von der späteren Forschung übernommen wurden. Das erste Argument bestand darin, dass der Autor der „Vita Adalberti“ sowohl Sankt Basilius als auch Sankt Benedikt pater noster nennt.2 Dies wurde nun als Indiz für eine Herkunft aus jenem Kloster SS. Bonifacio e Alessio auf dem Aventin gewertet, das mit griechischen und lateinischen Mönchen bestückt war und einen gemischten Ritus praktizierte.3 Schon Karwasińska wies darauf hin, dass in der 1
2
3
Johannes Fried, Gnesen – Aachen – Rom. Otto III. und der Kult des heiligen Adalbert. Beobachtungen zum älteren Adalbertsleben, in: Michael Borgolte (Hg.), Polen und Deutschland vor 1000 Jahren. Die Berliner Tagung über den „Akt von Gnesen“ (Europa im Mittelalter 5), Berlin 2002, S. 235–280. Vita S. Adalberti episcopi, hg. von Georg Heinrich Pertz (MGH SS 4), Hannover 1841, S. 574– 620, hier S. 574; Św. Wojciecha biskupa i męczennika żywot pierwszy / S. Adalberti Pragensis episcopi et martyris vita prior. Wydala, wstępem i komentarzem opatrzyla / edidit, praefatione notisque instruxit, hg. von Jadwiga Karwasińska (Pomniki Dziejowe Polski, Seria II 4, 1 / Monumenta Poloniae Historica, N. S. 4, 1), Warschau 1962, c. 15, S. 22, Z. 9, c. 25, S. 37, Z. 12. Vita S. Adalberti, hg. v. Pertz (wie Anm. 2), S. 574; Jadwiga Karwasińska, Les trois rédactions de „Vita I“ de S. Adalbert, in: Święty Wojciech. Wybór pism, hg. von Jadwiga Karwasińska, Warschau 1996, S. 217–237, S. 230–232.
54
Daniel Ziemann
Benediktsregel Basilius pater noster genannt wird.4 Damit wäre eine solche Formulierung nicht unbedingt als Hinweis auf einen gemischten Konvent anzusehen. Auch Johannes Fried sah hierin kein wirkliches Argument, obschon er für SS. Bonifacio e Alessio von einem gemeinsamen Konvent von Benediktinern und Basilianern ausging.5 Weiterhin wurde von Pertz die ausdrückliche Erwähnung des Urteils Leos, des Klosterabtes von SS. Bonifacio e Alessio, über das Leben und die Sitten Adalberts für eine in jenem Kloster zu suchende Autorschaft der Vita herangezogen.6 Pertz bezieht sich dabei auf eine Stelle im 20. Kapitel, bei der sowohl der Abt als auch die Brüder über Adalbert gesagt hätten, dass er in allen Tugenden ganz vollkommen und außer dem Martyrium wahrhaftig heilig sei.7 Dort heißt es weiterhin, es sei unbekannt, wie viele Jahre er studiert habe, aber dass er in den weltlichen Wissenschaften äußerst bewandert gewesen sei (saecularis philosophiae sat scientissimus), das wüssten wir alle. Auch dieser Satz diente Pertz zur Untermauerung seiner Annahme, da er hier mit der ersten Person Plural die Gemeinschaft der Klosterbrüder bezeichnet sieht.8 Pertz verweist zugleich auf Kapitel 12. Dort geht es um Adalberts Zeit als Bischof in Prag und die dortigen Schwierigkeiten, die ihn schließlich dazu veranlassten, nach Rom zu gehen. Dort erwähnt der Autor diejenigen, die den Ablauf der Geschehnisse aus Adalberts Mund erfahren hätten und die Gründe nannten, warum er sein Amt aufgab. Der Autor gehört also nicht zu diesen, sondern hat die Prager Ereignisse von anderen erfahren, die mit Adalbert selbst gesprochen hatten.9 Dies führt die Suche nach dem Autor zumindest weg von Prag und wohl auch von Adalberts unmittelbarer Umgebung. Weiterhin würde der mutmaßliche Autor Johannes Canaparius als einer der wenigen Mönche namentlich genannt, und dies in der Erzählung über eine Vision.10 Nicht zuletzt kenne sich der Autor gut in Rom aus, für den berühmten Editor ein weiteres Argument für die Autorschaft des Johannes Canaparius, der später sogar Abt des Klosters wurde.11 II. FRIEDS THESEN ZUR ADALBERTSVITA Johannes Fried stellte hingegen die These auf, dass die ursprüngliche Version der Vita keinesfalls aus Rom kommen könne und die Argumente für Johannes Canaparius als Autor auf tönernen Füßen stünden. Georg Heinrich Pertz habe, so Fried, 4 5 6 7 8 9 10 11
S. Adalberti vita prior (wie Anm. 2), S. 22, Anm. 81; Karwasińska (wie Anm. 3). Fried, Gnesen (wie Anm. 1), S. 236, Anm. 6. Vita S. Adalberti, hg. von Pertz (wie Anm. 2), S. 574; S. Adalberti vita prior (wie Anm. 2), c. 20, S. 30–32. Ebd., c. 20, S. 31, Z. 9; Vita S. Adalberti, hg. von Pertz (wie Anm. 2), S. 574. Vita S. Adalberti, hg. von Pertz (wie Anm. 2), S. 574; S. Adalberti vita prior (wie Anm. 2), c. 5, S. 9, Z. 3–4. Ebd., c. 12, S. 18, Z. 4–5. Ebd., c. 29, S. 43. Vita S. Adalberti, hg. von Pertz (wie Anm. 2), S. 574 f.
Verzerrte Erinnerungen
55
indem er die Vita Johannes Canaparius zuschrieb, einen Sumpf angelegt, in den ihm auch spätere Gelehrte gefolgt seien, darunter Jadwiga Karwasińska, die Herausgeberin der wissenschaftlichen Editionen der Adalbertsviten.12 Für Fried vermögen die vorgebrachten Argumente eine Autorschaft des Johannes Canaparius und eine Verortung der Vita in Rom vor allem deshalb nicht zu stützen, da sie für ihn keine exklusiven Informationsbestandteile enthalten, die nicht anderswo verfügbar gewesen wären. So könnten laut Fried derartige Kenntnisse auch dem Kaiserhof entstammen.13 Aussagen der Brüder oder des Abtes über Adalbert oder eine etwas umfangreichere Kenntnis der römischen Verhältnisse mögen laut Fried zwar Hinweise geben, Beweiskraft käme ihnen indes nicht zu. Frieds Kritik richtete sich allerdings nicht nur gegen die Argumente von Pertz für einen römischen Ursprung. Vielmehr wandte er sich vor allem auch gegen das aus seinen Erkenntnissen gewonnene Modell, das die Editorin der kritischen Ausgabe, Jadwiga Karwasińska, erarbeitet hatte. Es geht dabei um folgendes Schema: Jadwiga Karwasińska ging, und hinsichtlich der Richtigkeit dieser Annahme ist sich die Forschung wohl einig, von drei Redaktionen der älteren Adalbertsvita aus, einer ‚ottonischen‘ A-Version mit Handschriften aus dem nordalpinen Raum, einer B-Version mit Handschriften vornehmlich aus Italien und einer dem Kloster Montecassino zuzuordnenden C-Version.14 In Letzterer werden einige negative Bemerkungen zum Kloster Montecassino durch geschönte Formulierungen ersetzt. Diese C-Version leitet sich, und auch dies scheint aufgrund des Textvergleichs unbestritten zu sein, hinsichtlich der meisten Stellen aus der B-Version ab.15 Sie könnte daher bei der Suche nach der ursprünglichen Version der Vita zunächst unberücksichtigt bleiben. Diese wäre demnach vielmehr im Vergleich der A- mit der B-Version zu erschließen. Die A-Redaktion, auch ‚ottonische‘ Redaktion genannt, zeichnet sich durch einige emphatische Bemerkungen zu Otto III. aus, die in der B-Version ersetzt wurden oder – um es neutraler zu formulieren – nicht vorhanden sind.16 Jadwiga Karwasińska, die alle drei Redaktionen edierte, stimmte mit Georg Heinrich Pertz darin überein, eine Handschrift aus Lamspringe zur Grundlage ihrer Edition der A-Version zu nehmen.17 Zudem ging sie davon aus, in der A-Redaktion im Großen und Ganzen auch die ursprüngliche Version der Vita vor Augen zu haben. Jedoch ist ihr Modell komplizierter. Demzufolge gab es eine heute verlorene Urversion der Vita, einen Johannes Canaparius zuzuschreibenden Entwurf, der größtenteils der überlieferten A-Redaktion entspräche, bei dem teilweise aber auch die B-Redaktion durchschimmere.18 Karwasińska ging davon aus, dass die Urredaktion des Johannes Canaparius von hofnahen Personen im Sinne eines positiven Bildes Ottos III. ausgestaltet wurde.19 Später, nach dem Tode Ottos III., habe man 12 13 14 15 16 17 18 19
Fried, Gnesen (wie Anm. 1), S. 239. Ebd. S. Adalberti vita prior (wie Anm. 2), S. XXII–XXIX. So Fried, Gnesen (wie Anm. 1), S. 242 mit Anm. 29. Karwasińska, Les trois rédactions (wie Anm. 3), S. 228 f. S. Adalberti vita prior (wie Anm. 2), S. XL–XLIV. Karwasińska, Les trois rédactions (wie Anm. 3), S. 232, 236. Ebd., S. 232 f.
56
Daniel Ziemann
in Italien eine von diesen kaisernahen Formulierungen gereinigte Version zu erstellen versucht. Dazu habe man auf die ‚ottonische‘ Version zurückgreifen müssen, weil die Urredaktion nicht mehr vollständig verfügbar beziehungsweise lediglich in Form von Notizen vorhanden gewesen sei. Aus diesen Notizen und der ‚ottonischen‘ A-Redaktion habe man nun die B-Redaktion erstellt, eine von ottonischer Emphase gesäuberte Version, die zwar nicht so nah am Urtext läge wie die A-Redaktion, jedoch an einigen wenigen Stellen die Urredaktion durchschimmern ließe. Zwei unterschiedliche Versionen der B-Redaktion würden im einen Fall auf das Zurückgreifen auf die ursprünglichen Notizen verweisen, im anderen Fall die Überarbeitung der ‚ottonischen‘ Version verdeutlichen.20 Es ist genau dieses komplizierte Modell, gegen das Johannes Fried argumentierte. Er vertrat die Auffassung, dass der A-Version durchgängig der Vorzug zu geben sei. In einer detaillierten Analyse versuchte Fried, die Argumente für einen römischen Ursprung zu entkräften und stattdessen einer sogenannten ‚ottonischen‘ Version, deren Entstehung er im Umkreis des Hofes, vielleicht bei Notker von Lüttich, suchte, den Vorzug zu geben. Es ging dabei vor allem um diejenigen Stellen, bei denen Karwasińska in der B-Redaktion, also der ‚aventinischen‘ Redaktion, eine bessere Lesart sah. In seinem Aufsatz nahm er sich daher all diejenigen Beispiele vor, in denen laut Karwasińska die eigentlich sekundäre B-Redaktion einen Einblick in die Urversion verspräche. Fried versuchte jeweils zu verdeutlichen, dass man sich all diese Versionen auch ganz einfach durch eine Abhängigkeit der B-Redaktion von der A-Redaktion erklären könne und das komplizierte Modell Karwasińskas durch ein einfaches zu ersetzen sei, das schlichtweg der A-Version den Vorzug gäbe.21 Innerhalb dieser A-Version machte er zudem auf eine weitere Handschrift aufmerksam, eine von Karwasińska erst nach ihrer kritischen Edition berücksichtigte Aachener Handschrift22, die 2005 von Jürgen Hoffmann ediert wurde.23 Fried ging jedoch noch einen Schritt weiter, als lediglich die römische Herkunft der ältesten Adalbertsvita zu bestreiten. Vielmehr ging er von einem „Lütticher Nachrichtenpool zum heiligen Adalbert“ aus, dem auch die Ursprungsversion der ersten Adalbertsvita entstammen könnte.24 Die Beweisführung gründet sich auf Details, die Differenz weniger Worte und Wendungen, doch die Wirkungen sind weitreichend, sie haben Konsequenzen für die folgenschweren politischen Entwicklungen um die erste Jahrtausendwende, für die Beurteilung der Bedeutung Ottos III., für den Akt von Gnesen und nicht zuletzt für die Forschung zur lateinischen Literatur des Mittelalters.
20 21 22 23 24
Ebd., S. 236 f. Fried, Gnesen (wie Anm. 1), S. 246–253. Jadwiga Karwasińska, Studia krytyczne nad żywotami św. Wojciecha, biskupa Praskiego VI. Przekaz akwizgrański, in: Święty Wojciech (wie Anm. 3), S. 207–214. Jürgen Hoffmann, Vita Adalberti. Früheste Textüberlieferungen der Lebensgeschichte Adalberts von Prag (Europäische Schriften der Adalbert-Stiftung Krefeld 2) Essen 2005. Fried, Gnesen (wie Anm. 1), S. 263–272.
Verzerrte Erinnerungen
57
III. REAKTIONEN AUF FRIEDS THESEN Das Echo auf die Thesen Frieds war unterschiedlich, neben Zustimmung gab es auch Vorbehalte. In vielen jüngeren Arbeiten wird mitunter die Frage nach der Wertung von Frieds Thesen offen gelassen und lediglich auf sie hingewiesen, so auch in der von Lorenz Weinrich 2005 herausgegebenen Übersetzung innerhalb der renommierten Freiherr-vom-Stein-Gedächtnisausgabe.25 Die polnische Forschung hingegen zeigt sich bis in die jüngste Zeit skeptisch und gibt dem traditionellen, von Karwasińska vertretenen Modell den Vorzug.26 Betrachtet man die Reaktion der polnischen Forschung zu den Thesen Frieds, so ist der Aufsatz zu Adalbert sicherlich auch im Zusammenhang mit seinem 1989 erschienenen Buch zu sehen, das den Titel trägt: „Otto III. und Boleslaw Chrobry. Das Widmungsbild des Aachener Evangeliars, der ‚Akt von Gnesen‘ und das frühe polnische und ungarische Königtum. Eine Bildanalyse und ihre Folgen“.27 Dort schlug Fried eine völlig neue Interpretation des Aktes von Gnesen vor. So sah er in diesem Ereignis eine Königskrönung und kam zu einer Neubewertung der Bedeutung von Adalberts Bruder Gaudentius, der Rolle Magdeburgs, der Politik Bischof Ungers von Posen und vieler weiterer Aspekte. Im Jahr 2000 erschien die polnische Übersetzung des Buches und rief unterschiedliche Reaktionen hervor.28 Historiker wie Gerard Labuda29, Jerzy Strzelczyk30, der sich auch zu den Thesen zur Adalbertsvita äußert, oder auch Tomasz Jasiński31, lehnten Frieds Vorschläge ab. Letz25
26
27 28 29
30 31
Lorenz Weinrich/Jerzy Strzelczyk (Hgg.), Heiligenleben zur deutsch-slawischen Geschichte. Adalbert von Prag und Otto von Bamberg (Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters – FStGA 23) Darmstadt 2005, S. 13. Die Übersetzung der älteren Adalbertsvita ebd. S. 27–69; die Übersetzung der Adalbertsvita aus der Feder Bruns von Querfurt ebd. S. 70–117. Leszek Paweł Słupecki, St Adalbert (Wojciech) of Prague in Poland, in: Wolfgang Huschner/ Enno Bünz/Christian Lübke (Hgg.), Italien, Mitteldeutschland, Polen. Geschichte und Kultur im europäischen Kontext vom 10. bis zum 18. Jahrhundert (Schriften zur sächsischen Geschichte und Volkskunde 42) Leipzig 2013, S. 57–66; Gerard Labuda, Święty Wojciech. Biskup-męczennik, patron Polski, Czech i Węgier (Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Seria Humanistyczna) Breslau 22004. Johannes Fried, Otto III. und Boleslaw Chrobry. Das Widmungsbild des Aachener Evangeliars, der „Akt von Gnesen“ und das frühe polnische und ungarische Königtum, Stuttgart 22001. Ders., Otton III i Bolesław Chrobry. Miniatura dedykacyjna z Ewangeliarza z Akwizgranu, zjazd gnieźnieński a królestwa polskie i węgierskie analiza ikonograficzna i wnioski historyczne (Klio w Niemczech 6) Warschau 2000. Gerard Labuda, O badaniach nad zjazdem gnieźnieńskim roku 1000: spostrzeżenia i zastrzeżenia, in: Roczniki Historyczne 68, 2000, S. 107–156; ders., Zjazd i synod gnieźnieński roku 1000 w nowym oświetleniu historiograficznym, in: Dariusz Andrzej Sikorski/Andrzej Marek Wyrwa (Hgg.), Cognitioni gestorum. Studia z dziejów średniowiecza dedykowane Profesorowi Jerzemu Strzelczykowi, Posen 2006, S. 163–184. Jerzy Strzelczyk, Zjazd gnieźnieński (Biblioteka „Kroniki Wielkopolski“) Posen 2000; ders., Naukowe pokłosie millenium zjazdu gnieźnieńskiego, in: Roczniki Historyczne 68, 2002, S. 157–174. Tomasz Jasiński, Tytulatura Bolesława Chrobrego na zjeździe gnieźnieńskim, in: Wacław Korta u. a. (Hgg.), Memoriae amici et magistri. Studia historyczne poświęcone pamięci Prof. Wacława Korty, 1919–1999, Breslau 2001, S. 23–31.
58
Daniel Ziemann
terer schreibt in seiner Zusammenfassung, dass man feststellen könne, dass während der Versammlung in Gnesen (in Polen wird meist der Begriff zjazd = Zusammenkunft, Versammlung, Kongress, Synode gebraucht) Boleslaw nicht zum König gemacht worden sei und der Charakter des Kongresses ein primär religiöser und kirchlicher gewesen sei. Eine der ausführlichsten Auseinandersetzungen mit Frieds Thesen stellt eine Monographie von Roman Michałowski dar, der sich zwar nicht von ihnen überzeugen lässt, jedoch etwas abwägender urteilt.32 Ein ähnliches Bild bietet sich hinsichtlich der Thesen zur Adalbertsvita, bei der die Edition Karwasińskas und ihre Thesen in Polen prägend wirken. In der übrigen Forschung bietet sich hingegen ein differenziertes Bild sowohl in Bezug auf Frieds Vorschläge zu Gnesen als auch hinsichtlich seiner Ansichten zu Adalbert.33 Eine kürzlich erschienene englische Übersetzung der „Vita Adalberti“ durch Cristian Gaşpar gibt jedoch Anlass, die Diskussion wieder aufzugreifen.34 Gaşpar wendet sich nicht nur sehr deutlich gegen die Thesen Frieds, er ist zudem der Meinung, neue Aspekte zum Thema beigesteuert zu haben. Schon Karwasińska vertrat die Ansicht, dass alle mit dem lothringischen Raum verbundenen Handschiften, also Aachen, Rv1 (Rooklooster/Rouge-Cloître, jetzt in Brüssel), Rv2 (Rooklooster/Rouge-Cloître, jetzt in Wien), Ll (St. Laurentius in Lüttich, jetzt in Brüssel) und Ls (Lamspringe), auf eine gemeinsame Vorlage zurück32
33
34
Roman Michałowski, Zjazd Gnieźnieński. Religijne przesłanki powstania arcybiskupstwa gnieźnieńskiego (Monografie FNP. Seria humanistyczna) Breslau 2005; die englische Übersetzung: ders., The Gniezno Summit. The Religious Premises of the Founding of the Archbishopric of Gniezno. Translated by Anna Kijak (East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450–1450, vol. 38), Leiden/Boston 2016; ders., Polen und Europa um das Jahr 1000. Mit einem Anhang. Zur Glaubwürdigkeit des Berichts von Gallus Anonymus über das Treffen in Gnesen, in: Andreas Ranft (Hg.), Der Hoftag in Quedlinburg 973. Von den historischen Wurzeln zum Neuen Europa, Berlin 2006, S. 51–72; weitere Arbeiten zum Thema u. a.: Jaroslaw Dudek, Emperor Otto III’s „Advent“ at Gniezno in March 1000 as Evidence of the Presence of the Byzantine Ceremonials at the first Piasts’ Court?, in: Byzantinoslavica 63, 2005, S. 117–130; Przemysław Wiszewski, How far can you go with Emotions? The Gniezno Meeting of the Emperor Otto III and Boleslaw the Brave in the Year 1000, in: ders. (Hg.), Meetings with Emotions. Human Past between Anthropology and History (Historiography and Society from the 10th to the 20th Century). Studies (Disputationes 2) Breslau 2008, S. 77–88; Tomasz Jasiński, Otto III. und Boleslaw der Tapfere – Zwei unbekannte Aspekte des Treffens von Gnesen im Jahr 1000. Ein Beitrag zur Geschichte der deutsch-polnischen Beziehungen, in: Akademiekalender der Hessischen Akademie der Forschung 17, 2009, S. 94–110. Knut Görich, Ein Erzbistum in Prag oder in Gnesen?, in: Zeitschrift für Ostforschung 40, 1991, S. 10–27; Gerd Althoff, Otto III. (Gestalten des Mittelalters und der Renaissance) Darmstadt 1996, S. 126–147; Ludwig Falkenstein, Otto III. und Aachen (MGH Studien und Texte 22) Hannover 1998, S. 82; Giulia Barone, Il contributo di Silvestro II alla „giornata di Gniezno“ (9 marzo 1000), in: BISI 109, 1, 2007, S. 151–166; Wolfgang Huschner, Rom – Gnesen – Quedlinburg – Aachen – Rom. Die Reise Kaiser Ottos III. im Jahre 1000, in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins 113/114, 2011/2012, S. 31–59. Cristian Gaşpar, Life of Saint Adalbert Bishop of Prague and Martyr, in: Gábor Klaniczay (Hg.), Saints of the Christianization Age of Central Europe (Tenth-Eleventh Century). Vitae sanctorum aetatis conversionis Europae Centralis (Saec. X–XI) (Central European Medieval Texts 6) Budapest 2013, S. 77–182.
Verzerrte Erinnerungen
59
gingen.35 Alle diese Handschriften zeichnen sich unter anderem durch zwei Lücken aus. Eine dieser Lücken in Kapitel 29 mache, so Gaşpar, den Text unverständlich.36 Alle anderen Handschriften der A-Redaktion verfügen jedoch über einen vollständigen Text an der betreffenden Stelle.37 Ein anzunehmendes Original sollte diese Lücke indes nicht aufweisen. Dies würde nun bedeuten, dass es zwischen dem Urtext und den lothringischen Exemplaren mindestens eine Zwischenstufe gegeben haben muss, die als Vorlage für die lothringischen Handschriften gedient haben könnte. Nun sind jedoch die Handschriften der lothringischen Gruppe keineswegs einheitlich, ebenso wenig wie die nordalpine Gruppe insgesamt. Auch die von Karwasińska für ihre Edition herangezogene Handschrift aus Lamspringe zeigt einige Besonderheiten. Daraus folgt, dass zwischen der Aachener Handschrift, die zur lothringischen Gruppe gehört, und einem anzunehmenden Original auf jeden Fall mehr als eine Zwischenstufe anzunehmen ist, denn mindestens eine weitere Handschrift ohne die Lücke in Kapitel 29 müsste den restlichen Handschriften der nordalpinen Gruppe A als Vorlage gedient haben. Gaşpar verweist zudem auf ein neu entdecktes, auf 1060/70 datiertes Legendarium der heiligen Caecilia in Trastevere, welches die in italienischen Handschriften vertretene B-Redaktion der Adalbertsvita überliefere. Er hält 60 Jahre für einen zu geringen Zeitraum für die verschiedenen Redaktionsstufen nördlich der Alpen und eine Reise des Textes nach Italien, aus dem dann die B-Redaktion entwickelt worden sei. Zudem geht er auf Notker von Lüttich ein und sieht keinerlei Ähnlichkeiten zwischen Notkers Werk und der „Vita Adalberti“.38 IV. VORLAGEN UND STIL DES AUTORS Schließlich bringt er auch stilistische Argumente ins Spiel. Die „Vita Adalberti“ würde nur sehr selten Reimprosa verwenden, während doch im 11. Jahrhundert und vor allem in Lüttich im Umkreis von Notker gerade die Reimprosa fast durchgängig in allen Werken verwendet würde. Darüber hinaus versucht Gaşpar, die zahlreichen patristischen Zitate, beispielsweise aus Johannes Cassianus, als Argumente für eine Autorschaft des Johannes Canaparius ins Feld zu führen, würden sie doch den monastischen Hintergrund des Autors unterstreichen.39 Eine bemerkenswerte Passage, für die Cristian Gaşpar interessante Überlegungen anstellt, findet sich in Kapitel 8. Es geht um den Einzug Adalberts als frisch von Erzbischof Wiligis von Mainz am 29. Juni 983 geweihter Bischof von Prag. Es heißt dort in der Übersetzung von Lorenz Weinrich:
35 36 37 38 39
S. Adalberti vita prior (wie Anm. 2), S. X–XIII und das Stemma S. XIX; Karwasińska, Studia (wie Anm. 22). Gaşpar, Life (wie Anm. 34), S. 175, Anm. 4. S. Adalberti vita prior (wie Anm. 2), S. 44. Gaşpar, Life (wie Anm. 34), S. 89 und 158, Anm. 2. Ebd., S. 91.
60
Daniel Ziemann „Geweiht wurde er am Festtag Peter und Paul, der Freunde unseres Herrn Jesus Christus; mit großem Gefolge ritt er danach in seine geliebte Heimat. Das Pferd aber, auf dessen Rücken er saß, lief nicht nach Art der schnaubenden Rosse und nicht im Galopp, die Zügel glänzten nicht von Gold und Silber, sondern es war nach Art der Bauern mit einem Hanfseil gezäumt und trabte ganz nach dem Wunsch des Reiters.“40 Consecratus ille festo amicorum Domini nostri Jesu Christi, Petri et Pauli, multo comitatu equitat in dulcem patriam. Equus autem, cuius tergo insederat, non more frementium equorum nec properis [Varianten: pro properis] cursibus gradiebatur, neque auro et argento portat fulgentia frena, sed in rusticum morem torta canape ora strictus, incessit ad arbitrium sedentis.41 (Hervorhebungen durch Fettdruck kennzeichnen die Übereinstimmungen mit Ruricius von Limoges.)
Diese seltsame Stelle, deren Sinn sich modernen Lesern nicht auf den ersten Blick zu entschlüsseln vermag, scheint nach Gaşpar eine Allegorie für die Beherrschung der Begierden und der Demut darzustellen. Sie ähnle dabei sehr deutlich den Briefen des Ruricius von Limoges, in denen ein ähnliches Bild vorkommt. Tatsächlich sind die Ähnlichkeiten augenfällig, weniger in einer wörtlichen Textübernahme als im Motiv der Beherrschung des Pferdes als Allegorie: His itaque sufficienter, ut potuimus, indicatis salutatione animi desiderantis inpensa, si dignum ducitis, transmisi uobis caballum, qualem uobis sciebam esse necessarium, mansuetudine placidum, membris ualidum, firmum robore, forma praestantem, factura conpositum, animis temperatum, scilicet nec tarditate pigrum nec uelocitate praeproperum, cui frenus et stimulus sit sedentis arbitrium, cui ad euehendum onus et uelle suppetat pariter et posse, ita ut nec cedat superposito nec deponat inpositum.42 (Hervorhebungen durch Fettdruck kennzeichnen die Übereinstimmungen mit S. Adalberti vita prior.)
Falls dieser Zusammenhang besteht und der Autor der Adalbertsvita sich von den Briefen des Ruricius von Limoges hat inspirieren lassen, so ist jedoch darauf hinzuweisen, dass die Briefsammlung nur in einer einzigen Handschrift, dem wohl im 9. Jahrhundert entstandenen Codex Sangallensis 190, überliefert ist, der aus dem süddeutschen Raum stammen soll und spätestens ab dem 15. Jahrhundert in der St. Galler Stiftsbibliothek nachweisbar ist. Sollte dieser Kodex dem Autor der „Vita Adalberti“ bekannt gewesen sein, so wäre dies zumindest nicht unbedingt als Argument für Johannes Canaparius und Rom zu werten. Der Gedanke an Notker von Lüttich, der ja einst Abt von St. Gallen war, drängt sich zunächst auf. Jedoch lässt sich nicht nachweisen, ab wann genau der Kodex sich in St. Gallen befunden hat. Damit lassen sich aus diesem Zusammenhang keine weiteren Schlüsse ziehen. Wie sind die Argumente Karwasińskas und Gaşpars zu bewerten? Können sie Frieds Positionen überzeugend entkräften? Zunächst ist anzumerken, dass die vorgebrachten Argumente einerseits gegen die Identifizierung des Autors mit Notker von Lüttich und gegen eine stärkere Gewichtung der Handschriften aus dem RheinMaas-Raum gerichtet sind, andererseits für eine Herkunft aus Rom plädieren. Wäh40 41 42
Heiligenleben (wie Anm. 25), S. 37. S. Adalberti vita prior (wie Anm. 2), S. 13. Ruricius Lemouicensis, Epistularum libri duo, Cl. 0985, hg. von Roland Demeulenaere, Corpus Christianorum, Series Latina 64, Turnhout 1985, S. 313–394, hier lib. 2, ep. 35, c. 14, S. 367, Z. 18 ff.
Verzerrte Erinnerungen
61
rend Letzteres sich schwieriger gestaltet, ist Ersterem schon eher zuzustimmen. Tatsächlich bleiben etwaige Hinweise auf eine lothringische Herkunft wage. Auch die Edition der Aachener Handschrift, einem vermeintlich der Ursprungshandschrift nahe stehenden Textzeugen durch Jürgen Hoffmann, vermochte diesen Ansatz nicht zu unterstützen.43 Die Einordnung der Aachener Handschrift in die lothringische Handschriftengruppe scheint unbestritten. Sie weist jedoch bereits so viele Lücken und Veränderungen auf, dass sie als Ursprungsversion ausscheidet. Gleichermaßen ist jedoch auch eine Herkunft der Vita aus Rom oder eine Autorschaft des Johannes Canaparius nicht zweifelsfrei nachgewiesen. Die Edition Hoffmanns trägt interessante Hinweise für eine Neugruppierung der Handschriften zusammen. Hoffmann versuchte zu zeigen, dass die ‚aventinische‘ B-Version, die meist durch italienische Handschriften repräsentierte Klasse VI nach Karwasińska, in der ihrer Meinung nach eine ursprüngliche Version durchscheine, auf Handschriften der nordalpinen Klassen II–IV beruhe.44 Dies klingt insoweit überzeugend, als damit das etwas weit hergeholte Entstehungsmodell der ansonsten akribisch und äußerst sorgfältig vorgehenden Editorin in Frage gestellt wird. Jedoch lassen sich daraus noch keine Erkenntnisse für die Datierung der verschiedenen Klassen oder für das Entstehungsumfeld und die Autorschaft des Archetypus gewinnen.45 V. VORSCHLÄGE ZUR AUTORSCHAFT Die Frage nach der Autorschaft der Vita ist bekanntlich, wie bei einem solch berühmten Werk der Zeit um die erste Jahrtausendwende auch nicht anders zu erwarten, bereits Gegenstand intensiver Forschungsdiskussionen gewesen, wobei beide Viten eine entsprechende Berücksichtigung erfuhren.46 Schon H. G. Voigt konnte im Jahre 1904 eine Fülle von Theorien und Vorschlägen zur Autorschaft aus der Forschungsgeschichte zusammentragen, denen er seine eigene Theorie gegenüberstellte.47 43 44 45
46
47
Hoffmann, Vita Adalberti (wie Anm. 23), zusammenfassend auf S. 120 f. Ebd., S. 105–117. Hoffmann führt ebd., S. 108, in Anlehnung an Fried, Gnesen (wie Anm. 1), S. 261, eine Stelle aus Kap. 29 an, bei der hinsichtlich einer Vision des Johannes Canaparius in den Handschriftengruppen II–V das auf diesen bezogene ut adhuc hodie memimit (S. Adalberti vita prior [wie Anm. 2], S. 44), also die Bemerkung, dass er sich bis heute daran erinnern könne, auftaucht. Die italienische Handschriftengruppe VI ersetzt dies durch das auf den hl. Adalbert bezogene martirum numero annotatus (S. Adalberti vita prior [wie Anm. 2], S. 65). Ob daraus aber geschlossen werden kann, dass die Vorlage dieser Gruppe auf die Zeit nach dem Tod des Johannes Canaparius 1004 zu datieren ist, ist keineswegs sicher. Einen Überblick über die deutschsprachige Forschung zum hl. Adalbert insgesamt bietet Peter Hilsch, Der heilige Adalbert in der neueren deutschen Historiographie, in: Johannes Hofmann (Hg.), Tausend Jahre Benediktiner in den Klöstern Břevnov, Braunau und Rohr (Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktinerordens und seiner Zweige. Ergänzungsband 33) St. Ottilien 1993, S. 147–156. Heinrich Gisbert Voigt, Der Verfasser der römischen Vita des heiligen Adalbert. Eine Untersuchung mit Anmerkungen über die anderen ältesten Schriften über Adalbert, sowie einige strittige Punkte seiner Geschichte, Prag 1904.
62
Daniel Ziemann
Zunächst lässt sich wohl eine Autorschaft aus dem Prager Umfeld ausschließen. In Kapitel 12 geht es um Adalberts Zeit als Bischof in Prag und die dortigen Schwierigkeiten, die ihn schließlich dazu veranlassten, nach Rom zu gehen. Der Autor der älteren Vita spricht von denjenigen, die den Ablauf der Geschehnisse aus Adalberts Mund erfahren und die Gründe genannt hätten, warum er sein Amt aufgegeben habe.48 Der Autor gehört also nicht zu ihnen, sondern hat die Prager Ereignisse von anderen erfahren, die mit Adalbert einst selbst gesprochen hatten. Die erwähnten Gründe beziehen sich auf Adalberts Entschluss, seinen Prager Bischofsstuhl zu verlassen. Damit reduziert sich die Suche wohl auf ein persönliches, römisch-aventinisches oder dem kaiserlichen Hof zuzuordnendes Umfeld. Voigt, der sich für Gerbert von Aurillac, den späteren Papst Silvester II., entscheidet, führt in seiner Argumentation vor allem stilistische Gründe an.49 Für ihn war neben Gerbert von Aurillac und Johannes Canaparius auch Abt Leo von SS. Bonifacio e Alessio ein potenzieller Kandidat.50 Die Idee, Gerbert von Aurillac beziehungsweise Papst Silvester II. als Autor anzunehmen, beruht vor allem auf dem Hinweis in einer Handschrift der Gruppe aus Montecassino, die bei Karwasińska zur Gruppe C gehört. Dort heißt es: Passio Sancti Adalberti episcopi et martyris edita a domno Silvestro papa urbis Rome.51 Diese Möglichkeit hat sich indes in der Forschung nicht durchgesetzt. Das bildungsskeptische, monastische Milieu des Autors der ersten Vita lässt sich nur sehr schwer mit Silvester II. vereinbaren. In der Forschung wurde auch die Möglichkeit, ob der für die Abfassung der zweiten Vita verantwortliche Brun von Querfurt oder Adalberts Bruder Gaudentius als Autoren der ersten Vita in Frage kämen, diskutiert und weitgehend zurückgewiesen.52 Wie schon erwähnt, sind die Begebenheiten in Prag dem Autor nur aus zweiter Hand bekannt, das schließt Gaudentius als Autor aus. V.1. Abt Leo von SS. Bonifacio e Alessio Schon Voigt hatte Abt Leo als möglichen Autor ins Spiel gebracht. Brun von Querfurt nennt ihn in seiner Adalbertsvita als Berichterstatter. Adalbert habe Leo seinen Schrecken über die Worte Dietmars, des sterbenden Bischofs von Prag, übermittelt. Von ihm hat dann wohl auch Brun die Nachricht darüber erhalten.53 Es wäre nun 48 49 50 51 52
53
S. Adalberti vita prior (wie Anm. 2), c. 12, S. 18, Z. 4–5: Quod maxime de tribus causis actum esse dicunt, qui huius rei ordinem ipso narrante compierunt. Voigt, Verfasser (wie Anm. 47), S. 25–42. Ebd., S. 14. S. Adalberti vita prior (wie Anm. 2), S. 71. Augustin Kolberg, Das Lobgedicht auf den heiligen Adalbert, in: Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde des Ermlands 7, 1879/1881, S. 79–112, 373–598, hier S. 577; zusammenfassend zu den gegen eine Autorschaft des Gaudentius sprechenden Argumenten bereits Voigt, Verfasser (wie Anm. 47), S. 7–13. Św. Wojciecha biskupa i męczennika żywot drugi napisany przez Brunona z Kwerfurtu / S. Adalberti Pragensis episcopi et martyris Vita altera auctore Brunone Querfurtensi, hg. von Jadwiga Karwasińska (Pomniki Dziejowe Polski, Seria II 4, 2 / Monumenta Poloniae Historica,
Verzerrte Erinnerungen
63
genau dieser Bericht Adalberts an Abt Leo, der in der ersten Vita in Kapitel 6 geschildert wird, wo ausführlich in wörtlicher Rede die Beichte des scheidenden Bischofs Dietmar, dessen Name ungenannt bleibt, wiedergegeben wird.54 War dieser Bericht etwa Teil einer von Leo verfassten Vita? In Kapitel 14 der Vita Bruns bezieht sich dieser auf einen wohl mündlichen Bericht Abt Leos an ihn und andere Klosterbrüder. Abt Leo erörterte mit ihnen dabei die Heilige Schrift betreffende Fragen, die Adalbert an ihn gerichtet habe.55 Einen schriftlichen Bericht erwähnt Brun in Kapitel 8. Es handelte sich um eine schriftliche Darstellung Willicos über eine Geisteraustreibung Adalberts am Tag der Bischofswahl zum Bischof von Prag, die Willico dem Abt Leo ausgehändigt hatte. Dieser hatte sie Brun zu lesen gegeben.56 In Kapitel 15 der ersten Vita ist von einem Brief des berühmten Eremiten und Basilianers Nilus an Abt Leo die Rede, in dem die Aufnahme Adalberts empfohlen wird. Der Brief wird wörtlich zitiert und erwähnt dabei für den Fall der Nichtaufnahme Adalberts die Weiterempfehlung an den Abt von San Saba, was für den Handlungsverlauf unerheblich ist und daher wohl eine authentische Information darstellt.57 Neben dem Abt hatte also der Autor der Vita – sofern beide nicht identisch sind – Zugang zu diesem Schreiben, sofern kein mündlicher Bericht Adalberts vorliegt.58 In Kapitel 17 der älteren Vita ist von Beichten Adalberts die Rede, also ebenfalls einer Information, die neben dem Heiligen selbst vor allem dem Abt zugänglich war.59
54 55
56
57
58 59
N. S. 4, 2) Warschau 1969, c. 7, S. 7, Z. 3–5: Quem, ut ipse post abbati in monasterio dixit, visionis illius magnus horror invasit et ad primam salutem direxit; Voigt, Verfasser (wie Anm. 47), S. 14–19; auch in der älteren Vita wird eine Person genannt, der Adalbert die Geschehnisse seiner Anfangszeit als Bischof von Prag berichtet, jedoch ist nicht klar, wer dies war: S. Adalberti vita prior (wie Anm. 2), c. 12, S. 18, Z. 4–5; Friedrich Lotter, Das Bild des hl. Adalbert in der römischen und der sächsischen Vita, in: Hans Hermann Henrix (Hg.), Adalbert von Prag. Brückenbauer zwischen dem Osten und Westen Europas (Schriften der Adalbert-Stiftung Krefeld 4) Baden-Baden 1997, S. 77–107, hier S. 85. S. Adalberti vita prior (wie Anm. 2), c. 6, S. 9, Z. 13–10, Z. 15. Brun von Querfurt, S. Adalberti Vita altera (wie Anm. 53), c. 14, S. 16, Z. 18–20: Acutissime autem interrogavit de Scripturis sanctis, sedulo percunctatus de certantibus viciorum vel virtutum naturis; sed ad hęc quod ante nescivit, quęrenti illi recte abbas respondit, ut ipse non semel ad nos dixit; Voigt, Verfasser (wie Anm. 47), S. 18. Brun von Querfurt, S. Adalberti Vita altera (wie Anm. 53), c. 8, S. 7, Z. 19–21: Cui rei homo qui hora illa presens erat, Willico quidam, bonus clericus et sapiens, visibile testimonium asserebat; quod nos et legimus, cum ad abbatem nostrum hoc scripto filius mandaverat; Voigt, Verfasser (wie Anm. 47), S. 18. S. Adalberti vita prior (wie Anm. 2), c. 15, S. 23, Z. 5–9: Quo cum angelo bono te ducente perveneris, domnum abbatem Leonem nobis amicissimum ex nostra omniumque persona salutes, atque epistolam nostram feras in hęc verba: aut te apud se, quod plus volo, retineat, aut si ei difficile apparet, ad abbatem sancti Sabe mea vice commendet. Voigt, Verfasser (wie Anm. 47), S. 17. S. Adalberti vita prior (wie Anm. 2), c. 17, S. 25, Z. 2–5: Ipse vero omni obędientia ac humilitate ambulans inter fratres, contra bella temptantium viciorum intrepidus tyro accingitur. In cogitationibus suis ad humilem confessionem semper confugiens, quassate mentis archana spiritalibus viris pandere non cessavit; Voigt, Verfasser (wie Anm. 47), S. 17.
64
Daniel Ziemann
Brun berichtet vom Abt, dass er Adalbert öfters getadelt habe.60 Auch dies scheint der Abt Brun erzählt zu haben. Gegen Abt Leo spricht jedoch vor allem ein ihm eindeutig zuzuschreibender Brief an die Könige Hugo und Robert, dessen Stil nicht zur älteren Vita passen mag.61 Jedoch müsste man auch auf den völlig anderen Charakter des Briefes hinweisen, dem es um die Untermauerung der rechtlichen Position des Papsttums geht und der daher nicht nur zahlreiche Rechtsquellen zitiert, sondern auch stilistisch ganz anderen Anforderungen gerecht zu werden sucht. V.2. Johannes Canaparius Natürlich ist Johannes Canaparius, der von großen Teilen der Forschung als Autor der ersten Vita angesprochen wird, ein heißer Kandidat. Dabei sind die Hinweise nicht sehr zahlreich. Er wird namentlich in der ersten Vita als Visionär genannt, und zwar im 29. Kapitel. Es ist die Schlüsselstelle, aber zugleich auch die einzige, die eine Zuweisung der Vita an ihn möglich erscheinen lässt. Daher sei hier die betreffende Passage noch einmal genannt. In der nordalpinen Version lautet die Stelle in Kapitel 29 folgendermaßen: Haec dum in illa parte geruntur, ecce in monasterio, ubi ille talis nutritus fuerat, cuidam converso Iohanni Canapario talia Dominus per visum ostendit. E summo cęlo velut volantia deorsum veniunt usque ad terram duo linteamina, alba sicut nix et munda absque omni sorde et macula. Ambo sua onera, singulos quidem viros, de terra levant; ambo felicissimo cursu nubes et aurea sydera transnatant. Unius nomen extra ipsum, qui hoc vidit, admodum paucissimi sciunt; (alter vero erat, ut adhuc hodie ispe meminit, domnus Adalbertus, cui angelicus minister iam celestis mense convivia preparavit) [die eingeklammerte Passage fehlt in fünf Hss.]. At pater Nilus ignotum est, quid de eo videret.62
In den italienischen Versionen liest man hingegen Folgendes (die größere Schrift signalisiert die Unterschiede): Haec dum in diversa parte geruntur, ecce in monasterio, ubi ille talis nutritus fuerat, converso cuidam Iohanni Canapario talia Dominus per visum ostendit. E summo celo velut volantia deorsum veniunt usque ad terram duo linteamina alba sicut nix et munda absque omni sorde et macula. Ambo sua honera, singulos quidem viros, de terra levant; ambo felicissimo cursu nubes et aurea sidera transnant. Unius nomen extra ipsum onicrotem admodum pauci sciunt; Alter erat martirum numero annotatus domnus Adhelbertus, cui an-
60
61
62
Brun von Querfurt, S. Adalberti Vita altera (wie Anm. 53), c. 14, S. 17, Z. 5–8: Et cum abbas vehementissime eum increparet, occurrit benigna patientia et semper flexa humiliatio. Erat lętus ad omne iniunctum opus, non solum maioribus sed etiam minoribus obędire paratus, quę est prima via virtutis ad summa tendentibus cęlicolis viris. Concilia Aevi Saxonici. DCCCCXVI-MI. Die Konzilien Deutschlands und Reichsitaliens 916–1001, hg. von Ernst Dieter Hehl/Horst Fuhrmann (MGH Conc. 6, 1–2) Hannover 1987– 2007, S. 485–494; Helmut Zimmermann, Abt Leo an König Hugo Capet. Ein Beitrag zur Kirchengeschichte des 10. Jahrhunderts, in: Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft 12, 1966, S. 327–343; Pierre Riché, Gerbert dʼAurillac. Le pape de lʼan mil, Paris 1987, S. 159 ff. S. Adalberti vita prior (wie Anm. 2), S. 43 f., Z. 7–44, Z. 5.
Verzerrte Erinnerungen
65
gelicus minister cęlestis mensę preparavit convivia. At pater Nylus ignotum est, quid de eo viderit.63
Die deutsche Übersetzung bei Lorenz Weinrich folgt interessanterweise nur einer Gruppe innerhalb der transalpinen Handschriften: „Während dies in jener Gegend vor sich ging, seht!, zeigte der Herr in dem Kloster, wo jener sich aufgehalten hatte, einem Konversen Johannes Canaparius folgendes in einer Schau: Vom höchsten Himmel kamen zwei Leinengewänder wie Segel auf die Erde herab, weiß wie Schnee und sauber, ohne Flecken und Makel. Beide heben ihre Lasten, nämlich je einen Mann, von der Erde auf; beide steigen in glücklichem Flug zu den Wolken und goldenen Sternen auf. Der Name des einen war außer dem, der dieses sah, nur wenigen bekannt. Aber es ist unbekannt, was Vater Nilus über ihn sah, doch in süßen Schriften spricht er diesen Mann an: ‚Wisse, mein süßer Sohn, dass unser Freund Adalbert mit dem heiligen Geist wandelt und bald dieses Leben in einem seligen Ende beschließen wird.‘“64
Die Stelle scheint in der Übersetzung nur schwer verständlich, denn es ist diejenige einiger Handschriften der A-Redaktion. Es handelt sich dabei um die Leithandschrift von Pertz und Karwasińska, Lamspringe (Ls), eine weitere Handschrift aus dem Sankt Laurentius-Kloster in Lüttich (Ll), zwei Handschriften des Klosters Rooklooster/Rouge-Cloître (Rv1 und Rv2), die heute jeweils in Brüssel und Wien verwahrt werden, schließlich auch um die Passionalhandschrift G9 aus Aachen (Aq).65 Klarer zeigen sich hierbei alle anderen Handschriften der nordalpinen Redaktionen. Sie fügen nach dem Satz „Der Name des einen war außer demjenigen, der dies sah, bis jetzt den allerwenigsten bekannt“ (Unius nomen extra ipsum, qui hoc vidit admodum paucissimi sciunt) Folgendes hinzu: „Der andere aber war, wie bis heute derselbe sich erinnert, der Herr Adalbert, dem der Engelsdiener bereits die Speisen der himmlischen Tafel bereitete.“ Die ‚aventinische‘ B-Redaktion ersetzt „außer dem, der dieses sah“ durch den gräzisierenden Ausdruck onicrotem, sodass der Satz dort „der Name des einen ist außer dem onicrotes bis jetzt nur wenigen bekannt“ lautet. Es folgt, ähnlich der zweiten Gruppe der nordalpinen Handschriften, der Satz: „Der andere war der unter die Zahl der Märtyrer aufgenommene, Herr Adelbert, dem der Engelsdiener bereits die Speisen der himmlischen Tafel bereitete.“66 Während also ein Teil der ältesten Handschriften aus dem lothringischen Raum weder den einen noch den anderen nennen, enthüllen die anderen nordalpinen Handschriften und die italienische B-Redaktion zumindest einen der beiden Namen, Adalbert. Zudem verwenden die Handschriften der B-Redaktion das Wort onicrotem, worin wohl das griechische Wort ὀνειροκρίτης, der Traumdeuter, zu erkennen ist. Sind diese beiden Besonderheiten aber, der ὀνειροκρίτης und die Namensnennung, ein Hinweis darauf, dass sie schon in der vermeintlichen Urredaktion, 63 64 65 66
Ebd., S. 65, Z. 27–34. Heiligenleben (wie Anm. 25), S. 65 und 67. Hoffmann, Vita Adalberti (wie Anm. 23), S. 157. S. Adalberti vita prior (wie Anm. 2), c. 29, S. 65, Z. 32: Alter erat martirum numero annotatus domnus Adhelbertus; onicrotem findet sich in Z. 31.
66
Daniel Ziemann
also der von Karwasińska als Aventinensus I bezeichneten Redaktion, vorhanden waren?67 Johannes Fried bestreitet dies und hält ὀνειροκρίτης keinesfalls für einen Beweis für eine solche Ur-B-Version.68 Da auch die übrigen Hinweise für eine UrB-Version nicht sehr zahlreich sind, lässt sich aus dem Wort in der Tat wohl kaum eine solche Schlussfolgerung ziehen. Welche Erkenntnisse lassen sich indessen hinsichtlich der Autorschaft gewinnen? Ist besagte Stelle ein Hinweis auf die Verfasserschaft des Johannes Canaparius? Der Autor der Vita selbst hat eine durchaus differenzierte Einstellung zu Visionen. Im 20. Kapitel bemerkt er ausdrücklich, dass Adalbert aus Bescheidenheit eigene Visionen so erzählt, als seien sie Dritten widerfahren. Sollte ein solcher Autor sich selbst als ὀνειροκρίτης bezeichnen?69 Die Stelle ist nicht unbedingt eine, aus der die Autorschaft eines Johannes Canaparius zwingend folgt. Das hatte auch schon Voigt so gesehen. So bemerkte er: „Von einem in der zitierten Stelle liegenden stringenten Beweis kann schlechterdings nicht die Rede sein. Vielmehr muss, wer diese Stelle Canaparius selbst zuschreibt, annehmen, dass derselbe selbst gegen das Verhalten verstossen habe, welches er bei Adalbert besonders anerkannte.“70 Auch die Bemerkung ut adhuc hodie ipse meminit bietet für Voigt keinen Hinweis auf eine Autorschaft des Mönches, da Gleiches in Kapitel 15 von Abt Nilus gesagt wird.71 Fried weist darauf hin, dass in der italienischen Handschriftengruppe, also der B-Redaktion, genau diese Passage verändert wurde.72 Während die Handschriften der A-Redaktion die persönliche Erinnerung des Johannes erwähnen („Der andere aber war, wie bis heute derselbe sich erinnert, der Herr Adalbert“), fällt dieses Detail in der B-Redaktion weg („Der andere war der unter die Zahl der Märtyrer aufgenommene, allerheiligste Adelbert“).73 Für Fried bietet dieser Umstand einen Hinweis darauf, dass die BRedaktion nach dem Tod des Johannes entstanden sein muss.74 Bei einer Autorschaft des Johannes Canaparius wäre, so muss man unter Betrachtung des 29. Kapitels im Gesamtzusammenhang feststellen, die gesamte Vita etwas, woran sich Johannes Canaparius bis heute erinnert. Warum müsste dieser Autor bei einer Vision von sich in der dritten Person behaupten, er könne sich daran bis heute erinnern? Dies macht eigentlich nur dann einen Sinn, wenn der gesamte Rest der Vita eben nicht seiner Erinnerung entspringt, sondern auf anderen, wohl schriftlich vorliegenden Quellen beruht. Brun von Querfurt, der erste nachweisbare Leser der Vita, dem eine Version wohl vor 1004 vorlag, wartet zu diesem Thema mit interessanten Äußerungen auf. Zunächst einmal erzählt er die Vision des Johannes, der zu seiner Zeit bereits Abt 67 68 69 70 71 72 73 74
Ebd., S. XXVI. Fried, Gnesen (wie Anm. 1), S. 248 f. S. Adalberti vita prior (wie Anm. 2), S. 31 f. So schon Voigt, Verfasser (wie Anm. 47), S. 16. Ebd., S. 16; S. Adalberti vita prior (wie Anm. 2), S. 22, Z. 13. Fried, Gnesen (wie Anm. 1), S. 261. S. Adalberti vita prior (wie Anm. 2), S. 44 und 65. Fried, Gnesen (wie Anm. 1), S. 261, siehe auch Anm. 45.
Verzerrte Erinnerungen
67
geworden war, nach. In der ersten längeren Version Bruns gestaltet sich die Stelle folgendermaßen: Romę interea monasterio quo sanctus iste philosophia Benedicti patris nutritus erat, divina revelatio hęc dicta dedit: Inter plures visiones quas videt rapta mente sepe levatus, vidit et ita crucifixus mundo Iohannes monachus et abbas. Venerunt a cęlo usque ad terram descensu delectabili, aspectu pulchro duo linteamina ut nix candida, absque ruga et macula. Unum ex eis accępit quem quęrere venit, possedit carum pignus et dulce onus, fruens fruitur suo Adelberto, intrat cęlum aureum tramite recto. Quem aliud linteum suo amplexu acciperet et ad Deum portaret, ab eius ore, fateor, numquam excutere potuimus et ideo sive hic, sive alter sit, certa mente nescimus. Nec hoc nos fatigat; qui nostrum intercessorem in manibus habemus, Adelbertum, Domine, tuum, sancta sanctorum intrasse cognovimus et amantes veneramur.75
Während Brun in der ersten Vita grob der Version der älteren Viten folgt und sich unschlüssig über die Identifikation der ersten Person zeigt, ergänzt er in der zweiten, dass er glaube, die erste Gestalt sei der Visionär selbst. Die Änderungen im Text sind nach dem Vorbild der Edition Karwasińskas größer wiedergegeben. Rome interea monasterio quo sanctus iste philosophia Benedicti patris nutritus erat, revelatio divina hec dicta dedit: Inter plures visiones quas videt rapta mente sepe levatus, vidit et ita crucifixus mundo Iohannes monachus et abba. Venerunt a celo usque ad terram descensu delectabili, aspectu pulchro, duo linteamina ut nix candida, absque ruga et macula. Unum ex eis accepit quem querere venit, possedit carum pignus et accepit linteum dulce onus, fruens fruitur suo Adelberto, intrat aureum celum tramite recto. Quem aliud linteum suo amplexu acciperet et ad Deum portaret, ab eius ore, fateor, numquam excutare potuimus et ideo ipsum pro secreto amore celestis patrie alterum pondus esse cogitacione cogitamus. Sive autem hic, sive alter sit, certa mente nescimus. Nec hoc nos fatiget; qui nostrum intercessorum in manibus habemus, Adalbertum, Domine, tuum, sancta sanctorum intrasse cognovimus veneramur et amamus.76
Die deutsche Übersetzung folgt der späteren Version: „Inzwischen gab es in Rom in dem Kloster, in dem der Heilige mit der Weisheit Benedikts genährt worden war, folgende göttliche Offenbarung: Unter den vielen Visionen, die der Mönch und Abt Johannes sah, erblickte er oft, verzückt im Geiste und für die Welt gekreuzigt: Es kamen vom Himmel auf die Erde in lieblichem Flug, mit schönem Anblick zwei Leinentücher, weiß wie Schnee, ohne Flecken und Fehler. Einen nahm es, den zu suchen es gekommen war; es besaß ein teures Unterpfand und nahm das Linnen als süße Last, es brauchte es für Adalbert; der tritt auf geradem Pfad in den goldenen Himmel ein. Wen das andere Leinentuch umhüllte und zu Gott trug, konnten wir nie seinem Munde entreißen, und deshalb denken wir, dass er wegen der geheimen Liebe zur himmlischen Heimat die andere Bürde ist. Sei es, dass es dieser oder ein anderer war, wir wissen es nicht genau. Aber das stört uns nicht; die wir unseren Fürsprecher in Händen haben: Adalbert; wir wissen, Herr, dass er in dein Allerheiligstes eingetreten ist; wir verehren und lieben ihn.“77
Erinnerung wird hier interpretiert und verarbeitet. Brun behauptet also, er habe Johannes selbst nie entlocken können, wer denn die erste Person gewesen sei, legt damit also nahe, dass er nachgefragt hat. Dazu hatte er bekanntlich Gelegenheit, da 75 76 77
Brun von Querfurt, S. Adalberti Vita altera (wie Anm. 53), c. 27, S. 33, Z. 23–34, Z. 5. Ebd., c. 27, S. 64, Z. 27–65, Z. 5. Heiligenleben (wie Anm. 25), S. 109.
68
Daniel Ziemann
er selbst ab 998 in dem Kloster SS. Bonifacio e Alessio weilte. Brun spricht über Johannes Canaparius nicht wie über den Autor einer „Vita Adalberti“. Johannes Canaparius ist stattdessen derjenige, der durch seine Träume etwas sah. Viele Visionen habe er gehabt, wie Brun bemerkte, so war er vielleicht ein ὀνειροκρίτης, ein Traumdeuter, weniger jedoch der Autor einer Adalbertsvita. Ein weiteres Hindernis, die Vita Johannes Canaparius und dem Kloster SS. Bonifacio e Alessio zuzuschreiben, stellt der offensichtlich zwischen 1004 und 1012 im Kloster entstandene Text „Miracula Sancti Alexii“ dar, der unter anderem Informationen zu Johannes Canaparius liefert. Dort wird von Abbas Adalbertus im Zusammenhang der Gabe eines kostbaren Mantels durch Otto III. an das Kloster gesagt, dass er ihn achtlos weggegeben habe. „Abbas Adalbertus, über den viel zu sagen ich nicht für lohnend halte, schätzte, schamlos wie er war, dieses Geschenk gering und gab es an irgendwelche Leute als Pfand nicht zum Nutzen des Klosters, sondern aus seiner Leichtfertigkeit heraus. Er blieb bei ihnen, bis er, durch sein Verbrechen gefordert, verdientermaßen sein Leben aushauchte.“78 Es besteht kein Grund, aufgrund dieser Aussage im Verfasser der „Miracula“ einen Außenstehenden zu sehen. Die „Miracula“ präsentieren ansonsten die Sicht des Klosters und verfügen über entsprechende Informationen. Die meisten Informationen zu Johannes Canaparius entstammen diesen „Miracula“. Es besteht kein Grund, in dieser kritischen Sicht auf Adalbert keine im Kloster verbreitete Meinung zu sehen. Sollte eine solche Meinung sich aber in dieser Weise artikulieren, wenn der eigene Abt, Johannes Canaparius, als Autor einer „Vita Adalberti“ bekannt wäre? Zumindest spricht die betreffende Stelle nicht unbedingt für eine Verbindung von Kloster und Vita. VI. DIE ÄLTERE VITA UND BRUN VON QUERFURT. INHALTLICHE UNTERSCHIEDE In der Diskussion um den Verfasser der ersten Vita sollte die spätere Vita Bruns von Querfurt mit einbezogen werden, stellt sie doch wohl die früheste nachweisbare Verwendung der ersten Vita – in welcher Form auch immer sie vorgelegen haben dürfte – dar. Da Brun von Querfurt wohl im Jahre 1004 seine erste, längere Version der Lebensbeschreibung Adalberts abfasste und eine Form der älteren Vita offensichtlich benutzte, war er der erste nachweisbare Leser.79 Bevor Voigt seine Entscheidung für Gerbert von Aurillac als Autor der ersten Vita erläutert, geht er auf Aspekte ein, die für eine Autorschaft Abt Leos von SS. Bonifacio e Alessio oder Johannes’ Canaparius sprechen könnten. Dabei geht es um 78
79
Ex miraculis S. Alexii, hg. von Georg Heinrich Pertz, MGH SS 4, Hannover 1846, S. 619–620, hier S. 620, Z. 4–10: Cuius votum floccipendens Adelbertus abbas, de quo multa dicere dignum modo non arbitror, ut erat impudens, vestem ipsam, non causa utilitatis monasterii, set nequitia sua cogente, aliquibus dedit in pignore, apud quos mansit, quousque scelere suo petente, vita privari meruit. Brun von Querfurt, S. Adalberti Vita altera (wie Anm. 53), S. XVIII–XX.
Verzerrte Erinnerungen
69
das monastische Milieu. Er führt dabei Stellen an, die eindeutig auf ein solches hindeuten, wie etwa Kapitel 580 oder 25.81 Kapitel 25 der älteren Vita spricht von Fleury und sagt, es habe verdient, den seligen Leib „unseres Bekenners und Vaters Benedikt“ in seinem Schoß zu bergen.82 Kapitel 5 relativiert den Wert der weltlichen Kenntnisse, die dazu dienen, mit umso leichteren Schritt die Berge göttlicher Weisheit zu erklimmen beziehungsweise in einer noch schärferen Formulierung, er habe zunächst als junger Mann das Bittere der Welt trinken müssen, um dann als Mann die Lieblichkeit Gottes mit noch gierigerer Seele zu schöpfen.83 Die wohl um 1004 verfasste Vita Bruns von Querfurt präsentiert hingegen ein anderes Bild. Adalbert trägt hier den „süßen Nektar der Weisheit“.84 Die in Magdeburg erlernten Fähigkeiten lassen ihn „statt der dunklen Nacht“ „den Tag der Erkenntnis“ ergreifen.85 Der Wandel bei Adalbert von einem Menschen, der Späße, Speis und Trank liebte, zu einem, der auf das „erste Heil“ ausgerichtet war, erfolgte bei Brun später, beim Anblick des sterbenden Bischofs von Prag.86 Das an der Magdeburger Schule unter Ohtrik absolvierte Studium wird bei Brun als positive Erfahrung geschildert, als notwendige Voraussetzung für die spätere Lebensführung Adalberts, während die erste Vita dem Studium zurückhaltend gegenübersteht. Für den Autor der ersten Vita führt Adalbert bereits das Leben eines von Gott erwählten Menschen, des Studiums hätte er also nicht bedurft. Diesen Unterschied haben bereits Reinhard Wenskus und Friedrich Lotter herausgearbeitet, auf ihren Ergebnissen basieren die nun folgenden Abschnitte.87 Interessant für den hier im Mittelpunkt stehenden Zusammenhang sind die Aufschlüsse zur Autorschaft. Brun distanziert sich hier deutlich vom Geist der ihm vorliegenden Vita. Brun schrieb seine Vita, dies zeigen die von ihm vorgenomme80
81 82 83 84 85 86
87
S. Adalberti vita prior (wie Anm. 2), c. 5, S. 9, Z. 4–7: Quem dominus, credo, ad hoc humanae philosophiae studere voluit, ut post divinae sapientiae montes faciliore gressu scandere posset, aut pocius saeculi amara parvulus potare debuit, ut post vir factus dei dulcia avidiore animo hauriret. Ebd., c. 25, S. 37, Z. 11–12: confessoris nostri et patris Benedicti. Ebd.: Nec preteriit Floriacum, qui beatissimum corpus confessoris nostri et patris Benedicti suo gremio collocare meruit. Die Übersetzung nach: Heiligenleben (wie Anm. 25), S. 33. Brun von Querfurt, S. Adalberti Vita altera (wie Anm. 53), c. 6, S. 6, Z. 21: portans secum dulces sapientie liquores; Heiligenleben (wie Anm. 25), S. 75. Brun von Querfurt, S. Adalberti Vita altera (wie Anm. 53), c. 6, S. 6, Z. 18: contra ignorantię densam noctem pretendit scientię diem. Ebd., Z. 22–24: Hoc toto tempore adeo lascius erat ut homo, incubat terrenis deliciis, vacat puerilibus iocis, querens cibum et potum ut pecus incuruat vultum, nescit rectus cernere celum; c. 7, S. 7, Z. 3–5: Quem, ut ipse post abbati in monasterio dixit, visionis illius magnus horror invasit et ad primam salutem direxit. Fedor Schneider, Rom und Romgedanke im Mittelalter. Die geistigen Grundlagen der Renaissance, Köln 1959, S. 152 ff.; Reinhard Wenskus, Studien zur historisch-politischen Gedankenwelt Bruns von Querfurt (Mitteldeutsche Forschungen 5) Münster/Köln 1956, S. 7–68; Friedrich Lotter, Die Vita Brunonis des Ruotger. Ihre historiographische und ideengeschichtliche Stellung (Bonner Historische Forschungen 9) Bonn 1958, S. 70 f.; ders., Bild (wie Anm. 53), S. 83–86.
70
Daniel Ziemann
nen Akzentverschiebungen deutlich, in bewusster Abgrenzung zu der ihm vorliegenden Version. Er sah sich bemüßigt, korrigierend und verbessernd einzugreifen. Der Skepsis gegenüber des in Magdeburg Erlernten, die sicherlich einen monastischen Hintergrund des Autors der ersten Vita nahelegt, stellt Brun die Bildung als Voraussetzung für die Entwicklung Adalberts gegenüber. Ähnlich verfährt Brun auch mit dem etwas überraschend negativen Bild Magdeburgs in der ersten Vita als „halbverfallenes Haus“ (semiruta domus), dem er mit der Nennung des „edlen Magdeburg“ und dem heute noch zu sehenden „schönen Haus“ für den heiligen Mauritius einen Gegenentwurf zur Seite stellt. Dabei wird ganz bewusst das semiruta domus der ersten Vita zum pulcherrima domus, womit Brun den Magdeburger Dom bezeichnet.88 Zudem fühlt sich Brun bemüßigt, die Figur des sächsischen Gelehrten Ohtrik herauszustellen. Aus dem quidam philosophus der ersten Vita, unter dem sich die Zahl der Schüler und die Menge der Bücher erhöht habe, wird bei Brun der facundissimus, quasi Cicero unus, dessen Andenken bis heute in Sachsen hochgehalten werde.89 Sieht man die Vermehrung der Schüler und Bücher vor dem Hintergrund der zurückhaltenden Äußerungen zum in der ersten Vita geäußerten Wert der Studien in Magdeburg, so wird der Gegensatz in Bezug auf Ohtrik noch deutlicher. Aus einem in nutzlosen weltlichen Wissenschaften bewanderten philosophus wird bei Brun ein herausragender Gelehrter seiner Zeit. Hierbei wird auch die Position Bruns gegen die Auflösung des Bistums Merseburg eine Rolle spielen, die mit der Erhebung Giselhers, des Bischofs von Merseburg, zum Erzbischof von Magdeburg 981 vollzogen wurde. Dabei wurde der eigentlich vom Domkapitel gewünschte Ohtrik nicht berücksichtigt. Brun äußert sich später recht deutlich zu den Ereignissen und bezieht nachdrücklich gegen die Auflösung des Bistums Merseburg Stellung. Zugleich ist für ihn die Politik Ottos II. der Grund allen Übels.90
88
89
90
S. Adalberti vita prior (wie Anm. 2), c. 3, S. 6, Z. 4–7: civitas, grecę Parthenopolis vocatur; urbs quondam nota populis et una magna urbibus, dum primum Otto sceptra regalia rexit; nunc autem pro peccatis semiruta domus et male fida statio nautis. Brun von Querfurt, S. Adalberti Vita altera (wie Anm. 53), c. 4, S. 5, Z. 4–8: Traditur, inquam, ad ingenuam Parthenopolim, Theutonum novam metropolim, liberalibus disciplinis imbuendus. Quam urbem rex maximus, primus trium Ottonum, imperator augustus, in magnum archipresulatum erexit et, ut hodie cernere est, sancto Mauricio in fluminis Albis pulcro littore pulcherrimam domum prope construxit. S. Adalberti vita prior (wie Anm. 2), c. 3, S. 6, Z. 7–9: Ipso tempore erat magister scolarum Astricus quidam philosophus, sub quo turba iuvenum et librorum copia multa, nimis crescente studio, floruerunt. Karwasińska entschied sich für Astricus im Haupttext, weil ihre Leithandschrift Ls aus Lamspringe diese Form aufweist. Jedoch haben alle nordalpinen Kodizes Formen wie ohtricus, otricus, ottricus oder octricus und geben damit die wohl der ursprünglichen Version näherstehende Form wieder. Karwasińska sah in dem seltsamen Astricus eine Spur der von ihr angenommenen, aber verlorenen Urfassung Aventinensus I, siehe ebd., Anm. 18. Brun von Querfurt, S. Adalberti Vita altera (wie Anm. 53), c. 5, S. 5, Z. 19–6, Z. 2: Scolis preerat tunc Ohtricus quidam facundissimus, ętate illa quasi Cicero unus, cuius memoriale clarum usque nunc per omnem Saxoniam habetur. Ebd., c. 10, S. 8–10, c. 12, S. 13–15.
Verzerrte Erinnerungen
71
Hinsichtlich der Autorschaft wird deutlich, dass Brun nicht nur mit der Akzentuierung der ihm wahrscheinlich vorliegenden ersten Vita nicht einverstanden war, sondern auch mit dem von ihm festgestellten Informationsdefizit. So verweist Brun darauf, dass man nicht wisse, wann Adalbert vom damaligen Erzbischof von Magdeburg mit dem zweiten Chrisam gesalbt worden sei, die Mutter aber habe sich erinnert, dass dies geschehen sei, als Adalbert, gemeint ist der spätere Erzbischof Adalbert von Magdeburg (Erzbischof 968–981), als Bischof für die heidnischen Russen durch das Herrschaftsgebiet des Vaters gezogen sei.91 Die erste Vita lässt Adalbert stattdessen die Salbung in Magdeburg empfangen, was Brun offensichtlich als Fehlinformation beurteilt.92 Bewusst scheint Brun auch das jugendliche, mit weltlichen Freuden erfüllte Leben in Magdeburg, das Adalbert in der ersten Vita abgesprochen wird, zu betonen.93 Ähnliches geschieht mit dem positiven Bild Kaiser Ottos II. im 8. Kapitel der älteren Vita, dem Brun seine harsche Kritik an ebenjenem Kaiser entgegenstellt, die sich über zwei Kapitel hinzieht.94 Interessante Unterschiede lassen sich auch hinsichtlich der ersten Reise nach Rom feststellen. Die ältere Vita erwähnt die Zustimmung des Papstes (Johannes XV. 985–996), die von Adalbert unter den Armen verteilten Gaben der Kaiserin Theophanu vor der geplanten Pilgerreise nach Jerusalem, schließlich seinen Besuch des Klosters Montecassino, in das er zunächst einzutreten gedenkt, bis er durch die Bitte, als Bischof Kirchen zu weihen, sich veranlasst sieht, zum berühmten Nilus weiterzuziehen. Dieser überredet ihn, zurück nach Rom zu Abt Leo zu gehen, in dessen Kloster er nach eingehender Prüfung durch den Abt und nach Einholung der päpstlichen Erlaubnis eintritt.95 Auch hier distanziert sich Brun in seiner Version von einigen Aussagen der älteren Vita. Die päpstliche Zustimmung fehlt bei Brun in beiden von der älteren Vita genannten Fällen, das Kloster Montecassino erscheint bei ihm in keinem negativen Licht, während die Gaben Kaiserin Theophanus ihm erneut Gelegenheit geben, sich über Kaiser Otto II. und die Auflösung des Bistums Merseburg zu beklagen.96 In den folgenden Kapiteln bleibt der ungefähre Handlungsverlauf erhalten, jedoch setzt Brun weitere bewusste Akzentverschiebungen. Das Leben im Kloster bleibt in 91
92 93 94 95 96
Ebd., c. 4, S. 5, Z. 9–14: Urbis episcopus tunc Adalbertus, ipse et primus, qui quem suo nomine Adelbertum vocavit, bonę indolis puerum Wogitechum secundo crismate liniuit. Hec cum facta essent, non norunt; postea quando finito scolę duello domum redeunt, recordata est mater pueri, quia Pruzis episcopus gentium positus cum idem Adelbertus per regnum patris iter ageret, deducit filium cum ungendis pueris, ut tunc primo eum crismate episcopus liniret. S. Adalberti vita prior (wie Anm. 2), c. 3, S. 6, Z. 9–7, Z. 1: Ergo archiepiscopus ille puerum cum magna caritate suscipiens, dat sibi confimationem sacro sancti crismatis et suo nomine Adalbertum appellans, tradidit scolis. Brun von Querfurt, S. Adalberti Vita altera (wie Anm. 53), c. 6, S. 6; S. Adalberti vita prior (wie Anm. 2), c. 5, S. 8; Lotter, Bild (wie Anm. 53), S. 84. S. Adalberti vita prior (wie Anm. 2), c. 8, S. 12 f.; Brun von Querfurt, S. Adalberti Vita altera (wie Anm. 53), c. 9–10, S. 7–10; Wenskus, Studien (wie Anm. 87), S. 164–171; Lotter, Bild (wie Anm. 53), S. 88. S. Adalberti vita prior (wie Anm. 2), c. 13–17, S. 19–26. Brun von Querfurt, S. Adalberti Vita altera (wie Anm. 53), c. 12–14, S. 13–17; Wenskus, Studien (wie Anm. 87), S. 101–114; Lotter, Bild (wie Anm. 53), S. 93.
72
Daniel Ziemann
beiden Viten stereotyp. Die Rückkehr nach Prag wird in der älteren Vita von Erzbischof Willigis von Mainz und dem Bruder des Böhmenherzogs betrieben. Die Entscheidung fällt auf einer Synode mit einem salomonischen Urteil des Papstes. Bei Brun ruft hingegen das böhmische Volk seinen Hirten zurück. Der Papst sträubt sich, aber eine Synode fällt das Urteil: Papst und Abt befehlen Adalbert die Rückkehr. Der zweite Aufenthalt in Prag wird in groben Zügen ähnlich dargestellt, wobei Adalberts Entsendung von Boten nach Ungarn bei Brun eine interessante Zusatzinformation darstellt.97 Der zweite Aufenthalt im Kloster SS. Bonifacio e Alessio ist inhaltlich zwar ähnlich, aber doch mit einer ganz unterschiedlichen Färbung. Die ältere Vita erwähnt, wie zufrieden der Abt, der ihn zu seinem Stellvertreter ernennt, mit ihm ist, sie betont die Niedrigkeit und Ärmlichkeit. Sie nennt auch eine erste Vision, die Adalbert aus Bescheidenheit einem anderen zuschreibt und bei der ihm zwei himmlische Ränge, mit jeweils weißen und purpurnen Mänteln ausgestattet, erscheinen. Eine Stimme habe zu ihm gesagt, dass bei beiden Platz für ihn sei.98 Brun hingegen betont die Gespräche mit den Geistesgrößen, die aus Liebe zum Abt sich eingefunden hätten, Griechen und Lateiner. Adalbert sei zwischen den geistigen Anführern Basilius und Benedikt hin und her gegangen. Brun nennt Abt Johannes, also den vermeintlichen Autor der älteren Vita, der später Abt des Klosters SS. Bonifacio e Alessio wurde, beim Namen. Johannes habe ihm unter Tränen gesagt: „Wo sind meine Perlen? Wo sind die Speisen meines Geistes/meiner Seele (animae meae)?“ Die Übersetzung Weinrichs bevorzugt hier die Lesart amici mei, also die „Speisen meines Freundes“ zweier Handschriften der überarbeiteten Kurzversion der Vita. In der Langversion spricht Johannes aber nur von sich. Ihm fehlten also die erleuchteten Gedanken der heiligen Männer, die Brun nun – Johannes wiedergebend – nennt, „Abt Gregor, Vater Nilus, der gute kranke Johannes, der einfältige Stratus, ein Engel auf Erden, von den Großen Gottes in Rom der weise Johannes, der schweigsame Theodor, der unschuldige Johannes sowie der einfältige Leo, Freund der Psalmen und stets bereit zu predigen.“99 Bemerkenswert ist hier nur am 97 98 99
S. Adalberti vita prior (wie Anm. 2), c. 18–19, S. 26–30; Brun von Querfurt, S. Adalberti Vita altera (wie Anm. 53), c. 15–16, S. 17–19. S. Adalberti vita prior (wie Anm. 2), c. 20, S. 30–32. Brun von Querfurt, S. Adalberti Vita altera (wie Anm. 53), c. 17, S. 19, Z. 22–23, Z. 12: Usus vero sibi maximus erat colloquia quęrere spiritualium et seniorum, qui crebro illic pro caritate abbatis plures confluxerant. Greci, inquam, optimi veniunt, Latini similes militarunt. Superioribus quatuor pius Basilius, inferioribus quatuor magnus Benedictus dux sive rex erat. Inter quos medius incedens, Deum siciens Adelbertus verba vitę sumit et gluttit raptus in altum; cum fratribus dulcius contemplatur Deum. O quantotiens obortis lacrimis memini dicentem, cum causa ędificationis aggressus essem Iohannem abbatem: Ubi sunt, inquit, margaritę meę? ubi sunt dulces cibi animę meę? Cum convenerunt sancti viri, pluebant ibi sermones Dei, accensę sententię mutuo cursant, arsit ignis super terram cordis, testatur presentem Deum unda compunctionis. Hoc Gregorius abbas, hoc erat Nilus pater, hoc Iohannes bonus et infirmus, hoc simplex Stratus et super terram angelus unus, hoc ex Romę maioribus Dei sapiens Iohannes, hoc silens Theodorus, hoc Iohannes innocens, hoc simplex Leo, psalmorum amicus et semper predicare paratus; die Übersetzung ist entnommen aus: Heiligenleben (wie Anm. 25), S. 91 und 93.
Verzerrte Erinnerungen
73
Rande, dass damit neben Stratus vor allem ein Leo, der simplex, negativ konnotiert wird. Falls mit jenem der Klosterabt gemeint wäre, der von Voigt dereinst als Autor der Vita in Erwägung gezogen wurde, würden Bruns Kritik an dieser Vita und seine Probleme mit ihr eine neue Dimension erhalten. Doch das Bild Leos in den übrigen Kapiteln der Vita Bruns scheint dieser Vermutung eher zu widersprechen. Bruns Schwerpunkt ist aber auf jeden Fall ein ganz anderer. Ähnlich wie in der Beschreibung der Schulzeit in Madgeburg glaubte Brun, in dieser Passage korrigieren zu müssen. Sein Adalbert sollte kein simplex sein, wie die von ihm so bezeichneten Stratus und Leo. Bruns Adalbert ist gebildet, er ist gerne in dieser Gesellschaft und liebt die geistlichen Gespräche. Lassen sich aus diesen Beobachtungen Hinweise zur Autorschaft erkennen? Immerhin nennt Brun Johannes, er tritt als Bruns Informant auf, er ergänzt mündlich, was Brun in seiner Vorlage nicht zu finden vermag. Johannes ist Teil des illustren Kreises gebildeter Zeitgenossen. Zugleich beklagt derselbe Johannes das Fehlen der Gespräche, an denen er sich erfreut hat. Dies passt indes nur schwer zur bildungsskeptischen Haltung des Autors der älteren Vita. Die Passage ist jedenfalls kein Argument für seine Autorschaft. Brun lehnte die Tendenz der älteren Adalbertsvita ab und scheint sich daher bemüßigt gefühlt zu haben, eine Gegenvita zu schreiben, die das Bild Adalberts zurechtrückte. Es ist ein anderer Adalbert, den Brun zu beschreiben beabsichtigte. Brun glaubte also, den Kampf um die Deutungshoheit über Adalbert aufnehmen zu müssen. Aus seiner Vita wird deutlich, wogegen er sich inhaltlich wandte, jedoch bleibt die Frage, wer denn diese Brun so missfallende Lebensbeschreibung verfasste. Gegen wen bezog Brun Stellung? Immerhin, soviel scheint deutlich, lässt sich aus Bruns Äußerungen kein Hinweis ziehen, dass es Abt Johannes war, dessen Adalbertbild er zu verändern trachtete. Johannes scheint dafür zu sehr die Anliegen Bruns zu teilen, als dass er als Gegenbild in Frage käme. Die Frage nach einem Autor lässt sich daher wohl kaum klären, sie lässt sich durch den Vergleich mit der Vita Bruns eher schwerer beantworten als vorher. Vielleicht hilft indes ein genauerer Blick auf das Milieu und nähere Umfeld der älteren Vita. Lassen sich die grundsätzlichen Fragen lösen, wie beispielsweise die hinsichtlich eines römischen oder nordalpinen Ursprungs? Dabei stellt sich auch die Frage nach der Tragfähigkeit der Entstehungstheorie von Jadwiga Karwasińska, gegen die sich Johannes Fried wandte. Vielleicht hilft auch hier ein Blick auf Brun als dem ersten nachweisbaren Leser und Benutzer der Vita. Der folgende Abschnitt soll daher die bereits von Wenskus diskutierte Frage aufgreifen, welche Version Brun von Querfurt vorgelegen haben könnte.
74
Daniel Ziemann
VII. DIE ÄLTERE VITA UND BRUN VON QUERFURT. WELCHE VERSION BENUTZTE ER? Der Vergleich der beiden Viten scheint weitere Erkenntnisse zu versprechen. Auch hier hat Reinhard Wenskus Pionierarbeit geleistet und die wichtigsten Aspekte in akribischer Arbeit zusammengetragen.100 Die zahlreichen inhaltlichen Unterschiede und Akzentverschiebungen zwischen der ersten Vita und der Bruns von Querfurt, die von Reinhard Wenskus und Friedrich Lotter zusammengestellt wurden, zeigen deutlich, wie beide Autoren ihre Viten als literarische Werke zu gestalten suchten.101 Sie mahnen zugleich auch, die Viten unter literaturtheoretischen Gesichtspunkten zu lesen und in ihnen zunächst bewusst komponierte Werke zu sehen, deren historischer Gehalt nur im Gewand der literarischen Fiktion zu bewerten ist. Unbestritten ist aufgrund der immer noch zahlreichen wörtlichen Übernahmen, dass Brun die ältere Vita vorlag und er sie für die Abfassung seiner Version verwendete. Dabei spielt natürlich eine Rolle, welche Handschriftenredaktion Brun benutzt haben könnte. Karwasińska glaubte gemäß ihrer Theorie, dass es sich hierbei unter anderem um die von ihr als ‚aventinisch‘ bezeichnete Urfassung gehandelt haben könnte, die in der B-Redaktion durchscheine. Dies zeige sich beispielsweise an der irrtümlichen Nennung von Gnesen anstelle von Danzig in Kapitel 24 bei Brun als der Ort, an dem Adalbert seine letzte Reise zu den Preußen beginnt.102 Gnesen entspricht der durch die italienischen Handschriften repräsentierten Form der von Karwasińska als ‚aventinisch‘ bezeichneten Version B.103 Karwasińska ging davon aus, dass Brun mehrere der ursprünglichen Redaktionen bekannt waren, vor allem jedoch die ‚aventinische‘, wenn auch vielleicht in einer gekürzten Form.104 Es ist in der Tat erstaunlich, warum Brun Gnesen nicht durch Danzig ersetzte, da ihm der inhaltliche Fehler aufgefallen sein müsste. Jedoch ist die Verwechslung bei Brun eventuell auch anders erklärbar. Er spricht, anders als die erste Vita, nicht von dem Ort, wohin sich Adalbert begibt105, sondern von dem Ort, an dem er jetzt mit seinem heiligen Leibe ruhe und seine Wunder bewirke. Dies war zu Bruns Zeit in der Tat Gnesen.106 Jedoch verwundert es, dass Brun Danzig/Gydansk als Zielort Adalberts nicht nennt und dies auch nicht in seiner überarbeiteten Kurzversion nachholt.107 100 101 102 103 104 105
Wenskus, Studien (wie Anm. 87). Ebd., S. 7–68; Lotter, Vita (wie Anm. 87). Brun von Querfurt, S. Adalberti Vita altera (wie Anm. 53), c. 24, S. 29 mit Anm. 137. S. Adalberti vita prior (wie Anm. 2), c. 27, S. 64, Z. 24. Brun von Querfurt, S. Adalberti Vita altera (wie Anm. 53), S. XXXIV f. S. Adalberti vita prior (wie Anm. 2), Redactio Aventinensis Altera, c. 27, S. 64, Z. 24–25: Ipse vero adiit primo urbem Gnesdon, quam ducis latissima regna dirimentem, maris confinio tangunt. 106 Brun von Querfurt, S. Adalberti Vita altera (wie Anm. 53), c. 24, S. 29, Z. 23–24, Z. 2: Est in parte regni civitas magna Gnezne, ubi sacro corpori placuit quiescere, ubi mille miraculis fulgit, et si corde veniunt, recta petentibus salutes currunt. 107 Ebd., c. 24, S. 62.
Verzerrte Erinnerungen
75
Ansonsten scheint die handschriftliche Vorlage, die Brun benutzte, alles andere als eindeutig. Reinhard Wenskus hatte dereinst dargelegt, dass Brun eine italienische Version der älteren Vita benutzt habe, und die für ihn aussagekräftigen Stellen zusammengetragen.108 Er erwähnt die bei Brun im Gegensatz zur älteren Vita oft angewandte Veränderung des Tempus. Wenn er es nicht verändert habe, so sei er meist der italienischen Fassung gefolgt.109 Als weiteres Beispiel nennt er in Kapitel 30 einen Satz der Trostrede Adalberts an seine Begleiter bei der Gefangennahme.110 – Der Satz bringt zum Ausdruck, dass Adalbert seine Farbe geändert habe. Er lautet in der Vita Bruns: Nunc magnus Adelbertus timet […] moritura caro colorem mutat.111
Nur in der von Karwasińska „Redactio Aventinensis altera“ genannten B-Version, also der italienischen Handschriftengruppe, steht: Quis ille ignobilis color subito mutauit genas uestras?112
In der ‚ottonischen‘ Redaktion fehlt ein solcher Satz. Brun nennt auch im Gegensatz zur ‚ottonischen‘ Version den Namen des Vaters nicht.113 Diese nennt ihn Slawnik (Zlaunic)114, die ‚aventinische‘ Sclauonicus115 und Brun spricht lediglich von pater eius.116 Wenskus vermutete, dass auch Bruns Behauptung im 19. Kapitel, Adalbert sei mit Otto III. über die Alpen gezogen117, mit einer Lücke der italienischen Handschriften zu erklären sei.118 Die ‚ottonische‘ Version lässt Adalbert mit Notker von Lüttich nach Deutschland reisen und erst in Mainz mit Otto III. zusammenkommen119, während die italienischen Versionen dort eine Lücke aufweisen.120 Besonders deutlich wird der Zusammenhang laut Wenskus bei einem Vergleich mit der späteren kürzeren Version der Vita Bruns und der ersten längeren. Im folgenden Beispiel kennzeichnet die kleinere Schrift nach dem Vorbild der Edition Karwasińskas die wörtlichen Übereinstimmungen der italienischen mit der nordalpinen Redaktion und die zwischen den beiden Viten Bruns. Die breitere Skalierung kennzeichnet die Übereinstimmungen zwischen den älteren Adalbertsviten und den Adalbertsviten Bruns. Wenskus wies darauf hin, dass diese Stelle eine Verbindung des Wortlauts der älteren, längeren Adalbertsvita Bruns mit den italienischen Redaktionen nahelegt.121 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121
Wenskus, Studien (wie Anm. 87), S. 14–23. Ebd., S. 16, Anm. 57. Ebd., S. 16. Brun von Querfurt, S. Adalberti Vita altera (wie Anm. 53), c. 30, S. 36, Z. 2–4. S. Adalberti vita prior (wie Anm. 2), c. 30, S. 66, Z. 20. Wenskus, Studien (wie Anm. 87), S. 17. S. Adalberti vita prior (wie Anm. 2), c. 1, S. 4, Z. 1. Ebd., c. 1, S. 51, Z. 9. Brun von Querfurt, S. Adalberti Vita altera (wie Anm. 53), c. 1, S. 3, Z. 7. Ebd., c. 19, S. 24, Z. 6–7. Wenskus, Studien (wie Anm. 87), S. 17. S. Adalberti vita prior (wie Anm. 2), c. 22–23, S. 33–35. Ebd., c. 22–23, S. 81. Wenskus, Studien (wie Anm. 87), S. 18.
76
Daniel Ziemann
Die ältere Adalbertsvita nach den nordalpinen Redaktionen weist folgenden Wortlaut auf (Kapitel 26): sed declinavit ad prefatum ducem, quia sibi amicissimus erat et, s i s e recip ere vellen t, per eius missos explorare potuit.122
Die italienischen Redaktionen hingegen: statuit prius Palaniorum ducem Bolisclav u m adire e t , si se re c i p e re v e l l e n t , per eius missos diligenter inter rogare.123
In Bruns früheren, längeren Vita heißt es in Kapitel 23: Ergo quem suo labori adiutorem Deus preparavit, d u cem Po la n o r u m Bo liz la vu m rerum dubius petit; cuius auxilio nuntios suos miserat ad populum sibi commissum et multocies contradicentem, interrogans si eum recipere v e l l e n t.124
Die spätere, kürzere Vita hingegen bietet: Ergo quem suo labori adiutorem Deus preparavit, ducem Polonorum, Dei servorum matrem Boleslaum rerum dubius petit; cuius auxilio nuncios suos miserat ad insolentem uxorem, si vel stuprata amatoribus
multis priorem maritum accipere vellet.125
Wenskus weist jedoch auch auf jene Stellen hin, die auf eine Verwendung der ‚ottonischen‘ Redaktion hindeuten. Die Nennung des sächsischen Lehrers Ohtrik bei Brun, der in der italienischen Redaktion Clericus genannt wird, legt eine handschriftliche Vorlage der sogenannten nordalpinen Redaktionen nahe.126 Jedoch ist es auch möglich, dass Brun den Namen korrigiert hat, da ihm der in Sachsen einigermaßen bekannte Ohtrik geläufig gewesen sein muss. Johannes Fried trug weitere Hinweise zusammen, die im Gegensatz zu Wenskus gerade nicht auf eine Verwendung der italienischen Redaktionen hindeuten.127 So wird die Botschaft für Adalbert, die in Kapitel 24 der ersten Vita nur in der nordalpinen Redaktion überliefert wird, von Brun übernommen.128 In Kapitel 11 zitiert Brun in Bezug auf Adalberts Wirken in Prag fast wörtlich eine Stelle der älteren Vita zu Erzbischof Adalbert von Magdeburg (Kapitel 3), wobei, wie Lotter schon bemerkte, die nordal122 123 124 125 126
S. Adalberti vita prior (wie Anm. 2), c. 26, S. 38, Z. 16–39, Z. 2. Ebd., c. 26, S. 64, Z. 2–3. Brun von Querfurt, S. Adalberti Vita altera (wie Anm. 53), c. 23, S. 28, Z. 20–22. Ebd., c. 22, S. 60, Z. 24–27. S. Adalberti vita prior (wie Anm. 2), c. 3, S. 6, Z. 7–8 mit Anm. 18 und c. 3, S. 52, Z. 20; Brun von Querfurt, S. Adalberti Vita altera (wie Anm. 53), c. 5, S. 5, Z. 19–6, Z. 2: Scolis preerat tunc Ohtricus quidam facundissimus, ętate illa quasi Cicero unus, cuius memoriale clarum usque nunc per omnem Saxoniam habetur. 127 Fried, Gnesen (wie Anm. 1), S. 259 f., Anm. 99. 128 S. Adalberti vita prior (wie Anm. 2), c. 24, S. 37, Z. 1–3: Vide, inquiunt illi, quia Christo Domino secundante martyr eris futurus. Regis filia, quę dat tibi regia dona, hęc est domina cęli, sacratissima virgo Maria; Brun von Querfurt, S. Adalberti Vita altera (wie Anm. 53), c. 20, S. 26, Z. 9–12: Homo tibi contrarius, cito inuenies quod quęris, dono Virginis procul dubio martyr eris. Nec minus quod vidit de lecto fratrum, partim ante se vidit, partim hoc anno esse completum, sic collige mecum. Vgl. hierzu die ‚aventinische‘ Redaktion, S. Adalberti vita prior (wie Anm. 2), c. 24, S. 63.
Verzerrte Erinnerungen
77
pinen Redaktionen Bruns Text näher stehen.129 Im gleichen Kapitel vergleicht Fried die Formulierung Putabat se fratris sui curtem adire, die in der italienischen Redaktion nicht auftaucht, mit putabat se videre in domo maioris fratris.130 Ob der in den nordalpinen Handschriften überlieferte Eingang zu Kapitel 26 mit ergo pro his sceleribus aditum sibi clausum esse putans ille sanctissimus heros, noluit frustrari adventum suum, der in den italienischen Redaktionen anders lautet (nolens autem frustrare adventum suum) mit Bruns ergo quem suo labori adiutorem Deus preparavit zu vergleichen ist, muss dahingestellt bleiben.131 Wenskus bietet weitere Beispiele zur Frage, welche Handschriftenversion derjenigen, die Brun von Querfurt als erster Leser benutzt haben könnte, am nächsten stehen:132 Kapitel 28, italienische Version: Volat ex manibus liber psalmorum et co r po re exten s o to tus ad humum prosternitur.133 Kapitel 28, nordalpine Version: Excussus manibus volat in diversa codex, et ipse extenso capite et membris iacet humo prostratus.134 Brun, Kapitel 25: Evolat e manibus volumen excussum; alia ex parte ipse humi stratus dat oscula viridi terrę, mente extentus et cor pore to to .135
In dem Beispiel folgt Brun in Wortstellung und Wortlaut der durch die italienischen Handschriften vertretenen Version, weist aber zudem ein Wort auf, das nur in den nordalpinen Handschriften vorkommt. Kapitel 28, italienische Version: etsi amplius non erit, saltem p ro cr u cifixo rege vel u n u m ictum accip ere merui.136 Kapitel 28, nordalpine Version: saltim vel unum ictum pro crucifixo meo accipere merui.137 Brun, Kapitel 25: si plus non accipiam pro Crucifixo meo, unum preciosum ictum habeo.138
129 S. Adalberti vita prior (wie Anm. 2), c. 3, S. 6, Z. 1–3: misit eum pater ad archiepiscopum Adalbertum, qui ab eo, quod verbis docuit, moribus et vita nusquam recessit; ital. Redaktion, ebd., c. 3, S. 52, Z. 15–16: misit eum pater ad archiepiscopum Adhelbertum, qui ab eo, a quo verbis doctus est moribus et vita nusquam recessit; Brun von Querfurt, S. Adalberti Vita altera (wie Anm. 53), c. 11, S. 12, Z. 20–21: Bene vixit, bene docuit, ab eo quod ore dixit, nusquam opere recessit; Lotter, Bild (wie Anm. 53), S. 90, Anm. 40. 130 Fried, Gnesen (wie Anm. 1), S. 260, Anm. 99; S. Adalberti vita prior (wie Anm. 2), c. 24, S. 36, Z. 10–11; Brun von Querfurt, S. Adalberti Vita altera (wie Anm. 53), c. 20, S. 26, Z. 1. 131 S. Adalberti vita prior (wie Anm. 2), S. 38, Z. 15–16, S. 64, Z. 2; Brun von Querfurt, S. Adalberti Vita altera (wie Anm. 53), S. 28, Z. 20. 132 Wenskus, Studien (wie Anm. 87), S. 22. 133 S. Adalberti vita prior (wie Anm. 2), S. 65, Z. 7–8. 134 Ebd., S. 41, Z. 16–42, Z. 1. 135 Brun von Querfurt, S. Adalberti Vita altera (wie Anm. 53), S. 31, Z. 13–15. 136 S. Adalberti vita prior (wie Anm. 2), S. 65, Z. 10–11. 137 Ebd., S. 42, Z. 3. 138 Brun von Querfurt, S. Adalberti Vita altera (wie Anm. 53), S. 31, Z. 17–18.
78
Daniel Ziemann
Wie Wenskus bemerkt, ist in diesem Beispiel der Wortlaut den nordalpinen Handschriften näher, während die Wortstellung Ähnlichkeiten mit den italienischen Versionen aufweist. Kapitel 16, italienische Version: m onachico habitu illum induit.139 Kapitel 16, nordalpine Version: monachilem habitum sanctus ille episcopus accepit.140 Brun, Kapitel 14: monachilem vestem accepit.141
In dem letzten Beispiel ist wiederum die Ähnlichkeit mit der nordalpinen Handschriftengruppe deutlich erkennbar. Es bleibt festzuhalten, dass für Bruns erste Vita keine der in den Handschriften erkennbaren Redaktionen eindeutig als Vorlagenhandschrift nachweisbar ist. Wenskus ging mit gutem Grund von einer Handschrift als Vorlage der ersten Adalbertsvita Bruns aus, die gewisse Übereinstimmungen mit den italienischen Versionen zeigte. Jedoch ist sowohl im Hinblick auf die Übernahme der Formulierungen, die in den heute erhaltenen italienischen Versionen fehlen, als auch von inhaltlicher Seite her klar, dass Bruns Vorlage noch nicht die zahlreichen Lücken aufwies, die die späteren italienischen Versionen auszeichnen. So sind viele Elemente, die in den heutigen italienischen Handschriften fehlen, bei Brun vorhanden. Dazu gehören eine ausführliche Schilderung des Abschieds Adalberts aus Rom und seiner Audienz beim Papst, die in allen italienischen Handschriften übergangen wird.142 Weiterhin nennt Brun einige Einzelheiten und die Deutung des Traums Adalberts am Hofe Ottos, die ebenfalls in den italienischen Handschriften fehlen.143 Darüber hinaus bietet Brun einen ausführlichen Bericht über die Ermordung der Brüder Adalberts, den Brun sogar noch ausführlicher gestaltet als dies die nordalpinen Handschriften tun.144 Die nur in den nordalpinen Handschriften beschriebene Heilung der Tochter des römischen Präfekten Johannes wird ebenfalls von Brun übernommen, wenn auch in reduzierter Form, da seine Vorlage offensichtlich den Namen ihres Vaters schon nicht mehr überlieferte.145 Neben diesen Elementen weist Wenskus auch auf einige Namensformen hin, die bei Brun noch nicht verderbt sind wie in den italienischen Handschriften.146 139 140 141 142 143 144 145 146
S. Adalberti vita prior (wie Anm. 2), S. 59, Z. 19. Ebd., S. 24, Z. 9–10. Brun von Querfurt, S. Adalberti Vita altera (wie Anm. 53), S. 16, Z. 6–7. S. Adalberti vita prior (wie Anm. 2), c. 22, S. 33 f. und 62; Brun von Querfurt, S. Adalberti Vita altera (wie Anm. 53), c. 18, S. 23. S. Adalberti vita prior (wie Anm. 2), c. 24, S. 36 f. und 63; Brun von Querfurt, S. Adalberti Vita altera (wie Anm. 53), c. 20, S. 25 f. S. Adalberti vita prior (wie Anm. 2), c. 25, S. 38 und 63; Brun von Querfurt, S. Adalberti Vita altera (wie Anm. 53), c. 21, S. 26. S. Adalberti vita prior (wie Anm. 2), c. 17, S. 26 und 60; Brun von Querfurt, S. Adalberti Vita altera (wie Anm. 53), c. 17, S. 21. Wenskus, Studien (wie Anm. 87), S. 21. Brun von Querfurt, S. Adalberti Vita altera (wie Anm. 53), c. 1, S. 3, Z. 6, nennt Voicechus/Wogitihc, während die ottonische Version in S. Adalberti vita prior (wie Anm. 2), c. 2, S. 5, Z. 1, Woietech aufweist und die ital. Versionen ebd., S. 51, Z. 23, Uuentius bieten. Bei Brun von Querfurt, S. Adalberti Vita altera (wie Anm. 53), c. 5,
Verzerrte Erinnerungen
79
Wenskus verweist zudem auch auf eine Stelle, in der Brun den Einfluss beider Handschriftengruppen nahelegt:147 Brun, Kapitel 20: Putabat se videre in domo maioris fratris duos lectos bene p re p a r a t o s ; unus erat suus, alter erat fratribus destinatus; pulcher ille et decorus, sed q u i suus d eb u it esse, multo pulchrior refulsit, purpureus et floridus, et incomparabili ornamento preciosę vestitus. Erat autem in superiore parte panno capita li aureis litteris inscriptum: Munus hoc donat tibi filia regis.148 Es folgt die Deutung des Traums. Die ältere Adalbertsvita, Kapitel 24, nordalpine Versionen: Putabat se fratris sui curtem adire, et media curte stare domum, cuius structura aspectu erat delectabilis, parietes et tecta nivei candoris; intus duo lecti, unus sibi, alter fratri suo deputatus erat; uterque scilicet, ut decuit, multum honoris gerens, sed lectulus suus omnem gloriam alterius longe precellens, totus purpureo splendore et sericis ornamentis amictus, ad caput vero aurei staminis lintheo pulcherrime redimitus. Sursum vero in capite erat aureis litteris scriptum: Munus hoc auctentum filia sponsa tibi.149 Es folgt die Deutung des Traums. Die ältere Adalbertsvita, Kapitel 24, italienische Versionen: Remeante se ad patriam, stat alba domus, multo lumine ac magno decore refulgens, intus duo lecti: unus ad suum opus, alter pro quiete fratris stat prepar atus ; ambo amplissimo honore prediti, sed q u i episcopo d eb u it, m ulto eminentius pannis et auro ac diversis pulch r itu d in u m coloribus ves titu s apparuit, ab imo usque ad summum rarissimis ornatibus excultus et ca p ita le aureo p a n n o tectum, habens supra lectum aureis litteris scriptum.150
Damit wird Folgendes deutlich: Brun lag eine Handschrift vor, die nicht die Ursprungshandschrift gewesen sein kann, da sonst einige Wissenslücken gegenüber den nordalpinen Handschriften nicht zu erklären wären. Viele Elemente deuten auf eine Vorlage hin, die zwar einige der, in den heute erhaltenen italienischen Handschriften verlorenen, Textstellen noch enthielt, andererseits aber auch einige Lesarten der italienischen Gruppe aufwies. Wenskus folgerte völlig zu Recht, dass von einer Handschrift, die er Xb nannte, auszugehen sei, also einer Handschrift, die auf das Original zurückzuführen sei, aber bereits einige Lücken aufgewiesen haben muss.151 Es soll sich dabei um eine Handschrift gehandelt haben, die laut Wenskus als Vorgängerhandschrift für die italienischen Versionen (die B-Version Karwasińskas) anzusehen ist. Somit ist davon auszugehen, dass man erst in Italien mit dieser Vorlagenhandschrift in Berührung kam, die Adalbertsvita also mindestens um 1004 in einer lückenhaften Abschrift der Ursprungshandschrift in Italien verfügbar war. Es lassen sich indessen keine Beweise für eine Abhängigkeit der nordalpinen Handschriften von der Vorlagenhandschrift Bruns finden. Die nordalpinen Handschriften müssen
147 148 149 150 151
S. 5, Z. 19, lautet die Namensform Ohtricus/Octricus, die ottonischen Handschriften haben Octricus (S. Adalberti vita prior [wie Anm. 2], c. 3, S. 6, Z. 7–8, mit kritischem Apparat und Anm. 18; nur Lamspringe hat den im Obertext stehenden Astricus), die ital. Hss. ebd., S. 52, Z. 20, hingegen Stericus bzw. clericus. Wenskus, Studien (wie Anm. 87), S. 64 f. Brun von Querfurt, S. Adalberti Vita altera (wie Anm. 53), c. 20, S. 26, Z. 1–6. S. Adalberti vita prior (wie Anm. 2), S. 36, Z. 10–17. Ebd., S. 63, Z. 14–20. Wenskus, Studien (wie Anm. 87), S. 37.
80
Daniel Ziemann
demnach direkt von dem Urtext abzuleiten sein. Damit fällt aber auch Karwasińskas komplizierte Theorie einer Ur-B-Version, die sich im Kloster auf dem Aventin erhalten habe. Stattdessen ist eine einfachere Erklärung zu bevorzugen, nämlich ein Archetypus mit einem Text, der alle Namen korrekt aufführte und all die Stellen aufwies, die in den nordalpinen Handschriften zu finden waren. Von diesem stellte die Vorlagenhandschrift Bruns eine Abschrift dar, während die nordalpinen Versionen auf eine andere Abschrift dieses Archetypus’ zurückzuführen wären. VIII. BRUNS ZWEITE VITA Einen interessanten Aspekt eröffnet die Vermutung von Wenskus, dass Brun bei seiner zweiten, kürzeren Redaktion eine weitere Handschrift der älteren Adalbertsvita zum Vergleich herangezogen hat.152 Wenskus beruft sich dabei auf Perlbach153, der darauf aufmerksam machte, dass Brun das Wort adolescens, das sich in allen Fassungen der älteren Adalbertsvita findet, in der zweiten Version seiner Vita neu aufnimmt.154 Zudem füge er den Namen des Mörders Adalberts, Sicco, in seine zweite Vita ein, sofern das Wort überhaupt einen Namen darstellt.155 Wenskus ergänzt diese Belege durch den Hinweis auf die Einfügung des Wörtchens quis aus Kapitel 28 der älteren Vita in Kapitel 25 der zweiten Vita Bruns.156 Darüber hinaus könnte die Verbesserung des Namens für die Stadt Tours von Turonum/Turones in Turoniam in der zweiten Vita von der entsprechenden Schreibweise der älteren nordalpinen Adalbertsvita inspiriert worden sein.157 Wenskus vermutet, dass Brun für seine zweite Vita eine Handschrift der nordalpinen Redaktion benutzt haben könnte. Diese Annahme beruht unter anderem auf einem Satz des 20. Kapitels: Munus hoc donat tibi filia regis158, die Brun um das Wort autentum zu Munus hoc autentum donat tibi filia regis159 bereichert. Der Satz fehlt in den italienischen Handschriften, während er sich in der nordalpinen Version in der Form Munus hoc auc-
152 Ebd., S. 19. 153 Max Perlbach, Zu den ältesten Lebensbeschreibungen des heiligen Adalbert, in: NA 27, 1902, S. 35–70, hier S. 47. 154 Brun von Querfurt, S. Adalberti Vita altera (wie Anm. 53), c. 6, S. 6, Z. 20–22 (Redactio longior), im Vergleich zu c. 6, S. 48, Z. 9 (Redactio brevior). 155 Ebd., c. 33 (Redactio longior), S. 39, Z. 20 mit Anm. 173, und c. 33, S. 68, Z. 15; zu Sicco Wenskus, Studien (wie Anm. 87), S. 167 Anm. 37. 156 Ebd., S. 19; S. Adalberti vita prior (wie Anm. 2), c. 28, S. 42, Z. 7–8: Tunc sanctus Adalbertus, quis et unde esset vel ob quam causam illuc veniret, interrogatus. Brun von Querfurt, S. Adalberti Vita altera (wie Anm. 53), c. 25, S. 31, Z. 26–32, Z. 1 (Redactio longior): interrogant unde esset? quid quęreret? Quare venisset quem nemo vocavit?; c. 25, S. 63, Z. 15–16 (Redactio brevior): interrogant unde? quis esset? quid quereret? Quare venisset quem nemo rogavit? 157 Wenskus, Studien (wie Anm. 87), S. 19; S. Adalberti vita prior (wie Anm. 2), c. 25, S. 37, Z. 10: Turoniam; Brun von Querfurt, S. Adalberti Vita altera (wie Anm. 53), c. 19, S. 24, Z. 6–7 (Redactio longior): Turonum (Turones S); c. 19, S. 57, Z. 19 (Redactio brevior): Turoniam. 158 Brun von Querfurt, S. Adalberti Vita altera (wie Anm. 53), c. 20, S. 26, Z. 6 (Redactio longior). 159 Ebd., c. 20, S. 58, Z. 24 (Redactio brevior).
Verzerrte Erinnerungen
81
tentum filia sponsa tibi findet.160 Wenskus setzt damit für die spätere, verkürzte Überarbeitung die Benutzung einer Handschrift voraus, die einige der für die nordalpinen Versionen typischen Lesarten aufwies.161 IX. SCHLUSSFOLGERUNGEN Was folgt aus diesen Erkenntnissen für die Frage nach der Autorschaft und dem Entstehungskontext der älteren Adalbertsvita? Brun hatte 1004, also sieben Jahre nach Adalberts Tod, eine Vorlage seiner Vita zur Verfügung, die bereits einige verderbte Stellen aufwies und nicht der Ursprungstext gewesen sein kann. Diese Handschrift könnte, wie Reinhard Wenskus gezeigt hat, die Handschrift darstellen, aus der sich die anderen italienischen Handschriften abgeleitet haben könnten. Damit ist eine Benutzung der Handschrift durch Brun in Italien sehr wahrscheinlich. Es liegt nahe, davon auszugehen, dass Brun in Rom eine solche Handschrift zur Verfügung stand. Brun hielt sich ab 998 in dem Kloser SS. Bonifacio ed Alessio auf, jedoch ist es nicht zwingend, dass er die Handschrift im Kloster selbst vorfand. Zudem finden sich auch keine stichhaltigen Beweise für eine Autorschaft des Johannes Canaparius. Im Gegenteil, seine Autorschaft ist vor dem Hintergrund des Vergleichs mit den Viten Bruns eher unwahrscheinlich. Wie sieht es nun mit den nordalpinen Versionen aus? Tatsächlich können sie nicht über die italienische Vorlagenhandschrift Bruns hergeleitet werden. Vielmehr muss man von einer direkten Ableitung vom Urtext ausgehen. Die zahlreichen Informationen dieser Gruppe, die in den italienischen Versionen entfielen, mögen zwar Ergänzungen sein, jedoch ist es wahrscheinlicher, dass es sich größtenteils um Informationen handelte, die auch in der Ursprungshandschrift zu finden waren, wie beispielsweise der Name des römischen Stadtpräfekten. Dasselbe gilt natürlich nach wie vor für die schon von Karwasińska und andere herausgearbeitete ‚ottonische‘ Tendenz, also die äußerst positive Darstellung Ottos III. Es ist doch eher unwahrscheinlich, dass diese nach Ottos Tod nördlich der Alpen ergänzt wurde. Vielmehr ist davon auszugehen, dass sie später weggelassen wurde. Schließlich bleiben auch die Eigennamen, die in den nordalpinen Versionen erhalten sind, während sie in den italienischen Versionen fehlen. Einige von ihnen fehlen bereits in Bruns Vorlage. Leider finden sich keine Hinweise einer so frühen Benutzung wie die um 1004 anzusetzende Bruns für eine Handschrift der nordalpinen Versionen. Immerhin liegt es nahe, dass Brun eine nordalpine Handschrift für die wohl um 1008 erfolgte Abfassung seiner zweiten Vita herangezogen hat, da er entsprechende Ergänzungen vornahm. Also ließe sich die Existenz der nordalpinen Version spätestens um 1008 wahrscheinlich machen. Keine der erhaltenen Versionen, auch nicht der nordalpinen, kann den Ursprungstext repräsentieren, zu groß sind die Lücken und Unstimmigkeiten. 160 S. Adalberti vita prior (wie Anm. 2), c. 24, S. 36, Z. 17; Wenskus, Studien (wie Anm. 87), S. 20. 161 Ebd., S. 20.
82
Daniel Ziemann
Die Benutzung von zwei Versionen, der italienischen und der nordalpinen Versionen durch Brun spätestens jeweils 1004 und 1008, sowie die Darstellung Ottos III. in den nordalpinen Handschriften, die in den italienischen gekürzt wurde, legen einen äußerst schnellen Abschreibe- und Verbreitungsprozess nahe. Ein solcher Prozess war wohl nur unter der Ägide des ottonischen Kaiserhofs möglich. Das ist nun keineswegs eine neue Erkenntnis. Die schnelle Verbreitung der Vita entspricht den von der Forschung herausgearbeiteten intensiven Bemühungen um die Förderung des Adalbertkultes durch Otto III. Was lässt sich zur Autorschaft sagen? Johannes Canaparius ist wohl eher unwahrscheinlich, ebenso jedoch auch Notker von Lüttich. Cristian Gaşpar hat die Unterschiede im Stil herausgearbeitet. Zudem bietet die lothringische Handschriftengruppe nicht den besten Text. Ein Autor aus dem monastischen Milieu liegt hinsichtlich der Tendenz wohl sehr nahe. Die Ablehnung der Vita durch Brun und sein Bedürfnis, eine Gegenvita zu schreiben, machen Johannes Canaparius neben der Kritik an Visionen zu einem unwahrscheinlichen Kandidaten, jedoch ist die Beobachtung nicht ausreichend, wenn es gilt, neue, bessere Kandidaten zu finden. Wahrscheinlich ist vor allem der Gegensatz zwischen Italien und Deutschland aufzulösen. Er wird erzeugt durch die spätere Gruppenbildung der Handschriften. Vielmehr deutet die sehr frühe Aufspaltung der beiden Gruppen darauf hin, dass der Urtext sowohl in Rom als auch nördlich der Alpen relativ schnell verfügbar gewesen sein muss. Dies deutet auf eine dem Hof nahestehende Person aus dem Umfeld Ottos III., die zudem aus dem monastischen Milieu stammen müsste. Letztlich ist aber wohl doch eine Verbindung nach Rom wahrscheinlich, wenn auch nicht unbedingt zum Kloster SS. Bonifacio e Alessio selbst, wie die kritischen Stimmen aus seinem Umfeld vermuten lassen. Zu deutlich treten jedoch Rom und das Klosterleben hervor. Die offensichtliche Stoßrichtung der Vita gegen das Kloster Montecassino passt auch wohl eher nach Rom als in die Gebiete nördlich der Alpen. Leider lässt sich an dieser Stelle nicht mehr sagen. Johannes Fried hat in seinem Beitrag wichtige Impulse zur Infragestellung allgemein akzeptierter Ansichten geliefert. Vor allem machte er deutlich, dass die Frage längst noch nicht geklärt ist. Die Suche wird auf jeden Fall weitergehen.
IM SCHLAGSCHATTEN VON CANOSSA 1077: BRIXEN 1080 Die Einleitung eines kanonischen Verfahrens gegen Gregor VII. Jörg W. Busch Welches Schicksal dem Friedensplan beschieden war, den Gregor VII. und Heinrich IV. im Januar 1077 auf dem Burgfelsen von Canossa entwarfen, hat Johannes Fried in einer Streitschrift mit kräftigen Strichen bis hin zu der Brixener Bischofsversammlung von 1080 und Heinrichs Einzug in Rom 1084 skizziert.1 Wer diese Ereignisabfolge nachlesen will und deshalb zu gängigen Handbüchern oder zu den großen Darstellungen des sogenannten Investiturstreites greift, findet überwiegend zu der Bischofsversammlung von Brixen im Juni 1080 folgende Feststellung, die hier nach der 2012 von Klaus Herbers vorgelegten „Geschichte des Papsttums im Mittelalter“ zitiert wird: „In Brixen ließ er [Heinrich IV.] bei einer Synode im Juni 1080 einen Gegenpapst erheben, Wibert von Ravenna, der den Namen Clemens (III.) annahm. In Stellvertretung für alle Kardinäle fungierte dort Hugo Candidus – er setzte Gregor VII. ab. In der Folge wollte Heinrich Rom erobern und belagerte die Ewige Stadt. Ein Erfolg stellte sich erst 1084 ein, als Gregor von den Römern im Stich gelassen wurde und sich in die Engelsburg flüchtete. Ostern 1084 wurde Clemens (III.) inthronisiert und krönte Heinrich und Bertha zu Kaiser und Kaiserin.“2
Einmal ganz abgesehen davon, dass erst die siegreiche Partei bestimmte, wer als Gegenpapst anzusehen sei, vermittelt doch der Überrest, den das erhaltene Synodalprotokoll von Brixen 1080 bietet, ein ganz anderes Bild als jenes eben zitierte, das einst auch in Schulbüchern zu finden war, die Gregor VII. in Brixen absetzten und Wibert von Ravenna als Gegenpapst Clemens III. einsetzten.3 1
2 3
Johannes Fried, Canossa. Entlarvung einer Legende. Eine Streitschrift, Berlin 2012, S. 137 und 145. Die neue Sicht auf den Vorgang in der emilianischen Burg begründet ders., Der Pakt von Canossa. Schritte zur Wirklichkeit durch Erinnerungsanalyse, in: Wilfried Hartmann/Klaus Herbers (Hgg.), Die Faszination der Papstgeschichte. Neue Zugänge zum frühen und hohen Mittelalter (Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters. Beihefte zu J. F. Böhmer, Regesta imperii 28) Köln/Weimar/Wien 2008, S. 133–197; zu letzterem nimmt Stellung Stefan Weinfurter, Canossa als Chiffre. Von den Möglichkeiten historischen Deutens, in: Wolfgang Hasberg/Hermann-Josef Scheidgen (Hgg.), Canossa. Aspekte einer Wende, Regensburg 2012, S. 124–140 und 222–225. Klaus Herbers, Geschichte des Papsttums im Mittelalter, Darmstadt 2012, S. 133. Fünf von sechs Schulbüchern, die in dem letzten Jahrzehnt erschienen, erwähnen die Brixener Bischofsversammlung von 1080 überhaupt nicht mehr, nur Bernhard Askani/Elmar Wagener (Hgg.), Anno 2, 2: Vom Mittelalter bis zum Ende des Absolutismus, Braunschweig 22003, S. 32, vermerken ohne zeitlichen Bezug zu der zuvor genannten Schlacht 1080, in der Rudolf von Rheinfelden die Schwurhand (aber offensichtlich nicht das Leben) verlor: „Heinrich konnte […] den Papst auf einer Synode absetzen und den Erzbischof Wibert von Ravenna zum
84
Jörg W. Busch
Denn am 25. Juni 1080 bekräftigten Kardinalpresbyter Hugo Candidus, ein Patriarch, zwei Erzbischöfe und 24 Bischöfe sowie am Schluss Heinrich dei gratia rex mit ihrer Unterschrift einen Schriftsatz, der ausführlichst begründet, dass der Mönch Hildebrand überhaupt nicht rechtmäßig Papst sei, und aufführt, welche Verbrechen er in dem angemaßten Amt begangen habe, um dann in vier entscheidenden Worten zu gipfeln, die im Original lauten: Hildebrandum […] iudicamus canonice deponendum.4
Wir, die 29 Unterzeichner (und nicht wie in dem einleitend angeführten Zitat: ich, Hugo Candidus), verkünden das interlokutorische Urteil5, dass Hildebrand in einem dem Kirchenrecht entsprechenden Verfahren abgesetzt werden muss. Nun mag Unbehagen aufkommen, wenn aus vier lateinischen 16 deutsche Worte gemacht werden. Doch selbst wer anders übersetzen will, wer also die 16 Worte vermeiden will und statt „wir verkünden das interlokutorische Urteil, dass Hildebrand in einem dem Kirchenrecht entsprechenden Verfahren abgesetzt werden muss“ nur mit acht Worten übersetzt „wir urteilen, dass Hildebrand kanonisch abgesetzt werden muss“, selbst der legt doch das ‚Absetzen‘ zeitlich eindeutig hinter das ‚Urteilen‘. Auf je-
4
5
Gegenpapst wählen lassen.“ Mit einer Absetzungserklärung und der Wahl eines Gegenpapstes in Brixen wendet sich auch Jürgen Kaiser, Der Kampf um die Krone. Königsdynastien im Mittelalter, Stuttgart 2011, S. 64, an ein allgemeineres Publikum. Das Brixener Synodaldekret, gedruckt als Anhang C der Heinrici IV. Epistolae, hg. von Carl Erdmann (MGH Dt. MA 1) Leipzig 1937, S. 69–73, bzw. von Franz-Josef Schmale, in: ders./ Irene Schmale-Ott (Hgg.), Quellen zur Geschichte Kaiser Heinrichs IV. (Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters – FStGA 12) Darmstadt 42000, S. 53–141, S. 476– 482, bietet erst MGH S. 72, Z. (2)7 = FStGA S. 480, Z. (18)23, also gegen Ende, Hildebrandum […] iudicamus canonice deponendum, beginnt nach der einleitenden Datierung (MGH S. 69, Z. 17 f. = FStGA S. 476, Z. 13 f.), grundsätzliche Vorwürfe zu erheben und das Verfahren darauf auszurichten, ut iudicium episcoporum animadversionis sententia gladium materialem in ipsum Hildebrandum precederet (MGH S. 70, Z. 11–13 = FStGA S. 476, Z. 25–28), trägt dann die Anklage vor, indem es vor allem Verbrechen aus der Zeit vor dem ausführlich geschilderten, unrechten Introitus (MGH S. 71, Z. 4–19 = FStGA S. 478/480, Z. 17–8) auflistet (MGH S. 70, Z. 16 – S. 71, Z. 3 = FStGA S. 478, Z. 1–17), während es die verderbliche Amtsführung eher stichwortartig belegt (MGH S. 71, Z. 19–25 = FStGA S. 480, Z. 8–14), um abschließend nach dem Verweis auf seinen Einklang mit der Mainzer Bischofsversammlung (MGH S. 71, Z. 27 – S. 72, Z. 1 = FStGA S. 480, Z. 16 f.) das Zwischenurteil zu sprechen (MGH S. 72, Z. 7 = FStGA S. 480, Z. 23), wobei die Anklagepunkte noch einmal stichwortartig zusammengefasst werden: Predigt von Sakrilegien und Brandstiftung, Verteidigung von Meineid und Mord, die Häresie des Berengar bezüglich der Eucharistie, Verehrung von Weissagungen und Träumen, Schwarzkunst und damit Abfall von dem wahren Glauben (MGH S. 72, Z. 2–7 = FStGA S. 480, Z. 18–23). Vor den 29 Unterschriften (MGH S. 72, Z. 9 – S. 73, Z. 12 = FStGA S. 480/482, Z. 30–25) benennt das Dekret noch als Ziel des nächsten Verfahrensschrittes die Vertreibung und nisi ab ipsa sede his auditis descenderit die ewige Verdammnis des dann schuldig Gesprochenen (MGH S. 72, Z. 7 f. = FStGA S. 480, Z. 23–25). Zu dem Unterschied zwischen sententia interlocutoria und definitiva vgl. allgemein Raoul Naz, Sentence, in: ders. (Hg.), Dictionnaire du droit canonique 7, Paris 1965, Sp. 952–962, Sp. 953, sowie in den klassischen und nachklassischen Quellen Wieslaw Litewski, Zwischenbescheide im römischen Prozeß, in: RIDA Ser. 3, 44, 1997, S. 155–291, S. 160 f.
Im Schlagschatten von Canossa 1077: Brixen 1080
85
den Fall verwehrt die grammatische Konstruktion mit dem Gerundivum die Aussage, Hildebrand/Gregor sei in Brixen abgesetzt worden. „Eine unter Heinrichs Vorsitz in Brixen zusammengetretene Synode (25. Juni 1080) beschloß darauf die Einleitung eines kanon. Verfahrens gegen G. und nominierte Ebf. Wibert v. Ravenna zum Papst“, liest man seit 1989 in dem „Lexikon des Mittelalters“ unter dem Eintrag ‚Gregor VII.‘6 Dieser Feststellung von Tilman Struve, die in ihrem ersten Teil durch den Überrest gedeckt ist7, folgten 1999 Ian Stuart Robinson, 2006 Stefan Weinfurter und 2010 Rudolf Schieffer8; doch ließen sich hier gleich viele, wenn nicht mehr Gelehrte nennen, die – zumal der mit Pap-
6
7
8
Tilman Struve, Art. Gregor VII., in: LexMA 4, München/Zürich 1989, Sp. 1669–1670, Sp. 1670; ebenso ders., Art. Clemens III. (Wibert), Gegenpapst (1084) (1020/30–1100), in: LexMA 2, ebd. 1989, Sp. 2139–2140, Sp. 2139; so auch ders., Salierzeit im Wandel. Zur Geschichte Heinrichs IV. und des Investiturstreits, Köln/Weimar 2006, S. 109 mit S. 316 f., Anm. 115, 145 und 232 (erstmals 1991, 1997 und 2002). Gegen die „unbegründete Verzerrung des Sachverhalts […], wenn dennoch immer wieder von der Absetzung Gregors 1080 in Brixen gesprochen wird“, hatte sich zuvor Jürgen Ziese, Wibert von Ravenna. Der Gegenpapst Clemens III. (1084–1100) (Päpste und Papsttum 20) Stuttgart 1982, S. 55 f. (Anm. 26 das Zitat), ausgesprochen, der S. 60 in Brixen erst – wie in diesem Beitrag – ein kanonisches Verfahren eingeleitet sah. Ziese biete die beste Monographie, befindet Nicolangelo D’Acunto, Das Wibertinische Schisma in den Quellen des Regnum Italiae, in: Harald Müller/Brigitte Hotz (Hgg.), Gegenpäpste. Ein unerwünschtes mittelalterliches Phänomen (Papsttum im mittelalterlichen Europa 1) Wien/Köln/Weimar 2012, S. 83–96, S. 83, Anm. 1, der selbst auf das hier aufgeworfene Problem indirekt eingeht, dazu unten Anm. 77. Die Nominierung, von der Struve, Gregor VII. (wie Anm. 6), Sp. 1670, spricht, ist erschlossen, denn das Synodaldekret (wie Anm. 4) schweigt darüber. Anlass für den Schluss, Heinrich IV. habe Wibert in Brixen nominiert, bieten seine singuläre Nennung als electus (dazu unten bei Anm. 44) und Behauptungen der Gegenseite (dazu unten Anm. 67). Denn erst ein Vierteljahrhundert später (so Wattenbach/Holtzmann/Schmale, Geschichtsquellen 2 [wie Anm. 15], S. 733 mit Anm. 294) weiß Sigeberti Gemblacensis Chronographia, hg. von Ludwig Conrad Bethmann, MGH SS 6, Hannover 1848, S. 300–374, S. 364, Z. 15–18, zu berichten: Heinricus […] Guicbertum Ravennae archiepiscopus pro Hildibrando papam designat. Ian Stuart Robinson, Henry IV of Germany (1056–1106), Cambridge/New York/Melbourne/ Madrid 1999, S. 198 f. (keine Absetzung, aber erzwungene Selbstabsetzung!); Stefan Weinfurter, Canossa. Die Entzauberung der Welt, München 2006, S. 158 f. (korrektes kanonisches Verfahren in der Zukunft [vgl. S. 187], aber in Aussichtnahme eines neuen Papstes); und Rudolf Schieffer, Papst Gregor VII. Kirchenreform und Investiturstreit (Beck’sche Reihe Wissen 2492) München 2010, S. 80 (juristisch sauberer Weg zur Autodeposition), auf der Linie von Struve, Gregor VII. (wie Anm. 6), Sp. 1670. Die schmale Darstellung aller Salier von Johannes Laudage, Die Salier. Das erste deutsche Königshaus (Beck’sche Reihe Wissen 2397) München 2006, S. 80, umgeht die Problematik geschickt, indem sie bemerkt, die Mainzer Versammlung habe Gregor mit Bann und Absetzung bedroht und die Brixener sei noch einen Schritt weitergegangen, sie habe Wibert als künftigen Papst nominiert. Schon Egon Boshof, Die Salier (Kohlhammer Urban-Taschenbücher 387) Stuttgart/Berlin/Köln 1987, S. 244 f., trägt dem Quellenbefund Rechnung, indem er den entscheidenden Satz des Dekrets (bei Anm. 4) übersetzt, doch sieht er – anders als in dem vorliegenden Beitrag – mit der Nominierung Wiberts den endgültigen Bruch zwischen beiden Protagonisten vollzogen, so auch Fried, Canossa (wie Anm. 1), S. 145.
86
Jörg W. Busch
stabsetzungen Erfahrenste in Brixen 1080 eine ebensolche sieht9 – dem eingängigen Bild von Gregors Absetzung am 25. Juni 1080 in ihren Handbüchern10 und Einzelstudien11 folgen oder sich ihm nicht ganz entziehen können12, auch wenn sie bemerken, dass die Synode einen Nachfolger nur in Aussicht nahm oder nominierte.13 9
10
11
12
13
Harald Zimmermann, Papstabsetzungen des Mittelalters, Graz/Wien/Köln 1968, S. 210, spricht unter Verweis auf „die Dekrete der Synode von Brixen“ (so ebd., Anm. 12) von der „Absetzung Gregors VII. durch Heinrich IV. und [der] Erhebung Wiberts von Ravenna als Clemens (III.) zum Papst“; ders., Wurde Gregor VII. 1076 in Worms abgesetzt?, in: MIÖG 78, 1970, S. 121– 131, S. 124, sieht in Brixen ein kanonisches Depositionsurteil gefällt und S. 127 den Gegenpapst Clemens III. gewählt sowie S. 130 noch einmal zusammenfassend Absetzung und Wahl. Eingehend behandelt Michael E. Stoller, Eight Anti-Gregorian Councils, in: AHC 17, 2, 1985, S. 252–321, S. 266–278, Brixen, „where the pope’s deposition was decreed and Archibishop Wibert of Ravenna was chosen […] antipope“ (S. 266); S. 278, bezeichnet er es als „inappropriate to construe […] Wibert als not elected in Brixen“. Für Carl Mirbt, Die Publizistik im Zeitalter Gregors VII., Leipzig 1894, ND ebd. 1965, S. 20, der stellvertretend für die älteren Darstellungen angeführt sei, erfolgte in Brixen „der große Schlag […]: die Absetzung Gregors VII. und die Erhebung eines neuen Papstes“, so auch, da die Neubearbeitung noch nicht vorlag, die Handbuchdarstellung schlechthin von Karl Jordan, Investiturstreit und frühe Stauferzeit (Gebhardt. Handbuch der deutschen Geschichte 4 = dtv WR 4204) München 41978 (zuerst 1973), S. 48. Hildebrands Absetzung und Wiberts Nominierung verortet Hermann Jakobs, Kirchenreform und Hochmittelalter 1046–1215 (OGG 7) München 31994, S. 30, 1080 in Brixen, die Zeittafel auf S. 323 erhebt Wibert bereits dort zum Gegenpapst. Ebenfalls die Brixener Synode 1080 lässt Carlo Dolcini, Clemente III antipapa, in: Enciclopedia dei papi 2, o. O. 2000, S. 212–217, S. 212, Gregor VII. absetzen und Wibert zum Papst wählen, letzteres auch ebd., S. 215. Gregors erneute Absetzung und Wiberts Wahl verortet Thomas Frenz, Das Papsttum im Mittelalter (UTB 3351) Köln/Weimar/Wien 2010, S. 33, in Brixen 1080. Jörgen Vogel, Gregor VII. und Heinrich IV. nach Canossa. Zeugnisse ihres Selbstverständnisses (Arbeiten zur Frühmittelalterforschung 9) Berlin 1983, nennt sein Kap. IV.3, S. 209–219, „Die Reichssynode von Brixen: Die Absetzung Hildebrand-Gregors VII. im Spiegel des Synodaldekrets und die Wahl Wiberts von Ravenna zum Gegenpapst“, wobei S. 219 die ‚Bekleidung Wiberts mit den päpstlichen Insignien noch am Tage der Absetzung Gregors VII.‘ eindeutig Bonizos singulärer Nachricht (dazu unten Anm. 66) verpflichtet ist. „Absetzung Gregors und Neuwahl eines Papstes“ arbeitet Thomas Förster, Bonizo von Sutri als gregorianischer Geschichtsschreiber (MGH Studien und Texte 53) Hannover 2011, S. 249, als Bonizos Botschaft heraus, spricht aber selbst S. 222 von dem „Absetzungsdekret der Synode von Brixen vom Juni 1080“. Winfried Hartmann, Der Investiturstreit (Enzyklopädie deutscher Geschichte 21) München 32007, differenziert bedenkenswert, wenn er S. 27 schreibt: „die Synode […] beschloss […], Gregor VII. zu verurteilen und ihn zur Selbstdeposition aufzufordern“ und „legte[] sich auf einen Kandidaten für die Papstwürde fest“, doch S. 75 unterläuft ihm doch „die Absetzung Gregors VII. 1080 in Brixen“. Zutreffend bemerkt Gerd Althoff, Heinrich IV. (Gestalten des Mittelalters und der Renaissance) Darmstadt 2006, S. 190, dass die römische „Synode [von 1084] Gregor VII. […] die päpstliche Würde absprach […] [und] an seiner Stelle […] Clemens III. erhob[]“, doch zuvor spricht er S. 172 f. zweimal von der „Absetzung Gregors“ in Brixen. Gerd Tellenbach, Die westliche Kirche vom 10. bis zum frühen 12. Jahrhundert (Die Kirche in ihrer Geschichte 2, F1) Göttingen 1988, S. F196 (Absetzung Gregors und Nominierung Wiberts); Werner Goez, Kirchenreform und Investiturstreit 910–1122 (Kohlhammer Urban-Taschenbücher 462) Stuttgart 2000, S. 140 (Absetzung und in Aussichtnahme); Uta-Renate Blu-
Im Schlagschatten von Canossa 1077: Brixen 1080
87
Wendet man das methodische Rüstzeug an, das der Jubilar lehrt14, so ist leicht eine Überschreibung des Gedächtnisses zu erkennen: der von Johannes Fried als wohlinformiert geschätzte Gregorianer Bischof Bonizo von Sutri überschrieb in seinem „Trostbuch an einen Freund“ 1085/86, als er um die Absetzung seines verehrten Gregor 1084 in Rom wusste15, das Ereignis in Brixen 1080 mit den Worten eligitur Guibertus in Romanum pontificem a consimilibus.16 Diese Feststellung „Wibert wurde in Brixen von Seinesgleichen zum römischen Pontifex gewählt“ erwies sich als so wirkmächtig, dass immer wieder moderne Gelehrte darauf zurückgreifen, zumal für einige17, nicht für alle18 der Weg von Brixen 1080 gradlinig auf Rom 1084 zulief. Doch muss stutzig machen, dass Heinrichs Marsch auf Rom fast vier Jahre, genau drei Jahre und neun Monate, in Anspruch nahm, was sich bei dem besten Willen nicht mit den Reisegeschwindigkeiten erklären lässt, die Johannes Fried zu beachten anmahnt.19
14 15
16 17
18
19
menthal, Gregor VII. Papst zwischen Canossa und Kirchenreform (Gestalten des Mittelalters und der Renaissance) Darmstadt 2001, S. 190 (Absetzung und Nominierung); Elke Goez, Die Päpste der Salierzeit. Der Kampf um den Vorrang. Gregor VII. und Heinrich IV., in: Die Salier. Macht im Wandel. Katalogband, München 2011, S. 70 f., S. 71 (Verurteilung Gregors, Aufforderung zum Amtsverzicht und Festlegung auf einen neuen Papst). Jüngst betonte Michaela Muylkens, Reges geminati. Die „Gegenkönige“ in der Zeit Heinrichs IV. (Historische Studien 501) Husum 2012, S. 201, Wibert sei 1080 „nominiert, nicht etwa schon förmlich gewählt“ worden, sieht aber S. 199 f., „geistliche und weltliche Fürsten […] in Brixen […] gemeinsam die Deposition und Vertreibung Gregors VII.“ beschließen. Johannes Fried, Der Schleier der Erinnerung. Grundzüge einer historischen Memorik, München 2004, ND mit einem Nachwort, ebd. 2012. Bonizonis Liber ad amicum (wie Anm. 16) entstand zwischen dem 25. Mai 1085 und dem 24. Mai 1086, so Mirbt, Publizistik (wie Anm. 10), S. 43; vgl. auch Wilhelm Wattenbach/ Robert Holtzmann/Franz-Josef Schmale, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter. Die Zeit der Sachsen und Salier, Neuausgabe 1–3, Darmstadt 1967–1971, 3, S. 878. Fried, Canossa (wie Anm. 1), S. 34, 107 f. und 144 f., misst diesem Zeugen, der aus dem Umkreis Gregors VII. und in dessen Sinne berichtete, größere Bedeutung zu als den nordalpinen Berichterstattern über die Ereignisse 1076/77. Zu dem Autor allgemein vgl. Walter Berschin, Bonizo von Sutri. Leben und Werk (Beiträge zur Geschichte und Quellenkunde des Mittelalters 2) Berlin/New York 1972, und zu seinem historiographischen Arbeiten jetzt Förster, Bonizo (wie Anm. 11). Bonizonis episcopi Sutrini Liber ad amicum, hg. von Ernst Dümmler, MGH Ldl 1, Hannover 1891, S. 568–620, lib. 9, S. 612, Z. 30 – S. 613, Z. 1, registriert die Versammlung von Brixen, das Zitat Z. 32 f. Dazu das Zitat bei Anm. 2. Für Kaiser, Kampf (wie Anm. 3), S. 64 f., zog Heinrich 1081 mit dem Willen, seinen Erzfeind zu vernichten, nach Italien, wobei ihm im Sommer der Einzug in Rom gelang, wo er an Ostern 1084 gekrönt wurde; ähnlich rasch lassen Dolcini, Clemente (wie Anm. 10), S. 212 f., und Laudage, Salier (wie Anm. 8), S. 88, Heinrich vorankommen. So findet sich in der gedrängten Handbuchdarstellung von Tellenbach, Westliche Kirche (wie Anm. 13), S. F199, die hier vertiefte Feststellung: „Manches deutet sogar darauf hin, daß Papst und König immer noch eine Verständigung für möglich hielten, um die sich einige ihrer Anhänger bemühten.“ Eine solche Verständigung sei, so Althoff, Heinrich IV. (wie Anm. 12), S. 178, „wohl unrealistisch“ gewesen. Goez, Kirchenreform (wie Anm. 13), S. 140 f., Jordan, Investiturstreit (wie Anm. 10), S. 48 f., und Weinfurter, Canossa (wie Anm. 8), S. 168 f., erwähnen nur die schließlich zielführenden Verhandlungen mit gregorkritischen Kardinälen, alle hingegen behandelt Blumenthal, Gregor VII. (wie Anm. 13), S. 321–324. Fried, Canossa (wie Anm. 1), S. 63–72.
88
Jörg W. Busch
Warum also sollte noch einmal kurz von ‚Brixen 1080‘, das in der historischen Erinnerung eindeutig im Schlagschatten von ‚Canossa 1077‘ steht, gehandelt werden, wenn doch ganz offensichtlich eine interessegeleitete und parteigebundene Überschreibung des Gedächtnisses bereits durch einen Zeitgenossen vorliegt? Denn diejenigen Zeitzeugen, die Heinrich IV. nahestanden20, wissen nichts von Gregors Absetzung und von Wiberts Erhebung in Brixen. Der merkwürdige Bischof Benzo von Alba betonte schon im April 1084, dass erst im März 1084 das kanonische Verfahren gegen Hildebrand in Rom seinen Lauf nahm.21 Und der wohl Hersfelder Anonymus des „Buches über die zu bewahrende Einheit der Kirche“ legte 1092 großen Wert darauf, die Pontifikatsjahre von Heinrichs Papst Clemens ab dem Jahr 1084 zu zählen22, wie es dieser wohl selbst tat.23 Zuvor, 1086, 20
21
22
23
Der Autor, der dem Ereignis zeitlich am nächsten stand, erwähnte es überhaupt nicht: Wenrici scolastici Trevirensis Epistola sub Theoderici episcopi Virdunensis nomine composita, hg. von Kuno Francke, MGH Ldl 1, Hannover 1891, S. 280–299, bzw. von Irene Schmale-Ott, Schriften über den Streit zwischen Regnum und Sacerdotium (Quellen zum Investiturstreit 2 = Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters – FStGA 12b) Darmstadt 1984, S. 68–118. Wenrichs Schweigen über Brixen könnte entgegen dem älteren Zeitansatz von Mirbt, Publizistik (wie Anm. 10), S. 25 (in der Frist von Oktober 1080 bis August 1081, wahrscheinlich im Sommer 1081), daraufhin deuten, dass sein Text innerhalb von drei Wochen zwischen den Versammlungen von Mainz und Brixen entstand, was selbst Schmale-Ott, Einleitung, S. 11, einen „recht knappe[n] Zeitraum“ nennt. Benzonis episcopi Albensis Ad Heinricum IV. imperatorem libri VII, hg. von Hans Seyffert (MGH SS rer. Germ. 65) Hannover 1996, lib. 6.6, S. 564, Z. 1–6, erwähnt, nachdem die vorherigen Kapitel Heinrichs IV. langwierige Bemühungen, nach Rom zu gelangen, episodisch beschrieben haben, eine in St. Peter versammelte Synode, die den Säumigen (Gregor VII.) schuldig gesprochen und den Ravennaten erhoben habe. Die heute vorliegende Redaktion des gesamten Werkes ist nach Mirbt, Publizistik (wie Anm. 10), S. 44, in den Jahren 1085 bis 1088 erfolgt, einzelne Teile seien, so ebd., S. 35, bereits vor Gregors VII. Tod am 25. Mai 1085 entstanden, die hier paraphrasierte Stelle 6.6 nach Seyffert, S. 558, Anm. 263, bereits im April 1084. Benzonis Albensis lib. 7 Prologus, S. 578, Z. 2–18, nach Seyffert, Einleitung, S. 18, im Frühjahr 1084 geschrieben, berichtet dann im Einzelnen, wie das iustum iudicium (Z. 3) zustande kam (dazu unten Anm. 49); zur Sache vgl. Ziese, Wibert (wie Anm. 6), S. 89 f. Liber de unitate ecclesie conservanda, hg. von Wilhelm Schwenkenbecher, MGH Ldl 2, Hannover 1892, S. 173–284, lib. 2.17, S. 232, Z. 24–31, bzw. von Schmale-Ott, Schriften (wie Anm. 20), S. 272–378, S. 436, verortet sich zeitlich 1092, nämlich acht Jahre nach, so Z. 25– 27, Hildebrands Flucht oder der consecratio Wigberdi in pontificem sedis apostolicae oder der ordinatio Henrichi […] quando factus est imperator. Hinsichtlich der Abfassung aller drei Bücher in den Jahren zwischen 1091 und 1093 herrsche nach Schmale-Ott, Einleitung, S. 34, heute Übereinstimmung. Die leicht greifbaren Wiberti antipapae Epistolae, hg. von Jacques-Paul Migne, Patrologia Latina 148, Paris 1853, Sp. 827–842, besitzen in ihrer Mehrzahl, wohl überlieferungsbedingt, keine (vollständigen) Datierungen: Nr. 2, Sp. 828–830 (1085 zugewiesen); Nr. 4, Sp. 831 f. (1086 zugewiesen); Nr. 5, Sp. 832–836 (1089 zugewiesen); Nr. 6, Sp. 836–838 (1089 zugewiesen); Nr. 9, Sp. 840 f. (1097 zugewiesen); und Nr. 10, Sp. 841 f. (1097/98 zugewiesen); hingegen zählt Nr. 3, Sp. 830 f. (1086 Februar 27), nur Heinrichs Kaiser-, nicht aber Clemens’ Pontifikatsjahre. Lediglich drei weitere Urkunden besitzen vollständige Datierungen: Nr. 1, Sp. 828C, legt den 7. März 1084 in das dritte Jahr von Clemens’ Ordination, was auf eine gelehrte Rekonstruktion einer solchen in Brixen hindeutet. Hingegen setzt Nr. 6, Sp. 839D, den 19. Januar 1091 in das siebte Pontifikatsjahr und Nr. 8, Sp. 840D, den 13. Juni 1092 in das
Im Schlagschatten von Canossa 1077: Brixen 1080
89
hatte der im Umkreis Wiberts von Ravenna wirkende Bischof Wido von Ferrara bei der Darstellung von Brixen in Bezug auf seinen Metropoliten das Wort eligere tunlichst vermieden.24 Ja mehr noch, der unterschätzte Benzo von Alba erinnerte sich an Brixen 1080, dem er selbst krankheitshalber fernblieb, als den Ort und Zeitpunkt, an dem Heinrich IV. über seinen Romzug beraten ließ25 – was nicht nur eine Überschreibung des Gedächtnisses sein dürfte. Denn der dem Ereignis völlig fernstehende Ostsachse Bruno erkannte, dass sich Heinrich IV. in Brixen 1080 eine Handlungsalternative offenließ. Auch wenn der Ostsachse diese Handlungsalternative gleich wieder ins Negative gegen den gehassten König kehrte, sollte sie doch hier einmal kurz bedacht werden: entweder Gregor durch vorgespielte Demut zum Einlenken zu bringen oder Gregor mit tyrannischer Gewalt von dem apostolischen Stuhl zu vertreiben.26 Streicht man Brunos parteigebundene Gehässigkeit, also die Worte ‚vorgespielt‘ und ‚tyrannisch‘, dann hielt sich Heinrich IV. in Brixen zwei Möglichkeiten offen: den Verhandlungsweg oder das ordentliche Gerichtsverfahren.
24
25
26
neunte Pontifikatsjahr, mithin gehen nur diese beiden Urkunden von dem tatsächlichen Amtsantritt am 24. März 1084 aus, was, wenn sie ihn überhaupt beachteten, auch zeitgenössische Urkundenschreiber taten, dazu unten Anm. 77. „Daß der Akt von Brixen nicht konstitutiv für Wiberts Papsttum war, unterstreicht“ Heidrich, Ravenna (wie Anm. 44), S. 53 f., 56–58 und 159 f., „aufgrund des kanzleimäßigen Befunds“, so Struve, Salierzeit (wie Anm. 6), S. 316 f., Anm. 115. Wenn Widonis episcopi Ferrariensis De scismate Hildebrandi liber, hg. von Roger Wilmans/ Ernst Dümmler, MGH Ldl 1, Hannover 1891, S. 529–567, lib. 1.20, S. 548, Z. 21–23, mitteilt, apud Brixiam Noricam praefatus Heinricus rex, universis quos habere potuit adscitis episcopis, W[ibertum] Ravennatem episcopum in apostolatum promovit, ist zu bedenken, dass Wido in seinem ersten Buch die Ansichten der gregorianischen Gegenseite referiert, die er dann in dem zweiten Buch widerlegt, vgl. Jörg W. Busch, Certi et veri cupidus. Die Behandlung geschichtlicher Zweifelsfälle und verdächtiger Dokumente um 1100, um 1300 und um 1475. Drei Fallstudien (Münstersche Mittelalter-Schriften 80) München 2001, S. 73; zur Entstehung des Textes vor dem 24. Mai 1086 vgl. ebd., S. 51 f., Anm. 23. Benzonis Albensis libri (wie Anm. 21), lib. 6 Praefatio, S. 500, Z. 14–16: Celebravit proinde generalem conventum cum suis satrapis, scilicet Suevis et Italicis, penes Brixanorium tractans cum eis de suo itinere ad Romanum solium. Die Abwesenheit wegen Fuß- und Augenleidens bezeugt Benzonis Albensis lib. 4.40 (11), S. 422, Z. 10–12, ebenso lib. 6.2a, S. 530, Z. 10 f., vgl. Seyffert, Einleitung, ebd., S. 8. Brunonis Liber de bello Saxonico, hg. von Hans-Eberhard Lohmann (MGH Dt. MA 2) Leipzig 1937, c. 126, S. 118, Z. 25–32, bzw. von Franz-Josef Schmale, in: Quellen zur Geschichte Kaiser Heinrichs IV. (wie Anm. 4), S. 192–404, S. 394, Z. 29–36: Heinricus exrex Italiam disponebat ingredi, ut imponeret aliquem finem rerum suarum longo labori, scilicet ut vel, domino papa Gregorio humiliatione ficta placato sive vi tyrannica coacto, vincula banni, quibus erat ligatus, exueret vel, quod magis volebat, Gregorio per vim de sede pontificatus eiecto et in ipsa sede Wiperto Ravennate collocato, qui iam per triennium iuste fuerat excommunicatus, libere faceret omnia, quae suae tyrannidi placerent, cum de sede apostolica omnis suae voluntatis favorem haberet. Sicher ist nach Schmale, Einleitung, S. 29, nur, „daß Bruno sein Buch nach dem 26. Dezember 1081“, der Erhebung Hermanns von Salm, „beendet und vor dem 11. oder 12. Januar 1093, dem Todestag Werners von Merseburg, diesem überreicht haben muß“, bei Wattenbach/Holtzmann/Schmale, Geschichtsquellen 2 (wie Anm. 15), S. 592, ist das Werk im Jahr 1082 geschrieben worden.
90
Jörg W. Busch
Der Salier mochte kein besonders sympathischer Mensch sein, doch ein Dummkopf war er gewiss nicht. Heinrich mochte in seiner Jugend politische Fehler begangen haben, doch kann ausgeschlossen werden, dass er den gleichen Fehler zweimal beging, nämlich aus weiter Ferne einen römischen Bischof seines Amtes entheben zu wollen. Damit war die Wormser Versammlung vom Januar 1076 eindeutig gescheitert27 und doch drängten vielleicht schon im März 1080 in Italien28, an Ostern in Bamberg29 und ganz gewiss an Pfingsten in Mainz30 wiederum Bischofsversammlungen und einzelne Bischöfe31 darauf, einen würdigeren als Hildebrand auf 27
28
29
30
31
Das Wormser Absageschreiben als Anhang A von Heinrici IV. Epistolae (wie Anm. 4), MGH Dt. MA 1, S. 65–68 = FStGA 12, S. 470–474, sowie die begleitenden und folgenden Heinrici IV. Epistolae 10–12, MGH Dt. MA 1, S. 12–17 = FStGA 12, S. 60–66, lösten jene Krise aus, die allgemein bekannt ist, weil sie nach dem unterschiedlich bewerteten ‚Canossa‘ führte, dazu Anm. 1. Nur Bonizonis Liber (wie Anm. 16), lib. 9, S. 612, Z. 20–26, berichtet von der Rückreise der in Rom abgewiesenen Gesandten Heinrichs IV., legt dabei Z. 20–24 das Schwergewicht nicht etwa, was anzunehmen ist, auf ihren Bericht über die jüngste Entwicklung und die Erörterung der daraus zu ziehenden Konsequenzen, sondern vielmehr auf ihren Versuch, die Toskana dem Einfluss der Mathilde von Canossa zu entziehen (was als eine Konsequenz anzusehen ist), und erwähnt Z. 25 f. nur knapp, sie hätten omnes principes Longobardorum ad colloquium […] apud Brixianorium, diviso regno et sacerdotio, eingeladen. Eine Bamberger Versammlung süddeutscher Bischöfe, die Gregor VII. am 12. April 1080, an Ostern, den Gehorsam aufsagten, bezeugt nur Gebehardi Salisburgensis archiepiscopi Epistola ad Herimannum Mettensem episcopum data, hg. von Kuno Francke, MGH Ldl 1, Hannover 1891, S. 261–279, c. 15, S. 270, Z. 9–13, bzw. von Schmale-Ott, Schriften (wie Anm. 20), S. 120–172, S. 142. Die Mainzer Versammlung von 19 Bischöfen am 31. Mai 1080, an Pfingsten, wird durch das Brixener Synodaldekret (wie Anm. 4), MGH Dt. MA 1, S. 71 f., Z. 27 f. = FStGA 12, S. 480, Z. 16 f., bezeugt. Nach Aussage eines Teilnehmers, Huzmann von Speyer, in einem Brief an den Episkopat und die Großen der Lombardei habe man in Mainz beschlossen, ut Hildebrandus […] Deo opitulante omnimodis abdicetur; aliusque dignior illo in sedem apostolicam eligatur, Codex Udalrici 60, hg. von Philipp Jaffé, Monumenta Bambergensia (Bibliotheca rerum Germanicarum 5) Berlin 1869, S. 17–469, S. 126 f., auch abgedruckt von Ludwig Weiland, MGH Const. 1, Hannover 1893, S. 117–118, Nr. 69, das Zitat S. 118, Z. 15–18, paraphrasiert von Gerold Meyer von Knonau, Jahrbücher des Deutschen Reiches unter Heinrich IV. und Heinrich V. 1–7 (Jahrbücher der deutschen Geschichte 14, 1–7) Leipzig 1890–1909, 3, S. 278 f.; zum Überlieferungsträger vgl. Wattenbach/Holtzmann/Schmale, Geschichtsquellen 2 (wie Anm. 15), S. 439–442, und 3, S. 137 f. Der Mainzer Beschluss, ut Hildebrandus […] abdicetur, den Huzmann von Speyer (wie Anm. 30) mitteilte, könnte strenggenommen zunächst ‚nur‘ bedeuten, Hildebrand den Gehorsam aufzukündigen. Eine solche Gehorsamsaufkündigung überliefert Codex Udalrici 61, hg. von Jaffé, Monumenta Bambergensia (wie Anm. 30), S. 127–129 bzw. paraphrasiert von Gerold Meyer von Knonau, Jahrbücher (wie Anm. 30), 3, S. 279 f., aus der Feder des Trierer Elekten Egilbert, der es zwar einleitend S. 128 Wahnsinn nannte, gegen den Petrusstellvertreter vorzugehen, dann aber herausstellte, welche schändliche Vergehen der Schismatiker im allgemeinen und S. 129 im Besonderen begangen habe, ihm dem rechtmäßig Gewählten die Weihe zu verweigern. Während Egilbert mittelbar einen neuen Papst verlangte, indem er dem gegenwärtigen ausdrücklich den Gehorsam aufkündigte, hatte die Mainzer Versammlung nach Huzmann von Speyer die Wahl eines würdigeren beschlossen. Zu einer solchen forderte Egilberts Suffragan Theoderich von Verdun alle geistlichen und weltlichen Großen des römischen Rei-
Im Schlagschatten von Canossa 1077: Brixen 1080
91
den apostolischen Stuhl zu setzen, nachdem dieser auf der Fastensynode 1080 eindeutig für Heinrichs Schwager und Gegner Rudolf von Rheinfelden Partei genommen und Heinrich erneut aus der Altargemeinschaft ausgeschlossen hatte.32 Die oberitalienischen Bischöfe, die wie Rudolfs Anhänger 1077 den Friedensplan von Canossa zunichte gemacht hatten33, werden auch nach der Fastensynode 1080 darauf gedrängt haben, gegen den verhassten Hildebrand vorzugehen.34 Doch Heinrich IV. musste sich erst seines verfeindeten Schwagers erwehren35, wollte aber die lombardischen Bischöfe nicht wie 1076 alleine ‚im Regen stehen‘ lassen36, der sich in Form römischer Strafen über sie ergossen hatte, gab daher dem Drängen seiner Bischöfe nach und berief die Versammlung in dem sozusagen zwischen beiden Reichen gelegenen Brixen ein, um die Lombarden einzubinden37: Alle Anschuldigungen gegen Hildebrand kamen zur Sprache38 und das Urteil schien eindeutig. Und
32
33 34
35
36
37 38
ches auf, weil Hildebrands Verbrechen offenbar seien, seine Verdorbenheit ihn verdamme und seine hartnäckige Schlechtigkeit ihn verfluche, überliefert Codex Udalrici 62, hg. von Jaffé, Monumenta Bambergensia (wie Anm. 30), S. 129 f. bzw. paraphrasiert von Gerold Meyer von Knonau, Jahrbücher (wie Anm. 30), 3, S. 280 f. Gregorii VII. Registrum 7.14a, c. 7, hg. von Erich Caspar (MGH Epp. sel. 2, 1–2) Berlin 1920– 1923, S. 483–487, bzw. von Franz-Josef Schmale, Ausgewählte Briefe Papst Gregors VII. (Quellen zum Investiturstreit 1 = Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters – FStGA 12a) Darmstadt 1978, S. 332–338, Nr. 107, darin MGH S. 486, Z. 22 – S. 487, Z. 3 = FStGA S. 338, die Parteinahme für Rudolf und zuvor MGH S. 486, Z. 11–20 = FStGA S. 336/338, Heinrichs Ausschluss aus der Altargemeinschaft, die Wegnahme seiner Herrschaft und die Treueidlösung. Vgl. Fried, Pakt (wie Anm. 1), S. 190 mit Anm. 123. So habe Bischof Dionysius von Piacenza Heinrich IV. in Brixen zu dem Eid gedrängt, von keinem anderen als Wibert von Ravenna die Kaiserkrone zu empfangen, weiß allein Bonizonis Liber (wie Anm. 16), lib. 9, S. 613, Z. 7–9, worauf wohl Robinson, Henry IV (wie Anm. 8), S. 199, die Feststellung gründet, der Antrieb zu den radikalen Maßnahmen der Brixener Synode sei von Gregors VII. lombardischen Gegnern gekommen. Denn dass Heinrich IV. seines Schwagers Herr werden würde, war im Juni 1080 nicht ausgemacht, und tatsächlich verlor der Salier am 15. Oktober 1080 wieder einmal die Entscheidungsschlacht, sein Konkurrent aber das Leben, vgl. Althoff, Heinrich IV. (wie Anm. 12), S. 173–177; Boshof, Salier (wie Anm. 8), S. 245 f.; oder Weinfurter, Canossa (wie Anm. 8), S. 180–183. Huzmann von Speyer machte dies in seinem Schreiben an die Lombarden ganz deutlich, indem er für sich und seine Mitbischöfe selbstkritisch einräumte, sich früher (gemeint ist 1076) im sicheren Hafen gehalten zu haben, während die lombardischen Mitbrüder abgestraft wurden, vgl. Jaffé, Monumenta Bambergensia (wie Anm. 30), S. 127 bzw. MGH Const. 1, Nr. 69, S. 118, Z. 18–20, und übers. von Gerold Meyer von Knonau, Jahrbücher (wie Anm. 30), 3, S. 279. So verweist das Brixener Synodaldekret (wie Anm. 4), MGH Dt. MA 1, S. 71, Z. 27 – S. 72, Z. 1 = FStGA 12, S. 480, Z. 16 f., ausdrücklich darauf, dass die Versammelten sich in Einklang mit denjenigen sahen, die am 31. Mai 1080, an Pfingsten, in Mainz versammelt waren. Die meisten Anschuldigungen im Brixener Synodaldekret (wie Anm. 4), MGH Dt. MA 1, S. 70, Z. 16 – S. 71, Z. 3 = FStGA 12, S. 478, Z. 1–17, aus der Zeit vor 1073; MGH S. 71, Z. 4–19 = FStGA S. 478/480, Z. 17–8, den unrechten Introitus und MGH S. 71, Z. 19–25 = FStGA S. 480, Z. 8–14, die verderbliche Amtsführung betreffend sowie MGH S. 72, Z. 2–7 = FStGA S. 480, Z. 18–23, noch einmal stichwortartig zusammengefasst, waren in gregorkritischen Kreisen weithin bekannt und kehren, worauf Tilman Struve, Die Salier und das römische
92
Jörg W. Busch
doch, wie der Überrest von Brixen zeigt, nahm jemand am 25. Juni 1080 den Deckel von dem Topf, der überzukochen drohte: Hildebrandum […] iudicamus canonice deponendum39 „wir verkünden das interlokutorische Urteil, dass Hildebrand in einem dem Kirchenrecht entsprechenden Verfahren abgesetzt werden muss“.
Gegen die hier vorgenommene Deutung der vier entscheidenden Worte im Brixener Synodaldekret wird sich von verschiedenen Seiten Widerspruch erheben: 1. werden die Rechtshistoriker einwenden, dass der römisch-kanonische Prozess im Juni 1080 noch nicht einmal in seinen Kinderschuhen steckte40, mithin dürfe man iudicamus nicht mit „wir verkünden das interlokutorische Urteil“ übersetzen, 2. werden die Diplomatiker einwenden, dass Heinrich IV. in seiner Urkunde Nummer 322 vom 26. Juni 1080 den Empfänger Erzbischof Wibert von Ravenna summae sedis electus apostolicus nennen ließ41, mithin habe der Salier bereits im Eisacktal eindeutig Partei genommen, und 3. werden die der Ereignisgeschichte nachspürenden Historiker, so es sie überhaupt noch gibt, einwenden, dass Heinrich IV. auf der Fastensynode 1080 Gregor VII. das Ultimatum stellen ließ, entweder unterstütze dieser ihn gegen seinen Schwager Rudolf oder er werde sich einen anderen Papst suchen42, mithin habe Heinrich nach Gregors offener Parteinahme für Rudolf folgerichtig diesen anderen Papst in Brixen gefunden.43 Doch liefert der zweite Einwand der Diplomatiker entgegen dem ersten Anschein sogar einen Überrest, der für die hier vorgenommene Deutung der vier entscheidenden Worte im Brixener Synodaldekret spricht: Denn das Diploma Heinrici quarti 322 ist, obwohl es den Besitz von Wiberts Ravennater Kirche bestätigte, nie vollzo-
39 40 41 42 43
Recht. Ansätze zur Entwicklung einer säkularen Herrschaftstheorie in der Zeit des Investiturstreites (Akademie der Wissenschaften und Literatur. Abhandlungen der Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Klasse 1999, 5) Mainz/Stuttgart 1999, S. 50, Anm. 157, verweist, wieder, als sich ein einzelner (dazu unten Anm. 70) berufen sah, eine umfangreiche Anklageschrift zu verfassen, nämlich in Petri Crassi Defensio Heinrici IV. regis, hg. von Lothar von Heinemann, MGH Ldl 1, Hannover 1891, S. 432–453, c. 5–7, S. 441–452, bzw. von Schmale-Ott, Schriften (wie Anm. 20), S. 174–238, S. 196–234. Brixener Synodaldekret (wie Anm. 4), MGH Dt. MA 1, S. 72, Z. (2)7 = FStGA 12, S. 480, Z. (18)23. Vgl. Steffen Schlinker, Die prozessuale Funktion der sententia interlocutoria im spätmittelalterlichen gelehrten Zivilprozess, in: ZRG KA 96, 2010, S. 152–185. Heinrici IV. Diploma 322, hg. von Dietrich von Gladisz/Alfred Gawlik (MGH DD 6, 2) Weimar 1959, S. 422–424. Zu dem einzigen Zeugen für dieses Ultimatum unten Anm. 63. Sowohl Althoff, Heinrich IV. (wie Anm. 12), S. 168, wie auch Fried, Canossa (wie Anm. 1), S. 145, vertrauen dem einzigen Zeugen für Heinrichs Ultimatum, erster sieht „die singuläre Nachricht (dadurch gestützt), daß es nur wenige Monate dauerte, bis […] (Heinrich) […] tatsächlich in Brixen Gregor absetzen ließ“.
Im Schlagschatten von Canossa 1077: Brixen 1080
93
gen und besiegelt worden, es hat also nie Rechtskraft erlangt.44 Mochten die Bischöfe an Ostern, an Pfingsten und im Juni 1080 vehement einen neuen Papst fordern45, mochten sie in Wibert von Ravenna des Königs electus sehen, so nahm doch ein anderer als der Stilist des Diploms 322 den Deckel von dem Topf, der überzukochen drohte, und riet dazu, das Diplom nicht zu vollziehen. War dieser Jemand etwa Wibert selbst, der bis zu seiner Inthronisation am 24. März 1084 mit keiner Silbe behauptete, er sei der electus des römischen Stuhles46, der sich vielmehr auf sein von Gregor bestrittenes Amt in Ravenna konzentrierte47, der allerdings auch aktiv Heinrichs Versuche unterstützte48, überhaupt nach Rom zu gelangen? Erst dort in Rom im März 1084 fand das kanonische Verfahren gegen Hildebrand statt, erst dort sprach eine Bischofsversammlung das Urteil über den Angeklagten, weil er sich dem Gericht nicht stellte.49 Von daher gewinnt das Dekret vom Juni 1080 den Charakter einer interlocutio, eines ‚Zwischenbescheids‘ oder ‚Zwi44
45 46
47 48 49
Vgl. den diplomatischen Kommentar zu Heinrici IV. Diploma 322 (wie Anm. 41), S. 422, und zu seiner Bedeutung für Wibert vgl. Ingrid Heidrich, Ravenna unter Erzbischof Wibert (1073– 1100). Untersuchungen zur Stellung des Erzbischofs und Gegenpapstes Clemens III. in seiner Metropole (VuF Sonderband 32) Sigmaringen 1984, S. 57. Die einzige, bislang bekannte Privaturkunde, die Wibert am 16. Mai 1084 papa electus nennt (vgl. das Regest ebd., S. 181, Nr. 47), gehört nach ebd., S. 57, Anm. 88, unmittelbar vor Wiberts Inthronisation, weil der Notar madii für marcii verschrieben haben dürfte. Dazu oben Anm. 28–31. Mit ihrer Analyse der Ravennater Überlieferung sieht Heidrich, Ravenna (wie Anm. 44), S. 159 f. und 163, hinsichtlich der Einschätzung von Brixen und Wiberts konsequenter Negierung, electus apostolicus zu sein, die Ergebnisse von Ziese, Wibert (wie Anm. 6), S. 62 und 76 f., bestätigt. Auf die von einer weitgehenden damnatio memoriae verschleierte italienische Überlieferung zu Papst Clemens III. blickt jüngst D’Acunto, Schisma (wie Anm. 6), S. 85 f. zur Streitschriftenliteratur und S. 87–93 zu den Urkunden der reichsitalienischen Kirchen, auf die „ein wahrhafter archivalischer Kahlschlag verübt wurde“. Ihm voran ging die Behandlung von Wiberts Leichnam, vgl. Kai-Michael Sprenger, Der tote Gegenpapst im Fluss – oder wie und warum Clemens (III.) in den Tiber gelangte, in: Müller/Hotz, Gegenpäpste (wie Anm. 6), S. 97–125. Vgl. Ziese, Wibert (wie Anm. 6), S. 64–73. Vgl. ebd., S. 74–76 und 80 f. Der einzige Zeuge für das Verfahren (so auch Stoller, Councils [wie Anm. 9], S. 279–287) schrieb seine, so Ziese, Wibert (wie Anm. 6), S. 90, Anm. 51, „poetisch volltönende und parteiische“ Darstellung allerdings bereits im Folgemonat nieder (dazu oben Anm. 21), so dass Benzonis Albensis libri (wie Anm. 21), lib. 7 Prologus, S. 578, Z. 2–18, eine nicht allzu sehr verformte Erinnerung über den Ablauf wiedergibt: Danach sei eine Ladung an den Angeklagten vor eine Synode erfolgt (Z. 7–9), der sich dieser hartnäckig widersetzt hätte (Z. 5–7), wiewohl er dort die Möglichkeit gehabt hätte, sich mit Schriftbeweisen zu verteidigen (Z. 10–12). Drei Tage habe die Synode gewartet (Z. 13 f., was wohl eine mehrmalige Ladung andeuten soll), bevor wegen Säumnis wiederum schriftgestützt die Verurteilung erfolgt sei (Z. 15–18). Ebenso sieht Heinrici IV. Epistola 18 (wie Anm. 4), MGH Dt. MA 1, S. 27–29, S. 28, Z. 7 = FStGA 12, S. 82/84, S. 84, Z. 7, am Ende des Verfahrens ein legale omnium cardinalium ac totius populi Romani iudicium. Doch erst gut zwei Jahrzehnte später weiß Sigeberti Chronicon (wie Anm. 7), S. 364, Z. 47 – S. 365, Z. 2, zu berichten, dass die Verurteilung wegen ‚crimen laesae maiestatis‘ erfolgte, was allerdings zutreffen könnte, weil seit Mitte des 11. Jahrhunderts „die Kriminalisierung von Angriffen auf die Person des Herrschers als Majestätsverbrechen“ zu beobachten ist, wie Struve, Salier (wie Anm. 38), S. 12–19, zeigt.
94
Jörg W. Busch
schenurteils‘, mag auch der erste Einwand der Rechtshistoriker zutreffen, dass der römisch-kanonische Prozess 1080 noch nicht in der Welt war und der Begriff „interlokutorisches Urteil“ 1080 noch in den Textzeugen des römischen Rechts schlummerte50, so lassen sich doch Belege finden, dass man iudicare vor 1080 keineswegs nur für das ‚Aussprechen eines Endurteils‘ gebrauchte, sondern auch für die ‚Anordnung eines weiteren Verfahrensschrittes‘.51 Wer in Brixen im Juni 1080 nicht von Hass umnebelt war, musste erkennen, dass es dort im Eisacktal ein großes Hindernis gab, um ein dem Kirchenrecht gemäßes Verfahren gegen Hildebrand durchzuführen. Derjenige, der die Worte Hildebrandum […] iudicamus canonice deponendum formulierte, sah – wie schon einige Besonnene unter den aufgebrachten Bischöfen auf der Wormser Versammlung im Januar 1076 – dieses Hindernis sehr deutlich: der Angeklagte, der Beschuldigte, war nicht anwesend.52 Um diesen entscheidenden Verfahrensfehler zu erkennen53, musste der Stilist des ‚Zwischenurteils‘ nicht einmal zu jenen oberitalienischen Rechtspraktikern gehören, die von den 1070er Jahren an tastend die ‚Bologneser Renaissance‘ des römischen Rechts grundlegten.54 Vielmehr konnte jeder diesen 50
51 52 53
54
Zum Prozess oben Anm. 5 und 40. „[I]m römischen Recht […] ist die interlocutio jedes Zwischenurteil in Verfahrensfragen, z. B. gemäß D 49,5,2, C 2,11(12),17 und C 7,45,9. Die interlocutio ist gemäß D 42,1,14 abänderlich, während dies bei der sententia definitiva nach D 42,1,42 + 46 und C 7,43,3 nicht der Fall ist“, so Hermann Dilcher, Die sizilische Gesetzgebung Kaiser Friedrichs II. Quellen der Constitutionen von Melfi und ihrer Novellen (Studien und Quellen zur Welt Kaiser Friedrichs II. 3) Köln/Wien 1975, S. 161 zu LA 1.35, womit eine Rezeption des römisch-kanonischen Prozesses im 13. Jahrhundert wenigstens erwähnt sei. J. F. Niermeyer, Lexicon Mediae Latinitatis Lexicon minus, Leiden 1984, S. 563 f., führt zwei Nachweise, nach denen man im Regnum Italicum unter iudicare 825 und im 10. Jahrhundert „to ordain by an interlocutory sentence“ verstand. So Zimmermann, Wurde Gregor (wie Anm. 9), S. 126, der herausarbeitet, dass die Wormser Versammlung keine Depositionssentenz fällte, sondern eine „Aufforderung zur Selbstabsetzung“ formulierte (ebd., S. 124). In dem angeblich aus der Spätantike stammenden Grundsatz prima sedes a nemine iudicatur (vgl. Zimmermann, Papstabsetzungen [wie Anm. 9], S. 2) sahen die in Brixen Versammelten kein Verfahrenshindernis, denn ihre Prozessstrategie machten sie bereits – worauf dankenswerterweise Ernst-Dieter Hehl in der Diskussion hinwies – deutlich mit dem Namen, den sie dem abwesenden Angeklagten beilegten: denn wer als Hildebrand, wie dann in seiner Anwesenheit canonice festzustellen wäre, überhaupt nicht rechtmäßig Papst war (dazu oben Anm. 4 und 38), konnte, ohne den zitierten Grundsatz zu verletzen, aus dem angemaßten Amt entfernt werden. Johannes Fried, Die Entstehung des Juristenstandes im 12. Jahrhundert. Zur sozialen Stellung und politischen Bedeutung gelehrter Juristen in Bologna und Modena (Forschungen zur neueren Privatrechtsgeschichte 21) Köln/Wien 1974, S. 24–46, bietet Belege für solche Rechtspraktiker, iudex und causadicus genannt, im 11. Jahrhundert. Zu diesen Kennern „des eben“ (1077) „seiner Erneuerung zugeführten römischen Rechts“ (so ders., Canossa [wie Anm. 1], S. 125) vgl. dens., „… auf Bitten der Gräfin Mathilde“. Werner von Bologna und Irnerius – mit einem Exkurs von Gundula Grebner, in: Klaus Herbers (Hg.), Europa an der Wende vom 11. zum 12. Jahrhundert. Beiträge zu Ehren von Werner Goez, Stuttgart 2001, S. 171–206, S. 198 f., und am Beispiel eines Klosterortes Jörg W. Busch, Der Liber de Honore Ecclesiae des Placidus von Nonantola. Eine kanonistische Problemerörterung aus dem Jahre 1111. Die Arbeitsweise ihres Autors und seine Vorlagen (Quellen und Forschungen zum Recht im Mittelalter 5) Sigmaringen 1990, S. 28–30. Die in ‚vorbologneser Zeit‘ in Italien erkennbaren Versuche, das all-
Im Schlagschatten von Canossa 1077: Brixen 1080
95
entscheidenden Verfahrensfehler benennen, der mit dem überkommenen Kirchenrecht vertraut war. Denn das weitverbreitete Dekret des traditionellen Reichsbischofs Burchard von Worms gebot in seinem 16. Buch über Ankläger und Zeugen ganz eindeutig, „dass kein Abwesender verurteilt werde“55, mochte auch der zugrundeliegende Rechtssatz aus der Feder des Pseudoisidor geflossen sein56, so war er doch in Reginos „Sendhandbuch“ gleichsam festgeklopft.57 Mochten die Anklagen noch so schwerwiegend und die vorgetragenen Beweise noch so erdrückend sein58, am 25. Juni 1080 fehlte schlicht der Angeklagte, um ein rechtskräftiges Endurteil sprechen zu können.59 In Abwesenheit eine endgültige Entscheidung zu fällen, aber hätte den Angeklagten der Möglichkeit beraubt, sich zu verteidigen. Damit hätten die Brixener Synodalen genau das getan, was königstreue Publizisten Gregor VII. vorwarfen, nämlich ein Endurteil über Heinrich IV. ohne richterliches Gehör zu fällen.60 Selbst wenn, und das betrifft nun den dritten
55
56 57
58
59
60
mählich Wiedergewonnene in den Dienst der Herrschaftslegitimation zu stellen, behandelt Struve, Salier (wie Anm. 38). Burchardi Wormatiensis episcopi Decretorum libri viginti (Paris 1549), nachgedruckt von Jacques-Paul Migne, Patrologia Latina 140, Sp. 537–1053, 16.13, Sp. 911C, bzw. der ergänzte Neudruck der Editio Princeps Köln 1548, hg. von Gérard Fransen/Theo Kölzer, Aalen 1992, fol. 170va. Ps.Zepherinus, hg. von Paul Hinschius, Decretales pseudoisidorianae et capitula Angilramni, Leipzig 1863, ND Aalen 1963, c. 4, S. 131, Z. 21 f.: Nemo absens iudicetur: quia humanae et divinae hoc prohibent leges. Reginonis abbatis Prumiensis Libri duo de synodalibus causis et disciplinis ecclesiastis, hg. von F. G. A. Wasserschleben, Leipzig 1840, 2.306, S. 333, bzw. in Auswahl von Winfried Hartmann, Das Sendhandbuch des Regino von Prüm (Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters – FStGA 42) Darmstadt 2004, S. 392. Theoderich von Verdun drückte in seinem Brief an alle geistlichen und weltlichen Großen des römischen Reiches die Überzeugung aus: Vita sua accusat illum, perversitas dampnat, obstinatio maliciae illum anathematizat, überliefert Codex Udalrici 62, hg. von Jaffé, Monumenta Bambergensia (wie Anm. 30), S. 130, bzw. übersetzt von Gerold Meyer von Knonau, Jahrbücher (wie Anm. 30), 3, S. 281. Zu den Anschuldigungen der Brixener Synode oben Anm. 38. Im unmittelbaren Anschluss an den Anm. 55 zitierten Kanon meint Burchardi Decretum 16.14 (wie Anm. 55), Sp. 911C bzw. fol. 170va, Papst Hadrian anzuführen, dass Richter sich hüten sollen, gegen Abwesende zu verhandeln und zu urteilen, tatsächlich zitiert sind die Capitula Angilramni, hg. von Hinschius, Decretales (wie Anm. 56), c. 49, S. 766; auf heinrizianischer Seite ziehen diesen Kanon heran Petri Crassi Defensio (wie Anm. 38), c. 7, S. 447, Z. 3 f. = FStGA 12b, S. 214, und das Decretum Wiberti vel Clementis papae, hg. von Ernst Dümmler, MGH Ldl 1, Hannover 1891, S. 621–626, S. 622, Z. 33 f. Weiter bieten die Capitula Angilramni, c. 1bis, S. 766, eine Verfahrensregel, die Burchardi Decretum 16.6 (wie Anm. 55), Sp. 910C bzw. fol. 170ra, ebenfalls Papst Hadrian zuschreibt und die so in Brixen 1080 nicht völlig eingehalten werden konnte, dass nämlich ein Endurteil erst zu sprechen sei, nachdem der Beklagte sich schuldig bekannt habe oder durch Zeugen überführt sei. Vgl. Mirbt, Publizistik (wie Anm. 10), S. 147 f., zu der Kritik, die Verteidiger Heinrichs IV. an den ‚Verfahrensfehlern‘ bei der zweiten Exkommunikation durch Gregor VII. übten. Davon sei nur, weil die wohl 1083/84 verfasste ‚Anklageschrift‘ hier des Öfteren herangezogen ist, verwiesen auf Petri Crassi Defensio (wie Anm. 38), c. 7, S. 446, Z. 40 f. (Verweigerung richterlichen Gehörs), S. 446, Z. 43 – S. 447, Z. 3 (fehlende Anwesenheit des Angeklagten und rechtmäßiger Ankläger), S. 447, Z. 15 (Vorbringen erfundener Anschuldigungen), Z. 25 f. (Ankläger, Zeuge und Richter in einer Person) und Z. 38 f. (fehlender Beweis) = FStGA 12b,
96
Jörg W. Busch
Einwand, Heinrich IV. oder ohne sein Wissen seine Gesandten Gregor VII. auf seiner Fastensynode 1080 vor die Wahl gestellt haben sollten, entweder den Salier gegen seinen Schwager zu unterstützen, was dem Friedensprojekt von Canossa entsprach61, oder sein apostolisches Amt zu verlieren, selbst wenn also die heinrizianische Partei Anfang März Gregors Amtsenthebung in ihr politisches Kalkül gezogen hätte, dann hat sie diese im Juni 1080 nicht vollzogen, vielmehr ein ‚Zwischenurteil‘ verkündet. Dieses aber eröffnete Heinrich IV., darin hatte der Ostsachse Bruno recht, eine Handlungsalternative.62 Doch wie glaubwürdig ist die Nachricht, der Salier hätte Anfang März 1080 Gregor VII. mit der Amtsenthebung drohen lassen? Dafür gibt es nämlich nur einen einzigen Zeugen und das war nicht der Betroffene selbst. Nur der bei anderen Dingen wohlinformierte Gregorianer Bischof Bonizo von Sutri wusste 1085/86 von dem salischen Ultimatum Anfang März 1080 zu berichten63; Gregor selbst schwieg darüber, begründete vielmehr seine überraschende Parteinahme für Rudolf mit Heinrichs Verhalten im Jahr 1079.64 Weil der Betroffene unmittelbar nach dem angeblichen Ultimatum schwieg, liegt der Verdacht nahe, dass der einzige Zeuge, der auch den Juni 1080 mit dem März 1084 überschrieb, in seiner parteiisch verformenden Erinnerung – gerade wenn er als Augenzeuge an der Fastensynode teilgenommen haben sollte – eine klare Entwicklungslinie zog65, beginnend mit der Androhung von Gregors Amtsenthebung Anfang März 1080 über ein Amtsenthebungsurteil am 25. Juni 1080 hin zu dessen Vollstreckung im März 1084. Das entscheidende Zwischenstück in der von Bonizo 1085/86 erinnerten Entwicklung, seine Wiedergabe der Entscheidung von Brixen66, jedoch deckt sich nicht mit dem erhaltenen Überrest: was Bonizo rückschauend als Endurteil von
61 62 63
64 65
66
S. 214/216. Wie Gregor VII. selbst sich ein ordnungsgemäßes Verfahren vorstellte, belegt Mirbt, Publizistik (wie Anm. 10), S. 204–210, aus dessen Briefbuch, vgl. insbes. S. 207, Anm. 2, die dortigen Aussagen, dass die Anwesenheit des fristgerecht geladenen Angeklagten erforderlich sei. An dem Projekt von Canossa hielt Gregor VII., so Fried, Canossa (wie Anm. 1), S. 143, bis in den Sommer 1079 fest, erst auf der Fastensynode 1080 erfolgte, so ebd., S. 146, die den eigenen Erklärungen zuwiderhandelnde Anerkennung Rudolfs. Dazu oben Anm. 26. Bonizonis Liber (wie Anm. 16), lib. 9, S. 612, Z. 13–17. Förster, Bonizo (wie Anm. 11), S. 252, schätzt den „Quellenwert von Bonizos Angaben über den Inhalt der königlichen Botschaft“ (zur Fastensynode 1080) „nicht hoch“ ein, Struve, Salierzeit (wie Anm. 6), S. 108, erscheint die Drohung fraglich, andere (wie Anm. 43) hingegen folgen seinen Angaben; Weinfurter, Canossa (wie Anm. 8), S. 167, stützt sich auf Gregors Begründung (wie Anm. 64) und übergeht das Ultimatum mit Schweigen. Gregorii VII. Registrum 7.14a, c. 7 (wie Anm. 32), MGH Epp. sel. 2, S. 486, Z. 4–10 = FStGA 12a, S. 336. So lassen sich, um die Diskussion mit Johannes Fried, der Bonizo als Augen- und Ohrenzeuge sieht, aufzugreifen, die Überlegungen von Förster, Bonizo (wie Anm. 11), S. 247 f., zu Bonizos „‚geschlossene[r]‘ historische[r] Darstellung[] […] um der ‚höheren Wahrheit willen‘“ fortführen. Ebenfalls zu seiner Argumentationslinie passt, dass Bonizonis Liber (wie Anm. 16), lib. 9, S. 613, Z. 13 f., wissen will, Wibert von Ravenna habe Brixen mit papalia […] indumenta verlassen.
Im Schlagschatten von Canossa 1077: Brixen 1080
97
Brixen ausgab, war tatsächlich ein ‚Zwischenurteil‘, nämlich die Anordnung des nächsten Verfahrensschrittes, wenn der Anklagte dann wirklich anwesend war. Ob also Heinrich IV. Anfang März 1080 wirklich Gregor VII. hat drohen lassen, bleibt völlig ungewiss. Ganz gewiss hingegen ist die ‚Überschreibung‘ von Brixen 1080 durch Rom 1084, die Bonizo von Sutri 1085/86 vornahm und die wirklich eine ‚Überschreibung‘ ist, weil Gregor VII. und die Gregorianer, die sich vor 1084 äußerten, in Brixen natürlich keine Amtsenthebung, sondern nur die Wahl eines Häresiarchen erkennen konnten.67 Eine Erhebung Wiberts von Ravenna, wie sie Gregorianer nach 1084 behaupteten68, fand aber in Brixen nicht statt, sie konnte überhaupt erst stattfinden, nachdem der am 25. Juni 1080 angeordnete Verfahrensschritt im März 1084 gegangen war, doch bis dahin verflossen drei Jahre und neun Monate. Was in dieser langen Zeitspanne geschah, während Heinrich IV. dreimal vergeblich gegen Rom anrannte69, zeigt, dass der Salier die Handlungsalternative zu nutzen versuchte, die ihm ein kluger Kopf am 25. Juni 1080 offenhielt mit der Formulierung Hildebrandum […] iudicamus canonice deponendum. Diese Schritte sind bekannt, sie seien 67
68
69
Nur das Schreiben vom 21. Juli 1080 an Süditaliens Bischöfe, Gregorii VII. Registrum 8.5 (wie Anm. 32), MGH Epp. sel. 2, S. 521–523, S. 522, Z. 29–33 = FStGA 12a, S. 346/348, Nr. 110, S. 348, erwähnt (ohne die Ortsangabe Brixen) ein sathanę conventus, der den Verwüster der Ravennater Kirche W. als antichristus […] et heresiarcha eingesetzt habe. Entsprechend sieht Gebhardi Epistola ad Herimannum, c. 26 (wie Anm. 29), S. 275, Z. 3–11 = FStGA 12b, S. 158, von 1081 auf das namentlich genannte Brixen zurückblickend, dort einen Exkommunizierten, nämlich Wibert, unter dem Namen apostolicus einem apostata angelus gleichgesetzt. Die Schreiben, mit denen Gregor VII. – nach Ziese, Wibert (wie Anm. 6), S. 69 – vergeblich versuchte, den seit 1078 exkommunizierten Wibert in seiner eigenen Diözese durch einen rechtmäßigen Erzbischof namens Richard zu ersetzen, nennen Wibert vor allem den Verderber der Ravennater Kirche, so Gregorii VII. Registrum 8.14 (1080 Dezember 11), MGH Epp. sel. 2.2, S. 534 f., S. 535, Z. 21. Lediglich Registrum 8.12 (1080 Oktober 15), S. 531 f., S. 531, Z. 34– 36 = FStGA 12a, S. 354/356, Nr. 113, S. 354, könnte mit apostolicam sedem […] invadere und Registrum 8.13 (1080 Oktober 15), S. 532–534, S. 533, Z. 25, mit sanctam R. sedem […] invadere auf den Juni 1080 anspielen, doch fehlen beide Male nähere Angaben dazu, während Wiberts verderbliches Wirken in Ravenna eindeutig im Mittelpunkt steht. In diesen Äußerungen sieht Ziese, Wibert (wie Anm. 6), S. 63 f., Gregor VII. eben nicht behaupten, dass Wibert „sich als Papst geriere“, vielmehr werfe Gregor Wibert vor, „den apostolischen Stuhl widerrechtlich an sich zu reißen“. Der 1100 gestorbene Bernold von Konstanz sah gar, die vorherige danach setzend, eine Mainzer Versammlung (dazu Anm. 30) die Brixener electio Wiberts bestätigen: Bernoldi Chronicon, hg. von Ian Stuart Robinson, MGH SS N. S. 14, Hannover 2003, S. 383–540, S. 425, Z. 4–9 mit Anm. 173, bzw. von dems./Helga Robinson-Hammerstein, Bertholds und Bernholds Chroniken (Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters – FStGA 14) Darmstadt 2002, S. 280–432, S. 316 mit S. 317 Anm. 201. Über die Ereignisse zwischen dem Juni 1080 und dem März 1084 berichtet eher episodisch und Sachverhalte zusammenziehend Benzonis Albensis libri (wie Anm. 21), lib. 6 Praefatio, S. 502–520, und aus gregorianischer Sicht Bonizonis Liber (wie Anm. 16), lib. 9, S. 613, Z. 15 – S. 614, Z. 25, wo Heinrichs IV. Erfolg letztlich darauf zurückgeführt wird, dass er S. 614, Z. 15 f., die Römer pecunia et terrore et vi auf seine Seite gezogen habe, was nur schwach die salischen Verhandlungen mit den gregorkritischen Kardinälen (oben Anm. 18) widerscheinen lässt.
98
Jörg W. Busch
auch nur kurz erwähnt, weil es methodisch bedenklich wäre, die Motivation für die Brixener Formulierung aus den späteren Ereignissen abzuleiten. Heinrich IV. legte nämlich den nächsten Verfahrensschritt, der in Brixen angeordnet worden war, in die Hände der Römer70, im Jahr 1081 noch nicht deutlich71 und im Jahr 1082 ganz deutlich ausgesprochen, als der Salier den Römern anbot, sie sollten den schwebenden Fall entscheiden: Falls Gregor in dem apostolischen Amt verbleiben könne, versprach der Salier ihm Gehorsam; falls dieser des Amtes zu entheben sei, sollte im Zusammenwirken von Römern und künftigem Kaiser ein neuer Apostelnachfolger erhoben werden.72 Reine Propaganda, um die noch ihre Stadt verteidigenden Römer auf die eigene Seite zu ziehen, könnte man geneigt sein
70
71
72
Andere sahen sich aufgerufen, das in Aussicht genommene Verfahren vorzubereiten: Petri Crassi Defensio, c. 8 Poema (wie Anm. 38), S. 453, Z. 34 = FStGA 12b, Widmungsgedicht (II), S. 298, erarbeitete wohl zwischen November 1083 und März 1084 seine (Anklage)Schrift, ut prosit ad concilium. Zu dem Werk, das auf das römische Recht zurückgriff, und seinem Verfasser vgl. Struve, Salier (wie Anm. 38), S. 44–53 und 67 f. sowie ebd., S. 45 Anm. 136 zu den Zeitansätzen in der Forschung. Das Manifest an die Römer von 1081, Heinrici IV. Epistola 16 (wie Anm. 4), MGH Dt. MA 1, S. 22 f. = FStGA 12, S. 74/76, betont, der Salier sei in Frieden gekommen, wolle die ihm zustehende Würde erwerben, aber weder den honor Petri schmälern noch die römische res publica umstürzen. Gregor VII. wird namentlich nicht erwähnt, nur abschließend die Erwartung ausgedrückt, collato omnium vestrum [i. e. Romanorum] […] aliorumque fidelium nostrorum consilio diuturna discordia regni et sacerdotii beizulegen (MGH S. 23, Z. 21–23 = FStGA S. 76, Z. 14–16); den Text überliefert Codex Udalrici 66, hg. von Jaffé, Monumenta Bambergensia (wie Anm. 30), S. 138 f. Das Manifest an die Römer von 1082, Heinrici IV. Epistola 17 (wie Anm. 4), MGH Dt. MA 1, S. 24–26 = FStGA 12, S. 76–82, nennt ebenfalls als Grund für Heinrichs Kommen, pax inter regnum et sacerdotium mit Rat der Römer et canonica auctoritate herzustellen (MGH S. 24, Z. 25 f. = FStGA S. 78, Z. 7–9), und fordert die Römer, Kardinäle und Laien auf, Gericht über Hildebrand zu halten. Dieser kann den Ort der Verhandlung wählen (MGH S. 25, Z. 18–20 = FStGA S. 80, Z. 1–3) und werde Eide und Geiseln für freies Geleit erhalten, und zwar unabhängig von dem Ausgang des Verfahrens: sive in sede apostolica retinendus vel deponendus (MGH S. 25, Z. 14–17 = FStGA S. 78, Z. 28–31). Si debet et potest esse apostolicus, nos sibi obędiemus; sin autem, in vestro arbitrio et nostro ęcclesię provideatur alius ęcclesię necessarius (MGH S. 25, Z. 21–23 = FStGA S. 80, Z. 4–6), jedoch wird kein Kandidat für den zweiten Fall vorgegeben, vielmehr fiat discussio in conspectu ęcclesię (MGH S. 26, Z. 9 = FStGA S. 80, Z. 24), auch bestehe für den Angeklagten keine Lebensgefahr, etiam si vestro iudicio et canonum auctoritate privari debet iniuste possessa dignitate (MGH S. 26, Z. 25 f. = FStGA S. 82, Z. 7 f.), denn der Salier suche allein Gerechtigkeit (MGH S. 26, Z. 29 = FStGA S. 82, Z. 11). Zu dem Stilist des Manifests vgl. Jörgen Vogel, Gottschalk von Aachen (Albero C) und Heinrichs IV. Briefe an die Römer, in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins 90/91, 1983/84, S. 55–68. Dieser Kanzleinotar argumentierte erstmals mit dem Zweischwerter- (nicht Zweigewalten-)Gleichnis (Epistola 17, MGH S. 25, Z. 27 = FStGA S. 80, Z. 10) und entgegnete Gregors Anspruch, a nemine iudicare debere, gerade er als servus servorum Dei dürfe den Kleinen Christi kein Ärgernis bieten (MGH S. 26, Z. 12–22 = FStGA S. 80/82, Z. 27–4 mit Berufung auf Mt 18,6). Den Text überliefert nicht der Codex Udalrici, sondern der Londoner Codex 9, in: Epistolae Bambergensis cum aliis monumentis permixtae, hg. von Jaffé, Monumenta Bambergensia (wie Anm. 30), S. 471–536, S. 498–502.
Im Schlagschatten von Canossa 1077: Brixen 1080
99
zu urteilen.73 Doch ein solches Urteil übersähe die Verhandlungen, die Heinrich IV. und Wibert von Ravenna an Ostern, am 24. April, 1082 mit Abt Desiderius von Montecassino führten74, wiewohl Gregor VII. solche gegenüber diesem im Mai 1081 ausgeschlossen hatte.75 Abt Desiderius war kein anderer als der spätere kurzzeitige Nachfolger Gregors VII., Papst Viktor III., der für seine Bemühungen von 1082 später von einem Mitgregorianer scharfe Kritik erfuhr.76 Auch darf nicht übersehen werden, dass der Ravennate Wibert an Ostern 1082 und bei anderen Gelegenheiten mit keiner Silbe darauf beharrte, electus apostolicus zu sein.77 73
74
75
76
77
Jedoch gedenken die meisten Überblicksdarstellungen der Manifeste Heinrichs gar nicht; diejenigen, die sie erwähnen, stellen wie schon Ziese, Wibert (wie Anm. 6), S. 79, heraus, weder 1081 noch 1082 sei eine Vorentscheidung über eine mögliche Neubesetzung des Papststuhles herauszulesen, so Boshof, Salier (wie Anm. 8), S. 247, und Schieffer, Gregor VII. (wie Anm. 8), S. 90 f. Der singuläre Bericht, den die Chronica monasterii Casinensis, hg. von Hartmut Hoffmann (MGH SS 34) Hannover 1980, 3.50, S. 431–433, von den Bemühungen Heinrichs IV., Kontakt aufzunehmen, von seinen Forderungen und den Entgegnungen des Abtes Desiderius sowie dessen Unterredungen mit Salieranhängern liefert, ist nicht in allen Einzelheiten über jeden Zweifel erhaben, entstand er doch mindestens 30 Jahre nach den Verhandlungen und liegt nur in einer bis 1139 fortgeführten, wohl überarbeiteten Fassung vor, vgl. Hoffmann, Einleitung, ebd., S. IXf. Insgesamt aber ist die berichtete Einbeziehung des Desiderius in entsprechende Verhandlungen mit Heinrichs Anhängern glaubhaft, weil der Abt deswegen, als er selbst Papst war, kritisiert wurde, dazu Anm. 76. Den singulären Bericht der „Chronica“ berücksichtigen Tellenbach, Westliche Kirche (wie Anm. 13), S. F199; Althoff, Heinrich IV. (wie Anm. 12), S. 185; und Blumenthal, Gregor VII. (wie Anm. 13), S. 320. Gregorii VII. Registrum 9.11 (wie Anm. 32), MGH Epp. sel. 2, S. 588 f., S. 588, Z. 23–31 = FStGA 12a, S. 366/368, Nr. 118, S. 366, spricht dunkel von servitia, die der König angeboten habe. Wiewohl diese größer als die seiner Vorgänger seien, wolle Gregor sie wie auch die Drohungen des Königs für nichts achten, weil er dessen böse Absichten fürchte, vgl. dazu Ziese, Wibert (wie Anm. 6), S. 76 f. In einem Brief an die Markgräfin Mathilde vom April oder Mai 1087, spät überliefert von Hugo von Flavigny, Chronicon, hg. von Georg Heinrich Pertz, MGH SS 8, Hannover 1848, S. 288– 502, S. 466, Z. 37 – S. 468, Z. 3, klagte sich Hugo von Lyon S. 466 an, der Erhebung des Abtes Desiderius zugestimmt (Z. 41–44) und erst hinterher in Montecassino von seinen schändlichen Taten erfahren zu haben (Z. 44–48), indem dieser dem sogenannten König Heinrich Hilfe bei der Erlangung der Kaiserkrone zugesichert hätte (Z. 48–50); vgl. Tellenbach, Westliche Kirche (wie Anm. 13), S. F265. Dazu Anm. 46. Nach Heidrich, Ravenna (wie Anm. 44), S. 159, sei die Angabe der Chronica monasterii Casinensis (wie Anm. 74), 3.50, S. 433, Z. 23–27, insbes. Z. 26, glaubhaft, Wibert habe erklärt, „das Gegenpapsttum nur invitus übernommen zu haben“. Auch die Zeitgenossen nahmen Wibert als Papst erst nach seiner Inthronisation 1084 wahr, wie D’Acunto, Schisma (wie Anm. 6) an regionalen Urkundendatierungen zeigen kann, vgl. zusammenfassend ebd., S. 90. Allerdings findet sich unter seinen Beispielen aus Rimini (ebd., S. 89 f.) ein höchst merkwürdiges vom 11. September 1084, in dem „das angezeigte Inkarnationsjahr dem sechsten Pontifikatsjahr Clemens’ III. und dem zweiten Amtsjahr Heinrichs IV. in Italien entspricht“ (so S. 90), so dass der Amtsantritt noch vor der Brixener Synode liegen müsste. Der ebd., Anm. 31 geführte Nachweis, den dankenswerterweise Herr Martin Bach, Kunsthistorisches Institut Florenz, in Kopie übermittelte, bietet aber 1086, tempore Clementis pape et Heinrico imperatore in Italia anno secundo, die 11 septembris, indictione VII, wobei Angelo Turchini (Bearb.), Pergamene/Monumenta (994–1690) e Instrumenta (1041–[1295]) dell’Archivio della Canonica e
100
Jörg W. Busch
Doch wäre es, um erneut daran zu erinnern, methodisch bedenklich, aus diesen späteren Versuchen bereits die Motivation für die Brixener Formulierung Hildebrandum […] iudicamus canonice deponendum ableiten zu wollen. Statthaft hingegen ist die Feststellung, dass der 1081 und 1082 kriegerisch erfolglose Heinrich IV. die Handlungsalternative nutzte, die ihm das Brixener ‚Zwischenurteil‘ eröffnete. Gibt es aber nicht doch ein Indiz, dass genau dies am 25. Juni 1080 beabsichtigt war? Der Ostsachse Bruno, der Heinrichs Handlungsalternative aus Hass verzerrte, scheidet als Zeuge aus, denn er konstruierte sie aus weiter räumlicher und zeitlicher Ferne mit einer eindeutig gegen den Salier gerichteten Tendenz.78 Tatsächlich gibt es ein solches Indiz in Gestalt einer fehlenden Unterschrift unter dem Brixener Synodalprotokoll und einer später dazu erzählten Anekdote. Bischof Benno II. von Osnabrück unterschrieb das ‚Zwischenurteil‘ nicht, seine Unterschrift fehlt schlicht unter dem überlieferten Synodalprotokoll.79 Bennos Biograph, Abt Norbert von Iburg, wusste zehn oder gar zwanzig Jahre später80 im 18. Kapitel seiner Bennovita zu erklären, warum die Unterschrift fehlt, vor allem aber warum der Altar in der Kirche seines Klosters Iburg, das Benno gegründet hatte, innen derart hohl sei, dass ein Mann hineinkriechen und sich verbergen könne.81 Der große Baumeister Benno – der den Speyrer Salierdom davor bewahrte,
78 79 80
81
del Capitolo di Rimini. Regesti, Cesena 2008, S. 80 f., Nr. 13, das Inkarnationsjahr nach der Indiktionszahl korrigiert, was aber Clemens’ Amtsantritt in der Wahrnehmung dieses Zeitgenossen zwischen Brixen und Rom verortet. Eine Unsicherheit über Clemens’ Pontifikatsbeginn in einer römischen Urkunde belegt Jochen Johrendt, Rom zwischen Kaiser und Papst – die Universalgewalten und die Ewige Stadt, in: Gerhard Lubich (Hg.), Heinrich V. in seiner Zeit. Herrschen in einem europäischen Reich des Hochmittelalters (Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters. Beihefte zu J. F. Böhmer, Regesta Imperii 34) Wien/Köln/ Weimar 2013, S. 169–190, S. 173 f., Anm. 18. Zur Zeitstellung oben Anm. 25 und zur Tendenz zusammenfassend Schmale, Einleitung zu Brunonis Liber (wie Anm. 26), S. 29, oder Wattenbach/Holtzmann/Schmale, Geschichtsquellen 2 (wie Anm. 15), S. 593. Brixener Synodaldekret (wie Anm. 4), MGH Dt. MA 1, S. 72, Z. 13 – S. 73, Z. 12 = FStGA 12, S. 480/482, Z. 30–25. Abt Norbert in dem von Benno gestifteten Kloster Iburg soll dessen Lebensbeschreibung zwischen dem 3. Juli 1090 und dem 8. September 1100 verfasst haben, vgl. Kallfenz, Einleitung zur Vita Bennonis (wie Anm. 81), S. 366, so schon Wattenbach/Holtzmann/Schmale, Geschichtsquellen 2 (wie Anm. 15), S. 578. Die im Folgenden aufscheinende verformte Erinnerung spricht eher für einen späteren Abfassungstermin. Nach Wattenbach/Holtzmann/Schmale, Geschichtsquellen 3 (wie Anm. 15), S. 166*, spricht sich Kurt-Ulrich Jäschke, Studien zu Quellen und Geschichte des Osnabrücker Zehntstreits unter Heinrich IV. 1, in: AfD 9/10, 1963/64, S. 112–286, 2, in: ebd. 11/12, 1965/66, S. 280–402, 2, S. 358 ff., gegen Abt Norbert als Verfasser aus und nimmt einen der Mönche an. Hans-Werner Goetz, Die bischöfliche Politik in Westfalen und ihre historiographische Legitimierung während des Investiturstreits, in: Westfälische Zeitschrift 141, 1991, S. 307–328, S. 318, nennt den Biographen Norbert, ohne auf die Kontroverse einzugehen. Vita Bennonis II. episcopi Osnabrugensis auctore Nortberto abbate Iburgensis, hg. von Harry Bresslau (MGH SS rer. Germ. 56) Hannover 1902, c. 18, S. 24, Z. 9–25, bzw. von Hatto Kallfenz, Lebensbeschreibungen einiger Bischöfe des 10.–12. Jahrhunderts (Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters – FStGA 22) Darmstadt 1973, S. 372–440, S. 412, Z. 2–15.
Im Schlagschatten von Canossa 1077: Brixen 1080
101
vom Rhein unterspült zu werden82 – habe nämlich den Iburger Altar exakt jenem Altar nachbauen lassen, um den sich im Juni 1080 die Bischöfe versammelt hatten. Mit dem Iburger Altar habe Bischof Benno jener unbelebten Materie gedankt83, die ihn 1080 davor bewahrte, jenes Vorgehen mittragen zu müssen, das seine Mitbischöfe mehr aus Hass als aus Vernunft gegen Hildebrand forderten.84 Als Erster allein in der Kirche habe Benno psalmiert, dann das Altartuch gehoben, die Höhlung entdeckt und, bevor seine hasserfüllten Mitbrüder erschienen, habe er sich in der Höhlung verborgen. Als alle sich versammelt hatten, habe der König Benno vermisst und ihn, an des Bischofs Treue zweifelnd, vergeblich suchen lassen. Doch nachdem die Versammelten die Kirche erschüttert hatten, indem sie sich vom Papst losgesagt und ihn durch den Bischof von Ravenna ersetzt hätten, habe Benno sich unter seine höchst erstaunten Mitbrüder gemischt und auf Vorhaltungen, wo er gewesen sei, einen Eid zu den Heiligen angeboten, dass er während der ganzen Versammlung die Kirche nicht verlassen habe. Vor dem König bezeugte Benno seine Treue, die ihn der König ermahnte, in bewährter Weise einzuhalten.85 So umging Benno seine Unterschrift unter das ‚Zwischenurteil‘ von Brixen, wie Norbert zu ergänzen ist, der ebenfalls 1080 mit 1084 überschrieb.86 Diese Geschichte ist eine Steilvorlage für diejenigen, die Heinrichs IV. Vorgehen gegen Gregor VII. nicht einhellig unterstützt sehen wollen87, und sie ist eine 82 83 84 85 86 87
Vita Bennonis, c. 21 (wie Anm. 81), MGH SS rer. Germ. 56, S. 29, Z. 20–26 = FStGA 22, S. 420, Z. 26–30. Vita Bennonis, c. 18 (wie Anm. 81), MGH SS rer. Germ. 56, S. 24, Z. 11–13 = FStGA 22, S. 412, Z. 4–6. Vita Bennonis, c. 18 (wie Anm. 81), MGH SS rer. Germ. 56, S. 24, Z. 2–4 = FStGA 22, S. 410, Z. 30 f.: Benno videns enim in utraque parte magis odio quam ratione tractari. Vita Bennonis, c. 18 (wie Anm. 81), MGH SS rer. Germ. 56, S. 24, Z. 25 – S. 25, Z. 9 = FStGA 22, S. 412, Z. 15–33. Vita Bennonis, c. 18 (wie Anm. 81), MGH SS rer. Germ. 56, S. 24, Z. 34 f. = FStGA 22, S. 412, Z. 22 f.: die Versammelten papam abdicassent eiusque in locum substituissent Ravennatem episcopum. Wie in Worms 1076 sieht Zimmermann, Wurde Gregor (wie Anm. 9), S. 126, Anm. 18, die Brixener Beratungen an Bennos Verhalten nicht ohne Schwierigkeiten verlaufen. Daran lasse sich ablesen, dass nicht alle Anhänger Heinrichs das Brixener Vorgehen guthießen, bemerkt Boshof, Salier (wie Anm. 8), S. 245, und Althoff, Heinrich IV. (wie Anm. 12), S. 173, erkennt in der Anekdote „ein spätes Zeugnis dafür, wie reserviert selbst enge Anhänger Heinrichs einer Absetzung Gregors gegenüberstanden“. Goetz, Politik (wie Anm. 80), S. 319, hingegen hält „die recht unwahrscheinliche Episode“ für eine Erfindung des Autors der Vita, um nämlich Bennos Weigerung nachträglich zu beschönigen, die Episode fehlt bei Schieffer, Gregor VII. (wie Anm. 8), S. 80, und wird flüchtig betrachtet bei Robinson, Henry IV (wie Anm. 8), S. 199. Erst der Anonymus, der 1106 den Tod seines Herrschers beklagte und um die Krisen nach 1080, wenn auch nicht mehr in allen Einzelheiten wusste, schilderte – ohne den Ort Brixen zu erwähnen – die Gegenmaßnahmen nach der zweiten Exkommunikation mit dem warnenden Ausruf: Cessa, obsecro, rex gloriose, cessa ab hoc molimine, ut aecclesiasticum caput de suo culmine deicias et in reddenda iniuria te reum facias, Vita Heinrici IV. imperatoris, hg. von Wilhelm Eberhard (MGH SS rer. Germ. 58) Hannover 1899, c. 6, S. 22, Z. 21–24, bzw. von Franz-Josef Schmale, in: Quellen zur Geschichte Kaiser Heinrichs IV. (wie Anm. 4), S. 408–466, S. 430, Z. 6–8.
102
Jörg W. Busch
wahre Geschichte, stammt sie doch aus erster Hand, denn der greise Bischof Benno verbrachte seine letzten Jahre bis 1088 im Kreis seiner Iburger Mönche und erzählte ihnen, wie wir annehmen dürfen, aus seinem bewegten Leben.88 Diese wahre Geschichte bietet nur ein randständiges Problem, weil der Bennobiograph Norbert sie in der alten italischen Reichshauptstadt Pavia spielen ließ und eben nicht in Brixen.89 Doch ein solches Detail berührt nicht den wahren Kern der Geschichte, die Norbert tatsächlich, falls die Ironie nicht bemerkt wurde, mit seinen Erfahrungen der 1090er Jahre überschrieb, als Heinrich IV. im Kampf um das Gewaltenverhältnis durch den ehestiftenden Urban II. hoffnungslos in die Defensive geraten war.90 Der zutreffende Kern in der verformten Erinnerung des Bennobiographen Norbert ist schlicht: Im Juni 1080 nahm sich Bischof Benno von Osnabrück mit Billigung Heinrichs IV. aus der Schusslinie. Indem der Schwabe in Westfalen sich nicht mit einer Unterschrift unter das ‚Zwischenurteil‘ von Brixen belastete, stand er bereit für die eine der beiden Möglichkeiten, die Heinrich IV. sich mit der Formulierung Hildebrandum […] iudicamus canonice deponendum offen gelassen hatte: den Verhandlungsweg. „Treu dem König, aber niemals ungehorsam dem Papst“, wie ihn sein Biograph charakterisierte91, war Benno mit Heinrichs Billigung dafür ausersehen, den Gesprächsfaden nicht abreißen zu lassen, und folgerichtig trat der Bischof von Osnabrück Ende 1082 als Unterhändler zwischen König und Papst auf, wie sich Norbert in dem 22. Kapitel seiner Bennovita erinnerte. Allerdings konnte Norbert sich nicht mehr erinnern, wessen Starrsinn damals die Verhandlungen scheitern ließ.92 Daraufhin soll sich Benno enttäuscht aus dem Dienst für seinen Herrscher zurückgezogen haben93, der sich wiederum mehr als ein weiteres Jahr abmühen musste, um den in Brixen verkündeten nächsten Verfahrensschritt einleiten zu können.94 88
89 90
91 92 93 94
Vita Bennonis, c. 25 (wie Anm. 81), MGH SS rer. Germ. 56, S. 33, Z. 38 = FStGA 22, S. 428, Z. 28: multo igitur hic tempore solummodo manens. Schon c. 19, MGH S. 26, Z. 15–17 = FStGA S. 414, Z. 33–35, teilt mit, Benno habe den Westteil der Iburg einer Bischofswohnung vorbehalten: monteque diviso […] habitationi reservans. Vita Bennonis, c. 18 (wie Anm. 81), MGH SS rer. Germ. 56, S. 23, Z. 32 = FStGA 22, S. 410, Z. 23 f.: apud Ticinum. Vgl. Althoff, Heinrich IV. (wie Anm. 12), S. 209–213 und 219–223; Boshof, Salier (wie Anm. 8), S. 256–259, oder Goez, Kirchenreform (wie Anm. 13), S. 160 f. Die von Alfons Becker, Papst Urban II. 1: Herkunft und kirchliche Laufbahn. Der Papst und die lateinische Christenheit (MGH Schriften 19.1) Stuttgart 1964, S. 120, so genannte ‚Militärpaktehe‘ zwischen Mathilde von Tuszien und Welf V. sperrte Heinrich IV. die Pässe über Alpen und Apennin, so dass er von 1093 bis 1095 im Raum Verona-Padua regelrecht festgesetzt war, was bei Weinfurter, Canossa (wie Anm. 8), S. 184, nicht deutlich wird. Vita Bennonis, c. 18 (wie Anm. 81), MGH SS rer. Germ. 56, S. 24, Z. 4 f. = FStGA 22, S. 410, Z. 41 f.: regi semper fidelis, numquam autem papae inobediens. Vita Bennonis, c. 22 (wie Anm. 81), MGH SS rer. Germ. 56, S. 30, Z. 27–36 = FStGA 22, S. 422/424, Z. 28–2. Schieffer, Gregor VII. (wie Anm. 8), S. 92, vermerkt Bennos erfolglose Bemühungen. Vita Bennonis, c. 22 (wie Anm. 81), MGH SS rer. Germ. 56, S. 30, Z. 36 f. = FStGA 22, S. 424, Z. 2 f.: sed […] nullatenus posset obstinatia molliri sowie MGH S. 31, Z. 2–5 = FStGA S. 424, Z. 5–8 Bennos Rückzug a regni negotiis. Aus der Rückschau von knapp 20 Jahren (so Wattenbach/Holtzmann/Schmale, Geschichtsquellen 2 [wie Anm. 15], S. 496) erkannte Frutolfi Chronica, hg. und übers. von Franz-Josef
Im Schlagschatten von Canossa 1077: Brixen 1080
103
Damit ist, um es noch einmal zusammenzufassen, wohl Folgendes hinreichend deutlich geworden: Der Überrest, den das Brixener Synodaldekret mit den eindeutigen Worten Hildebrandum […] iudicamus canonice deponendum bietet, und das anekdotisch verbrämte Indiz dafür, dass der das Dekret nicht unterschreibende Bischof Benno von Osnabrück sich mit des Königs Billigung als Vermittler bereithielt, verwehren die Feststellung, Gregor VII. sei am 25. Juni 1080 in Brixen als Papst abgesetzt und Erzbischof Wibert von Ravenna zum Papst gewählt worden. Diese so eingängige und immer noch weitverbreitete Feststellung geht vielmehr auf den sonst wohlinformierten Gregorianer Bischof Bonizo von Sutri zurück, der in eindeutig parteigebundener Absicht die Erinnerung an Brixen 1080 mit der Erfahrung von Rom 1084 überschrieb, also das tatsächliche Zwischenurteil von Brixen mit dem Endurteil von Rom überdeckte, also die Anordnung des nächsten Verfahrensschrittes mit der endgültigen Absetzungsverfügung überformte. Auch der Bennobiograph Norbert von Iburg zog aus seiner noch späteren Rückschau Zwischenund Endurteil zusammen, worin ihm die verfahrene Situation der 1090er Jahre recht zu geben schien. Doch die Wirklichkeit des Sommers 1080 war eine andere, denn Heinrich IV. hielt sich, dieses Mal gut beraten, eine Handlungsalternative offen. Er gab dem vehementen Verlangen nordalpiner und italischer Bischöfe, dem verabscheuten Hildebrand eine Absage zu erteilen, ein Forum, sich gemeinsam zu artikulieren. Doch ließ der Salier es nicht zum Äußersten kommen, denn die Brixener Formulierung ordnete nicht die Absetzung an, sie kündigte den nächsten Verfahrensschritt an. Ob sich dieser nächste Verfahrensschritt würde einleiten lassen, war im Sommer 1080 völlig offen, denn Heinrich IV. musste sich schließlich noch seines verfeindeten Schwagers erwehren. Von daher zeugt die Brixener Formulierung wie auch das Bereithalten eines unbelasteten Vermittlers in Gestalt Bennos von Osnabrück von einiger Einsicht in die engen Grenzen salischer Politik im Sommer 1080. Mochte der Ostsachse Bruno den Salier zutiefst hassen, mit der gehässig verzerrten Handlungsalternative, die er ihm zuschrieb, traf Bruno – vielleicht ohne es zu wollen – genau die beiden Möglichkeiten, die sich Heinrich IV. im Sommer 1080 offenhielt: Verhandlungen mit Gregor VII. oder ein ordentliches Verfahren gegen Hildebrand.
Schmale/Irene Schmale-Ott, Frutolfs und Ekkehards Chroniken und die anonyme Kaiserchronik (Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters – FStGA 15) Darmstadt 1972, S. 48–120, S. 90, Z. 24–32, sehr wohl, dass die in Brixen beschlossenen Maßnahmen erst noch durchzuführen waren, denn er gebrauchte für das Vertreiben Gregors und seine Ablösung durch Wibert jeweils das Gerundivum der Verben. Doch wiewohl dem Mönch vom Bamberger Michelsberg der Beschluss von Brixen im Wortlaut bekannt war, denn er gab ihn, S. 90/92, Z. 33–16, wörtlich wieder und damit auch Z. 12 f. die entscheidende Formulierung iudicamus canonice deponendum, schlich sich in seine einleitende Darstellung, S. 90, Z. 30–32, doch die Erinnerung an die nachfolgende Entwicklung ein, denn das canonice entfiel ganz, deponendum wurde nur noch mit depellendum wiedergegeben und es erfolgte Gregorium […] subrogandum eine Wahl Wiberts.
AUTORITÄT OHNE AUTORITÄTEN Mündlichkeit in der Geschichtsschreibung der Salierzeit* Daniel Föller I. EINLEITUNG. EIN GLAUBWÜRDIGKEITSPROBLEM UND SEINE FOLGEN „Manches in meiner Niederschrift habe ich aus zerstreuten Blättern zusammengetragen, vieles ist aus Geschichtswerken und römischen Urkunden entlehnt, doch bei weitem das meiste erfuhr ich aus sachkundiger mündlicher Überlieferung unserer Alten; die Wirklichkeit selbst bezeugt, daß mein eigenes Hirn nichts erdacht, nichts grundlos behauptet hat. Alle meine Angaben will ich durch zuverlässige Belege erhärten, damit man wenigstens deren Ansehen vertrauen kann, wenn man mir keinen Glauben schenkt.“1 Mit diesen Worten antizipiert Adam von Bremen um 1075 im Widmungsschreiben zu seinen „Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum“ ein grundlegendes Problem seines Werkes2: Da es für seinen Gegenstand – die Geschichte des Erzbistums Hamburg-Bremen und der christlichen Mission in Nordosteuropa – nur wenige schriftliche Zeugnisse gab, war er gezwungen, häufig auf
* 1
2
Für Anregungen und Hilfestellungen möchte ich einer Reihe von Kolleginnen und Kollegen danken: Neben den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Kolloquiums sind dies besonders Anna Dorofeeva, Tim Geelhaar, Thomas Kohl, Erik Niblaeus, Levi Roach und Roland Scheel. Adam von Bremen, Hamburgische Kirchengeschichte, hg. von Bernhard Schmeidler (MGH SS rer. Germ. [2]) Hannover/Leipzig 1917, S. 3: Itaque de his, quae scribo, aliqua per scedulas dispersa collegi, multa vero mutuavi de hystoriis et privilegiis Romanorum, pleraque omnia seniorum, quibus res nota est, traditione didici, testem habens veritatem nihil de meo corde prophetari, nihil temere definiri; sed omnia, quae positurus sum, certis roborabo testimoniis, ut, si mihi non creditur, saltem auctoritati fides tribuatur. Übersetzung nach: Adam von Bremen, Bischofsgeschichte der Hamburger Kirche. Neu übertragen von Werner Trillmich, in: ders./Rudolf Buchner (Hgg.), Quellen des 9. und 11. Jahrhunderts zur Geschichte der hamburgischen Kirche und des Reiches (Ausgewählte Quellen zur Geschichte des Mittelalters – FStGA 11) Darmstadt 72000, S. 160–499, hier S. 163 (fortan zur Unterscheidung von der Edition Schmeidlers mit „übers. Trillmich“ gekennzeichnet). Die Edition von Schmeidler – auf der auch Trillmichs Übersetzung beruht – ist bislang unersetzt, trotz mannigfaltiger Kritik; vgl. zuletzt Michael H. Gelting, Uløste opgaver. Adam af Bremen, Saxo Grammaticus og Knytlinga saga, in: Scandia 77, 2011, S. 126–143, bes. S. 127–131. Die Datierungen des Editors Schmeidler aus Adam, Gesta (wie Anm. 1), S. LXVf., gelten bis heute als valide; vgl. Volker Scior, Adam Bremensis, in: Stephan Borgehammar u. a. (Hgg.), Medieval Nordic Literature in Latin. A Website of Authors and Anonymous Works c. 1100– 1530, Bergen 2012 (https://wikihost.uib.no/medieval/index.php/Medieval_Nordic_Literature_ in_Latin) [Stand: 26.01.2016].
106
Daniel Föller
mündlich überliefertes Material zurückzugreifen. Die Folge war ein schwerwiegendes Glaubwürdigkeitsproblem seines Textes.3 Adam ist mit diesem Problem keine Ausnahme, sondern die Regel. Die Frage nach der Zuverlässigkeit von Informanten beschäftigt die Geschichtsschreibung und -wissenschaft seit ihren Anfängen bis heute, und die „Oral History“-Methode der Zeitgeschichte oder Johannes Frieds Entwurf einer geschichtswissenschaftlichen Gedächtniskritik sind nur die aktuellsten Bewältigungsversuche.4 Besonders prekär ist die Situation für die mittelalterliche Geschichte, da sich einerseits kaum einmal genug Material erhalten hat, um die Aussagen mittelalterlicher Informanten einigermaßen umfassend miteinander zu konfrontieren, und andererseits davon auszugehen ist, dass die mediale Verfasstheit schwach literalisierter Wissenskulturen zu Transmissionsbedingungen führte, die sich von heutigen Gegebenheiten massiv unterscheiden. Umso erstaunlicher ist es, dass zwar die medialen und kognitiven Rahmenbedingungen mittelalterlicher Mündlichkeit ebenso wie die Stilisierung von schriftlichen (literarischen) Texten als orale Überlieferung ausführlich erforscht wurden5, aber der Umgang mittelalterlicher Autoren mit der Zuverlässigkeit mündlich tradierter Informationen kaum in den Fokus rückte. Für eine solche Untersuchung ist Adams Bischofsgeschichte ein vielversprechender Gegenstand, und das vor allem aus zwei Gründen. Zum einen verarbeitet Adam, wie er ja bereits im Eingangszitat selbst äußerte, sehr viel mündlich tradiertes Material, das er zudem einer großen Anzahl von Informanten verdankt; eine Durchsicht der „Gesta“ ergab eine Gesamtzahl von nicht weniger als 224 mehr oder minder expliziten Verweisen auf orale Überlieferungen oder Augenzeugenberichte, knapp zwanzig Individuen oder Gruppen werden als Informanten genannt6, und 3 4 5
6
Adam spricht dieses im Verlauf des Textes mehrfach an: Außer der in Anm. 1 genannten Stelle vgl. noch Adam, Gesta (wie Anm. 1), Praefatio, II.62, III.1, Epilogus, S. 1–3, 122, 142, 281. Vgl. zu ersterer Donald A. Ritchie (Hg.), The Oxford Handbook of Oral History, Oxford 2012, zu letzterer Johannes Fried, Der Schleier der Erinnerung. Grundzüge einer historischen Memorik, München 2004. Einen guten Überblick über die intensive, vor allem von Seiten der Literaturwissenschaft geführte Forschungsdiskussion bietet Ursula Schäfer, Mündlichkeit und Schriftlichkeit im Mittelalter, in: Michael Maurer (Hg.), Aufriß der historischen Wissenschaften 5: Mündliche Überlieferung und Geschichtsschreibung, Stuttgart 2003, S. 148–187. In die deutsche geschichtswissenschaftliche Debatte eingeführt hat das Konzept Hanna Vollrath, Das Mittelalter in der Typik oraler Gesellschaften, in: HZ 233, 1981, S. 571–594. Namentlich genannt werden nur fünf: Erzbischof Adalbert (insgesamt 31 Nennungen, bis auf eine alle im dritten Buch, das sich mit seiner Biografie befasst); der Dänenkönig Sven Estridsen (22 Nennungen); Bischof Adalward der Jüngere von Sigtuna, vgl. Adam, Gesta (wie Anm. 1), schol. 123, S. 247; daneben zwei Günstlinge Adalberts, die Bischöfe Bovo und Paulus, vgl. ebd., schol. 77 und III.77, S. 178 und 225. Hinzu kommen folgende Anonymi bzw. Gruppen: ältere Mitglieder des Bremer Domstifts, vgl. ebd., Praefatio, I.51, II.12, II.33, II.46, S. 3, 52, 69, 94, 104; zu diesen könnten auch die ebd., I.54, S. 55, genannten fratres zählen; ein Dänenbischof, vgl. ebd., I.57, S. 57; Einwohner Wolins, vgl. ebd., II.22, S. 79; unbestimmte Sachsen, vgl. ebd., II.32, S. 93; Gruppen von Seeleuten, vgl. ebd., II.52, IV.19, schol. 150, S. 104, 248, 270; „Neider“ des verstorbenen Erzbischofs Bezelin, vgl. ebd., schol. 58, S. 139 f.; Reisende in die slawischen Gebiete, vgl. ebd., III.20, S. 163; ein nordelbischer nobilis homo, vgl. ebd., III.22, S. 166; ein Goldschmied aus Bremen, vgl. ebd., III.46, S. 190; Dänen, vgl. ebd. IV.11,
Autorität ohne Autoritäten
107
in beiden Fällen ist mit hohen Dunkelziffern zu rechnen. Zum anderen reflektiert Adam ziemlich ausführlich über seinen Umgang mit diesen Informationen, einerseits wegen des von ihm befürchteten Glaubwürdigkeitsproblems, andererseits wohl aufgrund seiner avancierten Schulbildung und den historiografischen Arbeitsweisen seiner Zeit.7 Angesichts dieser Bedeutung und Präsenz mündlicher Überlieferung in Adams Geschichtswerk ist es erstaunlich, wie schlecht die Forschungslage ist. Die verhältnismäßig intensive wissenschaftliche Auseinandersetzung der letzten Jahre mit dem Text hat eine ganze Fülle von Themen aufgegriffen und damit ganze Bücher gefüllt8, die ausführlichsten Überlegungen zum Aspekt der Mündlichkeit aber finden sich in den Einleitungen der kritischen Edition von Schmeidler aus dem Jahre 1917 und der deutschen Übersetzung von Trillmich, die 1955 erstmals publiziert
7
8
IV.39, S. 240, 275; Ortskundige in Schweden und im Ostseeraum, vgl. ebd. IV.15, IV.25, S. 242, 257; Gefolgsleute Bischof Adalwards des Jüngeren, vgl. ebd., schol. 142, S. 262; Norweger, vgl. ebd., IV.32, S. 267. Adams hoher Bildungsgrad ist ein Allgemeinplatz der mit ihm befassten Forschung, die Schlussfolgerung ergibt sich schon aus der schieren Anzahl und Bandbreite der von ihm herangezogenen Schriftquellen. Vgl. knapp Volker Scior, Das Eigene und das Fremde. Identität und Fremdheit in den Chroniken Adams von Bremen, Helmolds von Bosau und Arnolds von Lübeck (Orbis mediaevalis 4) Berlin 2002, S. 29 ff., mit der älteren Literatur. Einen aktuellen Forschungsbericht gibt es nicht, Timothy Mark Barnwell, Missionaries and Changing Views of the Other from the Ninth to the Eleventh Centuries, Phil. Diss. Leeds 2014, S. 70–80, kennt zahlreiche Arbeiten nicht, v. a. den Sammelband Riccardo Scarcia/Fabio Stok (Hgg.), Devotionis munus. La cultura e l’opera di Adamo di Brema (Testi e studi di cultura classica 47) Pisa 2010, in dem sich mehrere Aufsätze mit Adams Verarbeitung klassischer Bildungsinhalte befassen (Maranini, Stok, Bianchetti, Andres), und Eva Schlotheuber, Persönlichkeitsdarstellung und mittelalterliche Morallehre. Das Leben Erzbischof Adalberts in der Beschreibung Adams von Bremen, in: DA 59, 2003, S. 495–548, die seine theologischen Kenntnisse betont. Generelle „Ansätze zu einer historischen Methodik“ und ein hohes quellenkritisches Bewusstsein erkennt bei den Geschichtsschreibern des ausklingenden 11. Jahrhunderts Tilman Struve, Salierzeit im Wandel. Zur Geschichte Heinrichs IV. und des Investiturstreites, Köln/Weimar/Wien 2006, S. 32 f. Die wichtigsten Arbeiten listet Scior, Adam Bremensis (wie Anm. 2), auf. Allgemein zu ergänzen wären: Scarcia/Stok (Hgg.), Devotionis munus (wie Anm. 7); Schlotheuber, Persönlichkeitsdarstellung (wie Anm. 7); Florian Hartmann, Konstruierte Konflikte. Die sächsischen Herzöge in der Kirchengeschichte Adams von Bremen, in: Christina Jostkleigrewe u. a. (Hgg.), Geschichtsbilder. Konstruktion – Reflexion – Transformation (Europäische Geschichtsdarstellungen 7) Köln 2005, S. 109–129. Einen starken Forschungsschwerpunkt bildete in den letzten Jahren Adams Darstellung des Fremden, hier wären zusätzlich zur Monografie von Scior, Das Eigene (wie Anm. 7), zu nennen: David Fraesdorff, Der barbarische Norden. Vorstellungen und Fremdheitskategorien bei Rimbert, Thietmar von Merseburg, Adam von Bremen und Helmold von Bosau (Orbis mediaevalis 5) Berlin 2005, S. 251–317; Thomas Foerster, Vergleich und Identität. Selbst- und Fremddeutung im Norden des hochmittelalterlichen Europa (Europa im Mittelalter 14) Berlin 2009, S. 32–42; Erik Niblaeus, German Influence on religious Practice in Scandinavia, c. 1050–1150, Phil. Diss. London 2011, S. 106–135; Ildar H. Garipzanov, Christianity and Paganism in Adam of Bremen’s Narrative, in: ders. (Hg.), Historical Narratives and Christian Identity on a European Periphery. Early History Writing in Northern, East-Central, and Eastern Europe (c. 1070–1200), Turnhout 2011, S. 13–29; Barnwell, Missionaries (wie Anm. 7), S. 65–132 (im Inhaltsverzeichnis angegeben S. 72–139).
108
Daniel Föller
wurde.9 Eine etwas eingehendere Auseinandersetzung mit den verschiedenen Textschichten liefert ein latinistischer Sammelbandbeitrag von 2010, der sich allerdings in erster Linie für die Vielstimmigkeit der „Gesta“ interessiert und die Frage nach Adams originärem Anteil an seinem Werk verfolgt.10 Die stiefmütterliche Behandlung dieses Themas ist angesichts der oben angesprochenen Materialfülle nicht weiter erstaunlich. Für eine gründliche Aufarbeitung des Problems wäre die detaillierte Auswertung und Kontextualisierung von mehr als 200 Einzelbefunden nötig, was für alle wissenschaftlichen Formate unterhalb einer Monografie schlicht zu aufwändig ist. Bei den folgenden Überlegungen zu Adams Umgang mit dem Problem der Zuverlässigkeit mündlich tradierter Informationen ist dementsprechend ein anderer Ansatz angebracht. Im Gesamtbefund der Verweise auf mündliche Informanten und von Adams (teilweise von diesen gelösten) Reflexionen zu seinem Umgang mit nichtschriftlichen Überlieferungen lassen sich insgesamt fünf Strategien zur Bewältigung dieses Problems erkennen, bei denen entweder der Informant oder die Information autorisiert wurden. Diese sollen anhand charakteristischer Passagen vorgestellt und exemplarisch diskutiert werden. II. AUGENZEUGENSCHAFT Adams Geschichtswerk ist eingerahmt von seinen Reflexionen über die Zuverlässigkeit seiner Aussagen, war es doch „a matter of great temporal and eternal danger to put lies into prestigious parchment-books“, wie Lars Boje Mortensen schreibt.11 Die Autorisierung der von ihm verarbeiteten Informationen, die nicht aus schriftlicher Überlieferung stammten, blieb sowohl im vorangestellten Widmungsbrief unscharf, in dem er die „Überlieferung der Alten“ (tradicio seniorum) nennt und damit die Seniorität seiner Informanten herausstellt12, als auch in einem dem Werk nachgestellten Gedicht, in dem es heißt: „Hab ich nichts Gutes geleistet, so hab ich wahrhaftig geschrieben, / Solche Zeugen nur nutzend, die sachkundig konnten berichten.“13 Adam betont also an dieser Stelle, dass er seine Informanten sorgfältig 9
10 11 12 13
Vgl. Adam, Gesta (wie Anm. 1), S. LXIV; der Absatz umfasst ganze 10 Zeilen. Für diesen als Referenzpunkt vgl. etwa Scior, Das Eigene (wie Anm. 7), S. 31, mit Verweis auf die Einleitung der FStGA-Übersetzung, die etwas ausführlicher als Schmeidler ist, aber im ganzen Absatz nur einen einzigen Verweis auf eine konkrete Stelle bietet; vgl. Adam, Gesta (wie Anm. 1), übers. Trillmich, S. 149. Vgl. Carlo Santini, Oculis atque auribus. Voci e scrittura in Adamo di Brema, in: Scarcia/Stok, Devotionis munus (wie Anm. 7), S. 35–56. So Lars Boje Mortensen, From Vernacular Interviews to Latin Prose (ca. 600–1200), in: Else Mundal/Jonas Wellendorf (Hgg.), Oral Art Forms and Their Passage into Writing, Kopenhagen 2008, S. 53–68, Zitat S. 54. Vgl. Adam, Gesta (wie Anm. 1), S. 3, übers. Trillmich, S. 163. Si bene non potui, certe veracia scripsi, / Testibus his utens, quibus haec notissima res est. Vgl. Adam, Gesta (Anm. 1), Epilogus v. 24 f., S. 281, übers. Trillmich, S. 497. Adams Gebrauch des Wortes testis zielt nie auf schriftliches Material, entweder ist ein Augenzeuge bzw. ein Zeuge
Autorität ohne Autoritäten
109
nach ihrem Wissen über den jeweiligen Gegenstand auswählte – allerdings verrät er nicht, nach welchen Kriterien er diese Auswahl traf. Um diese Kriterien soll es nun gehen. Eines ist die Augenzeugenschaft. Adam verweist mehrfach explizit darauf, dass seine Informanten das Geschilderte selbst gesehen hätten14, und die Zahl der Passagen, in denen er dies nur andeutet, ist noch erheblich größer. Er schließt hier klar an einen schon lange bestehenden lateineuropäischen Traditionsstrang an, der historiografisch verarbeitete Informationen in die Kategorien „Geschriebenes“ (scripta), „Gehörtes“ (audita) und „Gesehenes“ (visa) unterteilte und die Augenzeugenschaft für die entscheidende Informationsquelle hielt, zumindest für die Zeitgeschichtsschreibung, die kaum auf scripta zurückgreifen konnte.15 Vorzugsweise sollten Augenzeugen und Autoren sogar identisch sein, wie es Isidor von Sevilla in seinen Etymologien (nicht nur) für das Mittelalter paradigmatisch formulierte.16 Die Forderung Isidors richtete Adam durchaus auch an sich selbst. Im dritten Buch seiner „Gesta“, das ganz der Biografie des umstrittenen Erzbischofs Adalbert
14 15 16
im juristischen oder übertragenen Sinne gemeint oder es verweist auf mündliche Nachrichten, vgl. ebd., Praefatio, II.26, III.69, III.76, III.78, S. 3, 86, 215, 222, 225. Vgl. ebd., II.75, III.20.46, IV.15.21.25.32, schol. 123.142, S. 135, 163, 190, 242, 247, 250, 257, 262, 267. Vgl. Mortensen, From Vernacular (wie Anm. 11), S. 53 f., unter Verweis auf die ausführliche Auseinandersetzung bei Bernard Guenée, Histoire et culture historique dans l’occident médiéval, Paris 1980, S. 77–109. Vgl. Isidor von Sevilla, Etymologiarum sive originum libri XX. Recognovit brevique adnotatione critica instruxit Wallace Martin Lindsay 1–2, Oxford 1911 (ND 1962), I.41.1 f. (o. S.): De historia. Historia est narratio rei gestae, per quam ea, quae in praeterito facto sunt, dinoscuntur. Dicta autem Graece historia ἀπὸ τοῦ ἱστορεῖν, id est a videre vel cognoscere. Apud veteres enim nemo conscribebat historiam, nisi is qui interfuisset, et ea quae conscribenda essent vidisset. Melius enim oculis quae fiunt deprehendimus, quam quae auditione colligimus. Quae enim videntur, sine mendacio proferuntur. Deutsche Übersetzung bei: Isidor von Sevilla, Die Enzyklopädie. Übersetzt und mit Anmerkungen versehen von Lenelotte Möller, Wiesbaden 2008, S. 81 f.: „Von den historischen Erzählungen. Die Geschichte (historia) ist eine Erzählung von Taten, durch welche das, was in der Vergangenheit (praeteritum) geschehen ist, auseinandergelegt werden (dinoscere). Man sagt nämlich griechisch historia von ιστορειν (sic!), das heißt videre (sehen) bzw. cognoscere (erkennen). Bei den Alten aber hat niemand historia (Geschichte) geschrieben, außer denen, die interessiert waren (interesse) und das, was aufzuschreiben war, gesehen hatten. Besser nämlich fassen wir, was geschieht, mit den Augen auf, als das, was wir durch die Ohren erwerben. Was nämlich gesehen wird, wird ohne Täuschung (mendacium) [später] mitgeteilt (proferre).“ Die Übersetzung von interesse als „interessiert sein“ erscheint mir missverständlich, klarer (und näher am Wortlaut) wäre „außer denen, die dabei waren“. Zur Wirkungsgeschichte der Isidor-Stelle für die Vorstellung vom Augenzeugen vgl. Amelie Rösinger/Gabriele Signori, Einleitung, in: dies. (Hgg.), Die Figur des Augenzeugen. Geschichte und Wahrheit im fächer- und epochenübergreifenden Vergleich, Konstanz 2014, S. 7–11, bes. S. 8 f. Zur vormodernen Auffassung von Augenzeugenschaft vgl. neben den Beiträgen in dem genannten Band noch Fried, Schleier (wie Anm. 4), S. 173–200, und den Aufsatz von Carola Föller in diesem Band.
110
Daniel Föller
gewidmet ist17, referiert er ausführlich Selbstaussagen Adalberts, mit denen er den Erzbischof charakterisiert und fragwürdig erscheinendes Verhalten erklärt.18 Sein Verfahren legitimiert Adam am Anfang des dritten Buches so: „Da ich in der Umgebung dieses Mannes gelebt und sein Wesen täglich beobachtet habe, weiß ich nun wohl“19; auch anderswo in seiner Adalbertsvita autorisiert er kontroverse Aussagen mit eigenem Erleben.20 Freilich bleibt unklar, wie viel von dieser Augenzeugenschaft bloße Behauptung oder literarisches Stilmittel ist.21 Zwar hatte Adam den Erzbischof wohl tatsächlich kennengelernt – nach eigenem Bekunden war er im „vierundzwanzigsten Amtsjahr“ Adalberts, also zwischen Mai 1066 und Mai 1067 nach Bremen gekommen22, am 11. Juni 1069 fertigte er als magister scholarum eine Urkunde für diesen aus23 –, allerdings ist die suggerierte Augen- beziehungs17
18 19 20 21 22
23
Zur Biographie vgl. Wolfgang Seegrün, Erzbischof Adalbert von Hamburg-Bremen. Persönlichkeit und Geschichte, in: Katholische Akademie Hamburg (Hg.), Mit Ansgar beginnt Hamburg, Hamburg 1986 (ND 2000), S. 67–90; wieder in: Hamburgische Kirchengeschichte in Aufsätzen 1: Von der Christianisierung bis zur Vorreformation (Arbeiten zur Kirchengeschichte Hamburgs 21) Hamburg 2003, S. 131–150. Einen nicht mehr ganz neuen, im Großen und Ganzen aber vollständigen Überblick zu den Quellen bietet Otto Heinrich May, Regesten der Erzbischöfe von Bremen 1: 787–1306 (Veröffentlichungen der historischen Kommission für Hannover, Oldenburg, Braunschweig, Schaumburg-Lippe und Bremen 11) Hannover 1937, S. 53– 79 (Nr. 220–339). Nicht eingesehen werden konnte die unveröffentlichte, durch Anton Scharer an der Universität Wien betreute und 275 Seiten umfassende Diplomarbeit von Johannes Bobrowsky, Adalbert von Hamburg-Bremen. Aufstieg und Fall eines Kirchenfürsten im 11. Jahrhundert, Wien 2010. Die Informationen wurden dem elektronischen Archiv der Universitätsbibliothek Wien entnommen (http://othes.univie.ac.at/9782/) [Stand: 12.03.2015]. Zu Adalberts mangelnder Beliebtheit vgl. Claudia Zey, Vormünder und Berater Heinrichs IV. im Urteil der Zeitgenossen (1056–1075), in: Gerd Althoff (Hg.), Heinrich IV. (VuF 69) Ostfildern 2009, S. 87–126, besonders S. 107 ff. Zur komplexen Charakterisierung Adalberts vgl. zuletzt ausführlich Schlotheuber, Persönlichkeitsdarstellung (wie Anm. 7). Adam, Gesta (wie Anm. 1), III.2, S. 145, übers. Trillmich, S. 331: Nobis autem, qui cum eo viximus cotidianamque viri conversationem inspeximus, notum est. Vgl. ebd., III.1, III.2, III.3, III.56, III.70, III.77, IV.40, schol. 76, S. 142, 145 f., 173, 200, 202, 218, 222, 224, 276. Zur „Stimme“ Adalberts in den „Gesta“ vgl. Santini, Oculis (wie Anm. 10), bes. S. 43 f. Vgl. Adam, Gesta (wie Anm. 1), III.4, S. 146: […] ad annum pontificii XXIIII, cum et ego indignissimus ecclesiae Dei matricularius Bremam veni. Adalberts Vorgänger Alebrand/Bezelin starb am 15. April 1043. May, Regesten (wie Anm. 17), S. 52 f. (Nr. 219 f.), datiert Adalberts Ordination auf Anfang Mai, ihm folgt die Forschung bislang. Vgl. Johann Martin Lappenberg (Hg.), Hamburgisches Urkundenbuch 1: 786–1300, Hamburg 1842, S. 96 ff. (Nr. 101), Adams Unterschrift S. 97. Eine ausführliche Auseinandersetzung mit der Urkunde bietet Bernhard Schmeidler, Hamburg-Bremen und Nordost-Europa vom 9. bis 11. Jahrhundert. Kritische Untersuchungen zur Hamburgischen Kirchengeschichte des Adam von Bremen, zu Hamburger Urkunden und zur nordischen und wendischen Geschichte, Leipzig 1918, S. 255–284, mit einer Fotografie der Urkunde auf Tafel II. May, Regesten (wie Anm. 17), S. 75 (Nr. 325) erwähnt 1937, dass das Original im Staatsarchiv Hannover aufbewahrt werde, es dürfte zu jenen „2000 Urkunden des Erzstifts Bremen“ gehören, die bei einem Luftangriff am 9. Oktober 1943 verbrannten; vgl. Hans Goetting, Vor vierzig Jahren. Das Hauptstaatsarchiv Hannover und die Hochwasserkatastrophe vom 9.–11. Februar 1946, in: Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte 58, 1986, S. 253–278, das Zitat S. 257.
Autorität ohne Autoritäten
111
weise Ohrenzeugenschaft an mehreren Stellen fragwürdig. Beispielsweise erzählt Adam zwei unterschiedliche, einander widersprechende Versionen vom Tod Adalberts in Goslar am 16. März 1072, und obwohl er eine von ihnen explizit auf andere „Augenzeugen“ zurückführt (er also offenbar nicht selbst zugegen war), referiert er ausführlich Adalberts letzte Worte, so als habe er sie selbst gehört.24 Zudem inszenierte Adam bisweilen schriftliches Material als mündliche, selbst gehörte Rede Adalberts.25 Auffällig ist, dass Adam sowohl die „Ohrenzeugenschaft“ für die Worte Adalberts als auch den Verweis auf eigene Beobachtungen der Zustände während Adalberts Episkopat vorwiegend in der 1. Person Plural schreibt.26 Man könnte dies als simplen pluralis auctoris interpretieren, wie dies beispielsweise Trillmich in seiner oben zitierten Übersetzung der zentralen Stelle zur Augenzeugenschaft getan hat.27 Allerdings gibt es Indizien, dass hier eine Nuancierung notwendig ist. Zum einen meint Adams „Wir“ gerade im Bereich der jüngsten Ereignisse (ab 1066/67), während derer er sich bereits in Bremen aufhielt, einige Male klar das Kollektiv des Domklerus, etwa in der Schilderung eines Eklats bei einem Gastmahl mit dem billungischen Herzog Magnus, auf dessen Höhepunkt der Erzbischof an der Spitze seines geistlichen Gefolges psalmensingend den Saal verlässt.28 Adam stellt sich selbst hier gleichzeitig als Augenzeuge wie als Teil des Bremer Klerus dar. An zwei Stellen werden zudem Aushandlungsprozesse greifbar, denn Adam schreibt explizit, dass er gewisse problematische Aussagen pace fratrum, also „mit Erlaubnis der Brüder“ mache.29 Zusammengenommen scheint es, dass zumindest ein Teil des 24
25
26 27 28 29
Vgl. Adam, Gesta (wie Anm. 1), III.65, III.69, S. 211 ff., 215 ff. Zur Datierung von Adalberts Tod vgl. May, Regesten (wie Anm. 17), S. 78 f. (Nr. 338). Zur Darstellung der mala mors Adalberts und ihrem Platz in Adams Narrativ vgl. Schlotheuber, Persönlichkeitsdarstellung (wie Anm. 7), S. 537–545. Während die bei Adam, Gesta (wie Anm. 1), III.41, III.56, III.68, S. 184, 201, 215, zu findenden Bibelzitate in wörtlichen Aussagen Adalberts für die Redeweise eines gebildeten Klerikers noch irgendwie plausibel sind, ist die Übereinstimmung mit der Arenga einer Urkunde in ebd., III.26, S. 168, zumindest eigenartig. Für die komplizierten Überlieferungszusammenhänge vgl. Schmeidler, Hamburg-Bremen (wie Anm. 23), S. 284–287; daraus May, Regesten (wie Anm. 17), S. 62 (Nr. 261). Den in Anm. 20 genannten Stellen, die durchgehend in der 1. Person Plural gehalten sind, lassen sich weitere Verweise auf eigene Beobachtungen im Plural hinzufügen: Vgl. Adam, Gesta (wie Anm. 1), III.38 f., III.63 f., III.77, S. 181 ff., 208, 210, 224. Siehe oben, Anm. 19. Vgl. Adam, Gesta (wie Anm. 1), III.2, S. 145, übers. Trillmich, S. 331. Für die Episode vgl. ebd., III.70, S. 217 f. Wie der Konflikt zwischen den Billungern und den Erzbischöfen Adams historiografische Arbeit prägte, zeigt eindrucksvoll Hartmann, Konstruierte Konflikte (wie Anm. 8). Adam, Gesta (wie Anm. 1), III.3, S. 146: Ad quae omnia cum sibi habunde ad manus fore gloriaretur, ut pace fratrum dicam, solam clericorum et lapidum penuriam [sepe] querebatur; ebd., III.57, S. 203: […] hoc solum fas est pace omnium dici fratrum, quia toto septennio, quo supervixit archiepiscopus, ex illo famoso et opulento Bremensis ecclesiae hospitali nulla prorsus data est elemosina. Der Verweis auf die Erlaubnis der Brüder erscheint nur hier, im dritten Buch. Den Platz von Aushandlungsprozessen innerhalb der peer group des Geschichtsschreibers im historiografischen Arbeitsprozess des Mittelalters beschreibt Mortensen, From Vernacular (wie Anm. 11), S. 59 ff., 64 f.; die erinnerungskritische Grundlage entwirft Fried, Schleier
112
Daniel Föller
dritten Buches auf eine Bremer Erinnerungsgemeinschaft zurückgeht, in der erinnerte Episoden zusammengetragen und ausgehandelt wurden – gewissermaßen eine kollektive Augenzeugenschaft. Allerdings sollte nicht der Eindruck entstehen, dass Adam mit den Aussagen von Augenzeugen völlig unkritisch umgegangen wäre. Deutlich wird das an einer Episode aus dem dritten Buch der „Gesta“: Um eine hohe Geldsumme für den Erwerb einer Grafschaft aufzubringen, ließ Adalbert Kirchengeräte einschmelzen. Nach einer Aufzählung der Objekte fügt Adam hinzu: „Der Goldschmied, der sie einschmolz, erzählte, zu seinem tiefen Schmerz sei er zu dem Frevel gezwungen worden, diese Kreuze zu zerstören, und heimlich versicherte er gewissen Leuten, er habe unter den Hammerschlägen die Stimme eines stöhnenden Kindes gehört.“30 Danach fährt er ohne Umschweife in seiner Erzählung fort. Adam wusste also, dass Augenzeugen ihre Aussagen je nach Kontext anpassen konnten, er zog daraus aber keine weiterführenden Konsequenzen. Sowohl die fingierte eigene Augenzeugenschaft als auch Adams Bewusstsein über die mögliche Unzuverlässigkeit der Aussagen von Augenzeugen schmälern die Bedeutung des Konzeptes in den „Gesta“ nicht. Die Zuschreibung von Augenzeugenschaft ist ein zentrales Mittel im Text, um nichtschriftlich überlieferten Aussagen Autorität zu verleihen. Wie weit das gehen konnte, zeigt eine Bemerkung im vierten Buch der „Gesta“, der „Beschreibung der Inseln des Nordens“. Nach einer Schilderung Schwedens, in der Adam antike Bildungsinhalte und mündlich tradierte Informationen über verschiedene mirabilia miteinander kombinierte, schließt er: „Man erzählt sich noch vieles andere, das ich der Kürze halber ausgelassen habe; mögen die Augenzeugen selbst darüber berichten!“31 Dieser Schluss ist vor allem deswegen bemerkenswert, weil Adam derartige Wendungen normalerweise auf schriftliche Überlieferungen bezieht und seine Leser auffordert, in den genannten Werken selbst weiterzulesen, um ihre Kenntnisse zu vertiefen.32 Das Gespräch mit dem Augenzeugen erscheint somit als Äquivalent zu den schriftlichen Referenzwerken.
30 31
32
(wie Anm. 4), S. 83–86 (der Prozess in der nichthistorischen Gedächtnisforschung), S. 173– 183 (mittelalterliche Beispiele), S. 227 f. (grundlegende Beobachtungen zur Mündlichkeit), S. 378–380 (Teil der entworfenen historischen Memorik). Adam, Gesta (wie Anm. 1), III.46, S. 190, übers. Trillmich, S. 387: Narravit faber illa cremans magno se dolore coactum ad hoc sacrilegium, ut confringeret illas cruces, secreto quibusdam asserens ad sonitum mallei se audisse quasi vocem gementis pueri. Ebd., IV.25, S. 257, übers. Trillmich, S. 469: Aliaque multa recitari solent, quae brevitati studens omisi, ab his dicenda, qui se haec vidisse testantur. Eine vergleichbare Stelle findet sich ebd., IV.32, schol. 150, S. 267, übers. Trillmich, S. 481: Cumque diversa prorsus et insueta nostris multa ibi videantur, ab eiusdem patriae incolis haec et alia plenius dicenda relinquo. „Doch da dort noch vieles Fremde und Ungewohntes zu sehen ist, überlasse ich solche und ähnliche Erzählungen im einzelnen lieber den Landeskindern selbst“. Vgl. etwa ebd., I.13, I.22, I.26, I.29, I.43, I.61, II.2, II.3, II.24, III.74, schol. 48, S. 17, 28, 32, 35, 45, 59, 62, 64, 82, 127 f., 221.
Autorität ohne Autoritäten
113
III. INTELLEKT Die Parallelisierung von schriftlichen Autoritäten und Augenzeugenberichten führt direkt zu einer weiteren Strategie Adams, mündlich überlieferten Informationen Autorität zu verleihen. Verdankte das Konzept der Augenzeugenschaft seine besondere Valenz noch der unmittelbaren Beziehung zwischen Beobachter und Gegenstand, unterfüttert durch Theorien der Sinneswahrnehmung aus der mittelalterlichen Bildungstradition, so setzt die nächste Strategie bei der Person des Informanten selbst an. Am nächsten lag es, Informanten über ihr intellektuelles Potential aufzuwerten, und das funktionierte in einem gelehrten Umfeld am leichtesten, indem man ihre Nähe zu den klassischen Wissensbeständen und -techniken der Zeit herausstellte. Wie Adam sich dieses Mittels in seinen „Gesta“ bediente, lässt sich besonders deutlich an einer Gewährsperson zeigen: dem Dänenkönig Sven Estridsen.33 Adam artikuliert klar, dass er Sven für den wichtigsten Informanten seiner „Gesta“ hält: „Alle meine früheren und späteren Aussagen über die Barbaren stammen also aus den Berichten dieses Mannes.“34 Dies scheint angesichts der großen Zahl von anderen Informanten etwas übertrieben35, aber mit 22 expliziten Verweisen (und einer hohen Dunkelziffer von Informationen, die auf ihn zurückgehen dürften, ohne ihn eigens zu nennen) ist Sven nach Adalbert eindeutig die am häufigsten genannte nichtschriftliche Referenz. Seine besondere Bedeutung für die „Gesta“ zeigt sich auch darin, dass Adam eigens nach Dänemark reiste, um ihn zu treffen und zu interviewen: „Als ich in der letzten Zeit des Erzbischofs [Adalbert] nach Bremen kam und von den Kenntnissen dieses Königs hörte, entschloß ich mich gleich, ihn aufzusuchen.“36 Soweit wir wissen, war Sven der einzige Informant, für den Adam einen derartigen Aufwand betrieb.37 Angesichts dieser Stellung als Leitreferenz war es für Adam besonders wichtig, Svens Aussagen Autorität zu verleihen. In den „Gesta“ lassen sich drei Methoden zeigen, den Dänenkönig mit dem Kosmos schriftlicher Gelehrsamkeit in Verbindung zu bringen. Die erste war, Sven explizit eine literate Bildung zuzuschreiben: Neben entsprechenden Adjektiven (Adam bezeichnet den König als prudentissimus 33 34 35 36
37
Vgl. Santini, Oculis (wie Anm. 10), S. 50–56, zu Sven als Informant allgemein, zur Bildung bes. S. 51. Adam, Gesta (wie Anm. 1), III.54, S. 199: Igitur et ea, quae diximus vel adhuc sumus dicturi ex barbaris, omnia relatu illius viri cognovimus. Siehe oben die Liste in Anm. 6. Adam, Gesta (wie Anm. 1), III.54, S. 198: Novissimis archiepiscopi temporibus, cum ego Bremam venerim, audita eiusdem regis sapientia, mox ad eum venire disposui. Wann diese Reise allerdings genau stattfand, ist fraglich. Einen sicheren Terminus post quem stellt Adams Ankunft in Bremen dar, zwischen Mai 1066 und Mai 1067 (wie Anm. 22); als Terminus ante quem ist Adalberts Tod am 16. März 1072 zu nennen (wie Anm. 24). Dass Adam den König „gleich“ (mox) nach seiner Ankunft in Bremen aufsuchte, lässt vermuten, dass die Reise wohl in den späten 1060er Jahren stattfand. Zum Treffen der beiden vgl. vor allem – und im Kontext von Beispielen aus anderen Texten – Mortensen, From Vernacular (wie Anm. 11), S. 56 ff. Santini, Oculis (wie Anm. 10), S. 50–56, äußert sich nicht konzise zum Treffen der beiden, sondern streift diesen Punkt immer wieder.
114
Daniel Föller
beziehungsweise scientissimus)38 ist vor allem die bereits genannte Schilderung von Adams Reise einschlägig, denn in der Charakterisierung seines Informanten findet sich die Bemerkung, Sven sei nicht nur für seine sapientia berühmt, sondern auch scientia litterarum eruditus gewesen39, was in der Forschung gewöhnlich als Beleg für dessen literate, wenn nicht gar wissenschaftliche Bildung betrachtet wird und damit als Teil der ihm von Adam andernorts zugeschriebenen „zahlreichen Tugenden“ (multae virtutes).40 Dass Adams Aussage zu Svens Bildung keine reine literarische Erfindung ist, sondern zumindest an damals kursierende Vorstellungen über den Dänenkönig anknüpfte, impliziert ein Brief Papst Gregors VII. vom 25. Januar 1075. Der Reformpapst schrieb, er wisse, dass König Sven sich durch peritia litterarum auszeichne, was sich sogar in einer defensiven Übersetzung als „Kenntnisse der Schrift“ deuten lässt, wenn nicht sogar als weitergehende Bildung.41 Adam stellt aber noch auf anderen Wegen Verbindungen zwischen Svens Aussagen und dem gelehrten, schriftlich tradierten Wissen seiner Zeit her. Eine davon ist die sprachliche Parallelisierung. So bemerkt er einmal, dass Sven „die gesamte Überlieferung der Barbaren kannte, als wäre sie schriftlich festgelegt“.42 Im selben Kapitel – das sich mit dem gewaltsamen Widerstand heidnischer Slawen gegen die sächsischen Christianisierungsversuche um 1018 befasst und Märtyrererzählungen enthält – wird sogar dem Dänenkönig selbst eine vergleichbare Aussage in den Mund gelegt. Adam verlangt (offenbar in einer Interviewsituation) nach weiteren Berichten über Missionare, die den Märtyrertod starben, da diese „aus Mangel an Aufzeichnungen heute als erfunden gelten“, doch Sven winkt ab: „Laß sein, lieber Sohn! Wir haben in Dänemark und im Slawenlande so viele Märtyrer, daß sie ein Buch kaum fassen könnte.“43 In eine ähnliche Richtung weist Adams Verbgebrauch: Nicht weniger als fünf Mal verwendet er für die Mündlichkeit des Königs das Verb recitare, womit deutlich wird, dass seinen Aussagen nach Adams Verständnis festgefügte Texte zugrunde lagen.44
38 39 40
41 42 43
44
Vgl. Adam, Gesta (wie Anm. 1), II.38, IV.21, S. 99, 250. Vgl. ebd., III.54, S. 198 f. Vgl. etwa den Referenzartikel von Niels Lund, Sven Estridsen, in: Heinrich Beck/Dieter Geuenich/Heiko Steuer (Hgg.), Reallexikon der germanischen Altertumskunde 30: Stil – Tissø, Berlin 22005, S. 178 ff., hier S. 180: „Zusätzlich zu seinen polit. Qualitäten hatte Sven eine liter. Ausbildung, die ihn nach Aussagen von Gregor VII. vor anderen auszeichnete.“ Ebenso Santini, Oculis (wie Anm. 10), S. 51. Für die „zahlreichen Tugenden“ Svens vgl. Adam, Gesta (wie Anm. 1), III.54, S. 198, Santini, Oculis (wie Anm. 10), S. 51, 55. Vgl. Erich Caspar (Hg.), Das Briefregister Gregors VII. 1: Buch I–IV (MGH Epp. sel. 2,1) Berlin 1920, II.51, S. 192 ff., Zitat S. 193. Adam, Gesta (wie Anm. 1), II.43, S. 103, übers. Trillmich, S. 279: […] qui omnes barbarorum gestas res in memoria tenuit, ac si scriptae essent […]. Ebd., II.43, S. 104, übers. Trillmich, S. 281: Multa in hunc modum per diversas Sclavorum provintias tunc facta memorantur, quae scriptorum penuria nunc habentur pro fabulis. De quibus cum regem amplius interrogarem: ‚Cessa‘, inquit, ‚fili. Tantos habemus in Dania vel Sclavania martyres, ut vix possint libro comprehendi‘. Vgl. ebd., I.52, II.26, II.30, IV.16, IV.39, S. 52 f., 86, 92, 244, 275.
Autorität ohne Autoritäten
115
Adams Schilderung von Svens Gedächtnisleistungen wird von der Forschung oftmals in den Kontext oraler Traditionen gestellt, die der vorchristlichen Kultur Nordeuropas zugeschrieben werden, womit ein vermeintlicher Gegensatz zur christlich-lateinischen Bildungswelt konstruiert wird.45 Dabei hat auch die lateinische Rhetorik, die seit der Spätantike zum Trivium der septem artes liberales gehörte und somit zur schulischen Grundausbildung, eine ausgefeilte Mnemotechnik zu bieten, die im Mittelalter selbstverständlich rezipiert und angewendet wurde.46 Somit könnte man Adams Betonung von Svens mnemonischen Fähigkeiten durchaus als Hinweis auf dessen lateinische Schulbildung lesen. Dies würde gut zu anderen Aussagen der „Gesta“ passen, wenn etwa die Rede des Königs als dulcissima bezeichnet oder mit dem Verb sermocinare charakterisiert wird, das gelehrte, wenn nicht gar klerikale Konnotationen hat.47 Sven Estridsen wird von Adam also als gebildeter christlicher Monarch inszeniert, nicht als barbarischer Wikingerkönig, und durch sein intellektuelles Potential erscheint er als zuverlässiger Informant. Der Dänenkönig ist der einzige Informant Adams, dessen geistige Fähigkeiten in den „Gesta“ derart markant herausgestellt werden – angesichts seiner Bewertung als wichtigste Quelle mündlicher Überlieferung zu den „Barbaren“ wird diese besondere Autorisierung absolut verständlich. Er ist zudem der einzige Laie, den Adam in dieser Weise bewertet, ansonsten werden nur klerikale Informanten über ihre intellektuellen Kapazitäten autorisiert. Am deutlichsten geschieht dies bei Erzbischof Adalbert, und zwar sowohl in der allgemeinen Beschreibung seiner Persönlichkeit, losgelöst von konkreten Verweisen auf seine Aussagen, als auch direkt auf derartige Verweise bezogen.48 Bei anderen Klerikern – seien es die übrigen Mitglieder des Bremer Domkapitels, ein dänischer Missionsbischof, Bischof Adalward der Jüngere von Sigtuna oder Geistliche aus dessen Gefolge – ist ihre Bildung zwar selten direkt erwähnt49, darf aber doch implizit vorausgesetzt werden. Die besondere Autorität geistlicher Informanten in den „Gesta“ erklärt sich aber nicht allein aus ihrem Intellekt, sondern auch aus ihrer christlichen Religiosität. Dieser Autorisierungsstrategie gilt der nächste Abschnitt.
45 46
47 48
49
So zuletzt explizit Santini, Oculis (wie Anm. 10), bes. S. 54. Vgl. Frances A. Yeats, Gedächtnis und Erinnern. Mnemonik von Aristoteles bis Shakespeare, Berlin 62001, S. 53–122, zur mittelalterlichen Mnemotechnik nach antiken Vorbildern; Fried, Schleier (wie Anm. 4), S. 317–321, schreibt klar (S. 319): „Der Triumphzug der Rhetorik […] bewirkte die prinzipielle Einheitlichkeit des europäischen […] Gedächtniswesens“. Vgl. Adam, Gesta (wie Anm. 1), III.23, III.54, S. 166, 198 f. Vgl. die Charakteristiken ebd., III.1, III.2, S. 143 f., wo sogar von seinem „gefeierten Gedächtnis“ (memoria celebris) und seiner „einzigartigen Redegabe“ (eloquentia singularis) gesprochen wird. Für die Herausstellung seiner besonderen intellektuellen Qualität im Zusammenhang mit konkreten Aussagen vgl. ebd., III.16, III.69, S. 158, 216. Für den Kontext der geistigen Gaben Adalberts in der Charakterisierung insgesamt vgl. Schlotheuber, Persönlichkeitsdarstellung (wie Anm. 7), bes. S. 510, 512. So wird Adalward in Adam, Gesta (wie Anm. 1), IV.29, S. 261, übers. Trillmich, S. 475, beschrieben als „Bremer Domherr, der sich durch seine wissenschaftliche Bildung […] auszeichnete“ ([…] de Bremensi choro assumptum, vir litteris et morum probitate fulgentem). Der ebd., I.57, S. 57, erwähnte episcopus Danorum wird als vir prudens charakterisiert.
116
Daniel Föller
IV. FRÖMMIGKEIT Die mittelalterlichen Normvorstellungen zu Lüge und Wahrhaftigkeit sind erstaunlich schlecht erforscht. Das mag zum einen daran liegen, dass sich mittelalterliche Autoren derartigen Fragen selten ausführlicher widmeten50, zum anderen aber kann man die biblischen Aussagen, etwa das Wahrheitsgebot im Dekalog (2. Mose 20,16 respektive 5. Mose 5,20) oder in der Bergpredigt (Mt 5,37), als so eindeutig auffassen, dass sie kaum weiterer Erläuterung bedürfen – vielleicht ging es schon Adam und seinen Zeitgenossen so. Auch wenn die Wahrhaftigkeit in mittelalterlichen Tugendlehren nur in untergeordneter Funktion erscheint, so dürfte sie doch für den Bremer Domschulmeister zur Grundausstattung christlicher Moral gezählt haben. Dementsprechend überrascht es nicht, wenn Adam vor allem Aussagen geistlicher oder als besonders fromm gekennzeichneter Informanten mit entsprechenden Adjektiven versieht.51 Wie stark christliche Frömmigkeit für Adam Aussagen als wahr autorisieren konnte, zeigt ein Beispiel aus dem vierten Buch, der „Beschreibung der Inseln des Nordens“. Gegen Ende des Buches befasst er sich, nachdem er die Inseln im Nordatlantik beschrieben hat, mit dem Raum jenseits der bewohnten Gebiete. In der längsten Passage dieses Abschnitts beschreibt er in zwei Kapiteln eine Seereise, die „einige edle Friesen“ unternommen hätten, „zur Klärung der Frage“, ob es „unmittelbar nördlich der Wesermündung […] nur den endlosen Ozean, aber kein Land [gebe].“52 Mit mehreren Schiffen seien sie nach Norden gesegelt, bis sie nördlich von Island, „nachdem sie alle oben erwähnten Inseln hinter sich gelassen hatten“53, im Dunkel auf einen gewaltigen Strudel getroffen seien, der einige Schiffe zerstört habe, und danach auf einige geheimnisvolle, namenlose Inseln, von denen sie nur mit Mühe entkommen seien, nachdem sie dort Schätze an sich gebracht hätten. 50
51 52
53
Einen Überblick zu dieser Problematik bieten Paul Gerhard Schmidt, ‚De peccatis linguae‘. Lügen und andere Zungensünden, in: Ulrich Ernst (Hg.), ‚Homo mendax‘. Lüge als kulturelles Phänomen im Mittelalter (Das Mittelalter. Perspektiven mediävistischer Forschung. Zeitschrift des Mediävistenverbandes 9,2) Berlin 2005, S. 37–43; Hans-Werner Goetz, Konzept, Bewertung und Funktion der Lüge in Theologie, Recht und Geschichtsschreibung des frühen und hohen Mittelalters, in: ebd., S. 54–72. Vgl. etwa Adam, Gesta (wie Anm. 1), I.57, III.69, IV.39, S. 57, 216, 275. Auf entsprechende Bewertungen des Dänenkönigs Sven Estridsen wird noch einzugehen sein. Ebd., IV.40 f., S. 276 ff., übers. Trillmich, S. 491 ff.; der paraphrasierte Text (S. 276): […] quosdam nobiles de Fresia viros causa pervagandi maris in boream vela tetendisse, eo quod ab incolis eius populi dicitur ab ostio Wirrahae fluminis directo cursu in aquilonem nullam terram occurrere preter infinitum occeanum. Für die Untersuchung der Passage vgl. Scior, Das Eigene (wie Anm. 7), S. 131–134, mit der älteren Literatur, und neuer: Serena Bianchetti, Adamo di Brema e la geografia del Nord, in: Scarcia/Stok, Devotionis munus (wie Anm. 7), S. 101–118, bes. S. 112; Stefano Andres, Adamo di Brema e le meraviglie del Nord, in: ebd., S. 119–158, bes. S. 122 f., 139 ff., 146, 152 f., 157; Eva Valvo, Avventurosi viaggi nel misterioso Nord in Adamo di Brema e Saxo Grammaticus, in: ebd., S. 159–172; zu Adams Bild von den Friesen allgemein äußert sich dezidiert Barnwell, Missionaries (wie Anm. 7), S. 98–101. Adam, Gesta (wie Anm. 1), IV.40, S. 277, übers. Trillmich, S. 491: […] postquam retro se omnes, de quibus supra dictum est, insulas viderunt […].
Autorität ohne Autoritäten
117
Daraufhin seien sie nach Bremen zurückgekehrt, wo sie dem damals amtierenden Erzbischof Alebrand/Bezelin alles berichtet hätten.54 Die Erzählung enthält einige Elemente, bei denen es unwahrscheinlich erscheint, dass sie auf friesische Seefahrer zurückgehen – ganz gleich, ob dem Bericht eine tatsächliche Reise zugrunde liegt oder nicht.55 Für die Beschreibung des Meeres nördlich von Island – also jenseits der bewohnten Welt – verwendet Adam Motive der christlich-antiken Bildungstradition: Die „schwarze Finsternis des erstarrenden Ozeans“ spielt auf die Genesis (1. Mose 15,17) sowie einen (im vorherigen Kapitel sogar zitierten) Satz bei Martianus Capella an56, die Beschreibung des Mahlstroms ähnelt Paulus Diaconus, der wiederum auf die antike Charybdis rekurrierte.57 Im zweiten Teil der Erzählung, als die überlebenden Seeleute auf eine Insel kamen, „die ringsum wie eine Burg befestigt war“, werden ungeheure Reichtümer erwähnt, Menschen mit exotischer Lebensweise und schließlich „Menschen von erstaunlicher Größe […], die wir Kyklopen nennen“ (Adam nennt sie auch gygantes) sowie „Hunde […], die an Größe gewöhnliche Tiere weit übertrafen“. Nachdem die Friesen einige Schätze an sich genommen hatten, seien sie von den Monstren verfolgt worden und auf ihren Schiffen entkommen.58 54 55 56
57
58
Adam datiert die Reise der Friesen also auf die Jahre zwischen 1035 und 1043, wenn man den Daten von May, Regesten (wie Anm. 17), S. 49–52 (Nr. 201, 219), folgt. Zuletzt zu dieser Frage ausführlich: Gryte Anne van der Toorn-Piebinga, Friese ontdekkingsreizigers in de elfde eeuw, in: It beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy 48,2, 1986, S. 114– 126, bes. S. 123 ff. Adam, Gesta (wie Anm. 1), IV.40, S. 277, übers. Trillmich, S. 491: […] subito collapsi sunt in illam tenebrosam rigentis oceani caliginem, quae vix oculis penetrari valeret. Die entsprechende Bibelstelle hat mit caligo tenebrosa den selben Wortlaut. Martianus Capella, Les noces de Philologie et de Mercure. Livre VI: La géométrie. Texte établi et traduit par Barbara Ferré (Collection des universités de France 389) Paris 2007, S. 44 f. (§ 666), stimmt nur sachlich überein: […] ultra quam [d. h. Thyle] nauigatione unius diei mare concretum est. Für das Zitat im Text vgl. Adam, Gesta (wie Anm. 1), IV.39, S. 276. Vgl. Adam, Gesta (wie Anm. 1), IV.40, S. 277 mit Anm. 4. Schmeidler ist sicher, dass Adam „Paulus bis zum Schluß des A-Textes nicht gekannt“ habe, „erst in den Scholien ist er benutzt.“ Er wirft die Frage auf, ob „er den Bericht in dieser Gestalt mit der aus Paulus stammenden Schilderung des Flutwirbels von Erzbischof Adalbert […] in Bremen erhalten“ habe; in diesem Falle wäre noch die Möglichkeit zu ergänzen, dass ebenso gut Alebrand/Bezelin die Worte der Langobardengeschichte gegenüber Adalbert benutzt haben könnte, wenngleich Adam trotz großen Lobes in seiner Vita kein Wort über dessen Bildung verliert (vgl. ebd., II.69-II.82, S. 130–141). Für die erwähnte Stelle vgl. Paulus Diaconus, Historia Langobardorum. Geschichte der Langobarden, hrsg. und übers. von Wolfgang F. Schwarz, Darmstadt 2009, S. 118– 121 (I.6). Adam, Gesta (wie Anm. 1), IV.41, S. 278, übers. Trillmich, S. 493: Et iam periculum caliginis et provintiam frigoris evadentes insperate appulerunt ad quandam insulam altissimis in circuitu scopulis ritu oppidi munitam. Huc visendorum gratia locorum egressi reppererunt homines in antris subterraneis meridiano tempore latitantes. Pro quorum foribus infinita iacebat copia vasorum aureorum et eiusmodi metallorum, quae rara mortalibus et preciosa putantur. Itaque sumpta parte gazarum, quam sublevare poterant, laeti remiges festine remeant ad naves. Cum subito retro se venientes contemplati sunt homines mirae altitudinis, quos nostri appellant Cyclopes. Eos antecedebant canes magnitudinem solitam excedentes eorum quadrupedum, quorum incursu raptus est unus de sociis, et in momento laniatus est coram eis. Reliqui
118
Daniel Föller
Obwohl dieses Narrativ sich innerhalb der literarischen Konventionen mittelalterlicher Bildungstradition bewegt59, autorisiert Adam es mit besonderer Intensität. Zunächst einmal werden die Friesen als besonders fromme Christen dargestellt: Als sie die bekannte Welt hinter sich ließen, „empfahlen sie Gott, dem Allmächtigen, und seinem hl. Bekenner Willehad ihre Fahrt“60; als sie in den Mahlstrom gerieten, flehten „sie nur noch zu Gott um Erbarmen […], er möge ihre Seelen aufnehmen“61; die Rettung aus der Strömung erfolgte „durch Gottes gnädige Hilfe“62; und nach ihrer Rückkehr nach Bremen beschreibt Adam, dass sie „dem gütigen Christus und seinem Bekenner Willehad für ihre Rückkehr und Errettung Dankopfer darbrachten.“63 Neben dieser außergewöhnlich intensiven Zurschaustellung von Frömmigkeit zeichnet Adam penibel die Überlieferungskette nach. Die friesischen Seeleute hätten „Bischof Alebrand alles der Reihe nach [geschildert]“64, der es wiederum an seinen Nachfolger „Bischof Adalbert seligen Angedenkens“ weitergegeben habe und dieser an Adam selbst.65 Die Aussagen der frommen und auch von Gott begünstigten Augenzeugen sind also durch die Lehrautorität zweier Bischöfe bestätigt66, von denen einer in seiner Vita als geradezu idealer Hirte gezeichnet, und der andere, umstrittene an der fraglichen Stelle mit dem Zusatz beatae memoriae ebenfalls als fromm markiert wird. Mahlstrom, Kyklopen und Riesenhunde bedurften offenbar eines besonderen argumentativen Aufwands. Eine vergleichbare Autorisierungsstrategie wendete Adam auch bei dem seiner Ansicht nach wichtigsten Informanten seiner „Gesta“ an, dem Dänenkönig Sven Estridsen. Zusätzlich zu der bereits angesprochenen Betonung von dessen intellektuellen Fähigkeiten stellt Adam auch die besondere Religiosität Svens heraus.67 Direkte Epitheta sind selten, nur einmal erscheint er in den „Gesta“ als „rechtgläu-
59 60 61 62 63 64 65 66 67
vero suscepti ad naves evaserunt periculum, gygantibus, ut referebant, pene in altum vociferando sequentibus. Wie sehr Adam die in der christlich-antiken Bildungstradition kursierenden Topoi über den Norden fortschrieb, zeigt besonders deutlich Fraesdorff, Der barbarische Norden (wie Anm. 8), S. 290–308. Adam, Gesta (wie Anm. 1), IV.40, S. 277, übers. Trillmich, S. 491: […] postquam retro se omnes, de quibus supra dictum est, insulas viderunt, omnipotenti Deo et sancto confessori Willehado suam commendantes viam et audatiam […]. Ebd., IV.40, S. 277, übers. Trillmich, S. 493: Tunc illis solam Dei misericordiam implorantibus, ut animas eorum susciperet […]. Ebd., IV.40, S. 278, übers. Trillmich, S. 493: Ita illi ab instanti periculo, quod oculis viderant, oportuno Dei auxilio liberati […]. Ebd., IV.41, S. 278, übers. Trillmich, S. 493: […] pio Christo et confessori eius Willehado reversionis et salutis suae hostias immolarunt. Ebd., IV.41, S. 278, übers. Trillmich, S. 493: Tali fortuna comitati Fresones Bremam perveniunt, ubi Alebrando pontifici ex ordine cuncta narrantes […]. Ebd., IV.40, S. 276, übers. Trillmich, S. 491: Item nobis retulit beatae memoriae pontifex Adalbertus in diebus antedecessoris sui […]. So auch schon Scior, Das Eigene (wie Anm. 7), S. 133 f. Vgl. zu dieser Charakterisierung Svens in den „Gesta“ knapp Santini, Oculis (wie Anm. 10), S. 51, 54 f.
Autorität ohne Autoritäten
119
biger König“ (orthodoxus rex).68 Vielmehr beschreibt Adam das christliche Verhalten Svens: Er zählt seine Missionsbemühungen auf69, schildert seine Kirchenreformen in Dänemark70 und lobt ihn für sein vorbildliches Verhalten gegenüber den Erzbischöfen von Hamburg-Bremen.71 Auch Svens Umfeld wird als christlich charakterisiert: Ein Verwandter von ihm erscheint als Märtyrer in einem Slawenaufstand72, seine Tochter heiratet den christlichen Slawenfürsten Gottschalk und wird bei Konflikten mit Heiden 1066 aufgrund ihres Glaubens schwer gedemütigt73, Sven selbst war in seiner Jugend Gefolgsmann des Schwedenkönigs Anund Jakob, den Adam als Bekehrerkönig stilisiert.74 Selbst bei sündhaftem Verhalten zeigt Adam die vorbildliche Reue des Königs, etwa nach einem Eidbruch oder bei einer inzestuösen Ehe.75 Überhaupt habe er „alle Belehrungen Adalberts aus der Schrift sorgfältig aufgenommen und gemerkt.“76 Selbst sein Sexualleben, das offenbar chronisch von den christlichen Moralvorstellungen der Zeit abwich, wird von Adam als grundsätzliche Schwäche seiner Ethnie relativiert.77 Wie Adam mündliche Aussagen durch die Ausstellung christlicher Religiosität autorisierte, lässt sich auch ex negativo gut erkennen, wenn er nämlich Aussagen anzweifelt. Besonders eindrucksvoll sind die Beispiele von Bovo und Paulus, zwei engen Vertrauten Erzbischof Adalberts. Bischof Bovo wird am Ende des dritten Buches in einer Auflistung der von Adalbert geweihten Bischöfe zu dessen engsten drei Vertrauten gezählt.78 Während Adam die anderen beiden positiv zeichnet, scheint er der abenteuerlichen Vita Bovos zu misstrauen: „[E]r rühmte sich, aus Freude am Pilgern dreimal Jerusalem besucht zu haben; Sarazenen hätten ihn von dort nach Babylonien verschleppt, und als er endlich freigekommen sei, habe er
68 69 70
71 72
73 74 75 76 77 78
Vgl. Adam, Gesta (wie Anm. 1), III.72, S. 220. Vgl. ebd., III.54, IV.9, IV.16, S. 198 f., 237, 243 f. Vgl. ebd., III.25, III.33, IV.2, IV.8, S. 167 f., 175, 230 f., 235 f. Vgl. zu Svens Bistumsorganisation und ihrer Darstellung bei Adam zuletzt ausführlich Michael H. Gelting, Elusive Bishops. Remembering, Forgetting, and Remaking the History of the early Danish Church, in: Sean Gilsdorf (Hg.), The Bishop. Power and Piety at the first Millennium (Neue Aspekte der europäischen Mittelalterforschung 4) Münster 2004, S. 169–200, bes. S. 187–198. Vgl. Adam, Gesta (wie Anm. 1), II.75, III.72, III.74, S. 135, 220 f. Vgl. ebd., II.43, S. 103 f. Hier könnte man noch Svens Urgroßvater Harald Blauzahn ergänzen, den Adam zu einem Heiligen zu stilisieren versucht. Vgl. hierzu Niels Lund, Harald Bluetooth. A Saint very nearly made by Adam of Bremen, in: Judith Jesch (Hg.), The Scandinavians from the Vendel Period to the tenth Century. An ethnographic Perspective, Woodbridge 2002, S. 303–320. Vgl. Adam, Gesta (wie Anm. 1), III.19, III.51, S. 162, 194. Vgl. ebd., II.73, S. 134. Vgl. ebd., III.12, schol. 61, S. 151 ff. Ebd., III.21, S. 164, übers. Trillmich, S. 355: […] omnia, quae de scripturis ab illo proferebantur, subtiliter notans retinensque memoriter […]. Vgl. ebd., III.21 mit schol. 72, S. 164. Zu dieser Entschuldigung vgl. auch Santini, Oculis (wie Anm. 10), S. 49 ff. Vgl. Adam, Gesta (wie Anm. 1), III.77, S. 224 f. Vgl. zur narrativen Funktion der Schmeichler in den „Gesta“ die Überlegungen von Schlotheuber, Persönlichkeitsdarstellung (wie Anm. 7), bes. S. 522 f., zur „falschen Religion“ ebd., S. 524 f.
120
Daniel Föller
viele Länder der Erde durchzogen.“79 Der Gebrauch des negativ konnotierten Verbs iactare zur Einleitung von Bovos Reisebericht wird noch dadurch verstärkt, dass Adam eigens ergänzt, „seine Herkunft und seinen Weiheort kenne ich nicht“, und dass ihm ein eigener Bischofssitz gefehlt habe.80 Während die Verknüpfung eines dubiosen Reiseberichts mit einem dubiosen Bischof noch recht dezent bleibt, wird Adam in einem anderen Fall direkter. Einem Kapitel, in dem er die Schmeichler am Hof des Erzbischofs beschreibt81, fügt er ein Scholion hinzu, in dem er sich mit einem Mann namens Paulus beschäftigt.82 Dieser habe „aus Habgier oder Wissensdrang […] das Byzantinische Reich aufgesucht“ (pro avaritia vel pro sapientia exulatus in Greciam) und sich seither mit allerlei unwahrscheinlichen Fähigkeiten gebrüstet; durch seine „Lügen“ (mendacia) habe er das Vertrauen des Erzbischofs gewonnen. Um ihn und seine Aussagen zu delegitimieren, betont Adam, dass der „Fremde“ (advena) Paulus „aus dem Judentum zum christlichen Glauben bekehrt“ (ex Iudaismo conversus ad christianam fidem) sei – für ihn kein echter Christ, der lügenhafte Dinge sagt.83 V. DAS PROBLEM DER LÜCKE Die Autorisierung mündlich tradierter Aussagen erfolgte bei Adam also wesentlich über die Nähe des Informanten zu dem von ihm Beschriebenen (Augenzeugenschaft) oder über seine persönliche Zuverlässigkeit, mit den wesentlichen Kriterien der intellektuellen Eignung (vor allem durch literate Bildung) und der moralischen Integrität (durch den Ausweis christlicher Religiosität). Freilich wird damit nur ein Teil von Adams Aussagen abgedeckt, denn von den eingangs genannten gut 220 Verweisen auf orale Überlieferungen lässt sich nur etwa ein Drittel näher bestimmbaren Informanten zuordnen, in den übrigen zwei Dritteln der Fälle bleibt völlig unklar, woher die Informationen stammten.84 Es sind also noch jene Strategien in den Blick zu nehmen, mit denen Adam sich den mündlich tradierten Aussagen an 79 80 81 82 83
84
Adam, Gesta (wie Anm. 1), III.77, S. 225, übers. Trillmich, S. 431: […] qui se tamen peregrinationis amore Ierosolimam ter accessisse iactabat, indeque Babyloniam deportatum a Sarracenis, tandemque solutum multas per orbem transisse provincias. Vgl. ebd., III.77, S. 225, übers. Trillmich, S. 431; das Zitat: […] tercius Bovo nomen habuit, incertum unde natus aut ubi ordinatus. Vgl. ebd., III.36, S. 178 f. Vgl. ebd., schol. 77, S. 179, übers. Trillmich, S. 373, für die folgenden Zitate. Ob es sich hierbei um dieselbe Person handelt, die im Codex Laureshamensis. Bearbeitet und neu herausgegeben von Karl Glöckner 1: Einleitung. Regesten. Chronik, Darmstadt 1929, S. 392 (Kap. 123c), von Adalbert ins Kloster Lorsch entsandt und im Text ausnehmend negativ gezeichnet wird, ist unklar. Die Forschungslage zu jüdischen Proselyten im Mittelalter vor den Kreuzzügen ist verhältnismäßig schlecht; den ausführlichsten Überblick bietet Jessie Sherwood, Jewish Conversion From the Sixth Through the Twelfth Century. Phil. Diss. Toronto 2006, S. 85–104, zum 10. und 11. Jahrhundert. Gegen Ende des 11. Jahrhunderts scheint die Haltung gegenüber konvertierten Juden zunehmend negativer geworden zu sein (ebd., S. 98– 104); in diesem Zusammenhang wird auch auf Adams Aussagen zu Paulus verwiesen (S. 99). Siehe oben, S. 106 mit Anm. 6 für die Aufzählung der genauer identifizierbaren Informanten.
Autorität ohne Autoritäten
121
sich näherte. Eine der Hauptschwierigkeiten beim Abfassen der „Gesta“ stellte für ihn die Lückenhaftigkeit seiner Informationen dar, und sein Umgang mit diesem Problem verrät viel über seine Arbeitsweise. Adams Ausgangspunkt war klar die schriftliche Überlieferung; nicht zufällig steht sie bei seinen programmatischen Aussagen in der Vorrede an der Spitze seiner Informationsquellen, und durch die Formulierung hystoriae et privilegia Romanorum, mit der er sie umschreibt, oszillieren die Schriftzeugnisse zwischen zwei machtvollen Autoritäten, derjenigen des Papstes und derjenigen der römischen Antike.85 Der Primat des schriftlichen Materials wird im ersten Buch der „Gesta“ besonders deutlich, in dem Adam peinlich genau seine Quellen belegt. Mehrfach markiert er aber auch die Grenzen der schriftlichen Überlieferung. Bereits mit der Beschreibung des schriftlichen Materials in der Vorrede als „verstreute Zettel“ (scedulae dispersae) verdeutlicht er dessen fragmentarischen Charakter, was nur durch die „Überlieferung der Alten“ (seniorum traditio) ausgeglichen werden kann.86 Betrachtet man allein das erste Buch, so finden sich drei beziehungsweise vier Passagen, in denen schriftlich überlieferte Nachrichten mit anderweitig tradierten Informationen ergänzt wurden. Während dies einmal nur unbestimmte posteri, „Spätere“, sind, die einen Passus der „Vita Willehadi“ ergänzen (was sowohl mündliche Überlieferung als auch später entstandene Texte meinen kann)87, sind die anderen drei Stellen spezifischer: Einen Wunderbericht über Erzbischof Rimbert (Erzbischof 865–888), den er einem verlorenen Werk eines Corveyer Abtes namens Bovo entnimmt, ergänzt Adam mit einer Beobachtung über die zu seiner eigenen Zeit gepflegte Erinnerung an die Ereignisse88; an zwei weiteren Stellen füllt Adam Lücken in den ihm vorliegenden historiografischen Texten zur Geschichte der Dänen mit Aussagen Sven Estridsens auf, wenngleich er nach einer Aufzählung von Königen seine Unsicherheit über die Chronologie äußert.89 In den übrigen drei Büchern lässt sich ein ähnliches Vorgehen beobachten. In identischer Weise verfährt Adam mit den Lücken der ihm bekannten mündlichen Überlieferung, wenngleich sich das seltener erkennen lässt – möglicherweise eine Folge der überwiegend passivischen Hinweise, da ein simples dicitur („es heißt, dass“) durchaus mehrere Informanten und ihre Überlieferungen zur Quelle
85 86 87
88 89
Vgl. Adam, Gesta (wie Anm. 1), Praefatio, S. 3. Vgl. ebd. Vgl. ebd., I.18, S. 25. Für die entsprechende Passage über die Translation der Gebeine des hl. Willehad (Bischof 787–789) durch seinen Nachfolger Willerich (Bischof 789/805–838) vgl. Ansgar, Vita sancti Willehadi, hg. von Georg Heinrich Pertz, [Scriptores rerum Sangallensium. Annales, chronica et historiae aevi Carolini] (MGH SS 2) Hannover 1829, S. 378–390, hier S. 384 (Kap. 11). Zur Abfassung der Vita vgl. Gerlinde Niemeyer, Die Herkunft der Vita Willehadi, in: DA 12, 1956, S. 17–35. Vgl. Adam, Gesta (wie Anm. 1), I.39, S. 43; der verlorene Text wird offenbar wörtlich zitiert. Vgl. ebd., I.47 f., I.52, S. 47 f., 52 f., übers. Trillmich, S. 219, 225, mit dem Zitat an letzterer Stelle: Tanti autem reges, immo tyranni Danorum, utrum simul aliqui regnaverint, an alter post alterum brevi tempore vixerit, incertum est.
122
Daniel Föller
haben könnte.90 Wiederholte Verweise auf die Aussagen „anderer“ (aliqui oder alii) implizieren mehrere Überlieferungsträger91, die Adam zu einem Thema befragte und ihre Aussagen dann ergänzend arrangierte. Dabei ist mit Überschneidungen zu rechnen, wie die zweimalige Erwähnung von übereinstimmenden Aussagen „aller“ (omnes) nahelegt.92 Offen beschreibt Adam dieses Verfahren bei einer Rechtfertigung, warum Erzbischof Adalbert die ihm untergebenen Kleriker mit harter Hand führte: „[E]inen gewichtigen Grund hierfür habe ich aus seinem eigenen Munde vernommen; anderes erfuhr ich von anderen.“93 Neben Adalbert selbst hat es also noch mehrere andere Informanten zu diesem Punkt gegeben. Ähnlich verhält es sich mit der einzigen Lücke im Wissen Sven Estridsens, die Adam erwähnt. Nach einer langen Passage über den Schwedenkönig Erik ‚den Siegreichen‘ merkt der Chronist an: „Dass er [d. h. Erik] aber mit Otto III. gekämpft hat und besiegt wurde, habe ich von anderen gehört. Der König [d. h. Sven] wusste davon nichts.“94 Letztere Passage ist besonders deswegen interessant, weil Adam in den vorangegangenen Kapiteln ausführlich auf Sven rekurriert und diesen von ihm stark autorisierten Informanten offenbar nur dort ergänzt, wo diesem Wissen zu fehlen scheint. Allerdings hätte Adam wohl seinen eigenen Autorisierungsstrategien vertrauen sollen: Der Krieg zwischen Otto und Erik, von dem die anonymen alii berichteten, Sven aber nicht, hat nach derzeitigem Kenntnisstand nie stattgefunden.95 Das Schließen von Lücken der schriftlichen wie mündlichen Überlieferung ist aber nur eine Seite des Phänomens, denn in den „Gesta“ finden sich auch intendierte Lücken. Drei Begründungen Adams dafür erscheinen im Text: das Streben nach Kürze, Zweifel am Wahrheitsgehalt der Aussagen und schließlich Diskretion. Am Ende der Adalbertsvita im dritten Buch legt Adam die rhetorischen Prinzipien offen, denen er folgt: „[I]ch konnte nicht kurz und klar sein, wie es die Rhetorik verlangt, aber ich habe mir alle Mühe gegeben, wahrhaftig zu schreiben, soweit das Wissenschaft und Urteil bei einem solchen Thema vermögen. Allerdings habe ich vieles verschwiegen und bin nur auf das eingegangen, was im allgemeinen für die Nachwelt wissenswert und dessen Bewahrung für die Hamburger Kirche nützlich
90
91
92 93 94 95
Es kommt noch die Schwierigkeit hinzu, dass sich derartige rein verbale Wendungen auch auf schriftliche Quellen beziehen können, so etwa ebd., I.3, I.49, II.1, S. 6 (dicitur mit einem folgenden Sallust-Zitat), 48 f. (aiunt bezieht sich auf Paraphrase von Synodalakten), 61 (dicitur mit folgendem Vergil-Zitat). Vgl. ebd., II.29, II.35, II.37 f., II.40, II.61, III.56, III.65, schol. 159, S. 89, 96, 98–101, 121, 200, 212, 274. Einige dieser Stellen präsentieren auch verschiedene, einander widersprechende Versionen; auf dieses Phänomen und Adams Umgang damit wird im nächsten Abschnitt einzugehen sein. Vgl. ebd., II.40, III.47, S. 100 f., 190. Zitat ebd., III.56, S. 200, übers. Trillmich, S. 401: […] ipse magnam exposuit rationem, quam de illius ore nos audivimus; alia didicimus ex aliis. Zitat ebd., II.38, S. 99, übers. Trillmich, S. 275: Quod vero cum Ottone tercio pugnaverit et victus est, ab aliis comperi; rex tacuit. Vgl. ebd., II.38, S. 99, übers. Trillmich, S. 401, mit Anm. 2 (Schmeidler) bzw. Anm. 157 (Trillmich).
Autorität ohne Autoritäten
123
ist.“96 Daneben rechtfertigt er sich an anderer Stelle noch damit, dass er den Leser nicht „langweilen“ wolle.97 Allerdings bietet er dem (zeitgenössischen) Rezipienten bisweilen die Möglichkeit, solche Lücken durch eigene Recherchen zu füllen, indem er auf andere Werke oder gut informierte Personen verweist.98 Die Formulierung im vorangegangenen Zitat, er habe nur die Dinge aufgeschrieben, die ad sciendum digna seien, dürfte auch auf seine zweite Kategorie zielen, da nicht nur überflüssige oder leicht zugängliche Informationen, sondern auch Unglaubwürdiges von ihm nicht aufgenommen wurde, wie er an einer anderen Stelle klar sagt: „Soviel habe ich glaubwürdig von Island und dem äußersten Thule erfahren, Fabeleien übergehe ich.“99 Ebenfalls gut zu erkennen ist das Unterdrücken von Sachverhalten, die für Adam offenbar irgendwie schwierig waren. Während er die angeblich bei den heidnischen Opferzeremonien in Uppsala gesungenen „unanständigen Lieder“ (neniae inhonestae) klar aus moralischen Gründen nicht in ein Werk christlicher Gelehrsamkeit aufgenommen hat100, scheint er an einer anderen Stelle Erzbischof Adalbert beziehungsweise den Bremer Domklerus zu schützen. Er beschreibt, wie in den letzten Lebensjahren Adalberts, als dieser nach seiner Vertreibung vom Königshof 1066 in eine schwere politische und persönliche Krise geraten war, Gelder aus kirchlichen Einrichtungen veruntreut wurden, und an ein kurzes Referat der kanonischen Rechtslage schließt er an: „Nur soviel darf ich mit Erlaubnis der Brüder aussagen, daß während der sieben Jahre, die der Erzbischof noch zu leben hatte, aus diesem berühmten und reichen Spital der Bremer Kirche überhaupt keine Almosen verteilt wurden.“101 Das bereits erwähnte Erinnerungskollektiv unterwarf Adams Ausführungen in den „Gesta“ offenbar einer strikten Kontrolle.102
96 Ebd., III.71, S. 218 f., übers. Trillmich, S. 423: […] cum non potui breviter aut dilucide, ut ars precipit, omnem operam dedi, ut scriberem veraciter, secundum quod scientia et opinio se habet in hac parte. Quamvis multa reticens ad ea presertim festinarim, quae generaliter posteris ad sciendum sunt digna vel spetialiter ad retinendum Hammaburgensi ecclesiae utilia. Für weitere Verweise auf die Kürze als Begründung für Auslassungen vgl. ebd., I.13, I.17, I.26, S. 17, 24, 32. 97 Vgl. ebd., III.76, S. 222. 98 Vgl. ebd., I.13, I.17, I.26, I.43, III.74, S. 17, 24, 32, 43, 221, für schriftliche Überlieferungen; ebd., II.43, IV.25, IV.32, S. 103, 257, 267, für mündliche Informanten. 99 Ebd., IV.36, S. 274, übers. Trillmich, S. 489: Haec de Island et ultima Thyle veraciter comperi, fabulosa preteriens. 100Vgl. ebd., IV.27, S. 260. Obwohl die Menge der Forschungsliteratur zu Adams Uppsala-Beschreibung enorm ist, werden die neniae inhonestae kaum einmal ausführlicher betrachtet. Vgl. zur Forschungsgeschichte Magnus Alkarp, Det Gamla Uppsala. Berättelser & metamorfoser kring en alldeles särskild plats (Occasional Papers in Archaeology 49) Uppsala 2009; die aktuellsten Arbeiten sind: John Ljungkvist (Hg.), Gamla Uppsala i ny belysning (Religionsvetenskaplige studier från Gävle 9) Uppsala 2013 (darin besonders der Beitrag von Olof Sundqvist, S. 69–112); Timothy Bolton, A Textual Historical Response to Adam of Bremen’s Witness to the Activities of the Uppsala-Cult, in: Gro Steinsland (Hg.), Transformasjoner i vinkingtid og norrøn middelalder (Møteplass Middelalder. Medieval Crossroads 1) Oslo 2006, S. 61–91. 101 Adam, Gesta (wie Anm. 1), III.57, S. 203, übers. Trillmich, S. 405: […] hoc solum fas est pace omnium dici fratrum, quia toto septennio, quo supervixit archiepiscopus, ex illo famoso et opulento Bremensis ecclesiae hospitali nulla prorsus data est elemosina. 102 Für das Erinnerungskollektiv siehe oben, S. 111 f. mit Anm. 29.
124
Daniel Föller
Das beherrschende Prinzip dieses Verfahrens ist die Harmonisierung der gesammelten Aussagen. Adam spricht deutlich von der „Wahrheit“, um die es ihm geht und die er zu erkennen versucht.103 Diese Tendenz führt sogar dazu, dass Adam über manifeste Widersprüche kommentarlos hinweggeht. Gut erkennen lässt sich dies in zwei Kapiteln des dritten Buches, in denen er Konflikte zwischen paganen ostseeslawischen Gruppen um 1056/57 beschreibt, in die dann auch der Sachsenherzog Bernhard, der christianisierte Slawenfürst Gottschalk und Sven Estridsen eingriffen. Die erste Passage, die auf „einen gewissen Edelmann aus Nordelbien“ (quidam nobilis homo de Nordalbingis) zurückgeht, bewertet das Eingreifen der christlichen Fürsten durchaus negativ, denn nachdem die unterlegene Slawengruppe ihnen 15.000 Pfund Silber geboten hatte, seien sie heimgekehrt, „vom Christentum war nicht die Rede; die Sieger waren nur auf Beute bedacht.“104 Die zweite Passage geht in eine ähnliche Richtung, konzentriert sich allerdings auf die Sachsen: „[D]ie Slawenstämme hätten zweifellos schon längst mit Leichtigkeit zum Christenglauben bekehrt werden können, wenn nicht die Habsucht der Sachsen dem im Wege gestanden hätte.“105 Weitere Vorwürfe folgen. Pikanterweise ist der Informant hierfür der in den Konflikt selbst involvierte Dänenkönig. Dass auch er zu den Siegern gehörte, denen es angeblich nur um Silber und nicht um die Mission ging, kommt nicht zur Sprache. Adams Wahrheit über die gottlosen Sachsen verdrängt Inkohärenzen und Differenzierungen.106 Allerdings könnte man überlegen, ob sich Adam dieser Spannung bewusst war, denn Sven wird hier besonders deutlich als Informant autorisiert, mit dem Superlativ veracissimus. 103 Der explizite Bezug auf die Wahrhaftigkeit des eigenen Textes findet sich bei Adam, Gesta (wie Anm. 1), Praefatio, II.62, III.71, IV.36, Epilogus, S. 3, 122, 219, 274, 281 (zweimal, Z. 13 und 24) und öfter. 104 Vgl. ebd., III.22, S. 165 f., übers. Trillmich, S. 355, 357; das Zitat: Nostri cum triumpho redierunt, de christianitate nullus sermo, victores tantum predae intenti. Zu den Konflikten von 1056/67 vgl. Wolfgang Brüske, Untersuchungen zur Geschichte des Lutizenbundes. Deutschwendische Beziehungen des 10.–12. Jahrhunderts (Mitteldeutsche Forschungen 3) Köln/Wien 21983, S. 77–81 (mit vorsichtiger Datierung auf 1056/59); Christian Lübke, Regesten zur Geschichte der Slaven an Elbe und Oder (vom Jahr 900 an) 4: Regesten 1013–1057 (Osteuropastudien der Hochschulen des Landes Hessen. Reihe 1: Gießener Abhandlungen zur Agrar- und Wirtschaftsforschung des europäischen Ostens 152) Berlin 1987, S. 295–301 (Nr. 742 ff., Datierung auf „vor Sommer 1057“); für das dänisch-slawische Verhältnis dens., Die Beziehungen zwischen Elb- und Ostseeslawen und Dänen vom 9. bis zum 12. Jahrhundert. Eine andere Option elbslawischer Geschichte?, in: Ole Harck/Christian Lübke (Hgg.), Zwischen Reric und Bornhöved. Die Beziehungen zwischen den Dänen und ihren slawischen Nachbarn vom 9. bis ins 13. Jahrhundert. Beiträge einer internationalen Konferenz, Leipzig 4.–6. Dezember 1997 (Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropas 11) Stuttgart 2001, S. 23– 36, bes. S. 28. 105 Vgl. Adam, Gesta (wie Anm. 1), III.23, S. 166, übers. Trillmich, S. 357; das Zitat: […] populos Sclavorum iamdudum procul dubio facile converti posse ad christianitatem, nisi obstitisset avaricia Saxonum. 106 Vgl. Hartmann, Konstruierte Konflikte (wie Anm. 8), zu Adams Perspektive auf die Sachsenherzöge und die Folgen für die „Gesta“, bes. S. 118 ff. für Adams Darstellung des Verhältnisses von Erzbischof Adalbert und dem Billunger-Herzog Bernhard II., der an dem fraglichen Kriegszug teilnahm.
Autorität ohne Autoritäten
125
VI. DAS PROBLEM DER VARIANZ Dass Adam dazu imstande war, Widersprüchlichkeiten zu ignorieren, sollte keineswegs zu dem Schluss verführen, dieses Verfahren sei seine Standardantwort auf das Problem gewesen. Bisweilen äußert Adam nämlich durchaus offen, dass ihm zu bestimmten Themen widersprüchliche Nachrichten vorlagen. Um seine Arbeitsweise zu verstehen und den Prozess, in dem er Informationen autorisierte oder verwarf, soll hier ein prominentes Beispiel vorgestellt und analysiert werden: die Darstellung vom Tod des norwegischen Bekehrerkönigs Olaf Haraldsson, der zur Abfassungszeit der „Gesta“ bereits seit einigen Jahrzehnten als Heiliger verehrt wurde.107 Adam schließt sich dieser Tradition an, indem er dem eigentlichen Kapitel, das er den Ereignissen widmet, den Satz voranstellt, er werde nun „vom Martyrium des Königs Olaf“ (de martyrio Olaphi regis) berichten.108 Die Erzählung der „Gesta“ verläuft folgendermaßen109: Olaf, kontinuierlich im Konflikt mit dem anglodänischen König Knut dem Großen, habe sich durch seine Christianisierungsmaßnahmen Feinde unter seinen principes gemacht und sei von ihnen vertrieben worden; diese hätten die Herrschaft über Norwegen Knut angetragen. „Olaf aber setzte all seine Hoffnung auf Gott“110, habe Verbündete gesammelt und seine Herrschaft zurückerobert. Danach habe er die Christianisierung vor allem durch die Bekämpfung von „Zauberern“ (magi) weiter vorangetrieben. Dies sei ihm dann zum Verhängnis geworden: „Und schon hatte er sein Vorhaben größtenteils verwirklicht, da schreckten die wenigen übrig gebliebenen Zauberer aus Rache für die vom König gerichteten nicht mehr davor zurück, auch ihn zu ermorden.“111 Dem folgt sogleich eine 107 Nachweisen lässt sich der Kult nicht nur in Skandinavien, sondern spätestens seit den 1050ern in England und ab dem letzten Viertel des 11. Jahrhunderts auch in Russland. Vgl. für England jetzt den Überblick bei Lenka Jiroušková, Der heilige Wikingerkönig Olav Haraldsson und sein hagiographisches Dossier. Text und Kontext der Passio Olavi (mit kritischer Edition) 1–2 (Mittellateinische Texte und Studien 46) Leiden/Boston 2014, 1, S. 254–262; sie überlegt auch, ob es bereits im 11. Jahrhundert einen Olafskult in Nordfrankreich gab (S. 270–321). Für Russland vgl. Tatjana Jackson, The Cult of St Olaf and Early Novgorod, in: Haki Antonsson/Ildar H. Garipzanov (Hgg.), Saints and their Lives on the Periphery. Veneration of Saints in Scandinavia and Eastern Europe (c. 1000–1200) (Cursor Mundi 9) Turnhout 2010, S. 147–167. Für Dänemark vgl. Tore Nyberg, Olavskulten i Danmark under medeltiden, in: Lars Rumar (Hg.), Helgonet i Nidaros. Olavskult och kristnande i Norden (Skrifter utgivna av Riksarkivet 3) Stockholm 1997, S. 53–82; zu Island Ólafur Ásgeirsson, Olav den helige på Island, in: ebd., S. 83–90. Zur Entwicklung in Norwegen vgl. Haki Antonsson, St Magnús of Orkney. A Scandinavian Martyr-Cult in Context (The Northern World 29) Leiden 2007, S. 103–121. Beschreibungen des Kults bietet auch Adam selbst: Vgl. Adam, Gesta (wie Anm. 1), II.61, III.17, IV.33, S. 121 f., 159 f., 267 f. 108 Vgl. Adam, Gesta (wie Anm. 1), II.60, S. 120, übers. Trillmich, S. 299. 109 Vgl. ebd., II.61, 120 f. 110 Ebd., II.61, S. 120, übers. Trillmich, S. 301: Olaph vero totam spem suam in Deo ponens […]. 111 Ebd., II.61, S. 121, übers. Trillmich, S. 301: Et iam magna ex parte votum implevit, cum pauci, qui remanserant ex magis, in ultionem eorum, quos rex dampnavit, etiam ipsum obtruncare non dubitarunt. Zu Adams Verknüpfung der magi mit dem Norden, deren Quellen und den theolo-
126
Daniel Föller
zweite Variante: „Andere sagen, er sei im Kampf gefallen“112, wobei die Verwendung des Wortes bellum eine größere bewaffnete Auseinandersetzung impliziert. Als dritte Möglichkeit ergänzt Adam: „Auch versichern etliche, er sei zu Knuts Vorteil insgeheim umgebracht worden.“113 Diesen drei Versionen fügt ein Scholion, das für gewöhnlich Adam selbst zugeschrieben wird und in zwei Handschriftenklassen überliefert ist114, ein deutlich hagiografisch geprägtes Narrativ hinzu. Während des Kriegszugs zur Wiedereroberung Norwegens habe Olaf einen Traum gehabt, in dem er auf einer Leiter in den Himmel steigt. Das Scholion schließt: „Nach dieser Vision wurde der König von den Seinen umringt, ohne Widerstand erschlagen und mit der Krone des Martyriums geschmückt.“115 Die „Gesta“ präsentieren also vier verschiedene Erzählungen von Olafs Tod: zweimal seine Ermordung (durch heidnische Zauberer oder auf Geheiß des anglodänischen Königs Knut), seinen gewaltsamen Tod auf dem Schlachtfeld und – vielleicht als Variante hiervon – sein pazifistisches Martyrium bei der Wiedereroberung seines Königtums. Damit präsentiert Adam eine Vielfalt von Narrativen über Olafs Tod, die einzigartig in der Überlieferung ist. Schon die frühesten Zeugnisse, so sie nicht einfach nur den Tod des Bekehrerkönigs erwähnen oder ihn durch die Bezeichnung als Märtyrer implizit voraussetzen, kennen nur eine Version von Olafs Martyrium, nämlich den Tod in der Schlacht von Stiklestad. Als die ältesten Texte kann man zwei Skaldengedichte ansehen, die zwar erst im 13. Jahrhundert schriftlich aufgezeichnet, aber schon im Mittelalter dem 11. Jahrhundert zugeordnet wurden.116 Von
112 113 114 115
116
gischen Implikationen vgl. Scior, Das Eigene (wie Anm. 7), S. 126 f.; Fraesdorff, Der barbarische Norden (wie Anm. 8), S. 257, 299 f., 310 f. Adam, Gesta (wie Anm. 1), II.60, S. 121, übers. Trillmich, S. 301: Alii dicunt eum in bello peremptum. Ebd., II.60, S. 121, übers. Trillmich, S. 301: Sunt alii qui asserant illum in gratiam regis Chnud latenter occisum […]. Vgl. für diese Einordnung, die bis heute Gültigkeit hat, die Einleitung zu Adam, Gesta (wie Anm. 1), S. XLIf., sowie den Text des Scholions selbst (S. 120). Ebd., schol. 41, S. 120, übers. Trillmich, S. 301: Postquam visionem vidit rex, circumventus a suis, cum non repugnaret, occiditur et martyrio coronatur. Hierbei handelt es sich um eine Wundererzählung, die in zahlreichen anderen Texten der Olafstradition zu finden ist. Vgl. Jiroušková, Wikingerkönig (wie Anm. 107), 1, S. 181–218, 417–421, für die Überlieferungen des 12. Jahrhunderts. Auch spätere Belege nennt: A History of Norway and the Passion and Miracles of the Blessed Óláfr. Translated by Devra Kunin. Edited with an introduction and notes by Carl Phelpstead (Viking Society for Northern Research. Text Series 13) London 2001, S. 109. Der älteste Überlieferungsträger des Scholions ist Schmeidlers Handschrift C1 (Kopenhagen, Det Kongelige Bibliotek, GKS 2296, 4o) „aus dem ersten Drittel des 13. Jahrhunderts“ (Adam, Gesta [wie Anm. 1], S. XXXIf.), so dass nicht auszuschließen ist, dass ein späterer Bearbeiter, der mit der Olafstradition des 12. oder 13. Jahrhunderts vertraut war, die Version nachgetragen hat; Schmeidlers Zuordnung zu Adam selbst beruht rein auf erschlossenen textgeschichtlichen Argumenten und bedarf angesichts der eingangs angesprochenen Probleme möglicherweise der Revision. Das Problem, wie man die Skaldengedichte datiert und geschichtswissenschaftlich auswertet, ist bis heute weitgehend ungelöst. Einen guten Überblick (mit pragmatischem Ansatz) bietet Judith Jesch, Ships and Men in the Late Viking Age. The Vocabulary of Runic Inscriptions and Skaldic Verse, Woodbridge 2001, S. 15–33. Die skaldische Überlieferung zu Olaf behandelt
Autorität ohne Autoritäten
127
besonderem Gewicht sind hier die traditionell auf circa 1045 datierten „Gamanvísur“ („Spottverse“) des späteren Norwegerkönigs Harald ‚des Tyrannen‘, immerhin das Produkt eines Augenzeugen117: Er war Olafs Halbbruder, kämpfte 1030 gemeinsam mit ihm und wurde in eben jener Schlacht verwundet, in der sein Bruder starb. Etwa in den selben Zeitraum (um 1035/1047) gehört das große Memorialgedicht des Sigvatr Þórðarson, der selbst im Dienst Olafs gestanden hatte, und bereits einen ganzen Strauß von Erzählungen aus dem Umfeld der Schlacht präsentierte.118 Die anderen, teils auch unabhängigen zeitnahen Überlieferungen stimmen mit diesen frühesten Zeugnissen bezüglich des Schlachtentodes überein.119 Vor diesem Hintergrund ist es besonders interessant, dass Adam an dieser Stelle die verschiedenen Versionen von Olafs Tod nicht einfach unkommentiert nebeneinanderstellt, wie er es etwa im Falle von Sven Estridsens Rolle beim oben erwähnten Krieg mit den Liutizen getan hat, sondern eine Beurteilung vornimmt. Nachdem er die drei divergierenden Überlieferungen präsentiert hat, schließt er im Haupttext an die Erzählung von Olafs Ermordung „zu Knuts Vorteil“ (in gratiam regis Chnud) John Lindow, St Olaf and the Skalds, in: Thomas Andrew DuBois (Hg.), Sanctity in the North. Saints, Lives, and Cults in Medieval Scandinavia (Toronto Old Norse-Icelandic Ser. 3) Toronto 2008, S. 103–127. 117 Für den Text vgl. Haraldr harðráði Sigurðarson, Gamanvísur. Edited by Kari Ellen Gade, in: dies. (Hg.), Poetry from the King’s Sagas 2. From c. 1035 to c. 1300, 1–2 (Skaldic Poetry of the Scandinavian Middle Ages 2,1–2) Turnhout 2009, 1, S. 35–41, hier S. 36 für die entsprechende Strophe (1). Selten in diesem Zusammenhang zitiert, aber für die Schlacht von Stiklestad ebenso einschlägig wie zeitnah sind zwei weitere Gedichte auf Harald: Bǫlverkr Arnórsson, Drápa about Haraldr harðráði. Edited by Kari Ellen Gade, in: ebd., S. 286–293, hier S. 286–288 für die entsprechende Strophe (1); Þjóðólfr Arnórsson, Sexstefja. Edited by Diana Whaley, in: ebd., S. 108–147, hier S. 112 f. für die entsprechende Strophe (1). 118 Vgl. Sigvatr Þórðarson, Erfidrápa Óláfs helga (‚Memorial drápa for Óláfr inn helgi [S. Óláfr]‘). Edited by Judith Jesch, in: Diana Whaley (Hg.), Poetry from the King’s Sagas 1. From Mythical Times to c. 1035, 1–2 (Skaldic Poetry of the Scandinavian Middle Ages 1,1–2) Turnhout 2012, S. 663–697, für die fraglichen 14 Strophen (7–20) S. 673–689. 119 Für die skaldische Überlieferung vgl. Lindow, St Olaf (wie Anm. 116). Seinen Tod in der Schlacht gegen norwegische Gegner erwähnen um 1050 drei Handschriften (C, D, E) des „Anglo-Saxon Chronicle“: Vgl. David Dumville (Hg.), The Anglo-Saxon Chronicle. A Collaborative Edition 1, 3–8, 10, 17, Cambridge 1985–2004, 5: MS C. A semi-diplomatic Edition with Introduction and Indices. Edited by Katherine O’Brien O’Keeffe, 2001, S. 105; 6: MS D. A semi-diplomatic Edition with Introduction and Indices. Edited by G[eoffrey] P. Cubbin, 1996, S. 64 f.; 7: MS E. A semi-diplomatic Edition with Introduction and Indices. Edited by Susan Irvine, 2004, S. 76. Um 1060 berichtet der normannische Geschichtsschreiber Wilhelm von Jumièges ähnlich, vgl. Elisabeth M. C. van Houts (Hg./Übers.), The Gesta Normannorum ducum of William of Jumièges, Orderic Vitalis, and Robert of Torigni 1–2, Oxford 1995, 2, S. 26 f. (V.12). Das in englischen Handschriften des 11. Jahrhunderts überlieferte liturgische Material nennt den Tod in der Schlacht nicht explizit, die oftmals kriegerische Sprache der Gebete könnte ihn aber andeuten. Vgl. für die Texte und ihre Geschichte Eyolf Østrem, The Office of Saint Olav. A Study in Chant Transmission (Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Musicologica Upsaliensia. N. S. 18) Uppsala 2001, S. 28–33, Gunilla Iversen, Transforming a Viking into a Saint. The Divine Office of St. Olav, in: Margot E. Fassler/Rebeca A. Baltzer (Hgg.), The Divine Office in the Latin Middle Ages. Methodology and Source Studies, Regional Developments, Hagiography, Oxford 2000, S. 401–429.
128
Daniel Föller
an: „[U]nd das dürfte meines Erachtens der Wahrheit näher kommen, denn der hat ja sein Reich eingenommen. Ein solches Ende also fand, wie ich glaube, der König und Märtyrer Olaf.“120 Obwohl Adam also nicht weiß, welche Version der Wahrheit entspricht – und immerhin geht es um ein Martyrium –, zieht er aus seiner Kenntnis der politischen Lage Rückschlüsse und favorisiert eine (angesichts der anderen Überlieferungen vermutlich unzutreffende) Möglichkeit, auch wenn er mit non diffidimus (wörtlich „wir zweifeln nicht daran“) und ut credimus (wörtlich „wie wir glauben“) Formulierungen verwendet, die an dieser Stelle wohl eine gewisse Unsicherheit ausdrücken. Dieser Umgang Adams mit den ihm bekannten mündlichen Überlieferungen hat ziemlich wahrscheinlich damit zu tun, dass er seine Quellen für nicht besonders vertrauenswürdig hielt. Nicht zufällig weist er keiner der vier Versionen einen konkreten Informanten zu: Mit einer Formulierung Vergils bezeichnet er seine Informationen zu Olafs Martyrium einleitend als „fliegendes Gerücht“ (fama volans), die von seiner ersten Version (der Ermordung Olafs durch magi) abweichenden Erzählungen im Haupttext bringt er jeweils mit anonymen „Anderen“ (alii) in Verbindung, und das hagiografische Narrativ im Scholion markiert er rein verbal mit fertur („es wird erzählt“).121 Dass Adams ebenso erstaunliche wie fehlerhafte Entscheidungsfreudigkeit an seiner negativen Beurteilung der Informanten und nicht am Problem der widersprüchlichen Informationen liegt, zeigt neben der schon erwähnten Erzählung zum Liutizenfeldzug Sven Estridsens – in der Widersprüche zwischen zwei als glaubwürdig markierten Quellen schlicht ignoriert werden – eine Passage des ersten Buches. Hier reflektiert Adam (wiederum sachlich nicht ganz korrekt) die Rolle des umstrittenen Erzbischofs Ebo von Reims in den innerkarolingischen Konflikten der Zeit um den Tod Ludwigs des Frommen122: „Ebo, der Anstifter dieser Zwistigkei120 Adam, Gesta (wie Anm. 1), II.61, S. 121, übers. Trillmich, S. 301: […] quod et magis verum esse non diffidimus, eo quod regnum eius invasit. Igitur Olaph rex et martyr, ut credimus, tali fine consummatus est. 121 Vgl. ebd., II.59 f., S. 119–122. Dort auch der Verweis auf die Aeneis-Stelle: vgl. aktuell Publius Vergilius Maro, Aeneis. Recensuit atque apparatu critico instruxit Gian Biagio Conte (Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana 2005) Berlin/New York 2009, S. 336 (XI.139). Adam verwendet diese Formulierung noch ein weiteres Mal (III.63, S. 208), bezieht sie aber nicht auf eigene mündliche Informanten, sondern macht sie zum Teil eines Narrativs in der Adalbertsvita. 122 Vgl. allgemein zu Ebo: zuletzt Matthias Schrör, Aufstieg und Fall des Erzbischofs Ebo von Reims, in: Matthias Becher/Alheydis Plassmann (Hgg.), Streit am Hof im frühen Mittelalter (Super alta perennis. Studien zur Wirkung der Klassischen Antike 11) Göttingen 2011, S. 203– 222; Philippe Depreux, Prosopographie de l’entourage de Louis le Pieux (781–840) (Instrumenta 1) Sigmaringen 1997, S. 169–176; Peter R. McKeon, Archbishop Ebbo of Reims (816– 835). A Study in the Carolingian Empire and Church, in: Church History 43, 1974, S. 437–447. Die Bedeutung für die Skandinavienmission bzw. Ansgar beleuchten: Thomas Klapheck, Der heilige Ansgar und die karolingische Nordmission (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Niedersachsen und Bremen 242) Hannover 2008, S. 82 f., 85, 94 f., 106, 111, 114, 116 f., 138 f., 153 ff., 159; konzise Eric Knibbs, Ansgar, Rimbert, and the Forged Foundations of Hamburg-Bremen, Farnham/Burlington 2011, S. 49–100.
Autorität ohne Autoritäten
129
ten, der schon früher den Söhnen [Ludwigs des Frommen] Waffen gegen ihren Vater geliefert hatte und jetzt die Brüder zum Aufruhr gegeneinander aufhetzte, wurde des Hochverrats angeklagt und von Papst Gregor seines Amtes entsetzt. Doch die einen klagen ihn an, die anderen sprechen von einer berechtigten Tat; die Frage nach der Wahrheit lasse ich offen. Bewahrte ihm doch unser hl. Vater Ansgar bis an sein Lebensende die gleiche Zuneigung wie vordem. Man lese in seiner Lebensbeschreibung nach und in der Schrift des Hrabanus über Ebos zweifelhaften Ruf.“123 Adam stand also vor dem Problem, dass zwei definitive Autoritäten – die Heiligenvita Ansgars aus der Feder des seinerseits heiligen Rimbert und der als großer Kirchenlehrer verehrte Fuldaer Abt und Mainzer Erzbischof Hrabanus Maurus – zu widersprüchlichen Aussagen über eine Person kamen, und das machte es ihm unmöglich, eine Entscheidung zu treffen. Sogar bei seiner Aussage, keine weitere Aussage machen zu können, bedurfte er der Unterstützung durch Autoritäten, indem er einerseits für diese Nicht-Entscheidung ein Sallust-Zitat bemüht124, andererseits auf die konkreten Texte verweist, in denen die widersprüchlichen Wertungen zu finden sind. Um Divergenzen zwischen zwei Autoritäten zu harmonisieren, fehlte Adam offenbar die Deutungsmacht, um verschiedene Stränge der fama volans zu beurteilen, reichte sie hingegen aus. Als unzuverlässig klassifizierte mündliche Überlieferungen konnten also durch die sapientia des Historiografen selbst autorisiert werden. So bleiben zwei Ebos, aber aus den vier Toden des Olaf Haraldsson wurde ein einziger. VII. FAZIT. AUTORITÄT OHNE AUTORITÄTEN Das eingangs beschriebene Problem, wie ein Geschichtsschreiber mündlich tradierte Aussagen zu einem historiografischen Narrativ transformiert, sah Adam als einen der heikelsten Aspekte seines Werkes an. Allerdings konnte er es nicht umgehen, da er „fast nirgends den Spuren eines Vorgängers folgen konnte und im Dunkeln tappend unbekümmert einen unbekannten Weg einschlagen mußte.“125 Als Träger einer Wissenskultur, die ihre Gewissheiten wesentlich aus einem Reservoir 123 Adam, Gesta (wie Anm. 1), I.22, S. 28, übers. Trillmich, S. 195: Discordiae incentor Ebo, qui et supra filios in patrem armaverat et nunc fratres intestina seditione concitaverat, proinde conspirationis accusatus a papa Gregorio depositus est. Sed aliis hoc criminantibus, aliis recte factum astruentibus veritatem nos in medio relinquemus. Presertim cum a sancto patre nostro Ansgario ea dilectione, qua ab initio secum habuit, usque in finem habitus fuerit. Lege in Vita eius, et in capitulo Rhabani de fama Ebonis ambigua. Dort auch Verweise auf die konkreten Stellen in den Texten Rimberts bzw. Hrabans. 124 Identifiziert in ebd., I.22, S. 28, übers. Trillmich, S. 195. Für eine aktuelle Edition vgl. Gaius Sallustius Crispus, De coniuratione Catilinae, in: ders., Catilina. Iugurtha. Historiarum fragmenta selecta. Appendix Sallustiana. Recognovit brevique adnotatione critica instruxit Leighton Durham Reynolds (Scriptorum classicorum bibliotheca Oxoniensis) Oxford 1991, S. 5–53, hier S. 17 (19.4.5). 125 Adam, Gesta (wie Anm. 1), Praefatio, S. 2, übers. Trillmich, S. 161: […] quoniam fere nullius, qui me precesserit, vestigia sequens ignotum iter quasi palpans in tenebris carpere non timui […].
130
Daniel Föller
autoritativer Schriftüberlieferung bezog, musste er sich wegen der Spezifika seines Gegenstandes aus der Komfortzone klassischer Gelehrsamkeit hinausbewegen und sich der Herausforderung stellen, wie er in der Fülle der Informanten und unübersichtlichen Aussagen die „Wahrheit“ erkennen könnte (ein Problem, das er keineswegs als einziger hatte). Obwohl dieser Prozess weitgehend im Dunkel bleibt und Adam selten offenlegt, wie er zu seinen Entscheidungen kam, lassen sich doch zwei Mechanismen erkennen: zum einen die Autorisierung der Person eines Informanten, zum anderen die Sicherung von Informationen aus Quellen, die Adam weniger zuverlässig erschienen. Es haben sich drei Faktoren aufzeigen lassen, die Adam für die Zuverlässigkeit eines Informanten (und damit seiner Aussagen) offenbar für entscheidend hielt: erstens die Augenzeugenschaft, zweitens sein intellektuelles Potential, drittens seine christliche Religiosität.126 Alle drei Kriterien zielen letztlich auf eine Annäherung der mündlichen Aussagen an die Welt christlicher Gelehrsamkeit, so die von Adam herangezogenen Informanten nicht ohnehin schon Kleriker waren. Augenzeugen können im Text bisweilen wie autoritative Texte als Referenzpunkte für weitergehende Recherchen des Lesers fungieren. Bei Adams wohl wichtigster Informationsquelle, dem Dänenkönig Sven Estridsen, reicht die Autorisierung durch Bildung und Frömmigkeit so weit, dass widersprüchliche Aussagen nicht mehr aufgelöst werden können und das auf ihn zurückgehende Wissen sich allenfalls noch in Details ergänzen lässt. An seinem Beispiel wird auch besonders deutlich, mit welchen Mitteln Adam die Annäherung mündlich tradierten Wissens an schriftlich überlieferte Gewissheiten vollzog. Neben die Autorisierung des Informanten tritt die Autorisierung der Information, die offenbar besonders dann greift, wenn Adams Gewährsleute ihm als nicht besonders vertrauenswürdig erschienen. Es ist bemerkenswert, dass der Großteil der Verweise auf mündliche Überlieferungen keineswegs konkret identifizierbare Personen nennt, sondern eine irgendwie amorphe Masse unsicheren Wissens, kursierender Erzählungen und Gerüchte.127 Um auszudrücken, wie schwer ihm die Orientierung hier fiel, wählte Adam zu Anfang des dritten Buches – das ja wesentlich auf seine eigenen Erinnerungen an Adalbert und die des übrigen Bremer
126 Zu überlegen wäre, ob sich als ein weiterer Faktor der gesellschaftliche Status eines Informanten anführen ließe. So tauchen in der Liste der identifizierbaren Informanten (siehe oben, Anm. 6) insgesamt vier Bischöfe, ein König und ein nobilis homo auf, die alle (mit Ausnahme von Bischof Bovo) positiv gezeichnet werden. Vgl. zur Frage der Hierarchie zwischen Adams Informanten Sven Estridsen und ihm selbst auch Mortensen, From Vernacular (wie Anm. 11), S. 56 f. 127 Neben verbalen Wendungen wie dicitur o. ä. beschreibt Adam anonyme Überlieferungen als fabula, fama, opinio oder sermo; die Wendung certa testimonia erscheint bezeichnenderweise nur in der Vorrede für unbestimmte mündlich tradierte Informationen. Vgl. für die konkreten Stellen Adam, Gesta (wie Anm. 1), Praefatio, I.49, II.26, II.33, schol. 27, II.46, schol. 34, II.60, II.62, schol. 71, III.63, IV.3, unnummeriertes schol. in A3, IV.37, S. 3, 49, 85, 94, 102, 106 f., 120, 122, 163, 208, 231, 247, 274. Freilich können sich dicitur und ähnliche Formulierungen auch auf schriftliches Material beziehen (siehe oben, Anm. 9).
Autorität ohne Autoritäten
131
Domklerus zurückging, der sie auch zugleich zensierte128 – die Metapher der Seefahrt: „Habe ich mich törichterweise auf dieses Meer hinausgewagt, so glaube ich jetzt nicht unklug zu handeln, wenn ich wieder dem Ufer zusteuere. Zur Landung an dieser Küste finde ich freilich für meine Unerfahrenheit kaum einen Hafen. So wimmelt es überall von Klippen des Hasses und Untiefen der Verleumdung; mein Lob wird man als Schmeichelei auffassen, Kritik an Verfehlungen als Böswilligkeit tadeln.“129 Die Unsicherheit, wie das ihm Überlieferte zu beurteilen sei, wurde vor allem in einer gespannten Situation und angesichts eines kontroversen Themas (der Vita des umstrittenen Adalbert) zum Problem. Um Informationen aus unsicherer Quelle zu autorisieren, wählte Adam zwei Verfahren. Zum einen verwendete er die im lateinischen Westen weit verbreitete Technik der Kompilation130, aber mit einem besonderen Dreh: Er schloss neue Informationen an die Aussagen von Autoritäten an, seien sie schriftliche Tradition oder autorisierte mündliche Informanten. Durch die Harmonisierung von autoritativer (schriftlicher) und prekärer (mündlicher) Überlieferung entsteht der Eindruck, dass die unbedingte Glaubwürdigkeit des schriftlich fixierten Wissens gewissermaßen auf ergänzende Aussagen oraler Provenienz ausstrahlt. Das zweite Verfahren Adams zielt auf die Konfrontation widersprüchlicher Informationen, und wo keine Anknüpfung an autorisiertes Wissen möglich war, entschied er nach Kenntnis der Lage oder per Analogieschluss, wie etwa im Falle des Martyriums von Olaf Haraldsson. Nun stellt sich die Frage, wie erfolgreich Adams Autorisierungsstrategien waren, wie plausibel sie mittelalterlichen Rezipienten der „Gesta“ erschienen. Dies erfordert einen Blick auf die Rezeption und den Gebrauch des Werkes, ein Feld, das in der Adam-Forschung bislang nicht sehr stark repräsentiert ist. Ob die zahlreichen 128 Siehe oben, S. 111 f. mit Anm. 29. 129 Adam, Gesta (wie Anm. 1), III.1, S. 142 f., übers. Trillmich, S. 327: […] unde licet stulte audacterque introierim hoc pelagus, nunc tamen haut inprudenter fecisse videar, si ad litus properabo. In quo littoris accessione vix aliquem portum video inpericiae meae. Ita plena sunt omnia scopulis invidiae detractionumque asperitatibus, ut ea, quae laudaveris, adulatione carpant, quae vero delicta reprehenderis, dicant fieri ex malivolentia. 130 Die Kompilation als wissenschaftliches Verfahren ist vor allem für die Zeit ab dem 12. Jahrhundert untersucht; vgl. den klassischen, bis 2010 mehrfach nachgedruckten Aufsatz von Malcolm Beckwith Parkes, The Influence of the Concepts of ordinatio and compilatio on the Development of the Book, in: Jonathan James Graham Alexander/Margaret Templeton Gibson (Hgg.), Medieval Learning and Literature. Essays presented to Richard William Hunt, Oxford 1976, S. 115–141. Auf den Umstand wiesen hin: Richard Hunter Rouse/Mary A. Rouse, Ordinatio and Compilatio Revisited, in: Mark D. Jordan/Kent Emery, Jr. (Hgg.), Ad litteram. Authoritative Texts and their medieval Readers (Notre Dame Conferences in medieval Studies 3) Notre Dame 1992, S. 113–134, bes. S. 119–123; Neil Hathaway, „Compilatio“. From Plagiarism to Compiling, in: Viator 20, 1989, S. 19–44. Für die vorscholastische Wissenskultur gibt es zwar unzählige Einzelstudien, aber keine Synthese, wie mir Anna Dorofeeva (Frankfurt/Cambridge) freundlicherweise bestätigte. Die Kompilationstechnik mittelalterlicher Historiografie (auch vor dem 12. Jahrhundert) reflektiert knapp Gert Melville, Kompilation, Fiktion und Diskurs. Aspekte zur heuristischen Methode der mittelalterlichen Geschichtsschreiber, in: Christian Meier/Jörn Rüsen (Hgg.), Historische Methode (Beiträge zur Historik 5) München 1988, S. 133–153.
132
Daniel Föller
Korrekturen, Bearbeitungen und Ergänzungen, die sich in den insgesamt 22 erhaltenen Handschriften erkennen lassen131, darauf zurückzuführen sind, dass Adams Autorisierungsstrategien die mittelalterlichen Rezipienten nicht überzeugt haben, müsste man in weiteren Detailstudien klären. Die Rezeption der „Gesta“ im historiografischen Material der folgenden Jahrhunderte ist begrenzt, in der Forschung werden ein gutes Dutzend lateinischer Texte primär aus dem norddeutschen und skandinavischen Raum sowie einige altwestnordische Geschichtswerke genannt, die sie als Quelle benutzten.132 Dies deutet noch nicht auf Vorbehalte gegen das Werk hin, sondern kann ebenso gut am mangelnden Interesse an der Geschichte eines Erzbistums liegen, das seit der Erhebung Lunds zum Erzbistum 1103/04 seine hauptsächliche Daseinsberechtigung eingebüßt hatte. Aufschlussreich ist, dass vor allem die sehr reiche vernakulare Historiografie des norwegisch-isländischen Raumes kaum direkt auf ihn zurückgriff.133 Einem isländischen Geschichtsschreiber wie Snorri Sturluson lag die einheimische orale, vor allem skaldische Tradition offenbar näher als Adams Werk, und als scholastisch ausgebildeter Gelehrter entwickelte er eine eigenständige Herangehensweise, die bis heute den Umgang mit die-
131 Die letzte ausführliche Auseinandersetzung mit diesem Punkt findet sich bei Anne K. G. Kristensen, Studien zur Adam von Bremen Überlieferung (Skrifter udgivet af det Historiske Institut ved Københavns Universitet 5) Kopenhagen 1975, die sich aber in erster Linie an Schmeidlers Rekonstruktion des Urtextes abarbeitet. Knappe Zusammenfassungen bieten Gelting, Uløste opgaver (wie Anm. 1); Scior, Adam Bremensis (wie Anm. 2). Ansonsten sind die Arbeiten des Editors immer noch einschlägig, vgl. Adam, Gesta (wie Anm. 1), S. VII–XLV; Schmeidler, Hamburg-Bremen (wie Anm. 23), S. 1–107. 132 Eine vollständige Liste gibt es nicht. Einige lateinische Werke nennen: Adam, Gesta (wie Anm. 1), S. XLIVf., übers. Trillmich, S. 155 f.; Scior, Adam Bremensis (wie Anm. 2); Kristensen, Studien (wie Anm. 130), S. 20–23. Mit der Rezeption der „Gesta“ in der am Ende des 12. Jahrhunderts in Nidaros/Trondheim entstandenen „Historia Norvegiae“ befasst sich ausführlich Svend Ellehøj, Studier over den ældste norrøne historieskrivning (Bibliotheca Arnamagnæana 26) Kopenhagen 1965, S. 146–161, 171, 174, knapper geht er auf Oddr Snorrasons verlorene, nur durch vernakulare Übersetzungen zu greifende lateinische Biografie des Bekehrerkönigs Óláfr Tryggvason ein (ebd., S. 257 f.). Roland Scheel, Lateineuropa und der Norden. Die Geschichtsschreibung des 12. Jahrhunderts in Dänemark, Island und Norwegen (Frankfurter kulturwissenschaftliche Beiträge 6) Berlin 2012, S. 97 mit Anm. 210, nimmt auch eine Benutzung durch den dänischen Geschichtsschreiber Sven Aggesen an. Die Wirkung in der altwestnordischen Historiografie ist kaum erforscht; mit chronologischen Entlehnungen im ältesten erhaltenen isländischen Geschichtswerk, der „Íslendingabók“ des Ari Þorgilsson inn fróði befasst sich Aksel E. Christensen, Om kronologien i Aris Íslendingabók og dens lån fra Adam af Bremen, in: Johannes Brøndum-Nielsen/Peter Skautrup/Allan Karker (Hgg.), Nordiske studier. Festskrift til Chr. Westergård-Nielsen på 65–årsdagen den 24. november 1975, Kopenhagen 1975, S. 23–34. Allgemein mit der Rolle Adams für die skandinavische Geschichtsschreibung des 12. Jahrhunderts beschäftigen sich Birgit Sawyer/Peter Swayer, Adam and the Eve of Scandinavian History, in: Paul Magdalino (Hg.), The Perception of the Past in Twelfth-Century Europe, London 1992, S. 37–51. 133 So Sawyer/Sawyer, Eve of Scandinavian History (wie Anm. 132), S. 39, wenngleich sie zu dem Schluss kommen, dass „none of the historians who wrote then [d. h. ab 1170], nor their successors, could escape his [d. h. Adams] influence“ (S. 48), der freilich als indirekter angesehen wird.
Autorität ohne Autoritäten
133
sem Material strukturiert.134 Vorangegangen war allerdings ein Autorisierungsprozess, der die Skalden und ihre Werke im Rahmen des Schulunterrichts in den Rang von Autoritäten erhob.135 Was verrät Adams Umgang mit mündlich tradiertem Material nun über die historiografischen Entwicklungen des Hochmittelalters und seinen Platz darin? Für die Geschichtsschreibung des 11. Jahrhunderts postulierte Tilman Struve „eine stärkere kritisch-wissenschaftliche Fundierung“, die er als Folge eines „Vordringens der Rationalität“ wertete und in eine generelle „Wendezeit“ einbettete. Unter anderem seien „erste Ansätze zu einer sich auf Quellen gründenden ‚dokumentarischen‘ Geschichtsschreibung“ erkennbar, ja sogar „zu bescheidenen Ansätzen einer historischen Methodik“ sei man gelangt.136 Adams Versuch, mündliche Tradition der schriftlichen Überlieferung anzunähern, um sie so handhabbar und glaubwürdig zu machen, könnte man auch mit Überlegungen Hanna Vollraths verbinden, die im 11. Jahrhundert einen Wandel von episodisch zu argumentierend strukturierten historiografischen Texten feststellt und dies mit einem Wandel von einer oral zu einer eher literal geprägten Denkweise erklärt.137 Adams Autorisierungsstrategien, die hohe Anzahl von Verweisen auf orale Überlieferungen und die bisweilen drastische Offenlegung der Unzuverlässigkeit von Informanten (wie etwa des Goldschmieds) sprechen von einem hohen Problembewusstsein beim Umgang mit Informationen, die nicht aus Büchern stammten. Zugleich wird aber auch deutlich, dass Adam mit den Instrumenten, die ihm die Gelehrtenkultur seiner Zeit zur Verfügung stellte, an 134 Vgl. für eine Analyse von Snorris Selbstaussagen zu seinem Umgang mit oraler Tradition zuletzt Debora Dusse, Untersuchungen zur genealogischen Skaldendichtung, Phil. Diss. Berlin 2011, S. 23–31, zur langanhaltenden Wirkung und dem Einfluss bis heute Bjarne Fidjestøl, Skaldenstrophen in der Sagaprosa. Bemerkungen zum Verhältnis zwischen Prosa und Poesie in der Heimskringla, in: Alois Wolf (Hg.), Snorri Sturluson. Kolloquium anläßlich der 750. Wiederkehr seines Todestages (ScriptOralia 51) Tübingen 1993, S. 77–98, bes. S. 78. 135 Vgl. Guðrún Nordal, Tools of Literacy. The Role of Skaldic Verse in Icelandic Textual Culture of the Twelfth and Thirteenth Centuries, Toronto 2001. 136 Vgl. Struve, Salierzeit (wie Anm. 7), S. 32 f. Das entsprechende Kapitel (Geschichtsschreibung als Seismograph. Das 11. Jahrhundert als Wendezeit. Aspekte des Epochenwandel[s], S. 12–34, 240–263) ist die bearbeitete Fassung von: ders., Die Wende des 11. Jahrhunderts. Symptome eines Epochenwandels im Spiegel der Geschichtsschreibung, in: HJb 112, 1992, S. 324–365. 137 Vgl. Hanna Vollrath, Konfliktwahrnehmung und Konfliktdarstellung in erzählenden Quellen des 11. Jahrhunderts, in: Stefan Weinfurter (Hg.), Die Salier und das Reich 3: Gesellschaftlicher und ideengeschichtlicher Wandel im Reich der Salier, Sigmaringen 1991, S. 279–296, sowie dies., Oral Modes of Perception in Eleventh-Century Germany, in: Alger Nicolaus Doane/Carol Braun Pasternak (Hgg.), Vox intexta. Orality and Textuality in the Middle Ages, Madison 1991, S. 102–111. Eine Zusammenfassung der von ihr angestoßenen Debatte bietet Steffen Patzold, Überlegungen zu Kontinuitäten und Wandlungen in der Historiographie im ostfränkisch-deutschen Reich des 11. Jahrhunderts, in: Stephan Müller/Jens Schneider (Hgg.), Deutsche Texte der Salierzeit – Neuanfänge und Kontinuitäten im 11. Jahrhundert (MittelalterStudien 20) München 2010, S. 29–49, bes. S. 39 ff., der selbst „allein das Zusammenspiel von Mündlichkeit und Schriftlichkeit zu analysieren“ für nicht ausreichend hält, um jene Wandlungsprozesse zu erklären, sondern noch „den Wandel der politischen Ordnung“ sowie „die äußeren Zwänge und die – tatsächlich wirksamen oder auch nur antizipierten – Einflussnahmen, denen die Historiographen […] ausgesetzt waren“ (S. 49) namhaft macht.
134
Daniel Föller
der Aufgabe scheiterte, ein systematisches Verfahren zur Verarbeitung und Bewertung mündlich tradierter Informationen zu entwickeln. Es ist eine interessante Frage, ob dies späteren, scholastisch ausgebildeten Geschichtsschreibern besser gelang, oder ob erst die gegenwärtige Geschichtswissenschaft mit den Methoden von „Oral history“ und historischer Memorik diesen Zugang gefunden hat.
BENEFICIUM – WOHLWOLLEND INTERPRETIERT Der Hoftag von Besançon 1157 Ernst-Dieter Hehl Der Konflikt zwischen Kaiser Friedrich Barbarossa und der Gesandtschaft Papst Hadrians IV. auf dem Hoftag von Besançon im Oktober 1157 zählt zu den spektakulären Zwischenfällen des 12. Jahrhunderts.1 Bündelt er doch die unterschiedlichen Sichtweisen der beiden „Universalgewalten“ des Mittelalters über das Wesen des Kaisertums – sichtbar in dem Streit darüber, ob das Kaisertum als vom Papst vergebenes Lehen zu betrachten sei. Mit „Lehen“ nämlich hatte Rainald von Dassel, Barbarossas Kanzler, die Formel übersetzt, mit der Hadrian in einem Brief darauf hinwies, er hätte dem Herrscher noch „größere beneficia“ zukommen gelassen, falls das überhaupt möglich sei, und energisch forderte, der Kaiser möge endlich dafür sorgen, dass der Erzbischof Eskil von Lund freigelassen werde, der in Burgund gefangen genommen worden war. Knapp ein Dreivierteljahr später erläuterte Hadrian IV. in einem weiteren Schreiben, das den Kaiser in Augsburg vor dem Aufbruch zu seinem zweiten Italienzug erreichte, den anstößigen Begriff beneficium. Er dürfe nicht mit „Lehen“ (feudum) übersetzt werden, sondern bedeute entsprechend der Herkunft des Wortes bonum factum – Wohltat.2 1
2
Die Grundthese des Beitrags habe ich bereits 2003 auf einer Sitzung der Hessischen Sektion des Konstanzer Arbeitskreises für mittelalterliche Geschichte vorgetragen und danach in Oberseminaren von Stefan Weinfurter (Heidelberg) und Franz J. Felten (Mainz). Vgl. auch ErnstDieter Hehl, Das Papsttum in der Welt des 12. Jahrhunderts. Einleitende Bemerkungen zu Anforderungen und Leistungen, in: ders./Ingrid Heike Ringel/Hubertus Seibert (Hgg.), Das Papsttum in der Welt des 12. Jahrhunderts (Mittelalter-Forschungen 6) Stuttgart 2002, S. 9–23, hier S. 17–19. Otto von Freising und Rahewin, Die Taten Friedrichs oder richtiger Cronica, übers. von Adolf Schmidt †, hg. von Franz-Josef Schmale (Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters – FStGA 17) Darmstadt 21974. Hier III, 11 (S. 410/411–414/415) Hadrians in Besançon verlesener Brief und III, 26 (S. 448/449–452/453) Hadrians in Augsburg verlesener Brief; S. 412, Z. 28: maiora beneficia, S. 450, Z. 2–11: beneficium = bonum factum. Die Bücher III und IV der „Gesta Frederici“ hat Rahewin, Ottos Kaplan und Sekretär, verfasst; zu seiner Person Roman Deutinger, Rahewin von Freising. Ein Gelehrter des 12. Jahrhunderts (MGH Schriften 47) Hannover 1999. Schmales Edition gibt den Text nach der Widmungsfassung (C), die damals nur aus einer einzigen Handschrift bekannt war, siehe unten Anm. 47 zu den Handschriftengruppen B und C mit einer für unser Thema wichtigen Textabweichung in B. Die Edition von Georg Waitz und Bernhard von Simson (MGH SS rer. Germ. 46) Hannover/Leipzig 1912 geht von drei Redaktionsstufen (A, B und C) aus, vgl. die Vorbemerkung S. XXVII–XXXI. – Zur Konzeption der „Gesta“ jetzt Joachim Ehlers, Otto von Freising. Ein Intellektueller im Mittelalter. Eine Biographie, München 2013, S. 163 f. und 214–260.
136
Ernst-Dieter Hehl
Mit einer Wendung aus dieser Klarstellung Hadrians hat Walter Heinemeyer 1969 seinen für die Interpretation des Konfliktes wichtigen Aufsatz überschrieben: „beneficium – non feudum sed bonum factum. Der Streit auf dem Reichstag zu Besançon 1157“.3 Die Überschrift spiegelt Einlenken des Papstes und diplomatischen Triumph Barbarossas. Denn der Kern von Heinemeyers Interpretation besteht darin, dass Rainald von Dassel auf dem Hoftag von Besançon beneficium angemessen übersetzt habe. Dieses Wort habe im nordalpinen Reich noch für Lehen gestanden. Die römische Kurie habe das gewusst. Eine ganze Reihe von Papsturkunden für Kirchen des nordalpinen Reichs führt Heinemeyer auf, in denen beneficium „Lehen“ bedeutet. „Hadrian wollte“, so fasst Heinemeyer seine Ergebnisse zusammen, „das hier gebrauchte Wort beneficium als ‚Wohltat, Gnade, Gunsterweisung‘ verstanden wissen, war sich jedoch bewußt, dass es auch ‚Lehen‘ bedeuten konnte und in Verbindung mit weiteren dem Lehnrecht eigenen Begriffen von dem deutschen Empfänger so verstanden werden mußte. Der verdeckte Vorstoß sollte den Partner ‚testen‘.“4 Hadrian habe mit seinen Formulierungen zwar „nicht den Anspruch erheben wollen, er habe das Reich dem deutschen König als Lehen mit dem Investitursymbol der Kaiserkrone übertragen. Aber er sah die Kaiserkrönung als eine ‚Verleihung‘ der Kaiserkrone an und leitete daraus eine rechtliche Überordnung des Papstes gegenüber dem Kaiser ab“, dass aber diese „kurialen Vorstellungen mit Worten des Lehnrechtes wiedergegeben werden, ist kaum ohne Absicht geschehen.“5 Heinemeyers Deutung stößt aber auf eine Schwierigkeit: Hadrians Vorstoß wäre ins Leere gelaufen, seine Grundüberzeugung nicht sichtbar geworden, wenn Rainald nicht die lehnrechtliche Übersetzung gewählt hätte. Heinemeyers lehnrechtliche Fundierung des beneficiumBegriffs hat sich in der deutschsprachigen Forschung zunächst durchgesetzt, seine Differenzierungen sind sogar zu größerer Eindeutigkeit zugespitzt worden. Die ‚Regesta Imperii‘ nennen zu Besançon und Augsburg nur seinen Aufsatz.6 Ferdinand Opll, dem die Regesten zu verdanken sind, fasst das Ergebnis des Augsburger Tages in seiner Biographie Barbarossas damit zusammen: „Hadrian lenkte ein“, die geschlossene Ablehnung der „Übersteigerung der päpstlichen Ansprüche“ vor allem durch die Bischöfe des Reichs habe „Wirkung gezeigt“.7 So geht auch er davon aus, Rainalds Über3
4 5 6
7
Walter Heinemeyer, „beneficium – non feudum sed bonum factum“. Der Streit auf dem Reichstag zu Besançon 1157, in: AfD 15, 1969, S. 155–236 (zur Forschungsdiskussion S. 155–160). – Aus papstgeschichtlicher Perspektive gibt eine zusammenfassende Darstellung des Konflikts Michele Maccarrone, Papato e impero dalla elezione di Federico alla morte di Adriano IV (1152–1159) (Lateranum 25, 1–4) Rom 1959, S. 159–269 (Kap. 6–9). Heinemeyer, Beneficium (wie Anm. 3), S. 235; die Belege für Lehen S. 214 mit Anm. 194. Ebd., S. 202 und 203. J. F. Böhmer, Regesta Imperii IV: Ältere Staufer, 2: Die Regesten des Kaiserreichs unter Friedrich I. 1152 (1122) – 1190, 1: 1152 (1122) – 1158, neubearbeitet von Ferdinand Opll unter Mitwirkung von Hubert Mayr, Wien/Köln/Graz 1980, Nr. 491 (Besançon), Nr. 555 und 556 (Augsburg). Die weiteren Regesten zu dem Konflikt geben außer Heinemeyers Aufsatz nur noch ergänzende Literaturangaben, etwa zur Verfasserfrage: vgl. Nr. 492, 522. Ferdinand Opll, Friedrich Barbarossa (Gestalten des Mittelalters und der Reinaissance) Darmstadt 1990, S. 61 (so auch in 42009).
Beneficium – wohlwollend interpretiert
137
setzung habe das Richtige getroffen. Klar formuliert dies Odilo Engels in seinem Stauferbuch. Rainald habe das umstrittene Wort „gleich richtig mit ‚Lehen‘ und nicht dem neutralen Wort ‚Wohltat‘“ übersetzt.8 In Augsburg habe Hadrian „den Rückzug antreten“ müssen und eine „Entschuldigung“ überreicht.9 Jürgen Miethke hat dem Übersetzer Rainald bescheinigt, er habe das „doppeldeutige Wort […] ins Eindeutige gekehrt“10; auch er zweifelt nicht daran, dass Rainald in politischem Sinn das Richtige getroffen hat. Johannes Laudage urteilte, Hadrian wollte den Kaiser „auch darauf hinweisen, daß die Kaiserkrone strenggenommen als päpstliches Lehen zu betrachten sei.“ Aber die Lehnsfrage spielt in Laudages Analyse der Konfliktfelder zwischen Kaiser und Papst nur eine untergeordnete Bedeutung. Den Päpsten sei es konkret darum gegangen, die Petrusregalien vor jeglichem kaiserlichen Zugriff zu bewahren.11 So blieben – manchmal unausgesprochen – die Zweifel an den lehnrechtlichen Deutungen, und sie haben sich inzwischen verstärkt. Bereits vor Heinemeyers Aufsatz hatte Walter Ullmann eine betont kanonistische, auf lehnrechtliche Bezüge verzichtende Interpretation der päpstlichen Schreiben und ihrer Begrifflichkeit vorgelegt.12 Einen Widerspruch zu seiner These von der Entfaltung eines hierokratischen Papsttums sah er darin nicht. Die hierokratische Theorie bedurfte keiner lehnrechtlichen Unterfütterung, wie es die Befürworter der „Lehnsthese“ stillschweigend annehmen. Friedrich Kempf hat den „Vorstoß“, die „kuriale Tradition“ in den Mittelpunkt zu stellen, begrüßt. Auch für ihn ist die Frage nach der Richtigkeit von Rainalds Übersetzung in solchem Kontext eine sekundäre.13 Ulrich Schmidt hat dann die Grundsatzfrage nach dem Wesen und Ursprung der kaiserlichen Würde in den Mittelpunkt gestellt und so das Lehnsproblem in den Hintergrund.14 Knut Görich hat 8 9 10
11
12 13 14
Odilo Engels, Die Staufer (Kohlhammer Urban-Taschenbücher 154) Stuttgart 71998, S. 79 (Erstauflage 1972; 71998 hat Engels noch selbst betreut, 82005 ist ein Nachdruck, 92010 in den Literaturangaben durch Gerhard Lubich ergänzt). Ebd., S. 80. Jürgen Miethke, Rituelle Symbolik und Rechtswissenschaft im Kampf zwischen Kaiser und Papst. Friedrich Barbarossa und der Konflikt um die Bedeutung von Ritualen, in: Franz J. Felten/Stephanie Irrgang/Kurt Wesoly (Hgg.), Ein gefüllter Willkomm. FS für Knut Schulz zum 65. Geburtstag, Aachen 2002, S. 91–126, hier S. 116 (Zitat) – 119. Vgl. auch die Einleitung zu: Jürgen Miethke/Arnold Bühler, Kaiser und Papst im Konflikt. Zum Verhältnis von Staat und Kirche im späten Mittelalter (Historisches Seminar 8) Düsseldorf 1988, S. 13–59, hier S. 25: Rainald nutzte „die Möglichkeit […], durch eine eindeutige und verschärfende Übersetzung den Text vereinseitigend zuzuspitzen“. Johannes Laudage, Alexander III. und Friedrich Barbarossa (Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters. Beihefte zu J. F. Böhmer, Regesta Imperii 16) Köln/Weimar/ Wien 1997, S. 88–93 (Zitat S. 92, Hervorhebung E.-D. H.); S. 242–259 Laudages Sicht der Petrusregalien, unmittelbar anschließend S. 259–268 zum Verhältnis Kaisertum/Papsttum. Walter Ullmann, Cardinal Roland and Besançon, in: Sacerdozio e Regno da Gregorio VII a Bonifacio VIII (Miscellanea Historiae Pontificiae 18) Rom 1954, S. 79–125. Friedrich Kempf, Papsttum und Kaisertum bei Innocenz III. Die geistigen und rechtlichen Grundlagen seiner Thronstreitpolitik (Miscellanea Historiae Pontificiae 19) Rom 1954, S. 61 f. (die zitierten Wendungen in Anm. 16). Ulrich Schmidt, A quo ergo habet, si a domno papa non habet imperium? Zu den Anfängen der staufischen Kaiserwahlen, in: Sönke Lorenz/Ulrich Schmidt (Hgg.), Von Schwaben bis Jerusa-
138
Ernst-Dieter Hehl
in der öffentlichen und kontroversen Diskussion den Kern der Konfliktsituation gesehen.15 Roman Deutinger hat mit Berufung auf die Überlegungen von Walter Ullmann und Ulrich Schmidt nachdrücklich betont, „dass der Kern des Streits eigentlich gar nicht die richtige Übersetzung des Wortes beneficium war, sondern die Frage nach der rechtlichen Grundlage für das Kaisertum.“16 Zuletzt hat Stefan Weinfurter die Aufmerksamkeit auf die lehnrechtliche Interpretationsmöglichkeit zurückgelenkt und diese in den Rahmen päpstlicher Forderungen nach Gehorsam gestellt, wie sie seit den Zeiten Gregors VII. für das päpstliche Selbstverständnis grundlegend waren. Aber auch wenn Hadrian in seinem Brief „mit dem beneficium der Kaiserkrone einen Lehnsakt gemeint haben könnte“, sei es ihm „um eine ganz andere Vorrangstellung“ gegangen, „die sich weit über jede lehnrechtliche Einordnung erhob.“ Denn der Papst – so Weinfurters Fazit – hatte es „nicht nötig, ein Lehnsherr zu sein, um seinen Vorrang in Kirche und Welt und insbesondere gegenüber dem Kaisertum zu begründen, denn dafür standen ihm ungleich bessere Argumente zur Verfügung.“17 Das fügt sich gut in allgemeine Analysen der päpstlichen Lehnspolitik, die dieser eine nur untergeordnete Bedeutung für das päpstliche Selbstverständnis und den päpstlichen Autoritätsanspruch zuweisen.18 Der Interpretationsstrang „lehnrechtlicher Vorstoß des Papstes in Besançon – Einlenken in Augsburg“ gründet in einer deutschen historiographischen Tradition, die bis in das 19. Jahrhundert zurückreicht. Wilhelm von Giesebrecht hat in seiner „Geschichte der deutschen Kaiserzeit“ bereits 1880 dieses Bild gezeichnet. „Einlenken des Papstes“ hat er den Abschnitt über die Augsburger Ereignisse überschrieben, die sich so in einen Zusammenhang einordnen, den Giesebrecht als „neuen Aufschwung des Kaiserthums unter Friedrich I.“ verstand.19
15
16
17
18
19
lem. Facetten staufischer Geschichte, Sigmaringen 1995, S. 61–88; zu Besançon/Augsburg im Einzelnen dort S. 78–82. Knut Görich, Friedrich Barbarossa. Eine Biographie, München 2011, S. 268–282 (der Abschnitt steht unter der Überschrift: „Übersetzungsprobleme: Der Hoftag von Besançon“), vgl. bes. S. 274–279. Vgl. bereits ders., Die Ehre Friedrich Barbarossas. Kommunikation, Konflikt und politisches Handeln im 12. Jahrhundert (Symbolische Kommunikation in der Vormoderne) Darmstadt 2001, S. 106–118, 369. Roman Deutinger, Kaiser und Papst. Friedrich I. und Hadrian IV., in: Jürgen Dendorfer/Roman Deutinger (Hgg.), Das Lehnswesen im Hochmittelalter. Forschungskonstrukte – Quellenbefunde – Deutungsrelevanz (Mittelalter-Forschungen 34) Ostfildern 2010, S. 329–345, hier S. 340. Stefan Weinfurter, Die Päpste als „Lehnsherrn“ von Königen und Kaisern im 11. und 12. Jahrhundert?, in: Karl-Heinz Spieß (Hg.), Ausbildung und Verbreitung des Lehnswesens im Reich und in Italien im 12. und 13. Jahrhundert (VuF 76) Ostfildern 2013, S. 17–40, Zitate S. 27, 38 und 40. Vgl. Alfons Becker, Politique féodale de la papauté à l’égard des rois et des princes (XIe– XIIe siècles), in: Chiesa e mondo feudale nei secoli X–XII. Atti della dodicesima Settimana internazionale di studio, Mendola, 24–28 agosto 1992 (Miscellanea del Centro di studi medioevali 14) Mailand 1995, S. 411–445. Vgl. neben der Überschrift des Abschnittes (S. 133) den Bandtitel: Wilhelm von Giesebrecht, Geschichte der deutschen Kaiserzeit 5, 1: Neuer Aufschwung des Kaiserthums unter Friedrich I., Leipzig 1880.
Beneficium – wohlwollend interpretiert
139
Henry Simonsfeld fasste 1908 das Geschehen in den „Jahrbüchern der Deutschen Geschichte“ in diesem Sinne zusammen: „Kaiser Friedrich konnte mit diesem Abschluss des Zwischenfalls von Besançon wohl zufrieden sein. Dank seiner Entschiedenheit und Festigkeit hatte er […] einen unleugbaren Sieg über Papst Hadrian davongetragen, den Angriff auf die Unabhängigkeit seines Kaisertums ebenso energisch wie glänzend abgeschlagen – die Kurie selbst erkannte ihn als Herrn Roms und der Welt an.“20 Voraussetzung sowohl der den Ausgleich hervorhebenden Deutung Giesebrechts als auch der triumphalistischen Simonsfelds ist jedoch, dass Hadrian in seinem Schreiben das umstrittene Wort beneficium im Sinne von „Lehen“ verwendet hatte.21 Simonsfelds Rede vom „unleugbaren Sieg“ zeigt, wie sehr das Urteil über Barbarossas politisches Können und Geschick von solcher Lösung des Übersetzungsproblems abhängt. Dem Staufer, der einen „neuen Aufschwung des Kaisertums“ herbeigeführt hatte – ein Bild, das Peter Rassow nochmals in seiner gewichtigen Honor-Imperii-Studie über die „neue Politik Friedrich Barbarossas“, 1940 erschienen und 1961 erneut aufgelegt, unterstrichen hatte22 –, einen politischen Fehler und Missgriff zuzuschreiben, scheute sich die deutsche Forschung: Triumph und Sieg bestimmten lange das Vokabular und die Erinnerung. Dank der sprachlichen Kompetenz Rainalds schien es somit gelungen, einen versteckten Vorstoß Hadrians, der das Kaisertum als päpstliches Lehen darstellte, abzuwehren und Hadrian zum Einlenken zu bringen. Und dies offenbar mit dauerndem Erfolg. Denn das Verständnis vom Kaisertum als päpstliches Lehen spielt – soweit ich sehe – in der Folgezeit weder in der Politik noch in der gelehrten Diskussion eine entscheidende Rolle. Trotzdem ist es dem mittelalterlichen Kaisertum nicht gelungen, sich vom Papsttum zu lösen. Seit den Anfängen des 13. Jahrhunderts gab es zwar kanonistische Erörterungen, ob die Eide, die der (künftige) Kaiser dem Papst vor der Krönung leiste, als Lehnseide zu betrachten seien23, politische Auseinandersetzungen darüber erfolgten jedoch erst im Umfeld der Kaiserkrönung Heinrichs VII. (1312). Aber auch diejenigen, die Heinrich durch einen Lehnseid an den Papst gebunden sahen, entrückten den Papst in eine hierokratische, keiner lehnrechtlichen Unterstützung bedürfenden Position.24 20
21 22 23
24
Henry Simonsfeld, Jahrbücher des Deutschen Reiches unter Friedrich I. 1: 1152 bis 1158, Berlin 1908, S. 646; vgl. dort die Stichwörter im Inhaltsverzeichnis S. XXI: „Zutreffende Übersetzung […] mit ‚Lehen‘“; zu Augsburg im Inhaltsverzeichnis S. XXIII: „Erfolg Friedrichs in dem Streit mit Hadrian“, „Siegreicher Ausgang des Vorfalles in Besançon für Friedrich“. Vgl. Giesebrecht, Geschichte (wie Anm. 19), S. 123; Simonsfeld, Jahrbücher (wie Anm. 20), S. 570. Peter Rassow, Honor imperii. Die neue Politik Friedrich Barbarossas 1152–1159, München/ Berlin 1940 (Darmstadt 1961, durch den Text des Konstanzer Vertrages ergänzte Neuausgabe). Vgl. Eduard Eichmann, Die Kaiserkrönung im Abendland. Ein Beitrag zur Geistesgeschichte des Mittelalters. Mit besonderer Berücksichtigung des kirchlichen Rechts, der Liturgie und der Kirchenpolitik 1–2, Würzburg 1942, hier 2, S. 183–188 (S. 161–207 insgesamt zu den Eiden des Kaisers). Vgl. Malte Heidemann, Heinrich VII. (1308–1313). Kaiseridee im Spannungsfeld von staufischer Universalherrschaft und frühneuzeitlicher Partikularautonomie (Studien zu den Luxemburgern und ihrer Zeit 11) Warendorf 2008, S. 267–292 zur juristisch-kurialen Diskussion nach der Kaiserkrönung; dort S. 286 f.: die „Gegenseitigkeit“ der Lehnsbeziehung ist aufgehoben.
140
Ernst-Dieter Hehl
Zuvor sind die Dinge noch eindeutiger. Innozenz III. hat sein Eingreifen in den Thronstreit nicht lehnrechtlich begründet, sondern sein Recht und seine Pflicht dazu daraus abgeleitet, dass es dem Papst obliege, den römisch-deutschen König zum Kaiser zu krönen.25 Als Innozenz IV. 1245 Kaiser Friedrich II. absetzte26, argumentierte er nicht lehnrechtlich.27 Er konstatierte mehrfachen Eidbruch Friedrichs; auch den Lehnseid, den Friedrich dem Papst für Sizilien geleistet hatte, habe der nun abgesetzte Herrscher nicht beachtet.28 Sämtliche Treueide, die dem Kaiser geleistet worden sind, löst Innozenz. Für das päpstliche Lehnsgut Sizilien will er selbst für einen Nachfolger sorgen. Die Regelungen für das Imperium überlässt er den Fürsten. Sie, denen im imperium die Wahl zukommt, sollen „frei“ (libere) einen Nachfolger wählen.29 Das Imperium unterliegt nicht einer lehnrechtlichen Verfügungsgewalt des Papstes. Bei der Absetzung Friedrichs agierte Innozenz – wie er selbst in seinem Kommentar erläuterte – nicht als Oberlehnsherr, sondern Christus, der „von Ewigkeit her natürliche Herr“ (dominus naturalis), hat den hl. Petrus und dessen päpstliche Nachfolger in die gleiche Position eingewiesen. Nicht Lehnrecht, sondern „Naturrecht“ (ius naturale) legitimiert deshalb die Absetzung des Kaisers.30 Die Ansprüche der Päpste bezüglich des Kaisertums bedurften offensichtlich keiner lehnrechtlichen Fundierung. Auch in der Situation von 1157 ist es nicht sichtbar, welchen Vorteil Hadrian aus einer lehnrechtlichen Interpretation des umstrittenen Wortes beneficium hätte ziehen können. Denn die politischen Erfahrungen der Kurie sprachen entschieden dagegen, mit dem römisch-deutschen König und Kaiser den mächtigsten Herrscher der unmittelbaren Umgebung zum Lehnsmann der römischen Kirche zu machen. Hatten doch die süditalienischen Normannen ihren Lehnsherren zur Genüge beigebracht, dass sich mit dem Anspruch auf päpstliche Lehnshoheit keine politischen Fesseln aufer25 26
27
28
29 30
Grundlegend: Kempf, Papsttum (wie Anm. 13). Bulla depositionis (lat.-dt.), in: Dekrete der Ökumenischen Konzilien 2: Konzilien des Mittelalters. Vom Ersten Laterankonzil (1123) bis zum Fünften Laterankonzil (1512–1517), hg. von Josef Wohlmuth unter Mitarbeit von Gabriel Sunnus und Johannes Uphus, Paderborn/München/Wien/Zürich 2000, S. 278–283. Vgl. den Kommentar von Innozenz IV. zur Absetzungsbulle. Das Wichtigste daraus mit deutscher Übersetzung bei Miethke/Bühler, Kaiser (wie Anm. 10), S. 111 f. (Nr. IV 5), die Bulle ebd., S. 105–111 (Nr. IV 4). Zur Interpretation vgl. die Bemerkungen Miethkes in der Einleitung der Quellensammlung; grundlegend: Friedrich Kempf, Die Absetzung Friedrichs II. im Lichte der Kanonistik, in: Josef Fleckenstein (Hg.), Probleme um Friedrich II. (VuF 16) Sigmaringen 1974, S. 345–360, bes. S. 345–350; Ernst Schubert, Königsabsetzung im deutschen Mittelalter. Eine Studie zum Werden der Reichsverfassung (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen. Philologisch-Historische Klasse. Dritte Folge 267) Göttingen 2005, S. 217–228, bes. S. 220 f. Dekrete der Ökumenischen Konzilien (wie Anm. 26), dort Eidbruch/Meineid: S. 279, Z. 10– 17, 26 f., 32; S. 280, Z. 37 und 40. Fidelitatis iuramentum und ligium hominium für Sizilien: S. 280, Z. 1–6. Der Bruch der Eide ist als „Verrat und Majestätsverbrechen“ zu werten: S. 280, Z. 8–10. Friedrich zwingt zum Bruch der iuramenta fidelitatis, die der römischen Kirche geleistet worden sind: S. 280, Z. 32–37. Ebd., S. 283, Z. 25–33. Vgl. Miethke/Bühler, Kaiser (wie Anm. 10), S. 111 f. (letzter Absatz).
Beneficium – wohlwollend interpretiert
141
legen ließen. Die gegen die Normannen gerichtete Politik der Päpste, die noch der Konstanzer Vertrag von 1153 zwischen Papst Eugen III. und Friedrich Barbarossa festgeschrieben hatte, war gescheitert. Hadrian IV. hatte den Konstanzer Vertrag nochmals erneuert, sich dann aber im Konkordat von Benevent 1156 mit König Wilhelm I., seinem störrischen Lehnsmann, einigen müssen.31 Ihre Lehnsabhängigkeit vom Papsttum hatten die Normannen niemals bestritten. Einen weiteren Lehnsmann von solcher politischer Potenz konnte sich Hadrian IV. wohl kaum leisten. Gegen einen „kaiserlichen Lehnsmann“ hätte ihm kein Argument zur Verfügung gestanden, wenn dieser definierte „Lehnsterritorien“ mit darauf bezogenen Herrschaftsrechten eingefordert hätte, wie sie der normannische König als päpstlicher Vasall besaß. Nur Rom und das Patrimonium Petri hätten dafür zur Verfügung gestanden, denn das Reich als solches unterstand unbestritten der Herrschaft Barbarossas, nachdem dieser zum König erhoben worden war. Hätte Hadrian den Kaiser als päpstlichen Lehnsmann aufgefasst, hätte er die päpstliche Unabhängigkeit aufs Spiel gesetzt. Hatte Hadrian aber wirklich einen verschlüsselten Anspruch auf Lehnsabhängigkeit des Kaisertums formuliert, dann musste dieser ins Leere laufen, wenn der kaiserliche Hof ihn nicht explizit aufgriff. Hadrians Brief war zunächst einmal energischer Protest gegen konkretes Fehlverhalten, genauer Untätigkeit, Barbarossas. Er war nicht als zitierfähiges Dokument zu den Grundlagen des Kaisertums gedacht. Erst Rainalds Übersetzung führte die Grundsatzdiskussion herbei. Hätte Rahewin nicht den erläuternden und in Augsburg verlesenen Brief Hadrians in die „Gesta“ aufgenommen, ginge aus seinem Bericht nicht einmal hervor, dass Rainald beneficium mit „Lehen“ übersetzt hatte. Die Übersetzungsfrage würde die Forschung nur wenig (oder gar nicht) beschäftigen und wohl auch nicht das Problem einer Lehnsabhängigkeit des Kaisertums. In den Vordergrund würde Rahewins Äußerung rücken, zur „strengen Auslegung“ (stricta expositio) und „dem Glauben an die Zuverlässigkeit der Übersetzung“ (prefate interpretationis fides) hätte das Wissen darüber geführt, dass einige Römer die Herrschaft des römisch-deutschen Königs über Rom (imperium Urbis) und Italien (regnum Italicum) auf Schenkung durch die Päpste (donatio pontificum) zurückführten.32 Damit stellen sich zwei Fragen: 1. die alte Frage, ob Rainalds Übersetzung zutreffend war? 2. warum Rainald den Konflikt und Tumult riskierte, der aufgrund seiner Übersetzung vorherzusehen war?
31
32
Vgl. insgesamt Josef Deér, Papsttum und Normannen. Untersuchungen zu ihren lehnsrechtlichen und kirchenpolitischen Beziehungen (Studien und Quellen zur Welt Kaiser Friedrichs II. 1) Köln/Wien 1972, zu Benevent S. 246–257. Laudage, Alexander III. (wie Anm. 11), S. 83–89; Anne J. Duggan, Totius christianitatis caput. The Pope and the Princes, in: Brenda M. Bolton/Anne J. Duggan (Hgg.), Adrian IV, the English Pope (1154–1159). Studies and Texts, Aldershot 2002, S. 105–155, hier S. 117–120, zu den Beziehungen zwischen Barbarossa und Hadrian von der Kaiserkrönung bis Besançon S. 126–134. Rahewin, Taten III, 12 (wie Anm. 2), S. 414/415 f.
142
Ernst-Dieter Hehl
Die Antwort auf die zweite Frage erfolgt eher beiläufig, denn sie ergibt sich aus der Antwort auf die erste. Die erste Frage bleibt die entscheidende. Sie muss nach Heinemeyers Beobachtungen, dass an der Kurie der deutsche Sprachgebrauch beneficium = Lehen bekannt war, erneut gestellt werden, weil Johannes Fried 1980 auf die Formel maiora beneficia in einer fast zeitgleichen Urkunde Hadrians hingewiesen hat.33 In den Jahren 1156 bis 1158 hatte Hadrian IV. dem Grafen Raimund Berengar IV. von Barcelona ein Privileg erteilt, wonach ihn niemand ohne eine spezielles Mandat des apostolischen Stuhls oder päpstlichen Legaten a latere exkommunizieren dürfe. Für ein Interdikt galt das gleiche. Beide Sonderrechte, die dem Grafen damit zuteilwerden, bezeichnet Hadrian als maiora beneficia, die den Grafen auch dazu veranlassen sollen, der römischen Kirche ampliorem fidelitatem atque reverentiam zu erweisen.34 Nicht nur eine allgemeine Leistungspflicht des Grafen (reverentia), sondern auch eine lehnrechtlich formulierte (fidelitas) wird erwartet – als Gegenleistungen für die kirchlichen Vergünstigungen, die als maiora beneficia begrifflich zusammengefasst sind. Eine kirchliche Leistung verpflichtet zu einer Gegenleistung. Hadrians Protestbrief von Besançon lässt sich auf die gleiche Formel bringen: der päpstlichen Leistung der Kaiserkrönung steht derzeit keine entsprechende kaiserliche Gegenleistung gegenüber, nämlich für die Freilassung Eskils von Lund zu sorgen. Hadrian fordert, dass Barbarossa sich nach dem „Modell von Gabe und Gegengabe“ verhält35, eine Erweiterung zu dem „Modell Lehnsgabe und Lehnsdienst“ ist aus der Formel maiora beneficia nicht automatisch herleitbar. Erst Rainald von Dassel hat mit seiner Übersetzung einen derartigen lehnrechtlichen Zusammenhang hergestellt. Doch Johannes Laudage hat in seiner Monographie über Alexander III. und Barbarossa Frieds Hinweis auf die von Hadrian IV. außerhalb von Lehnsbezügen verwendete Formel maiora beneficia in seine allgemeine Sentenz einbezogen, dass für die Frage nach der Angemessenheit der Übersetzung Rainalds „eine Klärung allein aufgrund philologischer Überlegungen nahezu unmöglich sei.“ Laudage konstatiert so gewissermaßen ein philologisches Patt bei den von ihm notierten Bedeutungen, welche beneficium im kurialen Sprachgebrauch hatte, nämlich Wohl33 34
35
Johannes Fried, Der päpstliche Schutz für Laienfürsten. Die politische Geschichte des päpstlichen Schutzprivilegs für Laien (11.–13. Jh.) (Abhandlungen der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse 1980, 1) Heidelberg 1980, S. 194, Anm. 2. Paul Fridolin Kehr, Papsturkunden in Spanien. Vorarbeiten zur Hispania Pontificia 1: Katalanien (Abhandlungen der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Philologisch-Historische Klasse, N. F. 18, 2) Berlin 1926, S. 365 f., Nr. 82: Hoc ergo, dilecte in Domino fili, rationis debito provocati, preces tue nobilitatis benigne admisimus et personam tuam speciali decrevimus privilegio decorare, quatinus sacrosancte Romane ecclesiae tanto debeas ampliorem fidelitatem atque reverentiam iugiter exhibere, quanto ab ipsa maiora te noveris beneficia recepisse. Nobilitatem itaque tuam presenti scripto […, es folgt die Exkommunikationsklausel; später:] Ut autem nobilitatis tue devotio maius privilegium se gaudeat a Romana ecclesia recepisse, presenti privilegio sancimus (es folgt die Interdiktklausel). Marcel Mauss, Die Gabe. Form und Funktion des Austauschs in archaischen Gesellschaften (suhrkamp taschenbuch wissenschaft 743) Frankfurt am Main 1968 u. ö. (das französische Original „Essai sur le don“ erschien 1923/24).
Beneficium – wohlwollend interpretiert
143
tat, Pfründe, Lehen.36 Aber auch in den Herrscherurkunden der Zeit war beneficium nicht allein im lehnrechtlichen Sinne gebräuchlich. Gerade in den Arengen mit ihren allgemeinen Aussagen zum Herrschaftsverständnis begegnet das Wort im Sinne von „Wohltat“.37 Und ein gratis erteiltes beneficium war es gewesen, dass Erzbischof Arnold II. von Köln sich für die Erhebung Barbarossas zum König eingesetzt hatte, wie Wibald von Stablo 1152 schrieb. Barbarossa erinnere sich magna cum benivolentia et iocunditate daran und werde dem Erzbischof dafür zu danken wissen.38 Sowohl für den mittelalterlichen Übersetzer wie den modernen Historiker ist es eine waghalsige Philologie, einem einzigen Wort in einem kurialen Schreiben eine Bedeutung zuzuschreiben, die als spezifisch lehnrechtliche nicht dem kurialen Alltag entsprach.39 Denn lässt sich ein Begriff ohne weiteres als Fachterminus begreifen, wenn der Kontext, in dem er steht, nicht fachsprachlich geprägt ist, sondern Allerweltslatein bietet? Zunächst ist jedenfalls zu überprüfen, ob eine unspezifische, hier nicht-lehnrechtliche Interpretation möglich ist. Sowohl im klassischen wie (wenn auch seltener) im biblischen Latein ist das Wort beneficium belegt, beide Male naturgemäß ohne lehnrechtliche Konnotationen.40 Von den Belegen in der Vulgata lassen sich drei in das Modell von Gabe und Gegengabe einordnen. Angesprochen wird jeweils, dass ein beneficium keine entsprechende Gegenleistung gefunden habe.41 Des Weiteren werden Königtum und Königsherrschaft als von Gott übergebenes beneficium charakterisiert. Als der persische Großkönig Artaxerxes die Juden unter seinen Schutz stellte, pries er den „höchsten, größten und ewig lebenden Gott, durch dessen beneficium unseren Vorfahren und uns das regnum über-
36 37
38
39 40 41
Laudage, Alexander III. (wie Anm. 11), S. 91. Zu den genannten Bedeutungen von beneficium in den Urkunden Hadrians mit Belegen Heinemeyer, Beneficium (wie Anm. 3), S. 214 f. mit Anm. 192–194. Rudolf Schieffer, Das Lehnswesen in den deutschen Königsurkunden von Lothar III. bis Friedrich I., in: Dendorfer/Deutinger, Lehnswesen (wie Anm. 16), S. 79–90, hier S. 80 mit Anm. 5 und 6. Vgl. auch das Register bei Friedrich Hausmann/Alfred Gawlik, Arengenverzeichnis zu den Königs- und Kaiserurkunden von den Merowingern bis Heinrich VI. (MGH Hilfsmittel 9) München 1987, S. 652. Das Briefbuch Abt Wibalds von Stablo und Corvey 1–3, hg. von Martina Hartmann nach Vorarbeiten von Heinz Zatschek und Timothy Reuter (MGH Briefe d. dt. Kaiserzeit 9) Hannover 2012, hier 3, S. 746 f., Brief 356 (J. 381): Princeps noster bonam de se merentibus spei fiduciam prestat. Qui magna cum benivolentia et iocunditate beneficii vestri recordatur, quod ei gratis et plus quam gratis in suis ad imperii culmen provectibus exhibuistis et postmodum in suis primordiis singulari fide et constantia ad rei publice et sua emolumenta indificienter astititis. Vgl. Maccarrone, Papato (wie Anm. 3), S. 184 mit Zitat Anm. 48. Auf dieses methodische Problem weist Ullmann, Roland (wie Anm. 12), S. 108, nachdrücklich hin. Zur Bibel: Novae concordantiae Bibliorum sacrorum iuxta Vulgatam versionem critice editam, quas digessit Bonifatius Fischer 1–6, Stuttgart/Bad Cannstadt 1977, 1, S. 621. Siehe auch Anm. 42. Vgl. 2. Paralipomena (2. Chronik) 32, 25; Ecclesiasticus (Jesus Sirach) 29, 9; 1. Maccabaei 11, 53.
144
Ernst-Dieter Hehl
geben worden ist und bis heute behütet wird.“42 Frieds Hinweis auf die kuriale Verwendung von maiora beneficia in einem alltäglichen Sinn fordert jedenfalls zu neuem Nachdenken auf. Philologische Überlegungen schließen Fragen nach der Überlieferung ein und ebenso nach der literarischen Gestaltung und Erzähltechnik. Sie geben Hinweise, dass Rainalds Übersetzung bereits den Zeitgenossen, nämlich dem berichtenden Rahewin, fragwürdig erschien. So umstritten die Interpretation des Konflikts von Besançon bei den heutigen Historikern ist, so umfassend sind sie über die Vorgänge im Einzelnen informiert. Denn Rahewin hat die entscheidenden Schriftstücke der Auseinandersetzung in seine „Gesta Frederici“ aufgenommen.43 Noch ein weiteres Mal greift er zu diesem dokumentarischen Verfahren: bei der Schilderung des Papstschismas von 1159. In beiden Fällen begründet Rahewin sein Vorgehen. Er will den Leser nicht auf eine bestimmte Deutung festlegen, sondern ihm ein eigenes Urteil ermöglichen.44 So wie der Leser sich aufgrund der Schilderung des Schismas bei Rahewin für die Rechtmäßigkeit des Papsttums Alexanders III. oder Victors IV. entscheiden kann, so soll er sich bei der Schilderung der Vorgänge von Besançon für die Position einer der beiden streitenden Parteien entscheiden können. Rahewin weigert sich, den Leser auf die von der kaiserlichen Politik gewünschte „Lesart“ festzulegen, aber er riskiert nicht den offenen Widerspruch. In der Frage des Schismas hatten sich Rahewins Metropolit, Erzbischof Eberhard von Salzburg, und Albert, seit 1160 Bischof von Freising und Dienstherr Rahewins, gegen Barbarossas Entscheidung für Victor IV. ausgesprochen und Alexander III. anerkannt.45 Dem Kaiser über das Geschichtswerk verpflichtet und ebenso dem alexandrinisch gesinnten Bischof der Freisinger Kirche (sowie dem Salzburger Erzbischof als Vorsteher der Kirchenprovinz), befand sich Rahewin zwischen Baum und Borke. Dass er sich im Schisma eines eigenen Urteils enthielt und die Dokumente sprechen ließ, ist hierin hinreichend erklärbar. Diejenigen, die sich aus Rahewins Dokumentation ein Urteil bilden sollten, befanden sich am Hof oder in der kirchlichen Umgebung des Historiographen. Das gleiche gilt für Rahewins Dokumentation der Vorgänge von Besançon. Wenn er wiederum dem Leser die Entscheidung überlässt, geschieht das aus denselben Gründen wie bei dem Papstschisma: Rahewin weiß, dass die Vorgänge nicht einheitlich gesehen werden, dass Rainalds Zuspitzung nicht von allen für richtig 42 43 44
45
Esther 16, 16: altissimi et maximi semperque viventis dei, cuius beneficio et patribus nostris et nobis regnum est traditum et usque hodie custoditur. Auf die Stelle verweist auch mit knappem Zitat Maccarrone, Papato (wie Anm. 3), S. 257, Anm. 29. Siehe Anhang I die von Rahewin inserierten Dokumente und die Übersetzungsvermerke. Siehe Anhang II die Dokumentationsankündigungen Rahewins. Vgl. Deutinger, Rahewin (wie Anm. 2), S. 136–138. Für das Schisma nimmt Deutinger eine alexandrinische, für den Vorgang von Besançon eine „eher“ (S. 137) prokaiserliche Position an. Schmale sieht in der Einleitung zu seiner Edition (wie Anm. 2), S. 40 f., in Rahewin einen Parteigänger Victors IV. Für Maccarrone, Papato (wie Anm. 3), ist Rahewin mehr oder weniger ein Sprachrohr Barbarossas (vgl. S. 202: „versione ufficiale“, S. 203: „tendenziosità“). Deutinger, Rahewin (wie Anm. 2), S. 18 f.
Beneficium – wohlwollend interpretiert
145
gehalten wurde. Schon dass er die Dokumente sammelt, dokumentiert Kritik an Rainald. Rahewin selbst hat diese Kritik geteilt. Er äußert sich zur Übersetzung der päpstlichen Schreiben. Zweimal betrifft das den Brief von Besançon, Rahewins dritte Äußerung gilt dem Augsburger Schreiben Hadrians. Rainalds Übersetzung vor dem Hoftag von Besançon bezeichnet er als fida satis interpretatio, als „ziemlich genaue Übersetzung“.46 Das deutet bereits Zweifel an, eine Freisinger Lesart übt direkte Kritik, indem sie von fida nimis interpretatio, von einer „über die Maßen getreuen Übersetzung“ spricht.47 Rainald übersetzte den Brief nicht nur, sondern erläuterte ihn auch „sorgfältig“ (diligenter). Die Erinnerung an das Laterangemälde, das Lothar III. bei seiner Kaiserkrönung als päpstlichen Lehnsmann zu zeigen schien und das Hadrian, obwohl er dies versprochen hatte, immer noch nicht hatte beseitigen lassen, sowie Kenntnis von der leichtfertigen Äußerung „einiger“ Römer, die deutschen Könige besäßen das imperium Urbis und das regnum Italicum aufgrund einer „Schenkung“ (donatio) der Päpste, veranlassten die Zuhörer, Rainalds Übersetzung zu vertrauen und eine stricta expositio des Briefs vorzunehmen.48 Hier verliert Rahewin kein Wort darüber, ob Rainalds Übersetzung angemessen und richtig gewesen sei, sondern er erklärt nur, warum sie Glauben fand und warum eine stricta expositio erfolgte. Die Zweifel, die er zuvor mit der Formulierung fida satis/nimis interpretatio angedeutet hat, bleiben bestehen. In Augsburg übernahm Otto von Freising die Übersetzung und Erläuterung des päpstlichen Schreibens, das den Konflikt beendete. Auf eine Ankündigung dieses Dokuments verzichtet Rahewin. Denn nun ist die Sachlage eindeutig, und der Leser muss sich kein eigenes Urteil bilden. Aber wiederum kommentiert Rahewin die Art der Übersetzung: „Nachdem der Brief verlesen und in wohlwollender Weise verdeutscht und erläutert worden war“ – Lectis et benigna interpretatione expositis litteris.49 Das ist mehr als eine Charakterisierung seines Bischofs, der kein weiteres Öl ins Feuer gießen, sondern einen Ausgleich ermöglichen wollte. Die benigna interpretatio entspricht vielmehr Vorstellungen des römischen Rechts. „Gesetze sind so wohlwollend auszulegen, dass ihr Wille gewahrt bleibt“ (Benignius leges interpretandae sunt, quo voluntas earum conservetur), konnte man in Digesten 1.3.18 lesen. Und im folgenden Abschnitt (1.3.19) heißt es: „Bei mehrdeutigem Wortlaut des Gesetzes soll man lieber die Bedeutung annehmen, die fehlerfrei ist, 46 47
48 49
Rahewin, Taten III, 12 (wie Anm. 2), lat. S. 414, Z. 20 f.; dt. S. 415, Z. 20 f. Rahewins Zweifel notiert auch Heinemeyer, Beneficium (wie Anm. 3), S. 180 f. Diese Lesart findet sich in der Handschriftenklasse B der „Gesta“, die im Salzburger Raum verbreitet war und die „letztlich auf Rahewins Handexemplar in Freising“ zurückgeht, vgl. Deutinger, Rahewin (wie Anm. 2), S. 77. Zu den Handschriften die Übersicht S. 28 f. und die Zusammenfassung S. 69–87, bes. S. 85–87. Die Handschriftenklasse C gilt als Repräsentantin des Barbarossa überreichten Widmungsexemplars, das aber „von den damit beauftragten Hofbeamten Ulrich und Heinrich im prokaiserlichen Sinn durchkorrigiert“ wurde (S. 87). Rahewin, Taten III, 12 (wie Anm. 2), S. 414/415 f. Zu dem viel diskutierten Laterangemälde vgl. etwa Deutinger, Kaiser (wie Anm. 16), S. 332–337; Weinfurter, Päpste (wie Anm. 17), S. 18–20. Rahewin, Taten III, 27 (wie Anm. 2), S. 452, Z. 13.
146
Ernst-Dieter Hehl
zumal auf diese Weise auch der Wille des Gesetzes erschlossen werden kann.“50 Die benigna interpretatio, wie sie das römische Recht verlangte, sollte den Willen und die Absicht des Gesetzgebers offenlegen, deshalb war sie jeder anderen interpretatio vorzuziehen. Dieser Regel folgend, wies Hadrian in Augsburg Rainalds Übersetzung von Besançon zurück: „Mag auch dieses Wort beneficium von manchen in anderem Sinn aufgefasst werden, als es seiner Grundbedeutung nach hat, so war es doch hier in der Bedeutung zu verstehen, die wir selbst gemeint haben und die es bekanntlich seiner Zusammensetzung nach besitzt.“51 Rainalds Übersetzung war nicht allein philologisch falsch, sondern sie widersprach auch den Grundsätzen, nach denen eine Übersetzung vorzunehmen war. Rahewins Stellungnahmen52 zu den Übersetzungen von Besançon (fida satis/ nimis interpretatio) und Augsburg (benigna interpretatio) enthalten eindeutige Bewertungen: Rainalds Übersetzung ist fragwürdig, Otto von Freising hingegen findet die angemessenen Formulierungen. Barbarossa selbst hat 1182 den Grundsatz des benigne interpretari vertreten, als er das Privileg Heinrichs V. für Speyer von 1111 auch auf das dort nicht erwähnte „Hauptrecht“ bezog. Heinrichs V. Privileg war an der Front des Domes angebracht.53 In ihm konnte man lesen, die Einwohner von Speyer seien von der Errichtung des „Buteils“ befreit. Doch hatte der seit 1178 amtierende Bischof Ulrich von Speyer bestritten, dass darin die Befreiung vom Hauptrecht eingeschlossen sei und auf der Leistung dieser Todfallabgabe bestanden. Barbarossa entschied anders. Die Speyrer sollten auch von der Pflicht, das Hauptrecht zu zahlen, befreit sein und künftig solle jeder Zweifel daran ausgeschlossen sein. Nicht allein mit Zustimmung des Bischofs gab Barbarossa diese rechtsverbindliche Interpretation des Privilegs seines salischen Vorgängers, sondern er berief sich auch auf das Römische Recht. Ihm, dem Kaiser, komme es zu, Recht zu setzen und ebenso das, was hierbei zweifelhaft sei, „mit Güte“ auszulegen: nostrum est leges condere, ita et, quae dubia sunt, benigne interpretari, heißt es in seiner Urkunde.54 Der Grundsatz entstammt dem „Codex Justiniani“, der den 50
51 52 53
54
Corpus Iuris civilis. Text und Übersetzung. Auf der Grundlage der von Theodor Mommsen und Paul Krüger besorgten Textausgaben 2: Digesten 1–10, übers. und hg. von Okko Behrends u. a., Heidelberg 1995, S. 113 f., Dig. 1.3.18 und dann 19: In ambigua voce legis ea potius accipienda est significatio, quae vitio caret, praesertim cum etiam voluntas legis ex hoc colligi possi. Rahewin, Taten III, 26 (wie Anm. 2), S. 450/451, Z. 2–8. Zu Verbindungen Freisings zu den Rechtsschulen von Bologna vgl. Johannes Fried, Die Rezeption Bologneser Wissenschaft in Deutschland während des 12. Jahrhunderts, in: Viator 21, 1990, S. 103–145, hier S. 113 sowie 120 f. zu Schäftlarn und Rahewin. Zu 1111 vgl. Sebastian Scholz, Die Urkundeninschriften in Speyer (1111), Mainz (1135) und Worms (1184). Funktion und Bedeutung, in: Laura Heeg (Hg.), Die Salier. Macht im Wandel. Essays, München 2011, S. 162–165; ders., Die Urkundeninschriften Kaiser Heinrichs V. für Speyer aus dem Jahr 1111, in: ebd., S. 162–173; ders., Die Urkunden Kaiser Heinrichs V. für die Bürger der Stadt Speyer vom 7. und 14. August, in: ebd., S. 174 f.; Kurt Andermann, Die Speyerer Privilegien von 1111, in: ebd., S. 176–179; Hans Hattenhauer, Der Speyerer Freiheitsbrief vom 7./14. August 1111, in: Archiv für mittelrheinische Kirchengeschichte 63, 2011, S. 39–66 (dort auch Text und Übersetzung der Barbarossa-Urkunde). Die Urkunden Friedrichs I. 1–5, bearbeitet von Heinrich Appelt (MGH DD 10, 1–5) Hannover 1975–1990, hier 4, DF. I. Nr. 827 (Zitat S. 34, Z. 33). Zum römischen Recht in den Urkunden
Beneficium – wohlwollend interpretiert
147
Wortlaut der entscheidenden Passagen bestimmt.55 Aber das benigne fehlt in der hier zitierten Codex-Stelle. Es ist eigens hinzugefügt und offenkundig den Digesten entnommen.56 Der Skandal in Besançon wird so nicht von einer lehnrechtlichen Fachdiskussion ausgelöst, sondern durch eine Bemerkung, die keinen Bezug zur Lehnsproblematik enthält. Denn als die Diskussion heftiger wurde, fragte einer der Legaten: „Von wem hat er es denn, wenn er das Kaisertum nicht vom Papst hat?“ (A quo ergo habet, si a domno papa non habet imperium?)57 Das brachte das Fass der Empörung zum Überlaufen. Der Eklat war da, die Legaten wurden vom Hof verwiesen. Von lehnrechtlichen Subtilitäten, die Rainalds Übersetzung ins Spiel gebracht hatte, ist bei der Frage des päpstlichen Legaten nichts mehr zu spüren. Er drückte sich in Allerweltslatein aus: Das Kaisertum hatte Barbarossa vom Papst. Aber ebenso wie die Forschung sich bemüht hat, hinter den maiora beneficia des päpstlichen Schreibens rechtstechnische Begrifflichkeiten und lehnrechtliche Vorstellungen aufzuspüren, ist zu prüfen, ob sich nicht auch hinter der so dahergesagten und provokativen Frage „Von wem hat er es denn?“ rechtliche Vorstellungen verbergen oder ob nur eine patzige „Kindergartenlogik“ hinter der Formulierung des Legaten steht. Die polemische Äußerung des Legaten ist in der Hitze des Gefechts gefallen.58 Sie war kein vorbereitetes Statement. Aber dennoch begegnet die patzig und naiv klingende Frage des Legaten als grundsätzliche positive Aussage im Kirchenrecht des 12. Jahrhunderts. „Nur wer etwas hat, kann etwas geben“ war hier als Sentenz formuliert: „Wir stimmen dem zu und es ist wahr, weil er das, was er nicht hatte, auch nicht geben konnte“ (quia quod non habuit dare non potuit), hieß es im „Decretum Gratiani“. Das stammte aus einem Brief Papst Innozenz’ I., den Gratian bei der Erörterung des Simonieproblems zitierte. Noch deutlicher sind die Formulierungen in dem vorausgehenden Kapitel Gratians: „Wer den honor nicht hatte, der konnte den honor auch nicht geben; und nichts wird der Empfänger erhalten, weil nichts in dem Spender war.“59 Die Vorstellung, die hinter der Frage des Legaten stand, war im Kirchenrecht und in kirchlicher Politik gängige Münze. Sie offen-
55
56 57 58
59
Barbarossas vgl. die Einleitung zur Edition 5, S. 123–129, bes. S. 124–126 zur Zeit Rainalds, S. 128 zu DF. I. Nr. 827. Corpus iuris civilis 2: Codex Iustianianus, recognovit et retractavit Paulus Krueger, Berlin 111954, Cod. I.14.12.3, S. 68: Definimus autem omnem imperatoris legum interpretationem sive in precibus sive in iudiciis sive alio quocumque modo factam ratam et indubitatam haberi. Si enim in presenti leges condere soli imperatori concessum est, et leges interpretari solum dignum imperio esse oportet. Nach den Registern der Diplomataausgabe kommt die Wendung benigne interpretari nur in der Urkunde für Speyer vor. Rahewin, Taten III, 12 (wie Anm. 2), S. 416, Z. 16 f. (Übersetzung oben modifiziert). Heinemeyer, Beneficium (wie Anm. 3), S. 162 f., vermutet, Rahewin habe das Auftreten der Legaten in Besançon generell kritisch gesehen. Denn zu den nach Augsburg geschickten Legaten vermerkt Rahewin, Taten III, 21 (wie Anm. 2), S. 438/439, sie seien im Vergleich zu ihnen für ihre Aufgabe besser geeignet gewesen. Gratian, Concordia discordantium canonum, hg. von Aemilius Friedberg, Corpus Iuris Canonici 1: Decretum magistri Gratiani, Leipzig 1879, hier Sp. 363: C(ausa) 1 q(uestio) 1 c. 18; davor c. 17: Qui honorem non habuit, honorem dare non potuit, nec aliquid accepit, quia nichil
148
Ernst-Dieter Hehl
barte die Sprengkraft, die hinter der Formulierung maiora beneficia des Hadrianbriefes stand, wenn man sie auf ihre Konsequenzen befragte oder aus ihr politische Konsequenzen ziehen wollte.60 Einer lehnrechtlichen Interpretation, wie sie Rainald vortrug, bedurfte es dazu nicht. Die Ansprüche, die ein Papst gegenüber dem Kaiser erhob, den er gekrönt hatte, ließen sich ebenso aus dem Grundsatz „Wer nichts hat, kann nichts geben“ ableiten. Was einer der päpstlichen Legaten in die provokative Frage gekleidet hatte, das war schon bei dem ersten Empfang der Legaten durch Barbarossa angedeutet worden. Barbarossa hatte die Legaten zunächst abseits des Hoftages in kleinerem Kreis empfangen, und hier war ihm anscheinend auch der Papstbrief übergegeben worden, dessen Übersetzung am folgenden Tag zu dem Konflikt führte.61 Die Zusammenkunft war bereits seltsam verlaufen, denn die päpstlichen Legaten führten sich mit einer ungewöhnlichen Grußformel ein: „Es grüßt euch unser heiligster Vater, Papst Hadrian, und die Gesamtheit der Kardinäle der heiligen römischen Kirche, jener als euer Vater, diese als eure Brüder.“62 Rahewin notiert ausdrücklich, dass diese Form der Anrede aufgefallen ist, und er lässt erkennen, dass hier ein Schlüssel für die Erklärung der folgenden Ereignisse liegt, indem er vermerkt, sie sei ihm nur vom Hörensagen bekannt (quod tale fuisse dicitur). An der Bedeutung der Anredeform ist nicht zu zweifeln. Denn in Augsburg lässt Hadrian nicht allein die von ihm gemeinte Bedeutung von beneficium vortragen, sondern seine Legaten wählen auch eine andere Grußformel. Der Papst grüßt weiterhin als Papst, die Gesamtheit der Kardinäle lässt aber andere Grüße ausrichten: „Es grüßen euch auch sämtliche Kardinäle, unsere [der Legaten] Brüder, aber eure Geistlichen, als den Herrn und Kaiser der Stadt und des Erdkreises.“63 Die Grußformel von Besançon bildet das Problem. Der Papst grüße den Kaiser als ein Vater – das war eine übliche Formel, die hier ohne Präzisierungen und Zusätze rechtlicher Art verwendet wird.64 Das angesprochene Vater-Sohn-Verhältnis greift der Papstbrief auf. Hadrian richtet ihn an seinen „geliebten Sohn (dilectus filius) Friedrich, den erlauchten Kaiser der Römer“. Und bevor er von den maiora
60
61
62 63
64
erat in dante, sed dampnationem, quam habuit, per pravam manus inpositionem dedit. Vgl. auch Friedbergs Angaben zur kanonistischen Überlieferung der Exzerpte. Eine auf Gratian (C. 25 q. 1 c. 16) zurückgehende Formulierung am Beginn von Barbarossas Schreiben an den deutschen Episkopat (Rahewin, Taten III, 20 [wie Anm. 2], S. 436/437) bespricht Walter Ullmann, Über eine kanonistische Vorlage Friedrichs I., in: ZRG KA 46, 1960, S. 430–433. Weitere Gratianzitate bei Rahewin: Deutinger, Rahewin (wie Anm. 2), S. 207. Die Übergabe (proferre) des Papstbriefes bei dem ersten Zusammentreffen der Legaten mit Barbarossa erwähnt Rahewin bei der Schilderung der Zusammenkunft; Barbarossas Rundschreiben nach dem Hoftag erklärt hingegen, der Brief sei auf dem Hoftag „präsentiert“ (praesentare) worden: Rahewin, Taten III, 10 und 13 (wie Anm. 2), S. 410/411 und 418/419. Ebd., III, 10, S. 410/411, Z. 6–9. Ebd., III, 25, S. 448, Z. 11–13: Salutant etiam vos venerabiles fratres nostri, clerici autem vestri, universi cardinales, tamquam dominum et imperatorem Urbis et orbis. Nach Maccarrone, Papato (wie Anm. 3), S. 204 f., ist die Grußformel umfangreicher gewesen (so auch Heinemeyer, Beneficium [wie Anm. 3], S. 167) und Rahewin habe sie (wie er selbst andeute) nicht genau gekannt. Zum Vater-Sohn-Bild jetzt Weinfurter, Päpste (wie Anm. 17), S. 35.
Beneficium – wohlwollend interpretiert
149
beneficia spricht, was Rainald dann lehnrechtlich übersetzen wird, versichert er dem Kaiser, er habe seine „Person als die unseres teuersten und besonders nahen Sohnes und allerchristlichsten Princeps (personam tuam sicut karissimi et specialis filii nostri et principis christianissimi) […] immer aufrichtig geliebt und mit dem gebührenden Wohlwollen (benignitatis affectu) behandelt.“65 Filius specialis oder auch filia specialis ist in päpstlichen Urkunden und Briefen eine inhaltsreiche Wendung, wie Ulrich Schludi kürzlich herausgearbeitet hat.66 Als „besondere“ Söhne und Töchter begegnen in päpstlichen Urkunden eng mit dem Papst und der römischen Kirche verbundene, von anderer Gewalt eximierte kirchliche Einrichtungen (Bistümer, Klöster, Orden), deren Angehörige und Leiter, aber auch weltliche Herrschaftsträger, die Lehnsleute der römischen Kirche waren oder von dieser ein Schutzprivileg erhalten hatten. Ebenso konnte ein König, der wie die zuvor Genannten „in einer besonders engen und direkten Beziehung zum apostolischen Stuhl“ stand, als filius specialis charakterisiert werden, so der englische König Stephan von Blois und im 12. Jahrhundert wiederholt die römischdeutschen Könige seit Lothar III. Den „aufsässigen“ Normannenherrschern Süditaliens scheint die päpstliche Kanzlei das Prädikat niemals gegeben zu haben.67 Der Grund dafür ist einfach. Denn mit der Bezeichnung als „besonderer Sohn/besondere Tochter“ antwortete die Kurie auf eine vorausgegangene besondere devotio der so Bezeichneten und signalisierte die fortdauernde Erfüllung der väterlichen Gegenverpflichtung. Für den römisch-deutschen König bedeutete das vor allem das Versprechen, ihn zum Kaiser zu krönen. Aber auch nach der Kaiserkrönung bestand das „besondere“ Vater-Sohn-Verhältnis (wie in den sonstigen Fällen) fort.68 Zwischen Papst und Kaiser war ein Näheverhältnis entstanden, „das Lehnrecht brauchte die Kurie dabei gar nicht zu bemühen“. Wie all die anderen „besonderen“ Söhne und Töchter sollte der Kaiser sein „Verhältnis zu Papst und römischer Kirche als das eines gehorsamen Sohnes gegenüber seinem gütigen Vater bzw. seiner Mutter“ begreifen.69 Dass Hadrian die Rolle des „gütigen Vaters“ mit der Kaiserkrönung bereits erfüllt hatte und weiter zu erfüllen bereit war, bekundete er in seinen Bemerkungen über die maiora beneficia, doch das Verhalten seines „besonderen Sohnes“ ließ derzeit zu wünschen.70 65 66
67
68 69 70
Rahewin, Taten III, 11 (wie Anm. 2), S. 410/411 f.; filius specialis S. 412, Z. 16 (die Übersetzung von princeps mit „Fürst“, S. 413, Z. 20, ist oben nicht übernommen). Ulrich Schludi, Advocatus sanctae Romanae ecclesiae und specialis filius beati Petri. Der römische Kaiser aus päpstlicher Sicht, in: Stefan Burkhardt u. a. (Hgg.), Staufisches Kaisertum im 12. Jahrhundert. Konzepte – Netzwerke – Politische Praxis, Regensburg 2010, S. 41–73, zu filius specialis ab S. 48. Schludi, Advocatus (wie Anm. 66), S. 52, Anm. 41, nennt keinen von ihnen in seinen Belegen. In den Hauptdokumenten zu den normannisch-päpstlichen Beziehungen (bei Josef Deér, Das Papsttum und die süditalienischen Normannenstaaten 1053–1212 [Historische Texte. Mittelalter 12] Göttingen 1969) habe ich keinen gefunden. Zu devotus vgl. Schludi, Advocatus (wie Anm. 66), S. 52–55, zum Kaisertum S. 57–64. Zitate nach ebd., S. 64 und 63. Dazu verwendet Schludi überspitzend die Formulierungen „personales Unterwerfungsverhältnis“ und „hierarchische Überordnung“ (S. 64). Leider hat Schludi, Advocatus (wie Anm. 66), seine Ergebnisse nicht direkt auf Besançon angewandt (angedeutet S. 47), sie aber S. 65–73 am Beispiel des Friedens von Venedig exemplifiziert.
150
Ernst-Dieter Hehl
Die Kardinäle grüßten den Kaiser bei dem ersten Zusammentreffen als seine Brüder – das war ungewöhnlich. Versucht man diese „Verwandtschaftsbeziehung“ aufzulösen, die nicht auf das Vater-Sohn-Verhältnis zwischen Geistlichen und Laien rekurrierte, sondern auf Bruderschaft, wie sie sonst unter Geistlichen oder auch allen Menschen bestand, ergibt sich eine doppelte Möglichkeit: Entweder waren Kaiser und Kardinäle ganz allgemein und politisch unverdächtig Brüder in Christus, oder sie waren Brüder, weil sie ihre jeweilige Position dem Papst als gemeinsamen Vater verdankten.71 Das war brisant. Denn – sofern wir die Kardinalbischöfe außer Betracht lassen, bei denen theoretisch noch Elemente der Bischofswahl in Rechnung zu stellen sind – die Kardinäle verdankten ihre Position dem Papst. Das Kardinalat hatte weniger mit einer Weihe zu tun als mit dem konkreten Posten, auf dem der geweihte Diakon oder Priester seinen Dienst tat und der in der Verfügungsgewalt des Papstes stand. Hier konnte der Papst den einsetzen, den er wollte. Die Ernennung zum Kardinaldiakon oder Kardinalpriester war ein bonum factum, sie verlieh ein Amt, über das der Papst kraft eigenen Rechtes verfügte, eine Funktion, die er dem übertrug, den er für befähigt hielt, diese auszuüben.72 Hadrian hatte zwei seiner Kardinäle, den Kardinalpriester Roland von San Marco (den späteren Papst Alexander III.) und Bernhard, den Kardinalpriester von San Clemente, als Legaten entsandt.73 Roland war sein Kanzler, es war eine hochrangige Gesandtschaft nach Besançon gekommen.74 Das hätte (unbeschadet schwieriger Verhandlungsgegenstände) eine besondere Ehre für den Kaiser sein können. Doch nun begrüßten die beiden Kardinäle den Kaiser als ihren und der übrigen Kardinäle Bruder, sie grüßten von gleich zu gleich. Misstrauen, nicht Unbefangenheit oder gar Wohlwollen, prägte deshalb den offiziellen Empfang der Legaten in Besançon. Die Besonderheit der Grußformel von Besançon gibt einen Schlüssel zur Interpretation des offenen Konfliktes auf dem Hoftag selbst. Hadrian hatte signalisiert, dass der Kaiser seine Krone einer päpstlichen Wohltat verdankte, zu der der Papst 71
72
73 74
Vgl. zum Folgenden bereits Hehl, Papsttum (wie Anm. 1), S. 17–19; Heinemeyer, Beneficium (wie Anm. 3), S. 170 f., erwägt, mit der Anrede als Bruder sei Barbarossa als Kanoniker von St. Peter angesprochen worden, und stützt sich dazu auf das für Heinrich VI. bezeugte Kanonikat an St. Peter, was vielleicht auch für Barbarossa anzunehmen sei. Doch ist Heinrich VI. wohl der erste Inhaber eines Herrscherkanonikats an St. Peter gewesen, vgl. Jochen Johrendt, Die Diener des Apostelfürsten. Das Kapitel von St. Peter im Vatikan (11.–13. Jahrhundert) (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 122) Berlin 2011, S. 223 mit Anm. 218 und 219. Zu den Kardinalserhebungen Claudia Zey, Entstehung und erste Konsolidierung. Das Kardinalskollegium zwischen 1049 und 1143, in: Jürgen Dendorfer/Ralf Lützelschwab (Hgg.), Geschichte des Kardinalats im Mittelalter (Päpste und Papsttum 39) Stuttgart 2011, S. 63–94, hier S. 75; Werner Maleczek, Die Kardinäle von 1143 bis 1216. Exklusive Papstwähler und erste Agenten der päpstlichen plenitudo potestatis, in: ebd., S. 95–154, hier S. 99. Zur Legatentätigkeit der Kardinäle Maleczek, Kardinäle (wie Anm. 72), S. 139–146. Zu den Modalitäten eines Empfangs von Legaten vgl. Knut Görich, Eine „internationale“ Sprache der Ehre? Gesandte vor Friedrich Barbarossa, in: Hanna Vollrath (Hg.), Der Weg in eine weitere Welt. Kommunikation und „Außenpolitik“ im 12. Jahrhundert (Neue Aspekte der europäischen Mittelalterforschung 2) Berlin 2008, S. 35–57, hier bes. S. 39–41.
Beneficium – wohlwollend interpretiert
151
eben nicht verpflichtet war, und Barbarossa dazu aufgefordert, diese Wohltat mit Wohlverhalten in der Angelegenheit Eskils zu beantworten. Weitere Konsequenzen hatte Hadrian nicht gezogen. Anders Rainald.75 Er verdeutlichte, welche Folgerungen sich für das Verhältnis zwischen Papst- und Kaisertum und damit für das Wesen des Kaisertums aus Hadrians Formulierungen ziehen ließen. Um dies vor allem den weltlichen Fürsten76 begreiflich zu machen, wählte er die lehnrechtliche Übersetzung – nicht allein die politischen und rechtlichen Bezüge, in denen die Fürsten selbst standen, sondern auch das Heraufbeschwören der ominösen Darstellung von Lothars III. Kaiserkrönung im Lateran machte Rainalds Übersetzung für die Teilnehmer des Hoftags glaubwürdig. Rainalds Erfolg ist unbestreitbar. Die These, der Papst vergebe die Kaiserkrone und das Kaisertum als Lehen, stieß auf einhellige Ablehnung. In Augsburg hat Hadrian dementiert, das in seinem Brief behauptet zu haben. Dass die Kaiserkrönung ein bonum factum des Papstes sei, dieser Lesart konnte jetzt keiner widersprechen, nachdem man sich im Reich so auf eine lehnrechtliche Deutung des Begriffs beneficium kapriziert hatte. Weitere Klarstellungen Hadrians konnte der Hof nicht verlangen. Ein bonum factum aber ließ sich nicht als Erfüllung einer Pflicht einfordern, sondern war allenfalls nach dem Modell von „Gabe und Gegengabe“ auszuhandeln. Hadrian hatte seine Position, dass es ohne päpstliches Handeln keinen Kaiser geben könne, gewahrt. Die Umgebung Barbarossas hat bald nach dem Eklat von Besançon gemerkt, dass die lehnrechtliche Interpretation von beneficium das Problem nicht löste. Der umstrittene, von Hadrian geklärte Begriff begegnet nämlich an entscheidender Stelle in den „Gesta Frederici“, in deren letzten auf Otto von Freising zurückgehenden Teilen, vermutlich in unmittelbarer Reaktion auf den beneficiumStreit von Besançon. Otto von Freising stellte seiner Schilderung von Barbarossas Kaiserkrönung einen Bericht über die römische Gesandtschaft voraus, die dem Staufer die Kaiserkrone anbot. Und er legt dem Staufer eine zornige Rede in den Mund. Gegen den Anspruch der Römer, das Kaisertum zu vergeben, setzt Barbarossa das Recht des Eroberers. Seit den Tagen Karls und Ottos des Großen seien seine Vorgänger die rechtmäßigen Herren Roms. Gott habe es so verfügt. Rom ist den beiden Kaisern „nicht durch die Verleihung durch irgendeinen übergeben, sondern durch Tapferkeit erobert worden“ (nullius beneficio traditam, sed virtute expugnatam […] Urbem). Barbarossas Rede gipfelt in der Feststellung „Ich bin dein rechtmäßiger Eigentümer“ (Legitimus possessor sum). Barbarossa weist hier aber nicht einen Anspruch der Römer zurück, Rom und das Imperium als Lehen zu vergeben, sondern 75
76
Zu seiner Rolle in der Politik Barbarossas Christian Uebach, Die Ratgeber Friedrich Barbarossas (1152–1167), Phil. Diss. Düsseldorf 2007, S. 118–157, zu Besançon S. 139–142 (benutzt in der elektronisch zugänglichen Ausgabe: http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:d e:hbz:061-20071031-135854-9; Druck: Marburg 2008); Peter Godman, Transmontani. Frederick Barbarossa, Rainald of Dassel, and Cultural Identity in the German Empire, in: Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 132, 2010, S. 200–229, bes. S. 201–210. Die Bischöfe aus dem deutschen Reichsteil, die Barbarossa beraten und Rainald widersprechen hätten können, fehlten, vgl. Godman, Transmontani (wie Anm. 75), S. 210, Anm. 57.
152
Ernst-Dieter Hehl
generell ihre Anmaßung, die kaiserliche Würde zu übertragen. Die Römer haben keine Verfügungsgewalt über das Kaisertum, es ist nullius beneficio an die karolingischen Herrscher und ihre Nachfolger gekommen.77 Diese Aussage galt in gleicher Weise gegenüber dem Papst und dessen Interpretation von beneficium als bonum factum. Bereits in seinem Brief an die deutschen Bischöfe, die zwischen Papst und Kaiser vermitteln wollten und die kaiserliche Erklärung nach Rom schickten, hat sich Barbarossa auf die Lehnsfrage nicht mehr eingelassen. Und wiederum findet sich an der zentralen Stelle der umstrittene Begriff: „Die schuldige Ehrfurcht erweisen wir gern unserem Vater, aber die freie Krone unseres Reiches schreiben wir allein göttlicher Verleihung zu“ (liberam imperii nostri coronam divino tantum beneficio ascribimus).78 Schon bald nach Besançon ist dem Kaiser und seinen Beratern offenbar klar geworden, dass die von Rainald in den Mittelpunkt gestellte Lehnsfrage für das eigentliche Problem nur zweitrangig war. Rainalds Deutung beneficium = „Lehen“ ist in den „Gesta Frederici“ chronologisch von zwei Erklärungen des Kaisers selbst eingerahmt, in denen beneficium eindeutig nicht als „Lehen“ zu verstehen ist. Beide Erklärungen korrespondieren einander: Dem weltlich-politischen Anspruch der Römer setzte Barbarossa entgegen, nullius beneficio seien das Imperium und Rom in seinen legitimen Besitz gelangt; gegenüber dem als geistlichen Vater angesprochenen Papst ließ er verlautbaren, das Imperium verdanke er divino tantum beneficio. Sowohl einen weltlich-politischen Anspruch als auch einen geistlich begründeten, das Imperium zu vergeben, wies Barbarossa zurück. In beiden Fällen ließ er erkennen, dass diese Ansprüche nicht lehnrechtlich begründet waren. Denn Barbarossa verwendete in seiner Zurückweisung den Begriff genau so, wie Hadrian ihn in seiner Augsburger Erklärung für das Schreiben von Besançon klargestellt hatte: beneficium ist ein bonum factum. Als solches ist es nicht einzufordern, wie es Barbarossas Äußerung über das divinum beneficium zeigt, das auf göttlicher Gnade beruht, die ihm zuteilgeworden ist. Barbarossa beanspruchte das Kaisertum kraft eigenen, von Gott verliehenen Rechts. Ebenso beanspruchte er Herrschaft in Rom. Das geht aus seinen letzten Verhandlungen mit Hadrian IV. hervor, die er 1159 einige Monate vor dessen Tod am 1. September führte. Denn nur diese Herrschaft gab ihm die Legitimation, als
77
78
Otto von Freising, Taten II, 32 (wie Anm. 2), S. 346–352, die Zitate S. 348, Z. 11 f. und 26 f. Vgl. Jürgen Petersohn, Kaisertum und Rom in spätsalischer und staufischer Zeit (MGH Schriften 62) Hannover 2010, S. 325 (zur Datierung der Niederschrift nach Besançon ebd., Anm. 27). Zum Eroberungsrecht Ernst-Dieter Hehl, Eroberung und Herrschaft im Denken des hohen Mittelalters, in: Markus Meumann/Jörg Rogge (Hgg.), Die besetzte res publica. Zum Verhältnis von ziviler Obrigkeit und militärischer Herrschaft in besetzten Gebieten vom Spätmittelalter bis zum 18. Jahrhundert (Herrschaft und soziale Systeme in der Frühen Neuzeit 3) Berlin 2006, S. 27–49, hier S. 33. Rahewin, Taten III, 20 (wie Anm. 2), S. 436, Z. 12–14. Vgl. Maccarrone, Papato (wie Anm. 3), S. 237 f. – Im Kontext des Konflikts wendet sich dieser beneficium-Begriff gegen die Vorstellung, Barbarossa verdanke seine herrschaftliche Stellung in Rom und Italien einer päpstlichen donatio (dazu oben bei Anm. 48).
Beneficium – wohlwollend interpretiert
153
wahrer römischer Kaiser seine Italienpolitik auf das römische Recht zu stützen.79 Die Ausrichtung der Italienpolitik am römischen Recht ist erst ein Kennzeichen des zweiten Italienzuges des Staufers.80 Der Hoftag von Besançon fällt in dessen Vorbereitungsphase. Als Hadrians Gesandte in Augsburg erscheinen, sind Rainald von Dassel und Otto von Wittelsbach bereits in Italien für den Kaiser tätig. Nachdem Hadrian in seinem Brief von Besançon Barbarossas Kaisertum mit der beneficium Formel an das Papsttum gebunden hatte, sah Rainald eine der rechtlichen Grundlagen des kommenden Italienzuges gefährdet, nämlich die Autonomie von Barbarossas römischem Kaisertum. Um dies den Fürsten zu verdeutlichen, hat er die lehnrechtliche Übersetzung gewählt. Für die Zurückweisung derartiger Ansprüche ließen sich die Fürsten und die Bischöfe des Reiches gewinnen. Die Bindungen an das Papsttum zu lösen, gelang jedoch nicht, denn diese waren in der von Hadrian in Augsburg nochmals klar gestellten Formel beneficium = bonum factum begründet. Hadrians massiver Protest gegen die Untätigkeit des Kaisers nach der Gefangennahme Eskils von Lund erinnerte nachdrücklich daran, dass der Kaiser das Wohlwollen, das der Papst bei der Kaiserkrönung gezeigt habe, durch eigenes Wohlverhalten zu beantworten habe. Das war ein anerkannter Grundsatz sozialen und politischen Verhaltens, jetzt aber in einer Zeit zunehmender Verrechtlichung vorgetragen. Ob Hadrian seinen Brief in derartiger Verrechtlichungstendenz geschrieben hat, muss offen bleiben. Öffentlich gemacht, waren die päpstlichen Aussagen und Forderungen jedoch geeignet, den geplanten Italienzug zu stören.81 Denn sie stellten die Grenzen kaiserlicher Handlungsmöglichkeiten heraus, sahen den Kaiser in einem herkömmlichen Sinne zu bestimmten Handlungen, hier dem Schutz der Kirche, moralisch verpflichtet. Der Italienzug sollte jedoch unter der rechtlichen Prämisse der Vollgewalt des autonomen römischen Kaisers stehen. Rainald hat aus diesen Gründen einer verrechtlichten Interpretation von Hadrians Brief vorbauen wollen, indem er selbst eine solche in lehnrechtlicher Form vornahm. Dass Derar79
80 81
Böhmer/Opll (wie Anm. 6), IV, 2, 2: 1158–1168, neubearbeitet von Ferdinand Opll, Wien/Köln 1991, Nr. 723; Rahewin, Taten IV, 34–36 (wie Anm. 2), S. 584–591 (besonders die Erklärung Barbarossas IV, 35, S. 588, Z. 18–21). Petersohn, Kaisertum (wie Anm. 77), S. 312, spricht von der „notwendigen und untrennbaren Zusammengehörigkeit von Romhoheit und Kaiserwürde.“ Zu den Verhandlungen mit Hadrian Hehl, Papsttum (wie Anm. 1), S. 22; Jochen Johrendt, Barbarossa, das Kaisertum und Rom, in: Burkhardt u. a., Staufisches Kaisertum (wie Anm. 66), S. 75–107, hier S. 89–92 zu sich erneut aufbauenden Spannungen zwischen Papst und Kaiser, der auch mit Gesandten der römischen Kurie (Böhmer/Opll, Nr. 723, 738 f., 745) im Gespräch war. Johrendt nennt als politische Ziele Barbarossas: „eine Gleichbehandlung Roms mit den anderen Kommunen Italiens, eine Eingliederung der urbs und die Normalisierung ihrer Stellung im Reich“, was „aufgrund der besonderen Stellung des römischen Bischofs in der Stadt besondere Lösungen erforderte“ (S. 90). Gerhard Dilcher, Die staufische Renovatio im Spannungsfeld von traditionalem und neuem Denken, in: HZ 276, 2003, S. 613–646. Görich, Ehre Barbarossas (wie Anm. 15), S. 369, spricht von Interessenkonflikten, „die aus ihrer Latenz traten, als sie von der Dialektik der Anerkennung erfaßt wurden, die der Ehre entsprang“. Die Beschreibung der Positionen mit rechtlich auslegbaren Begriffen, wie sie Rainalds Übersetzung auslöste, gehört zu diesem Prozess.
154
Ernst-Dieter Hehl
tiges im Reich auf Empörung und Zurückweisung stieß, dessen konnte er sich gewiss sein. Noch in Besançon, in der anscheinend patzigen Frage eines der Legaten „Von wem hat er es denn, wenn er das Kaisertum nicht vom Papst hat?“, wurde deutlich, dass das eigentliche Problem nicht in der Verrechtlichung des beneficium zum feudum lag, sondern in einer verrechtlichten Auslegung des beneficium als bonum factum. Aber nachdem der Eklat aus dem Streit über die lehnrechtliche Interpretation erwachsen war, konnte Hadrian nur zu einer Klarstellung dieses Punktes aufgefordert werden, wie es im Schreiben der deutschen Bischöfe geschah. Das zu tun, fiel Hadrian leicht, hatte er doch solches nie behauptet. Auf die kaiserlichen Erklärungen, wie dieses beneficium/bonum factum im Einzelnen zu verstehen sei, mussten Hadrian und die Kurie nicht reagieren und taten es auch nicht. Die Kaiserkrönung blieb ein nicht erzwingbares bonum factum des Papstes. Von einem Einlenken Hadrians in Augsburg kann man nicht sprechen. Barbarossa hingegen trat seinen Italienzug an, ohne eine vom Papst anerkannte Klärung, wie sein Kaisertum zu verstehen sei, erreicht zu haben. Politisch blieb das Papsttum ein Bezugspunkt für diejenigen, die das anders sahen als der kaiserliche Hof. Das Bündnis zwischen Alexander III. und den oberitalienischen Städten konnte das nutzen. Eine philologische Interpretation war die Leitlinie der vorstehenden Überlegungen.82 Die Art und Weise, wie Rahewin berichtet, vor allem seine Kommentare zu Dokumentation und Übersetzung, die außerhalb des Lehnrechts liegenden Hintergründe mancher Formulierung wiesen die Spur. Am Schluss soll eine philologische Zusammenfassung stehen: Das umstrittene beneficium von Besançon ist mit „Wohltat“ zu übersetzen; im Sinne der Zeit ist diese Übersetzung eine „wohlwollende“, eine harmlose und belanglose ist sie deshalb nicht. Erinnerung und Erinnerungswege scheinen für diese Interpretation keine Rolle zu spielen. Rahewins Dokumente sollten verhindern, dass die Geschehnisse aus der Erinnerung heraus interpretiert wurden. Er trennt Dokumentation von Erinnerung. Die zuspitzende Frage des Legaten kennt er nur vom Hörensagen, wie er selbst schreibt. Hier ist er auf Erinnerung anderer angewiesen. Und ebenso auf Erinnerungen, jetzt des Kaisers und anderer, beruht das, was man in Besançon über das ominöse Laterangemälde und seine Inschrift zu wissen glaubt. Diese Erinnerung führt auf dem Hoftag zu der stricta expositio des Hadrianbriefes, die Rahewin für sachlich falsch hält.83 So interpretiert nicht allein Philologie, sondern auch Erinnerung 82 83
Auf die philologischen Ergebnisse von Ulrich Schludi zu filius specialis (siehe oben bei Anm. 66–70) ist nochmals hinzuweisen. Bei dem ersten Zusammentreffen von Barbarossa und Hadrian in Sutri (Böhmer/Opll [wie Anm. 6], Nr. 313 f.) hatte man den Konflikt und die Missverständnisse zum Empfangszeremoniell lösen können, indem man auch auf die Erinnerung der Fürsten an das Treffen von Lothar III. und Innozenz II. in Lüttich 1131 zurückgriff und dessen lehnsrechtliche Natur verneinte. Auch hier hat sich die neuere Forschung zunehmend von der Interpretation entfernt, ein versteckter lehnsrechtlicher Vorstoß des Papstes habe den Konflikt ausgelöst. Vgl. Achim Thomas Hack, Das Empfangszeremoniell bei mittelalterlichen Papst-Kaisertreffen (Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters. Beihefte zu J. F. Böhmer, Regesta Imperii 18) Köln/Weimar/Wien 1999, S. 515–540; Sebastian Scholz, Symbolik und Zeremoniell bei den Päpsten in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts, in: Stefan Weinfurter (Hg.), Stauferreich im
Beneficium – wohlwollend interpretiert
155
das Dokument. Rahewin erkannte und beschrieb den Übergang von einer philologischen, an Sprache und Intention des Absenders orientierten Übersetzung zu einer Interpretation, die ihre Deutungsmuster aus den Erinnerungen der Empfänger gewann. Gleichzeitig gewann diese Interpretation, auch weil sie einem aktuellen Dokument galt, einen prinzipiellen Charakter und deshalb konnte sie nur durch ein weiteres Schriftstück aus der Welt geschafft werden. Die Erinnerungsmuster – nicht der Wortlaut der Hadrianbriefe – haben dann die deutschsprachige Forschung in Fragestellung und Wertung bis in die jüngste Zeit mitbestimmt, sofern sie der „provokanten“ Übersetzung Rainalds gefolgt ist.84 ANHÄNGE I. Die Dokumentation Rahewins Als Dokumentation angekündigt (III, 10; hg. von Schmale [wie Anm. 2], S. 410, Z. 9–15): 1. Der Protestbrief Hadrians = Rahewin, Taten III, 11 (S. 410–415), der auf dem Reichstag einen Tumult auslöst, geschildert in III, 12 (S. 414–119). Übersetzungsvermerk Rahewins: fida satis/nimis interpretatione (III, 12, S. 414, Z. 20 f.). 2. Ein von Barbarossa im Reich verbreiteter Brief über die Vorfälle von Besançon = Rahewin, Taten III, 13 (S. 418–421). Als Dokumentation angekündigt (III, 19, S. 430, Z. 17–23): 3. Ein Brief Hadrians an die deutschen Bischöfe mit einer Beschwerde über die Behandlung seiner Legaten in Besançon, was wiedergutzumachen sei = Rahewin, Taten III, 19 (S. 430–435). 4. Die Antwort der Bischöfe an den Papst, in die eine Stellungnahme Barbarossas zu dem Streitfall aufgenommen ist = Rahewin, Taten III, 20 (S. 435–439). Ohne Ankündigung als Dokumentation: 5. Ein erneuter Brief Hadrians an Barbarossa, den eine päpstliche Legation auf dem Reichstag zu Augsburg im Juni 1158 überreicht = Rahewin, Taten III, 26 (S. 448– 453). In diesem Brief wird das päpstliche Schreiben von Besançon zu aller Zufriedenheit interpretiert. Übersetzungsvermerk Rahewins: benigna interpretatione (III, 27, S. 452, Z. 13).
84
Wandel. Ordnungsvorstellungen und Politik in der Zeit Friedrichs Barbarossa (Mittelalter-Forschungen 9) Stuttgart 2002, S. 131–148, hier S. 131–140; Roman Deutinger, Sutri 1155. Mißverständnisse um ein Mißverständnis, in: DA 60, 2004, S. 97–133; Görich, Barbarossa (wie Anm. 15), S. 241–246. Vgl. die Kennzeichnung der Übersetzung Rainalds bei Ehlers, Otto von Freising (wie Anm. 2), S. 164 (S. 227: „polemische Übersetzung“).
156
Ernst-Dieter Hehl
II. Rahewin zur Übernahme von Dokumenten in sein Werk Zur Übernahme der ersten Schreiben zu Besançon (III, 10, hg. von Schmale [wie Anm. 2], lat. S. 410, Z. 10–15; dt. S. 411, Z. 11–16): „Dieses [= Brief Hadrians in III, 11] sowie die Abschrift eines anderen [= Rundschreiben Barbarossas in III, 13], das in dieser Zeit der Verwirrung überall kursierte, habe ich diesem Werk eingefügt, damit jeder Leser, der sich einer Partei zuneigen möchte, nicht durch meine Worte und Behauptungen, sondern durch die eigenen Schreiben der Parteien selbst angezogen und gelockt, frei wählen kann, welcher Partei er seine Gunst zuwenden will.“
Zum erneuten Brief Hadrians und dem Schreiben der Bischöfe (III, 19, hg. von Schmale [wie Anm. 2], lat. S. 430, Z. 17–23; dt. S. 431, Z. 21–30): „Deshalb wollen wir bei der Darstellung dieser stürmischen Vorgänge, wie wir schon oben [= III, 10] sagten, nicht, daß sich der Leser auf unsere Worte stütze; wir werden vielmehr die Briefe hersetzen, die von dieser und von jener Seite geschrieben worden sind, damit der Leser aus ihnen entnehmen kann, welcher Partei er sich anschließen oder wem er treu bleiben will. Für uns aber bitten wir um Nachsicht, denn wir verehren beide Personen, die priesterliche wie die königliche, mit der schuldigen Ehrfurcht zu sehr, als daß wir uns anmaßen könnten, leichtfertig die eine oder andere zu verurteilen.“
III, 25 vor dem Brief nach Augsburg fehlt ein entsprechender Vermerk. Zum Schisma von 1159 (IV, 59, hg. von Schmale [wie Anm. 2], lat. S. 620, Z. 28 – S. 622, Z. 3; dt. S. 621, Z. 32 – S. 623, Z. 4): „In dieser Angelegenheit möchten wir nun den Leser mahnen, den wirklichen Verlauf dieses Ereignisses nicht nach dem, was wir sagen oder schreiben, zu ermessen, sondern darüber, wer richtiger handelte und sozusagen mit größerem Recht die Waffen anlegte, durch Vergleichung sämtlicher Schriftstücke, die von allen Seiten zusammenliefen, nach eigenem Urteil die Entscheidung zu treffen. Denn wenn wir die Sache einer Partei entweder lobend erhöben oder verkleinerten, würden wir offensichtlich von unserem Vorsatz abweichen, und sicherlich wäre der übrige Körper der Geschichte nicht gesund, wenn gerade diesen Teil, gleichsam das wichtigste Glied, die Krankheit persönlicher Begünstigung befallen hätte.“
In den folgenden Kapiteln (IV, 60–66) stehen die Rundschreiben Viktors IV. und Alexanders III., der jeweiligen Wähler, die Vorladung Alexanders III. zum Konzil von Pavia durch Barbarossa sowie die allgemeine Konzilseinladung.
„… DA WAR ICH AUCH DABEI“. Erinnerungskritische Fragen an Joinvilles „Vie de saint Louis“ Carola Föller Augenzeugenberichte gelten unter Mediävisten bekanntermaßen als seltener Glücksfall. Ihnen wird im Kreis der zur Verfügung stehenden Quellen stets ein besonders hoher Stellenwert eingeräumt – zu plausibel erscheint die Annahme, dass die unmittelbare Erfahrung eines Ereignisses oder die persönliche Bekanntschaft mit einer Person eine höhere ‚Glaubwürdigkeit‘ besitzt als das vom Hörensagen Niedergeschriebene weltferner Mönche. Die Beschreibungen erscheinen häufig zudem unmittelbarer, schärfer konturiert und damit realitätsnäher. Dies gilt auch für die „Vie de saint Louis“ des Seneschalls der Champagne, Jean de Joinville. Gegen all die von Geistlichen verfassten Viten Ludwigs des Heiligen erscheint die „Vie de saint Louis“ ein geradezu lebensnahes Bild des Heiligen und seines Kreuzzugs zu zeichnen, was sich auch an der Bewertung der modernen Forschung erkennen lässt: Es werden sowohl die literarische Finesse und Innovativität als auch die Farbenfreude der Beschreibung und der Detailreichtum in Belangen gewürdigt, zu denen andere Quellen schweigen.1 Einen besonders wirkmächtigen und folgenreichen Umgang mit dem Text zeigt der französische Mediävist Jacques Le Goff in seiner vielbeachteten Biographie des französischen Königs Ludwig IX.: Da er der Meinung ist, durch die Augen Joinvilles den „wahren Ludwig“ zu erkennen, stützt er wesentliche Teile seiner Biographie des Heiligen auf Joinvilles Werk.2 Seine Einschätzung von Joinville als „glaubwürdige[m] Zeuge[n]“ begründet er mit vier Argumenten: der Augenzeugenschaft, der Zuverlässigkeit von Joinvilles’ Informanten (die ebenfalls Augenzeugen waren), seinem Stand als Laie, der sich auch im Bruch mit literarischen Traditionen niederschlage, und den hervorragenden Gedächtnisleistungen oraler Gesellschaf1
2
Einen guten Forschungsüberblick bietet Brigitte Stark, „La vie de saint Louis“ von Jean de Joinville, in: Andreas Speer/David Wirmer (Hgg.), 1308. Eine Topographie historischer Gleichzeitigkeit (Miscellanea Mediaevalia 35) Berlin/New York 2010, S. 237–266, S. 246–248. Zur literarischen Funktion der ‚Wahrheitsbezeugung‘ durch Augenzeugenschaft bei Joinville jüngst Michael Schwarze, „Ce que je vi et oy“. Augen- und Ohrenzeugenschaft in Joinvilles Vie de saint Louis, in: Amelie Rösinger/Gabriela Signori (Hgg.), Die Figur des Augenzeugen. Geschichte und Wahrheit im fächer- und epochenübergreifenden Vergleich, Konstanz/München 2014, S. 61–74. Jacques Le Goff, Saint Louis (Bibliothèque des histoires) Paris 1996, das Kap. zu Joinvilles „Vie de saint Louis“ heißt: „Le ‚vrai‘ Louis IX de Joinville“; dt.: ders., Ludwig der Heilige, Stuttgart 2000.
158
Carola Föller
ten, insbesondere aber dem „affektive[n]“ und „audio-visuelle[n]“ Gedächtnis Joinvilles.3 Eine so deutlich formulierte, radikale Einschätzung des Textes fordert Widerspruch heraus. So reagiert der Literaturwissenschaftler Christopher Lucken einige Jahre nach dem Erscheinen von Le Goffs Biographie mit einem Beitrag, in dem er zeitgenössische literarische Vorlagen für Joinvilles Darstellung der Landung des Kreuzfahrerheeres vor Damiette zeigen kann – und in der Kompositionsgrundlage der Kreuzzugsbeschreibung die Imitation der Passion Christi.4 Daneben sind auch der hagiographische Impetus des Werkes und damit die Übernahme von gattungsspezifischen Eigenheiten häufig herausgestellt worden. Bereits 1978 (also deutlich vor dem Erscheinen der Biographie von Le Goff 1996) hat Michel Zink herausgearbeitet, dass Joinville sich in der Darstellung des um seinen Bruder Robert von Artois trauernden Königs an die Totenklage Bernhards von Clairvaux in seinem Hoheliedkommentar anlehnt.5 Joinvilles „Vie de saint Louis“ wurde also, wenn nicht absichtsvoll, so doch aus narrativer Tradition heraus, von Erzählmustern mittelalterlicher Traditionen beeinflusst. I. ERINNERUNGSKRITISCHE FRAGESTELLUNG. DIE ‚ABRUFSITUATIONEN‘ Doch – so lernen wir Historikerinnen und Historiker von Johannes Fried – nicht nur gelernte Erzählmuster beeinflussen die Wiedergabe von Erlebtem oder Geschehenem, sondern auch die gegenwärtige Situation des Erinnerns. Jedes Erinnern verändert potentiell die Erinnerung, denn Ereignisse werden nicht unveränderlich im Gehirn gespeichert, sondern in einem kognitiven Prozess bei jedem Erinnern neu modelliert. Fried nennt diese Erinnerungsmomente „Abrufsituationen“.6 Diese Abrufsituationen formen letztlich, ebenso wie intentionale Manipulationen und literarische Traditionen, die Erzählung, weshalb es lohnenswert erscheint, sich mit ihnen zu beschäftigen. So soll die Frage nach diesen Abrufsituationen und ihren Folgen für die Erzählung Joinvilles im Zentrum dieses Aufsatzes stehen. Dies 3 4
5 6
Vgl. Le Goff, Ludwig (wie Anm. 2), S. 417–421, Zitate: S. 420 f. Christopher Lucken, L’Évangile du roi. Joinville, témoin et auteur de la Vie de saint Louis, in: Annales. Histoire, Sciences sociales 56, 2001, S. 445–467. Dagegen wieder Jacques Le Goff, Mon ami le saint roi. Joinville et saint Louis (réponse), in: Annales. Histoire, Sciences sociales 56, 2001, S. 469–477. Ebenfalls skeptisch, aber kürzer auch Franck Collard, Quand l’apologie nourrit le réquisitoire. Une lecture en négatif des Mémoires de Joinville, in: Danielle Quéruel (Hg.), Jean de Joinville. De la Champagne aux royaumes dʼoutre mer (Hommes et Textes en Champagne) Langres 1998, S. 131–142. Michel Zink, Joinville ne pleure pas mais il rêve, in: Poétique. Revue de théorie et d’analyse littéraires 33, 1978, S. 28–45. Le Goff, Ludwig (wie Anm. 2), S. 419, sieht dies als Beleg für Joinvilles Bildung. Ausführlich zuerst Johannes Fried, Der Schleier der Erinnerung. Grundzüge einer historischen Memorik, München 2004, überarbeitet und erweitert: (Beck’sche Reihe 6022) ebd. 2012. Zum „Gedächtnis als konstruktive[m] Prozess“ vgl. ebd., S. 135–139.
„… da war ich auch dabei“.
159
eröffnet zwei Erkenntnismöglichkeiten: Zum einen kann so ein weiterer Schritt in der alten, aber dennoch wichtigen Frage der ‚Zuverlässigkeit‘ beziehungsweise des ‚Realitätsbezugs‘ des Werkes unternommen und zum anderen ein Beitrag zu den Forschungen um die Entstehungsbedingungen von Texten vor der Niederschrift beigesteuert werden. Für die Frage nach den Abrufsituationen vor der Niederschrift ist die Datierung des Textes von herausragendem Interesse, denn sie verweist auf den zeitlichen Rahmen zwischen erlebtem Geschehen und der Niederschrift. Joinville selbst datiert die Vollendung seines Werkes auf den Oktober 13097, der somit als terminus ante quem dienen kann. Auftraggeberin der Schrift war die französische Königin Johanna I. von Navarra, die 1305 starb. Daraus ergibt sich ein Abfassungszeitraum von mindestens vier Jahren im ersten Jahrzehnt des 14. Jahrhunderts, der von der modernen Forschung angenommen wird. Im ausgehenden 19. Jahrhundert nahm Gaston Paris hingegen an, Joinville habe bereits kurz nach dem Tod Ludwigs des Heiligen 1270 begonnen, seine Erlebnisse des Kreuzzugs niederzuschreiben und damit zunächst eigentlich eine Kreuzzugsgeschichte verfasst (in der Edition von Monfrin die §§ 110–666). Diese habe er dann später, als er auf Bitten Johannas von Navarra die Vita verfasste, mit den vorausgehenden und folgenden Kapiteln umrahmt. Das frühe Datum der Kreuzzugsgeschichte begründet Paris mit den angeblich präziser erinnerten Erzählungen des mittleren Teils.8 Dazu trete zum einen, dass 1272 oder 1273 der älteste Sohn Joinvilles in die Familie des berühmten Kreuzzugschronisten Villehardouin (um 1160–1213) einheiratete, zum anderen habe der Tod Ludwigs Joinville Anlass zur Abfassung gegeben. Außerdem fehle in diesen Teilen das Attribut „heilig“.9 Jacques Monfrin hat jüngst Paris’ Argumente überzeugend widerlegt: Er weist mehrere Stellen nach, in denen auch im mittleren Teil von Ludwig als Heiligem gesprochen wird. Die Verbindungen zur Familie Gottfrieds von Villehardouin hätten schon länger als die Ehe bestanden, so dass dies wohl auch keinen stichhaltigen Anlass biete.10 Die angenommene Nähe der Niederschrift zum Ereignis (allerdings handelt es sich hierbei auch um gut 20 Jahre) kann überdies als eine letztlich nicht begründete Einschätzung gelten, die auf den
7
8
9 10
Diese Datierung ist zwar lediglich in einer Handschrift aus dem 14. Jahrhundert vorhanden (Paris, BnF, Ms. fr. 13568, fol. 390v–391r). Dass damit allerdings ausschließlich diese (oder die Vorlage dieser) Handschrift datiert wurde, erscheint eher unwahrscheinlich, da das Manuskript später datiert (Jean de Joinville, Vie de saint Louis, hg. von Jacques Monfrin [Textes littéraires du Moyen Age 12] Paris 2010, S. LXVI; vgl. auch Stark, La vie [wie Anm. 1]), S. 245, die allerdings etwas zweideutig von einer „Brüsseler Handschrift“ spricht – die Pariser BnF, Ms. fr. 13568 wird allerdings wegen ihrer Provenienz so genannt). Auf jeden Fall bleibt aber damit der terminus ante quem erhalten. Letztlich ist dies ein indirektes Argument: Der mittlere Teil soll der älteste sein, da in den anderen beiden Joinville Erinnerungen durcheinanderbringe und diese ungenauer seien. Gaston Paris, La composition du livre de Joinville sur saint Louis, in: Romania 23, 1894, S. 508–524, S. 510. Vgl. auch Jean de Joinville, Vie (wie Anm. 7), S. LXIX. Paris, La composition (wie Anm. 8), S. 510 ff.; vgl. auch Stark, La vie (wie Anm. 1), S. 246. Vgl. Jean de Joinville, Vie (wie Anm. 7), S. LXIXf.
160
Carola Föller
optimistischen Annahmen über Gedächtnisleistungen aus dem ausgehenden 19. Jahrhundert beruht. II. MÖGLICHE ABRUFSITUATION VOR DER NIEDERSCHRIFT. DER KANONISATIONSPROZESS VON 1282–1285 1. Die Quellen Die Frage nach Abrufsituationen, die vor über 700 Jahren stattgefunden haben, ist natürlich nicht abschließend zu beantworten. Doch im Falle der Erinnerungen des Seneschalls gibt es zumindest eine Abrufsituation, von der wir wissen: Joinvilles Teilnahme an der Zeugenbefragung im Zuge des Kanonisationsverfahrens Ludwigs IX. Dieses fand in den Jahren 1282–1285 im Kloster Saint-Denis statt und umfasste die Befragung aller wichtigen Zeugen, unter ihnen auch der Sohn und Nachfolger des Königs, Philipp III., der „Kühne“.11 Leider sind die Akten dieses Prozesses fast vollständig verlorengegangen, so dass kein direktes Zeugnis von Joinvilles Befragung erhalten ist. Es kann also kein Vergleich zwischen zwei Erinnerungen Joinvilles stattfinden.12 Lediglich zwei Quellen sind erhalten, die in einem etwas größeren Umfang Auskunft über die Aussagen des Kanonisationsprozesses geben können: Zum einen die Vita Ludwigs des Guillaume de Saint-Pathus, zum anderen die Fragmente der Aussagen Karls von Anjou. Der Beichtvater der Königin Margarethe von Provence, der Franziskanermönch Guillaume de Saint-Pathus, verfasste 1302/03 im Auftrag von Ludwigs Tochter Blanche von Kastilien ebenfalls eine Vita Ludwigs, die nach eigener Aussage unter 11
12
Ausführlich zum Kanonisationsprozess Louis Carolus-Barré, Le procès de canonisation de saint Louis, 1272–1297. Essai de reconstitution (Collection de l’Ecole française de Rome 195) Rom 1994, S. 17–23. Der Titel des Buches verspricht etwas zu viel: Die sogenannte „reconstitution“ erschöpft sich in der Wiedergabe der möglichen Aussagen, überwiegend übernommen aus der „Vie de saint Louis“ des Guillaume de Saint-Pathus, der bei der Abfassung auf die Kanonisationsdokumente zurückgegriffen hat. Hinzu kommen kurze Lebensläufe der Zeugen und Überlegungen zu ihrer möglichen Bedeutung im Kanonisationsprozess. Im Fall von Joinville treten zu Guillaume de Saint-Pathus noch die Aussagen der „Vie de saint Louis“ des Seneschalls hinzu, die Carolus-Barré ergänzend zu den Aussagen Guillaumes nutzt. Diskrepanzen werden nicht angesprochen. Leitfaden für die Auswahl der präsentierten Zeugnisse sind hier weniger die möglichen Themen eines Kanonisationsprozesses als die Übereinstimmung der beiden Texte – die Annahme ist also, dass wenn über dieselben Vorkommnisse berichtet wird, diese Teil des Kanonisationsprozesses sein müssen. Wie Johannes Fried es so anschaulich im Falle der Erinnerungen Karl Löwiths zeigt, vgl. Fried, Schleier (wie Anm. 6), S. 32–35. In Joinvilles „Vie de saint Louis“ ist uns nur ein einziger Hinweis erhalten, in dem er behauptet, er habe im Kanonisationsprozess davon berichtet, dass Ludwig es abgelehnt habe, die „Sarazenen“ um 10.000 Pfund zu betrügen und damit den Vertrag habe halten wollen, den er nur „durch [s]ein einfaches Wort versprochen hatte“, Jean de Joinville, Vie (wie Anm. 7), S. 376: par sa simple parole, Übersetzung: Eugen Mayser, Das Leben des heiligen Ludwig. Die Vita des Joinville, Düsseldorf 1969, S. 285.
„… da war ich auch dabei“.
161
anderem auf den Prozessdokumenten des Kanonisationsprozesses beruht.13 In jüngster Zeit konnte Anja Rathmann-Lutz aber entgegen der gängigen Überzeugung, der Text sei lediglich eine Sammlung der Zeugenaussagen, aufzeigen, dass Guillaume ihn ausgesprochen eigenständig komponiert hat: Er überarbeite zum einen die nicht erhaltene „Vita per curiam approbata“, zum anderen sei die Geschlossenheit des Werkes und die durch Guillaume vorgenommene Strukturierung Zeichen von Originalität. Außerdem seien die Erinnerungen von Margarethe und Blanche, die nicht beim Prozess ausgesagt hatten, in das Werk eingeflossen.14 Dem könnte man noch hinzufügen, dass bereits der Editor des Textes, Henri Delaborde, anhand eines Vergleichs mit den Zeugenaussagen von Karl von Anjou Abweichungen gegenüber der Vita des Guillaume de Saint-Pathus aufgezeigt hat.15 Tatsächlich nennt Guillaume nur in äußerst seltenen Fällen zu konkreten Stellen seine Quellen, so dass nur eine einzige Aussage über Joinville auf den Kanonisationsprozess zurückgeführt werden könnte, die zudem noch recht allgemein ist: Joinville habe unter Eid ausgesagt, er habe nie vernommen, dass der König etwas Schlechtes oder Verleumderisches über andere gesagt habe – er habe nie einen so vollkommenen Menschen wie den König getroffen und er sei sicher, dass sich dieser nun im Paradies befinde.16 Allerdings sind durch eine Zufallsüberlieferung Fragmente der Aussage des Bruders des Königs, Karl von Anjou, erhalten, der seine Angaben nicht, wie die anderen Zeugen, in Saint-Denis zu Protokoll gab, sondern durch Kardinal Caetani, den späteren Papst Bonifatius VIII., in Neapel befragt wurde.17 Da Karl sich in den Fragmenten zu Ereignissen des Kreuzzugs äußert, bietet es sich an, diese heranzu13 14 15 16 17
Vie de saint Louis par Guillaume de Saint-Pathus, hg. von Henri-François Delaborde (Collection de textes pour servir à l’étude et à l’enseignement de l’histoire 27) Paris 1899. Die Aussagen zu den Kanonisationsdokumenten befinden sich auf S. 3–5. Anja Rathmann-Lutz, „Images“ Ludwigs des Heiligen im Kontext dynastischer Konflikte des 14. und 15. Jahrhunderts (Orbis mediaevalis. Vorstellungswelten des Mittelalters 12) Berlin 2010, S. 45 f. Vgl. Vie de saint Louis par Guillaume de Saint-Pathus (wie Anm. 13), S. 14, Nr. 3; S. 15, Nr. 1. Ebd., S. 133; Carolus-Barré, Le procès (wie Anm. 11), S. 95. Karl von Anjou, Zeugenaussage im Kanonisationsprozess, hg. von Paul Riant, Déposition de Charles d’Anjou pour la canonisation de saint Louis, in: Charles Jourdain (Hg.), Notices et documents publiés pour la Société de l’histoire de France à l’occasion du 50ième anniversaire de sa fondation, Paris 1884, S. 155–176, S. 162 f., Edition der Fragmente: S. 170–176; (unvollständige) frz. Übersetzung: ebd. S. 164–169; ergänzt: Carolus-Barré, Le procès (wie Anm. 11), S. 68–76; engl. Übersetzung: Peter Jackson, The Seventh Crusade, 1244–1254. Sources and Documents (Crusade Texts in Translation 16) Aldershot u. a. 2009, S. 115–120. Die Handschrift hat die Signatur Vat. Reg. lat. 547, fol. 108a–112a (14. Jh.). Es handelt sich um Auszüge aus dem „Liber bellorum Domini“, einer Kompilation des Pierre de la Palu. Zum Manuskript (inkl. der Edition des Inhaltsverzeichnisses): Paul Riant/Ignazio Giorgi, Description du Liber bellorum Domini. Rome, Vatican, Reg. Christ. 547, in: Archives de l’Orient Latin 1, 1881, S. 289–322. Zur Zuordnung zu Pierre de la Palu: Paul Fournier, Pierre de la Palu, théologien et canoniste, in: Histoire litteraire de la France 37, 1938, S. 39–84, S. 80–82. Die Zuordnung der Fragmente ergibt sich aus einer kenntnisreichen Glosse, ebenfalls des 14. Jh., die die Fragmente markiert. Dass es sich um den Prozess von 1282–1285 gehandelt haben muss, ergibt sich aus dem Todesdatum Karls (7. Januar 1285) und der Ernennung des durchführenden Benedetto
162
Carola Föller
ziehen und mit den Schilderungen des Jean de Joinville in der „Vie de saint Louis“ zu vergleichen, um einen Eindruck von den Befragungen, die vermutlich eine bedeutende Abrufsituation für Joinville waren, zu gewinnen. Ziel des Vergleichs ist nicht etwa die Frage nach einem direkten „Realitätsbezug“ der geschilderten Erlebnisse, sondern Ziele und Bedingungen in der konkreten Erinnerungssituation im Kanonisationsprozess zu identifizieren. Dass die Fragmente der Aussage Karls nicht direkt die zu Protokoll gegebenen Worte des Königs von Neapel übermitteln, da sie sicherlich im Verlauf des Prozesses überarbeitet wurden (sie wurden wohl zumindest ins Lateinische übersetzt und in die dritte Person Singular übertragen), ist für diese Frage deswegen auch weitgehend unproblematisch, da sie durch die Bearbeitung auch nur die Erkenntnisinteressen der am Prozess beteiligten verstärkt zeigen. Dabei gehe ich chronologisch vor, den Fragmenten der Aussage Karls folgend. 2. Die Krankheit des Königs Sowohl Karl von Anjou als auch Jean de Joinville berichten von der Seuche, die im Lager der Kreuzfahrer ausgebrochen war. Karl gibt zu Protokoll: „Sie litten an den Zähnen und am Zahnfleisch, und am Durchfall, und an den Unterschenkeln und Waden entwickelten sie schwarze Flecken. Zwei Tage bevor wir von Mansorra aufbrachen, erlag der König dieser Krankheit völlig.“18 Joinville beschreibt die Szenerie zwei Mal: zum ersten in der Chronologie des Kreuzzugs: „Und diese Krankheit […] war so, daß das Fleisch an unseren Beinen ganz verdorrte und ihre Haut schwarze und erdbraune Flecken bekam wie eine alte Gamasche. Wen von uns diese Seuche befiel, dem verfaulte das Zahnfleisch. Keiner blieb verschont, es war eine tödliche Krankheit; wenn die Nase anfing zu bluten, so kündete sich der Tod an.“19 Erst etwas später, als er vom Aufbruch von Mansura nach Damiette berichtet, erwähnt er dann die Erkrankung des Königs: „der König, der an der Lagerseuche und an einer überaus heftigen Ruhr litt.“20 Zum zweiten findet die Erkrankung des Königs im ersten Teil des Werkes, in dem Joinville von den Tugenden des Königs
18
19
20
Caetani (späterer Bonifatius VIII.) zum Kardinal (12. April 1281), vgl. Karl von Anjou, Zeugenaussage, S. 161–163. Karl von Anjou, Zeugenaussage (wie Anm. 17), S. 170: Patiebantur autem in dentibus et gigivis, et fluxum ventris, et habebant infirmi in tibiis vel cruribus aliquam plateam nigram. Per duos autem dies antequam recederent de Macorra, rex cepit illo morbo quoad omnia laborare. Die Wiedergabe berücksichtigt die Übersetzung von Jackson, Crusade (wie Anm. 17), S. 115. Jean de Joinville, Vie (wie Anm. 7), S. 144: la maladie de l’ost, qui estoit tele que la char de nos jambes sechoit toute, et le cuir de nos jambes devenoient tavelés de noir et de terre aussi comme uni vielz heuse; et a nous, qui avions tele maladie, venoit char pourrie es gencives, ne nulz ne eschapoit de celle maladie que mourir ne l’en couvenist. Le signe de la mort estoit tel que la ou le nez seignoit il couvenoit morir. Übersetzung: Mayser, Leben (wie Anm. 12), S. 147. Jean de Joinville, Vie (wie Anm. 7), S. 150: le roy, qui avoit la maladie de l’ost et menoison moult fort. Übersetzung: Mayser, Leben (wie Anm. 12), S. 151. Zu den Krankheiten bei Joinville vgl. auch Sylvie Bazin-Tacchella, Corps blessés et corps souffrants dans La vie de saint
„… da war ich auch dabei“.
163
berichtet, Erwähnung: „Er hatte die Malaria und dazu eine sehr schwere Ruhr; am Mund und an den Beinen war er von einer im Heer verbreiteten Krankheit befallen.“21 Die Krankheit wird also von beiden mit ähnlichen Symptomen, aber durchaus unterschiedlicher Wortwahl und in unterschiedlicher Reihenfolge der Symptome beschrieben, Joinville berichtet noch zusätzlich von Nasenbluten, das den Tod ankündige. Den Durchfall sieht er offensichtlich nicht als Symptom der Lagerseuche, sondern als zusätzliche Erkrankung des Königs an, ebenso wie die Malariaerkrankung. Diese Stelle lässt sich nur schwerlich für eine weitreichende Interpretation strapazieren – zu offensichtlich ist der Einwand, die Beschreibungen seien einfach eine faktengetreue Beobachtung der Symptome der sogenannten Lagerseuche. Dennoch ist auffällig, dass beide die Schwere des Leidens des Königs betonen; Karl spricht von quoad omnia laborare, Joinville erreicht dies durch die Addition der Krankheiten, deren eine, den Durchfall, er als moult fort bezeichnet. Diese Zuspitzung ist natürlich in der idealisierenden Anlage von Aussage und Vita begründet und läuft auf das Lobpreis des Königs hinaus: Karl berichtet im zweiten Teil des Fragments weiter, einige Ritter, die er sogar namentlich nennt22, und auch er selbst hätten dem König in dieser Situation geraten, sich auf ein Schiff in Sicherheit zu bringen, was der König nicht zugelassen habe, da er seine Leute nicht im Stich habe lassen wollen.23 Auch Joinville erzählt im Teil, der über die Tugenden des Königs berichtet, von beratenden Stimmen, die den König bedrängt hätten, sich aus der Gefahr herauszunehmen: Er gibt an, dass man ihm davon berichtet habe, dem König sei der Rat erteilt worden, mit einer Galeere nach Damiette aufzubrechen, damit er später die Gefangenen befreien könne und sich schone. In der Chronologie des Kreuzzugs verkürzt er die Ausführungen: Obwohl sich der König habe retten können, habe er sich doch geweigert, seine Leute zu verlassen.24 Die Erzählungen haben also die Gemeinsamkeit, Ludwig als tapferen, aufopferungsvollen König darzustellen, der die Gefahr des Todes nicht scheut, um auch – gegen den Rat von Vertrauten25 – seinen Leuten beizustehen. Ambivalent sind dagegen die Berichte des eigenen Verhaltens der Erzähler. Karl zitiert sein Bitten als einer der Ratgeber des Königs wörtlich: „Mein Herr, Ihr handelt falsch damit, den vernünftigen Rat der Freunde, an Bord zu gehen, nicht
21 22 23 24 25
Louis de Joinville, in: Quéruel, Jean de Joinville (wie Anm. 4), S. 175–192, die S. 187 die Akkuratesse in der Beschreibung als Beleg für Joinvilles Augenzeugenschaft wertet. Jean de Joinville, Vie (wie Anm. 7), S. 6: il avoit double tierceinne et menoisson moult fort et la maladie de l’ost en la bouche et es jambes. Übersetzung: Mayser, Leben (wie Anm. 12), S. 65. Es handelt sich um: Geoffrey de Sardines, Jean Fuinon, Jean de Valéry, P. de Baucay, Robert de Basoches und Gautier de Châtillon. Karl von Anjou, Zeugenaussage (wie Anm. 17), S. 171. Jean de Joinville, Vie (wie Anm. 7), S. 150–152. Lucken, Évangile (wie Anm. 4), S. 458–461, weist darauf hin, dass die vier Male, in denen Ludwig in der Aufzählung Joinvilles nur dem Tod entkommt, er jedes Mal gegen den Rat von Vertrauten handelt. Diese Stilisierung mache Ludwig zu einem „martyr potentiel“ (S. 460) und setze ihn mit Christus gleich, der sich opfere, um sein Volk zu erlösen.
164
Carola Föller
anzunehmen. Denn auf Euch zu warten, würde das Heer gefährlich verlangsamen und Ihr könntet der Grund für unser aller Tod sein.“ Der König habe darauf mit einem „finsterem Blick“ und dem Kommentar „Graf von Anjou, Graf von Anjou, wenn ich Euch eine Last bin, dann lasst mich hier‘, weil ich meine Leute (populus) nicht verlassen werde“, geantwortet.26 Karl aber hätte, so gibt er zu Protokoll, natürlich andere Motive gehabt: Er habe befürchtet, der König könne sterben und er habe ihn deswegen sicher in Damiette wissen wollen.27 Joinvilles Schilderung seines eigenen Verhaltens erscheint sogar noch unrühmlicher: Er habe sich bereits mit anderen zu Wasser befunden, als ihnen zugerufen worden sei, sie sollten auf den König warten – doch sie hätten sich geweigert und seien nur durch den Beschuss mit Bolzen aufgehalten worden.28 Hier wird bei beiden Erzählern das heiligenmäßige Handeln des Königs mit dem unzureichenden Verhalten seiner Vertrauten kontrastiert – nicht nur, dass sich Ludwig gegen den Rat aller anderen in Lebensgefahr begibt, die Erzähler selbst bieten sich als unrühmliche Folie an: Karl wirft dem König unvernünftiges strategisches Vorgehen vor, das alle (ihn selbst eingeschlossen) in Todesgefahr bringe. Er begründet diesen Vorwurf allerdings selbst mit seiner Sorge um den König; Joinville handelt sogar persönlich so, wie es dem König empfohlen wurde: er flieht, sogar obwohl er damit den König im Stich lässt. Direkt zuvor schildern beide die Situation, in der sich diese Episode abspielt. Aus Karls Aussage erkennt man den Strategen: Es sei der Befehl gegeben worden, dass die Schiffe das Ufer mit dem Heer schützen sollen, damit die Sarazenen29, die am gegenüberliegenden Ufer gelegen hätten, die Kreuzfahrer nicht von zwei Seiten umzingeln könnten. Umgekehrt habe das Heer die Schiffe schützen sollen – dieses Vorgehen aber habe die Fahrt verlangsamt. Die Kranken, die nicht auf den Schiffen untergebracht hätten werden können, hätten das Unterfangen zusätzlich behindert, da sie nur mühsam vorangekommen seien.30 Bei Joinville veranlasst der König, dass die Kranken auf den Schiffen versammelt und nach Damiette verschifft werden. Doch die Sarazenen hätten angegriffen und die Kranken am Ufer getötet, weshalb auf den Schiffen die Anker gekappt worden seien, um zu entkommen. Das Boot, auf dem sich Joinville befunden habe, sei dabei in Gefahr geraten, von den großen Schiffen zermalmt zu werden.31 26
27 28 29
30 31
Karl von Anjou, Zeugenaussage (wie Anm. 17), S. 171: Domine male facitis non acquiescendo sano consilio amicorum intrando navigium, quia propter espectationem vestra in terra via exercitus cum pericolo retardatur, et poteritis esse occasio mortis nostre. […] Comes Andegavensis, comes Andegavensis! Si vos estis oneratus de me, dimittatis, quia ego populum meum non dimittam. Karl von Anjou, Zeugenaussage (wie Anm. 17), S. 171. Jean de Joinville, Vie (wie Anm. 7), S. 152. Ich verwende hier den Quellenbegriff Joinvilles und Karls in seiner neudeutschen Form. Zur Erfahrung des Fremden bei Joinville vgl. Philippe Haugeard, L’expérience de l’altérité dans La vie de saint Louis de Joinville. L’Orient, l’ailleurs et la contagion possible de la barberie, in: Bien dire et bien aprandre 26, 2008, S. 121–135. Karl von Anjou, Zeugenaussage (wie Anm. 17), S. 170 f. Jean de Joinville, Vie (wie Anm. 7), S. 150.
„… da war ich auch dabei“.
165
Dramatischer erscheint im Vergleich die Schilderung Joinvilles, zumal er sein eigenes Erleben anschaulich in den Vordergrund rückt: Zusätzlich zu der ohnehin schon logistisch schwierigen Abreise wird von dem Sarazenenangriff berichtet. Der König (und mit ihm Joinville) ist also auch noch von den angreifenden Feinden akut gefährdet: Darüber, wie Ludwig aus dieser Lage entkam, schweigt sich Joinville allerdings aus. Auch in der Aussage Karls wird die Situation nicht aufgelöst: Ob seiner strategischen Ausführung noch ein Sarazenenangriff folgt, lässt das Fragment offen. Beide aber stellen die Situation als gefährlich und bedrängend dar: Karl argumentiert strategisch und schildert eine unbewegliche Flotte und ein mit Kranken belastetes Heer, die von den Sarazenen umzingelt sind. Joinvilles Erzählung ist handlungsorientierter und dadurch mitreißender: Die Sarazenen greifen das Heer am Ufer an und sind sogar in der Lage, die Kranken zu töten – hier geht die Gefahr noch über die latente Bedrohung, wie Karl sie schildert, hinaus. 3. Gefangenschaft des Königs Im folgenden Fragment (3) berichtet Karl über die Gefangenschaft, in die der König geraten ist: Als er den König im Lager besucht habe, habe er diesem erzählt, dass einzelne Ritter mit den Sarazenen ein Lösegeld für sich und ihre Leute verhandeln wollten. Darüber habe sich der König entrüstet, denn auf diesem Weg, so habe er gesagt, kämen nur die Reichen frei, die Armen aber würden „für immer“32 in Gefangenschaft bleiben. Ludwig habe die Ritter zu sich kommen lassen und ihnen bei Verlust von Leben und Besitz gedroht: Sie sollten allein ihm die Verhandlungen überlassen, denn er „wolle der Einzige sein“, der seine und die Befreiung aller zahle.33 Joinville erwähnt derartiges nicht, er weiß lediglich zu berichten, dass Sarazenen zu den Gefangenen gekommen seien und sie zu Verhandlungen aufgefordert hätten, um so in den Besitz einer oder mehrerer Burgen zu gelangen – was die Kreuzfahrer natürlich abgelehnt hätten. Auch Ludwig habe sich laut Joinville dem Austausch gegen Burgen widersetzt und lediglich in eine Zahlung von 500.000 Pfund für alle anderen Gefangenen und für sich selbst zusätzlich noch in die Übergabe der Stadt Damiette eingewilligt, wobei er sich aus Sicht des Sultans offensichtlich als großzügig erwiesen habe.34 Verhandlungen Einzelner oder Ludwigs Wut darüber werden nicht erwähnt. Natürlich lässt ein Vergleich dieser Episoden zunächst den Schluss zu, dass offensichtlich nicht nur Verhandlungen mit dem König stattfanden, sondern auch mit seinen Rittern – unabhängig davon, ob sie tatsächlich erfolgreich geführt wurden und wer die Initiative dazu ergriff. Vor allem aber zeigt sich, dass in beiden Erzählungen der König allein über die Bedingungen und Konditionen der Auslösung bestimmt. In Karls Erzählung verbietet er den Rittern eigene Verhandlungen unter der Androhung harter Strafen, bei Joinville sind die Ritter selbst tugendhaft genug, solche Verhandlungen abzulehnen und sich dem Handeln des Königs anzuvertrauen. 32 33 34
Karl von Anjou, Zeugenaussage (wie Anm. 17), S. 172: perpetuo. Ebd. S. 171 f., Zitat S. 172: sed volo solo esse. Jean de Joinville, Vie (wie Anm. 7), S. 166–168.
166
Carola Föller
4. Ermordung des Sultans Karl berichtet weiter über die Ermordung des Sultans (Fragment 4): Ludwig und seine zwei Brüder seien nach den erfolgreichen Lösegeldverhandlungen vor Damiette an Land gelassen worden, während die anderen Gefangenen an Bord geblieben seien. In dieser Situation sei ein Streit unter den Sarazenen ausgebrochen, in dem der Sultan getötet worden sei. Die Situation habe so bedrohlich gewirkt, dass Ludwig „die Kreuzmesse, die Liturgie des Tages, die Messe vom Heiligen Geist und das Requiem feiern ließ und weitere Gebete, von denen er wusste, dass sie in solchen Umständen hilfreich seien, rezitieren ließ.“35 Dann seien jene Sarazenen zum König und seinen Brüdern gekommen, die den Sultan getötet hätten und hätten ihr Handeln erklärt. Erstens hätte der Sultan Ludwig und die Seinen gar nicht freilassen, sondern sie an die Mauern Damiettes fesseln und foltern wollen, bis sie Damiette freigegeben hätten und er hätte sie anschließend töten wollen. Die Gefangenen hätte er schon zum Teil getötet und andere nach Kairo geschickt. Zweitens hätte der Sultan ihnen (also den Mördern selbst) den Rang, den ihr Vater durch seine Dienste beim Sultan erworben hatte, aberkannt und ihn an Unwürdigere vergeben. Karl berichtet weiter, dass auch der Gesandte des Kalifen von Bagdad anwesend gewesen sei und den König beschuldigt habe, die Unruhen durch seine unvollständige Lösegeldzahlung ausgelöst zu haben. Außerdem habe der Gesandte erzählt, dass der Kalif von Bagdad mit Krieg drohe. Also, so deutet Karl, hätten die Mörder des Sultans den König und die Gefangenen möglichst schnell freigegeben und den Rest des Lösegelds erhalten wollen, um einen Krieg zu umgehen.36 Auch Joinville weiß von den Emiren zu berichten, die die väterlichen Ehren verloren hätten, und ihrem Sinnen auf Rache, was sie zur Ermordung des Sultans geführt habe: Sie hätten die Leibwache des Sultans mit dessen Ermordung beauftragt. Die Schilderung dieser Ermordung selbst mutet abenteuerlich an: Es wird von einer Verfolgungsjagd erzählt, in der der Sultan einen Turm hinauf und wieder hinunter vor seinen Verfolgern flieht, letztlich aber von diesen gestellt und getötet wird – in der Nähe der Galeere, auf der sich Joinville aufhält. Der Mörder „zerspaltet ihn mit dem Schwert und reißt ihm das Herz aus dem Leib, dann kommt er zu unserem König, seine Hand ganz mit Blut befleckt, und sagte zu ihm: ‚Was gibst du mir dafür, daß ich deinen Feind erschlagen habe, der dich getötet hätte, wenn er am Leben geblieben wäre?‘ und der König antwortet ihm mit keinem Wort.“37 In dieser Episode unterscheidet sich auch die herausgestellte Tugendhaftigkeit des Königs in den beiden Erzählungen: Bei Karl stehen die Frömmigkeit des Kö35
36 37
Karl von Anjou, Zeugenaussage (wie Anm. 17), S. 172: fecit dici officium misse de Cruce, et de die, et de sancto Spiritu, et de Requiem, et quasdam alias orations quas sciebat esse utiles in tali statu. Jackson, Crusade (wie Anm. 17), S. 117, gibt diese Stellen so wieder, dass Ludwig selbst die Messen feiert und die Gebete spricht. Karl von Anjou, Zeugenaussage (wie Anm. 17), S. 172 f. Jean de Joinville, Vie (wie Anm. 7), S. 170–174, S. 174: le fendi de s’espee et li osta le cuer du ventre. Et lors il en vint au roy, sa main toute ensanglantee, et il dit: „Que me donras tu, que je t’ai occis ton ennemi qui t’eust mort se il eust vescu?“ [sic] Et le roy ne li respondit onques riens. Übersetzung: Mayser, Leben (wie Anm. 12), S. 163 ff.
„… da war ich auch dabei“.
167
nigs und sein religiöses Handeln gegen die Gefahr im Fokus, Joinville erzählt von der Verweigerung des Angebots, aus dem Fehlverhalten der Emire einen Vorteil zu erlangen. Und auch die anderen Ereignisse divergieren stark: Karl berichtet ausführlich, wie sich die Emire wegen der Ermordung des Sultans rechtfertigten. Ob Karl der Schilderung der Emire Glauben schenkt, bleibt offen, er scheint aber zumindest strategisch die Situation, in der sie sich aktuell befinden, nachvollziehen zu können. Joinville weiß zwar auch um eine vorangegangene Demütigung der Emire, stellt diese aber vor allem als blutrünstig und gewinnsüchtig dar, Verständnis für ihr Handeln zeigt er nicht. Ausgesprochen anschaulich berichtet er von der Flucht des Sultans, die von Karl nicht erwähnt wird. 5. (Erneute) Lösegeldverhandlungen Karl berichtet weiter über die Verhandlungen Ludwigs mit den Sarazenen um Lösegeld und die Frage, wer von den königlichen Brüdern als Geisel zurückbleiben solle. Ludwig habe sich drei Mal geweigert, auf die Forderungen (die im Fragment fehlen) einzugehen, und die Brüder hätten bei jeder Weigerung befürchtet, dass Ludwig nun getötet werde. Beim dritten Mal hätten die Sarazenen argumentiert, dass es keine Sünde sei, die Bedingungen anzunehmen. Dem habe Ludwig zwar zugestimmt, sich aber dennoch geweigert, da es in seinen Augen für einen Christen „ein Horror“ sei, solche Worte auszusprechen. Die Ritter hätten daraufhin bereut, so strikte Forderungen an die Eidesformel der Sarazenen gestellt zu haben und nur ihren eigenen Nachteil der Situation gesehen.38 Die Sarazenen hätten sich beruhigt und gefordert, die noch ausstehende Hälfte des Lösegelds zu zahlen und Damiette zu übergeben. Dem habe der König zugestimmt und um die Setzung eines Termins gebeten, da er das Geld noch nicht hätte, und die Garantie verlangt, dass er und die anderen Gefangenen dann auch tatsächlich freigelassen würden. Die Sarazenen hätten ihm daraufhin angeboten, dass entweder er in Gefangenschaft bleiben und alle anderen gehen könnten oder dass er freigelassen werde und alle anderen dafür bleiben müssten, bis das Geld bezahlt und Damiette übergeben sei. Der König habe sofort erklärt, er werde bleiben, während die Brüder und die Ritter widersprochen und gesagt hätten, dass sie nicht frei sein wollten, wenn ihr König gefangen sei. Die Diskussion habe so lange gedauert, bis die Sarazenen erkannt hätten, dass sie Zeuge eines „frommen Disputs über gegenseitige Barmherzigkeit“39 geworden seien und sie davon (und mit Gottes Hilfe) erweicht worden seien und angeboten hätten, der König könne statt seiner auch einen Bruder benennen und alle anderen würden freigelassen werden. Der König habe daraufhin Karl von Anjou gewählt. Die Sarazenen hingegen hätten entschieden, dass der Graf von Poitiers bleiben solle, da Ludwig ihn bevorzuge und er sicherlich deshalb die Bedingungen schneller erfüllen
38 39
Karl von Anjou, Zeugenaussage (wie Anm. 17), S. 173: horrendum esse. Ebd., S. 174: quod inter eos erat pia contentio de mutua caritate.
168
Carola Föller
werde. Der König habe in Damiette das Schiff nicht verlassen, bis sein Bruder wieder befreit gewesen sei.40 Joinville schließt die Verhandlungen um das Lösegeld für Ludwig direkt an die Ernennung des Sultans an. Nachdem der König dem Mörder selbst die Antwort verweigert habe, seien dreißig Sarazenen an Bord gekommen und hätten die Kreuzfahrer bedroht, die gefürchtet hätten, getötet zu werden. Die Lösegeldverhandlungen mit den Rittern seien am nächsten Tag in Gang gekommen, offensichtlich unter Beteiligung des Königs. Joinville gibt den Inhalt des Vertrags so wieder: König und Grafen sollten nach der Übergabe von Damiette freigelassen werden. Darüber hinaus habe Ludwig sich zur Zahlung von 400.000 Pfund verpflichtet, zu zahlen in zwei Raten, die erste bei der Abreise und die zweite in Akkon. Die Sarazenen dagegen hätten garantiert, die Kranken zu pflegen und das Kriegsgerät und das eingesalzene Schweinefleisch vorübergehend zu verwahren. Im Falle eines Eidbruchs drohen göttliche Strafen. Um die Schwere der Strafe bemessen zu können, werden jeweils Vergleiche mit anderen religiösen Verstößen gezogen und darauf geschworen. Die Sarazenen sollten beispielsweise im Falle des Eidbruchs so frevelhaft sein, wie ein Moslem, der Schweinefleisch esse – die Sarazenen hätten dies geschworen, ohne zu zögern. Ludwig habe auf einen christlichen Vergleich (Verwerfung wie bei der Verleugnung Gottes und Marias) geschworen, sich aber geweigert, zu schwören, dass er im Falle eines Vertragsbruchs so verdammt sein solle, „wie jemand der Gott und sein Gesetz verleugne und aus Verachtung Gottes auf das Kreuz spuckt und es mit Füßen tritt.“ Die Sarazenen hätten daraufhin gedroht, ihn und alle seine Leute zu enthaupten, wenn er den Eid nicht schwöre, da sie ja auch geschworen hätten, was von ihnen verlangt worden sei. Ludwig habe geantwortet, dass er in diesem Fall lieber als guter Christ sterben wolle, als „unter dem Zorn Gottes und seiner Mutter leben“. Die Sarazenen hätten daraufhin den Patriarchen von Jerusalem gefoltert und dieser habe den König unter Folter gebeten, den Eid abzulegen, und ihm angeboten, die Sünde, die durch den Eid verursacht werde, zu übernehmen. Joinville schließt an, dass er nun nicht mehr wisse, wie der Eid zustande gekommen sei, dass sich jedenfalls aber die Sarazenen mit diesem zufrieden gegeben hätten.41 Der Eid sei geschworen worden und die Kreuzfahrer seien mit den Galeeren nach Damiette gefahren um es zu übergeben. Die Sarazenen hingegen, so berichtet Joinville, hätten den Vertrag missachtet und die Gefangenen getötet, das Kriegsgerät veruntreut und das Schweinefleisch verbrannt. Der König sei ebenfalls nicht freigelassen worden, sondern es sei stattdessen über seine (und der Grafen) Hinrichtung diskutiert worden, denn er gelte den Sarazenen als „der mächtigste Feind [des] Gesetzes“. Dennoch seien einige Gefangene freigelassen und von einem Heer aus 20.000 Sarazenen an Land begleitet worden – als dann an der genuesischen Galeere aber 80 Armbrustschützen erschienen seien, seien die Sarazenen geflohen. 40 41
Ebd. Jean de Joinville, Vie (wie Anm. 7), S. 174–180, S. 178: qui renoie Dieu et sa loy, et qui en despit de Dieu crache sur la croiz et marche desus […] ou courrous Dieu et sa Mere. Übersetzung: Mayser, Leben (wie Anm. 12), S. 168.
„… da war ich auch dabei“.
169
Alle seien befreit worden, nur der Graf von Poitiers sei zurückgehalten worden, bis der König, wie vertraglich vereinbart, die 200.000 Pfund ausgezahlt habe.42 Bei der Lösegeldübergabe sei er selbst, Joinville, dabei gewesen und er habe darüber hinaus mit einiger Raffinesse das Geld von den Templern erhalten. Über seine Rückkehr von den Templern berichtet Joinville: „und der heilige Mann sah mich mit großer Freude.“ Gegen den Rat seiner Leute habe Ludwig den Vertrag eingehalten und vor der Übergabe des Bruders gezahlt – doch seine Leute hätten 10.000 Pfund zu wenig übergeben. Als Ludwig dies vernommen habe, sei er außer sich geraten und habe die sofortige Begleichung der Schuld verlangt.43 Nachdem dies ausgeführt worden sei, habe der König zum Aufbruch gerufen. Nach Joinville erfährt der König erst nach einer Meile, dass sein Bruder befreit sei und sich auf einer anderen Galeere befinde. Die Reaktionen schildert Joinville euphorisch: „Da rief der König: ‚Zündet die Lichter an! Zündet die Lichter an!‘“ und so geschah es. „Nun brach die größte Freude, die man sich denken kann, unter uns aus.“44 Hier unterscheiden sich die Erzählungen von Karl und Joinville deutlich, sowohl in der Chronologie als auch im Umfang des Erzählten. Karl stellt zunächst die religiöse Motivation, den Eid nicht zu schwören, in den Vordergrund und kontrastiert somit den heilig handelnden Ludwig mit den irdisch motivierten Rittern, die um ihr Leben fürchten. Die Situation wird letztlich so gelöst, dass die Sarazenen nachgeben und die Verhandlungen fortführen. Einen zweiten Schwerpunkt setzt Karl auf die Frage, wer nun als Geisel zurückbleiben solle. Dabei gelingt ihm eine Erzählung, in der alle beteiligten Kreuzfahrer, auch er selbst, ehrenhaft handeln: Der König besteht auf seinem Opfer, die Ritter auf ihrem und auch Karl sollte eigentlich als Geisel fungieren. Wiederum aber entscheiden die Sarazenen, einmal als sie die Lösung mit einem Bruder als Geisel vorschlagen, einmal als sie diesen dann auch noch – entgegen ihrer ursprünglichen Ankündigung – mit Alfons von Poitiers bestimmen. Um die Sorge Ludwigs zu zeigen, erzählt Karl, Ludwig sei in Damiette nicht von Bord gegangen, bis sein Bruder befreit gewesen sei. Joinville hingegen berichtet zunächst recht ausführlich vom Vertrag, um dann die Weigerung des Königs, den Eid zu schwören, auszuführen, den er ebenso wie in Karls Erzählung aus Gottesfurcht nicht leisten will. Bei Joinville wird nicht klar, ob Ludwig standhaft bleibt, er suggeriert aber, dass sich die Sarazenen eben auch mit dem zuvor geleisteten Eid zufrieden gaben. Der gefolterte Patriarch zeigt im Vergleich mit Ludwig wenig Gottvertrauen und bildet somit – trotz seines kirchlichen Amtes – gleichsam einen Gegenpol. Während die Sarazenen fast alle ihre Versprechen brechen, hält sich Ludwig penibel an die Zusagen – auch im Konflikt mit den eigenen Leuten. Joinville kontrastiert auch hier die ehrlos handelnden Sarazenen mit dem tugendhaften Verhalten des Königs. Wie groß die Sorge um den Bruder gewesen ist, zeigt 42 43 44
Jean de Joinville, Vie (wie Anm. 7), S. 180–186, S. 184: car c’est le plus fort ennemi que la loy paiennime ait. Übersetzung: Mayser, Leben (wie Anm. 12), S. 169–173. Jean de Joinville, Vie (wie Anm. 7), S. 186–192, S. 190: Et le saint home me vit moult volentiers et moult liement. Übersetzung: Mayser, Leben (wie Anm. 12), S. 173–176. Jean de Joinville, Vie (wie Anm. 7), S. 192: Lors fu la joie si grant comme elle pot estre plus entre nous. Übersetzung: Mayser, Leben (wie Anm. 12), S. 176.
170
Carola Föller
Joinville durch die Freude, die Ludwig und alle empfinden, als sie von dessen Freilassung erfahren. Und Joinville schreibt auch sich selbst keine geringe Funktion in der Geschichte der geglückten Verhandlungen zu – er unterstützt Ludwig bei der Beschaffung des Lösegeldes und macht damit die Freilassung des Bruders erst möglich. Bei aller Unterschiedlichkeit der Erzählungen gleichen sich die moralischen Intentionen der Geschichte doch: In beiden Erzählungen steht die Weigerung des Königs im Vordergrund, den Eid zu schwören. Karl spricht von einer dreimaligen Weigerung, die Bedingungen, die in den Fragmenten fehlen, zu akzeptieren und auch Joinville berichtet davon, dass der König den Eid nicht leisten will. Bei Karl hat Ludwig inhaltliche Vorbehalte, bei Joinville liegt es an der Formel. Beide Erzählungen müssen aber damit umgehen, dass der Vertrag zustande kam: Karl erklärt dies mit der Einsicht der Sarazenen, Joinville mit seiner Unwissenheit. In beiden Berichten zeigt sich Ludwig um seinen Bruder Alfons von Poitiers in der Geiselhaft besorgt. Karl berichtet davon, dass Ludwig nicht abreisen wollte, bevor nicht sein Bruder Alfons bei ihm sei, Joinville erzählt von der Besorgnis um den zurückgebliebenen Bruder und dass erst, als die Nachricht seiner Freilassung Ludwig erreichte, sich Erleichterung und Freude beim König einstellen wollte. 6. Rückkehr der Brüder Ein kritischer Moment ist in beiden Berichten die Abreise der Brüder des Königs, die verknüpft ist mit der Frage nach dem Abbruch des Unterfangens. Karl berichtet, dass Ludwig ihn zu sich gerufen und ihm gesagt habe, er wünsche, dass seine Brüder nach Hause zurück kehren. Karl habe ihn dagegen gebeten, bei ihm bleiben zu dürfen, was der König unter der Voraussetzung gestattet habe, dass Alfons von Poitiers allein reisen könne. Daraufhin habe Karl dem König angeboten, dass dieser Alfons in die Heimat begleite und Karl an seiner statt bliebe. Dies habe der König allerdings zurückgewiesen, da er als Einziger die Möglichkeit habe und in der Lage sei, die noch verbliebenen Gefangenen zu befreien. Dies sei, laut Karl, des Königs innigster Wunsch gewesen und er schließt an, dass die Gefangenen sicher nicht befreit worden wären, wenn der König nicht geblieben wäre.45 Joinville hingegen erzählt, dass der König sich in Akkon in einer Zwickmühle befunden habe: Einerseits sei das ‚royaume‘ in Gefahr gewesen, denn mit dem König von England sei noch kein Frieden geschlossen gewesen, andererseits habe die Gefahr bestanden, dass der Kreuzzug scheitere, wenn Ludwig ginge, da ihm in diesem Fall jeder gefolgt und niemand zurückgeblieben wäre.46 Die Brüder des Königs und die Grafen, die der König um Rat gebeten habe, hätten ihm geraten, nach Hause zurückzukehren und mit neuen Leuten und Geld wieder aufzubrechen, um sich an den Sarazenen für die Gefangennahme zu rächen. Auch nach mehrmaligem Insistieren habe der König keine andere Antwort erhalten. Lediglich der Graf 45 46
Karl von Anjou, Zeugenaussage (wie Anm. 17), S. 174 f. Jean de Joinville, Vie (wie Anm. 7), S. 206.
„… da war ich auch dabei“.
171
von Jaffa und Joinville selbst hätten eine Fortführung des Kreuzzugs befürwortet. Als Joinville dafür angegriffen worden sei, habe er eine bewegende Rede gehalten, die die anderen Ritter sehr ergriffen, aber nicht umgestimmt habe. Der König habe sich zum Nachdenken für acht Tage zurückgezogen und es sei ein Sturm der Entrüstung über Joinville hereingebrochen.47 Joinville schreibt hier, er habe darüber nachgedacht, dass er, selbst wenn der König nach Frankreich zurückkehrte, bei seinem Verwandten, dem Fürsten von Antiochien bliebe, um zu warten, „bis ein anderer Kreuzzug in dieses Land käme und all die armen Gefangenen endlich befreit würden.“ An dieser Stelle berichtet Joinville von einer Begegnung mit dem König, der ihm die Hände auf den Kopf gelegt und ihm für seinen Mut, gegen den Rat der anderen zu sprechen, gedankt habe und sich abermals von ihm habe versichern lassen, dass es ein Fehler sei, das Land zu verlassen.48 Der König habe sich für das Bleiben entschieden, mit der Begründung, dass Jerusalem sonst endgültig verloren sei.49 Über die Abreise der Brüder des Königs sagt Joinville: „ich weiß nicht, ob [die Rückkehr] auf ihren Wunsch geschehen ist oder nach dem Willen des Königs.“50 Joinville erzählt weiter: Kurz nach dem Befehl zu deren Abreise habe der König neue Ritter benötigt – habe allerdings Schwierigkeiten gehabt, welche in seinen Dienst zu nehmen, denn alle hätten mit den Brüdern nach Frankreich zurückkehren wollen. Lediglich der Seneschall der Champagne – also Joinville selbst – sei noch geeignet gewesen. Ihn habe der König nun in den Dienst genommen. Joinville verbindet also den Aufbruch, das Verlassen der Brüder mit seiner eigenen Kommendierung an den König.51 In beiden Erzählungen wird das persönliche Verhältnis zum König ausgehandelt. Für Karl besteht der Rechtfertigungszwang, warum er den König verlassen hat, was er mit zahlreichen Argumenten untermauert. Zum ersten legt er den Wunsch dem König in den Mund, zum zweiten gibt er die gesundheitlich schwierige Lage seines Bruders Alfons von Poitiers an und zum dritten sei das Bleiben des Königs erfolgsversprechender als seines gewesen. Joinville hingegen berichtet von ernsthaften Überlegungen Ludwigs, nach Paris zurückzukehren, für die er den Rat seiner Ritter eingeholt habe. Die Erzählung der Beratung nutzt Joinville dazu, um zum einen die selbstsüchtigen Motive der Brüder des Königs und seiner Ritter darzustellen, zum anderen um sich als guten 47 48 49 50 51
Ebd., S. 208–210. Ebd., S. 210–212, S. 212: jusques a tant que uni autre ale me venist ou paÿs, par quoy les prisonniers feussent delivré. Übersetzung: Mayser, Leben (wie Anm. 12), S. 189 f. Jean de Joinville, Vie (wie Anm. 7), S. 214. Ebd.: je ne sai se ce fu a leur requeste ou par la volenté du roy. Übersetzung: Mayser, Leben (wie Anm. 12), S. 191. Jean de Joinville, Vie (wie Anm. 7), S. 214–216. Zur autobiographischen Darstellung Joinvilles allgemein vgl. Axel Rüther, Inszenierte Autorschaft. Jean de Joinville. Vie de saint Louis, in: Susanne Friede/Michael Schwarze (Hgg.), Autorschaft und Autorität in den romanischen Literaturen des Mittelalters (Beihefte zur Zeitschrift für romanische Philologie 390), Berlin/Boston 2015, S. 230–246, besonders S. 240–243. Zum Gespräch am Fenster, das als literarisches Motiv für den Umgang mit schwierigen Entscheidungen gesehen werden kann, vgl. auch Caroline Smith, Crusading in the Age of Joinville, Aldershot/Burlington 2006, S. 70 f.
172
Carola Föller
Ratgeber zu inszenieren und seine eigenen hehren, ritterlichen Motive für den Kreuzzug darzulegen. Dies erscheint insofern notwendig, als dass die Abreise der meisten Ritter und der Brüder eng mit Joinvilles Kommendierung an den König verbunden wird – da dieser nun fast der einzige verbliebene Getreue ist. Während er seine eigene Motivation, den Kreuzzug fortzuführen, mit der Befreiung der verbliebenen Gefangenen erklärt, legt er dem König das ‚eigentliche‘ Ziel des Kreuzzugs in den Mund: die Gewinnung Jerusalems. Beide stellen also die Standhaftigkeit und die hehren Motive des Königs in den Vordergrund – wenn sie auch ein unterschiedliches Ziel angeben. 7. Tod des Alfons von Poitiers Der erste Teil des letzten Fragments der Aussagen Karls von Anjou berichtet vom Tod der Königsmutter Blanka von Kastilien und ihrer Vision des Todes ihrer Söhne Alfons von Poitiers und Robert von Artois. Im zweiten Teil erzählt Karl selbst vom Tod seiner Brüder: Robert von Artois habe im vertrauten Kreise davon gesprochen, gerne als Märtyrer für den christlichen Glauben im Kampf gegen die Sarazenen zu fallen, wie es dann auch geschehen sei. Anschließend fügt Karl noch den Bericht über den Tod Alfons’ von Poitiers an, der ebenfalls den Märtyrertod gestorben sei.52 Joinville berichtet über all dies nicht, weder über die Umstände des Todes der Mutter noch über das Gespräch der Brüder noch über den Tod Alfons’ von Poitiers, der ja auf dem Rückweg vom zweiten Kreuzzug Ludwigs ins Heilige Land verstarb, zu dem Joinville nicht aufgebrochen war. Lediglich vom Tod Roberts von Artois berichtet er, auch deutlich ausführlicher, wie dieser sich tollkühn und gegen den Befehl des Königs in die Schlacht gegen die Türken geworfen habe und gestorben sei.53 Die einzelnen Erzählungen sind zu unterschiedlich, um Einzelheiten miteinander zu vergleichen. Es fällt allerdings auf, dass sich die Bewertungen des Todes des Grafen Alfons von Poitiers deutlich unterscheiden. Karl versucht, wie auch sein Bruder Ludwig vor ihm54, den Tod in der Schlacht als Märtyrertod darzustellen. Joinville unterstützt diese Bestrebungen offensichtlich nicht, er bewertet das Verhalten des Grafen sogar als unangemessen. 8. Ergebnisse des Vergleichs Wenn man die Aussagen Karls mit den Darstellungen Joinvilles vergleicht, fallen viel weniger die Gemeinsamkeiten (etwa die Beschreibung der Lagerseuche) als signifikante Unterschiede ins Auge. Dies war durchaus zu erwarten, denn eine direkte Abhängigkeit der beiden Berichte voneinander ist unwahrscheinlich, da die 52 53 54
Karl von Anjou, Zeugenaussage (wie Anm. 17), S. 175 f. Jean de Joinville, Vie (wie Anm. 7), S. 106–108. Le Goff, Ludwig (wie Anm. 2), S. 636.
„… da war ich auch dabei“.
173
beiden Befragten die Aussagen des jeweils anderen aller Wahrscheinlichkeit nach nicht kannten. Joinville gibt an, in Saint-Denis befragt worden zu sein, für Karl von Anjou ist wahrscheinlich gemacht worden, dass dieser sein Zeugnis in Neapel ablegte. Höchstwahrscheinlich hatte Joinville die Kanonisationsakten bei der Abfassung seiner Vita nicht vorliegen. Die Unterschiede sind zahlreich, sie bewegen sich auf allen Ebenen der Erzählung: Während Karl meist relativ unaufgeregt Situationen zu Protokoll gibt, erzählt Joinville mitreißende Geschichten. Auch die Reihenfolge der Ereignisse (bei der Ermordung des Sultans), die daran beteiligten Personen (Karl sagt beispielsweise nichts vom Patriarchen von Jerusalem) und der Ausgang einer Episode unterscheiden sich (Sarazenen geben nach, beziehungsweise der König wird erpresst). Signifikante Unterschiede zeigen sich auch, wenn es um die Bewertung der Handlungen geht, sowohl der Sarazenen (Verhalten des Sultans) als auch der eigenen Leute (etwa Karls Abreise und die eigenmächtigen Verhandlungen der Ritter). Auch in der Wortwahl (abgesehen vom Sprachunterschied) unterscheiden sich die Erzählungen (Karl spricht von illi, während Joinville die Bezeichnung amiraus nutzt). Übereinstimmungen können hingegen vor allem in Bezug auf die Darstellung und Bewertung Ludwigs des Heiligen festgestellt werden: 1. In beiden Berichten bleibt Ludwig trotz seiner schweren Erkrankung in der gefährlichen Situation und gibt nicht dem Rat seiner Vertrauten nach, sich in Sicherheit zu bringen. Sowohl Karl als auch Joinville zeigen ausführlich die bedrohlichen Umstände auf, in denen sich das Kreuzfahrerheer und vor allem der König befinden. 2. Die leitende Rolle des Königs bei den (zunächst erfolgreichen) Verhandlungen mit dem Sultan wird von beiden herausgestellt und damit das Verantwortungsbewusstsein des Königs und seine herausragende Position betont. 3. Bei beiden weigert sich Ludwig vehement, den Eid zu schwören, der zuvor mit den Sarazenen ausgehandelt wurde – und beide schließen ein Nachgeben Ludwigs aus. 4. Beide betonen die große Sorge, in der sich Ludwig wegen seines in Gefangenschaft zurückgebliebenen Bruders Alfons von Poitiers befand. Schließlich verhandeln 5. beide ihre Rolle zum König. Nun ist es weder für eine Aussage in einem Kanonisationsprozess noch für eine Heiligenvita ungewöhnlich, die Handlungen des (potentiellen) Heiligen religiös vorbildhaft darzustellen, sein Verhalten als einem Heiligen würdig herauszustellen und die Erzählung auf ihn zuzuspitzen.55 Gerade aber die „Vie de saint Louis“ unterscheidet sich jedoch durch die ungewöhnliche Erzählperspektive des Ich-Erzählers von anderen Heiligenviten. Außerdem gehen die Gemeinsamkeiten über die einfache Intention hinaus, Ludwig als heilig darzustellen, denn bei aller Unterschiedlichkeit der Erzählungen ist dieses vorbildliche Verhalten des Königs bei beiden stets der Fluchtpunkt der Geschichte und die Darstellung der spezifischen Ausprägungen der Heiligkeit meist zumindest ähnlich. Beide wählen dieselben Manifestationen königlichen Handelns, um Ludwig als christliches Vorbild darzustellen, beide setzen die Handlungen Ludwigs als Höhepunkt der erzählten Episoden ein: Die schwere Krankheit des Königs, die Weigerung, vor den Sarazenen zu fliehen, 55
Obwohl genau dies der „Vie de saint Louis“ von Joinville zum Teil abgesprochen wird, z. B. Paris, La composition (wie Anm. 8), S. 514.
174
Carola Föller
die Verurteilung der Ermordung des Sultans, die Weigerung des Königs, den Eid zu schwören, die Sorge des Königs um seinen Bruder Alfons und schließlich der Entschluss zur Fortsetzung des Kreuzzugs. Die gemeinsamen Fluchtpunkte lassen es daher denkbar erscheinen – vor allem bei voneinander unabhängigen literarischen Traditionen –, dass im Kanonisationsprozess gezielt nach diesen Situationen und dem Verhalten des Königs gefragt wurde. Auf dem Laterankonzil von 1215 wurde festgelegt, dass bei Kanonisationsverfahren künftig den Zeugen articuli vorgelegt werden sollten, zu denen sie dann Stellung zu beziehen hatten.56 Thomas Wetzstein hat in seiner Arbeit zu den Kanonisationsprozessen im Spätmittelalter zeigen können, dass dieses Verfahren, neben der Möglichkeit von „freien Berichten“, durchaus auch in der Praxis angewandt wurde.57 Ein Formular mit solchen articuli von Papst Martin IV., in dessen Pontifikat eine wesentliche Etappe in der Vorbereitung der Kanonisation des Königs fällt, ist nicht völlig unwahrscheinlich. Ebenso ist dann entsprechend anzunehmen, dass dieser Fragenkatalog noch vom persönlichen Vorwissen des Papstes beeinflusst gewesen ist. Denn Martin IV. zählte in den 1260er Jahren, vor seiner Wahl zum Papst, zu den engeren Vertrauten des Königs und war bereits an den ersten Schritten in Richtung einer Heiligsprechung Ludwigs unter Papst Gregor X. beteiligt, bei der er mit der Zeugenbefragung betraut worden war.58 So wusste er möglicherweise schon Fragen zu stellen, deren Antworten zwangsläufig zu Aussagen zum heiligenmäßigen Verhalten des Königs hinführten. III. FAZIT Durch den Vergleich mit den wenigen fragmentarischen Dokumenten, die aus dem Kanonisationsprozess erhalten sind, ergibt sich also eine Ahnung, wie sehr die „Vie de saint Louis“ vom Erinnerungsprozess während der Zeugenbefragung beeinflusst sein könnte. Andere Situationen – beispielsweise nach dem Tod des Heiligen selbst, nach seiner erfolgreichen Kanonisation oder auch nur im Rahmen eines geselligen Beisammenseins – bleiben wohl auf immer verborgen. Wenn man nun das „Leben des Heiligen Ludwig“ Joinvilles als Niederschrift von Erinnerungen betrachtet, die bereits zwanzig Jahre zuvor beim Kanonisationsprozess auf spezifische Weise aktualisiert wurden, so hat das mehrere Folgen. Die Erinnerungssituation im ersten Jahrzehnt des 14. Jahrhunderts wäre auf diese Weise 56
57 58
Thomas Wetzstein, Heilige vor Gericht. Das Kanonisationsverfahren im europäischen Spätmittelalter (Forschungen zur kirchlichen Rechtsgeschichte und zum Kirchenrecht 28) Köln 2004, S. 164; Antonio Garcìa y Garcìa, Constitutiones Concilii quarti Lateranensis una cum Commentariis glossatorum (Monumenta iuris canonici. Ser. A, Corpus glossatorum 2) Città del Vaticano 1981, c. 8, S. 54–57. Wetzstein, Heilige (wie Anm. 56), S. 446–450. Carolus-Barré, Le procès (wie Anm. 11), S. 18 f.
„… da war ich auch dabei“.
175
durch den Abruf 20 Jahre zuvor beeinflusst, denn jede Erinnerung verändert ihren Gegenstand.59 Im Fall der „Vie de saint Louis“ wäre durch die Befragung im Kanonisationsprozess jeweils die heiligmäßige Überhöhung Ludwigs und damit der Fluchtpunkt der Erzählungen ‚vorerinnert‘ gewesen. Dies muss zwingend Folgen für die Frage nach der Zuverlässigkeit einzelner Gegebenheiten oder Ereignisse haben. Bestimmen die Fragen den Fluchtpunkt, werden auch die ‚Fakten‘ angepasst, wie das Beispiel der Schilderungen der Krankheit des Königs zeigt: Mit ausgesprochen unterschiedlichen Mitteln wird in beiden Berichten jeweils die zentrale Darstellungsabsicht, die Gefährdung des Königs und der Mission, herausgestellt. Und auch manche Eigenheiten der Vita könnten durch die Prägung der Erinnerung durch den Kanonisationsprozess zumindest mit verursacht sein: Das Benennen von Zeugen ist in mittelalterlichen Werken nicht ungewöhnlich. Joinville nennt aber nicht nur Zeugen, sondern er gibt auch ausgesprochen häufig Auskunft über andere anwesende Personen, auch wenn er beim Erzählten „auch dabei war“.60 Dies könnte auf ein durch die Zeugenbefragung eingeübtes Erinnerungsmuster deuten, das den weiteren Verlauf des Kanonisationsprozesses erleichtern sollte; vielleicht wurde Joinville gezielt nach weiteren Zeugen für das von ihm Geschilderte gefragt. Von den Befragungen im Kanonisationsprozess Elisabeths von Thüringen wissen wir, dass gezielt nach anderen anwesenden Personen gefragt wurde.61 Wenn Joinville nun zu Beginn des 14. Jahrhunderts die Vita diktierte, wird er vielleicht dieses Muster wiederholt haben. Die Beeinflussung durch die Erinnerungssituation im Kanonisationsprozess würde auch zur Erklärung der Ich-Perspektive des Autors beitragen.62 Auch hier verweise ich wieder zum formalen Vergleich auf die Kanonisationsprotokolle zur Heiligsprechung der Elisabeth von Thüringen. Die Aussage der vier Dienerinnen, die zwar durch den Inquisitor heftig überarbeitet wurde, lässt an manchen Stellen, an denen der Bearbeiter etwas nachlässig war, ebenfalls noch eine solche Ich-Perspektive erkennen.63 Joinville aber hatte in seiner „Vie de saint Louis“ keinen Redaktor, der dies zu glätten suchte. Augenzeugenberichte sind nicht besonders zuverlässig: Einen ‚wahren‘ Ludwig findet man in der Vita des Joinville sicher ebenso wenig wie eine zutreffende Schilderung des Kreuzzugs von 1248–1252. Nicht nur intentionales Verschweigen, Hinzufügen oder Verändern und der (unbewusste) Rückgriff auf literarische Tradi59 60 61 62 63
Wiederum grundlegend: Fried, Schleier (wie Anm. 6). Jean de Joinville, Vie (wie Anm. 7), S. 46: et la fu je. Übersetzung: Mayser, Leben (wie Anm. 12), S. 90. Ingrid Würth, Die Aussagen der vier Dienerinnen im Kanonisationsverfahren Elisabeths von Thüringen (1235) und ihre Überlieferung im Libellus, in: Zeitschrift des Vereins für Thüringische Geschichte 59/60, 2005/2006, S. 7–74, S. 13. Zur Erzählform Joinvilles in der ersten Person Singular jüngst Schwarze, „Ce que je vi et oy“ (wie Anm. 1), S. 65 f. Würth, Aussagen (wie Anm. 61), S. 27. Zum autobiographischen Charakter des Werkes Christine Ferlampin-Acher, Joinville de l’hagiographie à l’autobiographe. Approche de la Vie de saint Louis, in: Quéruel, Jean de Joinville (wie Anm. 4), S. 73–91.
176
Carola Föller
tionen beeinflussen die Erzählung des Erlebten. Es wirken auch die vielfältigen Möglichkeiten menschlichen Erinnerns, mithin die Verarbeitung von Realität – einem der wesentlichen Felder historischen Forschens. Für einen Blick in diese Bereiche sind Augenzeugenberichte – so wie die „Vie de saint Louis“ des Jean de Joinville – tatsächlich ein besonderer Glücksfall für Historikerinnen und Historiker.
PROTESTANT “GESCHICHTSKLITTERUNGEN” The History of Medieval German and Netherlandish Bibles Andrew Gow I. MEDIEVAL GERMAN BIBLES 1. The Problem Much traditional historiography and most mainstream perceptions about the Bible in pre-modern Europe would have it that in the Middle Ages, the Bible was read exclusively by clerics, and mainly in Latin. This is a legend based on a number of historical, theological and ideological postulates. They mesh perfectly in the interaction between the following three closely related strands: first, a progressivist whig history leading from a benighted, obscure medieval Europe, through the supposed humanistic awakening of the Renaissance – and the emphasis on individual religion and conscience claimed by Protestant apologists to have been licensed by the Reformation –, to individual freedom of religion as envisaged in Enlightenment and post-Enlightenment liberal projects; second, the fame of Biblicist and/or Biblical humanist theology; and third, the liberal view that both ‘freedom of religion’ and (humanistic) Biblicism were not merely personal but also civilizational (“weltgeschichtliche”) improvements over putatively oppressive medieval ecclesiastical institutions (the Papacy) and over scholastic obscurantism (the clergy and their authoritative Vulgate). Anyone who has ever had the misfortune to teach a western civilization or world history class using a traditional textbook will recognize a narrative that not only once dominated introductory textbooks, but still dominates popular histories, and finds expression in books for a larger educated readership, from Steven Ozment’s classic 1980 “The Age of Reform, 1250–1550” through Erika Rummel’s 1995 “The Humanist-Scholastic Debate in the Renaissance and Reformation” to the recent Luther-centric work of Thomas Kaufmann, Professor of Church History at the University of Göttingen. In fact, medieval Bible-readers were from many diverse strata of society, notably the urban burgher classes in burgeoning cities from Sicily to Scandinavia. Thousands and thousands of vernacular manuscripts of both Biblical texts, retellings of biblical stories, and full Bibles circulated all over Europe from the eighth century on, with vernacular versions of the Bible available to all literate town-dwellers by the fifteenth century except in England. The English ban on the vernacular Bible from 1409 until the Reformation continues to influence Anglo-American scholarship in negative ways – namely, via the incorrect (and whiggish) assumption that the English situation was normative and reflective of ‘oppressive’ ecclesiastical practice in all of Europe.
178
Andrew Gow
The various texts of the canonical Bible, and many more biblical texts besides, have almost always been available in Germanic (and other European) vernaculars, and accessible to a range of people starting with but not limited to the clergy and nobility. By the later Middle Ages, German burghers were being exhorted by preachers to keep (printed) Bibles in their houses and to read aloud from them regularly; preachers translated the Gospels aloud into the common language during Sunday church services, and had been doing so for some time. Why, then, the persistent myth that the Bible was withheld from the laity by restrictions on its translation or even on reading it in the vernacular? Other than in England, actual bans on making or owning translations of the Bible into the vernacular were generally local and temporary, or even equivocal: the decree of the archbishop of Metz of 1199 against ‘Waldensians’ and their vernacular Bibles was confirmed by Innocent III but without expressly prohibiting Bible translations in general, even though that was how theologians and churchmen understood “Cum ex iniuncto” (1199) for some time. Local and sporadic attempts to control the distribution of Scriptural material among the common people during outbreaks of ‘heresy’ (in the Languedoc or the Rhineland among Cathars and Waldensians, for example) or periods of religious tension have been taken by (mainly Protestant) church historians as proof that the medieval Roman Church officially opposed vernacular Bibles. Yet these same prohibitions, almost all limited in scope and intent, can be read as proving precisely the opposite: that vernacular Scriptures circulated freely among lay and clerical readers alike, at least by the high Middle Ages – that is, among the literate elites of western Europe – and that the Church was concerned merely to ensure that it not be interpreted ‘incorrectly’ by less-educated and less ‘reliable’ readers (who could also be understood as ‘heretics’ for their independent reading practices and concomitant rejection of clerical authority, e. g., the Waldensians).1 2. The Texts The rather indiscriminate scholarship of the medieval compilers and translators who produced the many gospel harmonies or diatessera, Jacob van Maerlant’s “Rijmbijbel” (1271), based largely on Peter Comestor’s “Historia Scholastica”, or the Dutch “Historiebijbel” (between 1359 and 1390), a translation of both Hebrew and Christian Scriptures from the Vulgate into Dutch, heavily larded with material drawn from the “Historia Scholastica”, helped produce the later bad reputation of pre-Reformation vernacular Bibles – yet such pious (and often muddled) retellings were by no means the only form in which vernacular biblical texts were available in the later Middle Ages. There were many German versions of biblical texts. The German Gospels of Mathew of Beheim, dated 1343, were based on a new translation of around 1300. Particularly in Germany, there was already in the fourteenth 1
Much of this discussion is based on my article: The Contested History of a Book. The German Bible of the Later Middle Ages and Reformation in Legend, Ideology, and Scholarship, in: Journal of Hebrew Scriptures 9, 2009, article 13, p. 1–37.
Protestant “Geschichtsklitterungen”
179
century a complete Middle High German New Testament, the “Augsburg Bible” of 1350. The Bohemian “Codex Teplensis” of around 1400 is a German New Testament, and from the same region we have the even more famous “Wenceslaus Bible” of between 1389 and 1400, which contains no New Testament material. A Munich manuscript contains fragments of a contemporary Old Testament and there are separate books of both Testaments in German from that time. In fact, the end of the fourteenth century, in the wake of the Black Death, was a period of intense translation and reading activity. Many German manuscripts of the Psalter survive from this period, as well as new German versions of Genesis, Kings and various prophets. At least three new translations of the Gospels and of Acts, various epistles and the Book of Revelation date from this era. The best known German Psalter of the later Middle Ages was that of the Meistersinger Heinrich von Mügeln (between 1365 and 1370), which included Nicholas of Lyra’s highly sophisticated exposition by way of a commentary. Heinrich was also court poet to Emperor Charles IV. Here the nexus of German scripture and high politics becomes visible: Heinrich broke with his patron over the 1369 imperial prohibition of new German translations of religious books. This was followed in 1375 by an even more sweeping papal effort to ban vernacular Scripture in Germany. Added to the 1409 Constitutions of Oxford, which effectively banned the English Scriptures, we see a concerted effort in the generation following the Plague to clamp down on the ebullient market and demand for vernacular Scripture. That the English edict was enforceable in a small, unified island kingdom is not surprising; nor is the utter failure of the imperial and papal attempts in the fragmented, constitutionally decentral Holy Roman Empire. Henry’s German Psalter was immensely successful, despite (or perhaps because of) the ban. As Margaret Deanesly pointed out ninety years ago, the evidence of manuscript and later printed Bibles demonstrates the utter nullity of these efforts. In fact, fifteenth-century craftsmen, nuns, guild masters and parish priests had very free access to vernacular Bibles in most of Europe well before the Reformation and Luther’s claim to have freed the Bible and made it accessible to all. 3. The Translations The long-term continuity of German Bible translation in the Middle Ages cannot be better illustrated than by the form of the language used in the first printed German full Bible, the Strasbourg “Mentel Bible” of 1466.2 Even though the printer or corrector modified the archaic diction somewhat, it clearly belongs to the early fourteenth century, probably to Nuremberg. This antiquated translation has often been cited in polemical literature as typical of pre-Lutheran Bible translation. Yet the “Mentel Bible” also had its own quite orthodox merits, including the erudite prologues it adopted from late antique sources. The text was largely the work of a single author and dated, as the language itself shows, from the fourteenth century. The 2
Die erste deutsche Bibel 1–10, ed. by Wilhelm Kurrelmeyer (Bibliothek des Litterarischen Vereins in Stuttgart 234, 238, 243, 246, 249, 251, 254, 258–259, 266) Tübingen 1904–1915.
180
Andrew Gow
text is frequently decried as ‘wooden’ and ‘literal’, and has generally been held in lower esteem than later versions because it was translated from the Vulgate, not from the Greek and Hebrew originals. Of course, by the standards of medieval exegesis and theology, the Vulgate was the official text of the Bible, so a translation of it was not problematic and could not have been seen by laypeople or the clergy as anything other than responsible and adequate. Moreover, there were better German texts than that of the “Mentel Bible” available. As we shall see, Luther in fact drew heavily from the manuscript and printed tradition of German Bible from the fourteenth and fifteenth centuries. Bibles more attuned to that tradition were being printed in the north: an Old Testament was printed at Delft in 1477, modified from the “Historiebijbel” and minus the passages from Comestor and the Psalms. The latter appeared again in a 1480 printing in Schutken’s popular Netherlandish translation. Around 1478, two editions of the Bible in two different forms of Low German were printed at Cologne, one of which circulated widely in the Low Countries. The broad circulation of printed German Bibles in this period is demonstrated by an archiepiscopal edict of 1486 banning the printing of vernacular religious books at Mainz. As a result, one of the most important Low German Bibles appeared not in the Rhineland, where one might have expected it, but at Lübeck, in 1494, a monumental work that included much of Lyra’s gloss. After this time, Low German Bible printing recedes for some time, as Low German calques of the Luther Bible were printed until around 1621. It was only in the increasingly separate Low Countries that any Low German language – now Nederlands, or in English, ‘Dutch’ – survived as a ‘state language’, leading to the inevitable production of the Dutch “Statenbijbel” of 1637. 4. Diffusion Erich Zimmermann’s 1938 survey of the extensive evidence of clerical, noble and burgher ownership of Bibles, books of the Bible and historiated Bibles in the fifteenth century has not yet been replaced or even equalled. It is worth repeating his insistence that burghers, both men and women, frequently appear in the sources as owners of Bibles. The scribal workshop of Diebold Lauber in Hagenau, active 1427–1467, produced a large number of Bible manuscripts, mainly historiated Bibles. Their clients included burghers in the imperial cities, about whom we know the most, and in other cities. Zimmermann lists dozens of burgher owners of Bibles. As Zimmermann points out, vernacular Bible texts that were once in burgher hands are known to us largely because they were at some point donated, often as pious bequests, to monastic (mainly convent) libraries and thus were preserved; the less-expensive manuscripts and printed books that burghers typically owned (including Bibles) have not otherwise survived very well – they were not well protected and may have been read to pieces or otherwise come to harm. They did not represent substantial capital investments and thus were not as carefully guarded as luxury editions.
Protestant “Geschichtsklitterungen”
181
Printing contributed to the distribution and success of Bible translations, including Luther’s. As Michael Milway has shown, even the earliest printers generally printed only for a market, to meet demand; and the vast majority of works printed in the fifteenth century were manuals and devotional works printed for clerics, followed by primers printed for students, then works of biblical and devotional content.3 Uwe Neddermeyer discussed the relationship between manuscripts and printed books in this period in his authoritative 1998 “Habilitationsschrift”.4 He sees print versions largely as a function of pre-existing manuscripts: those books that existed in large numbers of manuscript copies were those most likely to be printed. Aside from the many tens of thousands of medieval Bible manuscripts still extant, his figures show that from 1450 to 1519, there were in the Empire 65 printed Latin editions of the Bible and 22 Germanic ones; in Italy 41 Latin editions and 14 Italian ones; in France 45 Latin editions and 1 French one, as well as 21 of the “Bible abrégée”; making for a total of as many as 20,000 copies of Germanic Bibles in the Empire; 13,450 Italian Bibles in Italy; 1,200 French Bibles in France as well as 23,700 “Bibles abrégées”.5 These figures leave out the much larger numbers of manuscript and printed partial, para- and quasi-Biblical texts (‘plenaries’ [lectionaries], historiated Bibles, devotional works, etc.) and single books or partial editions of the Bible – and because these have not yet been adequately surveyed, we can only guess at their numbers as a multiple of the number of printed Bibles. Not one of the 22 Germanic Bibles printed before 1522 received official licence from an episcopal or other ecclesiastical agency. A Latin Bible printed at Cologne in 1479 received the censor’s approval; the 1480 German one printed there did not. This was in spite of ongoing efforts all through the Middle Ages to prevent the Bible from falling into the ‘wrong’ (i. e., unlearned) hands (efforts that clearly met with less and less success), and even despite efforts to control such printing, such as the 1486 Mainz Edict, which stopped the printing of German Bibles at Mainz for ten years – but nowhere else. We may say with assurance that in the later fifteenth and early sixteenth centuries, Biblical material was widespread, popular and well known among literate townspeople, clerics and nobles alike, especially in the Empire.6 Full Bible trans3 4
5 6
Michael Milway, Forgotten Best-Sellers from the Dawn of the Reformation, in: Continuity and Change. The Harvest of Late-Medieval and Reformation History. Essays presented to Heiko A. Oberman on his 70th Birthday, Leiden 2000, p. 113–142. Uwe Neddermeyer, Von der Handschrift zum gedruckten Buch. Schriftlichkeit und Leseinteresse in Mittelalter und in der frühen Neuzeit. Quantitative und qualitative Aspekte 1–2 (Buchwissenschaftliche Beiträge aus dem deutschen Bucharchiv München 61, 1–2) Wiesbaden 1998. Neddermeyer thus corrects the obsolete figures of Hans Rost, Die Bibel im Mittelalter. Beiträge zur Geschichte und Bibliographie der Bibel, Augsburg 1939, p. 418 f. Neddermeyer, Handschrift (as note 4), 1, p. 461. See Franz Falk, Die Bibel am Ausgange des Mittelalters, ihre Kenntnis und ihre Verbreitung (Görres-Gesellschaft zur Pflege der Wissenschaft im katholischen Deutschland. Vereinsschrift 1905, 2) Cologne 1905; and Erich Zimmermann, Die deutsche Bibel im religiösen Leben des Spätmittelalters (Neue Beiträge zur Geschichte der deutschen Bibel im Mittelalter 8) Potsdam 1938.
182
Andrew Gow
lations usually belonged to wealthy burghers, the gentry/nobility and religious houses (Brethren of the Common Life, etc.), with relatively large numbers of German Bibles showing up in inventories especially for the period 1500 to the Reformation. Perhaps the availability of printing presses in the German-speaking world facilitated this greater distribution. Because they were under the direction of a warden or house confessor, nuns had relatively good access to vernacular translations. In those important female houses whose library catalogues have survived, we notice the existence not merely of many vernacular works of Biblical piety and devotion, but also of vernacular Bibles.7 II. THE PROTESTANT PARADIGM. BIBLES AND THEIR FAMA IN CONFESSIONAL SCHOLARSHIP As we have seen, one of the most persistent legends regarding the Bible in the Middle Ages – both among the general public and among scholars – is the notion that the Roman church forbade or banned reading of the Bible in the vernacular. A corollary of this legend is the idea that Luther ‘freed’ the Bible for the laity by translating it into the vernacular – as though it had not ever been available –, in 1522 (the ‘September Testament’). According to this view, the thousands of medieval manuscript German Bibles and dozens of German editions of the Bible printed before 1522 might just as well never have existed. Protestant scholars of the Reformation were for many generations, and until quite recently, remarkably resistant to reassessing the importance of the Luther Bible. Some recent Lutheran commentators who have been willing to abandon the claim that it represented a political breakthrough in the democratization of religion have nevertheless insisted that the Luther Bible did represent a theological and cultural watershed.8 We might revise that rather partisan confessional opinion and refer to particular theological interpretations, and suggest not that Luther was finding the true meaning and thus revolutionizing Bible translation – as generations of Lutherans have held – but rather that his translation implied a particular ‘take’ on Scripture, or at least on select theologically sensitive passages, one that resonated with his followers. Scholarship has laid to rest the notion that Luther relied exclusively on the ‘original Greek’ text of the New Testament in his translation – a legend that placed more weight on Erasmus’ rather faulty 1516 edition of the New Testament in Greek and on Luther’s use of it than either can bear, ignores Luther’s reliance on both earlier German translations and the Vulgate, and gives him more credit as a philol7
8
See Andrew Gow, Challenging the Protestant Paradigm. Bible Reading in Lay and Urban Contexts of the Later Middle Ages, in: Thomas J. Heffernan/Thomas E. Burman (Eds.), Scripture and Pluralism. The Study of the Bible in the Religiously Plural Worlds of the Middle Ages and the Renaissance (Studies in the History of Christian Thought 123) Leiden 2005, p. 161–191, p. 181–183. Thomas Kaufmann, Vorreformatorische Laienbibel und reformatorisches Evangelium, in: Zeitschrift für Theologie und Kirche 101, 2004, p. 138–174.
Protestant “Geschichtsklitterungen”
183
ogist than he deserves. Specialists including Volker Leppin, the Professor for Recent Church History at Tübingen, now argue that the Protestant-nationalist German claim, masquerading as linguistic scholarship, that Luther’s German Bible formed or even invented the standard form of early modern German is at the very least exaggerated: after all, Luther himself claimed to have based his diction on the language already being spoken by the common man in the street; he drew heavily on earlier translations; and the prestige of his version was due as much to its association with the theological and charismatic aura of the great Reformer as to any other factor. 1. Historical Survey The Nuremberg City Library acquired its first (almost) complete Bible in Latin in the 1420s9, and a very large collection of German Bibles and other books from the immense library of the Dominican convent of St. Catherine after the Reformation. It therefore inherited a large number of medieval German Bible manuscripts, and provided the materials for an exhibition organized by the great bibliographer Georg Panzer in 1777 of the pre-Lutheran German Bibles (manuscript and printed) extant in that library. This exhibition was a contribution to a lengthy historical debate on the topic of the medieval German Bible and its importance relative to Luther’s translation that reaches back to the early eighteenth century. Earlier generations of German scholars were, in fact, able to debunk traditional Lutheran narratives that took Luther’s polemic about the inaccessibility of the Bible seriously.10 Eighteenth-century scholars were often surprised to discover that German Bibles had been circulating in large numbers well before Luther’s translation, so steeped were they in a myth started by Luther himself.11 The Lutheran Orthodox theologian Johann Friedrich Mayer (1701), the Lutheran Orthodox theologian and professor of theology at Leipzig, Christian Friedrich Boerner (1709), the Archdeacon of the Großmünster at Zurich, Johann Baptist Ott (1710), and the early Pietist theologian Johann Melchior Krafft (1714 and 1735) all produced works on German Bibles before Luther.12 In 1719, the Lutheran theologian Joachim Ernst Berger wrote: “Aus diesem also, was ich stückweise und nach der Wahrheit fürgebracht, ersieht ein jeglicher für sich selbst, daß unser seliger Lutherus wol nicht der Erste, der die Bibel in die deutsche Sprache übersetzt, wie viele glauben und dafür halten mögen.”13 In 1737, 9 10 11 12 13
See Gow, Challenging (as note 7). See, for example, the survey of earlier scholarship that emphasized the large number and broad diffusion of German Bibles before the Reformation in Kropatschek, Schriftprinzip (as note 26), p. 136–165, esp. p. 136 ff.; Rost, Bibel (as note 4), p. 37–66, 314–316. Rost, Bibel (as note 4), p. 311. Listed but not commented on by Rost, Bibel (as note 4), p. 317 f. From this material that I have brought forth piece by piece and according to the truth of the matter, anyone can see for himself that our revered Luther was not the first to translate the Bible into German, as many believe and would have him be. Joachim Ernst Berger, Instructorium
184
Andrew Gow
Lutheran minister and historian of philosophy Johann Jakob Brucker wrote: “Unsere Gottesgelehrten haben sich geirrt, wenn sie geglaubet, vor Lutheri Übersetzung wären nur drey andere deutsche herausgekommen.”14 The Lutheran pastor and scholar Johannes Nast published in 1767 a short piece about the six earliest German printed Bibles, with a brief survey of later ones.15 The great bibliographer Georg Wolfgang Panzer surveyed pre-Lutheran German Bibles in 1777.16 And even the anti-Enlightenment defender of Lutheran Orthodoxy, the Hamburg minister Johann Melchior Goeze, a great Bible collector, published a similar piece in 1775 about the printed Low German Bibles.17 It was important to these anti-Enlightenment intellectuals to document the large number and popularity of German Bibles in the Middle Ages as part of a strategy to undermine progressivist Enlightenment denigration of the Middle Ages as a time of clerical obscurantism. Perhaps because this position looked so hopeless to later scholars, none of this pioneering scholarship gets cited other than in specialist volumes like Rost’s.18 Leopold von Ranke, in an 1820 letter to his brother, the Lutheran theologian Friedrich Heinrich Ranke, struck a more nuanced and historicist note when he wrote: “Denn obwohl das Evangelium ganz ursprünglich durch Gottes Gnade Luthern geoffenbaret worden, so ruht doch der Erfolg der Mittheilung noch auf ganz andren Gründen. Nur das trockene Holz faßt sogleich die Flamme.”19 For Ranke, the preconditions for Luther’s Reformation to succeed were specifically historical ones, which he separated neatly from revelation. If the separation of History from Church History has merits, they are to be seen in this type of analysis – even if Rankean history later became so soaked in politics as to end up tone-deaf regarding religious phenomena.
14
15 16 17 18 19
Biblicum, Oder Unterricht von den Deutschen Bibeln […], Berlin 21719, p. 5, in Munich UB; cited from Rost, Bibel (as note 4), p. 310. Our learned divines have been in error, when they have believed that before Luther’s translation only three others had appeared. Jakob Brucker, Abhandlungen von einigen alten deutschen Übersetzungen der Hl. Schrift […], Leipzig 1737, p. 22; cited from Rost, Bibel (as note 4), p. 310. Johannes Nast, Historisch-critische-Nachrichten von den sechs ersten teutschen Bibel-Ausgaben […], Stuttgart 1767. Georg Wolfgang Panzer, Litterarische Nachricht über die allerältesten deutschen Bibeln aus dem funfzehenden Jahrhundert, welche in der öffentlichen Bibliotheck der Reichsstadt Nürnberg aufbewahret werden, Nuremberg 1777. Johann Melchior Goeze, Versuch einer Historie der gedruckten niedersächsischen Bibeln vom Jahr 1470 bis 1621, Halle 1775. Rost, Bibel (as note 4), p. 317–320, lists dozens of early scholarly works on pre-Lutheran German. Even though the Gospel was revealed by God’s grace originally to Luther, the success of the message was based on completely different grounds. Only dry wood is ignited immediately when exposed to flames. From late March, 1820. Leopold von Ranke, Sämmtliche Werke 1–54, ed. by Alfred Dove, Leipzig 1867–1890; 53/54: Zur eigenen Lebensgeschichte, Ausgewählte Briefe, p. 88–90, here p. 89; the translation in Leopold von Ranke, The Secret of World History. Selected Writings on the Art and Science of History. ed. and transl. by Roger Wines, New York 1981, p. 240 f., is adequate but renders the last sentence in a slightly less satisfactory way.
Protestant “Geschichtsklitterungen”
185
2. The “Kulturkampf” in Scholarship The high (or low) point in the debate about the medieval German Bible and the importance of the Luther-Bible came in the hundred years from the middle of the nineteenth to the middle of the twentieth century, the heyday of German nationalism in its “kulturkämpferisch” and later forms. Catholics such as Jean-Baptiste Malou (1809–1864), professor of theology at Louvain and later bishop of Bruges, and Johannes Janssen (1829–1891)20 emphasized the quality and quantity of religious and Biblical teaching in the later Middle Ages, and the large circulation of vernacular Bibles. In 1883, the Protestant church historian Wilhelm Krafft entered the lists with a short piece (published as a monograph) arguing that the large number of editions of the German Bible before Luther proves that it was not merely kept in the libraries of princes and religious houses or schools, but that it was read “in accordance with the repeated urgings of the editors and other Christian writers by educated laypeople”. For example, he cites the editor of the 1480 Cologne Bible, who wrote in his preface that all ‘good hearts’, clerics and laypeople, who see and read this Bible should unite themselves with God and ask the Holy Spirit, master of this text, to help them to understand this translation according to His will and for the salvation of their soul. Other editors of German Bibles and writers of the later fifteenth century also recommended that their readers read for themselves in the Bible.21 The main adversary of these scholars who took a positive approach to the medieval German Bible was the conservative Lutheran church historian, apologist and defender of the great originality and singularity of Luther’s Bible translation, Wilhelm Walther (1846–1924). Janssen’s and Walther’s work is packed with information, but so seriously biased that it now figures only in accounts of historiographical controversies and in learned footnotes. In 1891, the formidable Walther attacked both his Protestant and Catholic colleagues, defending Lutheran orthodoxy and cultural hegemony against an imaginary charge of ‘plagiarism’ (announced in an overwrought article title), asserting that Luther’s translation was original and entirely sui generis, and did not draw on the fourteenth-century (manuscript) tradition that was first printed in the 1466 “Mentel Bible”.22 As early as 1929, the great “Germanist” and pioneer of cultural history Friedrich Ohly demonstrated that this claim certainly was not true. He called for (and actually started to perform) a comparative study of the language in Luther’s Bible with that of the Mentel and other pre-Lutheran translations. His preliminary conclusions were that Luther relied heavily on the “Mentel Bible” for the bulk of his translation; the main differences over the bulk of the text consist in Luther modernizing the fourteenth-century diction and vocabulary of the Mentel version. 20 21 22
Johannes Janssen, Geschichte des deutschen Volkes seit dem Ausgang des Mittelalters 1: Deutschlands allgemeine Zustände beim Ausgang des Mittelalters, Freiburg 19/201913 (first 1876), esp. on vernacular Bibles p. 78 ff. Krafft, Bibel (as note 25), p. 6. Wilhelm Walther, Luthers Bibelübersetzung kein Plagiat, Erlangen/Leipzig 1891; reprinted in id., Zur Wertung der deutschen Reformation. Vorträge und Aufsätze, Leipzig 1909, p. 123–169.
186
Andrew Gow
More recently, Julie Winter has shown just how unconvincing were Walther’s attempts to refute the arguments of Krafft and Wedewer about Luther’s massive use of the printed German Bible in her 1998 book “Luther Bible Research in the Context of Volkish [sic!] Nationalism in the Twentieth Century”.23 To translate Ohly’s findings into our terms: the main differences are in diction and in the translation of theologically key passages, where Luther’s choice of words is based more on theological than on philological grounds – so Luther’s work differed from the earlier versions in that it was both a linguistically newer translation and a theologically Protestant translation. I think that Walther’s claim for the originality of Luther’s translation was as much as anything a feint (“Täuschungsmanöver”) to distract attention from the immense popularity of the German Bible in the later Middle Ages, an embarrassing fact that had to be abundantly clear by the end of the nineteenth century to anyone who could read. His claims about Luther’s original genius also neatly served a nationalist agenda that Walther found quite congenial, as would some of his spiritual successors, such as the Lutheran scholar and, for a time, enthusiastic Nazi Paul Althaus: Walther’s Luther was a learned and independent German Protestant who did not need to rely on the work of superstitious medieval papists. Walther was facing a phalanx of opponents both Catholic and Lutheran. He felt that German Bibles before Luther had no real importance, yet it was clear that they had been very popular as well as widely available. As the Catholic polemicist Jean-Baptiste Malou had already shown in 184624, as the Lutheran theologians Wilhelm Krafft in 188325 and Friedrich Kropatschek repeated in 190426, as the Catholic polemicist Franz Falk showed in 190527, and scholars Erich Zimmermann (1938) and Hans Rost (1939) demonstrated at length, vernacular Bibles circulated and were read widely, especially in the Empire and with the exception of fifteenth-century England, all through the later Middle Ages. Walther’s approach was, therefore, an evasion; he emphasized the uniqueness of Luther’s contribution in terms that made sense to humanistically educated nineteenth-century scholars: that is, as a philological and linguistic work of original genius, a claim that echoed down the decades through most of the twentieth century. Of all claims about Luther’s Bible, this essentially aesthetic one has proven to be the hardest to refute; it remained widespread in both Lutheran church history and even somewhat re-colon23 24
25 26 27
Julie M. Winter, Luther Bible Research in the Context of Volkish Nationalism in the Twentieth Century (Literature and the Sciences of Man 19) New York 1998, p. 35 f. Jean-Baptiste Malou, La lecture de la Sainte Bible en langue vulgaire, jugée d’après l’écriture, la tradition et la sainte raison […] 1–2, Leuven/Paris/Bonn 1846. This Catholic attack on the propaganda of the Protestant Bible Societies was widely circulated and even translated into German in 1846. Wilhelm Krafft, Die deutsche Bibel vor Luther, sein Verhältniss zu derselben und seine Verdienste um die deutsche Bibelübersetzung, Bonn 1883. Friedrich Kropatschek, Das Schriftprinzip in der lutherischen Kirche 1: Die Vorgeschichte. Das Erbe des Mittelalters, Leipzig 1904, esp. chapter 4: “Von der Verbreitung und dem Gebrauch der Bibel am Ausgang des Mittelalters”, p. 136–165. Falk, Bibel (as note 6).
Protestant “Geschichtsklitterungen”
187
ized the discipline of German literature studies (“Germanistik”) after the Second World War. 3. The Twentieth Century It is an historical irony that the only thorough monographic surveys of medieval German Bibles, by Erich Zimmermann (1938) and Hans Rost (1939), are not easy to find, and almost never appear in post-WWII literature regarding the Bible in the Middle Ages. The reasons for this scholarly amnesia or at least ignorance lie in both the vicissitudes of war and generational change, and in the whiggish historical narratives that became useful in the West during the course of the Cold War and came to dominate Anglo-American scholarship as a result. The supposed prohibition of merely reading vernacular scripture has been another stalking horse for those who would relegate the medieval vernacular Bible to obscurity. By 1904, Kropatschek announced: “Nimmt man alles Gesagte zusammen, so wird man in der Tat nicht mehr in dem alten polemischen Sinne sagen, die Bibel sei bei Theologen und Laien ein unbekanntes Buch gewesen. Je mehr man sich mit dem Mittelalter beschäftigt, desto mehr zerrinnt diese Legende.”28 Would that it were so! The great Lutheran church historian Karl Holl took the ‘anti-medieval’ (Protestant) side of this debate decisively in his 1923 volume “Luther”, the first of his influential “Gesammelte Aufsätze zur Kirchengeschichte”.29 Yet in 1927, the Hamburg “Germanist” Hans Vollmer, the editor of the massive series known as the “Deutsches Bibel-Archiv”, active in Hamburg for almost half a century before the Second World War, wrote in the foreword to an edition of a fifteenth-century glossed German excerpt from the Prophets: “Nicht selten unterschätzt man in protestantischen Kreisen die Bekanntschaft mit dem Bibelwort unter den Christen des Mittelalters.”30 However, this developing pre-war consensus among specialists in book history and “Germanistik” was cut short. The period from 1933 to 1945 produced a serious gap in the accessibility of German scholarship both to English-speakers and to German scholars, and the war did the rest.31 As late as 1972, the Göttingen church historian Hans Volz wrote, in his introduction to his edition of the 1545 Luther Bible: “Schöpften im ausgehenden Mittelalter die 28 29 30
31
Kropatschek, Schriftprinzip (as note 26), p. 163. Karl Holl, Gesammelte Aufsätze zur Kirchengeschichte 1: Luther, Tübingen 1923. It is quite common in Protestant circles to underestimate the knowledge of Biblical texts among late-medieval Christians. Hans Vollmer (Ed.), Ein deutscher glossierter Auszug des 15. Jahrhunderts aus den alttestamentlichen Propheten (Materialien zur Bibelgeschichte und religiösen Volkskunde des Mittelalters 3) Berlin 1927, p. xiii. Thomas Mann summed up what would be the attitude of German and non-German scholars alike to books published during the Third Reich: refusing an invitation to return to Germany after the war, he said that any books printed in Germany between 1933 and 1945 were less than worthless, smelled of blood and shame and should be pulped: Johannes F. G. Großer, Die große Kontroverse, Hamburg 1963, p. 31; and Jost Hermand/Wigand Lange (Eds.), “Wollt Ihr Thomas Mann wiederhaben?” Deutschland und die Emigranten, Hamburg 1999, p. 25.
188
Andrew Gow
breiten Volksschichten ihre Bibelkenntnisse vorwiegend aus Predigten oder aus Plenarien und Postillen, so war demgegenüber die damalige deutsche Bibel sowohl wegen ihres hohen Preises wie auch wegen ihrer großen sprachlichen Mängel weit davon entfernt, ein wirkliches Volksbuch darzustellen, wie sie es erst durch Martin Luthers einzigartiges Übersetzungswerk wurde.”32 It took almost another generation after the war for the tide to turn again. In the 1960s and 1970s, some German literary scholars (“Germanisten”) such as Olaf Schwencke returned to the topic and produced, mainly in specialized journals, a certain highly technical literature concerning late medieval knowledge and use of the Bible.33 Kenneth Strand published in 1966 a slim commemorative volume on the pre-Lutheran German printed Bibles.34 Such books simply did not find their way onto the shelves and into the footnotes of (Protestant) church historians in postwar Germany, never mind in the English-speaking world. In 1987, the Anglican priest and noted scholar Alister McGrath wrote that “no universal or absolute prohibition of the translation of scriptures into the vernacular was ever issued by a medieval pope or council, nor was any similar prohibition directed against the use of such translations by the clergy or laity”35, thus echoing earlier and perfectly orthodox Lutheran admissions of the same point by Friedrich Kropatschek in 190436 and Adolf Risch, in 192237, as well as Margaret Deanesly’s similar points in 1920. The most these older authors would admit is that the church was simply reluctant to allow unsupervised lay access to vernacular translations, the quality of which was difficult to control. By the end of the twentieth century, the situation was somewhat improved. Jaroslav Pelikan pointed out rather coolly, in 1996, that the legend that the trans-
32
33 34 35 36 37
D. Martin Luther, Die gantze Heilige Schrifft Deudsch. Wittenberg 1545. Letzte zu Luthers Lebzeiten erschienene Ausgabe 1–2, ed. by Hans Volz, Darmstadt 1972, 1, p. 41 (While the common people of the later Middle Ages drew their knowledge of the Bible mainly from sermons or ‘plenaries’ and postills, the contemporary German Bible was, by comparison, very far from being the sort of truly popular work – because of its high price and serious linguistic failings – that Martin Luther’s unique translation would be). E. g., Olaf Schwencke, Ein Kreis spätmittelalterlicher Erbauungsschriftsteller in Lübeck, in: Jahrbuch des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung 88, 1965, p. 20–58. Kenneth Albert Strand, German Bibles before Luther. The Story of 14 High-German Editions. In Celebration of the earliest vernacular printed Bible, 1466, Grand Rapids, MI 1966. Alister E. McGrath, The Intellectual Origins of the European Reformation, New York 1987, p. 124. Kropatschek, Schriftprinzip (as note 26), esp. chapter 3: “Das sogenannte Bibelverbot der Kirche”, p. 101–136, and chapter 4: “Von der Verbreitung und dem Gebrauch der Bibel im Mittelalter”, p. 136–165. “Den Vorwurf eines allgemeinen Bibelleseverbots oder gar der Feindschaft gegen die Bibel darf allerdings die katholische Kirche für die Vergangenheit als geschichtlich unberechtigt zurückweisen.” Adolf Risch, Luthers Bibelverdeutschung (Schriften des Vereins für Reformationsgeschichte Jahrgang 40, 135) Leipzig 1922, p. 10, with an exhaustive bibliographical summary of the entire history of the question in nineteenth-century scholarship from Malou on, in note 8 on p. 71 f.
Protestant “Geschichtsklitterungen”
189
lation of the Bible into German began with Luther is not true.38 In 2001, Owen Chadwick noted in a book addressed to a larger readership that there were many printed editions of the Bible before Luther: in Latin, 94; and he mentions 16 in German. As we know, there were 14 in early modern High German, 4 in early modern Low German, and 4 in early modern Netherlandish, for a total of 22 Germanic editions by 1518.39 Most recently, the current chair of Church history at Göttingen, Thomas Kaufmann, an avowed partisan of confessionally engaged scholarship, published a detailed account of pre-Lutheran vernacular Bibles and their articulation with Luther’s Bible translations – yet he refers to only one of the main historians of the pre-Lutheran German Bible cited above, Hans Rost (the only one who published on these topics after WWII), and thus seems unaware of (or indifferent to) the very substantial pre-existing scholarly work and debate on this topic.40 He also insists on the world-historical theological and cultural significance of Luther’s Bible translation, a point that maintains Wilhelm Walther’s ideological position while admitting that Walther was wrong on major points of substance. III. CONCLUSION. MEMORY AND LEGEND Legends begin with memorable deeds and occurrences. Luther’s 1522 ‘September Testament’ was immediately and wildly successful, selling out rapidly and experiencing multiple reprintings in the same year. As Johannes Cochlaeus, one of Luther’s fiercest opponents later wrote with some venom, “Luther’s translation was read (as the source of all wisdom, no less) by tailors and shoemakers, even women and simpletons, many of whom carried it around and learned it by heart, and eventually became bold enough to dispute with priests, monks, even masters and doctors of Holy Scripture about faith and the gospels.”41 This shocking scholar’s dystopia might or might not have been what Luther intended. But if the Bible was as widely known in the later Middle Ages as our evidence suggests, then where did the legend of its unavailability come from? In his notorious 1543 pamphlet “On the Jews and their Lies”, Luther said as an illustration to his charge that contemporary Jews knew nothing of ‘Moses’, that is of the Bible, and their ‘doctrine’ is nothing but the “additions of rabbis”, “[j]ust as among us [Christians] under the papacy the Bible became unrecognizable”.42 In his “Table Talk”, Luther is reported to have said that “Thirty years ago, the Bible was un38 39 40 41 42
Jaroslav Pelikan, The Reformation of the Bible, the Bible of the Reformation. A Catalog of the Exhibition by Valerie R. Hotchkiss/David Price, New Haven/Dallas 1996, p. 49. Owen Chadwick, The Early Reformation on the Continent, Oxford/New York 2001, p. 1. Chadwick cites only 16 German Bibles before 1522 and does not mention the Low German ones, which were equally important. Kaufmann, Laienbibel (as note 8). Johannes Cochlaeus, Historia Martini Lutheri […], Deutsch von Johann Chr. Hueber, Ingolstadt 1582, p. 120. D. Martin Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe, Weimar 1920, 53, p. 523: Gleich wie bey uns unter dem Papstum die Biblia unkendlich geworden ist.
190
Andrew Gow
known, the prophets were not spoken of and were considered impossible to understand. When I was twenty years old, I had never seen a Bible. I had no idea there were Gospels or Epistles beyond those in the postills. Then I found a Bible in the library and reread it many times, to the great wonderment of Doctor Staupitz.”43 He claimed in his exegesis of the book of Zechariah in 1527 that under the old Church, the Bible was openly contradicted by the Church and thus kept hidden away, “unter der Bank”, beneath the bench.44 Yet Luther’s opponent at the Leipzig Disputation of 1519, Johannes Eck, claimed to have read almost the entire Bible by the time he was ten years old. The Xanten chaplain Adam Potken had to learn the four Gospels by heart in his youth in the 1470s. He read excerpts from the Old and New Testaments daily with his eleven- and twelve-year-old fellow pupils.45 Even so careful a scholar as Thomas Kaufmann repeats some of the elements of the ‘hidden Bible’ narrative, citing, for example, Klaus Schreiner’s report, attributed to a general, unspecified past, of a clerical play on Matthew 7,6 according to which the church did not want to “throw the pearls of the Bible’s secrets before the swinish laity”.46 Memory plays tricks. An old, partisan man’s reminiscences about a period for the putative end of which he imagined himself to be a cause might not be the best source of information for historical inquiry. However, memory in the form of fama seems to have helped create and maintain one of the longest-lasting and most triumphalist legends in German Lutheran lore about the Reformation, one that has somehow managed to survive centuries of careful, source-based scholarship. It has cropped up again in nearly every generation since the first attacks on the legend by anti-Enlightenment proponents of establishment Lutheran Orthodoxy in the eighteenth century. The complex mechanisms by which those conservative theologians occupied the opposite side of the debate from German nationalists and “völkisch” thinkers in the later nineteenth and twentieth centuries simply demonstrates how complex, fragile and volatile memory is, and how easily it is enrolled under evernew banners to serve this or that cause.
43
44 45 46
D. Martin Luther’s Sämmtliche Schriften 22: Die Colloquia oder Tischreden 3, ed. by Karl Eduard Förstemann, Leipzig 1846, p. 229; see also “Die Biblia war im Papstum den Leuten unbekannt.” WA Tischreden 3, No. 2844b; cf. the Latin version in Aurifaber’s source, Anton Lauterbach’s collection: Biblia olim erant incognita. Luther, WA Tischreden 5, No. 6278. WA 23, 606. Janssen, Geschichte (as note 20), p. 81. Kaufmann, Laienbibel (as note 8), p. 138, citing Klaus Schreiner, Laienbildung als Herausforderung für Kirche und Gesellschaft. Religiöse Vorbehalte und soziale Widerstände gegen die Verbreitung von Wissen im späten Mittelalter und in der Reformation, in: ZHF 11, 1984, p. 257–354, esp. p. 290 f.; and id., Laienfrömmigkeit – Frömmigkeit von Eliten oder Frömmigkeit des Volkes? Zur sozialen Verfaßtheit laikaler Frömmigkeitspraxis im späten Mittelalter, in: id. (Ed.), Laienfrömmigkeit im späten Mittelalter. Formen, Funktionen, politisch-soziale Zusammenhänge (Schriften des Historischen Kollegs 10) München 1992, p. 1–78, esp. p. 25.
ERINNERUNGSSPUREN UND EREIGNISKUMULATIONEN Die Nürnberger Juden im städtischen Gedächtnis 1350–1946 Johannes Heil Von der Verbrennung der Juden in den fränkischen Städten während der RintfleischPogrome am Ausgang des 13. Jahrhunderts bietet die Weltchronik Hartmann Schedels (1440–1514) eine Holzschnittillustration, die, ganz anders als es der Holzstecher Michael Wolgemut gedacht haben dürfte, in unseren Tagen ob ihrer erschreckend direkten Darstellung des Tötens zu einer vielfach reproduzierten Ikone mittelalterlicher Judenfeindschaft geworden ist. Das Hauptwerk der frühen Nürnberger Buchdruckkunst zeigt fol. 220v inmitten eines in einer Kuhle hoch lodernden Feuers, das ein Knecht mit frischen Holzscheiten versorgt, mehr als zwanzig überwiegend männliche Juden, die – so will es scheinen – das grausame Geschehen in irritierender Passivität über sich ergehen lassen. Einige immerhin setzen zu einem Schrei an, andere schauen dem eigenen Sterben teilnahmslos zu, zweien scheint gar ein Lächeln ins Gesicht geschrieben. Wo Michael Wolgemut an einigen Gesichtern der Szene und auch sonst unter Beweis stellte, dass er sehr wohl im Stande war, Züge des Schmerzes und des Entsetzens auszuführen, könnte die unerwartete Anteilnahmslosigkeit in den anderen Gesichtern vielleicht ganz bewusst gesetzt gewesen sein. Womöglich schlägt sich hier im Bild das Erstaunen über die verbreitete Kunde von der immer wieder beobachteten unbeirrten Haltung der Juden angesichts der Alternative Taufe oder Tod nieder. Allerdings erläutert der beigegebene Text nichts dergleichen und vermerkt in lakonischer Kürze: Die iuden die sich an vil enden gemeret hetten sind in dem ersten jar könig albrechts von irer böser handlung wegen zu Nürmberg Würtzburg Rotenburg und an vil enden daselbst ub[erall] verprennt worden.1 Danach bleibt der Betrachter mit dem Eindruck zurück, dass es den Juden selbstverständlich gewesen sein muss, verbrannt zu werden, oder gespiegelt: dass es in diesen Jahren gewöhnlich und ebenso selbstverständlich abbildbar war, dass Juden zur Strafe für nicht weiter benannte „böse Handlung“ verbrannt würden. Gewiss, mit diesem und gerade einmal fünf weiteren Einträgen spielten die Juden, auf das Gesamte betrachtet, in Schedels opulenter Weltchronik nur eine Randrolle. Ihre Stellung war aber doch bedeutsam genug, um mit aufwendigen Holzstichen bebildert zu werden, im Fall der nicht minder bekannten Darstellung des „Martyriums“ des Simon von Trient 1475 gar über die gesamte Breite des Blattes 1
Hartmann Schedel, Weltchronik (Liber Chronicarum), Nürnberg 1493 (http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/is00309000), fol. 220v. Die lateinische Fassung (urn:nbn:de:bvb:12bsb00034024–1) führt fol. 220v immerhin weiter aus: non sexui non etati parcentes infelicem gentem aliquot milia periisse feruntur servati infantes baptismi gratia.
192
Johannes Heil
hinweg.2 Und bedenkt man, dass diese großformatige Chronik aus den Federn eines ganzen Autoren- und Künstlerkonsortiums unter Leitung des Arztes Schedel, die im Auftrag Nürnberger Kaufleute entstand, gemessen am damaligen Stand der Satzund Bildtechnik ein ungemein aufwendiges Unternehmen war3, dann gewinnt die Präsenz der Juden darin ein ganz eigenes Gewicht. Die Chronik wollte nichts verschweigen, vielmehr und im Unterschied zu sonstigen Darstellungen, die nur das Handeln des Gegenübers als grausam markieren, ganz bewusst die selbst verübte Gewalt ins Bild setzen.4 So darf man bis zur Annahme gehen, dass sie als letztlich ganz konventionelle Sinnproduktion realisierte, was die Finanziers und prospektiven Abnehmer des Werks erwarteten. Die Gewalt gegen Juden, wie sie in Schedels Meisterwerk von 1493 sehbar wird, gehörte demnach ebenso selbstverständlich zu ihrem Erwartungshorizont wie der schöne Prospekt der Stadt Nürnberg und die Bilder anderer Städte nah und fern.5 Denn sie war so gewöhnlich, wie die Bebilderung dazu austauschbar war: der Holzschnitt zum Judenmord von 1298 fand zur Illustration des angeblichen Deggendorfer Hostienfrevels von 1336 und des Sternberger Hostienfrevelvorwurfs 1490 gleich nochmals Verwendung.6 Damit entfaltete die Szene eine so sicher nicht beabsichtigte oder abgesehene Langzeitwirkung, die, anders als in der neueren Gewaltforschung gelegentlich postuliert, dem Beobachter das Bewusstsein der Betroffenen sehr wohl erschließt. All das war Thema eines eigenen Beitrags7, lässt sich aber auch für einen anderen Zusammenhang fruchtbar machen, von dem hier folgend gehandelt werden soll: Die Nürnberger Geschichtsschreibung und die besondere Rolle der Juden darin. Gemessen an ihrer Bedeutung ist die Geschichte der Nürnberger jüdischen Gemeinden des Mittelalters in der jüngeren Forschung bislang eher unzureichend be2 3
4
5 6 7
Ebd., fol. 254v. Vgl. Stephan Füssel, Die Welt im Buch. Buchkünstlerischer und humanistischer Kontext der Schedelschen Weltchronik von 1493, Mainz 1996; Christoph Reske, Die Produktion der Schedelschen Weltchronik in Nürnberg (Mainzer Studien zur Buchwissenschaft 10) Wiesbaden 2000; Reinhard Stauber, Hartmann Schedel, der Nürnberger Humanistenkreis und die „Erweiterung der deutschen Nation“, in: Johannes Helmrath/Ulrich Muhlack/Gerrit Walther (Hgg.), Diffusion des Humanismus. Studien zur nationalen Geschichtsschreibung europäischer Humanisten, Berlin 2002, S. 159–185. Vgl. Daniel Baraz, Medieval Cruelty. Changing Perceptions. Late Antiquity to the Early Modern Period (Conjunctions of Religion and Power in the Medieval Past) Ithaca 2003, S. 7 f.; Manuel Braun/Cornelia Herberichs, Gewalt im Mittelalter. Überlegungen zu ihrer Erforschung, in: dies. (Hgg.), Gewalt im Mittelalter. Realitäten – Imaginationen, München 2005, S. 7–37, hier S. 31; Silke Tammen, Gewalt im Bilde. Ikonographien, Wahrnehmungen, Ästhetisierungen, in: ebd., S. 307–339; Carolyn Walker Bynum, Violent Imagery in Late Medieval Piety, in: Bulletin of the German Historical Institute [Washington] 30, 2002, S. 3–36. Braun/Herberichs, Gewalt (wie Anm. 4), S. 30. Schedel, Weltchronik (wie Anm. 1), fol. 230v.; vgl. Braun/Herberichs, Gewalt (wie Anm. 4), S. 15–18, 21 f. Vgl. dazu Johannes Heil, Das unsichtbare Kollektiv und der gesichtslose Henker. Die Darstellung der Judenverbrennung in Hartmann Schedels „Nürnberger Chronik“, in: Michael Kohlstruck u. a. (Hgg.), Bilder kollektiver Gewalt – Kollektive Gewalt im Bild. Annäherungen an eine Ikonographie der Gewalt. Für Werner Bergmann zum 65. Geburtstag, Berlin 2015, S. 345–355.
Erinnerungsspuren und Ereigniskumulationen
193
handelt worden. Zwar reichen ihre Ursprünge nur in das 12. Jahrhundert zurück und stehen damit hinter den Anfängen der Gemeinden in den Bischofsstädten am Mittelrhein oder in Regensburg und Würzburg zurück, aber bis zu ihrem Ende mit der 1498/99 erfolgten Vertreibung zählte die Nürnberger Gemeinde zeitweilig zu den größten in Aschkenas. So bietet ihre Geschichte auch besonders gute Einblicke in die Entwicklung und das Leben einer jüdischen Minderheitengemeinschaft in christlicher Umgebung. Nach dem Bericht des Otto von Freising waren die ersten Juden als Flüchtlinge vor den Verfolgungen des 2. Kreuzzugs nach Nürnberg gekommen. Nach raschem Anwachsen wurde die Gemeinde dann zweimal – 1298 während der Rintfleisch-Verfolgungen und wieder während der Pestzeit 1349 – fast vollständig ausgelöscht. Danach gewann sie ihre vorherige Größe und Bedeutung nicht mehr zurück und ihre Entwicklung endete mit der Vertreibung der Juden in den Jahren 1498/99. Diese Geschichte ist dank einer Reihe von Studien der Jahre 1878 bis 1930 in ihren Grundzügen bekannt gemacht worden8, während wiederholte Versuche zu Gesamtdarstellungen nach 19459 nur punktuell über den älteren Stand hinausgelangt sind.10 Damit steht eine systematische, modernen Ansprüchen genügende Gesamtdarstellung der reichen Nürnberger jüdischen Sozial- und Kulturgeschichte weiterhin aus. 8
9
10
Hugo Barbeck, Geschichte der Juden in Nürnberg und Fürth, auf Grund des vorhandenen gedruckten Materials, der in den königl. Archiven zu Nürnberg und Bamberg befindlichen Akten und Urkunden, der Archivalien im Cultusgemeindebesitz etc., Nürnberg 1878 (online UB Frankfurt 2009: urn:nbn:de:hebis:30–180010812000); Adolf Kurländer, Geschichte der Juden in Franken mit besonderer Berücksichtigung auf die beiden Städte Nürnberg und Fürth auf Grund d. vorh. gedr. Materials, der in d. kgl. Archiven zu Nürnberg u. Bamberg befindl. Akten u. Urkunden, d. Archivalien im Cultusgemeindebesitz etc. hrsg. u. bis auf d. Neuzeit erg., Fürth 1887 (online UB Frankfurt 2009: urn:nbn:de:hebis:30–180013176001); Ernst Mummenhoff, Die Juden in Nürnberg bis zur ihrer Austreibung im Jahre 1499, in: ders., Gesammelte Aufsätze und Vorträge zur Nürnberger Ortsgeschichte 1 [mehr nicht erschienen], hg. vom Verein für Geschichte der Stadt Nürnberg, Nürnberg 1931, S. 301–334; ders., Die Juden in Nürnberg bis zu ihrer Austreibung im Jahre 1499 in topographischer und kulturhistorischer Beziehung, in: ebd., S. 335–366; Joshua Podro, Nuremberg, the Unholy City, London 1937. Arnd Müller, Geschichte der Juden in Nürnberg 1146–1945, Nürnberg 1968; Zvi Avneri u. a., Art. Nürnberg, in: Zvi Avneri (Hg.), Germania Judaica 2, 2, Tübingen 1968, S. 598–613; Kuno Ulshöfer, Zur Situation der Juden im mittelalterlichen Nürnberg, in: Manfred Treml/Josef Kirmeier (Hgg.), Geschichte und Kultur der Juden in Bayern 2: Aufsätze (Veröffentlichungen zur bayerischen Geschichte und Kultur 17/88) München u. a. 1988, S. 147–160; Alfred Eckert u. a. (Hgg.), Geschichte der Juden in Nürnberg und Mittelfranken, Nürnberg 1988; Liane Zettl (Bearb.), Juden in Nürnberg. Geschichte der jüdischen Mitbürger vom Mittelalter bis zur Gegenwart, Nürnberg 1993; Claudia Frieser/Birgit Friedel, „… di juden hi waren gesessen zu mittelst auf dem platz …“. Die ersten Nürnberger Juden und ihre Siedlung bis 1296, in: dies. (Hgg.), „… nicht eine einzige Stadt, sondern eine ganze Welt …“. Nürnberg. Archäologie und Kulturgeschichte, Büchenbach 1999, S. 52–70. Gut bearbeitet ist die Stellung der Juden in der Wirtschaft der Stadt, insb. dank der Arbeiten von Michael Toch; die wichtigsten davon zusammengefasst in: Michael Toch (Hg.), Peasants and Jews in Medieval Germany. Studies in cultural, social, and economic History, Burlington, VT 2003. Auf sicherer Grundlage stehen künftige Arbeiten auch für den gesamten Zeitraum 1350– 1500: vgl. Michael Toch, Art. Nürnberg und Art. Wöhrd, in: Mordechai Breuer u. a. (Hgg.), Germania Judaica 3, 2, Tübingen 1995, S. 1001–1044, 1665–1667.
194
Johannes Heil
Das kann dieser Beitrag nicht leisten; und er befasst sich mit einem Teilaspekt, aber auch einem besonderen Kennzeichen der Geschichte der Nürnberger Juden: ihrer nicht nur in den Bildern und Texten der Schedelschen Weltchronik, sondern auch sonst auffälligen, nämlich kontinuierlichen Präsenz in der Chronistik einer Stadt, die als eines der Zentren städtischer Historiographie des späten Mittelalters und der Frühneuzeit zu gelten hat.11 Dabei sind im Binnenraum der Stadt konzertierte Kräfte zu erkennen, bei denen die Interessen einzelner Ratsfamilien immer wieder in Spannung zu einer übergreifenden städtischen Geschichtspolitik gestanden haben.12 Während aus den Chroniken kaum Wesentliches für das zu gewinnen wäre, was der modernen Forschung im Interesse einer fundierten sozial- und kulturgeschichtlichen Durchdringung der Nürnberger jüdischen Geschichte aufgegeben ist, geht es in diesem Beitrag um die Weisen des Erinnerns und Erzählens dieser Geschichte, wie sie in Nürnberg auf der christlichen Seite nach der Mitte des 14. Jahrhunderts fassbar sind. Im Unterschied zu den Umgangsweisen mit der Vergangenheit an anderen Orten sind die dabei geformten Erzählungen im städtischen Gedächtnis Nürnbergs über das Jahr der Vertreibung der Juden 1499 hinaus erstaunlich präsent geblieben und in einem transgenerationellen Verständigungsprozess (sowie als Indikatoren für ein durchgehendes oder zumindest wiederkehrendes geschichtspolitisches Agieren im städtischen Binnenraum) intensiv fortgeschrieben worden. Am Anfang dieses Verständigungsprozesses steht das „Püchel von meim geslechet und von abentwr“ des Patriziers Ulman Stromer. Es deckt die Jahre von 1349 bis 1407 ab, also bis zu dem Jahr, als die Pest erstmals Nürnberg erreichte und die von den Stromers offenbar nur Ulman Stromers Sohn Jörg überlebte. Auf das für Nürnberg so ereignisreiche, zum Zeitpunkt der Abfassung zwei Generationen zu11
12
Zur städtischen und sonstigen Chronistik des späten Mittelalters vgl. Heinrich Schmidt, Die deutschen Städtechroniken als Spiegel des bürgerlichen Selbstverständnisses im Spätmittelalter, Göttingen 1958; František Graus, Funktionen der spätmittelalterlichen Geschichtsschreibung, in: Hans Patze (Hg.), Geschichtsschreibung und Geschichtsbewußtsein im späten Mittelalter (VuF 31) Sigmaringen 1987, S. 11–55; Rolf Sprandel (Hg.), Zweisprachige Geschichtsschreibung im spätmittelalterlichen Deutschland (Wissensliteratur im Mittelalter 14) Wiesbaden 1993; Heinrich Schmidt, Bürgerliches Selbstverständnis und städtische Geschichtsschreibung im deutschen Spätmittelalter. Eine Erinnerung, in: Peter Johanek (Hg.), Städtische Geschichtsschreibung im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit, Köln/Weimar/Wien 2000, S. 1–17; Regula Schmid, Geschichte im Dienst der Stadt. Amtliche Historie und Politik im Spätmittelalter, Zürich 2009, S. 15–19; vgl. auch Johannes Heil, Judenfeindschaft, Frömmigkeit und Gewalt im Mittelalter. Texte, Ereignisse und Deutungen, in: Michael Kohlstruck/Andreas Klärner (Hgg.), Ausschluss und Feindschaft. Studien zu Antisemitismus und Rechtsextremismus. Rainer Erb zum 65. Geburtstag, Berlin 2010, S. 17–37, 333 ff. Die Nürnberger städtische Chronistik, aus der im Folgenden nur für die Thematik einschlägige Beispiele besprochen werden können, bietet sich ausgesprochen heterogen dar. Es gehören dazu Arbeiten von Mitgliedern des Rats ebenso wie Auftrags- oder ratsnahe Werke und ferner enger gefasste Geschlechtergeschichten, in der Summe also über Generationen hinweg Produkte klar begrenzter Binnenmilieus, die auf äußere Impulse reagierten, sich aber in mehr oder weniger engen Kreisen betätigten. Vgl. Joachim Schneider, Heinrich Deichsler und die Nürnberger Chronistik des 15. Jahrhunderts (Wissensliteratur im Mittelalter 5) Wiesbaden 1991.
Erinnerungsspuren und Ereigniskumulationen
195
rückliegende Jahr 1349 verwendete Ulman Stromer allerdings nur wenige Zeilen, und die befassen sich ausschließlich mit den Juden. Neben topographischen Angaben zur Lage der Gassen und den dortigen Judenhäusern auf dem Areal der späteren Frauenkirche sowie am Zotenberg findet sich nur die knappe Notiz „Die Juden wurden verbrannt an Sankt Nikolaus Abend“13, ohne jede Angabe zu Hintergründen und Umständen des damaligen Geschehens. Da wird gerade einmal ein Ereignis berichtet und unterbleibt äußerlich betrachtet jede auch nur annähernde Bewertung oder Einordnung. Trotz der alles vernebelnden Kürze erscheint der Bericht für den Entwurf der eigenen Erzählung, mit der der Autor 1360 begonnen haben will, aber signifikant. Allein die Stellung der Ereignisse vom Dezember 1349, die Ulman Stromer als etwa zwanzigjähriger junger Mann erlebt haben müsste, ganz am Anfang dieser politisch durchfärbten Autobiographie und das Auslassen jeglichen Hinweises auf die anderen dramatischen Umstände jener Jahre – den Thronkampf auf Reichsebene und die davon bestimmte, schließlich niedergeschlagene innerstädtische Revolte sowie die eigene führende Rolle der Stromers auf Seiten der Sieger und Nutznießer – unterstreichen diese Ausnahmestellung.14 Das Nicht-Aufschreiben des Bekannten im Text liest sich auch heute noch als bewusst gesetzte Codierung, doch mangels Kenntnis der damaligen verschwiegenen Konventionen will eine wirklich befriedigende Deutung dieser Quelle heute nicht recht gelingen.15 Erkennbar ist noch, dass Ulman Stromer das Jahr 1349 als Einschnitt in der Geschichte seiner selbst, seiner Familie und seiner Stadt markieren und die Geschicke der Juden ebenso ausdrücklich in der Sache wie in den Einzelheiten unausgesprochen mit dem des eigenen Aufstiegs verknüpft wissen wollte. Denn diese – tatsächlich gegebene – Verbindung bleibt schlaglichtartig gesetzt und
13
14
15
Ulman Stromer, Püchel von meim geslechet und von abentewr 1349 bis 1407, hg. von Karl Hegel, Die Chroniken der fränkischen Städte. Nürnberg 1 (Die Chroniken der deutschen Städte vom 14. bis in’s 16. Jahrhundert) Leipzig 1862, S. 23–106, hier S. 25; vgl. Walter Vock, Ulman Stromer (1329–1407) und sein Buch. Nachträge zur Hegelschen Ausgabe, in: Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Stadt Nürnberg 29, 1928, S. 85–168; Joachim Schneider, Typologie der Nürnberger Stadtchronistik um 1500. Gegenwart und Geschichte in einer spätmittelalterlichen Stadt, in: Johanek, Geschichtsschreibung (wie Anm. 11), S. 181–203; Barbara Schmid, Schreiben für Status und Herrschaft. Deutsche Autobiographik in Spätmittelalter und früher Neuzeit, Zürich 2006, S. 67–71. Das Nürnberger Memorbuch verzeichnet die Namen von 562 Opfern; vgl. Siegmund Salfeld, Das Martyrologium des Nürnberger Memorbuches (Quellen zur Geschichte der Juden in Deutschland 3) Berlin 1898, S. 32–36, 170–180; Müller, Geschichte (wie Anm. 9), S. 33, nimmt in seinem „Die Austreibung von 1349“ überschriebenen Abschnitt an, dass die Zahl der Opfer ein Drittel der gesamten Nürnberger jüdischen Bevölkerung ausgemacht habe. Das gilt vor allem vor dem Hintergrund, dass spätere „autonome“, patrizische und mittelschichtige Familien- und Bürgerchroniken wie das Tuchersche Memorialbuch oder die Jahrbücher in den Fassungen durch Deichsler und andere sich im Unterschied zur Nürnberger Ratschronistik überhaupt nicht mit den Juden der Stadt befassten; vgl. Schneider, Typologie (wie Anm. 13). Zu Ulman Stromers Umgang mit dem eigenen Wissen vgl. auch Schneider, Heinrich Deichsler (wie Anm. 12), S. 7 f.
196
Johannes Heil
in der Sache unerklärt.16 Was Ulman Stromers kurzer Erzählung fehlt, sind Angaben zu den Akteuren der Ereignisse von 1349, bis hin zur Frage nach der eigenen Beteiligung oder der seiner Familienangehörigen.17 Auch ist keine Strategie, zumindest keine, die das Geschehene hätte erklären und rechtfertigen können, zu entdecken. Womöglich wollte der Chronist sich gerade darauf nicht einlassen und es, wenn es schon unumgänglich war, bei gezielt und so knapp wie möglich gesetzten Andeutungen und Bestandsaufnahmen belassen. So betrachtet wäre des Stromers ganz auf Reduzierung beschränkte Erzählstrategie aber schon in der übernächsten Generation gescheitert gewesen. Denn das Streben nach Rechtfertigung ist genau jenes Moment, das die folgende Nürnberger Historiographie nachliefernd immer wieder neu umgetrieben hat, ohne dabei je zu einer allseits befriedigenden Erzählung der Ereignisse von 1349 und überhaupt der Nürnberger jüdischen Geschichte zu gelangen. Die jüngeren Erzähler haben, gerade weil sie ein ums andere Mal den Erwartungen des Rats und der städtischen Gesellschaft genügen mussten, immer neue Varianten der Umstände geboten, dafür aber die Ereignisse von 1348/49 vernebelt und stattdessen unter anderen Daten weitere Ereignisse hinzugefügt.18 Was daraus folgte, war die Umschreibung der Nachricht vom Judenmord des Jahres 1349 zu einem nachgerade rechtsförmigen Umsiedlungsprojekt. Diese Tendenz findet sich schon recht zeitnah in einer vermutlich familieneigenen Notiz zur Handschrift des Stromer’schen Wappenbuchs aus dem 15. Jahrhundert, wonach der junge Ulman Stromer „von Rats wegen“ zum Kaiser gesandt worden sei, um über den Abbruch der verlassenen Judenhäuser zur Schaffung des nachmaligen Hauptmarktes um die Frauenkirche zu verhandeln. In der Notiz heißt es, „weil der Markt hier am Milchmarkt lag und die Stadt rasch wuchs, so dass der Markt zu klein war, während die Juden hier am jetzigen Markt lagen und wo jetzt unser Frauen Kirche steht ihre Synagoge (Schul) war, da sollte er [der Stromer] von Rats wegen den Kaiser bitten, dass man die Juden anderswo setzen ließe und dass man den Markt dort macht, wo er jetzt ist.“ Das markante Motiv der vertraulichen Nähe von Kaiser und Nürnberger Ratsmann knüpft an tatsächliche Vorgänge im Herbst 1349 an und wird auch in der späteren Chronistik wiederkehren.19 Die Notiz des Wappenbuchs 16
17
18 19
Danach gelangt dann auch eine moderne Betrachtung nur zu ungefähren Befunden, z. B. Rolf Sprandel, Chronisten als Zeitzeugen. Forschungen zur spätmittelalterlichen Geschichtsschreibung in Deutschland (Kollektive Einstellungen und sozialer Wandel im Mittelalter. N. F. 3) Köln 1994, S. 6: „1349 ist eine Epochenschwelle im Bewußtsein der Nachlebenden“. Dieser Eindruck wird noch durch die Tatsache verstärkt, dass das „Püchel“ eingangs verschiedene weitere Begebenheiten aus der Nürnberger jüdischen Geschichte bis 1390 auflistet, bevor dann zurück bei 1367 beginnend der Erzählfaden zur sonstigen Nürnberger Geschichte aufgenommen wird: Stromer, Püchel (wie Anm. 13), S. 25 f.; vgl. Schneider, Typologie (wie Anm. 13), S. 190. Das gilt nicht nur für die Nürnberger Chronistik; für Bern ist die Prüfung der Chronik Diebolds Schilling durch den Rat vor Aufnahme in das Archiv der Stadt belegt, vgl. Schmid, Geschichte (wie Anm. 11), S. 65–67. Zitiert nach Hegel, Chroniken. Nürnberg 1 (wie Anm. 13), Einleitung, S. 3–20, hier S. 7; die Nachricht bezieht sich auf die Gesandtschaft Ulrich Stromers zur Goldenen Rose im Auftrag des restituierten patrizischen Rats Mitte November 1349, in deren Ergebnis Karl IV. das Markt-
Erinnerungsspuren und Ereigniskumulationen
197
verschweigt dann aber, dass 1349 erst mit dem König über den Platz verhandelt (16. November) und dann zum Judenmord (5. Dezember) geschritten wurde; stattdessen klingt es so, als hätte es sich bei alledem um eine Umsiedlung von Juden innerhalb der Stadt handeln sollen, die zwischenzeitlich gar nicht getötet worden wären. Im Grunde reflektiert diese Notiz dann bereits den Umstand, dass bei der Wiederniederlassung von Juden, die ab 1362 in Gang kam, bereits vollendete Tatsachen geschaffen worden waren und den neu ankommenden Juden jenes jetzt weniger zentrale Viertel zugewiesen worden war, das sie bis zu ihrer Vertreibung 1498/99 bewohnten.20 Bei Siegmund Meisterlin, dem aus Augsburg über Würzburg 1478 nach Nürnberg gekommenen Benediktiner, dessen Position in der Stadtgesellschaft, wiewohl durch den Rat zu seinem Geschichtswerk förmlich beauftragt, anhaltenden Anfeindungen ausgesetzt war, ist der Bericht vom Streit um den innerstädtischen Platz dann geradezu marianisch unterlegt, wird das Geschehen also in die überirdische Sphäre erhoben. In der deutschen Version seiner ursprünglich lateinisch verfassten Chronik (1485/88) heißt es: „Es war ein großer Mangel zu Nürnberg, dass die Kaiserin der Himmel, die Gottesgebärerin, die edle Jungfrau Maria, keine eigene Kirche hatte in der Stadt. Ich meine, dass die Mutter des Gekreuzigten fluche das mörderische Geschlecht, das ihr liebes Kind getötet hatte, und wollt nicht besonder Wesen haben, da hier so viele wohnten. Doch der Schrein, darin die ewige Weisheit war gelegen, überwand das schnöde Volk zu dem letzten und fügt sich das gar wunderlich.“ Sodann erfährt man, dass der Nürnberger Rat Karl IV. nach dessen Sieg im Thronkampf mit Günter von Schwarzburg eine Botschaft habe schicken wollen, und der Bote sei ein Stromer gewesen. Tatsächlich habe der Kaiser den Nürnbergern in Aussicht gestellt, ihre Stadt zu einer seiner Residenzen zu machen, wenn sie denn über die nötigen Gebäude und großzügigen Straßen und Plätze verfüge. „Unter solchen Worten ward dem Stromer sein Mund aufgetan auf Ordnung der reinen Gottesgebärerin Maria und sprach: ‚gar leicht möge solches zu löblichem Ende gebracht werden, o aller sieghaftigster Mehrer des Reiches, wenn die Juden nicht innehätten die allerluftigsten, besten und schönsten Häuser und Flecken, aber des jüdischen Volks ist so viel, dass sie ob und unter der Erden die allerköstlichsten Stätten besitzen und ansonsten (hintan) die Diener Christi als in die Winkel bringen; man müsste schier verzweifeln ob Christus bei uns den Sieg hätte oder Moses.‘“ Im weiteren Verlauf des Gesprächs, wie durch Meisterlin bald 150 Jahre später aufgezeichnet, konzedierte Karl IV., dass er sehr wohl auf die Einnahmen aus den
20
privileg ausstellte, mitsamt der Erlaubnis, zu dessen Errichtung die Judenhäuser abzubrechen; vgl. Müller, Geschichte (wie Anm. 9), S. 33; Avneri, Nürnberg (wie Anm. 9), hier S. 603; Schneider, Heinrich Deichsler (wie Anm. 12), S. 178 f.; Zettl, Juden (wie Anm. 9), S. 11 f. Zur Lage des zweiten Judenviertels Müller, Geschichte (wie Anm. 9), S. 39 f.; ursprünglich war das Judenviertel ebenfalls randständig gelegen, rückte dann aber mit dem Wachsen der Stadt und der Entwicklung des St. Lorenzer Viertels in die Mitte des städtischen Zentrums; vgl. dazu die allerdings verzeichnete Darstellung ebd., S. 15, sowie im weiteren Verlauf unten, bei Anm. 43. Auch wenn dem Pogrom vom Dezember 1349 „nur“ ein Drittel oder die Hälfte der Nürnberger Juden zu Opfer gefallen sein soll (vgl. oben, Anm. 13), gibt es nirgendwo in diesen Tagen Hinweise auf eine planmäßige innerstädtische „Umsiedlung“.
198
Johannes Heil
Juden verzichten könne, wenn es „der jungfräulichen Mutter Gottes zu Ehren geschieht, auch so verachten wir gern den zeitlichen Nutzen, wo uns entspringt ewige Ehre.“ Also habe der Kaiser angeordnet, dass die Juden vom Platz weichen und binnen Jahresfrist ihre Häuser räumen müssten.21 Das hört sich, 1488 geschrieben, wie eine Ablaufskizze für die endgültige Vertreibung der Juden aus Nürnberg an, die zehn Jahre später erfolgte, und tatsächlich dürfte Meisterlins Blick auf 1349 wesentlich von den in seinen Tagen bereits allseits zu vernehmenden Forderungen nach Vertreibung der Juden bestimmt gewesen sein. Aus dem Judenmord des Jahres 1349 war bis zu seiner Erzählung ein in sich stimmig erscheinender Bericht von einer Vertreibung geworden, welche in ihrem Ablauf deutlich von städtischen und kaiserlichen Interessen nach Verfügung über die zentrale innerstädtische Lage bestimmt war.22 Die Klage, dass die Juden die besten Plätze in der Stadt innehätten, war ein gefälliges Deutungsmuster, denn Meisterlin hatte es bereits in seiner Version der Rintfleisch-Verfolgungen und des Nürnberger Pogroms von 1298 bemüht: Als gewaltauslösende Faktoren nannte er neben der Abneigung gegen die Juden, die er aus religiösen Gründen wohl selbst teilte, mit kritischem Unterton auch Neid und Besitzstreben und machte die Akteure implizit unter Außenstehenden und städtischen Unterschichten aus.23 Was die Ereignisse von 1349 angeht, bestimmte der Verweis auf die Lage der Judenhäuser und den Wohlstand ihrer Bewohner dann auch schon Meisterlins Bericht zu einer Ausplünderung, die den Juden, ohne dass es dafür Belege gäbe, in den Monaten der Zunftherrschaft 1348/49, also noch vor der Restituierung des patrizischen Rats, widerfahren sein soll.24 Ganz anders liest es sich dann zum Dezember 1349: Zwar teilte Meisterlin zufolge der Stromer dem Kaiser mit, dass die Juden 21
22 23 24
Siegmund Meisterlin, Chronik der Reichsstadt Nürnberg, hg. von Dietrich Kerler/Matthias Lexer, Die Chroniken der fränkischen Städte. Nürnberg 3 (Chroniken der deutschen Städte 3) Leipzig 1864, S. 32–256, hier III.22, S. 158 f. Meisterlin, der eine Schlüsselrolle in der „‚Inkubationszeit‘ für das Nürnberger Geschichtsbild“ einnahm (Schneider, Typologie [wie Anm. 13], S. 198), war als Ordensmitglied und Auswärtiger gleich zweifach von der städtischen Bürgerelite, über deren Handlungen er schrieb, ausgeschlossen; deshalb dürfte er zu genauer Beachtung lokaler Erzählkonventionen angehalten gewesen sein und mit seinem „Protokoll“ der Begegnung Stromers mit Karl IV. eine bereits etablierte ratsnahe Nürnberger bzw. hauseigene Stromer’sche Erzählung aufgegriffen haben. Die Ergänzungen zu Ulman Stromers Püchlein durch dessen Nachfahren, die Meisterlins „Protokoll“ zu Grunde liegen dürften, hat bereits Hegel, Chroniken, Nürnberg 1 (wie Anm. 19), Einleitung, S. 7, vorgelegt. Vgl. ferner Schneider, Heinrich Deichsler (wie Anm. 12), S. 16–28, 198 f.; Katharina Colberg, Art. Meisterlin, Sigismund OSB, in: Wolfgang Stammler u. a. (Hgg.), Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon 6: Marienberger Osterspiel – Oberdeutsche Bibeldrucke, Berlin/New York 21987, Sp. 355–383; ebd. 11: Nachträge und Korrekturen, Berlin/New York 22004, Sp. 988; ferner Joachim Schneider, Anspruch und städtische Realität. Die zweisprachige Nürnberger Chronik des Sigismund Meisterlin, in: Rolf Sprandel (Hg.), Zweisprachige Geschichtsschreibung im spätmittelalterlichen Deutschland, Wiesbaden 1993, S. 271–316, insb. S. 310 f.; dens., Typologie (wie Anm. 13), S. 196–198. Zu den Hintergründen vgl. auch oben, mit Anm. 13. Meisterlin, Chronik (wie Anm. 21), II.16, S. 118. Ebd., III.14, S. 146; die tatsächliche Haltung des aufständischen Rats knapp skizziert bei Schneider, Heinrich Deichsler (wie Anm. 12), S. 179; Zettl, Juden (wie Anm. 9), S. 9.
Erinnerungsspuren und Ereigniskumulationen
199
inmitten der Stadt der weiteren Entwicklung im Weg stünden, aber die treibende Rolle seiner Geschehensdarstellung lag bei der Gottesmutter, die ihre ganz eigenen, mütterlich gestimmten Motive hatte und diese ganz unmittelbar kundtat.25 Hätte Meisterlin seiner ratsfreundlichen Lesart ein Motto beigeben wollen, so hätte es dieses sein können: „Maria mit uns und gegen die Unterschichten – und alle gegen die Juden.“26 Wie geschickt Meisterlin hier gesponnen und gewoben hatte, zeigt der Abstand seines Erzählstücks zur Darstellung derselben Zusammenhänge in der Beschreibung Nürnbergs aus der Feder des Dichters Konrad Celtis (1459–1508) von 1502. Da sind die Angaben zum Bau der Frauenkirche, zum Wirken Karls IV., und der in Anknüpfung an Tacitus’ Judenexkurs geschriebene Bericht von der Vertreibung der Juden infolge des Vorwurfs der Vergiftung aller Brunnen nur mittelbar, nämlich als aufeinanderfolgende Berichte, angeordnet, bleiben aber ohne jedwede leitende narrative Verbindung.27 Wenn es eine gemeinsame Linie gibt, die die verschiedenen Berichte, seien es nun interessengeleitete Interpretationen zumindest ungefähr wie dargestellt geschehener Ereignisse oder solche, die sich in der Erinnerung überhaupt erst zusammenkomponiert haben, verbindet, dann ist es die der Legitimation des Handelns und insofern die Delegitimierung der jüdischen Präsenz in der Stadt. Ganz gleich, ob es um erschlichene Rechtstitel, unerhörten Reichtum, vergiftete Brunnen oder die Verärgerung der Gottesmutter gegangen sein sollte, stets war man um die Entschuldigung des eigenen Handelns beziehungsweise das der Vorväter bemüht. Wo Meisterlins Geschichte noch vor dem Hintergrund der laufenden Vertreibungsbemühungen komponiert war, hätte sich nach 1499 die Not um einen immer 25
26
27
Meisterlin, Chronik (wie Anm. 21), III.22, S. 158 f.; damit korrespondiert auch die Nachricht, die christlichen Häuser über dem alten Judenviertel seien auffällig dicht mit Heiligenfiguren, insbesondere Mariendarstellungen, versehen gewesen; so schon bei Barbeck, Geschichte (wie Anm. 8), S. 8. Die Selbstabschließung des Patriziats lässt sich an der Rezeption von Meisterlins Chronik und ihren dann auch reformationskonform angepassten Textvarianten nachverfolgen: Schneider, Typologie (wie Anm. 13), S. 198 mit Anm. 116; zur Rezeption Meisterlins in der mittelständischen Chronistik vgl. Lotte Kurras (Bearb.), Handschriften des Germanischen Nationalmuseums 3: Norica. Nürnberger Handschriften der frühen Neuzeit (Kataloge des Germanischen Nationalmuseums Nürnberg) Wiesbaden 1983, S. XI–XV. Konrad Celtis Protrucius, Qvatvor Libri Amorvm Secvndvm Qvatvor Latera Germanie / [fol. 81r ff.] De origine, situ, moribus et institutis Norinbergae libellus panegyricus, Nürnberg 1502, fol. 90r: Adiacet divae virginis phanum per Karolum quartum magnifico ope constructum opibusque regiis dotavit. Expulsis ab eo loco iudeis qui omnes fontes urbis veneno infecisse causabant excidenda profecto gens aut ad Caucasum et ultra Sauromatas perpetuo exilio releganda quae per universum orbem in se totiens iram numinum concitat humani generis societatem violans et conturbans (vgl. Tacitus Annales 15,44,4; L. Historiarum, 5, 2–5); ähnlich zur Vertreibung der Juden 1498/99 ebd., fol. 106r f. (urn:nbn:de:bvb:12-bsb00007499–6); zur Thematik der Verbannung zum Kaukasus und darüber hinaus vgl. Andrew C. Gow, The Red Jews. Antisemitism in an Apocalyptic Age 1200–1600 (Studies in medieval and Reformation Thought 55) Leiden/New York/Köln 1995; zu Celtisʼ Tacitus-Anleihen vgl. Jörg Robert, Konrad Celtis und das Projekt der deutschen Dichtung. Studien zur humanistischen Konstitution von Poetik, Philosophie, Nation und Ich (Frühe Neuzeit 76) Berlin 2003, S. 375 f.
200
Johannes Heil
gründlicher formulierten Nachweis der Illegitimität jüdischer Präsenz in der Stadt eigentlich erledigt haben sollen. Die Vertreibung der Juden war ja durch Kaiser Maximilian rechtsförmlich bestätigt worden, und die sonstigen Vertreibungen von Juden aus Territorien und Städten in dieser Zeit, wenige Jahre darauf auch aus Rothenburg und Regensburg, sollten ja zeigen, dass es nötigenfalls keiner derartigen Rechtstitel bedurfte, so dass die Akteure am Ende auch keine ernsten Konsequenzen zu gegenwärtigen hatten.28 Das Thema wich aber nicht und kam in der Nürnberger Historiographie auch während der folgenden Jahrhunderte immer wieder, und das nicht nur sporadisch, an die Oberfläche. So hat auch der Nürnberger Ratsschreiber und Chronist Johannes Müllner (1565–1634) in seiner Chronik der Stadt Nürnberg von 1623 wiederholt Episoden aus der jüdischen Geschichte der Stadt eingeflochten. Auch weil der studierte Sohn eines Predigers an St. Sebald zu den Rintfleisch-Verfolgungen von 1298 ältere Texte ausschrieb, bot er am Ende eine ausgesprochen ‚katholische‘ Interpretation des Hostienfrevelvorwurfs; so übernahm er auch die Version, wonach die Hostie von den Christen für ein lebendig fleisch geachtet wurde. Freilich hat er dieses Geschehen, das er bis 1307 streckte und mit einer Opferzahl von 100.000 ermordeten Juden in ganz Deutschland versah, dabei wiederholt des Pöfels Unsinnigkeit zugeschrieben und auf diese Weise eine gewisse Distanzierung zu altgläubigen Vorstellungen vorgenommen. Das war wohl eine ratsnahe Position, keine Distanz in der Sache. Denn zu 1298 selbst referierte er die nun schon bekannte Version, wonach die Juden die besten Plätze in der Stadt eingenommen hätten und vor Verfolgungen anderswo sich noch mehr Juden in die Stadt geflüchtet hätten, die allesamt als Handlanger der Regenten aufgetreten seien und solchermaßen ihr Unglück selbst heraufbeschworen hätten. Müllners Darstellung ist damit zum mindesten tendenziös, aber in einzelnen Punkten für seine Zeit bemerkenswert detailreich. Sein Bericht von der Opferung der eigenen Kinder angesichts der drohenden Zwangstaufe und der anschließenden Selbstverbrennung der Eltern wird kaum Allgemeingut gewesen sein und dürfte, wie auch immer vermittelt, aus hebräischen Quellen, hier wohl dem Nürnberger Memorbuch, bezogen gewesen sein.29 Deutet sich dabei eine gewisse Empathie 28
29
Markus J. Wenninger, Man bedarf keiner Juden mehr. Ursachen und Hintergründe ihrer Vertreibung aus den deutschen Reichsstädten im 15. Jahrhundert (Beihefte zum AKG 14) Wien/Köln/ Graz 1981; Friedhelm Burgardt/Alfred Haverkamp/Gerd Mentgen (Hgg.), Judenvertreibungen in Mittelalter und früher Neuzeit (Forschungen zur Geschichte der Juden. Abhandlungen A9) Hannover 1999; vgl. auch Céline Balasse, 1306. L’expulsion des juifs du royaume de France (Bibliothèque du Moyen âge 26) Brüssel 2008; Christoph Cluse (Bearb.), Darf ein Bischof Juden zulassen? Die Gutachten des Siffridus Piscator OP (gest. 1473) zur Auseinandersetzung um die Vertreibung der Juden aus Mainz (Studien und Texte. Arye-Maimon-Institut für Geschichte der Juden 7) Trier 2013. Johannes Müllner, Die Annalen der Reichsstadt Nürnberg von 1623 1: Von den Anfängen bis 1350, hg. von Gerhard Hirschmann (Quellen und Forschungen zur Geschichte und Kultur der Stadt Nürnberg 8) Nürnberg 1972, S. 67, 293 f.; vgl. Siegmund Salfeld, Das Martyrologium des Nürnberger Memorbuches, Berlin 1898; František Graus, Pest – Geissler – Judenmorde. Das 14. Jahrhundert als Krisenzeit (Mitteilungen des Max Planck-Instituts für Geschichte 86) Göttingen 1987, S. 258–260; die neuere Forschung skizziert bei Johannes Heil, Art. Märtyrer, in:
Erinnerungsspuren und Ereigniskumulationen
201
an, so erscheint Müllners Bericht zu den Ursachen der Pest und den Judenverfolgungen, zu 1347 datiert30, dann wieder ausgesprochen distanziert. Im Unterschied zu Meisterlins Vertreibungsversion folgte Müllner zur Verfolgung von 1349 und dem Abbruch der Judenhäuser zur Gewinnung eines Marktes und des Platzes für die Frauenkirche der ungeschminkten Erzählweise von der Verbrennung der Juden am Nikolaustag 1349, wie wir sie aus Stromers „Püchlein“ kennen, jetzt nur um einige Ausschmückungen erweitert.31 Stoff für den Vergleich von Einzelheiten böte die Nürnberger Historiographie mit ihrem „beinahe unübersehbarem Bestand“32 noch zuhauf und das brächte gewiss zahlreiche weitere Nuancen zu Tage. Hier aber soll auf eine andere Besonderheit dieser städtisch-kollektiven Selbstvergewisserung aufmerksam gemacht werden: Die Nürnberger jüdische Geschichte wurde in ihrer fortgesetzten Nacherzählung immer wieder neu zurückgeschrieben und kumulativ um neue Ereignisse angereichert. Das gilt etwa von Müllners Nachricht, wonach 1105, also lange bevor mit Ottos von Freising Bericht zu 1147 tatsächlich der Beginn der Nürnberger jüdischen Geschichte anzusetzen ist, die Juden in der Auseinandersetzung zwischen Heinrich IV. und seinem gleichnamigen Sohn eben diesem letzteren angehangen hätten; ja sie sollen ihm die Stadt verraten und nach deren Zerstörung sogleich die besten Plätze in ihrer Mitte eingenommen haben. Damit war gesagt, dass die Juden sich schon zu Beginn des 12. Jahrhunderts auf betrügerische Weise jene Position im städtischen Raum verschafft hätten, die ihnen in der wachsenden Stadt Mitte des 14. Jahrhunderts zunehmend Neid einbringen und schließlich zum Verhängnis werden sollte. Müllner berief sich an dieser Stelle ausdrücklich auf Siegmund Meisterlin.33 In dessen deutscher Version der Chronik hat sich allerdings kaum etwas dergleichen erhalten, wohl aber eine kurze Notiz in der lateinischen Fassung. Da heißt es, nach der Zerstörung der Stadt seien die christlichen Bürger 1105 allenthalben bei Verwandten und in den Nachbarstädten bis Bamberg und Regensburg untergekommen, wo sie ein armseliges Leben gefristet hätten, während Judei paulatim meliora loca sub eis ceperunt occupare, also „die Juden allmählich die besten Plätze in der Stadt an sich zu bringen begonnen hätten.“34 Da steht zwar noch nichts
30 31 32 33
34
Dan Diner (Hg.), Enzyklopädie Jüdischer Geschichte und Kultur 4, Stuttgart/Weimar 2013, S. 55–60. Müllner, Annalen 1 (wie Anm. 29), S. 435 f., 451 f. Ebd., S. 465; zur Hochschätzung des Stromer’schen „Püchl“ durch Müllner vgl. Schmid, Schreiben (wie Anm. 13), S. 70. Schneider, Heinrich Deichsler (wie Anm. 12), S. 5. Müllner, Annalen 1 (wie Anm. 29), S. 67. Mit Verweis auf das Wohlwollen Heinrichs IV. gegenüber den Juden ist die Nachricht zu 1105 erstmals als unglaubwürdig bezeichnet bei Michael Truckenbrot, Nachrichten zur Geschichte der Stadt Nürnberg 1–2, Nürnberg 1785–1786, 2, S. 256–258. Meisterlin, Chronik (wie Anm. 21), Anhang 1: Nieronbergensis cronica I.15, S. 207, ferner ebd., S. 80 f., 86; vgl. auch Imhoff’sche Chronik, Stadtarchiv Nürnberg F1, 14.1, S. 42; dazu bereits Hayim Tykocinski, Art. Nürnberg, in: Ismar Elbogen/Aron Freimann/Hayim Tykocinski (Hgg.), Germania Judaica 1 (Schriften der Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft des Judentums 33) Breslau 1934 (ND Tübingen 1963), S. 249–253, hier S. 249.
202
Johannes Heil
vom Verrat und der Anhänglichkeit der Juden an den Empörer, aber ein Schluss, wie ihn Müllner später anstellte, ließ sich aus Meisterlins Wortlaut wohl ziehen. Müllner akzentuierte die Geschichte vom Verrat der Juden noch durch eine entsprechende Note am Rand (Nurnberg durch die Juden veruntreut) und wusste nun, dass Heinrich die Stadt fürnehmlich durch Untreu und Verräterei der Juden, dern dazumal eine große Anzahl zu Nurnberg gewohnet und heimblich dem König angehangen, in seine Gewalt gebracht habe. Und er folgerte, dass sie nach der Zerstörung der Stadt als erste wieder zu Nürnberg gebaut hätten und derwegen mit ihren Häusern die besten und gelegensten Ort der Stadt eingenummen.35 Das neu aufgefundene Ereignis, mit dem nur einmal mehr die alte Mär vom jüdischen Verrat variiert wurde36, gehörte fortan zum Grundbestand des Wissens zur Geschichte der Nürnberger Juden: In der Stadtchronik von 1707 des nahe Nürnberg geborenen Juristen und späteren Hallenser Prorektors Nicolaus Hieronymus Gundling, den man auch einen Frühaufklärer nennt, erscheint das Motiv vom Verrat der Juden im Jahr 1105 wieder und sogleich noch um aussagekräftige Nuancen präzisiert: Es sei allein dieser Verrat der Juden gewesen, der den Truppen des jüngeren Heinrich nach langer Belagerung den Zugang zur Stadt verschafft habe. Noch aus den Trümmern heraus hätten die Juden sich in der geplünderten und verwüsteten Stadt neben einigen wenigen Christen die besten Wohnplätze verschafft.37 Zu den Rintfleisch-Verfolgungen von 1298 bietet Gundling dann eine ausführliche, fast wortgenaue Übernahme der Version des Sigismund Meisterlin38, dagegen nur eine knappe Darstellung zu den Pestpogromen, hier datiert auf den Nikolaustag 1348.39 Sodann befasst er sich zu 1350 mit Ulrich Stromer als Verhandlungsführer der Nürnberger beim Kaiser wegen Verlegung des Judenviertels, worauf ein Bericht zum Herkommen der Stromer folgt.40 Weiter schildert er den Fund von Pfandsachen aus dem Besitz der Juden in Gewölben vormaliger Häuser beim Aushub für den Bau der Frauenkirche, in die Karl IV. die Reichskleinodien habe einbringen
35 36 37
38 39 40
Müllner, Annalen 1 (wie Anm. 29), S. 67, 77. Vgl. als frühes Beispiel den angeblichen Verrat der Stadt Bordeaux an die Normannen 848 in den Annales Bertiniani, hg. von Georg H. Pertz, MGH SS 1, Hannover 1826, S. 419–515, hier S. 443. Nicolaus Hieronymus Gundling, Historische Nachricht Von dem Ursprunge und Wachsthum Des Heil. Röm. Reichs freyer Stadt Nürnberg: Aus uralten und glaubwürdigen documentis und Urkunden vorgestellet, Frankfurt [am Main] 1707, S. 18–21; zu Person und Werk vgl. Anneliese Bock, Nicolaus Hieronymus Gundling 1671–1729 und sein „Entwurf einer Teutschen ReichsHistorie“, Phil. Diss. Düsseldorf 2009, S. 16 ff., 107 ff.; (http://docserv.uni-duesseldorf.de/ servlets/DerivateServlet/Derivate-21129/Anneliese%20Bock_Nicolaus%20Hieronymus%20 Gundling_Dissertation_pdfa.pdf); ferner Daniela Fischer, Nicolaus Hieronymus Gundling 1671–1729. Der Blick eines frühen Aufklärers auf die Obrigkeit, die Gesellschaft und die Gebildeten seiner Zeit, Phil. Diss. Trier 2004 (http://ubt.opus.hbz-nrw.de/volltexte/2004/132/). Gundling, Nachricht (wie Anm. 37), S. 70 f. Ebd., S. 119 f. Ebd., S. 138.
Erinnerungsspuren und Ereigniskumulationen
203
lassen.41 Zu 1498 vermerkt Gundling schließlich die kaiserliche „Freiheit“ zur Vertreibung der Juden, die Lichtmess 1499 erfolgt sei.42 Wenn man diese Überlieferungen allesamt durchgeht, dann scheint es, als habe die Nürnberger Geschichte sich im Grunde als anhaltende Auseinandersetzung um die besten Immobilien abgespielt, wobei die Juden sich unverschämt gute Positionen verschafft hätten und was in der Folge energisch korrigiert worden sei. Bei alledem haben die Chronisten übersehen, dass erst mit der Ausdehnung der Stadt auf die südliche Pegnitzseite und dem Ausbau der Lorenzer Neustadt zu einem zweiten Zentrum das ursprünglich periphere, südöstlich von St. Sebald zur Pegnitz hin gelegene Judenviertel „äußerst verhängnisvoll“ in den Mittelpunkt der Stadt gerückt war. Aus der topographischen Aufwertung des ursprünglich noch außerhalb der Sebalder Stadtmauern gelegenen Viertels wurde im Nachhinein eine unerhörte Okkupation43, die umso skandalöser berichtet wurde, je weiter die Berichterstatter vom Ereignis entfernt schrieben. Erscheint es noch hinlänglich schlüssig, dass neuzeitliche Chronisten wie Müllner oder Gundling in ihren Chroniken zur Geschichte der Stadt Nürnberg die Juden nicht auslassen konnten und einige Abschnitte auf ihre Geschichte verwenden wollten, so erstaunen Nürnberger Einzelabhandlungen zur Geschichte der Juden. Da ist zunächst eine 1732 anonym publizierte, wenig geordnete und deshalb kaum verwertbare Kompilation älterer historischer Nachrichten von den Nürnberger und fränkischen Juden44 und dann die immerhin 164 Seiten umfassenden „Historischen Nachrichten von der Judengemeinde welche ehehin in der Reichsstadt 41
42 43
44
Ebd., S. 154. Gundling bezieht sich hier wohl auf die Ausstellung der Reichskleinodien in der Frauenkirche anlässlich der Taufe des späteren Königs Wenzel im Frühjahr 1361; dauerhaft übergeben wurden sie an Nürnberg erst 1423/24 und bis 1796 in der Kirche des Heilig-GeistSpitals aufbewahrt, wo sie sich also auch zu Gundlings Lebzeiten befunden haben müssen; vgl. dazu Hans Reither, Aufbewahrungsorte der Reichskleinodien, in: Jan Keupp u. a. (Hgg.) „… die keyserlichen zeychen …“ Die Reichskleinodien – Herrschaftszeichen des Heiligen Römischen Reiches, Regensburg 2009, S. 97–102; Mitchell B. Merback, Pilgrimage and Pogrom. Violence, Memory, and Visual Culture at the Host-Miracle Shrines of Germany and Austria, Chicago 2012, S. 199–202. Gundling, Nachricht (wie Anm. 37), S. 282 f. Über die Entwicklung der jüdischen Topographie in Nürnberg herrscht in der Forschung Dissens. Gegen die Annahme, das Judenviertel am späteren Hauptmarkt sei der erste jüdische Siedlungsort gewesen (etwa Müller, Geschichte, S. 15 f.; Zettl, Juden, S. 3, beide wie Anm. 9), steht der Fund eines Baukörpers mit dem Charakter einer Mikwe in der Königsstr. 18 im Stadtviertel St. Lorenz südlich der Pegnitz. Daraus wird geschlossen, dass das im 12. Jahrhundert bereits angelegte Gebiet um die Lorenz-Kirche auch die erste Judensiedlung geborgen habe und erst mit der Trockenlegung des Gebiets nördlich der Pegnitz mit dem Bau der zweiten Stadtmauer der jüdische Siedlungsschwerpunkt nach Norden gerückt sei; Zusammenfassung bei Ole Hark, Archäologische Studien zum Judentum in der europäischen Antike und dem zentraleuropäischen Mittelalter (Schriftenreihe der Bet Tfila 7) Petersberg 2014, S. 175 f. Für die Behandlung der jüdischen Geschichte in der spätmittelalterlichen und neuzeitlichen Nürnberger Historiographie ist diese Diskussion aber ohne Belang. Ausführlicher Bericht von denen Juden, so in der Stadt Nürnberg gewohnet, von ihren Freyheiten, auch wasgestalten sie ausgetrieben, und daher erfolgten Monte Pietatis, Nürnberg 1732 (online: http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10316037-2).
204
Johannes Heil
Nürnberg angerichtet gewesen, aber Ao. 1499 ausgeschaffet worden“, die Andreas Würfel (1718–1769) 1755 in Nürnberg verlegte.45 Würfel wurde als Sohn des Rektors der Lorenzer-Schule geboren und hatte es nach dem Studium in Altdorf nur zum Pfarrer der kleinen Gemeinde Oberkrumbach, nordöstlich von Nürnberg in der Hersbrucker Alp gelegen, und seit 1755 im nicht minder beschaulichen Nürnberger Dorf Offenhausen gebracht. Nachhaltig gewirkt hat er abseits seines Pfarramts. Mit 13 zumeist stattlichen historischen Arbeiten, davon zweien zur Geschichte der Juden, kann man ihn einen Nürnberger Kirchen- und Stadthistoriker nennen.46 Seine Werke zu den Juden in Nürnberg und Fürth dürften, sieht man vom Exkurs zur Frankfurter jüdischen Geschichte in Schudts „Jüdischen Merckwürdigkeiten“ einmal ab, die einzigen Monographien zur Geschichte einzelner jüdischer Gemeinden sein, die vor dem 19. Jahrhundert erschienen sind. Das Werk zu den Nürnberger Juden samt umfangreicher Quellenbeilagen geht chronologisch nach Sachthemen vor und beschäftigt sich in einzelnen Abschnitten etwa mit den Anfängen der Nürnberger Juden, ihren Gesetzen, Institutionen und inneren Organisationen, ihren Abgaben, ihrem Friedhof und schließlich ihrer „Ausschaffung“. Ein eigener Abschnitt am Ende befasst sich polemisch mit den Inhalten des Nürnberger Machsor, der sich seit der Vertreibung der Juden im Besitz der Stadt befand, sowie mit den Biographien getaufter Juden. Die Grundtendenz des Werkes wird schon zu Beginn des 1. Kapitels erkennbar: Unter denen heydnischen Kaysern hatten die Juden viele und herrliche Freyheiten genossen. So bald das Römische Reich auf Christliche Regenten gekommen, so wurden diese Vorzüge guten Theils beschnitten. Dies schmerzte die Juden und wollten sie das Regiment gerne hinwieder auf heidnische Regenten bringen. Sie erregten deswegen Verrätherey, Mord und Aufstand. Mit solch bösen Beginnen, haben sie sich der Christen Haß, heimlich zugezogen, welcher dann zu unterschiedlichen Zeiten, in grausamen Verfolgungen öffentlich ausgebrochen ist.47 Hier klingt schon das rechtshistorische Paradigma an, das später noch ausführlicher entwickelt wird: Danach hatten die Juden ihre Freiheiten und Privilegien noch von den „heidnischen“ Kaisern erhalten, und die christlichen hätten ihnen darin widerwillig und trotz mancher Einschnitte aus rein rechtsförmlichen Erwägungen folgen müssen.48 45
46
47 48
Andreas Würfel, Historische Nachrichten von der Judengemeinde, welche ehehin in der Reichsstadt Nürnberg angericht gewesen, aber anno 1499 ausgeschaffet worden, Nürnberg 1755; zur Person Art. (o. A.), Andreas Würfel, in: Andreas H. Grieb (Hg.), Nürnberger Künstlerlexikon. Bildende Künstler, Kunsthandwerker, Gelehrte, Sammler, Kulturschaffende und Mäzene vom 12. bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts, Bd. 4, München 2007, S. 1708 f.; Arno Herzig, Das Interesse an den Juden in der frühen Neuzeit. Studien zur Kontinuität und zum Wandel des Judenbildes, Hamburg 2012, S. 73–76. 1756 erschienen seine Lebensbeschreibungen aller Herren Geistlichen, welche in der ReichsStadt Nürnberg seit der Reformation Lutheri gedienet Angefangen von Herrn Carl Christian Hirschen, fortgesetzt und Vollendet durch Andreas Würfel Nürnberg, verlegts Christoph Melchior Roth, 1756. Würfel, Historische Nachrichten Nürnberg (wie Anm. 45), S. 1 (Das I. Capitel: Von der Stadt Nürnberg Freyheit Juden aufzunehmen). Ebd., S. 39 u. ö.
Erinnerungsspuren und Ereigniskumulationen
205
Das Verratsmotiv, das Müllner und Gundling zu 1105 entwickelt hatten, wird hier quasi in die konstantinische Zeit zurückverlängert. Danach überrascht es nicht, dass Würfel gleich zu Beginn des Berichts zu Nürnberg auch die Geschichte vom angeblichen Verrat der Juden im Jahr 1105 bietet. Es sei das erste, aber auch das schändlichste Andenken von ihrem Aufenthalt in Nürnberg gewesen. Einmal mehr ist dabei die jüngere Version gegenüber den älteren um neues Wissen bereichert worden. Denn Würfel wusste über seine Vorgänger hinaus, dass die 1105 in der Stadt verbliebenen Juden endlich auch andere Juden herbey gerufen und mit Geld von Kaiser Lothar II. die Erlaubnis zum Wiederaufbau der Stadt erlangt hätten49, ferner weitere Häuser in der Umgegend durch den mächtigen Vorspruch Kayserlicher Maiestäten aus der Christen Hände gerissen50, so dass, wie es wenig später – womöglich angeleitet von Meisterlins oben zitiertem Kontrast von Moses und Christus – heißt, man nicht wüste: ob Nürnberg eine Juden oder Christen Stadt ist.51 Dieser so gründlichen „Klarstellung“ der Irregularität von Anfängen und Verlauf jüdischer Geschichte in Nürnberg folgt das, was als „Katasterteil“ seiner Arbeit gelten kann: die geradezu grundbuchmäßige Beschreibung der Besitzverhältnisse um den Nürnberger Hauptmarkt nach 1350 und wer damals welche Liegenschaft an sich gebracht habe, nachdem endlich dieser Platz von denen Juden Häusern gesäubert worden war.52 Unter den nachmaligen Eigentümern nennt Würfel Conrad Haiden, Leupold Groß, Ulman Stromer, Ulrich Stromer53 – darunter sind nicht ohne Zufall einige Namen jener, deren Nachfahren eingangs seiner Schrift als Widmungsträger genannt wurden. Das alles wurde übrigens als Vorgang geschildert, der (nicht wie bei Meisterlin indirekt, sondern) nun ganz ausdrücklich eine Umsiedlung gewesen sein sollte und die Ermordung der Juden 1349 verschweigt: Doch war dies für Sie [die Juden] noch gut, dass Sie auf dießmal nicht völlig aus der Stadt vertrieben, sondern nur an einen andern Ort […] verwiesen wurden.54 Würfel bezog sich eingangs als Anreger auf Johann Christian Wagenseil (Nürnberg 1633 – Altorf 1705) und dessen „Commentatio de Civitate Noribergensis“55, 49 50 51 52 53 54 55
Ebd., S. 11. Ebd., S. 13; vgl. ferner den Exkurs in ebd., S. 33, Anm. 76. Ebd., S. 15. Ebd., S. 16. Ebd., S. 17–20. Ebd., S. 22. Vgl. zum Bau der Frauenkirche und den Hintergründen der Vertreibung 1498/99 bei Johann C. Wagenseil, De Sacri Rom. Imperii Libera Civitate Noribergensi Commentatio, Altdorf 1697, S. 67 ff., der sich seinerseits auf Johann J. Fugger, Spiegel der Ehren des Erzhauses Österreich, bezog; die sonstigen weitschweifigen, um nicht zu sagen geschwätzigen Ausführungen Wagenseils (S. 123–135, 157–178) dürften Würfel wenig Handhabe für seine historisch bemühte Darstellung geboten haben. Als bemerkenswerter Randbefund sei aus dem anhängenden Buch („Von der Meister-Singer holdseligen Kunst, Anfang, Fortübung, Nutzbarkeiten und Lehr-Sätzen – Es wird auch in der Vorrede von vermuthlicher Herkunft der Ziegeiner gehandelt“) Wagenseils Überlegung referiert, die ersten „Ziegeiner“ seien aus Deutschland gebürtige Juden und Überlebende der Pestverfolgungen der Jahre 1348/49 gewesen; den Brunnenvergiftungsvorwurf weist er anbei als „Wahn“ zurück: vgl. Wagenseil, De Sacri Rom., S. 438. Erst in der
206
Johannes Heil
schloss aber mit seinem Inventar jüdische Gebräuche und Institutionen in Nürnberg auch an die vergleichbaren Arbeiten des Frankfurter Pfarrers Johann Jakob Schudt (1664–1722) an. Dieser hatte in Wittenberg und Hamburg Theologie und Orientalistik studiert und 1714–1718 eine samt Supplementum gleich vierbändige Schrift über „Jüdische Merckwürdigkeiten“ vorgelegt, mit dem Unterschied, dass er anders als Würfel nicht antiquarisch vorgehen musste, sondern der vibrierenden jüdischen Kultur, die er in Frankfurt vorfand, trotz aller Ambivalenzen und Stereotypen seiner Darstellung im Grundsatz interessiert begegnete.56 Manchmal, gerade in seinem systematischen Teil zu Institutionen und Gebräuchen der Juden von Nürnberg, klingt auch Würfels Darstellung dann ganz so, als seien die Juden in diesen Tagen in Nürnberg, und nicht nur nebenan in Fürth57, noch präsent gewesen. Jedenfalls war die Erinnerung an die Juden bei Würfel und seinen Zeitgenossen allemal deutlicher präsent, als man mehr als zweihundertfünfzig Jahre nach ihrer Vertreibung aus Nürnberg annehmen wollte. Davon zeugt etwa Würfels schriftliche Nachbildung jüdischer Grabsteine der untergegangenen Gemeinde, die in der Stadt allenthalben noch zu sehen gewesen seien. Würfel gibt nicht nur (fehlerhaft) die Inschriftentexte und Übersetzungen wieder, sondern berichtet auch von angeregten Gesprächen mit Zeitgenossen über deren Herkommen. Zur Frage etwa, wann und weshalb der Stein der Gutlein, Tochter des Rabbi Shimon, den man bey dem Eintritt in den Sebalder Kirchhof rechter Hand zur Seiten, wo man nach des Keller Stuben gehet, findet, an seinen Platz gekommen sei, konnte Würfel unterschiedliche Versionen berichten.58 Ganz offensichtlich haben die Juden, zumindest ihre Hinterlassenschaft, auch in Würfels Tagen das Nürnberger Stadtgespräch noch immer beschäftigt. Und so will es scheinen, als hätten die Nürnberger auch im 18. Jahrhundert den Hauptmarkt auf die Frauenkirche hin nicht überschreiten können, ohne stets aufs Neue der einstmals dort lebenden Juden gewahr zu werden und sich ein ums andere Mal der Rechtmäßigkeit ihrer gewaltsamen Verdrängung, aus der Stadtmitte 1349 und aus der Stadt 1498/99, vergewissern zu wollen.
56
57 58
Zeit der Hussitenkriege hätten diese Juden sich wieder aus ihren Verstecken herausgetraut, es aber für ratsam gehalten, sich nicht als Juden zu zeigen, auf der anderen Seite zur Wahrung ihrer Religion sich nicht als Christen ausgeben wollen (ebd., S. 441). Johann J. Schudt, Jüdische Merckwürdigkeiten Vorstellende Was sich Curieuses und denckwürdiges in den neuern Zeiten bey einigen Jahrhunderten mit denen in alle 4 Theile der Welt, sonderlich durch Teutschland, zerstreuten Juden zugetragen sammt einer vollständigen Franckfurter Judenchronik 1–3, Frankfurt am Main 1714, und 4: Suppl., ebd. 1718. Schudt war wie Arnold ein Mitglied des Spener-Kreises. Das schlägt sich zumindest partiell in moderaten Passagen seines sonst an Luther und Eisenmenger geschulten Antijudaismus nieder: In seiner Schrift Judæus Christicida gravissime peccans et vapulans (etc.), Frankfurt am Main 1703, bestand er auf der kollektiven Schuld der Juden an der Kreuzigung Christi, wofür sie Bestrafung verdient hätten; mit den erlittenen Leiden in ihrer Geschichte sei diese Schuld aber längst abgetragen; zu Schudt vgl. insgesamt die Beiträge von Deutsch, Diemling und Lahav in: Fritz Backhaus u. a. (Hgg.), Die Frankfurter Judengasse, Frankfurt am Main 2007. Ihnen hatte eine im Jahr zuvor erschienene Abhandlung gegolten: Andreas Würfel, Historische Nachricht von der Judengemeinde in dem Hofmarkt Fürth Unterhalb Nürnberg, Frankfurt/ Prag 1754. Würfel, Historische Nachrichten Nürnberg (wie Anm. 45), S. 78.
Erinnerungsspuren und Ereigniskumulationen
207
Merkwürdig stimmt bei alledem indes, dass gewissenhafte Chronisten wie Würfel mehr Einzelheiten zu den fernen Geschehnissen zu berichten wussten als die früheren Berichterstatter, die viel dichter an den berichteten Ereignissen gewirkt hatten. Gewiss, da mag die ganz eigene Relation von Dichtung und Wahrheit die Feder geführt haben, oder wie es der markgräflich Ansbachische Resident in Erfurt, Johann Heinrich von Falckenstein (1682–1760), formulierte, als er bei seiner eigenen externen Evaluation der Nürnberger Geschichte unter den dortigen Historikerkollegen bey dem zu unsern Zeiten hell aufgesteckten historischen Lichte Leute sehen [musste], die in der Finsterniß der fabulösen Antiquität herum zu tappen sich ein Vergnügen machen.59 Es dürften mit der Zeit aber auch, zumal die frühesten Chronisten so sorgsam um Verknappung und Steuerung der Darstellung bemüht waren, im lokalen Raum abrufbare Erzählungen, die zuvor nicht niedergeschrieben worden waren, und womöglich auch Rückgriffe auf heute verlorene Aufzeichnungen60 zu Fakten geronnen sein. Hinzu kommt, dass in der Nürnberger Wahrnehmung die Juden 1499 zwar „ausgeschafft“, aber nicht wirklich abgezogen waren. Würfels Nürnberger Chronik sollte man deshalb auch stets im Zusammenhang seiner ein Jahr älteren Darstellung zu den Fürther Juden sehen. Und da hat Würfel, der ja selbst im Nürnberger Umland wirkte, gleich eingangs festgehalten, dass beim Abzug aus Nürnberg etlich begüterte nicht mit den größern Haufen nach Frankfurt am Mayn und in andere entlegene Lande gegangen seien, sondern sie suchten immer an solchen Orten sich zu enthalten, allwo sie doch ganz unvermerkt ihren Handel und Wucher mit denen Burgern in Nürnberg und auf dem Land mit ihren Unterthanen treiben kunnten.61 Die gefühlte Gegenwart der Juden, die Würfel hier Mitte des 18. Jahrhunderts zu Papier brachte, hat sich auch in der Folgezeit behauptet62 und wurde womöglich 59
60 61 62
(Ps.-)Ioannis ab Indagine, Wahre und Grund haltende Beschreibung der heutiges Tages weltberühmten des Heiligen Römischen Reichs Freyen Stadt Nürnberg, Erfurt 1750, Vorbericht; namentlich kritisierte er Meisterlin und dessen „Historia sine parente“ (sic), in der von den alten Geschichten, die allda sollen geschehen seyn, u. d. m. hergeschwatztet, aber nicht das geringste erwiesen wird […] Aus diesem Brunnen haben nachher alle diejenige geschöpfet, welche die Ursprünge der Stadt Nürnberg und andere fabelhafte Dinge mehr denen Innwohnern in deutscher Sprache haben bekannt machen wollen. Daraus sind viele geschriebene Nürnbergische Chroniken abgefaßt, und mit nicht wenig ersonnenen Zusätzen vermehret in die Welt geflogen. Johann Heinrich von Falckenstein stammte aus dem ansbachischen Schwabach und trat nach seiner Konversion zum Katholizismus 1717 zunächst in den Dienst des Bischofs von Eichstätt, danach des Markgrafen Wilhelm Friedrich von Ansbach (vgl. ADB 6, 1877, S. 555 f.; ferner die knappe Erwähnung bei Christopher R. Friedrichs, Urban Politics and Urban Social Structure in Seventeenth-Century Germany, EHQ 22, 1992, S. 187–215, hier S. 187 f.). Vgl. Schneider, Heinrich Deichsler (wie Anm. 12), S. 11. Würfel, Historische Nachricht Fürth (wie Anm. 57), S. 2. Hier lässt sich eine aufschlussreiche Beobachtung in den Schriften des Nürnberger Theologen und Stadtbibliothekars Friedrich W. Ghillany (1807–1876) anfügen: dass er in einer anti-emanzipatorischen Schrift, die zu Zeiten der allmählichen Wiederansiedlung von Juden in Nürnberg weltgeschichtlich weit, vor allem biblisch ausholend, um die Begriffe „Volk/Völker“ und „Erwählung“ zentriert ist, ganz unvermittelt auf jüngere Ereignisse in Fürth zu sprechen kommt: Friedrich Wilhelm Ghillany, Die Judenfrage: eine Beigabe zu Bruno Bauer’s Abhandlung über diesen Gegenstand, Nürnberg 1843, hier S. 45.
208
Johannes Heil
noch von neuen Besorgnissen bestimmt. Gewiss: Allein von Falckensteins böses Urteil über die Nürnberger Chronisten, das sich besonders auf deren sichtlich antikatholisch unterfütterte Lesart der jüdischen Geschichte bezog63, dürfte Würfel Anlass genug für eine nähere Beschäftigung mit der jüdischen Geschichte gewesen sein. Denn da hatte ein Außenstehender den geschlossenen und narrativ immer weiter ausgreifenden Kreis der Nürnberger Geschichtsschreibung aufgebrochen und wesentliche Grundannahmen des im lokalen Rahmen definierten Geschichtsbildes in Frage gestellt.64 In seinem weiteren Zeitumfeld konnte Würfel 1755 aber noch mehr Anlass zu seiner engagiert-negativen Lesart der jüdischen Geschichte Nürnbergs finden. Denn mehr noch als die verdeckt geführte Kontroverse mit von Falckenstein, bei der es mehr um konfessionelle Färbungen als um wirklich verschiedene Auffassungen von den Juden und ihrer Geschichte ging, mussten die so grundsätzlich anders argumentierenden kritischen Kirchengeschichten beunruhigen, wie sie 1699 der gewesene Wittenberger Student und nachmalig radikalpietistische Quedlinburger Privatgelehrte Gottfried Arnold (1666–1714) durch seine „Unparteyische Kirchenund Ketzer-Historie“65 oder der Braunschweigisch-Wolfenbütteler Generalschulinspektor und Göttinger Theologe Johannes Lorenz von Mosheim (1693–1755) mit seinem „Versuch einer vollständigen und Unparteiischen Ketzergeschichte“ von 1746 vorgelegt hatten.66 Erwähnung verdient auch der aus Hof gebürtige und in Erlangen wirkende Johann Christoph (auch Christian) Georg Bodenschatz (1707– 1797). Seit 1740 war Bodenschatz Pfarrer in Uttenreuth wenige Kilometer östlich von Erlangen. Geographisch von Würfels Oberkrumbach nur einige Wegstunden entfernt, lagen zwischen beider Sichtweisen auf das Judentum und die Juden ihrer Zeit die sprichwörtlichen Welten. Bodenschatzʼ Verbindung von theologischer und orientalistischer Perspektive äußerte sich in einem anteilnehmenden Interesse für jüdische Ritualien, besonders für den Bau der Arche, der Stiftshütte und des Tempels, aber im Unterschied zu Würfel fand er, wie sein 1749 erschienenes Hauptwerk „Kirchliche Verfassung der heutigen Juden, sonderlich derer in Deutschland“ zeigt, darüber auch zu einer aufgeschlossenen Einstellung gegenüber den Juden seiner Zeit.67 Diese Werke, die zumindest im Fall Arnolds und von Mosheims aus eigener Marginalisierungs- und auch Verfolgungserfahrung geschrieben waren, entwarfen 63
64 65 66 67
Kritisch äußerte sich von Falckenstein zu den Nachrichten vom Verrat der Stadt durch die Juden 1105: (Ps.-)Ioannis ab Indagine, Wahre und Grund haltende Beschreibung (wie Anm. 59), S. 144. Ansonsten erwähnte er die Juden in seiner Gegenschrift zur Nürnberger Historiographie seit Meisterlin nur ganz am Rande und ohne besonderes Interesse, und wenn, dann mit negativem Unterton: S. 378 f. (1248), 460 f., 463 (1349), 512 (1385), 616 (1452), 646 f. (1498/99). Vgl. etwa die Kritik bei Truckenbrot, Nachrichten (wie Anm. 33), 1, S. 60. Gottfried Arnold, Unparteyische Kirchen- und Ketzer-Historie 1–2, Frankfurt am Main 1699. Johannes Lorenz von Mosheim, Versuch einer vollständigen und Unparteiischen Ketzergeschichte, Helmstedt 1746. Johann C. G. Bodenschatz, Kirchliche Verfaßung der heutigen Juden, sonderlich derer in Deutschland mit 30 Kupfern 1–4, Erlangen/Coburg 1748–1749; erweitert als Aufrichtig deutschredender Hebräer, oder die Gebräuche und Ceremonieen der Juden, Frankfurt am Main 1756; zur Person nach https://opacplus.bsb-muenchen.de/metaopac/search?pnd=11621595X [Stand: 18.12.2015].
Erinnerungsspuren und Ereigniskumulationen
209
Bilder der jüdischen Geschichte, die mit lang eingehegten Darstellungsmustern brachen. Vor allem Arnold hat mit seinem heftig befehdeten Werk, auch mit Referenz auf Nürnberg, wo die Juden um das Ende dieses [13.] seculi mit Feuer und Schwerde hingerichtet wurden, wiewohl nur ein Randthema für ihn, die jüdische Geschichte in Deutschland schonungslos als Abfolge ungerechtfertigter Verfolgungen beschrieben.68 Arnold hatte seine provokante Lesart der Geschichte schon einige Jahre vor der „Histoire des Juifs depuis Jesus-Christ“ (1717) des exilierten Hugenotten Jacques Basnage de Beauval publiziert, die in der Forschung gerne als Wendepunkt in der christlichen Wahrnehmung des Judentums betrachtet wird.69 Doch schon vor Basnage entwickelten diese pietistischen und hugenottischen, auf die Frühaufklärung verweisenden Perspektiven ein entschieden anderes Verständnis der jüdischen Geschichte, und das war eines, wogegen Würfels Darstellung offensichtlich aufbegehrte.70 Die Verteidigung der lokalen Lesart der Nürnberger jüdischen Geschichte und der Entstehung des zentralen innerstädtischen Markts gegen alle kritischen Neuerer war Würfel dabei nicht alleine aufgegeben. Denn kaum unterschiedlich dazu gestaltete sich das Bild, das der Nürnberger Prädikant, Kinderbuchautor und VoltaireBiograph Michael Truckenbrot einige Jahrzehnte nach Würfel in den zwei Bänden seiner „Nachrichten zur Geschichte der Stadt Nürnberg“ (1785/86) zeichnete.71 Wenn die Gewalt gegen die Juden 1298 als Tat des von den Pfaffen aufgehetzten Pöbels, nicht aber der Obrigkeit verstanden wurde72, dann ist das gerade einmal eine althergebrachte antiklerikal-patrizische Entlastungsstrategie, die ansonsten jedem antijüdischen Impuls freien Raum ließ. Zur gewaltsamen Gewinnung des Platzes für den Hauptmarkt 1349, die einmal mehr und nun in allerlei Einzelheiten als 68 69
70
71 72
Arnold, Ketzer-Historie (wie Anm. 65), S. 402, ferner S. 416, 1069 ff. Jacques Basnage de Beauval, Histoire des Juifs depuis Jesus-Christ jusqu’à présent. Pour servir de continuation a l’histoire de Joseph, Rotterdam 1706; vgl. Jonathan M. Elukin, Jacques Basnage and the History of the Jews. Anti-Catholic Polemic and Historical Allegory in the Republic of Letters, in: JHIdeas 53, 1992, S. 603–630; Ulrich Wyrwa, Die europäischen Seiten der jüdischen Geschichtsschreibung, in: ders. (Hg.), Judentum und Historismus. Zur Entstehung der jüdischen Geschichtswissenschaft in Europa, Frankfurt am Main 2003, S. 9–36, hier S. 12–15. Dazu gehört auch, dass der bereits oben, Anm. 62, genannte Ghillany auf den „Ritualmord“Vorwurf von Damaskus noch im Jahr 1842 mit einer bald 800seitigen Schrift reagierte, die den Nachweis der rituellen Menschenopferung unter den alten Hebräern erbringen sollte, wonach dann gegen die Annahme der „Humanität der neueren Zeit“ auch die in Mittelalter und Neuzeit erhobenen Vorwürfe „nicht aus der Luft gegriffen“ sein könnten: Die Menschenopfer der alten Hebräer: eine geschichtliche Untersuchung, Nürnberg 1842; vgl. auch dens., Das Judenthum und die Kritik: oder es bleibt bei den Menschenopfern der Hebräer und bei der Nothwendigkeit einer zeitgemäßen Reform des Judenthums, Nürnberg 1844. Truckenbrot, Nachrichten (wie Anm. 33). Ebd., 2, S. 393, ferner S. 448. Vgl. auch ebd., S. 391: Man erdachte daher einen andern heiligen Fund, und wiegelte den andächtigen Pöbel, der noch itzt die Juden ärger als den Teufel haßt, gegen sie auf. Man schilderte dieses arme Volk als die ärgsten Feinde des Andenkens Jesu Christi, der christlichen Religion, der ganzen Christenheit, als Lästerer und Schänder der heiligsten Gegenstände des Christenthums, und als für den Staat gefährliche Bösewichter […] Für den Pöbel, der die Juden tödlich haßte, seinen Priestern blindlings glaubte.
210
Johannes Heil
maßvolle Umsiedlung beschrieben, wohingegen die Tötung der Juden in Abrede gestellt wurde, schrieb Truckenbrot lakonisch: Es ist bekanntlich eben kein lustiger Anblick, wenn die Hauptstrassen und großen Plätze eines Orts von vielen Juden bewohnt sind.73 Ganz anders in der Tonlage und mit erklärter Kritik an alten judenfeindlichen Traditionen, dafür aber mit neuen sachlichen Fehlern versehen, liest sich dagegen die „Kleine Chronik der Reichsstadt Nürnberg“, die der aus Nürnberg gebürtige Altdorfer Jurist Johann Christian Siebenkees 1790 vorlegte. Die Zerstörung der Stadt 1105 verband er nicht mit den Juden und zeigte sich reserviert gegenüber dem Brunnenvergiftungsvorwurf von 1348/49. Dafür verzeichnet er die Stadtrevolte von 1348 zu einem Angriff wider den Rath und die Juden, der Karl IV. durch Bestrafung der Aufrührer ein Ende bereitet habe: Sie plünderten die Häuser der Patricier und Juden, bemächtigten sich des Rathhauses, beraubten die öffentlichen Cassen und verwüsteten manche Urkunde. Sie jagten den alten Rath aus der Stadt und erwählten einen andern aus ihrem Mittel. Carl IV kam 1350 selbst nach Nürnberg, setzte den alten Rath aus den erbaren Geschlechtern in seine ehemahligen Gerechtsame wieder ein [und] bestrafte die Anstifter des Aufruhrs.74 Nach den vielstimmigen Mitteilungen zur Nürnberger jüdischen Geschichte, die in bemerkenswerter und hier nur annährend vollständig aufgezeigter Dichte bis zum Ende der reichsstädtischen Zeit geschrieben und gedruckt worden waren, mussten jüngere Bearbeiter regelrecht Aufräumarbeiten im städtischen Geschichtsraum leisten. Dabei kamen Ende des 19. Jahrhunderts im Abstand von nur neun Jahren gleich zwei Darstellungen heraus, die beide für sich in Anspruch nahmen, aufgrund der Mängel und tendenziösen Darstellungen der älteren Literatur (namentlich Würfel) die in den Archiven der Gemeinden und der Städte vorhandenen Quellen neu erschlossen zu haben. Ein nur kurzer Blick in die Bücher Hugo Barbecks (1878)75 und Adolf Kurländers (1887)76 zeigt, dass abgesehen von der leichten Verschiedenheit der Titel nicht nur ihre Entstehung zeitlich eng beieinanderlag, sondern sie sich, angefangen mit den Inhaltsverzeichnissen einschließlich der Benennung der Beilagen bis hin zu Auszeichnungen oder gelegentlich sehr eigenwilligen Formulierungen völlig gleichen, wobei der jüngere (Kurländer) dem älteren (Barbeck) wohl im Vorwort „dankend gedacht[e]“, dessen Arbeit selbst aber unerwähnt ließ.77 Als einzig nennenswerten Unterschied lässt sich anführen, dass Kurländer im Vorwort seiner „Geschichte der Juden in Franken“ von 1887 sich noch deutlicher von den „intolerantesten Anschauungen“ Würfels und seiner Vorgänger sowie den daraus folgenden „Entstellungen von Thatsachen“ absetzte.78 An diesen 73 74 75 76 77 78
Ebd., S. 449, 456 (hier das Zitat), ferner S. 451. Johann Christian Siebenkees, Kleine Chronik der Reichsstadt Nürnberg, Altdorf 1790, S. 16 f., zu 1498/99 S. 48 f., ferner S. 4. Vgl. Barbeck, Geschichte (wie Anm. 8); Hugo Barbeck (1851–1907), Buchhändler und Verleger, war als Vertreter der ‚Freisinnigen Volkspartei‘ Nürnberger Magistratsmitglied und von 1903 bis 1907 Mitglied des Deutschen Reichstags für den Wahlkreis Mittelfranken 2. Vgl. Kurländer, Geschichte (wie Anm. 8). Vgl. etwa beider Beginn der Darstellung zu Fürth, jeweils S. 45. Kurländer, Geschichte (wie Anm. 8), Vorwort.
Erinnerungsspuren und Ereigniskumulationen
211
Vorgängern hatte sich tatsächlich aber schon Barbeck mit immer neuen Korrekturen an Müllner, Würfel und den anderen abgearbeitet.79 Daran wird auch erkennbar, wie stark eine nur ansatzweise schon historistisch geprägte, aber deutlich liberalem Gedankengut verpflichtete Geschichtsschreibung sich im lokalen Zusammenhang in eine ältere Traditionslinie gerückt sah, auch wenn oder gerade weil deren Haltungen und Methoden als überholt und inakzeptabel galten und zur Formulierung von Gegenpositionen herausforderten. Nimmt man noch Siegfried Haenles bereits 1867 vorgelegte, qualitativ gegenüber Barbeck/Kurländer aber weitaus gründlichere „Geschichte der Juden im ehemaligen Fürstenthum Ansbach“80 oder Hans Carl Brieglebs Darstellung der Vertreibung der Nürnberger Juden 1498 von 186881 hinzu, dann lässt sich zweierlei festhalten: Einmal hat man im 19. Jahrhundert die bis auf Meisterlin zurückreichenden Verzerrungen der Nürnberger und fränkischen jüdischen Geschichte nicht unbeantwortet gelassen, sondern energisch gegengeschrieben; und zum andern hat sich mit und nach Hugo Barbeck die für Nürnberg so auffallende, andernorts vor dem späteren 20. Jahrhundert aber eher ungewöhnliche nichtjüdische Befassung mit jüdischer Geschichte fortgesetzt – nun freilich in kritischer Auseinandersetzung mit der Geschichtsschreibung von Meisterlin bis auf Würfel und in Ersetzung ihres durchweg tendenziösen Blicks. Die anhaltende Beunruhigung über den jüdischen Anteil an der Nürnberger Geschichte, die nach 1499 ein ums andere Mal zu immer neuen legitimatorischen Darstellungen von Verfolgung und Vertreibung angehalten hatte, fand unter neuen Vorzeichen in der Zeit des Kaiserreichs und der Weimarer Republik also Fortsetzung. Nimmt man Kurländers Darstellung als das, was sie ist – nämlich ein Aufguss von Barbecks älterem Buch (oder nennen wir es einfach ein Plagiat) – dann blieb in Nürnberg die jüdische Geschichte eine Domäne der nicht-jüdischen Historiographie. Man kannte dort – um nur zwei zu nennen – anders als für Frankfurt oder Bamberg keinen Isidor Kracauer oder Adolf Eckstein. Für diese ‚neue städtische Historiographie‘ zu den Juden stehen auch zwei längere Beitragsserien des Stadtarchivars Ernst Mummenhoff (1848–1931) für das „Unterhaltungsblatt“ des „Fränkischen Kuriers“ zur Nürnberger jüdischen Geschichte aus dem Jahr 1908, die dann in dessen „Gesammelten Aufsätzen und Vorträgen“ 1931 noch einmal zum Druck kamen.82 Für den historisch weit ausgreifen79 80
81
82
Zahlreiche Beispiele bei Barbeck, Geschichte (wie Anm. 8), S. 4–7, 13, 19 f., 26 f. u. ö. Siegfried Haenle, Geschichte der Juden im ehemaligen Fürstenthum Ansbach, mit Urkunden und Regesten, Ansbach 1867, ND mit [Geleitwort von Kurt Töppner und einem Vorwort sowie mit] einem Schlagwortregister versehen von Hermann Süß [Hainsfarth 1990]; Siegfried (Salomon) Haenle (1814–1889), Jurist und Historiker, entstammte einer Heidingsfelder Familie und konvertierte 1854; er war Mitbegründer des deutschen Anwaltsvereins und der ‚Juristischen Wochenschrift‘. Hans Carl B. Briegleb, Die Ausweisung der Juden von Nürnberg im Jahre 1499 – Geschichtlicher Rückblick, Leipzig 1868. Briegleb (1805–1879) war Rechtsanwalt in Nürnberg und wurde 1845 auf eine juristische Professur in Erlangen berufen; seine Arbeiten galten u. a. der mittelalterlichen Rechts-, insbesondere der Prozessgeschichte (ADB 47, 1903, S. 233 f.). Mummenhoff, Juden (wie Anm. 8); ders., Die Juden in Nürnberg […] in topographischer und kulturhistorischer Beziehung (wie Anm. 8); Mummenhoff (1848–1931) war Archivdirektor bis
212
Johannes Heil
den ersten Teil seiner Darstellung berief Mummenhoff sich auf einen Vortrag „Die Juden in Europa“, den der liberal-katholische Kirchenhistoriker Ignaz von Döllinger 1881 anlässlich des 37. Geburtstags König Ludwigs II. in der Münchener Akademie gehalten hatte. Damit hatte der Katholik Mummenhoff im protestantischen Nürnberg seine den Juden gewogene Lesart auf das geschickteste mit höchster Autorität versehen. Zum Beleg für seine Ausführungen zu Nürnberg verwies Mummenhoff pauschal auf die Bestände seines Hauses und ging, was angesichts des Druckorts nur zu verständlich ist, auch sonst sparsam mit Belegen um.83 Im „Unterhaltungsblatt“ breitete Mummenhoff Gelehrsamkeit vor einem allgemeinen Publikum aus, und das zu einem wenig bequemen Thema. Deutlich erkennbar ist der geschulte Umgang mit den Quellen, im Unterschied zu Barbeck/Kurländer mit dem Ergebnis einer wohlgeordneten und gut lesbaren Darstellung. Sie verzichtete auch weitgehend auf die Auseinandersetzungen mit den älteren Versionen und beschränkte sich konsequent auf den reich vorhandenen Quellenbestand seines Archivs. Das Ergebnis waren, um nur Beispiele zu nennen, Kratzer am sonst vorherrschenden glorreichen Kreuzzugsbild oder Kritik an Päpsten und Regenten, namentlich an Friedrich II. und dem in Nürnberg sonst so hoch verehrten Karl IV.84 Am deutlichsten brachte Mummenhoff seine Haltung da zum Ausdruck, wo er feststellte, dass sich unter den Ratsdeputierten, die den Juden 1498 die Bedingungen ihrer Vertreibung vermittelten, auch der Humanist Willibald Pirckheimer befunden habe, der sich „ebenso wenig zu einer höheren und menschlicheren Auffassung der Dinge hatte erheben können wie seine Ratsgenossen“ und „wie sie von der allgemeinen Seuche des Judenhasses angesteckt war.“85 Während sich in Nürnberg also die nicht-jüdische Geschichtsschreibung daran machte, das jüdische Mittelalter als Teil der eigenen Stadtgeschichte neu und auch selbstkritisch zu entdecken, wurde in der 1857 neu gegründeten Israelitischen Kultusgemeinde gerade die Distanz zu den Vorgängergemeinden betont – allem Anschein nach auch durch das ausgesucht distanzierte, nämlich orientalisierende Gepräge der 1874 geweihten neuen Hauptsynagoge auf dem Gelände des ehemaligen Harsdörferhofs, nachmals Hans Sachs-Platz, deren Adresse vielleicht schon die einzige von außen sichtbare Anknüpfung an lokale Traditionen war.86 In seinem Buch
83 84 85 86
1921; vgl. NDB 18, 1997, S. 583 f.; ein noch 1933 gedruckter Nachruf bemerkte, er habe in seiner Arbeit „der Juden in Nürnberg […] tragisches Schicksal hierselbst […] nach verschiedenen Seiten hin behandelt“: Emil Reike, in: Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Stadt Nürnberg 31, 1933, hier S. 10. Mummenhoff, Juden (wie Anm. 8), S. 301, Anm. 2. Für einen detaillierten Quellennachweis dürfte das „Unterhaltungsblatt“ auch gänzlich ungeeignet gewesen sein. Der Standort ließ sich bei der Mehrzahl der zitierten Quellen bei Bedarf aus dem Zusammenhang erschließen. Ebd., S. 305, 313 ff. Ebd., S. 333. Welch zentrale Rolle die mittelalterliche Geschichte bei der Bauplatzfindung für die neue Synagoge an Stelle des alten Harsdörferhofs spielte, geht, trotz der gebotenen Zurückhaltung der Darstellung, aus Ziemlichs Aufzeichnungen hervor: Bernhard Ziemlich, Die Israelitische Kultusgemeinde Nürnberg von ihrem Entstehen bis zur Einweihung ihrer Synagoge. Gedenkschrift aus Anlaß des 25jährigen Bestehens der Synagoge auf Wunsch der Gemeindeverwaltung herausgegeben, Nürnberg 1900, insb. S. 76 f., Exkurs Anm. 2.
Erinnerungsspuren und Ereigniskumulationen
213
anlässlich der fünfzigsten Wiederkehr des Weihetags der Synagoge schrieb Rabbiner Max Freudenthal: „Die Kultusgemeinde Nürnberg ist eine junge und darum in ihrem Gefüge, ihren Einrichtungen, in ihren inneren Strebungen und äußeren Beziehungen ganz moderne Gemeinde. Zusammenhänge mit den beiden mittelalterlichen Gemeinden bestehen nicht. Seit dem Jahr 1499, in welchem die Stadt Nürnberg ihre Tore für die Juden schloß, hörten die Traditionen auf.“87 Freudenthal ging auch auf das Erscheinungsbild der Synagoge mit ihrem „an den Orient gemahnenden Baustil“ ein, die sich „von den Bauwerken deutscher Gotik ringsum auffällig ab[hebt].“ Damit sollte sie „auf deutschem Boden ruhend […] heiliges Land der Väter mit heimischem Land der Söhne, religiösen Glauben und vaterländische Treue miteinander vereinen.“ Das „innerlich und äußerlich starke Band zwischen Vergangenheit und Gegenwart“ verlief aus Freudenthals Sicht also nicht zum Nürnberger Hauptmarkt und zur Pegnitz, sondern nach Jerusalem und an den Euphrat.88 In bemerkenswertem Kontrast dazu hatte die „Nürnberger Presse“ den Bau anlässlich seiner Weihe 1874 als „eine Art Sühne für die Greuel, welche die vergangenen Jahrhunderte an den Juden begangen haben“, gelesen. Das war durchaus eine offiziöse Lesart, denn es wird auch berichtet, dass der Erste Bürgermeister Karl Otto Stromer von Reichenbach am Weihetag in seinem Trinkspruch anlässlich des Festbanketts ausdrücklich die Verbindung zu 1349 und die Verwicklung seines Vorfahren Ulrich von Stromer darin hergestellt und derhalben lebhaft den seit 1349 „eingetretenen Fortschritt der Gesinnung“ beschworen habe.89 Immerhin: auch Rabbiner Freudenthal zeigte sich nicht vollends geschichtsvergessen, denn er hat 1912 den Kauf des im einstigen mittelalterlichen Judenviertel freigelegten „Judensteins“, ursprünglich ein Aufsatz zum Thoraschrein mit der Inschrift „Keter (Krone der) Tora“, angeregt und dafür gesorgt, dass dieses „Überbleibsel“ in der neuen Synagoge, dort allerdings an der Westwand, also gegen die Gebetsachse, eingelassen wurde.90 Die Arbeiten an der jüdischen Geschichte gingen auch nach 1933 weiter, oder besser gesagt: sie sollten einen neuen Aufschwung nehmen.91 Für Nürnberg zu nennen ist eine 1936 im Manuskript abgeschlossene, aber ungedruckt gebliebene „Geschichte der Juden in Nürnberg“ aus der Feder des Nürnberger Stadtarchivrats Reinhold Schaffer, der zum Zeitpunkt der Abfassung zumindest nominell noch
87 88 89 90 91
Max Freudenthal, Die israelitische Kultusgemeinde Nürnberg 1874–1924, Nürnberg 1925, S. 1. Vgl. auch Ziemlich, Kultusgemeinde (wie Anm. 86), S. Vi f., 1, 6; Außen- und Innenansicht der Synagoge bei Zettl, Juden (wie Anm. 9), S. 22 f. Freudenthal, Kultusgemeinde (wie Anm. 87), S. 3; Ziemlich, Kultusgemeinde (wie Anm. 86), S. Vi f., 1, 6. Nachweise bei Ziemlich, Kultusgemeinde (wie Anm. 86), S. 89, 91 f.; Zettl, Juden (wie Anm. 9), S. 3. Ziemlich, Kultusgemeinde (wie Anm. 86), S. 13; Abbildungen des ehemaligen und heutigen Zustands bei Zettl, Juden (wie Anm. 9), S. 16 f. Vgl. Dirk Rupnow, Judenforschung im Dritten Reich. Wissenschaft zwischen Politik, Propaganda und Ideologie (Historische Grundlagen der Moderne 4) Baden-Baden 2011.
214
Johannes Heil
Priester der Erzdiözese Bamberg war.92 Sie ist als Typoskript in zwei sich ergänzen92
Die auf bedrückende Weise aussagekräftige Biographie des Autors verdient eine kurze Skizze: Reinhold Schaffer (1891–1963) war in Pottenstein (Lkr. Bayreuth) aus einfachen Verhältnissen geboren und hatte nach Schulzeit im Internat der Redemptoristen in Gars am Inn und am Neuen Gymnasium Regensburg zunächst an der Philososphisch-Theologischen Hochschule Bamberg studiert (1912–1916). Im Oktober 1913 wurde er ins Bamberger Priesterseminar aufgenommen und im Dezember 1914 zum Militärdienst einberufen. Wegen eines Magenleidens folgte ein halbjähriger Aufenthalt im Lazarett bis zur Entlassung im Sommer 1915 „als dienstunbrauchbar“ und die Fortsetzung des Theologiestudiums. Ein neuerlicher Gestellungsbefehl vom November 1915 wurde auf Intervention des Erzbischofs bis 1. Januar 1916 aufgeschoben und offenbar nicht wiederholt. Die Priesterweihe empfing er im Juli 1916 (PA im EDiözA Bamberg). Nach eigenen Angaben war Schaffer von August 1916 bis Ostern 1918 als „Hilfsgeistlicher“ in der Diözese Bamberg tätig; diese Angabe ist überhaupt die einzige, die er im Laufe seiner späteren Archivarstätigkeit zu seiner kirchlichen Karriere machte (PA im StA München). Tatsächlich handelte es sich nach PA EDiözA Bamberg um Kaplans-, Kooperatoren- und Pfarrverweserstellen an sechs Orten des Erzbistums, darunter in St. Josef/Nürnberg. Nach ärztlichem Gutachten vom Herbst 1920 folgte ein halbjähriger bezahlter Erholungsurlaub „wegen nachgewiesener Erkrankung“, der mehrfach verlängert wurde. Im März 1922 erklärte die „Landesfürsorgestelle für Kriegsbeschädigte und Kriegshinterbliebene“ schließlich, Schaffer könne „die Tätigkeit eines katholischen Geistlichen […] glaubhafter Weise auf Dauer nicht ausführen. Er leidet an depressiver Neurasthenie auf psychopatischer Grundlage und außerdem an nervöser Herzstörung.“ Schaffers Gesuch um Versetzung in den Schuldienst vom März 1922 wurde mit Verweis auf seinen Gesundheitszustand (Kultusministerium) und den herrschenden Priestermangel (Erzdiözese) abgelehnt, ebenso wie die Empfehlung von Prof. Paul Clemen/Bonn, ihn im Bereich der kirchlichen Denkmalpflege einzusetzen (soweit PA im EDiözA Bamberg). Seit der Beurlaubung vom kirchlichen Dienst 1920 hatte Schaffer in Bonn Geschichte, Kunstgeschichte und Literatur studiert, wo er 1923 mit einer Arbeit zu Veit Stoss promoviert wurde. Im Mai 1923 stellte er, nachdem bereits für 1914 ein dann wieder aufgegebener Entschluss zum Verlassen des Priesterseminars belegt ist, bei der römischen Sakramentenkongregation den Antrag auf „Zurücksetzung in den Laienstand“, dem nicht entsprochen wurde (PA EDiözA Bamberg). Nach dem Volontariat für den Höheren Archivdienst am BayHStA München (1923– 1926) wechselte er 1926 an das Stadtarchiv Nürnberg, dessen Leitung er in Nachfolge Emil Reikes im Mai 1930 übernahm, allerdings nur im Rang eines Archivrats bei niedrigerer Besoldung. Die darauf folgenden Auseinandersetzungen mit der Stadt Nürnberg, die Schaffer zeitweise als Streitverfahren vor dem Schiedsgericht der Regierung von Ober- und Mittelfranken führte, wurde erst im Mai 1937 durch den Nürnberger OB Liebel zu Schaffers Gunsten entschieden (PA StA München). Im April 1933 stellte er, der sich ungeachtet des noch offenen Verfahrens im Briefkopf als „Direktor des Stadtarchivs Nürnberg“ ausgab, in Rom einen erneuten Antrag auf Laisierung, dem schließlich im Mai 1936 entsprochen wurde. Im Juni 1938, noch vor seinem Wechsel auf die Leitung des Münchener Stadtarchivs, folgte die katholische Eheschließung in der Kirche Heilig-Blut, München-Bogenhausen (wo unter Prälat Max Blumschein als Kapläne ab 1939 Alfred Delp S. J. und Dr. Hermann Josef Wehrle wirkten, die im Zusammenhang des gescheiterten Putsches vom 20. Juli 1944 hingerichtet wurden) mit der evang. Nürnbergerin Edith Maria Anika Müller (PA EDiözA Bamberg). 1939 wurde Schaffer in Nachfolge Pius Dirrs (1919–1924 DDP-Abgeordneter in der Bayerischen Abgeordnetenkammer) zum Leiter des Stadtarchivs München berufen, wo „die Kriegs- und Nachkriegswirren […] den organisatorischen und fachlichen Fähigkeiten Schaffers auf der Höhe seines Lebens sogleich jahrelang Fesseln an[legten]“ (Michael Schattenhofer, Nachruf Reinhold Schaffer, in: Der Archivar 17, 1964, Sp. 144 f.). Welche Vorgänge genau mit dieser nebulösen Formulierung überschrieben wurden und wo der Nachruf (ohne Kenntnis von Schaffers kirchlicher
Erinnerungsspuren und Ereigniskumulationen
215
den unvollständigen Versionen erhalten.93 Im Vorspann heißt es, „mangels entsprechender Literatur“ habe die „vorliegende Forschung […] ganz aus den Originalquellen herausgeholt werden“ müssen. Tatsächlich stützte sich Schaffer zu weiten Teilen auf ungedruckte Nürnberger Archivalien und gedruckte Quellen sowie Regesten (MGH, ferner Salfeld, Aronius und andere jüdische Bearbeiter) und legte hinsichtlich des Umfangs seiner Quellenbasis und der Genauigkeit der Nachweise gerade der Archivalien die bis dahin bei weitem sorgfältigste Arbeit zur Nürnberger jüdischen Geschichte vor. Dagegen ignorierte er, von wenigen Ausnahmen abgesehen94, die jüdische und sonstige Forschung des 19. und früheren 20. Jahrhunderts zur jüdischen Geschichte Nürnbergs; insbesondere fehlt, obwohl ihm kaum dessen Arbeiten im eigenen Haus entgangen sein dürften, ein Hinweis auf Hayim Tykocinskis wenig älteren, allerdings hinsichtlich seiner Quellenbasis auch weniger fun-
93
94
Karriere) ansonsten nicht mit dezenten Hinweisen auf Schaffers schwierige Persönlichkeit spart, lässt sich nicht mehr feststellen. Laut Schaffers mehrfachen Angaben – sowohl im Fragebogen zur Durchführung des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums mit Unterschrift vom 13. Juli 1933, dann im Personalbogen zur Anstellung als Direktor des Münchener Stadtarchivs 1939 wie auch im Zuge der Entnazifizierung im Fragebogen der Stadtverwaltung vom 22. Juni 1945 – war er nie Mitglied der NSDAP oder anderer nennenswerter NSGliederungen gewesen. Zu Schaffers wissenschaftlichen Arbeiten, in dessen Person sich „ein scharfer Verstand und ein ausgeprägtes Empfinden“ gegenübergestanden haben sollen und der auch Gedichte schrieb (vgl. Reinhold Schaffer, Verse, München ~1948), heißt es bei Schattenhofer u. a.: „Eine Geschichte der Juden in Nürnberg blieb ungedruckt.“ Vgl. auch den wohl längeren, aber weniger aussagekräftigen Nachruf von Max Spindler, in: ZBLG 26, 1963, S. 829–833; alle weiteren Angaben nach Archiv des Erzbistums Bamberg, verbunden mit großem Dank an dessen Leiter Diakon Andreas Hölscher, Rep. 3 Nr. 3103/806; sowie, mit ebensolchen Dank an die Leitung, Stadtarchiv München, Personalakten 11057: PA Reinhold Schaffer, insb. Pol. Unterlagen c; Zeugnisse f und n., Beiakt A2. Reinhold Schaffer, Geschichte der Juden in Nürnberg bearbeitet i. A. des Herrn Oberbürgermeisters der Stadt Nürnberg [1936], StA Nürnberg, E 10 / 25 Nr. 4; das hektographierte, unvollständige Manuskript ist mit originalen handschriftlichen Korrekturen samt Streichungen und Ergänzungen von einer Hand versehen; der Akte beigelegt ist eine zweite Version mit dem Titel: Geschichte der Juden in Nürnberg von Reinhold Schaffer, Städt. Archivdirektor in München; das stenotypierte Manuskript ohne Paginierung ist eingangs vollständig und hat die Korrekturen des „Nürnberger“ Exemplars ausgeführt; es bricht bei S. 69 des „Nürnberger Exemplars“ ab und weist nur geringe, ausschließlich formale oder orthographische handschriftliche Korrekturen auf. Zu Schaffers sonstigen Arbeiten: Andreas Stoss, Sohn des Veit Stoss, und seine gegenreformatorische Tätigkeit (Breslauer Studien zur historischen Theologie = N. F. der Kirchengeschichtlichen Abhandlungen 5), zugl. Phil. Diss. Bonn 1923 (1924), Breslau 1926. Es folgten auf Beiträge zu den Mitteilungen des Vereins für die Geschichte der Stadt Nürnberg 1928–1931 zwei kleinere selbständige Arbeiten über Veit Stoss (Nürnberg 1933) und das Pellerhaus in Nürnberg (Nürnberg 1934), sowie An der Wiege Münchens (Neue Schriftenreihe des Stadtarchivs München 2) München 1950. Aus der Münchener Zeit sind von 1939 bis 1950 keine Publikationen Schaffers belegt. Vgl. etwa Schaffer, Geschichte (wie Anm. 93), S. 18, Anm. 7, den handschriftlich nachgetragenen Bezug auf Heinrich Graetz; ferner S. 59 mit Anm. 1 („Der Jude Stern sieht das unter jüdischem Gesichtswinkel“); zum Umgang mit den Arbeiten jüdischer Historiker, hier am Beispiel Wilhelm Grau, vgl. Dirk Rupnow, Vernichten und Erinnern. Spuren nationalsozialistischer Gedächtnispolitik, Göttingen 2005, S. 188 f.
216
Johannes Heil
dierten Beitrag zum ersten Band der „Germania Judaica“ (1934).95 Schaffers Arbeit ist aus bislang ungeklärten Gründen nicht zum Druck gekommen. An mangelnder politischer Linienförmigkeit der Darstellung dieses ursprünglich von der katholischen Kirchengeschichte hergekommenen Archivars kann das aber kaum gelegen haben.96 Denn seine Arbeit ist in all ihren Vorannahmen und Schlussfolgerungen als unbedingter Beitrag zur nationalsozialistischen Erforschung der „Judenfrage“ gehalten. Einige kurze Leseproben reichen zum Nachweis, wie sehr sich Schaffer darauf verstand, die Gobbels’sche Semantik in den Dienst der Wissenschaft zu stellen: „Man scheute dafür [den Synagogenbau des 13. Jahrhunderts] nicht die Mittel, die der sumpfige Baugrund ‚Auf dem See‘ verschlingen mußte, nur um sich in echt jüdischer Bescheidenheit in den Vordergrund zu drängen.“97 Zu den Pogromen von 1298 überwiegen die Anleihen beim Wortschatz religiöser Judenfeindschaft: die Juden hätten mit ihrem wirtschaftlichen Gebaren selbst „allenthalben die Wut gegen die Erbfeinde der Christenheit und die Aussauger des Volkes“ entfesselt.98 Mit der Verquickung von gründlicher Quellenerschließung und ideologiegeleiteter Deutung ähnelt Schaffers Arbeit daher bei allerdings weit geringerem Umfang auffallend der 1934 erschienenen Studie von Wilhelm Grau zur Regensburger jüdischen Geschichte.99 Ganz so wie Grau es vorgemacht hatte, überformte auch Schaffer die jüdische Geschichte zu einem Reservoir gegenwartsorientierter Ideologiebegründung. Das wird besonders da deutlich, wo er hinter den „Ausweisungsgesetzen“ des Rates „gegen die Juden“ 1349 als Ziel „eine völlige Säuberung der Stadt“ 95
96
97 98 99
Hayim Tykocinski hatte seine Arbeiten für den Art. Nürnberg der Germania Judaica 1, S. 249– 253, wohl vor 1931 abgeschlossen; aller Wahrscheinlichkeit hatte Schaffer Tykocinskis Arbeiten in „seinem“ Archiv mitverfolgt, vielleicht sogar davon profitiert. Mummenhoff wird von Schaffer gelegentlich zitiert, ohne dabei anzuzeigen, in welchem Umfang seine Arbeit an den Vorgänger anschloss und ob sie ursprünglich als dessen Fortschreibung gedacht gewesen sein könnte. Ursache könnte nicht zuletzt ein schwindendes Nürnberger Interesse an Schaffers Hinterlassenschaft nach dessen Weggang nach München gewesen sein. In seiner Bewerbung um die Leitung des dortigen Stadtarchivs hatte er im Schriftenverzeichnis noch ausgeführt: „6. Die Geschichte der Juden in Nürnberg, im Manuskript fertiggestellt. Die Arbeit wird im Auftrag des Herrn Oberbürgermeisters der Stadt der Reichsparteitage in besonders schöner Ausstattung gedruckt und kann im Manuskript vorgelegt werden“ (Unterstreichung im Original, PA StA Nürnberg, Zeugnisse f: Anhang masch.schr. Schriftenverzeichnis zum C. V. Schaffer vom 27.7.1938). Womöglich hinderte auch Schaffers Herkommen aus dem katholisch-akademischen Milieu eine unbestrittene Etablierung in der NS-Judenforschung (vgl. dazu unten mit Anm. 99). Schaffer, Geschichte (wie Anm. 93), S. 6. Ebd., S. 8. Wilhelm Grau, Antisemitismus im späten Mittelalter. Das Ende der Regensburger Judengemeinde 1450–1519, Berlin 1934, ebd. 21939. Schaffer teilte mit Grau das Herkommen aus dem katholischen Milieu, trat aber, wohl auch weil aus bereits gesicherter Position wirkend, in der NS-Geschichtsforschung nicht so markant hervor; zu Grau vgl. Patricia von Papen-Bodek, Judenforschung und Judenverfolgung. Die Habilitation des Geschäftsführers der Forschungsabteilung Judenfrage, Wilhelm Grau, an der Universität München 1937, in: Elisabeth Kraus (Hg.), Die Universität München im Dritten Reich. Aufsätze (Beiträge zur Geschichte der Ludwig-Maximilians-Universität München 4) München 2008, 2, S. 209–264; Rupnow, Judenforschung (wie Anm. 91), S. 28 ff., 84 f., 98 f.
Erinnerungsspuren und Ereigniskumulationen
217
erkannte, die „sicher aber nicht die Tötung der fremden Volksteile ins Auge faßte.“100 Das war historisch bearbeitet, aber wohl vor allem gegenwärtig gedacht. Denn in der Sache bot Schaffer hier einen geschichtlichen Subtext zur nationalsozialistischen Verfolgungspolitik zum Zeitpunkt der „Nürnberger Gesetze“ von 1935, die dann namentlich auch als Schluss- und offenbar gewollter Höhepunkt seiner Darstellung angeführt werden. Im Grunde verstand Schaffer die „Nürnberger Gesetze“ und deren prospektive Folgen als erfolgreiche Wiedergänger des Nürnberger Vertreibungsbeschlusses von 1498, mit dem 1936 hoffnungsvoll stimmenden Unterschied, dass „nunmehr die Judenfrage keine Grenze mehr findet am Rande des reichsstädtischen Territoriums. Durch die Nürnberger Judengesetze zur Reinhaltung des deutschen Blutes vom Jahre 1935 wurde von einem alten, judenfeindlichen Vorwerk aus die Judenfrage für das ganze Reich gelöst. Die Kampfansage des Führers an das Weltjudentum auf dem Parteitag 1936 fand ein zustimmendes Echo weit über die Reichsgrenzen hinaus.“101 Der englische Publizist Joshua Podro hat in seinem Nürnberg-Buch aus entgegengesetztem Blickwinkel 1937 übrigens ganz ähnlich geurteilt: „The spirit and the laws of Nuremberg are now supreme in Germany […] the influence of Nuremberg has spread throughout Germany in all respect. […] In all Germany to-day, as in Nuremberg then, the god who rules is the state.“102 Während der in London schreibende Podro aller Wahrscheinlichkeit nach ohne Kenntnis von Schaffers Arbeit schrieb103, war die Verbindung zwischen den Arbeiten Graus und Schaffers womöglich noch enger, als der äußere Anschein preisgibt. Denn ganz wie Grau sich die umfangreichen Vorarbeiten Raphael Strauss’ für einen Quellenband zur Geschichte der Regensburger Juden verschafft hatte, um daraus seine ganz eigene Geschichte zu formen104, so dürfte Schaffer schon vor 1933 seine Arbeiten zur Nürnberger jüdischen Geschichte begonnen haben oder wenigstens dazu angeregt worden sein – nämlich von Ernst Mummenhoff, hatte dieser doch 1931 zur strittigen Frage des ersten jüdischen Wohngebiets in Nürnberg auf Schaf-
100 Schaffer, Geschichte (wie Anm. 93), S. 20 f.; vgl. dazu auch noch die zugespitzte Darstellung: ders., Die räumliche Entwicklung Nürnbergs [1937], S. 4 f., StA Nürnberg, E 10 / 25 Nr. 1. 101 Ebd., S. 154 f. 102 Podro, Nuremberg (wie Anm. 8), S. 120. Joshua Podro, in Russland geboren und an einer Yeshiva ausgebildet, war nach dem Ersten Weltkrieg nach England eingewandert und hat sich neben seiner Tätigkeit als Medienunternehmer einen Namen als freischaffender Orientalist und Texthistoriker gemacht (mit Robert Graves: The Nazarene Gospel Restored, London 1954). Eine ältere, mehrfach wiederaufgelegte und wohl gründliche, aber eher touristisch orientierte englische Darstellung zu Geschichte und Bauwerken Nürnbergs hatte die jüdische Geschichte nur am Rande erwähnt: Cecil Headlam, The Story of Nuremberg (Medieval Towns Series 34), London 1900 u. ö., S. 35–37. 103 Podros Bibliographie führt aus den erwähnten Schriften lediglich Barbeck und Würfel an. 104 Vgl. dazu das Geleitwort Friedrich Baethgens zu: Raphael Straus, Urkunden und Aktenstücke zur Geschichte der Juden in Regensburg 1453–1738 (Quellen und Erörterungen zur Bayerischen Geschichte) München 1960; vgl. Rupnow, Vernichten (wie Anm. 94), S. 184 ff.; dens., Judenforschung (wie Anm. 91), S. 231–239.
218
Johannes Heil
fer als ausgewiesenen Experten verwiesen.105 Mummenhoff dürfte in Schaffer den geeigneten Bearbeiter einer fundierten Darstellung der Nürnberger jüdischen Geschichte gesehen haben, die über seine eigene – 1908 dem eher populären Medium und beim Nachdruck 1931 seinem vorgerückten Alter geschuldete – doch eher kursorische Darstellung hinausgehen würde. Frappierend an Schaffers Darstellung ist, dass er trotz völlig anderer, archivgestützter Quellengrundlage beinahe nahtlos an die Deutungsmuster der älteren Nürnberger Historiographie anschließen konnte. So geraten ihm die Ereignisse von 1349 zu einer Vertreibung auf Geheiß des Rates, während der Pogrom im Dezember des Jahres nur noch einige wenige getroffen haben soll, die nicht rechtzeitig aus der Stadt hatten fliehen können; damit minimierte Schaffer, ganz wie Meisterlin es vor langer Zeit vorgemacht hatte, das Ausmaß des Nürnberger Judenmords vom Dezember 1349.106 Wo auch Schaffer in seine Geschichte der Juden über deren Vertreibung 1498/99 hinausgreift und gut ein Viertel seiner Arbeit für „Nürnbergs Kampf gegen die Juden der Umgebung 1500–1806“ verwendet107, zeigt sich, wie schon zuvor bei Würfel und anderen, dass beide, die Nürnberger und die Fürther jüdische Geschichte, gerade in einer dezidiert judenfeindlichen Wahrnehmung, als Einheit verstanden wurden. Ganz wie 1349 das Judenviertel im Zentrum der Stadt der innerstädtischen Entwicklung im Weg gestanden hatte, so geriet seit den 1920er Jahren die an der Pegnitz gelegene neue Synagoge am Hans Sachs-Platz zum Stachel im Selbstbild der „deutschesten aller Städte“. Das kam einem dramatischen Werteverfall gleich, denn der 1874 geweihte Bau hatte zunächst als Attraktion gegolten und gehörte nebst der Synagoge in der Oranienburger Straße Berlin zu den meistfotografierten jüdischen Sakralbauten der Zeit um 1900. Der nationalsozialistisch gewendete Reinhold Schaffer dagegen befand 1936, dass „in das Weichbild der Nürnberger Altstadt ein Fremdkörper gestellt [wurde], der heute in seiner Aufdringlichkeit nicht mehr zu begreifen ist.“108 Hier bildet sich schon die Haltung ab, die alsbald zur Tat schreiten wollte. Nach der Münchener Hauptsynagoge (in der „Hauptstadt der Bewegung“), die bereits im Juni 1938 auf Befehl Hitlers abgebrochen wurde, war die Synagoge in der Stadt der Reichsparteitage der zweite großstädtische jüdische Sakralbau, der noch vor dem Novemberpogrom 1938 zerstört wurde.
105 Mummenhoff, Juden (wie Anm. 8), S. 337 mit Anm. 1 (der Verweis ist allerdings unklar; in Frage kommen: Reinhold Schaffer, Der Königshof Nürnberg – Zur Kritik Dr. Krafts, in: Die Heimat. Frankenland und Frankenvolk, Ser. N. F. 4, 6, 1930, S. 1 f.; und ders., Der Königshof Nürnberg, in: Fränkische Monatshefte für Heimatkunde, Kultur und Kunst 9, 1930, S. 173– 177). Da Mummenhoff, wie an oben genannter Stelle ersichtlich, seine Beiträge von 1908 für den Druck 1931 überarbeitete, erscheint eine Mitarbeit Schaffers jedenfalls gut denkbar. 106 Vgl. Schaffer, Geschichte (wie Anm. 93), S. 6, 8, passim; ferner in dichter Folge S. 93 ff. zu Vorgeschichte und Gründen für die Ausweisung 1498/99. 107 Ebd., S. 106–139. 108 Ebd., S. 153; vgl. auch dens., Das Nürnberger Stadtbild in seiner Entwicklung, in: Völkischer Beobachter 1934, Nr. 185, 189, 192; zur Verschlechterung der Situation während der Jahre der Weimarer Republik vgl. Zettl, Juden (wie Anm. 9), S. 36 ff.
Erinnerungsspuren und Ereigniskumulationen
219
Gauleiter Julius Streicher, mit dem nach Schaffer den Juden „nicht zufällig ihr größter Gegner erwuchs“ und in dessen Person „die alten verschütteten Quellen der reichsstädtischen Zeit wieder aufgebrochen“ sein sollten109, inszenierte den Beginn der Abbrucharbeiten am 10. August 1938 feierlich als negative Grundsteinlegung, so wie Oberbürgermeister Willy Liebel es damals formulierte, als „letzten Baustein in das Bauwerk der Wiederherstellung Nürnbergs […] und dieser letzte Stein ist nicht ein Stein zum Aufbauen, es ist ein Stein, der herausgerissen werden muss.“ Gauleiter Streicher war es, der in seiner Rede den historischen Bogen zu 1349 spann und dem Nürnberger Ersten Bürgermeister Karl Otto Stromer von Reichenbach, der bei der Weihe der Synagoge 1874 seines Vorfahren Ulrich Stromer und der Vertreibung der Juden „mit Feuer und Schwert“ gedacht hatte, in neuer Umkehrung jenen Ulrich Stromer gegenüberstellte, „der einst die Stadt vom Judenjoch befreit hatte.“110 Im Anschluss daran finden wir in der Presse eine Notiz, dass bei dieser Gelegenheit die mittelalterliche Geschichte auch dinglich noch einmal zum Vorschein kam: „Die Stadt der Reichsparteitage Nürnberg erlebte am 10. 8. 1938 einen denkwürdigen Tag: Julius Streicher gab das Zeichen zum Abbruch der Hauptsynagoge am Hans-Sachs-Platz, die zur Durchführung städtebaulicher Maßnahmen entfernt werden mußte. Zehntausende Volksgenossen wohnten der geschichtlichen Stunde bei. […] Kurz vor dem Abbruch der Synagoge ließen die Juden in aller Heimlichkeit aus der Synagoge einen 5 Ztr. schweren Stein mit Inschrift zur Erinnerung an die vor 500 Jahren niedergebrannte erste Synagoge in Nürnberg entfernen und auf den jüdischen Friedhof verbringen.“ Es war jener Stein, den Rabbiner Freudenthal 1912 in die Westwand der Synagoge hatte einmauern lassen. Weiter heißt es: „Die Herausnahme des Steines besorgte der Nürnberger Baumeister Fritz Frisch, der sich erst im Jahre 1937 in die NSDAP hatte aufnehmen lassen. Frisch wurde sofort aus der Partei ausgeschlossen und seine Charakterlosigkeit in der Öffentlichkeit gebührend gebrandmarkt.“111 Nürnberg ist stets ein Ort gewesen, wo das Erzählen blühte und manchmal auch faule Blüten trieb. Ein guter Teil dessen, womit die ältere Germanistik für das späte Mittelalter befasst ist, verdankt sich der regen literarischen Tätigkeit in dieser Stadt.112 Die besondere Dichte der Nürnberger Chronistik, ja dass die Handhabung 109 Ebd., S. 154. 110 Vgl. die Reden Liebels und Streichers nach der „Fränkischen Tageszeitung“, gekürzt bei Müller, Geschichte (wie Anm. 9), S. 237 f.; ferner Zettl, Juden (wie Anm. 9), S. 45 f. 111 Vgl. Otto Dov Kulka/Eberhard Jäckel, Die Juden in den geheimen Stimmungsberichten 1933– 1945, Düsseldorf 2004, Dok. 343; ferner Müller, Geschichte (wie Anm. 9), S. 239. Der „Judenstein“ ist seit 1987 in der heutigen Nürnberger Synagoge eingebaut. 112 Podro nimmt das 1937 in den Blick, wenn er die Kulturschätze der Stadt wiederholt in Kontrast zur Geschichte ihrer Juden rückt; sein 9. Kap. (S. 56–65) ist der „City of the Muses“ und insbesondere Dürer gewidmet. Zum abseits biographischer Arbeiten in systematischer Hinsicht überraschend schwach beleuchteten Thema ‚Nürnberger Literaturgeschichte‘ vgl. etwa Jörn Reichel, Der Spruchdichter Hans Rosenplüt. Literatur und Leben im spätmittelalterlichen Nürnberg, Stuttgart 1985; Horst Brunner, Kleriker, Humanisten, Gelehrte – Hans Rosenplüt, Hans Folz, Hans Sachs. Nürnberg als Literaturstadt im späten Mittelalter und in der Frühen
220
Johannes Heil
der Geschichtswerke in Nürnberg nachgerade kultische Züge annehmen konnte, hat schon Michael Truckenbrot 1785 in seiner so kritischen wie beredten Bestandsaufnahme der Werke seiner Vorgänger und Zeitgenossen betont.113 Deshalb muss es nicht wundern, dass zu den Juden auch Ereignisse zur Gewissheit gerieten, die sich nicht so oder überhaupt nicht ereignet hatten. Es wäre von da ein Leichtes, das nationalsozialistische Nürnberg ganz aus seiner Vergangenheit zu erklären, eben derart, wie Podro es 1937 tat: „So Nuremberg reverted to her old medieval self“114 und „Nuremberg was the inventor centuries ago of ‚Gleichschaltung‘“.115 Mit diesen Worten wurde die Gegenwart zum Wiedergänger der Vergangenheit, jetzt nur im reichsweiten Maßstab: anstelle der Weimarer Republik als „Nürnberger Staat“. Für die propagandistische Oberfläche der Reden Liebels und Streichers anlässlich des Abbruchs der Nürnberger Synagoge im August 1938 trifft das ja auch uneingeschränkt zu. Doch wenngleich auch Reinhold Schaffer eine solche Kontinuität behauptete, hat der versierte Historiker sich selbst um den judenfeindlichen Fundus der älteren Nürnberger Geschichtsschreibung wenig geschert und stattdessen jenen Archivbestand zu Tage befördert, der für eine moderne Darstellung der Nürnberger Jüdischen Geschichte auch heute noch maßgeblich ist. Das ist dann vielleicht das am meisten verstörende an der hier skizzierten Lesung älterer und jüngerer Texte zur Nürnberger jüdischen Geschichte: Dass Schaffer, der ausweislich seiner Personalakte 1933, dann wieder 1939 und deshalb wohl auch 1945 wahrheitsgetreu angeben konnte, dass er „nie!“ Mitglied einer Partei gewesen sei116, 1936 einige pointierte Umschreibungen genügten, um nach gründlicher zeitgemäßer Schulung mitsamt Anknüpfung an die methodischen Maßgaben der liberal-humanistischen Geschichtsschreibung zu einem Geschichtsbild zu gelangen, das bis dahin beispiellos quellengesättigt in seiner judenfeindlichen Radikalität die älteren Vorläufer noch überbieten konnte. Dass sich nach alledem das neuerliche Erzählen, eben auch des nächsten und bis dahin letzten Kapitels Nürnberger jüdischer Geschichte, den Überlebenden der Shoa erst recht aufdrängte, dokumentiert ein anderes Manuskript im Nürnberger Stadtarchiv zu dieser Geschichte „von ihren Anfängen bis zum Einmarsch der amerikanischen Truppen am 20. April 1945.“ Bernhard Kolb, der seit 1923 als Geschäftsführer der Israelitischen Kultusgemeinde Nürnberg gewirkt hatte und 1943
113 114
115 116
Neuzeit, in: Nürnberger Altstadtberichte 37, 2012, S. 63–78; ferner Albrecht Classen, Die Entdeckung des städtischen Raumes als Lebensbereich und Identifikationsmedium in spätmittelalterlichen Bildern und Texten. Der „Luttrell Psalter“, Ambrogio Lorenzettis Fresken, Hartmann Schedels „Liber chronicarum“ und Hans Sachs’ Enkomium auf Nürnberg, in: Susanne Ehrich/ Jörg Oberste (Hgg.), Städtische Räume im Mittelalter (Forum Mittelalter. Studien 5) Regensburg 2009, S. 73–92; Robert, Konrad Celtis (wie Anm. 27), S. 408 ff. Truckenbrot, Nachrichten (wie Anm. 33), S. 14 ff., 25 ff. Podro, Nuremberg (wie Anm. 8), S. 109. Die Herleitung der nationalsozialistischen Geschichtspolitik aus dem Mittelalter wurde bereits in einem Artikel der New York Times am 12. Dezember 1935 vorgenommen, vgl. Rupnow, Judenforschung (wie Anm. 91), S. 29 mit Anm. 2. Podro, Nuremberg (wie Anm. 8), Umschlagtext. Siehe oben, Anm. 92.
Erinnerungsspuren und Ereigniskumulationen
221
nach Theresienstadt deportiert worden war, hat es 1946 verfertigt. Es ist, bis heute nur teilweise veröffentlicht, nicht weit von Reinhold Schaffers Manuskript im selben Archiv abgelegt.117 Soweit im Vergleich erkennbar ist, hat Kolb die Arbeit Schaffers nicht gekannt oder sich auch gescheut, darauf zurückzugreifen. Als Quellen lassen sich vor allem Mummenhoff und für die jüngste Zeit das eigene Erleben ausmachen. Kolb wird kaum eine Vorstellung davon gehabt haben, dass der ThoraStein von der mittelalterlichen Synagoge alsbald wieder seinen Platz in einer Nürnberger Synagoge finden würde. Seine Geschichte der Nürnberger Juden dürfte er eher als Epilog geschrieben haben. Gewiss hat er sie nicht für das Archiv geschrieben. Es wäre also an der Zeit, sie vollständig zu veröffentlichen und – besser noch – sie um eine gründliche Darstellung der Geschichte dieser bedeutenden jüdischen Gemeinde in all ihren Abschnitten zu ergänzen.
117 Stadtarchiv Nürnberg F 5, 404b; Auszüge: Bernhard Kolb, Die Juden in Nürnberg 1839–1945, Typoskript 1946, bearbeitet von Gerhard Jochem: www.rijo.homepage.t-online.de/pdf/DE_ NU_JU_kolb_text.pdf.
PORZELLAN UND PROPAGANDA – KARL DER GROSSE IM NS-GESCHICHTSBILD1 Janus Gudian I. KARL DER GROSSE IM WELTBILD DES NATIONALSOZIALISMUS Seit jeher beruft sich die europäische Politik auf Karl den Großen als einen „politischen Heiligen“2: Im Mittelalter etwa taten es die Staufer, die in Karl eine sakrale Bezugsperson sahen (Friedrich I. Barbarossa ließ Karl denn auch 1165 durch den ‚Gegenpapst‘ Paschalis III. heilig sprechen)3, und in der Neuzeit identifizierte sich der Kaiser der Franzosen, Napoleon, mit ihm: „Pour le pape, je suis Charlemagne.“4 Wenn also Adolf Hitler und Karl der Große auf einem Sèvres-Porzellanschälchen in eine direkte Verbindung zueinander gesetzt werden, ist dies fast schon ein ‚Herrschaftsmerkmal‘ europäischer Potentaten und kann auf eine lange Tradition zurückblicken. Dass Hitler mit dem Karolinger verglichen werden konnte, war allerdings keine Selbstverständlichkeit, denn im nationalsozialistischen Selbstverständnis herrschten divergierende, zum Teil sogar unvereinbare Karlsauffassungen: Je nachdem, 1
2
3 4
Der vorliegende Artikel basiert auf: Janus Gudian, Karel de Grote in de historische opvatting van het nationaalsocialisme, in: Provinciebestuur Oost-Vlaanderen (Jozef Dauwe) (Hg.), De erfenis van Karel de Grote 814–2014, Gent 2014, S. 353–360. Der auf diese Textgattung abzielende Duktus wurde beibehalten. Zum Begriff des „politischen Heiligen“ vgl. Knut Görich, Die Kanonisation Karls des Großen 1165 – Ein politischer Heiliger für Friedrich Barbarossa?, in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins 113/114, 2011/2012, S. 97–112, 97 f., 100 ff.; Görich argumentiert hier zumindest für die Zeit Barbarossas gegen die Deutung Karls als eines politischen Heiligen. Insbesondere zwischen Deutschland und Frankreich war es lange Zeit umstritten, wer der ‚wahre Erbe‘ Karls des Großen sei – um so die jeweils eigenen politischen Ansprüche zu legitimieren: Vgl. hierzu Karl Ferdinand Werner, Karl der Große oder Charlemagne? Von der Aktualität einer überholten Fragestellung (Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-Historische Klasse 1995, 4) München 1995; sowie ders., Charlemagne – Karl der Große. Eine französisch-deutsche Tradition, in: Mario Kramp (Hg.), Krönungen. Könige in Aachen – Geschichte und Mythos. Katalog der Ausstellung 1, Mainz 2000, S. 25–33. Vgl. etwa Dietrich Lohrmann, Politische Instrumentalisierung Karls des Großen durch die Staufer und ihre Gegner, in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins 104/105, 2002/2003, S. 95–112. Vgl. hierzu und weiteren Beispielen der Parallelisierung von Napoleon und Karl dem Großen Matthias Pape, Der Karlskult an Wendepunkten der neueren deutschen Geschichte, in: HJb 120, 2000, S. 138–181, 142 ff.; sowie Max Kerner, Die politische Instrumentalisierung Karls des Großen im 19. und 20. Jahrhundert, in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins 104/105, 2002/2003, S. 231–276, 232 f.
224
Janus Gudian
welches Karlsbild gerade offiziell propagiert wurde, differenziert die Geschichtswissenschaft drei unterschiedliche Umgangsphasen mit dem Kaiser.5 In der ersten Phase, bis 1935, wurde der Sachsenherzog Widukind als der ‚gute Germane‘ schlechthin angesehen, der sich gegen den Eindringling, den fremden Franken, den „Römling“ Karl zur Wehr gesetzt habe.6 Dessen Hof sei viel zu völkerreich, viel zu ‚international‘ gewesen (in der Tat zog Karl Gelehrte aus allen Landen an seinen Hof: Iren und Angelsachsen, Langobarden aus Italien, spanische Goten, Alemannen, Bayern und Sachsen). Zudem galt Karl als der „Sachsenschlächter“, der bei Verden an der Aller mehrere tausend Angehörige dieses germanischen Stamms abgeschlachtet habe7: „Hohl flüsternd bringt er […] die Kunde von dem grausen Schlachten […] an dem Tage, da das Wasser der Beeke rot floß, weil König Karl es gebot“, dichtete Hermann Löns „das Lied vom aisken Schlächter“ in seinem Werk „Die rote Beeke“.8 Es waren vor allem der Ideologe Alfred Rosenberg (der Hitler mit Widukind verglich)9 und Heinrich Himmler (der den Sachsenkönig Heinrich I. aufgrund seines Verzichts auf kirchliche Weihe und Romfahrt feierte), die in Karl einen Feind Deutschlands erblickten: einen welschen Despoten, der die Germanen zwang, eine ihnen fremde Religion, das Christentum, anzunehmen. Die zweite Phase des NS-Umgangs mit Karl setzte 1935 ein. Zum einen rief die ostentative Ablehnung Karls, nicht zuletzt wegen ihrer rein politisch motivierten, wissenschaftlich aber nicht haltbaren Argumentationsweise, die Fachvertreter der Geschichtswissenschaft auf den Plan: In einem 1935 erschienenen Gemeinschaftswerk „Karl der Große oder Charlemagne? Acht Antworten deutscher Geschichtsforscher“ sollte die Ehrenrettung Karls vor der nationalsozialistischen Vereinnahmung versucht und dessen angebliche Deutschenfeindlichkeit kritisch in den Blick genom5
6
7
8 9
Vgl. grundsätzlich zum nationalsozialistischen Geschichtsverständnis immer noch Karl Ferdinand Werner, Das NS-Geschichtsbild und die deutsche Geschichtswissenschaft (Lebendiges Wissen) Stuttgart u. a. 1967; sowie zum NS-Karlsverständnis ders., Karl der Große in der Ideologie des Nationalsozialismus. Zur Verantwortung deutscher Historiker für Hitlers Erfolge, in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins 101, 1997/1989, S. 10–64, 39 ff.; und Max Kerner, Karl der Große. Entschleierung eines Mythos, Köln/Weimar/Wien 2000, S. 211 ff. Vgl. etwa Alfred Rosenberg, Der Mythus des 20. Jahrhunderts. Eine Wertung der seelischgeistigen Gestaltenkämpfe unserer Zeit, München 67–701935, S. 186. Das Zitat „verhängnisvoll eifriger Römling“ bei Houston Stewart Chamberlain, Die Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts 2, München 161932, S. 734 ff. Vgl. dazu auch Arno Borst, Das Karlsbild in der Geschichtswissenschaft vom Humanismus bis heute, in: Wolfgang Braunfels/Percy Ernst Schramm (Hgg.), Karl der Große. Lebenswerk und Nachleben 4: Das Nachleben, Düsseldorf 1967, S. 364–402, 397 f. Vgl. exemplarisch Sabine Kuhlmann, Der Streit um Karl den Großen, Widukind und den ‚Tag von Verden‘ in der NS-Zeit. Eine Kontroverse im Spannungsfeld zwischen wissenschaftlicher Forschung und ideologischer Instrumentalisierung (Beiträge zur Geschichte und Kultur des Elbe-Weser-Raumes 4) Stade 2010. Hermann Löns, Die rote Beeke, in: ders., Sämtliche Werke in acht Bänden (7), hg. von Friedrich Castelle, Leipzig 1928, S. 40. Alfred Rosenberg, Der erste Dreißigjährige Krieg, in: ders., Gestaltung der Idee. Blut und Ehre 2: Reden und Aufsätze von 1933–1935, hg. von Thilo von Trotha, 2München 1936, S. 107–115, 110 f. Rosenberg sieht Hitler „[z]ugleich aber auch als Erbe der politischen Kraft Karls des Großen“, S. 111.
Porzellan und Propaganda – Karl der Große im NS-Geschichtsbild
225
men werden. Da sowohl ein Nationalsozialist als auch zwei entschiedene Gegner des Nationalsozialismus an diesem beispiellosen Buch deutscher Geschichtsschreibung mitwirkten, entstand ein differenziertes Karlsbild, das letztendlich aber „die Karlsfeindschaft durch andere Feindbilder“ ersetzte10: So wird etwa (von Wolfgang Windelband) die Ideologie der französischen Ausdehnungspolitik auf Charlemagne zurückgeführt11 beziehungsweise „Karl als ein von irgendwelcher Romanisierung noch gänzlich unberührter Germane“ dargestellt (Karl Hampe).12 Ausschlaggebend für den Perspektivwechsel im Jahr 1935 war zum anderen aber Hitler selbst: Dieser sah im Kaiser nicht nur einen germanischen Recken, sondern gar den Gründer Deutschlands, insofern dieser die verschiedenen Stämme13, wie eben die Sachsen, Bayern, Schwaben etc., zu einen gewusst habe.14 Bei dieser Einung der deutschen Stämme musste Hitler zufolge Härte angewendet, mussten diese ‚vergewaltigt‘ werden. Auf Individualitäten konnte (beziehungsweise wollte) er bei der Schaffung von Großem, der Gründung eines Reichs, Deutschlands, keine Rücksicht nehmen: „die erste staatliche Zusammenfügung deutscher Menschen konnte nur über einer [sic] Vergewaltigung des volklichen Eigenlebens der einzelnen deutschen Stämme zustande kommen“.15 Und er warnte seinen Chefideologen Rosenberg, „einen Heroen wie Karl den Großen als Karl den ‚Sachsenschlächter‘ zu bezeichnen“.16 Denn ansonsten käme in eintausend Jahren vielleicht „irgend so ein verrückter Gymnasialprofessor“ auf die Idee, „ihn [Hitler] als ‚Ostmark-Schlächter‘ zu bezeichnen, weil er bei der Heimführung des deutschen Österreichs alle habe an die Wand stellen 10 11 12
13
14
15 16
Johannes Fried, Zur Aktualität Karls des Großen, in: Stiftung Deutsches Historisches Museum (Hg.), Kaiser und Kalifen. Karl der Große und die Mächte am Mittelmeer um 800, Berlin u. a. 2014, S. 350–359, 353 f. Wolfgang Windelband, Charlemagne in der französischen Ausdehnungspolitik, in: Karl Hampe u. a. (Hgg.), Karl der Große oder Charlemagne? Acht Antworten deutscher Geschichtsforscher, Berlin 1935, S. 106–122, 106. Karl Hampe, Die Persönlichkeit Karls, in: ders. u. a., Karl der Große (wie Anm. 11), S. 9–29, 25. Vgl. zu einer Einschätzung der Schrift „Karl der Große oder Charlemagne? Acht Antworten deutscher Geschichtsforscher“ aus heutiger Perspektive Kerner, Karl der Große (wie Anm. 5), S. 218 f. Dagegen sprach Carl Erdmann, Der Name Deutsch, in: Hampe u. a., Karl der Große (wie Anm. 11), S. 94–105, 94 f., schon davon, dass die Bayern, Schwaben etc. zu Zeiten der Karolinger einzelne „Völker“ gewesen seien, die erst im Verlauf des Mittelalters zu einem Volk, den Deutschen, zusammengewachsen seien – und grenzte sich somit von der Ansicht ab, bei den Bayern etc. habe es sich um „Stämme“ gehandelt, die alle zusammen ein Volk bildeten. So sahen etwa auch die deutschen Anhänger Napoleons diesen als „den Überwinder der territorialen Zersplitterung und den Wegbereiter der ‚deutschen National-Einheit‘, der ‚Deutschland zum gemeinsamen Vaterland für alle Deutschen‘ machen werde“ an: Pape, Karlskult (wie Anm. 4), S. 155; und Kerner, Instrumentalisierung (wie Anm. 4), S. 240. Schlußrede des Führers auf dem Kongreß, in: Die Reden Hitlers am Parteitag der Freiheit 1935, hg. vom Zentralverlag der NSDAP, München 141936, S. 71–86, 73. Adolf Hitlers Tischgespräche vom 21. März 1942 bis zum 31. Juli 1942, Nr. 56, 31. März 1942 abends (Wolfsschanze), in: Henry Picker, Hitlers Tischgespräche im Führerhauptquartier. Vollständig überarbeitete und erweiterte Neuausgabe mit bisher unbekannten Selbstzeugnissen Adolf Hitlers, Abbildungen, Augenzeugenberichten und Erläuterungen des Autors, Stuttgart 31976, S. 164–173, 166.
226
Janus Gudian
lassen, die das Unternehmen zu hindern versucht hätten. Ohne Gewalt hätte man die deutschen Stämme mit ihren Dickschädeln und ihrer Eigenbrödelei [sic] weder zur Zeit Karls des Großen noch zu seiner Zeit zusammengebracht.“17 Letztendlich war die 180-Grad-Wende in der offiziellen Karls-Rezeption „im Augenblick nützlich“18 und blieb wohl auch nicht unbemerkt. So notierte etwa Joseph Goebbels in seinem Tagebuch: „Erhebliches Aufsehen hat in der deutschen Öffentlichkeit unsere vollkommene Kurswendung in der Beurteilung Karls des Großen […] erregt. Wir dürfen uns solche Damaskus-Vorgänge nicht oft leisten, sonst würde die ganze nationalsozialistische Geschichtswissenschaft in Mißkredit geraten. Es war überhaupt ein Unsinn, eine große Persönlichkeit der deutschen Geschichte herauszupicken und an ihr die nationalsozialistische Kritiksucht zu erproben. Die deutsche Geschichte ist ein einheitliches Ganzes. Man muß sie hinnehmen, so wie sie ist. Wenn wir den Standpunkt vertreten wollten, daß unsere Geschichte, so wie wir Nationalsozialisten sie uns denken und wünschen, überhaupt erst mit uns angefangen hat, dann würden wir damit eine zweitausendjährige deutsche Vergangenheit ausstreichen und als Parvenüs in das moderne Weltbild eintreten.“19 In der dritten Phase, die zum Zeitpunkt der Blitzsiege und des beginnenden Russlandfeldzugs einsetzte, wurde Karl zum ‚Europäer‘. Nun diente „das mittelalterliche Kaiserreich […] als Vorbild für die Neuordnung des europäischen Kontinents unter dem Hakenkreuz“20 – mit der Begründung, Karl habe schließlich ein ‚Weltreich‘ geschaffen.21 Der Hintergrund ist, dass die deutschen Eroberungen zu diesem Zeitpunkt die Frage aufwarfen, wie mit den besetzten Gebieten umzugehen, wie die Neuordnung Europas zu bewerkstelligen sei: ob direkte militärische Herrschaft oder etwa eine „Kollaboration“ sinnvoll sein könnte – ein von Marschall Pétain, dem ‚Held von Verdun‘ aus dem Ersten Weltkrieg, geprägter Begriff.22 Ein 17 18 19
20 21
22
Ebd. Siegfried Kracauer, Totalitäre Propaganda, hg. und mit einem Nachwort von Bernd Stiegler u. a. (Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft 2083) Berlin 2013, S. 147. Die Tagebücher von Joseph Goebbels 2: Diktate 1941–1945, 4: April – Juni 1942, hg. von Elke Fröhlich, München u. a. 1995, S. 92 f. Vgl. aber auch schon den Eintrag vom 17. September 1935 über die „Abwendung des Widukind-Kults“, in: Die Tagebücher von Joseph Goebbels. Sämtliche Fragmente 1: Aufzeichnungen 1924–1941, 2: 1. Januar 1931–31. Dezember 1936, hg. von Elke Fröhlich, München u. a. 1987, S. 515. Hans-Ulrich Thamer, Mittelalterliche Reichs- und Königstraditionen in den Geschichtsbildern der NS-Zeit, in: Krönungen. Könige in Aachen – Geschichte und Mythos. Katalog der Ausstellung 2, Mainz 2000, S. 829–837, 830. Vgl. zum Beispiel Theodor Mayer, Über den Sinn der europäischen Geschichte (1942): „Karl der Große hat die mitteleuropäischen germanischen Völker und Stämme staatlich zusammengeschlossen, er hat Europa vom Ebro und Unteritalien bis zur Elbe und Eider und bis Ungarn geeint, er hat das germanische Europa geschaffen“, zitiert nach: Johannes Fried, Otto der Große, sein Reich und Europa, in: Matthias Puhle (Hg.), Otto der Große. Magdeburg und Europa 1: Essays, Mainz 2001, S. 537–562, 556; und Rudolf Schieffer, Karl der Große und Europa, in: Stiftung Deutsches Historisches Museum, Kaiser (wie Anm. 10), S. 311–381, 327. Vgl. hierzu Dieter Gosewinkel, Die Illusion der europäischen Kollaboration. Marschall Pétain und der Entschluss zur Zusammenarbeit mit dem nationalsozialistischen Deutschland 1940, in: Rüdiger Hohls/Iris Schröder/Hannes Siegrist (Hgg.), Europa und die Europäer. Quellen und Essays zur modernen europäischen Geschichte, Stuttgart 2005, S. 329–335.
Porzellan und Propaganda – Karl der Große im NS-Geschichtsbild
227
Aspekt der nationalsozialistischen Antwort: Germanenstämme (im Sinn der nationalsozialistischen Auffassung) würden im 20. Jahrhundert ja auch noch außerhalb des Deutschen Reichs existieren (als die erfolgreichsten ‚Germanen‘ galten aufgrund des British Empire seit jeher die Angelsachsen), die es ‚heim ins Reich‘ zu holen gelte. „Europa [schrieb der einflussreiche NS-Funktionär Franz Alfred Six] ist der […] geschaffene Lebensraum der europäischen Rassen und Völker. Die gemeinsame rassische Herkunft ist über alle trennenden politischen, staatlichen und weltanschaulichen Unterschiede das verbindende Element der europäischen Völker.“23 Im Angesicht der Aufgabe, Europa für die Nationalsozialisten neu zu denken, gewinnt Six ausgerechnet dem Rassegedanken einen – dessen immanenten hierarchischen (‚Herrenmenschen‘) und separierenden Momenten nahezu entgegengesetzten – integrativen Gesichtspunkt ab, der aus Deutschland qua Einung aller germanischen Völker ein großes, eben Großdeutschland werden lässt und den „enge[n] Nationalstaatsgedanken“ zu überwinden hilft. Fast hat es den Anschein, als könne auch der nationalstaatlichen Zersplitterung Europas Six zufolge gerade mit dem Rassegedanken entgegengewirkt werden.24 II. EIN PORZELLANSCHÄLCHEN AUS SÈVRES Ein Sèvres-Schälchen, für das nicht nur Karl der Große, sondern auch der Vertrag von Verdun aus dem Jahr 843 zentrale Bedeutung aufweist, ist in eben dieser angesprochenen dritten Phase zu verorten (Abb. 1 und 2). In der deutschen Geschichtswissenschaft wird dieses Porzellanschälchen, Karl Ferdinand Werner, dem langjährigen Direktor des Deutschen Historischen Instituts in Paris, folgend, als eine von Hitler 1943 in Auftrag gegebene Gabe für französische Kriegsfreiwillige angesehen, insbesondere für die Offiziere der Waffen-Division der SS ‚Charlemagne‘.25 Da Werner keinerlei Belege für diese Informationen anführt, ist zu konstatieren, dass hinsichtlich Auftraggeber, Bezeichnung, Datum des Auftrags, Auflagenhöhe und Verwendungszweck alles andere denn Erkenntnissicherheit besteht. Drei dieser Aspekte, möglicher Auftraggeber, korrekte Bezeichnung sowie Zweck, seien herausgegriffen. Eine neu entdeckte Rechnung aus der staatlichen Porzellanmanufaktur Sèvres, die 23 solcher Exemplare auflistet, weist (da an einen Mitarbeiter des Reichsmarschalls adressiert) auf Hermann Göring als möglichen Auftraggeber hin.26 Doch 23 24 25 26
Franz A. Six, Das Reich und Europa. Eine politisch-historische Skizze (Europäische Politik 5) Berlin 1943, S. 6; vgl. zudem S. 7, 12, 27, 35. Vgl. ebd., S. 78 ff. Vgl. Werner, Ideologie (wie Anm. 5), S. 58 f.; ders., Aktualität (wie Anm. 2), S. 10 f.; ders., Tradition (wie Anm. 2), S. 27 ff. Envoi de la Manufacture Nationale de Sèvres, vom 13. September 1943 (Archives de la manufacture de Sèvres, Register Vv17, Carton S 6 und S 7). Zu Göring als möglichem Auftraggeber vgl. Marlen Topp, Sèvres sous l’occupation allemande (1940–1944). Les commandes de Hermann Goering, in: Revue de la Société des Amis du musée national de Céramique 24, 2015, S. 108–117, 114 f.
228
Janus Gudian
Abb. 1 und 2: © Hermann Historica Auktionen, München
falsifiziert dies nicht Werners These, da die hohen Kommittenten aus Deutschland inkognito bleiben wollten und daher schriftliche Belege hinsichtlich der Frage, wer dieses Schälchen bestellte, wahrscheinlich gar nicht existieren.27 Hitler kannte das Sèvres-Porzellan (über für Albert Speer im Jahr 1942 angefertigte Waren) und bestellte dort selbst zwei Tafelservice28; auch Göring orderte in Sèvres, so zum Beispiel ein großes Jagdservice.29 Nach wie vor erscheint es wahrscheinlich, dass dieses bekannte Schälchen zumindest im Namen Hitlers beziehungsweise für diesen gefertigt wurde. Zum einen weisen die Einzelstücke des Jagdservice Görings dessen persönliches Wappen auf30, das auf dem Karlsschälchen jedoch fehlt, zum anderen wird Hitler und nicht Göring auf besagtem Schälchen namentlich erwähnt.31 Vor dem Hintergrund, dass es durchaus üblich war, von NS-Größen zu besonderen Anlässen Porzellan geschenkt zu bekommen (Heinrich Himmler etwa pflegte sogenannte ‚Lebensleuchter‘ zu verschenken und Oswald Pohl verteilte zum Anlass der Sonnwendfeiern ‚Julteller‘ – die jeweils auf der Unterseite die Namenszüge des ‚Donators‘ tragen)32, aber auch, dass ursprünglich 500 der Karls-Schälchen ange-
27 28 29 30 31
32
Für diese Auskunft danke ich Marlen Topp. Vgl. Marlen Topp, Nicola Moufang als Sonderbeauftragter des Dritten Reiches. Zwei Tafelservice für Reichsmarschall Hermann Göring aus der Staatlichen Porzellan-Manufaktur Berlin (1937) und der französischen Staatsmanufaktur Sèvres (1943), in: Keramos 222, 2014, S. 61–70, 64. Ebd., S. 61; dazu generell dies., Sèvres (wie Anm. 26). Vgl. dazu etwa dies., Sonderbeauftragter (wie Anm. 28), S. 65. Werner wies zudem darauf hin, dass Hitler sogar zwei dieser Teller im „persönlichen Besitz“ hatte – einer habe sich auf dem Berghof, ein anderer im Berliner Führerbunker befunden: Vgl. Werner, Tradition (wie Anm. 2), S. 29; sowie ders., Ideologie (wie Anm. 5), S. 58, Anm. 103; jeweils mit weiteren Nachweisen. Vgl. für solche NS-Julteller und NS-Lebensleuchter die Website http://www.allach-porzellan. de/tafeln-teller.html bzw. http://www.allach-porzellan.de/tafeln-teller.html (Stand: 10.02.2017).
Porzellan und Propaganda – Karl der Große im NS-Geschichtsbild
229
fertigt werden sollten33, erscheint es plausibel, diese Schälchen als Geschenke einzuordnen.34 Ob die Schälchen jedoch (ausschließlich) für Soldaten, insbesondere französische Kriegsfreiwillige, gedacht waren, mag dahingestellt bleiben. Auszuschließen ist es nicht, weist die Unterseite mit dem Eisernen Kreuz doch einen genuin militärischen Schmuck auf (die von der Reiterstatuette auf der Vorderseite des Schälchens gespiegelt wird)35, und für Deutschland kämpfende französische Soldaten gab es mit der „Légion des volontaires français contre le bolchévisme“ (LVF) seit dem Beginn des „Kreuzzug[s] gegen den Bolschewismus“ im Juni 1941. Zu konstatieren ist allerdings, dass das Schälchen zumindest zu Beginn nicht für die Offiziere beziehungsweise verdiente Soldaten der französischen Division ‚Charlemagne‘ intendiert gewesen sein konnte: Die aufgetauchte Rechnung datiert auf den September 1943 (und vor diesem Jahr lassen sich auch keine solchen Schälchen nachweisen); die Waffen-Division der SS ‚Charlemagne‘ wurde jedoch erst 1944 aufgestellt.36 Als ein mögliches Gegenargument könnte hingegen ein Schreiben vom Dezember 1942 herangezogen werden, in dem Himmler Hitler vorschlug, eine „SS-Standarte“ (allerdings mit dem deutschen Namen des Kaisers) „Karl der Große“ aufzubauen: „Aufstellung eines französischen SS-Sturmbannes, später SSStandarte. Die französische Legion [LVF] kommt als Stamm in keiner Weise in Frage und bleibt beim Heer. Die Freiwilligen können nur als besonders gutrassige, germanisch aussehende und germanisch denkende Menschen gewonnen werden. Als Name für diese Standarte wird vorgeschlagen ‚Karl der Große‘ oder ‚Gobineau‘, in Erinnerung an den Grafen Gobineau, der der Begründer des Rassenlehre und ein Wiedererwecker germanischen Denkens in Frankreich war.“37 Hinsichtlich der Bezeichnung des Schälchens ist anzumerken, dass die Rechnung von „23 cendriers ‚Charlemagne à cheval‘“ spricht. Obwohl Aschenbecher durchaus repräsentative Geschenke darstellen können, ist es schwer vorstellbar, dass eine solche Gabe vom rigorosen Nichtraucher Hitler (oder in dessen Namen) überreicht worden sein könnte; zudem ist der dünne Rand des Schälchens weder zum Ablegen von Zigaretten geeignet noch weist er Vertiefungen für eben solche auf. Die 33
34 35 36
37
Vgl. das Schriftstück vom 13. Februar 1945, Archives de la Manufacture de Sèvres, Carton S 6, liasse 5. Jordan Gaspin, De ‚asbak‘ Karel de Grote (Charlemagne) van het Musée de l’Armée, in: Dauwe, Erfenis (wie Anm. 1), S. 361–363, 362, ging dagegen von 93 dieser Schälchen aus; und Werner, Aktualität (wie Anm. 2), S. 10, nahm insgesamt 80 Stück an; das DHM Berlin schließlich spricht (auf seiner Homepage, Zugangsnummer 1988/1758, Stand: 05.03.2014) von drei Exemplaren. Davon zu unterscheiden sind die militärischen Auszeichnungen, wie es etwa das Verdienstkreuz Croix de Guerre Légionaire darstellt. Vgl. zu dieser Statuette Achim Th. Hack, Karl der Große hoch zu Roß. Zur Geschichte einer (historisch falschen) Bildtradition, in: Francia 35, 2008, S. 349–380. Vgl. Eberhard Jäckel, Frankreich in Hitlers Europa. Die deutsche Frankreichpolitik im Zweiten Weltkrieg (Quellen und Darstellungen zur Zeitgeschichte 14) Stuttgart 1966, S. 301 f.: Nicht zuletzt aufgrund Hitlers Misstrauen gegenüber der Zuverlässigkeit französischer Soldaten gab es bis Ende 1943 keine eigene französische SS-Formation. Der Reichsführer-SS [Heinrich Himmler] an Adolf Hitler, Brief(entwurf? – die mir vorliegende Kopie weist keine Unterschrift auf) vom 12. Dezember 1942: National Archives and Records Administration, Washington D. C. (NARA), RG 242 T-175, 598755–598758, S. 4.
230
Janus Gudian
Bezeichnung als „Teller“ kommt zeitgleich mit der Produktion des Schälchens auf38; gegen diese sprechen jedoch die Maße (13,7 cm im Durchmesser) sowie die konkave Form (Höhe 2,9 cm).39 Unabhängig davon, ob die verwendete Goldfarbe, insbesondere des Bilds der Reiterstatuette40, einer alltagstauglichen Verwendung als Geschirr dienlich ist (insbesondere bei einem häufigen Putzen wird diese Farbe schnell abgetragen) – eine „Soucoupe“, wie von Werner angenommen und mit „Platzteller“ übersetzt41, ist das Schälchen aufgrund dieser Maße mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht. Eher erinnert es an eine Art Erinnerungsteller. III. CAROLUS NOVUS: DAS SÈVRES-SCHÄLCHEN ALS INSTRUMENT DER NS-PROPAGANDA Zwei Aspekte des Schälchens, Substanz und die auf der Rückseite aufgetragene Inschrift, verdienen hier Beachtung. Schon das Material, Porzellan, ‚weißes Gold‘, birgt eine Aussage, stellt sich doch der ein solches Geschenk Überreichende nicht zuletzt in die Tradition von (neuzeitlichen) Königen. So schätzte insbesondere Friedrich II. von Preußen Porzellangeschenke als Mittel der Diplomatie beziehungsweise als symbolische Kommunikationsform und war bekannt dafür, mittels Kunst- und Galanteriewaren nonverbale Politik zu betreiben, etwa indem er Katharina II. von Russland (auch sie eine ‚Große‘) ein kostspieliges Porzellanservice zukommen ließ.42 Die lateinische Inschrift auf der Rückseite des Schälchens lautet: IMPERIUM CAROLI MAGNI DIVISUM PER NEPOTES ANNO DCCCXLIII 38 39
40 41 42
Zwei Privatpersonen fragten bei der Manufaktur Sèvres im Jahr 1943 an, ob die zum 1100. Jubiläum des Vertrags von Verdun angefertigten „Teller“ („assiette“) käuflich zu erwerben seien, Archives de la manufacture de Sèvres (wie Anm. 26). Des Weiteren spricht die Tiefe von nahezu 3 cm gegen die Annahme, dass es sich hier um einen ‚Wandteller‘ handeln könnte, da etwa für eine Wandaufhängung geeignete sogenannte ‚Regimentsteller‘ meist eine durchschnittliche Tiefe von lediglich 1,5 cm aufweisen; zudem ist mir keine Aufnahme bekannt, die eines der Sèvres-Schälchen mit einer an diesem selbst befindlichen Aufhängevorrichtung zeigt. Dahingegen existiert eine Aufnahme, die ein solches Schälchen in einem anscheinend eigens dafür angefertigten roten Lederetui zeigt – und dieses Etui weist in der Tat eine Hängeöse auf (Hermann Historica oHG München, 60. Auktion, Los Nr. 3241). Marlen Topp, Auf Schatzsuche. Herman Görings französisches Tafelservice aus Carinhall, in: Spektrum 6, 2014, S. 44–45, 45, spricht hier von „radiertem Gold“. Werner, Aktualität (wie Anm. 2), S. 10. Vgl. hierzu Jeannette Opalla, Das Geschenkwesen am friderizianischen Hof. Absicht und Botschaft, in: Michael Kaiser/Jürgen Luh (Hgg.), Friedrich der Große und der Hof. Beiträge des zweiten Colloquiums in der Reihe Friedrich300 vom 10./11. Oktober 2008 (Friedrich300 – Colloquien 2) (http://www.perspectivia.net/publikationen/friedrich300-colloquien/friedrichhof/Opalla_Geschenkewesen).
Porzellan und Propaganda – Karl der Große im NS-Geschichtsbild
231
DEFENDIT ADOLPHUS HITLER UNA CUM OMNIBUS EUROPAE POPULIS ANNO MCMXLIII
Aus Sicht der NS-Propaganda sind vor allem vier Aspekte dieser Inschrift von Interesse: das Reich, dessen Teilung, die Parallelisierung von Karl und Hitler sowie Europa. 1. Der Nimbus des Reichs IMPERIUM CAROLI MAGNI – das wirkt geradezu wie eine Invocatio, eine Anrufung, klingt doch beim Stichwort ‚römisches Reich‘ immer auch der Gedanke der translatio imperii an (womit ein Grundthema des nationalsozialistischen „Edelkitsches“ angerissen wird: das der Ewigkeit43). Dieser Lehre zufolge wurde das antike römische Reich auf die mittelalterlichen Kaiser übertragen und damit auch der Anspruch, den Erdkreis zu einen, idealiter zu beherrschen.44 Wenn auch die Realität anders ausgesehen haben mag, zumindest ein Ehrenvorrang wurde dem Kaiser von anderen Königen zugestanden. Dass nun Hitler von einer realen Vormachtstellung des Reiches beziehungsweise des Kaisertums im Mittelalter ausging, könnte durch seine zweifache Lektüre von Ernst Kantorowiczʼ Stauferbiographie „Kaiser Friedrich der Zweite“ evoziert worden sein45: In diesem Werk lässt Kantorowicz vor dem geistigen Auge des Lesers ein mächtiges Kaisertum entstehen, das durchaus auf die „Weltherrschaft“ abzielte (wenn auch auf die „geistige“).46 2. Der Vertrag von Verdun 843: eine Teilung des Reichs? „Geteilt durch seine Enkel“ – diese Passage suggeriert vor allem drei Dinge: zunächst, dass das Reich eigentlich unteilbar war. Doch die historische Realität verhielt sich anders47: Das fränkische Erbrecht sah die gleichmäßige Teilung des väter43 44
45 46 47
Vgl. Saul Friedländer, Kitsch und Tod. Der Widerschein des Nazismus (Fischer-Taschenbuch 17968) Frankfurt a. M. 2007, S. 17. Insbesondere in der Romantik wurde diese Vorstellung einer religiös-kulturellen Einheit genährt, vgl. etwa Friedrich Schlegel, Vorlesungen über die neuere Geschichte (1810/11), in: ders., Studien zur Geschichte und Politik, eingeleitet und hg. von Ernst Behler (Kritische Friedrich-Schlegel-Ausgabe 7) München u. a. 1966, S. 125–407, 188 ff. Vgl. Percy Ernst Schramm, Vorwort und Erläuterungen, in: Henry Picker, Hitlers Tischgespräche im Führerhauptquartier 1941–1942, neu hg. von Percy Ernst Schramm u. a., Stuttgart 1963, S. 69. Ernst Kantorowicz, Kaiser Friedrich der Zweite (Werke aus dem Kreis der Blätter für die Kunst. Geschichtliche Reihe) Berlin 21928, S. 513 (in der ersten Ausgabe von 1927 ist noch kein Reihentitel angegeben). Vgl. grundsätzlich zum Vertrag von Verdun Peter Classen, Die Verträge von Verdun und von Coulaines 843 als politische Grundlagen des Westfränkischen Reiches, in: HZ 196, 1963, S. 1–35.
232
Janus Gudian
lichen Besitzes (egal ob Bauernhof, ob Reich) unter allen erbberechtigten Söhnen vor – und Entsprechendes verfügte auch Karl 806 in der Divisio regnorum. Der Übergang des ungeteilten Reichs 814 auf Ludwig den Frommen hatte schlicht darin seinen Grund, dass eben nur dieser eine erbberechtigte Sohn den Vater überlebte. Auch Ludwig selbst sah, im Einklang mit dem fränkischen Recht, die Aufteilung seines Reichs vor. Des Weiteren war Karls Reich ein Völkerkonglomerat, das u. a. Basken, Bretonen, Goten, Aquitanier umfasste; dabei hatten die einzelnen Völker ihr eigenes Recht, ihre eigene Sprache und konnten sogar als ‚Unterreiche‘ (regna, von Werner als Grundstruktur des Frankenreichs erkannt) mit eigenen ‚Unterkönigen‘ firmieren. Insgesamt war es also ein höchst heterogenes Reich und allein im Hinblick auf die Religion verlangte, ja befahl Karl tatsächlich Einheitlichkeit.48 Drittens wird die Teilung des Reichs (so sie überhaupt eine solche war: vom Standpunkt des Verfassungsrechts kann sogar argumentiert werden, 843 sei das Gesamtreichsbewusstsein des Frankenreiches gar nicht aufgehoben, sondern eine „Samtherrschaft“, eine gemeinsame Herrschaft dreier Brüder, errichtet worden49) als dem Willen des Reichsgründers entgegengesetzt, implizit als Unrecht begriffen: Die Teilung gilt als Verhängnis50 – eine Auffassung, die nach 1945 und bis heute noch von überraschend vielen Personen geteilt wird, etwa im Umkreis der Verleihung des Aachener Karlspreises.51
48 49 50
51
Vgl. Johannes Fried, Karl der Große. Gewalt und Glaube. Eine Biographie, München 2013, S. 261 ff., 301 ff., 342 ff., 435 ff., 445 ff. Vgl. Heinrich Mitteis, Der Vertrag von Verdun im Rahmen der karolingischen Verfassungspolitik, in: Theodor Mayer (Hg.), Der Vertrag von Verdun 843. Neun Aufsätze zur Begründung der europäischen Völker- und Staatenwelt (Das Reich und Europa) Leipzig 1943, S. 66–100, 67. Allerdings kamen schon während des Dritten Reichs Stimmen in der Geschichtswissenschaft auf, die den Vertrag von Verdun eben nicht mehr als reines Unglück empfanden, sondern ihn als „Aufbau neuer historischer Gestalten, einer neuen Form des Abendlandes“ bezeichneten, der „einen bedeutsamen Versuch dar[stellt], die Problematik der europäischen Völker- und Staatenwelt zu lösen. Er hat den Völkern die Selbständigkeit gesichert und doch die Gemeinsamkeit aufrechterhalten“, so etwa Theodor Mayer, Der Vertrag von Verdun, in: ders., Vertrag (wie Anm. 49), S. 5–30, 29. Zudem kann ein bzw. der Teilungsvertrag (von Verdun) auch einen Friedensvertrag unter den Erben darstellen, vgl. Classen, Verträge (wie Anm. 47), S. 13 ff.; und Johannes Fried, Erfahrung und Ordnung. Die Friedenskonstitution Karls des Großen vom Jahr 806, in: Brigitte Kasten (Hg.), Herrscher- und Fürstentestamente im westeuropäischen Mittelalter (Norm und Struktur. Studien zum sozialen Wandel in Mittelalter und früher Neuzeit 29) Köln 2008, S. 145–192. Vgl. Pape, Karlskult (wie Anm. 4), S. 178 ff.; vgl. zudem etwa Roger de Weck, Karl der Große, eine historische Utopie, in: Wilhelm Bonse-Geuking/Michael Jansen (Hgg.), 60 Jahre Karlspreis – Beitrag zur europäischen Vollendung, Köln 2010, S. 16–19, 17: „Die europäische Einigung hat im 20. Jahrhundert überwunden, was mit der Dreiteilung des karolingischen Kaiserreichs im 9. Jahrhundert begann und seither unseren Kontinent immerzu ins Elend stürzte: den Aufprall des Westfranken- und des Ostfrankenreichs, später der Deutschen und Franzosen, zuletzt der Nationen Deutschland und Frankreich. Karl der Große – Europas Einiger – war da eine historische Utopie“.
Porzellan und Propaganda – Karl der Große im NS-Geschichtsbild
233
3. Adolf Hitler als Verteidiger des Reichs Karls des Großen Zunächst das Evidente: Hitler wird – im Zuge einer imitatio Caroli – als ein ‚zweiter Karl‘, als Verteidiger beziehungsweise ‚Wiederbegründer‘ von dessen Reich vorgestellt. Wenn die Reichsteilung ein Verhängnis war, ist seine (Wieder-)Vereinigung, so der implizite Umkehrschluss, ein historisches Gebot. Und indem sich Hitler dieser Aufgabe stellt, wird er der legitime Erbe Karls und der mittelalterlichen Kaiser – damit fällt ihm (seinem Selbstverständnis nach) aber eben auch der mit dem Kaisertitel einhergehende und über das Reich hinausreichende Herrschaftsanspruch zu. Allerdings ist der Anspruch, der ‚wahre‘ Erbe Karls des Großen zu sein, im Verlauf der Geschichte wechselseitig sowohl von deutschen als auch von französischen Herrschern erhoben worden, um damit das eigene Begehren nach dem jeweils anderen Land zu legitimieren.52 Darüber hinaus stellte die historische Rückbindung des ‚Dritten Reichs‘ an das Karls eine Mystifikation (des NS-Reichs) dar, die die Suggestion einer ‚guten alten Zeit‘ beinhaltet, welche von der eigenen Gegenwart aber durch einen (zu überwindenden) Bruch getrennt ist. Dieses Gedankenkonstrukt ähnelt dem Dreischritt der Humanisten, die sich als von der von ihnen idealisierten Antike durch das ‚finstere Mittelalter‘ getrennt empfanden und daher eine ‚Renaissance‘ – zur Überwindung dieser Kluft – anstrebten.53 4. Europa Das interessanteste Stichwort auf dem Schälchen ist das Europas. Vorweggeschickt sei, dass Karl in der Tat von einem anonymen Zeitgenossen ‚Vater Europas‘ genannt worden ist54, doch handelte es sich hierbei um Panegyrik, bei der der Europabegriff gerade keine politische oder kulturelle Einheit meinte.55 Noch zu Zeiten Ottos des Großen besaß „‚Europa‘ freilich […] für die Zeitgenossen von damals 52
53
54 55
Vgl. etwa Pape, Karlskult (wie Anm. 4), S. 138 ff.; und Anm. 2. – Generell haben historische Parallelen gerade auch in Deutschland Tradition: Genannt sei nur das Beispiel von BarbarossaBarbablanca (der Staufer Friedrich I. und Wilhelm I. von Preußen), wie es im KyffhäuserDenkmal zum Ausdruck kommt. Vgl. zum Aufkommen einer dreiteiligen Geschichtseinteilung in „eine ferne und zum Teil sagenhafte Vergangenheit; eine Zeit, die als eigene Zeit empfunden wird; und eine mittlere Periode ‚seit Menschengedenken‘ “ grundsätzlich Johan Huizinga, Zur Geschichte des Begriffs Mittelalter, in: Kurt Köster (Hg.), Geschichte und Kultur: gesammelte Aufsätze, Stuttgart 1954, S.213–227, 225. De Karolo rege et Leone papa. Der Bericht über die Zusammenkunft Karls des Großen mit Papst Leo III. in Paderborn 799 in einem Epos für Karl den Kaiser, hg. von Wilhelm Hentze (Studien und Quellen zur westfälischen Geschichte 36) Paderborn 1999, S. 114. Anderer Auffassung ist Pape, Karlskult (wie Anm. 4), S. 170 (dort auch weitere Nachweise): „Der Begriff ‚Europa‘ läßt sich seit etwa 760 für das erweiterte Frankenreich belegen“; und Alessandro Barbero, Karl der Große. Vater Europas. Aus dem Italienischen von Annette Kopetzki, Stuttgart 2007, S. 117–131; vgl. auch Schieffer, Karl der Große (wie Anm. 21), S. 324, der hinsichtlich der räumlichen Dimension, in denen sich das bewusste Wirken des Kaisers abgespielt habe, auf das Frankenreich, das römische Reich sowie das Christentum verweist.
234
Janus Gudian
keine klaren Konturen. Es war, so zeigten es grob konturierte Weltkarten, Mappae mundi, der dritte Teil der Erde, eine vage Größe, ohne klare geographische Dimension und vollends ohne politische Konnotation. Die Frage, was Europa, die Länder nämlich jenseits ihres eigenen Reichs, für die vielen Herrscher und Völker bedeutete, warf damals niemand auf; es gab keine ‚europäischen‘ Taten, keine ‚europäische‘ Gemeinschaft. Weder die Kirche, die ganze ‚Christenheit‘, noch irgend ein Reich oder das Kaisertum besaßen europäisches Format.“56 – Es ließe sich zudem trefflich anführen, dass Karl geradezu als ‚Zerteiler‘ Europas angesehen werden kann: Mit der Erhöhung zum Kaiser sah sich Karl als dem bisher alleinigen römischen Kaiser in Konstantinopel ebenbürtig und anstatt eines ‚Universalkaisers‘ gab es nun (wieder) einen West- und einen Ostkaiser. Hinzu kommt, dass mit der Einberufung der Frankfurter Synode 794 durch Karl auch die Zeit der gesamtkirchlichen (Kaiser-)Konzilien passé war, waren doch die in den „Libri Carolini“ festgehaltenen Beschlüsse dieser fränkischen Synode auch gegen jene der ‚Ostkonzilien‘ gerichtet. Eine Christenheit beziehungsweise ein erster Schritt zur Kirchenspaltung? Karl tatsächlich der ‚Vater‘ eines einheitlichen Europas? Das oben Gesagte über das Werden ‚Deutschlands‘ wurde in der dritten Phase des NS-Verständnisses Karls nunmehr auf Europa übertragen: So wie ‚Deutschland‘ unter Karl, so sollte nun auch Europa unter Hitler vereinigt werden – und dies könne, so lehre es das historische Beispiel Karls, nur gewaltsam geschehen. Wenn Hitler also – denn wie sollte er als Epigone eine höhere Einheit schaffen beziehungsweise diese anders schaffen als der ‚große Karl‘? – auf den Spuren Karls wandelnd propagiert wird, wird stillschweigend eine historische Konstante unterlegt. Doch sah Karl die Anwendung von Gewalt wirklich als das einzig probate Mittel an, um Zustimmung zu erlangen, um zu herrschen? „Die Rhetorik dünkte den König höchst nützlich. ‚Induktion ist eine Rede‘, so belehrte ihn [Karl] der Angelsachse [Alkuin], ‚die über gewisse (Aussagen) ungewisse Sachverhalte erschließt und den, der sich sträubt, zur Zustimmung nötigt.‘ Karl konnte kaum glauben, dass solches möglich sei. […] Der König war an Zwang und Gewalt gewöhnt, an Betrug und Lüge. [Gewiss. Aber:] Alkuin verwies auf das Wort und die Frage und die Regeln der Vernunft. Karl hörte begierig zu, ein aufmerksamer Schüler. [Und] Mit der Zeit verloren seine Strafaktionen an Brutalität. Das Wort sollte sich durchsetzen.“57 Hinsichtlich der Form Europas träumte Hitler von einem „Germanische[n] Reich Deutscher Nation“.58 Und zur Art und Weise der Gründung führte er aus: „Eines ist jedenfalls sicher: Wenn wir überhaupt einen Weltanspruch erheben wol56
57 58
Fried, Otto der Große (wie Anm. 21), S. 543: „‚Europa‘ war erst zu entdecken. Bis zu den Türkenkriegen, zu Hugo Grotius und dem Zeitalter nach dem Westfälischen Frieden galt es sich zu gedulden, bevor ‚Europa‘ sich anschickte, in einem historisch-politischen Sinne, als das Gegen- und Miteinander der zahlreichen Staaten, als der Inbegriff ihres machtpolitischen Gleichgewichts in diesem Erdteil Gestalt anzunehmen“. Ders., Karl der Große als Mensch, in: Claudia Alraum u. a. (Hgg.), Zwischen Rom und Santiago. Festschrift für Klaus Herbers zum 65. Geburtstag, Bochum 2016, S. 361–381, 372. Adolf Hitlers Geheimrede vom 23. November 1937 auf der Ordensburg Sonthofen im Allgäu zur „Deutschen Geschichte und zum Deutschen Schicksal“, in: Picker, Tischgespräche (wie Anm. 16), S. 481–490, 485.
Porzellan und Propaganda – Karl der Große im NS-Geschichtsbild
235
len, müssen wir uns auf die deutsche Kaisergeschichte berufen. Alles andere ist etwas so Junges und derart Fragliches und nur bedingt Gelungenes. Die Kaisergeschichte ist das gewaltigste Epos, das – neben dem alten Rom – die Welt je gesehen hat. […] Die Kaisergeschichte gehört zum Gewaltigsten, was es gibt. 500 Jahre lang war das unbestritten die Herrschaft der Welt. Wenn mir die Führer der anderen Stämme des germanischen Raums begegnen, so bin ich in einer wunderbaren Lage durch meine Heimat: Ich kann darauf hinweisen, daß sie ein großes mächtiges Reich war mit einer Kaiserstadt – durch 5 Jahrhunderte –, daß ich aber keinen Augenblick gezögert habe, meine Heimat dem Reichsgedanken zu opfern. Während des Kampfes um die Macht habe ich die Partei so hart gemacht, daß sie ein Magnet geworden ist, der alles Eisen an sich riß, wenn man ihn über das Land zog. In wenigen Jahren mußte ich so alles, was Mann ist, in ihr haben, wobei es auf die Zahlen gar nicht mehr ankam. So müssen wir jetzt auch beim Ausbau des neuen Reichs verfahren: Wo immer germanisches Blut in der Welt sich befindet, nehmen wir das, was gut ist, an uns. Mit dem, was den anderen dann bleibt, werden sie gegen dieses germanische Reich nicht antreten.“59 Dem Historiker Theodor Mayer, von 1942 bis 1945 Präsident der MGH, zufolge galt es, die europäische Vormachtstellung in der Welt zu sichern: „Europa kann seine Weltstellung nur dann behaupten, wenn es mit gewollter Einigkeit an diese Aufgabe herantritt, und im Innern ein gesundes Gefüge und einen politischen Aufbau vorweist, der es zu solcher größeren Kraftleistung fähig macht.“ Grundbedingung dafür sei eine starke Mitte Europas, eben Deutschland, das beziehungsweise von dem aus Europa geordnet und geeint werden solle – zum Nutzen und Wohle eben auch dieses Kontinents.60 Unmoralisches Handeln im Namen der Moral, da es ja der ‚letzte Krieg‘ sein wird, ein europäischer „Einigungskrieg“61, der den ‚ewigen Frieden‘ bedeutet – eine immer wiederkehrende Legitimationsstratedie, eine immer wiederkehrende Faszination. Schlechte Mittel, gute Absichten also? Mitnichten. Hitlers ‚wahre‘ Gedanken über die anderen Völker Europas hatte er schon in „Mein Kampf“ niedergelegt und insbesondere gegen Frankreich richtete sich sein Hass. Noch 1945 schrieb er: „[…] Frankreich. Ich habe vor zwanzig Jahren geschrieben, was ich von Frankreich dachte. Es war und ist der Todfeind des deutschen Volkes. […] Wie er auch ausgehen wird, dieser Krieg hat wenigstens Frankreich auf den Platz gestellt, wo es hingehört, nämlich den einer fünftrangigen Macht.“62 Das Mittel pure Gewalt, die Absicht die Vorherrschaft der Germanen, der Deutschen – das war Europa für Hitler. 59 60
61 62
Adolf Hitlers Tischgespräche vom 21. Juli 1941 bis zum 11. März 1942, Nr. 22 vom 4. Februar 1942 abends, in: Picker, Tischgespräche (wie Anm. 16), S. 100–103, 102 f. Vgl. Theodor Mayer, Deutschland und Europa, in: Marburger Universitätsreden 3, Marburg 1940, S. 21 ff. Vgl. zur Argumentation, warum gerade Deutschland dazu berufen sei, Europa zu führen, etwa auch Dietrich Klagges, Geschichtsunterricht als nationalpolitische Erziehung (Volk und Führer. Deutsche Geschichte für Schulen) 2Frankfurt am Main 1937, S. 332. Six, Reich (wie Anm. 23), S. 89. Adolf Hitler gemäß den sogenannten Bormann-Vermerken, zitiert nach Jäckel, Frankreich (wie Anm. 36), S. 370.
236
Janus Gudian
IV. KUNST ODER KITSCH, KITSCH UND KUNST? Wie also sollten die anderen, nicht-deutschen Völker zu einer „Kollaboration“ animiert werden? Gerade mit Blick auf Frankreich können sowohl der Name der Division ‚Charlemagne‘63 als auch das Sèvres-Schälchen einen Anhaltspunkt liefern. Denn Karl spricht sowohl Deutsche als auch Franzosen an, wie überhaupt alle, die auf dem Boden seines ehemaligen Reiches wohnen und leben: In diesem Sinne ist Karl ein ideales ‚Interessensscharnier‘, kann er bestens ‚eingespannt‘ werden, um die nationalen Partikularinteressen (scheinbar) auf einen Nenner zu bringen. Ein Diktum Goethes lautet: „Das Beste, was wir von der Geschichte haben, ist der Enthusiasmus, den sie erregt.“64 Auf wen, wenn nicht auf Karl, trifft es zu? Denn Karl der Große hat die Fähigkeit, die Gedanken zu (be)zwingen, er übt eine geradezu magische Anziehungskraft aus, ist eine geistige Macht: ein Zauberspruch aus dem Buch der Geschichte, der immense geistige Wirkung entfaltet. Aber im NS-Geschichtsbild beziehungsweise in der NS-Propaganda war Karl ein Identifikationsangebot Hitlers, anders formuliert: eine geistige Falle. Karl war nichts weiter als ein Gefäß, in das der eigene politische Wille eingegossen wurde, eine Verbrämung, Verkleidung, Vehikel, das, weil es in des Kaisers neuem Kleid der ‚objektiven Wissenschaft‘, eben der Geschichtswissenschaft, daherkam, Anspruch auf Neutralität erhob und dadurch hohe Glaubwürdigkeit zu entfalten vermochte.65 Karl war nichts weiter als ein Instrument, um einen Mythos – den der Einheit Europas – zu kreieren.66 Doch wie ist nun das Sèvres-Schälchen zu charakterisieren? Ist es Kunst? Ist 63
64 65 66
Zum „‚europäischen‘ Gestus“ des Namens dieser SS-Division als Programmatik siehe Peter Schöttler, Dreierlei Kollaboration. Europa-Konzepte und „deutsch-französische Verständigung“ – am Beispiel der Karriere von SS-Brigadeführer Gustav Krukenberg, in: Zeithistorische Forschungen/Studies in Contemporary History 9, 2012 (www.zeithistorische-forschungen. de/16126041-Schoettler-3-2012), S. 365–386, 377. Johann Wolfgang von Goethe, in: Heinrich Kurz (Hg.), Goethes Werke (12). Maximen und Reflexionen. Erste Abteilung (Meyers Klassiker-Ausgaben) Leipzig (o. J.), S. 667. „Auch in der Wissenschaft hat der völkische Staat ein Hilfsmittel zu erblicken zur Förderung des Nationalstolzes“, so Adolf Hitler, Mein Kampf 2, Volksausgabe, München 1933, S. 473. Vgl. Schöttler (wie Anm. 62), S. 378, für den Europa im NS ein „Emblem und Ersatz für eine sonst nicht vorhandene […] Völkergemeinschaft“ darstellt. Doch auch nach 1945 wird sich bei der Zukunftsgestaltung Europas auf Karl den Großen berufen, d. h. dieser politisch instrumentalisiert (allen voran von Konrad Adenauer und Charles de Gaulle), vgl. etwa zum „Karlskult in der Gründungsphase der Bundesrepublik Deutschland“ Pape, Karlskult (wie Anm. 4), S. 161 ff., 172 ff.; sowie ders., Karl der Große – Franke? Deutscher? Oder Europäer? Karlsbild und Karlskult in der Gründungsphase der Bundesrepublik Deutschland, in: Jahrbuch für Europäische Geschichte 4, 2003, S. 243–254; vgl. zudem Schieffer, Karl der Große (wie Anm. 21), S. 323, mit weiteren Nachweisen; und allgemein Klaus Oschema, Bilder von Europa im Mittelalter (Mittelalter-Forschungen 43) Ostfildern 2013; sowie ders., Ein Karl für alle Fälle – Historiografische Verortungen Karls des Großen zwischen Nation, Europa und der Welt, in: Gregor Feindt u. a. (Hgg.), Europäische Erinnerung als verflochtene Erinnerung. Vielstimmige und vielschichtige Vergangenheitsdeutungen jenseits der Nation (Formen der Erinnerung 55) Göttingen 2014, S. 39–63. – Besonders augenfällig geschieht die Inanspruchnahme Karls für Europa im sogenannten „Karlsamt“, das alljährlich im Frankfurter Dom anlässlich Karls Todestag zelebriert wird: Dort wird zur Eröffnung gesungen,
Porzellan und Propaganda – Karl der Große im NS-Geschichtsbild
237
es Kitsch? Vor allem aber: Was wäre der Unterschied – im Hinblick auf seine Funktion in der NS-Propaganda? Vorauszuschicken ist, dass es vor dem Hintergrund des „Gesetzes zum Schutz der nationalen Symbole“ vom 19. Mai 1933 durchaus einen offiziösen Charakter wird beanspruchen dürfen. Zur Einschätzung des kleinen Porzellanschälchens könnte man einerseits ausführen, dass sowohl im Verständnis Hitlers als auch Goebbels Propaganda eine Kunst (der Volksführung) darstellt.67 Da die Machart des Schälchens (Porzellan – weißes Gold, und dann auch noch aus Sèvres, die Goldfarbe, die Abbildung einer allseits bekannten mittelalterlichen Statuette sowie die Verwendung der lateinischen Sprache, und das Ganze obendrein als ein Geschenk des ‚Führers‘) natürlich darauf abzielt, einen Eindruck von Exklusivität, einer Kostbarkeit zu erzeugen, könnte man hier eventuell zu dem Schluss gelangen, dass die Kunst (der Propaganda) qua Kunst (als Träger beziehungsweise Materie anstatt des die NS-Propaganda üblicherweise beherrschenden gesprochenen Worts) präsentiert wird. Daraufhin ließe sich Siegfried Kracauer zitieren: „Viele Maßnahmen der totalitären Propaganda sind einzig und allein darauf berechnet, ästhetisch zu faszinieren“, denn „indem die totalitäre Propaganda gewisse, der Analyse zugängliche Phänomene in Gegenstände der ästhetischen Betrachtung überführt, sorgt sie dafür, daß […] die betreffenden Phänomene […] vor der Analyse bewahrt bleiben“.68 Mittels der Überführung beziehungsweise Verschiebung von der Ebene der Ratio auf die der Emotionen kommt es, so der Gedankengang Kracauers, zu einer „Bewußtseinsreduktion“69, der der Manipulation Tür und Tor öffnet. Als Kunst zielt das Schälchen daher nicht nur darauf ab, Krieg und Tod einen historischen Sinn zu unterlegen (das Reich wieder zu errichten), sondern auch zu verherrlichen: Dulce et decorum est pro patria mori. Andererseits ist die Versuchung groß, Dinge wie Julteller, Lebensleuchter oder eben auch das kleine Sèvres-Schälchen unter Kitsch zu subsumieren. Hierbei spielt es eine erhebliche Rolle, dass der erste Blick nur die bekannte Reiterstatuette erkennt, der übliche Gebrauch von Geschirr nur der Ober- beziehungsweise Vorderseite Beachtung schenkt, nicht aber der Unter- oder Rückseite, die mit ihrer (‚verborgenen‘) Inschrift der eigentliche Bedeutungsträger des Schälchens ist. Insofern ist dieses mit den von der Nahrungsmittelindustrie zum Zweck der Kundenbindung
67 68 69
Karl habe aus seines „Reiches Mitten Europas Grund gelegt“ (vgl. die Begleithefte des Karlsamts vom 30. Januar 2016 und vom 28. Januar 2017 im Dom St. Bartholomäus zu Frankfurt, jeweils S. 2, Text: Lutz Riehl). Der Unterschied zum Nationalsozialismus ist freilich, dass Karl seit 1945 der Annäherung dient, insbesondere Deutschlands und Frankreichs, insofern er „einem Zeitalter angehört, das vor allen nationalen Differenzierungen […] lag“, Schieffer, Karl der Große (wie Anm. 21), a. a. O. Was Karl dagegen wirklich für Europa tat, liegt – etwa mit der Kalenderreform, der Schrift der karolingischen Minuskel sowie dem auf Logik aufgebauten Denkstil – auf kulturellem Gebiet, vgl. Fried, Karl der Große (wie Anm. 48), S. 290 ff., 319 ff., 395 ff., 625 ff. Vgl. Kracauer, Propaganda (wie Anm. 18), S. 63 f. Ebd., S. 64. Ebd.
238
Janus Gudian
eingesetzten Reklamesammelbildern vergleichbar, deren eigentliche Werbebotschaft auf der Rückseite zu finden ist: Seit ca. 1875 (bis in die 1970er Jahre) hat diese Art der Werbung „nachhaltig die historische Imagination und überhaupt das Weltwissen geprägt“.70 Anschließend würde man wohl mit Saul Friedländer argumentieren, dass solche (industrielle) Massenware – vielleicht gerade weil solche Dinge auf den ersten Blick so unscheinbar, so unverdächtig, so belanglos und unbedeutend anmuten – durchaus ernstzunehmende Propagandaträger sein können: Ihr „ästhetische[r] Reiz wird ausgelöst durch den Gegensatz zwischen Kitsch-Harmonie und permanenter Beschwörung der Themen Tod und Zerstörung“71 und eben die „Juxtaposition dieser beiden gegensätzlichen Elemente bildet die Grundlage einer gewissen religiösen Ästhetik“, eventuell gesteigert zu einer „perfekten Synthese“, die der politischen Mobilisierung dienen kann.72 Auch hier ließe sich Kracauer anführen. So man also das Schälchen als Kunst (im Dienst der NS-Propaganda) ansieht, würde seine Wirkabsicht – gemäß Kracauer – auf die Ausschaltung der Ratio abzielen und damit letztendlich auf eine Überwältigung. Wenn man es allerdings als Kitsch versteht, vereint es – Friedländer zufolge – zwei (sich widersprechende) Sehnsüchte (etwa Harmonie und Tod, vom Schälchen durch Krieg und Frieden, Reich und Europa symbolisiert) zu etwas Neuem: etwa der Opferbereitschaft. Diesem Gedankengang zufolge zielt der Kitsch darauf ab, Zustimmung zu erzeugen. Kunst und Kitsch weisen demnach einen unterschiedlichen Wirkmechanismus in der Propaganda auf, doch zielen beide qua ihrer spezifischen Ästhetisierung auf die Emotionen ab, um über sie – und nicht über den Verstand – zu beeinflussen und zu steuern. Es sind solche durch das Sèvres-Schälchen evozierte Überlegungen, die dieses nicht nur zu einer Primärquelle für den NS-Umgang mit der Geschichte im Allgemeinen und Karl dem Großen im Besonderen sowie den NS-Europagedanken machen, sondern vor allem auch für die NS-Propaganda.
70
71 72
Bernhard Jussen, Liebigs Sammelbilder. Weltwissen und Geschichtsvorstellung im Reklamesammelbild, in: Gerhard Paul (Hg.), Das Jahrhundert der Bilder. 1900 bis 1949, Göttingen 2009, S. 132–139, 135; vgl. auch ders., Bild- und Mediengeschichte. Karl der Große in der Moderne, in: Stiftung Deutsches Historisches Museum, Kaiser (wie Anm. 10), S. 330–349, 339: Reklamesammelbilder als „dem wichtigsten Medium zur Erzeugung von Weltwissen im Jahrhundert vor dem Fernsehzeitalter“ – womit diese natürlich auch die politische Kultur beeinflusst haben. Karl wird nicht von ungefähr auf der Vorderseite als Krieger abgebildet, die Rückseite ziert mit dem Eisernen Kreuz eine militärische Auszeichnung und der Text spricht von „verteidigen“. Friedländer, Kitsch (wie Anm. 43), S. 26, 33, 46, 14, 16.
Porzellan und Propaganda – Karl der Große im NS-Geschichtsbild
239
V. DER ‚GROSSE‘ PORZELLANTELLER AUS SÈVRES Als Pendant zu dem kleinen Schälchen ist nunmehr ein Teller entdeckt worden, der – so es sich nicht um eine Fälschung handelt – die gleiche Thematik anspricht.73 Während die Vorderseite jedoch ein verschleiertes Antlitz Karls des Großen ziert (das sich offensichtlich an einem Fresko Alfred Rethels im Aachener Rathaus aus dem Jahr 1847 orientiert, das die Öffnung des Karlsgrabes durch Otto III. im Jahr 1000 zeigt), prangt auf der Rückseite – zusammen mit einem Eisernen Kreuz und dem Sèvres-Logo – folgender Text: IMPERIUM A CAROLO MAGNO FUNDATUM DIVISUM ANNO DCCCXLIII PER LUDOVICUM CAROLI NEPOTEM DEFENSUM AB ADOLPHO HITLER DUCE GERMANORUM ANNO MCMXLIII
Abb. 3 und 4: © Hermann Historica Auktionen, München
Dieser Teller soll aus dem gleichen Jahr wie das Schälchen stammen, doch deutlich größer (31,5 cm im Durchmesser) sein, ebenfalls aus weißem, glasierten Porzellan 73
Sowohl das Foto als auch die Angaben über Entstehungszeit, Material und Größe dieses Tellers entnehme ich der Website des Auktionshauses Hermann Historica oHG München (60. Auktion, Los Nr. 3163), für deren Abdruckgenehmigung ich danke. Auf meine Nachfrage zu weiteren Informationen zu diesem Stück, die offensichtlich auch zu einem kleinen Werbetext führten, wurde mir geantwortet, dass sie „die Quellen unserer damaligen Gutachten nicht mehr eruieren können“, e-Mail von Hermann Historica München vom 24. März 2014.
240
Janus Gudian
mit Goldrand bestehen, ebenfalls in Sèvres hergestellt sein, und weist ebenfalls auf Karl den Großen, die Teilung des karolingischen Reichs 843 sowie auf Hitler als den Wiederbegründer beziehungsweise Beschützer dieses Reichs hin. So die Angabe des Auktionshauses, das diesen Teller anbot, zutrifft – „Ein Geschenk des Generalstabes von Groß-Paris zu Hitlers 54. Geburtstag am 20.4.1943. Einzelanfertigung“ –, handelt es sich hierbei um ein Geschenk an (und nicht von) Hitler. Was ist (immer unter der Voraussetzung, dass ein Auktionshaus keine 20.000,– Euro für eine Fälschung aufruft) nun von diesem Teller zu halten? Vor dem Hintergrund der Entwicklungen des Frühjahrs 194374 (als dem Zeitraum, in dem dieser Teller laut den vorliegenden Informationen entstanden sein müsste), also der Casablanca-Konferenz, der Berliner Sportpalastrede, dem beginnenden Rückzug der Wehrmacht an der Ostfront, Stalingrad, des einsetzenden Bombardements der Alliierten auf die deutsche Zivilbevölkerung, der sich im Deutschen Reich bemerkbarmachenden Rohstoffknappheit etc., sowie im Wissen darum, dass sich der amtierende Militärbefehlshaber in Frankreich, General Carl-Heinrich von Stülpnagel, am Attentat des 20. Juli 1944 beteiligen wird: Ginge es da zu weit, wenn man das Hauptaugenmerk auf das gewählte Abbild Karls legte und fragte: Warum schenkt man seinem (lebenden) Oberbefehlshaber das Abbild eines zwar ‚Großen‘, doch Toten? Ist es eine Andeutung von über den Tod hinausreichender historischer Größe? Ist es eine Vorwegnahme posthumer Verklärung des ‚zweiten Karl‘? Ginge es zu weit, wenn man (als einen ersten Gedanken)75 gemäß dem Sklaven, der hinter dem in Rom einziehenden Triumphator auf dem Streitwagen stand und flüsterte Respice post te, hominem te esse memento an eine Warnung dächte?
74 75
Vorausgesetzt die Aussage trifft zu, dass es sich um ein Geschenk für Hitlers 54. Geburtstag am 20. April 1943 handelt, wäre dieser Teller zeitlich vor den kleineren Schälchen zu verorten, deren erster Nachweis mit der Rechnung auf den 13. September 1943 datiert. Ein sich unmittelbar anschließender ist die Frage, ob „DUCE“ einfach eine direkte Übersetzung aus dem Deutschen darstellen soll (Führer) oder nicht vielmehr im Hinblick auf Kaiser Karl eine Abstufung zum Herzog bedeuten kann.
ZWISCHEN GEDÄCHTNIS UND RITUALISIERUNG – VARIANTEN DER STABILISIERUNGSSTRATEGIE Der verewigte Streit um das Weihnachtsfest in Jerusalem und die Memorialzeit in der isländischen „Njáls saga“ Mordechay Lewy In seinem Buch „Der Schleier der Erinnerung“1 hat unser Jubilar ein längeres Kapitel den Stabilisierungsstrategien von Erinnerungskulturen und deren Grenzen gewidmet. Dabei behandelte er zunächst die mündliche Erinnerung. „Bloße Erinnerung, die sich auf keine weiteren Hilfsmittel als das Gehirn zu stützen vermag, überlebt allenfalls zwei bis drei Generationen.“2 Auch dann wird die Erinnerung stetig verformt und nimmt eine unvorhersagbare Gestalt an. Die Grenze der Memorialzeit des menschlichen Erinnerungsvermögens lag sowohl in der Antike3 wie auch im Mittelalter4 bei drei bis vier Generationen. Neben der mündlichen entwickelte sich allmählich die schriftliche Erinnerungskultur. Geschichtsschreibung bedeutet zweifelsohne über die Schriftlichkeit hinaus einen Fortschritt.5 Ohne schriftliche Aufzeichnungen zwischen Ereigniszeit und Memorialzeit wird die Erinnerungsfähigkeit arg strapaziert und völlig verzerrt. Man konnte jedoch auf eine Stabilisierungsstrategie zurückgreifen. Diese war aber keineswegs mit erinnerter Wirklichkeit gleichzusetzen. Die Stabilisierung des Gedächtnisses wurde in Spätantike und Mittelalter durch die Kanonisierung von Texten abgesegnet. Voraussetzung dafür war die Schaffung eines gesellschaftlichen Konsenses oder die Existenz einer Autorität, die Disziplin und Ehrfurcht forderte, um den Kanon strikt einzuhalten. Die Vorgabe, eine Unveränderlichkeit mit einer Kanonisierung zu konstruieren, hat die Flexibilität von religiösen Ritualen erschwert. Die Heilserwartung und die Ängste um die kommende Endzeit haben die Kanonisierung der Texte und die Ritualisierung der Liturgie gefestigt. Dennoch entfachte das Spannungsverhältnis zwischen der behaupteten Unveränderlichkeit und den zeitgemäßen Anpassungsbestrebungen eine kreative Dynamik, die das Überleben von Institutionen wie der Kirche ermöglichte. Die Kanonisierung strebt an, ein kollektives Gedächtnis zu formen und aufrecht zu erhalten. Die Geschichtsschreibung ist eher eine individu1 2 3 4 5
Johannes Fried, Der Schleier der Erinnerung. Grundzüge einer historischen Memorik, München 2004. Ebd., S. 330. Herodot, Historien II, 142–143, übers. von Christian Bähr, Herodot. Neun Bücher zur Geschichte, Wiesbaden 2011, S. 214 f. (überarbeitete Ausgabe der Übersetzung von 1898). So bei Hermann dem Lahmen und Thietmar von Merseburg, vgl. Fried, Schleier (wie Anm. 1), S. 174. Ebd., S. 316.
242
Mordechay Lewy
elle Konstruktion einer erinnerten Wirklichkeit, in der man versucht, sich der Erlebniszeit zu nähern und die Memorialzeit zu überwinden. Der Begriff „Ritualisierung“ steht gedächtnisstrategisch vor allem für religiöse Handlungen, sei es Kanonisierung von Gebeten oder von liturgischen Gesten. Er stammt in seiner Bedeutungsnähe aus dem Umfeld der menschlichen Verhaltungsforschung. Die Ritualisierung kann mit einer stetig wiederholten Geste verbunden sein, die routinemäßig, ja fast wie ein eingefrorener Automatismus die Handlung wiederholt. Ritualisierung kann sich weit über die Erinnerungszeit hinaus erhalten. Sie beansprucht nicht mehr rational das Gedächtnisvermögen. Ich möchte an zwei Beispielen untersuchen, ob eine menschliche Gemeinschaft sich auf eine kollektive Gedächtnisstrategie berufen kann, die über drei oder vier Generationen hinaus Bestand hat. Johannes Fried hat den Begriff der Stabilisierungsstrategie durch Kanonisierung von Texten6 paradigmatisch auf das identitätsstiftende kulturelle Gedächtnis des Judentums seit der Zerstörung des zweiten Tempels angewendet. Der Begriff „Ritualisierung“ als Gedächtnisstrategie bietet sich ebenfalls an. Im Vergleich zur Kanonisierung beschränkt er sich nicht nur auf Texte, sondern auch auf Körpersprache von liturgischen Handlungen und anderen Handlungsweisen. Die Frage ist, inwieweit eine solche Versiegelung des Gedächtnisses jenseits der Erinnerungsschwelle von drei bis vier Generationen Bestand haben kann. I. DER RITUALISIERTE WIDERSTAND DER ARMENIER IN JERUSALEM GEGEN JUSTINIANS IMPERIALE EINFÜHRUNG DES WEIHNACHTSFESTS Jerusalem und Bethlehem sind wohl die einzigen Orte auf der Welt, an denen Weihnachten bis heute an drei verschiedenen Tagen begangen wird. Katholiken, Lutheraner und Freikirchen begehen die Geburt Jesu am 25. Dezember. Die griechischorthodoxe Kirche samt assoziierten Kirchen begeht dieses Fest gemeinsam mit den orientalischen Kirchen am 6. Januar. Die ursprüngliche Differenz zwischen dem gregorianischen und dem julianischen Kalender waren 10 Tage und sie vergrößerte sich bis heute wegen der periodisch alle zwei Jahrhundertwenden wegfallenden Schaltjahre auf 13 Tage. Sowohl lateinische und griechische wie auch orientalische Kirchen begingen bis zur Kalenderreform im Jahr 1582 Weihnachten am gleichen Tag, dem 25. Dezember. Die Armenier feiern aber die Geburt Jesu gemeinsam mit der Taufe am Fest der Epiphanie am 6. Januar nach dem julianischen Kalender. Nach dem gregorianischen Kalender wird Weihnachten heute auf den 19. Januar festgelegt. Verschiedene Theorien über Ursprünge von Epiphanie und Weihnachten sind zuletzt von Hans Förster verworfen worden.7 Förster widerspricht den Theo6 7
Ebd., S. 304. Vgl. zudem Jörg Frey, Die Herausbildung des biblischen Kanons im antiken Judentum und im frühen Christentum, in: Das Mittelalter 18, 1, 2013, S. 7–26. Hans Förster, Die Anfänge von Weihnachten und Epiphanias. Eine Anfrage an die Entstehungshypothesen (Studien und Texte zu Antike und Christentum 46) Tübingen 2007, S. 1–56. Förster
Zwischen Gedächtnis und Ritualisierung – Varianten der Stabilisierungsstrategie
243
rien, die für heidnische Vorläufer der Epiphanie plädierten.8 Er meint im Geburtsfest in Jerusalem und Bethlehem den ursprünglichen Kern des Epiphaniefestes am 6. Januar zu erkennen. Sein Entstehen könnte mit der Errichtung der konstantinischen Geburtskirche in Bethlehem um 333 in Zusammenhang gebracht werden.9 Durch die Pilger fand das Epiphaniefest auch Einzug in das weströmische Kaiserreich. Die relevante Frage für uns ist aber, warum die Armenier in Jerusalem bis heute Weihnachten gemeinsam mit der Epiphanie begehen. Welche Bedeutung hat dieses Datum für sie? Haben wir hier ein Beispiel eines historisch längst vergessenen Konflikts, der aber mit der konsequenten Einhaltung des Datums den Konflikt ritualisiert hat? Der Keim des Konflikts um das Weihnachtsfest begann in Rom, als der 25. Dezember als Weihnachtsdatum statt des natalis solis invicti festgesetzt wurde.10 Die Kaiser konnten nicht lange tolerieren, dass in ihrem Reich die Uneinigkeit soweit zur Schau gestellt wurde, dass die Geburt Jesu an zwei Feiertagen, am 25. Dezember und am 6. Januar, begangen wurde. Schon Kaiser Theodosius scheint den 25. Dezember im Jahr 379 in Konstantinopel eingeführt zu haben.11
8 9 10 11
hat in seinem Buch versucht, mit den drei herrschenden Theorien zum Ursprung des Weihnachtsfestes aufzuräumen. So wollte er den Ursprung vom heidnischen Kult in Rom natalis solis invicti am 25. Dezember nicht gelten lassen, da dieses Fest nur regionale, aber nicht allumfassende Verbreitung im Kaiserreich gefunden habe. Die Predigt 190 von Augustinus lässt aber diesen Schluss nicht zu, vgl. Aurelius Augustinus, Sermo 190 (In natali Domini), hg. von Hubertus R. Droebner, Augustinus von Hippo. Predigten zum Weihnachtsfest (Sermones 184–196). Einleitung, Text und Übersetzung (Patrologia. Beiträge zum Studium der Kirchenväter 11) Frankfurt/Berlin/Bern 2003, S. 182–195; vgl. auch Jacques-Paul Migne, Patrologia Latina 38, Paris 1841, Sp. 1007–1009. Augustinus’ Predigt deutet auf einen Zusammenhang zwischen dem am 25. Dezember begangenen Sonnen- bzw. Apollokult und der Festlegung des Weihnachtsfestes auf denselben Tag hin. Försters Ablehnung der apologetischen Theorie, wonach Weihnachten als eine anti-arianische Maßnahme zu verstehen sei, scheint stichhaltig zu sein. Die dritte Theorie, die Förster ablehnt, ist die Theorie von 9 Monaten, die ab Mariä Empfängnis (Verkündung) am 25. März gezählt werden. Somit fällt die Geburt Jesu auf den 25. Dezember. Besonderer Dank gilt Petra Heldt (Jerusalem), die mich in die komplexe Vielfalt der christlichen Feste in der Heiligen Stadt eingeführt hat. Als Vorläufer wurden genannt: die Geburt des Gottes Aion aus der Jungfrau Kore; Schöpfen und Aufbewahrung des Nilwassers; der Dionysos-Osiris-Kult. Itinerarium Burdigalense, hg. von Paul Geyer, Itinera Hierosolymitana saeculi IIII–VIII (Corpus scriptorum ecclesiasticorum Latinorum 39) Prag/Wien/Leipzig 1898, S. 1–33, hier S. 25. Bezeugt ist dies erstmalig in den Jahren 335–337. Es sind die Jahre, in die die Errichtung der konstantinischen Geburtskirche in Bethlehem fällt. Im Zuge der imperialen Förderung des Weihnachtsfestes am 25. Dezember im Osten und seiner Trennung von Epiphanias am 6. Januar wurde das Tauffest für die Epiphanie propagiert. Der nach Konstantinopel von Theodosius bestellte Erzbischof, der Kirchenvater Gregor von Nazianz, propagierte in zwei Predigten die Kaiserpolitik, indem er am 25. Dezember 380 das Geburtsfest Jesu als Fest der Lichter (In sancta Lumina) festhielt und danach am 6. Januar 381 das Fest der Taufe als Theophania beschrieb, vgl. Gregorii Theologi vulgo Nazianzeni, Oratio XXXIX und Oratio XL, hg. von Jacques Paul Migne, Patrologia Graeca 36, Paris 1846, S. 335–426; vgl. Gregory Nazianzen, Sermons 39 and 40, hg. von Philip Schaff, The Nicene and Post-Nicene Fathers, Ser. II, 7: S. Cyril of Jerusalem S. Gregory of Nazianzen, New York 1894, S. 352–377. Onlinezugriff via ‚Christian Classics Ethereal Library‘: www.ccel.org [Stand: 01.03.2015].
244
Mordechay Lewy
Juvenalis, Bischof von Jerusalem (424–457), hatte im Jahr 439 das Weihnachtsfest am 25. Dezember in Bethlehem eingeführt.12 Sein Einführungsversuch war nicht von langer Dauer, da die monophysitische Mehrheit in Palästina sich dieser Erneuerung widersetzte. Als Juvenalis vom Konzil in Chalcedon im Jahr 451 mit einer kaisertreuen Haltung zurückkehrte und die Grundsätze des Konzils in Palästina umsetzen wollte, wurde er aus seinem Amt verjagt.13 Die erneute Initiative von Kaiser Justinian (527–565), den imperialen Weihnachtskalender vom 25. Dezember in Jerusalem wiedereinzuführen, konnte bei den Monophysiten nur große Verbitterung hervorrufen. Tatsächlich ist ein Brief Justinians von 560/61 an die Christen in Jerusalem überliefert, in dem er alle theologischen Register zieht, um die Trennung der Geburt von der Epiphanie zu rechtfertigen.14 Die Krise seiner Herrschaft in Konstantinopel in den Jahren 541–543 machte Justinian noch weniger empfänglich für Abweichungen von der kaiserlichen Festlegung Weihnachtens auf den 25. Dezember. Justinian wollte die Einheit seines Reiches auch durch einen einheitlichen Festkalender demonstrieren. Es handelte sich also nicht nur um die Bekämpfung einer theologischen Abweichung, sondern es konnte auch als ein politisch-nationaler Konflikt umschrieben werden.15 Kaiser Justinian hatte mittlerweile in West-Armenien administrative Reformen eingeführt, um die armenische Elite militärisch gefügig zu machen. Armenien sollte als Bollwerk gegen die Sassaniden dienen, die Ost-Armenien beherrschten.16 Die Justinianischen Reformen führten zum armenischen Aufruhr in den Jahren 552–554. Die armenische Entscheidung zugunsten der monophysitischen Haltung wurde in der Synode von Dvin im Jahr 555 gefällt. Von diesem Jahr an trennte sich die armenische endgültig von der byzantinisch-orthodoxen Kirche und sagte sich vom julianischen Kalender los. Eine armenische Zeitrechnung wurde eingeführt, die Jahrhunderte lang gültig blieb.17 Es war ein Kalender, der einen starken zoroastrisch-persischen Einschlag hatte. Die byzantinische Kirche wurde seit 555 nicht mehr als rechtgläubig aufge12
13 14 15
16 17
Ernest Honigman, Juvenal of Jerusalem, in: Dumbarton Oaks Papers 5, 1950, S. 209–279, S. 226. Vgl. auch Vita Melaniae, Kapitel 63, übers. von Remigius Storf, Griechische Liturgien (Bibliothek der Kirchenväter 1, 5) München 1912, S. 446–498, hier S. 491. Melania stammte aus Rom, sodass sie keine Hemmungen hatte, das Epiphaniefest nicht zu begehen und stattdessen die Erneuerung von Juvenal zu beherzigen. Honigman, Juvenal (wie Anm. 12), S. 247–249. Michel van Esbroeck, La lettre de l’empereur Justinien sur l’Annonciation et la Noël en 561, in: Analecta Bollandiana 86, 1968, S. 351–371. Ernest Llewellyn Woodward, Christianity and Nationalism in the Later Roman Empire, London 1916, S. 48 f.: „The Armenian Church, which was under a Katholikos of its own, and which remained united after the partition of Armenia in 440, held to Monophysitism. They had first adopted it out of opposition to Persian Christianity [d. h. Nestorianismus] and out of friendship for the Empire. They used it finally as a barrier [d. h. gegen Byzanz] to defend their nationality; for this purpose they kept also certain peculiarities of ritual“. Nicholas Adontz, The Reform of Justinian in Armenia, hg. und übers. von Nina Garsoïan, Lissabon 1970, S. 155–164. Die armenische Ausgabe von 1908 wurde mithilfe der ‚Gulbenkian Foundation‘ ediert und ins Englische übersetzt. Der armenische Gelehrte Ananias von Shirakatsi schrieb um die Mitte des 7. Jahrhunderts einen Traktat über Weihnachten, vgl. Ananias of Shirak upon Christmas, übers. von Frederick
Zwischen Gedächtnis und Ritualisierung – Varianten der Stabilisierungsstrategie
245
fasst. Ein Brief des armenischen Bischofs in Jerusalem Georgios Arzruni nach Armenien belegt den Widerstand der Armenier in Jerusalem gegen die imperiale Politik.18 Darin wird ein iudaeus quidam haereticus beschuldigt, Kaiser Justinian gemeldet zu haben, dass Hypapante19 von den Jerusalemern nicht wie im ganzen Reich 40 Tage nach Weihnachten, sondern 40 Tage nach Epiphanie begangen wird. Arzruni erwähnt den Brief von Justinian an den Patriarchen Eustochios (552–564), der große Bestürzung in Jerusalem auslöste, weil er auf die Einhaltung des Weihnachtsfests am 24. Dezember bestanden hat. Ein Zeichen Gottes in Form von Wassertropfen an einer Säule in der Zionskirche beeindruckte die Menge wie auch die kaiserlichen Truppen so sehr, dass die Forderung Justinians nicht durchgesetzt wurde. Unter dem Patriarchen Makarios II., so fährt Arzruni fort, bedrohte Justinian diejenigen mit der Todesstrafe, die sich seinem Wunsch widersetzten. Dieser zweite gewaltsame Versuch Justinians fand 564 oder 565 statt.20 Arzruni berichtet, dass viele, die sich widersetzten, ihren Tod fanden. Als die kaiserlichen Truppen die Stadt bestürmen wollten, geschah ein zweites Wunder. An derselben Säule erschien die Jungfrau Maria mit dem Jesuskind in ihrem Arm. Die Erscheinung wurde sowohl von Gerechten wie auch von Sündern gesehen. Eine armenische Frau wurde als Erste geheilt. Die Gefahr wurde offenbar abgewendet. Erst nach dem Tode von Makarios II. hat, in den Worten Arzrunis, die Stadt diese Häresie angenommen. Die Durchsetzung des byzantinischen Weihnachtskalenders geschah also zur Zeit Kaiser Justins II. (565– 578), wahrscheinlich21 um das Jahr 570. Arzrunis Brief, der offenbar nach der Einführung des byzantinischen Weihnachtsfestes in Jerusalem um 570 geschrieben wurde, macht eines deutlich: Die meisten monophysitischen Kirchen haben sich der kaiserlichen Forderung gebeugt, zuletzt in Jerusalem.22 Armenier waren die Einzigen, die sich nicht beugten, weder in Armenien noch in Jerusalem. Es waren aber nicht nur doktrinäre Gründe, die die armenische Opposition bewegte. Nach der Trennung von Byzanz auf der Synode
18 19 20 21
22
C. Conybeare, in: The Expositor Ser. 5, 4, 1896, S. 321–337, S. 335 f.: „The Epiphany, according to the Armenians, changes its date every four years“. Der Brief ist in einer armenischen Handschrift überliefert und Auszüge davon wurden von van Esbroeck, La lettre (wie Anm. 14), S. 362–368, ins Lateinische übersetzt. Griechisch: Vorstellung. Bezieht sich auf das Fest der Vorstellung Jesu im Tempel. Im lateinischen Westen als Darstellung im Tempel oder Mariä Lichtmess bekannt. Ernennungsjahr des Makarios zum Patriarchen war 564; Sterbejahr von Justinian 565. Als Todesjahr von Makarios galt 575, aber van Esbroeck, La lettre (wie Anm. 14), S. 364 f., führt triftige Gründe an, dass sein Tod um 570 eingetreten sein könnte. Hilfreich dafür ist der um 570 datierte Bericht des Anonymus von Piacenza, der die Begehung des Namensfestes des Apostels Jakob und König Davids einen Tag nach Weihnachten bezeugt. Ferner berichtet dieser Anonymus von einem Tauffest am Jordan am Fest der Epiphania, zu dem man schwer Weihnachten begehen konnte. Vgl. Antonini Placentini Itinerarium, hg. von Paul Geyer, Itinera Hierosolymitana (wie Anm. 9), S. 157–191, hier S. 179 und S. 166. Noch im Brief von 560/61 beklagte sich Justinian, dass die Irregeleiteten in Jerusalem diese Namensfeste an Weihnachten begingen, vgl. van Esbroeck, La lettre (wie Anm. 14), S. 367. Ananias, Christmas (wie Anm. 17), S. 335: „I know a few of the Greeks who kept this feast until the Emperor Justinian; but all were constrained by him, and received it – Jerusalem, Rome, Alexandria, and every land“.
246
Mordechay Lewy
von Dvin im Jahr 555 war der Widerstand in Jerusalem auch eine politische Manifestation eines neuen Bewusstseins des gesteigerten Selbstständigkeitsgefühls. Im Gegensatz zu anderen monophysitischen Kirchen lag Armenien außerhalb des byzantinischen Reichsgebietes. In Jerusalem gab es seit dem 5. Jahrhundert eine armenische Diaspora, die sich diese byzantinische Erneuerung nicht bieten lassen wollte. Der Konflikt mit den byzantinischen Kaisern ist heute längst vergessen. Die armenische Zelebrierung des Weihnachtsfestes zusammen mit dem Tauffest in der Epiphanie hat sich jedoch wegen der Ritualisierung bis heute erhalten. Somit hat sich in Jerusalem das Gedächtnis dieses historischen Konflikts als Ritual erhalten. Die Ereigniszeit wurde als Kalenderabweichung über 1500 Jahre tradiert. Alle orientalischen und orthodoxen Kirchen23 in Jerusalem widersetzten sich den Reformversuchen von 1923, vom julianischen auf den gregorianischen Kalender überzugehen. Darin unterschieden sich die Armenier in Jerusalem nicht. Sie behielten aber als Einzige die Epiphanie als ihr Weihnachts- und Tauffest.24 Diese Stabilisierungsstrategie durch Ritualisierung verschleiert jedoch den historischen Kern des byzanto-armenischen Konfliktes zu Kaiser Justinians Zeiten. II. MEMORIALZEIT UND RITUALISIERUNG IN DER ISLÄNDISCHEN „NJÁLS SAGA“ Das folgende Beispiel zeigt, wie eine Gedächtnisstrategie in der vorchristlichen Epoche in Nordeuropa entstehen konnte. Auch in den Isländischen Sagas lässt sich eine Ritualisierung jenseits der Memorialzeit belegen. Diese Sagas sind auf ein Wieder- und Weitererzählen beziehungsweise Mehrfachhören angelegt. Die tradierten Wiederholungen der Sagas gestalten das Gedächtnis wie eine rituelle Funktion. Literaturforscher und Germanisten neigen dazu, diese Texte vornehmlich nicht als historische Quelle zu betrachten. Vielmehr unterziehen sie diese Texte eigens für sie geformten epischen Regeln zur literarischen Analyse, wobei die Chronologie nicht als Faustregel gilt.25 Eine chronologische Sichtweise könnte aber insofern hilfreich sein, da sie historische Umstände bei Entstehung und Rekonstruierung von Texten berücksichtigen kann. Ein Beispiel, wie ein historischer Kern sich verformt und sich der Ereigniszeit durch Mythenbildung entfremdet, findet sich in der isländischen „Njáls saga“. Das sogenannte Walkürenlied („Darraðarljóð“) ist überhaupt nur in einigen Handschriften der Saga überliefert. Die schriftliche Fixierung der weit älteren mündlichen Tradition wird auf die Jahre zwischen 1270 und 23
24 25
In Griechenland selbst wird Weihnachten seit einem Parlamentsbeschluss und nachfolgender Synode im Jahr 1923 dem gregorianischen Kalender am 24. Dezember angeglichen. Zur Erhaltung des julianischen Kalenders als Ausdruck eines antiquierten Konservatismus innerhalb der griechisch-orthodoxen Kirche vgl. Constantine Cavarnos, Blessed Elder Philotheos Zervakos, in: Modern Orthodox Saints 11, 1993, S. 69–75. Dieses Fest wird heute in Jerusalem am 19. Januar begangen (06.01. + 13 Tage). Axel Olrik, Epische Gesetze der Volksdichtung, in: Zeitschrift für Deutsches Altertum 51, 1909, S. 1–12.
Zwischen Gedächtnis und Ritualisierung – Varianten der Stabilisierungsstrategie
247
1290 datiert.26 Das Walkürenlied ist älter als die Saga selbst und befindet sich gegen Ende der Njáls saga im Kapitel 157. Das Kapitel ist der Schlacht von Clontarf im Jahr 1014 gewidmet. Dort taucht folgende makabre Vision als historische Einleitung auf, die das Walkürenlied in einen literarischen Rahmen einbetten soll27: „Am Morgen des Karfreitags [d. h. am 23. April 1014] trug sich in Caithnes folgendes Ereignis zu: Ein Mann namens Dörrud trat vors Haus und sah zwölf Leute zu einer Webkammer reiten und alle darin verschwinden. Er ging zu der Kammer und schaute durch eine Fensterluke hinein. Er sah, dass ein paar Frauen drinnen ein Gewebe aufgespannt hatten. Menschenköpfe dienten als Gewichte und Menschengedärme als Schuss und Kette, das Webbrett war ein Schwert und das Schiffchen ein Pfeil.“ Nach dem Gesang der Walküren klingt die Vision mit den folgenden Sätzen aus28: „Dann rissen sie das Gewebe herunter und zerfetzten es, und jede von Ihnen behielt das Stück, das sie in Händen hatte. Dörrud verließ die Fensterluke und ging zurück. Die Frauen aber stiegen auf ihre Pferde. Sechs von Ihnen ritten nach Süden und sechs nach Norden.“ Die Forschung ist sich uneins, ob das Weben im Lied metaphorisch gemeint ist, als Gleichnis zwischen Weben und Schlachtführung, oder ob es eher eine reale Schlachtbeschreibung oder gar eine aktive Schlachtbeteiligung der Walküren ist29, die in ihrem Gesang auf kriegerische und webtechnische Idiome zurückgreifen.30 Die literaturwissenschaftliche Forschung räumt eine große Bedeutung für die dichterische Gestaltung, wie Versstruktur und Rhythmus, ein. Eine historische Analyse dieses Liedes wurde kaum unternommen. Da wir uns aber hier mit Erinnerungskultur beschäftigen, interessiert uns die Frage: An welche Schlacht wird hier erinnert? Die später hinzugefügte Überschrift des Kapitels 157 ist mit „Brjanschlacht“ nach dem damaligen König der irischen Stämme überschrieben. Die genaue christliche Datierung des Ereignisses auf Karfreitag war für viele Forscher der Anlass, den martialischen Einschub des Walkürengesangs mit der Schlacht von Clontarf bei Dublin zu identifizieren, die am Karfreitag des Jahres 1014 stattfand. Dem Wikingerführer Brodir wurde nämlich vor der Schlacht prophezeit, „wenn die Schlacht 26 27
28 29
30
Sverrir Tómasson, Njáls saga, in: Heinrich Beck/Dieter Geuenich/Heiko Steuer (Hgg.), Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 21: Naualia – Østfold, Berlin/New York 22002, S. 231–234. Njals Saga. Die Saga von Njal und dem Mordbrand, hg. und übers. von Hans-Peter Naumann (Skandinavistik. Sprache – Literatur – Kultur 3) Wien/Berlin/Münster 32011; das Kapitel 157 befindet sich auf S. 309–315, darin ist das Walkürenlied auf S. 312–314 enthalten; die hier zitierte Stelle S. 311 f. Ebd., S. 314. Dagegen muss im Lied Bjarkamál die Walküre Ruta aufgerufen werden, um nicht passiv zu bleiben und sich in die Schlacht einzuschalten, vgl. Saxo Grammaticus. Die ersten neun Bücher der dänischen Geschichte, übers. von Hermann Jantzen, Berlin 1900, II, 17–19, S. 98: „Auch du, Ruta, stehe auf und erhebe dein schneeweisses Antlitz, verlasse dein Versteck und komme in den Kampf; das Blutbad, welches angerichtet wird, ruft dich heraus“. Heiko Uecker, Darraðarljóð, in: Heinrich Beck/Herbert Jankuhn/Kurt Ranke/Reinhard Wenskus (Hgg.), Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 5: Chronos – dona, Berlin/New York 21984, S. 254–256.
248
Mordechay Lewy
am Freitag stattfände, werde Brjan fallen und dennoch Sieger bleiben, aber wenn es vorher zur Schlacht käme, würden alle seine Gegner fallen. Da bestimmte Brodir, dass sie vor Freitag die Schlacht nicht eröffnen sollten.“31 Es ist nicht der einzige Fall in der Sagaliteratur, in dem ein älteres Lied nach Jahren in Erinnerung gebracht und zitiert wird. Der poetische Kunstgriff, ein bekanntes Lied anzustimmen, um Wikingerkrieger vor der Schlacht zu ermuntern oder an ihre Loyalitätspflicht zu erinnern, taucht auch in der um 1230 verfassten „Heimskringla“32 auf. Demzufolge hat König Olaf vor der Schlacht in Stiklastaðir33 um 1030 gebeten, das offensichtlich schon damals verbreitete Lied „Bjarkamál“34 vor seinen Kämpfern vortragen zu lassen. Das Lied erinnert an die mythologische Schlacht von Lethra, die angeblich im 6. Jahrhundert stattgefunden hat. Die um 1030 aufgerufene Erinnerung an diese Schlacht35 überschritt bei Weitem die Memorialzeit von drei Generationen. Das Walkürenlied stimmt aber inhaltlich nicht mit dem Ausgang der Schlacht von Clontarf überein. Im Lied sind nämlich die Iren die großen Verlierer, wobei die Hilfe der Walküren für die Wikinger entscheidend war, denn „auch die Iren wird Unheil schlagen, das im Gedächtnis spät erlischt.“36 Die Wikinger werden umschrieben mit: „Männer werden das Land beherrschen, die vorher auf felsigen Schären hausten.“37 Diese Aussagen passen aber eher zu den Kampfhandlungen, die in der Schlacht von Confey38 (auch als Cenn Fuait bekannt) von 917 bezie31 32 33
34
35 36 37 38
Njals Saga (wie Anm. 27), S. 309. Snorris Königsbuch (Heimskringla) 2, übers. von Felix Niedner (Thule 15) Jena 1923, Kap. 208 „Die Geschichte von König Olaf dem Heiligen“, S. 355. Ich bin Daniel Föller (Frankfurt/Main) dankbar für diesen Hinweis. Claus Krag/Lars F. Stenvik, Stiklastaðir, in: Heinrich Beck/Dieter Geuenich/Heiko Steuer (Hgg.), Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 29: Skírnismál – Stiklestad, Berlin/ New York 22005, S. 635–637, hier S. 635: „Im Sommer 1030 traf Olaf der Heilige hier auf eine übermächtige Koalition von Bonden aus dem Trøndelag und norwegischen Küstenhäuptlingen, die von Knut dem Großen unterstützt wurden. Diese Schlacht endete mit dem Tod Olafs, doch war die Niederlage zugleich der Beginn von Olafs Stellung als Märtyrer und Nationalheiliger Norwegens“. Das Lied sollte offenbar Olafs Krieger vor der Schlacht ermuntern und an die Pflicht der Treue zu Olaf erinnern. Mit dem darin besungenen Heldenmut der Krieger des dänischen Königs Rolf Krake sollte die Idealtugend der Kämpfer als Verhaltensmodell dienen, vgl. Edith Marold, Bjarkamál, in: Heinrich Beck/Herbert Jankuhn/Kurt Rank/Reinhard Wenskus (Hgg.), Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 3: Bilrost – Brunichilde, Berlin/New York 21978, S. 51–55. Das Lied ist um 900 in dänischem Umfeld entstanden. Es ist nur fragmentatisch überliefert. Saxo Grammaticus hat es in Hexameter bearbeitet und gewährt uns einen inhaltlichen Einblick, vgl. Saxonis Gesta Danorum 1–2, hg. von Jørgen Olrik / Hans Raeder, Kopenhagen 1931–1957, 1, lib. II, S. 59–66. In der Schlacht von Lethra (heute: Lejre) fiel der dänische König Rolf; seine Festung wurde von den Schweden zerstört. Das Lied ist nur fragmentarisch überliefert. Njals Saga (wie Anm. 27), S. 314, Strophe 8. Ebd., S. 313, Strophe 7. Für Confey im Jahr 917 vgl. The Annals of Ulster (To A. D. 1131) 1: Text and Translation, hg. und übers. von Seán MacAirt / Gearóid MacNiocaill, Dublin 1983, S. 367. Für Confey im Jahr 915 vgl. Annala Rioghachta Eireann. Annals of the Kingdom of Ireland by the Four Masters,
Zwischen Gedächtnis und Ritualisierung – Varianten der Stabilisierungsstrategie
249
hungsweise am 22. August 915 oder in der Schlacht von Ath-Ciath39 von 919 beziehungsweise am 17. Oktober 917 stattfanden. Es waren die Niederlagen, in deren Folge die Iren die Herrschaft über die östlichen Regionen der Insel an die Wikinger abtreten mussten. Diese waren von der gegenüberliegenden Westküste Englands aus nach Irland eingefallen. Die Wikinger machten Dublin für die nächsten hundert Jahre zu ihrem Machtzentrum in Irland, bis sie Dublin und Irland im Jahr 1014 wieder an die Iren verloren. Ein Sieg, der im Gedächtnis niemals erlischt, konnte etwa drei bis vier Generationen in Erinnerung bleiben. Hinzu kommt der Nimbus eines magischen Mythos des Walkürenliedes, das mit der ritualisierten Handlung des Webens in Zusammenhang stand. Der Mythos wurde nach 1014 mit der Webhandlung sozusagen ritualisiert. Für das Jahr 1014 wurde aber mit aller Wahrscheinlichkeit dieser alte Gesang in der noch mündlichen Überlieferung der „Njáls saga“ eingeschoben, ein Kunstgriff, der einer Prophezeiung vaticinium ex eventu gleichkommt.40 Es galt ja, die Kämpfer zu ermuntern. Diese Vision wurde nicht nur in Caithness (Isländisch: Katanes) in Nordschottland erlebt, sondern auch auf den Färöern. In der Kirche von Svínafell in Island, auf der Insel Orkney und auf den Hebriden wurde am selben Tag der Schlacht ebenfalls von wundersamen Ereignissen berichtet.41 Mir scheint, dass hiermit auch die Rekrutierzentren angedeutet wurden, von denen aus die Wikinger in die Schlacht von Confey zogen. Was aber um 1014 noch innerhalb der Memorialzeit blieb, war meiner Ansicht nach um die Zeit der schriftlichen Fixierung der „Njáls saga“ schon längst vergessen, da es weit über die Memorialzeit von drei Generationen hinaus reichte. Man konnte nicht mehr zwischen den zwei Schlachten, die zeitlich hundert Jahre auseinander lagen, unterscheiden. So wurde auch das Walkürenlied mit der Schlacht von 1014 identifiziert beziehungsweise ritualisiert. Dieses Missverständnis ist bis heute nicht ganz ausge-
39 40 41
from the earliest Period to the Year 1616. Edited from MSS in the Library of the Royal Irish Academy and of Trinity College Dublin with a Translation and copious Notes 1–7, hg. und übers. von John OʼDonovan, Dublin 1848–1851, 2, S. 589–591. Siehe: https://babel.hathitrust. org/cgi/pt?id=uc2.ark:/ [Stand:09.11.2016]. Für Ath-Ciath im Jahr 919 vgl. Annals of Ulster (wie Anm. 38), S. 369. Für Ath-Ciath im Jahr 917 vgl. Annals of the Four Masters (wie Anm. 38), S. 595–599. Die Prophezeiung mag dabei im chronologischen Ablauf des Textes vor dem Auftreten des zukünftigen Ereignisses eingeführt werden, vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Vaticinium_ex_ eventu [Stand: 01.03.2015]. Njals Saga (wie Anm. 27), S. 314 f.: „Eine gleiche Erscheinung hatte Brand Gneistason auf den Färöern. In der Kirche von Svinafell draußen auf Island fiel am Karfreitag Blut auf das Meßgewand des Priesters, und er mußte es ablegen. In Thvatta schien sich einem Priester neben dem Altar der Rachen der Tiefsee aufzutun, und da unten erblickte er so grauenhafte Dinge, daß es lange dauerte, bis er endlich die Messe singen konnte. Auf den Orkneys ereignete sich [etwas], daß Harek meinte, Jarl Sigurd zusammen mit einigen Männern ankommen zu sehen. Er holte sein Pferd und ritt dem Jarl entgegen. Man konnte beobachten, daß sie sich trafen und dann hinter einem Hügel verschwanden. Man sah nie wieder etwas von Ihnen, und auch von Harek fehlte jede Spur. Jarl Gilli von den Hebriden träumte, daß ein Mann zu ihm kam, der sich Herfinn nannte und sagte, er komme aus Irland. Dem Jarl war als frage er nach Neuigkeiten. Herfinn sprach dies: Ich war, wo Männer kämpften, im Schwertgeklirr in Irland. Es krachten Schild an Schild, und Eisen traf auf Helme. Ich weiß, ihr Kampf war grimmig: Sigurd starb im Speerregen nach vielen frischen Wunden. Brjan fiel und blieb Sieger“.
250
Mordechay Lewy
räumt.42 Die Episode in Kapitel 157 der „Njáls saga“ ist eines der übernatürlichen Ereignisse, in dem die markante Schlacht von Confey 915 beziehungsweise 917 mit der Ritualisierung des Webens in den häuslichen Wänden in Verbindung gebracht wurde. Zunächst geschah dies als Metapher für das suggestive vaticinium ex eventu und das schier unabwendbare magische Schicksal der bevorstehenden Schlacht im Jahr 1014 bei Clontarf. Diese Erzähltechnik ist selten in der nordischen Literatur anzutreffen.43 Erst nach 1014 wurde dieses Gedächtnis in der mündlichen Überlieferung der „Njáls saga“ aufgenommen. Die schriftliche Fixierung des Narrativs hat die verformte Memorialzeit soweit übernommen und damit ritualisiert. Somit ist nur die Erinnerung an die Schlacht von Clontarf erkennbar geblieben. Diese gehört aber nicht zur historischen Ereigniszeit der 100 Jahre vorher ausgefochtenen Schlacht von Confey, auf die sich das Walkürenlied bezieht. Zusammenfassend können diese zwei Beispiele aus verschiedenen Epochen und Kulturen zeigen, wie Stabilisierungsstrategien des Gedächtnisses durch Ritualisierung nach der Memorialzeit folgen können. Ritualisierung sollte neben der textuellen Kanonisierung ihren Platz als Gedächtnisstrategie einnehmen.
42
43
Nora Kershaw (1922) und Felix Genzmer (1956) waren die Ersten, die Zweifel an der verbreiteten Meinung äußerten, die Schlacht im Lied sei Clontarf im Jahr 1014, und stattdessen Confey vorschlugen, vgl. Russell Gilbert Poole, Viking Poems on War and Peace. A Study in Skaldic Narrative (Toronto medieval Texts and Translations 8) Toronto 1991, S. 122 f.; Uecker, Darraðarljóð (wie Anm. 30), meint, das Lied beziehe sich auf Clontarf. Zu dieser Meinung tendiert auch Tómasson, Njáls saga (wie Anm. 26). Unentschieden ist Matthias Egeler, Walküren, Bodbs, Sirenen. Gedanken zur religionsgeschichtlichen Anbindung Nordwesteuropas an den mediterranen Raum (Ergänzungsbände zum Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 71) Berlin/New York 2011, S. 57–59. Eine christliche Vision, die als vaticinium ex eventu verstanden werden könnte, findet sich in Rimbert, Vita Anskarii 25, hg. von Werner Trillmich, Quellen des 9. und 11. Jahrhunderts zur Geschichte der Hamburgischen Kirche und des Reiches (Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters – FStGA 11) Berlin 1961, S. 16–113, hier S. 84–87. Vor seiner gefährlichen Missionsreise nach Schweden schöpfte Anskar Ermunterung durch eine Vision, die sein früherer Abt Adalhard von Corbie gehabt hatte. Adalhard hatte dabei Rimbert zum „Licht der Heiden“ erkoren und seine kommende Mission mit der Berufung des Propheten Jesaja durch Gott verglichen (Jesaja 49, 1–5).
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS ADB AfD AHC AKG AnnTrento BayHStA BISI BnF Cod. DA Dig. EDiözA EHQ ep. FStGA Gn HJb HZ JHIdeas LexMA lib. Lkr. MGH MGH Briefe d. dt. Kaiserzeit MGH Capit. MGH Conc. MGH Const. MGH DD MGH Dt. MA MGH Epp. MGH Epp. sel. MGH Libri mem.
Allgemeine Deutsche Biographie Archiv für Diplomatik Annuarium Historiae Conciliorum Archiv für Kulturgeschichte Annali dell’Istituto storico italogermanico in Trento Bayerisches Hauptstaatsarchiv Bullettino dell’Instituto Storico Italiano Bibliothèque nationale de France Codex Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters Digesten Archiv des Erzbistums European History Quarterly epistula Freiherr-vom-Stein-Gedächtnisausgabe Genesis Historisches Jahrbuch Historische Zeitschrift Journal of the History of Ideas Lexikon des Mittelalters liber Landkreis Monumenta Germaniae Historica Monumenta Germaniae Historica, Die Briefe der deutschen Kaiserzeit Monumenta Germaniae Historica, Capitularia regum Francorum Monumenta Germaniae Historica, Concilia Monumenta Germaniae Historica, Constitutiones acta publica imperatorum et regum Monumenta Germaniae Historica, Diplomata regum et imperatorum Germaniae Monumenta Germaniae Historica, Deutsches Mittelalter. Kritische Studientexte Monumenta Germaniae Historica, Epistolae Monumenta Germaniae Historica, Epistolae selectae Monumenta Germaniae Historica, Libri memoriales et necrologia
252
MGH Poetae
Abkürzungsverzeichnis
Monumenta Germaniae Historica, Poetae latini Medii Aevi MGH SS Monumenta Germaniae Historica, Scriptores MGH SS rer. Germ. Monumenta Germaniae Historica, Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum separatim editi MGH SS rer. Lang. Monumenta Germaniae Historica, Scriptores rerum Langobardicarum et Italicarum saec. VI.–IX. MGH SS rer. Merov. Monumenta Germaniae Historica, Scriptores rerum Merovingicarum MIÖG Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung NA Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde NDB Neue Deutsche Biographie OB Oberbürgermeister OGG Oldenbourg Grundriss der Geschichte PA Personalakte RhVjbll Rheinische Vierteljahrsblätter RIDA Revue internationale des droits de l’antiquité schol. scholium StA Stadtarchiv UB Universitätsbibliothek v. Vers Vat. Vaticanus VuF Vorträge und Forschungen ZBLG Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte ZGO Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins ZHF Zeitschrift für historische Forschung ZRG GA Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Germanistische Abteilung ZRG KA Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung
DIE AUTOREN Jörg W. Busch studierte in Mainz (Promotion bei Alfons Becker 1987), war Projektmitarbeiter von Hagen Keller (Habilitation in Münster 1995), Heisenbergstipendiat und Lehrstuhlvertreter in Gießen, Münster und Passau sowie Frankfurt am Main, wo er seit 2008 als Hochdeputatslehrer wirkt. Nach Studien zur Wein-, kirchlichen und kommunalen Rechts- und Historiographiegeschichte Oberitaliens, einer Geschichte des Wortes Administratio und einem Handbuch zu den Karolingern gelten seine gegenwärtigen Forschungen einem auf vier Bände angelegten Regestenwerk zur Geschichte der Stadt Neuenburg am Rhein. John Van Engen studierte am Calvin College sowie in Heidelberg (bei Peter Classen) und promovierte 1976 bei Gerhart B. Ladner an der University of California, L. A. Seit 1977 ist er an der University of Notre Dame tätig (Andrew V. Tackes Professor of Medieval History), u. a. von 1986 bis 1998 als Director of Notre Dame’s Medieval Institute. Sowohl 1993/4 als auch 1998 war er Fellow am Institute for Advanced Study in Princeton und ist zudem korrespondierendes Mitglied der Monumenta Germaniae Historica. Seine Forschungsschwerpunkte liegen u. a. auf der kulturellen und intellektuellen Erneuerung im 12. Jahrhundert, den religiösen Bewegungen des Spätmittelalters sowie den Vorstellungen über die Christianisierung in der mittelalterlich-europäischen Geschichte. Publikationen u. a.: European Transformations (zusammen mit Thomas Noble) Notre Dame 2012. Carola Föller studierte Mittlere und Neuere Geschichte, Rechtsgeschichte und Politologie an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. 2011 Promotion in Mittelalterlicher Geschichte zur Erziehung am Hof Ludwigs des Heiligen von Frankreich. Von 2011 bis 2014 war sie akademische Mitarbeiterin der Eberhard Karls Universität Tübingen, seit 2014 ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Friedrich Alexander Universität Erlangen. Sie verfasst derzeit ihre Habilitationsschrift zu kulturellen Ausdifferenzierungsprozessen im frühen Mittelalter. Daniel Föller studierte Mittlere und Neuere Geschichte, Alte Geschichte, Ältere deutsche Literaturwissenschaft und Ältere Skandinavistik an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Anschließend war er Mitarbeiter an der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, der Goethe-Universität und der Johannes GutenbergUniversität Mainz sowie Stipendiat der Gerda Henkel Stiftung (2011/12). 2012 erfolgte die Promotion in mittelalterlicher Geschichte an der Goethe-Universität mit einer Arbeit über den Denkstil im wikingerzeitlichen Skandinavien. 2012/13 wurde er Resident Fellow am Deutschen Historischen Institut Paris, 2013–2017 forschte er als Postdoc am Exzellenzcluster „Die Herausbildung normativer Ordnungen“ an der Goethe-Universität. Seit dem Sommer 2017 setzt er am Frankfurter LOEWE-
254
Die Autoren
Schwerpunkt „Prähistorische Konfliktforschung“ die Arbeit an seinem Habilitationsprojekt zur Kriegerkultur im karolingischen Europa fort. Janus Gudian studierte Mittlere und Neuere Geschichte sowie Philosophie an der Goethe-Universität Frankfurt am Main und ist dort, mit einer Unterbrechung als Stipendiat der Gerda Henkel Stiftung, seit 2008 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Historischen Seminar. Seine Forschungsinteressen liegen auf der Historiographiegeschichte, der Wissenschaftsgeschichte der Moderne sowie der politischen Theologie. Publikationen und Herausgeberschaften u. a.: Ernst Kantorowicz. Der „ganze Mensch“ und die Geschichtsschreibung. Frankfurt am Main 2014; „Politisierung der Wissenschaft“. Jüdische Wissenschaftler und ihre Gegner an der Universität Frankfurt am Main vor und nach 1933, hrsg. von Moritz Epple, Johannes Fried, Raphael Gross und Janus Gudian, Göttingen 2016. Andrew Gow studierte Geschichte und Germanistik an der Carleton University, legte seinen M. A. an der University of Toronto ab und promovierte an der University of Arizona. Er wirkt als Professor am Department of History and Classics der University of Alberta und ist Director of the Program of Religious Studies; zudem gibt er die Studies in Medieval and Reformation Traditions heraus. Seine Forschungsschwerpunkte liegen u. a. auf der Apokalyptik, der Theologiegeschichte sowie den christlich-jüdischen Beziehungen. Publikationen u. a.: The Arras Witch Treatises: Johann Tinctorʼs Invectives contre la secte de vauderie and the Recollectio casus, status et condicionis Valdensium ydolatrarum by the Anonymous of Arras (1460) (zusammen mit Robert Desjardins und François Pageau), Pennsylvania 2015. Ernst-Dieter Hehl studierte Geschichte und Deutsch auf Lehramt in Mainz und Freiburg i. Br. und war von 1969 bis 1978 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Historischen Seminar II in Mainz. Die Promotion erfolgte 1977, die Habilitation 1992 (Venia für mittelalterliche Geschichte und historische Hilfswissenschaften), 1998 dann die Ernennung zum außerplanmäßigen Professor. Von 1978 bis 2009 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz. Seine Forschungsschwerpunkte liegen auf der Edition der Konzilien Deutschlands und Reichsitaliens von 920 bis 1022/23 (Projekt der Akademie Mainz in Verbindung mit den Monumenta Germaniae Historica), den Fragen der ottonisch-salischen Reichskirche (insbesondere unter kirchenrechtsgeschichtlichen Gesichtspunkten) sowie auf Kirche und Krieg (einschließlich der Kreuzzüge). Johannes Heil studierte Geschichte, Kunstgeschichte und Religionsphilosophie in Frankfurt am Main, dazu Judaistik in Frankfurt, Tel Aviv und Haifa. Auf die Promotion bei Johannes Fried und Heribert Müller 1994 folgte 2003 die Habilitation bei Wolfgang Benz in Berlin. Nach Fellowships in Madison (Wisconsin) und Notre Dame (Indiana) wurde er 2005 auf den Ignatz Bubis-Stiftungslehrstuhl der Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg berufen. Seit 2008 leitete er die Hochschule
Die Autoren
255
kommissarisch und wurde 2013 zum Rektor gewählt. Seit 2012 ist er Honorarprofessor der Universität Heidelberg. Publikationen u. a.: Kompilation oder Konstruktion? Die Juden in den Pauluskommentaren des 9. Jahrhunderts, Hannover 1998; „Gottesfeinde“ – „Menschenfeinde“. Die Vorstellung von jüdischer Weltverschwörung (13.–16. Jahrhundert), Essen 2006. Klaus Herbers ist seit 1998 Inhaber der Lehrstuhls für Mittelalterliche Geschichte und Historische Hilfswissenschaften an der Friedrich Alexander Universität Erlangen-Nürnberg. Seine Forschungsinteressen liegen im Bereich der Geschichte der Iberischen Halbinsel, der Hagiographie und Heiligenverehrung, der Pilgergeschichte und der Geschichte des Papsttums. Er ist korrespondierendes Mitglied der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, ordentliches Mitglied der Akademie der Wissenschaften zu Mainz und Mitglied der Zentraldirektion der Monumenta Germaniae Historica. Mordechay Lewy trat nach dem Studium der Geschichte an der Hebräischen Universität (1970–1975) in den diplomatischen Dienst Israels ein. Während seiner Dienstzeit war er in Bonn und Stockholm, als Generalkonsul in Berlin (1991–1994), als Botschafter in Bangkok (1994–1997), als Gesandter in Berlin (2000–2004), als Sonderberater beim Jerusalemer Bürgermeister für Christen und Muslime (2004– 2008) sowie als Botschafter am Heiligen Stuhl (2008–2012) tätig und publizierte über das Pilgerwesen in Jerusalem. In seinem Ruhestand promovierte er bei Johannes Fried mit dem Thema „Der apokalyptische Abessinier. Der Transfer eines frühislamischen Motivs nach Europa. Eine eschatologische Deutung Äthiopiens in mappe mundi des 13. und 14. Jahrhunderts“. Matthias M. Tischler (Promotion Heidelberg 1998; Habilitation Dresden 2008/2009) studierte Mittlere und Neuere Geschichte, Historische Hilfswissenschaften, Klassisches Latein und Mittellatein sowie Romanistik an den Universitäten Heidelberg und München (1989–1995), ferner Islamwissenschaften an der PhilosophischTheologischen Hochschule Sankt Georgen in Frankfurt am Main (2003–2008). Er war von 2001 bis 2009 wissenschaftlicher Mitarbeiter des Hugo von Sankt ViktorInstituts in Frankfurt am Main und lehrte von 2009 bis 2012 als Privatdozent für Mittelalterliche Geschichte an der TU Dresden. Seit 2013 ist er als Professor für Mittelalterliche und Transkulturelle Geschichte am Institut d’Estudis Medievals der Universitat Autònoma de Barcelona tätig, seit 2017 ist er ICREA Research Professor ebenda. Daniel Ziemann studierte von 1990 bis 1997 Mittlere und Neuere Geschichte, Alte Geschichte und Germanistik an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main. Im Jahr 2002 wurde er an der gleichen Universität promoviert. Von 2002 bis 2009 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter und später Assistent am Historischen Seminar der Universität zu Köln. Seit 2009 ist er Associate Professor am Department of Medieval Studies an der Central European University in Budapest. Von 2013 bis 2016 übernahm er dort die Funktion eines Head of Department. Seine
256
Die Autoren
Forschungsschwerpunkte umfassen die Geschichte Südosteuropas sowie die politische und Rechtsgeschichte des Frankenreiches und Deutschen Reiches im Frühund Hochmittelalter. Publikationen u. a.: Vom Wandervolk zur Großmacht. Die Entstehung Bulgariens im frühen Mittelalter (7.–9. Jh.), Köln u. a. 2007.
Der Historiker Johannes Fried hat der Geschichtswissenschaft zahlreiche Impulse gegeben. Freunde, Kollegen und Schüler schließen auf ihren „Erinnerungswegen“ im weitesten Sinne an Frieds Arbeiten an und setzen sich aus unterschiedlichen Perspektiven mit der Methodik, den Fragen und Themen auseinander, die die Geschichtswissenschaft dem Frankfurter Mediävisten verdankt. Die Beiträge kreisen um Karolinger und Kirchenfürsten, um
Kaiser, Päpste und Bischöfe, um Heilige und Juden; sie erörtern Hoftage und Canossa; spüren den Problemen der mittelalterlichen Geschichtsschreibung sowie denjenigen der Mittelalterrezeption in der politischen Kultur der Gegenwart nach. Die Autorinnen und Autoren schaffen so ein lebhaftes Panoramabild des Mittelalters, das zeigt, dass nicht das Mittelalter finster war – wohl aber konnte es sein politischer Schatten sein.
www.steiner-verlag.de Franz Steiner Verlag
ISBN 978-3-515-11831-6
9
7835 1 5 1 183 16



![Rechtsstaatlichkeit, Freiheit und soziale Rechte in der Europäischen Union: Deidesheimer Kolloquium 2012 zu Ehren von Detlef Merten anlässlich seines 75. Geburtstages [1 ed.]
9783428543540, 9783428143542](https://ebin.pub/img/200x200/rechtsstaatlichkeit-freiheit-und-soziale-rechte-in-der-europischen-union-deidesheimer-kolloquium-2012-zu-ehren-von-detlef-merten-anlsslich-seines-75-geburtstages-1nbsped-9783428543540-9783428143542.jpg)

![Die Europäische Union als Wertegemeinschaft: Forschungssymposium zu Ehren von Siegfried Magiera [1 ed.]
9783428541768, 9783428141760](https://ebin.pub/img/200x200/die-europische-union-als-wertegemeinschaft-forschungssymposium-zu-ehren-von-siegfried-magiera-1nbsped-9783428541768-9783428141760.jpg)

![Metaphysik: Von einem unabweislichen Bedürfnis der menschlichen Vernunft. Rémi Brague zu Ehren [1. Aufl.]
9783658315924, 9783658315931](https://ebin.pub/img/200x200/metaphysik-von-einem-unabweislichen-bedrfnis-der-menschlichen-vernunft-remi-brague-zu-ehren-1-aufl-9783658315924-9783658315931.jpg)
![Recht und Natur: Beiträge zu Ehren von Friedrich Kaulbach [1 ed.]
9783428474363, 9783428074365](https://ebin.pub/img/200x200/recht-und-natur-beitrge-zu-ehren-von-friedrich-kaulbach-1nbsped-9783428474363-9783428074365.jpg)
